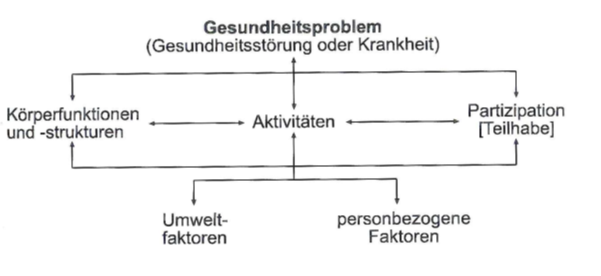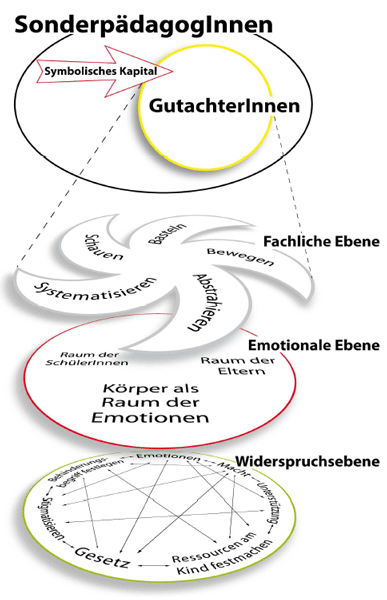Der Prozess des Begutachtens aus der Perspektive von SonderpädagogInnen
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie. Eingereicht am Institut für Erziehungswissenschaften an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck. Erstbegutachterin: Univ.-Prof.in Dr.in Kerstin Ziemen, Universität Köln. Zweitbegutachter: Ao. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Stöger, Universität Innsbruck
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in das diagnostische Arbeitsfeld der Sonderpädagogik
-
3 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs auf internationaler und nationaler Ebene
-
3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs in 15 Ländern Europas
- 3.1.1 European Agency for Development in Special Needs
- 3.1.2 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von unabhängigen Stellen
- 3.1.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von LehrerInnen, SonderpädagogInnen und Expertenteams
- 3.1.4 Zusammenschau der vergleichenden Studien
-
3.2 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs in Österreich
- 3.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich
- 3.2.2 Abgrenzung zu allgemeinen Förderungen
- 3.2.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs
- 3.2.4 Die Problematik des Sonderpädagogischen Förderbedarfs im System Schule aus juristischer Sicht
- 3.2.5 Der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“
- 3.2.6 Der Behinderungsbegriff
- 3.2.7 Behinderung und Ressourcen
- 3.2.8 Ausbildung zum Sonderschullehrer/zur Sonderschullehrerin, zum Gutachter/zur Gutachterin
- 3.2.9 Sonderpädagogischer Förderbedarf in einem inklusiven Bildungssystem?
-
3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs in 15 Ländern Europas
- 4 Empirischer Teil
-
5 Interpretation und Reflexion der
Ergebnisse
-
5.1 Die Metaphorik der Begutachtung
- 5.1.1 Metaphorik des Sehens – Begutachten ist Schauen
- 5.1.2 Metaphorik des Abstrakten - Begutachten ist Abstrahieren
- 5.1.3 Metaphorik der Skalen – Begutachten ist Systematisieren
- 5.1.4 Metaphorik der Arbeit – Begutachten ist Basteln
- 5.1.5 Metaphorik des Weges – Begutachten ist Bewegen
- 5.1.6 Metaphorik des Raums – Begutachten ist Räume erfahren
- 5.2 SonderpädagogInnen als GutachterInnen
-
5.1 Die Metaphorik der Begutachtung
- 6 Resümee
- 7 Literatur
- 9 Anhang
Abbildungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
„Die Macht der Benennung,
zumal der Benennung des Namenlosen,
dessen, was noch unbemerkt oder verdrängt ist,
ist von erheblicher Tragweite“
(Bourdieu 2011, S. 165).
Das Erstellen von Sonderpädagogischen Gutachten fällt seit Bestehen von Sonderschulen in den Aufgabenbereich von SonderpädagogInnen. In Österreich dient die sonderpädagogische Diagnostik als theoretische Grundlage für das sonderpädagogische Gutachten und zur Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Aufgrund der 15. SCHOG-Novelle im Jahr 1993 trat anstelle der Feststellung der „Sonderschulbedürftigkeit“ und der damit verbundenen Aufnahme in eine bestimmte Form der Sonderschule die Feststellung des „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“. Seit dieser Novelle sieht das Gesetz für die Eltern die Wahlmöglichkeit für die Beschulung ihrer Kinder in einer entsprechenden Sonderschule oder in einer integrativ geführten Klasse der Regelschule vor.
Seit den 1970er Jahren wird der diagnostische Vorgang in der Sonderpädagogik diskutiert und weiterentwickelt: So wurde eine statische und defektorientierte Diagnostik durch Begriffe wie z. B. „Prozessdiagnostik“ (Bundschuh 1985), „Begleitdiagnostik“ (Kobi 1988), „verstehende Diagnostik“ (Jantzen 1996) oder „Förderdiagnose“ (Bundschuh 1994) erweitert.
Im österreichischen Schulwesen sind sowohl Termini wie „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ als auch Zuständigkeiten und Ablauf des Feststellungsverfahrens gesetzlich definiert und geregelt. „Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz 1985 liegt vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag …“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 19/2008).
Als Grundlage für einen Sonderpädagogischen Förderbedarf dienen die Diagnostik und das Sonderpädagogische Gutachten: „Ein Sonderpädagogisches Gutachten ist die Aussage einer Sonderpädagogin/eines Sonderpädagogen als Sachverständige/r über ein Kind“ (BMUKK, Rundschreiben 19/2008).
Im Schuljahr 2010/11 erhielten in Österreich 5 % aller SchülerInnen im Pflichtschulbereich einen Sonderpädagogischen Förderbedarf – ermittelt durch SonderpädagogInnen. Aufgrund der Gesetzeslage muss in Österreich eine Behinderung diagnostiziert werden, um einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erteilen zu können. Ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ist nach österreichischem Gesetz demnach immer an eine Behinderung gekoppelt.
Lange wurde der Begriff der „Behinderung“ nur am Subjekt festgemacht und als gegebene Eigenschaft und Defekt einer Person gesehen.
Bereits in den 1980er Jahren wurde jedoch der Behinderungsbegriff in einer internationalen Klassifikation durch die , der ICIDH, in seinen Begrifflichkeiten
erweitert. In der neuen Fassung, der ICF, (vgl. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 2001), wird „Behinderung“ als Oberbegriff für „Schädigung“, „Beeinträchtigung der Aktivität“ und „Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe)“ verwendet. Darüber hinaus werden Umweltfaktoren aufgelistet, die ständig mit den oben genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen.
In der Praxis in Österreich allerdings stehen zumeist noch die Defizite der Kinder im Mittelpunkt des Begutachtungsprozesses; gezielte Fördermaßnahmen können, berücksichtigt man die Gesetzeslage, erst nach Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgrund einer diagnostizierten Behinderung erfolgen.
Im Jahr 2006 stellte eine ForscherInnengruppe in Österreich um Werner Specht (österreichischer Erziehungswissenschafter) in einer umfassenden Studie fest, dass die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nach wie vor problematisch sei: „Es herrscht vielfach keine Einigkeit darüber, unter welchen Umständen und für welches Kind SPF auszusprechen ist“ (Specht, u. a. 2006, S. 46). Als Schlussfolgerungen des Forschungsprojektes wurden einige Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung im Bereich des Sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens erarbeitet und veröffentlicht. So wurden unter anderem die Zuerkennung von Förderressourcen als Prävention sowie transparente, objektivierte Verfahren für die Gutachtenerstellung und Sonderpädagogische Zentren als Orte der Ressourcendistribution gefordert (vgl. ebd., S. 49 ff.).
Auch in der Literatur werden seit Jahren „… Wege und Irrwege sonderpädagogisch-diagnostischer Vorgehensweisen, Diagnosen und Analysen behindernder Bedingungen …“ (Bundschuh 1994, S. 9) thematisiert und empirischen Studien unterzogen. In den letzten Jahren setzten sich einige AutorInnen im deutschsprachigen Raum kritisch mit den Diagnoseprozessen auseinander (vgl.Jantzen 1996; 2005; Kottmann 2006; Bundschuh 2007; Dederich 2009).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der sonderpädagogischen Diagnostik und der Gutachtenerstellung. Das Forschungsinteresse an dieser Thematik wurde für die Autorin in der Zeit geweckt, in der sie selber als Sonderschullehrerin Gutachten für Kinder, die Probleme in der Schule hatten, verfasste. Die Komplexität des Themas – teilweise polarisierende Meinungen, fehlende Methodologie in den Diagnosemodellen, Unsicherheiten in der Entscheidung, sich für oder gegen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf aussprechen zu müssen und fehlende wissenschaftliche Informationen – veranlasste die Autorin, sich mit dem Thema „SonderpädagogInnen als GutachterInnen“ intensiv auseinanderzusetzen.
Die Perspektive richtet sich in dieser Arbeit auf die GutachterInnen selbst, auf den Prozess der Begutachtung, auf auftretende Widersprüche und ambivalente Handlungen in der Begutachtung, auf selbstreflexive Blickwinkel der GutachterInnen, auf belastende Momente sowie auf verdeckte Aspekte, die von GutachterInnen meist vage als „ungutes Gefühl“ wahrgenommen, jedoch noch nicht sichtbar gemacht und verbalisiert wurden. Die Forschungsarbeit hebt sich insofern von anderen Untersuchungen zu dieser Thematik ab, als dass sie SonderpädagogInnen, die als GutachterInnen arbeiten, fokussiert.
Für die vorliegende Arbeit sind Bourdieus wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen mit dem Modell des „sozialen Raums“ (Bourdieu 1995), den verschiedenen Formen von „Kapital“ (ebd.) sowie den „Machtstrukturen“ in und zwischen „Makro- bzw. Mikrokosmen“ (Bourdieu 1998a) von grundlegender Bedeutung.
Bourdieus Theorien veranlassen die Autorin dazu, das Tätigkeitsfeld von SonderpädagogInnen bzw. GutachterInnen als „Raum“ zu benennen, diesen zu erfassen und anschließend zu beleuchten.
Der Autorin ist dabei bewusst, dass sie den Forschungsgegenstand sowohl als Wissenschafterin als auch als Sonderpädagogin und ehemalige Gutachterin untersucht. Mit diesem Hintergrund ergibt sich die Tatsache, dass das zu erforschende Objekt einerseits als Wissenschafterin mit einer „gewissen Klarheit“ (Bourdieu 1998a) gesehen wird, andererseits besteht stellenweise die Möglichkeit, dass der Forschungsgegenstand, „… ausgehend von einem Blickwinkel im Feld, der selbst nicht in den Blick kommt“ (vgl. ebd.), betrachtet wird. Förderlich für die Forschungsarbeit war die Rolle als Sonderpädagogin und ehemalige Gutachterin vor allem in der Datenerhebung: Mit Hilfe der, über die Forschungsarbeit informierten Schulbehörden wurde die Autorin darin unterstützt, aktive GutachterInnen zu finden, die sich für Interviews bereit erklärten; es besteht darüber hinaus die Annahme, dass es den InterviewpartnerInnen eventuell leichter fiel, sich der Interviewerin gegenüber zu öffnen und über das sensible Thema des Begutachtungsprozesses zu sprechen.
Dennoch kann auch davon ausgegangen werden, dass der Verfasserin durch ihre Involviertheit im sonderpädagogischen „Feld“ gewisse Sichtweisen sowohl in der Datenerhebung als auch in der Auswertung verborgen bleiben können.
Dem Anspruch einer „absolutistischen“ Objektivierung kann damit die wissenschaftliche Forschungsarbeit in vollem Umfang nicht gerecht werden; leisten kann die vorliegende Arbeit jedoch eine „systematische Perspektivierung“ (ebd.), mit dem Ziel, Facetten des Forschungsobjekts zu erklären.
„Der Wissenschafter ist zugleich bescheidener und anspruchsvoller als der Kuriositätensammler, ihm geht es darum, Strukturen und Mechanismen zu erfassen, die sich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, dem Blick des Einheimischen ebenso entziehen wie dem des Fremden, etwa die Prinzipien der Konstruktion des sozialen Raums oder die Mechanismen der Reproduktion dieses Raums, und diese in einem Modell darzustellen …“ (Bourdieu 1998, S. 15).
Der theoretische Teil dieser Arbeit, der Kapitel 2 und Kapitel 3 umfasst, beschäftigt sich allgemein in wissenschaftlicher Hinsicht mit dem, die GutachterInnen betreffenden Problembereich der (sonder)pädagogischen Diagnostik:
Im Kapitel 2 setzt sich die Autorin kritisch mit den Termini „Diagnostik“, „psychologische Diagnostik“, „pädagogische Diagnostik“ und „sonderpädagogische Diagnostik“ auseinander. Der Aufgabenbereich der sonderpädagogischen Diagnostik wird dabei beleuchtet und deren Anforderungen an DiagnostikerInnen werden offengelegt.
Dieses Kapitel befasst sich weiters intensiv mit den wichtigsten Modellen und Ansätzen alter und neuerer Formen der Diagnostik im (sonder)pädagogischen Bereich. Das Offenlegen verschiedener Diagnoseansätze führt zur Hinterfragung nach der Bedeutung dieser, einerseits für DiagnostikerInnen, andererseits für die von der Diagnostik betroffenen Kinder.
Im Kapitel 3 wird auf die Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs auf internationaler und nationaler Ebene eingegangen:
Mit dem Blick über die Grenzen Österreichs hinaus wird dargestellt, wie die Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in 15 Ländern Europas gehandhabt wird. In den Fokus der länderübergreifenden Analyse rücken die unterschiedlichen Interpretationen der Begriffe „Beeinträchtigung“, „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und „Behinderung“. Weiters wird auf Basis von Daten der European Agency for Development in Special Needs herausgearbeitet, welche Berufsgruppen und/oder Institutionen in den verschiedenen Ländern einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erheben. Der Bogen spannt sich dabei von SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen über schulunabhängige Stellen bis hin zu ExpertInnenteams, die sich sowohl aus SonderpädagogInnen als auch unabhängigen DiagnostikerInnen verschiedenster Berufsgruppen zusammensetzen. Wenn auch die Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs im europäischen Raum unterschiedlichen Kriterien unterliegt, so kann als gemeinsame Entwicklung beobachtet werden, dass in den meisten Ländern der EU Diskussionen über veränderte Begriffssysteme, rechtliche Grundlagen, Klassifikationspraktiken und neue Finanzierungsmodelle mit inklusiven Zielsetzungen stattfinden.
Auf nationaler Ebene setzt sich die Autorin mit der rechtlichen Seite der Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich auseinander. In den Vordergrund rücken dabei ein geschichtlicher Aufriss der Gesetzgebung, auch hinsichtlich von Begrifflichkeiten wie „Sonderschulbedürftigkeit“, „Sonderpädagogischer Förderbedarf“, „physische und psychische Behinderung“ sowie etwaige Erläuterungen zum Gesetzestext. Eine Analyse einer persönlichen Anfrage der Autorin an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur soll Klarheit über fehlende Auslegungsmöglichkeiten des Gesetzestextes bringen. Weiters analysiert die Autorin auf etymologischer Basis den vagen Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und diskutiert dessen Bedeutung im Rahmen unterschiedlicher wissenschaftlicher Theorien (vgl. Eberwein 1995; Opp/Theunissen 2009). Da der Begriff der Behinderung im österreichischen Schulgesetz eine große Variationsbreite offen lässt, erscheint es notwendig, diesen Terminus sowohl aus rechtlicher Sicht, als auch aus dem Blickwinkel des Konstruktivismus (vgl. Lindemann/Vossler 1999; Dederich/Jantzen 2009) näher zu betrachten. Außerdem wird die von der WHO entwickelte Klassifikation von Behinderung, die ICF, kurz dargestellt. Das Kapitel 3 skizziert darüber hinaus die Ausbildung in Österreich zum/zur Gutachter/in.
Im Kapitel 4 werden anschließend Forschungsfragen, Forschungsdesign, methodisches Vorgehen und das Konzept der Untersuchung beschrieben. Dargestellt wird die Auswahl der InterviewpartnerInnen, die Datenerhebung und die Auswertungsmethoden – Metaphernanalyse und Grounded Theory.
Im Kapitel 5 werden die Forschungsergebnisse der empirischen Untersuchung in einer interpretativen und reflexiven Analyse präsentiert.
Die Arbeit schließt im Kapitel 6 mit einem Resümee. Der untersuchte Forschungsgegenstand wird einer zusammenfassenden Reflexion unterzogen und die Ergebnisse in einer aus dem Datenmaterial entwickelten Grafik dargestellt.
Auf diesem Weg möchte sich die Autorin herzlich bei den InterviewpartnerInnen bedanken, die der Interviewerin großzügig ihre Zeit widmeten und sich freundlich und offen für die Interviews bereit erklärten, sowie bei den VertreterInnen des Landesschul- bzw. Bezirksschulrates für deren Entgegenkommen. Aus Gründen der vereinbarten Beibehaltung der Anonymisierung werden die betroffenen Personen namentlich nicht genannt. Die Interviews liegen bei der Autorin und bei Frau Prof.in Ziemen (Uni Köln) auf und können dort auf Anfrage eingesehen werden.
Ein großes Anliegen ist es der Autorin anzumerken, dass sich die in der Untersuchung geäußerte Kritik nicht an die in der Praxis tätigen Personen richtet; in der Zeit der Untersuchung hat die Autorin sehr viele engagierte und motivierte SonderpädagogInnen getroffen, die sich mit ihrem Wissen und Können bestmöglich für die Kinder einsetzen. Vielmehr gilt die Kritik den bestehenden Strukturen, veralteten Gesetzen, unreflektierten Fakten sowie politischen Hintergründen im System Schule.
Inhaltsverzeichnis
Das sonderpädagogische Arbeitsfeld ist mittlerweile ein sehr umfassendes Gebiet und fordert Praktiker und Wissenschaft aufgrund der multikomplexen Fragestellungen heraus.
Im Bereich der Sonderpädagogik kann heute von einer sehr heterogenen Gruppe von Kindern und Jugendlichen gesprochen werden; die Spannbreite reicht vom mehrfach-schwerstbehinderten Kind, vom Kind mit geistiger Behinderung, von Kindern mit Sinnesbehinderungen, Wahrnehmungsstörungen, Lernauffälligkeiten bis hin zum Kind mit leichten bis massiven Verhaltensauffälligkeiten.
Die Menschen, die mit sonderpädagogischer Diagnostik konfrontiert werden, sind Kinder und Jugendliche, die hinsichtlich ihrer geistigen, körperlichen, psychischen, emotionalen, sozialen, motorischen und sensomotorischen Fähigkeiten im Kindergartenalter und/oder im schulischen Rahmen als beeinträchtigt, gestört oder behindert bezeichnet werden. Diese Kinder und Jugendlichen fallen in einem rein normorientierten Kontext hinsichtlich ihres Lern-, Emotional- oder Sozialverhaltens im Kindergarten bzw. in der Schule auf. Die speziellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie die Problemsituationen, in denen sich die Eltern befinden, erfordern einerseits verstärkt diagnostische, im Hinblick auf die Erstellung der Diagnose und das Erkennen der Problematik, und andererseits didaktisch fachliche Kompetenzen, verbunden mit dem Ziel der Förderung, zur Unterstützung des Kindes und der Erziehungsberechtigten.
Wenn auch die SchülerInnen mit Lernbehinderungen und/oder Verhaltensstörungen den größten Bereich der sonderpädagogischen Diagnostik umfassen, so geht es primär nicht nur um diese Personen. Es stehen Fördermaßnahmen, Hilfestellungen und Unterstützung für alle Kinder mit einem besonderen Förderbedarf im Vordergrund.
In den Lehrplänen der österreichischen Schulen werden die Bildungsaufgaben und Bildungsziele beschrieben. Aufgrund der Strukturen im österreichischen Schulwesen und aufgrund von verschiedenen Selektions- und Differenzierungsmechanismen ergibt es sich, dass die Erreichung der Lehrziele für einige Schüler aus verschiedenen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Erkennbare, offensichtliche Behinderungen, wie Körperbehinderungen, Sinnesbehinderungen, geistige oder Sprachbehinderungen, Mehrfachbehinderungen und Verhaltensbehinderungen werden von Lehrpersonen traditionell schnell wahrgenommen und in den Diagnostikprozess eingebunden. Schwieriger wird der Diagnostikprozess bei SchülerInnen mit Lernproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten, deren Lernstörungen weniger durch intellektuelle Ausfälle geprägt sind und die dennoch die Lehrplanziele nicht erreichen werden. Oft können aus gesetzlicher Sicht für diese SchülerInnen gezielte Fördermaßnahmen erst eingeleitet werden, wenn sie die Diagnose „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ erhalten; die Förderung ist dabei an eine diagnostizierte Behinderung gekoppelt.
„Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz 1985 liegt vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag und nicht gemäß § 15 Schulpflichtgesetz 1985 vom Schulbesuch befreit ist“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 19/2008).
Der Gesetzgeber bestimmt zwar im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik und des Sonderpädagogischen Förderbedarfs den Rahmen für Behinderungen im Allgemeinen, geht aber hinsichtlich des Begriffs auf die Umschreibungen einzelner Behinderungsarten und damit auf Lernbehinderung oder psychische Behinderung im Besonderen nicht genauer ein.
Auf die Problematik des unterschiedlichen Verständnisses von Störungen und Behinderungen wird im Kapitel 3.2.6 eingegangen.
Zur Realisierung einer pädagogischen Praxis, in der die Entwicklung der Persönlichkeit und Tätigkeit gefördert wird, werden diagnostische Prozesse vorausgesetzt (vgl. Jantzen 1990).
Für ein sonderpädagogisches Gutachten dient die sonderpädagogische Diagnostik als Grundlage. In den folgenden Kapiteln geht es um die Klärung der Begriffe „Diagnose“, „Diagnostik“, „psychologische Diagnostik“, „pädagogische Diagnostik“, sowie um Abgrenzungen der pädagogischen Diagnostik von der Diagnostik der Psychologie.
In einem weiteren Kapitel wird die sonderpädagogische Diagnostik beschrieben und deren Aufgabenbereich eingegrenzt.
„Die Wörter ‚Diagnose‘ und ‚Diagnostik‘ gehen zurück auf das griechische Verb ‚diagignoskein‘, das unterschiedliche Aspekte eines kognitiven Vorgangs bezeichnet, vom Erkennen bis zum Beschließen. Das Verb bedeutet ‚gründlich kennenlernen‘, ‚entscheiden‘ und ‚beschließen‘“ (Fisseni 1990, S. 1).
„Von der ursprünglichen Wortbedeutung her (dia: durch, hindurch, auseinander, gnosis: Erkenntnis) ist Diagnostik Erkenntnisgewinnung zur Unterscheidung zwischen Objekten“ (Hossiep/Wottawa 1993, S. 131).
Die Autoren sehen dabei Diagnostik nicht als Informationsansammlung zum Selbstzweck, sondern definieren als Ziel eine Handlungsoptimierung.
„Diagnose“ wird von der „Diagnostik“ hergeleitet. Unter dem Begriff „Diagnostik“ versteht man die Lehre von der Erkennung und Bestimmung von Krankheiten. Ursprünglich stammt Diagnostik aus der Medizin. In der Medizin werden mit dem Begriff „Diagnostik“ all jene Methoden oder Maßnahmen genannt, die der Erkennung und Benennung einer Krankheit oder Verletzung dienen. Absicht der Diagnostik ist die Stellung einer Diagnose, die als Grundlage für z. B. therapeutische Entscheidungen dienen kann. Neben der Medizin wird der Begriff „Diagnostik“ in anderen Bereichen verwendet, wie zum Beispiel in der Psychologie als psychologische Diagnostik oder Psychodiagnostik oder in der Erziehungswissenschaft als pädagogische Diagnostik. Weitere Gebiete, in denen der Begriff „Diagnostik“ zur Anwendung kommt, sind z. B. in der Biologie als Beschreibung von Pflanzen oder Tierarten oder im technischen Bereich z. B. zur Beurteilung technischer Systeme.
Nach Dorsch ist „Diagnostik … die Lehre von der sachgemäßen Durchführung der Diagnose; auch die Ausübung der Diagnose“ (ebd.1994, S. 138). Der Begriff „Diagnostik“ umfasst alle Aufgaben und Tätigkeitsbereiche, in denen Daten oder Informationen zum Zwecke von Entscheidungshilfen systematisch eingeholt und ausgewertet werden.
In der Psychologie wird die Aufgabe der Diagnostik darin gesehen, Verhalten, Leistungen, Eigenschaften und Fähigkeiten von Personen zu beurteilen.
Im Psychologie-Lexikon von Tewes und Wildgrube (1992) wird der Begriff „psychologische Diagnostik“ oder „Psychodiagnostik“ so beschrieben, dass anhand testpsychologischer Methoden die menschliche Persönlichkeit erfasst wird. Verhaltensweisen von Menschen, wie z. B. Probleme bei psychiatrisch und psychosomatisch Kranken, oder Eignungsuntersuchungen werden erforscht (vgl. Tewes/Wildgrube 1992, S. 267).
Das wissenschaftliche Fundament erhält die Diagnose durch Klärung von messtheoretischen Annahmen, durch Hypothesenerstellungen und durch die Präzisierung der Merkmale, auf die sie sich richtet. Durch eine genaue Analyse der Randbedingungen, durch Standardisierung und geeignete Messoperationen werden diagnostische Aussagen getroffen (vgl. Tent/Stelzl 1993).
Hossiep und Wottawa (1993) sprechen von Diagnostik als Praxis einer nutzenmaximierenden Anwendungstechnik auf wissenschaftlicher Grundlage.
Je nach Fragestellungen sind demnach Methoden zu wählen und anzuwenden, die den Ansprüchen einer wissenschaftlich fundierten Diagnostik entsprechen. Die gezogenen Schlussfolgerungen müssen anschließend den Gütekriterien entsprechen. Tent und Waldow fassen Diagnostik im Bereich der Psychologie wie folgt zusammen:
„Diagnostik ist ein theoretisch begründetes System von Regeln und Methoden zur Gewinnung und Analyse von Kennwerten für inter- und intraindividuelle Merkmalsunterschiede an Personen“ (Tent/Waldow 1984, S. 5).
Dazu gehören:
-
eine genaue Formulierung der diagnostischen Probleme und Fragestellungen,
-
die Erhebung diagnostischer Daten und deren Integration zu Diagnosen und
-
die damit verknüpften Prognosen im Hinblick auf verfügbare oder erwünschte Behandlungsalternativen (vgl. ebd.).
Die Autoren decken mit dieser Definition die Anwendung diagnostischer Prozesse und die Verarbeitung diagnostischer Informationen ab.
Bei der Definition von Amelang und Zielinski wird psychologische Diagnostik als Methodenlehre beschrieben, die das Ziel hat, Personen richtig zu beurteilen und zu unterscheiden (vgl. Amelang/Zielinski 1994, S. 12).
Im Buch „Verhaltensstörungen in der Schule“ wird der Begriff „Psychodiagnostik“ folgendermaßen definiert:
„… mit Hilfe der Psychodiagnostik will man das Verhalten und Erleben der Klienten erforschen, um Grundlagen für Lebensentscheidungen zu gewinnen. Hier werden die Klienten psychologisch, pädagogisch, soziologisch und medizinisch untersucht“ (Atzesberger/Frey 1978, S. 61).
Im Rahmen der psychologischen Diagnostik geht es also um das Feststellen von Merkmalen bei Personen mittels entsprechender wissenschaftlicher Methoden. Die diagnostischen Aussagen beziehen sich demnach primär auf die Einzelperson, der damit bestimmte Attribute zugeschrieben werden. Aus den individuellen Ergebnissen lassen sich dann Kennwerte für Gruppen errechnen, die dann hinsichtlich bestimmter Merkmale miteinander verglichen werden können.
Die pädagogische Diagnostik nimmt sowohl in der aktuellen Literatur, in fachinternen Diskussionen als auch im Bewusstsein der PädagogInnen immer noch eine Randstellung ein.
In der pädagogischen Praxis werden zwar fortlaufend diagnostische Urteile gefällt, formell und explizit, aber auch informell und implizit, jedoch wird noch wenig das Bedürfnis erkannt, diesen Teil der Praxis zu reflektieren, theoretisch zu durchdringen, wissenschaftlich zu durchleuchten und dadurch zu verbessern.
Der Begriff „pädagogische Diagnostik“ wurde 1968 von Karlheinz Ingenkamp in Anlehnung an medizinische und psychologische Diagnostik im Rahmen eines Forschungsprojektes vorgeschlagen und von Ingo Hartmann im Titel eines unveröffentlichten Projektberichtes benutzt (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2005).
Lange stand die individuelle Entscheidung über die Schullaufbahn sowie über Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Mittelpunkt der pädagogischen Diagnostik. Reulecke und Rollett (1976) rückten die Entscheidung über die Schullaufbahn in den Hintergrund und stellten Diagnostik aus verschiedenen Blickwinkeln folgendermaßen dar:
„Diagnostik in schulischen Entscheidungssituationen hat den Zweck, Informationen zur Optimierung des pädagogischen Handelns zu gewinnen. Entsprechend unterscheidet man zwischen pädagogischer Diagnostik im engeren Sinn, die die Planung und Kontrolle von Lehr- und Lernprozessen zum Gegenstand hat, und pädagogischer Diagnostik im weiteren Sinn, die alle diagnostischen Aufgaben im Rahmen der Bildungsberatung umfasst. Sie treten in zwei paradigmatischen Entscheidungssituationen auf (CRONBACH und GLESER 1965): 1. Selektion, 2. Förderung (Placement)“ (ebd., S. 177, Hervorhebung im Original).
Klauer definierte „pädagogische Diagnostik“ als: „… das Insgesamt von Erkenntnisbemühungen im Dienste aktueller pädagogischer Entscheidungen“ (Klauer 1978, S. 5).
Eine Klassifikation der Pädagogischen Diagnostik konnte laut Klauer (1978) aber kaum geleistet werden, da sich das Aufgabengebiet ständig wandelte; es variierte mit den pädagogischen Konzepten der Lehr- und Lernforschung und es änderte sich mit schulorganisatorischen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die selbst ständig Veränderungen unterworfen waren. Die Erkenntnisbemühung der Pädagogischen Diagnostik stand im Dienst einer pädagogischen Entscheidung, z. B. einer Planungsentscheidung, einer Handlungsentscheidung, einer Feststellungsentscheidung oder Beurteilung.
Pädagogische Diagnostik lehnt sich an die angloamerikanische Bezeichnung „educational measurement“ an und behandelt pädagogische Aufgaben, Probleme und Methoden (vgl. Schiefele/Krapp 1981, S. 77).
Ingenkamp u. Lissmann (2005) lassen Klauers Feststellung „Die Pädagogische Diagnostik ist aus der Psychologischen Diagnostik herausgewachsen“ (Klauer 1982, S. 11) nicht gelten. Laut Ingenkamp war die Pädagogische Diagnostik nach ihren Aufgaben, Zielen und Handlungsfeldern immer eigenständig. Die pädagogische Diagnostik habe zwar ihre Methoden und auch einige Denkweisen der Psychologischen Diagnostik entlehnt, als sie sich auf wissenschaftliche abgesicherte Verfahren zu stützen begann. Schon einige Jahrzehnte zuvor habe sie jedoch bereits viele ihrer Methoden und Modelle aus der Biologie und Medizin übernommen (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2005, S. 12).
Pädagogische Diagnostik ist auch heute noch ein eher umstrittenes und unklares Programm als eine wissenschaftliche Disziplin. Daher gibt es auch unterschiedliche Auffassungen und Definitionen von pädagogischer Diagnostik.
Bei Ingenkamp (2005, S. 13) gehören zur pädagogischen Diagnostik diagnostische Tätigkeiten, die eine Zuweisung zu Lerngruppen oder speziell auf das Kind abgestimmte Förderprogramme ermöglichen oder die Erteilung von Qualifikationen zulassen.
Die Hauptaufgabe der pädagogischen Diagnostik besteht somit darin, für den Lernenden richtige Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen beziehen sich auf Selektionsmaßnahmen, Fördermöglichkeiten und Platzierungsaufgaben.
Unter diagnostischer Tätigkeit im pädagogischen Bereich wiederum wird ein Vorgehen verstanden, in dem, mit oder ohne Hilfe diagnostischer Instrumente und unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien, Beobachtungen und Befragungen durchgeführt werden, um ein Verhalten zu beschreiben. Es wird versucht, durch das Diagnostizieren die Gründe für das Verhalten zu erklären und/oder künftige Verhaltens- und Lernweisen vorauszusagen.
Lange wurde eine ideologische Diskussion über die Anwendung von standardisierten Tests und objektiven Fragebögen in der pädagogischen Diagnostik geführt. Der inhumanen Selektionsdiagnostik wurde eine Diagnostik gegenübergestellt, die nicht nur mehr auf die Messung von Persönlichkeitsmerkmalen gerichtet war, Einführung in das diagnostische sondern den sozialen und situativen Kontext menschlichen Lernens und Verhaltens erfassen sollte.
Seit den 1990er Jahren ist eine Zunahme an objektiven Verfahren wieder zu beobachten. Zurzeit schreitet die Entwicklung von formellen Testverfahren in der pädagogischen Diagnostik im deutschsprachigen Raum voran, ein Umbruch in der Entwicklung von Testtheorien und Testmaterialien ist auch in der schulischen Praxis feststellbar.
Im Vergleich dazu ist in den USA in der pädagogischen Diagnostik die Entwicklung hinsichtlich der Testanwendungen in den letzten Jahrzehnten sehr weit fortgeschritten. Eine enge Verzahnung zwischen Psychologie und Erziehungswissenschaft ist erkennbar, im Bereich der Wissenschaft konnten sich neue Bereiche etablieren wie z. B. Educational Psychology, Professuren für Education und Educational Measurement.
Der Begriff „Diagnostik“ stammt ursprünglich aus der Medizin und wird auch als die Lehre der Diagnose bezeichnet.
Medizinische Diagnostik befasst sich mit dem Erkennen (Röntgen, Ultraschall usw.) einer Krankheit aufgrund von Symptomen und ist eine Feststellung des momentanen Zustandes. Symptome einer körperlichen oder geistigen Krankheit werden beobachtet und kategorisiert, um anschließend eine Behandlung oder Therapie durchzuführen.
Psychologische Diagnostik beschäftigt sich anhand testpsychologischer Methoden und anhand anderer Informationsquellen (Exploration, Verhaltensbeobachtung) mit der Bestimmung von Eigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen. Sie ist das systematische Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zu begründen und Prognosen zu liefern.
Die pädagogische Diagnostik erforscht unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien den gesamten Bereich pädagogischen Handelns. Dabei werden Lernprozesse bei Menschen analysiert, Lernergebnisse festgestellt, aber auch Bedingungen von Lernvorgängen ermittelt.
Eine Abgrenzung zur psychologischen Diagnostik, die auftragsmäßig Klienten überprüft und deren Merkmale zu kennzeichnen versucht, sieht Ingenkamp darin, dass pädagogische Diagnostik als Dienstleistung innerhalb von Erziehung und Unterricht zu verstehen ist.
Pädagogische und psychologische Diagnostik sind laut Lukesch (1998) nicht gleichzusetzen, da sie unterschiedliche Ansätze vertreten. Obwohl ein großer Überschneidungsbereich hinsichtlich der methodischen Grundlagen vorhanden ist, sind jedoch auch in der Pädagogik eigenständige Entwicklungen vorhanden, die dann wiederum in die Psychologie zurückgewirkt haben. Ein Beispiel dafür ist die kriteriumsorientierte Messung. Andererseits gibt es wieder Bereiche, die ausgehend von der Psychologie in der Pädagogik übernommen wurden. Dazu zählen die vielfältigen Anwendungen der klassischen Testtheorien im Bereich der Intelligenz-, Schul- und Schuleinstellungstestentwicklung.
Bei der Gegenüberstellung von pädagogischer und pädagogisch-psychologischer Diagnostik lassen sich jedoch Unterschiede in der Literatur kaum mehr erkennen. Leutner (2001) führt die Begriffe synonym an, um eine Trennung zu vermeiden. Auch Jäger (2003) spricht sich für eine Gleichsetzung der beiden Begriffe aus. Ingenkamp (2005) geht davon aus, dass ErziehungwissenschaftlerInnen den Begriff „pädagogische Diagnostik“ bevorzugen, während PsychologInnen den Begriff „pädagogisch-psychologische Diagnostik“ favorisieren.
Die Frage der pädagogischen Diagnostik kann aus Sicht der Autorin der vorliegenden Forschungsarbeit nicht aus einer Fachdisziplin heraus zufriedenstellend beantwortet werden. Wichtig erscheint ihr, dass die Methoden zwischen den Disziplinen vermittelt werden und sich damit Lösungsstrategien nicht nur durch einen Austausch der Ergebnisse ergeben.
Eine Voraussetzung für die fächerübergreifende Zusammenarbeit ist, dass über die Disziplingrenzen hinweg ein Verständigungsprozess stattfindet. Dies bedeutet z. B., dass ein ständiger Austausch der Disziplinen stattfindet sowie Kriterien, die die wissenschaftlichen Leistungen erbringen, geteilt werden. Im Rahmen des diagnostischen Prozesses müssen Informationen und Daten gesammelt, analysiert und interpretiert werden. Die einzelnen Verfahren und Erhebungsmethoden aus den verschiedenen Disziplinen Psychologie und Erziehungswissenschaften sollten dabei gleichwertig verarbeitet und zur Erstellung von Ergebnissen und geeigneten Fördermöglichkeiten herangezogen werden.
Die Geschichte der sonderpädagogischen Diagnostik ist durch die Entwicklung spezifischer Tests für Kinder und Jugendliche im Schulalter gekennzeichnet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten der Psychologe Alfred Binet (1857–1911) und der Arzt Theodore Simon (1872–1961) die ersten Testreihen zur Differenzierung von minderbegabten und normalen Schülern. Darauf aufbauend wurde eine breite Palette von Schultests für unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale konstruiert.
Die meisten der vorliegenden Tests sind normorientiert entwickelt und für das heute vorwiegend praktizierte förderdiagnostische Vorgehen nur mehr eingeschränkt verwendbar.
1932 wird der Begriff „Lernbehinderung“ in einem heilpädagogischen Werk erstmals von Egenberger (vgl. Atzesberger 1971) in die Fachdiskussionen eingeführt und in den 60er Jahren in die Amtssprache aufgenommen. Hofmann spricht in einer Zeitschrift davon, dass Kinder, die aufgrund von leichten Begabungsmängeln oder sonstigen geistig-seelischen Hemmungen und Entwicklungsstörungen in der Volksschule zu keinen befriedigenden Schulleistungen kommen, leistungs- oder lernbehindert sind (vgl. Hofmann 1961).
Klauer wiederum geht in den 1960er Jahren davon aus, dass Lernbehinderungen Intelligenzschwäche oder Schwachbegabung voraussetzen (vgl. Klauer 1973), dass somit die Begriffe „Intelligenz“ und „Lernfähigkeit“ parallel verwendet werden können und Abgrenzungen zur normalen Leistungsfähigkeit durch sonderpädagogische Diagnosen gestellt werden sollten.
Seit den 1970er Jahren wird der diagnostische Vorgang in der Sonderpädagogik diskutiert, teilweise ideologisch abgehandelt und als „Selektionsdiagnostik“ polarisiert. Die sonderpädagogische Diagnostik war lange dadurch gekennzeichnet, dass die individuellen Beeinträchtigungen von Kindern graduell eingeteilt wurden: Kinder mit Behinderungen wurden kategorisiert, ihre individuellen Beeinträchtigungen eingeteilt in z. B. mehrere Lernbereiche betreffend, unter dem Regelbereich liegend und langfristige Beeinträchtigungen umfassend (Bach 1979).
Kleber stellte 1978 fest (Kleber 1978, S. 207), dass sonderpädagogische Diagnostik als Gutachterdiagnostik etabliert ist, dennoch bestimmte das Thema, vor allem die Feststellung des Begriffes „Lernbehinderung“ jahrelang die fachlichen Diskussionen (vgl. Kornmann 1977; Kleber 1976; Pawlik 1976).
In den 1980er Jahren wurde die statische und defektorientierte Selektions- und Zuweisungsdiagnostik durch Begriffe wie „erziehungs- und lernorientierte Diagnostik“ (vgl. Kobi/Bonderer 1982), „Prozessdiagnostik“ (Bundschuh 1985) oder „Begleitdiagnostik“ (Kobi 1988) erweitert.
„Ein sonderpädagogisch relevanter Aspekt einer prozeß- und behandlungsorientierten Diagnostik wäre die unmittelbare und stetige Beobachtung schulischen Lern-, Leistungs- und sozialen Verhaltens und die Umsetzung dieser Beobachtungen in unmittelbar helfende und fördernde Maßnahmen didaktischer, pädagogischer und sozialer Art“ (Bundschuh 1985, S. 35 ff.).
Hauptaufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik war nach der Erstellung eines Gutachtens die Zuweisung der Schüler mit Lernproblemen oder Behinderungen in einen für sie entsprechenden Schultyp. Diagnostische Ausbildung, Untersuchungsinstrumente und Untersuchungszeit standen dennoch im Missverhältnis zur Bedeutung des sonderpädagogischen Gutachtens für die Lebenschancen der Beurteilten.
Die neue Gesetzeslage mit der 15. Novelle zum Schulpflichtgesetz 1993 brachte in Österreich eine Änderung der Begriffsbildung mit sich, die Verordnung „Sonderschulbedürftigkeit“ wurde durch den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ersetzt. Gleichzeitig setzte eine neue Diskussion um die Ermittlung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs und um die vorausgehende Diagnostik ein.
Diagnose und Förderung werden nicht mehr isoliert gesehen, sondern vermehrt als Einheit und Prozess wahrgenommen. Die Ermittlung des individuellen Förderbedarfs eines Kindes steht nun im Vordergrund, die sonderpädagogische Diagnostik entwickelt sich weg von einer Zustandsfeststellung zu einer Prozessdiagnostik.
Heute besteht die Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik vor allem darin, die Problemsituation des einzelnen Kindes im Hinblick auf die Beeinträchtigung zu analysieren, vor allem aber steht der Aspekt der Förderung im Mittelpunkt.
Das Aufgabengebiet der Sonderpädagogik umfasst unter Berücksichtigung der institutionellen Entscheidungsbereiche ein weites Aufgabenfeld bzw. eine breitere Zielgruppe. Für DiagnostikerInnen in der Sonderpädagogik ergibt sich eine Personengruppe, umfassend Kinder, Jugendliche und auch Eltern, die sich im Rahmen von Unterricht und Erziehung in schwierigen Situationen befinden. Bundschuh fasst folgende Zielgruppe zusammen (vgl. Bundschuh 2005):
-
Kinder, die im Kindergarten- oder vorschulischen Alter als auffällig, teilweise als entwicklungsverzögert bezeichnet werden,
-
Kinder, die bei der Einschulung individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, die offensichtlich geistig, sozial, emotional oder körperlich beeinträchtigt sind,
-
Kinder, die in der Pflichtschule auffällig werden, da sie partiell oder generell die vorgegebenen Lehrplanziele nicht erreichen können,
-
Kinder, die aufgrund ihres Verhaltens Probleme in der Schule haben Kinder mit Sinnesschädigungen (z. B. Hör-, Sehschädigungen), die sich auf die Lernleistungen oder auf das Sozialverhalten auswirken
-
Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen oder körperbehinderte Kinder
-
Kinder mit Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache
-
Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die vor der Berufswahl stehen.
Die sonderpädagogische Diagnostik erstreckt sich über einen großen Bereich an Anwendungsmöglichkeiten. In Österreich dient sie als theoretische Grundlage für die Gutachtertätigkeit und zur Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Aufgrund der gesetzlichen Lage muss ein/e Gutachter/in anhand der sonderpädagogischen Diagnose eruieren, ob bei einem Kind eine physische oder psychische Behinderung vorliegt, falls das Kind dem Regelunterricht nicht zu folgen vermag. Erst dann können Fördermaßnahmen eingesetzt werden.
-
Die sonderpädagogische Diagnostik bemüht sich um die Diagnose des Erscheinungsbildes der „Beeinträchtigung“ (Störung, Defizite, Behinderung).
-
Sie entscheidet darüber, ob ein Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erhält oder nicht.
-
Sie sollte zur Entscheidung der bestmöglichen Form der Beschulung und Förderung des Kindes dienen.
-
Die sonderpädagogische Diagnose bietet Möglichkeiten einer Prognose, wobei die Fragestellung der Hilfe, Förderung, der Förderaussichten, aber auch der eventuellen Verschlechterung eines Zustandsbildes oder Verhaltens im Vordergrund steht.
-
Sie trägt zur Entscheidungshilfe bei der Aufhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs bei (vgl. Bundschuh 2005).
Die sonderpädagogische Diagnostik zielt auf Früherkennung von Beeinträchtigungen ab (eine möglichst frühe und intensive Förderung ist die Folge).
Zusammenfassend muss sich die sonderpädagogische Diagnostik mit dem gegenwärtigen Stand des Kindes befassen und die Frage nach einer optimalen Förderung in den Mittelpunkt stellen. Im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik soll es in erster Linie nicht um die Feststellung einer Störung, eines Defizits oder einer Behinderung gehen, als vielmehr darum, Ansätze und Vorschläge für gezielte Maßnahmen zum Abbau von Beeinträchtigungen, zur Prävention von Störungen und zur Entfaltung von Spezialbegabungen zu finden.
Die Erwartungen an die sonderpädagogische Diagnostik im pädagogischen Arbeitsfeld sind sehr hoch. Diese Erwartungen, im Sinne einer genauen Beschreibung der wirklichen Probleme des Kindes, der Verhaltens- und Lernausgangslage, der Beschreibung behindernder Bedingungen und der Lernbedingungen, stellen an SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen hohe Ansprüche. Die Beschäftigung mit diagnostischen Fragestellungen nimmt im sonderpädagogischen Bereich zunehmend einen sehr wichtigen Platz ein. Das Auffinden optimaler, individueller Fördermöglichkeiten und Förderwege gestaltet sich für den/die Diagnostiker/in hinsichtlich gesellschaftlicher, finanzieller und politischer Rahmenbedingungen oft schwierig.
In der Gegenwart hat die sonderpädagogische Diagnostik den grundsätzlichen Anspruch, den SchülerInnen individuelle lern- und lebensbegleitende Förderung zu ermöglichen. In diesem Sinne kann in der Praxis eine klassifikatorische Einteilung von Befunden vermieden werden; vielmehr sollte, ausgehend von den Kompetenzen des Kindes, das Verständnis von Verhalten und Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt rücken. Im schulischen Kontext dient sie dazu, Bedarfe aufzuzeigen und nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Meist sind Ressourcen (zusätzliche Förderstunden, Material, finanzielle Ressourcen usw.) an die sonderpädagogische Diagnose geknüpft. Die derzeitigen Diskussionen um inklusive Bildung deuten auf eine veränderte Rolle des Feststellungsverfahrens zur Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs hin. In vielen Veröffentlichungen wird von unnötigen Etikettierungen Abstand genommen und eine neue Sichtweise auf Unterrichtsentscheidungen und Lernen entwickelt.
In der schulischen Alltagspraxis hinkt diese Umsetzung der sonderpädagogischen Diagnostik den wissenschaftlich-theoretischen Ansätzen und Konzepten allerdings hinterher. Unsicherheit verleitet viele SonderpädagogInnen sich an traditionellen Diagnostikmodellen zu orientieren. Im folgenden Kapitel wird daher die sonderpädagogische Diagnostik unter verschiedenen theoretischen Gesichtspunkten betrachtet.
Im an der klinischen Diagnostik orientierten Ansatz wird das Individuum als Träger spezifischer Symptome, Auffälligkeiten und Defizite gesehen. Es besteht eine enge Beziehung zur medizinischen Diagnostik, das Verfahren besteht überwiegend aus normorientierten Tests (Begemann 1989; Moog 1990).
Viele Symptome werden organischen Ursachen zugeordnet, Lernstörungen, emotionale Probleme oder auffälliges Verhalten werden mit psychischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Diese Denkweise führt dazu, dass krankhafte Zustände oder auffälliges Verhalten innerhalb der Person verankert werden.
Äußere Bedingungen und Wirkungen in Lern- und Interaktionsprozessen sowie der Einfluss der spezifischen Lebenswelt bleiben dabei unberücksichtigt. Der Ablaufprozess wird dabei nicht analysiert. Erfolgt eine richtige Diagnose und ist die Ätiologie einmal bekannt, so kann eine Therapie beginnen, die zur Besserung oder Heilung führt.
Das medizinische Modell der sonderpädagogischen Diagnostik und die Sichtweise, dass Intelligenz eine wesentliche Ursache für geistige Retardierung darstellt, bestehen seit Binet (1908).
In der sonderpädagogischen Diagnostik wird auch heute noch versucht mit Hilfe von entsprechenden Tests Symptome und Krankheitsaspekte zu erkennen und ein Persönlichkeitsbild eines betroffenen Schülers zu entwerfen. Tests bieten im Sinne des medizinischen Modells quantitative Messwerte und suggerieren damit eine hohe Wissenschaftlichkeit und Objektivität. Bei diesem Denkansatz besteht die Gefahr, dass der Blick der DiagnostikerInnen auf den Verursacher, nämlich auf das Kind als Träger von Symptomen (z. B. Wahrnehmungsstörung; Dyspraxie; Dyskalkulie; ADHS, minimale cerebrale Dysfunktionen usw.), gerichtet wird und Komponenten wie Erziehungsfehler, Reizarmut oder sozio-kulturelle Deprivation nicht wahrgenommen und diagnostiziert werden. Das „kranke“ Individuum ist Objekt der Diagnose, in ihm wird nach den Krankheitsgründen gesucht. Als Folge einer rein am medizinischen Modell orientierten Diagnostik kann eine häufige Verschreibung von Psychopharmaka für Kinder beobachtet werden; laut Berichten der österreichischen Krankenkassen ist ein Anstieg an Verschreibungen von z. B. Psychopharmaka bei Kindern mit Schlaf- oder Essstörungen oder auffälligem Verhalten bemerkbar (vgl. www.parlament.gv.at).
Die traditionelle Persönlichkeitsdiagnostik befasst sich mit der Erkundung von Persönlichkeitsmerkmalen und Eigenschaften, die dem Individuum zugrunde liegen. Daraus lassen sich gewisse Verhaltensweisen voraussagen. Das diagnostische Vorgehen basiert dabei auf psychometrischen Tests, die den Testgütekriterien „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Gültigkeit“ entsprechen und über eine Normierung verfügen. In der Testsituation wird das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen nach bestimmten Kriterien bewertet und mit einer repräsentativen Bezugsgruppe verglichen. Ziel dieser diagnostischen Vorgangsweise ist die situationsunabhängige Erfassung von Unterschieden bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften von Personen und führt in der Regel zu einer Klassifikation von Personen nach einem oder mehreren Merkmalen.
Seit den 1970er Jahren steht dieses Modell der Diagnose speziell im sonderpädagogischen Bereich im Kreuzfeuer der Kritik, da eine Selektions- und Klassifikationsfunktion zu erkennen ist und Informationen über Fördermaßnahmen nicht aus den Testergebnissen abzuleiten sind. Ebenso wie im medizinischen Ansatz werden beim psychodiagnostischen Ansatz soziale Bezüge nicht hergestellt und berücksichtigt.
„Es ergibt sich die Frage, ob die Psychodiagnostik, vor allem die traditionelle Psychodiagnostik, mit der Vorhersage von Verhalten nicht in hohem Maße stärker eine ‚Selektionsstrategie‘ im Sinne einer Optimierung durch geeignete Auswahl von Personen und/oder Bedingungen betrieb als eine ‚Modifikationsstrategie‘ im Sinne einer ‚Optimierung durch eine Veränderung des Verhaltens und/oder von Bedingungen‘“ (Pawlik 1982, S. 15 f.).
Im Prozess der Erstellung der sonderpädagogischen Diagnose nach dem psychodiagnostischen Ansatz wird es bei Kindern mit abweichendem Verhalten von der Norm und/oder Lerndefiziten und/oder Behinderungen daher höchstwahrscheinlich zu einer defizitorientierten Diagnostik kommen. Soziale Bezüge, die möglicherweise zu den Abweichungen geführt haben, spielen keine Rolle. Das Denken in Klassifikationen und Kategorien in der Sonderpädagogik birgt die Gefahr der Stigmatisierung, der Gleichsetzung von Person und Diagnose und der Vorurteilsbildung.
Eine Verwendung von psychodiagnostischen Methoden sollte dem jeweiligen Verfahren zur Erstellung der sonderpädagogischen Diagnostik angepasst sein. Das Ergebnis der psychodiagnostischen Untersuchung für die betreffende Person darf anschließend nicht als Festlegung und Stigmatisierung dienen, sondern sollte einen Ansatz zur individuellen Förderung bieten.
Ziel dieses Ansatzes ist es, das konkrete Verhalten eines Menschen in einer bestimmten Situation zu erfassen, d. h., dass eine bestimmte Reaktion auf spezifische Aspekte der Umwelt berücksichtigt wird. Werden Persönlichkeitsmerkmale bestimmt, die auf das Verhalten in einer Testsituation zurückzuführen sind, so spricht man in der traditionellen Diagnostik vom indirekten diagnostischen Ansatz. Dem gegenüber kann der direkte, verhaltensorientierte Ansatz gestellt werden, der als Ziel im diagnostischen Prozess beobachtbares Verhalten einer Person erfassen möchte.
Durch gezielte Verhaltensbeobachtungen (Selbst- und Fremdbeobachtung) und Verhaltensberichte in standardisierten und/oder natürlichen Situationen wird die Häufigkeit und Intensität eines Verhaltens festgehalten. Zugrunde liegende Ursachen oder Auslöser für bestimmte Verhaltensmuster werden nicht mit dem beobachtbaren Verhalten in Verbindung gebracht.
Die Grundlage dieses Ansatzes liegt in der Annahme, dass Verhalten durch die Lerngeschichte der Person beeinflusst, durch Erfahrungen erlernbar und veränderbar ist. Bei diesem Ansatz ergibt sich die Möglichkeit, durch Beobachtung eines bestimmten Verhaltens und durch Intervention, mit positiven oder negativen Verstärkern Häufigkeit und Intensität unangemessenen Verhaltens in einer spezifischen Situation direkt zu verändern. In den Vordergrund dieser Methode rückt die Betonung der Situationsabhängigkeit des beobachtbaren Verhaltens.
Einige Autoren (Schulte 1976; Jetter 1983; Kolt u. a. 1984) sehen die Vorteile dieses Ansatzes darin, dass sich aus einer konkreten Fassung eines Zieles und der Methode sowie der Beobachtung eines Verhaltens Maßnahmen zur Verhaltensveränderung und zur Verstärkerwirkung ergreifen lassen. Kritisch anzumerken ist, dass bei der Veränderung der Verhaltensmuster die Gefahr besteht, dass Manipulationen im Rahmen der Verhaltensmodifikation gegeben sind. Weiters stellt sich die Frage, welches Verhalten als „unangemessen“ einzustufen ist und damit veränderungsbedürftig ist. Über Intensität und Häufigkeit von Auffälligkeiten gibt es keine Kriterien, die eine Beurteilung zulassen würden.
Dieser Ansatz umfasst zwar die sozialen Aspekte und Bedingungen, die Frage nach den Ursachen des Verhaltens spielt jedoch eine untergeordnete Rolle.
Im Vergleich zum verhaltensorientierten Ansatz, bei dem die Häufigkeit und Intensität des Verhaltens der Person im Mittelpunkt der Diagnose steht, rückt beim sozialwissenschaftlichen Ansatz immer mehr die Lebenswelt des Kindes als Erklärung und Hintergrund seines Verhaltens in den Blick des Diagnostikers/der Diagnostikerin. Die Ursachen abweichenden Verhaltens werden nun vermehrt in sozialen Bedingungen und deren Wechselwirkungen gesucht. Bei diesem diagnostischen Ansatz wird das gesamte Bedingungsgefüge in die Beobachtung miteinbezogen.
„Eine an diesem Modell orientierte Diagnostik versucht die Interaktion einer Person mit gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen, in denen sie sich bewegt (z. B. Familie, Schule, Kirche, Altersgruppe usw.), zu analysieren. Ziel dieser Analyse ist es, innerhalb dieser Gruppen bzw. Institutionen Prozesse zu identifizieren, von denen wissenschaftlich begründet angenommen werden kann, dass sie Verhaltensauffälligkeiten und Leistungsschwierigkeiten begünstigen …, d. h. eigentlich Behinderungen (mit-)bedingen“ (Bundschuh 1994, S. 40).
Aus diesem diagnostischen Ansatz lässt sich eine genaue Diagnose behindernder Bedingungen ableiten. Können ungünstige Umweltbedingungen verändert werden, so lassen sich vermutlich Verhaltensauffälligkeiten und/oder Leistungsstörungen beeinflussen und gegebenenfalls reduzieren. Dabei spielen die Verhaltensweisen des Kindes und seine Persönlichkeitsmerkmale keine wesentliche Rolle. Bestehen also Veränderungsmöglichkeiten der Umwelt, so lassen sich Erfolge für Kinder mit Behinderungen auf Basis dieses diagnostischen Modells erzielen. Dem herkömmlichen Begriff der „Behinderung“ kann somit ein „ökosystemischer“ Begriff gegenübergestellt werden, d. h. eine Behinderung liegt nur dann vor, wenn das Kind aufgrund seiner Beeinträchtigung zu wenig in das Mensch-Umfeld-System eingebunden ist (vgl. Hildeschmidt u. a. 1988, S. 220).
Im Zentrum dieser Art der Diagnostik steht die entwicklungspsychologische Orientierung. Die Grundlagen dafür sind in der Entwicklungspsychologie und in der Lernpsychologie zu finden. Der/die Diagnostiker/in ermittelt den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes sowie die Voraussetzungen für einen weiteren Wissenserwerb.
„Der Stand der Entwicklung ergibt sich durch die Position der Leistung auf den allgemeinen Aneignungsstufen der entsprechenden Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Daraus leitet sich auch die Zone der nächsten Entwicklung mit den entsprechenden Fördermaßnahmen ab“ (Suhrweier 1993, S. 81).
Es wird also angenommen, dass es eine gewisse Lernhierarchie gibt und dass das Erreichen einer Lernstufe die Voraussetzung für die nächste zu erreichende Lernstufe ist. Das Diagnostizieren des Entwicklungsstandes kann z. B. durch Fehleranalysen, durch Abänderungen der Anforderungen, durch das Nachvollziehen von Aufgabenlösungsprozessen sowie der Methode erfolgen. Der Blick wendet sich bei dieser Art der Diagnose zum Lerngegenstand selbst, d. h. es wird eruiert, was vom Kind aus betrachtet einfach, komplex, leicht oder schwer erlernbar ist. Gewisse Aneignungsstufen wie Oberbegriffsbildung, Rechtschreibregeln, Zahlbegriff, perspektivisches Zeichnen (vgl. Probst 1981; 1991; Kornmann 1989; 1990) zeigen sich bei allen Kindern und können somit die strukturierende Diagnostik unterstützen.
Als Schwerpunkte dieses Ansatzes sind einerseits aus entwicklungspsychologischer Sicht die Entwicklungshöhe des Kindes bezogen auf den Lerngegenstand zu nennen sowie die Analyse des Lerngegenstandes selbst (z. B. die Aufteilung des Lerngegenstandes in kleinste Lernelemente).
Bei diesem diagnostischen Ansatz, dem ein lernorientiertes Persönlichkeitsmodell zugrunde liegt, wird von einer lernbegleitenden Diagnose ausgegangen. Dieses diagnostische Modell mit didaktischer Orientierung versucht eine Verbindung zwischen Diagnose und Förderung herzustellen und wendet sich somit von der klassischen Testtheorie ab. Im Zentrum steht nicht die Prognose von Lernleistungen, sondern deren Veränderbarkeit. Der/die Diagnostiker/in beobachtet und erfasst Lern- und Aufgabenlösungsprozesse, um anschließend Fördermaßnahmen einleiten zu können. Bei der Beobachtung wird untersucht, wie das Kind mit den einzelnen Lerngegenständen umgeht, welche Lernvoraussetzungen feststellbar sind und welche Schwierigkeiten beim Lernprozess entstehen.
„Eine Lerndiagnose unter handlungstheoretischem Aspekt schließt demnach die Aufgabe ein, zu eruieren, wieweit der Aufbau eines intendierten Handlungsprogramms fortgeschritten ist, d. h. es muss bestimmt werden, über welche der zu diesem Handlungsprogramm gehörenden Unterprogramme der Lernende bereits verfügt und wie er sie miteinander verknüpft hat. Ferner gehört dazu die Frage, welche Programm-Bestandteile noch fehlen und schließlich ggf., welche inadäquaten Vollzüge bzw. Programm-Bestandteile versehentlich angeeignet wurden“ (Bundschuh 2007, S. 60).
Um eine Diagnose stellen zu können, werden ein streng logischer Lösungsverlauf und kurze Lösungsschritte einer gestellten Aufgabe vorausgesetzt. Kritisch zu betrachten ist das Faktum, dass kognitive Lernprozesse nicht immer von außen zu beobachten und zu beurteilen sind und dass Faktoren wie Motivation und Emotionalität den Lernprozess beeinflussen. Im Gehirn eines Menschen geschieht aber in Bezug auf „Lernen“ unter Berücksichtigung emotionaler Prozesse und Wahrnehmungsprozesse ein sehr stark vernetzter Ablauf, der auch die derzeitige Forschung vor große Herausforderungen stellt und somit eine völlig logische wissenschaftliche Analyse der kognitiven Vorgänge nicht zulässt (vgl. Bundschuh 2003).
Die lernprozessdiagnostische Diagnose bezieht mehrere Faktoren (Schule als Lernraum, Klasse als Unterrichtssituation, Lehrer als Koordinator, Lerngegenstände) mit ein, um Verhaltensänderungen zu erzielen. Prozessdiagnostik bedeutet eine flexible, individuelle, situationsabhängige Methode über einen längeren Zeitraum hinweg, mit dem Ziel, durch Analyse und Beseitigung behindernder Bedingungen die Entwicklung des Kindes zu fördern. Schwarzer (1979, S. 19) spricht von „… Längsschnittanalysen über mehrere Zeitpunkte hinweg bei gleichzeitiger Beeinflussung des zu erfassenden Verhaltens“. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Form der Diagnostik ist die Durchführung und Ausarbeitung von curriculumbezogenen Testaufgaben und die ständige Beobachtung des schulischen Lern-, Leistungs- und Sozialverhaltens.
Die Kind-Umfeld-Analyse ist den Diagnostikmodellen nach dem Lernverständnis der interaktionistischen Theorie zuzuordnen (vgl. Hildeschmidt 1993; Sander 1993; Moog 1990; Schuck 1994 u. a.). Zu verändernde individuelle Lernförderung, die Diagnose der schulorganisatorischen Rahmenbedingungen sowie pädagogisch-psychologische Leitfragen zur kindlichen Entwicklung stehen im Zentrum des prozessdiagnostischen Modells.
Bei diesem breiteren Modellansatz führt der/die Diagnostiker/in eine Analyse der Interaktionsbeziehungen zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt durch.
Somit wird bei der Diagnose die gesamte Umwelt des Kindes miteinbezogen (Kind-Umfeld-Analyse). Mit der Erfassung der kind- als auch der umfeldbezogenen Daten soll eine auf das individuelle Kind-Umfeld-System abgestimmte Empfehlung zur bestmöglichen Förderung ermöglicht werden (Bundschuh 2005). Eine klare Abgrenzung findet dabei zu einseitigen kindzentrierten Diagnosen statt, die auf Basis von Testverfahren erstellt werden. Der Perspektivenwechsel beinhaltet eine Distanzierung von defektorientierten und normabweichenden Beschreibungen der Persönlichkeitsmerkmale des Kindes als Legitimation für den Sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Erfassung von kind- und förderorientierten Beurteilungen des Lern- und Leistungsvermögens steht hingegen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses.
Sander beschreibt folgende Charakteristika der Kind-Umfeld-Analyse:
„Nicht das Kind allein wird diagnostiziert, sondern das konkrete Kind-Umfeld-System.
Da es um den Schulbesuch geht, müssen neben den schulrelevanten Fähigkeiten des Kindes auch die kindrelevanten Gegebenheiten der in Frage kommenden Schule untersucht werden.
Die Diagnose des Umfeldes Schule darf nicht bei der Erfassung der Gegebenheiten stehen bleiben, sondern muß die im Einzelfall etwa notwendigen schulischen Veränderungen herausarbeiten.
Die Kind-Umwelt-Analyse muß von einem Team durchgeführt werden.
Die Kind-Umwelt-Analyse muß in bestimmten Zeitabständen sowie bei Veränderungen des Kind-Umwelt-Systems wiederholt werden.
Die Kind-Umwelt-Analyse muß im Schulleistungsbereich verschiedene Maßstäbe berücksichtigen: neben dem klassenbezogenen und dem lehrplanbezogenen auch den individuellen Bewertungsmaßstab“ (Sander 1997, S. 14, zit. nach Bundschuh 2005, S. 326).
Die Kind-Umfeld-Analyse darf mittlerweile als ein anerkanntes Verfahren einer integrativen Diagnostik bezeichnet werden, wobei der Fokus mehr auf die Organisationsentwicklung der Institution Schule gerichtet ist als auf die Entwicklung psychodiagnostischer Verfahren für die sonderpädagogische Diagnostik (vgl. Bundschuh 2005). Im Vergleich zu den oben beschriebenen Ansätzen setzt dieses Modell nicht an der Diagnose und Intervention beim Kind an, sondern die Interventionsstrategien setzen an ungünstigen Umweltbedingungen z. B. in der Institution Schule an. In diesem Fall spielen Verhaltensweisen einer Person oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale eine untergeordnete Rolle.
Bei diesem diagnostischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich jedes Kind körperlich, geistig, emotional und sozial weiterentwickelt und die Erziehung Einfluss auf die Entwicklung hat. Demnach verhalten sich Menschen mit oder ohne Behinderung nicht nach einem Reiz-Reaktions-Prinzip, sondern sie handeln als autonome Subjekte. Nach diesem, aus der Psychologie stammenden Modell beeinflussen nicht äußere Gegebenheiten das Verhalten des Menschen, sondern interne Vorstellungen von der Welt und der eigenen Person. Das epistemologische Subjektmodell hebt hervor, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, reflektiv zu sein, sich von seiner Umwelt zu distanzieren, indem er Phänomene seines Lebens mit Bedeutungen versieht, Fragen stellt, Erkenntnisse gewinnt und sein Handeln plant.
Ein Kind z. B. mit schwerer geistiger Behinderung oder mit einer Mehrfachbehinderung nimmt am Leben teil und ist Teil des Lebens, ist an Austauschprozessen beteiligt, hat Gefühle und spürt und empfindet Menschen in seiner Umgebung. Hier setzt der/die Diagnostiker/in an und beobachtet die Aktivitäten der Kinder, um sie anschließend im Förderprozess zu erweitern. Bei Kindern mit Mehrfachbehinderungen und geistigen Behinderungen versucht der/die Diagnostiker/in systematisch die Aktivitäten und Anknüpfungspunkte zu finden.
„Wenn die Hauptprobleme der Erziehung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in den Schwierigkeiten liegen, sich mitteilen, wahrzunehmen, kommunizieren zu können, Mitteilungen wahrzunehmen, zu decodieren, zu verstehen im Bereich der Erziehungspersonen und in der Herstellung von Aktivitäten zwischen dem Menschen mit schwerer Behinderung und anderen Personen bzw. Dingen aus der Umwelt, dann sollte diagnostisches Bemühen an dieser Stelle ansetzen“ (Bundschuh 1994, S. 49).
Der/die Diagnostiker/in wird bei dieser Form der Diagnose vor eine große Herausforderung gestellt, da manche Beobachtungsaufgaben fast unlösbar erscheinen und somit Grenzen deutlich werden, die bestmöglich zu überschreiten sind. Diese Art der Diagnostik verlangt von den DiagnostikerInnen viel Offenheit und eine ständige Bereitschaft zur Hinterfragung der Ziele für die anschließende Förderung.
Diese Art der Diagnostik versucht unter Einbezug von Datenerhebung das Verhalten jedes Menschen systematisch aus seiner Geschichte heraus zu verstehen. Im Zentrum der rehistorisierenden Diagnostik stehen die Analyse der Lebensgeschichte eines Kindes oder Jugendlichen, die Syndromanalyse sowie die Untersuchung der Lebenswelt. Diese Form der Diagnose wird von Jantzen beschrieben (vgl. Jantzen/Lanwer-Koppelin 1996) und ist vor allem für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung sowie für hospitalisierte Menschen ein systematischer Weg der Diagnostik.
Im Vergleich zu den oben beschriebenen Ansätzen der Diagnostik im sonderpädagogischen Bereich sind die Schwerpunkte der rehistorisierenden Diagnostik nicht nur als die Analyse der Lebensgeschichte, der vorhandenen Kompetenzen der zu untersuchenden Person, einer Kind-Umfeld-Analyse und/oder als Förderdiagnostik zu verstehen (vgl. Ziemen 2003).
Vielmehr versucht die rehistorisierende Diagnostik die unterschiedlichen Ebenen des Menschen, nämlich die biologische, psychische, soziale, kulturelle und gesellschaftliche Ebene mit einzubeziehen und Aussagen über deren Wechselverhältnisse zu treffen.
Diese Form der Diagnostik findet im Interesse des Kindes oder des Jugendlichen statt und beinhaltet folgende Aspekte:
-
die „Orientierung am Subjekt“,
-
die Beachtung der „Ganzheit des Subjekts“,
-
die Beachtung der „Historizität“,
-
die Beachtung der „Problemorientierung“ und
-
die Beachtung der Kompetenz der Einzelnen,
-
die Analyse seiner Lebenswelt sowie
-
eine sorgfältige „Deskription“ und „Interpretation“ der beobachteten Situationen.
-
Damit spielen die Analyse der lebensgeschichtlichen Aspekte, die Syndromanalyse und die Analyse der Lebenswelt eine gleichrangige Rolle (vgl. Ziemen 2009).
Die rehistorisierende Diagnostik beinhaltet eine Erforschung der Behinderung oder Verletzung auf medizinischer Ebene, um Prozesse beim Kind besser verstehen zu können. Ebenso wird die Persönlichkeitsentwicklung unter den Bedingungen von Diagnose analysiert Die gewonnenen Beschreibungen (z. B. biologische Bedingungen, Benachteiligungen, Isolationen) werden in die biographische Situation des Kindes miteinbezogen, um in der Folge mit der Geschichte der Behinderung die Persönlichkeit des Kindes zu verstehen. Ein weiterer Schritt beinhaltet die Analyse des Entwicklungsstatus von verschiedenen Tätigkeiten (z. B. Lernen, Spiel, Motivation, eigene Einschätzungen, Entwicklung von Handlungszielen usw.). Die Sichtweise des Kindes wird dabei stets berücksichtigt.
Weiters versucht der/die Diagnostiker/in Beziehungen (behindernde oder stützende) des Kindes zu erfragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der rehistorisierenden Diagnostik ist die Erforschung der Kompetenzen und Ressourcen (z. B. Ichkompetenzen, Sozialkompetenzen, Körperselbstbild, Verantwortungsbereiche, Kommunikationsmöglichkeiten usw.).
Eine große Bedeutung erhält in der Rekonstruktion der biographischen Geschichte des Kindes auch die Analyse der Lebensgeschichte (Anamnese, Wünsche, kritische oder wichtige Lebensereignisse usw.) sowie der Lebenswelt (Lebensort, Tagesstrukturen, Familie usw.) des Kindes.
Ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in der Vorgehensweise der rehistorisierenden Diagnostik ist die Selbstreflexion des Diagnostikers/der Diagnostikerin. In den Mittelpunkt werden Fragen nach den Erwartungen, beeinflussenden Aspekten, Vorkenntnissen, Perspektiven, Bildern um Behinderung, Zielen der Diagnostik usw. gestellt.
Diese umfangreiche Vorgangsweise in der Diagnostik ist sicher eine große Herausforderung für die SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen, bietet aber neue Ansatzpunkte für die sonderpädagogische Praxis und für gezielte Interventionen.
Das Diagnostische Mosaik wurde von Schley (1988) im Rahmen der Verhaltensgestörtenpädagogik zusammengestellt und von Boban und Hinz (1996) weiterentwickelt. Die beiden Autoren entfernen sich in ihren Ansätzen von der Zwei-Gruppen-Theorie (Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf) und streben eine Pädagogik der Vielfalt an (vgl. Hinz 1993).
Im Sinne des Diagnostischen Mosaiks wird die gesamte Situation eines Kindes einschließlich der in dieser Situation handelnden Personen erfasst. Dabei geht es bewusst um subjektive Sichtweisen und Eindrücke der Beteiligten (Ängste, Wünsche, Hoffnungen, Ziele usw.).
„Diagnostik bedeutet hier nicht, etwas Wahres und Vollständiges objektiv, valide und reliabel festzuhalten, sondern sich mit den jeweiligen Konstruktionen momentan bedeutsamer subjektiver Realität auseinanderzusetzen, aus denen Alltagshandeln wesentlich entsteht …“ (Boban/Hinz 1998, S. 153).
Das Diagnostische Mosaik ist ein Verfahren, das als ein wichtiger Beitrag zu einer Diagnostik für inklusive Pädagogik bewertet werden kann. Bausteine in der Vorgangsweise sind die biografische Analyse des Kindes, eine Kontextanalyse, die Analyse der Lerndynamik, der Übertragungsbeziehungen und des Familienkontextes sowie die Entwicklung inklusiver Perspektiven und Planungen von Veränderungen. Die komplexe Sichtweise der Lebens- und Lernsituationen eines Kindes ermöglicht es unter Berücksichtigung von Projektionen und Alltagshypothesen Planungen für Veränderungen zu erarbeiten.
Die Darstellung von verschiedenen Modellen in der sonderpädagogischen Diagnostik zeigt, dass es eine Reihe von Ansätzen gibt, die sich je nach Problemlage für den Sonderpädagogen/die Sonderpädagogin als Diagnostiker/in anbieten oder kritisch hinterfragt werden sollten. Traditionelle Ansätze, die sich als Selektionsdiagnostik, Merkmals- und Eigenschaftsdiagnostik sowie als statische Diagnostik erwiesen haben, bieten Kindern mit Lern- oder Entwicklungsstörungen wenige Möglichkeiten für Förderungen.
Die traditionellen Ansätze (medizinischer, psychodiagnostischer Ansatz) sehen endogene und/oder situationsunabhängige Persönlichkeitsmerkmale als Verursacher für Auffälligkeiten im Lernen und Verhalten. Die verhaltensorientierte Diagnostik geht davon aus, dass das menschliche Verhalten durch Erfahrung erlernbar und veränderbar ist.
Die neueren Ansätze in der sonderpädagogischen Diagnostik ermöglichen es, die Probleme der traditionellen Diagnostik zu überwinden. Diese Entwicklungen führen weg von statischen Vorgehensweisen und beziehen sozialwissenschaftliche, behavioristische, entwicklungspsychologische und subjekttheoretische Einflüsse in die diagnostische Vorgehensweise mit ein. Die sozialwissenschaftliche Diagnostik versucht Ursachen für Lernstörungen und Behinderungen in der sozialen Umgebung des Kindes zu finden. Durch den lerndiagnostischen Ansatz soll die Veränderbarkeit der Lernleistungen erfasst werden. Bei der strukturbezogenen oder qualitativen Diagnostik werden Voraussetzungen für den Wissenserwerb beim Kind diagnostiziert. Die Kind-Umwelt-Analyse ist ein breiteres, prozessorientiertes Diagnosemodell und richtet den Blick vermehrt auf die Interaktion zwischen Kind und Umfeld. Der epistemologische Ansatz stellt jeden Menschen als autonomes System dar und sucht nach Bedingungen, die es ihm ermöglichen, an Erkenntnisprozessen teilzunehmen. Basis der rehistorisierenden Diagnostik ist das Verstehen des Menschen unter Betrachtung der unterschiedlichen Ebenen (biologische, psychische, soziale, kulturelle, gesellschaftliche), wobei die Verhältnisse zwischen den Ebenen berücksichtigt werden.
Die fachliche Diskussion über die Problematik in der sonderpädagogischen Diagnostik hat zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen geführt. Kind-, Prozess-, Förder- und dynamische Ansätze sind gegenüber den traditionellen diagnostischen Ansätzen zu bevorzugen, da sie den Fokus nicht auf Defizite und Normabweichungen legen, sondern die Lebenswirklichkeit des Kindes zu erfassen versuchen. Dem Anspruch einer kindgerechten Förderung können somit die neueren Ansätze vielmehr gerecht werden als die herkömmlichen, normorientierten Verfahren.
Normorientierte Verfahren können dem Anspruch eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht gerecht werden, da sie nicht die Lebenswirklichkeit des Kindes erfassen.
Inhaltsverzeichnis
-
3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs in 15 Ländern Europas
- 3.1.1 European Agency for Development in Special Needs
- 3.1.2 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von unabhängigen Stellen
- 3.1.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von LehrerInnen, SonderpädagogInnen und Expertenteams
- 3.1.4 Zusammenschau der vergleichenden Studien
-
3.2 Die Erhebung des Sonderpädagogischen
Förderbedarfs in Österreich
- 3.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich
- 3.2.2 Abgrenzung zu allgemeinen Förderungen
- 3.2.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs
- 3.2.4 Die Problematik des Sonderpädagogischen Förderbedarfs im System Schule aus juristischer Sicht
- 3.2.5 Der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“
- 3.2.6 Der Behinderungsbegriff
- 3.2.7 Behinderung und Ressourcen
- 3.2.8 Ausbildung zum Sonderschullehrer/zur Sonderschullehrerin, zum Gutachter/zur Gutachterin
- 3.2.9 Sonderpädagogischer Förderbedarf in einem inklusiven Bildungssystem?
Im Jahre 2003 wurde in Europa das Jahr der Menschen mit Behinderungen ausgerufen. Forderungen nach Selbstbestimmung, sozialer Inklusion behinderter Menschen und die Abwendung der Vorstellung von behinderten Menschen als defizitäre Wesen standen und stehen im Vordergrund. Sonderpädagogische Aufgaben und Herausforderungen wurden auf einer internationalen Basis diskutiert. Während das sonderpädagogische Handeln in den Industriestaaten in Richtung Normalisierungskonzepte und in Richtung Durchsetzung der sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen geht, steckt in den Ländern der Dritten Welt der Aufbau sonderpädagogischer Angebote und elementarer Bildungsrechte von Kindern mit Behinderungen erst in den Anfängen (vgl. Biewer 2002)[1].
Um aktuelle Informationen aus europäischen Ländern zu erhalten, wurden von der Autorin Berichte der „European Agency for Development in Special Needs Education“ (Europäische Agentur für Entwicklung in der sonderpädagogischen Förderung) herangezogen.
Die europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung wurde 1996 als unabhängige und sich selbst verwaltende Institution gegründet, welche 26 Mitgliedstaaten als Plattform für die Zusammenarbeit in diesem Bereich umfasst. Sie steht in Zusammenarbeit mit anderen europäischen internationalen Gremien, insbesondere mit der Europäischen Kommission, der OECD, der UNESCO, dem Europäischen Parlament und dem Europarat.
Die Ziele der European Agency for Development in Special Needs Education sind:
-
Steigerung der Qualität im Bereich der sonderpädagogischen Förderung durch Schaffen entsprechender Rahmenbedingungen für eine umfassende und nachhaltige europäische Zusammenarbeit
-
Vermittlung eines gesamteuropäischen Bildes der „Special Needs Education“ in Europa
-
Identifikation von Schlüsselfaktoren und Rahmenbedingungen
-
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten
-
Erleichterung des Zugangs zu relevanten Daten und Informationen für politische Entscheidungsträger und Fachkräfte (vgl. www.europeanagency.org )
Finanziert wird die Europäische Agentur von den Bildungsministerien der teilnehmenden Staaten sowie von der Europäischen Union selbst. Die Finanzierung erfolgt einerseits durch projektspezifische Unterstützungen, andererseits durch das Jean-Monnet-Programm (2007–2013) zur Unterstützung von Initiativen zur Europäischen Integration[2]. Die wesentlichen Leitlinien für die Arbeit der Agency legt der Representative Board fest. In jedem Mitgliedsland ernennt das jeweilige Bildungsministerium eine/n nationale/n Koordinator/in. Das Management Board besteht aus dem/der Vorsitzenden und fünf gewählten Mitgliedern des Representative Board. In Zusammenarbeit mit der Direktion sorgt dieses Gremium für eine wirksame Umsetzung der strategischen Pläne und Beschlüsse.
Die einzelnen nationalen KoordinatorInnen werden von den jeweiligen Mitgliedsstaaten bestimmt. Aufgabe der KoordinatorInnen ist es, zur Entwicklung und Um-setzung der Arbeitsprogramme beizutragen und einen Informationsaustausch zwischen Agency und nationaler Ebene aufrechtzuerhalten.[3]
Im Abstand von vier Jahren findet ein European Parliament Hearing statt, an dem die Agency die Parlamentarier der EU auf ihre Aktivitäten, Ergebnisse von Projekten und Anliegen aufmerksam macht. Für das Jahr 2010 war eine internationale Konferenz während der spanischen EU-Präsidentschaft geplant, die dem Informationsaustausch und einer vermehrten Zusammenarbeit mit Drittländern dienen sollte. Die Agency erhält zunehmend Anfragen aus nicht europäischen Ländern im Bereich „Inclusive Education“ und „Special Needs Education“.
Die Agentur verfügt über Länder- und Syntheseberichte aus 23 teilnehmenden europäischen Ländern.
Die Informationen zur Erstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in anderen europäischen Ländern wurden von der Europäischen Agentur unter Verwendung von Beiträgen aus nationalen Informationsstellen von Eurydice (Europäisches Bildungsinformationsnetz) erstellt.
In vielen Ländern Europas sind multidisziplinäre Teams mit Personen aus verschiedenen Fachbereichen (sonderpädagogischer, schulischer Bereich, Gesundheitsbereich, sozialer Bereich, psychologischer Bereich, medizinischer Bereich) mit einer Ersteinschätzung und Erstdiagnose eines Förderbedarfs der SchülerInnen befasst. In einigen Ländern führt die gestellte Diagnose immer noch zu Entscheidungen über Ressourcen, die entsprechende Bildungsform und entsprechende Schulart.
Mitglieder des Representative Board der Europäischen Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung (European Agency for Development in Special Needs Education) haben Angaben zu den jeweiligen europäischen Ländern weitergeleitet und in einem Assessment-Projektbericht veröffentlicht.[4]
Die Artikel sind sowohl in der jeweiligen Landessprache als auch in Englisch verfasst. Die Berichte stehen in digitalisierter Fassung zur Verfügung, um optimalen Informationszugang zu gewährleisten, und wurden von der Agency in die englische Sprache übersetzt.[5]
Vergleichende Länderstudien oder ergänzende Berichte über die Vorgehensweise bei der Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten und der anschließenden Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in den einzelnen europäischen Ländern sind in der Literatur kaum zu finden.
Eine direkte Gegenüberstellung der Vorgehensweise der Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in den einzelnen Ländern Europas ist durch die vorhandenen Berichte nicht beabsichtigt; die sozialen, ökonomischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hintergründe sowie der Aufbau der Bildungssysteme sind anhand der Berichte nur sehr schwer zu vergleichen. Allein die unterschiedlichen Landessprachen und die Übersetzungen ins Englische bergen die Gefahr von vielen Missverständnissen. Erschwerend kommt hinzu, dass divergente Begriffssysteme, was Behinderung, Lernschwierigkeiten, Verhaltensstörungen, soziale Benachteiligungen usw. betrifft, in den einzelnen Ländern gelten.[6]
Im folgenden Abschnitt wird die Vorgangsweise der Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in 15 Ländern Europas dargestellt. Für diese 15 Länder liegen die Berichte abrufbar bei der Agency[7] vor. Es wurde von der Autorin eine Einteilung vorgenommen, nämlich, ob der Sonderpädagogische Förderbedarf vom Personal der Schule oder von unabhängigen Stellen erhoben wird; ein vergleichender Blick hinsichtlich der Personen, Institutionen und ExpertInnenteams, die mit der Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs befasst sind, hat für die Verfasserin der Forschungsarbeit folgende Kategorien entstehen lassen:
-
Länder, in denen ein SPF von schulunabhängigen Stellen erhoben wird, die aber mit den Schulen vernetzt sind; z. B. Spanien, Lettland, Italien, Island, Schweiz, Irland
-
Länder, in denen ein SPF hauptsächlich vom Lehrpersonal erhoben wird, jedoch unter Einbeziehung von ExpertInnengutachten (z. B. Österreich, Niederlande, Finnland, Schweiz, Schweden, England, Deutschland, Zypern, Litauen)
Nach dem Gesetz des Disability Act 2005[8] wird verlangt, dass ein Kind mit SPF von einer unabhängigen Stelle begutachtet wird. Ein Kind mit einer Beeinträchtigung kann nach dem Disability Act 2005 oder dem EPSEN (Education for Persons with Special Educational Needs) Act 2004 beurteilt werden.
Wird ein Sonderpädagogischer Förderbedarf nach Gesetz des Disability Act festgestellt, so muss dies an den/die für Gutachten zuständige/n Beamten/Beamtin des Nationalen Rates für Sonderpädagogik weitergeleitet werden. Wird nach dem EPSEN Act 2004 ein Förderbedarf ermittelt, so ist die nächste Instanz der/die Direktor/in der jeweiligen Schule. Werden in einer EPSEN-Beurteilung gesundheitliche Bedürfnisse festgestellt, so werden diese in einem „Service Statement“ behandelt.
Gutachten über SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf erstellen PsychologInnen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. Psychologische Untersuchungen werden aber auch von PsychologInnen der Gesundheitsbehörden und dem nationalen Amt für Rehabilitation durchgeführt oder von PsychologInnen, die im Dienst freier Wohlfahrtsverbände beschäftigt sind.
Wird ein Sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, muss das Gutachten an das Förderzentrum NCSE (National Council for Special Education) oder an den/die Direktor/in der Schule, mit Ziel einer angemessenen Förderung, weitergegeben werden.
Seit Juni 2007 können sich Eltern mit Kindern unter fünf Jahren an eine unabhängige Stelle, das HSE (Health Service), wenden und kostenlose und unabhängige Gutachten erstellen lassen. Die Beurteilung muss innerhalb von drei Monaten nach dem anfangs gestellten Antrag beginnen und das Gutachten den Eltern zur Verfügung gestellt werden, sobald es vollendet ist.
Da die Bedürfnisse der Kinder sich im Laufe der Zeit ändern, sind regelmäßige Folgeuntersuchungen notwendig.
Jene Teile des EPSEN Act, die die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung und den Prozess der Förderplanung bilden, werden im Laufe der nächsten drei Jahre ausgearbeitet werden.
Nach dem Gesetz können Eltern oder Erziehungsberechtigte eines Kindes mit Beeinträchtigung von der NCSE eine Begutachtung einfordern, unabhängig davon, ob ein Kind im Schulbetrieb ist oder nicht. Aufbauend auf das Gutachten wird ein Förderplan für das Kind ausgearbeitet. Wird während der Beurteilung auch ein medizinisches Bedürfnis festgestellt, so wird das HSE informiert. Sollten Eltern oder Erziehungsberechtigte das Gutachten anzweifeln oder nicht mit dem Förderplan einverstanden sein, können sie sich an die sonderpädagogische Beschwerdestelle des Ministeriums für Erziehung und Bildung wenden.
Die „Section 15“ des EPSEN Act 2004 ist zuständig für die weitere Begleitung und Förderung von Kindern bis ins Jugendalter: Der/die Schulleiter/in oder ein/e vom NCSE angestellte/r Organisator/in sind für die notwendigen Schritte einer, der Behinderung gerechten Förderung verantwortlich.
Stimmen die Eltern dem Gutachten oder dem Förderplan nicht zu, können sie beim Ministerium für Unterricht und Wissenschaft, beim „Special Education Appeals Board“, Einspruch erheben.
Das National Council for Special Education (NCSE) hat nationale Richtlinien für individuelle Förderpläne für LehrerInnen, Eltern und Schulen vorgegeben.
In Lettland gibt es noch keine offizielle Definition von Sonderpädagogischem Förderbedarf. SchülerInnen, die den Lehrplan aufgrund von Abweichungen von altersgemäßen Fähigkeiten, geistiger und physischer Entwicklung nicht erfüllen und Abweichungen im Verhalten zeigen, fallen unter den Begriff „Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf“.
Alle Kinder in Lettland beginnen ihre Schulzeit in einer Regelschule, außer es wurde schon sehr früh eine Behinderung festgestellt. Auf Wunsch der Eltern können behinderte Kinder eine Sonderschule besuchen.
Im ersten Schuljahr werden alle SchülerInnen nach dem Regelschullehrplan unterrichtet.
Hat ein Kind Schwierigkeiten das Lehrziel zu erreichen, werden Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet. Greifen diese nicht, so wird dem/der Schüler/in empfohlen, das Schuljahr zu wiederholen oder es wird eine pädagogisch-medizinische Kommission eingeschaltet.
Vor dem Besuch der Kommission muss das Kind von einem Team, bestehend aus PsychologInnen, LehrerInnen, LogopädInnen, begutachtet und ein Gesundheitscheck durchgeführt werden. Die Kommission schlägt dann den Eltern entsprechende Fördermaßnahmen vor.
Es gibt in Lettland zwei verschiedene Kommissionen, eine staatliche pädagogisch-medizinische Kommission, „State Pedagogical Medical Commission“ (SPMC), die vom Erziehungs- und Wissenschaftsministerium eingesetzt wird, und eine örtliche Kommission, „Municipal Pedagogical Medical Commission“. Die Kommissionen setzen sich aus SonderschullehrerInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen zusammen und diagnostizieren Sinnes-, Lern- und Körperbehinderungen, geistige Behinderungen sowie chronische Krankheiten.
Beide Kommissionen werden durch Gesetze des Ministerkabinetts reguliert.
Die Eltern haben die Wahlmöglichkeit zwischen Integration und Sonderschule.
Die meisten schweren Beeinträchtigungen werden bei Kindern bereits im Vorschulalter (0–5 Jahre) von VorschullehrerInnen oder von medizinischem Personal bei Gesundenuntersuchungen festgestellt. Der Antrag für ein Gutachten erfolgt durch KlassenlehrerInnen, Eltern oder Schulgesundheitsdienst. Die Kinder werden daraufhin an das staatliche Diagnose- und Beratungszentrum, das „State Diagnostic and Advisory Centre“, für medizinische Untersuchungen, psychologische Beurteilung und Gutachten durch SozialarbeiterInnen, PhysiotherapeutInnen und BeschäftigungstherapeutInnen verwiesen.
Der/die jeweilige Schulleiter/in, der/die Empfehlungen der Zentren erhält, trifft in Zusammenhang mit den Eltern eine Entscheidung über die schulische Förderung des Kindes.
Gesetzlich müssen alle Kinder im Pflichtschulbereich eine angemessene Beschulung an einer am Wohnort nahe liegenden Schule erhalten. Eltern haben die Wahlmöglichkeit zwischen Förderung in einer Regelschule oder Sonderschule, falls die Regelschule die entsprechende Ausbildung nicht anbietet. In den Gemeinden gibt es an Schulen SonderpädagogInnen und BeratungslehrerInnen, die RegelschullehrerInnen und Eltern der betroffenen Kinder beraten (Specialist Services of the Local Municipalities).
Vom Gesetz her geregelt ist auch die Einrichtung von „Schülerschutz-Komitees“ in jeder Schule. Diese haben das Ziel, die Zusammenarbeit von SpezialistInnen in Hinblick auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu fördern und umfassen die Direktion, ErziehungsberaterInnen, SpezialistInnen von Gesundheitseinrichtungen und von örtlichen Erziehungsbüros.
Für die Sekundarstufe ist das „Specialist Service“ nicht mehr zuständig; Berater, die von den Schulen beschäftigt werden, helfen SchülerInnen mit Lern- oder persönlichen Problemen. Gutachten werden nicht automatisch von einer Schule zur nächsten weitergegeben, außer die Eltern wünschen dies.
In Spanien existiert ein Gesetz namens „Organic Law of Education“, kurz LOE genannt, das für sonderpädagogische Unterstützung bei Lernproblemen, Hochbegabung, später Einschulung, personellen Angelegenheiten in Schulen oder für Schulunterlagen zuständig ist.
Das LOE reguliert und überwacht sonderpädagogischen Unterricht innerhalb der allgemeinen Ausbildung und ist für Integration verantwortlich. Es ist gesetzlich geregelt, dass Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf eine Regelschule besuchen müssen, wobei, je nach Behinderung, auf die SchülerInnen abgestimmte sonderpädagogische Fördermaßnahmen stattfinden.
Sonderschulen besuchen nur SchülerInnen, denen man durch die eingeleiteten Fördermaßnahmen nicht entgegenkommen konnte.
Nach LOE soll Sonderpädagogischer Förderbedarf im herkömmlichen Sinn nicht für bestimmte Kinder gelten, sondern als eine Kombination aus Materialien und personellen Ressourcen verstanden werden, die für das ganze Schulsystem zugänglich sind, um Kinder zu fördern.
Mit diesen Ressourcen sollen Kinder mit vorübergehenden oder ständigen Beeinträchtigungen auch die schulischen Ziele der Regelschule erreichen können.
Normalisierung und Integration ist das Ziel dieses Gesetzes.
Die Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt in Spanien durch ein Team, bestehend aus ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen. Aufgrund von Beobachtungen, Protokollen zur Ermittlung der schulischen Fähigkeiten durch Lehrpersonen, von Fragebögen und schulpsychologischen Tests durch Teams für Schullaufbahn- und schulpsychologische Beratung – (EOEP) – wird ein SPF festgestellt. Die EOEP erarbeiten eine Empfehlung zum Schulbesuch, d. h. entweder den Besuch einer Sonderschule oder den integrativen Unterricht in der Regelschule.
Die ExpertInnen erstellen auch Förderpläne in Absprache mit den Eltern, LehrerInnen und der Schulleitung.
Am Ende eines jeden Schuljahres wird eine Evaluation durch ein Team durchgeführt.
In Italien werden Kinder, die von Geburt an beeinträchtigt sind, vor Eintritt in den Kindergarten von den Diensten für Physische Rehabilitation diagnostiziert, betreut und begleitet.[9]
Werden Entwicklungsverzögerungen erst im Kindergarten oder in der Schule festgestellt, wird von KindergärtnerInnen oder Lehrpersonen ein schriftlicher Antrag um Abklärung an die Dienste der Sanitätsbetriebe geschickt. Der Antrag darf nur mit Zustimmung der Eltern erfolgen. ExpertInnen der Sanitätsbetriebe klären anhand klinischer und medizinischer Diagnostik ab, ob es sich bei den beobachteten Schwierigkeiten um effektive Behinderungen bzw. gravierende Störungen oder um Schwierigkeiten handelt, die durch gezielte schulische Maßnahmen behoben werden können.
Spezifische Dienste der Sanitätsbetriebe, die für den Kinder- und Jugendbereich zuständig sind, sind der Psychologische Dienst, der Rehabilitationsdienst und die Kinderneuropsychiatrie. In Italien gibt es keinen eigenen schulpsychologischen Dienst, sondern der psychologische Dienst wird von den Sanitätsbetrieben geleistet und ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zuständig. Der Psychologische Dienst arbeitet vernetzt mit den Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, mit Kindergarten und Schule, dem Jugendgericht, den Arbeitsämtern, den Krankenhäusern sowie anderen sozialen und sanitären Strukturen zusammen.
Laut Gesetz muss auch in Italien die Zuteilung von Fördermaßnahmen an die Feststellung einer Behinderung oder gravierenden Störung gebunden sein. Je nach Schweregrad der Beeinträchtigung wird zwischen zwei Gruppen von Diagnosen unterschieden: Für Diagnosen mit weitreichenden Auswirkungen wird eine Funktionsdiagnose erstellt, für Diagnosen mit eingegrenzten Auswirkungen wird eine Funktionsbeschreibung gemacht. Die Feststellung einer Behinderung erfolgt nach den internationalen Kriterien des Klassifikationssystems ICD-10, die Funktionsbeschreibung nach dem Klassifikationssystem ICF.
Aufgrund der Ergebnisse der Funktionsdiagnose (FD) oder des Funktionellen Entwicklungsprofils (FEP) wird gemeinsam von den KindergärtnerInnen, den Lehrpersonen, den MitarbeiterInnen für Integration und den Eltern ein individueller Erziehungsplan (IEP) ausgearbeitet. Das Fachpersonal der Sanitätsbetriebe arbeitet auf Anfrage an den individuellen Erziehungsplänen mit.
Mit dem Gesetz 517 wurde im Jahr 1977 eine Grundlage geschaffen, die behinderte Kinder verpflichtend in die Regelschule einschult. Seitdem gibt es keine Sonderschulen mehr, die erst 15 Jahre vorher gegründet wurden. 80–90 % der Stellen für IntegrationslehrerInnen werden den Schulen zugeteilt, ohne dass vorher eine Abklärung getroffen wurde; es besteht die Annahme, dass überall etwa gleich viel Supportbedarf vorhanden ist. Die restlichen Stellen verbleiben für Zusatzanträge beim Schulamt und werden auf Antrag der Schulen je nach Bedarfseinschätzung verteilt.
In der Schweiz gibt es in jedem Kanton Agenturen, die für die Erstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs verantwortlich sind, aber es gibt noch kein standardisiertes Verfahren, nach dem ein Gutachten erstellt wird; ein Projektteam entwickelt jedoch derzeit eine standardisierte Vorgehensweise nach den ICF (International Classification of Functioning) und ICD 10 (International Classification for Diseases) der WHO.
Bei sehr jungen Kindern wird ein Sonderpädagogischer Förderbedarf von ÄrztInnen und von SpezialistInnen der Frühförderstellen festgestellt.
Im Regelschulalter wird der Sonderpädagogische Förderbedarf sowohl vom Frühförderzentrum als auch von PsychologInnen, LehrerInnen und SonderpädagogInnen
diagnostiziert. Die Schulbehörde stellt den Bescheid aus. In der Übergangsphase zur Sekundarstufe basiert die Feststellung von Bedürfnissen meistens auf Ergebnissen von bereits vorliegenden Untersuchungen.
In Zukunft sollen alle Kantone die standardisierten Vorgehensweisen übernehmen, was eine bessere Verteilung von Ressourcen für die Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf erlaubt.
In den Niederlanden werden zwei Verfahren zur Begutachtung eines Kindes herangezogen:
Ein Verfahren für Kinder mit leichten Behinderungen, die die integrative Schule (Together to School Again Policy) besuchen, und ein Verfahren für Kinder mit Behinderungen mit einer Förderung in einer wahlweise speziellen Förderschule.
In der Regelschule überprüft grundsätzlich der/die Klassenlehrer/in das Kind mit leichten Lernstörungen (learning difficulties) und leichten geistigen Behinderungen (mild mental impairments) hinsichtlich eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs. Hat das zu begutachtende Kind schwerwiegende Probleme, bekommt der/die Klassenlehrer/in bei der Begutachtung Unterstützung von einem/er sonderpädagogischen Koordinator/in oder Beratungslehrer/in des regionalen Beratungsdienstes (Regional School Support Service). Anschließend wird das Kind mit dem Einverständnis der Eltern an ein Begutachtungsteam, bestehend aus PsychologInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen und erfahrenen SonderpädagogInnen, überwiesen.
In Absprache mit dem/der Direktor/in der Schule, den Eltern, dem/der Klassenlehrer/in und dem „School Support Service“ wird der Antrag auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt.
Damit Kinder mit Behinderungen eine spezielle Förderschule besuchen können, müssen sie hinsichtlich ihrer Behinderung laut Gesetz der „Expertise Centres“ gewisse Kriterien erfüllen (z. B. bei hörbehinderten Kindern ein Hörverlust über 80 dB, bei sehbehinderten Kindern ein Sehfeld kleiner als 30, bei geistig behinderten Kindern ein IQ kleiner als 55 usw.). Für chronisch kranke Kinder oder physisch behinderte Kinder werden ärztliche Atteste benötigt. Verhaltensauffällige Kinder werden nach Kategorien des DSM-IV begutachtet und beurteilt.
Der Trend in den Niederlanden geht weg von einem Sonderschulwesen, das sehr stark differenziert und breit gefächert ist, hin zur sonderpädagogischen Förderung in Regelschulen.
Grundsätzlich beruht das Beurteilungsverfahren auf der Untersuchung von medizinischen Aspekten, der kognitiven Entwicklung, speziellen Aspekten in der Entwicklung des Kindes (Sprache, Kommunikation, Konzentration und Motivation), sozial-emotionaler Entwicklung (Verhalten, emotionale Stabilität, Unabhängigkeit) genauso wie auf der Untersuchung der Familienverhältnisse, der Umgebung und Nachbarschaftsverhältnisse und/oder des kulturellen Hintergrundes. Der Fokus in der Betrachtung hängt von den Gründen der Überweisung und den Beeinträchtigungen des Kindes ab. Die Beurteilungsteams versuchen die Erkenntnisse im Sinne einer Planung der Ausbildung des Kindes zu formulieren.
Da die Gemeinden in Schweden dezentral organisiert sind, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen in der Feststellung von individuellen Bedürfnissen in Bezug auf Sonderpädagogischen Förderbedarf.
Im Jahre 1996 besuchten in Schweden 75 % aller Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren öffentliche oder private Kinderstätten; auf diese Weise kann der Sonderpädagogische Förderbedarf oft bereits identifiziert werden, bevor das Kind das Schulalter erreicht. Es gibt regelmäßige Gesundenuntersuchungen für Kinder.
MedizinerInnen und PsychologInnen stehen sowohl für die Belegschaft von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen als auch für Schulkinder und Eltern zur Verfügung.
Sollte der Bedarf an länger dauernden oder vertieften Untersuchungen bestehen, müssen die Eltern ihr Einverständnis geben.
Stellen LehrerInnen fest, dass sie den Bedürfnissen eines Kindes nicht gerecht werden können, wird eine Konferenz einberufen, um das Kind zu diagnostizieren. Schulen verfügen über ein „pupil-welfare team“, welches aus einem Mitglied des Ausschusses der betreffenden Schule und den jeweiligen Betreuungsbediensteten wie z .B. Krankenschwestern, PsychologInnen, TherapeutInnen und SonderpädagogInnen besteht. Wird bei einem Kind dann ein Sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, so entscheidet das Team rund um die Lehrpersonen über die bestmögliche Förderung des Schülers/der Schülerin.
Öffentliche Kinderbetreuungsstätten, Vorschule, Pflichtschule und nachschulische Betreuungsstätten sind oft Teil einer gemeinsamen Organisation und geben Informationen weiter. Dies ermöglicht eine komplette Sichtweise und Einschätzung des Schülers/der Schülerin mit Sonderpädagogischem Förderbedarf.
Im schwedischen Lehrplan wird die Wichtigkeit der Einbindung der Eltern an der Gestaltung der Bildung betont.
Aktuelle Rahmenbedingungen für die sonderpädagogische Förderung werden in England und Wales durch Bildungsgesetze (1981; 1993; 1996) vorgegeben.
Gemäß dem Education Act 1996 bekommt ein Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf dann, wenn es Lernprobleme hat und eine sonderpädagogische Förderung benötigt.
Die sonderpädagogische Förderung ist angebracht, wenn:
-
ein Kind signifikant größere Lernprobleme hat als der Altersdurchschnitt,
-
das Kind eine Beeinträchtigung hat, welche es ihm nicht ermöglicht, dem Unterricht in altersgemäßen Schulen zu folgen,
-
das Kind jünger als fünf Jahre ist und voraussichtlich im Alter über fünf Jahre unter die beiden oben genannten Kriterien fällt.
Nach dem Disability Discrimination Act[10] werden sonderpädagogische Gutachten und Sonderpädagogische Förderbedarf-Bescheide von LEAs (Local Education Authorities), den lokalen Bildungsbehörden, in einem multi-professionellen Team ausgestellt, wenn vermutet wird, dass ein Kind eine Betreuung benötigt, die über das Lernangebot in der Regelschule hinausgeht. Wenn notwendig wird ein Förderbedarf-Statement formuliert. Die LEA muss auch begründen, wenn kein Sonderpädagogischer Förderbedarf vergeben wird.
Ein Kodex für die sonderpädagogische Praxis empfiehlt Schulen und LEAs eine mehrstufige Beurteilung, die detailliert jede Phase dokumentiert und in welcher unterschiedlichste Strategien zur Beurteilung und Unterstützung des jeweiligen Kindes herangezogen werden, angefangen von der Unterstützung durch die jeweilige Schule, bis hin zu externer Beratung und Arbeit mit SpezialistInnen.
Die Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs wird als kontinuierlicher und flexibler Prozess betrachtet, der eine andauernde Begleitung, Überprüfung und Neubewertung erfordert.
Eltern können beim „Special Educational Needs and Disability Tribunal“ Einspruch erheben, wenn sie mit dem Urteil nicht einverstanden sind oder auch die LEA beschlossen hat, kein Statement zu verfassen.
LEAs in England und Wales müssen dafür sorgen, dass das Kind die in einem Gutachten festgelegten Förderungen auch erhält.
Für 13- bis 19-Jährige ist ein Beratungsservice, „guidance service“, für die Unterstützung bei SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten verantwortlich.
Alle SchülerInnen mit einem diagnostizierten Sonderpädagogischen Förderbedarf, die älter als 16 Jahre sind, müssen einen Übergangsplan, „Transition Plan“, haben, der vom „Learning and Skills Council“ für sie entwickelt wird.
Für alle SchülerInnen mit einem Sonderpädagogischen Förderbedarf muss ein Übergangsplan festgelegt werden, der ab dem 13. Geburtstag in einem jährlichen Treffen von den verantwortlichen Spezialisten überprüft wird.
Seit September 2004 wird in Zypern vom Unterrichtsministerium anhand von Richtlinien die Begutachtung von Kindern mit Lernproblemen, emotionalen und anderen Problemen in die Praxis umgesetzt. Sowohl Eltern, DirektorInnen von Kindertagesstätten, Kindergärten, Volksschulen, weiterführenden Schulen als auch ExpertInnen (ÄrztInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen), die mit dem Kind in Kontakt sind, müssen eine Meldung an den Bezirksausschuss (District Committee) machen, wenn der Verdacht auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf vorliegt. Im Gesetz ist vorgesehen, dass ab einem Alter von drei Jahren die Kinder auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf untersucht werden.
Das „District Commitee“ hat die Pflicht, den Sonderpädagogischen Förderbedarf eines Kindes mit Hilfe eines Teams, bestehend aus KinderpsychologInnen, SchulpsychologInnen, SonderpädagogInnen, ÄrztInnen, LogopädInnen und anderen SpezialistInnen zu ermitteln.
Das District Commitee entscheidet auch darüber, ob ein Kind mit SPF die sonderpädagogische Förderung in der Regelschule erhält, im Abteilungsunterricht oder in einer Sonderschule.
Alle zwei Jahre wird das Kind mit SPF erneut begutachtet und der Fortschritt festgehalten.
Kann ein Kind dem Unterricht in der Schule aufgrund einer Behinderung, Krankheit, Entwicklungsverzögerung, aufgrund emotionaler Probleme oder aus anderen ähnlichen Gründen nicht folgen, so erfolgt eine psychologische, medizinische oder soziale Überprüfung schon während der Vorschulzeit (pre-primary education) und während der Regelschule.
In Finnland erfolgt die Begutachtung eines Kindes mit vermuteter Behinderung oder Lernstörungen und des familiären Hintergrunds durch PsychologInnen, MedizinerInnen, SozialarbeiterInnen und spezielle LehrerInnen. Die Entscheidung, ob das Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf benötigt, wird vom öffentlichen Amt der jeweiligen Gemeinde übernommen.
Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf werden entweder in Regelklassen integriert und/oder in Kleingruppen sonderpädagogisch gefördert. Ist dies nicht möglich, kann der Förderunterricht auch in Förderklassen, Lerngruppen oder an der Sonderschule erfolgen. Wenn ein/eine Schüler/in nicht in der Lage ist, dem Regelunterricht zu folgen oder sich in den Unterricht einzufügen, kann er/sie in eine Sonderschule überwiesen werden. Der Beschluss erfolgt durch den Schulverwaltungsrat.
Nach dem „Basic Education Act“ muss zur Zulassung wie auch Übermittlung eines Kindes in Sonderschulbetreuung immer eine Beratung mit den Eltern erfolgen; sollte dies gegen den Willen der Eltern erfolgt sein, so kann beim „Provincial State Office“ Einspruch erhoben werden.
Für die Deutsche Demokratische Republik wurde mit dem „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem“ (vgl. www.nibis.ni.schule.de ) vom 25. Februar 1965 und mit der „Fünften Durchführungsbestimmung zum Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem – Sonderschulwesen“ vom 23. März 1984 die Erziehung und Unterrichtung behinderter Kinder und Jugendlicher (mit Ausnahme eines Teils der geistig Behinderten) geregelt.
In den Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung, welche 1994 vom KMK[11] erlassen wurden, wird klar die Notwendigkeit dargestellt, althergebrachte Kategorien von Behinderung abzuschaffen. Vermehrt wird in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland versucht zum einen die pädagogischen Folgen der gesellschaftlichen Umbrüche und zum anderen die in den vergangenen Jahren veränderten Lebensbedingungen und Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen.
Die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland unterschiedlich, da die Vorgehensweise nach Ländergesetzen geregelt ist.
Der Antrag auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt entweder durch die Schule, durch die Eltern oder durch eine kompetente Einrichtung.
Einen wichtigen Entwicklungsschritt für die Bildung von Menschen mit Behinderungen lieferten in der Bundesrepublik Deutschland die Empfehlungen[12] der Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1994 (vgl. ebd.).
Gutachten für Sonderpädagogischen Förderbedarf werden auf Basis von multidisziplinären Berichten erstellt.
In einigen Bundesländern sind die PädagogInnen der Sonderschulen, in anderen wiederum die Förderzentren für die Berichte über den Sonderpädagogischen Förderbedarf zuständig.
Um den SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf hinsichtlich der Förderung gerecht zu werden, haben die Bundesländer Ermittlungskriterien erörtert, damit nicht nur Defizite in Bezug auf Intelligenz und Verhalten ermittelt werden, sondern auch die jeweiligen Fähigkeiten, der individuelle Entwicklungsstand und die Beziehungen zum sozialen und schulischen Umfeld. In den Empfehlungen der KMK von 1994 wird die Notwendigkeit betont, eine herkömmliche Einteilung von SchülerInnen mit Behinderung zu überwinden und die individuelle Förderung und Entwicklung differenzierter durchzuführen.
Dafür ist es auch nötig, alle Faktoren der Entwicklung sowie das soziale Verhalten ganzheitlich zu untersuchen.
Acht elementare Entwicklungsbereiche (Motorik, Wahrnehmung, geistige Entwicklung, Motivation, sprachliche Kommunikation, Interaktion, emotionale Entwicklung und Kreativität) müssen bei der Ermittlung Sonderpädagogischen Förderbedarfs mit einbezogen werden.
Die Ermittlung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs umfasst eine Beschreibung des individuellen Bedarfs, die Entscheidung über den Bildungsgang und den Förderort.
Die Untersuchung wird von der jeweils verantwortlichen Lehrperson durchgeführt und eine Beurteilung erfolgt zweimal jährlich in der Mitte und am Ende des Schuljahres. Die Beurteilung ist ein pädagogischer wie auch administrativer Akt, welcher durch rechtliche und bürokratische Richtlinien bestimmt wird. Ein individueller Förderplan wird jährlich oder halbjährlich verfasst.
Um zu gewährleisten, dass geeignete Fördermaßnahmen getroffen werden, muss ein quantitatives und qualitatives Profil der Fördermaßnahmen erstellt werden, in das Informationen aus verschiedenen Bereichen (Entwicklung der Lern- und Verhaltensstrategien, Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung, soziale Einbindung, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, individuelle Erziehungs- und Lebensumstände, das schulische Umfeld und die Möglichkeiten seiner Veränderung sowie das berufliche Umfeld) einfließen.
In Portugal besteht erst seit 1990 Schulpflicht für Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf. Haben SchülerInnen Schwierigkeiten (z. B. beim Lesen, Schreiben oder Rechnen), die sich nicht mit den Schwierigkeiten der meisten SchülerInnen ihrer Altersgruppe decken, oder Behinderungen, wird ein Gutachten verfasst.
Ein Sonderpädagogischer Förderbedarf wird von LehrerInnen der Schule und von der Leitung der Schule erstellt. Genau definierte Richtlinien sind jedoch für Portugal in der Literatur noch nicht zu finden.
Für die Entwicklung der Förderpläne ist die Schule zuständig, jedoch muss der Förderplan in Absprache mit den Eltern und dem schulpsychologischen Dienst (SPO) erstellt werden.
In Portugal ist aktuell zu beobachten, dass Sonderschulen allmählich in spezielle Förderzentren umgewandelt werden, die den Regelschulen ihre Unterstützung anbieten. Eine vermehrt integrative Beschulung von Kindern mit SPF ist ein zugrunde liegendes Anliegen.
Nach dem Gesetz für Sonderpädagogik von 1998 sind Kinder und Erwachsene mit Sonderpädagogischem Förderbedarf Personen, die aufgrund von angeborenen oder später entwickelten Behinderungen begrenzte Möglichkeiten haben, am Erziehungsprozess und sozialen Leben teilzunehmen.
Laut diesem Gesetz wird der SPF eingeteilt in wenig, moderat, grundlegend und schwer behindert.
Ein zweiter Gesetzesentwurf ist die Regulierung der Evaluierung und Beurteilung von behinderten Personen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf und unterschiedlichen Ausprägungen von diesem; dieser Gesetzesentwurf wurde vom Minister für Erziehung und Wissenschaft, dem Minister für Soziale Sicherheit und Arbeit und dem Minister für Gesundheitswesen der Republik von Litauen am 12. Juli 2002 erlassen.
Das Gesetz wird angewendet bei:
-
sonderpädagogischen Kommissionen
-
lokalen pädagogisch-psychologischen Einrichtungen
-
dem Bundeszentrum für Sonderpädagogik und Psychologie (Überwachung, Kontrolle)
-
sonderpädagogischen SpezialistInnen.
Die Arbeit in Schulen oder in pädagogisch-psychologischen Einrichtungen wird von sonderpädagogischen Kommissionen durch spezielle Gesetze reguliert. Diese Gesetze sind für die Beurteilung und Untersuchung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs bei SchülerInnen von großer Bedeutung.
Meist werden Probleme eines Kindes zuerst von dem/der jeweiligen Lehrer/in festgestellt. Der/die Lehrer/in informiert die Eltern des Kindes und erst dann kann die erste Untersuchung des Kindes auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf durch SpezialistInnen (SonderpädagogInnen, LogopädInnen, PsychologInnen) durchgeführt werden. Die SpezialistInnen präsentieren ihre Ergebnisse und entscheiden dann vor der sonderpädagogischen Kommission, welche Anpassungen des Lehrplans vorgenommen werden müssen.
Mehrere Dokumente müssen dafür ausgefüllt werden, die vom Ministerium für Erziehung und Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.
Ebenso muss eine Zeitspanne angegeben werden, innerhalb derer die adäquate Lehrmethode angewendet und das Ausmaß der pädagogisch-psychologischen Unterstützung bekannt gegeben wird.
Wenn das Kind nach Ablauf der angegebenen Zeit nicht mit den Lernvoraussetzungen zurechtkommt und schlechte Ergebnisse erzielt, empfiehlt die Kommission den Eltern, um eine weitere Untersuchung durch eine pädagogisch-psychologische Einrichtung anzusuchen. In diesen Einrichtungen, die es fast in jeder Gemeinde gibt, arbeitet ein Team von SpezialistInnen.
Diese SpezialistInnen bieten nach einer weiteren Untersuchung Empfehlungen für die Eltern und die Schule des Kindes.
Die Empfehlungen zeigen an, welche spezielle Unterstützung und welcher Lehrplan für das Kind wichtig sind.
In Tschechien liegt der Schwerpunkt der Begutachtung im pädagogischen Bereich.
Eine Begutachtung des Schülers/der Schülerin kann nur mit Zustimmung der Eltern erfolgen.
Eine allgemeine Begutachtung sollte dazu dienen, präventiv eine negative Entwicklung im schulischen Bereich eines Kindes zu verhindern.
In der Republik Tschechien müssen die Lehrpersonen in Kooperation mit speziellen Schulen (resource centres) und Beratungsstellen Kinder begutachten.
KlassenlehrerInnen, Eltern, ÄrztInnen oder andere Personen, die mit dem Kind arbeiten, geben den Auftrag zur Begutachtung.
ExpertInnen beobachten dann die Art des Förderbedarfs eines Kindes und machen Vorschläge für dessen Unterstützung und Behandlung. Die Entscheidung, welche Unterstützung das Kind bekommt, obliegt dem/der Direktor/in der Regelschule, wobei Eltern Mitspracherecht erhalten.
ExpertInnen von sonderpädagogischen und pädagogisch–psychologischen Beratungszentren übernehmen die Aufgabe, die Kinder hinsichtlich medizinischer Gutachten abzuklären, um anschließend Vorschläge für die weitere Förderung zu machen. Für Erziehungsfragen stehen die Schulpsychologie als Beratungszentrum, spezielle pädagogische Stellen und Diagnostik-Institute innerhalb des pädagogischen Sektors zur Verfügung.
Das Gutachten beinhaltet eine Beschreibung der individuellen Bedürfnisse, die Wahl der Schulart, Einstufungen sowie Fördermöglichkeiten (personal, technological, professional, teaching material, special text books etc.).
Die Einstufung kann von den Eltern abgelehnt werden.
Der/die Direktor/in der Schule, die das Kind besucht, ist verpflichtet den Wechsel in eine spezielle Klasse oder Schule oder ein Förderprogramm für den/die Schüler/in jederzeit zu ermöglichen, wenn es die Bedürfnisse des Schülers/der Schülerin verlangen. Es gibt einen freien Weg zurück aus den Förderprogrammen in die „normale Erziehung“ und vice versa.
Die Erstellung von Diagnosen eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs wird in den einzelnen Ländern der EU unterschiedlich gehandhabt. In Ländern wie Italien, Lettland, Irland, der Schweiz, Island oder Spanien ist die Erstellung der Diagnosen an schulunabhängige Stellen ausgegliedert. Ein Team von ExpertInnen untersucht die Kinder teilweise bereits im Kindergartenalter und erstellt je nach Bedarf Fördermöglichkeiten.
In Ländern wie Schweden, England, Österreich, Deutschland, Portugal, den Niederlanden, Finnland, Tschechien oder Zypern wird ein Sonderpädagogischer Förderbedarf von KlassenlehrerInnen oder SonderpädagogInnen ermittelt und falls erwünscht mittels eines Expertenteams, bestehend aus PsychologInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen etc., ergänzt.
Wer letztendlich in den einzelnen europäischen Ländern nach der erstellten Diagnose für den endgültigen Bescheid einer sonderpädagogischen Förderung verantwortlich ist, lässt sich aus den Artikeln nicht klar entnehmen.
Alle Länder der EU bewegen sich auf einen Diagnoseprozess zu, bei dem die Erstdiagnose des SPF bevorzugt von einem Team vorgenommen wird. Im Bericht (2007) der European Agency for Development in Special Needs Education wird vermehrt der Begriff „Assessment“ verwendet, der als Arbeitsdefinition alle möglichen Formen von Methoden und Verfahren der Ersteinschätzung und prozessorientierten Einschätzung abdeckt. Assessment wird dabei als Art und Weise bezeichnet, wie Lehrkräfte und andere Personen, die an der Bildung und Erziehung eines Schülers/einer Schülerin beteiligt sind, Informationen über deren Leistungs- und Entwicklungsstand in den verschiedenen Erfahrungsbereichen (Schule, Verhalten, soziales Umfeld) zusammentragen und nutzen können. Dabei kommt auch den Eltern, den Klassenlehrkräften der Regelschule, den Fachkräften aus den verschiedensten Bereichen (Gesundheitsbereich, sozialer Bereich, psychologischer Bereich) sowie den betroffenen SchülerInnen, die in die Entscheidungen der Bildungsprozesse aktiv miteinbezogen werden, eine zentrale Rolle zu.
In der Schweiz werden beispielsweise interdisziplinäre Teams, an denen Eltern und die betroffenen SchülerInnen in vollem Umfang beteiligt sind, als beste Innovation im Diagnoseprozess gesehen. Spanien entwickelt derzeit gemeinsame Kriterien, anhand derer multidisziplinäre Teams Diagnosearbeit leisten können, auch wenn sie unterschiedliche Instrumente und Konzepte verwenden.
Aus den Berichten ist zu ersehen, dass Länder, wie beispielsweise Zypern, die Niederlande, Portugal und Italien, in der Entwicklung des Diagnoseverfahrens eine umfeldorientierte Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs anstreben, mit Empfehlungen für anschließende konkrete Aktionen.
Bei allen Ländern geht die Entwicklung der Begutachtung und Feststellung einer Behinderung weg vom medizinischen Ansatz hin zu einer pädagogischen Sichtweise.
Erziehungswissenschaftliche Denkanstöße und schulpolitische Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Ländern lassen heute vielfältige Übereinstimmungen erkennen; sie sind Zeichen für eine eher personenbezogene, individualisierende und nicht mehr vorrangig institutionsbezogene Sichtweise sonderpädagogischer Förderung. In diesem Prozess ist neben den Begriff der Sonderschulbedürftigkeiten in zunehmendem Maße der Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs getreten. Die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht mehr an die Institution Sonderschule gebunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen, zu denen auch berufliche Schulen zählen, vermehrt entsprochen werden.
Der Blick über die Grenzen zeigt, dass es in den verschiedenen Ländern keine einheitliche Interpretation von Begriffen wie „Beeinträchtigung“, „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ oder „Behinderung“ gibt. Definitionen und Kategorien von Sonderpädagogischem Förderbedarf unterscheiden sich von Land zu Land.
In allen europäischen Ländern gibt es aber die Diskussionen über veränderte Begriffssysteme, rechtliche Grundlagen, Klassifikationspraktiken und neue Finanzierungsmodelle mit inklusiven Zielsetzungen.
Innerhalb der EU und den Beitrittsländern ist in der Bildungspolitik die Tendenz zu spüren, die Integration/Inklusion von SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in Regelschulen anzustreben und Lehrkräften in unterschiedlichem Umfang in Form von zusätzlichen MitarbeiterInnen, Materialien, Fort- und Weiterbildung in der Schule und Ausstattung Unterstützung zukommen zu lassen.
Die Länder können anhand ihrer Politik der Integration/Inklusion von SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf in drei Gruppen eingeordnet werden:
Die erste Gruppe (one-track approach – Einheitssystem) schließt die Länder mit ein, die sich mit einem Schulsystem dem Ziel der Inklusion zu nähern versuchen. Dabei wird eine große Spannbreite an sonderpädagogischer Unterstützung zur Verfügung gestellt. Dazu zählen Länder wie Italien, Norwegen, Spanien, Griechenland, Island, Portugal, Schweden und Zypern.
Die zweite Gruppe (multi-track approach – Kombinationssystem) setzt auf ein mehrspuriges Fördersystem, bei dem es Fördermöglichkeiten zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen sowie Verbindungsmöglichkeiten gibt. Dazu zählen Länder wie Österreich, Finnland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Lettland, Dänemark, Estland, Litauen, Liechtenstein, Polen, Slowakei, Slowenien und Tschechien. Diese Gruppe ist die größte in Europa.
Die dritte Gruppe (two-track approach – duales System) setzt auf getrennte Bildung für Kinder mit oder ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf; Kinder ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf lernen in Regelschulen, Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Sonderschulen oder Sonderklassen unterrichtet. Für beide Systeme gelten verschiedene rechtliche Regelungen, d. h. es gelten andere Gesetze für die reguläre Schulbildung als für die Sonderschulbildung. Zu diesem Modell zählen Länder wie die Schweiz, Belgien, Deutschland und die Niederlande.
Da sich die politischen Voraussetzungen ständig ändern, ist es schwierig, ein europäisches Land genau einem System der Inklusionspolitik zuzuordnen. So wurden Deutschland und die Niederlande z. B. dem two-track-approach-System zugeordnet, sie bewegen sich derzeit aber klar in Richtung multi-track-System. Im Zentrum der europäischen Diskussionen um Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs und der daraus resultierenden Förderung stehen die Bildungsrechte behinderter Menschen.
Die Beschreibungen der Vorgangsweise der Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs sind, wie bereits bemerkt, vor allem wegen der unterschiedlichen Begriffssysteme in den einzelnen Ländern kompliziert, ebenso verhält es sich mit einer vergleichenden Datenlage.
Die Zahl von SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf liegt im Vergleich von 30 europäischen Ländern zwischen 1 % (z. B. Griechenland 0,9 %, Italien 1,5 %) und einem Wert von 17,8 % (z. B. in Finnland).[13]
In Österreich ist der Anteil der SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf gegenüber dem Schuljahr 2007/2008 von 4,5 % im Schuljahr 2008/2009 auf 4,7 % gestiegen und betrug im Schuljahr 2010/2011 bereits 5 %.[14]
Unterschiede im Prozentsatz der mit Sonderpädagogischem Förderbedarf gemeldeten Kinder sind wahrscheinlich auf Unterschiede in den Diagnoseverfahren, in Gesetzgebungen, Finanzierungsvereinbarungen und Angeboten der einzelnen Länder zurückzuführen. Sie spiegeln nicht das tatsächliche Vorkommen von Kindern mit Sonderpädagogischem Förderbedarf.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen Ländern Europas Inklusion als globale Agenda auf der bildungspolitischen und bildungsrechtlichen Tagesordnung steht. Europa ist seit der UNESCO-Erklärung von Salamanca 1994 auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungswesen.
Das Feststellungsverfahren zur Ermittlung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist in vielen europäischen Ländern einem Wandel unterworfen. Ein europäisches Ziel ist es, die Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs an die Unterstützung der SchülerInnen in der Regelschule zu binden; Stigmatisierungen können somit vermieden werden.
Bei der Erstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs sollte der Schwerpunkt auf der weiteren didaktischen Vorgehensweise beim Lehren und Lernen liegen. Stigmatisierungen können somit vermieden werden.
Finanzielle und personelle Unterstützungen sollen nicht mehr alleine von einer Diagnose abhängen und im Sinne einer inklusiven Bildung nicht an einzelne SchülerInnen gekoppelt werden. Im Kapitel „Behinderung und Ressourcen“ wird auf die Problematik der Ressourcensicherung näher eingegangen.[15]
Für SonderpädagogInnen und für die Behörde (Bezirksschulrat) stellt die Beurteilung der Frage, für welche Kinder mit Lern- und Verhaltensabweichungen eine Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs erforderlich ist, eine große Herausforderung dar.
Eine historische Abfrage beim Gesetzgeber ergab[16], dass im 240. Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 der Nationalrat beschloss, dass laut § 8 Abs. 1 „… schulpflichtige Kinder, die infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule nicht zu folgen vermögen, aber dennoch bildungsfähig sind (…) ihre allgemeine Schulpflicht in einer ihrer Eigenart und Bildungsfähigkeit entsprechenden Sonderschule oder einer Volksschule oder Hauptschule angeschlossenen Sonderschulklasse (…)“ zu erfüllen haben (§ 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1962, BGBl. Nr. 240).
In der Erläuterung zum § 8 der Regierungsvorlage von 1962 (zu § 8 IX. Gesetzgebungsperiode 1962) ist die Beschulung von Kindern mit Behinderungen bereits gesetzlich festgelegt.
„Die Bildung von aus irgendeinem Grunde physisch oder psychisch behinderten Kindern stellt eine der vornehmsten, aber auch schwierigsten Aufgaben des Schulwesens dar“ (zu § 8 Schulpflichtgesetz, Nr. 732 1962 IX. GP).
Der Nationalrat hat 1993 einem Anliegen des Arbeitsübereinkommens der damaligen Regierungsparteien entsprochen und durch Novellen zum Schulpflichtgesetz, zum Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz und zum Pflichtschulerhaltungs-Grundgesetz die Integration behinderter Kinder in der Grundschule als Alternative zum Sonderschulbesuch ermöglicht.
Mit der 15. Novelle zum Schulpflichtgesetz 1993 wurde der Begriff „Sonderschulbedürftigkeit“ durch den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ersetzt.
Das primäre Ziel dieser Novelle besteht darin, einen gemeinsamen Unterricht für Kinder mit physischen oder psychischen Behinderungen und für nicht behinderte Kinder gesetzlich zu verankern. Unter sonderpädagogischem Förderbedarf versteht man, dass ein/e Schüler/in mit Behinderung ein Anrecht hat, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert zu werden, entweder in der Sonderschule oder in einer Volksschule.
Das neue Gesetz (15. SCHOG-Novelle) sieht für die Eltern die Wahlmöglichkeit vor, ihr Kind entweder in einer für das Kind entsprechenden Sonderschule oder in einer Volksschule, die den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllt, unterrichten zu lassen.
Seit dem Schuljahr 1993/1994 sind somit ein gemeinsamer Unterricht und eine koedukative Förderung von behinderten und nicht behinderten SchülerInnen gesetzlich verankert. Vom Bezirksschulrat müssen die Rahmenbedingungen für die Integration geschaffen werden. Zuständig für die Integration sind die Sonderpädagogischen Zentren in den jeweiligen Bundesländern von Österreich.
Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen eine für alle SchülerInnen gemeinsame Elementarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integration behinderter Kinder zu vermitteln. Für Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung BGBl. Nr. 513/1993) sind die Bildungsaufgaben der der Behinderung entsprechenden Sonderschulart zu berücksichtigen (vgl. § 9 Abs. 2 Schulorganisationsgesetz).
Die 17. SCHOG-Novelle, die seit Dezember 1996 Gültigkeit hat, regelt die Integration von SchülerInnen mit Behinderung auch in der Sekundarstufe (Hauptschule). Die Bezirksschulbehörde ist per Gesetz verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Detailbestimmungen der schulischen Integration werden somit von den einzelnen Ländern per Landesgesetz geregelt, was zu geringfügigen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern in Österreich führen kann.
Unter Beachtung des Prinzips der sozialen Integration ist SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf eine, der Aufgabe der Sonderschule entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraussetzungen des Schülers/der Schülerin die Unterrichtsziele der Hauptschule anzustreben sind (vgl. § 15 Abs. 3 Schulorganisationsgesetz).
Für die Unterstufe der allgemein bildenden höheren Schulen ist die Bundesgesetzgebung zuständig. Unter Beachtung des Prinzips der sozialen Integration ist SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, die in die Unterstufe einer allgemein bildenden höheren Schule aufgenommen wurden, eine der Aufgabe der Sonderschule entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraussetzungen des Schülers/der Schülerin die Unterrichtsziele der allgemein bildenden höheren Schule anzustreben sind[17].
Durch sonderpädagogische Förderung soll für behinderte Kinder eine ihren persönlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechende schulische Bildung und Erziehung verwirklicht werden. Ziel ist es, in einem möglichst hohen Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, an der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben beizutragen.
Der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ist im § 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes
1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 161/1987 und 456/1992 gesetzlich verankert.
„Der Bezirksschulrat hat den sonderpädagogischen Förderbedarf auf Antrag (…) festzustellen, sofern dieses infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder im Polytechnischen Lehrgang ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag, aber dennoch schulfähig ist. (…) Der Bezirksschulrat hat zur Feststellung, ob ein Sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, ein sonderpädagogisches Gutachten, sowie erforderlichenfalls ein schul- oder amtsärztliches Gutachten und mit Zustimmung der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes ein schulpsychologisches Gutachten einzuholen“ (§ 8 Abs. 1 Schulpflichtgesetz 1985).
Daraus resultiert, dass ein schulisches Versagen eines Schülers/einer Schülerin auf eine physische oder psychische Behinderung rückführbar sein muss. Es muss somit ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Bestimmungsmerkmal „dem Unterricht nicht folgen können“ und dem Vorliegen einer physischen oder psychischen Behinderung bestehen.
Daraus ist abzuleiten, dass ungenügende Schulleistungen ohne das Bestimmungsmerkmal der Behinderung keinen Sonderpädagogischen Förderbedarf begründen.
Nicht jede Behinderung zieht Sonderpädagogischen Förderbedarf nach sich, da aufgrund von bloß organischen Defekten (z. B. körperliche Behinderungen, Sinnesbehinderungen) der jeweilige Lehrplanstoff erfüllt werden kann. Laut den gesetzlichen Bestimmungen reichen eine Berücksichtigung der Funktionseinschränkung bei der Gestaltung der Arbeitssituation sowie behinderungsspezifische Hilfsmittel und eine unterstützende Haltung der LehrerInnen aus (vgl. BMUKK).
Eine vage Erläuterung findet sich im österreichischen Gesetz in Bezug auf Behinderung auch bei SchülerInnen mit Beeinträchtigungen des Lernens: Im Rahmen der Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs wird zwischen lernbehinderten und lernschwachen Schülern unterschieden. Eine Abklärung sei nur möglich, wenn nach einem ausreichenden Beobachtungszeitraum und nach Durchführung aller grundschulspezifischen Fördermaßnahmen ein sorgfältiges diagnostisches Vorgehen erfolgt, so der Gesetzgeber:
„Bei Schülerinnen und Schülern, die ohne Vorliegen einschlägiger medizinischer oder psychischer Hinweise auf eine Behinderung in die Volksschule aufgenommen werden, ist bei Beeinträchtigungen des Lernens zwischen Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen und solchen mit Lernbehinderungen zu unterscheiden. Um diesbezüglich eine Abklärung zu erreichen, ist nach einem ausreichenden Beobachtungszeitraum und der Ausschöpfung aller grundschulspezifischen Fördermaßnahmen ein sorgfältiges förderdiagnostisches Vorgehen [18] erforderlich. Im Rahmen einer umfassenden Kind-Umwelt-Analyse[19] ist zu prüfen, ob ein Bedarf an sonderpädagogischer Förderung begründet werden kann“ (BMUKK, Abt. I/8 2010, S. 10, Hervorhebung im Original).
Innerhalb der Grundstufe 1 (bis zum Ende des 2. Schuljahres) soll aber, laut Gesetzgeber, eine Abklärung von Lernbehinderung stattfinden, obwohl der Begriff der Lernbehinderung im Gesetz nicht geklärt ist.
Für SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache darf das Nichtbeherrschen der Unterrichtssprache kein Kriterium für die Feststellung eines SPF sein. Treten Lernbeeinträchtigungen bei SchülerInnen mit anderen Erstsprachen auf, so muss geklärt werden, welche Ursachen für die Lernschwierigkeiten vorliegen.
Laut Gesetz sind alle gesetzlichen Möglichkeiten zuerst auszuschöpfen und Fördermaßnahmen zu ergreifen (Sprachförderkurse), bevor ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ausgesprochen wird.
Eine individuelle Förderung von SchülerInnen ist ein zentraler Auftrag der österreichischen Schule. Gemäß § 17 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes hat die Lehrperson im Unterricht
„… jeden Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen entsprechenden besten Leistungen zu führen, durch geeignete Methoden und durch zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtmitteln (…)“ (§ 17 Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 20/2006).
Dies wirft die Frage auf, inwieweit allgemeine Förderung von sonderpädagogischer Förderung abgegrenzt werden kann, denn körperliche und geistige Voraussetzungen weisen bei SchülerInnen im Schuleingangsbereich oft große Diskrepanzen auf. Dadurch ergibt sich in der Regel die Notwendigkeit für innere Differenzierung, Individualisierung sowie für weitere grundschulspezifische Fördermaßnahmen.
Kinder mit verschiedenen Lern- und Entwicklungsstufen können in der Schuleingangsphase (Vorschulstufe, erste und zweite Schulstufe) durch allgemeine Förderung meist ausreichend unterstützt werden. Demnach wäre zu prüfen, inwieweit durch eine Umsetzung des verpflichtenden Förderkonzeptes eine geeignete individuelle Förderung der Kinder bereits erfolgen könnte.
Eine klare Abgrenzung sonderpädagogischer Förderung zur allgemeinen Förderung im pädagogischen Konzept der Grundschule kann also kaum festgelegt werden. Demnach ist eine Definition, die den Begriff klar abgrenzen kann, fragwürdig. Eberwein (1995) geht davon aus, dass jedes Kind aufgrund seiner Individualität einen individuellen Förderbedarf habe und damit schon eine Abgrenzung zu sonderpädagogischem Förderbedarf problematisch ist:
„Insofern ist jeder Förderbedarf ein anderer. Deshalb ist auch die Frage nach zusätzlichem oder sonderpädagogischen Förderbedarf müßig. Wir sind ohnehin nicht in der Lage zu sagen, was regulärer und was zusätzlicher Förderbedarf ist. Und wenn man diesbezüglich die Begriffsvielfalt liest, angefangen bei besonderem über erheblichen, erhöhten, erheblich erhöhten bis zu ausgeweitetem Förderbedarf, dann wird deutlich, dass sich dahinter immanent die alten Behinderungsbegriffe verbergen, die wir eigentlich überwinden wollen“ (Eberwein 1995, S. 471).
Folgende Darstellung gibt einen Überblick über den Ablauf des Verfahrens:
|
Antrag auf Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs |
|---|
|
Die Antragstellung kann erfolgen:
|
|
1. Ermittlung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs durch den Bezirksschulrat |
|
a) durch Einholung
|
|
b) bei Bedarf werden das Gutachten und der Bericht ergänzt durch
|
|
c) weitere mögliche Verfahrensschritte sind
|
|
2. Bescheidmäßige Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs durch den Bezirksschulrat |
|
3. Akteneinsicht und Parteiengehör |
|
|
4. Beratung der Erziehungsberechtigten durch den Bezirksschulrat |
|
|
5. Bei einer Aufhebung bzw. Änderung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs kommen dieselben Verfahrensschritte zur Anwendung |
Der Antrag auf Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs[20] wird beim Bezirksschulrat eingebracht. Antragsteller sind Erziehungsberechtigte, der Leiter einer Regelschule oder ein Amt (z. B. Bezirksschulrat). Dem Antrag beizulegen ist ein Bericht des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin oder des Leiters/der Leiterin.
Zur Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs hat der Bezirksschulrat ein verpflichtendes sonderpädagogisches Gutachten einzuholen, erforderlicherweise ein schul- oder amtsärztliches Gutachten und, falls erforderlich, ein schulpsychologisches Gutachten nur mit Zustimmung der Eltern. Eltern können im Rahmen des Feststellungsverfahrens Gutachten von Personen vorlegen, die bisher mit dem Kind therapeutisch oder pädagogisch gearbeitet haben. Auf Wunsch der Eltern kann das Kind im Rahmen des Verfahrens bis zu fünf Monate zur Beobachtung in eine Volks-, Haupt- oder Sonderschule aufgenommen werden.
Vor Abschluss des Verfahrens findet eine Beratung (BSI, GutachtenerstellerInnen, SchulleiterInnen) der Erziehungsberechtigten statt, hinsichtlich der bestehenden Fördermöglichkeiten des Kindes in den verschiedenen Schularten. Den Erziehungsberechtigten ist laut § 17 AVG vor Ausstellung des Bescheids Akteneinsicht zu gewähren.
„§ 17. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die Parteien bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch möglichen Form gewährt werden“ (BGBl. I Nr. 5/2008).
Ein sonderpädagogisches Gutachten[21] ist die Aussage eines Sonderpädagogen/einer Sonderpädagogin als Sachverständige/r über das Kind. Die sonderpädagogische Diagnose erhebt im Gegensatz zur medizinischen und psychologischen den auf den jeweiligen Lehrplan bezogenen augenblicklichen Lernstand eines Kindes unter Einbeziehung seines Umfeldes im Hinblick auf angemessene Förderung (vgl. www.cisonline.at ).
Ein sonderpädagogisches Gutachten wird erstellt, etwa bei Antrag auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf, im Zuge einer Verlaufskontrolle, bei Aufhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs oder im Falle einer Befreiung der Schulpflicht.
Aufgabe der sonderpädagogischen GutachterInnen ist es, sich mit pädagogischen Inhalten zu befassen und festzustellen, ob für das Kind sonderpädagogische Maßnahmen nötig sind, um adäquate Ziele zu erreichen.
GutachterInnen sind Organe des Bezirksschulrates (im Schulpflichtgesetz etwa der Schulleiter/die Schulleiterin oder durch den Bezirksschulrat aufgeforderte fachkundige SonderpädagogInnen), die das Verfahren durchführen. Sonderpädagogische GutachterInnen müssen nach den neuen Richtlinien (vgl. www.cisonline.at) aus dem Jahre 2010 eine sonderpädagogische Aus- bzw. Weiterbildung nachweisen können. Neben praktischen Erfahrungen wird nun eine entsprechende Qualifikation für die Gutachtertätigkeit gefordert.
Das sonderpädagogische Gutachten beinhaltet Aussagen über folgende Bereiche:
-
eine Kind-Umwelt-Analyse (familiäre, sozioökonomische, soziokulturelle, soziomedizinische Situation)
-
eine Unterrichtsbeobachtung (Lern- und Sozialverhalten; Lernumfeld)
-
individuelle Entwicklungsbereiche (Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Lern- und Arbeitsverhalten, Lernstand, Schulleistung, Schullaufbahn, allgemeine Entwicklung)
-
Bekanntgabe der verwendeten Testverfahren, Überprüfungen, durchgeführten Beobachtungen und Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen
-
eine Zusammenfassung, Interpretation und Schlussfolgerung aus sonderpädagogischer Sicht (Beantwortung der Frage, ob sonderpädagogische Förderung erforderlich ist; Beantwortung der Frage, ob in der Sonderschule oder einer allgemeinen Schule Fördermöglichkeiten bestehen)
-
eine Darstellung von Förderschwerpunkten.
-
Es können Empfehlungen bezüglich der Lehrplaneinstufung gemäß § 17 Abs. 4a SchUG enthalten sein.
-
Die zentralen Aussagen sind in Kurzform darzustellen.
Der Bezirksschulrat erstellt den Bescheid aufgrund der vorgelegten Gutachten und der Beratungsgespräche. Inhalt des Bescheids sind die Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs, die Art der Behinderung und allenfalls die Lehrplaneinstellung (vgl. § 17 Abs. 4 SchUG) sowie die Begründung und die Rechtsmittelbelehrung.
Gegen den Bescheid kann beim Landesschulrat binnen 14 Tagen Einspruch erhoben werden, gegen die Entscheidung des Landesschulrats ist jedoch kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.
Der Sonderpädagogische Förderbedarf ist keine unveränderbare Größe oder Diagnose und kann, falls durch ausreichende sonderpädagogische Förderung eine ausreichende Leistungsfähigkeit für den Volks- bzw. Hauptschullehrplan erzielt wird, wieder aufgehoben werden.
„Sobald bei einem Kind auf die sonderpädagogische Förderung verzichtet werden kann, hat der Bezirksschulrat die Feststellung gemäß Abs. 1 aufzuheben“ (§ 8 Abs. 3 Schulpflichtgesetz).
Durch die eindeutige Gesetzgebung bleibt die Problematik aufrecht, dass der Sonderpädagogische Förderbedarf vorerst ermittelt und festgestellt werden muss, bevor eine umfassende Förderung einsetzt. Der Gesetzesgeber verlangt, dass nur ein Kind mit physischer oder psychischer Behinderung Sonderpädagogischen Förderbedarf erhält. Die gesetzliche Bestimmung ist dahin auszulegen, dass zwei kumulative Voraussetzungen für die Ausstellung des Bescheids gegeben sein müssen: einerseits eine physische und/oder psychische Behinderung, andererseits die Unfähigkeit der betroffenen Person, dem Unterricht zu folgen.
Geht man davon aus, dass eine Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs ohne Diagnostizierung einer physischen oder psychischen Behinderung nicht möglich ist, stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wer zur Erstellung der Diagnose berufen ist.
Auf Anfrage durch einen Rechtsanwalt (vgl. Briefwechsel im Anhang) beim BMUKK, Rechtsabteilung, ob gem. § 2 Abs. 2 Z 1 ÄrzteG die Untersuchung auf das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen von körperlichen und psychischen Krankheiten oder Störungen, von Behinderungen oder Missbildungen und Anomalien, die krankhafter Natur sind, nur Ärzten (§ 2 Abs. 2 BGBl. I Nr. 169/1998) vorbehalten ist, wurde Folgendes festgehalten:
„Dass die entsprechende Untersuchung bzw. Diagnostizierung auf Grund dieser Bestimmung ausschließlich Ärzten ‚vorbehalten‘ sein soll, lässt sich jedoch aus dieser Bestimmung nicht ableiten. Vielmehr werden psychische oder physische Behinderungen mitunter auch von anderen fachkundigen Personen (im Schulpflichtgesetz etwa durch den Schulleiter, welcher u. U. das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs auszulösen hat, bzw. durch Organe des Bezirksschulrates, welche dieses Verfahren durchführen), diverse Behinderungen unter Umständen sogar von Laien, erkennbar und im Sinne des § 8 SchPflG feststellbar sein“ (persönliches Antwortschreiben BMUKK 2008).
Seitens des Bundesministeriums kann somit die Beurteilung, ob ein Schulpflichtiger an einer physischen oder psychischen Behinderung leidet, an Organe des Bezirksschulrates (Schulleiter, Lehrpersonen) übertragen werden. Der Bezirksschulrat hat jedoch im Zweifelsfall, gemäß § 8 Abs. 1 dritter Satz Schulpflichtgesetz, ein schul- oder amtsärztliches Gutachten einzuholen.
Eine präventive Ausrichtung des Systems ist dabei nicht erkennbar, sonderpädagogische Arbeit darf erst dann beginnen, wenn andere Unterstützungssysteme mangelnde Wirksamkeit bewiesen haben.
Der Begriff „Förderung“ wird sowohl im Lehrplan der Grundschule als auch im Sonderschullehrplan als Allgemeines Bildungsziel angeführt, in dem es heißt: „Ziel der Schule ist die Entwicklung und Förderung individueller Begabungen und Möglichkeiten“ (BGBl. Nr. 137, BGBl. Nr. 290). Fördern bedeutet aus etymologischer Sicht „unterstützen, begünstigen, voranbringen“. Entsprechend bedeutet das Verb ursprünglich auch „vorwärts schaffen, wohin bringen“ (Pfeifer 2005, S. 365).
Bei der Durchsicht der Literatur konnte feststellt werden, dass sich der Begriff zu einem zentralen Terminus entwickelte, obwohl er über keine bildungs- und erziehungswissenschaftliche Ableitung verfügt (vgl. Biewer 2009; Bundschuh 2002). Obwohl der Begriff der Förderung im eigentlichen Sinn als allgemeiner Erziehungsauftrag aller Schulen zu verstehen ist, scheint er doch häufig da auf, wo Kinder im Vergleich zur Norm vermeintliche Leistungsrückstände aufweisen (z. B. Förderstunde, Förderprogramme, Förderpläne, Förderkurs, Förderschwerpunkte, Fördermöglichkeiten, Frühförderung usw.).
Warum sich der Begriff gerade in der Sonderpädagogik so etabliert hat, kann dadurch erklärt werden, dass der Terminus eine Bandbreite an Interpretationen und Aktivitäten offen lässt. Mit der 15. Novelle zum Schulpflichtgesetz 1993 wurde der Begriff „Sonderschulbedürftigkeit“ durch den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ersetzt, wodurch sich der Begriff speziell in der Sonderpädagogik durchzusetzen begann. Es folgte eine sprachliche Verschiebung von Erziehung und Bildung zur Förderung. Bundschuh (2002, S. 81) definiert Förderung folgendermaßen: „Mit Förderung sind in der Heilpädagogik solche Konzepte pädagogischen Handelns angesprochen, die auf den sozialen Umgang mit Behinderungen abzielen.“ Hier spiegelt sich der vermutete Inhalt des Begriffes wider: Förderung ist zwar pädagogisches Handeln, aber im Zusammenhang mit einer Behinderung zu verstehen. Damit erhält der Begriff eine wertende Bedeutung für das Schulkind.
Der Begriff „Bedarf“ wurde aus „bedarf, bederf“ – „Notdurf, Mangel“ übernommen und setzt sich im 18. Jahrhundert als Ausdruck der Handelssprache im Sinne von „Dinge, derer man bedarf“ allgemein gegenüber der alten Bedeutung „Mangel“ durch (Pfeifer 2005, S. 110). Der Terminus „Bedarf“ ist vor allem in der Wirtschaftsterminologie zu finden und wird klar vom Begriff „Bedürfnis“ (Verlangen, Wunsch) unterschieden. „Bedürfnis“ bezeichnet allgemein einen körperlichen oder psychischen Mangelzustand. Erst der Wunsch, ein Bedürfnis auch real zu befriedigen, z. B. durch Kaufkraft, führt zu einem Bedarf. Der Bedarf wird im wirtschaftlichen Sinn von außen durch z. B. Werbung geweckt und gesteuert. Mit der Umbenennung der „Sonderschulbedürftigkeit“ in „Sonderpädagogischen Förderbedarf“ im Jahre 1993 wurde der Begriff „Bedarf“ legitimiert und ist nun in Österreich in der Sonderpädagogik ein geläufiger Terminus.
Überträgt man die Terminologie in den pädagogischen Bereich, stellt sich die Frage, inwieweit bei einem Kind der Bedarf auch von außen festgelegt wird und inwieweit der Bedarf mit dem Bedürfnis des Kindes übereinstimmt. Streng genommen könnte bei jedem Kind ein Bedarf diagnostiziert und geweckt werden. Durch die Verwendung des Begriffs „Bedarf“ kann angenommen werden, dass damit nicht nur ein subjektives Bedürfnis eines Kindes definiert wird. Bedürfnistheoretisch betrachtet wird der Bedarf unter objektiven Aspekten in der Praxis öfter diskutiert als das Bedürfnis der Kinder.
Bei der Durchsicht der Literatur fällt auf, dass in der Sonderpädagogik die Begriffe „Bedarf“ und „Bedürfnis“ oft nebeneinander verwendet werden. Powell (2003) kritisiert den Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs: „Die Kinder sind nicht mehr ‚hilfsschulbedürftig‘, sondern ‚bedürfen der sonderpädagogischen Förderung‘, die jetzt sowohl in der Hilfs- bzw. Sonderschule als auch in der Regelschule stattfinden kann“ (ebd. S. 121). Die Entwicklung der letzten Jahre und die daraus resultierenden Erfahrungen haben gezeigt, dass dieser Terminus unterschiedlich interpretiert wurde bzw. immer noch wird, außer bei der Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs für sinnes-, körper- bzw. geistig behinderte Kinder, bei dem es kaum Interpretationsdifferenzen zu geben scheint. Aus etymologischer Sicht bedeutet „sonder“: „für sich abgetrennt, extra“; von „sunder“: „abgesondert, alleinstehend, einsam, besonder, ausschließlich, eigen, ausgezeichnet“ (Pfeifer 2005, S. 1308). Pädagogik ist die Wissenschaft von Erziehung und Bildung.
Der Begriff „Sonderpädagogik“ meint einen Teilbereich der Allgemeinen Pädagogik. Sonderpädagogik dient als eine Pädagogikkategorie für, wie der Name schon sagt, sämtliche „Sonderfälle“ einer allgemeinen Pädagogik und beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Menschen mit „besonderem Förderbedarf“ im Bereich Bildung und Erziehung.
Die Etablierung des Begriffes „Sonderpädagogik“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Wissenschaftsbezeichnung ging einher mit der Bildung und Erziehung von Menschen mit Behinderungen in gesonderten Institutionen. Die Verwendung des Begriffs „Sonderpädagogik“ rechtfertigte den „Fortschritt“ zwischen Behinderungsarten zu unterscheiden, Klassifizierungen vorzunehmen und die Differenz der Erziehungsbedürfnisse von behinderten Menschen und deren Besonderheiten zu betonen (vgl. Opp/Theunissen 2009). Bedingt durch den qualitativen und quantitativen Ausbau des Sonderschulsystems und der damit verbundenen Notwendigkeit der Qualifizierung von LehrerInnen bediente sich die „Sonderpädagogik“ auch einer gewissen Selbstdarstellung, als Rechtfertigung einer Wissenschaft und Ressourcenzuteilung.
In den Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde immer wieder die Aussonderung mit dem Wort „Sonderpädagogik“ betont, was der gesamten Integrationsbewegung im deutschsprachigen Raum nicht entgegenkam. Dem zu entgegnen wäre allerdings die Sichtweise, dass Sonderpädagogik nicht Aussonderung, sondern eine Pädagogik für Kinder mit Problemen darstellt. Bundschuh meint dazu: „Sonderpädagogik ist umfassender als die Pädagogik für Behinderte und meint jenen Bereich von Erziehung und Erziehungswissenschaft, der sich um die Verbesserung von erschwerten Situationen und um die Behebung besonderer Gefährdungen und Benachteiligungen in allen Lebensaltern bemüht“ (Bundschuh/Heimlich/Krawitz 2002, S. 258).
Biermann und Goetze (2005) definieren den unter den Begriff „Sonderpädagogik“ fallenden Personenkreis folgendermaßen: „… in der Sonderpädagogik geht es allgemein um eine Pädagogik für Kinder und Jugendliche, die im Lernen und Verhalten hervorstechende Besonderheiten aufweisen, die nicht zwangsläufig als Behinderung zu bezeichnen sind, aber Behinderungen durchaus einschließen“ (ebd. S. 12).
In der wissenschaftlichen Diskussion und in Bezug auf die Praxis gerät die Sonderpädagogik im schulischen Bereich immer wieder in einen Zwiespalt: Einerseits bietet sie professionelle Hilfe für die Kinder, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen in der Regelschule nur schwer gefördert werden können, andererseits bewirkt sie, allein durch ihren Begriff, Stigmatisierung und Exklusion.
„Das Dilemma schulischer Sonderpädagogik besteht hierbei in der Unüberwindbarkeit der selektiven Mechanismen von Schule. Konsens finden im Prinzip nur selektive Maßnahmen nach oben. Sonderpädagogische Hilfen markieren dagegen grundsätzlich eine eher negativ konnotierte Differenz, nämlich die Tatsache, dass ohne zusätzliche Hilfestellungen ein Kind die Lernziele nicht erreichen würde, die seine Alterskameraden ohne diese Unterstützung erreichen können. Sonderpädagogische Hilfe ist insofern schon immer ein excludierender Akt und steht damit in einem Widerspruch zur Integrationsabsicht des professionellen sonderpädagogischen Handelns“ (Opp/Theunissen 2009).
Sonderpädagogischer Förderbedarf scheint in der Praxis eine geklärte und gesicherte Gegebenheit zu sein. Die Problematik des Begriffs „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ergibt sich nun durch die Frage, inwiefern der „Sonderpädagogische Förderbedarf“ von einem pädagogischen Förderbedarf abzugrenzen ist.
Eberwein (1995) geht davon aus, dass jedes Kind einen individuellen Förderbedarf hat und daher die Abgrenzung zu einem sonderpädagogischen Förderbedarf sehr problematisch ist. Unter diesem Gesichtspunkt könnte Sonderpädagogik auch z. B. für hochbegabte Kinder, für sehr sportliche, musikalische Kinder, für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, für kranke Kinder etc. verwendet werden. Bei Zuschreibungen von „sonderpädagogischem Förderbedarf“ oder „erhöhtem Förderbedarf“ werden aber fragwürdige Kategorien gebildet und eine subtile Wiederverwendung von Behinderungsbegriffen ist bemerkbar.
Durch die gesetzliche Regelung werden Probleme von Schülern pauschaliert und mittlerweile auch Kinder mit z. B. Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zu „behinderten Kindern“ gemacht.
Unter den oben erwähnten Überlegungen ergibt sich die Feststellung, dass durch eine vage Definition des Begriffs „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ den GutachterInnen und Institutionen eine große Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird, die Weite des Begriffs zu nutzen. Dies wiederum heißt, dass die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs unter unterschiedlichen Aspekten durchgeführt wird. So hängt es z. B. von Wahrnehmung und Beobachtung der GutachterInnen ab, ob ein Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf benötigt oder nicht. Eine Untersuchung von Mand (2002) dazu bestätigt, dass das Feststellungsverfahren signifikant von Gutachtervariabeln abhängt.
„Es ist weiter zu vermuten, dass auch Sonderschullehrerinnen und -lehrern Wahrnehmungs- und Beobachtungsfehler unterlaufen, dass sie also wie Alltagsbeobachter dazu neigen, Verhalten von Schülern eher auf deren Eigenschaften und weniger auf situative Einflüsse zurückzuführen, dass sie von wahrgenommenen Verhaltensweisen auf vermutete Eigenschaften schließen (Haloeffekt) oder den ersten Eindruck, den Problemschüler hinterlassen, besonders intensiv wahrnehmen und werten …“ (Mand 2002, S. 8 f.).
In Österreich wird in der Praxis meist die Abkürzung SPF für Sonderpädagogischer Förderbedarf verwendet. Durch die Abkürzung scheint der Begriff auf etwas Selbstverständliches, auf ein Faktum reduziert zu werden. Da die Bedeutung der Wörter in der Abkürzung verschwindet, verliert der Begriff seine ursprüngliche Inhaltlichkeit und erhält eine abstrakte Ebene. Dadurch wird der Begriff viel weniger als gedankliche Konstruktion wahrgenommen; er suggeriert, dass es sich um einen Fachbegriff handeln könnte. Dass gerade im pädagogischen/psychologischen Bereich vermehrt Abkürzungen auftreten (ADHS, LRS, MCD usw.), ist in der Literatur auffällig.
Schlee (1985) meint dazu: „Verdächtig ist mir dabei, dass solche Abkürzungen offensichtlich besonders bei Konzepten verwendet werden, die theoretisch auf schwankenden Füßen stehen“ (ebd. S. 866).
„Behinderung kann nicht als natürwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten“ (Jantzen 1987, S. 18).
Für die Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens ist der Begriff der Behinderung zentral, da ein Sonderpädagogischer Förderbedarf laut Gesetzestext eine physische oder psychische Behinderung voraussetzt.
„Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz liegt vor, wenn ein Kind infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder im Polytechnischen Lehrgang ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 15/1996).
Im folgenden Abschnitt sollen deshalb die Begriffe „Behinderung“ sowie „physische und psychische Behinderung“ kurz erläutert werden. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Phänomen und dem Begriff „Behinderung“ als zentrales Thema würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Unterschiedliche Behinderungsarten sowie ausführliche Gegenüberstellungen aus einzelnen Disziplinen werden im folgenden Text nicht berücksichtigt.
In vielen Disziplinen der Humanwissenschaften wird der Begriff „Behinderung“ verwendet, obwohl die Grenzen der Bedeutung nicht ausreichend geklärt sind und Abgrenzungskriterien fehlen. So findet sich auch in der Literatur keine Einigkeit über einen durchgängig anerkannten Begriff der Behinderung. Während der Literaturrecherche zeigte sich, dass trotz interdisziplinären Austauschs über eine Begriffsklärung die Verschiedenheit der Zugänge das Phänomen Behinderung prägt und eine ständige Unklarheit des Begriffs bestehen bleibt. Wird der Begriff in der Medizin z. B. als Synonym für dauerhafte, angeborene oder erworbene Schädigungen, also als Defekt am Menschen gesehen, so steht in den Erziehungswissenschaften nicht mehr der Mensch mit Behinderung im Vordergrund, sondern Behinderung wird unter dem Aspekt der Lernvoraussetzung, -bedingung, -ziele, -methoden, -institutionen gesehen.
Neumann (1992) weist auf eine Unbestimmtheit des Begriffs „Behinderung“ hin, da es seiner Meinung nach keine überzeugende theoretische Festlegung gibt. Vielmehr ist „Behinderung“ als Stigmatisierung der Gesellschaft zu sehen (vgl. ebd.).
Der Behinderungsbegriff wird durch die Vorstellung einer „ökonomischen Verwertbarkeit“ menschlicher Fähigkeiten geprägt; dadurch wird der Zugang zu einem menschengerechten Verständnis erschwer (vgl. Lempp 1997; Heinzlmaier 2010).
Im juristischen Feld oder auch in der pädagogischen Praxis kann Behinderung als feststehendes Phänomen zur Zuweisung von finanziellen oder pädagogischen Ressourcen dienen, während er in anderen Disziplinen keine feststehende Bedeutung hat.
Die Verwendung des Begriffes beschreibt demnach Menschen als auch physikalisch geprägte Eigenschaften und wird von „sinnfälligen auf nichtsinnfällige Erscheinungen ausgedehnt“ (Lindmeier 1993, S. 23).
Eine Gemeinsamkeit der vielen Auslegungen des Begriffs lässt sich dahingehend sehen, dass durch die Verwendung des Begriffs „Behinderung“ meist Andeu tungen auf ein Negativphänomen des menschlichen Seins gemacht werden (Lindmeier 1993, S. 22).
Eine Formulierung von Bleidick (2008) findet sich in vielen Artikeln auffallend häufig wieder, wobei der Autor lediglich feststellt, welche Personen als behindert gelten, und nicht, welche Personen behindert sind.
„Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen so weit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erschwert werden“ (Bleidick u. a. 2008, S. 95).
Bleidick selbst betont die Vorläufigkeit einer solchen Feststellung, indem er festhält:
„ (1) Die Definition beansprucht nur einen eingeschränkten Geltungsrahmen.
(2) Behinderung wird als Folge einer organischen oder funktionellen Schädigung angesehen.
(3) Behinderung hat eine individuelle Seite, die die unmittelbare Lebenswelt betrifft.
(4) Behinderung ist eine soziale Dimension der Teilhabe am Leben der Gesellschaft“ (ebd. S. 95).
Bleidick verweist weiters darauf, dass „Behinderung“ nicht nur eine medizinische, pädagogische oder gesellschaftliche Kategorie darstellt, sondern der Begriff kann auch als „pragmatische Entscheidung“ (vgl. ebd.) mit dem Zweck erklärt werden, dem benachteiligten Menschen Hilfe zukommen zu lassen (z. B. Anspruch auf Versorgungsleistungen, Erfüllen der Schulpflicht usw.).
Da SonderpädagogInnen während der Gutachtertätigkeit mit dem Gesetzestext und rechtlichen Rundschreiben konfrontiert sind, ist es der Autorin ein Anliegen zum Verständnis des Begriffs noch einmal einen Blick auf die gesetzliche Ebene zu werfen. Dabei wird es als sinnvoll erachtet, nur das Gesetz zu erwähnen, das entweder den Begriff klar beschreibt (wie z. B. Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) oder auf den Begriff „Behinderung“ bei Kindern näher einzugehen versucht (z. B. Familienlastenausgleichsgesetz).
Der Begriff „Behinderung“ wird in Österreich im Bundesrecht zum ersten Mal im Schulbereich verwendet (Schulpflichtgesetz, BGBl. Nr. 241/1962, und Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962). In beiden Gesetzen werden die Begriffe „physische“ und „psychische“ Behinderung verwendet und spezielle Regelungen für Kinder mit physischer oder psychischer Behinderung eingeführt.
Die österreichische Bundesregierung erarbeitete 1993 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) ein Behindertenkonzept, das als Leitlinie in der Behindertenpolitik gesehen werden kann.
Es wurde zwar gefordert, eine Definition von Behinderung ins Gesetz aufzunehmen, an die derzeit gültige Rechtslage (in der österreichischen Rechtsordnung ist kein einheitlicher Kompetenztatbestand des Behindertenwesens verankert) können jedoch keine rechtlichen Konsequenzen, z. B. als Grundlage für Leistungen, geknüpft werden. Somit erschien es nicht sinnvoll, einen einheitlichen Behindertenbegriff in einem Gesetz zu verankern.
Nachdem die einzelnen Gesetze unterschiedliche Zielsetzungen haben, enthalten sie verschiedene Definitionen von Behinderung. Die Zuständigkeit liegt für verschiedenste Themen in unterschiedlichen Bereichen sowohl beim Bundesgesetz als auch bei den einzelnen Bundesländern.
Im österreichischen Recht werden unterschiedliche Definitionen von Behinderung angegeben, einige davon werden hier kurz angeführt.
-
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005):
„§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.“
Auch in den Bundesgesetzen, wie dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG, BGBl. Nr. 22/1970), dem Bundespflegegeldgesetz (BPGG, BGBl. Nr. 110/1993), dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG, BGBl. Nr. 189/1955) und dem Beamtendienstrechtsgesetz 1979 (BDG, BGBl. Nr. 33/1979), wird der Begriff der Behinderung angeführt und je nach Thema (z. B. Versorgung von Gütern und Dienstleistungen usw.) abgehandelt.
Im Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (BGBl. Nr. 376/1967) geht der Gesetzgeber auf den Begriff der Behinderung bei Kindern ein, indem eine erhebliche Behinderung wie folgt beschrieben wird:
„(5) Als erheblich behindert gilt ein Kind, bei dem eine nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychischen Bereich oder in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad der Behinderung muß mindestens 50 vH betragen, soweit es sich nicht um ein Kind handelt, das voraussichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Für die Einschätzung des Grades der Behinderung sind die Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152 in der jeweils geltenden Fassung, und die diesbezügliche Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 9. Juni 1965, BGBl. Nr. 150 in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Die erhebliche Behinderung ist spätestens nach fünf Jahren neu festzustellen, soweit nicht Art und Umfang eine Änderung ausschließen.
(6) Der Grad der Behinderung oder die voraussichtlich dauernde Unfähigkeit, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, ist durch eine Bescheinigung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen auf Grund eines ärztlichen Sachverständigengutachtens nachzuweisen. Die diesbezüglichen Kosten sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu ersetzen“ (BGBl. Nr. 376/1967).
-
Landesgesetze:
Die Bundesländer Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Vorarlberg und Wien regeln die Behindertenhilfe in Landesbehindertengesetzen, Kärnten und Niederösterreich in den Sozialhilfegesetzen und Tirol im Rehabilitationsgesetz.
Der Begriff der Behinderung ist im Tiroler Rehabilitationsgesetz (TRG, LGBl. Nr. 58/1983) erfasst und wird laut § 2 (Personenkreis) folgendermaßen definiert:
„Behinderte im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die wegen eines physischen oder psychischen Leidens oder Gebrechens in ihrer Fähigkeit dauernd wesentlich beeinträchtigt sind, ein selbständiges Leben in der Gesellschaft zu führen, insbesondere eine angemessene Erziehung, Schulbildung oder Berufsausbildung zu erhalten oder eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung zumutbare Beschäftigung zu erlangen oder zu behalten.“
Das Tiroler Schulorganisationsgesetz 1991, § 94 beschreibt behinderte Kinder folgendermaßen: „Physisch oder psychisch behinderte Schüler im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere bewegungsgestörte, sprachgestörte, hörgestörte und legasthenische Schüler“ (LGBl. Nr. 84/1991).
Die Begriffe „physische“ und „psychische Behinderung“ werden seit 1962 im Gesetz bis heute verwendet. Sie vermitteln implizit den Anschein, den Gesamtbegriff „Behinderung“ näher zu beschreiben und einzugrenzen. Bei genauerer Betrachtung bleiben sie jedoch weitläufig und unklar. Seit den 1960er Jahren wurde der Begriff als Beschreibung für Kinder in Sonderschulen gebraucht. Da der Begriff bis heute im Gesetz nicht geändert wurde, wird er noch immer als Kriterium für sonderpädagogische Förderung vorausgesetzt.
Die Klärung der physischen Behinderung bleibt im Schulorganisationsgesetz trotz des Versuchs, den Begriff durch Klassifizierungsversuche (bewegungsgestört, hörgestört usw.) zu beschreiben, weitgehend offen; das Phänomen psychische Behinderung bleibt insofern ungeklärt, als dass die eigentlichen Störungsbilder einer psychiatrischen Diagnose entspringen, dort aber unter dem Begriff „Störungsbild“ verwendet werden (vgl. Begriff der psychischen Störung in gängigen Klassifikationssystemen ICD 10 und DSM IV).
Die Begriffe sind in ihren Bedeutungen, Wertungen und Bewertungen so weit gefasst, dass ein großer Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten offen bleibt. Sie mögen somit als Konstrukt der Gesetzgeber verstanden werden. Es sollte bewusst ein gewisser Handlungsspielraum offen bleiben, um den Kindern zusätzliche Hilfestellungen zu ermöglichen. Spinner (1987) spricht dabei von einer Doppelvernunft, die im Einzelfall situationsgerechtes Handeln über jegliche abstrakte Basisregeln hinaus legitimiert.
Die Gesetzgebung an sich lässt die Vermutung zu, dass wirtschaftliche Faktoren bei der Begriffsbildung eine Rolle spielen. Die wirtschaftliche Logik bestimmt, „… was schön und hässlich ist, gesund und krank, korrekt und verwerflich“.
„Dass wir also, ob wir dies wahrhaben wollen oder nicht, bevölkerungspolitische Aufgaben wahrnehmen, die einmal offener und einmal versteckter bestimmt sind“ (Jantzen 2005, S. 34).
Das Phänomen Behinderung aus einem medizinischen Blickwinkel zu betrachten ist so wenig zeitgemäß wie ein Erklärungsversuch aus z. B. rein rechtlichen, sozial- und individualtheoretischen, konstruktivistischen, sozialpsychologischen oder soziologischen Sichtweisen.
Neuere Modelle versuchen alle bekannten Faktoren, die das Phänomen Behinderung beeinflussen, zu erfassen und in einem sinnvollen Rahmen darzulegen. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) entwickelte 1980 mit dem ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) ein Klassifikationsschema für Krankheiten und Behinderung. Die WHO ging in ihrer Definition von Behinderung von drei Begriffen aus: Schädigung (impairment) (Verlust und Abnormität psychologischer, physiologischer oder anatomischer Struktur oder Funktion), Fähigkeitsstörung (disability) (Funktionsbeeinträchtigung oder Funktionsmängel aufgrund von Schädigungen) und Beeinträchtigung (handycap) (Benachteiligung einer Person im gesellschaftlichen Leben als Folge einer Schädigung oder Beeinträchtigung) (vgl. WHO 1980). Dieses Begriffsschema wurde 1999 überarbeitet und durch Einbeziehen von personenbezogenen und umweltbezogenen Faktoren ergänzt. Die ergänzte Form liegt als ICIDH-2 Beta-1 und Beta-2 (International Classification of Impairments, Activities and Participation: A Manual of Dimensions and Functioning) vor und seit 2004 in einer deutschen Fassung.
Im Jahre 2001 beschließt die Vollversammlung der WHO die zweite Auflage der ICIDH unter dem Titel „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“, kurz ICF genannt.
Früher verwendete Begriffe wie „Schädigung“, „Fähigkeitsstörung“ und „soziale Beeinträchtigung“ werden in der ICF ersetzt durch „Körperfunktionen und -strukturen“, „Aktivitäten“ und „Partizipation (Teilhabe)“. Diese Begriffe sind definiert, innerhalb der Klassifikation im Einzelnen dargestellt, erweitern die Reichweite der Klassifikation und machen die Beschreibung positiver Erfahrungen möglich.
„Behinderung“ wird als Oberbegriff für Schädigung, Beeinträchtigung der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe) verwendet. Darüber hinaus werden Umweltfaktoren aufgelistet, die ständig mit den oben genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen.
In Abbildung 2 wird die Funktionsfähigkeit eines Menschen als eine Wechselwirkung oder komplexe Beziehung zwischen Gesundheitsproblem, dem Ausmaß der Funktionsfähigkeit des Menschen und Kontextfaktoren (Umweltfaktoren/ personenbezogene Faktoren) dargestellt. Zwischen den Größen bestehen Wechselwirkungen. Deutlich zu sehen ist, dass Umweltfaktoren (z. B. Einstellung der Gesellschaft, Rechtssysteme usw.) außerhalb des Individuums liegen. Personenbezogene Faktoren wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter usw. werden in dieser Fassung der ICF nicht klassifiziert.
Gesundheitsprobleme wie Krankheiten oder Verletzungen werden von der WHO in der ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision) klassifiziert.
Funktionsfähigkeit und Behinderung, in Kombination mit einem Gesundheitsproblem sind in der ICF klassifiziert. Die ICD-10 und die ICF ergänzen einander und bieten die Möglichkeit, ein angemessenes Bild über den Gesundheitszustand eines Menschen zu liefern.
Die ICF vereint das medizinische Modell mit dem sozialen Modell der Behinderung: Das medizinische Modell definiert Behinderung als: „… ein Problem einer Person, welches unmittelbar von einer Krankheit, einem Trauma oder einem anderen Gesundheitsproblem verursacht wird, das der medizinischen Versorgung bedarf, etwa in Form individueller Behandlung durch Fachleute. Das Management von Behinderung zielt auf Heilung, Anpassung oder Verhaltensänderung des Menschen ab“ (DIMDI 2005; S. 24).
Das soziale Modell definiert Behinderung als ein durch die Gesellschaft erzeugtes Problem. Behinderung ist somit nicht mehr als ein Merkmal einer Person zu sehen, sondern als Konstrukt des gesellschaftlichen Umfeldes.
„Daher erfordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln, und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation (Teilhabe) der Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens erforderlich ist“ (ebd. S. 25).
Die ICF verwendet den Begriff der Behinderung als einen allgemeinen Oberbegriff und weist darauf hin, dass jeder Mensch das Recht hat so genannt zu werden, wie er es wünscht (Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch). Die WHO spricht sich auch ganz deutlich gegen eine Klassifikation von Menschen aus, daher sind die Kategorien in der ICF neutral gefasst, um Stigmatisierungen zu vermeiden. Die Kategorien und Beurteilungsmerkmale sollen als Gesundheitscharakteristiken von Menschen im Kontext ihrer individuellen Lebenssituationen und der Umwelteinflüsse sein. Sie wurde als eine soziale Klassifikation der Vereinten Nationen anerkannt.
Mit dem Ansatz der WHO ist eine allgemeine Klassifikation für den Begriff „Behinderung“ gesetzt worden. Kritisiert am Klassifikationssystem wird, dass die soziale Dimension nach wie vor zu kurz kommt (vgl. Lindmeier 2010).
Sie zeigt sich an der stärkeren Gewichtung der Körperfunktionen und -strukturen (je acht Kapitel) gegenüber der Klassifikation der Umweltfaktoren (fünf Kapitel). Das medizinische Modell und die Defizitorientierung überwiegen demnach noch in der ICF.
In der ICF bleiben zwar personenbezogene Faktoren berücksichtigt, sie erscheinen aber nur vage als besonderer Hintergrund der Lebensführung (vgl. Schuntermann 2002). Für die Weiterentwicklung der Anwendung der ICF werden unter anderem folgende Aspekte weiterentwickelt werden (vgl. Lindmeier 2010):
-
die Entwicklung der Komponente der personenbezogenen Faktoren,
-
das Herstellen von Bezügen zu Konzepten der Lebensqualität und die Messung von subjektivem Wohlbefinden und
-
weitere Forschung zu den Umweltfaktoren, um die notwendige Detailliertheit für die Beschreibung zu bieten.
Die Diskussion um „Behinderung“ wird sich noch etlichen ideologischen Momenten entgegensetzen müssen. Umstritten bleibt die Tauglichkeit des Begriffs im traditionellen Verständnis unter dem Aspekt des Menschenbildes.
Konstruktivistische Theorien der Behinderung werden in der Theorie häufig diskutiert und miteinbezogen, bei der Erstellung von Gutachten in der schulischen Praxis wird dieser Ansatz noch wenig berücksichtigt.
Im folgenden Abschnitt wird über generelle Aussagen des Konstruktivismus gesprochen, wobei auf eine Unterscheidung der konstruktivistischen Positionen nicht näher eingegangen wird. Es wird auch nicht der Frage nachgegangen, ob die Aussagen des Konstruktivismus stichhaltig sind, sie werden eher als Verständnishilfe für den Behinderungsbegriff genutzt.
Konstruktivistische Theorien gehen davon aus, dass die Wahrnehmung nicht Gegebenheiten einer vom Menschen unabhängigen Realität abbildet, sondern dass der Mensch Modelle entwirft, deren allgemeingültige Wahrheit und Objektivität nicht überprüft werden kann (vgl. Lindemann/Vossler 1999). Beschreibungen von Realitäten sind innerhalb des Konstruktivismus als subjektive, kulturell und gesellschaftlich abhängige Konstruktionen zu sehen. Die Bausteine der Wirklichkeitskonstruktion, Beobachtungen, Erkennen, Erfahren und Handeln, sind als Relationen zwischen der subjektiven Wahrnehmung und der materialen und sozialen Umwelt, in der Behinderndes wirksam wird, zu begreifen (vgl. Walthes 1997).
Aus Sicht des Konstruktivismus birgt der Begriff der Behinderung viele Interpretationen, Vorannahmen und Vorurteile; in der Literatur eröffnet die Diskussion eines konstruktivistischen Zugangs des Behinderungsbegriffes neue Perspektiven. Das im Behinderungsbegriff festgelegte Menschenbild ist aus konstruktivistischer Sicht nicht haltbar, wie einige Autoren feststellen.
Auch in der pädagogischen Praxis der Gutachtenerstellung wird der Begriff der Behinderung immer wieder neu „konstruiert“. Wird eine „Behinderung“ von GutachterInnen diagnostiziert, so ist das keine unanfechtbare Kategorie, sondern hängt davon ab, wie die Realität des zu Begutachtenden beschrieben wird. Die Zuschreibung macht wiederum keine allgemeingültige Aussage über die Beschriebenen, sondern über den, der in diesem Fall das Gutachten verfasst. „Folglich kann Behinderung nicht als beobachterunabhängiger, objektiver Sachverhalt verstanden werden, sondern nur als auf Beobachtung, Unterscheidung und Kommunikation beruhende Konstruktion“ (Dederich/Jantzen 2009).
Wie die Konsequenz der Begutachtung aussieht, ist somit nicht nur allein durch die Begutachtung bestimmt, sondern unterliegt der Bewertung durch die Handelnden, d. h. durch die BegutachterInnen. Die Vorstellung der BegutachterInnen über Behinderung und die Wirkung des Phänomens schließen den aktuellen Diskurs über Behinderung mit ein, werden durch subjektive Theorien, Vorannahmen und Vorurteile beeinflusst und stellen „entscheidende“ Faktoren dar.
Die meisten GutachterInnen sehen Behinderung als eine gegebene Eigenschaft des Kindes, das Kind erscheint „gestört“, „verzögert“, „behindert“, „verhaltensauffällig“. Behinderung existiert hier als Erklärungsmodell, als eine Beschreibung, die die GutachterInnen anfertigen.
Traditionellerweise werden Behinderung und Probleme in der schulischen Praxis nicht als Konstruktion gesehen, sondern werden ursächlich auf die Behinderung als Eigenschaft der Person zurückgeführt.
Ein konstruktivistischer Zugang erlaubt es, Behinderung nicht an der Person festzumachen, sondern vielmehr auch auf den Kontext zu schauen, der für die Problementwicklung in der Schule wichtig ist.
Der konstruktivistische Ansatz, Behinderung als eine „Beobachterkategorie“, (Dederich 2001) und als einen „Prozeß intersubjektiver Wirklichkeitskonstruktion“ (Osbahr 2000) zu sehen, eröffnet die Möglichkeit, den Begriff von seiner Negativbewertung zu lösen und dem Kind „mit Behinderung“ einen moralischen Schutz zu bieten.
Die Berücksichtigung eines konstruktivistischen Ansatzes bietet für GutachterInnen die Chance die Subjekthaftigkeit des eigenen Tuns im Rahmen der Gutachtertätigkeit zu erkennen. Es schafft die Möglichkeit, scheinbare Gegebenheiten – in diesem Fall die Feststellung einer Behinderung – in ihrer Begründung zu hinterfragen und einen eigenen Weg zu finden, den man verantwortlich und hinsichtlich ethischer Überlegungen einschlagen möchte. Damit kann konstruktivistisches Gedankengut auch als Instrument dienen, den defizitorientierten Zugang zu Behinderung zu kritisieren.
In der schulischen Praxis können konstruktivistische Überlegungen eine Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns und dessen Möglichkeiten auslösen, eine Rechtfertigung pädagogischer Entscheidungen können sie nicht sein.
Die vermeintliche Sicherheit über das Sein oder Werden des Gegenübers, des zu diagnostizierenden Schulkindes also, wird durch das Einbeziehen eines konstruktivistischen Ansatzes ins Wanken gebracht, eröffnet aber auch die Möglichkeit, Verantwortung für die Praxis zu übernehmen und bietet Perspektiven, sie zu verändern. Weiters kann er als theoretisches Fundament in der Neuorientierung der Diagnostik angewendet werden.
In vielen europäischen Ländern ist der Sonderpädagogische Förderbedarf an eine diagnostizierte Behinderung gebunden. Ebenso verhält es sich in Österreich, wo zusätzliche Fördermaßnahmen und Förderressourcen an das Feststellen einer physischen oder psychischen Behinderung gekoppelt sind. In Österreich wird pauschal angenommen, dass 2,7 % der SchülerInnen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Nach dieser Zahl richtet sich die Ressourcenzuteilung, sprich die Zuteilung an zusätzlichen LehrerInnen und Zusatzstunden. Sind Ressourcen bereits vorhanden, so sollen diese zielgerichtet und angepasst auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen verantwortungsbewusst eingesetzt werden.
„Neben dem möglichen Einsatz zusätzlicher Lehrerinnen und Lehrer stellen das Teamteaching, der sonderpädagogische Kompetenztransfer sowie die Bewertung durch das Sonderpädagogische Zentrum und durch allfällige weitere Expertinnen und Experten entscheidende Unterstützungsmaßnahmen dar. Für die Kontrolle der zahlenmäßigen Entwicklung in den Schulbezirken ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf absolut und als Anteil der Zahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen durch die Schulaufsicht in Evidenz zu halten“ (BMUKK, Abt. I/8, 2008).
Wocken (1996) schreibt in seinem Artikel über die Begründung des Bedarfs-Angebots-Junktims, dass dem Junktim zwischen Bedarfsdiagnose und Ressourcenangebot „… der ursprünglichen Intention nach durchaus positive Absichten …“ zugrunde liegen (Wocken 1996, S. 34).
Die Begründung liegt darin, dass die Zuteilung von Ressourcen den Kindern in den Schulen zugutekommt, die besonderer Entwicklungshilfen bedürfen. Unter Ressourcen sind alle materiellen und personellen Mittel gemeint, die einem Schüler mit Sonderpädagogischem Förderbedarf zugestanden werden. Die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs und somit einer Behinderung hatte und hat noch immer die Funktion einer Ressourcenlegitimation, überspitzt formuliert: Kinder mit Behinderungen schaffen Zusatzstunden.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass z. B. Kinder mit Lern- oder Verhaltensstörungen, die früher in der Klasse mitgetragen wurden, schneller von der Zone der Normalität abweichen und der Kategorie „behindert“ zugeordnet werden.
Waren in vorintegrativen Zeiten die Konsequenzen der als „behindert“ diagnostizierten Kinder mit einer schulischen Aussonderung verbunden, so wird in integrativen Schulen die Deklassierung von Kindern mit zusätzlichen Ressourcen „belohnt“. Wocken (1996) fasst in seinem Artikel „Sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff“ zusammen, dass Integration und Prävention nicht zu einer zahlenmäßigen Verringerung von „behinderten“ Kindern führten. Der ursprünglich positive Gedanke der zusätzlichen Förderung von Kindern hat durch die diagnostische Kennzeichnung und der nur damit verbundenen Bereitstellung von Mitteln ins Negative geführt. Wocken kritisiert die derzeitige Vorgehensweise der Zuteilung von Ressourcen, indem er meint: „Integration produziert Behinderung“ (Wocken, 1996, S. 36). Dass die Ressourcenzuteilung kein integrationsspezifisches Problem ist und auch ganz unabhängig von integrativen Maßnahmen existiert, sei hier anzumerken.
Für PädagogInnen und SonderpädagogInnen heißt das, dass bei der Begutachtung der Kinder die Normalitätstoleranz sinkt. „Die Grenze zwischen Normalität und Behinderung hat sich in bedenklicher Weise verschoben“ (Wocken 1996, S. 36). An dieser Stelle sei anzumerken, dass die diagnostische Feststellung des Förderbedarfs eines Kindes immer ein selektiver Akt ist.
Die Anzahl der Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf hat sich in Österreich wie vergleichsweise auch in anderen europäischen Ländern erhöht, sie ist vom Schuljahr 2007/2008 von 4,5 % (28.056 Schülerinnen und Schüler) auf 5 % (28.236 Schülerinnen und Schüler) im Schuljahr 2010/2011 gestiegen. Es sei hier anzumerken, dass bei der Datenerhebung keine Berücksichtigung auf sozialen Hintergrund oder Behinderungsart vorliegt. In Österreich wird jedoch von einer Kontingentierung von 2,7 % Kinder mit SPF pro Altersjahrgang ausgegangen. Präventive Fördermaßnahmen für SPF-gefährdete Kinder sind aus dem Ressourcenpool der Sonderpädagogik nicht finanzierbar.
Obwohl aus wissenschaftlicher Sicht bewiesen ist, dass eine Förderung von Kindern effizienter ist, je früher sie einsetzt, darf in Österreich sonderpädagogische Arbeit erst beginnen, wenn alle Unterstützungssysteme bereits versagt haben (vgl. Specht 2006).
Wocken (ebd.) plädiert dafür, dass die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht in eine Etikettierung „behindert“ münden darf. Behinderung nur als Ressourcensicherung zu verwenden, ist eindeutig abzulehnen; Behinderungen gänzlich zu negieren, ist riskant und nicht im Sinne der Betroffenen, da der Anspruch auf Förderung verkannt wird.
Das Dilemma lässt sich in der Praxis allerdings deutlich erkennen, nämlich dass Kinder, die zwar offiziell nach den klassischen Diagnoseklassifikationen als nicht behindert gelten würden, im Schulbereich aber als „behindert“ geführt werden, damit sie zusätzliche Förderungen (vgl. Bildungsserver Südtirol) erhalten.
Welche und wie viele Schüler im Vergleich zu den normalen Unterrichtsstunden zusätzliche Ressourcen in Form von sonderpädagogischer, personeller und materieller Unterstützung benötigen, ist stets Thema von schulischem Personal, hauptsächlich jedoch auf politischer Ebene im Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten.
Um dem Widerspruch zu entkommen, dass nur behinderte Kinder Zusatzstunden schaffen, schlägt Wocken schon 1996 vor, den Regelschulen hinsichtlich ihrer Gesamtschülerzahl pauschal SonderpädagogInnen zuzuweisen.
In Südtirol wird bereits erfolgreich nach diesem Modell gearbeitet: Etwa 80–90 % der Stellen werden den Regelschulen zugeteilt in der Annahme, dass überall etwa gleich viel Unterstützung benötigt wird. Die restlichen Ressourcen bleiben beim zuständigen Schulamt und werden auf Antrag den Schulen zugeteilt.
Boban und Hinz (1998) fordern die Unabhängigkeit einer Prozessdiagnostik von administrativen Aufnahmeverfahren und sprechen sich klar gegen Ressourcenbeschaffung aus. Sie stellen deutlich dar, dass allein der Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einem Spannungsverhältnis zur Vorstellung einer Diagnostik für inklusive Bildung steht – es soll nicht klar unterschieden werden zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF (ebd., S. 152 ff.).
Nach Luhmann (2002) erzeugt das derzeitige Schulsystem Selektion durch die festgestellte Unterscheidung von „besser“ und „schlechter“. Dadurch wird eine Unterscheidung von SchülerInnen nach Leistung und Verhalten ermöglicht. Opp (2004) schließt sich Luhmann an, indem er feststellt, dass die diagnostische Feststellung eines Förderbedarfs entlang der Kodierung von „besser“ oder „schlechter“ immer selektiver Art insofern ist, als andere Kinder der Förderangebote zur Erreichung der schulischen Leistungsziele nicht bedürfen.
„Es ist sozusagen das Dilemma individueller Förderangebote, dass sie den Förderbedarf des Kindes nach außen sichtbar machen“ (Opp 2004, S. 27).
Laut einer umfassenden Studie des bifie (2007) sprechen sich viele Experten für die vollständige Abschaffung des SPF-Verfahrens aus:
„Den SPF braucht nur das System. Kinder brauchen LehrerInnen, die fähig sind, Lernstand- und Lernprozessanalysen zu machen, und genügend Personal, das jedem Kind ein adäquates Lernangebot stellt“ (bifie 2007, S. 58).
Die Entwicklungen in Europa (vgl. Meijer 1999) gehen ebenfalls in Richtung einer Ressourcenzuteilung an das System der Fördereinrichtungen. „Weg von kindbezogenen Ressourcenverteilungen zu systembezogenen Zuweisungen“ (Specht 2006, S. 57).
In den gängigen Diskussionen um Inklusion wird immer wieder die Erwartung mitgeführt, dass eine inklusive Schulkultur selektive Fördermöglichkeiten vermeiden kann und Ressourcen unabhängig von Zuweisungen zu einzelnen Kindern verfügbar macht.
In Österreich können seit dem Jahr 2007 an insgesamt neun Pädagogischen Hochschulen des Bundes und fünf Privaten Pädagogischen Hochschulen Lehramtsstudien für den Pflichtschulbereich (Volksschule, Hauptschule, Sonderschule, Polytechnische Schule, Religionspädagogik) und für den berufsbildenden Bereich (Berufsschule, Technisch-gewerbliche Pädagogik, Ernährungspädagogik, Informations- und Kommunikationspädagogik, Mode & Design) abgeschlossen werden. Voraussetzung für das Studium an der Pädagogischen Hochschule ist ein Reifezeugnis einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule, ein als gleichwertig anerkanntes anderes Zeugnis, eine Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung. Weiters müssen ein Aufnahmeverfahren und die Studieneingangsphase (Dauer vier Wochen) im ersten Semester erfolgreich absolviert werden. Inhalte, Zielsetzungen und Teilkompetenzen sind auf die jeweiligen Schularten abgestimmt. In einem Modulsystem werden die Inhalte vermittelt und reichen von wissenstheoretischen Hintergründen über fachdidaktische bis zu schulpraktischen Ausbildungen.
Für das „Lehramt an Sonderschulen“ schließen die Studierenden nach einer sechssemestrigen Ausbildung mit dem „Bachelor of Education“ das Studium ab. Dieses Lehramtsstudium befähigt Studierende zum Unterricht an integrativ geführten Klassen in Volks- bzw. Hauptschulen sowie in Sonderschulklassen.
Bei Durchsicht der Module[22] für das Lehramt an Sonderschulen konnte die Autorin feststellen, dass in der Grundausbildung kaum bis gar keine Module mit wissenschaftstheoretischen Hintergründen und Modellen der sonderpädagogischen Diagnostik angeboten werden. Nach dem abgeschlossenen Lehramtsstudium für Sonderschulen wird jedoch seit dem Schuljahr 2011/2012 bundesweit ein zweisemestriger Lehrgang zum Gutachter/zur Gutachterin angeboten. Für die Qualitätssteigerung dieses Lehrgangs wurde eine bundesweite Empfehlung erarbeitet. Nach Durchsicht der Hauptinhalte des Lehrgangs stellte sich heraus, dass diagnostische Verfahren (Lerndiagnostik; standardisierte diagnostische Verfahren; spezielle diagnostische Verfahren; nichtstandardisierte diagnostische Verfahren) und gesetzliche Grundlagen im Vordergrund stehen. Wie sich zeigt, orientiert sich der Lehrgang nach wie vor an klassischen Ansätzen in der sonderpädagogischen Diagnostik: Ein breiteres Spektrum der Sichtweise von Diagnostik, Kennenlernen von alternativen Diagnostikmodellen sowie eine kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten wie „Behinderung“ oder „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ sowie selbstreflexive Elemente fehlen derzeit noch in der Ausbildung.
Im Jahr 2006 wurde bei der UNO-Generalversammlung in New York die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert und trat im Jahr 2008 in Österreich in Kraft. Österreich hat sich damit völkerrechtlich verpflichtet, die in der UN-Konvention festgelegten Standards durch österreichische Gesetze umzusetzen und zu gewährleisten. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ist das erste internationale Völkerrechtsdokument, das genau vorschreibt, wie alle Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt leben können.
Im Artikel 3 werden unter den allgemeinen Grundsätzen der Konvention (BGBl. III Nr. 155/2008) unter anderem „Chancengleichheit“ und „Nichtdiskriminierung“ aufgelistet. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit im schulischen Bereich die Diagnostizierung eines „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ mit diesen im Gesetz verankerten Grundsätzen vereinbar ist:
Solange die Diagnostizierung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nach wie vor selektive Funktionen hat und vorrangig zu administrativen Zwecken dient (z. B. personengebundene Ressourcenzuweisungen), kann sie, nach Meinung der Autorin, in einem inklusiven Bildungssystem nicht länger bestehen. Allein der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ steht an sich schon in einem Widerspruch zu Diagnostik und inklusive Bildung: Durch die Zuschreibung des Begriffs werden Kinder in zwei Gruppen eingeteilt – in Kinder mit und ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. Boban/Hinz 1996).
Die Vergabe eines Sonderpädagogische Förderbedarfs kann in keiner Weise weder dem Anspruch nach Wertschätzung, Anerkennung individueller Unterschiede und Chancengleichheit in einem inklusiven Bildungssystem noch einer Pädagogik der Vielfalt (Prengel 2006) entsprechen.
Diagnostik im Sinne einer nicht selektiven, sondern inklusiven Diagnostik – ohne die Vergabe eines SPFs an ein Kind – hält die Autorin jedoch für sinnvoll: So stellen beispielsweise das Verfahren des „Diagnostischen Mosaiks“ (vgl. Schley 1988; Boban/Hinz 1998) oder eine „Rehistorisierende Diagnostik“ (vgl. Jantzen 1996) eine gute Möglichkeit dar, die Lebens- und Lernsituation eines Kindes zu erfassen, um dadurch zukünftiges pädagogisches Handeln zu planen.
Die Autorin schließt sich den Aussagen Jantzens (1996) an, dass Diagnostik im Sinn von inklusiver Diagnostik nicht auf empirische Verfahren und deren Ergebnisse verzichten muss. Vielmehr gilt es in Zukunft herauszuarbeiten, welche Bedeutung die erworbenen Daten und Fakten für eine diagnostische Interpretation haben, denn „… sie sind, entgegen der Annahme ihrer Kritiker, nicht selbstredend. Ihre Evidenz als Krankheitsurteile im Sinne von Verurteilung erlangen sie nur durch ihre unhinterfragte Hinnahme als für sich selbst sprechende Wirklichkeit …“ (ebd. S. 13).
Mit Blick auf ein zukünftiges inklusives Bildungswesen in Österreich wird sich das herkömmliche Verfahren des Sonderpädagogischen Förderbedarfs einem klaren Richtungswechsel stellen müssen: einerseits auf rechtlicher Seite durch Abschaffung der Vergabe des Begriffs „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und einer personenbezogenen Ressourcenverteilung, andererseits durch eine umfassende Änderung des traditionellen Diagnoseprozesses und eine somit umfangreichere Ausbildung der SonderpädagogInnen zu GutachterInnen.
[1] Vergleichsstudien internationaler Organisationen in unterschiedlichen Sprachen bieten mittlerweile eine Vielzahl von Erklärungen, Empfehlungen und Programmen, die vor allem unter dem Dach der UNESCO ausgearbeitet wurden. Für Europa wurden Veröffentlichungen, Konzepte und sonderpädagogische Aktivitäten vor allem von der OECD veranlasst (vgl. www.oecd.org ; www.eurydice.org ).
[2] Das Jean-Monnet-Programm wurde 1989 entworfen. Mit Hilfe des Programms werden Lehre, Reflexion und Diskussion über den europäischen Integrationsprozess an Hochschuleinrichtungen weltweit gefördert.
[3] Das Sekretariat der Agency befindet sich in Odense, Dänemark, eine weitere Dienststelle ist in Brüssel.
[4] Die Projektberichte sind unter www.european-agency.org abzurufen.
[5] Die Originalfassung sowie die englische Fassung können von folgender Internetseite heruntergeladen werden: www.european-agency.org/site/info/publications/agency/index.html .
[6] Die Begriffe SEN (special education needs) oder IEP (individueller Entwicklungsplan) wurden von mir sinngemäß nach österreichischem Sprachgebrauch als Sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) oder Sonderpädagogischer Förderplan übersetzt (SFP). Eine genauere Auseinandersetzung mit den Begriffen ist im Kapitel 3.2.5 zu finden.
[8] In Irland ist seit 1998 ein Gesetz zur Gleichstellung am Arbeitsplatz (The Employment Equality Act), seit 2000 ein Gleichstellungsgesetz (The Equal Status Act) und seit 2005 ein Gesetz zur Verbesserung der Situation von behinderten Menschen (Disability Act) in Kraft.
[9] Die Informationen über die Vorgangsweise der Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Italien wurden von der Autorin vom Pädagogischen Institut für die deutsche Sprachgruppe Bozen bezogen, da noch kein Bericht bei der Europäischen Agentur vorliegt (vgl. www.blikk.it ).
[10] Der „Disability Discrimination Act 1995“ hat die Gleichstellung von behinderten Menschen zum Ziel und bietet Menschen mit Behinderungen Schutz gegen jegliche Art der Diskriminierung (vgl. http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/ukpga_19950050_en_1 ).
[11] Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kurzform: Kultusministerkonferenz, Abk. KMK) wurde 1948, also noch vor Konstituierung der Bundesrepublik, gegründet und ging aus der „Konferenz der deutschen Erziehungsminister“ hervor.
[12] 2 vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Einheit in der Vielfalt (1998): 50 Jahre Kultusministerkonferenz 1948–1998.
[13] Diese Daten wurden aus Berichten der European Agency for Development in Special Needs Education (www.european-agency.org ) entnommen.
[14] vgl. Statistik Austria 2010/2011.
[15] vgl. dazu Kapitel 3.2.7.
[16] siehe Anhang.
[17] 1 vgl. § 34 Abs. 2 Schulorganisationsgesetz.
[18] ‚Förderdiagnostisches Vorgehen muss sich unmittelbar an den Bedürfnissen des Kindes als Person in einer Gesamtsituation orientieren. Förderdiagnostik beurteilt und beeinflusst langfristig Lern- und Erziehungsprozesse; …‘ (bifie-Report Individuelle Förderung im System Schule, September 2007), (zit. nach BMUKK, Abt. I/8 2010, S. 10, Hervorhebung im Original).
[19] ‚Um die Gesamtheit des Lern- und Entwicklungsstandes sowie Persönlichkeits- und Sozialisationsparameter zu erfassen, ist eine umfassende Kind-Umfeld-Analyse (Sander 1993) durchzuführen, in der zumindest die Bereiche Wahrnehmung, Sprache und Kommunikationsfähigkeit, Kognition, Lernentwicklung und Lernstand, das sozial emotionale Verhalten, das Selbstkonzept, das Lern- und Arbeitsverhalten, die außerschulischen und schulischen Lebensbedingungen sowie körperliche und motorische Entwicklungsstand näher betrachtet werden müssen. Leitmedium für die Ermittlung dieser Profile ist die strukturierte Beobachtung unter Maßgabe der Orientierung an didaktischen Strukturen und Entwicklungsskalen‘ (bifie-Report Individuelle Förderung im System Schule, September 2007), (zit. nach BMUKK, Abt. I/8 2010, S. 10, Hervorhebung im Original).
[20] Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur erarbeitete in seiner Handreichung vom Jänner 2010 in enger Kooperation von Abteilung I/8 mit den Landes- bzw. BezirksschulinspektorInnen für Sonderpädagogik Kriterien für ein transparentes Feststellungsverfahren sowie Qualitätsstandards für das Sonderpädagogische Gutachten. Ziel dieser Handreichung ist eine Qualitätsverbesserung im Zusammenhang mit der Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs. Zielgruppe dieser Handreichung sind Personen der Schulaufsicht, GutachterInnen und VertreterInnen der Schulpsychologie.
[21] Definition des sonderpädagogischen Gutachtens gemäß § 8 SchpflG.
[22] siehe Homepages der Pädagogischen Hochschulen: www.paedagogischehochschulen.at
Inhaltsverzeichnis
„Tatsächlich üben Worte eine typisch magische Macht aus:
sie machen sehen,
sie machen glauben,
sie machen handeln“
(Bourdieu 2005, S. 83).
Der Blick auf Metaphern in qualitativen Daten erfährt in verschiedenen Forschungsverfahren immer mehr an Bedeutung. Die Metaphernanalyse ist ein relativ neuer Ansatz in der qualitativen Sozialforschung. Lakoff und Johnson (1980) betonen in ihrem Buch „Metaphors we live by“ ausgehend von der kognitiven Linguistik die Wichtigkeit der Metapher in der Alltagssprache. Sie legen dar, dass Metaphern integrale Bestandteile der alltäglichen Sprache sind, unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln bestimmen. Seit diesen Studien steigt das Interesse an der Metapher in geschriebener und gesprochener Sprache, auch in Disziplinen wie Psychologie, Sozial- sowie Erziehungswissenschaften. Einige neuere Untersuchungen stimmen darin überein, dass Metaphern vorbegriffliche Orientierungen des Denkens und Erlebens bereitstellen, die anhand von deren Analyse erst zugänglich werden (vgl. Schmitt 2003; Buchholz 1996).
Aus einer intensiven Auseinandersetzung mit der Metaphernanalyse als ergänzende oder eigenständige Forschungsmethode[23] sind in Anlehnung an die kognitionslinguistische Metaphernanalyse von Lakoff und Johnson (1998) in den letzten Jahren einige Studien (vgl. Niedermair 2001; Jäkel 2003; Schmitt 1997; 2002; 2003; Buchholz 1996) entstanden. Die Studien wurden hauptsächlich im psychotherapeutischen und psychosozialen Praxisfeld durchgeführt, wobei der Metapher in diesen Bereichen eine zentrale Funktion im therapeutischen Kontext zuerkannt wurde. Diese Studien brachten die linguistische Metaphernanalyse mit dem breiten Methodenspektrum der qualitativen Sozialforschung in Verbindung. Die Metaphernanalyse ist eine interdisziplinäre Methode, in der unter anderem Eigenschaften aus der qualitativen Sozialforschung und den Sprachwissenschaften angewendet werden. Eine Verknüpfung der beiden Wissenschaften bietet die Chance, ein neues Spektrum an wissenschaftlicher Informationsgewinnung zu öffnen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist es, „… die Sprachblindheit der Qualitativen Sozialforschung aufzuheben und gleichzeitig Engführungen innerhalb der Qualitativen Sozialforschung zu vermeiden, etwa durch unreflektierte Übernahme ihrerseits verkürzter linguistischer Metaphernmodelle“ (Niedermair 2001, S. 144). Die Metaphernanalyse versucht im allgemeinen Sinn, Metaphern „… zu verstehen und zu klären, zu ersetzen, zu entfalten, weiterzuspinnen, fruchtbar zu machen – alles, was man überhaupt mit Metaphern tun kann, angefangen vom alltäglichen, mehr oder weniger bewussten metaphorischen Sprachgebrauch bis hin zu einer wissenschaftlichen Untersuchung der Metapher“ (ebd.).
Der Gegenstandsbereich der Studien bisher war die Darstellung der Metaphern, durch welche unbewusste Denkmuster und Strukturen der Konstruktion von Wirklichkeit bewusst gemacht werden sollten, mit dem Ziel, eine Veränderung in der Praxis zu bewirken.
„Gegenstand der Metaphernanalyse sind also die Bedingungen der Möglichkeit der Konstruktion von Wirklichkeit und der Neu-Konstruktion von Wirklichkeit. Metaphernanalyse entsteht insofern aus der Spannung von faktisch wirksamen und kontrafaktisch erwünschten metaphorischen Strukturen“ (Niedermair 2001, S. 158).
Ein wesentlicher Schritt in der Arbeit mit Metaphern ist deren Erkennung. Ein geschichtlich-literarischer Streifzug durch die einzelnen Disziplinen einer Metapherndefinition (z. B. Rhetorik, Philologie, Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften usw.) beginnt meist mit der Definition von Aristoteles und spannt den Bogen über die Conceptual Metaphor Theory[24] von Lakoff und Johnson (1980) bis hin zu neueren Metapherntherorien (vgl. dazu auch Haverkamp[25] 1983; 1996). Eine klare Definition zu finden, was „Metapher“ wirklich ist, scheint jedoch bis heute schwierig zu sein (vgl. Schmitt 1995). Dennoch soll hier ein kurzer Einblick in Beschreibungen von Metaphern gegeben werden. Der Versuch, den Begriff „Metapher“ zu definieren, geht bis in die Zeit Aristoteles zurück, der bereits um ca. 350 v. Chr. feststellte, dass alle Menschen Metaphern gebrauchen. Eine klassische Definition von Metapher ist bei Aristoteles‘ Poetik zu finden:
„Die Metapher ist die Übertragung eines Wortes, das (eigentlich) der Name für etwas anderes ist, entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von einer Art auf eine (andere) Art gemäß einer Analogie“ (Aristoteles 2008, S. 29, zit. nach Kruse/Biesel/Schmieder 2011, S. 63).
Die Beschreibungen der Metapher, die Lakoff und Johnson in ihren Studien darstellen, sind vergleichsweise allgemein gehalten:
-
Metaphern verweisen auf kognitive Modelle, mit denen wir unsere Welt strukturieren. Unsere Reflektionen, unser Handeln und Interagieren basiert auf metaphorischen Modellen.
-
Metaphern strukturieren komplexe und abstrakte Erfahrungsräume durch den Rückgriff auf körperlich und kulturell verankerte Erlebnisse.
-
Vor allem die Alltagsmetaphern (nicht linguistisch auffällige Sprachbilder) sind Träger von Modellvorstellungen (vgl. Lakoff/Johnson 2008).
Lakoff und Johnson gehen davon aus, dass Metaphern nicht nur Sprachbilder sind, sondern Träger kognitiver und emotionaler Strukturen. Metaphern werden daher nicht nur als Gegenstand der Rhetorik betrachtet, vielmehr sehen sie Metaphern als zusammenhängende Konzepte, nach denen unser Denken strukturiert und unser unreflektiertes Alltagshandeln gelenkt wird. Ihre Annahme besteht darin, dass das Konzeptsystem, nach dem wir täglich handeln, im Kern metaphorisch ist (vgl. Lakoff/Johnson 2008). Aufgrund physischer und kultureller Erfahrungen des Menschen können Metaphernkonzepte in Gruppen eingeteilt werden. Den Ausgangspunkt ihrer Theorie bilden drei Typen von Metaphern: die konzeptuelle Metapher, die ontologisierende und die orientierende Metapher:
Konzeptuelle Metaphern (Strukturmetaphern)
Konzeptuelle Metaphern zeigen sich als kognitivspachliches, vernetztes System, das Ordnungs- und Organisationsfunktionen hinsichtlich des Verständnisses von Wissen besitzt. Große komplexe Erfahrungsbereiche werden durch diese Metaphern in erfahrungsnahe, einfachere Erfahrungsbereiche und Situationskonstellationen ausgedrückt und konzeptualisiert. An dem klassischen Beispiel „Zeit ist Geld“ erläutern Lakoff und Johnson, dass alltagssprachliche metaphorische Ausdrücke metaphorische Konzepte bilden, nach denen Alltagsaktivitäten kulturabhängig strukturiert werden.
„Diese Konzepte sind deshalb metaphorisch, weil wir unsere Alltagserfahrungen im Umgang mit Geld, begrenzten Ressourcen und kostbaren Gütern dazu heranziehen, die Zeit zu konzeptualisieren. Es besteht für menschliche Wesen keine Notwendigkeit, die Zeit in dieser Weise zu konzeptualisieren; dieser Vorgang ist an unsere Kultur gebunden. Denn es gibt Kulturen, in denen Zeit keinem der erwähnten metaphorischen Konzepte entspricht“ (Lakoff/Johnson 2008, S. 17). Konzepte strukturieren sowohl die Wahrnehmung als auch die Beziehungen zu Menschen.
Ontologisierende Metaphern
Lakoff und Johnson gehen davon aus, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, komplexe Erfahrungstatsachen aufzuteilen und als einfache Objekte und Materien zu verstehen.
„Haben wir unsere Erfahrungen erst einmal als Entitäten oder Materien identifiziert, können wir uns auf sie beziehen, sie kategorisieren, sie zu Gruppen zusammenfassen und sie quantifizieren – und dadurch auch über sie reflektieren“ (Lakoff/Johnson 2008, S. 35).
Die Erfahrung mit physischen Objekten, vor allem mit dem eigenen Körper, bildet die Grundlage für eine Vielfalt an ontologischen Metaphern.
Die wichtigste Metapher ist in diesem Zusammenhang die Gefäßmetapher, die sowohl an den Adverbien bzw. Präpositionen (innen/außen; in/aus) erkennbar ist, aber auch an Verben (z. B. aus sich heraus gehen.) Neben diesen Gefäß- Strukturen zählen die beiden Autoren auch noch Konzepte des „Gegenstandes“ und der „Substanz“ zu den Schemata, die „wir als verdinglichende Projektionsleistungen im Grundbestand unseres kognitiven Vermögens haben“ (Schmitt 1996, S. 50). Diese Metaphern helfen, physische und psychische Erfahrungen zu benennen, zu quantifizieren und/oder sie zu personifizieren und als Ursache oder Gründe zu benennen (vgl. ebd.).
Orientierungsmetaphern
Die meisten dieser Metaphern haben mit Orientierung im Raum zu tun (oben/unten; innen/außen; vorne/hinten; tief/flach usw.).
„Diese Raumorientierungen ergeben sich aus dem Umstand, daß [sic!] der Körper eines Menschen so beschaffen ist, wie er ist, und daß [sic!] dieser Körper so funktioniert, wie er in unserer physischen Umgebung funktioniert. Orientierungsmetaphern geben einem Konzept eine räumliche Beziehung“ (Lakoff/Johnson 2008, S. 22). Emotionen und Kognitionen lassen auf räumliche Strukturierungen schließen, so sind z. B. Gesundheit und Leben oben, Krankheit und Tod unten. Diese metaphorischen Orientierungen basieren auf unserer physischen und kulturellen Erfahrung. Offen bleibt in deren Diskussion noch, wie sich auf metaphorischer Ebene die Interaktion zwischen körperlicher, sprachlicher und kultureller Struktur in der Entwicklung vollzieht.
Schmitt (1995) weist darauf hin, dass die Beispiele, die Lakoff und Johnson anführen, verdeutlichen, dass es allerdings nicht genügt, nur auffällige Metaphern zu interpretieren, sondern auch tote Metaphern[26] miteinbezogen werden sollen, da diese bildgesteuerte Grundlagen unseres Denkens zeigen.
„Für die Forschungspraxis heißt dies, daß unbedingt alle Worte, die nicht in strengerem Sinn wörtlich sind, als Metaphern gedeutet werden müssen“ (Schmitt 1995, S. 509).
Für die vorliegende Arbeit ist ebenso die Beschreibung von Metaphern von Schmitt (vgl. Schmitt 2003, Abs. 14) hilfreich, der sich an das Verständnis von Metaphern an Lakoff und Johnson lehnt und diese, wie unten angeführt, beschreibt. Die Autorin der vorliegenden Forschungsarbeit stellt bereits bei der Beschreibung von Metaphern einen Bezug zu ihrer Arbeit her, indem sie ein Beispiel aus dem verwendeten Textmaterial heranzieht.
Eine Metapher liegt aus der Sicht Schmitts dann vor, wenn
-
ein Wort oder eine Redewendung in einem strengeren Sinn in dem für die Sprechäußerung relevanten Kontext mehr als nur wörtliche Bedeutung hat (z. B.: „ein Kind anschauen“ im Sinn von „ein Kind begutachten“),
-
die wörtliche Bedeutung einem prägnanten Bedeutungsbereich (Quellbereich) entstammt (Beispiel: „anschauen – schauen“ verweist auf einen visuellen Sinneseindruck),
-
der Ausdruck auf einen zweiten, oft abstrakteren Bereich (Zielbereich) übertragen wird (Beispiel: die konkrete semantische Quelle [hier: „schauen“] wird auf ein abstraktes Ziel [hier: begutachten] übertragen).
Das Ziel der Metaphernanalyse ist davon abhängig, wie ForscherInnen die Metapher definieren:
„Das Ziel dieser Analyse ist jeweils davon abhängig, was als Metapher gesehen wird und als was sie gesehen wird. Metapher kann sein ein sprachlicher Ausdruck, ein Begriff, ein Bild, eine Softwareoberfläche, ein Affekt, eine Emotion, ein Schema – oder alles und jedes; und sie kann dabei gesehen werden als Schmuck und Ornament, als uneigentliche Redeweise, als Verfälschung der Wahrheit, als subversiver Störfaktor, als trojanisches Pferd, als hintergründige Manipulation, als Zeichen von Kreativität, als Strategie der Veränderung – oder überhaupt als Prinzip der Konstruktion der Wirklichkeit“ (Niedermair 2001, S. 144).
Grundsätzlich erhält die Metapher immer mehr Bedeutung, wenn es darum geht, Texte und Textpassagen hinsichtlich ihrer Repräsentation von Wirklichkeiten zu analysieren. Eine wichtige Rolle im Prozess der Metaphernanalyse nehmen die ForscherInnen selbst ein: Der/die Forscher/in definiert, was im Text als Metapher gilt und ob metaphorische Ausdrücke relevant oder irrelevant sind. Die nachfolgende Entwicklung von Schlüsselmetaphern und die Interpretation obliegt dem/der Forscher/in.
Im Vergleich zu den vielen verschiedenen Ansätzen von Metapherntheorien beschreiben nur wenige Autoren die Methode der Metaphernanalyse (vgl. Niedermair 2001; Buchholz 1996; Schmitt 1995; 2003). Die Analysestrategie der Autorin basiert auf der Vorgehensweise nach Schmitt (2003) in vier Schritten[27]: 1) Ausschneiden/Sammeln, 2) Kategorisieren, 3) Abstrahieren/Vervollständigen, 4) kontextuelles Einbinden und Interpretieren.
Den Korpus der Analyse bilden die von der Autorin transkribierten Interviews. Die Verfasserin analysierte den Text der Interviews hinsichtlich Metaphern nach folgenden Schritten:
-
Ausschneiden/Sammeln: Die Forscherin entschied sich, vor der Arbeit nicht genau festzulegen, was exakt als Metapher zu gelten hat und was nicht, da sie ihrem Forschungsprozess möglichst viel Raum gewähren wollte. Alle im Text vorkommenden metaphorischen Ausdrücke wurden in einer Liste gesammelt. Die Forscherin entschied dabei, ob sie lebende Metaphern für wichtig hielt und/oder tote Metaphern mit einbezog. Im praktischen Vorgehen wurden metaphorische Äußerungen, in denen der interessierende Zielbereich erschien, aus dem Text geschnitten und mitsamt dem unmittelbaren Text-Kontext mit Hilfe des Textverarbeitungsprogramms word in separate Listen eingefügt. Die Autorin schnitt dabei die Metaphern mit ihrem Umfeld aus, damit diese nicht gänzlich aus dem Kontext gerissen wurden (z. B. „ich hab die Kinder gut im Kopf drin“ anstatt nur „Kopf“).
-
Kategorisieren: Metaphorische Ausdrücke wurden gesichtet und übergeordneten metaphorischen Konzepten[28] zugeordnet, es wurden Kategorien gebildet. Bei der Rekonstruktion wurden metaphorische Wendungen, die der gleichen Bildquelle entsprangen und den gleichen Zielbereich beschrieben, zu metaphorischen Konzepten zusammengefasst. Diese Kategorien entstanden in ständiger Durchsicht am Material. In diesem Schritt ging es darum, die Metaphern semantisch und inhaltlich logisch zu gliedern. Möglichst alle Metaphern sollten in Kategorien erfasst werden. Kategorien konnten dabei untereinander zusammenhängen oder wiederum Ober- oder Unterkategorien bilden. Das Erstellen von metaphorischen Konzepten verlangte von der Forscherin eine kreative und synthetisierende Leistung insofern, als dass sie ständig im Wechselspiel zwischen subjektivem Vermögen (Wissensstand, biographische, kulturelle Vorprägungen, Bereitschaft zur Revision, Ausdauer) und wissenschaftlichem Anspruch stand (vgl. dazu auch Schmitt 2003). Im folgenden Raster wird ein kurzer Ausschnitt dargestellt, wie in der vorliegenden Arbeit Metaphern zu Kategorien zugeordnet wurden.
|
Metaphorische Ausdrücke |
Kategorie |
|---|---|
|
des Kind wär zum AnschauenJa, und dann schaust oanfach amaldas Kind wirklich ganz genau angeschautusw. |
Schauen |
|
da weiß ich dann nicht, was im Busch istwenn i mir nicht sicher bin, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht,ob ein Kind das hatAber bei manchen ist es ganz eindeutigusw. |
Abstrahieren |
|
das Ober-Standardprogrammso ein RasterProgrammea bissl a Einheitusw. |
Systematisieren |
|
das läuft jetzt ehund dann geh ichein gravierender Schrittin eine Routine hineinkommenusw. |
Bewegen |
-
Abstrahieren/Vervollständigen: In diesem Schritt wurde herausgearbeitet, was Metaphern implizieren, es erfolgte ein „Ausbuchstabieren“ (Schmitt, 2003) der Metaphern. Der bildspendende Bereich wurde weitergedacht, auf den Zielbereich übertragen und abstrahiert. Kategorien wurden zu metaphorischen Konzepten verdichtet.
|
Metaphorische Ausdrücke |
Kategorie |
Abstraktion |
|---|---|---|
|
des Kind wär zum AnschauenJa, und dann schaust oanfach amaldas Kind wirklich ganz genau angeschautusw. |
Schauen |
Metaphorik des Sehens: Das abstrakte Konzept „Wissen“ wird in der Begutachtung mit Hilfe des „Sehens“ zu sichtbaren Objekten konzeptualisiert. Das Vokabular des visuellen Bereichs ist an die Vorstellung des Denkens oder Wissens gebunden. |
|
da weiß ich dann nicht, was im Busch istwenn i mir nicht sicher bin, ist es jetzt oder ist es jetzt nicht, ob ein Kind das hatAber bei manchen ist es ganz eindeutigusw. |
Abstrahieren |
Die Metaphorik des Abstrakten: Vage und unstrukturierte Erfahrungsbereiche (z. B. behindert/nicht behindert) werden mit metaphorischen Objekt-und/ oder Substanzcharakteren umschrieben. |
|
das Ober-Standardprogrammso ein RasterProgrammea bissl a Einheitusw. |
Systematisieren |
Die Metaphorik der Skalen: Ein wichtiges Prinzip der Bewegung des Menschen im Raum ist seine Orientierung an horizontalen und vertikalen Achsen. (Testmaterialien werden als Mittel zur Orientierung wahrgenommen.) |
|
das läuft jetzt ehund dann geh ichein gravierender Schrittin eine Routine hineinkommenusw. |
Bewegen |
Die Metaphorik des Weges: Der Begutachtungsprozess kann in verschiedene Richtungen laufen. Das zeigt sich anhand von Metaphern, die neben Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auch Seitwärtsbewegungen ausdrücken und somit unzählige alternative Wege zeigen. |
-
Kontextuell Einbinden und Interpretieren: Parallel zu den Durchgängen der Metaphernanalyse läuft die Theoriebildung: Die herausgearbeitete Metaphorik wurde in diesem Schritt hinterfragt, in die Theoriebildung miteinbezogen und für die Ergebnisinterpretation aufbereitet. In dieser Forschungsarbeit wurde der „Raum“ der GutachterInnen als „metaphorischer Aufhänger“ (Niedermair 2001) herausgearbeitet. Dieser „Prototyp“ (ebd.) ist eine Metapher, die von der Forscherin konstruiert und in neuerlichen Durchläufen am Text überprüft wurde. In der vorliegenden Arbeit leitete die Raummetapher als übergeordnete Metaphorik den Forschungsprozess. In dieser Arbeit galt es den „Raum“ der GutachterInnen zu untersuchen.
Die Metaphernanalyse ist in der Sozial- und Erziehungswissenschaft ein sehr interessantes Phänomen. In den metaphorischen Konzepten bündeln sich spezifische, individuelle oder kulturelle Muster des Denkens, der Wahrnehmung, der Empfindungen oder des Handelns. Bis heute wird in der Debatte um die interdisziplinäre Anwendung in wissenschaftlichen Fachkreisen diskutiert, inwieweit sozialwissenschaftliche Antworten mit dem metaphorischen Angebot haltbar sind, da die Definitionen von Metaphern vielseitig und schwer zu abzugrenzen sind. Als relativ neue Methode ist die Metaphernanalyse einer kritischen Diskussion (Schmitt 2011; Kruse/Biesel/Schmieder 2011; 2012) ausgesetzt: Niedermair spricht davon, dass eine sozialwissenschaftliche Antwort auf das metapherntheoretische Angebot der Linguistik noch ausständig ist. Soziale, individuelle und kulturelle Aspekte und deren Zusammenhang mit der Metapher sind noch nicht ausreichend erforscht (vgl. Niedermair 2001).
Da die Metaphernanalyse für bestimmte Fragestellungen geeignet und nicht für jedes Datenmaterial uneingeschränkt tauglich ist, schlägt Schmitt je nach Forschungsfrage eine Triangulation[29] vor.
Parallel zur Metaphernanalyse wurde der Text anhand der „Grounded Theory“ (Glaser/Strauss 1998; Strauss/Corbin 1996) untersucht. Es handelt sich bei der „Grounded Theory“ weniger „…um eine Methode oder ein Set von Methoden, sondern eine Methodologie und einen Stil analytisch über soziale Phänomene nachzudenken“ (Strauss in Legewie/Schervier-Legewie 2011, S. 74).
Voraussetzung für die Anwendung der „Grounded Theory“ ist es, die Fragestellung zu Beginn der Untersuchung eher allgemein zu halten. Somit lässt sich, je nach Forschungsgegenstand und Erkenntnisinteresse, die Breite und Tiefe, aber auch der Fokus der Arbeit flexibler gestalten. Der/die Forscher/in entwickelt im Sinne der „Grounded Theory“ während des Forschungsprozesses die Theorie; dabei wird der Untersuchungsbereich an den Beginn der Forschungsarbeit gestellt, nicht jedoch eine Hypothese oder Theorie, die es zu überprüfen gilt. Ein zentrales Merkmal der „Grounded Theory“ ist es, in einem zeitlichen, thematischen und forschungspraktischen Prozess die Datenerhebung, Datenanalyse, Theoriebildung und Theorieprüfung zu durchlaufen.
Als Ziele der „Grounded Theory“ werden in der Literatur folgende genannt:
„ 1. eher eine Theorie zu entwickeln, als sie nur zu überprüfen
2. dem Forschungsprozeß die notwendige methodische Strenge zu verleihen ...
3. dem Analysierenden zu helfen, seine mitgebrachten und während des Forschungsprozesses entwickelten Verzerrungen und Vorannahmen zu durchbrechen
4. für Gegenstandsverankerung (grounding) zu sorgen; Dichte, Sensibilität und Integration zu entwickeln, die benötigt werden, um eine dichte, eng geflochtene, erklärungsreiche Theorie zu generieren, die sich der Realität, die sie repräsentiert, so weit wie möglich annähert“ (Strauss/Corbin 1996, S. 39).
Kernstück des Forschungsprozesses nach der „Grounded Theory“ ist das Kodieren des Datenmaterials. Strauss und Corbin (Strauss 1998; Strauss/Corbin 1996) unterscheiden drei Phasen des Kodierprozesses, die im folgenden Abschnitt kurz erläutert werden.
Offenes Kodieren
Der Prozess des offenen Kodierens beinhaltet eine genaue Analyse z. B. eines Interviews, d. h. für das gesamte Dokument, jeden Abschnitt, Zeile für Zeile, Phrase für Phrase oder Wort für Wort wird ein Kode gewählt, der das jeweilige Phänomen repräsentiert. Die Daten werden in diesem Schritt aufgebrochen, hinsichtlich Ähnlichkeiten und/oder Unterschieden untersucht und verglichen. In dieser Phase werden auch eigene Vorannahmen über Phänomene in Frage gestellt und erforscht, was zu neuen Erkenntnissen führt. Beim offenen Kodieren werden entstandene Konzepte[30] gruppiert und in Beziehungen zueinander gesetzt – daraus entstehen Kategorien.[31] Die entstandenen Kategorien können dann je nach Dimensionen und Eigenschaften weiter untersucht werden. Anhand von Memos und Kode-Notizen werden die Ideen des Forschers/der Forscherin festgehalten und Fragen und Vergleiche mit anderen Phänomenen werden notiert.
Axiales Kodieren
Beim axialen Kodieren werden die Daten, die beim offenen Kodieren aufgebrochen wurden, auf neue Art wieder zusammengefügt, indem Kategorien mit Subkategorien durch einen Satz von Beziehungen verbunden werden. Strauss und Corbin stellen ein Modell vor, das den ForscherInnen ermöglicht, systematisch über Daten nachzudenken und sie in sehr komplexer Form in Beziehung zu setzen: (A) ursächliche Bedingungen – (B) Phänomen – (C) Kontext – (D) Intervenierende Bedingungen – (E) Handlungs- und interaktionale Strategien – (F) Konsequenzen (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 78).
In dieser Phase findet eine ständiges Wechselspiel zwischen Aufstellen und Überprüfen von Kategorien statt – eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung lässt die Theorie gegenstandsverankert werden. Ziel ist es, Beziehungen herzustellen und den Blick auf das zu richten, was vorher noch nicht gesehen werden konnte.
Selektives Kodieren
Beim selektiven Kodieren wird die Kernkategorie[32] ausgewählt, diese Kernkategorie wird systematisch in Beziehung gesetzt mit anderen Kategorien; ein weiterer Schritt ist die Validierung dieser Beziehungen und das Auffüllen von Kategorien, die weiter entwickelt und verfeinert werden. In einigen Schritten wird ein Bild der Wirklichkeit entwickelt, dass konzeptuell, nachvollziehbar und gegenstandsverankert ist.
„Der erste Schritt besteht im Offenlegen des roten Fadens der Geschichte. Der zweite besteht aus dem Verbinden der ergänzenden Kategorien rund um die Kernkategorie mit Hilfe des Paradigmas. Der dritte umfasst das Verbinden der Kategorien auf der dimensionalen Ebene. Der vierte beinhaltet das Validieren dieser Beziehungen durch die Daten. Der fünfte und letzte Schritt besteht im Auffüllen der Kategorien, die einer weiteren Verfeinerung und/oder Entwicklung bedürfen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu begreifen, dass diese Schritte in der Praxis weder unbedingt in einer linearen Abfolge noch voneinander getrennt ausgeführt werden“ (Strauss/Corbin 1996, S. 95).
Letztendlich ist es das Ziel der Textinterpretation, eine Theorie entwickeln zu können.
In dieser Arbeit wurden alle Interviews passagenweise zusätzlich zur Metaphernanalyse durch „offenes Kodieren“ ausgewertet. Es entstand eine Vielzahl von Kodes, die es in Beziehung zu setzen galt. Durch die Metaphernanalyse wurden bereits Kategorien herausgearbeitet, die „Grounded Theory“ erlaubte es, die Texte neuerlich hinsichtlich Kategorien zu überarbeiten und/oder noch Ungesehenes in den Blick zu bekommen und in Beziehung zu setzen.
Eine zentrale Kategorie in dieser Forschungsarbeit ist die Kategorie des „Raums“ der GutachterInnen, die sich aus den Kodes (z. B. Begutachten des Kindes; Kapital der GutachterInnen; Raum der Eltern; Raum des Kindes) entwickelt hat.
Die Ergebnisse der Metaphernanalyse und die Bedeutung der Kodes, die anhand der „Grounded Theory“ erarbeitet wurden, wurden anschließend auf ihren Sinngehalt hin befragt und auf eine abstrakte Ebene gehoben, d. h. losgelöst von der subjektiven Ebene – in diesem Fall den GutachterInnen.
Der „Raum“ der GutachterInnen entwickelte sich als zentrales Thema dieser Forschungsarbeit, die wissenschaftstheoretisch durch Bourdieus Untersuchungen des „sozialen Raums“ geleitet ist.
Bevor die Forschungsergebnisse dargestellt werden, soll zunächst die Beschreibung der Untersuchung erfolgen.
Die derzeitige Diskussion in der Sonderpädagogik kreist sehr oft um das Thema „Inklusion“ und die damit verbundenen kritischen Auseinandersetzungen mit der Erstellung von sonderpädagogischen Diagnosen und Gutachten. Da die Verfasserin als Sonderpädagogin für einige Jahre auch als Gutachterin arbeitete, entwickelte sich in ihr die Motivation, Forschungen an der Gutachtertätigkeit von SonderpädagogInnen durchzuführen.
Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit liegt darin, die Praxis der GutachterInnen in einer bestimmten Region Österreichs darzulegen. Die Einschränkung auf eine bestimmte Region wurde bewusst gewählt, da die qualitative Untersuchung in ganz Österreich den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Da es der Autorin aufgrund der Transparenz ein Anliegen war, die Schulbehörde über ihre Forschungsarbeit zu informieren, wählte sie aus organisatorischen Gründen (Fahrwege zu den Bezirksschulräten, Fahrwege zu den GutachterInnen) die Region, in der sie selber als Sonderpädagogin arbeitet.
Bevor mit den Interviews begonnen wurde, informierte die Forscherin bei einem persönlichen Gesprächstermin den Landesschulinspektor für Sonderpädagogik über Inhalt und Ziel der Dissertation. Mit seiner Erlaubnis und Unterstützung vereinbarte sie anschließend mit jedem Bezirksschulinspektor der einzelnen Bezirke einen persönlichen Gesprächstermin, um die zukünftige Forschungsarbeit vorzustellen. Anschließend nahm sie Kontakt mit den GutachterInnen auf und bat diese um ein Interview. Die neun InterviewpartnerInnen waren bei der Kontaktaufnahme (mit der Erlaubnis des Landesschulinspektors für Sonderpädagogik) bereits von den jeweiligen Bezirksschulinspektoren über die Bitte um das Interview informiert worden. Die InterviewpartnerInnen stammen aus den einzelnen Bezirken und arbeiten als SchulleiterInnen, SonderschullehrerInnen sowie BeratungslehrerInnen und sind gleichzeitig für die Erstellung der Gutachten zuständig.
Die Basis der Befragungen bildeten neun problemzentrierte Interviews, die anhand eines Leitfadens geführt wurden. Der Leitfaden gestaltete sich dabei als flexibler Orientierungsrahmen, der Raum für Erzählungen und/oder Ad-hoc-Fragen offen ließ. Die GutachterInnen waren in einem Alter zwischen 35 und 59 Jahren. Die Interviews sind im Jahre 2008 geführt worden, dauerten zwischen 40 Minuten und 1,5 Stunden und umfassen ein Datenmaterial von über 200 Seiten.
Die Interviews wurden in den einzelnen Schulen außerhalb der Schulzeit in ruhigen Räumen (Konferenzzimmer, Besprechungszimmer, Therapieraum) aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Aus den theoretischen Überlegungen ergaben sich eine übergeordnete und weitere vier untergeordnete Forschungsfragen:
-
Inwieweit stellt die Gutachtertätigkeit eine Belastung für die SonderpädagogInnen dar?
-
Wie gestalten die SonderpädagogInnen den Ablauf des Begutachtungsprozesses?
-
Werden objektivierte Verfahren während der Diagnose bevorzugt und, wenn ja, inwieweit?
-
Wie nehmen die SonderpädagogInnen ihre Arbeit als GutachterInnen und die damit verbundene Verantwortung wahr?
-
Welche Aspekte werden in der Gutachtertätigkeit von den SonderpädagogInnen als positiv bzw. welche werden als negativ empfunden?
Geleitet einerseits durch die Metaphernanalyse, andererseits durch den Ansatz der Grounded Theory (Glaser; Strauss), trat im laufenden Forschungsprojekt eine zusätzliche Forschungsfrage in den Mittelpunkt:
-
Welche Widersprüche und Ambivalenzen erleben GutachterInnen im Begutachtungsprozess?
Um die Reihe der komplexen Fragestellungen beantworten zu können, wählte die Autorin neben der Metaphernanalyse (Schmitt 1997; 2003; 2004; 2005) die Grounded Theory (Glaser/Strauss 1998). Im Mittelpunkt der Auswertungen stehen die SonderpädagogInnen, deren Raum, in dem sie sich als GutachterInnen während der Gutachtertätigkeit bewegen, sowie der Begutachtungsprozess selbst. Da sich anhand vieler Metaphern (Raummetaphern) in den Interviewtexten der Begriff des Raums entwickelte, entschied sich die Autorin diesen Begriff in ihrer Arbeit weiter zu verwenden.
Den Raum, in dem sich die SonderpädagogInnen bewegen und in dem sie arbeiten, gilt es in dieser Arbeit anzusehen. Schon während des Forschungsprozesses zeigt sich, dass das Begutachten von SchülerInnen kein linearer, objektiver Vorgang ist, sondern Aspekte einfließen, die bisher in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung unberücksichtigt blieben und sich auf die Gutachtertätigkeit auswirken.
[23] 1 Schmitt (1997; 2003; 2004; 2005; 2011) leitet die systematische Metaphernanalyse von den Studien Lakoffs und Johnsons ab und entwickelt sie unter Anregungen von Gadamer und Habermas als eigenständiges Verfahren einer sinnverstehenden Forschung weiter. Aus methodologischer Sicht ist die Entwicklung seines Ansatzes, die sprachwissenschaftlichen und qualitativsozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbinden, differenziert und sehr zielbestimmt.
[24] 1 Die Begriffe „konzeptuelle“ oder „kognitive“ Metapherntheorie werden gleichwertig verwendet. Bekannt wurde die Theorie durch die Veröffentlichung der kognitiven Linguisten Lakoff und Johnson (1980). Die Grundannahme ihrer Theorie ist, dass die Metapher einen „Quell-“ und einen „Zielbereich“ aufweist.
[25] 2 Haverkamp (1996) setzt sich in seinem Buch „Theorie der Metapher“ mit verschiedenen Ansätzen der Metaphernforschung auseinander, auf die jedoch im Rahmen dieser Dissertation nicht näher eingegangen wird.
[26] Tote Metaphern sind Metaphern, deren metaphorischer Charakter nicht mehr bewusst ist.
[27] Die Ausführungen stützen sich auch auf Kruse/Biesel/ Schmieder (2011).
[28] Nach dem Ansatz von Lakoff und Johnson sind metaphorische Redewendungen nicht zufällig, sondern auf gemeinsame Konzepte zurückzuführen. Diese teilen den gleichen Quellbereich und den gleichen Zielbereich. Allgemeingültige metaphorische Konzepte werden von sozialen Gruppen und auch von den einzelnen Subjekten z. T. sehr eigenständig ausgeführt. Genau an dieser Stelle können qualitative Forschungen ansetzen, spezifische metaphorische Muster zu rekonstruieren (vgl. Schmitt 2003).
[29] Triangulation dient dazu, einen Forschungsgegenstand von mehreren Seiten aus zu betrachten und durch die Verwendung verschiedenere methodischer Zugänge zu untersuchen. Bei der Beantwortung der Forschungsfragen können sich die Perspektiven in unterschiedlichen Methoden und/oder unterschiedlichen theoretischen Zugängen konkretisieren (vgl. Flick 2008).
[30] 1 Konzepte sind konzeptuelle „Bezeichnungen oder Etiketten, die einzelnen Ereignissen, Vorkommnissen oder anderen Beispielen für Phänomene zugeordnet werden“ (Strauss/Corbin 1996, S. 43).
[31] 2 Eine Kategorie ist eine „Klassifikation von Konzepten. Diese Klassifikation wird erstellt, wenn Konzepte miteinander verglichen werden und sich offenbar auf ein ähnliches Phänomen beziehen. So werden die Konzepte unter einem Konzept höherer Ordnung zusammengruppiert – ein abstrakteres Konzept, genannt Kategorie“ (Strauss/Corbin 1996, S. 43).
[32] Als Kernkategorie wird das zentrale Phänomen bezeichnet, um das herum alle anderen Kategorien integriert sind.
Inhaltsverzeichnis
-
5.1 Die Metaphorik der Begutachtung
- 5.1.1 Metaphorik des Sehens – Begutachten ist Schauen
- 5.1.2 Metaphorik des Abstrakten - Begutachten ist Abstrahieren
- 5.1.3 Metaphorik der Skalen – Begutachten ist Systematisieren
- 5.1.4 Metaphorik der Arbeit – Begutachten ist Basteln
- 5.1.5 Metaphorik des Weges – Begutachten ist Bewegen
- 5.1.6 Metaphorik des Raums – Begutachten ist Räume erfahren
- 5.2 SonderpädagogInnen als GutachterInnen
„… wenn da jemand kommt
zum Anschauen …“ (A1, 64)
Stark belegt ist die Metapher des Sehens [33], d. h. das zu begutachtende Kind wird durch die sinnliche Wahrnehmung der SonderpädagogInnen wahrgenommen, es wird angesehen und angeschaut (Schauen [34]).
Das Sehen ist eine der grundlegendsten Erfahrungen des Menschen in unserem Kulturkreis. Die Metapher des Sehens zählt in Bezug auf den Herkunftsbereich der metaphorischen Übertragung zu den elementarsten Konstellationen[35] und weist in der metaphorischen Übertragung einen geringeren Grad an Komplexität auf. Das Sehen lässt sich auf eine unmittelbare physische Erfahrung zurückführen. Lakoff (1987) beschreibt die Konstellationsmetapher des Sehens als eine Anordnung von Betrachter, Objekt und zentralem Wissen.
Sehen als ein Teil der Wahrnehmung wird als eine Verbindung zwischen Person (dem zu begutachtenden Kind) und der Welt sowie einem zentralem Wissen aufgefasst.
Das abstrakte Konzept „Wissen“ wird in der Begutachtung mit Hilfe des „Sehens“ zu sichtbaren Objekten konzeptualisiert. Das Vokabular des visuellen Bereichs ist an unsere Vorstellung des Denkens oder Wissens gebunden.
In den von mir untersuchten Texten ist das Metaphernkonzept „Sehen ist Wissen“ stark belegt und findet sich in einer Vielzahl der Wörter „schauen“ und „anschauen“ wieder. Die Wörter „sehen“ oder „ansehen“ werden in den Interviews kaum verwendet; „sehen“ im Sinn von „ich seh mir das Kind mal an“ ist in der sprachlichen Region (Bundesland), in der die Untersuchung durchgeführt wurde, ein wenig geläufiger Sprachausdruck. Dennoch möchte ich auf eine sprachliche Unterscheidung zwischen Sehen und Schauen hinweisen: Wie schon als Definition im Etymologischen Wörterbuch festgehalten, bezieht sich Sehen in erster Linie auf die sinnliche Wahrnehmung der Augen, auf ein zufälliges Wahrnehmen. Schauen hingegen drückt eine innere geistige Tätigkeit aus, Schauen ist absichtlich und ein „Wahrnehmenwollen“, beim Schauen wird ein längeres Verweilen am Objekt ausgedrückt als beim Sehen. Der sprachliche Kreis schließt sich während der Begutachtung, wenn „Sehen“ mitunter als Erfolg des Schauens gilt, d. h. hier wird Wissen durch die Metaphorik konzeptualisiert und als Ergebnis wird „etwas“ gesehen. Das semantische Feld des Begriffes „etwas“ umfasst ein ganzes Spektrum sinn- und sachverwandter Termini, die zwar auf eine Behinderung hinweisen, jedoch in den Interviews unscharf abgebildet werden.[36]
Das Anschauen des Kindes durch die SonderpädagogInnen ist als eine erste Informationsquelle zu sehen, aus der Wissen bezogen wird, wie Baldauf 1997 formuliert: „Visuelle Wahrnehmung als primäre Quelle unserer Informationen über unsere Umwelt ist informativer und verlässlicher als jede andere Sinneswahrnehmung und nimmt im westlichen Kulturkreis in der Aneignung von Wissen eine dominante Stellung ein“ (vgl. Dundes 1972, zit. nach Baldauf 1997, S. 181).
Im „Anschauen“ ist der Blick auf das Kind zu finden, es wahrnehmen und in seiner Gesamtheit sehen. Zunächst wird von einer sinnlich erfassbaren Grundlage ausgegangen, beim ersten „Anschauen“ verschaffen sich die SonderpädagogInnen einen ersten „Überblick“ über das Kind, ohne dabei gezielt auf Teilbereiche (z. B. 1 vgl. dazu auch Kapitel 5.1.2 Rechenschwäche, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Teilleistungsstörungen usw.) zu achten oder die Teilbereiche durch Beobachtung zu überprüfen.
Das Anschauen des Kindes wird von den InterviewpartnerInnen als Grundlage der diagnostischen Tätigkeit verwendet („Ja, und dann schaust oanfach amal …“ [B3, 470]). Die SonderpädagogInnen stehen dabei selbst im sozialen Feld („… da tritt i dann in Erscheinung“ [B3, 40]), das sie beobachten und anschauen sollen.
… dass man halt da ein bisschen schaut … (A2, 335)
… ob i bitte kim und dass wir miteinander das anschauen … (A2, 445)
Du, schau dir den bitte an … (A3, 68)
Schau dir den an … (A3, 57)
… ah, da schau ich eben … (A4, 131)
… ma will natürlich eh oanfach nur schauen … (A6, 506)
… wenn i mi jetzt zu ihm selber hinsetz und mir des anschau … (B1, 153)
… des Kind wär zum Anschauen … (B1, 12)
Ja, und dann schaust oanfach amal … (B3, 470)
Du, schauen wir uns das mit den Eltern,
schauen wir uns das mal miteinander an (A5, 265)
… oder i kann a wieder mal, wenn sie anrufen, hin kemma und schauen … (B1, 413–414)
Mit „Anschauen“ verbinden die meisten InterviewpartnerInnen ein „Sich-ein-Bild-von-dem-Kind-Machen“, das zu begutachten ist. Dabei wird das Kind angeschaut und beobachtet und eine erste Einschätzung gemacht. Den Diagnoseprozess leiten alle InterviewpartnerInnen mit einem „Grobüberblick“ ein.
… i denk mir, ma schaut da schon immer ’s ganze Kind irgendwie an … (B1, 143)
… wenn ma a Kind oanfach jetzt anschaut … (B1, 392)
… und schau ma so des Gesamtbild an … (B3, 50)
Also des Kind amal in seiner Gesamtheit anschauen …(A6, 328)
das Kind wirklich ganz genau angeschaut … (A2, 246)
… hab i mir den wirklich intensiv angeschaut,
ganz intensiv angeschaut … (A2, 471–474)
… i schau mir etz a immer wieder Kindergartenkinder an … (A2, 442)
… dass ma nur einen Grobblick haben …(A6, 68)
Nach der Grobeinschätzung wird bei den meisten InterviewpartnerInnen der Blick auf Teilbereiche des Kindes gerichtet:
…, dass man einfach sagt, da schaut man auf das und das … (A2, 81,82)
… und, ja, seine Schulsachen anschauen kann … (A1, 57)
… dann schau i mir einfach zuerst seine Sprache aus, an, wenn, Deutsch würd i etz hernehmen, gei, schau i mal, wie spricht der, wie versteht der Deutsch … (A1, 192–194)
… das Kind wirklich von zwei Seiten sehen … (A6, 224)
… die Kinder von einer anderen Seite sehen … (A6, 42)
… und dann schau ich mir die verschiedenen Bereiche an … (B2 42)
… trotzdem denk i mir, muss man ganz genau hinschauen … (B2, 82)
… auf was muss man schauen? (B2, 59)
… je mehr ma da eini schaut, desto mehr kommt ma drauf, dass man da und da und da auch noch ... eigentlich irgendwo no an Bedarf hätte, mehr zu erfahren … (B1, 545–548)
Des heißt, aäh, aber nicht, also nicht jetzt schlecht denkend, sondern oanfach unbewusst, ma will natürlich eh oanfach schauen. (A6, 505–506)
Am Anfang sammeln, schauen … (A5, 129)
Manche Kinder werden nur ein bis zweimal während des Diagnoseprozesses „angeschaut“, wobei die Dauer des „Anschauens“ variiert. Im Durchschnitt dauert es laut InterviewpartnerInnen ein bis zwei Stunden, um sich anschließend ein „Bild“ von den zu begutachteten Kindern machen zu können. Die SonderpädagogInnen sprechen dabei von Kindern „… mit Behinderungen, also geistigen, schweren Behinderungen …“ (A6, 156). Es handelt sich in den Gesprächen um Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, bei diesen Kindern scheint eine „Behinderung“ eindeutig sichtbar zu sein. Einige zu begutachtende Kinder sind offenbar nicht so schnell einzuordnen, diese werden öfter hintereinander angeschaut, um sie zuordnen zu können und ihnen damit einen Sonderpädagogischen Förderbedarf auszusprechen. Laut InterviewpartnerInnen handelt es sich dabei um Kinder, die „Grenzgänger“ sind, das sind Kinder, bei denen „… es einfach nicht eindeutig ist …“ (A2, 177). Es werden Kinder auch öfter angeschaut, wenn sich die SonderpädagogInnen unsicher sind „… is es etz oder is es etz nicht …“ (A2, 185). Unter „öfter“ verstehen die InterviewpartnerInnen zwischen drei- und „xmal“.
… da schau i oft zwei-, dreimal … (A2, 454)
da bin i wirklich vier Tag lang hintereinand aussi gefahren, weil da wollt i, i weiß nit, (lacht), also den hab i mir wirklich intensiv angeschaut, ganz intensiv angeschaut … (A2, 471–474)
… und mir uns das miteinander anschauen … (A2, 184)
Also i moan, wenn i ma wirklich nit sicher sicher bin, dann is wirklich oft, dass i ma den a x-, x-mal anschau … (B1, 289)
… des (Kind) hab i siebenmal angschaut … (B1, 273)
… schauen, zwei, drei, im Durchschnitt vier Kontakte … (A5, 128–129)
… und dann geh i möglicherweise no amol hin … (B1, 56)
Bei diesem „Anschauen“ verwenden die interviewten SonderpädagogInnen noch keine normierten Beobachtungsbögen oder standardisierten Raster oder gehen nach einer systemisch gesteuerten Beobachtung vor. Beim „Anschauen“ wird noch nicht mit Materialien (Tests) hantiert, die SonderpädagogInnen notieren sich ihre Beobachtungen, sammeln Daten, Mitschriften und schreiben zu Hause die ersten Eindrücke auf. Durch das Anschauen machen sich die SonderpädagogInnen ein Bild[37] des Kindes. Abstrakte Sachverhalte werden nun zu sichtbareren Objekten, zu Bildern konzeptualisiert.
… weil da kriegen wir ein komplexes Bild nachand, von dem Kind … (A2, 157)
… wenn du das Kind so siehst, man kriegt schon a Gspür dafür, dass man merkt, des hat einfach eine Problematik da (A1, 418–420)
… i schau zuerst, wo steht das Kind wirklich … (B2, 96)
Im häufigen Vorkommen dieses Metaphernkonzepts (Wissen ist Sehen) zeigt sich, dass sich Sehen als ein sehr dominanter Wahrnehmungsmodus in unserem Alltag zeigt und kognitive Prozesse erheblich prägt. Mit Hilfe der Metapher des Sehens ist es möglich, verschiedene Denkprozesse und Wissensstrukturen zu bilden und sichtbar zu machen.
„… ist es jetzt oder
ist es jetzt nicht …“ (A2, 185)
Ein Kind anschauen im Sinn von Begutachten lässt Unsichtbares, Unklares sichtbarer werden, nach dem Schauen wird gesehen. Wissen ist im metaphorischen Sinn das „Sehen“ eines abstrakten[38] Sachverhalts (vgl. Baldauf 1997, S. 185). Um vage, abstrakte, tabuisierte Erfahrungsbereiche zu konzeptualisieren und sie dadurch rational und sprachlich aufzubereiten, bietet sich die ontologische[39] Metapher an. Eine erste Struktur erhalten, vage und unstrukturierte Erfahrungsbereiche mit metaphorischen Objekt- und/oder Substanzcharakteren. Allgemeines Wissen beinhaltet immer Wissen über Beschaffenheit von Gegenständen oder Substanzen. Bezogen auf das objektbezogene Wissen umfasst das Spektrum „… Faktoren wie Dreidimensionalität, Gewicht, Masse, Dauerhaftigkeit, klare Abgrenzbarkeit, eindeutige Identifizierbarkeit als Objekt, Lokalisierbarkeit, Berührbarkeit oder das Vorhandensein von Oberflächen“ (ebd., S. 119). Aufgrund von elementaren und unmittelbar greifbaren Erfahrungen entsteht das Wissen über Objekte, indem diese berührt, gespürt und betastet und von verschiedenen Seiten betrachtet werden können. Die Substanzmetaphorik „…beinhaltet Wissen wie die Notwendigkeit eines Behälters zur Aufbewahrung, Berührbarkeit, Sichtbarkeit sowie das Fehlen einer festen Oberfläche“ (ebd., S. 119). Nach Baldauf stellt das in Objekt- und Substanzmetaphern gespeicherte Wissen an sich schon eine gewisse Abstraktion dar. Objekte und Substanz können aber in ihrer Nutzung nicht bestimmten Objekten oder Substanzen zugeordnet werden. „Ein dem Menschen unbekanntes ‚Etwas‘ ist so auf dieser Ebene in einem ersten Schritt als Objekt oder Substanz kategorisierbar, identifizierbar und damit in einem ersten Schritt begreifbar. Abstrakte, die als Objekte oder Substanzen konzeptualisiert werden, werden ebenso in einer elementaren Weise verfügbar, ‚handhabbar‘ und begreifbar“ (Baldauf 1997, S. 119). Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die auf Objekte und/oder Substanzen projizierte Information, die sich aber einer genau festgelegten Zuordnung entzieht.
In den von mir untersuchten Interviewtexten findet sich eine große Anzahl der beschriebenen Metaphern in Bezug auf Behinderung. Die Wörter „Behinderung“ oder „behindert“ werden nur selten verwendet, weder von der Interviewerin noch von den InterviewpartnerInnen. Betrachtet man das metaphorische Feld der Begriffe „Behinderung“ bzw. „behindert“, so ergeben sich in den Texten eine Reihe von Termini, die durch Projektion metaphorisch strukturiert werden.
… da weiß i dann nit, was im Busch ist, da stimmt dann was nit, gei … (A1, 204)
… i fäll etz die Entscheidung über das Kind … (A2, 244)
… er war ein irrsinnig schwieriger Kerl … (A3, 675–676)
… hin und wieder kommt seine Art halt durch … (A3, 678)
… wenn sich a Entwicklung abzeichnet … (A6, 34)
…, dass der Schritt gesetzt wird … (B2, 228)
Wenn des Kind a so a Zweifelsfall is … (B3, 226)
… grundsätzlich, ah, versuch i mein Urteil zu fällen … (A4, 337)
… die Entscheidung treffen … (A4, 350)
… die Feststellung des SPF … (A4, 507)
… i sag da so meine Gefühle, meine Daten und bring meine Sachen her und gemeinsam wird das dann beschlossen … (A1, 393–394)
… und du merkst relativ bald schon, wenn du das Kind so siehst, man kriegt schon a Gspür dafür, dass man merkt, des hat einfach a Problematik da …,
bestimmte Sachen weisen dann einfach schon darauf hin …(A1, 418–421)
… wir haben keine andere Handhabe mehr gesehen als einen SPF … (A2, 242)
… meiner Meinung nach geht der an die Grenze, was ist da genau? ... (A5, 223)
… und dann stellen wir den SPF definitiv fest … (A5, 272)
Die Beispiele sollen zeigen, wie vielfältig und unterschiedlich abstrakte Konzepte sind, die durch Projektionen metaphorisch ausgedrückt werden können. Für den Menschen sind reale Dinge solche, die sichtbar und greifbar sind. Auf metaphorischem Weg wird das „Sehen“ einer Behinderung und/oder des Sonderpädagogischen Förderbedarfs sichtbarer und greifbarer, wenn Projektionen („… es ist etwas im Busch …“ [A1, 204]), („… geht an die Grenze …“ [A5, 223]) stattfinden.
In den Texten werden auch häufig Metaphern für „Behinderung“ herangezogen, die den Begriff auf sehr abstrakter Ebene lassen aber dennoch das Abstrakte durch eine Objektform ausdrücken.
… de Unsicherheit gibt es wohl mehr als genug (lacht), ganz oft, dass es einfach nicht eindeutig ist … (A2, 177)
… wenn i mir nit sicher bin, is es etz oder is es etz nicht, is es nur der eine Teil oder ist es der zweite Teil da … (A2, 185–186)
…, wenn sich die Eltern dagegen wehren, dann tun wir es nicht, weil das zieht so einen Schwanz hinten nach … (A2, 326–327)
„Du, i hab da so zwei, drei (…) i weiß es nit, a wenn i bis Juni wart, i weiß es nit, reservier einmal ein paar Stunden dafür und so kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. (A3, 305–307)
… und stellt halt dann fest, der hat das und das und das und das und das … und so Geschichten …(A3, 530–538)
… wir wollen des eh nit, aber er schafft des einfach wirklich nit … (A6, 181)
… ob a Kind des hat … (A6, 383)
Des ist auch und des wird ach ausgelassen, was des dann bedeutet. (A6, 503)
… und dann halt je nachdem, wie eindeutig oder was es ist …( B1, 58)
… is es jetzt …? (B1, 233)
Aber bei manche is es ganz eindeutig, bei manche da überlegt ma lang … (B1, 271)
Und i oanfach nit überzeugt war (lacht), dass des jetzt wirklich so notwendig ist (B1, 271–279)
… es soll ihnen schon verständlich sein, warum i des jetzt getan hab oder warum des jetzt meinem Gefühl nach so ist … (B1, 295–296)
… i glaub, da hat ma nit viel Möglichkeiten jetzt zu sagen, is oder is nit. (B1, 313)
… oder halt einfach speziell die Fälle, wo es jetzt nit ganz eindeutig ist … (B1, 337)
… aha da und da und da (B1, 533)
Wo ma jetzt sagt, mah (...) is des jetzt wirklich so? (B2,84)
… weil i so unsicher war, war des jetzt wirklich so? (A6, 305)
Mit einem andren Umfeld wär es jetzt wahrscheinlich nit notwendig …(B2, 123)
… wenns gar nicht anders geht, muss es eh sein, aber es is sicher der Start nit der ideale, wenn die Schul des stellt und die Eltern dagegen sind. (B2, 200–202)
… und dann muss i des wahrscheinlich irgendwo schwarz auf weiß nachweisen können … (B2, 276)
I hab da a Kind, da woass i nit ganz genau, irgendeppas stimmt net. (B3, 39-40)
… hab die Erfahrung gemacht, dass es im Jahr darauf trotzdem gewesen ist … (B3, 236)
… weil es für die Eltern schwierig is und scho für a für den weiteren Lebensweg a Weiche stellt (B3, 253–254)
Dass i nit immer in der Lage bin Eltern des so zu transportieren, dass es für sie annehmbar is. (B3, 334–335)
Der Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs und/oder einer Behinderung wird in den oben genannten Passagen mit abstrakten, unklaren Wörtern umschrieben. Sehr oft werden die Begriffe mit „es“, „das“ oder „etwas“[40] umschrieben, was einen sehr unklaren Gehalt der Begriffe beinhaltet. Die Begriffe „es“, „das“ oder „etwas“ sind in erster Hinsicht als Objekt kategorisierbar und greifbarer durch eine Benennung. Um ihrer Beobachtung einen verbalen Ausdruck zu verleihen und wahrgenommene Phänomene in Worte zu fassen, verwenden die InterviewpartnerInnen die metaphorisch gebrauchten Ausdrücke, die ihnen im Diagnostikprozess einen großen Spielraum offenlassen. Die BeobachterInnen, in diesem Fall die SonderpädagogInnen, sehen, dass die zu begutachtenden Kinder in dem Rahmen, in dem sie unterrichtet werden, den Anforderungen der LehrerInnen und des Lehrplans nicht gerecht werden können. Angesichts der Tragweite einer geforderten Entscheidung scheint es für die befragten SonderpädagogInnen leichter mit abstrakten Begriffen zu operieren, als die Begriffe „Behinderung“ und „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ zu verwenden und sich damit vorerst festlegen zu müssen.
„… da reduzier i ihn sozusagen
auf so Fakten …“ ( A1, 309)
Ein wichtiges Prinzip der Bewegung des Menschen im Raum ist seine Orientierung an horizontalen und vertikalen Achsen. Ein primäres Orientierungssystem ist dabei die Ausrichtung des Menschen auf der Erde durch die Erdanziehungskraft, seine eigene vertikale Ausrichtung sowie die Opposition (oben und unten). Diese klare Einteilung, die Erfahrung des Menschen und die Unverzichtbarkeit dieser Orientierungsachsen lassen dieses Ordnungsprinzip auch auf eine abstrakte Ebene projizieren. Baldauf (1997) bezieht sich dabei auf Laponce (1981), der den eigenen Körper (Kopf ist oben, Augen sind vorne usw.) als Grundlage der Raumorientierung definiert. Die Erfahrungsgrundlagen der geprägten Skalen-Schemata sind komplex, aus den Grundlagenforschungen geht hervor, dass „… ein Mehr an etwas mit Höhe und Aufwärtsbewegung verbunden ist, ein Weniger an etwas hingegen mit Niedrigkeit und Abwärtsbewegung. Hinzu kommt das Wissen, dass der Besitz größerer Mengen in der Regel positiv bewertet wird, der Besitz niedriger Mengen dagegen negativ“ (Baldauf 1997, S. 152).
Zeigt auf einer Skala[41] die Orientierung nach unten, so erfolgt eine Konzeptionalisierung der quantitativen Vorstellung im abstrakten Bereich mit „wenig“, „Verringerung“ und „schwach“. „Wenig“ bedeutet „unten“ und „klein“. Im Gegensatz dazu steht eine Aufwärtsbewegung auf einer Skala im abstrakten Sinn für Zunahme, Wachstum, Intensität. „Viel“ bedeutet „oben“, „stark“ und „groß“.
… und wenn die sich dann durch Tests, wenn dann noch Leistungskomponenten hinzukommen, zur geringen Aufmerksamkeit, zur geringen Konzentration … (A1, 422)
… ob a Kind abgestuft werden kann …(A1, 120)
… ein schwaches ASO-Kind … (A1, 37)
… der ist in Rechnen wirklich wahnsinnig schwach … (A1, 267)
… in Deutsch im Prozentrang 1 unten (A1, 267)
… etz müss mas abstufen (A6, 138)
… wenn i da bin bei de Prozentpunkte, die wo ich grad nimmer zählen kann, weil es unter null ist, nochand kommst schon eher hin zum Schwerstbehindertenbereich … (A3, 264–265)
Die Frage nach Testmaterialien beantworten alle interviewten SonderpädagogInnen sehr sachlich. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die InterviewpartnerInnen Testmaterialien dem „Anschauen“ bevorzugen, weil es „einfach fein“ ist, dass „… man ein standardisiertes Verfahren hat …“ (B1, 123) und „... die Testverfahren des a bissl vereinheitlichen“ (B2, 31). In allen Interviews werden einzelne verwendete Testmaterialien namentlich aufgezählt, teilweise wird der ganze Name des Testmaterials ausgesprochen („… der CMM, also der Columbia Matu…, Maturity Scale …“ [A4, 66]; „… der Salzburger Lese-Rechtschreibtest … [A1, 103]), teilweise werden die Testmaterialien abgekürzt und dafür saloppe Namen verwendet (z. B. „… der Ledl …“ [A3, 111], „… de Sindelar …“ [A3, 114]).
Nach den Namen der verwendeten Testmaterialien wurden die InterviewpartnerInnen im Interview nicht angesprochen, dennoch zählen alle InterviewpartnerInnen interessanterweise die ihnen jeweils bekannten Testmaterialien[42] namentlich auf; im weiteren Verlauf der Interviews werden diese dann umschrieben:
… Verfahren …(A3, 233)
… so Minimalanforderungen (A2, 126)
… hilfreiche Unterlagen … (A2, 130)
… Restverfahren … (A4, 119)
… bringt eine Form …(A4, 120)
… fix-fertige Testverfahren, wo eine Auswertung unten aussakimt … (A2, 168)
Die Tests werden in den Interviews als unveränderbare, objektive Objekte wahrgenommen und durch folgende Begriffe ausgedrückt:
… fix-fertig vorgefertigte Sachen … (A2, 131)
… fix-fertige Testverfahren, … (A2, 168)
… Testbatterie … (398)
… Skala … (A3, 241)
… Zahlendiagnostikum … (A4, 139)
… normierte Testergebnisse …(A4, 170)
… a so a Raster … (A2, 75)
… was, wo i Prozentränge feststellen kann … (A2, 168)
… Programme … (A3, 37)
… das Material … (A3, 155)
… so Arbeitsproben halt … (B1, 58)
… das Ober-Standardprogramm … (B1, 184)
… solche Sachen, i sag halt etz alleweil Arbeitsproben … (B1, 190)
… so verschiedene Materialien … (B2, 34)
Mit den Testmaterialien scheinen die interviewten SonderpädagogInnen auf den ersten Blick „endlich etwas in der Hand zu haben“ (B2, 45), um sich orientieren und anschließend objektive Urteile abgeben zu können.
Fortbildungen, in denen der genaue Ablauf einer Begutachtung geboten wurde, werden als hilfreich und erleichternd empfunden, denn da „… hat ma amal a bissl a System …“ (A1, 74), „… a einheitliche Form …“ (A1, 75), „… und es is alles a bissl a Einheit …“ (A1, 77).
Ein/e Interviewpartner/in hebt das Systematisieren anhand von Material, Rastern und Punkten klar hervor: „De Ausbildung hab i bei der Frau Dr. P. gemacht, die uns eben dann oanfach a Material in de Hand geben hat und a a Raster, was gehört in so a Gutachten eini, … welche Punkte gehören ungefähr eini …“ (B2, 59).
Mit den in den Fortbildungen angebotenen „Materialien“, Rastern und Tests, scheinen sich die befragten SonderpädagogInnen besser zurechtzufinden als „nur“ mit einer Beobachtung, denn „… es hat insofern was geholfen, weil man a bissl an an a Gerippe fürs Gutachten kriagt“ (B1, 93).
Testmaterialien werden als Mittel zur Orientierung wahrgenommen, scheinbar auch als hilfreiche Unterstützung vorerst gesehen. Eine genaue Einteilung der Kinder nach Punkten, Prozenträngen, nach oben oder unten wird aber in den Interviews überraschenderweise fast gar nicht vorgenommen. Nur ein/e Interviewpartner/in teilt die Kinder nach Punkten ein („… eine 48-Punkte- Liste … mit einer genauen Skala …“ [A3, 241]) und ordnet je nach Punkteanzahl die Kinder einer gewissen Kategorie zu („… da bin i bei de Prozentpunkte, die wo ich grad nimmer zählen kann, weil es unter null ist, nochand kommst du schon eher hin zum Schwerstbehindertenbereich“ [A3, 266–267]).
Die Tests dienen den InterviewpartnerInnen zur Sicherheit, um das Gutachten in seinem Ablauf und in seiner Form korrekt nach außen zu gestalten.
… hat a System reingebracht … (A1, 74)
… a einheitliche Form … (A1, 75)
… a bissl a Einheit … (A1, 77)
… Material … (A1, 168)
… Programme … (A1, 175)
… der ist in Deutsch im Prozentrang 1 … (A1, 267)
… das sind die Punkte, die wichtig wären … (A2, 83)
Das Systematisieren lässt die SonderpädagogInnen Unsicherheiten überwinden, was Ablauf, Darstellung und Form des Gutachtens betrifft. Bei den Ausbildungen (Wochenendseminare) wurde den GutachterInnen ein Schema oder Raster vorgestellt, nach dem diese ihre Testauswertungen machen können. Mit den vorgestellten Materialien und Tests können die SonderpädagogInnen verschiedene Bereiche (Lesen, Mathematik, Raumwahrnehmung usw.) eines Kindes überprüfen, um das Kind einordnen zu können. Betont wird von den InterviewpartnerInnen hierbei die Standardisierung („… da kommen klarerweise auch die standardisierten Tests …“ [A4, 65]). Der Verwendung von standardisiertem Material schreiben die interviewten SonderpädagogInnen mehr Fachlichkeit zu als der Beobachtung. „… also vom Menschenbild war nicht die Rede, … eigentlich ist es grundsätzlich um dieses Fachliche gegangen“ (A6, 110).
Der „fachliche Weg“ muss nach Ansicht der interviewten SonderpädagogInnen vor allem aus dem Grund eingeschlagen werden, um an Ressourcen für das begutachtete Kind zu kommen. „… es is in dem System oanfach nit anders zu machen, weil alles, was wir da machen, hängt ja dann mit Geld zamm, hängt mit Mitteln zamm, hängt mit Stunden zamm und dann muss i des irgendwo schwarz auf weiß nachweisen können, was tu i damit …“ (B, 276–279).
„… und dann fang i an,
an meinem Gutachten zu basteln …“ (A3, 95)
Dass das Begutachten und das Erstellen des Gutachtens neben der geistigen Tätigkeit auch eine „handwerkliche Arbeit[43]“ ist, lässt sich an einigen Metaphern aus dem Bereich der Arbeit festmachen. Im Vordergrund steht dabei das „Selbermachen“, die Tätigkeit, das Basteln[44] rückt dabei in den Mittelpunkt.
An einigen Zitaten ist zu erkennen, dass alle SonderpädagogInnen zwar Testmaterialien zur Begutachtung verwenden, um Kinder systematisieren zu können, aber einige teilweise gleichzeitig beginnen, selber Testmaterialien zusammenzustellen.
… I hab mir halt mei Formular zammgschrieben … wo i halt Punkte entweder drinnen lass oder manchmal was aussa tu … (B2, 63)
… aber i hab es mir selber gerichtet … (A2, 75)
… hab das nun für mich einfach gerichtet … (A2, 85)
… i hab mir etz einfach Sachen selber gerichtet … (A2, 136)
… und dann hab i mir selber ein Programm zusammengestellt … (A3, 37)
… und aus dem Ganzen einiges noch, was man sich so selber zusammensammelt
aus dem Internet, Literatur und alles Mögliche … (A3, 42)
… da klaub i mir da einfach ganz speziell die Aufgaben raus, wo i vermut, i kim vielleicht drauf: ist es Dyskalkulie, ist es keine … (A3, 152–153)
… da hab i mir selber was zusammengestellt und i glaub, das ist rar aus allen Verfahren, die es da so gibt und und und Testmöglichkeiten, die man hat, informell natürlich, offiziell dürfen wir ja keine Tests machen … (A3, 232–235)
… und aus so Beobachtungsbögen, die i mir für jedes Kind zusammengestellt hab, hab i mir selber, ah, eine 48-Punkte-Liste erstellt mit genauer Skala … (A3, 240)
… und dann fang i an, an meinem Gutachten zu basteln … wird halt abgeändert, wird wieder dazugeflickt … (A3, 97–98)
Ja, es kann aber auch durchaus sein, dass ich ein Material nicht zur Gänze verwende, nur einen Ausschnitt davon und einen Bereich davon, der mir halt dann besser zusagt. (A4, 155–157)
… dass i mir dann a Sachen such dazu … (B2, 101)
… im ersten Moment einfach ein Sammeln, was ist da, durchschauen … am Anfang sammeln … (AS5, 128)
… da muss man sich halt dann heraussuchen …(A1, 97)
… da hab i mir da selber no so verschiedene Sachen gerichtet …, da hab I Material dazu gesucht …(A1, 217–222)
Auffällig ist, dass die InterviewpartnerInnen beim Diagnostizieren nicht nur nach den Anweisungen der Testmaterialien vorgehen. Sie „klauben“ aus den Materialien selber Teile zusammen, schneiden Überprüfungsabschnitte aus und setzen das Ganze wieder zu Überprüfungsmaterialien zusammen. Die Metaphorik des handwerklichen Arbeitens impliziert, dass die InterviewpartnerInnen sich durch die standardisierten Testmaterialien nicht ganz festlegen wollen und daher produktiv das Material zusammenstellen möchten. Die Testmaterialien vermitteln ihnen zwar eine gewisse Absicherung offiziellen Stellen gegenüber und lassen das Gutachten gegenüber Einsprüchen gut verteidigen. Im Widerspruch dazu steht jedoch, dass die Testmaterialien zwar für die SonderpädagogInnen offensichtlich vom „Fachlichen“ her keine großen Probleme bereiten, jedoch für die Kinder eine „… heikle Geschichte“ sind, da man „… nur so punktuell an Ausschnitt von einem Kind sieht …“ (B2, 240) und auch nicht jedes Testmaterial für jedes Kind passt. Das „Fachliche“ beschreibt ein/e Interviewpartner/in als das „Sachliche“, das Durchführen und Auswerten der Tests und das Schreiben des Gutachtens. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit zurück, nicht vom „fachlichen“ Handling der Tests her, sondern vom „Menschlichen“ her, wie es ein/e Interviewpartner/in formuliert: „… des is ja oft, dass eigentlich dann Tests und Schulleistung oft a nit zamm passen, gei, oder Tests und Lebensbewältigung …“ (A6, 269–270) und „… vielleicht ist die Unsicherheit, weil ich, äh, weil mir, äh, weil mir so wichtig ist, äh, die Menschlichkeit“ (A6, 259).
Im Hinblick auf die Konsequenzen des Gutachtens, das einen „… ganzen Schwanz mit sich hinterherzieht“, versuchen die GutachterInnen durch die „Bastelei“ einen Mittelweg zu finden, zwischen einem „fachlichen“ Weg und dem Weg des „Menschlichen“. (Das „Menschliche“ wird von einigen InterviewpartnerInnen umschrieben als die „Einstellung zum Kind“, dass man „Maßnahmen setzen kann ohne SPF“ und dass man einfach nur sagen kann, „… des Kind braucht a Hilfe, des braucht a spezielle Unterstützung oder irgendwas ohne den ganzen Schwanz“ (B2, 303–305).
Das Dilemma, in dem sich die SonderpädagogInnen wiederfinden, versuchen sie durch das „Selbermachen“, das Produzieren, Suchen und Basteln zu überwinden.
„Es ist ja doch ein
gravierender Schritt …“ (B2, 298)
Eine Erfahrung, die an die Raumerfahrung gebunden ist, ist die des Weges. Der Weg-Metapher liegt eine Bewegung[45] von einem Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt zugrunde. Um einen Raum erschließen zu können, muss eine Erfahrung des Weges bereits vorhanden sein, die durch zugrunde liegende Handlungen angeeignet wird. Eine Weg-Metapher beinhaltet zusätzlich zur vereinfachten Struktur, von einem Ausgangspunkt zu einem Zielpunkt zu gelangen, auch Wissen um bestimmte Faktoren wie z. B. Direktionalität, zeitliche Dimensionen oder die Tatsache, dass auf einem Weg bestimmte Punkte durchlaufen werden müssen. Handlungen, in diesem Fall das Diagnostizieren, ob ein SPF gegeben werden soll, d. h. vom „Anschauen“ (Ausgang) des Kindes bis zum Treffen der Entscheidung (Ziel), können durch die Wegmetaphorik strukturiert und beschrieben werden.
„Da unsere Handlungen in der Regel zielgerichtet und mit Bewegung verbunden sind, liegt es nahe, jeder Form unseres Handelns das WEG-Schema zugrunde zu legen“ (Baldauf 1997, S. 140). Ausdrücke, die Bewegungen und Wege beschreiben, sind in den Interviews sehr häufig. Die SonderpädagogInnen sind während des Diagnoseprozesses in ständiger Bewegung, betreten verschiedene Wege und schlagen verschiedene Richtungen ein, bis sie das Gutachten verfassen. Bis auf einen/eine Interviewpartner/in, der/die sich bewusst für die Gutachtertätigkeit bereit erklärt hat, sind alle SonderpädagogInnen „einfach so“ zu dieser Tätigkeit gekommen, weil „… des gehört ja zum Geschäft …“ (B1, 7) und „… is da automatisch eigentlich a Folgeerscheinung …“ (B2, 9). Allein schon die Übernahme der Arbeit des Begutachtens ist mit Bewegung verbunden.
… in de Gutachtertätigkeit bin i so hineingeschlittert … (A3, 11)
… da bin i dazu kommen, dass man Gutachten schreibt … (B2, 5)
Zur Gutachterin bin i mit der Einstellung als Leiter/in hier kemmen … (B3, 7)
Zur Gutachtertätigkeit bin i kemmen, wie i … (B1, 6)
Dazu kemmen bin i mit meiner Funktion als Leiter/in … (A6, 11)
… und dann kann man da hineinwachsen …(A4, 603)
In den Interviews zeigt sich anhand der Wortwahl, dass die SonderpädagogInnen während des Diagnoseprozesses keinen linearen Weg einschlagen, sondern dass der Begutachtungsprozess mit einer ständigen Bewegung einhergeht. Die GutachterInnen machen sich auf den Weg und drücken ihre Bewegungen bildhaft aus, indem sie an die Sache heran gehen, wieder etwas auf Distanz gehen, kleine Schritte oder lange Wege machen, Zugänge suchen und/oder in Erscheinung treten.
… ich muss jetzt auch nicht nervös an die Sache dran gehen oder mit einem mords Druck: „Das könnte wieder schiefgehen, oder so!“ … (A5, 401–404)
… dann weiß i scho irgendwie, da muss i heran gehen … (A1, 317)
I würd das jetzt wirklich mal angehen … (A1, 511)
… dann haben der L. und ich … halt beschlossen, dass es am einfachsten ist, wenn ich das Gutachten schreib, weil i de Kinder kenn, weil i den Zugang hab … (A2, 36–37)
… und etz geh i dann und etz mach i des … (A2, 50)
… i geh a oft spazieren mit einer Freundin und dann reden wir über das Kind … (A1, 588)
Okay, …, weg mit dem Gutachten, brauchen wir nimmer weitergehen, das läuft jetzt eh … (A3, 298)
… und wenn i mir nach vielem Hin und Her noch nicht sicher bin … (A3, 282)
… i denk schon, dass ich umsichtig damit umgeh … (A4, 256)
… und dann geh i möglicherweise no amol hin und dann versuch i das Gutachten zu schreiben. (B1, 53–54)
… aber jetzt geh i trotzdem … (B1, 82)
Aber des, na des war eigentlich des, was mi am allermeisten g’schreckt hat, so, äh, weil i oanfach eher Lehrer bin und nit jetzt so Reisender … (B1, 388–389)
es ist ja doch ein gravierender Schritt, eben den zu setzen … (B2, 298)
Dann tret i amol in Erscheinung … (B3, 40)
Einfach weil ma in a so a Fahrwasser, in a, in a Routine einikimmt, wo ma scho aufpassen muss … (B3, 98–99)
Sonst ist es einfach, wie gesagt a so a bissl a Blindflug … (B3, 159)
Wobei wir natürlich intern oanfach alle Möglichkeiten ausschöpfen und des heißt, bevor wir den Schritt machen, machen wir mit den Eltern noch mal aus. (A6, 161)
… wenn i jetzt nach dem gangen wäre … dann wäre es beim ASO-Lehrplan blieben … (A6, 201)
… i bin glei mal auf der richtigen Spur … (A3, 87)
Dass der Begutachtungsprozess in verschiedene Richtungen laufen kann, zeigt sich anhand von Metaphern, die neben Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auch Seitwärtsbewegungen ausdrücken und somit unzählige alternative Wege zeigen.
Ich hab einmal das Gefühl gehabt, dass es schiefgegangen ist … (A5, 409)
… des ist dann auf die schiefe Bahn geraten … (A3, 654)
… auch wenn jetzt ein Einzelgutachten … in de andere Richtung zeigt … (A6, 243)
Ja, also, des sind jetzt amal zwei Wege: ganz selten is einfach! (A6, 33)
… und das ist dann in die Richtung gegangen … (A6, 210)
Des war schon a langer Weg, äh, a langer Prozess, des war nicht sehr schnell … (A6, 216)
Ja, wo i sieh, da war oanfach notwendig, was in die Richtung was zu tun (B1, 403)
Geh, also i glab, mir haben da schon den, den andern Weg. (B3, 490)
… i war eigentlich einer, der eher gegen den Strom geschwommen ist … (A3, 408)
… versuchen wir irgendwie einen menschlichen Weg zu machen … (A6, 164)
… eben zuerst das Gutachten und dann wird geschaut, welcher Weg der beste is … (A6, 483)
Immer wieder kommen die InterviewpartnerInnen an einen Punkt, an dem ein kurzer Stillstand in der Bewegung angezeigt wird, bevor die Bewegung in eine Richtung wieder fortgesetzt wird.
… und da kommt man immer wieder an, an die Schnittstelle Volksschul- oder Sonderschullehrplan … (A2, 23–24)
… kommen nicht mehr weiter mit dem Kind … (A2, 26–27)
… und wenn’s nimmer geht, dann müssen wir einfach einen SPF-Antrag stellen … (A2, 31)
… und wenn wirklich der Hut brennt oder man steht an … (A4, 227–228)
… dann geht des oanfach nit … (A6, 243)
… wenn nicht irgendwo der Hut brennt, kommst du gar nicht hin … (A4, 513)
… ja, und dass des nit so stehen blieben is, sondern der jetzige Stand … (A6, 27)
Des is oanfach dann offen dann, in was für a Richtung des lafft. (B3, 239)
… wo man sich auf den neuesten Stand halten muss … (A3, 781)
wenn, dann muss i das Gefühl haben, i steh hinter dem SPF … (A1, 594)
Oanfach wieder a bissl auf den neuesten Stand zu kemmen (B1, 90)
…, dass der Schritt gesetzt wird … (B2, 228)
… ich versuch … Hemmschwellen abzubauen … (A4, 58)
Bei einem/einer Interviewpartner/in zeigt sich, dass ein Weg manchmal verwehrt bleibt.
… aber das denk ich mir öfter einmal, dass das ganz gut wäre, wenn i da einfach auch einmal einen Zugang dazu hätte … (A2, 398)
Auch Entwicklungen jeglicher Art während des Verfahrens der Begutachtung werden in den Interviews als Weg konzeptualisiert. Das Ziel tritt dabei in den Hintergrund, der Übergang von einem Ausgangszustand in einen anderen Zustand, die Veränderung also, wird metaphorisch als Fortbewegung auf einem Weg gleichgesetzt. In diesem Fall bewegen sich nicht die SonderpädagogInnen, sondern die Sache an sich kommt in Bewegung und zeigt sich in einem metaphorischen Konzept.
… und das (gemeint ist der Schulbesuch eines SPZ auf Probe) geht auch ganz gut … (A5, 289)
… dann geht’s (Vergabe eines SPF) meistens reibungsfrei … (A5, 124)
… so im Laufe einer Woche wächst halt das … (A3, 97)
… offensichtlich ist die Sache gut gegangen … (A5, 424)
… wenn es an die Grenze geht … (A5, 223)
… wenn so was daherkommt, das ist ja nicht einfach (A1, 598)
Das ist alles Entwicklung einmal erstens und alles ändert sich ständig … (A3, 625)
… herauskommen tut gar nichts … (A3, 713)
Führt manchmal zu einem besseren Ziel (B3, 258)
… brauch i natürlich eine Zeit lang, bis i des ausgewertet hab, alles, de Entwicklung gemacht hab … (A3, 94)
… wenn es dann Richtung SPF ginge … (A5, 131)
… und manchmal kommen da wirklich individuelle Lösungen heraus … (A1, 400)
Je nachdem, wie das Gutachten für ein Kind ausfällt, beeinflusst das Ergebnis den weiteren Lebensweg des zu begutachtenden Kindes. In diesem Fall sprechen die GutachterInnen vom weiteren Weg bzw. Lebensweg des Kindes oder auch von Weichen, die sie für das Kind stellen.
… weil man da in relativ kurzer Zeit über ein Kind ganz massiv seinen Lebensweg, seinen Bildungsweg zu entscheiden hat … (A3, 335–336)
… man entscheidet ja dann doch über einen anderen Lebensweg oder mal einen Schulweg vom Kind … (A6, 502)
… oder halt wo man da irgendwo weiß, im Vordergrund steht, was könnt fürs Kind jetzt der bessere Weg für die Zukunft sein. (B1, 233–235)
Äh, also wo man, ja schon überlegt, wo hat er die größeren Chancen weiterzukommen … (B1, 237)
Weil oanfach dann da ihm jetzt nit irgendwo an Weg zu verbauen …, weil des is oanfach so a Grenzgänger … (B1, 372–374)
Ja vor allem, denk i, entscheidet ma schon oanfach a übern weitern Lebensweg von dem Kind. (B2, 169)
… und scho a für den weiteren Lebensweg fürs Kind einfach, einfach a Weiche stellt. (B3, 253–254)
Nit de schlechteste, aber es stellt a Weiche. (B3, 256)
Eben, weil eben die Entscheidung SPF ja oder nein eben a wichtige Entscheidung is, oder a doch a weichenstellende Entscheidung. (B3, 285–286)
Also da schick i sie a in a Richtung. (B3, 297)
Auf dem Weg zum Gutachten begegnen den GutachterInnen die Eltern der Kinder, die zu diagnostizieren sind. Das Treffen auf die Eltern bedeutet für die SonderpädagogInnen meist eine Weggabelung, sie halten entweder inne oder bewegen sich in eine Richtung.
… wenn ich mit den Eltern red oder mit den Lehrern, versuch ich hinüberzuspringen, dass ein SPF kein Stempel ist … (A5, 229–230)
… da geh ich dann, sagen wir mal (…), wenn dann noch zusätzlich Gutachten vorliegen, da geh i eher auf die Beratung hin … (A5, 262–264)
… entweder gehen wir zu zweit aussi, da muss i mir de Unterschrift von der Eltern einholen … (A2, 149)
… also dort, wo ich vielleicht, ah, rein wissenschaftlich zu wenig Material hab und selber zu wenig weiß, dort lässt es sich meistens überbrücken mit einer ehrlich ernst gemeinten Beratung … (A5, 276–283)
Die in den Interviews zu findenden metaphorischen Redeweisen zeigen Bilder, durch welche der Vorgang des Begutachtens als Wegstrecken, die durch Bewegung zurückzulegen sind, charakterisiert wird. In keinem der Interviews wird diese Wegstrecke als linearer Weg zurückgelegt, um an das Ziel zu kommen. Im Gegenteil, die InterviewpartnerInnen legen verschiedene Wege mit verschiedenen Bewegungen zurück (hineinschlittern, hinüberspringen, hinfahren, herauskommen, laufen, schwimmen, treten, gehen) und bewegen sich dabei in unterschiedlichen Richtungen im Raum.
Die Erfahrung von Raum[46] ist eine der elementarsten Erfahrungen des Menschen und drückt sich auf metaphorischer Ebene in verschiedenen Schemata aus. Viele lokale Präpositionen spiegeln die Raumerfahrungen und lassen eine Strukturierung in verschiedenen Bereichen zu.
„Die infrage kommenden Lageverhältnisse sind für alle Sprachen überraschend ähnlich: Innenraum/Außenraum, Kontakt/Nähe/Ferne, Richtungen, Vertikalität/Horizontalität/Lateralität, Ursprung und Ziel von Bewegungen, beobachteroder objektbezogen (…), Umschließung/Durchquerung usw. Dieser Umstand verweist darauf, dass die lokalen Präpositionen ziemlich zentral etwas mit dem menschlichen Raumkonzept zu tun haben, das zum großen Teil sprachunabhängig ist“ (Wunderlich 1982, S. 10; zit. nach Baldauf 1997, S. 124).
Die Behälter-Metapher ist eine sehr gebräuchliche und vergegenständlichende Metapher. Sie erlaubt dem Menschen auf verbaler Ebene physische, psychische und geistige Erfahrungen zu benennen (vgl. Schmitt 1995; Baldauf 1997). Der Mensch an sich und sein gesamter Tagesablauf sind geprägt von den Behälter-Erfahrungen: Der Mensch füllt den Körper täglich mit Nahrungsmitteln, aus dem Körper werden Dinge ausgeschieden, er geht in Räume hinein, steigt aus dem Auto aus, gießt Flüssigkeiten in Tassen, leert diese aus usw. Die Behälter-Erfahrungen können an unzähligen Beispielen des täglichen Lebens und am Menschen selbst dargestellt werden. Die Behälter-Metapher ist aufgrund seiner Körperlichkeit und seiner ursprünglichen physischen Erfahrungen damit bedeutungsvoll; der Mensch als ein Behälter an sich ist nicht nur ein Behälter für dessen Organe, sondern auch ein Behälter für das „… vage Phänomen der Emotionen“ (Baldauf, 1997, S. 134).
Auch Kövecses (1990; 2000) postuliert die Behälter-Metapher als ein hauptsächliches Konzept, wie Emotionen strukturiert werden können. Dabei kann sowohl der Körper als auch der Geist der Container sein, in dem sich Emotionen befinden.
Ebenso können Emotionen selbst als Behälter konzeptualisiert werden, in dem sich der Mensch befindet.
Die InterviewpartnerInnen betreten während des Diagnoseprozesses verschiedene Räume, die sich anhand der verwendeten Präpositionen darstellen lassen.
„… also ich hab de Kinder schon
ganz gut im Kopf drinnen …“ (A2, 417)
Den eigenen Körper als Raum von Emotionen betreten alle interviewten SonderpädagogInnen dann, wenn es um die Unsicherheit geht, bei einem Kind, das ein „Grenzfall“ ist, über einen Sonderpädagogischen Förderbedarf zu entscheiden. Als „Grenzfall“ werden in den Interviews Kinder beschrieben, die nicht eindeutig zuordenbar sind, also nicht eindeutig als behindert gesehen oder durch Tests eindeutig als förderbedürftig einstufbar sind.
… also ich hab de Kinder schon ganz gut im Kopf drinnen … (A2, 417)
… das hat man im Gnack jedes Mal, ja das sitzt da hinten drin, das sitzt da hinten drin (zeigt auf das Genick) … (A3, 350–353)
… da baut sich so eine Kraft in einem selber drin auf, wo man sagt: „I trau mi etz einfach zu sagen, so ist es und da könnt ihr jetzt mit eurer Wissenschaft nun baden gehen.“ (A3, 561–564)
… ein wissenschaftlich untermauertes Bauchgefühl braucht es da drin … (A3, 814)
… Überlegungen, die ein Leiter vom SPZ haben muss, weil er die Schule im Hinterkopf hat … (A4, 341–342)
… wie schwanger komm ich mir vor, gell, also wirklich … (A1, 589)
… da hat man a des im Kopf … (A6, 322)
Aber wenn i wieder herein kimm und i seh den Buabn dann wieder, dann is es scho wieder drin … (A6, 313)
Also, dass es einem ah immer im Kopf umma geht … (B1, 349)
Ja. Des erleb i so, dass mir des Kind dann ganz lange nit aus dem Kopf geht, dass des also sehr lange mein Begleiter is … (B3, 243)
… wenn man was amol einmal ausgesprochen hat und nit es nur im Kopf herum schwirrt, ist es a schon klarer … (B3, 319)
Also, dass es einem ah immer im Kopf umma geht … (B1, 349)
… momentan ist es nicht aktuell, wie das Kind nicht da ist, aber sobald der zurück ist, ist der wieder im Kopf, der SPF … (A2, 309–310)
Fast alle InterviewpartnerInnen äußern in den Interviews ein gewisses Unbehagen während der Gutachtertätigkeit. Vor allem die Entscheidung einen „SPF“ auszusprechen oder nicht scheint für sie bei manchen Kindern aufgrund der verschwommenen Randschärfe des Behinderungsbegriffes ein beklemmendes Gefühl hervorzurufen. („Also leichter ist es, wenns also eindeutig a Kind mit einem erhöhten Förderbedarf is“ [B1, 309]). Die interviewten SonderpädagogInnen sprechen auf der Gefühlsebene, indem sie den unbehaglichen, teilweise nicht verbalisierten Gefühlen einen Ausdruck im Raum ihres Körpers verleihen.
Das unbehagliche Gefühl während des Diagnoseprozesses wird in drei Interviews einfach nur als schlechtes Gefühl bezeichnet, das Gefühl wird aber nicht näher definiert und beschrieben und es werden keine offensichtlichen Gründe dafür genannt. („Ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt …“ [A5, 423]; „Ich, ich, ja, ah (…) aber da, da hab ich ein schlechtes Gefühl gehabt, total …“ [A5, 430–431]).
Ein/e Interviewpartner/in verleiht dem Gefühl des Unbehagens einen Ausdruck, indem er/sie sagt: „Gerade bei Kindern, die dann nicht eindeutig sind, da rear i manchmal, so fertig bin i“ (A1, 449).
„ …wie würde es mir dann als
Papa oder Mama gehen …“ (A6, 133–136)
Einen weiteren Raum, den die interviewten SonderpädagogInnen während der Gutachtertätigkeit wahrnehmen, ist der Raum, in dem sich die Eltern der zu begutachtenden Kinder befinden. Oft ist es dabei schwierig, die Ausdrücke als Metaphern zu identifizieren, da es sich auf der Wortebene häufig um Bewegungsverben oder Präpositionswörter handelt, die eine gewisse Raum- oder Containervorstellung implizieren. In den Interviews zeigt sich allerdings, dass es sich beim „Eltern-Raum“ um einen sehr verschwommenen unklaren Raum handelt, der sich zwar schwer an Metaphern festmachen lässt aber dennoch vorhanden ist. So klar die Metaphern für Emotionen als eigener Raum sind, so unklar präsentieren sich die Metaphern in Bezug auf den Raum der Eltern. Auffällig ist allerdings, dass auch hier sehr viel Bewegung herrscht, die Bewegungen der Eltern werden von den SonderpädagogInnen wahrgenommen und durch Bewegungsverben ausgedrückt.
Einige InterviewpartnerInnen „versetzen“ sich, wenn auch oft nur kurz, bewusst in die „Lage“ der Eltern, wenn es darum geht, bei deren Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf zu diagnostizieren. Sobald sich die GutachterInnen in die Lage der Eltern versetzen, sich also an deren Raum herantasten, fällt die Entscheidung der Diagnose sehr schwer. Bleiben die GutachterInnen im Raum der LehrerInnen, ist das Entscheiden über das Kind weniger belastend.
… also, i tu dann immer so, als wenn es mein Kind wär, was tät i; es ist auch gut, dass ich ein Kind hab und dass i mi da hinein fühlen kann, wie es einer Mutter geht … (A1, 592–598)
… i bin gern draußen, i kann gut mit Eltern umgehen … (A2, 350)
… und i versetz mi immer in die Lage, wie würde es mir dann als Papa oder Mama gehen … (A6, 133–136)
… was hat de Mama für ein Gefühl, wie schaut des Gefühl von der Mama aus, und a ins Elternhaus horch … (A2, 186–191)
… wenn wir einen Draht zu den Eltern haben, dann ist es ganz einfach, ganz einfach nit … (A2, 276–278)
… i red jetzt da als Lehrerin, aber i bin auch eine Mama und i muss da nur an mich denken, i tät da auch einfach, …, alles tun, wenn ein Kind von mir in de Gefahr kemmat … (A2, 367–370)
Viel Bewegung im Elternraum ist vorhanden, wenn es um die Begutachtung ihres Kindes durch die SonderpädagogInnen geht. Die SonderpädagogInnen drücken die Bewegungen, die sie bei den Eltern wahrnehmen, aus. Die Eltern haben einen Ort, an dem sie sich befinden, von dem sie Bewegungen in verschiedene Richtungen machen.
Ja, die großen Entscheidungen, die großen Entscheidungen, wenn dann die Eltern so furchtbar leiden darunter und dagegen arbeiten … (A1, 453–456)
… und da denkt man, die Eltern fangen das Kind schon auf; aber, wenn du merkst, die Eltern machen das Kind noch hinunter, weil es einen SPF braucht, des … (A1, 460–462)
… auch für die Mütter, dass man ihnen oft sagen muss, das ist nicht so eine Katastrophe, da gibt es auch wieder einen Ausweg heraus … und das würd ich mir wünschen und auch mehr Flexibilität da vom Gesetz her oder die Rahmenbedingungen für die Kinder, gei, also ganz individuell … (A1, 602–606)
… wo es ganz schwierig ist, wenn sich Eltern z. B. gegen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf auflehnen, oder wenn sie dann nicht unterschreiben … (A2, 237–239)
… wenn a im Gespräch a drauf kimmt, dass einfach viele, viele Mamas wirklich schon am Limit sind, weil sie ständig bei irgendetwas hinten nachspringen … (A2, 278–279)
… und dass sie dauernd eine Aufgabe von der Schul übernehmen muss, dann, dann bricht das ganz oft zusammen bei den Mamas und dann merkt man einfach, dass sie das auch nimmer lang ausheben, …(A2, 279–280)
Belastend ist sicher auch, ah, sind Situationen, wo Eltern die Einsicht: „Mein Kind ist behindert“, so vor sich herschieben und mit dem, was du ihnen dann sagen musst, sie in ein Loch a stürzt oft (A4, 407–410)
… wenn man oft sieht, wie wirklich verunsichert die Eltern dann sind … und beeinflusst von allen Seiten und jeder redet auf sie ein … (B2, 157–159)
In allen Interviews wird das Elternhaus von den InterviewpartnerInnen wahrgenommen und angesprochen, obwohl eine direkte Frage nach dem Elternhaus während des Interviews nicht gestellt wurde. Die GutachterInnen nehmen den Raum der Eltern der zu begutachtenden Kinder wahr. Einige der InterviewpartnerInnen gehen kurz aus ihrem Raum als GutachterInnen heraus und versetzen sich in die Lage der Eltern. Ein/e Interviewpartner/in beschreibt den „Raumwechsel“ folgendermaßen: „… i red jetzt da als Lehrerin, aber i bin auch eine Mama und i muss da nur an mich denken, i tät da auch einfach, i glaub, i tät da auch alles tun, wenn ein Kind von mir in de Gefahr kemmat (…), i glaub, mi müsste man auch zurückpfeifen und stopp und jetzt lässt du das Kind mal leben, i denk mir, i versuch einfach die Eltern zu verstehen, weil es ist einfach so, so das Letzte“ (A2, 366–375). Die Gutachterin verweilt noch im Raum der Mutter und berichtet weiter: „Und bei einem Sonderschulkind bricht ja nicht die Welt zusammen, ha, das seh i jetzt vielleicht als Lehrerin, aber wenn i das als Mama so seh, dann tät für mi auch eine Welt zusammenbrechen, das muss i jetzt einfach so sagen“ (A2, 375–379).
Bleiben die GutachterInnen in ihrem eigenen Raum, nehmen sie dennoch wahr, wie die Eltern in deren Raum „… furchtbar leiden darunter …“ (A1, 400–407), wenn dem Kind ein Sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wird. Eine große Belastung ist für alle InterviewpartnerInnen, den Eltern zu vermitteln, dass ihr Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf braucht, dass man sie also mit dem Stigma „… in ein Loch a stürzt …“ (A4, 407). Sehr schwierig ist es, den Eltern das Ergebnis „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ hinüberzutransportieren, rüberzubringen, rüberzuschieben, es zu vermitteln, irgendwie so zu bringen, dass die Eltern es einsehen. In diesem Fall bleiben die SonderpädagogInnen in ihrem Raum und versuchen die Diagnose SPF in den anderen
Raum, den Elternraum hinüberzutragen. Im Wissen darum, dass die Diagnose für die Eltern eine enorme Belastung darstellt, verweilen einige InterviewpartnerInnen im eigenen Raum und versuchen die Eltern zu beschwichtigen. „… das ist ja nicht einfach, wenn so was daherkommt, das ist ja nicht einfach, auch für Mütter, dass man ihnen oft sagen muss, das ist nicht so eine Katastrophe, da gibt es auch wieder einen Ausweg heraus …“ (A1, 602–604).
„… wo ist das Kind,
wo steht das Kind …“ (A2, 192)
Auffällig ist, dass die InterviewpartnerInnen in den Interviews kaum oder gar nicht die zu begutachtenden Kinder in den Diagnoseprozess miteinbeziehen. Die Entscheidung darüber, ob ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ausgestellt werden soll, wird nicht mit dem Kind besprochen, sondern über das Kind gefällt.
… weil man da in relativ kurzer Zeit über ein Kind … zu entscheiden hat … (A3, 334–337)
… i fäll die Entscheidung über das Kind … (A2, 237)
Der Raum des Kindes ist im Verfahren ein sehr kleiner und wird von den GutachterInnen nur insofern gestreift, als dass sie für das Kind eine gute Lösung im Verfahren finden möchten. Metaphern für den Raum des Kindes sind in den Interviews kaum gegeben, der Raum des Kindes wird in den Texten fast nicht beachtet und ist kaum an lokalen Präpositionen oder bildschematischen Metaphern festzumachen. Die InterviewpartnerInnen berichten allerdings davon, dass sie oft gerne für das Kind eine gute Lösung hätten, weil „… das ist so eine gravierende Entscheidung für das Kind …“ (A1, 593), dies aber oft unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht machbar ist. „… wenn das Kind halt wahnsinnig gerne da in de Volksschule, wo es eine Integration hätt und das geht halt nit und da ist man halt immer wieder mal frustriert, muss ich auch zugeben …“ (A1, 403–407). Ein/e Interviewpartner/in spricht von der großen Verantwortung, die er/sie gegenüber dem Kind hat. Er/Sie trifft eine Entscheidung über das Kind, wobei das Kind am Entscheidungsprozess nicht teilnehmen kann. „Also da hab i sehr viel Verantwortung gespürt, i hab einfach gewisst, i bin der Punkt, um den es sich nun dreht, i fäll die Entscheidung über das Kind …“ (A2, 237). In einem Interview wird eine Entscheidung für das Kind getroffen, wobei dem/der Gutachter/in bewusst ist, dass diese Entscheidung, die er/sie trifft, Folgen für das Kind hat und nicht „… du gehst jetzt bloß zur Nachhilfe, gell …“ (B3, 128) bedeutet.
Ein/e Gutachter/in spricht ganz vehement aus, dass seine/ihre Arbeit wichtig ist, damit dem Kind geholfen werden kann. „… dass den Kindern endlich damit geholfen wird und dass sie eine Chance kriegen … (B2 182) und er/sie freut sich, wenn es „… für das Kind einfach a Verbesserung gibt“ (B2, 205).
5.2.1 GutachterInnen als soziale Akteure[47]
„Will man die Welt ändern,
muß man die Art und Weise,
wie Welt ,gemacht‘ wird, verändern“
(Bourdieu 1992, S. 152).
Durch die Metaphernanalyse konnte die Autorin bereits einen Raum herausarbeiten, in dem sich die GutachterInnen bewegen. In Anlehnung an Bourdieu (1998; 1992; 2005), der u. a. den Raumbegriff sehr prägte, steht der Raum der GutachterInnen auch im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. Zunächst wird der wissenschaftliche Blick auf die Entstehung des Raums für GutachterInnen gelenkt, gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung mit den sich daraus ergebenden Begriffen, wie „symbolisches Kapital“ und „symbolische Macht“, statt. In Anlehnung an Bourdieu (1995; 1992), der ein umfassendes Modell des konstruierten sozialen Raums und sozialer Klassen darstellt, soll hier das Augenmerk auf die Konstruktion eines eigenen Raumes im Feld „Schule“ gelegt werden. Es bildet sich innerhalb der Gruppe der SonderschullehrerInnen eine neue Gruppe an Akteuren (GutachterInnen), die eine gewisse Position in diesem Raum einnehmen. In diesem konstruierten Raum agieren die SonderpädagogInnen mit einem ihnen zugestandenen Kapital. Fast alle SonderpädagogInnen sind „einfach so“ zum Gutachter/zur Gutachterin geworden, denn „… der Gutachter war automatisch dabei“ (A5, 9).
Ein/e Interviewpartner/in beschreibt das Betreten des neuen Arbeitsfeldes (Raums), indem er/sie sich wie folgt äußert: „In de Gutachtertätigkeit, ja, bin i so hineingeschlittert“ (A3, 11).
Ein zentraler Begriff bei Bourdieus Ausführungen (1995) ist der des Kapitals. Er unterscheidet begrifflich unterscheidbare Kapitalformen (z. B. ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) und stellt dies als ein theoretisches Kriterium zur Differenzierung spezifischer Felder dar. Eine entsprechende Sorte an Kapital, in diesem Fall das „symbolische Kapital“ (Bourdieu 1995), die ein Akteur (Sonderpädagoge/Sonderpädagogin) innerhalb eines spezifischen sozialen Feldes (Schule) hat, bedingt die Konstruktion eines Raums, in diesem Fall die Konstruktion des Raums der GutachterInnen.
Interessanterweise wird den GutachterInnen „symbolisches Kapital“ zugesprochen, das sie zu Beginn der Gutachtertätigkeit gar nicht haben. Zur Zeit der Interviews brauchten die SonderpädagogInnen keine besondere Ausbildung oder Zusatzqualifikation, um die Gutachtertätigkeit ausführen zu können.
Ein/e Interviewpartner/in erklärt, dass er/sie zu Beginn seiner/ihrer Gutachtertätigkeit wenig Informationen und keine Zusatzausbildung hatte: „… es hat niemand so ganz genau gewusst, wie das überhaupt genau sein soll“ (A3, 109). Ein/e andere/r Interviewpartner/in erzählt, dass es „… die Ausbildung an der Hochschule oder an, an der Pädak damals … noch gar nicht gegeben hat“ (A4, 97). Dem schließt sich ein/e weitere/r Sonderpädagoge/Sonderpädagogin an: „In der Zwischenzeit wird es wohl was geben, aber am Anfang san ma eigentlich total in der Luft ghängt“ (B2, 49). Ein/e Gutachter/in beschreibt seine/ihre Situation folgendermaßen: „Ich hab ja jetzt dezidiert keine Gutachterausbildung gemacht, sondern das ist ja eigentlich über die Erfahrung gegangen“ (A2, 66–67). Ein/e Interviewpartner/in bestätigt die Aussagen: „Am Anfang war relativ wenig“ (A5, 181). „Is da automatisch eigentlich a Folgeerscheinung … also, da wird ma gar nit lang gefragt, sondern … des gehört dazu“ (B2, 9–13), erzählt ein/e weitere/r Interviewpartner/in.
Erst während der Gutachtertätigkeit besuchen die GutachterInnen die eine oder andere Fortbildung, in der sie hauptsächlich über formale Dinge, wie den Ablauf der Diagnoseerstellung, das Raster eines Gutachtens, die Darstellung des Gutachtens und über Testmaterialien, die verwendet werden können, informiert werden.
Die Autorin lehnt sich nun an Bourdieus Gedankengut an, der davon ausgeht, dass „… symbolisches Kapital nichts anderes ist als ökonomisches oder kulturelles Kapital, sobald es bekannt und anerkannt, erkannt ist entsprechend den von ihm selbst durchgesetzten Wahrnehmungskategorien …“ (Bourdieu 1992, S. 149). In diesem Fall wird den SonderpädagogInnen unter anderem aufgrund ihrer Ausbildung zu SonderschullehrerInnen gleichzeitig das Kapital zugesprochen, Diagnosen zu stellen und Gutachten verfassen zu können. Der Titel Gutachterin/ Gutachter wird als Bildungstitel verliehen und „… stellt universell anerkanntes und garantiertes symbolisches Kapital dar …“, das offensichtlich offizielle Geltung besitzt (vgl. Bourdieu 1992, S. 150). Das zugesprochene „symbolische Kapital“ von GutachterInnen wird selten oder gar nicht, weder von ihnen selbst noch von Eltern oder Institutionen, in Frage gestellt. Diese Legalisierung gewährt den SonderpädagogInnen den neuen Raum, der offiziell, d. h. im System Schule, bei Eltern und anderen Institutionen, allgemein gültigen Wert besitzt. Dieser Raum konnte auch durch die Metaphernanalyse aufgespürt werden, indem sich zeigte, dass eine Vielzahl an Metaphern den Behälter- oder Körpermetaphern zuordenbar ist.
Die GutachterInnen sind in ihrer Arbeit angewiesen, Diagnosen zu stellen und Gutachten zu verfassen. Bourdieu spricht in seinem Aufsatz „Sozialer Raum und symbolische Macht“ (Bourdieu 1992) von dem Vermögen, das einem zugesprochen wird, auch von „symbolischer Macht“.
„Die symbolische Macht ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es ihr gelingt, sich anerkennen zu lassen, sich Anerkennung zu verschaffen; d. h. eine (ökonomische, politische, kulturelle oder andere) Macht, die die Macht hat, sich in ihrer Wahrheit als Macht, als Gewalt, als Willkür verkennen zu lassen“ (Bourdieu 2005, S. 82).
Ein/e Interviewpartner/in formuliert seinen/ihren Standpunkt dazu folgendermaßen: „… entweder gilt das, was der Gutachter sagt, ja oder nein!“ (A3, 740–741).
Durch den Diagnoseprozess und das anschließende Gutachten wird bei einem Kind entschieden, ob ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ausgesprochen wird oder nicht. Obwohl der Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs große Interpretationsbreiten offen lässt und die InterviewpartnerInnen zum Zeitpunkt der Interviews kaum oder nur wenig für die Gutachtertätigkeit ausgebildet sind, wird diese „Diagnose“ bei manchen Kindern gestellt. Dabei begibt sich der Gutachter/die Gutachterin in die Position der „symbolischen Macht“. Das nötige „symbolische Kapital“ wurde ihm/ihr bereits in einem Prozess der Institutionalisierung zugesprochen.
„Wie … ein Sternenbild erst dann zu existieren beginnt, wenn es selegiert und als solches bezeichnet wird, so beginnt tatsächlich eine Gruppe, Klasse, ein Geschlecht, eine Region, eine Nation erst eigentlich zu existieren, und zwar für die jeweiligen Mitglieder wie für die anderen, wenn sie oder es entsprechend einem bestimmten Prinzip von den anderen Gruppen, Klassen usw. unterschieden wurde, das heißt vermittels Erkennen und Anerkennen“ (Bourdieu 2005, S. 153). In Anlehnung an dieses Zitat bedeutet das für einige Kinder im Schulsystem, dass sie durch bestimmte Worte und/oder Begriffe der GutachterInnen plötzlich einer bestimmten Gruppe angehören, nämlich entweder zu der, die einen Förderbedarf benötigt, oder zu jener Gruppe, die keinen bekommt. „Symbolische Macht“ wirkt in diesem Fall durch die „magische Wirksamkeit der Wörter“ (vgl. ebd., S. 83), d. h. durch die Verbalisierung des Gutachters/der Gutachterin: „Ja, SPF liegt vor“ oder „Nein, kein SPF!“ Ein/e Interviewpartner/in beschreibt das Gefühl der ihm/ihr zuerkannten „symbolischen Macht“ folgendermaßen: „Also, da hab i sehr viel Verantwortung gespürt, i hab einfach gewisst, i bin der Punkt, um den es sich nun dreht, i fäll die Entscheidung über das Kind und des, des, (…), des is mir schon ganz (…)“[48] (A2, 242–245).
Die Zuerkennung von „symbolischem Kapital“ und der dadurch ermöglichten „symbolischen Macht“ kann von verschiedenen Seiten erfolgen. Ein/e Interviewpartner/in möchte die Verantwortung des Gutachtenschreibens loswerden, bekommt aber von außen immer wieder Anerkennung und Zuspruch und somit erneut „symbolisches Kapital“ zugesprochen, um als Gutachter/in weiterzumachen: „Ja, ja also, das ist das Einzige, so ein Druck, das ist ja das Lustige (LACHT), dass ich eigentlich alle Jahre versuch die Tätigkeit loszuwerden (LACHT LAUT), aber es will sie niemand haben und die sagen einfach: ‚Du machst das so gut, du kannst das so gut, du bist ja eh so kompetent‘ …“ (A1, 435–439).
Ein/e Interviewpartner/in erhält von den GrundschullehrerInnen den Status zuerkannt, viel Wissen zu besitzen: „Ah, so, dass i jetzt wirklich oft hinzugezogen werd, wenn a so a irgendwie schwieriges Kind is, oder so der Lehrer jetzt nit ganz genau weiß, wie, also i werd oft als, als Wissender hergenommen, was i nit alleweil bin“ (B3, 286–289).
Fast alle interviewten GutachterInnen spüren die „symbolische Macht“, entweder als undefinierbares Unbehagen oder als große Verantwortung gegenüber Eltern und Kindern.
Ein/e weitere/r Interviewpartner/in sagt, dass natürlich „… eben die Verantwortung also als Gutachter riesig groß ist …“ (A6, 282), noch ein/e Interviewpartner/in findet, dass „… des schon a große Verantwortung is zu sagen, des hat jetzt an Sonderpädagogischen Förderbedarf …“ (B1, 305). Ein/e Interviewpartner/in drückt seine/ihre Handlung als Akteur/in wie folgt aus: „Ja, vor allem, denk i, entscheidet ma scho einfach a übern weitern Lebensweg von dem Kind … und grad in der heutigen Zeit, wir wissen, des is für niemanden leicht was zu finden und wenn i dann mit dem Sonderschulzeugnis hin geh, haben sie’s halt, müss ma ehrlich sein, no amol schwerer“ (B2, 169–176).
Einen Widerspruch in ihrer Arbeit erleben die GutachterInnen, wenn sie einem Kind Unterstützung zukommen lassen wollen, dies ihnen aber nur möglich ist, wenn sie dem Kind vorher den Status „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ zuschreiben.
Durch die „symbolische Macht“ der GutachterInnen kann dem einen oder anderen Kind geholfen werden, geholfen in dem Sinn, dass es ab der Vergabe des Sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht mehr dem Druck der Regelschule ausgeliefert ist und endlich Unterstützung bekommt. „… und wie oft erheb i die Anamnese und die Eltern sagen mir dann, dass er (Schüler) wieder ins Bett macht, er bricht in der Früh immer, kann nimmer schlafen, er zerreißt mir de Heftln … das könnte man vermeiden, wenn man halt einen SPF früher ausspricht, dass das Kind nicht in diese Frustration hineinkommt …“ (A2, 369–376).
Ein/e weitere/r Interviewpartner/in kann leichter eine Entscheidung treffen, wenn er/sie dem Umfeld vermitteln kann, dass ein SPF eine Erleichterung für alle ist, „… weil da kann i einfach sagen, da könnt ihr jetzt alle miteinander einen Schritt zurückgehen und dann wird nämlich alles miteinander ein bissl entspannter und lockerer, die Mama kann Mama sein und das Kind darf daheim Kind sein; da ist es dann, da tu i mi dann leichter eine Entscheidung zu treffen …“ (A2, 288–294).
Hier wird impliziert, dass die Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs auf den ersten Blick unter den derzeitigen Rahmenbedingungen des Schulsystems etwas Gutes ist, etwas, das vor allem dem Kind und auch den Eltern zugutekommt. Zugute kommt es dem Kind in der Hinsicht, dass es zusätzliche Förderung erhält und/oder nach einem anderen Lehrplan unterrichtet werden kann, der Leistungsdruck reduziert und dadurch seine Versagensängste gemindert werden können. Ein/e Gutachter/in sagt, dass er/sie dem Kind durch die Vergabe eines SPF nur helfen möchte, „… wenn a Kind wirklich ganz notwendig a Unterstützung braucht“ (B3, 223) und, wie ein/e weitere/r Interviewte/r meint, „… dass des für die Kinder oanfach gut is und dass den Kindern damit geholfen wird und dass sie bei uns a Chance kriegen …“ (B2, 182–183). Einen SPF als Entlastung sieht auch ein/e Interviewpartner/in, indem er/sie sagt: „In dem Fall ist es gescheiter!“, da das Kind dann endlich Hilfe erhält. Ein/e Gutachter/in versucht es den Eltern oder Lehrern so hinüberzubringen, „… dass ein SPF kein, kein Stempel ist, der dem a so aufdruckt wird und der ihn belastet, sondern der a Hilfe ist, wenn er’s wirklich braucht, also, wenn dann braucht er einen SPF und dann ist es aber eine Hilfe und kein Ding …“ (A5, 330–333).
Der/die Interviewpartner/in erlebt die Ambivalenz, indem er/sie erkennt, dass die Vergabe eines SPFs einerseits eine Stigmatisierung des Kindes bedeutet, andererseits aber Hilfe für das Kind bedeutet.
Geraten die GutachterInnen in den Widerspruch zwischen Stigmatisierung und Unterstützung für das Kind, beginnen sie ihre „symbolische Macht“ selbst zu legalisieren, denn dann „… geht’s dem Kind auch besser …“ (A5, 376), und wenn dann die Ressourcen da sind, „… dass man jedes Kind wirklich individuell sonderpädagogisch fördern kann, einfach, dass das Lernen für die Kinder leichter wird …“ (A1, 482–483).
Indem das „symbolischen Kapital“ legalisiert wird, erhält eine bestimmte Perspektive des sozialen Raums absoluten, universellen Wert. Legalisiert wird das „symbolische Kapital“ sowohl von den LehrerInnen, den Eltern, den Behörden und von den GutachterInnen selbst. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema findet innerhalb der betroffenen Gruppen nicht statt.
„Ein Wort an die Stelle
eines anderen zu setzen heißt,
die Sicht der sozialen Welt zu verändern
und dadurch zu Veränderungen beizutragen“
(Bourdieu 2005, S. 84).
„Tatsächlich üben Worte eine typisch magische Macht aus: sie machen sehen, sie machen glauben, sie machen handeln“ (ebd. S. 83).
Schon zu Beginn der Begutachtungsphase befinden sich die GutachterInnen auf einem sprachlichen „Markt“, auf dem in einer „bestimmten, sozial charakteristischen Art“ gesprochen wird (vgl. Bourdieu 2005). Von LehrerInnen bekommen sie verbale Informationen, dass beim Kind beispielsweise „… halt da einfach irgend a Schwäche da ist …“ (B1, 138) oder „… der hat das und das und das und das und das …“ (A3, 538), „… irgendeppas stimmt net …“, „… da ist die Krise …“ (A2, 82).
Durch die Informationen, dass bei einem Kind in der Klasse „etwas nicht stimmt“, schauen die GutachterInnen während des Diagnoseprozesses das Kind an (vgl. Kapitel Metaphernanalyse), sie beginnen zu „sehen“, machen sich ein Bild vom Kind und fassen das Gesehene in Worte. Auf dem sprachlichen „Markt“ werden viele Fachausdrücke genannt, die sowohl Diagnosematerialien betreffen und diese genauer beschreiben als auch einzelne Störungsbilder wie Dyskalkulie, Dyspraxie, Wahrnehmungsstörungen usw. Sobald Worte für einzelne Störungsbilder bekannt sind, „machen diese glauben“, dass ein Kind dem jeweiligen Störungsbild zugeordnet werden kann. Außer Acht gelassen werden dabei die vielfältigen Möglichkeiten der Datenerhebung und einer damit verbundenen, verstehenden Diagnostik.
Verbalisiert werden zudem abstrakte Abkürzungen wie z. B. SPZ, SPF, EH usw., die für Außenstehende wie Eltern nicht oder kaum verständlich sind. Die Verwendung sämtlicher Fachausdrücke ist einer gewissen Gruppe (z. B. SonderpädagogInnen, GutachterInnen) vorbehalten, was einer Art Geheimsprache gleichkommt. Das Monopol der Worte auf dem sprachlichen Markt „Gutachtenerstellung“ kann hier sichtbar gemacht werden. Das schriftlich verfasste Gutachten beinhaltet schlussendlich den Begriff des Sonderpädagogischen Förderbedarfs.
Wie im Theorieteil beschrieben, kann einem Kind ein Sonderpädagogischer Förderbedarf[49] nur aufgrund einer physischen oder psychischen Behinderung zugesprochen werden. Geht man davon aus, wie Bourdieu es formuliert, „… dass Worte dazu beitragen, die soziale Welt zu erzeugen (Bourdieu 2005, S. 84), so bedeutet das im System Schule, dass hier eine „soziale Welt“ erzeugt wird, in der es eine Gruppe mit und eine ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf gibt. Durch bestimmte gängige Wörter wie „SPF“ oder „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ wird eine neue Gruppe geschaffen oder wie Bourdieu es formuliert, es „… schafft die Beschreibung die Dinge“ (Bourdieu 1992, S. 153).
In den Interviews zeigte sich, dass die Begriffe „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und/oder „SPF“ häufiger sowohl von den Interviewten als auch von der Interviewerin verwendet werden als „behindert“. Die Wörter „Behinderung“ und/oder „behindert“ werden kaum bis gar nicht ausgesprochen, obwohl sie im Gesetzestext in Zusammenhang mit der Vergabe des Sonderpädagogischen Förderbedarfs verwendet werden. Die InterviewpartnerInnen verwenden zusätzlich viele abstrakte Umschreibungen für „Behinderung“ wie z. B. „das“, „etwas“, „irgendwas“; „es“, „es ist was im Busch“, „da stimmt was nit“ usw. (siehe auch Kapitel 5.1.2.).
Die Abkürzung „SPF“ wiederum ist eine abstraktere Ausdrucksform für den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und mit ihr bleibt die ganze Tragweite des Begriffs noch mehr im Verborgenen. Die Macht des Wortes „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ löst sowohl bei den GutachterInnen ein großes Unbehagen aus, weil „… das zieht so einen Schwanz hinten nach ...“ (A2, 327) und ist oft ganz schwer „… zum Aushalten …“ (A2, 328), als auch bei Eltern („… wenn dann die Eltern so furchtbar leiden darunter …“ [A1, 454]).
Bourdieu (2005) geht der Frage der Macht im Diskurs nach und geht davon aus, dass „Kommunikationsbeziehungen auch Machtbeziehungen“ sind. Anhand eines Interviewausschnittes kann verdeutlicht werden, wie eine Auseinandersetzung mit dem tabuisierten Thema „SPF aufgrund einer physischen oder psychischen Behinderung“ stattfindet und sich durch die Wortwahl oder – wie Bourdieu es nennt – durch das Zusammentreffen eines „sprachlichen Habitus“[50] (ebd. S. 81) mit einem bestimmten „Markt“ entwickelt.
Zu Beginn der Interviewpassage spricht der/die Gutachter/in noch von der belastenden Situation, den Eltern sagen zu müssen, dass deren Kind behindert („magische Macht der Worte“ [Bourdieu 2005]) ist; mit diesen Worten werden die Eltern „in ein Loch gestürzt“. Die Interviewerin bestätigt die Aussage und verbalisiert den Zusammenhang von „SPF“ und „Behinderung“; auch in diesen ausgesprochenen Wörtern ist das „Prinzip der Macht“ zu suchen, die Wörter „SPF“ und „behindert“ bewirken eine Kehrtwende der Gesprächsrichtung; der/die Gutachter/in berichtet nun davon, in welches Spannungsfeld (Eltern, LehrerInnen) er/sie gerät und dass er/sie eigentlich von allen nur als Werkzeug benutzt wird.
Das Ansprechen der Behinderung in Bezug auf einen SPF durch die Interviewerin vermittelt ein eher negatives Bild der Gutachtertätigkeit. Der/die Gutachter/in versucht nun dem negativ besetzten Wort „behindert“ auszuweichen, indem er/sie davon berichtet, wie wichtig es ist, den Blick auf das zu richten, was ein Kind kann. Er/sie entzieht sich den „mächtigen Wörtern“ „SPF“ und „behindert“ und schafft durch andere Formulierungen einen positiv besetzten Blick auf das Kind:
B: (…) Belastend ist sicher auch, ah, (…) sind Situationen, wo Eltern die Einsicht: „Mein Kind ist behindert“, so vor sich herschieben und mit dem, was du ihnen dann sagen musst, sie in ein Loch a stürzt oft.
I: Eben, das ist es ja, weil durch den SPF erfolgt der Status „Behinderung“.
B: Ja, ja!
I: Gell, also SPF geht ja erst, wenn das Kind den Status „behindert“ hat.
B: Mh!
I: Mh! Und das dann den Eltern zu vermitteln, das ist schwer?
B: Ja! Schwierig, belastend jetzt tät ich das jetzt weniger bezeichnen, aber schwierig, weil sowohl die Eltern als auch die Lehrer einfach auch vorgefertigte Meinungen haben und einem mehr oder weniger nur als Werkzeug benutzen wollen in welcher Richtung auch immer (…)
I: Wie sagen Sie das dann den Eltern oder wie reden Sie dann mit den Eltern, wenn es fix ist, dass der einen SPF kriegt?
B: Ah, wie sag i das, also mir ist wichtig, und i glaub, dass das grundsätzlich auch ein wichtiger Aspekt in der Sonderpädagogik ist, dass man als Lehrer, in dem Fall als Gutachter, auch den Blick auf das richten muss, was der Schüler kann (A4, 412–436).
„… Ja, i glaub,
dass man als Sonderschullehrer
ein Kind anders anschaut …“ (B1, 478)
Eine Frage des Interviews zielte auf die Selbstwahrnehmung von SonderpädagogInnen als GutachterInnen selbst ab.
Positiv bewertet wird von den InterviewpartnerInnen, dass sie in ihrer Funktion als GutachterInnen eine etwas freiere Zeiteinteilung als SonderschullehrerInnen haben. Sehr spannend finden sieben von neun der Interviewten, dass sie als GutachterInnen verschiedene Schulen kennenlernen können: „Ja, es ist schon interessant, verschiedene Schulen kennenzulernen …“ (A1, 494–496). Ein/e Interviewpartner/in berichtet davon, dass sie „gerne draußen“ ist, „… und in viele Schulen hineinkommt, viele, viele unterschiedliche Typen von Lehrerinnen und Lehrern …“ kennenlernt und vor allem gern „… mit Kindern in der Einzelbetreuung …“ arbeitet (A2, 350–356). Dies bestätigt auch ein/e Gutachter/in, der/die zusätzlich zur „freieren Zeiteinteilung“ (A4, 357) die „direkte Arbeit mit dem einzelnen Kind“ (A4, 378) schätzt. Ein/e Gutachter/in formuliert die positiv bewertete Einzelarbeit mit einem Kind folgendermaßen: „Ja, bsonders gut gfallt mir an der Gutachtertätigkeit, dass ma sich bei der Arbeit wirklich einmal intensiv (...) mit dem Kind beschäftigt“ (A6, 318–319).
Ein/e Interviewpartner/in empfindet es als angenehm, dass „… die Anzahl der Kinder, für die man sich irgendwie verantwortlich fühlt, größer geworden ist“ (B1, 394–395).
Ihre Stärken als GutachterInnen sehen die interviewten SonderpädagogInnen darin, dass sie die zu begutachtenden Kinder mit „etwas anderen Augen“ sehen. „Sonderpädagogen haben einfach einen anderen Blick auf das Kind, mir kommt manchmal vor, die sind viel wohlwollender“ (A1, 639–641).
„Ja, i glaub, dass ma als Sonderschullehrer schon a Kind anders anschaut“ (B1, 204–205). Ein/e Interviewpartner/in sieht seine/ihre Stärke und die der SonderpädagogInnen als GutachterInnen darin, „… dass wir an und für sich a großes Blickfeld ham, dass wir also nit oanfach nur gezielt auf unser fachpezifisches Wissen zurückgreifen, sondern dass wir sowohl das Kind als Kind in seiner Familiensituation sehen und das Kind in der Testsituation – das sind ja oft ganz verschiedene Sichtweisen; da haben wir schon a großes Blickfeld, also des glaub i schon“ (B3, 460–465). Außerdem sieht, laut Interviewpartner/in, der Sonderpädagoge „… das Kind als einzigartigen Menschen, mit seinen besonderen Fähigkeiten und auch Bedürfnissen“ (B3, 499–500). Das große Blickfeld spricht ein/e weitere/r Interviewpartner/in an und stellt gleichzeitig seine/ihre Berufsgruppe anderen gegenüber: „I denk mir, dass wir das alles vielleicht ganzheitlicher sehen, und nit nur so punktuell an Ausschnitt von einem Kind, weil wenn i mir oft so Gutachten anschau, die man so als begleitende Gutachten von Kliniken oder überall her kriagt, oder von Ärzten, also da denk i mir, für was setzen wir uns stundenlang hin und probieren da wirklich was über des Kind auszusagen und andere werfen da drei Satzln hin und damit hat sichs“ (B2, 240–244).
Ein/e Interviewpartner/in spricht von der „Einstellung zum Kind“ (B2, 253) und vom „Menschenbild“ (B2, 253), das „der Sonderpädagoge“ (ebd.) hat. Auf das „Menschenbild“ wird im Interview explizit jedoch weder von der Interviewerin noch von dem/der Interviewpartner/in näher eingegangen. Auf die Frage, inwieweit sich die SonderpädagogInnen als GutachterInnen geeignet sehen, sprechen alle Interviewten eine gewisse Erfahrung an, die ihnen im Begutachtungsprozess zugutekommt. Mit dieser gewissen Erfahrung sieht man schneller „…, dass das Kind einen SPF hat, braucht oder nit, da hat man einfach die Erfahrung, die du da als Sonderpädagoge mitbringst, das, glaub ich, ist die Stärke“ (A5, 608–611). Dass „Erfahrung“ ein für ihn/sie wichtiges Kriterium ist, beschreibt ein/e Gutachter/in auf die Frage, wer eigentlich geeignet für die Gutachtertätigkeit wäre: „Jeder Pädagoge nach langer Berufserfahrung, ja nicht die Jungen dran lassen, die mit ihrem akademischen Wissen da, die da probieren das unterzubringen da irgendwo, sondern einer, der wirklich in der Sonderschule gearbeitet hat, der wirklich in der Integration schon gearbeitet hat, beides kennt, unbedingt, und in beiden Erfahrung geholt hat und dann eine entsprechende Ausbildung kriegt dazu“ (A3, 767–773).
Eine Ausbildung zu haben, wäre schon zielführend, meint ein/e Interviewpartner/in, aber „… das, was ein Gutachter dann noch zusätzlich braucht, das geht erst eigentlich mit Berufserfahrung; da brauchst einfach, i sag jetzt, zehn Jahre Erfahrungen, damit du das einordnen kannst“ (A4, 576–584).
Die Erfahrung spricht ein/e weitere/r Gutachter/in an: „I denk mir, dass da schon der Sonderpädagoge der Richtige is, der des macht, weil er oanfach a von der Praxis her Erfahrung hat“ (B1, 451). Die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes zu kennen, wäre als Gutachter/in von großem Vorteil, meint ein/e weitere/r Interviewpartner/in: „I glaub halt einfach, dass i den schulischen Bereich mehr abschätzen kann als irgendein Psychologe“ (B1, 466–472).
Erfahrung und Zeit für das Gutachten – das seien ihre Pluspunkte, meint eine Interviewpartnerin: „Also, da find i ganz gut, dass i die Rolle als Gutachterin hab, weil i auch an Schulen bin und a viel Zeit hab zum Reden und mir die auch nimm, weil es mir ganz wichtig ist; und i kenn vielfach auch schon die Eltern, weil immer wieder Gespräche da sind“ (A2, 416–422).
Ein/e Interviewte/r beschreibt seine/ihre Rolle als Gutachter/in, indem er/sie einen Blick in die Zukunft des Kindes wirft und sich über die Tragweite seiner/ihrer Gutachtertätigkeit Gedanken macht: „Dass man doch mehr im Hinterkopf hat, wie geht’s weiter und was bewirkt das? Und was lös i damit aus, oder? Oder was will i verändern? Und nit einfach nur den Auftrag hab und dann seh i des Kind vielleicht oamal und nie mehr wieder. Schreib des Gutachten und mach die Tür zu und dann is der Fall, es is ein Fall – vielleicht is des der Unterschied, dass man sich mit dem Kind über längere Zeit mehr befasst“ (B2, 253–264).
Ein/e Interviewte/r meint, dass gerade die SonderpädagogInnen am besten für die Gutachtertätigkeit geeignet sind, da diese am meisten „Verständnis für das Kind“ haben und „eher auf der pädagogischen Seite“ sind, auch wenn es „Nachteile“ geben und sie mit „Gefahren, die das System birgt“, verbunden sein könnten. Er/sie kann sich nicht vorstellen, dass die Gutachtertätigkeit ausgelagert wird, denn, so meint er/sie, andere Berufsgruppen, wie z. B. niedergelassene Psychologen, hätten bezüglich Integration oder „Menschenbild“ kein Feingefühl (vgl. A5, 641–648).
Als „Gefahr“ oder „Nachteil“ sieht der/die Gutachter/in die Tatsache, dass, „… wenn du hinausgehst, als Schülersammler für die Sonderschule empfunden wirst“ (A5, 584–585). Ein/e weitere/r Interviewpartner/in findet, dass es das Beste sei, wenn „SPZ-Leiter oder Sonderschullehrer“ Gutachten machen würden, weil: „… wir des Kind dann in dem Bereich haben, betreuen, fördern, erleben im Unterricht und ein, irgendwo ein Schulpsychologe, der kann oanfach nur einen IQ erheben“ (A6, 406–410).
Ein/e Interviewpartner/in findet es sogar sehr belastend, wenn mehrere Personen bzw. ExpertInnen in die Gutachtertätigkeit miteinbezogen werden. Laut seiner/ihrer Meinung bringen die vielen gestellten Diagnosen keine Hilfe für das Kind; erst durch eventuelle Änderungen der Rahmenbedingungen, wie z. B. der Klassenstruktur und/oder durch einen Förderplan, könne dem Kind geholfen werden: „Und nicht hergehen und was weiß ich, von fünf, sechs Experten abwarten, was da alles so zusammenkommt, weil da kommt nichts nämlich nachher dann. Weil es geht ja dann später in weiterer Folge um den Förderplan! Wie wird der Förderplan gemacht? Wer legt irgendwo fest, wie tun wir da überhaupt? Wo muss der gefördert werden, welche Werte, welche Seite ist es, wo es drauf losgehen wird, wie müssen wir die Klassenstruktur verändern … und das geht nicht, meiner Meinung nach, wenn sechse, siebene gescheit sind, es genügt, wenn es einer ist; wenn man sich mit der Mama abspricht, wenn man sich mit dem Klassenlehrer abspricht“ (A3, 745–757).
Ein/e Interviewpartner/in würde es bevorzugen, das Gutachten im Team zu machen. Die Testung der Intelligenz sollte durch die „Schulpsychologie“ erfolgen, eine „Entwicklungsanamnese durch einen Fachmann“, eine „neurologische Abklärung könnte eventuell von einen Facharzt“ durchgeführt werden und das Gutachten setze sich dann schlussendlich aus den verschiedenen Fachmeinungen zusammen (vgl. B3, 452–456).
Ein/e Interviewpartner/in fände es gut, wenn die Gutachten zwar schon von SonderpädagogInnen, aber unabhängig von den LehrerInnen einer Schule erstellt würden. Er/sie schlägt ein GutachterInnenteam vor, das die Kinder diagnostiziert, „… weil, so ist es schon manchmal so, der eine ist ein bisschen toleranter, der andere nit, es gibt ja da nicht so allgemein gültige Regeln, also drum fänd ich es nicht schlecht; und das Team macht de Gutachten mit den gleichen Kriterien, die arbeiten sich dann was aus und dann weiß man, das ist ein bestimmter Standard und da sind alle Kinder nach den gleichen Kriterien beurteilt, natürlich kommen dann noch andere Sachen, die einen SPF auslösen, dazu, was weiß ich, ein dramatisches Erlebnis, warum einer nicht lernen kann, aber das sind dann ja ausgebildete Leute“ (A1, 616–634).
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle InterviewpartnerInnen mit Blick auf die Eigenwahrnehmung SonderpädagogInnen als GutachterInnen am geeignetsten sehen. Als Gründe dafür werden eine „gewisse Erfahrung der SonderschullehrerInnen mit den Kindern“, „der Einblick in das System Schule und dessen Rahmenbedingungen“, und „die vermehrte Zeit“, die sie im Vergleich zu anderen DiagnostikerInnen für die Begutachtung zur Verfügung haben, genannt. Der Wunsch nach einer speziellen Ausbildung zum/zur Gutachter/in wird zur Zeit der Interviews nur im Hinblick auf das Kennenlernen von eventuell neuen Testmaterialien verbalisiert.
Wie sich in der Metaphernanalyse herausgestellt hat, wird der Raum der Eltern während der Begutachtungsphase von den GutachterInnen zwar wahrgenommen, die Eltern werden aber kaum bis gar nicht in den Begutachtungsprozess miteinbezogen. Das „symbolische Kapital“ und die daraus resultierende „symbolische Macht“ wird GutachterInnen zuerkannt und während der (sonder)pädagogischen Diagnostik nicht in Frage gestellt. Den Eltern von den zu begutachtenden Kindern wird diese Form von Kapital während der Begutachtung nicht zugestanden. Eltern werden zwar darüber informiert, wie der Ablauf einer Gutachtenerstellung ist, und darüber, wie es zu einem Ergebnis kommt, direkt in den Diagnoseprozess werden sie nicht miteinbezogen oder ebenfalls als kompetente „GutachterInnen“ gesehen. „Und dann ist es eben wichtig, dass die Eltern informiert sind, was etz tatsächlich passiert“ (A4, 42). „Und dann hab i des vorher mit der Mutter noch besprochen, alles, ihr Zeit gegeben und des erklärt“ (A6, 213).
Vom eigenen Raum der GutachterInnen aus wird wahrgenommen, dass bei Eltern vielleicht das „… Problembewusstsein noch gar nicht da ist …“ (A5, 107), dass den Eltern klar wird, „… dass eine besondere Hilfe notwendig ist …“ (A5, 123).
Wahrgenommen wird auch Widerstand der Eltern, „… wenn sie sich gegen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf auflehnen oder nicht unterschreiben …“ (A2, 238–239) oder dass sie ganz „… uneinsichtig sind und mit Einsprüchen unter Umständen …“ reagieren könnten. Manchmal ist es aus Sicht eines Gutachters/einer Gutachterin sogar sehr schwierig, „… in dem Fall, wo wir uns gegen die Eltern entschieden haben“ (A2, 307).
Ein/e Gutachter/in berichtet davon, dass er/sie eine gute Lösung für die Eltern finden möchte, aber „… aus irgendeinem Grund kann der Wunsch der Eltern nicht erfüllt werden, wenn das Kind halt wahnsinnig gern da in der Volksschule, wo es eine Integration gern hätt …“, nicht bleiben kann, „… weil da glei a Sparprogramm is“ (A1, 402–404).
Ein/e Gutachter/in drückt sein/ihr Unbehagen aus, indem er/sie feststellt, dass er/sie durch die Informationen über die Vergabe des Sonderpädagogischen Förderbedarfs die Eltern beunruhigt, „… wenn ma oft sieht, wie wirklich verunsichert die Eltern dann sind und wirklich sind und beeinflusst von allen Seiten und jeder redet auf sie ein und jeder sagt, was sie tun sollen, und sie sind dann einfach überfordert“ (B2, 159).
In den Interviews stellt sich heraus, dass alle GutachterInnen die Eltern in irgendeiner Form wahrnehmen, deren Widerstände, Ängste, Unsicherheiten, manchmal auch Erleichterung über zu erwartende Hilfe spüren, diese jedoch nicht aktiv in die Begutachtung miteinbeziehen. Den Eltern wird ein sehr kleiner Raum zugestanden, das heißt, ihnen wird „symbolisches Kapital“ in dieser Hinsicht nicht zuerkannt.
Ziemen (2002) setzte sich zu diesem Thema in einer wissenschaftlichen Studie mit dem „bisher ungeklärten Phänomen der Kompetenz“ von Eltern behinderter Kinder auseinander. Sie konnte darlegen, dass Kompetenzen über die Zuerkennung von „symbolischem Kapital“ erfolgen (vgl. Ziemen 2002). „Nur durch die bedingungslose Anerkennung des anderen, d.h. auch durch die Anerkennung ‚symbolischen Kapitals‘, bekommen Kompetenzen einen Stellenwert in entsprechenden Feldern. Insofern ist die Kompetenz ebenso eine symbolische Kategorie, die die Bewertung (von anderen) oder Selbstbewertung erwartet“ (Ziemen 2002, S. 279).
Das Zuerkennen von Kompetenz wird durch das Einbeziehen des Akteurs im entsprechenden Feld beeinflusst (vgl. ebd.). Im Fall der Gutachtertätigkeit lässt sich das Nicht-Einbeziehen der Eltern so erklären, dass diesen weder eine Kompetenz im Bereich der Gutachtenerstellung zugestanden wird noch ein gemeinsamer Raum für GutachterInnen und Eltern vorliegt. „Will der Beobachter Kompetenzen des anderen erkennen und anerkennen, gilt es in der Begegnung mit anderen gemeinsame ‚Räume‘ zu schaffen, über die letztlich Kompetenzen deutlich werden können“ (ebd., S. 279).
Das Einbeziehen der Eltern und die Zuerkennung von deren Kompetenzen erfordert, im Bereich der Gutachtertätigkeit neue „Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata“ (ebd., S. 279) wirksam werden zu lassen, die der Situation des anderen, seiner Möglichkeiten und Freiheiten entspricht und angemessen ist“ (ebd., S. 279). Die Anerkennung von Kompetenzen der betroffenen Eltern in angemessener Form und deren Einbeziehen in den Gutachterprozess ist anzustreben.
Ein Raum, der während des ganzen Begutachtungsprozesses leer bleibt, ist der des Kindes. Will man im Sinn einer „Rehistorisierenden Diagnostik“[51] das Kind im Diagnoseprozess verstehen, sind die Sichtweise der Kinder/Jugendlichen, deren eigene Einschätzung der Lebenssituation, deren persönliches Empfinden und Erleben von z. B. Verhaltensweisen unbedingt mit einzubeziehen. Dies kann aber nur gelingen, wenn dem Betroffenen, seinen Möglichkeiten entsprechend, Raum gegeben wird. Auch für die Schaffung dieses Raumes bedarf es dringend einer neuen wertschätzenden Sichtweise der GutachterInnen den Kindern gegenüber. Das Zuerkennen von „symbolischem Kapital“ auch für Betroffene würde ihnen mehr Raum zugestehen.
[33] „sehen“: „mit dem Gesichtssinn wahrnehmen“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S.1269).
[34] „schauen“: „den Blick auf etwas richten, betrachten, acht geben, sich kümmern um, innerlich erblicken, erfassen, erkennen“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 1185).
[35] Bei dem Begriff der Konstellation handelt es sich um „komplexe Wissensstrukturen, aus mehreren Elementen und/oder Handlungssequenzen bestehende Gestalten, die als Repräsentation prototypischer, komplexer Alltagssituationen anzusehen ist“ (Baldauf 1997, S. 178).
[36] vgl. dazu auch Kapitel 5.1.2
[37] „Bild“: flächige Darstellung von Personen und Dingen … sowie überhaupt „dem Auge sich darbietender Anblick“ oder „nur in der Vorstellung wahrgenommene Erscheinung“ … (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 136).
[38] „abstrakt“: „vom Gegenständlichen, Einzelnen absehend, losgelöst und daher unanschaulich begrifflich“. Aus „nicht sinnlich“ entwickelt sich … „nur gedacht, vorgestellt, nicht wirklich“. (Pfeifer, W.; u .a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 8)
[39] 2 „Ontologie“: die Lehre vom Sein, von den Ordnungs-, Begriffs- und Wesensbestimmungen des Seienden.
[40] „etwas“: „irgendeine, nicht näher bestimmte Sache“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 304).
[41] „Skala“: „Stufenleiter, Reihe, graduelle Maßeinteilung“; Entlehnung (16. Jh.), zunächst vereinzelt in der Bedeutung „Stufe, Treppe“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 1298).
[42] Genannt werden in den Interviews Tests wie RZD 2–6; (RZD 2–6 – Rechenfertigkeiten- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostikum für die 2. bis 6. Klasse); Zareki-Test; (ZAREKI-R – Testverfahren zur Dyskalkulie bei Kindern); Ledl, Viktor: Förderdiagnose 2.; Sindelar, Brigitte: Verfahren zur Erfassung von Teilleistungsschwächen – Material und Handanweisung; Salzburger Lese-Rechtschreibtest; CMM; Kramer-Test (Ein Verfahren zur Überprüfung der Intelligenz); Heidelberger Rechentest (HRT 1–4); der Bildertest.
[43] „Arbeit“: „zweckgerichtete körperliche und geistige Tätigkeit des Menschen. Produkt dieser Tätigkeit, Werk“, ahd. arbeit f., arbeiti n. „Mühsal, Plage, Anstrengung …“; im Mhd. tritt der Begriff „Mühsal, Not, die man leidet oder freiwillig übernimmt“ besonders hervor. Danach tritt der Sinn von „mühseliger, qualvoller Tätigkeit“ zurück, und Arbeit erstreckt sich auf jede zweckgerichtete, zunächst körperliche, später auch geistige Tätigkeit des Menschen. Der daneben bestehende konkrete Sinn („Produkt der Tätigkeit“), im Ahd. vereinzelt schon angedeutet, entwickelt sich vollends im Nhd. (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 55–56).
[44] „basteln“: „kleine handwerkliche Arbeiten“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 104).
[45] „Bewegung“: „Lage-, Ortsveränderung“, „bewegen“: „die Lage verändern, veranlassen, beeindrucken“. Das starke Verb ahd. Biwegan „aus dem Zustand der Ruhe bringen, wägend prüfen, bewegen“; mhd. wegen „in Bewegung setzen, (sich) bewegen, wägen, einschätzen“. (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 129).
[46] „Raum“: „sich dreidimensional ausdehnender Platz, Weite, Zimmer, nicht genau begrenztes geographisches Gebiet …“; mhd. „Raum, Platz zu freier Bewegung oder zum Aufenthalt“ (Pfeifer, W.; u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 2005, S. 1090).
[47] Die Verfasserin übernimmt in ihrem Text größtenteils das Vokabular von Bourdieu, wie z. B. „Kapital“, „sozialer Raum“, „Akteur“ usw.
[48] Der/die Interviewpartner/in lässt das Satzende offen.
[49] „Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz 1985 liegt vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag und nicht gemäß § 15 Schulpflichtgesetz 1985 vom Schulbesuch befreit ist. Daraus ergibt sich, dass sonderpädagogischer Förderbedarf auf eine festgestellte physische oder psychische Behinderung einer Schülerin bzw. eines Schülers zurückzuführen sein muss“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 19, 2008, S. 9).
[50] Unter „sprachlichem Habitus“ versteht Bourdieu die untrennbar technische und soziale Kompetenz – die Fähigkeit zu sprechen und die Fähigkeit, auf eine bestimmte, soziale charakteristische Art zu sprechen.
[51] vgl. dazu Jantzen (1996); Ziemen (2009).
„Es ist unendlich viel einfacher, für oder gegen eine Idee, einen Wert, eine Person, Institution oder Situation Stellung zu beziehen, als das zu analysieren, was sich in Wahrheit in seiner ganzen Komplexität dahinter verbirgt“ (Bourdieu 2004, S. 44).
Mit dieser Forschungsarbeit zum Thema:
SonderpädagogInnen als GutachterInnen –
der Prozess des Begutachtens aus der Perspektive von SonderpädagogInnen
wurde der wissenschaftliche Blick auf einen bisher unerforschten Bereich in der Gutachtertätigkeit gerichtet. In den Mittelpunkt der Studie rückten SonderpädagogInnen, die als GutachterInnen tätig sind.
Vor dem Hintergrund der wissenschaftstheoretischen Grundlage von Bourdieus „sozialem Raum“ und „symbolischem Kapital“ (vgl. Bourdieu 1992) wurde der Raum der GutachterInnen – ein „mit eigenen Gesetzen ausgestatteter Mikrokosmos“ (Bourdieu 1998a, S. 18) – beleuchtet. Im Folgenden fasst die Autorin die Ergebnisse der Untersuchung kurz zusammen, reflektiert sie und visualisiert diese anhand einer Grafik.
Wie sich über das triangulierte Forschungsdesign herausstellte, erlangen die SonderpädagogInnen in erster Linie durch das Zuerkennen von „symbolischem Kapital“ den Status „GutachterInnen“, d. h. es wird ihnen ein eigener Raum innerhalb des „Feldes“ der SonderpädagogInnen zugesprochen. Durch die Zuerkennung des „symbolischen Kapitals“ erhalten die GutachterInnen „symbolische Macht“: auf der einen Seite eine Macht, die durch das System Schule institutionalisiert ist, auf der anderen Seite eine spezifische Macht, die den SonderschullehrerInnen ein gewisses persönliches „Prestige“ bietet.
Mit Hilfe der GutachterInnen und deren „symbolischer Macht“, die sowohl von Behörden, Institutionen, Eltern als auch von den GutachterInnen selbst legitimiert wird, werden Kinder im österreichischen Schulsystem in zwei Gruppen eingeteilt, in „Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf“ und in „Kinder ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf“. Die Grundlage dafür liefert die veraltete Gesetzeslage (vgl. Kapitel 3.2.1). In der Forschungsarbeit konnte aufgezeigt werden, dass der Begriff des „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ eine sehr vage, fragwürdige Kategorie darstellt und für GutachterInnen eine sehr große Interpretationsbreite offenlässt. In den Interviews wurde dieser Begriff jedoch von den InterviewpartnerInnen keiner kritischen Hinterfragung unterzogen. Nicht erkannt oder/und verdrängt wird darüber hinaus die Tatsache, dass, laut Gesetz, die Vergabe eines „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ eine „Behinderung“ voraussetzt.
Die aktive Auseinandersetzung der InterviewpartnerInnen mit dem Begriff der „physischen“ oder „psychischen Behinderung“, der nach wie vor an den Sonderpädagogischen Förderbedarf gebunden ist, findet in der Gutachtertätigkeit derzeit in Österreich nicht statt. Vor allem der Begriff der „psychischen Behinderung“ bleibt ungeklärt und für jegliche Interpretationen offen.
Im Rahmen der empirischen Forschung zeigte sich, dass Begutachten kein reines „Abtesten“ des Kindes mit objektivierten Testmaterialien ist, sondern vielmehr auf und in verschiedenen Ebenen (siehe Grafik) stattfindet.
In der vorliegenden Grafik werden die drei Ebenen dargestellt: die fachliche Ebene, die emotionale Ebene und die Widerspruchsebene:
Die Ebenen werden nicht linear durchlaufen, sondern die GutachterInnen sind in ständiger Bewegung zwischen und in den Ebenen; die Ebenen selbst greifen teilweise ineinander. Begutachten ist „… Wege zurücklegen, innehalten, Schritte vor, zurück und seitwärts machen …“, wie die GutachterInnen verbalisieren.
Eine Ebene, die „fachliche Ebene“, bildet das Diagnostizieren und Begutachten an sich: GutachterInnen „schauen“, „abstrahieren“, „systematisieren“, „basteln“ und „bewegen sich“. Auf dieser Ebene machen sich die GutachterInnen durch „Schauen“ mit dem Erfolg des „Sehens“ aufgrund von „Wissen“ ein Bild von einem Kind, wie sich in der Metaphernanalyse zeigte. Vage, unstrukturierte Gegebenheiten bei dem zu begutachtenden Kind werden von den InterviewpartnerInnen identifiziert und verbalisiert – das Verbalisieren einer „Behinderung“ oder eines „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ findet jedoch nur durch Projektionen statt. Systematisieren über standardisierte Tests bildet nicht, wie angenommen, einen Schwerpunkt in der Gutachtertätigkeit, um Kinder „einzuordnen“, vielmehr nehmen GutachterInnen Ergebnisse von Tests als Legitimation vor Behörden, um Unterstützung, sprich Förderung, für das Kind zu erhalten. Die interviewten GutachterInnen sehen die Verwendung von Testmaterialien als „fachliche Seite“ in der Begutachtung. Gleichzeitig legen sich die InterviewpartnerInnen nicht gern auf einzelne Testmaterialien fest, da die Ergebnisse der standardisierten Verfahren laut GutachterInnen nur eine Momentaufnahme darstellen und zu wenig über die Lernfähigkeit des Kindes aussagen. Alle InterviewpartnerInnen stellen sich daher zum „Abtesten“ selbst Materialien aus Testbatterien zusammen.
Eine weitere Ebene, die „emotionale Ebene“, ist dadurch gekennzeichnet, dass die GutachterInnen während des Begutachtens ihren eigenen Körper als Raum für Emotionen wahrnehmen, den Raum der Eltern nur teilweise emotional betreten und den des Kindes nur streifen oder außer Acht lassen:
Der Emotionalität wird im Raum der GutachterInnen während des Begutachtungsprozesses offiziell wenig Platz gewährt. Gesellschaftliche und institutionelle Anforderungen und Erwartungen, die an das Berufsbild von GutachterInnen gestellt werden, sind „Fachkompetenz“ und „Wissen“, jedochkeine emotional geäußerten Meinungen.
Emotionen, die während des gesamten Begutachtungsprozesses auftreten, werden von den GutachterInnen daher nur verdeckt verbalisiert, indem sie ihnen einen Ausdruck im eigenen Körper (vgl. Kapitel 5.1.6.1) verleihen. Tiefgehende, emotionale Prozesse sind jedoch bei allen GutachterInnen während des gesamten Begutachtungsprozesses präsent und werden zusammenfassend von den InterviewpartnerInnen vage als „die menschliche Seite“ ausgedrückt.
In der Gutachtertätigkeit stehen eigentlich SchülerInnen im Mittelpunkt des Gutachterprozesses, Raum, im Sinne von Bourdieu, wird den SchülerInnen dabei aber kaum bis gar nicht gegeben, deren Raum bleibt verhältnismäßig klein. In der Studie zeigt sich, dass sich das Diagnostizieren hauptsächlich an alten traditionellen Ansätzen (siehe Kapitel 2.3.1) orientiert, wobei der Fokus noch immer auf die Defizite des Kindes gerichtet ist. Die interviewten GutachterInnen bewegen sich bei der Annäherung an den Raum des Kindes hauptsächlich auf der „fachlichen Ebene“ und ziehen sich aus der „emotionalen Ebene“ zurück.
Versetzen sich die InterviewpartnerInnen in die Lage der Eltern, nehmen sie wahr, wie Eltern darunter leiden, wenn deren Kind einen SPF erhält; im Wissen darum, dass die Diagnose SPF für Eltern eine Belastung darstellt, ziehen sich die GutachterInnen in den eigenen „Raum“ zurück und beginnen von dort aus mit Hilfe der „symbolischen Macht“ auf der „fachlichen Ebene“ den Eltern gegenüber zu argumentieren: Informationen über Gutachtenablauf, über das Ergebnis der Begutachtung und über Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind werden so, laut InterviewpartnerInnen, den Eltern „hinübertransportiert“ und „irgendwie rübergebracht“. In den Gutachterprozess selbst werden die Eltern nicht miteinbezogen. Einen gemeinsamen Raum, in dem Eltern ihre Erfahrungen mit dem Kind in das Gutachten mit einbringen können, gilt es demnach noch zu schaffen.
Wie aus den Gesprächen zu entnehmen ist, befinden sich die GutachterInnen ständig in einem Spannungsfeld von Widersprüchen und Ambivalenzen, das in der Grafik als „Widerspruchsebene“ dargestellt ist.
Aufgrund einer veralteten, gesetzlichen Grundlage, die dazu verpflichtet, einen „Sonderpädagogischen Förderbedarf“ nur aufgrund einer „physischen“ und/oder „psychischen Behinderung“ zu erteilen, müssen die GutachterInnen ein Kind stigmatisieren, um für dieses Ressourcen zu erhalten. In der Analyse tauchte für die Autorin immer wieder die Frage auf, inwieweit den GutachterInnen – trotz besten Wissens – ihre Teilnahme an der Konstruktion von „Behinderung“ bewusst ist. Die Frage ließ sich auf der „emotionalen Ebene“ und auf der „Widerspruchsebene“ beantworten:
Die GutachterInnen kommen nicht umhin, nach dem Gesetz zu handeln, spüren aber einen inneren Konflikt – Emotionen treten auf, die hauptsächlich durch Körpermetaphern (siehe Kapitel 5.1.6.1) verbalisiert werden.
Das Erstellen von Diagnosen im Sinne von Verurteilungen bringt die GutachterInnen in ein Dilemma zwischen erwünschter Unterstützung und Stigmatisierung. Ressourcen zur Förderung als Prävention sind im österreichischen Schulsystem kaum vorhanden.
Begriffe wie „Behinderung“ oder „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ sind weitgehend unklar, vage und individuell interpretierbar, dennoch müssen sich die GutachterInnen im Endbericht begrifflich festlegen.
Obwohl die GutachterInnen kaum oder nur wenig Ausbildung zum Gutachter/zur Gutachterin haben, erstellen sie Diagnosen, die für das Kind und deren Eltern weitreichende Folgen haben.
Auf der Widerspruchsebene zeigt sich deutlich, in welch großem Spannungsfeld sich die GutachterInnen bewegen, zwischen Macht, Emotionen, Stigmatisierung, Festlegung am Behinderungsbegriff, Forderung nach Ressourcen und Unterstützung für das Kind.
Empfehlungen aus der Studie
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Begrifflichkeiten „Behinderung“ und „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ sollte endlich auch auf gesetzlicher Ebene stattfinden: Eine Änderung dieser Begrifflichkeiten im Gesetz ist dringend anzustreben, um Stigmatisierung und Selektion zu vermeiden. Im Sinne der WHO-Definition, die Behinderung nicht mehr als Eigenschaft von Personen versteht, sondern von einer ökosystemischen Sichtweise des Begriffes ausgeht, ist der Begriff im Gesetz nicht länger haltbar.
Mit Blick auf die GutachterInnen würde das Abkoppeln von Förderung aufgrund einer „Behinderung“ GutachterInnen insofern entlasten, als dass sie für SchülerInnen durch Diagnose und Gutachten Unterstützung im Sinne einer individuelle Förderung veranlassen können. Voraussetzung dafür ist jedoch die Gesetzesänderung sowie ein Paradigmenwechsel im diagnostischen Denken.
Bedarfsgerechter Ressourceneinsatz – d. h. Stunden bzw. Personal sind nicht mehr an den einzelnen Schüler gebunden – würde präventive Maßnahmen sowie flexiblere Fördermodelle zulassen. GutachterInnen könnten Förderungen frühzeitiger empfehlen.
GutachterInnen sollten in Zukunft an den Pädagogischen Hochschulen eine wissenschaftstheoretische und praktische Grundausbildung erhalten, um Diagnostik und Gutachten erstellen zu können. Eine fundierte Aus- und Weiterbildung würde erweiterte Perspektiven sowohl in der Gutachtenerstellung als auch in der weiteren Förderung der SchülerInnen eröffnen. Die Ausbildung könnte endlich den Bogen von der Gewinnung von Daten und von empirischen Resultaten bis hin zur Diagnose als Grundlage einer individuellen Förderung spannen. Alte Denkmuster und Wertehaltungen könnten durch neue wissenschaftstheoretische Angebote aufgebrochen werden; die Bereitschaft zur Eigenreflexion sollte dabei geschult und gefördert werden.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Stigmatisierung von SchülerInnen durch die Ausstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs im derzeitigen Schulsystem stellt sich auch im Hinblick auf ein inklusives Bildungssystem: Mit dem Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben, am Spiel, am Lernen sollte eine bejahende, wertschätzende Einstellung zur Vielfalt der Individuen in der Gesellschaft verankert werden – eine Schule für ALLE ist eine Schule ohne Barrieren und Diskriminierung, eine Schule ohne Kinder mit und ohne Sonderpädagogischen Förderbedarf.
In diesem Sinne stellt die Autorin an den Schluss dieser Arbeit ein Gedicht von Erich Fried:
„Ich war von Anfang an nichts als ein Mensch/
und ich will auch nicht etwas anderes sein“
(Erich Fried 1995).
Inhaltsverzeichnis
Amelang M.; Zielinski W. (1994): Psychologische Diagnostik und Intervention. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin.
Angerhofer, U. (1996): Sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff. In: Sonderpädgogik, Heft 1. Marhold.
Ansperger, R. (1998): Die Gutachtenerstellung im Rahmen des Feststellungsverfahrens zum Sonderpädagogischen Förderbedarf. Diplomarbeit an der Universität Salzburg. WissenschaftsAgentur Salzburg.
Aristoteles (2008): De arte poetica; Poetik; griechisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart: Reclam.
Aster, Michael von; Weinhold Zulauf, M.; Horn, R. (2006): ZAREKI-R – neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern. Frankfurt: Harcourt Test Services.
Atzesberger, M. (1971): Rupert Egenberger 1877–1959. Schulreformer – Heilpädagoge – Lehrerführer – Wissenschaftler. Bonn-Bad Godesberg.
Atzesberger M.; Frey H. (1978): Verhaltensstörungen in der Schule. Erscheinungsformen, Diagnostik, Behandlung. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
Bach, H. (1979): Pädagogik der geistig Behinderten. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.
Baldauf, Ch. (1997): Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher. Frankfurt am Main: Lang.
Begemann, E. (1989): Sonderpädagogische Förderbedürfnisse Behinderter mit den bekannten, standardisierten Verfahren diagnostizierbar? In: Sonderpädagogik im Saarland, Mitteilungen des Landesverbandes Saarland, 21. Jg., H. 1.
Bergold, J.; Breuer, F. (1987): Methodologische und methodische Probleme bei der Erforschung der Sicht des Subjekts. In: Bergold, J; Flick, U.: Einsichten. Zugänge zur Sicht des Subjekts mittels qualitativer Forschung. Tübingen: DGVT.
Biermann, A.; Goezte H. (2005): Sonderpädgogik. Eine Einführung. Weinheim: Verlag W. Kohlhammer.
Biewer, G. (2002): Ist die ICIDH-2 für die Heilpädagogik brauchbar? In: Bundschuh, K. (Hrsg.): Sonder- und Heilpädagogik in der modernen Leistungsgesellschaft. Krise oder Chance? Bad Heilbrunn, S. 293–301.
Biewer, G. (2002a): Behinderung und Dritte Welt. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 53, S. 456–460.
Biewer, G. (2009): Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
BIFIE, (2007): Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischenBildungswesens: Individuelle Förderung im System Schule; Graz.
Bleidick, U. (1995): Behindertsein als menschliche Bedrohung. Die Geschichte der Bewertung behinderten Lebens in Wissenschaft und Politik. Zeitschrift für Heilpädagogik 64, Heft 1, S. 301–320.
Bleidick, S.; Ellger-Rüttgardt, L. (2008): Behindertenpädagogik – eine Bilanz. Bildungspolitik und Theorieentwicklung von 1950 bis zur Gegenwart. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
Boban, I.; Hinz, A. (1996): Kinder verstehen – mit Kindern gemeinsam Schritte entwickeln. Annäherungen an die Lebens- und Lernsituation von Kindern mit Hilfe eines diagnostischen Mosaiks. Hamburg: Selbstverlag.
Boban, I.; Hinz, A. (1998): Diagnostik für integrative Erziehung. In: Eberwein, H.; Knauer, S. (Hrsg.): Handbuch Lernprozesse verstehen. Wege einer neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik. Weinheim.
Boban, I.; Hinz, A. (2003): Förderpläne – für integrative Erziehung überflüssig!? Aber was dann?? In: Mutzeck, W. (Hrsg.): Förderplanung. Weinheim: Beltz, S. 131–144.
Boban, I.; Hinz, A. (2009): Schulische Sonderpädagogik im internationalen Raum. In: Opp, G.; Theunissen G.: Handbuch schulische Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Bourdieu, P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1990): Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tauschs. Wien: Braumüller.
Bourdieu, P. (1992): Rede und Antwort. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1993): Soziologische Fragen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1995): Sozialer Raum und „Klassen“. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1998): Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bourdieu, P. (1998a): Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes. Konstanz: UVK Soziologie.
Bourdieu, P. (2004): Gegenfeuer. Konstanz: UVK Soziologie.
Bourdieu, P. (2005): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. Hamburg: VSA Verlag.
Buchholz, M. (1996): Metaphern der „Kur“. Eine qualitative Studie zum psychotherapeutischen Prozess. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Bundschuh, K. (1985): Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. München: Ernst Reinhardt.
Bundschuh, K. (1994): Praxiskonzepte der Förderdiagnostik. Bad Heilbrunn.
Bundschuh, K; Heimlich, U.; Krawitz, R. (Hrsg.) (2002): Wörterbuch Heilpädagogik. Bad Heilbrunn.
Bundschuh, K. (2003): Emotionalität, Lernen und Verhalten. Bad Heilbrunn.
Bundschuh, K. (2004): Förderdiagnostik im 21. Jahrhundert – Zwischen Problem und Kompetenzorientierung. In: Mutzeck, W.; Jogschies, P. (2004): Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Weinheim und Basel, S. 39–55.
Bundschuh, K. (2005): Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. München: Ernst Reinhardt.
Bundschuh, K. (2007): Förderdiagnostik konkret: Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Bundschuh, K. (2008): Heilpädagogische Psychologie. Stuttgart: UTB.
Burgemeister, B. B.; Blum, L. H.; Lorge, I. (1954): The Columbia Mental Maturitiy Scale. Weinheim: Beltz.
Dederich, M. (2001): Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Dederich, M.; Greving, H.; Mürner, Ch.; Rödler, P. (Hrsg.) (2006): Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Dederich, M.; Jantzen, M. (2009): Behinderung und Anerkennung. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
DIMDI, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (2005): ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Genf: World Health Organization.
Dilling, H. (1993): Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F): Klinisch-diagnostische Leitlinien. Weltgesundheitsorganisation. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
Dorsch, F.; Häcker, H.; Stapf, K.-H. (1994): Psychologisches Wörterbuch. Bern: Verlag Hans Huber.
Eberwein, H. (1993): Systemische und förderungsorientierte Diagnostik in (integrativen) Grundschulen. In: Grundschule (25), Heft 1, S. 8–10.
Eberwein, H.(1994): Förderdiagnostik als ganzheitlicher Ansatz sonderpädagogischen Handelns. In: Lüpke, H.; Voß, R. (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, S. 142–151.
Eberwein, H. (1995): Zur Kritik des sonderpädagogischen Paradigmas und des Behinderungsbegriffes. Rückwirkungen auf das Selbstverständnis von Sonder-und Integrationspädagogik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 46, S. 468–476.
Eggert, D. (1997): „Von den Stärken ausgehen …“ Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderungsdiagnostik. Dortmund: Borgmann Publishing.
Eggert, D. (2003): Von der Testdiagnostik zur qualitativen Diagnose in der Sonderpädagogik. In: Eberwein, H.; Knauer, S.: Lernprozesse verstehen. Wege einer neuen (sonder-) pädagogischen Diagnostik. Weinheim: Beltz Handbuch.
Ellger-Rüttgardt, S. (2003): Lernbehinderung – nur ein Konstrukt? In: Gehrmann, P.; Hüwe, B. (Hrsg.): Kinder und Jugendliche in erschwerten Lernsituationen. Festschrift für Ditmar Schmetz. Stuttgart, S. 56–69.
European Agency for Development in Special Needs Education (2006): Individuelle Förderpläne für den Übergang von der Schule in den Beruf. Middelfart:
European Agency for Development in Special Needs Education (Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung).
European Agency for Development in Special Needs Education (2009): Multikulturelle Vielfalt und sonderpädagogische Förderung. Odense, Dänemark:
European Agency for Development in Special Needs Education (Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung).
Feuser, G. (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Fisseni, H. (1990): Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
Flick, U. (2008): Triangulation: Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.
Foerster, Heinz von (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Gansen, P. (2010): Metaphorisches Denken von Kindern. Theoretische und empirische Studien zu einer Pädagogischen Metaphorologie. Würzburg: Ergon.
Glaser, B.; Strauss, A. (1998): Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber.
Glasersfeld, Ernst von (1987): Siegener Gespräche über den radikalen Konstruktivismus. In: Schmidt, S. J: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Graumann, C.; Métraux, A.; Schneider, G. (1991): Ansätze des Sinnverstehens. In: Flick, U.; Kardorff, E. v.; Steinke, I. (2009): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag.
Habermas, J. (1970): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik. In: Bubner, R.; Cramer, K; Wiehl, R.: Hermeneutik und Dialektik, Tübingen.
Haeberlin, U. (1991): Die Integration von leistungsschwachen Schülern. Ein Überblick über empirische Forschungsergebnisse zu Wirkungen von Regelklassen, Integrationsklassen und Sonderklassen auf „Lernbehinderte“. Zeitschrift für Pädagogik 37, S. 167–189.
Haffner J.; Baro, K.; Parzer, P.; Resch, F. (2005): Heidelberger Rechentest. HRT 1–4. Göttingen: Hogrefe.
Haverkamp, A. (1983): Theorie der Metapher. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Haverkamp, A. (1996): Theorie der Metapher. Studienausgabe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Haverkamp, A. (2007): Metapher. Die Ästhetik in der Rhetorik. München: Wilhelm Fink Verlag.
Heinzlmaier, B. (2010): Bruch. In: Salzburger Nachrichten, Nr. 286, 66. Jahrgang, S. 3.
Herz, B. (2004): Emotionale und soziale Entwicklung. Heranwachsende in einer zerrissenen Welt. In: Zeitschrift für Heilpädagogik Nr. 1, S. 2–10.
Hildeschmidt, A. (1983): Konzeptuelle Probleme einer Förderdiagnostik in der Sonderpädagogik: Zwei Thesen. In: Kornmann u. a. (Hrsg.): Förderungsdiagnostik. Heidelberg (Schindele) 1983.
Hildeschmidt, A. (1988): Kind-Umfeld-Diagnose. Weiterentwicklung des Konzepts und Anwendung in der Praxis. In: Sander, A. (1988): Behinderte Kinder und Jugendliche in Regelschulen. St. Ingberg: Röhrig.
Hildeschmidt, A. (1993): Kind-Umfeld-Diagnose zur Feststellung des besonderen Förderbedarfs bei Schülern mit Behinderungen. In: Grundschule 25, Heft 1.
Hildeschmidt, A.; Sander, A. (2002): Der ökosystemische Ansatz als Grundlage für Einzelintegration. In: Eberwein, H.: (Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
Hinz, A. (1993): Heterogenität in der Schule. Integration – Interkulturelle Erziehung – Koedukation. Hamburg: Curio Verlag.
Hinz, A. (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 9.
Hofmann, W. (1961): Besondere Fragen der Hilfsschule. In: Hofmann, W. (1981): Schriften zur Sonderpädagogik aus fünfzig Jahren. Reutlingen.
Hollenweger J.; Kraus de Camargo, O. (2011): ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Bern: Verlag Hans Huber.
Hossiep, R.; Wottawa, H. (1993): Die Angewandte Psychologie in Schlüsselbegriffen. In: Schorr, A. (Hrsg.): Handwörterbuch der Angewandten Psychologie (S. 131–136). Bonn: Deutsche Psychologien Verlags GmbH.
Ingenkamp, K.H; Lissmann, U.(2005): Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik. Weinheim: Beltz.
Jäger, R. S. (2003): Pädagogisch-psychologische Diagnostik. In: Kubinger, K.; Jäger, R. S. (Hrsg.): Schlüsselbegriffe der Psychologischen Diagnostik. Weinheim: Beltz, S. 313–316.
Jäkel, O. (2003): Wie Metaphern Wissen schaffen. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. Jantzen, W. (1987): Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Weinheim: Beltz.
Jantzen, W.( 1998): Menschen mit geistiger Behinderung – veränderte Sichtweisen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 12, S. 526–532.
Jantzen, W. (1990): Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 2. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Weinheim: Beltz.
Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W. (1996): Diagnostik als Rehistorisierung – Methodologie und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen. Berlin: Marhold.
Jantzen, W. (2005): „Es kommt darauf an, sich zu verändern …“ Zur Methodologie und Praxis rehistorisierender Diagnostik und Intervention. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Jetter, K. H.; Schmidt, D.; Schönberger, F.(1983): Sonderpädagogische Förderdiagnostik. In: Haupt, U.; Jansen, G. W.: Handbuch der Sonderpädagogik (1983), Bd. 8. Berlin: Marhold.
Jogschies, P. (2006): Die wissenschaftliche Qualität sonderpädagogischer Gutachten untersucht am Beispiel der Anwendung standardisierter Verfahren. In: Sonderpädagogik 36. Jg., Heft 2, S. 127–138.
Jüttemann, G. (1992): Psyche und Subjekt. Für eine Psychologie jenseits von Dogma und Mythos. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
Kaminski, G. (1997): Behinderung in ökologisch-psychologischer Perspektive. In: Neumann, J. (1997): „Behinderung“. Tübingen: Attepto Verlag GmbH.
Kanter, G. O. (1977): Lernbehinderungen und die Personengruppen der Lernbehinderten. In: Kanter, G. O.; Speck, O. (Hrsg.): Pädagogik der Lernbehinderten. Berlin: Marhold.
Kleber, E. W (1976): Grundlagen sonderpädagogischer Diagnostik. Berlin: Marhold.
Kleber, E. W. (1978): Lehrbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Berlin: Marhold.
Klauer, K. J. (1973): Revision des Erziehungsbegriffs. Düsseldorf: Schwann.
Klauer, K. J. (1974): Methodik der Lehrzieldefinition und Lehrstoffanalyse. Düsseldorf: Schwann.
Klauer, K. J. (1978): Handbuch der Pädagogischen Diagnostik. Düsseldorf: Schwann.
Klauer, K. J. (1982): Handbuch der Pädagogischen Diagnostik. Düsseldorf: Schwann.
Kobi, E. E.; Bonderer, E. (1982): Diagnostik in der heilpädagogischen Arbeit. Luzern: Verlag der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.
Kobi, E. E. (1988): Was bedeutet Integration? – Analyse eines Begriffs. In: Eberwein, H. (Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim und Basel.
Kolt, Ch.; Rothers, H. J. (1984): Förderdiagnostik in der Sackgasse. In: Behindertenpädagogik, 25. Jg., Heft 4.
Kornmann, R. (1977): Diagnose von Lernbehinderungen. Weinheim: Beltz.
Kornmann, R.; Ullrich-Kehder, R.(1989): Entwicklung und Validierung einer Lernhierarchie zum Fähigkeitserwerb korrekten perspektivischen Zeichnens. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, Bd. XXI, Heft 1.
Kornmann, R. (1990): Wie Förderdiagnostik zur Gestaltung von Übungen der Rechenfertigkeit genützt werden kann. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 41. Jg., Heft 2.
Kottmann, B. (2006): Selektion in die Sonderschule. Das Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf als Gegenstand empirischer Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Kövecses, Z. (1990): Emotion Concepts. New York: Springer Verlag. Kövecses, Z. (2000): Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
Kövecses, Z. (2002): Metaphor. A Practical Introduction. Oxford University Press.
Kramer, J. (1974): Kramer-Intelligenztest. Solothurn: Antonius-Verlag.
Krell, G.; Riedmüller, B.; Sieben, B. u. a. (2007): Diversity Studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze. Frankfurt.
Kretschmann, R. (2004): Diagnostikausbildung – für alle Lehrerinnen und Lehrer? In: Mutzeck, W.; Jogschies, P.: Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Weinheim: Beltz, S. 123–137.
Kruse, J.; Biesel, K.; Schmieder, Chr. (2011): Metaphernanalyse. Ein rekonstruktiver Ansatz. Wiesbaden: VS Verlag.
Lakoff, G.; Johnson, M. (1980): Metaphors we live by. University of Chicago Press.
Lakoff, G. (1987): Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago, London.
Lakoff, G.; Johnson, M. (2008): Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
Laponce, J. (1981): Left and Right: The Topography of Political Perceptions. Toronto: University Press.
Ledl, V. (2003): Kinder beobachten und fördern. Wien: Jugend und Volk. Legewie, H.: Schervier-Legewie, B. (2011): „Forschung ist harte Arbeit, es ist immer ein Stück Leiden damit verbunden. Deshalb muss es auf der anderen Seite Spaß machen.“ In: Mey, G.; Mruck, K. (2011): Grounded Theory Reader. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Lempp, R. (1997): Behinderung aus anthropologischer Sicht. In: Neumann, J. (1997): „Behinderung“. Tübingen: Attepto Verlag GmbH.
Leutner, D. (2001): Pädagogisch-psychologische Diagnostik. In: Rost, D. H. (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (2001), S. 521–530. Weinheim: Beltz.
Lindemann, H.; Vossler, N. (1999): Die Behinderung liegt im Auge des Betrachters: Konstruktivistisches Denken für die pädagogische Praxis. Neuwied, Kriftel: Luchterhand.
Lindmeier, Ch. (1993): Behinderung – Phänomen oder Faktum. Versuch einer Klärung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Lindmeier, Ch. (2002): Rehabilitation und Bildung – Möglichkeiten und Grenzen der neuen WHO-Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), Teil I. In: Die neue Sonderschule 47, S. 404–421.
Lindmeier, Ch. (2003): Rehabilitation und Bildung – Möglichkeiten und Grenzen der neuen WHO-Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), Teil II. In: Sonderpädagogische Förderung 48, S. 3–23.
Luhmann, N. (2002): Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lukesch, H. (1998): Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik. Regensburg: Roderer.
Lurija, A. R. (1984): Reduktionismus in der Psychologie. In: Kindlers „Psychologie des 20. Jahrhunderts“. H. Zeier (Hrsg.): Lernen und Verhalten, Bd. 1: Lerntheorien. Weinheim: Beltz.
Lüking, J. (1976): Materialien und Vorschläge zu einer Förderkonzeption pädagogischer Diagnostik. Hannover: Stiftung VW. Unveröffentlicht.
Mand, J. (2002): Sonderschule oder Gemeinsamer Unterricht. Zum Einfluss von Gutachtervariabeln auf Schullaufbahnentscheidungen für schulschwache oder auffällige Kinder und Jugendliche. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 53, S. 8–13.
Meijr, C. (1999): The Financing of Special Needs Education: A Seventeen-Country Study of the Relationship between Financing of Special Needs Education and Inclusion. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.
Metzler, H.; Wacker, E. (2001): Behinderung. In: Otto, H. U.; Thiersch H.: Handbuch Sozialarbeitarbeit/Sozialpädagogik. Neuwied, Kriftel: Luchterhand.
Moll, K.; Landerl, K. (2010): Lese- und Rechtschreibtest. SLRT-II. Bern: Huber.
Moog, W. (1990): Aneignungsprozess-Analyse – Eine notwendige Ergänzung zum standardisierten Schulleistungstest. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 2/1990, S. 73–87.
Neumann, J. (1992): „Ursprünge und sozialpolitische Motive der Wohlfahrtspflege in Württemberg, dargestellt an den Anfängen dreier Behindertenheime“. In: Wehling, H. G.; Langewiesche, D.(1992): Baden-Württemberg. Eine politische Landeskunde Teil II, S. 13–26. Stuttgart: Kohlhammer.
Niedermair, K. (2001): Metaphernanalyse. In: Hug, Th. (2001): Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis, Bd. 2. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
OECD (ed.) (1997): Implementing Inclusive Education (= OECD-Proceedings, Centre for Educational Research and Innovation). Paris (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Opp, G; Kulig, W.; Puhr, K. (2004): Einführung in die Sonderpädagogik. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.
Opp, G.; Theunissen, G. (Hrsg.) (2009): Handbuch schulische Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Osbahr, S. (2000): Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Luzern: Edition SZH.
Pawlik, K. (1968): Diagnose der Diagnostik: Beiträge zur Diskussion der psychologischen Diagnostik in der Verhaltensmodifikation. Dimensionen des Verhaltens: Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse faktorenanalytischer psychologischer Forschung. Huber.
Pawlik, K. (1976): Diagnose der Diagnostik. Stuttgart: Klett.
Pawlik, K. (1982): Modell- und Praxisdimensionen psychologischer Diagnostik. In: Pawlik, K.: Diagnose der Diagnostik. Stuttgart: Klett, S. 13–43.
Pfeifer, W. u. a. (2005): Etymologisches Wörterbuch. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Powell, J. (2003): Hochbegabt, behindert oder normal? Klassifikationssysteme des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Deutschland und den Vereinigten Staaten. In: Cloerkes, G.: Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen. Heidelberg: Winter.
Prammer, W. (2009): „Assessment“ – Individuelle Förderplanung. In: BMUKK (Hrsg.): Sonderpädagogik aus inklusiver Sicht. Wien: Jugend & Volk, S. 98–110.
Prengel, A. (2006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden: Opladen.
Probst, H. (1981): Zur Diagnostik und Didaktik der Oberbegriffsbildung. Solms-Oberbiel: Oberbiel.
Probst, H. (1991): Inventar impliziter Rechtschreibregeln. In: Mitteilungen des Landesverbandes Bremen des VDS, 16. Jg., Heft 2.
Reulecke, W.; Rollett, B. (1976): Pädagogische Diagnostik und lernzielorientierte Tests. In: Pawlik, K. (Hrsg.): Diagnose der Diagnostik. Stuttgart.
Roth, G. (1994): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Sander, A. (1993): Kind-Umfeld-Diagnose: Ökologischer Ansatz in der Diagnostik. In: Hofmann, R. u. a.: Kinder mit Förderbedarf – Neue Wege in der sonderpädagogischen Diagnostik. Brandenburg (Päd. Landesinstitut).
Schachtner, Ch. (1999): Ärztliche Praxis. Die gestaltende Kraft der Metapher. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Schiefele, H. & Krapp, A. (1981): Handlexikon zur Psychologie. München: Ehrenwirth.
Schlee, J. (1985): Helfen verworrene Konzepte dem Denken und Handeln in der Sonderpädagogik? Eine Auseinandersetzung mit der „Förderdiagnostik“. Zeitschrift für Heilpädagogik, 36. Jg., S. 860–891.
Schley, W. (1988): Schüler verstehen –Schülern begegnen. In: Goetze, H.; Neukäter, H.: Disziplinkonflikte und Verhaltensstörungen in der Schule. München: Oldenburg.
Schmitt, R. (1995): Kollektive Metaphern des psychosozialen Helfens. In: report psychologie. Bonn, Heft 5–6, S. 389–408.
Schmitt, R. (1996): Metaphernanalyse und die Repräsentation biographischer Konstrukte. In: Journal für Psychologie. Heidelberg: Asanger Verlag, Doppelheft 1/1995–1/1996, S. 47–62.
Schmitt, R.(1997): Metaphernanalyse als sozialwissenschaftliche Methode. Mit einigen Bemerkungen zur theoretischen „Fundierung“ psychosozialen Handelns. In: Psychologie & Gesellschaftskritik. Mabuse-Verlag, Frankfurt, Nr. 81, 21. Jahrgang, Heft 1/1997, S. 57–86.
Schmitt, R. (1999): Rezension zu: Christa Baldauf. Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher. Lang. Frankfurt am Main, 1997. In: Journal für Psychologie, Jg. 7, Heft 4, Dezember 1999, S. 85–87.
Schmitt, R. (2002): Ein guter Tropfen, maßvoll genossen, und andere Glücksgefühle. Metaphern des alltäglichen Alkoholgebrauchs und ihre Implikationen für Beratung und Prävention. In: Nestmann, F.; Engel, F. (Hrsg.): Die Zukunft der Beratung – Visionen und Projekte in Theorie und Praxis. Tübingen: DGVT, S. 231–252.
Schmitt, R. (2002a): Nüchtern, trocken und enthaltsam. Oder: Problematische Implikationen metaphorischer Konzepte der Abstinenz. In: Sucht, 48(2), S. 103–107.
Schmitt, R. (2005): Entwicklung, Prägung, Reifung, Prozess und andere Metaphern. Oder: Wie eine systematische Metaphernanalyse in der Entwicklungspsychologie nützen könnte. In: Günter Mey (Hrsg.): Handbuch Qualitative Entwicklungspsychologie, S. 545–584. Köln: Kölner Studien Verlag.
Schmitt, R. (2010): Metaphernanalyse. In: Karin Bock, Ingrid Miethe (Hrsg.): Handbuch qualitative Methoden in der Sozialen Arbeit. S. 325–335, Opladen: Budrich.
Schmitt, R. (2011): Metaphernanalyse in der Erziehungswissenschaft. In: Sabine Maschke, Ludwig Stecher (Hrsg.): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. Fachgebiet: Methoden der empirischen erziehungswissenschaftlichen Forschung, Qualitative Forschungsmethoden, S. 1–34. Weinheim: Juventa.
Schnell, I; Sander, A. (2004): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Schuck, K. D. (1994): Probleme der Diagnostik in einer sich wandelnden Schule, In: Sonderpädagogik in Niedersachsen, 4/94, S. 4–30.
Schulte, D. (1976): Diagnostik in der Verhaltenstherapie. München: Urban & Schwarzenberg.
Schwarzer, Chr. (1979): Einführung in die pädagogische Diagnostik. München: Kösel.
Schwingel, M. (1995): Pierre Bourdieu zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (1998): Einheit in der Vielfalt: 50 Jahre Kultusministerkonferenz 1948–1998, Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand.
Sindelar, B. (2002): Verfahren zur Erfassung von Teilleistungsschwächen – Material und Handanweisung. Wien: Verlag Austria Press.
Soriano, V. (2002): Übergang von der Schule ins Berufsleben. Probleme, Fragen und Optionen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädgogischem Förderbedarf in 16 europäischen Ländern. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education (Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung).
Specht, W. (2006): Qualität in der Sonderpädagogik (QSP). Ansatz und ausgewählte Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Unser Weg, 61, Heft 3.
Specht, W.; Gross-Pirchegger, L.; Seel, A.; Stanzel-Tischler, E. u. a (2006): Qualität in der Sonderpädagogik. Ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Forschungsansatz, Ergebnisse, Schlussfolgerungen. ZSE-Report Nummer 70. Graz: Zentrum für Schulentwicklung 2006.
Specht, W.; Seel, A.; Stanzel-Tischler, E.; Wohlhart, D. & die Mitglieder der Arbeitsgruppen des Projekts QSP (2007): Individuelle Förderung im System Schule. Strategien für die Weiterentwicklung von Qualität in der Sonderpädagogik. Graz-Klagenfurt: bifie.
Strauss, A. (1991): Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen und soziologischen Forschung. München:Wilhelm Fink Verlag.
Strauss, A.; Corbin, J. (1996): Grounded theory. Grundlagen qualitativer Forschung. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
Suhrweier, H.; Hetzner, R. (1993): Förderdiagnostik für Kinder mit Behinderungen. Neuwied, Kriftel, Berlin: Hermann Luchterhand Verlag.
Temrock, G. (1998): Behinderung aus verhaltensbiologischer Sicht. In: Eberwein, H.; Sasse, A.: Behindert sein oder behindert werden. Berlin: Neuwied.
Tent, L.; Stelzl, I. (1993): Pädagogisch-psychologische Diagnostik. Band 1: Theoretische und methodische Grundlagen. Göttingen: Hogrefe.
Tent, L.; Waldow, M. (1984): Pädagogische Diagnostik in der Schule für Lernbehinderte: Gruppenbezogene Leistungsmessung oder Zielerreichungs-Tests? Heilpädagogische Forschung, Heft 11.
Tewes U. & Wildgrube K. (1992): Psychologie-Lexikon. R. München, Wien: Oldenburg Verlag.
Walthes, R. (1997): Behinderung aus konstruktivistischer Sicht. In: Neumann, J. (1997): Behinderung. Tübingen: Attempto Verlag.
Watkins, A. (2007): Assessment in inklusiven Schulen; Bildungspolitische und praxisorientierte Aspekte. Odense, Dänemark: European Agency for Development in Special Needs Education.
Weisser, J. (2005): Behinderung, Ungleichheit und Bildung. Eine Theorie der Behinderung. Bielefeld: transcript Verlag.
Witzel, A. (1982): Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Frankfurt am Main: Campus Wohlfahrt.
Wocken, H. (1996): Sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff. In: Sonderpädagogik, Heft 1.
Wunderlich, D. (1982): Sprache und Raum. In: Studium Linguistik 12, S. 1–19.
Ziemen, K. (2002) Das bisher ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder. Butzbach-Griedel: Afra Verlag.
Ziemen, K. (2003): Integrative Pädagogik und Didaktik. Aachen: Shaker Verlag. Ziemen, K. (2009): Rehistorisierende Diagnostik. Unveröffentlichtes Manuskript.
Bildungsserver Südtirol http://www.blikk.it/ [13.08.2010]
BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) (1996): Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Rundschreiben Nr. 15/1996. http://bsr.tsn.at/sonderpaed/?getPage=div/allgZielsetzung.html&menu=271 [19.02.2008]
BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), Abt. I/8 (2008): Rundschreiben Nr. 19/2008: Richtlinien für Differenzierungs- und Steuerungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2008_19.xml [21.04.2011]
BMUKK (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur), Abt. I/8 (2010): Der sonderpädagogische Förderbedarf; Qualitätsstandards und Informationsmaterialien http://www.cisonline.at [13.07.2011]
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) http://www.dimdi.de [24.06.2011]
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland http://nibis.ni.schule.de/~infosos/kmk-1994.htm [24.09.2012]
Feyerer, E.; Hauer, K. (2006): Individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit ASO-Lehrplan. Eine Bestandsaufnahme der Situation in Österreich (2005/06) und internationale Aspekte. Teilstudie im Rahmen des Projekts „Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im sonderpädagogischen Bereich“, 2006 www.cisonline.at/index.php [20.10.2008]
Hinz, A. (1993): Heterogenität in der Schule. Integration – Interkulturelle Erziehung - Koedukation. http://bidok.uibk.ac.at/texte [27.06.2009]
Informationen Reformpädagogik http://www.blikk.info/angebote/reformpaedagogik/infothek.htm [16.07.2011]
Kruse, J.; Biesel, K.; Schmieder, Chr. (2012): Rezension: Eine Replik auf: Schmitt, Rudolf (2011). Review Essay: Rekonstruktive und andere Metaphernanalysen [39 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 13(2), Art. 10 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1202102 [30.06.2012]
Lindmeier, Ch. (2010): Die neue internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO – Darstellung und Kritik http://www.uni-landau.de/instfson/joomla/lindmeier/ICF-Darstellung-und-Kritik.pdf [02.02.2012]
Parlamentarische Anfrage: Psychopharmaka bei Kindern und Jugendlichen http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_11821/fnameorig_255502.html [30.07.2012]
Pädagogische Hochschulen Österreichs http://www.paedagogischehochschulen.at [12.07.2012]
Schmitt, R. (2000): Rezension: Von der Schwierigkeit, Verstehen zu verstehen. Zu: Ronald Hitzler & Anne Honer (Hrsg.) (1999): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Eine Einführung [19 Absätze]. In: forum qualitative sozialforschung, fqs, [On-line Journal], 1(3) http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-00/3-00review-schmitt-d.htm [01.08.2011]
Schmitt, R. (2000a): Skizzen zur Metaphernanalyse. In: forum qualitative sozialforschung, fqs, [Online Journal], Vol. 1 (1) 2000 http://qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00schmitt-d.htm [02.08.2011]
Schmitt, R. (2003): Methode und Subjektivität in der Systematischen Metaphernanalyse [54 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 4(2), Art. 41 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0302415 [02.08.2011]
Schmitt, R. (2004): Diskussion ist Krieg, Liebe ist eine Reise, und die qualitative Forschung braucht eine Brille. Review Essay: George Lakoff & Mark Johnson (2003): Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern [54 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, Art. 19 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0402190 [03.08.2011]
Schmitt, R. (2005): Systematic Metaphor Analysis as a Method of Qualitative Research. The Qualitative Report, Volume 10, Number 2, June 2005, pp. 358–394 http://www.nova.edu/ssss/QR/QR10-2/schmitt.pdf [3.08.2011]
Schuntgermann, M. (2002): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Einführung und Kurzfassung der ICF http://www.vdr.de [16.03.2011]
Steingruber A.(2000): Der Behindertenbegriff im österreichischen Recht. Diplomarbeit an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität, Graz http://bidok.uibk.ac.at/texte/steingruber-recht.htm l [05.01.2011]
UN-Konvention – Schattenübersetzung http://www.slioe.at/downloads/themen/un/093_schattenuebersetzung-endgs.pdf [30.07.2013]
Anmerkung der bidok-Redaktion: Der Anhang kann unter http://bidok.uibk.ac.at/download/anhang-hoelzl.pdf herunter geladen werden.
Quelle
Christa Hölzl: SonderpädagogInnen als GutachterInnen. Der Prozess des Begutachtens aus der Perspektive von SonderpädagogInnen. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie. Eingereicht am Institut für Erziehungswissenschaften an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck. Erstbegutachterin: Univ.-Prof.in Dr.in Kerstin Ziemen, Universität Köln. Zweitbegutachter: Ao. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Stöger, Universität InnsbruckBibliographische Angaben / Zweckinformation und eventuelle weitere Hinweise.
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 29.01.15