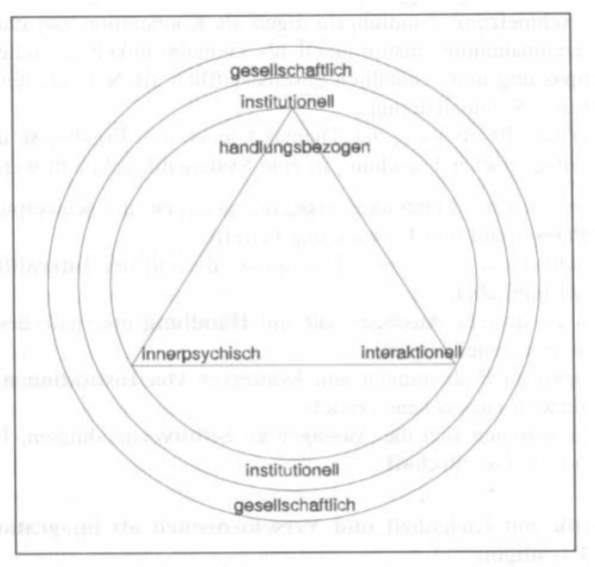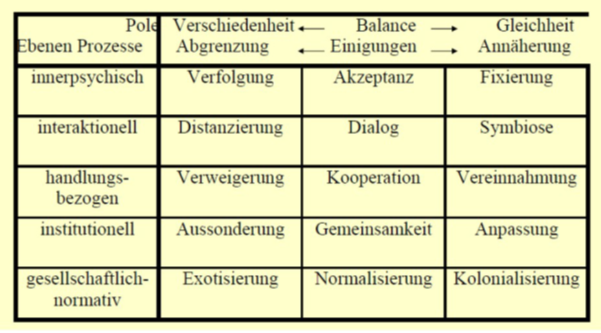Argumentationen entlang von Menschenrechten und Ökonomisierung
Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen; Eingereicht beim: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt Landesprüfungsamt für Lehrämter; Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz/ Zweitgutachterin: Ines Boban
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
-
1 Inklusion
- 1.1. Inklusion – historische Bedingungen des Begriffs in der deutschsprachigen Debatte
- 1.2 Der spezifische Fokus des Inklusionsbegriffs in Abgrenzung zur Praxis der Integration
- 1.3 Eckpfeiler der Vision Inklusion
- 1.4 Inklusion als Entwicklungsetappe des Bildungswesens
- 1.5 Inklusion – eine Frage des Umgangs mit Heterogenität
- 1.6 Menschenrechte – Normativer Bezugspunkt von Inklusion
- 2 Der Neoliberalismus als gesellschaftliche Bedingung von (inklusiver) Bildung
- 3 Zwischenfazit – Reflexionen über Inklusion im Kontext neoliberaler Transformationen
- 4 Untersuchung der Argumentationen eines Beitrags der Inklusionsdebatte
- 5 Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Selbstständigkeitserklärung
Abbildungsverzeichnis
Geht es um die paradigmatische Ausrichtung der Bildungspolitik in Deutschland, so kommen BeobachterInnen dieser Diskurse gegenwärtig an einem Begriff nicht vorbei: Inklusion. Mit der Salamanca-Erklärung der UNESCO-Konferenz von 1994 trat Inklusion als Ziel internationaler Bildungspolitik auf und spätestens seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2008, in der sich die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten, ist Inklusion ein bestimmendes Thema bildungspolitischer Auseinandersetzungen in Deutschland. Darüber hinaus ist das Thema wichtiger Bestandteil der LehrerInnenbildung und -fortbildung. Es gibt eine breite gesellschaftliche Debatte in den öffentlichen Medien um den neuen pädagogischen In-Begriff.
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Frage, warum Inklusion eigentlich zum pädagogischen In-Begriff avancierte. Dies konkretisiert sich in der Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen, auf deren Grundlage der Inklusionsbegriff seine Dynamik entwickelte. Bei der Frage nach gesellschaftlichen Bedingungen fällt der Blick auf gegenwärtige Analysen, die versuchen, unsere Gesellschaft als eine unter dem Vorzeichen neoliberaler Transformationen zu verstehen. Somit steht die Frage nach dem Verhältnis von Inklusion und Neoliberalismus im Blickpunkt des Interesses. Dies kulminiert in der Frage, ob es auch neoliberale Entwicklungen und entsprechende Gedanken und Argumentationen sind, die zur gegenwärtigen Ausrichtung an Inklusion beitragen. Um etwas darüber herauszufinden, gilt es, einen Beitrag zur Inklusionsdebatte exemplarisch zu untersuchen.
Um eine derartige Untersuchung realisieren zu können, soll zunächst in einem ersten Schritt ein Inklusionsverständnis herausgearbeitet werden, wie es im pädagogischen Fachdiskurs existiert. Zu diesem Zweck wird auf die historischen Bedingungen des Begriffs, seine Funktion im pädagogischen Diskurs, den spezifischen Gehalt, den der Begriff im pädagogischen Fachdiskurs erhielt, und seinen normativen Bezugspunkt eingegangen. Inklusion erscheint auf diese Weise nicht als ein stringentes Konzept, sondern als eine Vision, die sich aus verschiedenen Ansätzen speist. Alle vorgestellten Ansätze tragen, gerade in ihrer Spannung, zum hier vorgestellten Inklusionsverständnis bei. Es wird daher nicht versucht, mit theoretischer Härte ein einheitliches Bild zu entwickeln. Statt dessen ist es Ziel, über die Zusammenschau der einzelnen Ansätze eine umfassende Vorstellung der Gesamtidee zu vermitteln. Damit soll eine Reflexionsfolie für die Verwendung des Begriffs innerhalb der Debatte ausgebreitet werden.
Im nächsten Schritt wird versucht, herauszuarbeiten, was unter gesellschaftlichen Verhältnissen unter neoliberalem Vorzeichen verstanden werden kann. Zu diesem Zweck wird nach einer Begriffsbestimmung die historische Entwicklung der neoliberalen Lehre und ihrer politischen Umsetzung dargelegt. Im Anschluss werden mit Ausführungen zur Humankapitaltheorie und zur Neukonzeption des Staates zwei Kernaspekte neoliberalen Denkens und Handelns vorgestellt. Außerdem werden kritische Analysen zu deren Folgen behandelt. Diese Ausführungen dienen als Grundlage für die Identifikation neoliberaler Denkfiguren innerhalb der Debatte.
Bevor der Fokus der Arbeit sich jedoch direkt auf die Debatte richtet, soll zunächst theoretisch reflektiert werden, in welchem Verhältnis Inklusion und Neoliberalismus im jeweiligen hier dargelegten Verständnis zueinander stehen. Fallen Unterschiede in Grundannahmen und praktischen Konsequenzen auf, so liefert der theoretische Blick auf diese Unterschiede die Möglichkeit zur Bewertung bestimmter Argumentationen aus der jeweiligen Perspektive. Gleichzeitig wird mit Blick auf mögliche Berührungspunkte offenbar, in welchen Punkten die jeweilige Position geschärft werden müsste, um einer Vereinnahmung zu entgehen.
Derartig gerüstet soll im letzten Schritt ein Dokument der Inklusionsdebatte, in Anlehnung an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, untersucht werden. Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, wie sich auf den Inklusionsbegriff bezogen wird. Es wird überprüft, ob die Bezugnahme auf den Begriff mit dem dargelegten Verständnis von Inklusion vereinbar ist und in welcher Art und Weise Abweichungen vom dargelegten Verständnis identifizierbar sind. Außerdem ist von Interesse, ob neoliberale Denkfiguren Eingang in die Argumentation finden. Können vom pädagogischen Fachdiskurs abweichende Vorstellungen von Inklusion und neoliberale Denkfiguren identifiziert werden, so wären starke Indizien dafür geliefert, dass die gegenwärtige Ausrichtung an Inklusion in Zusammenhang mit neoliberalen Entwicklungen gedacht werden muss. Des Weiteren wären Ansatzpunkte für das Verständnis gegeben, auf welche Weise sich Inklusion für neoliberale Transformationen anbietet beziehungsweise wie Inklusion angepasst wird, um für neoliberale Transformationen nutzbar zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1. Inklusion – historische Bedingungen des Begriffs in der deutschsprachigen Debatte
- 1.2 Der spezifische Fokus des Inklusionsbegriffs in Abgrenzung zur Praxis der Integration
- 1.3 Eckpfeiler der Vision Inklusion
- 1.4 Inklusion als Entwicklungsetappe des Bildungswesens
- 1.5 Inklusion – eine Frage des Umgangs mit Heterogenität
- 1.6 Menschenrechte – Normativer Bezugspunkt von Inklusion
Inklusion ist ein relativ neuer Begriff in der pädagogischen Debatte. Hinz nennt in Anknüpfung an Skrtić (1995) eine Publikation von Reynolds (1976) als den Beginn der Inklusionsdebatte in den USA (vgl. Hinz 2008, 34). Auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada, dem „Geburtsland der inklusiven Schule“, kursierte der Begriff bereits eher (Sander 2002, 145). In der deutschen Debatte wurde der Begriff zunächst von der Integrationsbewegung aufgenommen und bekam so einen spezifischen Gehalt im deutschsprachigen Diskurs. Dieses Verständnis von Inklusion soll auch dieser Arbeit zu Grunde liegen und im Folgenden vorgestellt werden. Zunächst wird zu diesem Zweck genauer auf die Integrationsbewegung eingegangen, um verstehen zu können, welche Relevanz der Begriff in Deutschland bekam.
Unter dem Begriff der Integrationsbewegung wurden hauptsächlich Eltern, LehrerInnen, WissenschaftlerInnen aus dem Bereich (Sonder-)Pädagogik und Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit Behinderung gefasst, deren gemeinsames Bestreben die „schulische und gesellschaftliche Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderung“ war (Prengel 1995, 139). Vor allem Eltern waren dabei die „Integrationsantreiber vom Dienst“ (Mettke 1982, zit. n. Hinz. 1993, 21). „Im Kindergarten hatte man gute Erfahrungen mit dem gemeinsamen Spielen, Lernen und Leben gemacht, diese sollten weitergeführt werden“ (Schnell 2002). Daher gab es in den 70er Jahren verschiedene Modellversuche der gemeinsame Beschulung von Kindern, die als behindert, und Kindern, die nicht als behindert bezeichnet wurden. Auch WissenschaftlerInnen setzten sich für die gemeinsame Beschulung ein. „1973 verabschiedete die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates die ‚Empfehlung für die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher‛, die vom Ausschuss für Sonderpädagogik erarbeitet worden war“, dem verschiedene namhafte WissenschaftlerInnen angehörten (ebd.). „Die Empfehlung war das erste offizielle Dokument, das der bisherigen Ansicht, die separierte Förderung behinderter Kinder bereite deren Integration in die Gesellschaft vor, das gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder entgegensetzte und für alle Altersstufen Konzepte entwarf, die sich an der Gemeinsamkeit orientierten“ (ebd.). Dies hatte wiederum Wechselwirkungen mit der Praxis. „Die Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein in München, von dem Kinderarzt Theodor Hellbrügge gegründet, hatte seit 1970 gezeigt, dass die Gemeinsamkeit von Nichtbehinderten und Behinderten zum bereichernden Nutzen beider Seiten auch in der Schule zu realisieren sei. 1975 wurde in der Fläming-Grundschule in Berlin die erste Integrationsklasse an einer öffentlichen Schule eingerichtet“ (ebd.). Auch in die Politik hatte das Thema Einzug gehalten. „Die Freie Demokratische Partei (FDP) war die erste Partei, die in ihrem Programm nicht nur den Ausbau des Sonderschulwesens, sondern auch gemeinsames Lernen mit anderen als schulischen Weg für Kinder mit Behinderung in ihr Programm aufnahm“ (ebd.). „Es sollte aber noch bis in die 80er Jahre dauern, bis schulische Integration von Kindern mit Behinderung Thema des Wettstreits der Parteien wurde“ (ebd.).
„Die 80er Jahre können als das Jahrzehnt der Schulversuche in die Geschichte der Integrationsbewegung eingehen“ (ebd.). Im Zentrum vieler universitärer Institute stand „die wissenschaftliche Forschung als Begleitung von Modellversuchen zum Gemeinsamen Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung“ (ebd.). „Viele Forscher/innen sahen eine Chance, gute Pädagogik einer nichtaussondernden Schule zu beschreiben und auch die bildungspolitische Ausrichtung in ihrem Bundesland entsprechend zu beeinflussen“, was auch die Rolle von WissenschaftlerInnen in Bezug auf die Involviertheit mit dem Forschungsgegenstand fundamental veränderte (ebd.). Außerdem wurde Integration verstärkt Thema der Bildungspolitik, „da bei Ablehnungen des Regelschulbesuchs für ein Kind mit Behinderung jeweils eine breite Öffentlichkeit hergestellt werden konnte“, die dies kritisierte (ebd.). „In fast allen Bundesländern kämpften Eltern immer wieder darum, dass ihr Kind mit Behinderung eine Regelschule besuchen könne, und Parteien waren zur Stellungnahme aufgefordert“ (ebd.). „1986 war das Saarland dann das erste Bundesland, in dessen Schulgesetz festgehalten wurde, dass ‚der Erziehungs- und Unterrichtsauftrag der Schulen der Regelform grundsätzlich auch die behinderten Schüler‛ (SchOG) umfasse“ (ebd.). Weitere Landesregierungen folgten dem Beispiel, allerdings immer unter Haushaltsvorbehalten.
Die 90er Jahre brachten verschiedene neue Entwicklungen. „Die ‚Integrationseltern‛ der ersten Jahre befassten sich nun schon mit den Fragen, wie die Gemeinsamkeit Behinderter und Nichtbehinderter im beruflichen Leben bzw. der Vorbereitung darauf eingeleitet werden könne und welche Möglichkeit des Wohnens anzustreben sei“ (ebd.). Außerdem stieg die Zahl der SchülerInnen, die als behindert bezeichnet wurden, in Regelschulen an. „Das entspricht nicht zuletzt der ‚Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland‛, die von der Kultusministerkonferenz 1994 verabschiedet wurde […] und in deren Vorwort gesagt wird, dass sonderpädagogische Förderung zunehmend in Allgemeinen Schulen stattfinden solle und die Sonderpädagogik sich gegenüber der Allgemeinen Pädagogik in einem subsidiären Verhältnis zu verstehen habe“ (ebd.). „Eine weitere wichtige Weichenstellung war die Überwindung der Begriffe ‚Behinderung‛ und ‚Sonderschulbedürftigkeit‛, die mit der am Kind festgemachten defizitorientierten Diagnose schon die entsprechende schulische Einrichtung verbanden“, zugunsten der Feststellung des ‚Sonderpädagogischen Förderbedarfs‛ (ebd.). „Mit dem Jahr 1994 verbinden sich nicht nur in Deutschland Erwartungen an eine Weiterentwicklung des gemeinsamen Lernens. Die internationale Konferenz der UNESCO in Salamanca verabschiedete eine Erklärung, in der als Leitprinzip festgestellt wird, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen“ (ebd.). Der dies bezeichnende Begriff ‚Inclusion‛ des englischsprachigen Originals „wurde in der deutschsprachigen Fassung [...] mit ‚Integration‘ übersetzt – eben weil der pädagogische Inklusionsbegriff hier unbekannt war“ (Hinz 2013). „Die Salamanca-Erklärung stellte das Bildungswesen vor verschiedene Herausforderungen. Auch in europäischen Gremien wurden verschiedene Erklärungen verfasst, die die Bedeutung gemeinsamen Lernens betonten und Projekte anstießen, die schulische Integration in der Lehrerarbeit und Lehreraus- und -fortbildung verankern sollten“ (Schnell 2002). Folge war unter anderem die Errichtung von Sonderpädagogischen Förderzentren, die mit unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung versuchten, integrative Beschulung zu verbessern (vgl. ebd.). SonderpädagogInnen „waren mit der Ausweitung gemeinsamen Unterrichts für Kinder mit und ohne Behinderung zunehmend vor gänzlich neue Aufgaben gestellt“, was zu Debatten über sonderpädagogische Professionalität führte (ebd.). Außerdem deutete sich ein Wechsel in der theoretischen Perspektive an. „1993 erschienen von sonderpädagogischer Seite drei Werke, die die Bewältigung von Verschiedenheit in der Gleichberechtigung als pädagogische Herausforderung in der integrativen, der Koedukationspädagogik und in der Interkulturellen Erziehung begründeten. Schulische Integration wurde von der Autorin und den Autoren in den Zusammenhang der ‚Pädagogik der Vielfalt‛ (Prengel 1993 und Preuss-Lausitz 1993) bzw. der ‚Pädagogik der Heterogenität‛ (vgl. Hinz 1993) gestellt“ (ebd.). Dieser theoretische Switch fällt zusammen mit einer Kritik an der Praxis der Integration. Es fiel auf, dass „das Wesen gemeinsamen Lernens, das eine Reform für Schule und Unterricht im Sinne der Wahrnehmung der auf vielfältige Weise Verschiedenen beinhaltete, vielerorts in den Hintergrund“ geriet. In dieser Situation erwies sich der aus dem angloamerikanischen Raum importierte Begriff der Inklusion als fruchtbar für die deutschsprachige Fachdebatte; zum einen „als theoretischen Reflex eines geschärften Fokus angesichts einer konzeptionell verflachten und zunehmend problematischen Praxisentwicklung“ und zum anderen als treffendere Bezeichnung des Programms, in Folge des theoretischen Switches, im Sinne einer stärkeren Orientierung an Heterogenität (Hinz 2000, zit. n. Sander 2002, 147).
In Deutschland verhalf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2008 dem Begriff zum Durchbruch (vgl. Hinz 2013). „Und wie bei jedem Begriff, der eine neue Orientierung repräsentiert und damit allzu schnell zum unscharfen bis konturlosen Modebegriff wird [...], ist es auch bei Inklusion so, dass inzwischen nahezu alles als Inklusion deklariert wird, was sich positiv und fortschrittlich darstellen möchte. Das ist logisch und gleichzeitig dramatisch, weil damit die inhaltliche Klarheit dessen, was Inklusion ursprünglich als Innovationsperspektive bedeutet, immer mehr verloren geht“ (ebd.). Daher soll im Folgenden versucht werden, ein spezifisches pädagogisches Verständnis von Inklusion in der deutschsprachigen Debatte herauszuarbeiten.
Um das Besondere am inklusiven Fokus im Sinne einer optimierten Integration zu verstehen, macht es Sinn, sich der Kritik an der Praxisentwicklung der Integration zu widmen, was im Folgenden geschehen soll.
Hinz benennt qualitative und quantitative Probleme in der Integrationsentwicklung (vgl. Hinz 2004, 43). „Quantitativ problematisch ist die Tatsache, dass der gemeinsame Unterricht sich nicht – wie ursprünglich erhofft und aus vielen anderen Reformbewegungen wohl bekannt – zu einem ersetzenden System hat entwickeln können, sondern ein ergänzendes System geblieben ist – neben dem gegliederten Schulwesen, im Rahmen eines gestuften und damit selektiven Systems unterschiedlicher Angebote und ‚Integrationsstufen‛“ (ebd.). Außerdem kam es zu einer finanziellen Stagnation und zu „einem geradezu explosionsartigen Anwachsen sonderpädagogischen Förderbedarfs […], was vor dem Hintergrund der folgenden widersprüchlichen Logik folgerichtig ist: Je höhere Zahlen von SchülerInnen mit Special Educational Needs, desto höher die zusätzlichen Ressourcen, die die Situation verbessern helfen sollen“ (Hinz 2004, 44).
Probleme im qualitativen Bereich lagen unter anderem auf der Ebene der Strukturen. Jene wurden zwar modifiziert, sodass integrative Wege überhaupt möglich wurden. Eine grundlegende Veränderung der Strukturen fand jedoch nicht statt (vgl. ebd.). Außerdem fehlt bis heute häufig eine Revision tradierter Sichtweisen. „Das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit Special Educational Needs, mit Funktionsdiagnose ist primär – und das auch innerhalb integrativer Strukturen – das Kind mit Problemen, das ‚andere‛ Kind, das funktionsgeminderte Kind, bei dem die tradierte Alltagstheorie der Andersartigkeit oder zumindest die Dominanz des Andersseins weiter besteht. Und je mehr dieses Kind anders, also problematischer, schwächer, geminderter, defizitärer... ist, desto weniger kann es integriert werden“ (ebd.). Hierfür lassen sich verschiedene Beispiele auch im deutschen Schulsystem finden (s. ebd.).
Zusammenfassend lässt sich die Praxis der Integration und der Inklusion folgendermaßen vereinfacht gegenüberstellen:
|
Praxis der Integration |
Praxis der Inklusion |
|---|---|
|
|
Für den spezifisch inklusiven Fokus, wie er in der deutschen Debatte unter den dargestellten Bedingungen entstand, wurden vier Eckpunkte formuliert. Sie tauchen in Veröffentlichungen von Hinz in verschiedenen Formulierungen mit unterschiedlichen Gewichtungen und Umfängen auf. Im Folgenden sollen die Eckpunkte vorgestellt werden. Ich beziehe mich hier auf eine Formulierung, die zum einen sehr aktuell und zum anderen sehr umfangreich ist, da sie meines Erachtens den spezifischen Fokus am besten trifft.
-
„Im inklusiven Verständnis ist die Vielfalt von Menschen etwas Positives, mit dem die Beteiligten so umgehen, dass sie – bei allen Konflikten und Spannungen – für die Entwicklung von Menschen und ihr Zusammenleben förderlich ist und nicht durch Aufteilung und Zuordnung ‚wegorganisiert‛ werden muss.
-
Eine inklusive Sicht bezieht sich auf alle Aspekte der Vielfalt von Menschen, seien es unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, Erstsprachen, Hautfarben, soziale Milieus, Religionen, sexuelle Vorlieben, körperliche Bedingungen, politische und philosophische Orientierungen und andere Aspekte mehr. Dabei sind nicht die ‚Merkmale‛ an sich bedeutsam, sondern die gesellschaftlichen Bedeutungen, mit denen sie verbunden werden und durch die das Individuum hinter einer dominierenden, negativ (oder auch positiv) bewerteten, zugeschriebenen Eigenschaft zu verschwinden droht. Hinter jedem dieser Aspekte steht jeweils eine Debatte um gesellschaftliche Diskriminierung – um Sexismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Fettismus, Homophobie, Islamophobie, Adultismus usw.. Diese Aspekte werden nicht wie bisher getrennt diskutiert, sondern in einen Gesamtzusammenhang gebracht.
-
Inklusion ist an universellen Menschenrechten und der Bürgerrechtsbewegung orientiert. Sie wendet sich gegen jede Form von Diskriminierung und Marginalisierung, also jede Tendenz, eine Person aufgrund von Zuschreibungen und/oder exklusiver Strukturen und Rahmenbedingungen an den Rand zu drängen und Barrieren für ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Partizipation aufzubauen.
-
Inklusion ist keine primär pädagogische Orientierung, sondern eine weltweite gesamtgesellschaftliche Entwicklungsperspektive mit der Vision einer inklusiven Gesellschaft, die sich in allen Bereichen mehr und mehr realisieren soll – auch in der Bildung“ (Hinz 2014a, 17 f.).
Ein Dokument, in dem Inklusion als Forderung für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklungsperspektive aus der Perspektive von Menschen, denen eine Behinderung zugesprochen wird, dargestellt ist, ist die Deklaration von Madrid, die von über 600 TeilnehmerInnen am Europäischen Behindertenkongress 2003 vorgelegt wurde. Sie soll hier vorgestellt werden, um als Beispiel für den inklusiven Anspruch an gesellschaftliche Verhältnissen zur Verfügung zu stehen. Zentrale Forderungen sind eine umfassende Antidiskriminierungs-Gesetzgebung, Dienstleistungen, die ein unabhängiges Leben sichern, Unterstützung der Familien von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen, mit besonderem Fokus auf eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt, Kooperation mit Selbstvertretungsverbänden bei Fragen, die den Personenkreis betreffen und öffentliche Bildung für ein besseres Verständnis der Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und damit erhoffte Einstellungsänderungen (vgl. Deklaration von Madrid 2003). Die einseitige Fokussierung des Dokuments auf den Aspekt der Behinderung widerspricht einem inklusiven Anspruch. Dies liegt jedoch in der Logik einer Deklaration eines Behindertenkongresses begründet. Die vorgelegten Forderungen ließen sich mühelos als für alle Menschen gültig stellen.
Inklusion in diesem Verständnis wird zur Utopie oder zur Vision, die „nie als vollständig erreichbar angesehen werden kann“, sondern eher als „normative[r, d. V.] ‚Nordstern‛ […] Orientierung für nächste konkrete Entwicklungsschritte“ geben kann (Hinz 2014a, 18).
Diese Entwicklungsschritte lassen sich als Schritte auf einem Weg mit bestimmten Etappen verstehen. Auch in diesem Licht erscheint Inklusion als optimierte Integration und wird von Sander als eine der Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik verstanden, aus denen Hinz Entwicklungsetappen des Bildungswesens ableitet (vgl. Sander 2002, 147 & Hinz 2004, 47). „Sander unterscheidet im Anschluss an Bürli (1997) und Wilhelm/ Bintinger (2001, 45) insgesamt fünf Phasen“ (Hinz 2004, 47). Die Phasen werden an dieser Stelle nicht verstanden, als einander ablösend, als klar voneinander getrennt oder empirisch überprüfbar. Vielmehr werden sie begriffen, als einander überlagernd und eine Richtung anzeigend. Sie verdeutlichen notwendige Transformationen im Sinne inklusiver Entwicklungen und eine Vorstellung des Horizonts, entlang dessen sich diese Transformationen vollziehen. Daher werden die Etappen an dieser Stelle als weiterer Aspekt zum Verständnis eines inklusiven Anspruchs vorgestellt. „Am Anfang steht die Phase der ‚Exklusion‛, gefolgt von der Zeit der ‚Segregation‛, an die sich wiederum die ‚Integration‛ anschließt, die abgelöst wird von der ‚Inklusion‛ – bevor es schließlich zu einer ‚Allgemeinen Pädagogik‛ mit ‚Vielfalt als Normalfall‛ […] kommt“ (ebd.). „In der Phase der Exklusion werden bestimmte Personen ganz und gar aus dem System der Bildung und Erziehung ausgeschlossen“ (ebd.). „Bei der Segregation werden alle Kinder und Jugendlichen nach bestimmten Kriterien – vorrangig nach Leistung, aber […] auch nach sozialem Milieu – in je eigenen Institutionen gruppiert“, was dem gegliederten Schulsystem entspricht (Hinz 2004, 48). Integration wird in dieser Konzeption als eine Phase verstanden, in der marginalisierte Gruppen in eine dominante Gruppe der Normalen „hinein integriert“ werden, was von „Integrationsaktivität der Normalen und Integrationspassivität der Anderen“ gekennzeichnet ist (vgl. Hinz 2004, 49). In der Phase der Inklusion befinden sich alle in einer Gruppe und es gibt keine dominante Normalität mehr (vgl. ebd.). „Hier stellt sich nicht mehr die Frage, welche Personen […] integriert werden können, da sich alle von vornherein in der […] heterogenen Gruppierung befinden. Keiner muss sich mehr […] für die Zugehörigkeit qualifizieren“ (ebd.). „In der Phase der Allgemeinen Pädagogik sind Vielfalt und Heterogenität nichts Außergewöhnliches mehr, daher braucht es keinen eigenen Begriff mehr für einen spezifischen Ansatz oder ein Konzept. Inklusion geht in einer allgemeinen Pädagogik auf und ist kein eigenständiges Thema mehr“ (Hinz 2004, 50). Die Etappen sind hier für das Bildungssystem formuliert. Dem gesamtgesellschaftlichen Anspruch von Inklusion entsprechend, ließe sich das Modell auf alle Bereiche der Gesellschaft übertragen.
Nachdem der spezifische Fokus der Inklusion, abgeleitet aus ihrem Entstehungskontext in Deutschland in Abgrenzung zur verflachten Praxis der Integration mit spezifischen Eckpunkten und als Etappe des Bildungswesens dargelegt wurde, soll sich im Folgenden der Frage gewidmet werden, was genau passiert, wenn Menschen zusammenkommen, um mit einer Orientierung an der Vision der Inklusion eine gemeinsame Praxis des Zusammenlebens zu gestalten. Hierbei lohnt sich interessanterweise ein Blick in die Integrationstheorie, denn die „Theorie der deutschsprachigen Integrationspädagogik zeigt von Anfang an, ein aus heutiger Sicht, inklusives Verständnis der Integration, sie hat immer schon unterschiedliche Dimensionen von Heterogenität thematisiert“ (Hinz 2004, 55).
Wie lässt sich nun der Umgang mit Heterogenität theoretisieren? Folgende drei Modelle zum Umgang mit Heterogenität werden unterschieden:
-
Das Separierungsmodell (entspricht der Segregation)
-
„postuliert die anthropologische Dominanz von Verschiedenheit, derzufolge die jeweils Anderen in je eigenen Systemen gebildet und erzogen werden sollen“ (Hinz 2004, 59).
-
-
Das Anpassungsmodell (entspricht der Integration)
-
„postuliert gerade das Gegenteil: Anthropologisch dominiert die Gleichheit, derzufolge die allgemeine Normalität das Verbindliche darstellt, das ergo in einem gemeinsamen System so vermittelt wird, dass diese allgemeine Normalität auch von allen übernommen wird und sie sich möglichst entsprechend entwickeln“ (ebd.).
-
-
Das Ergänzungsmodell (entspricht der Inklusion)
-
„geht von einem dialektischen Verständnis von Gleichheit und Differenz aus und folgert daraus das Primat von Gemeinsamkeit bei individueller Verschiedenheit“ (ebd.).
-
Wie genau kann sich aber ein inklusives Eingehen auf Heterogenität vorgestellt werden? Hier macht die Theorie integrativer Prozesse ein Angebot für ein näheres Verständnis, welches trotz der noch verwendeten Terminologie der Integration auch einer inklusiven Denkrichtung zugrunde gelegt werden kann. Sie wurde von einer Frankfurter Arbeitsgruppe um Reiser erarbeitet, die davon ausgeht, dass eine „möglichst weitgehende Gemeinsamkeit in der Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder eine demokratische Selbstverständlichkeit sein sollte“ (Reiser 1986, zit. n. Jacobs 2005, 23).
Reiser beschreibt Integration als ein Ziel, jedoch nicht im Sinne eines „Zielpunktes auf einer physikalischen Wegstrecke“, sondern in einem „existentiellen Sinne“ (Reiser 1991, 14). Dies verdeutlicht, dass Integration nicht als Zustand, sondern als dynamischer Prozess verstanden wird. Dieses Ziel „beschreibt die immerwährende Lust, eine dynamische Balance herzustellen zwischen zwei Tendenzen“ (ebd.):
-
Tendenz zur Gleichheit, Verbundenheit, Annäherung mit anderen Menschen
-
Tendenz zur Abgrenzung, Differenz, Autonomie meiner Person (vgl. ebd.)
Diese beiden Tendenzen sind laut Reiser dialektisch ineinander verschränkt. Demzufolge schließen sie sich nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig. Diese Dialektik der Tendenz zur Gleichheit und der Tendenz zur Differenz ist der „Motor integrativer Prozesse“ (ebd.).
Wie sehen diese Prozesse aus? Reiser beschreibt sie wie folgt: „Als integrativ beschreibe ich Prozesse, bei denen zwischen Personen, zwischen Personengruppen, zwischen inneren Persönlichkeitsanteilen Annäherungen und Abgrenzungen stattfinden, die eine jeweils für die Situation passende und jeweils spezifische dynamische Balance von Gleichheit und Differenz herstellen“ (ebd.).
Dabei kommt es bei den Annäherungen und Abgrenzungen darauf an, dass „Einigungen zwischen widersprüchlichen innerpsychischen Anteilen, zwischen interagierenden Personen und auf gesellschaftlicher Ebene zustande kommen“ (Reiser 1986, zit. n. Jacobs 2005, 24). „Balancierte Widersprüche stellen dabei einen Idealzustand dar, der bisweilen nur schwer herstellbar ist. Die Einigung von Widersprüchen hat eher den Charakter einer »vorläufigen Positionsfindung mit weiterem Klärungsbedarf« auf einem Kontinuum zwischen den Polen“ (Cloerkes 2001, 188). Reiser weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Prozesse Wege sind, „die von Individuen und Gruppen selbst gegangen werden müssen“ (Reiser 1991, 16). PädagogInnen haben nur die Möglichkeit, förderliche Bedingungen im Sinne des Ziels der Herstellung einer Balance von Gleichheit und Differenz zu erzeugen. Förderliche Bedingungen können bestimmte Formen der Kommunikation und gemeinsame Tätigkeiten sein (vgl. Reiser 1991, 15). Nach der Herstellung förderlicher Bedingungen sollten PädagogInnen versuchen, wahrzunehmen, welche integrativen Prozesse durch Annäherung und Abgrenzung in Gang kommen. Diese Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse lassen sich auf verschiedenen Ebenen beschreiben, die sich wechselseitig bedingen. Folgende fünf Ebenen werden unterschieden und von Hinz (1993) in einem Modell angeordnet (vgl. Abb. 1).
Die Ebenen sind hilfreich, um die Analyse des Integrationsprozesses zu strukturieren, da für jede Ebene spezifische Ansprüche formuliert werden (vgl. Jacobs 2005, 25). Am Ende der Analyse kann versucht werden, gemäß dem Richtziel, weitere förderliche Bedingungen zu schaffen, wodurch sich folgender Kreislauf ergäbe (vgl. Abb. 2).
Ein mögliches Handwerkszeug zur Strukturierung dieser Kreisläufe in der Praxis ist der Index für Inklusion.
Welche Prozesse laufen nun im Einzelnen auf den unterschiedlichen Ebenen ab? Wie sieht jeweils Annäherung, Abgrenzung und Einigung aus? Diesen Fragen wird sich im folgenden Abschnitt intensiver gewidmet, um die Anforderungen auf den verschiedenen Ebenen besser zu verstehen.
1. Innerpsychische Ebene
„Die innerpsychische Ebene ist die Grundlage aller folgenden Ebenen insofern, als ohne sie auf allen weiteren Ebenen keine Einigungen gelingen können“ (Klein 1997, zit. n. Hinz 1993, 49). Eine Einigung auf der innerpsychischen Ebene kann gelingen, wenn „Personen ihre widersprüchlichen Empfindungen und Impulse zueinander in Beziehung [bringen, d. V.], ohne eigene Anteile verdrängen oder verleugnen zu müssen“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 25). Gerade in Begegnungen mit Behinderung treten Gefühle auf, die verursachen, dass wir uns „existentiell getroffen“ und „persönlich verletzt“ fühlen (Milani-Comparetti 1985, zit. n. Jacobs 2005, 26). Auf der innerpsychischen Ebene kommt es darauf an, diese und andere ungeliebte Empfindungen zu akzeptieren. Die eigenen Schwächen wahrzunehmen und zu akzeptieren, gilt als eine entscheidende Voraussetzung dafür, mit Schwächen von Mitmenschen verständnisvoll umzugehen. Das heißt im Umkehrschluss: „Wenden wir uns nicht unserer eigenen dunklen Seite zu, werden wir kaum in der Lage dazu sein, sie bei anderen zu ertragen“ (Hinz 1993, 50). Dies geschieht, wenn wir die zwei folgenden nicht-integrativen Strategien auf der innerpsychischen Ebene verfolgen. Bei der Verleugnung dieser Empfindungen, „versuchen wir diese Anteile zu vernichten, wir behaupten, dass sie in uns nicht existieren“ (ebd.). Wenn wir die Strategie der Verfolgung anwenden, sondern wir diese Empfindungen aus. Es kann dazu kommen, dass wir sie als Projektion stellvertretend besonders scharf bei anderen bekämpfen (vgl. ebd.). Diese Form der Abgrenzung drückt sich innerhalb der Schule beispielsweise im „Therapiewahn“ aus, da hier alles von der Norm abweichende behoben werden soll. Es wird verfolgt (vgl. Jacobs 2005, 26). Integrativ wirken Prozesse auf der innerpsychischen Ebene, wenn Einigungen zwischen widersprüchlichen Anteilen zustande kommen. Einigungen erfordern nicht unbedingt „einheitliche Interpretationen [sondern, d. V.] den Verzicht auf die Verfolgung [und Verleugnung, d. V.] des Andersartigen [und Unangenehmen, d. V.] und stattdessen die Entdeckung des gemeinsam Möglichen bei Akzeptanz des Unterschiedlichen“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 26).
2. Interaktionelle Ebene
Die interaktionelle Ebene erfasst den Aspekt der Gruppenbeziehungen und den Aspekt des gemeinsamen Handelns. Sie ist Voraussetzung für Prozesse auf der innerpsychischen Ebene, da nur durch Begegnung eine Einigung erfolgen kann, „aus der wiederum Akzeptanz resultiert“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 27). Sie baut jedoch auch auf der innerpsychischen Ebene auf, da unser Verhalten in der Interaktion abhängig von unseren inneren Haltungen ist. Integrativ wirken hier Prozesse, in denen „verschiedene Personen sich ganzheitlich wahrnehmen und begegnen und dabei die Erfahrung der Differenz und der Gleichheit machen“ (Wocken 1998, zit. n. Jacobs 2005, 27). In diesen Begegnungen sollte ein Dialog entstehen, „bei dem wir andere in ihren Widersprüchen wahrnehmen können und uns [selbst, d. V.] treu bleiben“ (Hinz 1993, 50). Nicht-integrative Begegnungen lassen sich wie folgt beschreiben. Bestimmte Empfindungen können dazu führen, dass wir Personen komplett ablehnen, was zur Entfremdung von dieser Person führen kann. Bei konsequenter Ablehnung einer Person ist Gleichheit schwer erlebbar und somit vergrößern sich die Unterschiede zwischen den Personen. Es kann aber auch sein, dass wir uns so mit einer anderen Person identifizieren, „dass wir genau wie sie und mit ihr eins sein sollen“ (ebd.). So entstehende Verschmelzungen führen zu einer Verwischung der Unterschiede. Sinnvoller erscheint es, eine „akzeptierende Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden“ in den dialogischen Begegnungen anzustreben (Wocken 1998, zit. n. Jacobs 2005, 27).
3. Handlungsbezogene Ebene
Ursprünglich war der Handlungsaspekt Teil der interaktionellen Ebene. Diese Ebene wurde erst im Zuge einer Modifizierung hinzugefügt. Um diesen Aspekt als wichtigen Teil schulischer und gesellschaftlicher Realität mehr zu gewichten, wurde „der kooperative Arbeitsprozess, der Tätigkeitsaspekt, einbezogen, der innerhalb Feusers Theorie des gemeinsamen Gegenstands betont wird“ (Jacobs 2005, 28). Integrativ wirken auf dieser Ebene Prozesse, „in denen Personen gemeinsam an einem Gegenstand/ Vorhaben mit dem Ziel, Realität zu bewältigen, arbeiten. Dies erfordert vielfältige und individuell gestaltbare Kooperationsmöglichkeiten“ (Reiser 1990, zit. n. Jacobs 2005, 28). „Die Kooperation stellt die dialektische Aufhebung zwischen den widersprüchlichen Tendenzen Verweigerung und Vereinnahmung dar“ (Jacobs 2005, 28).
4. Institutionell bestimmte Ebene
Auf dieser Ebene „geht es um die Frage, inwieweit konzeptionelle und institutionelle Rahmenbedingungen einen Spielraum für die Verschiedenheit von Menschen lassen“ (Hinz 1993, 50). Die Einrichtung integrativer Gruppen ist die „administrative Grundlage der Integration“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 28). Eine solche Gruppe, sei es eine Schule oder KITA oder irgendeine andere Institution, „nimmt die Kinder [(und andere Menschen auch), d. V.] an, wie sie sind, und versucht, ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu entsprechen“ (Hinz 1993, 50). Gegenläufig hierzu ist die Errichtung von separierenden Sondereinrichtungen, die Vorlagen und Bestimmungen haben, „auf die sich die Menschen in ihnen einzustellen haben“, wie beispielsweise Schulen für Erziehungshilfe oder Gymnasien (ebd.). Wenn Menschen diese Vorlagen nicht erfüllen, werden sie nicht in dieser Institution aufgenommen und in eine andere überwiesen. In diesen Fällen kommt es zur Aussonderung. Die Homogenisierungsversuche durch institutionelle Aussonderung bringen „die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit durch starre Einteilung von Individuen zum Stillstand“, indem die Menschen unter dem Vorwand der Gleichförmigkeit geführt werden (Jacobs 2005, 28). Eine weitere mögliche, nicht-integrative Folge der Errichtung von separierenden Sondereinrichtungen ist der Versuch der Anpassung von Menschen, die „scheinen in die Grenzen der Institution zu ’passen’, aber […] noch ’passender’ gemacht werden“ können (Hinz 1993, 50). „Der […] Therapiewahn ist ein Ausdruck dieses Anpassungsversuches“ (Jacobs 2005, 28). Wenn die Anpassung nicht gelingt, ist Aussonderung die Folge. Im Gegensatz dazu wird in integrativen Institutionen Heterogenität als Bereicherung gesehen. Wichtig bleibt zu erwähnen, dass die bloße Einbeziehung aller Menschen in die Institution nicht Integration garantiert, was durch die zuvor in Kapitel 1.2 beschriebene Verflachung der integrativen Praxis deutlich wird.
5. Gesellschaftliche Ebene
„Auf dieser Ebene geht es um den zentralen Widerspruch zwischen individuellen Maßstäben und Einstellungen einerseits und gesellschaftlichen Normen und Werten andererseits“ (Hinz 1993, 51). Wie kann mit diesem Widerspruch umgegangen werden? Es gibt eine nicht-integrative Tendenz auf dieser Ebene, die sich dadurch auszeichnet, dass alles von der Norm Abweichende für falsch, schädlich, schlimm etc. gehalten wird. Die Folge ist, dass die Gesellschaft sich abgrenzt, indem „geringe Ungleichheit als ’anormal’ exotisiert wird“ (ebd.). Der dialektische Pol zu dieser Exotisierung ist die „normative Kolonialisierung“ (ebd.). Dies beschreibt die Ausübung von Druck gegenüber den Exoten, sich den „bestehenden normativen Erwartungen anzugleichen. […] Integrativ wäre demgegenüber eine Haltung, die die Verschiedenheit von Normen, Vorstellungen und Verhaltensweisen anerkennt, ohne sie in eine Hierarchie zu fügen“ (ebd.).
Hinz fasst die „Ebenen integrativer Prozesse im Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit und mit den Prozessen der Abgrenzung und Annäherung in ihrer Widersprüchlichkeit“ in folgender Tabelle zusammen (Hinz 1993, zit. n. Jacobs 2005, 29) (vgl. Abb. 3).
Nach diesem Ansatz ist Integration nicht nur beschränkt auf das Verhältnis von Gesellschaft zu Minderheitengruppen. Sie ist ein Ziel für alle Bereiche menschlichen Zusammenkommens, „auch im Verhältnis der Geschlechter, im Verhältnis der Generationen, im Verhältnis verschiedener Kulturen“ (Reiser 1991, 16). Diese Reihe ließe sich beliebig um alle Aspekte der Heterogenität fortsetzen. Eine Grundvoraussetzung für gelingende Integration ist die Akzeptanz der grundsätzlichen Gleichheit, aber auch der Verschiedenheit aller Menschen. Dann lässt sich beginnen, die „immerwährende Lust“ aufzubringen, eine Balance herzustellen zwischen den Tendenzen.
Nachdem Ziele und Prozesse inklusiver Praktiken dargelegt wurden, soll im letzten Schritt der Darstellung des hier vorgelegten Inklusionsverständnisses der Frage nachgegangen werden, in welchem Begründungszusammenhang die Vision der Inklusion steht. Meyer weist in Anlehnung an Bernhard auf den Bedarf einer ethischen Begründung von Inklusion hin (vgl. Meyer 2013). „Das Fehlen einer solch ethischen Begründung birgt die Gefahr, dass Inklusion von Akteuren definiert und vereinnahmt wird, die ihre Einflussnahme im Sinne einer neoliberalen Umstrukturierung geltend machen“, argumentiert er im weiteren Textverlauf (ebd.). Wie steht es nun um die Begründung der Inklusion? In den Anfangsjahren der Integrationsbewegung ging es noch allgemein um den Kampf gegen gesellschaftlichen Ausschluss und die damit verbundene Ungerechtigkeit. Im Zuge der BürgerInnenrechtsbewegungen der 60er Jahre wurde „hierarchischen Ordnungen und Vorrechten einzelner gesellschaftlicher Gruppen die Gleichberechtigung aller entgegengesetzt“ (Schnell 2002). „Die politischen und sozialen Zusammenschlüsse und Aktionen von Menschen mit Behinderungen wurden zunehmend professioneller und weiteten sich aus“ (DIMR 2014). „Viele Schwierigkeiten, mit denen sich behinderte Menschen konfrontiert sahen, waren weniger auf ihre individuellen Einschränkungen zurückzuführen, sondern vor allem das Resultat gesellschaftlicher Barrieren und Ausgrenzungen. Diese wollten sie nicht länger akzeptieren und hinnehmen. Immer mehr Menschen bezeichneten diese Einschränkungen und Ausgrenzungen als Verletzung ihrer Menschenrechte“ (ebd.). 2006 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung verabschiedet, die 2008 in Kraft trat und seit 2009 auch in Deutschland gilt (vgl. ebd.). In dieser Konvention ist Folgendes festgehalten: „Jeder Mensch hat ein Recht auf ‚Inklusion‛, also darauf, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein“ (ebd.). Dementsprechend wurde auch die Inklusionsdebatte maßgeblich durch die Konvention befeuert. In den letzten Jahren häufen sich wissenschaftliche Publikationen, die den Menschenrechtsaspekt im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte erörtern (s. u.a. Schulze 2011, 11-27, Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31-53). Auch bei Hinz findet sich die Formulierung, dass die „Realisierung von Menschenrechten“ die „normative Basis von Inklusion“ ist (Hinz 2014b, 2). Auch in den Eckpunkten von Inklusion tauchen die Menschenrechte als Orientierung für Inklusion auf (vgl. Kap. 1.3). Daher soll sich im Folgenden genauer mit den Menschenrechten und insbesondere mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihrem Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte beschäftigt werden.
„Ein Blick in die Geschichte der Menschheit zeigt, dass mit der Gleichheit aller Individuen nicht immer verantwortungsvoll umgegangen wurde. Um diesem entgegenzuwirken, kam die Menschenrechtsidee auf, die im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und bis heute nicht vollendet wurde“ (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31). „Menschenrechte sind jene Rechte, die man Kraft Menschseins hat“ (Schulze 2011, 11). „Die Menschenrechte fungieren als Grundlage internationaler und nationaler Gesetzgebungen“ (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31). „Die Angaben, wann erstmalig von den Grundgedanken der Menschenrechte gesprochen werden kann, sind nicht eindeutig. Etwa ab dem 10. Jh. vor Chr., als das Judentum entstand, wurde die Gesinnung der Menschen durch die Aussage, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf, geprägt. Zwar lassen sich keine fassbaren Instruktionen für das heutige Handeln ausmachen, aber dennoch sind sie wesentlich für die Welt- und Menschenauffassung, aus denen die heutigen Menschenrechtsbestimmungen bestehen. Essenziell für die Menschenrechtsidee war das Christentum, das durch die Lehren und das Handeln Jesu geprägt wurde. Die tatsächliche Umsetzung sah mitunter anders aus. Den Umbruch schaffte die Aufklärung, die jedem Menschen Rechte zusprach. Dazu gehörten das Recht auf Privateigentum und der Schutz vor beliebiger Verhaftung sowie die Religionsfreiheit“ (Weiß 2002, zit. n. ebd.).
Die Idee der Menschenrechte erlebte im Nationalsozialismus eine schwere Erschütterung. Die Grausamkeiten der Terrorherrschaft führten vor Augen, wie eine Welt aussieht, in der Menschenrechte keine Beachtung erfahren oder bestimmten Gruppen nicht zuerkannt werden. Es war vor allem Franklin D. Roosevelt (Präsident der Vereinigten Staaten von 1933 bis 1945), der daraus auf die Etablierung von Menschenrechten nachwirkende Konsequenzen zog. „In einer Rede am 6. Januar 1941 stellte er, in Reaktion auf den Nationalsozialismus, die ‚Vier Freiheiten‛ vor. Wenn diese Freiheiten für alle Staaten gelten würden, so Roosevelts Hoffnung, wäre die Welt in Zukunft sicherer und friedlicher“ (DIMR 2014). Es handelte sich um die Freiheit von Not und Furcht, sowie die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit der Religionsausübung, welche er für die ganze Welt einforderte (vgl. ebd.). Kurz vor seinem Tod 1945 bereitete Roosevelt die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen vor (vgl. ebd.). Er „forderte als Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus eine Einigung aller Staaten auf die universelle Geltung der Menschenrechte“ (ebd.).
„Im Dezember 1948 veröffentlichten die Vereinten Nationen (UN) eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aufgrund von einigen Differenzen innerhalb der Staaten wurden die Menschenrechtspakte allerdings erst 1966 verabschiedet und erst 10 Jahre später verwirklicht“ (Weiß 2002, zit. n. Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 32). „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“, heißt es im ersten Artikel der Erklärung und somit ist eine Grundlage für das Verständnis des Anliegens der Erklärung geschaffen (AEMR 1948, 2). Die folgenden 29 Artikel sind Versuche, diesen Grundsatz auf verschiedene Lebensbereiche anzuwenden (s. ebd.).
„Nachdem der Grundpfeiler der Menschenrechte im Jahr 1948 gelegt wurde, sind bis heute viele internationale Erklärungen und Abkommen getroffen worden, die sich mit bestimmten Rechten von Menschen befassen“, so auch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008, die im Folgenden thematisiert wird (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 32).
Die Konkretisierung der Menschenrechte für bestimmte Gruppen ist nötig, da augenscheinlich wurde, dass die Gewährleistung der Menschenrechte für marginalisierte Gruppen nicht selbstverständlich ist. Artikel zwei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthält zwar eine Antidiskriminierungsklausel. Der Aspekt von Behinderung wird jedoch neben Weiteren, wie beispielsweise sexueller Orientierung, nicht aufgeführt. Somit ist es auch leichter, für Menschen in spezifischen Lebensumständen, die die Gefahr der Diskrimierung mit sich bringen, Ausnahmen von den Menschenrechten zu machen, auch wenn die Rechte an sich allgemein und unteilbar sind.
Aus diesem Grund wurde am „13. Dezember 2006 […] nach langjähriger Vorarbeit das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) in der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Das Übereinkommen konkretisiert die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen und vor dem Hintergrund ihrer besonderen Lebenslagen. Es ist für Deutschland seit dem 26. März 2009 [in der englischsprachigen Fassung, d. V.] rechtlich verbindlich“ (Doose 2014). Die Konvention „besteht neben der unverbindlichen Präambel aus 50 Artikeln. Die ersten neun Artikel könnte man den allgemeinen Teil der BRK nennen, der Bestimmungen enthält, die für alle weiteren Artikel des Abkommens bedeutsam sind, wie den Zweck der Konvention (Art. 1), Definitionen (Art. 2) und allgemeine Prinzipien (Art. 3) oder Bestimmungen zu behinderten Frauen (Art. 6) und zu behinderten Kindern (Art. 7). Weiterhin gibt es Bestimmungen zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins über Behinderung (Art. 8) und zur Barrierefreiheit (Art. 9). Die anschließenden Normen (Art. 10-Art. 30) könnte man als den besonderen Teil der BRK charakterisieren, der den Katalog der einzelnen Menschenrechte enthält. Die darauffolgenden Artikel betreffen die Implementierung und Überwachung des Abkommens (Art. 31-40). Die Schlussbestimmungen (Art.41-50) enthalten die üblichen technischen Regelungen von Völkerrechtsverträgen, wie z.B. Ratifikationsbestimmungen“ (Degener 2014). Es handelt sich um ein Dokument, das Inklusion als Menschenrecht festschreibt und ist daher sehr relevant zur Begründung eines inklusiven Anspruchs. In Artikel drei wird „full and effective participation and inclusion in society“ als ein Grundsatz der Konvention benannt (CRPD 2006, 4), was jedoch mit „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ in der deutschen Fassung übersetzt wurde und somit Teile seiner tatsächlichen Aussagekraft verlor, da der Inklusionsbegriff – wie dargelegt – weit mehr umfasst als Teilhabe und Einbeziehung (ÜRMB 2006, 4).
Das Recht aus Artikel drei wird im weiteren Textverlauf der Konvention auch für verschiedene Bereiche der Gesellschaft konkretisiert. Namentlich handelt es sich hierbei unter anderem um den Bereich der Bildung. Im Artikel 24 verpflichten sich die Vertragsstaaten, to „ensure an inclusive education system“ (CRPD 2006, 14). Dies hat weitreichende Konsequenzen. „Seit dem 26. März 2009 dürfen Schulbehörden und Gerichte nicht mehr behinderte Schüler und Schülerinnen diskriminieren, indem sie sie zwangsweise in Sonderschulen beschulen, selbst wenn ihre inklusive Beschulung mit Kosten und anderen Maßnahmen verbunden ist“ (Degener 2012). Es verwundert nicht, dass mit Hilfe terminologischer Tricks versucht wird, die Sprengkraft der Konvention zu mildern. „Bezüglich der deutschen Übersetzung wird moniert, dass so zentrale Begriffe wie z.B. ‚inclusion‛ mit dem deutschen Wort ‚Integration‛ übersetzt wurden. Diese Übersetzung reflektiert nicht den Paradigmenwechsel, der mit der BRK bezweckt ist und führt auch in der internationalen Kommunikation zu Irritationen“ (ebd.).
Ein weiterer Bereich, dessen inklusive Gestaltung in der Konvention als Menschenrecht festgeschrieben ist, ist der Arbeitsmarkt. In Artikel 27 heißt es: „States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities“ (CRPD 2006, 17). Es lässt sich also festhalten, dass die UN-Behindertenrechtskonvention dem Inklusionsgedanken eine rechtlich verbindliche Basis gibt und somit vermutlich einen maßgeblichen Anteil an seiner Umsetzung in den Unterzeichnerstaaten hat.
Nun erscheint es auf den ersten Blick widersprüchlich, wenn eine Konvention, die Rechte einer spezifisch konstruierten Gruppe sichern soll, einem inklusiven Anspruch Auftrieb gewährt, welcher sich ja gerade von tradierten Etikettierungen abwendet und Heterogenität als Fokus hat. Daher macht es an dieser Stelle Sinn, auf das Verständnis von Behinderung in der Konvention und auf das Verhältnis der Konvention zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einzugehen.
Das Verständnis von Behinderung, so wie es in der Konvention formuliert ist, weist zwei Aspekte auf, zwischen denen eine gewisse Spannung besteht (vgl. Bielefeldt 2009, 9). Der eine Aspekt lässt sich mit einer „kritischen Aufdeckung einer gesellschaftlichen Konstruktion von Behinderung“ beschreiben (ebd.). Er zeigt sich besonders in der Präambel der Konvention. Dort heißt es, dass „Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (ÜRMB 2006, 1). Es handelt sich um eine problemorientierte Definition von Behinderung. „Das Problem – oder, wenn man so will: das ‚Defizit‛ – wird dabei allerdings nicht in den betroffenen Menschen verortet, sondern im ausgrenzenden und diskriminierenden gesellschaftlichen Umgang gesehen, den […] Menschen vielfach erleben“ (Bielefeldt 2009, 8). Somit wird Behinderung nicht als Eigenschaft von Personen, sondern als Passungsproblem zwischen Individuum und Umwelt verstanden, wovon alle Menschen betroffen sein können. Diese Definition steht im Einklang mit einem inklusiven Anspruch, da sie eine Überwindung der Zwei-Gruppen-Theorie unterstützt.
Der andere Aspekt von Behinderung, der in der UN-Konvention zum Tragen kommt lässt sich mit der Formulierung „positiv konnotierte diversity-Komponente“ fassen (Bielefeldt 2009, 9). Hier geht es um die „Akzeptanz von Behinderung als Bestandteil menschlicher Normalität“ (Bielfeldt 2009, 7). Darüber hinaus geht die Konvention noch einen Schritt weiter, „indem sie das Leben mit Behinderungen als Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt positiv würdigt“ (ebd.). Ein solcher Blick auf Behinderung zeigt sich zum einen in der Präambel in der Ausformulierung der „Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können“ (ÜRMB 2006, 2). Zum anderen zeigt er sich in spezifischen Forderungen im Kontext einer Behindertenrechtskonvention, wie beispielsweise in der Forderung von „Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen“ (ÜRMB 2006, 15). Auch dieser Ansatz entspricht inklusivem Denken im Sinne eines positiven Umgangs mit Heterogenität, welcher neben der Anerkennung der sprachlichen Identität der Gehörlosen auch allen weiteren Aspekten von Heterogenität angedacht seien könnte.
„Für das menschenrechtliche Empowerment der Betroffenen sind […] beide Aspekte unverzichtbar. Das Vorgehen gegen strukturelles Unrecht, durch das Menschen daran gehindert werden, ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt mit anderen zu leben und ihre kreativen Möglichkeiten zu entfalten, gewinnt seine positive Handlungsperspektive in der selbstbewussten Forderung nach Anerkennung alternativer Lebens- und Kommunikationsformen, die den Pluralismus einer modernen freiheitlichen Gesellschaft mit prägen“ (Bielefeldt 2009, 9). Beide Aspekte – das Verständnis von Behinderung als allgemein mögliche menschliche Erfahrung auf der einen Seite und der positive Umgang mit Heterogenität auf der anderen Seite – sind auch in ihrer Spannung mit Inklusion vereinbar.
Hinzu kommt, dass ein Verständnis der UN-Konvention als Spezialkonvention, die bestimmte Sonderrechte für eine abgrenzbare Gruppe enthält, irreführend wäre (vgl. Bielefeld 2009, 13 f.). „Das ‚Spezielle‛ der Konvention besteht nicht in der Formulierung etwaiger Spezialrechte, sondern in der speziellen Perspektive der Behinderten auf die allgemeinen Menschenrechte. Das Gesamtspektrum der Menschenrechte wird gleichsam unter dem Gesichtspunkt durchgearbeitet, wie Menschen mit Behinderungen ihre Ansprüche auf Autonomie, Gleichberechtigung, Inklusion und Teilhabe wirksam zur Geltung bringen können“ (Bielefeld 2009, 14). „Die UN-Behindertenrechtskonvention steht im Kontext der anderen internationalen Menschenrechtskonventionen, die im Gefolge der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 entstanden sind. Sie dient in erster Linie dazu, die bereits bestehenden menschenrechtlichen Standards unter dem besonderen Blickwinkel der Menschen mit Behinderungen zu präzisieren und zu ergänzen“ (Bielefeldt 2009, 13). Mit der Orientierung an den allgemeinen unteilbaren Menschenrechten entspricht die Konvention einem inklusiven Anspruch.
Außerdem soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Konvention eine Innovation enthält, die sie besonders fruchtbar für inklusive Entwicklungen macht. Mit der „Akzentsetzung bei einer freiheitlich sozialen Inklusion“ stärkt die Konvention auch einen weniger beachteten Aspekt von Menschenrechten (Bielefeldt 2009, 11). „In der Menschenrechtsdebatte besteht nach wie vor eine Tendenz, die Rechte, die jedem Menschen zukommen, in erster Linie als individuelle Abwehrrechte gegen Staat, Gesellschaft und Gemeinschaften zu verstehen“ (Bielefeldt 2009, 12). „Erstaunlich wenig systematische Beachtung allerdings findet in der menschenrechtlichen Fachliteratur die Tatsache, dass die Menschenrechte ihr kritisches Potenzial auch gegen unfreiwillige Ausgrenzungen aus Gemeinschaften oder der Gesellschaft entfalten“, obwohl auch diese Komponente ein Menschenrechtsanspruch ist (ebd.). „Nicht der oft beschworene Gegensatz von Individuum versus Gemeinschaft bzw. Gesellschaft macht demnach die Pointe menschenrechtlicher Emanzipation aus. Vielmehr steht die durch menschenrechtliche Individualrechte zu ermöglichende freie Gemeinschaftsbildung in der doppelten Frontstellung gegen autoritäre, bevormundende Kollektivismen einerseits und gegen unfreiwillige soziale Ausgrenzungen andererseits“ (ebd.). Dies zeigt sich darin, dass im Unterschied zur Frauenrechtskonvention oder zur Antirassimsuskonvention nicht nur Antidiskriminierungspflichten verankert sind (vgl. Degener 2014). Wie die Kinderrechtskonvention verfolgt die UN-Behindertenrechtskonvention „einen ganzheitlichen Ansatz des Menschenrechtsschutzes mit staatlichen Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten“ (ebd.).
Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die in der Konvention verankerten Rechte von allen Menschen in Anspruch genommen werden könnten und dass der spezifische Blick auf menschliche Vielfalt, der hier der Gesellschaft abverlangt wird, positive Aspekte für alle Mitglieder der Gesellschaft enthält. „In diesem Sinne kommt der „diversity- Ansatz“, für den die Behindertenrechtskonvention steht, zuletzt uns allen zugute“ (Bielefeldt 2009, 16).
Es sollte gezeigt werden, welche Möglichkeiten in einer Bezugnahme auf Menschenrechte für eine Begründung des Inklusionsgedankens liegen und welche Rolle in diesem Zusammenhang die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat. Inklusion wird so als Versuch der Anerkennung menschlicher Würde verstanden, welcher in der Anerkennung spezifischer, ausformulierter Ansprüche Respekt gezollt wird. In der Form eines formulierten Rechtes bergen die Menschenrechte darüber hinaus die Möglichkeit, Maßnahmen zur Umsetzung von Inklusion beim Staat einzufordern. Beispielsweise wurde mit der Konvention „ein neuer Diskriminierungsbegriff in die deutsche Rechtsordnung eingeführt, der die bisherige deutsche Schulpolitik, die über 80% der behinderten Schüler und Schülerinnen aussondert, als mittelbare Diskriminierung charakterisieren lässt“ (Degener 2014). „Um zu überwachen, ob die Verpflichtungen aus der Konvention auch tatsächlich umgesetzt werden, soll es in allen Staaten eine Stelle geben, die diesen Prozess überwacht. In Deutschland ist dafür die Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte zuständig“ (DIMR 2014). Außerdem ist der rechtsbasierte Ansatz „als Gegenpol zu einer an Bedürftigkeit orientierten Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik zu verstehen, in der Behinderte als Objekte der Sozialpolitik, nicht aber als Bürgerrechtssubjekte gelten“ (Degener 2014).
Mit den Ausführungen zu Menschenrechten, die an dieser Stelle enden, werden auch die die Darstellungen zu Inklusion abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Zusammenschau der vorherigen Kapitel und der Konvergenz der einzelnen vorgestellten Aspekte ein Bild des hier zu Grunde gelegten Verständnisses von Inklusion ableiten lässt, das sich als Reflexionsfolie für die Analyse der Inklusionsdebatte eignet. Im Folgenden soll dieses visionäre Inklusionsverständnis mit Analysen gesellschaftlicher Realität konfrontiert werden.
Inhaltsverzeichnis
Geht es um die Frage, was gegenwärtig gesellschaftliche Verhältnisse prägt, so wird in tagespolitischen Diskussionen und in wissenschaftlichen Debatten häufig der Begriff des Neoliberalismus herangezogen, um Phänomene zu beschreiben. Darum eignet sich eine Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, um Inklusion vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verhältnisse zu reflektieren. Der Begriff des Neoliberalismus ist mittlerweile zu einem politischen Schlagwort geworden, „dem heute verschiedenste Bedeutungen zugewiesen werden“ (Ptak 2008, 14). Im Folgenden wird der Versuch unternommen, zu klären, was der Begriff umschreibt und wie sich der Neoliberalismus historisch als Lehre und in seiner politischen Umsetzung entwickelt hat.
„Neoliberalismus steht für eine seit den 1930er-Jahren entstandene Lehre, die den Markt als Regulierungsmechanismus gesellschaftlicher Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse verabsolutiert“ (Butterwege et al. 2008, 1). Der Neoliberalismus ist aber mehr als eine Lehre. „In ihm bündeln sich [...] philosophische, rechts- und politikwissenschaftliche, soziologische und historische Stränge zu einem strategischen Projekt der Durchsetzung einer individualistischen Marktgesellschaft“ (Ptak 2008, 26). Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr heterogene Strömung mit unterschiedlichen historischen und geografischen Wurzeln und Erscheinungsformen (vgl. ebd). Als wichtige Hauptströmungen gelten die Österreichische oder auch Wiener Schule, prominent vertreten durch Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises, die Chicago School, mit ihrem prominenten Vertreter Milton Friedmann und die Freiburger Schule des Ordoliberalismus, welche durch Walter Eucken, Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke prominent vertreten ist (vgl. Ptak 2008, 22).
Das Kernanliegen des Neoliberalismus ist die dauerhafte Durchsetzung und Stabilisierung der Marktgesellschaft (vgl. Ptak 2008, 16). Somit steht der Neoliberalismus im Gegensatz zum sogenannten Kollektivismus, der von Neoliberalen für die wirtschaftlichen Krisen des 20. Jahrhunderts verantwortlich gemacht wird. Ein Definitionsversuch dieses Feindbildes lautet wie folgt: „Die Verantwortung für das Wirtschaftsleben dem Staate anvertrauen, heißt: Kollektivismus“ (Röpke 1947, zit. n. Ptak 2008, 24 f.). „Der ‚Kollektivismus‛ stand begrifflich [...] für ein völlig indifferentes Bündel gesellschaftlicher und politischer Erscheinungen, einzig und allein zusammengeführt durch die Negation des Individualismus“ (Ptak 2008, 25). Unter Kollektivismus wird sowohl sozialistische Planwirtschaft, keynesianistische Vollbeschäftigungspolitik als auch nationalsozialistische Kriegswirtschaft subsumiert (vgl. ebd.). Die Ablehnung des Kollektivismus ist darin begründet, dass „der Neoliberalismus in seinen Ansichten davon überzeugt ist, dass eine Ausrichtung auf konkrete Ziele der Mehrheit der Menschen nicht möglich ist“ (Lange 2009, 14).
Der Bezugspunkt des neuen Liberalismus ist der alte Wirtschaftsliberalismus, von dem er sich jedoch auch abgrenzt (vgl. Ptak 2008, 27). „Der Neoliberalismus teilt […] mit dem klassischen Liberalismus die Befürwortung einer freien Marktwirtschaft und die entschiedene Ablehnung zentraler Planung“ (Gächter & Nyffeler 2001, 4). Die Abgrenzung der Neoliberalen zum klassischen Wirtschaftsliberalismus geschieht hauptsächlich durch die Kritik am Laissez-faire-Grundsatz. Jener „steht für eine freie Entfaltung des wirtschaftlichen Geschehens ohne jedwede staatliche oder sonstige Eingriffe“ (Ptak 2008, 27). Er hat also den sogenannten „Nachtwächterstaat“ zur Folge, in dem sich die Märkte, von der „unsichtbaren Hand“ gesteuert, selbst regulieren. Der Neoliberalismus vereinigt also zwei Einsichten: „Das Vertrauen auf die Freiheit der Märkte und die Einsicht, dass diese Freiheit einer umfassenden Politik bedarf, die das Feld der wirtschaftlichen Freiheit wie ein Spielfeld streng absteckt, ihre Bedingungen – sozusagen die Spielregeln – sorgfältig bestimmt und mit unparteiischer Strenge für die Respektierung dieses Rahmens der Marktwirtschaft (des Spielfeldes wie der Spielregeln) sorgt“ (Röpke 1950, zit. n. Gächter & Nyffeler 2001, 4).
Der Neoliberalismus ist also keine neue Erscheinung, „sondern eine modernisierte und erweiterte Variante des Wirtschaftsliberalismus in der Tradition von Klassik und Neoklassik“ (Ptak 2008, 16). „Am Ende des 20. Jahrhunderts avancierte der Neoliberalismus zur dominanten Ideologie des Kapitalismus, deren Leitsätze international den Referenzrahmen für die Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik vorgeben“ (Ptak 2008, 15).
Was waren die Bedingungen, unter denen sich der Neoliberalismus als Lehre formierte? Ptak bezeichnet die Weltwirtschaftskrise 1929 als „Geburtsstunde des Neoliberalismus“ (Ptak 2008, 16). Deutschland war seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen. In diesem Zug hatte sich die sozioökonomische Struktur grundlegend gewandelt, „weg von der autoritär liberalen, hin zu einer ordnungspolitisch neu ausgerichteten korporativen Marktwirtschaft“, was sich seit den 1880er Jahren in der Etablierung sozialer Sicherungssysteme und in der Regulierung der Marktwirtschaft durch wirtschaftspolitischen Interventionismus zeigte (ebd.). „Mit der Entstehung der Weimarer Republik 1918/19 wurde dieser Trend im Rahmen der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie noch einmal verstärkt“, begleitet jedoch durch die massiven Krisen der Zwischenkriegszeit (Ptak 2008, 17). „Unter dem Eindruck des neuen Phänomens der Massenarbeitslosigkeit wandten sich die Staaten zunehmend vom liberalen Ideal einer weltmarktorientierten Volkswirtschaft ab und richteten den Blick auf binnenwirtschaftliche Fragen“ sowie auf Fragen, wie der krisenhafte Kapitalismus aktiv, interventionistisch durch Prozesspolitik stabilisiert werden könne (Ptak 2008,17). Dass sich hier Widerstand liberal orientierter WirtschaftswissenschaftlerInnen formierte, liegt auf der Hand.
„Vor dem Hintergrund der Großen Depression seit Ende der 1920er Jahre […] vollzog sich dann endgültig ein Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftspolitik“ (ebd). Dieser Paradigmenwechsel beinhaltete eine Abkehr vom wirtschaftsliberalen Marktoptimismus, also der Vorstellung, dass der Kapitalismus die ihm gestellten Aufgaben selbst lösen könne, und damit eine Hinwendung zur politischen Intervention in den Markt. Dies begründet sich in einem veränderten Krisenerklärungsmuster. Nun wurde die neoklassische Vorstellung, dass nur exogene Faktoren Krisen auslösen, die sich über den Markt selbst regulieren, zu Gunsten endogener, also dem Kapitalismus innewohnender Faktoren als Krisenerklärung verworfen (vgl. Ptak 2008, 18). Dies führte zum Keynesianismus, „der in den westlichen Industrienationen vornehmlich als sozialdemokratische Reformpolitik Verbreitung fand“ (Ptak 2008, 19). Dies widerstrebte den Marktradikalen, die sich nun unter dem Namen Neoliberalismus versammelten und sie antworteten „mit einer erweiterten Neuauflage der exogenen (neo)klassischen Krisenerklärung“ (ebd.). „Statt Marktversagen wurde die These vom Staats- und Politikversagen ins Zentrum der Analyse gerückt, die zur Kernaussage des neoliberalen Programms werden sollte“ (ebd.). Das Versagen der Politik bestand demnach darin, die Kräfte des Wettbewerbs, durch die von chaotischen Kräften der Masse, zum Beispiel durch Einflussnahme von Gewerkschaften, geleiteten Interventionen, zum Erliegen gebracht zu haben. „Als Lösung des Problems favorisierten die neoliberalen Protagonisten in Deutschland […] einen ‚starken Staat‛, der mit großer Machtfülle ausgestattet einem übergeordneten Gesamtinteresse Geltung verschaffen sollte, um so den Einfluss der Parteien und Gewerkschaften zurückzudrängen“ (ebd.). Alexander von Rüstow, ein wichtiger Vertreter des deutschen Ordoliberalismus formuliert es 1932 auf einer Tagung des Vereins für Sozialpolitik wie folgt: „Der neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört. Und mit diesem Bekenntnis zum starken Staat im Interesse liberaler Wirtschaftspolitik und zu liberaler Wirtschaftspolitik im Interesse eines starken Staates – denn das bedingt sich gegenseitig, mit diesem Bekenntnis lassen Sie mich schliessen“ (Rüstow 1932, zit. n. Gächter & Nyffeler 2001, 2). Dies hat bis heute Bestand. „Die Kritik am ausufernden und fehllenkenden Interventionsstaat ist eine allgegenwärtige Grundfigur der neoliberalen Ideologie“ (Ptak 2008, 20). Auf der Grundlage der so formulierten Problemstellung entwickelte sich der Neoliberalismus als wissenschaftliche Strömung, die sich das Ziel setzte, allgemeingültige Ordnungsgrundsätze für eine Wirtschaftspolitik in der Marktwirtschaft zu formulieren – durchaus mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ (Ptak 2008, 21).
Auf einem internationalen Kolloquium der neuen Strömung 1938 in Paris tauchte vermutlich der Name Neoliberalismus das erste Mal auf (vgl. ebd.). Diese neue Strömung bemühte sich um internationale Vernetzung, was unter Führung von Hayek im Frühjahr 1947 zur Gründung der Mont Pèlerin Society (MPS) führte (vgl. Ptak 2008, 22). „Die MPS entwickelte sich in der Folge zum bedeutendsten neoliberalen Elitenetzwerk der Welt mit gegenwärtig an die 1000 Mitgliedern aus allen Kontinenten und etwa 100 vernetzten Denkfabriken“ (ebd.). Das Programm der MPS ist in den Statement of Aims von 1947 festgehalten. Das Statement of Aims kann als breite Basis neoliberalen Denkens angesehen werden. Dort heißt es: „The central values of civilization are in danger. Over large stretches of the Earth’s surface the essential conditions of human dignity and freedom have already disappeared. In others they are under constant menace from the development of current tendencies of policy. The position of the individual and the voluntary group are progressively undermined by extensions of arbitrary power. Even that most precious possession of Western Man, freedom of thought and expression, is threatened by the spread of creeds which, claiming the privilege of tolerance when in the position of a minority, seek only to establish a position of power in which they can suppress and obliterate all views but their own.
The group holds that these developments have been fostered by the growth of a view of history which denies all absolute moral standards and by the growth of theories which question the desirability of the rule of law. It holds further that they have been fostered by a decline of belief in private property and the competitive market; for without the diffused power and initiative associated with these institutions it is difficult to imagine a society in which freedom may be effectively preserved“ (Robbins 1947). Demzufolge ist unsere Welt bedroht, wenn Privateigentum, Wettbewerb und individuelle Freiheit eingeschränkt werden, und es muss Ziel sein, dem, mit Hilfe eines starken Staates, der nicht in den Wettbewerb eingreift, Einhalt zu gebieten. Dies war die Kernerkenntnis der hier nachgezeichneten Entwicklung. Wie wurde jedoch aus dieser Lehre politische Praxis?
An dieser Stelle soll der Versuch unternommen werden, grob nachzuzeichnen, wie sich der Neoliberalismus von einer Protestströmung gegen politischen Interventionismus in der Weimarer Republik zur herrschenden Lehre seit den 80er Jahren aufschwingen konnte.
„Nach dem 2. Weltkrieg war eine Rückkehr zur Marktwirtschaft vorerst nicht selbstverständlich“ (Gächter & Nyffeler 2001, 9). Es ist daher erstaunlich, wie schnell sich der Neoliberalismus durchsetzen konnte. „Erstaunlich auch, weil nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Kommunismus in den westeuropäischen Ländern breite Zustimmung fand (Zinn 2009, 1). „Überwiegend glaubte man, die katastrophale wirtschaftliche Situation Deutschlands nur mit planwirtschaftlichen Maßnahmen überwinden zu können“ (Gächter & Nyffeler 2001, 9). Folgt man den Ausführungen Zinns, so ist es auch durch den Einfluss der Westalliierten, insbesondere der USA, im Westen Nachkriegsdeutschlands bedingt, dass trotzdem eine Rückkehr zur Marktwirtschaft stattfand (vgl. Zinn 2009, 10). Programmatisch orientierte man sich hierbei an der von Alfred Müller Armack konzipierten Sozialen Marktwirtschaft, zu der sich die CDU 1949 bekannte und die dann unter Ludwig Erhardt als Wirtschaftsminister etabliert wurde (vgl. Gächter & Nyffeler 2001, 10). Die „Etablierung der ‚Sozialen Marktwirtschaft‛, die zwar von neoliberalen Vordenkern entworfen wurde, brachte [jedoch, d. V.] keineswegs eine lupenreine Umsetzung der neoliberalen Vorstellungen, sondern wurde […] stark sozialstaatlich modifiziert“ (Zinn 2009, 4). Im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft wurden wettberwerbspolitische Rahmensetzungen betonende Vorstellungen des Ordoliberalismus der Freiburger Schule mit sozial- und beschäftigungspolitischem Interventionismus verknüpft (vgl. Zinn 2009, 9). „Staatsinterventionistische Elemente und eine sowohl historisch als auch im internationalen Vergleich sehr fortschrittliche Sozial- und Beschäftigungspolitik führten zu vielfältigen Einschränkungen der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftsordnung nach 1949“ (Zinn 2009, 4). In den folgenden Jahren wurde die Soziale Marktwirtschaft jedoch immer weiter zugunsten einer keynesianischen Steuerung verdrängt (vgl. Gächter & Nyffeler 2001, 10). „Mit der Krise der fordistischen Produktionsweise und der damit verbundenen Umwandlung von Industrie- in Wissensgesellschaft ab Mitte der 70er Jahre, gerät allerdings das fordistisch-keynesianische Modell in Probleme und gerät politisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich unter Druck“, was zu einer Renaissance neoliberaler Wirtschaftstheorien führte (Zerowsky 2005, 19). „Die Durchsetzung dieser Vorstellungen erlebten erst […] ihren realen Durchbruch durch die Regierungen von M. Thatcher in England und R. Reagon in den Vereinigten Staaten“ (Lange 2009, 11). Daher wird dieser Prozess auch „als Offensive des angelsächsischen Neoliberalismus verstanden, da es sich um einen ideologischen Import aus den USA der Ära Reagan und aus Frau Thatchers Großbritannien handelt“ (Zinn 2009, 17). „Massiver Abbau von Arbeitnehmerrechten, Zerschlagung der Gewerkschaften, Rücknahme von sozialen Sicherungs- und Chancengleichheitsmaßnahmen sowie eine verstärkt austeritäre Geldpolitik waren die Hauptarbeitsfelder dieser Regierungen“ (Zerowsky 2005, 20). Der Schwerpunkt von Thatcherism und Reagonomics lag also auf der „Deregulierung und Privatisierung der bisher staatlich organisierten Bereiche der Gesellschaft, also auch des Bildungsbereichs“ (Lange 2009, 11). „Damit wandelt sich der wirtschaftstheoretische Mainstream, als Reaktion auf die (durch die Änderung der Produktionsweise) nicht mehr funktionierende staatliche Interventions- und Sozialpolitik in Richtung Neoliberalismus“ (Zerowsky 2005, 20). Mitte der 90er Jahre wurden gehäuft konservative Regierungen in Europa durch Mitte-Links Regierungen abgelöst. 1998 wurde auch in Deutschland die so genannte „Ära Kohl“ durch die Wahl des SPD-Politikers Gerhard Schröder zum Bundeskanzler beendet. Trotzdem wurde die konservativ-neoliberale Politik des Sozialabbaus fortgeführt (vgl. Zerowsky 2005, 22). Die wirtschaftspolitische Ausrichtung der SPD hatte sich verändert. „Insbesondere unter der Regierung Helmut Schmidts und verstärkt nach dem Verlust der Regierungsmacht seit 1982 entwickelte sich neben der offiziellen Parteiprogrammatik eine vor allem von Funktionsträgern beförderte Parteipragmatik, die sich stückweise vom ‚keynesianischen Wohlfahrtsstaat’ als Leitbild sozialdemokratischer Wirtschafts- und Gesellschaftskonzeption entfernte. Nicht mehr die immanente Krisenanfälligkeit einer interventionsfreien Marktwirtschaft wird zum Ankerpunkt sozialdemokratischer Pragmatik, sondern die drohende Erlahmung strukturverändernder und beschäftigungs- und wohlstandsschaffender unternehmerischer Dynamik“ (Heise 2002, 1).
Ziel der neuen Regierung war unter anderem der Abbau von Arbeitslosigkeit und damit die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Als Ursache für Arbeitslosigkeit werden zu hohe Lohnnebenkosten und Sozialstandards sowie überbordende Bürokratie angesehen (vgl. Zerowsky 2005, 23). „Statt Arbeitslosigkeit zu bezahlen, sollte wieder Arbeit bezahlt werden, um die Menschen schneller wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren“ (ebd.). Dies wird versucht durch verschiedene Punkte der Agenda 2010 zu realisieren. Außerdem änderte sich die Wahrnehmung des Staates. „Mit der Privatisierung der Staatsunternehmen und der Durchsetzung des europäischen Binnenmarktes, setzte eine zunehmende Vermarktlichungstendenz vormals gesamtgesellschaftlicher bzw. staatlicher Aufgaben ein“ (Zerowsky 2005, 24).
Die Nachfolgeregierungen setzten diesen Kurs fort. In der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin heißt es: „Ich möchte Bundeskanzler Schröder ganz persönlich dafür danken, dass er mit seiner Agenda 2010 mutig und entschlossen eine Tür aufgestoßen hat, eine Tür zu Reformen, und dass er die Agenda gegen Widerstände durchgesetzt hat“ (Merkel 2005, 78). Die neoliberalen Reformen der rot-grünen Koalition werden also in ihrer Grundrichtung anerkannt und weiterverfolgt.
Nachdem versucht wurde, eine nähere Begriffsbestimmung sowie die historische Entwicklung von Neoliberalismus als Lehre und ihrer gesellschaftspolitischen Umsetzung zu skizzieren, soll an dieser Stelle genauer auf bestimmte Aspekte des Neoliberalismus und deren Folgen eingegangen werden. Hierbei wird sich auch die Bedeutung der Betrachtung des Neoliberalismus im Kontext von Fragen zur Bildung weiter herauskristallisieren. Der Aspekt, auf dem nun die Konzentration liegen soll, ist ein Begriff, der „seit einigen Jahren zum stehenden Repertoire des (außerwissenschaftlichen) pädagogischen »Neusprechs«“ gehört und die dazugehörende Theorie (Ribolits 2006, 135). Ein Begriff, der „mit der Begründung, der Gebrauch dieses Wortes aus der Wirtschaftsfachsprache breite sich zunehmend auch in nichtfachlichen Bereichen aus und fördere damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren Lebensbezüge“ zum Unwort des Jahres 2004 gewählt wurde (Lohmann 2007, 618). Es handelt sich um den Begriff des Humankapitals. Die Auseinandersetzung mit der neoliberalen Theorie des Humankapitals ist an dieser Stelle angebracht, da sie zwei wesentliche Prozesse darstellt. „Den einen könnte man den Vorstoß der ökonomischen Analyse auf ein Gebiet nennen, das bis dahin unerforscht war, und zweitens auf der Grundlage dieses Vorstoßes die Möglichkeit, in streng ökonomischen Begriffen einen ganzen Bereich neu zu interpretieren, der bis heute als nicht-ökonomisch betrachtet werden konnte und tatsächlich so betrachtet wurde“ (Foucault 2010, 183). Im Folgenden werden die Entwicklung und Grundzüge der Humankapitaltheorie dargestellt, wie Foucault sie beschreibt, um im Anschluss Folgen des Denkens und Handelns in Bezug auf diese Theorie näher zu beleuchten.
Nach Annahme der klassischen politischen Ökonomie hängt die Güterproduktion von drei Faktoren ab, dem Land, dem Kapital und der Arbeit, wobei der Aspekt der Arbeit in ihren Theorien nicht ausreichend Beachtung fand oder auf den Faktor der Zeit reduziert dargestellt wurde (vgl. Foucault 2010, 183 f.). „Im Ausgang von der Kritik, die die Neoliberalen an der klassischen Ökonomie üben, besteht das Problem der Neoliberalen im Grunde darin, die Arbeit wieder in den Bereich der Wirtschaftsanalyse einzuführen“ (Foucault 2010, 185). Die Analyse der Arbeit durch Karl Marx, nämlich, dass der Arbeiter seine Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit für einen bestimmten Lohn verkauft, der auf der Grundlage einer bestimmten Marktsituation festgesetzt wird, die dem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in Bezug auf die Arbeitskraft entspricht, wodurch ein Wert geschöpft wird, der dem Arbeiter zu einem Teil entrissen wird, beachteten die Neoliberalen aus Gründen, die Foucault als ökonomischen Snobismus bezeichnet, nicht (vgl. Foucault 2010, 186). Somit teilen sie auch nicht Marx´s Erkenntnis, dass Arbeit in der Logik des Kapitalismus abstrakt wird, „d.h., dass die in Arbeitskraft verwandelte konkrete Arbeit, die zeitlich gemessen, auf den Markt gebracht und durch einen Lohn vergütet wird, nicht die konkrete Arbeit ist“, da sie ihrer menschlichen Wirklichkeit und ihren qualitativen Variablen entledigt, und auf Kraft und Zeit reduziert ist (Foucault 2010, 186 f.). Sie entgegnen dem, dass die Abstraktion der Arbeit „keine Tatsache des wirklichen Kapitalismus, sondern Tatsache der ökonomischen Theorie“ ist, die bis dahin die spezifische Ausgestaltung der Arbeit außer Acht gelassen hat, da die klassischen Ökonomen den Gegenstand der Ökonomie immer nur als Prozesse des Kapitals, der Investitionen, der Maschinen und der Produkte aufgefasst haben (ebd.). Daher muss nach neoliberaler Ansicht die ökonomische Theorie überarbeitet werden. Dies geschieht demzufolge über die Veränderung des Gegenstandsbereichs der Ökonomie (vgl. Foucault 2010, 188). Das heißt in diesem Falle eine Perspektivverschiebung, weg von der Untersuchung der Tauschmechanismen, der Produktionsmechanismen und der Gegebenheiten des Konsums und deren Wechselwirkung innerhalb einer vorhandenen Sozialstruktur, hin zur Natur und zu Folgen von substituierbaren Entscheidungen, „d.h. die Untersuchung und Analyse der Art und Weise, wie knappe Ressourcen auf konkurrierende Zwecke verteilt werden, d.h. auf alternative Zwecke, die einander nicht überlagern dürfen“ (ebd.). Somit wird die Ökonomie zur „Wissenschaft des menschlichen Verhaltens, als eine Beziehung zwischen Zwecken und knappen Mitteln, deren Verwendungen sich gegenseitig ausschließen“ (Robbins 1993, zit. n. Foucault 2010, 189). Es geht also nicht mehr um die „Analyse eines relationalen Mechanismus zwischen Dingen oder Prozessen“, sondern um „die Analyse menschlichen Verhaltens und der inneren Rationalität dieses Verhaltens“ (ebd.).
Das hat Folgen für die Analyse der Arbeit. Man fragt nicht mehr, „welche Stellung die Arbeit zwischen [...] dem Kapital und der Produktion einnimmt“, sondern das „grundlegende, wesentliche und jedenfalls vorrangige Problem, das man sich ab dem Moment stellt, wo man eine Analyse der Arbeit in ökonomischen Begriffen unternehmen will, wird darin bestehen, dass man herausfindet, wie der Arbeiter die Ressourcen einsetzt, über die er verfügt“ (ebd.). Dann wird Arbeit als praktiziertes ökonomisches Verhalten untersucht, „das vom Arbeiter eingesetzt, praktiziert und berechnet wird“ (Foucault 2010, 190). Man geht also „zum ersten mal davon aus, dass der Arbeiter in der ökonomischen Analyse kein Objekt ist, das Objekt eines Angebots und einer Nachfrage in Form von Arbeitskraft, sondern ein aktives Wirtschaftssubjekt“ (ebd.).
Wie wird dieses Wirtschaftssubjekt nun konzipiert? Menschen werden verstanden als welche, die arbeiten, um einen Lohn zu bekommen (vgl. ebd.). „Vom Standpunkt des Arbeiters ist der Lohn nicht der Preis für den Verkauf seiner Arbeitskraft, sondern ein Einkommen“ (ebd.). Um Einkommen zu definieren, beziehen sich die Neoliberalen auf eine Definition von Irving Fisher: „Ein Einkommen ist ganz einfach das Ergebnis oder der Ertrag eines Kapitals. Und umgekehrt nennt man »Kapital« alles, was auf die eine oder andere Weise eine Quelle von zukünftigem Einkommen sein kann“ (ebd.). Somit wird „die Gesamtheit aller physischen, psychologischen usw. Faktoren, die jemanden in die Lage versetzen, einen bestimmten Lohn zu verdienen“, zum Kapital, dessen Einkommen der Lohn ist (Foucault 2010, 191). Die Arbeit ist auch keine Ware, „die sich auf die Arbeitskraft und gearbeitete Zeit reduziert“, sondern sie umfasst ein Kapital, das „untrennbar von der Person [ist, d. V.], die es besitzt“, und ein Einkommen, „d.h. ein Lohn oder vielmehr eine Gesamtheit von Löhnen; man sagt auch Lohnfluss“ (ebd.). „Das ist keine Vorstellung der Arbeitskraft, sondern eine Vorstellung der Kompetenz als Kapital, das in Abhängigkeit von verschiedenen Variablen ein bestimmtes Einkommen erbringt, welches ein Lohn ist, ein Lohneinkommen, sodass der Arbeiter selbst sich als eine Art Unternehmen erscheint“ (Foucault 2010, 1992). Somit rücken nicht Individuen, Prozesse oder Mechanismen, sondern Unternehmen ins Zentrum der Analyse. „Eine Wirtschaft, die aus Unternehmenseinheiten besteht, eine Gesellschaft aus Unternehmenseinheiten: Das ist zugleich das mit dem Liberalismus verbundene Interpretationsprinzip und seine Programmgestaltung für die Rationalisierung sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft“ (Foucault 2010, 192 f.).
Woraus besteht nun das Humankapital? Bei der Bearbeitung dieser Frage wird deutlich, dass mit der Einführung der Arbeit in die Wirtschaftsanalyse im hier vorgestellten Sinne, Aspekte einer ökonomischen Betrachtung zugeführt werden, d.h. mit Begriffen der Ökonomie verhandelt werden, die vormals außen vor blieben (vgl. Foucault 2010, 195). Das Humankapital besteht nämlich „aus angeborenen und aus erworbenen Elementen“ (ebd.). Mit Blick auf die angeborenen Elemente des Humankapitals wird das Zeugen von Nachkommen zur Produktion von Humankapital, für die man sich am besten geeignete Koproduzenten, d.h. welche mit vorteilhafter genetischer Ausstattung, wählt (vgl. Foucault 2010, 1995 ff.). Die neuen Arten der Analyse der Neoliberalen beziehen sich jedoch eher auf die Bildung des erworbenen Humankapitals (vgl. Foucault 2010, 198). Humankapital generieren heißt, Bildungsinvestitionen zu tätigen (vgl. ebd.). „Die Neoliberalen weisen […] darauf hin, dass das, was Bildungsinvestition genannt werden soll oder jedenfalls die Elemente, die in die Bildung des Humankapitals eingehen, viel mehr umfassen als das bloße Lernen auf der Schule oder die bloße Berufsausbildung“ (ebd.). Die „Gesamtheit der kulturellen Reize, die das Kind empfängt“, sind Faktoren im Prozess der Humankapitalbildung (Foucault 2010, 199). „Auf diese Weise gelangt man zu einer Analyse der Lebensbedingungen des Kindes, […] die man berechnen und bis zu einem gewissen Grad in Zahlen ausdrücken kann, die man jedenfalls in Begriffen von Investitionsmöglichkeiten in menschliches Kapital messen kann“ (ebd.).
Hinzu kommt eine veränderte Interpretation der Innovation, die sich nicht mehr durch die „Kühnheit des Kapitalismus oder den ständigen Anreiz des Wettbewerbs“ erklären lässt (Foucault 2010, 201). „Wenn es Innovationen gibt, d.h., wenn man neue Dinge findet, wenn man neue Formen der Produktivität entdeckt, wenn man technologische Erfindungen macht, dann ist das alles nichts anderes als der Ertrag […] des Humankapitals, d.h. der Gesamtheit der Investitionen, die man auf der Ebene des Menschen selbst gemacht hat“ (Foucault 2010, 201 f.). Somit ergeben sich Prinzipien einer Wachstumspolitik, „die sich nicht mehr bloß am Problem der materiellen Investition des physischen Kapitals einerseits und an der Zahl der Arbeiter [andererseits] orientiert, sondern einer Wachstumspolitik, die sich sehr genau auf eines derjenigen Dinge konzentriert, die der Westen gerade am leichtesten verändern kann, und die in der Modifikation des Niveaus und der Investitionsform in Humankapital besteht“, was dann Auswirkungen auf Wirtschaftspolitik, sowie Kulturpolitik, Sozialpolitik und Bildungspolitik hat (Foucault 2010, 202).
Nachdem die Entwicklung einer bestimmten neoliberalen Perspektive und die Grundzüge dieser Perspektive auf die Menschen dargelegt wurde, soll im Folgenden darauf eingegangen werden, welche Folgen diese Betrachtungsweise für die Menschen hat. Ein besonderer Fokus soll an dieser Stelle auf den Folgen für den Bereich der (institutionalisierten) Bildung liegen.
Wie im Vorangegangenen dargelegt, werden mit Blick auf die erworbenen Elemente des Humankapitals, „die sich in den verwertungsrelevanten Eigenschaften eines Menschen verkörpernden [Bildungs-, d. V.] Investitionen [in das menschliche Rohmaterial – die Humanressource –, durch den Prozess der immer noch euphemistisch als Bildung bezeichnet wird, d. V. ] angesprochen“ (Ribolits 2008, 135). Dies führt zur „Verdinglichung des Menschen und [… zum, d. V.] Außerkraftsetzen des Anspruchs einer prinzipiellen – vom Markt und dessen Wertdimension unabhängigen – Würde des Menschen“ (Ribolits 2008, 136.). „Den Menschen als Ressource zu apostrophieren bedeutet [...], ihn auf seine der wirtschaftlichen Verwertung zugänglichen, naturwissenschaftlich erfassbaren und entsprechend [durch bildungsmäßige Bearbeitung, d. V.] manipulierbaren Funktionen [,d. h. als Mittel zum Zweck, d. V.] zu reduzieren“ und ihn zum „Anhängsel des wirtschaftlich-gesellschaftlichen Geschehens“ zu degradieren, auf das er keinen Einfluss hat (ebd.). „Die Grundprämisse des aufgeklärten Menschenbildes, dass der Mensch »Zweck seiner selbst« sei und ihm ein besonderer Status gegenüber der (sonstigen) Natur zukomme, wird damit genauso aufgegeben wie die Vorstellung, dass die gesellschaftlichen Bedingungen des Lebens von Menschen gemacht und damit von Menschen auch verändert werden können“ (ebd.).
Außerdem gibt es Auswirkungen der Humankapitaltheorie auf unsere Vorstellungen vom guten Leben. Nicht mehr Gottgefälligkeit oder eine vernunftgeleitete, sinnvolle Richtung im Leben, sondern die flexible und widerstandslose Anpassung an den Markt und seine Verwertungsbedingungen erscheinen als die Berufung des Menschen (vgl. Ribolits 2008, 137). „Vernunft reduziert sich unter diesen Umständen auf »instrumentelle Vernunft«, sie ist nur noch Mittel der Zweckerreichung, anstatt dem Hinterfragen und der Kritik des Zwecks selbst zu dienen“ (ebd.).
Auch das Lernen erscheint unter humankapitaltheoretischer Perspektive in einem besonderen Licht. Lernen dient nicht der „Selbstbefreiung des Menschen aus dem Gehäuse der Entfremdung“; es zielt also nicht darauf ab, „die historisch-gesellschaftlich bedingte Relativität aller so genannten Wahrheiten, geltenden Normen, Werte und üblichen Verhaltensweisen zu erkennen“ (ebd.). Es geht nicht darum, „dass der Mensch sich als autonomes Wesen erkennt, das außerhalb der Zweck-Mittel-Rationalität der (übrigen) Natur steht und für sein Dasein die […] Verantwortung trägt“, geschweige denn darum, dass er „auf Basis dieser Erkenntnis jenes Selbstbewusstsein entwickelt, das ihm ermöglicht, gesellschaftliche Bedingungen einzufordern, durch die seine prinzipielle Autonomie nicht wieder in Ketten gelegt wird“ (ebd.). Vielmehr „dient [Lernen, d. V.] der Domestizierung des Menschen – seiner Ausbildung zum »Nützling« (ebd.). „Organisiertes Lernen entkoppelt sich von jedem an Freiheit orientierten Bildungsanspruch und wird zur lebenslangen kontextlosen Ansammlung von Qualifikationsmodulen, deren Auswahl sich einzig aus ihrer Brauchbarkeit im Prozess der Humankapitalverwertung ableitet“ (Ribolits 2008, 139). „Modularisierung kennzeichnet die Grundtendenz eines Menschenbildes, das vom Menschen als einem beliebig in unterschiedliche marktgerechte Module aufspaltbaren Wesen ausgeht. Der zukunftsfähige Mensch soll demgemäß nicht mehr nur soziale Rollen übernehmen und ihren Erfordernissen gemäß handeln; vielmehr soll ihn eine nachgiebige, formbare Identität dazu befähigen, mit den ständig wechselnden Anforderungen in einem globalisierten, informations- und kommunikationstechnologisch gestalteten Arbeits- und Konsummarkt umzugehen. Umgang ersetzt in diesem Falle die Konfrontation, denn es geht um einen spielerischen Umgang mit sozialen Zwängen, nicht um die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Welt, es geht um die möglichst optimale Selbstbehauptung des Subjekts, nicht um den Widerstand, der gesellschaftlichen Zumutungen entgegengesetzt werden könnte“ (Bernhard 2003, 928). Ziel der marktkonformen Zurichtung des Menschen ist die „mobile, flexible, fluide, wandlungsfähige, auf permanente Selbsttransformation geeichte Persönlichkeit“ (ebd.).
In einer am Markt orientierten Bildung „gerinnen pädagogische Zentralbegriffe wie Mündigkeit, Autonomie, Selbstbewusstsein oder Emanzipation endgültig zu hohlen Phrasen“, da eine solche Pädagogik nur in „von Anpassungszwängen nicht völlig erfassten Freiräumen“ umgesetzt werden konnte (Ribolits 2008, 138). Mit der Ausweitung der ökonomischen Betrachtung auf menschliches Vermögen, wird der Druck, „Lernen einseitig im Sinn der Zurichtung der Individuen zum Zweck ihrer Verwertbarkeit zu gestalten, allerdings weitgehend totalitär“ (ebd.).
Neu ist auch, dass „im Unterschied zu früheren Indienstnahmen des schulischen Lernens hier noch die physiologischen, biographischen, emotionalen und kreativen Momente des Lernens für dieses Ziel nutzbar gemacht [...] werden“ (Bernhard 2003, 930). Unter humankapitaltheoretischer Perspektive kommt es zu einem „strukturell erweiterten Qualifikationsbegriff“ (ebd.). „Er berücksichtigt nicht nur die kognitiven Fähigkeiten, obgleich nur aus ihnen direkte Verwertungsmöglichkeiten erschlossen werden können, sondern auch die leiblichen, ästhetischen, affektiven und sozio-emotionalen, auf denen jene aufruhen und die mit diesen in ständiger Korrespondenz stehen“ (ebd.).
Der Begriff Humankapital signalisiert dementsprechend „eine neue Dimension in der ökonomischen Ausbeutung des Menschen“, die im Zusammenhang mit der „auf Basis der Informations- und Kommunikationstechnologien in Gang gesetzten Umwälzungen der Arbeitswelt“ steht (Ribolits 2008, 141). Unter den Bedingungen des postindustriellen Kapitalismus reicht ein innerlich distanziertes Verkaufen des eigenen Arbeitsvermögens nicht mehr aus (vgl. Ribolits 2008, 142). „Zunehmend braucht es Arbeitskräfte, die sich mit dem Prozess ihrer Verwertung voll und ganz identifizieren, die sich also selbst nur mehr in den Dimensionen von Humanressource und Humankapital wahrnehmen“ (ebd.). Neue Technologien können formalisierbare, normbezogene Aufgaben erfüllen, sodass menschliche Arbeitskraft verstärkt für nicht-formalisierbare Aufgaben, d.h. für Aufgaben, die „auf Grundlage besonderer sozialer und emotionaler Kompetenzen bzw. der Kreativität, Intuition oder Empathie der sie Verrichtenden bewältigt werden können“, gebraucht wird (ebd.). Diese Aufgaben erfordern autonomes Handeln auf der Basis verinnerlichter Einstellungen anstatt der bloßen Anwendung von Faktenwissen (know what); es werden unterschwellige Fähigkeiten (tacit skills) der ArbeitnehmerInnen benötigt, also „alle Formen des impliziten und informellen bzw. des Erfahrungswissens der Arbeitskräfte wie auch ihre Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation im Produktionsprozess“ (Atzmüller 2004, zit. n. Ribolits 2008, 143). Da nicht-formalisierbare Aufgaben nicht nach normierten Maßstäben kontrolliert werden können, muss die Qualitätssicherung über eine besondere Identifikation der ArbeiterInnen mit ihrer Aufgabe geschehen (vgl. ebd.). „Es muss ein Zustand geschaffen werden, in dem ihre Verwertung als Arbeitskräfte ihnen nicht länger »äußerlich« bleibt und sie sich mit ihrem ganzen Bewusstsein mit ihrer Marktgängigkeit identifizieren“ (ebd.). Dies ist in Lohnverhältnissen aufgrund ihrer „emanzipatorischen Potenz“ nicht möglich, weshalb es nötig wird, den Widerspruch von Subjekt und Unternehmen, von Arbeitskraft und Kapital zu beseitigen, indem die Menschen durch ständigen Konkurrenzkampf dazu gebracht werden, „den Druck der Verwertungslogik zu verinnerlichen“ (Ribolits 2008, 143 f.). „An die Stelle der Lohnabhängigen soll der Arbeitskraftunternehmer treten, der für seine Ausbildung, Weiterbildung, Krankenversicherung usw. selbst sorgt. An die Stelle der Ausbeutung tritt die Selbstausbeutung und Selbstvermarktung der ›Ich-AG‹“ (Gorz 2004, zit. n. Ribolits 2008, 144)
Außerdem werden „Schulen und Universitäten selbst [...] nun vielmehr wie und als kapitalistische Wirtschaftsunternehmen gestaltet“ (Lohmann 2007, 621). Lohmann sieht „seit etwa 1980, verstärkt seit den 1990er Jahren, eine marktorientierte Monetarisierungsoffensive, die den Bildungsbereich zusammen mit anderen öffentlichen Sektoren rund um den Globus in betriebswirtschaftliche Strukturen zwingt“ (ebd.). „Interne Rationalisierung der Einrichtungen und betriebswirtschaftliche Kosten-Ertrags-Kalkulationen sollen [...] die Qualität öffentlicher Dienstleistungen verbessern und die Produktionskosten senken; die Kunden sollen kostengerechte Preise für Dienstleistungen zahlen, und zwar vorzugsweise mittels Gebühren und Entgelten“ (ebd.). „In dem Maß, in dem heute die Effizienzkriterien der industriellen Kapitalverwertung auf organisierte Lernprozesse umgelegt werden, gehen die unhintergehbaren Bedingungen der Möglichkeit von Bildung – Muße, Leidenschaft, intellektuelle Beharrlichkeit oder echte Begegnung – endgültig verloren“ (Ribolits 2008, 138 f.).
„In einer sich in wirtschaftlichem Bereich globalisierenden, informations- und kommunikationstechnologisch gestalteten Gesellschaft, in der die Tendenzen der Maschinisierung und Automatisierung die Möglichkeit von Erwerbsarbeit systematisch ausdünnen, wächst der gesellschaftliche Druck auf eine Bildung, die in effizienterem Maße und in schnelleren Zyklen die gewünschten Subjektvermögen hervorbringen soll“ (Bernhard 2003, 927). Bildung wird den „beschleunigten Produktionsprozessen entspringenden zeitökonomischen Maximen unterworfen“ (Bernhard 2003, 930). Bernhard nennt hierfür folgende Indizien: „Die Bemühungen um Eliteförderung, Hochbegabtenförderung, Bildungsstandardisierung im Kindergarten, Verkürzung von Schulzeiten, Komprimierung der Zeit in der Vermittlung von Bildung, Modularisierung von Ausbildungsgängen und nicht zuletzt die Versuche der Privatisierung der Bildung durch Schaffung eines Bildungsmarktes für Bildungskonzerne“ (Bernhard 2003, 927).
Der Entwicklungsstand des Humankapitals und die Effizienz der Humankapitalveredelungsstätten lässt sich durch „die direkte Befragung von Wissen und Fertigkeiten“ outcome orientiert mittels bestimmter Indikatorensysteme messen, wobei „best value for money“ im Zentrum der inhaltlichen Bestimmung der Indikatoren steht (Klausenitzer 2002). Die PISA-Studie der OECD ist ein Instrument hierzu. „Die ökonomische Analyse von Bildung ist [...] ein Diagnosewerkzeug, um bildungs- und gesellschaftspolitische Prioritäten zu setzen. Das traditionelle Verfahren, Bildungsziele zu formulieren, wird auf den Kopf gestellt: an die Stelle einer gesellschaftlichen Debatte über Ziele tritt die ökonomische Analyse“ (ebd.). Außerdem können Tests als Teile von Steuerungsmechanismen eingesetzt werden. Amos erklärt anhand des No Child Left Behind Acts, wie dies geschieht. Tests erlauben es vermeintlich die Schulleistung zu messen, die mit der Leistung der SchülerInnen gleichgesetzt wird (vgl. Amos 2011, 328). „Diese Maßnahme ist, um wirksam sein zu können, an ein Anreiz- bzw. Bestrafungssystem gekoppelt“ (ebd.). Es droht das Etikett „failing school“, was im schlimmsten Fall zur Schließung der Schule führt. Umgedreht kann es als Anreiz für gute Ergebnisse Boni für die Schulleitung geben (vgl. Amos 2011, 329). Auch hier zeigt sich die Annahme, „Schule ließe sich ebenso auf ihren technologischen Kern reduzieren wie Güter-produzierende Unternehmen“ (ebd.). Als Folgen solcher Dynamiken können die sogenannte „teaching to the test“ Praxis sowie Versuche leistungsschwache SchülerInnen loszuwerden, die in dieser Logik die Schulleistung senken, ausgemacht werden (vgl. Amos 2011, 330 f.). Vergleichstests sind also Mittel zur „betriebswirtschaftliche[n, d. V.] Durchstrukturierung und Neuorganisation staatlicher Bildungs- und Erziehungsinstitutionen, demzufolge Schulen auf Quasimärkten miteinander konkurrieren. Permanente Leistungsvergleiche, Schulrankings, Elternwahlrecht und die Intensivierung einer testdiagnostischen ‚Förder(!)‛-Kultur […] schreiben die Segregation von SchülerInnen mit einer Behinderung fest“ (Herz 2012, 41).
Außerdem gibt es Folgen für die Auswahl und die Art und Weise der Vermittlung von Bildungsinhalten. Auch hier „schlägt die Verdinglichung der menschlichen Wesenskräfte […] durch, [insofern, d. V.] als der menschheitliche Entstehungszusammenhang von Bildungsinhalten und ihrer methodischen Vermittlung nicht mehr in den Horizont schulischen Lernens tritt“ und stattdessen an „vorfabrizierten […] präjudizierenden Materialien“ gelernt wird, die einen „schematischen Bildungsprozess“ befördern und „schablonenhafte Wahrnehmungs- und Erfahrungsformen“ verstärken, anstatt diese zu durchbrechen (Bernhard 2003, 932 f.).
Auf der Grundlage der hier dargelegten Aspekte dieses Kapitels kann abschließend festgehalten werden, dass der Aspekt der ökonomischen Verwertbarkeit, der sich mit der Humankapitaltheorie in unsere Vorstellung von Menschen einschreibt, „keinen pädagogischen Maßstab bilden“ kann (Bernhard 2003, 935).
Nachdem auf die Humankapitaltheorie, als ein wichtiger Aspekt neoliberaler Transformationen, eingegangen wurde, soll an dieser Stelle ein weiterer wichtiger Aspekt in den Blick geraten, der hilfreich für das Verständnis dieser Prozesse sein soll. Es geht um den „Wandel in der Wohlfahrtsarchitektur“, der sich „in Deutschland ebenso wie in allen anderen entwickelten Wohlfahrtsstaaten“ abzeichnet, also um ein verändertes Verständnis der Aufgaben des Staates (Olk 2009, 23). „Vor dem Hintergrund veränderter ökonomischer und sozialer Rahmenbedingungen und grundlegender Defizite des „alten“ Wohlfahrtsregimes werden neue wohlfahrtspolitische Konzepte und Leitbilder unter Oberbegriffen wie „aktivierender Staat“ oder „Sozialinvestitionsstaat“ propagiert, welche den „versorgenden Sozialstaat, der darauf abzielte, soziale Risikolagen durch die Zuteilung von Rechtsansprüchen auf Geldeinkommen zu kompensieren“, ablösen. (Olk 2007, 43). Es wird der „aktivierende Investitionsstaat“ errichtet, „der in das ‚Humankapital‛ von Menschen bzw. in das ‚Sozialkapital‛ von Gemeinschaften investiert“ (ebd.). Die Idee des Sozialinvestitionsstaats wurde als „Reaktion auf die neoliberale Kritik am traditionellen Wohlfahrtsstaatsmodell entwickelt“ (Olk 2007, 44). „Der herkömmliche reaktiv-kompensatorische, ‚sorgende‛ Staat zielte darauf ab, die negativen Folgen marktwirtschaftlicher Prozesse sozial abzufedern und soziale Risiken insbesondere für die abhängig Beschäftigten durch Ausbau von Schutzrechten und die Gewährung von Lohnersatzleistungen zu bekämpfen“ (ebd.).
Die Politik der Dekommodifizierung geriet mit „dem Scheitern der keynesianistischen Wirtschaftssteuerung in den frühen 1970er Jahren“ und dem gleichzeitigen Aufstieg des Neoliberalismus unter Druck und die „expansive Ausgabenpolitik des umverteilenden Sozialstaates“ geriet als wirtschaftsschädlich und als schädlich für die Menschen im Kontext von „Welfare Dependency“ in die Kritik (Olk 2007, 44 f.). „Aus diesem Grund richtet sich der Sozialinvestitionsstaat konsequent an möglichen produktiven Effekten staatlicher Sozialausgaben aus“ (ebd.). Wie ein Unternehmer tätigt er also nur Investitionen, „in denen er Gewinne in der Zukunft erwartet“ (ebd.). „Dementsprechend wird die Investition in Humankapital als Königsweg zur Vorbereitung auf eine Zukunft in einer globalisierten Welt und wissensbasierten Ökonomie verstanden“ (ebd.). Durch „die Investition in ihr Humankapital [werden die BürgerInnen, d. V.] in die Lage versetzt, sich flexibel an die wechselnden Anforderungen der (Arbeits-)märkte anzupassen und damit ihre Integration in die Gesellschaft (selbst) zu organisieren“ (ebd.). Im Schröder-Blair-Papier, in dem die Programmatik dieser Politik festgehalten ist, wird dies wir folgt formuliert: „Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung umwandeln“ (Schröder & Blair 1999). „Das zentrale Ziel des Sozialinvestitionsstaates ist die Inklusion der Sozialbürger in Märkte – insbesondere in Arbeitsmärkte – um sowohl die soziale Integration und Kohäsion einer nationalen Gesellschaft als auch deren ökonomische Wettbewerbsposition zu sichern“ (ebd.). Der Sozialinvestitionsstaat hat also insofern einen aktivierenden Charakter, als dass an „die Stelle der bisherigen Betonung des Sozialschutzes, der Gewährleitung von sozialer Sicherheit und der Abmilderung sozialer Ungleichheiten“ die „Förderung wirtschaftlichen Wachstums durch die Mobilisierung und Aktivierung der produktiven Potenziale unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen“ tritt (Olk 2009, 23). Das Ziel der Vollbeschäftigung weicht dem Ziel der Beschäftigungsfähigkeit (vgl. Olk 2007, 45). „Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind Strategien der Aktivierung durch eine Mixtur aus ‚Fordern und Fördern‛ sowie lebenslanges Lernen“ (Olk 2007, 45 f.). Das Prinzip zeigt sich in der „Verknüpfung sozialer Rechte mit bestimmten Verhaltensanforderungen“ nach dem Motto „keine Leistung ohne Gegenleistung“ (Olk 2009, 24). Fordern zeigt sich in der Verpflichtung zur Annahme jedweder Arbeit unter der Androhung von Kürzung oder Streichung von Sozialleistungen bei Ablehnung. Fördern zeigt sich beispielsweise in Angeboten eines maßgeschneiderten Case-Managements (vgl. ebd.).
„Eingeleitet wurde dieser Politikwandel durch den Regierungswechsel […] zur rot-grünen Regierungskoalition unter Kanzler Schröder im Jahre 1998“ (Olk 2007, 47). Er fand schließlich unter dem Namen Hartz-Gestze insbesondere seinen Niederschlag auf sozial-aktivierende Weise „in den Reformen […] der Arbeitsmarktpolitik“ (ebd.).
Welche Auswirkungen gab es jedoch im Bereich Bildungspolitik? Wie bereits erwähnt wurde menschliches Kapital ein entscheidender Faktor für wirtschaftlichen Erfolg, weshalb Regierungen in sozialinvestiven Staaten mit Nachdruck am Aufbau einer Wissensbasis arbeiten müssten, um wirtschaftliche Potenziale freizusetzen, wobei der Bildung eine Schlüsselrolle zukommt (vgl. Pasuchin 2012, 200). „Wer sich, von solchen und ähnlichen Aussagen ausgehend, tatsächlich steigende öffentliche Investitionen in den Bildungsbereich erwartet hatte, wurde [...] schnell und bitter enttäuscht“, da die finanziellen Möglichkeiten nicht aufgebracht wurden (ebd.). Somit stellt die Förderung von Bildung zwar ein essentielles staatliches Interesse dar, wobei „entsprechende Maßnahmen jedoch immer weniger mit öffentlichen Geldern finanziert werden können“ (ebd.). Es wird also deutlich, dass sich die Regierungen in einer Zwickmühle befanden. „Einerseits besteht der einzige Weg, der ihnen hier auf den ersten Blick Einsparungen erlaubt, in der größtmöglichen Privatisierung des Bildungssystems“, was jedoch „zwangsweise zum Rückgang des Bildungsniveaus der Bevölkerungen führt, was wiederum erwiesenermaßen das Sozialsystem auf Grund höherer Arbeitslosigkeit, Kriminalität etc. an anderen Stellen enorm belastet“ und was vor allem aber „in einem diametralen Widerspruch zur für den informationellen Kapitalismus zentralen Idee der außerordentlichen ökonomischen Bedeutung des ‚Humankapitals‛“ steht (ebd.). Somit blieben konkrete Handlungsspielräume der Bildungspolitik begrenzt (vgl. ebd.).
Es wurde zwar Privatisierung vorangetrieben. Sie „beschränkte sich jedoch fast ausschließlich auf den tertiären Sektor – d.h. auf Universitäten und (Fach-) Hochschulen und musste auch hier durch zahlreiche Maßnahmen ‚abgefedert‛ werden, um die ‚Akademikerquote‛ wenigstens auf einem konstanten Niveau halten zu können sowie um ein Minimum an Ausbildungsqualität zu gewährleisten“ (ebd.). „Erste Priorität muß die Investition in menschliches und soziales Kapital sein“, heißt es im Schröder-Blair-Papier, in welchem die Programmatik der Bildungspolitik formuliert ist (Schröder & Blair 1999). „Die Ausbildungsqualität auf allen Ebenen der schulischen Bildung und für jede Art von Begabung muss gesteigert werden: Wo Probleme bei Lesen, Schreiben und Rechnen bestehen, müssen diese behoben werden, da wir ansonsten Menschen zu einem Leben mit niedrigem Einkommen, Unsicherheit und Arbeitslosigkeit verurteilen“ und „Zugang und Nutzung zu Bildungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen stellen die wichtigste Form der Sicherheit in der modernen Welt dar“, heißt es weiterhin (ebd.). Abgesehen davon, dass sich hier der marktwirtschaftliche Nutzen als einzige Legitimation von Bildung hervortut, zeigt sich, dass das Papier, wenn es um konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele geht, vage bleibt. Es findet sich lediglich die Aussage, dass es Aufgabe der Regierung ist, „einen Rahmen zu schaffen, der es den Einzelnen ermöglicht, ihre Qualifikationen zu steigern und ihre Fähigkeiten auszuschöpfen“ (ebd.). Letztlich gab es jedoch auch Reformen auf sozial-investive Weise im Bereich der Bildungs- und Familienpolitik. Dazu gehörten der Ausbau Ganztagsschulen mit dem Programm „Zukunft Bildung und Betreuung – 2003-2007“, der Ausbau Kinderbetreuung durch das „Tagesbetreuungsausbaugesetz“ und die Senkung von Opportunitätskosten von Elternteilen, die ihre Erwerbstätigkeit für Kindererziehung unterbrechen durch das „Elterngeld“ (ebd.).
Inhaltsverzeichnis
Nachdem ein Inklusionsverständnis und Analysen gesellschaftlicher Bedingungen dargelegt wurden, soll an dieser Stelle der Versuch unternommen werden, beides in ein Verhältnis zu setzen. Lassen sich Unterschiede festmachen und wenn ja, in welchen Punkten? Gibt es Überschneidungen und Gemeinsamkeiten und wenn ja, wo liegen diese? Das sind die Fragen, die hierbei leitend sein sollen. Das vorgestellte Inklusionsverständnis im Sinne einer Vision oder Utopie muss sich zwangsläufig in Opposition zu gesellschaftlichen Verhältnissen verstehen, da es auf etwas zielt, das noch nicht ist. Ziel der folgenden Überlegungen zu Unterschieden ist es, Inklusion in Position zu gesellschaftlichen Verhältnissen zu setzen, damit klarer wird, an welchen Stellen genau ein inklusiver Anspruch in Opposition zu ihnen steht. Der Blick auf die Überschneidungen soll aufmerksamer für die Gefahren einer sachfremden Vereinnahmung der Inklusion machen. Hinz zufolge besteht die Gefahr, „dass Inklusion von […] neoliberal ausgerichteten Machtinteressen eingefangen und damit der bisherige Diskurs mehr und mehr enteignet wird“ (Hinz 2014b, 8). Dies ist verbundenen mit der Hoffnung, den inklusiven Anspruch auf diese Weise argumentativ genauer gegen widerstrebende Tendenzen behaupten zu können. Dies scheint nötig, da – wie bereits ausgeführt – sich in der Praxis unterschiedliche AkteurInnen mit unterschiedlichen Zielen unterschiedlich auf den Inklusionsbegriff beziehen. Pädagogische InklusionstheoretikerInnen haben es nach meinem Kenntnisstand bisher versäumt, den Inklusionsbegriff eindeutig in Stellung zu gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen zu bringen. Die deutschsprachige Inklusionstheorie ist auch vereinzelt Vorwürfen ausgesetzt, sie würde derzeitige gesellschaftliche Entwicklungen ignorieren (s. Herz 2012, 37). Diese Kritik ist verknüpft mit dem Vorwurf, es habe „etwas Weltfremdes, Inklusion als Vision anzupreisen, wenn nicht zugleich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen präzisiert werden, die bisher national wie international die Rahmenbedingungen einer ‚Inclusive Education‛ verhindern“ (Herz 2012, 47).
Ganz gerechtfertigt ist diese Kritik nicht, da auch Stellungnahmen zu gesellschaftlichen Verhältnissen, die Inklusion befördern oder verhindern aus inklusionspädagogischer Perspektive vorgestellt wurden und werden. So heißt es beispielsweise schon bei Prengel, dass „eine demokratische Vorstellung von Zusammenleben der Verschiedenen […] ohne politische und ökonomische Demokratisierung auf nationaler und internationaler Ebene undenkbar [ist, d. V.]. Die Umverteilung der vorhandenen ökonomischen Ressourcen zugunsten der ökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen und Staaten ist eine Voraussetzung zur Entfaltung von Vielfalt“ (Prengel 1995, 192).
Fruchtbar mag die genannte Kritik sein, wenn sie darauf verweist, dass der Bezug zu gesellschaftlichen Verhältnissen noch nicht ausreichend ausformuliert wurde, was angesichts der Komplexität der Thematik und der Notwendigkeit zu fachfremden Bezügen nicht verwundert. In diesem Sinne sollen die folgenden Ausführungen als Beitrag zum Nachdenken darüber verstanden werden.
Der wohl fundamentale Unterschied der beiden Konzeptionen liegt in ihrem normativen Bezugssystem. Inklusion bezieht sich auf die Menschenrechte. Folglich geht es um den Versuch der Anerkennung menschlicher Würde, der in der Anerkennung spezifischer, ausformulierter Rechte Respekt gezollt wird, die Menschen qua ihres Menschseins zustehen. Dies findet Ausdruck im anerkennenden Umgang mit allen Aspekten von Heterogenität, die in integrativen Prozessen im Sinne Reisers (vgl. Kap. 1.5.1) in ein Verhältnis zueinander gebracht werden sollen, was zur Ablehnung der Dominanz einzelner Aspekte der Heterogenität führt.
Der Unterschied zu neoliberalen Entwicklungen liegt auf der Hand. Dort, wo der Markt das alleinige Bezugssystem ist, werden alle Aspekte von Heterogenität, die sich nicht auf dem Markt behaupten können, wertlos. Berechtigungen ergeben sich nicht allein aus dem Menschsein, sondern aus dem Nutzen, den die menschliche Existenz innerhalb der Verwertungslogik erbringt. Alles, was nicht der marktorientierten Leistungslogik entspricht, wird notwendigerweise als normabweichend abgelehnt. Gilt das Humankapitalparadigma, geraten die angeborenen und erworbenen Eigenschaften der Menschen ausschließlich hinsichtlich ihrer Verwertungsrelevanz in den Blick und auch die bildungsmäßige Bearbeitung der Menschen kann keiner anderen Maxime unterworfen sein. Unter Rückgriff auf die Modelle zum Umgang mit Heterogenität (vgl. Kap. 1.5) entspräche dies dem „Anpassungsmodell“. Die allgemeine Normalität, an der sich alles in der Entwicklung orientiert, stellt sich in der Ausrichtung aller Lebensvollzüge an der Verwertungsrelevanz dar. Diese einseitige Fokussierung widerspricht inklusivem Denken, bei dem es darum geht, verschiedene Anteile, auch jene, die sich nicht oder schwer vermarkten lassen, in ein Verhältnis zueinander zu bringen.
Neben der Ablehnung der nicht-marktgängigen Aspekte von Heterogenität, die den Neoliberalismus in Widerspruch zur Inklusion bringt, bestehen auch Unterschiede in der Art und Weise des Umgangs mit Heterogenität. Neoliberalismus erzieht zu Individualismus und zu Konkurrenz. Es geht darum, sich mit den eigenen Heterogenitätsaspekten von Anderen abzugrenzen, um sich eigenständig am Markt behaupten zu können. Dies bedeutet, dass die Behauptung der eigenen Persönlichkeit stets nur über die Verdrängung und Nicht-Akzeptanz Anderer möglich ist. Dies steht im Widerspruch zum inklusiven Verständnis, in dem es darum geht, auf der Basis von Akzeptanz der Gleichheit und der Verschiedenheit, Aspekte des Eigenen und des Fremden dialogisch in ein balanciertes Verhältnis zu bringen. Konkurrenz produziert systematisch Ausschluss derjenigen, die sich nicht behaupten können und ist folglich nicht vereinbar mit Inklusion. Generell lässt sich sagen, dass im neoliberalen Denken aus inklusionstheoretischer Perspektive eine übersteigerte Bewertung individueller Freiheit stattfindet, da nur der Markt entscheidet, ob und wie sich etwas durchsetzen kann. In inklusiven Prozessen wären mehr Instanzen beteiligt.
Mit Blick auf Bildung widerspricht eine marktwirtschaftliche, outcome-orientierte Führung schulischer Institutionen inklusiven Ansprüchen. In inklusiven Schulen wird versucht, alle AkteurInnen mit ihrer spezifischen Eigenart wahrzunehmen. Sie haben das Recht, die Prozesse in der Schule zu gestalten, auch wenn sie sich mit Aspekten einbringen, die, einer ökonomischen Kalkulationen folgend, nicht in die Gestaltung schulischer Prozesse einfließen sollten. Argumentationen, deren Bezugspunkt die Kosten-Nutzen-Logik des Marktes ist, eignen sich daher nicht zur Unterstützung inklusiver Entwicklungen und müssten dort, wo sie auftauchen, aus inklusionspädagogischer Perspektive unter Verweis auf die Menschenrechte kritisiert werden. Trotzdem lassen sich solche Argumentationen auch aus inklusionspädagogischer Perspektive finden. So argumentierte beispielsweise Preuss-Lausitz in einem Streitgespräch in der Wochenzeitung „Die Zeit“ gegen die Möglichkeit, sowohl inklusive als auch Sonderbeschulung anzubieten, mit der Begründung, dass es teurer sei, verschiedene Systeme parallel zu finanzieren. Er wird zitiert mit den Worten: „Das können wir uns nicht leisten“ (Schnabel & Spiewak 2010, 5). Darin zeigt sich beispielhaft, dass neoliberales Denken an die Inklusionsdebatte herangetragen wird und dass es machbar ist, beides scheinbar widerspruchsfrei zu verbinden. Daher macht es Sinn, genauer zu schauen, an welchen Stellen eine solche Vereinnahmung leicht gemacht ist, um darauf mit Verweis auf die Unvereinbarkeit der beiden Konzepte aufgrund ihrer unterschiedlichen Bezugssysteme reagieren zu können. Dazu dienen die folgenden Überlegungen.
Welche Aspekte des inklusiven Ansatzes bieten nun Aneignungsmöglichkeiten des Begriffs aus neoliberaler Perspektive? Unter neoliberalem Blickwinkel ließe sich Inklusion beispielsweise im Einklang mit den Transformationen im deutschen Sozialstaatsmodell verstehen. Ein differenziertes Sonderschulwesen würde als Kostenfaktor aufgefasst werden, der wohlfahrtsstaatlich durch Umverteilung finanziert wird. „Obwohl von fachlicher Seite immer wieder betont wird, dass Integration/ Inklusion kein Sparmodell darstellt, dass es sogar teurer als das Förderschulsystem sein wird, scheinen manche hinter der unkalkulierbaren Chiffre ‚inklusives Schulsystem‛ die Chance zu sehen, nicht nur die Kosten für das bisherige Sonderschulsystem einzusparen, sondern auch diejenigen, für das ersatzweise aufzubauende schulinterne Lernstützsystem an der allgemeinen Schulen“ (Speck 2010, 129). Ziel schulischer Inklusion ist jedoch nicht Kostenreduktion. Ein solcher Blick verstellt die Sicht auf die tatsächlichen Anliegen inklusiver Schulentwicklung. Derartigen Argumentationen ist daher aus inklusionspädagogischer Perspektive mit Skepsis zu begegnen. Würde sich herausstellen, dass Inklusion mit Mehrkosten verbunden ist, wäre ihr sofort die Argumentationsgrundlage entzogen.
Eine weitere Möglichkeit zur Aneignung der Inklusion durch neoliberale AkteurInnen ergibt sich mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen in inklusiven Settings. Der Markt benötigt qualifiziertes und möglichst umfassend ausgebildetes Humankapital. Frühe Selektion, die nach wie vor stark an den sozioökonomischen Status der Eltern geknüpft ist, erschwert oder verbaut Bildungs- und Erfahrungschancen und steht somit einer optimalen Bildung des Humankapitals im Wege. Auch derartigen Argumentationen ist aus inklusionspädagogischer Perspektive mit Argwohn zu begegnen, da es in inklusiven Bildungsprozessen um mehr gehen muss als um Humankapitalproduktion. Unter Rückgriff auf Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ließe sich beispielsweise Folgendes entgegnen: „Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein“ (AEMR 1948, 6). Der Bezug auf die Menschenrechte geschieht hier exemplarisch für eine Reihe von Formulierungen von Bildungszielen und Bildungsidealen, die über die Humankapitalproduktion hinausgehen. Das Wissen um Alternativen zum Bildungsverständnis als Humankapitalproduktion und die Möglichkeit zum Rückgriff auf diese, scheinen geeignete Voraussetzungen, um eine derartige Verengung zunächst zu erkennen, um im Anschluss ein positives Gegenbild aufzuzeigen.
Mit Blick auf inklusive Settings könnte sich außerdem folgender Aspekt aus neoliberaler Perspektive als vorteilhaft erweisen. In einer Schule für alle gibt es gesteigerte Möglichkeiten, den Wettbewerbsdruck zu erhöhen. Entwicklungschancen in Bezug auf Zugang zu weiterführenden Qualifikationen sind nicht von vornherein ungleich durch unterschiedliche Startbedingungen in den unterschiedlichen Schulformen im segregierenden Schulsystem gegeben, sodass SchülerInnen in einer Schule für alle besser in einen tatsächlichen Wettbewerb um den Erweis ihrer Fertigkeiten gebracht werden können. Hier bleibt jedoch außer Acht, dass es inklusiver Pädagogik nicht darum geht, Menschen in Konkurrenz zu bringen. Treten solche Argumentationen auf, müsste darauf aus inklusionspädagogischer Perspektive mit dem Verweis auf das Ziel ausbalancierter Beziehungen reagiert werden.
Dies steht auch in Zusammenhang mit einem weiteren Punkt, der Aneignungsmöglichkeiten der Inklusion durch neoliberale AkteurInnen bietet. Ziel des Neoliberalismus ist die Mobilisierung und Aktivierung aller wirtschaftlichen Potentiale und die Integration aller in den Arbeitsmarkt. Hierin liegen starke Überschneidungen mit dem inklusiven Anspruch. Auch aus inklusiver Sicht geht es darum, Menschen mit ihren Potentialen wahrzunehmen, und Gelegenheiten zu schaffen, in denen Menschen sich mit ihren Potentialen einbringen können. Im Unterschied zum Neoliberalismus werden aus inklusiver Perspektive auch unwirtschaftliche Aspekte von Heterogenität als Potential aufgefasst. Trotzdem gilt der Anspruch, allen Potentialen Raum zu geben, auch für den gesellschaftlichen Bereich der Arbeit. Auch dieser Bereich wird in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung thematisiert. Wörtlich heißt es in Artikel 27: „States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appropriate steps, including through legislation“ (CRPD 2006, 17). Es geht also um die Möglichkeit, frei gewählt an einem Arbeitsmarkt teilzunehmen, der inklusiv gestaltet ist. Hier offenbart sich ein Widerspruch zum Neoliberalismus. Die Integration aller wirtschaftlichen Potenziale in den Arbeitsmarkt folgt hier ökonomischen Maximen. Ziel ist es, Sozialausgaben, die durch Umverteilung finanziert werden, zu senken, indem mit der Politik des Forderns und Förderns – nach dem Motto „keine Leistung ohne Gegenleistung“ – Druck aufgebaut wird, der Menschen antreibt, einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt nicht inklusiv gestaltet ist, da er auf dem Konkurrenzprinzip beruht und somit systematisch Ausschluss produziert. Diese Widersprüchlichkeiten müssten von inklusionspädagogischer Seite thematisiert werden, wenn inklusive Entwicklungen aus neoliberaler Perspektive derartig begründet werden.
Inhaltsverzeichnis
Es wurde versucht, ein Verständnis von Inklusion darzulegen und dieses Verständnis Analysen gesellschaftlicher Verhältnisse gegenüberzustellen, um im Anschluss das Verhältnis beider Denkweisen zu diskutieren, wobei Unterschiede und Überschneidungsmöglichkeiten herauskristallisiert wurden. Nun soll in Anlehnung an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ein Dokument der Inklusionsdebatte genauer untersucht werden. Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, wie der Inklusionsbegriff abweichend vom hier dargelegten Verständnis genutzt wird. Außerdem wird untersucht, ob neoliberale Denkfiguren im Text identifizierbar sind. Ist beides der Fall, so wäre belegt, dass Inklusion tatsächlich von neoliberalen AkteurInnen aufgegriffen, diesem Denken entsprechend genutzt wird und möglicherweise im Zuge dessen Umdeutungen unterliegt. Außerdem ließen sich Diskursstrategien identifizieren. Hieraus ließen sich Indizien für bestimmte Tendenzen der Umformung des Inklusionsbegriffs in neoliberaler Verwendung und Indizien für spezifische neoliberale Argumentationen innerhalb der Inklusionsdebatte ableiten. Kenntnisse darüber würden helfen, Beiträge der Inklusionsdebatte genauer zu verstehen und somit Möglichkeiten bieten, sich differenzierter in dieser Debatte zu bewegen.
Bei dem Material handelt es sich um das Vorwort zur Studie „Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland“, die 2010 vom emeritierten erziehungswissenschaftlichen Professor für empirische Bildungsforschung und Bildungsplanung an der Universität Duisburg-Essen Klaus Klemm verfasst wurde. Klaus Klemm absolvierte ein Lehramtsstudium und ein Zweitstudium in Wirtschaftswissenschaften, bevor er in den Wissenschaftsbetrieb einstieg. Neben seiner Arbeit an der Universität engagierte er sich in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Zukünftige Bildungspolitik“ und in dem von der Bundesregierung und den Regierungen der Länder gemeinsam berufenen „Forum Bildung“. Bis Ende 2006 war er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der PISA-Studien und im Beirat der Bildungsberichterstattung. 2010 wurde er in den Expertenkreis „Inklusive Bildung“ der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. berufen. Er ist im FAZ-Ranking der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands von 2013 auf Platz 43 geführt. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Feldern Bildungsplanung‚ Bildungsfinanzierung, empirische Bildungsforschung sowie Inklusion (vgl. Universität Duisburg-Essen o. J.).
Bei der Studie, die als kostenloser Download auf der Homepage der Bertelsmann Stiftung erhältlich ist, handelt es sich um eine „bildungsstatistische Analyse zum aktuellen Stand und zu jüngeren Entwicklungen inklusiver Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Schulen“ in Deutschland (Klemm 2010, 8). Um diesen darzustellen, wurden Daten zu sogenannten „Förderquoten“, „Exklusionsquoten“, „Inklusionsquoten“, „Exklusionsanteilen“ und „Inklusionsanteilen“ in den einzelnen Bundesländern erhoben (Klemm 2010, 13). Außerdem wurden empirische Befunde zu unterschiedlichen Förderkonzepten zusammengetragen und interpretiert. Aus den Befunden wurden zudem Handlungsbedarfe für Praxis und Forschung abgeleitet.
Die Studie wurde von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben und ist die erste einer Reihe von Studien, die Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zum Thema Inklusion durchführte. Die Darstellungen der Bertelsmann Stiftung sind sehr kontrovers. Die Stiftung wurde 1977 vom Leiter des Verlagshauses Bertelsmann Reinhardt Mohn gegründet. Laut Homepage der Stiftung lag der Gründung die Überzeugung des Stifters zugrunde, dass Folgen der Globalisierung nicht ausreichend bedacht seien. Daher sei es zur Aufgabe der Stiftung geworden, unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen, auch aus anderen Ländern, Problemlösungen für verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu entwickeln und somit der Systemfortschreibung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu dienen. Weiter heißt es, die Stiftung verfolge ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, wie die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Religion, öffentlichem Gesundheitswesen, von Jugend- und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Volks- und Berufsausbildung, Wohlfahrtswesen, internationalem Kulturaustausch, demokratischem Staatswesen und bürgerschaftlichem Engagement. Die Stiftung versteht sich als operative Stiftung. Es wird also nur Geld in Projekte investiert, die die Stiftung selbst konzipiert, initiiert und in Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis umsetzt (vgl. Bertelsmann Stiftung o. J.).
Gleichzeitig ist die Bertelsmann Stiftung zum Teil auch heftiger Kritik ausgesetzt. KritikerInnen brandmarken die Bertelsmann Stiftung als einen wichtigen Akteur neoliberaler Transformationen, da sie in diesem Sinne aktiv in die Politik eingreife. Ziel hierbei sei die Durchsetzung des New Public Management in allen öffentlichen Bereichen – auch der Bildung –, womit Effizienzsteigerung auf Kosten von MitarbeiterInnen, Privatisierung und Autonomisierung einhergehe. Aus diesem Grund wird auch der Status der Gemeinnützigkeit der Stiftung in Frage gestellt (vgl. Bertelsmannkritik 2009).
Das Vorwort zur Studie ist von Jörg Dräger und Annette Stein unterzeichnet. Jörg Dräger studierte Physik und Betriebswirtschaftslehre und erwarb den Master of Science sowie den Doctor of Philosophy in Theoretischer Physik. Er war unter anderem tätig für die Unternehmensberatung Roland Berger in Frankfurt/Main, Geschäftsführer des Northern Institute of Technology, parteiloser Senator für Wissenschaft und Forschung in Hamburg (unter seiner Verantwortung führte Hamburg Studiengebühren ein), Mitglied der Kultusministerkonferenz, stellvertretendes Mitglied des Bundesrates und Senator für Gesundheit und Verbraucherschutz. Seit 2008 ist er Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung für die Bereiche Bildung, Integration und Demokratie sowie Geschäftsführer des Centrum für Hochschulentwicklung. Seit 2012 ist Dräger außerdem assoziiertes Fakultätsmitglied der Hertie School of Governance und lehrt dort Public Management (vgl. Bertelsmann Stiftung o. J.). Anette Stein ist Direktorin des Programms wirksame Bildungsinvestitionen der Bertelsmann Stiftung (vgl. ebd.).
Der Wahl des Vorworts zum Analysematerial dieser Arbeit ging ein Sondierungsprozess voraus, in dessen Verlauf gezielt nach Beiträgen zur Inklusionsdebatte gesucht wurde, die sich in Kontexten befinden, die in Zusammenhang mit neoliberalem Denken gerückt werden. Dabei rückte die Bertelsmann Stiftung in den Blickpunkt des Interesses, da sie, wie bereits dargelegt, als neoliberaler Akteur bezeichnet wird und verschiedene Veröffentlichungen zum Thema Inklusion herausgebracht hat. Nachdem unterschiedliche Veröffentlichungen zunächst oberflächlich exploriert wurden, fiel die Wahl auf das Vorwort, da es den Eindruck erweckte, ergiebig in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit zu sein. Außerdem ist es der Vorteil der Textform Vorwort, dass bei geringem Textumfang viele Inhalte gerafft vorgetragen werden, was eine eine zeit- und platzökonomisch geeignete sowie Redundanz vermeidende Analyse begünstigt, welcher die Wahl mit beeinflusste.
Das Material wird als Beitrag zur Inklusionsdebatte betrachtet. In der Inklusionsdebatte besteht die Gefahr, dass AkteurInnen mit einem diffusen Inklusionsbegriff operieren, sodass nicht klar wird, was eigentlich gemeint ist. Wie dargelegt wurde, gibt es Überschneidungen von neoliberalen Anliegen und Inklusion, sodass Aneignungsmöglichkeiten bestehen, auch wenn sich aus dem unterschiedlichen Bezugssystem fundamentale Widersprüche ergeben. Demnach ist die Analyse auf den Gegenstand des Materials gerichtet. Folgende Fragen leiten die Analyse:
-
Passen die Ausführungen zu Inklusion im Vorwort der Studie zum im Kapitel 1 vorgestellten pädagogischen Verständnis von Inklusion?
-
Lassen sich Textpassagen im Vorwort der Studie finden, die der neoliberalen Denkweise, wie sie in Kapitel 2 vorgestellt wurde, entsprechen?
In einem ersten Schritt werden Textpassagen gesammelt, die zu den Fragestellungen passen. Anschließend wird versucht, inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen den Passagen zu finden, um Einzelpassagen zu größeren Sinnzusammenhängen zusammenzufassen. Im letzten Schritt werden die identifizierten und zusammengefassten Passagen in ein Verhältnis zur dargelegten Theorie gesetzt, um die Fragestellungen beantworten zu können.
Bei der Analyse des Vorwortes wurden vier Aspekte ausgemacht, bei denen die Ausführungen im Text zu Inklusion im Widerspruch zum pädagogischen Inklusionsverständnis stehen. Sie werden im Folgenden zusammengefasst und am Text belegt. Außerdem wird die genaue Widersprüchlichkeit expliziert.
1. Einseitige Fokussierung auf einen Aspekt von Heterogenität
Zunächst lässt sich feststellen, dass Begriffe genutzt werden, um bestimmte Sachverhalte zu beschreiben, welche nicht mit der Bedeutung der Begriffe im pädagogischen Diskurs übereinstimmen. Dies gilt unter anderem für den Begriff Inklusion. Dieser Begriff wird ausschließlich benutzt, um das Vorhandensein von SchülerInnen, denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert wurde, in der allgemeinen Schule zu beschreiben. Am deutlichsten wird dies im zweiten Abschnitt. Dort wird die Aussage, dass auch einige Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit anderen Kindern ohne Förderbedarf gemeinsam an Regelschulen lernen, als Inklusion definiert, indem der Begriff in Klammern hinter die Aussage gesetzt wird (vgl. Dräger & Stein 2010, 4). Dies ist eine im Sinne des pädagogischen Inklusionsverständnisses ungerechtfertigte Fokussierung auf einen Aspekt von Heterogenität und entspricht in dieser Form eher dem Verständnis von Integration.
2. Zementierung der Zwei-Gruppen-Theorie
Außerdem besteht die Gefahr der Zementierung der Zwei-Gruppen-Theorie bei einer derartigen Fokussierung. Verstärkt wird dieser Eindruck auch durch die Formulierung aus dem ersten Absatz, dass die Untersuchung zeigt, „wie sich diese Kinder und Jugendlichen auf die einzelnen Förderschwerpunkte verteilen“ (ebd.). Die Verwendung des Aktiv suggeriert, dass die entsprechenden Kinder und Jugendlichen durch ihr Sosein selbst dafür sorgen, dass sie einen bestimmten Förderbedarf diagnostiziert bekommen, wodurch verschleiert wird, dass es sich um eine Kategorie handelt, die von außen an die Kinder und Jugendlichen herangetragen wird. Selbiges zeigt sich auch in Formulierungen wie „Inklusionsanteil“ (ebd.). In einem System, in dem alle selbstverständlicher Teil sind und es keine dominante Normalität gibt, kann es keinen Inklusionsanteil geben. Die Verwendung des Inklusionsbegriffs auf die Weise, dass eine klar abgrenzbare Gruppe an der Regelgruppe teilnimmt, entspricht auch eher dem, was derzeitig unter dem Begriff der Integration verhandelt wird.
3. Heranziehen eigener Begründungen für Inklusion
Im Text finden sich verschiedene Stellen, an denen Argumente für den Ausbau eines inklusiven Schulsystems vorgestellt werden. Explizit wird als Begründung genannt, dass durch ein inklusives Schulsystem „Kindern und Jugendlichen […] Perspektivlosigkeit [,welche sich aus fehlenden Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt ergibt, d. V.], erspart bleibt und sie die für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendigen Kompetenzen erwerben können“ (Dräger & Stein 2010, 5). Außerdem werde Inklusion gebraucht, „um die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in Deutschland deutlich zu reduzieren“ (Dräger & Stein 2010, 6). Für Inklusion spreche weiterhin, dass „Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf – zumindest im Schwerpunkt Lernen – bei inklusiver Unterrichtung deutlich bessere Lernergebnisse erzielen“ (ebd.).
Des Weiteren findet sich folgender Satz zur Begründung eines inklusiven Ansatzes: „Auch die Kinder und Jugendlichen ohne Förderbedarf profitieren nachweislich vom gemeinsamen Unterricht – sie können soziale Kompetenz und Toleranz im täglichen Umgang einüben, ohne in ihren fachbezogenen Schulleistungen nachzulassen“ (ebd.). Abschließend wird festgestellt, dass Inklusion zum einen etwas sei, dass „wir alle jedem einzelnen Kind schuldig“ seien. Zum anderen hänge davon auch die „Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“ ab (Dräger & Stein 2010, 7). Der Wert von Inklusion ergibt sich also aus der Profitsteigerung in der Humankapitalproduktion, welche in Zusammenhang mit inklusiver Beschulung gebracht wird. Es geht also nicht primär wie im vorgestellten pädagogischen Verständnis um die Durchsetzung eines Menschenrechtes auf Abwehr von ungewolltem Ausschluss, auch wenn der Text auch Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention nimmt. Auffällig ist, dass die Bezugnahme erst relativ spät im Text erscheint. Zu Beginn werden Argumente angeführt, die Inklusion durch Effizienzsteigerung legitimieren und auch die abschließenden Begründungen entsprechen wieder diesem Gedanken. Auch der Textumfang, in dem die Argumentationen entfaltet werden, variiert zwischen 14 Zeilen für eine Argumentation auf Basis von Effizienzsteigerung und drei Zeilen auf der Basis von Menschenrechten. Beides kann als Indiz für eine Gewichtung des jeweiligen Aspekts im vorgestellten Begründungszusammenhang gelesen werden. Auffällig ist auch die Art und Weise, mit der sich auf die Menschenrechte bezogen wird. Die Konvention wird benannt als ein Dokument, mit dem sich Deutschland „verpflichtet“ habe, „ein inklusives Bildungssystem zu errichten“ (Dräger & Stein 2010, 7). Die Menschenrechte erscheinen so eher als ein Druckmittel, um das, was ohnehin wirtschaftlich sinnvoll ist, durchzusetzen. Aus inklusionspädagogischer Perspektive stellen die Menschenrechte jedoch ein hilfreiches Ideal und selbstverständliche Orientierung dar. In der Darstellung im Text pervertiert das inklusionspädagogische Bedürfnis, sich den Menschenrechten anzunähern, zum Zwang sich ihnen unterzuordnen.
4. Eigene Begriffsdefinitionen
Neben der bereits thematisierten Verwendung des Inklusionsbegriffs für Sachverhalte, die im inklusionspädagogischen Diskurs mit Integration beschrieben werden würden, lassen sich weiter abweichende Begriffsverwendungen finden. Im zweiten Abschnitt wird der Sachverhalt, dass die „große Mehrheit der Schulkinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf […] in Deutschland in getrennten Förderschulen unterrichtet“ wird, als Exklusion definiert, ebenfalls indem der Begriff in Klammern hinter die Aussage gesetzt wird (Dräger & Stein 2010, 4). Dem inklusionspädagogischen Diskurs folgend, entspräche dies jedoch der Segregation. Es lässt sich also festhalten, dass bei der Verwendung von Fachtermini das Vokabular des inklusionspädagogischen Fachdiskurses genutzt wird. Die Begriffe werden jedoch mit einer von diesem Diskurs abweichenden Bedeutung versehen.
Im Text ließen sich verschiedene Textpassagen identifizieren, aus denen sich Ansätze neoliberalen Denkens ablesen lassen. Sie wurden zu vier Punkten zusammengefasst. Im Folgenden werden die Punkte vorgestellt und am Text belegt. Außerdem wird expliziert, warum sich in den Punkten Aspekte neoliberalen Denkens widerspiegeln.
1. Kopplung von Bildung und verwertungsrelevantem Kompetenzerwerb
Im vierten Abschnitt des Vorworts wird problematisiert, dass Jugendliche Schwierigkeiten bekommen, einen Abschluss zu erwerben, der ihnen die Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht, was die Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen Leben stark einschränke (vgl. Dräger & Stein 2010, 5). Im folgenden Abschnitt steht: „Damit Kindern und Jugendlichen diese Perspektivlosigkeit erspart bleibt und sie die für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendigen Kompetenzen erwerben können, ist mehr Inklusion im deutschen Bildungssystem unabdingbar“ (ebd.). In diesem Argumentationsgang geschieht Folgendes. Zum einen kommt es zu einer Gleichsetzung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Integration in den Arbeitsmarkt. Dies entspricht neoliberalem Denken insofern, dass der Markt als der Regulierungsmechanismus gesellschaftlicher Prozesse verabsolutiert dargestellt ist. Dementsprechend ist alles, was sich außerhalb des Markts befindet, auch außerhalb der Gesellschaft. Dass durchaus gesellschaftliche Teilhabe außerhalb des Marktes denkbar ist, wird dabei nicht berücksichtigt. Zum anderen wird die Existenz spezifischer, bestimmbarer Kompetenzen suggeriert, die Voraussetzungen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt sind. Es wird weiterhin impliziert, dass der Erwerb dieser Kompetenzen messbar ist und dass verschiedene Abschlüsse den Erwerb dieser Kompetenzen bescheinigen können. Diese Abschlüsse ermöglichen dementsprechend die Integration in den Arbeitsmarkt und schützen somit vor Perspektivlosigkeit. Aufgabe der Bildungs- und Erziehungssysteme ist es somit, für den Erwerb dieser durch Abschlüsse bescheinigten Kompetenzen zu sorgen. In dieser Argumentation offenbart sich die im Zuge der Humankapitaltheorie entstandene Tendenz, (schulisches) Lernen einseitig zum Zweck der marktorientierten Verwertbarkeit der Individuen zu gestalten. Auch wenn innerhalb der Argumentation selbst der Nutzen des Hauptschulabschlusses für die Integration in den Arbeitsmarkt angezweifelt wird, wird im Verlauf des Textes am Ziel festgehalten, „die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in Deutschland deutlich zu reduzieren“ (Dräger & Stein 2010, 6).
2. Anlegen der Effizienzkriterien der Kapitalverwertung an Lernprozesse
In der Fokussierung auf die Steigerung der Anzahl der Hauptschulabschlüsse klingt bereits ein weiterer Aspekt neoliberalen Denkens an, der in folgender Passage noch weiter ausformuliert wird. Im sechsten Abschnitt fließt in die Argumentation für ein inklusives Schulsystem mit ein, dass dies bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischen Förderbedarf, zumindest mit Schwerpunkt Lernen, deutlich bessere Lernergebnisse hervorbringe (vgl. Dräger & Stein 2010, 6). „Auch die Kinder und Jugendlichen ohne Förderbedarf profitieren nachweislich vom gemeinsamen Unterricht – sie können soziale Kompetenzen und Toleranz im täglichen Alltag einüben, ohne in ihren fachbezogenen Schulleistungen nachzulassen“, heißt es im weiteren Textverlauf (ebd.). In diesem Argumentationsgang offenbart sich folgende neoliberale Blickrichtung. Dieser Blick auf das Bildungssystem ähnelt einem Blick, der sonst Wirtschaftsunternehmen gilt. Betriebswirtschaftlich kalkulierend wird geschaut, was den besten Ertrag in Form von durch Abschlüsse bescheinigte Leistungen und Kompetenzen bringt. Es werden also die Effizienzkriterien der industriellen Kapitalverwertung auf organisierte Lernprozesse umgelegt. Der Druck, in effizientem Maße bestimmte Subjektvermögen herzustellen, zeigt sich in dieser Argumentation in ihrer Ausrichtung auf Leistungssteigerung.
3. Erweiterter Qualifikationsbegriff
Darüber hinaus zeigt sich in dieser Argumentation ein weiterer Aspekt, welcher in Zusammenhang mit der Humankapitaltheorie steht. Auch sozio-emotionale Fähigkeiten, wie soziale Kompetenz und Toleranz, treten hier im Kontext verwertungsrelevanter, durch das Bildungssystem zu produzierender Qualifikationen auf (vgl. Dräger & Stein 2010, 6). Dies kann als Indiz für die im Zuge der Humankapitaltheorie entstandene Ausweitung des Qualifikationsbegriffs auf alle Bereiche menschlichen Vermögens angesehen werden.
4. Kopplung von Bildung und volkswirtschaftlichem Nutzen
Weitere Indizien für neoliberales Denken finden sich beim Blick auf die Darstellung des Verhältnisses von Bildung und Gesellschaft. Zum einen findet sich in einer Argumentation im sechsten Abschnitt eine Legitimation für die Investitionen finanzieller Ressourcen in das Bildungswesen mit folgenden Worten: „Sie werden sich bald für die Gesellschaft auszahlen“ (Dräger & Stein 2010, 7). Darin spiegelt sich ein Denken in betriebswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Logik in Bezug auf das Bildungswesen wieder. Investitionen in den Bildungsbereich werden nicht mit der Realisation eines Menschenrechtes, sondern mit dem Gegenwert für die Gesellschaft begründet. Ein weiterer Aspekt neoliberalen Denkens, der in dieser Argumentation vorscheint, wird im letzten Abschnitt noch stärker verdeutlicht. Dort wird argumentiert, dass die „Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“ von der Realisation eines „chancengerechten und leistungsstarken Bildungssystems für alle Kinder“ abhänge (ebd.). Diese Kopplung von Investition in Bildung und gesellschaftlichem Nutzen, welche hier pathetisch überhöht dargestellt wird, indem sogar die Zukunft unserer Gesellschaft von der Durchsetzung eines bestimmten Bildungssystems abhängig gemacht wird, entspricht der neoliberalen Bewertung des Humankapitals als entscheidenden Faktor für wirtschaftlichen Erfolg in einer wissensbasierten Ökonomie. Die Argumentation steht exemplarisch für das Vorgehen sozialinvestiver Staaten, unternehmerisch Investitionen dort zu tätigen, wo sie einen gesellschaftlichen Nutzen hervorbringen, welcher eben derzeitig in der Produktion von verwertungsrelevant qualifiziertem Humankapital gesehen wird. Der gesellschaftliche Nutzen, den das Bildungssystem hervorbringen soll, muss an dieser Stelle, auch wenn es nicht explizit so dargelegt wird, als Produktion von Humankapital interpretiert werden, da in vorhergehenden Abschnitten dargelegt wurde, dass es Aufgabe des Bildungssystem sei, verwertungsrelevante Kompetenzen auszubilden. Bildung wird in solchen Argumentationen zum Vehikel für die Freisetzung wirtschaftlicher Potenziale der Individuen, die als entscheidender Faktor für wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft gelten, degradiert.
Die Untersuchung ergibt, dass der Inklusionsbegriff im vorliegenden Analysematerial abweichend vom dargelegten Verständnis im inklusionspädagogischen Fachdiskurs verwendet wird. Unterschiede ließen sich an der einseitigen Fokussierung auf einen Aspekt von Heterogenität festmachen, der eher einem Verständnis von Integration entspricht. Außerdem fiel auf, dass sich im Text Anzeichen für eine Zementierung der Zwei-Gruppen-Theorie finden ließen und dass dem inklusionspädagogischen Fachdiskurs fremde Begründungen zum Ausbau eines inklusiven Schulsystems herangezogen worden. Zudem erfuhr auch der Exklusionsbegriff eine Definition, die dem inklusionspädagogischen Fachdiskurs nicht entspricht.
Des Weiteren konnten im Text Argumentationsfiguren identifiziert werden, die einer neoliberalen Denkweise zugeordnet werden können. Hierbei fielen besonders die Kopplung von Bildung und verwertungsrelevantem Kompetenzerwerb, das Anlegen von Effizienzkriterien der Kapitalverwertung auf Lernprozesse, das Nutzen des erweiterten Qualifikationsbegriffs und die Kopplung von Bildung und volkswirtschaftlichem Nutzen auf.
Zusammenfassend lässt sich also nach der Analyse des Textes sagen, dass neoliberale Argumentationsstrukturen Eingang in Inklusion befürwortende Argumentationen finden. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass der Erfolg des Inklusionskonzeptes in derzeitigen Debatten, auch in Zusammenhang mit Kraftanstrengungen im Zuge neoliberaler Transformationen gesehen werden muss. Maßnahmen für Inklusion werden also auch von AkteurInnen eingeleitet, deren Ziel die Gestaltung der Gesellschaft unter neoliberalem Vorzeichen ist. Dabei erfährt der Inklusionsbegriff jedoch spezifische Umformungen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Inklusion und gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen, welche als, unter neoliberalem Vorzeichen stehend, analysiert werden. Ein Blick auf ein Dokument der Inklusionsdebatte sollte helfen, dieses Verhältnis besser zu verstehen. Zunächst sollte jedoch eine theoretische Basis geschaffen werden, auf deren Grundlage, die Debatte analysiert werden kann.
Zu diesem Zweck wurde im ersten Kapitel ein pädagogisches Verständnis von Inklusion in der deutschsprachigen Debatte dargelegt. Inklusion erschien als ein Konzept, das aus der Integrationsbewegung hervorging und somit Nähe zu BürgerInnenrechtsbewegungen aufweist. Es zeigte sich, dass sich die Verwendung des Inklusionsbegriffs, zum einen als theoretischer Reflex angesichts einer zunehmend problematischen Praxisentwicklung der Integration, zum anderen als treffendere Bezeichnung des Programms, in Folge eines theoretischen Switches, im Sinne einer stärkeren Fokussierung auf Heterogenität, anbot. Im Anschluss wurde der spezifische Fokus von Inklusion in Abgrenzung zur Integration vorgestellt. Ausgehend davon wurde Inklusion als Vision beschrieben, mit der eine positive Bewertung von Vielfalt, die Beachtung aller Aspekte von Heterogenität, eine Orientierung an Menschenrechten und BürgerInnenrechtsbewegungen sowie die Entwicklungsperspektive einer inklusiven Gesellschaft einhergeht. Inklusion erschien in diesem Verständnis als normativer Nordstern, der Orientierung für nächste Schritte geben kann. Es wurde im Weiteren vorgestellt, dass sich diese Entwicklungsschritte als Schritte auf einem Weg mit bestimmten Etappen verstehen lassen. Inklusion stellt in diesem Verständnis eine Etappe dar, in der sich alle, ohne sich qualifizieren zu müssen, in einer heterogenen Gruppe befinden, in der keine dominante Normalität existiert. Daran anschließend konnte unter Rückgriff auf die Theorie integrativer Prozesse dargelegt werden, wie ein inklusiver Umgang mit Heterogenität zu verstehen ist. Es wurde deutlich, dass es, ausgehend von einer immerwährenden Lust zur Herstellung einer dynamischen Balance zwischen den Tendenzen zur Gleichheit und zur Differenz, darum geht, auf unterschiedlichen Ebenen durch Annäherungen und Abgrenzungen zu Einigungen zu gelangen, welche jedoch eher den Charakter einer vorläufigen Positionsfindung auf dem Kontinuum zwischen den Polen haben. In einem letzten Schritt der Darstellung des Inklusionsverständnisses wurde mit Bezug auf die Menschenrechte eine ethische Begründung des Konzepts vorgelegt. Es wurde deutlich, dass Inklusion dementsprechend mit dem Grundsatz verbunden ist, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Im weiteren Verlauf stellte sich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung als ein entscheidendes Dokument zur menschenrechtlichen Begründung eines Inklusiven Ansatzes heraus, da hier Inklusion als Menschenrecht explizit formuliert ist. Es konnte gezeigt werden, dass das innovative Potenzial der Konvention im Menschenrechtsdiskurs, welches in der Ausrichtung auf freie Gemeinschaftsbildung in doppelter Frontstellung gegen bevormundende Kollektivismen und unfreiwillige Ausgrenzung besteht, die Konvention zu einem geeigneten normativen Bezugspunkt von Inklusion macht.
Darüber hinaus wäre noch zu diskutieren gewesen, ob es Alternativen zu einer menschenrechtlichen Begründung der Inklusion, beispielsweise mit Bezug auf Gerechtigkeitstheorie, gäbe und was Vor- und Nachteile unterschiedlicher Begründungszusammenhänge wären. Dies hätte jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt, sodass sich unter Bezug auf derzeitige Tendenzen im pädagogischen Diskurs auf eine menschenrechtliche Begründung von Inklusion konzentriert wurde. Alle dargelegten Aspekte zu Inklusion sollten in ihrer Zusammenschau helfen, ein breites Verständnis des Begriffs im pädagogischen Diskurs zu vermitteln, was hilfreich zur Analyse der Inklusionsdebatte ist.
Im Anschluss daran wurden dem visionären Inklusionsverständnis Analysen gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse gegenübergestellt. Es wurde sich hierbei auf Darstellungen konzentriert, die versuchen, die Verhältnisse als neoliberal zu beschreiben. Der Versuch einer Annäherung an den Begriff des Neoliberalismus ergab, dass es sich um eine volkswirtschaftliche Lehre handelt, die den Markt als Regulierungsmechanismus gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse verabsolutiert. Die Sicherung des Marktes soll dabei von einem starken Staat, der einer liberalen Wirtschaftsordnung verpflichtet ist, übernommen werden. Darüber hinaus ergab sich, dass der Begriff auch für ein strategisches Projekt unterschiedlicher AkteurInnen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft steht, deren Ziel die Durchsetzung einer individualistischen Marktgesellschaft ist. Der Blick auf die Entwicklungsbedingungen der neoliberalen Lehre ergab, dass es sich um eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise handelte, der vermehrt staatliche Eingriffe in die Wirtschaft vorangegangen waren, was als Ursache der Krise bewertet wurde und wogegen sich das neue Programm wendete. Mit dem Blick auf die politische Umsetzung ließ sich erkennen, dass es sich um eine Reaktion auf die Krise der fordistischen Produktionsweise handelte, welche sich, vom anglo-amerikanischen Raum ausgehend, immer weiter verbreitete und schließlich seinen Ausdruck in der Abkehr von der keynsianistischen Wirtschaftssteuerung fand. Auf der Basis dieser historischen Einordnung wurde sich zwei Aspekten neoliberalen Denkens und Handelns anhand der Humankapitaltheorie und dem veränderten Verständnis der Aufgaben des Staates zugewandt. Hierbei wurden, unter Rückgriff auf kritische Analysen dieser Aspekte, konkrete Folgen einer Ausrichtung der Gesellschaft unter neoliberalem Vorzeichen deutlich. Diese Ausführungen ergaben eine geeignete Basis zur Analyse der Inklusionsdebatte, da von ihnen ausgehend neoliberale Aspekte identifiziert werden können.
Bei der darauffolgenden theoretischen Reflexion über das Verhältnis der beiden Programme wurden Unterschiede deutlich. Der fundamentale Unterschied wurde im jeweiligen normativen Bezugssystem gesehen. Daraus ergaben sich auch Unterschiede in der Bewertung von Heterogenität und im Umgang mit Heterogenität, aus denen sich wiederum unterschiedliche Ausrichtungen in der Frage zur Strukturierung von Bildungseinrichtungen ableiten ließen. Mit Verweis auf die Möglichkeit zu Sparmaßnahmen durch Inklusion, unter Berücksichtigung möglicher Effizienzsteigerung in der Humankapitalproduktion sowie der Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs im inklusiven System und mit Blick auf die stärkere Aktivierung aller wirtschaftlichen Potenziale in der Inklusion, ergaben sich Berührungspunkte der beiden Konzeptionen. Es wurde jedoch deutlich, dass ein Inklusionsverständnis unter diesen Prämissen abweichend von den Intentionen des pädagogischen Inklusionsbegriffs ist.
Die abschließende Analyse eines Dokuments der Debatte offenbarte jedoch, dass trotz der fundamentalen Unterschiede im Bezugssystem tatsächlich neoliberale Denkfiguren auftauchen, um inklusiven Entwicklungen Auftrieb zu verleihen. Neoliberale Denkfiguren, die identifiziert werden konnten, waren die Kopplung von Bildung und verwertungsrelevantem Kompetenzerwerb, das Anlegen der Effizienzkriterien der Kapitalverwertung an Bildungsprozesse, die Verwendung des erweiterten Qualifikationsbegriffs und die Kopplung von Bildung und volkswirtschaftlichem Nutzen.
Die Analyse des Dokuments ergab auch, dass die Äußerungen zu Inklusion im Text vom pädagogischen Fachdiskurs abweichen. Dies zeigte sich in einseitigen Fokussierungen auf einen Aspekt von Heterogenität und in Äußerungen, die eine Zementierung der Zwei-Gruppen-Theorie begünstigen. Beides verweist eher auf eine Vorstellung, die mit dem Begriff Integration verbunden ist. Außerdem werden Begründungen für die Durchsetzungen eines inklusiven Systems herangezogen, die eher einer ökonomischen als einer pädagogischen Perspektive entsprechen, sowie Fachtermini des pädagogischen Diskurses abgewandelt genutzt.
Alles in allem weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bestimmte Aspekte von Inklusion auch im Sinne neoliberaler Transformationen sind. Daher ist anzunehmen, dass der Erfolg von Inklusion in gegenwärtigen Bildungsdiskussionen sich auch teilweise im Kontext der Wirkmächtigkeit neoliberaler Umstrukturierungen erklären lässt. Inklusionstheorie steht somit vor der Aufgabe, sich in ein Verhältnis zu neoliberalen Entwicklungen zu setzen. Der Verweis auf die unterschiedlichen Bezugssysteme scheint eine besonders geeignete Möglichkeit zu sein, den inklusiven Anspruch gegen eine neoliberale Vereinnahmung zu verteidigen. Darüber hinaus scheinen mir Positionierungen aus inklusionspädagogischer Perspektive zu Aspekten neoliberaler Ausrichtung einzelner Gesellschaftsbereiche vonnöten. Gerade weil Inklusion einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch hat, muss aus inklusionspädagogischer Perspektive zu aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen kritisch Stellung bezogen werden. Es muss untersucht werden, an welchen Stellen gesellschaftliche Entwicklungen dem inklusiven Anspruch entgegengehen und gleichzeitig braucht es Vorschläge für Entwicklungsperspektiven im inklusiven Sinne, auch bezogen auf gesellschaftliche Bereiche abseits der Schule. Es stellt sich darüber hinaus die Frage, an welchen Stellen die Inklusionstheorie geschärft werden müsste, um neoliberale Aneignungen zu erschweren. Dies könnten Beiträge sein, um Inklusion vor neoliberalen Aneignungen abzuschirmen.
Abgesehen davon scheint es auch wichtig zu sein, die Debatte im Auge zu behalten und kritisch zu reagieren, wenn sich auf abweichende Weise auf den Inklusionsbegriff bezogen wird. Kenntnisse über Argumentationsstrategien können dabei hilfreich sein. Die Untersuchungsergebnisse zeigen mögliche Argumentationsstrategien an. Die Analyse weiterer Dokumente könnte hilfreich sein, um zusätzliche Strategien zu identifizieren und möglicherweise typische oder häufige Argumentationsweisen herauszufinden, um inklusionspädagogisch informiert Stellung beziehen zu können.
Noch ist nicht gesagt, wie sich das noch recht neue Konzept der Inklusion vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen behaupten kann und wird. Es bleibt offen, ob die visionären Entwicklungsperspektiven eine Chance auf Wirksamkeit in breite gesellschaftliche Bereiche bekommen, oder ob sie von gegenläufigen Tendenzen angeeignet und umgedeutet oder einfach verdrängt werden. Es bleibt noch anzumerken, dass Weichen für gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur auf der Ebene theoretischer Auseinandersetzungen gestellt werden. Neoliberalismus und Inklusion sind letztlich zwei unterschiedliche Konzepte gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der Kampf um Einfluss bei der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse wird auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen geführt. Es braucht daher Strategien zur Durchsetzung eines inklusiven Anspruchs, die sich auch auf den Umgang mit gegensteuernden gesellschaftlichen AkteurInnen beziehen. Das Nutzen neoliberaler Argumentationen, um einem inklusiven Anspruch Wirksamkeit zu verleihen, mag vor dem Hintergrund der gesellschaftlich weit verbreiteten Akzeptanz dieser Denkweise sinnvoll erscheinen. Es soll im Ausgang dieser Arbeit jedoch davon abgeraten werden, da gezeigt werden konnte, dass eine neoliberale Vereinnahmung des Inklusionsbegriffs möglich ist und dass die Bedeutung des Begriffs in diesem Kontext verändert auftreten kann. Sinnvoller erscheint es daher, inklusive Praktiken auf der Basis der Menschenrechte einzufordern, zu leben und in Opposition zu widerstrebenden Tendenzen zu verteidigen.
Dazu braucht es sowohl das Engagement der einzelnen Menschen in ihren Lebensbereichen, als auch den Zusammenschluss in BürgerInnenrechtsbewegungen, sowie eine engagierte Wissenschaft, Impulse aus der Politik und weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Zu diesen Fragen gelebter Inklusion wird es vermehrt Orientierung aus inklusionstheoretischer Perspektive brauchen. Vom Gelingen solcher Konzeptualisierungen und entsprechender Praktiken wird der Erfolg des inklusiven Projekts abhängen. Dies kann nur im Widerstand gegen neoliberale Entwicklungen, im Sinne der Verabsolutierung des Marktprinzips auf alle Lebensbereiche, geschehen.
Um einen Umgang mit diesen Entwicklungen zu finden, braucht es einen klar konturierten Inklusionsbegriff und einen geschärften Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse und Diskurse, sodass Vereinnahmungstendenzen erkannt und aus inklusionstheoretischer Perspektive bewertet werden können. In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit als Beitrag zum Versuch eines inklusionstheoretisch informierten Umgangs mit den beschriebenen gesellschaftlichen Verhältnissen verstanden werden
Monografien und Artikel in Zeitschriften und Sammelbänden:
Amos, S. K. (2001): Schule und Sozialer Ausschluss. In: Dollinger, B. & Schmidt-Semisch, H. (Hrsg.): Gerechte Ausgrenzung? Wohlfahrtsproduktion und die neue Lust am Strafen. VS Verlag. Wiesbaden, S. 319-335.
Bernhard, A. (2003): Bildung als Bearbeitung von Humanressourcen. Die menschlichen Wesenskräfte in einer sich globalisierenden Gesellschaft. In: UTOPIE kreativ, 156 (2003), S. 924-938.
Boysen, K. & Fitz, J. & Schmitt, A. (2012): Inklusion in Recht und Menschenrecht. In: von Saldern, M.: Inklusion. Deutschland zwischen Gewohnheit und Menschenrecht. Books on Demand. Norderstedt, S. 31-53.
Cloerkes, G. (2001): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. 2. Auflage. Universitätsverlag C. Winter. Heidelberg, S.185-188.
Foucault, M. (2010): [Neoliberale Gouvernementalität II: Die Theorie des Humankapitals]. Vorlesung 9 (Sitzung vom 14. März 1979). In: Bröckling, U. (Hrsg.): Kritik des Regierens. Schriften zur Politik. Suhrkamp Verlag. Berlin, S. 177-203.
Gächter, O. & Nyffeler, R. (2001): Der Neoliberalismus. Seminararbeit. Universität Bern.
Herz, B. (2012): Inklusion: Realität und Rethorik. In: Benkmann, R. & Solveig, C. & Stampf, E. (Hrsg.): Inklusive Schule. Einblicke und Ausblicke. Prolog-Verlag. Magdeburg, S. 36-54.
Hinz, A. (1993): Heterogenität in der Schule. Integration – Interkulturelle Erziehung – Koedukation. Curio Verlag. Hamburg, S. 11-58.
Hinz, A. (2004): Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion. In: Schnell, I. & Sander, A. (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Klinkhardt. Bad Heilbrunn, S. 41-75.
Hinz, A. (2008): Inklusion – historische Entwicklungslinien und internationale Kontexte. In: Hinz, A., Körner, I. & Niehoff, U. (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe-Verlag. Marburg, S. 33-52.
Hinz, A. (2014a): Inklusion im Bildungskontext: Begriffe und Ziele. In: Kroworsch, S. (Hrsg.): Inklusion im Deutschen Schulsystem. Barrieren und Lösungswege. Lambertus Verlag. Freiburg, S. 15-25.
Hinz, A. (2014b): Inklusion als Vision und Brücken zum Alltag. Über Anliegen, Umformungen und Notwendigkeiten schulischer Inklusion. In: Häcker, T. & Walm, M. (Hrsg.): Inklusion in Schule und Lehrer_innenbidung. Klinkhardt. Bad Heilbrunn (im Druck).
Jacobs, S. (2005): Integrative Prozesse bei der Teamarbeit im Gemeinsamen Unterricht. Verlag Dr. Kovač. Hamburg.
Lange, M. (2009): Neoliberale Bildungskonzepte Ausgewählte Beispiele und ihre Umsetzung. Diskursethische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von Finanzierungs- und Wirschaftlichkeitskonzepten durch die Bertelsmann-Stiftung. Diplomarbeit. PH Ludwigsburg, S. 9-18.
Lohmann, I. (2007): Was bedeutet eigentlich „Humankapital“? In: UTOPIE kreativ, 201/202 (2007), S. 618-626.
Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11. Auflage. Beltz Verlag. Weinheim und Basel.
Olk, T. (2009): Transformationen im deutschen Sozialstaatsmodell. Der „Sozialinvestitionsstaat“ und seine Auswirkungen auf die soziale Arbeit. In: Kessel, F. & Otto, H-U. (Hrsg.): Soziale Arbeit ohne Wohlfahrtsstaat? Zeitdiagnosen, Problematisierungen und Perspektiven. Juventa Verlag. Weinheim, S. 23-34.
Olk, T. (2007): Kinder im Sozialinvestitionsstaat. In: ZSE Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 27 (2007), S. 43-57.
Pasuchin, I. (2012): Bankrott der Bildungsgesellschaft. Pädagogik in politökonomischen Kontexten. VS Verlag. Wiesbaden, S. 199-208.
Prengel, A. (1995): Pädagogik der Vielfalt. 2. Auflage. Leske + Budrich. Opladen.
Reiser, H. (1991): Wege und Irrwege zur Integration. In: Sander, A. & Raidt, P. (Hrsg.): Integration und Sonderpädagogik. Saarbrücker Beitrage zur Integrationspädagogik. Band 6. 2. Auflage. Rohrig. St. Ingbert, S. 13-33.
Ribolits, E. (2008): Humanressource – Humankapital. In: Dzierzbicka/Schirlbauer (Hrsg.): Pädagogisches Glossar der Gegenwart. 2. Auflage. Löcker-Verlag. Wien, S. 135-145.
Sander, A. (2002): Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. In: Hausotter, A. & Bopperl, W. & Menschenmoser, H. (Hrsg.): Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in Deutschland. Dokumentation der nationalen Fachtagung vom 14. bis 16. November in Schwerin. European Agency for Development in Special Needs Education. Middelfahrt.
Schulze, M. (2011): Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In: Flieger, P. & Schönwiese, V. (Hrsg.): Menschenrechte. Integration. Inklusion. Klinkhardt. Bad Heilbrunn, S. 11-27.
Speck, O. (2010): Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität. Reinhardt. München, S. 56-132.
Zerowsky, G. (2005): Der Neoliberalismus als neuer Feind des Staates? Seminararbeit. Humboldt-Universität Berlin.
Zinn, K. G. (2007): Grundzüge und Besonderheiten des Neoliberalismus in Deutschland. In Draheim, H.-G. & Janke, D. (Hrsg.): Legitimationskrise des Neoliberalismus – Chance für eine neue politische Ökonomie? Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Leipzig, S. 27-52.
Internetquellen:
Bertelsmannkritik (2009): Bertelsmannkritik. Information. Kritik. Aktion. Entnommen von: http://www.bertelsmannkritik.de/index.htm (Stand: 14.01.2015).
Bertelsmann Stiftung (o. J.): Über uns. Entnommen von: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/ueber-uns/ (Stand: 14.01.2015).
Bielefeldt, H. (2009): Essay. Zum Innovationspotenzial der Un-Behindertenrechtskonvention. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin. Entnommen von: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Essay/essay_zum_innovationspotenzial_der_un_behindertenrechtskonvention_auflage3.pdf (Stand: 25.12.2014).
Degener, T. (2014): Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor. In: Online-Handbuch. Inklusion als Menschenrecht. Entnommen von: http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/index.php?id=310 (Stand: 15.12. 2014).
Deklaration von Madrid des europäischen Behindertenkongress 2003. Entnommen von: http://www.lebenshilfe-stmk.at/cms/fileadmin/lh_steiermark/ethik_deklarationen/deklaration_madrid.pdf (Stand: 11.12.2014).
DIMR (Deutsches Institut für Menschenrechte) (Hrsg.) (2014): Online-Handbuch. Inklusion als Menschenrecht. Entnommen von: http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/index.php?id=310 (Stand: 15.12. 2014).
Doose, S. (2014): Inklusion als Menschenrecht – Zukunftsplanung als Weg. In: Online-Handbuch. Inklusion als Menschenrecht. Entnommen von: http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/index.php?id=310 (Stand: 15.12. 2014).
Dräger, J. & Stein, A. (2010): Vorwort. In: Klemm, K. (2010): Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland. Erstellt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. Entnommen von: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/gemeinsam-lernen-inklusion-leben/ (Stand: 04.01.2015).
Heise, A. (2002): Versprochen und gehalten? Wirtschafts- und Beschäftigungspolitische Modernisierungskonzepte der Schröder-Regierung auf dem Prüfstand. Entnommen von: http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_dwp_vwl/Heise/Standpunkte/07-Versprochen.pdf (Stand: 29.11.2014).
Hinz, A. (2013): Inklusion – von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit?! Kritische Anmerkungen zu zehn Jahren Diskurs zur schulischen Inklusion. In: Zeitschrift für Inklusion-online, 1 (2013). Entnommen von: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/26/26 (Stand: 10.12.2014).
Klausenitzer, J. (2002): Investitionen in das Humankapital. Pisa und die Bildungspolitik der OECD. Entnommen von: http://www.bdwi.de/forum/archiv/uebersicht/441585.html (Stand: 03.12.2014).
Klemm, K. (2010): Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland. Erstellt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Gütersloh. Entnommen von: http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/gemeinsam-lernen-inklusion-leben/ (Stand: 04.01.2015).
Meyer, M. (2013): Eine gesellschaftskritische Haltung in der Inklusionsdebatte als grundlegende Voraussetzung für den Einsatz eines Instruments wie den Index für Inklusion. In: Zeitschrift für Inklusion-online, 2 (2013). Entnommen von: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/17/17 (Stand: 07.05.2014).
Robbins, A. (1947): Statement of aims. Entnommen von: https://www.montpelerin.org/montpelerin/mpsGoals.html (Stand: 27.11.2014).
Schnabel, U. & Spiewack, M. (2010): Das Recht auf Miteinander. Die Vereinten Nationen garantieren behinderten Kindern die freie Wahl ihrer Schule. Profitieren sie von mehr Normalität, oder brauchen sie besonderen Schutz? In: Die Zeit, 6 (2010). Entnommen von: http://www.zeit.de/2010/06/Streitgespraech-Integration (Stand: 05.01.2015).
Schnell, I. (2006): Wir haben damals übermorgen angefangen - sind wir schon im Heute gelandet?. In: Zeitschrift für Inklusion-online, 2 (2006). Entnommen von: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/188/188 (Stand: 09.12.2014).
Schröder, G. & Blair, T. (1999): Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten. Ein Vorschlag von Gerhard Schröder und Tony Blair (London, 8. Juni 1999). Entnommen von: http://www.glasnost.de/pol/schroederblair.html (Stand: 05.12.2014).
Universität Duisburg-Essen (o.J.): Prof. em. Dr. Klaus Klemm Vita. Entnommen von: https://www.uni-due.de/bifo/klemm_vita.php (Stand: 05.01.2015).
Rechtsquellen:
AEMR – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Entnommen von: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf (Stand: 15.12.2014).
CRPD - United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Entnommen von: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_en.pdf (Stand: 15.12.2014).
ÜRMB - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006. Entnommen von: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_b_de.pdf (Stand: 15.12.2014).
Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.
________________________________________
Ort/ DatumUnterschrift
Quelle
Alexander Herbst: Die Inklusionsdebatte. Argumentationen entlang von Menschenrechten und Ökonomisierung Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen; Eingereicht beim: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt Landesprüfungsamt für Lehrämter; Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz/ Zweitgutachterin: Ines Boban.
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 22.08.2016