Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration
Tagungsbericht der Tagung "Mehr Qualität - bessere Integration?", 22. und 23. Juni 2009, Kardinal König Haus, Wien
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wie beginnen? Ein Praxisbericht über Entscheidungsprozess und Einführung eines Qualitäts-Managementsystems zur Diskussion
- Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration: Überlegungen und Hinweise aus der Schweiz
- Qualitätsmanagement in der Schweiz: Beispiel eines Prozesses
- Qualität aus der Perspektive der NutzerInnen - ein Beitrag der Forschung zum Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Österreich
- Balanced Scorecard und Qualitätsmanagement
- Wirkungsorientierung und Wirkungsmessung in komplexen Aufgabenbereichen - Ein Erfahrungsbericht
- KASSYS - Kasseler Systemhaus
- Regionale Koordination - das Steuerungskonzept des LWL-Integrationsamtes Westfalen
- Barrierefreiheit über ein Qualitätsmanagementsystem in den Griff bekommen - wie geht denn das?
- Qualitätsentwicklung und Benchmarking am Beispiel der Arbeitsassistenz
- Fördervertrag oder Leistungsvereinbarung? Chancen und Risken
- Ermittlung der KundInnenzufriedenheit/Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Kontext Dienstleistung zur beruflichen Integration/Rehabilitation: Titel : "Der/die ExpertIn bin ich ...":
- AutorInnen
- Anmerkung bidok
- Impressum
Ausgehend von dem gemeinsam genutzten Qualitätsmanagementsystem QAP (Qualität als Prozess) entwickelten die Trägervereine Caritas Wien, Caritas St. Pölten und Psychosoziale Zentren GmbH ein Instrumentarium zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im Angebot der Arbeitsassistenz. Aus dieser intensiven Beschäftigung mit Qualitätsmanagement und Qualitätsinstrumentarien heraus entstand die Idee, eine Tagung zu diesem Thema zu veranstalten. Dank der finanziellen Unterstützung des Bundessozialamtes, Landesstelle Niederösterreich und mit organisatorischer Unterstützung des Dachverbandes berufliche Integration wurde diese Tagung vom 22. bis 23. Juni im Kardinal König Haus in Wien abgehalten.
Mit diesem Tagungsband liegen nun die Vorträge und Workshopinhalte auch schriftlich vor.
Pamela Aichelburg, Harald Loewit-Schneider und Marco Nicolussi geben Anregungen auch aus der eigenen Praxis heraus, wie der Prozess der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems gestaltet werden kann. Im Rahmen eines Projektes, vom Bundessozialamt finanziert, wurde das Thema der Wirkungsorientierung und Wirkungsmessung der Arbeit im Feld der beruflichen Integration beleuchtet. MichaelFürnschuss, Doris Rath und Susanne Wiedenhofer stellen in ihrem Artikel Ergebnisse dieses Projektes vor. Die Balanced Scorecard hat sich zu einem wichtigen Steuerungsinstrument entwickelt. Ihr Einsatz im Qualitätsmanagement wird im Artikel "Balanced Scorecard und Qualitätsmanagement" dargestellt. Peter Milbradt zeigt, wie Barrierefreiheit im Unternehmen über ein Qualitätsmanagementsystem erreicht und gesichert werden kann. Die Abrechnung der Projekte stellt Dienstleister, aber auch Kostenträger immer wieder vor große bürokratische Probleme. Daniela Spindler und Otto Lambauer versuchen in ihrem Beitrag darzustellen, wie über Leistungsverträge Qualität gesichert und bürokratische Vereinfachung herbeigeführt werden könnte. Karin Rossi und Max Stimpfl stellen das von den Veranstaltern entwickelte Qualitätsinstrumentarium für Arbeitsassistenzprojekte vor. Der Aspekt der Einbeziehung der KundInnen/KlientInnen in das Qualitätsmanagement wird in zwei Artikeln vertiefend beleuchtet. Helga Fasching, Oliver Koenig und Walter Krög referieren eine diesbezügliche Forschungsarbeit der Universität Wien, Nico Sowa und Sabine Unteregger berichten über ihre Erfahrungen mit KundInnenbefragungen. Beiträge aus der Schweiz und Deutschland erweitern den Erfahrungshorizont um diesen internationalen Aspekt. Annelies Debrunner beleuchtet die aktuelle Qualitätsdiskussion in der Schweiz, Gert Klüppel bringt vertiefende Einblicke in das bereits gut eingeführte Qualitätsinstrumentarium KASSYS. Quellenangaben und Literaturlisten zu den Beiträgen können beim Herausgeber des Tagungsbandes angefordert werden.
Die Veranstalter hoffen, dass die Artikel im Tagungsband zu weiteren Diskussionen und vertiefender Auseinandersetzung mit dem Thema anregen und so die Qualitätsdebatte in den Diensten zur beruflichen Integration bereichern. Wien, November 2009
Wien, November 2009
Inhaltsverzeichnis
Pamela Aichelburg, Harald Loewit-Schneider, Marco Nicolussi
autArK ist ein gemeinnütziger Verein, der in Kärnten seit dem Jahr 1997 soziale Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen anbietet.
autArK organisiert seine Qualität(en) noch nicht im Rahmen eines standardisierten Qualitätsmanagementsystems und ist daher auch noch nicht zertifiziert. Das liegt vor allem an dem rasanten Wachstum, den das autArK in den letzten Jahren durchlebt hat. Aufgrund von Neu- bzw. Umstrukturierungen in der Aufbau- und Ablauforganisation, aber auch Einflüssen von außen (z. B. FördergeberInnen), haben sich immer wieder Projekte und Maßnahmen ergeben, die notwendig waren, um den alltäglichen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Qualitätsmanagement(system) musste daher aufgrund von Mangel an Zeit- und Personalressourcen hintangestellt werden. Dennoch wurden in Bezug auf Qualität viele Maßnahmen getroffen, um auf allen Ebenen qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Neben standardisierten Abläufen mit einheitlichen Formularen, Checklisten, Arbeitsanweisungen etc. wurde ein elektronisches KlientInnenverwaltungssystem (e-Akt) entwickelt, welches neben Ablaufbeschreibungen vor allem auch die Schnittstellenproblematik der internen und zum Teil auch externen Prozesse organisiert. Besonderer Wert wird auch auf die Ebene der MitarbeiterInnen und der KundInnen gelegt. An Zufriedenheitsanalysen wurde und wird bereits gearbeitet. Des Weiteren werden laufend neue Handlungen gesetzt, um die Qualität der von autArK angebotenen Dienstleistungen zu optimieren bzw. zu verbessern.
Im Grunde betrachtet kann autArK bereits ein Qualitätsmanagement vorweisen, allerdings nicht im Rahmen eines standardisierten Systems wie es allgemein bekannt ist. Zukünftig angedacht ist aber, ein System nach ISO 9001:2008 aufzubauen. Die Entscheidung fiel auf ISO, da die Vorgaben übersichtlich und strukturiert sind. Des Weiteren könnte bei Bedarf leichter an andere Systeme angeknüpft werden, da man sich mit ISO ein sehr gutes Grundgerüst schaffen kann.
Im Laufe der Entwicklung unseres Unternehmens hat sich das Qualitätsdenken aller MitarbeiterInnen in Richtung eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements verändert und der Wunsch nach einem einheitlichen System wurde und wird immer größer. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für die Implementierung eines QM-Systems. Da Qualität in Zukunft zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Unternehmen wird, muss diese von allen MitarbeiterInnen getragen werden. Das QM-System kann nur erfolgreich sein, wenn es von den MitarbeiterInnen gelebt wird und daher ist eine frühe Beteiligung in vielen Bereichen anzustreben.
In diesem Zusammenhang ist der nächste Schritt in unserem Qualitätsprozess die Fertigstellung unseres Leitbildes. In diesem Prozess wurde allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit angeboten, um eine möglichst breite Akzeptanz zu schaffen. Da das Leitbild Werte und Vorstellungen vermittelt, die sich auch in der Qualitätspolitik wiederfinden, war wichtig, die KollegInnen von Anfang an zu partizipieren. Durch das Leitbild ist für uns der "eigentliche" Qualitätsprozess in Gang gekommen und alle weiteren Maßnahmen sollen bereits im Rahmen der ISO durchgeführt werden. Unser derzeitiges Ziel ist es jedoch nicht, eine Zertifizierung anzustreben, sondern unsere vorhandene Qualität zu organisieren und in ein System zu bringen. Solange es vor allem äußere Einflüsse (Vorgaben von FördergeberInnen) zulassen, sehen wir die Zertifizierung nur als Zeugnis und nicht als Ziel unserer Arbeit. Die wichtigste Erkenntnis für autArK war und ist es zu erkennen, dass wir bereits viele Qualitäten entwickelt haben und dass man auch ohne ein standardisiertes QM-System auf hohem Qualitätsniveau arbeiten kann. Jedoch wollen wir auch unsere Qualität noch verbessern, indem wir sie in ein standardisiertes Qualitätsmanagementsystem bringen und somit besser organisieren können.
Der Verein Arbeitsassistenz Tirol, kurz: Arbas Tirol, ist aus einer Initiative mehrerer engagierter Behinderteneinrichtungen Tirols entstanden. Es existierte bis in die 90er-Jahre hinein kein systematisches Integrationsangebot für Menschen mit Behinderungen im Bundesland. Das einte unterschiedlichste Institutionen von der Lebenshilfe Tirol bis zu den ambulanten Dienstleistern für psychisch beeinträchtigte Menschen in ihrer Vision, einen neuen sozialen Dienstleister für berufliche Integration zu schaffen. Parallel bot das BASB, Landesstelle Tirol, die Chance, mit dem noch jungen Assistenzmodell nach dem deutschen Vorbild der unterstützten Beschäftigung 1996 einen Trägerverein zu gründen. Maßgeblich beteiligt waren von Beginn an die Wirtschaftskammer sowie die Kammer für Arbeiter und Angestellte Tirol und stellen bis heute jährlich alternierend den Obmann bzw. erstmalig seit heuer die Obfrau. Diese organisatorische Struktur ist bis heute erhalten geblieben und prägt nach wie vor das Selbstverständnis der Institution Verein Arbeitsassistenz Tirol.
Für die qualitative Entwicklung des Vereins kennzeichnend war das rasche Wachstum: Es entstanden von 1996 bis 2008 insgesamt fünf Leistungsangebote rund um das Assistenzmodell. Derzeit beschäftigt Arbas Tirol 49 MitarbeiterInnen und betreut an fünf Standortbüros acht von neun Bezirken Tirols. Ein dezidiert eigenständiges Qualitätsmodell entwickelte sich in der Zeit nicht. Eigentlich steuern, nach unserem Verständnis, ja die Erwartungen der Kunden und Kundinnen die Qualitätsvorstellung der Dienstleistungen. Es waren aber bisher in erster Linie die Anforderungen der Geldgeber, die die Strukturen von Arbas geformt haben. Diese sind bis ins Detail in den Fördervereinbarungen grundgelegt. Daraus erwuchs im Lauf der Jahre ein Spannungspotenzial, schränkt die obig festgestellte Tatsache die Handlungsfähigkeit des Eigentümers (der Vorstand samt seines beratenden Gremiums, der Beirat) doch bei allen wesentlichen Entscheidungen ein. Dass dies keine Tiroler Eigenart war, bestätigte dabei die Gründung des Dachverbands in mehreren Anläufen. Unser Tiroler Qualitätsdilemma ist mit dem heutigen Symposiumthema vollständig kongruent.
Vergleichbar zur Entwicklung bei autArk wurden bei Arbas in den Jahren 1996 bis 2007 dennoch eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen, Standards in Prozessabläufen sowie im Organisationsaufbau, geformt und ständig weiterentwickelt. Es gibt ein Organisationshandbuch orientiert nach dem ISO 9000-Modell, Kernprozessbeschreibungen für alle Projekte, ebenso liegen Detailkonzepte vor. Sie sind das Randergebnis einer begonnenen Gütesiegelentwicklung für berufliche Integrationsdienstleister in Tirol, die leider nicht fertig entwickelt wurde. Gleichzeitig war es der Grundstein für ein Qualitätsmanagementsystem, dessen Notwendigkeit innerhalb der Arbas - sowohl seitens der ArbeitgeberInnen als auch der Beschäftigten - immer stärker erkannt wurde. Erst jetzt, gewissermaßen nach einem Umweg, waren Verständigungsprozesse darüber möglich, welcher Weg zur Qualität für Arbas der richtige sein könnte. In ausführlichen Gesprächen mit externen ExpertInnen, Beratungen im Vorstand und Beirat und in einem Konsultationsprozess, der über ein Jahr dauerte und an dem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arbas maßgeblich beteiligt wurden, hat sich Arbas 2008 für das EFQM entschieden. Das Business-Excellence-Modell nach EFQM, dem sich Arbas über wenigstens fünf bis sieben Jahre stetig annähern möchte und über deren Zwischenschritte bestimmte Levels von Qualität erreicht werden sollen, ist unser Bezugsmodell von Qualität. 2009 hat Arbas mit dem ersten Schritt zum Committed-to-Excellence-Level begonnen. Im nachhinein betrachtet, folgte die Qualitätsentwicklung von Arbas einer Dynamik zufälliger Ereignisse, die jetzt in ein zielgerichtetes Projekt geführt werden kann.
Erstmalig ist es damit möglich, leitende Qualitätsvorstellungen originär aus dem Verein Arbeitsassistenz Tirol heraus zu entwickeln und den Bestimmungen der Fördervereinbarungen der Geldgeber kunden- bzw. kundinnenorientierte Erwartungen von Klientel und Unternehmen gegenüberzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Annelies Debrunner
Sie sind selbstverständlich auch in der Schweiz in zahlreichen Institutionen vorhanden, die dicken Ordner zum Qualitätsmanagement. Jedes Jahr kriegen die Angestellten wieder neue Blätter. Die Institution - ob in der Wirtschaft, im Bildungs- oder Sozialbereich - wird zudem alle paar Jahre wieder neu zertifiziert. In meinen Ausführungen habe ich die Ordner nicht dabei, stelle kein Ranking zu Zertifizierungsfirmen auf. Hingegen versuche ich, Zwischenräume und Zwischentöne ebenfalls auszuloten.
Meine nachfolgenden Ausführungen gliedern sich in sechs Teile. In einem ersten Teil präsentiere ich Ihnen die zur Verständigung nötigen Schweizerischen Besonderheiten. Es folgen Hinweise zum Qualitätsmanagement (QM) im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Drittens spreche ich über Qualitätsmanagement im Integrationsbereich: Dabei fokussiere ich QM bei Psychischer Beeinträchtigung. Qualitätsmanagement von außen, zwischen Inspiration und Irritation ist das vierte Thema. Fünftens präsentiere ich Ihnen Beispiele von Institutionen, deren QM bereits bekannt ist. Meine Ausführungen schließe ich ab mit: Qualitätsmanagement von innen: Bewahren & die Entwicklung fördern. Was ich Ihnen präsentiere, sind die Überlegungen aus meiner Tätigkeit in Forschung und Praxis. Als Soziologin und Pädagogin verfolge ich die Debatten um Supported Employment (SE)[1] oder Arbeitsintegration seit zehn Jahren intensiv. Insbesondere beruht mein Wissen auf dem Forschungsprojekt "Supported Employment"[2] , das von 2001 bis 2004 die Situation in der Schweiz erfasste. QM beschäftigt mich zudem als Betroffene in Institutionen sowie als Evaluatorin in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung.
Ein Vergleich mit Ihrem Nachbarland - Hinweise will ich sie nennen - bedingt zumindest kurze Informationen zu Strukturen des Landes. Wir sind Nachbarn in Mitteleuropa, haben eine unterschiedliche Größe, aber eine ähnlich große Population. Die Schweiz zählte Ende April 2009 7,806.609 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner[3]. Dennoch gibt es hüben wie drüben unterschiedlich gewachsene und gelebte Strukturen und Kulturen. Stichwortartig nenne ich die folgenden Punkte als Schweizerische Besonderheiten:
-
Vielfalt der Kantone - föderalistisches Prinzip
-
Komplexe Aufteilung zwischen Bund (Land Schweiz) und Kantonen
-
Finanzkraft versus weitmaschiges Sozialnetz
-
Sprachgrenze als Kulturgrenze
-
Hoher AusländerInnenanteil von 22,8% (April 2009)
-
Insel in der EU
Keine Besonderheiten sind in der Schweiz auszumachen bezüglich der Globalisierung und deren Entwicklung, der Europäischen Wirtschaftsfaktoren, der damit verbundenen Zyklen mit Aufschwung und Krisen.
Qualitätsmanagement gehört seit Mitte der 90er-Jahre zum Alltag im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Seither sind Institutionen verpflichtet, Transparenz zu zeigen - sind sie doch der galoppierenden Kosten wegen unter Dauerbeschuss.
Viele von Ihnen können sich wohl an die Zeit erinnern, als im Arbeitsplatz noch keine dicken Ordner mit Zertifizierungstools Standard waren. Benchmarking war noch ein Fremdwort. Dieser Paradigmenwechsel hat dazu geführt, dass eine totale Ausleuchtung der internen Vorgänge gefordert wird. Gleichzeitig sind Schattenseiten möglichst nicht vorhanden. Die Zahl der QM-Systeme ist immens. Ursprünglich insbesondere betriebswirtschaftlich orientiert, werden zwischenzeitlich die Gesetzmäßigkeiten der sozial geprägten Bereiche einbezogen.
Wer hat in den letzten Jahren am ehesten gehandelt und QM-Systeme in die Firmenkultur integriert? Es sind insbesondere Institutionen, welche über einen gewissen finanziellen Freiraum verfügen, welche eine Förderung auf der strategischen Ebene durch Personen mit "Weitblick" genießen oder welche stark forschungsorientiert sind.
3. Qualitätsmanagement im Integrationsbereich[4]
Im Bereich Supported Employment/integrierte Beschäftigung ist man mit Qualitätsmanagement vertraut, je eher es sich in einem Land etabliert und die nötige politische Unterstützung sowie die handlungsrelevanten rechtlichen Gesetze hat. In der Schweiz, wo dies (noch) nicht der Fall ist, handeln Institutionen unterschiedlich. In der Schweiz werden ähnliche QM-Kriterien benutzt, wie EUSE (European Union of SE) vorgibt, oder wie allgemein QM im Sozialbereich angegangen wird.
Auf welchem Hintergrund wird SE qualifiziert und zertifiziert? Qualitätsmanagement im Integrationsbereich findet immer an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Sozialbereich statt. Wie in unseren Nachbarländern war seit den 90er-Jahren ein rasanter Anstieg der Neu-berentungen bei der Invalidenversicherung (IV) zu verzeichnen. Von 1993 bis 2002 stiegen diese, insbesondere bedingt durch vermehrte psychische Beeinträchtigungen bei jungen Menschen und bei Frauen, um 59 Prozent an. Dies hatte und hat immense finanzielle Belastungen der Staatskasse zur Folge. Zwar ist seit 2005 ein leichter Rückgang der Erstberentungen zu verzeichnen. Ein Ende der finanziellen Schwierigkeiten der IV ist noch nicht absehbar. Politische Diskussionen um eine Zusatzfinanzierung bestehen seit mehreren Jahren. Ein Lichtblick ist der Rückgang der Neuberentungen um acht Prozent im ersten Semester 2009 im Vergleich zur Vorjahresperiode.[5]
Der Staat hat somit, bedingt durch den Engpass in der IV, ein finanziell begründetes Interesse an SE. Er verspricht sich insbesondere Kosteneinsparungen und eine Beruhigung der Rentenexplosion. Der Integrationsfachmann Dörig (2009) befürchtet, dass im Neuland SE "vermehrt die fachlichen Anforderungen seitens der IV gesetzt (werden), was eine einseitige Perspektive zur Folge haben kann, aber ... auch einen Diskurs über Qualitätsstandards auslöst."[6]
Dieses Modell existiert in der Schweiz seit Anfang der 90er-Jahre. Während damals in einzelnen Pilotprojekten, oft angegliedert an soziale oder psychiatrische Institutionen, größtenteils eine auf psychisch beeinträchtigte Integration im Vordergrund stand, sieht es knapp 20 Jahre später anders aus. SE ist zu einem politisch interessanten Marktfaktor geworden. Es sind nicht mehr Pilotprojekte, welche je nachdem von personenbezogenem Wissen profitierten, oder beim Weggehen der Fachleute diese Abteilung wieder schließen mussten.
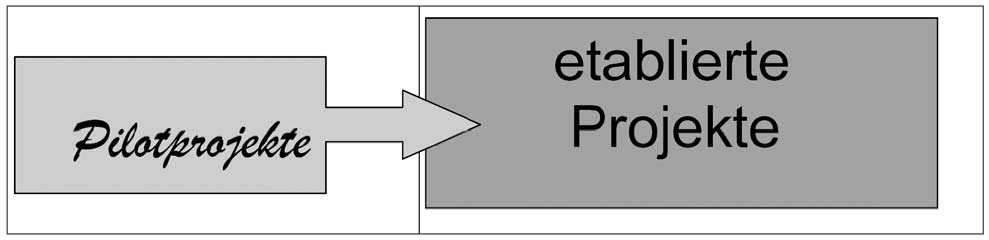
Grundsätzlich bestehen (1) Modelle, welche auf den Arbeitseinstieg vorbereiten und (2) Modelle eines raschen Einstiegs, nach dem Prinzip "first place, then train".[7]
Qualitätskontrolle von außen operiert immer zwischen Inspiration und Irritation. Welche Institution, welche Menschen sind nicht irritiert, wenn ihre Arbeit unter die Lupe genommen wird?
Generell sind, wie in anderen untersuchten Arbeitsbereichen, die relevanten Ziele definiert nach Zielgruppe, Ergebniskriterien, Prozesskritierien und Strukturkriterien. Dabei besteht in SE die Gefahr, dass eine ergebnisorientierte Qualitätssicherung harte Fakten priorisiert und damit beispielsweise Prozentzahlen in der Vermittlung anpeilt. Steht der Mensch im Zentrum, muss hingegen Qualität im Sinne von Nachhaltigkeit betrachtet werden (Doose 2004). Es sollen eine längerfristige Integration des beeinträchtigten Menschen und die damit verbundenen positiven und negativen Faktoren im Zentrum stehen.
Ein Einblick in die drei Phasen (1) Erhebungs- und Klärungsphase (profiling, assessment) (2) Aktive Platzierung und (3) Begleitendes Coaching am Arbeitsplatz sollen transparent werden.
Ausgangspunkt ist in SE/begleitete Beschäftigung das Coaching am Arbeitsplatz im Dreieck:
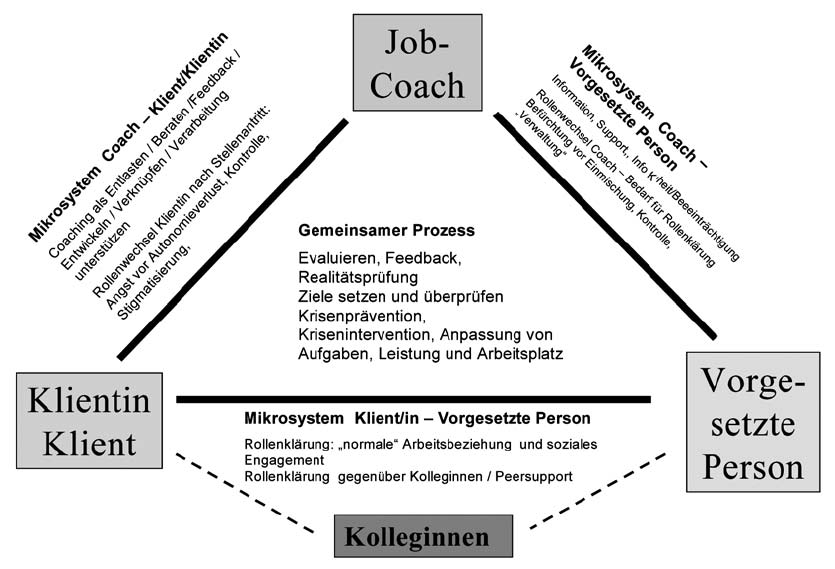
Dabei stehen im Job-Coaching sechs Punkte im Zentrum:
-
Gewährleistung einer kontinuierlichen Evaluation und von regelmäßigem Feedback
-
Vermittelnde Übersetzertätigkeit zwischen allen Beteiligten
-
Vermittlung situativ angepasster Information
-
Gezielte Beratung zur Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen
-
Förderung durch situationsgerechtes Setzen und Überprüfen von Zielen
-
Krisenintervention und Entscheidungshilfen
Der Job-Coach befindet sich innerhalb dieser Arbeit in verschiedenen, insbesondere in drei Spannungslinien. Zum einen zwischen der Ziel- und Prozessorientierung, zum anderen der/die KlientIn versus ArbeitgeberInnenzentrierung. Eine weitere Spannungslinie zeichnet sich ab, ob Interventionen orientiert sind an eigenen Vorstellungen der Stelle bzw. des Job-Coachs oder an der Selbstbestimmung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin.
In der Deutschschweiz sind zwei langjährige begleitende Studien mit wissenschaftlicher Begleitung und Qualitätssicherung bekannt. Bei der Studie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) wurden von 2003 bis Ende 2005 50 Personen mit affektiven oder schizophrenen Erkrankungen begleitet. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer Experimental- oder einer Kontrollgruppe zugewiesen. In der Experimentalgruppe unterstützte ein Job-Coach die Person bei der Vorbereitung, dem möglichen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt und der anschließenden Arbeitsphase. Auch die 25, schlussendlich 26 Personen der Kontrollgruppe erhielten Unterstützung bei der Arbeitsrehabilitation. Dieses traditionelle Vorgehen führt aber oft in geschützte Arbeitsplätze und erhebt keinen Anspruch, in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten und zu integrieren. Nach Ablauf der eineinhalb Jahre hatten elf Personen der Experimentalgruppe eine Stelle in der freien Wirtschaft, drei arbeiteten in einer geschützten Werkstatt, sechs hatten keine Stelle oder betätigten sich in Freiwilligenarbeit und sechs Personen waren aus der Studie ausgeschieden. Von den 25 Personen aus der Kontrollgruppe hatte niemand eine Arbeitsstelle in der freien Wirtschaft. Dieses Projekt unter der Leitung von Wulf Rössler wird laufend weiter geführt.
Eine weitere Studie, das "Job Coach Placement" der Universitätsklinik Bern unter der Leitung von Holger Hoffmann wurde Ende 2007 abgeschlossen. Diese Studie bestätigt tendenziell ebenso den Erfolg der Begleitung. Zudem weisen Verantwortliche des Projekts darauf hin, dass "Job Coach Placement" "...im Vergleich zu einer Beschäftigung der Behinderten in einer herkömmlichen geschützten Werkstatt (für das BSV) kostenneutral sein (sollte)".[8]
In der Westschweiz:
An den Hôpitaux Universitaires de Genève, Recherches psychosociales, Service de psychiatrie adulte besteht seit 2007 ein Projekt, das ehemalige Psychiatriepatientinnen und -patienten mittels SE den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert. Die wissenschaftliche Begleitung und die Qualitätssicherung werden durch Eric Zbinden gewährleistet.
Metaebene:
Es existiert eine Übersicht zur "Qualitätsmessung von SE für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten" in der Schweiz. Es handelt sich um die bereits erwähnte Zusammenfassung der Situation in der Deutschschweiz. Die 2009 von Marco Dörig verfasste Studie gibt einen Überblick, der dem interessierten Publikum weitere Zusammenhänge des SE erläutert.
Eine Qualitätssicherung von außen folgt Strukturen, welche sich stark an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren. Ein paralleles, selbstverständliches und Nachhaltigkeit bewirkendes Hinterfragen der Arbeit sollte von innen erfolgen:
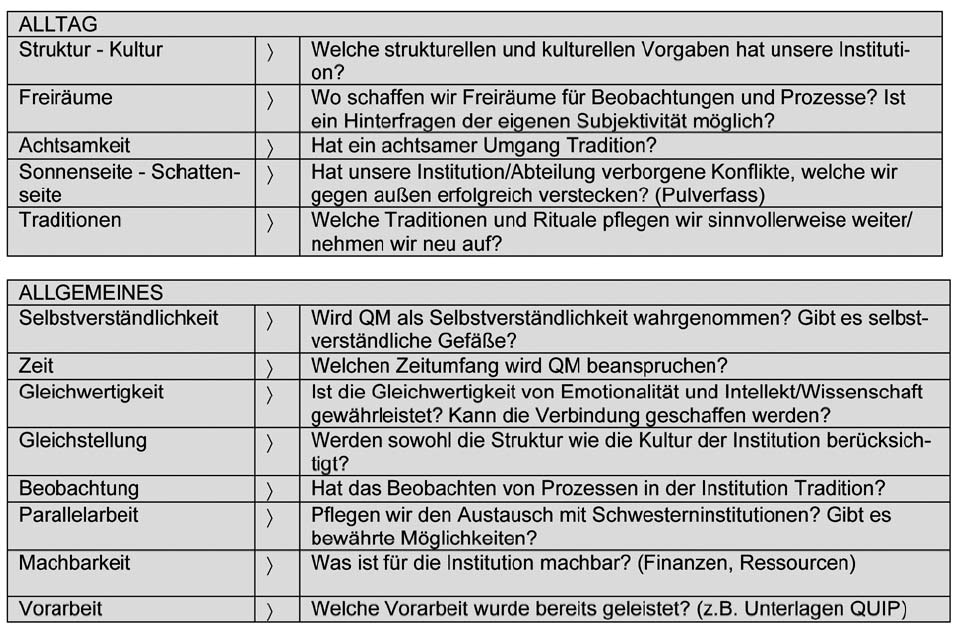
Die obigen Stichworte und Fragen, welche den Prozess der Qualitätssicherung betreffen, sind als Impulse für Ihren Arbeitsalltag gedacht.
[1] In der Schweiz wird für Arbeitsintegration/begleitete Beschäftigung oder Arbeitsassistenz der englische Begriff "SE" verwendet. Es existieren - im Gegensatz zu Österreich - keine Unterbegriffe.
[2] Projekt im NFP/Nationalen Forschungsprogramm 45 "Probleme des Sozialstaates". Gemeinsam mit Thomas Rüst
[3] Quelle: www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/2009.Par.0014.File.tmp /1C_wohnbevoelkerung_schweiz_2009-04-d.pdf (Stand: 20.08.2009)
[4] Weitere Details zur Entwicklung des SE in der Schweiz erfahren Sie in diesem Tagungsband im Artikel
"Qualitätsmanagement in der Schweiz: Beispiel eines Prozesses".
[5] Gemperli, Simon. 2009. Zahl der IV-Renten erneut gesunken. In: NZZ Neue Zürcher Zeitung 1.09.2009: 14.
[6] Dörig 2009: 5.
[7] Rüst & Debrunner 2005.
[8] Hoffmann, 2002, S. 120ff. Leider existiert kein Abschlussbericht des Projekts. BSV = Bundesamt für
Sozialversicherungen.
Inhaltsverzeichnis
Annelies Debrunner
In der Schweiz werden seit Ende der 90er-Jahre vermehrt Modelle der aktiven Vermittlung und Begleitung am Arbeitsplatz diskutiert. Auf der politischen Ebene spiegelt sich dies z. B. in der Einführung der erweiterten Arbeitsvermittlung im Rahmen der 4. IVG-Revision, in Kraft seit dem Jahr 2004. Eine rasch darauf folgende 5. IVG-Revision, welche in einer Volksabstimmung im Jahr 2007 angenommen worden war, hatte als Kernelement dann "Eingliederung vor Rente" zum Thema.[9] Im Jahr 2009 denkt man bereits laut nach über eine 6. IVG-Revision und nennt den Slogan "Eingliederung nach Rente".[10]
Dem politischen Diskurs waren bereits seit Anfang der 90er-Jahre Pilotprojekte vorausgegangen. Größtenteils unter dem englischen Begriff "Supported Employment" wurden kleine Projekte initiiert, welche sich inhaltlich an den Vorläufern im angelsächsischen Raum und an den daraus entstandenen Theorien orientierten. Einzelne Akteure im Feld hatten die Entwicklung in den Nachbarländern Österreich und Deutschland verfolgt. Unter oft schwierigen finanziellen Bedingungen - ohne gesetzlichen Rückhalt - wurde an einzelnen Institutionen im Sozialbereich Arbeit geleistet. Generell wurden diese Leistungen auf der politischen Ebene wenig zur Kenntnis genommen.
Größtenteils handelte es sich um Projekte für psychisch beeinträchtigte Menschen. Oft waren sie angegliedert an Psychiatrische Kliniken. So existieren an den psychiatrischen Universitätskliniken in Zürich und Bern seit vielen Jahren Projekte, welche auch publizistische Outputs hervorbrachten.[11]
Den Status der Pilotprojekte behielten auch diese Projekte während vieler Jahre bei. Dies bedeutete, dass das Fachwissen personengebunden blieb und ein Austausch zwischen den einzelnen Akteuren selten stattfand. Es waren keine Gefäße und Mittel für strukturierte Formen vorhanden. Eine Qualitätssicherung war unter diesen Umständen wenig vorangekommen. Diese bedingt beinahe zwingend eine robuste Struktur einer Institution im Hintergrund.
Die 5. IVG-Revision, deren politische Entwicklung und praktische Umsetzung, hat im Arbeitsalltag nachhaltig Veränderungen gebracht. Gleichzeitig ist auf der politischen Ebene das Interesse an der Möglichkeit einer Arbeitsintegration, insbesondere ausgelöst durch die galoppierende Kostenentwicklung, stark gewachsen. Anfang der Jahrtausendwende zählten wir in der Deutschschweiz rund ein Dutzend Fachstellen, welche einen bis drei Job-Coachs beschäftigten. Insbesondere psychisch beeinträchtigte Menschen wurden bei ihrem Arbeitseinstieg begleitet. Im Jahre 2009 ist die Zahl der Integrationsstellen unübersichtlich geworden - es sind viele, welche im Bereich der Integration von psychisch beeinträchtigten Menschen tätig sind. Neben den sozialen Institutionen, welche auch mit anderen Angeboten im Behindertenbereich aufwarten, handelt es sich größtenteils um staatliche Großbetriebe, wie die Post und die Bundesbahnen. Verändert hat sich auch die Klientel. Beeinträchtigte Menschen mit einer geistigen oder cerebralen Behinderung finden jetzt ebenfalls Anlaufstellen.
Gleichzeitig hat die Invalidenversicherung in den einzelnen Kantonen ihre Integrationsarbeit intensiviert. Faktoren des klassischen Supported-Employment/der Arbeitsintegration werden je länger je mehr zur Kenntnis genommen. Oft wird die Arbeitsintegration dann an versierte Fachstellen delegiert.
Zudem besteht seit 2008 der Verein "Supported Employment Schweiz". Dieser ist jüngstes Mitglied der EUSE European Union of Supported Employment. Ebenso ist in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Österreich und Deutschland auf Vereins- oder Verbandsebene angelaufen. Es findet bereits ein intensiver Austausch statt.
Was können Sie, als Zuhörender, jetzt als Lesender, von einer Länderpräsentation eines
"Benjamin" mitnehmen? Ich hoffe, Sie sehen darin die Qualitätssicherung als Chance,
Strukturen als Weiterentwicklung. Gleichzeitig soll dies auch bedingen, dass wir gewachsene
Strukturen nicht vorbehaltlos annehmen, eine Veränderung mit Maß mittragen.
Nachfolgend präsentiere ich Ihnen ein Fallbeispiel. Es handelt sich um Wintegra[12], die erste Integrationsfachstelle in der Schweiz für Menschen mit geistiger oder cerebraler Beeinträchtigung. Wintegra ist der privaten Stiftung Andante angegliedert. Diese ist im Bereich Wohnen und Arbeit von behinderten Menschen insbesondere in der Ostschweiz tätig. Der Anspruch einer ganzheitlichen Lebensgestaltung ist sehr wichtig. Andante hat die von der 68er-Bewegung inspirierte Forderung nach mehr Demokratisierung im Behindertenbereich früh aufgenommen. Selbstredend ist damit eine Möglichkeit der Teilhabe im ersten statt im zweiten Arbeitsmarkt verbunden.
Wintegra berät sowohl intern wie extern Menschen mit einer geistigen oder cerebralen Beeinträchtigung, welche eine Beschäftigung in der ersten Arbeitswelt suchen.
WINTEGRA 2003
-
Erste Integrationsfachstelle in der Schweiz für Menschen mit geistiger oder
-
crebraler Beeinträchtigung
-
Standort: Winterthur
-
Start 2003 mit Pilotprojekt 2 Jahre
-
Job-Coach mit 80%-Stelle
-
Private Trägerschaft
-
Teil der Stiftung Andante (vormals Bärbeli-Stiftung)
Die Stelle hatte ihre Arbeit im Frühjahr 2003 aufgenommen. Die Arbeit erfolgt nach den Prinzipien von Supported Employment. Während die Finanzierung in den ersten zwei Jahren größtenteils durch die Stiftung Andante gewährleistet war, sollte im Übergangsjahr neben dem Entscheid zur Weiterführung eine zusätzliche Finanzierung geprüft werden. Im Jahr 2005 wurde ich mit einer externen Evaluation betraut. Neueste Informationen stammen aus einem Gespräch mit zwei Job-Coachs im Mai 2009.[13]
Interne Qualitätssicherung
Wie andere Pilotprojekte hatte Wintegra bis anhin keine institutionalisierte Qualitätssicherung. Hingegen wurden interne Abläufe immer wieder überprüft. Es erfolgte in den drei Jahren seit Bestehen:
-
eine laufende Optimierung der Administration
-
Transparenz im längerfristigen Erfolg (Jahresbericht)
-
Begleitung der täglichen Arbeit durch eine Strategiegruppe
Machbarkeit bei hoher Arbeitsbelastung
Wichtig ist immer wieder die Frage nach der Arbeitsbelastung bei einer Qualitätssicherung. So auch bei Wintegra. Die Institution hatte sich in der bald dreijährigen Tätigkeit sehr gut positioniert. Der weibliche Job-Coach, eine Person, welche die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten in der prosperierenden Stadt Winterthur sehr gut kannte, fühlte sich trotz der erfolgreichen Führung der Stelle zunehmend überfordert. Trotz der voraussehbaren Mehrbelastung durch eine externe Evaluation wurde diese in Auftrag gegeben. Es begann eine intensive Zusammenarbeit zwischen Job-Coach und Evaluatorin. Der Geschäftsführer der Stiftung war ebenfalls stark involviert.
In dieser Evaluation wurden die folgenden vier Themenbereiche in die Evaluation einbezogen:
-
Klientenarbeit
-
Unternehmenskontakte
-
Organisatorische Entwicklung
-
Sozialpolitische Arbeit
Mittels qualitativer Interviews wurden die Klientenarbeit und die Unternehmerkontakte durchleuchtet. In inhaltsanalytischen Verfahren erfolgte die Prüfung der organisatorischen Entwicklung und der sozialpolitischen Arbeit.
Die Evaluation richtete sich nach den wichtigen sechs Punkten des Job-Coaching:
-
Gewährleisten einer kontinuierlichen Evaluation und eines regelmäßigen Feedbacks
-
Vermittelnde Übersetzertätigkeit zwischen allen Beteiligten
-
Vermittlung situativ angepasster Information
-
Gezielte Beratung zur Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen
-
Förderung durch situationsgerechtes Setzen und Überprüfen von Zielen
-
Krisenintervention und Entscheidungshilfen
Wintegra hatte sich in der Evaluation bestens positioniert. Die Stelle, welche laufend noch Aufbauarbeit zu leisten hatte, wies jährlich neun Begleitungen, 12 Beratungen und 47 Kurzberatungen aus. Die zusammenfassenden Resultate zeigen sich in acht Erfolgsfaktoren:
-
Hoher Bekanntheitsgrad
-
Selbstverständliche Zuweisung
-
Kerngeschäft Job-Coaching mit schlanker Administration
-
Zuweisende schätzen die Arbeit der Projektleiterin
-
Alle Beteiligten weisen auf rasches Handeln im Erstgespräch und in Krisensituationen hin
-
Personenzentriertes Vorgehen
-
Exzellente Rückmeldungen aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen
-
Abstützung durch Begleitgruppe und Geschäftsleitung
Eine solch transparente und erfolgreiche Institution zu untersuchen, ist auch aus Sicht der Evaluatorin eine Herausforderung. Es gilt, den Impuls für eine längerfristige Nachhaltigkeit zu geben.
Die Empfehlungen beinhalten vier Punkte. Erstens soll eine Aufstockung der Fachstelle Wintegra im Job-Coaching und im administrativen Bereich erfolgen. Dadurch könnte die Arbeitsbelastung auf ein erträgliches Maß gesenkt und der interne Austausch gewährleistet werden. Eine Neugestaltung der Abläufe, Zuständigkeiten, Arbeitsstrukturen soll - zweitens - damit einhergehen. Drittens sind, als Folge des Pilotcharakters, immer noch relativ unklare Strukturen vorhanden. Diese sollen in robustere Strukturen in der Administration, der Daten- und Wissensaufbewahrung überführt werden.
Viertens soll eine klarere Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben geschaffen werden.
Mit den Verantwortlichen der Fachstelle Wintegra wurden im Gespräch die vier Punkte diskutiert und weitere Schritte überlegt. Eine zusätzliche Herausforderung waren Vergleiche anhand von Fallbeispielen zwischen konventioneller Lebensgestaltung (z. B. geschützte Werkstätte) und Arbeitsintegration in finanzieller Hinsicht.
Die sozialpolitischen Veränderungen in der Schweiz brachten für Wintegra zusätzliche Herausforderungen. Neu fordert die Schweizerische Invalidenversicherung "Eingliederung vor Rente". Dadurch sind auf dem Platz Winterthur neue Anbieter im Bereich Arbeitsintegration tätig. Dennoch hat sich Wintegra weiterhin gut positioniert und ist gewachsen:
WINTEGRA 2009
-
Eine Integrationsfachstelle unter vielen auf dem Platz Winterthur für Menschen mit geistiger oder cerebraler Beeinträchtigung
-
Etabliert seit einigen Jahren
-
Seit 2008 neues Bildungsangebot für beeinträchtigte Menschen
-
Sehr gute Positionierung auf dem stark gewachsenen Integrationsmarkt
-
2 Job-Coaches mit total 160%, 1 Job-Coach nach Aufwand (zurzeit 30 bis 70%)
-
Administration mit 40%
-
Jährlich jeweils ca. 50 Abklärungen, 11 Vermittlungen, 15 Begleitungen (2007)
-
Interne Organisationsentwicklung läuft
-
Private Trägerschaft mit teilweise staatlicher Unterstützung und verschie-denen Finanzierungsquellen
-
Teil der Stiftung Andante (vormals Bärbeli-Stiftung)
Dennoch kristallisieren sich im Gespräch mit zwei Job-Coaches erstaunliche Parallelen zur Situation im Jahr 2005 heraus. Nach wie vor ist die Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben und damit die Verantwortung für den Prozess unklar. Die nicht vorhandene Robustheit der Administration wird des Weiteren bemängelt. Auch auf der finanziellen Ebene muss die längerfristige Finanzierung immer wieder thematisiert werden. Wie kann eine Institution, die nach außen Erfolgsfaktoren ausweist, ihre internen Schwachstellen bearbeiten?
Wo sehen Sie Parallelen zu Ihrer Institution?
-
Wie können wir eine Kultur des "alles-miteinander-machens" angehen und klarere Strukturen schaffen?
-
Wo sind flache Hierarchien hindernd - fördernd?
-
Erfahrungsaustausch statt Rezepte!
-
Wo gewährleisten wir Objektivität?
-
Wo haben wir Zeitfenster für längerfristige Handlungsstrategien und Überlegungen?
Die obigen Fragen aus der Diskussion mögen Ihnen Impulse für Ihre Arbeit geben.
[9] Quelle:www.bsv.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00092/01581/index.html?lang=de (Stand: 10.06.2009)
[10] Weitere Details zu Schweizerischen Verhältnissen und Literaturhinweise erfahren Sie in diesem Tagungsband im Artikel
"Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration: Überlegungen und Hinweise aus der Schweiz".
[11] Details siehe hierzu ebenda.
[12] www.projekt-wintegra.ch
[13] Interview vom 13. Mai 2009 an der Fachstelle Wintegra. Ich bedanke mich für den Austausch bei C. Welti und E.
Wissmann.
Inhaltsverzeichnis
Helga Fasching, Oliver Koenig, Walter Krög
In Forschung und Praxis zur Qualitätssicherung und -entwicklung von Maßnahmen der beruflichen Integration hat die Perspektive der NutzerInnen sowie deren partizipative Einbeziehung in den Qualitätssicherungs- und Entwicklungsprozess bislang kaum Berücksichtigung gefunden. Die mangelnde Berücksichtigung der Perspektive der NutzerInnen zeigt sich zum Beispiel daran, dass in aktuellen Qualitätsdiskussionen zur beruflichen Integration noch immer vorrangig AuftraggeberInnen sowie LeiterInnen und MitarbeiterInnen der einzelnen Organisationen bzw. Dienstleistungsanbieter der beruflichen Integration daran beteiligt sind, nur in seltenen Fällen werden die NutzerInnen in Qualitätsplanung, -durchführung und -kontrolle einbezogen. Dies - obwohl seit einigen Jahren in Diskussionen über "Was gute Qualität in der beruflichen Integration ausmacht" - die Perspektive der NutzerInnen als wesentlich erachtet wird.
Der Beitrag der Forschung zur Qualität aus der Perspektive der NutzerInnen möchte vor allem die Relevanz dieses Themas aus wissenschaftlicher Perspektive aufzeigen. Dafür ist es in einem ersten Schritt notwendig, einen kurzen Umriss über fachliche und politische Entwicklungen der beruflichen Integration zu geben sowie den Bedarf an Forschung speziell für die Zielgruppe der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufzuzeigen. Anschließend wird das Forschungsprojekt "Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung" vorgestellt, um zu zeigen, welchen wesentlichen Einfluss die Forschung - dies unter partizipativer Einbeziehung von Betroffenen - zum Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration einnehmen kann. Abgerundet wird der Beitrag mit positiven Beispielen nationaler und internationaler Erfahrungen zur Gestaltung innovativer Rahmenbedingungen der beruflichen Integration und daraus abgeleiteten Implikationen für die Praxis der beruflichen Integration in Österreich.
Politische und fachliche Entwicklungen im Feld der beruflichen Integration und Rehabilitation haben in den letzten Jahren neue Fragen der Inklusion und Partizipation (Teilhabe) aufgeworfen. Es kann beinahe von einem Perspektivenwechsel innerhalb der Behindertenarbeit bzw. der beruflichen Integration und Rehabilitation gesprochen werden, welcher 2001 durch die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, engl. International Classification of Functioning, Disability and Health) eingeleitet wurde. Das Modell von Behinderung der ICF bietet mit seiner zentralen Dimension der Partizipation zahlreiche Anknüpfungspunkte für den fachlichen Diskurs der gesellschaftlichen Inklusion und Exklusion. Nicht mehr das defizitäre behinderte Individuum steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern die Chancen bzw. Barrieren für seine/ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dominieren das Denken und Handeln der in diesem Bereich Tätigen und Forschenden (vgl. Wacker, Wansing & Hölscher 2003, 108f.). "Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen einer Person und den Umweltfaktoren vorliegt." (Wansing 2005a, 79) "Teilhabe bedeutet nach dieser Auffassung, unabhängig von individuellen Einschränkungen und Beeinträchtigungen Zugang zu unterschiedlichen Erfahrungswelten zu haben." (Metzler & Rauscher 2003, 238). Diese unterschiedlichen Erfahrungswelten klassifiziert die ICF in neun unterschiedliche Bereiche, welche den Aspekt der Erwerbsarbeit und Beschäftigung mit einschließen. Die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist deshalb entscheidend, andernfalls droht ein erhöhtes Risiko der Exklusion.
Das Ziel, Menschen mit Behinderungen den Zugang zu einer Ausbildung und zum Erwerbsleben zu ermöglichen, wird aber auch mit einer Vielzahl von politischen und ethischen Anstrengungen verfolgt. Eine wichtige internationale Deklaration ist die "Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen", die im Jahr 2007 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York beschlossen und 2008 vom österreichischen Parlament ratifiziert wurde. Zweck dieser Konvention ist, "den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern" (UN Konvention 2008, Artikel 1). Mit der UN Konvention und dem für den Bereich Arbeit und Beschäftigung darin enthaltenen Artikel 27 werden zahlreiche aktive Maßnahmen und gesetzliche Vorkehrungen zur Förderung einer beruflichen Integration am ersten Arbeitsmarkt gesetzt. Ausgangspunkte für diesen Wandel waren aber vor allem die von Betroffenenorganisationen erhobenen Forderungen nach Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft (Partizipation), die maßgeblich die wissenschaftliche und sozialpolitische Diskussion beeinflusst haben (vgl. Wacker, Wansing & Hölscher 2003).
Obwohl es eine Vielzahl politischer, fachlicher und ethischer Anstrengungen gibt, Menschen mit Behinderung den Zugang in die Arbeits- und Berufswelt zu ermöglichen, zählen diese nach wie vor zu den "Problemgruppen" auf dem Arbeitsmarkt. "In der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Exklusion wird Behinderung als einer der Hauptrisikofaktoren hervorgehoben; Menschen mit Behinderung werden deutlich als Bevölkerungsgruppe definiert, die potentiell von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist." (Wansing 2005a, 78). Um den Problemlagen von jungen Menschen mit Behinderungen bei der beruflichen Integration entgegenzuwirken, wurden in Übereinstimmung mit den politischen Vorgaben der UN Konvention von der österreichischen Bundesregierung in den letzten Jahren verstärkt arbeitsmarktpolitische Unterstützungsmaßnahmen mit dem Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen (Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 2008). Arbeitsmarktpolitische Angebote wie Berufsorientierung, Clearing, Arbeitsassistenz, Job Coaching, Mentoring, Persönliche Assistenz und Integrative Berufsausbildung stellen für junge Menschen mit Behinderung häufig die einzige Möglichkeit dar, sich beruflich zu orientieren, zu qualifizieren, eine Ausbildung zu erlangen und somit für den Eintritt in den Arbeitsmarkt gerüstet zu sein. Jedoch zeigt sich, dass institutionelle Unterstützungssysteme den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt erleichtern oder erschweren können und mitunter zu einer sozialen Ausgrenzung führen.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind häufig, aufgrund der vorgegebenen Förderstruktur, mit einer Laufzeit von etwa einem Jahr angelegt, und demnach gestaltet sich deren inhaltliche und zeitliche Ausrichtung. Dadurch kann eine "nachhaltige Bildung, Qualifizierung und Orientierung nicht optimal umgesetzt" (Egger-Subotisch 2006, 62) werden. Das betrifft vor allem junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die aufgrund eines erhöhten Unterstützungsbedarfs eine intensivere und langfristige Unterstützung benötigen würden.
Zudem wird der Erfolg vieler arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen derzeit durch quantitative Vermittlungsquoten seitens der FördergeberInnen definiert. Folglich findet eine Selektion der BewerberInnen bereits vor Eintritt in die Maßnahmen statt. So nutzen häufig Jugendliche mit einem geringen Unterstützungsbedarf - "die bereits als ,jobready' angesehen werden" (Koenig 2008, 74) - Angebote zur beruflichen Integration, die ursprünglich für die Zielgruppe Jugendliche mit einem höheren Unterstützungsbedarf konzipiert wurden (vgl. Gabrle 2004). Dies hat zur Folge, dass eine Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen häufig durch definierte Zugangskriterien seitens der Trägerorganisationen festgelegt definiert wird, und Creamingeffekte beobachtbar sind. Häufig werden Personen mit höherem Unterstützungsbedarf ausgeschlossen, weil bei ihnen eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt eher schwierig erscheint (vgl. Eglseer, Lechner, Riesenfelder et al. 2008, 158). Derartige Zielgruppenverschiebungen können in vielen Ländern Europas empirisch belegt werden und haben dort eine breite Diskussion um eine Reorganisation des Unterstützungssystems ausgelöst (vgl. Koenig & Pinetz 2009, 37).
Ausgrenzungserfahrungen aufgrund von Zielgruppenverschiebungen in arbeitsmarktpolitischen Angeboten betreffen vor allem Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und offenbaren sich in einer drastischen Weise im Lebenslauf der Betroffenen. Wansing spricht hierbei von einer "Exlusionskarriere Behinderung" (2005a, 99). Begünstigt wird ein Exklusionsrisiko oder eine "Exklusionskarriere Behinderung" dadurch, dass die gesellschaftlichen Institutionen und Funktionssysteme selbst Ausgrenzungsrisiken produzieren, welche sich besonders in den Übergangssituationen von Schule in Ausbildung und Beruf oder vom Erwerbsleben in den Ruhestand verdichten und zu Ausgrenzungen führen können (vgl. Wansing 2005b, 26). Die jungen Frauen und Männer mit Behinderung können durch "institutionelle Selektionen" (ebd.) nicht aus den Sonderwelten ausbrechen, welche für sie in Form von Sonderschulen oder Werkstätten als Ersatzarbeitsmarkt geschaffen werden. Dadurch verbleiben sie oft ihr ganzes Leben lang in diesem von der nicht-behinderten Gesellschaft abgesonderten Raum. Arbeitsmarktpolitische Unterstützungsmaßnahmen sollten jedoch wie ursprünglich durch das Konzept der unterstützten Beschäftigung so gestaltet sein, dass gerade durch individuelle, adäquate und langfristige Unterstützung im Bereich beruflicher Orientierung, Qualifizierung und Integrationsbegleitung der Eintritt und die Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht wird, um eben der beschriebenen Ausgrenzung der von einer intellektuellen Beeinträchtigung betroffenen Menschen entgegenzuwirken.
Vor diesem Hintergrund wird die Wichtigkeit eines Qualitätsmanagements in der beruflichen Integration besonders deutlich und ist seit einigen Jahren im fachlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Im Bereich der beruflichen Integration steht zumeist der Qualitätsanspruch der Kostenträger im Vordergrund. Es sind zunächst betriebswirtschaftliche Aspekte wie Vermittlungsquoten und Fördergelder, die mit dem Begriff Qualität in Verbindung gebracht werden. Finanzielle Überlegungen sind durchaus wichtig, doch darf die Diskussion über Qualität nicht ausschließlich auf diese Ebene reduziert werden. Im Kontext der beruflichen Integration, in dem verschiedene Interessensgruppen aufeinandertreffen, ist es notwendig, eine mehrperspektivische Qualitätsdiskussion zu führen (Fasching & Niehaus 2004, 11). Dabei werden Qualitätskriterien gemeinsam unter Einbeziehung aller beteiligten AkteurInnen (betroffene Personen, Angehörige der Betroffenen, MitarbeiterInnen, VertreterInnen von Betrieben sowie FördergeberInnen) festgelegt. Dieser Prozess ermöglicht allen Interessensgruppen einerseits Mitgestaltung und Orientierung, andererseits kann dem Anspruch nach Verbraucherschutz, Professionalisierung und Ressourcensteuerung Rechnung getragen werden.
Für eine erfolgreiche berufliche Inklusion und Partizipation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind qualitätsvolle und langfristige Unterstützungsmodelle in struktureller, inhaltlicher und personeller Hinsicht von großer Bedeutung, die über die konkrete Vermittlung eines Arbeitsverhältnisses hinausgehen und die Stabilität sowie Dauerhaftigkeit der beruflichen Integration zum Ziel haben. Insofern stellt sich die Frage, mit welchen Unterstützungsinstrumenten und mit welchen Methoden eine erfolgreiche und dauerhafte berufliche Vorbereitung und Integration für NutzerInnen von beruflichen Integrationsmaßnahmen erreicht werden kann, um damit die Qualität der Vermittlungserfolge langfristig zu sichern. Hierbei können die subjektiven Sichtweisen der NutzerInnen, ihre konkreten Partizipationserfahrungen bzw. Ausgrenzungserfahrungen im Prozess der beruflichen Integration und Teilhabe aufschlussreich sein.
Besonders im außerschulischen Bereich ist der Kenntnisstand über gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung als gering anzusehen. Auch Österreich bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Dies betrifft auch den Bereich der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, im Speziellen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Es existieren in Österreich zwar Forschungen zu Teilaspekten dieser Thematik wie z. B. zu den Problemlagen junger Frauen und Männer mit Behinderung im Bereich der beruflichen Integration (vgl. z. B. Fasching 2004) oder zum Erleben von Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung (vgl. z.B. Klicpera & Schabmann 1998). Die konkreten beruflichen Teilhabe-Erfahrungen der Betroffenen stehen als Forschungsfeld innerhalb der beruflichen Integration jedoch in Österreich nach wie vor weitgehend offen. In Österreich dominieren zum genannten Themenfeld staatlich geförderte Auftragsforschungen mit primär quantitativ ausgerichteten angebotsbezogenen Wirksamkeitsanalysen und Evaluationsforschungen arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsmaßnahmen (vgl. Blumberger 2002; Blumberger & Paireder 2003; Eglseer, Lechner, Riesenfelder et al. 2008; Heckl, Dorr, Sheikh 2004; Heckl, Dorr, Dörflinger et al. 2006; Horak & Schmid 2002; Horak & Schmid 2003; Lechner, Riesenfelder, Wetzel, et al. 2006).
Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) dreijährige, auftragsunabhängige Forschungsprojekt "Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biografie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung", welches am 1. Februar 2008 am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien seine Arbeit aufgenommen hat, fällt in den Bereich der Grundlagenforschung und ist als Längsschnittstudie konzipiert.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, sowohl für den Bereich "Übergang Schule und Beruf" wie auch für den Bereich "Teilhabe am Arbeitsleben" objektiv bestimmbare und subjektiv erlebte Partizipationserfahrungen im Lebenslauf von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung unter besonderer Berücksichtigung institutioneller Voraussetzungen in Österreich zu rekonstruieren. Die vorliegende Arbeit soll auf der Basis einer theoriegeleiteten Fundierung des Partizipationskonzepts, sowie primär einer qualitativ-empirischen Forschung eine grundlagentheoretische Gesamtbetrachtung zur Bedeutung von Partizipationserfahrungen von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in ihrer beruflichen Biografie liefern. Da in Österreich keine validen Statistiken zum Übergangsverlauf von der Schule in den Beruf sowie zur Beschäftigungssituation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung existieren, sollen zudem relevante deskriptiv statistische Verlaufs- und Strukturdaten erhoben werden.
Erstmals werden für Österreich in drei bundesweit als Vollerhebung konzipierten Befragungen mit Unterstützung durch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), die österreichischen BezirksschulinspektorInnen, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen und seiner Landesstellen (BASB), die Sozialabteilungen der neun Bundesländer, sowie den in diesem Feld aktiven Nicht-Regierungs-Organisationen als AnbieterInnen von arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen und/oder Werkstätten die wichtigsten AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik für intellektuell beeinträchtigte Menschen erfasst.
Die Befragungen finden gegenwärtig statt, erste Ergebnisse liegen Ende 2009 vor.
Dabei werden u. a. folgende Einflussfaktoren erhoben:
-
Institutionelle, konzeptionelle und administrative Rahmenbedingungen des österreichischen Ersatzarbeitsmarktes sowie übergangsfördernde Maßnahmen in den österreichischen Bundesländern im Rahmen einer Befragung aller Sozialabteilungen, sowie aller AnbieterInnen und Standorte von beschäftigungstherapeutischen Werkstätten in Österreich.
-
Personenbezogene Daten wie Bildungs- und Übergangsverlauf, Angaben zum Unterstützungsbedarf, sowie auf den Prozess der beruflichen Integration bezogene Detaildaten zu Personen, die im Referenzjahr 2008 von AnbieterInnen arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsangebote (wie Clearing, Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz etc.) betreut wurden.
-
Übergangsverläufe sowie die nachfolgenden institutionellen Karrieren eines kompletten SchülerInnenjahrganges, der entweder nach dem Lehrplan für schwerstbehinderte SchülerInnen oder nach dem Lehrplan für die Allgemeine Sonderschule unterrichtet wurde, und mit Ende des Schuljahres 2009 die Schule verlässt, in Form einer Längsschnittbefragung der Eltern dieser SchülerInnen zu zumindest zwei Zeitpunkten.
Zudem konnte als Pilotstudie im Zeitraum Mai bis November 2008 eine standardisierte Befragung von 230 NutzerInnen der Wiener Beschäftigungstherapie Werkstätten zu Beschäftigungspräferenzen sowie weiterer Partizipationsindikatoren (z. B. Bildung, Wohnen, Freizeit, Selbst- und Mitbestimmung etc.) mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien (FSW) abgeschlossen werden.
Im Mittelpunkt der qualitativen Forschungstätigkeit steht die Erarbeitung individueller Lebensgeschichten und beruflicher Entwicklungsverläufe gemeinsam mit zwei Forschungsgruppen (20 Personen für den Bereich "Übergang Schule und Beruf" und 20 Personen für den Bereich "Arbeitsleben"), die gleichsam die Datengrundlage für die Entwicklung übergreifender theoretischer Modelle darstellen sollen. Dabei ist der qualitative Methodenteil als Längsschnittuntersuchung konzipiert und versteht sich als Beitrag zur explorativen qualitativen Grundlagenforschung auf diesem noch wenig erforschten Gebiet. Auf der Basis unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Referenztheorien[14] wurde ein theoretisches Partizipationszonenmodell entwikkelt, welches den thematischen und strukturellen Referenzrahmen für den begleitenden Forschungsprozess mit den ForschungsteilnehmerInnen der qualitativen Längsschnittuntersuchung darstellt. Dabei werden Partizipationserfahrungen zunächst aus einer biografischen Perspektive heraus betrachtet und gemeinsam mit den ForschungsteilnehmerInnen der Versuch unternommen, zu einer umfassenden Darstellung der Lebensgeschichte der Personen zu gelangen. In weiterer Folge werden auf der Basis der entwickelten Lebensgeschichten interaktive, institutionelle und gesellschaftliche Dimensionen von Partizipations- und Ausschließungserfahrungen, insbesondere im Kontext der gemachten beruflichen Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen gezielter betrachtet werden. Grundlage für die Bearbeitung der qualitativen Daten im Forschungsprojekt ist die Grounded Theory (Charmaz 2006). Im Rahmen des Erhebungsdesigns spielt die gemeinsame Interpretation des bislang Erzählten eine zentrale Rolle in der Entwicklung und abschließenden Veröffentlichung der individuellen Lebensgeschichten. Dabei wird auf eine Vielzahl an kreativen und den kommunikativen Voraussetzungen der ForschungsteilnehmerInnen angepassten Methoden der Datenerhebung und Validierung, wie den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Interviewformen, die Verwendung von z. T. selbst gemachten Fotographien als Erzählungsstimulus, das Führen von Forschungstagebüchern durch die ForschungsteilnehmerInnen sowie gezielte Beobachtungen zurückgegriffen.
Um differenzierte Informationen und Kenntnisse über biografische und berufliche Partizipationserfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erhalten, wurde bei der Gewinnung der zwei Gruppen "Übergang Schule und Beruf" sowie "Arbeitsleben" auf eine heterogene Zusammensetzung in Bezug auf Alter, regionale Verteilung über Österreich sowie unterschiedliche Erfahrungshintergründe geachtet. Zu den Teilnahmevoraussetzungen zählte primär der biografische Erwerb der Zuschreibung einer intellektuellen ("geistigen") Beeinträchtigung (z. B. durch Lehrpläne oder andere Formen statusdiagnostischer und/oder administrativ/rechtlicher Zuschreibungsprozesse), die Fähigkeit zu informierter Zustimmung sowie im Falle der Minderjährigkeit die Zustimmung von Erziehungsberechtigten. Das Untersuchungsteam achtet auf die Einhaltung forschungsethischer Standards (vgl. Wiles/ Heath/ Crow 2005), die in Forschungen mit intellektuell beeinträchtigten Menschen in den vergangenen Jahrzehnten zumeist grob vernachlässigt wurden. So ist auch das informierte Einverständnis aller ForschungsteilnehmerInnen erst im Zuge individueller Informationsgespräche eingeholt worden und wird bei jedem weiteren Forschungstreffen wiederholt.
Der partizipative Ansatz des Projektes besteht auch in der Begleitung der gesamten Forschungsaktivitäten durch eine Referenzgruppe aus Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die eigene Interpretationen des Datenmaterials mit einbringen. Referenzgruppen zählen zu den am häufigsten erprobten und angewendeten Verfahren im Rahmen partizipativer Forschung mit intellektuell beeinträchtigten Menschen (vgl. Ramcharan/ Grant/ Flynn 2004). Die Fähigkeit und Bereitschaft, für sich selbst zu sprechen und Problemlagen behinderter Menschen zu thematisieren, zeichnet alle Mitglieder der Referenzgruppe aus, auch wenn dies in Einzelfällen über Kommunikationshilfen erfolgen muss. Die bisherigen Erfahrungen mit der Arbeit der Referenzgruppe führten teilweise zur Korrektur anfänglicher Ansprüche, eröffneten gleichzeitig aber auch den Blick auf bislang ungenutztes Potenzial dieser Form wissenschaftlicher Arbeit. Eine abschließende Wertung wird erst gegen Ende der Projektlaufzeit möglich sein.
Mit diesem Forschungsprojekt sollen die objektiv vorhandenen Strukturen wie auch die subjektiv erfahrenen Aspekte von Teilhabe und Ausschließungsprozessen im Prozess des Übergangs von der "Schule in den Beruf" sowie im "Arbeitsleben" bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung transparent gemacht werden. Der erwartbare Erkenntnisgewinn des Projektes wird in mehreren Bereichen liegen:
-
einem deutlich besseren Überblick über die in Österreich vorhandenen institutionellen Strukturen, die junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nach dem Verlassen der Schule und beim Übergang in das Berufsleben begleiten, einschließlich der Wirkungen, welche diese Teilhabe- und Ausschließungsprozesse im Verlauf auf die Betroffenen ausüben
-
eine Erfassung der Struktur sowie individueller Verlaufsdaten des Arbeitsmarktes, mit den Auswirkungen, die diese für die Lebenswelt der darin involvierten Menschen hat, einschließlich erfahrener Partizipationsmöglichkeiten wie unterbliebener Teilhabechancen
Mit dem innovativen Charakter des Projekts im Bereich der Forschungsmethoden und der Erfassung wesentlicher inhaltlicher Bereiche, für die es in Österreich kaum verwertbare Daten gibt, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse des Forschungsprojekts wertvolle Anregungen für die weitere qualitative Steuerung der beruflichen Integrationsarbeit in Österreich liefern können. Derartige Erkenntnisse erscheinen notwendig, um auch die insbesondere im Qualitätsdiskurs notwendige Weiterentwicklung (förder-)rechtlicher Rahmenbedingungen für eine dauerhafte, gleichwertige Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung am allgemeinen Arbeitsmarkt voranzutreiben.
In weiterer Folge soll anhand konkreter Beispiele veranschaulicht werden, wie das gezielte Nutzen von in wissenschaftlichen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen im Kontext einer verbesserten Steuerung arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsleistungen eingesetzt worden ist und welche Änderungen sich dadurch für ein NutzerInnen orientiertes Qualitätsmanagement ergeben.
"Nichts über uns ohne uns!" ist das Motto der Selbstbestimmt-Leben-Initiative (SLI). In den beiden Equal - Entwicklungspartnerschaften "QSI - Quality Supported Skills for Integration" und "IBEA - Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung" erhielt das Betroffenen Mainstreaming einen zentralen Platz. Der Impuls dafür ging von der "Elterninitiative Integration: Österreich" aus, allerdings in enger Zusammenarbeit mit der SLI. Als "Betroffene" werden sowohl Menschen mit Behinderung als auch Mütter und Väter von Kindern und Jungendlichen mit Behinderung definiert (vgl. Brandl, Krög & Finding, 2007, 7). Betroffenen Mainstreaming wird als Strategie gesehen, Partizipation von behinderten Menschen und ihren Angehörigen zu erreichen, indem die Perspektiven und Interessen Betroffener eingebracht und deren Diskriminierungen aufgezeigt werden. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, Menschen mit Behinderung bzw. betroffene Mütter und Väter in alle Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsschritte gleichberechtigt einzubeziehen. Als ExpertInnen in eigener Sache, aber auch in ihrer Rolle als Verbindungspersonen zu Interessensvertretungen, stellen MitarbeiterInnen als selbst Betroffene für das Betroffenen Mainstreaming ein Korrektiv dar, das aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation von den vier zentralen Prinzipien Inklusion, Empowerment, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit berührt wird. Bei Entscheidungsfindungen auf strategischer und operativer Ebene wird bewusst darauf geachtet, dass die Bedürfnisse der Betroffenen ernst genommen werden, keine diskriminierenden oder fremd bestimmenden Elemente vorkommen, Beiträge zur Förderung der Selbstbestimmung geleistet und Aktivitäten sich am Grundprinzip einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen orientieren (vgl. Wetzel & Bartl-Tettl, 2004,11).
Die erste Equal - Entwicklungspartnerschaft, in der Betroffenen Mainstreaming eine zentrale Rolle gespielt hat, war QSI (Quality Supported Skills for Integration) 2002 - 2004. Die Ergebnisse dieses Projekts sind eine Analyse der Ausbildungslehrgänge im Gesundheits- und Sozialbereich, ein "Haltungsfragebogen", mehrere Publikationen zum Thema Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit, aber auch ein Basiscurriculum und vier Spezialcurricula für die Ausbildung zur qualifizierten Integrationsfachkraft für Elternbildung, Familienberatung, Schulassistenz und Familien entlastende Dienste. Die Zusammenarbeit zwischen WissenschafterInnen, Integrationsfachkräften und Betroffenen - um nur einige PartnerInnen zu nennen, Integration: Österreich, Sozialökonomische Forschungsstelle Wien, Pädagogische Akademie Linz, Selbstbestimmt Leben Initiative Wien - führte zu überzeugenden Produkten. Von 2005 bis 2007 wurde die zweite Equal - Entwicklungspartnerschaft IBEA (Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung) von MitarbeiterInnen für Betroffenen Mainstreaming begleitet. Dabei entstanden ein Leitfaden für Barrierefreiheit in berufsbildenden Schulen und diverse Lehrmaterialien für den integrativen Unterricht. Des Weiteren wurde das ZIBB (Zentrum für inklusive Berufsbildung) pilotiert, der Index für Inklusion für die Berufsschule adaptiert und es wurden verbindliche Qualitätsprozesse und eine Kompetenzenbilanz für BerufsschülerInnen erarbeitet. Auch bei IBEA konnte der Mehrwert der Einbeziehung Betroffener beobachtet werden. Die Projektergebnisse waren glaubwürdig und die MitarbeiterInnen der Module bekamen Sicherheit, im Sinne der Betroffenen zu arbeiten. Auch der Umgang mit Begrifflichkeiten änderte sich in Richtung eines sensiblen Sprachgebrauchs. Durch die Supportangebote der MitarbeiterInnen für Betroffenen Mainstreaming konnten viele Arbeitsschritte einfacher vollzogen und ein wiederholtes inhaltliches Controlling durchgeführt werden.
In zahlreichen europäischen Ländern, wie Schweden, Niederlanden und Großbritannien, wurden schon seit mehr als zehn Jahren systematische Erfahrungen mit neuen Formen der Leistungserbringung in der Behindertenhilfe und der Pflege gesammelt (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing 2003, 198ff). Die normativen Zielvorstellungen, die bei Budgetansätzen leitend sind, ähneln sich sehr. Diese Innovationen implizieren nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung und Unterstützung der Autonomie, sondern auch höhere Effizienz in der Leistungserbringung und bei Kosteneinsparungen (vgl. Klie & Spermann 2004, 2). Zum 1. Juli 2001, gleichzeitig mit der Entstehung des Sozialgesetzbuches Neun (SBG IX), hat der Gesetzgeber die Leistungsform des Persönlichen Budgets in Deutschland eingeführt (vgl. Lachwitz, Schellhorn & Welti 2001). Mit dieser neuen Sozialleistungsform ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten und Hoffnungen bei der Umsetzung langjähriger Forderungen von Menschen mit Behinderungen nach Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (vgl. Wacker, Wansing & Schäfers 2005, 9f). Das formulierte Ziel der Leistungsbeurteilung im SBG IX (§ 17, Abs. 2) lautet folgend: "Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein persönliches Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen." (Lachwitz, Schellhorn & Welti 2001)
Das persönliche Budget stellt somit eine neue Art der Leistungsform für Menschen mit Behinderungen dar, auf dem seit dem 1.1.2008 ein Rechtsanspruch besteht (vgl. Windisch 2006, 9). Beim üblichen und parallel bestehen bleibenden Sachleistungsprinzip (wonach finanzielle Hilfen für Menschen mit Behinderungen nach Verhandlung der KostenträgerInnen mit der LeistungserbringerIn, nicht mit den Betroffenen selbst bezahlt werden) ist eine Mitbestimmung und Steuerung durch den/die LeistungsnutzerIn kaum denkbar. Die Beziehung zwischen LeistungsträgerIn (KostenträgerIn), LeistungsanbieterIn (Dienstleistung) und LeistungsnutzerIn (LeistungsempfängerIn) strukturiert sich im Persönlichen Budget gänzlich neu. Im Fokus steht jetzt der/die LeistungsempfängerIn, somit vollzieht sich eine Umwandlung vom ehemaligen passiven Leistungsempfänger zur aktiven KundIn (vgl. Schäfers, Schüller & Wansing 2005, 82ff). Das Modell des Persönlichen Budgets sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen direkt monetäre Leistungen von den infrage kommenden Leistungsträgern als Budget erhalten, mit denen sie die von ihnen benötigte Unterstützung aus zur Verfügung stehenden Angeboten selbst auswählen, organisieren und finanzieren können. Dieses Modell kann als Umstieg von der Tradition der Sachleistung zur Geldleistung verstanden werden, und damit erfolgt eine Umlenkung der wohlfahrtsstaatlichen Geldmittel von der AnbieterIn zum/zur NutzerIn der Leistungen (Hölscher, Wacker & Wansing 2003, 198). Das Persönliche Budget ermöglicht somit Personen mit einem Bedarf an Teilhabeleistungen anstatt einer Sach- oder Dienstleistung, eine bestimmte Geldsumme in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag wird in Form einer Geldleistung direkt auf das Konto der BudgetnehmerInnen überwiesen. Mit dem erhaltenen Budget können die BudgetnehmerInnen, je nach eigenem Anliegen, unterschiedliche professionelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, persönliche AssistentInnen nach dem ArbeitgeberInnenmodell anstellen oder Unterstützung auch privat organisieren. Entscheidungsspielräume auf sachlicher, sozialer und zeitlicher Ebene eröffnen sich, sodass der/die BudgetnehmerIn selbst entscheiden kann, welcher Dienst oder welche Person die Hilfe erbringen soll (vgl. Schäfers, Schüller & Wansing 2005, S. 84).
Diese neue Form der Erbringung staatlicher Sozialleistungen eignet sich nicht nur dazu, Entscheidungsspielräume aufzudecken, sondern sie bewirkt ebenso den Vollzug eines deutlichen "Paradigmenwechsels" in der Behindertenpolitik (Wacker, Wansing & Hölscher 2003, 108). Das heißt "(...) weg von einer Anbieter zentrierten und oft pauschalen Versorgung [sprich der Defizitorientierung bei Menschen mit Behinderung] und hin zu einer personenbezogenen Hilfe nach Maß." (Hölscher, Wacker & Wansing 2003, S. 198). Diese spezifische Hilfestellung soll eine ziel- und passgenaue Deckung der individuellen Unterstützungsbedarfe verwirklichen und die Kompetenzen und Ressourcen einer Person professionell handhaben (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing 2003, S. 198).
Empirische Ergebnisse zu Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget in europäischen Nachbarländern zeigen, dass die Realisierung von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe im Alltagsleben der BudgetnehmerInnen in hohem Maße gelingt und erfolgreich ist (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing, 2003, 199ff). Währenddessen kommen die praktischen Erprobungen in Ländern wie der Schweiz und Deutschland nur schleppend voran. Dies liegt vor allem an den weitestgehend fehlenden Praxiserfahrungen der Modellversuche (vgl. Wacker, Wansing & Schäfers 2005, 41ff). In Österreich bestehen gegenwärtig nur Überlegungen zur Einführung des persönlichen Budgets (vgl. Buchinger 2007 [Online]).
Als ein weiteres richtungweisendes internationales Beispiel für innovative Rahmenbedingungen im Kontext einer stärker NutzerInnen orientierten qualitativen Steuerung und Regelung arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsmaßnahmen soll an dieser Stelle der Finanzierungsansatz des "Performance Based Funding" näher beschrieben werden (vgl. Koenig 2008). Die Vereinigten Staaten von Amerika haben traditionell eine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Umsetzung von Supported Employment gespielt. So wurde bereits 1986 Supported Employment im bundesweit gültigen Rehabilitation Act wie folgt definiert: "Competitive work in integrated settings (A) for individuals with severe handicaps for whom competitive Employment has not traditionally ocurred, or (B) for individuals for whom employment has been interrupted as a result of a severe disability, and who, because of their handicap, need ongoing support services to perform such work." (Rehabilitation Act / PL 99-506 1986). In dieser bis heute gültigen Definition fällt im Unterschied zu der beschriebenen Situation in Österreich insbesondere die Verknüpfung von Supported Employment und dauerhafter Unterstützung auf. Supported Employment wurde in den USA seit den 80er-Jahren bis heute intensiv wissenschaftlich beforscht und hat dort längst das Stadium einer "Evidence Based Practice" erreicht. Ein weiterer Vorteil dieser breiten wissenschaftlichen Einbeziehung ist die Verfügbarkeit bundesweit einheitlicher Daten, welche jährlich unter bestimmten Blickwinkeln in dem Bericht "State of the States in Intellectual and Developmental Disabilities" veröffentlicht werden. Wird der tatsächlich erreichte Grad der Einbeziehung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (in den USA als "people with intellectual and developmental disabilities" bezeichnet) in den Blick genommen, so zeigt sich, dass es zwischen 1988 und 2004 zu einer relativen Zunahme des Anteils an Personen in Programmen der unterstützten Beschäftigung von 9% auf 24% gekommen ist (vgl. Braddock/ Hemp & Rizolo 2004). Dies bedeutet jedoch auch im Umkehrschluss, dass immer noch drei Viertel aller Personen in Einrichtungen des Ersatzarbeitsmarktes beschäftigt sind, obwohl seit dem berühmten "Olmstead Beschluss" des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten Angebote für Menschen mit Behinderung in "the most integrated settings" erfolgen sollen (vgl. Rogan 2007, 254). In einer Betrachtung einzelner Bundesstaaten fällt auf, dass auch in den USA große regionale Disparitäten existieren. So können einzelne Bundesstaaten identifiziert werden, in denen bereits über 50% der Personen in unterstützten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Dies wurde zum Anlass genommen zu erforschen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Implementierung in den sieben erfolgreichsten Bundesstaaten der USA[15] ausgemacht werden können. An erster Stelle, so bilanziert Rogan (2007), steht eine positive und wertegeleitete Philosophie auf der Ebene aller relevanten Stakeholder. Die Entscheidung für oder gegen einen verstärkten und nachhaltigen Umbau des Unterstützungssystems für Menschen mit Beeinträchtigungen ist also primär eine Werteentscheidung. Diese positive Philosophie zieht sich in den untersuchten Bundesstaaten sowohl durch die Ebene der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der konzeptionellen Ausrichtung der Leistungsanbieter sowie der Finanzierungssysteme selbst. So operieren als besondere Neuerung diese Bundesstaaten mit regional angepassten Systemen eines "Performance Based Funding". Auch hier wird der Stellenwert, dem wissenschaftliche Begleitforschungen in den USA zukommen, ersichtlich: Ergebnisse verschiedener Untersuchungen haben gezeigt, dass eine stundenweise Abrechnung von Unterstützungsleistungen in der Regel zu einer Überversorgung, umgekehrt ein rein outputorientiertes Finanzierungssystem zu einer Unterversorgung der anvisierten Zielgruppen führt (vgl. O'Brien & Grant-Revell 2007). Ziel derartiger Finanzierungssysteme ist ein auf größtmögliche Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unterstützungssystem, das insbesondere jenen Personen zugute kommt, die einen besonders hohen Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung aufweisen. Um dies zu erreichen, werden in der individuellen Ausgestaltung von "Performance Based Funding" Systemen die folgenden fünf Elemente berücksichtigt und an die regionalen und jeweiligen Unterstützungssystem bezogenen Erfordernisse angepasst
-
Definition des letztlich angestrebten Zieles der Unterstützungsleistung in einer sequenziellen Abfolge klar definierter Teilziele
-
Identifikation von Benchmarks bzw. Meilensteinen für jedes der definierten Teilziele
-
Definition von Qualitätsindikatoren für jeden definierten Benchmark bzw. Meilenstein
-
Zuweisung eines Geldwertes für jeden definierten Benchmark bzw. Meilenstein.
-
Definition zusätzlicher Incentive Prämien für die Betreuung besonders schwer zu vermittelnder Personen (Wehmann & Revell 2005, 90, eigene Übersetzung)
Wie schnell ersichtlich, wird durch ein derartiges Finanzierungssystem zwangsläufig dem Prozesscharakter der beruflichen Integration stärker entsprochen sowie ein umfassenderer Blick auf die Qualität und den Erfolg Arbeitsmarkt bezogener Unterstützungsleistungen gelegt. Insbesondere in der Definition der Benchmarks für die Finanzierung von Teilleistungen bzw. das Erlangen von Teilzielen werden international übliche Qualitätsstandards der unterstützten Beschäftigung herangezogen, da sich diese ebenfalls als Resultat zahlreicher Studien als von Faktoren für die Nachhaltigkeit unterstützter Beschäftigungsverhältnisse herausgestellt haben. Beispiele für derartige Teilziele bzw. Benchmarks wären z. B. die gemeinsame Entwicklung eines Karriereplans, der Aufbau eines Unterstützungskreises, die Durchführung einer fundierten Arbeitsplatzanalyse, eine erfolgte betriebliche Einarbeitung sowie die Identifizierung eines/r Mentors/in im Betrieb. Das bedeutet in der Praxis, dass LeistungsanbieterInnen die Erfüllung bestimmter Leistungen als Bausteine eines nachhaltigen beruflichen Integrationsprozesses gesondert nachweisen müssen. Ein weiteres entscheidendes Kriterium in derartigen Finanzierungssystemen ist die Aufwertung der Rolle der KundInnen in dem Prozess der beruflichen Integration. Indem sie Zustimmung geben müssen, dass sämtliche Leistungen zu ihrer Zufriedenheit erbracht wurden, wird zentral das Machtgefälle zu ihren Gunsten verschoben. Der Gefahr einer Zielgruppenverschiebung wird durch die Gewährung von finanziellen "Incentives" für besonders schwer zu vermittelnde Personen (z. B. Personen aus Werkstätten, Personen mit Doppeldiagnosen etc.) entgegengewirkt (vgl. O'Brien & Grant-Revell 2007).
Wie in den Beispielen zuvor ersichtlich wird, kann die Realisierung inklusiver Angebote sowohl durch eine konzeptionelle Ausrichtung als auch durch förderliche gesetzliche Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Unzureichende Rahmenbedingungen aufgrund fehlender politischer Willensbildung wie auch pessimistische Haltungen mancher UnterstützerInnen machen eine individuelle und passgenaue Unterstützung bei der Durchführung von diversen Einzelaktivitäten im Prozess der beruflichen Integration für NutzerInnen diverser Angebote unmöglich. Eine flexiblere Handhabung sowie eine effizientere Einsetzung finanzieller Ressourcen seitens der Politik können zur Optimierung der Qualität einzelner arbeitsmarktpolitischer Angebote dringend empfohlen werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die NutzerInnen haben (Fasching 2004). Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung benötigen in der Regel mehr zeitliche und personelle Unterstützung, um dem Ziel einer Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt näher zu kommen. Jedem Menschen mit Behinderung soll ermöglicht werden, das für ihn/sie höchstmögliche Bildungsniveau zu erreichen, um in den Arbeitsmarkt eintreten zu können (UN Konvention 2008, Artikel 24 und 27). Bildung und Ausbildung sind nach wie vor wesentliche Grundlagen, um einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Zudem vermitteln Bildung und Ausbildung auch soziale und lebenspraktische Kompetenzen, die häufig eine Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und eine zukünftige Lebensorientierung sind (Koenig & Pinetz 2009, 46). Für eine qualitätsvolle berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen bedarf es vor allem der Sichtweise der NutzerInnen, um die Qualität bzw. Sinnhaftigkeit von Unterstützungsleistungen zu beurteilen.
[14] Der phänomenologisch und wissenssoziologische Ansatz "Strukturen der Lebenswelt" von Schütz/ Luckmann
(1994), das sozialpädagogische Lebensweltmodell von Thiersch (2005) sowie das sozialwissenschaftlich basierte
ökosystemischen Modell menschlicher Entwicklung von Bronfenbrenner (1981).
[15] Kentucky, Oklahoma, Idaho, Conneticut, Vermont, Washington & Vermont
Inhaltsverzeichnis
Michael Fürnschuß
Jede Organisation (und mit ihr die Menschen, die für sie arbeiten) möchte erfolgreich sein. Daraus leiten sich zwangsläufig zwei Fragen ab:
-
Wie stellt man den eigenen Erfolg fest?
-
Auf welchem Weg erreicht man den gewünschten Erfolg?
Die erste Frage wirft das Problem der Messbarkeit des eigenen Erfolgs auf. Ist eine Organisation erfolgreich, wenn sie Gewinne erwirtschaftet oder zumindest kostendeckend arbeitet? Ist sie erfolgreich, wenn sie - im Fall von sozialen Organisationen - soziale Ziele erreicht? Ist sie erfolgreich, wenn sie hohe Qualität anbietet? Was aber bedeutet dann "hohe Qualität", wie wird diese festgestellt? Gerade im Feld von Nonprofit-Organisationen wird schnell klar, dass Erfolg nicht mit einseitig, zumeist finanziell ausgerichteten Kennzahlen dargestellt werden kann. Die zweite Frage ist die Frage der zu verfolgenden Strategie, die sich jede Organisation selbst wählt. Organisationsstrategien beantworten die Frage, wie dieser Erfolg erreicht werden soll. Die Strategieentwicklung stellt dabei durchaus große Herausforderungen, die auch zu einem Scheitern der Strategieumsetzung führen können. Das kann unter anderem daran liegen, dass
-
Strategien auf zu hohem, abstraktem Niveau entwickelt wurden,
-
Strategien von Personen oder Bereichen entwickelt wurden, die weit weg vom Tagesgeschäft sind,
-
konkrete Umsetzungsmaßnahmen nicht entwickelt werden - z. T. einfach, um die mit der Umsetzung verbundenen Mühen und Widerstände in der eigenen Organisation zu vermeiden,
-
keine oder zu wenig konkrete Erfolgsmessgrößen (Kennzahlen) entwickelt werden und Strategien damit eher unverbindlich und (Miss)Erfolg weniger leicht nachzuvollziehen ist,
-
Erfolgsmessgrößen einseitig auf finanzielle Größen (und damit vergangenheitsorientiert) ausgerichtet sind,
-
die Strategieformulierung für haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen und manchmal auch Funktionäre und Führungskräfte selbst zu wenig konkrete Anhaltspunkte liefert, um zu wissen, was in der täglichen Arbeit für eine erfolgreiche Strategieumsetzung zu tun ist.
Die Balanced Scorecard (BSC) wurde entwickelt, um die oben dargestellten Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Sie gilt - neben Projekt-, Prozess- und Changemanagement - als eines der wichtigsten Umsetzungsinstrumente in der strategischen Führung. Ihre Flexibilität macht sie gerade in Nonprofit-Organisationen sehr gut anwendbar.
Welcher Nutzen liegt nun in der Einführung und Anwendung von Balanced Scorecards? Er liegt in der
-
Ausrichtung der Organisation auf ihre Vision und strategischen Ziele
-
Übersetzung der Strategie in konkrete Ziele mit dazugehörigen Messgrößen
-
ausgewogenen Steuerung mit finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, die sowohl bezogen auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft ausgewählt werden
-
Berücksichtigung interner und externer Anspruchsgruppen
-
Kommunizierbarkeit der Zusammenhänge zwischen einzelnen strategischen Zielen
-
Möglichkeit des Lernens durch das Messgrößen-Feedback
-
Verknüpfung mit konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung
Balanced Scorecards bilden systembedingt verschiedene Perspektiven einer Organisation und ihrer Umwelt ab. Dadurch gewährleisten sie die Ausgewogenheit der strategischen Ziele. Ihre Entwickler, Robert S. Kaplan und David P. Norton, haben vier Perspektiven vorgeschlagen:
-
Finanzperspektive
-
Kundenperspektive
-
Interne Prozessperspektive
-
Lern- und Entwicklungsperspektive
Der Charme der BSC liegt nun darin, dass sowohl Anzahl als auch Aspekte der Perspektiven an die eigene Organisation, die eigene Vision und die eigene Strategie angepasst werden können, ja sogar müssen - ideal also für soziale Organisationen. In der Literatur findet man neben der Bezeichnung Perspektiven häufig auch die Bezeichnung "Dimensionen".
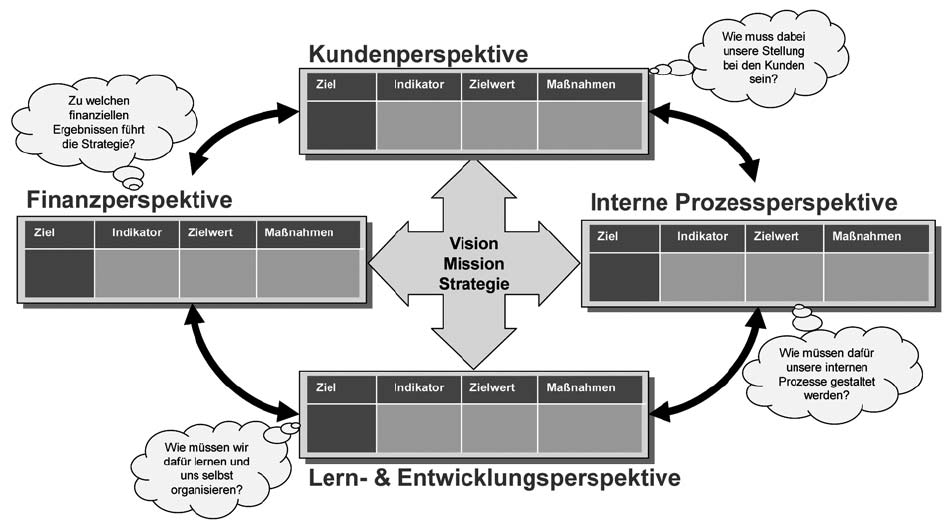
Abbildung 1: Balanced Scorecard und ihre vier Perspektiven (Nach R.S.Kaplan and D.P.Norton - "Balanced Scorecard: Measures that drive performance", Harvard Business Review, 1992 )
In jeder Perspektive gilt es, die strategischen Ziele zuzuorden, die dazu passenden Messgrößen samt Zielwerten zu definieren und jene strategischen Maßnahmen zu beschließen, die der Zielerreichung dienen.
Ein wichtiger Teilaspekt ist dabei die Diskussion und Darstellung der Zusammenhänge zwischen den strategischen Zielen in Form einer "Strategielandkarte", wie im folgenden Beispiel dargestellt:
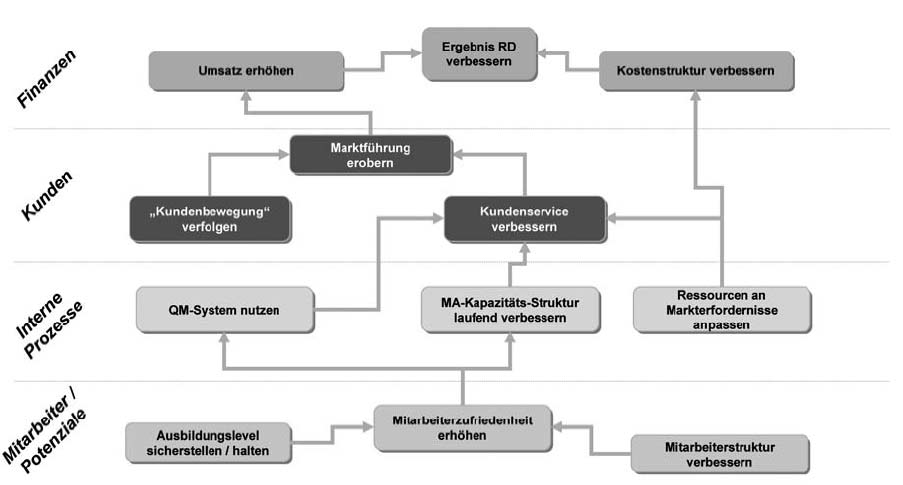
Abbildung 2: Beispiel einer Strategielandkarte aus dem Rettungsdienst (adaptiert nach: ÖCI, NPO-Kongress 2001)
Wichtiger als die "wissenschaftliche Richtigkeit" der Zusammenhänge ist dabei die gemeinsame Sicht der Beteiligten, der Organisationsmitglieder. Die Erarbeitung dieser Zielzusammenhänge fördert die Identifikation der Beteiligten mit der Strategie und unterstützt auch bei deren Kommunikation mit den anderen Organisationsmitgliedern.
Nach der Zuordnung der strategischen Ziele zu den Perspektiven und der Darstellung ihrer Zusammenhänge ist es notwendig, zu jedem strategischen Ziel zumindest eine passende Kennzahl für dessen Messung zu definieren. Weiters ist es nötig, Zielwerte für diese Kennzahlen zu definieren, um eine Messlatte für den eigenen Organisationserfolg festzulegen, die dann regelmäßig auf ihren Erreichungsgrad geprüft werden können.
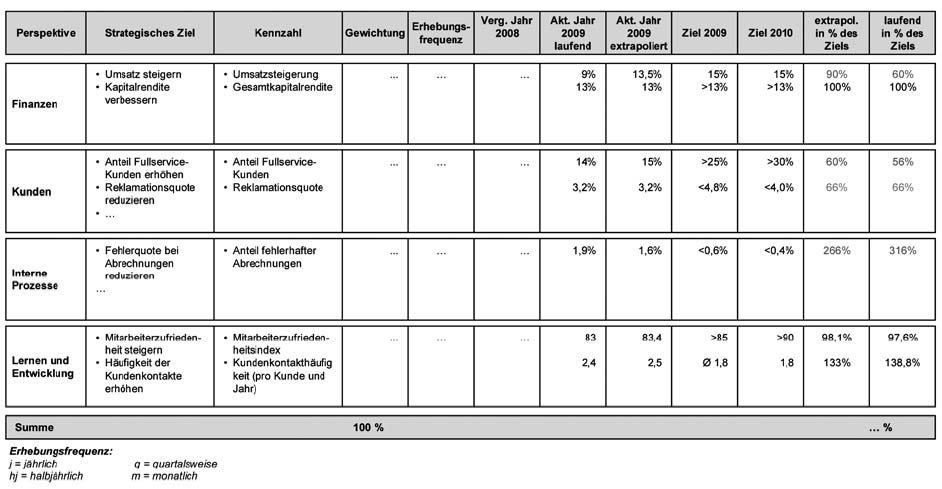
Trotz ihrer Flexibilität und des vielseitigen Nutzens ist eine BSC kein "Wundermittel des Managements". Sie erfordert ganz klar, dass bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein müssen, ohne die sie nicht funktionieren kann:
-
Die strategische Analyse und Planung muss vorab erfolgen. Das bedeutet, dass die Chancen und Risiken sowie die sich daraus ergebenden kritischen Erfolgsfaktoren aus der strategischen Umfeldanalyse abgeleitet wurden und die Stärken und Schwächen der eigenen Organisation bekannt sind. Vision, Ziele und Strategien der Organisation müssen auf dieser Basis ausgearbeitet sein und vorliegen.
-
Das Verständnis für die "Logik des eigenen Geschäfts" muss vorhanden sein. Führungskräfte müssen die Ursache-Wirkung-Beziehungen in der eigenen Organisation verstehen und diese auch den MitarbeiterInnen kommunizieren können. Die BSC hilft zwar bei der Kommunikation, ersetzt aber weder das Verständnis der Zusammenhänge noch legt sie diese a priori selbst fest.
-
Zumindest die Führungskräfte müssen eine gemeinsame Sicht sowohl zu diesen Zusammenhängen als auch zur oben genannten Strategie haben. Deswegen ist nicht nur das Ergebnis der strategischen Analyse und Planung, sondern auch deren Prozess wichtig. Die Einführung und das "am Leben erhalten" einer BSC ist dabei Chefsache - wenn sie nicht von der jeweils letztverantwortlichen Führungskraft getragen und genutzt wird, scheitert sie.
-
Die Bereitschaft, aus Feedback zu lernen und Strategien bzw. Maßnahmen anzupassen: Gerade durch das Messen, wie weit man strategische Ziele erreicht hat, erhält man unmittelbar Feedback über den eigenen Organisationserfolg, die Effektivität von strategischen Maßnahmen und über die "Richtigkeit" der Strategien. Damit wird eine Organisation transparent - diese Transparenz muss man aber auch wollen und mit ihr umgehen können.
-
Konkrete Zielwerte, Maßnahmen und Projekte müssen beschlossen und mit Ressourcen ausgestattet werden: ohne Zielkonkretisierung nach der "SMART-Formel" (Spezifisch, Messbar, Attraktiv/angemessen/aktionsorientiert, Realistisch, Terminisiert) kann eine BSC nicht funktionieren. Ohne Maßnahmen zur Zielerreichung bleibt letztere dem Zufall überlassen.
Für den Entwicklungsprozess selbst hat es sich bewährt, ...
-
... alle beteiligten Personen über das Projekt zu informieren und methodisch zu schulen
-
... die Entwicklung abzustimmen mit eventuellen weiteren, vorhandenen oder zu entwickelnden Scorecards
-
... eine/n neutrale/n, fachlich geeignete/n ProjektleiterIn mit dem Projekt zu betrauen.
Was genau ist Qualität? Fragt man öffentliche Geldgeber und soziale Organisationen, erhält man dazu häufig ganz unterschiedliche Antworten. Mitunter deckt sich das Verständnis von Qualität nicht einmal in der eigenen Organisation. Qualitätsverantwortliche sind daher gut beraten, die Begriffe von Qualität in der eigenen Organisation zu klären, transparent und verständlich zu machen. Von "Qualität" spricht man in einer grundlegenden Definition häufig dann, wenn sich die Anforderungen von Kunden an Produkte und Dienstleistungen mit ihren diesbezüglichen Wahrnehmungen decken. Ähnlich definiert es auch die ISO 9000-2000: "Qualität ist der Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt". Etwas einfacher formuliert es der amerikanische Qualitätsexperte Joseph M. Juran: "Qualität ist die Gebrauchstauglichkeit einer erstellten Leistung aus Sicht der Kunden" (fitness for use).
Um die eigenen Qualitätsbegriffe zu konkretisieren und transparenter zu machen, hilft die Unterteilung in verschiedene Qualitätsdimensionen. Je nach Modell spricht man von
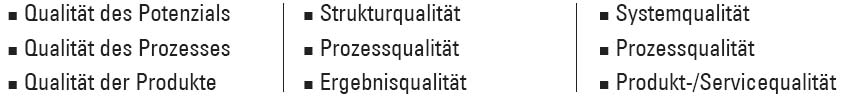
In jeder dieser Qualitätsdimensionen lassen sich qualitätsbeeinflussende Größen definieren, die mit geeigneten Kennzahlen auch gemessen werden können. Beispiele dafür finden sich in der folgenden Grafik:
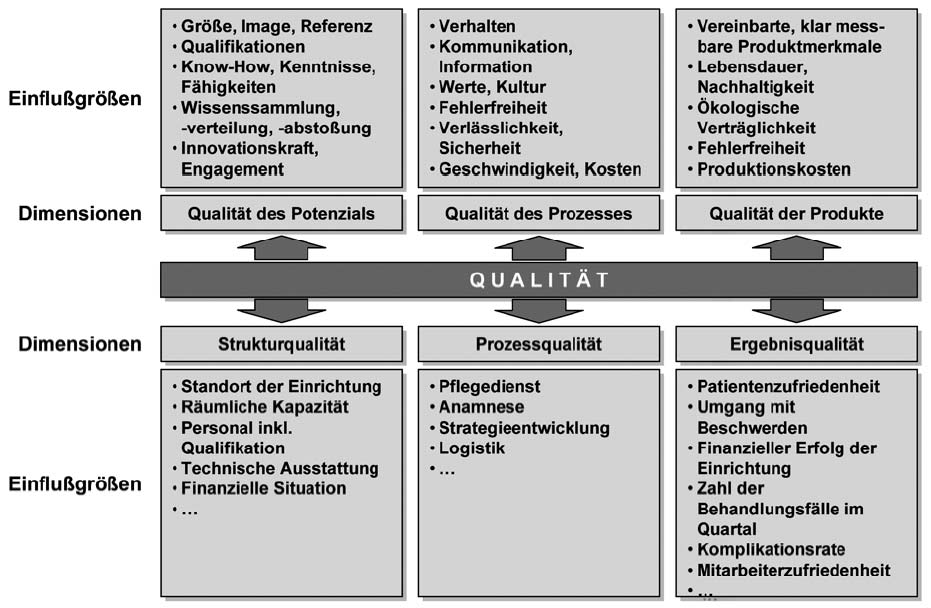
Abbildung 4: Gängige Darstellungen strukturieren Qualität in jeweils drei Dimensionen (eigene Darstellung nach Wagner/Zacharnik, 2006; Knon/Lobinger/Groß, 2005)
Für die Qualitätssteuerung hat sich der nach seinem Erfinder benannte "Deming-Kreislauf" etabliert. Dieser Kreislauf operiert mit vier Schritten:
-
PLAN: Qualitätsziele müssen nach der SMART-Formel geplant und ihre Umsetzung mit Ressourcen sichergestellt werden. Dazu gehört auch, Verantwortliche für die einzelnen Qualitätsziele zu benennen. Potenzielle Fehler gehören bereits in der Planungsphase berücksichtigt, um Abläufe so zu definieren, dass diese Fehler (möglichst) nicht auftreten können. Dazu ist häufig die Erstellung von Anleitungen für Abläufe nötig.
-
DO: Abläufe werden laut Plan durchgeführt und so das Produkt bzw. die Dienstleistung erstellt.
-
CHECK: Im dritten Schritt wird anhand der definierten Messgrößen der Grad der Zielerreichung festgestellt. Daneben wird auch festgestellt, ob und welche Fehler aufgetreten sind und in welcher Häufigkeit diese passiert sind.
-
ACT: Wurden in Schritt 3 Fehler festgestellt, müssen deren Ursachen geklärt, analysiert und behoben werden. Dazu ist zu überlegen, welche verschiedenen Lösungsmöglichkei-ten es für die Fehlerbehebung und zukünftige Fehlervermeidung es geben könnte und die geeignetste(n) Lösung(en) auszuwählen.

Abbildung 5: Deming-Kreislauf (Quelle: Wagner/Zacharnik, 2005)
Der "Deming-Circle" entspricht damit anderen gängigen Steuerungskreisläufen, z. B. dem Pflegekreislauf (Anamnese - Pflegeplanung - Durchführung - Evaluation) oder dem Controlling-Kreislauf (Planung - Umsetzung - Ergebnisfeststellung & Abweichungsanalyse - Gegensteuern)
Wie können die beiden Instrumente BSC und Qualitätsmanagement integriert werden?
Dazu gibt es grundsätzlich zwei Zugänge:
-
Man nutzt das Instrument der BSC, um Qualitätsmanagement zu betreiben
-
Man integriert Qualitätsziele in eine BSC
Der erste Zugang ist ein rein Qualitätsmanagement orientierter und dient der Abbildung und Verfolgung der Qualitätsstrategie. Hier können Struktur und Vorgehensweise einer BSC dazu benützt werden, um ausschließlich Qualitätsziele abzubilden (andere strategische Ziele würden also nicht aufgenommen). Dazu werden die Qualitätsziele und die zugehörigen Messgrößen auf die vier Standardperspektiven einer BSC zugeordnet. Alternativ können die Standardperspektiven der BSC auch gegen andere Perspektiven ausgetauscht werden (im einfachsten Fall z. B. in Ergebnis-, Prozess-, und Strukturperspektive). Wie im normalen BSCVorgehen werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Qualitätszielen definiert, und Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele verabschiedet.
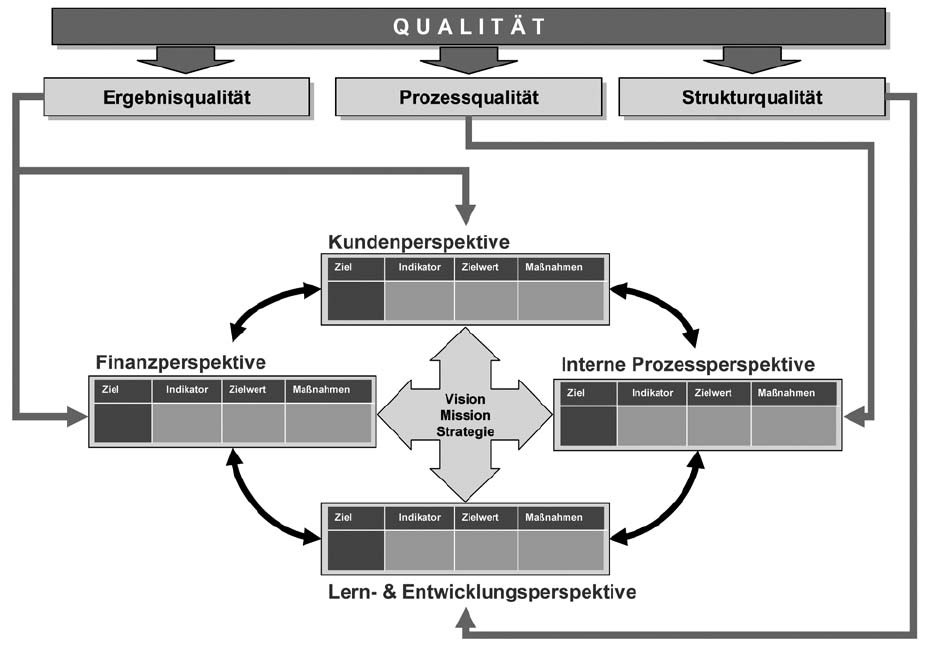
Abbildung 6: Wie fließen Qualitätsaspekte in die BSC ein?
Im zweiten Zugang fließen strategisch wichtige Qualitätsaspekte in eine "übergeordnete" BSC ein. "Übergeordnet" meint in diesem Zusammenhang, dass in der BSC die Gesamtstrategie der Organisation dargestellt wird. Qualitätsmanagement-Kennzahlen werden dabei als strategisch so wichtig gesehen, dass sie hier - als Teilkriterien unter mehreren Kriterien für strategischen Erfolg - aufgenommen werden. Dabei gilt auch für diesen Zugang, dass die Zuordnung der Qualitätskriterien zu den BSC-Perspektiven sinnvoll erfolgen muss, analog zum ersten Zugang.
Analog zu den Nutzenaspekten von Qualitätsmanagement und Balanced Scorecards bringt eine Integration der beiden Instrumente folgende Vorteile:
-
Klärung und Transparenz hinsichtlich der strategisch wichtigen Qualitätsbegriffe und -erfolgsmessgrößen
-
Kommunizierbarkeit der Qualitätsstrategie bzw. der Qualitätsaspekte in der Gesamtstrategie sowie der Zusammenhänge zwischen den einzelnen (strategischen) Qualitätszielen
-
Konkretisierung durch Operationalisierung der (strategischen) Qualitätsziele
-
Verknüpfung der Qualitätsziele mit konkreten Maßnahmen und Verantwortlichkeiten.
-
Lernen mittels Feedback durch Qualitätsergebnisse wird wie im Deming-Circle dargestellt möglich
-
Verknüpfung mit den Leistungen von Organisationsteilen bis hin zu MitarbeiterInnenzielen wird möglich
Inhaltsverzeichnis
Michael Fürnschuß
Das Bundessozialamt (BSB) ist in Österreich zentraler Ansprechpartner für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Österreichweit arbeiten über 700 MitarbeiterInnen an Aufgaben, die sich grundsätzlich aus gesetzlichen Grundlagen und Durchführungsverordnungen bzw. -richtlinien des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK) ergeben.
Um die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung voranzutreiben, fördert das BSB u.a. zahlreiche Projekte verschiedenster Projektträger. Seit 2007 besteht ein Auftrag des BMSK, dass alle geförderten Projekte einen unmittelbaren Arbeitsmarktbezug haben müssen. Für Projekte, die diesen Bezug 2007 noch nicht nachweisen konnten, wurde eine maximal dreijährige Übergangsfrist zugestanden. Eine verbindliche, allgemeingültige bzw. vom BMSK herausgegebene Definition, was unter "unmittelbarer Arbeitsmarktbezug" zu verstehen ist, war zum Startzeitpunkt dieses Projekts nicht gegeben.
Unter den zum Projektstart geförderten Projekten befanden sich auch 51 sogenannte Beratungs- und Sensibilisierungsprojekte. Das sind Projekte, die keinen oder einen nur untergeordneten Vermittlungsauftrag in den ersten Arbeitsmarkt oder heranführende Schulungen haben, sondern deren Inhalt darin besteht, von Behinderung betroffene Personen, deren Angehörige, Unternehmen und MultiplikatorInnen auf die verschiedenen Problemlagen aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und Lösungsangebote vorzustellen.
Für erste, einzelne Projekte wurden 2008 bereits Wirkungsziele vereinbart. Der Erfolg des Großteils dieser Projekte wurde allerdings noch über sogenannte "Aktivitäten" (z. B. Zahl der Beratungen) gemessen. Der Fokus der Erfolgsbeobachtung lag damit schwerpunktmäßig auf der Outputmessung und noch nicht in der Wirkungsorientierung.
In Summe erzielten die Projekte unterschiedliche Ergebnisse, wobei insbesondere der Zusammenhang zwischen dem geforderten unmittelbaren Arbeitsmarktbezug und den Projektergebnissen nicht immer eindeutig ablesbar war.
Im Endergebnis bot sich ein Bild, in dem unterschiedliche Ergebnisse, fehlender/nicht erkennbarer unmittelbarer Arbeitsmarktbezug sowie zu geringe Wirkungsorientierung und -messung seitens der Trägerorganisationen für das BSB als öffentlicher Auftraggeber kaum sichtbar war, inwieweit die investierten Mittel tatsächlich die beabsichtigten Wirkungen erzielten. Für die fraglichen Projekte ergab sich damit eine strategische und durchaus auch operative potenzielle Bedrohung.
In dieser Situation hat das Bundessozialamt 2008 einen überregional koordinierten und professionellen Entwicklungsprozess eingeleitet, an dessen Ende ein strukturiertes System zur Planung, Vereinbarung und Steuerung von Wirkungszielen stehen sollte. Vorgabe war dabei, dass das zu entwickelnde System mit einheitlichen, definierten, umsetzbaren Instrumenten arbeiten sollte, die gleichzeitig flexibel genug sind, bedarfsgerecht und auf die individuellen Bedürfnisse der Projekte abgestimmt werden zu können. Darüber hinaus sollte das System insbesondere träger- und projektseitig das Lernen voneinander über Organisationsgrenzen hinweg ermöglichen.
In einem gemeinsam von BSB, betroffenen Trägern und dem BMSK getragenen Prozess wurde daraufhin ein System entwickelt, das in der Lage ist, die existierende, vielfältige Projektlandschaft in einem mehrstufigen Zielsystem abzubilden. Die Systematik baut auf einigen Grundüberlegungen auf, die hier beschrieben werden:
Die erste Grundüberlegung ist die Überlegung zu unterschiedlichen Pfaden in die Integration am 1. Arbeitsmarkt. Menschen mit Behinderung stehen unterschiedlich nah an diesem Arbeitsmarkt. Bei manchen gilt es vielleicht, nur ein technisches Problem in den Griff zu bekommen, damit sie im Arbeitsmarkt verbleiben können. Bei anderen kann es wiederum sein, dass sie verschiedene Vorstufen absolvieren müssen, bevor sie sich z. B. in einer (Weiter-)Bildungsmaßnahme auf den Eintritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten können und erst der letzte Schritt die tatsächliche Vermittlung und gegebenenfalls eine Begleitung am Arbeitsplatz selbst ist. Integration ist damit auch Prozess, der schrittweise gegangen werden muss.
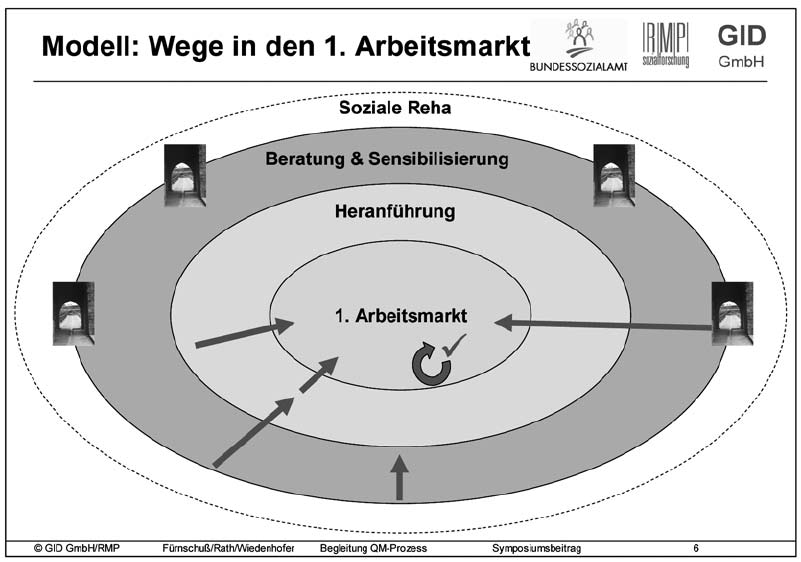
Abbildung 7: Integrationspfade in den ersten Arbeitsmarkt (Modell)
Arbeitsmarktpolitisch relevante Wirkungen müssen sich zufolge entlang dieser Integrationspfade entfalten, wenn die finalen Ziele einer erfolgreichen und nachhaltigen Arbeitsmarktintegration oder des Verbleibs am Arbeitsmarkt erreicht werden sollen. Die logische Wirkungszielstruktur und die definierten Wirkungsziele selbst spiegeln diese Grundüberlegung wider.
Im Kern steht hier die Frage: Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration/Verbleibssicherung? Anders gefragt: Welche Ursachen hat eine bestimmte "Wirkung"? Gerade bei der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung gibt es ja häufig keine monokausalen Zusammenhänge zwischen einer einzelnen, bestimmten (und lösbaren) Ursache und dem "Fernbleiben" vom allgemeinen Arbeitsmarkt. Für eine Lösung bedeutet das, dass man sich vorgelagerter Problemlösungen ("Wirkungen") bewusst sein muss, ohne die es keine erfolgreiche Integration geben wird.
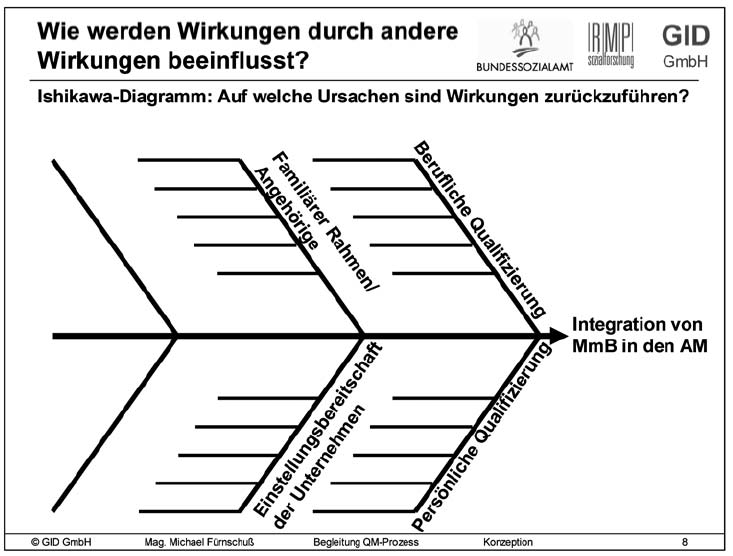
Abbildung 8: Ursache-Wirkung-Diagramm (in Anlehnung an Ishikawa)
Im Fall der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung heißt das, dass man sich neben ihren persönlichen/fachlichen Gründen der Nichtteilhabe auch über die systemischen Hintergründe Gedanken machen muss. So werden auch die fähigsten Betroffenen keine Integration erfahren, wenn auf der anderen Seite keine UnternehmerInnen gegenüberstehen, die bereit sind, ihnen Arbeit zu geben. Unterstützt das familiäre Umfeld eines Betroffenen diesen nicht, ist es ebenso schwierig, erfolgreich am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es gilt also, sich auf unterschiedliche Zielgruppen einzustellen, die gleichermaßen Einfluss auf besagte Integration haben.
Die Diskussion um (Qualitäts-)Ziele im sozialen Bereich wird häufig und mitunter sehr kontroversiell geführt. Ein Hintergrund für Kontroversen ist, dass sich die beteiligten Partner auf sehr unterschiedlichen Ebenen bewegen, zum Teil ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Ziele lassen sich aber nicht nur auf einer Ebene definieren: Man braucht daher Klarheit darüber, auf welcher Stufe man sich gerade in der Diskussion bewegt und man muss die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Zielebenen berücksichtigen. Tut man das, schafft man gegenseitig einen großen Beitrag zu besserer Kommunikation zwischen öffentlichem Auftraggeber und Auftragnehmer.
Ein im öffentlichen Bereich gängiges Zielmodell baut dazu auf vier verschiedenen Zielebenen auf: Wirkungsziele, Leistungsziele, Prozessziele und Input-/Ressourcenziele.
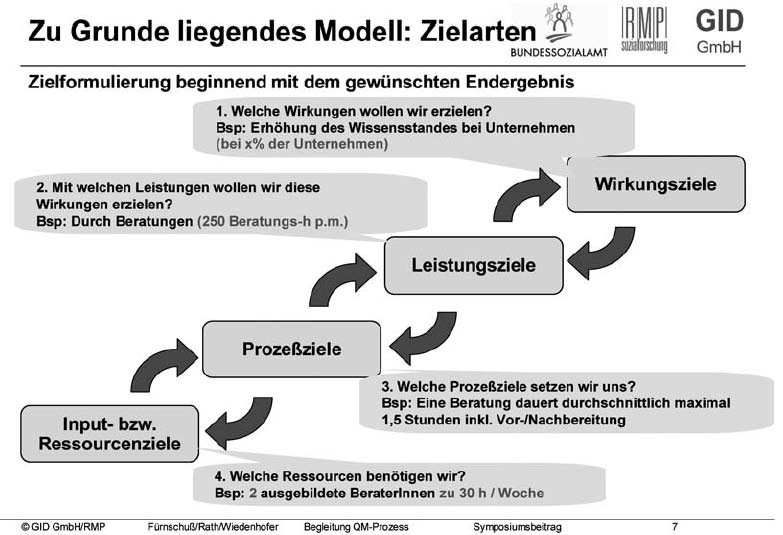
Abbildung 9: Zielebenen-Modell
Spricht man von "Wirkungszielen" ist somit eine ganz spezifische Art von Zielen gemeint, die sich deutlich von anderen Zielarten unterscheiden. "Wirkungen" meint dabei, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Problem gelöst ist, aus Sicht eines Einzelnen oder aus Sicht der Gesellschaft.
Wirkungen entstehen nicht im "luftleeren Raum". Will man nicht auf Zufallsergebnisse warten, benötigen Wirkungen jeweils bestimmte, planvoll erbrachte Leistungen als Auslöser. Dabei kann es durchaus sein, dass eine bestimmte Wirkung mit ganz unterschiedlichen Leistungen erreicht werden kann.
Häufig müssen die Prozesse, mit denen Leistungen erstellt werden, ganz spezifische Charakteristika aufweisen, damit die erbrachten Leistungen Wirkung zeigen.
Das Durchlaufen von Prozessen benötigt wiederum Ressourcen (MitarbeiterInnen, Infrastruktur, Arbeitsmaterial, ...) und Input (Fachwissen, auslösende Ereignisse wie die Nachfrage nach einer bestimmten Leistung, ...).
Zwischen diesen Zielebenen gibt es somit auch wieder einen Wirkungszusammenhang. In der Planung versucht man dabei, sich von den angestrebten Wirkungen über die Zielebenen hin zu den notwendigen Ressourcen zu bewegen. Entdeckt man auf einer dieser Ebenen einen Engpass (sehr "beliebt": Budgetengpässe) bedeutet das, dass man retrograd sich wieder die anderen Ziele ansehen muss, inwieweit diese auf den geplanten Wegen erreicht werden können oder es doch anderer Wege bedarf.
Auf Basis der oben dargestellten Grundkonzepte wurden im Projekt eine ganze Reihe von Wirkungszielen geschaffen, die den Kern des neuen Systems bilden. Eine "Wirkungsziel-Landkarte" bildet diese Wirkungsziele ab.
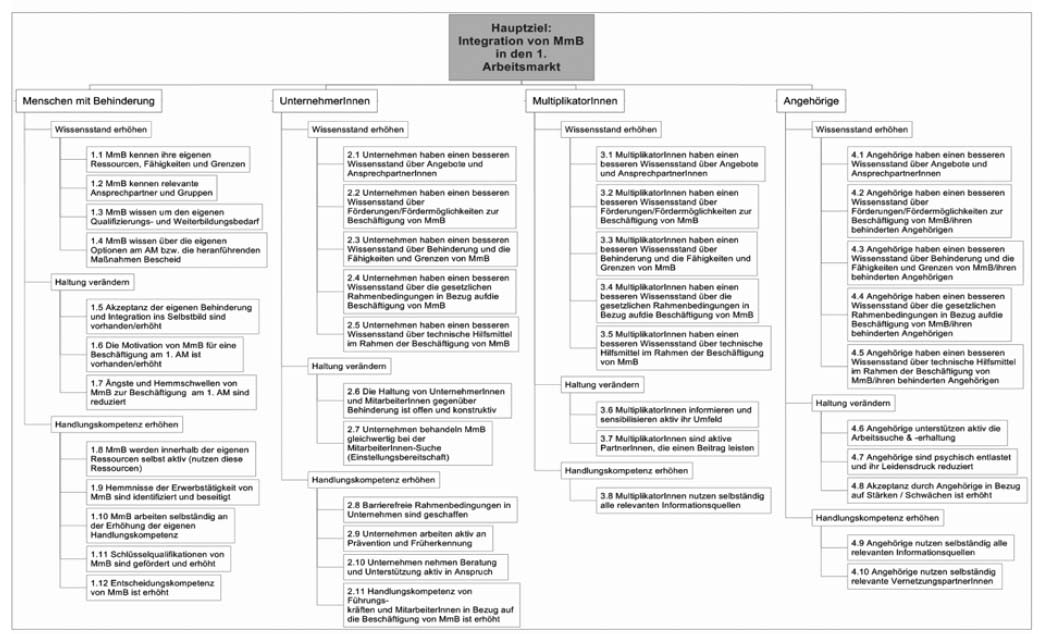
Abbildung 10: Wirkungsziel-Landkarte
Das System berücksichtigt jede der vier Zielgruppen "Menschen mit Behinderung", "UnternehmerInnen", "Angehörige" und "MultiplikatorInnen" und deren individuelle Bedürfnisse für sich. Unter "MultiplikatorInnen" werden im System Personen verstanden, die aus ihrer beruflichen Stellung heraus häufig AnsprechpartnerInnen für die anderen drei Zielgruppen sind, beispielsweise Behindertenvertrauenspersonen, ÄrztInnen, PflegerInnen, InteressensvertreterInnen, etc. Die gleichzeitige Berücksichtigung aller vier Zielgruppen ist nötig, weil sie in der Herausforderung der beruflichen Integration systemisch zusammenhängen. Eine einseitige Berücksichtigung nur einer oder einzelner Zielgruppen im Gesamtsystem hieße, den Einfluss der unberücksichtigten Zielgruppen auf eine erfolgreiche und nachhaltige berufliche Integration auszublenden.
Gemeinsam ist dabei allen Wirkungszielen, dass sie in jeweils drei Gruppen gegliedert sind, die in einem logischen Sinn aufeinander aufbauen:
-
Wissensstand erhöhen: Ziel ist hierbei, den Wissensstand der jeweiligen Zielgruppe zu (spezifischen Aspekten) Behinderungen zu erhöhen. Grundidee: nur wer mehr über Behinderung und ihre verschiedenen Aspekte Bescheid weiß, ist in der Lage, seine Einstellung zu verändern und sich anders als vorher zu verhalten.
-
Haltung verändern: Hier geht es darum, die Einstellung zu (eigener) Behinderung zu verändern.
-
Handlungskompetenz erhöhen: Diese Gruppe von Zielen spricht die aktive Handlungsfähigkeit von Menschen in der jeweiligen Zielgruppe an. Aufbauend auf den Vorstufen (mehr über Behinderung wissen/die eigene Einstellung zu Behinderung positiv verändern) sollen die Zielgruppen durch Aktivitäten in diesem Bereich ihr "Verhaltensrepertoire" erweitern und vollumfänglich nutzen können
Im Projekt wurden die dargestellten Wirkungsziele im Rahmen eines "Wirkungszielkatalogs" einzeln näher beschrieben und konkretisiert. Gleichzeitig wurden für jedes Wirkungsziel Vorschläge zu möglichen Mess- und Beobachtungsinstrumenten (z. B. Befragung, Zählung, ...) ausgearbeitet, um den Einstieg ins System möglichst einfach zu gestalten. Gemeinsam ist allen Wirkungszielen auch, dass sie auf die übergeordneten Integrationsziele "Arbeitsplatzerlangung" und "Arbeitsplatzsicherung" hinzielen.
Im Sinne österreichweit einheitlicher Grundstrukturen wurden für die Umsetzung dieses Modells einige konkrete Werkzeuge ausgearbeitet:
-
Antragstellung: Ein Beiblatt zum normalen Projektantrag des BSB bringt jene Punkte ein, die aus dem Wirkungsorientierungs-System stammen: Ausgewählte Wirkungsziele, damit in Zusammenhang stehende Leistungen und ausgewählte Messgrößen für die Wirkungen.
-
Vertragserstellung: Der Standardfördervertrag des BSB wurde für die fraglichen Projekte so angepasst, dass die Wirkungssystem relevanten Teile enthalten sind.
-
Berichtswesen: Für die Ergebniskommunikation zwischen Projektträger und BSB wurden zwei Berichtsstrukturen (Halbjahresbericht, Gesamtjahresbericht) geschaffen, die österreichweit einheitliche Struktur aufweisen, dabei aber projektindividuell mit den jeweils ausgewählten Zielen und Messgrößen befüllt werden können.
-
Erkennbare und verbindliche Wirkungsziele erleichtern die Orientierung und Ausrichtung von Projekten. Es besteht mehr inhaltliche Sicherheit bei beiden ProjektpartnerInnen.
-
Strukturierte Berichtsvorgaben erleichtern Projekten den Aufbau entsprechender interner Systeme, gleichzeitig reduzieren sie die Notwendigkeit für jeden Träger, sich über eigene mögliche Berichtsstrukturen Gedanken machen zu müssen.
-
Der Wirkungszielkatalog erleichtert die Verortung der Projekte und kann als Unterstützung für die wirkungsorientierten Zielvereinbarungen herangezogen werden.
-
Mögliche Indikatoren stehen als Unterstützung im Katalog zur Auswahl - eine Ergänzung um projekt- und situationsspezifische Indikatoren/Messgrößen ist aus der Projektexpertise der BSB-MitarbeiterInnen jederzeit möglich.
-
Ein definierter Prozessablauf unterstützt gleiche und hohe Betreuungsqualität in ganz Österreich.
-
Projektwirkungen sind als Bewertungs- und Auswahlkriterien beschreibbar
-
Österreichweit einheitliche Instrumente mit flexiblen Inhalten unterstützen einerseits eine einheitliche Betreuungsqualität seitens des BSB und erlauben gleichzeitig ein flexibles Eingehen auf die verschiedenen Landes- und Projektkonstellationen.
Derzeit (im Jahr 2009) befindet sich das Projekt in der Pilotphase und wird noch qualitätssichernd begleitet. Zu den bisherigen Erfolgsfaktoren aus dem Projekt gehören:
-
Rechtzeitiger Projektbeginn: Ein Start des Projekts noch im Jahr 2008 hat für ausreichend Zeit gesorgt, eine gründliche Anforderungs- und Bestandsanalyse mit allen Beteiligten durchzuführen, auf der dann die Konzeption des Modells und der Instrumente aufsetzen konnte. Weiters war es möglich, nach der Konzeption in eine Pilot- und Testphase zu starten und diese für gegebenenfalls notwendige Modifikationen zu nutzen.
-
Beteiligung wesentlicher Anspruchsgruppen im Projekt: Während der gesamten Analyse- und Konzeptphase wurden die wesentlichen Projektanspruchsgruppen (ProjektleiterInnen, BSBSachbearbeiterInnen und deren Führungskräfte, LandesstellenleiterInnen, Stabsabteilung und BSB-Leitung, Bundesministerium) immer wieder eingebunden. Dadurch konnten weitestgehend alle Ansprüche im Projekt berücksichtigt werden und so von vornherein für eine höhere Akzeptanz gesorgt werden.
-
Zügiger Prozess: Die zügige Durchführung des Projekts während der einzelnen Arbeitsphasen hat bei allen Beteiligten für hohe Energie und für rasch sichtbare Ergebnisse gesorgt. Die Gefahr des "schleichenden Versandens" in einem theoretisch dreijährigen Umstellungszeitraum wurde erfolgreich umschifft
-
Einbindung externer Experten: Durch die Einbindung externer Experten und der Nutzung deren Erfahrung konnten Analyse, Konzeption und Testphase sehr rasch umgesetzt werden. Der Zugriff auf das vorhandene branchen- und konzeptionelle Fachwissen hat für alle Projektbeteiligte andernfalls langwierige Lernprozesse beschleunigt. Gleichzeitig hat die Stellung der externen Berater und ihrer größeren Neutralität den Beteiligten gegenüber für höhere Akzeptanz gesorgt, als sie anderweitig zu erwarten gewesen wäre.
-
Fokus auf fundiertes Konzept und Umsetzungsunterstützung: Einer der wichtigsten Punkte im Projekt war - nach einer Systemeinschulung für BSB-MitarbeiterInnen und für ProjektleiterInnen - die konkrete Umsetzungsberatung auf Projektebene, soweit diese von den Beteiligten in Anspruch genommen wurde. Dadurch konnte auf jedes Projekt individuell eingegangen und die verantwortlichen ProjektleiterInnen und SachbearbeiterInnen gerade in der herausfordernden Startphase begleitet werden.
Bundessozialamt Österreich
Stabsabteilung
DSA Susanne Wiedenhofer
susanne.wiedenhofer@basb.gv.at
+43 (5) 99 88-2234
GID GmbH Gesellschaft für
Information und Datenverarbeitung
Mag. Michael Fürnschuß, Geschäftsführer
Industriestraße 13
61449 Steinbach/Taunus
Deutschland
office@fuernschuss.org
+49 (151) 5906 2673
+43 (699) 1029 2000
RMP Sozialforschung
Mag.a Marlene Mayrhofer/Mag.a Doris Rath
Hackhofergasse 1
1190 Wien
Österreich
marlene.mayrhofer@rmp.or.at
+43 (650) 207 0112
doris.rath@rmp.or.at
+43 (680) 122 0591
Inhaltsverzeichnis
Peter Beule, Gert Klüppel
In der Diskussion zur Qualität von sozialen Dienstleistungen werden zunehmend klare Standards in der Organisation und zur inhaltlichen Umsetzung gefordert. Diesem Umstand hat auch der Gesetzgeber bei der Formulierung des Sozialgesetzes - Neuntes Buch (SGB IX) Rechnung getragen, indem er Maßnahmen zur Qualitätssicherung als gemeinsame Aufgabe der AuftraggeberInnen und der AuftragnehmerInnen festgeschrieben hat. Ergänzend wird auch von der Seite der MitarbeiterInnen gefordert, dass inhaltliche Standards und Erfahrungswerte ebenfalls festgeschrieben werden sollen. Insofern ist die Qualitätspolitik nach KASSYS ganz selbstverständlich als Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) zu verstehen.
In der Industrie und im Dienstleistungssektor ist der Einsatz weitreichender Qualitätsmanagementsysteme inzwischen üblich und wird von den AuftraggeberInnen und KundInnen als selbstverständlich erachtet. Sie gelten oft als Grundlage jeglicher vertraglich geregelter Zusammenarbeit. Die Verflechtung und Überschneidung vieler Anbieter und Angebote dürften in Zukunft zu deutlich verstärktem Wettbewerb und höherem Legitimationsdruck führen. Nicht zuletzt sind es die KundInnen und AuftraggeberInnen der sozialen Dienstleistungen, die klare Erwartungen an die gewünschte Unterstützungsleistung formulieren und entsprechende Transparenz einfordern.
Die Aufgaben der Integrationsfachdienste sind gekennzeichnet durch ein breites inhaltliches Spektrum und durch die enge themenbezogene Kooperation aller beteiligten Stellen. Das Integrationsamt versteht seine zentrale Steuerungsrolle im Zusammenhang mit seiner gesetzlichen Verpflichtung als strukturverantwortlicher AuftraggeberInnen insbesondere in Bezug auf die Verpflichtung aller Beteiligten zur Qualitätssicherung und deren Weiterentwicklung.
KASSYS formuliert und strukturiert die Anforderungen an Führungs-, Prozess-, Ergebnis- und Strukturqualität. KASSYS ist in Abstimmung mit allen Auftraggebern der Integrationsfachdienste (IFD), dem Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG-UB) erarbeitet worden.
Das Referenzhandbuch zum Qualitätsmanagement-System KASSYS - wie auch das System selbst - ist modular aufgebaut, d. h. es besteht aus einzelnen Elementen. KASSYS kann in andere Systeme - z. B. trägerumfassende QM-Systeme - eingebunden werden. Diese müssen jedoch die Grundsätze von KASSYS beachten.
KASSYS bildet die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement ab, die in der gemeinsamen Empfehlung "zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistungen" nach § 20 Absatz 1 SGB IX formuliert sind. KASSYS bezieht seine Grundausrichtung eher aus dem Gedankengut der EFQM (European Foundation for Quality Management) als aus den in der Industrie üblichen EN-ISO-Systemen. Dies drückt sich besonders in der starken Gewichtung der Qualität der Prozesse der Dienstleistungserbringung aus. Die ISO-Norm folgt inzwischen in ihrer letzten Revision selbst diesem Denkansatz.
Die Gliederung des Handbuches entspricht der Architektur des Systemhauses.
-
KASSYS ist als Qualitätssicherungssystem die praktikable Grundlage für die Beauftragung der Integrationsfachdienste (IFD) durch alle AuftraggeberInnen nach dem SGB IX, für die Durchführung der Aufgaben durch die IFD und für die Strukturverantwortung der Integrationsämter.
-
KASSYS ist ab Version 3 mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und mit den übrigen AuftraggeberInnen neben den Integrationsämtern einvernehmlich abgesprochen und beschlossen.
-
KASSYS umfasst jetzt auch die Vermittlungsarbeit der IFD und die für die Vermittlung erforderlichen vorbereitenden Arbeiten - die Übergänge aus Schule und Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sowie den niederschwelligen Zugang.
-
KASSYS geht aus vom gesetzlichen Auftrag der IFD nach § 110 SGB IX, bezieht sich auf die gemeinsamen Empfehlungen nach den §§ 20 SGB IX zur "Qualitätssicherung" und 113 zur "Inanspruchnahme der IFD" sowie auf die "Grundsätze zur Nutzung und Mitfinanzierung" mit der Bundesagentur für Arbeit (BA).
-
KASSYS beschreibt die strukturellen Voraussetzungen beim Träger des IFD, beim IFD selbst und seinem Personal, ohne deren Gegebenheit keine Qualität bei der Unterstützung der besonderen Zielgruppen erwartet werden kann.
-
KASSYS macht differenzierte Vorgaben zu den unterstützenden Prozessen und Maßnahmen zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt und zur Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse.
-
KASSYS arbeitet bei der Überprüfung von Kennzahlen zur Qualität der IFD-Arbeit (vgl. Anhang "Eckdaten IFD 2005/2006" für die Berichterstattung der Bundesregierung an Bundestag und Bundesrat nach § 160 SGB IX) mit dem von der BIH entwickelten und bundesweit eingesetzten Dokumentationssystem KLIFD zusammen.
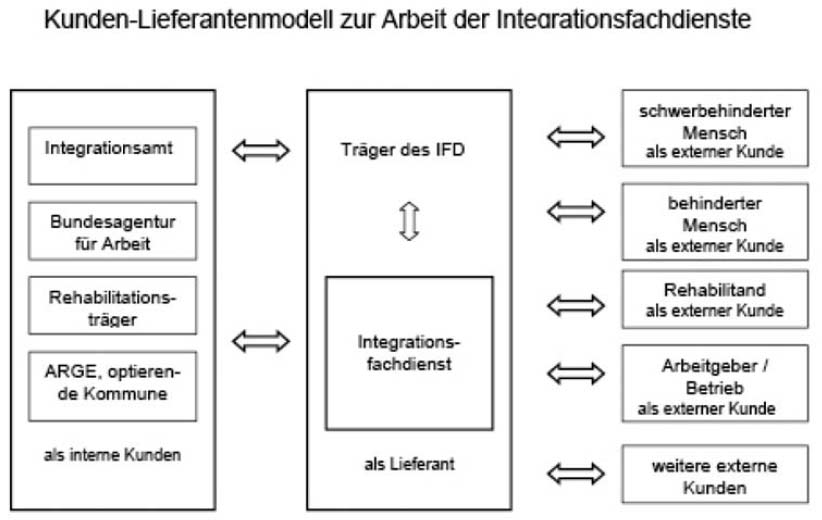
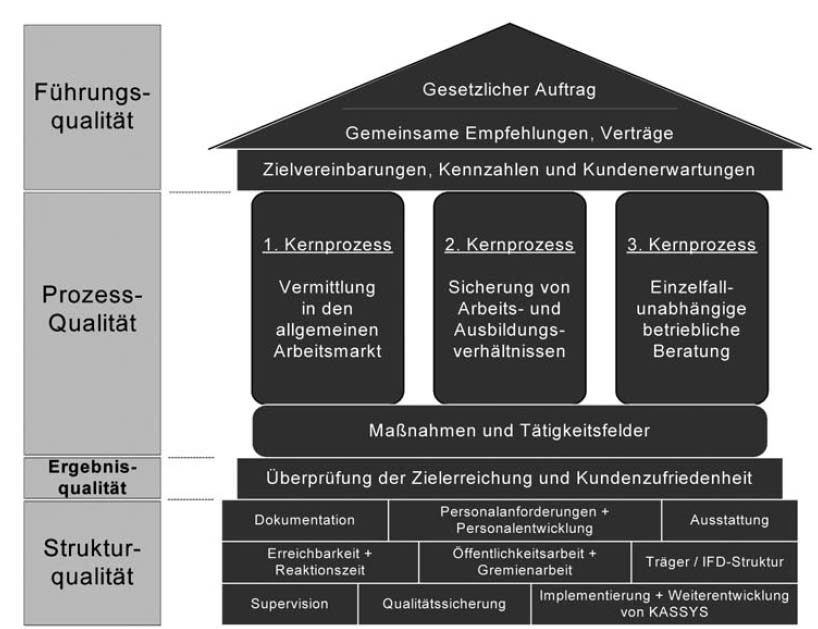
Abb. 1: KASSYS: Kasseler Systemhaus (Stand: 2006)
Im Kapitel Führungsqualität (Dach des Hauses) wird auf die wesentlichen bestehenden Regelungen und Steuerungsgrößen Bezug genommen, die für die Durchführung der IFD-Aufgaben relevant sind (gesetzlicher Auftrag, gemeinsame Empfehlungen/Verträge, Zielvereinbarungen/Kennzahlen und Kundenerwartungen). Zielvereinbarungen nehmen einen zunehmend wichtigen Stellenwert ein: Auf der Ebene der Steuerung der Qualität der IFD-Arbeit werden jährlich Ziele zwischen AuftraggeberInnen und IFD-TrägerInnen vereinbart.
Um die Strukturverantwortung gegenüber den IFD-TrägerInnen und den anderen AuftraggeberInnen der IFD wahrzunehmen, ist in den zuständigen Gremien der BIH festgelegt und als allgemein anerkannte Vorgabe in der "Gemeinsamen Empfehlung zur Inanspruchnahme der IFD" nach § 113 SGB IX verankert worden, dass mit dem Instrument der Vereinbarung von Zielen zwischen Integrationsamt und Integrationsfachdienst gearbeitet werden soll.
Gegenstand der Zielvereinbarung ist der gesamte IFD, d.h. die Zielvereinbarungen müssen sich sowohl auf den Vermittlungs- als auch auf den Begleitungsbereich des IFD beziehen. Sie werden jährlich zwischen dem Integrationsamt und jedem IFD-Träger abgeschlossen. Es sollten je Zielvereinbarung maximal 9 Ziele definiert werden (je 2 - 3 Ziele zur Strukturqualität, Prozess- und Ergebnisqualität). Es sollen sowohl quantitative als auch qualitative Ziele berücksichtigt werden. Die Abstimmung zu den Erwartungen an die Zielvereinbarung aller AuftraggeberInnen kann über den Landeskoordinierungsausschuss einfließen.
Berücksichtigt werden nur Ziele, deren Erreichbarkeit vom IFD beeinflussbar sind. Beispielweise sollten bei der Vereinbarung von Vermittlungszahlen (Ergebnisqualität) diese unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des IFD (Ausstattung, Erfahrung etc.) in Abhängigkeit von den Leistungspotenzialen der Klientel, der Verfügbarkeit von Fördermitteln und sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten durch Dritte sowie vom regionalen Arbeitsmarkt abhängig formuliert und die Zielerreichung unter diesen Aspekten bewertet werden.
Folgende 6 Punkte sollten grundsätzlich bei der Definition jedes Zieles erörtert werden:
-
Alle wesentlichen Daten zum Ist-Stand
-
Bedarf an Neugestaltung (Was muss geändert werden? Welches neue Ziel ist anzustreben?)
-
Zielobjekt oder Zielinhalt (Was und welches Ergebnis wollen wir erreichen?)
-
Zielerreichungsgrad oder Zielinhalt (Wie viel wollen wir erreichen? Welches Ausmaß der Zielerreichung streben wir an?)
-
Zielmaßstab (Woran wollen wir messen? Welche Messkriterien wenden wir an?)
-
Zeitlicher Bezug (Bis wann wollen wir die Ziele erreichen?)
Da Ziele nach dem SMART-Muster (S-Spezifisch - M-Messbar - A-Attraktiv - R-Realistisch - T-Terminiert) auch messbar sein müssen, bietet es sich an, für die vorstehenden Punkte 4. bis 6. jeweils mindestens einen der folgenden Indikatoren je Ziel festzulegen:
-
Menge (Leistungsumfang nach Qualitäten)
-
Zeit (Dauer, Termine, Meilensteine, Zeitrahmen)
-
Qualität (qualitative Ausprägung des Leistungsergebnisses)
-
Wirkung (Leistungsergebnis nach angestrebter Wirkung)
-
Kosten (Erlöse, Ressourceneinsatz)
Kennzahlen sind als Zielmaßstab zu verstehen und müssen durch konkrete Messkriterien überprüft
werden können. Als Indikatoren gelten beispielhaft folgende Kriterien:
-
Leistungsorientierung: Die Leistungserwartungen sind schon konkreter. So werden von den Leistungsträgern beispielsweise Vermittlungsergebnisse von einer Vermittlung pro Monat und (Vollzeit)-Vermittler oder ein prozentualer Anteil (z. B. 30% oder 70% bei BildungsträgerInnen) an positiven Vermittlungsergebnissen erwartet. Bei einzelnen Maßnahmen des IFD (z. B. Erstellung von Fachdienstlichen Stellungnahmen) werden Kennzahlen relevant, die zeitliche Aspekte (14-Tage-Frist) oder inhaltliche Vorgaben definieren. Im Bereich der Kosten wird teilweise der %-Anteil der Refinanzierung mit Kennzahlen belegt.
-
Strukturorientierung: Die Kennzahlen mit Strukturorientierung sind beispielsweise: ein IFD pro Agenturbezirk oder 30 Fälle pro (Vollzeit-)MitarbeiterInnen und Monat.
Im Kapitel Prozessqualität - dem Hauptteil des Hauses - werden die wesentlichen Aufgabenbereiche des Integrationsfachdienstes in drei Kernprozessen (3 Säulen) behandelt:
-
Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt
-
Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen
-
Einzelfallunabhängige betriebliche Beratung (in diesem Text ausgeklammert)
Integraler Bestandteil der Kernprozesse zur Vermittlung und Sicherung ist die Matrix der Maßnahmen und Tätigkeitsfelder, die aus den Bestimmungen des § 110 SGB IX abgeleitet worden ist. Die Kompetenz des Beraters zeichnet sich dadurch aus, dass der Berater sich bewusst macht, in welchem Tätigkeitsfeld er sich zur Zeit im jeweiligen Fall bewegt, und welche Maßnahmen erforderlich sind und/oder den größten Erfolg zur Zielerreichung versprechen. Dieses Zusammenspiel von Tätigkeitsfeldern und Maßnahmen ist in der Matrix dargestellt. Die gekennzeichneten Maßnahmen in einem Tätigkeitsfeld stellen eine Auswahl dar und müssen somit nicht zwingend bei jedem Fall komplett durchgeführt werden!

Die Qualitätsvorgaben zu den einzelnen Maßnahmen und Tätigkeitsfeldern sind in den meisten Fällen (auch) in Form von Prozessketten mit den möglichen und notwendigen Handlungsschritten niedergelegt. Die Prozessbeschreibungen enthalten, in modellhafter Form, alle für den Ablauf wesentlichen Elemente - d. h. Tätigkeitsfelder, Maßnahmenoptionen (die erkannt und realisiert werden sollten), Entscheidungsstellen (an denen auch Soll-Ist-Vergleiche erforderlich sind), Schnittstellen zu anderen Systemen (die oft regulierungsbedürftig sind), die Nennung von Verantwortlichen und Beteiligten sowie auch Führungsvorgaben und Dokumentationserfordernisse.
Bei der Orientierung an diesen modellhaften Darstellungen wird das Handeln des Beraters nachvollziehbar, Fehlerquellen sind leichter zu ermitteln. Qualitätssicherung heißt in diesem Zusammenhang, dass während des Prozessablaufes die Handlungsschritte und Ergebnisse reflektiert und gegebenenfalls korrigiert werden können. Ständige Prüfung der eigenen Arbeit, auch unter Einbezug der Beteiligten, ist Voraussetzung für das Erreichen eines gewollten Resultates. Die Prozessbeschreibungen formulieren damit qualitative Ansprüche an die Arbeit der FachdienstmitarbeiterInnen. In QM-Begrifflichkeit ausgedrückt bedeutet das: Die Prozessqualität determiniert die Ergebnisqualität.
Als Beispiel hier die Prozesskette (in zwei Teilen) zum Vermittlungsprozess:
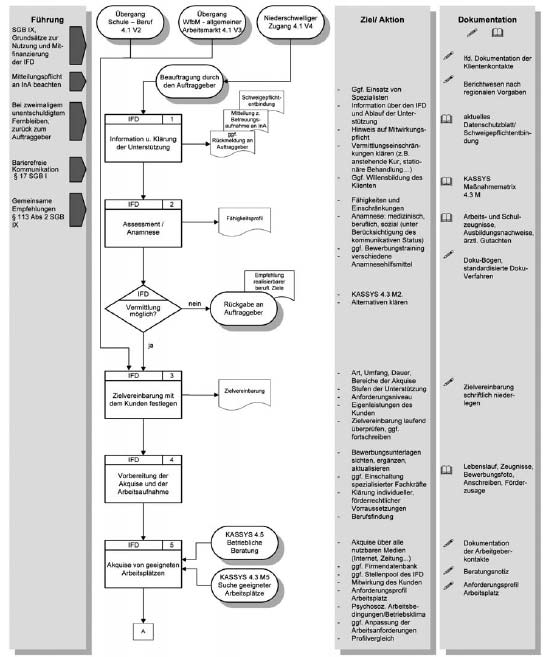

Die vorgelagerten Prozesse zu Beginn (4.1 V2, V3 und V4) weisen eigene Prozessketten auf ebenso wie andere in den Vermittlungsprozess einfließende Prozesse wie z. B. die "Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz" (4.3 M5).
Das Kapitel Ergebnisqualität gibt Vorgaben zum Abgleich von Zielvereinbarungen und Ergebnissen sowie von KundInnenerwartungen und der KundInnenzufriedenheit (Soll-Ist-Vergleich).
Seit Jahren werden für die Jahresberichte der BIH Ergebnis-Kennzahlen aus den (mit KLIFD) erfassten Daten der IFD generiert und veröffentlicht, seit 2005 auch in Form einer Zusammenstellung von Eckdaten für die Bundesregierung. Die Eckdaten umfassen inzwischen die folgenden Kategorien:
-
Anzahl der IFD
-
Personalausstattung mit Stellen, Personen, Schwerbehinderten und nach Geschlecht
-
Kosten, gesamt und pro Leistungsträgergruppe
-
Fallzahlen mit Beginnstatus (Arbeitslose, Schüler usw.), geschlechtsdifferenziert nach Behinderungsart und Nachweis der Behinderung, Fälle pro Fachkraftstelle, Fälle differenziert nach Auftraggeber und einleitender Stelle
-
Vermittlungen in den Arbeitsmarkt: insgesamt und bezogen auf die abgeschlossenen Fälle eines Berichtsjahres, pro Fachkraftstelle, Anteil an SchülerInnen/WfbM-Wechslern, nicht Vermittelte nach Ursachen
-
Fallzahl gesicherter Arbeitsplätze bei abgeschlossenen Fällen, nicht gesicherte nach Gründen
-
Fachdienstliche Stellungnahmen für AuftraggeberInnen
-
Einzelfall übergreifende betriebliche Beratungen
Weiter wird zur Ergebnisbeurteilung innerhalb von QM-Systemen i.d.R. das Instrument "Audit" genutzt. Damit ist ein transparenter Nachweis über Effektivität und Effizienz der Dienstleistung sowohl intern als auch extern möglich. Mithilfe solcher "Auditverfahren" sollen die Arbeitsprozesse, -strukturen und -ergebnisse, aber auch die Qualitätsinstrumente regelmäßig überprüft und im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs kontinuierlich weiterentwickelt werden. KASSYS definiert in Abschnitt 5.3.1 Verfahrensvorgaben zum Audit, Durchführungshinweise sowie Leitfragen.
Das Kapitel Strukturqualität (Fundament des Hauses) beschreibt die Voraussetzungen und Ressourcen, die für die qualitätsvolle Aufgabendurchführung vorhanden sein müssen. Dabei umfassen die Strukturverantwortung des Integrationsamtes und die Qualitätsverantwortung des IFD-Trägers die Einrichtung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung in ausreichender Qualität. Dies beinhaltet vor allem die Verantwortung für folgende Themen:
-
die Anforderungen an Träger und IFD-Struktur
-
die personelle Ausstattung und Qualifizierung
-
die sächliche Ausstattung und Barrierefreiheit des IFD
-
die Erreichbarkeit und die Reaktionszeit
-
die Öffentlichkeitsarbeit
-
die Netzwerk- und Gremienarbeit
-
die Qualitätssicherung selbst
-
die Sicherstellung der Ergebnisdokumentation
-
die Weiterentwicklung des QM-Systems
KASSYS wird im Steuerungs- und Redaktionskreis (SRK) kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt. Auf der Internetseite www.kassys.org sind die Texte und Materialien im pdf-Format verfügbar. Die Seite soll ausgebaut werden zu einer web-Version von KASSYS mit interner Verlinkung, Download-Bereich und Austausch-Forum für die Integrationsfachdienste.
Inhaltsverzeichnis
Gert Klüppel
Die Integrationsfachdienste (IFD) in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) stehen auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches, Neuntes Buch (SGB IX), als Dienstleistungsangebot für schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie ihre Arbeitgeber zum Thema Arbeitsmarkt-Integration zur Verfügung. Der Leistungsträger LWL-Integrationsamt Westfalen hat neben der Fallverantwortung für eigene KlientInnen auch die Strukturverantwortung für die Einrichtung der IFD. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, hat das LWL-Integrationsamt ein Steuerungskonzept entwickelt, das direkten Einfluss auf die Arbeit der IFD nimmt. Diese "Regionale Koordination" wird im folgenden Text vorgestellt.
IFD werden auf Grundlage der §§ 109 bis 115 SGB IX beteiligt und mit der Aufgabe betraut, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung von schwerbehinderten und von Behinderung bedrohten Menschen zu unterstützen. Die AuftraggeberInnen - also auch das LWL-Integrationsamt - bleiben für die Aufgabe verantwortlich (§ 111 SGB IX). Sie haben Art, Umfang und Dauer des Einsatzes des IFD sowie das Entgelt festzulegen. Außerdem hat der Auftraggeber nach § 111 Abs. 4 SGB IX für die generelle Qualitätssicherung Sorge zu tragen. Aufgrund dieser gesetzlichen Basis gilt daher nicht das ansonsten in der Wohlfahrtspflege gewohnte Subsidiaritätsprinzip. Das LWL-Integrationsamt selbst muss sicherstellen, dass auch die Einzelfallhilfe effektiv und unter Berücksichtigung der Gesamtverantwortung gegenüber behinderten Menschen und Betrieben gewährt wird (Siehe dazu BEULE, 1990, S. 145-165).
Die Beauftragten orientieren sich an den Rahmenbedingungen des SGB IX, der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und an den durch das Integrationsamt definierten Standards (z.B. KASSYS).
-
Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) beteiligt werden, indem sie
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,
2. die ArbeitgeberInnen informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.
-
Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,
1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil ... zu erarbeiten,
1a. die Bundesagentur für Arbeit ... bei der Berufsorientierung und Berufsberatung in den Schulen ... zu unterstützen,
1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,
2. geeignete Arbeitsplätze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,
5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter ...über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,
6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
7. als AnsprechpartnerIn ... über die Leistungen für die ArbeitgeberInnen zu informieren und ... diese Leistungen abzuklären,
8. in Zusammenarbeit mit den RehabilitationsträgerInnen und den Integrationsämtern ...
Zu beachten ist, dass gegenüber den verschiedenartigen Kunden ein Neutralitätsgebot für den IFD besteht und keine anwaltliche Funktion wahrgenommen wird. Die IFD sind keine Interessenvertreter für eine Partei.
Die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der IFD haben im Lauf der Zeit zu einer Diversifizierung des Dienstleistungsangebotes geführt. Die IFD halten verschiedene Fachbereiche vor, um den unterschiedlichen AuftraggeberInnen und KundInnen gerecht zu werden. Infos im Internet: www.ifd-westfalen.de
Das LWL-Integrationsamt Westfalen (IntA) hat bereits in den 80er-Jahren mit dem Aufbau von Psychosozialer Begleitung und Integrationsfachdiensten (damals: Projekt Integration) begonnen. Es liegen also langjährige Erfahrungen mit den Fragestellungen von Integration und Sicherung vor.
-
seit 2000 flächendeckendes Angebot an Fachdiensten in den Kreisen und kreisfreien Städten gemeinsam für Bundesagentur für Arbeit und IntA
-
seit 2005 Strukturverantwortung des IntA für alle Fachbereiche des IFD
-
Kooperation mit mehreren Leistungsträgern der beruflichen Integration und Rehabilitation
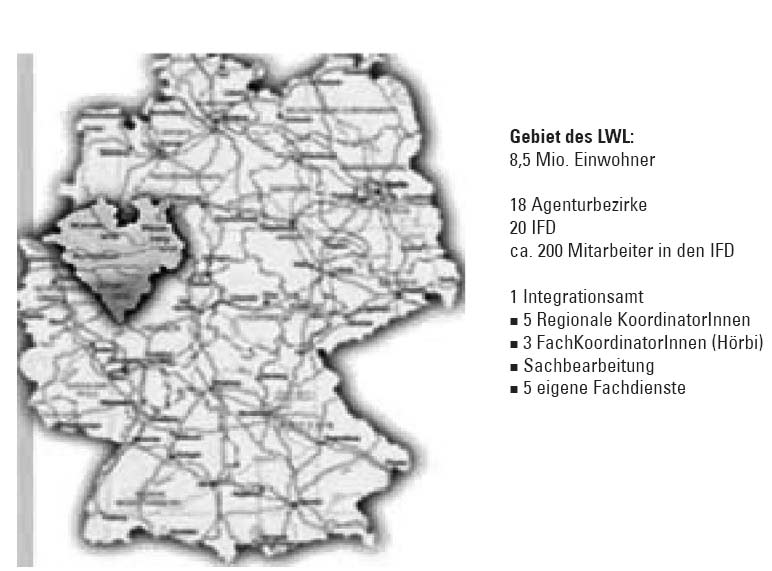
In der Regel arbeiten daher Integrationsamt und Träger der IFD seit vielen Jahren in gewachsenen Zusammenhängen erfolgreich im Interesse besonders betroffener schwerbehinderter Menschen zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen IntA und IFD kann nur in einem kooperativen Kontext erfolgen und sollte von einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts geprägt sein.
Zur Wahrnehmung seiner Fall- und Strukturverantwortung hat das LWL-Integrationsamt die Funktion der Regionalen Koordination bzw. Fachkoordination (für den Hörbehindertenbereich) eingeführt. Die IFD-Koordinatoren stellen die Schnittstelle zwischen dem LWL-Integrationsamt Westfalen und den TrägerInnen bzw. den einzelnen Teams dar.
Die IFD-Koordination seitens IntA erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Jahre hinweg fachliche Erfahrungen im Rahmen der begleitenden Hilfen nach dem SGB IX, der psychosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen sowie der örtlichen Netzwerkarbeit im Feld der beruflichen Integration und Sicherung gesammelt haben. Die Steuerungsfunktionen werden bereits seit Jahren durch die Fachdienste des IntA für psychisch und geistig Behinderte sowie für Hörbehinderte wahrgenommen. Sie sichern durch ihr Know-how die Bestimmung der passenden Unterstützungsleistungen nach den Gegebenheiten des Einzelfalles.
Wichtiges Forum der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Leitung des IFD ist der Koordinierungsausschuss. Die Einrichtung eines ständigen Begleitgremiums und Arbeitsausschusses macht deutlich, dass im Aufgabenbereich der beruflichen Eingliederung schwerbehinderter Menschen kein Partner autark operieren kann und Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten organisatorischen Einheiten besteht. Aufgaben und Themenfelder des Koordinierungsausschusses sind in den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) zu den Koordinierungsausschüssen beschrieben (BIH 2000).
Darüber hinaus besteht im bilateralen Verhältnis zwischen IFD-Koordination und IFDLeitung/Teamleitung Informations- und Verhandlungsbedarf u. a. bei folgenden Themen:
-
Verhandlung/Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungskapazitäten
-
Personalauswahl + -entwicklung
-
strukturelle Ausstattung des IFD
-
finanzielle Fragen
-
Berichtswesen/EDV
-
Öffentlichkeitsarbeit
Die Personalauswahl für den IFD erfolgt gemäß des Leistungsvertrages gemeinsam mit dem Integrationsamt. Der Träger des IFD vereinbart rechtzeitig mit der IFD-Koordination des IntA Vorgehensweisen zur Beteiligung bei der Auswahl und Einstellung einer neuen Integrationsfachkraft, die für das IntA oder andere LeistungsträgerInnen tätig werden soll.
Die Beteiligung des IntA trägt dazu bei, geeignetes Personal für die anspruchsvollen Aufgaben im IFD zu finden. Die Dienst- und Fachaufsicht des jeweiligen IFD-Trägers wird durch die Beteiligung der IFDKoordination nicht eingeschränkt.
Bei der Einschaltung des IFD durch das IntA handelt es sich nicht um eine Delegation, sondern um eine Beauftragung.
Eine Delegation kann definiert werden als Verlagerung von Befugnissen, Aufgaben inhaltlich zu gestalten, an nachgeordnete oder andere organisatorische Einheiten. Dabei ist der Delegationsgrad das Ausmaß, in dem Befugnisse übertragen sind. Delegation bedeutet auch, dass Kompetenzen übertragen werden und der Delegationsempfänger für die ihm übertragenen Aufgaben auch die entsprechende Verantwortung übernimmt (BLITZ u. a. 1998).
Bei den Aufgaben nach dem zweiten Teil des SGB IX wird jedoch das LWL-Integrationsamt als beauftragende Stelle nicht aus der Verantwortung entlassen, eine Verlagerung von Befugnissen ist nicht möglich. Es ist daher angemessener, von Partizipation oder Beauftragung zu sprechen. Das schließt nicht aus, dass ähnlich wie bei der Delegation der IFD einen eigenen Handlungsspielraum besitzt. Beauftragung meint weiterhin nicht nur eine reine Abgabe von Ausführungshandlungen. Der Beteiligungsumfang im Sinne des Delegationsgrades ist auch davon abhängig, wie der jeweilige IFD dazu befähigt ist, die übertragenen Aufgaben zu erledigen und Handlungsspielräume zu nutzen. Nicht unerhebliche Faktoren bei der Partizipation sind die vorliegende fachliche Qualifikation und Berufserfahrung der IFD-MitarbeiterInnen.
Da die KundInnen des IFD in den meisten Fällen im "niederschwelligen Zugang" (= direkter Kontakt ohne formelle Antragstellung) an den IFD herantreten, hat der IFD die Aufgabe, im Rahmen des Clearings die Zuständigkeit des jeweiligen Leistungsträgers zu prüfen und sein Ergebnis dem IntA mitzuteilen. Ist das LWL-Integrationsamt Westfalen als Leistungsträger identifiziert, erfolgt im Nachhinein eine Beauftragung durch die IFD-Koordination. Die Fallzuweisung erfolgt sowohl direkt zwischen dem Koordinator und derjenigen IFD-Fachkraft, die im Auftrag des IntA tätig wird, als auch generell über die Teamleitung des jeweiligen Dienstes.
Bei der Beteiligung des IFD im Rahmen der begleitenden Hilfen sieht die Beauftragung Zielvereinbarungen und ggf. Maßnahmen bezüglich des Falles vor, die in der Regel auch in unmittelbarem Kontakt erörtert werden. Oft ist auch eine Fallübergabe im Betrieb notwendig. Die Qualitätssicherung der laufenden Fallbearbeitung, der Berichterstattung, der fachdienstlichen Begutachtung sowie der Auswertung von Betreuungsergebnissen erfolgt in direktem, dialogischem Kontakt zwischen IFD-Fachkraft und KoordinatorIn des IntA, ggf. unter Einbezug weiterer Prozessbeteiligter und/oder Vorgesetzter. Dazu zählen Treffen zum Zwecke der Fallreflexion und des Erfahrungsaustausches. Der Koordinator des IntA kann an betrieblichen Kontakten im Rahmen der Fallbearbeitung teilnehmen und wird auch regelmäßig von den IFDMitarbeiterInnen unterstützend konsultiert.
Die Fachdienstlichen Stellungnahmen (= Gutachten für Leistungs- und Kündigungsverfahren des LWL-Integrationsamtes Westfalen) werden gesondert qualitätsgesichert. Sie werden nach Prüfung durch die IFD-Koordination (und eventueller Rückgabe zur Überarbeitung) für den Verwaltungsentscheid freigegeben. Das besondere Augenmerk liegt darauf, dass diese Gutachten gerichtsfest sein müssen.
Führungskräfte und Vorgesetzte der IFD-MitarbeiterInnen werden bei Einzelfällen immer dann eingebunden, wenn im Rahmen einer Fallbearbeitung allgemeine und grundsätzliche Aspekte angesprochen werden. Dies gilt auch für das Beschwerdemanagement.
Das IntA bietet regelmäßig Beratung und Fortbildung an. Das IntA hat gemäß des Leistungsvertrages die Möglichkeit, einzelne MitarbeiterInnen oder Gruppen direkt zu bestimmten und zu durch das IntA refinanzierten Veranstaltungen einzuladen. Fortbildungen und andere strukturierte Beratungsangebote dienen der Personalentwicklung sowie der Verbesserung der Handlungskompetenzen, um zielperspektivisch den Qualifizierungsgrad der IFD-MitarbeiterInnen zu erweitern. Für die langfristige Planung wurde ein Curriculum entwickelt. Alle durch das LWL-Integrationsamt Westfalen mitfinanzierten IFD-MitarbeiterInnen erhalten ein Supervisionsbudget, das für Fall- und Organisationssupervision nach eigener Wahl verwendet werden kann.
Die Umsetzung und Einhaltung der im IFD-Grundvertrag sowie gegebenenfalls der zusätzlich gemäß des bilateralen Leistungsvertrages vereinbarten Standards zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden regelmäßig durch die IFD-KoordinatorInnen des IntA betrachtet. Das IntA vereinbart zu diesem Zweck Audits mit den TrägervertreterInnen, an denen alle IFDMitarbeiterInnen teilnehmen.
Die Entwicklung von den ersten "Einzelkämpfern" in der psychosozialen Begleitung hin zu den differenzierten Teams der heutigen Integrationsfachdienste hat sich als großer Fortschritt erwiesen. Sowohl den KundInnen als auch den LeistungsträgerInnen steht ein abgestimmtes und einheitliches Dienstleistungsangebot durch die IFD zur Verfügung. Die einzelnen TrägerInnen arbeiten auf der gleichen Grundlage von Verträgen, Standards und QM-Methoden. Die Dienste sind regionalisiert und bilden untereinander keine Konkurrenz. Die Finanzierung durch das LWL-Integrationsamt Westfalen sichert die Struktur und fördert die Weiterentwicklung des einheitlichen Dienstleistungsangebotes.
Diese Effekte wären aus der Sicht des LWL-Integrationsamtes Westfalen ohne die direkte Kooperation und Steuerung nicht möglich gewesen. Das Integrationsamt sieht sich in der Strukturverantwortung und wird diese auch weiterhin wahrnehmen.
Inhaltsverzeichnis
Mag. Peter Milbradt
Der Grundstein für die Entwicklung des ee.Managementsystems wurde mit dem Forschungsbericht: "Behindert ist, wer behindert wird - Barrierefreiheit in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in der Steiermark, Graz 2003" gelegt: in dieser Arbeit wird aus den vorliegenden Forschungsergebnissen die Notwendigkeit von "verbindlichen Standards für Barrierefreiheit als Managementinstrument" abgeleitet.
Im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft "easy entrance" wurde diese Idee in einer cirka zwei Jahre dauernden, intensiven Entwicklungsarbeit professionell umgesetzt. Gefördert wurden diese Aktivitäten vom Europäischen Sozialfonds (esf) und dem Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK).
Experten und Expertinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Forschung und soziale Dienstleistungen haben im easy entrance Netzwerk zusammengearbeitet, um ein innovatives, objektives und vor allem ein schlankes Verfahren zum Managen von Barrierefreiheit anbieten zu können. Ergänzend zum Zertifizierungsverfahren wurden zur Vorbereitung darauf weitere Dienstleistungen entwickelt: ee.beratung.coaching unterstützt Betriebe bei der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen. Mit ee.fortbildung können sich Betriebe das entsprechende Know-how ins Haus holen.
Das Herz jedes Unternehmens sind motivierte MitarbeiterInnen, die ihr Wissen und Potenzial am richtigen Platz einbringen. Bereits 2010 werden ca. 53 % aller Arbeitnehmer/innen zwischen 40 und 64 Jahre alt sein. Junge Arbeitskräfte werden knapp.
Laut einer aktuellen Studie werden 65% der Behinderungen oder Erkrankungen im Laufe der Betriebszugehörigkeit erworben. Neben Unfällen zählen dazu auch stressbedingte (z. B.: Depressionen) und chronische Erkrankungen, die in allen Branchen stetig zunehmen. Abgesehen von sozialen Gründen wird es aufgrund mangelnder Arbeitskräfte immer wichtiger, diese MitarbeiterInnen längerfristig an den Betrieb zu binden und mit passenden Arbeitsplätzen die Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Ältere MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen mit Behinderung werden also zunehmend zur wichtigen Personalressource in Österreich. Die Bereitschaft von Betrieben, gezielt Maßnahmen für die Verbesserung der Einsetzbarkeit ihrer Belegschaft zu setzen wird immer größer. Sehr oft wissen Betriebe aber nicht, wo am Besten damit anzufangen wäre.
Genau da setzt easy entrance an: Mit einheitlichen und allgemein anerkannten Richtlinien und Standards für zugängliche Arbeitsplätze für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung. geben wir Unternehmen ein Werkzeug in die Hand, um gezielt menschengerecht gestaltete Arbeitsstrukturen (weiter)entwickeln zu können. Damit können Betriebe und Organisationen ihr MitarbeiterInnenpotential optimal ausschöpfen. Gleichzeitig eröffnet sich damit ein besserer Zugang zur wachsenden KundInnengruppe der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderungen.
Barriereabbau kommt auch anderen Gruppen zugute!
Beispielsweise Mütter und Väter mit Kleinkindern und KundInnen oder MitarbeiterInnen, die kurzfristig - z. B. nach einem Sportunfall - mobilitätsbehindert sind. Für geschätzte 10% der Bevölkerung ist barrierefreie Zugänglichkeit zur Bewältigung des alltäglichen Lebens unbedingt notwendig. Zählen wir Kinder von 0-5 Jahren, deren Betreuungspersonen, schwangere Frauen und durch Verletzung oder Erkrankung behinderte Personen hinzu, kommen wir auf einen Bevölkerungsanteil von rund 40%, für den eine barrierefreie Zugänglichkeit eine notwendige Erleichterung darstellt.
Dies trifft besonders auf KundInnenräume zu!
Und nicht zu vergessen: 100% der Bevölkerung profitieren von Maßnahmen zur barrierefreien Zugänglichkeit. Häufig können kleine Sofortmaßnahmen, die nur geringe Kosten verursachen, bereits eine deutliche Verbesserung der Zugänglichkeit bewirken (Quick-Wins).
Nachweislich mehr Leistung, Motivation, Zufriedenheit und besseres Klima im Betrieb!
Zugänglichkeit und Barrierefreiheit verbessern das Betriebsklima. Wo die Interessen von Menschen mit Behinderungen oder von älteren Menschen zur Sprache kommen, dort nimmt das Verständnis für die Bedürfnisse aller MitarbeiterInnen zu. Die Arbeitsplätze werden attraktiver, die Zufriedenheit wächst. Damit steigern Sie die Leistungsbereitschaft aller MitarbeiterInnen.
Einhaltung gesetzlicher Richtlinien
Das Wissen um notwendige gesetzliche Regelungen ermöglicht, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
Auszeichnung für den jeweiligen Betrieb
Mit der Auszeichnung können Betriebe ihr hohes Entwicklungsniveau kommunizieren und im Wettbewerb nutzen.
Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Zertifizierungsbereiche überblicksmäßig beschrieben. Details siehe unter: http://www.easyentrance.at/files/easyentrance/592_A_03_Checkliste-v01-2008.pdf
In diesem Bereich wird geprüft, ob es eine dokumentierte Firmenpolitik und -strategie zum Thema gibt und ob diese unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der MitarbeiterInnen entwickelt, von der Unternehmensleitung freigegeben, regelmäßig überprüft und bei Bedarf auch aktualisiert wird.
Wie Führungskräfte aller Ebenen für den langfristigen Erfolg erforderliche Werte erarbeiten, diese durch entsprechende Maßnahmen und Verhaltensweisen umsetzen sowie durch persönliches Mitwirken einführen und weiterentwickeln.
Wie eine Organisation sich strukturiert und ihre Prozesse gestaltet, managt und verbessert, um ihre Politik und Strategie zu unterstützen und alle Interessensgruppen zufriedenzustellen
Hier geht es um Umfang, Qualität und Stabilität sozialer Beziehungen innerhalb des Arbeitsteams und der Gesamtorganisation.
Für jede Funktion liegt eine Beschreibung der Anforderungen und Mindestqualifikationen vor. Die Arbeitsgestaltung und die Ausstattung des Arbeitsplatzes sowie der Arbeitsmittel werden unter arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und ergonomischen Aspekten den jeweiligen Bedürfnissen der MitarbeiterInnen angepasst. Auch das Wohlbefinden als sogenannter "Soft Faktor" ("Weicher Erfolgsfaktor") ist dabei inkludiert: die subjektiv wahrgenommene Befindlichkeit der MitarbeiterInnen.
Wie die Organisation das Wissen und das gesamte Potenzial ihrer MitarbeiterInnen auf individueller, teamorientierter und organisationsweiter Ebene managt, entwickelt und freisetzt und wie sie diese Aktivitäten plant, um ihre Politik und Strategie zu unterstützen und Visionen zu verwirklichen.
Unterstützungsangebote umfassen Unterstützungsleistungen innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zur bedarfsgerechten Förderung der Mitarbeitenden und zur Lösung von Aufgaben und Problemfeldern.
Allgemeines
Im Folgenden wird das Verfahren zur Zertifizierung eines easy entrance Managementsystems beschrieben, d. h. Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Arbeitsplätzen für ältere MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen mit Behinderung, kurz ee-Managementsystem genannt.
Die Grundlage der Zertifizierung von ee.Managementsystemen bildet die ee.Checkliste.
Die Dokumente und die Checkliste sind grundsätzlich nur gemeinsam anzuwenden. Die Verantwortung für Änderung und Weiterentwicklung der Management System Dokumente und des Verfahrens obliegt ausschließlich der BAN GmbH-easy entrance. Ein Unternehmen, das gemäß dieses Verfahrens zertifiziert wurde, erhält für sein ee.Managementsystem ein Zertifikat und ist berechtigt, das ee.Logo zu führen. Die Erteilung des ee.Zertifikats befreit das Unternehmen nicht von seinen gesetzlichen und sozialen Verpflichtungen.
Das Verfahren der Zertifizierung läuft wie folgt ab:
Ein Unternehmen, das sich zertifizieren lassen möchte, wendet sich an eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft und ersucht um Bewertung nach dem Regelwerk easy entrance. Nachdem der Zertifizierer alle relevanten Unternehmensangaben erhalten hat, unterbreitet er dem Antragsteller ein Angebot.
Nach Annahme des Angebotes übersendet das zu zertifizierende Unternehmen alle zur Beantwortung der Mindestfragen relevanten Unterlagen, die dem Auditor/der Auditorin einen Einblick in das ee.Management gewähren, d. h. es muss eine entsprechende und angemessene Dokumentation vorhanden sein. Nach Durchsicht der Unterlagen kann die Bewertung bzw. Auditierung erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Unternehmen wird ein Audit-Zeitplan erarbeitet, in dem aufgeführt ist, welche Bereiche der Unternehmensorganisation auditiert werden. Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien der ee.Checkliste.
Nach der erfolgreichen Auditierung erteilt der Zertifizierer ein Zertifikat.
Während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats (drei Jahre) muss sich der Zertifizierer einmal jährlich von der Systemaufrechterhaltung und Systemweiterführung überzeugen. Hierfür führt er Überwachungsaudits durch. Diese periodischen Audits basieren wiederum auf einem Audit-Zeitplan, der vom Auditor erstellt wurde. Bei den Audits muss sichergestellt werden, dass alle für das ee-Managementsystem relevanten Bereiche mindestens einmal während der Dreijahresperiode ausgewertet werden.
Vor Ablauf der Gültigkeit des Zertifikates kann das Unternehmen eine Zertifikatsverlängerung beantragen. In diesem Fall hat der Zertifizierer in einem Erneuerungsaudit die komplette Bewertung durchzuführen.
Missbrauch, Entzug oder Annullierung
Der Zertifizierer hat das Recht, das ee.Zertifikat zu jeder Zeit während der dreijährigen Gültigkeitsdauer vorläufig außer Kraft zu setzen, einzuziehen oder für nichtig zu erklären, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Das Zertifikat kann vorläufig außer Kraft gesetzt werden, wenn das Unternehmen die korrigierenden Maßnahmen (nicht ausreichende Erfüllung der Mindestfragen) während der festgesetzten Frist (von maximal drei Monaten) nicht durchgeführt, oder falls sich herausstellt, dass das ee.Logo oder das Logo des Zertifizierers missbraucht wird. Bei Beschwerden findet das Beschwerdeverfahren des Zertifizierers Anwendung.
Audit
Zweck und Anwendungsbereich
Für unparteiische, dritte Stellen, die auf der Basis der ee.Checkliste auditieren und zertifizieren, gelten die allgemeinen Anforderungen der
ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021:2007 01 01
i. V. m. diesem und anderen einschlägigen Dokumenten des ee.Regelwerks
i. V. m. der ÖNORM ISO 19011 in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Berücksichtigung einiger Ausschlüsse und Erläuterungen, die im Folgenden mit Begründung aufgeführt werden. Durch Einhaltung der zutreffenden Anforderungen können Zertifizierungsstellen als kompetent und zuverlässig für die Zertifizierung von ee.Managementsystemen auf der Basis der ee.Checkliste und auf nationaler oder europäischer Ebene anerkannt werden.
ee.Audit
Eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob
-
die Tätigkeiten unter Einhaltung der ee-Anforderungen durchgeführt,
-
die damit zusammenhängenden Ergebnisse den Anforderungen der ee-Checkliste entsprechen und
-
diese Tätigkeiten wirkungsvoll seit mindestens 3 Monaten verwirklicht und geeignet sind, die Ziele zu erreichen.
Voraudit
Das Voraudit dient der Vorbereitung des Zertifizierungsaudits. Da das Voraudit kein fester Bestandteil des Zertifizierungsverfahrens ist, wird es nur auf Wunsch des Auftraggebers angeboten. Das Voraudit wird in der Regel von einem ee-Auditor durchgeführt.
Zertifizierungsaudit
Es stellt das erste Audit mit dem Ziel dar, das ee-Zertifikat zu erlangen.
Nachaudit
Wenn die Zertifizierungsbedingungen nicht ausreichend erfüllt werden, entscheidet der Zertifizierer, ob ein Nachaudit erforderlich ist. Es dient der Überprüfung der Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung von Abweichungen, die im Rahmen eines Audits festgestellt wurden. Das Nachaudit muss in einem festgelegten zeitlichen Rahmen erfolgen (im Regelfall ein bis drei Monate nach der letzten Bewertung). Es ist nur ein Nachaudit zulässig. Nachaudits werden in der Regel von einem ee-Auditor durchgeführt, der am letzten Audit beteiligt war. Der Gesamtbericht wird nach Auditabschluss erstellt und schließt die Feststellung und Behebung der Abweichungen mit ein.
Überwachungsaudit
Es dient zur periodischen Überwachung des ee-Systems.
Erneuerungsaudit
Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zertifikats von 3 Jahren wird auf Antrag des Zertifikatinhabers ein Wiederholungsaudit durchgeführt. Ziel ist die Erneuerung des Zertifikats und der Gültigkeit für weitere 3 Jahre.
Auditbericht
Die Bewertung wird mit einem Bericht abgeschlossen. Dieser Bericht stellt das Gesamtergebnis der Bewertung dar und zeigt die Stärken und Potenziale für die Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen auf.
Zertifikat
Nach erfolgter Bewertung durch den Auditor/leitenden ee-Auditor und Prüfung des korrekten Audit-Ablaufs durch die Zertifizierungsstelle erhält das Unternehmen nach Abgleich der Vorgaben ein Zertifikat. Neben der Angabe des Geltungsbereiches (Organisationseinheit/Tätigkeitsbereich) werden im Zertifikat die Logos "easy entrance", jenes des Zertifizierers und auf Wunsch auch das Logo des zertifizierten Unternehmens angeführt. Das Zertifikat kann auf spezielle Anordnung des zertifizierten Unternehmens in allen Sprachen ausgestellt werden.
Bewertung
Mindestkriterien: Die mit einem "*" in der ee.Checkliste gekennzeichneten Mindestkriterien müssen für eine Zertifikatsausstellung zu 100 % erfüllt sein.
Punktefragen: Von allen weiteren in der ee.Checkliste aufgeführten Punktefragen müssen für eine Zertifikatsausstellung mindestens 50% der möglichen Punkteanzahl erreicht werden. Die Fragen werden nur mit JA oder Nein bewertet. Eine Punkteteilung ist nicht zulässig. Abweichung/Nichtkonformität: Eine Abweichung/Nichtkonformität zum Regelwerk liegt dann vor, wenn
1) die Fragen eines ee-Mindestkriteriums nicht nachweislich erfüllt werden
2) weniger als 50% der möglichen Punktefragen erreicht werden.
Die Anforderungen gelten für ee.AuditorInnen, die im Rahmen von ee.Audits eingesetzt werden. Allerdings dürfen in ee.Verfahren nur Auditoren zum Einsatz kommen, die AuditorInnen-Qualifikation gemäß ÖNORM EN ISO 19011 in der jeweils aktuellen Fassung haben und Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der barrierefreien Zugänglichkeit nachweisen können, oder sich in die Besonderheiten der Thematik auf andere Art und Weise eingearbeitet haben.
Der Auditumfang richtet sich danach,
-
wie viele MitarbeiterInnen im Zertifizierungsumfang enthalten sind;
-
ob es sich um ein Vor-, ein Zertifizierungs-, ein Überwachungs-, ein Wiederholungs- oder um ein Nachaudit handelt;
-
wie viele Niederlassungen im Zertifizierungsumfang enthalten sind;
Die Anzahl von Auditstunden entspricht den derzeitigen Empfehlungen des BMWA Leitfadens L08 und ist bestimmt durch eine vorgeschriebene Auditmindestdauer pro Organisationsgröße. Wesentliche Unter- und Überschreitungen der Auditmindestdauer sind vom Zertifizierer entsprechend schriftlich zu begründen.
Die Basisdaten des Unternehmens sollten grundsätzlich in direkter Absprache mit der auditierten Organisation ermittelt und vor jedem Audit aktualisiert werden, um ev. Missverständnissen vorzubeugen.
Detaillierte Informationen und die vollständige Checkliste finden Sie unter
http://www.easyentrance.at/src/web/easyentrance/front/index.php?i_ca_id=210
Inhaltsverzeichnis
Karin Rossi, Max Stimpfl
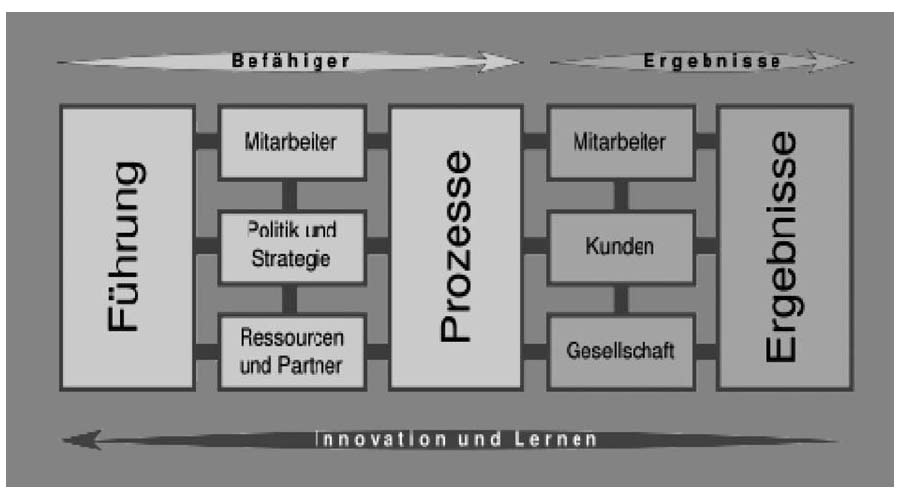
EFQM unterscheidet 9 Kriterien, die für die Qualität einer Organisation ausschlaggebend sind:
-
Kriterium 1: Führung der Organisation/des Unternehmens
-
Kriterium 2: Politik und Strategie
-
Kriterium 3: MitarbeiterInnenführung
-
Kriterium 4: Ressourcen
-
Kriterium 5: Prozesse
-
Kriterium 6: KundInnenergebnisse
-
Kriterium 7: MitarbeiterInnenergebnisse
-
Kriterium 8: Wirkung auf die Gesellschaft
-
Kriterium 9: Geschäftsergebnisse
-
Die Kriterien 1 bis 5 sind "Befähigerkriterien", d.h. je "besser" sie gestaltet werden, desto höher ist die Qualität. Diese ist messbar/überprüfbar anhand der Kriterien 6 bis 9, der "Ergebniskriterien". An ihnen wird sichtbar, welche Aktivitäten aus den Kriterien 1 bis 5 welche Wirkungen gezeigt haben.
-
EFQM unterteilt weiters jedes Kriterium in fünf bis neun Subkriterien, die unterschiedliche Gesichtspunkte eines Kriteriums zeigen.
-
So wird beispielsweise Kriterium 3, MitarbeiterInnenführung, unterschieden in: Auswahl neuer MitarbeiterInnen, ständige Verbesserung der Leistung der MitarbeiterInnen, Personalentwicklung, Arbeit mit Zielen, Belohnung von Leistung, Beteiligung der MitarbeiterInnen an der ständigen Verbesserung, optimale Arbeit durch Sicherheit, Gesundheit und richtige Auslastung.
-
QAP setzt hier an und liefert für jedes Subkriterium mindestens eine Spezifikation. Dies ist ein Text, der die Praxis dieses Subkriteriums in fünf Reifestadien beschreibt. Weiters liefert QAP ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Organisation auf Basis der Spezifikationen einen Prozess der permanenten Selbstüberprüfung und Verbesserung durchführen kann. Die entsprechenden Regeln, Abläufe, Rollen und Verantwortlichkeiten werden im à QAP - Reglement der anwendenden Organisation festgelegt.
-
Modell: QAP Fünfstufenmodell
-
Nutzen der Anwendung des Modells
-
Entwicklung von Maßnahmen im Sinne der KundInnen
-
Benchmarking: Wissenstransfer, Lernen von den anderen
-
MitarbeiterInnenbeteiligung und Förderung von MitarbeiterInnenzufriedenheit
-
Erarbeitung des Einstufungssystems nach BEST PRACTICE Ansatz
-
Festlegung des Themas/Indikators
-
Um was geht es? Beschreibung des Themas in max. 3-4 Sätzen
-
Definition von Wirkungszielen: Welche Wirkungen wollen wir erreichen und wie werden diese überprüft?
Best Practice Ansatz beschreiben:
Was sind die besten Handlungen? Wie machen wir das? Formulierung des Best Practice Ansatzes in Handlungssätzen: z. B. MitarbeiterInnenaufnahmen werden langfristig geplant. Das Instrument wird kontinuierlich und systematisch weiterentwickelt.
Präambel
-
Die vorliegenden sieben Spezifikationen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Arbeitsassistenzdiensten wurden in Zusammenarbeit der Träger PSZ GmBH - Institut zur beruflichen Integration, Caritas St. Pölten und Caritas Wien entwickelt.
-
Diese 3 Trägerorganisationen bedienen sich für ihre Qualitätssicherung und -entwicklung des Qualitätssystems QAP - einer Branchenversion des Europäischen (Qualitäts-)Management-Modells (EFQM). Das System basiert auf Lernprozessen innerhalb von Organisationen, welche durch systematische Selbst-Evaluation eingeleitet und aufrechterhalten werden.
Der Evaluations- und Entwicklungsprozess
-
Der Prozess beginnt mit der Selbst-Evaluation durch die MitarbeiterInnen einer Organisation oder Organisationseinheit. Das Q-System stellt die Instrumente und Hilfsmittel dafür zur Verfügung. Diese Instrumente wurden nun im Rahmen eines Projekts erweitert: Fachleute für Arbeitsassistenz und Fachleute für Qualitätsentwicklung der drei Träger-Organisationen, unterstützt von der ForscherGruppe EVALuation in Dornbirn (ehem. Frey Akademie), haben sogenannte "Fachspezifikationen" für den Arbeitsbereich Arbeitsassistenz entwickelt. Diese zeigen in einer Stufenfolge, was normale, was gute, was sehr gute und was beste Arbeit in bestimmten Kernthemen bedeuten würde.
-
Die Ergebnisse der Selbst-Evaluation werden innerhalb von Teams oder Organisationseinheiten nach einer lern- und entwicklungsorientierten Systematik verarbeitet. Dabei bringen die Beteiligten die persönlichen Perspektiven und Einschätzungen ein. Analysen über die Ursachen werden gemacht und mögliche Verbesserungsmaßnahmen entwickelt. Diese Arbeit mit dem Instrumentarium ist für die Teilnehmenden Orientierung und fachliche Fortbildung zugleich. Das innerhalb von Organisationen oder Teams vorhandene Wissen wird systematisch identifiziert und genutzt.
-
Mit der anschließenden Überleitung des Gelernten in das tägliche Tun können dann positive Wirkungen auf Produktivität und Leistung gezielt verfolgt werden.
Die Fachspezifikationen Arbeitsassistenz
Die Auswahl der Themen der neuen Fachspezifikation lehnt sich eng an die von den PraktikerInnen eingebrachten und in der Literatur beschriebenen kritischen Erfolgsfaktoren für Arbeitsassistenzdienste an, nämlich:
-
Aufnahmeverfahren: Wie gestaltet der Dienst sein Aufnahmeverfahren so, dass be-reits hier der Grundstein für eine bestmögliche Prozessbegleitung der KlientInnen gegeben ist?
-
Akquise: Wie informiert der Dienst potenzielle ArbeitgeberInnen, um auf diesem Weg eine klare Leistungsbeschreibung der Möglichkeiten des Dienstes an die Unternehmen zu bringen und wie managt der Dienst seine Unternehmenskontakte so, dass er rasch auf für die KundInnen passende Arbeitsplatzangebote zugreifen kann?
-
Arbeitsplatzerlangung: Wie gestaltet der Dienst den Prozess der Arbeitsplatzerlangung so, dass ein optimales Matching zwischen Arbeitssuchenden und Unternehmen möglich wird?
-
Arbeitsplatzsicherung: Wie gestaltet der Dienst den Prozess der Arbeitsplatzsicherung, damit eine für ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn bestmögliche Lösung der Problematik erreicht wird?
-
Dokumentation: Wie dokumentiert der Dienst seine Tätigkeit, damit aus dieser Dokumentation sowohl ein Leistungsnachweis als auch Kennzahlen und Rückschlüsse für eine Weiterentwicklung hervorgehen?
-
Beschwerden: Wie geht der Dienst mit Beschwerden um, damit diese zur Verbesserung des Angebotes herangezogen werden können?
-
Öffentlichkeitsarbeit: Wie werden vom Dienst Öffentlichkeitsarbeit geleistet und auf diesem Wege sowohl Unternehmen und Öffentlichkeit für die Anliegen der Integration von Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt geschieht sensibilisiert, als auch neue Erkenntnisse gut an die Öffentlichkeit herangetragen?
Voneinander Lernen und Benchmarking
-
Durch die Verfügbarkeit dieser Fach-Spezifikationen und deren Einsatz mit einem sozialwissenschaftlich hoch zuverlässigen (Selbst-)Evaluations-Verfahren (die Übereinstimmung interner und externer Einschätzung der tatsächlichen Leistung einer Organisation ist außerordentlich hoch, d. h. der Korrelationskoeffizient ,r' liegt bei 0,9) eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die Dienste für Arbeitsassistenz können damit
-
die "Bestpractice" für die oben beschriebenen Themenbereiche kennen lernen,
-
die eigene Arbeit im Lichte dieser Bestpractice betrachten und
-
sie können sich selbst mit anderen Diensten - im Rahmen eines anonymen Benchmarkings - vergleichen und daraus interessante Erkenntnisse ableiten.
-
Die Fach-Spezifikationen sollen aber auch auf überbetrieblicher Ebene dazu beitragen, die Diskussion über gute Qualität im Bereich der Arbeitsassistenz voranzutreiben.
-
In diesem Sinne wünschen die EntwicklerInnen der Spezifikationen allen AnwenderInnen spannende Gespräche über die Qualität in der Einrichtung, interessante Ergebnisse des Benchmarkings und gute Ansätze zur Weiterentwicklung der Dienste.
Projekt-Team:
-
Max Martin Gebetsberger, Leitung Arbeitsassistenz, Caritas St. Pölten
-
Martin Kargl, Organisations- und Personalentwicklung und QAP-Prozessbegleiter, Caritas St. Pölten
-
Otto Lambauer, Grundlagenarbeit Behinderteneinrichtungen und QAP-Prozessbegleiter, Caritas Wien
-
Roland Mangold, Leiter der ForscherGruppe EVALuation/Dornbirn
-
Karin Rossi, Leitung Arbeitsassistenz ibi, PSZ GmbH
-
Josef Schönhofer, Leitung Arbeitsassistenz, Caritas Wien
-
Max Stimpfl, Assistent der Geschäftsführung und QAP-Prozessbegleiter, PSZ GmbH
Inhaltsverzeichnis
Daniela Spindler, Otto Lambauer
Zielsetzung
Im Rahmen des Workshops wurde die Zusammenarbeit zwischen Staat und Non-Profit-Organisationen (NPOs) im Bereich der sozialen Dienstleistungen näher betrachtet. Im Fokus der Betrachtung stand das Modell des Kontraktmanagements.
Ausgangslage
Die derzeit in Österreich vorherrschende Form der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Verwaltungseinheiten und Non-Profit-Organisationen ist die Subvention bzw. der Fördervertrag. Diese Form der Zusammenarbeit sichert die Finanzierung und somit die Durchführung von sozialen Maßnahmen durch den sogenannten "Dritten Sektor". NPOs übernehmen in diesem Fall staatliche Aufgaben, der Staat selbst stellt im Rahmen seiner Gewährleistungsverantwortung die Finanzierung sicher. Beim Konzept des Fördervertrages verpflichtet sich eine öffentliche Verwaltungseinheit Aufwendungen, die bei der Erbringung einer bestimmten Leistung anfallen, zu ersetzen. Durch diese Konzeption der Subvention müssen alle Aufwendungen, die innerhalb einer Leistungsperiode entstehen, genau aufgelistet und nachgewiesen werden, was mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden ist.
Grundlagen der Prinzipal-Agent Theorie
Die Prinzipal-Agent Theorie befasst sich mit Vertragsbeziehungen zwischen Prinzipal und Agent
und kann auf beliebige Bereiche der Wirtschaft übertragen werden. Es kann sich auch um
Beziehungen zwischen der öffentlichen Hand und einer NPO handeln. Als Einführung in die
Prinzipal-Agent Theorie sei hier zunächst eine Begriffsdefinition vorangestellt.
Die Akteure
Unter dem Prinzipal wird der Auftraggeber verstanden, der Auftragnehmer wird als Agent bezeichnet. Der Prinzipal und der Agent schließen gemeinsam einen Vertrag ab, der den Agenten mit der Durchführung einer Aufgabe betraut und auch die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit der beiden Parteien regelt.
Der Vertrag
Bei klassischen Verträgen werden Leistungen und Rechte sowie Pflichten der einzelnen Vertragspartner klar festgelegt und müssen auch von Dritten nachvollziehbar sein. Der unterzeichnete Vertrag ist ein Abkommen zwischen den Parteien und dient dazu, alle möglichen Begebenheiten, die im Rahmen der Ausführung der vereinbarten Aufgabe entstehen können, zu regeln. Aus dem Vertrag entsteht für den Agenten die Verpflichtung, die vereinbarte Aufgabe für den Prinzipal auszuführen. Der Agent erhält im Gegenzug eine im Vertrag näher spezifizierte Art der Entlohnung. Eine wichtige Eigenschaft der vereinbarten Vertragsinhalte ist, dass diese verifizierbar und somit (z. B. von einem Gericht) überprüfbar und als rechtens nachzuweisen sein sollten.
Verhaltensannahmen
Zur genaueren Analyse von Agency-Beziehungen werden Annahmen zum individuellen Verhalten der einzelnen Akteure getroffen. Zunächst wird von einer Nutzenmaximierung ausgegangen. Diese besagt, dass alle Beteiligten auf Grundlage ihrer Präferenzen danach streben, ihren individuellen Nutzen zu maximieren. Die zweite Annahme besagt, dass Menschen rational handeln. Da Menschen keine Computer sind und Informationen nur begrenzt verarbeiten können, wird zumindest angenommen, dass Menschen versuchen, sich rational zu verhalten. Die dritte Annahme betrifft den Opportunismus. Das Verhalten von Menschen "... schließt opportunistische Praktiken und damit die Anwendung von List, Betrug und Täuschung mit ein, sodass Leistungszurückhaltung, trügerische Darstellung von Leistungen oder eigeninteressierte Vertragsauslegung [...] zum Verhaltensrepertoire gehören." (Ebers/Gotsch 2002: 211).
Die Darstellung dieser Verhaltensannahmen macht deutlich, dass jede Vertragsbeziehung von Unregelmäßigkeiten und Asymmetrien, begründet durch unterschiedliche Ziele und Interessen von Agent und Prinzipal, betroffen sein kann. Diese verschiedenen Arten von Asymmetrien bzw. Agenturproblemen und die daraus resultierenden Gefahren und Lösungsansätze können wie folgt eingeordnet werden.
Agenturprobleme
Wie bereits erwähnt, entstehen Agenturprobleme durch verschiedene Interessen und Informationsasymmetrien zwischen Prinzipal und Agent.
Wenn der Prinzipal von Eigenschaften des Agenten selbst oder von Eigenschaften in Zusammenhang mit der Leistung vor Vertragsabschluss nicht in Kenntnis gesetzt wurde, spricht man von "hidden characteristics". Der Prinzipal gerät in Gefahr, einen für seine Interessen ungeeigneten Agenten auszuwählen.
Im Fall von "hidden intention" gerät der Prinzipal in Abhängigkeit des Agenten, weil er vor Vertragsabschluss nicht umkehrbare Vorleistungen erbracht hat und deshalb auf die Erfüllung des Vertrages durch den Agenten angewiesen ist. Das Verhalten des Agenten kann zwar beobachtet und beurteilt, jedoch nicht unterbunden werden. Es besteht die Gefahr von "hold up", d. h. der Agent nutzt die Abhängigkeit des Prinzipals opportunistisch aus.
"Hidden action" liegt vor, wenn der Prinzipal keine Kenntnis über die Handlungen des Agenten hat und nur die Ergebnisse seiner Handlungen beurteilen kann. Es besteht eine Asymmetrie in der Informationsverteilung zwischen Prinzipal und Agent. Damit in Zusammenhang steht das Agenturproblem der "hidden information", die dann auftritt, wenn der Agent einen Informationsvorsprung gegenüber dem Prinzipal hat und diesen zur eigenen Interessensbefriedigung einsetzt. Die beiden letztgenannten Asymmetrien bergen beide die Gefahr von "moral hazard", des setzen einer moralisch verwerflichen Handlung, die der Prinzipal nicht beobachten kann, in sich.
Agenturkosten
Als "Agenturkosten" werden jene Kosten definiert, die sich aus der Differenz zwischen vollständiger Information beider Vertragspartner und einer Leistungserstellung bei ungleicher Informationsverteilung ergeben. Beispiele für Agenturkosten sind Überwachungs- und Kontrollkosten des Prinzipals, Garantieleistungskosten des Agenten und der Wohlfahrtsverlust, der sich aus der Differenz des Nutzenmaximums für den Prinzipal und der tatsächlichen Leistung des Agenten ergibt. Eine Gestaltungsform eines Vertrages gilt als vorteilhaft, wenn geringere Agenturkosten und somit eine höhere Effizienz entstehen als durch eine alternative Gestaltungsform. Als effizient kann ein Vertrag dann angesehen werden, wenn das Risiko und die Anreizgestaltung zwischen Prinzipal und Agent optimal verteilt sind.
Lösungsansätze
Zur Lösung der eben aufgezeigten Agenturprobleme wurden Mechanismen entwickelt, die auf eine Angleichung der Informations- und Interessensunterschiede zwischen Prinzipal und Agent abzielen. In der Literatur wird meist von einem Informationsvorsprung des Agenten ausgegangen, da er über mehr Wissen und Fähigkeiten zur Leistungserstellung verfügt, weswegen er auch als Vertragspartner ausgewählt wurde. Die Mechanismen zur Lösung von Agenturproblemen dienen letztendlich dem Schutz des Prinzipals, da seine Möglichkeiten zur Überwachung des Agenten begrenzt sind bzw. höhere Agenturkosten verursachen würden.
Anreizsysteme
Anreizsysteme sollen einer Interessensangleichung zwischen Prinzipal und Agent dienen und beteiligen den Agenten am Ertrag, den die von ihm erbrachte Leistung erzielt. Dies bewirkt, dass der Agent zu einer ertragsreicheren Leistung motiviert wird. Anreizsysteme gelten als geeignetes Element um "hidden information" und "hidden action" zu verhindern.
Kontroll- und Informationssysteme
Durch die Schaffung bzw. Verbesserung von Kontroll- und Informationssystemen kann der Prinzipal seine Kenntnisse über die Handlungen des Agenten während der Leistungserbringung bzw. über den Mitteleinsatz bei der Leistungserbringung erhöhen. Beispiele für Kontroll- und Informationssysteme stellen Elemente des Controllings, wie z. B. Kennzahlen, Nachweise über die Verwendung finanzieller Mittel oder auch Leistungsvergleiche dar.
Anwendung auf Beziehungen zwischen Staat und NPOs
NPOs sind nicht nur öffentlichen Verwaltungseinheiten als direkte Vertragspartner, sondern auch ihren KlientInnen gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet. In diesem Fall agieren NPOs als Agenten für mehrere Prinzipale gleichzeitig. Die Interessen dieser Gruppen können differieren und einander im Widerspruch stehen. Während für öffentliche Verwaltungseinheiten als Geldgeber Effizienz ein wichtiger Indikator für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt, legen KlientInnen von NPOs auf ein möglichst breites Leistungsspektrum wert. Die Messbarkeit des Ergebnisses von Dienstleistungen im Allgemeinen und sozialen Dienstleistungen im Speziellen stellt im Vergleich zu hergestellten Produkten ein Problem dar.
Leistungsvereinbarung versus Kontraktmanagement
Als "Kontraktmanagement" wird der gesamte Rahmen der Zusammenarbeit in Bezug auf genau definierte Leistungen zwischen Politik und Verwaltung, zwischen zwei öffentlichen Verwaltungseinheiten oder auch zwischen staatlichen Einheiten und Dritten (also POs oder NPOs) bezeichnet. Konkretisiert wird dieser Rahmen durch Globalbudgets und Leistungsvereinbarungen.
Das Globalbudget besteht aus einem Finanzplan, der die zur Verfügung stehenden Mittel festhält. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Budgets dahingehend, dass die einzelnen Etats nicht mit einer genauen Summe festgelegt sind, sondern nur ein globaler Gesamtbetrag, der alle Aufwendungen pauschal abdeckt, ausgewiesen wird. Diese Art der Budgetierung ermöglicht dem Leistungserbringer einen größeren Handlungsspielraum, verlangt jedoch auch eine genaue Festlegung von Indikatoren zur Ermittlung der Zielerreichung.
Durch Leistungsvereinbarungen sollen Ziele operationalisiert, die zu erbringenden Leistungen spezifiziert und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel festgelegt werden.
Gemäß Broder, der die Merkmale von Leistungsvereinbarungen speziell zwischen staatlichen Verwaltungseinheiten und sozialen Einrichtungen beschreibt, besteht eine Leistungsvereinbarung aus einer möglichst detaillierten Leistungsbeschreibung, die von der NPO in Absprache mit der zuständigen Verwaltungseinheit verfasst wird; einer Leistungsvereinbarung im eigentlichen Sinne, in der der Vertragsgegenstand mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten festgelegt wird, und einer Beschreibung des Controllings, d. h. einer Festlegung von Messgrößen, an denen eine Zielerreichung gemessen werden kann.
Ausgestaltung eines Kontraktmanagements zwischen Staat und NPO
Das Globalbudget
Im Rahmen von NPM soll der Fokus von der Input- zur Outputsteuerung verlagert werden. Ein wichtiges Mittel zur Erreichung dieser Maxime ist die Einführung von Globalbudgets. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, dass auch Aufwendungen über diesen Gesamtbetrag hinaus entstehen dürfen, diese jedoch durch zusätzliche Einnahmen ausgeglichen werden müssen. Diese Vorgangsweise bedeutet eine Abkehr vom für öffentliche Budgets vorgesehenen "Bruttoprinzip", das besagt, dass zusätzliche Einnahmen von der Budgetsumme abgezogen werden müssen.
Die Leistungsvereinbarung
Dvorak/Ruflin empfehlen eine Standardisierung der Leistungsvereinbarungsvorlage aus Gründen der Rationalisierung und Vereinfachung, weil nicht bei jeder Vertragsverhandlung die Elemente einer Leistungsvereinbarung von neuem festgelegt werden müssen. Abbildung 1 zeigt eine Musterleistungsvereinbarung mit wesentlichen Elementen:

vgl. Knorr/Scheppach 1999: 118; vgl. Ruflin 2006: 209)
Die Leistungsbeschreibung
Wie bereits festgehalten, dient eine Leistungsbeschreibung zur genauen Definition der zu erbringenden Leistungen. In Abbildung 2 ist eine Muster-Leistungsbeschreibung für Arbeitsassistenz, mit Definition der Zielgruppe, den Zielen und den zur Messung der Zielerreichung geeigneten Indikatoren angeführt.
Abbildung 2: Leistungsbeschreibung Projekt Arbeitsassistenz (eigene Erstellung in Anlehnung an Broder 2006 und den Fördervertrag Arbeitsassistenz 2008)
|
Leistungsbeschreibung |
|
|
Leistung: |
Durchführung von Arbeitsassistenz für Menschen mit intellektueller und/oder mehrfacher Behinderung und Jugendliche mit Lernbehinderung und sozialem oder emotionalem Handicap |
|
Umschreibung der Leistung: |
Begleitung von Menschen mit Behinderungen bei der Erlangung oder Sicherung von Arbeitsplätzen auf dem ersten Arbeitsmarkt. |
|
Nebenziele: |
Darüber hinaus unterstützen ArbeitsassistentInnen ihre KlientInnen bei der Abklärung von beruflichen Perspektiven und bei Problemen außerhalb des Arbeitsplatzes, beraten DienstgeberInnen und arbeiten mit Behörden und |
|
KlientInnenprofil: |
Menschen mit Behinderungen, die einen Bescheid nach § 14 Abs. 1 oder Abs. 2 BEinstG bzw. nach den Behindertengesetzen der Länder vorweisen können. Kann der Nachweis der Behinderung nicht durch Bescheid erbracht werden, ist die Behinderung durch Vorlage fachärztlicher Befunde, in Anwendung der §§ 2 und 3 BEinstG glaubhaft zu machen. |
|
Ziel 1 der Leistung: |
Begleitung von KlientInnen die dem KlientInnenprofil entsprechen. |
|
Indikator für Ziel 1: |
Die Begleitung beginnt mit Unterzeichnung eines Begleitungsvertrages, der konkrete Zielvereinbarungen für den jeweiligen Klienten, die jeweilige Klientin enthält. Eine Begleitung soll im Regelfall nicht länger als ein Jahr dauern. Überschreitungen im Einzelfall sind zu begründen. |
|
Standard für Indikator: |
Innerhalb der 3jährigen Vertragslaufzeit muss ein Personen-Anteil von 0,075 % der 3fachen Gesamtbevölkerungszahl in den vertragsgegenständlichen Bezirken begleitet werden. |
|
Pönale bei Nichterreichen: |
Das Globalbudget wird durch die ermittelte Sollbegleitungszahl dividiert. Pro Unterschreitung der ermittelten Sollbegleitungszahl werden 75 % des zuvor ermittelten Anteils der Sollbegleitungszahl vom Globalbudget abgezogen. |
|
Ziel 2 der Leistung: |
Über die Begleitung der KlientInnen hinaus sollen Erfolge in der Vermittlung von neuen bzw. der Sicherung von bestehenden Arbeitsplätzen erzielt werden. |
|
Indikator für Ziel 2: |
Eine Vermittlung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes kann als Erfolg gewertet werden, wenn das eingegangene bzw. gesicherte Arbeitsverhältnis über eine geringfügige Beschäftigung hinaus geht und mindestens 2 Monate besteht. |
|
Standard für Indikator: |
Der Anteil der Ist-Erfolge an den Ist-Begleitungen liegt bei 45 %. |
|
Pönale bei Nichterreichen: |
Pro 10 % weniger Ist-Erfolgsquote (gestaffelt: zwischen 44,9% und 35% 1x Pönale; zwischen 34,9% und 25% 2x Pönale usw.) wird bei der Endabrechnung eine Pönale von € 6.000,00 verrechnet. |
|
Bonus bei Übererfüllung von Ziel 4: |
Bei Übererfüllung von Ziel 4, also ein Anteil von Langzeitarbeitslosen von über 50 % werden pro 5 % mehr den Ist-Erfolgen 3 zusätzliche Erfolge hinzugerechnet. |
|
Ziel 3 der Leistung: |
Beim Erzielen von Erfolgen ist verstärkt auf die Vermittlung von Arbeitsplätzen zu achten. |
|
Indikator für Ziel 3: |
Verhältnis Ist-Vermittlung zu Ist-Sicherungen |
|
Standard für Indikator: |
Das Verhältnis von Ist-Vermittlungen zu Ist-Sicherungen liegt bei 80 zu 20 oder höher. |
|
Pönale bei Nichterreichen: |
Liegt das Verhältnis von Ist-Vermittlung zu Ist-Sicherung unter 60 zu 40, werden € 15.000,00 vom Globalbudget abgezogen. |
|
Ziel 4 der Leistung: |
Das Angebot der Arbeitsassistenz soll vermehrt von KlientInnen in Anspruch genommen werden, die länger als 6 Monate keiner Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt über das Ausmaß der Geringfügigkeit nachgingen. |
|
Indikator für Ziel 4: |
Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Ist-Begleitungen |
|
Standard für Indikator: |
Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Ist-Begleitungen soll mindestens 50 % betragen. |
|
Pönale bei Nichterreichen: |
Pro 10 % Unterschreitung der geforderten 50 % wird eine Pönale von € 6.000,00 verrechnet. |
|
Ziel 5 der Leistung: |
Durch das Angebot der Arbeitsassistenz sollen vermehrt KlientInnen ohne Hauptschulabschluss als höchste abgeschlossene Ausbildung begleitet werden. |
|
Indikator für Ziel 5: |
Anteil der KlientInnen ohne Hauptschulabschluss an den Ist-Gesamtbegleitungen. |
|
Standard für Indikator: |
33 % der begleiteten KlientInnen haben keinen Hauptschulabschluss. |
|
Pönale bei Nichterreichen: |
Bei diesem Nebenziel wird bei Nichterreichen auf ein Pönale verzichtet. |
|
Kosten der Leistung: |
€ 1.361.000,00 |
|
verantwortlich für diese Leistung: |
Leitung des Projektes Arbeitsassistenz |
Von anfänglicher Mehrbelastung hin zu Reduzierung von Bürokratie
Ein Wechsel der Finanzierungsinstrumente von der Gewährung von Subventionen hin zum Kontraktmanagement bedarf zunächst eines erheblichen Mehraufwands, da dem Vertragsabschluss eine lange Vorlaufzeit vorangeht und so ein hohes Maß an Personalressourcen, z. B. zur Vorbereitung und Führung von Verhandlungsgesprächen, zur Entwicklung von Leistungsbeschreibungen und Controllingsystemen, gebunden ist. Nach dem Vertragsabschluss kann jedoch eine Reduzierung von Bürokratie erreicht werden, wenn das Berichtswesen dem internen Controllingsystem angepasst wurde und außerdem nicht mehr eine jährliche Endabrechnung mit Verwendungsnachweis, wie bei der Vergabe von Subventionen vorgeschrieben, erforderlich ist.
Von der Planungssicherheit zur Innovationshinderungsgefahr
Durch Leistungsbeschreibungen werden Leistungen genau definiert hinsichtlich deren Quantität und Qualität. Für die Dauer der Leistungsperiode ist somit die Erbringung der jeweiligen Leistung gesichert. Die NPO wird danach bestrebt sein, die Leistungsvereinbarung zu erfüllen und genau die zuvor definierten Leistungen erbringen. Es wird somit ein hohes Maß an Planungssicherheit und somit Stabilität geschaffen. Dieses statische Element birgt aber auch die Gefahr der Vernachlässigung von Innovationen.
Höheres Maß an Flexibilität durch Kooperation und Vertrauen
Leistungsvereinbarungen können nur so gut sein wie die partnerschaftliche Kooperation, die dahinter steht. Die VereinbarungspartnerInnen verpflichten sich, im Gespräch zu bleiben und regelmäßigen Austausch zu betreiben. Leistungsvereinbarungen haben eine Gültigkeit, die befristet ist. Eine Leistungsperiode geht meist über zwei bis vier Jahre. Es sind Verlängerungen wahrscheinlich und Anpassungen möglich. Lindenmeyer bezeichnet deshalb Leistungsvereinbarungen als "gelebtes Recht".
Stärkung der Managementfunktionen
Ruflin sieht in den Ergebnissen ihrer empirischen Untersuchung ihre These, dass Leistungsvereinbarungen dazu beitragen, Managementkompetenzen und Kostenbewusstsein in NPOs zu stärken, bestätigt. In den von ihr untersuchten Einrichtungen fanden bereits in den 1990er-Jahren Änderungen in der Organisationsstruktur, Produktdefinitionen und die Einführung von Qualitätsmanagement statt. Diese erhöhte Managementfunktion sieht Ruflin nicht nur als Folge der Einführung von Leistungsvereinbarungen, sondern auch als Vorbereitungen für einen vermuteten Systemwechsel weg von der Subvention hin zum Kontraktmanagement.
Auch auf Seite der Vertreter der öffentlichen Verwaltungseinheit wird mit der Umsetzung von Instrumenten aus dem Bereich New Public Management ebenfalls die Führungsverantwortung erhöht. Denn die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der "Public Manager" müssen erweitert werden, um wirkliche Verhandlungen mit VertreterInnen von NPOs zu ermöglichen.
Grenzen der Ergebnisverbesserung bei sozialen Dienstleistungen
Zwar wird mit dem Instrument der Leistungsvereinbarung ein höheres Maß an Messbarkeit von Effizienz und Effektivität erreicht, in der Erfüllung pädagogischer und sozialer Aufgaben darf dieses Instrument jedoch nicht überbewertet werden. Es werden messbare Kriterien zu Input und Output definiert, diese beeinflussen aber nicht direkt den tatsächlichen Output sozialer Dienstleistungen. Denn Betreuung und Begleitung von Menschen kann nur das Ausmaß einer "Co-Produktion" erreichen, die Hauptpersonen sind die KlientInnen selbst. Die erzielbaren Ergebnisse können nicht, wie bei betriebswirtschaftlichen Herstellungsprozessen, genau vorausgesagt werden.
Messproblematik
Ein zentrales Element stellt die Abkehr von der Inputsteuerung über jährlich verhandelte Maximalbudgets hin zur Outputsteuerung über die Messung von Wirkungen dar. Wirkungsziele sind besonders im Dienstleistungsbereich nur erschwert operationalisierbar, weil zwischen dem Ergebnis einer Leistung und den erzielten Wirkungen ein kausaler Zusammenhang bestehen und erkannt werden muss. Erst danach können Indikatoren zur Messung von Wirkungen erarbeitet werden.
Betriebswirtschaftliche Instrumente versus Öffentliche Rechtmäßigkeit
Die mit den VertreterInnen von NPOs ausgehandelten Leistungsvereinbarungen müssen auf das öffentliche Buchführungs- und Rechtssystem umgelegt werden. Jedoch verstoßen Elemente eines Kontraktes, wie z. B. das Globalbudget, gegen Budgetgrundsätze. Das Globalbudget lässt sich nicht mit der Vorschrift der Einjährigkeit des Budgets vereinbaren und sieht keine Unterscheidung zwischen Personal- und Sachkosten vor.
Das System der Kameralistik ist auf die Aufzeichnung von Ausgaben und Einahmen beschränkt und dient in erster Linie zur Haushaltskontrolle. Die Einführung eines Rechnungswesens auf Basis der doppelten Buchführung würde eine Eingliederung von Leistungsvereinbarungen ins öffentliche System erleichtern.
Eine Vielzahl von derzeit bestehenden Problemfeldern bei Förderverträgen könnte durch Abwandlungen der Vertragspraxis in Richtung Kontraktmanagement verkleinert bzw. aufgelöst werden. Eine Anwendung des bereits in den Kapiteln 3.1 und 3.2 näher beschriebenen Kontraktmanagements, das die Leistungsvereinbarung, die Leistungsbeschreibung, das Globalbudget und die dazugehörigen Vertragsverhandlungen beinhaltet, erscheint aus mehreren Gründen sinnvoll.
So zielt eine Vertragsvereinbarung auf Basis eines Fördervertrages auf die Rückerstattung von im Rahmen der Projekttätigkeit entstandenen Aufwendungen ab. Bei einer Leistungsvereinbarung hingegen ist der Vertragsgegenstand die Erbringung einer bestimmten Leistung zu einem zuvor festgelegten Preis. Durch diese geänderte Ausgangsbasis können folgende Änderungen in der Ausgestaltung vorgenommen werden:
-
Der Finanzplan wird durch ein Globalbudget bzw. durch einen angebotenen Preis ersetzt und ermöglicht ein größeres Maß an Flexibilität bei der Finanzierung einzelner Teilleistungen des Projekts. Auch aus Sicht des Fördergebers würde eine einmalige Genehmigung eines Gesamtbudgets das Volumen von Einzelgenehmigungen reduzieren und so weniger Personal- und Zeitressourcen binden.
-
Mithilfe des Instruments der Leistungsvereinbarung könnte durch eine längere Projektlaufzeit ein höheres Maß an Effizienz erreicht werden, da die Phasen der Projektvorbereitung, der Projektabrechnung und der Projektüberprüfung in zeitlich größeren Abständen durchlaufen werden müssen.
-
Viele im Kapitel 3.2.3 näher skizzierten Elemente einer Leistungsvereinbarung sind bereits in der derzeitigen Vertragsform des Fördervertrags vorhanden (z. B. eine Quotenregelung und vertragliche Grundannahmen) und könnten adaptiert, neu gewichtet bzw. detaillierter ausformuliert (z. B. Projektcontrolling) werden. So kann durch die Überführung eines bereits bestehenden (Förder-)Projekts in das Kontraktmanagement der geeignete Transfer von Erfahrung und Know-how gewährleistet und die Angemessenheit von Globalbudget und Controllinginstrumenten besser beurteilt werden.
-
Durch die Anwendung des Instruments des Globalbudgets würde das Bruttoprinzip, das bei Fördervereinbarungen zur Anwendung kommt, durch ein Nettoprinzip ersetzt werden. Dies bedeutet, dass von dem/der AuftragnehmerIn zusätzlich generierte Erträge nicht vom Gesamtbudget abgezogen werden, sondern dem Budget hinzugerechnet werden können. Dies dient in weiterer Folge einem Ausbau des Projekts und kann den Leistungsumfang vertiefen bzw. verbreitern.
-
Durch die Festlegung des Budgets als Gesamtsumme ist es dem Agenten möglich, das Projekt kostendeckend zu führen. Die Berücksichtigung von bisher nicht (voll) förderfähigen Kosten wie z. B. Gemeinkosten oder Abfertigungsrückstellungen liegt im Ermessen der/des Auftragnehmers. Zur Absicherung des Risikos der Nicht- bzw. Schlechterfüllung des Vertrags gegenüber dem/der AuftraggeberIn muss das Projektcontrolling ausgebaut und für den Fall einer Vertragsverletzung ein Pönale vereinbart werden.
-
Durch das Instrument des Kontraktmanagements, das die Bezahlung einer Leitung vorsieht, ist keine Endabrechnung, kein Einzelnachweis der Aufwendungen und Erträge mittels Rechnungen und somit keine lückenlose Belegsprüfung erforderlich. Der Erfolg des Projekts wird an zuvor genau festgelegten Indikatoren bzw. durch ein geeignetes Projektcontrolling gemessen. Die Qualität der Leistungserbringung wird zusätzlich durch Standards (genaue Definition von Art und Umfang der Leistung, Festlegung von Ausbildungsstandards des Personals) definiert. Zusätzlich kann eine stichprobenartige bzw. systemorientierte Überprüfung der Buchhaltung und der KlientInnenverlaufsdokumentation der AuftragnehmerIn vereinbart werden. Diese Vorgangsweise würde die Phasen der Projektabrechnung und -überprüfung signifikant verkürzen, bedarf aber einer genaueren Vorbereitung vor Beginn der ersten Projektphase im Kontraktmanagement, um eine adäquate Vorbereitung des Projektcontrollings gewährleisten zu können. Vor Beginn der jeweiligen Folgeperioden könnten die Indikatoren mit erheblich kürzerem Zeitaufwand angepasst werden.
-
Eine Änderung in der Vertragsgestaltung stellt für beide VertragspartnerInnen ein Risiko dar. Besonders der Auftraggeber läuft Gefahr, sich Risiken aus der Prinzipal-Agent Theorie, wie sie in Kapitel 2 angeführt sind, auszusetzen
-
Durch die in einer Leistungsvereinbarung verwirklichte Konstellation der Erbringung einer vereinbarten Leistung und der Bezahlung einer vereinbarten Gesamtsumme als Gegenleistung gelten nach Auslegung des Bundessozialamtes die Bestimmungen des österreichischen Vergaberechts. Durch eine Ausschreibung des Projekts Arbeitsassistenz und der Durchführung eines mehrstufigen Vergabeverfahrens sowie den damit verbundenen MitbewerberInnen besteht für bisherige Leistungserbringer die Gefahr des Verlusts des Projekts. Die bisher erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung des Projekts Arbeitsassistenz könnten jedoch den Zuschlag für diese ausmachen. Für das Bundessozialamt hingegen würde die Möglichkeit der Bewertung mehrerer Angebote die Risiken eines überhöhten Preises bzw. einer Auswahl eines ungeeigneten Vertragspartners reduzieren.
Nico Sowa, Sabine Unterweger
Seit Mitte der 90er-Jahre finden Konzepte des Qualitätsmanagements und der Qualitätsentwicklung Einzug in die unterschiedlichen Bereiche sozialer Arbeit und haben inzwischen nicht geringen Einfluss auf die Erbringung sozialer Dienstleistungen. Nicht unerheblicher ökonomischer Druck und konkrete Forderungen des Gesetzgebers bzw. der Kostenträger sind Auslöser der Auseinandersetzung mit diesen Themen. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Veröffentlichungen, die Für und Wider dieser Entwicklung analysierten und diskutierten (zur Anwendung von Qualitätsmanagement in Bereichen der sozialen Arbeit siehe z. B. Drabner & Pawellek 1996, Jantzen, Lanwer-Koppelin & Schulz 1999, Sonnenberg 1999, Sonnenberg 2000, Wittenius 2003).
Die intensive Auseinandersetzung mit Methoden des Qualitätsmanagements führte dazu, den/die klassischen "KlientIn" sozialer Arbeit bzw. "NutzerIn" sozialer Dienstleistungen mit anderen Augen zu betrachten. Lange Zeit wurde in der Behindertenhilfe der Begriff "Hilfebedürftiger" verwendet. Er betonte eine einseitig orientierte Beziehung im Kontext "Hilfe geben - Hilfe nehmen". Es hat sich inzwischen ein Perspektivenwechsel vollzogen, der die aktive und mit gestaltende Rolle der Betroffenen bzw. NutzerInnen einer Dienstleistung am personalen Dienstleistungsgeschehen betont. Nutzerorientierung und eine damit einhergehende Partizipation der als NutzerInnen verstandenen Menschen bestimmen seitdem stärker die Diskussion. Noch Mitte der 90er spielte die Kontrolle und Bewertung der Dienstleistungen durch die NutzerInnen kaum eine Rolle. Es fehlen insgesamt Studien zur Erfassung der qualitativen Lebenssituation der Betroffenen (Gromann 1996). Dies führt Gromann vor allem darauf zurück, dass grundsätzlich in Frage gestellt wurde, ob Menschen mit Behinderung komplexe und komplizierte Zusammenhänge bewerten können, oder ob aufgrund vorhandener Abhängigkeitsverhältnisse Gefälligkeitsaussagen zu erwarten sind. Insbesondere ausgehend von einem "mündigen Konsumenten" mussten mindestens zwei Voraussetzungen verneint werden: Zum einen lagen und liegen die finanziellen Ressourcen zur Kaufentscheidung auch trotz der teilweisen Einführung persönlicher Budgets (Deutschland) nicht bei den betroffenen Personen. Zum anderen ist die lebenspraktische Abhängigkeit von der Hilfeleistung problematisch. Zu wenig Wahlalternativen stehen zur Verfügung, um eine wirkliche Entscheidung treffen zu können. Auch kann bei den EmpfängerInnen von sozialen Dienstleistungen in der Regel nicht von einem "kritischen Verbraucherverhalten" ausgegangen werden (Neumann 1998 123).
Der Begriff der "Kundenorientierung" hat zahlreiche Diskussionen angeregt und an vielen Stellen dazu geführt, die Betroffenen und ihre Perspektive stärker einzubeziehen. Verkürzt könnte man sagen, dass Kundenorientierung langfristig zu einer Stärkung der Betroffenenperspektive führt, wird sie für den Bereich der sozialen Arbeit angemessen interpretiert und umgesetzt.
Eine Forderung in den meisten Ansätzen des Qualitätsmanagements wie z. B. der DIN EN ISO 9001:2000 ist die intensive Auseinandersetzung mit dem Kunden, die Einbeziehung von dessen Wünschen sowie eine Beurteilung der erbrachten Leistung durch diesen. Die Zufriedenheit des Kunden ist eine der zentralen Anforderungen. Voraussetzung der Erfüllung von Kundenanforderungen und -wünschen ist zunächst, Kenntnis davon zu haben. Dies führt direkt zu Überlegungen, wie Anforderungen, Wünsche und Zufriedenheit ermittelt werden können.
In vielen Feldern der sozialen Arbeit stoßen die derzeit üblichen Befragungsinstrumente und -methoden an deutliche Grenzen (z. B. bei Menschen mit hohem Hilfebedarf). Für viele Bereiche müssen erst geeignete Methoden zur Erfassung entwickelt werden, so z. B. für Menschen mit hohem Hilfebedarf und Dualdiagnosen, da hier noch wenig Erfahrungen mit der Berücksichtigung der NutzerInnen- oder Betroffenenperspektive vorliegen (Schwarte & Oberste-Ufer 2001, 2002). Erst bei wenigen DienstleistungsanbieterInnen liegen Erfahrungen mit Qualitätsentwicklungskonzepten und der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen vor, obwohl die Beurteilung von Dienstleistungen durch NutzerInnen und sogenannte "NutzerInnenkontrolle" als wichtiger Bestandteil von Qualitätssicherung seit Mitte der 90er diskutiert werden (Gromann 1996, Gromann & Niehoff-Dittmann 1999).
Zufriedenheit wird in der aktuellen Forschung in direkten Zusammenhang mit "Lebensqualität" gesetzt: Modelle der Lebensqualität sind Grundlage verschiedener Forschungen zur Zufriedenheit. Es gibt keine allgemeingültige Definition von "Lebensqualität":
"Gleichwohl kann Lebensqualität weder abschließend noch eindeutig definiert werden. Vielmehr ist es als komplexes und mehrdimensionales, offenes und relatives Arbeitskonzept zu betrachten, das der theoretischen und empirischen, der normativen und lebensweltlichen Begründung bedarf." (Beck 2001a 339).
Als mehrdimensionales Konzept beinhaltet Lebensqualität mindestens die Unterscheidung zwischen objektiven Merkmalen und subjektiven Bedeutungen. Zu den objektiven Merkmalen zählen alle beobachtbaren Lebensverhältnisse, die von Außenstehenden nach wissenschaftlichen oder moralischen Standards (=Werte) bewertet werden können (Zapf 1984). Subjektive Bedeutungen erhalten bestimmte Lebensverhältnisse durch das Individuum. Sie entstehen aufgrund individueller Urteile von Personen über die eigene Situation. So kann einer von außen als ähnlich bewerteten Situation, durch unterschiedliche Individuen eine grundlegend andere Bedeutung zugewiesen werden.
Die gegenwärtige Wissenschaft wendet integrierte Ansätze an, da sich in der empirischen Forschung die Unterscheidung und Gegenüberstellung zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden bewährt haben (Glatzer & Zapf 1984). Insbesondere die Erhebung der subjektiven Bedeutung der Zufriedenheit ist an die Person des Betroffenen gebunden und kann nicht durch Beobachtungen ergründet oder aus Konzeptionen abgeleitet werden. Die bedürfnistheoretische Betrachtung versteht unter Lebensqualität das Ausmaß der Befriedigung individueller Bedürfnisse oder die Erreichung persönlicher Ziele. Lebensqualität stellt sich aus der Perspektive des Individuums anders dar, als aus der Perspektive von Außenstehenden. Lebensqualität sollte nicht durch Außenstehende definiert werden (Diener 2000), da Fremd- und Selbstperspektive sich nicht selten bei der Beurteilung scheinbar objektiver Situationen unterscheiden.
Bekannt sind inzwischen einige Instrumente aus dem Qualitätsmanagement, die meistens indirekt, einzelne direkt die Nutzerperspektive in die Erhebungen einbeziehen. So gibt es einerseits Verfahren zur Personalbemessung (GBM, SYLQUE etc.) d. h. Befragungen von Einrichtungen, die die Nutzerperspektive mit einbeziehen. Andererseits stellen Verfahren zur Erhebung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung (Qu An Ta = Qualitätssicherung der Angebote in der Tagesförderung, schöner Wohnen; "ich bin mir wichtig ...") einen Ansatzpunkt dar. Das Modell der DIN ISO 9004 ist einrichtungsbezogen, beinhaltet jedoch auch inzwischen ein Instrument der Kundenbefragung als integralen Baustein. Das Üben von Bewertung, die Unterstützung der Wahrnehmung und die Äußerung von Wünschen und Bedürfnissen sind darüber hinaus Grundlage des SIVUS-Konzeptes (Soziale und individuelle Entwicklung durch gemeinschaftliches Handeln, vgl. Janßen, 1999), das damit ebenfalls als Instrument zur NutzerInnenbeurteilung genutzt werden kann. Als Leitlinie sollte gelten, dass NutzerInnen das beurteilen können, was ihnen wichtig ist. Darüber hinaus ist es jedoch auf jeden Fall sinnvoll, die Lebensumstände der NutzerInnen zu bewerten.
Wie in allen Befragungen ist es schwierig, eine Tendenz zur Positiv-Beantwortung (i.S. sozialer Erwünschtheit) zu minimieren. Einerseits ist es schwer für Menschen mit Behinderung, Kritik zu äußern. Darüber hinaus ist in der Gruppe der Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen, dass häufig Abhängigkeitsverhältnisse im Betreuungsbereich bestehen. Dadurch werden weitere Mechanismen wirksam, die aufgrund der Behinderung stärker ausgeprägt sind, als in der Normalbevölkerung. Weiters ist eine gewisse Kommunikationsfähigkeit für eine zuverlässige Beurteilung notwendig. Für Menschen mit Behinderung besteht eine mangelnde Übung hinsichtlich der Beurteilung ihrer Lebensqualität.
Dies ist jedoch eine Frage, wie der Sinn und das Verfahren in der NutzerInnengruppe eingebracht werden. Es ist keine alltägliche Frage, mit der die NutzerIn konfrontiert wird: "Wie zufrieden bin ich mit ,meinen' MitarbeiterInnen? Was darf ich dazu überhaupt sagen?" Für Menschen mit Behinderung bestehen selten Vergleichsmöglichkeiten innerhalb ihres Settings (z. B. zwischen verschiedenen Teams, Arbeitsmöglichkeiten etc.). Dafür ein praktisches Beispiel: Zur Möglichkeit, in der Stadt zu arbeiten, fragte ein Mensch mit Behinderung nach: "Ist das denn überhaupt möglich?". Geringe sprachliche Kompetenzen hinsichtlich des aktiven und passiven Wortschatzes, des Sprachverständnisses (z. B. bei komplexen Fragen relevant) und der Lese- und Schreibfertigkeiten der NutzerInnen zeigen weitere Schwierigkeiten auf. Insgesamt zeigt jedoch die Forschung, dass die Verlässlichkeit von Befragungen Menschen mit Behinderung ebenso so hoch zu veranschlagen ist, wie in der Normalbevölkerung, wenn die richtige Methodenwahl erfolgt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Menschen mit Behinderung befragt werden möchten und auch viel zu sagen haben. Eine nutzerorientierte Angebotsüberprüfung gibt Anstöße für eine Qualitätsverbesserung innerhalb des Arbeitsalltags in z. B. Integrationsprojekten. Die Befragung von Menschen mit Behinderung kann und sollte die Organisationsentwicklung beeinflussen und nicht um ihrer selbst willen durchgeführt werden. Hoffentlich finden viele DienstleisterInnen den Mut, die Sichtweisen von Menschen mit Behinderung zu erfassen und sie als ExpertInnen ihres Lebensumfeldes (= ExpertInnen in eigener Sache) anzuerkennen. Vielleicht wird dann häufiger in Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu hören sein: "Der/die ExpertIn bin ich ...!"
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg, Qualitätsbeauftragte autArK Kärnten
Dr. Peter Beule, Referatsleiter, Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Integrationsamt
Dr.in Annelies Debrunner, Sozialwissenschaftlerin, Leiterin Debrunner Sozialforschung & Projekte, Frauenfeld, Schweiz, www.annelies-debrunner.ch
Dr.in Helga Fasching, Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien http://homepage.univie.ac.at/helga.fasching/
Mag. Michael Fürnschuß, Geschäftsführer GID GmbH Gesellschaft für Information und Datenverarbeitung Steinbach/Taunus Deutschland
Gert Klüppel, Regionaler Koordinator IFD, Deutschland, LWL-Integrationsamt, Westfalen
Otto Lambauer, Grundlagenarbeit Behinderteneinrichtungen, Caritas Wien
DSA Harald Loewit-Schneider, Arbas Tirol, Team Arbeitsassistenz Innsbruck
Mag. Peter Milbradt, BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH, Funktion bei easy entrance,
ee.Ansprechpartner, Berater, Projektleitung, http://www.easyentrance.at
Dr. Marco Nicolussi, Geschäftsführer Arbas Tirol
Mag. Oliver Koenig, Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien
Dr. Walter Krög, Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien
Mag.a Doris Rath, RMP Sozialforschung, Wien http://www.rmp.or.at/
Dr.in Karin Rossi, Leitung Arbeitsassistenz Wien, PSZ GmbH (ibi Institut zur beruflichen Integration)
Nico Sowa, autArKademie Brückl, AutarK Kärnten
Mag.a Daniela Spindler, Controlling, Caritas Wien
Max Stimpfl, Organisations- und Personalentwicklung, EFQM/QAP Verantwortlicher, PSZ GmbH
Mag.a Sabine Unterweger, Fachbereichsleitung AQB AutarK Kärnten
DSAin Susanne Wiedenhofer, Bundessozialamt Österreich
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger: Caritas der Erzdiözese Wien
Redaktion: Caritas Behinderteneinrichtungen
1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21
Tel.: 01/878 12-332, Fax: 01/878 12-9332
E-Mail: behinderteneinrichtungen@caritas-wien.at
Quelle:
Pamela Aichelburg, Harald Loewit-Schneider, Marco Nicolussi, Annelies Debrunner, Michael Fürnschuss, Doris Rath, Susanne Wiedenhofer, Peter Milbradt, Daniela Spindler, Otto Lambauer, Karin Rossi, Max Stimpfl, Helga Fasching, Oliver Koenig, Walter Krög, Nico Sowa, Sabine Unterweger, Gert Klüppel, Peter Beule: Mehr Qualität - bessere Integration? Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration Tagungsbericht
Tagungsbericht der Tagung "Mehr Qualität - bessere Integration?", 22. und 23. Juni 2009, Kardinal König Haus, Wien
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 08.05.2012

