Zu Theorie und Praxis verstehender Diagnostik bei geistig behinderten Menschen
Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 6/99, Thema: Sich erinnern; Gekürzte Fassung eines Vortrages bei einer Tagung der Johannes-Anstalten Mosbach, D-74869 Schwarzach, zum Thema "Lebensgeschichten" am 17. und 18. März 1999; die ausführliche Fassung erscheint im Tagungsbericht. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (6/1999)
Inhaltsverzeichnis
Ich möchte Sie im folgenden mit einigen Aspekten des von uns in den Traditionen von A.R. Lurija entwickelten Konzeption der Rehistorisierenden Diagnostik vertraut machen. Diese Konzeption wurde bisher insbesondere für Prozesse schwerer Behinderung dargestellt (vgl. Jantzen 1998, Jantzen und Lanwer-Koppelin 1996 sowie zu Aspekten institutioneller Umsetzung Jantzen 1997, Jantzen u.a. 1999).
Sicherlich kennen Sie die neurologischen Geschichten von Oliver Sacks, insbesondere die beiden Bände "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte" und "Eine Anthropologin auf dem Mars" (Sacks 1987, 1995). Was uns an diesen Geschichten fasziniert, ist die Übersetzungsleistung des Autors: Vorher uns fremde, bizarre Formen menschlicher Lebensäußerungen erscheinen uns nahe und verstehbar. Es leuchtet ein, daß dies nur möglich ist, wenn Oliver Sacks das der jeweiligen Geschichte zugrunde liegende Syndrom zu identifizieren vermag. Denn damit hört die jeweilige Geschichte auf, nur als einzelne, von uns unverstandene Geschichte zu existieren. Durch die Einführung des Syndroms, und damit des Wissens über das Syndrom, wird sie zu einer besonderen Geschichte. Was bedeutet es, unter Bedingungen dieses Syndroms Mensch zu sein, welche Auswirkungen also hat das Syndrom auf die Entwicklung der Persönlichkeit?
Eine solche Frage steht natürlich auch im Mittelpunkt unseres diagnostischen Vorgehens bei geistiger Behinderung, allerdings stellen wir sie unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. Denn geistige Behinderung ist per definitionem eine Störung, deren organische Korrelate sich bereits im Kindheits- und Jugendalter realisieren. Sei es als Folge von Änderungen des Genotyps und einer entsprechenden Rückkoppelung auf die Entwicklung von Gehirn und Nervensystem wie bei Trisomie 21 oder bei Fragilem-X-Syndrom, als Folge intrauteriner Vergiftungen (Fetales-Alkohol-Syndrom) oder Erkrankungen (Rubella-Syndrom), perinatalen Sauerstoffmangels oder postnataler Veränderungen des Gehirns durch entzündliche oder traumatische Prozesse. Und nicht nur, daß wir sehr häufig gar nicht über entsprechende Diagnosen verfügen, sondern bestenfalls über globale Urteile wie "geistige Behinderung unklarer Genese", sehr häufig liefern langjährige Akten kaum mehr als Beschreibungen einer ausweglosen Situation des Personals denn valide Verhaltensbeobachtungen. Trotzdem sind auch unter diesen Bedingungen syndromanalytische Erörterungen sinnvoll und von Nutzen. Auf jeden Fall gehört zum Neubegreifen einer Geschichte als erstes dazu, nach den besonderen Ausgangsbedingungen zu fragen, unter denen sie stattgefunden hat, um einen "Kern der Retardation" im Sinne der durch das Syndrom veränderten sozialen Entwicklungssituation zu ermitteln (vgl. Vygotskij 1993). Ebenso wie Blindheit oder Gehörlosigkeit das Verhältnis zu den Menschen und zur Welt auf spezifische Weise ändern, so geschieht dies auch durch unterschiedliche organische Veränderungen des ZNS. Und auf jeden Fall ist es von Nutzen, dies nicht nur für die Geschichte als solche, sondern auch für die heutige Situation zu wissen.
Elke G., zum Zeitpunkt der Beratung 39 Jahre alt, lebt in einer Wohngruppe des sog. harten Kerns der Einrichtung. Sie ist tetraspastisch mit deutlicher Linksbetonung, und neigt zu Autoaggressionen, z.B. indem sie sich auf den Kehlkopf schlägt. Möglicherweise ist sie blind. Dies konnte nie richtig geklärt werden. Sie reißt an der Tischdecke und wirft Gegenstände herunter. Sie stört durch hohe Töne ständig MitarbeiterInnen und andere BewohnerInnen. Sie spricht nicht. Über motorische Elementarfunktionen der Hände ebenso wie über gegenständliches Greifen verfügt sie. Die Akte - die insgesamt außerordentlich schmal ist - spricht von einem durch CT verifizierten perinatalen Defekt rechts temporal und parietal. Ich lerne Frau G. während der Fachberatung in der Gruppe kennen. Abgesehen von einer kurzen Anfangsphase habe ich von ca. 100 Fachberatungen bei ca. 80 BewohnerInnen die Fachberatungen immer im Beisein der BewohnerInnen durchgeführt (vgl. auch Jantzen 1997). Elke G. wird herein geschoben. Die Gruppe hat sich wahrscheinlich deshalb darauf eingelassen, weil ohnehin nichts passieren wird. Mit ihrem linken Arm umklammert sie eine große Cola-Flasche aus Plastik, die sie nach Aussagen der MitarbeiterInnen braucht, um ruhig zu sein (also eine Art Übergangsobjekt). Mit der rechten Hand traktiert sie dauernd eine Mitarbeiterin, zippelt an deren Kleidung, kneift usw. Ich versuche ihre Hand anzutippen. Sie überträgt sofort das Muster auf mich. Während die MitarbeiterInnen über die gegenwärtige Situation berichten, fange ich an, Verschiedenes mit Frau G. auszuprobieren. Ich unterstelle auf Grund der CT-Befunde ein Rechtshemisphären-Syndrom und damit verbunden eine linksseitige Störung des Körperselbst. Bei einer derartigen Störung verschwindet im Extremfall eine ganze Körperhälfte "ins Blaue" (vgl. Robertson und Marshall 1993), wie dies Oliver Sacks (1989) in der Geschichte seines "verlorenen" Beines für dieses entsprechend schildert. Während Frau G. auf Annäherung von rechts sofort mit ihrer rechten Hand tätig wird, passiert bei Annäherungen von links überhaupt nichts. Ich fange an, im rechten Körperraum mit ihr zu arbeiten. Ich berühre ihre Hand, z.T. gebe ich ihr kurze rhythmische Muster auf die Handoberfläche oder den Handrücken, warte ab bis sie reagiert, und nur wenn sie anfängt meine Hand zu traktieren, ziehe ich diese wieder weg. Binnen kurzer Zeit gelingt es, daß sie sich selbst, z.T. auch in Form von Lauten, an der Mustervariation beteiligt. Alles was sie produziert, greife ich auf und wiederhole es bzw. biete es später erneut an. Am Ende der Beratung ist ein wechselseitiges, rhythmisches in die Hände Klatschen mit ihrer rechten Hand möglich.
Diese wenigen Fakten zeigen nicht nur, daß die diffuse Abgrenzung mit der rechten Hand nicht anderes als ein Kompensationsmuster bezogen auf ihre hospitalisierte Situation ist (dies gilt auch für die berichteten hohen Töne), sondern auch, daß sie sehr schnell in der Lage ist, elementare dialogische Muster aufzunehmen. Die Nutzung des linken Armes für ein "Übergangsobjekt" zeigt, daß zumindest auch linksseitig Ansätze eines differenzierten Körperselbst vorhanden sind.
Mehr festzustellen ist bei dem heutigen Wissen der MitarbeiterInnen und bei der Aktenlage nicht möglich. Auf jeden Fall erscheinen jedoch bereits durch die Syndromanalyse erste Spuren der Geschichte wieder im Bewußtsein der MitarbeiterInnen, aus dem sie genauso schnell wieder verschwinden werden. Denn hierzu müßte sich die Situation der Gruppe ändern, in der 12 schwer geistig und mehrfachbehinderte Menschen leben, z.T. mit schweren Bewegungseinschränkungen z.T. mit schweren hospitalismusbedingten Verhaltensstörungen. Erst ein Auseinandernehmen eines derartig harten, auskristallisierten Kerns von Alltagsproblemen und Hoffnungslosigkeit würde es ermöglichen, eine entsprechende regelmäßige pädagogische Arbeit mit Elke G. aufzubauen.
Syndromanalyse, so wird an diesem kurzen und rudimentären Beispiel deutlich, hat den Kern der Retardation zu bestimmen. Welcher Art ist die veränderte Ausgangssituation im Verhältnis zu den Menschen und zur Welt, in die Frau G. durch ihre perinatale Hirnschädigung geraten ist? Was ist der Kern dieser perinatalen Hirnschädigung? Und was sind primäre Kompensationen, um in der dramatisch eingegrenzten Lebenssituation zu überleben? Da Frau G. seit dem 6. Lebensjahr in der Einrichtung lebt und über ihre vorherige Geschichte wenig bekannt ist, außer, daß die Eltern aus sehr einfachen Verhältnissen stammen, kann das heutige Resultat vor allem langjähriger schwerer Hospitalisierung zugeschrieben werden. Trotzdem ist die Kenntnis des zugrunde liegenden Syndroms von Nutzen, um Bereiche bestimmen zu können, in denen Dialog und Kommunikation sinnvoll anzusetzen sind. Dies wird aber nur möglich sein, wenn es zu Verschiebungen im Feld der Macht kommt, die Interessen von Elke G. dauerhaft gegen die Alltagsroutine der Station artikuliert werden können, und die MitarbeiterInnen selbst andere Freiräume erhalten, was in der vorgefundenen Situation kaum möglich ist.
Nicht immer ist die Datenlage derartig schlecht. Allerdings konfrontiert uns eine bessere Datenlage mit der neuen Aufgabe, den Entwicklungsprozeß unter den Bedingungen der durch das Syndrom veränderten sozialen Situation bzw. ihrer weiteren Veränderung durch Akte der sozialen Ausgrenzung und defektbezogener Diagnosen zu rekonstruieren. Es ist offensichtlich, daß hierzu eine für Einzelphänomene sensible Entwicklungspsychologie von höchster Bedeutung ist (vgl. hierzu Jantzen 1987, Kap. 5 und 6), mittels derer auch sogenannte Defekte als Resultat von Entwicklung betrachtet werden können.
Dies demonstriert exemplarisch die folgende Geschichte von Carola M., für deren Rekonstruktion in den Akten vorhandene, wenn auch höchst knappe, jährliche Entwicklungsberichte herangezogen werden konnten.
Carola M., zum Zeitpunkt der Beratung 32 Jahre alt, galt in der Großeinrichtung als "Monster". Sie ist außerordentlich kräftig, und nachdem ihr im Rahmen beginnender Reformen in den letzten Jahren mehr Freiheit gegeben wurde, ereignete sich ein Zwischenfall nach dem anderen, sowohl im Bereich von Schwestergesellschaften auf dem Einrichtungsgelände als auch in der Nachbarschaft in der die Einrichtung umschließenden Kleinstadt. Frau M. spricht nicht, verfügt über wenige, nicht konventionalisierte Gesten und versteht nur sehr wenig. Eine rehistorisierende Analyse der Akten im Vorfeld von Fachberatungen, an denen sie dann, wie dies unterdessen Standard ist, teilnimmt, ergibt folgendes.
Carola M. wird unter denkbar ungünstigen Umständen geboren. Der Vater erscheint in der Akte als arbeitsscheu und sozial schwach. Im Alter von neun Monaten kommt Carola wegen Wohnungsverlust der Eltern in ein Kinderheim. Bereits mit sechs Monaten hatte sie eine offene TB. Ihre Diagnose lautet auf angeborenen Schwachsinn vom Grad der Idiotie verbunden mit cerebralparetischen Störungen choreatischer und athetotischer Art. Vermutlich, so ist heute zu schließen, handelt es sich um eine jener perinatalen Störungen, möglicherweise durch Asphyxie, die lange mit Littleschem Syndrom beschrieben wurden. Zumindest ist dies das pathologische Grundmuster, das am widerspruchsfreisten alle Daten zu ordnen vermag.
Bereits mit 1 1/4 Jahr kann Carola laufen und faßt Spielzeug an. Etwas später erscheinen alle jene Reaktionen auf Hospitalisierung, die wir in Kinderheimen dieser Zeit auch bei weniger oder überhaupt nicht hirnorganisch geschädigten Kindern finden. Im Alter von 1,8 Jahren näßt und kotet sie ein, im Alter von zwei Jahren wird sie als aggressiv geschildert, sie zieht andere Kinder an den Haaren. Diese Tatbestände genügen uns retrospektiv bereits, um die Diagnose Idiotie restlos zu verwerfen. Sie drücken aus, daß Carola gegenständliche Mittel anwendet, um soziale Situationen zu beeinflussen, daß sie also mindestens auf dem fünften, wahrscheinlich sogar auf dem sechsten sensomotorischen Niveau nach Piaget organisiert ist, also bis hierhin fast altersadäquat. Im Alter von ca. vier Jahren kommt sie in die Großeinrichtung. Sie steht lange Jahre, zwecks Dämpfung der Aggressivität, unter Psychopharmaka und wird häufig fixiert. Im Alter von sechs Jahren baut sie mit Bauklötzen einen Turm, auf dem etwas kleben muß. Alles andere zerstört sie. Auf jeden Fall zeigt sie jetzt trotz höchst eingeschränkter sozialer Handlungsräume Leistungen auf dem sechsten sensomotorischen Niveau, vermutlich jedoch bereits auf der Ebene des präoperationalen Denkens, wie die Bemerkung nahelegt, daß etwas auf dem Turm "kleben muß", also eine ritualisierte Handlung! Zur gleichen Zeit werden neue Verhaltensweisen berichtet: Sie schlägt in bestimmten Situationen autoaggressiv mit dem Kopf gegen die Scheibe oder den Tisch. Sie regrediert also unter den Bedingungen der Hospitalisierung in Notsituationen auf tiefere sensomotorische Niveaus (in diesem Fall in Form von Autoaggression auf SN IV), als sie diese früher in Form der Aggressionen (SN VI) zur Situationslösung benutzt hatte.
Im Alter von acht Jahren sitzt sie lange still auf dem Schoß von Erwachsenen und beschlagnahmt Erwachsene am liebsten den ganzen Tag. Sie fängt an zu kritzeln. Bei Fixierungen bleibt nach wie vor die Neigung, sich selbst zu beschädigen. Im Alter von zehn Jahren malt sie mit kraftvollen Strichen und im Alter von knapp vierzehn Jahren nimmt sie am Ämterplan, an hauswirtschaftlichen Arbeiten gerne und mit zunehmender Dauer genauer und zweckmäßiger teil. Sie hat also gelernt in einem Gemeinwesen regelmäßig und geordnet Aufgaben zu übernehmen, und demgemäß mindestens das späte präoperationale Alter des sozialen Regelgebrauchs erreicht. Bevor ich hierauf näher eingehe, noch kurz zur entschlüsselten Ausgangssituation: Carola M. hat auf Grund des Littleschen Syndroms, also einer perinatalen Hirnschädigung, die häufig Temporallappenläsionen mitbeinhaltet, ersichtlich weder aktives Sprechen noch Sprachverständnis gelernt. Gleichzeitig ist sie aus ihrer Lebensgeschichte in besonderer Weise auf einen Raum von überschaubarer Sicherheit und Anerkennung angewiesen, anderenfalls beginnt sie diffus zu werden. Nach Berücksichtigung dieser Interpretation, nach Klärung von Ängsten und Beziehungskonflikten und Kränkungen in der Gruppe, nach Übertragen sozial wichtiger und anerkannter Aufgaben an sie sind die eskalierten Probleme unterdessen weitgehend zurückgegangen oder verschwunden.
Entwicklungspsychologisch betrachtet hat Frau M., dies zeigt ihr differenzierter Gebrauch sozialer Regeln, ein Piaget-Niveau von 4-5 Jahren erreicht, also das Stadium der späten präoperationalen Intelligenz. Dies ist ein Niveau, wie wir es in vielen Aspekten des Alltags realisieren. Was Frau M. von uns unterscheidet, ist, daß sie in viel geringerem Umfang einen über Sprache und kulturelle Erfahrungen realisierten symbolischen Raum aufgebaut hat, in welchem sie sich reflexiv bewegen kann. Selbst mögliche Alternativen wie Gebärdensprache, auf die sie positiv anspricht, sind niemals in Erwägung gezogen worden, da die Wahrnehmung der Defektivität alles andere überlagert hatte und folglich an die Stelle von Anerkennung die Ausübung von Macht und Gewalt getreten war. Spätestes hier jedoch taucht erneut die Frage auf, was heißt eigentlich "geistig behindert"? Da auch Menschen mit Down-Syndrom in der Regel das Stadium der späten präoperationalen Intelligenz erreichen, ist es nicht unangebracht, in diesem Kontext die Fragen aufzugreifen, die Pablo Pineda, ein junger spanischer Lehrer mit Down-Syndrom in seinem Eröffnungsvortrag beim 6. Weltkongreß zum Down-Syndrom im Oktober 1997 in Madrid gestellt hat: Glauben wir wirklich an ihre, Carolas Fähigkeiten ebenso wie der Menschen mit Down-Syndrom oder halten wir sie für einen Fehler? Haben wir Vertrauen in ihre Kompetenzen oder sehen wir vor allem ihre Fehler? Sind sie für Politiker und Wissenschaftler anerkannte Bürger oder stupide Idioten? Pablo Pineda schloß mit den Worten: "Teilt uns nicht in zwei Gruppen, die Normalen und die Anormalen! Wir sind genauso gleich und verschieden wie Ihr!" (Boban/Hinz 1998, S. 186).
Spätestens hier gelangen wir jedoch an einen weiteren Punkt der Rehistorisierung, der eigenständiger Erörterung bedarf. Bisher hatten wir im Rahmen der Syndromanalyse nach einer angemessenen Ausgangsabstraktion, einem Syndrom gesucht, das die Vielzahl der Erscheinungen und Befunde am besten und eindeutigsten ordnet. Manchmal ist dies nicht nur ein Syndrom, sondern zwei oder drei müssen herangezogen werden. Danach haben wir aber in beiden Geschichten bereits einen weiteren Schritt vollzogen, in der Geschichte von Elke G. nur rudimentär, in der Geschichte von Carola M. sehr viel ausführlicher: Wir haben unsere Ausgangsabstraktion, also das Syndrom, als Schlüssel zur Lebensgeschichte genutzt, um sie durch eine derartige Entschlüsselung zu verstehen. Und wir haben beide Frauen, Elke G. und Carola M. als die Instanzen betrachtet, welche die aus unseren diagnostischen Überlegungen entspringenden Transaktionen verifizieren oder falsifizieren können.
Alexander Lurija, der große russische Neuropsychologe, hat in Anlehnung an eine Bemerkung von Karl Marx diesen Schritt der Entschlüsselung als "Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten" gekennzeichnet (Lurija 1984), also als Schritt von der wissenschaftlichen Abstraktion zur "Romantischen Wissenschaft" (Lurija 1993). Ähnlich argumentiert auch Oliver Sacks (1990). Für unsere Zwecke ist es nun von Bedeutung, was der wesentliche Inhalt dieses Schrittes ist.
Der Akt des Erklärens im Sinne der Syndromanalyse versetzt in einem zweiten Schritt das Syndrom an den Ausgangspunkt einer Geschichte. Er öffnet damit den Weg für das Verstehen. Durch diese Transformation wird die uns vorher fremde Geschichte durch den Modus der "Entschlüsselung" zu einer besonderen Geschichte von Mensch sein, die auch die unsere hätte sein können. Was vorher als Natur oder mir fremdes Schicksal erschien, erscheint nun als Ausdruck eines Dramas des Lebens. Und in dieser Hinsicht läßt uns der Erkenntnisakt nicht unberührt. Er stiftet eine ästhetische Dimension des Berührtseins durch ein Schicksal von meinesgleichen, das unter Umständen hätte auch das meinige sein können. Und die Frage taucht auf, hätte ich es unter vergleichbaren Umständen besser oder schlechter gemacht? Das Feld der Macht wird also durch den ästhetischen Erkenntnisakt gesprengt, Anerkennung wird möglich, wo vorher Ausgrenzung herrschte.
Ein derartiger Akt der Berührung ist in der Biographieforschung hinreichend oft beschrieben worden. Ihn nicht zu verlieren, verlangt, in der Nähe Distanz zu halten, aber ebenso in der Distanz Nähe. Insofern verlangt die Wiedergabe des Verstehens zugleich zwingend nach einer dem Verstehensprozeß angemessenen ästhetischen Form, in welcher die Dimension des Humanen in einer ihr angemessenen Denkform reflektiert wird und in einer ihr entsprechenden Sprache eingefangen bleibt. Dies ist Voraussetzung dafür, eine Form des Ausdrucks zu finden, in welcher der sinnstiftende Akt von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit im Sinne des Berührtwerdens durch die Geschichte eines anderen Menschen auch für andere, die in Form meines Berichtes oder meines Gutachtens von dieser Geschichte erfahren, zugänglich wird.
Eine solche ästhetische Form der Reflexion eines in der Regel als "defekthaft" begriffenen Zustandes ist in Film und Literatur höchst selten anzutreffen; trotzdem gibt es bereits entsprechende Beispiele. Die literarische Darstellung der Photographie eines "geistig behinderten" Jungen in einem Gitterbett, aufgenommen von Dietmar Riemann und kommentiert von dem großen Literaten Franz Fühmann, mag einen Eindruck von dem geben, wie eine dem Verstehensprozeß in einer rehistorisierenden Diagnostik angemessene ästhetische Form der Reflexion aussehen kann.
"Wie jedes gültige Kunstwerk sind auch Photographien von Rang als Träger eines Mythos verstehbar; sie halten jenen Ort und jenen Moment fest, da der Alltag transzendiert oder, um es noch einmal zu sagen, da ein Atom Zeit ein Atom Ewigkeit wird.
-
Der Junge, gefesselt hinter Stäben, "fixiert", wie die Fachsprache es nennt, da er weitgehend schmerzunempfindlich, sonst gegen sich selbst zu wüten begönne, etwa sich die Haare büschelweis ausraufte oder sich Stirn und Wangen zerfleischte. Es ist die uralte Form schmerzlichster Klage, ritualisierte Form der Reaktion auf einen je ins Dasein gebrochnen Verlust, den dann, als die Heilung des Selbst, erst Trauerarbeit bewältigen kann.
-
Um wen klagt der Junge, wen oder was hat er verloren? Oder welch ein anderer Feind als der grimme Tod ist in sein Dasein und seine Seele gebrochen, gegen den, da er innen sitzt, der Junge als gegen sich selbst schlägt?
-
Bei den Alten war jede mania, jener Wahnsinnseinbruch, wie jeder Antrieb von einer Gottheit bewirkt, in deren spezifischer Wesenssphäre, bei Ares etwa einer anderen als bei Hera oder Apollon, und als die Krieger des glorreichen Aias ihren Feldherrn an Trojas Küste im Wahn sahn, auf einem Haufen zerstückelter Rinder, gegen die er mit den Schwert gewütet, da er sie für seine Feinde gehalten, die ihn um den höchsten Siegespreis, die Waffen des Achilleus betrogen: Da seine Krieger ihren Feldherrn solcherart geschlagen sahen, begannen sie, laut Sophokles, als erstes die Frage aufzuwerfen, welche Gottheit diese mania gesandt, um, entsprechend dem Besonderen der Gottheit, das Besondere des Wahns erkennen zu können. Hier ist es Athene gewesen, und man erfährt dann durch einen Seherspruch, daß Aias geheilt werden könne, wenn man ihn einen Tag lang vor sich selbst bewahre, einen Tag ihn bewache, ihn nicht aus seinem Zelt lasse, notfalls an einen Pfosten binde, dann sei der Zorn der Götter vorbei. Dieser Tag wird versäumt, und Aias heilt sich auf seine Weise, in Hybris, ohne göttliche Hilfe, indem er den Träger des Wahns hinwegrafft: durch den Sturz seiner selbst in das eigene Schwert.
Der wahnsinnsgeschlagene, gebundene Aias als Knabe - ich kann diese Photographie nicht anders betrachten, und mich erschüttert dieses Knaben Alleinsein; vielleicht ist es gerade seine mania, daß er dieses Alleinsein nicht erträgt." (Fühmann und Riemann 1985, S. 17).
Soweit Fühmann, der in dichterischer Sprache jenen Moment der hellwachen Auseinandersetzung mit der Besonderheit einer Person, die mich berührt, die ich als meinesgleichen erkenne, eingefangen hat. Eine derartige Berührung wird innerhalb der Ästhetik als Katharsis beschrieben, als Akt der Läuterung. Als solcher Akt der "Wahrheit des Konkreten" (Hegel) geht sie jedoch wieder verloren, manchmal unwiederbringlich. Denn die Geschichten, die wir erschließen, sind als solche nicht schön: Sie sind voller Schmerz und Gewalt, voller Aufbegehren und Verzweiflung, voller Suche nach und Verweigerung von Verständnis. Hier gibt es keine Götter, die eine mania gesendet haben; der Mensch als des Menschen Wolf hat wider besseres Wollen, und manchmal auch wider besseres Wissen, geistig behinderte Menschen in die Situation des bloßen Objekts versetzt. Und diese Wahrheit von Gewalt und Ausgrenzung verschlägt die Sprache, ist kaum auszuhalten, wird immer wieder verdrängt.
Was sollten wir auch anderes erwarten unter dem Zwang von Verhältnissen, die ständig das auf Natur reduzieren, was sozialer Konstruktion geschuldet ist. Und ganz abgesehen von vorenthaltener Qualifikation, von Arbeitsbedingungen der emotionalen Ausbeutung und u.a.m., selbst gut ausgebildete PsychotherapeutInnen vermögen einem solchen Druck nicht immer standzuhalten. Dies zeigt die Diskussion um Psychotherapie bei Gewaltopfern (vgl. Herman 1993, Farber 1995). Nur allzu leicht werden schmerzhafte Wahrheiten verdrängt oder ausschließlich der Vergangenheit zugeschrieben. Nur allzu leicht wendet sich der Blick von dem oder der Anderen, die mich berühren, zur eigenen Geschichte. Mit der Zentrierung des reflexiven Blickes auf eigene Gewalterfahrungen verliere ich jedoch die Andere als diejenige, die mich berührt in gleicher Weise, als wenn ich die je aufscheinende Gewalt negiere. Empathische Verwirrung im einen und empathischer Rückzug im anderen Fall sind die Modi der Gegenübertragung, welche ins Spiel kommen. Die "Hinreise" zu dem oder der Anderen, ein Begriff von Dorothee Sölle (1975), der sehr schön die ästhetische Berührung einfängt, bedarf einer geordneten Rückreise. Ich muß, obwohl ich nicht im Konkreten verbleiben kann, trotzdem das Konkrete in Form der Berührung so bewahren, daß mir sein möglicher Verlust als ständige Gefahr präsent ist. Psychoanalytisch betrachtet: Ich muß in die Lage gelangen, meine Gegenübertragungen so zu kontrollieren, daß ich auch dann, wo mir auf den ersten Blick der oder die Andere wieder als Ausgangspunkt von Störungen, von Provokationen oder nur als Ort bloßer Natur erscheinen, daß ich auch dann mit eigenen Mitteln erneut zum Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten in der Lage bin, also im Konkreten aufzusteigen vermag. Nur unter diesen Bedingungen wird es mir gelingen, sowohl im diagnostischen Prozeß selbst als auch im praktischen Handeln das Feld der Macht offen zu halten.
Geistige Behinderung bedeutet innerhalb unterschiedlicher gesellschaftlicher Felder jeweils an den Pol der Ohnmacht gedrängt zu werden. Totale Institutionen im Sinne Goffmans (1972) sind nach Bourdieu (1997, S. 43 ff.) lediglich ein Spezialfall von Verschiebungen im "Feld der Macht", bei dem durch extreme Ungleichheit in der Verteilung der Macht alle sozialen Kämpfe aufzuhören scheinen.
Zentrale Voraussetzung und Ziel rehistorisierender Diagnostik ist es, das Feld der Macht zu öffnen und den bisher als Objekt wahrgenommenen geistig behinderten Menschen als mit Vernunft ausgestattetes Subjekt zu betrachten. Er oder sie allein sind in der Lage, meinen Deutungen durch ihre Interpretation Wirklichkeit zu verleihen. Hätte Elke G. meinen Deutungen keine Wirklichkeit verliehen, indem sie diese dialogisch aufgenommen und variiert hätte, so hätte sich meine Position als Gutachter vom Pol der Macht zum Pol der Ohnmacht verschoben. Dies liegt in der Natur der Sache: Nicht immer sind wir einfallsreich genug, klug genug, und manchmal ist die Situation auch gar nicht so, daß wir es sein könnten, um einen Dialog mit einem anderen Menschen zu realisieren. Denn immer gehört zu einer Situation das unverfügbare Recht des Anderen, "Nein" zu unseren Deutungen zu sagen. Erst dieses Recht schafft Freiheit und nur die Garantie von Freiheit schafft die Möglichkeit der Entwicklung.
Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum es unabdingbare Voraussetzung ist, Fachberatungen im Sinne einer rehistorisierenden Diagnostik nur in Anwesenheit derjenigen Menschen durchzuführen, von denen die Rede ist. Daß dies Angst hervorruft, ist selbstverständlich. Wer diese Angst nicht hat, sollte aufhören, pädagogisch zu arbeiten. Und nicht immer liefert die Aktenlage vorweg eine Interpretation, die schon einen Weg sichtbar macht. Aber immer ist es gut, wenn alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, und wenn nicht nur die scheinbar wahrgenommenen Realitäten zum Tragen kommen sondern auch die Phantasien. Dann kann es auch einmal sein, mit einer Gruppe ohne Anwesenheit einer BewohnerIn zu sprechen, aber Gegenstand sind dann die Phantasien der Gruppe, so in meiner letzten Geschichte:
Franz M. war zum Zeitpunkt der Beratung 32 Jahre alt. Konfrontiert mit seinem für sie kaum ertragbaren "autistischen Verhalten" gingen die MitarbeiterInnen seiner Wohngruppe in immer größere Distanz zu ihm. Und immer häufiger regredierte der blinde Franz M. in psychoseähnliche Zustände, durchbrochen von schweren aggressiven und autoaggressiven Ausbrüchen. Gleichzeitig entwickelten die MitarbeiterInnen eine Reihe von Allmachtsphantasien, daß gerade ihr Rückzugsverhalten in besonderer Weise dem Problem angemessen sei. Bei meinem ersten Kontakt mit der Gruppe bekam ich eine fast einstündige Lektion, in welcher Weise die Gruppe die Prinzipien der humanistischen Milieutherapie von Bruno Bettelheim realisiert, bevor erste Fragen zum Gruppenalltag überhaupt aufgenommen und beantwortet wurden. Eine Fachberatung mit einem Kollegen, bei der Herr M. anwesend war, hatte bereits in einem fürchterlichen Chaos geendet, weil sich niemand für die Absicherung von Herrn M. verantwortlich erklärte. Als ich bei meiner dritten Fachberatung zu Herrn M. nun die Toleranz der MitarbeiterInnen erbat, daß er anwesend sein dürfe, war dies nur mit größter Mühe erreichbar. Während die MitarbeiterInnen während des ganzen Gesprächs sich z.T. hektisch wie ein Haufen aufgescheuchter Hühner verhielten, blieb es - trotz meiner mehrfachen entsprechenden Hinweise - gänzlich bei mir, Herrn M.s Gesprächsbeiträge aufzugreifen, zu kommentieren und ihn emotional abzusichern.
Indem ich in der Fachberatung folglich das Feld der Macht zugunsten von Herrn M. geöffnet hatte, wurden die MitarbeiterInnen damit konfrontiert, daß sie selbst restlos ohnmächtig geworden waren und ihre überschießenden Phantasien ersichtlich in keinerlei Einklang mehr mit der Wirklichkeit standen. In einem folgenden Gruppengespräch, diesmal ohne Herrn M., wurde seitens der MitarbeiterInnen die eigene völlige Ohnmacht thematisiert. Ich schlug der Gruppe vor, sich an dieser Ohnmacht zu orientieren und restlos auf die bisherigen Bemächtigungstechniken zu verzichten. Vielleicht wäre es den Versuch wert, das Vertrauen von Franz M. wiederzugewinnen, indem die MitarbeiterInnen konsequent sein Bedürfnis aufgreifen, in jeder Spannungssituation zu baden. Es ehrt die Gruppe, daß sie dies durchgehalten hat: Bis zu elfmal am Tag wurde gebadet und alle waren völlig verzweifelt. Aber langsam kam es dann wie es kommen mußte; Franz M. gewann seine Sicherheit zurück, interessierte sich wieder für äußere Situationen und stabilisierte sich in ganz außerordentlicher Weise.
Niemand hätte voraussagen können, daß dies so erfolgt. Aber vorauszusagen war sicher, daß nur eine Änderung im Feld der Macht Freiheit und damit Entwicklung zu schaffen vermochte. Insofern ist der Schlüssel zu jeder Form von Rehistorisierung der Verzicht auf Gewalt.
Als zwar nicht einzig möglichen aber auch nicht als schlechtesten Schluß meiner Ausführungen erteile ich daher das letzte Wort an die Menge in Brechts "Badener Lehrstück vom Einverständnis" (Brecht 1967, Bd. 2, S. 599):
"Um Hilfe zu verweigern, ist Gewalt nötig.
Um Hilfe zu erlangen, ist auch Gewalt nötig.
Solange Gewalt herrscht, kann Hilfe verweigert werden.
Wenn keine Gewalt mehr herrscht, ist keine Hilfe mehr nötig.
Also sollt ihr nicht Hilfe verlangen, sondern die Gewalt abschaffen."
Boban, Ines; Hinz, A.: Tagungsbericht "I don't feel down!" Sechster Weltkongreß zum Down-Syndrom 23.-26.10.1997, Madrid. Geistige Behinderung, 37 (1998) 2, 186-187.
Bourdieu, P.: Der Tote packt den Lebenden. Schriften zu Politik & Kultur 2. Hamburg (VSA) 1997.
Brecht, B.: Werke in 20 Bänden. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1967.
Farber, Barbara M.: Übertragung, Gegenübertragung und Gegenwiderstand bei der Behandlung von Opfern von Traumatisierungen. Hypnose und Kognition, 12 (1995) 2, 68-83.
Fühmann, F.; Riemann, M.: Was für eine Insel in was für einem Meer? Leben mit geistig Behinderten. Darmstadt (Büchergilde Gutenberg) 1985.
Goffman, E.: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1972.
Herman, Judith: Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. München (Kindler) 1993.
Jantzen, W.: Allgemeine Behindertenpädagogik Bd. 1. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Weinheim (Beltz) 1987.
Jantzen, W.: Deinstitutionalisierung. Geistige Behinderung, 36 (1997) 4, 358-374.
Jantzen, W.: Enthospitalisierung und verstehende Diagnostik. In: Theunissen, G. (Hrsg.): Enthospitalisierung - ein Ettikettenschwindel? Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 1998. 43-61.
Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W. (Hrsg.): Diagnostik als Rehistorisierung. Methodologie und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen. Berlin (Edition Marhold) 1996.
Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, Kristina (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin (Edition Marhold) 1999.
Lurija, A.R.: Reduktionismus in der Psychologie. In: Zeier, H. (Hrsg.): Lernen und Verhalten Bd. 1; Kindlers "Psychologie des 20. Jahrhunderts". Weinheim (Beltz) 1984. 606-614.
Lurija, A.R.: Romantische Wissenschaft. Reinbek: Rowohlt 1993.
Robertson, I.H.; Marshall, J.C.: Unilateral Neglect. Clinical and Experimental Studies. Howe (UK) (LEA) 1993.
Sacks, O.: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Reinbek (Rowohlt) 1987.
Sacks, O.: Der Tag, an dem mein Bein fortging. Reinbek (Rowohlt) 1989.
Sacks, O.: Lurija and "Romantic Science". In: Goldberg, E. (Hrsg.): Contemporary Neuropsychology and the Legacy of A.R. Lurija. Hillsdale, N.J. (LEA) 1990. 181-194.
Sacks, O.: Eine Anthropologin auf dem Mars. Reinbek (Rowohlt) 1995.
Sölle, Dorothee: Die Hinreise. Zur religiösen Erfahrung. Texte und Überlegungen. Stuttgart (Kreuz) 1975.
Theunissen, G. (Hrsg.): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 1998.
Vygotskij, L.S.: The Diagnostics of Development and the Pedological Clinic for Difficult Children. In: Vygotskij, L.S.: The Fundamentals of Defectology. Collected Works. Vol. 2. New York (Plenum-Press) 1993. 241-291.
|
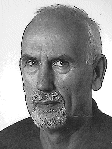
|
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Fachgebiet: Allgemeine Behindertenpädagogik. Jg. 1941, Sonderschullehrer, Diplompsychologe; 1966-1971 Lehrer an einer Sonderschule L., 1971-1974 Studienrat i. H. Philipps-Universität Marburg; seit Mai 1974 Prof. an der Universität Bremen, Aufbau des Lehramtsstudienganges (Beginn 1975) und des Diplomstudienganges Behindertenpädagogik (ab 1985). WS 1987/88 Wilhelm-Wundt-Professor für Psychologie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Zahlreiche Publikationen zu behindertenpädagogischen, psychologischen, neurowissenschaftlichen, soziologischen, anthropologischen und philosophischen Fragen im Rahmen der Entwicklung einer dem historischen und dialektischen Materialismus (und hier insbesondere Vygotskij und seiner Schule) verpflichteten Konzeption der Behindertenpädagogik als synthetische Humanwissenschaft. Vorsitzender der Luria-Gesellschaft. Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Grundlegung der Rehabilitation hirngeschädigter Menschen e. V. |
Schillerstraße 33
D-27711 Osterholz-Scharmbeck,
Quelle:
Wolfgang Jantzen: Rehistorisierung - Zu Theorie und Praxis verstehender Diagnostik bei geistig behinderten Menschen
Erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 6/99; Reha Druck Graz
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 12.05.2010
