Perspektiven für die Selbstbestimmung behinderter Menschen im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und Praktiken ihrer Ermöglichung und Beschränkung
Diplomarbeit im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Bremen, eingereicht bei Prof. Dr. Georg Feuser und Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Institut für Behindertenpädagogik, Bremen Dezember 2002
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Allgemeine Definition des Begriffes "Selbstbestimmung"
- 2. Selbstbestimmung im kulturhistorischen Kontext
- 3. Geschichte, Grundsätze und Forderungen der Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen
- 4. Das Recht behinderter Menschen auf Selbstbestimmung
- 5. Gesellschaftliche Diskurse und Praktiken und deren Beschränkungen für Selbstbestimmung
-
6. Gegenkräfte zur Beschränkung von Selbstbestimmung
- 6.1. Ein verändertes Verständnis von Behinderung
- 6.2. Humanisierung und Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse
- 6.3. Humanisierung und Demokratisierung institutioneller Verhältnisse
- 6.4. Handlungsorientierungen für professionelle HelferInnen: Erhaltung und Wiedergewinnung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten in "Grenzsituationen"
- 7. Schlussbetrachtung
- 8. Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der Abbildungen
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist die Beschäftigung mit der Frage, welche Perspektiven für die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen existieren. Aus den momentanen Bedingungen dafür resultiert ein Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen. In den letzten 30 Jahren hat das Thema Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung zunehmend an Bedeutung gewonnen, einhergehend mit positiven Entwicklungen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Seit den 90er Jahren entwickelte sich dabei auch die Diskussion um Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung. Gleichzeitig sind gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen einschränken. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden diese beiden, zunächst widersprüchlich erscheinenden Entwicklungsrichtungen, als Diskurse und Praktiken der Ermöglichung und Beschränkung dargestellt und aufeinander bezogen. Es wird sich zeigen, dass sie keineswegs zufällig nebeneinander verlaufen. Beide sind Ausdruck grundlegender Entwicklungen im Rahmen einer neoliberalen Variante der modernen Gesellschaft, die sich auf verschiedene Bereiche wie Kultur, Politik und Wirtschaft auswirken. Diese Gesellschaft betont die Freiheit und Gleichheit der Menschen, konstruiert aber gleichzeitig auch Beschränkungen durch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu dieser ideologischen Konzeption. Obwohl sich aus bestimmten gesellschaftlichen Wandlungen Möglichkeiten für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ergeben, bergen diese Möglichkeiten auch die Gefahr, zu blockieren bzw. sich gegen die Wandlungen zu kehren.
Vor einer Darstellung und Diskussion dieser Zusammenhänge soll zunächst der für die Arbeit zentrale Begriff der Selbstbestimmung in seiner allgemeinen Bedeutung näher bestimmt werden. Daran schließt sich ein Blick auf die kulturhistorische Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Selbstbestimmungsbegriffes vom Mittelalter bis in die Gegenwart an. Hiernach werden besonders die Auswirkungen dieser Entwicklung für die Lebenssituation behinderter Menschen im Zusammenhang mit ihren Zugangsmöglichkeiten zur Selbstbestimmung betrachtet. Im weiteren Verlauf stellen diese theoretischen und historischen Grundlagen zum Selbstbestimmungsbegriff den Hintergrund für ein Verständnis aktueller Bedingungen und Entwicklungen dar.
Die Diskurse und Praktiken der Ermöglichung von Selbstbestimmung sollen an verschiedenen Entwicklungen verdeutlicht werden. In den 60er Jahren begannen Menschen mit Behinderung Forderungen nach Selbstbestimmung zu stellen. Sie wandten sich gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung sowie gegen die Einschränkung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen der Abhängigkeitsverhältnisse institutioneller Versorgungsstrukturen der Behindertenhilfe. Daraus entwickelten sich unterschiedliche Selbstbestimmungsbewegungen körperlich und geistig behinderter Menschen, aus denen Grundsätze und Praxiskonzepte für ein selbstbestimmtes Leben hervorgingen. Begleitet wurde dies durch einen Wandel in der Betrachtungsweise und im Umgang mit behinderten Menschen von Seiten der Behindertenpädagogik und Psychiatrie. Getragen durch wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden neue konzeptionelle Leitideen, die sich in Paradigmen wie Normalisierung, Integration, Deinstitutionalisierung und schließlich Selbstbestimmung niederschlugen, und die die alte Praxis der Verwahrung und Förderung in Frage stellten. In dieser Hinsicht haben sich Verbesserungen der Lebenssituation, verbunden mit einem Zuwachs an Selbstbestimmungsmöglichkeiten, ergeben. Auch wenn dies eher auf Menschen mit körperlichen Behinderungen zutrifft, finden etwa seit Mitte der 80er und zunehmend im Verlauf der 90er Jahre Bemühungen statt, auch für geistig behinderte Menschen selbstbestimmte Lebensbedingungen zu realisieren. Selbstbestimmung wird heute, und das zeigt besonders eine Betrachtung ihrer rechtlichen Absicherung auf der Basis verschiedener Gesetzesgrundlagen, als ein Grundrecht behinderter Menschen anerkannt und als solches unter besonderen Schutz gestellt.
Die hier zu verzeichnenden Entwicklungen der Ermöglichung von Selbstbestimmung sind aber eingebettet in andere Entwicklungen, die ihrerseits zu Beschränkung von Selbstbestimmung führen. Die ohnehin mit der institutionellen Versorgungsstruktur der Behindertenhilfe verbundenen eingeschränkten Möglichkeiten der Lebensgestaltung sind davon bedroht, sich mit einer zunehmenden Verknappung finanzieller Ressourcen im sozialen Bereich fortschreitend zu verringern. Im Weiteren werden in einer hiervon abstrahierenden Diskussion um Sterbehilfe sowie in einer Diskussion um Bioethik, Wert und Würde des Lebens behinderter Menschen in Frage gestellt. Hintergrund dieser Entwicklungen ist zum einen eine Transformation des Staatsgefüges im Rahmen einer sich globalisierenden Wirtschaft, deren Folge der Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung ist. Dies tritt als Krise des Sozialstaates in Erscheinung. Zum anderen bilden zunehmend an Popularität gewinnende utilitaristische Ethikkonstruktionen die Grundlage für eine neue "Euthanasie"-Debatte. In diesem Zusammenhang zeigen sich Formen der Instrumentalisierung und der Ablehnung von Selbstbestimmung, die als Legitimation für die Beschränkung von behinderten Menschen dienlich sind.
In Anbetracht dieser zweiten Entwicklungsrichtung wird sich der letzte Teil dieser Arbeit mit möglichen Gegenkräften zur Beschränkung von Selbstbestimmung beschäftigen. Dies soll mit der Darstellung eines entsprechenden Verständnisses von Behinderung beginnen, da vor allem im historischen Rückblick deutlich wird, dass mit verschiedenen Menschenbildern jeweils unterschiedliche Umgangsformen mit behinderten Menschen verbunden sind. Anschließend sollen Veränderungs- und Handlungsmöglichkeiten auf gesellschaftlicher, institutioneller und, damit zusammenhängend, auf der Beziehungsebene betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
Eine erste Definition des Begriffes Selbstbestimmung findet sich im Lexikon, als "die Möglichkeit und Fähigkeit des Individuums, der Gesellschaft oder des Staates, frei dem eigenen Willen gemäß zu handeln und die Gesetze, Normen und Regeln des Handelns selbstverantwortlich zu entwerfen" (BROCKHAUS 1998, S.21). In Bezug auf das Individuum soll im Folgenden, orientiert an den unterschiedlichen Bedeutungsgehalten "Fähigkeit" und "Möglichkeit", Selbstbestimmung genauer bestimmt werden. Die Fähigkeit eines Individuums zur Selbstbestimmung bezieht sich auf konkrete Tätigkeiten des Auswählens. Auf der Grundlage biologischer Theorien zur Selbstorganisation und Autonomie lässt sich das grundsätzlich vorhandene Potenzial des Menschen hierfür zeigen. Da die auswählende Tätigkeit eines Individuums aber unter sehr fremdbestimmenden Bedingungen stattfinden kann, liefert dies noch keine hinreichende Definitionsgrundlage für Selbstbestimmung. Erst in der Betrachtung der Selbstbestimmung als Möglichkeit wird der Begriff genauer bestimmbar. Selbstbestimmung ist dann auf die äußeren Bedingungen des Individuums bezogen, d.h. auf die Möglichkeitsräume eines Individuums bei der Auswahl und Gestaltung seiner Randbedingungen.
Wie angedeutet wurde, ist Selbstbestimmung nicht als spezifische Eigenschaft des Menschen zu beschreiben. Als soziale Kategorie bezieht sie sich auf die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt sowie die darin gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten. In jedem Individuum existiert aber ein allgemeines Potenzial zur Selbstbestimmung, das mit der Eigenschaft der Selbstorganisation lebender Systeme gegeben ist. Eine Theorie der Selbstorganisation im Bereich der Lebewesen wurde von den chilenischen Biologen MATURANA und VARELA (1987) beschrieben. Auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelten sie das Konzept der "Autopoiese" (vgl. S. 50ff), dessen Grundzüge im Folgenden dargestellt werden sollen. Der Begriff Autopoiese stammt aus dem Griechischen und ist abgeleitet aus den Begriffen "autos" (= selbst) und "poiein" (=machen). Nach MATURANA/VARELA ist die Autopoiese das gemeinsame Charakteristikum alles Lebendigen. Sie beschreibt die Organisationsform aller Lebewesen, die sich in einem andauernden Prozess der Selbstherstellung und Selbsterhaltung befinden. Zur Verwirklichung dieser "Organisation" wird eine "Struktur" (S.54) benötigt, die das Lebewesen vom umgebenden Milieu abgrenzt und so überhaupt erst als Einheit kennzeichnet. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur ihm "Offenheit" gegenüber dem angrenzenden Milieu, die es für seinen existenziell notwendigen materiellen und energetischen Austausch benötigt. Jedes lebende System verfügt darum als grundlegendste Bedingung über einen "Rand" (Membran) (S.53). Das Verhältnis von Organisation und Struktur beschreiben MATURANA/VARELA so:
"Ein Lebewesen ist durch seine autopoietische Organisation charakterisiert. Verschiedene Lebewesen unterscheiden sich durch verschiedene Strukturen, sie sind aber in bezug auf ihre Organisation gleich."(MATURANA/VARELA 1990 S. 55)
Während die Organisationsform unveränderlich ist, befindet sich jedes Lebewesen in einem permanenten strukturellen Wandel. Dieser Strukturwandel wird zum einen durch eine "innere Dynamik", zum anderen durch "Interaktionen" mit dem umgebenden Milieu ausgelöst (MATURANA/VARELA 1987, S.84), auf die das Lebewesen zur Realisierung der Selbstherstellung und Selbsterhaltung angewiesen ist. Die Interaktionen führen zu "Pertubationen" (Stör-Einwirkungen) (S. 85) an den Rändern des lebenden Systems, die zu einer Störung des homöostatischen Zustands führen. Dies ruft Aktivitäten des Systems hervor, deren Ziel die Wiederherstellung der Homöostase ist (WAGNER 1995, S.120). Nicht jede Pertubation bringt das System aus dem Gleichgewichtszustand. Nur solche, die für das System "nichttrivial" sind, müssen in "triviale" (JANTZEN 1994, S.120) überführt werden, um damit wieder nahe dem Gleichgewicht zu sein. Gelingt dies nicht, z.B. im Falle "destruktiver Interaktionen" (MATURANA/VARELA 1987, S.108), führt dies zur Auflösung der autopoietschen Organisation und damit zum Tod des Systems. Für die Aufrechterhaltung der Autopoiese muss sich das lebende System an sein Milieu anpassen, "d.h., es muß lernen" (JANTZEN 1994, S. 121). Mit diesen strukturellen Veränderungen ist jedes Lebewesen bestrebt, möglichst effiziente Anpassungen an sein Milieu zu erreichen. Dabei gibt es im Rahmen eines "natürlichen Driftens"(vgl. MATURANA/VARELA 1987, S.127) der Evolution aber nicht die jeweils bessere Anpassung, sondern nur solche, die im Sinne der Aufrechterhaltung der autopoietischen Organisation funktionieren. Strukturveränderungen können damit als die Ontogenese eines Systems, unter Erhaltung der Anpassung und somit unter Erhaltung der Autopoiese, beschrieben werden. MATURANA und VARELA bezeichnen dies als "strukturelle Koppelung" zwischen Lebewesen und Milieu (S. 85ff). Die bei der strukturellen Koppelung stattfindenden Interaktionen haben einen besonderen Charakter. Sie zeichnen sich dadurch aus, "daß die Strukturen des Milieus in den autopoietischen Einheiten Strukturveränderungen nur auslösen, diese also weder determiniert noch instruiert (vorschreibt), was auch umgekehrt für das Milieu gilt"(S. 85).
"Bei den Interaktionen zwischen Lebewesen und Umgebung innerhalb dieser strukturellen Kongruenz determinieren die Pertubationen der Umgebung nicht, was dem Lebewesen geschieht; es ist vielmehr die Struktur der Lebewesen, die determiniert, zu welchem Wandel es infolge der Pertubation in ihm kommt. Eine solche Interaktion schreibt deshalb ihre Effekte nicht vor. Sie determiniert sie nicht und ist daher nicht ‚instruierend', weshalb wir davon sprechen, daß eine Wirkung ‚ausgelöst' wird." (S.106)
Diese Unmöglichkeit der direkten Einflussnahme basiert auf speziellen Eigenschaften autopoietischer Systeme. Im Rahmen ihrer Selbstherstellung und Selbsterhaltung sind sie zum einen "offen" zu ihrer Umgebung, dabei aber "selbstreferenziell" und "operational geschlossen". Dies gilt für organische wie auch für kognitive Bereiche des Systems. Selbstreferenziell heißt, "[d]as System konstruiert sich selbst aufgrund der jeweils historischen Erfahrungen aus den jeweiligen Vorstadien im Rahmen seiner gattungs- und individualgeschichtlichen Möglichkeiten" (JANTZEN 1998, S.122). Operationale Geschlossenheit meint, dass "[i]n der Tiefenstruktur ihrer Selbststeuerung [...] lebende Systeme geschlossen und insofern unabhängig bzw. nicht beeinflussbar sind von der Umwelt" (HOLLSTEIN-BRINKMANN 1992, S.46; z.n. OSBAHR 2000, S.56). Dieser Charakter lebender Systeme "trifft für Einzeller genauso zu wie für Lebewesen mit höchstentwickelten Nervensystemen, wie der Mensch eines ist" (OSBAHR 2000, S.52). Er kennzeichnet Lebewesen als "autonome Einheiten" (MATURANA/VARELA 1987, S.55). MATURANA und VARELA schreiben dazu, dass
"[...]ein System [...] autonom [ist], wenn es dazu fähig ist, seine eigene Gesetzlichkeit beziehungsweise das ihm Eigene zu spezifizieren. [...]. Nach unserer Ansicht ist deshalb der Mechanismus, der Lebewesen zu autonomen Systemen macht, die Autopoiese; sie kennzeichnet Lebewesen als autonom". (ebd.)
Die Autonomie eines Lebewesens bezüglich der Interaktion mit dem umgebenden Milieu ist ebenso gültig für Interaktionen mit anderen Lebewesen. Für die strukturelle Koppelung steht hier der Begriff der "Verhaltenskoppelung" (S.200) oder "Verhaltenskoordination" (S.206). Anstelle des umgebenden Milieus wirken nun ein oder mehrere Lebewesen als Quelle wechselseitiger Pertubationen. Auch in der Interaktion zwischen den Lebewesen haben diese nur auslösenden, nicht instruierenden Charakter. Im Rahmen einer Verhaltenskoppelung können die wechselseitigen Strukturveränderungen der Lebewesen als "Ko-Ontogenese" (S.209) bezeichnet werden, die stattfinden kann, solange die Interaktionen mit der Aufrechterhaltung der Autopoiese und damit der Autonomie der einzelnen Lebewesen verträglich ist.
Das Besondere an dieser Auffassung von Autonomie ist die Verbindung der operationalen Geschlossenheit von Lebewesen bei gleichzeitiger Umweltoffenheit. Im Rahmen der strukturellen Koppelung werden subjektive Konstruktionen der Welt hervorgebracht, die sich aber auf eine konkrete, außen liegende Umwelt beziehen. D.h., dass weder Abbilder der Welt in das Lebewesen eingeschleust werden können, noch, dass, im Sinne des Solipsismus, das Außen nur durch die Konstruktion des Lebewesens existiert (S.146). Damit sind Lernprozesse, wie auch das Verhalten, als Bestandteile der Milieu-Anpassung, Konstruktionen des Lebewesens, die auf der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt basieren. Seine "Autonomie realisiert sich und erweist sich in Auseinandersetzung mit einer höchst differenzierten Umwelt, innerhalb derer das Subjekt selbst bewertet, was es zur Aufrechterhaltung seiner Autonomie für sinnvoll erachtet und was es verwirft" (JANTZEN 1998, S.78). In der Interaktion mit anderen Subjekten wird hieraus ein Akt der Hervorbringung gemeinsamer sozialer Systeme. Durch Ko-Ontogenese, im Rahmen der Verhaltenskoordination, sind Lebewesen wie der Mensch in der Lage, auf der Basis ihrer Autonomie eine soziale Welt zu konstruieren, "in der wir auf den anderen angewiesen sind und die daher das Akzeptieren des anderen voraussetzt" (MATURANA/VARELA 1987, S.15).
Die hier beschriebenen Eigenschaften der Selbstorganisation und Autonomie aller Lebewesen, also auch die des Menschen, in ihrer Entwicklung und bei der Auswahl verschiedener Randbedingungen, sind noch keine hinreichende Definition dessen, was unter Selbstbestimmung zu verstehen ist. Wie sich im Folgenden zeigen wird, wäre dies allein eine unzulässige Verkürzung und Fehlinterpretation des Begriffes. Die autonome Selbstorganisation des Menschen kennzeichnet ausschließlich sein grundsätzliches Potenzial zur Selbstbestimmung und verweist gleichzeitig auf ihre existenzielle Bedeutung für den Menschen.
Als ein sich selbst organisierendes Lebewesen sucht sich der Mensch aus gegebenen Randbedingungen diejenigen heraus, die ihm für seine Autopoiese und Autonomie dienlich sind. Bei einer extremen Einschränkung von Alternativen, kann aber von Selbstbestimmung nicht wirklich die Rede sein. Zwar wird auch in dieser Situation eine durch Autonomie gekennzeichnete Auswahl getroffen, aber unter fremdbestimmten Bedingungen. Die Auswahl unter fremdbestimmten Randbedingungen ist darum nicht Selbstbestimmung, sondern autonome Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der autopoitischen Organisation. Je weniger Alternativen zur Verfügung stehen, desto eingeschränkter sind die Möglichkeiten dafür. JANTZEN (1994) schreibt hierzu, dass
"[...]das lebende System [...] seinem Wesen nach Autonomie [ist]. Je mehr seine Autonomie eingeengt wird, desto mehr wird sein Lebensbereich und damit seine Existenzfähigkeit als Leben eingeschränkt." (S.121ff)
Selbstbestimmung dient damit der Absicherung von Autonomie. Sie ist gekennzeichnet als das Vorhandensein von alternativen Möglichkeiten. Selbstbestimmung kann folglich als Gestaltungsmöglichkeit von Randbedingungen beschrieben werden. Diese erste Festlegung kann noch erweitert werden. Ob ein Mensch selbstbestimmt handelt oder nicht, kann also nicht aus der Beobachtung einer auswählenden Tätigkeit festgestellt werden. Dies gilt sowohl für einen Lernprozess, wie auch für Verhaltensweisen. Die Auswahl an Alternativen kann sowohl auf individueller, wie auch auf gesellschaftlicher Ebene eingeschränkt sein. Ein blinder Mensch in einer fremden Umgebung ohne entsprechende Hilfen, oder der Insasse einer "totalen Institution" (vgl. GOFFMAN 1973), wie z.B. einer Psychiatrie oder einem Gefängnis, wird weiter aus gegebenen Randbedingungen auswählen, aber mit gravierenden Einschränkungen seiner potenziellen Möglichkeiten, die er unter anderen Bedingungen hätte. Da sein Handeln in diesen Verhältnissen nicht selbstbestimmt, aber weiterhin autonom ist, müssen diese beiden Begriffe, entgegen ihrer häufig synonymen Verwendung, deutlich voneinander unterschieden werden. Durch die Tatsache, dass Gestaltungsmöglichkeiten und Alternativen vorenthalten und eingeschränkt werden können, verbindet sich Selbstbestimmung aber mit anderen synonym verwendeten Begriffen wie "Freiheit" und "Emanzipation" (vgl. WALDSCHMIDT 1999, S. 14ff). WALDSCHMIDT schreibt dazu:
"Freiheit impliziert den Gegensatz zur Sklaverei [...], und Emanzipation bedeutet die Freilassung aus oder den Kampf gegen Abhängigkeitsverhältnisse und Entmündigung. Selbstbestimmung dagegen scheint neben der Selbstgesetzgebung noch die Selbstherrschaft zu meinen; sie scheint der Freiheit nicht nur äußere Merkmale, sondern auch positive Inhalte zu verleihen; schließlich impliziert sie wohl nicht nur die Befreiung aus unterdrückerischen Beziehungen, sondern auch die Utopie eines guten Lebens nach dem Emanzipationskampf." (S.15)
In diesem Sinne kann Selbstbestimmung als autonome Tätigkeit eines freien und emanzipierten Menschen unter der Bedingung eines vollen Zugriffes auf individuell und gesellschaftlich potenziell vorhandene Alternativen beschrieben werden. Dabei ist Selbstbestimmung aber keine Kategorie mit absolutem Charakter. Sie findet immer auch eine Grenze innerhalb der Gegebenheiten einer Gemeinschaft. Ausdruck und Inhalt von Selbstbestimmung basieren auf Übereinkünften, die das Leben einer Gemeinschaft regeln. Diese Endlichkeit der Freiheit zur Selbstbestimmung hebt sie aber nicht auf. HAMANN (1998) schreibt in diesem Zusammenhang:
"Jene naturhaften und geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen und Vorgegebenheiten sind sozusagen die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Mensch sich überhaupt frei verhalten kann. Aufgrund solcher Vorgaben, denen gegenüber er sich verhalten muß, ist er erst imstande, das aus sich zu machen, was er wirklich ist. Menschliche Freiheit besteht geradezu darin, daß der Mensch sich zu allem Vorgegebenen verhalten kann und muß, sich darin zu sich selbst verhält und so seine Selbstbestimmung vollzieht." (S.110)
HAMANN verweist im Weiteren darauf, dass auch der Vollzug von Freiheit im Sinne der Selbstbestimmung kein absoluter Anspruch sein kann. Jedem Einzelnen muss es überlassen werden, ob er sich unter den Gegebenheiten als frei und selbstbestimmt empfindet. Das Entscheidende dabei ist nicht, dass die Möglichkeitsräume auch tatsächlich ausgeschöpft sind, sondern dass diese nicht von außen eingeschränkt werden (vgl. ebd). Im Folgenden soll die Betrachtung von Selbstbestimmung unter sozialen Aspekten vertieft werden. Es lässt sich zeigen, dass sich die hier skizzierten Bedeutungsgehalte von Selbstbestimmung sich in einem kulturhistorischen Prozess erst herausgebildet haben, und dass dabei jeweils unterschiedliche Grenzen und Zugangsmöglichkeiten vorhanden gewesen sind.
Inhaltsverzeichnis
Selbstbestimmung wurde im vorigen Abschnitt anhand bestimmter qualitativer und quantitativer Merkmale beschrieben. Solche Vorstellungen von Selbstbestimmung können aber nicht im Sinne einer "universellen Eigenschaft" (WALDSCHMIDT 1999, S.28) menschlichen Denkens verstanden werden. Vielmehr sind solche Bedeutungsgehalte Konstruktionen von Gemeinschaften mit einer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Selbstbestimmung ist eine "überlieferte Kategorie" (ebd.), die sich in historischen Prozessen und im Kontext jeweiliger gesellschaftlicher Bedingungen geprägt hat. Als Kategorie ist sie damit ein Produkt menschlicher Ideengeschichte. Im historischen Rückblick auf diese Geschichte lassen sich sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten verschiedener Bevölkerungsgruppen zur Teilhabe an diesen Ideen feststellen. Insbesondere Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen waren und sind davon bedroht, von der Teilhabe an Selbstbestimmung ausgeschlossen zu werden.
Heutige Vorstellungen von Selbstbestimmung entwickelten sich im Rahmen der Modernisierung von Gesellschaftsordnungen. Mit Beginn der Renaissance und der folgenden Aufklärung (MÜLLER 1988) entstanden sie auf der Basis sich verändernder Welt- und Menschenbilder, die wesentlichen Einfluss auf die Identitätsbildung der Menschen hatten. Ihre Wirkung entfalteten diese Ansätze in den vergangenen beiden Jahrhunderten im "Projekt der Moderne" (WAGNER 1995). Die Identitätsbildung und das Selbstverständnis der Menschen in der vormodernen, mittelalterlichen Gesellschaft kann hiervon grundlegend unterschieden werden. Diese resultierten aus der durch die Kosmologie der damaligen Zeit geprägten, Weltanschauung. Für die Menschen in der traditionellen Gesellschaft gründete die Welt und mit ihr die Gesellschaft der Menschen auf einer "sinnhaften" und "sinnvollen" Ordnung. Diese Ordnung war in der Vorstellung der Menschen geschlossen. Es gab eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten und Plätzen. Die Welt und alle Dinge darin waren die Verkörperung von Ideen, die ein sinnhaftes Schema ergaben. Diese Ideen waren keine zufällige Ansammlung, sondern sie bildeten eine Ordnung, in der jede Idee einen notwendigen Platz besaß (TAYLOR 1999, S.246ff). Für die Menschen vormoderner Gesellschaften war diese Vorstellung wesentlich für ihr Selbstverständnis, und die Frage, was es bedeutete, ein richtiges und erfolgreiches Leben zu führen. Hierbei ging es weniger um individuelle Selbstbestimmung, als vielmehr darum, eine zugedachte Position innerhalb gegebener Strukturen auszufüllen (WALDSCHMIDT 1999, S.29). Die feudalistisch strukturierte mittelalterliche Gesellschaft war in eine Ständeordnung gegliedert. König, Adel, Geistliche und Ritter teilten sich, auf der Basis gegenseitiger Treue, die Macht für die Herrschaft über Bauern und Leibeigene (MÜLLER 1988, S.33ff), die im Rahmen von Dorfgemeinschaften zusammenlebten und den größten Teil der Bevölkerung bildeten (S. 78). Die Menschen sahen sich als Elemente dieser Gesamtordnung, die es durch ihren Beitrag aufrechtzuerhalten galt:
"Der Einzelne strebte danach, eine stabile Position innerhalb der Ordnung der Dinge einzunehmen. Die Erhaltung des Hauses, des Besitzes und der familiären Position war der Zweck des individuellen Daseins. Ziel des Lebens war es, der Ordnung des Seins näher zu kommen, und die Identität galt dann als erfüllt, wenn man den zugedachten Platz in den bestehenden Strukturen angemessen ausfüllte und dafür öffentliche Anerkennung erlangte." (WALDSCHMIDT 1999, S.29ff)
Selbstverwirklichung bestand demnach darin, den Platz, an den man gestellt wurde, "vollständig" und "glanzvoll" (TAYLOR 1999, S.251) auszufüllen. Die Ordnung des Seins als solche hatte eine definierte Form, die durch die Einnahme der Nische, in der man sich befand, zu erhalten war. Die Ordnung wirkte dabei als Orientierungspunkt für die Erfüllung dieser Aufgabe. Sie "ist ein äußerer Horizont, der entscheidend ist für die Beantwortung der Frage, wer ich bin" (S.249). Damit war Selbstverwirklichung keine private, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Jeder trug dazu bei, die Ordnung, in der er lebte, "als eine wesentlich öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten"(S.253). Hieraus resultierte ein hohes Maß an sozialer Kontrolle und das Fehlen von Privatheit in der vormodernen Gesellschaft. Es bestand eine starke Einmischung der Allgemeinheit in das individuelle Leben und Störungen der Ordnung wurden als Angriffe auf die Gemeinschaft gewertet (WALDSCHMIDT 1999, S. 30).
Mit der Epoche der Renaissance begannen sich diese Vorstellungen zu verändern. Grundlage dafür war ein neues Verständnis davon, was die "Natur" ist. Es fand ein Bewusstseinswandel statt, dessen Thema "[...] die Ablehnung einer geoffenbarten oder natürlichen Ordnung und das Einsetzen des Individuums, des Ich, des Selbst als Leitstern des Bewusstseins [war]" (BELL 1990, S. 28). TAYLOR (1999) sieht hier einen radikalen Wechsel im Ort des Denkens. Der "Logos" (S.248) ist nicht mehr in den Dingen gegeben. Das Denken ist etwas, dass sich im Verstand des Subjektes abspielt. Die Natur der Dinge bestand nicht mehr in der Idee, sondern in ihrem "Funktionszusammenhang" (WALDSCHMIDT 1999, S.30):
"Im heraufziehenden Zeitalter der Vernunft ist der Mensch nicht mehr das Element eines bedeutungsvollen Kosmos, das Geschöpf Gottes in einer tiefgründigen Welt, sondern wird zu einem denkenden Wesen mit einem "Verstand", ein Wesen, das sich seine Bedeutungen selbst macht." (S.31)
Für den mit Vernunft ausgestatteten modernen Menschen verlagerte sich der Bezugspunkt seiner Identitätsbildung. Der Horizont der Identität wurde nun im Inneren des Individuums verortet (TAYLOR 1999, S. 249). Die Ausformung der Identität des Menschen war nicht mehr orientiert an einer gegebenen äußeren Welt. Sie wurde geleitet durch die "Erfüllung der Triebe, Ziele und Sehnsüchte, die seine Natur ausmachen" (S.251). Zu diesem Zweck brauchte das moderne Individuum eine Privatsphäre. Das hatte zur Folge, dass die traditionellen Dorfgemeinschaften mit ihren Großfamilien ihre Bedeutung verloren. Das öffentliche Leben der Gemeinschaft trocknete aus und wurde durch die Privatheit der Kernfamilie ersetzt (S.254). Diese Entwicklung stand aber auch in Verbindung mit umfassenderen gesellschaftlichen Veränderungen in Kultur, Wirtschaft und Politik, die wiederum auf der Durchdringung mit den neuen Denkweisen beruhten. BELL (1990) fasst den Bedeutungsgehalt des sich entwickelnden Selbstbestimmungsbegriffs folgendermaßen zusammen:
"Es ist die Behauptung, daß Ziele oder Zwecke nicht ‚in der Natur' gegeben sind, daß der Einzelne und seine Selbstverwirklichung der neue Urteilsmaßstab ist und daß man zur Erreichung dieser Ziele sich selbst und die Gesellschaft verändern kann." (S.23)
Die Durchdringung der Gesellschaft mit den neuen Gedanken vollzog sich aber in einem sehr langsamen Prozess erst nach und nach. Über lange Zeit blieben sie nur auf Teilbereiche der Gesellschaft beschränkt. In der Renaissance war dies vor allem der kulturelle Bereich, der im Bezug auf die Kultur der Antike die neuen "positiven Werte" (MANN/NITSCHKE 1964, S.433) vertrat. Und die sich nach den europäischen Reformations- und Glaubenskriegen dieser Zeit etablierende Herrschaftsform des Absolutismus brachte mit ihrem "Verstaatungsprozess" (MÜLLER 1988, S.109) für den Großteil der Bevölkerung eher unterdrückerische und bevormundende Strukturen hervor. Der Durchbruch der Ansätze des neuen Denkens erfolgte erst mit der Aufklärung (S.120). Die Aufklärungsbewegung wendete sich gegen einen göttlich gegebenen Herrschaftsanspruch des Absolutismus. Die geistige Grundlage dafür war der eindrucksvolle Aufschwung der Naturwissenschaften, der die Entwicklung eines neuen Welt- und Menschenbildes förderte. Die Aufklärung betonte die Vernunft des Individuums, auf die sich sein Anspruch auf Autonomie gründete (vgl. S.121). Die Grundgedanken der Aufklärung entwickelten sich zu einer politischen Theorie des Liberalismus (S.127), die eine wesentliche Antriebskraft für die Überwindung der alten Herrschaftsstruktur war. Diese stand immer mehr im Konflikt zu den sich emanzipierenden Bürgern. Mit der französischen Revolution wurde dann eine grundlegende gesellschaftliche und politische Umgestaltung eingeleitet (S.127). Verbunden mit einem industriellen "take-off" im Verlauf des 19. Jahrhunderts kann dies als Beginn der Moderne angesehen werden (WAGNER 1995, S.24). Die in der Aufklärung entstandenen Leitideen von Freiheit und Gleichheit aller Menschen wurden nun als unveräußerliches, selbstverständliches Menschenrecht aufgefaßt. Erstmals wurde Selbstbestimmung prinzipiell möglich. Trotz dieser "liberalen Utopie" ist aber auch die Moderne gekennzeichnet durch deren "Eindämmung" (S.27).
"Sobald die Aufklärungsidee vom Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ausgesprochen war, erwies sie sich als unkontrolliert, und ihre eigene Dynamik drängte sie über die ursprünglichen Vorstellungen hinaus. [...] In Anbetracht der Furcht, daß die Gesellschaft außer Kontrolle geraten könne [...], wurde eine intellektuelle Auseinandersetzung um die Eindämmung und Schließung des Konzepts, um die Ziehung von Grenzen geführt." (S. 74)
WAGNER (1995) zeigt, dass dieser doppelte Charakter der Moderne in ihrer gesamten Geschichte deutlich bleibt. Er beschreibt dies als Koexistenz der Diskurse von "Freiheit" und "Disziplin", also der Ermöglichung individueller Selbstbestimmung und ihrer strukturellen Einschränkung, welche sich als Paarung in verschiedenen Variationen immer wieder finden lassen (S.12ff). Insofern bleibt auch das Projekt der Moderne weit davon entfernt, sich in reale soziale Praktiken für alle umzusetzen (S.34). Darüber hinaus wird bereits ihr Ende mit einem Übergang in die Postmoderne prognostiziert. Neben der Idee der Emanzipation der Individuen steht die Moderne auch für den Glauben an unbegrenzten Fortschritt in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und an die Vorherrschaft der Rationalität freier und wissender Subjekte bei der Verwirklichung einer schönen Zukunft. WAGNER (1995) schreibt dazu:
"Das Projekt der Moderne ruht auf den beiden grundlegenden Annahmen von der Verstehbarkeit und Gestaltbarkeit (oder Steuerbarkeit) der sozialen Welt. Zu Beginn der Moderne wurden sehr starke und klar formulierte Ideen darüber, wie die soziale Ordnung operierte, mit allgemeinen und weitreichenden Schlußfolgerungen über die Erfordernisse zur Schaffung einer erwünschten derartigen Ordnung verbunden." (S.254)
Diese Vorstellungen der Moderne sind enttäuscht worden, denn "Umweltzerstörung allerorts, Krieg auf Krieg, Hunger und Armut in großen Teilen der Welt sind Teil der Bestandsaufnahme" (JANTZEN 1998, S. 167). In dieser Hinsicht kennzeichnet sich postmodernes Denken, so JANTZEN, notwendigerweise durch die "Destruktion von Utopien"(ebd). D.h., durch das Ende der Entwicklung einer universalisierten Zivilisation, die auf der Grundlage einer eindeutigen Vernunft organisiert ist (und in der, hiermit verbunden, immer auch ein Spaltung zwischen denjenigen, die an der Vernunft teilhaben und denjenigen, die nicht teilhaben, gegeben ist). In diesem Sinne kann WELSCH (vgl SCHLIPPE/SCHWEITZER 2002, S. 81ff) angeführt werden, für den Postmoderne die "Verfassung radikaler Pluralität" auf verschiedenen Ebenen ist. Dies stellen SCHLIPPE und SCHWEITZER so dar:
"[...] eine Gesellschaft mit Differenzen auch in den Grundwerten; ein Individuum, das selbst ‚im Plural lebt', also auch in sich selbst gegensätzliche Ideen und Lebensweisen vereinigt [...]." (S. 81)
Ob mit diesem Denken eine neue Epoche anbricht oder ob es sich nur um eine Variation der Moderne handelt, ist umstritten (vgl. MEIER 1990). Für JANTZEN (1998) bedeutet Postmoderne zunächst "den Zustand und die Erkenntnis, daß die Moderne ihre Versprechen nicht halten konnte" (S.167)[1]. Er hält die sogenannte Postmoderne für sozialwissenschaftlich noch offen (S. 12). Er bemerkt hierzu, dass postmoderne Soziologie und Psychologie noch geschrieben werden müssen (S.175). Insofern bleibt auch offen, welchen Einfluss dieser Übergang auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf die Identitätskonstruktionen der Menschen und, damit verbunden, auf die Konstruktion von Selbstbestimmung haben wird (vgl. dazu WAGNER 1995, S.255).
Vor diesem Hintergrund soll im folgenden Abschnitt die sich mit den gesellschaftlichen Umständen wandelnde Lebenssituation behinderter Menschen betrachtet werden. Dabei sollen insbesondere ihre Partizipationsmöglichkeiten an der Konstruktion Selbstbestimmung hinterfragt werden.
Entstehung und Wandel der Idee der Selbstbestimmung basieren auf Veränderungen der Anschauungen der Welt und der sich mit dieser in Beziehung setzenden menschlichen Identität. Dies verbindet sich aber mit weitreichenden Veränderungen der Gesellschaft im Ganzen. Mit diesen Prozessen in Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ergeben sich, besonders im Verlauf der Moderne, sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten behinderter Menschen zur Selbstbestimmung.
Die vormoderne Vorstellung der Gesellschaft als geschlossene, sinnhafte Ordnung, in der alle Dinge die Verkörperung vorgegebener Ideen darstellen, hatte auch für die gesellschaftliche Position behinderter Menschen und den Umgang mit ihnen eine spezifische Bedeutung. Die "vormoderne Problematik" (WALDSCHMIDT 1999, S. 30) der Behinderung war die Bedrohung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf Sittlichkeit und Moral. Trotzdem musste, im Sinne des mittelalterlichen Weltbildes, auch diesen Menschen ein Platz in der Gemeinschaft zugewiesen werden. Auch eine Behinderung musste, im Kontext einer kosmischen Ordnung, einen Sinn besitzen. Diese Sichtweise wirkte sich in verschiedener Art und Weise aus. Menschen mit leichteren Behinderungen wurden zum "Gegenstand von Nächstenliebe und Mildtätigkeit, waren Sündenböcke und Dorfnarren. Sie hatten ihr von Gott auferlegtes Schicksal zu tragen, übernahmen Aufgaben oder wurden mitversorgt in der Hausgemeinschaft; sie dienten auf Jahrmärkten der Belustigung oder verschwanden hinter Klostermauern"(S.30). Mit schwerer behinderten Menschen, so THEUNISSEN (2000), wurde anders verfahren. Sie wurden, so z.B. durch Luther, als "Wechselbälger" also als "Söhne des Satans" angesehen und verkörperten damit die Idee des "Bösen" in der Gesellschaft. Sie wurden aus der Gemeinschaft verbannt und zusammen mit anderen Ausgegrenzten, wie Kriminellen, Armen, Arbeitslosen, Bettlern oder Landstreichern unter zumeist unwürdigen Umständen interniert (S.20ff).
Durch die Veränderungen der Weltanschauung im Verlauf der Renaissance und durch das Aufkommen des Absolutismus als Herrschaftsform änderte sich die Situation gravierend. In einer Gesellschaftsordnung, die immer mehr als Funktionszusammenhang wahrgenommen wird und nicht länger als sinnhaftes Schema, in dem alles seinen Platz hat, verloren auch leichter behinderte Menschen ihre Nischen im Sinne tradierter Rollen und Aufgaben (WALDSCHMIDT 1999, S.31ff). Sie wurden Teil eines Heeres von "freigesetzten" Bettlern und Landstreichern, das sich durch Kriege und gesellschaftliche Veränderungen des Absolutismus, wie ökonomische Umstrukturierungen des Merkantilismus und Auflösung der mittelalterlichen Ständegesellschaft, bildete. Die Ständegesellschaft war bis dahin in der Lage, die größte Not auf der Basis einer Almosenpolitik zu lindern. Um der neuen Lage, die eine Gefahr für die Sicherheit des Eigentums und die öffentliche Ordnung darstellte, Herr zu werden, trat an ihre Stelle zunächst eine "restriktive Blutgesetzgebung", später dann eine "ökonomisierte Armenpolitik". Diese ersetzte Körperstrafen durch Freiheitsstrafen und Arbeitzwang in Arbeits-, Zucht-, Armen-, Waisen- und Findelhäusern. Solche Maßnahmen betrafen bis zu 25% der Bevölkerung (JANTZEN 1992, S. 47ff). WALDSCHMIDT (1999) bezeichnet diese allgemeine Gefangennahme als "undifferenziert; unterschiedslos umfaßt sie die Verbrecher ebenso wie die Kranken und Gebrechlichen, die Ausschweifenden wie die aus ihren Familien Verstoßenen. Dem allgemeinen Gewahrsam liegt eine Heilungsabsicht fern; äußerer Zwang und sittliche Unterweisung sind seine Mittel" (S.32).
Das Ende des Absolutismus und der Anbruch der Moderne, mit ihren Leitideen wie Freiheit und Gleichheit aller Menschen, veränderten auch den Umgang mit behinderten Menschen ein weiteres Mal. Das geschah aber nicht auf der Basis ihrer Teilhabe an der liberalen Idee der Universalität. Nach WALDSCHMIDT (vgl. 1999, S.33ff) kann die Ursache hierfür darin gesehen werden, dass die Universalität als optimistischer Aufklärungsgedanke der bürgerlichen Revolution, auch als Bedrohung der sich entwickelnden kapitalistischen Ordnung wahrgenommen wurde. Letztere beruht auf der freien Entfaltung einer Waren- und Vertragsgesellschaft. Vertraglich geregelte Tauschbeziehungen zwischen gleichen und freien Subjekten und die Zirkulation von Gütern und Ressourcen sowie von Menschen, die immer mehr in ihrem Wert als Arbeitskraft wahrgenommen wurden, mussten gewährleistet sein. Um diese Ordnung aufrecht zu erhalten, kam es zur Beschränkung des Zugangs zur liberalen Utopie der Selbstbestimmung. Der hier entstehende ideologische Konflikt wurde, so WAGNER (vgl. 1995, S.72ff) gelöst, indem die Vernunft, auf die sich die Autonomie der Individuen begründet, zur Grenzlinie wurde. Diejenigen, die das Projekt der Moderne und die bürgerliche Vorstellung von Gesellschaft gefährdeten, wurden als die "Anderen" außerhalb der Vernunft definiert. Dies betraf insbesondere die niederen, arbeitenden Klassen, die Frauen und die Verrückten. WALDSCHMIDT (1999) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass im Hinblick auf die Konstruktion des Anderen diese Grenzziehung überhaupt als konstitutives Moment der bürgerlichen Gesellschaft angesehen werden kann (S.33). Ein solches Vorgehen ermöglichte es, die Universalität trotz der Beschränkungen als optimistische Einstellung der Aufklärung beizubehalten. WAGNER (1995) meint dazu, dass hier das Recht auf Selbstbestimmung derjenigen eingeschränkt wurde, die als unreif für die Moderne eingestuft wurden. Man konnte argumentieren, dass nicht alle so frei und wissend waren, wie sie es sein sollten und müssten (S.32). Er schreibt dazu:
"Erziehung und/oder Ausschließung waren die Mittel, die diesen Menschen gegenüber anzuwenden waren. Solch ein Konzept setzt offensichtlich voraus, daß einige besser wissen als andere, was natürlich, vernünftig oder gut ist. Diese können dann die anderen zur Einsicht führen; bis diese erreicht ist, wird die volle Mitgliedschaft in der Moderne auf die ersteren beschränkt." (ebd.).
WALDSCHMIDT (1999) zeigt, dass dies für Menschen mit Behinderungen in besonderer Weise zur Geltung kam. Im Gegensatz zu weiteren Gruppen, die als die Anderen der Gesellschaft angesehen wurden, warfen behinderte Menschen eine besondere Problematik auf. Zum einen gefährdeten sie die neue Ordnung, da sie weder ausreichend arbeitsfähig noch vertragsfähig waren und somit nicht in die Zirkulation der bürgerlichen Gesellschaft eintreten konnten, zum andern konnte ihnen keine direkte Schuld für ihre Unfähigkeit und Unvernunft zugewiesen werden:
"Als Unvernünftige sind geistesschwache und verrückte Menschen keine Rechtssubjekte; als Unverantwortliche können sie jedoch auch nicht bestraft werden." (S.36)
In einer Gesellschaftsordnung, in der die Freiheit und Gleichheit aller proklamiert wurde, musste damit ein "modernes System" für den Umgang mit der Problematik der Behinderung gefunden werden. Das absolutistische System der Gefangennahme und Bestrafung schien unangebracht. Zum einen entwickelte sich hieraus das "Institut der Vormundschaft" (S.36). Durch seine "Relaisfunktion" (ebd.) garantierte es die Herstellung von Vertragsbeziehungen auch zu den Unvernünftigen und suggerierte so die Partizipation der Ausgeschlossenen an der Gesellschaft. Zum anderen wurde, neben der Entwicklung erster heilpädagogischer Institutionen (S.37), in Frankreich 1838 ein Gesetz verabschiedet, das die Installation eines psychiatrischen Anstaltswesens vorsah (vgl. CASTEL 1983). In diesem Rahmen kam es, so WALDSCHMIDT (1999), zu einer "zweiten großen Einschließung" (S.33). Diese zeichnete sich durch eine doppelte Bewegung aus. Sie bestand aus einer "Freilassung aus den Zuchthäusern und der Scheidung der eingesperrten Massen in spezielle Personengruppen einerseits und der erneuten Einkerkerung eines großen Teils von ihnen in besondere Anstalten zum Zwecke der Heilung, Erziehung und Besserung andererseits" (S.33ff). Die Internierung behinderter Menschen bekam damit ein anderes Vorzeichen. Ihre Behandlung mit dem Ziel der Heilung und Therapie wurde zur wissenschaftlichen Disziplin. Die Insassen wurden klassifiziert und aufgeteilt, und es wurden spezielle Behandlungsmethoden entwickelt. Aber auch, wenn sich Sinn und Zweck der Unterbringung verändert hatten, war die Lebenssituation für behinderte Menschen weiterhin durch Unterdrückung und Isolation gekennzeichnet:
"Der Umgang der bürgerlichen Gesellschaft mit physisch, geistig und psychisch kranken und geschädigten Kindern und Erwachsenen beruht auf den Elementen der Einsperrung, der Abtrennung dieser Personengruppe von der restlichen Bevölkerung und ihrem Einschluß im Asyl auf der Grundlage eines Dualismus des Normalen und des Pathologischen. Mittels autoritärer, paternalistischer und direktiver Verfahren werden die Betroffenen normalisiert und zugleich stigmatisiert. [...]. Die Organisation der Behandlung bzw. der Erziehung und Bildung in der Form einer großen Einschließung ist krude und nicht subtil, autoritär und nicht liberal, auf die Masse gerichtet und nicht auf das Individuum; sie widerspricht somit wesentlichen Merkmalen der Moderne." (S.38)
Ausschluss und autoritäres Beziehungsgefüge waren Merkmale sowohl der Behindertenanstalten wie auch der psychiatrischen Anstalten. Heilpädagogik und Psychiatrie, als Fachdisziplinen, entwickelten sich auf einem gemeinsamen, an der bürgerlichen Logik ausgerichteten, ideologischen Hintergrund, der die Sichtweise von Behinderung und den Umgang mit ihr prägte. Grundlage von Theoriebildung und Praxis war eine Sicht von Behinderung, die ihren Zusammenhang mit sozialen Faktoren leugnete. Als biologische Ursache bewirkt sie die Bildungsunfähigkeit des Menschen. In Abgrenzung dazu gab es zwar auch andere Denkrichtungen und pädagogische Ansätze, wie die von SEGUIN, der sehr wohl die Zusammenhänge von Behinderung und sozialer Lage sah und der die Bildungsfähigkeit aller Menschen betonte, diese waren aber nicht in der Lage sich durchzusetzen (vgl. JANTZEN 1992, S.49ff). An ihrer Stelle hat sich eine "‚schwarze Pädagogik' entwickelt, wie sie schlimmer nicht sein könnte". Ihre Mittel waren "körperliche Züchtigung, Hunger, Freiheitsentzug, u.U. verschärft durch Händebinden und Einsperren in ein finsteres Zimmer usw. ..." (S. 53). Die Entwicklung der Behindertenpädagogik vor dem Hintergrund einer biologisierenden Sicht von Behinderung fand in der durch die naturwissenschaftliche Medizin geprägten Psychiatrie ihre Ergänzung und Ausformung. Das psychiatrische Denkmodell war dabei stark an das Denken der bürgerlichen Elite geknüpft. Dies enthielt bestimmte Attribute, anhand derer sich moderne Identität und die gesellschaftliche Ordnung entwickeln sollte. Hieraus entstanden Konstruktionen von "Normalität", die auf der anderen Seite in psychiatrische Dogmen von "Pathologie" umschlugen. Dieses Denkmodell wirkt bis heute in Behindertenpädagogik und Psychiatrie bestimmend für Theorie und Praxis. JANTZEN (1992) gibt dazu eine tabellarische Darstellung:

Abb.1: Gesellschaftlicher Störungszusammenhang und Nosologie von psychischer Krankheit und Behinderung (S.58)
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich aus diesen Anschauungen ein Menschenbild, das zwischen der biologisch und sozial hochwertigen "Elite" der Gesellschaft und der biologisch minderwertigen "Masse" (S. 60) unterscheidet. Dieses Menschenbild wird für behinderte Menschen mit dem Aufkommen des Faschismus zur tödlichen Bedrohung und führt insbesondere im Rahmen des deutschen Nationalsozialismus in "Euthanasie"-Programmen zu ihrer Ermordung. TOLMEIN (1990) gibt einen Überblick über Vorbereitung und Durchführung der "Euthanasie". Bereits vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten entwickelte sich die "Euthanasie"-Diskussion in Deutschland. 1920 veröffentlichten BINDING und HOCHE eine Schrift mit dem Titel "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" (S.182). Grundlage ihrer Forderung war die Verbindung zwischen vermeindlich existierendem individuellem Leid und dem angeblichen Nutzen für die Gesellschaft. Der betroffene Personenkreis, der zur Vernichtung freigegeben werden sollte, umfasste unheilbar Kranke, Bewusstlose und unheilbar Blödsinnige (S.183). Obwohl die Aussagen von BINDING und HOCHE von Juristen und Ärzteschaft kritisch gesehen wurden, gab es eine erhebliche Zustimmung bezüglich der Vorschläge zur Zwangssterilisation. Nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933 wurde das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" durchgesetzt (ebd.). TOLMEIN schreibt dazu:
"Künftig konnten nach rechtsstaatlichen Kriterien Menschen aufgrund tatsächlicher oder unterstellter biologischer Eigenarten im ‚Interesse des Ganzen' (und, das wurde immer mitgedacht: in ihrem eigenen Interesse) verstümmelt und um ihre eventuelle Lebensplanung gebracht werden." (S.184)
Auch wenn öffentlich noch vereinzelt Stellung gegen die "Euthanasie" bezogen wurde, fanden in mehreren Anstalten, in denen sich die Lebensverhältnisse durch systematisch gesenkte Plegesätze zunehmend verschlechterten, bereits seit 1933 heimlich "Euthanasie"-Maßnahmen statt. Spätestens ab 1936/37, so TOLMEIN, müssen maßgebliche Ärzte und Politiker zur Durchführung von "Euthanasie"-Aktionen bereit gewesen sein (S.186). Obwohl die "Euthanasie" nie, wie die Zwangssterilisation, eine gesetzliche Grundlage erhielt, gab es in der Folge verschiedene Vernichtungsprogramme. Am Anfang stand die "Kindereuthanasie", bei der, auch durch Unterstützung von Eltern, bis Kriegsende 6000 Kinder ermordet wurden (S.189). Hierauf folgten die Aktion "T4", bei der zwischen 1940 und 1941 etwa 70000 Anstaltsinsassen getötet wurden, die "Sonderbehandlung 14f13", die zur Ermordung etwa 20000 kranker und arbeitsunfähiger KZ-Häftlinge führte und die "Aktion Brandt", mit der sogar über den Tag der Befreiung hinaus weitergemordet wurde (S.190ff). In welcher Weise die "Euthanasie" des Hitler-Regimes durch Ärzte und Anstaltspersonal mitgetragen wurde, wird am deutlichsten bei der "wilden Euthanasie", die nicht mehr zentralen Anweisungen folgte, sondern dezentral betrieben wurde. Während bei der Aktion "T4" die Opfer vergast wurden, starben die Anstaltsinsassen bei der "wilden Euthanasie" durch Verhungern. TOLMEIN merkt dazu an, dass wahrscheinlich mehr Menschen auf diese Weise ermordet wurden als zu Zeiten von "T4" (ebd.). Das die "Euthanasie"-Programme der Nazi-Diktatur trotz vieler Entwürfe nie auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wurden, liegt nach Meinung TOLMEINS daran, dass sie großen Unmut, aber auch Ängste in der Bevölkerung verursacht haben. Ein Gefühl der Bedrohung entstand dadurch, dass immer mehr gesellschaftliche Gruppen (Kriegsversehrte, Alte, Schwerkranke, Asoziale) in die Vernichtung einbezogen wurden. Zum anderen hätte ein Gesetz die Eigendynamik der Radikalisierung der "Euthanasie" gestört (vgl. S. 191ff).
Auch nach dem Terror der Hitler-Zeit kam es zunächst zu keiner fundamentalen Änderung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen. Es vollzog sich eine Rekonstruktion der alten Internierungspolitik:
"So als sei nichts geschehen, werden die großen Anstalten wieder mit Insassen bevölkert, [...] wird ein umfassendes Spektrum an speziellen Institutionen aufgebaut, hinter deren Mauern behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder verwahrt und sonderbehandelt werden. Von Betreuung, Fürsorge, Förderung, ist in jenen Jahren viel die Rede, von Selbstbestimmung und persönlicher Autonomie dagegen nicht." (WALDSCHMIDT 1999, S. 39)
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann sich diese Situation zu verändern. Mit der "kulturellen Revolution" von 1968 veränderten sich auch die Bedingungen der Identitätsbildung der Menschen. Während des Neoliberalismus wurden Forderungen nach Individualität, Pluralität und Liberalität mit der Betonung eines verallgemeinerten Anspruches gestellt. Nach der Eindämmung und anschließenden Schließung sozialer Praktiken kam es zu einer "Wieder-Öffnung" im Rahmen der späten Moderne (S.39). Dies veränderte auch die Situation behinderter Menschen. Die neoliberale Gesellschaft verweigerte ihnen nicht mehr die Teilhabe an ihren Ideen. Menschen mit Behinderung begannen sich zu organisieren und Forderungen zu stellen, die sich gegen Diskriminierung und gesellschaftlichen Ausschluss richteten. Die Selbstbestimmungs- bewegungen wurden begleitet durch Veränderungen der paradigmatischen Ausrichtung im Bereich der Pädagogik und Psychiatrie. HÄHNER (1998a) beschreibt den Wandel mit einem Übergang von der "Verwahrung" über die "Förderung" hin zur "Selbstbestimmung" (S.25). Er wurde getragen von der Bildung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, zu denen die Dogmen der "Endogenität", "Unbildbarkeit", "Unerziehbarkeit", "Unversteh-barkeit" immer mehr im Widerspruch gerieten. Der neue "pädagogische Optimismus" (S.30) brachte einen Aufschwung in der "Rehabilitation", der Förderung und Therapie. Das Durchlaufen einer "Förderkette" (S. 31) sollte den behinderten Menschen an die "normale" Gesellschaft anpassen und ihm Aufnahme und Akzeptanz ermöglichen. Insbesondere dieser Prozess wurde durch die Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen als eigentliches Grundproblem von Behinderung herausgestellt und deshalb abgelehnt. Auch in der Fachöffentlichkeit wurde Behinderung als Problem sogenannter " ‚Isolationskarrieren'(vgl. Kapitel 6.1; Anm. d. Verf.), die mit dem Eintritt in die Frühförderung beginnen und über Sonderkindergärten und Sonderschulen in Werkstätten für Behinderte münden" (ebd.), erkannt. In diesem Zusammenhang wird damit begonnen, der Selbstbestimmung behinderter Menschen eine größere Bedeutung beizumessen. HÄHNER stellt diese Entwicklung in einem Schaubild dar:
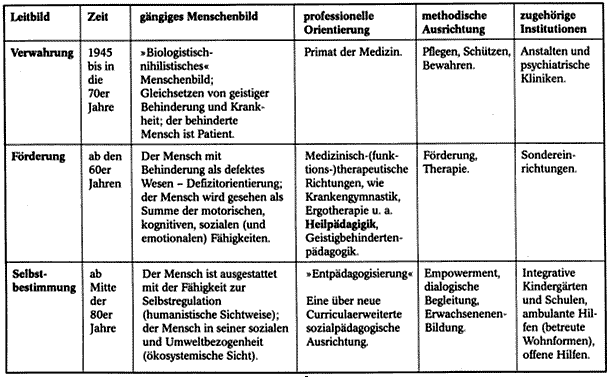
Abb. 2: Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung (S.45)
In Verbindung mit diesem Wandel wurden neue Praxismodelle entwickelt. 1959 formulierte BANK-MIKKELSEN (vgl. NIRJE 1974, S.34) die Grundidee des "Normalisierungsprinzip", die später durch NIRJE (ebd., S.34ff) präzisiert wurde. Es wurden Kriterien festgelegt, anhand derer Menschen mit geistiger Behinderung ihr Leben so normal wie möglich führen sollten. Heute ist das Normalisierungsprinzip als wesentliche Leitidee in die Praxis eingegangen, wenngleich es noch weit von einer Umsetzung entfernt ist (THIMM 1995). Neben dem Normalisierungsprinzip wurde in den 80er Jahren das Konzept der "Integration" entworfen, mit dem der gesellschaftliche Ausschluss behinderter Menschen überwunden werden soll. Dabei darf Integration nicht missverstanden werden als das Einsetzen behinderter Menschen in an sich ausgrenzende Bedingungen. FEUSER (1996a) formuliert sein Grundverständnis von Integration in Beziehung auf das Erziehungs- und Bildungssystem, es ist aber auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragbar. Integration sei:
"[...] die uneingeschränkte Teilhabe an allen regulären Erziehungs-, Unterrichts- und Ausbildungsangeboten, in der Weise, daß jede Person alles auf ihre Art und Weise lernen darf und dazu die Hilfe gewährt bekommt, die im kooperativen Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen als dafür erforderlich erkannt wird. Keine Art und kein Schweregrad einer Behinderung kann ein Kriterium dafür sein, einen Menschen davon legitim auszuschließen" (S.28)
Einen wesentlichen Umbruch in der Praxis des institutionellen Einschlusses stellt die Anfang der 60er Jahre beginnende Psychiatriereform in Italien dar. Vor allem durch BASAGLIA (1971) wurden psychiatrische Anstalten als "Institutionen der Gewalt" gekennzeichnet. Dazu stellte er ihre gesellschaftliche Funktion als Instrument des Ausschlusses sowie ihre Wirkung auf die Insassen dar. Insbesondere problematisierte er dabei die Position des Psychiaters, der als "Techniker" im Dienste der herrschenden Klasse zum "Befriedungsverbrecher" (BASAGLIA 1980) wird, wenn er Funktion und Folgen des institutionellen Ausschlusses verschleiert, indem er beides auf den Defekt eines Menschen zurückführt, und so rechtfertigt und begründet. Entpsychiatrisierungs- und Enthospitalisierungs-bemühungen gab es über Italien hinaus auch in anderen Teilen der Welt, z. B. in den USA (vgl. DAHLFERT 1997) und auch in der BRD (vgl. THEUNISSEN 1996). Mit Beginn der 80er Jahre wurde die Selbstbestimmung als Leitidee in der behindertenpädagogischen Arbeit zunehmend bedeutsamer. Dabei wurde "Behinderung als soziale Abhängigkeit" (HAHN 1981) thematisiert und z.B. durch SPECK (1985) "mehr Autonomie für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung" gefordert. Dieser Wandel wurde maßgeblich durch das Engagement der behinderten Menschen gefördert[2]. WALDSCHMIDT (1999) bemerkt hierzu:
"Es ist eine nachholende Befreiung, eine Befreiung, die andere Gruppen schon längst für sich vollzogen haben, etwa die Arbeiter mit der Gewerkschaftsbewegung und die Frauen mit der feministischen Bewegung. Als einer der letzten Nachzügler unter den bisher von der Idee der Selbstbestimmung Ausgegrenzten reklamiert nun auch die Gruppe der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen elementare Bürgerrechte für sich." (S. 43)
Aus den Betrachtungen über die Möglichkeit des Zugangs zur Selbstbestimmung wird deutlich, dass sie nicht unabhängig von äusseren Bedingungen auftritt. Sie entsteht im Zusammenhang mit bestimmten ideologischen Ausrichtungen der Gesellschaft. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet der Zugang zur Selbstbestimmung einen Wendepunkt in einer weit zurückreichenden Geschichte von der Diskriminierung und Ermordung. Das soll nicht heißen, dass die Geschichte als abgeschlossen gelten kann. Der Neoliberalismus und seine spezifischen Bedingungen und Auswirkungen auf die Gesellschaft haben für die Selbstbestimmung behinderter Menschen verschiedene Wirkrichtungen. Zum einen ermöglicht er ihre Selbstbestimmung, zum anderen bringt er aber auch neue Bedrohungen hervor (vgl. Kapitel 5.2, 5.3 u. 5.4). Es kann aber festgestellt werden, dass sich im Kontext der potenziellen Ermöglichung von Selbstbestimmung und den diesbezüglichgestellten Forderungen behinderter Menschen ihr Auftauchen als "Subjekte in der Geschichte" (WALDSCHMIDT 1999) vollzieht. Im Nachfolgenden sollen Inhalte und Entwicklungen verschiedener Selbstbestimmungsbewegungen betrachtet werden, die u.a. fordern, Selbstbestimmung als Bürgerrecht zu deklarieren.
[1] Nach WAGNER (1995) sind aber auch Übergänge von einer Phase der Moderne in eine andere durch Krisen bezüglich ihrer Verstehbarkeit und Gestaltbarkeit gekennzeichnet (vgl. S. 254).
[2] Die beschriebenen Paradigmen der Behindertenhilfe Normalisierung, Integration, Deinstitutionalisierung, Selbstbestimmung entwickelten sich zwar aufeinanderfolgend, sie ersetzen sich aber nicht und schließen sich nicht gegenseitig aus. Jedes einzelne ist mit seinen Vorstellungen in den anderen aufgehoben und betont einen bestimmten Aspekt. In diesem Sinne bilden Normalisierung, Integration und Deinstitutionalisierung Bezugspunkte für die Leitidee der Selbstbestimmung.
Inhaltsverzeichnis
Parallel zu anderen Bürgerrechtsbewegungen bildeten sich in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, in Teilen Europas und der USA Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen. Wie andere Bürgerrechtsbewegungen dieser Zeit, wie den "Black Panthers" oder der Emanzipationsbewegung amerikanischer Frauen, versuchten sie sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zur Wehr zu setzen. Körperlich und geistig behinderte Menschen organisierten sich. Sie entwickelten Grundsätze für ein Verständnis von Selbstbestimmung sowie Forderungen für Veränderungen ihrer Lebensverhältnisse und deren Umsetzung in der Praxis.
Im Verlauf der 70er Jahre entwickelte sich in den USA die Independent-Living-Bewegung. In ihr organisierten sich vorwiegend körperlich beeinträchtigte Menschen. Durch die Arbeit der Bewegung veränderte sich die Lebenssituation behinderter Menschen in den USA wesentlich. Zuvor stand für diejenigen, die für die Bewältigung des Alltags Unterstützung benötigten, nur ihre "Institutionalisierung" als Lösung zur Verfügung (MILES-PAUL 1992, S.28). Ausgangspunkt für die Bewegung war eine Gruppe behinderter Studierender um ED ROBERTS, der als zentrale Figur genannt wird (S.29ff). Sie erkämpften sich 1962 die Möglichkeit der Zulassung zur University of California in Berkley. Um sich entsprechende Bedingungen zu schaffen, entwickelten sie das "Physically Disabled Studend´s Program" (PDSP), das neben der Beseitigung architektonischer Barrieren auf die Bereitstellung notwendiger Dienstleistungen abzielte. Das ermöglichte ihnen ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde. Nachdem sie die Universität verließen, übertrugen sie diese Strukturen auf ein Dienstleistungssystem für die ganze Gemeinde. 1972 entstand daraus das erste "Centre of Independent Living (CIL)" in Berkley. Von dort entwickelte sich Independent-Living zu einer nationalen Bewegung über die ganzen USA. 1986, so MILES-PAUL (1992), existieren bereits 300 "ILP´s" (S.33).
Die Independent-Living-Bewegung versteht sich in erster Linie als "politische Bürgerrechtsbewegung". Es geht ihr um die Erlangung eines selbstbestimmten Lebens und um die Abschaffung der "Apartheitspolitik", "Segregation" und "Diskriminierung" (WETZEL 1988). Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten lag auf der Durchführung weitreichender Protestaktionen gegen diskriminierende Verhältnisse und dem Engagement für entsprechende gesetzliche Veränderungen (vgl. ebd.). MILES-PAUL (1992) sieht die größten Erfolge in der Verabschiedung zweier Gesetze. Dem "Rehabilitation Act of 1973" (Rehabilitationsgesetz von 1973) und dem "Americans with Disabilities Act of 1990 - ADA" (Gesetz über behinderte Amerikaner/innen von 1990). Diese Gesetze verbesserten die berufliche Eingliederung behinderter Menschen und schrieben die behindertengerechte Veränderung öffentlicher Bauten, Verkehrsmittel und Telekommunikationsmittel vor (S.31ff). Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der ILPs ist die Beratung behinderter Menschen, welche sie bei der Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens unterstützen soll. Dies reicht von der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung bis zur Organisation persönlicher Assistenzen. Die Beratung verläuft in Form von Gesprächen oder Kursen auf der Basis des sogenannten "Peer Support" oder "Peer Counseling". Als Beratungsform von den anonymen Alkoholikern und der Frauenbewegung übernommen, ist das zugrundeliegende Prinzip dabei eine Beratung Betroffener durch Betroffene (S. 24ff). Grundlage dafür ist die Überzeugung, "daß behinderte Menschen selbst am besten wissen, welches die Bedürfnisse von behinderten Menschen sind und wie diesen am besten begegnet werden kann - also die besten Experten in eigener Sache sind" (S. 26). Darüber hinaus können behinderte BeraterInnen als positive "Rollenvorbilder" fungieren, die es bereits "geschafft hatten, den weitverbreiteten Stereotypien über Behinderte und den verschiedensten Einschränkungen, [...], den Kampf anzusagen und ein selbstbestimmteres Leben zu führen" (S.27). Insbesondere für Menschen, die lange in Institutionen der Behindertenhilfe leben, ist dies von Bedeutung. Die Herauslösung aus der Abhängigkeit der traditionellen "Behindertenfürsorge" professioneller HelferInnen wirft viele Fragen und Ängste auf (OSBAHR 2000, S. 124).
An den Aktivitäten der Bewegung wird deutlich, dass Behinderung und die Einschränkung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten von ihr nicht als individuelles, sondern als soziales Phänomen begriffen wird. Ziel der Independent-Living-Bewegung ist es, diesbezüglich grundsätzliche Bürgerrechte auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen geltend zu machen und die dafür notwendigen gesellschaftlichen Bedingungen einzufordern. Zu den Forderungen gehört auch die Veränderung in den Einstellungen und Denkweisen der Öffentlichkeit, der Betroffenen selbst, wie auch der professionellen HelferInnen. DEJONG (1982) stellt Denkweisen der traditionellen "Rehabilitation" denen der Independent-Living-Bewegung gegenüber:
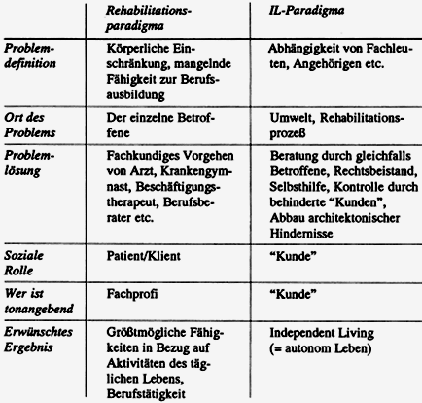
Abb. 3: Gegenüberstellung der Paradigmen von Rehabilitation und Independent-Living (S. 153)
In der Auffassung der Independent-Living-Bewegung besteht die eigentliche Einschränkung der Selbstbestimmung nicht in der körperlichen Beeinträchtigung, sondern in der Abhängigkeit von unzulänglichen sozialen und räumlichen Verhältnissen. Rehabilitation im skizzierten Sinne wird deshalb abgelehnt. Im Besitz der Definitionsmacht und auf der Grundlage eines defektorientierten Denkens verorten die Fachleute das Problem einzig im Betroffenen. Die selbstbestimmte, volle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben soll durch die Beseitigung der körperlichen Einschränkungen erreicht werden. Im Gegensatz zu dieser Einstellung meint WALTHER (1998), dass Behinderung nicht als "Personenmerkmal" anzusehen ist, sondern auf einen entsprechenden "Dienstleistungsbedarf" (S. 74) verweist. Selbstbestimmung darf nicht mit Selbständigkeit verwechselt werden (vgl. auch WETZEL 1988). Nach WALTHER (1998) sollte die Frage nicht mehr lauten: " ‚Wie müssen wir behinderte Menschen fördern, damit sie in unserer nichtbehinderten Gesellschaft so ähnlich wie wir Nichtbehinderten leben können?' sondern: ‚Wie können wir unsere Dienstleistungen ausbauen, damit auch behinderte Menschen - so, wie sie sind - damit in ihr leben können?'" (S.75). Dies kann als Hinweis auf notwendige Veränderungen der Umwelt, vor allem aber auch auf notwendige Veränderungen der Zielorientierungen des professionellen Hilfesystems verstanden werden. Im Hinblick auf ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, stünde dabei "nicht die Quantität der Tätigkeiten, die Behinderte ohne Assistenz ausüben können, sondern die Qualität des Lebens, das Behinderte mit persönlicher Assistenz führen können, im Vordergrund" (MILES-PAUL 1992, S.19). Da behinderte Menschen Experten in eigener Sache sind, muss die Gestaltungsmöglichkeit dieser Assistenzdienste in ihren Händen liegen, um mögliche Abhängigkeiten von Wertesystemen anderer zu minimieren (vgl. Kapitel 6.3.2.).
Den resultierenden Selbstbestimmungsbegriff der Independent-Living-Bewegung formuliert FREHE (1999) wie folgt:
"Selbstbestimmt leben bedeutet, das eigene Leben kontrollieren und gestalten zu können und dabei die Wahl zwischen akzeptablen Alternativen zu haben, ohne in die Abhängigkeit von Anderen zu geraten. Das schließt das Recht ein, die eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, am öffentlichen Leben der Gemeinde teilzunehmen, verschiedene soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen selbst treffen zu können. Selbstbestimmung ist daher ein relatives Konzept, das jeder für sich bestimmen muß." (S.278, zit. n. DELOACH; WILINS 1983)
Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in der BRD stimmt in Grundsätzen, Zielen und Strukturen mit denen der Independent-Living-Bewegung überein und ist, vor allem durch Kontakte Mitte der 80er Jahre, durch deren Arbeit inspiriert. STEINER (1999) stellt dazu aber fest, dass ein Engagement für ein selbstbestimmtes Leben und gegen fremdbestimmende Strukturen für behinderte Menschen bereits weit früher stattfand und die Bewegung in so fern auch auf eine eigene Geschichte zurückblicken kann. Aufgrund der Unzufriedenheit mit den bestehenden Strukturen der Behindertenhilfe begannen vor allem jüngere Behinderte und Nichtbehinderte sich ab 1968 zu organisieren. Sie nannten sich "Clubs Behinderter und ihrer Freunde (CeBeeF´s)" (MILES-PAUL 1992, S 116ff). Einige Jahre später, 1974, begannen GUSTI STEINER und ERNST KLEE Volkshochschulkurse zu geben, in denen sich ebenfalls Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam mit diskriminierenden Bedingungen auseinander setzten. Daraus ergaben sich in der Folge verschiedene öffentliche Protestaktionen (KLEE 1976). In der nächsten Zeit entwickelten sich verschiedene Gruppen, unter denen sich aber ein Streit darüber entwickelte, ob die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Nichtbehinderten in diesen Gruppen sinnvoll ist oder nicht. Ein Teil der Zusammenschlüsse, die sich selbst "Krüppelgruppen" nannten (vgl. CHRISTOPH 1983), waren der Meinung, dass es zunächst einmal um die Bildung eines eigenen Selbstverständnisses und politischen Bewusstseins in Abgrenzung zur "Nichtbehinderten-Normalität" geht (S.30).Denn ob sie es wollen oder nicht: Nichtbehinderte tragen die gesellschaftlichen Strukturen gegenüber Behinderten in die Gruppen (MILES-PAUL 92, S.118), was zu einer Verschleierung bestehender Probleme führen kann. FRANZ CHRISTOPH (1983) drückt dies so aus:
"Das Bekenntnis: ‚Wir sind doch alle behindert!', wird oft hergenommen, um Unterschiede und daraus resultierende Konflikte zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu verdecken. Als Selbstschutz schlage ich vor, in diesen Fällen auf zwei alte, wenn auch häßlich klingende Wörter zurückzugreifen: ‚Krüppel' und ‚Idiot'. [...] Mal sehen, wer sich von den freiwilligen Behinderten dann noch behindert, also Krüppel oder Idiot nennt." (S.104)
Das dies auch auf der sozialpolitischen Ebene als Gefahr gesehen wurde, zeigt sich in einer Protestaktion, die 1981 bei den Feierlichkeiten zum UNO-Jahr der Behinderten auf der Reha-Messe durchgeführt wurde. Mit dem Motto "Keine Reden - Keine Aussonderung - Keine Menschenrechtsverletzungen" wurde die Rednertribüne durch das "Aktionsbündnis gegen das UNO-Jahr" besetzt. Die Kritik am Jahr der Behinderten und der Behindertenpolitik als Teil der Verschleierung tatsächlich bestehender Probleme behinderter Menschen wurde am Ende des Jahres mit dem Abhalten eines "Krüppeltribunals" noch einmal verdeutlicht (MILES-PAUL 1992, S.119).
Zu den ersten Kontakten der Behindertenbewegungen in der BRD mit der Independent-Living-Bewegung kam es 1982. Nachdem die ersten Versuche, ein organisiertes Beratungsangebot aufzubauen, scheiterten, wurde nach amerikanischem Vorbild 1986 das erste "Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZsL)" in Bremen gegründet. Mit weiteren solcher Projekte in anderen Städten entstand 1990 ein nationaler Zusammenschluss der bundesdeutschen Selbstbestimmt-Leben-Initiativen zur "Interessenvertretung selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL e.V.)". Bereits 1989 kam es zur Vernetzung auf internationaler Ebene mit der Gründung des "European Network on Independent Living (ENIL)". Die IsL ist inzwischen zu einer wichtigen politischen Kraft geworden, vor allem in der Bemühung um Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze. Darüber hinaus gibt es Beratungsangebote und eine Förderung von Dienstleistungssystemen für Assistenzen (MILES-PAUL 1992, S. 118ff). Im Weiteren versucht die IsL Grundsätze und Definitionen zu erstellen, die ihren Selbstbestimmungsbegriff schützt. Hiermit sollen klare Kriterien für Organisationen, die diesen Begriff für sich verwenden wollen, geschaffen werden. Das Konzept Selbstbestimmung für behinderte Menschen hat zwar in vielen Bereichen der Behindertenhilfe und Politik an Bedeutung gewonnen. Dabei besteht, so MILES-PAUL (1992), aber die Gefahr der "Verweichlichung der Begriffes" (S. 120), mit der Folge seiner Instrumentalisierung gegen die Interessen behinderter Menschen. Solche Kriterien werden wie folgt beschrieben (vgl. MILES-PAUL 1992, S. 122ff):
-
Gleichstellung und Antidiskriminierung Behinderter: Behinderung ist nicht individuelles Schicksal, sondern Resultat sozialen Unrechts. Sämtliche Diskriminierungen Behinderter müssen abgebaut werden. Dafür muss die Behindertenarbeit reformiert werden und es müssen Gleichstellungsgesetze verabschiedet werden.
-
Abkehr vom medizinischen Krankheitsbild: Behinderte Menschen dürfen nicht in die Rolle des Patienten gedrängt werden. Behinderung ist i.d.R. kein medizinisches Problem, sondern ein Problem ungleicher Machtverhältnisse. Die Definitionsmacht über benötigte Hilfen darf nicht bei den Professionellen liegen. Behinderte sind "Experten in eigener Sache", die ihre Hilfen über Assistenzen selbst organisieren sollten.
-
Integration und Nicht-Aussonderung: Sondereinrichtungen schränken Selbstbestimmungsmöglichkeiten ein. Sie wirken negativ auf Selbstsicherheit und Entfaltungsmöglichkeiten. Behinderte Menschen können mit entsprechender Infrastruktur außerhalb von Einrichtungen Leben. Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung lehnt Sondereinrichtungen prinzipiell ab und arbeitet an Formen nicht bevormundender Dienstleistungssysteme.
-
Kontrolle über die eigenen Organisationen: Behinderte sollen selbst die Kontrolle über ihre eigenen Organisationen haben. In der ISL e.V. z.B. können nur Organisationen Mitglieder werden, deren Vorstandsmitglieder selbst behindert sind. Dies sichert eine inhaltliche Selbstbestimmung und kann zu einem veränderten Bewusstsein der Öffentlichkeit beitragen.
-
Kontrolle über die Dienstleistungen für Behinderte: Behinderte Menschen sollen sich nicht an strukturelle Zwänge von Dienstleistungssystemen anpassen müssen. Die Dienstleistungserbringung muss sich an Perspektiven, Erfahrungen und Bedürfnissen der behinderten Menschen ausrichten.
-
Peer Support - Beratung Behinderter durch Behinderte: Dies ist ein wesendliches Element der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Es ermöglicht über die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung auch eine effektivere Arbeit an Veränderungsprozessen der Gesellschaft.
Auch wenn die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung vorwiegend von Menschen mit körperlichen Behinderungen getragen wird, ist sie aus ihrem Selbstverständnis heraus eine Organisation aller Menschen mit Behinderungen. In einer Resolution der IsL heißt es dazu:
"Unsere Initiativen für ein selbstbestimmtes Leben sind eine behinderungsübergreifende Bewegung, die sich für die Befriedigung der Bedürfnisse von allen behinderten Menschen einsetzt. Um dies zu gewährleisten, müssen wir uns von Vorurteilen befreien, die wir gegenüber Personen mit anderen Behinderungen als unseren eigenen haben und das Engagement anderer unterrepräsentierter Gruppen fördern." (MILES-PAUL 1992, S.152) Laut Angaben von MILES-PAUL sind im Geschäftsjahr 1987/88 innerhalb der amerikanischen Independent-Living-Bewegung in Berkley 17% der KundInnen Menschen mit geistiger Behinderung gewesen (S. 59). Trotzdem begannen geistig behinderte Menschen parallel auch eigene Organisationen zu entwickeln.
Die Gruppen geistig behinderter Menschen, die sich für ihre Rechte auf Selbstbestimmung einsetzen, werden in der Literatur im allgemeinen als Self-Advocacy-Bewegung bezeichnet (vgl. ROCK 1997; KNUST-POTTER 1994). In verschiedenen Ländern finden sich aber vielfältige Bezeichnungen für solche Gruppen. Diese lauten z.B. "People First" und "Advocacy in Action" in Großbritannien, Kanada und den USA (KNUST-POTTER 1994; OSBAHR 2000), "Onderling Sterk" (RIETBERGEN/KOOYMAN 1997, S. 535ff) in den Niederlanden und "Grunden" (STRAND/BERGSTRÖM 1997, S.509ff) in Schweden. Ihren Ursprung hat die Self-Advocacy-Idee in Schweden. Hier gründeten geistig behinderte Menschen in den 60er Jahren, größtenteils selbst organisierte Freizeitclubs. Aus einem Kursangebot, das ihnen die dafür erforderlichen Fähigkeiten vermitteln sollte, entwickelten sich verschiedene Tagungen und Konferenzen, die einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch dienten (ROCK 1997). In der Folge wurde die Idee des Self-Advocacy auch in Großbritannien, Kanada und den USA aufgegriffen. Vor allem in Amerika ist Self-Advocacy als soziale Bewegung vergleichsweise erfolgreich gewesen. ROCK (1997) sieht die Gründe hierfür in der Möglichkeit der Partizipation an den Aktivitäten der Independent-Living-Bewegung und dem dort stattfindenden Einstellungswandel gegenüber behinderten Menschen in Politik, Wissenschaft und Praxis, der zu einer Deinstitutionalisierung von Großanstalten führte (S. 358). KNUST-POTTER (1994) bezeichnet die ständig wachsende Zahl der Self-Advocacy Gruppen als eine der bedeutensten Errungenschaften der Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Sie gründen ihre eigenen Organisationen und wählen ihre eigenen Vorstände (S. 321). In den folgenden Jahren kam es zu nationalen und internationalen Verbindungen der einzelnen Gruppen. 1971 wurde eine erste Konferenz in Großbritannien organisiert. Etwas mehr als 10 Jahre später, 1984, gelang nach Auffassung verschiedener Autoren ein Durchbruch in Bezug auf mehr politisches Engagement und Selbstverständnis der Gruppen. In diesem Jahr wurde in London die "People-First"-Gruppe gegründet. Im September 1988 fand in London erstmals eine internationale Self-Advocacy Konferenz statt, in deren Rahmen sich fast 300 TeilnehmerInnen trafen. An der 3. internationalen Konferenz der People-First-Bewegung, die im Juni 1993 in Toronto stattfand, nahmen bereits 1400 Personen teil (KNUST-POTTER 1994, S.320). Auf der internationalen Ebene organisieren sich die Gruppen im "Comitee Self-Advocacy" der "Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung (ILSMH)" (ROCK 1997, S.357).
Ein Grundsatz in der Organisation der einzelnen Gruppen ist die Eigenständigkeit (ROCK 1997, S. 355) und damit Unabhängigkeit von der Beeinflussung durch Nichtbehinderte. Unabhängigkeit wird im wesentlichen durch zwei Faktoren erschwert. KNUST-POTTER (1994) beschreibt unterschiedliche Organisationsformen der Self-Advocacy-Gruppen. Ein Kennzeichen dabei ist der Grad an Einbindung in verschiedene Organisationen der Behindertenhilfe. Im Gegensatz zu solchen, die völlig unabhängig sind, gibt es andere, die sich innerhalb institutionelle Strukturen organisierten. Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von finanziellen, zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten sowie von der Interessenlage der Gesamtorganisation (vgl. S. 323). ROCK (1996) merkt hierzu an, dass institutionell eingebundene Modelle zwar eine wichtige Vorstufe sein können, insgesamt zeigte sich aber, dass die Einflussmöglichkeiten der Gruppen tendenziell mit ihrer Unabhängigkeit wüchsen. Ein weiterer Faktor ist, dass, im Gegensatz zu Gruppen der Selbstbestimmungs-Bewegungen körperbehinderter Menschen, die Nichtbehinderte prinzipiell ausschließen, an den Self-Advocacy Gruppen sogenannte "Advisors" (ROCK 1997, S. 363) als Assistenz teilnehmen. KNUST-POTTER (1994) schreibt hierzu, dass Selbstbestimmung nicht in fataler Weise mit Selbständigkeit zu verwechseln ist und Unterstützung und Assistenz innerhalb der Gruppen eine wesentliche Bedeutung hat (S. 320). Diese wird von den Self-Advocates aber nicht in Form eines paternalistischen Verhaltens einer Beschützerinstanz gewollt. Sie soll auf der Basis eines gleichberechtigten Miteinanders zweier Personen zur Kompensation von ungleichen Lebenschancen beruhen (KNUST-POTTER 1997, S. 521).
Die inhaltliche Arbeit der Self-Advocacy-Bewegung basiert auf dem grundsätzlichen Recht auf Selbstbestimmung. Nach ROCK (1997) bedeutet Self-Advocacy im wesentlichen, "als Mensch mit einer geistigen Behinderung die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Rechte zu kennen, sie zu äußern und selbst zu vertreten" (S.354). Dies ist gerichtet auf eine individuelle, aber auch politische Interessenvertretung gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Als wichtiges Element wird dabei auch die Vertretung derer gesehen, die noch nicht für sich sprechen können (vgl. KNUST-POTTER 1994, S. 319). Self-Advocacy richtet sich hier zum einen gegen die bislang bevormundenden und defizitorientierten Interaktionsstrukturen gegenüber geistig behinderten Menschen (S.320), zum andern gegen institutionelle und gesellschaftliche Verhältnisse. Das Comitee Self-Advocacy (Komitee Selbstbestimmung) der "Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung" erarbeitete im Juni 1993 in Utrecht (Holland) folgende Grundsatzaussagen[3]:
Zunächst einmal bin ich ein Mensch ! An erster Stelle müssen wir als Menschen und als Personen behandelt werden.
Wir entscheiden ! Wir müssen unsere Entscheidungen selber treffen.
Wir haben ein Recht zu lernen ! Wir müssen Risiken selbst tragen und aus unseren Fehlern lernen.
Wir haben unsere eigene Identität ! Wir sind alle unterschiedlich und unverwechselbar.
Wir haben Namen ! Der Begriff "geistig behindert" wertet uns ab und beschreibt uns nicht.
Wir haben etwas zu sagen ! Ihr müßt uns zuhören, wenn wir uns mitteilen.
Wir wollen gleiche Chancen im Leben ! Unabhängig vom Grad der Behinderung müssen alle Menschen die gleichen Chancen haben und optimal unterstützt werden. Und sie müssen auch gehört werden.
Wir sind etwas wert ! Jeder Mensch ist wertvoll und auch dementsprechend zu behandeln.
Wir haben das Recht, am Leben der Gesellschaft teil zu nehmen ! Keiner soll abgestempelt oder aus dem gemeinsamen Leben ausgeschlossen werden, damit er an erster Stelle ein Mensch sein kann.
Wir wollen so wie alle anderen in der Gesellschaft behandelt werden !
Die Arbeit der Self-Advocacy-Bewegung besteht aber nicht nur in verbalen Forderungen nach Selbstbestimmung. Sie bedeutet auch ein Selbst-Aktiv-Werden gegen existierende Dienstleistungsangebote und Lebensbedingungen (KNUST-POTTER 1997, S.519ff) und ist bestrebt, aus einer passiven Situation herauszutreten und sich an einem Veränderungsprozess zu beteiligen. ROCK (1997) stellt anhand verschiedener Beispiele von Errungenschaften der Self-Advocacy-Bewegung fest, dass es ihr gelang, durch eine Stärkung der eigenen Position Theorie und Praxis zu beeinflussen und Veränderungen auf politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Ebenen herbeizuführen (S.361ff).
In Deutschland kommt es erst seit einiger Zeit zu einer Entwicklung solcher Gruppen (HÄHNER 1998a, S.35). Ein auslösendes Ereignis dafür war der Kongress der Lebenshilfe mit dem Thema "Ich weiß doch selbst was ich will-Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung" vom 27.9.- 1.10.1994 in Duisburg. Aus diesem Kongress resultiert die sogenannte "Duisburger Erklärung", die die Forderungen der geistig behinderten TeilnehmerInnen enthält (vgl. FRÜHAUF 1995; DUISBURGER ERKLÄRUNG 1996). Sie stimmen inhaltlich weitgehend mit den in Utrecht formulierten Grundsatzaussagen überein.
Die Self-Advocacy-Bewegung ist bestrebt, Menschen mit geistiger Behinderung ein neues Selbstbild zu ermöglichen sowie einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft zu initiieren. Sie setzt ein deutliches Signal für den Anspruch des Rechts auf Selbstbestimmung.
[3] Auf dem mir vorliegenden Exemplar sind keine genaueren Angaben für einen Literaturverweis. Einzige Angabe ist die Adresse der BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE e. V.
Inhaltsverzeichnis
In ihren Forderungen reklamieren Menschen mit Behinderungen elementare Menschen- und Bürgerrechte und die selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft. Mit der historischen Perspektive auf die Zugangsmöglichkeiten zur Selbstbestimmung behinderter Menschen wurde verdeutlicht, dass jene in hohem Maße abhängig von ideologischen Strömungen der Gesellschaft sind. Dieser Zusammenhang macht es sinnvoll, Selbstbestimmungsmöglichkeiten in Bezug zu aktuellen Bedingungen der Gesellschaft zu setzen. Es soll zunächst die gesetzliche Verankerung von Selbstbestimmung für behinderte Menschen betrachtet werden und im Anschluss daran die gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurse und Praktiken, die den Rahmen für ihre Verwirklichung bilden.
Eine allgemeine gesetzliche Verankerung von Selbstbestimmung findet sich im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird das "Allgemeine Persönlichkeitsrecht" des Einzelnen folgendermaßen festgelegt:
"Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." (GG, Art. 2 Abs. 1)
Auch wenn im Grundgesetz die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz festgeschrieben ist, wird dies für Menschen mit Behinderungen besonders betont. Nicht zuletzt durch das Engagement von Selbstbestimmungsgruppen behinderter Menschen wurde 1994 ein Zusatz im Grundgesetz aufgenommen:
"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." (GG, Art. 3 Abs. 3 Satz 2)
Um die Umsetzung dieses Benachteiligungsverbots gewährleisten zu können, wurde der Zusatz durch spezielle Gesetzesgrundlagen ergänzt. Das Sozialgesetzbuch und das Bundessozialhilfegesetz treffen hierzu Regelungen für Maßnahmen, die behinderten Menschen eine Rehabilitation und Teilhabe an der Gemeinschaft ermöglichen sollen. Im SGB IX heißt es dazu:
"Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen." (SGB IX, §1)
Eine weitere Gesetzesgrundlage, die die Selbstbestimmung insbesondere geistig behinderter Menschen sichern soll, ist das seit 1992 geltende Betreuungsgesetz (vgl. BÜRGERLICHES GESETZBUCH - BGB), das das Vormundschaftsrecht ablöste. Die Vormundschaft bedeutete die Entmündigung des Betroffenen und mit ihr die Aberkennung jedweder Freiheitsrechte. Im BTG bewirken Regelungen, wie der Erforderlichkeitsgrundsatz oder der Einwilligungsvorbehalt, dass auch im Falle einer gesetzlichen Betreuung ein Großteil der Rechte beim Betreuten bleibt. So bleiben z.B. die Geschäftsfähigkeit und das Recht auf Eheschließung von einer Betreuung unberührt. Das BTG trägt so zur Stärkung des Rechtes auf Selbstbestimmung behinderter Menschen bei.
Am 1.5.2002 ist das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Bundesgleichstellungsgesetz - BGG) in Kraft getreten. Für die Umsetzung des Benachteiligungsverbotes enthält es unter anderem Regelungen zur Herstellung von Barrierenfreiheit, zum Recht auf Verwendung der Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen sowie zur Bestellung eines Behindertenbeauftragten (vgl. ebd.).
Betrachtet man die Umsetzung dieser Gesetzesgrundlagen, so wird deutlich, dass sie noch nicht die Praxis bestimmen. LACHWITZ (1999) verweist hierzu auf verschiedene Gerichtsurteile und Beschlüsse, die das Benachteiligungsverbot betreffen. Die angeführten Beispiele stammen zum einen aus Entscheidungen zum Schulrecht. So entschied der Bayrische Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil vom 11.12.1996, "daß der Freistaat Bayern nicht gezwungen werden könne, Integrationsklassen an Grundschulen einzuführen"(S.79). Dazu hieß es, hierin könne zwar eine Benachteiligung im Sinne des Grundgesetzes gesehen werden, eine zulässige Beschränkung dieses Grundrechtes sei aber aufgrund der verfassungsrechtlich konstituierten Schulhoheit in Betracht gezogen worden. Des Weiteren traf das Bundesverfassungsgericht mit einem Beschluss vom 8.10.1997 die Feststellung, dass die Überweisung einer behinderten Schülerin in die Sonderschule gegen ihren Willen und den ihrer Eltern, keine verbotene Benachteiligung darstelle. Dies ergänzt sich durch ein Beispiel aus dem Privatrecht. Das Oberlandesgericht Köln entschied am 8.1.1998 in einem Nachbarschaftsstreit. Hier wurde dem Kläger darin recht gegeben, dass die Lärmeinwirkung, durch die auf dem Nachbargrundstück wohnenden geistig behinderten Menschen unzumutbar sei. Die Wohneinrichtung wurde dazu verurteilt, an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten Ruhe zu halten (vgl. S. 79ff). Diese Urteile zeigen, "daß Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 GG ins Leere läuft, wenn der Gesetzgeber das Benachteiligungsverbot nicht durch ein Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgesetz konkretisiert" (S.80). In welcher Weise sich in dieser Hinsicht das relativ neue Bundesgleichstellungsgesetz auswirkt, bleibt noch abzuwarten.
Auch in Bezug auf die gesetzlich verankerten Sozialleistungen, die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen sichern sollen, sind beeinträchtige Bestrebungen zu verzeichnen. So werden seit Einführung der Pflegeversicherung von den Sozialhilfeträgern Versuche unternommen, Zahlungen für sog. schwerstbehinderte Menschen auf der Basis der Eingliederungshilfe zu verringern (vgl. dazu LACHWITZ 1998). Auf diese Weise geraten Einrichtungen der Behindertenhilfe unter den Druck, sich in Pflegeeinrichtungen umwidmen zu lassen. Hiermit sind aufgrund der speziellen Vorgaben für Pflegeeinrichtungen aber auch Personalstrukturveränderungen verbunden, was eine Verlagerung von pädagogischen hin zu pflegerischen Fachkräften in der Behindertenhilfe bedeutet. Somit besteht die Gefahr des Verlustes eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Erbringung von Hilfeleistungen für behinderte Menschen. Steht die Pflege anstelle von Eingliederung im Vordergrund, sind Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe in Frage gestellt (S.9ff).
Ebenso muss die Umsetzung des Betreuungsgesetzes, das von seinen Grundlagen her eine positive Wirkung auf die Selbstbestimmungsmöglichkeiten behinderter Menschen verspricht, kritisch betrachtet werden. Wie das Vormundschaftsrecht ist auch das Betreuungsgesetz nach wie vor "Grenzregime" (JANTZEN 1998, S. 34) zwischen den Kategorien "normal" und "anormal", "vernünftig" und "unvernünftig". In diesem Rahmen wird die "Einwilligungsfähigkeit" und "Einwilligungsunfähigkeit" des Betroffenen festgelegt und eine Betreuer bestellt. Dieser "hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu erledigen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten" (vgl. BGB, § 1901). Die Bewältigung dieser Entscheidungsprozesse ist im Rahmen des Betreuungsgesetzes durch individuellere und flexiblere Überprüfungen der Bedarfe und eine höhere Transparenz der Instanzen gekennzeichnet. Trotzdem stellt sich die Frage, wie, bezogen auf die Problematik einer Behinderung, die notwendige Informiertheit, Kompetenz und Einstellung der als Zonen des Grenzregimes an den Entscheidungen beteiligten Gutachter, Richter, Betreuer und Folgeinstitutionen im Sinne der Betroffenen abgesichert ist. Normalität, Vernunft und auch das Wohl des Einzelnen sind keine objektiven Kategorien. Sie sind subjektive Konstruktionen der Gesellschaft oder des Individuums. Die Vorstellungen des Grenzregimes und des Betroffenen können hier weit auseinanderfallen, wobei es für ihn nicht leicht sein wird, seiner Stimme Gehör zu verschaffen (vgl. JANTZEN 1998, S. 35ff). Auch die Einwilligungsunfähigkeit ist kein objektives Kriterium. Ihre Festlegung ist abhängig von den Kompetenzen des Umfeldes eines behinderten Menschen, ihm einen Sachverhalt zu vermitteln und seine darauf bezogenen Äußerungen zu verstehen (LACHWITZ 1999, S. 74ff). Angesichts medizinisch-psychiatrischer Gutachten auf der Basis biologisierenden Denkens, unzureichend ausgebildeter Richter und fremdbestimmender institutioneller Strukturen (JANTZEN 1998, S. 35ff) sowie mangelhafter Unterstützung gesetzlicher Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben (LACHWITZ 1999, S. 70), bleibt das Betreuungsgesetz in hohem Maße umsetzungsbedürftig.
Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen zwar Gesetze für die Sicherung der Selbstbestimmung behinderter Menschen geschaffen wurden, ihre Umsetzung aber unzureichend ist. Auch eine gesetzliche Verankerung des Selbstbestimmungsrechtes bestimmt somit nicht automatisch die gesellschaftliche Realität. Nach LACHWITZ (1999) ist das "Recht [...] ein Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklung" (S. 68). Im Folgenden sollen daher gesellschaftliche Diskurse und Praktiken betrachtet werden, in denen sich Tendenzen zeigen, die die Selbstbestimmung behinderter Menschen bedrohen, in Frage stellen oder sie gegen ihre Interessen instrumentalisieren.
Inhaltsverzeichnis
Die neoliberale Wendung der Moderne ab Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts versprach einen verallgemeinerten Anspruch auf Selbstbestimmung aller Menschen. Auch Menschen mit Behinderungen wurden von diesem Gedanken nicht mehr ohne weiteres ausgeschlossen. Die Ermöglichung von Selbstbestimmung, die Forderungen behinderter Menschen wie auch die gesetzliche Verankerung des Selbstbestimmungsrechtes, ereigneten sich aber nicht im leeren Raum. Die Forderungen machen deutlich, dass sowohl auf gesetzlicher Ebene wie auch im Bereich der institutionellen Behindertenhilfe Einschränkungen der Selbstbestimmung nach wie vor vorhanden sind. Auch wenn sich hier Anzeichen einer Befreiung behinderter Menschen aus Unterdrückung und Ausgrenzung zeigen, verschärfen sich auf anderen Ebenen die Bedingungen. In einer Gesamtbetrachtung gesellschaftlicher Entwicklungen lassen sich, wie in allen Etappen der modernen Gesellschaft, auch im Neoliberalismus neue Formen der Beschränkung von Freiheit und Gleichheit erkennen. Hierfür stehen zunehmend diskutierte Begriffe wie "Sozialabbau", "Neue Euthanasie", "Bioethik und Gentechnik", "Behindertenfeindlichkeit" und "Sterbehilfe". Sie alle betreffen die Selbstbestimmung behinderter Menschen und enthalten auf unterschiedliche Weise ihre Bedrohung, Infragestellung oder Instrumentalisierung. Vor einer genaueren Beschreibung dieser Zusammenhänge sollen im Folgenden, nach einer Darstellung institutioneller Einschränkungen der Selbstbestimmung, gesellschaftliche Entwicklungsprozesse dargestellt werden, die den entsprechenden Hintergrund hierfür liefern.
Hier soll zunächst eine allgemeine Betrachtung der Einschränkungen der Selbstbestimmungsmöglichkeiten in Institutionen gemacht werden. Vom analytischen Standpunkt aus ist dies sinnvoll. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene institutionalisierte Praxisfelder wie Schule, Arbeit und Wohnen abhängig von ihrer Größe oder den in ihnen vertretenen fortschrittlichen oder nicht fortschrittlichen Auffassungen sehr unterschiedliche Bedingungen aufweisen, besteht bei einer fokussierten Betrachtung die Gefahr eines verkürzten Blickwinkels auf die vorhandenen Probleme. Auch GOFFMAN (1973) bezieht sich in seiner Beschreibung "totaler Institutionen" hierauf. Er überträgt die Ergebnisse seiner in einer psychiatrischen Anstalt durchgeführten Untersuchung auch auf andere Institutionen wie Gefängnisse, Konzentrationslager, Kasernen, Schiffe, Internate, Abteien, Klöster u.a.m. (vgl. S. 16). Er schreibt dazu:
"[...]offenbar findet sich keines der von mir beschriebenen Elemente ausschließlich in totalen Institutionen, und keines ist allen gemeinsam. Bezeichnend für totale Institutionen ist, daß sie alle einen beträchtlichen Anteil dieser Gruppe von Attributen aufweisen." (S. 17)
Veränderungsprozesse müssen im Sinne der Selbstbestimmung (vgl. Kapitel 6.3.) einer Analyse der jeweils vorherrschenden institutionellen Praxis auf der Basis einer weitreichenden Kenntnis möglicher Einschränkungen der Selbstbestimmung unterliegen. Eine Grundlage dafür soll sich im Folgenden aus den von GOFFMAN beschriebenen Strukturen und Wirkungen totaler Institutionen ergeben. Dies wird ergänzt durch eine Darstellung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten in Wohnstätten der Behindertenhilfe.
GOFFMAN (1973) legt die zentralen Merkmale "totaler Institutionen" fest:
"1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben. 4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen." (S. 17)
Diese Merkmale sollen das Management einer großen Gruppe von Menschen durch einige wenige ermöglichen. Zu diesem Zweck steht den "Insassen" das "Personal" gegenüber (S.18), dem zur Erfüllung dieser Aufgabe ein gewisses Instrumentarium zur Verfügung steht. Für die Insassen ergeben sich hieraus verschiedene Momente, die im Kern einen "Demütigungsprozess" darstellen. Bereits der Eintritt in die Institution ist für den Neuankömmling durch seine Trennung von der Aussenwelt mit einem "Rollenverlust" (S.25) verbunden. Dieser verstärkt sich durch eine Reihe von "Aufnahmeprozeduren", die den Insassen zum Objekt machen, "das in die Verwaltungsmaschinerie der Anstalt eingefüttert und reibungslos durch Routinemaßnahmen gehandhabt werden kann" (S. 27). Drinnen erwartet den Insassen ein System von Reglementierungen, das Anstaltsabläufe in Form einer "Hausordnung" (S.54) festlegt. Die Anpassung daran stellt eine Bedrohung der "Handlungsökonomie" des Einzelnen dar. Handlungen und Handlungsabläufe können nicht mehr an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet werden, womit "die Autonomie des Handelns selbst verletzt wird" (S.45). Diese Prozesse bewirken, dass der Insasse mit der Organisationsstruktur vertraut gemacht und an diese angepasst wird. Hierüber stellt sich seine Kooperationsfähigkeit, bezogen auf die Interessen der Institution, her. Sie versetzen den Betroffenen damit in eine Situation, in der ihm neben seiner Individualität elementare Selbstbestimmungsmöglichkeiten genommen werden. Ein Auflehnen hiergegen kann vom Personal durch einen Komplex von Mechanismen verhindert werden. Als einer dieser Mechanismen ist das "Privilegiensystem" (S.54ff) zu sehen. Es bezieht sich auf die Einhaltung der Reglementierungen durch die Hausordnung und basiert auf dem Prinzip von Belohnung und Strafe. Für eine entsprechende Kooperation der Insassen werden diese Vergünstigungen in Form von besonderen Arbeits- oder Schlafplätzen, der Zuteilung von Zigaretten und Kaffee oder auch der in Aussicht gestellten Entlassung aus der Institution vergeben. Bei unkooperativen Verhalten können diese zur Strafe aber jederzeit wieder entzogen werden. In der Welt draußen sind viele dieser Vergünstigungen etwas, was im Rahmen der normalen Verfügbarkeit lag. Deshalb stellen Privilegien in totalen Institutionen keine Vergünstigungen dar, "sondern lediglich die Abwesenheit von Entbehrungen, die man normalerweise nicht ertragen zu müssen erwartet" (S.56ff). Allgemein ist das Privilegiensystem auf diese Weise eine effektive Methode, um die Kooperationsbereitschaft der Insassen sicherzustellen. Das Privilegiensystem verknüpft sich mit einer umfassenden Informiertheit des Personals über die Insassen in ihren verschiedenen Lebensbereichen, wie Wohnen, Arbeit und Freizeit. GOFFMAN schreibt dazu:
"In totalen Institutionen sind die Lebensbereiche vermischt, so daß das Verhalten eines Insassen auf einem Schauplatz seines Handelns ihm vom Personal in Form von Kritik und Überprüfung seines Verhaltens in einem anderen Kontext vorgeworfen werden kann." (S.44)
Diese Möglichkeit für das Personal wird zum einen über das Anlegen einer "Fallgeschichte" (S.154) gegeben, die auch das Leben des Insassen vor seinem Eintritt in die Institution mit einbezieht. Dies wird ergänzt durch geführte "Krankenblätter" (S.157), die den Krankheitsverlauf und das gegenwärtige Verhalten des Insassen dokumentieren sollen. Diese Quelle wird gespeist durch formelle Kommunikationsstrukturen, wie den umfassenden Personalbesprechungen, auf denen auch entsprechende Handlungsstrategien bezüglich der Insassen beschlossen werden. Hinzu kommen informelle Kanäle in Form des "Mittags- oder Kaffeepausenklatsches" des Personals. GOFFMAN meint hierzu, dass in sozialen Institutionen stets davon ausgegangen wird, dass "alles, was den Patienten betrifft, irgendwie der rechtmäßigen Befugnis des Personals untersteht" (S.159). Da die Insassen von den Kommunikationsstrukturen des Personals weitgehend ausgeschlossen sind, besitzen sie weder Kenntnis noch Einflussmöglichkeiten darüber, wem welche sie betreffenden Informationen zugetragen werden. In dieser Hinsicht sind sie, unabhängig von Ort, Zeitpunkt und ihrem Gegenüber, ständig der Möglichkeit von Sanktionen ausgeliefert, wodurch sie zu anstaltskonformen Verhalten aufgefordert werden.
In der Interaktion zwischen den Insassen und dem Personal entsteht im Zusammenhang mit den beiden zuvor beschriebenen Mechanismen ein weiterer, der die Kooperationsbereitschaft der Insassen sichern soll. GOFFMAN beschreibt hier Interaktionsmuster, die er "Looping" (S. 43) nennt. In ihrer Grundstruktur lassen sie sich folgendermaßen beschreiben: "Jemand ruft beim Insassen eine Abwehrreaktion hervor und richtet dann den nächsten Angriff gerade gegen diese Reaktion" (ebd.). Die Auflehnung der Insassen gegen die verschiedenen Formen von Demütigungen wird zum Anlass weiterer Reglementierungen, Entzüge von Privilegien oder verunglimpfender Bloßstellungen durch das Personal. JANTZEN (1999b) sieht solche Handlungsstrategien als Teil dessen, was in der Arbeit im sozialen Bereich häufig unter dem Begriff "Beziehungsarbeit" (S.208) verstanden und gerechtfertigt wird. Diese Formen der "Herrschaft mit Samthandschuhen" (S.207ff) haben ihren Ursprung in einer paternalistischen Grundhaltung. Kern des Paternalismus ist es, für sich zu beanspruchen, die "wirklichen Bedürfnisse" anderer Person besser wahrnehmen und erkennen zu können als diese selbst. Mit dem vorgeblich besseren Wissen um die Bedürfnisse des Anderen und dem hieraus resultierenden Anspruch einer höheren moralischen Kompetenz wird gleichsam mitdefiniert, was gut ist für den anderen und was nicht, bzw. wie dies zu erreichen sei. Dies "bringt gleichzeitig eine Sicht der Unterlegenen hervor, die diese nur in Termini dieser Definition als wert und würdig ansieht" (S. 209). Gelingt die Einwilligung der Insassen in solche selbstdefinierten Arrangements, kann aus der paternalistischen Stellvertreterposition sozioemotionaler Gewinn gezogen werden. Das kann über das Umfeld oder über die Betroffenen selbst geschehen. Wird dies zur Motivation der Arbeit, entstehen Problematiken, die SCHMIDTBAUER (vgl. 1997) unter dem Begriff "Helfersyndrom" beschrieben hat. Zentral dabei ist, dass es für den Helfer mit Helfersyndrom zur Regulierung seines Selbstgefühls unumgänglich ist, positive Bestätigung aus seiner Umgebung zu erhalten. Gelingt die Einwilligung unter diesen Umständen nicht, so JANTZEN (1999), "schlägt Sentimentalität in Terror um (S.209). Die folgenden Loopingprozesse werden im Kontext der Beziehungsarbeit anhand von Emphatiezyklen der Zu- und Abwendung gestaltet, die eine Ergänzung zu Zyklen von Bestrafung und neutralen Verhalten darstellen (S.207). Die Insassen, denen für ihre Kooperationsbereitschaft Freundschaft und Gemütsbewegung angeboten wird, unterliegen einer "Doppelstrategie von emotionaler Bestechung und kriminalisierender Ausgrenzung" (JANTZEN 1999a, S.193). Angesichts dieser Strategien bleibt dem Betreffenden kaum etwas anderes übrig, als in die jeweiligen Arrangements der "guten Helfer" einzuwilligen und ihnen zu spiegeln, dass dies aus eigener Überzeugung geschieht. JANTZEN bemerkt hierzu:
"Die unreflektierte Rede von der Beziehungsarbeit der Professionellen als Kern von Wohlfahrt, wie sie auf allen Ebenen dort vorzufinden ist, sollte in Anbetracht der Realität der Machtlosen und realen Strukturen der Beziehungen im Halse stecken bleiben." (S. 194)
Aus den hier beschriebenen allgemeinen Merkmalen totaler Institutionen ergibt sich eine Vielzahl von Bedingungen, die die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Insassen einschränken. Nach dieser allgemeinen Beschreibung soll im Folgenden die konkrete Lebenssituation behinderter Menschen betrachtet werden.
Bei einer Betrachtung der Lebenssituation behinderter Menschen in Institutionen kommt neben den Bereichen Schule und Arbeit dem Wohnbereich m.E. eine besondere Bedeutung zu. Dieser hat einen zentralen Stellenwert für die Ermöglichung oder Beschränkung der selbstbestimmten Lebensführung. Die institutionelle Unterbringung stellt zur Familie[4], vor allem für Menschen mit geistiger Behinderung, meist die einzige Alternative dar. PIEDA und SCHULZ (vgl. 1990) geben einen ausführlichen Überblick über die hier existierenden sehr unterschiedlichen Wohnformen. Es reicht von der geschlossenen Großinstitution bis hin zu offenen gemeindeintegrierten Wohngruppen, die verschiedene Grade an Einschränkung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten für die BewohnerInnen mit sich bringen. Mit Ausnahme weiterer Wohnformen, die den Prinzipien der Selbstbestimmung besser entsprechen, wie selbstorganisierten Wohngemeinschaften oder Einzelwohnungen, weisen sie aber alle in verschiedener Ausprägung die Elemente "totaler Institutionen", wie GOFFMAN sie beschrieben hat, auf. Dabei ist weniger die Größe der einzelnen Wohnformen entscheidend, als vielmehr ihre Organisationsform. BRADL (1996) beschreibt diese in seiner Darstellung zum "institutionellen Betreuungsmodell":
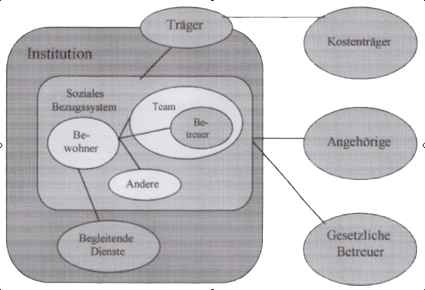
Abb. 4: Institutionelles Betreuungsmodell (S.199)
Dieses Betreuungsmodell hat sowohl für die Großinstitution als auch für die gemeindeintegrierte Wohngruppe, seine Gültigkeit. Für die BewohnerInnen enthält es verschiedene fremdbestimmende Elemente. Eine grundlegende Struktur hierfür ist das sogenannte "Dreiecksverhältnis" zwischen Kostenträger, Einrichtungsträger und Hilfeempfänger (vgl. LANWER-KOPPELIN 1999, S.154). Zahlungen von Mitteln zur Abdeckung des individuellen Hilfebedarfs der BewohnerInnen entfallen nicht direkt an sie. Im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel werden zwischen den Kostenträgern und dem Träger der Einrichtung pauschale Pflegesätze und Personalschlüssel ausgehandelt. Wie diese Vorgaben in der Praxis eingesetzt werden, bleibt der Verfügungsgewalt der Einrichtungsträger überlassen. Die Organisation des Hilfesystems ist im hohen Maße abhängig von der jeweiligen "Trägerphilosophie" (vgl. KRÜGER 1999, S.293f). Diese variiert darin, in welcher Art und Weise die BewohnerInnen betrachtet werden. Dabei kann der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen und Hilfebedarfen im Vordergrund stehen oder seine Behinderung unter pädagogischen, therapeutischen und organisatorischen Aspekten der ausschlaggebende Faktor sein. Letzteres führt in Verbindung mit dem Streben nach einem möglichst rationellen Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen z.B. zur Bildung differenzierter Angebotsstrukturen mit festgelegten, abgestuften Wohnformen (vgl. BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1991) und der Zusammenfassung bestimmter "Fallgruppen" (vgl. BRADL 1996, S.187). Im Resultat vollzieht sich hierdurch eine Erbringung der Hilfen ohne konkreten Bezug zum individuellen Hilfebedarf und zu den Bedürfnissen des Einzelnen. Den BewohnerInnen werden auf verschiedenen Ebenen Mitbestimmungsmöglichkeiten verbaut. Bereits die Aufnahmeprozedur ist davon betroffen. Eine Aufnahme ist abhängig von der Verfügbarkeit eines Platzes und der Frage, ob der Betreffende in die jeweilige Gruppe passt, nicht umgekehrt. Vergrößert sich im Laufe der Zeit der Bedarf an Unterstützung, ist zumeist ein Umzug in eine "angemessenere" Wohnform nötig, womit die BewohnerInnen aufgefordert sind, sich anzupassen, nicht die Einrichtung. Angesichts langer Wartelisten für Wohnstättenplätze ist der Betreffende, wenn er von zu Hause ausziehen möchte oder muss, kaum in der Lage, zu bestimmen wo, mit wem und mit wie vielen er zusammenwohnen will. Die Probleme solcher Zwangsgemeinschaften vergrößern sich noch bei einer Unterbringung in Doppel- oder Mehrbettzimmern, die eine Entfaltung der Persönlichkeit und die Wahrung der Intimsphäre besonders erschweren. Im Weiteren bestehen innerhalb solcher Organisationsstrukturen für die BewoherInnen kaum Einflussmöglichkeiten darauf von wem sie betreut werden. Dadurch entsteht eine große Abhängigkeit von der Kompetenz und der "Betreuermentalität" (PIEDA/SCHULZ 1990, S.73) der jeweiligen MitarbeiterInnen der Wohnstätten. Obwohl die Aufgaben durch den institutionellen Auftrag, die Aufsichtspflicht und die Organisation des Gruppenalltags geregelt sind, besteht eine relative "Unbestimmtheit" (METZLER 1988, S. 106) hinsichtlich deren Umsetzung. Angesichts möglicher arbeitsrechtlicher Konsequenzen sind die MitarbeiterInnen im Zweifelsfall zur Loyalität gegenüber dem Einrichtungsträger, nicht gegenüber den BewohnerInnen, verpflichtet oder haben sich hierbei mit gesetzlichen Betreuern und Angehörigen auseinanderzusetzen. Greifen die MitarbeiterInnen zur Bewältigung oder Abwehr solcher Loyalitätskonflikte[5] auf die Konstruktion eines Privilegiensystems oder auf Loopings zurück, können die BewohnerInnen , bedingt durch das fehlende Mitspracherecht bei der Personalbesetzung, dem kaum aus dem Weg gehen. Ein weiteres Element der Fremdbestimmung, das im Zusammenhang mit dem Personal entsteht, ist deren Arbeitsorganisation im Schichtdienstmodell. Dieses sieht zumeist eine Einteilung des Personals in Früh-, Spät- und Nachtdienste vor. Die Erbringung von Hilfen ist, bezogen auf Zeitpunkt, Dauer, Ort und Person an Schichtwechsel und Schichtende gebunden. Das schränkt eine den individuellen Bedürfnissen und Hilfebedarfen der BewohnerInnen entsprechende, kontinuierliche Betreuung, besonders in Verbindung mit Teilzeitbeschäftigung und geteilten Diensten (vgl. BRADL 1996, S. 189), ein. Die Organisation von alltäglichen Abläufen, wie Mahlzeiten, Schlafenszeiten oder Freizeitgestaltung sind durch die Arbeitszeiten der MitarbeiterInnen strukturiert. Zusätzlich macht das Schichtdienstmodell einen umfangreichen Informationsaustausch über die BewohnerInnen notwendig, um die MitarbeiterInnen im Alltag handlungsfähig zu machen. Hierzu gehören z.B. Dienst- und Tagebücher, Aktennotizen, Dienstübergaben und Dienstbesprechungen des Personals. Werden solche Kommunikationsstrukturen auf die Bereiche Arbeit und Freizeit ausgedehnt, entsteht das von GOFFMAN problematisierte Zusammenfließen der Lebensbereiche. Auch in gemeindeintegrierten Wohnformen, in denen Wert auf die Trennung dieser Lebensbereiche gelegt wird, entsteht so, zumindest auf der Ebene des Informationsflusses, eine Aufhebung dieser Trennung. Den BewohnerInnen, die von der umfassenden Kommunikationsstruktur der MitarbeiterInnen weitgehend ausgeschlossen sind, fehlen neben der Kontrolle, wem welche persönlichen Informationen zugänglich sind, auch transparente Einblicke in die organisatorischen Belange der Wohnstätte sowie in die von den MitarbeiterInnen entwickelten Handlungsstrategien. Einfluss durch Mitsprache wird dabei nicht nur vorenthalten, den BewohnerInnen wird auch die Möglichkeit genommen, sich hierfür notwendige Kompetenzen anzueignen.
In den Strukturen der Institutionen, die nach dem von BRADL gezeichneten Betreuungsmodell funktionieren, lassen sich die von GOFFMAN beschriebenen Merkmale totaler Institutionen wiederfinden. Sie zeigen sich in der Unterordnung unter den durch die Trägerphilosophie bestimmten institutionellen Plan und der damit verbundenen organisatorischen Ausgestaltung des Hilfesystems sowie dem Zusammenfließen der Lebensbereiche durch die umfassende Informiertheit des Personals. Durch die verschiedenen Abhängigkeitsverhältnisse im Geflecht der Institution besteht immer die Möglichkeit, dass die Bedürfnisse der BewohnerInnen hinter denen der Einrichtung und der BetreuerInnen zurücktreten müssen. Demütigungsprozesse durch Einschränkung der Selbstbestimmung sind dem System immanent. D.h., selbst in den am fortschrittlichsten denkenden und der Selbstbestimmung der BewohnerInnen verpflichteten Einrichtungen bleiben im Rahmen der beschriebenen institutionellen Struktur fremdbestimmende Elemente erhalten. Andererseits kann auch bei Wegfall der strukturellen Einschränkungen die Beziehung der BewohnerInnen zu den BetreuerInnen, durch deren Handlungsstrategien fremdbestimmend wirken. Beide Aspekte, sowohl die Struktur wie auch die Beziehungsebene sind im Sinne der Selbstbestimmung der BewohnerInnen zu bearbeiten. Dies wird aber nicht selten, bewusst oder unbewusst, verleugnet. THEUNISSEN (2001a) schreibt dazu, dass die meisten Betreiber von Wohneinrichtungen für behinderte Menschen davon überzeugt sind, "daß es sich hier um ein "Refugium" handle, welches den Bewohnerinnen und Bewohnern Menschlichkeit, Schutz, Sicherheit und Geborgenheit und neuerdings auch eine von vielen Betroffenen eingeforderte Lebensgestaltung in weitgehenster Selbstbestimmung bietet" (S. 137). JANTZEN (1999b) erklärt dies damit, dass der Begriff "totale Institution" anscheinend nicht analytisch angewendet wird, sondern einzig mit Bildern der Massenunterbringung oder früheren Formen der Anstaltspädagogik assoziiert ist. Damit dient er als Mittel der Abgrenzung gegenüber dem, was man nicht mehr will, aber auch an der eigenen Praxis nicht mehr wahrnehmen möchte (S.206). Totale Institutionen sind aber nicht Ausdruck einer baulichen Struktur, sondern einer Organisationsform. In dieser Hinsicht ist er nicht durch den Ort bestimmt, sondern durch ein spezifisches soziales Verhältnis (JANTZEN 1998, S.119).
Nach den Betrachtungen zu Selbstbestimmungsmöglichkeiten im institutionellen Bereich der Behindertenhilfe soll ein Blick auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen folgen. Der historische Rückblick hat gezeigt, dass gesellschaftliche Strömungen wesentlichen Einfluss auf die Zugangsmöglichkeiten behinderter Menschen zur Selbstbestimmung haben. Auch in Verbindung mit ihrer Bedeutung für die Lebensbedingungen in Institutionen.
Der Diskurs zur neuen "Euthanasie"-Debatte entwickelte sich unter anderem im Zusammenhang mit dem von SINGER (1994) gelieferten Entwurf einer "Praktischen Ethik". Eines seiner Hauptanliegen hierbei war, die Frage der "Euthanasie" für bestimmte Personengruppen neu zu stellen und Gründe für ihre Legitimierung zu liefern. SINGER diskutiert dabei auch die Selbstbestimmungsmöglichkeiten behinderter und alter Menschen, um einen Angriff auf deren Lebensrecht zu rechtfertigen. Im Anschluss an die Darstellung der Thesen SINGERs soll die "Euthanasie"-Debatte in der BRD skizziert werden.
SINGER findet den Ansatz für seine Ethikkonzeption in den Vorstellungen des Utilitarismus. Er bezieht sich dabei vor allem auf BENTHAM und MILL. Der Utilitarismus entwirft seine Moral und Ethik an der Formel: "Tu, was Glück vermehrt und Leiden vermindert" (S.17). Richtiges Handeln ist damit einem Nützlichkeitsdenken unterworfen, dessen Richtschnur eine "Glücksbilanz" ist. Diese individuelle Entscheidungsgrundlage wird universalisiert und auf eine gesellschaftliche Ebene übertragen. Hierfür steht das "Prinzip der gleichen Interessenabwägung".
"Anstelle meiner eigenen Interessen habe ich nun die Interessen aller zu berücksichtigen, die von meiner Entscheidung betroffen sind. Dies erfordert von mir, daß ich alle diese Interessen abwäge und jenen Handlungsverlauf wähle, von dem es am wahrscheinlichsten ist, daß er die Interessen der Betroffenen weitestgehend befriedigt. Also muß ich - wenigstens auf einer bestimmten Ebene meiner moralischen Überlegungen - den Handlungsverlauf wählen der per Saldo für alle Betroffenen die besten Konsequenzen hat." (S.30)
Die Glücksbilanz, deren Steigerung zum größten Glück der größten Zahl an Menschen führen soll, lässt sich nach SINGER auf zweierlei Art und Weise verbessern: Zum einen durch die Vermehrung von Lust oder die Verminderung von Schmerz bei existierenden Wesen ("Vorherige-Existenz"-Ansicht), zum anderen durch Vermehrung der Zahl von Wesen, die Lust empfinden sowie durch die Verminderung der Zahl von Wesen, die Schmerz empfinden ("Totalansicht") (S.139ff). Vor diesem Hintergrund geraten nicht nur z.B. schwer kranke und alte Menschen, die sich als leidend empfinden, unter Druck, über den Wert ihres Lebens nachzudenken (anstatt über unzureichende Versorgungsstrukturen, die Leiden erst verursachen). Insbesondere behinderte Menschen kommen durch solche Argumentationen in Lebensgefahr. Ihnen aus einer unhaltbar subjektiven Position heraus unterstellte Leiden werden im Sinne eines "Tödlichen Mitleids" (DÖRNER 1989) zur Begründung, ihr Leben beenden zu dürfen. Seine Argumente dafür versucht er noch einmal durch ein "Ersetzbarkeits-Argument" (SINGER 1994, S. 238) zu untermauern. Dies besagt, dass die Beendigung des Lebens eines behinderten Säuglings nicht nur die Gesamtsumme des Glücks erhöht, sonder auch zur Geburt eines "gesunden" Säuglings führen kann, der sonst nicht gezeugt worden wäre. In wesentlichen Zügen ist dies die Grundlage, auf der SINGER nach Rechtfertigungen für die "Euthanasie" all derjenigen sucht, die in seinen Augen die Gesamtsumme des Glücks negativ beeinflussen. SINGER unterscheidet dafür zwischen drei Arten von "Euthanasie" (S. 226ff). Der "nichtfreiwilligen", der "freiwilligen" und der "unfreiwilligen Euthanasie".
"Nichtfreiwillige Euthanasie" bezeichnet nach SINGER das Töten von Menschen, die "die Fähigkeit, ihrem Tod zuzustimmen, nicht haben, weil sie die Wahl zwischen der Fortsetzung ihrer Existenz und ihrer Nicht-Existenz nicht zu verstehen vermögen" (S.257). Insofern unterscheidet er sie von der "unfreiwilligen" Euthanasie. Seine Rechtfertigung für die "nichtfreiwillige" Euthanasie begründet er aus dem Präferenz-Utilitarismus, einer Variante des klassischen Utilitarismus.Diese Form des Utilitarismus betont in besonderer Weise die Präferenz einer Person bei einer Interessenabwägung:
"Nach dem Präferenz-Utilitarismus ist eine Handlung, die der Präferenz irgendeines Wesens entgegensteht, ohne daß diese Präferenz durch entgegenstehende Präferenzen ausgeglichen wird, moralisch falsch. [...] Für Präferenz-Utilitaristen ist die Tötung einer Person in der Regel schlimmer als die Tötung eines anderen Wesens, weil Personen in ihren Präferenzen sehr zukunftsorientiert sind." (S.128ff)
Im letzten Satz dieses Zitates wird das Kriterium für die Rechtfertigung des Tötens angerissen. Dies ist verbunden mit der Kategorie "Person". Nach SINGER ist eine Person darüber definiert, dass sie sich als "distinkte Entität" (S.123) mit Zukunft und Vergangenheit in der Zeit existierend wahrnehmen kann, also mit Selbsterkenntnis ausgestattet ist, und dass sie darüber hinaus die Fähigkeit besitzt, sinnvolle Beziehungen zu anderen zu knüpfen. Nur eine Person mit diesen Eigenschaften könnte den Wunsch haben weiter zu existieren und "deshalb könnte nur eine Person ein Recht auf Leben haben" (S.131). Diese Kriterien für den Personenstatus sind laut SINGER nicht an die Spezies Mensch gebunden. Für ihn kann es Menschen geben, die keine Personen sind, sowie Personen, die keine Menschen sind. Dazu schreibt er:
"Ein Schimpanse, ein Hund oder ein Schwein etwa wird ein höheres Maß an Bewußtsein seiner selbst und eine größere Fähigkeit zu sinnvollen Beziehungen mit anderen haben als ein schwer zurückgebliebenes Kind oder jemand im Zustand fortgeschrittener Senilität. Wenn wir also das Recht auf Leben mit diesen Merkmalen begründen, müssen wir jenen Tieren ein ebenso großes Recht auf Leben zuerkennen oder sogar ein noch größeres als den erwähnten zurückgebliebenen oder senilen Menschen." (SINGER 1982, S.40; zit. n. FEUSER 1995, S.58)
SINGERs (1994) Logik für die Begründung der "nichtfreiwilligen" Euthanasie kann hiernach kurz zusammengefasst werden. SINGER hebelt das allgemeine Menschenrecht auf Leben aus und ersetzt es durch das gattungsübergreifende Freiheitsrecht der einzelnen Person. Er definiert, wer überhaupt eine Person ist. Für die, die aus dem Personenstatus hinausdefiniert werden, werden Selbstbestimmungsmöglichkeiten und -rechte negiert. Wer keine Person ist, kann, da er nicht selbstbestimmungsfähig ist und ohnehin kein Recht auf Leben hat, moralisch unbedenklich getötet werden. Er schreibt dazu:
"Wenn ein Wesen unfähig ist, sich selbst als in der Zeit existierend zu begreifen, brauchen wir nicht auf die Möglichkeit Rücksicht zu nehmen, daß es wegen der Verkürzung seiner künftigen Existenz beunruhigt sein könnte." (S.125).
Und an einer anderen Stelle:
"Der Kern der Sache ist freilich klar: die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht" (S. 244).
Wer für eine "nichtfreiwillige Euthanasie" in Frage kommt, gibt SINGER in verschiedenen Beispielen an. Zu ihnen gehören Kinder mit Behinderungen wie Down-Syndrom, Hämophilie oder Spina bifida und ebenso Menschen im Koma, Menschen mit Hirnverletzungen und alte Menschen. Für sie (wie auch für die "Glücksseligkeit" der Gesellschaft; Anm.d.Verf.) stellt der Tod, nach Meinung SINGERs, einen Vorteil dar (vgl. S.247).
Dies gilt für ihn auch in Bezug auf die "freiwillige Euthanasie". Sie bezieht sich auf solche Menschen, die "die Fähigkeit haben, zwischen der Fortsetzung ihres Lebens und dem Tod zu wählen und eine wohlinformierte, freiwillige und sichere Entscheidung treffen, zu sterben" (S. 257). Es geht um die ethische Begründung der Sterbehilfe (vgl. Kapitel 5.4.2.) für Menschen, denen per Definition ein Personenstatus und damit ein wertvolles Leben zugeschrieben wird, die aber auf Grund physisch oder psychisch empfundenen Leides den Tod wünschen. Auch SINGER ist sich bewusst, dass solche Leiden, z.B. schwer kranker Menschen, in Abhängigkeit stehen zu adäquaten medizinischen und sozialen Versorgungsstrukturen. Diese für alle, die sie benötigen, in angemessener Form bereitzustellen, hält er für ein "utopisches Ideal" (vgl. S.254ff). Um die Förderung von Lebenshilfe geht es SINGER auch gar nicht. Ihn interessiert die Legitimierung der Sterbehilfe. Darum verweist er hier ausdrücklich auf das Selbstbestimmungsrecht rationaler und selbstbewusster Personen.
"Es ist in jedem Fall in hohem Maße paternalistisch, sterbenden Patienten zu sagen, sie seien nun unter so guter Fürsorge, daß man ihnen die Wahlmöglichkeit der Sterbehilfe nicht anzubieten brauche. Man würde den Respekt vor der individuellen Freiheit und Autonomie besser wahren, wenn die Sterbehilfe legalisiert und es den Patienten überlassen würde, zu entscheiden, ob ihre Situation unerträglich ist."(S. 255)
Schließlich findet SINGER nur im Falle der "unfreiwilligen Euthanasie" keine Rechtfertigung. Nach dem präferenz-utilitaristischen Grundverständnis ist es Unrecht "eine Person zu töten, die es vorzieht, weiterzuleben" (S.128ff). Eine solche Willensbekundung bezüglich des Wunsches, weiter existieren zu wollen, wird als Indiz für den Personenstatus eines Menschen gewertet und kann m.E. als einziger wirklicher Schutz gegen das "Getötetwerden" angesehen werden.
Die hier vorgestellten Thesen SINGERs sind Teil eines breiten Diskurses über die "Euthanasie" an bestimmten Gesellschaftsgruppen. Mit dem Erscheinen der deutschen Ausgabe seines Buches "Praktische Ethik" 1984 wird er durch sie zu einer zentralen Figur einer sich entwickelnden "Euthanasie"-Debatte in der BRD. Besondere Aufmerksamkeit bekam in diesem Zusammenhang Singers Einladung zu einem Symposium unter der Schirmherrschaft der Bundesvereinigung Lebenshilfe mit dem Thema "Biotechnik - Ethik - Geistige Behinderung". SINGER war dort mit einem Vortrag mit dem Titel "Zwischen Leben entscheiden: eine Verteidigungsschrift" angekündigt. Zusätzlich gab es Einladungen zu Vorträgen an der Universität in Dortmund durch den Behindertenpädagogen CRISTOPH ANSTÖTZ und an der Universität Saarbrücken durch den Professor für Philosophie GEORG MEGGLE (vgl. TOLMEIN 1990, S.14ff). Daraufhin kam es zu Protesten durch ein Bündnis behinderter Menschen, ihrer Angehörigen und Freunde, Behindertenpädagogen Praktikerinnen der Wohlfahrtsverbände usw. (JANTZEN 1998 S.147). Neben Störaktionen und dem Informieren der Öffentlichkeit wurde eine Veranstaltung unter dem Motto "Unser Lebensrecht ist nicht diskutierbar" (vgl. TOLMEIN 1990, S.15) geplant, welches die Problematik mehr als verdeutlicht. Unter diesem Druck wurden die Auftritte SINGERs in Marburg und Dortmund verhindert. Einzig in Saarbrücken gelang es ihm zu reden (TOLMEIN 1990, S.16). Obwohl weitere Auftritte SINGERs verhindert werden konnten, hatten seine Einladung und die folgende Auseinandersetzung ihre Auswirkungen. Im Rahmen einer Debatte um Meinungs- und Redefreiheit tendierten die Thesen SINGERs nun zu einer gleichberechtigt diskutierbaren Meinung neben anderen zu werden. JANTZEN (1998) bemerkt hierzu: "Der Frage nach der Angemessenheit eines Redeverbots hätte m.E. die Frage nach der Angemessenheit einer Einladung von Herrn SINGER als Hauptredner, also einer Redeerlaubnis vorwegzugehen (S. 148, Hervorhebung des Autors). So kam es, auf die wissenschaftliche Unhaltbarkeit von SINGERs Thesen (vgl. FEUSER 1995) wie auch auf ihre Nähe zur "Euthanasie"-Praktik unter der Nazi-Diktatur im "Dritten Reich" (vgl. TOLMEIN 1990, CHRISTOPH 1993) hingewiesen wurde, zu einer öffentlichen Debatte zwischen "Euthanasie"-Gegnern und "Euthanasie"-Befürwortern. Diese wurde, vor allem durch die Beteiligung für Singer eingenommener Medienvertreter, wie dem damaligen ZEIT-Autor MERKEL, sowie durch entsprechend argumentierende Philosophen und Behindertenpädagogen auf universitärer und wissenschaftlicher Ebene vorangetrieben.
Auch wenn Form und Inhalt dieses Diskurses über das Töten neue Qualitäten zeigen, so ist er doch nicht wirklich neu. TOLMEIN (1990) zeichnet den Verlauf einer Euthanasie-Debatte seit Beginn der 80er Jahre nach. 1986 wird in der "Einbecker Empfehlung" der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht der Schluss gezogen, dass unter bestimmten Umständen eine Einschränkung der ärztlichen Behandlungspflicht bei Neugeborenen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen als gegeben angesehen wird. Obwohl die "Einbecker Empfehlung" keinen gesetzlichen Status besitzt, muss davon ausgegangen werden, dass sie in vielen Krankenhäusern bestimmend für die Praxis ist. Diese Praxis betrifft das sogenannte "Liegenlassen" behinderter Neugeborener. Es ist davon auszugehen, dass auf diese Weise 1200 Säuglinge, nach anderen Angaben sogar 5000-6000 Säuglinge pro Jahr, ermordet werden (FEUSER 1995, S.53; vgl. auch SIERCK 1993). TOLMEIN (1990) verweist im Weiteren auf die Arbeit der DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben), und hierbei im besonderen auf Professor HACKETHAL, der auf medienwirksame Weise anhand von Einzelschicksalen für die Sterbehilfe argumentierte.
SINGER bricht mit seinen "Euthanasie"-Thesen also nur vermeintlich mit einem "Tabu, das nie eines war" (TOLMEIN 1990, S.17). In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, welche Bedingungen es SINGER und anderen, die seine Auffassungen teilen, ermöglichen eine derartigen Popularität zu erlangen. FEUSER (1995) weist darauf hin, dass die Wurzeln der "Euthanasie"-Forderungen nicht, wie oft angenommen wird, im Faschismus liegen. Sie finden sich stattdessen, zusammen mit der Entwicklung des Utilitarismus, in verschiedenen Ausprägungen des Liberalismus des 18. und 19. Jahrhunderts. Eine der Grundkonzeptionen der liberalen Moderne war die "freie" Entfaltung der Wirtschaftskraft am ökonomischen Eigeninteresse des Einzelnen im "freien" Wettbewerb. Die uneingeschränkte Profitmaximierung erfolgte zum einen durch den Imperialismus zum anderen durch die innergesellschaftliche Eliminierung von sogenannten "Ballastexistenzen" (Begriff des Hitler-Faschismus). Solches Vorgehen bedurfte entsprechender ideologischer Rechtfertigungen (vgl. FEUSER 1995, S.56). Auch bei SINGER lassen sich solche Hintergründe, vor allem in den gemeinsamen Ausführungen mit KUHSE, wiederfinden. Darin machen sie deutlich, dass ihrer Meinung nach die Glückseligkeit der Gesellschaft auch von einer finanziellen Komponente bei der Interessenabwägung abhängig ist. In ihrem Buch "Muß dieses Kind am Leben bleiben?" resümieren sie nach der Konstruktion diverser Rechenbeispiele:
"Jedes Gemeinwesen kann nur eine begrenzte Anzahl von Menschen verkraften, für die es aufkommen muß. Wenn wir alle Kinder - ungeachtet ihrer künftigen Möglichkeiten - am Leben halten wollen, müssen wir andere Dinge, die wir möglicherweise für ebenso wichtig halten, aufgeben." (KUHSE/SINGER 1993, S.226)
Um der Passung zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und den Thesen SINGERs als Grundlage ihrer Popularität nachzugehen, soll im folgenden Abschnitt die neoliberale Variante der Moderne und deren politische und ökonomische Ausprägung betrachtet werden, die den Hintergrund für die Ermöglichung einer neuen "Euthanasie"-Debatte bildet.
Seit etwa Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts vollzieht sich ein grundlegender Wandel des kapitalistischen Systems. Dies steht im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise der 70er Jahre, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, einer Internationalisierung des Kapitals sowie der Machtübernahme durch neoliberale Regierungen in vielen Teilen der Welt (vgl. HIRSCH 1998, S.7). Beschrieben wird dieser Wandel als Übergang vom "Fordismus" zum "Postfordismus". Hiermit geht eine Transformation des Staatsgefüges einher. Im Rahmen einer sich "globalisierenden Wirtschaft" entstehen hierbei "nationale Wettbewerbsstaaten", innerhalb derer sich die sozialen Sicherungs-systeme zunehmend verschlechtern.
Die seit Ende des zweiten Weltkrieges und bis in die 70er Jahre dominierende kapitalistische Ausrichtung war der "Fordismus". Er kennzeichnet sich durch neue Formen kapitalistischer "Akkumulationsstrategien" und politisch-sozialer "Regulationsweisen" (HIRSCH S.20). Sie bildeten sich im Zuge der ersten Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre heraus und konnten sich anhand der international dominierenden Position der USA, die Resultat des zweiten Weltkrieges und der Systemkonkurrenz zur Sowjetunion war, im westlichen Teil der Welt etablieren. Merkmal des fordistischen Kapitalismus war die Konzentration auf die Binnenmärkte. Als Folge der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre begann eine Abkoppelung der Nationalstaaten vom Weltmarkt durch die Kontrolle des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs. Die Akkumulationsstrategie zur Erschließung des inneren Marktes basierte auf einer "Durchkapitalisierung" (ebd.) der Gesellschaft. Traditionelle Produktionsverhältnisse wurden durch Lohnarbeit im Sinne tayloristischer Massenproduktion verdrängt. Dies ergänzte sich durch ein Massenkonsummodell. Die Arbeiterschaft wurde so weitgehend in die kapitalistische Akkumulation integriert, "d.h., der Konsum der Arbeiterklasse wurde selbst ein Teil des Kapitalverwertungsprozesses" (ebd.). Diese Strategien wurden durch entsprechende staatliche Regulationen gestützt. Die interventionistische Wirtschaftssteuerung bezog sich auf eine Wachstums-, Einkommens- und Beschäftigungspolitik sowie auf die der Institutionalisierung eines "sozialpartnerschaftlichen Verhandlungssystems" (ebd.) zwischen Unternehmern, Gewerkschaften und Staat. Zusammen mit dem Auf- und Ausbau des "Sozialstaates" (vgl. BUTTERWEGGE 2001) und der damit verbundenen tendenziellen Gewährleistung einheitlicher Lebensbedingungen sollte ein "Klassenkompromiss", einerseits zur Abwendung der "kommunistischen Bedrohung", andererseits zur Stützung des Massenkonsummodells, erreicht werden (HIRSCH 1998, S. 20). Der Staat erschien auf diese Weise als "Sicherheitsstaat" (S. 78ff). In dieser Funktion war er einerseits "Wohlfahrtsstaat", der materielle Gleichheit und die Absicherung ökonomischer Risiken zur Aufrechterhaltung des Klassenkompromisses erzeugen sollte. Für diese Zielorientierung zeigte er sich aber auch als "Überwachungsstaat", der über administrative und bürokratische Kontroll- und Repressionsmaßnahmen das Massenintegrationssystem vor politisch, gesellschaftlich und ideologisch Abweichenden schützen sollte. Durch seine Verbindung von Massenwohlfahrt und der sich steigernden Profitabilität des Kapitals wurde der Fordismus für die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte als "goldenes Zeitalter" (S. 21) des Kapitalismus wahrgenommen. Im Laufe der Zeit zeigten sich aber dessen Grenzen. In den Protestbewegungen Ende der 80er Jahre, die sich gegen ökologische Zerstörungen durch ungehemmtes industrielles Wachstum, die patriarchalische Ausbeutung und Diskriminierung der Frauen und bürokratische Gängelung richteten, deutete sich eine erste Krise an (S. 78). Die Weltwirtschaftskrise der 70er Jahre, deren Folgen bis heute andauern, machte dann deutlich, dass Wachstum, Fortschritt und Kapitalprofite nicht beliebig gesteigert werden konnten (S. 22).
Die Antwort der Wirtschaft und der Politik auf diese Krise ist im Prozess der "Globalisierung" zu sehen. Dieser Prozess findet in verschiedenen Bereichen statt (S. 17ff). Technische Entwicklungen im Bereich der Informationsverarbeitung und -übermittlung erlauben weltweite Kommunikation und Transaktionen ohne Zeitverluste, so dass der Eindruck eines "globalen Dorfes" entsteht. Auf einer politisch-ideologisch-kulturellen Ebene kann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Verallgemeinerung von Demokratie und Menschenrechten sowie die Durchsetzung des kapitalistischen Konsummodells verzeichnet werden. Dies reicht nach HIRSCH für eine Erklärung der Globalisierung aber nicht aus. Er stellt heraus, dass diese Entwicklungen nur den Hintergrund für einen "ökonomischen Vorgang" (S.19) bilden. Dieser liegt in einem Übergang vom Fordismus zu einer "postfordistischen" Variante des Kapitalismus. Anstelle einer durch staatliche Regulation kontrollierten Konzentration auf den Binnenmarkt wird, im Rahmen neoliberaler Politik, eine "Deregulierung" des Marktes (S.111) bewirkt. Die dadurch vorangetriebene "Internationalisierung des Kapitals" ist verbunden mit der Bildung "multinationaler" Konzerne (S.22). In diesem Zusammenhang kommt es aber nicht zur Auflösung der Nationalstaaten. Die Internationalisierung des Kapitals verbindet sich nicht mit einer Internationalisierung der Arbeitskräfte. Strategisch ist dies von Bedeutung, da für eine Maximierung der Profite die höchst unterschiedlichen Produktions- und Lebensbedingungen abgegrenzter Regionen entscheidend sind (S.72). So können billig produzierte Produkte anderenorts teuer verkauft werden. Statt ihrer Auflösung treten die Nationalstaaten in einen Transformationsprozess ein.
Die Veränderung der Ausrichtung der Nationalstaaten führt auf nationaler Ebene zu erheblichen politischen und sozialen Transformationen des Staates. Dies steht im Zusammenhang mit der nun gegebenen Möglichkeit multinational agierender Konzerne, plötzlich und unvermittelt mit Abwanderung zu drohen, sollte die Profitabilität des Standortes nicht ausreichend erscheinen. Zu dem Problem, dass Konzerne nicht länger auf jeweilige Standorte angewiesen zu sein scheinen, schreibt FORRESTER (1997) Folgendes:
"Nun ist diese Welt, in der die Orte der Arbeit und die der Wirtschaft zusammenfielen, wo die Arbeit vieler Akteure für die Entscheidungsträger unersetzlich war, aber wie weggezaubert. Noch immer glauben wir, in dieser Welt zu leben, in ihr zu atmen, ihr zu gehorchen oder sie zu beherrschen - aber sie existiert nicht mehr, oder nur noch scheinbar, und das unter Kontrolle der wahren Kräfte, die sie auf diskrete Weise lenken und ihr Scheitern betreiben." (S. 33)
FORRESTER spielt darauf an, dass es auf diese Weise zu einer selbst erzeugten, direkten Abhängigkeit der Politik von den Interessen der Wirtschaft kommt. Der auf politischem Wege herbeigeführten Deregulierung des Marktes und den dadurch verlorengegangenen Interventionsmöglichkeiten wird mit einer "Standortpolitik" (HIRSCH 1998, S.32) begegnet, deren Ziel die Schaffung international konkurrenzfähiger Kapitalverwertungsbedingungen für die Konzerne ist. Um dieses Ziel zu erreichen, geht es um eine Zerschlagung des Klassenkompromisses, d.h. einer Einkommensverteilung zugunsten des Kapitals und einem systematischen Abbau sozialstaatlicher Sicherung (S.23). Dies steht im Zusammenhang, da die für die Einkommensverschiebung benötigten Massenentlassungen und Senkungen der Reallöhne und Lohnnebenkosten dem Sozialstaat die finanzielle Basis für materielle Zuwendungen entziehen (vgl. BUTTERWEGGE 2001, S. 67ff). Zusätzlich kann auch die Senkung bzw. Stagnation ökologischer Standards als Maßnahme im Sinne eines Standortvorteils gewertet werden (vgl. HIRSCH 1998 S. 31). Dass dies bislang ohne erhebliche Gegenreaktion der Bevölkerung funktioniert, hat nach HIRSCH verschiedene Gründe. Nach dem Scheitern der sozialistischen Systeme sind diese als konkurrierende Gegenspieler und mögliche Alternativen verschwunden. Soziale Bedingungen brauchen nicht mehr im Vergleich der Systeme gerechtfertigt werden (S. 34). Ähnlich verhält es sich mit der nationalen politischen Landschaft. Demokratische Prozesse laufen ins Leere, da, orientiert an "Marktlogik" und "Standortpolitik", politische Parteien in ihrer Ausrichtung kaum mehr unterscheidbar sind (ebd.). Gewerkschaften und Arbeiterschaft sind auf dieser Basis jederzeit erpressbar. Vor allem, wenn das Vorgehen durch Politik und Wirtschaft mit Unterstützung der "Massenmedien" (vgl. BUTTERWEGGE 2001, S. 45ff) als Sachzwang verkauft wird. Dabei wird verschleiert, dass es sich um eine umfassende politische Strategie zur Bewältigung der Krise des Fordismus handelt.
"Was als naturwüchsiger Prozeß erscheint, der die Bundesrepublik - genauso wie andere Länder - zwingt, ihre Lohn- bzw. Lohnnebenkosten und Sozialleistungen zu senken, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden, basiert auf wirtschafts-, währungs- und finanzpolitischen Weichenstellungen der mächtigen Industriestaaten." (S. 66)
In dem die Krise des Fordismus in eine Krise des Sozialstaates umgedeutet wird (vgl. S. 39ff), wird ein Wandel vom "Sicherheitsstaat" zum "nationalen Wettbewerbsstaat" vor der Bevölkerung gerechtfertigt und weiter vorangetrieben.
Die innergesellschaftlichen Folgen dieses Prozesses sind weitreichend. Im Rahmen einer Politik, die sich aus der sozialen Verantwortung zurückzieht und auf die Sicherung des Standortes ausgerichtet ist, kalkuliert der Staat Massenarbeitslosigkeit, sinkende Einkommen und soziale Unsicherheit systematisch ein. Er erzeugt damit einen erhöhten "Mobilisierungszwang" (vgl. HIRSCH 1998, S.73) hinsichtlich der Eigenpotenziale der Bevölkerung. Konsequenz ist die Privatisierung sozialer und ökonomischer Risiken (S.81). Anhand völlig unterschiedlicher Ausgangbedingungen und Möglichkeiten des Einzelnen führt dies zu einer Spaltung der Gesellschaft in "Modernisierungsgewinner und -opfer" (S.73; S.111). Anstelle der Angleichung der Lebensbedingungen durch sozialstaatliche Intervention kommt es zur Pluralisierung und Individualisierung der Gesellschaft, die durch eine größer werdende Armut breiter Teile der Bevölkerung gekennzeichnet ist (S.107ff). Die Spaltung der Gesellschaft vollzieht sich sowohl sozial, als auch räumlich. Innergesellschaftlich wie auch international schotten sich die Modernisierungsgewinner von den Modernisierungsopfern ab. Diejenigen, die als fordernde Individuen auftreten und damit im Sinne eines "Standortnachteils" als überflüssig, störend oder gefährlich gelten, werden ausgegrenzt, wenn nötig mit Gewalt. Der Abbau des Sozialstaates ist deshalb mit einem Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaates verbunden (vgl. S.36ff). Des Weiteren erklärt sich in diesem Zusammenhang ein Aufleben von Nationalismus, Rassismus, Wohlstandschauvinismus und Biologismus als reduktionistisches Deutungsmuster in der Gesellschaft (S.93ff). Hierbei sei auf FEUSER (1996a) verwiesen, der auf eine Zunahme "behindertenfeindlicher Tendenzen" (S.27) hinweist, die bis hin zu Gewalttaten gegen behinderte Menschen reichen (S.30ff).
Die Betrachtung gesellschaftlicher Auswirkungen veränderter Strategien und Zielorientierungen von Politik und Wirtschaft lassen deutlich werden aus welchen Grunde moralphilosophische "Euthanasie"-Forderungen erneut eine Konjunktur erleben. Sie bieten eine ideologische Rechtfertigung dafür, sich derer zu entledigen, die als Hemmnis für die uneingeschränkte Profitmaximierung und damit als schädlich für den Standort erscheinen. Wie genau sich diese Diskurse und Praktiken auf direkte oder sehr subtile Art und Weise für behinderte Menschen und ihre Forderung nach Selbstbestimmung auswirken, soll im Folgenden gezeigt werden.
Bereits für sich genommen, lassen sich anhand der dargestellten Diskurse und Praktiken Beschränkungen für die Selbstbestimmung behinderter Menschen ablesen. Als Ausdruck einer gesellschaftlichen Verfasstheit sind sie aber miteinander verwoben und wirken aufeinander. In der Beschreibung ihrer Auswirkungen lassen sie sich in verschiedener Kombination und Ausprägung in unterschiedlichen Bereichen und Diskussionen als Hintergrund wiederfinden.
Die Forderung nach Selbstbestimmung behinderter Menschen fällt mit einem systematischen "Abbau des Sozialstaates" zusammen. BUTTERWEGGE (2001) beschreibt diesen Prozess als "paradoxe Intervention" der Regierung:
"Denn man gab vor, den Sozialstaat sichern zu wollen, indem man ihn Schritt für Schritt amputierte, und behauptete, sich auf die Kernfunktionen der sozialen Sicherung in wirklichen Notlagen zu konzentrieren, tat jedoch das Gegenteil, indem die Leistungskürzungen zuerst und besonders einschneidend dort erfolgten, wo sie die Schwächsten bzw. die Bedürftigsten trafen: Arme, Erwerbslose, Kranke und Behinderte." (S. 50ff)
Folgende "Sparrunden" (ebd.) sind jeweils vorprogrammiert, denn im Rahmen einer standortpolitischen Umverteilung des Kapitals von unten nach oben wird dem sozialstaatlichen Sicherungssystem gleichsam die finanzielle Grundlage weiter entzogen. WALDSCHMIDT (1999) stellt deshalb fest, dass Selbstbestimmung nicht nur als neues Freiheitsrecht, sondern auch als Pflicht konzipiert wird. Für behinderte Menschen bedeutet dies, wie für alle anderen auch, dass sie zunehmend auf die Mobilisierung eigener Potenziale im Rahmen einer allgemeinen Privatisierung sozialer Risiken angewiesen sind. WALDSCHMIDT schreibt hierzu:
"Die Autonomiebestrebungen Behinderter, die Bewegungen aus den Anstalten und personalen Abhängigkeitsverhältnissen heraus darstellen, müssen in einem Kontext realisiert werden, der von dem Wegbrechen und der Erosion traditioneller Strukturen der Fürsorge geprägt ist, ohne daß sich neue Systeme der Unterstützung bereits gebildet hätten. Auch künftig wird es wohl eher nicht der Fall sein, daß bedarfsgerechte Hilfeangebote bereitgestellt werden." (S. 43)
Behinderte Menschen, deren Situation durch erhöhte Hilfebedarfe gekennzeichnet ist, sind damit deutlich der Gefahr ausgesetzt, dass sich ihre Forderung nach Selbstbestimmung im Kontext des Entzugs solidarischer Hilfe gegen sie wenden. Dies gewinnt zusätzlich an Brisanz, wenn dieser Prozess unter dem Begriff der Selbstbestimmung vorangetrieben wird.
Eine solche Instrumentalisierung des Selbstbestimmungsbegriffes zeigt sich in der Verbindung von Dezentralisierungs- und Enthospitalisierungsbemühungen im Psychiatrie- und Behindertenbereich und in der Verknappung von Sozialleistungen. DAHLFERT (1997) verweist anhand von Studien zur Lebensqualität in gemeindeintegrierten Wohneinrichtungen aus den USA, Großbritannien und Norwegen auf die Gefahren. Dort zeigte sich, dass sich die Lebensqualität der aus Großeinrichtungen in gemeindeintegrierte Wohnformen umgesiedelten behinderten Menschen dramatisch verschlechtert hatte. Der Grund für diese Entwicklungen ist eine Reduzierung der finanziellen Leistungen, die zu teilweise katastrophalen Versorgungs- und Betreuungssituationen führte. Ein Merkmal für die schlechte Lebensqualität war die hohe Sterberate in solchen Einrichtungen. Unter der Bedingung, dass "selbstverständlich [...] davon ausgegangen [wurde], daß das Leben in offenen Wohnformen per se eine günstigere Lebenswelt darstelle" (S. 350) wurden behinderte Menschen angesichts möglicher Einsparungen, so lässt sich vermuten, "zweifelhaften Organisationen und Geschäftemachern" (S.352) überantwortet. FEUSER (1995) schreibt zu solchen Annahmen, auch unter Bezug auf Entwicklungen in der BRD:
"Das Gerangel jener Träger, die die neue Verwaltung des psychischen Elends der Betroffenen in schönen Häusern der Wohnstraßen Bremens Hand in Hand mit der Stadt nach dem Prinzip ‚teile und herrsche' übernommen haben [...] retuschieren zwar das ins gesellschaftliche Blickfeld und in die Kritik geratene Anstalts- und Sonderbetreuungswesen bzw. verzieren es z.B. mit Bällchenbad und Snoezel-Räumen für sog. Schwerstbehinderte, reproduzieren es aber in vielfach neuer Weise. Quecksilber, das zu Boden fällt, zerstiebt in unzählige kleine Kügelchen, aber es bleibt Quecksilber - und giftig!" ( S.43)
Eine Verbesserung der Lebensqualität für behinderte Menschen bedarf in diesem Sinne mehr als nur eine Veränderung der institutionellen Strukturen. Eine den individuellen Bedarfen der BewohnerInnen qualitativ und quantitativ angemessene Betreuung ist hierfür unabdingbar. Unter der Voraussetzung fortwährender Kürzungen der Mittel wird diese immer schwieriger zu realisieren sein. Die von behinderten Menschen geforderte und mehr als überfällige Dezentralisierung und Enthospitalisierung unter diesen Bedingungen per se als Projekte für mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung darzustellen, wäre angesichts der Erfahrungen anderer Länder zynisch.
Weitere Varianten der Instrumentalisierung des Begriffes Selbstbestimmung, die ebenso Teil der zuvor beschriebenen Problematik sein kann, sind die auch in der BRD zu verzeichnenden Bestrebungen der Anpassung der Behindertenhilfe an die "Gesetze des freien Marktes". Die Argumentation dafür basiert auf dem Aspekt der "Qualität durch Wettbewerb" und damit auch auf einer Verbesserung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten behinderter Menschen im System der Behindertenhilfe durch die Position als "Kunden" (BECK 1999, S. 41). "Sozial benachteiligte (behinderte, Anm.d.Verf.) Menschen avancieren dabei zu ,Marktteilnehmern', die sich selbst für eine Firma (Einrichtung, Anm.d.Verf.) entscheiden und Dienstleistungsofferten in Anspruch nehmen" (BUTTERWEGGE 2001, S. 105ff). Dass diese Entwicklungsrichtung real zur Ermöglichung von Selbstbestimmung führt, ist zu bezweifeln. BECK (1999) meint dazu, dass sich im Rahmen aktueller Sozialpolitik in nach der Marktlogik geführten Einrichtungen das "Spannungsfeld zwischen humaner Akzeptanz und solidarischer Hilfe einerseits und Ausgrenzung, Marginalisierung, Begrenzung von Hilfen durch die Ideologie der Brauchbarkeit und wirtschaftlichen Nützlichkeit andererseits verschärfen [wird]" (S. 35). Sie verweist dabei auf die Novellierung des Bundessozialhilfegesetzes. Hiermit verbundene neue Rahmenbedingungen für die Zahlung von Eingliederungshilfe binden diese an entsprechende pädagogische Erfolge (S.42). Die anhand der Kategorien "ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich" zu erbringende Qualität der Betreuung, die "das Maß der Notwendigkeit nicht überschreiten darf" (LANWER-KOPPELIN 1999, S.153), führt die Einrichtungen gleichzeitig in einen "Unterbietungswettbewerb" (S.155), der wieder, und auf verschärfte Weise, die Gefahr des Abbaus personeller Standards mit sich bringt. Unter dem Motto "aus Weniger wird Mehr" (S.151ff) ist der behinderte Mensch als "Kunde" nicht automatisch auch "König". Umworben werden dann wohl eher diejenigen, die "eingliederungsfähig" erscheinen. Die übrigen, die aufgrund defizitorientierter Menschenbilder, als "eingliederungsunfähig" diagnostiziert werden (vgl. S. 154), werden in kostengünstigere Alternativen wie familiäre Versorgung oder Pflegeheime (vgl. BECK 1999, S.43) verschoben. Hinzu kommt die Problematik des "Dreiecksverhältnisses" für die Zahlung von Leistungen zwischen Kostenträger, Anbieter und Hilfeempfänger. Solange die Zahlungen nicht direkt an den Hilfeempfänger erfolgen, besitzt dieser keine "Konsumenten-souveränität", die seinen Kundenstatus rechtfertigen und ihm Gegenwehr erlauben würde (LANWER-KOPPELIN 1999, S. 154). Unter diesen Umständen verschleiert das vorgeschobene Interesse Selbstbestimmung zu ermöglichen, das eigentliche Vorhaben, soziale Leistungen im Kontext freier marktwirtschaftlicher Orientierung der Behindertenhilfe abzubauen.
Eine weitere Gefahr der missbräuchlichen Verwendung des Begriffes Selbstbestimmung folgt aus der Debatte um Sterbehilfe. Ihre Befürworter, wie SINGER, berufen sich dafür explizit auf das Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen, gegebenenfalls den eigenen Tod fordern zu dürfen. Hierbei darf unter keinen Umständen der Rahmen, in dem diese Debatte geführt wird, ausgeblendet werden. Den Rahmen bilden sich allgemein verschlechternde soziale Bedingungen der Bevölkerung, wie Massenarbeitslosigkeit, die Ensolidarisierung der Gesellschaft und erheblicher Einbrüche in den Versorgungsstrukturen für alte, kranke und behinderte Menschen. Dies verbindet sich mit dem öffentlich ausgeübten Druck, dieser Gesellschaft nicht zur Last zu fallen. Hierzu gehören ins Feld geführte Begriffe wie der "Pflegenotstand", der alte Menschen dazu bringt, den eigenen Tod der Abhängigkeit vorzuziehen. Auch von Seiten der Politik ist ein solcher Druck vorhanden. BRADL und STEINHART (1996) verweisen hier auf Aussagen im 3. Behindertenbericht der Bundesregierung, in dem es heißt, dass die "Pflichten der Gesellschaft gegenüber behinderten Menschen nicht unbegrenzt [sind], insbesondere soweit für ihre Rehabilitation und Eingliederung menschlich und finanziell Ressourcen in Anspruch genommen werden, die dann für andere, ebenfalls wichtige Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen" (S.13). Solche Äußerungen weisen eine bedenkliche Nähe zu den von KUHSE und SINGER (vgl. 1993) angeführten ökonomischen Interessenabwägungen auf, die ihnen als Begründungen für das Töten behinderter Kinder dienlich sind. Und nicht zuletzt wird dies alles durch die Massenmedien gepusht, in denen der Wohlfahrtsstaat als "Selbstbedienungsladen" für Arbeitsunwillige, "Abzocker" und Sozialschmarotzer, und so als "bloße Last" denunziert wird (BUTTERWEGGE 2001, S. 45). Die Ängste, die hier geschürt werden, sind "wesentlich eine Folge des subjektiven Sinnverlustes aufgrund gesellschaftlich-sozialer Deklassierung und Isolation" (FEUSER 1995, S.54). Anstelle von Lebenshilfe und der Verbesserung der dafür erforderlichen Bedingungen wird die Legitimierung der Sterbehilfe vorangetrieben. FEUSER (1995) schreibt dazu:
"Eine gesellschaftlich, durch eine menschenunwürdige Struktur und Praxis der Alten-[,Behinderten-; Anm.d.Verf.] und Krankenversorgung induzierte Selbstentwertung, kaschiert mit dem Begriff des ‚Pflegenotstandes' (in Anbetracht von real wohl sechs Millionen Arbeitslosen), deklariert die Sterbebereitschaft als freien Willen eines freien Bürgers, dem man in liberal-pluralen Gesellschaften in demokratischer Weise zu entsprechen hat. So wird das Töten derer, die wieder als ‚unnütze Fresser' und ‚Ballastexistenzen' empfunden werden, zum Selbstgänger." (S. 54)
In Australien und in den Niederlanden (vgl. TOLMEIN 1993, S. 77ff) wird die Sterbehilfe bereits als legalisierte "Euthanasie" praktiziert.
Die Instrumentalisierung von Selbstbestimmung für "Sozialabbau" und "Euthanasie" ist aber nur eine Möglichkeit, die im spätmodernen Neoliberalismus ökonomisch motivierte Beschränkung des sich verallgemeinernden Anspruches auf Freiheit und Gleichheit aufrechtzuerhalten. Auch heute werden Grenzen für den Anspruch auf Selbstbestimmung konstruiert:
"Das Ziehen dieser Grenzen und ihre Aufrechterhaltung ist ein komplizierter Mechanismus, der die gesamte Moderne durchzieht." (JANTZEN 1998, S.162).
Hier wird deutlich, in welcher Hinsicht die "neue Ethik" SINGERs und anderer Moralphilosophen tatsächlich "praktisch" ist. Mit der Konstruktion eines Personenbegriffes und entsprechender Ausschlusskriterien werden behinderte Menschen als die "Andersartigen" definiert und direkt von der Teilhabe an allgemeinen Rechten ausgeschlossen. Ihre Interessen werden in der Abwägung zu den Interessen der Gesellschaft als "nicht berücksichtigungswürdig" deklassiert. Die seit Beginn der Moderne aufrechterhaltene Teilung der Menschen an Kategorien wie Vernunft und Unvernunft findet sich hier in veränderten Begriffen wieder. Der praktische und ökonomische Nutzen solcher Definitionen und ihrer Schlussfolgerungen für den "Wert" oder "Unwert" des Lebens, zeigt sich in den Entwürfen zur Bioethik-Konvention des Europarates[6] sowie der Bioethik-Deklaration der UNESCO[7] (vgl. EMMERICH 1999). Mit beiden Dokumenten sollen "fremdnützige" Eingriffe an "einwilligungsunfähigen" Menschen ermöglicht und rechtlich abgesichert werden. Sie sehen die "Benutzung von behinderten Menschen als Versuchsobjekte und als Organbanken unter bestimmten Bedingungen vor" (JANTZEN 1998, S.160). Dies kann im Hinblick auf die "Fremdnützigkeit" auch geschehen, wenn der Betroffene keinen Vorteil daraus zieht: genau dann, wenn die Interessen anderer oder der Gemeinschaft als vorrangig erachtet werden[8]. In Bezug auf die Kategorie "Einwilligungsunfähigkeit" sind die hiervon betroffenen Menschen Minderjährige, Altersdemente, Menschen mit geistiger Behinderung, psychischen Erkrankungen, Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen und Wach-Koma-Patienten (WUNDER 2000, S. 140). Bislang sind in der BRD "fremdnützige" Eingriffe an "einwilligungsunfähigen" Menschen weder mit dem Transplantationsgesetz noch mit dem Betreuungsgesetz vereinbar. Das TPG interpretiert eine Organspende als "höchstpersönlichen Akt [...], für den Stellvertretung nicht zulässig ist" (RIXEN 2000, S.126). Eine Stellvertretung im Falle der Einwilligungsunfähigkeit, deren gesetzlicher Rahmen das BTG ist, basiert auf dem Grundsatz zum Wohle des Betreuten zu entscheiden, nicht zum Wohle Dritter oder der Gesellschaft (WUNDER 2000, S.146). Es werden aber bereits Versuche unternommen diese rechtlichen Beschränkungen auszuhöhlen, um so die Bioethik-Konvention und die Unesco-Deklaration mit den Rechtsgrundlagen der BRDabzugleichen. Beim TPG betrifft dies die Aufweichung der eng gefassten Zustimmungspflicht des Betroffenen (vgl. JANTZEN 1998, S. 161). Im Falle des BTG verweist WUNDER (2000) auf einen Grundsatzartikel des Berliner Richters ELZER, in dem es heißt, "dass der § 1901 BGB den Betreuer auch ermächtige, Gemeinwohlaspekte in seine Entscheidung einfließen zu lassen" (S. 146). Im Hinblick auf die im § 1901 verfassten Formulierungen zu den Aufgaben des Betreuers (vgl. BGB, § 1901), kann dies m.E. nur bedeuten, dass dem Betreuten der "mutmaßliche Wille", Versuchsobjekt oder Organspender zum Wohle der Gemeinschaft zu sein, unterstellt wird. Dies würde nicht nur eine weitere Möglichkeit der Instrumentalisierung von Selbstbestimmung gegen die Interessen behinderter Menschen darstellen, sondern auch eine erhebliche Beugung des eigentlichen Zwecks des §1901 des BTG.
Die Freigabe behinderter Menschen als Versuchsobjekte und lebende Organbanken findet in den Singerschen Thesen ihre ethische Legitimation. Das Leben derer, die hierzu missbraucht werden sollen, als "unwert", und ihre Interessen als "nicht berücksichtigungswürdig" zu definieren, ermöglicht erst die benötigte Akzeptanz solcher Vorhaben. Der Zusammenhang zwischen SINGERs "Euthanasie"-Forderungen und den Bestrebungen des Bio- und Gentechnikbereiches sind nicht zufällig. SCHÖNWIESE (1993) weist darauf hin das SINGER Direktor des "Centre for Human Biothics" an der Monash University ist, welche ein durch die Wirtschaft stark gefördertes "Institut für Gen- und Reproduktionstechnologie" besitzt. Insofern dienen Kritikern entgegnete Behauptungen, eine neue Ethik aufgrund rein wissenschaftlicher Denk-Methodik zu entwickeln, dazu, Entstehungs- und Verwertungszusammenhänge zu verschleiern (S. 228ff). FEUSER (1995) sieht in der Entwicklung des Bio- und Gentechnologiebereichs eine neue Komponente der Möglichkeiten der Profitmaximierung. Neben Versuchen, kostenträchtige "Ballastexistenzen" ideologisch gerechtfertigt zu eliminieren, was insbesondere im Hitler-Faschismus tödliche Realität wurde, wird nun versucht, die Vernutzung menschlichen Lebens ethisch zu legitimieren (vgl. S.56). JANTZEN (1998) merkt dazu an:
"Was für uns wohl unvorstellbar war, war der Übergang von der Ausgrenzung nicht nur zur Vernichtung, sondern darüber hinaus zur Verwertung." (S.160)
Die eigentliche Aufgabe der Bioethik-Konvention und der UNESCO-Deklaration, den Schutz der menschlichen Würde und der Menschenrechte zu garantieren, ist im Rahmen bestimmter ökonomischer und ethischer Strömungen der Gesellschaft gezielt hintergangen worden.
Alle dargestellten Beschränkungen von Selbstbestimmung, durch Instrumentalisierung oder Absprache, haben auf verschiedene Art und Weise einen Prozess zur Folge, den WOLFENSBERGER (1996) einen "neuen Genozid" an Benachteiligten, Alten und Behinderten nennt. Er beschreibt dazu verschiedene "Direktheitsgrade" (S.20) anhand derer des "Totmachen[s]" (S.12) entwerteter Menschen. Die verschiedenen Grade lassen sich in den beschriebenen Entwicklungen wiederfinden. Das "Totmachen" beginnt nicht erst mit der direkten Durchführung der "Euthanasie". Die Senkung der Lebensstandards behinderter Menschen durch Kürzungen der Sozialleistungen, die mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate verbunden ist, stellt eine der indirekteren Stufen des Totmachens dar. Das Totmachen hat seinen indirektesten Anfang schon in dem unbewussten Denken ein anderer sollte besser tot sein oder sich mit seinem Tod, anstatt mit seinem Leben auseinandersetzen, wie dies in der Diskussion um Sterbehilfe mitschwingt. Der Umgang mit behinderten Menschen im Sinne der Bioethik-Konvention zeigt dagegen bereits eine sehr direkte Form. Diese Prozesse werden kaum als das wahrgenommen was sie sind. Das liegt daran, dass sie durch Verschleierung "entgiftet" (S.37) werden. D.h. etwas "Schlimmes wird zu etwas Gutem und Sauberen gemacht" (ebd.). So können diejenigen, die das Totmachen aktiv oder passiv unterstützen, mit vorgeschobenen Idealen der Menschlichkeit in Übereinstimmung bleiben. Die Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen bedeuten für behinderte Menschen, wie gezeigt, nicht nur Chancen, sondern auch konkrete Bedrohungen. In der Art ihrer wissenschaftlichen, politischen, ökonomischen und ethischen Rechtfertigung (Entgiftung) sieht FEUSER (1995) Tendenzen, die denen der faschistischen Vergangenheit in nichts nachstehen (vgl. S. 61). M.E. liegt der Unterschied in den Direktheitsgraden und der veränderten Rhetorik für die Entgiftung. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse schreibt FEUSER dazu:
"Es fehlen in diesem Verbund nur noch die Herrschafts- und Gewaltstrukturen, die die Tötung realisieren. Sie werden, dessen bin ich mir sicher, als ‚liberales Prinzip', z.B. im Sinne der Selbstbestimmung, von Zeit und Art und Weise des eigenen Todes oder des Todes der von uns abhängigen Säuglinge und beeinträchtigten Menschen ‚demokratisch' realisiert, d.h. als Mehrheitswille gerechtfertigt und verwaltungstechnologisch abgewickelt." (S. 61ff)
[4] Nach PIEDA/SCHULZ (1990, S.20) leben etwa 70% der geistig behinderten Menschen in der BRD in ihrem Elternhaus. JANTZEN (1999b, S. 210) weist darauf hin, dass behinderte Menschen auch innerhalb des Familiensystems paternalistischen Strukturen ausgesetzt sind. Entsprechende Verkehrsformen (Penetration und Normierung) sind eher die Regel als die Ausnahme. Wie bei der institutionellen Versorgung entstehen auch in der Familie Einschränkungen der Selbstbestimmungsmöglichkeiten.
[5] FENGLER und FENGLER beschreiben in ihrer Untersuchung zum "Alltag in der Anstalt" (1994) die Problematik des "Loyalitätskonflikts" und wie das Personal einer Institution versucht, diese zu bewältigen (vgl. S. 117ff).
[6] Bioethik-Konvention des Europarates: "Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin."
[7] Bioethik-Deklaration der UNESCO: "Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte."
[8] Die entsprechenden Vorgaben dazu finden sich der Bioethik-Konvention Artikel 6, 17, 20 und 22 sowie der Bioethik-Deklaration Artikel 5 (EMMERICH 1999, S. 447ff)
Inhaltsverzeichnis
- 6.1. Ein verändertes Verständnis von Behinderung
- 6.2. Humanisierung und Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse
- 6.3. Humanisierung und Demokratisierung institutioneller Verhältnisse
- 6.4. Handlungsorientierungen für professionelle HelferInnen: Erhaltung und Wiedergewinnung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten in "Grenzsituationen"
Auch im Neoliberalismus der späten Moderne werden in dargestellter Weise Beschränkungen für die Selbstbestimmung behinderter Menschen aufrechterhalten und wohl noch ausgeweitet. Die Konsequenzen dieser Entwicklung, die zur tödlichen Bedrohung werden können, sind kaum abzusehen. Das geschieht auch unter Einbeziehung der durch sie erkämpften und ihnen zugestandenen Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Damit sich Selbstbestimmung als soziale Konstruktion im Sinne behinderter Menschen entwickelt, und nicht gegen sie, bedarf es einer "Gegenkraft" (vgl. FEUSER 1996, S. 35, zum Thema Integration) zu den beschriebenen gesellschaftlichen Diskursen und Praktiken. Bestandteile einer solchen Gegenkraft sollen im folgenden Abschnitt betrachtet werden.
Der Umgang der Gesellschaft mit behinderten Menschen ist wesentlich davon abhängig, welche Einstellungen und Betrachtungsweisen in Bezug auf Behinderungen existieren. Darauf verweisen die sich verändernden Zugangsmöglichkeiten behinderter Menschen zur Selbstbestimmung im Verlauf der Geschichte. Deutlich wird dies auch an den Veränderungen der Leitideen der Behindertenhilfe von der Verwahrung zur Förderung hin zur Selbstbestimmung. In der "Euthanasie"-Debatte, wie auch in der Form institutioneller Versorgungsstrukturen zeigt sich aber eine Kontinuität an Denkmodellen, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten und -rechte behinderter Menschen in Frage stellen oder sogar absprechen. M E. entsteht eine Gegenkraft hierzu aus einem Bruch mit der Vorstellung eines kausalen Verhältnisses von Behinderung und Selbstbestimmungsunfähigkeit. In dieser Hinsicht soll im Folgenden ein Verständnis von Behinderung dargestellt werden, das aufzeigt, dass Behinderung ein sozial konstruierter Prozess ist, der wesentlich mit der Einschränkung von Selbstbestimmung verbunden ist. Hieraus entwickelt sich die Sichtweise, dass Selbstbestimmung und Behinderung zwei Richtungen des Behinderungsprozesses sind. Dabei wird Selbstbestimmung über ihre Bedeutung für die aktuelle Lebensqualität eines Menschen hinaus auch in ihrer Bedeutung für seine Entwicklungsmöglichkeiten dargestellt.
Heutige Sichtweisen von Behinderung, wie sie in der Heil- und Sonderpädagogik nach wie vor gängig sind, haben ihren Ursprung in den Vorstellungen der bürgerlichen Elite im Rahmen der Entwicklung kapitalistischer Produktions- und Verwertungszusammenhänge der modernen Gesellschaft. Die aus diesem Denken entwickelten medizinisch-psychiatrischen Modelle sind an Konstruktionen bürgerlicher "Normalität" orientiert, die in Konstruktionen der "Pathologie" umgesetzt werden (vgl. Kapitel 2.2.2.). Mit ihnen werden körperliche, geistige wie auch psychische Behinderungen beschrieben. In Anlehnung an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert das Weltgesundheitsamt Behinderung als eine:
"[...]vorhandene Schwierigkeit (für die Leistungsminderung und/oder Schädigung verursachende Faktoren sind), eine oder mehrere Tätigkeiten auszuüben, die in bezug auf das Alter der Person, ihr Geschlecht und ihre soziale Rolle im allgemeinen als wesentliche Grundkomponenten der täglichen Lebensführung gelten, wie etwa Sorge für sich selbst, soziale Beziehungen, wirtschaftliche Tätigkeit." (Weltgesundheitsamt 1981, S. 32; z.n. JANTZEN 1992, S.16ff)
Behinderte Menschen werden im Denken wie in der Sprache mit Begriffen belegt, die ihren Mangel, ihre Unfertigkeit, ihre Beschädigung und Schwäche ausdrücken (HERRIGER 1997, S. 67). Solche "Metaphern des Defizits" (ebd.) haben ihre Grundlage in der Annahme, dass die beobachtete Pathologie eines Menschen ursächlich auf einen in diesem Menschen verorteten "Defekt" (Leistungsminderung, Schädigung) zurückzuführen ist:
"Das heißt, was uns an einem Menschen als klassifizierbare Erscheinung (als psychologisierbare "Merk- Male") auffällt (das ist unsere Wahrnehmung des anderen) machen wir zu seiner Natur, deuten sie -pars pro toto- als sein inneres Wesen, als "Eigenschaft" seiner Natur." (FEUSER 1996b, S.19)
Solche Definitionen von Behinderung als Natur oder Schicksal, gemessen an dem, was als gesellschaftliche Normalität gesetzt wird, führen zu medizinisch-psychiatrischen Dogmen der Pathologie. In der Beschreibung behinderter Menschen erscheinen diese in Begriffen wie "Endogenität", "Chronizität", "Therapieresistenz", "Uneinfühlbarkeit", "Unverstehbarkeit", "Andersartigkeit", "Lern- und Bildungsunfähigkeit", "Irreversibilität", "Krankheits- und Behinderungsspezifität" (FEUSER 1995, S.48ff). Darüber hinaus werden insbesondere Menschen mit schwerer geistiger Behinderung durch Moralphilosophen wie SINGER mit der Eigenschaft "nicht distinkte Entität" belegt, womit ihnen eine Orientierung in der Zeit, und damit verbunden Bewusstsein, abgesprochen wird. Stigmatisierungen dieser Art stellen eine Entwertung behinderter Menschen dar, deren Folge Diskriminierung und Benachteiligung, gesellschaftlicher Ausschluss und Einschluss in verwahrende und fördernde Institutionen ist. Mit einer der Defektlogik entgegengesetzten Sichtweise wird deutlich, dass gerade dieser Umgang mit behinderten Menschen den wesentlichen Faktor für Behinderung darstellt.
Entgegen dem Denkmodell der Defektlogik definiert JANTZEN (1999b) Behinderung als "sozialen Tatbestand" (S.197ff). Behinderung ist nicht auf einen Defekt zu reduzieren, sondern Konstruktion innerhalb sozialer Verhältnisse. Die Reduktion des Menschen auf seine Natur verstellt den Blick für soziale Prozesse, in denen er sich entwickelt. JANTZEN und LANWER-KOPPELIN(1996) schreiben dazu:
"Behinderung wird als soziales Faktum verstanden, das durch gesellschaftliche Arbeits- und Verwertungsprozesse, historische und kulturelle Normen seinen Bestimmungsort findet. Insbesondere sind hierbei Prozesse der Verteilung abstrakter Arbeit von Bedeutung: Behinderung verweist jeweils auf ‚Arbeitskraft minderer Güte' sowie auf unterschiedliche Dimensionen sozialer ‚Unvernunft'. Im Prädikat ‚Behinderung' spiegeln sich demzufolge immer auch Prozesse der Ausgrenzung und des sozialen Ausschlusses. Derartige Prozesse haben Wirkung für den Aufbau der Persönlichkeit und des Ichs. Nicht der körperliche ‚Defekt' ist in dieser Hinsicht das entscheidende und grundlegende Ereignis, sondern die durch diesen ‚Defekt' radikal veränderte soziale Entwicklungssituation. (S. 21)
JANTZEN (1980) beschreibt in diesem Sinne als grundlegendes Moment für die Behinderung eines Menschen das "Paradigma der Isolation". Danach ist Isolation "der Ausdruck inadäquater Lebensbedingungen" (S.88). Zum einen können hier "krankhafte Prozesse, Sinnesschäden, Bewegungsbeeinträchtigungen sowie zentrale Störungen [...] als innere isolierende Bedingungen" (S.90) bezeichnet werden. Wesentlich ist, dass diese ihre Wirkung als inadäquate Lebensbedingungen nur entfalten, wenn das Umfeld des Betreffenden keine adäquaten Kompensationsmöglichkeiten bereithält. JANTZEN und LANWER-KOPPELIN (1996) führen aus:
"Ausgangspunkt von Isolation kann eine biotische Schädigung sein, entscheidend ist jedoch ob mit dieser zugleich das soziale Verständnis für einen Menschen abreisst." (S. 5)
Der Defekt beeinträchtigt die Möglichkeit des Austausches mit der Welt. Er versetzt den Menschen in eine Entwicklungssituation, in der der normale soziale Kontakt nicht mehr ausreicht. Von zentraler Bedeutung in dieser Situation ist die Möglichkeit des Umfeldes, angemessene Formen des Dialoges und der Kooperation zu realisieren, die diesen Austausch aufrechterhalten und sichern (vgl. JANTZEN 1990, S. 209ff). Der Mensch als selbstorganisiertes Wesen ist zur Verwirklichung der Selbstorganisation auf den Austausch mit der Umwelt angewiesen. Mit dieser ist er strukturell gekoppelt, wodurch seine "Ontogenese" immer auch "Ko-Ontogenese" ist (vgl. Kapitel 1.1.). Erst im Austausch mit anderen Menschen besteht die Möglichkeit menschlicher Entwicklung durch einen Prozess der persönlichen Aneignung gesellschaftlicher Bedeutungen (vgl. LEONT`EV 1977):
"Der Mensch lebt in einer Wirklichkeit, die sich ihm gleichsam immer weiter öffnet. Zu Anfang ist die Welt des Menschen der enge Kreis der ihn unmittelbar umgebenden Menschen und Gegenstände, die Wechselwirkung mit ihnen, ihre sinnliche Wahrnehmung, die Aneignung dessen, was man von ihnen weiß, die Aneignung ihrer Bedeutung." (S. 92)
Grundlage für diesen Entwicklungsprozess eines Menschen ist die Beziehung zu anderen Menschen im "Dialog". BUBER (1994) fasst die Bedeutung des Dialogs in die Aussage: "Der Mensch wird am Du zum Ich" (S. 32). Nur im Dialog entsteht die Basis für die Vermittlung des "gesellschaftlichen Erbes" (JANTZEN 1980, S.91) von Gegenstandsbedeutungen, Sprache und Kultur, mit denen sich der Aufbau von "Tätigkeit", "Bewußtsein" und "Persönlichkeit" (vgl. LEONT`EV 1977) vollzieht. Die Vermittlung von Bedeutungen auf der Basis des Dialoges realisiert sich in der "Kooperation am gemeinsamen Gegenstand" (FEUSER 1995, S.174). Unter "gemeinsamen Gegenständen" sind dabei nicht nur materielle Gegenstände zu verstehen, sondern ebenso abstrakte Prozesse. Die Reichhaltigkeit der Kooperation ist bezüglich der Angebote und der dabei eröffneten Erfahrungsmöglichkeiten maßgeblich für die Entwicklungs-möglichkeiten eines Menschen. Aufbauend auf BUBER schreibt FEUSER (1995) dazu:
"Der Mensch, so können wir folgern - und das schließt ein, was wir an ihm vermeintlich pathologisch wähnen -, wird zu dem ICH, dessen DU wir ihm sind!" (S. 127)
Welche Folgen das Vorenthalten dialogisch-kooperativer Beziehungen für den Menschen hat, verdeutlichen die Untersuchungen von SPITZ (vgl. 1992), die zeigten, dass Säuglinge bei Verlust der kontinuierlichen Beziehung zu einer primären Bezugsperson je nach Dauer "anaklitische Depressionen" und darauf folgend schwere Formen des "Hospitalismus" ausbildeten. Aus den hier dargestellten Zusammenhängen wird deutlich, dass das Vorliegen einer inneren isolierenden Bedingung das Umfeld auf die Aufgabe verweist, ein adäquates dialogisch-kooperatives Verhältnis zu schaffen. Bezogen auf eines der von WATZLAWICK, BEAVIN und JACKSON (1993) beschriebenen Axiome menschlicher Kommunikation: "Man kann nicht nicht kommunizieren" (S.53), hebt FEUSER (1995) hervor, dass kein Defekt den Dialog, die Interaktion und die Kommunikation mit einem Menschen verhindern kann (vgl. S. 55). Dies haben sowohl ZIEGER (1997) in der Arbeit mit Menschen im Koma, als auch MESHCHERYAKOW (1979) in der Arbeit mit taubblinden Menschen gezeigt. Wesentlich hängt ein Gelingen von Dialog und Kooperation von der Kompetenz der Menschen ab, mit denen der betreffende Mensch konfrontiert ist. FEUSERs (1996b)erläutert:
"Was ich z.B. an einem anderen Menschen nicht verstehen kann, nehme ich wahr als seine Unverstehbarkeit. Meine Verstehensgrenze wird per Projektion auf den anderen zu dessen Begrenztheit. Meine Annahme über diese (nun für wesensmäßig gehaltene) Begrenztheit des anderen, die im Grunde aber meine Grenze charakterisiert, ihn wahrzunehmen, lassen mich nun so handeln, daß ich den anderen in Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssysteme, Förderungs-und Therapiezusammenhänge verbringe, die dieser meiner Annahme über seine Begrenztheit entsprechen." (S. 19)
FEUSER verweist hier auf die zweite Ebene der Isolation. Diese ist durch "äußere isolierende Bedingungen" gegeben, zu denen auch inadäquate dialogisch-kooperative Verhältnisse zu rechnen sind. Sie resultieren aus "Lebenssituationen, die durch Macht, Bedrohung, Vorenthaltung sozialer Erfahrungen, Vorenthaltung von Arbeit, Kooperation, Sprache, Realitätskontrolle, Individuen in Tätigkeitsformen der Ausgeliefertheit, Entfremdung, Armut, Verelendung zwingen"(JANTZEN 1980, S. 91). Diese können durch ganz unterschiedliche Situationen ausgelöst sein: "sei es durch den Aufenthalt in einem Gefängnis, der Situation nach einem Schiffbruch, dem Leben in einem Heim für Behinderte, dem Aufenthalt in einer Eisernen Lunge usw." (JANTZEN/LANWER-KOPPELIN 1996, S.21). Jede Form des Ausgeschlossenseins von der Teilhabe an vorhandenen Möglichkeitsräumen der Gesellschaft setzt den Menschen in ein Verhältnis, das sein Potenzial zur Persönlichkeitsentfaltung und
-bildung einschränkt. Nach GALTUNG (1975) lässt sich ein solches Verhältnis als Gewaltverhältnis bezeichnen. Gewalt liegt dann vor,
"[...] wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle und somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung. [...] Gewalt wird hier definiert als die Ursache für den Unterschied zwischen dem Potentiellen und dem Aktuellen, zwischen dem, was hätte sein können, und dem, was ist." (S.9)
Der Isolation als Ausdruck inadäquater Lebensbedingungen liegt Gewalt zugrunde. GALTUNG unterscheidet zwischen "direkter" und "indirekter" Gewalt, die "personal" oder "strukturell" (S.12) verursacht ist. In diesem Sinne sind Paternalismus auf der Beziehungsebene und Postfordismus als gesellschaftliche Struktur Formen der Isolation durch Gewalt, die sich Behinderung in den sozialen Verhältnissen und nicht am Defekt eines Menschen konstruiert. Dazu schreibt JANTZEN (1999b):
"Geistige (körperliche, psychische; Anm.d.Verf.) Behinderung als soziale Konstruktion bedeutet nicht, dass die Biologie keine Rolle spielen würde. Ganz im Gegenteil. Sie versetzt geistig behinderte Menschen in ein anderes Verhältnis zu den Menschen und zur Welt und damit zur Möglichkeit des Aufbaus von Sprache, Kultur und Identität. Und dieses Verhältnis dauert das ganze Leben. Allerdings ist es nicht mehr die Biologie, die in diesem Prozess die führende Rolle spielt, sondern die Fähigkeit der jeweiligen Umgebung, ihre Ausdrucksweise so zu normalisieren, dass jeder behinderte Mensch auf jedem Niveau in jedem Lebensabschnitt besondere Möglichkeiten der Teilhabe entwickeln kann. Geschieht dies nicht, so entwickeln sich behinderte Menschen in kultureller, in sprachlicher und in dialogischer Isolation." (S.211; Hervorhebungen des Autors)
Für die soziale Konstruktion körperlicher Behinderung kann dieser Zusammenhang an folgenden Beispielen verdeutlicht werden. Dabei sind die äusseren Bedingungen die wesentliche Ursache der Behinderung, nicht eine vorliegende Schädigung:
"Ein Rollstuhlfahrer, zum Beispiel, wird behindert durch einen Architekten, der nicht an Rampen denkt. Jemand, der nicht sprechen kann, ist behindert durch den Mangel an Vorrichtungen für elektronische Kommunikation. Ein Blinder wird behindert durch Autos, die auf dem Gehweg parken, und jemand, der taub ist, durch den Mangel an Kenntnissen in der Zeichensprache unter den Hörenden." (SINASON 2000, S. 11)
Die Konstruktion geistiger und psychischer Behinderung lässt sich in Betrachtung der Ausführungen von MATURANA und VARELA (1987) verdeutlichen. Isolation durch inadäquate Beziehungs- und Gesellschaftsstrukturen, die auf der kognitiven Ebene Aneignungsprozesse einschränken oder auf der emotionalen Ebene Stress durch Angst, Wut usw. hervorrufen, ist für die Selbstorganisation des Menschen eine Randbedingung, unter der seine Möglichkeit Autonomie aufrechtzuerhalten erheblich beeinträchtigt wird. Um die Autonomie unter diesen Bedingungen zu sichern, wird seine Tätigkeit dadurch geprägt sein, Kompensationsstrategien zu entwickeln. Kognitiv wie emotional müssen Anpassungen zur Bewältigung der Gegebenheiten der Umwelt geleistet werden. Damit verbunden sind notwendige Übergänge von einer durch das isolierende Ereignis unterbrochenen Entwicklungslinie zu einer anderen, die die Kompensation des isolierenden Ereignisses zulässt, und so die weitere Existenz sichert. In diesem Sinne ist "jede Verhaltensänderung (jeder Lernprozess; Anm.d.Verf.) komplexer Systeme[...]entwicklungslogisch - ob uns das resultierende Ergebnis nun genehm ist oder nicht." (FEUSER 1995, S.121). FEUSER schreibt hierzu:
"Was uns aus der Außenperspektive als ‚andersartig', als ‚pathologisch' erscheint, muß aus der Binnenperspektive als gelungener Versuch angesehen werden, das eigene System an einer kritischen Labilitätsgrenze auf einem anderen, ihm in gleicher Weise möglichen ‚Zweig' seiner Evolution zu stabilisieren." (S.122)
Das Stabilisieren kann sowohl auf der biologischen, der psychologischen wie auch auf der soziale Ebene stattfinden. Was aus der defektlogischen Sicht an einem Menschen als Defizit erscheint, ist aus der entwicklungslogischen Perspektive individuell sinnvoll, und damit Ausdruck seiner Kompetenz. FEUSER (1995) schreibt in diesem Zusammenhang:
"Der Wahn, die tiefe Bewußtlosigkeit, die schwere geistige Behinderung, der Autismus, die Epilepsie, die Neurose u.a.m. sind nicht das Produkt eines aus der menschlichen Natur herausgefallenen Individuums, das nun keine Person mehr ist, sondern das qualitative Integral der selbstorganisierten Lebensrealität eben dieses Subjekts; eine eben nur dem Menschen mögliche und unter den für ihn gegebenen Bedingungen intelligente Möglichkeit des (Über-)Lebens. Jedes lebendige System hat nichts mehr oder weniger als (s)eine Geschichte (Biographie) und eine nicht bestimmbare Fülle an Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln ( E(n-1))." (S.122ff)
Wird durch die Umwelt keine Möglichkeit gegeben, isolierende Bedingungen für einen Menschen aufzuheben, um damit neue Möglichkeitsräume zu schaffen, kommt es im Resultat zur andauernden Produktion und Reproduktion von Behinderung als sozialer Konstruktion. Wird Behinderung aus der entwicklungslogischen Sicht verstanden, erscheint es mehr als zweifelhaft angesichts der Vielzahl der Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen, diese anhand diagnostischer Dogmen festlegen zu wollen. Dies kann nur als (Vor-)Urteil einer defektlogischen Sichtweise angesehen werden (vgl. FEUSER 1995, S. 107ff).
Nachdem ein Verständnis für Behinderung als soziale Konstruktion entwickelt wurde, sollen in diesem Zusammenhang die isolierenden Bedingungen des institutionellen Kontextes betrachtet werden und dabei insbesondere die Bedeutung der Einschränkung von Selbstbestimmung für den Behinderungsprozess als ein Element dieser Bedingungen.
Institutionen arbeiten zum Zwecke reibungsloser Abläufe und der Erfüllung ihres institutionellen Auftrages mit Mechanismen, die die Selbstbestimmung ihrer Insassen systematisch einschränken. GOFFMAN (1973) schreibt dazu:
"In erster Linie unterbinden oder entwerten totale Institutionen gerade diejenigen Handlungen, die in der bürgerlichen Gesellschaft die Funktion haben, dem Handelnden und seiner Umgebung zu bestätigen, daß er seine Welt einigermaßen unter Kontrolle hat - daß er ein Mensch mit der Selbstbestimmung, Autonomie und Handlungsfreiheit eines ‚Erwachsenen' ist." (S.50ff)
Entsprechende Disziplinierungen beziehen sich im Rahmen des institutionellen Auftrages auf das Handeln und auf das Sein der Insassen (S.184). Dies bewirkt Demütigungsprozesse und die Zerstörung der Handlungsökonomie. Für die Insassen ergeben sich aus dieser Situation massive Angriffe auf ihr Selbst, denen sie sich zu stellen haben. Begegnen sie diesen mit Widerstand, ist das Personal durch seine umfassende Informiertheit in der Lage, dies dem Insassen als Ausdruck seiner Problematik zu spiegeln und mit der Aberkennung von Privilegien zu sanktionieren. Aus den dadurch schwankenden Lebensbedingungen des "Ortes" Institution und den Zurechtweisungen, die dem Betreffenden unsanft klar machen, dass er schließlich zu Recht dort ist, ergeben sich "Spiegeleffekte" (S.148). Beim den Betreffenden kann dies in einen Prozess der fortschreitenden Selbstentwertung führen (vgl. S.145ff). Darüber hinaus birgt der Widerstand des Insassen gegenüber dem Personal die Möglichkeit von Spiralen aus Reaktion und Gegenreaktion, die GOFFMAN "Looping" nennt. Diese sind angesichts ihrer Ohnmacht eine Quelle aggressiver und autoaggressiver Verhaltensweisen auf Seiten der Insassen. Aggression und Autoaggression (vgl. JANTZEN 1992) als "auffällige" Verhaltensweisen, wie sie besonders auch Menschen mit geistiger Behinderung zeigen (vgl. JANTZEN 1999b, S.200ff), werden auf diese Weise erst geschaffen. Da Widerstand "jedoch bedeutet, die gesamte negative Kraft der Einrichtung auf sich zu ziehen" (JANTZEN/SCHNITTKA 2001, S.42), wird der Betreffende je nach Kompetenz und Schwere der Angriffe auf sein Selbst Anpassungen an die Situation suchen, mit denen er sich schützen kann. GOFFMANs (1973) Beschreibung der "moralischen Karriere" von Insassen totaler Institutionen beinhaltet verschiedene Strategien solcher Anpassungen, die der Betreffende in verschiedenen Phasen seines Aufenthaltes verfolgen kann (vgl. S."65ff).
-
Mit dem "Rückzug aus der Situation" bricht der Insasse Interaktionsprozesse zur Umgebung ab. Diese sieht er aus einer Perspektive, die von den anderen nicht geteilt wird. GOFFMAN verweist darauf, dass für diese Art des Verhaltens Begriffe wie "Regression" und "Stumpfsinn" angewendet werden.
-
Der "kompromisslose Standpunkt" bedeutet die Verweigerung der Mitarbeit. Dieser Schutz des Selbst zieht weitere Sanktionen nach sich und wird häufig als anfängliche Reaktionsphase zugunsten anderer Anpassungen aufgegeben.
-
In der "Kolonisierung" arrangiert sich der Insasse mit den Lebensbedingungen der Institution. Hierdurch versucht er, die günstigsten Bedingungen für sich zu erreichen.
-
Bei der "Konversion" werden die definierten Ziele der Institution übernommen und leidenschaftlich vertreten.
-
In der Strategie des "ruhig Blut Bewahrens" zeigt sich eine opportunistische Kombination verschiedener Strategien.
Neben solchen primären Strategien beschreibt GOFMAN die sekundäre Anpassung. Aus ihr entsteht das "Unterleben" einer Institution, das vergleichbar ist mit der "Unterwelt" einer Stadt (S.194). Mit der sekundären Anpassung sind Praktiken gemeint, die die offiziellen Ziele und Regeln des Systems unterlaufen. Dies ist stark mit dem Privilegiensystem der Institution verbunden, mit dem Zugänge, z.B. zu Privatheit und Besitz, geregelt werden. So schaffen sich die Insassen Freiräume, in denen sie die Möglichkeit haben, ihr Selbst zu reorganisieren und aufrechtzuerhalten. Innerhalb der Freiräume kann eine Handlungsökonomie hergestellt und damit ein gewisses Maß an Selbstbestimmung gesichert werden. Dies kann zu "Überdeterminiertheiten" führen. In der Überdeterminiertheit bekommen Territorien, Gegenstände und ihre Verfügbarmachung eine herausragende Bedeutung, die sie "normalerweise" nicht besitzen. Dies drückt sich z.B. im Anlegen von "geheimen Depots" (S.239) oder "in Form des Hortens seltsamer Gegenstände" (JANTZEN 1999b, S.207) aus. Für die Überdeterminiertheit von Territorien gibt GOFFMAN (1973) ein Beispiel:
"Die Mindestfläche, die ein persönliches Territorium einnahm, war die Bettdecke des Patienten. Auf einigen Stationen trugen etliche Patienten ihre Decke tagsüber mit sich herum, und in einem Akt tiefster Regression rollten sie sich auf dem Fußboden zusammen und bedeckten sich vollkommen mit ihrer Decke; auf dem bedeckten Raum verfügte jeder dieser Patienten über einen Rest von Selbstbestimmung." (S.237)
Betrachtet man GOFFMANs Ansatz gemeinsam mit der von JANTZEN (1999b) beschriebenen paternalistisch orientierten Beziehungsarbeit der guten Helfer, so lassen sich Strukturen erkennen, aus denen sich Effekte für das Selbst ergeben. Die mit Loopings und Empathiezyklen aufgenötigte Einordnung in die Selbstdefinition der HelferInnen führt zur emotionalen Überwältigung des Betroffenen. Dieser muss in die definierten Arrangements auf eine Weise einwilligen, die dem Helfer seine gute Rolle bestätigt, falls er das für sein Selbstgefühl benötigt. Als Konsequenz kann diese Form der Überwältigung im Laufe der Zeit auch mit der Übernahme der paternalistischen Definitionen des Personals in das eigene Selbstbild einhergehen. Die Hilfebedürftigkeit, die stellvertretende Positionen als notwendig erscheinen lässt, wird so erst hergestellt und weiter aufrechterhalten (vgl. 207ff). JANTZEN beschreibt das Ergebnis einer Identitätskonstruktion in paternalistischen Abhängigkeitsverhältnissen als Konstruktion von geistiger Behinderung auf der Basis "erlernter Inkompetenz":
"Motivationale Abhängigkeit von der Beziehungsabsicherung statt vom Handlungsergebnis [...], schwankendes und niedriges Anspruchsniveau, Mißerfolgsmotivierung, vor allem aber auch Selbstentwertung, denn der Verstoß gegen den ‚guten' Helfer kann nur als Ausdruck der eigenen ‚schlechten' Natur, des eigenen ‚schlechten' Charakters wahrgenommen werden." (S.209)
Die hier beschriebenen Folgen der Isolation durch das Verhindern von Selbstbestimmung zeigen nicht nur die Einschränkung aktueller Gestaltungsmöglichkeiten der Umwelt, sondern der Selbstbestimmungspotenziale des Menschen selbst. Die Kultur der Institution, die sich wesentlich von der Kultur der Außenwelt unterscheidet, ruft nach längerem Aufenthalt für den Betreffenden einen Prozess der "Diskulturation" (S.24) hervor, d.h., der Betreffende verliert, oder gewinnt gar nicht erst, die Möglichkeit, sich in den Gegebenheiten der Außenwelt zurechtzufinden. In diesem Sinne sieht RÜGGEBERG (1985) Selbstbestimmung und Behinderung als zwei Richtungen ein und desselben Prozesses:
"Autonomie (Selbstbestimmung, Anm.d.Verf.) ist also zu verstehen als Richtung des Behinderungsprozesses, nämlich als die Gegenbewegung zu Behinderung, zu Isolation und Abhängigkeit." (S. 51)
Ein solcher Ansatz ist nicht selbstverständlich. Nicht unbedingt werden die hier von GOFFMAN und JANTZEN beschriebenen Verhaltensweisen als entwicklungslogisches Produkt sozialer Erfahrungen und persönlicher Geschichte unter bestimmten Lebensbedingungen begriffen. Ebenso finden sich solche Beschreibungen in psychiatrischen und pädagogischen Klassifikationen, die sie im Rahmen der Defektlogik auf Natur und Schicksal des Betreffenden reduzieren oder anhand bestimmter "Devianzkriterien" (vgl. FENGLER/FENGLER 1994 S.90) dem Charakter eines Menschen zuweisen. Aus der Sicht von Behinderung als sozialer Konstruktion ist ein Mensch mit Behinderung nicht als geschichtsloses Objekt zu begreifen, sondern nur als Subjekt seiner Biografie, zu der auch die Auseinandersetzung mit der Institution gehört. GOFFMAN (1973) stellt fest, dass die Ähnlichkeiten der einzelnen Anpassungsstrategien darauf hinweisen, dass die Gründe für ihre Entstehung nicht auf individuelle Problematiken zurückzuführen sind (S. 129). BASAGLIA (1971) verweist darauf, dass immer die doppelte Realität im Behinderungsprozess erkannt werden muss:
"Wenn der Kranke (behinderte Mensch, Anm.d.Verf.) tatsächlich die einzige Realität ist, mit der wir uns zu befassen haben, so müssen wir uns allerdings mit beiden Gesichtern dieser Realität auseinandersetzen: 1. mit der Tatsache, daß wir einen kranken Menschen vor uns haben, der psychopathologische Probleme aufwirft (die dialektisch und nicht ideologisch zu verstehen sind), und 2. mit der Tatsache, daß wir einen Ausgeschlossenen, einen gesellschaftlich Geächteten vor uns haben. Eine Gemeinschaft, die sich als therapeutisch versteht, muß diese doppelte Realität berücksichtigen - die Krankheit und die gesellschaftliche Ächtung -, um schrittweise die Persönlichkeit des Kranken wiederherstellen zu können, und zwar so, wie sie wahrscheinlich war, bevor die Gesellschaft mit ihren zahlreichen Etappen der Ausschließung einerseits und die von dieser Gesellschaft erfundene Irrenanstalt mit ihrer negativen Gewalt andererseits auf ihn einwirkte." (S. 151)
Für eine an der doppelten Realität orientierten Entschlüsselung des Behinderungsprozesses bedarf es einer Diagnostik, die dieser Problematik Rechnung tragen kann. Hierzu sei auf den Ansatz von JANTZEN und LANWER-KOPPELIN (1996) zu einer rehistorisierenden, verstehenden Diagnostik verwiesen. Rehistorisierung bedeutet, den anderen als Subjekt seiner Geschichte zu begreifen, mit der Frage, warum jemand so geworden ist, wie er ist. Über die Sammlung von Erklärungswissen über die vergangene und gegenwärtige Lebensrealität des Betreffenden hinaus muss der Akt des Verstehens für die dialektische Entschlüsselung der Situation geleistet werden. Der Schlüssel dazu liegt in der Anerkennung des anderen als Meinesgleichen:
"Indem ich mich in die Möglichkeit versetze, daß ich es hätte sein können, der diesen Bedingungen ausgesetzt war, wird aus dem "Fall von" des oder der Anderen nunmehr ein Fall von Meinesgleichen. Indem ich mich in dem Anderen als Möglichkeit meiner Existenz spiegele, werde ich für einen Augenblick emotional überwältigt, berührt." (S.26)
In einem solchen Verständnis findet sich der Ansatzpunkt für die Außerkraftsetzung isolierender Bedingungen. Hierzu gehört die Analyse aller Strukturen einer Gesamtsituation. Nach JANTZEN (1998) ist dazu eine Reflexion anhand verschiedener Beobachterstandpunkte notwendig, wobei nur die Einnahme aller Standpunkte die Bedingungen der Gesamtsituation berücksichtigt. Dazu gehören der am Defekt orientierte "personenbezogene Beobachterstandpunkt", der "verhaltensbezogene Beobachterstand-punkt", der Verhalten und soziale Umstände in Bezug setzt, der "systemische Beobachterstandpunkt", der dynamische Beziehungen berücksichtigt und ein vierter "selbstreflexiver Beobachterstandpunkt", mit dem man in der Lage ist, sich selbst als Bestandteil isolierender Bedingungen zu begreifen (S.129ff). So kann eine Veränderung der Gesamtsituation einschließlich der Selbstveränderung vorgenommen werden, durch die die Teilhabe eines Menschen an der gemeinsamen Welt und die erst damit gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten in dialogisch-kooperativen Situationen entwickelt und gesichert werden können. Unter diesen Bedingungen kann sich Selbstbestimmung als Gegenkraft zum Behinderungsprozesses entfalten.
Anerkennung und Ermöglichung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten sind aber nicht nur von Bedeutung für den Behinderungsprozess. Ihre Verweigerung ermöglicht darüber hinaus Angriffe auf die allgemeinsten Menschenrechte. Angesichts der Forderungen SINGERs und anderer Moralphilosophen ist die Teilhabe am Selbstbestimmungsrecht auch ein Schutz der Lebensrechte behinderter Menschen. SCHÖNWIESE (1993) formuliert dazu:
"Nur die praktisch gelebte Integration auf der Grundlage der Selbstbestimmungsrechte behinderter Menschen ist die langfristig wirksamste Waffe gegen die inhumane Theorie und Praxis der neuen Euthanasie. Schaffen wir die Bedingungen dafür !" (S. 234ff)
Bei der Schaffung solcher Bedingungen geht es vor allem um die Aufhebung isolierender Bedingungen und den Abbau struktureller Gewaltverhältnisse in allen Lebensbereichen behinderter Menschen. Dies soll im Nachfolgenden auf gesellschaftlicher, institutioneller wie auch auf der Beziehungsebene betrachtet werden.
Auf der gesellschaftlichen Ebene entsteht strukturelle Gewalt und als Folge davon isolierende Bedingungen, vor allem durch den fortschreitenden "Abbau des Sozialstaats". Dies ist der Rahmen, in dem Menschen mit Behinderungen ihre Forderungen nach Selbstbestimmung stellen. Verschlechterungen der Versorgungsstrukturen der Behindertenhilfe bedeuten aber nicht nur, dass eine Zunahme an Gestaltungsmöglichkeiten in Frage gestellt ist, sondern auch eine allgemeine Verschlechterung von Lebenschancen. Anstelle einer adäquaten Bereitstellung von finanziellen Ressourcen, die eine angemessene Unterstützung durch Sachmittel und Personal erlauben würde, steht deren zunehmende Verknappung. Im Kontext einer sich globalisierenden Wirtschaft wird dies der Bevölkerung als Sachzwang im Rahmen einer nationalen Standortsicherung verkauft, und die Auswirkungen für behinderte Menschen werden durch Instrumentalisierungen des Selbstbestimmungsgedankens oder durch direkte Angriffe auf ihre Menschenrechte legitimiert. Die Zielvorstellung für dieses standortpolitische Vorgehen, die Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit mit Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und Armut durch Stärkung der Wirtschaft, ist angesichts weiter wachsender Arbeitslosenzahlen aber zu bezweifeln. BUTTERWEGGE (2001) bemerkt dazu:
"Die Steuerbelastung der Unternehmen war noch nie so gering, die Arbeitslosigkeit hingegen noch nie so hoch. Daraus den Schluß zu ziehen, man müsse die (Gewinn-) Steuern senken, damit in Privatunternehmen mehr Stellen entstünden, war völlig absurd... " (S. 132)
Und weiter sagt er:
"Das neoliberale Konzept der Flexibilisierung und der Deregulierung des Arbeitsmarktes vermehrt die Armut auf der ganzen Welt, wohingegen es den unvorstellbaren Reichtum weniger Konzernherren, Großaktionäre und Finanzmagnaten in den Metropolen potenziert. Dadurch gewinnt die von altersher bestehende, sich aber vertiefende Kluft zwischen Armen und Reichen eine ganz andere Qualität." (S. 134)
Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der angebliche Sachzwang so "vielmehr [als] Bestandteil einer Strategie zur Änderung der gesellschaftlichen Macht-, Einkommens- und Besitzverhältnisse" (S. 70). Eine postfordistisch orientierte Politik und Wirtschaft verursacht durch eine Deregulierung der Marktes eine massive Verteilung vorhandener Ressourcen von unten nach oben und von öffentlichen in private Hände. Politik und Wirtschaft sind aber keine isolierten Gesellschaftsbereiche. Ihre Ausformungen basieren auf einem Grundkonsens. FEUSER (1996a) bewertet die Verknappung finanzieller Ressourcen im sozialen Bereich vor diesem Hintergrund deshalb folgendermaßen:
"Die Endlichkeit aller Ressourcen ist eine derart lapidare Tatsache, daß sie sich anscheinend wie ein Narkotikum über unser Denken legt und damit einen Vorhang bildet, der die Verteilungsinteressen derer, die über die endlichen Ressourcen verfügen, hervorragend verschleiert. Es wird deutlich, daß es nicht um Ressourcen, sondern um Verteilungsfragen geht. Und daß diese wiederum primär mit Interessenssphären verbunden sind, die unmittelbar mit fundamentalen Einstellungen und Wertehaltungen dieser Gesellschaft zu tun haben, also mit mehr oder weniger konsensfähigen Bedeutungszumessungen an verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Diese berühren wiederum nicht primär den Umfang der zu verteilenden Ressourcen, sondern - ich möchte das einmal so sagen - die mit dem Prozess der Verteilung zum Ausdruck kommende gesellschaftliche Moral. Selbst wenn nur noch eine DM zu verteilen wäre, würde das Problem kein anderes sein." (S. 28ff)
In der Praxis verdeutlicht sich die gesellschaftliche Moral. Die bei der Verteilung von Ressourcen angewendeten utilitaristischen Kosten-Nutzen-Rechnungen und eine Ausrichtung auf Profitmaximierung zeigen, "dass das gesellschaftliche Interesse an der sozialen Wohlfahrt begrenzt ist, wenn keine wirtschaftlich verwertbaren Erfolge (Gegenleistungen) zu erwarten sind. Dies gilt vor allem für Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung, die volkswirtschaftlich gesehen einen lästigen Kostenfaktor darstellen..." (THEUNISSEN 2000, S.80ff). Was dies konkret heißen kann, beschreibt HIRSCH (1998) mit Blick auf die französische Sparpolitik:
"Nun kürzte aber die Regierung nicht die gewaltigen Subventionen für den europäischen Airbus oder das europäische Raumfahrtprogramm, sie kürzte auch nicht die sehr hohen Rüstungsausgaben, sondern eben die Sozialleistungen. Denn erstere sind für den ‚nationalen Standort' förderlich, die letzteren schädlich." (S.35ff)
In einer Gesellschaft, in der die Moral an der Marktlogik orientiert ist, tritt die soziale Komponente hinter die ökonomische zurück. Vor allem, wenn der Sozialstaat als "Sündenbock" identifiziert wird. BUTTERWEGGE (2001) ist der Meinung, dass "[s]elbst wenn die Standortsicherung zum Primärziel der Politik eines Landes avanciert, die soziale Sicherheit seiner Bürger/innen nicht auf der Strecke bleiben [muß], zumindest dann nicht, wenn es riesige Exportüberschüsse verzeichnet, wie über längere Zeit die Bundesrepublik Deutschland" (S.70). Er sieht einen möglichen Wandel hin zu einer Humanisierung gesellschaftlicher Verhältnisse in der Veränderung von Bedeutungszumessungen, Einstellungen und Wertehaltungen:
"Ausgangspunkt wäre nicht das verantwortungslose Krisengerede, mit dem man den Wohlfahrtsstaat zu schwächen sucht, vielmehr eine grundlegende Kurskorrektur in Richtung von mehr Solidarität, die einen breiten Konsens über die Notwendigkeit und Möglichkeit zur Umlenkung gesellschaftlicher Ressourcen sowie die Parteinahme zugunsten Armer, Obdachloser, Erwerbsloser, Kranker, Drogensüchtiger, Behinderter und anderweitig Benachteiligter einschließt." (S.160)
Eine solidarische Parteinahme findet ihre allgemeinste Grundlage in der Distanzierung von utilitaristischen Ethikkonzeptionen. An ihre Stelle wären Vorstellungen von Ethik und Moral zu setzen, die sich gegen die Konstruktion und Definition des nutzlosen Menschen, dessen man sich entledigen darf, stellen. Für JANTZEN (1998) sind die Bestimmungsstücke einer solchen Ethik das "sinnvolle Sein" und die "Ehrfurcht vor dem Leben" (S.203). Hieran orientiert kann parteiliches Handeln auf der Basis einer klaren Analyse der globalen Zusammenhänge, verbunden mit einer "Entkoppelung des ‚Sozio-Ökonomischen'" (FEUSER 1996a, S. 29) entstehen. D.h., die sozialen Fragen einer Gesellschaft nicht länger von der Logik des Marktes, der Maxime der Profitmaximierung und von Kosten-Nutzen-Rechnungen abhängig zu machen. Die soziale Frage ist "zwar unlösbar mit der ökonomischen verbunden, aber deshalb dennoch nicht ausschließlich durch diese bestimmbar"(ebd.). Es geht, im Sinne eines Abbaus struktureller Gewalt und damit einer gerechten Verteilung von Macht und Ressourcen, darum sich gegen die Handlungsweise neoliberaler Nationalstaaten und multinationaler Konzerne zu wenden und dabei anstelle des Wettbewerbes das Soziale bei der Lösung sozialer Probleme in den Vordergrund zu rücken.
Von Staat und Politik ist ein diesbezügliches Engagement kaum zu erwarten. Als Urheber der deregulierten Marktwirtschaft stehen die demokratischen Parteien immer mehr in Abhängigkeit der mit Abwanderung drohenden Konzerne. HIRSCH (1998) schreibt dazu:
"Wenn die Politik der nationalen Regierungen direkt und entscheidend von den Zwängen der internationalen Kapitalakkumulation und Kapitalzirkulation bestimmt wird, dann wird es immer unwichtiger, wer die Mehrheit im Parlament besitzt oder welcher Regierungschef gewählt wird." (S.35)
Ähnliches trifft auch auf die Zivilgesellschaft als wichtige, von der Regierung unabhängige Ebene sozialer Bewegungen zu. Gewerkschaften sind durch standortpolitische Argumentationen erpressbar, Presse und Universitäten sind kapitalistisch strukturiert und von privaten Geldgebern abhängig (S. 58). Die seit den 70er Jahren existierenden sozialen Bewegungen wie die Ökologie-, die Frauen- oder die Friedensbewegung sind gescheitert, als ihre Themen von den Parteien absorbiert und symbolisch übernommen wurden (S. 64). Auch die Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen sind von diesem Prozess bedroht, da das Thema Selbstbestimmung wesentlicher Bestandteil der neoliberalen Konzeption ist. Um Möglichkeiten für gesellschaftliche Veränderungen zu schaffen, ist HIRSCH (2002) angesichts dieser Zusammenhänge der Meinung:
"Es kommt darauf an, die bestehende, von den kapitalistischen gesellschaftlichen Formen geprägte und von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchzogene ‚Zivilgesellschaft' zu verändern, und zwar weltweit." (S. 214)
Vor diesem Hintergrund entwickelten sich seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, verstärkt aber seit Ende der 90er Jahre, neue soziale Bewegungen. Diese bilden eine wesentliche Kraft zur Wiederbelebung und Stärkung demokratischer Prozesse, indem sie unabhängig von Regierung und von kapitalistischen Verwertungszusammenhängen agieren. Sie unterscheiden sich in ihren Organisations- und Entscheidungsstrukturen, ihrem Organisationsgrad, ihren Aktionsformen, der Radikalität ihren Positionen und ihrem Selbstverständnis deutlich voneinander. Eine wesentliche Gemeinsamkeit ist hingegen die Kritik an der neoliberalen Globalisierung und deren Folgen (vgl. BOEHME/WALK 2002). International wahrgenommen wurden diese Bewegungen z.B. durch die Aufstände der Zapatistas in Chiapas Mexiko 1994 oder durch Protestaktionen wie z. B. in Seattle anlässlich der WTO-Tagung 1999 und in Genua zum G8-Gipfel 2001 (vgl. ebd.). Hier auftretende Gruppen wie ATTAC geht es dabei vornehmlich um die Korrektur kapitalistischer Fehlentwicklungen (vgl. HIRSCH 2002, S. 211), z.B. durch die Einführung der Tobin-Steuer. Anderen wie der PGA (Peoples Global Action) geht es dagegen um die Ablehnung des Kapitalismus als Lebensprinzip (HABERMANN 2002, S. 146). Neben diesen auf große Umbrüche abzielenden Aktivitäten spielen aber auch die gesellschaftsverändernde Kräfte des Alltäglichen, die vor allem von den Zapatistas (vgl. BRAND 2002) hervorgehoben werden, eine wesentliche Rolle. BOEHME und WALK (2002) schreiben hierzu:
"Neue soziale Bewegungen repräsentieren, so wird in der Bewegungsforschung hervorgehoben, eine Politik von unten. Soziale Gruppen, Nachbarschaft, persönliche Beziehungen und Freundschaften bilden das eigentliche Bewegungsmilieu, in dem sich die Interessen, Protesthintergründe, Argumentationslinien und Zielperspektiven einer Bewegung entfalten. Hier entstehen die Gemeinsamkeiten, Identitäten und Solidaritäten, aus denen sich schließlich das Lebenselixier der Bewegung zusammensetzt. Der Suchprozess, in dem Bewegungen ihre Ziele definieren und allmählich eine symbolische Gemeinschaftsidentität ausbilden, hat bei der Entstehung einer Bewegung einen hohen Stellenwert." (S. 14)
HIRSCH (2002, S. 200) ist der Meinung, dass dieser Teil verändernder Kräfte seinen Ansatzpunkt in den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu suchen hat. Weder die Konstruktion abstrakter Gegenentwürfe, noch die Schaffung autonomer Lebenswelten sind wirksame Alternativen. Die Veränderung muss "aus der Gesellschaft selbst hervorgehen" (HIRSCH 1998, S.65), womit letztendlich jeder Einzelne in seinem Lebenszusammenhang angesprochen ist.
Nachdem Möglichkeiten zur Humanisierung und Demokratisierung in einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung bestimmt wurden, verweist HIRSCH ebenfalls auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Beseitigung struktureller Gewalt im konkreten Lebensalltag behinderter Menschen. Auch wenn Gewalt von der gesellschaftlichen Ebene ausgeht, kann eine Gegenkraft in der Beseitigung ihrer direkten und indirekten Folgen liegen. Aus den Forderungen der Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen wird deutlich, dass vor allem der Bereich der institutionellen Behindertenhilfe zu betrachten ist. Neben den Forderungen nach Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzen liegt ein Schwerpunkt im Engagement für den Abbau institutioneller Abhängigkeitsverhältnisse und damit einhergehender struktureller Gewalt.
Damit institutionelle Veränderungsprozesse zu einer wirklichen Gegenkraft im Sinne der Selbstbestimmung behinderter Menschen werden, dürfen sie nicht isoliert verlaufen, sondern haben ihre Wirkung auch tatsächlich auf den gesellschaftlichen Kontext zu entfalten, bzw. diesen Kontext mitzubearbeiten. Nicht zuletzt auch, weil diese Institutionen in ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte eng an die der kapitalistischen Gesellschaft gebunden sind. Gesellschaft und Institution stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander. In diesem kommt den Institutionen der Auftrag zu, den reibungslosen Ablauf der gesellschaftlichen Prozesse zu gewährleisten. Zur Bedeutung der Beachtung dieser Zusammenhänge schreibt FEUSER (1995):
"Es wird [...] so getan, als wäre mit der Beseitigung der Sondereinrichtung bereits die Gegenwelt zu der des Aus- und Einschlusses geschaffen, in der die Persönlichkeitsentwicklung ohne psycho-soziale Beeinträchtigungen erfolgen könnte, als wäre die Gegenkraft entfaltet, die es zu leisten vermag, dem Druck der normierenden gesellschaftlichen Mythen und Ideologien zu widerstehen, die dem Instrument der sozio-ökonomischen Benachteiligung auch außerhalb der Mauern der Sondereinrichtungen die Vorenthaltung der Teilhabe an regulären Lebensprozessen praktizieren und auf diese Weise immer wieder die Welt des Aus- und Einschlusses von neuem schaffen." (S. 42ff)
Orientierungspunkt für die Humanisierung und Demokratisierung institutioneller Verhältnisse ist der Abbau der Merkmale totaler Institutionen. Wie gezeigt wurde sind die institutionellen Strukturen der Behindertenhilfe, da sie eine Vielzahl von Elementen der Fremdbestimmung aufweisen, wenig geeignet, eine selbstbestimmte Lebensführung behinderter Menschen zu ermöglichen. Zumindest auf dem Sektor der Fachliteratur sind diese Probleme weitgehend wahrgenommen und bearbeitet worden[9]. Aus diesen Analysen ist eine Anzahl von Ansätzen entstanden, die dazu beitragen können, ein selbstbestimmtes Leben für behinderte Menschen zu ermöglichen. Nach der Kenntnisnahme der Ursachen institutioneller Formen struktureller Gewaltverhältnisse ist die Veränderung der Praxis aber ein noch offener Prozess. Mit Bezug auf die verschiedenen Aspekte, die für einen Veränderungsprozess zu beachten sind, verweist das Zitat eines Gespräches zwischen BASAGLIA (u.a., 1980) und SARTRE auf konkrete Ansatzpunkte:
"Basaglia: Es kommt darauf an das Andere nicht nur zu denken, sondern es zu machen. Eine der Vorbedingungen dafür ist, sich gegen die Instrumentalisierung der Wissenschaft (z.B. Pädagogik, Anm.d.Verf.) zu einem Mittel der Herrschaft zur wehr zu setzen [...] Sartre: Das Andere muß sich aus der Überwindung des Bestehenden ergeben. Kurz, es geht nicht darum, das gegenwärtige System pauschal zu negieren, abzulehnen. Man muß es vielmehr Zug um Zug außer Kraft setzen: in der Praxis. Der Angelpunkt ist die Praxis. Sie ist die offene Flanke der Ideologie." (S.39-40)
Ein wichtiger erster Schritt für eine "Zug- um- Zug- Außerkraft-setzung" der bestehenden Praxis besteht damit in der Beseitigung von Macht- und Gewaltmitteln von Seiten derer, die im institutionellen Bereich tätig sind. Dies ergibt sich durch eine Haltung, die von einer ungeteilten solidarischen Parteilichkeit gekennzeichnet ist und die Interessen und Bedürfnisse der behinderten Menschen zum Orientierungspunkt macht. Diese Parteilichkeit hat zwei Ebenen. Zum einen kann am Beginn eines Veränderungsprozesses im Sinne der Selbstbestimmung nicht das "Empowerment" (vgl. THEUNISSEN/PLAUTE 1995) stehen. Für den Akt der Selbstbemächtigung (vgl. dazu S.12) stellen die herrschenden Verhältnisse in den Wohnstätten eine unzumutbare Ausgangsbedingung dar. Trägerorganisationen der Behindertenhilfe wie auch die MitarbeiterInnen in den Wohnstätten müssen dem Rechnung tragen. "Es ist zynisch, Menschen mit geistiger Behinderung zu einer Befreiung von unserer Über-Macht über sie aufzurufen, anstatt unsere Macht über sie entschieden aufzugeben" (FEUSER 1998, S. 23). Auf einer zweiten Ebene bedeutet Parteilichkeit im Sinne der Selbstbestimmung, diese nicht erneut zu blockieren. FREHE (1996) schreibt hierzu:
"Für die professionellen Helfer bedeutet dies insgesamt, daß wir nicht wollen, daß sie durch ihr Engagement die Diskussion dominieren." (S.26)
Die Inhalte von Veränderungen und die Gestaltung neuer Lebensformen und Unterstützungssysteme müssen an den Interessen, Bedürfnissen und Vorstellungen der BewohnerInnen ausgerichtet sein. Aus den vielen Überlegungen zu dieser "Herausforderung an die Professionellen" (ROCK 1996) lassen sich wichtige, immer wiederkehrende Aspekte einer Neuorientierung in der Arbeit entnehmen. Die Basis einer solchen Neuorientierung liegt in der Veränderung bestehender Menschenbilder, die die Grundlage für die Betrachtung behinderter Menschen und für das Handeln professioneller Helfer bildet (vgl. HÄHNER 1994 u.1998b; WALTHER 1998). THEUNISSEN und PLAUTE (1995) erläutern:
"In der herkömmlichen Behindertenhilfe/Heilpädagogik werden behinderte Menschen als Patienten wahrgenommen und behandelt. Die professionellen Helfer haben sich dem ‚medizinischen Modell' verschrieben und dominieren als Experten [...] Charakteristische Momente dieses Ansatzes sind, auf dem Hintergrund eines biologistischen Menschenbildes, die Suche nach den Ursachen in der Person, die Beschreibung und Registrierung von Defiziten, Symptomen oder Auffälligkeiten, eine Etikettierungsdiagnostik [...] und eine auf Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit bzw. auf Anpassung und gesellschaftliche Verwertbarkeit zielende Therapie, die den einzelnen verobjektiviert und diszipliniert ..."(S. 17)
Dem kann ein Menschenbild entgegengestellt werden, das Behinderung als Ausdruck der Kompetenz eines Menschen und seiner Entwicklungslogik unter isolierenden Bedingungen entschlüsselt. In Verbindung mit der Erkenntnis, dass Behinderung und Selbstbestimmung zwei Richtungen eines Prozesses sind, ergibt sich hieraus die Notwendigkeit der Veränderung von Handlungsstrategien. NIEHOFF (1998b) umschreibt diesen Vorgang als "Entpädagogisierung des Alltags" (S.172) behinderter Menschen. Dies bezieht sich im Sinne BASAGLIAs darauf, Pädagogik nicht als Mittel der Herrschaft zu missbrauchen. Die paternalistische Definitionsmacht und deren Förderungsgedanke soll ersetzt werden durch die Unterstützung behinderter Menschen gemäß deren tatsächlichen Hilfebedarfen und Bedürfnissen. In diesem Zusammenhang muss besonders eine Verwechslung der Begriffe Selbstbestimmung und Selbständigkeit vermieden werden. Hilfe im Sinne der Selbstbestimmung kann nicht an Vorstellungen orientiert sein wie "[s]olange du nicht alleine deine Schuhe anziehen oder alleine mit dem Stadtbus fahren kannst, müssen wir dich in dieser Hinsicht fördern oder gar therapieren" (BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1996, S. 52). Auch bei eingeschränkter Selbständigkeit müssen Hilfen hierzu vom Betreffenden erwünscht sein. Bei einer Entpädagogisierung des Alltags geht es aber nicht um eine Entprofessionalisierung der Arbeit, wie dies z.B. von SACK (1998) ins Spiel gebracht wird. Bei seinen Vorstellungen zur "Normalisierung der Beziehung" (S.105ff) hebt er die Bedeutung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen hervor. Insbesondere geistig behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf[10] sind aber auf die Kompetenz ihrer Helfer hinsichtlich der Wahrnehmung und Umsetzung ihrer Interessen und Bedürfnisse angewiesen. Entscheidend ist, dass der behinderte Mensch die führende Rolle in der Beziehung zu den professionellen Helfern übernimmt. WALTHER (1998) sieht in diesem Zusammenhang eine "Auftragsänderung" für die Arbeit als bedeutsam an. Nicht der Lebensentwurf eines Menschen fällt mehr in den primären Aufgabenbereich des Helfers, sondern die Bereitstellung ausreichender Beratung, Unterstützung und Angebote, mit denen der einzelne diesen Entwurf nach eigenen Vorstellungen entwickeln kann (S.77ff). Zur Aufgabe von Pädagogik und Therapie sagt FEUSER (1996b) folgendes:
"Die Modifikation von Entwicklungsprozessen resultiert aus den Randbedingungen eines Systems und diese, nicht das System selbst, können unter Berücksichtigung der Biographie des Subjektes und der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten menschlicher Entwicklung pädagogisch und therapeutisch optimiert werden. Das ist die einzige Aufgabe, die legitim als pädagogische und therapeutische wahrgenommen werden kann." (S. 22)
Hinsichtlich der Gestaltung seines Lebens wird der behinderte Menschen nicht länger als "Defizitwesen", sondern als "Dialogpartner" (HÄHNER 1998a, S.32) bei der Gestaltung von Randbedingungen betrachtet. Ein solches dialogisches Verhältnis, dass überhaupt erst die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen sichert, muss im Sinne der Selbstbestimmung deren freie Entfaltung gewährleisten. Eine Entwicklung "dialogischer Formen der Begleitung" (vgl. HÄHNER 1998b; SACK 1998; OSBAHR 2000) muss das berücksichtigen. Manipulative Methoden paternalistischer Bevormundung, die FREIRE (1973) als "antidialogisch" bezeichnet, können dabei nicht in das Repertoire professioneller Hilfe gehören.
"Das erste Charakteristikum der antidialogischen Aktion liegt im Zwang zur Unterwerfung. Der antidialogische Mensch geht in seinem Verhältnis zu anderen Menschen darauf aus, sie zu unterwerfen - zunehmend und mit allen Mitteln, vom härtesten zum besorgtesten (Paternalismus)" (S.116).
Unter einem dialogischen Verhältnis versteht FREIRE folgendes:
"Zur dialogischen Aktionstheorie gehört nicht ein Subjekt, das aufgrund der Eroberung herrscht, und ein beherrschtes Objekt. Vielmehr gibt es hier Subjekte, die sich zusammenfinden, um die Welt zu benennen, um sie zu verändern." (S. 143)
Das hier von FREIRE beschriebene "Zusammenfinden" entspricht der Kooperation zweier Subjekte am gemeinsamen Gegenstand, die für die Entwicklung des Menschen von zentraler Bedeutung ist (vgl. Kapitel 6.1.1.). Für FREIRE ist die Kooperation auch Charakteristikum eines dialogischen Verhältnisses (vgl. ebd). Das Eingehen eines dialogisch-kooperativen Verhältnisses bedeutet für die professionellen HelferInnen eine Änderung des "beruflichen Selbstverständnisses" (HÄHNER 1998b, S.144). In diesem können sie nicht mehr als unangefochtene Experten mit Macht, Einfluss und Dominanz auftreten. Diese Position muss zugunsten der Gestaltungsmöglichkeiten und damit der Selbstbestimmung behinderter Menschen innerhalb des institutionellen Rahmens aufgegeben werden. In Anbetracht der Tatsache, dass unter institutionalisierten Lebensbedingungen für die BewohnerInnen kaum Möglichkeiten bestanden, Gestaltungskompetenzen zu entwickeln, wird sich eine Veränderung als "zirkulärer Prozess" (S.149) gestalten. Auftretende Schwierigkeiten und Ängste der BewohnerInnen angesichts der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Wahlmöglichkeiten auszuschöpfen, müssen respektiert werden. Das muss aber nicht das Ende von Veränderungsprozessen bedeuten, wenn durch die Aufrechterhaltung der Angebote zur Selbstbestimmung Gelegenheiten zur persönlichen Entwicklung für die BewohnerInnen weiterhin gegeben bleiben. FEUSER (1998) schreibt dazu:
"Freiheit, Selbstbestimmung und Integration können wir einem Menschen nicht geben, wohl aber grundlegend verhindern, daß er sie entwickelt, wie wir gesehen haben. Sie sind in kooperativen Prozessen von jedem von uns selbst anzueignen und zu entfalten" (S. 25)
Eine Umsetzungsmöglichkeit solcher Vorstellungen zur Neuorientierung der Arbeit im Sinne der Selbstbestimmung wird im "Assistenzmodell" gesehen (vgl. BRADL 1996; NIEHOFF 1998a; THEUNISSEN 2000). Dieses im Rahmen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung entwickelte Arbeitsmodell für HelferInnen soll durch eine Machtumverteilung die Selbstbestimmungsmöglichkeit in der Beziehung zwischen AssistentIn und AssistenznehmerIn gewährleisten. Das Modell basiert grundsätzlich auf der Übernahme bestimmter Kompetenzen für die Gestaltung und Durchführung der Assistenz durch die AssistenznehmerInnen:
-
"Personalkompetenz: Assistentinnen und Assistenten selbst auswählen und auch ablehnen zu können - und nicht das Personal des Pflegedienstes oder der Einrichtung akzeptieren zu müssen,
-
Organisationskompetenz: Einsätze und Zeiten der Hilfen planen zu können - und nicht von dem Einsatzplan des Pflegedienstes oder dem Dienstplan des Heimes abhängig zu sein,
-
Anleitungskompetenz: Über Form, Art, Umfang und Ablauf der Hilfen im einzelnen bestimmen zu können - und nicht durch die sogenannte Fachkompetenz der Pflegekräfte entmündigt zu werden,
-
Raumkompetenz: Den Ort der Leistungserbringung festlegen zu können - und die Hilfe nicht nur innerhalb der Wohnung zu erhalten,
-
Finanzkompetenz: Die Bezahlung der Hilfen kontrollieren - und die korrekte Leistungserbringung überprüfen zu können.
-
Differenzierungskompetenz: Die Hilfen nach eigener Entscheidung von verschiedenen Personen oder Anbietern oder aus einer Hand abfordern zu können - und nicht von den Leistungsdefinitionen in Kostenvereinbarungen der Anbieter abhängig zu sein." (FREHE, 1999, S.280)
Das Konzept der "persönlichen Assistenz" (vgl. S.271ff) ist vor allem von Menschen mit körperlichen Behinderungen erstellt worden. Prinzipiell richtet es sich aber an alle Menschen mit Behinderungen. Eine einfache Übertragung des Modells auf die Arbeit mit geistig behinderten Menschen wird aber als problematisch angesehen. NIEHOFF (1998a) schreibt dazu:
"Es hat sich gezeigt, daß der Begriff Assistenz auch bei helfenden Beziehungen zu Menschen mit geistiger Behinderung grundsätzlich von Bedeutung ist [...] Allerdings bedarf das Assistenzkonzept in bezug auf geistig behinderte Menschen der Erweiterung. Sie haben oft Schwierigkeiten, Anleitungsfunktionen auszuüben und einzuschätzen, wieviel und welche Hilfe sie benötigen. Das aufrichtige Bemühen um ihre größtmögliche Autonomie kann auch dazu führen, daß an geistig behinderte Menschen unerfüllbare Forderungen gerichtet werden." (S.54)
Im Sinne eines erweiterten Assistenzverhältnisses werden deshalb häufig auch die Begriffe "Begleitung" und "Begleiter" gewählt (vgl. HÄHNER 1994 u. 1998b). Die genannten Probleme sind aber weniger den Menschen mit geistiger Behinderung zuzuordnen. Eher wird hier der Stellenwert deutlich, den die Professionalität der HelferInnen im Assistenzverhältnis einnimmt. Eine Assistenz (oder auch Begleitung) für Menschen mit geistiger Behinderung realisiert sich an der Kompetenz der AssistentInnen im dialogisch-kooperativen Prozess Signale der Anleitung vom Betreffenden zu entschlüsseln und umzusetzen. FEUSER (2001) führt aus:
"Es ist damit am anderen nicht eine neue Kompetenz auszubilden, die wir ‚Selbstbestimmungsfähigkeit' nennen, sondern die Wahrnehmung und Analyse der ‚Verhältnisse zwischen den Verhaltensweisen' zu leisten, die deren Funktion und Bedeutung offenlegt." (S.337)
BRADL (1996), der ebenfalls eine Erweiterung des Assistenzkonzeptes im Hinblick auf geistig behinderte Menschen für erforderlich hält, bezieht dies nicht auf die Anleitungskompetenzen. Er bezeichnet das Konzept der "persönlichen Assistenz" der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung als "praktische Assistenz", die ein sachorientiertes Dienstleistungsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer darstellt und auf dieses beschränkt bleibt.
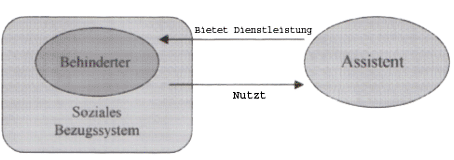
Abb. 5: Praktische Assistenz (S.198)
Eine "persönliche Assistenz" für Menschen mit geistiger Behinderung hat nach seinen Vorstellungen zusätzlich eine "Dolmetscherfunktion" zu erfüllen, die die AssistentInnen als wichtige Bezugspersonen teilweise in das soziale System der AssistenznehmerInnen mit einbindet und ihnen Aufgaben bei der Mitgestaltung ihrer Lebensplanung und von sozialen Kontakten zuweist.
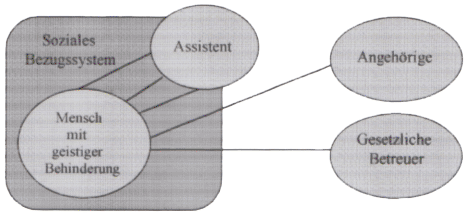
Abb. 6: Assistenz bei Menschen mit geistiger Behinderung (S. 199)
Im Gegensatz zum "institutionellen Betreuungsmodell" (vgl. Kapitel 5.1.2.) reduziert sich im Assistenzmodell das komplexe Beziehungsgeflecht. Die AssistentInnen sind dabei ausschließlich gegenüber dem behinderten Menschen und seinen individuellen Bedürfnissen verpflichtet und stehen nicht in der Loyalitätspflicht gegenüber Trägern, Team, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern. Neben dem Abbau fremdbestimmender Einflüsse auf der Beziehungsebene richtet sich das Assistenzmodell mit seinen Grundlagen auch gegen die bestehenden institutionellen Strukturen an sich. Die Umsetzung einer Assistenz ist im Rahmen eines auf allen Ebenen pauschalisierenden Systems nur bedingt möglich. Fremdbestimmende Strukturen wie das Dreiecksverhältnis bei der Zahlung von Geldern, das Schichtdienstmodell und die Bildung spezieller Wohnformen und Fallgruppen, die den BewohnerInnen eine Anpassung und Unterordnung an organisatorische Notwendigkeiten abfordert, sind mit der individualisierten Hilfeerbringung des Assistenzverhältnisses nur schwer vereinbar. Dies macht die Auflösung dieser fremdbestimmenden Strukturen durch Prozesse der Deinstitutionalisierung[11] erforderlich. Als Beispiel für eine Deinstitutionalisierung, aufbauend auf dem Assistenzkonzept, kann der Veränderungsprozess der Ev. Stiftung Alsterdorf in Hamburg gesehen werden (vgl. WEBER 2002, S.30 ff). Insbesondere der Geschäftsbereich Hamburg-Stadt bemüht sich dabei um eine "echte" Enthospitalisierung der BewohnerInnen aus dem ehemaligen Anstaltsgelände in die Stadtteile. Die zugrundeliegende Philosophie ist, jedem, der sich an den Geschäftsbereich wendet, eine Assistenz im Rahmen eines auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen zugeschnittenen Wohn- und Leistungsangebotes zu ermöglichen. Die AssistentInnen sind dazu nicht mehr als geschlossenes Team einem Haus zugeordnet. In Stadteilbüros werden "individuelle Hilfeplanungen" (vgl. LÜBBE/BECK 2002, S.30ff) zwischen NutzerInnen und AssitenInnen, vermittelt durch neutrale BeraterInnen erstellt. Den BewohnerInnen obliegt die führende Rolle in der Wahl der Person des Assistenten, sowie Zeitpunkt, Dauer und Ort der Hilfen. Ob unter der momentanen Bedingung zunehmender Verringerung finanzieller Ressourcen im Bereich der Behindertenhilfe, Veränderungsprozesse im Sinne der Deinstitutionalisierung stattfinden, wird wesentlich von der Bereitschaft der Träger abhängen, vorhandene Spielräume in diese Richtung zu nutzen (vgl. KRÜGER 1999, S. 289ff). Im Weiteren werden vorhandene "Motivation" und "Kompetenz" von MitarbeiterInnen institutioneller Wohneinrichtungen (vgl. RÜCKHOLDT 1999) dafür entscheidend sein, ob Veränderungsprozesse Selbstbestimmungsmöglichkeiten ungeteilt und konsequent umsetzen. Dazu verweisen THEUNISSEN und PLAUTE (1995) auf die Gefahr "heimlicher Betreuungskonzepte" (S.59). Zumeist unbewusst werden unter neuem Etikett alte Betreuungsmuster weitergeführt. GRÜNEWALD (1997) stellt anhand einer Befragung von MitarbeiterInnen in Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinderung fest, dass ein Großteil der MitarbeiterInnen davon ausgehen, bereits ansatzweise im Sinne der Selbstbestimmung der BewohnerInnen zu arbeiten. In der Ausgestaltung der Praxis bewegen sie sich aber in gewohnten Bahnen und halten an ihrem ursprünglichen Betreuungsauftrag fest. GRÜNEWALD geht in ihrer Untersuchung davon aus, dass die Tragweite der notwendigen Veränderung für die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens der BewohnerInnen nicht erkannt wurde (S. 64ff). Außerdem besteht die Gefahr der Bildung von Restgruppen, die im Sinne eines "harten Kerns" (JANTZEN 1999c. S. 40) als nicht "selbstbestimmungsfähig" oder nicht "assistierbar" gelten. Hinsichtlich dieser Problematiken soll sich der nachfolgende Abschnitt mit möglichen Handlungsorientierungen für professionelle HelferInnen in Grenzbereichen der Selbstbestimmung beschäftigen. Ein auf Selbstbestimmung als unteilbare Kategorie basierendes Handlungskonzept muss ein prinzipielles Anerkennen und Zugestehen von Selbstbestimmungsmöglichkeiten auch dann leisten, wenn diese außer Kraft gesetzt zu sein scheinen.
In vielen Beiträgen, die sich mit dem Selbstbestimmungsgedanken und seiner Umsetzung in die Praxis beschäftigen, taucht die Frage nach Grenzsituationen auf. Hierbei werden Situationen angesprochen, die Selbstbestimmung unmöglich oder zumindest schwierig erscheinen lassen. Es geht darum, ob man handeln muss und wie dies gestaltet sein kann. WALTHER (1998) zählt drei dieser Situationen auf: Nothilfe (um Gefahren abzuwenden), Notwehr (zur Selbstverteidigung des professionellen Helfers) und Vertretung der Interessen anderer, wie z.B. der Einrichtung oder der Mitbewohner (S. 87). In allgemeiner, gesellschaftlicher und rechtlicher Übereinkunft ist ein eingreifendes Handeln in solchen Situationen durchaus angezeigt und auf einer gesetzlichen Grundlage geregelt (vgl. SENATOR FÜR ARBEIT... 1999). Die Möglichkeiten der Ausgestaltung solcher Situationen im Sinne eines Selbstbestimmungskonzepts sollen später genauer betrachtet werden. Weitaus problematischer in der Klärung sind hier die, wie HÄHNER (1998b) sie nennt, "weniger schwerwiegenden Fälle" (S.140), die in vielen Alltagssituationen die Selbstbestimmung von BewohnerInnen in Frage stellen. Solche Situationen, die von den MitarbeiterInnen als schwierig erlebt werden und sie zu einem Rückgriff auf ihre Machtposition verleiten, verzeichnen APPEL und KLEINE-SCHAARS (1999) dann:
-
"wenn ein Bewohner sich nicht pflegt,
-
wenn ein Bewohner zuviel trinkt oder isst,
-
wenn ein Bewohner regelmäßig die Speisekammer plündert,
-
wenn ein Bewohner seinen Haushaltspflichten nicht nachkommt." (S.48)
Das Auftreten dieser Probleme kann, so WALTHER (1998), mit dem vorschnellen Urteil verbunden sein, dass Selbstbestimmung und Selbstverantwortung letztendlich eben doch keine realen Möglichkeiten für die Begleitung sind:
"Dann kann Selbstbestimmung plötzlich als unrealistisch erscheinen, sie wird zum schönen, aber leider abwegigen Wunschtraum. Wie stellt sich Verantwortung dar, wenn Begleiter bei der Ausübung von Selbstverantwortung durch behinderte Menschen Gefahren sehen? Müssen Begleiter nicht eingreifen und behinderte Menschen in der Ausübung ihrer Verantwortung dann doch wieder beschneiden? Wie weit kann Risiko zugelassen oder ausgehalten werden? Kann ein Mensch überhaupt selbst Verantwortung übernehmen, wenn er die Folgen seines Handelns aus der Sicht seiner Begleiter nur schlecht oder gar nicht einschätzen kann?" (S. 79)
Eine Klärung dieser Situationen ist also angezeigt, denn selbst, wenn es nicht zu einer totalen Verwerfung des Selbstbestimmungsgedankens kommt, ist an dieser Stelle zumindest eine weitere Gefahr zu sehen. Selbstbestimmung könnte so zu einer teilbaren Kategorie werden, die für die einen gilt, für andere aber nicht. Geistig behinderte Menschen könnten dann in Kategorien wie z.B. "assistierbar" oder nicht "assistierbar" eingeteilt werden. Wird Selbstbestimmung nicht als konzeptionelle Grundlage für alle anerkannt, lässt sich so erneut ein Ausschlussfaktor für den Zugang zur Selbstbestimmung konstruieren. Es könnte wieder zur Bildung von "harten Kernen" kommen. In diesem Sinne ist zu betrachten inwieweit ein Handeln in problematischen Situationen mit dem Selbstbestimmungskonzept in Einklang zu bringen ist. Die Fragen deuten auf eine Klärung des Handlungsbedarfs hin. Dem schließt sich m.E. die Frage nach entsprechenden Handlungsmöglichkeiten im Sinne der Selbstbestimmung der BewohnerInnen an.
Die Frage des Handlungsbedarfs soll hier an zwei Aspekten diskutiert werden. Den ersten Aspekt bringt JANTZEN (1998) ein, indem er auf verschiedene Varianten von "Sackgassen" (S.109ff) für Deinstitutionalisierungsprozesse verweist, die zur Verschleierung der vorhandenen Probleme führen. Eine dieser Varianten besteht darin, Handeln in Bezug auf Verhaltensweisen, wie die von APPEL und SCHAARS beschriebenen, grundsätzlich als Einschränkung des Selbstbestimmungsrechtes zu deklarieren. Ein bloßes Ignorieren entspräche aber einer unangemessenen Verschiebung von Verantwortung. Sowohl die Entstehungsgeschichte, als auch die Entstehungszusammenhänge solcher Verhaltensweisen würden damit verleugnet werden. Das, was als "Behinderung" oder "Verhaltensauffälligkeit" wahrgenommen wird, ist immer soziale Konstruktion unter Bedingungen der Isolation. In Institutionen ist diese durch vielfältige strukturelle Gewaltverhältnisse gegeben. Verhalten ist dann als kompetenter Versuch der Aufrechterhaltung von Autonomie anhand eingeschränkter Handlungsalternativen zu verstehen (vgl. JANTZEN 1998, S. 78 u. S.129ff). Verhaltensauffälligkeiten sind insofern kein Ausdruck von Selbstbestimmung. Selbstbestimmung kennzeichnet sich dem gegenüber gerade durch die Möglichkeit zur Auswahl von Handlungsalternativen. THEUNISSEN (2000) schreibt dazu:
"Derlei Verhaltensweisen sind nur oberflächlich betrachtet Ausdruck einer Selbstbestimmung, denn hinter dem Schein verbirgt sich nicht selten eine stark eingeschränkte Autonomie, insofern durch Hospitalisierung (totale Betreuung, Versorgung und Isolation)das Selbst-Konzept des Einzelnen schwer beschädigt, ja pervertiert wurde." (S. 139)
Die Verantwortung für die Schaffung humanerer Bedingungen kann nicht an die Opfer struktureller Gewalt abgetreten werden. Nicht zu handeln, wo Verhalten als Problem für den Betreffenden oder andere wahrgenommen wird, hieße im Grunde die Verhältnisse für die BewohnerInnen nur vorgeblich verbessern:
"Die betreffenden Personen mit diesem eingeschränkten Verhaltensrepertoire allein zu lassen, wäre ebenso inhuman und verantwortungslos wie der heilpädagogische oder therapeutische Versuch, die Verhaltensprobleme durch eine ausschließlich symptomzentrierte oder gar aversive Behandlung zu beseitigen." (S. 139)
Nachdem hier deutlich geworden ist, dass Handlungsbedarfe auch im Rahmen des Selbstbestimmungskonzeptes weiterhin bestehen können, betrifft der zweite Aspekt eine kritische Betrachtung zu Möglichkeiten der Festlegung von Handlungsbedarfen im Sinne der Selbstbestimmung der BewohnerInnen. Für die Feststellung eines Handlungsbedarfes scheint es darum zu gehen, die Fähigkeit oder Unfähigkeit einer Person zur Selbstbestimmung einzuschätzen. WALDSCHMIDT (1999) sieht den dafür angelegten Maßstab in der zugestandenen Vernunftfähigkeit einer Person. Dabei stehen Menschen, die mit dem Stigma einer Behinderung belegt werden, besonders leicht unter dem Verdacht, zur Selbstbestimmung[12] nicht oder nur eingeschränkt fähig zu sein. Vor allem für psychisch und geistig behinderte Menschen wird Selbstbestimmung eingeschränkt, weil ihnen ein vernünftiger Wille nicht zuerkannt wird:
"Die Vernunftfähigkeit, die Teilhabe an geistigen Fähigkeiten und damit verbunden das Vermögen, an der gesellschaftlichen Rationalität zu partizipieren, ist wohl der entscheidende Maßstab, an dem sich die Hierarchie unter Behinderten ausrichtet. Der jeweilige Grad an Vernunft weist den gesundheitlich Geschädigten (bzw. behinderten Menschen[13] ;Anm.d.Verf.) einen mehr oder weniger großen Grad an Subjekthaftigkeit zu und legitimiert zugleich, ihnen unterschiedliche Abstufungen an Selbstbestimmung zuzugestehen." (S. 25)
Wird Vernunft als die Grenze der Selbstbestimmung angesehen, besteht die Gefahr, dass jedes unliebsame Verhalten der BewohnerInnen von den MitarbeiterInnen als unvernünftig definiert wird und damit anscheinend außerhalb der Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Betreffenden liegt. Handeln wäre dann zu rechtfertigen. Wenn erforderlich, bestehen mit einem möglichen Rückgriff auf bis dahin ausgesetzte Macht- und Gewaltverhältnisse die Mittel, das Verhalten zu unterbinden. Bei Verdacht läge hier die Last, Vernunft zu beweisen und das Recht auf Selbstbestimmung zu erhalten, bei den BewohnerInnen. Um einer möglichen Willkürlichkeit des Handelns der MitarbeiterInnen entgegenzuwirken, wären für die Orientierung an der Selbstbestimmung der BewohnerInnen deutliche Verschiebungen von Machtverhältnissen und Beweislasten notwendig.
Wie ein solcher Standpunkt eingenommen werden kann, zeigt sich bei einer veränderten Sicht auf die Vernunftproblematik. Mit einer einfachen Gegenüberstellung von Vernunft und Unvernunft als Maßstab für Selbstbestimmung wird die Grenze in der Person verortet. Dies entspricht einem defektlogischen Denken. Mit einem Verständnis, das jede Tätigkeit eines Menschen als kompetente und entwicklungslogische Lösung begreift, ist diese Auffassung aber nicht vereinbar. Denn in diesem Sinne ist sogar einem gewalttätigen Verhalten Vernunft zuzuweisen. ARENDT (1970) schreibt dazu:
"Was Wut provoziert, sind nicht so sehr entgegenstehende Interessen, als die Scheinheiligkeit, der Schein von Vernunft, hinter dem man sie zu verbergen trachtet. Sich vernünftig zu benehmen, wo die Vernunft als Falle gebraucht wird, ist nicht ‚rational', so wie es nicht ‚irrational' ist, in Selbstverteidigung zur Gewalt zu greifen."(S. 67)
Vermeintlich unvernünftiges Verhalten, wie Gewalt, als Reaktion auf eine Vernunftfalle, die dadurch gekennzeichnet ist, dass entgegenstehende Interessen durch die einseitige Umdeutung von Vernunft in Unvernunft verschleiert werden, ist also durchaus vernünftig. Um diesen Widerspruch aufzulösen, darf das Problem nicht länger in der Person verortet werden. Die Umdeutung von Vernunft in Unvernunft muss unterbleiben, um das eigentliche Problem zu erkennen. JANTZEN (1998, S. 119ff) unterscheidet in diesem Sinne, in Anlehnung an BOURDIEU (vgl. 1999), institutionelle und habituelle Vernunft. Jede Gesellschaft basiert auf Regeln der Produktion, der Konsumtion, der Anerkennung, der Kultur, des sozialen Verkehrs. Auf Seiten des Individuums entwickelt sich in der Sozialisation innerhalb dieser Verhältnisse sein Habitus, der sich in konventionalisierten Praktiken (Gewohnheiten) ausdrückt. Für die Gesellschaft stellen sich ihre Regeln als soziale Institutionen dar. Das Individuum ist in seinen habitualisierten Formen des Handelns auf diese bezogen und schafft sie dabei beständig von Neuem (vgl. WAGNER 1995, S. 46). Im Sinne seiner Selbstorganisation sind die Handlungen des Einzelnen in diesem Verhältnis immer sinnhaft und so durch habituelle Vernunft gekennzeichnet. Hierbei steht er aber immer in einem Anerkennungsverhältnis zur institutionellen Vernunft. Hierin kann Anerkennung in der Form "symbolischen Kapitals" (BOURDIEU 1999) erworben und verloren werden.
Bezogen auf das Problem der Handlungsbedarfe bei auffälligen Verhaltensweisen werden diese folglich nicht an der Grenze der Vernunft des Einzelnen festgestellt. Handeln erscheint notwendig, wenn institutionelle Vernunft und habituelle Vernunft bei unterschiedlicher Interessenlage auseinanderfallen und symbolisches Kapital verbraucht ist. Auch in diesem Fall bleibt ein Mensch aber auf der habituellen Ebene prinzipiell vernünftig und vernunftfähig. Dadurch bleiben auch prinzipiell seine Selbstbestimmungsmöglichkeiten erhalten. Grenzbereiche der Selbstbestimmung sind deshalb in den sozialen Verhältnissen zu bestimmen, nicht in der Person. Im Sinne der Selbstbestimmung des anderen müssen wir uns damit bei Festlegungen von Handlungsbedarfen und Handlungsmöglichkeiten um die prinzipielle Anerkennung der habituellen Vernunft der Person bemühen. Dazu schreibt JANTZEN (1998):
"Die Existenz und notwendige Aufrechterhaltung habitueller Vernunft setzt der möglichen Machtübertragung an die Institution die äußerste Grenze." (S. 121)
Um diese Grenze nicht zu überschreiten, muss die Richtigkeit meiner Annahmen und Handlungen von der betreffenden Person im Rahmen seiner Ausdrucksmöglichkeiten bestätigt werden. Bedingung dafür ist, in jedem Fall auf paternalistische Grundhaltungen und Handlungsstrategien zu verzichten, über die sich eine solche Bestätigung, auch gegen die eigentlichen Interessen des anderen, immer erreichen lässt (siehe Kapitel 5.1.1.). Hierzu gehören alle Arten von Reglements und Abmachungen, deren Einhaltung von den MitarbeiterInnen kontrolliert und eingefordert werden kann; auch wenn sie sich diese Kontrolle von den BewohnerInnen legimitieren lassen, wie HÄHNER (1998b) dies vorschlägt. Dies vollzieht sich in Form von "Kontrakten" (S.140ff) zwischen den MitarbeiterInnen und den BewohnerInnen. In gemeinsamen Gesprächen werden Verhaltensweisen problematisiert und Lösungsmöglichkeiten im Sinne von Handlungsalternativen gesucht. In einer Auftragsklärung wird den MitarbeiterInnen durch die BewohnerInnen die Erlaubnis erteilt, diese Handlungsalternativen beim Auftreten problematischen Verhaltens einzufordern. Paternalismus wird hier als Auftrag verschleiert und so gerechtfertigt. Die Vernunft der betreffenden Person und damit ihre Selbstbestimmungsmöglichkeit wird in Frage gestellt, weil die Bedeutung des Verhaltens in den betreffenden Situationen, außer acht bleibt. Um auch in Grenzsituationen eine Anerkennung der Vernunft und damit der Selbstbestimmung zu leisten, müssen Handlungsalternativen geschaffen werden, die über eine einfache Verhaltensmodifikation hinausgehen. FEUSER (1998) beschreibt dies folgendermaßen:
"D.h. für die Seite der Fachleute, unter Einsatz professionellen und wissenschaftlichen Rüstzeuges, sich die Lebensgeschichte anderer zu erarbeiten, die Lage des anderen zu erfassen und zu erspüren, sich ihn aus der Binnenperspektive heraus denken können, seine Bedürfnisse zu antizipieren, seiner Logik folgen und - auch dort, wo umfassende Hilfe, Schutz und therapeutisches Handeln unabdingbar und lebenssichernd für einen schwerstbeeinträchtigten Menschen sind - ihn nicht aus der führenden Rolle der Interaktion zu drängen. Wir müssen lernen, ihm zu folgen, auch dort, wo geleitet, angeleitet werden muß." (S. 25)
Um an der Selbstbestimmung der BewohnerInnen ausgerichtet zu bleiben, wäre auch in Grenzsituationen ein gemeinsamer, die Situation reflektierender Dialog wichtig, der sowohl innerhalb als auch außerhalb problematischer Situationen als Möglichkeit bestehen bleiben muss. Grundlagen dafür können auf der Basis verstehender Diagnostik entstehen. Dies schließt über die Rehistorisierung der Geschichte des Betreffenden hinaus die umfassende Reflexion der Gesamtsituation unter Einnahme eines 4. Beobachterstandpunktes ein. Die BewohnerInnen als Bezugspunkt nehmend, ist im Sinne der einzig legitimen pädagogischen und therapeutischen Aufgabe (vgl. Kapitel 6.3.1.) das Handeln dann auf die mögliche Veränderung der Randbedingungen einschließlich der Selbstveränderung zu richten. JANTZEN (1998) schreibt dazu in Bezug auf als problematische erlebte Verhaltensweisen:
"Sie sind Kompetenzen in einer Situation der Isolation. Nicht sie sind das Problem, sondern das Fehlen von Alternativen. [...]. [Der Isolation] ist nur zu entkommen, wenn die Gesamtsituation für die betroffenen Personen humanisiert wird." (S. 130)
Für die MitarbeiterInnen bedeutet dies, Formen struktureller Gewalt zu entschlüsseln und nach Möglichkeit gemeinsam mit den BewohnerInnen aufzuheben. An Stellen, wo dies nicht gelungen ist und sich im Weiterbestehen problematischen Verhaltens der BewohnerInnen spiegelt, muss, so JANTZEN (1998):
"[...]die Bitterkeit der nicht gelingenden Lösung erhalten bleiben und darf weder theoretisch noch praktisch entsorgt werden." (S. 112)
Ein solches Dilemma muss weiterhin als Problem fehlender Alternativen und zu beseitigender struktureller Gewaltverhältnisses bearbeitet werden. Frustrationen der MitarbeiterInnen dürfen im Sinne der Parteinahme für die BewohnerInnen nicht als Problem auf die BewohnerInnen abgewälzt werden. Z.B., wie bereits dargestellt, durch Ignorieren der Verhaltensweise oder durch willkürliches Handeln. Dies gilt insbesondere, wenn sich das Dilemma nicht gefundener Lösungen noch einmal verschärft. Dies ist der Fall, wenn trotz aller Bemühungen und trotz der Anerkennung habitueller Vernunft ein eingreifendes Handeln bis hin zu Situationen der Nothilfe, Notwehr und der Vertretung der Interessen anderer notwendig erscheint. In solchen Fällen angewandter Gewalt wird Selbstbestimmung vor allem aus der Sicht der BewohnerInnen gravierend eingeschränkt. Besonders hier muss den BewohnerInnen das Fehlen von Handlungsalternativen auf Seiten der MitarbeiterInnen deutlich offengelegt werden. Die Orientierung an der habituellen Vernunft der BewohnerInnen darf auch in diesen Situationen nicht abreißen. Ihr Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, mit Vernunft und Selbstbestimmungsmöglichkeiten ausgestattet zu sein, darf nicht entsorgt werden. JANTZEN (1998), spricht davon, ungerechte soziale Verhältnisse, in denen MitarbeiterInnen und BewohnerInnen handeln nicht in Unglück und Schicksal der BewohnerInnen umzudeuten:
"Welche Entscheidung wir auch immer treffen, sie wird solange ungerecht sein, wie wir der Ansicht des Opfers nicht uneingeschränkt Rechnung tragen und seiner Stimme nicht volles Gewicht verleihen. Weniger zu tun, ist nicht nur unfair, sondern gefährlich." (S 40, z.n SHKLAR 1992, S.203)
Dem fügt er hinzu, dass dies auch unter der Bedingung gilt, dass das Opfer in einer bestimmten Situation Unrecht hat. Situationen, in denen ein eingreifendes Handeln erfolgt, stellen für alle Beteiligten eine hohe Belastung dar. Für eine Konkretisierung der praktischen Handlungsmöglichkeiten der MitarbeiterInnen soll hier auf die Arbeit von REDL und WINEMAN (1976) verwiesen werden. Darin beschreiben sie insgesamt 17 Techniken der Steuerung aggressiven Verhaltens. Ziel ihrer Überlegungen war es, Interventionsmöglichkeiten zu entwerfen, die die Bedingungen "Verhaltenshygiene" und "Antisepsis" erfüllen:
"In diesem Zusammenhang ist damit gemeint, das eine Technik zur Steuerung eines bestimmten Verhaltens so angewendet werden muß, daß sie ‚hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen für das grundlegende therapeutische Ziel zumindest unschädlich' ist." (S.126)
Dies ist von Bedeutung, um problematische Verhaltensweisen nicht weiter zu verstärken und Möglichkeiten für Dialog und Kooperation nicht zu verbauen. Details dieser Techniken sollten in Bezug auf hier dargelegte Anforderungen für eine Orientierung an der Selbstbestimmung der BewohnerInnen überprüft werden. Grundlagen dafür sind die grundsätzliche Anerkennung der Vernunft des Anderen und die Einnahme eines 4. Beobachterstandpunktes, der immer auf die Betrachtung der Veränderungsmöglichkeiten der Gesamtsituation einschließlich der Selbstveränderung verweist.
[9] Vgl. dazu verschiedene Artikel in den Fachzeitschriften "GEISTIGE BEHINDERUNG" und "BEHINDERTENPÄDAGOGIK" seit den 1990er Jahren, BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1997
[10] Vgl. SCHULZ/BURKHARDT (1999, S. 255), die 5 Hilfebedarfsstufen anhand der Möglichkeiten eines Menschen, ein dialogisch-kooperatives Verhältnis zu gestalten, unterscheiden.
[11] vgl. JANTZEN (1999c) und seine Ausführungen zu einem Deinstitutionalisierungsprozess in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Er verdeutlicht darin wesentliche theoretische und praktische Aspekte solcher Vorhaben.
[12] WALDSCHMIDT benutzt an dieser Stelle den Begriff Autonomie. Sie verwendet die Begriffe Selbstbestimmung und Autonomie aber jeweils synonym.
[13] WALDSCHMIDT bezieht sich in ihrer Arbeit auch auf Menschen mit chronischen Erkrankungen. Die Formulierung "gesundheitliche Schädigung" ist für den hier diskutierten Zusammenhang aber problematisch.. Behinderung soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht als Krankheit, sondern als soziale Konstruktion verstanden werden (siehe Kapitel 3.4.1).
Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, sich damit zu befassen, welche Perspektiven es für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen gibt. In den aktuellen Entwicklungen lassen sich ermöglichende Komponenten erkennen, die aber von beschränkenden Komponenten begleitet werden. Die kausale Logik dieser widersprüchlichen Entwicklungsrichtungen erschloss sich in der Betrachtung der Konzepte neoliberaler Ideologie, Kultur, Politik und Ökonomie, in denen sich ein universeller Anspruch auf Selbstbestimmung mit ökonomischen Interessen verbindet und sich diesen unterzuordnen hat. Damit verbunden werden Zugangsmöglichkeiten zur Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung erschwert und eingeschränkt. Durch den spezifischen Charakter der neoliberalen Moderne funktionieren die Beschränkungen von Selbstbestimmung zum Teil offen, zum Teil auf sehr subtile Weise. Der Abbau des Sozialstaates, der im Rahmen der an Wirtschaftsinteressen ausgerichteten "Standortsicherung" als unumgängliche Notwendigkeit deklariert wird und eine von diesen Zusammenhängen abstrahierende Diskussion um Sterbehilfe, die so die Gefahr mit sich bringt, das Recht auf Selbstbestimmung zum Zwecke der Beseitigung "störender" Individuen zu instrumentalisierten sowie die Bioethik-Konvention, die die Vernutzung behinderter Menschen vorbereitet, sind Beispiele hierfür. Alle diese durch das Kosten-Nutzen-Kalkül beeinflussten Entwicklungen werden anhand utilitaristischer Ethikkonzepte begründet und legitimiert. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und den Komponenten, die Selbstbestimmung ermöglichen, Vorschub zu leisten, bedarf es der Gegenkräfte. Grundlage dafür ist ein verändertes Verständnis von Behinderung, das Behinderung nicht mehr mit der Unfähigkeit zur Selbstbestimmung gleichsetzt. Aufbauend auf der Erkenntnis, dass die Möglichkeit zur Selbstbestimmung mit dem Leben an sich gegeben ist, was durch keine Form der Behinderung, so schwer sie auch sei, negiert werden kann, ist Behinderung als ein sozial konstruierter Prozess zu verstehen, der mit der Einschränkung von Selbstbestimmung einhergeht. Die Isolation vom gesellschaftlichen Erbe sowie der Teilhabe an Möglichkeitsräumen des gesellschaftlichen Lebens in personalen und strukturellen Gewaltverhältnissen unterdrückt nicht nur gegenwärtige Selbstbestimmungsmöglichkeiten, sondern auch grundlegende Kompetenzen, sich diese anzueignen. Dies verweist auf die Notwendigkeit, Gewaltverhältnisse auf allen Ebenen abzubauen. In einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung ist eine Grundlage dafür vor allem ein Wandel der gesellschaftlichen Moral bei der Verteilung der vorhandenen Ressourcen. Durch Akte der Parteinahme und Solidarität müssen soziale und ökonomische Interessen entkoppelt werden. Den sozialen Aspekten müsste dabei eine vorrangige Bedeutung eingeräumt werden. Nur so kann Selbstbestimmung vor ökonomischen Interessenkonstellationen geschützt werden, um sich orientiert an den Interessen und Bedürfnissen behinderter Menschen bezüglich der Inhalte und Ausdrucksformen zu entwickeln. Ansatzpunkte hierfür sind aber nicht nur national und international organisierte Bewegungen, die Widerstand gegen einen global agierenden Kapitalismus mobilisieren, sondern vor allem auch Veränderungsprozesse innerhalb der konkreten Lebensbedingungen behinderter Menschen. Die Forderungen der Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen, die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung richten, machen besonders einen Veränderungsbedarf der institutionalisierten Behindertenhilfe deutlich. Dabei sind Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse auf der Ebene struktureller Bedingungen genauso wie auf der Ebene veränderter Handlungsorientierungen professioneller HelferInnen zu bearbeiten. Praxiskonzepte wie das Assistenzmodell bilden hierbei einen Orientierungspunkt. Das Assistenzmodell ist vor allem von Bedeutung, da es in seinen Grundzügen von Menschen mit Behinderung gemäß ihrer Vorstellungen einer im Sinne der Selbstbestimmung angemessenen Hilfe entwickelt wurde. Entscheidend für diese Veränderungsprozesse ist die konsequente und ungeteilte Umsetzung der Selbstbestimmungskonzepte für alle Menschen mit Behinderung. Menschen mit geistiger Behinderung oder auffälligem Verhalten dürfen nicht ausgeschlossen werden. Hierzu müssen sich professionelle HelferInnen diagnostische, reflektorische, dialogische und kooperative Handlungskompetenzen aneignen, die auch in Grenzsituationen Selbstbestimmungsmöglichkeiten eines Menschen erkennen, anerkennen und mit ihm gemeinsam realisieren können.
In dem Maße, in dem sich solche Gegenkräfte in der Praxis niederschlagen und diese verändern können, besteht die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, sich Selbstbestimmung, verstanden als Gestaltungsmöglichkeit auf der Basis einer vollen Teilhabe an der Gesellschaft, anzueignen. Dafür wird entscheidend sein, inwieweit auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens Macht-, Herrschafts- und Gewaltstrukturen zugunsten von Parteilichkeit und Solidarität mit behinderten Menschen aufgegeben werden. Dabei wäre den Forderungen behinderter Menschen uneingeschränkte Priorität, basierend auf der uneingeschränkten Anerkennung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten, einzuräumen, damit sich Selbstbestimmung als ihr unveräußerliches und unteilbares Grundrecht etabliert. Hierzu sei nocheinmal auf BASAGLIA verwiesen, der dazu auffordert, das Andere nicht nur zu denken, sondern auch zu machen. Hierin liegt im kleinen wie im großen Zusammenhang einer Gemeinschaft der Ansatzpunkt, mit dem Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen geschaffen werden.
APPEL, M.; KLEINE SCHAARS, W.: Anleitung zur Selbstständigkeit. Wie Menschen mit geistiger Behinderung Verantwortung für sich übernehmen. Weinheim; Basel: Beltz, 1999
ARENDT, H.: Macht und Gewalt. 10. Aufl. München: Piper & Co., 1995
BASAGLIA, F. (HRSG.): Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971
BASAGLIA, F. u. a.: Befriedungsverbrechen. Über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1980
BECK, I.: Der "Kunde", die Qualität und der "Wettbewerb": Zum Begriffschaos in der Qualitätsdebatte. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999. S. 35-47
BELL, D.: Zur Auflösung der Widersprüche von Modernität und Modernismus: Das Beispiel Amerikas. In: Meier, H. (Hrsg.): Zur Diagnose der Moderne. München: Piper & Co, 1990. S. 21-67 (Serie Piper Band 3)
BOEHME, N; WALK, H.: Einleitung. Globalisierung von unten: Transnationale Netzwerke in Aktion. In: Boehme, N; Walk, H. (Hrsg.): Globaler Widerstand: Internationale Netzwerke auf der Suche nach Alternativen im globalen Kapitalismus. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, 2002. S. 9-24
BOURDIEU, P.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. 3.Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999
BRADEL, C; STEINHART, I.: Enthospitalisierung und Selbstbestimmung - neue Perspektiven trotz Kostendruck und Behindertenfeindlichkeit. In: Bradl, C.; Steinhart, I. (Hrsg.): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996. S. 7-15
BRADL, C.: Vom Heim zur Assistenz. In: Bradl, C.; Steinhart, I. (Hrsg.): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996. S. 178-203
BRAND, U.: Globaler Widerstand: Die zapatistische Suche nach neuen Formen radikaler Politik. In: Boehme, N; Walk, H. (Hrsg.): Globaler Widerstand: Internationale Netzwerke auf der Suche nach Alternativen im globalen Kapitalismus. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, 2002. S. 119-142
BROCKHAUS - DIE ENZYKLOPÄDIE: in 24 Bänden. 20. Aufl. Leipzig; Mannheim: Brockhaus, 1998. (Band 20 Seif-Stal)
BUBER, M.: Das dialogische Prinzip. Gerlingen: Verlag Lampert Schneider, 1994
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE E.V. (HRSG.): Grundsatzprogramm der Lebenshilfe. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1991
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE E.V. (HRSG.): Wenn Verhalten auffällt.... Eine Arbeitshilfe zum Wohnen von Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1996a
BUSCH, L.; MANNHAUPT, G.: Reflexion: Notwendigkeiten und Möglichkeiten entwicklungsorientierter Teamarbeit in der Betreuung Geistigbehinderter. In: Behindertenpädagogik, 33 (1994) 3, S. 252-269
BUTTERWEGGE, C.: Wohlfahrtsstaat im Wandel. Probleme und Perspektiven der Sozialpolitik. 3. Aufl. Opladen: Leske+Buderich, 2001
CASTEL, R.: Die psychiatrische Ordnung. Das goldene Zeitalter des Irrenwesens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983
CHRISTOPH, F.: Krüppelschläge. Gegen die Gewalt der Menschlichkeit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1983
CHRISTOPH, F.: Wir sind alle Gefangene des Zeitgeistes. In: Christoph, F.; Illiger, H. (Hrsg.): Notwehr. Gegen die neue Euthanasie. Neumünster: Paranus Verlag, 1993. S. 168-200
DAHLFERT, M.: Zurück in die Institution? Probleme der gemeindenahen Betreuung geistig behinderter Menschen in den USA, in Norwegen und Großbritannien. In: Geistige Behinderung 36 (1997) 4, S. 344-357
DEJONG, G.: Independent Living: Eine soziale Bewegung verändert das Bewußtsein. In: Vereinigung Integrationsförderung (Hrsg.): Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten. München: VIF, 1982, S. 132-160
DÖRNER, K.: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1975
DÖRNER, K.: Tödliches Mitleid. Zur Frage der Unerträglichkeit des Lebens. 2. Aufl. Gütersloh: Verlag Jakob van Hoddis, 1989
DUISBURGER ERKLÄRUNG: In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (HRSG.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998. S. 103-104
ELBING, U.: Nichts passiert aus heiterem Himmel... es sei denn, man kennt das Wetter nicht. Transaktionsanalyse, Geistige Behinderung und sogenannte Verhaltensstörungen. 2. Aufl. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 1996
EMMERICH, M. (HRSG.): Im Zeitalter der Biomacht. 25 Jahre Gentechnik - eine kritische Bilanz. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag, 1999
FENGLER, C; FENGLER, T.: Alltag in der Anstalt. Wenn Sozialpsychiatrie praktisch wird. Bonn: Psychiatrie- Verlag, 1994 (= Edition Das Narrenschiff)
FEUSER, G.: Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995
FEUSER, G.: Parteilichkeit für behinderte Menschen.... In: Bradl, C.; Steinhart, I. (Hrsg.): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996a. S. 27-52
FEUSER, G.: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Projektionen und Artefakte in der Geistigbehindertenpädagogik. In: Geistige Behinderung, 35 (1996b) 1, S. 18-25
FEUSER, G.: Lebenslanges Lernen für Menschen mit geistiger Behinderung - Selbstbestimmung und Integration. In: Martinsclub Bremen e.V. (Hrsg.): Dokumentation der Tagung "Dialoge-Menschen mit geistiger Behinderung in der Erwachsenenbildung". Bremen: 1998. S. 21-26
FEUSER, G.: Ich bin, also denke ich! Allgemeine und fallbezogene Hinweise zur Arbeit im Konzept der SDKHT. In: Behindertenpädagogik, 40 (2001) 3, S. 268-350
FORRESTER, V.: Der Terror der Ökonomie. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 1997
FREHE, H.: Von der Notwendigkeit, das Stellwerk zu besetzen. In: Bradl, C.; Steinhart, I. (Hrsg.): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996. S. 16-26
FREHE, H.: Persönliche Assistenz - eine neue Qualität ambulanter Hilfen. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999. S. 271-284
FREIRE, P.: Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1973
FRÜHAUF, T.: Mehr Selbstbestimmung - eine Aufgabe für uns alle! In: Geistige Behinderung, 34 (1995) 1, S. 1-4
GALTUNG, J.: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1975
GOFFMAN, E.: Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973
GOFFMAN, E.: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975
GRUNDGESETZ: 37.Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, Stand 1. Oktober 2001
GRÜNEWALD, K.: Selbstbestimmtes Leben geistig behinderter Menschen in Wohnheimen - sich ändernde Bedingungen für die Mitarbeiter. Bremen: 1997. (Diplomarbeit, Fachbereich Sozialwesen, Hochschule Bremen)
HABERMANN, F.: Peoples Global Action: Für viele Welten! In pink, silber und bunt. In: Boehme, N; Walk, H. (Hrsg.): Globaler Widerstand: Internationale Netzwerke auf der Suche nach Alternativen im globalen Kapitalismus. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, 2002. S. 143-156
HAHN, M.: Behinderung als soziale Abhängigkeit. Zur Situation schwer behinderter Menschen. München:, 1981
HÄHNER, U.: Von der Betreuung zur Begleitung (Assistenz) - Überlegungen zum Wandel im Rollenverständnis hauptamtlicher Mitarbeiter/innen in gemeindenahen Wohneinrichtungen der Lebenshilfe. Bremen: Referatstext anlässlich des 10. Wohnstätten - Vertretertreffens am 25./26.11.1994
HÄHNER, U.: Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998a. S. 25-51
HÄHNER, U.: Überlegungen zur Entwicklung einer Kultur der Begleitung. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998b. S. 121-151
HAMANN, B.: Pädagogische Anthropologie. 3. Aufl. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt, 1998
HERRIGER, N.: Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Stuttgart; Berlin; Köln: Kohlhammer, 1997
HIRSCH, J.: Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat. Berlin: ID Verlag, 1998
HIRSCH, J.: Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen. Hamburg: VSA Verlag, 2002
JANTZEN, W.: Menschliche Entwicklung, allgemeine Therapie und allgemeine Pädagogik. Studien zur Entwicklung einer allgemeinen materialistischen Pädagogik. Solms-Oberbil: Jarick, 1980
JANTZEN,W.: Allgemeine Behindertenpädagogik. Neurowissen-schaftliche Grundlagen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie. Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 1990 (= Band 2)
JANTZEN, W.: Allgemeine Behindertenpädagogik. Sozialwissen-schaftliche und psychologische Grundlagen. 2. korrigierte Aufl. Weinheim; Basel: Beltzverlag, 1992 (= Band 1)
JANTZEN, W.: Am Anfang war der Sinn. Zur Naturgeschichte, Psychologie und Philosophie von Tätigkeit, Sinn und Dialog. Marburg: BdWi-Verlag, 1994 (Forum Wissenschaft: Studien; Bd. 23)
JANTZEN, W.; LANWER-KOPPELIN, W. (HRSG.): Diagnostik als Rehistorisierung. Methodologie und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1996
JANTZEN, W.: Die Zeit ist aus den Fugen. Marburg: BdWi Verlag, 1998
JANTZEN, W.: Deinstitutionalisierung als Kern von Qualitätssicherung. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999a. S. 191-196
JANTZEN, W.: Geistige Behinderung ist ein sozialer Tatbestand - Bemerkungen zu der Frage, an welchen anthropologischen Maßstäben sich die Eingliederung geistig behinderter Menschen zu orientieren hätte. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999b. S. 197-215
JANTZEN, W.: Deinstitutionalisierung. Materialien zur Soziologie der Veränderungsprozesse in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Bremen: Universität Bremen, Fachbereich 12, Studiengang Behindertenpädagogik, 1999c
JANTZEN, W; SCHNITTKA, T: "Verhaltensauffälligkeit" ist eine soziale Konstruktion: Über Vernunftfallen und andere Angriffe auf das Selbst. In: Theunissen, G (Hrsg.): Verhaltensauffälligkeiten - Ausdruck von Selbstbestimmung? Wegweisende Impulse für die heilpädagogische, therapeutische und alltägliche Arbeit mit geistig behinderten Menschen. 2. Aufl. Bad Heilbrunn: Klinkhard, 2001. S. 39-62
JERVIS, G.: Die offene Institution. Über Psychiatrie und Politik. Frankfurt am Main: Syndikat, 1979
KLEE, E.: Behinderten-Report II. >Wir lassen uns nicht abschieben<. Frankfurt am Main: Fischer 1976
KNUST-POTTER, E: >We can change the future<. Self-Advocacy-Gruppen in Großbritannien. In: Geistige Behinderung, 33 (1994) 4, S. 319-330
KNUST-POTTER, E.: Self-Advocacy - oder: Wir sprechen für uns selbst. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Selbstbestimmung. Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1997. S. 519-534
KRÜGER, C.: USTA-Problemaufriß: Zu den Variablen Rahmenbedingungen, Träger, Immobilien und Beratung. In: Eisenberger, J. u.a. (Hrsg.): Das Normalisierungsprinzip- vier Jahrzehnte danach. Veränderungsprozesse stationärer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Reutlingen: Diakonie-Verlag, 1999 (Berliner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Behinderung Band 7)
KUHSE,H.; SINGER, P.: Muß dieses Kind am Leben bleiben? Das Problem schwerstgeschädigter Neugeborener. Erlangen: Harald Fischer-Verlag, 1993
LACHWITZ, K.: Recht auf Teilhabe. Eingliederung von Menschen mit Behinderungen aus juristischer Sicht. In: Geistige Behinderung 37 (1998) 1, S. 7-21
LACHWITZ, K.: Menschen mit geistiger Behinderung - Bürger oder Leistungsempfänger? In: Geistige Behinderung 38 (1999) 1, S. 68-84
LANWER-KOPPELIN, W.: Aus Weniger wird Mehr? Kritische Aspekte zu Fragen der Qualität und Qualitätssicherung ambulanter pädagogischer Unterstützung für Menschen, die neben ihrer körperlichen und/oder "geistigen Behinderung" psychische Auffälligkeiten zeigen. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999. S. 151-170
LEONT´EV, A. N.: Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit. Stuttgart: Klett, 1977
LÜBBE, A.; BECK, I: Individuelle Hilfeplanung. Anforderungen an die Behindertenhilfe. In: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V. (Hrsg.): Hamburg; Düren: Eigenverlag DHG, 2002. (= DHG Schriften 9)
MANN, G; NITSCHKE, A (HRSG.): Propyläen Weltgeschichte. Weltkulturen. Renaissance in Europa. Frankfurt am Main; Berlin: Propyläen Verlag, 1964 (Band 6)
MATURANA, H. R.;VARELA, F. J.: Der Baum der Erkenntnis. Die Biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. München: Scherz Verlag, 1987
MEIER, H.: Die Moderne begreifen - die Moderne vollenden? In: Meier, H. (Hrsg.): Zur Diagnose der Moderne. München: Piper, 1990. S. 7-20
MESHCHERYAKOW, A. I.: Awakening to Life. Forming Behaviour and the Mind of Deaf-Blind Children. Moskau: Progress 1979
METZLER, H.: Die Struktur der Betreuungsarbeit im Behindertenheim. In: Neumann, J. (Hrsg.): Arbeit im Behindertenheim. Strukturanalyse und Strategien zu ihrer Humanisierung. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 1988. S. 101-209 (Schriftreihe >Humanisierung des Arbeitslebens< Band 96)
MILES-PAUL, O: "Wir sind nicht mehr aufzuhalten". Behinderte auf dem Weg zur Selbstbestimmung . München: AG SPAK- publ., 1992
MÜLLER, H. M.: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Durchgesehener Nachdruck Mannheim: Bibliographisches Institut, 1988
NEUMANN, J.: 40 Jahre Normalisierungsprinzip - von der Variabilität eines Begriffs. In: Geistige Behinderung, 38 (1999) 1, S. 3-20
NIEHOFF, U.: Grundbegriffe selbstbestimmten Lebens. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998a. S. 53-64
NIEHOFF, U.: Einführende Überlegungen zum Handeln der Betreuer. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998b. S. 171-176
NIRJE, B.: Das Normalisierungsprinzip und seine Auswirkungen in der fürsorgerischen Betreuung. In: Kluge, R. B.; Wolfensberger, W.: Geistig Behinderte - Eingliederung oder Bewahrung? Heutige Vorstellungen über die Betreuung geistig behinderter Menschen. Stuttgart: Georg Thiem Verlag, 1974
OSBAHR, S.: Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Beiträge zu einer systemtheoretischen-konstruktivistischen Sonderpädagogik. Luzern: Ed. SZH/SPC, 2000 (ISP- Universität Zürich Band 4)
PIEDA, B.; SCHULZ, S.: Wohnen Behinderter - Literaturstudie. Stuttgart; Berlin; Köln: Verlag W. Kohlhammer, 1990 (= Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Band 245/1)
REDL, F.; WINEMAN, D.: Steuerung des Aggressiven Verhaltens beim Kind. München: Piper & Co. Verlag, 1976
RIETBERGER, R.; KOOYMAN, C.: "Onderling Sterk" in den Niederlanden. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Selbstbestimmung. Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1997. S. 535-538
RIXEN, S.: Rechtsfragen der Organspende geistig und psychisch behinderter Menschen. In: Dörr, G. u.a. (Hrsg.): Aneignung und Enteignung. Der Zugriff der Bioethik auf Leben und Menschenwürde. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben, 2000
ROCK, K.: Selbstbestimmung als Herausforderung an die Professionellen. In: Geistige Behinderung, 35 (1996) 3
ROCK, K.: Selbstvertretung von Menschen mit einer geistigen Behinderung - Die angloamerikanische Self-Advocacy-Bewegung. In: Behindertenpädagogik, 36 (1997) 4, S. 354-372
RÜCKHOLDT, F. D.: Zur Rolle der Mitarbeiter/-innen bei der Dezentralisierung von Komplexeinrichtungen der Behindertenhilfe. In: Eisenberger, J u.a. (Hrsg..): Das Normalisierungsprinzip- vier Jahrzehnte danach. Veränderungsprozesse stationärer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Reutlingen: Diakonie-Verlag, 1999. S. 208-226 (Berliner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Behinderung Band 7)
RÜGGEBERG, A.: Autonom-Leben - Gemeindenahe Formen von Beratung, Hilfe und Pflege zum selbständigen Leben von und für Menschen mit Behinderungen. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz: Verlag W. Kohlhammer, 1985 (= Schriftenreihe des Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Band 173)
SACK, R.: Normalisierung der Beziehung. Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Begleiter. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998. S. 105-119
SCHLIPPE, A. v.; SCHWEITZER, J.: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. 8. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002
SCHMIDBAUER, W.: Hilflose Helfer. Über die seelische Problematik helfender Berufe. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1997
SCHÖNWIESE, V.: Die neue Euthanasie-Debatte als Bedrohung von Menschenrechten. In: Christoph, F.; Illiger, H. (Hrsg.): Notwehr. Gegen die neue Euthanasie. Neumünster: Paranus Verlag, 1993. S. 222-236
SCHULZ, K.; BURKHARDT, S.: Rehistorisierende Qualitätsentwicklung: Eine individuelle kompetenzorientierte Hilfebedarfsplanung ist auch mit Menschen, die als schwer geistig behindert bezeichnet werden, möglich. In: In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelin, W.; Schulz, K. (Hrsg.): Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung: niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin: Edition Marhold im Wissenschafts-Verlag Spiess, 1999. S. 253-261
SENATOR FÜR ARBEIT, FRAUEN, GESUNDHEIT, JUGEND UND SOZIALES: Freiheitsentziehende Maßnahmen. Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen. Bremen: 1999
SIERCK, U.: Das "Liegenlassen" behinderter Neugeborener. In: Christoph, F.; Illiger, H. (Hrsg.): Notwehr. Gegen die neue Euthanasie. Neumünster: Paranus Verlag, 1993. S. 112-125
SINASON, V.: Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 2000. (=Beiträge zur Integration)
SINGER, P.: Praktische Ethik. 2. Aufl. Stuttgart: Reclam, 1994
SPECK, O.: Mehr Autonomie für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung 24 (1985) 3, S. 162-170
SPITZ, R. A.: Vom Säugling zum Kleinkind. Stuttgart:, 1992
STEINER, G.: Selbstbestimmung und Assistenz. In: bidok-Volltextbibliothek: Veröffentlicht im Internet, Stand: 15.10.1999
STRAND, A.; BERGSTRÖM, A.: "Grunden" - ein Verein geistig behinderter Menschen in Schweden. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Selbstbestimmung. Kongressbeiträge. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1997. S 509-518
TAYLOR, C.: Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus. 3. Aufl. Franfurt am Main : Suhrkamp, 1999
THEUNISSEN, G.; PLAUTE, W.: Empowerment und Heilpädagogik - Ein Lehrbuch. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag, 1995
THEUNISSEN, G.: Enthospitalisierung in Deutschland. In: Bradl, C.; Steinhart, I. (Hrsg.): Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung. Kritische Analysen und neue Orientierungen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996. S. 67-93
THEUNISSEN, G.: Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. 2. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2000
THEUNISSEN, G.: Wohneinrichtungen und Gewalt - Zusammenhänge zwischen institutionellen Bedingungen und Verhaltensauffälligkeiten als "verzweifelter" Ausdruck von Selbstbestimmung. In: Theunissen, G (Hrsg.): Verhaltensauffälligkeiten - Ausdruck von Selbstbestimmung? Wegweisende Impulse für die heilpädagogische, therapeutische und alltägliche Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Bad Heilbrunn: Klinkhard, 2001a. S. 135-171
THIMM, W.: Das Normalisierungsprinzip - Eine Einführung. 6. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1995 (Kleine Schriftenreihe Band 5)
TOLMEIN, O.: Geschätztes Leben. Die neue >Euthanasie<-Debatte.Hamburg: Konkret Literatur-Verlag, 1990
TOLMEIN, O.: Wann ist der Mensch ein Mensch? Ethik auf Abwegen. München; Wien: Carl Hanser Verlag, 1993
WAGNER, M.: Menschen mit geistiger Behinderung - Gestalter ihrer Welt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1995 (= Beiträge zur Heilpädagogik)
WAGNER, P.: Soziologie der Moderne. Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag, 1995
WALDSCHMIDT, A.: Selbstbestimmung als Konstruktion. Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer. Opladen: Leske+Buderich, 1999
WALTHER, H.: Selbstverantwortung-Selbstbestimmung-Selbständigkeit. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. 2. Aufl. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1998. S. 69-90
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. D.: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien. 8. Aufl. Bern; Stuttgart; Toronto: Verlag Hans Huber, 1993
WEBER, E.: Persönliche Assistenz - Assistierende Begleitung. Veränderungsanforderungen für professionelle Betreuung und für Einrichtungen der Behindertenhilfe. In: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V. (Hrsg.): Köln; Düren: Eigenverlag DHG, 2002. (= DHG Schriften 8)
WETZEL, G: Selbstbestimmtes Leben - Ein Erfahrungsbericht über die "Independent Living Centers" in den USA. In: bidok-Volltextbibliothek: Veröffentlichung im Internet, Stand Februar 1999
WOLFENSBERGER, W.: Der neue Genozid an den Benachteiligten, Alten und Behinderten. 2. Aufl. Gütersloh: Verlag Jakob van Hoddis, 1996
WUNDER, M.: Schutz des Lebens mit Behinderung und biomedizinische Forschungsinteressen. In: Geistige Behinderung 39 (2000) 1, S. 138-149
ZIEGER, A.: Personsein, Körperidentität und Beziehungsethik - Erfahrungen zum Dialogaufbau mit Menschen im Koma und Wachkoma aus beziehungsmedizinischer Sicht. In: Strasser. P.; Starz, E. (Hrsg.): Personen aus bioethischer Sicht. Stuttgart:, 1997. S. 154-171
Abb. 1: Gesellschaftlicher Störungszusammenhang und Nosologie von psychischer Krankheit und Behinderung
Abb. 2: Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung
Abb. 3: Gegenüberstellung der Paradigmen von Rehabilitation und Independent-Living
Abb. 4: Institutionelles Betreuungsmodell
Abb. 5: Praktische Assistenz
Abb. 6: Assistenz bei Menschen mit geistiger Behinderung (persönliche Assistenz)
Quelle:
Uwe Bartuschat: Perspektiven für die Selbstbestimmung behinderter Menschen im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und Praktiken ihrer Ermöglichung und Beschränkung.
Diplomarbeit im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Bremen, eingereicht bei Prof. Dr. Georg Feuser und Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Institut für Behindertenpädagogik, Bremen Dezember 2002
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 14.06.2010
