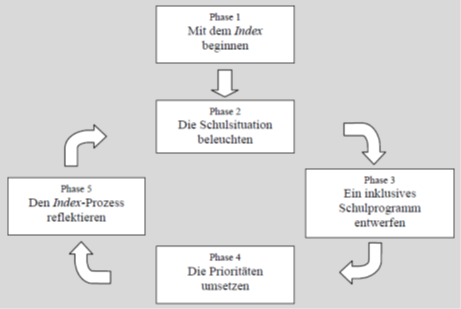Eine Möglichkeit der Partizipation in der Praxis
Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen. Eingereicht 15. Juni 2011 beim Landesprüfungsamt für Lehrämter in Sachsen-Anhalt. Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz , Zweitgutachterin: Ines Boban
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 3. Die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein'
- 4. Methoden der Datenerhebung
- 5. Theoretische Grundlagen
- 6. Darstellung der Ergebnisse
- 7. Schlüsselelemente und -barrieren inklusiver Weiterbildungen
- 8. Resümee
- 9. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema von inklusiven Weiterbildungen, die eine Möglichkeit der Partizipation am gesellschaftlichen Leben darstellen.
Erfahrungsgemäß wird in dem Bereich Bildung nur der Bildungssektor Schule in den Blick genommen – der Bereich der Erwachsenenbildung bleibt meist unbeachtet. Bei einer inklusiv angelegten Weiterbildung erlebte ich, als Beobachterin und Teilnehmerin, mit, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, unterschiedlichen Alters und Geschlechts und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam lernten. Dennoch stellt sich mir, der Begleitforschung, den Teilnehmern und den Referenten die Frage, ob diese Weiterbildung wirklich einen inklusiven Charakter hat – was sind bereits inklusive Elemente und wo gibt es Hürden. Aus den konkreten Erfahrungen resultiert meine Motivation diese Arbeit zu schreiben.
Inklusive Weiterbildungen sind ein Schritt auf dem Weg zur Bildung für alle. Zum Thema inklusive Schulen liegt zahlreiches Material vor. Aber kann von Inklusion gesprochen werden, wenn diese nach der schulischen Laufbahn abgeschlossen ist? Kinder lernen gemeinsam in inklusiven Schulen, aber im Anschluss stehen nur den Jugendlichen ohne Beeinträchtigung der allgemeine Arbeitsmarkt, eine eigene Wohnung und Freizeitaktivitäten in verschiedenen Vereinen offen. Jugendlichen mit Beeinträchtigung aber nur die Werksstatt für Menschen mit Behinderung, das Wohnheim und die dort angebotenen Freizeitaktivitäten.
Bezieht sich Inklusion nur auf einen Teilaspekt der Gesellschaft, wie Schule? Nein – Inklusion greift viel weiter. Die Vision einer inklusiven Gesellschaft umfasst alle Lebensbereiche, sowohl der Bereich der Erwachsenenbildung, als auch die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit. CONRADS (2008, S. 9f.) stellt sich die Frage: „Brauchen wir heute noch Visionen? Meine Antwort ist eindeutig ‚ja‘, wir dürfen nicht nur Visionen haben, wir brauchen sie geradezu, um notwendigen Entwicklungen Schubkraft zu verleihen! Das gilt selbstverständlich auch für das neue Leitbild der Inklusion. […] Gesellschaftlichen Entwicklungen gehen zumeist Visionen und Utopien voraus. Warum und wie wurden sie Wirklichkeit? Weil es Menschen gab, die an diese Träume glaubten“ – so wie ich und viele andere.
Es folgt zunächst ein kurzer geschichtlicher Abriss der Situation der Erwachsenenbildung für Menschen mit Beeinträchtigung in Deutschland.
Das Thema der inklusiven Bildungsprozesse im Erwachsenenalter findet erst seit den letzten 30 Jahren zunehmend Interesse. Die Erwachsenenbildung von Menschen mit Beeinträchtigung ging zunächst von der Krüppelbewegung, von körper- und sinnesbeeinträchtigten Menschen, Anfang der 1970er Jahre aus. Dafür wurden meist „[…] spezielle Fachbereiche an allgemeinen Bildungseinrichtungen gegründet […]“ (BÜCHELER 2006, S. 215). In Hannover, Frankfurt am Main und Nürnberg wurden erste Kurse an Volkshochschulen initiiert und durchgeführt. Die Tagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe in Stetten und verschiedene Volkshochschulinitiativen leiteten 1972 eine Erwachsenenpädagogik für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Innerhalb eines Jahres kam es zu Angeboten von der Volkshochschule Dillenburg für geistig behinderte Menschen und die Bundesvereinigung Lebenshilfe veröffentlichte „Empfehlungen zur Erwachsenenpädagogik bei Geistigbehinderten.“ Während der 1980er Jahre entstanden weitere Bildungsangebote für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten und mehrfache Behinderung. 1984 wurde der „Fachausschuss Erwachsenenbildung der Bundesvereinigung Lebenshilfe“ gegründet. Dieser sollte die Bildung von Erwachsenen mit sogenannter geistiger Behinderung intensivieren. Es entstanden unter anderem Rahmenempfehlungen und modelhafte Ausbildungsangebote. Jedoch wurde der Fachausschuss 1989 wieder aufgelöst.
Das integrative Konzept von SCHUCHARD (1987) in der Monografie „Schritte auf einander zu. Soziale Integration Behinderter durch Weiterbildung“ brachte die Thematik ein großes Stück voran. In diesem Zielgruppen-Interaktions-Konzept beschreibt sie das wechselseitige Lernen und schafft somit einen neuen Ansatz, der als gesellschaftspolitische Aufgabe aus der Erwachsenenbildung nicht mehr wegzudenken ist. Im Hinblick auf die Normalisierung und der Anerkennung der Notwendigkeit von Erwachsenenbildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfacher Behinderung etablierten sich zielgruppenbezogene und integrative Angebote an Volkshochschulen und allgemeinen Bildungsstätten. Im Mai 1989 wurde die ‚Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.‘ gegründet. Ihr ist eine neue Ära der Verbreitung und Vertiefung des Themas zu verdanken.
In den 1990er Jahren weiteten sich die Angebote der Erwachsenenbildung, sowohl in Sonder-Einrichtungen als auch in Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung aus. Diese Angebote sind nach unterschiedlichen Organisationsformen aufgebaut (vgl. BÜCHELER 2003 S. 43; BÜCHELER 2006, S. 215ff; HOFFMANN/THEUNISSEN 2003, S. 46ff).
LINDMEIER (2000a, S. 33f., 2003b, S. 199ff) und LINDMEIER u.a. (2000, S. 139ff) teilen die Angebote in vier Modelformen; dem Separations-, dem Kooperations-, dem Zielgruppen- und dem Integrationsmodell:
-
Im Separationsmodell übernehmen ausschließlich Einrichtungen der Behindertenhilfe die Organisation und die Durchführung von Weiterbildungskursen. Sie sind meist intern anlegt und durchweg für Menschen mit Beeinträchtigung vorgesehen.
-
Im Kooperationsmodell arbeiten Einrichtungen der Behindertenhilfe und Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung im Hinblick auf Kursorganisation und Durchführung zusammen.
-
Im Zielgruppenmodell bietet die allgemeine Erwachsenenbildungsstätte selbstständig Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung an. Allerdings bilden sie meist eine eigene Zielgruppe.
-
Im Integrationsmodell öffnen allgemeine Bildungsinstitutionen ihre regulären Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung. Gegebenenfalls werden eine Fachberatung und eine persönliche Assistenz organisiert. Eine umfassende Dienstleistung von separaten bis integrativen Kursen wird den Teilnehmern angeboten.
BÜCHELER (2006, S. 217) beschreibt jedoch, dass es nicht wesentlich über das Kooperationsmodell hinausgegangen sei und integrative, geschweige denn inklusive Angebote die Ausnahme bilden.
Aktuelle Tendenzen, beeinflusst durch die Leitgedanken der Selbstbestimmung, des aktiven Eintretens für die eigenen Rechte (vgl. BÜCHELER 2003, S. 43) und die Ratifizierung der UN-Konvention 2009, zeigen Entwicklungen in Richtung integrativer und inklusiver Angebote auf. Dennoch werden auch heutzutage die meisten Bildungsangebote durch Sondereinrichtungen (Werkstätten für Behinderte Menschen (WfbM), Wohnheime oder große Einrichtungen der Behindertenhilfe) abgedeckt – an Orten, an denen die Betroffenen leben, arbeiten, ihre Freizeit gestalten und sich fortbilden (vgl. THEUNISSEN 2009, S. 331). Die Tendenz zu einer „Sonder-Andragogik“ (BERNATH 1986) scheint weiterhin zu bestehen (zit. n. LINDMEIER 2003a, S. 29; LINDMEIER 2003b, S. 192).
Im Ausland finden sich erfolgreiche Modelprojekte: Österreich, die Schweiz und England bieten gute Beispiele und zeigen eine starke Entwicklung auf (vgl. BABILON 2008; DIESENREITER 2008a/b; GRUBER 2010; KNITTELFELDER 2008; LINDMEIER u.a. 2000). Diese Aspekte fließen in meine Arbeit ein.
Beim Literaturstudium zeigt sich, dass zu diesem Themenzweig wenige Publikationen vorliegen, obwohl ihm besondere Beachtung entgegen gebracht werden sollte. Auch zeigt es den zwingenden Handlungsbedarf auf.
Die Situation, dass dem Erwachsenenbildungsbereich wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, resultiert evtl. daher, dass in Deutschland die finanziellen Ressourcen eher der Frühförderung und dem schulischen Bereich zur Verfügung stehen. Finanzielle Mittel für Weiterbildungen sind wesentlich geringer. Begründet ist diese Vernachlässigung durch die unterschiedliche Prioritätensetzung. Daraus zeigt sich eine unterschiedliche Herangehensweise: In Deutschland liegt der Schwerpunkt immer noch auf dem Aspekt der Förderung von Kindern, bei denen noch am meisten „zu machen“ ist (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 198). Das Leitbild der Inklusion verbietet solch einen Ansatz, da jeder, so wie er ist, willkommen ist. Ich beschäftige mich, um dem Leitbild in einem anderen gesellschaftlichen Bereich als Schule näher zu kommen, mit dem Themenzweig der Erwachsenenpädagogik.
Die Arbeit beginnt zunächst mit der Erläuterung der Begriffe Inklusion, Weiterbildung und Partizipation und setzt diese in Beziehung zueinander.
Das darauffolgende Kapitel beschreibt die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘. Hier wird das Thema ‚Persönliche Zukunftsplanung‘ definiert und die Struktur sowie die Inhalte der Weiterbildung aufgegriffen. Ferner wird die Rolle der Evaluation diskutiert.
Im vierten Kapitel werden die Methoden und Materialien, die zur Gewinnung der empirischen Daten genutzt werden, erläutert: Beobachtungen, Evaluationsbögen, Interviews und Fragebögen.
Hinführend auf den Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich das fünfte Kapitel mit den theoretischen Bezügen, die zur Analyse der Daten herangezogen werden. Dabei wird zum einen der Index für Inklusion und zum anderen das Kreative Feld aufgegriffen.
Der wesentliche Teil der Arbeit umfasst, die in Kapitel sechs dargestellten Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung anhand der Indikatoren und der Fragestellungen des Index für Inklusion. Mit Hilfe dieses Kapitels wird die Weiterbildung unter dem Fokus, ‚Was ist vorhanden‘ und ‚Was ist verbesserungswürdig‘, evaluiert. Daraus werden Elemente entwickelt, die zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen.
Das letzte Kapitel untermauert die sich herauskristallisierten Elemente und bezieht weitere Literatur zur Frage der Inklusivität ein. Auch Schlüsselbarrieren für inklusive Weiterbildungen werden überblickartig vorgestellt.
Den Schluss der Arbeit bildet ein Resümee mit der Beantwortung der Frage nach Schlüsselelementen, die zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen können und ob, inklusiv angelegte Bildungsprozesse tatsächlich Partizipation sicherstellen.
Inhaltsverzeichnis
Das Wort Inklusion leitet sich vom lateinischen Verb ‚includere‘ ab und bedeutet ‚einschließen‘ (DUDEN 2006, S. 531). Bevölkerungsgruppen, die aus verschiedenen Gründen (Religiosität, Nationalität, sexuelle Orientierung, Beeinträchtigung usw.) an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden drohen, sind nach dem Verständnis des Inklusionskonzepts in die Gesellschaft eingeschlossen und somit Teil der gesamten Heterogenität. Im Gegensatz dazu steht das Konzept der Integration mit der Bedeutung ‚Eingliederung‘ (ebd., S. 535). Dieses Prinzip verfolgt die Leitidee marginalisierte Personengruppen mit Hilfe besonderer Maßnahmen, zugeschnitten auf die jeweilige Person, einzugliedern. Durch das „hinein integrier[en]“ (HINZ, 2004 S. 49) bleibt aber die Dominanz der Personengruppen bestehen, die als ‚Normalität‘ definiert werden. Integration ruft ein bloßes Nebeneinander statt Miteinander hervor (vgl. FRÜHAUF 2008, S. 19).
Inklusion hingegen erhebt den Anspruch, dass alle, unabhängig von ihren Fähigkeiten, als geschätzte Mitglieder einer Gruppe anerkannt werden (vgl. BOBAN/HINZ 2003b, S. 39). Mara SAPON–SHEVIN (1998, S. 4) untermauert dies: „ […] a child does not have to earn his or her right to be included or struggle to maintain it.“[1] Das Verständnis der Integration geht davon aus, dass man seine ‚Integrationsfähigkeit‘ erst unter Beweis stellen muss.
„Inklusion bemüht sich [dagegen, d.V.] alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick zu bekommen und gemeinsam zu betrachten. Dabei kann es um unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen […], soziale Milieus, Religionen und weltanschauliche Orientierungen, körperliche Bedingungen oder anderes mehr gehen. Charakteristisch ist dabei, dass Inklusion sich gegen dichotome Vorstellungen wendet, die jeweils zwei Kategorien konstruieren: Deutsch und Ausländer, Männer und Frauen, Behinderte und Nichtbehinderte, Reiche und Arme usw. […]“ (HINZ 2008, S. 33). Der Index für Inklusion beschreibt, dass „jeder Mensch […] seine eigene Vorstellung von einer komplexen Idee wie Inklusion [hat, d.V.]“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 10). Für mich bedeutet es, alles und jeden, unabhängig von seinen Begabungen, Fähigkeiten, seinem Äußeren, seiner Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung, unabhängig von allem – also als Mensch, so wie er ist, willkommen zu heißen.
Inklusion stellt für mich die Vision vom Leben mit vollkommener Akzeptanz der vorherrschenden Heterogenität dar. Indem die Denkstrukturen der Kategorisierungen nach Gruppierung nicht mehr existieren. Die zwei Gruppen-Theorie löst sich auf. Es wird nicht mehr unterschieden in Mann und Frau, Mensch mit und ohne Beeinträchtigung, reich und arm (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 10; BOBAN/HINZ 2004, S. 11; SANDER 2004, S. 15). Inklusion stellt einen nie endenden Prozess dar, weil er nie vollkommen erreicht werden kann. Es gibt immer Veränderungen auf die eingegangen wird und die wiederum Veränderungen hervorrufen.
Der Index für Inklusion beschäftigt sich mit dem Gedanken von inklusiven Schulen: „Inklusion bedeutet Veränderungen und einen nicht endenden Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller SchülerInnen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird. Jedoch wird inklusive Qualität spürbar, sobald die Absicht greift, die Teilhabe für alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft zu steigern“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 10). Inklusion beschränkt sich aber nicht nur darauf, sondern ist sowohl auf andere Bildungseinrichtungen, wie Kindergarten, Hochschule oder Weiterbildungen, als auch auf weitere gesellschaftliche Strukturen: Arbeitsmarkt, Wohnsituation und Freizeitaktivitäten übertragbar.
Die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ ist Grundlage für meine Ausführungen unter dem Inklusionsaspekt von Menschen mit Beeinträchtigung. Dem Begriff in seiner vollkommenen Intention kann ich nicht gerecht werden, da ich indirekt wieder eine Zwei-Gruppen-Theorie eröffne. Inklusion wird „je nach vorfindbaren Gegebenheiten […] anders aussehen und sich anderen Heterogenitätsdimensionen in anderer Gewichtung widmen – in Südafrika etwa gesunder Ernährung und dem HIV/AIDS-Problem oder in Indien das Kastenwesen, Mädchen auf dem Lande oder bestimmte Volksgruppen“ (HINZ 2006, S. 5).
„Inklusion bezieht sich immer auf alle Aspekte von Verschiedenheit; Behinderung ist also immer nur ein Subaspekt. […] Geht es ausschließlich um Behinderung, bleibt der Integrationsbegriff angemessener, denn andernfalls droht die Inflationierung des Inklusionsbegriffs. Geht es um Behinderung im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Marginalisierung insgesamt, ist allerdings der Inklusionsbegriff sinnvoller und angemessener“ (HINZ 2008, S. 49f.). Ich bin mir bewusst, dass es nicht möglich ist, in der vorliegenden Arbeit alle Aspekte von Inklusion zu beleuchten. Ich beschränke mich daher auf die Betrachtung von Menschen mit Beeinträchtigung und ihre uneingeschränkte Teilhabe am Bildungssystem des Erwachsenenbereichs.
„Weiterbildung ist der Oberbegriff für alle Lernprozesse, in denen Erwachsene ihre Fähigkeiten entfalten, ihr Wissen erweitern bzw. ihre fachlichen und beruflichen Qualifikationen verbessern oder neu ausrichten“ (RUF, o.J.). Somit schließt der Begriff alle Aktivitäten, die der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen dienen, die eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben, mit ein (vgl. NAGEL 2007, S. 3). Häufig wird der Begriff mit dem der Erwachsenenbildung gleichgesetzt. Sie ist eine „[…] Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase […]“ (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 197). Weiterbildung umfasst viele Bereiche und ist facettenreich, so fallen Volkshochschulkurse, Umschulungen, Meisterlehrgänge, Lehrgänge, Schulungen u.v.m. darunter.
„Inklusion geht es darum, alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle [Menschen, d.V.] auf ein Minimum zu reduzieren“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 11). Bildung ist eine lebenslange Aufgabe, die nach dem Schulbesuch nicht abgeschlossen ist. So greift der Inklusionsgedanke auch in der vierten Bildungssäule[2] – der Erwachsenenbildung.
Hier gibt es noch zahlreiche Barrieren, die es Menschen mit Beeinträchtigung nicht ermöglichen, an Fortbildungsangeboten teilzunehmen. Dadurch wird ihnen ein bestimmter Bereich unserer Gesellschaft verwehrt. Der Index für Inklusion bezeichnet einen Ausschluss von Institutionen als „institutionelle Diskriminierung“ (ebd., S. 14). Die Gründe für einen Ausschluss können vielfältig sein: keine Offenheit der Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung, bauliche Barrieren, kein Informationsfluss an Interessierte, finanzielle Engpässe u.v.m.
Obwohl das Recht auf Bildung erstmals 1948 in der Erklärung der Menschenrechte formuliert wurde, ist bis heute nicht allen die diskriminierungsfreie Partizipation am Bildungswesen garantiert. Die Perspektive der Menschenrechte wird erst seit kurzer Zeit in die bildungspolitische Diskussion mit einbezogen (vgl. PLATTE 2009).
Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 (vgl. AICHELE 2010, S. 4; KLAUSS/LAMERS/TERFLOTH 2009, S. 14; MILES-PAUL 2009, S. 46) wird ein Ausschluss von Menschen von Bildungsinstituten als Menschenrechtsverletzung eingestuft, gegen die rechtliche Schritte zu unternehmen sind. Artikel 24 der UN-Konvention besagt, dass die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung anerkennen (vgl. BAS 2010). „Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:
-
die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
-
Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
-
Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (ebd.).
Der Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigung von Bildungsangeboten kann nach der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen als Menschenrechtsverletzung bewertet werden (vgl. GALLE-BAMMES 2009, S. 219). Inklusive Bildung wird daher als Konsequenz des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe aufgefasst (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 18).
RAPPAPORT (1985, S. 268) hat schon vor der Ratifizierung der UN-Konvention die Frage gestellt: „Was nutzt es, Rechte ohne Ressourcen zu besitzen?“ (zit. n. THEUNISSEN 2006, S. 14). Oft fehlen die grundlegenden Bedingungen, um die eigenen Rechte zu nutzen. Laut dem Index für Inklusion gilt es, Barrieren mit Hilfe der Mobilisierung von Ressourcen auf ein Minimum zu reduzieren (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 12).
Ich versuche in meiner Arbeit durch die Evaluation der Weiterbildung in Ostholstein eingebunden in den theoretischen Kontext des Index für Inklusion und des Kreativen Felds, mögliche Ressourcen aufzuzeigen.
Partizipation leitet sich vom lateinischen Verb ‚particeps‘ ab. Es bedeutet ‚an etwas teilnehmen‘. Gleichgesetzte Übersetzungen sind ‚Beteiligung‘, ‚Teilhabe‘, ‚Teilnahme‘, ‚Mitwirkung‘, ‚Mitbestimmung‘ und ‚Einbeziehung‘ (DUDEN 1990, S. 578f.; DUDEN 2006, S. 766).
Die gesellschaftliche Teilhabe im vollen Ausmaß wird noch vielen marginalisierten Menschengruppen verwehrt – so auch Menschen mit Beeinträchtigung. Oft fehlen die Möglichkeiten, eine wohnortnahe Schule zu besuchen, der allgemeine Arbeitsmarkt ist ihnen oft nicht zugänglich und auch von weiterführenden Bildungsangeboten werden sie häufig ausgeschlossen.
„Volle gesellschaftliche Teilhabe ist dann realisiert, wenn Menschen mit Behinderung ein Leben führen, dass sich nicht von dem unterscheidet, welches sie ohne Behinderung leben würden. Teilhabe kann sich dann realisieren, wenn nicht nur der behinderte Mensch Anpassungsbereitschaft an gesellschaftliche Strukturen signalisiert, sondern wenn die Gesellschaft ebenfalls bereit ist, sich den Bedarfen behinderter Menschen anzupassen“ (NIEHOFF 2005, S. 35).
Der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, insbesondere der Erwachsenenbildung, trägt zur Individualisierung, zum Erwerb von Autonomie, zur schrittweisen Emanzipation, zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben und zur sozialen Integration bei (vgl. MAY 2007).
Ich sehe in inklusiven Bildungsangeboten die Möglichkeit der „volle[n] gesellschaftliche[n] Teilhabe“ (NIEHOFF 2005, S. 35). Inklusive Bildung geht in meinen Augen daher mit Teilhabe einher.
[1] „Ein Kind muss sich sein Recht auf Inklusion nicht erst verdienen oder darum kämpfen, es zu erhalten“ (SAPON-SHEVIN 1998, S. 4).
[2] Neben Schul-, Berufsausbildung und Hochschulwesen wird Erwachsenenbildung häufig als ‚vierte Säule‘ des deutschen Bildungssystems bezeichnet (vgl. FAULSTICH/ZEUNER 2010, S. 13).
Inhaltsverzeichnis
‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ ist ein Pilotprojekt für den Zeitraum von Februar 2009 bis Dezember 2010. Projektträger sind die Ostholsteiner Behindertenhilfe und Integra als veränderungsbereite Organisationen. Kooperationspartner sind u.a. die Fachschule für Sozialpädagogik in Lensahn als Bildungsträger und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als wissenschaftliche Begleitung (vgl. DOOSE 2009, S. 4f.).
An diesem Angebot können Menschen teilnehmen, die sich mit dem Thema Zukunftsplanung befassen wollen. Die Weiterbildung erstreckt sich über zwei Jahre mit mehreren Kursen. Es finden zwei Grundkurse mit je vier Modulen zwei Tagen statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, einen Aufbaukurs mit ähnlicher Struktur zu besuchen.
Im Jahr 2009 wird die Weiterbildung Teil des Leonardo-da-Vinci-Projekts ‚New Path to Inclusion‘. Das Projekt ist dadurch um europäische Elemente aus England, Österreich und der Tschechei erweitert worden. Diese Weiterbildung findet in Wien, Prag und Eutin statt und stellt für Eutin den dritten Grundkurs dar.
Zusätzlich gibt es 2011 einen europäischen Multiplikatorenkurs in Prag und Bratislava, der die Teilnehmer befähigt, über Zukunftsplanung zu referieren. Hier nehmen aus jedem Land, außer England, sechs Personen teil.
Meine Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf den dritten Grundkurs im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-Projekts, an dem ich als Teilnehmerin und Beobachterin mitarbeite.
Die Weiterbildung bietet eine theoretische und praktische Einführung in die Methoden der Zukunftsplanung. „Jeder Mensch hat eine Zukunft. Diese Zukunft beginnt heute und dauert hoffentlich noch etliche Jahre. Wir sind oft auf Unterstützung von anderen Menschen angewiesen, um diese Zukunft gut gestalten zu können“ (DOOSE 2009, S. 3). Persönliche Zukunftsplanung ist ein methodischer Ansatz, in dem gemeinsam mit vielen Menschen über die eigene Zukunft nachgedacht wird (vgl. ebd., S. 3). Sie ist auf die einzelne Person und ihr eigenes Lebenskonzept konzentriert. Es handelt sich um ein Entwicklungsfeld, bei dem sich eine Person mit ihrer Lebenssituation intensiv auseinandersetzt und sich dazu Unterstützung verschiedener Art sucht (vgl. HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, mit anderen, für sie wichtige und vertraute Personen, über individuelle Vorstellungen, Wünsche und Ziele nachzudenken und diese anschließend schrittweise umzusetzen (vgl. EMRICH 2004, S. 22).
„Wie möchtest du leben? Wovon träumst du? Was soll aus dir werden?“ (DOOSE 2009, S. 12): Das sind u. a. Beispiele für Leitfragen innerhalb Persönlicher Zukunftsplanung. Viele dieser Fragen sollten offene Fragen, Such- oder Orientierungsfragen innerhalb eines gemeinsamen Planungsprozesses sein (vgl. ebd., S. 12). Um diese Fragen zu erörtern, trifft sich die planende Person mit ihrem Unterstützerkreis an einem Ort, der von ihr ausgewählt wurde.
Die planende Person lädt andere, zu denen sie Vertrauen hat oder die eine besondere Kompetenz zu einen Thema besitzen, ein. Sie können als „gute Geister“, „Kraftspender“ (ebd., S. 233) dienen und Verbündete sein (vgl. BOBAN 2008, S. 233; HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Der Unterstützerkreis ist in vier konzentrische Kreise aufgebaut und von großer Bedeutung (vgl. BOBAN 2008, S. 233). Dieser setzt sich aus „umgebenden Menschen“ (die Familie, der Partner), „Freunden“ (Menschen, die einem nahe stehen), „guten Bekannten“ (Menschen, die bei solch wichtigen Treffen nicht fehlen dürfen) und „bezahlten Personen“ (Menschen, die eine gute Arbeit leisten) zusammen (vgl. ebd., S. 233) (Abb. 1). Je vielfältiger die Beziehungen und Wahrnehmungen der Unterstützer sind, desto bunter und breiter wird der Weg, weil durch viele kreative Köpfe vermehrt Ideen verschiedenster Art entstehen. Eine große Heterogenität im Unterstützerkreis ist also ein klarer Vorteil (vgl. HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Manche Unterstützerkreise repräsentieren nicht alle Personengruppen auf Grund institutioneller Hintergründe oder Kleinfamiliensituationen. Gründe dafür können Wohnsituationen in Heimen, lange Klinikaufenthalte oder Wohnort und Arbeitsplatz in einer Einrichtung sein. Diese Bedingungen bieten oft nicht die Möglichkeit, einen ausdifferenzierten Unterstützerkreis mit den Lebensfeldern Freunde, Familie, Bekannte und Bezahlte zu bilden. Doch dies ist kein Hindernis, die Zukunftsplanung zu beginnen, sondern Anlass, „[…] diese leeren Kreise bewußt zu machen und zu füllen“ (HINZ 1998).
Persönliche Zukunftsplanung bietet sich immer dann besonders an, wenn sich die Lebenssituation ändert oder verändern wird z. B. beim Übergang von der Schule in den Beruf, beim Auszug von zu Hause, beim Schul- oder Wohnortwechsel. Sie umfasst alle Lebensbereiche: Freizeit, Arbeit, Schule, Partnerschaft, Wohnen usw. (vgl. DOOSE 2009, S. 12; EMRICH 2004, S. 22). Aber auch existenzielle Probleme (Krankheit, Tod eines nahestehenden Menschen) können krisenbehaftete Zustände sein, die eine Planung entstehen lassen können.
„Persönliche Zukunftsplanung versteht sich als ein Ansatz, der prinzipiell für alle Menschen hilfreich sein kann […]“ (EMRICH 2004, S. 22). Gleichwohl kann er für Menschen mit Beeinträchtigungen in besonderer Weise relevant sein, vor allem in Bezug auf ihre Selbstbestimmung und ihre Wahlmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 22). Wichtig ist, dass es sich bei der Persönlichen Zukunftsplanung immer um einen kontinuierlichen Problemlösungsprozess handelt (vgl. DOOSE 2009, S. 22).
Für den Planungsprozess bedarf es, im Idealfall, eines Moderationsteams, bestehend aus einem Gruppenmoderator und einem Grafikmoderator. Der Gruppenmoderator leitet den Prozess, während der Grafikmoderator die Ergebnisse und wichtigsten Aspekte zeichnerisch oder schriftlich festhält. All dies geschieht immer in Absprache mit der planenden Person.
„Persönliche Zukunftsplanung sieht den einzelnen Menschen als einzigartiges Individuum mit seinen Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Träumen“ (ebd., S. 14). Träume sind ein wichtiges Element. In ihnen liegen der Ursprung der Motivation sowie kleine und große Ziele und Visionen. Nicht jeder Traum kann in die Wirklichkeit umgesetzt werden, dennoch hat er seine Berechtigung (vgl. ebd., S. 20). Es gilt hinter den Traum zu schauen und Details zu erfragen. Das Erkunden des Kernstücks des Traums, also was er der Person bedeutet, führt häufig zu neuen Erkenntnissen, die für die weitere Planung genutzt werden können. „Persönliche Zukunftsplanung begreift die Wirklichkeit als individuell gestaltbar“ (ebd., S. 21).
BOBAN/HINZ benutzen den Begriff der „Bürgerzentrierten Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen“ (BOBAN 2008, S. 230) anstatt Persönlicher Zukunftsplanung. Der Bürgerzentrierte Ansatz nimmt den Menschen, der unterstützt wird, in seiner Rolle als Bürger mit allen Rechten und Pflichten in den Blick und bezieht sein Umfeld als Bürger mit ein (vgl. ebd., S. 240). In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Begriff der Persönlichen Zukunftsplanung gearbeitet, weil er in der Weiterbildung verwendet wird.
In den Ausführungen von BOBAN/HINZ wird Zukunftsplanung als „Schlüssel zu Partizipation“ (ebd., S. 234) bezeichnet, da es nicht nur einfach um die Teilhabe geht, sondern die gemeinsame Gestaltung der Situation. Das Involviertsein ist ein wesentlicher Aspekt (vgl. ebd., S. 234).
Um die Komplexität von Zukunftsplanung zu erkennen und zu erlernen, wird die Weiterbildung mit Elementen dieser entwickelt. Grundlage dafür ist das eigens erstellte Curriculum von Ines Boban, Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne Göbel und Oliver Koenig. Stefan Doose fungiert als kontinuierlicher Kursbegleiter und führt im Teamteaching mit Ines Boban, Carolin Emrich, Susanne Göbel, Oliver Koenig und Julie Lunt die einzelnen Module durch. Die erfahrenen Referenten bilden den Entwicklerkreis dieser Weiterbildung und setzten sich in halbjährlichen Treffen zusammen, um sich über bereits gemachte Erfahrungen auszutauschen und nächste Schritte festzuhalten.
Der dritte Grundkurs erstreckt sich von März 2010 bis Oktober 2010 mit einem Treffen pro Monat in den Räumen der Ostholsteiner Behindertenhilfe in Eutin. Die vier deutschsprachigen Module (Basismodule) finden freitags und samstags statt, die zwei englischsprachigen donnerstags bis samstags. An diesen nehmen weitere Interessierte aus den vergangenen Kursen und der Leitungsebene der Ostholsteiner Behindertenhilfe teil. Sie werden konsekutiv übersetzt.
An der gesamten Fortbildung können alle Interessierten vor allem aus dem Kreis Ostholstein kostenlos teilnehmen. In den vier Basismodulen des dritten Grundkurses sind zu Beginn der Weiterbildung 22 Teilnehmer.
Die Teilnehmerzusammensetzung ergibt sich auf Grund des definierten Schlüssels:
-
„6 TeilnehmerInnen mit einer Behinderung (30%)
-
8 Fachkräfte aus Organisationen, die Menschen mit Behinderung begleiten und unterrichten (40%)
-
2 Führungskräfte aus Organisationen (10%)
-
2 Elternteile, die ein behindertes Kind haben, aber auch als Lehrerin in der Integration bzw. professionelle Unterstützerin in diesem Bereich arbeiten (10%)
-
1 (+2) ExpertInnen von Kooperationspartnern außerhalb des Kreises im Rahmen des Innovationstransfers (5%)
-
1 Studentische Mitarbeiterin der Begleitforschung der Universität Halle als teilnehmende Beobachtung (5%)“ (DOOSE 2010, S. 12).
Mit Hilfe von PowerPoint und Kopiervorlagen werden theoretische Einführungsblöcke präsentiert. Das geschieht meist im Kreis oder in U-Form (Abb. 2). Im Anschluss gibt es meist die Möglichkeit, eben Vermitteltes in Kleingruppen oder Paarweise anzuwenden und zu üben (Abb. 3). Bei Gruppenarbeiten können die Teilnehmer zwischen drei verschiedenen Räumen und dem Außenbereich wählen. Die Räume der Weiterbildung sind für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich. Vielfältiges Material ist vor Ort: Beamer, Flipcharts, Papier und Stifte. Sowohl der Besuch der Weiterbildung als auch das zahlreiche Material und die Verpflegung sind kostenfrei.
Für die Weiterbildung ist eine Internetplattform ‚http://www.edumoodle.at/bidok/‘ angelegt worden, die prinzipiell für alle Teilnehmer zugänglich ist. Sie bietet die Möglichkeit der Vernetzung mit den anderen Kursen und europäischen Partnern. Auf ihr werden organisatorische Tatsachen bekannt gegeben und das Material der einzelnen Module zur Verfügung gestellt.
Durch die Teilnahme an der Weiterbildung gibt es die Möglichkeit, drei unterschiedliche Zertifikate zu erwerben:
-
Ein Basiszertifikat für die Teilnahme an der Weiterbildung mit kontinuierlicher Anwesenheit.
-
Für ein Moderationszertifikat ist zusätzlich die Erstellung eines Portfolios mit der Reflexion der Weiterbildung, persönlichen Erfahrungen und Präsentation der Moderation von zwei Planungen (einmal als Gruppenmoderator, einmal als Grafikmoderator) und der eigenen notwendig. Weiterhin ist die Teilnahme an einem Projekt, z. B. Erstellen der Methodenbox oder bei der Gestaltung eines Workshops am Fachtag[3] notwendig.
-
Für das Multiplikationszertifikat ist es Voraussetzung an den europäischen Kursen in Bratislava und Prag teilzunehmen.
Das Erlernen der Moderation und der grafischen Unterstützung von Zukunftsplanungen sind Schwerpunkte der Weiterbildung. Das Menschenbild und die Philosophie von Persönlicher Zukunftsplanung werden ebenso wie die aus Großbritannien stammende Philosophie und Methoden des Personenzentriertes Denkens thematisiert. Im Vordergrund stehen weiterhin Planungsmethoden, Gestaltung von Zukunftstreffen, Moderation von Unterstützerkreisen und die Visualisierung von Planungen. Ein wichtiger Punkt bei Persönlicher Zukunftsplanung ist das Erkunden von individuellen Stärken, Fähigkeiten, Träumen und Zielen. Die Unterstützung für Menschen mit schweren Behinderungen ist genauso Themenschwerpunkt, wie Sozialraumorientierung, Vernetzung mit Organisationen und personenbezogene Dienstleistungen (vgl. DOOSE 2010, S. 3f.).
Die Evaluation liegt in den Händen von Prof. Dr. Andreas Hinz von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zwei Studentinnen sind jeweils an einem Kurs als Beobachterinnen beteiligt. Die evaluationsrelevanten Daten aus Evaluationsbögen, Interviews und Beobachtungen sind Grundlage für die Erstellung einer Publikation über die gesamte Weiterbildung (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010). In ihr werden die einzelnen Module beschrieben und Planungsprozesse innerhalb der Weiterbildung dargestellt. Die Evaluation zeigt Stärken („Erfolgsgeschichten, Neue Horizonte, Bedeutung des Austauschs, Neue Kooperationsbeziehungen, Atmosphäre im Kurs, Methoden und Materialien“) (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 3) und Stolpersteine („Planungen im Kurs: reale Zukunftspläne in Übungssituationen?, Inklusive Weiterbildung, aber wie?, Moderation: Erfahrungen ermöglichen und präsentieren?, Demokratischer Ansatz in hierarchischen Organisationen?, Bedingungen für Zertifikate?“) (ebd., S. 3) des Projektes auf. Innerhalb der Stolpersteine bin ich auf den Aspekt der Inklusivität gestoßen, den ich zum Anlass dieser Arbeit nehme.
Der Entwicklerkreis setzt sich aus den sechs Referenten zusammen. Bei Treffen des Entwicklerkreises, circa zweimal im Jahr, sind stets die Evaluationsgruppe als auch Beteiligte vom Umfeld anwesend. Hier werden über die bisherigen Kurse und noch zu erfüllenden Aufgaben gesprochen. So zum Beispiel, was läuft gerade gut und was weniger, welche Inhalte werden aufgegriffen, die Gestaltung des Fachtages oder das Thema der Publikation der Evaluation.
Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr ein Treffen der regionalen Plattform, an der das Umfeld, Politiker, vertretende Organisationen und Finanzgeber teilnehmen. Sie werden über den aktuellen Stand der Weiterbildung in Kenntnis gesetzt. Weiterhin wird versucht, offene Fragen zu beantworten. Aus diesen Treffen hervorgegangene Aufzeichnungen und Interviews werden in die Arbeit einbezogen.
[3] Am 30.09.2010 fand ein Landesweiter Fachtag ‚„Neue Wege zur Inklusion“ Persönliche Zukunftsplanung, personenzentrierte Dienstleistung und Sozialraumorientierung‘ in Lensahn statt. Auf diesem wurde das Projekt vorgestellt und verschiedene Workshops rund um Zukunftsplanung angeboten.
Inhaltsverzeichnis
Im Rahmen der Evaluation des gesamten Projekts ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ entscheidet sich die wissenschaftliche Begleitforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für qualitative Forschungsmethoden. Infolgedessen finden sie ebenso Eingang in diese Arbeit. Qualitative Forschung hat eine starke Anwendungsorientierung in ihren Fragestellungen und Vorgehensweisen, weshalb sie als geeignet empfunden wird (vgl. FLICK/KARDORFF/STEINKE 2008, S. 13).
„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (ebd., S. 14). Die Begründung der Begleitforschung, sich für diesen Zugang zu entscheiden, liegt darin, dass „sie […] in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch ‚näher dran‘ als andere Forschungsstrategien“ ist (ebd., S. 17).
Die Strategien der Datenerhebung bei qualitativen Forschungsmethoden weisen einen kommunikativen, dialogischen Charakter auf (vgl. ebd., S. 21). Dieser bietet sich bei der Frage nach der Inklusivität des Kurses gut an, da ich die Meinungen der beteiligten Personen abbilden möchte und somit in Beziehung zu ihnen trete. Bei qualitativen Methoden wird „[…] die Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis“ (FLICK 1999, S. 15).
Alle sechs Module der europäischen Weiterbildung werden mit einem standardisierten Evaluationsbogen ausgewertet. Es findet eine Beobachtung und Begleitung aller Kurse, mit Ausnahme des ersten Grundkurses statt. Nach jedem Modul werden jeweils mit den Referenten Interviews zu verschiedenen Aspekten geführt. Ein längeres Interview über die Gesamtsicht der Referenten, einiger Teilnehmern und dem Umfeld wird am Ende der Weiterbildung durchgeführt. Ferner gibt es Spontaninterviews zu passenden Augenblicken mit Teilnehmern. Daneben erhalten die Teilnehmer und Referenten einen Fragebogen zur Inklusivität der Kurse.
Diese verschiedenen Methoden bilden eine Daten-Triangulation und Investigation-Triangulation ab. Erstes besagt, dass verschiedene Daten kombiniert werden, die aus verschiedenen Quellen stammen „und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben wurden. [Letzteres, d.V.] kennzeichnet den Einsatz verschiedener Beobachter bzw. Interviewer, um subjektive Einflüsse durch den Einzelnen auszugleichen“ (FLICK 2008, S. 310). Es werden gezielt verschiedene Forschungsmethoden miteinander kombiniert, „[…] um deren Stärken zu ergänzen und Grenzen wechselseitig aufzuzeigen“ (ebd., S. 315).
Im Folgenden beschreibe ich die von mir verwendeten Methoden ausführlicher.
Beobachtung ist „die absichtliche, aufmerksam-selektive Art des Wahrnehmens, die ganz bestimmte Aspekte auf Kosten der Bestimmtheit von anderen beachtet […]. Gegenüber dem üblichen Wahrnehmen ist das beobachtbare Verhalten planvoller, selektiver, von einer Suchhaltung bestimmt und von vorneherein auf die Möglichkeit der Auswertung des Beobachteten im Sinne der übergreifenden Absicht gerichtet“ (GRAUMANN 1966, S. 86 zit. n. GREVE/WENTURA 1997, S. 12).
Es handelt sich um eine teilnehmende Beobachtung. Dies bedeutet das Eintauchen des Forschers in das untersuchte Feld. Wesentliche Kennzeichen dieser Art sind auf der einen Seite Beobachtung aus der Perspektive des Teilnehmers, und auf der anderen Seite der Einfluss auf das Beobachtete durch aktive Teilnahme (vgl. FLICK 1999, S. 157). Diese Rolle habe ich im dritten Grundkurs eingenommen.
Da es sich um eine teilnehmende Beobachtung handelt, ist sie von subjektiven Interpretationen geprägt. Die qualitative Forschung greift aber „[…] auf die […] subjektive Wahrnehmung des Forschers als Bestandteil der Erkenntnis zurück“ (FLICK/KARDORFF/STEINKE 2008, S. 25). Dabei bietet diese involvierte Beobachtung außerdem die Möglichkeit des geschärften Blicks. Bei der teilnehmenden Beobachtung wird der Beobachter selbst Element des zu beobachteten sozialen Feldes (vgl. LAMNEK 2005, S. 715). LÜDERS (2008, S. 385) deutet darauf hin, dass die teilnehmende Beobachtung Anfang der 1960er Jahre in den USA von den damaligen Forschern als ein wichtiger Zugang zur sozialwissenschaftlichen Beschreibung von Wirklichkeit verstanden wurde.
Durch den Abgleich verschiedener Meinungen, sowohl seitens der Referenten als auch der Teilnehmer, werden die beobachteten Gegebenheiten jedoch unabhängig von den eigenen subjektive geprägten Empfindungen eingeordnet.
Zunächst ist es eine unstrukturierte, offene Beobachtung, die nach und nach zur strukturierten Beobachtung übergeht. „Die strukturierte Beobachtung setzt […] die Aufstellung eines detaillierten Kategoriensystems voraus, was aber erst möglich ist, wenn dem Beobachtungsvorgang differenzierte und konkrete Hypothesen zu Grunde liegen“ (LAMNEK 2005, S. 560). Solche Hypothesen können jedoch erst benannt werden, wenn sich der Forscher einen Überblick über die zu beobachtende Situation und die verschiedenen sozialen Zusammenhänge verschafft hat. Die unstrukturierte Beobachtung ist die Voraussetzung für den Informationsgewinn und die Hypothesenkonstruktion (vgl. ebd., S. 560).
Ich beobachte die Weiterbildung ein halbes Jahr weitgehend unter dem Fokus der Inklusivität. Dabei werden der Tagesablauf und die verwendeten Methoden mit Bemerkungen dokumentiert und mit Bemerkungen versehen. „Durch die aktive Beobachtung des Geschehens in den Kursen können Aussagen über Ergebnisse, aber auch über Prozesse im Verlauf des Projektes gemacht werden“ (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 36).
Am Ende jedes europäischen Moduls werden die Teilnehmer gebeten, mit Hilfe eines standardisierten Evaluationsbogens bezüglich der Organisation, der vermittelten Inhalte und Methoden des Moduls zu bewerten (Abb. 4). Auch die Bedeutsamkeit für das private Leben und die Arbeitswelt wird mit Hilfe von vier Items (sehr gut/sehr bedeutsam, gut/bedeutsam, ausreichend/kaum bedeutsam, nicht zufriedenstellend/nicht bedeutsam) ermittelt. Dabei gibt es immer Raum für individuelle Kommentare. Hinzu kommt die Auswertungsmethode ‚4+1 Frage‘. Diese Methode hilft Menschen zu erkennen, was sie aus ihren bisherigen Bemühungen und Aktivitäten lernen und wie sie auf diese Lernerfahrungen aufbauen können. Sie eröffnet die Möglichkeit, zukünftige Bemühungen und Aktivitäten neu in den Blick zu nehmen und weiter zu planen (vgl. SANDERSON/GOODWIN 2010, S. 18f.). Die Beantwortung der fünf Fragen stellt somit den zweiten Aspekt des Evaluationsbogens dar. Folgende Fragen gilt es zu beantworten:
-
Was haben Sie versucht?
-
Was haben Sie gelernt?
-
Worüber waren Sie erfreut?
-
Worüber waren Sie besorgt?
-
Was möchten Sie als nächstes tun?
Im zweiten Grundkurs und im Aufbaukurs werden je Modul andere Evaluationsbögen benutzt, sodass diese nicht in die Auswertung der Arbeit mit einbezogen werden.
Das Interview ist „[…] eine Gesprächssituation, die bewusst und gezielt von den Beteiligten hergestellt wird […]“ (LAMNEK 2005, S. 330). „Damit Situationen und Verläufe differenziert erfasst werden können, kommt methodisch nur das Interview in Frage“ (vgl. FLICK 1995, S. 94ff zit. n. HINZ/BOBAN 2001, S. 99). „Nur bei ihm gibt es die Möglichkeit, in ein Gespräch einzusteigen, sodass sich bei den BefragerInnen ein Bild von der Situation ergibt. Wichtig darüber hinaus ist, dass den Befragten das ‚Wort gegeben wird‘ (BOURDIEU 1997), d. h. nicht die Fragen der BefragerInnen sind vorrangig wichtig, sondern die Sicht, die Akzente und die subjektive Wahrheit der Befragten sollen im größtmöglichen Maße zur Geltung kommen können. […] Die Interviews orientieren sich also an dem Gütekriterium von BOURDIEU, das darin besteht, ‚eine Beziehung des aktiven und methodischen Zuhörens zu schaffen […]" (BOURDIEU 1997, S. 782 zit. n. HINZ/BOBAN 2001, S. 99).
Die verwendeten Interviews sind ‚episodische Interviews‘, die sowohl Erzählungen, als auch zielgerichtete Fragen beinhalten (vgl. LAMNEK 2005, S. 362). „Ziel des episodischen Interviews ist, bereichsbezogen zu ermöglichen, Erfahrungen in allgemeinerer, vergleichender etc. Form darzustellen, und gleichzeitig die entsprechenden Situationen und Episoden zu erzählen“ (FLICK 1999, S. 125). In dieser Form des Interviews lässt der Befrager seine Interviewpartner erzählen, stellt aber auch zielgerichtete Fragen anhand des Leitfadens (vgl. LAMNEK 2005, S. 363). Es gibt somit „[…] Raum für kontextbezogene Darstellungen in Form von Erzählungen […]“ (FLICK 1999, S. 125).
Das Interview ist in der Sprache der Befragten zu führen und versucht den Charakter eines Alltagsgesprächs zu realisieren, wobei der Interviewer sich mit Äußerungen zurückhält und die befragte Person zu Wort kommen lässt und somit auf den Sprecher so reagiert, dass er zu weiteren Aussagen ermuntert wird. Dies geschieht insbesondere durch Mimik, Gestik und weniger durch Worte (vgl. LAMNEK 2005, S. 374). „Das einseitige Zuhören ist also keineswegs lethargisch oder passiv, sondern stimulierend-aktiv“ (ebd., S. 374).
Kurzinterviews werden mit jedem Referenten einzeln nach jedem Modul geführt. Um vergleichbare Daten zu gewinnen, finden diese nach einem Interviewleitfaden statt, welcher für ein episodisches Interview typisch ist (Abb. 5). Dieser dient dabei als Gedächtnisstütze und Orientierung. Offenen Fragen bieten einen Anstoß zum Erzählen. Um einen besseren Gesprächsfluss zu ermöglichen, wird der Interviewleitfaden flexibel gehandhabt und die Formulierungen der Fragen sind nicht vollständig festgelegt (vgl. HOPF 2008, S. 351).
So liegen sechs Interviews mit dem kontinuierlichen Kursbegleiter der europäischen Weiterbildung vor, sowie jeweils ein Interview der hinzukommenden Referenten. Auch die Interviews des ersten und zweiten Grundkurses, des Aufbaukurses und weiterer beteiligter Personen beziehe ich ein. Der Inklusionsaspekt stellt nur einen Teilaspekt der Fragen dar, da die Interviews der gesamten Evaluation dienen.
Zusätzlich werden am Ende des Projektes Abschlussinterviews mit allen Referenten, fünf Teilnehmern und dem Umfeld anhand weiterer, ausführlicheren Interwieleitfadens aufgezeichnet (Abb. 6 – 8). Die Teilnehmer repräsentieren verschiedene Subgruppen, die exemplarisch intensiver befragt werden und so ihre spezifische Sicht der Dinge differenzierter darstellen können. Die fünf Teilnehmer sind sowohl Männer als auch Frauen, berufstätig, Jugendlich bis mittleres Alter, mit und ohne Beeinträchtigung.
Hinzu kommen Spontaninterviews mit Teilnehmern zu speziellen Themen, unter anderem dem Inklusionsaspekt. Mit diesen speziellen Befragungen wird genau eruiert, womit die Personen zufrieden sind und womit nicht. Hierzu befrage ich zwei Menschen mit Beeinträchtigung.
Der gesamte Interviewzeitraum erstreckt sich von April 2009 bis Dezember 2010. Die Interviews werden jeweils mit dem Einverständnis der befragten Personen aufgezeichnet und vollständig transkribiert, um eine möglichst genaue Auswertung zu gewährleisten. Anschließend werden jedem Interview prägnante Sichtweisen entnommen, miteinander verglichen und ausgewertet. Auf Grund der vielen Interviewpartner stellen die Ergebnisse eine repräsentative Aussage zur Einschätzung der Weiterbildung dar.
Um nähere Informationen der Teilnehmer über ihr Empfinden der Inklusivität zu bekommen, gibt es einen Fragebogen. Die Teilnehmer können zunächst ihre eigenen Vorstellungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit inklusiven Weiterbildungen darlegen und anschließend die Weiterbildung in Eutin einschätzen. Auch Potenziale, Barrieren und die Möglichkeit der Partizipation sind Aspekte.
Der Fragebogen orientiert sich nicht an quantitativen Daten, sondern die Breite der erhobenen Daten steht im Vordergrund. Ich erstelle ihn sowohl in ‚schwerer‘ als auch in ‚einfacherer‘ Sprache, mit Bildern und Piktogrammen, um die Fragen zu untermauern (Abb. 9/10).
Es handelt sich um keine Vollbefragung, da es den Teilnehmern, Referenten und weiteren in das Projekt involvierten Personen frei stand, den Fragebogen zu beantworten. Zwei Fragebögen werden von Teilnehmern aus dem österreichischen Kurs beantwortet. Zur Auswertung nutze ich 25 anonym beantwortete Fragebögen.
Inhaltsverzeichnis
Zur Interpretation der Daten werden zwei Ansätze herangezogen: Das Kreative Feld evaluiert die Weiterbildung unter dem Fokus der vorhandenen und verbesserungswürdigen Elemente auf den Ebenen der drei Dimensionen des Index für Inklusion. Mit Hilfe des Index für Inklusion, seinen einzelnen Indikatoren und dazugehörigen Fragen wird versucht Prioritäten für die Weiterentwicklung abzuleiten. Aus der Gesamtbetrachtung des Index für Inklusion können Elemente einer inklusiven Weiterbildung abgeleitet werden. Diese beiden Ansätze sind besonders geeignet, weil es um Prozessveränderung geht und das Ziel in Inklusion besteht, welches ein Prozess ist.
Grundlage für meine Auswertungen ist der Index für Inklusion. Hierzu stelle ich zunächst seine Intention und seinen Aufbau vor. Dabei beleuchte ich die verschiedenen Dimensionen und reiße den Index-Prozess mit seinen einzelnen Phasen an. Er verdeutlicht, wie eine inklusive Weiterbildung gestaltbar sein kann. Die einzelnen Phasen folgen vollständigkeitshalber, meine Arbeit beleuchtet jedoch hauptsächlich die Phase 2 des Index-Prozesses.
Der Index für Inklusion wurde von Tony BOOTH und Mel AINSCOW entwickelt und von Ines BOBAN und Andreas HINZ 2003 übersetzt und hinsichtlich der Verhältnisse in deutschen Schulen modifiziert. „Er bietet die Möglichkeit Inklusion zu leben“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 3). Das Wort ‚Index‘ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: Anzeiger, Register, Zeigefinger oder Inhaltsverzeichnis (DUDEN 1990, S. 340).
Dieser Index ist ein Selbstevaluierungsmaterial für Schulen. Im Rahmen dieser Arbeit wird er punktuell auf einen anderen Bildungsbereich bezogen, denn er ist „[…] ein wertgeleitetes Angebot für jegliche Einrichtung […]“ (HINZ 2008, S. 46). Er ist eine Hilfe, die Vorschläge bietet und kein Test. Er gibt eine Systematik, die dabei hilft nächste Schritte in der Entwicklung zur Inklusivität zu gehen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 3). „Der Index ist kein festgelegtes Programm, dem eine [Bildungseinrichtung; d.V.] von Anfang bis Ende systematisch zu folgen hat, sondern ist für verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten offen – wenn dadurch die Fähigkeit der [Bildungseinrichtung; d.V.] gesteigert wird, der Vielfalt der [Teilnehmer; d.V.] zu entsprechen“ (HINZ 2005, S. 59).
„Der Rahmen für die Bestandsaufnahme und die Entwicklung von Zielperspektiven der inklusiven [Weiterbildungen; d.V.] wird durch drei mit einander verbundene Dimensionen gebildet […]: Es gilt, inklusive Kulturen zu schaffen, inklusive Strukturen zu etablieren und inklusive Praktiken zu entwickeln. Alle drei Dimensionen sind notwendig, um Inklusion in einer [Bildungseinrichtung; d.V.] zu entwickeln“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 14) (Abb. 11).
Als Fundament des Dreiecks wurde bewusst die Dimension ‚Inklusive Kulturen schaffen‘ platziert. In der Vergangenheit wurde dem Potenzial von Bildungskulturen nur wenig Beachtung und Aufmerksamkeit entgegengebracht. Das Herzstück von Entwicklungen inklusiver Bildungsangebote ist, Entwicklungen im Lehren und Lernen zu unterstützen. Bereits die Entfaltung inklusiver Kulturen, wie Werte, kooperative Beziehungen, ein herzlicher, respektvoller Umgang untereinander, können schon Veränderungen in den anderen Dimensionen einleiten (vgl. ebd., S. 14f).
-
Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen
Die Dimension ‚Inklusive Kulturen schaffen‘ zielt darauf, eine wertschätzende und gegenseitig respektierende Gemeinschaft zu schaffen. Gemeinsam sollen inklusive Werte, wie „Gleichheit“, „Rechte“, „Teilhabe“, „Lernen“, „Gemeinschaft“, „Anerkennung von Vielfalt“, „Vertrauen“, „Nachhaltigkeit“, „Mitgefühl“, „Ehrlichkeit“, „Mut“, „Freude“ (BOOTH 2008, S. 59ff), Rücksicht, Empathie, Akzeptanz entwickelt und an alle anderen Beteiligten weiter vermittelt werden. Diese Werte sind maßgebend für alle Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 15), „so dass das Lernen aller durch einen kontinuierlichen Prozess der [Weiterbildungsentwicklung; d.V.] verbessert wird“ (ebd., S. 15). Eine ‚Inklusive Kultur‘ wird von dem Vertrauen in die Entwicklungskräfte aller Beteiligten und dem Wunsch, niemanden je zu beschämen, getragen (vgl. ebd., S. 15).
-
Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren
Aufbauend auf der vorherigen Dimension „soll [diese, d.V.] absichern, dass Inklusion als Leitbild alle Strukturen einer [Weiterbildung; d.V.] durchdringt“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 15). Die Strukturen erhöhen die Teilhabe aller und verringern die Ausgrenzung – damit geben sie eine klare Richtung für Veränderungen vor. Die Vielfalt der Teilnehmer wird durch jegliche Form der Unterstützung unterlegt (vgl. ebd., S. 15f.). „Alle Arten der Unterstützung werden in einen einzigen Bezugsrahmen gebracht und aus der Perspektive der [Teilnehmer, d.V.] und ihrer Entwicklung betrachtet […]“ (HINZ 2005, S.61).
-
Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln
In der Gestaltung von Inklusiven Praktiken spiegeln sich die inklusiven Kulturen und Strukturen wider. Die Gestaltung der Weiterbildung entspricht der Vielfalt der Teilnehmer. Sie werden dazu angeregt, aktiv an ihrer Gestaltung teilzunehmen, wobei ihre Stärken, Fähigkeiten, Erfahrungshintergründe und ihr Wissen den Grundstein bilden, auf dem aufgebaut wird. Zusammen finden alle heraus, welche Ressourcen in den jeweils Beteiligten (Teilnehmern, Referenten, Evaluationsgruppe, Finanzgebern, Umfeld) liegen. Auch materielle Ressourcen werden mobilisiert, um aktives Lernen und Teilhabe aller zu fördern (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 16; HINZ 2005, S.61f.).
Alle Dimensionen zusammen bieten einen Analyserahmen, in welchem der Planungsprozess für die Entwicklung von Bildungsprozessen strukturiert werden kann. Jeder einzelne Bereich enthält zwischen fünf und elf Indikatoren, die die Zielsetzungen bezeichnen (Abb. 12). Durch eine Reihe von Fragen wird die Bedeutung jedes Indikators erklärt (siehe BOBAN/HINZ 2003a, S. 53–95). Sie laden dazu ein, die Facetten im Detail zu erkunden und fordern zum Nachdenken auf. Die vorhandenen Erfahrungen werden bewusst gemacht, wodurch die Wahrnehmung der aktuellen Situation geschärft wird. Zusätzliche Ideen für Entwicklungsaktivitäten werden gegeben und der Fortschritt kann über dieses Kriterium betrachtet werden.
Beim Betrachten der Fragen zeigt sich die praktische Relevanz des Index. Auch können eigene Fragen hinzu kommen. Dadurch ist der Index individuell, denn jede Bildungseinrichtung erstellt ihn angepasst an ihre eigenen Situationen und Bedarfe (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 16).
Der Index-Prozess regt zu einer gemeinschaftlichen Bestandsaufnahme an, in der alle Personen, die einen Bezug zur Weiterbildung haben, ihre Erfahrungen einbringen (Abb. 13). Er beinhaltet fünf Phasen, die nachfolgend beschrieben werden. Dabei ist der Index-Prozess nicht als mechanischer Prozess zu verstehen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 18f.).
Der Beginn des Index-Prozesses stellt die Beschäftigung mit den Materialien dar, wobei die Anpassung an die eigene Situation entscheidend ist. Die Entwicklung eines inklusiven Bildungsangebotes wird dadurch in eigene Hände genommen (vgl. ebd., S. 22).
Die erste Phase beginnt mit der Bildung einer Koordinationsgruppe – dem Index-Team. Dieses Team repräsentiert alle Beteiligten der Weiterbildung. Sie steigern das Bewusstsein für den Index und setzten sich mit den Materialien auseinander. Weiterhin bereiten sie deren Gebrauch für die Ausarbeitung der Bestandsaufnahme mit allen Beteiligten vor. Diese Phase kann bis zu sechs Wochen dauern (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 24).
-
Das Index-Team bilden
Bedeutsam ist, dass die Gruppe alle Heterogenitätsdimensionen der Weiterbildung abbildet und demzufolge das Index-Team durch Teilnehmern, Evaluationsgruppe, Finanzgeber und Politiker erweitert wird. Auch neuen Mitgliedern ist das Hinzukommen während des Arbeitsprozesses gestattet. Um eine gute Arbeit im Team zu ermöglichen, sollten alle Materialien allen Mitgliedern zur Verfügung stehen (vgl. ebd., S. 24f.).
-
Einen kritischen Freund einbeziehen
Als hilfreich wirkt häufig ein ‚kritischer Freund‘. In den Prozess könnte eine außenstehende Person mit einbezogen werden, die die Weiterbildung gut kennt. Sie begleitet kontinuierlich den Prozess, ohne ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu erzeugen. Vertrauen und Sensibilität seitens des ‚kritischen Freundes‘ haben eine hohe Priorität (vgl. ebd., S. 25). „Es könnte jemand sein, der den Index gut kennt und mit seinem ‚fremde Blick‘ bei den detaillierten Untersuchungen der [Weiterbildung; d.V.] und bei den Versammlungen und Analysen der Sichtweisen aller Beteiligter hilft“ (ebd., S. 25). Diese Aufgabe können Hochschuldozenten, Studenten, Eltern, Lehrer, Schulpsychologen oder Referenten übernehmen (vgl. ebd., S. 25).
Teilweise betrachte ich die wissenschaftliche Begleitung des Projekts als eine Art ‚kritischer Freund‘. Sie steht in Beziehung zur Weiterbildung, dennoch existiert kein Abhängigkeitsverhältnis der Personen untereinander. Eine externe Evaluation, die im Index-Prozess mitwirkt, halte ich für nützlich.
-
Auf Gruppenprozesse achten
„Das Index-Team sollte selbst ein Modell für eine inklusive Praxis […] werden, indem es kollegial zusammenarbeitet, dafür sorgt, dass jedem genau zugehört wird, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Status, und dass niemand die Diskussion dominiert. Die Mitglieder brauchen das Gefühl, dass sie einander vertrauen können und frei und im Vertrauen miteinander sprechen können“ (ebd., S. 25). Dabei kommt es darauf an, die eigene Meinung so zu äußern, dass sie zum Dialog einlädt. Unterschiedliche Sichtweisen sollten nicht als Kritik aufgefasst werden. Sie sind Punkte, an denen man arbeiten kann und die das Denken der Gruppe vorwärts bringen können (vgl. ebd., S. 25).
In dieser Phase werden vom Index-Team Einschätzungen von allen Beteiligten (z. B. Teilnehmern, Umfeld und Bezugspersonen) eingeholt. Die Ergebnisse werden analysiert und weitere notwendige Untersuchungen abgeleitet. Im Anschluss werden die Prioritäten für die Entwicklung gemeinsam festgelegt (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 33; HINZ 2005, S. 59).
-
Einschätzungen erkunden
Die jeweilige Herangehensweise, Informationen über die Weiterbildung zu bekommen, ist sehr verschieden. Wichtig ist, dass alle Ansichten als Möglichkeit für Diskussionen und weitere Analysen dienen. Die Einschätzungen kann man über die Indikatoren und dazugehörigen Fragen erkunden. Dies kann beispielsweise über einen Informationstag, Fragebögen, Interviews oder Tutoren-Stunden geschehen. Das Index-Team systematisiert die zusammengetragenen Informationen, dabei wird deutlich, ob bei bestimmten Schwerpunkten noch weitere Informationen fehlen. Bei der Arbeit mit dem Index spiegelt die Erwartungshaltung teilweise wider, alles sofort zu verändern. Deshalb muss betont werden, dass der Sinn der Analyse in der Auswahl der Prioritäten besteht (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 33ff).
-
Prioritäten für die Entwicklung festlegen
„In diesem Abschnitt geht es darum zu überlegen, was in Bezug auf Kulturen, Strukturen und Praktiken der [Weiterbildung; d.V.] angesprochen werden muss, um das Lernen und die Partizipation zu verbessern“ (ebd., S. 38).
Die Aussagen werden dazu analysiert, wobei alle Beiträge ihre Berücksichtigung finden, um die Gesamtprioritäten abzuleiten. Hierfür bietet sich eine Arbeitsaufteilung und die Hilfe des ‚kritischen Freundes‘ an. Zu Beginn sollten die Aussagen den einzelnen Gruppen (Teilnehmer, Referent, Umfeld) zugeordnet und zusammengefasst werden. So werden Unterschiede in den Gruppenperspektiven deutlich.
Gegebenenfalls bedarf das Index-Team weiterer Informationen, um die Prioritäten endgültig festzulegen. Diese können auf verschiedenen Wegen (Portfolios, Beobachtungen, Gespräche) eingeholt werden (vgl. ebd., S. 38). „Die endgültig festgelegten Prioritäten sind nicht einfach nur das Ergebnis des Zusammentragens derjenigen Inhalte, die während der Beratungen am häufigsten genannt worden sind. Das Index-Team muss sicherstellen, dass die Meinungen von weniger ‚lautstarken‘ Gruppen an dieser Stelle nicht verloren gehen und sich besonders die Stimmen der [Teilnehmer; d.V.] […] in der endgültigen Prioritätenliste widerspiegeln“ (ebd., S. 39).
Die vorliegende Arbeit beläuft sich ausschließlich auf diese Phase. Mit Hilfe der gewonnenen Daten wird versucht, einzelne Fragen des Index zu beantworten. Daraus ergeben sich für jede Dimension Prioritäten, die es bedarf, um eine inklusive Weiterbildung zu verwirklichen. Die Prioritäten leiten sich aus den noch verbesserungswürdigen Aspekten der Daten ab. In einer Zusammenfassung werden sowohl diese als auch die bereits umgesetzten und positiven Elemente noch einmal aufgegriffen, sodass Schlüsselelemente inklusiver Weiterbildungen abgeleitet werden können.
Das Index-Team überarbeitet das bisherige Weiterbildungsprogramm in einigen inhaltlich konzentrierten Treffen. Es entscheidet, in welchem Umfang die bisherige Struktur verändert werden soll und arbeitet die Prioritäten in Übereinkunft mit allen Beteiligten in das Weiterbildungsprogramm ein (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 41; vgl. HINZ 2005, S.59f.).
Hier werden die Prioritäten in der Praxis umgesetzt. Es können weitere Untersuchungen in der Praxis erforderlich sein. Sie können den Charakter der Handlungsforschung[4] annehmen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 43). „Die Entwicklungsschritte werden durch Zusammenarbeit, gute Kommunikation und das allgemeine Engagement für inklusive Werte unterstützt und entsprechend den Kriterien im [Weiterbildungsprogramm, d.V.] beobachtet und eingeschätzt, der Fortschritt wird dokumentiert. Dies ist eine fortlaufende Phase“ (ebd., S. 43).
-
Entwicklungen nachhaltig gestalten
In der Umsetzungsphase kann es zu gewaltigen Herausforderungen und Widerständen kommen. Daher ist es notwendig, das Engagement aller Beteiligten während dieses Prozesses hindurch aufrecht zu erhalten. Während der Umsetzung der Prioritäten in die Struktur der Weiterbildung sollte die umfassende Arbeit nicht vergessen werden (vgl. ebd., S. 44). „Das Wachsen einer inklusiven Kultur braucht sicher mehrere Jahre; gleichzeitig kann es sich nur über das dauerhafte Engagement aller Beteiligten für kleine, konkrete Veränderungen in Strukturen und Praktiken der [Weiterbildung; d.V.] vollziehen“ (ebd., S. 44). Kommt es unter den Teilnehmern, den Referenten, der Evaluationsgruppe und weiteren Beteiligten zu unterschiedlichen Ansichten, könnte dies als Weg zur Verbesserung von Entwicklung angesehen werden.
Die Steuerungsgruppe ist für die Informationsweitergabe bezüglich der Veränderungen in Form von Versammlungen, Beratungen, Treffen, Rundschreiben, Tutorenstunden, Willkommenssitzungen, Aushängen u.v.m. verantwortlich (vgl. ebd., S. 44).
Im Rückblick auf den Gesamtprozess der Entwicklung werden von der Steuerungsgruppe die Fortschritte bei der Veränderung von Kulturen, Strukturen und Praktiken reflektiert und nötige Modifikationen diskutiert. Neue Prioritäten für das Weiterbildungsprogramm der kommenden Jahre werden formuliert (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 46).
-
Entwicklungen evaluieren
Die Ergebnisse aus Phase 4 sollten gemeinsam zusammengetragen und eingeschätzt werden. Veränderungen werden positiv betrachtet und neu auftretende Fragen diskutiert. Weitere Überlegungen für Folgejahre stehen an (vgl. ebd., S. 46).
-
Die Arbeit mit dem Index reflektieren
„Auch der Index-Prozess selbst erfordert Evaluation“ (ebd., S. 46). Die Art der Anwendung wird reflektiert und es findet eine Entscheidung über den Gebrauch der bestmöglichen Nutzung von Materialien für die Folgejahre statt. Es wird reflektiert, inwieweit die Arbeit mit dem Index ein stärkeres Engagement für inklusive Arbeitsweisen hervorgerufen hat. Die Steuerungsgruppe hinterfragt die Zusammensetzung des Index-Teams und beurteilt dabei verschiedene Aspekte, z. B. Vorbereitung auf Aufgaben, Zusammenarbeit mit andere Gruppen, Tragfähigkeit der gemeinsamen Verantwortung.
Der am Anfang erwähnte ‚fremde Blick‘‚ des ‚kritischen Freundes‘ kann an dieser Stelle sehr wertvoll sein. Dabei geht es um die kritische Reflexion der Praxis.
-
Den Index-Prozess weiterführen
Die Steuerungsgruppe hat die Aufgabe zu überprüfen, wie die Arbeit mit dem Index koordiniert wird. „Die nochmalige Betrachtung der Indikatoren und Fragen als Teil der Reflexion der Fortschritte könnte zu weiteren Analysen führen – Phase 5 geht über in die Phase 2 und mündet in die Weiterführung des Planungszirkels […]“ (ebd., S. 47).
In meinen Augen ist es unerlässlich mit dem Index für Inklusion auf diese Art und Weise zu arbeiten, wenn man eine Weiterbildung inklusiv gestalten will. Das Durchlaufen des Index-Prozesses mit seinen einzelnen Phasen und die erneute Reflexion und der Neubeginn verdeutlichen die Prozesshaftigkeit. Nur durch die kontinuierliche Reflexion und Überarbeitung kann man dem Anspruch von Inklusivität näher kommen.
Das Kreative Feld wird im Rahmen dieser Arbeit als Evaluationshilfe der empirischen Daten genutzt. Zunächst folgen eine Begriffsbestimmung sowie die wesentlichen Kennzeichen von Kreativen Feldern. Im Anschluss wird die Arbeitsweise, modifiziert auf meine empirische Analyse, erläutert.
„Das „Kreative Feld“ zeichnet sich durch den Zusammenschluss von Persönlichkeiten mit stark unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten aus, die eine gemeinsam geteilte Vision verbindet […]“ (BUROW 2004a, S. 4).
Das Index-Team stellt in meinen Augen einen Zusammenschluss von verschiedenen Persönlichkeiten dar, die die Vision einer inklusiven Bildungslandschaft teilen. In einem wechselseitigen Lernprozess versuchen sie ihr kreatives Potenzial gegenseitig hervorzulocken, auszubauen und zu entfalten (vgl. ebd., S. 4).
Kreative Felder – also das Index-Team sind/ist:
-
„durch eine dialogische Beziehungsstruktur (Dialog),
-
durch ein gemeinsames Interesse (Produktorientierung bzw. gemeinsame Vision),
-
durch eine Vielfalt unterschiedlicher Fähigkeitsprofile (Vielfalt und Personenzentrierung),
-
durch eine Konzentration auf die Entfaltung der gemeinsamen Kreativität (Synergieprozess),
-
durch eine gleichberechtigte Teilhabe ohne Bevormundung durch „Experten“ (Partizipation)
-
sowie durch ein kreativitätsförderndes soziales und ökologisches Umfeld (Nachhaltigkeit) charakterisiert“ (BUROW/HINZ 2005, S. 49f.).
Um kreatives Potenzial freizusetzen, erfordert es:
-
‚Kristallisationskerne‘
-
‚Die richtige Mischung‘
-
‚Das Jazzbandmodell der Führung‘ (BUROW 2000).
Die besondere Zusammensetzung von Teams ist entscheidend für den Erfolg. Es bedarf laut BUROW (2000; 2002) einen besonders befähigten Anführer, der es versteht, die Gruppe auf eine faszinierende, außergewöhnliche Art, auf eine signifikante Vision einzuschwören. Er begeistert die Menschen zur Zusammenarbeit. Solch eine Person nennt BUROW (2000) „Kristallisationskern im Feld“: „Er wirkt wie ein Magnet und zieht Synergiepartner mit unterschiedlichen Fähigkeiten an, die gemeinsam ein Kreatives Feld bilden. Erst das Zusammentreffen der unterschiedlichen Fähigkeiten läßt etwas Neues entstehen. Es kommt auf die Mischung an!“ (ebd. 2000)
Es ist zu beachten, dass der Anführer nur phasenweise führt, denn „[…] im Sinne aufgabenbezogener Führungsrotation, können – je nach den geforderten Fähigkeiten – einzelne Mitglieder zeitweise die Führung übernehmen“ (BUROW 2000; 2002).
BUROW (2000; 2002; 2004a; 2004b; 2005) benutzt häufig die Metapher einer funktionierenden Jazzband als ein Kreatives Feld. In einer Jazzband sind verschiedene spezialisierte Musiker, die zu einem selbst gewählten Thema improvisieren – sie treten zurück, stützen den Partner, wenn er improvisiert, übernehmen einen Augenblick später selber die Führung. Jeder kann seine Fähigkeiten nach seinen Bedürfnissen einbringen, gemeinsam wird ein Stück geschaffen, das die Synergie der Beteiligten widerspiegelt (vgl. BUROW 2004a, S. 4). Das Index-Team ist ebenso ein Kreatives Feld, in dem jeder seine Fähigkeiten, Ideen und Vorschläge einbringt. Es kommen verschiedene Menschen zusammen, die die gesamte Heterogenität einer Schule, Weiterbildung oder Gemeinde abbilden.
BUROW (2000; 2002; 2005) erkennt, dass sich die schöpferischen Spitzenleistungen nicht aus der besonderen Begabung von Einzelpersonen begründen lassen, sondern fast immer das Ergebnis eines Zusammenwirkens von unterschiedlichen Personen sind. Daher geht er davon aus, dass es keine Spitzenleistungen ohne ein Synergiefeld gibt, denn hinter jeder Spitzenleistung steht ein Unterstützerfeld – „Kreativität gibt es nur im Plural“ (BUROW 2002; 2004b; 2005; 2007). Aus diesem Grund fordert er die „Befreiung aus der Individualisierungsfalle“ (BUROW 2000).
„Kreative Felder entstehen, wenn jeder darin unterstützt wird, sein individuelles Talent zu entwickeln und es ihm ermöglicht wird, passende Synergiepartner zu finden“ (BUROW 2008). Sie bilden sich, indem die Schwächen einer Person als Andockpunkte für einen anderen Partner dienen, der über die nötige Kompetenz verfügt. Erst in der Kombination voneinander kann das ganze Potenzial entfaltet werden, denn gerade die jeweiligen Defizite sind „Andockpunkte für passende Synergiepartner“ (BUROW 2000).
Zukunftswerkstätten oder Zukunftskonferenzen bieten sich an, um z. B. aus dem Arbeitsplatz ein Kreatives Feld zu machen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass negative Glaubenssysteme wie ‚es hat doch eh keinen Sinn‘ zu überwinden sind und befriedigende Aspekte der Arbeitssituation herausgesucht werden (vgl. BUROW 1998). Es geht zunächst um das Herausfinden von unbefriedigenden Situationen, die dann konstruktiv genutzt werden. Dabei reflektiert man den Arbeitsalltag kritisch. Es wird hinterfragt: ‚Was stört mich?‘ ‚Woran genau kann das liegen?‘ Anschließend erstellt man einen Entwurf der persönlichen Vision – eine Vision für das Leitbild eines befriedigenden Arbeitsplatzes. Dabei werden drei Ebenen in den Blick genommen:
-
Die individuelle Ebene,
-
die Ebene der Kollegen und
-
die Ebene der Rahmenbedingungen.
Anschließend erstellt man einen konkreten Umsetzungsplan, indem zeitliche Strukturen und die Mobilisierung von Unterstützung festgehalten werden (vgl. BUROW 2004a, S. 5; 2005). Auch im Team bietet sich solch eine kritische Reflexion an.
Die vorliegende Arbeit betrachtet mit der Theorie des Kreativen Feldes die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘. Hierbei wird mit Hilfe der erhobenen Daten die Weiterbildungssituation auf die drei Dimensionen Kulturen, Strukturen und Praktiken kritisch reflektiert. Dabei werden positive und bereits vorhandene Elemente, die eine inklusive Weiterbildung benötigt, bedacht (Abb. 14). Die Vision für das Leitbild einer inklusiven Weiterbildung entsteht und mit Hilfe der zweiten Phase des Index-Prozess wird der Versuch unternommen, ein inklusives Weiterbildungsprogramm zu entwerfen.
[4] „In der Handlungsforschung sind jene Menschen und Menschengruppen, welche von den Wissenschaftlern untersucht werden, nicht mehr bloße Informationsquelle des Forschers, sondern Individuen, mit denen sich der Forscher gemeinsam auf den Weg der Erkenntnis zu machen versucht“ (LEWIN, zit. n. STANGL o.J.).
Inhaltsverzeichnis
Im Folgenden werden die Ergebnisse, die im Kreativen Feld zusammengetragen wurden, mit Hilfe der einzelnen Indikatoren der Dimensionen und den dazugehörigen Fragen des Index betrachtet (Abb. 15–21). Obwohl er für Schulen entwickelt wurde, kann er als brauchbares Instrument genutzt werden, um inklusive Elemente für andere Bildungsbereiche zu beleuchten.
Die Indikatoren benennen Zielsetzungen, welche mit der bestehenden Situation verglichen werden. Daraus werden anschließend Prioritäten für weitere Entwicklungen abgeleitet. Durch die einzelnen Fragen wird die Bedeutung jedes Indikators verdeutlicht. Sie laden dazu ein, den Indikator facettenreich und detailgetreu zu erkunden. Weiterhin fordern sie zum Nachdenken über einen bestimmten Indikator heraus. So schärfen die Fragen die Wahrnehmung der Situation, geben weitere Ideen für Entwicklungsaktivitäten und dienen als Kriterien für die Bewertung des Fortschritts. Der Index ist so aufgebaut, dass er vorsieht, eigene Fragen angepasst auf die jeweilige Situation der Weiterbildung mit einzubeziehen. Dadurch entsteht eine eigene Version des Index, indem er an die individuelle Situation und Bedarfe angepasst wird und bestehende Fragen verändert und eigene hinzufügt werden (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S.16). „Mit Dimensionen, Indikatoren und Fragen ergibt sich ein systematisches Raster von Aspekten, die eine zunehmend detaillierte Karte der [Weiterbildung, d.V.] ergeben und Ansatzpunkte für die Entwicklung nächster Schritte anbieten kann“ (BOBAN/HINZ 2003b, S. 44f.).
„Jede Dimension ist in zwei Bereiche geteilt, um die Aufmerksamkeit auf die Komplexität der Aktivitäten zu lenken, mit denen sich [die Weiterbildung, d.V.] auseinandersetzen [muss, d.V.], wenn sie Lernen und Partizipation verbessern [will, d.V.]“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 16). Die Bereiche stellen einen Analyserahmen dar, in welchem der Planungsprozess für die Weiterbildungsentwicklung strukturiert werden kann. Sie dienen als Überschriften und Strukturierungshilfe zur Beleuchtung der momentanen Situation (vgl. ebd., S. 16).
Ich beschäftige mich mit einzelnen ausgewählten Indikatoren und deren Fragen. Im Anschluss leite ich pro Dimension Prioritäten für die Umsetzung von Inklusion ab. Mit einer Zusammenfassung schließt das Kapitel.
Die Dimension A beinhaltet die Schaffung einer wertschätzenden und respektierenden Gemeinschaft. Inklusive Werte sollen an alle anderen Beteiligten vermittelt werden. Sie sind maßgebend für alle Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 15).
In Anlehnung an die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a folgen hier einige Indikatoren aus dem Bereich ‚Gemeinschaft bilden‘.
Heißt die Weiterbildung alle Menschen willkommen, z. B. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus, Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten?
Die Teilnehmerzusammensetzung im ersten Grundkurs ist im Vergleich zu den folgenden Kursen sehr einheitlich: „Also beim ersten [Grundkurs, d.V.], finde ich, hat man eindeutig gemerkt, dass es ein Start war und dass es eine relativ homogene Gruppe war, weil viele aus der OHBH kamen. […] Die zweite Gruppe, […] die fand ich dufte und da habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt: Oh ja, da kommen viele verschiedene Spieler zusammen und die kriegen auch voneinander mehr mit […]“ (Interview 1).
Die Teilnehmerzusammensetzung erweitert sich im Verlauf des Projekts zunehmend. Trotzdem wird sie von den Teilnehmern und Referenten unterschiedlich bewertet. Die Heterogenität spiegelt sich in Bezug auf Alter, Berufserfahrung, Geschlecht, sexueller Orientierung, institutioneller Hintergründe, Essverhalten, neue und alte Bundesländer, Nationalitäten, psychische und körperlicher Konstitution, Beeinträchtigung wider. Aber aus den Umfragen geht hervor, dass zu wenig Teilnehmer mit Beeinträchtigung anwesend sind. Die Lebensfelder Schule, Eltern, gesetzliche Betreuer und die Politik sind nicht besetzt. Es ist deshalb notwendig weitere Personengruppen zu involvieren. Die nicht beeinträchtigte Zielgruppe steht im engen Zusammenhang zur Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung oder ausgegrenzten Personengruppen (Sozialpädagogische Arbeitsbegleitung, JobA GmbH, integra gGmbH, mixed pickles e.V. und careNetz service). Dadurch ist der Adressatenkreis im Bezug auf das Arbeitsfeld homogen. Die Mischung wird von vielen Teilnehmern und Referenten als positiv bewertet. Dennoch ist ein Mangel an Vielfalt in der Teilnehmerzusammensetzung erkennbar.
Die Zusammensetzung des dritten Grundkurses auf Grund eines definierten Schlüssels lässt vermuten, dass nicht alle Bewerber angenommen werden konnten (siehe Kapitel 3.2). Die Weiterbildung ist zugangsvoraussetzungsfrei, sodass keine potenziellen Teilnehmer ausgewählt werden. Sie wird mehrmalig durchgeführt, dadurch besteht die Möglichkeit, zu einem anderen Zeitpunkt am Kurs teilzunehmen. In anderen Regionen werden Kurse mit gleicher oder ähnlicher Thematik angeboten[5], auf die verwiesen werden kann.
Ferner besteht die Möglichkeit, dass alle Interessierten teilnehmen können, wenn es die Rahmenbedingungen wie Räumlichkeiten oder Materialverfügung gestatten und die Referenten sich dem gewachsen fühlen. Dann sind auch Kurse mit einer höheren Anzahl von Teilnehmern möglich. Eine Referentin berichtet von einer positiven Erfahrung der ‚Summer University‘, wo inklusive Lehrgänge mit 70 bis 80 Personen stattfanden.
Heißt die Weiterbildung weitere Interessierte willkommen?
Tageweise steht die Weiterbildung auch für weitere Interessierte offen. Ein Teilnehmer bringt meist an den Samstagen seine Lebensgefährtin mit, die sich sowohl bei Gesprächen und Übungen eingliedert als auch anderen weiterbildungsunabhängigen Tätigkeiten nachgeht. Dies wird vom Umfeld in einigen Situationen als störend empfunden, weil ihre Aussagen nicht im Zusammenhang mit dem besprochenen Thema stehen. Die Gemeinschaft geht mit der Situation tolerant um. Eine Referentin merkt kritisch an, „[…] dass diese Frau durchaus ein Störpotenzial darstellt. Das muss man einfach kritisch sagen, weil sie halt unpassende Dinge einbringt und so, und damit muss die Gruppe umgehen. Alle gehen damit ausgesprochen tolerant um, aber das bedeutet nicht, dass es willkommen ist“ (Interview 2). Auch andere Besucher (Familienmitglieder, Ehepartner, Kinder) sind bei der Weiterbildung akzeptiert und bei nachfolgenden Aktivitäten herzlich eingeladen (gemeinsames Abendbrot, Strandbesuch, gemeinsames Fußball schauen).
Ist die Tür zu solchen Kursen ständig und für alle geöffnet, kann womöglich eine Unruhe hinein getragen werden. Immerhin gilt es, den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Wird durch eine zu große Gastfreundlichkeit die Struktur beeinträchtigt, könnte man alternativ die Interessierten zum Fachtag oder zum nächsten Kurs als Teilnehmer einladen.
Sind Informationen über die Weiterbildung für alle zugänglich und verständlich, z. B. in verschiedenen Sprachen bzw. in einfacher Sprache, in Braille, in Audioformat, in Großdruck?
Informationen zur Weiterbildung gibt es in Form eines Flyers, der gleichzeitig als Anmeldeformular dient (Abb. 22). Er enthält Informationen zu Persönlicher Zukunftsplanung, der Struktur, dem Aufbau und den Inhalten der Weiterbildung.
Den Flyer gibt es in einfacher Sprache (Abb. 23), aber nicht in anderen Sprachen, Audioformat oder Brailleschrift. Die meisten Teilnehmer mit Beeinträchtigung werden von anderen auf die Weiterbildung hingewiesen und kommen mit ihnen. Der Verweis, dass es möglich ist, sich zu zweit anzumelden, wird teilweise von Menschen mit Beeinträchtigung wahrgenommen. Auch ein Feld zur Beantragung von Unterstützung ist vorhanden.
Weil die Zugänglichkeit von Informationen über verschiedene Wege (Audio, Braille, andere Sprache) ein wesentlicher Indikator des willkommen heißen ist, bietet sich die Möglichkeit an, dass Studenten, Schüler, freiwillige Helfer oder Grafikunternehmen diese Aufgabe übernehmen können. Die in schriftlicher Form vorliegenden Informationen können so für alle aufgearbeitet werden.
Die Internetplattform ‚moodle‘ stellt weitere Informationen, Möglichkeiten der Vernetzung und Materialrecherche zur Verfügung. Der Zugang wird im Verlauf des Seminars beispielhaft erklärt und eine schriftliche Anleitung ausgegeben (Abb. 24). Dennoch ist vielen dieser Weg nicht zugänglich, da manche keinen Internetanschluss oder Computer besitzen. Auch die Orientierung im Internet fällt einigen nicht leicht, wiederum andere sind von dem Medium überfordert und wollen mit ihm nicht in Berührung kommen. Eine Teilnehmerin äußert, dass sie „findet […], dass es generell zu wenig genutzt wurde. […] Ich finde es auch nicht sehr benutzerfreundlich gemacht. Und dann haben einige in der Gruppe keinen Computer oder gucken nur einmal im Monat rein“ (Interview 3). Andere Nutzer der Plattform finden sie gut und hilfreich, stellen dennoch „[…] aus der Perspektive von anderen Teilnehmern [fest, dass sie d.V.] anders erlebt worden [ist, d.V]. Also ich denke mal, dass ein Mensch mit Beeinträchtigung natürlich nicht ohne Unterstützung das nutzen kann. Je nachdem wie die Beeinträchtigung ist, und ich weiß auch nicht, wie die Unterstützung dafür ausgesehen hat aber es gab auch, in Anführungsstrichen, Professionelle, die ihre Schwierigkeiten hatten und die nicht immer nur durch Zeitmangel oder sonst welche Probleme gebündelt waren“ (Interview 4). Ein Referent bietet bereits Alternativvorschläge zum Internet an, setzt sie jedoch nicht um: „Es war natürlich für mich einfach, Sachen über E-Mail weiter zu geben, aber im Grunde genommen stößt E-Mail an Grenzen, weil einige keinen Zugang haben. Wir hätten das im Grunde besser organisieren müssen – den Postdienst, wo alles, was in ‚moodle‘ ist, automatisch von Herrn S. oder jemand anderen eingetütet wird und den Leuten noch mal per Post zugeschickt [wird, d.V.]“ (Interview 5).
Um den Ausschluss anderer Teilnehmer zu vermeiden, bedarf es weiterer Systeme. Es könnte beispielsweise ein Ablagesystems für Teilnehmer ohne Internet eingerichtet werden. In ihm finden sich dieselben Dokumente, wie im Internet. Sie liegen zugriffsbereit am Weiterbildungsort vor. Die Informationen können auch über einen Postkurier an die Menschen übermittelt werden. Diese Aufgabe könnte ein Arbeitsuchender am Weiterbildungsort übernehmen. Das gesamte Material müsste in verschiedenen Formen (Audio, bildlich unterlegt, leichte Sprache, Braille usw.) für alle Teilnehmer aufgearbeitet werden.
Weitere, auf die individuelle Situation der Weiterbildung bezogene Fragen sind:
Gibt die Weiterbildung jedem das Gefühl, genau zum richtigen Zeitpunkt, genau am richtigen Ort, richtig zu sein? Diese Frage könnte man im Evaluationsbogen aufgreifen.
Die Frage nach der Atmosphäre im Kurs war den Referenten, Teilnehmern und der Evaluationsgruppe immer wichtig:
Ist die Atmosphäre in der Weiterbildung herzlich und respektvoll?
Die Gesamtauswertungen aller vier Kurse zeigen, dass sie in einer wertschätzenden Atmosphäre stattfinden. Die Grundhaltung, die ‚Vielfalt willkommen zu heißen‘, ist dominierend und verändert die Kurse positiv. Das belegt eine Vielzahl von Antworten aus den Umfragen. Die Gruppenatmosphäre wird in den meisten Evaluationsbögen als sehr positiv bewertet. Sie bereichert die Weiterbildung und ist wichtige Grundlage des Zusammenarbeitens und des Lernens. „Ein herzlicher Umgang, Freude die anderen wiederzusehen, Mut zu jeglicher Frage und gemeinsame Unternehmungen sind wichtige Bausteine auf der sozialen Ebene, die eine Weiterbildung als gelungen erleben lassen“ (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 48). Sowohl die Referenten als auch die Teilnehmer sind dieser Meinung.
In einer Umfrage wird bemerkt, dass in manchen sozialen Situationen eine Distanz zu Menschen mit Beeinträchtigung besteht. Dazu eine Referentin: „Ich denke, dass nach wie vor auch J. nicht wirklich eine echte Verbindung hat, die positiv geprägt ist in dieser Gruppe. Das ist mein Eindruck. Er wird in friedlicher Koexistenz sozusagen geduldet, aber ich kann nicht erkennen, dass Menschen wirklich aktiv auf ihn zugehen“ (Interview 6). Ein anderer Referent meint dazu: „Ich bin mir auch sicher, dass es die Gruppendynamik beeinflusst. Vielleicht in manchen Dingen auch problematisch beeinflusst. Ich denke mal grundsätzlich, es schafft eine Kultur“ (Interview 7).
Bieten die Teilnehmer untereinander Hilfe an und helfen sie sich gegenseitig?
In einer verständnisvollen Atmosphäre fällt es den Teilnehmern nicht schwer, andere um Hilfe zu bitten. Geht es um organisatorische Fragen, wie Stift oder Papier ausleihen, wird meistens Hilfe geleistet. Auch zwischenmenschliche Wünsche werden erfüllt, z. B. das Mitnehmen zum Bahnhof, Übernachtungsangebote oder die Übernahme der Moderation einer Planung. Den Teilnehmern mit Beeinträchtigung fällt es häufig schwerer nach Hilfe zu fragen. Ansprechpartner sind meist ihre ständige Begleitperson.
Präsentiert die Weiterbildung die Ergebnisse aus Gruppenarbeiten sowie individuelle Leistungen von allen?
Ergebnisse aus Gruppen- oder Einzelarbeiten werden stets präsentiert und wertgeschätzt. Diese Präsentation ist immer freiwillig, dennoch haben manche Teilnehmer die Befürchtung, dass ihre Situationen oder privaten Träume öffentlich werden. Gerade diese individuellen Themen bedürfen einer sensiblen Herangehensweise.
Ein Leistungsvergleich innerhalb der Weiterbildung findet eher selten statt, da die Aufgaben individuellen Charakter haben. Jede Lösung wird anerkannt, ob man bei der Erstellung des eignen Profils mit viel Farbe und detailgetreu arbeitet oder eher weniger detailliert (Abb. 25/26).
Bei den Portfolios kommt es zum Leistungsvergleich untereinander. Im Vordergrund steht die Anzahl von Seiten und nicht der Inhalt. Die Referenten versuchen den Druck herauszunehmen, indem nicht das Äußerliche im Vordergrund steht und sie Abgabetermine verlängern.
Die Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Erfüllung der Aufgaben wird nicht bewertet. Nicht fertig gestellte Aufgaben werden nicht kritisiert. In anschließenden Open-Space-Phasen gibt es die Möglichkeit, sich Zeit zur Weiterführung der Arbeiten zu nehmen.
Meiden die Teilnehmer und Referenten rassistische, sexistische, homophobe, behinderungsspezifische und andere Formen diskriminierenden Hänselns?
Diskriminierende Äußerungen werden vermieden. Niemand wird wegen des Dialekts, der Aussprache oder der Herkunft negativ konnotiert. Dennoch kommt es häufiger zu Diskussionen in Bezug auf ‚frauendiskriminierende‘ Äußerungen, weil meist nur die männliche Form (der Referent, der Teilnehmer, der Vegetarier, der Moderator) in der gesprochenen und geschriebenen Sprache verwendet wird. Manche Teilnehmer fühlen sich dadurch verletzt und sprechen diese Problematik in fast jedem Evaluationsbogen an. Diese Diskriminierung ist sicherlich keine Absicht, dennoch sollte auf die Aussagen in den Evaluationsbögen sensibel reagiert werden. Eine Referentin vermerkt im Zusammenhang mit der Inklusionsfrage diesen Aspekt: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass sexuelle Orientierung, also dass es lesbische Personen gegeben hat in diesem Kontext, […] und es wäre spannend, ob die sich zum Teil durch bestimmte Darstellungen diskriminiert fühlten oder ob man mehr noch eine höhere Sensibilität […] vom Gendern her [benötigt, d.V.]. Das wär sehr spannend, das weiß ich nicht genau, da hab ich keine Antenne momentan“ (Interview 8). Anscheinend hat die Referentin die richtige „Antenne“, denn es stellt für einige ein großes Problem dar.
Die Debatte um gegenderte Sprache ist derzeit aktuell. Sprachforscher hingegen empfinden die Doppelnennung der Geschlechter als schwerwiegenden Eingriff in die Sprache. Denn „[…] die Forderung nach einer konsequenten Doppelnennung menschlicher Funktionsträger [beruht, d.V.] auf einem fundamentalen sprachwissenschaftlichen Irrtum. Die Fehlüberlegung besteht in der Gleichsetzung von biologischer Geschlechtlichkeit und grammatikalischem Genus. Diese Gleichsetzung ist allerdings unstatthaft, denn es gibt drei Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum) aber nur zwei Geschlechter“ (BRÜHLMEIER 2009). Auch wird allem Ungeschlechtlichen (der Herd, die Terrasse, das Auto) ein Genus beigeordnet, was erneut zeigt, dass biologisches Geschlecht und grammatikalisches Genus keineswegs gleichgesetzt werden dürfen. In diesem Zusammenhang wird das Geschlecht übergeschlechtlich (als Androgynem) verwendet. Insbesondere sämtliche Funktionen, die praktisch von allen Verben abgeleitet werden können und auf -er enden, sind trotz des maskulinen Genus nicht biologisch männlich, sondern androgyn zu verstehen. Zum Beispiel ist ein Mensch, der redet, ein Redner (vgl. ebd.). Demzufolge wird „die Forderung nach konsequenter Doppelnennung menschlicher Funktionsträger […] gegenstandslos, wenn man die zusätzliche übergeschlechtliche (androgyne) Funktion aller drei Genera erkennt“ (ebd.).
Sprechen die Referenten alle Teilnehmer respektvoll an, nennen sie sich bei dem Namen, mit dem sie gerufen werden wollen, mit der richtigen Aussprache?
Die Sprache, der Umgang und die Gesten aller sind stets respektvoll besetzt. Durch die Anrede mit dem Vornamen gibt es kein Machtgefälle zwischen Referent und Teilnehmer. Dem Prinzip der erwachsengemäßen Ansprache aller Teilnehmer folgt die Weiterbildung gänzlich (vgl. THEUNISSEN 2003, S. 65; THEUNISSEN 2009, S. 333).
Dennoch kommt es im Verlauf der Weiterbildung zu Rollenkonflikten zwischen Angestellten und deren Vorgesetzten, da man sich in diesem Kreise der Weiterbildung duzt, was aber im Arbeitskontext Probleme hervorrufen kann. Individuelle Lösungen unter den Teilnehmern wurden dafür gefunden. Dieses Beispiel zeigt die Problematik von hierarchischen Strukturen in unserer Gesellschaft auf.
Werden Meinungen von Teilnehmern zur Weiterentwicklung eingeholt und wirken sich die Ansichten der Teilnehmer darauf aus, was in der Weiterbildung passiert?
Die Meinungen der Teilnehmer werden mit Hilfe der Evaluationsbögen eingeholt. Auch die Portfolios dienen dazu. Dies spiegelt die Broschüre mit der Gesamtevaluation des Projekts wider. Aber die Meinungen, Erkenntnisse und Ideen der Teilnehmer werden wenig umgesetzt. Die Auswertungsbögen beinhalteten nach jedem Modul Kritikpunkte in Bezug auf:
-
zu viel PowerPoint,
-
zu viel Theorie,
-
zu wenig Eigenaktivität und
-
zu wenig einfache Sprache.
Diesen Punkten wird im Verlauf der Weiterbildung wenig Beachtung geschenkt – sie werden kaum verbessert. Umfragen ergeben, dass die Organisation der einzelnen Module von den jeweiligen hinzukommenden Referenten und deren Inhalte abhängig sind. Nur durch punktuelles Auftreten sind Veränderungen kaum zu beurteilen.
Meiner Meinung nach ist es nicht hilfreich, sich Meinungen der Teilnehmer einzuholen und dann nur für (alle) auf ‚moodle‘ zu veröffentlichen aber nicht umzusetzen. Nicht alle haben die Möglichkeit sich damit auseinanderzusetzen. In den folgenden Kursen wäre es gut sich immer über die Auswertungen zu unterhalten. Es gibt zwar immer Feedback-Runden, in denen jedoch nur Positives zum jeweiligen Modul genannt wird. Negative Aspekte werden stets in der schriftlichen Form abgegeben und nie mündlich thematisiert. KALLENBACH (2001, S. 34) äußert, dass sich solche Plenumssituationen zur Reflexion weniger eignen, da durch den persönlichen Charakter der Lernäußerungen diese meist nur an der Oberfläche bleiben. Besser wären hier nicht nur mündliche, sondern auch eine anonyme schriftliche Feedback-Runde, deren Ergebnisse anschließend im Plenum besprochen werden. Für die Abschlussrunden ist meist so wenig Zeit eingeplant, dass auf Gesagtes kaum noch reagiert werden kann. Es wäre wichtig für diese Runden ausreichend Zeit einzuplanen.
Um eine inklusive Gemeinschaft zu bilden, bedarf es einer Kultur der Vertrautheit untereinander. Sich akzeptiert und angenommen zu fühlen, ist ein wesentliches Element. Bei der inklusiven Weiterbildung in Eutin ist zu bemerken, dass die ‚Inklusive Kultur‘ bereits in großen Ansätzen geschaffen ist. Die Weiterbildung versucht alle Heterogenitätsdimensionen abzubilden und auch der Umgang untereinander zeugt von Respekt und Toleranz. Die Atmosphäre ist sehr gut, sodass ein gemeinsames Lernen möglich ist. Dennoch sind einzelne Punkte neu und kritisch zu hinterfragen.
Aus den gesammelten Informationen leite ich die Prioritäten unter den kritischen Aspekten ab. Laut dem Kreativen Feld interpretiere ich negative Punkte als Andockpunkte für Verbesserungen im Sinne von Synergiepartnern (vgl. BUROW 2000). Darum stelle ich negative Aspekte der Weiterbildung heraus, ohne sie dadurch abwerten zu wollen. Mit den negativen Punkten kann man konstruktiv umgehen.
Es ist ganz wesentlich, bei weiteren Weiterbildungen die Informationen für alle zugänglich zu machen. Eine weitere Priorität betrifft die Umsetzung der angesprochenen Kritikpunkte von Teilnehmern. Die Meinungen der Teilnehmer sollten nicht nur eingeholt werden, sondern auch eine Reaktion hervorrufen.
Die Prioritäten des Bereichs ‚Gemeinschaft bilden‘ lauten:
-
Informationen über die Weiterbildung sind allen Beteiligten zugänglich.
-
Auf Anmerkungen der Teilnehmer wird reagiert.
Diese Prioritäten stellen nur einen Auszug dar, da Inklusivität ein Prozess ist, der Stück für Stück stattfindet. So arbeitet man immer wieder an neuen Punkten. Nach dem Durchlauf des ersten Grundkurses würde die Priorität vielleicht darin bestehen, alle Heterogenitätsdimensionen abzubilden. Dies ist jedoch im Verlauf der Weiterbildung schon geschehen, deswegen entstehen neue Prioritäten, an denen noch zu arbeiten ist.
Diese Prioritäten würden nun durch das Index-Team in die Weiterbildungsstrukturen eingearbeitet werden. Anstatt ein inklusives Weiterbildungsprogramm für Eutin zu erarbeiten, fasse ich am Ende meiner Arbeit Elemente zusammen, die eine inklusive Weiterbildung ausmachen können.
In Anlehnung an die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a werden hier einige Indikatoren aus dem Bereich ‚Inklusive Werte verankern‘ aufgezeigt.
Werden alle Teilnehmer so behandelt, als ob es keine obere Leistungsgrenze für sie gäbe?
Die oberste Leistungsgrenze wird allen Teilnehmern durch die Vergabe von drei unterschiedlichen Zertifikaten mit unterschiedlichen Anforderungen verdeutlicht (siehe Kapitel 3.2). Die höchste Anforderung erfüllt man, wenn man das Multiplikatoren-Zertifikat erwerben möchte. Dazu absolviert man zwei Wochenendkurse in Prag und Bratislava mit einer englischen Referentin ohne Übersetzung.
Das Portfolio stellt eine weitere Leistungsgrenze dar. In ihm spiegelt sich eine Vielzahl gemachter Erfahrungen wider und auch die Weiterbildung wird darin reflektiert. Durch die dreifache Abstufung der Zertifikate werden verschiedene Leistungsgrenzen aufgemacht. Allerdings besteht eine Freiwilligkeit in Erfüllung der Aufgaben.
Geht man auf Versagensängste von Teilnehmern entlastend und unterstützend ein?
Diese Frage ist sowohl mit ja als auch mit nein zu beantworten. Der ständige Kursbegleiter versucht den Druck für die Erstellung des Portfolios herauszunehmen. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Teile oder das gesamte Portfolio nachzureichen. Dennoch fühlen sich viele diesem Druck nicht gewachsen. Neben persönlichen Seiten, ist eine Reflexion der Weiterbildung zu erarbeiten. Ein Teilnehmer sagt offenkundig, dass ihm die Reflexion Schwierigkeiten bereitet. Hilfe wird ihm angeboten aber nicht verwirklicht. Zu einem späteren Zeitpunkt klinkt er sich häufiger am zweiten Tagen aus: „Der C. ist heute am zweiten Tag auch nicht wieder gekommen, weil er jetzt gestern sagte […] er müsste das jetzt erst mal für sich sortieren“ (Interview 9).
Ein weiterer Grund, neben dem Anforderungscharakter, könnte ein Verständnisproblem sein. Viele Personen, vor allem Menschen mit Beeinträchtigung, wissen nicht, um was es sich bei einem Portfolio handelt. Es wird versucht, den Begriff mündlich und schriftlich in einfacher Sprache zu erklären, dennoch ist nicht allen deutlich geworden, was sich hinter Reflexionsprozessen verbirgt (Abb. 27). Meines Erachtens ist kein Teilnehmer mit Beeinträchtigung allein der Aufgabe gewachsen, dieses Portfolio zu erstellen – hier bedarf es mehr Unterstützung. Auch andere Teilnehmer fühlen sich mit der Erfüllung überfordert. Zahlreiche empfinden es als eine enorme Belastung neben Familie und Beruf. In vielen Auswertungsbögen wird die Angst geäußert, dem Druck nicht standhalten zu können.
Solche Anforderungsprofile, neben der beruflichen Anforderung, Menschen zu stellen, gestaltet sich häufig schwierig. Individuelle Gestaltung und Abgabetermine können helfen, den Teilnehmern Alternativen anzubieten. THEUNISSEN (2003, S. 76) merkt an, dass „Erwachsene […] vor allem dann erfolgreich [lernen, d.V.], wenn sie Leistungen nicht unter Zeitdruck erbringen müssen. Ebenso ungünstig wie der Faktor Zeitdruck sind prüfungs- oder testzentrierte Lernbedingungen, unter denen sich Betroffene nicht selten verspannt erleben und Versagensängste entwickeln. Affektive Erregungen oder Stresssituationen sollten vermieden werden. Unter einem sozial positiven Klima der personalen Wertschätzung, Ermutigung und des Vertrauens werden hingegen Aufgaben als Herausforderung angenommen, ohne dabei lernbeeinträchtigende Ängste zu verspüren.
Eine weitere, noch mit den Referenten zu klärende, Frage ist:
Werden die Erwartungen an die Teilnehmer nach einem vorgegebenen Curriculum gestellt, oder individuell auf jede Person, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten bezogen?
Wird der Aufbau einer unterstützenden Gemeinschaft als genauso wichtig angesehen wie die Steigerung der kognitiven Leistungen?
Bei der Weiterbildung stehen sowohl der Wissenserwerb als auch der Austausch und die Kommunikation im Vordergrund. Es gibt genug Zeit, miteinander in Austausch zu kommen und sich gegenseitig kennenzulernen. Die Weiterbildung dient dem Wissenszuwachs, dennoch sehen viele den Austausch als sehr wichtig an. Sie können mit Anderen Kontakt aufnehmen, die ihnen bei Projekten oder Planungen helfend zur Seite stehen. Durch eine unterstützende Gemeinschaft kommt es zum Wissenserwerb. Meist werden theoretische Informationen gegeben, die anschließend in Partner- oder Gruppenarbeiten gefestigt werden. So tritt man wieder in den Austausch und lernt die Gruppe besser kennen.
Ein Teilnehmer hat sich zwei Teilnehmer als Moderationsteam zu seiner Planung eingeladen. Dies ist ein Beispiel für die unterstützende Gemeinschaft aber auch gleichzeitig für den Wissenserwerb. „Die Kursstruktur ist so angelegt, dass genügend Raum und Zeit für Austauschprozesse vorhanden ist. Die TeilnehmerInnen treten in Interaktion und knüpfen Kontakte. Dadurch vergrößern sich ihre Netzwerke und somit auch die Potenziale für ihre Unterstützerkreise“ (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 44).
Wird Unterschiedlichkeit als anregend wertgeschätzt – und nicht Anpassung an eine einzige 'Normalität' angestrebt?
Ja, die Unterschiedlichkeit wird als anregend wertgeschätzt. Es werden immer wieder Aussagen getätigt, dass genau die Heterogenität die Atmosphäre im Kurs ausmacht und auch verändert. Die Meinungen aller sind wichtig und werden versucht vom Kurskoordinator einzuholen. Jeder ist verschieden, darum findet keine Anpassung an eine einzige ‚Normalität‘ statt. So müssen nicht alle die ganze Zeit zuhören oder mitarbeiten. Individuelle Pausen sind gestattet. Die Aufgabenstellungen müssen nicht erfüllt werden, aber es gibt auch keine Alternativangebote für die Zeit. Der Wunsch nach solchen wird häufiger in den Evaluationsbögen benannt. Die Erarbeitung eines individualisierten Curriculums halte ich dennoch für notwendig, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden.
Wird Vielfalt als reiche Ressource für die Unterstützung des Lernens angesehen – und nicht als Problem?
Bei dieser Frage bietet sich die Antwort: teils – teils an. Im Letzten Modul bekommen zwei Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, über ihre Zukunftsplanungen zu berichten. Ihr Wissen wird als Unterstützung für das Lernen von Interessierten einbezogen.
Dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen die Vielfalt der Teilnehmerzusammensetzung als herausfordernd angesehen wird. Eine Teilnehmerin weiß schon sehr viel über Persönliche Zukunftsplanung und stellt bei grundlegenden Einführungen sehr detaillierte Fragen. Aber sie klärt ihre Fragen in der Pause unter vier Augen mit dem Referenten und nicht im Plenum. Einer Referentin „[…] ist nochmal klar geworden, dass der Unterschied zum Teil sehr groß ist zwischen den Leuten, die schon sehr viel gemacht haben und viel wissen und denen vieles nicht mehr so neu ist, und anderen, die noch den roten Faden suchen“ (Interview 10). Auch der kontinuierliche Kursbegleiter stellt fest, dass „[…] durch die Fragen von U., die dann gleich sehr ins Detail gingen, dass eben das Spannungsfeld […] sehr groß ist. Auf der einen Seite, Leute wie U., die schon sehr erfahren sind und praktisch Detailfragen hatten, wo ich noch auf der Schiene war, ich muss erst mal den grundlegenden Rahmen klar kriegen. Im Nachhinein war das so ein Spannungsfeld das hinzukriegen, hätte ich vielleicht so eine Liste setzen sollen, darüber können wir auch später nochmal vertiefend drüber reden“ (Interview 11).
Ein Teilnehmer beobachtet, dass man der Vielfalt der Teilnehmer nicht im vollen Maß gerecht wird: „Es war auch so, das des Öfteren […] und das ist normal bei der Vielfältigkeit der Zusammensetzung des Kurses, dass auch andere Leute einfach da saßen und dachten ‚das kenn ich‘ und dann auch n bisschen auf Durchzug geschaltet haben. Das ging mir zwischendurch auch so. Ist aber auch normal. Wir hatten viele Leute dabei, die auf ziemlich hohem Niveau selber Fortbildungen schon lange angeboten haben. Und das Thema schon lange kannten […] Da ist das normal, dass das so ist“ (Interview 12).
Auch kommt es zum Diskussionsabbruch auf Grund des Verlassens der leichten Sprache. In leichter Sprache werden jedoch die wenigstens Vorträge gehalten. Manche Teilnehmer sind darüber nicht erfreut, dass man Diskussionen auf Grund von Verständigungsproblemen abbricht. Hier bieten sich andere Möglichkeiten an:
-
die Diskussionspunkte mit einfachen Worten oder Bildern auszudrücken.
-
Alternativangebote anbieten, nicht nur für die, die der Diskussion nicht folgen können, sondern auch für die, die sie uninteressant finden.
Viele Teilnehmer äußern in den Umfragen, bei den Grenzen inklusiver Bildung, die Gefahr, dass sie Exklusion von erfahrenden Personen hervorrufen kann. Den Bedürfnissen aller gilt es gerecht zu werden, darin sehen viele eine Herausforderung.
Wird an die Einstellungen zu den Grenzen von Inklusion offensiv herangegangen, etwa in Bezug auf Teilnehmer mit schweren Beeinträchtigungen?
Bei der Weiterbildung gibt es keine Teilnehmer mit schweren Beeinträchtigungen. In einigen Umfragen wird dieser Punkt als interessant angesprochen. Auch Menschen mit schwerer Beeinträchtigung müssen solche Angebote offen stehen. Hier bedarf es weiterer Unterstützung, offenerer Strukturen und weiterer Lernhilfen.
Beziehen Darstellungen – innerhalb und außerhalb der Weiterbildung – die Leistungen aller Teilnehmer ein?
Ja, innerhalb der Weiterbildung werden Erfahrungen von allen thematisiert. In der offenen Anfangsrunde, wie auch bei der Verabschiedung, kommen alle zu Wort. Auch bei der Präsentation der Ergebnisse wird darauf geachtet, dass alle, die es möchten, ihre Ergebnisse vorstellen können.
Auf dem landesweiten Fachtag in Lensahn werden verschiedene Subgruppen ausgewählt, die vor dem gesamten Plenum ihre Erfahrungen weitergeben (Abb. 28). Hier stehen Aussagen von Elternteilen, von Mensch mit Beeinträchtigung, von Teilnehmern, von Referenten, von Arbeitgebern, von Politikern im Vordergrund. Allen Personen kann man bei solch öffentlichen Präsentationen sicherlich nicht gerecht werden, sodass manche auf die Darstellung ihrer Ergebnisse verzichten müssen. Für sie gibt es aber u.a. die Möglichkeit, in Workshops von ihren Erfahrungen zu berichten.
Werden alle Beteiligten der Weiterbildung zugleich als Lernende und Lehrende angesehen?
Meiner Meinung nach werden die Teilnehmer in der Weiterbildung hauptsächlich als Lernende angesehen. Sie besitzen einen großen Erfahrungsschatz, aus dem sie nur kurz in den Anfangsrunden berichten. Die Leitung und Impulsgebung der Module liegt meist in den Händen der Referenten. Einigen Teilnehmern kommt es sehr verschult vor, sodass man eher die Rolle des Lernenden innehat. Es werden laut der Recherche der Evaluation mehr Erfahrungen präsentiert als ermöglicht, diese selbst zu tätigen und dann von ihnen zu berichten. Ein Teilnehmer empfindet, dass es „ein kleines Übergewicht war in Bezug auf die Erfahrungen und die Vermittlung durch die Referenten. […] Also, es gab ja immer auch Momente, in denen man selber tätig wurde, und die das Denken und den Ansatz dann selber in Erfahrung umsetzten sollten. Da gab es natürlich Möglichkeiten, aber ich würde jetzt sagen […] in Bezug auf die Gestaltung des Seminars mit einzuwirken, dass stand nicht im Vordergrund“ (Interview 13).
Alle Sichtweisen werden stets berücksichtigt und eine gemeinsame Begegnung auf Augenhöhe findet statt. Indem Menschen über ihre Planungsprozesse berichten, treten sie in die Rolle des Lehrenden – leider geschieht dies noch zu wenig. In den Umfragen häufen sich die Antworten, dass man sich mehr Präsentationen von Eigenerfahrungen wünsche.
Dennoch findet eine Auflösung der alten Denkstrukturen hin zu offeneren statt, den Menschen mit Beeinträchtigung mehr zuzutrauen. In den ersten Kursen gibt es eine Rollenzuschreibung: Menschen mit Beeinträchtigung sind meist die Teilnehmer im Kurs, die eine Zukunftsplanung machen sollten, auch wenn manchmal kaum Bedarf besteht. Das Verständnis, dass Zukunftsplanung allen Menschen zugänglich ist, entsteht erst nach und nach. Im letzten Kurs übernehmen auch Menschen mit Beeinträchtigung die Co-Moderation. Im Interview äußert sich ein Teilnehmer des ersten Grundkurses, dass die Inhalte für Menschen mit Beeinträchtigungen etwas Persönliches sei und für die Professionellen etwas Professionelles. Dieses Denken hat sich laut einer Referentin zumindest beim Aufbaukurs und laut Beobachtungen im dritten Grundkurs aufgelöst: „Indem […] Leute ja für sich auch solche Planungen gemacht haben und gemerkt haben, oh es hat was mir zu tun und ich bin hier nicht als Profi-Teilnehmer gefragt“ (Interview 14).
Werden Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe so verstanden, dass sie bei jedem (potenziell) auftreten können?
Ja, die Referenten nehmen die Teilnehmer als eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen wahr. Ihnen ist bewusst, dass Probleme beim Verstehen und Auffassen bei allen Beteiligten auftreten können.
Bei einem Wahlangebot im ersten Modul gibt es die Möglichkeit, einer PowerPoint-Präsentation zu folgen oder den Weg von Persönlicher Zukunftsplanung sinnlich mit Hilfe von Playmobilfiguren darzustellen (Abb. 29). Die Gruppen werden nicht von den Referenten eingeteilt, sondern jeder kann selbst entscheiden, welches Angebot er annehmen möchte. Für viele stellt eine Power-Point-Präsentation ein Hindernis zum Lernen dar, darum wählen sie das andere Angebot aus.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage:
Wie eruieren die Referenten die Schwierigkeiten im Lernen? Werden dazu alle Beteiligten nach ihrer Meinung gefragt?
Inklusive Werte, wie BOOTH (2008, S. 59ff) sie beschreibt, „Gemeinschaft“, „Anerkennung von Vielfalt“, „Vertrauen“, „Mitgefühl“, „Ehrlichkeit“ und „Freude“ werden im Rahmen der Weiterbildung entwickelt und versucht an andere Beteiligte weiterzugeben.
Diskriminierungen untereinander, auf Grund von Dialekt, Herkunft oder sexueller Orientierung, treten nicht auf. Die Teilnehmer werden in ihrer Vielfalt wertgeschätzt und als kulturverändernd wahrgenommen. Vor allem die Begegnungen auf gleicher Augenhöhe gefallen den Teilnehmern und Referenten.
Die Weiterbildung kann ‚Inklusive Werte‘ weiter verankern, wenn sie den Anforderungsdruck an die Teilnehmer minimiert und die Vielfalt als Potenzial anerkennt.
Anforderungsdruck zu minimieren könnte über bereitgestellte Unterstützung realisiert werden. Es ist wichtig, dass es zu keinen Leistungsvergleichen kommt. Die Individualität der erstellten Arbeiten steht im Vordergrund und nicht der Vergleich untereinander. Ich denke, die Weiterbildung hat das versucht, dennoch ist es Bestandteil einer Gesellschaft, sich ständig zu vergleichen. Durch ein tolerantes Umfeld und Vorzeigen vieler verschiedener Portfolios könnte dieser Druck verringert werden.
Die Vielfalt als Potenzial erkennen, stellt eine Herausforderung dar. Es stört einige Teilnehmer Rücksicht auf andere zu nehmen, die langsamer arbeiten oder Verständnisprobleme haben. Eine Teilnehmerin äußert im Evaluationsbogen: „Ich musste mich lernen zu gedulden, da es mir teilweise zu langsam war und ich mich unterfordert gefühlt habe.“ Dazu ist es ratsam, die Vielfalt der Persönlichkeiten mehr zu betrachten und einzubeziehen. Jeder hat etwas zu sagen und kann von Erfahrungen berichten, so treten die Teilnehmer als Lehrende auf.
Die Prioritäten des Bereichs ‚Inklusive Werte verankern‘ sind:
-
Die Teilnehmer sind keinem Anforderungsdruck ausgesetzt.
-
Die Vielfalt der Teilnehmerpersönlichkeiten wird als Ressource wahrgenommen und genutzt.
Während der Weiterbildung sind in dieser Dimension vom ersten bis zum dritten Grundkurs positive Entwicklungstendenzen zu beobachten. Die Weiterbildung hat bereits einige Aspekte verwirklicht. Sie steht prinzipiell allen Interessierten offen und ihr Zugang ist voraussetzungsfrei. Obwohl die Teilnehmerschaft von großer Heterogenität geprägt ist, besteht weiterhin Entwicklungspotenzial. Auch Interessierte als Gäste sind willkommen. Die Heterogenität schätzen alle Beteiligten sehr. Sie empfinden sie als kulturverändernd. Die Anpassung an eine einzige ‚Normalität‘ steht nicht im Mittelpunkt. Auf individuelle Bedürfnisse wird versucht einzugehen: Man kann sich eigene Pausen nehmen, freiwillig Aufgaben lösen und die Anfangszeit individuell festlegen. Die Atmosphäre im Kurs ist herzlich und freundlich, sodass sich viele Teilnehmer immer auf das Wochenende und das Wiedersehen mit den anderen freuen. Die angenehme Umgebung trägt zum Vertrauensverhältnis zwischen Referenten und Teilnehmern bei. Der Aufbau einer Gemeinschaft ist den Referenten genauso wichtig, wie die Wissensvermittlung. So gibt es immer ausreichend Zeit, miteinander in Kontakt zu treten und sich besser kennenzulernen. Ergebnisse aller Teilnehmer werden stets im Rahmen der Weiterbildung gezeigt. Auch auf dem Fachtag besteht die Möglichkeit, Ergebnisse, wie das ‚Persönliche Zukunftsplanung Lesezeichen‘ oder Erfahrungen aus eigenen Planungen, zu präsentieren.
Es gibt einige Aspekte, an denen weiter zu arbeiten ist. Die Informationen zur Weiterbildung liegen nur in schriftlicher Form vor. Hier bedarf es noch weiterer Medien, um wirklich barrierefrei zu sein. Audioformate, bildliche Darstellungen, Piktogramme, Brailleschrift und Versionen in leichter Sprache bieten sich hier an. „Der Begriff der Barrierefreiheit hat mehrere Dimensionen und gerade im Bildungsbereich ist dies besonders offenkundig. Nicht nur bauliche Barrieren, sondern auch geeignete Technologien und Lernmethoden sind Grundvoraussetzungen für den unbehinderten Zugang für Menschen mit unterschiedlichen Benachteiligungen“ (GRILL 2005).
Auch in den Umsetzungen der Anmerkungen von Teilnehmern treten Schwierigkeiten auf. Zwar werden über die wissenschaftliche Begleitforschung Meinungen der Teilnehmer, Referenten und dem Umfeld eingeholt, dennoch zeigen sich keine Veränderungen in den Strukturen und dem Ablauf der Weiterbildung. Auf die Wünsche der Teilnehmer nach mehr Eigenaktivität, Gruppenarbeit und praktischem Tun geht die Weiterbildung zu wenig ein. Durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben (Portfolio, Projekt oder Workshop durchführen, Planungen begleiten und durchführen) kommt es zu enormen Anforderungen an die Teilnehmerschaft. Unterschiedliche Zertifikate verdeutlichen obere Leistungsgrenzen. Manche Teilnehmer empfinden dies als große Belastung. Im Umgang mit Versagensängsten und Anforderungsdruck besteht ein weiterer Arbeitspunkt, um inklusiver zu werden. Die Vielfalt der Teilnehmerzusammensetzung wird stets als positiv und wertbringend eingeschätzt. Trotzdem schöpft man noch nicht aus ihrem vollen Potenzial, sodass die Vielfalt nicht als Ressource für die Unterstützung des Lernens genutzt wird. Sie stellt in einigen Bereichen ein Problem dar, das durch Wahlangebote, Differenzierung oder verschiedenes Aufarbeiten der Themenschwerpunkte abgemildert werden kann. Die Teilnehmer werden zu oft als Lernende und zu wenig als Lehrende betrachtet. Auch hier steckt verschenktes Potenzial. Das gilt es zu nutzen, in dem mehr eigene Erfahrungen von Teilnehmern präsentiert werden können.
Nach der Betrachtung dieser Dimension leiten sich, aus den noch nicht gelungenen Punkten, folgende Prioritäten ab:
-
Informationen über die Weiterbildung sind allen Beteiligten zugänglich.
-
Auf Anmerkungen der Teilnehmer wird reagiert.
-
Die Teilnehmer sind keinem Anforderungsdruck ausgesetzt.
-
Die Vielfalt der Teilnehmerpersönlichkeiten wird als Ressource wahrgenommen und genutzt.
Inklusion soll als Leitbild aller Strukturen einer Weiterbildung durchdringen, da durch inklusive Strukturen die Teilhabe aller erhöht wird. Auf die Vielfalt der Teilnehmer wird eingegangen und individuelle Unterstützung wird mobilisiert (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 15f.).
Hier folgen ausgewählte Indikatoren aus dem Bereich ‚eine Weiterbildung für alle entwicklen‘ in Anlehnung an die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a.
Spiegeln die leitenden Positionen das Gleichgewicht der Geschlechter und Erfahrungshintergründe der Referenten in der Weiterbildung wider?
Die Referenten kommen aus ganz Deutschland und jeweils einer aus Österreich und England. Ein Gleichgewicht bei der Geschlechterverteilung existiert nicht, da mehr weibliche Referentinnen anwesend sind. Das wirkt sich jedoch nicht negativ aus. Die Referenten haben unterschiedliche Erfahrungshintergründe und Zugänge zu dem Thema, das sie als Kompetenz bedienen. Durch diese Vielfalt wird die Weiterbildung bunter und erfreut die Teilnehmer. In den Evaluationsbögen sind die wechselnden Referenten positiv vermerkt. Durch die eigenen Erfahrungen können die Referenten unterschiedliche Aspekte in der Weiterbildung bedienen, wie z. B. grafisches Darstellen und vereinfachte Aussprache von Susanne Göbel, MAP und PATH, sowie Persönliche Zukunftsplanung bei Menschen mit erhöhten Unterstützungsbedarf bei Ines Boban und unter Oliver Koenig Organisations- und Strukturveränderungen. Die Erfahrungshintergründe zum Thema sind verschieden.
Gibt es eine klare Strategie, die die Einstellung von Referenten mit Beeinträchtigung ermöglicht?
Die Weiterbildung ist ein Pilotprojekt, bei dem sich erfahrene Personen rund um das Thema Zukunftsplanung treffen. Zu diesem Thema gibt es kaum Referenten mit einer Beeinträchtigung in Deutschland. Sie fungieren in der Weiterbildung oft als Referenten, so M. K., der von seiner Zukunftsplanung berichtet. Auch Ines Boban lädt mitunter Menschen mit Beeinträchtigung ein, die von ihren Erfahrungen sprechen. Bei der Moderation einer Zukunftsplanung lernt sie Patricia Netti kennen. Eine junge Frau mit Down-Syndrom, die wunderbar Zukunftsplanungen illustrieren kann. „Als Graphic Facilitator übernimmt sie den Part, im Moderationsteam von Zukunftsfesten die Ergebnisse gemeinsamer Denk- und Gestaltungsprozesse grafisch festzuhalten. Bei einem Workshop zum Thema in Tirol lehrt sie Graphic Facilitation […]“ (BOBAN 2008, S. 242).
Um weitere Menschen in Zukunftsplanung auszubilden, reist eine Gruppe des Kurses nach Prag und Bratislava. Dort absolvieren sie den Multiplikatorenkurs, der sie befähigt, im Anschluss Kurse über Zukunftsplanung zu geben. An diesem Kurs nehmen sowohl deutsche als auch österreichische Menschen mit Beeinträchtigung teil. So werden sie zu Multiplikatoren ausgebildet und können als Referenten oder Co-Referenten auftreten.
Ein Beispiel aus Österreich zeigt auf, dass die Einstellung von Referenten mit Beeinträchtigung nichts Ungewöhnliches ist. KNITTERFELDER (2008, S. 48) beschreibt in seinem Artikel über das Bildungshaus Schloss Großrußbach, wie Teilnehmer mit Beeinträchtigung als Referenten aufgetreten sind: „Es hat mich fasziniert, als ich hörte, dass diese Menschen im Kurs die „ReferentInnen“ sind. […] Sie sind die Fachleute. Mit ihnen haben wir den Dialog gesucht.“
Eine Frage, die sich während der Evaluation herauskristallisiert hat, ist:
Ob die Referenten gleichwertige Anteile haben?
Es kommt hin und wieder zu Spannungen zwischen den Referenten. Vom kontinuierlichen Kursbegleiter werden die hinzukommenden Referenten manchmal in den Hintergrund gedrängt, weil er die kontinuierlichen Prozesse im Blick hat und der Gruppe am meisten vertraut ist. So kommen die Erfahrungen der anderen manchmal zu kurz. Dadurch fühlen sie sich zurückgesetzt. Eine Referentin stellt kritisch fest: „Ich finde einfach die Rolle schwierig, dass er so dauernd da ist und die Gruppe kennt und das Thema gut kennt, und durch das, wer er ist, seinen Raum hat. Und es deshalb schwer ist, dann daneben rein zu kommen als zweite, und dann auch den eigenen Stil machen zu können“ (Interview 15).
Es bedarf ausführlichen Absprachen, um Diskrepanzen zu vermeiden. Ein vorheriges Treffen oder telefonische Absprachen sind wichtig. Um die Zeitlimits beider Parteien einzuhalten, dienen Wecker, Sanduhr oder ähnliche Medien.
Auch anschließende Reflexionen solcher Teamteaching-Situationen sind wichtig. Im Austausch kann man eruieren, was gut und was weniger gut war. Hierbei ist Ehrlichkeit zueinander sehr wichtig. Hierzu kann die Rolle des ‚kritischen Freundes‘ nützlich sein.
Ich kann die Rolle der Evaluation hier kritisch beurteilen, da sie von beiden Parteien immer ein Feedback bekommt, jedoch meist nicht ausreichend Zeit ist, es sich gegenseitig zu geben. Hierzu dienen Zeitfenster, Nachtreffen, Telefonate oder E-Mails. Es ist wichtig, dass sich jeder in seiner Rolle wohl fühlt und seine Persönlichkeit mit seinen Kompetenzen zur Geltung kommt.
Werden die Bedürfnisse von gehörlosen, sehgeschädigten und körperbehinderten Menschen beim Prozess bedacht, die Gebäude für alle zugänglich zu machen?
Da die Weiterbildung in den Eutiner Werkstätten stattfindet, ist sie barrierefrei für gehbeeinträchtigte Menschen. Viele reisen mit dem Auto oder der Bahn an. Einige Teilnehmer finden die Erreichbarkeit etwas problematisch. Vom Bahnhof fahren nur unregelmäßig Busse und zu Fuß sind die Räume zwei Kilometer entfernt. Wünschenswert wäre ein bereitgestellter Fahrdienst. Fahrgemeinschaften aus der Umgebung existieren, sodass dieses Problem behoben wird.
Die Barrierefreiheit der Räume wird sowohl in den Evaluationsbögen als auch in der Umfrage oft positiv genannt. Dies vereinfacht die Situation einer inklusiven Weiterbildung.
Für körperbehinderte Menschen sind die Weiterbildungsräume zugangsfrei. Ich weiß nicht, inwieweit sich gehörlose oder sehgeschädigte Menschen in dem Gebäude orientieren können. Es gibt einen Teilnehmer mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Er arbeitet in diesem Komplex und kennt sich von daher gut aus. Auf den Fußböden gibt es keine farblichen Markierungen und ein Leitsystem mit Hilfe eines Geländers durch den langen Flur fehlt.
Suchen die Referenten Möglichkeiten für die Teilnehmer, in heterogenen Gruppen mit- und voneinander zu lernen?
Ja, in der Weiterbildung lernen die Teilnehmer in einer heterogenen Gruppe miteinander. Gruppenarbeiten werden entweder durch das Zufallsprinzip oder freie Wahl entschieden. Bei der Möglichkeit der freien Wahl entzieht es sich meiner Kenntnis, ob die Teilnehmer mit Beeinträchtigung häufig ihre Begleitperson wählen.
Die Sitzordnung ist nicht festgelegt. Bei Partnerarbeiten arbeitet man meist mit seinem Banknachbarn zusammen, sodass sich viele verschiedene Konstellationen ergeben. Es steht den Teilnehmern frei, sich ein Angebot mit verschiedenen Zugangswegen auszusuchen. Nach Leistungsstand wird die Gruppe nicht geteilt, dies belegt die Aussage einer Referentin: „[…] Dann können sich Leute aussuchen, wo sie hin wollen. Also ich würde nicht sagen, die Leute mit Lernschwierigkeiten müssen in die einfache Gruppe und die anderen in die schwere, sondern ich würde sagen, wir bieten zwei Varianten an und jeder sucht sich für sich aus, was er möchte. Denn so erwachsen sind alle, und wenn jemand das Schwere wählen will und nicht mitkommt, dann ist das für mich kein Problem. Wenn jemand intellektuell das Leichte wählt, weil das bauchmäßig passt, super“ (Interview 16).
Wird allen Teilnehmern eine echte Auswahl erlaubt, wo es Wahlmöglichkeiten gibt?
Echte Wahlmöglichkeiten gibt es während der Weiterbildung selten. Meist leitet ein theoretischer Input eine Übungsphase ein. Angebote, die unterschiedliches thematisieren oder sich unterschiedlichen Zugangswegen bedienen, gibt es nur im ersten Modul. Dies wird von den Teilnehmern laut Umfrage sehr positiv bewertet. Sie sehen weiteren Bedarf solcher Elemente.
Es wird bemängelt, dass zu wenige Differenzierungsmöglichkeiten vorhanden sind. Auf die Frage hin antwortet ein Teilnehmer: „Das war vorgesehen und das war auch dabei – natürlich. Wir hatten das gleich am Anfang im Rahmen des ersten Moduls […]. Und da […] wurde dann einfach die Möglichkeit gegeben, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Die eine, da wurde es dann in schwerer Sprache vermittelt und in dem anderen hat dann ein anderer Referent […] das einfach mit leichter Sprache gemacht und mit der Hilfe von Figuren […]. Was ganz gut gelungen ist“ (Interview 17). Durch vermehrte Wahl- oder Alternativangebote kann man individuelleres Lernen besser ermöglichen. Die Situation des Teamteaching könnte gut genutzt werden, die Thematik anders zu erläutern oder ein anderes Angebot zu machen. Eine Teilnehmerin erkennt diese Kraftreserve: „Vielleicht hätte man dann doch öfter mal überlegen müssen, ob man die Gruppen teilt, es sind ja immer zwei Referenten gewesen, und das vielleicht ein bisschen handlungsorientierter und ein bisschen theoretischer anbieten, ohne zu sagen, die Behinderten gehen dahin und die Nichtbehinderten bleiben da. […] Und heute Vormittag zum Beispiel war es ja schon sehr abstrakt und sehr theoretisch, und O. und S. haben es die ganze Zeit gemeinsam gemacht. Und da habe ich gedacht: Mensch, wenn die beiden jetzt die Zeit und die Ressourcen gehabt hätten sich aufzuteilen, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, um es in leichterer Sprache oder […] mit Bildern oder […] mit Handeln und Methoden zu erklären, um was es geht“ (Interview 18).
Solche Wahlangebote stellen aber auch wieder die Problematik heraus, dass sich die Teilnehmer nicht entscheiden können, in welches Angebot sie gehen, weil sie womöglich etwas anderes verpassen könnten. Da die Aspekte beider Gruppen in schriftlicher Form zum Nachlesen, als Audiodatei oder als Bildstrecke aufgearbeitet und anschließend verteilt werden können, tritt keine Benachteiligung einer Gruppe auf. Zwei Referenten bekommen von der Problematik und den Ängsten der Teilnehmer mit: „[es ist auch wichtig, d.V.] gewisse gemeinsame Grundlagen zu haben. Zum Beispiel gab es ein Wahlangebot, da waren einige draußen, auch von den Profis […] und es fehlten dann aber Grundlagen, auf die du aufbauen willst und die du brauchst, um Sachen weiter vertiefen zu können. Das heißt, es steht die Frage: was müssen alle machen, was können wir differenzieren?“ (Interview 19) „[…] Aber ich glaube schon immer noch so einen Beigeschmack blieb, ist so meine Wahrnehmung von, wenn ich den Theorieinput nicht habe, dann fehlt mir vielleicht was. […] Also, verpasse ich was, wenn ich mich eine halbe Stunde ganz viel Theorie widme von dem anderen“ (Interview 20). Durch vorbereitere Materialien wäre diese Situation abzumildern.
Um ‚Inklusive Strukturen‘ zu etablieren, dient ein respektvolles Verhältnis aller zu einander. Achtungsvoller Umgang mit einander ist die Basis guter Zusammenarbeit. Die Gleichgewichtigkeit aller Referenten ist sehr wichtig. Kommt es zu Problemen im gemeinsamen Arbeiten, ist ehrliche und offene Aussprache bedeutend.
Die Möglichkeit von Wahlangeboten schafft ‚Inklusive Strukturen‘. Es ist wichtig, auf die Heterogenität der Gemeinschaft einzugehen. Durch heterogene Lerngruppen, die bereits existierten, wird ein Anfang geschaffen. Mit Wahl- bzw. Parallelangeboten wird man dem weiterhin gerecht. Diese sollte die Thematik unterschiedlich aufbereiten und auch andere Themen beinhalten, sodass nach Zugangsweg und Interesse entschieden werden kann. Inhalte jedes Angebots sind so für alle Teilnehmer auf verschiedenen Wegen aufgearbeitet. Die Prioritäten des Bereichs ‚eine inklusive Weiterbildung für alle‘ sind:
-
Die Referenten haben ein gleichwertiges Auftreten und verbalisieren ihre Sorgen und Ängste.
-
Wahlmöglichkeiten und Parallelangebote ermöglichen differenziertes Lernen nach den Bedürfnissen des Einzelnen.
Bezugnehmend zu den Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a folgen hier speziell ausgewählte aus dem Bereich ‚Unterstützung für Vielfalt organisieren‘.
Werden alle Unterstützungssysteme mit einer Strategie koordiniert, die auf verbesserte Fähigkeiten der Weiterbildung zielt, der Vielfalt zu entsprechen?
Organisierte Unterstützungssysteme sind nicht zu erkennen. Ein Referent äußert, dass für die Teilnahme von Menschen mit Behinderung die Voraussetzung besteht, eine Unterstützungsperson mit sich zu bringen. Dies wird nicht erfüllt, da manche ohne Begleitung kommen und manche zwar mit, diese aber selbst aktiver Teilnehmer der Weiterbildung ist und eigentlich nicht die Rolle des Unterstützers hat. Einige von ihnen brechen die Weiterbildung nach einigen Modulen ab, andere haben Probleme bei der Erfüllung von Anforderungen, wie bei dem Portfolio. Die Weiterbildung wird von jeweils zwei Menschen mit Beeinträchtigung im zweiten und dritten Grundkurs aus nicht bekannten Gründen abgebrochen. Eine Teilnehmerin bemerkt, dies, und das „[…] sie ohne ihre Betreuer hier [waren, d.V.]“ (Interview 21) (Abb. 30).
Auch Verantwortungsgefühle der jeweiligen Begleitperson und anderer Teilnehmer werden deutlich, so fühlt sich z. B. eine Teilnehmerin ständig verpflichtet, ihrer Begleitperson beizustehen und alles zu erklären. An einem Modul nimmt der Teilnehmer mit Beeinträchtigung nicht teil und die Teilnehmerin fühlt dort, dass sie freier und unbefangener ist. Da die Rolle des Unterstützers zu Beginn der Weiterbildung nicht geklärt ist, treten solchen Engpässe auf: „Und ich weiß auch von der E., die mit K. kommt, dass sie sagt, ich bin total angestrengt. Und das eine Wochenende war K. nicht da […]. Und da sagte sie, >>Ah, super, ich fühle mich so verantwortlich, dass er hier inklusiv mit dabei ist, und es kostet mich richtig Kraft.<< Sie übersetzt ihm das teilweise. So wie die englischen Übersetzer hier zu tun haben. Und ich weiß das auch von W., dass sie bei M. immer so was sagt. […]“ (Interview 22). Eine Teilnehmerin stellte sich die Frage: „[…] sind wir hier inklusiv?“ (Interview 23) Und spürt auch Verantwortung für die anderen Teilnehmer, sodass eigene Lernprozesse darunter leiden.
Der Abbruch verschiedener Teilnehmer wird nie mit der Gruppe besprochen und verunsichert viele Teilnehmer. Sie vermerken das Verschwinden ständig im Evaluationsbogen. Vermutungen lassen das Fernbleiben darauf zurückzuführen, dass sie aufgrund mangelnder Unterstützung und daraus folgender Überforderung die Weiterbildung abgebrochen haben. Hilfe und Unterstützung wird zwar angeboten, dennoch reichen diese nicht aus, um eine vollkommene Partizipation zu leisten. „Trotzdem denke ich so für mich als Knackpunkt, ich glaube, dass es für die Leute mit Behinderung, die dabei waren, die hätten fast jemanden einfach vor Ort noch mal gebraucht, der oder die sie noch ein bisschen an die Hand nimmt und unterstützt, in welchem Umfang auch immer. Das hat sicher bei manchem besser, bei anderen weniger gut geklappt. Und das hätte es ihnen in diesen Situationen manchmal leichter gemacht“ (Interview 24).
Hilfreich könnte ein Mentorensystem sein, mit dem man die Inhalte des Moduls vor- und nachbereitet. Auch das System der Referenzgruppe, auf welches ich in Österreich gestoßen bin, bietet sich an. Hier bearbeitet man in einer Gruppe die Inhalte der einzelnen Module. Es gibt sowohl Treffen davor, als auch danach, die offene Fragen klären können. Oliver Koenig äußert in seinen Interviews, dass es in Wien Lernunterstützer gibt, die die Treffen gemeinsam mit ihrer begleitenden Person vor- und nachbereiten und auch an den Modulen beteiligt sind. Diese bauen die Brücke zwischen Inhalt, Referent und betroffener Person.
Auch externe Unterstützer, die nicht als Teilnehmer der Weiterbildung fungieren, bieten sich an. Die englische Referentin spricht an: “I Think we need to think about how the people who have a learning disability how they are supported within the training. […] A partnership … they would meet the day before with some key people. They would go through all the agenda beforehand, looking at it, checking out whether they have understood all the information, checking out whether they have any questions. So when they came to the board meeting, they felt better prepared. And that seemed to work quite well“[6] (Interview 25).
Es gibt viele Möglichkeiten Unterstützung zu organisieren. Julie Lunt, Oliver Koenig und die anderen Referenten haben in ihren bereits zahlreich gegebenen Kursen solche Erfahrungen gemacht. Es gilt sie umzusetzen und Unterstützung im Team zu mobilisieren, wie beispielsweise durch:
-
Referenzgruppe,
-
Tutorenstunden,
-
Mentorensystem,
-
Patenschaften,
-
Lernunterstützer,
-
Externe Unterstützung.
Auch externe Begleiter, die man über das persönliche Budget, Spendengelder oder dem Prinzip der Freiwilligkeit einer Win-win-Situation gewinnen kann, bieten sich an.
Eine Referentin berichtet in ihrem Interview über die Erfahrungen, die sie in den USA bei einer inklusiven Weiterbildung gemacht hat. Dort war es „[…] Voraussetzung für diesen Kurs, die mussten alle eine Unterstützungsperson vor Ort haben, die mit ihnen arbeitet. Die mussten nicht in den Kurs kommen“ (Interview 26). Auch hier spielt die Vor- und Nachbereitung der Inhalte eine große Rolle. Sie bedeutet allerdings einen Mehraufwand der Menschen mit Beeinträchtigung, welchen sie bereitwillig annehmen müssen. Die Teilnehmer beschweren sich regelmäßig, dass ihnen die Tage zu lang erscheinen. Ich kann nicht beurteilen, ob sie sich im Anschluss noch einmal mit einem Unterstützer zur Nachbereitung treffen würden. Hier würde ein anderer Tag bzw. ein verkürzter Seminartag ausreichend sein.
Eine weitere Frage zum Thema Unterstützung trat am Ende der Gesamtauswertung auf:
Nehmen alle die angebotene Unterstützung an und sagen sie Bescheid, wenn sie welche benötigen?
Das Kundtun von eigenen Bedürfnissen, z. B. langsameres Tempo, Erklärungen in einfacher Sprache oder Pausen, ist nicht zu bemerken. In der Broschüre ‚Bildung für alle. Menschen mit Behinderung in der Erwachsenenbildung‘ äußert sich eine Kursleiterin zu diesem Thema: „Teilnehmer melden sich oft nicht von sich aus und holen sich Hilfe, sondern als Kursleiterin muss man sehr genau erkennen, wer wo Hilfe benötigt“ (EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG 2005, S. 10). Der Äußerung stimme ich in diesem Sinne teilweise zu, dass man auch einen geschärften Blick für Bedürfnisse und Hilfestellungen der Teilnehmer entwickeln sollte, dennoch können die Teilnehmer auch selbst ihre Bedürfnisse und Probleme verbalisieren. In Eutin fordern die Referenten vor allem die Personen auf, die zuvor lautstark verkündet haben, dass sie einschlafen würden. Dennoch reagieren sie nicht auf das Angebot. Ein Betroffener äußert sich dazu: „In der Beziehung bin ich so einer, da nehme ich das so, wie das ist. […] Naja, ich bin da manchmal so ein bisschen eigenartig drauf, ich trau mich dann manchmal nicht den Mund aufzumachen, weil ich denke 'Hm, ja toll, jetzt sagst du was und äh...“ Bevor er den Ablauf der Weiterbildung ‚stört und aufhält‘ „[…] halt ich lieber die Klappe und sage nichts“ (Interview 27). Dieses Verhalten ist im Kursverlauf zunehmend zu beobachten. Eine Referentin empfindet dieses Verhalten als eine „stückweite Provokation an die eigene Adresse“ (Interview 28). Ein Referent „appelliert an die Eigenverantwortung. Aber er hat nie was gesagt. Ich habe gesehen er schläft ein, aber ich wollte es nicht noch einmal sagen, weil ich es ihm in der Pause unter vier Augen gesagt habe, bitte sag [es, d.V.] mir […]“ (Interview 29).
In einer Kultur des Vertrauens fällt es den Menschen einfacher, ihre Bedürfnisse, Ängste und Bedarfe zu zeigen. Durch die fehlende kontinuierliche Unterstützung und „spezifischer Sozialisationserfahrungen“ (THEUNISSEN 2003, S. 87), wie lange Institutionalisierungen und daraus entstandene „erlernte Bedürfnislosigkeit“ und „Passivität“ (ebd., S. 87) ermöglichen das Kundtun von Wünschen nur bedingt. Dennoch ist an ihre Selbstständigkeit zu appellieren, die aber evtl. erst gelernt wird. „Der Gedanke, dass Selbstbestimmungskompetenzen erlernt und vielleicht sogar regelrecht trainiert werden müssen, ist im deutschsprachigen Raum noch recht „neu“, dennoch finden sich einige Ansätze zur Umsetzung“ (LINDMEIER/LINDMEIER 2002). So z. B. ein Buch von Susanne Göbel (‚So möchte ich wohnen!‘), welches eine Adaption eines amerikanischen Programms zum Training von Selbstbestimmungsfähigkeiten aufgreift (vgl. ebd.). Die Volkshochschule in Ulm veranstaltet seit 1999 mit der Behindertenstiftung und der Lebenshilfe die ‚Sommerschule Ulm‘. Hier werden zahlreiche Kurse für Menschen mit intellektueller und mehrfacher Behinderung angeboten, so z. B. der Kurs: ‚Gemeinsam! Aktive Bürgerbeteiligung für Menschen mit geistiger Behinderung.‘ Sie sollen befähigt werden, sich einzumischen und an Entscheidungen aktiv teilzuhaben – im Sinne des Empowerment-Ansatzes (vgl. SCHWEITZER 2011). Durch den Besuch solcher Kurse kann die Selbstvertreterrolle weiter ausgebaut werden. THEUNISSEN (2003, S. 55) sieht die Notwendigkeit „[…] durch gezielte Angebote […] Eigenverantwortlichkeit anzuregen und/oder zu stärken.“
Sind alle Weiterbildungsplanungen ausgerichtet auf die Teilhabe von Teilnehmern unterschiedlicher Herkunft, Erfahrungen, Leistungen und Beeinträchtigung?
Die groben Weiterbildungsplanungen werden gemeinsam während der Entwicklertreffen vorgenommen. Im Detail ist das jeweilige Referenten-Team dafür verantwortlich. Da die Referenten die Gruppe gar nicht persönlich kennen, sondern nur aus Rücksprache mit dem kontinuierlichen Kursbegleiter, beziehen sie meist wohl nur die Gesamtheit der Masse in ihre Planung mit ein. Auf die Teilhabe der Teilnehmer mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen kann man nur eingehen, wenn man diese ermittelt hat und die Gruppe kennt. Passgenaue Angebote können nur mit den Betroffenen entwickelt werden und nicht über ihre Köpfe hinweg, so ist die Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung an der Weiterbildungsplanung unabdingbar (vgl. HESS/KAGEMANN-HARNACK/SCHLUMMER 2008, S. 24). Dies ist zu realisieren wenn, „[…] gezielt Menschen mit Behinderung nach ihren Themenwünschen befragt und diese Themen in die Planung eingebaut [werden, d.V.]“ (ebd., S. 24).
Eine Referentin findet es „[…] eine echt schwierige Geschichte, wenn wir nur einfach dieses plakative Wort 'inklusiv' nehmen, das zeigt einfach, wenn sich Menschen nicht selber in ihren Bedarfen und Bedürfnissen konkret artikulieren oder aber zum Teil sehr floskelhaft und immer wieder so Phrasen im Wesentlichen als Bedürfnis artikulieren, so nach dem Motto 'Ich schlaf ein, wenn ich nicht und so', dass wir nicht genau wissen, womit wir ihr Bedürfnis treffen […] ja dann bleibt das Ganze immer so ein bisschen auf wackeligen Füßen. Du kannst dir sonst was Gutes überlegen, aber wusstest nicht, dass auch das und das wiederum eine Hürde ist. Dazu kenne ich sowieso alle Beteiligten viel zu wenig und es braucht mehr Kontinuität, um wirklich dann mehr solche Situationen zu schaffen“ (Interview 30).
Es gibt in wenigen Modulen Wahlangebote, sodass man auf Erfahrung, Leistung und Beeinträchtigung etwas eingehen kann. Aber dies geschieht den meisten Beteiligten noch zu wenig. Eine Teilnehmerin sagt, dass „[…] nicht alle Teilnehmerzielgruppen angesprochen [werden]“ (Interview 31). Auch ein Referent bemerkt nach seinem Modul: „Da werden wir vielleicht nicht allen gerecht. […] ich glaube, dass es katastrophal war […]“ (Interview 32). Die Umfragen präsentieren aber auch, dass ‚das Gerecht werden jeden Bedürfnisses‘ die größte Herausforderung darstellt. Um den Bedürfnissen gerecht zu werden, ist es wesentlich diese erst selbst zu erkennen und anschließend weiter zu geben. Eine große Rolle spielt dabei auch die Gruppenstärke, da es viele als schwieriger erachten, auf 22 als auf 10 bis 15 Individualitäten einzugehen. Kleinere Gruppen würden die Bedürfnisse der einzelnen näher betrachten. Sowohl Referenten als auch Teilnehmer finden, dass „es […] einfach eine zu große Gruppe [war, d.V]. Es ist toll, wenn man vielen Leute die Chance geben will, aber es bleibt dadurch auch etwas auf der Strecke. Ich finde, wir haben dadurch Leute nicht im Blick gehabt, die es gebraucht hätten, im Blick zu sein“ (Interview 33). Ebenfalls bietet sich hier die Erstellung von individualisierten Curricula an.
Benutzen die Referenten Technologien, die das Lernen unterstützen können (z. B. Fotoapparat, Fernsehen, Video, Overheadprojektor, Kassettenrekorder, CD-Player, Computer/Internet)?
In der heutigen medialen Welt bedienen sich die meisten Weiterbildungen solcher Medien. Auch bei der Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion‘ arbeiteten die Referenten mit zahlreichen Technologien: Laptop und dazugehörige PowerPoint-Präsentationen, Videos, Musik und Internet.
Das Lernen wird dadurch nur teilweise unterstützt. Vor allem die textlastigen Power-Point-Präsentationen werden häufig in den Evaluationsbögen und Umfragen kritisiert. Sie seien zu kompakt und zu schwer verständlich. Durch diese frontal gestaltete Situation – jemand präsentiert etwas, 22 Menschen hören ihm zu – kommt es vielen sehr ‚verschult‘ vor. Power-Point-Präsentationen, die Bilder und Geschichten präsentieren, welche als Visualisierungsunterstützung dienen, werden hingegen sehr positiv aufgenommen. BERZBACH (2004, S. 48) empfindet, dass sich die Power-Point-Präsentation nicht nur durchgesetzt hat, sondern dass sie mittlerweile obligatorisch geworden ist. In seinen Augen wird der Zuhörer in eine „Fernsehstimmung“ versetzt, die durch die Perfektion der Präsentation, der Vielzahl an Grafiken, der Töne und der Filme hervorgerufen wird. Er kritisiert, dass die Folien meist ohne den Referenten rezipiert werden können und als Textdatei parallel vorliegen, sodass der Referent überflüssig wird. Im Verlauf der Weiterbildung sind solche Tendenzen zu beobachten, obwohl von vielen Teilnehmern der Wunsch nach parallelem Skript besteht, um sich Notizen machen zu können. Für GRILL (2005) ist ein Medienwechsel von zentraler Bedeutung, weil Beamer-Präsentationen die Zuhörer ermüden und in eine Passivität drängen.
Videos zur Persönlichen Zukunftsplanung gefielen den meisten gut. Manche Teilnehmer wünschen sich einen vermehrten Einsatz solcher Mittel. Vor allem Videos machen das Gelernte erfahr- und vorstellbar, weil sie durch ihre bildliche Unterstützung der Sprache vielen zugänglich sind. Ein Teilnehmer äußert explizit seinen Wunsch danach, „dass mal ein Video von so einer Zukunftsplanung gezeigt wird“ (Interview 34).
Beteiligen die Referenten die Teilnehmer vermehrt an Entscheidungen über Inhalte und Lernwege? Und welche Lernwege bieten sich an?
Die direkte Beteiligung an Entscheidungen über Inhalt und Lernwege sind ansatzweise zu beobachten. Meist kommt es zu zeitlichen Engpässen, die das Wegbleiben oder Verschieben einiger Inhalte nach sich zieht. Hier werden die Teilnehmer gefragt, was ihnen nun wichtiger sei. Nach den Bedarfen wird sich des Öfteren erkundigt und versucht, diese Wünsche mit einzubauen.
In offenen Treffen, die nach Beendigung der Kurse stattfinden, entscheiden die Teilnehmer über Inhalte mit. Sie äußern ihre Wünsche oder wählen aus vorgegebenen Angeboten aus.
Entscheidungen über Lernwege sind fast gar nicht zu beobachten. Lediglich bei dem Wahlangebot kann man sich einen Vermittlungsweg aussuchen. Ansonsten sind es meist theoretische Blöcke in Form von Power-Point-Präsentationen. Hier äußern einige Teilnehmer ihr Unbehagen in den Evaluationsbögen. Gern hätten sie sich mehr Eigenaktivität gewünscht. Auch eine Referentin „glaub[t] ganz sehr, dass sie wirklich Sachen ausprobieren müssen, klar, sie brauchen ein Input, aber sie müssen ganz viel machen und oft fehlte so aus meiner Sicht ein bisschen die Zeit für das Ausprobieren, für das selber machen, für ihre Projekte und für meinen Geschmack könnte es manchmal weniger an Theorie sein zugunsten dessen, dass sie einfach mehr Zeit haben“ (Interview 35).
Auch Methoden des kooperativen Lernens bieten sich an, indem die Teilnehmer aktiv ihr Wissen selbst erarbeiten. Es gibt zahlreiche Methoden, z. B.: ‚Platzdecken‘, bei dem vier oder sechs Personen an einem Gruppentisch arbeiten. Alle lesen denselben Text oder schauen denselben Film und tragen anschließend wesentliche Punkte zur Zusammenfassung in das Plakat ein. Jeder für sich, ohne mit einander zu reden. Erst im Anschluss spricht man darüber (Abb. 31). Auch die Methode ‚Think – Pair – Share‘ bietet sich gut an. ‚Think‘ bedeutet die individuelle Auseinandersetzung mit Text, Video, Geschichte oder Bildstrecke. ‚Pair‘ bedeutet der Austausch darüber, entweder Paar- oder Gruppenweise und ‚Share‘ beutetet eine Ergebnispräsentation. ‚JigSaw‘ ist ebenfalls eine gute Methode, die zur Eigenaktivität auffordert. Der zu erarbeitende Stoff wird in möglichst gleich umfangreiche und schwierige Abschnitte unterteilt. Die Teilnehmer bilden eine Gruppe. Nun entscheidet sich jeder für einen zu bearbeitenden Abschnitt und trifft sich mit den Teilnehmern der anderen Gruppen, die denselben Abschnitt bearbeiten. Man bildet sozusagen Expertengruppen pro Abschnitt, die sich nach der Bearbeitung wieder zu ihrer Stammgruppe gesellen und ihnen von den gemachten Erfahrungen berichten. So tauschen sich alle miteinander aus (vgl. BLOMERT o.J.; HAAN o.J.; MIEHE/MIEHE 2005; RIELEIT 1992). Ein Referent erkennt: „Das ist es: ich muss es in meiner Sprache sagen können und dann verstehe ich es auch“ (Interview 36). Die Methoden des kooperativen Lernens entsprechen diesem Grundgedanken.
Auch eine Referentin glaubt, dass die Teilnehmer von praktischen Beispielen sehr viel lernen und man das Potenzial – in Gruppen zu lernen – hier nutzen könnte: „[…] also ich glaube von was sie echt profitieren, sind Beispiele aus der Praxis, das ist auch nochmal eine andere Qualität glaub ich von Input, also sie verdeutlicht ihnen nochmal mehr. Wirklich Zeit auch miteinander, wir können ja gut auch in Gruppen arbeiten, da finde ich, sind die schon auch stark drin sich Sachen zu erarbeiten ja und Zeit einfach um Sachen auszuprobieren für sich selber“ (Interview 37).
Die Weiterbildung hat noch kein grundlegendes Unterstützungssystem, dessen es aber bedarf. Möglichkeiten hierzu werden bereits angeboten. Wichtig ist, dass Menschen, die der Unterstützung bedürfen, diese auch zulassen. Bei den Menschen mit Beeinträchtigung ist der Selbstvertreteraspekt noch zu wenig erkennbar. Dabei handelt es sich um einen Prozess. Der Rahmen der Weiterbildung ermöglicht ihnen das ansatzweise.
Bei Entscheidungen bezüglich der Weiterbildungsinhalte und Lernwege werden die Teilnehmer nicht ausreichend einbezogen. Durch die Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmer, kann man eine Weiterbildung auf sie ausrichten. Dazu bedarf es, die Bedürfnisse und die Teilnehmerschaft zu kennen.
Der mediale Einsatz ist sehr gut. An technischen Mittel fehlt es kaum. Ihr Einsatz wird unterschiedlich bewertet. Als Visualisierungshilfe und Veranschaulichung sind solche Mittel angebracht. Aber sich nur auf Power-Point-Präsentationen zu verlassen, ist nicht ratsam, da dort viele Teilnehmer abschalten und so dem schriftlichen Teil nicht mehr folgen. Bilder und Geschichten können jedoch immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Die Prioritäten aus diesem Bereich leiten sich aus der mangelnden Unterstützung und zu geringen Einbeziehung der Teilnehmer in Inhalte und Lernwege ab:
-
Ein Unterstützungssystem sorgt für die aktive Partizipation aller Teilnehmer.
-
Die Teilnehmer sind bei Entscheidungen über Lerninhalte und methodische Wege einbezogen.
Ansatzweise ist Inklusion als Leitbild aller Strukturen der Weiterbildung durchgedrungen. Das zeigt sich daran, dass die Weiterbildungsräume barrierefrei sind. Für gehbeeinträchtige Menschen stehen somit alle Räume, wie Seminarräume, Speisesaal und Toiletten offen.
Die Überlegungen, Persönliche Zukunftsplanung weiter zu verbreiten, sind vorhanden. Dazu werden Teilnehmer aus Eutin, Wien und Prag zu Multiplikatoren ausgebildet. Darunter sind auch Teilnehmer mit Beeinträchtigung. Daher besteht eine Strategie zur Einstellung von Menschen mit Beeinträchtigung.
Die Lerngruppe ist durch die Teilnehmerzusammensetzung in vielerlei Hinsicht heterogen. Nie wird nach Leistungsstand oder Erfahrungen selektiert. Bei Wahlmöglichkeiten hat man immer eine echte Auswahl. Sowohl Menschen mit Beeinträchtigung wählen die ‚schwerere‘ Variante als auch Menschen ohne Beeinträchtigung die ‚leichtere‘. Es findet keine Zuteilung zu den verschiedenen Angeboten statt.
Der mediale Einsatz von verschiedenen Techniken wird sehr positiv aufgenommen. Gerade bildliche Darstellungen, Videos oder Geschichten untermauern das Lernen und vereinfachen es. Rein schriftliche Power-Point-Präsentationen hingegen werden oft kritisiert, weil sie eine Barriere für das Lernen aller sind.
Durch aktive Einbeziehung der Teilnehmer in kurzfristige Planänderung oder Bearbeitung der für sie relevanten Themen, kommt man der Bedürfnisorientierung sehr nahe. Die Teilnehmer fühlen sich ernst genommen und finden es wichtig selbst zu entscheiden, was sie gerade inhaltlich bearbeiten wollen. Im Gegensatz dazu können die Teilnehmer bei der Methodenauswahl wenig mitbestimmen. Sie äußern ihre Wünsche meist in den Evaluationsbögen, auf die aber nicht eingegangen wird.
Gleichwohl bestehen auch in dieser Dimension weiter zu erfüllende Aufgaben. Problematisch stellt sich die Situation der Unterstützung heraus. Hier besteht eindeutiges Entwicklungspotenzial, da einige Teilnehmerinnen auf Grund mangelnder Unterstützung die Weiterbildung abbrechen, eine Teilnehmerin auf Grund geleisteter Unterstützung selbst wenig Lernerfahrung sammeln kann und sich so einige Teilnehmer für die unterstützungsbedürftigen Personen verantwortlich fühlen. Ein Unterstützungssystem, um der Partizipation aller gerecht zu werden, ist zu mobilisieren.
Die Referenten arbeiten gut zusammen und die Teilnehmer finden es lohnenswert immer im Duo begleitet zu werden. Dennoch gibt es manchmal Spannungen zwischen den Referenten. Die Zusammenarbeit sollte für beide Seiten positiv verlaufen und über Probleme, die im zwischenmenschlichen Raum nun mal auftreten können, kann gesprochen werden. Dazu dienen Zeitfenster der Reflexion oder ein ‚kritischer Freund‘.
Folgende Prioritäten beziehen sich auf diese Dimension:
-
Die Referenten haben ein gleichgewichtiges Auftreten und verbalisieren ihre Sorgen und Ängste.
-
Wahlmöglichkeiten und Parallelangebote ermöglichen differenziertes Lernen nach den Bedürfnissen des Einzelnen.
-
Ein Unterstützungssystem sorgt für die aktive Partizipation aller Teilnehmer.
-
Die Teilnehmer sind bei Entscheidungen über Lerninhalte und methodische Wege einbezogen.
„Dieser Dimension zufolge gestaltet jede [Weiterbildung, d.V.] ihre Praktiken so, dass sie die inklusiven Kulturen und Strukturen der [Weiterbildung, d.V.] widerspiegeln“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 16). Die Weiterbildung entspricht der Vielfalt ihrer Teilnehmer. Sie werden zur aktiven Gestaltung ihrer Bildung mit dem Fokus auf ihre Stärken, Wissen und Erfahrungen angeregt. In Gemeinschaft werden Ressourcen, die in den jeweils Beteiligten innewohnen, ermittelt. Auch materielle Ressourcen gilt es, zu mobilisieren, um ein aktives Lernen und die Partizipation für alle aufzubauen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 16).
In Hinblick auf die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a werden im Folgenden einige Indikatoren aus dem Bereich ‚Lernarrangements organisieren‘ aufgegriffen.
Entsprechen die Lernmaterialien den Hintergründen, Erfahrungen und Interessen der Teilnehmer?
Die Lernmaterialien sind größtenteils auf den Erwachsenenbildungsbereich zugeschnitten. Die Arbeitsblätter, Power-Point-Präsentationen und Kartensets entsprechen meist den Interessen und Erfahrungen der Teilnehmer. Ein junger Mann mit Beeinträchtigung dagegen empfindet die Kartensets und vor allem die Übungen mit Playmobilfiguren wie im „Kindergarten“ (Interview 38). Weil sie Prozesse veranschaulichen, mögen viele andere Teilnehmer diese Arbeit. Eine Referentin bemerkt die Unzugänglichkeiten einiger Materialien und begründet den Einsatz mit ihrer individuellen Arbeitsweise: „Ich bin jemand, die muss einen Autobus dabei haben, eine Schnur […] was viele dann vielleicht zu kindisch finden, aber da sind unsere Stile sehr unterschiedlich. Und das ist bei einer gemischten Gruppe, wie wir sie dort hatten, schwierig“ (Interview 39).
Legt die Weiterbildung eine Vorstellung des Lernens als kontinuierlichen Prozess nahe statt als Erledigung bestimmter Aufgaben?
Die Weiterbildung betrachtet Lernen als einen kontinuierlichen Prozess. Daher auch die zeitlichen Abstände der Weiterbildung von vier Wochen, um Geschehenes reifen zu lassen. Auch nach der Beendigung der Weiterbildung ist die Lernerfahrung noch nicht abgeschlossen. Durch die Präsentation der eigenen Lernerfahrungen im Portfolio wird deutlich, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt. Auch GRILL (2005) hat die Vorstellung von Lernen als einen kontinuierlichen Prozess und sieht dies als wesentlichen Aspekt inklusiver Bildung.
Nimmt die Planung der Weiterbildungsgestaltung Rücksicht auf bestimmte Teilnehmer und bemüht sie sich um den Abbau von Hindernissen für deren Lernen und Teilhabe?
Die Gestaltung der Weiterbildung liegt in den Händen der Referenten. Laut Umfragerecherchen werden zu oft Inhalte angeboten, die für den gesamten Personenkreis vorgesehen sind. Auf die Bedürfnisse einzelner Personen, wie größere Schrift, einfache Sprache, tief greifende Diskussionen und mehr Pausen wird wenig Rücksicht genommen.
Hindernisse des Lernens werden mit Hilfe der Evaluationsbögen erfragt. Auch die Broschüre benennt sie. Dennoch wird an ihnen wenig gearbeitet. Hindernisse stellen laut Umfragen:
-
lange theoretische Einführungen mit Hilfe von Power-Point-Präsentationen,
-
zu lange und intensive Arbeitsblöcke,
-
zu verbal- und kopflastige Phasen,
-
Vernachlässigung des aktiven Tun,
-
Missachtung der leichten Sprache,
-
zu geringe methodische Vielfalt und
-
zu wenig Differenzierungsmöglichkeiten dar.
Das sind sie Hauptaspekte, die am häufigsten in den Umfragen benannt und auch von Menschen mit Beeinträchtigung als wesentlich empfunden werden. Ein Referent erkennt die Einseitigkeit im Bereich der kopflastigen Teile: „[Zentrale Qualität ist, d.V.] das für Andere vermitteln zu können, ohne nur den Kopf anzusprechen, sondern auch die Hand und das Herz. Ich glaub das gelingt nicht immer aber das ist die zentrale Qualität, die ich bei allen Teilnehmern erreichen muss. Die Einheit von Kopf, Herz und Hand, dann hab ich eine Lernerfahrung, die erfolgreich und auch nachhaltig sein kann. Ich glaub, wir bedienen hauptsächlich den Kopf, vielleicht schaltet sich das Herz manchmal ein bisschen ein aber die Hand fast gar nicht. Das ist sicherlich eine Herausforderung“ (Interview 40).
Durch einen vermehrten Methodenwechsel, Wahlangebote und Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmer, können Hindernisse für das Lernen weitgehend abgebaut werden. Auch mobilisierte Unterstützung, das Referieren in leichter und verständlicher Sprache dienen dazu. Eine Referentin empfindet, dass das „methodisch vielleicht nicht ausreichend genug“ (Interview 41) war. Einer Teilnehmerin gefällt „[…] das deduktive Arbeiten […] immer besser als das induktive, weil ich es unglaublich anstrengend finde, wenn mir vorne immer jemand was erzählt von fünf Theorien hintereinander. Das überfordert mich. Wenn ich mir aber eine Theorie selber erarbeite und dann auch noch an Hand des Beispiels gucke, wie man das so aufbauen kann, dann finde ich es gut. Das Beispiel aber dann am besten aus meiner eigenen Erfahrung, das ist mir wichtig!“ (Interview 42) Diese Arbeitsweise könnte genutzt werden, um die Hindernisse im Lernen zu minimieren.
Schließen die Module ebenso Partner- und Gruppenarbeit wie Einzelarbeit und Arbeit im Plenum ein? Gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten, z. B. mündliche Vorträge und Diskussionen, Zuhören, Schreiben, Zeichnen, Problemlösen, audiovisuelle Materialien, praktische Aufgaben und Arbeit mit dem Computer?
„Klar, wir hatten jede Menge Arbeitsgruppen, am Anfang fand ich noch so eindrücklich, da haben wir so Traumwolken gebastelt, das hat mir gefallen, um uns gegenseitig vorzustellen, oder auch diesen Körperumriss fand ich gut, weil wir da so mit Materialien gearbeitet haben, das fand ich sehr sinnlich und hat mich angesprochen. Dann haben wir ja auch viel in so kleineren Arbeitsgruppen gearbeitet, wo man dann Sachen miteinander diskutiert und überlegt hat, das war auch immer befruchtend und gut“ (Interview 43). In der Weiterbildung wird in vielen verschiedenen Sozialformen gearbeitet. Dies wird auch in den Umfragen positiv vermerkt.
Durch die Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten gestalten sich die Lernprozesse nachhaltiger (Abb. 32/33). Mündliche Vorträge werden meist von den Referenten gehalten. Anschließende Übungen haben oft praktischen Charakter. Ein Referent lobt den Wechsel der Aktivitäten: „[…] und ich glaube, dieser Wechsel zwischen Input und Übung war wieder gut und dadurch lebendig“ (Interview 44).
Die Mehrheit der Umfragen empfindet das Üben und Ausprobieren sehr gewinnbringend. Diese Aufgaben beinhalten z. T. beliebte Orte zu zeichnen, eine Sozialraumkarte der Umgebung anzufertigen, Fragen zu diskutieren oder verschiedene Kartensets in Partnerarbeit zu bearbeiten. Dennoch wird in den Umfragen angemerkt, dass der Wechsel zwischen Tun und Zuhören zu kurz kam.
Vor allem das Zeichnen und die praktischen Übungsphasen gefallen den Teilnehmern. In solchen Situationen beobachtet ein Referent die gelungene Gestaltung eines inklusiven Lehrgangs: „[…] ich glaube, es gibt immer wieder Momente im Seminar, wo es uns gut gelungen ist, gerade wenn es um konkrete Planungen ging, Leute selbst geplant haben, Sachen praktisch ausprobiert haben, wo sie beteiligt waren“ (Interview 45).
Baut die Weiterbildung auf Unterschiede in Wissen und Erfahrungen der Teilnehmer auf?
Die Weiterbildung dient der Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Persönliche Zukunftsplanung‘. Zu Beginn der Weiterbildung werden alle Teilnehmer gebeten, ihre bereits gemachten Erfahrungen mit dem Thema zu verbalisieren. Dabei wird deutlich, dass die Spanne, von ‚ich habe noch nichts von Zukunftsplanung gehört‘ bis ‚ich führe selber welche durch‘, reicht. Dennoch, so auch in den Auswertungen zu verzeichnen, wird auf die Vielfalt der persönlichen Erfahrungsschätze wenig aufgebaut, da meist Informationen für alle angeboten werden. Teilnehmer mit vielen Vorkenntnissen finden die Weiterbildung dennoch bereichernd. Die Diskussionspunkte und Fragen, die sie beschäftigten, werden leider wenig in Betracht gezogen, da sie zu detailliert waren (siehe Kapitel 6.1.2.2). Um die Erfahrungen und das Wissen der Teilnehmer zu nutzen, bietet es sich an, erfahrene Teilnehmer zu Tutoren zu ernennen, die kleine Sequenzen der Weiterbildung leiten und den anderen Teilnehmern ihr Wissen und den Erfahrungsschatz weitergeben. Auch als Lernunterstützer können sie fungieren, da sie dem gesamten Prozess der Weiterbildung nicht mehr so intensiv folgen müssen, wie jemand für den das Neuland ist. Die Berücksichtigung der individuellen Erfahrungen der Teilnehmer könnte größer in die Planung mit einbezogen und als Potenzial erkannt werden.
Wird emotionalen Aspekten des Lernens die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wie kognitiven?
Der emotionale Aspekt des Lernens wird eher weniger angesprochen und ist vom jeweiligen Referenten abhängig. Eine Referentin berichtet von eigenen Erfahrungen und Geschichten unterlegt mit passenden Fotos. Durch ihre Vorträge, durch ihre Mimik und Gestik wird ihr Wissen emotional untermauert. Den Teilnehmern fällt es dadurch leichter, ihren Ausführungen zu folgen. „Erwachsene Lerner […] lernen dann wirksam und nachhaltig, wenn die ihnen zugemuteten Lernthemen etwas mit ihren eigenen „Lernprojekten“ (HOLZKAMP) zu tun haben […]“ (ARNOLD 2001, S. 27). Die Menschen verfügen über zwei Gehirne – das Kopf- und dem Bauchhirn. Das Letztere bestimmt dabei in vielerlei Hinsicht das Erste (vgl. ebd., S. 26). Durch die Verknüpfung von Kognition und Emotion gestalten sich Lernprozesse einprägsamer. Solche Momente werden sich vermehrt gewünscht. Bei der Kombination mancher Referentenpaare werden emotionale Aspekte des Lernens eher weniger angesprochen, sodass das Modul ausschließlich kopflastig ist: „Drum sind wahrscheinlich auch gerade die Module, wenn ich und S. zusammen kommen, die die am sprachlastigsten und am wenigsten kreativ sind“ (Interview 46).
Wird die gesprochene und geschriebene Sprache für alle zugänglich gemacht? Werden wesentliche Fachbegriffe erklärt und angewandt?
Der Aspekt Sprache und Verständlichkeit wird immer kritisch betrachtet. Viele Teilnehmer beschweren sich sowohl in den Evaluationsbögen und Umfragen als auch in den Interviews, dass die Weiterbildung sich zwar den Stempel leichte Sprache aufsetzt, dies jedoch nicht erfüllt[7]. „Was ich schon mehrfach hatte, ist, dass ich gesagt habe, wir haben hier keine leichte Sprache, und das ist bei einzelnen Dozenten schnell so. […] Und das wurde echt nicht gut beachtet. […] Auch so die PowerPoints, die wir kriegen, die sind nicht in leichter Sprache. Auch die Materialien und Vorträge [nicht, d.V.]“ (Interview 47).
Manche Referenten versuchen ihre Power-Point-Präsentationen in einfache Sprache zu transferieren, was nicht immer gelingt: „Ich versuche, wenn ich was erzähle, es auch noch einmal einfacher zu sagen, als auf den Folien. Ich merke aber, dass solche Leute wie C. und K. […] da geht auch vieles an denen vorbei. Ich hoffe, dass durch den Wechsel [der Methoden, d.V.] […] ein bisschen auffangen [zu, d.V.] können“ (Interview 48). Beispiele von Fremdwörtern sind: desolate Zustände, Metakommunikation, Portfolio, U-Prozess u.v.m. Teilweise fordern Teilnehmer die Erklärung der Wörter ein, oft jedoch hören sie den Vorträgen der Referenten einfach nur zu. Auch Erklärungen fallen den Referenten nicht leicht: „Und gerade ich bin jemand, ich weiß, ich kann nicht ganz leicht sprechen, kann ich nicht“ (Interview 49). Sowohl People First, als auch die Europäische Vereinigung der ILSMH bieten Kurse zur Übung in leichter Sprache, als auch Übersetzungen von Texten und Materialien an[8]. Diese bieten sich an, im Vorfeld zu besuchen und sich fehlende Kompetenzen anzueignen. Die Referenten bemühen sich Angeboten in einfacherer Sprache zu machen, bzw. Arbeitsblätter in leichter Sprache zu verteilen. Dies wird von vielen Personen in den Umfragen gelobt.
Der Zugang zur Sprache ist nicht immer barrierefrei. Nach jedem Modul kommt die Rückmeldung, dass die gesprochene und geschriebene Sprache zu schwer sei und dass man sich größere Schrift auf den Power-Point-Folien wünsche. Im dritten Grundkurs gibt es einen Teilnehmer mit einer Sehbeeinträchtigung, der sowohl größere Power-Point-Präsentationen als auch Arbeitsblätter mit größerer Schrift benötigt. Die Präsentationen sind meist in Schrittgröße 28 gehalten. In vielen aussagekräftigen Grafiken allerdings liegt sie zwischen 11 und 18.
Ein Referent aus Wien berichtet, dass sich seine Teilnehmer sofort zu Wort melden würden, wenn sie etwas nicht verstehen und Begriffe erklärt bekommen haben wollen. Ihr kontinuierlicher Kursbegleiter weiß, dass die Teilnehmer auf ihn zukommen und: „[…] sagen, es geht nicht […] und fordern das dann ein. […] Und da haben wir eine extra Runde gemacht. […] Und ich glaube, dass man auch jedes Fremdwort erklären können muss, ich merk es ja bei mir immer wieder selbst. Aber die Leute in Wien sagen sofort Stopp, wenn mir das passiert, da kann ich mich darauf verlassen. Ich kann jetzt so ungefähr mit ihnen reden, wie ich mit dir spreche […]“ (Interview 50). In Eutin ist das leider nicht zu beobachten, obwohl die Teilnehmer oft aufgefordert werden. Diese Heranführung an aktive Beteiligung und Einforderung von Rechten ist ein Prozess. Eine Referentin bemerkt bei den Teilnehmern mit Beeinträchtigung, die aus institutionellen Hintergründen stammen, häufig eine resignative Zufriedenheit. Das Heranführen zu Selbstvertretern dauert Zeit (siehe Kapitel 6.2.2.1).
Können Teilnehmer ihre Arbeitsergebnisse auf unterschiedliche Weise vorstellen, indem sie Zeichnungen, Fotografien und Kassetten ebenso wie geschriebene Texte anfertigen?
Die Möglichkeit der unterschiedlichen Ergebnispräsentation ist gegeben. Manche Teilnehmer erfüllen Aufgaben, indem sie die Ergebnisse grafisch gestalten. Andere bevorzugen die Textvariante und manche mischen beide Formen. Auch in den Portfolios gibt es die Möglichkeit, Planungen, die man begleitet, auf Video aufzuzeichnen oder zu fotografieren. Ein Teilnehmer berichtet über seine Zukunftsplanung in Form einer Fotopräsentation, andere bevorzugen die Story-Telling Variante.
Fördert die Weiterbildung den Dialog zwischen Referenten und Teilnehmern und ebenso wie unter den Teilnehmern selbst?
Die Kommunikation – das in Kontakt treten miteinander – wird durch die Weiterbildungsstrukturen begünstigt. Die Teilnehmer haben durch die offen angelegten Strukturen die Möglichkeit, in den Austausch mit anderen zu treten. Die Arbeitsphasen der Module, das gemeinsame Mittagessen und die Pausen sind so gestaltet, dass man mit anderen Teilnehmern in Beziehung tritt. Auch auf die Referenten gehen die Teilnehmer zu oder umgekehrt. Dadurch entstehen Kontakte und Kooperationsfelder. Manche Referenten finden so bereitwillige Teilnehmer, die ein Seminar zur Persönlichen Zukunftsplanung halten wollen oder Teilnehmer untereinander starten gemeinsame Projekte.
Der Dialog im Bereich der Wissensvermittlung kommt vielen zu kurz. Hier findet eher eine einseitige Kommunikation seitens der Referenten statt, die das Plenum öfter einbeziehen kann. Einigen Referenten gelingt das sehr gut, sodass Diskussionen entstehen und eigene Erfahrungen präsentiert werden können.
Helfen die Einrichtung des Raumes, Ausstellungen und andere Ressourcen beim eigenständigen Lernen?
Der Weiterbildung stehen drei Räume und der Außenbereich zur Verfügung. In Raum Nummer 1 sind Tische und Stühle in U-Form angeordnet (Abb. 34). Hier finden meist theoretische Inputs statt. Im zweiten Raum befinden sich zahlreiche Stühle, die in einem Kreis aufgestellt sind (Abb. 35). Der dritte Raum bietet die Möglichkeit für die Arbeit an Sechser-Tischen (Abb. 36). In der Außenanlage gibt es einen Tisch, Bänken und Sitzmöglichkeiten um das Gewässer (Abb. 38). Durch diese Vielfalt an Räumlichkeiten ist eigenständiges Lernen in einer großen Gruppe gut möglich. Die Personen können sich auf die Räume aufteilen und haben so genügend Patz und Ruhe, um miteinander arbeiten zu können.
Die Ausstattung der Räume und der Weiterbildung ist erstklassig. Technischen Medien, wie Laptop, Beamer und Musikanlage als auch Ständerwände, Stifte, Papier, Wandtafeln, Flipchart und Magnete, sind vorhanden. Alle Mittel können zur Erfüllung von Aufgaben oder bei den Übungen genutzt werden. Somit ist ein eigenständiges Lernen möglich.
Weitere Ressourcen zum eigenständigen Lernen wären evtl. ein vor Ort vorhandener Computerpool oder weitere Open-Space-Phasen.
Für eine Teilnehmerin sind die gestellten Arbeitsaufträge „[…] ein wirklicher Kritikpunkt. […] Manche [sind, d.V.] überhaupt nicht präzise formuliert worden; es gab manche Momente hier im Kurs, […] die total unklar waren, und die für ganz viel Chaos gesorgt haben. […] Ich finde es gut, wenn es auch Aufträge schriftlich gibt. […] Das wäre eine große Anregung, dass man diese Aufträge einfach viel klarer hält, viel strukturierter, was im Übrigen gerade für die Menschen mit Lernschwierigkeiten hier noch viel wichtiger ist, als vielleicht für mich. Und selbst ich fand es oft genug verwirrend“ (Interview 51). Durch schriftliche formulierte Arbeitsaufträge, Visualisierungshilfen oder Auftragskärtchen ist eigenständigeres Lernen besser zu realisieren.
Wird mit den Teilnehmern darüber beraten, welche Unterstützung sie brauchen?
Aus den Beobachtungen ergibt sich die Erkenntnis, dass die Referenten wenig mit den Teilnehmern über die Art und den Umfang von benötigter Unterstützung reden. Es entzieht sich meiner Kenntnis, inwieweit die begleitenden Personen mit ihnen über das Thema sprechen. Der mangelnde Unterstützungspunkt wurde bereits in Kapitel 6.2.2 benannt.
Ich halte es für wichtig, gemeinsam herauszufinden, welcher Unterstützung es bedarf. Dazu dienen runde Tische, die zum Gespräch einladen oder Dialoge zu zweit. Auch das Erproben verschiedener Systeme (Lernunterstützer, Tutorensystem, Referenzgruppe oder Mentoren) bieten sich an, um anschließend festzustellen, welche Unterstützung für jeden individuell geeignet ist. Ebenfalls über technische und organisatorische Unterstützung kann gemeinsam nachgedacht werden. Beobachtungen, Evaluationsbögen und Interviews zeigen auf, dass manche Teilnehmer größere Schrift, weniger Power-Point-Präsentationen und leichtere Sprache benötigen. Auch das sehe ich als eine Unterstützung zum eigenständigen Lernen an.
Fühlen sich die Teilnehmer verantwortlich dafür, anderen in der Weiterbildung bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu helfen?
Dieses Verantwortungsgefühl tritt bei einigen Teilnehmern auf – vor allem gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung. Bei manchen nimmt es überhand, sodass eigene Lernprozesse darunter leiden. Bei Situationen, in denen man sieht, dass Menschen Hilfe brauchen, bietet man sie gern an, so z. B. beim Ausfüllen der Evaluationsbögen oder Umfragen. Dieses Verantwortungsgefühl gegenüber anderen erachte ich als gut, da man so zu einer sich gegenseitig helfenden Gemeinschaft heranwächst. Problematisch wird es hingegen, wenn das ‚eigene Ich‘ zu kurz kommt. Dazu dienen klare Aufgabenverteilungen und Grenzen. Lernunterstützer könnten dies abmildern.
Wird Teamteaching immer auch als Möglichkeit genutzt, gemeinsam das Lernen der Teilnehmer zu reflektieren?
Die Situation des Teamteaching wird von allen Teilnehmern als bereichernd angesehen. Eine Teilnehmerin „[…] fand es gut, [dass, d.V.] S. [sich, d.V.] für bestimmte fachliche Inhalte immer nochmal einen zweiten Fachmenschen dazu geholt [hat, d.V]. […] Alleine ist das, glaub ich, schwierig“ (Interview 52).
Um dem Inklusivitätsgedanken näher zu kommen sind zwei Referenten förderlich. Auch die kontinuierliche Begleitung wird positiv aufgenommen. Dennoch haben sich einige Teilnehmer vermehrt Kontakt zu den anderen Referenten gewünscht, die nur punktuell anwesend sind.
Durch das gemeinsame Auftreten und Auswerten der Prozesse im Entwicklerkreis können die Referenten die Weiterbildung reflektieren. Um das Lernen der Teilnehmer zu reflektieren, dient das Portfolio, was für alle Entwickler zugänglich ist. Gleichwohl kann eine Einschätzung der einzelnen Teilnehmer fast ausschließlich nur über den kontinuierlichen Kursbegleiter erfolgen, da er mit ihnen über die gesamte Weiterbildung in Kontakt ist.
Können alle Teilnehmer an Aktivitäten teilnehmen, die ihnen zusagen? Ist eine Transportmöglichkeit vorgesehen, um Teilnehmer, die von weit her kommen oder in der Mobilität eingeschränkt sind, die Teilnahme an Nachmittagsaktivitäten zu ermöglichen?
Prinzipiell können alle Teilnehmer an den weiterbildungsunabhängigen Tätigkeiten, wie Abendessen, Einkaufsbummel, Baden in der Ostsee oder Fußball Gucken, teilnehmen. Einige Teilnehmer unternehmen nach jedem Modul etwas gemeinsam. Hierzu sind auch die Familienangehörigen herzlich eingeladen, was ein festes Gruppengefühl entstehen lässt.
Größtenteils setzt sich die Gruppe immer aus denselben Personen zusammen. Andere Teilnehmer können auf Grund anderer Verpflichtungen am Wochenende nicht kommen oder sind vom Seminar, den langen Tagen oder der bevorstehenden Heimfahrt her nicht mehr gewillt zu kommen. Transportmöglichkeiten werden immer durch Fahrgemeinschaften oder öffentliche Verkehrsmittel organsiert.
Aus der Analyse der Daten geht hervor, dass das eingesetzte Material dem Lernbereich der Erwachsenenbildung entspricht. Die Kritiken eines Teilnehmers sind ernst zu nehmen. Durch zahlreiche Sozialformwechsel und verschiedene Aktivitäten, wie Zeichnen, Diskutieren oder praktische Arbeiten, wird die Weiterbildung inhaltlich aufgelockert. Das Lernen wird durch verschiedene Formen und Aktivitäten begünstigt. Dennoch besteht hier Entwicklungspotenzial. Eine Berücksichtigung der verschiedenen Erfahrungshintergründe der Teilnehmer findet in Teilbereichen statt. Eigenpräsentationen der erfahrenen Teilnehmer können genutzt werden. Referentenabhängig werden Lernprozesse emotional gestaltet. Dabei werden die Teilnehmer von den Geschichten gefesselt und begeistert. Sie sind sich einig, dass emotionales Lernen in die Tiefe geht und dadurch leichter zugänglich ist. Dennoch gibt es Referenten, denen diese Form unzugänglich bleibt. Die Arbeitsergebnisse können und werden in unterschiedlicher Art und Weise präsentiert. Dabei werden Fotos, Zeichnungen, Grafiken oder schriftliche Dokumente genutzt. Durch die offene Struktur der Weiterbildung ergeben sich viele Möglichkeiten gemeinsam in Beziehung zu treten. Die Auswahl zwischen vier Örtlichkeiten begünstigt selbstständiges und individuelles Lernen. Das Verantwortungsgefühl einiger Teilnehmer gegenüber ‚Schwächeren‘ ist während der Weiterbildung zu beobachten. Es darf die eigenen Lernprozesse jedoch nicht blockieren. Als angenehm empfinden die Teilnehmer die Teamteaching-Situation. Durch die Anwesenheit von zwei Referenten sind einzelne Teilnehmer und Gruppenprozesse besser im Blick. Bei weiterbildungsunabhängigen Aktivitäten ist eine rege Beteiligung festzustellen. Hier werden Fahrdienste oder Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen.
Weiterhin im Blick sollte der Punkt der Qualitätsbefragung sein. Diese wird zwar unternommen, aber auf Anmerkungen der einzelnen Module wird kaum eingegangen. Um Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe abzubauen, ist es nützlich, die Teilnehmerbedürfnisse mehr in den Fokus zu rücken. Dies gelingt nur ansatzweise. Die Referenten der Weiterbildung könnten sich in der Gestaltung mit leichter Sprache üben und ihre Vortragsweise, Arbeitsaufträge und Materialien danach ausrichten. Ein wichtiger Punkt, der häufig bei der Weiterbildung aufgetreten ist, ist der Themenschwerpunkt der Unterstützung. Unterstützung ist, in Absprache mit der zu unterstützenden Person, zu mobilisieren. Gemeinsam mit Teilnehmern, Begleitpersonen oder Referenten bestimmt sie, in welchem Maß und Umfang sie der Unterstützung bedarf. Gespräche darüber sind maßgebend, um auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zu reagieren.
Folgende Prioritäten der dritten Dimension gilt es in das Weiterbildungsprogramm einzuarbeiten:
-
In der Weiterbildungsplanung ist der Abbau von Hindernissen für das Lernen bedacht.
-
Die Weiterbildung wird in leichter verständlicher Sprache geführt. Auch Materialien entsprechen den Standards von leichter Sprache.
-
Das Thema Unterstützung wird gemeinsam mit der betroffenen Person besprochen.
In Anlehnung an die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a werden hier einige Indikatoren aus dem Bereich ‚Ressourcen mobilisieren‘ thematisiert.
Geben Teilnehmer, die z. B. ein bestimmtes Problem überwunden haben, ihren Erfahrungen an andere weiter?
Viele Teilnehmer planen außerhalb der Weiterbildung ihre Zukunft weiter. In den folgenden Modulen sprechen sie über überwundene Hindernisse, gemachte Erfahrungen und die aktuelle Situation. Im letzten Modul werden Zeitfenster eingebaut, die es Teilnehmern ermöglichen, andere an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. So berichtet einer von seiner erfolgreichen Zukunftsplanung an Hand einer Fotopräsentation. Auch er benennt Probleme: So seien zwei Freunde von ihm trotz Einladung nicht gekommen. Ein anderer Teilnehmer berichtet ebenso von seiner Planung und das er wenig Hoffnung auf die Realisierung seines Traums habe, weil seine Eltern diesen nicht teilen. Sie lassen einen sowohl an überwundenen als auch an momentan noch bestehenden Problemen teilhaben. In einer aus vielen verschiedenen Menschen bestehenden Weiterbildungsrunde kann sich die Möglichkeit ergeben, noch bestehende Probleme gemeinsam anzugehen. Die Weiterbildung bietet sowohl intern als auch extern viele Gelegenheiten, um über seine eigene Situation zu sprechen.
Gibt es angemessen angepasste Materialien, z. B. in Großdruck, Brailleschrift oder als Hörkassette, für Teilnehmer mit Beeinträchtigung?
Die Materialaufbereitung ergibt wenig Differenzierung. Es gibt Arbeitsblätter in leichter Sprache, aber Materialien in Großdruck, Audioformat oder filmische Darstellungen fehlen. Um eine inklusive Weiterbildung zu werden, bedarf es einer unterschiedlichen Aufarbeitung der Inhalte. Eine Referentin berichtet von ihren Erfahrungen mit verschiedenen Materialien aus einem inklusiven Kurs „[…] in den USA [den ich, d.V.] mit begleitet habe, der inklusiv lief und ich find der lief super inklusiv. […] Da lernen Eltern, Angehörige und Menschen mit Behinderung […]. Es gab zu jedem Themenblock irre viel Lesematerialien, das gab es komplett, dazu gab es Fragestellungen, kleinere Hausaufgaben, man musste nicht alles lesen. Es gab Lesematerialien, das sozusagen genannt wurden als, ‚die sind absolut wichtig gelesen zu haben‘. Das Ganze gab es in einer vereinfachten leichten Spracheversion und auf Kassette. Das heißt, Leute konnten sich auswählen, was sie lesen und konnten die Fragen, die die Thematik vorbereiten, und in dem Kurs selber war dann praktisches Arbeiten, praktisches Ausprobieren und ein paar Vorträge.“ Auf die Frage hin, ob das Vorbereiten der Inhalte funktionierte, antwortete die Referentin: „Ja. Und der Kurs war von dem Zeitaufwand her […], der war immer Freitag bis Samstag, also war vom Umfang her ähnlich wie wir es jetzt in Ostholstein hatten. […] Da waren nicht lesende Leute dabei, da waren nicht sprechende Leute dabei, und es war richtig, richtig gutes gemeinsames Lernen. Aber, und das ist mein ‚aber‘ dran, ich hatte eine Stelle, und circa 40% meiner Stelle waren das Aufbereiten dieser Sachen. Also das waren das Aufbereiten des Schriftlichen, […] das auf Kassette zu kriegen und das war das Vorbereiten mit den Leuten mit Behinderung, mit der Unterstützung der Leute mit Behinderung. Die haben alle, und das war Voraussetzung bei diesem Kurs, die mussten alle eine Unterstützungsperson vor Ort haben, die mit ihnen arbeitet. Die musste nicht mit zum Kurs kommen. Aber die mussten vor Ort jemanden haben. […] Also das war auch Arbeit und Aufwand, aber dadurch hat es auch geklappt. […] Das geht nur, wenn du wirklich die Stunden dafür hast“ (Interview 53).
Die Materialaufbereitung und deren Aufwand werden von einigen Referenten als eine Herausforderung angesehen, die sehr zeitintensiv ist. Dennoch bringt sie eine inklusive Weiterbildung bedeutend näher und ist daher unabdinglich. Hierfür bedarf es der Mobilisierung weiterer Ressourcen in Form von Helfern. Die Frage der Finanzierung bleibt in dem Fall offen. Am Ende der Arbeit werden ‚Schlüsselbarrieren‘, wie der zeitliche Aufwand und die Finanzierung, noch einmal beleuchtet.
Dieser Bereich zeigt, dass es den Teilnehmern ermöglicht wird, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen. Sie können über überwundene als auch bestehende Probleme berichten. Die Begegnungen auf Augenhöhe finden in der Weiterbildung – zu Freuden vieler Teilnehmer – statt (Abb. 38). Die Aufbereitung der Materialien bedarf weiterer Handlungsschritte. Hier besteht Bedarf, der inklusives Lernen besser ermöglichen würde. Unterstützend für das Lernen wäre es, wenn die Materialien in leichter Sprache, in Bildstrecken, als Audiodatei, mit größerer Schrift oder gegenständlicher vorhanden wären. Auch ein differenziertes Angebot – nicht alle bedürfen alles – bietet sich an. So gibt es verschiedene Materialien, die zur Vor- und Nachbereitung dienen.
Die Priorität des Bereichs ‚Ressourcen mobilisieren‘ lautet:
-
Die Materialien liegen in verschiedenster aufgearbeiteter Form (Brailleschrift, Großdruck, Bildstrecke, Audioformat, Sprachausgabe, leichter Sprache usw.), ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmer, vor.
Aus den Betrachtungen der einzelnen Indikatoren ergibt sich, dass das Material dem des Erwachsenenbildungsbereichs Größenteils entspricht. Dass hier die Gestaltung zu meist von den unterschiedlichen Stilen der Referenten abhängig ist, ergibt sich von selbst. So spricht das ein oder andere Modul manchen Teilnehmern mehr und manchen weniger an. Die Bewertung der Materialien erfolgt subjektiv. Die Mehrheit findet den Einsatz der Playmobilfiguren sehr lohnenswert und würde ungern darauf verzichten. Dennoch muss die Stimme eines einzelnen Teilnehmers, dem dies zu kindlich erscheint, beachtet werden.
Durch den Wechsel der Sozialformen und die praktischen Übungen werden Lerninhalte vertieft und intensiver behandelt. Vor allem die Übungen mit den Materialien oder das Ausprobieren stoßen auf positives Feedback. Laut Anmerkungen seitens der Referenten, Teilnehmer und der wissenschaftlichen Begleitung könnten in die Weiterbildung weitere Phasen des eigenständigen Tuns eingebaut und weniger Inhalte frontal durch Power-Point-Präsentationen vermittelt werden (Abb. 39).
Das Spektrum von ‚wenig‘ bis ‚viel‘ Wissende im Themenbereich ‚Persönliche Zukunftsplanung‘ ist sehr weit gefasst. Die Erfahrungen und das Wissen aller Teilnehmer sollten Eingang in die Seminargestaltung finden.
Emotionale Aspekte vom Lernen werden beim Präsentieren von fesselnden Geschichten angesprochen und sind für die Gruppe tiefsinniger und leichter zugänglich. Solche Inhalte bekommen eine subjektiv geprägte Bedeutsamkeit.
Bei der Präsentation der Arbeitsergebnisse ist Vielfalt gewünscht und zugelassen. Sowohl Zeichnungen, Fotos, schriftliche Verfassungen oder Grafiken werden gern angenommen.
Die Veranstaltungsräume liegen im Komplex der Ostholsteiner Behindertenhilfe und sind somit barrierefrei für Rollstuhlfahrer zugänglich. Die Räume sind groß und mit einer Glasfront versehen, was sie hell und freundlich erscheinen lässt. Insgesamt stehen drei Räume und ein Außenbereich zur Verfügung.
Durch mangelnde Unterstützung für verschiedene Personen wächst ein Verantwortungsgefühl einiger Teilnehmer, das aber ihr eigenes Lernen eingeschränkt. Durch mobilisierte Unterstützung könnte man dies evtl. umgehen.
Die Situation des Referenten-Teams wird immer hoch gelobt. Den Teilnehmern gefällt das Lernen mit zwei Referenten an ihrer Seite. Durch die Anwesenheit von zwei Personen sind einzelne Teilnehmer und Gruppenprozesse mehr im Blick.
An Aktivitäten nach der Weiterbildung partizipieren viele Teilnehmer. Sie genießen dies und freunden sich an. Um Außerorts Zusammenkünfte zu ermöglichen, werden Fahrdienste oder Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen.
Sowohl die wissenschaftliche Begleitforschung als auch die Untersuchung der Inklusivität an Hand dieser Arbeit decken erhebliche Entwicklungsschritte auf. Diese zeigen sich in der Qualitätsbefragung der Weiterbildung, die zwar unternommen, dennoch nicht beachtet wird. Die Evaluationsbögen werden stets in ihrer Gesamtheit ausgewertet und auf ‚moodle‘ gestellt, dennoch finden die Vorschläge und Kritikpunkte der Teilnehmer keine Umsetzung. Durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse in der Planung der Weiterbildung werden Hindernisse für das Lernen abgebaut. Auf die Bedürfnisse der Teilnehmer gilt es einzugehen, so geht man einen großen Schritt in Richtung Inklusivität. Hindernisse für das Lernen wurden vielseitig genannt:
-
Power-Point-Präsentationen in schwer verständlicher Sprache,
-
zu viel frontale Wissensvermittlung,
-
zu lange und intensive Arbeitsblöcke,
-
zu wenig Alternativangebote und
-
zu wenig Pausen.
Durch die Gestaltung der Weiterbildung in leichter Sprache könnten Verständigungsproblematiken abgebaut werden. In dieser Art und Weise zu referieren bedarf es an Übung.
Auch der bereits thematisierte Punkt der Unterstützung wird in dieser Dimension wieder aufgegriffen. Gemeinsam mit der zu unterstützenden Person und einem Unterstützungssystem gelingt das Lernen besser. Ein weiterer noch zu verbessernder Punkt ist die Aufbereitung der Materialien in verschiedenster Art und Weise. Unterstützend für das Lernen wären Materialien in leichter Sprache, in Bildstrecken, als Audiodatei, als Filmversion, mit großer Schrift oder gegenständliche Materialien. Auch die Auswahl der Materialien ist entscheidend, da nicht jeder alles benötigt: Einige sind für alle gedacht und andere bedienen verschiedene Interessengruppen. Andere dienen dem Vor- und Nachbereiten der Weiterbildung mit einem jeweiligen Unterstützer oder einer Unterstützergruppe. Folgende Prioritäten entnehme ich der Analyse für die dritte Dimension:
-
In der Weiterbildungsplanung wird der Abbau von Hindernissen für das Lernen bedacht.
-
Die Weiterbildung wird in leichter verständlicher Sprache geführt. Auch Materialien entsprechen den Standards von leichter Sprache.
-
Das Thema Unterstützung wird gemeinsam mit der betroffenen Person besprochen.
-
Die Materialien liegen in verschiedenster aufgearbeiteter Form (Brailleschrift, Großdruck, Bildstrecke, Audioformat, Sprachausgabe, leichter Sprache usw.), ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmer, vor.
Die Beschreibung der vergangenen Dimensionen spiegelt das Bild der Weiterbildungssituation in Eutin aus verschiedenen Betrachtungswinkeln wider. Deutlich wird dabei, dass die drei Dimensionen ein in sich gewebtes Netz darstellen und sich gegenseitig bedingen, weil viele Indikatoren und Fragen übergreifend wirken. Die Betrachtung einer einzelnen Dimension erübrigt sich, da sie in Wechselbeziehung zu einander stehen und nur in ihrer Gesamtheit Bedingungen für inklusive Prozesse geschaffen werden können.
Mir ist – wie im Index beschrieben – bewusst geworden, dass die Dimension ‚Inklusive Kulturen schaffen‘ das Fundament von inklusiven Prozessen bildet, da es einer willkommenen und herzlichen Atmosphäre bedarf, um darauf aufzubauen. Selbst wenn zahlreiche Ressourcen für das Lernen mobilisiert wären, würde eine inklusive Weiterbildung in einem nicht toleranten Umfeld nicht zu Stande kommen. Die Weiterbildung in Eutin kann bereits auf dem Aspekt der ‚Inklusiven Kulturen‘ aufbauen, da sie schon ansatzweise implementiert worden sind. Weitaus mehr Entwicklungspotenzial besteht in den Dimensionen der Strukturen und Praktiken. Die hierzu erstellte folgende Grafik verdeutlicht, welche Aspekte bereits verwirklicht wurden und welche nur ansatzweise Eingang gefunden haben (Abb. 40). Auch die Prioritäten, an denen es zu arbeiten gilt, zeigt sie auf.
Wichtig dabei ist das Verständnis, dass man Schritt für Schritt anfängt und nicht gleich versucht alles umzusetzen und zu verbessern. In der Erwartungshaltung der Beteiligten spiegelt sich teilweise wider, dass sich alles sofort verändern sollte. Aus diesem Grunde muss betont werden, dass der Sinn der Analyse darin besteht, einzelne Prioritäten auszuwählen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 33ff).
Die Zusammenfassung deckt nochmals bereits realisierte und noch zu realisierende Punkte auf. Dabei werden Elemente von inklusiven Weiterbildungen abgeleitet.
|
Inklusive Kultur schaffen |
Inklusive Strukturen etablieren |
Inklusive Praktiken entwickeln |
|
|---|---|---|---|
|
Bereits realisiert |
|
|
|
|
Ansatzweise realisiert |
|
|
|
|
Priorität in der Umsetzung |
|
|
|
Quelle: Eigenerstellung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Weiterbildung eine wertschätzende und von respektzeugende Gemeinschaft existiert. Die Teilnehmer sind einem freundlich zugewandt, das Begegnen auf gleicher Augenhöhe und die ständige Hilfsbereitschaft werden positiv aufgenommen. Aus der Hilfsbereitschaft entsteht bei manchen Teilnehmern schnell ein Gefühl von Verantwortung, das im gewissen Maß positiv ist. Dieses Gefühl darf jedoch nicht die eigenen Lernprozesse blockieren und zu weit ausufern. Auch die Möglichkeit im Anschluss gemeinsam etwas zusammen zu unternehmen, wird von einigen Teilnehmern, Referenten und Familienmitgliedern angenommen. Hier werden immer Möglichkeiten des Transports geschaffen. Dennoch ist es wichtig, auch den einzelnen Stimmen Gehör zu verschaffen, die in manchen sozialen Situationen Distanzen zu Menschen mit Beeinträchtigung wahrnehmen. Es bedarf an dieser Stelle einer genauen Beobachtung und Analyse. Durch die Begegnungen im zwischenmenschlichen Raum ist es selbstverständlich, dass man nicht mit jedem auskommen kann, aber Ausgrenzung eines Einzelnen durch die gesamte Gruppe ist zu vermeiden. Als Elemente für die Schaffung von inklusiver Weiterbildung leite ich hieraus ab: ‚Die Begegnungen finden auf Augenhöhe statt und zeugen von Respekt, Wertschätzung und Anerkennung‘, ‚Hilfsbereitschaft untereinander ist selbstverständlich‘ und ‚Möglichkeiten an weiterbildungsunabhängigen Tätigkeiten teilzunehmen, werden realisiert‘.
Die Weiterbildung ist so anlegt, dass sie dem Wissenserwerb und dem Aufbau von sozialen Kontakten gleichviel Bedeutung zumisst. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um eine Gemeinschaft aufzubauen. Es begünstigt auch den Dialog zwischen allen Beteiligten, sodass vielfältige Beziehungen entstehen können. Auch diese Dialoge zeugen von den Begegnungen auf Augenhöhe. Ein weiteres Element für inklusive Bildung ist: ‚Der Wissenserwerb und der Aufbau von sozialen Kontakten ist gleich viel wert‘.
Die Weiterbildung folgt der Auffassung, dass Lernen ein kontinuierlicher Prozess ist, der nicht durch das Erledigen bestimmter Aufgaben verwirklicht werden kann oder bei jedem gleich aussieht. Sie räumt den Teilnehmern individuelle Zeit zum Aufbau von Denkstrukturen ein. Um diesen Prozess besser zu gestalten, bedarf es Vorerfahrungen, Wissen und Kenntnisse der Teilnehmer in die Weiterbildungsplanung einzubeziehen. Hier besteht deutlicher Entwicklungsbedarf, da die Planungen wenig auf die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer aufgebaut sind. Zu oft sind alle dem Gleichen ausgesetzt, ohne sich Inhalte oder Lernwege auszuwählen zu können. Es sind mehr Wahlangebote, die sich in Thematik, Zugangsweg und Verständlichkeit unterscheiden, notwendig. Aber auch Möglichkeiten, die ein eigenständiges Lernen sowie ein Lernen voneinander ermöglichen, sind wichtig. So treten die Teilnehmer zu selten als Lehrende auf und sind eher in der Rolle der lernenden, sitzenden und zuhörenden Person. Das Wissen, die Erfahrungen und die Kenntnisse von jedem können in diesem Prozess gut genutzt werden, um gemeinsame Lernerfahrungen zu sammeln. Zu ihnen ist es in einer heterogenen Gruppe gekommen, da eine Gruppeneinteilung nie nach Leistungsstand, Beeinträchtigung, Geschlecht oder anderem Merkmal stattfindet. Es bieten sich verschiedene Wege an: Methoden des Kooperativen Lernens, Auftritt als Tutor, Wahlangebote u.v.m. Als Elemente leite ich folgende ab: ‚Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess‘, ‚Vorerfahrungen, Wissen und Bedürfnisse der Teilnehmer werden in der Organisation bedacht‘, ‚Wahlmöglichkeiten und eigenständiges Lernen spiegeln sich wider‘, ‚Lernen in heterogenen Gruppen‘ und ‚Eigene Erfahrungen der Teilnehmer werden zum Lernansatz‘.
Die Recherche ergibt, dass es für einen Großteil der Beteiligten schwierig vorzustellen ist, wie man allen Bedürfnissen gerecht werden könne. Den optimalen Kurs zu gestalten ist sicherlich nicht möglich, aber der Versuch wird anerkannt und bringt dieses Ziel ein Stück näher. So auch die Anlegung dieses Pilotprojektes, indem sich die Referenten selbst als Lernende sehen. In BOBAN/HINZ (2008, S. 71) ist zu finden, dass es „[…] nicht das eine Modell und den einen einzig gültigen Ansatz […]“ gibt, dennoch die Gestaltung von inklusiven Bildungsprozessen ähnliche Merkmale, Werte und Grundüberzeugungen aufweisen. Dieses Zitat zeigt, dass es nie die inklusive Weiterbildung an sich geben kann und wird, jedoch tragen einige wesentliche Elemente dazu bei, inklusiver zu werden.
Durch die Präsentation aller Ergebnisse und die Ermöglichung dies auf unterschiedliche Art und Weise zu gestalten, zeigen sich inklusive Aspekte in der Weiterbildung. Durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben und deren Präsentation verspüren einige Teilnehmer einen Anforderungs- und Leistungsdruck, dem sie mit Angst gegenüber stehen. Durch drei unterschiedliche Zertifikate kommt es zur Aufmachung von Leistungsgrenzen. Einigen Teilnehmern sind die Anforderungen, die an sie gestellt werden, zu hoch und zu viel, sodass sie Ängste verspüren, dem nicht gewachsen zu sein. Bei einigen äußert sich dies im Fernbleiben der Weiterbildung für ein bis zwei Tage, um sich Zeit für die Erledigung der Aufgaben zu nehmen. Vielleicht wäre hier, wie auch an anderen Stellen in der Weiterbildung, Unterstützung notwendig gewesen. Die Weiterbildung hat kein zu erkennendes Unterstützungssystem, was auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer ausgerichtet ist. Zwar kommen einige in Begleitung, diese ist jedoch selbst aktiver Teilnehmer. Eine Beratung und Mobilisierung von Unterstützung geht einher mit einer inklusiven Weiterbildung. Möglichkeiten wären hier, einzelne Unterstützer, Mentoren, Patenschaften, Partnerschaften, Tutoren, Lernunterstützer oder die Referenzgruppe. Gemeinsam können Inhalte der Weiterbildung vor- und/oder nachbereitet werden. Hier bedarf es der Mobilisierung von barrierefreiem und altersgerechtem Material. In der Weiterbildung gibt es in Teilen Dokumente in leichter Sprache, Filmsequenzen und bildliche Power-Point-Präsentationen oder gegenständliches Material. Der Großteil von Präsentationen, Gesprächen und Diskussionen werden allerdings in schwerer Sprache geführt. Es gibt keine Audiodateien und die Schrift ist vielen zu klein. Auch moderne Technologien, wie das Medium Internet, stellen für viele eine Barriere dar. Der Einsatz von verschiedenen Medien ist lobenswert, jedoch nur, wenn sie das Lernen nicht behindern – textlastige Power-Point-Präsentationen behindern. Um die Zugänglichkeit von Informationen und die Aufmerksamkeit auf die Weiterbildung zu gewährleisten, bedarf es barrierefreiem Material, welches in verschiedenen Formaten aufgearbeitet wird. Dieses Aufarbeiten der Inhalte ist eine zeitliche, finanzielle und arbeitseingreifende Aufgabe. Die Weiterbildung benötigt dafür personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen. Um solche Hindernisse für das Lernen zu eruieren, bedarf es einer Befragung oder Evaluation. Die daraus resultierenden Daten dienen der Analyse und Umsetzung. Dies ist leider nicht der Fall gewesen, sodass man an den Kritikpunkten nicht arbeitet. Folgende Elemente bedienen einen inklusiven Kurs: ‚Präsentation aller Ergebnisse auf unterschiedlicher Art‘, ‚Es gibt keine Leistungsgrenzen‘, ‚Versagensängsten geht man entgegen‘, ‚Unterstützungssysteme sind ausreichend vorhanden‘, ‚Die Unterstützung erfolgt in Absprache mit der betroffenen Person‘, ‚Material und Sprache ist für alle zugänglich und barrierefrei‘, ‚Technologien werden zum Lernen eingesetzt‘, ‚Hindernisse für das Lernen werden eruiert und verbessert‘ und ‚die Aufarbeitung barrierefreier Materialien ist sichergestellt‘.
Die Weiterbildung steht allen Interessierten offen, weil sie keine Zugangsvoraussetzung hat. Auch die Teilnahme ist kostenlos, sodass es keinen finanziellen Hinderungsgrund gibt. Die Fortbildung präsentiert eine heterogene Lerngemeinschaft, die dennoch nicht alle Heterogenitätsdimensionen, wie Lehrer, Familie, Eltern oder Politik, abbildet. Auch das Zahlenverhältnis von Teilnehmern mit Beeinträchtigung empfinden viele zu gering. Eine Strategie, wie man Referenten mit Beeinträchtigung gewinnt, existiert. An einem Multiplikatorenkurs, zusammengesetzt aus Teilnehmern aus Wien, Prag und Eutin, nehmen sowohl Teilnehmer mit als auch ohne Beeinträchtigung teil. Sie können im Anschluss als Multiplikatoren über das Thema ‚Zukunftsplanung‘ fungieren. Die meisten Teilnehmer kommen aus institutionellen Hintergründen. Von ihnen ist wenig Bedürfnismitteilung festzustellen, eher eine ‚resignative Zufriedenheit‘. Sie melden sich kaum zu Wort. Auch wenn man ihnen das Wort gibt oder sie darum bittet, für ihre Rechte einzustehen, empfinden sie das als schwierig. Die Beispiele aus Österreich zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigung als Selbstvertreter ein anderes Auftreten haben. Sie setzten sich für ihre Rechte, Bedürfnisse sowie Interessen ein – sie fordern sie ein. Dies geschieht in Eutin noch zu wenig. Der Selbstvertreteraspekt ist ein Prozess, der nicht von heut auf morgen realisiert werden kann. So bedarf es dazu Hilfe, z. B. durch Angebote der ‚Sommerschule‘ in Ulm. Durch das Heranführen an Selbstvertreter können die Menschen mit Beeinträchtigung besser am gesellschaftlichen Leben partizipieren. Solche Weiterbildungen bieten die Möglichkeit dazu, wie ein Bespiel eines jungen Teilnehmers in Eutin zeigt, der eine positive Entwicklung machte. Elemente des Abschnittes lauten: ‚Willkommen heißen und Abbilden aller Heterogenitätsdimensionen‘, ‚Strategie zur Einstellung von Referenten mit Beeinträchtigung‘, und ‚eine Strategie zur Heranführung von Selbstvertretern‘.
Barrierefreiheit wurde in einem vorangegangenen Punkt schon einmal aufgegriffen. Dort beinhaltete das Wort allerdings barrierefreie Materialien, die das Wort Barrierefreiheit genauso einschließt wie bauliche Bedingungen. Die meisten Menschen denken bei dem Wort vordergründig an Rampen und das Fehlen von Stufen, damit das Gebäude rollstuhlgerecht ist. Diese Bedingung erfüllt der Weiterbildungsort in Eutin. Aber darüber hinaus umfasst der Begriff mehr Aspekte. Auch auf die Bedürfnisse von sehgeschädigten oder taub-stummen Menschen ist zu reagieren. Dies können z. B. durch ein Geländerleitsystem im Flur, farbliche Markierungen oder unterschiedliches Material auf dem Fußboden sein. Aber auch tief herumhängende Objekte, wie Dekoration oder Lampen, stellen eine Gefahr für nicht sehende Menschen dar. Auf solche Bedürfnisse ist die Weiterbildung nicht ausgerichtet, aber es gibt auch keine Teilnehmer für die es nötig wäre. Dennoch sollten alle Gebäude nach vorgegebenen Standards ausgerichtet sein. Ein wesentliches und offensichtliches Element ‚ist die Gestaltung von barrierefreien Räumlichkeiten‘.
Die Situation der zwei anwesenden Referenten wird als sehr positiv vermerkt. Durch die ständige Begleitung seitens des kontinuierlichen Kursbegleiters gibt es eine Vertrauensperson, die die Prozesse im Blick hat und die Gruppe kennt. Als angenehm wird die Abwechslung der anderen Referenten empfunden, jedoch hätten einige Teilnehmer gern mehr Zeit mit den einzelnen verbracht und sie nicht nur punktuell erlebt. Die Situation im Zweierteam gestaltet sich zeitweilig etwas schwierig. Die gemeinsamen Prozesse sollten durch Absprachen über jeweilige Inputs und Zeitlimits genau vorbereitet sein. Anschließend könnte eine Reflexion des Moduls erfolgen, um Diskrepanzen offen anzusprechen. Eine unparteiische Person, die den Prozess moderiert, ist dabei von Vorteil. Durch die Anwesenheit von zwei Referenten bieten sich Wahlangebote, das Teilen der Gruppe und verschiedene Aktivitäten an. Das kommt der Gruppe meist zu kurz. In Eigenaktivität verinnerlichen sie das Lernen besser und tiefgreifender. Dazu dienen auch emotionale Aspekte des Lernens, die sowohl als auch zu den kognitiven Aspekten hinzutreten. Die Balance zwischen beiden Aspekten liegt nicht vor, sodass das Reservoir an emotionalen Lernprozessen noch weiter ausgeschöpft werden kann. Während der Weiterbildung wird ansatzweise deutlich, dass Hindernisse im Lernen bei allen Teilnehmern auftreten können, weil keine Gruppenzuweisung stattfindet. Dennoch, empfindet der Großteil, dass Menschen mit Beeinträchtigungen den meistens Hindernissen für das Lernen ausgesetzt sind. Dies begründet sich aber durch die Rahmenbedingungen, wie ausschließlich theoretische Einführungen über Power-Point-Präsentationen, zu wenig Pausen, Eigenaktivität und Verständigungsprobleme auf Grund der akademischen Sprache. Diese Hindernisse treten aber, abhängig von Vorerfahrungen, Tagesform und Gemütszustand, auch bei vielen anderen Teilnehmern auf. Der Unterschiedlichkeit wird noch zu wenig Beachtung entgegengebracht. Sie ist aber eine Ressource, die zu erkennen und um den Lernprozess gemeinsam und voneinander stattfinden zu lassen, zu nutzen ist. Folgende Elemente tragen zur Inklusivität bei: ‚Zwei Referenten gestalten die Weiterbildung im gleichwertigen Auftreten‘, ‚Aktivitätswechsel begünstigt das Lernen‘, ‚Aspekte des emotionalen und kognitiven Lernens sind vorhanden‘, ‚Hindernisse beim Lernen treten bei allen auf‘, und ‚Unterschiedlichkeit ist eine Ressource, die dem Lernprozess nutzt‘.
Ein Punkt, den es weiterhin zu überdenken gilt, betrifft diskriminierendes Hänselns in Form von ‚frauenunbeachteten‘ Äußerungen. Einige Teilnehmer beschweren sich über die nicht geschlechtsgetrennte Sprache. Die Begründung für die ausschließlich männliche Verwendung von Funktionsträgern wurde durch sprachwissenschaftliche Kenntnisse untermauert, dennoch sollte man die Gefühle dieser Teilnehmer ernst nehmen und mit ihnen darüber reden. ‚Diskriminierendes Hänseln wird vermieden‘, so ein weiteres Element.
Die vorliegende Zusammenfassung zeigt, dass ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ eine inklusiv angelegte Weiterbildung ist. Es gilt Prozesse ständig zu reflektieren und zu überprüfen, um weitere Schritte umzusetzen. „Inklusive Weiterbildung in Bildungseinrichtungen verlangt vor allem, dass die Rahmenbedingungen und die Umgebung an die Lernenden angepasst werden und nicht umgekehrt. Der Anspruch der Inklusion kann und muss daher als ein kontinuierlicher Prozess der Organisationsentwicklung verstanden werden und die Veränderung und Entwicklung hin zu inklusiv gestalteten Lern- und Veränderungsprozessen möglichst alle Strukturen und Abläufe einer Bildungseinrichtung umfassen“ (GRUBER 2010, S. 147). In Eutin kann man beobachten, dass eine inklusive Weiterbildung – auch begründet durch das Thema ‚Persönliche Zukunftsplanung‘ – die Organisation ein Stück verändert. Inklusive Weiterbildungen können als Schlüssel fungieren, welcher Machtverhältnisse, Rollenverständnisse und Abhängigkeitsverhältnisse positiv beeinflusst und auflösen kann. GRILL (2005) versteht die Bildungsinstitution selbst als lernende Organisation, die sich ständigen Selbstreflexionsprozessen unterziehen muss. Dies verwirklicht man meinem Erachten nach mit der Arbeit des Index für Inklusion. Ich denke, dass die Arbeit mit ihm im Entwicklerkreis und einem Index-Team, das alle Heterogenitätsdimensionen abbildet, von Nutzen ist. Dennoch sollte man die Entwicklungsschritte vom ersten bis zum letzten Kurs anerkennen.
Nun bietet sich an, die aus meiner Analyse stammenden Prioritäten in das Weiterbildungsprogramm für nachfolgende Weiterbildungen einzuarbeiten. Folgende Punkte stellen die nächsten Handlungsschritte dar:
-
Informationen über die Weiterbildung sind allen Beteiligten zugänglich.
-
Auf Anmerkungen der Teilnehmer wird reagiert.
-
Die Teilnehmer sind keinem Anforderungsdruck ausgesetzt.
-
Die Vielfalt der Teilnehmerpersönlichkeiten wird als Ressource wahrgenommen und genutzt.
-
Die Referenten haben ein gleichgewichtiges Auftreten und verbalisieren ihre Sorgen und Ängste.
-
Wahlmöglichkeiten und Parallelangebote ermöglichen differenziertes Lernen nach den Bedürfnissen des Einzelnen.
-
Ein Unterstützungssystem sorgt für die aktive Partizipation aller Teilnehmer.
-
Die Teilnehmer sind bei Entscheidungen über Lerninhalte und methodische Wege einbezogen.
-
In der Weiterbildungsplanung wird der Abbau von Hindernissen für das Lernen bedacht.
-
Die Weiterbildung wird in leichter verständlicher Sprache geführt. Auch Materialien entsprechen den Standards von leichter Sprache.
-
Das Thema Unterstützung wird gemeinsam mit der betroffenen Person besprochen.
-
Die Materialien liegen in verschiedenster aufgearbeiteter Form (Brailleschrift, Großdruck, Bildstrecke, Audioformat, Sprachausgabe, leichter Sprache usw.), ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmer, vor.
„Der Spagat zwischen unterschiedlichen Voraussetzungen, Interessen und Lernstilen ist die zentrale Aufgabe der Gestaltung inklusiver Lernsituationen“ (HINZ/FRIES/TÖPFER 2011, S. 56). Eine Frage, die sich immer zu stellen ist, ob man den Weg der Inklusion beschreitet:
-
„Werden wir wirklich allen gerecht?“ (Interview 54)
„So bleibt die Weiterentwicklung inklusiver Kulturen, Strukturen und Praktiken eine dauerhafte Aufgabe und ein niemals endender Reflexionsprozess“ (ebd., S. 56).
[5] Bürgerzentrierte Planungsprozesse in Unterstützerkreisen in Halle/S. Fortbildung zum personen-zentrierten Denken und der Methode der Persönlichen Zukunftsplanung in Freiburg uvm.
[6] „Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie die Menschen, die eine Lernschwäche haben, wie sie in der Ausbildung unterstützt werden können. […] So eine Partnerschaft ... sie treffen sich den Vortag mit einigen wichtigen Leuten. Das würde durch alle Tagesordnung vorher gehen, es zu betrachten, auschecken, ob sie alles verstanden haben, überprüfen, ob sie irgendwelche Fragen haben. Also, wenn sie auf der Vorstandssitzung kam, fühlte sie sich besser vorbereitet. Und das schien ganz gut zu funktionieren.“
[7] Leichte Sprache kennzeichnet sich durch kurze Sätze, keine Fremd- und Fachwörter, sowie klare und große Schrift. Bilder unterstützen den Verständigungsprozess (vgl. Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. 2005-2008).
[8] siehe http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf
Inhaltsverzeichnis
Um inklusive Bildungsmöglichkeiten anzubieten, ist die Arbeit mit dem Index für Inklusion in meinen Augen unabdingbar. Gemeinsam mit allen Beteiligten der Weiterbildung bildet man das Index-Team und durchläuft die Phasen des Index, wie in Kapitel fünf beschrieben. Meine Analyse bringt wichtige Erkenntnisse, die zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen können, zum Vorschein.
Zur Untermauerung dieser Aspekte und um weitere Elemente herauszukristallisieren, die die Analyse mit dem Index für Inklusion und dem Kreativen Feld der Weiterbildung nicht abdeckt, ziehe ich weitere Literatur hinzu.
Die folgenden Schlüsselelemente werden nicht den einzelnen Dimensionen des Index für Inklusion zugeordnet. Einige, mir wichtig erscheinende Aspekte, greife ich aus der Vielzahl heraus und betrachte sie unter Hinzunahme weiterer Literatur. Dieses Kapitel hat damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Verschiedene Organisationen erstellten bereits Checklisten zur Durchführung von inklusiven Weiterbildungen. Hier ein kurzer Überblick:
-
Die Redaktion ‚impulse‘ (2005) hat einen Fragenkatalog für die Weiterbildung für Menschen mit Behinderung entworfen. Sie greift verschiedene Oberpunkte, wie Barrierefreiheit, Erreichbarkeit, Kosten, Materialien u.v.m. auf, und stellt dazu offene Fragen.
-
BIV INTEGRATIV (2007, S. 24ff) bietet eine Checkliste zu inklusiven Weiterbildungen unterteilt nach den Bedürfnissen von Menschen mit intellektueller Behinderung, Psychischer Erkrankung, Mobilitätsbehinderung, Sehbehinderung, Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit an (Abb. 41).
-
Mixed pickles erstellt einen Leitfaden für die Planung und Durchführung von barrierefreien Veranstaltungen. Dieser bietet kurze prägnante Informationen zu den Aspekten: Einladung, Räume, Assistenz, Struktur, Referenten und Essen (Abb. 42).
Barrierefreiheit ist eine erforderliche Rahmenbedingung für Inklusion – ohne sie ist Inklusion nicht denkbar (vgl. MASG 2010, S. 5/12). Zunächst einmal müssen „Barrieren wahrgenommen und sukzessiv abgebaut werden“ (BOHUSLAV 2008, S. 6).
BIV INTEGRATIV (2007, S. 4), GRILL (2005), LINDMEIER (2003b, S. 193) und das MASG (2010, S. 12) sehen in dem Begriff Barrierefreiheit weitaus mehr, als nur bauliche Barrieren. Ihr Verständnis ähnelt dem von FREHE (2003/2004, S. 22): „Entscheidend für die »Enthinderung« der Erwachsenenbildung wird es sein, in wie weit die Angebote für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sind. Hiermit sind nicht nur die bauliche Erreichbarkeit für Rollstuhlfahrer, also stufenfreie oder mit dem Aufzug erreichbare Bildungsorte gemeint. Vielmehr geht es um Fragen der blindentechnischen Aufbereitung von Lehrmaterialien, die Zur-Verfügung-Stellung von Gebärdensprachdolmetschern für Gehörlose, die Abfassung der Lehrinhalte in einfacher Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Unterrichtsteilnahme für körperlich Beeinträchtigte. Erwachsenenbildung darf sich nicht an segregierten Konzepten orientieren, sondern muss Barrierefreiheit der Angebote in einem umfassenden Sinn einlösen.“ Diesem Verständnis stimme ich zu. Folglich wird Barrierefreiheit als erstes Schlüsselelement von inklusiven Weiterbildungen aufgeführt. Trotz dessen Verständnis, dass fehlende Unterstützung, nicht gerechte Methodik und Materialien den Teilnehmern eine Barriere für das Lernen sind, werden unter diesem Punkt die baulichen Barrieren thematisiert. Folgende andere Lernbarrieren sind anderen Oberpunkten zugeordnet.
Die Selbstverständlichkeit von barrierefreier Gestaltung der Weiterbildungsräume ist in zahlreicher Literatur (vgl. BRUNNER 2005, S. 152; DROLSHAGEN/ROTHENBERG 1998; GALLE-BAMMES 2009, S. 222) zu finden. Dennoch merkt GLAUSE (2008, S. 40) an, dass es „kaum Standorte gibt, an denen die Barrierefreiheit voll und ganz gegeben ist.“ Heutige Baumaßnahmen müssen solche Standards mit einbeziehen. Es dürfen keine Gebäude mehr neu entstehen, die diesen nicht gerecht werden. Auch kleine Adaptierungen mit einfachen Mitteln können eine Einrichtung schrittweise barrierefreier machen (vgl. BIV INTEGRATIV 2007, S. 4). Kriterien für barrierefreie Gebäude sind:
-
gute Erreichbarkeit,
-
Behindertenparkplatz,
-
rollstuhlgerechte Bauweise (keine Treppen, Rampen, Hebelift, Wendekreis von 1,50m; Türbreite min. 0,85m, Gangbreite min. 1,20m),
-
behindertengerechte Sanitäranlagen,
-
Geländer-Leitsysteme,
-
Ausstattung mit einer induktiven Höranlage[9],
-
hallfreie Räume,
-
akustische Informationsausgabe in Fahrstühlen,
-
Hinweisschilder/Piktogramme/große Schrift,
-
Ausstattung mit Brailleschrift auf Türen, Fahrstuhl usw.,
-
farbige Orientierungsstreifen auf Treppen und im Gang,
-
keine bodentiefe oder von der Decke hängenden Hindernisse (Blumen, Dekoration, Lampen),
-
kontrastreiche Gestaltung,
-
einfache, klar strukturierte Gebäude, ohne viele Verwinkelungen,
-
Tische und Stühle in Höhe verstellbar und
-
Liegemöglichkeiten oder ein Ruheraum (vgl. BIV INTEGRATIV 2007, S. 8ff; DIESENREITER 2008b, S. 79; DROLSHAGEN/ROTHENBERG 1998; GLAUSE 2008, S. 40; GRILL 2005; HEUSOHN o.J.; KNITELFELDER 2008, S. 49; LINDMEIER u.a. 2000, S. 98).
Für die Teilnahme an Weiterbildungen ist die Zugänglichkeit von Informationen über sie das A und O, um potenzielle Bewerber zu gewinnen. Um alle Interessenten zu erreichen, bedarf es auch hier einer barrierefreien Gestaltung. Diese kann man gewährleisten, wenn die Ausschreibungen in leichter-Sprache-Version, Brailleschrift, Audioformat oder als Video vorliegen. Auch Bilder, Symbole, kontrastreiche Gestaltung und eine geeignete Schriftgröße helfen bei der Verständlichkeit. Wichtig ist, dass auf dem Anmeldeformular Informationen zur benötigten Unterstützung angegeben werden können. Positive Erfahrungen werden bereits mit Ankreuz-Anmeldungen gemacht, die eine Übersichtlichkeit darstellen und eine selbstständige Anmeldung ermöglichen. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, bedarf es an Vielfalt: Telefonisch, Fax, E-Mail, SMS, per Post oder persönlich (vgl. BABILON 2008, S. 68; BIV INTEGRATIV 2007, S. 10f.; DIESENREITER 2008b, S. 80; EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG 2005, S. 13; GALLE-BAMMES 2009, S. 221f.; GLAUSE 2008, S. 39ff.; HEUSOHN o.J.; LINDMEIER 2003b, S. 197).
BIV INTEGRATIV (2007, S. 4/10), EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG (2005, S. 13) und LINDMEIER u.a. (2000, S. 21) führen die Möglichkeit an, eine Ansprechperson im Verzeichnis zu vermerken. Diese Variante halte ich für gut, weil so erste Berührungsängste genommen werden können und man sich mit offenen Fragen an jemanden wenden kann. BIV INTEGRATIV (2007, S. 11) veranstaltet einen Tag der offenen Tür, der es den Teilnehmern ermöglicht, sich gegenseitig und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Auch LINDMEIER u.a. (2000, S. 98) bietet Schnupperkurse und -angebote an. So können eigene Bedürfnisse geäußert und bestehende Hindernisse bis zum Kursbeginn noch abgebaut werden.
Auch das Medium Internet wird in der einschlägigen Literatur häufig aufgegriffen. So fordern BIV INTEGRATIV (2007, S. 11), GLAUSE (2008, S. 42f.), GRILL (2005) und HEUSOHN/SCHWEITZER (2008, S. 8) die Gestaltung einer barrierefreien Website. Das Internet stellt ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit dar und sollte darum selbstverständlich für alle zugänglich sein: Mit leichter Sprache versehen, als Sprachausgabe, mit großer Schrift, übersichtlich, kontrastreich, Navigation ohne Maus, Gebärdensprachvideos und Bilder, Symbole und Piktogramme.
Durch mangelnde oder fehlgeleistete Unterstützung kann es zu einer nicht befriedigenden Teilnahme am Kursangebot oder sogar zum Abbruch kommen. THEUNISSEN (2003, S. 57) sieht die Gefahr darin, dass durch mangelnde Unterstützung sich Teilnehmer „gänzlich überfordert“ fühlen. Daher messe ich dieser Thematik große Bedeutung zu. Sie ist für mich eine wichtige Voraussetzung zur vollen Partizipation am Bildungsprozess.
Nach Ausführungen von WILDER (2007, S. 35) ist „die Notwendigkeit von Bildungsassistenz […] unbestritten.“ Auch BÜCHELER (2006, S. 219) sieht in der Bereitstellung von Assistenz den Weg zur „erfolgreiche[n] inklusive[n] Erwachsenenbildung.“ Von daher ist die Gewährleistung von Unterstützung ein wesentliches Element inklusiver Weiterbildungen.
In einem Artikel aus ‚DIE Zeitschrift‘ wird der Gedanke aufgegriffen, dass „Supportstrukturen“ die Zugangsmöglichkeiten zu Weiterbildungen verbessern können (vgl. FAULSTICH/ZEUNER 2003, S. 18ff.). Zugänglichkeit besteht also nicht nur darin, dass die Informationen, die Materialien und die Räumlichkeiten für alle erreichbar sind, sondern auch darin, dass ihnen die benötigte Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. „Für Personen mit Behinderung bedeutet dies, dass sie Unterstützung und Hilfe bekommen müssen, damit ihnen der Zugang zu Bildung und Lernen erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wird. Einrichtungen der Erwachsenenbildung müssen über konkrete Informationen und entsprechendes Know-how verfügen, wie und mit welcher Unterstützung Kursangebote möglichst barrierefrei für alle zugänglich gemacht werden können“ (BIV INTEGRATIV 2007, S. 2).
VANOLI (2009) stellt in ihrem Artikel fest, dass sich die Forderungen von Teilnehmern nach Bildungsassistenz in den letzten Jahren verstärkt haben. Dies zeigt erneut den Selbstvertretungsaspekt auf, der durch PeopleFirst und dem Empowerment-Gedanken verstärkt vorangetrieben wurde. Die GEB (2003) sieht in bereitgestellter Assistenz einen „[…] zentrale[n] Schlüssel zur Realisierung von mehr Selbstbestimmung.“ Diese Selbstbestimmung wird unter anderem durch die Mitbestimmung über die benötigte Assistenz erreicht. Zahlreiche weiterführende Literatur belegt diesen Grundgedanken: „[…] Kernpunkte dieses Ansatzes sind, daß der Hilfeabhängige sich die AssistentInnen aussucht, sie anleitet, unter seinen Vorstellungen einsetzt und bezahlt“ (STEINER 1999). Auch in BABILON (2008, S. 66f.), DROLSHAGEN/ROTHENBERG (1998) und LINDMEIER u.a. (2000, S. 19) wird der Gedanke der gemeinsamen Entscheidung aufgegriffen. Bloße Vermutungen über die zu leistende Unterstützung, können oft zu ungenügender oder falscher Assistenz führen (vgl. BABILON 2008, S. 66f.).
Aufgaben der Assistenz variieren sehr nach den Bedürfnissen der zu unterstützenden Person. So gibt es lediglich Transportassistenz, die die Teilnehmer zum Kursort bringen und wieder abholen. Also am Kursgeschehen nicht teilnehmen, als auch Assistenz, die dem Kurs als Teilnehmer angehört und unterstützende Aufgaben übernimmt. In ihrer Diplomarbeit ‚Von der Verwahrung zur Selbstermächtigung. Perspektiven der Erwachsenenbildung von und für Menschen mit geistiger Behinderung‘ beschreibt VANOLI (2009) weitere Aufgaben der Lernassistenten:
-
Unterstützung bei der Umsetzung von Lerninhalten,
-
Vermittlung zwischen Teilnehmern und der Kursleitung,
-
Aufbereitung und Wiederholung der Inhalte und
-
didaktisch-methodische Beratung der Kursleitung.
Ein Beispiel aus England zeigt auf, dass die Assistenz „[…] Sorge dafür [trägt, d.V,], dass Material und Arbeitsplatz gut erreichbar sind, die Informationen, beispielsweise durch Vorlesen oder nochmaliges Erklären, aufbereitet werden und die Teilnehmer/innen die nötige Hilfestellung erhalten“ (LINDMEIER u.a. 2000, S.181f.). Diese Beispiele verdeutlichen, dass der Assistenz Verantwortung und zahlreiche Aufgaben zukommt. Durch diese ist die vollkommende Teilhabe des Assistenten am Kurs nicht gewährleistet. Ich empfinde es als schwierig, sowohl Teilnehmer als auch Unterstützer zu sein. Hier bieten sich vielleicht erfahrenere Personen an, die mit dem Thema schon vertraut sind oder externe Unterstützer. Ein weiteres Beispiel aus England zeigt, dass nichtbehinderte Kursteilnehmer als Begleiter (‚volunteer students‘) eingesetzt werden. Sie begleiten die Teilnehmer zum Kursort, leisten Hilfe wo nötig war und stellten ein Art Bindeglied zu den andere Teilnehmern und Referenten dar (vgl. ebd., S. 25). BABILON (2008, S. 68) beobachtet während ihrer Studien in England, dass dort Assistenz in unterschiedlicher Form erbracht wird: „Selbst mitgebrachte Assistenz, Freiwillige aus dem Kurs, Freiwillige in der Einrichtung, AssistentInnen auf Honorarbasis [oder, d.V.] von der Einrichtung fest angestellte MitarbeiterInnen.“ Auch den Themen des Peer-Counseling und Peer-Support kommt immer mehr Bedeutung zu (vgl. BOBAN/HINZ 2000, S. 21; THEUNISSEN 2009, S. 278ff). Gleichbetroffene können sich so gegenseitig unterstützen, beraten und Hilfe anbieten.
LINDMEIER u.a. (2000, S. 192) stellen fest, dass die Sicherstellung von ausreichender Begleitung sich nicht ganz einfach gestaltet. Einerseits durch den finanziellen Aspekt begründet und andererseits dadurch, dass keine genauen Vorstellungen von den zu erfüllenden Aufgaben bestehen. Letzteres kann durch Einführungsveranstaltungen, die dem gegenseitigen Kennenlernen dienen (vgl. ebd., S. 188) oder durch geschulte Assistenzagenturen umgangen werden. Einrichtungen könnten persönliche Assistenz durch Assistenzagenturen vermitteln (vgl. GEB 2003; LINDMEIER 2003b, S. 197) oder aber Kontakt zu Freizeitassistenzagenturen (ideal e.V. Halle-Saale, Assistenzagentur für Betreuung usw.) herstellen. Es bedarf eines „Pool von AssistentInnen“ (BRUNNER 2005, S. 152), dessen man sich bedienen kann. So kann individuelle Unterstützung, passend auf eigene Interessen und Bedürfnisse, sichergestellt werden.
Viele Autoren erwähnen die Möglichkeit der ehrenamtlichen Begleitung oder das Arbeiten auf Honorarbasis (vgl. BABILON 2008, S. 68; LINDMEIER 2003b, S. 197; LINDMEIER u.a. 2000, S.159/175). Beispiele aus England zeigen, dass den Assistenten die Kursgebühren und Fahrtkosten erstattet werden und sie gleichzeitig Weiterbildungsqualifikationen erhalten (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 184). Dies ist ein Beispiel der in Kapitel 6.2.2. angesprochenen Win-win-Situation. Die Erstattung der Kursgebühr ist gerechtfertigt, da der eigene Nutzen am Kurs häufig eingeschränkt ist (vgl. ebd., S. 190).
Auch in Deutschland gibt es Beispiele für gute Unterstützung. FEHRE (1998, S. 20) berichtet von der Tagung ‚Dialoge - Menschen mit Behinderung in der Erwachsenenbildung‘ in Bremen, bei der umfassende Assistenz gebührenfrei und rund um die Uhr durch Studierende des Studienganges Behindertenpädagogik der Universität Bremen zur Verfügung gestellt wurde. Auch die Beispiele von Deutscher Hochschulpolitik lassen Zuversicht spüren. DROLSHAGEN/ROTHENBERG (1998) berichten über Universitäten aus Nordrhein-Westfalen, die individuelle Fachtutorien anbieten, die Studierende mit Beeinträchtigung unterstützen. HEUSOHN (o.J.) sieht Möglichkeiten in der Gewinnung von Assistenten über den Bereich der Studierenden oder Auszubildenden von Pädagogik oder ähnlichen Fachbereichen.
Wichtig ist, dass Menschen, die Unterstützung bedürfen, diese nicht aus verschiedenen Gründen (Finanzierung, Verfügbarkeit, Kenntnisse) verwehrt wird. Ein ausdifferenziertes Unterstützungssystem, auf das man zurückgreifen kann, könnte durch Assistenzagenturen oder Vereine aufgebaut werden. Ebenso besteht die Möglichkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit.
„Ziel muss somit die uneingeschränkte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an allgemeinen Bildungsangeboten unter Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung sein“ (HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 6). Die GEB (2003) sieht in Assistenz den „[…] Schlüssel zu einer integrativen Bildung.“
Die diesbezügliche Literatur ist sich einig darüber, dass inklusive Gruppen klein gehalten und stets von zwei erfahrenen Referenten begleitet werden sollten.
Die Vorstellungen über die Gruppengröße schwanken von vier bis zwölf Personen (vgl. BIV INTEGRATIV 2007, S. 13; BÜCHELER 2006, S. 219; EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG 2005, S. 13; HEUSOHN o.J.; GALLE-BAMMES 2009, S. 226; GEB 1995; GRILL 2005; HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 12; THEUNISSEN 2003, S. 68f./99). Meiner Meinung nach kann die Gruppe auch größer sein. Es ist gruppen-, referenten- und rahmenbedingungsabhängig in welcher Größe sich die Gruppe zusammensetzt. Wichtig dabei ist, dass jeder seine Lernerfahrungen machen kann und auf Grund der Größe kein Teilnehmer zu kurz kommt.
Zahlreiche Autoren erachten das Teamteaching als wichtigen Aspekt von inklusiven Bildungsangeboten (vgl. BIV INTEGRATIV 2007, S. 13; BRUNNER 2005, S. 153; EBERWEIN 1998; EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG 2005, S. 13; FEUSER 2001; GALLE-BAMMES 2009, S. 222; GEB 1995; GRILL 2005; HEUSOHN o.J.; LINDMEIER 2003a, S. 30; LINDMEIER 2003b, S. 193; THEUNISSEN 2003, S. 68f./99). „In Bezug auf die große Heterogenität der Lernenden […] ermöglicht das „Teamteaching“ die notwendige Differenzierung des Lernangebots und die Arbeit in temporären Kleingruppen, sowie die kontinuierliche Einbeziehung der Lernenden mit dem höchsten Unterstützungsbedarf“ (GALLE-BAMMES 2009, S. 222). Um allen Teilnehmern die nötige Aufmerksamkeit widmen zu können, bedarf es zwei Referenten oder eines Referenten mit einem Assistenten (vgl. HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 12).
BRUNNER (2005, S. 153), BÜCHELER (2006, S. 219), EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG (2005, S. 13); GEB (2003), HEUSOHN (o.J.); LINDMEIER (2003a, S. 30); LINDMEIER (2003b, S. 193), und THEUNISSEN (2003, S. 101ff) fordern qualifizierte, professionelle Kursleiter mit Erfahrungen im Erwachsenenbildungsbereich und im Bereich soziale Arbeit oder Behindertenpädagogik: „Didaktische und methodische Kenntnisse in behindertenpädagogischen wie in erwachsenenbildnerischen Feldern sind elementare Bestandteile der Qualifikation der Dozenten/innen“ (GEB 2003). Laut THEUNISSEN (2003, S. 101) bringt der Erwachsenenpädagoge ein notwendiges Maß an themenbezogener Sachkompetenz mit, weiß aber auch über die unterschiedlichen Assistenzformen Bescheid. Es ergibt sich daraus ein weiteres Aufgabenspektrum für den Referenten: Er fungiert als Organisator, Lehrender, Berater, Fürsprecher und Vertrauenspartner. Das Auftreten als Referentenpaar ist demzufolge ein bedeutungsvoller Gesichtspunkt von inklusiven Weiterbildungen.
„[…] Barrieren liegen […] häufig im Bereich der Methodik und Didaktik“ (GRILL 2005). Die Referenten der Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ haben „bei der methodisch-didaktischen Gestaltung […] darauf geachtet, durch vielfältige methodische Zugänge, Visualisierungen, Geschichten, Praxisbeispiele und direkter Anwendung der Methoden Persönlicher Zukunftsplanung eine lebendige Lernatmosphäre zu schaffen“ (DOOSE 2010). Die Entwickler bedienen sich dabei des Gedankens, dass keine Methode für sich inklusiv ist, sondern erst in Kombination mit anderen diesem Gedanken gerecht werden kann (vgl. GRILL 2005). Um effektives Lernen zu ermöglichen, wird die Entwicklung differenzierter Curricula gefordert (vgl. EBERWEIN 1998; MARKOWETZ 2004, S. 177). Diese sollten „[…] so flexibel und anpassungsfähig wie möglich“ (HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 12) gehalten sein. Durch die Gestaltung eines persönlichen, an den Bedürfnissen orientierten Lehrprogramms, ist eine „subjektzentrierte Orientierung an den Inhalten“ (VANOLI 2009) möglich, weil kein festgelegtes, gleichbleibendes, generalisiertes Programm für alle besteht (vgl. BIV INTEGRATIV 2007, S. 15; GRILL 2005; LINDMEIER 2003b, S. 99; SEITZ 2004, S. 215f.). Ein persönliches Curriculum führt nicht zwangsläufig zur Einzelarbeit der Teilnehmer, auch in der Gruppe können individuelle Aufgaben erledigt werden (vgl. THEUNISSEN 2003, S. 68/90).
„Unerlässlich ist die Vielfalt von Methoden […] und Aktivitäten […]“ (HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 20). So sollten Denk- und Sprachaktivitäten immer im Wechsel mit kreativen und/oder entspannenden Übungen folgen (vgl. ebd., S. 20). Auch Sozialformwechsel begünstigt inklusives Lernen (vgl. THEUNISSEN 2003, S. 97; THEUNISSEN 2009, S. 348). Vortrags- und Demonstrationseinheiten werden keinem Teilnehmer gerecht, so fordert GRILL (2005) eine Schwerpunktverlagerung auf praktisches Handeln und eine Zeitbegrenzung von 15 Minuten bei theoretischen Einführungen. „Alltagsbezogenes und handlungsorientiertes Lernen ist demnach das wichtigste methodische Instrument“ (MAY 2007). Auch GRILL (2005) LINDMEIER (2003b, S. 98) und VANOLI (2009) erachten praktische Übungen, handlungsorientiertes Lernen und Anschaulichkeit als wesentlichen methodischen Punkt. THEUNISSEN (2003, S. 97ff) greift die Methoden des Kooperativen Lernens auf, die sich besonders eignen, um differenziert und nach eigenen Bedürfnissen zu lernen. GRILL (2005) fügt in ihrem Artikel zahlreiche aktivitätsfördernde Methoden an.
SCHUCHART (1980) erachtet die Metakommunikation als wesentliches methodisches Instrument zur Gestaltung inklusiver Lernprozesse (vgl. VANOLI 2009). Auch Umfrageergebnisse und GRILL (2005) repräsentieren dieses Verständnis. „Die Metaebene bezeichnet […] eine Sprachebene, bei der […] die Sach- und Beziehungsebene verlassen [wird, d.V.] und das Gesprächsverhalten sowie der Gesprächspartner selbst zum Thema gemacht werden. Das bietet die Chance einer Vertiefung, Klärung oder des „[…] Ausstiegs für die weitere Diskussion“ (HUNGER 2000-2011). Er stellt die These ‚Ohne Metakommunikation keine dauerhafte Verständigung‘ auf, „[…] weil für eine Vielzahl von Kommunikationszusammenhängen eine Verständigung von Sender und Empfänger zunächst nur möglich ist, wenn sie sich auf der Metaebene über die „Spielregeln“ oder die Sichtweise oder den Kommunikationszusammenhang einigen“ (ebd.). ‚Spielregeln‘ sind in diesem Falle:
-
„Wir hören einander zu.
-
Es spricht immer nur eine Person.
-
Wir bemühen uns, gegenseitig zu verstehen.
-
Wir sagen uns gegenseitig, wie wir das Gespräch empfinden.
-
Wir knüpfen am Gesagten an.
-
Wir achten auf die Sprache, vermeiden Beschimpfungen“ (KNILL 2003).
Bedient man sich der Metakommunikation, können Kommunikationsprozesse erleichtert werden.
Die Materialien sollten den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Person angepasst sein. Dabei ist die Ermittlung dieser von zentraler Bedeutung. In der Literatur häufen sich die Möglichkeiten der Adaptierung von Materialien an die jeweiligen Bedürfnisse:
-
Materialien in digitaler Form (Tonbandaufnahmen, Videos),
-
einfach und klar formulierte Unterlagen nach den Standards der einfachen Sprache (große Schrift min. 30, einfache Wörter, kontrastreiche Gestaltung, Überschaubarkeit – nicht mehr als sechs Punkte pro PowerPoint-Folie),
-
Visualisierungen,
-
Brailleschrift Unterlagen,
-
Gebärdensprachdolmetscher,
-
Großdrucke,
-
Mitschreibkräfte,
-
Lesegeräte und
-
Fachwörterglossar (vgl. BABILON 2008, S. 67; BIV INTEGRATIV 2007, S. 14f.; DROLSHAGEN/ROTHENBERG 1998; GLAUSE 2008, S. 39ff; GRILL 2005; HEUSOHN o.J.; HEUSOHN/SCHWEITZER 2008, S. 8; LINDMEIER 2003a, S. 30; SCHULZE 2010).
Dass Verständigungsbarrieren nicht so einfach durch ‚Aneignung von leichten Sprachen Standards‘ abgebaut werden können, thematisiert LINDMEIER (2003a, S. 33): „Meist stellen die sprachlichen Barrieren und Verständigungsprobleme die größte methodische Herausforderung dar. Und zwar nicht in erster Linie wegen der Einschränkungen der verbalen Kommunikationsmöglichkeiten […]. Bedeutsamer noch ist der unterschiedliche biografische und milieubedingte Erfahrungshintergrund […].“ Einige Referenten der Weiterbildung bemerkten bereits die Schwierigkeit, Inhalte trotz leichter Sprache für alle verständlich zu machen. Ich sehe nicht nur sprachliche und milieubedingte Barrieren, auch durch Interesse an manchen Themen wird Verständlichkeit begründet. Erforderlich ist eine Verbindung oder ein Bezug des Teilnehmers zum Thema. Für viele Teilnehmer der Weiterbildung fehlte dieser z. B. bei Organisationsveränderungen oder Implementierungsstrategien von Persönlicher Zukunftsplanung in den Betrieb. Auch ist es ein Prozess, sich in Kommunikation zu üben. Erfahrungen aus Wien zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigung es gelernt haben, die Bedeutung oder die Übersetzung schwieriger Wörter einzufordern. Dadurch erweitern sich ihre Denkstrukturen, sodass mittlerweile Gespräche in ‚schwerer Sprache‘ verfolgt und gehalten werden können.
THEUNISSEN (2009, S. 352) greift den Aspekt der altersgerechten Materialien auf. Der Autor führt die Überlegung an, ob das Material „[…] sich eher nach dem tatsächlichen Alter […] oder nach der aktuellen Handlungskompetenz (Prinzip der Entwicklungsgemäßheit) richten sollte“ (ebd., S. 352). Mein Standpunkt zu dieser Überlegung ist, dass die Teilnehmer selbst über ihre Materialien entscheiden können: Wenn es Personen gefällt mit Kinderspielzeug, wie Playmobilfiguren, zu arbeiten, ist das in Ordnung und wenn es manchen auf Grund des ‚Kindergartenhintergrunds‘ nicht gefällt, dann sollte man das akzeptieren und nach weiteren nützlichen Materialien schauen. „[…] Die pädagogische Kunst besteht also darin, Medien oder Materialien so einzusetzen, dass ein sinnvolles und signifikantes Lernen stattfinden kann (z. B. durch modifizierte Arbeitsmaterialien, einfache Sprache, große Buchstaben, vereinfachte Gebrauchsanweisungen mit Bildern unterlegt, selbst hergestellte Lehr- oder Lernmaterialien, Arbeitsblätter, Vorlagen, Modelle, Demonstrationen)“ (ebd., S. 352).
Die drei Prinzipien der Erwachsenenbildung werden in zahlreicher Literatur aufgegriffen:
-
Prinzip der Wahlmöglichkeit
-
Prinzip der Freiwilligkeit und
-
Prinzip der Selbstbestimmung (vgl. DIESENREITER 2008a, S. 25; LINDMEIER 2003a, S. 30; LINDMEIER 2003b, S. 194; LINDMEIER u.a. 2000, S. 129; THEUNISSEN 2003, S. 66; THEUNISSEN 2009, S. 333).
Alle drei Prinzipien beziehen sich auf den gesamten Erwachsenenbildungsbereich. Sie sind wesentliche Faktoren von inklusiven Bildungsprozessen. In meinen Augen geht es ferner um Mitbestimmung an Inhalten, Methoden und Materialien. BRUNNER (2005, S. 154) verlangt, dass „[…] Menschen mit Behinderung als gleichwertige PartnerInnen bereits an der Konzeption von Bildungsprojekten mitarbeiten […].“ Dieser Forderung gehen viele andere Autoren nach: BABILON (2008, S. 66), GALLE-BAMMES (2009, S. 21), GRILL (2005), HESS/KAGEMANN-HARNACK/SCHLUMMER (2008, S. 24), HEUSOHN/SCHWEITZER (2008, S. 19), LOEKEN/WINDISCH (2006, S. 224), THEUNISSEN (2003, S. 67) und VANOLI (2009).
Die Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigung ist notwendig, um die unterschiedlichen Hindernisse zu eruieren und entsprechende Lösungen zu erarbeiten (vgl. GALLE-BAMMES 2009, S. 21). Da sich die Wahl der Lernmethoden, Inhalte und Materialien an den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert (vgl. GRILL 2005), ist das in Beziehung Treten mit ihnen unerlässlich. Im gemeinsamen Dialog kristallisieren sich die Bedürfnisse heraus, auf die es einzugehen gilt. „Daher sollte in der Bildungsarbeit darauf geachtet werden, alle Teilnehmer soweit wie möglich an der Auswahl der Inhalte, der Festlegung von Themen und Lernzielen, sowie an der Wahl der Verfahren zu beteiligen, individuelle Vorschläge zuzulassen und zu unterstützen“ (THEUNISSEN 2003, S. 67).
Erstaunlicher Weise publiziert die sachgemäße Literatur über Aspekte, wie die der Barrierefreiheit, Mobilisierung von Unterstützung, geeignetes Material und teilnehmerzentrierte Methodik und Didaktik. Das Fundament – eine ‚Inklusive Kultur‘ – aller inklusiven Bildungsprozesse wird weitgehend vernachlässigt. „Aus günstigen Rahmenbedingungen […] folgt [aber, d.V.] nicht zwangsläufig eine qualifizierte inklusive Pädagogik. So kommt es letztendlich auf die Einstellung/Haltung und Kompetenzen der Professionellen [und allen weiteren Beteiligten, d.V.] an, die bereit sein müssen, sich für eine inklusive Lern- und Lebenswelt zu arrangieren“ (THEUNISSEN 2006, S. 24). Die Grundlage, eine ‚Inklusive Kultur‘, gilt es zu schaffen. Denn auf ihr kann nur eine inklusive Weiterbildung errichtet werden, denn Inklusion „[…] lässt sich nur Verwirklichen, wenn alle mitmachen und sich selbst dafür verantwortlich fühlen, niemanden auszugrenzen“ (MASG 2010, S. 7).
Einige Autoren sehen in dem Aufbau einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Beziehung, einer angstfreien und angenehmen Lernatmosphäre und eines wertschätzenden und respektvollen Umgangs einen Schritt in Richtung Inklusivität (vgl. GRILL 2005; May 2007; MASG 2010, S. 8; THEUNISSEN 2003, S. 93; THEUNISSEN 2006, S. 253).
GRILL (2005) sieht in dem Bestehen von Vorurteilen die größten Barrieren, weil manche Menschen zu Menschen mit Beeinträchtigung keinen Kontakt haben, diesen scheuen oder Angst und Berührungsängste haben. Sie lassen sich nach Erfahrungen von BRUNNER (2005, S. 151) in einer direkten und gut begleiteten Begegnung allerdings schnell abbauen. Für FRAGNER (2008, S. 33) und KNITTERFELDER (2008, S. 47f.) sind die „Begegnungen auf Augenhöhe“ ein bedeutsames Element. Ein wohlfühlendes Klima mit einem ernst genommenen, offenen und ehrlichen Umgang begünstigt inklusives Lernen. Auch CARROLL (1998, S. 306f.) akzentuiert eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung zwischen allen Beteiligten als wichtige Grundlage von Bildungsarbeit, welche auch ich als wichtigste Grundlage bezeichne.
Diese Elemente bieten wichtige Hinweise und Anregungen zur Gestaltung einer inklusiven Weiterbildung. Sie ist keine „wirklichkeitsfremde Utopie“ (BABILON 2008, S. 73), sondern ein realisierbares Ziel, auch wenn es noch Herausforderungen zu bewältigen gilt.
Trotz zahlreicher Überlegungen, wie man eine Weiterbildung inklusiv gestalten kann, bin ich während meiner eigenen Analyse und im Literaturstudium auf weitere Stolpersteine gestoßen.
THIEN (2009, S. 45) beschreibt laut einer empirischen Untersuchung von SCHIERSMANN folgende berufliche Weiterbildungsbarrieren:
-
„Zeitmangel,
-
fehlender Nutzen,
-
Angebotsdefizite,
-
Kosten sowie
-
Qualitätsmangel.“
THIEN (2009, S. 45) fügt die Punkte; große räumliche Entfernung des Angebots, einhergehend mit unzureichenden Transportmöglichkeiten (vgl. BABILON 2008, S. 70) und wenig Transparenz in der Angebotsstruktur hinzu. Auch wenn sich die Untersuchung von THIEN nicht auf inklusive, sondern auf allgemeine Weiterbildungen bezieht, lassen sich die Barrieren übertragen. Für die Gesichtspunkte des Qualitätsmangels und der geringen Transparenz in Angebotsstrukturen sind einige nötige Aspekte im vergangenen Kapitel aufgegriffen wurden. Im Wesentlichen behandelt dieser Punkt auftretende Fragen bzw. Barrieren, für die noch nicht die passenden Antworten gefunden wurden.
THIEN (2009, S. 45) hält fest, dass eine der größten Barrieren der finanzielle Aspekt, besonders bei einkommensschwachen Gruppen, ist. Dieser beinhaltet somit einen starken Ausgrenzungsmechanismus. Auch Beispiele aus der Schweiz und England zeigen, dass eine Gefahr des Scheiterns von Inklusion durch mangelnde finanzielle Möglichkeiten besteht (vgl. BYERS 2004, S. 16 zit. n. BABILON 2008, S. 70; LINDMEIER u.a. 2000, S. 107).
LINDMEIER (2003a, S. 29) begründet das Desinteresse der allgemeinen Erwachsenenbildung damit, dass diese bei ihrer Angebotsplanung immer mehr den Fokus auf zahlungskräftige Adressaten ausrichten und somit einen bestimmten Personenkreis nicht in den Blick nehmen. Auch KLAUSS (2008, S. 135) begründet den Mangel an Kursen in der finanziellen Situation, das sich diese „[…] des Bildungswesen[s, d.V.] insgesamt und speziell der Behindertenhilfe verschlechtert hat.“ Ein Bespiel von HESS/KAGEMANN-HARNACK/SCHLUMMER (2008, S. 18ff) zeigt, dass eine wirkende Tagesbildungsstätte in München (TABS) geschlossen wurde, das Angebote sogar zurückgefahren werden und zum Teil mit Mühe etablierte Strukturen rückgebaut werden, „[…] weil die Finanzierung als nicht mehr leistbar gesehen wird.“ Auch scheint es ihnen, dass Kürzungen und Stellenstreichungen „[…] beinahe alltägliche Erscheinung geworden […]“ sind. BABILON (2008, S. 62), BRUNNER (2005, S. 154), BÜCHELER (2006, S. 219) und HEUSOHN (o.J.) führen an, dass finanzielle Hürden eine Teilnahme an Weiterbildungen verhindern können. Begründet wird dies durch „[…] aktuelle[…] Entwicklungen und Trends in Zeiten zunehmender Ökonomisierung an einer kommunalen Einrichtung öffentlich verantworteter Erwachsenenbildung[…]. [Diese sind, d.V.] gegenläufig zum Inklusionsparadigma. Die permanent rückläufige Bezuschussung von Erwachsenenbildung führt zu kontinuierlich steigenden Preisen und exkludiert […] mit zunehmender Tendenz Bürger mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten“ (GALLE-BAMMES 2009, S. 224). Beispiele aus Wien zeigen, dass es Kurse gibt, „[…] die die finanziellen Möglichkeiten und Grenzen vieler behinderter Menschen berücksichtigen“ (EU-BILDUNGSPROGRAMM SOKRATES-GRUNDTVIG 2005, S. 7). So auch die Forderung in Deutschland mit dem Gedanken, das Kosten für Hilfsmittel sich nicht in den Kursgebühren niederschlagen dürfen (vgl. BRUNNER 2005, S. 152).
Wirkliche Möglichkeiten dieses Problem zu beseitigen, finden sich in der Literatur kaum: zum einen soll das persönliche Budget und zum anderen das Land für die entstehenden Kosten auf kommen (vgl. GEB 1995; TIMMERMANN 2000, S. 21). TIMMERMANN (2000) bietet in seinem Artikel weitere Alternativen zur Finanzierung lebenslangen Lernens an. Dennoch existiert kein Masterplan – hier besteht eindeutig Entwicklungspotenzial, denn der Mangel an finanziellen Voraussetzungen „[…] darf freilich kein Argument gegen entsprechende Bildungsmaßnahmen sein“ (THEUNISSEN 2003, S. 101).
Dieser Gedanke greift nicht den des ursprünglichen Exklusionsgedanken von benachteiligten Personengruppen auf, sondern geht vielmehr um innerlich entstehende Prozesse. Durch gemeinsame Lernprozesse in einer Gruppe kann es zu verschiedenen Interessenlagen kommen. In der Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ wurde die Problematik angesprochen, dass man vertiefend theoretische Ansprüchen nicht nachkommen kann, ohne andere Menschen zu exkludieren. Verzichtet man aber auf die Ansprüche derer, die sich vertiefend mit dem Thema befassen wollen, exkludiert man sie wiederrum. Auch in den Umfragen wird dieser Aspekt, jedoch nicht unter ‚Barrieren‘, sondern als ‚Herausforderung‘ angesehen. Es wird die Frage gestellt: „Wer hat die Zeit und die Geduld als Teilnehmer ohne Behinderung diesen Weg zu gehen?“ Dies Beispiel verdeutlicht wieder, dass der Ursprung von inklusiven Bildungsprozessen in der Schaffung einer inklusiven Kultur liegt.
Auch in der Schweiz wurden Gruppengespräche auf Grund von Verständigungsschwierigkeiten gemieden (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 100). Zu solchen Vermeidungsstrategien kam es auch in Eutin, was manche Teilnehmer verärgerte. Für einige stellen Wissensvermittlung von Theorie und die Gespräche in leichter Sprache einen „unüberwindbaren Widerstand“ dar. Sie möchten Detailfragen stellen und intensive Auseinandersetzungen mit Themenschwerpunkten ohne dabei „ein schlechtes Gewissen“ zu haben. Diese Problematik ist ernst zu nehmen. Meiner Meinung nach ist die Aufarbeitung der Inhalte ausschlaggebend. Diese Problematik könnte durch die Umsetzung der zuvor geschilderten Elemente abgemildert werden, vor allem im Bereich der Methodik und Didaktik, sowie in den Medien und Materialien. Es bedarf weiterer Beobachtung.
Problematisch sehe ich hingegen die Tendenz, die von GALLE-BAMMES (2000, S. 21) aufgeführt wird: „[...] die Bildungsbenachteiligung behinderter Menschen [ist, d.V.] noch derart ausgeprägt, dass es zunächst darum gehen sollte, behinderte Menschen an Weiterbildung partizipieren zu lassen. Die Maximalforderung nach „ausschließlich integrativen Angeboten“ ist angesichts des vielerorts noch vorhandenen Bildungsnotstands fehl am Platz und bremst womöglich den flächendeckenden Ausbau des Bildungsangebots für behinderte Menschen [...].“ Trotz der zehn vergangenen Jahre zu dieser Aussage sehe ich darin einen falschen Ansatz, Menschen mit Beeinträchtigung nur teilnehmen zu lassen ohne auf sie und ihre Wünsche einzugehen. Solchen Annahmen entsprechen nicht dem Verständnis von Inklusion. Meines Erachtens gilt es allen Bedürfnissen von Anfang an gerecht zu werden. Diese These eröffnet den Aspekt der Alibifunktion von inklusiv angelegten Angeboten und ist kein Weg zur Etablierung flächendeckender Angebote. Auch in der Schweiz finden sich solche erschreckenden Tendenzen wieder, indem dem Kursleiter eine soziale Integration genügte, aber die Begleitperson auf eine inhaltliche hinzielte (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 105). Solch ein Verständnis ruft die Assoziation der ‚full inclusion‘ hervor, welche sich nach dem richtigen Verständnis der Definition erübrigt hat. Auch GRUBER (2010, S. 147) geht es dabei „[…] keineswegs um das freundliche Bemühen eines Dabeisein-Könnens und Mitgenommen-Werdens, sondern um die Ermöglichung echter Teilhabe für alle im Sinne von aktivem Mitmachen, Mitgestalten, Mitentscheiden.“ BOBAN (2000) äußert in diesem Zusammenhang: „Man fixiert sich stark auf die administrative Ebene, entsprechend dem Motto: ‚Hauptsache drin! [Die Person, d.V.] ist voll integriert!‘ Dabei wird ausgeblendet, dass dies noch nicht Qualität bedeutet, sondern nur der Rahmen für pädagogische Qualität bildet, die sich an der emotionalen, sozialen und nicht zuletzt der Dimension der Einbindung in kooperative Prozesse im [gemeinsamen Lernen, d.V.] festmacht. Auf eine kurze Formel bringt dies Marsha FOREST in dem Satz: Inclusion means WITH not just IN[10]!“ (BOBAN/HINZ 2003b, S. 39)
„Inklusion ist anstrengend, teilweise mühevoll und oft eine Mehrbelastung, das wird in vielen Einrichtungen auch klar so benannt […]“ (BABILON 2008, S. 71). Dieses Thema kam auch während der Weiterbildung in Eutin zur Sprache (siehe Kapitel 6.3.2.). Auch THEUNISSEN (2009, S. 356) beleuchtet den Mehraufwand der Referenten. Durch Engagement und Gemeinsamkeit im Team – „Kreativität gibt es nur im Plural“ (BUROW 2002; 2004b; 2005; 2007) – gelingt es, diesen Mehraufwand zu leisten und auf gelungene Weiterbildungen zu blicken.
Trotz der bestehenden Herausforderungen sollte es daran nicht scheitern inklusive Weiterbildungen zu kreieren. Gemeinsam kann man diese angehen und bewerkstelligen. Inklusion ist ein Prozess, der Zeit bedarf: „Das Wachsen einer inklusiven Kultur braucht sicher mehrere Jahre, gleichzeitig kann es sich nur über das dauerhafte Engagement aller Beteiligten für kleine, konkrete Veränderungen in Strukturen und Praktiken [der Weiterbildung, d.V.] vollziehen“ (BOBAN/HINZ 2003b, S. 44).
Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Frage, welche Elemente zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen können und in wieweit dies ein Schritt zur Partizipation darstellt.
Nach der Gegenstandsbestimmung und Zielsetzung wird in der Arbeit der Zusammenhang von Inklusion, Bildung und Partizipation herausgestellt. Inklusive Bildungsprozesse ermöglichen zwischenmenschliche Begegnungen und die aktive Mitgestaltung eines gesellschaftlichen Bereichs. Dadurch ist Partizipation am gesellschaftlichen System möglich.
Im anschließenden Teil wird eine Standortbestimmung der Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ unternommen. Dabei werden die inklusiven Ansprüche ihres Programms beleuchtet.
Das vierte und fünfte Kapitel dienen der Beschreibung der Forschungsmethoden und theoretischen Bezüge als Grundlage meiner Arbeit. Erst der theoretische Bezug des Index für Inklusion macht es möglich, inklusive Elemente abzuleiten. Die Arbeitsweise des Kreativen Feldes bietet sich besonders an, da sie die verschiedenen Ebenen der Weiterbildung beleuchtet und so transparent macht, was in den einzelnen Dimensionen bereits vorhanden und was verbesserungswürdig erscheint.
Im Hauptteil der Arbeit wird die Weiterbildung an Hand der drei Dimensionen (Inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken) und den dazugehörigen Indikatoren und Fragen evaluiert. Ich denke, dies bringt wesentliche Aspekte der Situation in der Weiterbildung hervor. Sowohl noch zu bestehende Aufgaben als auch bereits erfolgreiche Elemente kristallisierten sich heraus (Abb. 43).
|
Bereits inklusive Elemente |
Ansatzweise realisierte Elemente |
Handlungsbedarf |
|---|---|---|
|
|
|
Quelle: Eigenerstellung
Ein weiterführendes Kapitel stützt die im vorausgegangenen Kapitel herausgestellten Elemente und belegt sie mit den Ausführungen erfahrener Autoren. Dabei wird deutlich, dass über einige Elemente, wie Barrierefreiheit, Zugänglichkeit von Informationen, Unterstützung, Methodik, Medien und Materialien vielfältig publiziert wird. Andere Aspekte, wie die Schaffung einer inklusiven Kultur, Begegnungen auf Augenhöhe, gemeinsames echtes Lernen usw., werden dort oft ausgespart.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor von inklusiver Weiterbildung die Schaffung einer ‚Inklusiven Kultur‘ ist. Diese ‚Inklusive Kultur‘ äußert sich im Willkommen-Heißen aller Heterogenitätsdimensionen und in respektvollen, wertschätzenden und auf Augenhöhe stattfindenden Begegnungen. Auf dieser ‚Kultur‘ gilt es aufzubauen und Inklusion in Strukturen und Praktiken zu etablieren. Hierbei kommt es vor allem auf Unterstützungssysteme, lernunterstützende Technologien und das Einbeziehen der Vorerfahrungen, des Wissen und der Bedürfnisse der Teilnehmer in der Planung an. Durch die Erstellung individueller Curricula kann den Bedürfnissen jedes Teilnehmers am ehesten entsprochen werden. So ist gemeinsames und differenziertes Lernen in einer heterogenen Gruppe möglich. Sozialformwechsel, Teamteaching-Situationen und eine überschaubare Gruppengröße begünstigen inklusives Lernen. Durch zahlreiche Aktivitätenwechsel, das Referieren in leichter und verständlicher Sprache sowie den aktiven Einbezug von Teilnehmern, ist ein erfahrungsorientiertes und -basiertes Lernen möglich. Um eigenständiges Lernen zu gewährleisten, bedarf es zugänglicher und barrierefreier Materialien. Eine barrierefreie Anfahrt und entsprechende Räumlichkeiten sind selbstverständlich. Durch diese unerlässlichen Elemente befinden sich Weiterbildungen auf einem guten Weg zur Inklusion.
Dennoch „[…] braucht [es, d.V.] Veränderungen auf vielen Ebenen und [das, d.V.] ist nicht nur Aufgabe der Bildung. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen sich weiter entwickeln. Vielfältigkeit muss eine Selbstverständlichkeit, das Andere als ein wertvolles Gegenüber wahrgenommen werden“ (BOHUSLAV 2008, S. 6). Hilfreich ist hier die Vision des Kreativen Feldes, die ein inklusives Bildungssystem in einer inklusiven Gesellschaft impliziert. Inklusion ist nicht nur die Leitorientierung im Bereich Bildung, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft (Abb. 44).
Laut GALLE-BAMMES (2009, S, 229) ist „die gesellschaftliche und kulturelle Partizipation von Menschen mit Behinderung […] nach wie vor bedroht“, deswegen scheint die Teilhabe an Bildung besonders wichtig zu sein. Diese Teilhabe gilt es auszubauen, aufrecht zu erhalten und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln. Denn eine Bildungsbenachteiligung ist einer der häufigsten Auslöser für soziale Benachteiligung (vgl. BRÜNIG/KUWAN 2002, S. 225 zit. n. DIESENREITER 2008a, S. 19). Diese Benachteiligung kann durch inklusive Bildungsprozesse abgemildert werden, denn Erwachsenenbildung ermöglicht nachholendes Lernen, Erhaltung erworbener Fähigkeiten und Fertigkeiten und kann so gesellschaftliche Benachteiligungen ausgleichen (vgl. GEB 1995).
Bildung ermöglicht Teilhabe, indem sie Teilnehmer dazu befähigt, sich an gesellschaftlich relevanten Aktivitäten zu beteiligen und somit die Gesellschaft mitzugestalten. Wie sich in diesem Projekt zeigt, entstehen in einer Weiterbildung Netzwerke und soziale Kontakte, die füreinander Kristallisationskerne werden können. Solche Bildungsprozesse sind „[…] ein Ort der zu zwischenmenschlichen Begegnungen [führt, d.V.] und bedeutet für den einzelnen ein Stück Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und damit eine Verbesserung von Lebensqualität“ (CARROLL 1998, S.313f.). Diese Weiterbildung ist für mich – trotz ihres Entwicklungsbedarfs in einigen Bereichen – ein praktisches Beispiel für gelebte Inklusion. „Es ist notwendig, eine Bildung für alle zu[…] erreichen, die auf den Prinzipien der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung basiert. Bildung spielt eine Schlüsselrolle für die Zukunft eines jeden Menschen, sowohl aus persönlicher als auch auf sozialer und beruflicher Sicht. Das Bildungssystem muss daher die Hauptrolle spielen, um eine persönliche Entwicklung und soziale Einbeziehung zu sichern. […] Das Bildungssystem [ist, d.V.] der erste Schritt zu einer einbeziehenden Gesellschaft“ (DEKLARATION VON MADRID 2002, S. 9).
Um dies im vollen Maß zu verwirklichen, bedarf es politischer Aktionen und des weiteren Ausbau inklusiver Bildungsangebote. Durch die Öffnung verschiedener gesellschaftlicher Bereichen, wie Bildung, Arbeit, Wohnen oder Freizeit, lässt sich Partizipation persönlich erfahrbar machen. „Als gemeinsame Blickrichtung und verbindende Zielperspektive bleibt [daher, d.V.] bestehen: Inklusion auf verschiedenen Wegen zu fördern in einer Welt, in der Ausgrenzung nach wie vor existiert“ (JERG/SCHUMANN 2006, S. 236).
Das zentrale Anliegen meiner Arbeit – das Herausstellen inklusiver Schlüsselelemente und -barrieren – ist meiner Meinung nach gelungen. Dabei ist es essentiell – so die Vision aus dem Kreativen Feld –, dass die Weiterbildung an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert ist, sie in Planung und Gestaltung mit einbezieht und ein gemeinsames und dennoch individuelles Lernen auf Augenhöhe ohne Benachteiligung stattfinden kann.
Meine Kernfrage, ob inklusive Weiterbildungen einen Beitrag zu einem Mehr an Partizipation darstellt, ist eindeutig mit ‚ja‘ zu beantworten. Durch inklusive Weiterbildungen wird die Teilhabe an einem gesellschaftlichen Bereich garantiert, auf den eingewirkt werden kann und Mitgestaltung möglich ist. Somit wird man als aktives Mitglied der Gesellschaft einbezogen. Man lebt in einer sich ständig wandelnden Lerngesellschaft, in der die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der Schulzeit nicht mehr alleine genügen, um den gesellschaftlichen Anforderungen und dem eigenen ‚Wissenshunger‘ gerecht zu werden. Lebenslanges Lernen ist dabei ein entscheidender Faktor, der es Menschen ermöglicht sich auf Veränderungen einzulassen und am gesellschaftlichen Fortschritt teilzuhaben. Durch lebenslanges Lernen können Menschen ihre Rolle im gesellschaftlichen Kontext einnehmen und definieren.
Mit Blick in die Zukunft halte ich fest, dass sich inklusive Erwachsenbildungsangebote in der Gesellschaft etablieren werden. Ein wichtiger Faktor hierfür ist der Artikel 24 der bereits 2009 ratifizierten UN-Konvention, welcher ein inklusives „(…) Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (…)“ (BAS 2010) fordert. Die Frage nach der Qualität dieser Angebote bleibt allerdings weiterhin bestehen. Angst vor ‚grauer Integration‘ und dem ‚Alibi-Inklusionsgedanken‘ liegen teilweise nahe. Meine Hoffnung zielt jedoch auf inklusive Weiterbildungen nach gewissen Standards, die mit dieser Arbeit aufgezeigt und diskutiert wurden.
Aichele, Valentin: Die UN- Behindertenrechtskonvention. Inhalt, Umsetzung, „Monitoring“ – ein Überblick. S. 04 – 08. In: Zeitschrift des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.: Das Band. Inklusion. Düsseldorf 02/2010.
Arnold, Rolf: Die Polarität von Kognition und Emotionin der Erwachsenenbildung. Lernwiderstand als Indikation emotionalen Lernens. S. 26 – 28. In: DIE Zeitschrift: Polarisierungen. 02/2001. http://www.diezeitschrift.de/22001/arnold01_01.pdf [Stand: 04.04.2011].
Babilon, Rebecca: Inklusive Erwachsenenbildung in England. S. 58 – 74. In. Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
(BAS) Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Bonn 2010. http://www.un-konvention.rlp.de/un-konvention/die-un-konvention/ [Stand: 30.08.2010].
Berzbach, Frank: Generation Power Point. Unzeitgemäßes zur visuellen Power-Point-Kultur. S. 48. In: DIE Zeitschrift: Erwachsenenbildung. 04/2004. http://www.diezeitschrift.de/42004/berzbach04_01.htm [Stand: 04.04.2011].
biv integrativ – Akademie für integrative Bildung: Erwachsenenbildung barrierefrei. Leitfaden für ein gemeinsames Lernen ohne Hindernisse. Wien 2007. http://www.biv-integrativ.at/pdf/Erwachsenenbildung_barrierefrei.pdf [Stand: 20.03.2011].
Blomert, Peter: Kooperatives Lernen. o.J. http://www.kooperatives-lernen.de/dc/CL/index.html [Stand: 29.09.08].
Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hg.): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2003a.
Boban, Ines/Hinz, Andreas: „The inclusive classroom“ – Didaktik im Spannungsfeld von Lernprozesssteuerung und Freiheitsberaubung. S. 71 – 98. In: Ziemen, Kerstin (Hg.): Reflexive Didaktik. Annäherungen an eine Schule für alle. Athena Verlag, Oberhausen 2008.
Boban, Ines/Hinz, Andreas: Der Index für Inklusion eine Möglichkeit zur Selbstevaluation von „Schulen für alle“. S. 37 – 46. In: Feuser, Georg (Hrsg.): Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Peter Lang Verlag, Hamburg 2003b.
Boban, Ines/Hinz, Andreas: Qualität des gemeinsamen Unterrichts (weiter)entwickeln – Inklusion. S. 10 – 14. In: Leben mit Down-Syndrom. Nr.45, Januar 2004.
Boban, Ines: Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zur Partizipation und Empowerment pur. S. 230 – 247. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Bohuslav, Petra: Schritt für Schritt in eine barrierefreie Erwachsenenbildung für ALLE NiederösterreicherInnen. S. 6. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Booth, Tony: Ein internationaler Blick auf inklusive Bildung: Werte für alle? S. 53 – 73. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Brühlmeier, Arthur: Sprachfeminismus in der Sackgasse. In: "Deutsche Sprachwelt", Ausgabe 36. Erlangen, 2009. http://www.bruehlmeier.info/sprachfeminismus.htm [Stand: 25.01.2011].
Brunner, Doris: Der Etablierungsversuch einer Inklusiven Erwachsenenbildung. Für eine Bildungskultur der Vielfalt. S. 145 – 161. In: Kaiser, H./Kocenik, E./Sigot, M. (Hrsg.): Vom Objekt zum Subjekt. Inklusive Pädagogik und Selbstbestimmung. Hermagoras Verlag, Klagenfurt 2005.
Bücheler, Heike: Der lange Weg zu inklusiver Bildung. S. 43. In: DIE Zeitschrift: Behinderung. 04/2003 http://www.die-bonn.de/doks/buecheler0301.pdf [Stand: 04.04.2011].
Bücheler, Heike: Der lange Weg zur inklusiven Erwachsenenbildung – Entwicklung, aktuelle Situation und Visionen. S. 214 – 221. In: Platte, Andrea/Seitz, Simon/Terfloth, Karin (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Julius Klinkhard Verlag, Bad Heilbrunn 2006.
Burow, Olaf-Axel/Hinz, Heinz: Die Entdeckung des Kreativen Feldes – oder: Wie die Schule bzw. Organisation laufen lernt. S. 35 – 76. In: Burow, Olaf-Axel/Hinz, Heinz (Hg.): Die Organisation als Kreatives Feld. Evolutionäre Personal- und Organisationsentwicklung. kassel university press GmbH, Kassel 2005.
Burow, Olaf-Axel: Der Arbeitsplatz als ”Kreatives Feld”. S.120 – 124. In: Friedrich-Jahresheft: Arbeitsplatz Schule. Velber: Friedrich-Verlag, 1998. http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/downloads/ArbeitsplatzalsKF.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Der Arbeitsplatz als „Kreatives Feld“ – Positive Kommunikation im Kollegium. S. 3 – 6. In: Der berufliche Bildungsweg - vlbs, 7 – 8, 2004a. https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2006102515272/1/vlbs-KF.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Ganztagsschule als Kreatives Feld. Vortrag auf dem Kongress des Ganztagsschulverbandes 02. – 04.11.05, Frankfurt/Main. In: Appel, S. (Hrsg.): Jahrbuch Ganztagsschule 2007. Einen Presseartikel zum Vortrag Ganztagsschule als Kreatives Feld, Titel: "Die Weisheit der Vielen". http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/aob/burow_texte/Ganztagssch.%20als%20KF.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Ganztagsschule entwickeln: Theoretischer Hintergrund und praktische Umsetzung. S. 1 – 31. In: Schulleitung Neue Länder AL Nr. 43, Oktober 2007. http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/downloads/GT-J%9Frgens7-07end.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Kreative Felder: Das Erfolgsgeheimnis kreativer Persönlichkeiten. In: manager seminare Heft 35, 2000. http://www.grauezelle.de/downloads/Kreative_Felder.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Kreativität gibt es nur im Plural! In: Personalführung, Juli 2002. https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2006110715544/1/Art_Personalfuehrung0602.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Schul- und Unterrichtsentwicklung nach der Theorie des Kreativen Feldes. Vortrag am 20.9.2008 bei der KARG-Stiftung für Hochbegabtenförderung Braunschweig. http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/downloads/Karg.pdf [Stand: 07.09.2010].
Burow, Olaf-Axel: Wie Organisationen zu Kreativen Feldern werden: Das Jazzbandmodell der Führung und die Rolle der Improvisation. In: Zeitschrift für Supervision, 2/2004b. http://www.uni-kassel.de/fb1/burow/aob/burow_texte/Supervision_2-0%5B2%5D.pdf [Stand: 07.09.2010].
Carroll, Volker: Bildungsangebote für Erwachsene mit geistiger Behinderung. S. 290 – 316. In: Jakobs, Hajo (Hrsg.); König, Andreas (Hrsg.); Theunissen, Georg (Hrsg.): Lebensräume - Lebensperspektiven. Ausgewählte Beiträge zur Situation Erwachsener mit geistiger Behinderung. AFRA-Verlag, Butzbach-Griedel 1998.
Conrads, Bernhard: Wie hilfreich sind Visionen. S. 07 – 32. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan für das Bildungswesen. Bonn 1970.
Die Deklaration von Madrid: „Nicht-Diskriminierung plus positive Handlung(en) bewirken soziale Integration“. http://infomed.mds-ev.de/sindbad.nsf/de083cd4fce51312c12571e700442bef/7c32d85942fcf49f80256c06007fea07/$FILE/DeklMadrid2002.pdf [21.03.2011].
Diesenreiter, Carina: Erwachsenenbildung - inklusiv und barrierefrei. Eine Einführung. S. 19 – 26. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008a. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Diesenreiter, Carina: Öffentliche Erwachsenenbildung in Niederösterreich. S. 76 – 97. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008b. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Doose, Stefan: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. 8. überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Netzwerk People First Deutschland e.V., Kassel 2009.
Doose, Stefan: Projektbericht. Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung im Kreis Ostholstein. Entwicklung einer inklusiven Weiterbildung in Persönlicher Zukunftsplanung. 2010.
Drolshagen, Birgit/ Rothenberg, Birgit: Didaktik der Zukunft - eine Didaktik für alle. Berücksichtigung der Belange Behinderter in Hochschuldidaktik, Lehre und Forschung. Erschienen in: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3-98. http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-98-didaktik.html [Stand: 23.03.2011].
Duden: Das Fremdwörterbuch. 5. Auflage. Meyers Lexikonverlag. Mannheim, Wien, Zürich 1990.
Duden: Die deutsche Rechtschreibung. 24. Auflage. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2006.
Eberwein, Hans: Ein Rückblick nach 25 Jahren Integrationsentwicklung. Die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ von 1973. Erschienen in: Gemeinsam leben – Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 2 – 98. http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-98-bildungsrat.html [Stand: 23.03.2011].
Emrich, Carolin: Persönliche Zukunftsplanung. S. 22 – 25. In: BAG UB (Hrsg.): impulse Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Ausgabe 29, 2004.
EU-Bildungsprogramm Sokrates-Grundtvig: Bildung für alle. Menschen mit Behinderung in der Erwachsenenbildung. Wien 2005. http://www.vh-ulm-sommerschule.de/resources/broschuere+mobile.pdf [Stand: 20.03.2011].
Europäische Vereinigung des ILSMH: Sag es einfach! Europäische Richtlinien für die Erstellung von leicht lesbaren Informationen für Menschen mit geistiger Behinderung. Brüssel, 1998. http://www.webforall.info/downloads/EURichtlinie_sag_es_einfach.pdf [Stand: 18.01.2011].
Faulstich, Peter/ Zeuner, Christine: Erwachsenenbildung. Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2010.
Faulstich, Peter; Zeuner, Christine: Lebensbegleitendes Lernen in Netzwerken. Supportstrukturen zur Lernunterstützung. S. 18 – 20. In: DIE Zeitschrift: Support für die Weiterbildung. 03/2000. http://www.diezeitschrift.de/32000/positionen1.htm [Stand: 04.04.2011].
Fehre, Eva-Maria: Dialoge - eine Idee wird Konzept und Wirklichkeit. Bericht über die Tagung "Dialoge - Menschen mit Behinderungen in der Erwachsenenbildung". S. 20 – 21. In: BAG UB (Hrsg.): impulse Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Nr. 10, Okt. 1998.
Feuser, Georg: Prinzipien einer inklusiven Pädagogik. Erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft: Integration ist unteilbar. Nr. 2/2001. http://bidok.uibk.ac.at/library/beh2-01-feuser-prinzipien.html [Stand: 30.08.2010].
Flick, Uwe/Kardorff, Ernst/Steinke, Ines: Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. S. 13 – 29. In: Flick, Uwe/Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 6. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2008.
Flick, Uwe: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. 4. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1999.
Flick, Uwe: Triangulation in der qualitativen Forschung. S. 309 – 318. In: Flick, Uwe/Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 6. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2008.
Fragner, Josef: Inklusive Bildung. S. 27 – 35. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Frehe, Horst: Stichwort Behinderungen. S. 22. In: DIE Zeitschrift: Behinderungen. 04/2003. http://www.diezeitschrift.de/42003/frehe03_01.htm [Stand: 04.04.2011].
Frühauf, Theo: Von der Integration zur Inklusion – ein Überblick. S. 11 – 32. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Galle-Bammes, Michael: Das Bildungszentrum Nürnberg auf dem Weg zu einer Erwachsenenbildung für alle. S. 219 – 230 In: Schwalb, Helmut; Theunissen, Georg (Hrsg.): Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit. Best-Practice-Beispiele: Wohnen – Leben – Arbeit – Freizeit. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2009.
Galle-Bammes, Michael: Überlegungen zur integrativen Bildungsarbeit an einer Volkshochschule. S. 20 – 23. In: Erwachsenenbildung und Integration Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland (Hrsg.): Zeitschrift Erwachsenenbildung und Behinderung: Mittendrin- nicht nur dabei. 02/2000.
GEB (Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland): Grundsätze und Standpunkte der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland. 2003. http://www.geseb.de/einzelpublikationen.php [Stand: 30.08.2010].
GEB (Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung e.V., Deutschland): Berliner Manifest. Erwachsenenbildung und Behinderung. 6. Internationale Tagung der Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung. 21. – 23. Juni 1995. http://www.geseb.de/einzelpublikationen.php [Stand: 30.08.2010].
Glause, Henning: Praxiserfahrungen – ein Blick hinter die Kulissen. S. 37 – 43. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Greve, Werner/Wentura, Dirk: Wissenschaftliche Beobachtung. Eine Einführung. Psychologie Verlags Union, Weinheim 1997.
Grill, Isabell: Inklusive Bildung. Erste Schritte zu einer gemeinsamen Erwachsenenbildung für behinderte und nichtbehinderte Menschen. 2005. http://bidok.uibk.ac.at/library/handbuch-inklusiv.html [Stand: 30.08.2010].
Gruber, Joachim: Bildungshaus Schloss Retzhof – Weiterbildung für alle Menschen! Inklusive Weiterbildung braucht umfassende Barrierefreiheit. S. 145 – 148. In: Lassnigg, Lorenz: Magazin. Erwachsenenbildung.at – Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs: Zielgruppen in der Erwachsenenbildung. Objekte der Begierde? Books on Demand GmbH, Norderstedt. Ausgabe 10, Wien 2010. http://erwachsenenbildung.at/magazin/10-10/meb10-10.pdf [Stand: 15.03.2011].
Haan, Gerhard de: Programm Demokratie lernen und leben. o.J. http://www.blk-demokratie.de/materialien/demokratiebausteine/programmthemen/kooperatives-lernen.html [Stand: 29.09.08].
Heß, Gerhard/ Kagemann-Harnack, Gaby/Schlummer, Dr. Werner (Hrsg.): Wir wollen – wir lernen – wir können! Erwachsenenbildung, Inklusion, Empowerment. Beiträge, Positionen und Weiterentwicklungen der Internationalen Fachtagung Erwachsenenbildung und Empowerment an der Universität zu Köln, 20. bis 22. September 2007. Lebenshilfe-Verlag, Marburg 2008.
Heusohn, Lothar/Schweitzer, Franz: Aktive Bürgerbeteiligung für Menschen mit geistiger Behinderung. Methoden, Aktivitäten, Materialien. Gemeinsam! Projektgruppe. Ulm, 2008. http://www.vh-ulm-sommerschule.de/resources/Leitfaden+f$C3$BCr+Kursleiter.pdf [Stand: 15.03.2011].
Heusohn, Lothar: >>Ich melde mich auf jeden Fall nächstes Mal wieder an!<<. http://www.vh-ulm-sommerschule.de/resources/Ich+melde+mich+wieder+an.pdf [Stand: 21.03.2011].
Hinz, Andreas/Boban, Ines: Integrative Berufsvorbereitung. Unterstützes Arbeitstraining für Menschen mit Behinderung, Luchterhand Verlag, Berlin 2001.
Hinz, Andreas/Friess, Sabrina/Töpfer, Juliane: Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein. Inhalte - Erfahrungen – Ergebnisse. Unveröffentlichtes Skript, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2010.
Hinz, Andreas: "Niemand darf in seiner Entwicklung behindert werden. Von der integrativen zur inclusiven Pädagogik?" Überarbeitete Fassung eines Vortrags am 16. 9. 1998 in der Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main. http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-inclusion.html [Stand: 30.08.2010].
Hinz, Andreas: Inklusion – historische Entwicklungslinien und internationale Kontexte. S. 33 – 52. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Hinz, Andreas: Inklusion und Arbeit – wie kann das gehen? S. 03 – 12. In: BAG UB (Hrsg.): impulse Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Nr. 39, März 2006.
Hinz, Andreas: Schulentwicklung hin zur Teilhabe aller Schüler(innen). Der Index für Inklusion – Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. S. 55 – 66. In: In: Wacker, Elisabeth; Bosse, Ingo; Dittrich, Torsten; Niehoff, Ulrich; Schäfers, Markus; Wansing, Gudrun; Zalfen, Birgit (Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2005.
Hinz, Andreas: Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? S. 41 – 74. In: Schnell, Irmtraud; Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbronn 2004.
Hoffmann, Claudia/Theunissen, Georg: Entwicklung, Theorie und Perspektiven einer Erwachsenenbildung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfacherer Behinderung. S. 45 – 64. In: Erwachsenenbildung und Behinderung. Impulse für die Arbeit mit Menschen, die als lern-oder geistig behindert gelten. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn 2003.
Hopf, Christel: Qualitative Interviews – ein Überblick. S. 349 – 360. In: Flick, Uwe/Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 6. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2008.
Hunger, Lutz: TEIA AG - Internet Akademie und Lehrbuch Verlag. Berlin 2000 – 2011. http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Basiswissen-fuer-Selbststaendige/17738-Ohne-Metakommunikation-keine-dauerhafte-Verstaendigung.html [Stand: 12.04.2011].
Jerg, Jo & Schumann, Monika: Überlegungen zu Ausbildungsprofilen von Inklusion an Fachhochschulen. S. 231 – 237. In: Platte, Andrea/Seitz, Simon/Terfloth, Karin (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Julius Klinkhard Verlag, Bad Heilbrunn 2006.
Kallenbach, Christiane: Perspektivenwechsel. Lernen ist nicht nur Wissensvermittlung. S. 32 – 34. In: DIE Zeitschrift: Sprachen lehren lernen. 04/2001. http://www.diezeitschrift.de/42001/kallenbach01_01.pdf [Stand: 04.04.2011].
Klauß, Theo/Lamers, Wolfgang/Terfloth, Karin: Auf dem Weg zur Inklusion. S. 14 – 21. In: BAG UB (Hrsg.): impulse Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Ausgabe Nr.50 02/03 2009.
Klauß, Theo: Inklusion in Schule und Erwachsenenbildung – vom Zufall abhängig oder ein Menschenrecht? S. 130 – 153. In: Hinz, Andreas; Körner, Ingrid; Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2008.
Knill, Marcus: Metakommunikation oder: "Über das Reden reden". 2003. http://www.rhetorik.ch/Metakommunikation/Metakommunikation.html [Stand: 12.04.2011].
Knittelfelder, Franz: Von der Theorie zur Praxis oder wie ein barockes Bildungshaus langsam barrierefrei wird. S. 47 – 50. In: Diesenreiter, Carina (Hrsg.): Barrierefreie Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Handbuch. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2008. http://www.oieb.at/upload/3130_2_Handbuch_Barrierefreie.pdf [Stand: 20.03.2011].
Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung. 4. Auflage. Beltz Verlag, Weinheim, Basel 2005.
Lindmeier, Bettina/ Lindmeier, Christian/ Ryffel, Gaby/ Skelton, Rick: Integrative Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung. Praxis und Perspektiven im internationalen Vergleich. Luchterhand Verlag, Berlin 2000.
Lindmeier, Bettina/ Lindmeier, Christian: Professionelles Handeln in der Arbeit mit geistig behinderten Erwachsenen unter der Leitidee der Selbstbestimmung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft: Achtung und Anerkennung. Nr. 4/5/2002. http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-5-02-lindmeier-arbeit.html [Stand: 31.01.2011].
Lindmeier, Christian: Integrative Erwachsenenbildung. Auftrag – Didaktik – Organisationsformen. S. 28 – 35. In: DIE Zeitschrift: Behinderung. 04/2003a. http://www.die-bonn.de/doks/lindmeier0301.pdf [Stand: 31.01.2011].
Lindmeier, Christian: Integrative Erwachsenenbildung. S. 189 – 204. In: Theunissen, Georg: Erwachsenenbildung und Behinderung. Impulse für die Arbeit mit Menschen, die als lern-oder geistig behindert gelten. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn 2003b.
Loeken, Hiltrud & Windisch, Matthias: Inklusive außerschulische Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene. S. 222 – 226. In: Platte, Andrea/Seitz, Simon/Terfloth, Karin (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Julius Klinkhard Verlag, Bad Heilbrunn 2006.
Lüders, Christian: Beobachten im Feld und Ethnographie. S. 384 – 401. In: Flick, Uwe/Kardorff, Ernst/Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 6. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2008.
Markowetz, Reinhard: Alle Kinder alles lehren! Aber wie? – Maßnahmen der Inneren Differenzierung und Individualisierung als Aufgabe für Sonderpädagogik und Allgemeine (Integrations-) Pädagogik auf dem Weg zu einer inklusiven Didaktik. S. 167 – 185. In: Schnell, Irmtraud; Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbronn 2004.
MASG (Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein): Inklusion. Leitorientierung der Politik für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. Alle inklusive, Kiel 2010.
May, Alexandra: Erwachsenenbildung bei Menschen mit geistiger Behinderung. 2007. http://www.heilpaedagogik-info.de/erwachsenenbildung/ [Stand: 31.01.2011].
Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.: Leichte Sprache. Kassel, 2005 – 2008. http://www.people1.de/was_halt.html [Stand: 18.01.2011].
Miehe, Kirsten/Miehe, Sven – Olaf: Praxishandbuch Cooperative Learning. Effektives Lernen im Team. 2. erweiterte und überarbeitete Auflage. dragonboard publishers, Hamburg 2005.
Miles-Paul, Ottmar: UN-Behindertenrechtskonvention öffnet neue Türen. S. 46 – 47. In: In: BAG UB (Hrsg.): impulse Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Ausgabe Nr. 50 02/03 2009.
mixed pickles: Lesezeichen: An alles gedacht – Leitfaden für die Planung und Durchführung von barrierefreien Sitzungen und Veranstaltungen. Lübeck, o.J. http://www.mixedpickles-ev.de/publikationen/publikationen.htm [Stand: 16.05.2011].
Nagel, Bernhard: Das Rechtssystem in der Weiterbildung. In: Krug, Nuissl (Hrsg.): Praxishandbuch Weiterbildungsrecht. Köln 2007.
Netzwerk Leichte Sprache: Halt! Leichte Sprache. Was ist Leichte Sprache? Wie geht Leichte Sprache? Tipps und Tricks. http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf [Stand: 18.01.2011].
Niehoff, Ulrich: Die Quadratur des Kreises? Teilhabe behinderter Menschen bei einem Fachkongress. S. 35 – 52. In: Wacker, Elisabeth; Bosse, Ingo; Dittrich, Torsten; Niehoff, Ulrich; Schäfers, Markus; Wansing, Gudrun; Zalfen, Birgit (Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Lebenshilfe Verlag, Marburg 2005.
Nuissl, Ekkehard: Finanzierung lebenslangen Lernens auf mehrere Schultern verteilt. >>Kompendium<< mit Botschaften an alle. S. 4 – 8. In: DIE Zeitschrift: Kosten – Konten – Kommissionen. 02/2004 http://www.die-bonn.de/doks/nuissl0401.pdf [Stand: 04.04.2011].
Platte, Andrea: Das Recht auf Bildung und das besondere Recht auf Bildung. In: Zeitschrift für Inklusion, Ausgabe 02/2009. http://bidok.uibk.ac.at/library/inkl-02-09-platte-bildung.html [Stand: 04.01.2011].
Redaktion impulse: Checkliste für die Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen. S. 32 – 33. In: impulse Nr. 35, September 2005.
Rieleit, Birgit: Heterogene Gruppen – Gestaltung von individuellen Lernprozessen; Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin und Bonn, 1992.
Ruf, Sebastian: Bildungsatlas Stadt Mainz. o.J. http://www.step-on.de/InfosBB/Weiterbildung/Def [Stand: 09.02.2011].
Sander, Alfred: Inklusive Pädagogik verwirklichen – zur Begründung des Themas. S. 11 – 22. In: Schnell, Irmtraud; Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbronn 2004.
Sanderson, Helen & Goodwin, Gill: Personen-zentriertes Denken. Helen Sanderson Associates, Stockport 2010.
Sapon-Shevin, Mara: Because we can change the world. A Practical Guide to Building Cooperative, Inklusive Classroom Communities. Allyn & Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore 1998.
Schulze, Marianne: Was ist ein Menschenrecht? Wie können Menschenrechte für behinderte Menschen umgesetzt werden? Was kann der Monitoringausschuss dazu beitragen? Beispiele aus der Arbeit des Monitoringausschusses. Auszug Vortrag mit Diskussion, 24. Jahrestagung der InklusionsforscherInnen 2010 zum Thema: Inklusionsforschung im Lichte der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen, Innsbruck 24. bis 27. Februar 2010. http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-menschenrecht.html [Stand: 30.08.2010].
Schweitzer, Frank: Gemeinsam! Aktive Bürgerbeteiligung für Menschen mit geistiger Behinderung. 2011. http://www.vh-ulm-sommerschule.de/10.html [Stand: 23.03.2011].
Seitz, Simone: Forschungslücke Inklusive Fachdidaktik – ein Problemaufriss. S. 215 – 231. In: Schnell, Irmtraud; Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbronn 2004.
Stangl, Werner: [werner stangl]s arbeitsblätter. Linz, o.J. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/ [Stand: 28.02.2011].
Steiner, Gusti: Selbstbestimmung und Assistenz. Erschienen in Gemeinsam leben – Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3 -99. http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-99-selbstbestimmung.html [Stand: 04.04.2011].
Theunissen, Georg: Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und soziale Arbeit. 2. Auflage. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau 2009.
Theunissen, Georg: Erwachsenenbildung und Behinderung. Impulse für die Arbeit mit Menschen, die als lern-oder geistig behindert gelten. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn 2003.
Theunissen, Georg: Inklusion – Schlagwort oder zukunftsweisende Perspektive? S. 13 – 40 In: Theunissen, Georg; Schirbot, Kerstin (Hrsg.): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – soziale Netze – Unterstützungsangebote. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2006.
Thien, Klaus: Regionale Bildungsbedarfserhebung. Theorien, Prozesse und Methoden für eine partizipative Umsetzung. Österreichisches Institut für Erwachsenenbildung, Wien 2009. http://www.oieb.at/upload/3567_handbuch-regionale-bildungsbedarfserhebung.pdf [Stand: 14.04.2011].
Timmermann, Dieter: Alternativen. Modelle zur Finanzierung lebenslangen Lernens. S. 21 – 23. In: DIE Zeitschrift: Finanzierung lebenslangen Lernens. 2000/1. http://www.diezeitschrift.de/12000/timmermann00_01.pdf [Stand: 23.03.2011].
Vanoli, Eléonore: Von der Verwahrung zur Selbstermächtigung Perspektiven der Erwachsenenbildung von und für Menschen mit geistiger Behinderung. Diplomarbeit im Studiengang Pädagogik in der Fakultät Humanwissenschaften an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2009. http://bidok.uibk.ac.at/library/vanoli-verwahrung-dipl.html [Stand: 04.04.2011].
Wilder, Bernd: Erwachsenenbildung und Empowerment – Vorbereitungen zur Herbst-Tagung 2007 in der Universität zu Köln. S. 33 – 36. In: Erwachsenenbildung und Behinderung: Die inklusive Gesellschaft. Beiträge aus der Erwachsenenbildung und Behindertenhilfe. Jahrgang 18, Heft 1/2007.
Quelle
Juliane Töpfer: Inklusive Weiterbildungen: Eine Möglichkeit der Partizipation in der Praxis. Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen. Eingereicht 15. Juni 2011 beim Landesprüfungsamt für Lehrämter in Sachsen-Anhalt
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 08.07.2014