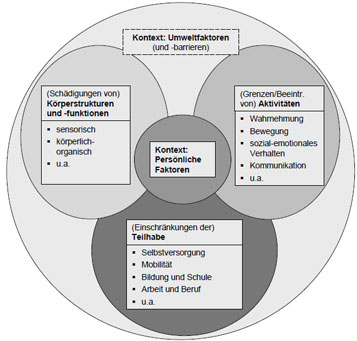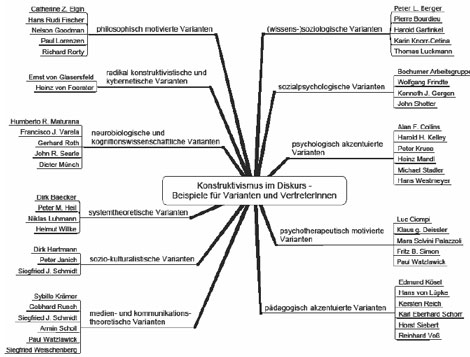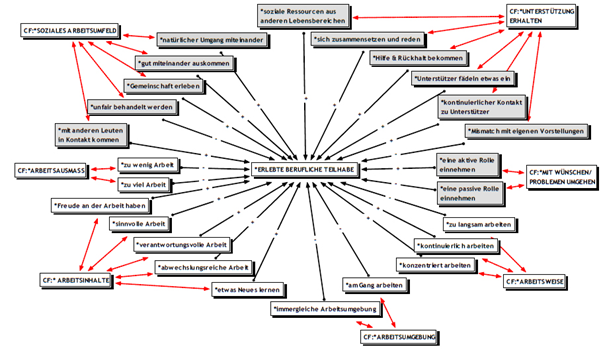„Interaktionelle Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext und deren Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe.“
Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magistra der Philosophie (Mag. phil.), Betreuer: Univ.-Prof.Dr. Gottfried Biewer
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Anbindung an das Forschungsprojekt
- 3 Klärung relevanter Begriffe
- 5 Forschungslücken
- 6 Forschungsvorhaben
- 7 Forschungsmethoden
- 8 Wissenschaftstheoretische Verortung – Die Position des Sozialen Konstruktionismus
- 9 Auswertung des Interviewmaterials
- 10 Beantwortung der Forschungsfrage
- 11 Zusammenfassung, Schlussfolgerung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Behinderung ist als Phänomen zu verstehen, das unter anderem durch soziale Zuschreibungsprozesse konstruiert wird. Das Selbstbild eines Menschen, die Art und Weise, wie er seine Behinderung sieht und bewertet und welche Chancen und Nachteile er in seinem Leben wahrnimmt sind stark von den Erfahrungen geprägt, die er im sozialen Umgang mit anderen Menschen macht. Das soziale Umfeld trägt zu einem sehr wesentlichen Teil dazu bei, ob ein Mensch in seiner Lebenssituation glücklich oder unglücklich ist, ob er sich zugehörig oder ausgeschlossen fühlt. Aus diesem Grund stellt es aus heilpädagogischer Sicht einen wichtigen Forschungsgegenstand dar. Ebenso eröffnet der Lebensbereich Arbeit ein wichtiges Untersuchungsfeld. Arbeit erfüllt im Leben jedes Menschen existenzielle Grundbedürfnisse. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung treten dabei besonders soziale Funktionen in den Vordergrund. Ihr soziales Netz setzt sich oft hauptsächlich aus Familienangehörigen zusammen, weshalb die Möglichkeit, über diesen Kreis hinausgehende zwischenmenschliche Kontakte zu knüpfen einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die von Betroffenenorganisationen vielfach geäußerte Forderung nach (beruflicher) Teilhabe von Menschen mit Behinderungen findet zwar innerhalb sozialpolitischer und wissenschaftlicher Diskussionen in den letzten Jahren immer mehr Gehör, wird verstärkt aufgegriffen und als erstrebenswertes Ziel hochgehalten, allerdings steht dieses geschärfte Bewusstsein immer noch in erheblichem Widerspruch zu tatsächlich geschaffenen Partizipationsmöglichkeiten. Dies gilt im Speziellen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.
Dass diese Menschen mit entsprechender Unterstützung prinzipiell in der Lage sind, am allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich einer Beschäftigung nachzugehen, steht spätestens seit der erfolgreichen Umsetzung von Projekten der unterstützten Beschäftigung gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts außer Frage. (vgl. Pinetz & Koenig, 2009; Biewer, Fasching, & Koenig, 2009) Dennoch stellt das Innehaben eines Arbeitsplatzes am allgemeinen Arbeitsmarkt für diesen Personenkreis nach wie vor die Ausnahme dar. Und selbst in diesen Ausnahmefällen kann nicht ohneweiters davon ausgegangen werden, dass die offensichtliche Teilnahme am Arbeitsleben mit dem tatsächlichen Erleben von Teilhabe an Arbeit aus der subjektiven Sicht der Betroffenen einhergeht. Denn Teilhabe im Sinne eines Einbezogenseins in eine Lebenssituation bzw. einen Lebensbereich lässt sich von außen kaum sinnvoll bestimmen. Die entscheidende Frage ist immer, ob der Mensch, dessen Einbezogenheit im Mittelpunkt der Betrachtung steht, sich selbst einbezogen fühlt. Die Herausforderung für eine effektive Förderung von Teilhabe besteht also darin, individuell passende Unterstützung anzubieten. Getroffene Maßnahmen sollen den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen. Beispielsweise sind Interventionsmaßnahmen, die am Individuum mit intellektueller Beeinträchtigung ansetzen und die Steigerung seiner (sozialen) Fähigkeiten zum Ziel haben, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für den Abbau von Teilhabebarrieren (im Lebensbereich Arbeit) kritisch zu betrachten. Denn Einbezogensein ist nicht nur von den Kommunikationsfähigkeiten des Individuums abhängig, sondern auch von Kontextfaktoren, wie beispielsweise den prinzipiellen Möglichkeiten zum In-Kontakt-Treten mit anderen Personen. Das 2001 in der International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) zugrunde gelegte bio-psycho-soziale Modell von Behinderung trug zu einer verstärkten Berücksichtigung ebensolcher Kontextfaktoren bei. Um herauszufinden an welchen Stellen im individuellen Fall Bedarf nach Unterstützung besteht, ist es wichtig, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu den Aspekten zu befragen, die aus ihrer Sicht dem Erleben von Teilhabe im Wege stehen bzw. einem solchen Erleben dienlich sind. Vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es hierzu bislang kaum Untersuchungen. (vgl. Pinetz & Koenig, 2009) Nach Fornefeld (2008) ist dies auf die immer noch vorherrschende Annahme zurückzuführen, diese Zielgruppe könne aufgrund ihrer eingeschränkten Wahrnehmungs-, Denk-, Reflexions- und Kommunikationsfähigkeiten nicht zu sich selbst befragt werden. Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderte Projekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ stellt in dieser Hinsicht eine beachtenswerte Ausnahme dar (siehe Kapitel 2).
Die vorliegende Diplomarbeit steht in Anbindung an das Projekt und untersucht interaktionelle Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext hinsichtlich ihrer Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe.
Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt:
Zunächst erfolgt in Kapitel 2 eine grobe Darstellung der Inhalte und Ziele des Forschungsprojekts „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“, um schließlich darzulegen, in welcher Weise die vorliegende Arbeit daran anknüpft.
Anschließend werden in Kapitel 3 Begriffe geklärt, die für das Thema der Diplomarbeit als relevant zu betrachten sind. Dazu zählen Behinderung, geistige Behinderung, Partizipation / Teilhabe und Arbeit sowie im Speziellen soziale Interaktion, Kommunikation und soziale Beziehungen. Ziel dieses Abschnitts ist es herauszuarbeiten, was in der Fachliteratur unter diesen Begriffen verstanden wird und darüber hinaus zu klären, was im Rahmen dieser Diplomarbeit darunter zu verstehen ist.
Kapitel 4 widmet sich dem aktuellen Stand der Forschung bezüglich der in der Diplomarbeit bearbeiteten Thematik. Darauf aufbauend werden in Kapitel 5 Forschungslücken identifiziert, deren Deckung durch das in Kapitel 6 dargestellte Forschungsvorhaben angestrebt wird.
Kapitel 7 dient der Darstellung der Forschungsmethoden, die zur Analyse des im Rahmen des Forschungsprojekts bereits erhobenen Interviewmaterials eingesetzt wurden. Zunächst wird dabei auf den Forschungsstil der Grounded Theory eingegangen und seine Entstehung und Entwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte nachvollzogen. Darauf aufbauend wird der für das Forschungsvorhaben gewählte konstruktionistische Ansatz nach Kathy Charmaz dargestellt und im Kontext der Forschungstradition der Grounded Theory verortet. Im Anschluss wird das Arbeiten mit computergestützten Programmen zur qualitativen Datenanalyse thematisiert und kritisch diskutiert. In diesem Zusammenhang wird die zur Analyse verwendete Software Atlas.ti vorgestellt. Schließlich wird auf die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommende Untersuchungsform der Sekundäranalyse und die damit verbundenen Vor- und Nachteile eingegangen.
Kapitel 8 dient der Darstellung der wissenschaftstheoretischen Position des Sozialen Konstruktionismus, aus der heraus diese Arbeit verfasst wurde und in deren Kontext ihre Inhalte zu setzen sind.
Kapitel 9 ist der Auswertung des Interviewmaterials gewidmet und gliedert sich in drei Teile. Zunächst wird das Vorgehen zur Analyse des Datenmaterials beschrieben. Im Anschluss daran werden jene acht ForschungsteilnehmerInnen, deren Interviews zur Analyse herangezogen wurden, einzeln vorgestellt. Schließlich erfolgt die Darstellung der Analyseergebnisse.
In Kapitel 10 wird die Forschungsfrage der Diplomarbeit beantwortet. Eine Zusammenfassung der durchgeführten Untersuchung, daraus abgeleitete Schlussfolgerungen sowie ein Ausblick folgen in Kapitel 11.
Wie bereits erwähnt, steht die Diplomarbeit in Anbindung an das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderte und derzeit am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien in seiner Umsetzung befindliche Projekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“.[1]
Besonders in Österreich besteht im Hinblick auf die Zielgruppe intellektuell beeinträchtigter Menschen ein beträchtlicher Datenmangel bezogen auf die Struktur des Arbeitsmarkts und die Übergangsverläufe von der Schule in den Beruf. Dies ist zum Großteil auf die heterogenen rechtlichen und institutionellen Zuständigkeiten und auch auf Schwierigkeiten bei der Weitergabe von Daten zurückzuführen. Aus diesem Grund ist es bisher nicht möglich, empirisch gesicherte Aussagen über die derzeitige Situation und das objektive Vorliegen oder Fehlen von Teilhabe der Zielgruppe im Arbeitskontext zu treffen. (vgl. Biewer u. a., 2009) Darüber hinaus sind, insbesondere bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, subjektive nachschulische Teilhabe- und Ausschlusserfahrungen noch weitgehend unerforscht. „So stellt sich die Frage, inwieweit objektiv feststellbare Zurückweisungen und Teilhabebeschränkungen sich im Lebenslauf der einzelnen Betroffenen niederschlagen und in welcher Weise sie Unterstützungsleistungen erleben und wünschen […].“ (Biewer u. a., 2009, S. 395, unter Verweis auf Wacker, Wansing, & Hölscher, 2003)
Aufbauend auf der beschriebenen Ausgangslage, setzt sich das FWF-Projekt zum Ziel, „sowohl objektiv bestimmbare als auch subjektiv erlebte Partizipation im Lebenslauf von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu rekonstruieren“. (Biewer u. a., 2009, S. 396; Hervorhebung im Original) Dabei wird sowohl die biographische Schnittstelle zwischen Schule und Beruf als auch die Lebensphase Arbeitsleben in den Blick genommen. (vgl. ebd.) Neben diesem thematischen Forschungsanliegen, intendiert das Projekt außerdem die Weiterentwicklung partizipativer Forschungsmethoden durch die Einbindung einer Referenzgruppe, bestehend aus Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, in allen Untersuchungsphasen. (vgl. Biewer u. a., 2009; Koenig, 2009)
Die methodische Umsetzung dieser Ziele lässt sich in einen quantitativen und einen qualitativen Teil aufgliedern.
Ersterer zielt vor allem auf die Verbesserung der oben erläuterten Datenlage in Österreich ab. Dazu werden die bereits vorhandenen Strukturdaten zum Arbeitsmarkt, sowie zum Übergangsverlauf von der Schule in den Beruf gesammelt und darüber hinaus Befragungen zur eigenständigen bundesweiten Datenerhebung entwickelt. Konkret stehen dabei die drei folgenden interessierenden Aspekte im Mittelpunkt: (1) Die Erhebung von schulischen Ausgangssituationen und Verlaufsdaten von SchülerInnen mit intellektueller Beeinträchtigung im Schuljahr 2008/09, (2) die Erhebung des Zugangs von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen im Referenzjahr 2008, (3) die Erhebung der Beschäftigungssituation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Beschäftigungstherapiewerkstätten im Referenzjahr 2008, sowie (4) eine Fragebogenerhebung, gerichtet an NutzerInnen von Beschäftigungstherapiewerkstätten in Wien im Referenzjahr 2008, zur Erfassung ihrer Beschäftigungspräferenzen. (O. Koenig, 2009, S. 10f)[2]
Der Schwerpunkt der im Rahmen des Projekts zu leistenden Forschungsarbeit liegt auf der Untersuchung der subjektiven Betroffenenperspektive, welche mithilfe von qualitativen Methoden realisiert werden soll. (vgl. Biewer u. a., 2009) Dabei wird vor allem den beiden folgenden Hauptfragestellungen nachgegangen:
-
Wie erleben Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gesammelte bzw. unterbliebene Partizipationserfahrungen in den genannten Lebensbereichen?
-
Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erfahren von Partizipation und der Wahrnehmung einer individuellen und selbstbestimmten Lebensgestaltung? (O. Koenig, 2009, S. 23)
Durch die Beantwortung dieser Fragen soll eine wichtige Grundlage für die (Weiter-) Entwicklung von Angeboten für die Zielgruppe geschaffen werden, die sich an Partizipation und Selbstbestimmung orientieren. (vgl. O. Koenig, 2009)
Der qualitative Methodenteil des Forschungsprojekts ist als explorative Längsschnittuntersuchung konzipiert, an der zwei Gruppen von je 20 bis 25 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung teilnehmen. Dabei umfasst die eine Gruppe Personen, die sich zu den Erhebungszeitpunkten in den Jahren 2008 bis 2010 in der Übergangsphase zwischen Schule und Arbeitsleben befanden, die andere Gruppe setzt sich aus bereits seit Jahren im Arbeitsleben stehenden Personen zusammen. Um die Chance auf reichhaltige und vielfältige Untersuchungsergebnisse zu erhöhen, wurde darauf geachtet, dass beide Gruppen bezüglich der Kriterien Alter und regionale Verteilung in Österreich sowie im Hinblick auf ihre Erfahrungshintergründe möglichst heterogen zusammengesetzt sind. (vgl. Biewer u. a., 2009) Eine wesentliche Gemeinsamkeit aller ForschungsteilnehmerInnen besteht im „biographische[n] Erwerb der Zuschreibung einer intellektuellen (‚geistigen’) Beeinträchtigung (z. B. durch Lehrpläne oder andere Formen statusdiagnostischer und / oder administrativ- / rechtlicher Zuschreibungsprozesse)“ (Biewer u. a., 2009, S. 399).
Die im Rahmen der Diplomarbeit geleistete Forschungsarbeit spezialisiert sich auf die qualitative Untersuchung von Partizipationserfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die im Zusammenhang mit sozialen Kontakten im Arbeitskontext aus subjektiver Perspektive gemacht werden. Die Umsetzung des Forschungsvorhabens erfolgte dabei unter Heranziehung von Interviewmaterial, das im Zuge des übergeordneten Projekts erhoben wurde. An dieser Stelle sei daher explizit darauf hingewiesen, dass - auch wenn das subjektive Erleben der Betroffenen den Kern der Untersuchung bildet - dabei keine Einbindung der ForschungsteilnehmerInnen stattfand. Der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit ist daher im Gegensatz zu dem des Projekts nicht als partizipativ, d.h. die Zielgruppe miteinbeziehend, zu bezeichnen.
[1] Projekt-Homepage: http://vocational-participation.univie.ac.at, Projektlaufzeit: 1.2.2008 - 31.1.2013
[2] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen bezeichnen die Foliennummer der zugehörigen Powerpoint-Präsentation.
Inhaltsverzeichnis
Der Begriff Behinderung umfasst Schädigungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen und ist durch eine Vielzahl von Ursachen, Schweregraden, Arten und Folgewirkungen bestimmt, weshalb Bleidick (2006, S. 80) ihn als „relational und relativ“ bezeichnet. Zusätzlich zu dieser begrifflichen Unschärfe verstehen Fachrichtungen und Berufsfelder, die sich mit Behinderung beschäftigen, wie zum Beispiel Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Sozialpolitik etc., den Begriff in jeweils unterschiedlichen Kontexten, verfolgen unterschiedliche Erkenntnisinteressen und vertreten daher auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. (vgl. Bleidick & Hagemeister, 1998; Dederich, 2009; Fischer, 2008c; Speck, 2005) Darüber hinaus hat sich der Begriff Behinderung im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt und wird mitunter diskriminierend verwendet (vgl. Lindmeier, 1993), weshalb Betroffene häufig Alternativbezeichnungen bevorzugen. All dies geht damit einher, dass einerseits bis heute kein allgemein gültiger bzw. akzeptierter Begriff von Behinderung vorliegt. (vgl. etwa Bleidick, 2006; Dederich, 2009) Weiters ist Behinderung immer mit Ambivalenz verbunden. Sie stellt für die Umwelt des betroffenen Menschen eine Besonderheit dar, „die positiv Hilfebedürftigkeit signalisiert und besondere Zuwendung hervorruft, oder auf die negativ mit Befremden und Distanzierung reagiert wird“ (Speck, 2008, S. 237).
Speck (2008, S. 241f) betont, dass Behinderung - im Unterschied zu medizinisch determinierten Krankheiten oder Funktionsbeeinträchtigungen - kein Begriff ist, der sich für differenzialdiagnostische Zwecke, d.h. für die Unterscheidung von „behinderten“ und „nicht behinderten“ Menschen eignet. Dafür fehle es, vor allem wegen der hohen Kontextbedingtheit und subjektiven Bestimmtheit des Phänomens Behinderung, an operationalisierbaren Kriterien.
Weiters ist Behinderung nach Speck (2008) sowohl als Prozess als auch als dessen Ergebnis zu verstehen. Sie ist in Abhängigkeit von sich ändernden Wechselwirkungsprozessen einem stetigen Wandel unterworfen und konstruiert sich laufend neu. In der aktuellen Lebenssituation eines Menschen kann sie sich aber auch in Form einer Erschwerung, zum Beispiel der Bewegung, der Kommunikation, des schlussfolgernden Denkens etc. manifestieren. In jedem Fall gilt es nach Speck (2008, S. 233) zu beachten, dass die Behinderung von dem betroffenen Menschen in der Regel nicht als „das Wesentliche seines Daseins“ erlebt wird, sondern als „Begleitmoment, mit dem er sein Leben zu gestalten hat“.
Speck (2008) unterscheidet in seinem Werk System Heilpädagogik zwischen individualtheoretischen und sozialtheoretischen Sichtweisen von Behinderung. Erstere gehen vom Individuum und seinen „körperlichen Anormalitäten, psychischen Entwicklungshemmungen oder sozialen Benachteiligungen“ (ebd., S. 188) aus. „Anormalität“ meint dabei die Abweichung von bestehenden Normen, wobei verschiedene Arten von Normen unterschieden werden können (vgl. Speck, 2008, S. 189f):
-
Ausgehend von statistischen Normen werden messbare Werte (z.B. IQWerte) bezogen auf eine bestimmte Population als normal betrachtet, wenn sie innerhalb eines definierten Durchschnittsbereichs liegen.
-
Biologisch-funktionelle Normen nehmen Bezug auf die zweckmäßige Funktionalität eines Organismus bzw. Organs. Als normal gilt dabei das, was so funktioniert, wie es gemäß seinen Aufgaben funktionieren soll (beispielsweise die Leber).
-
Nach sozialen Normen werden Verhaltensweisen als normal betrachtet, wenn sie den Erwartungen oder Regeln einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft entsprechen.
-
Ethische Normen beziehen sich auf bestimmte Werte, die es im Sinne der Normalität zu erstreben gilt.
Speck (ebd.) hebt hervor, dass soziale Probleme im Zusammenhang mit Normabweichungen nicht auf die in einer Gesellschaft existierenden Normen per se zurückzuführen sind, sondern auf die Art und Weise, wie mit diesen Normen umgegangen wird. Aus der individuumszentrierten Perspektive wird Behinderung oft unzulässigerweise mit Schädigung gleichgesetzt oder kausal damit verknüpft. In letzterem Fall wird dabei Schädigung als Ursache und Behinderung als daraus resultierende Folge betrachtet. (vgl. Fornefeld, 2008; Bleidick & Hagemeister, 1998) Speck (2008, S. 196f) spricht sich für die Notwendigkeit einer expliziten begrifflichen Unterscheidung von Schädigung und Behinderung aus:
Während unter „Schädigung“ eine definierbare psycho-physische Beeinträchtigung verstanden wird, bezieht sich der umfassendere Begriff der „Behinderung“ auf die Gesamtfolgen dieser Schädigung, schließt also auch soziale Auswirkungen mit ein. Schädigungen werden im Allgemeinen innerhalb des medizinischen Bezugsrahmens festgestellt als organische Einschränkungen oder als Ausfälle, z.B. des Seh- oder Hörvermögens, der Bewegung, des äußeren Erscheinungsbildes (Entstellungen) u.a. […] Soziologisch, sozialpsychologisch, pädagogisch bedeutsam werden Schädigungen erst, wenn sie zu funktionellen Einschränkungen (functional limitations) im Rollenhandeln führen. Von solchen Funktionseinschränkungen (disabilities) kann man dann reden, wenn diese zum Dauerzustand werden, der in umfassender und schwerwiegender Weise Identität und soziale Integration in Frage stellt und deshalb spezielle Hilfe nötig macht. (ebd.)
Seit den 1970er Jahren wurde die personenbezogene Perspektive auf Behinderung zunehmend kritisiert und es vollzog sich ein Paradigmenwechsel vom medizinischen zum sozialwissenschaftlichen Modell, welches die soziale und gesellschaftliche Bedingtheit von Behinderung hervorhob. (vgl. Speck, 2008, S. 216f)
Aus interaktionstheoretischer Sicht manifestiert sich Behinderung etwa erst über Zuschreibungs- und Etikettierungsprozesse (labeling) im Zuge der Interaktion mit anderen. Ein Merkmal oder Verhalten wird demnach als abweichend angesehen, „wenn es von anderen als solches definiert wird“ (ebd., S. 220). Je nach Reaktion dieser anderen auf die erkannte Abweichung können für jene Menschen, die sich „abweichend“ verhalten, Probleme - zum Beispiel sozialer, aber auch persönlicher Art - entstehen.Der sozialtheoretischen Wende ist es zu verdanken, dass der „reduzierende und monokausale Individualansatz“ (Speck, 2008, S. 240) überwunden und den eine Behinderung umgebenden Umständen mehr Bedeutung beigemessen wurde. Allerdings ging damit auch oft eine vollständige Ausklammerung des Anteils individueller Schädigungen am Phänomen Behinderung einher.
Sowohl individualtheoretische als auch sozialtheoretische Sichtweisen von Behinderung greifen für sich genommen zu kurz. Um die Einseitigkeit dieser Betrachtungsweisen zu überwinden, gilt es Behinderung nicht nur als Folge von psycho-physischen Schädigungen oder sozialen bzw. gesellschaftlichen Reaktionen und Zuschreibungsprozessen zu sehen, sondern stattdessen in ihrer Wechselwirkung mit einer Vielzahl an person- und umweltbezogenen Faktoren zu begreifen. Dies wird über ein mehrdimensionales bio-psycho-soziales Modell von Behinderung versucht, welches im Folgenden dargestellt werden soll.
Ein bio-psycho-soziales Modell von Behinderung wurde 1980 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) vorgelegt. Indem sie Behinderungen als Krankheitsfolgephänomene beschrieb, war die ICIDH ursprünglich darauf ausgelegt, das Klassifikationssystem der International Classification of Diseases (ICD), bei dem Krankheiten anhand ihrer Ätiologie klassifiziert werden, zu ergänzen. (vgl. Biewer, 2009) Die ICIDH ist daher der Gruppe der medizinischen Klassifikationen zuzurechnen. (vgl. ebd.) Sie differenzierte zwischen folgenden drei Dimensionen von Behinderung:
-
Schädigung (impairment) von psychologischen, physiologischen oder anatomischen Strukturen oder Funktionen im Sinne einer somatischen Dimension von Behinderung;
-
Beeinträchtigung (disability) eines Menschen in der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten durch Einschränkung oder Fehlen von als normal geltenden Fähigkeiten (bedingt durch die vorliegende Schädigung) im Sinne einer personalen Dimension von Behinderung;
-
Benachteiligung (handicap), die aus der Schädigung oder Beeinträchtigung hervorgeht und eine für den Menschen normale Rollenerfüllung einschränkt oder verhindert im Sinne einer sozialen Dimension von Behinderung;
(vgl. WHO, 1980; Bleidick & Hagemeister, 1998; Biewer, 2009)
Das Modell der ICIDH kann insofern als fortschrittlich gegenüber bisherigen Sichtweisen von Behinderung bezeichnet werden als es hervorhebt, dass objektiv feststellbare Schädigungen im körperlich-organischen Bereich je nach den Anforderungen und Erwartungen, mit denen ein Mensch in verschiedenen Lebensbereichen konfrontiert ist, zu ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Benachteiligungen führen können. Behinderung wird also sowohl als schädigungs- als auch als kontextabhängig aufgefasst.
In der International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF), die von der WHO 2001 als Weiterentwicklung der ICIDH von 1980 veröffentlicht wurde, wird Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation verwendet (DIMDI, 2005, S. 9) und verstanden als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen umwelt- sowie personbezogenen Kontextfaktoren (ebd., S. 22). Gegenüber der ICIDH, die als Klassifikationsgrundlage Krankheitsfolgen heranzieht, unterscheidet sich die ICF dadurch, dass sie nach „Komponenten der Gesundheit“ klassifiziert (ebd., S. 10) und damit auf die Lebenssituation aller Menschen, nicht nur auf jene von Menschen mit Behinderungen anwendbar ist (ebd., S. 13). Des weiteren wurde die Individuums- und Defektbezogenheit, die in der ICIDH vorherrschend war, in der ICF zugunsten einer relationalen und am Ziel sozialer Teilhabe orientierten Sichtweise von Behinderung aufgehoben. (vgl. Cloerkes, 2007; Fischer, 2008a; DIMDI, 2005) Behinderung wird demgemäß nicht mehr als „isoliertes Problem und als Eigenschaft einer Person beschrieben […], sondern als komplexe Konstellation von Umständen […].“ (Fischer, 2008a, S. 407) Während weiters in der ICIDH die Phänomene impairment, disability und handicap in einem linear-kausalen Zusammenhang begriffen wurden (eine Schädigung führt zu einer Beeinträchtigung, die wiederum soziale Benachteiligungen nach sich zieht), werden innerhalb der ICF zwischen den unten dargestellten Komponenten verschiedene Wirkungsrichtungen berücksichtigt. Kausale Verknüpfungen werden dabei als möglich, aber nicht zwangsläufig erachtet. (vgl. Fischer, 2008a; Meyer, 2004)
Die ICF besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich dem Verständnis von Gesundheitsproblemen unter der Berücksichtigung der folgenden drei Aspekte, die jeweils positiv (charakterisiert durch den Begriff Funktionsfähigkeit) oder negativ (ausgedrückt durch den Begriff Behinderung) ausgeprägt sein können. (vgl. DIMDI, 2005)
-
(Schädigung von) Körperfunktionen und -strukturen
Unter Körperfunktionen fallen sowohl physiologische als auch psychologische Funktionen des Organismus (z.B. Sehfunktionen, Stimm- und Sprechfunktionen, Bewusstsein), während unter Körperstrukturen die anatomischen und organischen Bestandteile des Körpers (z.B. Gehirn, Auge, Haut) gemeint sind. (vgl. DIMDI, 2005, S. 16; 51ff; 84ff). Von einer Schädigung ist zum Beispiel bei wesentlicher Abweichung oder dem Verlust von bestimmten Körperfunktionen oder -strukturen zu sprechen. (ebd., S. 16)
-
(Beeinträchtigung der) Aktivitäten
Aktivität wird im Sinne der ICF definiert als die „Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung (Aktion) durch einen Menschen“. (DIMDI, 2005, S. 95) Eine Beeinträchtigung besteht im Falle von auftretenden Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Aktivität. (ebd.)
-
(Beeinträchtigung der) Partizipation / Teilhabe
Unter Partizipation (Teilhabe) wird das Einbezogensein in eine Lebenssituation verstanden. Beeinträchtigt ist sie dann, wenn diesbezüglich Probleme auftreten. (ebd.)
Nachdem eine getrennte Behandlung von Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) im Verlauf des Erarbeitungsprozesses der ICF weder als möglich noch als sinnvoll betrachtet wurde, sieht die ICF eine gemeinsame Klassifikation beider Aspekte vor. (vgl. Biewer, 2009, S. 66)
Der zweite Teil der ICF ist den so genannten Kontextfaktoren gewidmet, wobei unterschieden wird zwischen
-
Umweltfaktoren und
-
personbezogene Faktoren.
Erstere beziehen sich auf „die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (DIMDI, 2005, S. 123) und von der einerseits fördernde, andererseits aber auch beeinträchtigende Einflüsse ausgehen können. (ebd., S. 14) Dazu zählen etwa verschiedenste Technologien, die gegenständliche Umwelt, in der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen verankerte Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, aber auch soziale Beziehungen, individuelle und gesellschaftliche Einstellungen. (ebd., S. 47ff)
Unter personbezogenen Kontextfaktoren werden all jene Aspekte gefasst, die einen Menschen im Speziellen ausmachen, jedoch nicht seinem Gesundheitsproblem bzw. -zustand zuzurechnen sind (z.B. Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Beruf). (DIMDI, 2005, S. 22) Sie werden „wegen der mit ihnen einhergehenden großen soziokulturellen Unterschiedlichkeit“ (ebd., S. 14) in der ICF nicht klassifiziert.
Jede der vier Komponenten
-
Körperfunktionen und -strukturen,
-
Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe),
-
Umweltfaktoren und
-
personbezogene Faktoren
setzt sich aus verschiedenen Domänen zusammen. Jede Domäne gliedert sich wiederum in mehrere Kategorien auf, welche letztlich die Einheiten der Klassifikation bilden. (DIMDI/WHO 2005, S. 16)
Abbildung 1 stellt die im Modell der ICF berücksichtigten Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten dar.
Der Taxonomie der ICF ist es zu verdanken, dass Behinderungen und Partizipationsbarrieren einer differenzierten Beschreibung und Bewertung zugänglich werden. Sie bietet allerdings keine Anhaltspunkte für die Ableitung von zu setzenden Maßnahmen. (vgl. Niediek, 2008)
Mit ihrer Systematik beansprucht die ICF eine transdisziplinär anwendbare Terminologie zu liefern (Biewer, 2009, S. 63) und damit die Kommunikation zwischen verschiedenen Personengruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern (DIMDI, 2005, S. 11). Dies ist für eine Zusammenarbeit der Heilpädagogik mit anderen Fachdisziplinen und Professionen von besonderer Relevanz. (vgl. Speck, 2008)
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das zentrale Interesse weniger auf Behinderung im Sinne einer individuellen Schädigung gelegt, sondern vielmehr auf ihre person- und umweltbezogenen Aus- und Wechselwirkungen, speziell im Hinblick auf berufliche Teilhabe. Trotz dieser thematischen Fokussierung, betrachtet die Autorin Behinderung insgesamt als bio-psycho-soziales Phänomen, weshalb sich ihr Verständnis am Konzept der ICF, das sowohl biologisch-medizinische, personale und psychische als auch soziale und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt, orientiert. Durch die Miteinbeziehung von Kontextfaktoren wird in der ICF die Relativität und Relationalität des Behinderungsbegriffs zum Ausdruck gebracht. (vgl. Friedrich, 2006, S. 34) Darüber hinaus thematisiert sie den Zusammenhang zwischen Behinderung und Teilhabe explizit.
Der Begriff geistige Behinderung wurde Ende der 1950er Jahre von der Elternvereinigung Lebenshilfe eingeführt. (Theunissen, 2000, S. 13) Vorrangiges Ziel war es dabei, bis dahin gebräuchliche, diskriminierende Begriffe wie Schwachsinn, Blödsinn oder Idiotie abzulösen. (Kulig, Theunissen, & Wüllenweber, 2006, S. 116) Ähnlich wie für den Oberbegriff Behinderung gilt auch für den Begriff geistige Behinderung, dass bis heute keine einheitliche Definition der damit bezeichneten Personengruppe vorliegt. (vgl. etwa Speck, 2005; Theunissen, 2000) Um die theoretische Perspektivenvielfalt in Bezug auf geistige Behinderung zu verdeutlichen sei auf Fischer (2008b) verwiesen, der zwischen folgenden Sichtweisen differenziert:
-
körperlich-organische Schädigungen beschreibende Ansätze aus medizinisch-psychiatrischer Sicht,
-
auf Entwicklung, Lernen und Kognition ausgerichtete Konzepte aus psychologischer Sicht,
-
auf „Soziales“ bzw. auf gesellschaftliche Bedingungen von „Be-Hinderung“ ausgerichtete Positionen aus soziologischer Sicht,
-
ersonalistische, soziale Bezüge berücksichtigende Ansätze aus pädagogischer Sicht,
-
anthroposophisch ausgerichtete Sichtweisen und Beschreibungen,
-
phänomenologisch und konstruktivistisch orientierte Arbeiten sowie
-
Konzepte, die geistige Behinderung als Ausdruck eines besonderen (und individuellen) Förderbedarfs zu umschreiben versuchen.
(Fischer, 2008b, S. 19)
Zur Einordnung dieser Sichtweisen schlägt Fischer (ebd., S. 31ff) eine Gegenüberstellung von „individuumsbezogenen, defizitären Modellen“ einerseits und „kompetenzorientierten Ansätzen“ andererseits vor. Erstere legen zentrales Augenmerk auf das jeweils Besondere eines Menschen, dabei vor allem auf dessen Ausgangsschädigungen, Behinderungen und sich daraus ergebenden besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse. Letztere stellen dagegen den Menschen mit seiner Persönlichkeit und seinen individuellen Kompetenzen aus einem positiven Blickwinkel heraus in den Mittelpunkt ihres Interesses. Ähnlich wie die in Abschnitt 3.1.1 beschriebene sozialtheoretische Perspektive auf Behinderung wird „Behinderndes“ aus der Sicht von kompetenzorientierten Ansätzen „nicht so sehr in der Person selbst, sondern in Besonderheiten der zwischenmenschlichen Wahrnehmung und Begegnung sowie in gesellschaftlichen Verhältnissen“ gesehen. (ebd.)
Auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass bei einer zu starken Fokussierung vorliegender Defizite das „Menschsein“ in all seinen heterogenen Facetten in den Hintergrund tritt (vgl. Biewer, 2004) und vorhandene Möglichkeiten und Potentiale nicht gesehen werden. Auf der anderen Seite kann eine Konzentration auf vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten aber wiederum dazu führen, dass die Erschwernisse, mit denen Menschen mit Behinderung in ihrem Leben konfrontiert sind, aus dem Blick geraten. (vgl. Fischer, 2008b) Die Bemühung um einen Ansatz, der beide Sichtweisen in ausgleichender Weise integriert ist daher wünschens- und begrüßenswert.
Eine besondere Schwierigkeit bei der Beschreibung von geistiger Behinderung im Vergleich zu anderen Behinderungsarten ergibt sich daraus, dass die vorliegenden Defizite (z.B. im Denken, im Reflexions- und Ausdrucksvermögen) den Zugang zu ihren eigenen Sichtweisen, Gefühlen und Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Behinderung erschweren und deren Einbezug dadurch nur eingeschränkt möglich ist bzw. oft gar nicht vorgenommen wird.
Die gebräuchlichen Beschreibungen und Klassifikationen von geistiger Behinderung erfolgen vom Standpunkt eines externen Beobachters aus, ohne Berücksichtigung der Sichtweise des betroffenen Menschen selbst. Im Falle von Menschen mit geistiger Behinderung hielt man den Einbezug bislang nicht für nötig, da man davon ausging, dass sie nicht zu sich selbst befragt werden können. (Fornefeld, 2008, S. 341)
Dieser Umstand ist bei dem Versuch geistige Behinderung zu definieren, oder auch bei der Orientierung an bereits erarbeiteten Definitionen, unbedingt zu berücksichtigen. ForscherInnen als „Nicht-geistig-Behinderte“ versuchen etwas zu beschreiben, das sie - wenn überhaupt - nur aus einer Außenperspektive heraus kennen. Dabei besteht die Gefahr, zu inadäquaten Aussagen zu gelangen, die nicht das treffen, was aus der Sicht von Menschen mit geistiger Behinderung eigentlich vordergründig wäre. Zudem beschreiben Definitionen immer etwas „Definitives“, „Endgültiges“ (Speck, 2005, S. 52) und können schon allein deshalb dem veränderlichen Phänomen der (geistigen) Behinderung nie gerecht werden. Selbst die ICF, die in der Literatur überwiegend als fortschrittliches Klassifikationssystem anerkannt wird, sieht ausschließlich die Feststellung eines gegenwärtigen Ist-Zustands vor, die Berücksichtigung von Vergangenem oder Zukünftigem bleibt dagegen aus. Damit wird eine Momentaufnahme der (geistigen) Behinderung eingefroren und ihr biographischer Aspekt, also ihre Entwicklung, Aufrechterhaltung und Veränderung über die Zeit, ausgeblendet. (vgl. Fischer, 2008a) Trotz der genannten Argumente, die gegen eine Festschreibung von (geistiger) Behinderung in Form von Definitionen sprechen, kann auf eine Bestimmung dessen, was (geistige) Behinderung ausmacht bzw. was darunter verstanden wird, nicht verzichtet werden, da dies beispielsweise für die Klärung von diversen Rechtsansprüchen oder Entscheidungen über die Form der Beschulung unerlässlich ist. Speck (2005) formuliert diese Notwendigkeit wie folgt:
Da […] das Handeln für Menschen mit geistiger Behinderung nicht allein der subjektiven Sichtweise des Einzelnen und seinen Normen ausgeliefert sein soll, ist es nötig, das Phänomen „geistige Behinderung“ in eine Verstehensordnung zu bringen, an der sich die pädagogische Praxis orientieren und überprüfen lassen kann, ohne über den Edukanden zu verfügen. (ebd., S. 46; Hervorhebung im Original)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus wissenschaftlicher, rechtlicher und organisationaler Sicht es ein Erfordernis bleibt, für sinnvolle und begründete Zwecke hinreichend klare Begriffe zu verwenden und zwar auch international vergleichbare. (Speck, 2005, S. 52)
Speck (2005) spricht sich daher für eine „Umschreibung“ - statt Definition - geistiger Behinderung aus, die nur so weit reichen soll, wie es „im Sinne einer hinreichenden Verständigung und Unterscheidung für einen bestimmten sinnvollen Zweck notwendig ist und zugleich die soziale Situation und die pädagogische Förderung am wenigsten belastet.“ (ebd., S. 52)
Dem Dilemma, dass die Bestimmung von geistiger Behinderung von außen her wohl immer unzureichend bleibt, versuchen partizipative Forschungsansätze zu begegnen, indem sie sich der Erforschung der Sichtweisen und Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung unter deren aktivem Einbezug widmen. So fordern etwa Palmowski und Heuwinkel (2000) dazu auf, die Perspektive von Menschen mit (geistiger Behinderung) „zum Ausgangspunkt einer neu zu gestaltenden Forschung und zu einer Theoriebildung von ‚innen heraus’ zu machen“ (Fischer, 2008b, S. 31). Einen Versuch dieser Forderung nachzukommen stellt zum Beispiel die Weiterentwicklung der ICIDH zur ICF dar, in deren Prozess von Beginn an Menschen mit Behinderungen eingebunden wurden. (vgl. Fischer, 2008a)
Auch wenn geistige Behinderung als solche in der ICF nicht eigens thematisiert wird, bietet das mit ihr dargelegte bio-psycho-soziale Modell einen sowohl theoretisch als auch praktisch relevanten Rahmen zur Einordnung verschiedener „Formen von kognitiv ‚be-hindert’ werden und ‚behindert sein’“ (Fischer, 2008a, S. 403).Wie auch in Abbildung 2 grafisch veranschaulicht, kann nach Fischer (ebd., S. 410f) im Sinne der ICF
[…] bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von einer „geistigen Behinderung“ gesprochen werden, wenn bzw. insofern und solange unter den Bedingungen
-
von Schädigungen von Körperstrukturen und -funktionen und/oder
-
einschränkenden/hemmenden sozialen und gesellschaftliche Lebens- und Entwicklungsbedingungen (Aspekt Kontextbedingungen)
der Erwerb und die Aneignung von altersgemäßen bzw. sozial erwarteten Kompetenzen (Aspekt „Aktivitäten“) – im Vergleich zu anderen Menschen – umfänglich und längerfristig erschwert wird und dadurch die Teilhabe (Partizipation) in zentralen Lebensbereichen […] massiv ver- oder „be-hindert“ wird.
In den letzten Jahren wurde die Verwendung des Begriffs geistige Behinderung zunehmend in Frage gestellt (vgl. Pinetz & Koenig, 2009), weil dadurch „ein Defizit, etwas Negatives, ein Manko, ein Handikap […], nämlich eine intellektuelle Unzulänglichkeit“ (Speck, 2005, S. 47; Hervorhebungen im Original) hervorgehoben wird, die nur allzu leicht „bestimmend für den ganzen Menschen“ (ebd.) wird. Betroffene bzw. People First empfinden den Begriff als stigmatisierend und bevorzugen stattdessen die Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten. (vgl. Kulig u. a., 2006) Ein Begriffswandel kann jedoch aus unterschiedlichen Gründen zu Unklarheiten und Verwirrung führen (vgl. ebd., S. 117f): erstens bedeuten alternative Begriffe oft fachlich etwas anderes und sind weniger präzise definiert, was die interdisziplinäre und internationale Kommunikation erschwert; zweitens können durch die Wahl sensiblerer Begriffe vorhandene Benachteilungen, sowie bestehender Unterstützungsbedarf verschleiert werden; drittens ist es wahrscheinlich, dass „ein neuer Begriff in relativ kurzer Zeit einen genauso stigmatisierenden Effekt erzeugen würde wie der derzeitige Terminus ‚geistige Behinderung’“ (ebd., S. 118). Letzteres Argument liegt darin begründet, dass nicht die Bezeichnung an sich stigmatisierend wirkt, sondern deren „gesellschaftlich geläufige Konnotationen des gemeinten Inhalts“ (Speck 2007, S. 136)
Statt geistiger Behinderungwird in der Diplomarbeit in Anlehnung an das Forschungsprojekt (siehe Kapitel 2) der alternative Begriff intellektuelle Beeinträchtigung verwendet. Er bezieht sich auf Personen, „deren kognitive Leistungsfähigkeit in Kombination mit unzureichendem Anpassungsverhalten zu lebenslangem Unterstützungsbedarf führt“. (Biewer u. a., 2009, S. 392)
Mit dieser Begriffswahl möchte die Autorin die Ablehnung der Betroffenen gegenüber dem Begriff geistige Behinderung respektieren und dabei fachlich möglichst präzise bleiben. Von der Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten möchte sie aus den oben genannten Gründen Abstand nehmen.
Die Begriffe Partizipation und Teilhabe werden in der deutschsprachigen Literatur häufig synonym verwendet (vgl. Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2005; DIMDI, 2005) und rühren von der Frage nach den Rechten von Menschen mit Behinderung her. (Biewer, 2009, S. 141) Laut Wacker (2005, S. 13) bezeichnet Teilhabe sowohl ein Recht als auch den Weg dorthin.
Biewer (2009, S. 142) unterscheidet zwischen einem politischen und einem lebensbereichbezogenen Partizipationsbegriff, wobei er letzteren unter anderem in der Systematik der ICF verankert sieht und als bestimmend für das gegenwärtige Verständnis im pädagogischen Kontext betrachtet.
Wie bereits in Kapitel 3.1.2 erwähnt, wird Partizipation / Teilhabe nach der ICF als „das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (DIMDI, 2005, S. 95) definiert und ihr Gelingen bzw. ihre Beeinträchtigung von der Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem einer Person und ihren Umweltfaktoren abhängig gemacht. (ebd., S. 5) Partizipation / Teilhabe kann sich dabei auf verschiedene (Lebens-) Bereiche, wie zum Beispiel Selbstversorgung, das häusliche Leben, Mobilität, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Kommunikation, Lernen und Wissensanwendung, die Übernahme von Aufgaben, Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, das wirtschaftliche sowie das Gemeinschafts-, soziale und staatsbürgerliche Leben, beziehen. (DIMDI, 2005, S. 42ff)
Theunissen (2009, S. 93) betont den Zusammenhang von Teilhabe zu Empowerment und Inklusion: „Empowerment ist der Wegbereiter für soziale Teilhabe und Inklusion erstreckt sich auf die Bedingungen, unter denen soziale Teilhabe mit Leben gefüllt werden kann.“
Wansing (2005) versteht Teilhabe als untrennbar verbunden mit ihrem Gegenpart, der Exklusion. Sie setzt sich aus soziologischer Perspektive mit den Inklusionsbedingungen und Exklusionsrisiken in der modernen Gesellschaft auseinander. Behinderung betrachtet sie dabei als einen der Hauptrisikofaktoren für Exklusion (ebd., S. 78), Menschen mit Behinderung als Träger von besonders hohen bzw. mehrfachen Exklusionsrisiken. (ebd., S. 15) Wie Theunissen (2009) bringt auch Wansing Teilhabe in Zusammenhang mit Inklusion: sie sieht Teilhabe gleichzeitig als Voraussetzung, Modus und Wirkung von Inklusion. (ebd., S. 171)
Obwohl Biewer (2009) der Verschränktheit der Konzepte Partizipation, Empowerment und Inklusion prinzipiell zustimmt, plädiert er dennoch für eine klare Unterscheidung dieser. (ebd., S. 141) Der pädagogische Begriff der Inklusion sei historisch eng mit institutionellen Entwicklungen verknüpft, während sich Partizipation „gleichermaßen auf nichtinstitutionelle Bereiche von Lebenserfahrungen“ beziehe. (ebd., S. 143)
Viele AutorInnen sprechen sich dafür aus, Teilhabe von bloßer Teilnahme zu unterscheiden. (vgl. etwa Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2005; Niediek, 2008; Theunissen, 2009; Biewer, 2004) Dementsprechend lautete etwa das Motto des Dortmunder Kongresses im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung (2003): „Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ (Wacker, 2005, S. 14). Denn physische Anwesenheit reiche nicht aus, um „den Respekt vor der Verschiedenheit und der Persönlichkeit, den behinderungserfahrene Menschen benötigen, um eine eigene Rolle aus Bürger(innen) der Gesellschaft zu spielen“ (ebd.), sicherzustellen.
Bezüglich der begrifflichen Trennung von Teilhabe und Teilnahme schreibt Biewer (2004, S. 296):
Teilhabe bezeichnet den Einbezug von Menschen mit Behinderungen in die Handlungskontexte des regulären Lebens. Auch wenn mit Teilnahme am Arbeitsleben der Besuch von Sonderinstitutionen für Behinderte gemeint sein kann, setzt sich in letzter Zeit eher ein solches Verständnis durch, das den Einbezug in das alltägliche Leben der Gesellschaft und den Verzicht auf verbesonderte Handlungsfelder meint. Teilhabe wird verstanden als uneingeschränkter Zugang zu allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens, und zwar nicht als ein bloßes „Dabei-Sein“. Vielmehr soll es um Mitbestimmung, Mitwirkung und Gestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens in allen Lebensbereichen und Lebensphasen gehen. (Biewer, 2004, S. 296)
Ähnlich wie die ICF begreift Niediek (2008) Partizipation als etwas, das seine individuelle Ausgestaltung in der Wechselwirkung zwischen einer Person und ihrer Umwelt erfährt. Sie entstehe „in der sozialen Interaktion von Personen mit anderen Personen.“ (ebd., S. 293) Diese Sichtweise ist von besonderer Relevanz für die in der Diplomarbeit untersuchte Thematik.
Niediek betont in diesem Zusammenhang, dass sich Partizipation im Sinne einer aktiven Beteiligung nicht nur an die Gemeinschaft und die soziale Umwelt des zu Beteiligenden richtet, unter der Forderung, „Partizipationsräume zu eröffnen“, sondern auch an das Individuum selbst, unter der Aufforderung, „zur Gestaltung ihrer sozialen Umwelt durch eigene Aktivität beizutragen“. (ebd.)
Weiters hebt Niediek „Interessengerichtetheit“ als Merkmal von Partizipation hervor und meint damit, dass Teilhabe nur dort stattfinden kann, wo sich gemeinsame Interessen und Angelegenheiten vorfinden. (ebd., S. 294) Zudem sei ein direktes Ansetzen bei den sozialen Gruppen erforderlich, in denen Partizipation angestrebt wird. (ebd., S. 296) Damit begründet Niediek, dass gut gemeinte Partizipationsbemühungen auch scheitern können, wenn sie nicht die Interessen der daran Beteiligten treffen, und Integration stattdessen zum Selbstzweck wird. (ebd., S. 294)
Der Ausgangspunkt für Diskussionen um berufliche Teilhabe besteht in der „große[n] Bedeutung des Arbeitslebens für alle Bürgerinnen und Bürger unser Gesellschaft“ (Frühauf & Wendt, 2005, S. 348). (siehe hierzu Kapitel 4.2) Chancen oder Barrieren beruflicher Teilhabe ergeben sich nach Niehaus (2005, S. 83) unter anderem durch Faktoren, die auf sozialer Ebene wirken: „Im Kontext der beruflichen Teilhabe spielen die Einstellungen der betrieblichen Akteure (z.B. Vorgesetzte, Kollegen, Personaler) im Sinne von affektiv-emotionalen und kognitiven Reaktionen und Verhaltensbereitschaften gegenüber der Gruppe von Mitarbeitern mit Behinderungen eine wichtige Rolle.“
Die Literatur zum Themenbereich berufliche Teilhabe konzentriert sich weitestgehend auf die Herausarbeitung aktuell vorhandener Möglichkeiten und Barrieren beruflicher Teilhabe und auf das Aufzeigen möglicher bzw. die Entwicklung neuer Maßnahmen der beruflichen Integration zur Förderung beruflicher Teilhabe. (vgl. etwa Bieker, 2005b; Pinetz & Koenig, 2009; Niehaus, 2005) Lenkt man das Interesse weg von den Bedingungen, die berufliche Teilhabe (un)möglich machen, und bemüht sich stattdessen um eine Klärung des Begriffs selbst, so wird deutlich, dass hier offensichtlich eine beträchtliche Forschungslücke besteht. Nur vereinzelte Beiträge thematisieren, was berufliche Teilhabe konkret bedeutet, zum Beispiel aus rechtlicher oder aus heilpädagogischer Perspektive. Vom Literaturüberblick der Autorin ausgehend, bleibt die Sicht der teilhabenden bzw. von Teilhabe ausgeschlossenen Menschen diesbezüglich bislang gänzlich unberücksichtigt. Der Begriff der beruflichen Teilhabe bleibt somit weitgehend inhaltsarm (vgl. auch Biewer, 2009, S. 143) und seine Operationalisierbarkeit fraglich.
Es ist davon auszugehen, dass sich in der Praxis weniger die Frage stellt, ob in der aktuellen Lebenssituation eines Menschen von (erlebter) beruflicher Teilhabe gesprochen werden kann – denn eine Beantwortung mit „ja“ oder „nein“, so sie denn überhaupt möglich ist, bliebe in jedem Fall unbefriedigend – sondern viel eher inwiefern. Daher wäre es wichtig, den „in pädagogischen Zusammenhängen zunehmend häufiger […] fast schon inflationär“ verwendeten Begriff (Biewer, 2009, S. 147) in unterschiedliche inhaltliche Dimensionen aufzugliedern. Dies stellt keine einfache Aufgabe dar, besonders in Anbetracht der Überlegung, dass fast alle der in der ICF unter der Komponente „Aktivitäten und Partizipation“ subsumierten Bereiche (siehe hierzu das übergeordnete Kapitel Partizipation / Teilhabe bzw. DIMDI, 2005, S. 42ff) für die Teilhabe am Arbeitsleben relevant sein können. Auch Friedrich (2006, S. 36) betont, dass Teilhabe am Arbeitsleben alle Partizipationsdimensionen berührt, womit er begründet, dass der Ausschluss von Arbeit Ausgrenzungserfahrungen und -gefahren mit sich bringt, die über das berufliche Leben hinausreichen.
Stöpel (2005) unterscheidet in einem Beitrag in der Zeitschrift Sonderpädagogik zwischen verschiedenen Formen beruflicher Teilhabe, je nach Umfang und Art. Dazu zieht er ein Modell mit den Achsen „Grad der Selbständigkeit“ und „Umfang der beruflichen Teilhabe“ heran, das die Verortung verschiedener Kategorien von Arbeitenden (z.B. selbständige Unternehmer, Angestellte / Arbeiter / Beamte, Teilzeitbeschäftigte, Rehabilitanden etc.) in dem durch die Achsen aufgespannten zweidimensionalen Raum vorsieht. (Stöpel, 2005, S. 20f) Berufliche Teilhabe wird dabei nach Stöpel (ebd., S. 20) „lediglich über den zeitlichen Umfang definiert“. In diesem Zusammenhang spricht er auch von „quantitativer beruflicher Teilhabe“ und geht beispielsweise davon aus, dass der selbständige Unternehmer für gewöhnlich im Vergleich zum Teilzeitbeschäftigten mehr berufliche Teilhabe erlebt. (ebd., S. 21) Die Autorin teilt diese Sicht nicht. Sie begreift Teilhabe als etwas, das sich einer quantitativen und von außen aufgestempelten Bestimmung entzieht. Auch wenn Stöpel betont, dass „‚mehr nicht gleich besser’ bedeutet“ und die „exemplarisch eingefügten beruflichen Stellungen […] idealtypisch positioniert“ sind (ebd.), bleibt der theoretische und praktische Wert eines solchen Teilhabeverständnisses aus heilpädagogischer Sich stark anzuzweifeln. Es ist statisch und objektivierend und verabsäumt daher die Berücksichtigung jeglicher Individualität und Relativität. Am Ende seines Forschungsbeitrags räumt Stöpel ein, dass das Modell eigentlich um eine weitere Achse, nämlich „Qualität der Arbeit“, zu ergänzen wäre, aus „Gründen der Darstellbarkeit“ aber „an dieser Stelle darauf verzichtet werden [musste]“. (ebd., S. 29) Das Modell bliebe allerdings selbst unter der Einbeziehung dieser zusätzlichen Dimension enttäuschend undifferenziert, vergleicht man es mit dem Modell der ICF und der darin vorgesehenen Vielfalt an berücksichtigten Faktoren, die Partizipation beeinflussen können.
Die Autorin richtet ihr Verständnis von Partizipation / Teilhabe an der Taxonomie der ICF aus. In der vorliegenden Arbeit beschäftigt sie sich mit den Teilhabeerfahrungen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Lebensbereich Arbeit machen. Unter beruflicher Teilhabe versteht sie daher alle Formen der Partizipation, die sich auf das Einbezogensein in diesen Lebensbereich beziehen.
Arbeit wird sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen oft mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt, vor allem wenn „Arbeit haben“ von „arbeitslos sein“ unterschieden werden soll. (vgl. Bieker, 2005a; Kirchler, Meier-Pesti, & Hofmann, 2008)Unter Erwerbsarbeit ist nach Bieker (2005a, S. 12), der auf einen Literaturbeitrag von Kocka (2002, S. 6) zurückgreift, Folgendes zu verstehen:
Erwerbsarbeit meint Arbeit, die darauf ausgerichtet ist, zum Zweck des Tausches auf dem Markt Güter herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Sie meint Arbeit, von der man lebt, durch die man verdient – sei es in abhängiger oder selbständiger Stellung oder in einer der vielen Zwischenstufen, sei es mit manueller oder nichtmanueller, mit mehr oder weniger qualifizierter Tätigkeit […].
Versteht man Arbeit ausschließlich als Erwerbsarbeit, so zählen nach Bieker (2005a) Tätigkeiten, die Menschen mit Behinderung in Werkstätten auf dem Ersatzarbeitsmarkt erbringen, nicht dazu. Dies begründet er damit, dass solche Tätigkeiten nicht vorrangig der Einkommensbeschaffung, sondern anderen Zwecken, wie etwa der individuellen Förderung, der Beschäftigung oder der beruflichen Qualifizierung, dienen. (ebd., S. 12) Da aber zum einen Erwerbsarbeit keineswegs immer klar von anderen Formen der Arbeit abgrenzbar ist (vgl. Kirchler u. a., 2008) und zum anderen Menschen mit Behinderungen die von ihnen geleistete Werkstattarbeit in vielen Fällen als „Arbeit wie andere Arbeit auch“ wahrnehmen (Bieker, 2005a, S. 13), reicht es in diesem Rahmen nicht aus, Arbeit als reine Erwerbsarbeit zu verstehen. Aus dieser Überlegung heraus sei auf Kirchler u. a. (2008, S. 18ff) verwiesen, die folgende wesentliche Aspekte von Arbeit herausstreichen:
-
Arbeit in Form von (körperlicher oder psychischer) Anstrengung bei der Verrichtung einer Tätigkeit;
-
Arbeit als Gegensatz zur Untätigkeit;
-
Arbeit als zielgerichtete Tätigkeit zur Schaffung eines eigenen Werks (gemeint sind damit Güter und Dienstleistungen);
Werden Tätigkeiten, welche die genannten Aspekte aufweisen, als Arbeit verstanden, so schließt diese Betrachtungsweise nicht von vornherein die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen geleisteten Tätigkeiten aus.
In der Diplomarbeit werden unter Arbeit prinzipiell jene Tätigkeiten verstanden, welche die von Kirchler u. a. (ebd.) genannten Aspekte aufweisen. Im Einzelfall versteht die Autorin darunter aber letztlich all jene Tätigkeiten, die von den ForschungsteilnehmerInnen als Arbeit erlebt werden. Auf den Kontext, in dem diese Tätigkeiten erledigt werden, wird dementsprechend unter Verwendung des Begriffs Arbeitskontext Bezug genommen. Die Bedeutung von Arbeit für den Menschen (mit einer Behinderung) wird in Kapitel 4.2 behandelt.
Unter interaktionellen Erfahrungen werden im Rahmen dieser Arbeit alle Erfahrungen verstanden, die ein Mensch im sozialen Umgang mit anderen macht. Um dieses Verständnis zu präzisieren bedarf es einer Klärung der Begriffe soziale Interaktion, Kommunikation und soziale Beziehungen. Vorweg ist zu sagen, dass jeder der drei Begriffe Bezug auf mindestens zwei Personen nimmt, die miteinander in sozialem Austausch stehen. Interaktionen, Kommunikation und Beziehungen können also prinzipiell immer von zwei Seiten aus betrachtet werden. An dieser Stelle sei daher explizit darauf hingewiesen, dass sich die innerhalb dieser Arbeit durchgeführte qualitative Untersuchung hingegen ausschließlich dem (einseitigen) Erleben der ForschungsteilnehmerInnen und ihren persönlichen Erfahrungen widmet. Die Perspektive ihrer Interaktions-, Kommunikations- und Beziehungspartner bleibt dabei unberücksichtigt.[3]
Bierhoff und Jonas (2011, S. 132) verstehen unter sozialer Interaktion „ein wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln von mindestens zwei Akteuren“. Im Unterschied zur Kommunikation, die auch in nur eine Richtung verlaufen kann, beeinflussen sich die an einer sozialen Interaktion beteiligten Personen in ihrem Verhalten immer gegenseitig, und zwar in Form von Aktionen und Reaktionen. Soziale Interaktionen sind in ihrer Dauer zeitlich begrenzt und können zwischen den Beteiligten in ganz unterschiedlichen Zeitintervallen (z.B. mehrmals pro Tag, Woche, Monat oder Jahr) wiederholt stattfinden. (vgl. Hinde, 1993; Bierhoff & Jonas, 2011) Hughes, Kim und Hwang (1998) betonen die Vielschichtigkeit sozialer Interaktion, die sich aus ihrer Bedingtheit durch viele verschiedene Faktoren ergibt. Dazu zählen etwa die Interaktionspartner mit ihren Persönlichkeiten, Kognitionen, Emotionen und Motivationen, aber auch der Kontext, in dem interagiert wird, der Inhalt, die Funktion und die Absicht der Interaktion sowie ihre Tiefe und Dauer. (vgl. Hughes u. a., 1998; Bierhoff & Jonas, 2011)
Im Lebensbereich Arbeit unterscheidet Kirmeyer (1988, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128f) zwischen arbeitsbezogenen und nichtarbeitsbezogenen Interaktionen. Erstere beziehen sich direkt auf die zu erledigenden Aufgaben und bestehen etwa im Folgen von Anweisungen, im Einholen von Unterstützung bei der Erledigung der Arbeit, im Austausch von arbeitsbezogenen Informationen und im Reagieren auf arbeitsbezogene Kritik. Letztere nehmen dagegen keinen direkten Bezug zu den Arbeitsaufgaben und beinhalten eher Dinge wie das Treiben von Scherzen, sich gegenseitig auf den Arm Nehmen, und den Austausch über private Angelegenheiten. Nach Chadsey und Beyer (2001) sind beide Arten von Interaktionen als wesentlich zu betrachten, arbeitsbezogene vor allem für eine erfolgreiche Erledigung der Arbeitsaufgaben und in diesem Sinne für das Aufbauen einer Beziehung zum/zur ArbeitgeberIn und nichtarbeitsbezogene, indem sie Anknüpfungspunkte für positive soziale Beziehungen zu KollegInnen bieten.
Wenn Menschen miteinander kommunizieren geben sie „verbal oder nonverbal, bewusst oder unbewusst weiter, was sie meinen, denken oder fühlen bzw. nehmen Informationen aus ihrer Umwelt wahr“. (Frey & Bierhoff, 2011, S. 346)Der Kommunikationsprozess kann dabei in folgende Komponenten gegliedert werden.
(vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)
Es ist wichtig zu erwähnen, dass gesendete und empfangene Informationen einander nicht immer entsprechen, etwa weil der Sender beim Ausdrücken (Kodieren) und der Empfänger beim Verstehen und Interpretieren (Dekodieren) der Information auf unterschiedliche Zusammenhänge und Annahmen zurückgreift, oder aber, weil Störungen im Kommunikationskanal (z.B. hoher Geräuschpegel, schlechte Verbindung) auftreten u. v. m. (vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)
Das oft genannte Zitat von Watzlawick: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2000, S. 53, zit. nach Traut-Mattausch & Frey, 2011, S. 165) weist darauf hin, dass wir durch unser Verhalten, und sei es Schweigen, ständig Informationen vermitteln.
Für die Thematik der Diplomarbeit ist insbesondere die interpersonelle Kommunikation von Relevanz, die sich durch ein direktes In-Beziehung-Treten von Sender und Empfänger auszeichnet. (vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)
Von einer sozialen Beziehung ist nach Asendorpf und Banse (2000, S. 4) dann zu sprechen, wenn eine aus zwei Menschen gebildete Dyade stabile und für diese Beziehung spezifische Interaktionsmuster aufweist.Für die kognitive Repräsentation einer Beziehung verwenden die Autoren (ebd.) unter Verweis auf Baldwin (1992) den Begriff des Beziehungsschemas. „Es besteht aus einem Bild der eigenen Person in der Beziehung, einem Bild der Bezugsperson und aus Interaktionsskripten für bestimmte Situationen, die die eigene Sicht des Interaktionsmusters in diesen Situationen repräsentieren.“ (Asendorpf & Banse, 2000, S. 4; Hervorhebungen im Original)Die meisten sozialen Beziehungen werden zum einen durch wechselseitige Rollenerwartungen, zum anderen durch die Persönlichkeit der miteinander in Beziehung stehenden Menschen geprägt. (vgl. Asendorpf & Banse, 2000, S. 7ff)
Hinde (1993, S. 10) bringt die Verschränktheit der Begriffe Interaktion und Beziehung zum Ausdruck, indem er schreibt: „Beziehungen sind dynamisch und jede Interaktion innerhalb einer Beziehung kann den weiteren Verlauf der Beziehung beeinflussen. Umgekehrt ist jede Interaktion durch die Beziehung geprägt, in die sie eingebettet ist – etwa durch Erinnerungen an frühere Interaktionen oder die Erwartung zukünftiger“.
Arbeitsbeziehungen unterscheiden sich von anderen Beziehungen vor allem durch die Organisiertheit ihres sozialen Kontextes, also ihre „Einbettung in eine übergreifende Ordnung, die nicht in den Beziehungen selbst geschaffen wird, sondern prä-existent und super-potent ist“ (Neuberger, 1993, S. 259). Ähnlich bemerkt auch Argyle (1992, S. 59): „Work relationships are the result of people being brought together by the work”. Daraus ergibt sich, dass es nur begrenzt möglich ist, sich die Personen, mit denen man beruflich zu tun hat, auszusuchen. Ebensowenig kann ihnen bei zwischenmenschlichen Konflikten ohneweiters aus dem Weg gegangen werden. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass wir uns ArbeitskollegInnen gegenüber im Vergleich zu FreundInnen oder Bekannten in besonderer Weise verhalten und umgekehrt von ihnen auch anderes Verhalten als von FreundInnen oder Bekannten erwarten. Neben der stark formalen Komponente, die Arbeitsbeziehungen prägt, entwickelt sich über die Zeit aber auch ein gewisses Ausmaß an informellem Spielraum für ihre Ausgestaltung. (vgl. Argyle, 1992) So können soziale Beziehungen im Arbeitskontext je nach gegenseitiger Sympathie, erlebten Gemeinsamkeiten o. Ä. mehr oder weniger oberflächlich bzw. persönlich ausfallen. Argyle (1992, S. 80f) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen vier unterschiedlich engen Formen von Arbeitsbeziehungen:
-
Reine Arbeitsbeziehungen, die nur wegen der vorgegebenen Organisationsstruktur aufrechterhalten werden und als unausweichlich charakterisiert werden können.
-
Freundlich gesinnte Arbeitsbeziehungen zu Personen, denen man bei der Arbeit öfters und überwiegend gerne begegnet, die man aber zum Beispiel nicht auswählen würde, um zusammen Mittagessen zu gehen.
-
Arbeitsfreundschaften, die während den Arbeitspausen, nicht aber im privaten Lebensbereich gepflegt werden.
-
Private Freundschaften, die nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch darüber hinaus, etwa in der Freizeit, aufrechterhalten werden.
Nach Gaska und Frey (1993, S. 281), die auf Weber (1922) verweisen, werden andere Menschen in formellen Beziehungen eher partikularistisch, in informellen Beziehungen eher holistisch wahrgenommen. Eine partikularistische Sichtweise ist durch die Konzentration der menschlichen Wahrnehmung auf einen bestimmten Teil oder Ausschnitt gekennzeichnet, die in diesem Fall daher rührt, eine Person nur in ihrer einen Rolle, nämlich ihrer beruflichen, zu kennen. Allzu oft besteht die Neigung, diesen Ausschnitt als das einzig Wahre anzusehen und daraus Rückschlüsse auf die gesamte Persönlichkeit des anderen zu ziehen. Eine holistische Sichtweise meint dahingehen die ganzheitliche Wahrnehmung eines Menschen, die dadurch entsteht, sehr viele Seiten von ihm zu kennen und ihn in unterschiedlichen Rollen zu erleben.
Zur Herausarbeitung des aktuellen Forschungsstands im Zusammenhang mit dem Thema der Diplomarbeit ging die Autorin folgenden Fragen nach:
-
Was ist über soziale Beziehungen und soziale Interaktionen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Verlauf ihres Lebens, vor allen Dingen im Lebensbereich Arbeit, bekannt? (siehe hierzu Kapitel 4.1)
-
Welche Bedeutung hat Arbeit für den Menschen (mit einer Behinderung) und welche Bedeutung kommt dabei im Speziellen den interaktionellen Erfahrungen im beitskontext zu? (siehe hierzu Kapitel 4.2)
Menschen mit Behinderung schreiben sozialen, insbesondere freundschaftlichen Beziehungen in ihrem Leben ein hohes Maß an Wichtigkeit zu. (O’Connor, 1983, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) Bezogen auf den Lebensbereich Arbeit konnten Flores, Jenaro, Orgaz und Martín (2011) in einer groß angelegten Studie zeigen, dass soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und KollegInnen wesentliche Faktoren für die Vorhersage der „quality of working life“ von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung – sowohl in Werkstätten für Menschen mit Behinderung als auch in unterstützter Beschäftigung – darstellen.
Chadsey und Beyer (2001) setzen sich in ihrem Artikel mit Forschungsbeiträgen zu sozialen Beziehungen und sozialen Interaktionen zwischen Menschen mit Behinderung (speziell mit intellektuellen oder kognitiven Beeinträchtigungen) und ihren ArbeitskollegInnen ohne Behinderung auseinander. In Bezug auf die in Kapitel 3.5.3 dargestellte Unterscheidung verschieden enger Beziehungen nach Argyle (1992) konnten etwa Ohtake und Chadsey (1999, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) sowie Rusch, Hughes, Johnson und Minch (1991, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) feststellen, dass unterstützte Beschäftigte mit Behinderungen bei der Arbeit nur selten Freundschaften knüpfen, vor allem keine, die auch in den privaten Lebensbereich hineinreichen: „[…] co-workers may assume many roles in the lives of supported employees, such as a trainer, advocate, and evaluator, but few describe themselves as befriending their colleagues with disabilities […].” (Chadsey & Beyer, 2001, S. 130) Zu diesem Ergebnis gelangten auch Forrester-Jones, Jones, Heason und Di Terlizzi (2004, zit. nach A. Jahoda, Kemp, Riddell, & Banks, 2008) in ihrer Studie über den Einfluss von unterstützter Beschäftigung auf die sozialen Netzwerke von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Nach den AutorInnen charakterisieren die Betroffnen bei der Arbeit nur wenige Beziehungen als reziproke Freundschaften und sehen in nur wenigen InteraktionspartnerInnen Personen, denen sie sich anvertrauen können. „Those regarded as the most supportive […] were staff and family members” (A. Jahoda u. a., 2008, S. 12)
Schwierigkeiten, die Menschen mit Behinderungen im sozialen Kontakt zu ihren ArbeitskollegInnen erleben, können nach Chadsey und Beyer (2001, S. 129) auf unterschiedliche Faktoren bzw. auf ihre ungünstige Kombination zurückgeführt werden:
-
Der durch die Arbeits- und Organisationskultur geprägte Kontext, in dem soziale Interaktion stattfindet; MitarbeiterInnen, die den Erwartungen und Wertvorstellungen dieser Kultur entsprechen, werden von ihren KollegInnen tendenziell eher akzeptiert und geschätzt als solche, die dies nicht tun. (Wayne & Linden, 1995, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001)
-
Eine unausgeglichene Ermöglichung von arbeits- und nichtarbeitsbezogenen Interaktionen; nicht jeder Beruf bzw. jede Arbeitstätigkeit ermöglicht beide Arten von Interaktionen in ausgleichender Weise. (vgl. Gaska & Frey, 1993; Hughes u. a., 1998)
-
Ein Mangel an sozialen Fähigkeiten des Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung; häufig besteht ein solcher Mangel aufgrund eines eingeschränkten expressiven und rezeptiven Sprachvermögens. (Chadsey & Beyer, 2001, S. 129)
-
Die Erfahrung, sowohl von Menschen mit als auch von Menschen ohne Behinderung im gegenseitigen Umgang miteinander, speziell im Arbeitsumfeld; fehlende Erfahrung kann den natürlichen sozialen Umgang miteinander hemmen, weil er mit viel Unsicherheit verbunden ist.
-
Negative Einstellungen der KollegInnen gegenüber Menschen mit Behinderungen;
-
Fehlendes Interesse, miteinander in sozialen Austausch zu treten;
In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass soziale Faktoren (z.B. soziale Sensibilität, Kooperation, soziale Kompetenz, sozial angepasstes Verhalten) in gleichem Maße ausschlaggebend für die Kündigung von MitarbeiterInnen mit Behinderungen waren wie ein angeblicher Mangel an Fähigkeiten zur erfolgreichen Erledigung der Arbeitsaufgaben. (vgl. Chadsey & Beyer, 2001)Weiters konnten etwa Beyer, Kilsby und Willson (1995, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) Unterschiede in den Interaktionsmustern zwischen Beschäftigten mit und ohne Behinderung feststellen: „supported employees generated fewer interactions than their nondisabled co-workers, […] the frequency of directions and greetings were higher, and […] teasing, joking, and general conversations were lower for supported employees than co-workers.” (Chadsey & Beyer, 2001, S. 130) Nach Chadsey-Rusch, Gonzalez, Tines und Johnson (1989, zit. Nach Chadsey & Beyer, 2001) betreiben MitarbeiterInnen ohne Behinderung untereinander mehr Konversation über nichtarbeitsbezogene Themen und weisen deshalb allgemein höhere Interaktionsraten auf als ihre KollegInnen in unterstützter Beschäftigung.
Hughes u. a. (1998) setzen sich in ihrer Literaturstudie mit Indikatoren sozialer Integration von Menschen mit Behinderung (zum überwiegenden Teil mit einer intellektuellen Beeinträchtigung) am Arbeitsplatz auseinander. Unter sozialer Integration verstehen sie, dass Menschen mit und ohne Behinderung in gleicher Weise und in gleichem Ausmaß an sozialen Interaktionen partizipieren (ebd., S. 173). Beispielhaft wird auf die von Parent, Kregel, Metzler und Twardzik (1992, zit. nach Hughes u. a., 1998, S. 173) vorgeschlagenen Indikatoren für soziale Integration am Arbeitsplatz verwiesen: „taking lunch and breaks at the same time and location as coworkers; interacting frequently with other employees throughout the day; and participating in special events at work, such as celebrating a coworker’s birthday with cards or gifts.”Ein zentrales Anliegen von Hughes u. a. (1998) bestand darin, aus der Literatur die wichtigsten Variablen zusammenzutragen, mit deren Hilfe soziale Interaktionen von Beschäftigten mit und ohne Behinderungen deskriptiv erhoben wurden. Als Kriterium für die Auswahl von Studien setzten sie unter anderem die Anwendung von Methoden der direkten Beobachtung fest. „Studies in which social interaction was measured using only subjective assessment methods (e.g., surveys or interviews) were not included […].” (Hughes u. a., 1998, S. 174f)Über zwölf ausgewählte Studien hinweg zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung der herangezogenen Variablen. Zu deren Einordnung identifizierten Hughes u. a. (1998) folgende zehn Kategorien:
-
Funktion der Interaktion (z.B. Kontaktaufnahme initiieren oder erwidern)
-
Inhalt der Interaktion (z.B. arbeitsbezogen vs. Nichtarbeitsbezogen
-
an der Interaktion beteiligte Personen (neben „Zielperson“ z.B. KollegInnen, Vorgesetzte)
-
Absicht bzw. Zweck der Interaktion (z.B. Unterstützung anbieten, anfordern oder erhalten, jemanden grüßen oder gegrüßt werden, sich gegenseitig aufziehen)
-
Umgebungskontext der Interaktion (z.B. während der Arbeit, beim Mittagessen, in der Pause)
-
Angemessenheit vs. Unangemessenheit der Interaktion
-
Physische Nähe zwischen MitarbeiterInnen mit und ohne Behinderung
-
Anzahl der an der Interaktion Beteiligten
-
Sozialer Kontext der Arbeitsvermittlung
-
Anzahl der InteraktionspartnerInnen über alle Interaktionen hinweg
Die AutorInnen sprechen von einem generellen Effekt des Umgebungskontextes sowie des „Vorhandenseins“ vs. „Nichtvorhandenseins“ einer Behinderung auf die beobachteten Interaktionsmuster. (Hughes u. a., 1998, S. 178) Weiters zeigten sich folgende Ergebnisse über die in Betracht gezogenen Studien hinweg:
-
Beschäftigte mit einer Behinderung initiierten mehr Interaktionen mit anderen MitarbeiterInnen mit einer Behinderung, während Beschäftigte ohne Behinderung wiederum vermehrt in Kontakt mit KollegInnen ohne Behinderung traten. (Hughes u. a., 1998, S. 178)
-
Beschäftigte ohne Behinderung waren an mehr arbeitsbezogenen Interaktionen beteiligt als Beschäftigte mit Behinderung. (ebd., S. 179)
-
Sowohl MitarbeiterInnen mit als auch ohne Behinderung interagierten mehr mit ihren KollegInnen als mit ihren Vorgesetzten. Im Beisein eines „Job Coach“ interagierten MitarbeiterInnen mit Behinderung weniger mit KollegInnen ohne Behinderung. (Hughes u. a., 1998, S. 180)
-
Während MitarbeiterInnen mit Behinderung hauptsächlich in Interaktionen zum Zwecke des Grüßens oder des Erhalts / der Anfrage von Instruktionen involviert waren, verbrachten Beschäftigte ohne Behinderung mehr Zeit damit, nach Informationen zu fragen, Witze zu machen und sich gegenseitig aufzuziehen. (ebd.)
-
Unangemessene Interaktionen traten sowohl bei Beschäftigten mit als auch ohne Behinderung nur selten auf. (ebd.)
Im Folgenden werden einige neuere Studien dargestellt, die sich zwar nicht direkt auf den Arbeitskontext beziehen, die aber dennoch Wesentliches zum Verständnis von sozialen Interaktionsprozessen, in die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Verlauf ihres Leben häufig involviert sind, beitragen.
Jingree, Finlay und Antaki (2006) untersuchten in einer Studie die Macht-Dynamik in verbalen Interaktionen zwischen Pflegepersonal und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in einem Pflegewohnheim im Südosten Englands. Die Analyse zeigte, dass das Pflegepersonal während so genannter „residents’ meetings“ auf verschiedene subtile Arten Macht ausübte und damit bestimmte Aussagen und Entscheidungen auf der Seite der betreuten BewohnerInnen herbeiführte. Dadurch entstanden Interaktionsmuster, die dem ursprünglichen Ziel dieser Treffen – nämlich die Stärkung der Autonmie der BewohnerInnen – entgegengesetzt waren.
Antonsson, Graneheim, Lundström und Åström (2008) führten in ihrer Studie eine qualitative Inhaltsanalyse der Reflexionen des Betreuungspersonals in betreuten Wohneinrichtungen über ihre Interaktionen mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch. Dabei kristallisierten die AutorInnen die Hauptkategorien „erfolgreiche Interaktion“ und „erfolglose Interaktion“ heraus. (ebd., S. 486) Die Beziehung zwischen Pflegepersonal und den Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lässt sich laut Antonsson u. a. als „subject-to-subject relation“ oder als „subject-to-object relation“ beschreiben, wobei erstere durch Reziprozität und letztere durch Distanziertheit gekennzeichnet sei. (ebd., S. 489)
Williams, Ponting, Ford und Rudge (2009) konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass die Referenz auf gemeinsames Wissen und gemeinsame Erfahrungen dem Herstellen einer Verbindung zwischen menschlichen und professionellinstitutionellen Beziehungsaspekten dienlich ist und insofern eine persönlichere Beziehung zwischen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ihren AssistentInnen ermöglicht.
Whitehouse, Chamberlain und O'Brien (2001) untersuchten in ihrer Studie verschiedene Gründe, weshalb Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben, persönliche Beziehungen aufzubauen. Die AutorInnen konnten zeigen, dass die reine Möglichkeit, anderen Menschen in einem unterstützenden Umfeld zu begegnen, einen weitaus wichtigeren Faktor darstellt als der Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigung oder die vorhandenen Sozialkompetenzen.
Dass Arbeit im Leben eines Menschen einen großen Stellenwert einnimmt, gilt heute als unumstritten. Er verbringt einen beträchtlichen Teil seines Lebens damit, sie strukturiert sein Zeiterleben (den Tag, die Woche, das Jahr und auch die gesamte Lebensspanne) und erfüllt wesentliche Grundbedürfnisse wie finanzielle Sicherheit, soziale wie gesellschaftliche Zugehörigkeit, soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung. (vgl. Frese, 1985; A. Jahoda u. a., 2008; Dittrich, 2005; Gaska & Frey, 1993; Speck, 2005) Nach Stewart (1985, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128) bildet der Arbeitskontext für erwerbstätige Personen neben dem engsten Familienkreis oft das zweitwichtigste soziale Umfeld. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass soziale Interaktionen und Beziehungen bei der Arbeit, weil sie einen großen Teil der Gesamtmenge sozialer Interaktionen und Beziehungen im Leben ausmachen, wesentlich zum allgemeinen Wohlbefinden eines Menschen beitragen. Diesen Umstand hebt auch Argyle (1992, S. 59) hervor: „Work relationships are a major factor in job satisfaction, and therefore for happiness as a whole.“ Arbeit stellt für viele Menschen aber auch Mühe und Last dar und wird als etwas Unangenehmes, Aufgezwungenes erlebt. Und dennoch zieht die „Befreiung“ davon, also Arbeitslosigkeit, meist eine Reihe negativer Konsequenzen nach sich. (vgl. M. Jahoda, 1984, 1986; Klicpera & Innerhofer, 1992; Gaska & Frey, 1993) Aufbauend auf ihre Studien zu den Wirkungen langfristiger Arbeitslosigkeit beschreibt Marie Jahoda (1984, S. 12f) fünf Kategorien von Erfahrungen, die mit Erwerbsarbeit einhergehen und deren Fehlen bei Arbeitslosigkeit mit besonders hoher psychischer Belastung verbunden ist:
-
Zeiterleben und Strukturierung des Alltags;
-
Erweiterung des sozialen Horizonts:
Am Arbeitsplatz ist es unumgänglich, daß man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, erfährt, was sie denken und fühlen, was sie erfreut und worunter sie leiden. Gerade weil man sich die Arbeitskollegen nicht selbst aussuchen kann und weil Kontakt mit ihnen weniger emotionell ist als in der Familie, bereichert er das Wissen um die Welt. (Jahoda 1984, S. 12)
-
Das Erleben von Zusammenarbeit, durch die mehr vollbracht werden kann als durch die Arbeit Einzelner;
-
Die soziale Identität, die durch den Arbeitsplatz und die Berufskategorie bestimmt wird;
-
Bindung an die soziale Realität;
Klicpera und Innerhofer (1992, S. 5ff) versuchen den Wert der Arbeit für Menschen mit Behinderung über die allgemeine Bedeutung von Arbeit für alle Menschen zu erschließen. Diese gliedern sie dabei in folgende positive und negative Teilaspekte: Existenzsicherung, das Erreichen von Unabhängigkeit, die Erweiterung des geistigen Horizontes, das Vorhandensein eines strukturierten Alltags, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, (Weiter-)Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, Entwicklung hin zu mehr Verantwortung, Identitätsstiftung, aber auch Monotonie, Leistungsdruck, Entfremdung und erlebte Ungerechtigkeiten bei der Entlohnung. (vgl. auch Heinz, 1991, S. 387)
Ähnlich wie Klicpera und Innerhofer, geht auch Schubert (1996) davon aus, dass Arbeit sowohl für Menschen mit als auch für Menschen ohne Behinderung prinzipiell gleiche Funktionen erfüllt, vermutet aber Unterschiede bezogen auf den Stellenwert einzelner Funktionen. Folgende Funktionen der Arbeit betrachtet er insbesondere für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als wichtig: die Möglichkeit zu sozialen Kontakten, um sozialer Isolation entgegenzuwirken und die Möglichkeit, auch außerhalb des Familienkreises Erfahrungen mit „nicht behinderten Personen“ zu machen. (ebd., S. 511)
In diesem Zusammenhang betont auch Bieker (2005a, S. 16f): „Die Enge des Lebensbereichs Heim oder Wohngruppe wird durch Arbeit um einen weiteren Ort der Lebensführung mit anderen inhaltlichen Bezügen, Anforderungen und sozialen Kontaktchancen erweitert.“ Weil Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in ihrem Alltag „vielfach verdünnte und wenig motivierende zwischenmenschliche Kontakte erleben“ und daher im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung diesbezüglich ein erhöhtes Bedürfnis haben, sollte nach Speck (2005, S. 341) der Arbeitsplatz primär „ein Ort zwischenmenschlicher Begegnung“ sein.
In Anbetracht der eingangs schon erwähnten relativen Wichtigkeit des Arbeitskontextes in unserem Leben, erscheint es nicht verwunderlich, dass positive wie negative Erfahrungen oder Bedingungen bei der Arbeit einen starken Einfluss auch auf andere Lebensbereiche nehmen. So kann sich zum Beispiel Stress, der durch Leistungsdruck, eine schlechte Arbeitsatmosphäre oder extremere Fälle wie Mobbing hervorgerufen wird, negativ auf den Umgang mit Familienmitgliedern auswirken oder sich in gesundheitlichen Beeinträchtigungen niederschlagen. Ärger mit KollegInnen oder Vorgesetzten, der am Arbeitsplatz nicht offen ausgetragen werden kann, wird oft mit nach Hause genommen. (vgl. Heidbrink, Lück, & Schmidtmann, 2009; Gaska & Frey, 1993) Umgekehrt dämpfen positive Beziehungen und ein hohes Ausmaß an sozialer Unterstützung bei der Arbeit im Sinne der Pufferhypothese die möglichen negativen Konsequenzen von erlebter Belastung. (Heidbrink u. a., 2009, S. 93) Auch ein hohes Maß an Autonomie im Beruf, die Möglichkeit zur Übernahme von Verantwortung und das Gefühl, durch die eigene Arbeit einen produktiven Beitrag zu leisten, stellen Faktoren dar, deren Wirkung über die Grenzen des Arbeitsplatzes hinausreicht, z.B. dadurch, dass ein Mensch auch im privaten Bereich gerne von sich aus Initiative ergreift.
Schubert (1996, S. 511) geht davon aus, dass die Ausübung einer Arbeitstätigkeit für Menschen mit Behinderung generell einen höheren Statusgewinn bedeutet als für Menschen ohne Behinderung. „Eine Arbeit verrichten zu können, vermittelt gerade behinderten Menschen das Gefühl, nützlich und wertvoll für die Gesellschaft zu sein.“ (ebd.)Auch Speck (2005, S. 340f), Niehaus (2005) und Gaska und Frey (1993) sehen einen wichtigen Aspekt von Arbeit darin, dass sie Möglichkeiten für das Erleben von Kompetenz und Leistungsfähigkeit schafft, was sich wiederum positiv auf den Selbstwert eines Menschen auswirkt. Allerdings ist es nach Speck (2005) dafür auch erforderlich, dass dem Menschen bei der Arbeit Autonomie zugesprochen wird und Wert auf seine Urteile und Entscheidungen gelegt wird. Zusätzlich sei es wichtig, ihm die Erweiterung seiner Fertigkeiten zu ermöglichen.
Nach Marie Jahoda (1984, S. 17) sind die bewussten Motive für Erwerbsarbeit bei der Mehrheit der Menschen ökonomischen Ursprungs, d.h. sie geben an zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Demgegenüber werde die „latente Bedeutung der Arbeit“ (ebd.), womit sich Jahoda auf die oben dargestellten fünf Kategorien von Erfahrungen bezieht, häufig unterschätzt. Umgekehrt treten nach Klicpera und Innerhofer (1992, S. 12) bei Menschen mit Behinderungen ideelle Aspekte der Arbeit gegenüber wirtschaftlichen Aspekten in den Vordergrund, was die Autoren wie folgt begründen:
Es besteht für sie [Menschen mit Behinderung] kein wirtschaftlicher Druck zu arbeiten, denn die Familie oder die Gesellschaft kommt für ihren Unterhalt auf. Ihre Arbeit ist oft auch – so wie in den Behindertenwerkstätten – unter ökonomischen Gesichtspunkt [sic!] nicht sinnvoll, weil der Erlös der Arbeit die Unkosten nicht deckt. In diesen Fällen bleibt daher nur der individuelle persönlichkeitsfördernde Wert der Arbeit. Er ist vielleicht der Grund, weshalb bei der Arbeit von Behinderten stärker nach dem ideellen Wert gefragt wird.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Bedeutung von Arbeit und ihr Stellenwert individuellen Variationen unterliegen, und zwar deshalb, weil sowohl Menschen mit als auch Menschen ohne Behinderung untereinander sehr verschieden sind. (vgl. Gaska & Frey, 1993; Bieker, 2005a)
[3] Die einzige Ausnahme stellt hierbei IP12 dar, deren Mutter unterstützend an den Interviews teilnahm. In diesem Fall geht auch die Perspektive der Mutter in die Analyse mit ein.
[4] Zur Erleichterung des Leseflusses erfolgt die Verwendung dieser Begriffe ausschließlich in ihrer maskulinen Form, gemeint sind aber beide Geschlechter.
[5] siehe 4
Im Zuge der Auseinandersetzung mit der aktuellen, facheinschlägigen Literatur wurde deutlich, dass bisher insgesamt nur wenig Forschung über soziale Interaktionsprozesse und soziale Beziehungen im Arbeitskontext betrieben wurde. Jene Werke oder Beiträge, die sich damit auseinandersetzen, greifen oft die gleichen Aspekte auf, wie etwa die Unterscheidung in arbeitsbezogene und nichtarbeitsbezogene Interaktionen nach Kirmeyer (1988), die Differenzierung zwischen verschiedenen Beziehungsformen nach Argyle (1992) oder die Kriterien zur Abgrenzung von beruflichen gegenüber anderen Beziehungen nach Neuberger (1993) (vgl. etwa Asendorpf & Banse, 2000; Chadsey & Beyer, 2001; Heidbrink u. a., 2009). Sie tragen somit oft nur wenig neue Erkenntnisse bei. Weiters stellen einige Beiträge (z.B. Asendorpf & Banse, 2000; Heidbrink u. a., 2009; Neuberger, 1993) besonders spezielle Themen wie sexuelle Beziehungen oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder Mobbing in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen und setzen sich weniger mit geläufigeren Formen von Interaktionen und Beziehungen bei der Arbeit auseinander. Andere Werke, wie z.B. das Lehrbuch Soziale Beziehungen im Lebenslauf von Schmidt-Denter (2005), widmen den sozialen Beziehungen bei der Arbeit nur wenige Seiten, was in Anbetracht der relativen Wichtigkeit des Lebensbereichs Arbeit im Vergleich zu anderen Lebensbereichen (vgl. Kapitel 4.2) verwundert. In der gesichteten Literatur über soziale Beziehungen wird der Schwerpunkt zumeist auf den familiären Kontext gelegt.
Ein allgemeines Forschungsdefizit lasst sich hinsichtlich der Perspektiven und dem subjektiven Erleben von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung feststellen. (vgl. auch Pinetz & Koenig, 2009; Fornefeld, 2008) Dies gilt im Besonderen auch für das Arbeitsleben und den damit verbundenen interaktionellen Erfahrungen. Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, konzentrieren sich Hughes u. a. (1998) in ihrer Literaturstudie ausschließlich auf Beiträge, in denen soziale Interaktionen und soziale Integration am Arbeitsplatz von außen her, d.h. unter Heranziehung „objektiver“ Methoden, betrachtet und bewertet werden. Die AutorInnen diskutieren in ihrem Artikel kritisch, dass die in den meisten Studien herangezogenen Variablen von Vorstellungen der Arbeitgeber über wichtige Fähigkeiten am Arbeitsplatz abgeleitet wurden. (ebd., S. 181) Es sei deshalb fraglich, inwieweit sie valide Indikatoren für das Vorliegen oder Fehlen sozialer Integration darstellen. (Hughes u. a., 1998, S. 181) Alternativ sollte die Identifizierung von Indikatoren nach Hughes u. a. über die Befragung von ArbeitnehmerInnen ohne Behinderung zu den von ihnen als wichtig erachteten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz erfolgen. Anschließend sollte das Vorliegen dieser Verhaltensweisen bei Beschäftigten mit und ohne Behinderung untersucht und verglichen werden, um schließlich das Ausmaß an sozialer Integration abzuschätzen. (ebd.) Nun ist zuerst danach zu fragen, warum die AutorInnen nicht vorschlagen, ArbeitnehmerInnen mit Behinderung zu befragen, wo doch besonders ihre soziale Integration im Mittelpunkt steht. Weiters betrachtet es die Autorin als problematisch, die Erfahrungen und Wünsche von Menschen ohne Behinderung als Referenzwert heranzuziehen. Erlebnisse von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zu vergleichen ist angesichts der Tatsache, dass weder die einen noch die anderen eine homogene soziale Gruppe darstellen, nur bedingt sinnvoll. (vgl. Bieker, 2005a) Außerdem stellt sich die Frage, wozu ein solcher Vergleich führen soll und ob er nicht zu sehr auf die Feststellung von Abweichungen ausgerichtet ist. Im Artikel von Hughes u. a. (1998) wird ein Mangel an sozialer Integration über das Vorliegen von Abweichungen zwischen den sozialen Interaktionen bzw. Beziehungen von Menschen mit und ohne Behinderung definiert. Aus der Sicht der Autorin kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass ein Mensch mit Behinderung sozial integriert ist, wenn er das Gleiche macht oder erlebt, was Menschen ohne Behinderung machen oder erleben und für wichtig erachten. Es führt kein Weg daran vorbei, Menschen mit Behinderung selbst zu fragen, welche Erlebnisse für sie relevant sind, um sich sozial integriert zu fühlen bzw. (berufliche) Teilhabe zu erleben. Interventionen, die darauf abzielen, Menschen mit Behinderung das Gleiche erleben zu lassen, was Menschen ohne Behinderung erleben, laufen Gefahr am Ziel vorbeizuführen, weil für die Zielgruppe evt. andere Dinge oder aber ähnliche Dinge, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung von Bedeutung sind.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass soziale Interaktionsprozesse und Beziehungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext bisher nicht aus deren Perspektive untersucht wurden. Forschungslücken bestehen weiters hinsichtlich der Teilhabe- bzw. Ausschlusserfahrungen dieser Zielgruppe im Lebensbereich Arbeit. (vgl. Biewer u. a., 2009; Pinetz & Koenig, 2009)
Vor dem Hintergrund der in Kapitel 5 beschriebenen Forschungslücken erscheint es sowohl interessant als auch wichtig, die interaktionellen Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext aus deren persönlicher Sicht zu untersuchen. Weiters soll der Frage nachgegangen werden, in welchem Zusammenhang diese Erfahrungen mit beruflicher Teilhabe stehen. Diesem Forschungsinteresse entsprechend lautet die im Rahmen der Diplomarbeit bearbeitete Forschungsfrage wie folgt:
„Welche interaktionellen Erfahrungen machen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext und welche Bedeutung kommt diesen Erfahrungen im Hinblick auf die erlebte berufliche Teilhabe zu?“
Dabei erscheinen insbesondere die folgenden Teilaspekte interessant:
-
Nach welchen Gesichtspunkten können die Erfahrungen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung am Arbeitsplatz mit anderen Personen machen, gegliedert werden?
-
Welche Zusammenhänge zwischen interaktionellen Erfahrungen im Arbeitskontext und gewissen im Leben der ForschungsteilnehmerInnen gesetzten oder unterbliebenen Handlungen (z.B. aktives Eingreifen zur Lösung eines Problems, passives „Sich-gefallen-Lassen“, Kündigung, Wechsel der Arbeitsstelle etc.) lassen sich erkennen?
-
Lassen sich generelle Muster identifizieren, wie zum Beispiel, dass der Umgang miteinander bei bestimmten Beschäftigungsformen oder Berufen als positiver / negativer erlebt wird als bei anderen?
-
Welchen Stellenwert nehmen soziale Aspekte des Arbeitskontextes gegenüber anderen Aspekten hinsichtlich des subjektiven Erlebens beruflicher Teilhabemöglichkeiten bzw. -einschränkungen ein?
-
Welche sozialen Interaktionen bzw. welche sozialen Beziehungen im Arbeitskontext zeigen sich als mehr oder weniger bedeutsam für die erlebte berufliche Teilhabe?
Die Autorin möchte die in den Artikeln von Hughes u. a. (1998) und Chadsey und Beyer (2001) zusammengetragene Forschung zu sozialen Interaktionen und sozialen Beziehungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext um die Erforschung des subjektiven Erlebens und der Perspektiven dieser Menschen erweitern. Unter Anwendung des Forschungsstils der Grounded Theory nach Kathy Charmaz sollen über einen induktiven Analyseprozess verschiedene aus der Sicht der ForschungsteilnehmerInnen bedeutsame Aspekte sozialer Interaktionen und Beziehungen herausgearbeitet werden. Eventuell können daraus neue, bislang nicht beachtete Indikatoren für das Erleben von beruflicher Teilhabe abgeleitet werden.
Die Beantwortung der Forschungsfrage ist von Relevanz, weil interaktionelle Erfahrungen im Arbeitskontext eine entscheidende Rolle für das allgemeine Wohlbefinden im Leben eines Menschen spielen (siehe Kapitel 4.2). Weiters bilden sie vermutlich eine wichtige Grundlage für im Lebensverlauf zentrale (gesetzte oder unterbliebene) Handlungen und werden neben anderen Faktoren für das subjektive Erleben von beruflicher Teilhabe als konstitutiv betrachtet.Die hier durchgeführte Untersuchung soll zu einem differenzierten Verständnis der subjektiv erlebten interaktionellen Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext beitragen. Ein solches Verständnis kann dabei helfen, die Gestaltung von Partizipationsprozessen im Lebensbereich Arbeit für diese Zielgruppe zukünftig zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
Der Forschungsstil der Grounded Theory, der in der Soziologie der 1960er Jahre in den USA entstand, eignet sich nach Biewer u. a. (2009, S. 399) besonders für die qualitative Analyse des im Rahmen des Forschungsprojekts erhobenen Datenmaterials, weil er „keine Vorannahmen über die Strukturierung von Untersuchungsfeldern erfordert“. Dies ist von spezieller Relevanz im Hinblick auf die explorative Forschungsausrichtung einerseits und die geringe Strukturierung und hohe Sensibilität des Forschungsfeldes andererseits. (vgl. ebd.) Strübing (2008, S. 14) bezeichnet die Grounded Theory als einen „Forschungsstil zur Erarbeitung von in empirischen Daten gegründeten Theorien“. Der Prozess der Datenerhebung und -analyse ist dabei durch ein induktives Vorgehen in dem Sinne gekennzeichnet, dass der/die Forschende keine spezifischen Vorannahmen hat, die er/sie zu bestätigen bzw. zu widerlegen sucht. (vgl. Mills, Bonner, & Francis, 2006)
Der Analysestil der Grounded Theory wurde von Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss in den frühen 1960er Jahren im Zuge ihrer soziologischen Studien zum Umgang mit Sterbenden im Krankenhaus entwickelt und erstmalig eingesetzt. (vgl. Strauss, 2004; Bryant & Charmaz, 2007) Im Mittelpunkt steht dabei das „Kodieren“, das Strübing (2008, S. 19) als „den Prozess der Entwicklung von Konzepten in Auseinandersetzung mit dem empirischen Material“ definiert. 1967 veröffentlichten Glaser und Strauss das Ursprungswerk The Discovery of Grounded Theory.
An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die beiden Autoren in der Tradition unterschiedlicher methodisch-theoretischer Positionen innerhalb der Soziologie stehen. Glaser wurde von der positivistischen Ausrichtung und dem Fokus auf systematische quantitative Forschung an der Columbia University, im Speziellen durch Paul F. Lazarsfeld und Robert K. Merton, geprägt. Strauss brachte dagegen die pragmatistische Orientierung der Chicago School und deren Schwerpunkt auf ethnographische Feldforschung und den symbolischen Interaktionismus in die Entwicklung der Grounded Theory mit ein und wurde insbesondere durch Herbert Blumer und Robert Park beeinflusst. (vgl. Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2000; Strübing, 2008)
With a heritage rooted in the educational background of Strauss, from the University of Chicago, and Glaser, from Columbia University, grounded theory combined the depth and richness of qualitative interpretive traditions with the logic, rigor and systematic analysis inherent in quantitative survey research. (Walker & Myrick, 2006, S. 548)
Im Kontext der amerikanischen Soziologie der 1960er Jahre bestand die ernstzunehmende Gefahr einer Degradierung qualitativer gegenüber quantitativer Forschung. Glaser und Strauss setzten sich zum Ziel, eine Basis für systematische qualitative Forschung zu schaffen und zu zeigen, dass ihre Ergebnisse ebenso valide, reliabel und signifikant sein können wie die der quantitativen Forschung. (vgl. Bryant & Charmaz, 2007) Weiters betonten sie, dass die (induktive) Generierung neuer Theorien ebenso wichtig sei wie die (deduktive) Verifizierung bereits existierender Theorien:
Previous books on methods of social research have focused mainly on how to verify theories. This suggests an overemphasis in current sociology on the verification of theory, and a resultant de-emphasis on the prior step of discovering what concepts and hypotheses are relevant for the area that one wishes to research. [...] Since verification has primacy on the current sociological scene, the desire to generate theory often becomes secondary, if not totally lost, in specific researches. (Glaser & Strauss, 1967, S. 1f)
Allerdings thematisierten Glaser und Strauss in ihrem damaligen Werk (1967) mit der induktiven Erarbeitung von Theorien verbundene Schwierigkeiten nicht. So sind etwa Verallgemeinerungen auf der Basis einzelner Beobachtungen problematisch, da – auch wenn die Zahl der Einzelbeobachtungen noch so groß ist – immer die Gefahr besteht, eine Ausnahme übersehen zu haben. (Bryant & Charmaz, 2007, S. 45)
Glaser und Strauss war es ein wichtiges Anliegen, andere ForscherInnen zu ermutigen, ihre eigenen Methoden zur Theoriegenerierung zu veröffentlichen. Dementsprechend dient ihr Werk The Discovery of Grounded Theory (1967) weniger dazu, AnfängerInnen in das Arbeiten mit der Methode der Grounded Theory einzuweisen, sondern ist vielmehr als Plädoyer für systematische ualitative Forschung und die Entwicklung von in empirischen Daten verankerten Theorien zu verstehen. (vgl. Allen, 2010) Eine solche Theorie habe (innerhalb der Soziologie) nach Glaser und Strauss Folgendes zu leisten:
(1) to enable prediction and explanation of behavior; (2) to be useful in theoretical advance in sociology; (3) to be usable in practical applications – prediction and explanation should be able to give the practitioner understanding and some control of situations; (4) to provide a perspective on behavior – a stance to be taken toward data; and (5) to guide and provide a style for research on particular areas of behavior. [...] Theory that can meet these requirements must fit the situation being researched, and work when put into use. By “fit” we mean that the categories must be readily (not forcibly) applicable to and indicated by the data under study; by “work” we mean that they must be meaningfully relevant to and be able to explain the behavior under study. (Glaser & Strauss, 1967, S. 3)
Aus Glasers Perspektive stellt die Methode des ständigen Vergleichens (constant comparative method), an deren Entwicklung er bereits vor dem Zusammenschluss mit Strauss arbeitete, den wesentlichen Kern der Grounded Theory dar. (vgl. Strübing, 2008, S. 68) Nach Charmaz (2000, S. 515) beinhaltet diese Methode fünf verschiedene Arten von Vergleichen:
The constant comparative method of grounded theory means (a) comparing different people (such as their views, situations, actions, accounts and experiences), (b) comparing data from the same individuals with themselves at different points of time, (c) comparing indicent with incident, (d) comparing data with category, and (e) comparing a category with other categories [...].
Glaser und Strauss betonen in ihrem gemeinsamen Werk (1967), dass die Generalität der constant comparative method vergleichbar mit jener von experimentellen und statistischen Methoden sei. (Glaser & Strauss, 1967, S. 21)
Besonders Glaser geht von der Annahme einer hinter den beobachtbaren Phänomenen liegenden Realität aus, die es im Zuge des Forschungsprozesses zu entdecken gilt (vgl. Charmaz, 2000): „The constant comparative method discovers the latent pattern in the multiple participant’s worlds [...].” (Glaser, 2002, S. 3) Um dies zu gewährleisten, sollte der/die ForscherIn mit möglichst wenigen theoretischen Vorannahmen, die den Verlauf der Analyse beeinflussen könnten, in den Forschungsprozess einsteigen. (vgl. Glaser, 1978) „In this posture, the analyst is able to remain sensitive to the data by being able to record events and detect happenings without first having them filtered through and squared with pre-existing hypotheses and biases.” (ebd., S. 2f, zit. nach Bryant & Charmaz, 2007, S. 47) In The Discovery of Grounded Theory (1967) schlagen Glaser und Strauss ihrer Leserschaft vor, die Literatur zu ihrem Forschungsgebiet vorerst gänzlich zu ignorieren, „in order to assure that the emergence of categories will not be contaminated by concepts more suited to different areas.” (Glaser & Strauss, 1967, S. 37) Ein Abgleich mit der vorhandenen Forschungsliteratur sollte aus ihrer Sicht erst erfolgen, wenn die Analyse der Daten so weit fortgeschritten ist, dass aus ihnen Kernkategorien herauskristallisiert werden konnten.Glaser (2002) hält ForscherInnen dazu an, ihr Vorwissen bzw. ihre Vorannahmen in Form von Feldnotizen aufzuschreiben und sie als zusätzliches Datenmaterial in die Analyse mit einzubeziehen, um zu verhindern, dass sie den Daten ihre eigenen Sichtweisen aufzwingen:
Indeed, in GT [Grounded Theory] the researcher’s experience itself may just be more data for doing a GT [...]. I often counsel researchers with similar experience as their respondents to do field notes on themselves as just more data to constantly compare. This prevents their forcing the read on the data as if it comes from the respondent. (Glaser, 2002, S. 9)
Allerdings läuft menschliches Denken, Kommunizieren und Verstehen natürlicherweise so ab, dass neue Informationen (beispielsweise die Ausführungen einer/s ForschungsteilnehmerIn in einem Interview) unweigerlich in Bezug zu dem gesetzt werden, was bereits erfahren oder gelernt wurde. Ähnlich betont Kathy Charmaz in einem Interview mit Antony J. Puddephatt (2006, S. 10): „[…] the very view you have as an observer shapes everything you see. And that means that values and facts are connected. […] I think that the observer’s standpoint is not an add-on, it is a way of seeing […].“ Das heißt, selbst wenn der/die ForscherIn sich um die bewusste Reflexion seiner/ihrer Vorannahmen bemüht, sie schriftlich festhält und in die Analyse miteinbezieht, wird er/sie dennoch nicht in der Lage sein, das gesammelte Datenmaterial auf neutrale Weise zu verstehen und zu analysieren. Strübing (2008, S. 70) betont in diesem Zusammenhang, dass es zum Anstellen von Vergleichen grundlegender „kognitiver ‚Werkzeuge’ [bedarf] die – mehr oder weniger stark, mehr oder weniger explizit – theoriegeladen sind.“ Dabei spricht er beispielsweise die „Selektivität unser Wahrnehmung beim analytischen Zugriff auf die Daten“ und „die sprachlichen Mittel zur vergleichenden Darstellung als relevant erachteter Eigenschaften der zu vergleichenden Indikatoren“ (ebd.) an. Was er damit sagen will ist, dass der Mensch bereits auf der Ebene der kognitiven Operationen, die er sicherlich zu einem beträchtlichen Teil unhinterfragt ausführt, von seinem Vorwissen, Vorannahmen und Vorerfahrungen geprägt ist. Entgegen dieser Annahme impliziert Glasers Vorschlag, dass sich Forschende von ihren Vorannahmen befreien können – wenn sie diese nur schriftlich fixieren und als Daten in die Analyse mit aufnehmen – und sich dadurch einen Zugang zu der puren und ungefärbten „Realität“ der Daten verschaffen können. Glaser (2002, S. 12) sieht den Einfluss des/der Forschenden im Forschungsprozess als eine von vielen Variablen an, die es nur dann zu berücksichtigen gilt, wenn es sich im Zuge des Arbeitens als relevant erweist. Wer jedoch nach welchen Kriterien darüber entscheidet, wann diese Berücksichtigung angebracht ist, bleibt ungeklärt. Weiters geht Glaser davon aus, dass der Einfluss des/der ForscherIn ohnehin im Zuge des Analysierens einer ausreichend großen Datenmenge heraus gemittelt werde: „[…] so much data are used in GT [Grounded Theory] research to generate categories (latent patterns), that categories are generated by constant comparison of many, many interviews that both moot researcher impact or interpretation and constantly correct it if necessary.” (ebd.) Dieses Argument legt die Annahme nahe, es handle sich bei den (objektiven) Daten und dem (subjektiven) Einfluss des/der ForscherIn um zwei grundverschiedene Dinge. Durch die quantitative Erhöhung des einen soll das andere minimiert werden. Dass aber erstens Daten niemals objektiv sind und zweitens dem Forscher eine vollständig objektive Herangehensweise an das, bzw. Arbeitsweise mit dem, Datenmaterial nicht möglich ist, erkennt Glaser nicht. Auch Bryant und Charmaz (2007) üben Kritik an der naiven und unkritischen Haltung den Daten gegenüber und der angenommenen Neutralität des/der ForscherIn, zwei Aspekte, die im Ursprungswerk The Discovery of Grounded Theory (1967) deutlich zum Ausdruck kommen:
In particular, their [Glaser and Strauss] early work placed huge emphasis on ‘data’ [...]; but data itself was posited as non-problematic, something to be observed in ‘phenomenalist’ fashion by a disinterested researcher. (Bryant & Charmaz, 2007, S. 43)
Data is an unproblematic concept for positivists; it is simply what one observes and notes down in the course of doing one’s research. So too for Glaser and Strauss in the 1960s, and for many GTM [Grounded Theory Method] proponents since then. How researchers define, produce, and record data largely remains unexplained. […] Glaser does not acknowledge that researchers’ own standpoints, historical locations, and relative privileges shape what they can see.” (ebd., S. 44; Hervorhebung im Original)
Glaser and Strauss continually refer to theory being ‘grounded in the data’, with theory almost mystically ‘emerging’ from the data. Such statements are often quoted as the mantra of the grounded theorist. Like a mantra, it is continually chanted but rarely questioned or examined. (Bryant & Charmaz, 2007, S. 46)
Anfang der 1990er Jahre entwickelte Anselm L. Strauss zusammen mit Juliet Corbin die ursprüngliche Grounded Theory nach Glaser und Strauss weiter, „mit den Zielen, diese Methodologie unter Darstellung vieler praktischer Beispiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die technische Vorgangsweise der Analyse zu präzisieren.“ (Lueger, 2009, S. 192; vgl. auch Charmaz, 2000) Auf das von Strauss und Corbin 1990 veröffentlichte Werk Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques reagierte Glaser mit heftiger und öffentlicher Kritik und forderte dessen Zurücknahme. Sein Hauptvorwurf bestand und besteht auch weiterhin darin, dass Strauss und Corbin durch die von ihnen postulierten analytischen Vorgehensweisen das Datenmaterial in vorgefasste Kategorien zwängen und damit die induktive Entwicklung (emergence) einer Theorie verhindern würden. (vgl. Charmaz, 2000; 2008) Ihr Ansatz ist aus Glasers Perspektive keine Grounded Theory mehr, sondern eine neue Methode, die er als „full conceptual description“ bezeichnet. (Walker & Myrick, 2006, S. 547) Aufgrund dieser Auseinanderentwicklung unterscheidet Strübing (2008, S. 9; Hervorhebungen im Original) in seinen Ausführungen die beiden Ansätze der Grounded Theory nach Strauss und Glaser explizit voneinander:
Ein Problem besteht allerdings darin, dass die Rede von ‚der’ Grounded Theory mittlerweile irreführend ist: Spätestens seit 1978, als Glasers Theoretical sensitivity (1978) erschien, gibt es zwei Varianten dieses Verfahrens, eine pragmatistisch inspirierte von Anselm Strauss, die er teilweise allein, teilweise gemeinsam mit Juliet Corbin in ihren praktischen Dimensionen näher ausgearbeitet hat, sowie eine – wie ich es nennen würde – empiristische Variante von Barney Glaser, die dieser nach „Theoretical sensitivity“ vor allem in dem sehr polemischen und Strauss-kritischen Buch Emergence vs. Forcing (1992) und dann noch einmal aktualisiert in Doing Grounded Theory (1998) postuliert hat.
Neben den konzeptionellen Unterschieden zwischen den Ansätzen von Glaser und Strauss/Corbin, insbesondere in Bezug auf die jeweils postulierten Analysestrategien, betont Charmaz (2008, S. 400) aber auch das Vorliegen grundlegender epistemologischer Gemeinsamkeiten, wie etwa die Annahme einer externen Realität, verbunden mit der Zielsetzung, diese aufzudecken, sowie der Glaube an die – durch die Anwendung spezieller methodischer Techniken zumindest prinzipiell erreichbare – Neutralität des/der ForscherIn, und der wenig reflektierte Umgang mit dem Datenmaterial. Beispielsweise sehen Strauss und Corbin (1996, S. 8f) das Ziel einer in empirischen Daten gegründeten Theorie darin, die Wirklichkeit darzustellen. Sie verabsäumen aber zu erkennen, dass es sich dabei nicht um die objektiv wahre, sondern lediglich um eine von vielen möglichen Darstellungen handelt. Charmaz (2000, S. 514) zitiert andere Stellen aus Strauss und Corbin (1998), welche ihre Haltung gegenüber den Daten illustrieren: „Strauss and Corbin (1998) write of ‘the reality of the data’ and tell us, ‘The data do not lie’ (p. 85).“ Dem widerspricht sie mit folgendem Argument: „Data […] are reconstructions of experience; they are not the original experience itself […].” (ebd.)
Strauss und Corbin (1994) verstehen unter Grounded Theory eine Methodologie – „a way of thinking about and conceptualizing data“ (ebd., S. 275) –, zugleich aber auch das im Zuge des Arbeitens mit dieser Methodologie entwickelte Produkt – „systematic statements of plausible relationships“ (ebd., S. 279). Bei der Datenanalyse erachten die Autoren ein Vorgehen nach „festen und dauerhaften Regeln“ (Strauss, 2004, S. 429) nicht für sinnvoll und setzen sich stattdessen zum Ziel, ihrem Publikum „allgemeine Leitlinien und Faustregeln für eine effektive Datenanalyse“ (ebd.) zu bieten. Dabei betonen sie die Notwendigkeit der Anpassung dieser Faustregeln an das jeweilige Forschungsanliegen. Charmaz (2000, 2008) merkt in ihren Ausführungen kritisch an, dass Strauss und Corbin dieses Ziel verfehlt hätten, da die von ihnen postulierten Leitlinien nicht flexibel, sondern präskriptiv in dem Sinne seien, dass sie konkrete Ablaufschritte bei der Datenanalyse vorschreiben, welche insbesondere bei „Neuligen“ die Gefahr einer rigiden Ausführung in sich bergen. Im Interview mit Antony J. Puddephatt (2006, S. 11f) äußert sich Charmaz über das Werk Basics of Qualitative Research (1998) wie folgt: „[…] the way that the book was written was quite positivist and objectivist in certain ways. It had all of that technology to apply to the data, rather than emerging from what you are analyzing.”
Als die zentralen methodologischen Elemente der Grounded Theory nach Strauss und Corbin sind neben dem beständigen Anstellen von Vergleichen weiters das systematische Stellen von generativen Fragen, das Kodierparadigma (coding paradigm) und – als Erweiterung dieses – die konditionale Matrix (conditional matrix) zu nennen. (vgl. Strauss & Corbin, 1994; Strauss, 2004; Walker & Myrick, 2006; Strübing, 2008) Das Kodierparadigma, das zur Analyse von Zusammenhängen zwischen Kategorien und ihren Subkategorien dienlich sein soll, bezieht sich auf dreierlei Aspekte eines Phänomens: (1) die Bedingungen bzw. Situationen seines Auftretens (2) die (zwischen-)menschlichen Handlungen bzw. Interaktionen infolge des Geschehens in derartigen Situationen, und (3) die Konsequenzen bzw. Folgen dieser Handlungen / Interaktionen. (Strauss & Corbin, 1998, zit. nach Walker & Myrick, 2006, S. 553) Die konditionale Matrix dient zur Spezifizierung und grafischen Veranschaulichung der Bedingungen und Konsequenzen. (vgl. Strauss & Corbin, 1994) Strauss und Corbin unterscheiden zwischen drei verschiedenen Kodiertypen: offenes, axiales und selektives Kodieren. Beim offenen Kodieren erfolgt ein Aufbrechen und Kategorisieren der Daten. Das axiale Kodieren dient der Spezifizierung von Merkmalen und Eigenschaften der einzelnen Kategorien. Dabei werden die Daten neu zusammengesetzt, indem mithilfe des Kodierparadigmas Verbindungen zwischen Kategorien hergestellt werden. Während des selektiven Kodierens erfolgt schließlich die Auswahl einer Kernkategorie und darüber hinaus die systematische Herausarbeitung von Beziehungen dieser Kernkategorie zu anderen Kategorien. Weiters wird die analytische Entwicklung von Kategorien, die einer Verfeinerung bedürfen, weiter vorangetrieben. (vgl. Strauss & Corbin, 1996) Wichtig zu erwähnen ist, dass im Zuge des Kodierens bei Strauss und Corbin stets die Anwendung spezifischer analytischer Techniken im Vordergrund steht. (vgl. Walker & Myrick, 2006)
Über den gesamten Forschungsprozess hinweg arbeitet der/die Forschende mit den drei grundlegenden Verfahren Induktion, Deduktion und Verifikation. Strauss (2004) betont dies insbesondere, um der gängigen Fehlinterpretation der Grounded Theory als „induktive Theorie“ (ebd., S. 441), welche er auf die plädoyerhafte Betonung induktiver Theoriegenerierung gegenüber deduktiver Hypothesenprüfung in The Discovery of the Grounded Theory Method (1967) zurückführt, entgegen zu wirken.
Mit Induktion sind die Handlungen gemeint, die zur Entwicklung einer Hypothese führen d.h. der Forscher hat eine Vermutung oder eine Idee, die er dann in eine Hypothese umwandelt und schaut, ob diese, zumindest vorläufig, als Teilbedingung für einen Typus von Ereignis, Handlung, Beziehung, Strategie usw. brauchbar ist. Hypothesen sind sowohl vorläufig als auch konditional. Deduktion heißt, daß der Forscher Implikationen aus Hypothesen oder Hypothesensystemen ableitet, um die Verifikation vorzubereiten. Die Verifikation bezieht sich auf Verfahren, mit denen Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüft werden, d.h. ob sie sich ganz oder teilweise bestätigen lassen oder verworfen werden müssen. (Strauss, 2004, S. 441)
Mit Verifikation meint Strauss vor allem die Überprüfung der bis zu einem gewissen Zeitpunkt erarbeiteten Theorie an (neuem) empirischem Datenmaterial. (Strübing, 2008, S. 73f) Bryant und Charmaz (2007, S. 46; Hervorhebung im Original) sprechen in diesem Zusammenhang von "abductive reasoning“ und meinen damit das Wechselspiel zwischen der induktive Analyse von Einzelfällen, der Erarbeitung von theoretischen Konzepten bzw. Erklärungen aus diesen und dem „Testen“ dieser Konzeptionen durch die Heranziehung weiteren Datenmaterials. Abductive reasoning stellt nach Bryant und Charmaz (ebd.) ein Kernelement des Forschungsstils der Grounded Theory dar: „[…] it links empirical observation with imaginative interpretation, but does so by seeking theoretical accountability through returning to the empirical world […].”
Strauss und Corbin (1996) bezeichnen die Grounded Theory als „wissenschaftliche Methode“ (ebd., S. 11), die den/die ForscherIn durch ihre „systematischen Techniken und Analyseverfahren [dazu] befähigen […], eine bereichsbezogene Theorie zu entwickeln, die die Kriterien für ‚gute’ Forschung erfüllt: Signifikanz, Vereinbarkeit von Theorie und Beobachtung, Verallgemeinerbarkeit, Reproduzierbarkeit, Präzision, Regelgeleitetheit und Verifizierbarkeit.“ (ebd., S. 18) Auf Basis der entwickelten Theorien sollen Vorhersagen im nachfolgend spezifizierten Sinne getroffen werden können:
Insofar as theory that is developed through this methodology [Grounded Theory] is able to specify the consequences and their related conditions, the theorist can claim predictability for it, in the limited sense that if elsewhere approximately similar conditions obtain, then approximately similar consequences occur. (Strauss & Corbin, 1994, S. 278; Hervorhebungen im Original)
Im Gegensatz zu Glaser, distanzieren sich Strauss und Corbin (1994, S. 279) von der Annahme einer externen Realität: „A theory is not the formulation of some discovered aspect of a preexisting reality ‘out there’.” Darüber hinaus betonen sie, dass jenes fachliche Wissen, sowie jene Forschungs- und persönliche Erfahrungen, die der/die WissenschaftlerIn in den Forschungsprozess hineinträgt, zentral für die theoretische Sensitivität – die „Art und Weise, über Daten in theoretischen Begriffen zu reflektieren“ (Strauss, 2004, S. 440) – sind und daher nicht ausgeblendet werden sollten. (vgl. ebd; Strauss & Corbin, 1994) Allerdings erscheint es widersprüchlich, Forschende einerseits dazu aufzufordern, ihr Kontextwissen in die Analyse mit einzubringen, andererseits aber dem ständigen Wechsel zwischen Datenerhebung, Kodierung und Memoschreiben – von Strauss (2004, S. 440) als „Triade der analytischen Operation“ bezeichnet – die Funktion zuzuschreiben, „die persönlichen Einstellungen und Meinungen des Forschers von Grund auf zu kontrollieren“. (ebd.)
Strauss und Corbin erkennen an, dass die Interpretationen und analytischen Darstellungen des/der ForscherIn nicht die einzig möglichen sind:
Theories are interpretations made from given perspectives as adopted or researched by researchers. [...] Researchers and theorists are not gods, but men and women living in certain eras, immersed in certain societies, subject to current ideas and ideologies, and so forth. [...] In short, theories are embedded ‘in history’ – historical epochs, eras, and moments are to be taken into account in the creation, judgment, revision and reformulation of theories. (Strauss & Corbin, 1994, S. 279f)
Im Unterschied zu Glaser, der wie folgt argumentiert: „The product, a GT [Grounded Theory], will be an abstraction from time, place and people […] In addition, the abstractions that emerge become independent of the researcher bias […].” (Glaser, 2002, S. 1;4) , sprechen sich Strauss und Corbin also explizit für die Einbeziehung der kontextuellen Bedingungen des Forschungsprozesses aus. Ihre Aussage: „[…] theories are always traceable to the data that gave rise to them“ (Strauss & Corbin, 1994, S. 278) ist so zu verstehen, dass die Abstraktion im Rahmen des Analyseprozesses niemals die Form einer Distanzierung bzw. Entfremdung gegenüber dem Datenmaterial annehmen sollte. Strauss und Corbin erkennen zwar die „aktive Rolle der Menschen beim Gestalten der Welten, in der sie leben“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 9) an, scheinen sich dabei aber mit „Menschen“ vordergründig auf ForschungsteilnehmerInnen und weniger auf ForscherInnen zu beziehen. (vgl. Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2008) Dadurch vernachlässigen sie die aktive Rolle des/der ForscherIn bei der Erhebung und Analyse des Datenmaterials. Aus ihrer Sicht haben WissenschaftlerInnen eine Vielfalt an Perspektiven systematisch in Betracht zu ziehen und durch die Anwendung der von ihnen postulierten „coding procedures“ sicherzustellen, dass sie sich von keiner dieser Perspektiven blind leiten lassen bzw. diese unkritisch als wahr akzeptierten. (vgl. Strauss & Corbin, 1994) Wie bereits erwähnt, soll also durch die Anwendung von Techniken die Neutralität des/der WissenschaftlerIn, so gut es eben geht, sichergestellt werden.
Kathleen C. Charmaz, eine Schülerin von Glaser und Strauss, wendet sich gegen die objektivistischen Elemente, die auch im weiterentwickelten Ansatz der Grounded Theory nach Strauss und Corbin noch vorhanden sind, und entwickelt um die Jahrtausendwende erstmals einen explizit konstruktionistischen Ansatz der Grounded Theory. (vgl. Mills u. a., 2006)
Während Glaser auf die ursprüngliche Version der Grounded Theory (1967) als die einzig wahre beharrt (vgl. Glaser, 2002; Bryant & Charmaz, 2007; Bryant, 2003), zeigen sich Strauss und Corbin (1994, S. 283) gegenüber der Weiterentwicklung der Methodologie durch andere WissenschaftlerInnen weitaus aufgeschlossener: „Yet, no inventor has permanent possession of the invention – certainly not even of its name – and furthermore we would not wish to do so.“
Kathy Charmaz (2005, S. 507) versteht unter Grounded Theory „a set of flexible analytic guidelines that enable researchers to focus their data collection and to build inductive middle-range theories through successive levels of data analysis and conceptual development.” Eine Gemeinsamkeit zwischen ihrem Ansatz und dem von Strauss und Corbin besteht in der thematischen Fokussierung von menschlichen Interaktions- und Handlungsmustern und -prozessen. (vgl. Strauss & Corbin, 1994; Charmaz, 2006, 2008) Weiters spricht sich auch Charmaz für ein kontinuierliches Hin- und Herwechseln zwischen analytischer Theorieentwicklung und Datensammlung im Forschungsfeld aus, um so die Kategorien immer weiter anzureichern und mit den Daten abzustimmen. Im Prozess des Kodierens unterscheidet Charmaz (2006) zwischen zwei Phasen, dem initialen und dem fokussierten Kodieren. Auf die Arbeitsweise, die sie ihrer Leserschaft in Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis (2006) nahe legt wird genauer in Kapitel 9.1 eingegangen.
Charmaz grenzt in ihrem Buchbeitrag Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methods (2000) ihren konstruktivistischen Ansatz der Grounded Theory scharf von objektivistischen (Vorgänger-)Formen ab, obwohl sie später in einem anderen Buchbeitrag mit dem Titel Constructionism and the Grounded Theory Method (2008) von einem Kontinuum zwischen beiden Positionen spricht: „In practice, however, grounded theory inquiry ranges between objectivist and constructionist approaches and has elements of both.“ (ebd., S. 402) In ihrem Interview mit Puddephatt (2006) erklärt sie die von ihr vorgenommene Abgrenzung damit, dass der Forschungsstil der Grounded Theory zum Zeitpunkt der Publikation von Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methods Gefahr lief, insbesondere von postmodern orientierten ForscherInnen verworfen zu werden, und zwar wegen seines Rufs als „the most realist and positivist of the modernist qualitative methods“. (Charmaz, 2008, S. 400, unter Verweis auf Van Maanen, 1988) Den positivistischen Annahmen im Rahmen der traditionellen Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1967) und damit dem gesamte methodische Ansatz wurden im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend mit Skepsis begegnet.
I [Kathy Charmaz] made the boundaries rather firm between objectivist and constructivist grounded theory at that time [2000] so that people could discern some differences, and see the usefulness of grounded theory techniques for doing a different kind of research, and taking a somewhat different approach. […] So basically I was trying to lay things out, and try to save grounded theory from being cast aside, because a lot of it had subsumed a lot of positivistic kinds of approaches. (Puddephatt, 2006, S. 11f)
Bryant und Charmaz (2007) plädieren daher für eine Unterscheidung zwischen den zentralen methodologischen Kernelementen der Grounded Theory, die es sich aus ihrer Sicht weiter zu verfolgen lohnt, und jenen epistemologischen Grundlagen, welche eng mit dem Kontext der Entstehung dieses Forschungsstils in den 1960er Jahren verbunden sind und auch in diesem Zusammenhang nachvollzogen werden sollten. „We need to understand this trajectory, and to some extent dismantle the method from its initial formulations.” (ebd., S. 48)
Charmaz (2008, S. 402) geht in ihrem konstruktionistischen Ansatz der Grounded Theory von folgenden Grundannahmen aus:
-
Die Wirklichkeit ist vielschichtig, prozessual und unter spezifischen - d.h. nicht zufälligen - Bedingungen konstruiert.
-
Der Forschungsprozess entsteht aus der Interaktion der an ihm Beteiligten und
-
berücksichtigt sowohl die Positionierungen des/der Forschenden als auch die der ForschungsteilnehmerInnen.
-
Die Daten werden von forschenden und erforschten Personen aktiv konstruiert und sind damit ein Produkt des Forschungsprozesses.
Mit der ersten Annahme spricht sie sich explizit gegen den Glauben an eine einzig wahre Realität aus und fordert die Miteinbeziehung des Kontextes bzw. ein Verständnis für die Welt der ForschungsteilnehmerInnen aus deren Perspektive. Ihre dritte Annahme wendet sich gegen die im traditionellen Ansatz der Grounded Theory geforderte Neutralität bzw. Unvoreingenommenheit des/der WissenschaftlerIn. Schließlich grenzt sie sich mit der zweiten und vierten Annahme von der Auffassung ihrer Vorgänger ab, dass Theorien vom/von der Forschenden entdeckt werden oder sich aus den Daten (wie von selbst) abzeichnen. (vgl. Charmaz, 2006) Die fertig ausgearbeitete Grounded Theory sieht Charmaz immer als eine Konstruktion der Realität an: „We construct our grounded theories through our past and present involvements and interactions with people, perspectives, and research practices.“ (ebd., S. 10)
Charmaz (2008, S. 400) stellt bereits in der traditionellen Version der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1967) grundlegende konstruktionistische Tendenzen fest, und nennt hierbei etwa die Betonung der induktiven Theorienbildung aus empirischen Daten heraus, das Interesse an der Aufdeckung von zugrunde liegenden Prozessen sowie für die Art und Weise, wie ForschungsteilnehmerInnen ihre Welt erleben und konstruieren. Allerdings bezeichnet sie diese Form des sozialen Konstruktionismus, die auch von vielen anderen SozialwissenschaftlerInnen des 20. Jahrhunderts vertreten wurde bzw. immer noch wird, als eingeschränkt, und zwar in dem Sinn, dass dabei zwar die erforschten Welten als sozial konstruiert angesehen werden, nicht aber die praktizierte Forschung selbst. Letztere bleibt dagegen unhinterfragt. „Glaser and Strauss did not attend to how they affected the research process, produced the data, represented research participants and positioned their analyses. Their research reports emphasized generality, not relativity, and objectivity, not reflexivity.” (Charmaz, 2008, S. 399)
Bezüglich der Ansprüche, die eine Grounded Theory als Forschungsprodukt stellt, grenzt sich Charmaz von ihren VorgängerInnen ab: Während objektivistische Ansätze „why questions“ (Charmaz, 2008, S. 398; Hervorhebung im Original) zu beantworten suchen und dabei nach Generalisierbarkeit streben und universelle Erklärungen, sowie Vorhersagen liefern möchten, setzt sie sich zum primären Ziel, „what and how questions“ (ebd.) zu bearbeiten, also die Sichtweisen der ForschungsteilnehmerInnen in ihrer Fülle, Vielfalt und Komplexität nachzuvollziehen und zu verstehen und sie so gewissenhaft wie möglich in die theoretischen Darstellungen mit aufzunehmen. (vgl. Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2008) „Instead of aiming to achieve parsimonious explanations and generalizations devoid of context, constructionists aim for an interpretative understanding of the studied phenomenon that accounts for context.” (Charmaz, 2008, S. 402)
Den/die Forschende(n) sieht Charmaz (2007) als eine(n) InterpretIn dessen, was er/sie im Feld vorfindet, an und grenzt sich damit von Glaser und Strauss ab, denen sie vorwirft, die Wege der Erkenntnisgewinnung und das Expertenwissen des/der WissenschaftlerIn über jene der ForschungsteilnehmerInnen zu stellen und davon auszugehen, dass er/sie durch die sorgfältige Anwendung methodischer Vorgehensweisen zu objektivem und universell gültigem Wissen gelangen könne. (vgl. Bryant & Charmaz, 2007) Weiters ist der Wissens- und Erfahrungskontext, in dem sich der/die ForscherIn zum Zeitpunkt des Eintretens in den Forschungsprozess befindet nach Charmaz nicht nur zu berücksichtigen, sondern auch kritisch zu reflektieren. (vgl. Charmaz, 2008)
Constructivist grounded theorists take a reflexive stance on modes of knowing and representing studied life. […] Nor does it assume that impartial observers enter the research scene without an interpretive frame of reference. Instead, what observers see and hear depends upon their prior interpretive frames, biographies, and interests as well as the research context, their relationships with research participants, concrete field experiences, and modes of generating and recording empirical materials. No qualitative method rests on pure induction – the questions we ask of the empirical world frame what we know of it. […] Similarly, our conceptual categories arise through our interpretations of data rather than emanating from them or from our methodological practices […].Thus, our theoretical analyses are interpretive renderings of a reality, not objective reportings of it. (Charmaz, 2005, S. 509f; Hervorhebungen im Original)
Die Methode des ständigen Vergleichens kann dem/der ForscherIn nach Charmaz (2008, S. 402) dabei helfen, sich bei der Konzeptionalisierung des Datenmaterials nicht zu sehr von den eigenen Vorannahmen leiten zu lassen. Sie betont aber gleichzeitig, dass ihr Einsatz die Daten deshalb noch lange nicht objektiv macht, wie dies etwa Glaser behauptet. Auch der Kontext, in dem die ForschungsteilnehmerInnen stehen, hat im Prozess der Theorieentwicklung nach Charmaz unbedingt Berücksichtigung zu finden. Objektivistische Ansätze der Grounded Theory vernachlässigen ihrer Ansicht nach jedoch diese Notwendigkeit: „Objectivists aim to generalize through abstractions that separate the completed grounded theory from the conditions and contingencies of its data collection and analysis […]. As abstraction increases, so does decontextualization of the research that gave rise to this abstraction.” (Charmaz, 2008, S. 402)
Der Vorteil eines konstruktionistischen Ansatzes der Grounded Theory liegt nach Charmaz (2008) in der Überbrückung der Spannung zwischen den Ansprüchen Erklären und Verstehen. Denn die mit ihm erzielten Ergebnisse können aus ihrer Sicht sowohl ein konzeptionelles Verstehen ermöglichen als auch potentielle Erklärungskraft besitzen, ohne dabei jedoch reduktionistisch zu sein. „A social constructionist approach to grounded theory allows us to address why questions while preserving the complexity of social life.” (Charmaz, 2008, S. 397; Hervorhebung im Original)
Laut Biewer u. a. (2009, S. 399) ermöglicht Charmaz’ Sichtweise ein Anknüpfen an Ansprüche partizipativer Forschung: „Während die Grounded Theory in den 1960er Jahren eher beanspruchte, im Forschungsgegenstand selbst liegende Gesetzmäßigkeiten zu ‚entdecken’, anerkennt der konstruktivistische Ansatz sozialwissenschaftliche Erkenntnisse als Schöpfungsakt der am Forschungsprozess beteiligten AkteurInnen.“ Durch diese Herangehensweise werde die Aufnahme und theoretische Einbettung der subjektiven Sichtweise der Zielgruppe erleichtert. (vgl. ebd.) Da auch das zentrale Interesse dieser Diplomarbeit darin besteht, subjektive Perspektiven der ForschungsteilnehmerInnen zu rekonstruieren und dabei sehr spezielle Aspekte in vielen Interviews in die Tiefe gehend zu analysieren sind, erscheint der Ansatz der Grounded Theory nach Kathy Charmaz zur Bearbeitung der Fragestellung als besonders geeignet.
Das Aufkommen der Nutzung von Computersoftware zur Unterstützung der qualitativen Datenanalyse (QDA-Software bzw. QDAS) reicht in die mittleren bis späten 1980er Jahre zurück. Zu dieser Zeit bestand ihre Hauptfunktion in der Vereinfachung von Kodier- und Abrufprozessen. (vgl. Mangabeira, Lee, & Fielding, 2004) Nach Kuckartz (2009, S. 728) entstand im Laufe der 1990er Jahre eine methodische Diskussion darüber, „ob die computergestützte Analyse eine eigenständige Methodik darstelle oder ob sie lediglich ein Hilfsmittel der Analyse (ein ‚Buchhalter’) sei, mit dem sich andere, bewährte Methoden wie etwa die Qualitative Inhaltsanalyse in ein neues Medium umsetzen ließen“. Mac Millan und Koenig (2004) setzen sich in ihrem Artikel mit den „wow factors“ von QDAS auseinander und warnen davor, das Arbeiten damit als eigenständige Methodik anzusehen, da dies insbesondere bei Forschungsnovizen zu unkritischen Annahmen und Haltungen, sowie falschen Erwartungen führe. (vgl. auch Darmody & Byrne, 2006) „The wow factor is reflected in an assumption that the software is the methodology, and that by simply learning to operate the program, the researcher is doing analysis.” (MacMillan & Koenig, 2004, S. 180)
Trotz der heutzutage weiten Verbreitung von Software zur qualitativen Datenanalyse in den verschiedensten Disziplinen, wie zum Beispiel in der Soziologie, Psychologie, Ethnologie, den Erziehungswissenschaften, Pflegewissenschaften, in der Sozialarbeit und vielen anderen (vgl. Kuckartz, 2009; Muhr & Friese, 2004), scheint nach wie vor nicht von Vornherein klar zu sein, was diese Programme leisten können und wo ihre Grenzen liegen. Zusammenfassend werden daher im Folgenden die Hauptfunktionen von Softwareprogrammen zur Unterstützung der qualitativen Datenanalyse aufgelistet:
-
Daten- und Ideenmanagement: Einfache Verwaltung und Organisation der Gesamtheit des zu einem Projekt gehörigen Datenmaterials, sowie der eigenen Ideen und Überlegungen dazu;
-
Kodieren des Datenmaterials;
-
Markieren und Kommentieren des Datenmaterials;
-
Such- und Abruffunktionen zur Datenexploration, beispielsweise die Suche nach Worten oder Wortkombinationen, um relevante Textstellen oder Kodes auffinden zu können;
-
„Data linking“ über die Erstellung von Hyperlinks zwischen Textstellen, Kodes oder Memos;
-
Schreiben von Memos;
-
graphische Veranschaulichung von Zusammenhängen;
(vgl. Weitzman, 2000; Kuckartz, 2009; Lewins & Silver, 2007)
In der Literatur (vgl. etwa Kuckartz, 2009; di Gregorio, 2009; Konopásek, 2008; Muhr & Friese, 2004; Weitzman, 2000) wird durchwegs hervorgehoben, dass QDA-Software den Menschen primär bei der Ver- und Bearbeitung von Informationen unterstützt, genauer gesagt, die Verwaltung, Aufbereitung, Sortierung, Organisation, Verknüpfung, Veranschaulichung etc. von Daten und der vom Forschenden dazu erstellten Kommentare gegenüber der händischen Auswertung erleichtert. In diesem Zusammenhang betont Weitzman (2000, S. 806) neben vielen anderen AutorInnen: „QDA software provides tools that help you do these things; it does not do them for you.” und versucht damit, falsche Hoffnungen aus dem Weg zu räumen. „Many researchers have had the hope – for others it is a fear – that the computer could somehow read the text and decide what it all means. That is, generally speaking, not the case.” (ebd., S. 805) Thompson (2002) unterscheidet in seinem Artikel zwischen automatisierbaren und konzeptionellen Komponenten der qualitativen Datenanalyse: „Any computer can be programmed to do the mechanical part of analysis, but no computer can do the conceptual part.“ (ebd., S. 2)[6]Nach seiner Argumentation findet durch die Anwendung von QDAS eine Auslagerung der mechanischen Aspekte der Datenanalyse statt, was den Menschen entlaste und seine Konzentration auf die eigentliche, nämlich konzeptionelle Arbeit ermögliche. (vgl. auch St John & Johnson, 2000) Auch viele andere AutorInnen betonen, dass QDAS den Analyseprozess ökonomischer mache. So reduziere sich etwa durch automatisierte Such- und Kodierfunktionen der benötigte Zeitaufwand. (vgl. Kuckartz, 2009, S. 716) Auch die elektronische Verwaltung der eigenen Ideen und Kommentare in direkter Anbindung an das Datenmaterial erleichtere die Arbeitsweise und spare Zeit. „When writing the research report, material does not have to be retyped.” (St John & Johnson, 2000, S. 394) Die Konzentration aller zu einem Projekt gehörigen Dokumente sowie den zugehörigen Ideen des Forschenden „an ein und derselben Stelle“ ermögliche eine einfachere Zugänglichkeit des Datenmaterials. (di Gregorio, 2009, S. 735f) ForscherInnen können ihre Projekte dadurch leichter überblicken. St. John und Johnson (2000, S. 394) argumentieren wie folgt:
An important feature of QDAS is the way it enables all data related to a topic to be examined. This ability contrasts with the human tendency of privileging parts that fit with one’s own assumptions and world views. QDAS can enable researchers to examine their own assumptions and biases. Segments of data are not likely to be lost or overlooked, and all material coded in a particular way will be retrieved.
Die hier genannten Vorteile sind in der Literatur allerdings umstritten und unbedingt kritisch zu betrachten. Die leichtere Abrufbarkeit von Datensegmenten und die Möglichkeit, einmal verfasste Kommentare über „Copy and Paste“ einfach in die eigenen Ausführungen einzubauen könnte etwa zu einer weniger intensiven Befassung, sowohl mit dem Datenmaterial als auch mit den eigenen Ideen dazu, führen. Der/die Forschende kann dank des Computers auf Knopfdruck finden, was er/sie sucht und muss das Material nicht selbst durchsuchen. Die Annahme, dass er/sie das Material daher weniger oft liest als ein(e) ForscherIn, der/die bei der Datenanalyse händisch vorgeht, ist also naheliegend.
Im Gegensatz zu oben zitierten AutorInnen wie di Gregorio oder St. John und Johnson, geht Charmaz (2000) davon aus, dass der Computer dem Blick auf „das Ganze“ eher im Wege steht als ihn zu erleichtern:
Part of interpretive work is gaining a sense of the whole – the whole interview, the whole story, the whole body of data. No matter how helpful computer programs may prove for managing the parts, we can see only fragments on the screen. (ebd., S. 520f)
Weiters spricht sie von der Gefahr, dass diese vereinzelten Fragmente isoliert von ihrem Kontext und den Konstruktionen der am Forschungsprozess Beteiligten betrachtet bzw. analysiert und als etwas objektiv Gegebenes hingenommen werden. (vgl. ebd.)
Konopásek (2008) spricht sich in seinem Artikel gegen das Verständnis von QDAS als reine Instrumente zur Erweiterung der menschlichen mentalen Kapazitäten aus und betrachtet sie bevorzugt als „complex virtual environments for embodied and practice-based knowledge making“ (Konopásek, 2008, S. 1)[7]. In dieser „virtuellen Umgebung“ stünden dem/der Forschenden weit mehr Möglichkeiten offen als bei der ursprünglichen händischen Datenanalyse und der Grad an Flexibilität und Vernetztheit sei wesentlich höher. Dementsprechend verändere sich die Konstruktion von Wissen unter Verwendung von QDA-Software. Konopásek betont die Wichtigkeit, diese Konstruktionsprozesse zu reflektieren und nicht davon auszugehend, dass Softwareprogramme zur qualitativen Datenanalyse lediglich dazu dienen, die geistigen Prozesse des/der ForscherIn, so wie sie in seinem/ihrem Gehirn ohnehin ablaufen, sichtbar und übersichtlich zu machen. Auch Mangabeira u. a. (2004, S. 167) betonen: „Qualitative packages increasingly support procedures that are new or impractical without the computer; it is no longer possible to argue that the software is simply an aid to code-and-retrieve.”
Ein weiterer umstrittener Aspekt von computergestützter qualitativer Datenanalyse ist die erleichterte Darstellung der Analyseergebnisse (Hadolt, 2009, S. 14) bzw. die Möglichkeit, die einzelnen gesetzten Schritte im Analyseprozess sichtbar zu machen. Einige AutorInnen (vgl. etwa di Gregorio, 2009; St John & Johnson, 2000; Thompson, 2002) verstehen dies als Vorteil, weil sich dadurch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit qualitativer Forschung erhöhe und sie davon ausgehen, dass damit eine Qualitätssteigerung verbunden ist. Beispielsweise merkt Strübing (2008, S. 7) an der aktuellen Forschungspraxis kritisch an, dass insbesondere dann nach dem „Gütesiegel ‚Grounded Theory’“ gegriffen wird, „wenn man selbst nicht so recht weiß, wie man zu Ergebnissen gekommen und welchem Verfahren man dabei gefolgt ist.“ Dem könnte durch die Erleichterung einer nachvollziehbaren Darstellung des Forschungsprozesses durch die Zuhilfenahme von QDAS entgegengewirkt werden. Andere AutorInnen stellen das Streben nach Transparenz in der qualitativen Forschung infrage und betonen, dass Maßstäbe aus der quantitativen Forschung nicht einfach unkritisch auch an qualitativer Forschung angelegt werden können. (vgl. Strübing, 2008; Puddephatt, 2006) Aus diesem Grund widmen manche AutorInnen, wie etwa Charmaz (2006) und Strübing (2008), der Diskussion von Gütekriterien zur Beurteilung von Theorien, die auf Basis des Forschungsstils der Grounded Theory erarbeitet wurden, in ihren Werken eigene Kapitel.
Ein kritischer Punkt besteht des Weiteren darin, dass die Verbreitung von bestimmter Computersoftware zur qualitativen Datenanalyse gleichzeitig auch zu einer Verbreitung der Analysemethoden und Forschungsausrichtungen führen könnte, auf denen diese Programme basieren, und damit die Variabilität nebeneinander bestehender Ansätze reduziert würde. (vgl. Mangabeira u. a., 2004, S. 167; Charmaz, 2000, S. 521) „Most QDAS packages are based on an assumption that qualitative data analysis is based on coding and retrieval. Thus, QDAS may lead researchers to favour a code and retrieval method of data analysis.” (St John & Johnson, 2000, S. 395) Es besteht also die Befürchtung, ForscherInnen könnten ihre Forschungsfragen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Softwareprogrammen formulieren. (vgl. ebd.) Aus diesem Grund plädieren viele AutorInnen (vgl. etwa MacMillan & Koenig, 2004; Peters & Wester, 2007; Bringer, Johnston, & Brackenridge, 2006) für eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit der gewählten Forschungsmethodik bevor verfügbare Computersoftwareprogramme zur Unterstützung der qualitativen Datenanalyse in Betracht gezogen werden. ForscherInnen sollten QDAS im Hinblick auf die von ihnen eingenommenen methodischen oder wissenschaftstheoretischen Positionen kritisch reflektieren können, bevor sie damit zur arbeiten beginnen. (vgl. MacMillan & Koenig, 2004) Mangabeira (2004, S. 170ff) unterscheidet in ihrer Studie an einer englischen Hochschule für Sozialwissenschaften hinsichtlich der Anwendung von QDAS zwischen drei Gruppen von UserInnen: „program loyalists“, „critical appropriators“ und „experienced hands“. Während UserInnen, die von den AutorInnen als „program loyalists“ bezeichnet werden, QDAS als neutrale Instrumente betrachten und es meist verabsäumen, sich kritisch mit ihren Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen, tendieren „critical appropriators“ eher dazu, verschiedene Softwarepakete zu vergleichen und im Hinblick auf die von ihnen gewählte Forschungsmethodik und ihre epistemologische Ausrichtung zu bewerten. Sie finden oftmals kreative Wege, die Software an ihre Forschungsvorhaben anzupassen anstatt umgekehrt. „Experienced hands“ ist die von den AutorInnen gewählte Bezeichnung für die dritte Gruppe von UserInnen, die bereits Erfahrungen mit der händischen Analyse qualitativer Daten gesammelt haben und nicht mit dem Computer aufgewachsen sind. Sie nehmen eine skeptische Haltung gegenüber QDAS ein, einerseits aufgrund der Befürchtung, gegenüber der für sie bereits bewährten händischen Arbeit eingeschränkt zu sein, andererseits auch wegen ihrer mangelnden Computerkenntnisse und -fähigkeiten, die ihre Flexibilität im Umgang mit Hardware und Software zusätzlich schmälern.
Charmaz (2000, S. 520) begründet ihre Vorbehalte gegenüber QDAS in ihren Ausführungen mit den folgenden vier Argumenten:
(a) Grounded theory methods are often poorly understood; (b) these methods have long been used to legitimate, rather than to conduct, studies; (c) these software packages appear more suited for objectivist grounded theory than constructivist approaches; and (d) the programs may unintentionally foster an illusion that interpretive work can be reduced to a set of procedures.
Da die Autorin der vorliegenden Arbeit die explizite Vorgabe hatte, ihre Daten softwaregestützt mit dem Programm Atlas.ti zu analysieren, war für sie, wie aus den obigen Ausführungen deutlich wurde, die intensive Auseinandersetzung mit der Forschungsmethodik der Grounded Theory vor dem Beginn des Forschungsprozesses von großer Relevanz. Weiters hielt sie es für wichtig, die im Rahmen von Atlas.ti verfügbaren Funktionen stets kritisch im Hinblick auf die Position des für diese Arbeit gewählten konstruktionistischen Ansatzes der Grounded Theory nach Kathy Charmaz zu reflektieren und sie in Bezug zur methodischen Vorgehensweise zur Datenanalyse zu setzen. (vgl. Peters & Wester, 2007)
Im Folgenden wird das verwendete Softwareprogramm Atlas.ti vorgestellt und die Grundzüge des Arbeitens damit beschrieben.
Atlas.ti dient der computergestützten Verwaltung, Analyse und Darstellung qualitativer Daten verschiedener Art, z.B. Text-, Audio-, Bild- und Videodaten. (vgl. Muhr & Friese, 2004) Es bietet dem/der ForscherIn all jene Funktionen, die oben bereits dargestellt und diskutiert wurden. Beim Arbeiten mit Atlas.ti erfolgt zunächst das Anlegen eines Projekts, einer sogenannten Hermeneutic Unit (HU), in welches in einem nächsten Schritt die zu analysierenden Primärdokumente (im Falle dieser Untersuchung die anonymisierten Interviewtranskripte als „Rich Text Format“ (RTF)-Textdateien) eingebunden werden. Danach kann mit dem Kodieren begonnen werden, indem Textstellen in den Primärdokumenten markiert und dafür Kodes vergeben werden. Durch diesen Prozess werden zwei Arten von Objekte erzeugt: Zitate (die markierten Textstellen) und zugehörige Kodes. Memos können entweder frei oder in Anbindung an bestimmte Kodes erstellt werden. Die Benutzeroberfläche von Atlas.ti ist so angelegt, dass ein weitgehend intuitives Arbeiten ermöglicht wird. Sie besteht neben Symbolleisten und Dropdown-Menüs im Wesentlichen aus zwei Teilen: einem Textfeld auf der linken Seite, in dem das jeweils ausgewählte Primärdokument angezeigt wird, und einem Randbereich rechts daneben (dem sog. Margin Display), in dem erstellte Objekte, also Zitate, Kodes, Kommentare und Memos, auf gleicher Höhe wie die dazugehörigen Textpassagen des Primärdokuments angezeigt werden. Die beiden Bereiche lassen sich beliebig verschieben. Primärdokumente, Kodes und Memos, können in eigens dafür eingerichteten Managern verwaltet und in Kategorien (sog. Familien) organisiert werden. Durch Anklicken im jeweiligen Objekt-Manager können Zitate, Kodes und Memos an ihrem „ursprünglichen Ort“, also im Kontext der zugehörigen Primärdokumente wieder aufgefunden werden.Durch das Erstellen von Hyperlinks können Datensegmente oder Objekte, die aus theoretisch-analytischen Überlegungen heraus zusammengehören, miteinander verknüpft werden. „Neben einer Reihe von vordefinierten Relationen (z.B. ‚A ist Teil von B’, ‚A verursacht B’ und ‚A widerspricht B’) erlaubt ATLAS.ti auch das Erstellen neuer Relationen.“ (Hadolt, 2009, S. 17) Im Netzwerk-Editor können diese Verknüpfungen bearbeitet und grafisch veranschaulicht werden.Durch die Möglichkeit, erstellte Objekte im Verlauf des Analyseprozesses laufend anzupassen bzw. zu verändern ermöglicht Atlas.ti dem/der ForscherIn eine flexible Arbeitsweise. So ist es etwa möglich verschiedene Kodes zusammenzuführen oder einen Kode in mehrere aufzuspalten. Auch die Grenzen von erstellten Zitaten sind jederzeit verschiebbar. (vgl. ebd.)
Da für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchung auf bereits erhobenes Interviewmaterial zurückgegriffen wurde, ist von einer Sekundäranalyse qualitativer Daten zu sprechen. (Bortz & Döring, 2006, S. 370) Diese Untersuchungsform birgt vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten Vorteile in sich. Der Aufwand der Datenerhebung und die damit verbundenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen entfallen. (vgl. etwa Bortz & Döring, 2006; Diekmann, 2009; Schnell, Hill, & Esser, 2008) Somit wird es auch in kleineren Forschungsarbeiten, wie etwa Diplomarbeiten, möglich, Datenmaterial zu bearbeiten, dessen eigenständige Erhebung in diesem Rahmen nicht umsetzbar gewesen wäre, und dadurch wertvolle Forschungsbeiträge zu liefern. Diekmann (2009, S. 200) spricht in diesem Zusammenhang von „Demokratisierung“ empirischer Forschung: „Auch wer nicht in den Genuss höherer Förderungssummen für kostenintensive Erhebungen kommt, hat per Sekundäranalyse gute Chancen, hochwertige Forschungsresultate zu produzieren“. Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, werden im Zuge des Projekts „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ über mehrere Jahre hinweg biographische Interviews mit ca. 40 bis 50 Personen der Zielgruppe (Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung) in verschiedenen Bundesländern Österreichs geführt. Eine durch die Autorin selbst initiierte Datenerhebung hätte demgegenüber in ihrem Umfang, ihrer zeitlichen und geographischen Reichweite etc. weitaus reduzierter ausfallen müssen.
Weil im Rahmen von Sekundäranalysen keine eigenen Daten erhoben werden, ist das zentrale Augenmerk auf die Auswahl von Primärdaten zu legen, die zur Bearbeitung der eigenen Fragestellung herangezogen werden. (vgl. Burzan, 2005; Medjedović, 2008) Eine solche Auswahl hat theoretischen Überlegungen zu folgen und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. „Qualitative data are a rich and often not fully exploited source of research material.” (Medjedović, 2008, S. 193) Einmal erhobene Daten können, wenn sie reichhaltig genug sind, von verschiedenen ForscherInnen unter Einsatz verschiedener theoretischer und methodischer Ansätze und hinsichtlich unterschiedlichster Fragestellungen untersucht werden. Dies trägt zu einem verbesserten Kosten-Nutzen-Verhältnis von Forschung und zu einer verstärkten Perspektivenvielfalt bei. Durch die Kombination verschiedener Untersuchungsformen wird nach Schnell u. a. (2008, S. 262; Hervorhebung im Original) „Triangulation“ ermöglicht: „Sie versucht, durch den kombinierten Einsatz verschiedener Erhebungstechniken, Auswahlverfahren, Versuchsanordnungen und Messtechniken die spezifischen Schwächen der einen Strategie durch den Einsatz einer anderen, die dort ihre besondere Stärke hat, zu kompensieren.“ (Schnell u. a., 2008, S. 262) Insofern fördert die kombinierte Durchführung von Sekundäranalysen die Güte der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse. Außerdem erhöht die Zurverfügungstellung von empirischen Daten für wissenschaftliche Sekundärnutzungen die Transparenz des Forschungsprozesses der Primärforschung, nämlich durch die Ermöglichung von intersubjektiver Nachvollziehbar- und Kontrollierbarkeit (vgl. Burzan, 2005; Diekmann, 2009)
Die Durchführung von Sekundäranalysen bringt aber auch Nachteile mit sich. Durch fehlende Informationen über den Entstehungsprozess der Daten können diese unter Umständen nur unzureichend in ihrem Kontext verortet werden. (vgl. Medjedović, 2008) Ein ähnliches Problem ergibt sich aus der fehlenden persönlichen Eingebundenheit der ForscherInnen in die Phase der Datenerhebung. Ein direktes In-Beziehung-Treten mit den ForschungsteilnehmerInnen findet nicht statt. Dadurch entfallen persönliche Eindrücke, die für ein ganzheitliches Verständnis des Erhebungskontexts von Relevanz wären. Medjedović (ebd., S. 202) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Gefühl für die Daten“, das sich nur entwickeln kann, wenn der/die ForscherIn sie selbst erhebt.
Ein weiterer Nachteil von Sekundäranalysen ergibt sich daraus, dass die Primärdaten nicht für die Bearbeitung der spezifischen Forschungsfrage des/der Forschenden, sondern in der Regel zu anderen Zwecken erhoben wurden. Sie passen daher nicht unbedingt zur Fragestellung (vgl. Burzan, 2005; Schnell u. a., 2008; Geyer, 2003) oder gehen beispielsweise an Stellen, die von besonderer Relevanz zu deren Beantwortung wären, zu wenig ins Detail. Die Möglichkeit, an solchen Stellen genauer nachzufragen und zu theoretisch relevanten Aspekten weiteres Datenmaterial einzuholen bleibt dem/der ForscherIn, der/die ausschließlich mit bereits erhobenen Daten arbeitet, verwehrt. Bei der Sekundärnutzung von qualitativem Datenmaterial eignet sich nach Medjedović (2008) aus diesem Grund eher eine induktive Vorgehensweise mit dem Ziel der Hypothesengenerierung als eine deduktive Vorgehensweise, die auf Hypothesenprüfung ausgerichtet ist. ForscherInnen, die mit einer vorab formulierten Forschungsfrage und einem vorgefassten „theoretischen Korsett“ (ebd., S. 199) an vorhandenes Datenmaterial herantreten, werden im Zuge des Forschungsprozesses feststellen müssen, dass die Daten nicht immer in ihr Schema passen. Eher bietet es sich an, die Forschungsfrage erst in Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial zu entwickeln, also nach Aspekten zu fragen, die in den Daten ein offensichtlich wichtiges Thema bilden, und hinsichtlich der theoretischen Perspektive auf das Material zunächst offen zu bleiben. (vgl. Medjedović, 2008, S. 199f) Der Forschungsstil der Grounded Theory (siehe hierzu Kapitel 7.1) sieht einen solchen induktiven Ansatz vor.
Wie sich aus der obigen Diskussion zeigt, stellen die genannten Nachteile von Sekundäranalysen keine unüberwindbaren Hürden dar. (vgl. Medjedović, 2008) Durch eine detaillierte Dokumentation des primären Forschungsprozesses (z.B. in Form von schriftlichen Aufzeichnungen zur Interviewsituation und ihren Rahmenbedingungen), eine induktive forschungsmethodischen Ausrichtung der Sekundäruntersuchung und/oder die weitere Erhebung von spezifischer auf die Forschungsfrage zugeschnittenem Datenmaterial kann ihnen entgegengewirkt werden.
In Bezug auf die hier durchgeführte Untersuchung ist kritisch anzumerken, dass von den PrimärforscherInnen zusätzlich zum Datenmaterial kaum Kontextinformationen bereitgestellt wurden. Dies erschwerte insgesamt das Nachvollziehen des von Medjedović (2008, S. 202) sogenannten projektspezifischen Erhebungskontexts. Demgegenüber stellte es sich als positiv heraus, auf das Datenmaterial in seiner Rohform (Audioaufzeichnung der Interviews) zugreifen zu können. Die bereits vorhandenen Interviewtranskripte entsprachen oft nicht den im Anhang (siehe S. 169ff) dargestellten Transkriptionsrichtlinien. Sie wiesen beispielsweise Lücken auf oder verabsäumten die Kennzeichnung von Pausen und nichtverbalen Äußerungen, was einen Verlust von wichtigen Gesprächsinformationen bedeutet hätte. Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem Audiomaterial sowie die eigenständige Transkription der Interviews durch die Autorin erleichterten daher das Nachvollziehen des interviewspezifischen Kontexts. (vgl. Medjedović, 2008, S. 202)
[6] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen richten sich nach der auf der Homepage der Open Access Zeitschrift (http://www.qualitative-research.net) online verfügbaren PDF-Datei.
[7] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen richten sich nach der auf der Homepage der Open Access Zeitschrift (http://www.qualitative-research.net) online verfügbaren PDF-Datei.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel gilt es, erkenntnistheoretische Grundannahmen zu klären, welche die Basis für die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen im Rahmen der Diplomarbeit bilden. Der Fokus auf subjektiv und insbesondere im sozialen Kontext konstruierte Erfahrungen ist keineswegs willkürlich, sondern von der Autorin bewusst gewählt, weil sie von sozial-konstruktionistischen Annahmen ausgeht. Was das bedeutet, soll im Folgenden herausgearbeitet werden.
Der soziale Konstruktionismus wird in der Literatur oftmals unter dem Oberbegriff „Konstruktivismus“ eingeordnet, mit diesem gleichgesetzt bzw. unter der Bezeichnung „sozialer Konstruktivismus“ behandelt. (vgl. Ameln, 2004; Lee, 2011) Auch Kathy Charmaz bezeichnet den von ihr entwickelten Ansatz der Grounded Theory inkonsistent als „konstruktivistisch” (vgl. Charmaz, 2000) bzw. als „konstruktionistisch“ (vgl. Charmaz, 2008). Raskin (2002, S. 1)[8] bemängelt die uneinheitliche Verwendung verwandter Begriffe: „Terms like ‚constructivism’, ‚constructionism’ and ‚constructive’ are employed so idiosyncratically and inconsistently that at times they seem to defy definition.“ (vgl. auch Young & Collin, 2004) Aus diesem Grund wird versucht, zunächst die Grundlagen und Vielfalt des Konstruktivismus aufzuzeigen, um schließlich in Anbindung daran, aber auch in Abgrenzung davon die Grundzüge der verwandten Position des Sozialen Konstruktionismus herauszuarbeiten.
Konstruktivismus ist nach Siebert (2005, S. 11) „keine eigene Wissenschaftsdisziplin, sondern ein inter- und transdisziplinäres ‚Paradigma’, eine Perspektive“. Ameln (2004, S. 3) kennzeichnet Konstruktivismus als Denkströmung, die sich in eine Vielzahl von konstruktivistischen Ansätzen gliedert. Auch Hug (2011, S. 467) betont:
Eine konzeptionelle, institutionelle oder personelle Geschlossenheit „des“ Konstruktivismus ist weder im Allgemeinen noch im Kontext der Erziehungswissenschaft in Sicht. Vielmehr lassen sich unterschiedliche Diskursstränge ausmachen, die sich zum Teil überschneiden und ergänzen, zum Teil auch widersprechen oder relativieren, und die sich häufig in einem ungeklärten Verhältnis zueinander befinden.
Einige AutorInnen, wie zum Beispiel Raskin (2002) und Lindemann (2006) verwenden daher bevorzugt den Plural und beziehen sich in ihren Ausführungen bewusst auf „contructivisms“ bzw. „Konstruktivismen“.
Unterschiedliche konstruktivistische Positionen zeichnen sich nach Ameln (2004) durch eine gemeinsame erkenntnistheoretische Grundüberzeugung aus, nach der Menschen das, was sie als Wirklichkeit erleben, aktiv konstruieren und somit Erkenntnis immer beobachterabhängig ist. Damit erfolgt eine klare Abgrenzung gegenüber dem Realismus, der davon ausgeht, dass menschliche Wahrnehmung die Realität[9] abbildet. (vgl. Siebert, 2005) Pörksen (2011a, S. 21; Hervorhebung im Original) betont in diesem Zusammenhang die begrenzte Bewusstseinsfähigkeit und Steuerbarkeit von Konstruktionsprozessen:
Die Konstruktion von Wirklichkeit erscheint nicht als ein planvoller, bewusst steuerbarer Vorgang; es handelt sich nicht um einen intentionalen Schöpfungsakt, sondern um einen durch die Auseinandersetzung mit der konkreten Umwelt in vielfacher Weise bedingten Prozess, der von biologischen, soziokulturellen und kognitiven Bedingungen bestimmt wird.
Aus der Annahme, dass Erkenntnis immer beobachterabhängig ist, folgt schließlich, dass keine sicheren Aussagen über die Realität möglich sind und daher auch keine über den Grad der Übereinstimmung zwischen Wirklichkeit und Realität. (vgl. Ameln, 2004) Durch die angenommene Perspektivengebundenheit von Erkenntnis ergibt sich weiters, dass unzählige Wirklichkeiten nebeneinander bestehen können. (vgl. Pörksen, 2011a)
Der Konstruktivismus beschäftigt sich also insgesamt vielmehr mit „epistemologisch zu verstehende[n] Wie-Fragen“ nach dem Prozess des Erkennens als mit „ontologisch gemeinte[n] Was-Fragen“ nach der Erkenntnis an sich. (Pörksen, 2011a, S. 21; vgl. auch Siebert, 2005) „Im Vordergrund steht zumeist die Gemachtheit der Tatsachen, des Wissensaufbaus, der Wirklichkeit, der Geschichte oder des gesellschaftlichen Seins, wobei die verschiedenen Konstruktivismusvarianten als unterschiedliche Interpretationen der Beziehungen von Wissen und der Produktion von Wirklichkeit verstanden werden können.“ (Hug, 2011, S. 467)
Nach Theo Hug (2011) lässt sich kein eindeutiger historischer Zeitpunkt bestimmen, zu dem konstruktivistisches Denken seine Anfänge nahm. „Es lassen sich mehrere Anknüpfungspunkte benennen, auf die in der erziehungswissenschaftlichen Rezeption selektiv und mit unterschiedlichen Gewichtungen Bezug genommen wird.“ (ebd. 2011, S. 464) In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass erste konstruktivistische Denkansätze weit in die Geschichte zurück reichen und sich bereits im Altertum und Mittelalter, etwa in den Werken der antiken Skeptiker, finden. (vgl. Ameln, 2004) Von diesen hebe sich der „moderne“ Konstruktivismus insofern ab, als er „nicht nur die klassische erkenntnistheoretische Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis aufwirft, sondern seine Eigenständigkeit insbesondere durch die Fokussierung der aktiven, gestaltenden Seite der menschlichen Erkenntnistätigkeit gewinnt“. (ebd. S. 11) Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts wie René Descartes, Giovanni Batista Vico, George Berkeley und Immanuel Kant sind als wichtige Vorläufer des heutigen Konstruktivismus zu nennen. (vgl. Ameln, 2004; Hug, 2004) In der Philosophie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beeinflussten unter anderem die Phänomenologie von Edmund Husserl, die Position von William James im Kontext des amerikanischen Pragmatismus und der Instrumentalismus von John Dewey und Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme die konstruktivistische Diskussion maßgeblich. (vgl. Ameln, 2004) Weitere in der Literatur häufig erwähnte konstruktivistische Ansätze sind jene von George Spencer Brown, Jean Piaget, George Alexander Kelley, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Wolfgang Klafki, Wolfgang Brezinka und Lev S. Vygotskij. (vgl. Ameln, 2004; Hug, 2011)
In der Pädagogik, sowie in anderen geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, erfuhr die konstruktivistische Diskussion seit den 1970er Jahren eine intensive Ausdifferenzierung. (vgl. Hug, 2011, 2004) So etablierte sich etwa der Radikale Konstruktivismus mit seinen Hauptvertretern Humberto R. Maturana, Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld und Gerhard Roth. (vgl. Pörksen, 2011a; Ameln, 2004; Moser, 2004) Weiters sind in diesem Zusammenhang insbesondere der Sozialkonstruktivismus von Peter L. Berger und Thomas Luckmann, der Symbolische Interaktionismus nach George H. Mead und der sozialkonstruktionistische Ansatz nach Kenneth J. Gergen zu nennen. (vgl. Hug, 2011)
Die stärkste Kontinuität pädagogisch-konstruktivistischer Diskurse ist einerseits im Zusammenhang der Rezeption soziologischer sowie sozialpsychologischer und sozialphänomenologischer Konstruktivismusvarianten zu verzeichnen. Andererseits sind im Zusammenhang der Entstehung konstruktivistischer Positionen in der Pädagogik insbesondere die Arbeiten von Ernst von Glasersfeld und Humberto R. Maturana von Bedeutung. (ebd., S. 466)
Um zu demonstrieren, wie vielfältig und unüberschaubar der konstruktivistische Diskurs mittlerweile ist, sei auf Hug (2011, S. 467) verwiesen, der unter anderem zwischen radikal konstruktivistischen und kybernetischen, kognitionswissenschaftlichen und neurobiologischen, systemtheoretischen, sozio-kulturalistischen, (sozial-)psychologischen und psychotherapeutischen, (wissens-)soziologischen und philosophischen Konstruktivismusvarianten unterscheidet. (siehe Abbildung 3)
In der Literatur finden sich zahlreiche Versuche, die unübersichtliche Vielfalt der nebeneinander existierenden konstruktivistischen Positionen in eine Systematik zu bringen.
So unterscheidet etwa Pörksen (Pörksen, 2011b) zwischen naturalistischem und kulturalistischem Konstruktivismus, wobei sich ersterer auf kognitive Erkenntnisprozesse konzentriert und letzterer soziale, kulturelle und gesellschaftliche Erkenntnisprozesse in den Mittelpunkt stellt.
Raskin (2002) differenziert in seinem Artikel in Anlehnung an Chiari und Nuzzo (1996) zwischen epistemologischem und hermeneutischem Konstruktivismus. Ersterer geht von der Existenz einer beobachterunabhängigen, externen Realität aus, die durch den Menschen allerdings in ihrer „natürlichen“ Form nicht erfahrbar ist, sondern lediglich über seine Konstruktionen. Letzterer negiert dagegen die Existenz einer beobachterunabhängigen Realität und postuliert: „there can be as many knowledge systems as there are groups discursively negotiating them“ (Raskin, 2002, S. 3).
Collin (2008) klassifiziert verschiedene konstruktivistische Positionen anhand der drei folgenden Dimensionen:
-
Erkenntnistheoretischer versus ontologischer Konstruktivismus: ersterer folgt der Annahme, alles Wissen von der Wirklichkeit sei eine Konstruktion, letzterer sieht die Wirklichkeit selbst als Konstruktion an.
-
Die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen versus gesellschafts- und humanwissenschaftlichen Inhalten;
-
Die Konstruktionen erfolgen entweder durch WissenschaftlerInnen, „gewöhnliche Gesellschaftsmitglieder (soziale Akteure)“ oder durch „Episteme“[10] im Sinne Foucaults. (ebd., S. 24)
Im Gegensatz zu den bisher genannten Autoren verzichtet Lindemann (2006) in seinem Einführungswerk Konstruktivismus und Pädagogik aufgrund der aus seiner Sicht unüberschaubaren Vielfalt an Gemeinsamkeiten und Unterschiede konstruktivistischer Positionen auf eine Einteilung.
Auch der Soziale Konstruktionismus geht von der Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis aus und sieht die Wirklichkeit als konstruiert statt gegeben an. Der wesentliche Unterschied zu konstruktivistischen Ansätzen besteht in der Fokussierung sozialer Konstruktionsprozesse. (vgl. Ameln, 2004; Young & Collin, 2004) In der Literatur wird der Soziale Konstruktionismus oftmals im Kontrast zum Radikalen Konstruktivismus dargestellt, welcher im deutschsprachigen Raum nach von Glasersfeld (1998, zit. nach Westmeyer in Gergen, 2002, S. 4) die bekannteste Position darstellt. So schreibt etwa Schwandt (1998, S. 240, zit. Nach Lee, 2011, S. 3):[11]„Contrary to the emphasis in radical constructivism, the focus here is not on the meaning-making activity of the individual mind but on the collective generation of meaning as shaped by conventions of language and other social processes.“ Aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus ist der Mensch ein kognitiv geschlossenes System, kann die Welt also nur über seine subjektiven Konstruktionen wahrnehmen bzw. erfahren und niemals in direkten Kontakt mit der Realität treten. (vgl. Raskin, 2002) Moser (2004, S. 10) bezeichnet diese Position daher auch als „kognitionswissenschaftlichen Konstruktivismus“. Aus dieser Perspektive ist Wissen stets Subjektgebunden und existiert ausschließlich in den Köpfen der einzelnen Menschen. (Glasersfeld, 1998, S. 11, zit. nach Westmeyer in Gergen, 2002, S. 5) Der Soziale Konstruktionismus betont demgegenüber die soziale Eingebundenheit allen Wissens.
Dieser Gegensatz zwischen Radikalem Konstruktivismus und Sozialem Konstruktionismus kommt in der Gegenüberstellung von „Ich denke, also bin ich“ und „Ich kommuniziere, also denke ich“ zum Ausdruck. (Frindte, 1998, S. 41ff) Die relationale Reinterpretation üblicherweise als individuumsbezogen konstruierter Zustände und Prozesse ist aus meiner Sicht das eigentlich Revolutionäre am Sozialen Konstruktionismus. (Westmeyer in Gergen, 2002, S. 5)
In der Literatur (vgl. etwa Young & Collin, 2004; Raskin, 2002; Lee, 2011) wird auch in Bezug auf den Sozialen Konstruktionismus auf das Vorliegen einer Fülle von Ansätzen hingewiesen. „Indeed, it is appropriate to speak of a family of social constructionisms.“ (Young & Collin, 2004, S. 377) So unterscheidet etwa Zuriff (1998, zit. nach Young & Collin, 2004, S. 377) zwischen metaphysischem und empirischem Sozialen Konstruktionismus, Hosking (2002, zit. nach Young & Collin, 2004, S. 377) postuliert im Rahmen der Organisationspsychologie einen relationalen Konstruktionismus und schreibt darin relationalen Prozessen eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Wirklichkeit zu und Madill, Jordan und Shirley (2000, zit. nach Young & Collin, 2004, S. 377) differenzieren zwischen kontextualem und radikalem Konstruktionismus.
Nach Raskin (2002, S. 9) bevorzugt die Mehrheit derjenigen, die sich der Position des Sozialen Konstruktionismus verbunden fühlen, den Begriff Konstruktionismus gegenüber Konstruktivismus, was seiner Auffassung nach – und wie bereits oben angesprochen – deren Ablehnung der Vorstellung von Menschen als isolierte Konstrukteure widerspiegelt. Ameln (2004, S. 179) zählt den Sozialen Konstruktionismus aufgrund dieser Distanzierung und der „unterschiedlichen Akzentsetzung“ bewusst nicht zur Familie der konstruktivistischen Ansätze, sondern beschreibt ihn als verwandte Position.
Nach Gergen (1985) liegen den meisten konstruktionistischen Ansätzen mindestens eine der folgenden vier Annahmen zugrunde:
-
Eine kritische Haltung gegenüber der als selbstverständlich erlebten Welt, sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft;
Soziale Konstruktionisten hinterfragen allgemein akzeptierte und bedenkenlos eingesetzte Kategorien und Verstehensweisen, die sich über vermeintlich objektive Beobachtungsprozesse legitimieren. Als Beispiele sind Konstrukte wie Kindheit, psychische Störung, Menopause, Schizophrenie oder die Unterscheidung der Geschlechter in männlich/weiblich zu nennen. (vgl. Gergen, 1985) Der Soziale Konstruktionismus geht davon aus, dass derartige Kategorien, mit deren Hilfe man sich die Welt (und sich selbst) verständlich macht, nicht der Realität entspringen, sondern von Menschen im kulturellen, zeitlichen, sozialen und gesellschaftlichen Kontext konstruiert werden. (vgl. Burr, 1997; Gergen, 1985) Dementsprechend ist danach zu fragen, warum etwa der Kategorie Geschlecht eine höhere Bedeutung bei der Unterscheidung von Menschen zugesprochen wird als beispielsweise der Kategorie Körpergröße. (vgl. Burr, 1997)
-
Historische und kulturelle Bedingtheit von Wissen über die Welt;
Das Wissen, das Menschen über die Welt haben, und die Art und Weise, auf die sie die Welt verstehen, zeichnen sich durch hohe geschichtliche und kulturelle Spezifität aus. (vgl. Burr, 1997) Gergen (1985, S. 267) spricht in diesem Zusammenhang von „social artefacts, products of historically situated interchanges among people“. Um zu demonstrieren, dass menschliches Wissen und menschliche Verstehensweisen nicht von der „Natur der Welt“ herrühren, führt er als Beispiel den deutlichen Wandel des Kindheitsverständnisses innerhalb der letzten Jahrhunderte an und betont, dass dieser kein Resultat einer Veränderung der Kinder an sich darstelle, sondern auf historisch und kulturell bedingte kontextuelle Veränderungen zurückführbar sei.
-
Wissen wird durch soziale Prozesse aufrechterhalten;
Welche alternativen Wissensversionen in einer Gesellschaft beibehalten und welche verworfen werden, entscheidet sich durch alltägliche zwischenmenschliche Interaktions- und Kommunikationsprozesse. Im Austausch mit anderen erfolgt eine Art „Einigung“ auf bestimmte Wissensformen bzw. Verstehensweisen, auf die schließlich im Rahmen von Kommunikation immer wieder Bezug genommen wird. Dies führt zu einer Festigung von „Mainstream“-Wissensversionen, während alternative Wissensversionen in den Hintergrund treten oder gar verschwinden. (vgl. Gergen, 1985)
-
Wissen und soziales Handeln bedingen sich wechselseitig;
Bestimmte Konstruktionen – in Form von Beschreibungen bzw. Erklärungen von in der Welt beobachteten Phänomenen – legen bestimmte Handlungsmuster nahe und schließen andere aus. Beispielsweise impliziert die Annahme, Menschen mit psychischen Störungen seien von bösen Mächten besessen, andere Handlungen diesen Menschen gegenüber (z.B. Exorzismus) als etwa die Annahme von zugrunde liegenden psychischen und physischen Fehlfunktionen (z.B. Therapieversuche).Auch Kathy Charmaz (1995, S. 62) betont: „[…] social reality does not exist independently of human action.“
Westmeyer (2011, S. 416) versteht den „Begriff des Konstruierens […] als eine (wenigstens) vierstellige Relation […], in die ein Konstruktionssubjekt x, ein Konstruktionsobjekt y, ein Konstruktionsresultat z und ein Konstruktionszeitpunkt t eingehen: x konstruiert y als z zur Zeit t“. Das heißt, dass ein Objekt y von verschiedenen Personengruppen x und/oder zu unterschiedlichen Zeiten t als verschiedene Versionen von z konstruiert werden kann. (vgl. Westmeyer in Gergen, 2002, S. 2) Folgendes Beispiel soll der Verdeutlichung dienen: Im frühen 20. Jahrhundert (t) sahen Anhänger der somatogenen Sichtweise (x1) psychische Störungen (y) als physisch bedingtes Phänomen (z1) an, Anhänger der psychogenen Sichtweise (x2) hingegen als psychisch verursachtes Phänomen (z2). Nach Westmeyer (2011, S. 417) fragen Soziale Konstruktionisten insbesondere nach dem Konstruktionssubjekt x, wobei er betont, dass es sich aus ihrer Sicht dabei nicht um Einzelpersonen, sondern immer um Personengruppen handelt, die miteinander in sozialem Austausch stehen, und dem (historischen) Konstruktionskontext t. „Und sie werden nach alternativen Konstruktionen für y über z hinaus suchen, um den Blick auf y zu erweitern.“ (ebd.)
Vivien Burr (1997, S. 14) versteht den Sozialen Konstruktionismus als „movement which has arisen from and is influenced by a variety of disciplines and intellectual traditions“ und nimmt in ihren Ausführungen Bezug auf drei zentrale Einflussquellen: die Soziologie, die Arbeiten des amerikanischen Psychologen Kenneth J. Gergen und die Postmoderne.
Als erste Impulsgeber des Sozialen Konstruktionismus (Ameln, 2004, S. 180) sind zum einen der Symbolische Interaktionismus nach George H. Mead, begründet in dessen Werk Mind, Self and Society (1934) (1968 erstmals auf Deutsch unter dem Titel Geist, Identität und Gesellschaft) und zum anderen der Sozialkonstruktivismus nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann, begründet in deren Hauptwerk The Social Construction of Reality (1966) (1969 erstmals auf Deutsch unter dem Titel Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit) zu nennen. (vgl. Burr, 1997)
Die zentrale Annahme des Symbolischen Interaktionismus nach Mead besteht darin, dass Menschen ihre eigenen Identitäten und die Identitäten anderer in den alltäglichen sozialen Interaktionen und Bezügen, in denen sie stehen, konstruieren. (vgl. Burr, 1997; Ameln, 2004) Interaktion bzw. Kommunikation läuft dabei über Zeichen, Gesten und Symbole ab. (vgl. Abels, 2009) Für das bewusste soziale Handeln ist die Sprache von zentraler Relevanz, da sie als „vokale Geste“ (Faulstich-Wieland, 2000, S. 140) fungiert und damit die Grundlage „zur Antizipation, zur Perspektivenübernahme und zu einer bewußten Stellungnahme zum eigenen Handeln aus der Sicht des anderen“ bildet. (Brumlik, 1996, S. 886). Berger und Luckmann (1969) postulieren drei grundlegende Prozesse, anhand derer sie darlegen, wie Wirklichkeit einerseits durch soziale und gesellschaftliche Praktiken konstruiert, und andererseits von den Gesellschaftsmitgliedern als gegebene Realität erlebt werden kann: Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung. Eine Idee wird sozial zugänglich gemacht – beispielsweise durch das Erzählen einer Geschichte oder das Schreiben eines Buches – (Externalisierung). Über Prozesse der Verbreitung und Verfestigung, wie das Weitererzählen der Geschichte oder das Lesen des Buches durch andere Personen, erhält diese Idee innerhalb einer Gesellschaft einen gewissen Wahrheitsgehalt und Objekt-Status (Objektivierung). Folgende Generationen, die in einer Gesellschaft geboren werden, in der besagte Idee bereits als Objekt „existiert“, nehmen diese als naturgegeben hin (Internalisierung). (vgl. Burr, 1997) Berger und Luckmann (1969, S. 139) betonen, dass die drei Prozesse nicht notwendigerweise in der eben dargestellten zeitlichen Abfolge auftreten müssen, sondern in der Regel simultan verlaufen.
Der Ausgangspunkt der Etablierung des Sozialen Konstruktionismus innerhalb der Psychologie wird vielfach an dem von Kenneth J. Gergen (1973) verfassten Artikel Social Psychology as History festgemacht, in dem er sich kritisch mit der traditionell positivistisch-empiristischen sozialpsychologischen Forschung auseinandersetzt. (vgl. Burr, 1997; Westmeyer, 2011) Gergen betont in dieser Schrift die historische und kulturelle Spezifität allen Wissens, inklusive des psychologischen, und hält die eingehende Analyse von sozialen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kontexten zusätzlich zur Erforschung von menschlichem Verhalten auf individueller Ebene für unabdingbar, um zu einem integrierten Verständnis des gegenwärtigen (psychologischen) Wissens gelangen zu können. (vgl. Burr, 1997; Gergen, 1973) In der psychologischen Fachzeitschrift American Psychologist veröffentlichte Gergen (1985) schließlich seinen Artikel The Social Constructionist Movement in Modern Psychology, welchen Westmeyer (2011, S. 411) als „so etwas wie ein Manifest des sozialen Konstruktionismus“ bezeichnet. Darin umschreibt Gergen (1985, S. 266) den Fokus sozialkonstruktionistischer Forschung wie folgt: „Social constructionist inquiry is principally concerned with explicating the processes by which people come to describe, explain, or otherwise account for the world (including themselves) in which they live.” Der Ansatz von Gergen erfreute sich seit seiner Begründung einer differenzierten Verbreitung, insbesondere in der qualitativen Forschung der Human- und Sozialwissenschaften. (vgl. Hug, 2004; Edley, 2001) Nach Westmeyer (2011, S. 412) „haben Gergens Überlegungen inzwischen [auch] Eingang gefunden in die psychologische Therapie, in die pädagogische Praxis, in die Praxis der Arbeitsund Organisationspsychologie und in viele andere Bereiche“.
Die intellektuelle Bewegung der Postmoderne, welche in der Kunst, Literatur und den Kulturwissenschaften ihren Ausgang nahm, sucht die Überwindung zentraler Annahmen ihrer Vorgänger-Bewegung, der Moderne. (vgl. Burr, 1997) Dazu gehört insbesondere der Glaube an eine ultimative Wahrheit und die Vertretung des Strukturalismus:
This search for truth was often based upon the idea that there were rules or structures underlying the surface features of the world, and there was a belief in a ‚right’ way of doing things which could be discovered. [...] In each case the ‘hidden’ structure or rule is seen as the deeper reality underlying the surface features of the world, so that the truth about the world could be revealed by analysing these underlying structures. (ebd., S. 12f)
Diese Vorstellung ist auch im Gegensatz zu sowohl konstruktivistischen als auch konstruktionistischen Positionen zu sehen, da sie implizit eine objektiv gegebene, stabile Realität voraussetzt, die es mithilfe von Vernunft und Rationalität aufzudecken gilt. (vgl. ebd.) Die Postmoderne betont das gleichzeitige Bestehen verschiedener und vielfältiger Lebensarten und Wissensformen und stellt sich gegen die Annahme der Erklärbarkeit der Welt durch einige wenige Meta-Theorien. (vgl. ebd.)
Sprache und Kommunikation spielen aus der Perspektive des Sozialen Konstruktionismus eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Wirklichkeit. (vgl. Gergen, 2002; Westmeyer, 2011; Raskin, 2002; Talja, Tuominen, & Savolainen, 2005) Sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft wird oft davon ausgegangen, Sprache sei ein mehr oder weniger neutrales „Instrument“, dessen sich der Mensch bedient, um seinen Gedanken anderen gegenüber Ausdruck zu verleihen. Der Soziale Konstruktionismus sieht Sprache dahingegen als Voraussetzung für menschliches Denken an. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Menschen denken, anhand welcher Kategorien und Konzepte sie sich die Welt verständlich machen, durch die Sprache, mit der sie aufwachsen, festgelegt wird. (vgl. Burr, 1997, S. 7)
Sprache wird im Sozialen Konstruktionismus nach Gergen als „etwas durch und durch Soziales“ angesehen. (Westmeyer, 2011, S. 417)
Die Entwicklung einer Sprache, ihre Verwendung, also sprachliche Performanz, und ihre Weiterentwicklung erfolgen in sozialen Interaktionen. In Aussagen der Form „x konstruiert y als z zur Zeit t“ sind – trivialerweise – alle Bestandteile sprachlicher Natur. [...] Worauf auch immer wir uns mit einem y beziehen wollen, in Aussagen der Form „x konstruiert y als z zur Zeit t“ kommt y also bereits selbst in versprachlichter und deshalb konstruierter Form vor; (ebd., S. 418; Hervorhebung im Original)
Zentral ist also die strukturalistische Annahme, dass Sprache nicht die in der Realität scheinbar vorliegenden Ordnungen reflektiert, sondern bereits einen im sozialen Austausch konstruierten Rahmen darstellt, mit dessen Hilfe wir die Welt wahrnehmen. Poststrukturalisten gehen noch einen Schritt weiter und betonen, dass die Bedeutungen von sprachlichen Begriffen und Formulierungen einem steten Wandel unterworfen ist und je nach Kontext unterschiedlich sein können. (vgl. Burr, 1997)
In der Literatur wird oft vor der Gleichsetzung von qualitativer und konstruktivistischer bzw. konstruktionistischer Forschung gewarnt. Qualitative Forschung ist nicht notwendigerweise konstruktivistisch / konstruktionistisch, ebensowenig wie konstruktivistische / konstruktionistische Forschung notwendigerweise qualitativ sein muss. (Hug, 2004, S. 132; vgl. auch Lee, 2011; Siebert, 2005) Aus der Perspektive des Sozialen Konstruktionismus erhält die Frage nach dem Verhältnis von ForscherInnen und ForschungsteilnehmerInnen besondere Aufmerksamkeit. So spricht sich Hans Westmeyer im Vorwort zur deutschen Ausgabe des Werks von Kenneth Gergen (2002, S. 1) im Namen des Autors explizit gegen eine „Zweiteilung der Menschheit in forschende und beforschte Wesen“ aus und betont, dass „die am Dialog beteiligten Personen“ sich auf gleichgestellter Ebene begegnen. Jede Form von Dialog zielt dabei nicht auf die Bildung eines Konsenses ab, sondern soll „ganz im Gegenteil die Vielstimmigkeit der Welt zum Ausdruck bringen“. (ebd., S. 4) Nach Lee (2011, S. 5) geht der Soziale Konstruktionismus von der Existenz vieler Realitäten anstatt von vielen Auffassungen ein und derselben Realität aus. Auch Ameln (2004, S. 181) betont: „Das Wissenschaftsideal liegt also nicht im Auffinden der ‚richtigen’ und im Verwerfen der ‚falschen’ Theorie, sondern darin, die Komplexität der Wirklichkeit aus unterschiedlichen Perspektiven mit zahlreichen ko-existierenden, gleichermaßen legitimen Beschreibungen abzubilden.“
Nach Westmeyer (in Gergen, 2002, S. 4) ist das Herausstreichen einer solchen „Vielstimmigkeit“ jedoch keinesfalls mit angenommener Willkürlichkeit zu verwechseln, da jede(r) Einzelne seine/ihre Perspektive als „wahr“ und nicht als beliebig erlebt und entsprechend dieser erlebten „Wahrheit“ handelt: „If human beings define their situations as real, they are real in their consequences“. (W. I. Thomas & Thomas, 1928, S. 527, zit. nach Charmaz, 2000, S. 523) Darüber hinaus entstehen soziale Konstruktionen nicht willkürlich, sondern gemäß bestimmten kontextuellen Bedingungen, „[…] denen sozialisierte Individuen in ihrer sozialen und natürlichen Umwelt unterworfen sind.“ (Schmidt, 1994, S. 16, zit. nach Westmeyer, 2011, S. 422) Kathy Charmaz (2008, S. 397) hebt in ihren Ausführungen über die Methode der Grounded Theory hervor, dass die Annahme der aktiven Konstruktion von Wirklichkeiten nicht nur für ForschungsteilnehmerInnen, sondern ebenso für WissenschaftlerInnen gilt: „Grounded theory not only is a method for understanding research participants’ social constructions but also is a method that researchers construct throughout inquiry.“ Die Forschungsarbeit verlangt daher viel Reflexivität in Bezug auf die eigenen Sichtweisen, Werte und Traditionen. Nur so kann dem entgegengewirkt werden, was Siebert (2005, S. 125) an der gängigen Forschungspraxis bemängelt: „Viele Forschungsprojekte sagen mehr über die Konstrukte der Forscher als die der Erforschten aus.“
Wie bereits erwähnt, wird der Ansatz der Grounded Theory nach Kathy Charmaz in der Literatur - und auch von ihr selbst - manchmal als „konstruktivistisch”, manchmal als „konstruktionistisch“ bezeichnet. (vgl. etwa Charmaz, 2000, 2005, 2008; Puddephatt, 2006; Mills u. a., 2006) Der Begriff konstruktivistisch wird dabei meist in Abgrenzung zu objektivistisch und synonym mit konstruktionistisch verwendet. Während objektivistische Ansätze der Grounded Theory sich nach Charmaz (2008, S. 398) primär um die Beantwortung von „Warum-Fragen“ bemühen und damit über den spezifischen Forschungskontext hinaus generalisierbare Erklärungen und Vorhersagen von empirischen Phänomenen anstreben, stehe bei konstruktionistischen Ansätzen vielmehr ein Fragen nach dem „Was“ und „Wie“ im Vordergrund. Konstruktionistische Ansätze zielen also auf ein in den spezifischen Forschungskontext eingebettetes, also explizit nicht universell gültiges, Verstehen von Phänomenen ab. (vgl. ebd.)
In ihrem Beitrag Constructionism and the Grounded Theory Method im Handbook of Constructionist Research (Holstein & Gubrium, 2008) siedelt Charmaz ihren Ansatz im Sozialen Konstruktionismus an:
The form of constructionism I advocate includes examining (1) the relativity of the researcher’s perspectives, positions, practices, and research situation, (2) the researcher’s reflexivity; and (3) depictions of social constructions in the studied world. Consistent with the larger social constructionist literature, I view action as central focus and see it as arising within socially created situations and social structures. (Charmaz, 2008, S. 398)
Insbesondere die Punkte (1) und (2) sind hervorzuheben. Bei der Entwicklung einer Grounded Theory nach dem Ansatz von Charmaz geht es nicht nur darum, die sozialen Konstruktionen der ForschungsteilnehmerInnen zu untersuchen, sondern darüber hinaus als ForscherIn die eigenen Sichtweisen und Werte, sowie den Forschungskontext und deren Relativität bewusst zu reflektieren. „In short, constructing constructivism means seeking meanings [meaning wird in diesem Zusammenhang als Gegensatz zu truth verstanden] – both respondents’ meanings and researchers’ meanings.” (Charmaz, 2000, S. 525)
Insofern ist aus der Sicht der konstruktionistischen Grounded Theory der Forschungsprozess selbst als soziale Konstruktion, entstanden in den Interaktionen zwischen ForscherInnen, ForschungsteilnehmerInnen und dem Forschungsfeld, zu behandeln. Alle in diesem Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen bzw. eingenommenen Positionen gilt es kritisch zu hinterfragen. (vgl. Charmaz, 2008, 2000)
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass letztlich auch das fertige Forschungsprodukt niemals den Anspruch erheben kann, „wahr“ zu sein. „We can claim only to have interpreted a reality, as we understood both our own experience and our subjects’ portrayals of theirs.“ (Charmaz, 2000, S. 523; Hervorhebung im Original) Dies gilt auch für die im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführte qualitative Untersuchung.
[8] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen richten sich nach der auf der Homepage der Open Access Zeitschrift (http://www.ac-journal.org) online verfügbaren PDF-Datei.
[9] An dieser Stelle sei auf die Begriffsverwendung von Ameln (2004) verwiesen, nach der sich auch die Autorin richtet: der Begriff Realität wird demnach für die Bezeichnung der objektiven, von unseren Wahrnehmungen unabhängigen Welt verwendet, während der Begriff Wirklichkeit die durch unsere Wahrnehmungen und Erkenntnisprozesse konstruierte Welt meint.
[10] abstrakte Größen, wie etwa begriffliche und gedankliche Strukturen (F. Collin, 2008, S. 10)
[11] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen richten sich nach der vorab veröffentlichten Online-Version (mit Zulassung verfügbar unter http://onlinelibrary.wiley.com).
Inhaltsverzeichnis
Vorweg sei angemerkt, dass die Vorgehensweise zur Analyse des Datenmaterials zwar in linearer Form dargestellt wird, bei deren praktischer Umsetzung aber nicht immer Linearität gegeben war und auch nach Charmaz (2006, S. 10) nicht anzustreben ist. Oft erfolgten verschiedene Arbeitsschritte parallel bzw. wurde wiederholt zwischen ihnen hin- und hergewechselt. (vgl. Strübing, 2008) Dies wurde insbesondere auch dann praktiziert, wenn die Schritte auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen angesiedelt sind.
Das von der Autorin zur Eingrenzung des Datenmaterials herangezogene Hauptkriterium bestand darin, dass in den Interviews interaktionelle Erfahrungen im Arbeitskontext thematisiert wurden und für die jeweiligen InterviewpartnerInnen von subjektiver Bedeutsamkeit zu sein schienen. Das bedeutet etwa, dass in den Interviews intensiv auf derartige Erfahrungen eingegangen wurde und/oder sie im Verlauf mehrerer Interviews immer wieder zur Sprache kamen. Das Ziel bestand darin, ein Sample zu erstellen, welches einerseits eine große Bandbreite an interaktionellen Erfahrungen umfasst und andererseits eine differenzierte Analyse dieser Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf das Erleben von Teilhabe bzw. Ausschluss im Arbeitskontext ermöglicht. Darüber hinaus achtete die Autorin auf eine möglichst heterogene Zusammensetzung des Samples in Bezug auf das Alter, die Beschäftigungsbiographie und den aktuellen Beschäftigungsstatus der ForschungsteilnehmerInnen, um diesbezüglich Vergleiche anstellen zu können.
Dementsprechend wurden aus der Gruppe der bereits im Arbeitsleben stehenden ForschungsteilnehmerInnen die folgenden Interviews ausgewählt (siehe Tabelle 1).
|
ID |
Geschlecht |
Anzahl analysierter Interviews pro Person |
|---|---|---|
|
IP01 |
w |
2 |
|
IP06 |
w |
2 |
|
IP10 |
w |
3 |
|
IP11 |
m |
3 |
|
IP12 |
w |
1 |
|
IP21 |
w |
2 |
|
IP22 |
m |
2 |
|
IP25 |
w |
2 |
Die ausgewählten Interviews wurden im Zeitraum von Oktober 2008 bis Juli 2010 von Mag. Oliver Koenig geführt.
Nach der Auswahl der Interviews erfolgte deren Transkription, einschließlich Anonymisierung. Die Autorin ging dazu nach den im Anhang (siehe S. 169ff) dargestellten Transkriptionsrichtlinien vor.
Aus Datenschutzgründen wurde darauf verzichtet, die vollständigen Interviewtranskripte in die Diplomarbeit aufzunehmen. Um dem/der LeserIn dennoch die Verortung der Analyseergebnisse in ihrem Kontext zu ermöglichen, werden die InterviewpartnerInnen in Kapitel 9.2 einzeln vorgestellt. Weiters werden Auszügen aus den anonymisierten Transkripten in die Darstellung der Analyseergebnisse miteingebunden. Bei Zitaten aus den Interviewtranskripten wird immer zunächst auf die betreffende Interviewperson und anschließend auf das jeweilige Interview verwiesen. Beispielhaft nimmt das Zitat „Transkript IP01_2“ auf das zweite geführte Interview mit IP01 Bezug.
Anhand der „Atlas.ti 6 Quick Tour“ (Friese, 2010) verschaffte sich die Autorin einen „ersten allgemeinen Eindruck von den Möglichkeiten des Programms“ (ebd., S. 4), machte sich mit der Benutzeroberfläche vertraut und übte das Arbeiten mit Atlas.ti, Version 6.2 mit Beispieldaten, die im Softwarepaket enthalten waren. Zur detaillierteren Einarbeitung und als Hilfestellung in konkreten Fällen wurden weiters das Manual von Muhr und Friese (2004), sowie eine Zusammenstellung von Stefanie Rühl (o. J.), die sich stark am Einführungskurs von Jörg Strübing (1997) orientiert, herangezogen.
Die Auseinandersetzung mit den Interviewtranskripten stellt nach Peters und Wester (2007) das Kernstück der qualitativen Datenanalyse dar. Die Autoren unterscheiden hierbei drei verschiedene Arten des „Lesens“ der Transkripte (ebd. S. 638):
-
Lesen im Sinne von Beobachten, d.h. die Wahrnehmung des Textes;
-
Lesen im Sinne von Interpretieren, d.h. das Verstehen des Textes aus einer analytischen Perspektive heraus;
-
Lesen im Sinne von Selektieren, d.h. das Vornehmen von Unterscheidungen zwischen dem, was in Bezug auf die Forschungsfrage von Relevanz und dem, was dafür nicht relevant ist;
Die erstmalige Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial, die noch vor der Entwicklung der Forschungsfrage stattfand, hatte für die Autorin den vorrangigen Zweck, die Interviewpersonen „kennenzulernen“ und sich einen ersten Überblick über die in den Interviews behandelten Themen zu verschaffen. Nach erfolgter Konkretisierung des Forschungsvorhabens ging es bei einer erneuten Auseinandersetzung darum, das Datenmaterial im Hinblick auf Aspekte, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Relevanz sind, einzugrenzen.Im Zuge des Transkribierens erfolgte eine besonders intensive, allerdings nicht vordergründig analytische Auseinandersetzung mit dem für die Diplomarbeit ausgewählten Interviewmaterial. Im Verlauf der computergestützten Analyse nach der in diesem Kapitel dargestellten Vorgehensweise erfolgten weitere zyklische Auseinandersetzungs- Durchläufe mit dem Datenmaterial. Das wiederholte Lesen der vollständigen Interviewtranskripte war dabei von großer Wichtigkeit, um den Kontext stets im Auge zu behalten und sich nicht im „Dschungel“ der einzelnen, bereits entwickelten Kodes, Kategorien und Memos zu verlieren.
„Coding means that we attach labels to segments of data that depict what each segment is about.“ (Charmaz, 2006, S. 3)
Die entwickelten „Labels” oder Kodes zeichnen sich durch ihre Nähe zum Datenmaterial aus, sind handlungs- und prozessorientiert (anstatt themenorientiert) und dienen dazu, das Datenmaterial zu kategorisieren, zusammenzufassen und dabei jede einzelne Dateneinheit mit zu berücksichtigen. (vgl. Charmaz, 2006, S. 43ff) Entsprechend den Empfehlungen von Charmaz (2006) war die Autorin bemüht, einfache, prägnante und präzise Kodes zu entwickeln und sich deren Vorläufigkeitscharakter immer wieder vor Augen zu halten. „Your first reading and coding of the data need not be the final one.“ (ebd., S. 70)
Das initiale Kodieren weist die größte Nähe zum Datenmaterial auf. Die Analyseeinheiten können dabei unterschiedlich gewählt werden. Zum Beispiel kann Wort für Wort, Zeile für Zeile oder Ereignis für Ereignis kodiert werden. Die vorliegenden Interviewdaten legten eine zeilenweise Kodierung nahe. Ihr Vorteil besteht nach Charmaz (2006, S. 50f) darin, dass sie dem/der Forschenden sowohl das Identifizieren impliziter als auch expliziter Aspekte erlaubt, einen kritischen und analytischen Blick auf das Material erleichtert und dabei dem Zugriff auf vorgefasste Meinungen entgegen wirkt. Charmaz empfiehlt an dieser Stelle des Analyseprozesses eine möglichst zügige und spontane Vorgehensweise. Beim initialen Kodieren sei es besonders wichtig, offen für die Exploration aller in den Daten wahrnehmbaren theoretischen Richtungen zu bleiben. (vgl. Charmaz, 2006, S. 47ff) In Vivo Kodes, bei denen von den ForschungsteilnehmerInnen verwendete Begriffe in die Kodierung aufgenommen werden, sind nach Charmaz (ebd., S. 55ff) hilfreich für das Bewahren deren subjektiver Sichtweisen und Bedeutungen und die Verankerung der Analyse in ihrer Welt.
Um analytische Tendenzen im Datenmaterial herauszukristallisieren, werden während des gesamten Analyseprozesses komparative Methoden eingesetzt. Dabei werden zunächst Daten mit anderen Daten verglichen, zum Beispiel innerhalb desselben Interviews, zwischen aufeinander folgenden Interviews derselben Person oder zwischen Interviews verschiedener Personen.
Tabelle 2 stellt das initiale Kodieren anhand eines Auszugs aus dem ersten mit IP01 geführten Interview beispielhaft dar.
|
I: […] wie schaut so ein Arbeitstag von dir aus? // |
|
|
IP01: Ich hab Gaude [Anm. C.S. Spaß] mit allen, ah, alle sind nett |
mit anderen eine Gaude haben, nette Kollegen haben |
|
I: Mhm. |
|
|
IP01: und, / wir haben viel Spaß beim Mittagessen, / tun wir immer ein klein wenig blödeln miteinander |
zusammen Spaß haben, zusammen Mittag essen, miteinander herumblödeln, mit anderen eine Gaude haben |
|
I: Mhm. / Mhm. Und die Arbeiten? Machen dir die Spaß, oder? |
|
|
IP01: Ja, machen mir Spaß. |
Spaß an den Arbeitstätigkeiten haben |
|
[…] |
|
|
I: Mhm. / Mhm. / Und wie ist es mit den, mit den Betreuern da? |
|
|
IP01: Auch super. |
sich mit allen Betreuern gut verstehen |
|
I: Mhm. Mit allen, oder? |
|
|
IP01: Ja, mit allen. |
|
|
I: Aha. Hast du da schon irgendwann einmal irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht mit Betreuern, hier oder woanders? |
|
|
IP01: Schlechte Erfahrung? |
|
|
I: Ja. // |
|
|
IP01: In D(O), wo ich früher war, in D(O) war, hat es einen Chef gegeben, und den hab ich nicht so gerne mögen. |
den Chef nicht so gerne mögen |
|
I: Mhm, warum nicht? / |
|
|
IP01: Weiß nicht, der / hat immer s' so gehetzt und gesagt: / „Schneller, komm, es muss fertig werden." |
Schwierigkeiten bei der Spezifizierung einer eigenen Empfindung haben, bei der Arbeit gehetzt werden, unter Zeitdruck gesetzt werden |
|
I: Mhm |
|
|
IP01: Die Arbeiten. |
|
|
I: Mhm. Und, w' mmh, wie, wie war das für dich? |
|
|
IP01: Nicht fein. |
sich unwohl fühlen |
|
I: Aha, und warum nicht? // |
|
|
IP01: Weil ich das nicht mag, wenn man so hetzt und so. |
gehetzt werden als unangenehm erleben |
|
I: Aha. Und das ist hier besser? |
|
|
IP01: Mmh, viel [Wort wird betont] besser! [bestimmt] |
durch Werkstatt-Wechsel eine deutliche Verbesserung erleben |
Im Zuge des fokussierten Kodierens wurden analytisch besonders bedeutsame initiale Kodes für die Kategorisierung des Datenmaterials herangezogen. Fokussierte Kodes sind daher stärker gerichtet, selektiver und konzeptioneller als initiale Kodes. (Charmaz, 2006, S. 57) Die fokussierten Kodes wurden vor allem durch den Vergleich von Daten mit Daten entwickelt. Anschließend wurden die Daten mit diesen Kodes verglichen, um diese im Bedarfsfall besser anzupassen. (vgl. ebd., S. 60)
Tabelle 3 stellt das fokussierte Kodieren beispielhaft dar. Um einen Vergleich zum initialen Kodieren zu ermöglichen, erfolgt dies anhand desselben Interviewauszugs wie oben.
|
I: […] wie schaut so ein Arbeitstag von dir aus? // |
|
|
IP01: Ich hab Gaude [Anm. C.S. Spaß] mit allen, ah, alle sind nett |
es mit anderen lustig haben, soziales Arbeitsumfeld |
|
I: Mhm. |
|
|
IP01: und, / wir haben viel Spaß beim Mittagessen, / tun wir immer ein klein wenig blödeln miteinander und / haben noch eine Gaude und |
es mit anderen lustig haben, Gemeinschaft erleben |
|
I: Mhm. / Mhm. Und die Arbeiten? Machen dir die Spaß, oder? |
|
|
IP01: Ja, machen mir Spaß. |
Freude an der Arbeit haben |
|
[…] |
|
|
I: Mhm. / Mhm. / Und wie ist es mit den, mit den Betreuern da? |
|
|
IP01: Auch super. |
mit anderen gut auskommen |
|
I: Mhm. Mit allen, oder? |
|
|
IP01: Ja, mit allen. |
|
|
I: Aha. Hast du da schon irgendwann einmal irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht mit Betreuern, hier oder woanders? |
|
|
IP01: Schlechte Erfahrung? |
|
|
I: Ja. // |
|
|
IP01: In D(O), wo ich früher war, in D(O) war, hat es einen Chef gegeben, und den hab ich nicht so gerne mögen. |
mit anderen nicht gut auskommen |
|
I: Mhm, warum nicht? / |
|
|
IP01: Weiß nicht, der / hat immer s' so gehetztund gesagt: / „Schneller, komm, es muss fertigwerden." |
Schwierigkeiten haben, die richtigen Worte für etwas zu finden, gehetzt werden |
|
I: Mhm |
|
|
IP01: Die Arbeiten. |
|
|
I: Mhm. Und, w' mmh, wie, wie war das fürdich? |
|
|
IP01: Nicht fein. |
Arbeit negativ erleben, gehetzt werden |
|
I: Aha, und warum nicht? // |
|
|
IP01: Weil ich das nicht mag, wenn man sohetzt und so. |
gehetzt werden |
|
I: Aha. Und das ist hier besser? |
|
|
IP01: Mmh, viel [Wort wird betont] besser![bestimmt] |
Arbeitsstelle wechseln |
Charmaz (2006, S. 72) bezeichnet Memos als „informal analytic notes“, die den gesamten Forschungsprozess begleiten. Dabei schreibt der/die Forschende seine/ihre spontanen Gedanken und Ideen über das Datenmaterial sowie über die sich entwickelnden Kodes und Kategorien und deren Zusammenhänge untereinander in jeder ihm/ihr in den Sinn kommenden Form nieder. „We write our memos in informal, unofficial language for personal use.” (ebd., S. 80) Nach Charmaz (ebd., S. 72) hilft dieses Vorgehen dabei, kontinuierlich in die Analyse involviert zu bleiben und das Abstraktionsniveau der eigenen Ideen laufend zu steigern. Auf das Diplomarbeitsthema übertragen, geht es an dieser Stelle im Analyseprozess also darum, die interaktionellen Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen im Arbeitskontext und deren Zusammenhänge zu anderen Phänomenen zu explorieren.
Im Prozess des Memo-Schreibens füllt der/die Forschende die sich in ihrer Entwicklung befindlichen Kodes mit Inhalten und Bedeutungen und erhebt bestimmte fokussierte Kodes zu konzeptionellen Kategorien, die es in weiterer Folge zu analysieren gilt. „Categories explicate ideas, events, or processes in your data – and do so in telling words. A category may subsume common themes and patterns in several codes.” (Charmaz, 2006, S. 91)Auch Konopásek (2008, S. 13) betont, dass Memos nicht nur zur Festhaltung von Ideen dienlich sind, sondern dem/der ForscherIn vor allem die Möglichkeit und den Rahmen für die allmähliche Entwicklung analytischer Zusammenhänge bieten. Deshalb bezeichnet er „comments“ als „space in which sociological text is gradually born.” (ebd.) Im fortgeschrittenen Analyseprozess formen die angefertigten Memos den Kern der zu entwickelnden Grounded Theory. (Charmaz, 2006, S. 94)
Beispielhafte Darstellung eines Memos zur Verwendung von „man"
erstellt am: 11.08.2011 um 11:58:21 Uhr
überarbeitet am: 02.10.2011 um 18:54:32 Uhr
zugehöriger Kode: verwendet den Ausdruck „man“
Auffällig, dass mehrere InterviewpartnerInnen in vielen Zusammenhängen den Ausdruck „man" verwenden.
-
z.B. „Weil jetzt weiß man ein bisschen mehr, in welche Richtung ich einschlagen will [...]" (Transkript IP11_2, Zeile 237) → Wer ist mit „man" gemeint? Vermutlich die Unterstützer; die Aussage erhält durch den Ausdruck „man" so eine allgemeine Form und wird diffus; auch anonym: z.B.: „[…] dann hat man mich gekündigt" (Transkript IP12, Zeile 527) → kann sein, dass IP12 gar nicht weiß, wer die Kündigung veranlasst hat oder dass sie es nicht sagen möchte; Ähnliches gilt für das Bsp. „[...] und dort hat man immer wieder verlängert, und immer wieder verlängert." (Transkript IP11_3, Zeile 77)
-
In manchen Zusammenhängen wirkt der Ausdruck „man" wie etwas unverhinderlich Eingetretenes, z.B. „[…] da hat man mich nicht genommen." (Transkript IP12, Zeile 357; 373; 567; 571) → die Kündigung ist sozusagen vom Himmel gefallen, war unaufhaltbar, übermächtig;
-
„man" wird an manchen Stellen auch verknüpft mit einer passiven Rolle der IP verwendet, z.B. „[...] man hat de' der richtige Beruf nicht gefunden für mich." (Transkript IP12, Zeile 131),
„mit mir ist man halt einmal [gedehnt gesprochenes Wort] / nach / nach weit, nach D(O) hin'aus gegangen, da sind wir einmal auf einem Bauernhof gewesen [...]" (Transkript IP12, Zeile 197),
„IP12: Und hat man gesagt te' - also, es wäre ihnen lieber, wenn man eine / Ausbildung machen würde bei mir." (Transkript IP12, Zeile 583)
-
An manchen Stellen wird „man" verwendet, an denen es eigentlich „ich" oder „wir" heißen müsste, z.B.
„I: Und sechs Jahre warst du dann insgesamt schaffen [Anm. C.S. arbeiten]?
IP06: Ja, sechseinhalb Jahre.
I: Ja. Und was ist da dann passiert, dass das dann zu Ende gegangen ist?
IP06: Das weiß man eigentlich [unverst. etwa so] nicht genau. [...]"
(Transkript IP06_1, Zeile 111-117)
→in diesem Fall drückt die IP mit „man" evt. aus, dass nicht nur sie den Grund für einen Jobverlust nicht weiß, sondern dieser allgemein, also auch anderen (beispielsweise Personen, mit denen sie darüber gesprochen hat) unbekannt ist;
„IP11: Ja am Wochenende werkad i oft [unverst. etwa so] - / geht man manchmal ins Kino, o' mmh, man geht Pizza essen, man geht
I: Und wer ist man?
IP11: Oder wir. Halt wir, unsere Gruppe, oder [gedehntes Wort] /// [...]"
(Transkript IP11_2, Zeile 1189-1193)
→durch den Ausdruck „man" besteht in diesem Fall Zweifel daran, ob sich IP11 wirklich dieser „Freizeitgruppe“ zugehörig fühlt.
Um eine Präzisierung und bessere Anpassung der entwickelten Kategorien zu erreichen, soll nach Charmaz (2006, S. 96ff) so lange neues Datenmaterial erhoben werden bis die Kategorien gesättigt sind, das heißt, bis die Hinzuziehung weiterer Daten keine neuen Einsichten mehr mit sich bringt. (vgl. auch Strübing, 2008, S. 33f) Nach Strübing (ebd., S. 34; Hervorhebung im Original) ist bei der Analyse im Sinne der Grounded Theory „konzeptuelle Repräsentativität“ (im Gegensatz zu statistischer Repräsentativität) anzustreben. Damit bezeichnet er „die möglichst umfassende und hinreichend detaillierte Entwicklung der Eigenschaften von theoretischen Konzepten und Kategorien“ (ebd.).
Da die Autorin im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit mit bereits erhobenem Datenmaterial aus dem Forschungsprojekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ arbeitete, war ein Hin- und Herwechseln zwischen Datenerhebung und -analyse, wie Charmaz (2006) dies nahe legt, nicht möglich. (vgl. hierzu Kapitel 7.3)
Das Sortieren der analytischen Memos, die theoretische Integration der entwickelten Kategorien, sowie die Erstellung von Diagrammen stellen nach Charmaz (2006, S. 115ff) miteinander verwobene Prozesse innerhalb der Analyse dar, die dazu dienen, die Zusammenhänge zwischen den Kategorien klar herauszuarbeiten und die Verschriftlichung eines ersten Theorieentwurfs vorzubereiten.Charmaz betont, dass nicht notwendigerweise nur eine Hauptkategorie den Kern der Analyse bilden muss. (ebd., S. 120)
Am Ende des analytischen Prozesses steht der Theorieentwurf. Sein Ziel es ist, darzulegen, wie Bedeutungen, Aktionen und soziale Strukturen von der Zielgruppe konstruiert werden (vgl. Charmaz, 2006, S. 151) und dadurch die in Kapitel 6 ausgewiesene Forschungsfrage der Diplomarbeit zu beantworten.Einen wichtigen Schritt stellt in diesem Zusammenhang auch die Integration von Erkenntnissen aus der Literatur dar.
Um dem/der LeserIn der vorliegenden Arbeit die Verortung der Analyseergebnisse im Kontext der individuellen Lebensgeschichten der acht InterviewpartnerInnen zu ermöglichen, werden diese nachfolgend in zusammengefasster Form und unter Rückgriff auf Informationen aus den Interviews (siehe Tabelle 1) dargestellt.Zur Wahrung der Anonymität wird auf konkrete Alters- bzw. Zeitangaben sowie auf die Angabe von Orten, Arbeitsstellen, Institutionen etc. verzichtet. Weiters nimmt die Autorin bewusst Abstand von der Verwendung von Pseudonymen, um die vorgenommene Anonymisierung auf den ersten Blick unverkennbar zu machen.
IP01
IP01 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjährigen an. Sie wuchs zusammen mit ihren Geschwistern in einem Kinderheim unter der Obhut einer Ersatz-Mutter auf, die für sie bis heute eine sehr wichtige Bezugsperson darstellt. Ihre leiblichen Eltern sind bereits beide verstorben. Als Jugendliche zog IP01 in eine betreute Wohngemeinschaft für Mädchen und wohnte dort bis ins junge Erwachsenenalter. Danach zog sie in ein vollbetreutes Wohnheim, in dem sie nun seit über zehn Jahren lebt. Sie teilt sich eine Wohnung mit zwei Mitbewohnerinnen, wobei jede von ihnen ein eigenes Zimmer hat. Nach der Sonderschule arbeitete IP01 in verschiedenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Weil sie sich in einer davon nicht wohl fühlte, wechselte sie schließlich in eine Fachwerkstatt, in der sie bis zuletzt arbeitet. Ihr soziales Arbeitsumfeld nimmt IP01 dort sehr positiv wahr. Sie wurde von ihren Kolleginnen zur Werkstattsprecherin gewählt und erfüllt ihre Aufgaben als solche mit viel Freude. Auch mit ihren Arbeitstätigkeiten ist sie weitgehend zufrieden. In einer Arbeitsgruppe erledigt IP01 zusammen mit einigen KollegInnen Auftragsarbeiten für verschiedene Firmen. Dabei wechseln sie sich mit den Arbeiten ab. Ihre Freizeit verbringt IP01 gerne mit Stricken und Rätsel lösen. IP01 wünscht sich schon seit Längerem, irgendwann einmal in einer Firma am allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten, vor allem - wie sie sagt - um mehr Geld zu verdienen und einmal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Dass sie oft bei der Arbeit einschläft, hindere sie derzeit an der Realisierung dieses Wunsches.
IP06
IP06 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjährigen an. Sie wuchs gemeinsam mit ihren Geschwistern bei ihren Eltern auf und wohnt seit einigen Jahren in einer eigenen Wohnung. Ihre Mutter ist mittlerweile verstorben. IP06 besuchte eine Sonderschule und absolvierte anschließend eine zweijährige Haushaltsschule. Ursprünglich wollte sie gerne Krankenschwester werden, was aufgrund ihres langsamen Arbeitstempos aber nicht möglich gewesen sei. Nach ihrer Ausbildungszeit erhielt IP06 einen geschützten Arbeitsplatz bei einer Lebensmittelkette, bei der sie dann über mehrere Jahre hinweg in zwei verschiedenen Filialen arbeitete. Zu ihren Tätigkeiten gehörten das Einräumen der Regale und die Betreuung der Obstabteilung. Mit den MitarbeiterInnen und ihrer Vorgesetzten verstand sie sich gut. Krankheitsbedingt – insbesondere wegen der Verschlechterung ihres Geh- und Redevermögens – war IP06 laut eigener Aussage schließlich gezwungen, einige Wochen im Krankenhaus zu verbringen. Ihr Arbeitsverhältnis wurde damals aus Gründen, die ihr nicht genau bekannt sind, beendet. In der Hoffnung auf Besserung ihres Gesundheitszustands, und infolgedessen auf die Wiederaufnahme ihres Arbeitsverhältnisses, verbrachte IP06 eine Zeit lang zu Hause. Daraufhin begann sie, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu arbeiten, erst in der „Großgruppe“ und anschließend in der „Selbständigengruppe“. Seitdem verrichte sie täglich die gleichen Arbeiten (Bügeln und Heimarbeit). Sie sehnt sich nach ihrer ehemaligen Arbeitsstelle zurück und begründet dies damit, dass man im Lebensmittelmarkt mehr Leute kennen lerne. Weiters hebt sie hervor, dass sie ihre Tätigkeiten in der Werkstatt nicht als richtige Arbeit, sondern bloß als Beschäftigung erlebt. IP06 wünscht sich, aus der Werkstatt hinaus zu kommen und wieder arbeiten zu gehen. Da sie aber aufgrund ihrer Gehbeeinträchtigung – sie benötigt zur Fortbewegung zum Teil einen Rollstuhl – auf Unterstützung angewiesen ist, die mit organisatorischem und finanziellem Aufwand verknüpft ist, glaubt sie nicht an die Realisierbarkeit dieses Wunsches. Eine zusätzliche Belastung stellt für sie die Ungewissheit über die Ursachen ihrer Erkrankung dar, die man bisher noch nicht feststellen konnte. In ihrer Freizeit unternimmt IP06 viele verschiedene Dinge. So ist sie beispielsweise ein langjähriges Mitglied bei den Pfadfindern, trifft sich mit Bekannten regelmäßig zum Stammtisch oder nimmt an Freizeitveranstaltungen verschiedener Vereine teil.
IP10
IP10 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen an. Gemeinsam mit fünf älteren Geschwistern wuchs sie bei ihren Eltern auf, bei denen sie als einzige unter ihnen auch heute noch wohnt. IP10 besuchte einen integrativen Kindergarten und absolvierte die Volksschule in einer Integrationsklasse. Danach besuchte sie eine Hauptschule (unterrichtet nach Hauptschullehrplan), die sie mit guten Noten abschloss. Mit viel Ehrgeiz arbeitete sie auf ihr Ziel hin, einen Beruf zu ergreifen. Im Anschluss an ihre Schulzeit besuchte IP10 für zwei Jahre eine Berufsvorschule in einem Internat. Während dieser Zeit sammelte sie Schnuppererfahrungen in vier verschiedenen Berufen (Zimmermädchen, Köchin, Büroangestellte, Verkäuferin). Aussicht auf eine Arbeitsstelle hatte sie als Büroangestellte, sowie als Verkäuferin. Weil sie gerne in Kontakt mit anderen Leuten kommt und sich von den Arbeitsaufgaben mehr versprach, entschied sie sich schließlich für letzteren Beruf. Sie erhielt bei einer Lebensmittelkette eine Lehrstelle und ist dort seit einigen Jahren für 20 bis 30 Wochenstunden als Verkäuferin angestellt. Abwechselnd ist sie für die Molkereiund Getränkeabteilung, an der Wurst- und Käsetheke bzw. für die Brotabteilung zuständig. Zu ihren Aufgaben zählen das Einsortieren und Platzieren von Waren, das laufende Kontrollieren des Warenbestands, sowie die Kundenbedienung. Letzteres bereite ihr besonders viel Freude. Mit ihrem Chef kommt IP10 gut aus und fühlt sich von ihm sowohl bei der Arbeit als auch in privaten Belangen gut unterstützt. Zusätzlich erhält IP10 über eine Institution Unterstützung bei der Arbeit. Die ihr zugewiesene Unterstützungsperson besucht sie in regelmäßigen Abständen bei ihrer Arbeitsstelle, um mit ihr über eventuelle Anliegen oder Probleme zu sprechen. Schwierigkeiten erlebte IP10 einst mit einer ehemaligen Kollegin, von welcher sie bei der Arbeit oft unter Druck gesetzt wurde. Weiters empfindet sie es als unangenehm, von Kunden auf private Themen angesprochen zu werden, was ab und zu vorkomme. In ihrer Freizeit treibt IP10 leidenschaftlich gerne Sport. Sie nahm bereits erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil. Weiters geht sie gerne Wandern, Schwimmen und Radfahren oder trifft sich mit Freunden, wobei sie ein wenig bedauert, nicht viele Freunde zu haben. Zusätzlich hilft sie ihren Eltern gerne im Haushalt und in der Landwirtschaft, die sie besitzen. Für ihre Zukunft wünscht sich IP10 vor allem, dass sie mit ihrem Job so weitermachen kann wie bisher.
IP11
IP11 ist männlich und gehört der Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjährigen an. Er hat drei ältere Geschwister (eines davon ist bereits verstorben), mit denen er gemeinsam bei seinen Eltern aufwuchs. IP11 benützt zur Fortbewegung einen Elektrorollstuhl. Seit einigen Jahren wohnt er auf eigenen Wunsch in einem vollbetreuten Wohnheim. IP11 verbrachte fast fünfzehn Jahre in einem Sonderschulheim und bedauert dies im Nachhinein, weil er gerne mehr Kontakt mit „Nichtbehinderten“ gehabt hätte. Sein Wunsch wäre es gewesen, einen Beruf mit Bürotätigkeiten zu ergreifen, allerdings bevorzugten seine Eltern eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung als Alternative für ihn. IP11 habe sich damals darauf eingelassen, bereue diese Entscheidung aber rückblickend. Für zirka zwanzig Jahre arbeitete er in der immergleichen Arbeitsumgebung und fühlte sich darin vor allem deshalb nicht wohl, weil er das Gefühl hatte, der „Fitteste“ zu sein, nicht hineinzupassen und sich mit seinen Mitmenschen nicht angemessen austauschen zu können. Darüber hinaus empfand er das Ausmaß sowie die Art der Arbeiten, die er in der Werkstatt zu erledigen hatte, als seinen Fähigkeiten nicht entsprechend. In vielen Tätigkeiten, die man ihm auftrug, sah er keinen Sinn. Mit seinen BetreuerInnen in der Werkstatt kam er zum Teil gut, zum Teil weniger gut aus. Vor einigen Jahren setzte sich IP11 zum Ziel, eine berufliche Tätigkeit außerhalb der Werkstatt zu ergreifen. Im Zuge dessen stieg er in ein neues, von der Werkstatt aus organisiertes Projekt ein, das sich an Menschen mit Beeinträchtigungen richtet und ihnen Orientierung und Unterstützung bei der Vorbereitung auf einen zukünftigen Beruf bieten soll. Sein erstes Praktikum absolvierte IP11 in einem zur Werkstatt gehörigen Kunstgeschäft. Entgegen seiner Erwartung betraute man ihn dort allerdings hauptsächlich mit eintönigen Arbeitstätigkeiten. Ein weiteres Praktikum, das ihm sehr gut gefiel, machte IP11 bei einer Hochschulbibliothek. Seine Hauptaufgabe bestand dabei in der Katalogisierung von Büchern. Zu IP11s Bedauern stand jedoch von vornherein fest, dass der Praktikumsplatz nicht auf einen Arbeitsplatz hinauslaufen würde. Eine Weile später bewarb sich IP11 mit der Unterstützung seines Bezugsbetreuers bei einem Selbstvertreterverein, war aber letztendlich nicht unter den ausgewählten BewerberInnen. IP11 wechselte schließlich zu einer anderen, nicht direkt der Werkstatt zugehörigen Unterstützungsinstitution, die sich ebenfalls zum Ziel setzt, Menschen mit Beeinträchtigungen zu beruflicher Integration zu verhelfen. Auf diesem Weg kam er zu einem Praktikum in der Bau- und Verpackungsindustrie, in dessen Rahmen er Telefondienste, Botengänge sowie Arbeiten am Computer erledigte. Zusätzlich arbeitet er bis zuletzt an jeweils fixen Wochentagen in einem zur Werkstatt gehörigen Atelier. Mit der berufsbezogenen Unterstützung ist IP11 insgesamt nur bedingt zufrieden, weil daraus erwachsende Fortschritte seiner Meinung nach nur sehr langsam voran gehen. Vor einiger Zeit wechselte IP11 in eine andere Werkstatt, vor allem weil er das Gefühl hatte, in die dortige Gemeinschaft besser hineinzupassen. Allerdings habe er auch dort immer die gleichen Arbeiten zu erledigen und empfindet dies als eintönig. In der neuen Werkstatt wurde er bald zum Werkstattsprecher ernannt, eine Aufgabe, die er gerne annahm. Zusätzlich ist IP11 in der Selbstvertretung aktiv und Mitglied in einem Zeitungsredaktionsteam der Werkstatt. Seit Kurzem nimmt er außerdem an einem neuen Projekt der Werkstatt teil, das die Kombinierung von Arbeit und Werkstatt ermöglicht. Seitdem erledigt IP11 einerseits regelmäßig Botengänge für ein privates Dienstleistungsunternehmen, arbeitet andererseits für zwei Halbtage in der Woche für einen Servicebetrieb des Arbeitsmarkts und verbringt die übrige Zeit in der Werkstatt. Da die Räumlichkeiten des Servicebetriebsgebäudes nur bedingt barrierefrei zugänglich sind und zusätzlich Platzmangel herrscht, arbeitet IP11 nicht in einem herkömmlichen Büro, sondern stattdessen in einer Art „Durchzugsbereich“, was er als unangenehm empfindet. Sein Gehalt für die von ihm geleisteten Arbeitstätigkeiten bezieht IP11 über die Werkstatt. Sein Wunsch, aus der Werkstatt hinaus zu kommen ist damit zwar noch nicht vollständig erfüllt, doch er gibt sich mit der derzeitigen Lösung im Großen und Ganzen zufrieden. In seiner Freizeit trifft sich IP11 gerne mit Freunden, zum Beispiel um etwas trinken oder ins Kino zu gehen. Allerdings bedauert er, nicht viele gute Freunde zu haben.
IP12
IP12 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen an. Sie lebt derzeit bei ihren Eltern und hat eine Schwester, die bereits von zu Hause ausgezogen ist. IP12s frühe Kindheit war geprägt von Krankheit und damit verbundenen Spitalsaufenthalten. Sie besuchte eine Sonderschule, von der sie zwischenzeitlich aufgrund von Problemen mit Mitschülern, die sie hänselten, für einige Zeit freigestellt wurde. Da ein naher Verwandter eine Landwirtschaft besitzt, war es schon immer IP12s Wunsch, beruflich mit Tieren zu tun zu haben. Nach der Schulzeit verbrachte sie einige Zeit zu Hause. Schließlich wendete sie sich an eine Unterstützungsinstitution, zu der sie bereits zu Schulzeiten Kontakt geknüpft hatte und die ihr in weiterer Folge zu verschiedenen Praktika verhalf. So schnupperte sie etwa bei verschiedenen Bauernhöfen, sowie in der Küche eines Seniorenheims. Anschließend arbeitete sie für einige Jahre halbtags in einem Gastronomiebetrieb. Zu ihren Aufgaben gehörten die Zubereitung von verschiedenen Speisen und das Einsortieren von Waren. Nachdem ihre Vorgesetzte den Betrieb verließ, verlor IP12 bald ihre Arbeit. Nach einer mehrere Monate andauernden Arbeitspause nahm sie schließlich Kontakt mit ihrer Unterstützerin auf, um erneut nach Arbeit zu suchen. Im Zuge dessen schnupperte sie in verschiedenen Bekleidungsgeschäften sowie in einem Einzelhandelsbetrieb für Papierwaren, bei dem sie nach einer Probephase schließlich ein Jobangebot bekam. Dort arbeitet IP12 bis zuletzt und wünscht sich, dies auch zukünftig zu tun. Zu ihren Arbeitstätigkeiten zählen die Einsortierung von Waren sowie die Erledigung von Reinigungsarbeiten. Dass sie sich mit allen KollegInnen gut versteht, ist ihr dabei besonders wichtig. In ihrer Freizeit bastelt IP12 gerne, verbringt Zeit in der freien Natur und trifft sich mit FreundInnen.
IP21
IP21 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen an. Zusammen mit ihren beiden jüngeren Geschwistern wohnt sie derzeit bei ihren Eltern. Während der Schulzeit in einer Sonderschule erlebte IP21 häufig Konflikte mit Mitschülern. Ein besonders einschneidendes Erlebnis hatte sie, als sie einmal von Klassenkollegen aufgrund ihrer Beeinträchtigung schwer beschimpft wurde. Nach der Schule machte IP21 eine mehrere Jahre dauernde Berufsvorbereitung in einem Internat und absolvierte dort eine Anlehre als Gärtnerin. Vor allem zu Beginn dieser Zeit hatte sie oft Heimweh. Nach ihrer Ausbildungszeit verbrachte IP21 einige Monate zu Hause. Zusammen mit einer Arbeitsassistentin stellte sie Überlegungen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft an. Schließlich machte IP21 ein Praktikum in der Küche eines Seniorenheims. Erneut musste sie erleben, dass eine Kollegin negative Äußerungen bezogen auf ihre Beeinträchtigung tätigte. Sie zögerte nicht lange und meldete den Vorfall bei einer öffentlichen Stelle. Daraufhin erhielt die betreffende Kollegin eine Mahnung und ihr gemeinsamer Vorgesetzter setzte sich für IP21 ein. Nach ihrem Praktikum begann IP21 schließlich in einer Fachwerkstatt zu arbeiten. Nach einigen Jahren wurde ihr aber der lange Arbeitsweg zu viel, darüber hinaus empfand sie das Erledigen von Auftragsarbeiten für externe Firmen oft als stressig. Besonders aus dem zuerst genannten Grund entschied sie daher, in eine andere Werkstatt zu wechseln, in der sie sich nun auch wohler fühlt. Weil einige ihrer ehemaligen Werkstatt-KollegInnen diese Entscheidung fehlinterpretierten, geriet sie in Konflikt mit ihnen. Mit ihren derzeitigen KollegInnen komme IP21 zum Großteil gut aus. Allerdings falle ihr das Arbeiten in der Gruppe aufgrund der lauten Umgebung oft schwer. Über ein Projekt ihrer ehemaligen Werkstatt gelangte IP21 zu einem Langzeitpraktikum bei einem Unternehmen für Kommunikationstechnik, für das sie bis zuletzt arbeitet und bei dem für sie auch die Chance auf einen geschützten Arbeitsplatz besteht. Anfangs erledigte sie dort hauptsächlich Sortierarbeiten, nach einiger Zeit wurden ihre Arbeitstätigkeiten auch abwechslungsreicher und sie sammelte Erfahrungen in unterschiedlichen Abteilungen. Den Umgang mit den MitarbeiterInnen des Unternehmens, sowie den Job insgesamt erlebt sie als äußerst positiv. Im Leben von IP21 gab es immer wieder Zeiten, die sie als persönliche Krisen beschreibt, in denen sie besonders schlechte Laune hatte und in denen es ihr allgemein nicht gut ging. Wegen einer solchen Krise entschied sie sich etwa auch, ihr Langzeitpraktikum vorübergehend für einige Monate niederzulegen, um ihre Energie auf die Wiedererlangung persönlicher Stabilität fokussieren zu können. Für ihre Zukunft wünscht sich IP21, irgendwann einmal von der Werkstatt weg zu kommen. Ihr Hauptziel ist es, den in Aussicht stehenden geschützten Arbeitsplatz in dem bereits erwähnten Unternehmen für Kommunikationstechnik zu erhalten. Da dies für sie einen großen, mit eventuellen Umstellungen verbundenen Schritt darstellen würde, möchte sie sich ausreichend Zeit dafür nehmen. In ihrer Freizeit trifft sich IP21 gerne mit Freundinnen, insbesondere mit ihrer besten Freundin, die sie schon seit ihrer Kindheit kennt.
IP22
IP22 ist männlich, gehört der Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjährigen an und hat eine Schwester. Derzeit wohnt er unter der Woche in einem vollbetreuten Wohnheim und an den Wochenenden bei seiner Familie. IP22 besuchte eine Sonderschule und absolvierte im Anschluss daran eine mehrjährige Berufsvorbereitung in einem Internat. Während dieser Zeit litt er unter starkem Heimweh, was auch den Grund dafür darstellte, dass er nicht im Internat, sondern weiterhin bei seiner Familie wohnte. Im Berufsvorbereitungszentrum probierte er verschiedene Berufe aus, besonderen Gefallen fand er dabei an den Arbeiten in der Malerei, der Wäscherei und der Küche. Nach der Berufsvorbereitung sah sich IP22 gemeinsam mit seinen Eltern eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung an, fand Gefallen daran und fing schließlich dort zu arbeiten an. Seit über zehn Jahren ist er nun in der „Holzgruppe“ tätig und hat viel Freude an den Arbeiten, die er erledigt. Zu seinen Tätigkeiten gehören die Bearbeitung von Holz, beispielsweise das Schleifen, Schneiden, Sägen und Streichen. IP22 schätzt das Erleben von Gemeinschaft in seiner Gruppe sehr und zählt viele seiner Kollegen zu engen Freunden. IP22 hat bisher noch keine Erfahrungen am allgemeinen Arbeitsmarkt gemacht und auch noch niemals darüber nachgedacht, außerhalb der Werkstatt nach Arbeit zu suchen. Er fühlt sich in der Werkstatt sehr wohl und möchte dort bleiben. In seiner Freizeit treibt IP22 gerne Sport und macht Musik. Zurzeit musiziert er alleine, könnte sich aber gut vorstellen, in einer Band zu spielen. Darüber hinaus geht er gerne ins Kino oder in die Diskothek. Unter anderem nimmt er auch gerne an von der Werkstatt aus organisierten Freizeitaktivitäten teil oder unternimmt etwas mit Leuten aus seinem Wohnheim.
IP25
IP25 ist weiblich und gehört der Altersgruppe der Vierzig- bis Fünfzigjährigen an. Sie hat zwei Geschwister und lebt derzeit bei ihren Eltern. Sie besuchte eine Sonderschule, wurde aber laut ihrer Mutter in normalem Lehrplan-Tempo unterrichtet und erlebte daher in ihrer Schulzeit viel Überforderung. Mit dem Schulende brach der Kontakt zu den SchulkollegInnen abrupt ab, was IP25 bedauert. Nach der Schulzeit verbrachte sie einige Jahre zu Hause, half ihrer Mutter im Haushalt und unternahm viel mit der Familie. Anschließend sammelte sie Schnuppererfahrungen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Als Alternative bot sich die Absolvierung einer zweijährigen Haushaltsschule an. IP25 entschied sich für letztere Option. Nach Abschluss dieser Ausbildung verbrachte sie wieder einige Zeit zu Hause und half ihrer Mutter. Als sie schließlich den Wunsch nach Aktivität äußerte, nahm die Familie Kontakt mit einer Unterstützungsinstitution auf, die sich für die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Auf diesem Wege gelangte IP25 einmal pro Woche zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Bücherei. Ihre dortigen Arbeitstätigkeiten bestehen beispielsweise im Verleimen von Büchern, Stempeln, Falten und Aufgeben von Mahnungen etc. Zusätzlich erhielt IP25 – ebenfalls über die Unterstützung der oben angesprochenen Institution – vor einigen Jahren einen geschützten Arbeitsplatz als Halbzeit- Reinigungskraft in einem Seniorenheim, bei dem sie bereits zu früheren Zeiten unverbindlich geschnuppert hatte. Zu ihren Aufgaben gehören das Abstauben, Papier auffüllen, Zusammenkehren, das Beseitigen von Abfällen, Putzen von Bad und WC etc. Ihre Arbeit erledigt IP25 zumeist gemeinsam mit einer ihrer beiden Mentorinnen, wobei sie mit dem Arbeitstempo der einen gut mithalten kann, während die andere zu schnell für sie ist. Seit einiger Zeit hat IP25 einen neuen Unterstützer, der sie bei der Arbeit in regelmäßigen Abständen besucht und sich für sie einsetzt. In ihrer Freizeit ist IP25 sehr aktiv und genießt das Zusammensein mit anderen Menschen ganz besonders. So nimmt sie etwa an diversen Aktivitäten eines Freizeitzentrums teil, musiziert gerne mit ihrer Familie, fährt mit ihnen auf Urlaub und spielt Gesellschaftsspiele. Zusätzlich hat sie viel Freude am Radfahren und Reiten.
Bevor die Ergebnisse der Analyse des Interviewmaterials dargestellt werden, ist es der Autorin ein Anliegen, folgende Vorbemerkung zu machen.
Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel 8 sei der/die Leserin explizit darauf hingewiesen, dass die aus dem Datenmaterial entwickelten Kategorien und Kodes unweigerlich sowohl das widerspiegeln, was für die InterviewpartnerInnen von Bedeutung ist als auch das, was die interviewführende Person für relevant hält. Trotz der Anwendung möglichst narrativer Interviewstile und dem Verzicht auf einen vorformulierten Interviewleitfaden (vgl. O. Koenig, 2009) bleibt die Einflussnahme der interviewführenden Person auf den Verlauf der Interviews und die darin thematisierten Inhalte, etwa über das Ansprechen bestimmter Themenblöcke, das Stellen bestimmter Fragen bzw. das Nachfragen an bestimmten Stellen, prinzipiell unvermeidbar. Darüber hinaus fließt selbstverständlich die Perspektive der Autorin, welche die Analyse vornahm, in die Generierung der Kategorien und Kodes mit ein. Auch wenn sie stets um die Herausarbeitung dessen, was für die InterviewpartnerInnen von Bedeutung ist, bemüht war, ist dennoch nicht auszuschließen, dass die Analyse in Bereichen, die sie selbst – etwa aufgrund ihres Vorwissens / ihrer Vorerfahrungen – für die Beantwortung der Fragestellung für besonders wichtig hielt, differenzierter ausfällt und dementsprechend weniger differenziert an Stellen, die ihr weniger relevant erschienen. Es wäre daher unzulässig davon auszugehen, dass die präsentierten Analyseergebnisse ausschließlich in den Perspektiven der InterviewpartnerInnen gründen.
Bei der nun folgenden Ergebnisdarstellung bezeichnen Abschnittsüberschriften der dritten Ebene (X.X.X) Kategorien, Abschnittsüberschriften der vierten Ebene (X.X.X.X) Subkategorien und Abschnittsüberschriften der fünften Ebene (X.X.X.X.X) den jeweiligen Subkategorien zugeordnete fokussierte Kodes.
Die Kategorie „Soziales Arbeitsumfeld“ ist für die Beantwortung der Frage nach den interaktionellen Erfahrungen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext machen, von zentraler Relevanz. Darunter subsumiert werden alle Subkategorien bzw. Kodes, die sich auf das soziale Umfeld bei der Arbeit beziehen.
Wie sich im Zuge der Datenanalyse herausstellte, spielt der allgemeine zwischenmenschliche Umgang bei der Arbeit für die meisten InterviewpartnerInnen eine wesentliche Rolle für das Erleben von Arbeit. Dabei ist es aus Sicht der InterviewpartnerInnen in erster Linie wichtig, nett und freundlich zueinander zu sein. Darüber hinaus wird ein positiver Umgang oft damit in Zusammenhang gebracht, es mit anderen lustig zu haben.
I: Wie war es mit den Kollegen dort?
IP11: War eigentlich [hohe Stimme, unverst. etwa so], also es war so eine / eine sehr nette Atmosphäre find ich jetzt einfach mal [unverst. etwa so]. Also, es war irgendwie / lustig, war irgendwie /// (seufzt) also, es war irgendwie schon cool, also, wie soll ich sagen, es is' - war eine nette Atmosphäre für mich. [...]
(Transkript IP11_2, Zeile 167-169)
IP01: Ich hab Gaude [Anm. C.S. Spaß] mit allen, ah, alle sind nett [...] und, / wir haben viel Spaß beim Mittagessen, / tun wir immer ein klein wenig blödeln miteinander und / haben noch eine Gaude [...]
(Transkript IP01_1, Zeile 103-107)
IP01 hebt immer wieder hervor, auch mit den BetreuerInnen eine „Gaude" zu haben und Spaß machen zu können. Offensichtlich erlebt sie dies als etwas Besonderes, nicht Selbstverständliches. Miteinander „Gaude" zu haben könnte bedeuten, mit dem Gegenüber auf gleicher Ebene zu interagieren.
Bezogen auf BetreuerInnen erachten die InterviewpartnerInnen weiters einen „normalen Umgang" für wichtig. IP11 betont in diesem Zusammenhang, dass er keinen Grund sehe, warum sich der Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung anders gestalten sollte als mit anderen Menschen.
I: [...] Welche Aufgabe haben Betreuer aus deiner Sicht, oder wie sollen die mit dir umgehen? Was ist dir dabei wichtig?
IP11: /// Mit uns? Ganz einfach m'
I: Mh, mit dir. Mit dir.
IP11: Soll man normal umgehen. Also, ääh, ja, äh / äh
I: Blöde Frage.
IP11: Ja, halt irgendwie, pf (lacht) wie soll man mit mir umgehen? (lacht) ähh, ff.
I: Ok. (lacht)
I: Nein. War eine gute Antwort, [Vorname] (lacht).
IP11: Normal einfach.
I: Ja.
IP11: S' so wie Sie mit / den anderen Kollegen
I: Mhm.
IP11: Zum Beispiel.
I: Mhm.
IP11: wir sind ja eigentlich nicht anders.
I: Genau.
IP11: Nur haben wir eine Behinderung. [...]
(Transkript IP11_2, Zeile 1141-1173)
Einen normalen sozialen Umgang zu erfahren erscheint also eng damit verknüpft, sich als Mensch wertgeschätzt zu fühlen. IP21 machte dahingegen die Erfahrung, von einer Vorgesetzten nicht „normal“, sondern anders behandelt zu werden:
IP21: [...] Weil, / es war nämlich noch eine zweite Praktikantin oben, und zu der war sie allwei [Anm. C.S. immer] scheiß [Wort wird betont]- freundlich, sag ich jetzt einmal. [...] Und zu mir, und bei mir hat sie allwei [Anm. C.S. immer], hat sie allwei [Anm. C.S. immer] ihren Frust abgelassen.
(Transkript IP21_2, Zeile 539-543)
Eng in Zusammenhang mit dem zwischenmenschlichen Umgang bei der Arbeit steht die Beziehung zu bzw. das Auskommen mit anderen. In den Interviews ist an vielen Stellen davon die Rede, mit Personen aus dem Arbeitsumfeld gut bzw. weniger gut auszukommen.
IP21: Weil es sind einige Klienten da, / da passt es gut, […] und mit ein paar komme ich überhaupt nicht zusammen […]
(Transkript IP21_1, Zeile 619-623)
Im Folgenden gilt es darzustellen, welche Aspekte die InterviewpartnerInnen für gutes und weniger gutes Auskommen jeweils als ausschlaggebend betrachten.
Eine Person zu mögen ist für die InterviewpartnerInnen oftmals damit verknüpft, sie ganz allgemein als nett zu erleben, ohne dies weiter zu spezifizieren. (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 408, Transkript IP11_1, Zeile 1010, Transkript IP12, Zeile 483; 657) Wie schon in den Ausführungen zum Kode 9.3.1.1 („Zwischenmenschlicher Umgang bei der Arbeit") angesprochen, ist die Sympathie für andere besonders ausgeprägt, wenn sie als „lustige Menschen" erlebt werden, das heißt, wenn sie zum Herumscherzen bereit sind. Damit assoziiert sind ein ungezwungener, aufgeschlossener Umgang miteinander und das Gefühl, akzeptiert zu werden. Erneut scheint hierbei das Thema Normalität im Umgang miteinander eine wichtige Rolle zu spielen. Ein weiterer Aspekt, der dazu beiträgt, jemanden zu mögen besteht darin, miteinander über private Dinge reden zu können. Indem andere etwa Informationen aus ihrem Privatleben preisgeben, zeigen sie sich bereit, ihrem Gegenüber Intimität entgegen zu bringen und es an ihrem Leben teilhaben zu lassen.
Das folgende Zitat aus dem zweiten Interview mit IP25 bringt die beiden zuletzt genannten Aspekte des Kodes „Jemanden mögen“ sehr treffend zum Ausdruck.
I: [...] Und was, was, was, was schätzt du an dem Herrn K(Pm)?
IP25: Ja (lacht), er macht halt auch ein b' - ein Späßle [Anm. C.S. Verkleinerungsform von Spaß] hie und da. [...] Er vers', ääh, ja, wenn ich frage, >Glockengeräusch< äh, „Wie, wie geht es mit deiner Frau?", dann sagt er etwas.
(Transkript IP25_2, Zeile 1492-1502)
Wie die folgenden drei Zitate zeigen, schätzen die InterviewpartnerInnen andere Personen außerdem, wenn sie ihnen ihre Zeit bzw. Aufmerksamkeit widmen.
IP22: Dann, in der Freizeit bin ich mit dem, mit dem G(Pm) unterwegs.
I: Mh, wer ist das?
IP22: Das ist der Chef vom Wohnheim.
I: Mhm. //
IP22: Und // und >Hintergrundgeräusche, Tür fällt ins Schloss< und, und er fährt mit mir sogar mit dem Rad.
(Transkript IP22_2, Zeile 104-112)
I: Und was gibt es für Eigenschaften, die du schätzt an Betreuern?
IP11: Mein Bezugsbetreuer von der Werkstätte
I: Mhm. Und was schätzt du an ihm?
IP11: Dass er eigentlich sehr /// toll mit mir um’ umgeht und dass, dass, dass, / dass er eigentlich einige - dass er einiges mit mir macht und >Trinkgeräusche< halt auch / ja / oder viel mit mir überlegt, was // ich machen könnte oder so.
(Transkript IP11_1, Zeile 560-566)
IP11: […] Ja, halt, der [gedehntes Wort], derje', der Bruder, wo jetzt, wo verstorben ist, der ist - hat mir da [unverst. etwa so] - hat / am meisten mit mir gemacht.
I: Mhm.
IP11: Also, der, der (seufzt) ist mit mir ausgegangen, der ist mit mir [gedehntes Wort] /// zu Kollegen oder zu Freunden oder einfach f' // - er hat sich mit mir am meisten abgegeben einfach.
(Transkript IP11_2, Zeile 466-470)
Die drei Zitate legen nahe, dass es die InterviewpartnerInnen nicht als selbstverständlich ansehen, wenn andere sich mit ihnen „abgeben“, wie IP11 es formuliert. Offensichtlich bilden jene Menschen, die dies tun eine positive Ausnahme und werden daher gemocht.
Des Weiteren werden Personen, die man gern hat, vermisst, wenn sie einmal nicht anwesend sind.
IP01: […] der B(Pm), ein Betreuer von da.
I: Aha.
IP01: Aber der hat - Der ist jetzt nicht da, der hat Urlaub.
I: Aha.
IP01: Leider. Geht mir schon ab.
(Transkript IP01_1, Zeile 311-319)
Wenn die Interviewpersonen davon sprechen, andere Personen aus ihrem Arbeitsumfeld nicht zu mögen, führen sie dies meist entweder auf die persönliche Art der jeweiligen Person zurück oder auf das, was die jeweilige Person tut. So begründet etwa IP11 das mangelhafte Zurechtkommen mit bestimmten BetreuerInnen folgendermaßen:
IP11: Ich meine einfach die Art, was sie haben, so, so die, die, die – das mag ich nicht so. (Transkript IP11_1, Zeile 550)
Bei der Arbeit zu hetzen, (hinterrücks) schlecht über andere – insbesondere die IP – zu reden, Unwahrheiten zu verbreiten, sich in eine Gemeinschaft zu drängen, die IP verbal anzugreifen oder aggressiv zu reagieren stellen Beispiele für Verhaltensweisen dar, die von den InterviewpartnerInnen als unangenehm erlebt werden und in weiterer Folge dazu führen, jemanden nicht zu mögen. (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 63; 71-75; 147-163; Transkript IP21_1, Zeile 385; 623- 627; 785; 857; Transkript IP22_1, Zeile 592-610) Darüber hinaus können Kommunikationsschwierigkeiten bzw. Missverständnisse dazu führen, dass sich die Beziehung zu Personen aus dem Arbeitsumfeld zum Negativen wendet. (vgl. etwa Transkript IP21_1, Zeile 185-191) Ebenso wie das Mögen einer Person oft nicht näher erläutert wird, kommt es auch vor, dass die InterviewpartnerInnen nicht genau beschreiben können, warum sie jemanden nicht mögen. (vgl. etwa Transkript IP11_1, Zeile 524-554) Sympathie bzw. Antipathie sind als globale, emotional gefärbte Grundeinstellungen anderen Personen gegenüber anzusehen, die im Einzelfall nicht immer begründet werden können. Auf schlechtes Auskommen mit anderen reagieren die InterviewpartnerInnen unterschiedlich. Wut, Traurigkeit, Wechsel der Arbeitsstelle, aus dem Weg gehen sind in den Interviews angesprochene Beispiele dafür. (vgl. etwa IP01_1, Zeile 67; 77-79; Transkript IP21_1, Zeile 623-627; Transkript IP22_1, Zeile 592)
Wie die folgenden Zitate zeigen, bringt IP01 das gute Auskommen mit ihren KollegInnen damit in Zusammenhang, von diesen gemocht und gebraucht zuwerden. Die Freude im Umgang miteinander scheint in diesem Fall ein gegenseitiges Geben und Nehmen zu sein, was der Interviewpartnerin ein gutes Gefühl verschafft.
IP01: Also, we' / wenn ich jetzt da [Wort wird betont] bin, am Schaffen [Anm. C.S. Arbeiten], komme ich eigentlich mit allen super aus.
I: Mhm.
I: Mhm.
IP01: und mögen mich alle gerne und, ich bin auch Werkstatt Sprecherin und, wenn ich komme, alle: „[Vorname], [Vorname], [Vorname]!!" [energisch], jeder ruft mich und /
I: Mhm.
IP01: es ist schon ein super Gefühl, mol. [Anm. C.S. „einmal", könnte aber auch „schon" heißen]
(Transkript IP01_2, Zeile 227-237)
IP01: Also, / in A(O) gefällt es mir am besten.
I: Mhm.
IP01: Weil dort einfach alle / mich rufen und jeder will - hängt auf mir drauf und - viele machen alle eine Gaude [Anm. C.S. einen Spaß] mit mir und - macht mir Spaß.
(Transkript IP01_2, Zeile 387-391)
An einigen Stellen machen die InterviewpartnerInnen ein gutes Auskommen mit Personen aus dem Arbeitsumfeld daran fest, dass mit ihnen weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart Konflikte bzw. Probleme auftraten. Dies ist allgemeiner auch als positiver Aspekt von Arbeit zu werten.
I: Du, und mit den Kollegen?
IP21: Gibt es überhaupt keine Probleme, also es ist jeder [Wort wird betont] nett, also es gibt da gar nichts. [...] Es ist jeder nett, es schimpft keiner, / es hat keiner einen Frust, also, passt gut.
(Transkript IP21_2, Zeile 255-261)
I: [...] Und hat es jemals Probleme gegeben in der Arbeit?
IP12: Nein.
I: Mit Kunden oder mit der Arbeit, mit der Chefin?
IP12: Mit der Kunden [Wort wird betont] hat es noch nie Probleme gegeben bei mir
I: Mhm. Mhm, und mit der Chefin?
IP12: Mit der Chefin auch nicht.
I: Habt ihr euch gut verstanden?
IP12: Wir haben uns gut verstanden, doch.
(Transkript IP12, Zeile 465-479)
Aus den Erzählungen derjenigen InterviewpartnerInnen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, wird die besondere Relevanz der Gruppe als soziales Arbeitsumfeld deutlich. Dafür spricht auch die Einteilung in Arbeitsgruppen (z.B. Holzgruppe, Großgruppe, Selbständigengruppe), die in Werkstätten zumeist erfolgt.
Das Arbeitsumfeld „Gruppe" wird von den einzelnen InterviewpartnerInnen unterschiedlich erlebt. So bringt etwa IP22 wiederholt zum Ausdruck, wie wohl er sich in seiner Arbeitsgruppe fühlt und dass ihm die tagtäglich erlebte Gemeinschaft viel bedeutet. (Transkript IP22_1, Zeile 370; 388; 494; Transkript IP_2, Zeile 366: 370; 402; 418) Auch IP01 betont mehrfach, mit den Kollegen aus ihrer Gruppe eine „Gaude" zu haben. (Transkript IP01_1, Zeile 103; 107; 512; Transkript IP01_2, Zeile 293; 391) Dieses Miteinander scheint auch in ihrem Leben eine zentrale Rolle zu spielen. Die Gruppe als Arbeitsumfeld kann sich in mancher Hinsicht allerdings auch negativ auf einen Menschen auswirken. So spricht etwa IP21 davon, dass sie sich in der Gruppe oft nicht auf ihre Arbeit konzentrieren könne, weil sie von Kollegen und dem von ihnen verursachten Lärm abgelenkt werde. (Transkript IP21_1, Zeile 591; 595; Transkript IP21_2, Zeile 613; 625-629; 649) Sie müsse „die Gruppe gewöhnt bleiben" und komme nach einer längeren Auszeit von der Gruppe oft nicht damit zurecht. (Transkript IP21_2, Zeile 729; 737) Weiters kommen innerhalb von Gruppen dynamische interaktionelle Prozesse zum tragen. Dies kommt besonders deutlich in den Interviews mit IP21 zum Ausdruck. So wird etwa an vielen Stellen deutlich, welch wichtige Rolle soziale Anerkennung innerhalb der Arbeitsgruppe für die Forschungsteilnehmerin spielt. Sie hebt wiederholt hervor, dass sie die Gruppe dazu gebracht habe, ihr zuzuhören, wenn sie etwas zu sagen hat. (vgl. etwa Transkript IP21_1, Zeile 291- 303; 539-551; 635-639; Transkript IP21_2, Zeile 725) Macht und Status nehmen hierbei einen zentralen Stellenwert ein. In der Arbeitswelt der freien Wirtschaft scheint das Arbeiten in einer Gruppe – wenn man nach den Erzählungen der InterviewpartnerInnen geht – in dieser engen Form nicht praktiziert zu werden. Hier bietet sich eher eine Unterscheidung von „Arbeiten alleine erledigen" und „Arbeiten zusammen erledigen" an.
Zu den sozialen Erfahrungen im Arbeitsumfeld gehört unter anderem auch das Erleben zwischenmenschlicher Konflikte. Aus dem Datenmaterial wurden dabei die folgenden fokussierten Kodes entwickelt.
IP01 und IP10 machten beide in ihrem Leben die Erfahrung, bei der Arbeit von Kolleginnen „fertig gemacht“ zu werden. So erzählt IP01, dass ehemalige Kolleginnen sie ständig durch das, was sie – unter anderem über sie – herumerzählten „verrückt“ machten. (Transkript IP01_1, Zeile 63; 69-75) IP10 berichtet davon, dass sie von einer Kollegin zu Arbeitstätigkeiten gezwungen wurde, die sie sich selbst nicht zutraute. (Transkript IP10_1, Zeile 576-600; Transkript IP10_3, Zeile 308) Weiters drohte die Kollegin ihr, die sie betreuende Unterstützungsperson zu informieren, wenn sie ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß erledigt bzw. ihr bei der Arbeit Fehler unterlaufen. (Transkript IP10_1, Zeile 722- 744) In beiden Fällen fühlten sich die InterviewpartnerInnen von ihren Kolleginnen psychisch unter Druck gesetzt, in die Enge getrieben und empfanden die konfliktreiche Situation, mit der sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder konfrontiert waren, als ausweglos.
Was genau es bedeutet, von Personen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld blöd angeredet zu werden, lässt sich aus dem Datenmaterial nicht klar erschließen, da die Interviewpersonen, die von dieser Erfahrung berichten, nicht näher darauf eingehen. (Transkript IP01_1, Zeile 63; Transkript IP21_1, Zeile 631; 857) Der Kode „von anderen blöd angeredet werden“ zeichnet sich aber allgemein dadurch aus, dass andere das Wort direkt an die IP richten und dabei Aussagen tätigen, die sie sich aus der Sicht der IP besser gespart hätten.
Im Arbeitskontext von anderen beschimpft zu werden stellt gegenüber dem zuvor angeführten Kode eine Steigerung dar. Die IP erlebt dabei eine persönliche Beleidigung bzw. eine Abwertung durch andere. IP21 machte einst eine solche Erfahrung: ihr wurde während eines Praktikums von einer in der Hierarchie über ihr stehenden Kollegin vorgeworfen, „nicht gescheit arbeiten“ zu können und daher in eine „Behindertenwerkstätte“ zu gehören. (Transkript IP21_1, Zeile 385; Transkript IP21_2, Zeile 547) Die Interviewpartnerin erlebte dies als Beschimpfung (Transkript IP21_2, Zeile 517), die zu einer starken persönlichen Kränkung führte. Weiters betont sie an mehreren Stellen in den Interviews, dass dadurch die Grenze des für sie Ertragbaren klar übertreten wurde. (IP21_1, Zeile 389; 409, IP21_2, Zeile 547)
Die Verbreitung von „Lügengeschichten“ durch andere stellt ein weiteres konfliktreiches Erlebnis dar, mit dem die InterviewpartnerInnen bei der Arbeit oftmals konfrontiert sind. Die Unwahrheiten betreffen dabei entweder die Interviewperson selbst, d.h. sie wird vor anderen schlecht gemacht (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 71; Transkript IP21_1, Zeile 785; Transkript IP25_1, Zeile 1252), oder andere Personen. So erlebte etwa IP10, dass eine ehemalige Arbeitskollegin versuchte, sie gegen ihren Vorgesetzten aufzuhetzen, indem sie Dinge über ihn erzählte, die nicht stimmten. (Transkript IP10_1, Zeile 604-608)
Auch Missverständnisse können bei der Arbeit zu zwischenmenschlichen Problemen führen. So geriet etwa IP21 einst in Konflikt mit Arbeitskolleginnen, weil diese ihren Wunsch, die Arbeitsstelle zu verlassen, den sie schließlich auch in die Tat umsetzte, fehlinterpretierten.
IP21: Und / natürlich ist auch dann von meine Arbeitskolleginnen ist dann auch eine Rückmeldung gekommen, und die haben halt dann gesagt: „Nein [Wort wird betont], die [Vorname] geht jetzt weg, weil sie uns nicht mehr mag" und und und. Und dann habe ich [Wort wird betont] aber gesagt: „Nein! [Wort wird betont] Stimmt nicht! […]
I: Mhm. / Mhm. Und, i' habt ihr euch vorher gut verstanden gehabt?
IP21: Ja, schon,
I: Ja? Hast du Freunde gehabt dort?
IP21: schon. / Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann diese Entscheidung getroffen habe, dass ich nicht mehr / lang nach C(O) fahren will, ist eigentlich dann so gewesen, dass / dass teilweise / schon [Wort wird betont] gesagt worden ist, nein, ich mag sie einfach nicht mehr.
(Transkript IP21_1, Zeile 179-191)
Neben dem unmittelbaren Erleben von Konflikten, ist an einigen Stellen in den Interviews auch davon die Rede, Konflikte zwischen anderen mitzuerleben. Auch das kann als belastend erlebt werden und zieht, wie etwa die folgenden Zitate aus den Interviews mit IP21 und IP25 zeigen, nicht einfach spurlos an den InterviewpartnerInnen vorüber.
IP21: Weil es sind ein paar, die sind - es sind zwei in meiner Gruppe, die sind ziemlich empfindlich [betont] / und wenn man die [Wort wird betont] blöd anredet, dann kann es passieren, dass / der eine spinnt, und die andere, kann passieren, dass die zum rean [Anm. C.S. heulen, weinen] anfängt.
I: Mhm. /
IP21: Also es sind beide, / sage ich jetzt einmal, // sehr empfindlich. [betont]
I: Mhm. //
IP21: Und meistens, meistens krieg [Anm. C.S. bekomme] es ich [Wort wird betont] halt dann mit, weil ich [Wort wird betont] bin meistens dann in der Gruppe
I: Mhm.
IP21: und krieg [Anm. C.S. bekomme] die Diskussion dann mit [Wort wird betont] und dann / ist es meistens schwierig, dass ich dann etwas sage, aber meistens geht das, aber ab und zu ist es halt dann so, dass ich halt leider laut werde.
(Transkript IP21_1, Zeile 327-339)
IP25: Sie kommt mit dem - ääh mit dem - ääh, mit dem Chef nicht aus /
M[12]: Jaja.
IP25: Und mit J(Pw) nicht, weil sie //
M: Es ist der -
IP25: J(Pw) ist eine Ausländerin und
I: Okay.
IP25: und da kommt sie auch nicht gut aus.
I: Aber du hast damit kein Problem?
IP25: Nein.
I: Nein.
M: Die [Vorname] hat schon [Wort wird betont] ein Problem. Sie möchte, dass alle Leute miteinander gut sind.
I: Mhm.
IP25: Also mit J(Pw) ist es, / ist es
M: Und das ist für sie ein Problem,
I: Mhm.
M: wenn jemand über andere schimpft.
I: Mhm.
M: Dann nimmt sie Stellung / für die, die jetzt beschimpft [Wort wird betont] werden.
(Transkript IP25_1, Zeile 1078-1112)
IP10 und IP25 sprechen in den Interviews Probleme in der Zusammenarbeit mit Arbeitskolleginnen an. So erlebte IP10 etwa Schwierigkeiten, eine neu hinzugekommene Kollegin in die zu verrichtenden Arbeitstätigkeiten einzuweisen (Transkript IP10_3, Zeile 74-106; 122-130), während IP25 mit dem Arbeitsstil bzw. -tempo einer ihrer Kolleginnen nur schwer mithalten kann. (Transkript IP25_1, Zeile 1020-1036)
Die folgenden Kodes (9.3.1.4.8 bis 9.3.1.4.11) beziehen sich auf den Umgang mit erlebten Konflikten sowie auf ihre Konsequenzen.
Bei der Beurteilung eines Konflikts versuchen die InterviewpartnerInnen mitunter, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen und dessen Perspektive mitzuberücksichtigen, sowie Kontextinformationen aus dessen Leben miteinzubeziehen. Beispielhaft seien dafür zwei Zitate angeführt.
IP21: Weil am Tag vorher, / am Tag vorher haben sie ihr Kätzchen eingeschläfert, was ich ja verstehe [Wort wird betont], […] dass sie da nicht gut drauf [Anm. C.S. aufgelegt] ist […]
(Transkript iP21_1, Zeile 401-405)
M: die I(Pw) [betont].
I: Mhm.
M: Weil die einfach - Sie ist von Haus aus einfach [unverst. 1-2 Sek.] - eine - eine Frau, die selber nicht immer so ein einfaches Leben hatte.
IP25: Sie ist geschieden. Die I(Pw) ist geschieden. Zwei, aah
I: Mhm.
M: Mhm. / Jetzt erzähl! [freundlich auffordernd] Was die I(Pw) - Wie es mit der I(Pw) ist.
IP25: Zwei Kin', ah, ah
M: Fünf [Wort wird betont] Kinder hat sie.
IP25: Fünf Kinder hat sie gehabt.
I: (Ausdruck des Erstaunens) Mhm.
M: Mhm. //
IP25: Wenn sie, n' au' au' - wenn sie nicht / f', ah, wenn sie nicht o' f' folgt, d' [unverst. < 1 Sek], ähh
M: Das ist wieder das Problem, wie die I(Pw) aufgezogen worden ist.
IP25: Ja, [unverst. < 1 Sek]
M: Da musst du ein bisschen zuerst, ah, von der - ihr - I(Pw)s Leben, [Vorname], I(Pw) hatte
IP25: [unverst. ca. 1 Sek.] sie ist - ist
M: nie - hat - nie eine Mama gehabt, oder?
IP25: Nein. Das ist [unverst. Wort] F(O) [unverst. etwa so]
M: Ja.
IP25: u' und nach dem F(O) ist sie wieder hinauf
I: Mhm.
M: Aha. [zustimmend]
IP25: Dann //
M: Bei Pflegeeltern immer
IP25: Pflegeneltern
I: Mhm. // Das heißt, du, du ve' - Du kannst das ein bisschen verstehen, warum s', warum sie
M: Ja. [bestimmt]
IP25: (Zustimmender Laut)
[…]
IP25: Wenn sie nicht f' folgen [unverst. 1-2 Sek.] I(Pw)
M Ja.
IP25: ist sie, ah, ist sie eingesperrt, / Li' L' Licht abgeschalten, ist im
Dunkeln.
I: Mhm.
M: Ja. Die I(Pw) hat
IP25: Im Zimmer.
M: sehr ein schweres Leben hinter sich und, ah
I: Mhm.
M: und, ah, irgendwie, ich glaube, sie fühlt sich ganz schnell
benachteiligt oder irgendwie. / […]
(Transkript IP25_1, Zeile 1160-1248)
Nach aufgetretenen Konflikten wird von Dritten – in den Interviews ist in diesem Fall von BetreuerInnen oder Vorgesetzten die Rede – oft die Perspektive der InterviewpartnerInnen eingeholt. (vgl. etwa Transkript IP21_1, Zeile 437; 817; Transkript IP21_2, Zeile 571-575; Transkript IP10_1, Zeile 752-760) Dies steht in engem Zusammenhang mit ihnen entgegengebrachter Wertschätzung. Der Sichtweise der IP wird Interesse gewidmet, sie wird offensichtlich als wesentlich für den Nachvollzug eines Problems erachtet. Das bedeutet, Dritte sind auf das Wissen der IP um eine Sache angewiesen, weil sie etwa selbst nicht genügend Einblick darin haben.
Wie bereits erwähnt, erlebten sowohl IP10 als auch IP21 bei der Arbeit eine unfaire Behandlung durch andere. Das Bekanntwerden dieser zog in beiden Fällen für die jeweiligen Personen unangenehme Konsequenzen nach sich. Die Arbeitskollegin von IP10 wurde etwa gekündigt, während die Kollegin von IP21 eine ernst zu nehmende Abmahnung von übergeordneter Stelle erhielt, um ihren Job fürchten musste, dazu angehalten wurde, Distanz zu IP21 zu wahren und von der Belegschaft in weiterer Folge gemieden wurde. (vgl. Transkript IP10_3, Zeile 318; Transkript IP21_2, Zeile 527; 531; 535; 559-563; 687) Zu erleben, dass unfaires Verhalten anderer sanktioniert wird, ruft auf der Seite der InterviewpartnerInnen Genugtuung und/oder Erleichterung hervor. Zu wissen, dass sie beschützt werden, wenn sie von anderen schlecht behandelt werden, verschafft ihnen weiters das Gefühl von Sicherheit und Gerechtigkeit.
Insgesamt reagieren die InterviewpartnerInnen unterschiedlich auf zwischenmenschliche Konflikte bei der Arbeit. Manche drücken ihren Ärger offen aus und werden dabei laut und ungehalten, während sich andere eher zurückziehen, traurig sind und sich hilflos fühlen. Von den ForschungsteilnehmerInnen angewandte Strategien, um Konflikte in den Griff zu bekommen, bestehen etwa darin, sich an Vertrauenspersonen zu wenden oder zum Beispiel Geschichten zu erfinden, um sich selbst zu schützen. Für eine ausführlichere Darstellung sei der/die LeserIn auf die Kategorie 9.3.6 („Mit Wünschen bzw. Problemen umgehen“) verwiesen.
Mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen stellt für viele der InterviewpartnerInnen einen positiven und erstrebenswerten Aspekt von Arbeit dar. Vor allem wenn das Arbeitsumfeld einer Werkstatt mit dem eines Arbeitsplatzes am allgemeinen Arbeitsmarkt verglichen wird, scheint dieser Kategorie besondere Relevanz zuzukommen. So sprechen etwa IP01 und IP11 davon, dass Arbeit für sie bedeute, auch einmal andere Leute kennenzulernen. (Transkript IP01_1, Zeile 233-239; Transkript IP11_2, Zeile 1005-1009) IP06 sehnt sich nach ihrem ehemaligen Arbeitsplatz zurück, weil sie dort mehr in Kontakt mit Leuten gekommen sei als derzeit in der Werkstatt. (Transkript IP06_1, Zeile 387-401) IP11 vermisst im sozialen Umfeld der Werkstatt den Kontakt zu Seinesgleichen und den kommunikativen Austausch auf gleichem Level. (vgl. folgendes Zitat, sowie Transkript IP11_1, Zeile 422; Transkript IP11_2, Zeile 547; 801-819; Transkript IP11_3, Zeile 445-461)
IP11: […] Und zwar, waren am Anfang // also mehr / fittere Leute, also mit denen ich einfach irgendwie mehr / reden haben können oder eben konnte oder einfach nur // Pausen was machen konnte. Jetzt / s'
I: Und wo sind - Was ist mit denen dann geschehen?
IP11: Die sind jetzt irgendwie ein einem [gedehntes Wort] - ins A [Anm. C.S. Kunsthandel] oder haben einfach woanders hingewechselt, oder / sind nicht mehr dort.
I: Mhm.
IP11: Jetzt, zum Beispiel, sind einfach mehr // achtzig Prozent / Schwerstbehinderte.
I Mhm.
IP11: Und ich mitten darin.
I: Mhm.
IP11: Und ich fühl mich einfach nicht mehr wohl. [sehr bestimmt, jede einzelne Silbe betont]
I: Mhm.
IP11: Und ich [Wort wird betont] als eigentlich, wie soll ich sagen, Fitter,
I: Mhm.
IP11: fitter Mensch, / pass einfach nicht mehr in das Ding hinein, in das Schema hinein, finde ich.
(Transkript IP11_2, Zeile 751-775)
Dass er zusammen mit schwerer beeinträchtigen Menschen in einer Werkstatt „gelandet“ ist, führt IP11 vor allem darauf zurück, dass er in seinem Leben kaum die Möglichkeit hatte, mit „Nichtbehinderten“ in Kontakt zu kommen.
IP11: Äh, da, da hab ich eigentlich immer [Wort wird deutlich betont] nur mit Behinderten / zu tun gehabt.
I: Mhm. Und wie war das für dich?
IP11: Nichts [Wort wird betont] gegen Behinderte, aber i' // ääh, Kontakt zu außen, also Kontakt / zu Nicht- [betont] Behinderten / hat einfach wenig / wenig z' - stattgefunden, daher nie [Wort wird betont] mit Nichtbehinderten in den Kindergarten gehen und nie [Wort wird betont] mit Nichtbehinderten in die Schule gehen und nie [Wort wird betont] einen Beruf abkriegen [unverst. etwa so].
I: Mhm.
I: Mhm.
IP11: Also, bis jetzt.
I: Mhm. Mhm.
IP11: Und / das is, ah (seufzt leicht) was sehr ein Hä' - sehr großes Handicap für m' - für mich jetzt immer ist. […]
(Transkript IP11_2, Zeile 547-557)
IP11: Immer nur mit Behinderten, und das meine ich damit, ja. Das hat mich eigentlich gestresst. // Und ich bin der Meinung, da bin ich einf', einfach / voll der Überzeugung, wenn ich [betont] / am Anfang gleich Kindergarten und [betontes Wort] Schule immer normal / mit Nicht- Behinderten zusammen gewesen wäre, da hätte ich hundert prozentig, ich bin überzeugt, gan'
I: Mhm.
I: Ein ganz anderes soziales Netz.
IP11: Hätte ich sicher andere Kontakte.
(Transkript IP11_2, Zeile 1239-1245)
IP11 spricht davon, dass ihm der „Kontakt zu außen“ fehlt. Betrachtet man die Werkstatt im Lichte dieser Formulierung, so erscheint sie als nach außen hin abgeschlossene Einheit. Mit diesem „Außen“ bezieht sich IP11 offensichtlich auf die „normale Welt der Nichtbehinderten“, die ihm in seinem Leben großteils verborgen blieb und nun auch weiterhin bleibt.
Auch diejenigen InterviewpartnerInnen, die in ihrem Leben nie eine Werkstatt besucht haben, schätzen den Kontakt zu anderen Leuten bei der Arbeit. So gibt IP10 etwa an, unter verschiedenen Arbeitstätigkeiten jene vorzuziehen, bei denen sie die Kundschaft bedienen kann. (Transkript IP10_1, Zeile 486-502, Transkript IP10_2, Zeile 224-226) IP12 hebt das Kennenlernen vieler Leute als positiven Aspekt ihrer Arbeit in einem Gastronomiebetrieb hervor. (Transkript IP12, Zeile 429-435)
Ein Kode, der ebenfalls der Kategorie „mit anderen Leuten in Kontakt kommen“ zuzuordnen ist, ist „sich für andere und ihr Leben interessieren“. Viele Passagen in den Interviews mit IP25 wurden von der Autorin durch diesen Kode gekennzeichnet. Das In-Kontakt-Kommen mit anderen – nicht nur bei der Arbeit, sondern in allen Lebensbereichen – bereitet der InterviewpartnerIn Freude, weil sie sich für die Menschen und ihr Leben interessiert. Über alle drei mit ihr geführten Interviews hinweg fiel auf, dass sie sich viel mit dem persönlichen Lebenshintergrund von ihr bekannten Personen beschäftigt. Auch die folgenden Aussagen ihrer Mutter weisen auf den hohen Stellenwert hin, den IP25 sozialen Kontakten beimisst.
M: Die [Vorname] / (schnalzt mit der Zunge) ah / ist sehr glücklich, wenn sie / mit Menschen zu tun hat
I: Mhm.
M: Also, ich glaube Menschen bedeuten dir enorm viel. // Und ich glaube, dass das auch, ah, im Sozialzentrum, wenn einer oder der andere weniger // Interesse zeigt, aber der Großteil
I: Mhm.
M: zeigt Interesse, und geht auf die [Vorname] zu und sie geht auch auf die Leute zu.
I: Mhm.
M: Weil, das erlebe ich immer wieder, [...] / wie das irgendwie einfach, ja. Also, das will sie nicht auslassen, / weil da
IP25: Nein, das.
M: sind Menschen und da kann sie auch erzählen und da erzählt sie auch frei.
[…]
M: Also, ich erlebe immer / ah, das, ah, Begegnung mit Menschen.
I: Mhm. //
M: Das - und, äh, da ist sie auch, äh, sprachlich / so fließend und, äh, was sie da alles fragt [unverst. ca. 1 Sek.] [leiser werdend], das - / Oder Leute, die öfters zu uns kommen, wie sie da ins Gespräch / äh, hineinsteigt, also
[…]
M: Wenn wir irgendwo gehen, wo Menschen sind, äh, ja. Da entfernt sie sich auch von uns / und geht selber auf die Leute zu.
(Transkript IP25_2, Zeile 1012-1128)
Anhand dieser Zitate wird deutlich, wie wohltuend die Begegnung mit anderen auf einen Menschen wirken kann. IP25 blüht in derartigen Momenten auf, wird locker, kann sie selbst sein und erhält dafür von ihrer Umwelt positive Reaktionen.
Diese Subkategorie bezieht sich auf das Erleben eines oder mehrerer Wechsel von Personen aus dem sozialen Arbeitsumfeld, respektive von BetreuerInnen, UnterstützerInnen, Vorgesetzten und/oder KollegInnen. Ein solcher Wechsel ist für die InterviewpartnerInnen in jedem Fall mit Umstellungen verbunden und kann darüber hinaus auch weitreichende Konsequenzen für ihre Beschäftigungsbiographie nach sich ziehen. So führte der Wechsel eines/r Vorgesetzten bei IP12 und IP25 etwa zum Verlust der Arbeitsstelle. (Transkript IP12, Zeile 525-527; Transkript IP25_1, Zeile 598) Wie bereits unter 9.3.1.5 („Mit anderen Leuten in Kontakt kommen“) erwähnt, erlebte IP11 einen Wandel der Zusammensetzung seines KollegInnenkreises. Ehemalige KollegInnen, mit denen er „sozial etwas anfangen“ konnte, wechselten die Werkstatt-Gruppe oder zu einer anderen Arbeitsstelle. So kam es, dass er sich irgendwann in einer Gruppe von Menschen wieder fand, die er im Vergleich zu sich selbst als viel schwerer beeinträchtigt beschreibt. Auch IP10, IP12 und IP25 erlebten bei der Arbeit öfters den Wechsel von MitarbeiterInnen. IP10 macht dies im dritten mit ihr geführten Interview auch explizit zum Thema. Wie das folgende Zitat zeigt, bringt sie den häufig erlebten Personalwechsel unter anderem mit ihrer Beeinträchtigung in Zusammenhang.
IP10: Ja halt, das war, das war früher, das Personal hat immer gewechselt und ich habe immer, / immer gedacht, dass wahrscheinlich kommt das nur wegen dem Down Syndrom,
I: Mhm.
IP10: also von meinem Herzfehler. Und das Personal, das hat halt auch immer verändert und // ja, war schon eine kleine, / schwierige Situation, ah, mmh, äh, ich hab eine gehabt, die, ääh, ist von H(O) gekommen, das weiß ich noch, von K(O), und die hat mich fast jeden Tag nur noch fertig gemacht und hat mich gezwungen, zur Kasse zu gehen.
I: Mhm.
I: Mhm.
IP10: Das, das weiß ich noch.
I: Mhm.
IP10: Und, da ist der, ähm, hat es der Chef nicht gemerkt, und irgendwann / habe ich gedacht, so, jetzt muss die Wahrheit raus, und habe ich zum Chef gesagt, und der Chef hat sie dann gefeuert und -
I: Mhm.
IP10: Sie ist dann selber dann gegangen. / Und dann hat das Personal wieder gewechselt, dann ist wieder eine gekommen, mit der, wo ich w' wieder nicht gut klar gekommen bin, dann wieder [Wort wird betont] und, dann hat das Personal wieder gewechselt. / Ääh, mit, mit, also mit der ehemaligen Mitarbeiterin, wo ich [Wort wird betont] zusammen gearbeitet habe, hat jetzt ein Baby bekommen,
I: Mhm.
[…]
IP10: Und, / ja, jetzt hat das Personal wieder gewechselt, und, jetzt ist ein Lehrling gekommen, […] Und, und zwei von H(O) […]
(Transkript IP10_3, Zeile 304-334)
Aus ihrer Sicht führt das mangelhafte Auskommen zwischen ihr und dem Personal dazu, dass andere den Arbeitsplatz wieder verlassen. Wie sie selbst sagt, stellt dieser ständige Wechsel für sie – und vermutlich auch für andere – eine schwierige Situation dar. Weiters spricht IP10 auch andere Umstände des Personalwechsels an, wie etwa die Schwangerschaft einer Kollegin oder das Hinzukommen neuer Auszubildenden bzw. KollegInnen. IP10 wünscht sich, „dass wir im, im C [Anm. C.S. Lebensmittelhandel] alle, alle zusammen / bleiben“ (Transkript IP10_3, Zeile 472), eine Aussage, der zu entnehmen ist, dass sie sich nach Stabilität in Bezug auf die personelle Zusammensetzung an ihrem Arbeitsplatz sehnt.
Es ist anzunehmen, dass die meisten der InterviewpartnerInnen während ihrer beruflichen Laufbahn den Wechsel von Betreuungs- bzw. Unterstützungspersonal erleben - etwa auch bedingt durch den Wechsel der Arbeitsstelle. Explizit angesprochen wurde ein solcher Wechsel in den Interviews mit IP10, IP11 und IP25.
Die folgenden Kategorien (9.3.2 bis 9.3.5) beziehen sich nicht primär auf interaktionelle Erfahrungen im Arbeitskontext und stehen daher nicht im Mittelpunkt der Analyse. Für die Beantwortung der Forschungsfrage sind sie aber dennoch nicht unerheblich, da auch sie Aspekte beinhalten, die wesentlich zum Erleben von beruflicher Teilhabe beitragen. Aus diesem Grund werden sie im Folgenden in ihren Grundzügen dargestellt.
Neben der eben behandelten Kategorie „soziales Arbeitsumfeld“ bezieht sich diese Kategorie auf die umweltbezogene bzw. räumlich-gegenständliche Arbeitsumgebung der ForschungsteilnehmerInnen.
IP21 arbeitet für einen „riesen Betrieb“ (Transkript IP21_2, Zeile 159), weiß über die hohe Anzahl an MitarbeiterInnen, die er umfasst, Bescheid und betont, dass er viele Filialen hat. (ebd., Zeile 137-159) Offensichtlich erfüllt es sie mit Stolz, ein Teil eines so großen Unternehmens zu sein. Es scheint ihr das Gefühl zu geben, an etwas Wichtigem mitzuwirken. IP11 arbeitet in einem Betrieb, dessen Räumlichkeiten nur bedingt barrierefrei zugänglich sind und muss deshalb mit dem Korridor als „Arbeitsplatz“ Vorlieb nehmen. Weiters, so erzählt er, habe man eigentlich keinen Platz für ihn. (Transkript IP11_3, Zeile 691) Man weiß also sozusagen nicht, wo man IP11 „hintun“ soll. Dieser Eindruck auf der Seite des Interviewpartners lässt darauf schließen, dass er sich im Betrieb nicht nur räumlich, sondern auch menschlich und tätigkeitsspezifisch nicht optimal verortet fühlt. Die derzeitige Lösung bezüglich seiner unmittelbaren Arbeitsumgebung empfindet IP11 als unangenehm – wörtlich spricht er davon, dass es ihn stresst –, gibt aber an, sich mittlerweile damit abgefunden zu haben.
Im nachfolgenden Abschnitt wird auf die Arbeitsumgebung „Werkstatt“ Bezug genommen. Von den acht für die Analyse ausgewählten InterviewpartnerInnen arbeiten zu den Zeitpunkten der Interviewführung fünf Personen (IP01, IP06, IP11, IP21, IP22) in einer Werkstatt. Zwei der übrigen ForschungsteilnehmerInnen (IP10 und IP12) haben zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben in einer Werkstätte gearbeitet, IP25 entschied sich laut Angabe ihrer Mutter nach einer Schnuppererfahrung selbst gegen diese Option. Die InterviewpartnerInnen IP01, IP11, IP21 und IP22 kamen in mehr oder weniger direktem Anschluss an die Schulzeit in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Im Fall von IP11 geschah dies auf den Wunsch der Eltern hin. Auch IP06 gelangte nach anfänglicher Berufstätigkeit unfreiwillig, nämlich infolge der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes in die Arbeitsumgebung „Werkstatt“. IP21 und IP22 trafen die Entscheidung für eine Werkstatt ihren Aussagen nach in Übereinkunft mit Bezugs- bzw. Unterstützungspersonen. IP06, IP11 und IP22 verbrachten bzw. verbringen in ihrem Leben (bereits) über zehn Jahre in der gleichen Werkstatt. IP11 spricht davon, diese immergleiche Arbeitsumgebung satt zu haben (Transkript IP11_2, Zeile 739), während IP22 sich im Gegensatz dazu gar nichts anderes vorstellen kann und sehr glücklich in seiner Arbeitsumgebung ist. (Transkript IP22_1, Zeile 344-346; 632-662; 760-762; Transkript IP22_2, Zeile 418) Der Wunsch, aus der Werkstätte auszutreten hängt bei den InterviewpartnerInnen IP01, IP06, IP11 und IP21 mit dem Wunsch nach „richtiger“ Arbeit (vgl. etwa Transkript IP06_1, Zeile 411-421; Transkript IP06_2, Zeile 383-385) bzw. nach persönlicher Unabhängigkeit (vgl. etwa Transkript IP11_3, Zeile 971-975) zusammen. (vgl. hierzu auch Abschnitt 9.3.3 und 9.3.4)
Der Wechsel der Arbeitsumgebung wird an dieser Stelle behandelt, hätte aber ebenso der Kategorie 9.3.1 („Soziales Arbeitsumfeld“) zugeordnet werden können, da sich damit gleichzeitig die örtliche Umgebung und das soziale Umfeld ändern. An dieser Stelle sei daher auch erwähnt, dass die Arbeitsumgebung im Sinne eines umweltbezogenen Kontextes und das soziale Arbeitsumfeld im Sinne eines sozialen Kontextes Hand in Hand gehen und keine klar voneinander abtrennbaren Aspekte von Arbeit darstellen. Sich bei der Arbeit wohl zu fühlen hängt immer sowohl mit den umweltbezogenen bzw. räumlich-gegenständlichen Gegebenheiten als auch mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, zusammen. Ein Wechsel der Arbeitsumgebung kann entweder freiwillig oder unfreiwillig, etwa durch Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Auslaufen der Praktikumszeit oder anderen von außen auferlegten Umständen, erfolgen. Für einen freiwilligen Wechsel lassen sich in den Interviews mehrere Gründe ausmachen. So kann etwa das „Flüchten“ vor Personen, mit denen man nicht gut auskommt, denen man aber nicht aus dem Weg gehen kann, dafür ausschlaggebend sein. (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 63-67; 147-151; 452-456) Weiters stellen die erlebte Eintönigkeit der aktuellen Arbeitsumgebung (vgl. Transkript IP11_2, Zeile 725- 739) bzw. der zu erledigenden Arbeitstätigkeiten (vgl. Transkript IP11_1, Zeile 610; Transkript IP11_3, Zeile 471-481) und ein langer und beschwerlicher Arbeitsweg (vgl. Transkript IP21_1, Zeile 67-75; 149-167) von den InterviewpartnerInnen genannte Beweggründe für einen Arbeitsplatzwechsel dar. IP10, IP12 und IP22 sind mit ihrer aktuellen Arbeitsumgebung / ihrem aktuellen sozialen Arbeitsumfeld insgesamt glücklich und können sich daher keinen Wechsel der Arbeitsstelle vorstellen. (Transkript IP10_1, Zeile 854-864; Transkript IP10_3, Zeile 164-170; 472; Transkript IP12, Zeile 917-921; Transkript IP22_2, Zeile 418)
Für das Erleben von Teilhabe am Arbeitsleben spielen neben den interaktionellen Erfahrungen auch die Inhalte von Arbeit eine wesentliche Rolle.
Diese Kategorie bezieht sich auf die erlebte Freude bzw. den erlebten Spaß an den zu erledigenden Arbeitstätigkeiten. Die InterviewpartnerInnen berichten, Freude an der Arbeit zu haben, wenn die Tätigkeiten, die sie erledigen, ihren persönlichen Interessen entsprechen. IP11 umschreibt dies sehr treffend, indem er über eine Tätigkeit (die Katalogisierung von Büchern), bei der das zutrifft sagt: „Das war wiederum Meines.“ (Transkript IP11_1, Zeile 638) Weitere Beispiele für Arbeitstätigkeiten, welche von den ForschungsteilnehmerInnen als zu ihnen passend charakterisiert werden, sind wie folgt: IP11 hat Spaß an kreativen Arbeitstätigkeiten (Transkript IP11_1, Zeile 458- 462; Transkript IP11_3, Zeile 1317-1321), IP22 interessiert sich besonders für das Arbeiten mit Holz (Transkript IP22_1, Zeile 350), IP25 erledigt gerne Reinigungsarbeiten im Haushalt (Transkript IP25_2, Zeile 444-450) und IP10 erlebt besondere Freude an der Bedienung von KundInnen. (Transkript IP10_1, Zeile 184; 486-502)
Ein weiterer bestimmender Faktor für das Erleben von Freude bei der Arbeit besteht darin, sich kompetent für das zu fühlen, was man tut. Beispielsweise hat IP21 großen Spaß an der Erledigung von Sortierarbeiten, weil sie das Gefühl hat, darin besonders gut zu sein. (Transkript IP21_1, Zeile 687-725; Transkript IP21_2, Zeile 169-175) Umgekehrt vermeidet etwa IP10 die Erledigung von Arbeitstätigkeiten, bei denen sie befürchtet, sich nicht auszukennen, wie zum Beispiel die im Beruf einer Büroangestellten anfallenden Tätigkeiten oder das Kassieren im Lebensmittelmarkt. (Transkript IP10_1, Zeile 238-242; 588-600) Ähnliches zeigt sich auch im Interview mit IP01, die davon spricht, nicht gerne an der Nähmaschine zu arbeiten, weil sie sich damit schwer tue. (Transkript IP01_1, Zeile 291-307) Um Freude an den Arbeitstätigkeiten erleben zu können, sollten diese an das Fähigkeitsniveau der Arbeitenden angepasst sein, sodass sie sich bei deren Erledigung weder über- noch unterfordert, sondern stattdessen gefordert fühlen. Eine derart individuelle Abstimmung ist allerdings – insbesondere in Arbeitsgruppen – sicherlich nicht immer einfach umzusetzen. Dem Datenmaterial ist zum Beispiel zu entnehmen, dass die Erledigung von Auftragsarbeiten mit Deadline von IP11 als positiv und fordernd, von IP21 allerdings eher als negativ und anstrengend erlebt wird. (Transkript IP11_1, Zeile 462; Transkript IP21_1, Zeile 129-133) IP01 liefert weiters ein Beispiel für Arbeitstätigkeiten, die mit körperlichen Unannehmlichkeiten, nämlich in ihrem speziellen Fall mit Blasen an den Händen, verbunden sind und die ihr deshalb keine Freude bereiten.
In Bezug auf die Arbeitsinhalte ist es wichtig zu differenzieren, ob die ForschungsteilnehmerInnen diese als sinnvoll erleben oder nicht. IP11 äußert in den Interviews etwa das Gefühl, Aufgaben oft nur zwecks Beschäftigung aufgetragen zu bekommen.
IP11: […] was ich [Wort wird betont] das Gefühl habe, wenn jemand einmal sagt, ich soll was am PC machen, dass man wirklich so sagt // was eigentlich im Moment gerade sinnlos [Wort wird betont] ist, dass ich so Sachen mache, obwohl das nicht wirklich notwendig ist, dass ich etwas mache.
I: Also die Aufgaben, die sie dir geben sind
IP11: Die Aufgaben, äh, hab ich das Gefühl, es ist einfach nicht irgendwie - grad dass ich etwas zu tun hab also mmh
I: Also Beschäftigung.
IP11: Ja. [unzufrieden-trauriger Unterton]
(Transkript IP11_1, Zeile 502-510)
Auch IP06 erlebt die Tätigkeiten, die sie in der Werkstätte ausführt, verglichen mit ihren damaligen Arbeitstätigkeiten im Lebensmittelhandel nicht als „richtige Arbeit“ (Transkript IP06_1, Zeile 413-417), sondern eher als Beschäftigung.
I: Mhm. / Du, [Vorname], was ist denn, was ist denn anders an deiner Arbeit früher und der Arbeit in der Werkstatt?
IP06: (seufzt leise) Ja, dass es halt für mich da nicht so richtige A' Schaffen [Anm. C.S. Arbeiten] ist, sondern halt nur Beschäftigung.
(Transkript IP06_2, Zeile 383-385)
Der Eindruck, eigentlich nichts Sinnvolles zu erledigen, ist vermutlich mit Frustration verknüpft und kann dazu führen, sich nutzlos zu fühlen. Im Gegensatz zu den gebrachten Beispielen, entnimmt IP22 seiner Arbeit innerhalb der Werkstatt wiederum sehr viel Sinn. Gemeinsam mit seinen KollegInnen fertigt er Produkte aus Holz an, unter anderem auch auf Aufträge externer Firmen hin. Diese Tätigkeit gibt ihm das gute Gefühl, etwas Neues zu schaffen, auf das man gemeinsam stolz sein kann.
IP22: Und da haben wir auch einen riesen Erfolg gemacht.
I: Mhm. / Und was für einen riesen Erfolg?
IP22: Die Zugspiele,
I: Mhm.
IP22: dann die / den Sessel / aus Holz. /// Ja so, lauter so // das, was da aus der Produktion, ah, // gemacht [geflüstert], gemacht worden ist.
(Transkript IP22_1, Zeile 354-362)
Die von den InterviewpartnerInnen erledigten Arbeiten lassen sich weiters klassifizieren in eintönig vs. abwechslungsreich. IP06 und IP25 berichtet etwa, in ihrem Arbeitsalltag jeden Tag das Gleiche zu tun. (Transkript IP06_1, Zeile 347- 359; Transkript IP25_1, Zeile 654-666) Auch IP21 und IP11 erzählen, im Rahmen eines Praktikums eine längere Zeitspanne mit der Erledigung immergleicher Tätigkeiten verbracht zu haben. IP21 verrichtete eine Woche lang die gleiche Sortierarbeit (Transkript IP21_1, Zeile 479-481), während IP11 monatelang Papiertüten bemalte. (Transkript IP11_1, Zeile 610) Wie leicht nachzuvollziehen ist, erledigen die ForschungsteilnehmerInnen bevorzugt vielfältige Arbeitstätigkeiten mit Abwechslung. (vgl. etwa das folgende Zitat, sowie Transkript IP11_3, Zeile 471-473)
IP21: […] also / ich [Wort wird betont] mag es gerne abwechslungsreich, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich jetzt / einen ganzen Tag das Gleiche mache, […] also immer [Wort wird betont] das Gleiche. […] Es geht zwar einmal eine Zeit lang, aber geht nicht, die gan' - die ganze Zeit geht das nicht.
(Transkript IP21_1, Zeile 725-733)
Ähnlich stellt IP12 als positiven Aspekt ihrer derzeitigen Arbeitsstelle im Vergleich zu einer ehemaligen fest, hier „mehr tun“ zu können. (Transkript IP12, Zeile 673) Wie sich in den Interviews mit IP01, IP10 und IP21 zeigt, kann erlebte Abwechslung bei der Arbeit durch eine durchdachte Arbeitsaufteilung unter den KollegInnen, die laufend rotiert wird (IP01_1, Zeile 127-131), durch den regelmäßigen Wechsel des Aufgaben- bzw. Zuständigkeitsbereiches (Transkript IP10_3, Zeile 40-46; 60-70) sowie über das Durchlaufen verschiedener Firmenabteilungen (Transkript IP21_1, Zeile 481) herbeigeführt werden. In jedem einzelnen Fall bewerten die InterviewteilnehmerInnen dies als positiv.
Die InterviewpartnerInnen berichten unter anderem von Arbeitsinhalten, die mit der Übernahme von Verantwortung verbunden sind, bei denen es etwa besonders wichtig ist, keine Fehler zu machen und/oder bei denen sie einen Beitrag zum Treffen wichtiger Entscheidungen leisten. (vgl. etwa Transkript IP10_1, Zeile 430- 482; Transkript IP11_3, Zeile 587; Transkript IP12, Zeile 689; Transkript IP21_2, Zeile 649)
Das folgende Zitat zeigt, dass IP21 durch die Erledigung einer verantwortungsvollen Tätigkeit ihre eigene Position innerhalb der Werkstatt definiert. Sie erkennt die Wichtigkeit ihrer Aufgabe und fühlt sich dadurch dem koordinierenden Team zugehörig.
IP21: (atmet tief ein) Dann mache ich die Wocheneinnahmen, die mache ich nämlich jetzt auch jede Woche, weil wir wollen ja wissen, was wir in der Woche einarbeiten.
(Transkript IP21_1, Zeile 579)
Auch die Aufgaben als WerkstattsprecherIn, wie beispielsweise die Interessen der ArbeitskollegInnen zu vertreten, bei Problemen für sie da zu sein, als Kommunikationsschnittstelle zwischen KollegInnen und BetreuerInnen zu fungieren etc. (vgl. Transkript IP01_2, Zeile 255-281; Transkript IP11_3, Zeile 535) sind den Arbeitsinhalten mit Verantwortung zuzurechnen. IP01 gibt an, dass sie diese Rolle mit Stolz erfülle und ihr ein gutes Gefühl verschaffe. (Transkript IP01_2, Zeile 233-237; 283-297)
Ein wichtiger Aspekt von Arbeit besteht für die InterviewpartnerInnen auch darin, immer wieder etwas Neues dazu zu lernen. (vgl. etwa Transkript IP11_2, Zeile 349; 1009; Transkript IP22_2, Zeile 380-382) Dies steht in engem Zusammenhang mit dem erlebten Abwechslungsreichtum der zu erledigenden Arbeit. (siehe Abschnitt 9.3.3.3) Etwas Neues zu lernen kann allerdings auch mit Mühe verbunden sein und Überwindung erfordern, wie etwa dem zweiten Interview mit IP11 zu entnehmen ist. (Transkript IP11_2, Zeile 349-379)
Die ForschungsteilnehmerInnen berichten öfters, Hilfsarbeiten zu erledigen, bei denen sie anderen Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld zuarbeiten bzw. Aufgaben auszuführen, die andere für sie vorbereitet haben. (vgl. etwa Transkript IP06_2, Zeile 59; Transkript IP21_1, Zeile 425; 583; Transkript IP25_1, Zeile 502- 530; 760-770; Transkript IP11_2, Zeile 63-71; Transkript IP11_3, Zeile 743-757; Transkript IP21_2, Zeile 725) Die erlebte Selbständigkeit bei ebendiesen Tätigkeiten ist vermutlich gering. Sie können daher jenen Arbeitsinhalten, die an die Übernahme von Verantwortung geknüpft sind (siehe Abschnitt 9.3.3.4), entgegengesetzt werden.
Das Ausmaß an Arbeit, dem sich die InterviewpartnerInnen gegenübersehen, stellt für das Erleben von Arbeit und für die erlebte Teilhabe an Arbeit ebenfalls einen wesentlichen Aspekt dar. In den Interviews wird an einigen Stellen ein „zu Wenig“ an Arbeit beklagt. So erzählt etwa IP11, dass er in der Werkstatt, in der er einst tätig war, regelrecht um Arbeitstätigkeiten betteln musste. (Transkript IP11_1, Zeile 518) Er hatte das Gefühl, gemessen an seinem Fähigkeitsniveau zu wenig Arbeit zugewiesen zu bekommen. (ebd., Zeile 474-482) Schließlich wechselte IP11 die Werkstätte unter anderem deshalb, weil er sich woanders mehr Arbeit erhoffte. (Transkript IP11_3, Zeile 465) Ein weiterer Punkt, der sich auf das „von außen“ festgestellte Arbeitsausmaß bezieht, besteht darin, dass der Erhalt eines Jobs für Menschen mit Beeinträchtigung – den Interviews mit IP11 und IP21 nach zu schließen – oft davon abhängig gemacht wird, ob vorab ein ausreichendes Ausmaß an Aufgaben für sie definiert werden kann.
I: […] Hast du dort eine Anstellung bekommen?
IP11: Nein, eben nicht.
[…]
I: Weil?
IP11: Weil [gedehntes Wort] // die Tätigkeiten, was ich machen kann, die haben sie auf Dauer nicht.
(Transkript IP11_2, Zeile 137-151)
IP21: (holt Luft) Mah, es ist, / Die Personalchefin hat gesagt, sie überlegt sich jetzt einmal ein Konzept mit den Arbeiten, die was ich machen könnte [Wort wird betont]. […] Und es besteht die Chance, eventuell irgendwann einmal, auf einen geschützten Arbeitsplatz.
(Transkript IP21_1, Zeile 507-511)
Oftmals wird von den InterviewpartnerInnen betont, viel Arbeit zu haben bzw. vielbeschäftigt zu sein. (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 31; Transkript IP11_3, Zeile 205-213; 599-603; Transkript IP12, Zeile 503; Transkript IP22_1, Zeile 186-188; 234-238; Transkript IP25_1, Zeile 532-534; 778-782) Beides scheint einem Menschen, der heutzutage in unserer westlichen Gesellschaft lebt, Sicherheit und Stabilität und vor allem das Gefühl von Normalität zu geben. Ein „zu Viel“ an Arbeit wird von den ForschungsteilnehmerInnen wiederum als unangenehm erlebt und mit Stress bzw. Überforderung in Zusammenhang gebracht. (vgl. etwa Transkript IP11_3, Zeile 437; 599-601; Transkript IP21_1, Zeile 121-133; Transkript IP25_2, Zeile 192-212)
Aus dem Datenmaterial wurden unter anderem Kodes entwickelt, die sich auf die Art und Weise, nach der die InterviewpartnerInnen ihre Arbeit verrichten, beziehen.
Ein besonders relevanter Punkt dürfte hierbei das Arbeitstempo sein, das von mehreren ForschungsteilnehmerInnen wiederholt angesprochen wurde. An einigen Stellen ist davon die Rede, das von außen auferlegte Arbeitstempo als unangenehm zu empfinden. So fühlte sich etwa IP01 von ihrem ehemaligen Vorgesetzten bei der Arbeit gehetzt (Transkript IP01_1, Zeile 147-163), IP21 empfand das zügige Erledigen von Auftragsarbeiten bei ihrer ehemaligen Arbeitsstelle als stressig (Transkript IP21_1, Zeile 121-125) und IP25 erlebt es als große Belastung, mit der Arbeitsgeschwindigkeit einer ihrer KollegInnen nicht mithalten zu können (Transkript IP25_1, Zeile 1020-1056). Darüber hinaus musste sich IP06 damit abfinden, dass ihr Wunschberuf (Krankenschwester) aufgrund ihres langsamen Arbeitstempos für sie unerreichbar blieb. (Transkript IP06_2, Zeile 83-99) Einige der InterviewpartnerInnen geben an, für ihre Arbeit länger zu brauchen als manch anderer und wünschen sich, dass darauf Rücksicht genommen wird.
IP06: Weil ich kann doch nicht so schnell schaffen [Anm. C.S. arbeiten] als wie ein normaler Mensch. (Transkript IP06_2, Zeile 175)
IP11: Na, ich brauche für die Arbeiten, was ich mache, immer ein bisschen länger, […] (Transkript IP11_3, Zeile 761)
M: […] Der Mensch kann nicht alles so schnell, […] und wenn er noch so lang da ist. (Transkript IP25_2, Zeile 296-300)
IP21: Weil ich hab ihnen auch schon gesagt, sie müssen auch / darauf Rücksicht nehmen, dass ich [Wort wird betont] einfach / meine Zeit brauche, / fertig. (Transkript IP21_1, Zeile 615)
IP06: […] und ich bin in der - in sechs Jahren [unverst. etwa so] über viel Verständnis für solche Leute hat, wo ein bisschen lang' – länger sind. [unverst. ca. 1 Sek.] Ich meine, mir ist es ja gleich. /
(Transkript IP06_2, Zeile 103)
Konzentriertes und kontinuierliches Arbeiten erwiesen sich ebenfalls als für die InterviewpartnerInnen relevante Aspekte in Bezug auf ihre Arbeitsweise. So betont etwa IP12, meistens ohne Pause durchzuarbeiten (Transkript IP12, Zeile 507-523; 715-721), IP01 und IP21 sehen es als wichtig an, bei der Arbeit „dran zu bleiben“ (Transkript IP01_2, Zeile 301; Transkript IP21_1, Zeile 555-563). Wie bereits in Abschnitt 9.3.1.3 erwähnt, möchte sich IP21 bei der Arbeit konzentrieren können und nicht durch die sie umgebenden Personen abgelenkt werden.
Die InterviewpartnerInnen erleben es als positiv, wenn andere ihnen für ihre Arbeitsweise Anerkennung aussprechen bzw. sie selbst das Gefühl haben, gute Arbeit zu leisten. (vgl. etwa Transkript IP01_1, Zeile 331-343; Transkript IP11_3, Zeile 77; Transkript IP12, Zeile 635-639; Transkript IP21_1, Zeile 687; 701-721; Transkript IP21_2, Zeile 227-253; Transkript IP25_1, Zeile 986-994)
Wie sich bei der Analyse des Datenmaterials zeigte, machen die ForschungsteilnehmerInnen im Arbeitskontext viele interaktionelle Erfahrungen im Zuge des Umgangs mit Wünschen und/oder Problemen. Dabei nehmen sie eine mehr oder weniger aktive bzw. passive Rolle ein.
Unter der Einnahme einer aktiven Rolle im Umgang mit Wünschen und/oder Problemen versteht die Autorin, Initiative zu ergreifen, mitzureden und sich für eine Sache, die einem persönlich wichtig ist, einzusetzen.
In den Interviews, insbesondere mit IP21, ist an einigen Stellen davon die Rede, dass die ForschungsteilnehmerInnen vor anderen Personen aus ihrem Arbeitsumfeld klar ausdrücken, was für sie Sache ist. Dazu gehört etwa, klar zu kommunizieren, was einen stört, was man möchte, wie man sich gerade fühlt, oder auch, dem Gegenüber unmissverständlich zu verstehen zu geben, dass man über eine Angelegenheit (im Moment) nicht reden möchte. Zur Veranschaulichung werden nun einige Passagen aus den Interviews zitiert, die durch den Kode „sich klar ausdrücken“ integriert wurden.
IP21: Ich habe auch dann noch einmal mit ihr[13] geredet, habe auch noch einmal gesagt, habe auch noch einmal gesagt, wenn sie /// (zieht Nase auf) - habe auch ganz klar noch einmal gesagt, was [Wort wird betont] mich jetzt so gestört hat. […]
(Transkript IP21_2, Zeile 567)
IP21: /// Das erste Mal, wo ich so richtig gesagt habe, ich will nicht mehr nach C(O) fahren, das war / da habe ich zuerst gerade zwei Wochen Urlaub gehabt, und dann bin ich vom Urlaub zurück gekommen, und dann war so ein Stress [Wort wird betont], / gleich am ersten / Arbeitstag schon, und dann habe ich gesagt, nein [Wort wird betont], ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr // und dann sind dann eigentlich, meine Eltern sind dann auch hinaus gekommen […], / dann haben wir ein Gespräch gehabt, und bei dem Gespräch ist eigentlich dann auch noch einmal ganz deutlich heraus gekommen, dass / dass ich das eigentlich überhaupt nicht mehr will, dass ich so weit fahren muss. […] Und ich habe das auch mehrere Male ganz klar gesagt, //
(Transkript IP21_1, Zeile 167-171)
IP21: (zieht Nase auf) / Und da hat man einfach auch gemerkt jetzt / - es geht mir einfach nicht gut, und ich habe es auch immer wieder gesagt. […]
(Transkript IP21_2, Zeile 273)
IP21: Wobei ich [Wort wird betont] ja normal nicht der Typ dazu bin, dass ich meinen Frust auf andere a' äh auslasse. / (zieht Nase auf) Und, das habe ich dann ah / ein paar Mal bekräftigt, dass ich das eigentlich gar nicht will.
(Transkript IP21_1, Zeile 77)
IP21: Dann bin ich nämlich ganz schön ausgezuckt [Anm. C.S. ausgerastet], da, da hat sie[14] sogar ein' - da hat sie mich dann angeredet, was jetzt war [Wort wird betont], aber dann habe ich gesagt: „Nein, jetzt lässt du mich einmal bitte fünf Minuten, weil jetzt, jetzt mag ich gerade nicht reden." […] Und wenn ich [Wort wird betont] sage, ich mag jetzt einmal gerade nicht reden, dann, dann wissen sie es eh schon, was dann geschlagen hat. […]
(Transkript IP21_1, Zeile 817- 821)
IP10: Und, ün' über das Thema möchte ich halt, halt nicht so gerne reden [Wort wird betont] mit den Kunden. […] Und dann, ah, sage ich auch „Über das Thema möchte ich nicht reden und, wenn es mir lieb wäre, ruft ihn[15] bitte selber an."
(Transkript IP10_1, Zeile 538-568)
Sich vor anderen klar auszudrücken bzw. anderen etwas klar zu kommunizieren ist eng damit verbunden, dem Gegenüber persönliche Stärke und den Willen sich durchzusetzen zu beweisen und damit eine Basis dafür zu schaffen, von diesem Gegenüber in weiterer Folge ernst genommen zu werden. In den Interviews mit IP21 wird an mehreren Stellen deutlich, dass Stärke und Durchsetzungswillen als positive Aspekte in ihr Selbstbild eingehen.
Die Äußerung eines Wunsches wird von der Autorin - im Gegensatz zur bloßen Hegung eines solchen - als wichtiger, dem Setzen von Handlungen vorausgehender Schritt angesehen und daher dem Einnehmen einer aktiven Rolle im Umgang mit Wünschen zugeordnet. Der Grad an Aktivität kann höher eingestuft werden, wenn die InterviewpartnerInnen aus eigener Initiative heraus ihre Wünsche äußern, als wenn sie dies erst tun, nachdem sie - etwa im Zuge von Unterstützungsgesprächen - danach gefragt werden.
Ein Problem vor anderen laut auszusprechen und zu thematisieren bedeutet aus der Sicht der Autorin, mutig zu sein, zu dem, was einen stört, zu stehen und sich für diesbezügliche Änderungen aktiv einzusetzen. Dieser Kode findet beispielsweise in den Interviews mit IP21 Anwendung: sie meldet einen für sie problematischen Vorfall bei einer öffentlichen Stelle und macht diesen Vorfall damit zu einem Thema, mit dem sich nun auch andere auseinandersetzen müssen. Auch im Kontext von Unterstützungsgesprächen – d.h. unter der expliziten Zuwendung von Aufmerksamkeit durch Unterstützungspersonen – sprechen die InterviewpartnerInnen aus eigener Initiative Probleme an. (vgl. etwa Transkript IP11_3, Zeile 793-797; 1345)
Sich mit Wünschen bzw. Problemen an jemanden zu wenden erfordert in erster Linie Vertrauen zum Gegenüber. Die InterviewpartnerInnen führen zumeist Personen aus ihrem engeren Familienkreis und aus dem unmittelbaren Betreuungsumfeld bei der Arbeit als ihre Ansprechpersonen für arbeitsbezogene Wünsche oder Probleme an. (vgl. Transkript IP11_2, Zeile 1261-1267; Transkript IP01_1, Zeile 193-195; 357-371; Transkript IP01_2, Zeile 393-409; 507-517; Transkript IP06_1, Zeile 743-45; Transkript IP10_1, Zeile 618-620; 798-808; Transkript IP10_3, Zeile 318; Transkript IP21_1, Zeile 173-175; 199; Transkript IP22_1, Zeile 92-110; 124- 126; Transkript IP25_1, Zeile 1216-1230) IP01 sieht es als zentralen Bestandteil von Betreuung an, jemanden zum Reden zu haben und wichtige Angelegenheiten besprechen zu können. (Transkript IP01_2, Zeile 473-487) Der Kode „sich an jemanden wenden“ ist auch bezogen auf das Initiativwerden bei der Suche nach Arbeit, etwa durch die Kontaktierung von Unterstützungspersonal. (vgl. folgendes Zitat, sowie Transkript IP25_1, Zeile 256-270; 354-366)
IP12: Und dann hab ich es aber nicht mehr ausgehalten, hab ich mit der A(Pw) telefoniert, wenn ich wieder (holt Luft) eine Arbeit will.
(Transkript IP12, Zeile 531)
Eine besonders aktive Form des Umgangs mit Problemen stellt die Einleitung von gegensteuernden Maßnahmen dar. Beispielsweise stellte der lange Arbeitsweg für IP21 ein Problem dar, woraufhin sie eine andere Werkstatt besichtigte, um eventuell dorthin zu wechseln. (Transkript IP21_1, Zeile 75) IP01 wiederum versucht durch zeitigeres Schlafengehen ihrer Müdigkeit bei der Arbeit entgegenzuwirken und sich dadurch für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. (Transkript IP01_1, Zeile 175-191) In beiden Fällen ergreifen die Interviewpartnerinnen selbst Maßnahmen zur Problemlösung. Ebensolche können aber auch durch Dritte eingeleitet werden, was durch die folgenden Interviewauszüge demonstriert werden soll.
IP21: Und dann war aber der Punkt für mich [Wort wird betont] der Punkt erreicht [Wort wird betont], wo ich gesagt habe: Schluss [Wort wird betont], Schluss und das melde ich jetzt auf der Gemeinde, weil / unser Bürgermeister hat damals schon gesagt, wenn [Wort wird betont] etwas ist, / ich sollte mich bitte rühren, weil dann können sie nämlich etwas machen, weil dann können sie mit ihr[16] reden. [Wort wird betont]
(Transkript IP21_1, Zeile 389)
I: Na, was ist die Aufgabe von einem Werkstätten-Sprecher?
[…]
IP01: Und // probieren, die Probleme zum lösen und // wenn es nötig ist auch / mit den Betreuern // zum reden und sagen, was los ist und
I: Mhm. Das heißt, du redest auch mit Betreuern, wenn es Probleme gibt dann
IP01: Ja.
I: bei anderen? / Und [gedehntes Wort], wie reagieren die dann? Hören die dir z' - die Betreuer?
IP01: Dann / schauen sie, dass es vielleicht zum Gespräch gibt, dass es dann / gut ausgeht alles und
[…]
(Transkript IP01_2, Zeile 255-281)
Wie leicht nachvollziehbar ist, steht die Einleitung von Maßnahmen zur Problemlösung über andere Personen oder Instanzen in enger Verbindung mit den zuvor besprochenen Kodes „ein Problem zum Thema machen“ und „sich an jemanden wenden“. Zentral ist dabei immer das Aktivwerden der ForschungsteilnehmerInnen durch das Setzen von Handlungen. Dieser Kernaspekt kommt im folgenden Zitat besonders deutlich zum Ausdruck.
IP21: […] Weil ich bin dann Mittag heim gegangen, bin heim gegangen, wollte nämlich baden gehen, und ich habe mir gedacht, nein, jetzt gehe ich eigentlich gleich heim und regel das auf der Gemeinde, weil dann, / weil dann hat die nämlich einen ordentlichen Dings. / Kriegt [Anm. C.S. bekommt] die einen ordentlichen Zammputzer [Anm. C.S. Rüge] und so war das dann auch. […] Na, und das war auch - der Schritt war auch richtig, weil sonst, / weil sonst, wenn ich es nämlich nicht gemeldet hätte, / wäre vielleicht noch einmal etwas gewesen, und noch einmal, und dann [… ] wäre es erst recht – […]
(Transkript IP21_2, Zeile 527- 555)
Die Autorin definiert „sich zur Wehr setzen“ als eine Reaktion der ForschungsteilnehmerInnen auf erlebtes Unrecht, etwa in der Interaktion mit anderen Personen aus dem Arbeitskontext. Der Umgang mit Problemen kann hierbei als konfrontativ bezeichnet werden und zielt vor allem darauf ab, sich selbst zu schützen. Viele Beispiele für diesen Kode liefern die Interviews mit IP21 (vgl. etwa Transkript IP21_1, Zeile 795; Transkript IP21_2, Zeile 521), die auch mehrfach betont, sich nicht alles gefallen zu lassen. (vgl. etwa Transkript IP21_1, Zeile 263-279; 853- 857; Transkript IP21_2, Zeile 325-329; 521)
Mit dem Kode „einer Sache nachgehen“ meint die Autorin, Angelegenheiten (insbesondere Wünsche), die von persönlicher Wichtigkeit sind, aktiv zu verfolgen, an ihnen „dran zu bleiben“ und diesbezüglich nicht locker zu lassen.
Ein treffendes Beispiel dafür liefert IP11, der in Bezug auf ein ihm wichtiges Anliegen meint:
„Da will ich ein bisschen hart sein. [unverst. etwa so] […] Und das werde ich auch weitergeben und weitertun und weitermachen, bis es klappt.“
(Transkript IP11_3, Zeile 1363; 1435)
Auch auf IP21, die angibt, gezielt auf den Erhalt eines geschützten Arbeitsplatzes hinzuarbeiten (vgl. Transkript IP21_2, Zeile 745-753), und auf IP01, die angibt, ihrem Wunsch nach Arbeit außerhalb der Werkstätte immer wieder aufs Neue Ausdruck zu verleihen und zeigen zu wollen, was in ihr steckt (vgl. etwa Transkript IP01_2, Zeile 75; 157-159; 163), sei an dieser Stelle verwiesen.
Für das Treffen von Entscheidungen gilt als Voraussetzung, aus subjektiver Sicht die Wahl zwischen mindestens zwei Alternativen zu haben. Entscheidungen bezogen auf die eigene berufliche Biographie zu treffen, bedeutet zum einen, Risiken einzugehen, abzuwägen und mit Ungewissheit konfrontiert zu sein, zum anderen aber auch, eigenständig handeln und die Verantwortung für sich selbst und das eigene Leben zu übernehmen. IP10 und IP12 bot sich etwa die Wahl zwischen verschiedenen Berufssparten bzw. Arbeitsplätzen. Beide Interviewpartnerinnen entschieden sich für eine Alternative. (Transkript IP10_1, Zeile 36; 232-246; 386-390; Transkript IP10_2, Zeile 142; Transkript IP12, Zeile 587-615; 643-653) Außerdem entschied sich IP12 aus persönlichen Überzeugungen gegen einen potentiellen Praktikumsplatz. (Transkript IP12, Zeile 249-261) Die Mutter von IP25 betont, dass sie ihre Tochter zum gegebenen Zeitpunkt selbst entscheiden ließ, welchen Ausbildungs- bzw. beruflichen Weg sie in Anknüpfung an die Schulzeit einschlagen möchte. (Transkript IP25_1, Zeile 44-58)IP21 entschied sich, die Werkstätte, in der sie arbeitete, zu wechseln. (Transkript IP21_1, Zeile 79-83; 203-223; Transkript IP21_2, Zeile 703-707) In den Interviews zeigt sich in allen genannten Fällen, dass die Möglichkeit zum Treffen derart zentraler Entscheidungen und der Prozess der Entscheidungsfindung für die ForschungsteilnehmerInnen eine wichtige Rolle spielt und von ihnen dementsprechend ausführlich und häufig, d.h. über verschiedene Interviewzeitpunkte hinweg, thematisiert wird.
Die Einnahme einer passiven Rolle im Umgang mit Wünschen und/oder Problemen steht aus Sicht der Autorin mit einer abwartenden, resignativen bzw. distanzierten Grundhaltung in Verbindung. Die InterviewpartnerInnen ergreifen dabei wenig bis keine Eigeninitiative für persönlich wichtige Belange, sondern versuchen sich vielmehr an gegebene Umstände anzupassen.
Die ForschungsteilnehmerInnen nehmen gegenüber einem Wunsch und/oder Problem oftmals eine abwartende Haltung ein, d.h. sie lassen die Dinge auf sich zukommen und hoffen, dass sie sich für sie zum Guten fügen.
I: […] Ahm / Mmh, glaubst du, wirst du Unterstützung brauchen, wenn du in einer Firma arbeiten magst? // Wirst du da irgendwo Hilfe brauchen, glaubst du? ///
IP01: Schwer zu sagen, ich lasse auf - meistens auf mich zukommen. //
I: Lässt du das auf dich zukommen?
IP01: Ja.
I: Ja? Einmal schauen, wie es dann wird.
IP01: Mhm.
(Transkript IP01_2, Zeile 441-451)
IP21: […] Und wenn es ein Arbeitsplatz wird, dann wird [Wort wird betont] es einer, und sonst, sehen wir eh. (Transkript IP21_2, Zeile 393)
IP11: […] Ich meine, es hat sich bis jetzt noch nicht so wirklich diesbezüglich, äh, getan, von der Arbeit her, aber ich hoffe, es ändert sich noch in J(O).
I: Mhm.
IP11: Aber,
I: Was ändert sich noch? Oder was hoffst du, dass sich ändert in J(O)?
IP11: Dass ich nicht nur das eine mache, was ich jetzt mache. // Aber sonst passt es schon.
(Transkript IP11_3, Zeile 465-473)
Wenn die InterviewpartnerInnen einem persönlich wichtigen Anliegen nicht weiter nachgehen, so kann dies darauf zurückzuführen sein, dass sie in ihrem unmittelbaren Umfeld keine realistischen Chancen für dessen Umsetzung wahrnehmen. Dies zeichnet sich insbesondere in den Interviews mit IP06 ab, wie die folgenden Auszüge zeigen.
I: Mm [verneinend]. / Was, was ist das, was du hier machst, für dich?
IP06: Beschäftigung.
I: Aha. Und wie geht es dir damit?
IP06: Aber ich kann [Wort wird betont] sonst nichts anderes tun. //
I: Was würdest denn du dir wünschen? // Würde'
IP06: Dass ich wieder zurück gehen kann zum A [Anm. C.S. Lebensmittelhandel].
I: Aha. Und glaubst du nicht, dass du, / dass es Möglichkeiten für dich geben würde, / woanders zu arbeiten? //
IP06: Halt, einen Betreuer haben wir da halt gehört [unverst. etwa so], der meint, das ginge schon mit mir. / Ob ich dort bügeln tu oder im Altersheim, das ist ihm gleich.
(Transkript IP06_1, Zeile 419-433)
I: Ja, aber redest du mit ihr[17] darüber, dass du aus der [A] raus magst? /
IP06: Nein.
I: Nicht? Warum nicht? / Vertraust du ihr da nicht?
IP06: Oja! [bestimmt]
I: Wohl? Aber?
IP06: Aber das Thema, sie hat noch, noch nie angeredet.
I: Sie [Wort wird betont] hat es noch nicht angeredet?
IP06: Ja.
I: Aha. Und du hast sie aber auch noch nicht angeredet darauf?
IP06: Nein.
I: Mm. [verneinend] //
IP06: Aber ich glaube, sie wird sich auch denken, wie ich: es gibt nichts anderes.
I: Sie [Wort wird betont] denkt sich das.
IP06: Ja.
I: Für dich, oder wie?
IP06: Ja.
I: Sie glaubt -
IP06: Und ich auch.
I: Du glaubst, sie unterschätzt dich. //
IP06: Also, sie hätte auch nie gedacht, dass ich einmal eine Wohnung bekomme. /
I: Aha. / Sie denkt nicht, dass du einmal / einen Job kriegst, / oder wie?
IP06: Ja, dass ich aus der [A] heraus komme.
I: Das denkt sie, meinst du.
IP06: Ja. /
I: Hat sie dir das gesagt?
IP06: Nein, aber das glaube ich [Wort wird betont] halt.
I: Das, das glaubst [Wort wird betont] du halt. // Aha. / Ja, hast du vor [Wort wird betont ], mit ihr darüber zu reden? Mit der Wegbegleiterin? //
IP06: Nein, eigentlich nicht.
I: Mm? [verneinend] Mit wem würdest du gerne reden darüber? / Oder, hast du schon mit jemandem geredet darüber?
IP06: Eigentlich mit niemand.
(Transkript IP06_1, Zeile 763-821)
Die InterviewpartnerInnen geben sich in Bezug auf Wünsche und/oder Probleme häufig mit Lösungen zufrieden, die für sie nicht vollständig befriedigend ausfallen. Im Zuge der Datenanalyse entwickelte die Autorin drei markante Formen des Sich-Zufriedengebens.
-
Resignatives Sich-Zufriedengeben tritt ein, wenn die ForschungsteilnehmerInnen die mit dem unentwegten Einsatz für eine Sache verbundene Anstrengung nicht weiter auf sich nehmen wollen. Um nicht dauerhaft unglücklich zu sein, geben sie sich mit der aktuellen Situation zufrieden.
-
Sich mit einem nur bedingt zufrieden stellenden Umstand zufriedenzugeben kann auch von einer Gewöhnung an diesen Umstand herrühren. Das folgende Zitat liefert hierfür ein gutes Beispiel.
I: Glaubst - Taugt [Anm. C.S. Gefällt] dir das beim H [Anm. C.S. Dienstleistungsunternehmen am Arbeitsmarkt], gefällt dir das?
IP11: Mittlerweile ja, doch, doch, doch, schon.
I: Warum mittlerweile erst? Am Anfang
IP11: Doch! Na, es ist schon okay. Was heißt, nein, nicht mittlerweile, es passt schon.
I: Mhm. // Aber? // Es schwingt noch ein Aber mit in deiner Wortwahl /// Mit den Kollegen vielleicht? Ist gut?
IP11: Nein, das ist schon ziemlich okay. Was mich ein bisschen, ein bisschen stresst, dass ich im Gang arbeiten muss.
(Transkript IP11_3, Zeile 669-679)
-
Nur teilweise zufriedenstellende Lösungen werden aber manchmal auch als Fortschritt gesehen, der zwar noch nicht so weit reicht wie man es sich gewünscht hätte, erstmals aber für die InterviewpartnerInnen einen annehmbaren Kompromiss darstellt (Sich-Zufriedengeben auf Zeit). Dies kommt etwa im nachfolgenden Zitat zum Ausdruck.
I: […] Wie ist das jetzt für dich, wenn du das mit früher vergleichst? Ist es das das, was du wolltest? Ist es eine - ist es ein Mittelding?
IP11: Mittelding.
I: Ein Mittelding. Was ist w', was ist, was ist besser, was ist schlechter, jetzt [Wort wird betont] als früher?
IP11: /// Ja ich wollte halt irgendwie heraus aus der [B], ganz raus.
I: Mhm.
IP11: Wollte aber, das hätte ich, hätte ich halt gerne gemacht, und [gedehntes Wort] /// irgendwie ist das nicht gegangen.
I: Mhm.
IP11: Ah, deswegen hab ich gesagt: na ja, vielleicht ergibt sich ja einmal was anderes, nicht? [unverst. etwa so] Es ist schon, wie gesagt, es ist nicht das, was ich unbedingt wollte.
I: Okay.
IP11: Aber
I: Ist es besser als vorher? Bist du zufriedener damit? /// Oder denkst du es ist ein schlechterer Kompromiss?
IP11: Ja, ich kann jetzt damit leben, halt. [unverst. etwa so: eigentlich nur halb, aber]
(Transkript IP11_3, Zeile 403-425)
Allgemein lassen sich in den Interviews gegenüber der Umsetzung von Wünschen und/oder der Lösung von bestehenden Problemen zwei passive Grundhaltungen ausmachen, welche die Autorin als hoffnungsvoll-optimistisch bzw. resignativ-pessimistisch bezeichnet. Unter der Einnahme der ersteren hoffen die InterviewpartnerInnen darauf, dass sich etwas ergibt, das zur Besserung ihrer aktuellen Situation führt (vgl. nachfolgendes Zitat: Transkript IP11), während sie bei Einnahme der letzteren nicht mehr an Möglichkeiten zur Besserung ihrer Situation glauben und diese als aussichtslos erleben (vgl. nachfolgendes Zitat: Transkript IP06).
IP11: […] Ja jetzt [lauter], schaue ich jetzt einmal noch weiter, aber, vielleicht ergibt sich ja einmal keine Ahnung, was.
(Transkript IP11_3, Zeile 481)
I: […] Du, / gibt es noch irgendwelche / Wünsche von dir, für // für deine Zukunft?
IP06: Nein, / ich glaube nicht. //
I: Dass die Krankheit nicht schlechter wird,
IP06: Ja.
I: eventuell wieder schaffen [Anm. C.S. arbeiten] gehen.
IP06: Ja, wenn es - aber ich glaube [unverst. 2-3 Sek.], weil wenn man nicht gescheit laufen kann, /
I: Wenn man nicht laufen kann, dann kann man nicht schaffen [Anm. C.S. arbeiten], oder wie?
IP06: Ja, glaube ich [Wort wird betont].
I: Mhm. /// Ja, gut -
IP06: Und dann muss es halt auch rollstuhlgerecht sein [unverst. Etwa so]. //
I: Aber da gäbe [Wort wird betont] es ja Möglichkeiten, vielleicht, oder? //
IP06: Ja, >Mikrophon wird verschoben< aber - also, wenn es da eine gibt. //
(Transkript IP06_2, Zeile 457-479)
Im Zusammenhang mit dem Erleben von Teilhabe im Lebensbereich Arbeit ist auch das Erhalten von Unterstützung von besonderer Bedeutung. Dieses kann grob in drei Bereiche unterteilt werden: Unterstützung bei der Realisierung von Wünschen (vorrangig dem Wunsch nach Arbeit), Unterstützung bei der Arbeit, sowie Unterstützung allgemein im Leben. In jedem Fall machen die ForschungsteilnehmerInnen interaktionelle Erfahrungen im persönlichen Kontakt mit UnterstützerInnen. Darunter werden all jene Personen verstanden, die Unterstützung leisten, zum Beispiel BetreuerInnen, Familienangehörige sowie Personen aus dem persönlichen Freundeskreis oder aus dem Arbeitsumfeld. In den Interviews zeigt sich, dass gezielte Unterstützung ihren Ausgang oft in eigens organisierten Unterstützungstreffen nimmt. (vgl. etwa Transkript IP10_1, Zeile 70-74; Transkript IP12, Zeile 289-291) Positiv anzumerken ist, dass dabei eine Bündelung der im sozialen Umfeld des betreffenden Menschen bestehenden Unterstützungsressourcen erfolgt. Aus der Sicht der InterviewpartnerInnen wichtige Aspekte an solchen Unterstützungsgesprächen bestehen darin, dass sie selbst Einfluss darauf haben, wer zur Unterstützung eingeladen wird und dass sich ein Kreis an Vertrauenspersonen mit ihnen zusammensetzt, ihren Vorstellungen Beachtung schenkt, ihnen bei ihren Anliegen und Ideen zuhört und mit ihnen gemeinsam Überlegungen zu deren Umsetzung anstellt. (vgl. Transkript IP01_1, Zeile 325-335; Transkript IP11_1, Zeile 560-566; 634-642; 788; 834; Transkript IP12, Zeile 289-321; Transkript IP21_2, Zeile 497; Transkript IP25_1, Zeile 434- 460) Die ForschungsteilnehmerInnen erleben es meist als etwas sehr Positives im Mittelpunkt eines solchen Treffens zu stehen. (vgl. Transkript IP01_1, Zeile 337- 343; Transkript IP10_1, Zeile 112-162; Transkript IP11_1, Zeile 948-966) IP11 hebt zudem positiv hervor, dass im Rahmen dieser Treffen die zur Unterstützung erforderliche Arbeit systematisch angegangen werden kann. Er habe das Gefühl, dass dadurch Bewegung in Gang gesetzt wird. (vgl. Transkript IP11_1, Zeile 932- 946; 978-994) Wesentlicher Bestandteil solcher Unterstützungstreffen ist also das Aufnehmen und Festhalten von Informationen durch die UnterstützerInnen, insbesondere zur Konkretisierung bestehender Wünsche oder Anliegen. Gemeinsam mit der zu unterstützenden Person werden Ideen gesammelt und Ziele definiert.
Im Anschluss an ein solches Treffen leiten die UnterstützerInnen Wege ein, die der Umsetzung der festgehaltenen Wünsche und der Erreichung der definierten Ziele dienlich sein sollen. Bei der Datenanalyse wurde hierfür der fokussierte Kode „Unterstützer fädelt etwas ein“ vergeben, so etwa auch für die im Folgenden angeführten Interviewauszüge.
IP11: Und jetzt / ist man eben jetzt dran zum /// Nachhaken.
(TranskriptIP11_1, Zeile 994)
IP11: […] So, also jetzt hat man halt die / Leute, die jetzt da für mich, äh, zum Unterstützungskreis / gekommen sind, […] ähm // haben >Mikrophongeräusch< [unverst. < 1 Sek.] versucht, äh, einige Firmen [gedehntes Wort] kontaktieren, die man aufgeschrieben hat beim, beim Kon' / […] beim Unterstützungskreis. (
Transkript IP11_2, Zeile 31-39)
IP12: Und dann ist die A(Pw) auf / den B [Anm. C.S. Papierhandel] / gekommen und in dem B [Anm. C.S. Papierhandel] habe ich dann einmal geschnuppert, da bin ich dann einmal eine Woche gewesen.
(Transkript IP12, Zeile 579)
IP10: Ääh, / und der Job, den hab ich von der B(Pw) so bekommen, dass sie das so [Wort wird betont] organisiert hat, dass ich den Job bekommen habe.
(Transkript IP10_1, Zeile 122)
IP21: Das ist / (schnalzt mit der Zunge) meine Betreuerin, die was mich im [C] betreut, die hat eine Bekannte […] und die hat das Ganze eigentlich eingefädelt. Die hat eben, / die hat eben das gemacht, dass sie mit dem Chef redet, wegen einem Praktikum.
(Transkript IP21_2, Zeile 409-413)
M: Und dann ist der[18] - haben wir dann halt einfach abgewartet, der ist da dann im Dorf einmal schauen gegangen, was könnte [Wort wird betont] sein, also das, ah Seniorenheim, sie war, äh, früher [Wort wird betont] schon einmal, […] Und das habe ich dann auch dem Herrn B(Pm) erzählt, da ist er auch hin gegangen. / Und, dann hat er / - ist ein Platz frei geworden, da war jemand dort, der irgendwo anders untergekommen ist und somit / hat man es mit der [Vorname] versucht.
(Transkript IP25_1, Zeile 554-616)
Der Prozess der Zielumsetzung wird durch Unterstützungstreffen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen begleitet. Dabei kommt es immer wieder zum Zusammensetzen mit der zu unterstützenden Person und zum Führen von Gesprächen, auch unter Einbezug von Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld (meist Vorgesetzte). (vgl. Transkript IP10_1, Zeile 746-752; 798-820; Transkript IP10_3, Zeile 194-212; Transkript IP12, Zeile 537-539; Transkript IP25_2, Zeile 280) Im Zuge der Unterstützung bei der Arbeitssuche bzw. der berufsbegleitenden Unterstützung kommt es vermehrt dazu, dass UnterstützerInnen an die zu unterstützende Person Informationen weitergeben, beispielsweise um sie über sich ergebende Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten. (vgl. Transkript IP11_1, Zeile 806; 1142-1150; Transkript IP11_2, Zeile 987-993; Transkript IP12, Zeile 553-559; Transkript IP25_2, Zeile 1508-1520;) Die folgenden Interviewauszüge veranschaulichen die Wichtigkeit des kontinuierlichen Kontakts zu unterstützendem Betreuungspersonal begleitend zur Arbeit, auch wenn keine spezifischen Anlässe dafür vorliegen.
M: Der[19] besucht euch immer [Wort wird betont], immer wieder,
IP25: Ja. [möchte noch weiter sprechen, wird unterbrochen]
M: in immer kurzen Abständen.
IP25: Er redet auch mit dem Chef,
I: Mhm.
M: Mhm.
IP25: wenn etwas ist [unverst. < 1 Sek.]
M: Mhm.
I: Und das ist jetzt besser so, oder? Dazwischen waren die[20] nicht so oft da?
M: Früher, äh, habe ich halt, wenn, wenn ich gemerkt habe, >Motorradlärm im Hintergrund< es steht etwas an, habe ich dann einfach mit dem / Herrn B(Pm) Kontakt, weil wir gedacht haben: das klappt [Wort wird betont] doch, oder?
I: Mhm.
M: Und, ah, der Herr K(Pm), der hat dann gesagt, nein [Wort wird betont]. / Ah, man muss immer wieder da [Wort wird betont] und ihnen - sie pa' praktisch fast ermahnen. / Der Mensch kann nicht alles so schnell,
I: Mhm.
M: und wenn er noch so lang da ist.
I: Mhm. Dass sie das immer wieder sagen.
M: Dass sie - nur schon seine Anwesenheit macht / macht sie irgend' - Aha.
(Transkript IP25_2, Zeile 274-304)
I: Mhm. Du aber, na ich meine, du hast ja jetzt / auch / die, die Unterstützung vom, vom [G], da bist du ja auch mittendrin. Wie, wie ist das anders als die Unterstützung, die du von der [B] bekommen hast? Ist das anders, oder?
IP11: // Ähm / Da bin ich einfach mehr in Kontakt mit dem Be', Betreuer. Also eher
I: Mit dem D(Pm)?
IP11: Mit dem D(Pm). [unverst. < 1 Sek.]
I: Er hält dich immer auf dem Laufenden?
IP11: Ja schon eher.
(Transkript IP11_2, Zeile 979-989)
Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld wie Vorgesetzte oder Kollegen leisten „ad hoc Unterstützung“ bei auftretenden Problemen sowie bei der Erledigung von Arbeitstätigkeiten. (vgl. etwa Transkript IP10_1, Zeile 618-634; 704-718; Transkript P25_1, Zeile 874-882) Wichtig bei dieser Form der Unterstützung ist es aus der Perspektive der InterviewpartnerInnen, jemanden zu haben, an den/die sie sich wenden können und der/die ihnen in schwierigen Situationen verlässlich Rückhalt bietet. (vgl. Transkript IP10_3, Zeile 308-318) Weiters wird es als wichtig empfunden, von Personen aus dem Arbeitsumfeld Hilfe bei der Arbeit zu bekommen, insbesondere, wenn diese ein überforderndes Ausmaß anzunehmen droht. (vgl. etwa IP06_1, Zeile 87-93) Auch allgemeine Unterstützung im alltäglichen Leben kann erforderlich oder förderlich für das Erleben beruflicher Teilhabe sein. Beispielsweise benötigt IP06 bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel Unterstützung, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Für sie stellt dieser Umstand eine Einschränkung der beruflichen Teilhabe dar, da sie gerne außerhalb der Werkstatt arbeiten würde, dies aber aufgrund des längeren Anfahrtsweges mit höherem Unterstützungsaufwand bzw. höheren Kosten zur Deckung desselbigen verbunden wäre.
IP06: Na, das Hauptproblem ist vor allem, wie komme ich da hinein.
I: Wie kommst du hin, gell?
IP06: Und wer zahlt das? Wie geht das dann auch finanziell?
(Transkript IP06_1, Zeile 825-829)
Auch in den Interviews mit IP10 tritt die Bedeutung von „allgemeiner Unterstützung im Leben“ hervor. Die Interviewpartnerin bewertet die Unterstützung, die sie durch ihren Vorgesetzten erhält, vor allem deswegen positiv, weil sie sie als ganzheitlich, d.h. nicht nur auf den Arbeitskontext, sondern auch auf den für sie wichtigen Lebensbereich der sportlichen Betätigung, bezogen erlebt. (vgl. Transkript IP10_2, Zeile 34-38)
Erhaltene Unterstützung wird von den ForschungsteilnehmerInnen dann negativ erlebt, wenn sie nicht ihren persönlichen Vorstellungen entspricht. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich bietenden Möglichkeiten nachgegangen wird, für welche die zu unterstützende Person aber von Beginn an eigentlich kein Interesse aufbringt. (vgl. Transkript IP12, Zeile 323-333) In diesem Fall kann von fehlgeleiteter Unterstützungsenergie durch mangelhafte Vorab-Übereinstimmung gesprochen werden. Im Fall von IP11 entspricht die erhaltene Unterstützung nicht seinen Vorstellungen, weil sie zu wenig flexibel ist um seiner individuellen Bedürfnislage gerecht zu werden.
IP11: Persönliche Assistenz beim Arbeitsplatz. Und irgendwie ist das nicht gegangen, das, was ich wollen habe und nebenher wollte ich aber auch noch ins E [Anm. C.S. Kunsthandwerke] gehen zum Malen und nebenher wollten irgendwie - wollte [B], das E [Anm. C.S. Kunsthandwerke] weglassen, wollte aber Assistenz und beides zusammen ging ja nicht.
(Transkript IP11_3, Zeile 111)
Weiters wird Unterstützung negativ erlebt, wenn sie aus Sicht der Interviewpartnerinnen nur langsam und zäh voran geht. (vgl. Transkript IP11_2, Zeile 43; 303-311; 935-937)
[12] M = Mutter der IP
[13] Anm. der Autorin: IP21 nimmt an dieser Stelle Bezug auf eine in der Hierarchie über ihr stehende Arbeitskollegin.
[14] Anm. der Autorin: IP21 nimmt an dieser Stelle Bezug auf eine Betreuerin.
[15] Anm. der Autorin: IP10 nimmt an dieser Stelle auf eine Person Bezug, nach der sie von ihrer Kundschaft des Öfteren gefragt wird.
[16] Anm. der Autorin: IP21 nimmt an dieser Stelle Bezug auf eine in der Hierarchie über ihr stehende Arbeitskollegin, mit der sie einst in Konflikt geriet.
[17] Anm. der Autorin: an dieser Stelle wird auf eine Betreuerin der IP Bezug genommen.
[18] Anm. der Autorin: an dieser Stelle wird auf den Betreuer B(Pm) Bezug genommen.
[19] Anm. der Autorin: an dieser Stelle wird auf den Betreuer K(Pm) Bezug genommen.
[20] Anm. der Autorin: an dieser Stelle wird auf das Betreuungspersonal einer Unterstützungsinstitution Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
Im Rahmen dieses Kapitels gilt es die Forschungsfrage
„Welche interaktionellen Erfahrungen machen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext und welche Bedeutung kommt diesen Erfahrungen im Hinblick auf die erlebte berufliche Teilhabe zu?“
einer Beantwortung zuzuführen. Dies erfolgt anhand der Analyseergebnisse (siehe Kapitel 9.3), unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus der Literatur (siehe Kapitel 4).
Aus dem Interviewmaterial wurden im Zuge der Analyse nach dem Forschungsstil der Grounded Theory drei Hauptkategorien herausgearbeitet, die der Einordnung der interaktionellen Erfahrungen dienen, welche Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung - nämlich die in Kapitel 9.2 vorgestellten acht ForschungsteilnehmerInnen - im Lebensbereich Arbeit machen.
-
Die erste Kategorie („soziales Arbeitsumfeld“) umfasst interaktionelle Erfahrungen, die im Rahmen des sozialen Arbeitsumfelds, also im alltäglichen Umgang mit KollegInnen, BetreuerInnen, Vorgesetzten etc., gemacht werden.
-
Die zweite Kategorie („mit Wünschen bzw. Problemen umgehen“) umfasst interaktionelle Erfahrungen im Zuge des Umgangs mit Wünschen und Problemen. Die dieser Kategorie zugeordneten erlebten sozialen Interaktionen und Beziehungen beziehen sich also auf bestimmte Inhalte (Wünsche und Probleme) und sind weiters auf einen spezifischen Zweck hin ausgerichtet (den Umgang damit). (vgl. Hughes u. a., 1998)
-
Die dritte Kategorie („Unterstützung erhalten“) umfasst all jene interaktionellen Erfahrungen, die die ForschungsteilnehmerInnen im Zuge des Erhalts von Unterstützung im Lebensbereich Arbeit machen. Hier besteht also Spezifität im Hinblick auf die InteraktionspartnerInnen (Unterstützungspersonen) und in Bezug auf den Zweck der erlebten sozialen Interaktionen und Beziehungen (Unterstützung erhalten). (vgl. ebd.)
Zunächst werden nun die interaktionellen Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen, gegliedert nach den genannten Kategorien, dargestellt. Im Anschluss daran wird schließlich der Bezug dieser Erfahrungen zu erlebter beruflicher Teilhabe erläutert.
Eine wichtige Basis für ein positives Arbeitsklima stellt aus der Sicht der ForschungsteilnehmerInnen der allgemeine zwischenmenschliche Umgang bei der Arbeit dar. Dieser sollte durch Freundlichkeit und Lockerheit geprägt sein. Es sei wichtig, miteinander lachen zu können, auch über verschiedene hierarchische Positionen hinweg. Weiters möchten die ForschungsteilnehmerInnen, dass Menschen ohne Behinderung ihnen „normal“ begegnen, also sowie anderen Menschen auch. Insgesamt wird also ein natürlicher Umgang miteinander als erstrebenswert erachtet. Damit dieser erreicht werden kann, bedarf es zum Beispiel einer aufgeschlossenen Arbeits- und Organisationskultur, die interindividuelle Unterschiede nicht nur toleriert, sondern auch schätzt. (vgl. Chadsey & Beyer, 2001) Soziale Fähigkeiten der ForschungsteilnehmerInnen, die Unvoreingenommenheit ihrer InteraktionspartnerInnen in Bezug auf ihre intellektuelle Beeinträchtigung (und eventuellen anderen Behinderungen) sowie ein hohes Maß an Erfahrung im gegenseitigen Umgang miteinander auf beiden Seiten sind weitere Faktoren, die einen natürlichen Umgang miteinander ermöglichen bzw. erleichtern können. (vgl. ebd.)
Beim Erleben von sozialen Beziehungen bei der Arbeit wird in den Interviews unterschieden zwischen „mit anderen gut auskommen“ und „mit anderen nicht gut auskommen“. Positive soziale Beziehungen sind laut Angaben der InterviewpartnerInnen dadurch gekennzeichnet, miteinander über private Dinge sprechen zu können, miteinander Spaß haben zu können und aktiv Zeit miteinander zu verbringen, d.h. etwa auch außerhalb der Arbeitsbereichs gemeinsame Unternehmungen zu tätigen. Weiters stellt Reziprozität, also wechselseitiges Geben und Nehmen, ein als wichtig erachtetes Merkmal positiver Beziehungen dar: die Beziehungspartner mögen sich gegenseitig und brauchen einander (vgl. hierzu Antonsson u. a., 2008, die „subject-to-subject relations“ ebenfalls durch das Merkmal der Reziprozität kennzeichnen).
Vergleicht man diese Erkenntnisse mit der Literatur, so spielt für die ForschungsteilnehmerInnen vor allem das Einbezogensein in nichtarbeitsbezogene Interaktionen (Herumscherzen, über Privates sprechen) (vgl. Kirmeyer, 1988, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128f) eine wichtige Rolle. Arbeitsbeziehungen werden vor allem dann positiv erlebt, wenn sie im Sinne der Unterscheidung nach Argyle (1992, S. 80f) als private Freundschaften charakterisiert werden können. Sich miteinander „abzugeben“, d.h. bewusst Zeit miteinander zu verbringen und etwa auch über den Arbeitskontext hinaus gemeinsame Erfahrungen zu teilen, ermöglicht es den BeziehungspartnerInnen, sich gegenseitig holistisch, also ganzheitlich, als Mensch mit vielen verschiedenen Facetten, wahrzunehmen. (vgl. Gaska & Frey, 1993; Williams u. a., 2009) Die Feststellung, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ebensolche Interaktionen und Beziehungen im Lebensbereich Arbeit nur selten erleben (Chadsey & Beyer, 2001, S. 130; Hughes u. a., 1998, S. 180) kann anhand der Interviewdaten nicht eindeutig bestätigt werden. Dass die ForschungsteilnehmerInnen das Erleben solcher Interaktionen und Beziehungen als etwas ganz Besonderes hervorheben, kann aber als Hinweis auf ein eher seltenes Vorkommen betrachtet werden. Zusätzlich bedauern zwei der acht InterviewpartnerInnen explizit, nicht viele Freunde zu haben. (siehe Abschnitt 9.2)
Das soziale Arbeitsumfeld unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Mensch in einer Werkstatt oder am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeitet, und zwar vor allem im Umgebungskontext und im Hinblick auf die in Frage kommenden InteraktionspartnerInnen. Jene ForschungsteilnehmerInnen, die in einer Werkstatt arbeiten, berichten vor allem von sozialen Interaktionen innerhalb der Arbeitsgruppe, mit KollegInnen, die auch Behinderungen haben, und mit BetreuerInnen. Personen, die am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, berichten von sozialen Interaktionen mit KollegInnen ohne Behinderungen, mit Vorgesetzten und mit Personen, die außerhalb des beständigen sozialen Arbeitsumfeldes stehen, wie zum Beispiel KundInnen. Vergleicht man das „typische“ soziale Arbeitsumfeld eines Arbeitsplatzes innerhalb einer Werkstatt mit dem „typischen“ sozialen Arbeitsumfeld eines Arbeitsplatzes am allgemeinen Arbeitsmarkt, so lässt sich ersteres als eher geschlossen und letzteres als nach außen hin offen charakterisieren. Zwei Aspekte erscheinen also für eine Unterscheidung relevant, nämlich zum einen der soziale Kontakt zu Menschen mit Behinderung vs. zu Menschen ohne Behinderung und zum anderen die Geschlossenheit vs. Offenheit des sozialen Arbeitsumfelds. Auf diese beiden Aspekte scheint sich etwa auch IP11 zu beziehen als er hervorhebt, dass ihm in der Werkstatt der „Kontakt zu außen“ fehle. (siehe Abschnitt 9.3.1.5)
Trotz der Feststellbarkeit dieser prinzipiellen Unterschiede lässt sich anhand der Analyseergebnisse keine Aussage darüber treffen, welches der beiden „typischen“ sozialen Arbeitsumfelder von den ForschungsteilnehmerInnen im Allgemeinen positiver erlebt wird. Fragt man nämlich nach dem subjektiven Erleben, so reicht der Bezug auf das „Typische“ nicht aus, sondern erfordert die Betrachtung des jeweils individuellen Kontextes. Anhand des analysierten Interviewmaterials lässt sich feststellen, dass zwischen den ForschungsteilnehmerInnen große Unterschiede im Erleben ihres jeweiligen sozialen Arbeitsumfelds bestehen. (vgl. Abschnitte 9.3.1.3 und 9.3.1.5)
Das Erleben von zwischenmenschlichen Konflikten stellt eine dem sozialen Arbeitsumfeld zugeordnete Subkategorie von interaktionellen Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen bei der Arbeit dar. Die erlebten Konflikte können übergreifend dadurch charakterisiert werden, dass andere den InterviewpartnerInnen gegenüber ein unfaires Verhalten an den Tag legen, sie zum Beispiel fertig machen, blöd anreden, beschimpfen oder über sie Unwahrheiten verbreiten (siehe Abschnitte 9.3.1.4.1 bis 9.3.1.4.4). Hinzu kommt das Miterleben von Konflikten zwischen anderen Personen. Weiters wird in einzelnen Fällen das Zusammenarbeiten mit KollegInnen ohne Behinderung als mit Schwierigkeiten verbunden erlebt. Bei der Klärung von Konflikten erleben es die InterviewpartnerInnen als wichtig, dass ihre Perspektive eingeholt und für das Ziehen von Konsequenzen berücksichtigt wird. Sie beschreiben weiters unterschiedliche Arten, wie sie auf Konflikte reagieren. Diese reichen von offener Konfrontation anderer mit ihrem Verhalten über das Hilfesuchen bei Vertrauenspersonen bis hin zum sozialen Rückzug und erlebter Hilflosigkeit.
Durch das „Kommen und Gehen“ von InteraktionspartnerInnen (z.B. Vorgesetzte, KollegInnen, BetreuerInnen, UnterstützerInnen) ändern sich auch die von den ForschungsteilnehmerInnen im Arbeitskontext erlebten sozialen Interaktionen und Beziehungen. Führt ein solcher Wechsel zum Verlust von positiven sozialen Beziehungen oder zu sozialer Unbeständigkeit, so wird dies negativ erlebt.
Erlebte Kritik an der eigenen Arbeitsweise, z.B. wegen eines langsamen Arbeitstempos, aber auch Anerkennung für geleistete Arbeit stellen interaktionelle Erfahrungen dar, die im Sinne Kirmeyers (1988, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128f) als arbeitsbezogen zu charakterisieren sind. Erstere werden von den ForschungsteilnehmerInnen tendenziell negativ, letztere positiv erlebt.
In Bezug auf den Umgang mit Wünschen bzw. Problemen stellten sich im Zuge der Datenanalyse zwei gegensätzliche Subkategorien als relevant heraus: „eine aktive Rolle einnehmen“ vs. „eine passive Rolle einnehmen“. Unter ersterer werden erlebte soziale Interaktionen subsumiert, die darauf abzielen, einen Wunsch zu äußern und aktiv zu verfolgen bzw. Probleme anzusprechen, sich gegen diese zur Wehr zu setzen und Lösungsmaßnahmen in Gang zu bringen. Als Ansprechpersonen für Wünsche oder Probleme werden meist Menschen aus dem Familienkreis, aber auch Vertrauenspersonen aus dem direkten Arbeitsumfeld wie BetreuerInnen oder Vorgesetzte, nicht jedoch KollegInnen genannt. Dies steht in Einklang mit den Ergebnissen der Studie von Forrester u. a. (2004, zit. nach A. Jahoda u. a., 2008). Die Subkategorie „eine passive Rolle einnehmen“ stellt den Gegenpart zur erstgenannten dar. Hierunter werden verschiedene Formen des „Nicht- Aktivwerdens“ subsumiert, die vermutlich im Zusammenhang mit gemachten interaktionellen Erfahrungen stehen (z.B. wenn InteraktionspartnerInnen der IP das Gefühl geben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowieso keine Chance auf eine Arbeitsstelle zu haben). Für die Beantwortung der Fragestellung ist hier weiters das Ausbleiben von als wichtig zu erachtenden interaktionellen Erfahrungen, wie etwa sich an jemanden zu wenden, einer Sache nachzugehen etc. relevant.
Interaktionelle Erfahrungen, die von den ForschungsteilnehmerInnen im Zuge des Erhaltens von Unterstützung gemacht werden, bestehen darin, sich mit Unterstützungspersonen zusammenzusetzen, von ihnen Beachtung geschenkt zu bekommen und gemeinsam mit ihnen Überlegungen anzustellen. In vielen Fällen werden in solche Gespräche auch Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld mit eingebunden. UnterstützerInnen hören den InterviewpartnerInnen zu und halten Informationen fest, geben aber auch Informationen an sie weiter und halten sie über wichtige Dinge auf dem Laufenden. Dadurch, dass Unterstützungspersonen „etwas einfädeln“, schaffen sie für die ForschungsteilnehmerInnen in den meisten Fällen Möglichkeiten zum Erleben beruflicher Teilhabe. In Abhängigkeit von der Regelmäßigkeit der Treffen besteht zu den UnterstützerInnen ein mehr oder weniger kontinuierlicher Kontakt. Mitunter übernehmen auch Personen aus dem sozialen Arbeitsumfeld, wie z.B. KollegInnen oder Vorgesetzte, die Rolle eines/r UnterstützerIn, indem sie den ForschungsteilnehmerInnen etwa bei der Erledigung der Arbeit helfen und beim Auftreten von Problemen hinter ihnen stehen.
Das In-Kontakt-Kommen mit anderen Leuten (siehe Abschnitt 9.3.1.5) wird von fast allen InterviewpartnerInnen als sehr wesentlicher Aspekt von Arbeit hervorgehoben und kann daher für das Erleben von beruflicher Teilhabe als zentral angesehen werden. Sozialer Zusammenhalt und das Erleben von Gemeinschaft, Aspekte, die durch ein gutes Auskommen miteinander und durch gemeinsame Arbeitsaufgaben gefördert werden, sind ebenfalls entscheidend für das erlebte Einbezogensein in den Lebensbereich Arbeit. Wie sich in den Interviews zeigte, können InteraktionspartnerInnen ohne Behinderung aus der Sicht der ForschungsteilnehmerInnen durch einen wertschätzenden und vorurteilsfreien Umgang mit sowie durch faires Verhalten gegenüber ihren KollegInnen mit intellektueller Beeinträchtigung dazu beitragen, dass diese berufliche Teilhabe verstärkt erleben. Weiters zeigte sich, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch das Einnehmen einer aktiven Rolle im Umgang mit Wünschen und Problemen selbst ihre Teilhabe am Arbeitsleben förderlich beeinflussen können. Deshalb ist es wichtig, ihnen das Einnehmen einer solchen Rolle zu ermöglichen und sie darin zu stärken.
Unterstützung, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Suche nach Arbeit erhalten, wirkt sich besonders dann positiv auf die erlebte berufliche Teilhabe aus, wenn sie durch ihre aktive Miteinbeziehung und im Einklang mit ihren persönlichen Interessen und Präferenzen erfolgt (vgl. hierzu Niediek, 2008, die „Interessengerichtetheit“ als wesentliches Merkmal von Partizipation hervorhebt). Bei der Erledigung der Arbeit selbst wünschen sich die ForschungsteilnehmerInnen Hilfe und sozialen Rückhalt, um effektiv an Arbeit teilhaben zu können. Erhaltene Unterstützung, die dem erlebten Einbezogensein in anderen Lebensbereichen dienlich ist, kann sich indirekt auch positiv auf die Teilhabe am Arbeitsleben auswirken (vgl. hierzu die in Kapitel 4.2 angesprochene, verschiedene Lebensbereiche übergreifende Wirkung von Ressourcen und Belastungen).
Im Zuge der Datenanalyse wurde ersichtlich, dass neben interaktionellen Erfahrungen auch andere Aspekte, die sich etwa auf die Arbeitsinhalte, das Arbeitsausmaß, die Arbeitsweise und die Arbeitsumgebung beziehen (siehe hierzu Abschnitte 9.3.2 bis 9.3.5), von den ForschungsteilnehmerInnen für das Erleben beruflicher Teilhabe als bedeutsam erachtet werden. Für eine ganzheitliche Betrachtung des subjektiven Erlebens beruflicher Teilhabe dürfen sie deshalb nicht außer Acht gelassen werden. Beispielsweise hilft ein förderliches soziales Arbeitsumfeld und ein hohes Ausmaß an gezielter Unterstützung nur wenig, wenn die zu erledigende Arbeit an sich als sinnlos und eintönig bewertet wird und dies zu einem eingeschränkten Teilhabeerleben beiträgt.
Abbildung 4 (siehe Anhang) soll dem/der LeserIn einen Überblick über die Vielfalt der hier angesprochenen Aspekte mit ihren jeweils förderlichen (mit „+“ gekennzeichneten) und hinderlichen (mit „-“ gekennzeichneten) Einflüssen auf die erlebte berufliche Teilhabe verschaffen. Da das in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehende Forschungsinteresse in erster Linie den sozialen Aspekten gilt, werden diese durch eine graue Hinterlegung hervorgehoben.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden interaktionelle Erfahrungen, die Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im Lebensbereich Arbeit aus ihrer eigenen Perspektive heraus machen, sowie die Bedeutung, die diese Erfahrungen für die subjektiv erlebte berufliche Teilhabe haben, untersucht. Dazu wurde auf Interviewmaterial zurückgegriffen, das im Zeitraum von Oktober 2008 bis Juli 2010 im Zuge des Forschungsprojekts „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ erhoben wurde. Insgesamt wurden siebzehn Interviews mit acht unterschiedlichen ForschungsteilnehmerInnen, die selbst RepräsentantInnen des untersuchten Personenkreises sind, unter Anwendung des Forschungsstils der Grounded Theory nach Kathy Charmaz und unter Verwendung der Software Atlas.ti analysiert. Vor dem Beginn der analytischen Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit der Forschungsmethodik der Grounded Theory, mit der wissenschaftstheoretischen Position des Sozialen Konstruktionismus sowie mit den prinzipiellen Chancen und Risiken, die aus der Zuhilfenahme von Programmen zur computergestützten qualitativen Datenanalyse erwachsen. Die detaillierte Herausarbeitung des aktuellen Forschungsstands erfolgte mit Absicht erst nach Abschluss der Analyse und der schriftlichen Darlegung der aus ihr gewonnenen Ergebnisse, um im Prozess der Theoriegenerierung nicht durch Forschungsergebnisse anderer AutorInnen beeinflusst zu werden.[21]
Die qualitative Datenanalyse ergab, dass sich die von den InterviewpartnerInnen gemachten interaktionellen Erfahrungen im Lebensbereich Arbeit im Wesentlichen den drei Kategorien „soziales Arbeitsumfeld“, „mit Wünschen bzw. Problemen umgehen“ und „Unterstützung erhalten“ zuordnen lassen. Die erste davon beinhaltet Aspekte, die sich für eine positive Gestaltung des zwischenmenschlichen Umgangs und der zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Arbeit als relevant erwiesen. Die zweite Kategorie umfasst soziale Interaktionen und Beziehungen, die beim Umgehen mit Wünschen und/oder Problemen hinsichtlich Arbeit erlebt werden oder deren Erleben ausbleibt. Es zeigte sich, dass die InterviewpartnerInnen bei Erfahrungen dieser Kategorie eine mehr oder weniger aktive bzw. passive Rolle einnehmen. Die dritte Kategorie umfasst interaktionelle Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Erhalten von Unterstützung im Lebensbereich Arbeit. Dabei konnten insbesondere soziale Aspekte herausgearbeitet werden, die für ein positives Erleben von Unterstützung bedeutsam sind. Insgesamt konnte die hohe Relevanz interaktioneller Erfahrungen für die erlebte berufliche Teilhabe festgestellt werden. Insbesondere das In-Kontakt-Kommen mit anderen Leuten, damit sind meist Menschen ohne Behinderung gemeint, nimmt aus subjektiver Sicht der Betroffenen einen hohen Stellenwert ein. Weiters wird ein gutes Auskommen mit den Menschen bei der Arbeit für besonders wichtig befunden, um erfolgreich am Arbeitsleben teilhaben zu können und an der derzeitigen Arbeitsstelle auch zukünftig weiter verbleiben zu wollen. Darüber hinaus zeigten sich auch andere Aspekte von Arbeit, welche vor allem die Inhalte und das Ausmaß von Arbeit sowie die Arbeitsumgebung und die Arbeitsweise betreffen, aus der Perspektive der ForschungsteilnehmerInnen als relevant für berufliche Teilhabe. Dazu gehört im Speziellen, sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit zu erledigen, sich einem herausfordernden Arbeitsausmaß gegenüberzusehen, sich kompetent für die Arbeit, die man erledigt, zu fühlen, sich in den Räumlichkeiten, in denen man arbeitet, wohl zu fühlen sowie konzentriert und im eigenen Tempo arbeiten zu können.
Aus den Analyseergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass Unterstützung, die am Individuum und seinen Fähigkeiten ansetzt, vor allem der Stärkung einer aktiven Rolle im Umgang mit Wünschen und/oder Problemen dienen könnte. Für die meisten der im Zuge der Analyse herausgearbeiteten interaktionellen Erfahrungen gilt aber, dass sie vor allem unter der Miteinbeziehung von Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld (KollegInnen, BetreuerInnen, Vorgesetzte) positiv beeinflussbar wären. Zu nennen sind hier etwa ein natürlicher und wertschätzender zwischenmenschlicher Umgang, ein faires Verhalten einander gegenüber und eine positive Arbeitsatmosphäre, in der auch das miteinander Lachen und das Führen von Unterhaltungen über private Angelegenheiten nicht zu kurz kommen. Ein Unterstützungsrahmen, der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ihre InteraktionspartnerInnen bei der Arbeit zusammenbringt, um gemeinsam die Gestaltung sozialer Interaktionsprozesse und Beziehungen bei der Arbeit zu reflektieren, diesbezüglich bestehende Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und ihre Bedeutung für erlebte berufliche Teilhabe zu besprechen, könnte große Chancen in sich bergen.
Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die im Rahmen dieser Untersuchung erarbeiteten Analyseergebnisse aus der Perspektive aller Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung von subjektiver Bedeutsamkeit für das Erleben beruflicher Teilhabe sind, wäre es wichtig, weitere Studien mit anderen ForschungsteilnehmerInnen durchzuführen. Weiters könnte bei zukünftigen Untersuchungen der sozialen Interaktions- und Beziehungsprozesse (im Arbeitskontext) von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine Kombination aus subjektiven Befragungs- und objektiven Beobachtungsmethoden neue Erkenntnisse liefern. Da in dieser Arbeit ausschließlich die subjektiven Sichtweisen der Betroffenen analysiert wurden, konnten zum Beispiel keine Aussagen darüber getroffen werden, wie sich objektiv feststellbare Teilhabechancen oder -barrieren auf das subjektive Erleben auswirken.
Insgesamt konnten durch die vorliegende Arbeit Ansatzpunkte für die weitere Erforschung der Sichtweisen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als auch für die Gestaltung von beruflichen Unterstützungsangeboten für diese Zielgruppe geschaffen werden.
[21] Dieses Vorgehen entspricht den Empfehlungen von Charmaz (2006; siehe auch Puddephatt, 2006, S. 15) und Strauss und Corbin (1996, S. 33).
Abels, H. (2009). Einführung in die Soziologie. Die Individuen in ihrer Gesellschaft (4. Aufl., Bd. 2). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage, Wiesbaden.
Allen, L. M. (2010). A critique of four grounded theory texts. The Qualitative Report, 15(6), 1606-1620.
Ameln, F. von. (2004). Konstruktivismus. Die Grundlagen systemischer Therapie, Beratung und Bildungsarbeit. Tübingen u. a.: Francke.
Antonsson, H., Graneheim, U. H., Lundström, M., & Åström, S. (2008). Caregivers’ reflections on their interactions with adult people with learning disabilities. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(6), 484-491.
Argyle, M. (1992). The social psychology of everyday life. London u. a.: Routledge.
Asendorpf, J., & Banse, R. (2000). Psychologie der Beziehung. Bern u. a.: Huber.
Baldwin, M. W. (1992). Relational schemas and the processing of social information. Psychological Bulletin, 112(3), 461-484.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. New York: Doubleday.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1969). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer.
Beyer, S., Kilsby, M., & Willson, C. (1995). Interaction and engagement of workers in supported employment: A British comparison between workers with and without learning disabilities. Mental Handicap Research, 8(3), 137-155.
Bieker, R. (2005a). Individuelle Funktionen und Potentiale der Arbeitsintegration. In R. Bieker (Hrsg.), Teilhabe am Arbeitsleben: Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (S. 12-24). Stuttgart: Kohlhammer.
Bieker, R. (Hrsg.). (2005b). Teilhabe am Arbeitsleben: Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer.
Bierhoff, H.-W., & Jonas, E. (2011). Soziale Interaktion. Sozialpsychologie - Interaktion und Gruppe (S. 131-159). Göttingen u. a.: Hogrefe.
Biewer, G. (2004). Leben mit dem Stigma „geistig behindert“. In E. Wüllenweber (Hrsg.), Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung (S. 288-299). Stuttgart: Kohlhammer.
Biewer, G. (2009). Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Biewer, G., Fasching, H., & Koenig, O. (2009). Teilhabe von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung an Bildung, Arbeit und Forschung. SWSRundschau, 49(3), 391-403.
Bleidick, U. (2006). Behinderung. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis (2., überarb. und erw. Aufl., S. 79-81). Stuttgart: Kohlhammer.
Bleidick, U., & Hagemeister, U. (1998). Einführung in die Behindertenpädagogik I. Allgemeine Theorie der Behindertenpädagogik (6., überarb. Aufl., Bd. 1). Stuttgart: Kohlhammer.
Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Humanund Sozialwissenschaftler (4., überarb. Aufl.). Berlin u. a.: Springer.
Bringer, J. D., Johnston, L. H., & Brackenridge, C. H. (2006). Using computerassisted qualitative data analysis software to develop a grounded theory project. Field Methods, 18(3), 245-266.
Brumlik, M. (1996). Interaktionstheorien. In H. Hierdeis & T. Hug (Hrsg.), Taschenbuch der Pädagogik. Gerontagogik - Organisation (4., vollst. überarb. und erw. Aufl., Bd. 3, S. 883-892). Baltmannsweiler: Schneider.
Bryant, A. (2003). A constructive/ist response to Glaser. About Barney G. Glaser: Constructivist grounded theory? published in FQS 3(3). Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 4(1), o. S. Verfügbar unter http://www.qualitative-research.net [16.01.2012].
Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). Grounded theory in historical perspective: An epistemological account. In A. Bryant & K. Charmaz (Hrsg.), The SAGE handbook of grounded theory (S. 31-57). London u. a.: Sage Publications.
Burr, V. (1997). An introduction to social constructionism (1. Aufl., unveränd. Nachdr.). London u. a.: Routledge.
Burzan, N. (2005). Quantitative Methoden der Kulturwissenschaften: Eine Einführung. Konstanz: UTB.
Chadsey, J., & Beyer, S. (2001). Social relationships in the workplace. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 7(2), 128-
Chadsey-Rusch, J., Gonzalez, P., Tines, J., & Johnson, J. R. (1989). Social ecology of the workplace: Contextual variables affecting social interactions of employees with and without mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 94(2), 141-151.
Charmaz, K. (1995). Between positivism and postmodernism: Implications for methods. In N. K. Denzin (Hrsg.), Studies in symbolic interaction (S. 43-72). London: Jai Press Inc.
Charmaz, K. (2000). Grounded theory. Objectivist and constructivist methods. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), Handbook of qualitative research (2. Aufl., S. 509-535). Thousand Oaks, Calif. u. a.: Sage Publications.
Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century: Applications for advancing social justice studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), The SAGE handbook of qualitative research (3. Aufl., S. 507-536). Thousand Oaks, Calif. u. a.: Sage Publications.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis. London u. a.: Sage Publications.
Charmaz, K. (2008). Constructionism and the grounded theory method. In J. A. Holstein & J. F. Gubrium (Hrsg.), Handbook of constructionist research (S. 397-412). New York u. a.: The Guilford Press.
Chiari, G., & Nuzzo, M. L. (1996). Psychological constructivisms: A metatheoretical differentiation. Journal of Constructivist Psychology, 9(3), 163-184.
Cloerkes, G. (2007). Soziologie der Behinderten. Eine Einführung (3., neu bearb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Winter.
Collin, F. (2008). Konstruktivismus. Paderborn u. a.: Fink.
Darmody, M., & Byrne, D. (2006). An introduction to computerised analysis of qualitative data. Irish Educational Studies, 25(1), 121-133.
Dederich, M. (2009). Behinderung als sozial- und kulturwissenschaftliche Kategorie. In M. Dederich & W. Jantzen (Hrsg.), Behinderung und Anerkennung, Behinderung, Bildung, Partizipation (Bd. 2, S. 15-39). Stuttgart: Kohlhammer.
di Gregorio, S. (2009). Software-Instrumente zur Unterstützung qualitativer Analyse. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), Qualitative Marktforschung (2., überarb. Aufl., S. 731-760). Wiesbaden: Gabler.
Diekmann, A. (2009). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen (vollst. überarb. und erw. Neuausg., 20. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
DIMDI. (2005). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Neu-Isenburg: MMI.
Dittrich, T. (2005). Arbeitsleben. In E. Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.), Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein (S. 99-100). Marburg: Lebenshilfe.
Edley, N. (2001). Unravelling social constructionism. Theory and Psychology, 11(3), 433-441.
Faulstich-Wieland, H. (2000). Individuum und Gesellschaft. Sozialisationstheorien und Sozialisationsforschung. München; Wien: Oldenbourg.
Fischer, E. (2008a). Geistige Behinderung im Kontext der ICF - ein interdisziplinäres, mehrdimensionales Modell? In E. Fischer (Hrsg.), Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung: Sichtweisen - Theorien – aktuelle Herausforderungen (2., überarb. Aufl., S. 385-417). Oberhausen: Athena.
Fischer, E. (2008b). „Geistige Behinderung“ - Fakt oder Konstrukt? Sichtweisen und aktuelle Entwicklungen. In E. Fischer (Hrsg.), Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung: Sichtweisen - Theorien – aktuelle Herausforderungen (2., überarb. Aufl., S. 13-44). Oberhausen: Athena.
Fischer, E. (Hrsg.). (2008c). Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung: Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen (2., überarb. Aufl.). Oberhausen: Athena.
Flores, N., Jenaro, C., Orgaz, M. B., & Martín, M. V. (2011). Understanding quality of working life of workers with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 24(2), 133–141.
Fornefeld, B. (2008). Menschen mit geistiger Behinderung – Phänomenologische Betrachtungen zu einem unmöglichen Begriff in einer unmöglichen Zeit. In E. Fischer (Hrsg.), Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung: Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen (2., überarb. Aufl., S. 331-352). Oberhausen: Athena.
Forrester-Jones, R., Jones, S., Heason, S., & Di Terlizzi, M. (2004). Supported employment: A route to social networks. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17(3), 199-208.
Frese, M. (1985). Arbeit. In T. Herrmann & E.-D. Lantermann (Hrsg.), Persönlichkeitspsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen (S. 139-146). München u. a.: Urban & Schwarzenberg.
Frey, D., & Bierhoff, H.-W. (2011). Sozialpsychologie - Interaktion und Gruppe. Göttingen u. a.: Hogrefe.
Friedrich, J. (2006). Orientierung im Entscheidungsprozess: Menschen mit geistiger Behinderung und der allgemeine Arbeitsmarkt. Eine qualitative Studie zum Entscheidungsverhalten im Übergang von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hamburg: Kovač.
Friese, S. (2010). ATLAS.ti 6 Quick Tour. Revision 423. Abgerufen von http://www.atlasti.com/download.html [15.05.2011].
Frindte, W. (1998). Soziale Konstruktionen. Sozialpsychologische Vorlesungen. Opladen u. a.: Westdt. Verl.
Frühauf, T., & Wendt, S. (2005). Teilhabe am Arbeitsleben - Grundpositionen im Spiegel aktueller Entwicklungen. In R. Bieker (Hrsg.), Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (S. 348-353). Stuttgart: Kohlhammer.
Gaska, A., & Frey, D. (1993). Berufsbedingte Rollenbeziehungen. In A. E. Auhagen & M. von Salisch (Hrsg.), Zwischenmenschliche Beziehungen (S. 279-298). Göttingen u. a.: Hogrefe.
Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of Personality and Social Psychology, 26(2), 309-320.
Gergen, K. J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. American Psychologist, 40(3), 266-275.
Gergen, K. J. (2002). Konstruierte Wirklichkeiten. Eine Hinführung zum sozialen Konstruktionismus. Stuttgart: Kohlhammer.
Geyer, S. (2003). Forschungsmethoden in den Gesundheitswissenschaften. Eine Einführung in die empirischen Grundlagen. Weinheim; München: Juventa.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA: Sociological Press.
Glaser, B. G. (2002). Constructivist grounded theory? Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 3(3), o. S. Verfügbar unter http://www.qualitative-research.net [16.01.2012].
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. New York u. a.: Aldine de Gruyter.
Glasersfeld, E. von. (1998). Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme (2. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hadolt, B. (2009). Qualitative Datenanalyse mit Atlas.ti. comment, (1), 14-19.
Heidbrink, H., Lück, H. E., & Schmidtmann, H. (2009). Psychologie sozialer Beziehungen. Stuttgart: Kohlhammer.
Heinz, W. R. (1991). Berufliche und betriebliche Sozialisation. In K. Hurrelmann & D. Ulich (Hrsg.), Neues Handbuch der Sozialisationsforschung (4., völlig neubearb. Aufl., S. 397-415). Weinheim und Basel: Beltz.
Hinde, R. (1993). Auf dem Wege zu einer Wissenschaft zwischenmenschlicher Beziehungen. In A. E. Auhagen & M. von Salisch (Hrsg.), Zwischenmenschliche Beziehungen (S. 7-36). Göttingen u. a.: Hogrefe.
Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (Hrsg.). (2008). Handbook of constructionist research. New York u. a.: The Guilford Press.
Hosking, D. M. (2002). Constructing changes: A social constructionist approach to change in work (and beetles and witches). Katholieke Universiteit Brabant.
Hug, T. (2004). Konstruktivistische Diskurse und qualitative Forschungsstrategien. Überlegungen am Beispiel des Projekts Global Media Generations. In S. Moser (Hrsg.), Konstruktivistisch Forschen: Methodologie, Methoden, Beispiele (S. 121-144). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Hug, T. (2011). Die Paradoxie der Erziehung. Theo Hug über den Konstruktivismus in der Pädagogik. In B. Pörksen (Hrsg.), Schlüsselwerke des Konstruktivismus (S. 463-483). VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Hughes, C., Kim, J.-H., & Hwang, B. (1998). Assessing social integration in employment settings: Current knowledge and future directions. American
Journal on Mental Retardation, 103(2), 173-185.
Jahoda, A., Kemp, J., Riddell, S., & Banks, P. (2008). Feelings about work: A review of the socio-emotional impact of supported employment on people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21(1), 1-18.
Jahoda, M. (1984). Braucht der Mensch die Arbeit? In F. Niess (Hrsg.), Leben wir, um zu arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch (S. 11-17). Köln: Bund-Verlag.
Jahoda, M. (1986). Wieviel Arbeit braucht der Mensch? Arbeit und Arbeitslosigkeit im 20. Jahrhundert (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
Jingree, T., Finlay, W. M. L., & Antaki, C. (2006). Empowering words, disempowering actions: An analysis of interactions between staff members and people with learning disabilities in residents’ meetings. Journal of Intellectual Disability Research, 30(3), 212-226.
Kirchler, E., Meier-Pesti, K., & Hofmann, E. (2008). Menschenbilder. In E. Kirchler (Hrsg.), Arbeits- und Organisationspsychologie (2., korr. Aufl., S. 17-195). Wien: Facultas.
Kirmeyer, S. L. (1988). Observed communication in the workplace: Content, source, and direction. Journal of Community Psychology, 16(2), 175-187.
Klicpera, C., & Innerhofer, P. (1992). Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt. Neue Formen der Arbeitsintegration und traditionelle Beschäftigungseinrichtungen. Eine Analyse der Arbeitssituation behinderter Erwachsener in Südtirol und im europäischen Umfeld. Heidelberg: Roland Asanger Verlag.
Kocka, J. (2002). Last und Lust - Arbeit im Wandel. Bundesarbeitsblatt, (7-8), 1-9.
Koenig, O. (2009). Methodologische Aspekte des Forschungsprojekts: Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Behinderung. Vortrag auf dem „Forschungskolloquium des Insituts für Sonderpädagogik“, 13. Mai 2009, Universität Zürich.
Konopásek, Z. (2008). Making thinking visible with Atlas.ti: Computer assisted qualitative analysis as textual practices. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 9(2), o. S. Verfügbar unter http://www.qualitative-research.net [16.01.2012].
Kuckartz, U. (2009). Computergestützte Analyse qualitativer Daten. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), Qualitative Marktforschung (2., überarb. Aufl., S. 713-730). Wiesbaden: Gabler.
Kulig, W., Theunissen, G., & Wüllenweber, E. (2006). Geistige Behinderung. In E. Wüllenweber, G. Theunissen, & H. Mühl (Hrsg.), Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis (S. 116-127). Stuttgart: Kohlhammer.
Lee, C.-J. G. (2011). Reconsidering constructivism in qualitative research. Educational Philosophy and Theory, in Druck. Vorab veröffentlichte Online- Version mit Zulassung verfügbar unter http://onlinelibrary.wiley.com [18.01.2012].
Lewins, A., & Silver, C. (2007). Using software in qualitative research. A step-bystep guide. Los Angeles, Calif. u. a.: Sage Publications.
Lindemann, H. (2006). Konstruktivismus und Pädagogik. Grundlagen, Modelle, Wege zur Praxis. München u. a.: Reinhardt.
Lindmeier, C. (1993). Behinderung - Phänomen oder Faktum? Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Lueger, M. (2009). Grounded Theory. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), Qualitative Marktforschung (2., überarb. Aufl., S. 189-205). Wiesbaden: Gabler.
MacMillan, K., & Koenig, T. (2004). The wow factor: Preconceptions and expectations for data analysis software in qualitative research. Social Science Computer Review, 22(2), 179-186.
Madill, A., Jordan, A., & Shirley, C. (2000). Objectivity and reliability in qualitative analysis: Realist, contextualist and radical constructionist epistemologies. British Journal of Psychology, 91(1), 1-20.
Mangabeira, W. C., Lee, R. M., & Fielding, N. G. (2004). Computers and Qualitative research: Adoption, Use, and Representation. Social Science Computer Review, 22(2), 167-178.
Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press.
Mead, G. H. (1968). Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. (C. W. Morris, Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Medjedović, I. (2008). Sekundäranalyse qualitativer Interviewdaten – Problemkreise und offene Fragen einer neuen Forschungsstrategie. Historical Social Research, 33(3), 193-214.
Meyer, A.-H. (2004). Kodieren mit der ICF: Klassifizieren oder Abklassifizieren? Potenzen und Probleme der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“. Ein Überblick. Heidelberg: Winter.
Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 25-35.
Moser, S. (2004). Konstruktivistisch Forschen? Prämissen und Probleme einer konstruktivistischen Methodologie. In S. Moser (Hrsg.), Konstruktivistisch Forschen: Methodologie, Methoden, Beispiele (S. 9-42). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Muhr, T., & Friese, S. (2004). User’s Manual for ATLAS.ti 5.0. Abgerufen von http://www.atlasti.com/download.html [15.05.2011].
Neuberger, O. (1993). Beziehungen zwischen Kolleg(inn)en. In A. E. Auhagen & M. von Salisch (Hrsg.), Zwischenmenschliche Beziehungen (S. 257-278). Göttingen u. a.: Hogrefe.
Niediek, I. (2008). Ist dabei sein wirklich alles? - Konzeptionelle Anregungen zur Gestaltung von Partizipationsprozessen. Zeitschrift für Heilpädagogik, 59(8), 293-298.
Niehaus, M. (2005). Chancen und Barrieren der Teilhabe gesundheitlich beeinträchtigter und behinderter Menschen im Betrieb. Zeitschrift für Sozialreform, 51(Sonderheft), 73-86.
O’Connor, G. (1983). Presidential address 1983: Social support of mentally retarded persons. Mental Retardation, 21(5), 187-196.
Ohtake, Y., & Chadsey, J. (1999). Social disclosure among coworkers without disabilities in supported employment settings. Mental Retardation, 37(1), 25-35.
Palmowksi, W., & Heuwinkel, M. (2000). „Normal bin ich nicht behindert!“ Wirklichkeitskonstrukte bei Menschen, die behindert werden - Unterschiede, die Welten machen. Dortmund: Borgmann.
Parent, W. S., Kregel, J., Metzler, H. M., & Twardzik, G. (1992). Social integration in the workplace: An analysis of the interaction activities of workers with mental retardation and their co-workers. Education and Training in Mental Retardation, 27(1), 28-38.
Peters, V., & Wester, F. (2007). How qualitative data analysis software may support the qualitative analysis process. Quality and Quantity, 41(5), 635-
Pinetz, P., & Koenig, O. (2009). Berufliche Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung in Österreich. In S. Börner, A. Glink, B. Jäpelt, D. Sanders, & A. Sasse (Hrsg.), Integration im vierten Jahrzehnt. Bilanz und Perspektiven (S. 186-199). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Pörksen, B. (2011a). Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Eine Einführung. In B. Pörksen (Hrsg.), Schlüsselwerke des Konstruktivismus. (S. 13-28). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Pörksen, B. (Hrsg.). (2011b). Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Puddephatt, A. J. (2006). An interview with Kathy Charmaz: On constructing grounded theory. Qualitative Sociology Review, 2(3), 5-20.
Raskin, J. D. (2002). Constructivism in psychology: Personal construct psychology, radical constructivism, and social constructionism. American Communication Journal [Online Journal], 5(3), o. S. Verfügbar unter http://www.ac-journal.org [07.06.2011].
Rühl, S. (o. J.). Atlas.ti - Einführung. Version 5.0. Überarbeitete und gekürzte Fassung von Strübing (1997).
Rusch, F. R., Hughes, C., Johnson, J. R., & Minch, K. E. (1991). Descriptive analysis of interactions between co-workers and supported employees. Mental Retardation, 29(4), 207-212.
Schmidt, S. J. (1994). Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schmidt-Denter, U. (2005). Soziale Beziehungen im Lebenslauf (4., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2008). Methoden der empirischen Sozialforschung (8., unveränd. Aufl.). München; Wien: Oldenbourg.
Schubert, H.-J. (1996). Arbeitsgestaltung für behinderte Menschen. In E. Zwierlein (Hrsg.), Handbuch Integration und Ausgrenzung. Behinderte Menschen in der Gesellschaft (S. 510-515). Neuwied u. a.: Luchterhand.
Schwandt, T. A. (1998). Constructivist, interpretivist approaches to human inquiry. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), The landscape of qualitative research: Theories and issues (Bd. 1, S. 221-259). Thousand Oaks, Calif. u. a.: Sage Publications.
Siebert, H. (2005). Pädagogischer Konstruktivismus (3., überarb. und erw. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
Speck, O. (2005). Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung (10., überarb. Aufl.). München u. a.: Reinhardt.
Speck, O. (2008). System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung (6., überarb. Aufl.). München u. a.: Reinhardt.
St. John, W., & Johnson, P. (2000). The pros and cons of data analysis software for qualitative research. Journal of Nursing Scholarship, 32(4), 393-397.
Stewart, N. (1985). Winning friends at work. New York: Ballantine Books.
Stöpel, F. (2005). Bedingungen des Arbeitsmarktes für die berufliche Teilhabe. Sonderpädagogik, 35(1), 18-32.
Strauss, A. L. (2004). Methodologische Grundlagen der Grounded Theory. In J. Strübing (Hrsg.), Methodologie interpretativer Sozialforschung. Klassische Grundlagentexte (S. 429-450). Konstanz: UVK.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. An overview. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), Handbook of qualitative research (S. 273-285). Thousand Oaks, Calif. u. a.: Sage Publications.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1996). Grounded Theory. Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz, Psychologie-Verl.-Union.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2. Aufl.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Strübing, J. (1997). ATLAS/ti-Kurs. Einführung in das Arbeiten mit ATLAS/ti für Windows95 Versionen 4.0 und 4.1. Mitteilungen aus dem Schwerpunktbereich Methodenlehre, Heft 48. Berlin: Freie Universität.
Strübing, J. (2008). Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung (2., überarb. und erw. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Talja, S., Tuominen, K., & Savolainen, R. (2005). „Isms“ in information science: Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation, 61(1), 79-101.
Theunissen, G. (2000). Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten (3., stark erw. und überarb. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Theunissen, G. (2009). Soziale Teilhabe aus pädagogischer Sicht. In Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen und Pädagoginnen e.V. (Hrsg.), Teilhabe gestalten. Kongressbericht. XXXIV. Kongress vom 14.-18.Juli 2008 in Hannover (S. 93-99). Würzburg: Edition Bentheim.
Thomas, W. I., & Thomas, D. S. (1928). The child in America. New York: Alfred A. Knopf.
Thompson, R. (2002). Reporting the results of computer-assisted analysis of qualitative research data. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], 3(2), o. S. Verfügbar unter http://www.qualitative-research.net [16.01.2012].
Traut-Mattausch, E., & Frey, D. (2011). Kommunikation. Sozialpsychologie - Interaktion und Gruppe (S. 161-180). Göttingen u. a.: Hogrefe.
Van Maanen, J. (1988). Tales of the field: on writing ethnography. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Wacker, E. (2005). Selbst Teilhabe bestimmen? In E. Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.), Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein (S. 11-19). Marburg: Lebenshilfe.
Wacker, E., & Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.). (2005). Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Wacker, E., Wansing, G., & Hölscher, P. (2003). Maß nehmen und Maß halten – in einer Gesellschaft für alle (I). Von der Versorgung zur selbstbestimmten Lebensführung. Geistige Behinderung, 42(2), 108-118.
Walker, D., & Myrick, F. (2006). Grounded theory: An exploration of process and procedure. Qualitative Health Research, 16(4), 547-559.
Wansing, G. (2005). Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (2000). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien (10., unveränd. Aufl.). Bern: Huber.
Wayne, S. J., & Linden, R. C. (1995). Effects of impression management on performance ratings: A longitudinal study. Academy of Management Journal, 38(1), 232-260.
Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr.
Weitzman, E. A. (2000). Software and qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Hrsg.), Handbook of qualitative research (2. Aufl., S. 803-820). Thousand Oaks, Calif. u. a.: Sage Publications.
Westmeyer, H. (2011). Communicamus ergo sum oder Am Anfang stehen die Beziehungen. Hans Westmeyer über Kenneth Gergens Konstruierte Wirklichkeiten. In B. Pörksen (Hrsg.), Schlüsselwerke des Konstruktivismus. (S. 411-424). VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
Whitehouse, R., Chamberlain, P., & O’Brien, A. (2001). Increasing social interactions for people with more severe learning disabilities who have difficulty developing personal relationships. Journal of Learning Disabilities, 5(3), 209-220.
WHO. (1980). International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Genf: WHO.
Williams, V., Ponting, L., Ford, K., & Rudge, P. (2009). ‘A bit of common ground’: Personalisation and the use of shared knowledge in interactions between people with learning disabilities and their personal assistants. Discourse Studies, 11(5), 607-624.
Young, R. A., & Collin, A. (2004). Introduction: Constructivism and social constructionism in the career field. Journal of Vocational Behavior, 64(3), 373-388.
Zuriff, G. (1998). Against metaphysical social construtionism in psychology. Behavior and Philosophy, 16(1-2), 5-28.
Inhaltsverzeichnis
Transkriptionsrichtlinien[22]
Allgemeine Hinweise
-
Die Transkription eines Interviews sollte möglichst exakt, jedoch ohne Beibehaltung des Dialekts oder sprachlicher Eigenheiten durchgeführt werden. Hiervon ausgenommen sind Wörter, für die es keine eindeutige Übersetzung ins Hochdeutsche gibt. Diese werden in der Transkription ausgeschrieben und mit einer Anmerkung des/der TranskriptverfasserIn versehen, der das äquivalente hochdeutsche Wort zu entnehmen ist.
Beispiel: IPXX: Und dann hat mir der Götte [Anm. C.S. Onkel/Taufpate]
-
Dialekte und sprachliche Eigenheiten werden im Transkriptionskopf vermerkt. Sollte die Mundsprache nicht verstanden werden, so ist dies ebenfalls im Transkriptionskopf zu vermerken.
Beispiel: A. spricht sehr schnell, sein Dialekt wird im Laufe des Interviews immer intensiver, dadurch wird er schwerer zu verstehen. Da die transkribierende Person den Dialekt nicht versteht, könnten einige Aussagen falsch verstanden worden sein.
Format der Transkription
Die Transkripte sind im RTF-Format abzuspeichern. Für die Formatierung gelten folgende Richtlinien:
-
Der Transkriptionskopf befindet sich am Beginn des Dokuments und ist mittels Trennlinie deutlich erkennbar vom Interviewtranskript abzugrenzen.
-
Von einer Zeilennummerierung im Transkript ist Abstand zu nehmen, da eine solche im Softwareprogramm Atlas.ti vorgesehen ist.
-
Zeitmarken sind unbedingt auszuschalten.
-
Seitenränder: oben: 70,85 pt; unten: 56,7 pt; links und rechts: 70,85 pt (Word-Dokument Standard Einstellung)
-
Schriftart: Arial
-
Schriftgröße: 12 pt
-
Einfacher Zeilenabstand
-
Zwischen den wechselnden Aussagen wird jeweils eine Zeile Abstand gelassen
Beispiel:
I: Und wie ist es dir ergangen?
IPXX: Gut.
Kennzeichnung der sprechenden Personen
I: kennzeichnet Aussagen der interviewführenden Person im Transkript. Diese sind zur Gewährleistung einer besseren Lesbarkeit stets fett hervorzuheben.
IPXX: kennzeichnet Aussagen der interviewten Person im Transkript. Zur Gewährleistung der Anonymität bekommt jede Interviewperson eine Nummer zugewiesen, die anstelle des Platzhalters „XX“ einzufügen ist.
M: kennzeichnet Aussagen der Mutter im Transkript.
V: kennzeichnet Aussagen des Vaters im Transkript.
Weitere Personen sowie deren Abkürzung werden im Transkriptionskopf vermerkt. Empfehlenswert ist es, den ersten Buchstaben ihrer Beziehung zur Interviewperson zu verwenden, z.B. „S“ für Schwester oder „F“ für Freund.
Kennzeichnung von Pausen
/Pausen mit einer Dauer von weniger als 2 Sekunden
//Pausen mit einer Dauer von 2-3 Sekunden
///Pausen mit einer Dauer von über drei Sekunden
Kennzeichnung nichtverbaler Äußerungen (z.B. Lachen, Husten)
Wiedergabe kursiv, in runder Klammer und an der Stelle im Transkript, an der sie beim Abhören des Tonbandes auftreten;
Beispiel:
IPXX: (lacht, Stimme wird ganz leise)
Kommentare
Bspw. zur Kennzeichnung von auffälligen Betonungen oder zum Festhalten von Eindrücken des Transkribierenden; Angabe kursiv, in eckiger Klammer;
Beispiel 1:
IPXX: (lacht) [ironisch]
Beispiel 2:
IPXX: Ich [Wort wird betont] wollte schon.
Kennzeichnung eines nicht beendeten Wortes
mit Glottalverschluss;
Beispiel:
IPXX: Dann ha’…
Kennzeichnung eines nicht beendeten Satzes
mit Bindestrich;
Beispiel:
I: Was hast - Kannst du mir einmal am Anfang erzählen…?
Kennzeichnung Situationsspezifischer Geräusche
Angabe in spitzer Klammer;
Beispiel:
>Telefon läutet<
Hörersignale
bzw. gesprächsgenerierende Beiträge; als normalen Text anführen;
Beispiel:
I: Mhm.
IPXX: Äh…
Unverstandenes
mit [unverst.] kennzeichnen und die Dauer des unverstandenen Abschnitts beim Abhören des Tonbandes angeben;
Beispiel:
IPXX: Und erst als [unverst. 4 Sek.] konnten wir […]
Vermuteter Wortlaut
nach schlecht verständlichen Stellen in Klammer schreiben: [unverst. etwa so];
Beispiel:
IPXX: Halt, einen Betreuer haben wir da halt gehört [unverst. etwa so]…
Gleichzeitiges Sprechen:
Wenn die interviewführende Person der interviewten Person ins Wort fällt oder umgekehrt, ist die Stelle, an der die Unterbrechung beim Abhören des Tonbandes auftritt, im Transkript zu unterstreichen.
Beispiel:
I: Du, [A], da bist du ja ziemlich daran gehangen, gell?
IP09: Ja.
IP09: Ich bin sehr schwer weggegangen.
Anonymisierung
Für die Anonymisierung der Transkripte gelten folgende Richtlinien:
-
Zur Gewährleistung der Anonymität bekommt jede Interviewperson eine Nummer zugewiesen. Weder ihr Name noch ihre Initialen werden im anonymisierten Transkript angeführt. Wird im Interview der Vor- oder Nachname ausgesprochen, so wird dies mit [Vorname] bzw. [Nachname] gekennzeichnet.
Beispiel 1:
I: Lieber Max, erzähle mir deine Lebensgeschichte.
Anonymisierung:
I: Lieber [Vorname], erzähle mir deine Lebensgeschichte.
Beispiel 2:
IPXX: Ja, also ich bin der Max Mustermann.
Anonymisierung:
IPXX: Ja also ich bin der [Vorname] [Nachname].
-
Auch Namen anderer Personen, Orte, Altersangaben, Daten, Institutionen und Arbeitsstellen sind zu anonymisieren. Dabei wird jeweils nach dem Alphabet vorgegangen. Die zugewiesenen Bezeichnungen sind im Verlauf eines Interviews, aber auch über mehrere Interviews mit derselben Interviewperson hinweg beizubehalten. Das heißt, wenn beispielsweise der Ort Wien im 1. Interview mit der IPX1 mit A(O) anonymisiert wird, so ist diese Bezeichnung bei erneuter Nennung des Orts Wien im selben oder in nachfolgenden Interviews mit der IPX1 weiterhin zu verwenden.
-
Personen-Namen sind wie folgt zu anonymisieren: die erste im Transkript erwähnte Person erhält die Bezeichnung A(P), die zweite die Bezeichnung B(P) usw. Zusätzlich ist das jeweilige Geschlecht mit „m“ bzw. „w“ kenntlich zu machen.
Beispiel:
IPXX: Da war ich weg mit Max, Klara, Susi und Peter und dann habe ich mich dort mit Susi gestritten weil sie […]
Anonymisierung:
IP11: Da war ich weg mit A(Pm), B(Pw), C(Pw) und D(Pm) und dann habe ich dort mit C(Pw) gestritten weil sie […]
-
Orte (z.B. Städte, Dörfer, Länder) sind wie folgt zu anonymisieren: der erste im Transkript erwähnte Ort erhält die Bezeichnung A(O), der zweite die Bezeichnung B(O) usw.
Beispiel:
IPXX: Jetzt wohne ich in Albertschwende und vorher haben wir in Dornbirn gewohnt. Aber mein Vater, der arbeitet noch immer in Dornbirn und meine Mutter in Bregenz.
Anonymisierung:
IPXX: Jetzt wohne ich in A(O) und vorher haben wir in B(O) gewohnt. Aber mein Vater, der arbeitet noch immer in B(O) und meine Mutter in C(O).
-
Altersangaben sind wie folgt zu anonymisieren: das erste im Transkript erwähnte Alter erhält die Bezeichnung A(A), das zweite die Bezeichnung B(A) usw.
Beispiel:
IPXX: Ich bin 35 Jahre alt. Mein Bruder ist 32, meine Schwester 28.
Anonymisierung:
IPXX: Ich bin A(A) Jahre alt. Mein Bruder ist B(A), meine Schwester C(A).
-
Daten sind wie folgt zu anonymisieren: das erste im Transkript erwähnte Datum erhält die Bezeichnung A(D), das zweite die Bezeichnung B(D) usw.
Beispiel:
IPXX: Ich wurde am 16. 05. 1986 geboren. Seit dem 13. 11. 2002 wohne ich in einer eigenen Wohnung.
Anonymisierung:
IPXX: Ich wurde am A(D) geboren. Seit dem B(D) wohne ich in einer eigenen Wohnung.
-
Institutionen sind wie folgt zu anonymisieren: die erste im Transkript erwähnte Institution erhält die Bezeichnung [A], die zweite die Bezeichnung [B] usw.
Beispiel:
IPXX: Ich war dann bei der Lebenshilfe und bei der Caritas, […]
Anonymisierung:
IPXX: Ich war dann bei der [A] und bei der [B], […]
-
Arbeitsstellen sind ebenfalls nach dem Alphabet zu anonymisieren, wobei in eckiger Klammer eine Anmerkung zur jeweiligen Branchenbezeichnung angefügt wird. (Branchenverzeichnis siehe: http://portal.wko.at/wk/branchen.wk?ftyp=3 [zuletzt aufgerufen am 29.09.2011])
Beispiel
IPXX: Ich arbeite beim Spar und vorher habe ich beim H&M gearbeitet. Aber mein Traum wäre es bei einem Tierarzt zu arbeiten.
Anonymisierung:
IPXX: Ich arbeite beim A [Anm. C.S. Lebensmittelhandel] und vorher hab ich beim B [Anm. C.S. Modehandel] gearbeitet. Aber mein Traum wäre es bei einem Tierarzt zu arbeiten.
-
Die Anonymisierung ist in einem extra Beiblatt (siehe Vorlage auf der Lernplattform Moodle) genau festzuhalten, um die Nachvollziehbarkeit für die weitere Interviewführung zu gewährleisten.
In Anbindung an das Forschungsprojekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ untersucht diese Arbeit Erfahrungen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Lebensbereich Arbeit im sozialen Umgang mit anderen Personen machen, hinsichtlich ihrer Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe. Dies erfolgte über die computergestützte Analyse von bereits erhobenem Interviewmaterial nach dem konstruktionistischen Ansatz der Grounded Theory von Kathy Charmaz. Im Zuge der Datenanalyse wurden drei Hauptkategorien von interaktionellen Erfahrungen entwickelt, die den alltäglichen zwischenmenschlichen Umgang bei der Arbeit, den Umgang mit arbeitsbezogenen Wünschen oder Problemen und das Erhalten von Unterstützung im Lebensbereich Arbeit betreffen. Darüber hinaus zeigten sich nicht-soziale Aspekte, die den Inhalt, das Ausmaß, die Umgebung von Arbeit sowie die Arbeitsweise betreffen, als relevant für das Erleben beruflicher Teilhabe.
In connection to the research project „Experiences of participation in the vocational biography of persons with an intellectual disability“, this thesis investigates social interaction experiences of people with intellectual disabilities in their working lives and their relevance for experiencing vocational participation. This was done through computer-assisted analysis of already collected interview data, working with the constructionist grounded theory approach of Kathy Charmaz. The analysis revealed three main categories of interactional experiences concerning interpersonal dealings in everyday working, the handling of work-related desires or troubles, and receiving work-related support. In addition to interactional experiences, other aspects of work, relating to its content, extent, environment and the way of working, were identified as relevant for experiencing vocational participation.
-
17. Sept. 1988: Geburt in Wien, Österreich
Ausbildung
-
voraussichtl. Mai 2012: Abschluss des Diplomstudiums Pädagogik mit den Schwerpunkten Heilpädagogik und Integrative Pädagogik und Aus- und Weiterbildungsforschung
-
1. Sept. 2009 - 31. Mai 2010: Erasmus-Auslandsstudienjahr an der University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
-
31. Okt. 2008: Erste Diplomprüfung (Pädagogik), mit Auszeichnung bestanden
-
27. Juni 2008: Erste Diplomprüfung (Psychologie), mit Auszeichnung bestanden
-
seit Okt. 2006: Diplomstudium Psychologie, Diplomstudium Pädagogik und Diplomstudium Romanistik - Französisch an der Universität Wien
-
Juni 2006: Matura am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien 21, Franklinstraße 26 mit ausgezeichnetem Erfolg
Weiterbildung
-
5. - 8. Juli 2011: Projektmanagement: Seminar im Zeitausmaß von 24 Stunden aus dem Fortbildungsangebot der Medizinischen Universität Wien
Praktika
-
Apr. - Juni 2009: Wissenschaftliches Praktikum am Institut für Bildungspsychologie, Fakultät für Psychologie, Universität Wien
-
Aug. - Sept. 2008: Psychologisches Pflichtpraktikum an der Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Wien
-
März - Juni 2008: Supervidiertes Praktikum im Dachverband Österreichische Autistenhilfe, Wien
-
Juli 2007: Auslandspraktikum in der Personalabteilung von Wolseley France, Paris
Berufstätigkeit
-
März - Juni 2011, Sept. - Dez. 2011: Wissenschaftliche Projektmitarbeit am Institut für Umwelthygiene, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien für das EU Projekt iSPACE (innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environment)
-
Feb. - Aug. 2011: Freiberufliche Mitarbeit bei Great Place to Work®, Wien
[22] abgewandelt nach einer Zusammenstellung von Frau Mag. Postek (2010) für das Projekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“.
Ich, Cornelia Siegl, erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. Ich versichere weiters, dass ich diese Diplomarbeit bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe.
Wien, im Februar 2012Cornelia Siegl
Quelle
Cornelia Siegl: „Interaktionelle Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext und deren Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe.“ Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magistra der Philosophie (Mag. phil.), Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer, 2012.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 27.10.2015