Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie eingereicht von Karin Maria Schiefer bei Ao. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese, Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold-Franzen-Universität Innsbruck
Inhaltsverzeichnis
- Dank
- 1. Einleitung
- 2. Selbstbestimmung
- 3 Empowerment
- 4. Identität
- 5. Fremdbestimmung in Einrichtungen und Institutionen
- 6. Historizität und Ambivalenz des Autonomiekonzepts
- 7. Autopoiese
- 8. Das Modell der Persönlichen Assistenz
- 9. Darstellung der Untersuchung
-
10. Darstellung der Ergebnisse
- 10.1 Überblick über die InterviewpartnerInnen
-
10.2 Vergleich der Ergebnisse anhand der Kategorien
- 10.2.1 Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung
- 10.2.2 Unterstützung von der Umwelt
- 10.2.3 Selbstbestimmung im Bereich Wohnen
- 10.2.4 Selbstbestimmung im Bereich Arbeit/Beruf
- 10.2.5 Selbstbestimmung im Bereich Freizeit
- 10.2.6 Grenzen der Selbstbestimmung
- 10.2.7 Eigenverantwortlichkeit
- 10.2.8 Fremdbestimmung
- 10.2.9 Zugewinn an Selbstbestimmung durch Persönliche Assistenz
- 10.2.10 Anforderungen des Assistenzmodells an die AssistenznehmerInnen
- 10.2.11 Einblicke in persönliche und intime Bereiche des Lebens
- 10.2.12 Abhängigkeit von AssistentInnen
- 10.2.13 Unabhängigkeit von Freunden und Familie
- 10.2.14 Nachteile
- 11. Darstellung der Forschungsfragen und Veränderungsvorschläge
-
12. Schlussfolgerungen und Diskussion der Ergebnisse
- 12.1 Zusammenhang Lebensqualität Selbstbestimmung
- 12.2 Selbstbestimmung als ambivalentes Konzept
- 12.3 Selbstbestimmung und Identität: Stigma-Identitäts-These
- 12.4 Selbstbestimmung als Grundrecht und seine biologische Legitimierung
- 12.5 Kern des Selbstbestimmungsgedanken
- 12.6 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Barrierefreiheit
- 12.7 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Information
- 12.8 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Eigene Bedürfnisse kennen
- 12.9 Grenzen der Selbstbestimmung und Behinderung als soziale Konstruktion
- 12.10 Selbstbestimmung in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit
- 12.11 Selbstbestimmung, Kontakthypothese und Inklusion
- 12.12 Unabhängigkeit und Entlastung von Freunden, Familie und LebenspartnerIn
- 12.13 Kontinuität der Assistenzbeziehungen
- 12.14 Verletzlichkeit der Assistenzbeziehung
- 12.15 Anforderungen an die AssistenznehmerInnen und Erweiterung des Modells
- 12.16 Widerspruch zur Zielsetzung des Assistenzmodells
- 12.17 ExpertInnen in eigener Sache
- 12.18 Voraussetzungen AssistentInnen und Empowerment
- 12.19 AssistentInnen: Zwischen Entgrenzung Person/Arbeitskraft und Instrumentalisierung
- 12.20 Unterschied zwischen den Geschlechtern: Nähe- Distanzbalancierung
- 12.21 Persönliche Assistenz als Schlüsselbegriff für Selbstbestimmung
- 12.22 Sensibilisierung für Selbstbestimmung
- 13 Perspektive für die Praxis: Veränderungsvorschläge für das Assistenzmodell
- 14 Resümee
- Literaturverzeichnis
- Eidesstattliche Erklärung
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Lebenslauf
Zuallererst möchte ich meinen InterviewpartnerInnen danken. Ohne sie wäre diese Diplomarbeit nicht möglich gewesen. Ich möchte mich bedanken für ihre Offenheit und dafür, dass sie ein Stück ihrer Lebenswelt mit mir geteilt haben. Diese Gespräche sind nicht nur die Grundlage dieser Diplomarbeit, sondern waren auch für mich persönlich eine wertvolle Erfahrung.
Danken möchte ich ebenso Dr. Volker Schönwiese für seine umsichtige Betreuung. In Phasen, in denen ich unsicher war, hat er mir die notwendige Orientierung gegeben. Er hat mir aber auch genügend Freiraum für meine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt.
An dieser Stelle möchte ich aber auch den Machern und Betreibern von ‚bidok', der digitalen Volltextbibliothek, danken. Dadurch war zu jeder Zeit ein Zugriff auf wissenschaftliche Arbeiten, Beiträge aus Zeitschriften und Büchern, Berichte usw. möglich, welche maßgeblich zum Gelingen der vorliegenden Diplomarbeit beigetragen haben.
Autonomie gehört zum ureignen Wesen des Menschen. Die Verletzung seiner Autonomie richtet sich letztlich gegen sein Menschsein, seine einmalige Weise Person zu sein und nimmt ihm so seine Identität. (Haupt 2007, S. 60)
Der Mensch ist Subjekt, ist Selbst, und deshalb ist seine prinzipielle Potenz zur Selbstbestimmung oder Autonomie zu respektieren. Es fällt - oder besser gesagt: es fiel - immer wieder schwer, z.B. hinter einer sogenannten geistigen Behinderung die Befähigung zur Selbstverwirklichung, zur vernünftigen Wahlentscheidung zu bestätigen. Dies dürfte vor allem mit der Selbstüberschätzung des nichtbehinderten Menschen zusammenhängen; denn alle realisierte Autonomie des Menschen kann immer nur eine relative und begrenzte sein. Alle Selbstbehauptung steht in der Spannung zu den Bedingungen und Normen in der Umwelt. Mag auch die Selbstentwicklung durch eine psycho-physische Schädigung noch so sehr eingeschränkt sein und deshalb in stärkerem Maße Fremdbestimmung als mitmenschliche Sorge bedingen, die subjektive Potenz für Selbstverantwortung, die Selbstbezüglichkeit, kann nicht negiert werden. (Speck 1988, S. 209f)
Im Gegenteil: Es ist jede sinnvolle Chance zu nutzen, diese prinzipielle Potenz anzusprechen und zu respektieren, und Erziehung an diesem zentralen Bedürfnis nach Autonomie im Gleichgewicht mit einer unverzichtbaren Anpassung an die Umwelt, das Bedürfnis also nach innerer Freiheit, zu orientieren. (ebd. S. 110) Es geht dabei um die Unterstützung der Selbstorganisation, die der Mensch als sich selbst organisierendes System in Wechselwirkung mit der Umwelt zu leisten hat. Diese Selbstorganisation ist im Besonderen auf "Selbsterneuerung" und "Selbsttranszendenz" gerichtet, d.h. auf die Fähigkeit, "durch die Vorgänge des Lernens, der Entwicklung und der Evolution kreativ über die eigenen physischen und geistigen Grenzen hinauszugreifen" (Capra 1985, S. 298)
Das menschliche Leben ist wesentlich gekennzeichnet durch ein Streben nach größtmöglicher Unabhängigkeit. Dieser Prozess sollte mit Erreichen des Erwachsenenalters abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt liegt der verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen Freiräumen in den Händen jedes einzelnen Individuums.
Die somit als wesenhaft zum Menschen gehörende Selbstbestimmung bildet die Grundlage für menschliches Wohlbefinden, welches in engem Zusammenhang mit der Befriedigung von Bedürfnissen, dem subjektiv sinnvollen Erleben des eigenen Wirkens und der Möglichkeit zur Integration steht (vgl. Hahn 1994, 82ff). Eine grundlegende Gefährdung des Wohlbefindens besteht zu jeder Zeit, wenn Autonomie untersagt wird:
-
Eigene Bedürfnisbefriedigung ist nicht mehr gewährleistet, da die notwendigen Bedürfnisse durch andere festgelegt werden.
-
Das eigene Wirken wird ersetzt durch fremdbestimmte Vorgaben, die aus eigener Sicht nicht unbedingt als sinnvoll betrachtet werden können.
-
Integration an sich ist "ohne der Verantwortlichkeit angemessenen Selbstbestimmung im eigentlichen Sinne nicht möglich" (Hahn 1994, S. 86)
Selbstbestimmung nimmt somit einen hohen Stellenwert im menschlichen Leben ein. Sie ist notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen Identität und deren Integration. Sie ist die Basis für Unabhängigkeit und Freiheit und somit jedem Menschen uneingeschränkt zuzusprechen.
Mit der Etablierung des Unterstützungskonzepts "Persönliche Assistenz" ist das Ziel von Menschen mit einer Behinderung verbunden, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Hinwendung zu dieser Unterstützungsform erfolgte vor dem Hintergrund einer Abwendung von herkömmlichen Versorgungsformen, die als entmündigend, fremdbestimmend und bevormundend erlebt wurden bzw. werden. Die Idee der Persönlichen Assistenz ist dabei eng mit einer Bewegung verbunden, in der sich körperbehinderte Menschen begannen gegen ihre alltäglichen Diskriminierungen zu wehren. Wesentlich dabei war auch die Abkehr von Institutionen, in deren Vordergrund eine als völlig unakzeptabel empfundene Betreuung der Bewohner stand, die letztlich auf eine Versorgung über einen so gering wie möglichen personellen und arbeitsorganisatorischen Aufwand hinauslief. Im Mittelpunkt des Assistenzmodells steht demgegenüber der Wunsch nach Lebensqualität. Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund eines gewandelten Verständnisses von Behinderung, das den Fokus auf die sozialen Aspekte von Behinderung lenkte. Behinderung ist vor allem gesellschaftlich bedingt, weil es in erster Linie gesellschaftliche und nicht körperliche Hindernisse sind, die Menschen mit einer Behinderung die Teilhabe am sozialen Leben erschweren. Persönliche Assistenz soll nun mit dazu beitragen, dieser Form von Behinderung entgegenzuwirken und behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Als wichtige Voraussetzung hierfür wird im Modell eine Umkehr der sonst für Pflegeverhältnisse üblichen Asymmetrie zwischen Personal und Hilfeempfänger angestrebt.
Die folgenden Fragestellungen sollen in dieser Arbeit untersucht werden:
-
Was bedeutet Selbstbestimmung für die AssistenznehmerInnen allgemein und im Besonderen für Menschen mit Behinderung? Welchen Stellenwert hat Selbstbestimmung im Leben der AssistenznehmerInnen?
-
Welche Voraussetzungen müssen Persönliche AssistentInnen mitbringen? Welche Kriterien machen eine/n gute/n Persönliche/n AssistentIn aus?
-
Persönliche Assistenz soll nach den Bedürfnissen der AssistenznehmerInnen ausgerichtet sein. Wie sieht die Umsetzung dieser Vorgabe in der Praxis aus? Fällt es den AssistenznehmerInnen leicht bzw. schwer eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu äußern?
-
Wie gehen AssistenznehmerInnen mit der Nähe um, die durch das besondere Arbeitsverhältnis zwischen AssistentInnen und AssistenznehemerInnen entstehen kann? Wie leicht bzw. schwer fällt die Nähe- Distanzbalancierung?
Inhaltsverzeichnis
Das Konzept der Selbstbestimmung von Menschen mit einer Behinderung stellt eine Denk- und Lebensweise dar, die von Betroffenen selbst geprägt wurde und ihnen ein eindeutiges Recht auf Selbstvertretung einräumt (Miles-Paul 1992, S. 9). Im Kontext des Selbstbestimmt- Leben-Paradigmas verstehen sich Menschen mit einer Behinderung als ExpertInnen in eigener Sache, die die von ihnen benötigten Hilfen selbstbestimmt mittels Schaffung echter Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens in allen Bereichen organisieren wollen. (Franz 2002, S. 15)
Der Wortteil "Selbst" bildet sich erst im 18. Jahrhundert, also zur Zeit der Aufklärung, zu einem eigenständigen Begriff heraus. Um ihn herum entfaltet sich relativ schnell eine große Wortfamilie. Seine Bedeutung veränderte sich von einem Demonstrativpronomen weg, hin zu seinem heutigen reflexiven Bedeutungsinhalt (vgl. Waldschmidt 2003, im Internet). Mit dem Begriff des "Selbst" verbindet sich auch eine moderne Vorstellung der Identität und des Subjekts.
"Wie in einen Spiegel schauend entdeckt das Individuum sein "Ich" seine "Identität", kurz sein "Selbst". (ebd.)
Der Wortteil "Bestimmung" besitzt zwei eng verbundene Bedeutungsebenen: Einmal den Befehl über etwas im Sinne personaler Macht und zum anderen, die Benennung von etwas im Sinne von Klassifikation. Waldschmidt interpretiert die sprachgeschichtliche Entwicklung von Selbstbestimmung zusammenfassend wie folgt:
"Somit verweist Selbstbestimmung von der Wortgeschichte her auf ein einzelnes Wesen, das sich erkennt, indem es sich definiert und zugleich Macht über sich ausübt. In anderen Worten, der Selbstbestimmungsbegriff bündelt selbstreferentielle, erkenntnistheoretische und individualistische Facetten sowie Aspekte von Macht und Herrschaft." (Waldschmidt 2003, im Internet)
Der Begriff "Autonomie" wird meist synonym zum Selbstbestimmungsbegriff verwendet. Mit den Bestandteilen "autos" (selbst) und "nomos" (Gesetz) bezeichnet dieser Begriff, ‚das Recht, sich selbst Gesetze zu geben', allgemeiner: ‚das Recht, nach eigenem Gesetz zu leben'. (Ungern-Sternberg 2009, S. 139)
Das Konzept von "independent living" bzw. das Konzept selbstbestimmter "persönlicher Assistenz" wird in seiner klassischen Formulierung wie folgt beschrieben:
"Selbstbestimmt leben heißt, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren. Das schließt das Recht ein, seine eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, an dem öffentlichen Leben der Gemeinde teilzuhaben, verschiedenste soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen fällen zu können, ohne dabei in die psychologische oder körperliche Abhängigkeit anderer zu geraten. Unabhängigkeit ('Independence') ist ein relatives Konzept, das jeder persönlich für sich bestimmen muß." (Definition der amerikanischen 'independent-living-Bewegung' nach Frehe 1990, S.37)
"Selbstbestimmt Leben" umschreibt eine Lebenshaltung von Menschen mit einer Behinderung und ist darüber hinaus Kennzeichen einer neuen sozialen Bewegung, der "Selbstbestimmt-Leben-Bewegung" (Franz 2002, S. 16). Selbstbestimmung im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist ein Prinzip und ein Gegenbegriff zu Fremdbestimmung. Das Konzept "Selbstbestimmt Leben" ist Ausdruck des veränderten Selbstverständnisses von Menschen mit einer Behinderung und kann zugleich auch als Forderung gegen Fremdbestimmung, Diskriminierung und Aussonderung verstanden werden. In den meisten Fällen sind daher nicht unmittelbar selbst betroffene, insbesondere professionelle Kräfte aus der Arbeit mit behinderten Menschen, explizit aus der Bewegung ausgeschlossen (vgl. Rohrmann 1994, S. 20). Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung steht für eine gesellschaftliche Mitwirkung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne selbstbestimmter Wahlmöglichkeiten in allen Lebensbereichen. (vgl. Franz 2002, S. 16) Als einer der führenden Vertreter der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung definiert Steiner (1999) Selbstbestimmung als "[...] das Recht, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen" (ebd. S. 104).
Rund um den Selbstbestimmungsgedanken sind seit Mitte der 80iger Jahre verstärkt konzeptionelle Ausarbeitungen entstanden, behinderte Menschen wagen unter dem Stichwort "Selbstbestimmt Leben" den Auszug aus dem Heim und organisieren die benötigten Hilfen selbst (vgl. Waldschmidt 1999, S. 10). Waldschmidt stellt fest, dass der zu Grunde liegende Begriff der Selbstbestimmung dabei aber nicht eindeutig zu definieren ist.
"Der Selbstbestimmungsbegriff ist offen für sehr unterschiedliche, ja widersprüchliche Inhalte, Deutungen und Praktiken. Statt ein festgefügtes, präzise definiertes Grundrecht darzustellen, scheint es sich eher um ein formales Konstrukt zu handeln, dessen konkrete, inhaltliche Bedeutung sich nur in Operationalisierungen erschließt, in Bezug auf die jeweilige Praxis, die sich aus ihm ergibt, die wiederum abhängig ist von gesellschaftlichen und institutionellen Kontexten". (ebd., S. 10)
Diese Auslegung des Selbstbestimmungsbegriffes findet sich bei Steiner (1999) wieder, wenn dieser darauf hinweist, dass der Begriff der Selbstbestimmung behinderter Menschen immer auch im Zusammenhang mit den Behindertenhilfesystem definiert werden muss, da die Institutionen der Behindertenhilfe fast immer dem Grundgedanken der Selbstbestimmung entgegenwirken (vgl. ebd., S. 104). Dabei meint Selbstbestimmung nie ein Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern ist vielmehr zu verstehen als ein von institutionellen, sachlichen und personellen Zwängen unabhängiges Treffen von Entscheidungen. Steiner definiert Selbstbestimmung im Leben behinderter Menschen daher wie folgt:
"Kein Mensch auf dieser Welt - gleich ob behindert oder nichtbehindert - ist gänzlich selbstbestimmt. Aber für behinderte Menschen ist entscheidend, dass in der Aneignung von Selbstbestimmung, Fremdbestimmung und Bevormundung keine Rolle spielen. Wenn sich dieser Rahmen findet und zwar ohne Wenn und Aber, dann eignen sich Menschen Selbstbestimmung an". (Steiner 1999, S. 109)
Selbstbestimmung ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Selbständigkeit. Den Unterschied beschreibt Haeberlin (1996) wie folgt.
"'Selbständigkeit" als optimale Unabhängigkeit von Unterstützung ist ein objektiver Tatbestand und als solcher beobachtbar und messbar. ‚Selbstbestimmung' hingegen ist ein subjektives Lebensgefühl und als solches nicht beobachtbar und messbar. ‚Selbständigkeit' ist durch geplante Ausbildung optimierbar. ‚Selbstbestimmung' hingegen als individuell erfassbares Lebensgefühl ist nicht im gleichen Sinne durch (sonder-)pädagogische Maßnahmen machbar. Denn diese haben notwendigerweise immer eine fremdbestimmte Komponente die im Widerspruch von Selbstbestimmung steht." (Haeberlin 1996, S. 486)
Walther (1999 S. 69) differenziert Selbstbestimmung in die aufeinander aufbauenden Ebenen der Selbständigkeit, der Selbstleitung und der Selbstverantwortung. Wobei er mit Selbstverantwortung den Aspekt des Willens und der Motive, mit der Selbstleitung den Aspekt des Wissens und Entscheidens und mit der Selbständigkeit den Aspekt des Könnens und Handelns bezeichnet. Dabei führt Walther u.a. die Selbstbestimmung letztlich auf biophysische Selbstregulationsmechanismen zurück.
Waldschmidt (1999 S. 28) hält dem in ihrer historisch argumentierenden Betrachtung entgegen, dass "Selbstbestimmung weniger eine universale Eigenschaft des Menschen als vielmehr eine überlieferte Kategorie ist. Die moderne Identität, die der individuellen Autonomie den Boden bereitet, hat sich in einem langwierigen geschichtlichen Prozess ausgeprägt". Es gelingt Waldschmidt damit die Ambivalenzen der neoliberalen Ausprägung des Projekts der Aufklärung aufzuzeigen. Sie stellt nämlich die Frage, ob der Kampf der Menschen mit Behinderung um (mehr) Selbstbestimmung noch als eine Form der "nachholenden Befreiung" zu verstehen sei oder ob es sich hierbei letztendlich nur noch um die unentrinnbare Einfädelung in das "neoliberale Pflichtprogramm" handele. (Waldschmidt 1999, S. 28)
Nach Schönwiese (2003) muss der Selbstbestimmungsgedanken aber immer auch Verstehen beinhalten.
"Verstehen und Achtung der Selbstbestimmung behinderter Menschen heißt (...) auch nicht willfähriges Erfüllen jedes Wunsches der betroffenen Personen, wie es missverstanden werden könnte. Das wäre eine Form des Alleinlassens oder eine Laissez-fair-Pädagogik, die nur die Umkehrung einer direktiven, autoritären und fremdbestimmenden Pädagogik wäre. Verstehen heißt verständnisvolles Reagieren, Vorschläge machen und in Dialog treten, bezogen auf die jeweilige Situation." (Schönwiese 2003, im Internet)
Dabei gilt das Konzept der Selbstbestimmung für alle Betroffenen. Die Grundsätze der Selbstbestimmung gelten auch für Personen mit schwersten Beeinträchtigungen und es stellt sich immer wieder die Frage nach der Rolle und der Qualifikation der UnterstützerInnen, die die Selbstbestimmung wahren können (Schönwiese 2009, S. 31). Um Ausgrenzungen zu vermeiden, schlägt Speck (2001 S. 25) vor, von der "Unbestimmtheit des Selbstbestimmungsbegriffs" auszugehen: So ist zum Beispiel nicht vollständig definierbar, was Selbstbestimmung im Lichte einer Handlungsautonomie (selbständiges Handeln) und einer Bewusstseinsautonomie (Einsicht) heißen soll. "Die Erfahrung lehrt uns, dass beide Realitäten bei mental Behinderten zweifelsfrei beobachtet werden können" (ebd. S. 25) - sei es nur rudimentär, im Gefühlsausdruck oder auf der Ebene der "Leiblichkeit" wahrnehmbar. Da "Selbststeuerung als Funktion eines sich selbst organisierenden Organismus immer gegeben ist (S. 25), muss die Selbstbestimmungsfähigkeit grundsätzlich angenommen werden. Jedem Menschen ist Selbstbestimmung als eine "formale Voraussetzung" einverleibt, wie sie sich jedoch entwickelt und entfaltet, hängt von Lern- und Entwicklungsprozessen ab. (Klafki 1977, S. 28f)
Demnach gilt Selbstbestimmung als ein Entwicklungsprozess, der das ganze Leben anhält und sich auf Handlungen bezieht, die nach Wehmeyer und Kollegen (1992) durch spezifische Charakteristika gekennzeichnet werden können: Durch die "freie", autonome Entscheidung der Person; durch eine "Selbstaktualisierung" zum Beispiel im Sinne einer bewussten Nutzung eigener Stärken; durch ein "selbstgeregeltes" Verhalten in Verbindung mit einer Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle; durch die Möglichkeit, selbst Ziele zu setzen und danach zu handeln; durch Initiativen, die vom Betroffenen ausgehen; durch die Fähigkeit, auf Ereignisse mit einem "psychologischen Empowerment" (d.h. selbstbewusst und ich-stark) zu reagieren; durch die Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände; durch eine Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen und auf eine "selbstrealisierende" Art. (Wehmeyer 1992, S. 305)
Buber macht mit seiner berühmten Aussage "Der Mensch wird am Du zum Ich" (1962 S. 97) auf so einfache und treffende Weise deutlich, was Selbstbestimmung meint: Nicht die Freisetzung von sozialen Bindungen, sondern eigenverantwortliches Entscheiden und autonomes Handeln in der Beziehung zum Du. Dieses "Du" steht in erster Linie für den Mitmenschen, im weiteren Sinne bezieht es sich auf die "ganze Wirklichkeit", auf die sachliche und mitgeschöpfliche, natürliche Umwelt (Theunissen 2009, S. 45). Diese fundamentale Bindung bedeutet keine Negation oder Aufhebung individueller Freiheit, sondern sie bietet die Möglichkeit, Selbstbestimmung und damit auch Selbstverwirklichung sinnstiftend und sinnerfüllt zu realisieren.
Der Kern des Selbstbestimmungsgedanken lasst sich, so Waldschmidt, in dem Wunsch ausmachen, "so leben zu wollen, wie alle anderen" (Waldschmidt 1999, S. 42).
Im Jahr 1994 trafen sich in Duisburg einige hundert Menschen zu einem ersten europäischen Kongress von Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten zum Thema Selbstbestimmung. Unter dem Motto "Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung" wurde zu diesem Thema eine Diskussion eingeführt, wie es sie zuvor in Deutschland noch nie gegeben hatte (Frühauf 1996, S. 8).
Zielgruppe des Kongresses waren in erster Linie Betroffene, danach Fachleute und Eltern. In dieser Erklärung wird die Bedeutung von Selbstbestimmung aus der Sicht der Betroffenen definiert (siehe Abbildung 1).
Hemmnisse der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung sind zum Beispiel Formen der Infantilisierung, Überbehütung, Überversorgung, ständige Kontrolle und Reglementierung, die Ignoranz individueller Wünsche oder Interessen sowie ein durch Hinweis- und Stoppschilder gekennzeichnetes Lebensmilieu. (Theunissen 2009, S. 43)
Abbildung 1
Duisburger Erklärung
Duisburger Erklärung
Vorbereitet vom Programmkomitee behinderter Menschen,
per Akklamation angenommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses
Wir möchten mehr als bisher unser Leben selbst bestimmen. Dazu brauchen wir andere Menschen. Wir wollen aber nicht nur sagen, was andere tun sollen. Auch wir können etwas tun!
Wir wollen Verantwortung übernehmen.
(Zum Beispiel in der Werkstatt pünktlich mit der Arbeit anfangen.)
Wir wollen uns auch um schwächere Leute kümmern. Auch schwerbehinderte Menschen können sagen, was sie wollen. Vielleicht nicht durch Sprache, aber man kann es im Gesicht sehen oder am Verhalten.
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
(Zum Beispiel soll eine Familie mit einem behinderten Kind genauso wie andere eine Wohnung mieten können.)
Alle haben das Recht, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.
(Zum Beispiel soll niemand in einer psychiatrischen Klinik wie im Gefängnis leben müssen. Sie ist kein Ort zum Leben.)
Jeder Mensch muss als Mensch behandelt werden!
(Zum Beispiel ist es nicht in Ordnung, wenn man behinderte Menschen abfüttert oder ihnen sagt, wann sie ins Bett oder zur Toilette gehen sollen.)
Wenn Politiker von Selbstbestimmung sprechen, heißt das nicht, dass sie Geld sparen können. Denn Selbstbestimmung heißt nicht, dass man ohne Hilfe lebt.
Selbst zu bestimmen heißt, auszuwählen und Entscheidungen zu treffen:
Wir möchten die Wahl haben, in welche Schule wir gehen: zusammen mit Nichtbehinderten in die allgemeine Schule oder in die Schule für Geistigbehinderte.
Wir möchten die Wahl haben, wo und wie wir wohnen: mit den Eltern, zu zweit oder mit Freunden, im Wohnheim, in einer Außenwohngruppe oder Wohngemeinschaft. Es soll auch Betreutes Wohnen geben.
Wir möchten soviel Geld verdienen, wie es zum Leben braucht.
Wir wollen überall dabei sein! Beim Sport, in Kneipen, im Urlaub, wie jeder andere auch. Wir möchten über Freundschaft und Partnerschaft selbst entscheiden. Es soll leichter sein, sich zu treffen oder sogar zusammen zu leben.
Jeder lernt am besten durch eigene Erfahrungen.
Eltern meinen es oft zu gut. Sie lassen uns nichts selbst probieren. Es ist ja nicht schlimm, wenn man Fehler macht und von vorne anfängt.
Betreuer sollen uns helfen, dass wir Dinge selbst tun können. Sie sollen sich mit Geduld auf behinderte Menschen einstellen. Wir wollen zusammenarbeiten, wir sind keine Befehlsempfänger.
Wie werden wir stark?
Wir können mehr, als uns zugetraut wird - zum Beispiel alleine fortgehen oder mit der Bahn fahren. Das wollen wir zeigen; auch wenn man mal etwas gegen den Willen der Eltern oder der Betreuer tun muss.
Wir wollen oft mit behinderten Menschen aus anderen Orten sprechen, um zu wissen, wie sie leben. So können wir vergleichen und sagen, was besser werden soll. Wir wollen Gruppen bilden, in denen wir miteinander reden können.
Abb. 1: Duisburger Erklärung (entnommen aus Bundesvereinigung Lebenshilfe 1996 S. 10f)
Empowerment greift den Grundgedanken der Selbstbestimmung auf und integriert ihn in ein umfassendes Konzept. Empowerment bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Selbstbestimmung im Leben der Menschen zu erhöhen und ihnen zu ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenständig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten.
Der Begriff "Empowerment" stammt aus den USA. Übersetzt werden könnte er mit "Selbst-Bemächtigung", "Selbst-Ermächtigung" oder "Selbstbefähigung". (Theunissen 2009, S. 27) Eine bloße Übersetzung des Begriffs greift jedoch zu kurz und steht in der Gefahr, das Anliegen, welches mit Empowerment in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe verknüpft wird, zu verfehlen. Denn hinter dem Begriff des Empowerment verbergen sich eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen wie aber auch Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze, die mit Blick auf die Arbeit im sozialen Bereich auf die (Wieder)Erlangung von Stärke zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse hinauslaufen oder - genauer gesagt - vorhandene Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position (z.B. soziokulturell Benachteiligte, ethnische Minderheiten, allein erziehende Frauen, Menschen mit einer psychischen Krankheit oder Behinderung) zu ihrem Ausgangspunkt nehmen, zu tragfähigen Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfe-Zusammenschlüsse sowie sozialer Netzwerke anstiften und die (Wieder-)Gewinnung von Selbstbestimmungsfähigkeit und Kompetenzen (Zuständigkeiten) zur Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände zum Ziele haben. (Theunissen 2009, S. 27)
Dabei lassen sich vier zentrale begriffliche Zugänge unterscheiden (Theunissen 2009, S. 27ff):
-
Empowerment verweist auf individuelle Selbstverfügungskräfte, vorhandene Stärken oder Ressourcen, die es dem Einzelnen ermöglichen, Probleme, Krisen oder Belastungssituationen aus eigener Kraft zu bewältigen sowie ein relativ autonomes Leben zu führen.
-
Empowerment wird mit einer politisch ausgerichteten Durchsetzungskraft verbunden, indem sich zum Beispiel Gruppen behinderter Menschen oder Eltern behinderter Kinder für einen Abbau von Benachteiligungen und Vorurteilen, für "Barrierefreiheit", rechtliche Gleichstellung und Gerechtigkeit engagieren.
-
Empowerment steht im reflexiven Sinne für einen selbstbestimmten Lern- und Handlungsprozess, in dem zum Beispiel behinderte Menschen oder Eltern behinderter Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer Kompetenzen bewusst werden, sich in eigener Regie Wissen und Fähigkeiten aneignen und soziale Ressourcen, u.a. auch selbstorganisierte Gruppenzusammenschlüsse, nutzen.
-
Empowerment wird auch im transitiven Sinne benutzt, indem zum Beispiel behinderte Menschen oder Angehörige angeregt, ermutigt und in die Lage versetzt werden, eigene (vielfach verschüttete) Stärken und Kompetenzen zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu entdecken, zu entwickeln und zu nutzen. An dieser Stelle steht Empowerment für eine professionelle Praxis, die bereit sein muss, das traditionelle (medizinisch präformierte) paternalistische Helfermodell aufzugeben und sich auf Prozesse der Konsultation und Zusammenarbeit, eines gemeinsamen Suchens und Entwickelns von Lösungswegen, einzulassen. (Theunissen 2009, S. 27ff)
Zum weiteren Verständnis des Empowerment-Konzepts in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe ist es notwendig, sich die hintergründige Philosophie vor Augen zu führen, die ihre Wurzeln in den US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen des Schwarzen Amerikas, der lateinamerikanischen Befreiungstheologie und "Pädagogik der Unterdrückten" hat und zugleich aber auch durch Grundannahmen aus der humanistischen Psychologie angeregt wurde (Theunissen 2009, S. 38).
Ausgangspunkt des daraus abgeleiteten "Empowerment-Ethos" ist der radikale Bruch mit der traditionellen Denkfigur, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ausschließlich im Lichte von Schwächen, Mängeln, Versagen, Hilflosigkeit, Inkompetenz oder gar pathologischer Auffälligkeit wahrzunehmen und zu behandeln. Diese Defizit-Sicht hatte jahrzehntelang das Planen und Handeln im Bereich der Heilpädagogik und Behindertenhilfe maßgeblich bestimmt. Stattdessen hat sich das Empwerment-Konzept einem optimistisch gestrickten Menschenbild verschrieben. (ebd. S. 39) Demnach entwickelt sich die Persönlichkeit eines Menschen nach Maßgabe einer im Organismus angelegten Tendenz zur Selbstaktualisierung im Rahmen sozialer Beziehungen, in denen der Betreffende dieses, sein Selbstwerden erfährt. Die Selbstentfaltung gilt als gelungen, wenn ein Individuum sein Wachstumspotenzial ausschöpft, ohne dies auf Kosten anderer zu tun. Das damit einhergehende unbedingte Vertrauen in Stärken und Potenziale eines jeden Menschen, Lebenssituationen in eigener Regie produktiv zu gestalten, "ist der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken". (Herriger 2006a, S. 72)
Ausgangspunkt des Empowerment-Konzeptes ist eine Kritik an den blinden Flecken des tradierten Klientenbildes der sozialen Arbeit. Dieses Klientenbild ist bis heute in weiten Passagen von einem Defizit-Blick auf den Menschen geprägt. Identitätsentwürfe und lebensgeschichtliche Erfahrungen von Menschen, die psychosoziale Dienstleistungen nachfragen, werden nur allzu oft allein in Kategorien von Mangel, Unvermögen und Schwäche wahrgenommen. Das Empowerment-Konzept bricht mit diesem Blick. Die Adressaten sozialer Dienstleistungen werden hier - auch in Lebensetappen der Belastung und der Demoralisierung - in der Rolle von kompetenten Akteuren wahrgenommen, welche über das Vermögen verfügen, ihre Lebenssettings selbstbestimmt zu gestalten und Lebenssouveränität zu gewinnen. Dieses Vertrauen in die Stärken der Menschen, in produktiver Weise schmerzliche Lebensbelastungen zu verarbeiten, eigene Kräfte zu entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen für eine selbstbestimmte Lebensführung zu nutzen, ist das Leitmotiv der "Philosophie der Menschenstärken". (Herriger 2006b, im Internet)
Aus der Stärken-Perspektive sind spezifische Leitprinzipien hervorgegangen, die heute wegweisend für die Empowerment-Praxis sind, so zum Beispiel:
-
Abkehr vom Defizit-Blickwinkel
-
Die unbedingte Annahme des Anderen
-
Vertrauen in individuelle und soziale Ressourcen
-
Der Verzicht auf etikettierende, entmündigende und denunzierende Expertenurteile
-
Der Respekt vor der Sicht des Anderen und seine Entscheidungen
-
Das Respektieren des So-Seins des Anderen, seiner "eigenen" Wege und "eigenen" Zeit
-
Die Orientierung an der Rechte-Perspektive, an der Bedürfnis- und Interessenlage sowie der Lebenszukunft des Betroffenen (Theunissen 2009, S. 40)
Der erste Grundwert ist die Selbstbestimmung (Autonomie), die "unzweifelhaft ein wesentliches Element vom Empowerment ist" (ebd. S. 40). Allein diese Aussage signalisiert, dass eine Gleichsetzung von Empowerment und Selbstbestimmung unzulässig ist und dass ein Empowerment-Konzept, das sich nur am Selbstbestimmungsgedanken orientiert, viel zu kurz greift.
Der zweite Grundwert, der vom Selbstbestimmungsgedanken nicht losgelöst betrachtet werden kann, ist die demokratische und kollaborative Partizipation. Er besagt, dass Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, ein Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und Teilhabe an Entscheidungsprozessen haben. Freie Wahlen oder Mitbestimmungsrechte sind aber nicht die einzigen Bestimmungsmerkmale eines demokratischen Systems. Sein Wert bemisst sich auch daran, inwieweit eine faire und gerechte Verteilung von Ressourcen und Lasten in der Gesellschaft gegeben ist. Im Fokus dieses dritten Grundwerts steht somit die Frage nach sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen (z.B. behinderter Menschen) sowie das Eintreten für soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Inklusion. (Theunissen 2009, S. 46ff) Mit dieser Wertebasis versteht sich Empowerment als gesellschaftskritisches Korrektiv zur Gewinnung von mehr Menschlichkeit und sozialer Gerechtigkeit.
Vor dem Hintergrund der drei Bezugswerte ist es erklärtes Ziel der Empowerment-Philosophie, Menschen in marginaler Position zur Entdeckung und (Wieder-)Aneignung eigener Fähigkeiten, Selbstverfügungskräfte und Stärken anzuregen, sie zu ermutigen, zu stärken sowie konsultativ und kooperativ zu unterstützen, Kontrolle, Kontrollbewusstsein und Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände (zurück) zu gewinnen, so dass "eine Lebensform in Selbstorganisation" (Keupp 1990, S. 180) (wieder) statthaben kann. Dieses sehr anspruchsvolle Programm verweist auf eine neue Kultur des Helfens.
Aufgabe psychosozialen Handelns im Sinne von Empowerment ist es in erster Linie, die in der jeweiligen Situation vorfindbaren Ressourcenquellen und -netzwerke herauszufinden, zu stärken und nutzbar zu machen. Professionelle beschäftigen sich unter einer Empowermentperspektive daher vor allem mit den Fähigkeiten und Stärken von Individuen und mit den auf der Gruppen- und Strukturebene vorzufindenden und entwickelbaren Ressourcen, ohne damit die Schwächen oder Bedürfnisse der Betroffenen zu vernachlässigen. Das Ziel der Interventionen besteht darin, auf den verschiedenen Ebenen versteckte oder nicht genutzte Ressourcen zu entdecken und sie für die Bearbeitung aktueller sozialer Probleme und für die Weiterentwicklung (Stärkung) des sozialen Systems nutzbar zu machen. (Stark 1996, S. 160f)
Abbildung 2
Unterschiede zwischen herkömmlicher Behindertenhilfe und dem Empowerment-Konzept
|
Herkömmliche Behindertenhilfe / Heilpädagogik |
Empowerment-Konzept |
|
Behinderter = PatientIn |
Behinderter = ExpertIn |
|
Professionelle/r HelferIn = ExpertIn |
Professionelle/r HelferIn = AssistentIn |
|
Medizinisches Modell |
Sozialwissenschaftliches Modell |
|
Individuumzentrierte (biologistische) Ursachenforschung |
Kontextuelle biopsychosoziale Problemsicht |
|
Defizitorientierung |
Ressourcenorientierung |
|
Individualistisch-disziplinierende Intervention |
Lebensweltorientierte Behindertenarbeit |
|
Ziel: reibungslose Anpassung / gesellschaftliche Verwertbarkeit |
Ziel: Selbstbestimmung |
|
HelferIndominant (autoritär) |
Betroffenendominant / kooperativ |
|
Segregation |
Integration |
|
Totale Sondereinrichtungen |
Mobile, bedarfsgerechte, gemeindeintegrierte und vernetzte Hilfen |
|
Besonderung |
Normalisierung |
|
Menschliche Entfremdung |
Sinnerfüllte Lebensverwirklichung |
Inhaltsverzeichnis
Der Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit spielt entwicklungspsychologisch eine wichtige Rolle (Weiß 2000, S. 121). Aus psychoanalytischer Sicht kann sich das kindliche Selbst nur in der Beziehung zu anderen differenzierend ausbilden. Dies geschieht in einem spannungsvollen Prozess zwischen Selbstbehauptung und wechselseitiger Anerkennung von
Mutter und Kind. Ist dieses Gleichgewicht von Autonomie und Abhängigkeit gestört, entstehen schon im Kindesalter Verhältnisse, die durch Herrschaft und Unterwerfung gekennzeichnet sind und somit der Ausbildung von Identität entgegenstehen.
Hahn (1994) macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass die Entwicklung individueller Identität von Selbstbestimmung abhängig ist. Ohne dass eine Person selbst entscheidet (selbst bestimmt), kann sie weder die eigenen Möglichkeiten und Grenzen, noch ihre Bedürfnisse kennen lernen. Sie ist in Gefahr, Fremddefinition ihres eigenen Selbst zu übernehmen (Hahn 1994, S. 86). Identität entsteht für Hahn aus der "oszillierenden Balance" zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit.
Wie sich Selbstbestimmung entfaltet und artikuliert, ergibt sich aus dem Zusammenspiel individueller und sozialer Faktoren, was sich am Identitätskonzept verdeutlichen lässt: Jedes Individuum will im Rahmen sozialer Kommunikation ein Selbst (Identität) einbringen und darstellen. Dieses gilt sowohl für das personale Selbst als einzigartige Kombination von biographischen Daten, Körpermerkmalen und subjektiven Momenten (Bedürfnissen), als auch für das soziale Selbst, das als antizipiertes und perzipiertes Bild der eigenen Person in den Augen anderer auf Grund von Zuschreibungen und sozialen Erwartungen zustande kommt und das Individuum zur Rollenübernahme und zu einem "sozial angepassten" Rollenspiel verpflichtet. Als Selbst-Konzept (Ich-Identität) erscheint sodann die ständig zu erbringende Leistung, beide Momente ins Verhältnis zu setzen und zu balancieren. Dieser Balanceakt bewirkt zugleich psychisches Wohlbefinden und hat für die seelische Gesundheit des Einzelnen konstitutive Bedeutung. (Theunissen 2008, S. 29)
Der Grad der Selbstbestimmung ist nach diesem Modell dann am größten, wenn sich das Individuum weder einem "inneren Zwang" (überhöhte personale Selbstansprüche, rücksichtslose Bedürfnisdurchsetzung, zwanghafte Triebhaftigkeit) ergibt, noch durch ein starres, von außen aufoktroyiertes, entwicklungshemmendes Normengefüge festlegen und bestimmen lässt. Dazu wie überhaupt zur Entwicklung von Selbstbestimmung bedarf es einer "haltgebenden" Lebenswelt, die es versteht, Autonomieprozesse zu erkennen, wertzuschätzen und zu unterstützen ohne dabei eine "moralische Erziehung" zu vernachlässigen. (ebd. S. 29)
"Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben" (Abels 2006, S. 254)
Als Identität wird die Fähigkeit des einzelnen verstanden, reflexiv aus sich selbst herauszutreten, sich selbst zum Objekt zu machen bzw. sich ein Bild von sich selbst zu machen (vgl. Mead 1968, S. 179ff). Ein einzelner aber kann nicht isoliert von anderen zur Selbstreflexion gelangen. Identität kommt dadurch zustande, wenn der einzelne sich im Prozess der Kommunikation mit den Augen des anderen sehen kann und somit ein Bild von sich selbst entwickelt. "Über Identität verfügen wir" schreiben Brumlik und Holtappels (1993, S. 91), "wenn wir dazu in der Lage sind, uns sowohl als biographisch einzige und einmalige Individuen, als auch als Mitglieder von Gruppen oder Gesellschaften zu begreifen, deren Eigenschaften wir mit anderen teilen. Im ersten Fall geht es um personale, im zweiten Fall um soziale Identität. Zur voll ausgebildeten Identität gehört es, die oft konfligierenden eigenen Ansprüche und die Erwartungen anderer so einzulösen, dass weder die Zugehörigkeit zu bedeutsamen sozialen Gruppen noch das Selbstbild einer eigenständigen, unverwechselbaren Individualität mit eigenen Wünschen und Ansprüchen verletzt wird. (Warning 2002, S. 59)
Nach Erikson ist Identität eine Integrationsleistung des Individuums, bei der Erfahrungen, Konflikte und Bewältigungsformen im Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Selbst stehen. Das Kontinuitätserleben bildet den Kern der Identität im Rahmen von Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung, wobei das Erleben von Kontinuität auch hier durch Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft definiert ist. (Schuppener 2005, S. 33)
Modell nach Goffman
Grundlegend für die Auseinandersetzung mit der Identitätsproblematik behinderter Menschen ist Goffmans Buch "Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität" (1967). In diesem Werk versteht Goffman den Menschen als sozial stigmatisiert, d.h. der Mensch befindet sich in einem Prozess permanenter Abwehr sozialer Zuschreibungen, die mit der Vorstellung über die eigene Person nicht übereinstimmen. Als Endpunkt von Stigmatisierung wird die Organisation der Identität um ein deviantes Verhaltensmuster angenommen. Devianz ist eine erlernte soziale Rolle. Goffman konzentriert sich auf die Frage, wie das deviante Individuum mit seiner besonderen Situation umgeht. Er unterscheidet dabei drei Identitäten: die soziale Identität, die persönliche Identität und die Ich-Identität. (Cloerkes 1997, S. 152)
-
Soziale Identität (social identity): Menschen ordnen sich routinemäßig typisierend in soziale Kategorien ein (Goffman 1967, S. 10). Soziale Identität beschreibt die Zugehörigkeit zu einer solchen Kategorie (z.B. Student, Körperbehinderter, Drogenabhängiger). Sofern die Angehörigen der Personenkategorie durch ein unerwünschtes Merkmal gekennzeichnet sind, kann dies ein Aufhänger für Stigmatisierungen sein. (Cloerkes 1997, S. 152)
-
Persönliche Identität (personal identity) beschreibt bei Goffman (1967 S. 72ff) die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, die in direkter Verbindung mit der jeweils einzigartigen Biographie steht. Zentral ist dabei der Aspekt der Identifizierung einer bestimmten Person, wie dies beispielsweise durch einen Personalausweis geleistet wird. Nicht gemeint mit persönlicher Identität ist das "Innerste Sein" einer Person (ebd. S. 74), was durch die missverständliche Übersetzung des Begriffs in der deutschen Ausgabe mit "persönlich" statt "personal" nahe gelegt wird. Es handelt sich also bei Goffman um eine externe Kategorie der Verortung eines Individuums im sozialen Umfeld. (Cloerkes 1997, S. 152f)
-
Ich-Identität (ego identity) meint bei Goffman in Anlehnung an Erikson den Innenaspekt von Identität. Der Begriff wird eher am Rande erwähnt. Ich-Identität ist "das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum allmählich als ein Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt" (Goffman 1967, S. 132).
Die dreifache Identitätstypologie (soziale, persönliche und Ich-Identität) kennzeichnet verschiedene Problembereiche beim Umgang mit Stigmatisierten. Soziale Identität verdeutlicht, wie Stigmatisierung zustande kommt. Die stigmatisierte Person wird aufgrund eines Merkmals einer ungünstigen sozialen Kategorie zugeordnet. Im Zusammenhang mit der persönlichen Identität zeigt Goffman Techniken der Informationskontrolle und des Stigma-Managements, mit deren Hilfe Stigmatisierte ihre Stigmata verbergen bzw. auftretende Interaktionsprobleme bearbeiten. Ich-Identität schließlich ist "zuallererst eine subjektive und reflexive Angelegenheit" (ebd. S. 132). Sie beschreibt den Zugang zu den Empfindungen eines stigmatisierten Individuums. Interaktionserfahrungen haben einen starken Einfluss auf Empfindungen und damit auf die Ich-Identität. Wie diese Einflüsse aber wirksam werden, wird von Goffman nicht weiter untersucht.
Goffman befasst sich in erster Linie mit den verschiedenen Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person und die dadurch provozierten Widersprüche in der Selbsterfahrung des Individuums. Danach bietet die Umwelt einen Handel an (ebd. S. 151ff): Vom stigmatisierten Individuum wird verlangt, sich weitgehend so zu benehmen, als ob es normal sei. Dafür werde es dann auch wie ein Normaler behandelt. Zugleich wird ihm deutlich gemacht, dass es nicht normal ist und dass es dies anzuerkennen habe. Es soll die zugeschriebene Andersartigkeit (z.B. eine Behinderung) akzeptieren. Insbesondere habe es kein Recht, sich auf Normalitäten zu berufen. Goffman spricht deshalb von "Scheinnormalität" und "Scheinakzeptanz". "Kurzum, es wird ihm gesagt, dass es wie jeder andere ist und dass es dies nicht ist - wenngleich es unter den Sprechern wenig Übereinstimmung darüber gibt, wie viel es von jedem für sich beanspruchen sollte" (ebd. S. 154f). Damit macht die Außenwelt auch Vorgaben darüber, wie ein stigmatisiertes Individuum über sich denken sollte. Ich-Identität ist Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Dies alles wird für das Individuum ein Problem, weil es anders ist. Am Ende seiner Arbeit gibt Goffman allerdings zu erkennen, dass alle Menschen gleichermaßen den Zumutungen und Zuschreibungen der Umwelt ausgesetzt sind und den Anforderungen an Normalität nicht genügen können. Deshalb folgert er, dass seine Analyse für alle Interaktionen Gültigkeit habe. (Cloerkes 1997, S. 154)
Modell nach Krappmann
Für Krappmann steht im Vordergrund, wie ein Individuum seine Identität vor Schaden bewahren kann (Haeberlin 1978, S. 41). Seine Identitätskonzeption basiert auf Goffmans Dreiertypologie. Identität ist eine Leistung, vor allem hinsichtlich der folgenden zwei Anforderungen:
-
Zum einen soll das Individuum den Erwartungen seines Gegenübers entsprechen und sich in vorgegebene Kategorien einordnen lassen, d.h. es soll eine soziale Identität (social identity) annehmen.
-
Zum anderen soll das Individuum seine eigenen spezifischen Erwartungen vermitteln und sich damit selbst als einzigartig zeigen, d.h. es soll eine persönliche Identität (personal identity) haben. (Cloerkes 1997, S. 154)
Die Möglichkeit, Einzigartigkeit zu präsentieren, ergibt sich für das Individuum aus früheren Erfahrungen und den daraus resultierenden Haltungen und Verpflichtungen. Zugleich schränkt Einzigartigkeit den Spielraum ein, die Erwartungen eines Gegenübers erfüllen zu können. Die Teilnahme an einer Interaktion erfordert somit nach Krappmann die Auflösung widersprüchlicher Anforderungen. "Im Falle der "social identity" wird verlangt, sich den allgemeinen Erwartungen unterzuordnen, im Falle der "personal identity" dagegen, sich von allen anderen zu unterscheiden. Es wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und zu sein wie niemand" (Krappmann 2000, S. 78).
Die gleichzeitige Erfüllung der nach Krappmann an sich unvereinbaren Forderungen wird möglich, indem der Interaktionspartner zugleich eine Schein-Normalität (phantom normalcy) und eine Schein-Einzigartigkeit (phantom uniqueness) zuerkennt (ebd. S. 74ff). Die Interaktion verläuft damit auf einer "als-ob-Basis". Schein-Normalität erlaubt die "als-ob-Übernahme" der sozialen Erwartungen und bietet zugleich die Möglichkeit zu signalisieren, anders zu sein als alle anderen, d.h. eine eigene Biographie zu haben und an einer spezifischen Auswahl von Interaktionen beteiligt zu sein. Schein-Einzigartigkeit erlaubt die "als-ob-Übernahme" der Anforderung, einzigartig zu sein bei gleichzeitiger Berücksichtigung der allgemeinen Erwartungen (ebd. S. 78f). Krappmann sieht das Individuum zu einem ständigen Balanceakt zwischen sozialer Identität und persönlicher Identität aufgefordert. "Diese Balance aufrechtzuerhalten, ist die Bedingung für Ich-Identität" (ebd. S. 78). Das Ziel ist also eine angemessene Selbstdarstellung und Anpassung, ohne dass Diskrepanzen und Konflikte geleugnet werden (Haeberlin 1978, S. 41).
Die Individualität des Individuums besteht in der Art, wie es balanciert. Der unumgängliche Balanceakt birgt jedoch zwei Gefahren. Erstens kann das Individuum die Balance verlieren, weil es ihm nicht gelingt, sich von der sozialen Identität abzuheben, wenn es die Erwartungen der anderen vollständig übernimmt. Zweitens droht Verlust der Balance, wenn es die Erwartungen der anderen völlig ignoriert und in seiner die persönliche Identität konstituierenden Einzigartigkeit aufgeht. In beiden Fällen ist "Nicht-Identität", verbunden mit gravierenden Persönlichkeitsstörungen die Folge, wie Krappmann am Beispiel von Schizophrenen vorführt (2000 S. 173ff). "Für jedes Individuum ist seine balancierende Ich-Identität ein ständiger Versuch, sich gegen Nicht-Identität zu behaupten. (...) Mit Menschen ohne Ich-Identität ist es nicht möglich zu interagieren" (ebd. S. 79).
Obwohl auf Goffman gestützt, unterscheidet sich Krappmanns Modell in wesentlichen Punkten von diesem. Bei Goffman ist die persönliche Identität eine Tatsache, die an die physische Existenz eines Menschen gebunden ist. Jeder Mensch kann von anderen unterschieden werden, da an ihm eine einzigartige, kontinuierliche Reihe sozialer Fakten (Biographie) festgemacht werden können. Jeder Mensch hat also persönliche Identität. Bei Krappmann wird der Besitz einer einzigartigen persönlichen Identität zu einer an das Individuum herangetragenen Forderung, die es erst durch angemessene Selbstdarstellung erfüllen muss. Persönliche Identität muss erarbeitet werden, ist eine Leistung, verbunden mit dem Risiko des Scheiterns. Krappmann sieht deshalb in der Aufgabe von Einzigartigkeit und der vollständigen Übernahme einer angesonnen sozialen Identität ein Problem. (Cloerkes 1997, S. 155) Für Goffman stellt sich das völlig anders dar: Einzigartig ist letztlich jeder; das Problem liegt in der Nichterfüllung sozialer Erwartungen. Sobald dies der Fall ist, folgt aus der Einzigartigkeit die Möglichkeit, diesen Makel aufzudecken. Ist der Makel erstmal bekannt, wird gefordert, zum Makel zu stehen und zugleich Normalität vorzuspielen, d.h. sowohl anders als auch normal zu sein. Daraus folgt die Ambivalenz der Selbsteinschätzung, die von Goffman als wesentliches Identitätsproblem genannt wird. Krappmann (2000 S. 79) hingegen verweist mit seiner Fassung von Ich-Identität auf einen Integrations- und Balanceaspekt von Identität und spricht darüber hinaus vom "Zuerkennen" von Ich-Identität durch das Gegenüber.
Modell nach Thimm
Thimm greift Krappmanns Modell der balancierten Ich-Identität auf und erweitert es um die Entstehung möglicher Identitätsprobleme durch die doppelte Gefahr einer Nicht-Identität durch das Scheitern auf beiden Identitätsebenen (soziale und persönliche). Das Modell von Thimm ist zwar eng an dem Ansatz Krappmanns orientiert, arbeitet aber die Einflüsse von Stigmatisierungen im Bereich von Menschen mit Behinderung wesentlich differenzierter aus und nähert sich damit wiederum dem Goffmaschen Ansatz. (Schuppener 2005, S. 37f)
Neu sind die auf Dreitzel (1972, S. 291ff) zurückgehenden Bezeichnungen "Distanzierungsstörung und "Kontaktstörung". Identitätsstörungen werden an der Selbstdarstellung des Individuums, d.h. im Balance-Aspekt der Identität festgemacht. (vgl. Abb. 1) Das von Goffman thematisierte subjektive Empfinden und die Selbstreflexion stigmatisierter Individuen bleiben unberücksichtigt.
Modell nach Frey
Das Identitätsmodell von Frey setzt an der Erweiterung bzw. Ausdifferenzierung des Innenaspekts der Identitätsentwicklung an, die bei den bisher beschriebenen Modellen zu kurz kommt. (Schuppener 2005, S. 38) Frey schlägt zunächst eine neue begriffliche Verwendung der Identitätskategorien vor, indem er folgende drei Aspekte von Identität unterscheidet:
-
Der externe Aspekt: Gemeint ist der einer Person zugeschriebene Status, er umfasst die soziale und persönliche Identifizierung durch andere und entspricht somit weitgehend der von Goffman beschriebenen sozialen und persönlichen Identität (Frey 1983, zit. nach Cloerkes 2000, im Internet). Zum externen Aspekt gehören sämtliche Erfahrungen und Informationen eines Individuums über seine sachliche und personale Umwelt. Das Hauptaugenmerk in einem interaktionistischen Modell gilt jedoch dem Interaktionspartner. Er schreibt soziale und persönliche Identität zu und hat spezifische Erwartungen.
-
Der interne Aspekt: Der interne Aspekt (Frey spricht von Selbst) wird als reflexiver Prozess aufgefasst und entspricht damit der Ich-Identität bei Goffman. Frey unterscheidet zwei Ebenen: das soziale Selbst und das Private Selbst. Das soziale Selbst steht für die "interne Ebene der Selbsterfahrung, auf der die Person sich aus der Perspektive ihrer Umwelt definiert" (Frey 1983, zit. n. Cloerkes 2000, im Internet). Es geht um die Frage, wie die anderen das Individuum sehen, und wie das Individuum dieses vermutete Fremdbild von sich selbst wahrnimmt. Das soziale Selbst nimmt also Außeninformationen wahr, es wählt wichtige Informationen aus und auf diese Weise entsteht ein Bild von der Meinung anderer. (vgl. Cloerkes 2000, im Internet) Das private Selbst steht für die Selbstinterpretation aus der eigenen privaten Perspektive "Wie sehe ich mich selbst?". Es bewertet das soziale Selbst, übernimmt Inhalte des sozialen Selbst oder weist sie zurück. So entsteht ein privates Bild von sich selbst (Selbstbild). (vgl. ebd.)
-
Der Integrations- und Balanceaspekt: Dieser Aspekt schließt an Krappmanns Entwurf der balancierten Identität an. Frey schlägt vor, den Begriff Identität nur auf diesen dritten Aspekt anzuwenden und den Innenaspekt mit Selbst zu bezeichnen. Identität integriert Privates und Soziales Selbst, berücksichtigt auch andere Rahmeninformationen, leitet das Handeln an und bestimmt die Identitätsdarstellung. Auf der Basis der Integrations- und Balanceleistung findet die Präsentation der Identität nach außen hin statt. Diese Selbstdarstellung des Individuums kann durchaus vom privaten Selbst abweichen. (Cloerkes 2000, im Internet)
Der Begriff ‚Stigma' (griechisch = Zeichen, Mal) beschrieb bei den alten Griechen ein Brandmal oder eine geschnitzte Wunde/Narbe, die einem Verbrecher, Sklaven oder Verräter gut sichtbar (z.B. an der Stirn) zugefügt wurde. Der so markierte Mensch konnte von jedem erkannt und mit der verdienten Verachtung und dem gesellschaftlichen Ausschluss bedacht werden. Das äußerlich angebrachte Zeichen sollte also eine bestimmte Bewertung und Behandlung der Person bewirken.
Den Begriff "Stigma" hat Goffman (1967) in die soziologische Diskussion eingeführt. Mit Stigma bezeichnet man eine Eigenschaft einer Person, "die zutiefst diskreditierend ist" (Goffman 1967, S. 11).
"Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden. (...) Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert haben." (ebd. S. 13)
Ein Mensch mit einem Stigma entspricht in seiner "aktualen sozialen Identität" nicht den normativen Erwartungen seiner Umwelt. Diese normativen Erwartungen als antizipierte Vorstellungen von einem "Normalen" nennt Goffman "virtuale soziale Identität" (ebd. S. 10). Bei einem Menschen mit einem Stigma besteht eine Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität. Er weicht in seinem Sosein von sozialen Normen ab. (Cloerkes 1997, S. 146)
Übersehen wird dabei der wichtige Hinweis, dass Eigenschaften "an sich weder kreditierend noch diskreditierend" sind. "Ein und dieselbe Eigenschaft vermag den einen Typus zu stigmatisieren, während sie die Normalität des anderen bestätigt" (Goffman 1967, S. 11). Stigma bezieht sich also auf "Relationen", kann sich erst in sozialen Beziehungen darstellen. Es geht nicht um das Merkmal selbst, sondern um die "negative Definition des Merkmals bzw. dessen Zuschreibung" (Hohmeier 1975, S. 7).
Goffman (1967 S. 12f) unterscheidet drei Typen von Stigmata:
-
"Abscheulichkeiten des Körpers" (physische Deformationen, z.B. Körperbehinderung)
-
"Individuelle Charakterfehler" (Sucht, Homosexualität, Selbstmoderversuche)
-
"Phylogenetische Stigmata" (Rasse, Nation, Religion) (Goffman 1967, S. 12f)
Menschen mit einer Behinderung wären demnach den beiden erstgenannten Typen zuzuordnen.
Stigmata wirken auf der Ebene der Einstellungen, d.h. es geht noch nicht um tatsächliches Verhalten. Von Stigma zu trennen ist daher der Begriff "Stigmatisierung". Stigmatisierung ist das Verhalten aufgrund eines zu eigen gemachten Stigmas. (Cloerkes 1997, S. 147)
Stigma und Stigmatisierung können in einem engen Zusammenhang stehen, sie müssen es aber nicht in jedem Fall. Wichtig ist also der Rückschluss von beobachtbarem, tatsächlich stigmatisierendem Verhalten auf das Stigma. (ebd. S. 147f).
Die Diskriminierung von Menschen mit einem Stigma erfolgt sehr wirksam, wenn auch oft gedankenlos, über die Konstruktion einer Stigma-Theorie, "eine Ideologie, die ihre Inferiorität erklären und die Gefährdung durch den Stigmatisierten nachweisen soll" (Goffman 1967, S. 14). Zu unterscheiden sind "Diskreditierte" und Diskreditierbare". Im ersten Fall nimmt das stigmatisierte Individuum an, dass man über sein Anderssein Bescheid weiß, dass es unmittelbar evident ist. Im zweiten Fall geht es davon aus, dass sein Zustand noch nicht bekannt bzw. wahrnehmbar ist. (ebd. S. 12) Ein Stigmatisierter wird wahrscheinlich mit beiden Situationen Erfahrung haben und sich darum bemühen, sein unerwünschtes Anderssein möglichst zu verbergen. (Cloerkes 1997, S. 148)
Stigmatisierungen knüpfen bei Merkmalen von Personen an. Diese Merkmale können sichtbar oder unsichtbar sein (z.B. körperliche Behinderung, Gruppenzugehörigkeit, Verhalten). Die Sichtbarkeit erleichtert das Stigmatisieren. Auf der Grundlage eines Stigmas tendieren die "Normalen" dazu, weitere Unvollkommenheiten und negative Eigenschaften zu unterstellen (ebd. S. 148). Über derartige Generalisierungen wird das Stigma zum alles beherrschenden Status.
Auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe droht Diskriminierung durch formellen und informellen Verlust von bisher ausgeübten Rollen, es kommt zu Kontaktverlust, zu Isolation und Ausgliederung. Auf der Ebene der Interaktionen orientiert sich alles am Stigma, die Person und ihre Biographie wird in diesem Sinne umdefiniert. Die Interaktionen sind durch Spannungen, Unsicherheit und Angst erschwert. Auf der Ebene der Identität drohen daher erhebliche Gefährdungen der Identität. (Cloerkes 1997, S. 149)
Stigmatisierung ist die Zuschreibung eines sozialen Vorurteils, von der eine Person oder Gruppe betroffen ist, die in unerwünschter Weise von der Norm abweicht. Da der Mensch mit einer Behinderung als der von der Norm abweichende sozial vermeintlich weniger achtenswert erscheint, kann sich im Hinblick auf Interaktionsprozesse ein asymmetrisches Verhältnis zwischen nichtbehinderten Menschen und Menschen mit einer Behinderung ergeben. Dieses Ungleichgewicht kann zu einer bedeutsamen Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts eines Menschen mit Behinderung führen. Aufgrund von Zuschreibungen werden von Nichtbehinderten Erwartungen an den Menschen mit einer Behinderung gestellt, die seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen oftmals zuwiderlaufen und den Aufbau der eigenen Identität erschweren, gefährden oder verhindern.
Eine "gelungene Identität" ist nach Mattner & Gerspach (1997) als ein "eins sein mit sich selbst" zu kennzeichnen (S. 160). Im Laufe einer Identitätsentwicklung macht ein Individuum allerdings auch Erfahrungen, die eine Bedrohung für die Identität darstellen und diese letztlich auch beschädigen können, was im Extrem zu einer "misslungenen Identität" führen kann, bei der man nach Mattner & Gerspach "mit sich selbst entzweit" wäre (ebd. S. 160f).
Goffman hat sich insbesondere mit den Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person befasst, die vom Individuum einerseits eine Akzeptanz der Rolle als Stigma-Träger erwarten (Scheinakzeptanz) und andererseits ein normales Verhalten fordern (Scheinnormalität). Die Ich-Identität ist somit bei stigmatisierten Personen Gegenstand öffentlicher Diskussionen, da die Außenwelt Vorgaben über die Verhaltensweisen stigmatisierter Individuen macht (Cloerkes 2000, im Internet). Goffman differenziert hinsichtlich der Einflussnahme von Außenstehenden auf ein stigmatisiertes Individuum zwischen virtualer sozialer Identität und aktualer sozialer Identität.
-
Virtuale soziale Identität: Hierunter ist der gesamte Satz von Beurteilungsstandards zu verstehen, der zur Kategorisierung von Interaktionspartnern in aktuellen sozialen Situationen zur Verfügung steht.
-
Aktuale soziale Identität: Diese bezieht sich auf die tatsächlich existenten Attribute, die ein Interaktionspartner in einer aktuellen sozialen Situation aufweist. (Schuppener 2005, S. 56)
Krappmann und Timm fokussieren ebenfalls die Außeneinwirkungen auf das stigmatisierte Individuum und gehen davon aus, dass eine Gefährdung der Ich-Identität auftritt, wenn das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher und sozialer Identität nicht mehr homöostatisch ist. Beim Misslingen der Stabilisierung einer homöostatischen Ich-Identität besteht die Gefahr des Rückfalls auf die persönliche Identität, indem Rückzug und Desinteresse an Interaktionspartnern erfolgt, oder es entsteht eine Art Überanpassung an die soziale Identität, was einen ausschließliche Fixierung auf Bezugspersonen aufgrund eines totalen Anpassungsverhaltens impliziert (Schuppener 2005, S. 57). Die beschriebenen möglichen Auswirkungen einer Stigmatisierung auf die Entwicklung einer Ich-Identität sind in Abbildung 3 veranschaulicht.
Abbildung 3
Identität und mögliche Störungen angelehnt an Thimm
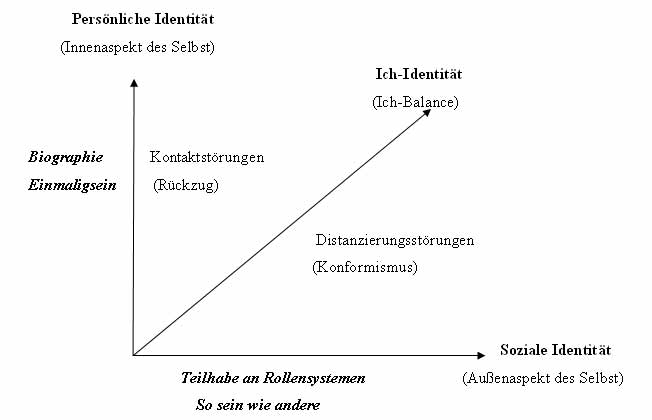
Quelle: Thimm 1975, S. 138
Distanzierungsstörungen in aktuellen Rollen mit der Konsequenz ritualisierter, konformistischer Anpassungsmuster (Dreitzel 1972, S. 330ff) resultieren aus der Unfähigkeit oder dem Verzicht, für die Interaktion ausreichende Informationen aus der als stigmatisiert empfundenen Biografie, persönliche Identität also, ins Spiel zu bringen.
Kontaktstörungen (ebd. S. 317ff) hingegen resultieren aus einem Zusammenbruch der Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität in Richtung auf die biografische Dimension von Ich-Identität.
Missglückt der Balanceakt zwischen persönlicher und sozialer Identität und es kommt zur Dominanz einer der beiden Identitätsebenen, wie beschrieben, ist dies nach Krappmann in beiden Fällen mit dem Resultat einer "Nicht-Identität" verbunden und mündet in gravierenden Persönlichkeitsstörungen. Goffman, Krappmann und Thimm vernachlässigen bewusst die internen Aspekte, also die Verarbeitung von Stigmatisierungsprozessen (Cloerkes 2000, im Internet). Diese greift Frey auf und lässt ihnen zentrale Aufmerksamkeit zukommen. Nach Frey kann das Individuum Stigmatisierung auf zweifache Art begegnen (ebd.):
-
Im sozialen Selbst, indem es veränderten Bewertungen widerspricht, diesen ausweicht oder sie völlig leugnet. Damit erhält es sich den Eindruck, dass zumindest der relevante Teil der Umwelt weiterhin eine positive Einschätzung seiner Person vornimmt. Ein Mensch mit einer Behinderung sieht sich in diesem Falle nicht durchgängig als abgewertet oder stigmatisiert.
-
Im privaten Selbst kann das Individuum der Stigmatisierung entgegentreten, indem es zwar die negativen Bewertungen durch andere wahrnimmt, aber ihre Berechtigung leugnet bzw. sie als relativ unwichtig ansieht. (Cloerkes 2000, im Internet)
Das Modell von Frey setzt sich also erstmals mit internen Verarbeitungsmöglichkeiten von Stigmatisierungen auf der Ebene der Identitätsentwicklung auseinander. Die wichtigsten Erkenntnisse von Frey lassen sich in den folgenden zwei Thesen zusammenfassen:
-
Auf eine Bedrohung der Identität durch Stigmatisierungen kann das Individuum in vielfältiger Art und Weise reagieren.
-
Stigmatisierungsfolgen sind weder zwangsläufig, noch einheitlich und sollten deshalb im konkreten Fall empirisch ermittelt werden. (Schuppener 2005, S. 58)
Die klassische "Stigma-Identitäts-These" (Abb. 4) geht davon aus, dass stigmatisierende Zuschreibungen zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung und Veränderung der Identität stigmatisierter Personen führen. Empirische Studien zur Bewältigung von Identitätsproblemen behinderter Menschen allerdings widerlegen den Charakter der Zwangsläufigkeit. Auch behinderte Menschen wenden Stigma-Management-Techniken an und schützen ihre Identität durch eine Reihe gezielt eingesetzter Identitätsstrategien. Erst wenn diese versagen, kommt es zur Anpassung des Selbst an die unangenehmen Bewertungen durch die Außenwelt und nur dann können wir davon ausgehen, dass die Identität beschädigt wurde. (vgl. Cloerkes 2000, im Internet)
Abbildung 4
Stigma-Identitäts-These
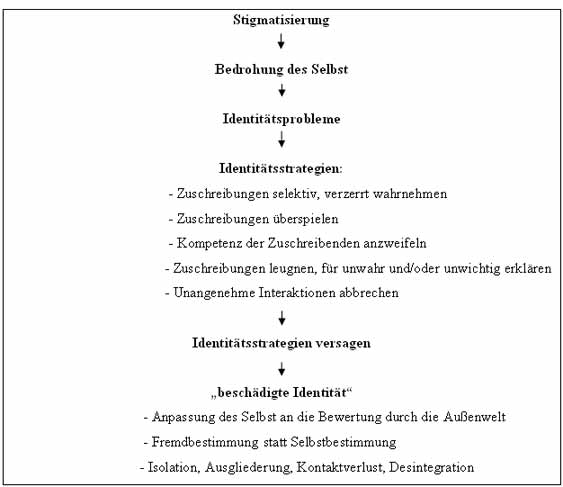
Quelle: vgl. Cloerkes 1997, S. 160f
Vor allem Befürworter der Integration erhoffen sich vom gemeinsamen Leben, Lernen und Arbeiten mit Menschen ohne Behinderung, dass auch die Heranwachsenden mit Behinderungen ein stimmiges Bild von sich selbst, eine tragfähige Identität entwickeln können. Bei der Forderung nach Integration in Kindergarten und Schule geht es um die Vermeidung einer durch das separierende Schulsystem zerstörten sozialgesellschaftlichen und individuellen Identität. Menschen müssen sich als nicht zugehörig, als minderwertig erleben (und in ihrer Identitätsentwicklung auch so sehen), wenn sie separiert werden und ihnen durch die Separierung der Zugang zum vollen Reichtum der Kultur verschlossen bleibt (Klauß 2005, S. 150). Integration wird hier als Prozess angesehen in dessen Verlauf sich Einstellungen verändern und sich so soziale Vorteile vermeiden lassen. Es geht also um Prozesse, die sich in einer dynamischen Balance von Annäherung und Abgrenzung vollziehen.
Inhaltsverzeichnis
"Eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen." (Goffman 1973, S. 11)
Soziale Einrichtungen - in der Alltagssprache Anstalten (institutions) genannt - sind Räume, Wohnungen, Gebäude oder Betriebe, in denen regelmäßig eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt wird. Jede Institution nimmt einen Teil der Zeit und der Interessen ihrer Mitglieder in Anspruch und stellt für sie eine Art Welt für sich dar; kurz, alle Institutionen sind tendenziell allumfassend. Ihr allumfassender oder totaler Charakter wird symbolisiert durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut sind, wie verschlossene Tore, hohe Mauern, Stacheldraht, Felsen, Wasser, Wälder oder Moore. Solche Einrichtungen nennen sich totale Institutionen. (ebd. S. 15f)
In der modernen Gesellschaft besteht eine grundlegende soziale Ordnung, nach der der einzelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbeitet - und dies mit wechselnden Partnern, unter verschiedenen Autoritäten und ohne einen umfassenden rationalen Plan. Das zentrale Merkmal totaler Institutionen besteht darin, dass die Schranken, die normalerweise diese drei Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind.
-
Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt.
-
Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen.
-
Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben.
-
Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen. (Goffman 1973, S. 17)
Wenn der Aufenthalt der Insassen lange andauert, kann das eintreten, was "Diskulturation" genannt wurde - d.h. ein Verlern-Prozess, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden. (ebd. S. 24)
Im Vergleich ganz unterschiedlicher Einrichtungen, wie beispielsweise der Psychiatrischen Klinik, dem Gefängnis, dem Konzentrationslager, der Kaserne und dem Kloster arbeitet Goffman allgemeine Merkmale der totalen Institution heraus (Goffman 1973, S. 13ff). Keines dieser Merkmale findet sich ausschließlich in totalen Institutionen, und keines ist allen gemeinsam. Kennzeichnend für totale Institutionen ist jedoch, dass sie einen beträchtlichen Anteil dieser Gruppe von Attributen aufweisen.
In totalen Institutionen erfolgt die Handhabung von menschlichen Bedürfnissen durch die bürokratische Organisation ganzer Gruppen von Menschen. Es erfolgt eine strikte Trennung
zwischen der großen Gruppe der Insassen und dem weniger zahlreichen Aufsichtspersonal. Für die Insassen gilt, dass sie in der Institution leben und beschränkten Kontakt zur Außenwelt haben. Das Personal hält sich lediglich zur Arbeit in der Institution auf und ist sozial in die Außenwelt integriert. Der soziale Kontakt zwischen den beiden Gruppen ist gering, die Kommunikation eingeschränkt und kontrolliert. Totale Institutionen fordern aufgrund ihres allumfassenden Charakters von ihren Insassen eine radikale Disziplin. Die Anpassung an die institutionellen Bedingungen läuft auf eine ständige zunehmende Schwächung des Selbstwertgefühls der Insassen hinaus weil sie ihrer Möglichkeiten zum autonomen Handeln ganz entschieden beraubt werden. (Goffman 1973, S. 17ff)
Kennzeichnend für totale Institutionen ist ein hohes Maß an Informationskontrolle. Dem Insassen werden Informationen, besonders solche seine Person betreffend, nicht weitergegeben oder nur selektiv und zensiert. Typisch ist, dass der Insasse von Entscheidungen, die ihn betreffen, keine Kenntnis erhält. Beim Eintritt in die Einrichtung werden Fakten - besonders die diskreditierenden - über den sozialen Status und die Vergangenheit des Insassen gesammelt und in einem dem Personal zur Verfügung stehenden Dossier zusammengestellt. Befragungen und Verhöre zielen darauf ab, Fakten und Daten über Persönlichkeitsmerkmale und vergangenes Verhalten der Insassen zu sammeln. Der Insasse muss bei solchen Gelegenheiten Fakten und Gefühle, die seine Person betreffen, ihm zumeist unbekannten Zuhörern offenbaren. (ebd. S. 26f)
Der Eintritt in die totale Institution ist durch spezifische Aufnahmeprozeduren markiert: Aufnahme des Lebenslaufs, Fotografieren, Messen und Wiegen, usw. Die meisten dieser Prozeduren beruhen auf Attributen, die das Individuum lediglich insofern ausweist, als es ein Mitglied der größten und abstraktesten sozialen Kategorie, nämlich der Menschheit ist. Eine Behandlung aufgrund solcher Attribute lässt weitgehend die Grundlagen einer früheren Selbstidentifikation außer Acht. Der Eintritt in die totale Institution führt zum bürgerlichen Tod des Insassen: Verlust des Wahlrechts und der Beteiligung an anderen Formen politischer Partizipation, des Rechts über Geld zu verfügen usw. Einige dieser Rechte können ihm auch für immer aberkannt werden. (Goffman 1973, S. 26f).
Totale Institutionen beschränken und besetzen systematisch und umfassend die Territorien des Selbst der Insassen: Besuch zu empfangen oder außerhalb der Anstalt Besuche zu machen, ist verboten oder wird kontrolliert und reglementiert; persönliche Habe wird auf ein Minimum beschränkt und durch uniforme, standardisierte Anstaltsobjekte ausgetauscht. Es kommt zu einer Auflösung der Grenzen zwischen Verbergen und Zurschaustellen: Körperpflege, Hygiene und Notdurft müssen öffentlich ausgeführt werden und unterliegen der Kontrolle. Der Körper des Insassen, seine Kleidung, sein Schlafplatz werden routinemäßig unter- und durchsucht. Es besteht kein Schutz vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. (ebd. S. 26ff)
Das formelle Verhältnis zwischen dem handelnden Individuum und seinen Handlungen wird zerstört: Insassen totaler Institutionen verfügen nicht in dem selben Maße über Möglichkeiten, sich gegen verbale Angriffe, Demütigungen oder Ungerechtigkeiten zur Wehr zu setzen, denn dafür können sie sofort bestraft werden. Die Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, ein Herausgehen (Flucht) aus der Situation ist nicht möglich. Das Verhalten eines Insassen in einer bestimmten Situation kann ihm vom Personal in Form von Überprüfung und Kritik in einem anderen Kontext vorgeworfen werden. In totalen Institutionen steht das Verhalten der Insassen permanent zur Diskussion, Kritik und Sanktionen sind allgegenwärtig. Die Autonomie des Handelns wird verletzt, weil für die Durchführung von Handlungen (Briefe schreiben, telefonieren, Geld ausgeben) eine Genehmigung einzuholen ist. (Goffman 1973, S. 43)
Die zeitliche Aufeinanderfolge von Aktivitäten unterliegt kontrollierten Regelungen. Insassen haben keine "freie Zeit" bzw. keine "eigene Zeit". Die Kontrolle der Zeit ist allumfassend, der Tagesplan ist vorgeplant und die Zeitökonomie des Insassen wird strenger Disziplin unterworfen. Bei den Insassen herrscht weitgehend das Gefühl, dass die in der Anstalt verbrachte Zeit verlorene, vergeudete und nicht gelebte Zeit ist. Der Insasse bekommt das Gefühl, dass er für die Dauer seines Aufenthalts in der Anstalt vollkommen vom Leben abgeschlossen ist. Die Zeit wird als tot und bleischwer erlebt. (ebd. 21ff)
Die totale Institution bildet gleichsam bestimmte Organisationsmuster für das alltägliche Leben heraus, die es den Insassen erlauben, zu überleben ohne die Identität völlig aufzugeben. Goffman bezeichnet diese Handlungsmuster als "sekundäre Anpassung". Weil die primäre Anpassung, die kooperative Zusammenarbeit in der Organisation nicht geschehen kann, stellt sich mit der Zeit in solchen Institutionen ein "Unterleben" ein. Damit bezeichnet Goffman die im offiziellen Zielkatalog der Organisation weder intendierten noch formal erfassten Organisationsleistungen der Insassen, die mit den Absichten und Zielen der Einrichtung nicht oder wenig im Einklang stehen, die von der Welt des Personals getrennt sind und die durch die Stabilisierung der Insassenidentität und -individualität dennoch einen funktionellen Beitrag zum mehr oder weniger reibungslosen Betreiben einer Einrichtung leisten. (Goffman 1973, S. 65ff)
Goffman (1973 S. 65ff) unterscheidet fünf Arten der sekundären Anpassung an die totale Institution, die dem Insassen zur Verfügung stehen.
-
Rückzug aus der Situation: Der Insasse reduziert sein persönliches Engagement für das, was in der Anstalt passiert, auf ein Minimum.
-
Kompromissloser Standpunkt: Der Insasse ordnet sich den Regeln der Anstalt nicht unter und widersetzt sich den Anweisungen des Personals so oft wie möglich.
-
Kolonisierung: Der Insasse zieht Vorteile aus der Anpassung an das System der Anstalt. Sein Verhalten passt sich der Ordnung des Systems an.
-
Konversion: Der Insasse übernimmt die Ansichten der Mitarbeiter über die Außenwelt, die Anstalt und die Insassen und macht sie zu seinen eigenen Ansichten.
-
Ruhig Blut bewahren: Der Insasse passt sich erfolgreich dem Privilegiensystem an und setzt Umwandlung, Kolonisierung und Loyalität gegenüber der Gruppe der Insassen je nach den Erfordernissen der Lage für ein erfolgreiches Verhalten, das Erreichen von Zielen und das Identitätsmanagement ein. (Goffman 1973, S. 65ff)
Sekundäre Anpassung ist insbesondere ein Mittel, das es den Mitgliedern einer Organisation erlaubt, in dieser Organisation zu leben, aber dennoch Distanz zu wahren, d.h. sich nicht vollständig an ihr Weltbild und ihr Ordnung anzupassen und eine Identität aufrecht zu erhalten, die nicht vollständig mit den angepassten Mitgliedern der Institution verschmilzt, sondern immer noch anders bleibt. Wie Goffman feststellt erfordert der Aufbau eines stabilen Selbst zwei Vorgänge: Inklusion in die Gesellschaft und Distanz zur Gesellschaft. (Münch 2002, S. 301)
Unter Enthospitalisierung wird der Prozess der Ausgliederung nicht krankenhausbehandlungsbedürftiger (behinderter) Menschen aus hospitalisierenden Einrichtungen verstanden. Enthospitalisierung steht aber auch für einen Prozess, bei dem es, in Bezug auf (ehemals) fehlplazierte Menschen, um die größtmögliche Realisierung des Normalisierungsprinzips[1] und des Integrationsgedankens geht. Normalisierung und Integration sind dabei zugleich Mittel und Zielvorstellungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen hospitalisierter Menschen. (Hoffmann 1999, S. 20)
Demzufolge umfasst Enthospitalisierung ein breites Spektrum politischer, strukturverändernder und pädagogischer Maßnahmen, die darauf zielen, für (ehemals) fehlplazierte Menschen Lebensbedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen integriert zu leben.
Während anfangs der Prozess der Enthospitalisierung vor allem auf die Ausgliederung der Menschen mit Lernschwierigkeiten aus Psychiatrien beschränkt war, ging es doch sehr bald auch um die Forderung nach Auflösung von Behindertenanstalten zugunsten gemeinwesenintegrierter Wohnangebote und Hilfssysteme. Für Feuser (1995) ist "das Ende der Verwahrung" Voraussetzung und Wendepunkt dafür, Menschen Lernschwierigkeiten ein auf Autonomie und Selbstbestimmung beruhendes Leben zu ermöglichen. "Dabei gilt es jedoch darauf zu achten, dass der Ausgliederung nicht die Eingrenzung in vier Wände scheinbarer Privatheit und Freiheit erfolgt". (S. 268)
Der Beginn der Enthospitalisierung liegt nach Gromann-Richter (1993) in der scheinbaren Banalität, die Betroffenen mit einzubeziehen.
"Ich behaupte (...), dass die Versorgung ohne das Einbeziehen, das Befragen der Patienten eine Umhospitalisierung bleibt. Das Fragen ist sehr wichtig, gerade weil es Voraussetzungen hat: ohne eine Veränderung der Grundhaltung, dass Patienten etwas zu sagen haben, ist wenig zu erreichen. Um dieses "Etwas-sagen-Können" der Patienten muss ich mich bemühen. Und dieses Bemühen schließt gerade auch die Patienten ein, die sich nicht oder nicht mehr äußern können. (...) Ich als Frager muss es ernst meinen, ich muss mich bemühen, auch scheinbar Nebensächliches ernst zu nehmen, muss mir die Mühe machen, auch bei Unverständlichem den Zusammenhang wiederherzustellen, ich benötige Zeit. Aber das wichtigste - gerade bei Patienten, die sich nicht äußern, ist das Herstellen von Wahlmöglichkeiten im Alltag. Erst wenn ich mich sinnvoll wieder für oder gegen etwas in meinem Lebensalltag entscheiden kann, kann ich mich äußern" (ebd. S. 55).
Zur Konkretisierung von Enthospitalisierung bieten sich eine Unterscheidung in formale und inhaltliche Aspekte an. Diese sind jedoch miteinander verzahnt und bedingen einander (Hoffmann 1999, S. 20f).
Aspekte der formalen Enthospitalisierung
-
Räumliche, funktionale und organisatorische Integration
-
Dezentralisierung
-
Regionalisierung
-
Schaffung gemeindeintegrierter, bedürfnisorientierter, häuslicher Wohneinheiten
-
Selbstversorgungsprinzip
-
Verwirklichung einer demokratisch-partnerschaftlichen Organisationsstruktur
Aspekte der inhaltlichen Enthospitalisierung
-
Soziale, personale und gesellschaftliche Integration
-
Gewährleistung eines normalen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus und eines normalen Lebenslaufs
-
Mit- und Selbstbestimmung der BewohnerInnen
-
Ermöglichung einer angemessenen Beziehung zwischen den Geschlechtern
-
Alltagsbegleitung bzw. Assistenz als Hilfe zur Selbsthilfe
-
Emanzipation und Autonomie entsprechend den jeweiligen Möglichkeiten
-
Beachtung und Respektierung der Person, ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten
-
Arbeits-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten außerhalb des Wohnbereichs
-
Psychosoziale Angebote zur Bewältigung bzw. Kompensation von psychischen Krisen, Verhaltensauffälligkeiten oder Hospitalisierungssymptomen
-
Gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahmen bzw. Hilfen. (Hoffmann 1999, S. 20f)
Darüber hinaus gilt es ein regionales Verbundsystem auf- und auszubauen, damit gemeindenahe Hilfe in ambulanten und komplementären Bereich zur Verfügung stehen. Fehlt ein regionales Verbundsystem und werden die Aspekte von Normalisierung und Integration nur unzureichend berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass es statt zu einer Enthospitalsierung zu Vorgängen kommen kann, die als "Umhospitalisierung" bezeichnet werden.
Der Begriff "Umhospitalisierung" steht für einen Prozess, in dem behinderte Menschen, die bislang in Einrichtungen wie Psychiatrien, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen fehlplaziert lebten, zwar ausgegliedert, aber erneut in Wohneinrichtungen mit hospitalisierendem Charakter untergebracht werden. Dabei kann unterschieden werden zwischen Wohnbereichen (Heimen etc.), in denen sich die Lebensqualität der Betroffenen nicht verbessert hat, d.h. es fand weder eine formale noch eine inhaltliche Enthospitalisierung statt, und solchen, in denen sich die Lebensqualität aufgrund einer weitreichenden inhaltlichen Enthospitalisierung trotz unzureichender formaler Enthospitalisierung erhöht hat. Dies bedeutet, dass eine gemeindenahe häusliche Wohnung (formale Enthospitalisierung) keine Garantie für eine gelingende Enthospitalisierung bietet, wenn nicht gleichzeitig inhaltliche Enthospitalisierungsprozesse stattfinden. (Hoffmann 1999, S. 21f)
Der Terminus "Deinstitutionalisierung" wird meist synonym zu "Enthospitalisierung" gebraucht, zumal die Intention der damit verbundenen Prozesse ähnlich ist. (Hoffmann 1999, S. 23). Deinstitutionalisierung zielt in einem erweiterten Verständnis auf eine Veränderung von Macht- und Gewaltstrukturen, wie sie beispielsweise, aber nicht nur, einer "totalen Institution" innewohnen. Diese sind mit dem Verlassen einer "hospitalisierenden" Einrichtung bzw. einer "totalen Institution" nicht automatisch verschwunden (Jantzen 1998, S. 113). Auch können und müssen strukturelle Veränderungen innerhalb von Institutionen erfolgen. Dabei geht es vor allem darum, "dass die Verobjektivierung im Verkehr zwischen Personal und behinderten Menschen in großem Umfang beseitigt wir" (ebd. S. 122) und der Objektstatus des Einzelnen zu Gunsten des ihm zustehenden Subjektstatus aufgelöst wird. Gleichzeitig bedeutet dies, dass erlebte Gewalterfahrungen wahrgenommen, anerkannt und aufgearbeitet werden können, und dass dafür entsprechende Sicherheiten und Unterstützungsmöglichkeiten gewährleistet werden, wie sie zum Beispiel die verstehende oder rehistorisierende Diagnostik bietet. Rehistorisierung bezeichnet die Rekonstruktion individueller Lebensgeschichten und deren Bedeutung für das betreffende Individuum. Dabei spielt die Einsicht eine Rolle, dass es letztlich keine Verhaltens- und Erlebnisweisen (Auffälligkeiten wie auch Kompetenzen) gibt, die nicht aus der Entwicklung als Ganzes zu begreifen wären. Jantzen (1996 S. 17) betont dabei, dass eine verstehende Diagnostik "nicht auskommt ohne eine Theorie der möglichen Entwicklungsgeschichte des Subjekts, welche die Verhältnisse der Entwicklung der verschiedenen Ebenen mit einschließt. Eine solche Theorie muss zudem als Theorie möglicher unterschiedlicher Entwicklungspfade konstruiert werden".
Weder chronisch psychisch Kranke noch Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen dauerhaft in Anstalten leben. Vielmehr sind neue Formen der dezentralen Betreuung in kleinen, integrierten Einheiten möglich. Der Erfolg der Deinstitutionalisierung und des integrierten Wohnens und Lebens im Stadtteil ist an wichtige Voraussetzungen gebunden, etwa das Vorhandensein einer als sinnvoll erlebten Arbeit, abgestufter und individuell zugeschnittener Hilfen oder die Verfügbarkeit von Kriseninterventionsdiensten. Eine weitere, häufig genannte Voraussetzung für das Gelingen ist bürgerschaftliches Engagement, das sich im Zuge der Herausbildung einer neuen Bürger- oder Zivilgesellschaft entwickeln soll. (Dederich 2006, S. 1)
Eines der am meisten diskutierten Konzepte, das diese neue Philosophie, Konzeption und Organisationsform der Behindertenhilfe umreißt, ist die sog. "Community Care". Hierbei geht es um eine integrierte, gemeindenahe Form institutionalisierter Hilfe, die die notwendige Unterstützung behinderter Mitbürger bei einem anzustrebenden Maximum an Selbstbestimmung und gleichzeitiger Einbindung in einen sozialen Kontext gewährleisten soll. Das Community-Care-Konzept steht für das Prinzip der Fürsorge in der Gemeinde.
Angestrebt wird eine Aktivierung vorhandener Netzwerke oder der Aufbau solcher Netzwerke, die auf der Nutzung vorhandener lokaler Ressourcen beruhen, also ausdrücklich die nichtbehinderten Bürger eines Ortes oder Stadtteiles einbeziehen. Gegenseitige Unterstützung und Solidarität, der Aufbau von tragfähigen Beziehungen und die Möglichkeit, einer integrierten Arbeit bzw. sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, sind ebenso wichtig für dieses Konzept wie die Gewährleistung von Schutz, Assistenz und, wo notwendig, advokatorische Unterstützung. So sollen Menschen mit einer Behinderung als Mieter, Nachbarn, Bürger mit Rechten und Pflichten zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Kommune werden. (Dederich 2006, S. 2)
[1] Das Normalisierungsprinzip wurde 1959 von Bank-Mikkelsen postuliert, von Nirje 1974 präzisiert und von Wolfensberger 1980 systematisiert. Es stellt eine sozialpolitische und pädagogische Grundlage zur Integration von Menschen mit einer Behinderung in die Gesellschaft dar und hat sich in der heutigen Zeit als Leitidee für die Behindertenhilfe durchgesetzt. Ziel ist, Isolierung und gesellschaftliche Randstellung von Menschen mit Behinderungen aufzuheben und ihnen ein "normales" Leben durch Schaffung von Lebensmustern und Lebensbedingungen, die den Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Kultur entsprechen, zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
Auch wenn Freiheit und Autonomie seit Jahrtausenden Themen unseres Kulturkreises sind, ist ein individualistisches Verständnis von Selbstbestimmung ein Ergebnis der Neuzeit. (Klauß 2007, S. 9)
Es geht nicht darum, das Konzept des rationalen, autonomen Subjekts als quasi naturgegeben vorauszusetzen und von diesem Ansatz aus zu untersuchen, wie viel Selbstbestimmung (vielleicht) denjenigen zugestanden werden kann, die von der Gesellschaft eigentlich gar nicht als autonomiefähig angesehen werden. Vielmehr gilt es, sich dem Subjektstatus zuzuwenden und ihn zu dekonstruieren als historische und gesellschaftspolitische Kategorie, dessen Funktion es ist, soziale Gruppen wie "die Behinderten" (und vor allem: "wir Normalen") (Goffman 1973, zit. nach Waldschmidt 2004. S. 10) zu konstituieren. Indem die Mehrheitsgesellschaft behinderten Menschen einen Mangel an Vernunft zuschreibt, versichert sie sich im Gegenzug ihrer eigenen Vernünftigkeit und legitimiert auf diese Weise die Teilhabe an Freiheitsrechten (bzw. die Exklusion von ihnen). Selbstbestimmung ist offensichtlich eine Dimension der sozialen Kategorisierung und Differenzierung und somit auch eine Machtstrategie, deren unkritische Übernahme "Creaming"-Prozesse bewirken kann: die Etablierung einer neuen Behindertenhierarchie, deren Rangordnung nach der Autonomiefähigkeit strukturiert ist. In der künftigen Auseinandersetzung muss es deshalb darum gehen, nicht nur die Chancen des Autonomiegedankens für behinderte herauszuarbeiten, sondern auch auf seine Gefahren aufmerksam zu machen. (vgl. Waldschmidt 2004, S. 10)
Für den philosophischen Diskurs über Autonomie ist der Ansatz Immanuel Kants grundlegend. Nach Kant wird die Menschheit durch Vernunft, Willensfreiheit, Autonomie, Selbstgesetzgebung und Sittlichkeit gekennzeichnet. Diese Vermögen laufen in der Freiheit bzw. Autonomie zusammen. (Dederich 2004, S. 9)
Nach Kant ist der Mensch grundsätzlich zur Selbstbestimmung fähig, da er über praktische Vernunft verfügt. Diese wird von Kant definiert als das Vermögen, das eigene Handeln unabhängig von Bedürfnissen, Emotionen und Motivationen auszurichten. (Waldschmidt 2003, im Internet) Derart bestimmtes freies Handeln ist an die (praktische) Vernunft gebunden, die einem zeigt, was richtig und falsch ist. Menschliche Autonomie bezeichnet also kein beliebiges Tun und Lassen was man möchte. Sie meint vielmehr, dass man selbst (autos) sich an einem als vernünftig erkannten Gesetz (nomos) orientiert. (Klauß 2007, S. 1)
Die praktische Vernunft zeichnet den Menschen allgemein aus und macht ihn zu einem rational handelnden Subjekt. In Gefahr gerät die Subjekthaftigkeit des Menschen dann, wenn er krank wird, eine dauernde gesundheitliche Beeinträchtigung erwirbt oder mit einer solchen geboren wird. (Waldschmidt 2003, im Internet) Für Kant erweist sich der Mensch nicht in seiner Krankheit als Subjekt, sondern indem er sich in ärztliche Behandlung begibt, also die Krankheit zu überwinden sucht. Die Aufklärungsphilosophie sieht den Kranken als grundsätzlich vernünftiges Wesen an, nicht so den psychisch Kranken oder den Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie gelten als die Unvernünftigen. Da man davon ausging, dass sie nicht rational handeln können, sprach man ihnen ihr Subjektsein ab. Die Selbstbestimmung der "Unvernünftigen" wurde somit in Frage gestellt. (Dederich & Jantzen 2009, S. 185)
Dennoch wurde Autonomie für behinderte Menschen möglich: Als am Ende des 20. Jahrhunderts die bis dato Ausgegrenzten begannen, ein autonomes Leben für sich zu reklamieren, forderten sie im Grunde das ein, was ihnen als Menschen vom Anspruch des bürgerlichen Zeitalters her zusteht. Sie forderten, so wie alle anderen leben zu können, sie beanspruchten den Subjektstatus. (Waldschmidt 2003, im Internet)
Um die gesellschaftlichen Bedingungen sichtbar werden zu lassen, innerhalb derer die behindertenpolitische Autonomieforderung zu einer realistischen Möglichkeit werden konnte, ist ein historischer Exkurs notwendig.
Durch die gesamte Geschichte zumindest der abendländischen Kultur zeigt sich die soziale, gesellschaftliche, aber auch rechtliche Situation behinderter Menschen in einem wechselhaften Spannungsverhältnis von Exklusion, gesellschaftlicher Marginalisierung, Separierung, Entrechtung und verweigerter Anerkennung, eingeschränkter Teilhabe bis hin zu Bemühungen um schulische, beruflich und soziale Integration. Die Rekonstruktion der historischen Veränderungen innerhalb dieses Spannungsverhältnisses zeigen keineswegs einen linearen, gradlinigen Verlauf, sondern vielfältige Verlagerungen und Verschiebungen. (Dederich 2004, S. 2)
Im Mittelalter stellte Behinderung ein Problem dar. Es war aber weniger eine Frage von Arbeits- und Leistungsfähigkeit, sondern eher ein Problem der sozialen Ordnung, von Sittlichkeit und Moral. Menschen mit leichteren Behinderungen wurden zum Gegenstand von Nächstenliebe und Mildtätigkeit, waren Sündenböcke und Dorfnarren. Sie hatten ihr von Gott auferlegtes Schicksal zu tragen, übernahmen Aufgaben oder wurden mitversorgt in der Hausgemeinschaft. Sie dienten auf Jahrmärkten der Belustigung oder verschwanden hinter Klostermauern. Schwerer behinderte Menschen wurden als "Wechselbälger", als "Söhne des Satans" angesehen und verkörperten damit die Idee des "Bösen" in der Gesellschaft. Sie wurden aus der Gemeinschaft verbannt und zusammen mit anderen Ausgegrenzten (Kriminelle, Arme, Bettler) unter zumeist unwürdigen Umständen interniert. (Theunissen 2000, S. 20f)
In der Renaissance, mit Herausbildung der modernen Identität veränderte sich auch die soziale Rolle der behinderten Menschen. Gemeinsam mit anderen Gruppen bevölkerten sie nun das Heer der Armen und Besitzlosen und gehörten zu den "Asozialen". Insbesondere "idiotische" und "verrückte" Menschen wurden mit der heraufziehenden Moderne zu fundamental Fremden, zu den "Anderen", die am Reich der Vernunft und damit der Freiheit nicht teilhatten. Im 17. Jahrhundert versuchte die absolutistische Staatsgewalt durch eine Politik der Einschließung, der entwurzelten Massen, die bettelnd und vagabundierend durch die Lande zogen, Herr zu werden. In ganz Europa wurden Zucht und Arbeitshäuser eingerichtet, um diejenigen einzusperren, die als gefährlich und lasterhaft, mittellos und bedürftig, überflüssig und störend galten. Diese erste große Internierung war undifferenziert. Sie umfasste die von ihrer Familie Verstoßenen, die Verbrecher ebenso wie die Kranken und Gebrechlichen. Dem Einschließen lag keine Heilungsabsicht zugrunde. (vgl. Waldschmidt 2003, im Internet)
Die Aufklärungsphilosophie lieferte die Grundlage für eine neue moralische Gesinnung, die auf der Vorstellung des autonomen Subjekts gründete. Mit dem Zeitalter der Aufklärung und des Humanismus rückte das Individuum in den Mittelpunkt der Weltbetrachtung. Diese neue Sichtweise bedeutete für Menschen mit Behinderung zunächst, dass sich Mediziner und bürgerliche Pädagogen ihnen interessiert zuwendeten und sich mit ihnen beschäftigten. Ihre Lebensumstände verbesserten sich aber keineswegs. Sie waren zwar nicht mehr Mittel zum Heilserwerb, erhielten aber ihren Zweck als Gegenstand wissenschaftlicher Erörterungen und ökonomischer Überlegungen. Der Mensch mit einer Behinderung blieb Objekt, das mit sich geschehen lassen musste. (Sierck 1987, im Internet)
Seit der Aufklärung ist individuelle Selbstbestimmung prinzipiell möglich - und zwar eigentlich für alle Menschen. Allerdings erwies sich die Idee der Universalität in Verbindung mit dem Autonomiegedanken schnell als gefährlich für die herrschende soziale Ordnung. Aus der Furcht heraus, die bürgerliche Gesellschaft könnte als Ganzes außer Kontrolle geraten, wurden deshalb große Personengruppen, die durch ihren Mangel an Vernunft und Zivilisation definiert wurden, weiter ausgegrenzt. Ausgeschlossen wurden vor allem diejenigen, die wir heute als Behinderte bezeichnen. Mit der Masse der "Krüppel", "Idioten" und "Irren", mit denjenigen, denen der Ausgang aus der Unmündigkeit nicht möglich war, da sie diese nicht selbst verschuldet hatten, verfuhr die Moderne ganz und gar nicht liberal, sondern höchst autoritär. (Waldschmidt 2003, im Internet) Die Aufklärungsphilosophie sieht den Kranken als grundsätzlich vernünftiges Wesen an, nicht so den psychischen Kranken und den Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie gelten als die Unvernünftigen. Da man davon ausging, dass sie nicht rational Handeln können sprach man ihnen ihr Subjektsein ab. (Dederich & Jantzen 2009, S. 185)
Seit etwa dem 18. Jahrhundert begannen die Mediziner, die "Krüppel" zu trennen in körperlich "Verkrüppelte, Schwachsinnige und Idioten". (Sierck 1987, im Internet) Ziel dieser Aufteilung war es, die "verlässlichen und verwertbaren Krüppel" von den wirtschaftlich "Unbrauchbaren" zu trennen. Gleichzeitig und mit demselben Hintergrund beginnt der Aufbau der Sonderschulen. (Sierck 1987, im Internet)
Mit der Moderne veränderte sich demnach der gesellschaftliche Umgang mit den behinderten Menschen entscheidend. Einerseits schloss man sie weiter weg, andererseits fing man an, sie nach Schädigung, Bildsamkeit, Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit in verschiedene Untergruppen zu differenzieren und medizinischen und pädagogischen Eingriffen zu unterziehen. Der humanistische Impuls der europäischen Aufklärung führte zu vielfältigen Bildungsbemühungen. Ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurden Heime für behinderte Kinder errichtet und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Unterrichtsmethoden entwickelt. (Waldschmidt 2003, im Internet)
In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde die Anstaltstechnologie zum Ansatzpunkt der eugenischen Auslese- und Ausmerzungsstrategien. In der nationalsozialistischen Rassenhygiene wurden behinderte Menschen nicht mehr "nur" verwaltet und weggeschlossen, sondern in großer Zahl selektiert, zwangssterilisiert und physisch vernichtet. Mit dem nationalsozialistischen Gedankengut wurde aus der "Hilfe dem Hilflosen" sehr schnell die Opferung der "Hilflosen". Mediziner wollten "Verkrüppelungen" heilen, indem sie die Vernichtung der "Krüppel" anstrebten. Maßgeblich beteiligt an der Ausbreitung der "krüppelfeindlichen Ideologie" waren Juristen, Ärzte, Sonderpädagogen. (Sierck 1987, im Internet)
1933 verabschiedeten die Nationalsozialisten das erste Massenvernichtungsgesetz, nämlich das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses". Dies hatte zur Folge, dass bis 1945 zahlreiche Menschen zwangssterilisiert wurden. Hitler hat zusätzlich zu Kriegsbeginn, am 01. September 1939, den ‚Gnadentod' für ‚unheilbar Kranke' angeordnet. Somit wurden tausende (‚lebensunwerte') behinderte Menschen in Tötungsanstalten durch Gas ermordet. Neben diesen direkten Tötungen sind mehrere hunderttausend Menschen in psychiatrischen Einrichtungen durch Verhungern, Medikamentenüberdosis oder Nichtbehandlung von Krankheiten gestorben bzw. umgebracht worden. (Hähner 1997, S. 25)
Nach 1945 wurde weder Trauerarbeit geleistet noch Schuld und Versagen aufgearbeitet. Statt dessen ging ein Großteil der ‚Henker', also Personal und Ärzte, wieder zur Tagesordnung über. Konkret heißt das, jene Menschen, die in den Jahren zuvor Tötungsakte vorgenommen hatten oder Menschen bewusste sterben ließen, waren nun beauftragt, sich um behinderte Menschen zu kümmern und zwar in den gleichen Anstalten und psychiatrischen Krankenhäusern wie zuvor. (Hähner 1997, S. 26)
Nach 1945, in einer Phase, in der Konformität und Anpassung die zentralen Werte darstellen, kam es zur Rekonstruktion auch der Internierungspolitik. So, als sei der Massenmord an behinderten Menschen nicht geschehen, wurden die großen Anstalten wieder mit Insassen bevölkert. Ein ganzes Spektrum an speziellen Institutionen wurde aufgebaut, hinter deren Mauern behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene erneut verwahrt und sonderbehandelt wurden. (vgl. Waldschmidt 2003, im Internet) Von Betreuung, Fürsorge, Förderung war in jenen Jahren viel die Rede, von Selbstbestimmung und persönlicher Autonomie dagegen nicht.
Erst Ende der 1970 Jahre vollzog sich in Orientierung an den internationalen behindertenpolitischen Modellen eine stärkere Hinwendung zum Individuum. Dieser Individualismus rückte die Bedarfe der Menschen mit Behinderung selbst ins Zentrum der fachlichen Diskussion. Selbstbestimmung und Teilhabe wurden zu verbindlichen Leitgedanken des Ausbaus und der Umgestaltung des Behindertensystems. (Dederich & Jantzen 2009, S. 185) Bereits 1979 hat Hahn auf dem Hintergrund einer Untersuchung zur sozialen Abhängigkeit von Menschen mit einer Behinderung das "Prinzip Entscheidenlassen" später "Autonomieprinzip" publiziert. Es enthält den Appell, Menschen - auch mit schwerer geistiger Behinderung - selbst entscheiden zu lassen. (Hahn 1999, zit. nach Dederich & Jantzen 2009, S. 185)
Nach den ersten behindertenpädagogischen Appellen setzte eine breite Selbstbestimmungsdiskussion ein, die anthropologisch, pädagogisch, und behindertenpolitisch geführt wurde. (Dederich & Jantzen 2009, S. 186)
Die Entwicklung von der Verwahrung über die Förderung hin zur Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen seit 1945 fasst Hähner (1997) in einem Schaubild zusammen.
Abbildung 5
Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung
|
Leitbild |
Zeit |
Gängiges Menschenbild |
Professionelle Orientierung |
Methodische Ausrichtung |
Zugehörige Institutionen |
|
Verwahrung |
1945 bis in die 70er Jahre |
"Biologisitisch-nihilistisches" Menschenbild; Gleichsetzen von geisitger Behinderung und Krankheit; der behinderte Mensch ist Patient. |
Primat der Medizin |
Pflegen, Schützen, Bewahren |
Anstalten und psychiatrische Kliniken |
|
Förderung |
Ab den 60er Jahren |
Der Mensch mit Behinderung als defektes Wesen - Defizitorientierung; der Mensch wird gesehen als Summe von motorischen, kognitiven, sozialen (und emotionalen) Fähigkeiten |
Medizinisch- (funktions-) therapeutische Richtungen, wie Krankengymnastik, Ergotherapie u.a. Heilpädagogik, Geistigbehinderten-pädagogik |
Förderung, Therapie |
Sondereinrichtungen |
|
Selbst-bestimmung |
Ab Mitte der 80er Jahre |
Der Mensch ist ausgestattet mit der Fähigkeit zur Selbstregulation (humanistische Sichtweise); der Mensch in seienr sozialen und Umweltbezogenheit (ökosystemische Sicht). |
"Entpädagogisierung" Eine über neue Curricula erweiterte sozialpädagogische Ausrichtung |
Empowerment, dialogische Begleitung, Erwachsenen-Bildung |
Integrative Kindergärten und Schulen, ambulante Hilfen (betreute Wohnformen), offene Hilfen. |
In den letzten Jahren mehren sich Einwände, zumindest gegen eine Überbetonung und Verabsolutierung der Selbstbestimmung als Leitidee (vgl. Waldschmidt 2003).
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die neoliberale Gesellschaft und mit ihr die Behindertenpolitik vor einer neuen Herausforderung. Nunmehr gilt es, nicht nur soziale Ordnung zu gewährleisten, sondern auch Dynamik zu ermöglichen. Die globalisierte Ökonomie macht es notwendig, die Märkte miteinander zu vernetzen, die Zirkulation von Waren und Arbeitskräfte zu beschleunigen und das Verhalten der Menschen zu flexibilisieren. (Waldschmidt 2003, im Internet) In der gegenwärtigen Zeit still zu stehen, an einem Ort zu verharren, in einem Wort "behindert" zu sein, kann den sozialen Tod bedeuten. Vor diesem Hintergrund verändert sich auch die Zielrichtung von Behindertenhilfe und -politik. Nun geht es darum, auch bei der Personengruppe der Behinderten Bewegung herzustellen, sie dazu zu bringen, mit zu eilen im Strom der Zeit, sich einzureihen auf den Autobahnen und in den Kommunikationsnetzen mit zu surfen (ebd.). Hierfür wird ein Impuls benötigt, der von dem Subjekt selbst ausgeht. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung, das ist der Antrieb, den die individualisierte Moderne erzeugen muss, will sie den beschleunigten sozialen Wandel gewährleisten. Erst der Neoliberalismus schafft somit die Voraussetzungen für die Selbstbestimmung auch der behinderten Menschen. (ebd.)
Der Neoliberalismus ist aber ebenso Voraussetzung für gegensätzliche Tendenzen. Dederich (2003) unterscheidet in der politischen Perspektive bezüglich der Selbstbestimmung zwei gegenläufige Zugänge und Bedeutungskontexte. Zum einen wird Selbstbestimmung im Sinne bürgerlicher Subjektautonomie verstanden, die u.a. auch Menschen mit Behinderung für sich reklamieren. Zum anderen aber ist Selbstbestimmung ein im Dienste des Neoliberalismus instrumentalisiertes Programm, das auf die Souveränität, die Eigenverantwortlichkeit, die Flexibilität, die Macht und den Erfolg des Subjektes setzt. (Dederich 2003, S. 2) Weil der Mensch als wesensmäßig autonom gedacht wird, müssen Zwangsmaßnahmen und gesellschaftliche Abhängigkeiten von ihm ferngehalten werden. Da das Individuum seine Welt selbst erschafft und hierfür verantwortlich ist, kommt in dieser Perspektive dem Staat und der Gesellschaft keine Verantwortung für das Wohl des einzelnen Menschen zu. Diese Deutung von Selbstbestimmung fungiert im politischen Diskurs u.a. als Legitimation für neoliberale Umorientierungen, etwa die Flexibilisierung oder den Abbau des Wohlfahrtsstaates. (Dederich 2003, S. 3)
Dederich führt weiter aus, dass in der Behindertenpädagogik und der politischen Selbsthilfe gegenwärtig eine Fassung von Selbstbestimmung hoch im Kurs stehe, die die Befreiung beeinträchtigten Menschen aus Abhängigkeit, sozialer Kontrolle und Definitionsmacht akzentuiere. Er gibt aber zu bedenken, "wenn nur diese Fassung gewürdigt ist, droht die Schattenseite der Autonomie, nämlich ihr Eingebundensein in ein neoliberales Pflichtprogramm, aus dem Blick zu geraten. Selbstbestimmung als neoliberales Pflichtprogramm ist deshalb höchst problematisch, weil ein selbstbestimmtes Leben nur möglich ist, wenn Menschen über ein Mindestmaß an ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen verfügen. Genau diese aber werden durch neoliberale Tendenzen zurückgeschnitten und immer größeren Teilen der Bevölkerung vorenthalten". (Dederich 2003, S. 3)
Der Kampf, der Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen um die Anerkennung als selbstbestimmte Subjekte und seine Erfolge lässt sich, so Waldschmidt (1999), als "nachholende Befreiung", als "Auftauchen behinderter Männer und Frauen als Subjekte in der Geschichte" (Waldschmidt 1999, S. 43) begreifen und kann durchaus im positiven Sinne gedeutet werden. Allerdings stellt Waldschmidt fest, dass sich Selbstbestimmung ebenso als ambivalentes Konzept in der späten Moderne erweist. Das Erlangen von Selbstbestimmung als ein Grundrecht beinhaltet zum einen Befreiung und Selbstermächtigung, zum anderen lässt sich gegenwärtig die Tendenz erkennen, dass Selbstbestimmung zunehmend im Sinne von Selbstverantwortung interpretiert wird und zum "neoliberalen Pflichtprogramm" (Stinkes 2000, S. 170) wird, mit all den (individuell zu tragenden) Risiken, die das für Menschen mit Unterstützungsbedarf haben kann.
Selbstbestimmung als Pflicht, welche das vernünftige, autonome Subjekt zum Vorbild nimmt kann währenddessen neue Ausschlusskriterien produzieren und Spaltungsprozesse zwischen denjenigen, "deren Verstandeskräfte als ungenügend eingestuft werden" (Waldschmidt 1999, S. 25), befördern. Menschen mit Lernschwierigkeiten und schwerstbehinderte Menschen werden es nach Einschätzung Waldschmidts weitaus schwerer haben am Modell des selbstbestimmten Subjekts zu partizipieren.
Heute wird die Diskussion um Selbstbestimmung und Autonomie von Menschen mit Behinderung breit und unter Einbezug systemtheoretischer, konstruktivistischer, ethischer, soziologischer und kulturwissenschaftlicher Positionen geführt. (Dederich & Jantzen 2009, S. 186). Unterschiedliche Einschätzungen zur Selbstbestimmung beförderten eine Grundsatzdiskussion, auf die hier nur mit wenigen Beispielen verwiesen werden kann.
Für Osbahr (2000) ist Selbstbestimmung "systemtheoretisch, eine Grundbedingung von Lebensprozessen und, sozialpolitisch, eine menschenrechtliche Forderung (Osbahr 2000, S. 190). Thimm (2005) hingegen geht davon aus, dass "das Normalisierungskonzept dem dialektischen Charakter von Lebenschancen in besserer Weise Rechnung trägt als ein neues - einseitiges - Paradigma Selbstbestimmung oder Autonomie, denn es reflektiert immer wieder das Verhältnis zwischen Selbstbestimmung und sozialen Einbindungen" (Thimm 2005, S. 13).
Neben positiven Bewertungen von Selbstbestimmung als Errungenschaft der modernen Behindertenhilfe, mehren sich kritische Stimmen, die in der neoliberalen Moderne einen Zwang zur Selbstbestimmung sehen. Stinkes (2000) diskutiert Selbstbestimmung im Kontext humaner Rechte eines Subjekts, das durch neoliberale Erwartungen an Grenzen seiner ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen stößt (Stinkes 2000, S. 176). Durch die Übernahme ökomischen Denkens in die Behindertenversorgung wird Selbstbestimmung und Autonomie zur Pflicht für Menschen mit Behinderung. Für Dederich (2001) ist Selbstbestimmung "ein Schlüsselbegriff in der gegenwärtigen Diskussion um die Zurückschneidung des Wohlfahrtsstaates" (Dederich 2001, S. 203). "Mit dem Appell an das selbstbestimmte Subjekt" so betont Rössner (2002) "verabschiedet sich der bisherige Wohlfahrtsstaat, um das Management von Lebensrisiken vermehrt auf das Individuum zu übertragen" (Rösner 2002, S. 371).
Nach Dederich (2001) wird in der gegenwärtigen Betonung von Selbstbestimmung übersehen, dass sie Gefahr läuft "ein unangemessenes Bild vom Menschen zu entwerfen" (Dederich 2001, S. 202). Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, Autonomie und Fremdzwänge bilden für Dederich "in der Alltagspraxis der Menschen ein kaum analytisch sauber auflösbares Geflecht" (ebd.). Der Selbstbestimmungsbegriff bekräftigt in seiner einseitigen Ausrichtung die Tendenz der subtilen Negativbewertung von Abhängigkeit, Bindung und Verpflichtung. (ebd. S. 203) Darum muss die Diskussion um Selbstbestimmung immer auch anthropologisch geführt werden und mit einer "Ethik der Anerkennung" (vgl. Moosecker 2004) verbunden werden. "In der anthropologischen Perspektive erscheint der Gedanke der reinen Selbstbestimmung des Subjektes eine einseitige Sichtweise zu sein. Die Abhängigkeit vom Anderen und die Notwendigkeit der Anerkennung durch den Anderen lässt den Menschen sowohl in einer angreifbaren als auch in einer durch Fremdeinflüssen maßgeblich gekennzeichnete Position erwachsen" (Moosecker 2004, S. 114). Eine Kultur der Anerkennung bringt dem anderen Respekt und Achtung entgegen. Erst über die Reflexion einer Notwendigkeit der Anerkennung lässt sich ein Fundament legen, welches asymmetrische Beziehungs- und Machtstrukturen in den Hintergrund rückt (Moosecker 2004, S. 115).
In Anlehnung an die Ethik von Levinas und Foucaults Genealogie der Macht entwickelt Rösner eine neue Ethik über die Anerkennung von Menschen mit Behinderung hinaus. (Eberwein 2002, S. 12) Rösner (2002) geht davon aus, dass rechtlich garantierte Anerkennungsverhältnisse keine hinreichende Schützhülle für ethische Möglichkeiten der Wahl zwischen verschiedenen Lebensformen und Identitätsbildungen bilden würden. (Rösner 2002, S. 18)
"So können Menschen andere zwar als Rechtspersonen in ihrer Würde achten, das heißt jedoch noch nicht, sie auch in ihren ethischen Differenzen anzuerkennen. Es muss auch darum gehen, sich einer Politik zu verweigern, die durch Naturalisierung und Verdinglichung die Identität "Behinderter" erzeugt. Insofern (...) muss das moralische Bemühen um Anerkennung des Anderen weit mehr eine Auseinandersetzung um seine persönliche Integrität und seine je individuelle Lebensform sein." (Rösner 2002, S. 18)
Die Euthanasiedebatte der letzten zehn Jahre hat allzu deutlich gemacht, dass Anerkennung für alle Menschen nur in einer Gesellschaft erfolgreich sein kann, in der mehr als nur rechtlich garantierte Selbstbestimmung und Wohltätigkeit ein gelebtes Ethos bildet. Er muss über die rechtliche Absicherung selbstbestimmungsfähiger und fürsorgeabhängiger Individuen hinaus, eine am guten und geglückten Leben orientierte Selbstsorge, vor allem auch Sorge für den Anderen umfassen, der an seinem eigenen Wohlergehen nicht selbst zu schmieden vermag. Die Freiheit zur Selbstsorge und die Verantwortung der Sorge für den Anderen bilden für Rösner (2002, S. 18) den Resonanzboden für eine Politik der Differenz, in der sich der gestalterische Umgang mit sich selbst und das solidarische Eintreten für den Anderen verbinden können.
Rösner konstatiert, dass
"Menschen mit Behinderung das Dilemma begreifen, ablehnen zu müssen, das zu sein, was andere ihnen als Identitätsangebote vorgeben und ihre doppelte und paradoxe Aufgabe darin sehen, in Selbstverständigungsprozessen Möglichkeiten einer veränderten Haltung zu sich selbst zu erproben und in politischen Willensbildungsprozessen Forderungen nach rechtlicher Anerkennung einer zukünftig autonomen Lebensform zu erheben. Statt das Leben nur den vorgegebenen Normen und Konventionen anzupassen, bietet die ‚Sorge um sich selbst' die Möglichkeit, Widerstand gegen Formen der Fremdbestimmung zu leisten und der kritiklosen Verinnerlichung geforderter Verhaltensformen entgegenzuwirken.". (Rösner 2002, S. 385)
Lindmeier (1999) kritisiert, dass die Diskussion um Selbstbestimmung in der Geistigenbehindertenpädagogik bislang "hinsichtlich der pädagogisch grundlegenden Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Erziehung und Bildung noch nicht hinreichend klar artikuliert" (Lindmeier 1999, S. 209) sei. Denn Erziehen und Bilden selbst bedeutet richtungsgebende Einflussnahme. Die Grundfrage aller Pädagogik lautet daher: Wie kann die Freiheit aus der installierten Einflussnahme hervorgehen? (ebd. S. 215) Die Aufgabe des Pädagogen und der Pädagogin ist es, mit dem Kind eine Form leiblicher Erziehung zu realisieren, indem er/sie sich auf das Kind und seine Welt einlässt, damit im unmittelbaren Erziehungsgeschehen ein ‚Drittes' zwischen ihnen entstehen kann. Ein ‚Drittes' das dem Kind den Mut zur Überwindung seiner Grenzen gibt und es damit auf seinen Weg zur Selbstwerdung stärkt. (Lindmeier 1999, S. 219) In diesem Zusammenhang konstatiert Fronefeld (2000), dass Selbstbestimmung mehr sei "als nur Artikulation oder Durchsetzung eigener Bedürfnisse, und Bildung mehr ist als die Befähigung zur Selbstartikulation. Selbstbestimmung gehört zum Wesen der Bildung eines Menschen. Bildung ergibt sich nicht aus der praktischen Vernunft eines Menschen sondern aus seinem Leibsein. In ihr hat auch die Selbstbestimmung ihren Ursprung. Selbstbestimmung und Bildung bedingen sich also wechselseitig. Darum ist Selbstbestimmung ein Leben lang Arbeit an sich selbst" (Fronefeld 2000, im Internet).
Auf der biologischen Ebene wird der Autonomiegedanke u.a. legitimiert durch den Ansatz von Maturana & Varela, jeden Menschen als ein autonomes lebendes System zu begreifen, das über den Mechanismus der Autopoiese vermittelt wird. Der Begriff "Autopoise" setzt sich aus dem griechischen autos (=selbst) und poien (=machen) zusammen und bedeutet so viel wie Selbsterzeugung, Selbstherstellung, Selbsterhaltung. Dies bedingt, dass der Mensch als Konstrukteur seiner eigenen Erkenntniswelt auftritt und die Umwelteinflüsse durch dieses autonome System "gefiltert" werden, so dass letztlich ganz einzigartige "strukturelle Koppelungen" zwischen dem Individuum und der Umwelt entstehen können. (Baudisch 2000, S. 41)
Lebende Systeme sind Gebilde, die sich dadurch ständig selbst erhalten, indem sie ihre Bestandteile, aus denen sie bestehen, durch eben diese Bestandteile selbst produzieren und herstellen. Lebende Systeme erzeugen somit durch ihre Organisation fortlaufend ihre eigene Organisation und werden deshalb auch als selbstorganisierte Systeme bezeichnet.
Der Prozess der Selbstorganisation kann exemplarisch am Beispiel einer einzelnen Zelle dargestellt werden. Auch eine Zelle als lebendes System hebt sich dadurch von seiner Umwelt ab, dass sie Grenzen (die Zellmembran) definiert und festlegt, die sie von dem, was sie nicht ist, abgrenzt. Diese Festlegung von Grenzen vollzieht sich jedoch durch Operationen im Inneren der Zelle, die ihrerseits erst durch diese Grenzen möglich gemacht wird. Die Produktionsvorgänge im Inneren und die Grenzen bedingen sich wechselseitig, wodurch sich die Zelle von ihrer Umwelt abhebt. Die Operationen im Zellinneren sind zirkulär und bilden einen geschlossenen Kreis, wodurch es unmöglich wird, zwischen dem Produkt und dem Produzenten, zwischen Anfang und Ende, zwischen Input und Output zu unterscheiden. (vgl. Maturana & Varela 1987, S. 53)
Das, was lebende Systeme tun, ihre Operationen, halten ihre Organisation als Einheit dieses zirkulären Prozesses aufrecht. Die autopoietische Organisation ist in unzähligen konkreten Strukturen verwirklicht, etwa als Fisch, Vogel, Maus, Affe oder Mensch. Lebende Systeme besitzen somit zwar die gleiche Organisation, haben aber unterschiedliche Strukturen. Die Struktur, die konkrete Beziehung zwischen den Bestandteilen eines lebenden Systems kann sich - im Gegensatz zu ihrer Organisation, die fortlaufend aufrecht erhalten wird, - verändern. Wie ein lebendes System konkret operiert, ist damit abhängig von ihrem vorherigen Zustand, also abhängig von ihrer Struktur. Daher lassen sich Systeme auch als strukturdeterminierte Systeme beschreiben. (vgl. ebd. S. 108)
Da sich autopoietische Systeme ausschließlich mit ihren Operationen auf sich selbst beziehen, werden sie auch als operational geschlossen bezeichnet. Das heißt, sie benutzen ständig die Produkte oder Ergebnisse ihrer Operationen als Grundlage für weitere Operationen. Es gibt weder einen Input in das System hinein noch einen Output aus dem System heraus. Alles, was ein System zur Erhaltung seiner Organisation braucht, erzeugt es selbst. (vgl. Maturana & Varela 1987,. S. 55ff)
Zugleich sind autopoietische, operational geschlossene Systeme aber auch offene Systeme, indem sie ständig bestimmte Substanzen aufnehmen. Diese Offenheit, der Umweltkontakt wird aber erst durch die Geschlossenheit des Systems möglich. Denn das System wird durch seine Grenze sowohl von der Umwelt getrennt als auch verbunden. Die Formen des Austausches aber werden nicht von der Umwelt, sondern von der geschlossenen Organisationsweise des Systems und seiner konkreten Struktur festgelegt. Deshalb werden autopoietische System auch als autonom bezeichnet. Sie sind zwar nicht autark, da es kein umweltunabhängiges System gibt, aber autonom, indem ihre eigene Struktur, ihre eigenen Systemoperationen bestimmen, ob und wie die Umwelt auf es einwirken kann. Dadurch, dass lebende Systeme auf diese Weise die Unterscheidung zwischen System und Umwelt erzeugen und aufrechterhalten, werden sie auch als beobachtende bzw. kognitive Systeme bezeichnet, unabhängig davon, ob sie ein Nervensystem besitzen oder nicht. Die systemisch-konstruktivistische Sichtweise unterscheidet somit nicht zwischen körperlichen und geistigen Prozessen. Aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit haben beobachtende System jedoch keinen Zugang zu ihrer Umwelt. Die Umwelt kann sie lediglich verstören, irritieren oder "pertubieren", wobei wie gesagt ihre eigene Struktur festlegt, ob und wie Umweltereignisse auf das beobachtende Systeme einwirken (vgl. Maturana & Varela 1987, S. 98). Aus einer solchen systemisch-konstruktivistischen Perspektive gibt es somit keine vom beobachtenden System unabhängige Umwelt, sondern so viele Wirklichkeiten, wie es beobachtende Systeme gibt. Beobachten heißt nicht abbilden, sondern konstruieren, erschaffen, gestalten.
Die Vernetzung zwischen lebenden Systemen und Umwelt wird als strukturelle Kopplung bezeichnet. Strukturelle Kopplungen haben Maturana und Varela (1987 S. 85) zunächst auf der biologischen Ebene beschrieben: "Dass sich zwei (oder mehr) autopoietische Einheiten in ihrer Ontogenese gekoppelt haben, sagen wir, wenn ihre Interaktionen einen rekursiven oder sehr stabilen Charakter erlangt haben." D.h. die lebenden Systeme haben einen Bereich wechselseitig kompatibler Interaktionen herausgebildet. Rekursiv bedeutet hierbei, dass die gegenseitigen Perturbationen (Verstörungen, Anregungen) so zueinander passen, dass sie wechselseitig in anschlussfähiger Weise verarbeitet werden.
Wenn diese Fähigkeit zur Selbststeuerung für alles Lebendige gilt, ist die Folgerung naheliegend, dass wohl keinem Kind, keinem Menschen, wie behindert oder geschädigt eingeschätzt, die Fähigkeit der Eigenaktivität und Selbstbestimmung abgesprochen werden darf. (vgl. Schönwiese 2003, im Internet)
Inhaltsverzeichnis
Hervorgegangen ist das Modell der Persönlichen Assistenz aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, die sich gegen die vielfältigen Diskriminierungen von behinderten Menschen in nahezu allen Lebensbereichen wandte und die vorrangig von körperbehinderten und sinnesbeeinträchtigten Menschen initiiert wurde. Das Konzept der Persönlichen Assistenz stand dabei von Anfang an als Idee im Mittelpunkt der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, die ihre Wurzeln wiederum in der bundesdeutschen "Behinderten- und Krüppelbewegung" findet. Außerdem erhielt sie Impulse aus der US-amerikanischen Independent-Living-Bewegung (vgl. Miles-Paul 1992a).
Den Weg zu einem selbstbestimmten Leben und gesellschaftlicher Partizipation haben demnach behinderte Menschen selbst aufgezeigt: das Modell der Persönlichen Assistenz. Dieses Modell kann als Methode gegen fremdbestimmende Fachlichkeit und gegen Abhängigkeit verstanden werden, es nimmt einen radikalen Perspektivenwechsel gegenüber der traditionellen Behindertenarbeit vor. Mit Hilfe von Persönlicher Assistenz werden aus behinderten Menschen mit Hilfebedarf AssistenznehmerInnen, die in ihrer Rolle als ArbeitgeberInnen die von ihnen benötigten Hilfen selbstbestimmt organisieren. Aus HelferInnen werden Persönliche AssistentInnen, die entsprechend der geleisteten Arbeit beschäftigt und bezahlt werden. Im Mittelpunkt dieses Modells steht der Kompetenzgedanke, der alle Zuständigkeit für die eigenen Belange bei den behinderten Menschen selbst, als ExpertInnen in eigener Sache, verortet. (Franz 2002, S. 37)
Martin Hahn hat in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten bereits 1994 den Begriff der assistierenden Hilfe in die Diskussion eingebracht.
"Wir assistieren demjenigen, der unsere Hilfe benötigt, bei der Verwirklichung seiner (!) Ziele. Beachten wir dies nicht, führt unsere vielleicht durchaus gut gemeinte Hilfe zu Überbefürsorgung, die real als Fremdbestimmung erlebt wird. Aus diesem Grund ist der Begriff des "Assistenten" (...) der subsidär geleisteten Hilfe angemessener als der Begriff des Helfers.
Assistierende Hilfe ist die Voraussetzung für die Realisierung der Autonomiepotentiale, die auch im Leben von Menschen mit schweren Behinderungen liegen und ihnen Zustände des Wohlbefindens ermöglichen können" (Hahn 1994, S. 91)
Persönliche Assistenz beschreibt eine Organisationsform der Abdeckung des Hilfebedarfs hilfeabhängiger Menschen mit dem Ziel einer selbstbestimmten Lebensführung. Persönliche Assistenz bedeutet für behinderte Menschen, Abläufe des Alltags, die sie selbst nicht oder nur schwer ausführen können, durch die Hilfe anderer Personen selbstbestimmt erledigen zu lassen. Dem Modell der Persönlichen Assistenz liegt der Gedanke zu Grund, dass sich die Assistenz für behinderte Menschen nicht grundsätzlich von Dienstleistungen unterscheiden, die alle Menschen im Alltag in Anspruch nehmen, beispielsweise von Restaurants, Autowerkstätten oder Umzugsunternhemen usw. Der Begriff "persönlich" soll verdeutlichen, dass sich die Assistenz behinderter Menschen mit Hilfebedarf an deren individuellen Lebensvorstellungen auszurichten hat (Österwitz 1996, S. 204).
Bei ‚Assistenz' handelt es sich um ein Fremdwort lateinischen Ursprungs. Es geht zurück auf ein Kompositum des lateinischen Verbs ‚sistere'. ‚Sistere' lässt sich übersetzen mit ‚stellen oder ‚sich stellen', ‚anhalten' oder ‚stehen bleiben', während die lateinische Vorsilbe ‚ad' ‚hin' oder ‚hinzu' bedeutet. Der Begriff ‚ad-sistere', der assimiliert wird zu ‚assistere', heißt wörtlich übertragen folglich ‚sich hinzu stellen', ‚dabei stehen', ‚hintreten' und im übertragenen Sinne ‚beistehen', ‚unterstützen'. (Mohr 2006, S. 18)
Unbedingtes Kriterium für die Organisation von Hilfebedarfen nach dem Modell der Persönlichen Assistenz ist die Realisierung der Personal-, Anleitungs-, Organisations- und Finanzkompetenz durch die AssistenznehmerInnen (vgl. Kap. 8.3). Hilfeleistungen, die die Möglichkeit einer Realisierung der genannten Kompetenzbereiche ausschließen, sind ausdrücklich nicht unter den Begriff der Persönlichen Assistenz zu fassen.
Hilfeleistungen durch Familienmitglieder, die in der Regel unentgeltlich erfolgen, sowie die Inanspruchnahme von Leistungen Ambulanter Dienste oder Institutionen sind nicht als Persönliche Assistenz zu bezeichnen. Da hier die Realisierung der Kompetenzen seitens der Betroffenen nicht oder nur erheblich eingeschränkt erfolgt. Hieraus darf jedoch nicht abgeleitet werden, dass es sich bei der Wahl einer dieser "traditionellen" Organisationsformen von ambulanter oder institutioneller Hilfe nicht auch um eine selbstbestimmte Entscheidung der Betroffenen handeln kann. Unbedingte Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Menschen mit Bedarf an Hilfe die freie Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten zur Abdeckung dieses Bedarfs haben. (Franz 2002, S. 38)
Um den unbestrittenen Nachteilen und Leistungsbeschränkungen institutioneller und ambulanter Hilfe (knappes Personal bzw. keine oder mangelnde Auswahlmöglichkeiten beim Personaleinsatz seitens der Menschen mit Hilfebedarf, bürokratische Strukturen, wenig flexible Dienstplangestaltung) zu begegnen, organisieren behinderte Menschen ihre Hilfe über Persönliche Assistenz selbst. Entscheidendes Kriterium für Art, Inhalt und Umfang von Persönlicher Assistenz ist der individuelle Bedarf an Hilfe in der jeweiligen Lebenssituation, der sich zudem je nach Lebensphase unterschiedlich gestalten kann. Grundsätzlich umfasst Persönliche Assistenz Hilfe in allen Lebensbereichen und richtet sich an alle Menschen mit Hilfebedarf, die sich trotz Beeinträchtigungen für ein Leben in der eigenen Wohnung, außerhalb institutioneller Einrichtungen, entschieden haben. (vgl. Franz 2002, S. 38) Behinderte Menschen mit Hilfebedarf und zunehmend auch ältere Menschen mit Bedarf an Hilfe organisieren die erforderlichen Hilfeleistungen zu ihrer Alltagsgestaltung und Pflege eigenverantwortlich, da ihnen diese Organisationsform von Hilfe eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung garantiert, ohne dabei einseitig zum Objekt von Zuwendung zu werden.
Persönliche Assistenz umfasst Dienstleistungen im Sinne praktischer Hilfen zur Alltagsbewältigung in verschiedenen Lebensbereichen (siehe Abbildung 3). Eine eindeutige Zuordnung dieser Hilfen in Lebensbereiche fällt schwer, da es oftmals zu Überschneidungen kommt: Hilfe bei der Körperpflege, z.B. beim Toilettengang, wird im häuslichen Bereich ebenso benötigt wie am Arbeitsplatz. (Franz 2002, S. 39)
Der Personenkreis von Menschen, die ihre benötigten Hilfen nach dem Modell der Persönlichen Assistenz selbst organisieren, setzt sich in erster Linie aus Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zusammen. In den letzten Jahren haben aber auch Menschen mit Lernschwierigkeiten damit begonnen, die Organisation der von ihnen benötigten Hilfen mit Unterstützung selbst zu gestalten. Geschieht dies auch in der Regel nicht nach dem ArbeitgeberInnenmodell, so existieren doch Konzepte und Ideen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten bei der Realisierung einer selbstbestimmten Lebensführung unterstützen. (Franz 2002, S. 40)
Persönliche Assistenz beinhaltet eine große Bandbreite von vielfältigen Gestaltungs- und Organisationsmöglichkeiten. Diese stehen einerseits in Abhängigkeit zu der jeweiligen Beeinträchtigung einer Person als auch andererseits zu den Behinderungen, die auf Seiten der Gesellschaft ihren Ursprung haben und die es zu kompensieren gilt. Die folgende Abbildung illustriert neben den Kompetenzen Persönlicher Assistenz das mögliche Spektrum erbrachter Hilfestellungen sowie die Lebensbereiche, in denen Persönliche Assistenz wirksam werden kann.
Abbildung 6
Das Modell der Persönlichen Assistenz als Form selbstorganisierter Hilfen
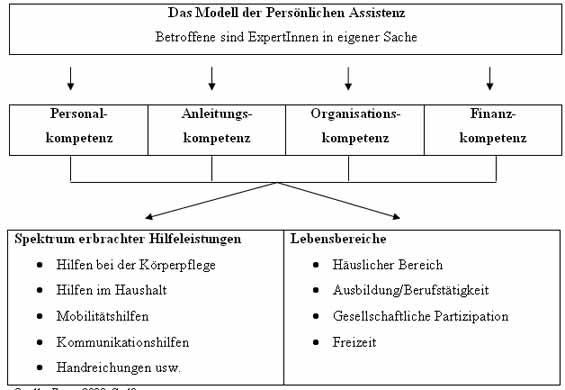
Quelle: Franz 2002, S. 40
Von hoher Relevanz ist in jedem Fall, dass behinderte Menschen mit Hilfebedarf als ExpertInnen in eigener Sache über Einsatz und Umfang Persönlicher Assistenz selbstbestimmt entscheiden können. In diesem Zusammenhang kommt dem Kompetenzverständnis des Modells der Persönlichen Assistenz besondere Bedeutung zu.
Wie bereits mehrfach angesprochen wurde, liegt der Kern des Gedankens der Persönlichen Assistenz in den Kompetenzen, die alle Menschen für ihr Leben inne haben. Hiervon zu unterscheiden ist die Formulierung "kompetent sein", da hier die Bedeutung von "Fähigkeit" mitschwingt. Kompetenz im Sinne der Selbstbestimmt Leben Bewegung meint die rechtliche Zuständigkeit und das Anordnungsrecht eines jeden Menschen für das eigene Leben (Drolshagen & Rothenberg 1999, S. 24). Alle behinderten Menschen sind in diesem Sinne zuständig für die eigene Person, sie sind kompetent für sich und ihr Leben. In diesem Kontext ist es unmöglich zwischen Menschen mit bzw. ohne Kompetenz zu unterscheiden. Im Folgenden wird daher von der "Realisierung der Kompetenzen" und nicht vom "Besitz der Kompetenzen" gesprochen, da selbst ein vollkommen fremdbestimmter Mensch die Zuständigkeit für sein Leben besitzt, selbst wenn er daran gehindert wird, diese wahrzunehmen. Zu berücksichtigen gilt weiterhin, dass die Betroffenen - wie alle anderen Menschen auch - das Recht darüber besitzen zu entscheiden, in welchem Rahmen und Umfang sie diese Kompetenzen wahrnehmen wollen.
Im Einzelnen lassen sich vier zentrale Kompetenzen im Kontext des Modells der Persönlichen Assistenz benennen (vgl. Miles-Paul & Frehse 1994): Personal-, Anleitungs-, Organisations- und Finanzkompetenz.
-
Personalkompetenz: Das Aussuchen oder Ablehnen von AssistentInnen
-
Anleitungskompetenz: Den AssistentInnen die Form, die Art und den Umfang der Hilfen vorgeben.
-
Organisationskompetenz: Planung von (Arbeits-)Zeiten
-
Finanzkompetenz: Die empfangenen Unterstützungen eigenständig bezahlen können (Miles-Paul & Frehse 1994, S. 14)
Diesen zentralen Kompetenzen, die von verschiedenen AutorInnen benannt werden (vgl. Drolshagen & Rothenberg 1999, Miles-Paul & Frehse 1994, Steiner 1999), fügt Combrink (1997, S. 19) noch eine weitere Kompetenz hinzu, die sie als Raumkompetenz bezeichnet. Hiermit ist gemeint, dass hilfeabhängige Menschen nicht zum Ort der Hilfe gebracht werden sollen, sondern die Hilfe in ihrer Lebensumgebung erfolgen muss. Dies schließt begleitende Hilfen, etwa in der Freizeit, mit ein. Ist diesem Gedanken vom Grundsatz her mit Zustimmung zu begegnen, so kann die Raumkompetenz bereits in den zuvor thematisierten Kompetenzen der Organisation und Anleitung abgedeckt werden.
Festzustellen bleibt, dass Persönliche Assistenz eine Form der Hilfeleistung darstellt, die eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht. Verbunden mit Persönlicher Assistenz ist aber auch auf Seiten der AssistenznehmerInnen ein hoher zeitlicher, organisatorischer und u.U. finanzieller Aufwand (Drolshagen & Rothenberg 1999, S. 255). Dies gilt vor allem dann, wenn die Betroffenen im Rahmen des ArbeitgeberInnenmodells jede der vier Kompetenzen vollständig wahrnehmen.
Jeder Mensch kann seine eigene persönliche Situation am besten beurteilen. Dementsprechend ist es für die Organisation Persönlicher Assistenz von besonderer Bedeutung, dass die Assistenznehmerin ihren Bedarf an Unterstützung selbst benennt. Menschen mit Bedarf an Persönlicher Assistenz sind in ihrer selbständigen Lebensführung, z.B. beim Anziehen und Essen, in einem gewissen Maße eingeschränkt, sie wissen aber, was, wie und wie viel sie anziehen und essen möchten. Sie sind ExpertInnen in eigener Sache, d.h. sie wissen am besten, für welche Tätigkeit sie wann, wo und wie Persönliche Assistenz benötigen. Es ist wichtig, dass AssistenznehmerInnen dieses Wissen, sich selbst am besten einschätzen können, bewusst ist und sie mit Selbstbewusstsein "gutgemeinten Ratschlägen" (z.B. ihrer Persönlichen AssistentInnen) entgegentreten. Aus einem Interviewzitat eines hörbehinderten Mannes, der innerhalb der Studie "Leben mit Assistenz" (Drolshagen et al. 2001, S. 193) befragt wurde, wird das Wissen, Experte in eigener Sache zu sein, deutlich:
"Man könnte, da kann dann jemand sagen, so ist es vielleicht besser oder andersherum ist es vielleicht besser, aber wenn ich meine, dass es so gut ist, dann ist es gut."
Auch für die Anleitung bzw. Einarbeitung der Persönlichen AssistentInnen ist das ExpertInnenwissen der AssistenznehmerIn bestimmend. Konkrete Tätigkeiten können unter Anleitung der AssistenznehmerIn von den Persönlichen AssistentInnen so durchgeführt werden, wie es für die AssistenznehmerIn am günstigsten ist. Die Deckung individueller Bedürfnisse kann in besonderer Weise berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde ist es für viele AssistenznehmerInnen besonders wichtig, ihre Persönlichen AssistentInnen selbst nach ihren eigenen Vorstellungen und auf ihre eigene Art und Weise anzuleiten. Auch für eine befragte Assistenznehmerin in der Studie "Leben mit Assistenz" (ebd. S. 193) ist die Entscheidung, ihre Persönlichen AssistentInnen selbst anzuleiten, mit dem Wissen, Expertin in eigener Sache zu sein, zu begründen:
"[...] das mach ich selber. [...] Weil ich mich da wirklich am besten damit auskenne."
Inhaltsverzeichnis
"Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus' aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen." (Flick et al. 2007, S. 14)
Das problemzentrierte Interview ist eine Variante des Leitfaden-Interviews. Das Adjektiv ´problemzentriert´ kennzeichnet den Ausgangspunkt einer vom Forscher wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemstellung, deren individuelle und kollektive Bedingungsfaktoren mit diesem Forschungsdesign ergründet werden sollen. (Friebertshäuser 1997, S. 379)
Charakteristisch für Problemzentrierte Interviews ist die vorangegangene theoretische Auseinandersetzung der Forschenden mit der Problemstellung, auf deren Basis bestimmte Aspekte herausgefiltert werden und zu einem Interviewleitfaden zusammengestellt werden, der das Gespräch strukturiert. (Mayring 2002, S. 67) Dabei sind drei Kriterien wesentlich (Friebertshäuser 1997, S. 379f):
-
Problemzentrierung: Sie bezieht sich sowohl auf die vom Forscher/der Forscherin ermittelte Problemstellung und deren Kriterien als auch auf die Betonung der Sichtweise der Befragte.
-
Gegenstandsorientierung: Die Methoden werden am Gegenstand entwickelt und modifiziert.
-
Prozessorientierung: Die Datengewinnung erfolgt schrittweise, wobei das theoretische Konzept für Modifizierungen durch Erkenntnisse aus dem Forschungsprozess offen gehalten wird. (ebd. S. 379f)
Dabei finden vier Instrumente bei der Durchführung eines problemzentrierten Interviews Anwendung (Friebertshäuser 1997, S. 381f):
-
Der Kurzfragebogen: Er dient zur Erhebung demographischer Daten und entlastet das nachfolgende Interview von denjenigen Bereichen, die als Frage-Antwort-Schema aufgebaut sind. Er erleichtert - in Kombination mit einer offenen Frage - den Gesprächseinstieg.
-
Die Tonträgeraufzeichnung: Sie erlaubt die authentische und präzise Erfassung des Kommunikationsprozesses und sollte anschließend vollständig transkribiert werden. Der Interviewer/die Interviewerin kann sich somit ganz auf den Gesprächsverlauf konzentrieren.
-
Der Leitfaden: Er dient als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze für den Interviewer/die Interviewerin und sichert die Vergleichbarkeit der Interviews. Eine Frage zur Einleitung ist meist vorformuliert, weitere Fragen können Themenbereiche einleiten.
-
Das Postskriptum: Hier werden unmittelbar nach dem Interview Beobachtungen zu nonverbalen und situativen Aspekten des Gesprächsverlaufes festgehalten. Es können spontane thematische Auffälligkeiten und Interpretationsideen, die Anregungen für die Auswertung geben, notiert werden. Das Postskriptum trägt der Tatsache Rechnung, dass der Interviewer/die Interviewerin und die Interviewsituation einen wesentlichen Einfluss auf die zustande gekommenen Daten ausüben (Friebertshäuser, 1997, S. 381).
Friebertshäuser weist darauf hin, dass der Interviewleitfaden lediglich als Orientierungshilfe dienen soll, in dem alle wichtigen Aspekte systematisch organisiert sind, dabei soll er aber flexibel gehandhabt werden. (Friebertshäuser 1997, S. 380)
Der Leitfaden stellt nur ein Instrument des Problemzentrierten Interviews dar, das neben anderen zur Erfassung von Daten zum Einsatz kommt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Interview einen Kurzfragebogen vorzuschalten, um beispielsweise demographische Daten zu erhalten, die bei der Interpretation dann hilfreich sein könnten. Weitere Hilfsmittel sind Postskripte, die unmittelbar nach jedem Interview vom Forscher oder der Forscherin angefertigt werden, und all das festhalten, was nicht auf dem Tonband zu hören ist und trotzdem von Relevanz sein könnte: nonverbale Reaktionen, Rahmenbedingungen, Gespräche vor oder nach der Tonaufzeichnung, aber auch Erwartungen, Vermutungen oder Ahnungen der Forscherin oder des Forschers. (vgl. ebd., S. 381)
Kommunikationsstrategien gekennzeichnet. Lamnek (2005, S. 365f) nennt vier Phasen:
-
Einleitung: Am Beginn des Gesprächs steht die Festlegung des Themas für das Interview und die Gestaltung einer erzählenden Gesprächskultur
-
Allgemeine Sondierung: Durch ein Erzählbeispiel soll nun die narrative Phase des Interviews eingeleitet werden. Die Befragten werden durch allgemeines Nachfragen dazu angehalten, detaillierte und ausführliche Beschreibungen ihrer Lebenswelt zu geben.
-
Spezifische Sondierung: In diesem Abschnitt des Interviews geht es um die Verständnisgenerierung durch die Forscherin oder den Forscher. Die Darstellungen der Befragten sollen nachvollzogen werden. Zu diesem Zweck bieten sich drei Möglichkeiten: In der Zurückspiegelung wird eine Interpretation des Gesagten angeboten, das durch den oder die Befragten kontrolliert und korrigiert oder modifiziert werden kann. Verständnisfragen bieten eine Möglichkeit beispielsweise ausweichende oder widersprüchliche Aussagen zu thematisieren. Die dritte Technik, die allerdings mit viel Sorgfalt eingesetzt werden will, ist die Konfrontation. Der oder die Interviewerin kann die Befragten direkt mit Widersprüchen in ihren Äußerungen konfrontieren
-
Direkte Fragen: Hier bietet sich die Chance, eventuell noch nicht zur Sprache gebrachte, wichtige Aspekte direkt anzusprechen. Diese ‚Ad-Hoc-Fragen' werden durch die Interviewerin oder den Interviewer spontan eingebracht. (Lamnek 2005, S. 365).
Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem. Durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. (Mayring 2002, S. 114)
Es sind dabei drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse vorgeschlagen worden:
-
Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist.
-
Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, usw.) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verhältnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.
-
Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen. (ebd. S. 115)
Die Technik inhaltsanalytischer Zusammenfassung lässt sich weiter nutzen für eine induktive Kategorienbildung. Innerhalb der Inhaltsanalyse ist die Kategorienentwicklung systematisch angelegt. Sie kann dabei dieselbe Logik, dieselben reduktiven Prozesse benutzen, die bei zusammenfassender qualitativer Inhaltsanalyse verwendet werden.
Innerhalb der Logik der Inhaltsanalyse müssen die Kategorisierungsdimensionen und das Abstraktionsniveau vorab definiert werden. Es muss ein Selektionskriterium für die Kategorienbildung festgelegt werden. Dies ist ein deduktives Element und muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der Analyse begründet werden. Mit dieser Definition im Hinterkopf wird das Material Zeile für Zeile durchgearbeitet. (Mayring 2002, S. 115f)
Wenn das erste Mal eine zur Kategoriendefinition passende Textstelle gefunden wird, wird dafür eine Kategorie konstruiert. Ein Begriff oder Satz, der möglichst nahe am Material formuliert ist, dient als Kategorienbezeichnung. Wird im weiteren Analyseverlauf wieder eine dazu passende Textstelle gefunden, so wird sie dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet. Wenn die neue Textstelle die allgemeine Kategoriendefinition erfüllt, aber zu der (den) bereits induktiv gebildete(n) Kategorie(n) nicht passt, so wird eine neue Kategorie induktiv, aus dem spezifischen Material heraus, formuliert. (ebd. S. 117)
Nach einem Teil des Materialdurchgangs (etwa 10 bis 50%), wenn so gut wie keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können, wird das gesammelte Kategoriensystem
überarbeitet. Es muss geprüft werden, ob die Logik klar ist (keine Überlappungen) und der Abstraktionsgrad zu Gegenstand und Fragestellung passt. Falls dadurch Veränderungen des Kategoriensystems vorgenommen werden mussten, wird das Material nochmals von Anfang an bearbeitet.
Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet werden. Die weitere Auswertung kann nun in verschiedene Richtungen gehen:
-
Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden.
-
Die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden. Es kann z.B. geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert wurden. (Mayring 2002, S. 117)
Der Grundgedanke der Explikation ist nun, dass vorher genau definiert wird, wo nach zusätzlichem Material gesucht wird, um die fragliche Textstelle zu explizieren. Die Suche nach Explikationsmaterial soll also systematisiert werden. Dabei kann man zwei Quellen unterscheiden:
-
Der enge Textkontext als die direkten Bezüge im Text, also das direkte Textumfeld der interpretationsbedürftigen stelle. Solche Texte können definierend/erklärend, ausschmückend/beschreibend, beispielgebend/Einzelheiten aufführend, korrigierend/ modifizierend oder auch antithetisch/das Gegenteil beschreibend zur fraglichen Textstelle stehen.
-
Der weitere Textkontext als die über den Text hinausgehenden Informationen über Textverfasser, Adressaten, Interpreten, kulturelles Umfeld; auch nonverbales Material und Informationen über die Entstehungssituation können hier eingehen. (Mayring 2002, S. 118)
Die Explikation als inhaltsanalytische Technik ist damit im eigentlichen Sinn eine Kontextanalyse. Wichtig für systematisches Vorgehen ist nun, aus dem Kontextmaterial eine erklärende Paraphrase zu bilden (bei großen Materialmengen mit Hilfe einer Zusammenfassung) und diese Paraphrase statt der fraglichen Stelle in den Text einzufügen. Nun ist zu prüfen, ob die Explikation ausreicht. Im negativen Fall muss neues Explikationsmaterial bestimmt und ein neuer Durchlauf der Kontextanalyse vollzogen werden.
Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein. Es kann aber auch eine Skalierung, eine Einschätzung auf bestimmte Dimensionen angestrebt werden. Das Herzstück dieser Technik ist nun, dass das aus den Strukturierungsdimensionen zusammengestellte Kategoriensystem so genau definiert wird, dass einen eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist. Dabei hat sich ein bewährt, das in drei Schritten vorgeht:
-
Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen.
-
Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für die Kategorie.
-
Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (Mayring 2002, S. 118f)
Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt, der als Handanweisung für den (die) Auswerter dient. Im Laufe der Analyse können weitere Ankerbeispiele darin aufgenommen und bei strittigen Kodierungen neue Kodierungen formuliert werden.
In einem ersten, zumindest ausschnittsweisen Materialdurchgang werden die Kategorien und der Kodierleitfaden erprobt und eventuell überarbeitet. Der Materialdurchgang unterteilt sich dabei in zwei Arbeitsschritte. Zunächst werden die Textstellen im Material bezeichnet, in denen die Kategorie angesprochen wird. Diese "Fundstellen" können durch Notierung der Kategoriennummern am Rande des Textes bezeichnet werden. In einem zweiten Schritt wird je nach Art der Strukturierung das gekennzeichnete Material dann herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet. (ebd. S. 120)
In der vorliegenden Arbeit wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt, weil dieses den Anspruch hat, Lebenswelten ‚von innen heraus' aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen. (Flick et al. 2007, S. 14) Dieser Anspruch war ein wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung für eine qualitative und gegen eine quantitative Methode. Das zentrale Anliegen dieser Untersuchung war, Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen und ihre je eigenen Wahrnehmungen und Erlebniswelten zu erfassen.
Ziel des problemzentrierten Interviews ist eine unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realitäten. Diese Zielsetzung entspricht dem Vorhaben, das mit dieser Untersuchung verfolgt werden soll. Unter Berücksichtigung des Themas der vorliegenden Arbeit sowie der Fragestellungen wurde diese Form des semistrukturierten Interviews gewählt, da es anhand dieser Methode möglich ist, Vorwissen in die Interviewgestaltung einzubringen, gleichzeitig aber auch systematisch das Verlassen der "Leitfaden-Bürokratie" gefordert wird, um dem individuellen Fall gerecht zu werden. Um das individuelle und subjektive Erleben der InterviewpartnerInnen erfahrbar zu machen, wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser thematische Gesprächsleitfaden diente aber lediglich als Gliederungshilfe und Orientierungsrahmen während des Interviews. Im Unterschied zu freieren narrativen Gesprächsformen, in denen der Gesprächsverlauf mehr oder weniger ausschließlich vom Befragten bestimmt wird, bedeutet ‚Problemzentrierung', dass im Gespräch durch Impulse des Interviewers bestimmte Aspekte angesprochen werden, die von den Forschenden aufgrund einer vorherigen theoretischen Analyse zusammengestellt worden sind. Dadurch soll erreicht werden, dass das thematische Feld ausreichend und verständlich exploriert wird. (vgl. Lamnek 1988, S. 74)
Die Vergleichbarkeit der Daten durch die teilweise Standardisierung ist zudem ein wesentlicher Aspekt dieser Methode. Dies waren die ausschlaggebenden Gründe, weshalb in der vorliegenden Arbeit das problemzentrierte Interview als Erhebungsmethode gewählt wurde.
Zur Auswertung der gewonnen Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt, weil es eine Stärke dieser Methode ist, dass sie das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem. Durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. (Mayring 2002, S. 114) Diese streng methodische Vorgehensweise trägt dazu bei, dass die gewonnen Ergebnisse nachvollziehbar sind.
Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse wurde gewählt, weil anhand der Zerlegung in Einheiten ein überschaubarer Text entsteht, in dem die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und nacheinander methodisch am Ausgangsmaterial überprüft werden können. Die Entwicklung des Kategoriensystems filtert die für die Untersuchung relevanten Aspekte heraus. Anschließend kann das gesamte Kategoriensystem in Bezug auf die Fragestellungen und die dahinter liegenden Erklärungen interpretiert werden.
Der Forschungsprozess von der Themenwahl bis zur endgültigen Fassung der Arbeit war begleitet von Zweifeln: Habe ich die bedeutenden theoretischen Ansätze erfasst um dem Thema gerecht zu werden? Wird es mir gelingen, die Lebenswelten der AssistenznehmerInnen aus deren Perspektive wieder zu geben? Deshalb ist es im Verlauf der Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit beständig zu neuen Entscheidungen bzw. Überarbeitungen alter Entscheidungen gekommen. Dies spiegelt sich auch bei einem Vergleich des anfänglich formulierten Exposés und der endgültigen Fassung dieser Arbeit wieder.
Das Anliegen dieser Arbeit war es, ein möglichst umfassendes Bild von Wirklichkeitsausschnitten aus dem Leben der AssistenznehmerInnen abzubilden. Dennoch ist anzunehmen, dass auch meine subjektive Perspektive in diese Arbeit mit eingeflossen ist, da sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Assistenzmodell zunehmend eine positive Einstellung hinsichtlich dieses Konzepts eingestellt hat. Dadurch ist es möglich, dass ich nicht alle Kritikpunkte am Assistenzmodell und dem Selbstbestimmungsparadigma erfasst habe.
-
Reflexion Gesprächsleitfaden Rückblickend musste ich mit Bedauern feststellen, dass im Gesprächsleitfaden ein wesentlicher Aspekt nicht berücksichtigt wurde, nämlich die Einflussgröße Geschlecht auf die Personalwahl. Persönliche Assistenz greift tief in die Privatsphäre der AssistenznehmerInnen ein. AssistenznehmerInnen sind oftmals aufgrund ihrer Beeinträchtigung gezwungen, Einblicke in intime Lebensbereiche zu gewähren, deshalb müssen sie das Recht haben, ihre AssistentInnen als Personen ihres Vertrauens selbst auswählen zu können. Insbesondere für Frauen ist es dabei meist wesentlich, von einer gleichgeschlechtlichen Person unterstützt zu werden. Die vorliegende Untersuchung kann über die Wahl von AssistentInnen nach geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten allerdings keinen Aufschluss geben, weil dieser Aspekt in den Interviews nicht behandelt wurde.
-
Reflexion Interviews Bis auf ein Interview haben sich bei allen Befragungen aufschlussreiche Gesprächssituationen entwickelt. Das Interview mit Frau E stellt eine Ausnahme dar. Ihre Antworten beschränkten sich meist auf ‚ja' und ‚nein'. Auch die Umformulierung von Fragen und das Anführen von Beispielen konnten am Antwortverhalten von Frau E wenig ändern. Die Ursachen dafür sind schwer zu ergründen, da die Voraussetzungen für das Interview eigentlich sehr gut waren und sowohl vor als auch nach dem Interview ein angenehmes Gespräch stattgefunden hat. Wir haben das Interview zu einem von ihr gewählten Zeitpunkt bei ihr zu Hause durchgeführt. Der Zeitpunkt wurde von ihr so gewählt, dass sie an jenem Tag genügend Zeit und Ruhe für das Interview hatte. Wir waren alleine in ihrer Wohnung, deshalb konnten wir das Interview ungestört durchführen. Eine mögliche Erklärung für das knappe Antwortverhalten von Frau D könnte sein, dass Selbstbestimmung für sie auf einer praktischen Ebene sehr wohl von Bedeutung ist, eine Reflexion und Auseinandersetzung auf theoretischer oder abstrakter Ebene mit dem Selbstbestimmungsbegriff allerdings in geringerem Maße stattgefunden hat.
Eine Einschränkung der Studie ergibt sich aus dem befragten Personenkreis. Es wurden ausschließlich Menschen mit einer Körperbehinderung befragt und keine Menschen mit Lernschwierigkeiten. Diese Auswahl war nicht geplant, sondern hat sich erst im Laufe der Suche nach InterviewpartnerInnen abgezeichnet. Die Einschränkung der InterviewpartnerInnen verweist auf den Umstand, dass ein Großteil der Personen, die Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, immer noch Menschen mit körperlichen Behinderungen sind. Durch diese selektive Zusammenstellung der InterviewpartnerInnen müssen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit relativiert werden.
Eine wesentlichste Grenze der Untersuchung zeichnet sich auch durch die geringe Zahl der Befragten ab. Es wurden nur fünf Interviews durchgeführt, deshalb können die erhobenen Daten lediglich zur Unterstützung dienen, um die Fragestellungen dieser Untersuchung zu beantworten.
Für die vorliegende Untersuchung wurden problemzentrierte Interviews mit insgesamt fünf Personen durchgeführt, die Persönliche Assistenz selbst in Anspruch nehmen. Zwei der InterviewpartnerInnen waren männlich und drei weiblich. Alle InterviewpartnerInnen sind körperbehindert und leben in Tirol.
Alle InterviewpartnerInnen sind KundInnen einer Selbstbestimmt-Leben-Initiative. Das SLI führt eine AssistentInnenkartei. Die Vermittlung zwischen AssistenznehmerInnen und AssistentInnen erfolgt mit Hilfe dieser computerunterstützten Kartei. Die AssistenznehmerInnen beauftragen die KoordinatorInnen mit der Suche nach den für ihre Bedürfnisse geeigneten AssistentInnen. Die Entscheidung wer beauftragt wird, treffen die AssistenznehmerInnen bzw. entscheiden die AssistentInnen, ob sie die Assistenz übernehmen wollen und können. Die Abrechnung der geleisteten Stunden erfolgt über Selbstbestimmt-Leben.
Bei meiner Suche nach InterviewpartnerInnen habe ich mich an eine Selbstbestimmt-Leben-Initiative gewandt. Dadurch wurden mir die Kontaktdaten von drei InterviewpartnerInnen vermittelt. Um den Kontakt zu eine/r/m Betroffenen herzustellen, konnte ich auf persönliche Kontakte zurückgreifen. Eine/n weitere/n InterviewpartnerIn habe ich über eine Anzeige in der ÖH-Jobbörse gefunden, als er/sie auf der Suche nach eine/r/m Persönlichen AssistentIn war.
Die erste Kontaktaufnahme mit meinen InterviewpartnerInnen erfolgte auf unterschiedliche Weise. Zwei InterviewpartnerInnen kontaktierte ich telefonisch, zwei per E-mail und eine/n persönlich. Im ersten Gespräch bzw. schriftlichen Kontakt beschrieb ich jeweils kurz das Thema meiner Diplomarbeit und erklärte den Ablauf der Interviews. Bei der Vereinbarung von Ort und Zeit überließ ich meinen InterviewpartnerInnen die Wahl, wo und wann sie das Interview führen wollten.
Zwei Interviews führte ich in den Wohnungen der InterviewpartnerInnen durch und drei am Arbeitsplatz der InterviewpartnerInnen. Die Dauer der Interviews betrug zwischen 30 und 80 Minuten.
Zu Beginn jedes Interviews erklärte ich noch einmal Thema und Ziel meiner Arbeit, beschrieb die Weiterverarbeitung der Tonaufzeichnung und die Anonymisierung der Daten. Das gesamte Interview wurde mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet.
Vor dem eigentlichen Interview stand ein Kurzfragebogen, dessen Fragen mündlich gestellt wurden. Im Interview orientierte ich mich an meinem vorher erarbeiteten Leitfaden, wobei die Fragen und deren Reihenfolge entsprechend dem Gesprächsverlauf variierten.
Nach den Treffen mit meinen InterviewpartnerInnen verfasste ich jeweils ein Postskriptum, in dem ich die Interviewsituation, Störungen bzw. Unterbrechungen und persönliche Eindrücke der Gesprächssituation festhielt. Danach erfolgte die Transkription. Dabei wurden alle persönlichen Angaben anonymisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 10.1 Überblick über die InterviewpartnerInnen
-
10.2 Vergleich der Ergebnisse anhand der Kategorien
- 10.2.1 Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung
- 10.2.2 Unterstützung von der Umwelt
- 10.2.3 Selbstbestimmung im Bereich Wohnen
- 10.2.4 Selbstbestimmung im Bereich Arbeit/Beruf
- 10.2.5 Selbstbestimmung im Bereich Freizeit
- 10.2.6 Grenzen der Selbstbestimmung
- 10.2.7 Eigenverantwortlichkeit
- 10.2.8 Fremdbestimmung
- 10.2.9 Zugewinn an Selbstbestimmung durch Persönliche Assistenz
- 10.2.10 Anforderungen des Assistenzmodells an die AssistenznehmerInnen
- 10.2.11 Einblicke in persönliche und intime Bereiche des Lebens
- 10.2.12 Abhängigkeit von AssistentInnen
- 10.2.13 Unabhängigkeit von Freunden und Familie
- 10.2.14 Nachteile
Alle InterviewpartnerInnen leben in Tirol. Zum Zeitpunkt der Interviews ist die jüngste meiner InterviewpartnerInnen 27 Jahre, der/die älteste 57 Jahre alt. Ein Mann ist auf freiberuflicher Basis Vollzeit berufstätig, eine Frau ist neben ihrem Studium Teilzeit beschäftigt. Eine weitere Frau ist Teilzeit berufstätig. Ein Mann ist geringfügig beschäftigt und eine Frau ist aufgrund ihrer Behinderung nicht berufstätig.
Tabelle 1: Demographische Daten
|
Nummer |
Geschlecht |
Alter |
Ausbildung |
Beruf |
|
1 |
männlich |
57 |
Matura (abgebrochenes Studium) |
Grafiker |
|
2 |
männlich |
38 |
Lehre zum Tischler |
Empfangsmitarbeiter (gering. beschäftigt) |
|
3 |
weiblich |
27 |
Matura (derzeit Studium) |
Fachberaterin (20 Std./Woche) |
|
4 |
weiblich |
45 |
Studium |
Verwaltungsangestellte (20 Std./Woche) |
|
5 |
weiblich |
40 |
Lehre zur Bürokauffrau |
Nicht berufstätig |
Zwei der InterviewpartnerInnen leben derzeit in einer Beziehung und zwei sind geschieden. Eine der InterviewpartnerInnen hat einen 10-jährigen Sohn, eine weitere Frau hat einen 19-jährigen Sohn.
Tabelle 2: Familie
|
Nummer |
Familienstand |
Kinder |
|
1 |
Ledig (derzeit keine Beziehung) |
keine |
|
2 |
Geschieden (lebt derzeit in einer Beziehung) |
keine |
|
3 |
Ledig (derzeit keine Beziehung) |
keine |
|
4 |
Geschieden (derzeit keine Beziehung) |
Einen 10-jährigen Sohn |
|
5 |
Ledig lebt derzeit in einer Beziehung |
Einen 19-jährigen Sohn |
Alle InterviewpartnerInnen sind bewegungsbehindert. Bei zwei InterviewpartnerInnen ist die Behinderung angeboren. Zwei InterviewpartnerInnen haben ihre Behinderung als Folge eines Unfalls im Jugend- bzw. Erwachsenenalter erworben. Ein/e InterviewpartnerIn hat ihre Behinderung aufgrund einer Krankheit mit progressivem Verlauf. Bei allen besteht die Behinderung bereits seit mehreren Jahren. Vier der bewegungsbehinderten InterviewpartnerInnen benutzen einen Rollstuhl.
Tabelle 3: Behinderung
|
Nummer |
Art der Behinderung |
Seit wann besteht die Behinderung |
|
1 |
Querschnittlähmung |
1997 (Unfall) |
|
2 |
Querschnittlähmung |
1997 (Unfall) |
|
3 |
Muskelerkrankung |
Geburt |
|
4 |
Aufgrund Multipler Sklerose Bewegungsbehinderung |
1996 (Krankheit) |
|
5 |
Spina bifida |
Geburt |
Alle InterviewpartnerInnen haben langjährige Erfahrung mit Persönlicher Assistenz. Diese reichen von fünf bis zwanzig Jahren.
Tabelle 4: Persönliche Assistenz
|
Nummer |
Anzahl AssistentInnen |
Seit wann Assistenz |
|
1 |
7 - 10 |
1999 |
|
2 |
7 - 8 |
1999 |
|
3 |
5 |
2000 |
|
4 |
5 |
2005 |
|
5 |
3 |
1990 |
Herr A ist 57 Jahre alt und wohnhaft in Tirol. Er lebt derzeit in keiner Beziehung. Seine langjährige Partnerin ist vor sieben Jahren verstorben, seither lebt er alleine. Die Querschnittlähmung besteht seit 1997, entstanden durch einen Unfall. Der Unfall ist gegen Ende seines Studiums passiert, wodurch er das Studium abbrechen musste. Herr A arbeitet auf freiberuflicher Basis als Grafiker.
Persönliche Assistenz nimmt Herr A seit 1999 in Anspruch. Er beschäftigt zwischen sieben und zehn Persönliche AssistentInnen. Unterstützungsbedarf hat Herr A bei der Arbeit, Körperpflege, im Haushalt und in der Freizeit. Seine Pflege und Betreuung hat zuvor seine Partnerin übernommen. Die Umstellung von der privaten Unterstützung zum Modell der Persönlichen Assistenz hat Herr A als sehr großen Einschnitt in seinem Leben empfunden. Durch diesen Wechsel musste er sehr viele Einschränkungen in Kauf nehmen, da er nicht nur seine Lebenspartnerin verloren hat, sondern auch seine Freizeitpartnerin, Sexualpartnerin, Mitarbeiterin in seinem Beruf und durch die zusätzliche Berufstätigkeit seiner Partnerin auch wichtige Einnahmequelle, welche viel zum Lebensunterhalt beigetragen hat. Nun muss Herr A den Lebensunterhalt nicht nur alleine bestreiten, er muss auch für seinen Unterstützungsbedarf zusätzliches Geld aufbringen.
Herr A fühlt sich in seinem Leben sehr selbstbestimmt. Auch bedingt durch seine freiberufliche Tätigkeit. Sein Beruf ermöglicht es ihm, selbstbestimmt leben zu können. Einerseits durch die finanzielle Unabhängigkeit, die er dadurch erfährt und andererseits durch die Möglichkeit, nach seinen Vorstellungen arbeiten zu können ohne sich an die Vorgaben eines Vorgesetzten richten zu müssen.
In seiner Selbstbestimmung eingeschränkt fühlt sich Herr A in seiner Freizeit. Bedingt dadurch, dass ihm geeignete Freizeitpartner fehlen, mit denen er seine Freizeit nach seinen Vorstellungen verbringen kann.
Herr B ist 38 Jahr alt und lebt in Tirol. Er ist geschieden, lebt aber derzeit wieder in einer Beziehung. Er lebt mit seiner Partnerin allerdings nicht zusammen. Seine Querschnittlähmung besteht seit einem Unfall im Jänner 1997. Nach dem Unfall hat Herr B zwei Jahre in einem Heim verbracht weil seine Wohnung nicht behindertengerecht war. Es war allerdings klar, dass dieser Zustand nicht von Dauer sein konnte, weil er ein selbständiges Leben führen wollte. Deshalb hat er sich für das Modell der Persönlichen Assistenz entschieden. Dadurch ist es ihm möglich, selbständig in seiner Wohnung zu leben. Obwohl die Möglichkeit bestanden hätte, wollte er nicht bei seinen Eltern oder Geschwistern leben. Er wollte nicht abhängig sein von seiner Familie.
Herr B hat eine Lehre zum Tischler absolviert. Seit seinem Unfall arbeitet er jedoch auf geringfügiger Basis als Empfangsmitarbeiter in einer sozialen Einrichtung. Herr B würde gerne mehr arbeiten, aber um den Anspruch auf seine Invaliditätsrente nicht zu verlieren muss er darauf verzichten.
Herr B nimmt seit 1999 Persönliche Assistenz in Anspruch und beschäftigt derzeit sieben bis acht Persönliche AssistentInnen. Unterstützungsbedarf hat Herr B bei der Körperpflege, im Haushalt und im Bereich Freizeit.
Herr B fühlt sich in seinem Leben sehr selbstbestimmt. Fremdbestimmungsmomente gibt es seiner Meinung nach in seinem Leben nicht. Er hat sich bewusst gegen ein Leben im Heim entschieden, um Selbstbestimmung in seinem Leben verwirklichen zu können.
Frau C ist 27 Jahre alt und wohnhaft in Tirol. Sie lebt in einer WG, wobei ihre MitbewohnerInnen an den Wochenenden nicht anwesend sind. Frau C lebt derzeit in keiner Beziehung. Sie studiert und schreibt zurzeit an ihrer Diplomarbeit. Nebenbei ist Frau C in einer Organisation mit dem Schwerpunkt Selbstbestimmung für Menschen mit einer Behinderung als Fachberaterin tätig. Dort arbeitet sie 20 Stunden pro Woche.
Frau C leidet seit ihrer Geburt an einer Muskelerkrankung. Aufgrund dieser Erkrankung ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Persönliche Assistenz nimmt Frau C seit Herbst 2000 in Anspruch. Dieses Modell ermöglichte es ihr, mit 20 Jahren von zu Hause auszuziehen und ein eigenständiges Leben zu führen. Derzeit beschäftigt Frau C fünf Persönliche AssistentInnen. Sie nimmt Persönliche Assistenz bei der Köperpflege, im Haushalt und im Freizeitbereich in Anspruch.
Frau C sieht den Selbstbestimmungsgedanken in ihrem Leben verwirklicht, ermöglicht durch das Modell der Persönlichen Assistenz. Dadurch wird ihr Unterstützungsbedarf von Persönlichen AssistentInnen gedeckt und muss nicht mehr von ihrer Familie oder Freunden geleistet werden. Das ermöglicht ihr ein eigenständiges Leben und Abhängigkeiten zu vermeiden.
Frau D ist 45 Jahre alt und lebt in Tirol. Sie ist geschieden und hat einen 10-jährigen Sohn. Frau D hat das Pädagogik Studium absolviert und wäre eigentlich Sozialpädagogin. Aufgrund ihrer Erkrankung konnte sie allerdings nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Als ihre Krankheit (Multiple Sklerose) ausgebrochen ist, mit der damit verbundenen Bewegungsbehinderung, wäre ihr eine Anstellung als Leiterin einer sozialen Einrichtung angeboten worden. Dieses Angebot musste sie jedoch ablehnen, da es ihr nur mit Arbeitsassistenz möglich gewesen wäre, diese Aufgabe zu erfüllen. Um die Auflagen für Arbeitsassistenz zu erfüllen ist aber die Pflegestufe 3 vorgesehen. Frau D ist aber niedriger eingestuft. Sie bedauert diesen Umstand sehr, weil sie gerne in ihrem erlernten Beruf arbeiten würde. Derzeit arbeitet Frau D als Verwaltungsangestellte 20 Stunden pro Woche.
Die Krankheit ist bei Frau D 1996 aufgetreten. Seit 2005 beschäftigt sie Persönliche AssistentInnen. Zuvor wurde ihr eine Familienhelferin gestellt. Bis November 2009 beschäftigte sie eine/n Persönliche AssistentIn, seit diesem Zeitpunkt sind es fünf. Frau D nimmt Persönliche Assistenz hauptsächlich für die Haushaltsführung, den privaten und Freizeitbereich in Anspruch. Zusätzlich wird sie von ihren AssistentInnen zur Arbeit gefahren.
Frau D empfindet ihre Lebensführung als selbstbestimmt. Einschränkungen in ihrer Selbstbestimmung sieht sie vor allem in ihrem Beruf. Sie würde gerne in ihrem erlernten Beruf arbeiten, bedingt durch ihre Behinderung und durch gesetzliche Regelungen ist dies allerdings nicht möglich.
Frau E ist 40 Jahre alt und lebt in Tirol. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen 19-jährigen Sohn. Ihr Sohn absolviert derzeit den Zivildienst und lebt noch bei Frau E. Seit drei Monaten lebt Frau E wieder in einer Beziehung. Aufgrund einer Spina bifida ist Frau E auf den Rollstuhl angewiesen. Frau E hat eine Lehre zur Bürokauffrau absolviert, aufgrund ihrer Behinderung ist sie allerdings nicht mehr berufstätig.
Frau E nimmt Persönliche Assistenz bereits seit 20 Jahren in Anspruch. Zuvor wurde ihr Unterstützungsbedarf durch den MOHI (Mobiler Hilfsdienst) gewährleistet. Derzeit beschäftigt Frau E drei Persönliche AssistentInnen. Unterstützungsbedarf hat sie vor allem im Bereich Freizeit, Haushaltsführung und Körperpflege. Den Selbstbestimmungsgedanken sieht Frau E in ihrem Leben weitestgehend realisiert.
Die Aussage von Herrn A weist darauf hin, dass er die Voraussetzungen für Selbstbestimmung vor allem in seiner Persönlichkeit verortet. Selbstbestimmung verbindet er zudem mit einer zu erbringenden Leistung.
"Ich glaube, dass eine gewisse Eigenständigkeit notwendig ist, ein gewisses Durchsetzungsvermögen, Hartnäckigkeit, Disziplin, vor allem auch Disziplin. Wenn man sich gehen lässt und zum Beispiel die Organisation des Lebens schleifen lässt. Weil sonst gerät man in Abhängigkeiten, wenn das nicht gegeben ist." (Herr A)
Wenn aber Selbstbestimmung an Bedingungen geknüpft wird, die in der Persönlichkeit des Menschen liegen und eine Leistungsfähigkeit voraussetzen, widerspricht dies der in Kap. 2.2 und Kap. 7 beschriebenen Annahme, dass Selbstbestimmung letztlich auf biophysische Selbstregulationsmechanismen zurückzuführen ist. Denn jenen Menschen, die nicht über die genannten Persönlichkeitseigenschaften und die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügen, wird damit die Fähigkeit zur Selbstbestimmung abgesprochen.
Im Gegensatz dazu werden Einstellungen genannt, die verändert werden müssen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Betroffene ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das Zuerkennen des Grundrechts auf Selbstbestimmung ist dabei ein wesentlicher Aspekt. (vgl. Kap. 2.2) Im Unterschied zu Herrn A, macht Frau C die Selbstbestimmungsfähigkeiten eines Menschen nicht abhängig von Bedingungen, sondern gesteht sie allen Menschen zu, unabhängig von einer eventuell vorhandenen Behinderung.
"Es braucht im Prinzip eine Gesellschaft, die dem Individuum die Grundfreiheit zuerkennt. Wenn es jetzt um Behinderung geht, wird es etwas komplizierter weil theoretisch leben wir ja in einer Gesellschaft, die dem Menschen die Grundfreiheit zuerkennt. (...) Aber wenn es darum geht, dass ein Mensch mit einer Behinderung nicht mehr daheim wohnen kann weil der Betreuungsaufwand zu groß ist, dann ist das, für den Großteil der Bevölkerung immer noch völlig klar, dass derjenige in ein Heim muss. Wo dann auf einmal das grundlegende Selbstbestimmungsrecht nicht nur in Frage gestellt wird, sondern eigentlich nicht mehr existent ist."
Mit dieser Aussage macht Frau D deutlich, dass das Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung und Teilnahme am Leben der Gesellschaft unteilbar ist. Es gilt für alle Menschen, unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung (vgl. Kap. 2.2) Hahn (1981) erkennt Selbstbestimmung als ein grundsätzliches Wesensmerkmal des Menschen. Der behinderungsbedingt sozial abhängige Mensch ist kraft seiner Geburt Mensch und nicht kraft seiner Leistungsfähigkeit im Normbereich der Gesellschaft. Man darf ihn daher nicht als Wesen anderer Art behandeln und bei ihm Menschenwürde, Rechte, Bedürfnisse, Freiheitsräume missachten, die von anderen Mitgliedern der Gesellschaft selbstverständlich in Anspruch genommen werden. Diese Forderung gilt auch für schwerbehinderte Menschen. (Hahn 1981, S. 237)
Für Frau D stellt das Assistenzmodell mit der damit einhergehenden Möglichkeit den AssistentInnen selbst Anweisungen geben zu können, ohne dass diese über ihren Kopf hinweg Entscheidungen treffen, eine wesentliche Voraussetzung für Selbstbestimmung dar. Dieser Wunsch kann dahingehend interpretiert werden, als "Expert/e/in in eigner Sache" (vgl. Kap. 8.4) anerkannt zu werden. Expert/e/in in eigener Sache zu sein bedeutet, dass die Anleitung der Persönlichen Assistenzkräfte im Sinne größtmöglicher Selbstbestimmung den behinderten Menschen selbst obliegt. Sie wissen selbst am besten, wie ihnen die benötigten Hilfen erbracht werden sollen.
"Dass man eben selber die Assistenten anleiten kann, was sie zu tun haben und wie man es auch haben will, wann sie kommen sollen, für was man sie braucht." (Frau D)
Gefragt nach der Unterstützung, die sich Betroffene von ihrer Umwelt wünschen, erwähnen Herr A und Frau C in erster Linie Barrierefreiheit, d.h. dass Gegenstände, Medien und Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie von jedem Menschen unabhängig von einer eventuell vorhandenen Behinderung uneingeschränkt benutzt werden können.
"Es müssen die Barrieren weg und zwar alle: Informationsbarrieren, Barrieren was die Personen mit Sinnesbeeinträchtigung betrifft, es muss Gebärdensprache großflächig her, es muss einfach ein allgemeines Umdenken her, weil sonst werden die Barrieren nicht weniger. (...) Wenn ich mir anschaue, wie wenig barrierefreies Informationsmaterial es gibt, wie viele Hompages noch immer nicht barrierefrei sind. Wie es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Barrierefreiheit ausschaut. Der private Sektor ist sowieso katastrophal. Die Leute bauen sich nicht einmal die eigenen Häuser so, dass sie im Notfall barrierefreie Grundstrukturen hätten. Es mangelt im Prinzip an allen Ecken."(Frau C)
Diese Aussage macht deutlich, dass öffentlich verfügbare Infrastrukturangebote und deren Zugänglichkeit, die sich als exklusiv oder aber als inklusiv erweisen, maßgeblich zur Selbstbestimmung behinderter Menschen beitragen. Barrieren sind keine technischen Hindernisse, die aus schädigungsbedingten Einschränkungen resultieren. Sie sind in aller Regel Ergebnis der von Menschen geschaffenen und gewollten Strukturen, die Menschen mit Behinderung ausschließen. Barrierefreiheit ist demnach eine wesentliche Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen von Menschen mit einer Behinderung. (Frehe 2007, S. 4)
Frau D hingegen wünscht sich in erster Linie aufgrund eigener negativer Erfahrungen den Abbau von Vorurteilen behinderten Menschen gegenüber. Sie wünscht sich Achtung, Respekt und integrierte Teilhabe statt Diskriminierung und gesellschaftlich-institutionelle Ausgrenzung. Sie fordert im Sinne der Kontakthypothese von Cloerkes (2007), dass vermehrte Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung stattfinden sollen, um Vorurteile abzubauen. Die Kontakthypothese basiert auf der Annahme, dass Kontakte mit Menschen mit Behinderung die Einstellungen positiv beeinflussen können. (Cloerkes 2007, S. 146) Cloerkes geht allerdings davon aus, dass häufige, oberflächliche Kontakte eher zu einer Verstärkung von Vorurteilen, als zu deren Abbau führen. Nicht die Häufigkeit von Begegnungen bestimmt die Qualität von Einstellungen, sondern deren Intensität. Je intensiver die Beziehung zu Menschen mit Behinderung ist, desto positiver gestalten sich demnach die Einstellungen. (ebd. S. 147)
"Ich wünsche mir, seitdem ich jetzt selber ein bisschen mitkriege, dass weniger in die Schubladen gesteckt wird. Dass man wirklich sofort in eine Schublade gesteckt wird und dann im Prinzip gar keine Chance mehr hat. Zum Beispiel mein Sohn sagt jetzt oft, dass sie ihn in der Schule blöd anreden, was er für eine Mama hat. Dass die Umwelt einfach mehr mit Leuten mit Behinderung konfrontiert wird, damit es einfach normaler wird."
Die Erfahrungen ihres Sohnes, die Frau D schildert, entsprechen meines Erachtens einer Stigmatisierung (vgl. Kap. 4.3). Ein Mensch mit einem Stigma entspricht in seiner "aktualen sozialen Identität" nicht den normativen Erwartungen seiner Umwelt. Diese normativen Erwartungen als antizipierte Vorstellungen von einem "Normalen" nennt Goffman "virtuale soziale Identität" (ebd. S. 10). Bei einem Menschen mit einem Stigma besteht eine Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität. Er weicht in seinem Sosein von sozialen Normen ab. (Cloerkes 1997, S. 146) Auf der Grundlage eines Stigmas tendieren die "Normalen" dazu, weitere Unvollkommenheiten und negative Eigenschaften zu unterstellen (ebd. S. 148). Über derartige Generalisierungen wird das Stigma zum alles beherrschenden Status.
Zudem werden finanzielle Unterstützungsleistungen genannt, um Selbstbestimmung realisieren zu können. Ohne öffentliche Zahlungen wäre es nicht möglich, die finanziellen Mittel für die AssistentInnen aufzubringen.
"Dass ich zum Beispiel vom Land einen Teil finanziert kriege. Weil das könnte ich mir selber nicht bezahlen."(Frau E)
In diesem Zusammenhang betont Adolf Ratzka die Wichtigkeit der finanziellen Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderung. Er fordert, dass es Ziel der Behindertenpolitik sein muss, dem einzelnen Behinderten und der Gruppe der Behinderten mehr Macht zu verschaffen. Mehr Macht hat derjenige, der über finanzielle Mittel verfügt und soziale Situationen und Sachverhalte definieren kann. So wird konsequent im Sinne der Independent-Living-Philosophie gefordert, dass die für Behinderte staatlicherseits vorgesehenen Mittel auch ihnen selbst zufließen, damit sie im ökonomischen Sinne nachfragen können und sich so neue Strukturen von Hilfe und Unterstützung ergeben. (Österwitz o.J., S. 2)
Selbstbestimmt leben bedeutet auch Umweltkontrolle. Die eigene Wohnung ist für die meisten Menschen der Bereich, in dem sie Kontrolle ausüben und selbst bestimmen können, mit wem sie welche Kontakte und in welcher Intensität pflegen wollen.
Für Frau C ist es wichtig, sich die Wohnung selbst aussuchen zu können, wo sie gerne leben möchte. Hierbei kritisiert sie, dass die Auswahl an behindertengerechten Wohnungen in Innsbruck sehr gering ist. Nach Speck (1999, im Internet) untergräbt diese Tatsache das Recht jedes Bürgers arbeiten, lernen und leben zu können, wo es im entspricht. Ebenso möchte sie selbst wählen können, in welcher Wohnform sie lebt und wie der jeweilige Wohnraum gestaltet wird.
"Dass ich mir soweit es geht, selber aussuchen kann wo ich wohnen will. Was insofern eingeschränkt ist, weil die baulichen Gegebenheiten einfach miserabel sind. Also in Innsbruck eine barrierefreie Mietwohnung zu finden, ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. (...) Es ist für mich auch die Möglichkeit ganz wichtig, dass man sich aussuchen kann, in welcher Wohnform man wohnen möchte. Dass ich mir den Wohnraum selbst gestalten kann, wie ich den haben will. Und wenn bestimmte Sachen vielleicht nicht so praktisch sind aber dafür hübsch, dann soll es halt so sein. Oder umgekehrt."
Diese Aussage zeigt, dass Wohnen nicht beliebig ist, sondern es befriedigt zahlreiche Bedürfnisse wie Vertrautheit, Geborgenheit, Ungestörtheit, Individualität, Selbstdarstellung, Kontrolle und eben auch Selbstbestimmung. Bollnow (1963) geht davon aus, dass Wohnen viel mehr beinhaltet als das bloße Sein an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Raum. Wohnen heißt, "an einem bestimmten Ort zu Hause sein, in ihm verwurzelt sein und an ihn gehören" (Bollnow 1963, S. 125) Diese Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort zeigt sich auch in der je eigenen Individualität einer Wohnung.
Für alle InterviewpartnerInnen kann das Wohnen in einer eigenen Wohnung nur aufgrund der Möglichkeit zur Persönlichen Assistenz umgesetzt werden. Alle sind auf die Unterstützung in der Haushaltsführung, zum Teil bei der Körperpflege und im Beruf und vor allem auch im Freizeitbereich angewiesen. Demnach ist die gelebte Selbstbestimmung der InterviewpartnerInnen nur aufgrund des Modells der Persönlichen Assistenz realisierbar.
"Weil es wäre jetzt ohne diese Konstruktion, ohne diese finanziellen Zuschüsse völlig unmöglich allein jetzt in meiner Wohnung, in meinem Haus zu leben. Könnte also nicht stattfinden. Und damit würde natürlich auch mein Leben ganz stark eingeschränkt. Sie ist einfach notwendig, um so ein Leben führen zu können." (Frau C)
Die besondere Bedeutung, die dem selbstbestimmten Wählen der jeweiligen Wohnverhältnisse zukommt, wird auch von Sack (1997 S. 193ff) beschrieben. Wohnen hat auch mit Geborgenheit zu tun, in dem Sinne, dass der Mensch sich in seinen Mauern zurückziehen kann, sich dort entspannen kann, seine Angst gegenüber Gefahren aufgeben kann. Geborgenheit enthält aber neben dem Punkt der Sicherheit auch noch die Komponente der Wohnlichkeit, gemeint ist die Gestaltung des Wohnraums nach individuellen Vorstellungen. "Wenn die Wohnung eine derart zentrale Bedeutung hat, dann liegt es auf der Hand, dass die Möglichkeit, über diesen Ort, seine Gestaltung, das darin stattfindende Leben und die darin ein- und ausgehenden Personen selbst bestimmen zu können, ein besonders elementares Bedürfnis darstellt". (Sack 1997, S. 193)
Erwerbsarbeit ist ein wesentlicher Faktor für die gesellschaftliche Integration, besonders auch für Menschen mit Behinderung. Bildung und Arbeit sind notwendige Bestandteile des menschlichen Entwicklungs- und Lebensbedürfnisses.
Frau C kritisiert, dass behinderte Menschen im Bildungssystem immer noch sehr benachteiligt werden, indem sie dazu gezwungen werden, Sonderschulen zu besuchen und damit das Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderung stark beschnitten wird.
Die Aussage von Frau C verweist auf ein zugrundeliegendes inklusives Verständnis, die Ausbildungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung betreffend. Nach dem Denk- und Handlungsmodell der Inklusion kann jedes Individuum darauf vertrauen, dass seine Bedürfnisse und Interessen von Gesellschaft ohne Selektion und Segregation gewahrt und vertreten werden, da separierende Sondersysteme nicht zu rechtfertigen sind. Aus diesem Blickwinkel hat jeder Mensch ein unteilbares Anrecht darauf, als gleichwertig und gleichberechtigt respektiert zu werden, sowie selbstbestimmter Gestalter seines Lebens innerhalb der Gesellschaft zu sein, ungeachtet der im möglichen oder nicht möglichen Leistungen. (Bintinger & Wilhelm 2001, im Internet)
Die von Frau C geäußerte Kritik wird durch zahlreiche Studien belegt. Diese zeigen, dass sich Förderschulen nicht - wie der Name nahelegt - förderlich auf die Schüler auswirken. Ganz im Gegenteil. Zwar sollen sie die SchülerInnen durch individuelle Hilfen unterstützen und begleiten, um für diese ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbständiger Lebensgestaltung zu erlangen. Doch SchülerInnen erbringen schlechtere Leistungen und erwerben weniger soziale Kompetenzen, je länger sie auf einer Förderschule verbleiben - im Vergleich mit Kindern und Jugendlichen, die an einer Regelschule inklusiven Unterricht genießen können. (vgl. Mängel 2009, im Internet)
Herr B betont die Wichtigkeit der Arbeit für die Selbstbestimmung. Sie dient nicht nur der Sicherung des Lebensunterhalts, sondern stiftet Sinn und gibt dem Leben Inhalt.
Aufgrund eines Unfalls kann Herr B nicht mehr in seinem erlernten Beruf arbeiten. Er arbeitet auf geringfügiger Basis als Empfangsmitarbeiter in einer sozialen Einrichtung. Herr B verbringt allerdings mehr Stunden als vorgesehen an seinem Arbeitsplatz, weil er sich dort wohl und gebraucht fühlt. Herr B hat ein herzliches und freundschaftliches Verhältnis zu seinen ArbeitskollegInnen und seiner Chefin.
"Arbeitet ist wichtig, weil man sich nicht so leer vorkommt. Weil es immer ein gutes Gefühl ist wenn man gebraucht wird. Wenn man irgendwie eine Aufgabe hat. Weil, wie soll ich sagen, weil man nicht so verkümmert zu Hause. Man langweilt sich nicht. Wichtig ist mir, dass ich eine Aufgabe habe. Das ist ganz wichtig für die Selbstbestimmung."
Die Aussage von Herrn B zeigt, dass die Bewältigung von Aufgaben zur Stärkung des Selbstwertgefühls beiträgt und somit entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nimmt. Arbeit ermöglicht den Erhalt und die Weiterentwicklung von Fähigkeiten und trägt zu einem Zuwachs an Handlungskompetenzen bei. Zudem strukturiert Arbeit den Alltag sowohl in zeitlicher wie auch in räumlicher Hinsicht. Dadurch entstehen unterschiedliche Lebensräume mit spezifischen Erfahrungs- und Kommunikationsstrukturen. Der Rhythmus des Lebens, des Alltags als wichtige Forderung des Normalisierungsgedankens (vgl. Kap. 5.2), Arbeit/Freizeit, Wochentag/Wochenende, Urlaub, Pension, wird dadurch hergestellt. (Niedermair 2002, S. 4)
Engelmeyer (2000) geht davon aus, dass die Fähigkeit zur Selbstbestimmung durch Bestätigungen für das Selbst gefördert wird. Einerseits durch eigene Erfolge, andererseits durch den Respekt der Umwelt. Selbstbestimmung korreliert also mit einem positiven Selbstbild. (Engelmeyer 2000, S. 113) Die Aussage von Herrn B zeigt, dass das positive Selbstbild durch eine erfüllende Berufstätigkeit verstärkt werden kann und damit zu mehr Selbstbestimmung beiträgt.
Der Berufsfindungsprozess von Frau C erfolgte unter Berücksichtigung ihrer Stärken, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse. Dies spricht für eine selbstbestimmte Wahl ihrer Ausbildung und ihres Berufs. Dabei blieb ihre individuelle Ausgangssituation aber nicht unberücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt dabei war, dass Frau C diesen Beruf voraussichtlich trotz ihrer Behinderung über längere Zeit ausüben wird können. Dadurch wird die selbstbestimmte Wahl eingeschränkt. Es gilt einen Beruf zu wählen, der mit der Behinderung zu bewältigen ist.
"Im Bereich Arbeit und Beruf denke ich ist es wichtig, dass man einen Beruf findet, der einen interessiert, der einem Spaß macht, man weitestgehend seinen Weg halt umsetzen kann. In meinem Fall war es so, dass ich was die Ausbildung betrifft schon eine Richtung ausgesucht habe, wo ich gewusst habe das interessiert mich. Aber ich habe mir bereits etwas gesucht, wo ich gewusst habe das ist auch etwas wo ich auch recht gut arbeiten könnte oder möchte. Und wo ich auch eventuell lange Zeit, ganz egal wie sich mein Leben noch verändert, darin arbeiten würde können, soweit ich die Möglichkeit bekomme eine Arbeitsstelle zu finden."
Frau E muss im Bereich Beruf Einschränkungen in ihrer Selbstbestimmung in Kauf nehmen. Aufgrund gesetzlicher Regelungen kann sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Um als Sozialpädagogin arbeiten zu können, wäre sie auf eine Arbeitsassistenz angewiesen. Diese wird ihr jedoch nicht gewährt, weil dafür die Einstufung auf die Pflegestufe drei notwendig wäre. Diese Voraussetzung erfüllt Frau E aber nicht.
"Weil ich würde sonst sicher noch in meinem anderen Beruf arbeiten.(...). Das ist aber nicht durchführbar. (...) ich bräuchte eben im Dienst einfach eine zweite Person, die permanent mit mir auf die Kinder aufpasst, weil ich wäre Leiterin von der Krabbelstube geworden. Und ich habe gesagt, ich kann das alleine nicht, es geht einfach nicht. Ich kann nicht mehr auf sieben acht kleine Kinder aufpassen. Ich kann nicht, wenn ich die Verantwortung habe, davon ausgehen, es wird alles gut gehen. Und das dann wirklich umzusetzen, denke ich, fehlt einfach noch die finanzielle Unterstützung. Dass man da einen Antrag stellen könnte."
Die Problemlage von Frau E zeigt, wie wichtig die Möglichkeit zur Assistenz am Arbeitsplatz ist. Die persönliche Hilfeleistung am Arbeitsplatz zur Kompensation funktioneller Defizite oder zur Überwindung (anfänglicher) Schwierigkeiten in der Arbeitssituation ist ein wichtiger Faktor der beruflichen Eingliederung. Wo entsprechende Hilfe am Arbeitsplatz nicht geboten werden kann, ist unnötige berufliche Ausgliederung (Werkstätten für Behinderte, Sonderarbeitsplatz) oder erzwungene "Berufsunfähigkeit" die Folge. Im Fall von Frau E hat dieser Umstand dazu geführt, dass sie ihren Beruf wechseln musste. (Speck 1999, im Internet)
Herr A hingegen sieht die Selbstbestimmung in seinem Beruf als Grafiker aufgrund seiner freiberuflichen Tätigkeit verwirklicht. Er betont jedoch auch, dass dies nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern auch negative Aspekte zur Folge haben kann. Er trägt die volle Verantwortung für seine Entscheidungen und dies kann manchmal auch zur Last werden. Trotzdem weiß er die Vorzüge seiner Situation zu schätzen.
"Ich mein, irgendwo habe ich natürlich schon gute Voraussetzungen, weil ich keinen Vorgesetzten habe, der mir Aufgaben erteilt. Ich kann also auf der einen Seite frei entscheiden, muss aber auch frei entscheiden. Meine Entscheidungen, die ich in meinem Beruf auch schwerwiegend sein können, die muss ich halt auch alleine treffen. Also das sind die Vor- und die Nachteile. Aber ich ziehe natürlich meine Situation vielen anderen vor. Denn diese Selbständigkeit ist natürlich schon goldeswert."
Durch die Aussage von Herrn A wird deutlich, dass Arbeitszufriedenheit in starkem Maße davon abhängt, wie viele Spielräume für Selbstbestimmung und Gestaltung darin enthalten sind. (Klauß 2007, S. 10)
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen zeigen, dass der Beruf ein zentraler Aspekt für Selbstbestimmung ist. Menschen mit Behinderung steht ein Höchstmaß an persönlicher Handlungsautonomie zu. Auch und gerade in ihrem Berufsleben als einem zentralen Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe.
Menschen mit einer Behinderung haben wie Menschen ohne Behinderung Vorlieben, Interessen und Wünsche bei ihren Freizeitaktivitäten. Jedoch sehen sie sich im Freizeitbereich mit Benachteiligungen verschiedener Art konfrontiert. Es ist davon auszugehen, dass eine Behinderung zwar einen gewissen Einfluss auf das Freizeitverhalten eines behinderten Menschen hat, allerdings nicht zwangsläufig zu einer unbefriedigenden, fremdbestimmten und von der Assistenz anderer abhängigen Freizeitsituation führen muss. (Markowetz 2001, S. 272)
Herr A empfindet Einschränkungen in seiner Selbstbestimmung vor allem in seiner Freizeit. Eingeschränkt fühlt er sich dadurch, dass ihm geeignete FreizeitpartnerInnen fehlen, mit denen er seinen Hobbys nachgehen könnte.
"Es würde mir allein darum gehen eine geeignete Person, die gerne mit mir die Freizeit teilt, die Freizeit genießt. Das muss ich schon sagen, da bestehen schon gewisse Einschränkungen. Also wenn wir jetzt einen Wunsch nehmen, wo mehr Selbstbestimmung vorhanden sein könnte, dann ist es die Freizeit."
Herr B empfindet die Möglichkeit im Bereich Freizeit für Menschen mit Behinderung ebenso begrenzt. Er kritisiert, dass viele Einrichtungen den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung nicht entsprechen. Dadurch werden die Möglichkeiten zur individuellen Freizeitgestaltung eingeschränkt.
"Es gibt gewisse Einrichtungen, aber auch gewisse Sachen, die man nicht tun kann, die vielleicht fein wären, weil es noch nicht so viel gibt."
Für eine selbstbestimmte Lebensführung ist allerdings die Einbindung in gesellschaftliche Aktivitäten von großer Bedeutung. Hilfe muss deshalb darauf abzielen, Barrieren für Menschen mit Behinderung in ihrer sozialen und baulichen Umgebung abzubauen.
Frau C betont die Wichtigkeit der Möglichkeit zur individuellen Freizeitgestaltung. Dabei soll Freizeit vor allem der Erholung und dem Vergnügen dienen. Frau C kritisiert, dass von Menschen mit Behinderung oftmals erwartet wird, dass sie in ihrer Freizeit Therapie- und Trainingsmöglichkeiten wahrnehmen, um körperliche Defizite zu verringern. Dies stellt für Frau C allerdings keine Freizeitgestaltung dar, sondern schränkt Menschen mit Behinderung in ihrer selbstbestimmten Freizeitgestaltung ein.
"Es gibt zum Beispiel Menschen die denken, dass Menschen mit einer Behinderung in ihrer Freizeit möglichst viel trainieren sollten, um ihren Behinderungsgrad zu verringern um sich den körperlichen Normstatus anzunähern. Das finde ich ist keine Freizeitgestaltung. Freizeitgestaltung soll Spaß machen, soll entspannen, je nach dem was man grad will. Also ich denke, das sollte sich jeder genauso gestalten können wie er individuell will. Das macht ja jeder andere auch so. Da wird es ja auch nicht in Frage gestellt."
Das Verständnis einer individuellen und selbstbestimmten Freizeitgestaltung von Frau C kann mit zwei wesentlichen Merkmalen von freier Zeit übersetzt werden: individuelle Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Freizeit muss als freie Zeit aufgefasst werden, losgelöst von Ideen der Rehabilitation und entsprechenden Bildungs- und Fördermaßnahmen. Diese Forderung scheint berechtigt, war doch in den 1970er Jahren die als Freizeit deklarierte Zeit von Menschen mit Behinderung häufig durch Rehabilitationsmaßnahmen und Therapien geprägt. Der Fördergedanke stand im Mittelpunkt und es wurde die Tatsache vernachlässigt, dass auch Menschen mit einer Behinderung einer zweckfreien Zeit bedürfen. (Niehoff 2000, S. 309)
Frau D empfindet ihre Möglichkeiten im Freizeitbereich ebenso begrenzt. Beispielsweise bei der Wahl von Urlaubszielen muss sie sich danach richten, welche Angebote barrierefrei sind und kann nicht nach persönlichen Vorlieben entscheiden, wo sie ihren Urlaub verbringen möchte. Hinzu kommt ein damit verbundener hoher Organisationsaufwand.
"Zum Beispiel gebe ich jetzt auch die Urlaubsziele gezielt so ein, dass ich schon weiß, oder erkundige mich im Reisebüro, dass keine Stufen sind und dass sie beim Fliegen den Rollstuhlservice haben. Es ist einfach viel mehr Organisation."
Für Menschen mit Behinderung kann es schwierig sein, an Informationsmaterial bezüglich behindertengerechter Reise- und Urlaubsangebote heranzukommen, was die soziale Integration behinderter Menschen in das allgemeine Reise- und Urlaubsgeschehen natürlich nur noch weiter erschwert. (Markowetz 2001, S. 292) Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellt sich außerdem häufig die Problematik der Mobilität und Barrierefreiheit am Urlaubsort, die bei der Planung berücksichtig werden muss. (Flieger 2000, S. 49)
Wichtig ist Frau D, dass sie die Freizeit mit ihrem Sohn alleine verbringen kann. Bei der Organisation von Freizeitaktivitäten ist Frau D zwar auf Unterstützung angewiesen, das eigentliche Ereignis möchte sie jedoch ohne Hilfe von AssistentInnen bewältigen. Frau D macht dies anhand eines Beispiels deutlich.
"Also für mich ist momentan noch wirklich der Wunsch, das alleine machen zu können. Zwar mit der Unterstützung, dass mich jemand hinfährt oder jemand begleitet. Zum Beispiel gehe ich mit meinen Sohn schwimmen. Da lassen wir uns vom Assistenten hinfahren und gehen dann 4 Stunden schwimmen und lassen uns wieder abholen. Also die Organisation bis zu dem Ereignis hin, dass das irgendwie gemacht wird, dass ich aber dann die Freizeitaktivität selber gestalten kann."
Diese Beschränkung der Assistenzleistungen im Freizeitbereich auf das Nötigste findet sich auch bei Ebert (2000) wieder. Nach Ebert bedeutet die Forderung nach Freizeit als zweckfreie und selbstbestimmte Zeit für die Praxis, dass die Begleitung durch Persönliche AssistentInnen auf das tatsächliche Bedürfnis nach Assistenz begrenzt wird. (vgl. Ebert 2000, S. 53f)
Das Freizeitbedürfnis und das Freizeitverhalten von Menschen mit und ohne Behinderung sind nahezu identisch. Das Vorliegen einer Behinderung muss nicht automatisch zu einer unbefriedigenden, fremdbestimmten und von der Hilfe anderer abhängigen Freizeitsituation führen (Markowetz 1998, S. 4) Die Befragung der InterviewpartnerInnen zeigt allerdings, dass im Bereich Freizeit sehr wohl noch Aufholbedarf besteht, um Menschen mit Behinderung eine individuelle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen machen deutlich, dass Selbstbestimmung im Bereich Freizeit einen zentralen Aspekt darstellt. Um selbstbestimmt leben zu können braucht es Freiraum, Zeit, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume. Einen idealen Rahmen dafür bietet der Freizeitbereich.
Gefragt nach den Grenzen der Selbstbestimmung weist Frau C darauf hin, dass kein Mensch gänzlich selbstbestimmt ist. (vgl. Kap. 2.2) Jeder muss sich an die Regeln des Zusammenlebens halten.
"Die Grenzen der Selbstbestimmung gibt es überall für jeden Menschen denke ich. Weil es einfach durch Gesellschaft durch Kultur vorgegeben wird wo die Selbstbestimmungsrechte aufhören. Gesetzliche Regelungen setzen schon mal Selbstbestimmungsgrenzen für jeden."
Somit geht Frau C davon aus, dass jeder Mensch mit Grenzen seiner Selbstbestimmungsmöglichkeiten konfrontiert wird, unabhängig von einer eventuell vorhandenen Behinderung. In diesem Zusammenhang geht Frühauf (1995) davon aus, dass die Lebenssituationen eines jeden Menschen immer von einem ‚mehr' oder ‚weniger' an Selbstbestimmungsmöglichkeiten geprägt sind. Es gibt keine Situationen, in denen ein generelles ‚Ja' oder ‚Nein', in Bezug auf Selbstbestimmung, zutrifft. (Frühauf 1995, S. 10)
Frau D werden die Grenzen der Selbstbestimmung durch gesetzliche Regelungen aufgezeigt. Um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen war sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da sie selbst nicht mehr Auto fahren kann. Zeitweise musste sie für die Strecke von ihrer Wohnung bis zum Arbeitsplatz mit vier Bussen fahren. Als sie sich jedoch um eine Ermäßigung für die Fahrkarten bemühte, wurde sie darauf verwiesen, dass dafür ein Invaliditätsgrad von 70% notwendig sei, sie hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings nur einen Invaliditätsgrad von 50%.
"Ich habe wirklich zwei Jahre bei der IVB (Innsbrucker Verkehrsbetriebe Anm. der Verf.) nachgefragt und habe einfach gesagt, es ist einfach ein Witz, dass ich keine Ermäßigung kriege. Ich fahre ja nicht freiwillig mit euch, sondern weil ich nicht mehr Auto fahren kann. Ich bin vom Sehen her drunter und kann auch nicht weit gehen. Es gibt aber diese öffentliche Klausel, dass erst ab 70% die Ermäßigung ist. Und ich war damals 50% eingestuft. Da hat man keine Chance. Ich habe gesagt, es muss doch irgendeine Ausnahmeregelung oder irgendetwas geben. Das gibt es aber nicht. Da gibt es eben wirklich diese klaren Vorgaben. Und das ist eben schwierig."
Durch die engen gesetzlichen Regelungen kann Frau D wesentliche Charakteristika für Selbstbestimmung (Wehmeyer 1992, S. 305) nicht verwirklichen, nämlich die Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände und durch eine Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen. (vgl. Kap. 2.2)
Im Gegensatz zu Frau C, Frau D und Frau E, welche die Ursachen für die Begrenzung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten vor allem in ihrer Umwelt sehen, geht Herr A davon aus, dass die Grenzen der Selbstbestimmung in erster Linie durch seinen körperlichen Zustand verursacht sind. Grenzen werden nicht von außen auferlegt, sondern sind bedingt durch seine Behinderung. Die Ursachen für Fremdbestimmung sieht Herr A ebenso in seinem körperlichen Zustand (vgl. Kap. 10.2.8).
"Natürlich in meinem Fall, der körperliche Zustand verhindert auch sehr viel Selbstbestimmung. Also da habe ich schon das Gefühl, dass meine Selbstbestimmung ganz stark reduziert ist."
Die Aussage von Herrn A weist auf eine Anpassung des Selbst an die Bewertung durch die Außenwelt hin. Durch diese Internalisierung der gesellschaftlichen Entwertungen, die Menschen mit Behinderungen immer wieder erfahren müssen, droht nach Goffman (1967) die "Beschädigung der Identität". (vgl. Kap. 4) Behinderte Menschen bekommen immer wieder vermittelt, dass sie "anders" sind und nicht in die Gesellschaft "Normaler" gehören, ob durch Starren und Kommentare (Brown 1990, S. 41), oder durch fehlenden Zugang zu Gebäuden und Verkehrsmitteln oder durch Barrieren in Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten.
Herr B hingegen gibt an, dass es in seinem Leben keine Grenzen der Selbstbestimmung gibt. Wenn er etwas möchte, dann bekommt er das auch. Auch wenn es manchmal besondere Wege oder einen hohen Organisationsaufwand erfordert.
"Was ich will, Kopf nach vor und gib ihm. Dann ermöglicht das eigentlich alles. Es gibt keine Grenzen, absolut nicht. Das ist immer Einstellungssache. (...) Ich kann auch 3000 Meter hoch gehen. Ich kann nicht hoch gehen, das ist klar, aber dann lass ich mich halt bringen. Aber ich bin oben. Ich kann nicht gehen, aber das muss man abhaken. Aber wenn ich irgendwo hin will, dann komme ich mit Sicherheit dort hin. Und wenn ich es plane und wenn es länger dauert, aber ich komme hin."
Die Aussage von Herrn B weist darauf hin, dass er die Behinderung als zu seiner Körperidentität zugehörig empfindet. Ereignisse, die mit der Behinderung zusammenhängen, können auf diesem Hintergrund erklärt und eingeordnet werden. Die Handhabbarkeit wird im Alltag gelebt, indem körperliche Grenzen akzeptiert und für Probleme Lösungen gefunden werden. Die Behinderung wird weniger als Belastung, sondern mehr als Herausforderung empfunden. Zudem lässt die Einschätzung von Herrn B auf ein zugrundeliegendes optimistisches Menschenbild schließen, wie es vom Empowerment-Ansatz vertreten wird (vgl. Kap. 3). Der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken liegt in einem unbedingten Vertrauen in Stärken und Potenziale eines jeden Menschen, Lebenssituationen in eigener Regie produktiv zu gestalten (Herriger 2006a, S. 72)
Sowohl Herr A als auch Herr B haben ihre Behinderung aufgrund eines Unfalls im Jugend- bzw. frühen Erwachsenenalter alter erworben. Es ist davon auszugehen, dass später erworbene oder auftretende Schädigungen zusätzliche und andere die Identität betreffende Aufgaben an die Menschen in der Bewältigung stellen: Erlernte, über einen langen Zeitraum ausgeführte Fähigkeiten gehen plötzlich verloren. (vgl. Schlüter 2010, S. 98)
Selbstbestimmung bedeutet, dass die AssistenznehmerInnen eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und für die daraus entstehenden Konsequenzen die Verantwortung tragen.
Alle InterviewpartnerInnen sind sich darüber einig, dass die Eigenverantwortlichkeit, die ein selbstbestimmtes Leben mit sich bringt, auch zur Last werden kann. Selbstbestimmung und Gestaltungsfreiheit können auch zur Gestaltungspflicht werden, das heißt, dass man verpflichtet ist, sein Leben selber zu gestalten. Eigenverantwortlichkeit kann anstrengend und ungewisser sein und schließt auch ein Risiko für Misserfolg mit ein.
Herr A hat vor sieben Jahren seine Partnerin verloren. Er hat nicht nur seine Lebenspartnerin verloren hat, sondern auch seine Freizeitpartnerin, Sexualpartnerin, Mitarbeiterin in seinem Beruf und durch die zusätzliche Berufstätigkeit seiner Partnerin auch wichtige Einnahmequelle, welche viel zum Lebensunterhalt beigetragen hat. Durch diesen Verlust musste er sein Leben vollständig neu organisieren. Der Aufwand, den die Aufrechterhaltung eines selbstbestimmten Lebens erfordert hat, war für Herrn A sehr hoch, seiner Meinung nach auch manchmal zu hoch.
"Wenn man in Lebensumstände kommt, die einfach einem halbwegs guten Leben entgegenstehen. Dann kann schon eine starke Überforderung aufkommen. (...) Und ja, das war natürlich anfänglich auch eine Belastung, das alles zu organisieren, weil ich bis dahin natürlich keine Erfahrung gewonnen habe. Dass man sich dann einfach sagt, im Prinzip könnte ich selbstbestimmt leben, aber ich muss eigentlich viel dafür tun. Auch manchmal zu viel. In meiner Situation ist es so, also ich muss das Haus erhalten, aber das ist natürlich meine freie Entscheidung."
Hahn (1981) geht davon aus, dass Freiheit notwendig ist, um durch das Erleben eigener Verantwortung die Konsequenzen eigener Entscheidungen und Handlungen als selbst verursacht wahrzunehmen. In dieser Übernahme von Verantwortung konstituiert sich nach Hahn ‚Sinn im menschlichen Leben'. (Hahn 1981, S. 132) Dabei verweist er darauf, dass der Erwerb von Verantwortlichkeit nur durch praktizierte Selbstbestimmung möglich ist. ( Hahn 1994, S. 85) Hahn relativiert sein Freiheitspostulat jedoch indem er es an ‚angemessene' Verantwortlichkeit bindet. Sie soll weder unter- noch überfordern.
Herr B empfindet es manchmal als Last, wenn er neues Personal einstellen muss. Besonders dann, wenn langjährige AssistentInnen den Dienst beenden. Dadurch verliert er nicht nur lieb gewonnene WeggefährtInnen, sondern Routinen im täglichen Ablauf müssen mühevoll wieder gefunden werden.
Frau C empfindet vor allem die Abhängigkeit von AssistentInnen und den Organisationsaufwand, der mit dem Modell der Persönlichen Assistenz verbunden ist, als Belastung. Das Angewiesen sein auf Unterstützung und das Wissen darum, dass man sich selbst darum kümmern muss, seine Assistenz zu organisieren, kann durchaus auch zu einer Belastungsprobe werden. Die Entscheidung für das Modell der Persönlichen Assistenz kann ein Zugewinn an Freiheiten bedeuten, bringt aber auch Unsicherheiten und das Tragen von Verantwortung mit sich. Die Assistenz kann selbst organisiert werden, sie muss es allerdings auch.
"Es ist auf jeden Fall eine Form der Belastung. Und zwar weil ich selber immer in einer Abhängigkeitssituation bei zum Beispiel der Assistenz. Wenn ich jetzt also komplett Selbstbestimmt mit Assistenz lebe, dann muss ich mir das selber organisieren. Das kann unter Umständen auch ein relativ hoher Organisationsaufwand sein, wo ich immer im Hinterkopf habe, dass wenn ich mir das jetzt nicht schaffe zu organisieren, dann stehe ich ohne Assistenz da. Es kann auf jeden Fall eine Belastung sein, sich selbst Assistenz organisieren zu dürfen oder zu müssen. Es ist halt immer so ein Pendel zwischen Freiheit, die man hat und Unsicherheit oder Verantwortung, die man selber aushalten muss.."
In Übereinstimmungen mit den Aussagen der InterviewpartnerInnen, geht Mohr (2004, S. 43) davon aus, dass selbstbestimmte Entscheidungen verantwortlich zu treffen und ihre Konsequenzen zu tragen, oft eine sehr schwierige, keineswegs angenehme Angelegenheit sein kann. Denn der Wunsch, selbstbestimmt leben zu wollen, beinhaltet auch, Risiken in Kauf zu nehmen und das Bekannte und Wohlvertraute mit dem Unbekannten und Ungewohnten zu vertauschen. Risiken in Kauf zu nehmen ist allerdings notwendig für Wachstum und Entwicklung eines Individuums.
Alle InterviewpartnerInnen schätzen ihren Selbstbestimmungsgrad sehr hoch ein. Dementsprechend geben nur zwei der InterviewpartnerInnen an, dass es auch Situationen gibt, in denen sie sich fremdbestimmt fühlen. Bei genauer Analyse und Betrachtung der Interviews wird allerdings deutlich, dass es sehr wohl Bereiche gibt, in denen sich die InterviewpartnerInnen eingeschränkt fühlen. Obwohl sie dies auf die Frage nach Fremdbestimmungsmomenten nicht explizit anführen. Theunissen & Plaute (1995) erkennen die Ursachen für Fremdbestimmung in dem fehlenden Vertrauen in die Ressourcen von Menschen mit Behinderung und einem defizitorientierten Menschenbild. (Theunissen & Plaute 1995, S. 56)
Herr A sieht sich vor allem durch seinen Körper fremdbestimmt. Sein körperlicher Zustand verhindert teilweise eine selbstbestimmte Lebensführung. Auffällig ist dabei, dass Herr A sowohl die Grenzen der Selbstbestimmung als auch die Ursachen für Fremdbestimmung bei sich selbst verortet. Mögliche Ursachen dafür werden in Kap. 10.2.6, Kap. 12.3 und Kap. 12.9 angeführt.
"Also die Fremdbestimmung passiert durch den Zustand des Körpers. Vielleicht auch ein Aspekt. Also nicht von außen, sondern eine innere Fremdbestimmung sozusagen."
Demgegenüber verortet Frau C Fremdbestimmungsmomente in ihrem Leben bei den zuständigen Ämtern, die über die Bewilligung des Antrags zur Verlängerung der Assistenz entscheiden. Sie fühlt sich abhängig von der Entscheidungsmacht der Behörden, denen sie sich machtlos gegenüber sieht.
"Ein Fremdbestimmungsmoment ist immer wieder für mich der stressige Moment, wenn ich den Verlängerungsantrag stelle. (...) Es ist dann so, dass man vom guten Willen von Sacharbeitern, Sozialarbeitern abhängt, ob man wieder die Stunden kriegt, die man braucht. Das gleiche gilt bei Erhöhungsanträgen, wenn man mal ein paar Stunden mehr braucht. Man ist ständig in dem Rechtfertigungsdruck seinen Standpunkt zu verteidigen "ich brauch die Stunden, gebt mir sie" und die sind dann in der Position, diese zu verteilen oder eben nicht. Und das ist jedes Mal eine Situation, da fühle ich mich äußerst unwohl, weil ich einfach in diesem Moment total abhängig bin von den Personen, die darüber bestimmen können."
Meines Erachtens lässt diese Aussage eine hohe Sensibilität für Selbstbestimmungsmöglichkeiten in ihrem Leben erkennen. Diese Äußerung, sowie die Betrachtung des gesamten Interviews von Frau C zeigt, dass sie sehr großen Wert auf Selbstbestimmung in ihrem Leben legt und auch bemüht ist, diese in den unterschiedlichsten Lebensbereichen umzusetzen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte ihre Berufstätigkeit bei einer Organisation mit dem Schwerpunkt Selbstbestimmung für Menschen mit einer Behinderung sein. Dadurch hat eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Selbstbestimmungs-Paradigma stattgefunden. Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit, sowohl AssistentInnen als auch AssistenznehmerInnen verstärkt die Möglichkeit zu geben, sich mit den vielfältigen Facetten des Selbstbestimmungsbegriffs auseinanderzusetzen.
Es ist davon auszugehen, dass ein überwiegendes Erleben von Fremdbestimmung es erschweren kann, Vertrauen in eigene Möglichkeiten zu gewinnen und ein positives Selbsterleben auszubilden. (Jennessen 2008, S. 215)
Nur zwei der Befragten geben an, auch Fremdbestimmungsmomente in ihrem Leben zu erfahren. Fremdbestimmung - als Gegenpol zur Selbstbestimmung - ist gegeben, wenn das Individuum auf eine Handlung keinen Einfluss hat und diese ausschließlich durch andere bestimmt ist. (Renner 2004, S. 203) Unter Berücksichtigung dieser Definition von Fremdbestimmung und der Betrachtung der Interviews ist aber anzunehmen, dass alle InterviewpartnerInnen auch Fremdbestimmungsmomente in ihrem Leben erfahren. Es ist möglich, dass Fremdbestimmung nicht als solche wahrgenommen wird, aufgrund von fehlenden Alternativen und Möglichkeiten auf das jeweilige Selbstbestimmungsrecht zu bestehen.
Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass Selbstbestimmung immer auch ein relativer Sachverhalt ist. Keinem Menschen auf der Welt, der in sozialen Strukturen eingebunden ist, ist es möglich hundertprozentig selbstbestimmt zu leben. (vgl. Kap. 2.2) Laut Frühauf wird die Selbstbestimmung "von Anteilen im Leben" bestimmt, "die durch das Individuum selbst oder durch die ihn beeinflussenden Mitmenschen gesteuert werden" (Frühauf 1995, S. 8)
Alle InterviewpartnerInnen sind sich darüber einig, dass durch das Modell der Persönlichen Assistenz mehr Selbstbestimmung und damit eine höhere Lebensqualität möglich ist. Lebensqualität wird als offenes Konzept verstanden, das objektive Bedingungen und subjektive Zufriedenheit integriert, unter Berücksichtigung persönlicher Werte und Ziele. (Seifert 2007, S. 205)
Ein mehr an Lebensqualität gewinnt Frau D dadurch, dass ihr durch das Abgeben von beschwerlichen Alltagspflichten mehr Kraft bleibt, die sie für sich selbst und ihre kleine Familie benötigt.
"Mir ging es damals noch um einiges besser aber ich habe jetzt zum Beispiel seit 2004 kein Auto mehr, hab dann eine Assistentin gehabt, die mir Einkäufe erledigt hat. Dadurch ist das Leben wieder viel leichter geworden. Und ich habe einfach wieder mehr Kraft für mich und meinen Sohn, weil ich sonst davor die Sachen alle habe alleine erledigen müssen. Es wird halt immer beschwerlicher. Dass ich eben einfach das Gefühl habe, dass Sachen doch noch machbar sind."
Die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse verwirklichen zu können, ist für Frau C eine zentrale Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität. Dies wird ihr durch Persönliche Assistenz ermöglicht. In Übereinstimmung mit den Aussagen von Frau C und Frau D geht Hahn (1994) davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen menschlichen Wohlbefinden und Selbstbestimmung besteht. Durch selbstbestimmte Entscheidungen können individuelle Bedürfnisse eher berücksichtigt werden. Selbstbestimmte Entscheidungen tragen zur Befriedigung von Bedürfnissen und damit zum Wohlbefinden bei. (Hahn 1994, S. 82f)
Alle InterviewpartnerInnen geben an, dass das Modell der Persönlichen Assistenz eine unabdingbare Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben darstellt.
"Auf jeden Fall ist mehr Selbstbestimmung möglich. Weil es wäre jetzt ohne diese Konstruktion (...) völlig unmöglich allein jetzt in meiner Wohnung, in meinem Haus zu leben. Wäre völlig unmöglich. Könnte also nicht stattfinden. Und damit würde natürlich auch mein Leben ganz stark eingeschränkt. Sie ist einfach notwendig, um so ein Leben führen zu können." (Herr A)
Alle InterviewpartnerInnen geben jedoch an, dass keinem der Befragten das Assistenzmodell bekannt war und alle von Dritten darauf hingewiesen wurden. Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit, den Bekanntheitsgrad des Assistenzmodells zu steigern, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass möglichst viele Betroffenen Zugang zu Persönlicher Assistenz haben. Denn ein wesentliches Element eines selbstbestimmten Lebens ist die Möglichkeit, aufgrund von Informationen, Beratung und vorhandenen Ressourcen selbst die Richtung des Lebens zu bestimmen.
Das Assistenzmodell erfordert von den AssistenznehmerInnen eine Reihe von Kompetenzen (vgl. Kap. 8.3), dies wird auch von den InterviewpartnerInnen so empfunden. Die Anforderungen werden von den InterviewpartnerInnen mit jenen eines Arbeitgebers verglichen. Indem die AssistenznehmerInnen als ArbeitgeberInnen der Assistenz auftreten, können sie mit einer anderen Selbstverständlichkeit als zuvor die Umsetzung der Unterstützungsleistungen bestimmen. Eine klare Rollenverteilung und Kompetenzklärung zwischen den AssistenznehmerInnen und ihren AssistentInnen wird dadurch deutlich erleichtert.
Eine weitere Anforderung, die das Assistenzmodell an die AssistenznehmerInnen stellt, wird von allen InterviewpartnerInnen genannt. Der hohe Organisationsaufwand, der das Koordinieren der AssistentInnen erfordert, kann für die Betroffenen zeitaufwendig und mühevoll sein. Die AssistenznehmerInnen können in der Regel auf keine vergleichbaren Erfahrungswerte zurückgreifen, wie die Organisation des täglichen Lebens mit Assistenz umgesetzt werden kann. Es bedarf eines Lernprozesses im Umgang mit Assistenz.
Für die InterviewpartnerInnen ist es nicht immer leicht, den hohen Organisationsaufwand zu meistern. Frau C gibt an, dass ihre Mutter, in ihrer Vorbildfunktion als berufstätige Mutter mit drei Kindern dazu beigetragen hat, den hohen Organisationsaufwand bewältigen zu können.
"Ich denke, ich habe meiner Mama zugeschaut, wie sie drei Kinder und einen Beruf unter einen Hut gekriegt hat und wie sie das organisiert hat und wenn man sich das als Rollenmodell ein bisschen vor Augen führt, dann kann man auch mit Assistenz leben. Ich denke, es ist relativ vergleichbar. Also wenn ich mir anschaue wie zum Beispiel eine Frau alleinerziehend mit Kind den Alltag managet, dann denke ich, dass es organisatorisch ziemlich der gleiche Aufwand ist, wie mit der Assistenz zu leben."
Zudem wird neben Empathie noch Lernbereitschaft als Anforderung an die AssistenznehmerInnen genannt. Es erfordert die Fähigkeit, sich in die Lage des anderen hineinversetzen zu können und mit ihm mitzufühlen, sich darüber klar werden, was der andere fühlt, sowie die eigenen Gefühle zu erkennen und angemessen zu reagieren. Das Assistenzmodell erfordert die Fähigkeit, sich immer wieder neu auf AssistentInnen einlassen zu können.
Diese Aussagen machen deutlich, dass das Assistenzmodell nicht nur ein Zugewinn an Freiheiten bedeutet, sondern an die AssistenznehmerInnen auch Anforderungen stellt, die es in der täglichen Auseinandersetzung mit Assistenz zu meistern gilt. Die Betrachtung der Interviews verdeutlicht aber auch, dass durch die zunehmende Erfahrung in ihrer Funktion als ArbeitgeberIn die InterviewpartnerInnen stetig an Sicherheit in ihren Kompetenzen als AssistenznehmerInnen gewinnen.
Die von den InterviewpartnerInnen und in der Literatur genannten Anforderungen und Kompetenzen (vgl. Kap. 8.3) zeigen allerdings auch die Grenzen des Assistenzmodells auf. Dieses Modell stößt bei vielen Menschen mit Lernschwierigkeiten auf "unüberwindliche Schwierigkeiten" (Speck 2001, S. 34).
Um auch Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu Persönlicher Assistenz zu erleichtern, erweitern Selbstvertretungsgruppen in der "People first" - Bewegung das Modell hin zu einem Unterstützungskonzept. Unterstützung geht in dieser Konzeption über die Aufgaben der Persönlichen Assistenz hinaus. Menschen, die Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, verfügen über eine Anleitungskompetenz, d.h., sie bestimmen, wie die konkrete Hilfeleistung, die sie brauchen, aussehen muss. In Abgrenzung dazu beschreiben Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht unbedingt bis ins Detail, welche konkrete Hilfeleistung sie gerade brauchen, sondern nennen sehr oft die Dinge, die sie nicht oder nicht so gut können. Daran erkennt die Unterstützungsperson den Hilfebedarf. (Göbel & Puschke, o.J.)
Dabei werden zwei Formen der Unterstützung unterschieden: Praktische Unterstützung (ähnlicher der Assistenz) und inhaltliche Unterstützung. Bei der inhaltlichen Unterstützung hat die Unterstützungsperson eine aktivere Rolle. Hier geht es darum, sein gesamtes Wissen zur Verfügung zu stellen (z.B. Informationsquelle sein, Ideen und Ratschläge geben, komplexe Abläufe strukturieren). (Göbel & Puschke, o. J.)
Die Persönlichen AssistentInnen erhalten Einblicke in sehr persönliche und intime Bereiche des Lebens der AssistenznehmerInnen. Der Umgang der InterviewpartnerInnen mit dieser Intimität variiert. Alle geben jedoch an, dass langjährige und vertrauensvolle Beziehungen zu den AssistentInnen es erleichtern, Einblicke in Privates zu gewähren.
"Weil das Verhältnis auf jeden Fall enger ist als ein normales Arbeitsverhältnis. Allein schon durch die Körperpflege, Freizeit. Es ist wicht, dass man seine Verantwortung, dass man eine gute Balance findet." (Herr A)
Diese Aussage macht deutlich, dass die besondere Beziehung zwischen AssistentInnen aus AssistenznehmerInnen eine stetige Balance von Vertrautheit und Vertraulichkeit auf der einen Seite und klaren Grenzziehungen auf der anderen Seite erfordert. Das verlangt von beiden Seiten Sensibilität, Empathiefähigkeit und Diskretion, aber auch eine sehr klare Definition der jeweiligen Rollen.
Diese Einblicke in private Bereiche des Lebens sind allerdings nicht nur einseitig. Die InterviewpartnerInnen geben an, dass es auch immer wieder zu Situationen kommt, in denen sie mit privaten und intimen Informationen der AssistentInnen konfrontiert werden.
"(...) Man erhält Einblicke in das Private, aber ich von der anderen Seite genauso. Dann quatscht man alles ein bisschen aus. Dann muss ich meistens die Assistenten trösten, wenn etwas ist." (Herr B)
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen zeigen die Reziprozität der Beziehung zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen. Durch Gegenseitigkeit entsteht eine Beziehung und Vertrauen. Die Einblicke in private Bereiche der AssistentInnen werden von einer Interviewpartnerin aber durchaus auch ambivalent erlebt. Frau C versucht dies deshalb zu vermeiden, wenn es möglich ist.
"Und wenn ich jetzt sehr persönliche Dinge vom Assistenten mitbekomme, dann finde ich es auch nicht unbedingt so angenehm. Das ist jetzt zwar eher selten, weil man das auch schon steuern kann aber ich denke es ist nicht unbedingt so etwas was ich anstrebe. Da pass ich schon ein bisschen auf. Ich werde auch zunehmend vorsichtiger was das betrifft. Je jünger ich war, umso mehr egal war mir das. Je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich."
Frau D gibt an, damit Schwierigkeiten zu haben, dass AssistentInnen viel Privates miterleben. Sie musste anerkennen, dass es ihr in bestimmten Situationen nicht mehr möglich ist, alleine zu sein, obwohl sie es gerne wäre. Frau D braucht derzeit noch keine Unterstützung bei der Körperpflege. Da sie aber an einer Krankheit mit progressivem Verlauf leidet, kann es in Zukunft durchaus dazu kommen, dass sie auch in diesem Bereich einen Bedarf an Hilfe entwickelt. Sie äußert, dass sie im Fall eines Unterstützungsbedarfs bei der Körperpflege, wahrscheinlich Schwierigkeiten damit haben würde.
"Das ist etwas, was mir schon schwer fällt. Bei mir ist es jetzt nicht so extrem. Aber ich bin jemand, der so gerne ich auch sonst mit Leuten zusammen bin, auch gerne alleine bin. Und wo ich dann schon manchmal denke, es ist mir gar nicht mehr möglich bei gewissen Dingen allein zu sein. Manchmal fällt es mir schon schwer. Ich habe schon oft überlegt, wie ich das händeln würde, wenn ich auch jemanden zum Baden und zur Körperpflege brauche. Über das habe ich dann aber nicht weiter nachgedacht. Das ist sicher etwas, wo ich Probleme haben werde."
Diese Aussage zeigt, dass in der Körperpflege ein besonders sensibler Umgang miteinander wichtig ist, denn für die AssistenznehmerInnen stellt die Tatsache, in diesem Bereich auf Hilfe angewiesen zu sein einen großen Eingriff in ihre Intimsphäre dar. Sowohl die AssistentInnen als auch die AssistenznehmerInnen begeben sich dabei auf Pfade, die normalerweise in unserer Gesellschaft tabu sind, denn intime Lebensbereiche spielen meist nur in partnerschaftlichen Beziehungen eine Rolle. In der Persönlichen Assistenz gehören Themen wie Nacktheit und Körperlichkeit jedoch meist zum Arbeitsbereich dazu. (vgl. Kap. 8.4) Für Menschen, die in der Körperpflege auf die Hilfe anderer angewiesen sind, besteht eine existenzielle Abhängigkeit. Das negative Erleben dieser Abhängigkeit kann starke Scham- oder sogar Schuldgefühle auslösen. (Klie 2004, S. 379f)
Aufgrund der Schwierigkeiten von Frau D mit der Tatsache, dass AssistentInnen Einblicke in Privates und Intimes erhalten, trennt Frau D Assistenzleistungen strikt von Putztätigkeiten in ihrer Wohnung. Durch das Putzen der Wohnung, so die Interviewpartnerin, würden die AssistentInnen sehr viel Privates mitkriegen und das möchte Frau D vermeiden.
"Es ist ja schon teilweise so, wenn die Assistenten mit in der Wohnung sind. Ist ja auch das schon irgendwo sehr persönlich. Für mich war zum Beispiel klar, dass das Putzen nicht eine Assistentin macht, dafür habe ich eine Putzfrau. Mir hätte eine Assistentin das angeboten. Und ich habe dann gesagt, das Putzen von einer Wohnung ist für mich einfach etwas Intimes und ich mag einfach nicht, dass das jemand macht, der für mich fährt meine Wohnung putzt. Und sie hat das dann überhaupt nicht verstehen können. Das ist für mich etwas, da kriegt jemand schon sehr viel Einblick."
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen machen deutlich, dass eine geschützte Privatsphäre, einen unbeobachteten Rückzugsraum zu haben für jeden Menschen von zentraler Bedeutung ist.
Dederich (2003) konstatiert, dass Menschsein immer auch ein gewisses Maß an Abhängigkeit impliziert. Dabei unterscheidet er zwei Dimensionen von Abhängigkeit:
-
Gesellschaftlich oder sozial hergestellte Abhängigkeit
-
Abhängigkeit, die zur conditio humana gehört
Wegen seiner biologischen Unbestimmtheit und seiner leiblichen und psychischen Verletzbarkeit ist der einzelne Mensch ebenso auf andere Menschen wie auf ein Lebensumfeld angewiesen, das ein physisches und psychisches Überleben und wenigstens ein Minimum an innerer und äußerer Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleistet. Dieser Typ von Abhängigkeit zeigt sich am deutlichsten in Zeiten entwicklungsbedingter Abhängigkeit, etwa in der Kindheit oder im hohen Alter, aber auch im Krankheitsfalle oder bei schweren Behinderungen, durch die wir auf andere Menschen angewiesen sind; darauf, nicht verletzt und nicht alleine gelassen zu werden. Darauf, dass unsere leibliche, psychische und soziale Integrität geschützt und gewahrt wird. (Dederich 2003, S. 2f)
Alle InterviewpartnerInnen geben an, zumindest zeitweise auch Abhängigkeiten von ihren AssistentInnen zu empfinden. Herr A betont dabei, dass diese Abhängigkeiten aber nicht nur einseitig sind, sondern auf beiden Seiten bestehen. Es sind lediglich verschiedene Ebenen der Abhängigkeit. Die Anweisungen an die AssistentInnen werden meist in Form einer Bitte geäußert und dieses Bitten müssen, erzeugt bei Herrn A ein Gefühl von Abhängigkeit.
"Die Abhängigkeit ist immer gegenseitig. Ich mein, natürlich fühle ich mich abhängig. Wenn ich in der frühe aufstehe und Hilfe brauche, was das Waschen betrifft, das ist einfach schon eine Abhängigkeit. (...)Du fragst ja sozusagen, das ist auch immer mit einer Bitte verbunden. Und dieses ständige Bitten schafft natürlich auch ein gewisses Gefühl der Abhängigkeit. (...) Natürlich ist sie beidseitig, weil die Assistentinnen denken sich natürlich, wenn ich das jetzt nicht mache, sonst bin ich meinen Job los. Also die Abhängigkeit ist gegenseitig. Aber sie hat halt andere Formen."
Hahn (1994) geht davon aus, dass der Mensch zusätzlich zur Selbstbestimmung auch Abhängigkeitsverhältnisse benötigt, die ein gewisses Maß an Fremdbestimmung in sein Leben bringen. Der Mensch bejaht diese Abhängigkeit aber nur, weil sie seiner Bedürfnisbefriedigung dient. Überschreitet sie das bedürfnisbefriedigende Maß, bekämpft er sie, weil sie seine Selbstbestimmungsmöglichkeiten beschneidet und Wohlbefinden verhindert. (Hahn 1994, S. 85)
Herr B empfindet Abhängigkeit vor allem bei langjährigen AssistentInnen. Durch die Dauer der Beziehung entsteht Vertrautheit und Routinetätigkeiten können mühelos durchgeführt werden. Durch den Weggang von langjährigen AssistentInnen müssen alltägliche Arbeitsabläufe beschwerlich wieder erarbeitet werden.
"Bei Assistenten, die schon lange bei mir sind. Und es entwickelt sich eine totale private Harmonie, wenn die dann wieder gehen. Das heißt nach 5 - 6 Jahren. Wenn dann eine neue kommt. Bis das dann wieder halbwegs läuft. Da denkt man dann zurück, wie gemütlich das mit der anderen war. Das braucht dann halt seine Zeit, bis das Neue dann wieder läuft."
Durch den Verlust von langjährigen Beziehungen gerät die Balance von Herrn B zwischen Unabhängigkeit und bedürfnisbezogener Abhängigkeit aus dem Gleichgewicht (vgl. Hahn 1994). Dabei geht Hahn (1994, S. 86) davon aus, dass die Zustände menschlichen Wohlbefindens auf einem Ausgewogensein gründen - im Sinne einer oszillierenden Balance - zwischen größtmöglicher verantwortbarer Unabhängigkeit und bedürfnisbezogener Abhängigkeit (vgl. Kap. 4).
Frau C hingegen gibt an, Abhängigkeit besonders dann zu verspüren, wenn AssistentInnen krankheitsbedingt ausfallen und sie Ersatz für die ausgefallenen Stunden suchen muss. Hahn (1981) geht davon aus, dass sich Behinderung in einem ‚Mehr' an sozialer Abhängigkeit in der Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung manifestiert. Abhängigkeiten konkretisieren sich in den realen Lebenswirklichkeiten der Menschen (Nahrung, Hygiene, Kommunikation, Mobilität aber auch Sexualität).
"Abhängigkeiten bestehen immer. Also wenn ich gerade einen spontanen Anruf kriege, von einem auf den anderen Tag, dass meine Assistentin krank ist, dann ist das ganz klar, dass ich in einem Abhängigkeitsverhältnis bin. Weil wenn ich jetzt jemanden brauche und der kommt nicht, dann stehe ich vor der Drucksituation jetzt schnell einen Ersatz finden zu müssen. Dann bin ich auch wieder in der Abhängigkeit von den anderen Assistenten, ob die jetzt wieder einspringen können oder nicht. Also das ist mir völlig klar. Und das gibt es auch immer wieder."
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen machen deutlich, dass das Assistenzverhältnis potenziell wechselseitige Abhängigkeiten enthält: Einerseits haben die AssistenznehmerInnen gegenüber den Assistenzkräften eine gewisse Sanktionsmacht, die bis zur Kündigung gehen kann. Andererseits können sie von den AssistentInnen insofern abhängig sein, als sie im Konfliktfall unmittelbar keine Alternativen haben. (Zander 2008, S. 48f)
Allen InterviewpartnerInnen ist es wichtig, nicht von der Hilfe und Unterstützung ihres näheren Bezugssystems abhängig zu sein. Ihr Unterstützungsbedarf soll von AssistentInnen gedeckt werden, um unabhängiger zu sein und die Beziehungen zu Familie und Freunden zu entlasten. Dies ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb sich die InterviewpartnerInnen für das Assistenzmodell entschieden haben.
Um Abhängigkeiten von seiner Familie zu verhindern, hat Herr B sogar einen zweijährigen Heimaufenthalt in Kauf genommen, bis er sich dazu entschlossen hat, ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung zu führen.
"Ich hatte keine behindertengerechte Wohnung und dann bin ich eben ins Heim gekommen. Familiär wollte ich nie, obwohl wir eigentlich genug Häuser haben, genug Schwestern. Aber ich wollte immer selbständig sein und nie abhängig von Familie oder etwas anderem. Obwohl leider Gottes war die Zwischenstation in dem Heim. Und da war ich 2 Jahre drinnen. Und von da weg habe ich gesagt, ich brauche eine Wohnung." (Herr B)
Herr B bewahrt sich ein Stück Selbständigkeit dadurch, dass sein Unterstützungsbedarf ausschließlich von AssistentInnen gedeckt wird. Obwohl seine Partnerin gerne dazu bereit wäre, ihn in seinen alltäglichen Abläufen zu unterstützen, möchte er Privates von den Assistenztätigkeiten trennen. Diese Trennung ist Herrn B auch deshalb wichtig, um ein Gefühl von Dankbarkeit, welches durch erbrachte Hilfeleistungen vielleicht erwartet werden könnte, zu umgehen.
"Ich will das nicht einbinden in die Beziehung, ich will das ein bisschen trennen. Das heißt nicht, dass sie das nicht möchte, aber ich möchte das trennen. Dass nicht alles zusammen kommt, weil sie geht ja auch arbeiten. Das ist eben für mich auch eine Form von Selbständigkeit. Nicht von einer Person abhängig zu sein. Das man das ein bisschen aufteilt. Dass man das private eben trennt."
Die Haltung von Herrn B lässt auf einen reflektierten Umgang mit Abhängigkeiten und Selbstbestimmung schließen. Er berücksichtigt, dass die Entwicklung bzw. Erhaltung einer partnerschaftlichen Beziehung erschwert sein kann, wenn ein/e PartnerIn existenziell davon abhängig ist, dass der/die andere bestimmte Dienstleistungen für ihn/sie übernimmt. In dieser Weise abhängig zu sein, kann auf der Seite des/der Behinderten eine Tendenz zur Überanpassung fördern, zur verstärkten Unselbständigkeit und zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Auf der Seite des/der nichtbehinderten Partners/in kann sie eine erhebliche physische und psychische Belastung zur Folge haben. Die Tendenz, den/die behinderte/n PartnerIn abhängig und unselbständig zu machen und ihn/sie andererseits wegen seiner/ihrer Unselbständigkeit unter Druck zu setzen, ist eines der problematischen Verhaltensmuster, die sich infolge dieser Dauerbelastung entwickeln können. (vgl. Rülcker 1990, S. 24)
Für Frau C bedeutet es ein Zugewinn an Qualität der Beziehungen zu Freunden und Familie, dadurch dass ihr Unterstützungsbedarf von AssistentInnen gedeckt wird.
"Weil das für mich eine Unabhängigkeit von meinem näheren Bezugssystem darstellt. Ich bin jetzt nicht mehr von meiner Familie und meinen Freunden abhängig und das gibt den ganzen Beziehungen einfach eine viel höhere Qualität."
Frau C hebt die besondere Bedeutung ihrer Geschwister in diesem Zusammenhang hervor. Durch die Assistenz können sie zumindest teilweise von ihrem Gefühl der Verantwortung für Frau C entlastet werden. Das Wissen darum, dass sie ihr Leben eigenständig meistern kann, verringert Abhängigkeitsgefühle auf beiden Seiten.
"Auch was meine Geschwister betrifft bin ich sehr dankbar darum, weil ich denke, dass gerade für Geschwister oft ein behindertes Geschwisterchen bedeuten kann, dass sie eben für die Zukunftsplanung immer so ein Anhängsel haben, um das sie sich kümmern müssen. Dass sie genau wissen, dass ich für den ganzen lästigen Alltagskram niemanden brauche. (...) Ich glaube das Rücksicht nehmen ist da ein wichtiger Punkt. Der für meine Familie und meine Freunde eine positive Geschichte ist und für mich ist es im Prinzip befreiend. Weil ich jetzt meine Beziehungen gleich gestalten kann wie jeder andere, der halt keine Behinderung hat."
Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit vom näheren Bezugssystem scheint berechtigt zu sein. Wenn assistenzabhängige Menschen von ihren Familien bei der für sie lebensnotwendigen Pflege und Assistenz unterstützt werden, können daraus sowohl für die Familien als auch für die betroffenen Menschen mit Behinderungen vielfach schwierige Lebenssituationen mit oft problematischen Abhängigkeitsverhältnissen entstehen. (ISL 2001, im Internet) Die Familienangehörigen, welche die Assistenz leisten sind großen Belastungen ausgesetzt, da sie oft neben ihrer beruflichen Tätigkeit und / oder der Versorgung der Familie die Assistenz zusätzlich erbringen. Dies verlangt von ihnen enorme körperliche Leistungen, die besonders bei hohem Assistenzbedarf kaum ohne Schaden an der eigenen Person auf Dauer erbracht werden können.
Aber auch für die assistenzabhängigen Menschen mit Behinderungen ist diese Situation nicht ohne Belastung. So sind sie häufig den Sachzwängen der Familienabläufe, die für die assistierenden Familienmitglieder notwendig sind, unterworfen und werden somit fremdbestimmt und können nicht selbstbestimmt ihr Leben gestalten. (ebd.)
Eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für das Assistenzmodell spielen für die InterviewpartnerInnen Zielsetzungen, die sich auf die Familie bzw. das familiäre Umfeld beziehen. Wichtig dabei sind die Entlastung von Familienangehörigen und zugleich die eigene Unabhängigkeit vom familiären Unterstützungssystem. Die Äußerungen der InterviewpartnerInnen zeigen, dass eine Steigerung der Unabhängigkeit von familiärer Unterstützung und die Entlastung der Familie durch das Assistenzmodell auch weitestgehend verwirklicht werden können.
Der häufige Personalwechsel, mit der damit verbundenen Mühe bei der Personalsuche, wird von Herrn B als Nachteil des Assistenzmodells empfunden. Eine hohe Fluktuation verhindert es vertrauensvolle Beziehungen auf einer kooperativen Basis zu entwickeln.
"Wie es momentan auch wieder ist. Momentan muss ich wieder Personal suchen, weil leider wieder eine weg geht, die länger bei mir war. Dann hast du wieder viele Vorstellungsgespräche. Bis das alles wieder halbwegs seinen Lauf nimmt, das ist dann oft mühsam. Da fragt man sich dann schon, wann läuft wieder alles halbwegs normal? Das kann ab und zu schon drücken."
Diese Aussage macht deutlich, dass eine gewisse Kontinuität der Assistenz als Entlastung erlebt wird. Durch eine regelmäßige Zusammenarbeit entsteht Vertrauen und die ständige Anleitung entfällt nach einiger Zeit. Als eingespieltes Team kann eine zuverlässige Basis entstehen.
Frau C und Frau D erkennen den hohen Organisationsaufwand, den das Assistenzmodell erfordert, als Nachteil. Wenn die Möglichkeit fehlt, die Organisation abzugeben, kann dies zu Überforderungen der AssistenznehmerInnen führen.
Weitere Probleme bestehen für Frau C darin, dass Beziehungen zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen auch konfliktreich sein können. Frau C gibt zu bedenken, dass die AssistenznehmerInnen in diesen Situationen auf sich alleine gestellt sind. Sie müssen diese Probleme selbständig bewältigen und können nicht auf geeignete unparteiische und kompetente Unterstützungspersonen zurückgreifen.
"Was die Assistenten betrifft kann die Assistenz Nachteile haben weil wenn jetzt jemand in einem schwierigen Assistenzverhältnis ist und selber sehr unerfahren oder jung dann ist er halt auf sich alleine gestellt ohne einem direkten Kontakt mit anderen, ohne ein Team. Und nicht wie jetzt zum Beispiel in einer Einrichtung. Da entwickeln sich dann Dynamiken, die dann meistens auf Kosten des zu Unterstützenden gehen."
Vertrauen. Herr A hat einen besonders schweren Missbrauch seines Vertrauens erlebt, er wurde von eine/r/m seiner AssistentInnen bestohlen. Ein Nachteil für Herrn A ist es demnach, dass AssistentInnen, die angeworben werden, auch das entgegengebrachte Vertrauen und die Abhängigkeit der AssistenznehmerInnen ausnutzen können.
"Es ist zum einen schwierig, in andere hinein zu schauen und für mich schwierig und auch für den Selbstbestimmt-Leben-Verein schwierig. Sie wissen ja auch nicht, wen Sie da weiterempfehlen im Prinzip. (...) Da habe ich schon negative Erfahrungen gemacht. (...) Weil ich ja auch nicht genau weiß, wer es war. Und damit sozusagen, würde man das Verhältnis zu den anderen Assistentinnen trüben. Weil das entwickelt dann ganz eigene Dynamiken. Es ist mir schon einmal etwas gestohlen worden und ich habe das unter den Assistentinnen abgehandelt. Ein bestimmter Beigeschmack bleibt doch. Aber ich werde das nicht weiter verfolgen. Diese Nachteile hat man dann natürlich in Kauf zu nehmen. Nachdem das halt doch eine enge Arbeitsbeziehung ist, ist halt ein gewisses Risiko."
Diese Erfahrung zeigt die Verletzlichkeit der Beziehung zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen, denn sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Dieser Vorfall verdeutlicht die Dringlichkeit der Forderung, dass das Vertrauensverhältnis zwischen AuftraggeberIn und AssistentIn in keiner Weise zu missbrauchen ist.
Ein derartiger Missbrauch des Vertrauens dürfte allerdings eher die Ausnahme darstellen und würde in der Regel wahrscheinlich auch zur Beendigung des Dienstverhältnisses führen. Herr A hat in diesem Fall davon abgesehen, aufgrund der Einmaligkeit des Vorfalls und weil er nicht feststellen konnte, wer der/die TäterIn war.
Trotz der genannten Nachteile und Schwierigkeiten sind sich alle InterviewpartnerInnen einig, dass die Vorteile beim Assistenzmodell überwiegen.
"Aber meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile beim Assistenzmodell. Assistenz ist im Moment das non plus Ultra für Menschen mit Unterstützungsbedarf." (Frau A)
Diese Aussage wird durch Umfragen und Studien bestätigt. Die Zufriedenheit der behinderten Menschen, die beim Assistenzmodell ja auch selbst die beste Kontrolle und Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung der Unterstützungsleistungen haben, ist im Verhältnis zu anderen Alternativen wesentlich größer. (vgl. Drolshagen 2001, 34)
Inhaltsverzeichnis
Was bedeutet Selbstbestimmung für die AssistenznehmerInnen allgemein und im Besonderen für Menschen mit Behinderung? Welchen Stellenwert hat Selbstbestimmung im Leben der AssistenznehmerInnen?
Selbstbestimmung bedeutet für die InterviewpartnerInnen in erster Linie, so leben zu können wie sie es möchten. Wichtig dabei ist, dass Entscheidungen, die das eigene Leben und die Lebensführung betreffen, selbst getroffen werden. Diese Entscheidungen betreffen ganz alltägliche Dinge, beispielsweise wann der Betroffene Mittagessen möchte, wie ebenso die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit ausleben zu können. Dies entspricht dem von Wehmeyer (1992, S. 305) angesprochenem Charakteristikum einer selbstbestimmten Lebensführung, nämlich freie und autonome Entscheidungen treffen zu können. (vgl. Kap. 2.2)
"Selbstbestimmung ist im Prinzip für mich die grundsätzliche Möglichkeit seine eigene Persönlichkeit auszuleben. Das bedeutet, dass man die Dinge, die einem wichtig sind im Leben, so umsetzen kann, wie das für einen selber wichtig ist. Ob das jetzt die Wahl ist, wie ich mir meine Haare zusammenbinde oder was ich zum Mittag essen will, wann ich entscheiden kann, was ich zum Mittagessen haben will, ob das eine Woche vorher sein muss oder erst 5 Minuten bevor ich im Supermarkt steh. Das sind alles Sachen die für mich grundsätzlich Selbstbestimmung bedeuten, die einen ganz großen Anteil dessen ausmachen, wie sich eine Persönlichkeit entwickelt. (Frau C)
Frau C führt an, dass Selbstbestimmung für sie auch bedeutet, ihre Persönlichkeit ausleben zu können. Hahn (1994) geht davon aus, dass die Entwicklung individueller Identität von Selbstbestimmung abhängig ist (vgl. Kap. 4). Ohne dass eine Person selbst entscheidet, kann sie weder die eigenen Möglichkeiten und Grenzen, noch ihre Bedürfnisse kennen lernen und sie ist in Gefahr, Fremddefinitionen ihres eigenen Selbst zu übernehmen (Hahn 1994, S. 86)
Selbstbestimmung wird von den InterviewpartnerInnen als Grundrecht ausgewiesen, welches für alle in gleichem Maße gelten muss. Diese Aussage entspricht den Angaben in der Literatur (vgl. Kap. 2.2)
"Es ist eine Grundfreiheit im Prinzip, die jedem zuerkannt werden muss." (Frau C)
Für Menschen mit Behinderung im Besonderen bedeutet Selbstbestimmung vor allem auch die Möglichkeit, den Unterstützungsbedarf durch Persönliche AssistentInnen decken zu können. In diesem Zusammenhang betont Steiner (2001 S. 31), dass Persönliche Assistenz die einzige Methode ist, die es ermöglicht, fremdbestimmender Fachlichkeit von HelferInnen und den Sachzwängen von Institutionen zu entgehen.
"Für mich ist es durch die MS (Multiple Sklerose, Anm. der Verf.) seit 2008, seit dem bin ich in der chronisch progredienten Versorgung, seit dem bin ich einfach ein Abhängiger weil einfach viele Sachen, die ich früher selber machen hab können, nicht mehr machen kann und von dem her bedeutet Selbstbestimmung für mich Persönliche Assistenz, dass ich trotzdem mein Leben noch so gestalten kann, wie ich will." (Frau D)
Wichtig dabei ist, Wahlmöglichkeiten zu haben, welche AssistentInnen eingestellt werden und wie die Unterstützung umgesetzt wird. Eine zentrale Bedeutung dabei hat die Ausrichtung der bedarfsorientierten Unterstützung. Richtig verstandenes Helfen bedeutet assistieren: "Wir assistieren demjenigen, der unsere Hilfe benötigt, bei der Verwirklichung seiner Ziele" (Hahn 1994, S. 91) Ansonsten besteht nach Hahn die Gefahr, dass gutgemeinte Hilfe zu Überversorgung und damit zu Fremdbestimmung des Menschen mit Behinderung verkommt.
"Im Besonderen würde ich sagen bedeutet es eben, dass man seine Pflege und Betreuung, Assistenz frei wählen kann. Dass man frei entscheiden kann wo und wie man betreut werden will und die Assistenz in Anspruch nehmen kann." (Herr A)
Demnach sehen die InterviewpartnerInnen Selbstbestimmung realisiert, wenn die von Wehmeyer (1992, S. 305) angesprochenen Charakteristika (vgl. Kap. 2.2) erfüllt sind, nämlich freie, autonome Entscheidungen treffen zu können, die Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände und durch eine Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen und auf eine "selbstrealisierende" Art.
Der Wunsch nach Selbstbestimmung ist für Frau C angeboren und muss nicht erst erworben werden. Damit erkennt die Interviewpartnerin, dass die Möglichkeit zur Selbstbestimmung mit dem Leben an sich gegeben ist, was durch keine Form der Behinderung, so schwer sie auch ist, negiert werden kann (vgl. Kap. 7). Selbstbestimmung wird dabei nicht als etwas Statisches gesehen, sondern ist im ständigen Wandel begriffen. Selbstbestimmung wird als Entwicklungsprozess betrachtet, der das ganze Leben anhält.
"Ich denke, der Wunsch nach Selbstbestimmung ist angeboren. Also ich denke, dass man da jetzt nicht wirklich sagen kann wann der entstanden ist. Ich glaube der Selbstbestimmungswunsch ist von Geburt an da. Die Frage ist, wann man sich dessen bewusst wird. Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass das in unterschiedlichen Lebensabschnitten eine unterschiedliche Bedeutung für mich bekommen hat und einen unterschiedlichen Bewusstseinsgrad und ich denke, der wird sich auch in den nächsten Lebensjahrzehnten bei mir auch noch wandeln und ändern." (Frau C)
Der Kern des Selbstbestimmungsgedanken lasst sich nach Waldschmidt in dem Wunsch ausmachen, "so leben zu wollen, wie alle anderen" (1999, S. 42) (vgl. Kap. 2.2). Dies wird auch immer wieder in den Interviews deutlich.
"Wenn ich das gleiche was du tust, auch machen kann." (Herr B)
Selbstbestimmung bedeutet für die InterviewpartnerInnen, dass Menschen mit Behinderungen gleiche Rechte und Entscheidungsfreiheit genießen und dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, über jeden Aspekt ihres Lebens selbst zu entscheiden.
"Das Leben mit den Assistenten hat schon den Vorteil, dass man einfach das Gefühl hat, man kann doch noch alles. Obwohl man es eigentlich nicht kann. Aber man kann die Sachen, die einfach nicht mehr gehen, einfach delegieren." (Frau D)
Diese Aussage zeigt, dass das Konzept des Selbstbestimmten Lebens Menschen mit Behinderungen in ihrem Streben unterstützt, Gleichberechtigung und umfassende Teilhabe an der Gemeinschaft zu verwirklichen. Für viele Menschen mit einer Behinderung ist Persönliche Assistenz der erste Schritt zu einem selbstbestimmten Leben und ein Weg aus der Betreuungs- und Pflegesituation. Dabei ist Persönliche Assistenz die Grundvoraussetzung für Chancengleichheit und Selbstbestimmung.
Welche Voraussetzungen müssen Persönliche AssistentInnen mitbringen? Welche Kriterien machen eine/n gute/n Persönliche/n AssistentIn aus?
Alle InterviewpartnerInnen nennen Flexibilität und Zuverlässigkeit als wichtige Voraussetzungen, die Persönliche AssistentInnen mitbringen müssen. Drei der InterviewpartnerInnen zählen Kommunikationsfähigkeit zu den Bedingungen, die Persönliche AssistentInnen erfüllen sollen. Weitere Kriterien, die eine/n gute/n Persönliche/n AssistentIn ausmachen, fallen unterschiedlich aus.
Herr A nennt neben Persönlichkeitseigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Loyalität und Verständnis, auch das Erspüren und Eingehen können auf die jeweiligen Bedürfnisse des anderen als wichtige Voraussetzungen.
"Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft, Loyalität, Verständnis, gegenseitiges Verständnis, nicht zu stark ausgeprägten Egoismus, Flexibilität. Dass man beidseitig gut aufeinander eingehen kann. Das heißt auch, dass man auch spürt, wie die Bedürfnisse des anderen sind. Und es ist auch ganz gut, wenn man überwiegend guter Laune ist."
Gefragt nach den Voraussetzungen, die Persönliche AssistentInnen mitbringen sollen, verwendet Frau C eine Bezeichnung, die in den Interviews immer wieder aufgetaucht ist:
"der/die Persönliche Assistent/in ist der verlängerte Arm von mir"
Diese Aussage kann übersetzt werden mit Adolf Ratzka "Assistenz ersetzt uns Arme und Beine. Nicht mehr und nicht weniger." (1988, S.187) Das heißt, dass die Funktion und die Rolle der AssistentInnen insofern klar und eindeutig definiert ist, als dass sie quasi instrumentell die fehlenden bzw. die beeinträchtigten körperlichen Funktionen der AssistenznehmerInnen kompensieren. Dinge, die selbst nicht erledigt werden können, werden von AssistentInnen übernommen.
Dabei erwartet Frau C von ihren AssistentInnen, dass ihre Anweisungen ohne in Frage gestellt zu werden, ausgeführt werden. Als AssistentInnen zu arbeiten impliziert demzufolge, sich in weitreichender Weise den Relevanzen der AssistenznehmerInnen unterzuordnen. AssistenznehmerIn zu sein heißt, diesen Relevanzen zur Geltung zu verhelfen.
"Ein guter Persönlicher Assistent ist jemand, der erkennt, dass er der verlängerte Arm von mir ist. Das heißt, dass er im Prinzip dazu da ist, um mich in meinem Alltag ein Stück zu begleiten und mir dann die Sachen abnimmt, die ich selber nicht machen kann. Damit meine ich jetzt nicht, dass sich der Assistent soweit zurücknehmen muss, dass er ein Unterstützungsroboter ist. Das auf keinen Fall. Aber dass er sich einfach so weit zurücknimmt, dass er mir die Sachen macht, die ich einfach brauche und das nicht hinterfragt wird."
Dieser Aussage liegt der Wechsel der Perspektive zugrunde, der die Grundlage der Konzeption der Persönlichen Assistenz bildet. Das traditionelle Modell der Pflege betrachtet Menschen mit Hilfebedarf oftmals als Objekte, denen geholfen werden muss. Die Konsequenz aus dieser Bevormundung kann ein Verlust der eigenen Fähigkeiten auf Seiten der Empfänger von Hilfeleistungen sein. Demgegenüber spricht das Modell der Persönlichen Assistenz gewisse Kompetenzen zu und geht davon aus, dass ein Mensch mit Hilfebedarf die notwendigen Ressourcen zur Bewältigung seiner Situation besitzt und lediglich in gewissen Bereichen eine Unterstützung benötigt.
Als weitere Voraussetzung nennt Frau C Kommunikationsfähigkeit. Diese Voraussetzung erscheint insofern wichtig, als dass das Delegieren von Arbeiten Aushandlungsprozesse und Rückmeldung darüber erfordert, ob die Anweisungen verstanden worden sind und nach den Vorgaben umgesetzt werden können. Dazu ist es notwendig, dass ein ständiger Austausch zwischen AssistenznehmerIn und AssistentIn stattfindet. Assistenz zeichnet sich in besonderem Maße durch das Gelingen der Kommunikation zwischen AssistenznehmerInnen und AssistentInnen aus. Es muss ein Kommunikationsweg des gegenseitigen Verstehens entwickelt werden, damit ein gleichberechtigtes Verhältnis entstehen und kooperativ-dialogischer Austausch stattfinden kann. (Scholz 2006, S. 13)
In diesem Zusammenhang beschreibt Sack (1999) Selbstbestimmung als einen dialogischen Prozess. Selbstbestimmung heißt demnach, in ein wechselseitiges Interesse einbezogen zu werden und sich selbst einem wechselseitigen Interesse zu öffnen, das daran interessiert ist, das eigene Wollen und das Wollen des anderen zu verstehen und zu klären, was dem Wohl- und Gutsein dienen könnte. (Sack 1999, S. 106)
Frau C fordert zudem eine absolute Akzeptanz ihrer Person und ihrer Art der Lebensführung. Veränderungsvorschläge ihre Lebensgewohnheiten betreffend sind von Frau C nicht erwünscht. Es soll nach Aufforderung stellvertretend für ihre Person gehandelt werden und nur nach ihren Interessen. Dabei soll die/der AssistentIn eigene Ansichten zurückstellen. Diese Forderung kann übersetzt werden mit dem Wunsch, als "Experte/in in eigener Sache" anerkannt zu werden (vgl. Kap. 8.4). Experte/in in eigener Sache zu sein bedeutet, dass die Anleitung der Persönlichen Assistenzkräfte im Sinne größtmöglicher Selbstbestimmung den behinderten Menschen selbst obliegt. Sie wissen selbst am besten, wie ihnen die benötigten Hilfen erbracht werden sollen.
"Wichtig ist für mich auch, dass der Assistent meine Lebenssituation und mich als Person so akzeptiert und nicht versucht irgendetwas zu ändern. Ein Assistent, der auf mich zukommt und mir ständig irgendwelche Vorschläge macht, was ich alles für Therapien machen könnte oder meine Ernährung ändern möchte, der wäre nicht lange bei mir. Weil wenn ich das will, kann ich immer noch in ein Heim gehen. So sehe ich das mit den Assistenten."
Frau D führt zudem Ehrlichkeit als wichtige Voraussetzung für Persönliche AssistentInnen an. Dies ist für sie Bedingung, um Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche auch äußern zu können. Das Wissen darum, dass AssistentInnen auch ablehnen, wenn sie keine Zeit haben, gibt Frau D die nötige Sicherheit, ihre Anliegen vorzubringen.
"Ehrlichkeit ist für mich ganz ganz wichtig. Also ich sage immer zu jedem Assistenten, der bei mir anfangt, mir ist lieber er sagt mir ganz ehrlich, ob er kann oder nicht, als ich habe das Gefühl, er meint er muss das jetzt machen. Weil wenn er mir das ehrlich sagt, dann traue ich mich auch zu fragen. Also dann traue ich mich auch anzurufen. Ich habe einfach noch vier andere, und wenn jemand jetzt sagt, er hat keine Zeit, dann kann ich immer noch versuchen jemand anderen zu finden."
Auch bei AssistentInnen kann ein erheblicher Druck entstehen, wenn sie sehen, dass ihr/e AuftraggeberIn von ihrer Assistenz abhängig ist und weder ein/e KollegIn zur Vertretung noch Ressourcen bei Angehörigen zur Verfügung stehen.
Keiner der InterviewpartnerInnen ist der Meinung, dass eine Ausbildung im sozialen Bereich notwendig sei, um für diese Tätigkeit geeignet zu sein.
"Man muss da jetzt keine Ausbildung haben oder so. Es sind schon mehrere bei mir gewesen, die damit noch nie etwas zu tun hatten, haben sich aber super herauskristallisiert." (Herr B)
Der Umstand, dass die meisten AssistentInnen Laien sind, kann allerdings auch Nachteile mit sich bringen. Einerseits lernen die AssistentInnen nichts über Beeinträchtigungen, nichts über Hebetechniken, haben nicht die Möglichkeit, sich mit dem Paradigma der Selbstbestimmung auseinander zu setzen, sondern sind auf die Anleitung der AssistenznehmerInnen angewiesen. Die Laienhilfe bringt für die Persönliche Assistenz jedoch auch einen wesentlichen Vorteil, denn sie ist eine universelle Hilfe.
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen zeigen allerdings auch, dass hohe soziale Kompetenzen notwendig sind, um die Arbeit als Persönliche/r AssistentIn gut erfüllen zu können. Die Tätigkeit der AssistentInnen erschöpft sich nicht darin, Anordnungen auszuführen. Für die Praxis sind entsprechendes Rollenverhalten, Distanz- Nähebalancierung, die Wahrung der Selbstbestimmung der AssistenznehmerInnen und die Fähigkeit Konflikte zu bearbeiten unverzichtbar. Mit dieser Tätigkeit ist ein hoher Anspruch an Fähigkeiten verbunden, die keineswegs selbstverständliche Grundfähigkeiten sind. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Laienarbeit kann in der Persönlichen Assistenz zu einem Problem werden.
In diesem Zusammenhang wäre es bedeutsam, wenn auch UnterstützerInnen die Möglichkeiten dazu hätten, sich mit dem Paradigma der Selbstbestimmung und den daraus für ihr Handeln resultierenden Konsequenzen auseinanderzusetzen.
"(...) es stellt sich immer wieder die Frage nach der Rolle und der Qualifikation der UnterstützerInnen, die die Selbstbestimmung wahren können." (Schönwiese 2009, S. 31)
Bobzien (1993) verlangt in diesem Sinne nach einem neuen Helfertypus, der sich durch spezifische persönliche Qualität (Kreativität, flexibles Denken in Zusammenhängen, selbstreflexive Haltung, Vertrauen in eigene Fähigkeiten, Geduld, Empathie, Engagement...) auszeichnet und "der seine Rolle auf Gegenseitigkeit, Gleichgestelltheit und Entfaltung von Selbsthilfepotentialen hin verändert hat und darüber hinaus das Prinzip des Sich-überflüssig-Machens als Ziel und Weg seiner Arbeit ansieht" (Bobzien 1993, S. 49)
Die Diskussion um die Voraussetzungen der AssistentInnen verweist auf die Notwendigkeit, auch einen Blick auf die Perspektive der AssistentInnen zu richten. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass es sich meist um Frauen handelt, die im Berufsfeld Assistenz tätig sind.
Pflegeberufe zählen allgemein zu den sogenannten Frauenberufen. Dies gilt sowohl für die eher gesundheitsbezogenen Pflegeberufe (nursing), als auch für die eher sozialpflegerischen und/oder sozialpädagogisch ausgerichteten Pflegeberufe des sogenannten "Care-Sektors". (Krenn 2004, S. 7) Dabei gelten die Pflegeberufe - wie die Sozialberufe insgesamt - als "das Herzstück" von Frauenberufen und gehen im
"Kern auf die ehrenamtliche soziale Arbeit von Frauen zurück, die zunächst von der zeitgenössischen Frauenbewegung organisiert und ausgeübt wurde und deren Professionalisierung seit der Jahrhundertwende vor allem bürgerliche Frauen vorangetrieben haben." (Willms-Herget 1985, S. 244)
Diese Herkunft aus der ehrenamtlichen Arbeit und die Typisierung als "Frauenberuf" spiegeln sich bis heute in den Ausbildungs- und Berufsstrukturen, in der gesellschaftlichen Anerkennung und in der Bezahlung der Pflegeberufe wieder. Die historische Konzipierung der Pflegearbeit als "Dienst am Nächsten", die Verknüpfung von Weiblichkeitsideologie und beruflicher Tätigkeit, von "Liebesdienst" und (schlecht) bezahlter Arbeit sowie die inhaltliche Diffusität der pflegerischen Arbeit verhindern zudem bis heute, dass "weibliche" Fähigkeiten als erworbene und zu erlernende Qualifikation anerkannt, im Berufsbild abgesichert und entsprechend bezahlt werden und dass Pflegeberufe zu Berufen mit anerkannten Qualifikationsprofilen und beruflichen Aufstiegsleitern wurden.
Dienstleistungsberufe in der Kranken- und Altenpflege, der Kindererziehung und angrenzender Bereiche, die in der Statistik als personenorientiert gekennzeichnet sind, sind eingebunden in eine doppelte gesellschaftliche Verpflichtung, zum einen für den Menschen umfassende Dienste zu erbringen, die dessen Existenz - physisch, psychisch, aber auch als gesellschaftliches Wesen - betreffen, im weitesten Sinne garantieren. Zum anderen wird von den TrägerInnen der Berufe abverlangt, dass sie diese existentiellen Dienste für die Gesellschaft wie für die Individuen unter Bedingungen erbringen, die durch ökonomische Rationalität bestimmt sind, oder einfacher ausgedrückt, unter Einsparungsdruck.(Rabe-Kleberg 1991, S. 15)
Die gegenwärtige Expansion des Dienstleistungssektors beruht wesentlich auf der Ausweitung personenbezogener Dienstleistungen im tertiären Sektor und der steigenden Nachfrage nach marktförmig erbrachter Arbeit im Feld der Betreuung und Versorgung des Alltags. Diesen wachsenden Bedarfen des Arbeitsmarktes steht eine Beschäftigungsstruktur gegenüber, die im Spannungsfeld eines dynamischen quantitativen Wachstums und fehlender Qualität in personenbezogenen Ausbildungsberufen und Erwerbsfeldern verläuft. (Friese 2010, S. 49) Das für moderne Industriegesellschaften charakteristische "Mismatch-Problem", nach dem der wachsende Bedarf nach qualifiziertem Personal trotz hoher Arbeitslosigkeit nicht gedeckt ist, setzt sich im Feld personenbezogener Dienstleistungen fort. Dabei werden insbesondere gering qualifizierte Personen zu Verlierern des Strukturwandels und es werden Prozesse der historisch bedingten Dequalifizierung, Semi-Professionalität und Marginalisierung in personenbezogenen Dienstleistungen dramatisch verstärkt. (ebd. S. 57f)
Bei den sozialen Diensten handelt es sich um einen Sektor mit besonders hohen Frauenbeschäftigungsanteilen sowie mit hohen Anteilen atypischer Beschäftigung und mobiler Arbeit - mit all den typischen Attributen wie geringes Einkommen, geringes Berufsprestige usw.
Krenn et. al. (2004) zeigen in ihrem Projekt "Soziale Dienste (Mobile Pflege) in Österreich - Skizze eines Sektors" eindrücklich, dass Entgrenzung (etwa jene von Arbeitsort/Betrieb, Person/Arbeitskraft, Arbeitszeit, Beschäftigungsverhältnis, Arbeitsrolle und Leistungsanforderungen) ein wesentlicher Aspekt von mobilen Unterstützungsformen ist. (Krenn 2004, S. 1)
Krenn et. al. postulieren, dass Entgrenzung in diesem Berufsfeld zum einen sehr stark mit dem Charakter der Arbeit selbst zu tun habe. "Pflegearbeit ist durch ihre inhaltliche Nähe zu den unbezahlten Formen privater Alltags- und Versorgungsarbeit und die für die herkömmlichen Kriterien zur Bewertung von Erwerbsarbeit diffusen Inhalte, in denen sich medizinisch-fachliche, kommunikativ-kooperative und emotional-interaktive Anforderungen und Handlungsweisen untrennbar miteinander verbinden, schwer zu bestimmen. Sie entzog sich damit bis zu einem gewissen Grad den herkömmlichen auf Rationalität und Verwissenschaftlichung ausgerichteten Bewertungsmaßstäben. Diese Diffusität machte die Eingrenzung der Pflegearbeit als verberuflichte Erwerbsarbeitsform von Beginn an schwierig, was sich im Kampf um die Ausdeutung ihrer Professionalisierung niederschlägt." (Krenn et. al. 2004, S. 11)
Krenn et. al. führen weiter aus, "gleichzeitig wurde in der Pflege immer schon der erweiterte Zugriff auf die Arbeitskraft im Sinne der Nutzung der Subjektivität der Arbeitskräfte praktiziert. Bilder der Aufopferung und des "Liebesdienstes" waren in das Berufsbild integriert und die emotionalen Kompetenzen der fast ausschließlich weiblichen Arbeitskräfte wurden als nicht zertifizierte Fähigkeitsanteile stillschweigend und unentgeltlich genutzt. Allerdings handelt es sich bei dem Zugriff auf die Subjektivität der Pflegekräfte zum Großteil um eine auf weibliche Rollenzuschreibungen begrenzte und eingeengte Subjektivität, die als scheinbar natürliche Ressource mitgenutzt wurde. Andererseits erfordert der interaktive Charakter personenbezogener Dienstleistungsarbeit selbst ein im Vergleich zu anderen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern verstärktes Einbringen der eigenen Subjektivität." (ebd. S. 11)
Darüber hinaus ergeben sich Entgrenzungen in mobilen Unterstützungsformen auch hinsichtlich des Arbeitsortens, denn dieser ist unmittelbar in der Privatsphäre der KlientInnen angesiedelt. Das Problem des Balanceaktes von Nähe und Distanz, der zu einer der wesentlichsten Anforderungen dieser Arbeit zählt, verdeutlicht die tendenziell immer schon vorhandene Verwischung der Grenze zwischen Arbeitkraft und Person. (ebd. S. 12)
Krenn et. al. konstatieren, dass sich die Problemlagen der MitarbeiterInnen von mobilen Unterstützungsformen aus hohen emotionalen und körperlichen Belastungen, tendenziell niedrigem Einkommen und in der für MitarbeiterInnen belastenden Problematik der Erfolgsmessung ergeben. (Krenn et. al. 2004, S. 1)
Ein kritischer Aspekt am Assistenzmodell auf Seiten der AssistentInnen ergibt sich meines Erachtens zudem aus der Feststellung sowohl der InterviewparterInnen dieser Untersuchung als auch von Ratzka (1988, S. 187) "Assistenz ersetzt uns Arme und Beine. Nicht mehr und nicht weniger." Daraus ergibt sich quasi eine Instrumentalisierung der AssistentInnen ohne deren Persönlichkeit zu berücksichtigen. Deshalb gilt es Wege zu finden, die sowohl mit der Selbstachtung der AssistenznehmerInnen vereinbar sind als auch die AssistentInnen nicht ausbeuten.
Das System personenbezogene Dienstleistungsberufe zeichnet sich durch ein facettenreiches Spannungsverhältnis von arbeitsmarkt- und professionspolitischen Risiken sowie Modernisierungsoptionen aus. Es gilt Qualifikations-, Kompetenz- und Professionsstandards auf der Basis differenzierter Analysen von Berufsfeld- und Zielgruppenprofilen zu entwickeln. Unverzichtbar sind darüber hinaus theoretische und berufspolitische Konzepte, die auf eine Entmystifizierung personenbezogener Tätigkeiten in einem traditionell weiblich konnotierten Berufsbereich abzielen. (Friese 2010, S. 64)
Persönliche Assistenz soll nach den Bedürfnissen der AssistenznehmerInnen ausgerichtet sein. Wie sieht die Umsetzung dieser Vorgabe in der Praxis aus? Fällt es den AssistenznehmerInnen leicht bzw. schwer eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu äußern?
Grundsätzlich ist Persönliche Assistenz dazu da, die Wünsche und Bedürfnisse der AuftraggeberInnen nach deren Vorstellung zu erfüllen. Die AssistentInnen sind angehalten sich möglichst danach zu richten, darin besteht die Kernkompetenz dieser Arbeit.
Nach Klauß (2007) gibt es zwei Arten der Selbstbestimmung:
-
Bei Bedürfnissen, die unabhängig von anderen Menschen selbst befriedigt werden können
-
Bei Bedürfnissen, deren Befriedigung von anderen Menschen abhängt, bedeutet Selbstbestimmung, dass diese anderen Menschen mitgeteilt werden und diese sich darauf einlassen.
Die Befriedigung von Bedürfnissen, bei der man auf andere Menschen angewiesen ist, setzt damit zweierlei voraus:
-
Kommunikation (Mitteilung der Bedürfnisse und Verstandenwerden)
-
Bereitschaft und Fähigkeit anderer Menschen, darauf einzugehen und bei der Befriedigung von Bedürfnissen zu assistieren.
Dies gilt für alle Menschen, hat aber besondere Bedeutung bei Personen, die wegen ihrer (kognitiven) Beeinträchtigungen mehr auf Unterstützung angewiesen sind als andere. Die Idee der Selbstbestimmung hat befördert, dass auch sie wesentlichen Einfluss auf ihre Lebensumstände nehmen können, wenn ihnen Kommunikation ermöglicht wird und andere Menschen ihre Intentionen ernst nehmen und beachten. (Klauß 2007, S. 6)
Alle InterviewpartnerInnen geben an, dass die AssistentInnen auf die Wünsche und Bedürfnisse der AssistenznehmerInnen eingehen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Betroffene seine Bedürfnisse auch kennt. Herr A macht das mit folgender Aussage deutlich:
"Indem man sich zum einen klar wird über die eigenen Bedürfnisse. Dass man sich Notizen macht und das festlegt. Was brauche ich, was brauche ich wann, welchen Zeitaufwand erfordert das Ganze. Was ist unbedingt notwendig, auf was kann ich verzichten."
Das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, bedeutet, sich mit den eigenen Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen zu beschäftigen. Für diese intensive Auseinandersetzung mit sich selbst sollten sich die AssistenznehmerInnen Zeit nehmen und alle spontanen Gedanken zulassen. Die InterviewpartnerInnen geben an, dass ein Lernprozess notwendig war, um Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche auch äußern zu können. Nach langjährigen Erfahrungen mit Persönlicher Assistenz haben die InterviewpartnerInnen aber gelernt, ihre Bedürfnisse auch zu artikulieren.
"In bestimmten Bereichen ist es leicht. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich mich ganz konkret artikulieren kann. Also von der Seite her, das fällt mir nicht so schwer." (Herr A)
Alle InterviewpartnerInnen geben an, dass die AssistentInnen ihre Bedürfnisse, wie von der Assistenzidee vorgesehen, weitestgehend nach ihren Vorstellungen erfüllen.
Frau C ist im Umgang mit diesem Thema allerdings sehr sensibilisiert, weil sie sich dessen bewusst ist, dass Menschen mit Behinderung durch Erfahrungen mit Fremdbestimmung und passivierender Betreuung eigene Bedürfnisse vielleicht nicht mehr so wahrnehmen. Deshalb achtet sie bei sich selbst besonders darauf, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu spüren und zu berücksichtigen.
"Ich bin so weit reflektiert, dass ich mir denke, bestimmte Sachen habe ich in meinem Leben noch nicht so weit angegangen, dass mir das jetzt so bewusst ist. Das kann natürlich auch leicht sein. Ich habe das Gefühl, dass Menschen mit Behinderung, und da möchte ich mich selber nicht ausschließen, oft bestimmte Möglichkeiten im Kopf gar nicht so wahrnehmen, weil es ihnen nicht anerzogen wurde. Und das ist eine Geschichte, bei der ich sehr aufmerksam bin bei mir selber, weil ich das ja nicht will. Ich will ja im Prinzip alles genauso machen können wie andere Leute. Ich möchte dementsprechend auch die Bedürfnisse haben."
Dieser achtsame Umgang mit den eigenen Bedürfnissen scheint berechtigt, da lange Jahre der Fremdbestimmung und der passivierenden Betreuung dazu geführt haben, dass viele Menschen mit Behinderungen sehr verunsichert und vorsichtig ihre Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche äußern. Innerhalb der Familie wachsen behinderte Menschen häufig mit den Gedanken auf, dankbar und bescheiden sein zu müssen.)
Darüber hinaus sehen sich behinderte Menschen häufig gezwungen, auf ihre Selbstbestimmung zu verzichten, da sie im Falle eines Interessenskonflikts den Entzug der existenziellen Hilfe befürchten. Sie haben im Extremfall erlebt, wie HelferInnen in letzter Konsequenz ihre Entscheidungsmacht darüber, ob, wie und wann Bedürfnisse befriedigt werden, ausgenutzt haben. (Reinarz 1989, S. 3)
Das aktive Vertreten der eigenen Person und der persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche ist jedoch notwendige Voraussetzung, um die eigene Lebensführung zu bestimmen und zu realisieren. Die Bestimmung der Bedürfnisse durch die AssistenznehmerIn ist eine wichtige Ausgangsbasis, um das Konzept der Persönlichen Assistenz selbst zu organisieren. Um als AssistenznehmerIn geeignete Persönliche AssistentInnen eigenständig suchen, auswählen und anleiten zu können, ist es wichtig, den Bedarf an Unterstützung genau benennen zu können. Hat die AssistenznehmerIn keine klaren Vorstellungen davon, was und wie ihre Persönlichen AssistentInnen arbeiten sollen, können auf beiden Seiten Missverständnisse und Unzufriedenheit auftreten.
Wie gehen AssistenznehmerInnen mit der Nähe um, die durch das besondere Arbeitsverhältnis zwischen AssistentInnen und AssistenznehemerInnen entstehen kann? Wie leicht bzw. schwer fällt ihnen die Nähe- Distanzbalancierung?
Assistenz erfordert den Aufenthalt der HelferInnen im privaten Bereich der AssistenznehmerInnen. Der Privathaushalt gilt als Schutzzone, als Gestaltungsraum von Individualität und Identität, als Ruhe- und Rückzugsraum, als ein von öffentlichen Legitimationszwängen relativ freier Ort. Bedingt durch die körpernahe Arbeit entsteht zudem eine besondere Nähe zwischen AssistenznehmerInnen und AssistentInnen. Dadurch wird deutlich, dass Akzeptanz, Vertrauen, gegenseitiger Respekt und die Einhaltung der Schweigepflicht Grundvoraussetzungen dieser Arbeit sind.
Die Handlungsweise der InterviewpartnerInnen im Umgang mit Nähe und Distanz in den Beziehungen zu AssistentInnen ist sehr unterschiedlich. Zwei der Befragten bevorzugen nahe, freundschaftliche Beziehungen. Frau C und Frau D ist es wiederum wichtig, Distanz zu den AssistentInnen zu wahren. Sie wollen Freundschaft und Assistenz klar voneinander trennen. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: die Männer bevorzugen mehr Nähe, die Frauen hingegen mehr Distanz.
Herr A erkennt die Schwierigkeit, welche die nahe Beziehung zu den AssistentInnen mit sich bringt, eine Balance zwischen Nähe und Distanz herzustellen. Er macht dies anhand folgender Aussage deutlich:
"Dass man also eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz wahrt. Was gar nicht immer so leicht ist. Also wenn man viele Stunden gemeinsam verbringt. Dass man also doch auch versucht objektiv zu sein. Dass man nicht die einen sehr stark bevorzugt und die anderen irgendwo benachteiligt."
Bestätigung findet diese Aussage von Rehfeld (2001). Wenn ein Arbeitgeber seine AssistentInnen aufgrund von gegenseitiger Sympathie ausgesucht hat, entsteht sehr schnell ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Dies kann für beide Seiten schwierig werden, da zu viel Nähe die Ausübung der eigentlich im Hintergrund zu verrichtenden Assistenzarbeiten behindern kann. Es sollte auch genügend emotionale Distanz vorahnden sein bzw. geschaffen werden, um eine gelingende Assistenz zu gewähren, was auch als Grenzen setzen bezeichnet werden kann. (vgl. Rehfeld 2001b, S. 141)
Ob Herr A ein eher freundschaftliches oder distanziertes Verhältnis zu seinen AssistentInnen aufbaut, hängt von den Vorlieben der AssistentInnen ab. Wobei er eine stärkere Nähe bevorzugt. Er akzeptiert es jedoch auch, wenn AssistentInnen mehr Distanz in der Beziehung wahren wollen. Seinen Wunsch nach mehr Nähe zu den AssistentInnen begründet er mit seiner langjährigen Beziehung. Er gibt an, dass er es dadurch gewohnt sei, in Beziehungen große Nähe herzustellen.
"Und das ist dann so, dass es von Fall zu Fall sehr verschieden ist. Dass sich eine Freundschaft entwickelt zum Beispiel. Ich biete einer Assistentin nie meine Freundschaft an, oder einem Assistenten. Das muss von der anderen Seite kommen. Und da ist dann so, dass mir die natürlich auch Probleme schildern, Rat suchen. Dass ich sozusagen auch an ihrem Leben ziemlich intensiv teilhabe. Und dann gibt es natürlich auch Assistentinnen, die von vorneherein ihre Arbeit tun und etwas mehr Distanz wollen. Und das ist dann auch zu akzeptieren. Ich persönlich fühle mich jetzt sehr wohl wenn eher eine stärkere Nähe vorhanden ist. In meinem Fall kann sicher auch aufgrund meiner langjährigen Partnerschaft, von der Vorgeschichte her. Weil das einfach das Privileg einer Beziehung ist, eine ganz starke Nähe pflegen kann."
Herr B bevorzugt ebenso nahe, freundschaftliche Beziehungen zu seinen AssistentInnen. Genauso wie Herr A macht er die Handhabung dieses Wunsches jedoch abhängig von den Einstellungen der AssistentInnen. Dabei reichen einige Beziehungen auch über das Dienstverhältnis hinaus. Das Verbringen von gemeinsamer Freizeit mit den AssistentInnen gehört für Herrn B auch zu einer gelungenen Beziehung dazu.
Frau C und Frau D hingegen sind bemüht, Rollendiffusionen durch Grenzziehungen zu vermeiden. Sie bevorzugen dabei eine klare Trennung zwischen Privatbeziehung und Assistenz.
"Und dass er sich als Assistent versteht und nicht als Person, die halt kommt und einem hilft, weil dann die Grenze zwischen Privatbeziehung und Assistenz verschwimmt. Ich glaube das ist ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat. Weil wenn man das nicht vergisst, dann kann man auch viel besser eine angemessene Beziehung aufbauen, ohne dass man Gefahr läuft, dass sich irgendwelche komische Abläufe entwickeln. Und dann läuft das Ganze viel entspannter." (Frau C)
In diesem Zusammenhang stellt Rehfeld fest, dass die Rollenverteilung und die zu verrichtenden Dienstleistungen vertraglich geregelt sind, um eine professionelle Assistenz zu gewähren und Machtübergriffen vorzubeugen (vgl. Rehfeld 2001a, S. 47).
Frau D ist es wichtig, enge und herzliche Beziehungen zu ihren AssistentInnen zu unterhalten. Trotzdem kann ein/e AssistentIn für sie kein Freund sein. Wenn sich aus eine/r/m AssistentIn eine Freundschaft entwickeln würde, würde sie das Assistenzverhältnis beenden.
"Ich würde nie mit einer Assistentin oder einem Assistenten heimgehen auf einen Kaffee. Weil das für mich nicht mehr passt. (...) Damit es nicht so verschwimmt. Damit schon klar ist, sie oder er ist Assistent und kein Freund und ich bin die Kundin. Das kann schon ein enges und herzliches Verhältnis sein, aber das so Sachen dann doch eher in den Bereich Freundschaft fallen. Und damit das einfach klarer bleibt, mach ich das von vornherein einfach nicht."
In Übereinstimmung mit dieser Aussage schlägt Niehoff vor, dass die Beziehung zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen nicht freundschaftlich sein sollte, sondern die Assistenz hintergründig stattfinden muss, damit eine klare Trennung der Beziehung zum Hilfegeber und anderer Beziehungen stattfindet. Der Assistent oder die Assistentin ist somit nur für die "nötigen Hilfestellungen/Dienstleistungen" (Niehoff 2001, S.15) zuständig .
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen zeigen, dass die Arbeit in der Persönlichen Assistenz eine ständige Gratwanderung zwischen notwendiger Nähe und genauso notwendiger Distanz ist. Einerseits ist der vertrauensvolle Umgang miteinander die Grundlage für ein positives Verhältnis zwischen beiden. Andererseits, je größer die Vertrauensbasis, desto wichtiger kann es aber sein, genaue Trennlinien zu ziehen. Den großen Anspruch, den Persönliche Assistenz erfüllen soll, liegt darin, den AssistenznehmerInnen trotz räumlicher Nähe und allem, was den AssistentInnen offenbart wird, auch Raum für das Eigene und Private zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 12.1 Zusammenhang Lebensqualität Selbstbestimmung
- 12.2 Selbstbestimmung als ambivalentes Konzept
- 12.3 Selbstbestimmung und Identität: Stigma-Identitäts-These
- 12.4 Selbstbestimmung als Grundrecht und seine biologische Legitimierung
- 12.5 Kern des Selbstbestimmungsgedanken
- 12.6 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Barrierefreiheit
- 12.7 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Information
- 12.8 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Eigene Bedürfnisse kennen
- 12.9 Grenzen der Selbstbestimmung und Behinderung als soziale Konstruktion
- 12.10 Selbstbestimmung in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit
- 12.11 Selbstbestimmung, Kontakthypothese und Inklusion
- 12.12 Unabhängigkeit und Entlastung von Freunden, Familie und LebenspartnerIn
- 12.13 Kontinuität der Assistenzbeziehungen
- 12.14 Verletzlichkeit der Assistenzbeziehung
- 12.15 Anforderungen an die AssistenznehmerInnen und Erweiterung des Modells
- 12.16 Widerspruch zur Zielsetzung des Assistenzmodells
- 12.17 ExpertInnen in eigener Sache
- 12.18 Voraussetzungen AssistentInnen und Empowerment
- 12.19 AssistentInnen: Zwischen Entgrenzung Person/Arbeitskraft und Instrumentalisierung
- 12.20 Unterschied zwischen den Geschlechtern: Nähe- Distanzbalancierung
- 12.21 Persönliche Assistenz als Schlüsselbegriff für Selbstbestimmung
- 12.22 Sensibilisierung für Selbstbestimmung
Die vorliegende Untersuchung weist auf einen Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Selbstbestimmung hin. Durch selbstbestimmte Entscheidungen können individuelle Bedürfnisse eher berücksichtigt werden. Selbstbestimmte Entscheidungen tragen zur Befriedigung von Bedürfnissen und damit zum Wohlbefinden bei. (Hahn 1994, S. 82f) Lebensqualität bemisst sich an der Erfüllung individueller Bedürfnisse und findet in subjektivem Wohlbefinden ihren Niederschlag (vgl. Seifert 2007, S. 205). Unter Berücksichtigung dieser Definition und der Analyse der Interviews wird deutlich, dass Assistenz das Potenzial hat, zur Lebensqualität der AssistenznehmerInnen beizutragen. Durch Persönliche Assistenz ist ein Mehr an Selbstbestimmung und somit auch eine Steigerung der Lebensqualität möglich.
Die Interviews bestätigen allerdings ebenso, dass sich Selbstbestimmung auch als ambivalentes Konzept erweist (vgl. Waldschmidt 2003). Alle InterviewpartnerInnen sind sich darüber einig, dass die Eigenverantwortlichkeit, die ein selbstbestimmtes Leben mit sich bringt, auch zur Last werden kann. Ob Selbstbestimmung allerdings als überfordernder Anspruch erlebt wird, hängt vom Lebenskontext der Betroffenen ab (d.h. in welcher Situation befindet sich der/die AssistenznehmerIn biografisch und sozial, welche persönlichen, sozialen und finanziellen Ressourcen sind verfügbar?), wie anhand der Befragung von Herrn A gezeigt werden kann.
Bei einem Vergleich der Interviews wird deutlich, dass Herr A ein besonders ambivalentes Konzept von Selbstbestimmung aufweist. Unter Berücksichtigung seiner Biografie wird allerdings deutlich, dass zwischen Herrn A und den restlichen InterviewpartnerInnen ein Unterschied besteht. Herr A hat in seinem Leben zwei einschneidende Brüche erlebt. Er ist seit einem Unfall gegen Ende seines Studiums querschnittgelähmt. Darüber hinaus hat Herr A vor sieben Jahren seine langjährige Partnerin verloren. Er hat nicht nur seine Lebenspartnerin verloren hat, sondern auch seine Freizeitpartnerin, Sexualpartnerin, Mitarbeiterin in seinem Beruf und durch die zusätzliche Berufstätigkeit seiner Partnerin auch wichtige Einnahmequelle, welche viel zum Lebensunterhalt beigetragen hat. Neben der psychischen Belastung, die eine derartige Verlusterfahrung mit sich bringt, musste er sein Leben zum wiederholten Male vollständig und aus eigener Kraft neu organisieren. Seine Frau hatte zuvor seinen gesamten Unterstützungsbedarf gedeckt, dadurch war ein hoher Grad an Selbstbestimmung möglich, der nach dem Tod seiner Frau mühevoll wieder erarbeitet werden musste. Ein derart hoher Selbstbestimmungsgrad konnte nach Angaben von Herrn A mit dem Assistenzmodell jedoch nicht mehr erreicht werden. Herr A wurde demnach zwei Mal in seinem Leben mit wesentlichen Einbußen seiner Selbstbestimmungsmöglichkeiten konfrontiert und hat dabei einen wesentlichen Bezugspunkt in seinem Leben verloren. Das Wiedererlangen seiner Selbstbestimmung hat jedes Mal sehr viel Kraft gekostet, seiner Meinung nach, auch manchmal zu viel.
Die vorliegende Untersuchung bestätigt sowohl die klassische "Stigma-Identitäts-These" (Herr A) als auch Empirische Studien, welche den Charakter der Zwangsläufigkeit von einer beschädigten Identität durch Stigmatisierung entkräften (Herr B).
Herr A verortet die Ursachen für Fremdbestimmung in seinem körperlichen Zustand, d.h. er fühlt sich durch seine körperlichen Einschränkungen fremdbestimmt. Dieser Umstand deutet auf Widersprüche in seiner Selbsterfahrung hin. Widersprüche in der Selbsterfahrung können dadurch entstehen, dass dem Individuum eine soziale Identität zugewiesen wird, die nicht seiner Selbstwahrnehmung entspricht. Dadurch wird der Konflikt des stigmatisierten Individuums deutlich, das sich selbst "nicht anders als irgend ein anderes menschliches Geschöpf definiert, während es von sich und den anderen Mensch seiner Umgebung zur gleichen Zeit als jemand, der abgesondert ist, definiert wird" (Goffman 1967, S. 136) Wenn es ihm nicht gelingt, sich von der sozialen Identität abzuheben, kommt es zur Anpassung des Selbst an die unangenehmen Bewertungen durch die Außenwelt. Behinderte Menschen bekommen immer wieder vermittelt, dass sie "anders" sind und nicht in die Gesellschaft "Normaler" gehören, ob durch Starren und Kommentare (Brown 1990, S. 41), oder durch fehlenden Zugang zu Gebäuden und Verkehrsmitteln oder durch Barrieren in Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten. Die Anpassung des Selbst an die Bewertung durch die Außenwelt führt zu einer "beschädigten" Identität.
Der Körper ist als identitätsstiftendes Merkmal anzusehen. Im Prozess der Identitätsfindung der Individuen, d.h. in dem Prozess der Herausbildung des Selbst-Bewusstseins in Auseinandersetzung und Abstimmung mit Fremdwahrnehmung und der Entwicklung einer individuellen Einheitlichkeit von Eigenschaften, erhält der Körper eine besondere Bedeutung. Da unsere Identität allerdings zumindest teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung durch die anderen geprägt wird, so dass der Mensch wirklich Schaden nimmt, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt. (Taylor 1993, S. 13)
Einen Gegenpol zur Annahme von Herrn A und damit Bestätigung der empirischen Studien, welche den Charakter der Zwangsläufigkeit von einer beschädigten Identität durch Stigmatisierung entkräften, stellen die Aussagen von Herrn B dar. Die Analyse des Interviews mit Herrn B weist darauf hin, dass er die Behinderung als zu seiner Körperidentität zugehörig empfindet. Die Behinderung wird weniger als Belastung, sondern mehr als Herausforderung empfunden. Dieser Umstand weist darauf hin, dass Herr B Identitätsstrategien (z.B. Zuschreibungen leugnen, für unwahr oder unwichtig erklären) zur Verfügung hat, um die Folgen von Stigmatisierung und Diskriminierung abzuwehren.
In Übereinstimmung mit Kapitel 2.2 wird Selbstbestimmung von den InterviewpartnerInnen als Grundrecht ausgewiesen, das für alle in gleichem Maße gelten muss. In diesem Zusammenhang konstatiert Feuser (2006), dass Selbstbestimmung in demokratischen Gesellschaften ein rechtsstaatlich abgesichertes Grundrecht und international geachteter Grundwert ist, die für alle Menschen zu realisieren als kulturelle Notwendigkeit und ethische Verpflichtung angesehen wird (Feuser 2006, im Internet). Frau A kritisiert allerdings, dass dieses allgemeine Grundrecht bei schwerstbehinderten Menschen immer noch in Frage gestellt wird. Feuser (2006) stellt ebenso fest, dass ein allgemeiner Konsens über Selbstbestimmungsrechte unmittelbar zusammenbricht, wenn die Frage der Realisierung dieses Grundrechtes mit Bezug auf Personen aufgeworfen wird, die als schwerstbehindert gelten. (ebd.)
Lediglich Herr A knüpft Selbstbestimmung an Bedingungen, die in der Persönlichkeit des Individuums liegen und verbindet sie mit einer zu erbringenden Leistung. Diese Annahme widerspricht allerdings der in Kap. 7 ausgeführten These, dass Selbstbestimmung letztlich auf biophysische Selbstregulationsmechanismen zurückzuführen sei. Denn jenen Menschen, die nicht über die genannten Persönlichkeitseigenschaften und die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügen, wird damit die Fähigkeit zur Selbstbestimmung abgesprochen.
Denn auch dann, wenn die Selbstentwicklung durch eine psycho-physische Schädigung noch so sehr eingeschränkt ist und deshalb in stärkerem Maße Fremdbestimmung als mitmenschliche Sorge bedingt, kann die subjektive Potenz für Selbstverantwortung, die Selbstbezüglichkeit, nicht negiert werden. (Speck 1988, S. 209f)
Auch beim Assistenzmodell ist Assistenz von Kompetenz nicht zu trennen, die dem eigen sein muss, der sie zu seiner selbstbestimmten Lebensführung selbstbestimmt in Anspruch nimmt. Aber Kompetenz in diesem Verständnis hat nichts mit Selbständigkeit zu tun, sondern mit Zuständigkeit, die auch dann, wie Steiner (1999) betont, nicht negiert ist, wenn Zuständigkeit nicht eigenständig verwirklicht werden kann. Er schreibt: "Man muss dann höchstens darüber nachdenken, wie man ihnen helfen kann, diese Zuständigkeit in ihrem Leben umzusetzen" (Steiner 1999, S. 109).
Der Kern des Selbstbestimmungsgedanken lässt sich für die InterviewpartnerInnen darin ausmachen, dass sie all das, was andere machen, auch tun können. Das machen die Befragten im Laufe der Interviews immer wieder deutlich. Selbstbestimmung ist für die InterviewpartnerInnen "wenn ich das gleiche was du tust, auch machen kann". In Übereinstimmung mit dieser Aussage geht Waldschmidt (1999) davon aus, dass sich Selbstbestimmung auf den Wunsch bezieht, "so leben zu wollen, wie alle anderen" (Waldschmidt 1999, S. 42).
Die Untersuchung unterstreicht die Bedeutung von Barrierefreiheit als wesentliche Voraussetzung für Selbstbestimmung. Die Analyse der Interviews macht deutlich, dass öffentlich verfügbare Infrastrukturangebote und deren Zugänglichkeit, die sich als exklusiv oder aber als inklusiv erweisen, maßgeblich zur Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen beitragen. Barrieren sind dabei keine technischen Hindernisse, die aus schädigungsbedingten Einschränkungen resultieren. Sie sind in aller Regel Ergebnis der von Menschen geschaffenen und gewollten Strukturen, die Menschen mit Behinderungen ausschließen. (Frehe 2007, S. 4) Deshalb fordern die InterviewpartnerInnen, dass Barrieren zu beseitigen sind, um allen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Ein wesentliches Element eines selbstbestimmten Lebens ist die Möglichkeit, aufgrund von Informationen, Beratung und vorhandenen Ressourcen selbst die Richtung des Lebens zu bestimmen. Die Untersuchung zeigt allerdings, dass keinem der Befragten das Assistenzmodell bekannt war und alle von Dritten darauf hingewiesen wurden. Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit, den Bekanntheitsgrad des Assistenzmodells zu erhöhen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Betroffene Zugang zu Persönlicher Assistenz erhalten und somit ein selbstbestimmteres Leben führen können.
Die Untersuchung zeigt, dass das aktive Vertreten der eigenen Person und der persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche notwendige Voraussetzungen sind, um die eigene Lebensführung zu bestimmen und zu realisieren. Die Bestimmung der Bedürfnisse durch die AssistenznehmerInnen ist eine wichtige Ausgangsbasis, um das Konzept der Persönlichen Assistenz zu verwirklichen.
Das setzt allerdings voraus, dass sich AssistenznehmerInnen intensiv mit eigenen Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen auseinandersetzten, da lange Jahre der Fremdbestimmung und der passivierenden Betreuung dazu geführt haben, dass viele Menschen mit einer Behinderung sehr verunsichert und vorsichtig ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern. Innerhalb der Familie wachsen Menschen mit einer Behinderung häufig mit den Gedanken auf, dankbar und bescheiden sein zu müssen. (Reinarz 1989, S. 3)
Die Betrachtung der Interviews zeigt allerdings, dass die InterviewpartnerInnen überwiegend keine Schwierigkeiten damit haben, Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu äußern. Dies könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass bis auf einen zweijährigen Heimaufenthalt im Erwachsenenalter eines Interviewpartners, keiner der InterviewpartnerInnen Heimerfahrungen hat. Zudem wurden die Behinderungen von drei InterviewpartnerInnen erst im Jugend- bzw. Erwachsenenalter erworben. Es hat also bereits ein Erziehungs- und Sozialisationsprozess stattgefunden, in dem die Betroffenen nicht mit passivierender Betreuung konfrontiert waren.
Die anfänglichen Schwierigkeiten, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und der Lernprozess, der notwendig war um diese zu äußern, dürften eher auf die ungewohnte Rolle als ArbeitgeberIn (Anleitungskompetenz) zurückzuführen sein.
Die Interviews bestätigen, dass Menschen mit einer Behinderung immer noch mit zahlreichen Grenzen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten konfrontiert werden. So können beispielsweise durch enge gesetzliche Regelungen wesentliche Charakteristika für Selbstbestimmung nicht verwirklicht werden, nämlich die Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände und durch eine Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen (Wehmeyer 1992, S. 305). Dadurch wird deutlich, dass gesellschaftspolitische Veränderungen notwendig sind, denn nur durch entsprechende Rahmenbedingungen haben Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit Chancengleichheit zu erlangen.
Im Gegensatz zu den restlichen InterviewpartnerInnen, welche die Ursachen für die Begrenzung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten gemäß dem Konzept von Behinderung als soziale Konstruktion, vor allem in ihrer Umwelt sehen, geht Herr A davon aus, dass die Grenzen der Selbstbestimmung in erster Linie durch seinen körperlichen Zustand verursacht sind und identifiziert sie somit nicht als vor allem historisch, kulturell und gesellschaftlich hergestellte Grenzen.
Um die Grenzen der Selbstbestimmung für AssistenznehmerInnen zu minimieren, ist es Aufgabe der AssistentInnen, Verantwortlichkeiten für in Selbstbestimmung ausfüllbare Freiheitsräume auszuloten und Risiken mitzutragen (Hahn 1994, S. 91)
Zahlreiche Aspekte der Duisburger Erklärung, entstanden auf dem Kongress für Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten zum Thema Selbstbestimmung, finden sich auch in den Interviews der vorliegenden Studie wieder. Beispielsweise Forderungen nach einer selbstbestimmten Wahl der Schule, der Wohnform, der Freizeit und der Arbeit werden in der Duisburger Erklärung genannt und ebenso von den InterviewpartnerInnen als zentrale Aspekte für Selbstbestimmung erkannt. In Übereinstimmung mit der Duisburger Erklärung fordern die InterviewpartnerInnen Achtung, Respekt und integrierte Teilhabe statt Diskriminierung und gesellschaftlich-institutionelle Ausgrenzung
Die Untersuchung unterstreicht die zentrale Bedeutung einer erfüllenden Tätigkeit, einer bedürfnisorientierten Freizeit und der selbstbestimmten Wahl der Wohnform für die Selbstbestimmung von Menschen mit einer Behinderung, wie die folgenden Ausführungen zeigen.
Die Analyse der Interviews zeigt, dass Wohnen nicht beliebig ist, sondern es befriedigt zahlreiche Bedürfnisse wie Vertrautheit, Geborgenheit, Ungestörtheit, Individualität, Selbstdarstellung und eben auch Selbstbestimmung. Wenn die Wohnung eine derart zentrale Bedeutung hat, dann liegt es auf der Hand, dass die Möglichkeit, über diesen Ort, seine Gestaltung, das darin stattfindende Leben und die darin ein- und ausgehenden Personen selbst bestimmen zu können, ein besonders elementares Bedürfnis darstellt (Sack 1997, S. 193) und lässt damit traditionelle Großeinrichtungen als "totale Institutionen" (Goffman 1973) als völlig indiskutabel erscheinen.
Die Untersuchung zeigt, dass im Berufsfindungsprozess von Menschen mit einer Behinderung sowohl persönliche Stärken, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse als auch individuelle Ausgangssituationen zu berücksichtigen sind. Ein vielversprechendes Konzept, um Betroffene in diesem Prozess zu unterstützen ist die "Persönliche Zukunftsplanung". Die "Persönliche Zukunftsplanung" ist ein methodischer Ansatz, bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam über ihre Zukunft nachdenken, sich Ziele setzen und diese gemeinsam mit anderen konkret abarbeiten. (Doose 2007, im Internet)
Die Untersuchung unterstreicht die Annahme, dass der Beruf ein wesentlicher Aspekt für Selbstbestimmung ist. Arbeit dient dabei nicht nur der Sicherung des Lebensunterhalts, sondern stiftet Sinn und gibt dem Leben Inhalt. Mit Hilfe von Arbeit verorten sich die Menschen in ihrer soziokulturellen Umwelt, indem sie diese aktiv mitgestalten (Doose 2006, S. 65). Auch und gerade in ihrem Berufsleben als einem zentralen Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe, steht Menschen mit einer Behinderung deshalb ein Höchstmaß an persönlicher Handlungsautonomie zu. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Arbeitslosigkeit unter Menschen mit einer Behinderung um ein vielfaches höher ist als die der Durchschnittsbevölkerung, erscheint diese Forderung noch dringlicher.
Arbeitsassistenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Die persönliche Hilfeleistung am Arbeitsplatz zur Kompensation funktioneller Defizite oder zur Überwindung (anfänglicher) Schwierigkeiten in der Arbeitssituation ist ein wichtiger Faktor der beruflichen Teilhabe. Wo entsprechende Hilfe am Arbeitsplatz nicht geboten werden kann, ist unnötige berufliche Ausgliederung (Werkstätten für Behinderte, Sonderarbeitsplatz) oder erzwungene "Berufsunfähigkeit" die Folge. (Speck 1999, im Internet)
Die Analyse der Interviews macht deutlich, dass Selbstbestimmung im Bereich Freizeit einen zentralen Aspekt darstellt. Um selbstbestimmt leben zu können braucht es Freiraum, Zeit, Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume. Einen idealen Rahmen dafür bietet der Freizeitbereich. Die InterviewpartnerInnen fordern in diesem Sinne eine Freizeit, die durch individuelle Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gekennzeichnet ist, losgelöst von Ideen der Rehabilitation und entsprechenden Bildungs- und Fördermaßnahmen. Die Befragung der InterviewpartnerInnen zeigt allerdings auch, dass im Bereich Freizeit sehr wohl noch Aufholbedarf besteht, um Menschen mit Behinderung eine individuelle Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Denn Freizeitmöglichkeiten, die nicht eigens für Menschen mit Behinderungen veranstaltet und organisiert sind, bleiben ihnen oftmals verschlossen.
Die vorliegende Untersuchung weist darauf hin, dass bis heute Diskriminierung, Behindertenfeindlichkeit, offene und strukturelle Gewalt präsent sind. Im Sinne der Kontakthypothese von Cloerkes (2007) fordern die InterviewpartnerInnen deshalb, dass vermehrte Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Behinderung stattfinden müssen, um Vorurteile abzubauen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass häufige, oberflächliche Kontakte eher zu einer Verstärkung von Vorurteilen, als zu deren Abbau führen. Nicht die Häufigkeit von Begegnungen bestimmt die Qualität von Einstellungen, sondern deren Intensität. Je intensiver die Beziehung zu Menschen mit Behinderung ist, desto positiver gestalten sich demnach die Einstellungen. (Cloerkes 2007, S. 147)
In Übereinstimmung mit Jerg (2007) weist die Untersuchung darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen Selbstbestimmung, Inklusion und Assistenz besteht. Inklusion ist eine Idee, eine Sichtweise, die strukturelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen herstellt, die benötigt wird, um die Idee der Assistenz als Konzept, als eine Form der individuellen Unterstützung, gewähren zu können. Inklusion bezieht sich auf das strukturelle Fundament der Gesellschaft, Assistenz auf die Verbindungen zwischen den Menschen (Jerg 2007, im Internet)
Eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für das Assistenzmodell spielen für die InterviewpartnerInnen (Herr B, Frau C, Frau D) Zielsetzungen, die sich auf die Familie, Partnerschaft und Freunde beziehen. Wichtig dabei sind die Entlastung von Familienangehörigen und zugleich die eigene Unabhängigkeit vom familiären Unterstützungssystem. Die Äußerungen der InterviewpartnerInnen deuten darauf hin, dass eine Steigerung der Unabhängigkeit von familiärer Unterstützung und die Entlastung der Familie durch das Assistenzmodell auch weitestgehend verwirklicht werden können.
Die Unabhängigkeit und Entlastung vom näheren Bezugssystem scheint besonders bedeutsam, denn sowohl für das Bezugssystem als auch für die betroffenen Menschen mit Behinderungen können schwierige Lebenssituationen mit oft problematischen Abhängigkeitsverhältnissen entstehen, wenn assistenzabhängige Menschen allein auf ihr Bezugssystem bei der für sie lebensnotwendigen Assistenz angewiesen sind. Das bedeutet aber nicht, dass Assistenz durch Familienangehörige grundsätzlich abzulehnen ist, sondern weist nur auf die besonderen Bedingungen dieses Verhältnisses hin. Um schwierige Lebenssituationen und Abhängigkeitsverhältnisse zu vermeiden, können entsprechende Bildungs-, Hilfs- und Beratungsangebote unterstützend wirken. Ebenso ist eine soziale und ökonomische Sicherung der Personen, die Unterstützungsbedarfe im familiären Kontext leisten, unabdingbar. Dabei ist von einer "Weiblichkeit der Hilfe" (Blinkert & Klie 1999; Becker 2008) auszugehen. Diese Bezeichnung veranschaulicht prägnant, dass die Hauptpflegepersonen in den Familien meist pflegende Frauen sind. Diese Übernahme der Pflege birgt die Gefahr der Marginalisierung von Frauen, die Care[2] übernehmen sowohl am Arbeitsmarkt als auch in der sozialen Sicherung. (Geissler 2002, S. 189) Der Umstand, dass Care meist von Frauen übernommen wird, verweist auf die Notwendigkeit einer geschlechtergerechten Verteilung von Sorgetätigkeiten.
Die Analyse der Interviews zeigt, dass eine gewisse Kontinuität der Assistenz als Entlastung erlebt wird. Durch eine regelmäßige Zusammenarbeit kann sich ein eingespieltes Team entwickeln und eine zuverlässige Basis entstehen. Durch die Dauer der Beziehung entsteht Vertrautheit und Routinetätigkeiten können mühelos durchgeführt werden ohne ständige Anleitung zu erfordern. Hingegen durch den Weggang von langjährigen AssistentInnen müssen alltägliche Arbeitsabläufe mühevoll wieder erarbeitet werden. Zudem erleichtern langjährige und vertrauensvolle Beziehungen das Gewähren von Einblicken in persönliche und intime Bereiche des Lebens.
Aufgrund der besonderen Nähe zwischen AssistenznehmerInnen und AssistentInnen, die einerseits durch die körpernahe Arbeit, anderseits durch den Aufenthalt der AssistenInnen im privaten Bereich der AssistenznehmerInnen entsteht, wird auch die Verletzlichkeit dieser Beziehung deutlich. Eine gelungene Assistenzbeziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Deshalb besteht die unbedingte Forderung, dass das Vertrauensverhältnis zwischen AssistenznehmerInnen und AssistentInnen in keiner Weise zu missbrauchen ist. Die Untersuchung zeigt allerdings, dass es trotz dieses Anspruchs zu Verletzungen des Vertrauensverhältnisses kommen kann. Ein Interviewpartner (Herr A), der einen Vertrauensmissbrauch erlebt hat indem er bestohlen wurde, hat diesen Vorfall jedoch weder bei der Selbstbestimmt-Leben-Initiative gemeldet noch hat er andere Konsequenzen daraus gezogen. Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit einer professionellen Assistenzbegleitung, um AssistenznehmerInnen mit konfliktreichen Situationen nicht allein zu lassen.
Die Analyse der Interviews macht deutlich, dass das Assistenzmodell nicht nur ein Zugewinn an Freiheiten bedeutet, sondern an die AssistenznehmerInnen auch Anforderungen stellt. Das Assistenzmodell erfordert von den AssistenznehmerInnen eine Reihe von Kompetenzen, dies wird auch von den InterviewpartnerInnen so empfunden. In Übereinstimmung mit Kapitel 8.3 werden die Anforderungen von den InterviewpartnerInnen mit jenen von ArbeitgeberInnen verglichen. Das Angewiesen sein auf Unterstützung und das Wissen darum, dass man sich selbst darum kümmern muss, seine Assistenz zu organisieren, wird von den AssistenznehmerInnen durchaus auch als Belastungsprobe erlebt. Die Entscheidung für das Modell der Persönlichen Assistenz kann ein Zugewinn an Freiheiten bedeuten, bringt aber auch Unsicherheiten und das Tragen von Verantwortung mit sich.
Um auch Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu Persönlicher Assistenz zu erleichtern, erweitern Selbstvertretungsgruppen in der "People first" - Bewegung das Modell hin zu einem Unterstützungskonzept. Unterstützung geht in dieser Konzeption über die Aufgaben der Persönlichen Assistenz hinaus. Menschen, die Persönliche Assistenz in Anspruch nehmen, verfügen über eine Anleitungskompetenz, d.h., sie bestimmen, wie die konkrete Hilfeleistung, die sie brauchen, aussehen muss. In Abgrenzung dazu beschreiben Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht unbedingt bis ins Detail, welche konkrete Hilfeleistung sie gerade brauchen, sondern nennen sehr oft die Dinge, die sie nicht oder nicht so gut können. Daran erkennt die Unterstützungsperson den Hilfebedarf. (Göbel & Puschke, o.J.)
Dabei werden zwei Formen der Unterstützung unterschieden: Praktische Unterstützung (ähnlicher der Assistenz) und inhaltliche Unterstützung. Bei der inhaltlichen Unterstützung hat die Unterstützungsperson eine aktivere Rolle. Hier geht es darum, sein gesamtes Wissen zur Verfügung zu stellen (z.B. Informationsquelle sein, Ideen und Ratschläge geben, komplexe Abläufe strukturieren). (Göbel & Puschke, o. J.)
Im vermeintlichen Widerspruch zur Zielsetzung des Assistenzmodells, AssistenznehmerInnen zu mehr Selbstbestimmung zu verhelfen, empfinden die AssistenznehmerInnen zumindest zeitweise auch Abhängigkeiten von den AssistentInnen. Abhängigkeit und Hilfebedürftigkeit kann allerdings als existenzielle Bedingung des menschlichen Seins interpretiert werden. Nussbaum (2003) konstatiert, dass jede reale Gesellschaft eine fürsorge-spendende und fürsorge-empfangende Gesellschaft sei und daher Wege finden müsse, um mit diesen Fakten menschlicher Bedürftigkeit und Abhängigkeit klarzukommen. Wege, die vereinbar sind mit der Selbstachtung der Fürsorgeempfänger und die den Fürsorgespender nicht ausbeuten. (Nussbaum 2003, S. 183)
In Übereinstimmung mit Kapitel 8.4 fordern die AssistenznehmerInnen als "ExpertInnen in eigener Sache" anerkannt zu werden. Dies äußert sich dadurch, dass die AssistenznehmerInnen eine absolute Akzeptanz ihrer Person und ihrer Art der Lebensführung fordern. Es soll nach Aufforderung stellvertretend für ihre Person gehandelt werden und nach ihren Interessen. Dabei sollen die AssistentInnen eigene Ansichten zurückstellen. Die besondere Bedeutung dieser Forderung wird von Burtscher (1999) bestätigt. Selbstbestimmung wird gestärkt, wenn AssistentInnen auf Macht den Menschen mit Behinderung gegenüber zu verzichten. Das eigene zurücknehmen und Raum geben für das Unbekannte, für das Unsichere führt dazu, dass sich Selbstbestimmung und Selbstverantwortung entfalten können. (Burtscher 1999, im Internet)
Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Angaben hinsichtlich der Voraussetzungen der AssistentInnen widersprüchlich sind. Einerseits ist keiner der InterviewpartnerInnen der Meinung, dass eine Ausbildung im sozialen Bereich notwendig sei, um für diese Tätigkeit geeignet zu sein. Andererseits zeigen die Aussagen der InterviewpartnerInnen auch, dass hohe soziale Kompetenzen notwendig sind, um die Arbeit als AssistentIn gut erfüllen zu können. Die Tätigkeit der AssistentInnen erschöpft sich nicht darin, Anordnungen auszuführen. Für die Praxis sind entsprechendes Rollenverhalten, Distanz- Nähebalancierung, die Wahrung der Selbstbestimmung der AssistenznehmerInnen und die Fähigkeit Konflikte zu bearbeiten unverzichtbar. Mit dieser Tätigkeit ist ein hoher Anspruch an Fähigkeiten verbunden, die keineswegs selbstverständliche Grundfähigkeiten sind. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Laienarbeit kann in der Persönlichen Assistenz zu einem Problem werden.
Ein vielversprechendes Konzept, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können und traditionelle Vorstellungen vom Helfen aufzubrechen, ist der Empowerment-Ansatz. Denn Empowerment greift den Grundgedanken der Selbstbestimmung auf und integriert ihn in ein umfassendes Konzept. Empowerment bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Selbstbestimmung im Leben der Menschen zu erhöhen und ihnen zu ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenständig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten.
Assistenz gilt als ein Berufsfeld, in dem überwiegend Frauen tätig sind, mit all den typischen Attributen (geringes Einkommen, geringes Berufsprestige usw.), die mit Frauenberufen verbunden sind. Darüber hinaus sind mobile Unterstützungsformen wesentlich durch Entgrenzung gekennzeichnet: Arbeitsort/Betrieb, Person/Arbeitskraft, Arbeitszeit, Beschäftigungsverhältnis, Arbeitsrolle und Leistungsanforderungen. (Krenn 2004, S. 1)
Entgrenzung hinsichtlich Person/Arbeitskraft, d.h. der erweiterte Zugriff auf die Arbeitskraft im Sinne der Nutzung der Subjektivität der Arbeitskräfte, ist für das Assistenzmodell meines Erachtens besonders zentral. Emotionale Kompetenzen der fast ausschließlich weiblichen Arbeitskräfte werden dabei als nicht zertifizierte Fähigkeitsanteile unentgeltlich genutzt. Allerdings handelt es sich bei dem Zugriff auf die Subjektivität der Assistenzkräfte zum Großteil um eine auf weibliche Rollenzuschreibungen begrenzte und eingeengte Subjektivität, die als scheinbar natürliche Ressource mitgenutzt wird. Andererseits erfordert der interaktive Charakter personenbezogener Dienstleistungsarbeit selbst ein im Vergleich zu anderen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern verstärktes Einbringen der eigenen Subjektivität (ebd. S. 11)
Ein Gegenpol zu dieser Entgrenzung von Person/Arbeitskraft ergibt sich meines Erachtens aus der Feststellung sowohl der InterviewpartnerInnen dieser Untersuchung als auch von Ratzka (1988, S. 187) "Assistenz ersetzt uns Arme und Beine. Nicht mehr und nicht weniger." Daraus ergibt sich quasi eine Instrumentalisierung der AssistentInnen ohne deren Persönlichkeit zu berücksichtigen.
Durch diese gegensätzlichen Anforderungen, die AssistentInnen in der Praxis erfüllen müssen, wird eindrücklich der hohe Anspruch dieser Tätigkeit deutlich. Es gilt Wege zu finden, die sowohl die Selbstbestimmung und Selbstachtung der AssistenznehmerInnen wahren als auch das Selbst der AssistentInnen berücksichtigen.
Das Assistenzverhältnis ist gekennzeichnet durch eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen, deshalb kommt der Nähe-Distanzbalancierung eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich entscheiden AssistentInnen und AssistenznehmerInnen gemeinsam, ob die Beziehung zwischen ihnen über ein reines Arbeitsverhältnis hinaus geht. Rehfeld (2001) weist allerdings darauf hin, dass eine klare Rollenverteilung wichtig sei, um professionelle Assistenz zu gewähren und Machtübergriffen vorzubeugen (Rehfeld 2001a, S. 47). Hingegen Klie (2004, S. 378) geht davon aus, dass die Verknüpfung einer freundschaftlichen Beziehung mit einem Dienstverhältnis auch gut funktionieren könne. Um diesen ständigen Rollenwechsel zu bewerkstelligen, müssen allerdings beide Seiten die Fähigkeit besitzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und Grenzen zu setzen, was auch ein hohes Maß an Klarheit, Reflexion und Disziplin erfordert.
Die Untersuchung zeigt, dass in der Praxis sowohl freundschaftliche als auch distanzierte Beziehungen gelebt werden. Während Herr A und Herr B nahe, freundschaftliche Beziehungen bevorzugen, ist es Frau C und Frau D wichtig, Distanz zu den AssistentInnen zu wahren. Sie wollen Freundschaft und Assistenz klar voneinander trennen. Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Nähe- Distanzbalancierung in den Assistenzbeziehungen. Dieser Umstand könnte auf geschlechtsstereotype Rollenzuschreibungen zurückzuführen sein. Von Frauen wird in der Regel erwartet, dass sie für andere sorgen und für sie da sind, während Männer vorwiegend als diejenigen gelten, denen diese Fürsorge zusteht. Der seelische Konflikt behinderter Frauen wird dadurch verstärkt, dass die Abhängigkeit von anderen Personen zusätzlich als "weibliches Versagen" empfunden wird, weil "Frau" nicht für andere "sorgen" kann und sich stattdessen "versorgen" lassen muss. Demgegenüber ist es für Männer eher selbstverständlich, die Hilfe anderer (Frauen!) anzunehmen. (Eiermann 2000, S. 49f) Es ist möglich, dass Frauen deshalb mehr Distanz bevorzugen, um sich vor dem Gefühl des "weiblichen Versagens" zu schützen.
In Übereinstimmung mit der These, dass Persönliche Assistenz als die eine Methode gilt, die es ermöglicht, fremdbestimmender Fachlichkeit von HelferInnen und den Sachzwängen von Institutionen zu entgehen (Steiner 2001, S. 31), gehen die InterviewpartnerInnen davon aus, dass Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung wesentlich davon abhängt, dass sie den jeweiligen Unterstützungsbedarf durch Persönliche AssistentInnen decken können. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Ausrichtung der Unterstützung. Richtig verstandenes Helfen bedeutet assistieren, d.h. dem Betroffenen dabei zu assistieren, seine Ziele zu verwirklichen. (Hahn 1994, S. 91) Denn die Autonomie eines Menschen ist dann gefährdet, wenn das eigene Wirken ersetzt wird durch fremdbestimmte Vorgaben, die aus eigener Sicht nicht unbedingt als sinnvoll betrachtet werden können. (Hahn 1994, S. 86)
Die Aussagen der InterviewpartnerInnen machen deutlich, dass Persönliche Assistenz sich als ein Schlüsselbegriff verstehen lässt, wenn es darum geht, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung durchzusetzen.
Unter Berücksichtigung der von Wehmeyer und Kollegen (1992) bestimmten Charakteristika von Selbstbestimmung und der Betrachtung der Interviews, kann festgestellt werden, dass durch Persönliche Assistenz vermehrt Selbstbestimmung realisiert werden kann. Die Analyse der Interviews zeigt, dass folgende Charakteristika, unterstützt durch das Assistenzmodell, verwirklicht werden können:
-
"freie", autonome Entscheidung der Person
-
"Selbstaktualisierung" zum Beispiel im Sinne einer bewussten Nutzung eigener Stärken
-
Möglichkeit, selbst Ziele zu setzen und danach zu handeln
-
Initiativen, die vom Betroffenen ausgehen
-
Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände
-
Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen und auf eine "selbstrealisierende" Art (Wehmeyer 1992, S. 305)
Der Umstand, dass zahlreiche Charakteristika von Selbstbestimmung verwirklicht werden können, verweist auf das große Potenzial des Assistenzmodells.
Eine besondere Stellung unter den fünf Interviews nimmt die Befragung von Frau C ein. Die Betrachtung des gesamten Interviews von Frau C lässt eine hohe Sensibilität für Selbstbestimmung sowohl für sich selbst als auch für andere erkennen. Es zeigt sich, dass sie sehr großen Wert auf Selbstbestimmung in ihrem Leben legt und auch bemüht ist, diese in den unterschiedlichsten Lebensbereichen umzusetzen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte ihre Berufstätigkeit bei einer Organisation mit dem Schwerpunkt Selbstbestimmung für Menschen mit einer Behinderung sein. Dadurch hat eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Selbstbestimmungs-Paradigma stattgefunden. Dieser Umstand verweist auf die Notwendigkeit, sowohl AssistentInnen als auch AssistenznehmerInnen verstärkt die Möglichkeit zu geben, sich mit den vielfältigen Facetten des Selbstbestimmungsbegriffs auseinanderzusetzen.
Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass zur weiteren Verbesserungen des Assistenzmodells zusätzliche Veränderungen wünschenswert sind, um das Modell zu verbessern und seine Qualität zu steigern.
-
Es muss die Möglichkeit geboten werden, dass sich sowohl AssistenznehmerInnen als auch AssistentInnen mit dem Paradigma der Selbstbestimmung und dem Empowerment-Ansatz auseinandersetzen können. Auf Seiten der AssistentInnen steht dabei die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des Selbstbestimmt-Leben-Paradigmas und der Methode der Persönlichen Assistenz auf die eigene Fachlichkeit im Mittelpunkt. Hilfeabhängige Menschen entscheiden zu lassen und sich selbst in angemessener Weise zurückzunehmen, stehen dem traditionellen Verständnis von Helfen entgegen und muss erlernt werden.
-
Es besteht die Forderung, nach einem allgemeinen Recht auf Persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen. Allen Menschen mit Behinderung muss der Zugang zu Persönlicher Assistenz in den erforderlichen Bereichen gewährt werden, und zwar ohne Einschränkungen. Dies darf nicht dazu führen, wie der Fall von Frau D zeigt, dass die benötigte Arbeitsassistenz verweigert wird.
-
Zudem wäre es sinnvoll, das Assistenzmodell noch individueller und flexibler den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung anzupassen. Das beinhaltet vor allem gesicherte Vertretungen für Urlaubs- und Krankenstandszeiten.
-
Um Konfliktsituationen zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen zu minimieren, könnte die Möglichkeit zu regelmäßiger Supervision zwischen den beiden Parteien vorgesehen werden. Eine professionelle Assistenzbegleitung könnte ebenso dazu beitragen, spannungsreiche Situationen zwischen AssistentInnen und AssistenznehmerInnen zu lösen.
-
Es muss die Möglichkeiten gegeben sein, bei Organisatorischem oder bei der Auswahl von geeignetem Personal auf die kompetente Hilfe Dritter zurückgreifen zu können, wenn dieser Aufwand die AssistenznehmerInnen überfordert oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden kann.
-
Das Assistenzmodell ist vor allem an jene Personen gerichtet, die einen verhältnismäßig niedrigen Unterstützungsbedarf haben. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten vermehrt in dieses Konzept mit einzubeziehen. Es gilt inhaltliche, organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu gestalten, die auch für Menschen tragfähig sind, die Organisations-, Personal-, Anleitungs- und Finanzkompetenz nur in Teilbereichen wahrnehmen können.
-
Der Erfolg des Assistenzmodells spiegelt sich in erster Linie in der Zufriedenheit der NutzerInnen wieder. Deshalb müssen Modellentwicklungen und Beratungsangebote von Betroffenen mitgestaltet werden.
Mit dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, die vielfältigen Facetten des Selbstbestimmungsbegriffs in Zusammenhang mit dem Modell der Persönlichen Assistenz nachzuzeichnen. Ziel war es, einen Einblick in die Wahrnehmungen und Erlebniswelten der AssistenznehmerInnen zu erhalten.
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ist nicht nur rechtlich erwünschte oder gewollte Handlungsorientierung, sondern vielmehr ein unbedingter Sollanspruch. Ein wesentlicher Schritt in Richtung Umsetzung dieser Forderung ist das Assistenzmodell. Das Hilfesystem der Assistenz ist grundsätzlich ein Subjektorientiertes, "bedarfsgerechtes und flexibles Konzept, das die Betroffenen dort abholen will, wo sie sich gerade befinden". (Theunissen & Plaute 1995, S. 64) Ziel des Assistenzmodells ist es, den AssistenznehmerInnen dazu zu verhelfen, das Selbstverfügungsrecht über die eigene Person zu beanspruchen. Er/sie soll über seinen/ihren Körper und den Umgang der HelferInnen damit, über seine/ihre Zeit, insbesondere seinen/ihren Tagesablauf, und seinen/ihren Lebensstil selbst verfügen können. Der Selbstbestimmungsgedanken muss dabei aber auch Verstehen beinhalten. "Verstehen heißt verständnisvolles Reagieren, Vorschläge machen und in Dialog treten, bezogen auf die jeweilige Situation" (Schönwiese 2003, im Internet)
Diese Zielsetzungen des Assistenzmodells weisen allerdings auch auf den damit verbundenen hohen Anspruch an die AssistentInnen hin. Dieser Umstand deutet auf die Notwendigkeit von Ansätzen bezüglich der Frage nach den Qualifikationen der AssistentInnen hin, die bislang ungeklärt bleiben.
Einige AssistenznehmerInnen stehen einer Professionalisierung des Assistenzberufs aufgrund der Befürchtung, dass diese zu erneuter Fremdbestimmung führen kann, allerdings eher skeptisch gegenüber. Diese Befürchtung ist sicher nicht unbegründet. Wenn sich aber die Qualifizierung der AssistentInnen wesentlich am Selbstbestimmungs-Paradigma und am Empowerment-Konzept orientiert, könnten meines Erachtens sowohl AssistenznehmerInnen als auch AssistentIennen davon profitieren.
Sorgende und Sorgeempfangende müssen die Sorgebeziehung mit ihren Dimensionen von Macht und Ohnmacht, Abhängigkeit und Unabhängigkeit aushalten können. Solche Sorgebeziehungen setzten sensibilisierende Handlungsrahmen voraus, die auf Kompetenzen und Empathiefähigkeit beruhen und Fachkenntnisse sowie lebensweltliche Fertigkeiten einschließen. (Toppe 2010, S. 81)
Die vorliegende Untersuchung deutet darauf hin, dass das Modell der Persönlichen Assistenz die nötigen Bedingungen zur Realisierung der Zielsetzungen schafft und unterstreicht damit das große Potenzial dieser Unterstützungsform zur Selbstbestimmung und Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung.
Der Ansatz des Assistenzmodells scheint dabei auch für andere soziale Bereiche zukunftsweisend zu sein. Beispielsweise stellt er auch traditionelle Großeinrichtungen in der Altenhilfe in Frage und eröffnet damit neue Perspektiven für zahlreiche ältere Menschen, die ein Leben in Heimen fristen, obwohl ihr Unterstützungsbedarf durch Persönliche Assistenz gedeckt werden könnte.
Die Untersuchung versucht allerdings auch gesellschaftliche Entwicklungen nachzuzeichnen, die Selbstbestimmungsrechte der Menschen betonen und ermöglichen, parallel dazu aber auch durch die zunehmende Brüchigkeit wohlfahrtsstaatlicher Hilfs- und Unterstützungsleistungen zu einer Verschiebung gesellschaftlicher Anforderungen ins Private führen: Erst der Neoliberalismus schaffte die Voraussetzungen für die Selbstbestimmung auch für Menschen mit einer Behinderung. Gleichzeitig lassen sich allerdings auch Tendenzen erkennen, dass Selbstbestimmung zunehmend im Sinne von Selbstverantwortung interpretiert wird und zum "neoliberalen Pflichtprogramm" (Stinkes 2000, S. 170) wird, mit all den (individuell zu tragenden) Risiken, die es für Menschen mit Unterstützungsbedarf haben kann.
Kritisch anzumerken bleibt, dass Selbstbestimmung die Gefahr der erneuten Ausgrenzung durch Isolation in sich birgt, wenn sie nicht auf der Grundlage sicherer sozialer Beziehungen entfaltet wird.
Abels, Heinz (2006): Identität. Wiesbaden
Baudisch, Winfried (2000): Selbstbestimmt leben trotz schwerer Behinderungen? Münster
Becker, Regina (2008): Beratung von pflegenden Angehörigen: Eine queer-feministische Diskursanalyse. Kasseler Gerontologische Schriften. Bd. 45. Kassel
Bintinger, Gitta & Wilhelm, Marianne (2001): Inklusiven Unterricht gestalten. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh2-01-bintinger-inklusiv.html Stand: 03.08.2010
Blinkert, B. & Klie, Th. (1999): Pflege im sozialen Wandel: eine Untersuchung über die Situation von häuslich versorgten Pflegebedürftigen nach Einführung der Pflegeversicherung. Hannover
Bozien, Monika (1993): Kontrolle über das eigene Leben gewinnen - Empowerment als professionelles Konzept in der Selbsthilfeunterstützung. In: Blätter der Wohlfahrtspflege 2, S. 46 - 49
Bollnow, Otto Friedrich (1963): Mensch und Raum. Stuttgart
Brown, Christy (1990): Mein linker Fuß. Berlin
Brumlik, Micha & Holtappels Heinz G. (1993): Mead und die Handlungsperspektive schulischer Akteure - interaktionistische Beiträge zur Schultheorie. In: Tillmann, K.-J. [Hrsg.]: Schultheorien. Hamburg, S. 89 - 103
Buber, Martin (1962): Schriften zur Philosophie, Bd. I, Gesammelte Werke. München
Burtscher, Reinhard (1999): Behindertenpolitik und Emanzipation. Aktuelle Situation der Integration. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/burtscher-politik.html#id2980835 - Stand. 12.07.2010
Capra, Fritjof (1985): Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. Bern/München/Wien
Cloerkes, Günther (1997): Soziologie der Behinderten. Heidelberg
Cloerkes, Günther (2000): Die-Stigma-Identitätsthese. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-stigma.html#id2744835 - Stand: 12.07.2010
Cloerkes, Günther (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidelberg
Combrink, Barbara (1997): Pflegeformen wirken auf Abhängigkeit. In: Aktuelle Gespräche. Berichte, Kommentare, Interviews, 45. Jg., Heft 1, S. 14 - 21
Dederich, Markus (2001): Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung. Bad Heilbrunn
Dederich, Markus (2003): Gibt es ein Recht auf Anderssein? Überlegungen zu einer Ethik der Anerkennung. Online unter: http://www.beratungszentrum-alsterdorf.de/cont/GibteseinRechtaufanderssein(3).pdf - Stand 12.07.2010
Dederich, Markus (2004): ‚Bioethik', Menschenwürde und Behinderung. Online unter: http://www.fk-reha.uni-dortmund.de/Theorie/pdf/Bioethik.pdf - Stand 13.07.2010
Dederich, Markus (2006): Einsame Selbstbestimmung statt fürsorglicher Gemeinschaft - ist das die Zukunft für Menschen mit Behinderungen? Online unter: http://www.lvr.de/Soziales/service/veranstaltungen/veranstaltungsreihe/vortragdederich.pdf Stand: 04.08.2010
Dederich, Markus & Jantzen, Wolfgang (2009) [Hrsg.]: Behinderung und Anerkennung. Stuttgart
Doose, Stefan (2006): Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. Marburg
Doose, Stefan (2007): "I want my dream!" Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-zukunftsplanung.html - Stand: 15.10.2010
Dreitzel, Hans-Peter (1972): Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft. Vorstudien zu einer Pathologie des Rollenverhaltens. Stuttgart
Drolshagen, Birgit & Rothenberg, Birgit (1999): Selbstbestimmt Leben als Lebensperspektive sehgeschädigter Menschen. Eine Herausforderung auch für die Sehgeschädigtenpädagogik. In: Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik [Hrsg.]: XXXII. Kongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen "Lebensperspektiven", S. 249 - 271
Drolshagen, Birgit et al. (2001): Handbuch Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Ein Schulungskonzept für AssistenznehmerInnen. Band A. Neu-Ulm
Eberwein, Hans (2002): Vorwort. In: Rösner, H.-U.: Jenseits normalisierender Anerkennung. Reflexion zum Verhältnis von Macht und Behindertsein. Frankfurt a.M.
Ebert, Harald (2000): Menschen mit geistiger Behinderung in der Freizeit. Bad Heilbrunn/Obb
Eiermann, Nicole et. al. (2000): Live. Leben und Interessen vertreten - Frauen mit Behinderung. Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit Körper- und Sinnensbehinderungen. Stuttgart
Engelmeyer, Elisabeth (2000): "Das soll mal schön ausbleiben!" - die Forderung nach Respekt als Voraussetzung und Bedingung für Selbstwert, Selbstachtung und Selbstvertretung. In: Windisch/Kniel [Hrsg.] a.a.O., S. 102 - 114
Feuser, Georg (1995): Die Lebenssituation geistig behinderter Menschen. In: AG SPAK [Hrsg.]: Leben auf eigene Gefahr. München S. 258 - 286
Feuser, Georg (2006): Advokatorische Assistenz für Menschen mit Autismus-Syndrom und/oder geistiger Behinderung. Widerspruch oder Chance? Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-advokat.html - Stand: 01.06.2010
Flick, Uwe at al.(Hrsg.) (2007): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Flieger, Petra (2000): Freizeit mit Hindernissen. Wie Kinder mit Behinderung ihre Freizeit erleben, die Sicht ihrer Eltern und was Anbieter von Freizeitaktivitäten dazu sagen. Bericht zur Lage der Kinder 2000. Wien
Franz, Alexandra (2002): Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Eine alternative Lebensform behinderter Frauen. Neu-Ulm
Frehe, Horst (1990): Thesen zur Assistenzgenossenschaft, in: Behindertenzeitschrift LOS Nr. 26/1990
Frehe, Horst (1999): Persönliche Assistenz - eine neue Qualität ambulanter Hilfe. In: Jantzen, Wolfgang [Hrsg.]: Deinstitutionalisierung als Kern von Qualitätssicherung. Berlin S. 271 - 284)
Frehe, Horst (2007): Selbstbestimmung als Grundlage der Behindertenpolitik. Online unter: http://www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/Termine_und_Vernetzung/Arbeitskreise/AK_Soziales/2007_Vortrag_Frehe_Selbstbestimmte_Behindertenpolitik.pdf Stand: 15.07.2010
Friebertshäuser, Barbara (1997): Interviewtechniken - ein Überblick! In: Friebertshäuser, Barbara; Prengel, Annedore [Hrsg.]: Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim, München, S. 371-395.
Frey, Hans-Peter (1983): Stigma und Identität. Eine empirische Untersuchung zur Genese und Änderung krimineller Identität bei Jugendlichen. Weinheim/Basel
Friese, Marianna (2010): Die ‚Arbeit am Menschen'. Bedarfe und Ansätze der Professionalisierung von Care Work. In: Moser, V. & Pinhard, I. [Hrsg.]: Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft. Care - wer sorgt für wen? Opladen
Fronefeld, Barbara (2000): Selbstbestimmung und Erziehung von Menschen mit Behinderung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, 1 S. 27 - 34 Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-00-selbstbestimmung.html Stand: 04.08.2010
Frühauf, Theo (1995): Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung - Herausforderung für Betroffene und Fachleute. In: Berufsverband für Heilerziehung, Heilerziehungspflege und -hilfe in der Bundesrepublik Deutschland [Hrsg.]: Wehr/Baden, Heft 4 S. 6 - 18
Frühauf, Theo u.a. (Hg.) (1996): Selbstbestimmung. Kongressbeiträge. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Lebenshilfe Verlag
Geissler, Birgit (2002): Die (Un)Abhängigkeit in der Ehe und das Bürgerrecht auf Care. Überlegungen zur Gendergerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat. In: Gottschall, Karin et. al.: Zukunft der Arbeit und Geschlecht. Diskurse, Entwicklungspfade und Reformoptionen im internationalen Vergleich. Opladen
Göbel, Susanne & Puschke, Martina (o.J.): Was ist Unterstützung für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Abgrenzung zu Assistenz? Online unter: http://www.people1.de/02/t/05forderungskatalog.shtml Stand: 03.08.2010
Goffman, Erving (1967): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt a. M.
Goffman, Erving (1973): Asyle: Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt a.M
Gromann-Richter, Petra (1993): Was wollen Patienten und Patientinnen und kann regionale Versorgung beim Aufbau komplementärer Einrichtungen aussehen? In: Aktion psychisch Kranke [Hrsg.]: Enthospitalisierung statt Umhospitalisierung. Bonn S. 55 - 59
Haeberlin, Urs (1978): Identitätskrisen. Theorie und Anwendung am Beispiel des sozialen Aufstiegs durch Bildung. Bern/Stuttgart
Haeberlin, Urs (1996): Selbständigkeit und Selbstbestimmung für alle - pädagogische Vision und gesellschaftliche Realität. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 12, S. 186 - 192
Hahn, Martin (1981): Behinderung als soziale Abhängigkeit. Zur Situation schwerbehinderter Menschen. Gammertingen
Hahn, Martin (1994): Selbstbestimmung im Leben, auch für Menschen mit geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung 33 (2) S. 81 - 94
Hähner, Ulrich (1997): Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung: Fragmente zur geschichtlichen der Arbeit mit "geistig behinderten Menschen" seit 1945.Hähner, U. u.a. [Hrsg.] In: Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg S. 25 - 51
Haupt, Ursula (2007): Zum Problem der Fremdbestimmung in Therapie und Förderung körperbehinderter Kinder. In: Haupt, U. & Wieczorek, M. [Hrsg.]: Brennpunkte der Körperbehindertenpädagogik. Stuttgart, S. 51 - 64
Herriger, Norbert (2006a): Empowerment in der sozialen Arbeit. Stuttgart
Herriger, Norbert (2006): Stichwort Empowerment. Online unter: http://www.empowerment.de/materialien/materialien_1.html Stand: 15.07.2010
Hoffmann, Claudia (1999): Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung - Einführung in die Leitterminologie. In: Theunissen, G.; Ling, A. [Hrsg.]: Wohnen und Leben nach der Enthospitalisierung. Perspektiven für ehemals hospitalisierte und alte Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung. Bad Heilbrunn, S. 16 - 27
Hohmeier, Jürgen (1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess. In: Brusten, Manfred & Hohenmeier, Jürgen [Hrsg.]: Stigmatisierung. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied/Darmstadt. S. 5 - 25
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.: Leben mit Assistenz. Online unter: http://www.isl-ev.de/2005/06/21/leben-mit-assistenz/ Stand: 10.06.2010
Jantzen, Wolfgang (1996): Diagnostik, Dialog und Rehistorisierung. In: Jantzen, W.; Lanwer-Koppelein, W. [Hrsg.]: Diagnostik als Rehistorisierung. Berlin
Jantzen, Wolfgang (1998): Die Zeit ist aus den Fugen. Behinderung und postmoderne Ethik. Marburg
Jennessen, Sven (2008): Leben geht weiter... Neue Perspektiven der sozialen Rehabilitation körperbehinderter Menschen im Lebenslauf. München
Jerg, Jo (2007): Projekt Bo(d)yzone: Jungensichten - Körperbilder.Basistexte zur inklusionsorientierten Jungenpädagogik. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/jerg-bodyzone.html#id3030614 - Stand: 13.07.2010
Keupp, Heiner (1990): Gemeindepsychologie. In Speck, Otto [Hrsg.] Sonderpädagogik und Sozialpädagogik. Handbuch der Sonderpädagogik Bd. 10. Berlin S. 107 - 122
Klafki, Wolfgang (1977): Organisation und Interaktion in pädagogischen Feldern. In: Zeitschrift für Pädagogik. 13. Beiheft S. 11 - 38
Klauß, Theo (2005): Ein besonderes Leben. Grundlagen der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Heidelberg
Klauß, Theo (2007): Selbstbestimmung als Leitidee der Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Online unter: http://www.ph-heidelberg.de/org/allgemein/fileadmin/user_upload/wp/klauss/Selbstbestimmung.pdf - Stand: 13.07.2010
Klie, Thomas & Spermann, Alexander [Hrsg.] (2004): Persönliche Budgets - Aufbruch oder Irrweg? Ein Werkbuch zu Budgets in der Pflege und für Menschen mit Behinderungen. Hannover
Krenn, Manfred et. al. (2004): Soziale Dienste (Mobile Pflege) in Österreich - Skizze eines Sektors. Online unter: http://www.node-research.at/dokumente/upload/0024/05EAP%20%20Diskussionspapier%205%20Papouschek-Krenn-Simsa.pdf - Stand: 15.07.2010
Krappmann, Lothar (2000): Soziologische Dimensionen der Identität. Stuttgart
Lamnek, Siegfried (1988): Qualitative Sozialforschung 1. Weinheim
Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung. Weinheim
Lindmeier, Christian (1999): Selbstbestimmung als Orientierungsprinzip der Erziehung und Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung - kritische Bestandsaufnahme und Perspektive. In: Die neue Sonderschule, 44. Jg., 3/1999, S. 209 - 224
Mängel, Annett (2009): Endstation Sonderschule. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 9/2009 S. 20 - 23 Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/maengel-sonderschule.html Stand: 03.08.2010
Mattner, Dieter & Gerspach, Manfred (1997): Heilpädagogische Anthropologie. Stuttgart
Maturana, Humberto R. & Varela, Francisco, J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern/München
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim/Basel
Markowetz, Reinhard (1998): Kinder und Jugendliche mit Behinderung auf ihrem Weg in einen ganz "normalen" Verein. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 21. Ausgabe 03, S. 1 - 46
Markowetz, Reinhard (2001): Freizeit behinderter Menschen. - In: Cloerkes, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidelberg S. 259-293
Mead, George (1968): Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt a.M.
Miles-Paul, Ottmar (1992): Selbstbestimmung Behinderter. Ein neues Denken erobert die Behindertenpolitik. In: Pro Infirmis 5/6, S. 9 - 14
Miles-Paul, Ottmar & Frehse, Uwe (1994): Persönliche Assistenz. Ein Schlüssel zum selbstbestimmten Leben Behinderter. In: Gemeinsam Leben, Heft 2, S. 12 - 16
Mohr, Lars (2004): Ziele und Formen heilpädagogischer Arbeit. Luzern
Mohr, Lars (2006): Was bedeutet "Assistenz"? In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 11/06 S. 18 - 23
Moosecker, Jürgen (2004): "Selbstbestimmung" in anthropologischem und pädagogischem Blickwinkel. In: Sonderpädagogik, 34, 2, S. 107 - 117
Münch, Richard (2002): Soziologische Theorie. Band 2. Frankfurt am Main
Niehoff, Ulrich (2000): Wie viel Pädagogik verträgt die Freizeit? In: Geistige Behinderung 39, Heft 4, S. 309-312
Niehoff, Ulrich (2001): Selbstbestimmung, Assistenz, Begleitung. Professionelles Handeln unter neuen Paradigmen. In: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e. V. (DHG) (2001). Hilfe nach Mass?! Köln/Düren, S. 10 - 16
Niedermair, Claudia (2002): Zur Pragmatik der Vision einer Schule für alle: integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg. Innsbruck
Nussbaum, Martha (2003): Langfristige Fürsorge und soziale Gerechtigkeit. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2, S. 179 - 198
Osbahr, Stefan (2000): Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Luzern
Österwitz, Ingolf (o.J.): Das Konzept "Selbstbestimmt Leben" - ein neues Paradigma in der Rehabilitation? Online unter: http://www.assista.org/files/Oesterwitz94.pdf - Stand: 13.07.2010
Österwitz, Ingolf (1996): Das Konzept Selbstbestimmt Leben - eine neu Perspektive in der Rehabilitation? In: Zwierlein, Eduard [Hrsg.]: Handbuch Integration und Ausgrenzung. Neuwied u.a. 1996, S. 196 - 205
Rabe-Kleberg, Ursula (1991): Dienstleistungsberufe in Krankenpflege, Altenpflege und Kindererziehung: Pro Person, Bielefeld
Ratzka, Adolf (1988): Aufstand der Betreuten. Stil - Persönliche Assistenz und Independent Living in Schweden. In: Mayer, Anneliese & Rütter, Jutta [Hrsg.]: Abschied vom Heim - Erfahrungsbericht aus Ambulanten Diensten und Zentren für Selbstbestimmtes Leben. München, S. 183 - 201
Rehfeld, Silke (2001) (a): Das Modell der Persönlichen Assistenz - Eine Einführung für Persönliche Assistentinnen. In: MOBILE (2001). Handbuch Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Ein Schulungskonzept für Persönliche AssistentInnen. Dortmund/Köln, S. 47 - 52
Rehfeld, Silke (2001) (b): Die Beziehung zwischen der Assistenznehmerin und der Persönlichen Assistentin. In: MOBILE (2001). Handbuch Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Ein Schulungskonzept für Persönliche AssistentInnen. Dortmund/Köln, S. 141 - 184
Renner, Gregor (2004): Theorie der unterstützen Kommunikation. Eine Grundlegung. Berlin
Rohrmann, Eckhard (1994): Integration und Selbstbestimmung für Menschen, die wir geistig behindert nennen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 1, S. 19 - 28
Rösner, Hans-Uwe (2002): Jenseits normalisierender Anerkennung. Frankfurt a. M.
Rülcker, Tobias (1990): Selbständigkeit als pädagogisches Zielkonzept. In: Preuss-Lausitz, Ulf & Rülcker, Tobias u.a. [Hrsg.]: Selbständigkeit für Kinder - die große Freiheit? Weinheim Basel, S. 20 - 27
Sack, Rudi (1997): Emanzipierende Hilfen beim Wohnen. In: Hähner, U. [Hrsg.]: Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg
Sack, Rudi (1999): Normalisierung der Beziehungen. Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Begleiter. In: Hähner, U. u.a. [Hrsg.]: Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg
Schlüter, Martina (2010): Das Leben mit einer angeborenen Körperbehinderung - eine Literaturanalyse von sechs Autobiographien. In: Empirische Sonderpädagogik, Nr. 1, S. 95 - 105
Scholz, Stefan (2006): Selbstbestimmt Leben mit Dialogischer Assistenz für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Online unter: http://www.behindertenreferat.uni-oldenburg.de/download/Reader_Vortrag1.pdf Stand: 10.06.2010
Schönwiese, Volker (2009): Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Grundsätze und Hinweise zu ihrer Bedeutung für die Unterstützung von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. In: Rödler, Peter; Berger, Ernst; Jantzen, Wolfgang [Hrsg.]: Es gibt keinen Rest! - Basale Pädagogik für Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. Neuwied S. 26 - 39
Schönwiese, Volker (2003): Selbstbestimmt Leben - eine Herausforderung für Professionelle. Online unter: http://www.beratungszentrum-alsterdorf.de/cont/Selbstbestimmtleben(2).pdf - Stand 05.04.2010
Schuppener, Saskia (2005): Selbstkonzept und Kreativität von Menschen mit geistiger Behinderung. Bad Heilbrunn
Seifert, Monika (2007): Lebensqualität. In: Theunissen, G. [Hrsg.]: Handlexikon Geistige Behinderung. Stuttgart S. 205
Sierck, Udo: Mißachtet - Ausgesondert - Vernichtet. Zur Geschichte der Krüppel. In: Wunde,r Michael / Sierck, Udo (Hg.): Sie nennen es Fürsorge. Behinderte zwischen Vernichtung und Widerstand, Frankfurt am Main (Dr. med. Mabuse) 1987. Seite 27-42. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/mabuse_sierck-krueppel.html - Stand 12.07.2010
Speck, Otto (1988): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. München
Speck, Otto et. al. (1999): Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten. Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum selbständigen Leben. Online unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/vif-selbstbestimmung.html#id2780539 Stand. 03.08.2010
Speck, Otto (2001): Autonomie und Kommunität - Zur Fehldeutung von Selbstbestimmung in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen. In: Theunissen, Georg [Hrsg.]: Verhaltensauffälligkeiten - Ausdruck von Selbstbestimmung? Bad Heilbrunn S. 11 - 32
Stark, Wolfgang (1996): Empowerment. Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Praxis. Freiburg
Steiner, Gusti (1999): Selbstbestimmung und Assistenz. In: Gemeinsam Leben. Heft 3, S. 104 - 110
Steiner, Gusti (2001): Selbstbestimmung und Persönliche Assistenz. In: MOBILE - Selbstbestimmt Leben Behinderter e.V. [Hrsg.]: Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz. Ein Schulungskonzept für AssistenznehmerInnen Band A. Neu Ulm S. 31 - 52
Stinkes, Ursula (2000): Selbstbestimmung - Vorüberlegung zur Kritik einer modernen Idee. In: Bundschuh, Konrad [Hrsg.]: Wahrnehmen, Verstehen, Handeln. Bad Heilbrunn, S. 169 - 193
Taylor, Charles (1993): Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt a.M.
Theunissen, Georg & Plaute, Wolfgang (1995): Empowerment und Heilpädagogik: Ein Lehrbuch. Freiburg
Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung. Empowerment in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Bonn
Theunissen, Georg (2005): Empowerment als Handlungsorientierung für die Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen. Online unter: http://www.lebenshilfe-aktiv.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/downloads/Theunisse-Empowerment.pdf - Stand 12.07.2010
Theunissen, Georg (2008): Förderung seelischer Gesundheit von Menschen mit geistiger Behinderung - Überlegungen im Lichte von Selbstbestimmung und Empowerment. Online unter: http://www.dgsgb.de/downloads/band%2013.pdf#page=23 - Stand: 27.04.2010
Theunissen, Georg (2009): Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Freiburg
Thimm, Walter (1975): Lernbehinderung als Stigma. In: Brusten, M. & Hohmeier, J. [Hrsg.]: Stigmatisierung. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Neuwied, Darmstadt
Thimm, Walter (2005): Haus Hall und anderswo - Orte zum Leben? Online unter: http://www.haushall.de/contenido/cms/upload/pdf/Publikationen/Vortrage/Thimm.pdf Stand: 04.08.2010
Toppe, Sabine (2010): Care-Ethik und Bildung - Eine neue "Ordnung der Sorge" im Rahmen von Ganztagsbildung? In: Moser, V. & Pinhard, I. [Hrsg.]: Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft. Care - Wer sorgt für wen?
Ungern-Sternberg von, Jürgen (2009): Griechische Studien. Band 266. Berlin
Waldschmidt, Anne (1999): Selbstbestimmung als Konstruktion. Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer. Opladen
Waldschmidt, Anne (2003): Selbstbestimmung als behindertenpolitisches Paradigma - Perspektiven der Disability Studies. APuZ B8/2003. S. 13 - 20 Online unter: http://www.bpb.de/files/Q72JKM.pdf - Stand. 12.07.2010
Waldschmidt, Anne (2004): Die Selbstbestimmung behinderter Menschen heute - Verheißung oder Verpflichtung? Online unter: http://www.beratungszentrum-alsterdorf.de/cont/Waldschmidt(3).pdf Stand: 03.08.2010
Walther, Helmut (1999): Selbstverantwortung - Selbstbestimmung - Selbständigkeit. Bausteine für eine veränderte Sichtweise von Menschen mit einer Behinderung. In: Hähner, Ulrich et. al.: vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg S. 69 - 90
Warning, Rolf (2002): Sonderpädagogik. Lernen, Verhalten, Sprache, Bewegung und Wahrnehmung. München
Wehmeyer, Michael L. (1992): Self-Determination and the Education of Students with Mental Retardation. In: Education and Training in Mental Retardation. S. 302 - 314
Willms-Herget, Angelika (1985): Frauenarbeit. Zur Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt. Frankfurt a.M.
Zander, Michael (2008): Selbstbestimmung, Behinderung und Persönliche Assistenz - politische und psychologische Fragen. Online unter: http://web33.server-drome.info/Brensell%20PDFs/Brensell_Reader_Schwerpunkt2.pdf Stand: 12.06.2010
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Innsbruck, August 2010
Karin Maria Schiefer
usw. = und so weiter
bzw. = beziehungsweise
z.B. = zum Beispiel
u.U. = Unter Umständen
d.h. = das heißt
etc. = et cetera
f.= folgende (Seite)
ff. = fortfolgende (Seiten)
vgl. = vergleiche
Abbildung 1: Duisburger Erklärung S. 9
Abbildung 2: Unterschiede zwischen herkömmlicher
Behindertenhilfe und dem Empowerment-Konzept S. 13
Abbildung 3: Identität und mögliche Störungen angelehnt an Thimm S. 21
Abbildung 4: Stigma-Identitäts-These S. 22
Abbildung 5: Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung S. 32
Abbildung 6: Das Modell der Persönlichen Assistenz als Form selbstorganisierter Hilfe S. 50
Tabelle 1: Demographische Daten S. 49
Tabelle 2: Familie S. 49
Tabelle 3: Behinderung S. 49
Tabelle 4: Persönliche Assistenz S. 50
Persönliche Daten:
Karin Maria Schiefer
Geboren am 19.03.1979
Wohnhaft in Meran
Schulbesuche:
1985 bis 1991
Grundschule St. Martin i.P.
1991 bis 1993
Mittelschule St. Martin i.P.
1993 bis 1997
Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus
"Peter Mitterhofer" in Meran
2005/2006
Abendschule "AZB" Meran
Seit 2006
Universität Leopold Franzen Innsbruck
Institut für Erziehungswissenschaften
Seit 2008
Studienzweig "Erziehung - Generationen - Lebenslauf"
Prüfungen:
Juni 1997
Fachprüfung der Sektion Datenverarbeitung
an der Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus
November 1997
Zweisprachigkeit der Laufbahn "C"
Juli 2006
Maturaprüfung
an der Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus
November 2008
Zeugnis über die erste Diplomprüfung
Berufstätigkeit:
20.01.1998 bis 30.09.1999
Verwaltungsassistentin Gemeinde St. Leonhard
01.10.1999 bis 29.02.2000
Assistentin Sportarzt Dr. Max Regele
19.03.2000 bis 30.04.2005
Verwaltungsassistentin Sanitätsbetrieb Meran
Quelle:
Karin Maria Schiefer: Selbstbestimmt leben mit Persönlicher Assistenz
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie eingereicht von Karin Maria Schiefer bei Ao. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese, Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold-Franzen-Universität Innsbruck
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 09.12.2010
