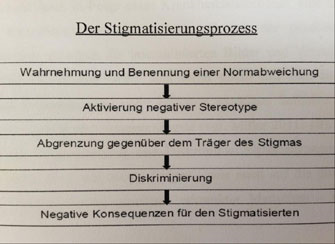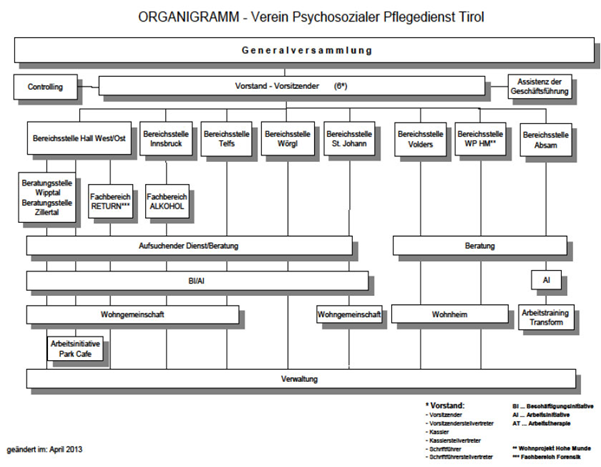Handlungsempfehlungen für die praktische klinische soziale Arbeit
Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts; Fachhochschule Vorarlberg Studiengang Soziale Arbeit; Eingereicht bei Prof.in (FH) Dr.in Erika Geser-Engleitner
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Danksagung
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Zugänge zum Thema Stigmatisierung
- 3. Forensische Nachsorgebegleitung des PSPPsychosozialer Pflegedienst Projekts RETURN
- 4. Methodik
- 5. Auswertung der ExpertInnenbefragung
- 6. Diskussion
- Literaturverzeichnis
- 7. Anhang
- Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Danken möchte ich in erster Linie meiner Familie, die mir mein Studium ermöglicht und mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt hat.
Theresa, danke für die unablässige und motivierende Unterstützung im Prozess meiner Arbeit.
Außerdem danke ich meinen lieben Kolleginnen des PSP Park Café für die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten, die mir meine Anwesenheitszeiten an der FH ermöglicht haben und die außerdem jederzeit ein offenes Ohr für mich hatten.
Besonders danke ich Lisa für das Korrekturlesen und ihre wertvollen strukturellen Hinweise.
Vor allem aber gilt mein Dank meiner Betreuungsprofessorin Prof.in Dr.in Erika Geser-Engleitner für die sehr gute Zusammenarbeit, die konstruktive Kritik und ihr „Mitleben“ an meiner Begeisterung.
Mein Interesse an dieser hier vorliegenden Master-Thesis wurde durch meine Arbeit in der PSP Arbeitsinitiative Park Café, einer tagesstrukturierenden sozialpsychiatrischen Rehabilitationsmaßnahme im Gelände des psychiatrischen Krankenhauses in Hall/Tirol geweckt. Die Grundidee dieser Arbeit war auf individuelle Stigmatisierungserfahrungen von Menschen ausgelegt, die über die forensisch-psychiatrische Nachsorgebegleitung des PSP Projekts RETURN in Tirol betreut werden zu hinterfragen und in Folge dessen Bewältigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In der Recherche wurde deutlich, dass Stigmatisierung eine zwanghafte Erfahrung ist, die jedenfalls prägend wirkt. Die Wirkung ist zudem selbstprophezeihend in dem Sinne, als dass die stigmatisierte Person die Kränkung übernimmt. Diese Lebenserfahrung/en kann/können zu Delinquenz und Selbstentfremdung (psychischen Erkrankungen und Störungen) führen. Stigmatisierung als Wort ist aus dem Sprachgebrauch fast verschwunden, aber die Handlung und die Methode sind nach wie vor präsent. Stigmatisierung ist des Weiteren eine Rollenzuschreibung, die vom Individuum oft im Einzelnen nicht (mehr) wahrgenommen wird. Stigmatisierungserfahrungen können demnach ausschließlich als Erfahrungen, die aufgenommen werden, erkannt und beschrieben werden. Es ist demnach aus Sicht der Verfasserin als betroffener Mensch nicht möglich, Stigmatisierung konkret fest zu machen. Der Zeitpunkt, an dem Menschen ein Delikt setzen, psychische Krisen erleiden oder eine Kombination aus beidem auftritt, (forensisch-psychiatrischer Kontext) werden sie stigmatisiert, was bedeutet, dass Menschen das Phänomen, welches im theoretischen Abriss genauer erläutert wird, zu diesem Zeitpunkt noch nicht als schmerzhafte Erfahrung (in ihrer Intensität und langfristigen Wirkung) erfassen können. Metaphorisch gedacht könnte man sich Stigmatisierung in Anlehnung an den Soziologen Hohmeier (vgl. Hohmeier 1975) wie eine Hülle, einen durchsichtigen Mantel vorstellen, die/der sich um den Menschen herum ausbreitet und beständig bleibt. Es besteht einzig und allein die Möglichkeit sowie die Chance, einen persönlichen Umgang damit zu finden. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten: Stigmatisierung wird oft verschwiegen, verdrängt oder nicht wahrgenommen, wird aber auf der Handlungsebene deutlich.
Forschungsergebnisse belegen die Tatsache, dass die problematisch zu beurteilenden negativen Zuschreibungen an Menschen mit (forensisch-) psychiatrischen Lebenshintergründen das Gesamtbild unserer Gesellschaft und der Betroffenen selbst prägen und dazu beitragen, dass Stigmatisierung entsteht (vgl. u.a. Corrigan und Rüsch 2002).
Corrigan und Rüsch veröffentlichten 2002 einen Artikel in welchem ausgeführt wird, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen von anderen stigmatisierten Gruppen unterscheiden und daher die Eigenschaften, aus der das Stigma resultiert, oft nicht zu Tage treten (vgl. u.a. Goffman 1975). Immer wieder wird von ForscherInnen und AutorInnen betont, dass in diesem Zusammenhang zwischen negativer Einstellung und Stigma differenziert werden muss – sowohl seitens Betroffener als auch seitens der Gesellschaft. Gängige Stereotypen, wie sie beispielsweise aus einer Forschung von Brockington, Hall, Levings et al. herausgehen sind, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen generell gefährlicher wären als Menschen ohne eine solche Erkrankung und sie aus diesem Grund gemieden werden sollten (vgl. Brockington, Hall, Levings et al. 1993). Außerdem werden Betroffene als inkompetent wahrgenommen und es wird ihnen unterstellt selbst schuld an ihren Erkrankungen zu sein.
Aus dem vorherigen Absatz geht hervor, dass Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose (wie beispielsweise über das Klassifikationsinstrument des DSM 5 oder dem des ICD 10 attestiert) Stigmatisierung erfahren. Beachtung und Hauptaugenmerk wird in dieser Master-Thesis auf ExpertInnen gelegt, welche mit Menschen arbeiten, die an einer forensisch-psychiatrischen Nachsorgebegleitung teilnehmen.
Die betroffenen Menschen der forensisch-psychiatrischen Nachsorge – „randständige AußenseiterInnen unserer Gesellschaft“ mit einer psychiatrischen Diagnose versehen – werden auf Grund einer Straftat in der Mehrheit als „nicht schuldfähig“ verurteilt.
Nach Ablauf des Maßregelvollzuges, einer unbefristeten Unterbringung in der Psychiatrie oder einer befristeten Verbüßung einer Straftat nach dem Gesetz in einer Justizvollzugsanstalt, nimmt die betroffenen Zielgruppe an einer meist weisungsgebundenen forensisch-psychiatrischen Nachsorge teil (vgl. u.a. Freese 2003). Eine aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung zu dieser Thematik kann in der deutschsprachigen Recherche nicht gefunden werden.
Die Autorin dieser Arbeit geht davon aus, dass Stigmatisierung an sich nicht durch die Betroffenen selbst überwunden werden kann. Stigmatisierung ist ein gesellschaftlich auferlegtes Phänomen, sowie ein Prozess, der wiederum nur durch die Gesellschaft wieder aufgelöst werden kann. Menschen, die Stigmatisierungen erfahren, können jedoch individuelle Mechanismen, Bewältigungsstrategien und einen lebenslangen Umgang damit entwickeln.
Weiters sieht die Autorin auf professioneller Ebene (klinisch-) sozial Arbeitender eine Notwendigkeit, das Wissen um die Stigmatisierung in die tägliche Begleitung/Betreuung bewusst einfließen zu lassen.
In dieser Arbeit wird versucht, gelingende Interventionen und Betreuungsverläufe der sozialen Arbeit in der forensisch-psychiatrischen Nachsorge, im Konkreten der von Menschen im Raum Tirol, die im Rahmen des Angebotes der ambulanten forensisch-psychiatrischen Nachsorge über das Projekt RETURN des PSP Tirol teilnehmen und begleitet werden, zumindest ansatzweise und fragmentarisch zu erfassen, aufzuzeigen und kritisch zu analysieren. Es stellt sich sowohl die Frage, welche Rollen, Haltungen und Werte unabdinglich sind, als auch inwieweit die Betreuungsperson in dieser Diskussion eine Rolle spielt und/oder ob andere Aspekte wesentlich sein könnten, die bis dato nicht oder zu wenig in diesem Diskurs beachtet wurden.
Ziel der Masterthesis ist es, vor diesem fachlichen Hintergrund, Stigmatisierung in der sozialen Arbeit transparent zu machen und herauszufiltern, welche Strategien und Möglichkeiten sich betroffene Menschen mit ihren jeweiligen Erfahrungen zurecht legen und welchen durchaus essentiellen Beitrag die soziale Arbeit in der Begleitung/Betreuung leistet und leisten kann.
Für die klinische soziale Arbeit eröffnen sich durch diesen Versuch der Aufschlüsselung von gelingenden Betreuungsverläufen und –phasen, unter dem Hauptmerk des sozialen Phänomens der Stigmatisierung an der beschriebenen Zielgruppe, möglicherweise Erklärungsansätze sowie auch die Option, diese Erfahrungsberichte in zukünftige Interventionen aus dem Überwinden des „Nicht-Wissens“ heraus, professionell einzubauen und weiter zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
Historisch aufgegriffen stammt das Wort „Stigma“ aus dem Griechischen und bedeutet „(Schand-), Brandmal“ oder „Zeichen“. Demnach wurde Stigma als körperlicher Verweis verstanden und konnte als etwas Ungewöhnliches oder als ein Zustand begriffen werden, der immer etwas über die ansonsten verborgenen Eiegenschaften des Trägers/der Trägerin aussagte. Diese für rituell als unrein erklärten Personen sollten gemieden werden. Die körperliche Erscheinungsform trat dabei in den Hintegrund, die zugeschriebene Unehre widerrum machte deutlich, dass es Macht bedurfte, um ein Stigma zu setzen. (vgl. Goffman 1975, S.9.)
In diesem Zusammenhang spricht man auch davon, dass es im menschlichen Zusammenleben einer schnellen Orientierung bedarf, welche ein Miteinander ermöglicht. Eine negativ bewertete Eigenschaft wird immer dann zu einer Diskrepanz führen, wenn diese mit unseren Vorstellungen, wie ein gewisser Typ von Individuum sein sollte, nicht vereinbar ist. (vgl. Goffman, S.10-11.) (siehe K.2.1.1)
Weiterführend nimmt sich Jürgen Hohmeier der Stigmatisierung an und schreibt davon, dass es auf der ganzen Welt und in allen Kulturen Stigmata gibt. Er beschreibt diese als komplexe soziale Interaktionsmuster. Stigmata werden einerseits verwendet, um Komplexität zu verringern, erlauben jedoch auf der anderen Seite Interpretationen, die sich ausschließlich auf wenige Informationen oder Vorstellungen berufen können. Weiters sieht Hohmeier als Voraussetzung für die Durchsetzung von Stigma immer in der „Normabweichung“, demnach einem „Normverstoß“. Hohmeier bezieht dies auf allgemein gültige Normen, (vgl. Hohmeier 1975, S.3-23) (siehe K 2.1.2)
Was im aktuellen Diskurs unter Stigmatisierung verstanden wird, hat sich nach den grundlegenden Arbeiten vor allem Erving Goffman von aber auch Jürgen Hohmeier weiterentwickelt und differenziert. Als populäre Theorien wären an dieser Stelle der Etikettierungsansatz von Thomas Scheff oder das Stigmakonzept nach Bruce Link und Jo Phelan zu erwähnen.
In dieser hier vorliegenden Thesis wird in der Begriffsannäherung (siehe K.2.1) versucht, Stigmatisierung und das Stigma der psychischen Erkrankung näher zu beleuchten und eine Überführung in die soziale Arbeitsbeziehungsweise in die Arbeit mit Menschen, die an einer forenisch ambulanten Nachsorge teilnehmen und im Rahmen dessen betreut werden, herzustellen.
Anknüpfend sei nun der Soziologe Erving Goffman erwähnt, welcher sich in seiner Standardliteratur „Stigma – über Techniken und Bewältigung beschädigter Identität“ aus dem Jahre 1963, der Analyse sozialer Prozesse annahm. (vgl. Goffman 1963)
Laut Goffman ist Stigmatisierung im übertragenen Sinn eine Zuschreibung meist negativ bewerteter Eigenschaften, welche zum Einen „zutiefst diskreditierend“ sind und zum Anderen zu Isolation und infolgedessen zu Ausgrenzung der betroffenen Menschen führt.
Es lässt sich festhalten, dass diese Stigmatisierungsprozesse langfristige Auswirkungen, Folgen und Konsequenzen in allen Lebensbereichen darstellen und immer in sozialen Bezügen zu denken sind. (vgl. Goffman 1963, S.11.)
Der Soziologe prägte mit seiner Arbeit den ursprünglichen Begriff dessen, was unter „Stigma“ und „Stigmatisierung“ verstanden wird. Historisch betrachtet, bedeutet Stigma „das Brandmal“ oder „Schandmal“. Goffman bezeichnet in diesem Zusammenhang „Stigma“ weniger als die körperliche Erscheinungsform, sondern mehr als die Macht, jemandem ein Stigma zuzuschreiben. Nach Goffman bedarf es eben dieser Macht eines Einzelnen/einer Einzelnen, der/die einer bestimmten Mehrheit oder einer Gruppe Eigenschaften zuschreibt.
In seiner Arbeit betont er weiteres immer wieder, dass nicht alle negativen Zuschreibungen oder Definitionen zu einer Diskrepanz führen, und demnach Stigmatisierungen zur Folge haben, sondern nur jene Eigenschaften, die für uns als Person selbst nicht vereinbar sind. (vgl. Goffman 1975, S.9-11.)
Prinzipiell werden Zuschreibungen gebraucht, um uns als Menschen Orientierung zu geben, uns zugehörig zu fühlen oder um uns und andere von einer Mehrheit bzw. Minderheit abzugrenzen und/oder auszuschließen.
„Aktuale soziale Identitäten“ - also das, was wir „meinen“ zu sein - sind essentiell im menschlichen Zusammenleben und unterscheiden sich von unserer „virtualen sozialen Identität“ - also von dem, was wir „vorgeben zu sein“ – so unterscheiden sich unsere verschiedenen Rollen, die wir einnehmen, zumeist von unserer sozialen Identität. (vgl. Goffman 1975, S.11.)
Demnach ist nichts und niemand an sich stigmatisiert, sondern es wird durch unerwünschte Vorstellungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften in sozialen Prozessen, die Personen für sich selbst als „falsch“, „unerträglich“, „abartig“, „unmoralisch“ in sich verankert. (vgl. Goffman 1975, S.13.)
Ebenfalls erwähnenswert ist an dieser Stelle noch Goffmans essentielle Unterscheidung zwischen „Diskretiertem“ und „Diskretierbarem“. Er beschreibt „diskretierte Menschen“ als solche, welche annehmen oder wissen, dass ihr Gegenüber Kenntnis über beispielsweise eine psychische Erkrankung und jene, die dies weder denken, noch ahnen oder erkennen können. Diese Differenzierung ist wesentlich und beeinflusst die Betroffenen in ihrer Lebenswelt. (vgl. Goffman 1975, S. 14.)
Jürgen Hohmeier beschäftigt sich zeitgleich aber unabhängig von Goffman im Jahre 1975, ebenfalls erstmals mit „Stigma“, fokussiert allerdings den Gesichtspunkt, Stigmata würden in allen Kulturen und Gesellschaften existieren und soziale Interaktionen regulieren, Komplexität herausnehmen und demnach auch als Hilfsmittel anzusehen wären. Nach Hohmeier werden durch Stigmata auch Normen und Normvorstellungen von „Nicht-Stigmatisierten“ gestärkt.
Zusammenfassend passiert durch die Abwertung der Anderen eine Aufwertung der eigenen Gruppe. Auch Hohmeier geht wie Goffman davon aus, dass bei Stigmatisierung Personen oder Gruppen negative Merkmale zugeschrieben werden, betont jedoch, dass es für die Durchsetzung von Stigmatisierung folgendes benötigt: Ein Stigma muss immer generalisierend und einfach sein, damit jede/r es versteht und umzusetzen vermag. Außerdem muss ein „Normverstoß“, - um Normen geht es in dieser Diskussion laufend („du bist nicht weiß“, „du bist kein/e Österreicher/in“, „du bist homosexuell“, „du bist behindert“, „du bist geistesgestört“, „du bist kriminell“, etc.) - vorliegen, der sanktioniert werden muss. Letztlich betont Hohmeier den Begriff der Macht, denn Menschen oder Gruppen mit wenig Einfluss auf allen gesellschaftlichen Ebenen sind immer leichter zu stigmatisieren. (vgl. Hohmeier 1975, S.3-11.)
Jürgen Hohmeier führt die Überlegungen Goffmans insofern fort, indem er vorschlägt, Stigmatisierungsprozesse nicht an einem Merkmal selbst, sondern an dessen negativer Zuschreibung fest zu machen. Demnach würde er Stigmatisierung und das „Sich-darauf-beziehen“ und „Anknüpfen“ als ein Phänomen bezeichnen, welches teils durch selbst gemachte/erlebte Erfahrungen, teils durch nicht mehr reflektierte Pauschalisierungen zu Stande kommt und nicht mehr hinterfragt wird – unabhängig davon, ob sichtbare oder unsichtbare Merkmale vorliegen. Diese „Verdachtsmerkmale“ werden daraufhin zum „Merkmalsträger“ und der Gesamtperson wie eine Tatsache „angehaftet“. (vgl. Hohmeier et.al.1975, S.5-8.) Je-de Norm bietet demnach die Möglichkeit, Individuen als „abweichend“ zu stigmatisieren. (vgl. Hohmeier 1975, S.24.)
Gesellschaftlich vordefinierte Abweichungen vom „Normalzustand“ - wie auch deviantes Verhalten es beispielsweise darstellt - sind immer kontextgebunden und allenfalls durch Ordnungsstrukturen und Mechanismen von Macht und Kontrolle abgesteckt. Dieser Vorgang der „Abkehrung von der Gesellschaft“ ist immer durch eben diese paradoxerweise bereits in gleichem Maße wieder vorgegeben und zugeschrieben. (vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.25-26.)
Auch dem Phänomen der Selbststigmatisierung, der erwarteten Ablehnung und Ausgrenzung muss in diesem Diskurs Beachtung geschenkt werden – besonders wenn es darum geht, dass Selbstverständnisse verändert und infolgedessen verinnerlicht und stagniert werden. Hier kommt es zu Aufhebungen, Projektionen und Umwandlungen von menschlichem Verhalten, welche ein „Verschulden“ produzieren – wenngleich sich in diesem Zusammenhang die Frage aufdrängt, ob Selbststigmatisierung implizit auch einen „Zweck“ haben kann. Wann beginnen Menschen sich selbst zu stigmatisieren oder fordern dies vielleicht bewusst heraus? Nimmt Selbststigmatisierung die Konsequenzen vorweg? (vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.30-39.)
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass existierende „Ausschließungsprozesse“ in Bezug zu einem gesellschaftlichen Moment immer als eine sich gegenseitig beeinflussende Komponente verstanden und reflektiert werden muss.
„Ein Ansatzpunkt zur Veränderung und Aufhebung von Ausgliederungsprozessen wäre es, zu versuchen, solche Randgruppen aus ihrer inneren Logik heraus zu begreifen und ihr Handeln vor dem Hintergrund einer Situationsgebundenheit zu sehen.“(vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.73.)
Ein Hauptvertreter des Etikettierungsansatzes ist Thomas Scheff. (vgl. Scheff 1966) In einem seiner Werke geht er davon aus, dass es in gesellschaftlichen Denktraditionen allgemeingültige Regeln gibt, die nicht mehr verhandelt werden. Stigmatisierung oder den Versuch ihrer Erklärung sieht er immer in Verbindung mit verwendetet Begriffen, wie z.B. „kriminell“ oder „psychisch krank“. Wie bei vielen TheoretikerInnen lässt sich in Bezug auf abweichendes Verhalten von der Norm nach Scheff Stigmatisierung immer auf die Gesellschaft zurückführen. Diese Zuschreibungsprozesse in der Interaktion sind fest in der jeweiligen, auch kulturell bedingten Sozialisation verankert. Ob eine Gesellschaft etwas toleriert oder beispielsweise ein Verhalten vollständig ablehnt, kommt auf die Interpretation innerhalb der Gesellschaft an und äußert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Im Konzept von Scheff kommt es erst dann zur Verfestigung, wenn Betroffene diese ihnen zugeschriebene Rolle übernehmen und dadurch die Etikettierung, beziehungsweise die Stigmatisierung entsteht. RegelbrecherInnen bekommen demnach das sprachliche und „unsichtbare“ Etikett „der Gestörte“, „die Kriminelle“, „der Süchtler“ (vgl. Scheff 1966, S25.). Deutlich wird hier, dass es weniger auf die negativen Eigenschaften, als mehr auf die Interpretationen der Gesellschaft ankommt. Diese Interpretationen können sich geschichtlich auch ändern, wie man am Beispiel der Judenverfolgungen oder Hexenverbrennungen, sowie der Thematik HIV erkennen kann (vgl. Markowitz 2005, S 130.).
Eine sehr kritische Sichtweise wird an den Tag gelegt wenn man wie Scheff (vgl. Scheff 1966) davon ausgeht, dass das Etikett der „psychiatrisch-forenischen KlientInnen“ aus Reaktionen und zuschreibenden Interpretationen der Gesellschaft heraus entsteht.
Zusammengefasst lässt sich hier festhalten, dass Betroffene sobald sie ihr Etikett annehmen und verinnerlichen eine Veränderung der Identität oder Umstrukturierung (man nimmt sich selbst als „psychiatrisch-forensische/r KlientIn“ an, mit allem was damit verbunden wird, also als „schwach“, „kriminell“, „gemeingefährlich“, „krank“, „arbeitsunfähig“, „gestört“, „arm“, etc.) erfahren. Dies führt erst zu einer Chronifizierung, auf die man als Betroffener oder Betroffene selbst wenig Einfluss nehmen kann.
Als kritische Gegenbewegung zu Scheff findet sich der modifizierte Etikettierungsansatz (vgl. Link et.al. 1989). Link und KollegInnen betonen, dass die Gesellschaft den Verlauf der Stigmatisierung zwar maßgeblich beeinflussen kann, aber nicht, dass Stigmatisierungen rein aus der Bevölkerung heraus resultieren.
Demnach gehen die VertreterInnen dieser Theorie ebenfalls davon aus, dass es einen Einfluss darauf hat, wie betroffenen Personen selbst denken, wie Andere auf sie reagieren könnten (vgl. Link et.al 1989 S.400.).
Relevant und zu berücksichtigen ist in diesem Diskurs sowohl das Ausmaß der Entwertung als auch das Ausmaß der Diskriminierung - sowohl bei der Fremd -, als auch bei der Selbststigmatisierung. Außerdem nennen Link et. al. Reaktionen, die auftreten können, wie etwa die Geheimhaltung und/oder der sozialer Rückzug. In Bezug auf seine/ihre jeweilige/n Stigmatisierung/en versuchen Betroffene ihren Kontakt auf Personen mit gleicher Erfahrung zu beschränken bzw. auf Menschen, die diese Situation kennen und auf Grund dessen akzeptieren. Vermeidungsverhalten ist im Kontext der Unsicherheit oder der Angst zurückgewiesen oder ausgegrenzt zu werden sehr zentral und steht somit der dritten Reaktion, aktiv darüber zu sprechen und damit angreifbar zu sein, gegenüber. (Vgl. Link et.al.1989 S. 400-403.)
Aus diesem modifizierten Ansatz haben Jo Phelan und Bruce Link das Stigmakonzept und damit eine neue Definition von Stigma entwickelt. Anhand zahlreicher Studien und Erfahrung beschreiben und betonen sie vor allem die Seite der Stigmatisierten selbst, die bis dato vernachlässigt wurde.
Für die KollegInnen ist Statusverlust eine Konsequenz aus sozial relevanten Unterschieden, was heißt, Unterschiede werden zwar immer wahrgenommen, die negativen Bewertungen jedoch entstehen in den jeweiligen Gesellschaften und sind stark kulturell (z.B Körperbehaarung), örtlich (je nach Kulturkreis unterschiedlich) und zeitlich („Hexen haben rote Haare“) abhängig und variabel. (Vgl. Link und Phelan 2001, S. 367-371.)
Wenngleich die Thematik der Stigmatisierung in diesem Diskurs der psychischen Erkrankungen in politischen Debatten angekommen zu sein scheint, findet sie in der breiten Öffentlichkeit wenig Beachtung.
Die WHO betont immer wieder, dass Stigmatisierung einen Teufelkreis darstellt, welcher Regeneration und Reintegration vermindert und zu sozialer Isolation, Arbeitsunfähigkeit, Obdachlosigkeit und/oder Inhaftierung führen kann (vgl. WHO 2014).
Dieses Phänomen der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist vielschichtig und dringt in alle erdenklichen Lebensbereiche ein.
Um sich diesem Prozess der Stigmatisierung gedanklich anzunähern bedarf es wieder der Theorie Goffmans, in welcher er ausführt, dass Stigma ein Individuum kennzeichnet. Dadurch soll immer ersichtlich werden, dass ein Individuum über bestimmte Eigenschaften verfügt, welche als nicht erwünscht angesehen werden. (Vgl. Goffman 1975, S.9.)
Der Stigmatisierungsprozess kann nach Link und Phelan 2001 wie folgt dargestellt werden:
Wie und ob Stigmatisierung erfahren wird, fällt bei psychisch erkrankten Menschen, Angehörigen von Betroffenen und MitarbeiterInnen psychosozialer, sozialpsychiatrischer Dienste höchst unterschiedlich aus.
Abbildung 2. Dimensionen des Stigmas aus Sicht psychisch erkrankter Menschen, ihrer Angehörigen und MitarbeiterInnen psychosozialer Einrichtungen
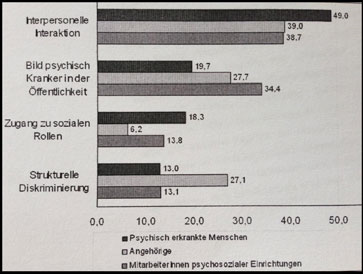
(entnommen Schulze/Angermeyer 2003, S.308.)
Anhand dieser Grafik lässt sich erkennen, dass die „interpersonellen Interaktionen“ und der „Zugang zu sozialen Rollen“ von betroffenen Menschen als am meisten belastend wahrgenommen wird. Ausgrenzungserfahrungen führen dazu, dass die Betroffenen sich sozial isolieren und ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Der Zugang zu sozialen Rollen wird auf Grund der Erkrankung meist verwehrt.
Viele Betroffene entschließen sich daher dazu, die Erkrankung zu verschweigen, denn für betroffenen Menschen gestaltet es sich beispielsweise als schwierig, einen Arbeitsplatz am 1. Arbeitsmarkt zu finden und/oder eine Partnerschaft einzugehen.
Hingegen wird für Angehörige die „strukturelle Diskriminierung“ vordergründig als negativ erlebt. Beispielsweise würden sich hier Ungerechtigkeiten bei Ämtern, Behörden, medizinischen Institutionen einordnen lassen.
Für die MitarbeiterInnen von sozialen Institutionen spielt das Bild psychisch erkrankter Menschen in der Öffentlichkeit die zentralste Rolle und wird als ebenfalls negativ wahrgenommen. Das Bild der Gruppe der psychisch Erkrankten wird auch von den Betroffenen selbst internalisiert und führt in weiterer Folge zu Selbststigmatisierung. (Vgl. Schulze 2005, S.123-132.)
„Das Vorherrschen negativer Vorstellungen und Stereotypen über psychisch Kranke in der öffentlichen Meinung wird nicht allein als Ursache der Stigmatisierung wahrgenommen, sondern als direkt diskriminierend und verletzend empfunden. Die Gegenwart dieses negativen Öffentlichen Bildes ist Teil des Stigmaerlebens.“ (Schulze 2005, S.129.)
Aus sozialisationstheoretischer Sicht lässt sich erkennen, dass die Diskussion über Menschen, welche dissoziales Verhalten aufweisen, von großer Bedeutung ist und in diesem Zusammenhang auch sozialwissenschaftliche Aspekte miteinzubeziehen sind. An dieser Stelle ergibt sich die Frage nach möglicher Entstehung, nach Ursachen und nach der Aufrechterhaltung eben dieser. (vgl. Rauschfleisch 1999, S.19-23.)
Die soziale Arbeit interessiert sich im Diskurs über Praxis überwiegend für den fachlichen Umgang mit dieser Differenz oder Andersheit – im Grunde genommen geht es um das Ansprechen und um die Thematisierung. (vgl. Kessl/Plößer 2010, S.7.)
Die Tatsache, dass Differenzkategorien Stigmatisierung erzeugen und bedingen, steht außer Frage. In der sozialen Arbeit benötigen professionell Tätige jedoch Konzepte, welche die Relevanz fachlich einschätzen und Praktiken der Ausgrenzung berücksichtigen. (vgl. Plößer 2005 in: Kessl/Plößer 2010, S.7-8.)
„Soziale Arbeit passt „die Anderen“ in diesem Sinne an die bestehenden Normen an oder produziert die NutzerInnen durch die fachliche Fallmarkierung überhaupt erst als „Andere“ (mit.)“ (Kessl/Plößer 2010, S.8.)
„Wohlfahrtsstaatlich stellt die Andersheit von Personen, die zu bearbeitende Problematik für sozialpädagogische Organisationen wie Fachkräfte - aber auch andere sozialpolitische AkteurInnen insgesamt - dar.“ (Kessl/Plößer 2010, S.8.)
„Besonders wichtig ist es, zu beachten, daß Fremdstigmatisierung im Laufe der Entwicklung zunehmend in die eigene Persönlichkeit übernommen werden und zu einer Verstärkung der negativen Identität des betreffenden Menschen beitragen können.“ (Rauchfleisch 1999, S.23.)
Von der ersten Kontaktaufnahme an gestaltet sich die Begleitung von Betroffenen zumeist als schwierig, da man sowohl mit anfänglicher Ablehnung rechnen muss, als auch hinsichtlich dessen, dass man sich immer in einem Spannungsfeld aus Entwicklungsmöglichkeiten, Hoffnung, Resignation, unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erwartungen befindet. (vgl. Rauchfleisch 1999, S157.)
Mit der Figur des „Antisocialen“, der später zum „Asozialen“ wird, beginnt die Pathologisierung der sozialen Devianz: die Her- und Herausstellung eines „Defekt-menschen“ (mit krimineller Neigung), dessen Geistes- und Willenskräfte anlage- und milieubedingt vermindert seien, dessen Zurechnungsfähigkeit aber nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden könne. (Vgl. Ledebur 2007, S.221.)
Die spezifische Form der Abweichung im forensischen-psychiatrischen Kontext stellt sich als Dialog zwischen Justiz und Psychiatrie dar. Es existiert die Ansicht, dass dies zwei Gründe habe: Zum Einen die Gefängnisüberfüllungen von scheinbar weder durch Sanktionen der Strafe noch durch jene der Erziehung zu bessernden „Kranken“ zu reduzieren und zum Anderen der Psychiatrie Legitimationen für die Errichtung spezifischer Anstalten für geisteskranke RechtsbrecherInnen und damit einhergehend auch Macht zu verleihen. (vgl. Ralser, S.139. In: Kessl/Plößer 2010)
Wenn man davon ausgeht, dass Stigmatisierung nicht überwunden werden kann - weder von den Betroffenen, noch von den Angehörigen, ProfessionistInnen oder der Gesellschaft selbst - sondern lediglich ein Umgang mit diesem Phänomen gefunden werden muss/kann, scheint es klar, dass die soziale Arbeit sich mit dieser konstruierten, sozial hergestellten Ungleichheit fachlich beschäftigen muss. Die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen an sich fordert bereits ein Wissen um den Umgang und die Reflexion dessen.
Ausgehend von dem kritischen Blick durch die konstruktivistische Brille entsteht Stigmatisierung durch die Zuschreibung meist negativer Eigenschaften oder Makel, durch welche von einem Merkmal auf die Gesamtperson oder auf eine spezifizierte Gruppe von Menschen geschlossen wird. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.187-188.)
Es kann nun der Ansatz diskutiert werden, diese wie bereits erwähnte konstruierte Differenz unter dem Gesichtspunkt der „Unauflösbarkeit“ durch Aufwertung zu rekonstruieren und dies als Aufgabe sozialer Arbeit anzusehen (vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S189.).
Es wäre in dieser Debatte höchst widersprüchlich, zum Einen die Differenz und damit einhergehende Stigmatisierung Betroffener zu produzieren und mit besonderen speziellen Institutionen zu legitimieren und zum Anderen eine Zielsetzung zu verfolgen, welche an einer Auflösung dieser Differenz gegensätzlich interessiert ist. Mit Sicherheit erscheint es der Autorin dieser hier vorliegenden Thesis sinnvoll, sich einer „Normalitätsorientierung“ aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu unterziehen bzw. scheint dies unabdinglich. Es sei jedoch erwähnt, dass es in der Verbindungslinie zwischen Theorie und Praxis gilt, dieses Moment in beruflicher, fachlicher und professioneller Hinsicht und Haltung mitzudenken.
„Denn wenn statt von ‚abzuschaffender Ungleichheit‘ von ‚anerkennenswerter Differenz‘ die Rede ist, wird damit weniger strukturelle Benachteiligung sondern per se wertvoll erscheinende gruppenspezifische und individuelle Andersheit diskutiert.“ (Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.188.)
Der Normalisierungsauftrag der sozialen Arbeit ist es, diese Dimensionen der Ungleichheit nicht ohne zu hinterfragen hinzunehmen, anzunehmen oder gar unreflektiert zu ignorieren. Die ProfessionistInnen sozialer Arbeit haben den Auftrag, diese Heterogenität zu erfassen, zu begreifen, zu (be-)handeln und die Bedeutungen und Wirkungen neugierig zu erfragen. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.189.)
Differenzkategorien schaffen aus soziologischer Betrachtungsweise heraus gedacht Orientierung. Die Stigmatisierung ist das durch Macht auferlegte und produzierte Ergebnis von Ungleichheits- und Ausschlussverhältnissen sowie gesamtgesellschaftlich produzierten Prozessen, welche das „Normale“ zur distanzierten Abgrenzung verwenden, um eigene Unsicherheiten zu überwinden bzw. zu verschleiern versuchen. Aufgabe der sozialen Arbeit ist es nun, diese ungleichheitsgenerierenden Konstruktionen theoretisch und professionell praktisch zu realisieren. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.189.)
Außerdem ist zu betonen, dass sich der Blick von einer naturgegebenen Auffassung von Differenz entfernen muss, welcher die Konstruktion begreift und diese sowohl als soziale Problematik als auch als subjektive und individuelle Wahlmöglichkeit versteht. (Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.190-191.)
Diese anerkennende Thematisierung von Differenz betrifft die soziale Arbeit in jeglicher Praxis.
Inhaltsverzeichnis
Durch privates Engagement einer psychiatrischen Diplomkrankenschwester wurde der Psychosoziale Pflegedienst im Jahr 1986 gegründet. Hauptaugenmerk legte man zu dieser Zeit auf die häusliche Betreuung von Menschen mit psychischen „Störungen“ und Beeinträchtigungen. Bald wurde deutlich, dass sich die Grundüberlegungen auch in Richtung ambulante Nachbetreuung richten sollten. Im Jahre 1988 wurde der Psychosoziale Pflegedienst „PSP“ in einen gemeinnützigen Verein übergeführt und neue Einrichtungen wurden geschaffen.
Seit diesem Zeitpunkt betreute der PSP Tirol auch Menschen mit einem forensisch- psychiatrischen Hintergrund. Ab 2005 läuft diese Betreuung unter dem Namen „PSP Projekt RETURN“ und wird als separater Fachbereich geführt. Allgemein umfasst der Verein mittlerweile differenzierte Rehabilitationsangebote in unterschiedlichen Beschäftigungsausmaßen und ,-verhältnissen. Außerdem bietet der PSP neben Beschäftigungsinitiativen auch höherschwellige Arbeitsinitiativen, Beratungen, Einzelbetreuungen und dem damit einhergehenden aufsuchenden Dienst sowie betreute Wohngemeinschaften und Wohnheime an. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN , Stand 2014)
Der im Jahre 2005 ins Leben gerufene „Fachbereich RETURN“ bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen, welche aus einer Anstalt für geistig abnorme RechtsbrecherInnen oder einer entsprechenden Abteilung einer psychiatrischen Klinik bedingt entlassen werden oder denen eine Einweisung bedingt nachgesehen wird, sozialpsychiatrische Rehabilitation an. Sozialpsychiatrische Rehabilitation umfasst nach den heutigen Standards unter Anderem soziale Integration und Umgang mit der Erkrankung. Außerdem kann soziale Rehabilitation dazu beitragen, dass die betroffenen Menschen womöglich berufliche Integration erlangen. Dies wird vorerst unter fachlicher Anleitung angestrebt. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
Bei der Betreuung dieser Zielgruppe, auf die Unterkapitel K 3.1.2 näher eingegangen wird, ist außerdem darauf zu achten, dass gerichtlich verordnete Weisungen eingehalten werden. Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gericht, der forenischen Ambulanz und der Entlassungsstation ist unerlässlich in der Arbeit mit und für Menschen, welche an der forensisch-ambulanten Nachsorge teilnehmen. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
Bei der ambulanten Nachsorge der KlientInnen wird auf die üblichen sozialpsychiatrischen und soziotherapeutischen Vorgehensweisen bis hin zu konkreter Unterstützung bei der Alltagsbewältigung geachtet. Die mit dem jeweiligen Facharzt/der jeweiligen Fachärztin abgesprochenen Behandlungs-/Betreuungsmaßnahmen haben immer die soziale Integration und die Stabilisierung des Gesundheitszustandes zum Ziel, welcher in weiterer Folge der Vorbeugung und Verhinderung neuerlicher Delinquenz dient. Weiteres erscheint es dem Verein als essentiell, dass die Frequenz und Intensität der Betreuung jederzeit auf die aktuellen Erfordernisse angepasst werden kann. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
Die Zielgruppe der forensischen Nachsorgebegleitung des PSP Projekt RETURN leitet sich wie folgt ab: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
-
Personen, die gem. §47 StGB bedingt aus einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher entlassen werden
-
Personen, die gem. §45 StGB eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher bedingt nachgesehen werden kann
-
Gemäß § 21 StGB untergebrachte Personen, die sich im Stadium der Genehmigung von mit Freiheitserprobung verbundene Vollzugslockerungen (Unterbrechung der Unterbringung - kurz „UdU“) befinden.
Der Psychosoziale Pflegedienst orientiert sich seit jeher an dem Leitsatz „so wenig Hilfe wie möglich aber so viel Hilfe wie notwendig“. Mit einer intensiven Abklärung beginnt jeder Rehabilitationsprozess. In der Regel erfolgt dieser mit der betroffenen Person, dem Team der jeweiligen Entlassungsstation und dem behandelnden Facharzt/der behandelnden Fachärztin. Um Unter- bzw. Überforderung zu vermeiden dient dieser Prozess dazu, gemeinsam ein bedürfnisgerechtes Maßnahmenpaket zu erstellen. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
Mögliche Betreuungsziele leiten sich laut PSP RETURN durch folgendes ab: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
-
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
-
Psychische Stabilisierung
-
Finanzielle Absicherung der Lebensnotwendigkeiten
-
Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen
-
Beschäftigung/Arbeit
-
Sinn- und bedarfsorientierte Zeitgestaltung
-
Notwendige Kontrollen (z.B. Einhaltung von Weisungen, Medikamenteneinnahme, etc.)
Auch mögliche, hier fragmentarisch dargestellte, Therapieziele werden im Konzept des Projekts RETURN wie folgt vorgeschlagen: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
-
Steigerung der Sozialkompetenz
-
Steigerung der Persönlichkeitskompetenz
-
Experte im Wissen über die eigene Störung
-
Strukturierung des Alltags und des Lebens
-
Eigene Lebensphilosophie, Imagewandel und damit Entstigmatisierung
Bereits bei Durchsicht des Konzeptes wird rasch transparent, dass sich in den möglichen erwünschten Betreuungszielen und Therapiezielen gleichzeitig die vorherrschenden Problematiken und Herausforderungen in der alltäglichen Begleitung spiegeln.
Wenn es beispielsweise um die Förderung sozialer Interaktion von KlientInnen geht, kann man davon ausgehen, dass betroffene Menschen in manchem Fall Schwierigkeiten damit haben, den Wohnsitz zu verlassen und mangelnde soziale Kompetenzen aufweisen.
Aus den Weisungen heraus ergibt sich erfahrungsgemäß eine mangelnde Kooperationsbereitschaft und Schwierigkeit, sein eigenes Verhalten mit den einhergehenden Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung abzuschätzen.
Außerdem ergeben sich für betroffene Menschen aus unterschiedlichen Problemlagen Beeinträchtigungen in den Bereichen Beschäftigung, Haushaltsführung, Körperhygiene und Alltagsbewältigung. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)
Im Konzept wird außerdem formuliert, dass betroffenen Menschen der forensischen Nachsorgebegleitung an denselben Rehabilitationsleistungen teilnehmen können wie psychiatrische PatientInnen, um zusätzliche Stigmatisierung zu vermeiden (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014).
Stigmatisierung als Wort in seiner ursprünglichen Benutzung/Bedeutung ist fast verschwunden und lässt sich dennoch als eine Rollenzuschreibung definieren, die vom Individuum im Einzelnen nicht mehr wahrgenommen wird und ist jedenfalls eine zwanghafte Erfahrung, die von betroffenen Menschen in Form von Selbststigmatisierung übernommen wird.
Wie schon im ersten Kapitel ausgeführt ist Stigmatisierung ein „Zeichen“, welches ein Mensch „an sich trägt“ bzw. „mit sich herum trägt“. Dieses kann man nicht verändern, man kann nur lernen, die eigene Haltung zu verändern und einen individuellen Umgang damit zu entwickeln.
Besonders in der sozialen Arbeit wird Stigmatisierung oft verschwiegen, verdrängt oder nicht wahrgenommen, allerdings wird sie auf der Handlungsebene deutlich.
Menschen, welche psychische Krisen erleiden oder im forensisch-psychiatrischen Kontext auf Grund ihrer Erkrankung ein Delikt setzen, werden per se stigmatisiert. Die betroffenen Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, schon legt sich diese/r „Hülle“/„Schleier“ über sie, der sie das ganze Leben lang begleiten wird.
Mit dem „Stempel“ der „Gemeingefährlichkeit“ und anderen Stigmatisierungserfahrungen behaftet werden straffällig gewordene Menschen mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen aus dem Maßregelvollzug entlassen. Diese Tatsache an sich verwehrt den Betroffenen Zugänge und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In der Maßregel untergebrachte Personen sind in der Mehrzahl auf unbefristete Zeit zu „nicht schuldfähig“ verurteilt worden und leiden sehr unter diesem Makel, von der Gesellschaft keine Chance mehr zu bekommen. (Vgl. Freese 2009, S.28-29.)
Freese beschreibt die Problematik der Menschen darin, dass sich eine resozialisierende Wiedereingliederung sehr in die Länge zieht, da die Menschen meist auf Jahre an Weisungen gebunden sind, die es ihnen verwehren, diese Distanz wie-der zu schließen. Er weist ebenfalls darauf hin, dass die meisten PatientInnen in der Maßregel funktionelle Psychosen, Persönlichkeitsstörungen und eine kleinere Gruppe davon hirnorganische oder geistige Beeinträchtigungen vorweisen, die im Leben vor der Aufnahme und der Setzung eines Deliktes bereits von Rückzug, Fehlen von sozialen Kontakten und Isolation durchdrungen sind. (Vgl. Freese 2009, S.29-30.)
Man geht aus professioneller Sicht davon aus, dass durch die zum Großteil chronifizierten Anamnesen der betroffenen Menschen auch nach der Entlassung aus der stationären Behandlung teils massive Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung vorherrschen (vgl. Freese 2009, S.31.).
Auch die UdU-Unterbrechung der Unterbringung wird in der Praxisliteratur als „realitätsferner Test“ eingestuft, welcher mit dem tatsächlichen Leben „draußen“ wenig bis gar nichts zu tun hat (vgl. Freese 2009, S.31.).
Die forensische Nachsorge ist neben der Aufnahme, der Therapie und der Entlassungsvorbereitung die Vierte von insgesamt vier Säulen aktueller forensisch-psychiatrischen Behandlungskonzepte (vgl. Freese 2009, S.31.).
Diese Stufe des Gesamtkonzeptes der forensischen Nachsorge soll eine kontrollierte Absicherung von innerhalb im Maßregelvollzug erreichten und (wieder-) er-langten/erlernten Fähig-, und Fertigkeiten darstellen (vgl. Freese 2009, S.39.).
„Das Angebot der forensischen Nachsorge ist abgestimmt auf schwierig zu betreuende Probanden, die ohne eine derartige Betreuung entweder gar nicht außerhalb von Institutionen leben könnten oder im Falle einer Entlassung in hohem Maße gefährdet wären, durch selbst- und mehr noch fremdaggressives Verhalten sowie Straftaten gravierend auffällig zu werden.“ (Freese 2009, S.124.)
Auch wenn dieses Phänomen in dem Sinne nie überwunden werden kann, können persönliche Bewältigungsstrategien im alltäglichen Leben entwickelt werden. Soziale Arbeit kann die betroffenen Menschen dabei unterstützen, dass die Bewältigung von Stigmatisierung durch die bewusste Auseinandersetzung erleichtert wird. Außerdem kann das Wissen um die Stigmatisierung auf beiden Seiten möglicherweise genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise zur Forschung formuliert und beschrieben. Bei der Fragestellung „Wie kann die soziale Arbeit auf die Stigmatisierung der KlientInnen in der alltäglichen Begleitung über die forensisch-ambulante Nachsorge des PSP Projekt RETURN einwirken?“ wird die ExpertInnenseite in den Fokus genommen.
Das primäre Forschungsinteresse ist ein Professionsbezogenes und gilt der professionellen Haltung, dem Informationsgehalt sowie der Bewertung von einem „gelingenden Fall“, dessen Definition vermutlich variieren wird und deshalb erfragt wird. Die Forschungsfrage lautet:
„Wie können sozial Arbeitende auf die Stigmatisierung der KlientInnen in der alltäglichen Begleitung über die forensisch-psychiatrische Nachsorge des PSP Tirol einwirken?“
Folgende Annahmen werden überprüft:
-
Menschen, die über die forensisch-psychiatrische Nachsorge begleitet werden erfahren von ProfessionistInnen der sozialen Arbeit, ihrem Umfeld und von Seiten der Gesellschaft Stigmatisierung.
1a: Stigmatisierung entsteht durch soziale Zuschreibungsprozesse von „Andersartigkeit“, welche von der Gesellschaft und in Folge dessen vom Umfeld sowie von den sozial Arbeitenden als von der gesellschaftlichen Norm „abweichend“ definiert wird.
1aa: Sozial Arbeitende sind grundsätzlich wie das Umfeld als Teil der Gesellschaft anzusehen, weil sie auch Personen in der Gesellschaft und daher nicht von ihr zu trennen sind.
1aaa: Sozial Arbeitende haben als ProfessionistInnen die Aufgabe, sich dem Berufskodex anzunehmen und sich und dieses Dilemma durch bewusste, reflexive Auseinandersetzung und professionellem Wissen zu überwinden.
- 1b: Definitionsprozesse von „Andersartigkeit“ beeinflussen den Umgang und haben Konsequenzen und Folgen für die betroffenen Menschen.
- 1bb: Durch Definitionsprozesse wird von Merkmalen auf die gesamte Person geschlossen.
- 1bbb: Das Stigma bestimmt in weiterer Folge generalisierend die Stellung einer Person in der Gesellschaft.
-
Stigmatisierung kann von den Betroffenen selbst nicht überwunden werden.
2a: Selbststigmatisierung entsteht durch die Stigma-Erwartung der betroffenen Menschen und wird nicht ausschließlich gesellschaftlich hergestellt.
2b: Das Verhalten der Betroffenen ändert sich, weil sie sich als „ausgegrenzt“ wahrnehmen.
2c: Betroffene sind darauf angewiesen, Menschen um sich zu haben, die sie als „Menschen“ und nicht als „psychisch Erkrankte“ oder „GesetzesübertreterInnen“, annehmen und akzeptieren.
-
Stigmatisierung wird im professionellen Selbstverständnis sozialer Arbeit zu wenig bis gar nicht beachtet.
3a: Aufgabe professioneller sozialer Arbeit ist es, Stigmatisierung von betroffenen Menschen bewusst in der Begleitung/Betreuung zu thematisieren.
3b: Prädikatoren wie beispielsweise Werte oder Haltungen der sozial Arbeitenden beeinflussen den Betreuungs-, Begleitungsverlauf maßgeblich.
3c: Es können Möglichkeiten und Strategien für einen lebenslangen Umgang mit Stigmatisierung von betroffenen Menschen gemeinsam erarbeitet und entwickelt werden.
In dieser Arbeit entscheidet sich die Autorin für eine retrospektive Studie, in welcher durch die Analyse von mehreren Fällen vergleichend, typisierend und kontrastierend gearbeitet wird. Vergangene Prozesse werden rückblickend vom Zeitpunkt der Forschung bearbeitet, um Bedeutungen der Prozesse aus dem Material heraus zu bewerten. Hierbei wird eine konstruktivistische Perspektive eingenommen, welche aus der Analyse der Blickwinkel der befragten ExpertInnen gewonnen wird. (Vgl. Flick 2011, S. 180-181.)
Die qualitativen Ausprägungen sind von besonderem Interesse. Einordnen lässt sich diese Arbeit im Rahmen von professionsbezogenen Konzepten und Methoden mit einer weiterführenden Aufschlüsselung und der Einordnung in die Methodik der rekonstruktiven Fallanalyse bzw. dem Fallverstehen. (Vgl. Giebeler et.al. 2008)
Wenn AdressatInnen der sozialen Arbeit mit professionellen HelferInnensystemen in Interaktion bzw. in Beziehung sind, setzt Fallrekonstruktion ein. Diese ist bemüht, mittels Analyseprozessen und Reflexionen eben dieser Prozesse Typologien zu entwickeln, welche in zukünftigen Fällen erweiterndes Potenzial für die professionelle soziale Arbeit leisten können. Wenn es mit diesen Fallanalysen gelingt, Strukturen und Dimensionen von Fällen zu erfassen, welche sinnvoll in einen Zusammenhang gebracht werden können, ist es möglich alternative und Vertiefende Handlungsmodelle in der sozialen Arbeit als Beitrag zur Professionalisierung aufzuwerten. (Vgl. Giebeler et.al. 2008, S.13-18.) Rekonstruktive Sozialarbeit versucht demnach, sich den konstruierten und vermittelten Wirklichkeiten von handelnden Subjekten anzunähern (vgl. Galuske 1998, S.199-201.). Wenngleich sich in diesem Zusammenhang eventuell die Problematik verbirgt, dass diese Rekonstruktionsversuche systematischen Verzerrungsfaktoren unterliegen. (Vgl. Schütze In: Galuske 2007, S.215.)
Eine qualitative ExpertInnenbefragung ist in dieser Forschung erforderlich und notwendig, um in der Literatur noch wenig erforschte Prozesse zu erfassen und dieses Wissen in zukünftige soziale Arbeit in der forensisch-ambulanten Nachsorge einfließen zu lassen und Handlungsempfehlungen zu explorieren.
Vorerst werden die Eckdaten des PSP Projekt RETURN zur Verständnisbildung aufgezeigt. Weiteres wird die Auswahl der Untersuchungseinheiten erläutert.
Insgesamt 55 KlientInnen (11 Frauen, 44 Männer) werden im Jahr 2012 von 11 MitarbeiterInnen laut Jahresbericht 2012 (aktuellste Version) im PSP Projekt RETURN betreut. Die Zahl der Neuaufnahmen und Abmeldungen variiert bis zum Jahr 2014 äußerst geringfügig, demnach können die Zahlen nach Absprache mit der zuständigen Bereichskoordinatorin des Projektes Dipl.SA Barbara Kleinheinz als Richtwert in dieser hier vorliegenden Arbeit verwendet werden.
24 KlientInnen von 55, welche 2010 in der Probezeit waren, können laut ihrer Diagnose dem schizophrenen Formenkreis zugeordnet werden. Die zweit-häufigste Diagnose in diesem Betreuungskontext ist beim PSP Projekt RETURN ist eine bipolare affektive Störung/Erkrankung. Die am geringsten vorkommenden Diagnosen der betreuten Personen sind mit 1 aus 55 eine depressive Erkrankung und mit ebenfalls 1 aus 55 eine Manie. Nicht näher ausdifferenzierte Persönlichkeitsstörungen sind mit 8 Menschen von 55 im unteren Schnitt einzuorden, wenngleich auch Mehrfachdiagnosen miteingenommen werden. (Vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.6)
Hinsichtlich der Deliktverteilung lässt sich mit 23 Setzungen die gefährliche Drohung als Häufigste nennen. Es folgt die (schwere) Körperverletzung mit 13 aus 55 und mit 6 aus 55 der Widerstand gegen die Staatsgewalt als die am dritthäufigsten vorkommende Handlung. Schließlich werden jeweils mit einem Delikt beispielsweise versuchte Nötigung, geschlechtliche Nötigung, Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, Belästigung, Raub oder vorsätzliche Gemeingefährdung. (vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.6.) Der aufsuchende Dienst (Einzelbetreuung) wird von 32 Betroffenen in Anspruch genommen. 18 Personen nehmen an einer Beschäftigungs-/ oder Arbeitsinitiative teil. Eine Person geht einer Tätigkeit am 1. Arbeitsmarkt nach und eine weitere nimmt an einer Suchtberatung teil. (vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.7.)
Im interdisziplinären Betreuungsteam des PSP Projekt RETURN befinden sich ProfessionistInnen aus unterschiedlichen Grundberufen der sozialen Arbeit. Im Jahresbericht des Projekt RETURN vom Jahr 2012 scheinen Dipl. psychiatrische Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Dipl. SozialarbeiterInnen, Dipl. PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, Dipl. SozialpädagogInnen, Dipl. ErgotherapeutInnen mit unterschiedlichen universitären Abschlüssen (u.a. Bachelor of Arts (BA) in Social Science) in der Personalausstattung auf. (vgl. Jahresbericht RETURN Stand 2012, S.4.)
Im Vorfeld der ExpertInnenauswahl war eine Bestimmung und Definition in diesem Kontext entscheidend. Als ExpertInnen werden in dieser Forschung diejenige Personen bezeichnet, welche über einen hohen Informationszugang im forensisch-psychiatrischen Bereich und über Verantwortung im Rahmen der Nachsorgebegleitung des PSP Projekt RETURN im Hinblick auf die betroffenen Menschen verfügen und vorweisen können. (vgl. Meuser und Nagel 2002, S.73.) Berufsgruppenspezifisch gab es keine Ausschlussprinzipien, um eine möglichst variierende und breit angelegte interdisziplinäre Sichtweise zu erzeugen.
In diesem Zusammenhang werden daher alle FachmitarbeiterInnen des PSP Projekt RETURN an dieser Stelle als ExpertInnen verstanden.
Gegenstand der Forschung sind konkrete Subjekte, also Menschen mit ihren individuellen beruflichen Erfahrungen, an denen die Annahmen überprüft werden. Ziel ist die Repräsentativität, darum wird in dieser Forschung ein Apriori Sampling gewählt.
Die Stichprobengröße für die ExpertInnenbefragung beläuft sich auf acht Menschen (Betreuungspersonen des Projekts RETURN). Für die Stichprobenauswahl werden Betreuungspersonen gewählt, welche einen eigens und individuell definierten „gelungenen Fall“ aus ihrem beruflichen Umfeld vorstellen möchten.
Ein Mensch wird zu einem Fall, wenn Hilfebedarf und/oder Unterstützung in (Teil-) Bereichen des Lebens vorherrscht – wenn es also demnach eine Problemlage individuell oder aus der gesellschaftlichen Perspektive heraus zu lösen gilt und diese in die definierte Zuständigkeit der sozialen Arbeit fällt. Der Bedarf muss jedenfalls formuliert und thematisiert werden. Außerdem wird menschliches Handeln dann zum Fall, wenn die gesellschaftlichen oder selbst definierten Akzeptanzen erreicht bzw. überschritten wurden. (Vgl. Giebeler in Giebeler et.al. 2008)
Jene in der qualitativen Befragung verwendeten Erhebungsinstrumente werden im Folgenden erläutert und die Durchführung des Pretests wird beschrieben.
Für die qualitative Befragung der ExpertInnen des PSP Projekt RETURN wurde ein Leitfaden erstellt. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht die Privatperson, sondern der/die ExpertIn mit ihrem/seinem Wissen in Bezug zum institutionellen und organisatorischen Kontext. (Vgl. Meuser und Nagel 2002, S.72-73.)
Die Autorin entscheidet sich in dieser Thesis für ein Leitfadeninterview, da die Forschungsfrage sehr konkret ist und es der Autorin als wesentlich erscheint, einen Erzählfluss zu erzeugen, trotz alledem aber den Fokus nicht zu verlieren. Ziel der Auswertung des Datenmaterials ist eine möglichst unverzerrte Darstellung und Deutung dieser Ausschnitte der Betreuungspersonen in ihrer Arbeit mit und für Menschen.
Konkret auf den Erkenntnishintergrund bezogen bietet sich das problemzentrierte Interview an. Der theoretische Hintergrund lässt sich als „Auseinandersetzung mit Subjekten“ einordnen. Die gewählten Fragestellungen richten sich auf gewählte Sachverhalte. Auch das Wissen um Sozialisationsprozesse kann an dieser Stelle eingeklammert werden.
Im Vorfeld wurde der Leitfaden mittels Leitfragestellungen zu Themenbereichen in drei Blöcke unterteilt. Zu Beginn wurde gebeten, über einen bereits selbst als „gelungenen definierten Fall“ im Rahmen der Betreuung in der forensisch-psychiatrischen ambulanten Nachsorge zu erzählen und auszuführen. Im zweiten Block wird die Arbeitshaltung und berufliche Reflexion des Kontextes exploriert. Stigmatisierung als Phänomen in der täglichen sozialen Arbeit mit betroffenen Menschen bildet den letzten Block. Um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten, wurden bei Bedarf Subfragestellungen erstellt, welche aus den Themenkomplexen heraus entstanden sind. Die erste Frage, nämlich jene zum „gelungenen Fall“ , kann als Einstiegsfrage betrachtet werden.
Am Ende des Interviews gab es die Möglichkeit, Anmerkungen, Meinungen, Ergänzungen mit einer offenen Abschlussfrage auszusprechen. Der vollständige Leitfaden mit den spezifischen Fragestellungen befindet sich in Anhang A.
Sowohl der Leitfaden, als auch das Interview wurden einem Pretest unterzogen. Im Zeitraum von einer Woche wurden beide Instrumente auf die zu erwartende Befragungszeit und die Verständlichkeit hin überprüft.
Bereiterklärt hat sich hierfür eine Mitarbeiterin des Projekts RETURN, die in der tatsächlichen Forschung nicht einbezogen wurde.
Nach dem Pretest wurden die Befragungsinstrumente adaptiert.
Der Erhebungszeitraum erstreckte sich bei der vorliegenden Untersuchung von der ersten Kontaktaufnahme der aquierierten MitarbeiterInnen des PSP Projekts RETURN über die Organisation von Interviewterminen und Räumlichkeiten bis hin zur tatsächlichen Interviewsituation über insgesamt 12 Wochen.
Die erste Kontaktaufnahme über ein mögliches Interesse an einer qualitativen Erhebung im Rahmen der Master Thesis erfolgte im Oktober 2013 bei der zuständigen Bereichskoordinatorin und Hauptverantwortlichen des PSP Projekt RETURN Dipl. Sozialarbeiterin Barbara Kleinheinz. Im Gespräch wurde das konkrete Untersuchungsvorhaben vorgestellt und an die Geschäftsführung weitergeleitet.
Des Weiteren wurde der Autorin infolgedessen eine Liste mit E-Mail-Adressen der in Frage kommenden über das PSP Projekt RETURN beschäftigten MitarbeiterInnen ausgehändigt. Alle MitarbeiterInnen wurden angeschrieben, ob sie im Rahmen der Untersuchung Interesse an einer Teilnehme hätten. Es wurde verdeutlicht, dass es sich bei der Untersuchung um die Erhebung beruflicher Strategien und professionellen Umgang mit Stigmatisierung handelt, sowie ein Fokus auf individuelle Betreuungsgestaltung gelegt wird und dass keine vereinsspezifischen Interessen, sondern ausnahmslos ein persönliches Forschungsinteresse im Hintergrund steht. (siehe Anhang B)
Nachdem nur zwei MitarbeiterInnen abgesagt haben, konnte in dieser Forschung konkret ein theoretisches Apriori Sampling Anwendung finden. Im Zuge der Interviews, demnach im Prozess der Datenerhebung und parallelen Auswertung, wurde die Auswahl nach und nach generiert. Nach jedem Interview wurde neu entschieden, welche relevanten Daten als Nächstes erhoben werden, um eine möglichst umfassende Datensammlung zu erzielen.
Die Interviews fanden in den eigens dafür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten des PSP Tirol mit Hauptsitz in Hall in Tirol statt. Die Interviews konnten in einer ungestörten Atmosphäre abgehalten werden. Vor Interviewbeginn stellte man sich vor, der Ablauf wurde erklärt, der Tonträger zur Aufnahme bewilligt und getestet und die Einwilligung unterschrieben. Außerdem wurde ein Kurzfragebogen eingesetzt, damit für das Thema weniger relevante Daten, wie beispielsweise die demographische Erhebung, herausgenommen werden konnte. Dadurch wurde die Zeit für spezifizierte Themen genutzt.
Die Dauer der Interviews bewegt sich in einem Zeitrahmen zwischen 23 und 70 Minuten. Ebenfalls kam ein Postscriptum zur Anwendung, in welchem nach geführten Interviews Eindrücke von der Forscherin notiert wurden, die für die Interpretation als hilfreich und unterstützend begriffen wurden.
Der freie Erzählcharakter des Leitfadeninterviews bot zudem die Möglichkeit bei Bedarf, sowohl verbale als auch non verbale Schemata zu analysieren und einzuordnen.
Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der Transkription und Auswertung verschriftlicht.
Bei der Aufbereitung der Daten findet eine vollständige wörtliche Transkription der Interviewaufnahmen Verwendung. Der Dialekt wird durch Überführung in Schrift-deutsch bereinigt und übertragen. Satzbaufehler, die durch den Erzählfluss entstanden sind und weitere sprachliche „Verschönerungen“ wurden insofern angewendet, als dass ein inhaltliches Verstehen möglich ist. Soweit möglich, wurde nur der im Original zu Protokoll gegeben Text verschriftlicht. Es stand jedenfalls der inhaltliche Aspekt der einzelnen Aussagen im Blickfeld des Interesses.
Es erfolgte eine organisationsbezogene (andere Institutionen betreffende) und personenbezogene Anonymisierung. (vgl. Mayring 2002, S.91.)
Längere Pausen oder relevante Betonungen wurden ebenfalls berücksichtigt und erkenntlich gemacht. (vgl. Flick 2011, S.380.)
Im Rahmen der Kategorienbildung wurde deduktiv und theoriegeleitet vorgegangen. Aus den Hauptkategorien heraus bildeten sich Unterkategorien, die sich aus theoretischen Vorüberlegungen ableiten.
Die Auswertung des erstandenen Datenmaterials erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse und wurde mit dem qualitativen Datenauswertungsprogramm Atlas.ti durchgeführt. Das Ziel ist die Reduktion auf die Kerninhalte, welche nach Mayring jedoch immer ein Abbild des Ausgangsmaterials sind und ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen bilden. (vgl. Mayring 2008, S.58.)
Die methodische Zusammenfassung selektiert im ersten Schritt zwischen relevanten und unwichtigeren Passagen. Bei relevanten Passagen wird daraufhin über-prüft, inwieweit und ob sich der Inhalt in das Kategoriensystem einordnen lässt.
Das System wurde laufend auf Trennschärfe hin überprüft und auf alle Transskripte angewandt, nachdem eine Paraphrasierung und Reduktionen stattgefunden haben. Bei der Inhaltsanalyse geht es nach Lamnek immer darum, dass Menschen ihre Annahmen und Ansichten in dem was und wie sie sprechen ausdrücken und dieses Gesprochene wiederrum Rückschlüsse zulässt. (vgl. Lamnek 1995, S.209-211.) Die entwickelten Codes befinden sich im Anhang E auf der CD.
Gütekriterien orientieren sich immer am Gegenstand und stellen die Qualität von Forschung sicher. Im Folgenden bezieht sich die Autorin auf die allgemeinen Gütekriterien nach Mayring (2002), um eine Einschätzung der Ergebnisse zu erlangen. In Bezug zum Gütekriterium der Verfahrensdokumentation wurde ein besonderes Augenmerk auf die detaillierte und genaue Dokumentation des methodischen Vorgehens gelegt. Nachvollziehbarkeit und höchst mögliche Transparenz werden im Forschungsprozess gewährleistet. Jegliche Interpretationen werden mit Begründungen unterlegt und Phrasen mit zusätzlichen Textstellen abgesichert. Dadurch sollen sich Widersprüche auflösen und transparent gemacht werden. Dies lässt sich dem Kriterium der argumentativen Interpretationsabsicherung zuordnen. Weiters wird auf die Regelgeleitetheit geachtet. Der Kodierplan kann hier eingeordnet werden, denn die genaue Definition und Verdichtung durch Ankerbeispiele verhindert Willkür und erhöht die Qualität und Nachvollziehbarkeit. Gegenstandsnähe wird durch den „Zugang zum Feld“ und die Interessensübereinstimmung im forensisch-psychiatrischen Kontext erreicht. (Vgl. Mayring 2002, S.144-146.)
Inhaltsverzeichnis
Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen ExpertInnenbefragung vorgestellt. Die verwendete qualitative Auswertungstechnik in dieser Thesis ist die Zusammenfassung und deduktive Kategorienbildung. Dabei wird anhand von Paraphrasierung, Selektion und Streichung das Ausgangsmaterial gebündelt und systematisch zusammengefasst (vgl. Mayring 2010, S.67-68.).
Die Kategorien wurden vom Interviewleitfaden und der Forschungsfrage abgeleitet. Die Gliederung dieses Kapitels orientiert sich wiederum an der vorab erstellten Kodierliste.
Dabei ergeben sich folgende Hauptkategorien:
-
Formen der Stigmatisierung
-
Benachteiligungen stigmatisierter Personen
-
Ausbreitungstendenz des Stigmas
-
Folgen und Auswirkungen der Stigmatisierung von Betroffenen aus Sicht des Betreuungspersonals
-
Antistigma-Kompetenz
Die Kodierliste ist in Anlehnung an das Buch „Antistigma-Kompetenz in der psychiatrisch-psychotherapeutisch und psychosozialen Praxis“ entstanden (vgl. Freimüller/Wölwer 2012). Am Ende des Abschnitts folgt eine Ergebniszusammenfassung.
Von insgesamt 11 MitarbeiterInnen des PSP Projekts Return wurde mit 8 MitarbeiterInnen ein qualitatives Interview geführt.
Nicht-Teilnahme der verbleibenden drei MitarbeiterInnen lässt sich einmal durch die Teilnahme am Pretest begründen, in einem weiteren Fall die weite Distanz und durch die damit einhergehende fehlende zeitliche Ressource sowie in einem letzten Fall ohne Begründung für die Absage.
Die 8 MitarbeiterInnen stammen aus unterschiedlichen Grunddisziplinen. Drei der Befragten geben auf die Frage der Vorbildung an, das psychiatrische Krankenpflegediplom absolviert zu haben, zwei weitere Befragte können ein sozialwissenschaftliches Studium vorweisen und drei der Befragten haben differenzierte Individualausbildungen die zur Ausübung des Berufs SozialarbeiterIn befähigen.
Die abgeleiteten definierten Formen der Stigmatisierung wurden in die Unterformen einer direkten, strukturellen sowie kulturellen Stigmatisierung unterteilt und werden somit gesondert angeführt.
Die BetreuerInnen gaben in den Interviews an, dass Menschen, die sie begleiten, direkte Stigmatisierung meist nicht als solche wahrnehmen bzw. sich an die „abwertenden Blicke“ vermeintlich schon gewöhnt haben. Aus einer gezielten Nachfrage heraus wurde ebenfalls deutlich, dass die Erahrungen direkter Stigmatisierung der zu betreuenden Menschen von den betreffenden BetreuerInnen bis auf einen Fall nicht angesprochen und im Betreuungskontext nicht thematisiert wurde.
B3: „Nein, über Stigmatisierung reden wir eigentlich nicht, wenn mein Klient sich zum Beispiel nicht wäscht und wir einen Café trinken gehen und er komisch angeschaut wird, merkt er das gar nicht, da sage ich ihm dann, dass es angebracht wäre sich zu waschen. Mir ist es wichtig, dass die Betreuung stattfindet, über die Blicke sehe auch ich hinweg.“
Auffallend war, dass strukturelle Stigmatisierung den am häufigsten kodierten Code dieser Gruppe darstellt. In dieser Ausprägung gaben die BetreuerInnen des PSP Projekts RETURN eigene Erfahrungen struktureller Stigmatisierung ihres Klientels als auch diesbezügliche Erzählungen aus dem Erleben der KlientInnen im Betreuungssetting an.
Folgende Beschreibungen werden hier zur Verdeutlichung angeführt:
B6: „Ich glaube nicht, dass ihn die Stigmatisierung stört. Ihn stört mehr die Einschränkung, die er faktisch über das Gesetz hat. Also Stigmatisierung ist für ihn nicht das Problem, sondern die konkrete Einschränkung, die er hat, weil er richterliche Anordnungen hat.“
B4: „Wo sie es draußen merken ist, dass man ganz fest aufpassen muss – das habe ich zum Beispiel bei meinem Klienten, sei es in der Berufsschule, dass niemand es weiß, sei es in der Arbeit, dass niemand davon weiß, ganz viel mit der Verschwiegenheitspflicht und mit dem Vertrauen und dass man einfach im Gegensatz zu anderen Klienten sie da ganz feinfühlig sind ist mir aufgefallen. Und die Integrität oder ihre Persönlichkeit da relativ stark schützen. Und ganz, ganz Wenigen eigentlich erzählen, was wirklich los ist. Und es auch eine Zeit lang braucht, bis sie dir erzählen, wie es dabei geht, wie sie sich dabei fühlen.“
An dieser Stelle kann zusammengefasst werden, dass viele betroffene Menschen versuchen, ihre Erkrankung zu verheimlichen. Viele Betroffene leiden unter dem auferlegten sozialen Stigma und haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht. In Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen sind Menschen vermehrt von Stigmatisierung betroffen, da das medizinische Personal Akten zur Verfügung hat. Das Wissen über die Krankheitsgeschichte der KlientInnen schafft nach der Meinung der BetreuerInnen einen Nährboden für Ungleichbehandlung.
B4: „Mehr in einem öffentlichen Krankenhaus passieren die Stigmatisierungen was gewisse Erkrankungen anbelangt. Das heißt, mit der Depression kann noch jeder relativ gut umgehen, sobald es über die Depression hin-ausgeht passiert auch im professionellen Bereich sehr, sehr viel Stigmata bis hin, dass keine Untersuchungen gemacht werden, notwendige Untersuchungen einfach vergessen werden zu machen, Blutbefunde nicht gemacht werden und es sehr viel ausmacht, ob ein Betreuer mitgeht zu Untersuchungen, mit dabei ist bei Untersuchungen, sein Wissen miteinbringt in das Ganze und selbst dann ich diese Woche zur Antwort bekommen habe: ‚Solange die Blutwerte nicht passen, ist es unter Ultraschall zu teuer, einen Leber- oder eine Bauchspeicheldrüsenultraschall zu machen.‘ was meines Erachtens nach €50,-- kostet – maximal im Krankenhaus. Wie gesagt, da merke ich einfach die Stigmatisierung, was mit psychisch kranken Menschen passiert, weil ich vorher auch in allgemeinen Krankenhäusern gearbeitet habe und auf Stationen gearbeitet habe und auch weiß, was die Pflegepersonen so hinten herum reden und beim Kaffee über die Leute dann reden und sich denken. Und viel größer, als in der allgemeinen Bevölkerung, zumindest, wie ich es jetzt wahrnehme und auch sehe.“
Interessanter Weise wurde die kulturelle Stigmatisierung nur bei einer der befragten Personen erwähnt. Im Zusammenhang mit Stigmatisierung wurde lediglich in einem Interview bei einer Fragestellung angeführt „dass man es noch schwerer hat am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen wenn man andere kulturelle Lebensweisen pflegt und lebt“ (B3)
Um eine ausspezifizierte und differenzierte Betrachtungsweise zu erlangen wurden bestimmte Lebensbereiche im Rahmen der Kodierung herausgefiltert um herauszufinden, in welchen Bereichen Menschen vermehrt oder vermindert Stigmatisierung auf Grund ihrer „forensisch-psychiatrischen Zuschreibungen“ und damit einhergehend Benachteiligungen, erfahren.
Allgemein lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass betroffene Menschen resultierend aus der psychischen Erkrankung gepaart mit einer Anhaltung in einem Maßregelvollzug oder einer Justizvollzugsanstalt durch die fehlenden Versicherungsjahre und zusätzlich meist auch prekären Lebenssituationen und fehlender bis schlechter Bildung/Ausbildungsmöglichkeiten Benachteiligungen am Arbeitsmarkt erfahren.
B5: „Ich habe natürlich auch Klienten, die arbeiten möchten und die dann schon merken, dass es nicht so leicht ist, wenn man in der Psychiatrie gewesen ist, dass man da auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fasst.“
B3: „Bei der Arbeitssuche wird es sichtbar, wenn jemand erzählen muss, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Wenn da herauskommt, er hat einen längeren stationären Aufenthalt gehabt… wobei das muss dann auch nicht gesagt werden. Eine Verurteilung… Beim Leumundszeugnis… Wenn jemand tatsächlich eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt sucht, dann ist es ersichtlich.“
Immer wieder wird von Befragten erwähnt, dass betroffene Menschen versuchen, ihre Erkrankung oder die Tatsache der Anhaltung, der Inhaftierung oder stationären Aufenthalte zu tabuisieren und bei der Arbeitssuche zu verheimlichen.
B7: „Beim X eben schon, weil er partout nicht wollte, dass der neue Arbeitsplatzchef, also der neue Chef oder auch generell, wo er sich beworben hat… Der will einfach nicht, dass die wissen, dass er eine psychische Erkrankung hat. Ich meine, früher oder später werden sie draufkommen, weil früher oder später merkst du es beim X, weil er einfach nicht in Gruppen arbeiten kann. Für sich selber kann er gut arbeiten aber sobald Gruppen da sind… Vielleicht reißt er sich auch zusammen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und da hat der X ganz große Angst, dass er stigmatisiert wird, dass er abgewertet wird.
B6: „Das ist oft das Schwierige, dass man sagt, ok, das steht… ist nicht einbetoniert und das kann man erzählen, Leuten, denen man vertraut, muss man aber nicht. Jeder hat seine Geschichte irgendwie oder jeder hat… irgendeine Leiche hat eh ein jeder im Keller, eine größere oder kleinere. Und dass das eben nicht so dominiert quasi. Aber natürlich, gerade in unserer Gesellschaft, da ist halt… da macht so Leistung, arbeiten gehen… das sind so besondere Werte und haben eben einen hohen Stellenwert bei uns. Und da wird es dann schon schwierig. Aber da brauche ich noch gar nicht forensisch werden, sondern da geht es einfach um die Leistungsfähigkeit, die eigene. Und dann wird es da oft schon schwierig, dass man sagt, ok, ich bin da… ich hab die Erkrankung und ich gebe das, was ich kann und da bin ich auch stolz drauf, auch wenn es nicht der 40-Stunden-Schichtdienst beim Swarovski ist oder so (lacht) Keine Ahnung.“
Auch das Betreuungspersonal sah sich hier immer wieder zwischen den Stühlen angesiedelt. Sie stellten sich die Frage, ob sie diese Tatsache im Sinne der KlientInnen mittabuisieren sollten – was sie meist dann auch taten. In keinem der Interviews der Befragten wurde diese konkrete Form der Benachteiligung in der Betreuung längerfristig thematisiert. BetreuerInnen tragen die „Unsicherheit und die tiefsitzende Angst“ (B5) der KlientInnen augenscheinlich mit.
B4: „Da versuche ich auch so weit wie es geht, dann auch nichts zu sagen. Aus Angst, dass er da einfach Nachteile oder auch im Berufsleben Nachteile bekommt.“
Ebenfalls wurde in vier aus acht Interviews die Beeinträchtigung auf Grund der Medikation angesprochen die es den Betroffenen schwer macht, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, da die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. In einem Interview wurde erwähnt, dass ArbeitgeberInnen zu wenig gefördert würden, um Menschen mit Beeinträchtigungen Stellen bieten zu können (B5).
B3: „Sie hat dann aber keine Tagesstruktur gehabt, dann war das große Thema, dass sie nichts zu tun gehabt hat den ganzen Tag. Dann haben wir eine Arbeit gesucht. Arbeit suchen war sehr schwierig, weil sie durch die Medikation sehr beeinträchtigt war. Konzentration und Auffassungsfähigkeit waren ebenfalls eingeschränkt.“
Die Wohnsituation der betroffenen Menschen ist meist an Weisungen geknüpft, demnach wird oft eine betreute Wohnform vonseiten des Gerichts verordnet.
Die häufigsten Aussagen über die Wohnthematik verliefen dahingehend, dass es für die Einhaltung der Weisungen von den BetreuerInnen als notwendig erachtet wurde, dass eine betreute Wohnform für ihre KlientInnen zur Verfügung stehen müsse. Die BetreuerInnen sprachen davon, dass die betreute Wohnform gerade in der „Anfangszeit“ ihrer Meinung nach die Basis für das Zustandekommen einer Betreuung bildet, da die „Ausgehzeiten der KlientInnen kontrolliert und dokumentiert werden“ (B5). Zwei von acht Befragten meinten, sie würden sonst vor verschlossenen Türen stehen und könnten daher der Betreuung nicht nachgehen (B5, B7).
B8: „Der Klient ist in einer Wohngemeinschaft untergebracht worden bei uns. Das war so ein bisschen fast eine Ruck-Zuck-Aktion. Der ist entlassen worden, aus einem anderen Bundesland, hat da in Tirol niemanden gehabt, einen sehr engagierten Sozialarbeiter beim Verein X gehabt und ist schlussendlich in der WG gelandet.“
B3: „Er ist in einer WG vom PSP. Schwierig wird es, wenn er am Abend mal zu einem Fest oder ins Kino gehen möchte, das geht meistens nicht weil der Ausgang zeitlich begrenzt ist. Kontakte außerhalb der WG hat er nur in der Beschäftigungsinitiative. Mit seinen Jugendfreunden hat er den Kontakt abgebrochen, er hat mir erzählt dass es ihm zu peinlich wäre, wenn jemand was von ihm wüsste z.B dass er in einer WG wohnt.“
Die häufigsten Aussagen von befragten MitarbeiterInnen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung lassen sich gebündelt so zusammenfassen, dass die betroffenen Menschen am meisten darunter leiden, wenn der (forensisch-) psychiatrische Versorgungsbedarf offensichtlich von medizinischem Personal gesondert von jenem nicht-psychiatrischen behandelt wird.
B4: „Fragende Blicke, abweisende Blicke, lange Wartezeiten – sprich Hausärzte oder generell medizinisches Personal, wo ich mich einmal für einen Klienten angemeldet habe und dann hat sich der Warteraum zweimal gefüllt und geleert bis mir der Kragen geplatzt ist. Wobei sie nur den Namen gehabt haben und ich den Klienten gar nicht mitgehabt habe, weil ich ihm ein Rezept geholt habe, weil er krank war zu Hause und nicht zum Arzt gehen wollte. Also ich habe wirklich, was das anbelangt, viel gesehen und war da eigentlich auch relativ geschockt von der Stigmatisierung.“
Sieben von acht MitarbeiterInnen des Projekts RETURN gehen davon aus, dass sich betroffene Menschen der direkten Stigmatisierung nicht bewusst sind und sich in ihre Erkrankung zurückziehen.
B5: „Aber ich glaube, viele sind so mit ihrer Krankheit beschäftigt, dass es kein Thema ist. Erst vielleicht wenn sie wieder gesünder werden, werden sie aufmerksam, dass sie nicht vielleicht normal wieder in die Gesellschaft hineinkommen. Aber viele von meinen Klienten sind eben dauernd krank. Die sind so mit ihrer Krankheit beschäftigt, dass es eigentlich ein kein großes Thema ist.“
Alle Befragten geben an, dass von ihnen betreute Menschen ein sehr einfaches, meist schuldenbesetztes, öfters auch ärmlich-zurückgezogenes Leben führen.
B2: „Wir haben dann versucht ihn von einer Tagesstruktur, von einer einfachen Struktur wieder in einen Arbeitsprozess einzuführen, vom AMS her war er als nicht arbeitsfähig eingestuft und hat deswegen auch finanziell keine Unterstützung mehr bekommen.“
B5: „Es war einfach er hat eine eigene Firma gehabt und ist da in Konkurs gegangen also es waren bei ihm ziemlich viel an Schulden aufgehäuft was wir dann gemacht haben war einfach eine Schuldenregulierung aus einem Privatkonkurs der ist auch nur möglich gewesen weil er wieder arbeiten hat können das war eben davor nicht möglich weil er keine Arbeit gehabt hat.“
B6: „ Die Wohnsituation lässt sich als sehr einfach beschreiben, er hat wenig Möbel und die sind auch nicht mehr die Neuesten. Er sagt aber, dass er sich so wohlfühlt.“
Man kann davon ausgehen, dass die sozialen Stigmata der Deliktsetzung als Normverstoß und der psychiatrischen Erkrankung dazu beitragen, dass sich die Betroffenen immer mehr zurückziehen.
Die fehlenden, lückenhaften Versicherungszeiten führen dazu, dass Betroffene mit minimalen finanziellen Bezügen leben müssen. Die Lebenssituation wirkt sich demnach auch deutlich auf die sozialen Beziehungen aus. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird dadurch minimiert, bzw. die Nicht-Teilnahme erkenntlich mitproduziert.
B1: „Es war eben der Versuch da, zu schauen, ob es eine Hobbymannschaft gibt, wo er mitspielen kann, weil er sich nur daheim eingesperrt hat sozusagen. Saunagänge, Schwimmen gehen, körperliche Aktivität. Er hat aufgrund der ganzen Medikamente und aufgrund seiner Antriebslosigkeit durch die Medikamente doch ordentlich zugelegt, hat schlechte Blutwerte, Fettwerte, hat aufgrund von seinem Übergewicht auch Schlafprobleme, Schlafapnoe.“
Im Projekt RETURN, so wurde mehrmals erwähnt, werden immer wieder Möglichkeiten der Beteiligung an Freizeitaktivitäten für betroffene Menschen geschaffen. Meist funktionieren diese Versuche ausschließlich innerinstitutionell, was bedeutet dass es sich in erster Linie um vereinsinterne Gruppenangebote handelt. Die Menschen wehren sich meist jedoch massiv dagegen, mit „fremden“ Menschen „draußen“ etwas zu unternehmen.
Die BetreuerInnen geben an zu erkennen, dass dies aus Unsicherheit und aus Angst vor Zurückweisung und Ablehnung geschieht. Eine aus acht Befragten besuchte mit ihrer/ihrem KlientIn gemeinsam einen „Yoga Kurs, was gut funktioniert hat“. (B8)
Die betroffenen Menschen sind „meist auch schwer zu motivieren, möchten am liebsten immer im Zimmer sein.“ (B3)
Dass Medien neben den Betroffenen selbst auch das soziale Umfeld mittelbar beeinflussen, steht außer Frage. Das mediale Bild psychisch erkrankter Menschen in der breiten Öffentlichkeit verbreitet stigmatisierende und stereotype Vorstellungen.
Es finden sich Verallgemeinerungen und Konstruktionen von Erkrankungen wieder, darüber sind sich alle Befragten einig. Die ProfessionistInnen betonen diese Problematik und weisen darauf hin, weiterhin für Information und Aufklärung zu sorgen.
B1: „Da gibt es schon immer wieder Stigmatisierung in alle Richtungen, auch psychiatrisch. Wenn wieder in der Zeitung drinnen steht: „Schizophrener hat dies und jenes getan“ - nicht der Schizophrene hat das getan, der Mensch hat das getan. Ob der jetzt schizophren ist oder nicht schizophren ist, das ist zweitrangig. Und da denke ich, ist Handlungsbedarf meines Erachtens wirklich massiv auf die Presse zuzugehen und solche Pressemeldungen dementsprechend umzuschreiben.“
Außerdem wird in fünf von acht Interviews darauf verwiesen, dass die Darstellung von psychischen Erkrankungen oder der Institution Psychiatrie in den jeweiligen Medien nicht ihrer tatsächlichen Repräsentation entspricht und deshalb massiv dazu beiträgt, dass Stereotypen und verfälschte Vorstellungen verbreitet werden. Diese „Bilder“ prägen sich ein und führen dazu, dass in Folge nicht mehr von Individuen und ihren Erfahrungen gesprochen wird als viel mehr von kategorisierten Zuschreibungen
B1:“Und ich denke, wenn sie schon solche Sachen publizieren wollen - weil der Mensch ist ja eigentlich mediengeil – wenn sie schon so etwas publizieren wollen, dann sollten sie zumindest die Diagnosestellung komplett außen vor lassen, weil dadurch verschlimmert es ja eigentlich die Situation für die anderen psychisch erkrankten Menschen, die tendenziell nicht die Bereitschaft oder das Potenzial haben, irgendwie dermaßen auffällig zu werden.“
B3: „Aufklärung bezüglich Erkrankungen glaube ich ist total wichtig. Es ist nicht wahnsinnig förderlich, wenn in den Medien dann drinnensteht „Schizophrener Straftäter“, weil die Leute das dann in Zusammenhang bringen: Schizophrenie ist etwas sehr Gefährliches! Stimmt aber nicht. Also das ist ein Bruchteil von Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung, die tatsächlich etwas begehen, eine Straftat begehen. Da wäre die Aufklärung „Was ist z.B. Schizophrenie?“ und „Aus welchem Hintergrund Menschen eine Straftat begehen?“ total wichtig.“
B3: „Meine Personen im Umfeld reagieren oft ängstlich, geschockt… „Was machst du? Mit geistig abnormen Rechtsbrechern?“ Die kennen das auch nur, wie es in den Medien steht oder wie man es halt im Radio oder im Fernsehen hört. „Die sind ja alle gefährlich. Das sind ja alles Psychopathen!““
B6: „Und auch eben wenn du draußen mit den Leuten redest – „Ma zach, das ist ja so gefährlich!“ Und da gibt es ja den Film „Einer flog übers Kuckucksnest“. Ja… seit dem meinen sie halt alle du hast ganz schwer gestörte Leute.“
Begriffe der Zuschreibung sind schon längst in die Medien eingegangen und man kann davon ausgehen, dass die in den Medien produzierten Bilder, die Vorstellungen der Allgemeinbevölkerung über psychisch erkrankte Menschen spiegeln.
Interessant ist es zu erwähnen, dass alle Befragten von sich aus die Medienthematik eingebracht haben, ohne dass eine dezidierte Frage im Interview gestellt wurde.
Die Grundidee dieses Kodes liegt in der Erfragung und Bewertung der Chance zur Familiengründung. Viele der betreuten Betroffenen befinden sich jedoch in keiner Beziehung, eingetragenen Partnerschaft oder einer Ehe, weshalb das Thema Familiengründung in der Betreuung weniger präsent war.
Die Befragten meinten jedoch, dass Stigmatisierung der Erkrankung zuzüglich des forensischen Kontexts Betroffene an sich schon bei der PartnerInnensuche benachteiligt und erschwerende Bedingungen schafft, weil die Kontakte der Betroffenen sich überwiegend auf nahe Familienmitglieder wie Mutter, Vater, Geschwister beschränken.
Lediglich eine befragte Person konnte angeben, dass sein/e oder ihr/e KlientIn in einer Ehe ist und ausführen, wie sich seine Situation äußert.
B1: „Also stigmatisiert sind sie schon. Sie stigmatisieren sich aber auch zum Teil selber. Also gerade bei ihm, bei meinem forensischen Klienten… also es ist schon… Der innere familiäre Kreis weiß Bescheid über seine forensischen Auflagen und über sein sogenanntes Krankheitsbild. Der äußere Familienkreis… also es ist eine typische türkische Familienstruktur. Also Cousins, Geschwister, Onkel, Tanten… Also ich glaube, wenn da die ganze Familie wirklich auf ein Paket bringst, dann hast du locker deine 200 – 300 Leute zusammen. Und wie gesagt, es gibt den inneren Kreis, das sind z.B. die nahen Angehörigen von seiner Frau und wirklich die nahen Angehörigen von seiner Seite, die wissen Bescheid. Der äußere Kreis weiß, dass es etwas gibt, etwas ist, aber die sind sicher nicht so informiert.“
Eine weitere befragte Person konnte angeben, dass sein/ihre KlientIn einen Kinderwunsch geäußert hat.
B2: „ Mein Klient ist auf Grund dessen, dass er seit vielen Jahren Medikamente nimmt zeugungsunfähig, so sagt er es zumindest. Er wollte aber immer Kinder haben.“
Man gelangt durch die Schilderungen der Befragten zu dem Schluss, dass die auferlegte forensisch-psychiatrische Zuschreibung und verallgemeinernde Konstruktion die PartnerInnenauswahl und Aufrechterhaltung als auch den Kinderwunsch und/oder den Erhalt des Sorgerechts betroffener Menschen erschwert wenn nicht sogar teilweise verwehrt. Das auferlegte Stigma wirkt sich auch auf diesen Lebensbereich massiv negativ aus. Oft sind Betreuungspersonen die einzige Bezugsperson der Klientel.
B2: „Die Stigmatisierung macht sich dann bemerkbar, einfach wenn Außen-stehende unmittelbar betroffen sind.“
Diese Beschreibung bildet auch die Definition der Codezuteilung von Ausbreitungstendenz allgemein.
Dass Stigmatisierungen auch übertragen werden können - sei es auf Personen oder konkrete Situationen - untermauert folgende Ausführung:
B2: „Es hat eine Umfrage von Krankenpflegeschülern in Kufstein gegeben: „Wie es um die konkrete Frage gegangen ist „Würde es Ihnen etwas ausmachen, dass jemand aus dem forensischen Kontext in der Umgebung wohnt?“ da hat es sofort geheißen „Nein, nicht bei uns!“ Also da merkt man halt doch den Widerstand – aber auch die Ängste, die in der Bevölkerung sind.“
Die Befragten bewerteten die Ausbreitungstendenz auf und durch Angehörige wie folgt:
B1: „Ich glaube, dass die Stigmatisierung von der Erkrankungen für den Klienten selber weniger das Problem ist, als die Stigmatisierung, die er durch die Familie auferlegt bekommt.“
B1: „Ich habe das Gefühl, die Familie traut ihm einfach auch nicht mehr und traut ihm auch nichts zu.“
B1: „Also für mich hat X. schon sehr viele Kompetenzen, die er nicht nutzen kann, weil ihn seine Familie hinten und vorne auch blockt und auch hinuntermacht. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, die drücken ihn einfach hinunter. Für mich war am Anfang eben von der Betreuung die Überlegung, ob es nicht geschickter wäre, ihn aus dem System rauszuholen und in eine betreute Wohnform reinzubringen. Das hat er aber auch ganz klar abgelehnt, dadurch, dass er im Gefängnis gewesen ist hat er schon ein sehr hohes Bedürfnis an familiärer Stabilität gehabt.“
Durch den Wegfall des eigenen Freundeskreises gewinnt die Familie zunehmend an Bedeutung, wenngleich auch viele Betroffene von ihren nahen Angehörigen nicht die gewünschte Unterstützung erfahren.
Welche Ambivalenzen bei den nahen Angehörigen auftreten, veranschaulichen die folgenden Ausschnitte.
B1: „Die Frau selber zeigt dem Betreuer, also mir gegenüber, sehr oft eine totale Ambivalenz dem Klienten gegenüber. Einerseits kommen Aussagen von ihr: „Das, was er mir früher angetan hat, das bekommt er jetzt alles zurück.“, andererseits deckt sie ihn dann wieder, dann zeigt sie wieder mit dem Zeigefinger auf ihn und „Da und da hat er das getan. Und da hat er Scheiße gebaut. Und das hat er getan.“
B3: „Das muss sich erst festigen, dass man erkennt, die Kombination aus medikamentöser Therapie und sozialer Begleitung macht die Stabilisierung. Dann kommen massive Widerstände oft von Angehörigen, wenn jemand Eltern hat oder Partner, dass die damit hadern, dass der jetzt mindestens 5 Jahre Auflagen hat und etwas einzuhalten hat. Es ist ja nur einmal passiert. Es ist jetzt einmal irgendein Delikt passiert. Anderen passiert das auch. Warum werden andere nur verurteilt und bekommen dann eine bedingte Strafe und warum hat der eine Auflage, dass er mindestens 5 Jahre die ganzen Weisungen einhalten muss? Das Hadern kommt auch sehr oft von Seiten der Angehörigen.“
B4: „Ich habe auch mit der Mutter geredet, ein ganz ein langes, intensives Gespräch um die ganze Situation aus ihrer Sicht auch zu sehen. Die hätte die Möglichkeit gehabt, auch ihn nach Hause zu nehmen, wobei sie gesagt hat, ja, aber er hebt sie so hintenherum, dass sie sich nicht traut. Sie kann die Verantwortung nicht übernehmen.“
B4: „Die Mutter von einem Klienten hat, wo ich gesagt habe, er hat Suizidgedanken geäußert, wollte ihn nicht einliefern. Also die hat gesagt: „Nein. Und so schlimm ist das gar nicht.“ Bis er dann eine Suizidhandlung getätigt hat, er hat 5 Zigaretten gegessen, wobei ich dann über den Sprengelarzt ihn einweisen hab lassen müssen. Es war dann so, dass er nach 24 Stunden – nein, nach 48 Stunden wieder sich selbst entlassen hat entgegen dem Rat der Ärzte, weil da die Mutter solche Vorurteile gegen die stationäre Aufnahme gehabt hat. Wobei ich einfach versucht habe, ihr das zu erklären, aber die das nicht wirklich akzeptieren wollte. Einen anderen Klienten habe ich, der ist freiwillig hergegangen, weil er gesagt hat: „Mir geht es nicht gut und ich habe Gedanken, dass ich mir den Kopf herunterschneide mit der Motorsäge.“ Er hat mich angerufen und hat mir gesagt: „Ich fahre jetzt nach Hall.“ Das gibt es eben auch.“
B4: „Da stehen die Eltern dahinter, da war der Umkreis auch dahinter und wissen auch viele Bescheid. Und der andere ist eher isoliert und hat relativ wenig soziale Kontakte bis gar keine. Und da ist es umso schwieriger dann eigentlich wirklich professionell dann einzuwirken und auch einmal sich gegen Bezugspersonen von Klienten zu richten.“
B4: „Ein Klient selber hätte es getan, würde mir auch Langzeittherapien o-der was machen, aber da sträuben die Eltern dagegen, weil sie das Stigma von Psychiatrien so stark drinnen haben.“
Auch Menschen, die mit Betroffenen arbeiten erfahren die Ausbreitungstendenz. Wie sich diese äußert, zeigen die kommenden Auszüge deutlich.
B3: „Ich erlebe die Stigmatisierung im Alltag, wenn ich mit Klienten einkaufen gehe, wenn ich mit Klienten in einem Kaffeehaus sitze. Es kann vorkommen, dass ich mich gar nicht wohl fühle.“
B4:“Ich merke es, wenn ich mit den Klienten etwas trinken gehe oder wenn ich mit den Klienten essen gehe manchmal an den Blicken oder an Reaktionen von anderen Menschen.“
B1: „Da muss ich von zwei Aspekten ausgehen. Der eine Aspekt ist, gewisse enge Freunde, Freundschaften, Bekanntschaften, Familie… wenn wir in der Familie sind, also meine Schwester, meine Frau und ich sind alle im Pflegeberuf. Wir haben alle mit gewissen Stigmatisierungen zu kämpfen.“
B7: „Du bist automatisch irgendwie eine Hass-Person für die Leute, würde ich sagen. Du bist der Feind. Du könntest der Grund sein, dass ich wieder zurückgehen muss. Und das nächste Problem ist, die sind ja alle nicht krankheitseinsichtig, die Forensischen. Also da gibt es sehr wenige, die sagen „Ja, ich habe eine psychische Erkrankung und ich habe diese Tat gesetzt, weil ich gerade psychotisch war. Weil ich mir gedacht habe, der Polizist, der will mich jetzt in die Gaskammer stecken.““
B7: „Nein, ich sage meistens, wenn halt irgendwer auch jetzt kommt und fragt „Was tust du gerade?“ und „Gehst du jetzt einkaufen?“ – „Nein, ich bin beim Arbeiten!“ Also das sage ich dann schon, mit dem muss der X auch klarkommen.“
B7: „Ma zaaaaach!“ (lacht) „Traust du dich das schon? Ist das nicht gefährlich?“ Aber man erklärt es ihnen halt und sagt „Nein, die lassen sie ja nicht heraus, wenn nicht alles passen würde!“
B6: „Ich denke mir, die, die ihr soziales Netz haben, da ist das sowieso… das ist das auch dann die Person, um die es geht, und nicht was die alles aufgeführt hat sondern da kennt man die Person mit ihren ganzen 10.000en Eigenschaften und dann ist das auch nicht so zentral. Und dass natürlich auch die Klienten auch vielfach in Bereichen, dann z.B. Tagesstruktur oder so, arbeiten, wo andere Betroffene auch sind, die dann mehr… wo dann einfach der Verständnisboden vielleicht von Haus aus schon größer ist.“
B6: „Weil man sieht die Person…Versucht man… ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber man versucht eben das nicht so… die Stigmatisierung bei einem selber nicht aufkommen zu lassen quasi. Aber ich denke man unterschätzt, oder ich unterschätze das sicher, wie das im Außen für die Personen auch ist. Das ist sicher für die Betroffenen selber doch immer wieder präsent. Also das… das denke ich mir schon. Selber versucht man das natürlich nicht… eine Person zu stigmatisieren natürlich. Aber es wird auch wenig so – bei mir jetzt – wenig thematisiert von Seiten der Klienten.“
B6: „Und da passieren meines Erachtens nach mehr im professionellen Bereich als im öffentlichen Bereich die Stigmatisierungen und die Vorurteile gegenüber von psychisch kranken Menschen.“
I: „Und auch umgekehrt: Denkst du, dass MitarbeiterInnen KlientInnen auch stigmatisieren, die in der Betreuung tätig sind?“ B2: „Kann vorkommen, das hoffe ich, dass das nicht so viel der Fall ist (lacht). Kann im Einzelfall sichelich sein, aber da würde ich einfach sagen, im Großen und Ganzen vermeiden das Mitarbeiter schon. Ansonsten würde ich sie als unkompetent/inkompetent bezeichnen.“
Auffallend sind die vermehrt getätigten Aussagen über die Psychiatrie als Institution.
B5: „Psychiatrie ist etwas, was allein an sich stigmatisiert. Alles, was man nicht kennt und nicht einordnen kann, verändert uns und unser Verhalten. Wenn wir es einordnen können, dann verändert es uns auch noch einmal wieder. Aber gerade Psychiatrie kann niemand beurteilen.“
B4: „Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da hat es immer geheißen „ins gelbe Häuschen nach Hall“. Und mittlerweile ist das nicht mehr so, sondern sagt man ich wirklich „die Psychiatrie“ oder auch einmal stationär zu gehen.“
B4: „Was bei den Klienten sehr viel mit Angst und Stigma behaftet ist, ist ein stationärer Aufenthalt. Beispiel: Die Mutter von einem Klienten hat, wo ich gesagt habe, er hat Suizidgedanken geäußert, wollte ihn nicht einliefern. Also die hat gesagt: „Nein. Und so schlimm ist das gar nicht.“ Bis er dann eine Suizidhandlung getätigt hat, er hat 5 Zigaretten gegessen, wobei ich dann über den Sprengelarzt ihn einweisen hab lassen müssen. Es war dann so, dass er nach 24 Stunden – nein, nach 48 Stunden wieder sich selbst entlassen hat entgegen dem Rat der Ärzte, weil da die Mutter solche Vorurteile gegen die stationäre Aufnahme gehabt hat.“
B6: „Ja… Das ist einfach so vom Umgang her so auf der Klinik. Also so… es war nicht respektlos, aber es war auch nicht respektvoll. Auch nicht das Wertschätzende. Oder der Fokus ist vielleicht auch manchmal weniger auf dem wie es dem Patienten oder Klienten geht, sondern einfach wie er… was er macht. Also so läuft da die Fokusverschiebung jetzt weniger auf das subjektive Empfinden des Klienten, wie es ihm geht mit der Erkrankung oder wie es ihm geht mit der Medikation und wie er sich fühlt. Sondern mehr der Fokus auf dem dass… kommt man mit dem Gesetz nicht mehr in Konflikt quasi.“
B4: „In meiner Arbeit… Ich sehe ganz viel Stigmatisierung was psychische Erkrankungen angeht. Ich sehe sie bei… verwunderlicherweise auch bei Psychiatern oder bei professionellen Mitarbeitern oder anderen Institutionen eigentlich, mehr als im eigenen beruflichen Umfeld.“
B2: „Naja, die Stigmatisierung denke ich ist generell im psychiatrischen Bereich da – nach wie vor. Vielleicht nicht mehr so häufig wie es vor 10 oder 15 oder 20 Jahren war, weil doch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet worden ist und weil sich auch viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch oft sich zu ihrer Krankheit – ob das jetzt Angstkrankheiten, Depressionen waren – dazu bekannt haben. Und ich denke, es fällt heute den Menschen leichter zu sagen: „Ich bin depressiv“ als noch vor 15 Jahren. Schwierig ist es zu sagen: „Ich bin schizophren“ – das ist nach wie vor denke ich eine große Stigmatisierung und das ist ja eigentlich auch das Hauptklientel in der Forensik.“
B6: „Ich meine, welcher Arzt will die Verantwortung für forensische Klienten haben?“
Die Auswirkungen und Folgen der Stigmatisierung werden nach von Seiten des Betreuungspersonals beurteilten positiven, negativen oder neutralen Aspekten unterschieden und näher beleuchtet.
Ob und inwieweit psychische Erkrankungen und Deliktsetzungen als Resultat erfahrener Stigmatisierungen angesehen werden kann, soll mit diesem Kode herausfiltert werden.
B2: „Ja, schon, das Leid ist in der Betreuung spürbar. Weil sie ja sehr viel Kraft kostet, diese Fassade nach außen hin aufrecht zu erhalten und immer so zu tun, als wenn das eh nicht so arg wäre.“
Es wird deutlich, wie Betroffene auf Weisungen und damit einhergehend auf soziale Stigmatisierungen reagieren und wie versucht wird, mit diesen auferlegten kontrollierten Auflagen umzugehen.
B8: „Er hat einfach Weisungen gehabt, keinen Alkohol, kein Drogenkonsum. Er hat müssen in einer Wohngemeinschaft sein, er hat müssen eine Depotmedikation nehmen, er hat müssen Kontrolle beim Facharzt haben, eine Tagesstruktur haben und von diesen Dingen hat er glaube ich… Ich glaube, er hat Alkohol konsumiert, er hat Drogen konsumiert, er hat keine Tagesstruktur ganz lange gehabt, er hat…“
B7: „Naja, wenn man mit dem X darüber redet, flippt er meistens aus, wenn man sagt. „X, du bist psychisch krank. Ohne Grund bist du nicht da. Ohne Grund bin ich nicht da. Also irgendetwas muss ja da sein. Irgendein Arzt hat sich gedacht – Hoppala, beim X passt etwas nicht.“ Und mit dem kann er nicht gut umgehen. Er sagt es auch… Also wenn er jetzt neue Leute kennenlernt, sagt er auch nur, er wohnt in einer betreuten WG. Was ja eigentlich eh gut ist irgendwie. Weil wenn er jetzt ein Mädchen kennenlernt, er ist X Jahre, sag einmal einem Mädchen: „Du, ich wohne in einer betreuten WG. Ich bin Projekt Return, weil ich das und das angestellt habe. Und psychisch krank bin ich auch noch.“ Dass die davonläuft… Er will halt einfach, dass zuerst die Leute ihn kennenlernen und danach die Erkrankung. Finde ich eh gut, das ist eigentlich eh schon… ja… Er nützt es nicht aus.“
Die Arbeit mit Menschen im Zwangskontext ist geprägt von Unsicherheit und mangelndem Vertrauen, auch dem Betreuungspersonal gegenüber.
Hier kann man ebenfalls kritisch hinterfragen, ob diese soziale Kontrolle ein ausschließendes oder ein eingliederndes Element darstellt (vgl. Peters 2002, S.143.).
Auch Elemente der Selbststigmatisierung findet man in dieser Filterung wieder.
B6: „Aber beim X ist es halt einfach die Persönlichkeit, dass er sich da ein bisschen stigmatisiert fühlt. Weil er sich selber, bzw. er stigmatisiert die andern. Extrem!
Die BetreuerInnen bewerten auch den gesellschaftlichen Aspekt als problematisch wenn es davon handelt, dass Individuen auf ihre Erkrankung oder ihr Delikt reduziert werden und daher mit negativen Lebenschancen konfrontiert sind.
B3: „Also da erkennt die Gesellschaft nicht, dass es sich da dabei um eine Erkrankung handelt und dass man die behandeln kann. Also die Gesellschaft sieht oft nur das Delikt und meint, die sind dann brandgefährlich und man muss sie dann wegsperren.“
Die BetreuerInnen sind sich einig, dass die vertrauensvolle Beziehungsgestaltung in jedem Fall positive Auswirkungen auf die Betreuung und damit einhergehend auch auf den Umgang mit Stigmatisierungserfahrungen betroffener Menschen hat.
B6: „Ja in Summe… es war einfach so die positive Entwicklung durch die gemeinsame Arbeit, dass ich meine Existenz auch damit rechtfertigen kann oder dass ich auf der Welt sein kann, auch wenn ich mich nicht durch negative Auffälligkeiten auszeichne. Dass da in mir andere Sachen stecken, auf die ich stolz sein kann, ohne dass i sag… bei ihm war so ein bisschen dieses „Ich bin halt der Rowdie“, das war so ein bisschen die Identität auch. „Ich bin der Zähe und ich führe mich auf!“ Sondern dass das auch einen Wert hat, wenn man eben sich anpassen kann auch an die Gesellschaft und auch gewisse Normen einhält und dann auch stolz auf das sein kann quasi. Auf legale Weise glücklich und sinnhaft zu leben. (lacht) Er hat dann auch geheiratet und alles Mögliche. Total nett. (lacht)“
B3: „Also die besagt Klientin hat eine eigene Wohnung gehabt, hat schon selbständig gewohnt, hat beruflich Fuß gefasst, hat schon eine Tagesstruktur gehabt, hat schon Medikamente genommen, hat schon gewusst, es bringt ihr was – Medikamenteneinnahme. Das sind alles förderliche Faktoren.“
B4: „Gelungen finde ich den Fall, weil wir einfach gemeinsam geschafft haben, Aktivitäten zu bringen oder den Alltag hineinzubringen ins Leben von ihm und dass er das einfach weiterführt auch ohne meine Unterstützung.“
Wenn es gelingt, davon gehen die BetreuerInnen des PSP Projekts RETUN allesamt aus, eine tragfähige und kontinuierliche Arbeitsbeziehung aufzubauen, dann kann der Stigmatisierung der betroffenen Menschen entgegengewirkt werden.
Eine Befragte ist der Meinung, dass sich das Laienbild sehr wohl gewandelt hat und dies mittelbare Auswirkungen auf die Betroffenen hat.
B4: „Was mir aber auffällt, im Allgemeinen habe ich langsam das Gefühl, dass es von der Bevölkerung mehr angenommen wird, weil ganz viele Leute zumindest einmal einen Depressiven in der Familie gehabt haben und eigentlich schon wissen, was es heißt, psychisch erkrankt zu sein.“
Hier finden sich Aussagen wieder, welche von der Verfasserin weder als neutral bewertet wurden.
B5: „Das Stigma ist auf jeden Fall da, aber es ist nicht die Ursache dafür, dass sie keinen Fuß fassen. Sondern meiner Meinung nach meistens die Krankheit an sich oder eine falsche Selbsteinschätzung.“
B5: „Das ist nicht die Stigmatisierung, sondern seine tatsächliche psychische und physische Situation. Also Stigmatisierung ist Thema, aber Hauptproblem ist schon die Krankheit, überhaupt der Klient an sich.“
B4: „Ja, wobei die Betroffenen es oft gar nicht so wahrnehmen, sei es durch ihre Erkrankungen, dass sie einfach mit sich selber dann so beschäftigt sind oder mit ihren Ängsten und mehr betroffen sind, dass es ihnen jetzt nicht auffällt oder dass einfach schon das Ganze als normal empfinden, weil sie schon so viele Jahre mit dem leben.“
B4: „Er erzählt relativ gern und viel über sein Leben, wobei sagen wir 95 % des Inhaltes nicht der Realität entsprochen hat. Aber es war jetzt nicht so dahergelogen, dass man sagt, es würde jetzt nicht dazupassen. Aber er hat halt die Geschichten so erzählt, um das Gefühl zu erwecken, auch ein normales Leben zu haben.“
B2: „Was es beeinflussen kann ist, ob der- oder diejenige akzeptiert, dass er/sie krank ist und entsprechend auch Medikamente nehmen muss. Wenn der Betroffene nicht versteht, dass er krank ist, dass es wichtig ist Medikamente zu nehmen, wird es einfach den Gesundheitsverlauf einfach negativ beeinflussen. Und wenn er sieht, wenn er akzeptiert „Ich bin krank, ich brauche Medikamente“ wird er es auch sehr positiv erleben.“
B3: „Betroffene Klienten hadern sehr mit der Stigmatisierung. Sie erleben es ganz unterschiedlich. Bei manchen Klienten… Manche Klienten bekommen sie auch gar nicht mit, die Stigmatisierung. Also glaube ich jetzt einmal als Außenstehende so zu beobachten. Manche leben damit. Manche bekämpfen es auch aktiv, indem sie was dagegen tun.“
Wenngleich betroffene Menschen Stigmatisierung zumeist nicht konkret wahrnehmen und benennen können, findet bei Zeiten eine Verinnerlichung statt, ob bewusst oder unbewusst. Transparent wird an dieser Stelle auch die Prozesshaftigkeit dieses Phänomens.
Es wird deutlich, dass es ab dem Zeitpunkt der Problemwahrnehmung zu Widerstand oder Bewältigungsstrategien des Rückzuges kommt, Behandlungen werden von betroffenen Menschen verzögert wahrgenommen oder abgelehnt. Erst in weiterer Folge, wenn es den moralisch Verpflichteten (Angehörigen) oder den professionellen HelferInnen gelingt, mit den Betroffenen gemeinsam Strategien aus dem Rückzug und der sozialen Distanz heraus zu entwickeln, kann der Stigmatisierung aktiv entgegengewirkt werden.(Vgl. Rüesch 2005, S.199-200.)
Im Psychiatrischen, Psychosozialen Tätige bilden dann die bedeutendste Zielgruppe wenn es darum geht, der Stigmatisierung betroffener Menschen entgegenzuwirken. Die Belastungen die auf der Betroffenenseite durch Stigmatisierung erlebt werden führen dazu, dass dieses Phänomen meist als „zweite Erkrankung“ angenommen wird. Die Unsicherheit und Angst vor Ausschluss und Abwertung führen dazu, dass betroffene Menschen sich zurückziehen und Behandlungen verweigern oder zu spät annehmen (vgl. Freimüller/Wölwer 2012, S.7.) .
Das Erleben von Stigmatisierung durch beruflich Befasste beschreiben Betroffene als eine Form von Intoleranz, einem Mangel an Verständnis, einem Wissensmangel im Umgang mit Erkrankten oder auch das Verwenden von Fachvokabular (vgl. Schulze 2005, S.134.). Ebenfalls erwähnen Betroffene ein Desinteresse von ÄrztInnen an der Vorgeschichte, der eigenen Sichtweise oder den eigenen Bedürfnissen (vgl. Schulze 2005, S.304.).
Im psychiatrisch-psychosozialen Arbeitsbereich Tätige sind besonders gefordert, durch konkretes Verhalten, Wissen aber auch Haltungen Stigmatisierungen entgegenzuwirken und gesellschaftliche Sensibilisierungsarbeit zu leisten.
Durch die Analyse dieser Kodegruppe möchte herausgefiltert werden, welche konkreten Möglichkeiten sich im (Arbeits-)Alltag eröffnen und wie diesen Situationen begegnet wird.
„Antistigmakompetenz“ bezeichnet die Fähigkeit, sich wirksam gegen Stigma und Diskriminierung zu richten. Sie drückt sich in Wissen, Haltungen und Verhalten aus und bedeutet einen aktiven Beitrag zu einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander.“ (Freimüller/Wölwer 2012, S.7.)
B4: „Konfrontieren. Also… direkt konfrontieren, wenn es einem auffällt einfach anzusprechen. Es nicht mitzutabuisieren, wenn einem so etwas auffällt, sondern wirklich den Mut haben, die Leute darauf anzureden und unabhängig vom Status.“
Es wird vorausgesetzt, dass konkretes Wissen um psychische Erkrankungen vorhanden ist und die Bedeutung des Stigmas für Betroffene erkannt und richtig eingeordnet werden kann. Außerdem kann man von ProfesionistInnen erwarten, Recovery-, Selbsthilfeansätze und Stigmatisierungstheorien zu kennen und diese gezielt in der Betreuung zu kommunizieren und einzubauen. Auch der sprachliche Gebrauch, wenn es um die Arbeit mit und für Betroffene geht muss reflektiert und sensibilisiert werden. (vgl. Freimüller/Wölwer 2012, S.8.)
B6: „Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt klassisch schizophren oder klassisch depressiv oder klassisch Persönlichkeitsstörung. Natürlich, das schwingt mit, man spürt das auch, aber es sind oft so konkretisierte Problemstellungen, dass das dann wirklich so die Person… Da hat man dann den und den Namen und das Gesicht und das ist dann einfach der und der und dann konzentriert man sich auf das ganze Individuelle quasi. Man hat natürlich schon so allgemeine Aspekte, die eben natürlich auch so einen Leitfaden bilden, dass man sagt, man weißt, wenn jetzt jemand depressiv ist, ist es ganz gut oder gesund, wenn der hinauskommt und Aktivierung usw. und der Selbstwert auch immer wieder da mitgenommen wird und der gestärkt wird. Aber jetzt so viel, denke ich mir, so ein großer Einflussfaktor ist es eigentlich nicht. Nein, das ist mehr auf die Person dann wirklich… und das ist ja ganz unterschiedlich (lacht) Es gibt ja nicht den klassisch Depressiven oder die klassische Schizophrene.“
B6: „Ich denke mir, natürlich das Wissen um die Straftat beeinflusst natürlich schon, denke ich mir. Also das… Man will es ja auch wissen… Man wird ja auch informiert und dann hängt es natürlich schon davon ab, ist da ein Gewaltdelikt im Hintergrund oder mehr so Betrug oder andere Dinge, dann… Das beeinflusst einen natürlich. Man will, man versucht das dann… Aber je näher man eine Person kennt oder je mehr man mit der Person erlebt quasi, desto mehr wird es dann zum eigenen Gefühl. Man sagt, ok, bei dem habe ich jetzt keine Angst oder so. Oft im Vorfeld, wenn man Informationen dann bekommt, oder Betreuungsübergabe, dann gibt es ja oft ganz wilde Geschichten und dann denkt man so: „Oh, jetzt bin ich gespannt!“ Und dann ist es aber meistens, ja… (lacht) genau… genau… Aber natürlich das Delikt selber. Und man hat natürlich das immer im Kopf und dann schaut man, ok, geht irgendetwas in die Richtung und so… Oder warum ist das überhaupt… Man bespricht ja auch das ganz viel durch, was da, warum es dazu gekommen ist und was da los war und… genau… ja… „
Die Befragten sind sich einig, dass es in Bezug auf psychische Erkrankungen zu der Verallgemeinerung und Kategorisierung („Der Schizophrene“ usw.) kommt, es wird demnach von der Erkrankung auf die Gesamtperson geschlossen, in Bezug auf die Deliktsetzung ebenfalls.( „Der Gemeingefährliche“)
Haltungen in Bezug zu Antistigmakompetenz basieren immer auf der Annahme, einen wertschätzenden, würdigen und respektvollen Umgang mit den Betroffenen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang wird auch der Recovery-, Ressourcenorientierung und der Sensibilisierung für Stigmatisierungsprozesse besonderer Wert zugeschrieben. (vgl. Freimüller/Wölwer 2012, S.8.)
B5: „Es ist immer gegenseitig. Ich lerne genauso, ich lerne – auch wenn es nur das Zurückhalten ist, oder das Tiefer-Schauen.“
B5: „Ich glaube, generell kann man nicht darauf eingehen. Wie ich auf einen Klienten zugehe, das liegt natürlich in erster Linie am Klienten. Also ich habe keine… es gibt da kein Schema, sondern das, was gerade für mich persönlich sehr wichtig ist, ist die Zurückhaltung.“
B7: „Ich probiere immer, das Delikt ein bisschen wegzulassen. Also ich schaue mir jetzt gleich an, was sie gemacht haben, weil dann gehst du einfach schon mit einem Gedanken hinein „Ma zach, der hat jetzt die Mama umgebracht!“ So, also eher… Ich schaue, dass ich wertfrei hineingehe.“
B3: „Was mir persönlich wichtig ist, dass man das Gefühl gibt, ein normaler Mensch zu sein, der einfach nicht das Forensische, nicht die Straftat, die er einmal begangen hat, zur Last lege, oder ihm das Gefühl gebe, ich habe Angst vor ihm oder er ist etwas Schlechteres, sondern ihm einfach so viel Normalität und Offenheit entgegenbringen, wie es einfach mir möglich ist.“
B6: „Ja, ich denke mir eben, dieses Auf-Augenhöhe, das ist sicher ganz wichtig, dass man das schafft. Dass man eben wertschätzend und respektvoll… dass das ganz viel ausmacht. Und dass man auch natürlich eine Vertrauensbeziehung, die man aufbauen will, dass die dann auch wirklich stabil besteht und dass sie nicht wegen… durch irgendwelche Erschütterungen von Seiten der Betreuungsperson dann gleich eben gerade in dem forensischen Bereich, wo dann viel um… wo es dann um Kontrolle eben auch geht, ob alles hinhaut. Dass da… dass man da das gut transportiert. Wenn man jetzt sagt: „Ich muss jetzt aber doch den und den Richter informieren, warum er das machen muss.“ , wenn man es machen muss. Und worum es da geht, dass das… das ist sicher das Heikelste da in der Arbeit, dass man das irgendwie hinkriegt, dass sich das ausgeht.“
B6: „Und eben die Vorurteile, dass man da versucht, ein bisschen einen Schritt… weil es klingt ja wild, die abnormen Rechtsbrecher. Das ist ein ganz ein wildes Wort. Das ist schon heftig. Dass das eben auch nicht im Fokus steht, sondern wirklich der Mensch mit seiner Erkrankung und wie er sein Leben hinbekommt dann mit der Geschichte.“
B6: „Ja, ich denke mir das Wesentliche, was wichtig ist, dass sie… dass man gemeinsam erkennt oder die Person das auch selber schätzt, die ganzen Fähigkeiten und Stärken und Ressourcen, die die Person hat. Und dass natürlich das auch ein Teil ist, oder ein Teil der Lebensgeschichte, dass man da das und das Delikt gemacht hat oder…. und da eine Zeit inhaftiert war. Aber dass man das nicht natürlich als eigene Überschrift wahr-nimmt quasi. Und erkennt, was einen alles so ausmacht, unabhängig… oder zu dem dazu. Dass man das auch besser integrieren kann. Oder auch dann für sich selber verstehen kann, warum ist das passiert und wie kann ich dem vorbeugen und dann kann ich dafür sorgen selber, dass ich das nicht mehr… dass das so nicht mehr… dass es nicht mehr so weit kommt oder dass ich dann nicht mehr… das nicht mehr erlebe… und dass das jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte… ist ja nicht dann die Haft oder die psychische Erkrankung quasi. Sondern es gehört ja viel mehr dazu, was mich ausmacht.“
B2: „Allgemein denke ich ist es einfach so dass man einmal unvoreingenommen hingeht. Jetzt ohne dass man auf das schaut, was einfach als Tat geschehen ist. Und ich glaube einfach dass das sich auch beim Gegenüber als positiv erweist einfach dass… er sieht einfach, das man ihn einfach als Mensch einfach nimmt und ich denke einfach…. Jede Betreuung ist doch ein gleichwertiges Vorgehen ganz wichtig also nicht ich als Über-Drüber-Betreuer und dort der Klient sondern einfach wirklich ein Gleichgestellter sein.“
B2: „Man gibt ja ihnen als betreuende Person sehr viel Sicherheit. Und das heißt einfach diese Sicherheit verliert er, wenn ich mich zurückziehe. Und da muss man ihn einfach unterstützen, dass er diese Ängste gut bewältigen kann und dass er einfach auch sieht, dass er das allein schafft. Da braucht es sehr viel motivierende, sehr viele aufklärende Gespräche.“
B6: „Es sind auch die Haltungen unterschiedlich. Weil du das auch… zuerst, wenn ich das aufgreifen darf, mit der Stigmatisierung und so… das ist dann schon oft auch ein Unterschied. Also manche Personen… weil ich habe immer ganz gemischte Gruppen gehabt… also sowieso immer den Einzelmenschen.“
B7: „Am Anfang beim X auf alle Fälle, aber eben mittlerweile habe ich dieses Wurstigkeitsgefühl entwickelt. Also ich grenze mich richtig ab. Ich lasse ihn einfach auch. Ich dokumentiere alles und das ist es halt, was er braucht, dass er merkt „OK, die lässt mich jetzt von der Leine. Aber, wenn irgendetwas ist, kann ich sie anrufen“ Das ist ganz wichtig. Geht sicher nicht bei jedem, aber bei ihm ist es… Er ist ja so gesehen, er hat eine gute Intelligenz und ja… Da kann man das schon machen. Ein bisschen Selbstverantwortung den Leuten wieder geben, ist ganz wichtig, finde ich.“
B6: „Also ich sehe eher das Sozialarbeiterische und rede mit jemandem – unabhängig welche Diagnose er hat.“
B3: „Was wahnsinnig wichtig war bei der Übernahme, war Beziehungsaufbau.“
Unter den Kode des Verhaltens fallen der sensible Sprachgebrauch und dessen ständiges Reflektieren. Außerdem wird hier ein Hauptaugenmerk auf das direkte Thematisieren von Stigmatisierung gelegt. Außerdem erweist sich gut verständliche Aufklärung im privaten und beruflichen Umfeld als unumgänglich. (vgl. Freimüller/Wölwer 2012, S.8.)
B8: „Ich versuche, nicht klarzumachen, dass ich Betreuer bin. Wenn die Frage aufkommen sollte, die selten aufkommt, so wie „Wer bist du? Bist du ein Freund, ein Angehöriger, ein Verwandter?“ – dann sage ich: „Ich begleite ihn.“ Also ich umgehe das so ein bisschen. „Ich begleite den Herrn…“ Al-so respektvoll mit „Herr“, wenn sie uns nicht kennen.“
B8: „Die Straftat… am Anfang habe ich ein bisschen Bauchweh gehabt, von der Straftat. Also vor allem für die anderen Klienten habe ich gewusst, er hat mit Waffen zu tun gehabt… habe ich gewusst, dass das bei ihm gar kein Thema ist. Mein Weg ist es, Vertrauen aufbauen und das Vertrauen nicht zu missbrauchen. Wenn du jemanden jetzt nicht hineinlegst – was weiß ich was… klassisch: „Ich verspreche dir, wenn du das und das machst, dann verspreche ich dir das.“ und dann sagst du „Jetzt hast du es getan, aber du bekommst es trotzdem nicht.“ Das versuche ich total zu vermeiden und ich versuche immer offen und ehrlich zu sein und darum glaube ich, wenn du… Also ich bin eine emotionaler Typ und bei ihm hat es gepasst mit der emotionalen Ebene. Er hat die Sachen verstanden, er hat sie umdenken können.“
B1: „Am Anfang der Betreuung hat es auch immer wieder Situationen gegeben, wo er mir angedroht hat, er würde mir eine hauen. Also zum Vergleich: ich bin 1,70 m, mein Klient ist ungefähr eineinhalb Köpfe größer als ich, ein Bär von einem Mann. Also durchaus leicht möglich, dass eine Eskalation stattfinden hätte können. Ich bin auf seine Aggressions- oder Gewaltandrohungen eigentlich nie wirklich darauf eingestiegen. Ich habe ihm klargemacht, er kann tun, was er will. Er muss dann die Konsequenzen davon tragen. Ich habe damit kein Problem. Ich habe mir einen gewissen – ich sage einmal Respekt bei ihm aufgebaut, dadurch, dass ich ihm gegenüber keine Angst gezeigt habe.“
B7: „Das Problem ist, dass sie betreut werden müssen. Das ist das Hauptproblem. Der X, sobald die Maßnahme vorbei ist, wird nicht mehr betreut. Das sagt er auch. Finde ich auch, passt auch. Das passt wirklich bei ihm. Es ist ganz schwer, jemanden zu betreuen, der eigentlich gar keinen Bock hat. Der es als unnötig sieht, dass du da bist. Das ist beim X auch teilweise so, weil er muss, aber er will nicht. Und das ist eben bei ihm dann auch das Schwere, dass eben bei ihm darfst du gar nicht so ganz hart die Grenzen aufzeigen. Das packt er gar nicht. Das musst du halt auch können bei den Leuten. Das machst du schon auch individuell. Bei manchen musst du es machen, die mögen das auch, die brauchen das. Und eben bei meinem Klienten ist es halt eher so, der stellt es die Haare auf, wenn man das tut. Und dann muss man halt abwiegen, was jetzt… Ist es jetzt gescheiter, dass man da so schulmeisterlich auftritt oder ist es gescheiter, dass du mit ihm eine gute Beziehung hast.“
B6: „Das ist so ein bisschen die blöde Situation. Man will Vertrauensperson sein und gleichzeitig dazu muss man ein bisschen Kontrolletti… der Kontrolletti sein. Und ich habe halt immer mit ihm geredet und dann habe ich auch gesagt… z.B. gezielt vereinbart, dass ich ihn gar nicht frage, sondern er erzählt mir einfach, wie und was er da alles geschafft hat. Also von ihm aus. Und er hat das dann so ein bisschen gesteuert auch. Und dass ich die Informationen habe, die ich auch brauche quasi für diesen Kontrollbereich und er hat das Gefühl gehabt, er steuert das, wenn er… wann er sagt und wie er es sagt usw. Und von dem her hat er das dann immer besser dann angenommen auch. Und dann ist er auch mit Problemen gekommen und dann hat man auch das bearbeiten können. Da war dann nicht mehr das so zentral, dass man auch dahinter sein muss, dass das alles hinhaut sozusagen und funktioniert. Das war eben ganz… zum Beispiel… dass er sich dann eben mehr anvertraut hat und auch eben die Vertrauensperson, dass das dann mehr in den Vordergrund gerückt ist. Das war dann toll. Wo er gemerkt hat, denke ich mir jetzt, wo er gemerkt hat, ok, er hat sein Leben ja selber in der Hand. Man ist als Stütze da, aber dass er gemerkt hat, ich kann eine Selbstverantwortung auch wieder übernehmen und man hat sie ihm dann natürlich auch gegeben. Das hat er dann irgendwie gemerkt, dass das… dass ihm keiner etwas Böses will. Im Gegenteil sozusagen. Und dann ist auch immer mehr weggefallen. Man hat dann immer reduziert, reduziert, reduziert. Man hat immer gemerkt, mah… Und so. Und dann hat er noch ein Jahr dann freiwillig, das hat mich eben gefreut, da ist es ausgelaufen und dann hat er gesagt, nein, jetzt hängen wir noch ein Jahr dran, damit er das noch zeigen kann, dass er das auch wenn der Druck von oben nicht mehr ist. Und er wirklich frei wieder ist und dass er dann trotzdem das alles super hinbekommt.“
B4: „Mir fällt auf, dass es mir fast mehr auffällt, als den Klienten selber. Ich dann immer überlege, empfinde ich das nur so oder ist es für sie schon eine Normalität geworden? Das ist immer wieder die große Frage, die ich mir stelle, soll ich jetzt etwas sagen und soll ich das jetzt auch ansprechen. Bei manchen Menschen sieht man eine Traurigkeit im Gesicht, sieht man und merkt man ihnen an, dass sie das jetzt getroffen hat und dann versuche ich es auch anzusprechen oder auch die jeweiligen Personen direkt darauf anzureden, wobei sie das dann immer wieder verneinen oder natürlich, wenn sie damit konfrontiert werden, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist so meine Erfahrung damit. Und ich versuche es gerade im professionellen Bereich die Leute darauf hinzuweisen und die Leute dann auch direkt darauf anzureden, wenn ich das nicht richtig finde.“
B5: „Ich versuche, mich einfach so zu verhalten, dass es nicht auffällt, dass ich ein Betreuer bin. Ich denke das ist das, was man tun kann. Wie gesagt, Stigmatisierung ist nur einfach da jetzt nicht so ein großes Thema gewesen bis jetzt. Da kann ich jetzt viel zu wenig sagen.“
Mitarbeitende im psychosozialen, sozialpsychiatrischen Kontext können sowohl beruflich, als auch privat als gesellschaftliche MultiplikatorInnen angesehen werden und haben den Auftrag wesentlich Schritte gegen Stigmatisierung einzuleiten und zu stützen. (vgl. Freimüller/Wölwer 2012, S.7.)
Die einhergehenden Abwertungen, das Leiden der Betroffenen und die sozialen Ausschließungsprozesse müssen aktiv aufgegriffen und gesellschaftlich thematisiert werden. Dennoch setzt die aktive Thematisierung von Mitarbeitenden in Beruf und Privatem eine hohe Sensibilität, sowie reflektiertes Handeln voraus.
Fünf von acht Befragten geben an, privat auch immer wieder in ihrem Umfeld Informationen über psychische Erkrankungen und Aufklärungsarbeit über die forensisch-psychiatrische Arbeit in ihrem näheren Umfeld zu leisten.
I: „Wie sind so die Reaktionen?“ B4: „Durchwegs positiv. Manchmal werde ich so gefragt, ob ich da nicht Angst habe. Und ich muss eigentlich sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt Angst haben.“
Ebenfalls wird deutlich, dass sich bei drei aus den vorher genannten fünf Befragten die Meinung des sozialen Umfeldes über die forensisch-psychiatrische Arbeit oder allgemein psychische Erkrankungen ins Positive transformiert hat. Ein/e Befragte/r geht davon aus, dass sein/ihr Beitrag die Meinung des näheren Umfeldes nicht verändern würde und zwei Befragte vermeiden es, privat über ihre Arbeit als Betreuerin oder Betreuer im forensischen Kontext zu sprechen.
B1: „Für uns ist eigentlich eine Vorverurteilung, eine Stigmatisierung nicht Thema. Da haben wir einfach schon zu viele Berufsjahre hinter uns. Im näheren Bekanntenumfeld, zum Teil auch im familiären Umfeld, sprich meine Mama, … das ist ein Waschbecken voller Vorurteile. (lacht) Wenn der eine bei Rot über die Straße geht, ist genauso ein Vorurteil wie… sie findet für alles irgendetwas. Genauso auch oft in der Nachbarschaft. Also da gibt es auch immer wieder Diskussionen und Thematisierungen, wo eigentlich gar nicht darüber nachgedacht wird.“
Zwei Befragte geben konkret an, dass es innerhalb des Arbeitsbereiches zu Geringschätzungen und Abwertungen der Betroffenen vom Fachpersonal her kommt.
B7: „Ich glaube, dass es schon oft ein bisschen abwertend auch wird: „Ma, der ist ja forensisch! Nein, den können wir jetzt nicht anschauen. Da brauchen wir jetzt die Dr. X zum Beispiel, weil die macht ja die Ambulanz.“ Dass sich da schon… Es wird oft so ein bisschen hin und her geschoben, die Verantwortung. Zwischen den Ärzten im Krankenhaus. Man muss es immer dazu sagen, dass er forensisch ist, dass sie es wissen.“
B4: „Ich habe eine Psychiater gehabt, der hat zur Mutter eines Klienten gesagt: „Sein Sie froh, dass er das Rad nicht gestohlen hat“, weil er gesagt hat, er hat gesehen, dass ihm ein… oder ihm ist ein Rad gestohlen worden am Bahnhof, als er zur Arbeit fahren wollte und sie hat das schlimm gefunden und dieser Psychiater hat dann gesagt: „Bei diesen Menschen oder bei ihrem Sohn kann man eh nichts besseres machen und sind Sie froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.““
Ein/e Befragt/e gibt an, den Arbeitsbereich komplett außen vor zu lassen.
Die Gefahr der Stigmatisierung ist meiner Meinung nach sehr groß. Ich könnte mich auch nicht davon frei machen, weil ich weiß, da hat jemand vielleicht irgendetwas gemacht. Dann denke ich auch darüber nach. Das ist denke ich mir … das ist glaube ich eine große Gefahr. Deswegen mache ich hier auch keine Andeutungen und so… Das soll nicht bei Betreuung, die ja auch in der Öffentlichkeit stattfindet, irgendwie rauskommen, dass ich jetzt ein Betreuer bin oder sowas. Das versuche ich möglichst wenn es irgendwie geht nicht zu zeigen oder dass es offensichtlich wird. Ich habe mehr den Eindruck, dass den Klienten das nichts ausmacht. Die nennen mich dann automatisch „mein Betreuer“ wo ich auch immer hinkomme. Denen macht das vielleicht weniger aus als mir.“
B2: „Naja, Erfahrungen einfach dass sie sagen „Ma ist das schwierig! Was macht ihr da einfach?“ Oder: „Hast du keine Angst, dass dir jemand etwas antut?“ Und da muss man halt auch immer wieder aufklären, dass der diese Straftat ja gemacht hat im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung und wenn er die in den Griff bekommt, dann ist auch nicht zu erwarten, dass er neuerlich straffällig wird. „
B5: „Nein ich will da eigentlich nicht darüber… Das ist… Ich rede auch nicht im Allgemeinen… Wenn, dann rede ich mit meiner Frau, aber sonst rede ich über meine Arbeit weder im psychiatrischen, also im allgemeinen Bereich, im forensischen Bereich rede ich überhaupt nicht.“
An dieser Stelle werden Strategien zur Stigmatisierungsbewältigung aus Sicht der Mitarbeitenden aufgezeigt. Die Unterteilung erfolgt in den persönlichen Umgang, die Frage nach der Gestaltung der Betreuung und möglichen Zukunftsperspektiven.
B4: „Das habe ich so schön langsam lernen müssen, es muss nicht alles perfekt sein, sondern es darf so sein wie es ist.“
B5: „Aber ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig ist am Anfang der Beziehung, nicht mit eigenen Erwartungen zu kommen, sondern erst mal zu schauen, was bringt mir der Klient entgegen. Weil doch jeder Mensch verschieden ist. Das gilt aber nicht nur für die forensische Betreuung, sondern das gilt für alle Klienten.“
Drei von acht Befragten geben an, dass sie es nicht als ihre berufliche Aufgabe sehen und interpretieren, die Stigmatisierung aktiv in die Betreuung einzubauen und dagegenzuwirken. Mehr, dass Stigmatisierung ihre KlientInnen betrifft, sie das aber so hinnehmen, zumindest was das tatsächliche Betreuungssetting betrifft.
B5: „Wie gesagt, das Thema Stigmatisierung, das ist jetzt eigentlich nicht so… ist auch in der Betreuung finde ich nicht so passend. Ich möchte jemandem schon helfen, dass er darüber hinwegkommt oder dass es gar nicht von meiner Seite aus dazu kommt. Mehr kann ich nicht tun. Aber es steht eigentlich dem Vertrauensverhältnis im Weg – die Angst vor Stigmatisierung. Das habe ich auch dann schon erlebt, dass sie eigentlich keinen Betreuer wollen. Vor allem nicht in Bereichen, wo sie bekannt sind. Das ist dann schon Thema. Aber ich kann ja jemandem nicht helfen dann.“
Fünf Befragte sehen sehr wohl Handlungsbedarf und das man sich stets kritisch hinterfragen sollte. (B3) Außerdem schreiben sich die Mitarbeitenden eine Vorbildrolle zu.
B3: „Wir sind unter anderem als Betreuungspersonen wichtige Vorbilder. Es wäre ja das Ziel, dass sich Klienten unter anderem an uns orientieren: Wie kann man Normalität leben? Wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen? Wie kann man Strategien lernen, in Stresssituationen, in Situationen, wenn es Konflikte mit anderen Mitmenschen gibt? Ich glaube, wir sind eine wesentliche Vorbildrolle. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Betreuungspersonen oder als Sozialarbeiter oder als Krankenpfleger gute Strategien haben, mit Alltagssituationen und Stresssituationen umzugehen. Das ist glaube ich total wichtig. Wir sind Vorbilder und wir sind Beobachter und sind verpflichtet, den Klienten Rückmeldung zu geben. Jederzeit Rückmeldung zu geben, wie sie wirken in Situationen, wie sie reagieren. Ich glaube, das ist die Herausforderung.“
B3: „Die soziale Arbeit trägt wesentlich dazu bei Normalität vorzuleben.“
Der Beziehungsaufbau, da sind sich alle Befragten einig, bildet die Grundlage der Betreuungsarbeit und basiert jedenfalls auf gegenseitigem Vertrauen.
B2: „Es ist ganz wichtig einfach, dass man einen guten Beziehungsaufbau macht, der gute Akzeptanz und vor allem die Einsichtsfähigkeit über seine Krankheit fördert.“
Bei der Betreuungsgestaltung wird immer sehr individuell darauf geachtet, Bedürfnisse in die Begleitung miteinzubauen und den Prozess gemeinsam zu gestalten.
Alle der acht Befragten achtet konkret darauf, Außenaktivitäten mit ihren KlientInnen zu unternehmen weil sie ihr Hauptaugenmerk auf gesellschaftliche Teilhabe legen.
B6. „Dann habe ich gesagt: „Du, wie geht es dir eigentlich mit der Tagesstruktur?“ oder „Hast du Lust auf ein Eis?“ Ich habe ihn einmal auf ein Eis eingeladen. Das hat ganz gut funktioniert, so auf eine Kugel Eis einladen. Da hat man ihn rausgebracht aus seiner Höhle. Dann sind wir unten in einem Park gesessen und haben halt einmal ein Eis geschleckt. Das hat ganz gut funktioniert. Und da ist die Stimmung sofort gekippt. Ich habe manchmal auch den Eindruck… Also er war von dem her sparsam, dass er sich keine Kugel Eis geleistet hat, leisten wollte oder so, aber er hat… wo man ihn dann eingeladen hat, ist der Eindruck gewesen, dass es einfach so ein… „Jetzt kann ich auch teilnehmen an der grundgesellschaftlichen Teilnahme…“ist.“
Alle BetreuerInnen würden sich selbst ausnahmslos eine unterstützende und eine kontrollierende Funktion gleichermaßen zuordnen wünschen sich aber, dass sich die Beziehung dahingehend entwickelt, dass eine einsichtige und weitgehend widerstandsfreie Betreuung möglich ist und wird.
B5: „Ich habe mich auch nie bereiterklärt, einen Aufseher zu spielen und das werde ich natürlich auch nicht sein. Also ich möchte schon in die Position reinkommen, wo ich den Klienten helfen kann, weiterzukommen. Und das ist die Voraussetzung… ist eine freiwillige Beziehung. Also ich muss es irgendwie schaffen, dass der Klient mich trotz der Situation, dass er gezwungen ist mich zu nehmen, meine Hilfe freiwillig annehmen kann.“
B5: „Das Wichtigste dafür ist die Vertrauensbeziehung, weil wenn ich dieses Vertrauen nicht genieße von ihm, dann wird er meine Vorschläge nicht annehmen. Dann wird er mir vielleicht sagen: „Ja, ok, jaja“ weil er glaubt, er muss das, aber er kann es niemals umsetzen. Ob er es dann umsetzen kann, wenn er mir vertraut, ist das nächste Problem. Weil das ist ja schwierig genug. Aber die dringende, die wichtigste Voraussetzung ist das Vertrauen. Das muss ich mir gewinnen. Wenn ich in einem Zwangsverhältnis bin, ist das natürlich relativ schwierig.“
B6: „Du musst ihm immer, wenn du irgendeine Idee hast, musst du sie ihm so verkaufen, als hätte er selber die Idee gehabt und er bräuchte dich eigentlich gar nicht. Und dann wird es freiwillig bei ihm.“
B6: „Also es war ganz schwierig, dass er die Betreuung auch akzeptiert. Es war auch schwierig, weil es alles Weisungen waren. Also da war nichts freiwillig und so. Und dann hat er halt immer irgendwelche Fluchtwege gefunden, uns quasi aus dem Weg zu gehen und um das Ganze zu boykottieren. Und das war dann eben schön, dass es mit der Zeit hat er dann halt auch erkannt, dass es ihm etwas bringen kann – persönlich auch. Und das war dann einfach schön. Die Zusammenarbeit war dann einfach immer besser und das Tolle, was er dann einfach erkannt hat, ist, dass er so viel Stärke und Ressourcen und Fähigkeiten hat, dass er auch auf legalem Weg zu seinen Wünschen, Bedürfnissen usw kommen kann quasi.“
B4: „Ist auch so ein großer Erfolg, dass er das Vertrauen hat, dass er uns nicht anlügen muss.“
B3: „Das Allerwichtigste in der Betreuung von forensischen Klienten ist der Beziehungsaufbau, also die Klienten müssen irgendwann das Gefühl haben: Es bringt für sie etwas. Das ist eben die Schwierigkeit, zwischen der Kontrolle – „Ich muss dich kontrollieren.“ – und auf der anderen Seite „Ich biete dir aber Unterstützung an.“ Und wenn Klienten dann erkennen, es wird eine Unterstützung angeboten, dann ist es ein Erfolg. Wenn sie irgendwann nicht mehr den Zwangskontext im Vordergrund haben, dann ist es ein Erfolg. Und sie merken: „Es bringt mir etwas und ich kann mit der Unterstützung meine Krankheit stabilisieren.“ Wenn sie erkennen: „Ja, ich habe eine Erkrankung. Ich habe etwas getan. Ich habe ein Delikt begangen aufgrund meiner Erkrankung. Und ich spreche gut an, ich kann mit der Medikation leben. Und ich habe das akzeptiert, dass ich krank bin.“ – Dann finde ich, ist es ein Erfolg.“
Eine Befragte gibt an, dass es unabhängig vom allgemein psychiatrischen oder forensisch-psychiatrischen Kontext die Ziele, welche die Betreuungsgestaltung beeinflussen können, im Großen und Ganzen immer dieselben sind. „Es geht immer um den Menschen mit seiner individuellen Geschichte.“(B3)
B3: „Ziel ist die psychische Stabilisierung und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und die soziale Rehabilitation. Ob etwas passiert ist oder nicht spielt in der Herangehensweise des Ziels keine Rolle.“
Außerdem stellt sich heraus, dass die Kommunikation und Transparenz der eigenen professionellen Arbeit einen essentiellen Eckpfeiler darstellt.
B3: „Da gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Da nützt nur kommunizierten und aufzuklären und die Angst zu nehmen, indem man alles offen darlegt. Aber im Grunde… es ist nicht so wahnsinnig viel… Ich will immer damit sagen, es ist nicht so… es gibt nicht wahnsinnig große Unterschiede im Umgang in der Rehabilitation mit allgemeinpsychiatrischen Klienten und forensisch-psychiatrischen Klienten.“
B1: „Kommunikation! Er hat jetzt über die Jahre schon sehr offen über seine Probleme reden angefangen. Es war lange Zeit das Thema Sexualität, es war lange Zeit das Thema Eltern, Familie, Überforderung von denen. Es kommt immer wieder so ein Erwarten von Zukunftsperspektiven von ihm. Also er ist sich total unschlüssig oder unsicher, was er in Zukunft machen soll.“
Die Wahrung der Würde des Einzelnen und ein respektvolles Miteinander sind für die Mitarbeitenden Indikatoren für eine tragfähige Betreuungsbeziehung.
B7: „Er hat gesagt, er will das nicht. Dann mache ich es auch nicht. Also da wollte der PSP, dass ich anrufe. Also man muss das auch respektieren, wenn der Klient sagt: „Nein!“. Dann heißt das nein, auch wenn er forensisch ist. Ein Privatleben hat er eben noch.“
Alle Befragten gaben das Thema Vernetzung als wesentlich in ihrer Arbeit an.
B2: „Und da ist eine gute Vernetzung, eine gute Absprache, „was will man als Ziel erreichen?“, ganz etwas Wichtiges.“
Wenn die meist langjährige und intensive Betreuung ausläuft, so sind sich alle Befragten einig, kommt es zu einem herausfordernden Teil der Betreuung, - der Beendigung.
B2: „Wenn ich merke einfach, dass der Klient mich einfach nicht mehr so notwendig braucht. Und das denke ich ist auch – das wissen wir aus Erfahrung – der schwierigste Prozess – diese Ablösung.“
Behält man die Grundidee im Hinterkopf, dass alle Menschen - unabhängig der momentanen Umstände - frei sind und man als Betreuerin oder Betreuer mit den KlientInnen gemeinsam darauf hinarbeiten kann, auf Bereiche aufmerksam zu machen, die sich trotz Einschränkungen und Benachteiligungen eröffnen können, so wird die Arbeit Früchte tragen. Denn jeder Mensch verspürt grundsätzlich den Drang nach Freiheit in sich. Man könne sogar weiter gehen und behaupten, dass der Mensch als solcher ohne Freiheit nicht überlebensfähig wäre. Wenn man der richtige Moment erkannt werden kann, in dem der/die KlientIn die Stärke beweist über die Problematiken hinwegzusehen, kann Selbstermächtigung und Entwicklung passieren. (vgl. Conen/Cecchin 2013, S.184.)
B2: „Mit dem Selbstbewusstsein, dass er doch wieder arbeiten kann, hat sich auch seine ganze Körperhaltung, seine Stimmung geändert. Er ist einfach wieder aufrecht gegangen, man hat gemerkt einfach durch die Arbeit ist sein Selbstbewusstsein gestiegen.“
Eine Befragte gibt Gedanken an, um Stigmatisierung zu überwinden.
B2: „Naja, ich denke schon, dass man die Stigmatisierung überwinden kann. Einfach mit noch mehr Öffentlichkeitsarbeit, noch mehr Gespräche über psychiatrische Erkrankungen, über die Folgen, auch über die Chancen einfach einer regelmäßigen Medikamenteneinnahme. Dass das nicht viel ärger ist, als jede andere chronische Erkrankung.“
Weiteres gibt der/die Befragte an, dass Aufklärung einen gesellschaftlichen und berufsbezogenen Auftrag darstellt.
B2: „Ja… Naja, die soziale Arbeit denke ich, kann in erster Linie zur Aufklärung beitragen. Vor allem dann, wenn man Klienten begleitet und dann wirklich hautnah ihre Umgebung, wo sie jetzt wohnen oder arbeiten, dort die Aufklärung macht. Also ich denke, die Aufklärung kann auf beider Basis über öffentliche Wege passieren – muss aber einfach auch im Einzelfall immer wieder gemacht werden. Ganz speziell, ob das jetzt Nachbarn sind, Freunde sind oder Mitarbeiter.“
Diesem Denken schließen sich die anderen Befragten an wenn sie meinen:
B3: „Man kann glaube ich die Stigmatisierung nur bekämpfen, indem man aktiv mit Klienten am Gesellschaftsleben teilnimmt. Das ist unser Job. Unser Job ist mit Menschen, denen man es auch teilweise ansieht, teilweise auch gar nicht – die Erkrankung – unter die Gesellschaft geht, in ein Kaffeehaus geht, in eine Einkaufszentrum geht, am Gesellschaftsleben teilnimmt, an Veranstaltungen teilnimmt. Und da Aufklärungsarbeit betreibt, soweit es der Klient auch zulässt.“
B4: „Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und dadurch, dass es die psychosoziale Betreuung, dass es sonst andere Institutionen gibt, die mit den Menschen hinausgehen, die mit den Menschen auch andere Menschen damit konfrontieren, dass dem so ist, glaube ich, ist da der richtige Weg die Menschen zu desensibilisieren und ihre Vorurteile abzulegen.“
B6: „Dass man nicht sich fixiert so auf das „Oh Gott, ich bin da der Rechtsbrecher“ oder – anderer Fokus – „Die anderen sind alle gemein und ich die haben mit da eingekastelt und jetzt hasse ich die Welt deswegen!“ quasi… Das kommt ja auch vor, dass man das… schon, dass das natürlich Platz hat und dass man das integrieren kann, aber dass da ja viel mehr dazugehört. Und dass man auch einmal sagen kann, jetzt setzte ich den Haken darunter quasi. Das war, und das habe ich aber super hinbekommen.“
B1: „Die soziale Arbeit, also alle, die in einem sozialen Beruf tätig sind, haben in meinen Augen den Auftrag der Information.“
B1: „Also es geht nur über eine wirkliche Zusammenarbeit einerseits, dass die Medien wirklich schauen, dass sie solche Berichterstattungen verändern und andererseits, dass jeder, der in einem Sozialberuf tätig ist und mit der Materie zu tun hat, sein näheres Umfeld und auch sein weiteres Umfeld bei solchen Diskussion auch darüber informiert: Wie schauen die Hintergründe wirklich aus. Wenn meine Nachbarin über einen Schizophrenen oder über einen Persönlichkeitsgestörten motzt und mault und eigentlich ohne Hintergrundwissen, dann ist das – finde ich schon – meine Aufgabe, dass ich sie auch einmal darüber informiere: „Du, was bedeutete denn eigentlich Narzissmus?“ Genauso finde ich, ist es eben auch in Sozialberufen… Information! Ganz einfach. Information! Nicht jetzt Information im Sinne von offenlegen von Daten und solche Sachen, sondern Hintergrundinformation über Krankheitsbilder, Hintergrundinformation über Abläufe, Hintergrundinformation über Tatsachen. Weil es ist… Vergleiche es mit der Religion: die meisten Problem bei religiösen Streitereien – siehe Islam, siehe Katholizismus oder auch… egal was für eine – entstehen aus Unwissenheit. Die entstehen nur aus Unwissenheit. Wenn ich einen Fanatiker habe, der gut reden kann und rhetorisch wirklich gut drauf ist, der findet immer Doofe, die ihm glauben. Und das ist das Gleiche mit Vorurteilen, mit der Stigmatisierung. Ich brauche nur einen wirklich guten Redner und ich kann fast eine ganze Gemeinde zu Nazis machen. Ausländerfeindlich, Vorurteile gegen psychisch Kranke, Vorurteile gegen Schwule und Lesben, und und und Ich brauche nur einen, der wirklich gut reden kann. Der sie manipuliert. Und Manipulation oder sowas kann ich nur verhindern durch Wissen, durch Information.
Der Mensch neigt einfach dazu, Angst zu haben vor dem, was er nicht kennt.“
Ein/e andere/r BetreuerIn betont den Recovery Gedanken wenn sie davon spricht, dass es eine Entwicklung aus den Beschränkungen der KlientInnenrolle geben muss und es die Kräfte des Widerstandes bedarf, um Kräfte entstehen zu lassen die zum Einen vor Selbststigmatisierung bewahren und zum Anderen zu Selbstbefähigung beitragen. (vgl. Amering/Schmolke 2007, S.17.)
B3: „Es ist absehbar, die Betreuung oder die Behandlung. Es wird ja auferlegt mindestens 5 Jahre, die Probezeit. Und es soll auch ein Leben nach der Betreuung geben. So wie es vorher ein Leben gegeben hat, soll es auch danach eines geben. Ein selbständiges Leben ohne Unterstützung. Das ist das Ziel: Dass die Leute selber erkennen: „Wie gehe ich mit meiner Erkrankung um? Und was mache ich, damit so etwas nicht mehr passiert, so ein Delikt?“ Und da kann man ihnen das eingestehen, dass man sagt: „OK, du schaffst das. 3, 4, 5 Wochen von mir aus schaffst du das allein.“ Was kann man tun? Man macht einen Notfallplan: „Wie kannst du dir einfach selber helfen?““
B3: „Es ist enorm wichtig, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Wir arbeiten mit Neustart, mit der Bewährungshilfe zusammen. Wir arbeiten mit der Sachwalterschaft zusammen, mit dem Verein X, wenn jetzt jemand akut von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Das ist das Um und Auf. Vernetzung, Zusammenarbeit muss engmaschig sein und es ist wichtig, dass alle an einem Strang gemeinsam ziehen.“
Den Fokus der qualitativen Untersuchung bildete die Fragestellung nach den professionellen Einwirkungsmöglichkeiten auf die Stigmatisierung forensisch-psychiatrischer KlientInnen.
Dabei wurde zunächst deutlich, dass alle befragten Personen bereits stigmatisierende Erfahrungen ihrer KlientInnen in ihrer täglichen Nachsorgearbeit erfahren haben. Alle BetreuerInnen bestätigen, dass es bei soziotherapeutischen Außenaktivitäten am spürbarsten ist. In der Mehrheit drücken sich Stigmatisierungen der betreuten KlientInnen beim gemeinsamen wahrnehmen kultureller Angebote oder in Bereichen des allgemeinen Gesellschaftslebens, wie etwa einem Besuch im Caféhaus, aus. In der Mehrheit der Darstellungen und Erzählungen wurde die wahrgenommene Stigmatisierung, also beobachtete verachtende Blicke oder Gemurmel auf den Nebentischen, von den BetreuerInnen bewusst wahrgenommen, jedoch nicht in der Begleitung thematisiert oder angesprochen. (siehe Kapitel 5.1.3.2 od. 5.1.1.1 oder 5.2.1.3) Diese Ergebnisse legen nahe, dass die BetreuerInnen in den meisten Fällen, auch dafür finden sich in der Auswertung Belege, davon ausgehen, dass ihre KlientInnen die Stigmatisierung selbst gar nicht wahrnehmen. (siehe Kapitel 5.1.4.3 od. 5.1.2.3) Dieses „Nicht-Verhalten“ impliziert die Annahme der Mitarbeitenden, Stigmatisierung könne nicht überwunden werden. Deshalb sei es nicht als Aufgabe in der Betreuung zu verorten. (siehe Kapitel 5.1.4.3) Kritisch könnte man auch meinen, dass die BetreuerInnen das Ausmaß und die Intensität des Leidens der betroffenen Menschen, die mit der Stigmatisierung einhergeht, durch die Prozesshaftigkeit dessen vernachlässigen und die Betreuungsziele mitunter an Symptomreduktion und Stabilisierung festmachen. (siehe Kapitel 5.2.3.1)
Positiv ist in dieser Relation zu vermerken, dass alle BetreuerInnen sich einig waren, dass eine vertraute und wertschätzende Beziehung zu ihren KlientInnen die Betreuungsgestaltung begünstigt und einen hohen Stellenwert zugeschrieben bekommt. (siehe Kapitel 5.2.3.2) Dieses Ergebnis ist insofern von Bedeutung, als dass eine gelungene Beziehungsgestaltung die Voraussetzung für effektive Vorgehensweisen und Interventionen bildet, die in weiterer Folge „Einwirkungen“ ermöglichen.
Tendenziell ließ sich aus den Ergebnissen ableiten, dass es gelungene Interventionen zur möglichen Auflösung der Zurückziehung und Isolation der KlientInnen gab. (siehe Kapitel 5.2.3.2)
In Äußerungen über die Vorbildrolle (siehe Kapitel 5.2.3.1) sprachen die BetreuerInnen von einem doppelten Auftrag. Jenem, den betroffenen Menschen gegenüber und im Sinne der verschriebenen Fachlichkeit sozialer Arbeit auch dem der Gesellschaft gegenüber.
Über die Hälfte der Befragten berichtete auch davon, mit Formen der Selbstreflexion zu arbeiten, um Stigmatisierungskonstruktionen zu durchbrechen. Es kann ebenfalls belegt werden, dass alle MitarbeiterInnen bereits Stigmatisierung in Bezug auf ihre KlientInnen im professionellen Sektor erfahren bzw. mitgetragen haben. Hier werden hauptsächlich der stationäre Kontext und allgemein medizinische Einrichtungen erwähnt. (siehe Kapitel 5.1.3.2 od. 5.1.3.3)
Von den ExpertInnen wird ebenfalls bestätigt, dass betroffene Menschen von sozialen Zuschreibungsmechanismen betroffen sind, welche wiederum mit massiven Auswirkungen und Folgen auf die gesellschaftliche Teilhabe einhergehen. (siehe Kapitel 5.1.4.1) Außerdem ziehen sich diese Benachteiligungen durch alle Lebensbereiche hindurch. (siehe Kapitel 5.1.2)
Die Annahme, dass Definitions- und Zuschreibungsprozesse den Umgang mit den betroffenen Menschen maßgeblich beeinflussen, konnte jedenfalls bestätigt werden. Nach wie vor werden Merkmale wie psychische Erkrankungen oder die Tatsache der Deliktsetzung in diesem Zusammenhang pauschalisierend auf die Gesamtperson übertragen, was seine/ihre Stellung in der Gesellschaft bestimmt. (siehe Kapitel 5.1.2.6)
In der Literatur wird dezidiert darauf verwiesen, dass sich Stigmatisierung als „zweite Erkrankung“ einstufen lässt und von den betroffenen Menschen somit verinnerlicht wird. (vgl. Finzen 2001, S.24.) Im Hinblick auf die Aussagen des Betreuungspersonals kann bestätigt werden, dass betroffene Menschen die negativen Zuschreibungen psychischer Krankheiten oder Straffälligkeit allgemein, wenn auch unbewusst, auf ihre Person beziehen und darauf zumeist mit Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben reagieren. (siehe Kapitel 5.1.2.7 oder 5.1.2.7) Entgegen der hier gewonnen Forschungsergebnisse muss jedoch festgehalten werden, dass eine aktive Thematisierung und Kommunikation von Stigmatisierung in der Betreuungsarbeit als Intervention wesentlich ist. Inwieweit und ob die Thematisierung und bewusste Einwirkung positive Effekte auf die Betroffenen hat, ließe Raum für künftige Forschungen.
Eine Mittabuisierung von Stigmatisierung hingegen wäre im Hinblick auf die Benachteiligungen als problematisch zu bewerten, da sich dadurch keine bis wenig hilfreiche Bewältigungsstrategien entwickeln können. (siehe Kapitel 5.1.1.1 und 5.2.1.3)
Wenn es um die individuelle Betrachtung von betroffenen Einzelpersonen und ihren jeweiligen Problemlagen geht, so sind sich alle Befragten grundsätzlich aus beruflicher Sicht einig, den Mensch an sich und nicht die Erkrankung und oder die Deliktsetzung in den Vordergrund zu stellen. (siehe Kapitel 5.2.1.2) Trotzdem beeinflusse das Wissen um Delikt und Erkrankung die Betreuungsgestaltung. (siehe Kapitel 5.2.1.1)
In diesem Sinne spielen wiederum neben dem Wissen um Erkrankungen und Deliktsetzungen auch Haltungen und Verhalten den KlientInnen gegenüber eine zentrale Rolle. Diese Untersuchung kam in der Analyse des professionellen Selbstverständnisses auf folgende Prämisse:
Die Mitarbeitenden, die befragt wurden, sprachen teilweise die direkte Konfrontation als Intervention gegen Stigmatisierung in all ihren Formen an. Es konnte allerdings im Rahmen der Untersuchung nicht vollständig geklärt werden, in welchem Ausmaß und in welcher Intensität dies in der Begleitung auch tatsächlich stattfand und welcher fachlichen Möglichkeiten sich die BetreuerInnen konkret bedienten. (siehe Kapitel 5.2.1)
Alle Befragten verfügten über ein vergleichsweise hochwertiges Wissen um psychische Erkrankungen, deren möglichen Phasen und Verläufe, wenn auch das Wissen um Stigmatisierungstheorien in den Hintergrund tritt. Bis auf eine/n Befragte/n gaben alle an, außerberuflich Aufklärungsarbeit im näheren Umfeld zu leisten. (siehe Kapitel 5.2.1.1)
Auch in Bezug auf die Arbeitshaltungen konnte man ein deutlich ausgereiftes professionelles Selbstverständnis erkennen. (siehe Kapitel 5.2.1.2)
Die höchst differenzierten Aussagen über die Betreuungsgestaltungen legen nahe, dass auf Grund der individuellen Weisungen und Betreuungsintensitäten Fokus auf maßgeschneiderte Nachsorgebegleitungsmöglichkeiten gelegt werden kann was sich jedoch in der Schwierigkeit wiederspiegelt, verallgemeinerbare und vergleichbare Arbeitsweisen zu abstrahieren.( siehe Kapitel 5.2.1.3) Übereinstimmend waren die Aussagen darüber, die Balance zwischen Vertrauensperson und sozialem Kontrollmechanismus zu halten, welche das Fachpersonal immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.
Dieser hier beschriebene Balanceakt spiegelt sich im Begriff des „Zwangskontextes“ wieder, welcher von den Befragten oftmals kritisch erwähnt wurde. Dieser Zwangskontext impliziert teilweise eine nur bedingte Form von Freiwilligkeit und damit auch eine beschränkte Motivation der KlientInnen an der aktiven Teilnahme des Betreuungsgeschehens.
Um die Diskrepanz zwischen der empfundenen sozialen Kontrolle und der notwenigen Vertrauensbasis zu überwinden gilt es, eine tragfähige Beziehung zu den Betroffenen aufzubauen und diese zu festigen. Einen wesentlichen Teil dieser Beziehungsarbeit sollte die gemeinsame Entwicklung von Strategien im Umgang mit (un)mittelbaren Stigmatisierungserfahrungen sein.
Geht man davon aus, dass Stigmatisierung ähnlich wie das Phänomen der Diskriminierung ein von Machtverhältnissen getragener sozialer Prozess ist, kann Stigmatisierung zwar als sogenannte „zweite Erkrankung“ „diagnostiziert“ werden, ist jedoch nicht als solche „behandelbar“. Stigmatisierung als gesellschaftliches Phänomen ist somit weder zeitlich begrenzt, noch vollständig überwindbar. Was eine umfassende Auseinandersetzung mit möglichen Interventionsstrategien unumgänglich macht.
Inhaltsverzeichnis
In der hier vorliegenden Untersuchung stand die Frage nach möglichen Einwirkungen des professionellen HelferInnensystems in Bezug auf die Stigmatisierungsproblematik der betroffenen Menschen, welche über die forensisch-psychiatrische Betreuung begleitet werden, im Fokus. Anhand von „gelingenden/gelungenen Fällen“ wurde mittels der Methodik der rekonstruktiven Fallanalyse versucht, sich dieser Problematik wissenschaftlich anzunähern. Die jeweiligen Subfragestellungen wurden bereits im letzten Abschnitt genau erläutert, weswegen sich nun der Blickwinkel im Besonderen auf die Zusammenführung der gewonnenen Erkenntnisse, richtet. Im Anschluss daran werden mögliche Handlungsempfehlungen für die praktische klinische soziale Arbeit aufgezeigt sowie das methodische Vorgehen der qualitativen Untersuchung diskutiert. Den Abschluss bildet der auf weiterführende Forschungsschwerpunkte ausgelegte Ausblick.
Durch die Forschungsergebnisse lässt sich die Notwendigkeit ableiten, Stigmatisierung als Thema der Nachsorgebegleitung ernst zu nehmen und einzubauen, da die Betroffenen massive Ausgrenzungen und Benachteiligungen in unserer Gesellschaft erfahren.
Beruhend auf der Tatsache, dass die Stigmatisierung implizit aufgenommen, meist aber nicht bewusst wahrgenommen wird, ist es als Verantwortung der Mitarbeitenden zu verstehen, im Rahmen des Möglichen zur Destigmatisierung beizutragen, bzw. den Fokus auf Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stigmatisierung zu legen.
Bei Betroffenen muss ein Augenmerk auf die Gesamtbiographie gelegt werden. Die als lebenslanger Prozess zu betrachtende Stigmatisierung bleibt auch über die Nachsorgezeit hinaus bestehen und begleitet die Betroffen in ihrem Privats-, sowie Berufsleben. Demnach ist es ein Auftrag der Nachsorgebegleitung diese Tatsache nicht außer Acht zu lassen und Betroffene dahingehend zu unterstützen, individuelle Strategien zu entwickeln.
Insofern gilt es den Resozialisierungsgedanken über den Resozialisierungsprozess hinaus in seinem gesamten Umfang auch hinsichtlich der Stigmatisierungsproblematik auszuweiten.
Klar geht aus der Befragung hervor, dass von Mitarbeitenden eine positive Tendenz hinsichtlich einer professionellen Aufklärungsarbeit sowie Berichterstattung erkannt wird. Sieht man von den Berichterstattungen der Trivialmedien ab, finden sich vermehrt qualitativ hochwertige Publikationen, die sich mit der Thematik der psychischen Erkrankungen beschäftigen. Wenig differenziert wird hierbei zwischen psychischen Erkrankungen und Informationen zu psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Deliktsetzungen.
Stark betont kann die Notwendigkeit der Aufklärungsarbeit durch ProfessionalistInnen werden, die einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Verständnis leisten.
Hervorzuheben ist, dass der direkte Kontakt, sowie Begegnungen zwischen Betroffenen und Außenstehenden zu einer Steigerung des Verständnisses und Erhöhung der Akzeptanz führen.
Vor dem Hintergrund der gesammelten Erkenntnisse lässt sich an dieser Stelle resümieren, dass Interventionen der klinischen sozialen Arbeit auf mehreren Ebenen stattfinden müssen.
So geht es einerseits um die Weitergabe von Informationen und professionelle Aufklärungsarbeit und andererseits um die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und die Förderung sozialer Kompetenzen. (vgl. Rüsch 2005, S.210.)
Nach einer umfassenden Betrachtung können nun Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen für die klinische soziale Arbeit abgeleitet werden.
Vorweg muss erwähnt werden, dass der Rahmen, in dem sich Handlungsmöglichkeiten bewegen, in direktem Verhältnis mit spezifischem forensischem Fachwissen steht. Konkret bedeutet dies, dass nur unter Anwendung von hochprofessionellem Hintergrundwissen individuelle Optionen erkannt und angewandt werden können. Daher bezieht sich eine wesentliche Handlungsempfehlungen auf die Schaffung und Ausweitung maßgeschneiderter Weiter-, und Fortbildungsmöglichkeiten für ProfessionistInnen der forensischen Nachsorgebegleitung. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Anforderungen durch differenzierte Krankheitsbilder, Deliktsetzungen und Persönlichkeiten ist eine kontinuierliche Wissensaktualisierung notwendig. Das Wissen um die Stigmatisierung und deren Folgen und Auswirkungen gilt es in dieser Form ebenso zu vermitteln, wie Fachwissen um die „1. Erkrankung“.
Interdisziplinäres Handeln und Vernetzungsarbeit, als auch Kooperationen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene stellen ebenso einen wichtigen Eckpfeiler dar.
Das in diesem Zusammenhang unumgängliche interdisziplinäre Handeln kann mit regelmäßigen Fallsupervisionen und Teamsitzungen verbessert werden. Zielführend im Sinne einer gelungenen KlientInnenarbeit ist weiteres eine Vernetzung mit den beteiligten Institutionen, als auch den Angehörigen der Betroffenen. So wird Vernetzungsarbeit zwar als grundsätzliche Voraussetzung in der Arbeit postuliert, muss jedoch in der Praxis immer wieder von einzelnen AkteurInnen eingefordert und konkretisiert werden. In diesem Zusammenhang nicht außer Acht zu lassen sind die Erfahrungen der Angehörigen und somit ein enger Kontakt und ein Miteinbeziehen der selbigen.
Nicht nur familiär betroffene Angehörige, sondern auch Personen aus dem weiteren Kreis oder Außenstehende müssen im Sinne einer umfassenden Informationsarbeit in den Mittelpunkt rücken. Es gilt daher, Vorträge, Kampagnen und Schulungen im Sinne einer Kooperation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu installieren. Nur so kann es zu mehr Verständnis und in weiterer Folge zu einem Abbau von stereotypen Denkweisen führen.
Geht man zurück auf die Möglichkeiten die einzelnen Mitarbeitenden offen stehen, so lässt sich festhalten, dass auch im kleinen Rahmen Kooperationen auf gesellschaftlicher Ebene möglich sind. Durch alltagsnahe Interventionen sowie dem Aufbau zwischenmenschlicher Kontakte auch außerhalb der Betreuungsdualität können zwei wichtige Effekte erreicht werden.
Zum Einen werden durch soziale Nähe Außenstehenden Unsicherheiten und Ängste genommen und einer durch Stereotypisierung gekennzeichneten Unwissenheit entgegengewirkt. Zum Anderen stellt ein „Nach außen gehen“ und die Einbindung in gesellschaftliche Dynamiken eine der wichtigsten Interventionsmöglichkeiten für Betroffene dar.
Nur durch ein Zusammenführen von Prozessen der Gegensteuerung auf der Mikro-, Meso- und Makroebe können langfristige und zielführende Ergebnisse erreicht werden. HauptakteurInnen sind in diesem Zusammenhang MitarbeiterInnen der forensischen Nachsorge, da sie einerseits als Bindeglied zwischen Außenstehenden und Betroffen fungieren und andererseits über einzigartiges Wissen in einem professionellen sowie praktischen Kontext verfügen.
Insofern ist eine Sensibilisierung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene notwendig, die aber gleichzeitig durch aktives Handeln im Betreuungsprozess unterstützt werden muss wobei hier die Bedeutung von „Wissen“, „Verhalten“ und „Haltungen“ im Kontext der Destigmatisierung in den Vordergrund rückt.
Die Untersuchungsergebnisse legen für die klinische soziale Arbeit nahe, dass es sich in der Betreuung von Menschen, die zumeist dissoziale Züge aufweisen, in der professionellen Begleitung als ratsam einstufen lässt, sich kritisch mit den eigenen Haltungen auseinanderzusetzen. Angesiedelt zwischen einer einerseits versuchten Vermittlung von Wahrnehmungen und Realität und andererseits eben dieser Grenzen und Spannungen in der psychosozialen Arbeit liegt die Herausforderung. Es gilt die gravierenden Spannungen und sozialen Beeinträchtigungen zu erkennen, zu thematisieren, zu hinterfragen und in ihrer Bedeutung ernst zu nehmen. Unrealistisch wäre es davon auszugehen, dass sich in der forensisch-psychiatrischen Arbeit rasch Erfolge erkennen lassen als auch ebenfalls, dass sich positive Ereignisse als Wendepunkte verfestigen würden. (vgl. Rauchfleisch 1999, S.157-160.)
Die Arbeit im forensischen Kontext impliziert ein auf stetige Risikoeinschätzung, Risikomanagement und ein spezifisches forensisch-psychiatrisches Fachwissen basierendes Selbstverständnis. (vgl. Freese 2003, S.128.) MitarbeiterInnen im forensisch-psychiatrischen Bereich benötigen eben dieses Fachwissen als Handlungsinstrumentarium der Betreuungsarbeit.
Bei Menschen, die dissoziales Verhalten aufweisen, so ging es auch aus der Untersuchung hervor, erscheint es in Bezug auf professionelles Handeln ebenfalls wichtig zu wissen, dass bereits geringfügige Belastungen zu Impulskontrollverlust führen können. Für diese betroffenen Menschen ist kennzeichnend, dass ihre/seine Fähigkeiten der Strukturierung nicht ausreichen, um sowohl den eigenen als auch den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden. Das Agieren dieser Menschen lässt sich mehr als ein reagieren auf das Verhalten der Umgebung beschreiben als auf ein aktiv eigenmotiviertes. Als weitere Merkmale und Indikatoren für die klinische soziale Arbeit können der teils verzerrte oder verringerte Realitätsbezug und die Selbsteinschätzung, als auch eine Kontaktstörung gefasst werden. (vgl. Rauchfleisch 1999, S. 161-163.) Auch dieses Wissen um spezifische theoretische Hintergründe und Theorien sind voraussetzend und wesentlich für die praktische Arbeit.
Die Lebenschancen betroffener Menschen sind im Allgemeinen durch sozial strukturelle und institutionelle als auch gesamtgesellschaftliche Bedingungen massiv eingeengt. Dadurch internalisieren Betroffene die zugeschriebenen Stigmatisierungen und übernehmen sie in ihr Selbstverständnis. Dieser Verhaltensstatus der ausgelieferten Zuschreibenden und sozialer Kontrolle in der Interaktion beeinflusst die Menschen maßgeblich. (vgl. Böhnisch 2010, S.56-57.) Ein Stück weit liegt es in der Arbeit mit forensisch-psychiatrischen KlientInnen an der professionellen Verantwortung und einem ausgereiften Selbstverständnis der MitarbeiterInnen, auf diese beschriebenen Internalisierungen einzuwirken.
Im Sinne der klinischen sozialen Arbeit spielt insbesondere ein interdisziplinäres Handeln MIT und FÜR Menschen eine zentrale Rolle. Für ein erfolgreiches Arbeiten MIT und FÜR betroffene Menschen benötigt man dazu die Basis, eigene, auf die individuellen Bedürfnisse der KlientInnen abgestimmte Verstehens-, sowie Handlungsmodelle und Strategien zu entwickeln. (vgl. Ortmann und Schaub 2003, S.80-92.)
Es gilt hier zur Verdeutlichung, unterschiedliche Ausprägungen und Stärken individueller Kompetenzen gemeinsam mit den betroffenen Menschen zu entwickeln als auch soziale Netzwerke zu nutzen. (vgl. Ortmann und Schaub 2008, S.21.)
Es wurde aus den Ergebnissen explizit deutlich, dass sich positive Tendenzen, vor allem in der Vernetzungsarbeit abzeichnen. Um weitere förderliche Bedingungen im Sinne der betroffenen Menschen zu schaffen bedarf es jedoch notwendige Adaptierungsmaßnahmen und Zuständigkeiten als auch Evaluierungen auf dem Fachgebiet vor dem Hintergrund einrichtungsspezifischer Unterschiede.
Mit dem Schwerpunkt der Stärkung sozialer Gerechtigkeit zielt die lebensweltorientierte soziale Arbeit, die als Theorie der Forschung im Hintergrund mitgeschwungen ist, auf das Aushandeln unterschiedlicher Lebenskonstellationen sowie individueller Lebensentwürfe ab. Die Prägung dieses Verhandelns-Aushandelns ist selbstverständlich immer im Kontext struktureller Rahmenbedingungen zu betrachten. Verweisen kann man insbesondere auf Kooperationen und Koalitionen verschiedener Politik und Gesellschaftsbereiche. Vor dem Hintergrund gegebener Macht- und Interessensstrukturen sieht sich soziale Arbeit immer wieder mit begrenzten Möglichkeiten konfrontiert. Dies ist im Betreuungskontext zu berücksichtigen. (vgl. Thiersch 2008, S 22-23.)
Greift man den Begriff des Verhandelns als Medium klinischer sozialer Arbeit auf, ist dessen Gelingen an die Voraussetzung gebunden, dass zwischen PartnerInnen und Institutionen eine gegenseitige Anerkennung und Gleichwertigkeit herrscht oder hergestellt werden muss. (vgl. Grunwald/Thiersch 2008, S 25.)
Die klinische Sozialarbeit als handlungsorientierte Wissenschaft ist laufend in Bewegung. Innerhalb institutioneller Rahmensetzungen ist aus dieser Perspektive heraus ein eigenes Gestalten notwendig, welches von ethischen Ansprüchen geleitet ist und seinen Fokus auf Menschenwürde setzt. (vgl. Ortmann und Schaub 2008, S.239.)
Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass es Bemühungen im Hinblick der Gestaltung von einzelnen MitarbeiterInnen, nun im Speziellen in der gewählten Nachsorgebegleitung des PSP Projekt RETURN, gibt.
Es wäre durchaus ratsam, diese Erfahrungen in regelmäßigen Treffen und Fallsupervisionen zusammenzutragen und weiterzuentwickeln. Auch der Angehörigenarbeit, die zumeist vernachlässigt wird, kann an dieser Stelle ein hoher Stellenwert zugeschrieben werden.
Weiters kann daraus abgeleitet werden, dass sich der Fokus einzelner Fachkräfte aus der einsamen Reflexion heraus in das Beziehungssystem rund um KlientInnen verlagern würde. (vgl. Ortmann und Schaub 2008, S.241.)
Ein weiterer Begriff von klinisch sozialer Relevanz der die Ansprüche an lebensweltorientierte soziale Arbeit treffend beschreibt ist die „Alltagsnähe“, die einerseits eine Hilfe in der direkten Lebenswelt der KlientInnen meint und andererseits auf eine ganzheitliche Orientierung abzielt, die ineinander verwobenen Lebenserfahrungen gerecht wird. (vgl. Grunwald/Thiersch 2008, S 26.)
Denn: „Sozialpsychiatrische Einrichtungen verfolgen das Ziel, chronisch psychisch kranke(n) Menschen den Verbleib im Gemeinwesen zu ermöglichen, sie also darin zu unterstützen, dass sie in ihrer eigenen Lebenswelt bleiben, leben und zurecht kommen können.“ (Obert, K. In: Thiersch/Grundwald 2008, S.305.)
An dieser Stelle muss für die klinische soziale Arbeit nachhaltig festgehalten werden, dass man ein System schaffen muss, welches anerkennt, dass man den Menschen individuelle Interventionen bieten muss die nicht zwangsläufig auf die große Mehrheit anwendbar sind. Als Indikatoren von forensisch-psychiatrischer Versorgungsqualität müssen Gesundheitsförderung, flexible Hilfeangebote sowie eine über die Symptomreduktion und Stabilisierung darüber hinaus gehende Ausweitung bestimmter Fähig-, und Fertigkeiten unter Berücksichtigung von Stigmatisierung stattfinden. (vgl. Amering/Schmolke 2007, S.314.)
„Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dort anfangen, wo der Klient steht, ihn zum Partner im Hilfeprozess werden lassen: All diese hinlänglich bekannten und etablierten Leitsätze sozialpädagogischen Handelns zielen darauf ab, den Subjektstatus des Klienten im Hilfeprozess zu sichern und der Gefahr vorzubeugen, dass der Klient zum Objekt der Behandlung degradiert wird.“ (Galuske 1998, S.57.)
Eine Zusammenarbeit zwischen Betroffenen, Behandlern, Fachpersonal, Angehörigen und Gesellschaft kann durch neue einwirkende Kommunikationsformen und aktive Thematisierungen dazu beitragen, konkrete Veränderungen in Bezug auf Stigmatisierung der betroffenen Menschen herbeizuführen.
Im Hinblick auf die hier vorliegende qualitative Untersuchung folgt eine methodische Diskussion, welche insbesondere Hauptaugenmerk auf die Gütekriterien qualitativer Forschung legt.
Die berücksichtigten qualitativen Gütekriterien, welche in der vorliegenden Untersuchung weitgehend umgesetzt worden sind, wurden bereits in Kapitel 4.7 thematisiert. Besonders wurde auf die Verfahrensdokumentation, die argumentative Interpretationsabsicherung und Regelgeleitetheit sowie die Nähe zum Gegenstand geachtet (vgl. Mayring 2002, S.144-147.).
Die bewusst sehr offen gehaltenen Fragestellungen in den Interviews führten zu sehr heterogenen und vielfältigen Antwortmöglichkeiten und damit einhergehend ein sehr weitfächeriges und breites Spektrum an Aussagen. Teilweise kann an dieser Stelle die Schwierigkeit gesehen werden, die Ergebnisse konkret miteinander zu vergleichen. Die Zusammenfassung der Aussagen, die sich sehr individuell darstellten, war nur bedingt möglich. An der Auswertung der Ergebnisse kann man erkennen, dass viele Textpassagen in ihrer Ganzheit und Vollständigkeit herangezogen wurden, um diesen individuellen Aussagen Ausdruck zu verleihen. An diesen vorliegenden Erkenntnissen kann man die Chance sehen, in weiterführenden Untersuchungen auf die Erkenntnisse aufzubauen und detailliertere Befragungsstrukturen heranzuziehen.
Es wurde ebenfalls deutlich, dass kein gemeinsames Begriffsverständnis zum Phänomen der Stigmatisierung vorherrschte. Gerade im Hinblick auf die vorliegende Thematik wurde deutlich, dass es ein zu geringes bis kein fachliches Vorverständnis gab. Um eine genauere inhaltliche Ergebnisinterpretation zu erlangen, kann man diese Tatsache als Verbesserungsmöglichkeit ansehen.
ExpertInneninterviews kann für weitere Untersuchungen im Hinblick auf die Prxisanleitungen und Interventionsmöglichkeiten eine wertvolle Bedeutung zugemessen werden.
Durch das spezifische Verfahren der Konstruktion durch die Subjekte, welches in dieser Untersuchung verwendet wurde, ist ein aktuell viel diskutierter Aspekt, rekonstruktive Verfahren für den Bereich der Praxis sozialer Arbeit nutzbar zu machen. (vgl. Galuske 2007, S.213.)
„Der Begriff der Rekonstruktiven Sozialpädagogik zielt auf den Zusammenhang all jener methodischer Bemühungen im Bereich der sozialen Arbeit, denen es um das Verstehen und die Interpretation der Wirklichkeit als einer von handelnden Subjekten sinnhaft konstruierten und intersubjektiv vermittelten Wirklichkeit geht.“ (Wensierski/Jakob 1997, S.9.)
Anzumerken wäre in diesem Zusammenhang kritischer Diskussion von Methoden: „Eine Schwierigkeit der sozialen Arbeit besteht darin, dass ihre Rekonstruktionsversuche systematischen Verzerrungen unterliegen.“ (Galuske 2007, S.215.)
Äußerst interessant stellt sich für die Autorin dieser hier vorliegenden Untersuchung der beachtliche Teilaspekt des „sensiblen Sprachgebrauches“ für künftige Forschungen dar, der auf Grund des engen Zeitrahmens der Untersuchung nicht behandelt werden konnte.
Als Ziel dieser qualitativen Sozialforschung kann vor dem fachlichen Hintergrund angesehen werden, Stigmatisierung als Herausforderung in der sozialen Arbeit transparent zu machen und Strategien für betroffene Menschen als auch Handlungsempfehlungen für die klinische soziale Arbeit herauszufiltern. Welchen essentiellen Beitrag die soziale Arbeit in der Begleitung/Betreuung leisten kann und leistet wurde in den Handlungsempfehlungen ausgearbeitet. Diese Untersuchung hat aber auch zum Ziel, einen allgemeinen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Forschungslücke beizutragen und auf Stigmatisierung aufmerksam zu machen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass man die Erfahrungen professioneller HelferInnen nutzen kann um diesen Diskurs, in Form von neuen Fragestellungen und Forschungen , aufzugreifen, zu kommunizieren und zu thematisieren, da Stigmatisierung einen zu wenig beachteten bzw. einen Aspekt mit zu gering eingeschätzter Relevanz darstellt.
Für die klinische soziale Arbeit eröffnen sich durch diesen Versuch der Aufschlüsselung von gelingenden Betreuungsverläufen und -phasen unter dem Hauptmerk des sozialen Phänomens der Stigmatisierung an der beschriebenen Zielgruppe Erklärungsansätze sowie auch die Möglichkeit, diese Erfahrungsberichte künftig zu verdichten. Anknüpfend an diese Studie könnte man die Thematik erweitern und Adaptionen der aufgezeigten Beschränkungen vornehmen.
Die Studie verdeutlicht, dass die Notwendigkeit des Zuganges für klinische soziale Arbeit, sich der Stigmatisierung mit fachlicher Verantwortung zu verschreiben, sich als unumgänglich darstellt.
Neben dem fachlichen Personal sind es selbstverständlich auch die betroffenen Menschen selbst, deren individuellen Erfahrungen und Bedürfnisse in weiterführenden Studien berücksichtigt werden sollten. Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen: die Angehörigen. Auch hier können belastende Erfahrungen, Strategien des Umganges aber auch Einstellungen im Fokus der Stigmatisierung zu wertvollen und zusätzlichen Perspektiven künftiger Forschungen beitragen.
Empfehlungen thematischer Vertiefungsmöglichkeiten wären neben dem bereits vorab erwähnten „ Sensiblen Sprachgebrauch“ und einer genauen Analyse zur Bewusstmachung verwendeter sprachlicher Konstruktionen im Kontext der Stigmatisierung auch die Implizierung auf gesellschaftliche Dimensionen zu sehen.
Diese Skizzierungen und fragmentarischen Überlegungen machen deutlich, dass ein enormer Forschungsbedarf in diesem fachlichen Diskurs besteht.
Zum Einen, um die Zuständigkeiten und Verantwortungen im Professionellen zu klären und zum Anderen, der Komplexität des Stigmatisierungsphänomens mit ausreichendem Wissen, Verhalten, Haltungen und gezielten Interventionen begegnen zu können.
Amering, M. und Schmolke, M. (2007): Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Psychiatrie Verlag.
Böhnisch, L. (2010): Abweichendes Verhalten. Eine pädagogisch-soziologische Einführung. Verlag Juventa: Weinheim und München.
Brockington, I. F., Hall, P., Levings, J., et. al (1993): The community's tolerance of the mentally ill. British Journal of Psychiatry, 162.
Brusten, M. und Hohmeier, J. (Hrsg.)(1975): Stigmatisierung 1. Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Hermann Luchtermann Verlag: Neuwied und Darmstadt.
Conen, M.-L. und Cecchin, G. (2013): Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Therapie und Beratung mit unmotivierten Klienten in Zwangskontexten. Carl-Auer Systeme: Heidelberg.
Corrigan, P.W. und Rüsch, N. (2002). Mental illness stereotypes and clinical care: Do people avoid treatment because of stigma? In: Psychiatric Rehabilitation Skills 6 (3), S.312-334.
Finzen, A. (Hg.) (2001): Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen, 2. Auflage. Bonn, Psychiatrie Verlag.
Flick, U. (2011): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Rowohlt: Reinbek.
Freese, R.(2003): Ambulante Versorgung psychisch kranker Straftäter. Pabst Science Publishers: Lengerich.
Freimüller, L. und Wölwer, W. (2012): Antistigma-Kompetenz in der psychiatrisch-psychotherapeutischen und psychosozialen Praxis. Schattauer: Stuttgart.
Galuske, M.(1998): Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Juventa: Weinheim und München.
Galuske, M.(2007): Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Juventa: Weinheim und München.
Giebeler, C., Fischer, W., Goblirsch, M., Riemann, G. (Hrsg.)(2008): Fallverstehen und Fallstudien. Interdisziplinäre Beiträge zur rekonstruktiven Sozialarbeitsforschung. Verlag Barbara Budrich: Opladen.
Goffman E. (1963): Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Simon and Schuster Inc; New York.
Goffman, E. (1975): Stigma. Über Techniken und Bewältigung beschädigter Identität. Suhrkamp: Frankfurt am Main.
Grunwald, K. und Thiersch, H. [Hrsg.] 2008): Praxis lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. Handlungszugänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Juventa: Weinheim und München.
Hohmeier, J.(1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess. In: Brusten, M., Hohmeier, J. [Hrsg.] 1939): Stigmatisierung: Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen. Luchterhand: Darmstadt.
Kessl, F. und Plößer, M. (2010): Differenzierung, Normalisierung, Andersheit. Soziale Arbeit als Arbeit mit den Anderen. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
Lamnek, S. (1995): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch.Beltz PVU Lehrbuch.
Lebedur, S. In: Eberhard, G. (2007): 100 Jahre Gesundheitsstandort Baumgartner Höhe: Von den Heil- und Pflegeanstalten am Steinhof zum Otto-Wagner-Spital. Facultas.
Link, B. G. et.al (1989): A Modified Labeling Theory Approach to Mental Disorders: An empirical Assessment. In: American Sociological Review, 1989, vol. 54, S. 400-423.
Link, B. G. und Phelan, J. C. (2001): Conceptualising Stigma. In: Annual Review of Sociology, 2001, vol. 27, S. 363–385.
Markowitz, F. E. (2005): Sociological models of mental illness stigma: progress and prospects. In: Corrigan, Patrick W. (Hg.), On the Stigma of Mental Illness. Practical strategies for Research and Social Change. 2. Ausgabe, American Psychological Association: Washington.
Mayring, P. (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Beltz: Weinheim und Basel.
Mayring, P. (2008): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz: Weinheim und Basel.
Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz: Weinheim und Basel.
Meuser, M. und Nagel, U. (2002): „Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion.“ In: Bogner, A., Littig, B., Menz, W. (Hrsg.): Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung. Leske und Budrich: Opladen. S.71-94.
Ortmann, K., Schaub, H.-A. (2003): Zu den Beziehungen zwischen Sozialarbeit und Gesundheitswissenschaften. Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften, 11,1,S.80-92.
Peters, H. (2002): Soziale Probleme und soziale Kontrolle. Westdeutscher Verlag. Wiesbaden.
Rauchfleisch, U. (1999): Außenseiter der Gesellschaft. Psychodynamik und Möglichkeiten zur Psychotherapie Straffälliger. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
Rüesch, P. (2005): Überwindungsversuche. Soziale Netzwerke und Lebensqualität. In: Gaebel, W., Möller H.-J., Rössler, W. (Hg.): Stigma-Diskriminierung-Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. W. Kohlhammer Verlag. Stuttgart, S.196-212.
Sartorius, N. und Schulze, H. (2005): Reducing the stigma of mental illness. A Report of a Global Programme of the World Psychiatric Association.Cambridge University Press: Cambridge.
Schaub, H.-A. (2008): Klinische Sozialarbeit. Ausgewählte Theorien, Methoden und Arbeitsfelder in Praxis und Forschung. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
Scheff, T. J., (1966): Being Mentally I ill: A Sociological Theory. De Gruyter: Chicago.
Schulze B. (2005): Praxiserfahrungen, In: Gaebel W., Möller H.-J., Rössler W. (Hg.) Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, S.122-154.
Schulze B., Angermeyer M.C. (2003): Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals, in: Social Science and Medicine, Nr. 56, S.299-312.
Wensierski, H.-J. v./Jakob, G. (1997): Rekonstruktive Sozialpädagogik. Sozialwissenschaftliche Hermeneutik, Fallverstehen und sozialpädagogisches Handeln. In: Jakob/Wensierski (1997), S.7-22.
WHO – offizielle Homepage der WHO: http://www.who.int/en/ (Stand: 04.10.2014)
Weiterführende Literatur
Dollinger, B., Raithel, J.(2006): Einführung in die Theorien abweichenden Verhaltens. Beltz Verlag: Weinheim und Basel.
Finzen A. (Hg.) (2001): Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisung, 2. Auflage. Bonn, Psychiatrie Verlag.
Gaebel, W., Baumann, A., Zäske, H.(2004): Gesellschaftsrelevante Ansätze zur Überwindung von Stigma und Diskriminierung. In: Rössler, W. (Hg.) Psychiatrische Rehabilitation. Springer Verlag: Berlin. S.5-24.
Gaebel, W., Möller, H.-J., Rössler, W. (2005): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Springer Verlag: Berlin, Heidelberg.
Galuske, M. (2013): Methoden der sozialen Arbeit. Eine Einführung. Beltz, Juventa: Kassel.
Geißler, K.A., Hege, M.(2007): Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Ein Leitfaden für soziale Berufe. Juventa: Weinheim und München.
Geißler-Piltz, B., Räbinger , J. [Hrsg.] (2010): Soziale Arbeit grenzenlos. Budrich Uni Press: Opladen und Farmington.
Goffman, E. (2002): Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. Piper: München.
Kähler, H. und Zobrist, P. (2013): Soziale Arbeit in Zwangskontexten. Wie unerwünschte Hilfe erfolgreich sein kann. Ernst Reinhardt: München und Basel.
Leiprecht, R. [Hrsg.] (2011): Diversitätsbewusste Soziale Arbeit. Wochenschau Verlag: Schwalbach.
Pauls, H. (2011): Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer Behandlung. Juventa: Weinheim und München.
Peters, H. (2009): Devianz und soziale Kontrolle: Eine Einführung in die Soziologie abweichenden Verhaltens. Juventa: Weinheim und München.
Rasch, W. und Konrad, N. (2004): Forensische Psychiatrie. Kohlhammer Verlag: Stuttgart.
Rauchfleisch, U. (2011): Begleitung und Therapie straffälliger Menschen. Vandenhoeck und Ruprecht: Göttingen.
Schilling, J. und Zeller, S. (2007): Soziale Arbeit. Geschichte, Theorie, Profession. München.
Thiersch, H. und Otto, H.-U. (2002): Positionsbestimmungen der sozialen Arbeit. Gesellschaftspolitik, Theorie und Ausbildung. München.
Usaraki, F. (2007): Der Etikettierungsansatz- eine „Gegentheorie“ des abweichenden Verhaltens. Grin: Norderstedt.
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die hier vorliegende Masterarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel ange-fertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Innsbruck, Oktober 2014 Teresa Santer, BA
Quelle
Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts; Fachhochschule Vorarlberg Studiengang Soziale Arbeit; Eingereicht bei Prof.in (FH) Dr.in Erika Geser-Engleitner
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 01.12.2015