Interdisziplinarität als notwendige Bedingung inklusiver Pädagogik
Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen, Eingereicht beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt, Landesprüfungsamt für Lehrämter am: 30.01.2012. Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz. Zweitgutachter: Dr. Tanja Kinne
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erkenntnisleitende Grundlagen
- 3 Historische Entwicklungen
- 4 Aktuelles Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik
-
5 Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses
- 5.1 Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik
- 5.2 Therapieimmanenter Unterricht als Form der Kooperation
- 5.3 Potenziale unterrichtsimmanenter Therapie für ALLE
- 5.4 Inklusive Grundwerte als Begründung für Therapieimmanenz- Therapieimmanenz als Begründung für Inklusive Grundwerte
- 5.5 Ausbalancierung des Spannungsfeldes durch eine ökosystemische Sichtweise auf den Menschen
- 6 Entwurf für die Praxis
- 7 Fazit und Ausblick
- 8 Literaturverzeichnis
- Internetquellen
"Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners, der verschiedene Pflanzen pflegt. Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, die andere den kühlen Schatten; die eine liebt das Bachufer, die andere die dürre Bergspitze. Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben, anderenfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend." (ABBAS EFFENDI 1844-1921, arabischer Schriftgelehrter)
Diese Worte über die Pflege der Vielfalt sensibilisieren und öffnen für den Umgang mit Heterogenität. Die verantwortungsvolle Aufgabe des Gärtners, für die jeweils passenden Wachstums- und Entwicklungsbedingungen Sorge zu tragen, wird in diesem Zitat herausgestellt. Der Unterstützerkreis eines Kindes und die Bindung Gedeihen' eines Individuums dar. Geeignete Gärtner finden sich demnach in den Personen, die Kompetenz und Leidenschaft mitbringen, die sich unterstützend auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Welchen Status die entsprechenden Fachpersonen aufweisen ist dabei zweitrangig, von Bedeutung sind Kenntnisse von und die Begeisterung für die Vielfalt der 'bunten Pflanzen'.
Nach einer knapp zweijährigen Berufstätigkeit als Ergotherapeutin beendete ich mein bestehendes Arbeitsverhältnis in einem interdisziplinären Therapiezentrum in NRW zugunsten des Pädagogik-Studiums an der MLU, in dessen Rahmen ich diese Arbeit verfasse. In der pädiatrischen Praxis eröffneten sich mir zuhauf die Lücken meiner ausschließlich therapeutischen Arbeit. Mir wurde zunehmend bewusst, dass pädagogische und therapeutische Berufsgruppen im Sinne des Kindes zusammenwirken müssen. Kostspielige Fortbildungsangebote wie 'Sensorische Integrationstherapie nach Ayres', 'Bobath für Kinder', 'LRS-Therapie', etc., konnte ich aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen und stellten somit keine 'echte' Perspektive zur Weiterentwicklung dar. Bereits zu Ausbildungszeiten bereitete es mir große Freude, Gruppen von Auszubildenden, Schülern oder Klienten für komplexe Krankheitsbilder und damit verbundene Sachverhalte zu sensibilisieren. Dennoch stellt die Arbeit des Ergotherapeuten für mich weiterhin eine wichtige Unterstützung des Kindes in der Begleitung seiner Entwicklung dar und von daher sehe ich in der Verbindung medizinischtherapeutischer und pädagogischer Handlungsfelder die Chance, den Forderungen nach optimaler Unterstützung und voller Teilhabe ALLER gerecht werden zu können. In dieser Arbeit möchte ich den Versuch unternehmen, die Unterstützung und die Gestaltung von Lernprozessen zu Gunsten des Kindes zusammenzuführen. Im Pädagogik-Studium wurde mir recht schnell bewusst, wie stark die Abgrenzung der beiden Berufsgruppen voneinander ist. Rückblickend auf meine therapeutische Tätigkeit muss ich feststellen, dass sich defizitäre Sichtweisen mit Blick auf die Störungen und Probleme des Klienten rasch entwickeln und im täglichen Handeln verfestigen. Der Fokus der Behandlung liegt schwerpunktmäßig auf den Symptomen und Auffälligkeiten und die Aufhebung und Beseitigung dieser steht im Zentrum der therapeutischen Maßnahme. Es existiert die reine Funktionsförderung, bei der es schwerpunktmäßig um die Wiederherstellung und den Ausbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. In dieser Arbeit möchte ich mich allerdings auf die Förderung als (Lern-)Begleitung konzentrieren. Die Begleitung und Unterstützung von Kindern stellt die Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie dar. Beide Berufsgruppen ermöglichen dem Kind durch ihre Arbeit lebensbedeutsame Lernerfahrungen und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte der Frage auf den Grund gehen, ob sich Therapie und Pädagogik gegenseitig bedingen, sie vielleicht sogar gleiche Ziele in der Arbeit mit dem Kind verfolgen und ob diese gegenwärtige Abgrenzung (aus 'nostalgischen' Gründen) künstlich aufrechterhalten wird. Profitiert das Kind von einer Zusammenarbeit oder von einer Separierung beider Berufsgruppen? Können durch eine Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik im gemeinsamen Unterricht die vorhandenen Grenzen aufgeweicht und Gemeinsamkeiten zu Gunsten des Kindes genutzt werden?
Systematisch soll in den folgenden Kapiteln der Begriff der Therapieimmanenz, in Form indirekter oder direkter Unterstützung der Gestaltung von Bildungsprozessen analysiert werden. Ziel ist es, die Besonderheit immanenter Unterstützung herauszuarbeiten, um den 'Therapiedschungel' zu lichten und einen fremdbestimmt- manipulierten 'Therapiemarathon' aufzuhalten.
Spätestens seit dem Dezember 2008 und der Ratifizierung der UN-KONVENTION ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG, welche zwei Jahre zuvor von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, muss auch Deutschland gesetzliche Grundlagen schaffen, einen 'inklusiven Weg' zu ermöglichen. Mit Artikel 24 verpflichtet sich Deutschland, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten und einen diskriminierungsfreien Zugang zu allgemeinen Bildungseinrichtungen im Nahraum sicher zustellen (vgl. UN-ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 2008, 18ff.). Dieser Beschluss spricht jedem Menschen das Recht auf Bildung, Chancengleichheit und damit die Teilhabe an der Gesellschaft zu (vgl. ebd.) und an dieser Stelle entsteht der gemeinsame Unterricht, eine immer heterogener werdende Schülerschaft, die ein Team an Lernbegleitern fordert, dass auf all ihre Bedürfnisse eingestellt ist bzw. gewillt ist, sich erforderliche Kompetenzen anzueignen. Die Erfahrungen aus der Praxis deutscher Schulen sollen die bisherigen Umsetzungen der Konvention beleuchten. Die Realität zeigt, dass weiterhin alle Bundesländer mit der Möglichkeit lernzieldifferenten gemeinsamen Unterrichts in einem Ressourcenvorbehalt verankert sind, was bedeutet, dass nur bei Finanzierungsmöglichkeit entsprechender (sonderpädagogischer) Ausstattung ALLEN der Zugang zur allgemeinen Schule eröffnet wird. So gibt es bisher auch in keinem Bundesland eine Ausgewogenheit von Angebot und Nachfrage gemeinsamen Unterrichts, ganz im Gegenteil, "in allen Bundesländern übersteigt die Anzahl der Anträge von Eltern auf gemeinsamen Unterricht bei weitem die Zahl der ausgestatteten Plätze in allgemeinen Schulen" (MÜLLER-ERICHSEN/FRÜHAUF 2007, 11).
Diese Tendenz führt zu folgender Fragestellung, der in dieser Arbeit nachgegangen werden soll. Sind es die Unsicherheiten und Ängste der Fachexperten, die in den Köpfen zu einer Separierung in die Bereiche des 'Belehrens' und des 'Behandelns' führen. Weicht man diese Grenzen auf und lässt eine Kompetenzvermischung zu, würden dann nicht alle Beteiligten professionelle und bedürfnisorientierte Unterstützung erfahren? Entscheidend ist, dass es gar nicht um das 'Belehren' oder das 'Behandeln', sondern um die Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf dem Weg ihrer Persönlichkeitsentwicklung geht und um das eingangs beschriebene Beispiel des Gärtners aufzugreifen, erfordert diese Begleitung einer Vielfalt in ihrer Entwicklung eine Vielfalt an Bezugspersonen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Interessen. Die Veränderung der Schülerschaft an deutschen Schulen muss zu verändertem Lernen führen und diese Tatsache wiederum, fordert das Überdenken traditioneller Konzeptionen für die Praxis. Mögliche Formen der Zusammenarbeit sowie Erfahrungen aus der Schulpraxis werden dargestellt und dienen zur Analyse und Überprüfung 'echter' Interdisziplinarität. Neben den Potentialen für das Kind, sollen die den Teamprozess fördernden Vorteile und Faktoren, die sich durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ergeben, in den folgenden Kapiteln aufgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit den Schlagwörtern 'Interdisziplinarität', 'Therapieimmanenz' und 'inklusive Pädagogik' soll in dieser Arbeit konkret einer zentralen Fragestellung nachgehen: Wird das interdisziplinäre Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik in Form unterrichtsimmanenter Therapie bislang lediglich an Förderschulen als notwendig angesehen oder stellt die Vernetzung ALLER erforderlichen Kompetenzbereiche ALLER an der Entwicklung des Kindes Beteiligten nicht die unabdingbare Grundlage inklusiver Pädagogik dar? Bei der Bearbeitung dieser Fragestellung kommen ebenfalls relevante Fragen hinzu: Woran liegt, dass Interdisziplinarität so schwer zu praktizieren ist? Liegt es daran, dass hier zwei Systeme, das medizinische und das pädagogische System, aufeinander treffen, die durch Konkurrenz geprägt sind und die Entscheidungskompetenz jeweils für sich beanspruchen und der anderen Disziplin misstrauisch gegenüberstehen? Liegt es an der Angst der Fachkräfte, dass sie, anstatt ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern, auf einmal 'zwischen allen Stühlen sitzen' und nichts richtig können? Liegt es an den starren Finanzierungssystemen durch die gesetzlichen Krankenkassen und örtlichen Sozialhilfeträger, die eine fachliche Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen nur sehr begrenzt finanzieren? Oder fehlt bislang ein klares Konzept zur Umsetzung der Interdisziplinarität in der alltäglichen Praxis?
In der Literatur wird der Schwerpunkt auf die Organisation und Inhalte der Zusammenarbeit des therapeutischen und (sonder-)pädagogischen Personals in Förderschulen, sowie die Herausforderungen kooperativer Prozesse zwischen Regelpädagogen und Sonderpädagogen in integrativen Schulen, gesetzt. Dies vermittelt das Bild, als seien therapeutisch- pädagogische Grundsätze und Interventionen lediglich an Förderschulen notwendig. Es mangelt insgesamt an wissenschaftlich begründeten Konzepten und theoretischen Modellen des Zusammenwirkens von Therapie und Pädagogik, deren Entwicklung aber unumgänglich ist, um ALLEN Beteiligten mehr Sicherheit und Motivation für das zukünftige gemeinsame Handlungsfeld (der Inklusionspädagogik) zu vermitteln. In der Literatur gilt Therapieimmanenz besonders in der Begleitung schwermehrfachbehinderter Kinder als bedeutend. Im Rahmen des Praxisentwurfs (vgl. Kap.6, 6.6) wird ebenfalls der Umgang mit dieser spezifischen Schülergruppe dargestellt, um beispielhaft die Potentiale therapieimmanenten Unterrichts herauszuarbeiten. Allerdings soll es, wie der Titel meiner Arbeit verrät, nicht um die Integration einer spezifisch ausgewählte Gruppe von Menschen in die allgemeine Schule durch die Integration pädagogisch-therapeutischer Momente in den Unterrichtsalltag gehen, sondern um das Schaffen von adäquaten Bedingungen zur Partizipation ALLER. Die Möglichkeiten der Realisierung gemeinsamen Unterrichts bei Schülern mit ICP (Infantile Cerebralparese) zu beschreiben, ist darin begründet, Die volle Teilhabe der Kinder, denen das Etikett 'harte oder schwere Behinderung' angeheftet wurde, wird in der Praxis für 'hart und schwer' zu realisieren angesehen, deshalb werden in dieser Arbeit Möglichkeiten und Potentiale durch die Immanenz therapeutischer Unterstützung im gemeinsamen Unterricht am Beispiel von Schülern mit ICP aufgezeigt. Theoretisch zu verorten ist die Arbeit in der Systemtheorie, in der Therapeut und Pädagoge durch eine ökosystemische Sichtweise auf den Menschen als Kooperationspartner fungieren. Miteinander reden und handeln statt nebeneinander und voneinander entfernt als Experten und Einzelkämpfer zu agieren. Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden pädagogischen und therapeutischen Begriffen, dem Begriff der Kooperation, sowie den drei Modellen der Zusammenarbeit nach Goll, findet im zweiten Kapitel ein geschichtlicher Abriss zur Zusammenarbeit von Medizin und Pädagogik statt. Auf das sich wandelnden Verhältnis und die Entstehung des Spannungsverhältnisses wird eingegangen, um dem Leser einen theoretischen Hintergrund für die aktuelle Situation zwischen Therapie und Pädagogik zu vermitteln. Im darauf folgenden Kapitel soll der dieser Status quo beschrieben und analysiert werden. Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem aktuellen Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik und sieben theoretische Konzeptionen und Modelle werden vorgestellt, von denen einige bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Ein Zwischenfazit schließt das vierte Kapitel ab. Im fünften Kapitel werden die Gemeinsamkeiten der beiden Berufsgruppen dargestellt, um daran die Potentiale therapieimmanenten Unterrichts für ALLE und die wechselseitigen Bedingungen zwischen den Grundwerten der Inklusion und Therapieimmanenz, herauszuarbeiten. Nach dem das Spannungsfeld analysiert, unterschiedliche Menschenbilder und Sichtweisen dargelegt, aber auch Gemeinsamkeiten und Potentiale aufgezeigt wurden, findet am Ende des fünften Kapitels die Vorstellung verschiedener Möglichkeiten und Ansätze zur Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses zwischen Therapie und Pädagogik satt. Es soll deutlich werden, dass der Zusammenarbeit beider Berufsgruppen in einem interdisziplinären Team innerhalb der Inklusionspädagogik ein hoher Stellenwert zukommt. Dabei werden mögliche Konfliktfelder, die Kooperation und Interdisziplinarität gefährden können, nicht außer Acht gelassen. Im sechsten Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse der theoretischen Analyse genutzt, um einen Ausblick in die Praxis zu wagen. Ansätze und Ideen zur Realisierung inklusiver Grundwerte im gemeinsamen Unterricht mittels indirekter Unterstützung, sollen dem Leser als konzeptioneller Entwurf und als Handreichung für die Praxis angeboten werden. Fazit und Ausblick im siebten Kapitel schließen die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
Bis heute, so zeigt die Analyse der Fachliteratur, gibt es für die Kooperation von Therapeuten und Sonderpädagogen kaum speziell ausgearbeitete Konzepte oder theoretische Modelle der interprofessionellen Zusammenarbeit aus dem deutschsprachigen Raum (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 168). Dem Forschungsfeld der Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik im schulischen Kontext wurde bislang kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet. Studien zur Thematik Therapieimmanenz, therapieimmanenter Unterricht bzw. unterrichtsimmanente Therapie oder zur Kooperation zwischen Therapeuten und Pädagogen, sind in der Literatur sowie in Fachportalen der Pädagogik und Medizin spärlich. Lediglich FEUSER und WOCKEN widmen sich in ihren Dissertationen der integrierenden und allgemeinen Pädagogik und betonen die zugrundeliegenden kooperativen und interdisziplinären Kompetenzen. Die Suche nach aktuellen renommierten und aussagekräftigen Studien, zur Untersuchung der Therapieimmanenz im gemeinsamen Unterricht, blieb erfolglos. Eine empirische Studie zur Zusammenarbeit von Physiotherapeuten und Sonderpädagogen an Schulen für Körperbehinderte liefert MAIER-MICHALITSCH 2009. Eine Voruntersuchung und eine Hauptuntersuchung mit einer quantitativen und qualitativen Befragung sind Inhalt (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 197). Die Publikationen von HANSEN, JANZ, SOWA/ RISCHMÜLLER, KOBI und GOLL, setzen sich mit der Integration pädagogisch-therapeutischer Momente in den Unterricht auseinander (vgl. ebd. 347). Allerdings wird in diesen Dissertationen vorwiegend auf das Spannungsfeld zwischen Therapie und Pädagogik und auf die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns hingewiesen, die Vernetzung der beteiligten Berufsgruppen zur Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses als notwendige Voraussetzung inklusiven Handelns, kam bislang zu kurz.
Pädagogik beschäftigt sich mit Bildungs- und Erziehungsprozessen und deren Zielen in Theorie und Praxis. Den Begriff 'Unterricht', wie im Titel dieser Arbeit verwendet, halte ich im Kontext der Inklusion für weniger geeignet. Bevorzugt geht es um die 'Gestaltung von Bildungsprozessen', um das Primat der Selbstbestimmung hervorzuheben.
"Therapie und Pädagogik sind historisch gewachsene Begriffe, die beide neben dem stehen, was wir als normale Entwicklung des Menschen bezeichnen. Therapie will Abweichendes heilen, um Normales möglich zu machen. Pädagogik will die normale Entwicklung auf ein Ziel orientieren" (ALY 1987).
Theorie und Praxis der Lernprozesse, die wissenschaftliche Begründung deren Grundlagen, die Organisation sowie die Auswertung und Überprüfung in der Praxis, stellen das Handlungsfeld des Pädagogen dar. Pädagogik verfolgt dabei primär das Ziel, jedes ihm anvertrauten Individuum zu einem selbstbestimmten und unabhängigen Menschen zu befähigen. Nach KAISER und KAISER sind die beiden wichtigsten Momente eines Unterrichts der interaktionell- soziale und der didaktisch- methodische Aspekt. Unterricht ist ein Geschehen, bei dem beides ineinander greift, eines auf dem anderen aufbaut und eines das andere voraussetzt. Konkret bedeutet dies, dass Unterricht einerseits zum Ziel hat, Lerninhalte an bestimmte Adressaten zu vermitteln und andererseits diese Vermittlung in Interaktionen eingebettet ist, was bedeutet, dass eine Vielzahl komplexer sozialer Handlungen, oft in engem Zusammenhang mit dem eigentlichen Lerngeschehen, ablaufen. Als weiteres Strukturmoment gilt die Behandlung von Inhalten unter bestimmten Intentionen und die methodische Aufbereitung des Themas hinsichtlich der Adressatenbedingungen (vgl. KAISER/KAISER 1994 in HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 18f). Nicht nur das Thema muss bedürfnisorientiert methodisch aufbereitet werden, die gesamte Struktur von Unterricht und Schule muss der Schülerschaft entsprechend vorbereitet und organisiert werden. Sieht man die Gestaltung von Lernprozessen nicht als vorgefertigten Planablauf im Gleichschritt an, sondern als Plattform für differenziertes Lernen mit- und voneinander, dann können viele Ängste reduziert werden und im Sinnen der Inklusion Unterricht didaktisch-methodisch und personellorganisatorisch so gestaltet werden, dass ALLE teilhaben können. SCHWEINS sieht die Aufgabe der Pädagogen in der Unterstützung. Seiner Auffassung nach sind Pädagogen von berufswegen Menschen, die das Verhalten eines anderen Menschen zu beeinflussen versuchen. Die Absicht, ein Verhalten beeinflussen zu möchten, gehe grundsätzlich von dem Verständnis aus, dass Verhalten alle für eine erfolgreiche Lebensführung notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, sowie Haltungen einschließt (vgl. SCHWEINS 1996, 24f.). Ein Pädagoge habe immer das Verhalten eines Menschen als Ganzheit von motorischen, kognitiven, emotionalen und sozial-kommunikativen Lebensäußerungen im Auge und sei sind in das Spannungsfeld gestellt, grundsätzlich die erfolgsversprechenden Ansätze beim Schüler aufzuspüren und diese mit Zuversicht auszubauen. Auf der anderen Seite könne er Hilfe für Schüler nur anfordern, wenn sie auch bereit sind, die Notwendigkeit solcher Hilfe anhand der Darstellung der Mängel und Defizite, der Darstellung des Förderbedarfs, zu verdeutlichen. (vgl. ebd. 25). WOCKEN bezeichnet dies als "Ressourcen- Etikettierungs-Junktim" (WOCKEN 2011, 119). Ein Kind muss erst stigmatisiert werden, damit Systeme sich seiner individuellen Lage nach ausrichten können. In dieser Hinsicht besteht also auch unter der Perspektive der UNKonvention noch deutlicher Handlungsbedarf. Pädagogen als sogenannte 'Beeinflusser' von Verhalten betrachten in ihrem beruflichen Tun das Lernen in allen für den Menschen bedeutsamen Lebensbereichen. Sie müssen berücksichtigen, dass Lernen als Verhaltensänderung nicht losgelöst betrachtet werden kann von physischen und psychischen Zuständen, den konstitutionellen Voraussetzungen des Schülers, sich die Welt anzueignen (vgl. SCHWEINS 1996, 26). Diese umfassende Aufgabe kann der Pädagoge nicht im Alleingang bewältigen. Um allen Schülern das Lernen und damit die uneingeschränkte Teilhabe zu ermöglichen, benötigt auch er zusätzliche Ressourcen, Unterstützung und detaillierte Fachkenntnisse.
Nach BLOEMERS und WISCH versteht man unter dem Begriff der Therapie ein Verfahren, in dem "in einer partnerschaftlichen, therapeutischen Beziehung mit Hilfe von Kommunikation, durch Erklären, Verstehen und Beeinflussen von Verhalten und Entwicklung, physische, geistige und psychische Beeinträchtigungen sowie deren Folgen gemildert oder behoben werden sollen" (BLOEMERS/ WISCH 2004, 252). DEPUIS und KERKHOFF sehen in "Krankheit eine Vorbedingung für Therapie" (DEPUIS/KERKHOFF 1992, 664 in MAIERMICHALITSCH 2009, 25). Aussagen wie diese, gekoppelt mit Begrifflichkeiten wie Unterrichten und Therapieren, signalisieren meines Erachtens einen sehr defizitären und fremdbestimmten Blick auf den Menschen. Im Zuge der Inklusion sollte man diese Begrifflichkeiten zugunsten (indirekter) Unterstützung, Begleitung und Teilnahme fallen lassen. Andererseits trage auch ich persönlich das Etikett 'Therapeut' als Berufsbezeichnung. Berufsgruppen und deren zugrundeliegende Begrifflichkeiten sollten auch im Zuge der Inklusion bei den Empfängern entsprechender Dienstleistungen nicht zu Schamgefühlen und 'Reden mit vorgehaltener Hand' führen. Diese 'Heilberufe' haben ihre Berechtigung und statt sie 'wegzudenken' sollte man im Sinne der Inklusion umdenken und Therapeuten als notwendige Professionen im interdisziplinären Prozess ansehen und anerkennen. Im Kontext Schule werden Therapeuten dann integraler Bestandteil eines pädagogischen Teams sein. In Rahmen dieser Arbeit entscheide ich mich bewusst für einige therapeutische Begrifflichkeiten, von anderen wiederum nehme ich bewusst Abstand. Von der Wortbedeutung her lässt sich 'Therapie' auf das griechische Wort 'therapeia' zurückführen und bedeutet so viel wie 'dienen'. Ein häufig verwendetes Synonym ist 'Heilung' oder 'Heilbehandlung' (WOXIKON). Therapeuten üben einen Beruf aus, der im medizinischen Sinne die 'Heilbehandlung' zum Gegenstand hat. Geht man dem Begriff der 'Heilbehandlung' weiter nach, so impliziert dieser eine Vorstellung vom Menschen, die durch das Merkmal 'heil sein', was bedeutet, frei von Beschwernissen und Schmerzen, Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, frei von Störungen des Selbstbewusstseins und der Sozialkompetenz, frei von Störungen der Entwicklung, zu sein (vgl. SCHWEINS 1996, 21). Sieht man sich allerdings heutige Felder der Therapie an, im Besonderen ist hier die Ergotherapie zu erwähnen, so zeigt sich, "dass Therapie zunehmend den Anspruch erhebt, Menschen in all ihren Dimensionen des Selbstseins und der sozialen Bewährung in der Welt zu betrachten und hierfür Dienste anzubieten" (SCHWEINS 1996, 22). 'Heilbehandlung' schließt auch Fördern ein, was meint, dass sie das Vorwärts-, Aufwärtsbringen eines empirisch zu erwartenden Entwicklungsvorganges oder eine Stabilisierung eines Entwicklungszustandes bewirken will (vgl. ebd., 22). Beide Berufe, Physiotherapie und Ergotherapie, gehen von der Annahme aus, dass Bewegung und Wahrnehmung zentrale Grundbedürfnisse des Menschen sind und dass Bewegung eine der überragenden Lebensäußerungen des sich entwickelnden Menschen ist. Die Langzeitstudie von Dr. BREITHECKER (siehe dazu: Kap.6, 6.6) bietet Belege für diese Annahmen. Bei der defizitär erscheinenden Sichtweise der Therapeuten ist die Gefahr gegeben, dass der Mensch als Ganzes zu Gunsten eines therapeutisch lokalisierbaren Mangels in den Hintergrund tritt. In der heutigen Medizin und Therapie ist allerdings erkennbar, dass bei aller differenzierten 'Heilbehandlung' zunehmend die Einbettung der Teilmaßnahmen in die gesamten Lebensbezüge des betroffenen Menschen beachtet wird. Therapeuten erfahren in der Realität der schulischen Förderung, dass die Integration des therapeutischen Handelns in den gesamten Lebensalltag des Schülers nicht nur wichtig ist, sondern zunehmend auch von fachspezifischen Autoren als die einzig wirksame Voraussetzung für Therapie anerkannt wird. Ein Lebensweltbezug und Alltagsbezug gelingt am besten, wenn alle am Entwicklungsprozess Beteiligten zusammenarbeiten und so voneinander profitieren. Innerhalb der ganzheitlichen und integrativen Sichtweise der therapeutischen Berufsgruppen zeigt sich eine weitere Entwicklung, die ein traditionelles, enger gefasstes Verständnis von 'Heilbehandlung' zu durchbrechen beginnt. Bisher wurde Heilbehandlung, also Therapie, als weitgehende Fremdbehandlung eines Menschen durch den Therapeuten gesehen, ohne die Mitverantwortung und Eigenbeteiligung des Patienten zu berücksichtigen. 'Moderne' Therapie besinnt sich darauf, die Eigenkräfte und Eigeninitiativen des zu Behandelnden zu seiner Mitverantwortung für seine Heilbehandlung voll zu nutzen. Sinnvolles und für den Menschen sinnhaftes Lernen entwickelt sich dahingehend, dass "der zu behandelnde Mensch nicht nur be- handelt wird, sondern "dass seine Angelegenheit 'Behinderung' mit ihm 'verhandelt' und mit ihr gehandelt wird" (ebd. 24). Auch in der 'modernen' Pädagogik sind Entwicklungen von einer Lehrerorientierung im Frontalunterricht hin zu einem selbstbestimmten Lernens zu verzeichnen. Diese gemeinsamen Entwicklungen bieten quasi die beste Voraussetzung zur Annäherung, um sich in diesem entwickelnden Prozess zu unterstützen, gegenseitig fortzubilden und somit weiterzuentwickeln. Maria Montessori stellt heraus, "dass therapeutische Behandlung genauso wie Erziehung nichts anderes ist als 'Hilfe zur Selbsthilfe'" (MONTESSORI in SOWA/RISCHMÜLLER 1996, 24). Der DEUTSCHE VERBAND DER ERGOTHERAPEUTEN (DVE) stellt die Ziele ergotherapeutischer Maßnahmen wie folgt dar:
"Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jedes Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen" (DVE 2011).
Im Gegensatz zur Physiotherapie, die vorwiegend die Bewegung selbst zum Mittel nimmt, werden in der Ergotherapie Objekte, Spielzeuge, Werkzeuge, wird eigentlich Umwelt im weitesten Sinne in die Bewegung eingebaut. Das Kind wird durch vorbereitende Bewegungsbehandlung zum Erlernen von Fertigkeiten geführt, es werden Handlungsabläufe erarbeitet, die für das Kind von unmittelbarer praktischer Bedeutung sind. Dadurch erfährt das Kind sinnhaftes und subjektiv bedeutsames Lernen. Der Alltags- und Lebensweltbezug sowie die Formulierung eines persönlichen Handlungsziels als Motivationshilfe, stehen an oberster Stelle der Therapieplanung. Dennoch stellen "Therapien, wie Psychomotorik, Spieltherapie, Maltherapie, Musiktherapie, Beschäftigungstherapie häufig noch künstliche Therapien dar" (ALY 1987). Allerdings schaden sie niemandem, ganz im Gegenteil, sie tun allen Kindern gut und könnten daher in jedem Kindergarten und in jeder Schule für ALLE Kinder durchgeführt werden. Die Existenz unserer Sondereinrichtungen fordert geradezu eine "Übertherapeutisierung" (ebd.) und auch umgekehrt wird leider Therapie allgemein mit einem 'Förderbedarf' und einer 'Unfähigkeit' gleichgesetzt. Ein Rechtfertigungsgrund, um ein Kind in eine Sondereinrichtung zu geben, ist in erster Linie eine Förderung durch Therapie. Gerade deshalb sollte sich das Bild der Therapeuten grundlegend ändern, um allen Schülern das Lernen und damit die uneingeschränkte Teilhabe zu ermöglichen. Häufig benötigt das Kind nur kleine unscheinbare, in den Unterrichtsalltag integrierte, Stützen.
Das zentrale Tätigkeitsfeld für diese Arbeit bildet die Pädiatrie, die Lehre der Entwicklung des Kindes. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Logopäden sind die gängigen Vertreter therapeutischer Berufe an pädiatrischen Einrichtungen.
Die bereits erwähnten unterstützenden, in den Unterrichtsalltag integrierten, Maßnahmen, werden mit dem Begriff der Therapieimmanenz beschrieben. Für die Entwicklung eines inklusiven Leitbildes kann und darf man die starren Grenzen zwischen den verschiedenen Fachgebieten nicht (mehr) ziehen. Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen muss im Mittelpunkt stehen. Eine separate und isolierte Be-Handlung, die je nach Diagnose und festgestelltem Förderbedarf geplant und gestaltet wird, bringt dem Kind für die selbstbestimmte Bewältigung seines Alltags genauso wenig, wie die Verfolgung von Bildungs- und Erziehungszielen ohne das Eingehen auf und gegebenenfalls Anpassen seiner Ausgangslange. Inklusion fordert den 'Blick über den Tellerrand', die intensive und echte Auseinandersetzung mit dem Kind, gewährleistet von kompetenten Personen in einem interdisziplinären Team. Alle Kompetenzen, die das Kind für die volle Teilhabe benötigt, müssen integraler Bestandteil des schulischen Teams sein. Beim therapieimmanenten Unterricht handelt es sich nach HEDDERICH und DEHLINGER um einen Unterricht, der von therapeutischen Momenten durchzogen, bereichert, durch diese erweitert oder ergänzt wird (vgl. HEDDERICH/DEHLINGER, 1998, 19). Der Begriff 'immanent' kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie 'innenwohnend', 'enthalten' (THE FREE DICTIONARY). Dazu wird zum einen die therapeutische Übungsbehandlung, integriert in den Schulalltag, gezählt. Zum anderen sind all die Aktivitäten gemeint, die die Pädagogik nach Anleitung aus therapeutischen Konzepten übernommen hat und in ihre spezielle Unterrichtsituation einfließen lässt (z.B. Handling, Lagerung, Basale Stimulation, usw.). Durch die enge Kooperation der verschieden ausgerichteten Mitarbeiter kommt es zu einer einheitlichen und ganzheitlich ausgerichteten Unterstützung und damit zu einem durchgängigen Erziehungs- und Bildungskonzept, bei dem der Schüler stets den Mittelpunkt bildet (vgl. ebd. 57). KOBIs Ausführungen zufolge gibt es keine offensichtliche Trennung zwischen Therapie und Unterricht, sie verschmelzen unweigerlich. Entscheidend sei nicht was jemand tut, sondern wo und wer etwas macht. Er drückt damit aus, dass die Institution die Tätigkeit bestimmt (vgl. KOBI 1986 in HEDDERICH/DEHLINGER, 1998, 20). Der Autor unterscheidet zwei Formen therapieimmanenten Unterrichts (vgl. KOBI 1986, 90f.). Zum einen nennt er das "kooperative Konzept". Hier treten Therapeut und Erzieher dem Kind gegenüber als Lehr-Team auf, was bedeutet, dass sie auf der inhaltlichen, der funktionellen und der beziehungsmäßigen Ebene konzentriert und damit integrations-, identifikations- und transferförderlich zusammen arbeiten (vgl. ebd.). In der Weise würden sie mit dem Kind zusammen eine lern-lehrpsychologische Struktureinheit bilden, in der das therapeutische und das pädagogische Bewegungsmuster im Idealfall deckungsgleich werden - "ohne partnerschaftlichen Identitätsverlust!" (ebd.). Die Nachteile dieses Konzepts liegen nach Auffassung des Heilpädagogen "in administrativen Rigiditäten, welche zum Beispiel aus finanz- und arbeitsrechtlichen Gründen derartigen systemübergreifenden Funktionseinheiten entgegenstehen, sowie in der hohen Personabhängigkeit" (ebd. 91). Das "induktive Konzept" (ebd.) impliziert das Mitwirken der Therapeuten im Unterrichtsalltag und der Pädagogen im Therapiealltag "lediglich als Berater und Instruktoren" (ebd.). Hier kommen beide Berufsgruppen im jeweils anderen Berufsfeld mit den Schülern kaum bzw. mehr zu Demonstrationszwecken in Kontakt. KOBI veranschaulicht: "Eine Physiotherapeutin instruiert beispielsweise die Bezugspersonen eines cerebralparetischen Kindes bezüglich [...] des motorischen Umgangs. Oder eine Logopädin berät eine Früherzieherin bezüglich der kommunikativ- sprachlichen Umgebungsgestaltung" (ebd.). Die Vorteile dieses Konzepts lägen in einer vorweggenommenen Integration von Therapie und Erziehung, in einer Reduktion der oft verwirrenden Vielheit von Personen, Methoden, Räumen, Inhalten, Materialien, Zielsetzungen, Erwartungen etc. Der Nachteil liege in der nicht hoch fachspezifischen Belehrung beziehungsweise Therapie der Klientel (ebd.). Der Autor gibt zu bedenken, dass beide Konzepte ambivalente Ansprüche an die beteiligten Berufsgruppen setzen. Einerseits führe das systemische Arbeiten im "kooperativen Konzept" (ebd.), in dem "Therapeut und Pädagoge von dominierenden Spezialisten" (BERGEEST/HANSEN 1999 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 90) zu kooperativen Partnern werden, häufig zu Überforderungen auf beiden Seiten. Noch stärker könnte die Überforderungstendenz im "induktiven Konzept" ausfallen, wenn pädagogisches Personal sich nicht nur therapeutische Maßnahmen und Methoden aneignen müssen, sondern diese dann zusätzlich zu pädagogischen Inhalten im Unterricht (in der Funktion eines Co-Therapeuten) durchführen müssen. Jedes Kind hat das Recht auf hoch fachspezifischen Umgang, auf adäquate Unterstützung durch entsprechend kompetentes Personal. Ein Team, bestehend aus vielfältigen Kompetenzen, stellt eine Chance für eine immer heterogener werdende Schülerschaft dar.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns in inklusiven Settings transparent zu machen. Interprofessionelles Zusammenwirken beinhaltet Aushandlungsprozesse über gemeinsame Inhalte und Ziele und sollte im optimalen Fall zu gemeinsamen Beschlüssen und Aktionen führen (vgl. BEHRINGER/HÖFER 2005 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 157). Kooperation bedeutet zielorientiertes Vorgehen bei der Bewältigung von Aufträgen. Der gemeinsame Auftrag für das Multiprofessionelle Team in einer 'Schule für ALLE' lautet: Verantwortungsbewusste Begleitung des Kindes auf dem Weg seiner Persönlichkeitsentwicklung. Der Pädagoge und Wissenschaftler, Hans WOCKEN, beschäftigt sich eingehend und tiefgreifend mit den Bedingungen und Voraussetzungen funktionaler Kooperation. Er deutet darauf hin, dass "Kooperationsprobleme [...] nicht selten mit fehlenden Kooperationserfahrungen der Lehrer in Verbindung gebracht [werden]" (WOCKEN 1988). MUTH und TOPSCH geben zu bedenken, dass "für den deutschen Lehrer [...] Formen der Kooperation in einem gemeinsam durchgeführten Unterricht etwas Außergewöhnliches [sind], weil er von Beginn seines Berufslebens an auf sich selbst gestellt ist und nur in besonderen Ausnahmesituationen einen anderen Erwachsenen - mehr als Gast oder als Aufsichtsperson denn als Mitarbeiter - in seinem Unterricht erlebt; darum kann er über Jahrzehnte weder eine Kritik noch eine Verstärkung seines Handelns erfahren. Das führt dazu, dass sich in ihm ein beruflicher Solipsismus habitualisiert, der sich gegen Formen der Kooperation im Unterricht sperrt" (MUTH/TOPSCH 1972 in WOCKEN 1988). FEUSER stellt fest, dass Lehrer eigentlich "von Anfang an darauf orientiert und spezialisiert sind, nicht zu kooperieren" (FEUSER 1987, 170). KREIE diagnostiziert eine "Angst des Lehrers vor der Zweisamkeit" (KREIE 1985 in WOCKEN 1988). Ihrem Ansatz nach, ist "das Maß der Bedrohungsgefühle und Ängste unmittelbar abhängig von dem Entwicklungsstand der Selbstwahrnehmung, d.h. sich selbst als wahr und in Gewahrsam (Fürsorge) nehmen können, und von dem Selbstwertgefühl, d.h. sich selbst als eigenen Wert fühlen können" (KREIE 1985 in WOCKEN 1988). Kooperationsfähigkeit wird hier verstanden als ein dialektischer Prozess von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Es ist anzunehmen, "dass mit der Entwicklung der Selbstwahrnehmung eine Entwicklung der Fremdwahrnehmung einhergeht, d.h. den anderen wahrzunehmen, 'für wahr' nehmen und verantwortlich mit ihm umgehen zu lernen. In diesem wechselseitigen Prozess verliere der Umgang mit dem anderen an Bedrohlichkeit, wenn man selbst zunehmend sicherer weiß, wer man ist und wer der andere ist, was man selbst will und was der andere will. Das bedeute dann auch, dem anderen die eigene Wahrnehmung von einem selbst und von ihm, sowie die Gegensätze und Differenzen ohne Angst mitteilen zu können, da man sich selbst und den anderen ernst nehme (vgl. ebd.). Kooperationsfähigkeit seien in erster Linie Persönlichkeitsprobleme, da essentiell für das Gelingen von Kooperation der psychische Entwicklungsstand der Lehrer, ihre Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl in beruflichen Arbeitszusammenhängen sei (vgl. ebd.). Damit Kooperation für jeden am Kooperationsprozess Beteiligten funktional und erstrebenswert wird und bleibt, formuliert FEUSER folgendes Übereinkommen, welches in einem Team seine Gültigkeit haben muss: "Für Kooperation ist es im allgemeinen grundsätzlich unverzichtbar, dass die Kooperierenden einen identischen gemeinsamen Gegenstand und identische Ziele haben und eine Einigung darüber erzielen können, mit welchen Verfahrensweisen die Ziele am besten zu erreichen sind" (FEUSER 1987, 205). Denn die Bewältigung der Heterogenität sei erstens auf der Ebene der Ziele und Inhalte des Unterrichts und zweitens auf der Ebene der Wege und Mittel des Unterrichts zu leisten. Mit wachsender Heterogenität komme jeder menschliche Lehrer unweigerlich an seine persönlichen Leistungsgrenzen. Kein Lehrer könne gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Schülers und die gesamte Klasse im Auge haben (vgl. WOCKEN 1988). Mit dieser Aussage soll herausgestellt werden, dass "eine heterogene Gruppe von Schülern [...] unabweisbar auch mehrere Pädagogen [erfordert]" (ebd.). Doch entscheidend ist nicht die Anzahl, die Quantität einer Berufsgruppe, sondern vielmehr eine qualitativ hochwertige Kompetenzvernetzung, die vielfältigen Fachbereiche und Wissensgebiete, die hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe der wachsenden Heterogenität unverzichtbar sind. WOCKEN umschreibt diese Kompetenz im Umgang mit heterogenen Lerngruppen als "Teilung von Autonomie" (ebd.), die aussagt, dass der Umgang mit Heterogenität vereinfacht werden kann, wenn die Aufgaben "unter der Berücksichtigung der Interessen und Kompetenzen der Teammitglieder unterteilt und auf verschiedene Schultern verteilt wird" (ebd.). Auf diese Art und Weise entstehe "im Team ein Rollendifferential, eine formelle Rollenstruktur mit definierten Rollen und Rollenerwartungen" (ebd.). WOCKEN zeigt auf, dass die Differenzierung der Rollen und Aufgaben innerhalb eines heterogenen Teams nicht nur für die Bewältigung der Komplexität heterogener Lerngruppen her geboten sei, "die klare Differenzierung habe auch unschätzbare Vorteile für die Pädagogen" (ebd.), da "diffuse Rollenerwartungen und unklare Aufgabenverteilungen [...] dazu [führen], dass niemand genau weiß, was er zu tun hat, dass man sich gegenseitig im Wege und auf den Füßen steht" (ebd.). Eine "differenzierte Rollenstruktur" (ebd.) stellt demnach eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Kooperieren dar. Die Einsicht und Umsetzung dieser Bedingungen funktionaler Kooperation sind unerlässlich, da weder Unterrichtsgestaltung noch Unterrichtsunterstützung autonom funktionieren, sondern nur in einem komplementären Zusammenspiel. Aus diesem Grund müssen ALLE wissen, was 'Sache ist'. Dieser außerordentlich bedeutsame Austausch kann nicht ausschließlich zwischen 'Tür und Angel' geführt werden, sondern muss im Rahmen gemeinsamer Teamsitzungen, Fallbesprechungen erfolgen und durch Prozesse der Evaluation und Reflexion begleitet werden. Allein durch 'echte' und offene Kommunikation, können Spannungsherde rechtzeitig erkannt und Missverständnisse zügig aus dem Weg geräumt werden. Der Prüfstein kooperativer Arbeit ist die authentische "Gemeinsamkeit in der täglichen Situation vor der Klasse" (SHAPLIN 1972a in WOCKEN 1988). Alle Beteiligten müssen sich der Ehre bewusst sein, die ihnen anvertrauten Kinder auf ihrem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. WOCKEN unterscheidet vier grundlegende Problemfelder, die sich dennoch in einem multiprofessionellen Team einer Schule entwickeln können.
-
Persönlichkeitsprobleme ergeben sich, wenn vermeintliche interdisziplinäre Misshelligkeiten durch selbstunsichere Persönlichkeiten bedingt werden. Missverständnisse und Fehlkommunikationen sind schwerer zu beheben, als fachliche Unstimmigkeiten. Konkurrenzdenken und Egoismus behindern den Kooperationsprozess, allerdings gehören ambivalente Spannungen zwischen Solidarität und Rivalität zu Kooperationsbeziehungen dazu.
-
Beziehungsprobleme treten bei einer zu hohen Erwartungshaltung und Führungsanspruch der Pädagogen (beispielsweise für die Klassenlehrer) und unterschiedlicher Würdigung bei gleicher Leistung auf.
-
Sachprobleme stellen sich ein, wenn nach Kooperation verlangt wird, dann aber doch jeder Fachbereich eigene Bestimmungen entwickelt. Unübersichtliche Fortbildungsangebote und die Einführung neuer berufsspezifischer Begrifflichkeiten unterstützen die Entstehung.
-
Organisationsprobleme ergeben sich, wenn ein Hierarchiegefälle aufgrund von Höherqualifizierung, Besserbezahlung für Pädagogen, allgemeiner Unterscheide in der tariflichen Einordnung, Unterschiede in den Anstellungsbedingungen (Verbeamtung vs. begrenzter Vertrag), unterschiedliche Trägerschaften (freie vs. staatliche) oder eine hierarchische Besserstellung in Form von teilweise gravierenden Gehaltunterschieden vorliegt (vgl. WOCKEN 1991, 21f.).
WOCKEN macht an dieser Stelle bewusst, dass für Pädagogen Kooperation keineswegs allein mit Gefühlen der Entlastung, Bereicherung und Befriedigung verbunden wird. "Was beeindruckt sind die Kosten: Verunsicherung und Angst im offenen Umgang miteinander; Einschränkung individueller Handlungsfreiheit, Einbußen an emotionalen Befriedigungen aus eigenständiger Berufstätigkeit, Verluste an ungeteilter Zuwendung und Anerkennung von Schülern und Eltern, Zwänge zu fortwährenden Abstimmungen und Kompromissen, Zeit. Enttäuschungen sind die Regel, Konflikte nicht selten, Trennungen nicht auszuschließen" (WOCKEN 1991, 21).
Für die Gestaltung konkreter Angebote in der pädagogisch- therapeutischen Praxis ist die Strukturierung auf organisatorischer Ebene entscheidend. Im multiprofessionellen Team sollte zu folgenden Fragen Klarheit und Konsens verschafft werden. Führen die Spezialisten ihre Maßnahmen selbst durch (direkt) oder haben sie im Wesentlichen Beratungsfunktionen inne (indirekt)? Erfolgen die Maßnahmen in speziellen Förderbzw. Therapieräumen (isoliert) oder im alltäglichen Lebensumfeld des behinderten Menschen (integriert)? Sind die Spezialisten in einem Zentrum konzentriert, das vom Klienten aufgesucht werden muss (zentralisiert) oder werden die Maßnahmen vor Ort angeboten (dezentralisiert)? Aus diesen Fragen ergeben sich unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit, denn "trotz gelegentlichen 'Kompetenzgerangels' in der Praxis besteht heute weitgehender Konsens darüber, dass die Zusammenarbeit verschiedener 'Experten' und 'Spezialisten' in einem multiprofessionell [...] zusammengesetzten Team unabdingbar ist" (GOLL 1996, 166). Nach GOLL können die Möglichkeiten einer solchen pädagogisch- therapeutischen Zusammenarbeit nach dem Grad der Koordination und Kooperation der beteiligten Disziplinen im Wesentlichen in drei Modellen zusammengefasst und jeweils durch ein handlungsleitendes Motto charakterisiert werden (vgl. ebd. 166).
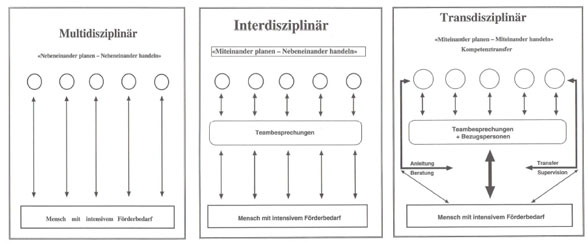
Abb.1: Interdisziplinarität Abb.2: Multidisziplinarität Abb.3: Transdisziplinarität(Quelle: GOLL 1996, 167f.)
Das erste Modell der Zusammenarbeit "Multidisziplinarität" ist charakterisiert durch folgendes Motto: "Nebeneinander planen- Nebeneinander handeln" (ebd.). Die jeweilige Disziplin plant ihr Programm und führt es auch selbst durch. Die verschiedenen Hilfen laufen unkoordiniert nebeneinander her. "Multidisziplinarität gestaltet sich als eine Koexistenz von Professionen" (ebd. 167).
Das zweite Modell "Interdisziplinarität" ist durch ein "Miteinander planen- Nebeneinander handeln" (ebd.) charakterisiert. Die beteiligten Disziplinen planen ihr Programm gemeinsam mit den Kollegen, deren Anregungen in die Programmgestaltung mit eingehen. Die einzelnen Maßnahmen führt der Pädagoge jedoch selbst durch. "Interdisziplinarität gestaltet sich als Kooperation von Professionen" (ebd. 167).
Nach MAIER-MICHALITSCH wirken beim interdisziplinären Zusammenwirken die verschiedenen Disziplinen partiell gemeinsam. Sie treffen beispielsweise in Teamsitzungen aufeinander, in denen eine gemeinsame Zielsetzung besprochen wird. Die einzelnen Fachkräfte arbeiten anschließend aber getrennt voneinander mit unterschiedlichen Methoden an der Zielerreichung (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 169). FEUSER zeigt auf, dass Pädagogen "Interdisziplinarität, Kooperationsfähigkeit und stete Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung" aufbringen müssen, "um dem Anspruch der Integration (und Inklusion) gerecht zu werden. Durch die Komplexität des Gegenstandes der Erziehungswissenschaften erfordert eine Lehrerbildung eine konsequent interdisziplinäre Ausrichtung, um den Mensch als Gegenstand der Erziehungswissenschaft in möglichst vielen Facetten zu erfassen. Diese Komplexität erfordert aber ebenso Kooperationsbereitschaft, da Dialog, Kommunikation, Interaktion und Sprache Basisvoraussetzungen für den Erziehungsprozess sind" (FEUSER 2002 in HEDDERICH/ HECKER 2009, 44).
Das dritte Modell der Zusammenarbeit "Transdisziplinarität" verdeutlicht ein "Miteinander planen- Miteinander handeln"- Transferdisziplin spezifischer Handlungsqualifikationen auf die Bezugspersonen (GOLL 1996, 167). Die beteiligten Disziplinen planen ihre Angebote gemeinsam und gegenseitige Anregungen gehen in die inhaltliche und methodische Konzeption mit ein. Die jeweils passende Kompetenz für den individuell erforderlichen Unterstützungsbedarf demonstriert den Bezugspersonen die wesentlichen Maßnahmen, die diese teilweise selbst, gemeinsam mit der Fachperson oder unter seiner Supervision integriert in Alltagssituationen durchführen. "Transdisziplinarität gestaltet sich daher als Integration von Professionen und deren Transzendierung zu einer qualitativ veränderten 'Metaprofession'" (ebd. 170f.).
Im Unterschied zu den traditionellen Teammodellen erfolge im transdisziplinären Team die Durchführung der Förder-, Pflege- und Therapiemaßnahmen nicht disziplinspezifisch, sondern so weit als möglich disziplinübergreifend (transdisziplinär) in alltäglichen Lebenszusammenhängen und durch die jeweiligen Bezugspersonen, die fest zum Team gehören (vgl. ebd. 166). "Die Vertreter der einzelnen Fachdisziplinen haben vor allem Anleitungs-, Beratungs- und Supervisionsfunktionen im Sinne eines Kompetenztransfers" (GOLL 1996, 166). MAIER-MICHALITSCH beschreibt transdisziplinäres Zusammenwirken als Vereinigung unterschiedlicher Disziplinen in einem gemeinsamen Konzept, in dem enge Kooperation und intensiver Austausch stattfindet. Ein großer Vorteil für alle Kinder sei, dass weniger 'fremde' Personen direkt am Kind arbeiten und es nicht aus seinem Klassenverband herausgelöst werde, um mit einer mehr oder weniger 'fremden' Fachperson in einem separaten Raum zu arbeiten. Die jeweils wichtigste Bezugsperson für das Kind und nicht für das speziell vorliegende motorische oder kognitive Problem, übernehme nach intensiver Anleitung durch die Fachprofession, die ganzheitliche Begleitung und Unterstützung des Kindes. Die Voraussetzung allen Lernens sei das Vertrauen und das gewinne das Kind ausschließlich durch Bindung zu seinen Bezugspersonen (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 169). "Das Konzept des transdisziplinären Ansatzes, bei dem die strikte Rollenverteilung unter den einzelnen Professionen aufgehoben ist, stärkt gerade die Kompetenz und Bedeutung der einzelnen Disziplinen, weil ihre Inhalte nun auch und gerade im Rahmen einer gemeinsamen Förderung an Wichtigkeit gewinnen" (ebd.).
Mir stellt sich an dieser Stelle die Frage, welche Stellung dem Kind im 'Zusammenwirken' zukommt, inwieweit in den dargestellten Modellen die Ressource: Kind verankert wird? Im Titel dieser Arbeit wird 'Interdisziplinarität' als Notwendigkeit angesehen. Bewusst fiel die Wahl auf diese Form der Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik als Bedingung für inklusive Pädagogik. Das Konzept der 'Transdisziplinarität' enthält viele relevante Eigenschaften, wie die Integration der Professionen und deren Transzendierung zugunsten eines qualitativ hochwertigen Angebotes für das Kind. Die Bedeutung der beständigen Bezugspersonen für Bindungsqualitäten, für den gesamten Entwicklungsprozess, sind ebenfalls wichtige Komponenten. Vorteile bestehen weiterhin in den "Metaprofessionen" (ebd.), ALLE kennen ALLES. Dadurch hat das Kind jederzeit einen Ansprechpartner und sollte Unsicherheit durch Unwissenheit entstehen, stehen fachkundige Professionen zur Unterstützung parat. Die Vereinigung von den an der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Beteiligten in einem gemeinsam erstellten Konzept, ist unumgänglich, um dem Kind neben der vollen Teilhabe am Lernen, sinnstiftendes und in den Alltag übertragbares Lernen zu ermöglichen. Ich möchte aber in dieser Arbeit trotzdem weiterhin von der Interdisziplinarität als notwendige Bedingung für das Gelingen einer Pädagogik der Vielfalt sprechen. Dieser Begriff ist in der Literatur und ‚in den Köpfen' eingängig verankert und bildet in Verbindung mit dem Aspekt des Kompetenztransfers und der Transparenz hinsichtlich gemeinsamer Planungs- und Entscheidungsprozesse, die Grundlage für eine inklusive Pädagogik. Eine detaillierte kritische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten und den Potentialen der drei Modelle im Rahmen inklusiver Settings, findet im Zwischenfazit statt.
Inhaltsverzeichnis
Die frühe medizinisch-therapeutische und pädagogische Literatur gewährt Einblicke in ein Arbeitsverhältnis, das von starrer Separierung und Abgrenzung weit entfernt ist. Historische Ergebnisse decken die gemeinsamen Wurzeln medizinischer und pädagogischer Berufsgruppen auf, denn spätestens mit der Entstehung des Therapeutenberufes, sind die medizinischen und pädagogischen Professionen, auf eine Zusammenarbeit angewiesen. MAIER-MICHALITSCH stellt heraus, dass "seit über 100 Jahren [...] pädagogisches und medizinisches Personal unter unterschiedlichen Bedingungen, aber einem gemeinsamen Dach [arbeiten]" (MAIERMICHALITSCH 2009, 33). Bereits 1780 eröffnete der Schweizer Orthopäde Jean Andre Venel (1740-1791) die erste orthopädische Heilanstalt in Orbe/ Kanton Waadt. STADLER und WILKEN nennen Venel "einen Pionier, eines auch die Pädagogik umfassenden Rehabilitationskonzepts, da mit ihm außer einem Inspektor, einer Anzahl von Pflegerinnen, noch zwei Lehrer für den Unterricht" (STADLER/ WILKEN 2004 in MAIERMICHALITSCH 2009, 34) tätig waren. Nach Auffassung der beiden Autoren war dies eine zukunftsweisende Konzeption, die Orthopädie und Pädagogik zusammenführte und an dieser Stelle können die ersten gemeinsamen Wurzeln von Medizin und Pädagogik gesehen werden. Die frühere Literatur eröffnet weitere Gemeinsamkeiten von Pädagogik und Therapie. Der Arzt J.G. BLÖMER beispielsweise errichtete in Berlin an der Spitalbrücke eine "Heilanstalt für arme verwachsene Kinder", die allerdings nicht lange bestand. Dort war die "Erziehung [...] einem Lehrer anvertraut" (BLÖMER 1827 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 35). Das dort etablierte Konzept einer gemeinsamen Abstimmung von Pädagogik und Therapie im Schulunterricht, gibt erste Hinweise auf eine Modifikation des Unterrichts für Kinder und Jugendliche mit körperlichen Schädigungen stellt außerdem ein frühes Beispiel für das Zusammenwirken beider Berufsgruppen bei der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Gebrechen dar (vgl. STADLER/WILKEN 2004 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 35). Nach Aussage des Zeitzeugen KALBHENN (2004) reifte erst in den 60er Jahren das Bewusstsein, dass direkt in der Schule mehr für das körperliche Wohl der Schüler getan werden muss. KALBHENN berichtet, dass ab 1966 in den 18 Sondervolksschulen für Körperbehinderte wöchentlich insgesamt 393 ergotherapeutische, krankengymnastische und sprachheilpädagogische Therapiestunden schulisch finanziert wurden (vgl. KALBHENN 1982 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 36). MAIER-MICHALITSCH stellt fest, dass "ab den 70er Jahren [...] die Therapie fest in den schulischen Ablauf integriert [war]" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 36). Im Jahre 1977 gab es beispielsweise neun Planstellen für Physiotherapeuten, drei für Ergotherapeuten und zwei für Logopäden (vgl. ebd. 36). Im selben Jahr macht KALBHENN in seinem Werk auf die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns aufmerksam, um dem Kind ein angemessenes Lernens ermöglichen zu können. "Eine ganzheitliche Erziehung konnte nur gelingen, wenn die Bemühungen um das einzelne Kind [...] in einem engen Miteinander der Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche, der Eltern, der Kinder [...] erfolgten. Dies war eine permanente und oft schwierige Aufgabe" (KALBHENN 1977 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 37). Für das Zusammenwirken von Erziehung, Unterricht und Medizin wurde von BLÖMER 1827 eigens für seine Schule ein Konzept entwickelt. STADLER und WILKEN postulieren, dass "bis heute gilt, dass Pädagogik und Therapie im Schulunterricht Körperbehinderter aufeinander abgestimmt werden müssen. Gesprochen wird dabei von einem 'therapieimmanenten' Unterricht bzw. von einer 'unterrichtsimmanenten' Therapie" (STADLER/WILKEN 2004, 192). Der schwedischen Pfarrer Knudsen initiierte und koordinierte medizinisch- pädagogische Angebote, indem er 1872 begann, eine Krüppelfürsorge, die durch eine Koordination von medizinischer Behandlung, orthopädischer Hilfsmittelversorgung, schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung geprägt war, zu entwickeln (vgl. SCHÄFER 1900, in MAIER-MICHALITSCH 2009, 50). Der "geistliche Leiter des Oberlinhauses, Pfarrer Hopper, war von dieser komplexen, interdisziplinären methodischen Gestaltung (seines Kollegen aus Schweden) so beeindruckt, dass er sie nach Deutschland brachte" (ebd.). BIESALSKI beschrieb 1911, dass "an Heimschulen meist ein namhafter Arzt aus dem orthopädisch- chirurgischen Fachbereich vorhanden (war). Auf der "Konferenz der Krüppelheime" (1907) einigte man sich auf eine gemeinsame Leitung eines Heimes von Geistlichen, Pädagogen und Ärzten, um die 'gemeinsame Sache' von beiden Seiten in Angriff zu nehmen" (BIESALSKI 1911 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 51). BIESALSKI macht mit folgender Aussage auf die Notwendigkeit medizinischer und pädagogischer Zusammenarbeit aufmerksam: "Das Unterrichten und Erziehen kann nicht erst nach Beendigung der Heilung einsetzen, sondern muss schon während der Behandlung und gleichzeitig mit ihr so früh als möglich beginnen" (BIESALSKI 1909 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 51). "Ohne den Arzt ist der Pädagoge ohnmächtig" (WÜRTZ/ SCHLÜTER 1914 in STADLER/WILKEN 2004, 192). Mit diesem Satz stellt WÜRTZ die Abhängigkeit der Pädagogik von der Medizin dar. Trotz dieser Einsicht in die Notwendigkeit und gegenseitiger Abhängigkeit, um die Voraussetzungen zur vollen Teilhabe aller am Lernen zu schaffen, "zeigt sich recht bald in der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte der Komplex von Status- und Ermessensfragen, aus dem heraus sich Konflikte entwickeln" (SCHMEICHEL 1983, 3). BIESLAKI, der Vorreiter der interdisziplinären Weiterbildung, lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass "die Gesamtleitung und die Gesamtverantwortung für den Heil- und Entkrüppelungsplan (in heutiger Terminologie für den Rehabilitationsplan) beim Arzt liegen" (BIESALSKI 1926 in SCHMEICHEL 1983, 12f.). BERNDT liefert 1968 mit seiner Veröffentlichung, den er mit dem Titel "Zur Abgrenzung und Integration der medizinischen und pädagogischen Arbeit an Körperbehindertenschulen" (BERNDT 1968, 488) überschreibt, ebenfalls Argumente für das Zusammenwirken von Pädagogik und Medizin. Er stellt heraus, dass "eine Zielstellung [...] nur in pädagogisch- medizinischer Zusammenarbeit lösbar" (ebd. 489) ist. Der Autor macht an dieser Stelle auf die Bedeutsamkeit interdisziplinären Handelns aufmerksam, um die notwendigen Ressourcen zur Problemlösung aufzubringen. Er stellt fest, dass nur "der Arzt [...] dem Lehrer individuell spezifizierte Hinweise über Art und Ausmaß der im Unterricht und bei anderen pädagogisch gelenkten Tätigkeiten zweckmäßigen Bewegungsanforderungen zu geben [vermag]" (ebd. 490). Er erkennt zudem den Zusammenhang unterstützender Maßnahmen mit erfolgreichem Lernen und nennt dazu die Notwendigkeit disziplinübergreifender Ansätze in Form zusätzlicher medizinisch angeleiteter Übungen, die der gezielten Funktionsverbesserung aus rehabilitativer Indikation dienen sollen. In dieser Weise ließen sich entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben schaffen (vgl. ebd. 490f.). D.V. WILSON, bis 1966 Generalsekretär der ISRD (The International Strategy for Disaster Reduction), beschreibt folgendes Ziel: "Das streben wir in aller Welt an, dass der Arzt in die Schule kommt und dass die Schule die notwendigen Therapieeinrichtungen besitzt. Hier soll der Arzt die Schüler bei der Arbeit sehen und sie behandeln und fördern" (D.V.WILSON in BERNDT 1968, 491). BERNDT gibt zu bedenken, dass medizinisch-therapeutische Zielstellungen und deren Realisierung erst dann die notwendige Differenziertheit erlangen können, wenn jederzeit die Möglichkeit zu unmittelbarem Kontakt mit dem sonderpädagogischen Bereich gegeben sei. Dazu müsse der Therapeut wie der Arzt die Kinder bei den verschiedensten Tätigkeiten, bei der Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben, beobachten. Außerdem müsse auch der Pädagoge die Arbeit der Therapeuten mit dem Kinde aus eigener Anschauung kennen. Entsprechende Bewegungsanforderungen solle er in den Rahmen seiner pädagogischen Arbeit einfügen. Nur wenn das Kind mit dem Erwerb funktioneller Fähigkeiten und Fertigkeiten zugleich an deren Anwendung im Alltag gewöhnt werde, würden sie zum bleibenden Besitz und zur Grundlage weiterer Entwicklung werden (vgl. BERNDT 1968, 492). Der Autor zeigt auf, dass "diese neuen Aufgaben [von den medizinischen Kräften] das Bemühen um Einsicht in Ziele und Methoden der sonderpädagogischen Arbeit voraus [setzen]. Die gesellschaftlich determinierte Zielstellung der pädagogischen Arbeit gibt damit zugleich die Richtung für die speziellen medizinischen Bemühungen" (ebd. 492). Eine systematische medizinisch -pädagogische Zusammenarbeit zur Steigerung der Bildungs- und Erziehungserfolge habe sich in Anfängen und mit entsprechenden Erfolgen dort gezeigt, wo die Schulärzte mit einigen Stunden wöchentlich eingesetzt wurden (vgl. ebd. 493). Dementsprechend fordere eine "rehabilitative Funktionsschulung ein so hohes Maß an sachlichem Miteinander in der praktischen Arbeit aller Beteiligten des medizinischen und pädagogischen Bereiches, dass ein räumliches Beieinander der Arbeitsstätten unumgänglich werde (vgl. ebd.). Abschließend berichtet BERNDT, dass es für die DDR ein dringendes Bedürfnis sei, diese Probleme zu klären, da es bis zu diesem Zeitpunkt für den Einsatz medizinischer Kräfte im Rahmen bzw. zur Unterstützung der Bildung und Erziehung (körperbehinderter) Kinder keine verbindlichen Grundsätze gebe (vgl. ebd. 493).
Wie ersichtlich wurde, sind in der früheren medizinischen wie therapeutischen Literatur demnach bereits einige Fürsprecher und Vorreiter interdisziplinären Zusammenwirkens zu finden. KALBHENN (1977) charakterisierte diese Verbindung als eine "permanente und schwierige Aufgabe". Fraglich ist und bleibt, ob es den verschiedenen Kompetenzen gelingen wird, diese Aufgaben entsprechend professionell zu bewältigen oder ob sie daran scheitern werden. Große 'Steine' legten sich in den Weg dieser hoffnungsreichen Kompetenzvernetzung. Die Grundrechte, die jedem Menschen das Recht auf Gesundheit, Bildung und Arbeit zusprechen, führten zunächst zu der Entwicklung entsprechender Institutionen, Professionen und Dienstleistungen. Spezialanstalten für jede Form auffälligen, 'norm'- abweichenden Verhaltens. GIDONI und LANDI berichten von einer Vermehrung der Institutionen, Tageszentren, Ambulatorien und im Zuge derer von einer Erweiterung der zugrundeliegenden Theorien, Modelle, Methoden und Praktiken der Physiotherapie, der Logopädie, der Sonderpädagogik (vgl. GIDONI/ LANDI 1989). Der Bereich der Pädagogik und Rehabilitation hatte nun einiges zu tun. Auf geradezu stürmische Weise entwickelte sich in den Nachkriegsjahren bis in die 70er Jahre das "Ziel der Rehabilitation" (ebd.). Für diesen 'Sondermechanismus' mussten die auf einzelne Defekte bei den jeweiligen Fachdisziplinen behandelten und als auffällig etikettierten Kinder häufig "den Preis der Isolation" (ebd.) zahlen. Hatte man zuvor noch erkannt, dass ein Zusammenwirken der Fachbereiche dem Kind zu Gute kommt, erschuf man nun zusammenhanglose und fremdbestimmte Behandlungen, Übungen und Maßnahmen. GIDONI und LANDI fassen diese Entwicklung wie folgt zusammen:
"Die Vervielfältigung spezialisierter Maßnahmen und ihre fachmännische Anwendung auf ein und dasselbe Kind hatte eine Vervielfältigung unterschiedlicher Kompetenzen (und Einrichtungen) zur Folge, d.h. eine maßlose Zersplitterung des Kindes in seine Krankheitsbilder, wodurch die normalen Aktivitäten des Alltags in therapeutische Vorgänge umgewandelt wurden, wie z.B. das Schwimmen in Hydrotherapie, das Reiten in Hippotherapie, das Turnen in Mototherapie, usw." (ebd). Abschließend wenden sich die Autoren an alle am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten und fordern die systemische Sichtweise auf das Kind: ".Es geht mehr um die Behandlung zugunsten der Validität und nicht nur um die Versorgung der Invalidität. Es geht um den Reichtum des Umfeldes im Gegensatz zum Zergliedern des Menschen in Stereotypien in Institutionen" (ebd.).
Diesen "Reichtum des Umfeldes" (ebd.) zu schätzen und eine systemische Arbeitshaltung einzunehmen, stellt auch heute noch vielerorts eine große Herausforderung für Pädagogen wie Therapeuten dar. Die 'professionelle' Distanz erschwert funktionale Kooperation und "auch in der gegenseitigen Wahrnehmung gibt es für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erschwerende Bedingungen. So sehen die Ärzte in der Zusammenarbeit mit den Pädagogen einige Probleme. Beanstandet wird beispielsweise der "Mangel an Forschungsergebnisse im Bereich der Frühförderung, fehlende erprobte Curricula, ungenügende Ausbildung der Heilpädagogen, mangelndes Wissen über die körperliche Entwicklung des Kindes und entsprechende somatopsychische Zusammenhänge" (BEHRINGER/ HÖFER 2005, 58). Von den Pädagogen wird auf ärztlicher (und ebenso medizinisch-therapeutischer) Seite die "Festlegung auf Defizite und unpräzise Auskünfte, das Fehlen konstruktiver Vorschläge für die Förderung [...], mangelndes Wissen über Notwendigkeit und Möglichkeit heilpädagogischer Maßnahmen bemängelt" (ebd.). An dieser Stelle wird deutlich, dass neben der gegenseitigen (Fehl-)Wahrnehmung, die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Kind, Isolationstendenzen und Segregationsprozesse, mögliche Verursacher und Verstärker für existente Spannungen und potentielle Konflikte darstellen. Diesen Vermutungen soll hinsichtlich der Entstehung des Spannungsverhältnisses zwischen Medizin und Pädagogik im folgenden Kapitel vertieft nachgegangen werden.
Verschiedene Autoren beschäftigen sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Therapie und Pädagogik. Es ist die Rede von einem "Beziehungskonflikt" (KOBI 1986), von einer Gefahr verursacht durch Therapie, wenn sie die (Sonder-) Pädagogik zu sehr beeinflusst (vgl. BACH 1983, 28), von den beiden Wörtern "Versuch" und "Annäherung", welche ausdrücken, dass zwischen Therapie und Pädagogik eine große Spanne liegen muss, die es zu überwinden gilt (vgl. KOSKE 1991). Von "Pädagogik statt Therapie" (KRAWITZ 1992) ist bei KRAWITZ die Rede, womit sich der Autor an die Pädagogik wendet, da er der Ansicht ist, dass "innerhalb der praktisch pädagogischen Aufgabenfelder wesentliche Aufgaben bisher nicht angemessen erkannt, aufgenommen und bewältigt wurden" (ebd. 9). Durch unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind wird Zusammenarbeit erschwert, durch gegenseitige Konkurrenz- und Rivalitätsgefühle entstehen Spannungen und Konflikte, Ängste vor dem Verlust der eigenen Berufsidentität unterstützen Engmaschigkeit und Rückzug. All diese Faktoren hemmen Kooperation und behindern interdisziplinäres Handeln.
Was sind die Gründe für diesen vollzogenen Wandel der Zusammenarbeit hin zu einer regelrechten Kluft zwischen Therapie und Pädagogik? Woran liegt es, dass Interdisziplinarität so schwer zu praktizieren ist? In ihren Anfängen stand die Heilpädagogik stark unter dem Einfluss der medizinischen Krankheitslehre. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten sich sozialwissenschaftliche Theorien und Erklärungsmodelle in diesem Arbeitsfeld dominierend durch, so dass sich die Heilpädagogik wissenschaftlich von der Medizin emanzipieren konnte. Dieser Paradigmenwechsel entsprach dem erziehungswissenschaftlichen Grundsatz: "Erziehung ist soziales Handeln, und Heilpädagogik ist Pädagogik und nicht heilende Behandlung" (SPECK 1998 in MAIER-MICHALITSCH, 141). Die klare Abgrenzung führte dann sogar dazu, dass jeglicher Kontakt von der Pädagogik zur Medizin, aber auch zu anderen Fächern nur stark reduziert stattfand. MAIERMICHALITSCH stellt heraus, dass "eine Leiborientierung bzw. die Betonung der Bedeutung des Körperlichen [...] für viele Pädagogen sogar zur Provokation [wurde]" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 141). Wie bereits berichtet, kommt es im Zuge der Segregation und Separierung des medizinisch-pädagogischen Bereichs "in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg [...] zu einer immer deutlicher werdenden Abgrenzung der beiden Berufsgruppen auf weitgehend allen Ebenen" (ebd. 53). "Im Zuge der Emanzipation der Sonderpädagogik und einer damit verbundenen Abgrenzung von der Orthopädie [gehört] die Schul- und Heimleitung [...] von nun an zur Aufgabe des Heil- und Sonderpädagogen. Die Abteilungen der verschiedenen Therapieeinrichtungen werden konstant ausgebaut und räumlich stärker von den Klassenzimmern getrennt. Die Therapie erstarkt als eigenständige Abteilung innerhalb der Schule. Gesonderte Therapieräume für Einzeltherapie werden eingerichtet und entsprechend ausgestattet" (ebd. 53). Hier zeigt sich der Auftakt des gegenwärtig dominierenden additiven Modells. Nicht nur auf räumlicher Ebene werden Mauern gezogenen, auch in den Köpfen findet eine Distanzierung der Pädagogik, bis hin zu einer "fast als Therapiefeindlichkeit wahrnehmbaren Tendenz der Abgrenzung von allen medizinisch-therapeutischen Denkweisen" (ebd. 53) statt. Der Erwerb kognitiver Fähigkeiten, emotionale Befindlichkeiten und das Sozialverhalten des Schülers stehen im unterrichtlichen Alltag dieser Zeit im Vordergrund. Beinahe als historische zu bezeichnende Erkenntnisse, dass erst ein körperliches Wohlfinden und eine schmerzfreie Ausgangslage die Voraussetzung zum Lernen bieten, werden übergangen oder ganz und gar ignoriert. MAIER-MICHALITSCH stellt fest, dass "der Vorwurf einer Defektorientiertheit therapeutischen Handelns [...] bis heute in den Köpfen vieler Pädagogen [anhält] und [...] die Annäherung sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch in der Praxis [erschwert] und [...] zur Distanzierung innerhalb eines gemeinsamen Berufsfeldes [führt]" (ebd. 53). Die Autorin sieht in den unterschiedlichen Sichtweisen und Menschenbildern der beiden Berufsgruppen den Ursprung der Spannungen und Konflikte. MAIER- MICHALITSCH weist darauf hin, dass "wie früher der Arzt, sind heute Therapeuten die "Wanderer zwischen beiden Welten" (MEINHARDT 1987,7). Wanderer zwischen der Welt der Medizin und der Pädagogik. Hinter dem Ausdruck "zwei Welten" verbergen sich unterschiedliche Menschenbilder bzw. zumindest unterschiedliche Sichtweisen von Therapeuten und Pädagogen, die in einem gemeinsamen Arbeitsfeld aufeinander treffen" (ebd. 143). Entsprechend ihrer engen Bindung an die analytisch- naturwissenschaftlich orientierte Schulmedizin ist im Besonderen die Physiotherapie seit über 100 Jahren geprägt vom Paradigma des Leib- See- Dualismus. Nur langsam wenden sich die therapeutischen Berufe zunehmend mehr dem bio-psycho-sozialen Modell des Menschen zu (vgl. ebd. 145). Das Klassifikationssystem ICF der WHO unterstützt diese Entwicklung positiv (dazu Näheres in Kap.5, 5.5).
Einen Blick in die Geschichte wagt auch KOBI. Der Heilpädagoge stellt dar, dass Konflikte zwischen Erziehung und Therapie bis in zeitlich nicht mehr genau fixierbare Epochen zurückreichen und seine Darlegungen zum Spannungsverhältnis zwischen Therapie und Pädagogik überschreibt er eindrücklich mit "Therapie und Erziehung. Ein chronischer Beziehungskonflikt?" (KOBI 1986). Was aus pädagogischer Sicht den Grundkonflikt zwischen Erziehung und Therapie erzeugt und unterhält, fasst der Heilpädagoge unter folgenden Stichpunkten zusammen (KOBI 1986, 83f.):
-
Pragmatismus: hier werde der Mensch wird durch den Mediziner vom Gang der Natur und seiner eigenen Natur entfremdet.
-
Omnipotenz: drückt die Gewaltausübung in Form von einer Zusprechung von Krankheiten und Gesundheiten, zeitlich und örtlich limitierten Zurechnungsfähigkeiten, Tauglich- und Untauglichkeiten, von Seiten der Mediziner aus.
-
Totalitarismus: beschreibt die Tendenz der Medizin, sämtliche Daseinsbereiche zu durchdringen, als heilungsbedürftig zu erklären und sie vom Heil der Heilkunst abhängig zu machen.
-
Illusionismus: verdeutlicht die vorhandenen Widersprüche zwischen exzellenten Heilungen und der Realität umfänglichen Versagens, die gelegentlich sogar zu zusätzlichen Schädigungen und Be- Leidigungen führen.
Die Haltung der Gesellschaft und so auch der Pädagogik und deren Vertretern gegenüber dem System der Medizin ist nach Auffassung KOBIs, ambivalent und stellt zusammenfassend fest, dass die paradoxen Wünsche von Seiten der Pädagogen in folgendem Zitat zum Ausdruck kommen:
"Ich, Pädagoge, dulde gegenüber meiner Person und weniger noch in Bezug auf meinen Zögling keinen Eingriff in die 'Natur' und 'Natürlichkeit' des Soseins- verlange aber zugleich für den einzelnen Notfall (den ich als solchen definieren will) jederzeit, jedenorts die totale, rasche und überdies kostengünstige Wiederherstellung des natürlichen Zustands meines Zöglings und meiner Person" (ebd. 84).
Nach Ansicht des Autors beziehen sich Therapie und Erziehung auf zwei unterschiedliche Menschenbilder, die sich mit den Verben 'behandeln' und 'belehren' etikettieren lassen. Zum Wesen jeder Behandlung gehöre, dass sie aus einem Subjekt-Objekt-Verhältnis heraus erfolgt und dass dadurch einem materiellen Substrat eine ideelle Gestalt verliehen werden solle. Folgendes Beispiel hat zum Ziel, diese unterschiedlichen Ziele pädagogischen und therapeutischen Handelns zu veranschaulichen:
"Ein Klumpen Ton wird so behandelt (geformt, geknetet, geglättet, gefärbt, gebrannt), dass sich in ihm die Idee eines Kruges, der seinen Zweck als Wasserbehälter erfüllen soll, realisiert. Behandlung hat im weitesten Sinne stets mit Formung, Umformung zu tun, ist Formation". Andererseits gehört es zum Wesen jeder Belehrung, dass sie aus einem Subjekt- Subjekt-Verhältnis heraus erfolgt und dass dadurch einem personalen Subjekt ein Handlungsmuster vermittelt werden soll. Belehrung hat stets mit Mitteilung Erfahrungsvermittlung, zu tun und ist Information" (ebd. 84f.).
KOBI veranschaulicht mit diesem Beispiel Entstehung und Ursache der gegenseitigen Abgrenzung in Form "uneinheitlicher Professionalisierungswege" (ebd. 85). Das "behandlungsorientierte Medizinalsystem und das belehrungsorientierte Bildungssystem" (ebd.) seien je andere Professionalisierungswege gegangen. Dies wäre ein Grund dafür, dass Vertreter medizinaler Professionen und solche pädagogischer Berufe sich zwar je als Existenzsicherer und Daseinsgestalter im Dienste der Humanitas verstehen, dass dieses scheinbar identische Selbstverhältnis jedoch anderen Motiven entspringt und über andere Wege erfahren wird, so dass es keine zureichende Basis bildet für ein gegenseitiges, um die partnerschaftlichen Anliegen erweitertes Verständnis und Verstehen (vgl. ebd. 85). Aus Sicht des Autors werde spätestens in der Praxis die Inkongruenz therapeutischer und unterrichtlicher Ansprüche, Zielsetzungen und Maßnahmen sichtbar und oft genug zum spannungsgeladenen Störfaktor. Die vielbeschworene Teamarbeit gerate aus dem Tritt: Man komme einander ins Gehege, gerate einander in die Haare, trete einander auf die Füße, und wie sonst die metaphorischen Umschreibungen derartige Bewegungskonflikte ins Bild setzen (vgl. ebd. 86). KOBI macht auf die Bedeutsamkeit einer gemeinsamen Diagnostik aufmerksam, um sogenannte "Stempel-Effekte" (ebd.) zu vermeiden und das Kind optimal zu unterstützen.
"Therapie- bzw. unterrichtsorientierte Voraus- Definitionen (spielen) eine entscheidende Rolle: Je nachdem, ob aus einem Kind, das viele Rechtschreibfehler macht, per Definition ein 'schlechter Rechtschreiber' oder ein 'gestörter Orthografiker' (Dysorthographiker) gemacht wird, ergeben sich andere Konsequenzen: Nach dem badness- Prinzip ('schlechter Schüler') wird auf vermehrten, qualifizierten Rechtschreibunterricht gesetzt. Dies mit dem Ziel, dem Kind etwas Fehlendes (die Rechtschreibung) beizubringen, es zu belehren. Nach dem madness- Prinzip ('Gestörtes krankes Kind' = Patient) erscheint eine Dysorthografie- Therapie indiziert mit dem Ziel, das Kind von einem Fehler zu befreien, es zu heilen" (ebd. 88).
Wenn Pädagogen genauer hinsehen würden, was in Therapien tatsächlich gemacht wird, so würde er sich "in vertrauten Gefilden wieder finden: Es wird gelehrt und gelernt" (ebd.). Mit einer provokanten Aussage stellt KOBI die Daseinsberechtigung spezifischer Dienstleistungen dar:
"Die Patientenrolle ist in unserer leistungsorientierten Gesellschaft praktisch als einzige übriggeblieben [...], um gelegentlich auch - legitim, bezahlt und anerkannt - auszuspannen, spezielle Aufmerksamkeit zu gewinnen, beachtet, umsorgt, 'fokussiert' zu werden" (ebd. 89).
An dieser Stelle wird deutlich, welche Funktion die Gesellschaft der Therapie auferlegt hat. Die Inanspruchnahme therapeutischer Unterstützung hat in unserer Gesellschaft immer einen 'fahlen Beigeschmack'. Hilflosigkeit und Scham macht sich breit, muss man 'gestehen', sich therapeutische Hilfe zu holen. Der Gang zu einem Therapeuten wird in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist immer noch gleichgesetzt mit Schwäche und Unfähigkeit. Liegen in dieser Tatsache möglicherweise die Tendenzen der Abwehr und des Ausschluss therapeutischer Professionen aus allgemeinbildenden Schulen begründet?
Im Rahmen eines Modellversuchs untersuchten WOCKEN, ANTOR und HINZ (1988) die Kooperation von Pädagogen in Integrationsklassen von Hamburger Grundschulen. In der Begleitung des pädagogischen Personals eröffneten sich den Autoren zahlreiche Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen die beschäftigten Pädagogen im Zuge der 'Zwang-Kooperation' zu kämpfen hatten. Rückblickend auf den Modellversuch stellt WOCKEN (1988) fest, dass für den deutschen Lehrer Formen der Kooperation in einem gemeinsam durchgeführten Unterricht etwas Außergewöhnliches sind, weil er von Beginn seines Berufslebens an auf sich selbst gestellt ist und nur in besonderen Ausnahmesituationen einen anderen Erwachsenen - mehr als Gast oder als Aufsichtsperson denn als Mitarbeiter- in seinem Unterricht erlebt. Aufgrund dessen könne er über Jahrzehnte weder Kritik noch Verstärkung seines Tuns erfahren. Das führe letztendlich dazu, "dass sich in ihm ein beruflicher Solipsismus habitualisiert, der sich gegen Formen der Kooperation im Unterricht sperrt" (MUTH/ TOPSCH 1972 in WOCKEN 1988). FEUSER postuliert, dass "Lehrer [...] von Anfang an darauf orientiert und spezialisiert [sind], nicht zu kooperieren" (FEUSER 1987 in WOCKEN 1988).
Was der Lehrer in seinem Klassenzimmer mache, dass sei allein seine Sache. Die vier Wände des Klassenraumes umgrenzen den Hoheitsbereich des einzelnen Lehrers; hier sei er sein eigener Chef. Diese territoriale Isolation des Lehrers habe allerdings verheerende Folgen für seine Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Kollegen Der Preis für die Isolation des Lehrers in seinem Klassenzimmer sei "die Beziehungslosigkeit" (WOCKEN 1988). Neben der erforderlichen engen und ehrlichen Zusammenarbeit müsse den 'Experten' bewusst werden, dass in der gemeinsamen Arbeit für das Kind nicht das 'Spezialwissen' im Vordergrund stehen darf, sondern die aktuell bedeutsame Unterstützung für das konkrete Kind. Dies werde allerdings zunächst oft jahrelang geübte Berufspraktiken erschüttern und mobilisiere die Angst, kontrolliert zu werden (vgl. ebd.). Das gilt für Pädagogen und ebenso für Therapeuten. Beide Berufsgruppen sind gewöhnt, in 'ihrem' Raum zu fördern und zu therapieren, 'geschützt' vor kritischen Blicken der Kollegen und Eltern. Therapie und Pädagogik haben zum Ziel, Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Das Kind braucht weniger eine 'Entwicklungshilfe', als einen seinem Entwicklungsstand angemessenen Rahmen, in dem es selbstständig seine Bewegungen ausprobieren und Erfahrungen sammeln kann. Die Ausgangsfrage wäre dann beispielsweise nicht mehr: "Wie kann ich das Kind aus seinem spastischen Muster 'herausbringen'?", sondern: "Wie kann das Kind mit seinen Bewegungsbesonderheiten lernen, welche Positionen sind dabei am günstigsten, welches wäre die beste Fortbewegungsart, welche Hilfsmittel sind dazu nötig, welche Form (indirekter) Unterstützung benötigt das Kind?" (ALY/ALY 1987). Häufig war in diesem Kapitel die Rede von unterschiedlichen Menschenbildern und Sichtweisen. ALY und ALY stellen das entscheidende Moment heraus, indem sie fordern, das Kind immer innerhalb seines individuellen Systems zu betrachten, da"nicht abstrakte Ideen und Techniken, die festlegen, was für das Kind gut sei, Maßstab für die Art der therapeutischen Hilfe sei, sondern das einzelne Kind als Persönlichkeit und Teil seiner Gruppe. Ziel der therapeutischen und ebenpädagogischen Arbeit sei es, für einen Rahmen zu sorgen, in dem dieses Kind seine Möglichkeiten selbstständig erproben kann (vgl. ebd.).
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel sollen Erfahrungen aus der Praxis dargestellt werden. Der Fokus der Betrachtung und Beobachtung liegt dabei auf der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen und deren interdisziplinären Handeln.
LBZ - Landesbildungszentrum für Körperbehinderte in Halle (Saale) Der Leistungskatalog der Einrichtung stellt sich wie folgt dar: "Umfassende medizinische Betreuung und Versorgung der Kinder rund um die Uhr [...] durch den Einsatz von Krankenschwestern und -pfleger; zahnärztliche Betreuung einmal im Jahr; psychologische Betreuung auf Anfrage; logopädische Betreuung durch externe Kollegen; physiotherapeutische Betreuung" (HOMEPAGE LBZ).
In der Abteilung Therapie seine derzeit vier Physiotherapeuten und eine Ergotherapeutin beschäftigt. Pädagogen und Therapeuten übernehmen gemeinsam die therapeutische Betreuung und Förderung der Schüler und die Einrichtung werde von externen Kollegen (externen Praxen) unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit lege das LBZ auf "unterrichtsimmanente Therapie, weil so die Übertragung der Ziele und Ergebnisse der Arbeit mit den Kindern optimal in den Schulalltag gewährleistet" (ebd.) werden könne. Die Betreuung der Schüler könne nach individueller Absprache und entsprechender Befundung auch außerhalb des Klassenverbandes gewährleistet werden. Die therapeutische Arbeit finde in Kleingruppen und in Gruppentherapie statt (vgl. ebd.).
Als Vorbereitung auf diese Arbeit hospitierte ich über einen Zeitraum von sechs Wochen im Landesbildungszentrum für Körperbehinderte in Halle (Saale). Die Besuche rückten den Fokus der Beobachtung auf den (im Rahmen der Homepage geworbenen) therapieimmanenten Unterricht. Nachdem der Portiers mir den Weg wies, fand ich die Therapie im Untergeschoss der Schule. Neongrelles Licht und lange Flure empfangen mich, bevor meine Ansprechpartnerin, die angestellte Physiotherapeutin des LBZ, dies freundlich tut. Ich erlebte Einzeltherapien, bei denen das Kind aus der Klasse herausgeholt wurde, in den Therapieräumen Förderung erfuhr, um danach in seine Klasse zurückzukehren. Zwischen Lehrerin und Therapeutin sind Formen des Austauschs rar. Lediglich der Verweis auf ein weiteres "auffälliges Kind" und der damit verbundene Diagnostik-Auftrag an die Therapeuten, wird bei 'Übergabe' des Schülers von der Klassenlehrerin geäußert. Im Rahmen des regulären Klassenunterrichts findet einmal am Tag im Gruppenraum der Physiotherapie ein Angebot für eine gesamte Lerngruppe statt. In Absprache über individuelle Lernstände und aktuelle Unterrichtsinhalte mit der Klassenlehrerin planen die Therapeuten themenbezogene Gruppenangebote, zu deren aktiver Teilnahme zumindest ein kleiner Teil der Lehrer auch bereit ist. Aus den Gesprächen mit den Therapeuten wird deutlich, dass Kooperation nicht mit allen Mitarbeitern der Schule möglich sei, da "stimme die Chemie dann einfach nicht". Die Initiative für spezielle Angebote, wie dem "Frühsport" zur Konzentrationssteigerung vor Unterrichtsbeginn, werde von den Therapeuten initiiert und vereinzelte Lehrer würden diese Angebote annehmen. Laut Aussage der Physiotherapeuten stelle der therapieimmanente Unterricht am LBZ ein "Auslaufmodell" dar. In den 90er Jahren seien noch zwölf Therapeuten verschiedener Fachbereiche an der Schule angestellt gewesen, heute sind es lediglich drei Physiotherapeuten. Eine ortsansässige Logopädische Praxis biete bei Bedarf ambulante Therapien in den Räumlichkeiten der Schule an. Die Ergotherapeutin sei erkrankt, eine Vertretung oder Ersatz sei nicht vorgesehen. Ich erfahre im Gespräch außerdem, dass in den 90er Jahren fachübergreifende Fortbildungen sowie interdisziplinäre und länderübergreifende Teamtreffen noch vom Kultusministerium organisiert wurden. Zu Zeiten der ehemaligen DDR sei Interdisziplinarität "fast schon Zwang beziehungsweise eigentlich institutionalisiert" gewesen. Im LBZ besitzen Therapeuten und Pädagogen einen separaten Teamraum im Untergeschoss, beide Berufsgruppen treffen offiziell lediglich zur großen Schulkonferenz aufeinander. Weiter erfahre ich, dass heute eine einzige Physiotherapeutin 13 Klassen betreut. Gegenwärtig sei interdisziplinäre Zusammenarbeit "sympathieabhängig" und "viele Lehrer wollen Kooperation einfach nicht". Interessanterweise begegneten mir in der Besucherrolle als Ergotherapeutin die beschäftigten Pädagogen mit spürbarer Distanz. Erwähnte ich, dass der Grund meiner Hospitation die Vorbereitung meiner Abschlussarbeit des Pädagogik-Studiums sei, nahm ich eine veränderte Wahrnehmung meiner Person und eine Annäherung in Form gesteigerten Interesses wahr.
Berg Fidel - Inklusive Gemeinschaftsgrundschule in Münster
Laut Schulprogramm gehen Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit den anderen Kindern zusammen in eine Klasse. Dort lernen und leben sie gemeinsam. Sie erhalten zeitlich begrenzte individuelle Unterstützung. Wenn es erforderlich ist, werden die Kinder in Kleingruppen unterrichtet und/ oder erhalten zusätzliche spezielle Angebote, z.B. Psychomotorik, Verhaltenstraining usw. Alle Angebote werden in einem Fachteam (Grund und Sonderschullehrer, Heil und Sozialpädagogin) gemeinsam erarbeitet und nach Absprache untereinander durchgeführt. Voraussetzung sei die über viele Jahre eingespielte Teamarbeit zwischen allen Berufsgruppen (vgl. SCHULPROGRAMM GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE BERG FIDEL). In meiner fünfwöchigen Zusammenarbeit mit der inklusiven Ganztagsschule, erlebe ich ein sehr heterogenes Team, bestehend aus Erziehern, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen, Grundschulpädagogen, Heilerziehungspflegern, Praktikanten, Integrationshelfer und Studenten. Therapeuten sind nicht integraler Bestandteil des Teams. In den jahrgangsübergreifenden Lerngruppen beobachtete ich bei einigen Kindern besondere Unterstützungsbedürfnisse, die medizinisch- therapeutische Fachkenntnisse erforderten. Das Beispiel eines Jungen mit Down-Syndrom, dessen Artikulation von seiner Lerngruppe schwer zu verstehen ist, soll verdeutlichen, dass indirekte Unterstützung in Form therapieimmanenter Elemente, zur Teilhabe führen kann. Die Situation des Jungen bedarf einer Unterstützten Kommunikation, damit er verstanden wird, sich ausdrücken und teilnehmen kann. Die Schule stellte den Antrag auf Einstellung eines Logopäden, der mit dem Jungen innerhalb seines direkten schulischen Umfeldes den adäquaten Umgang mit Kommunikationsmitteln üben sollte. Nach Aussage der Klassenlehrerin wurde der Antrag von der Krankenkasse abgelehnt. Der Junge musste weiterhin nach der Schule in die die logopädische Praxis, um dort Sprachförderung und unterstützte Kommunikation zu erfahren. Im Unterricht nutzt der Junge seinen 'Talker' gar nicht, denn ihm selbst und seinen Mitschülern sei es meist "zu mühselig, da fragen sie lieber noch dreimal nach". Diese Situation ist beispielhaft für viele weitere verschenkte Potentiale. Zwei mal wöchentlich nehmen fünf bis sechs Kinder, finanziert durch die Stadt Münster, am therapeutischen Reiten teil. Die Fortschritte und positiven Entwicklungen der Kinder, besonders im Bereich der Motorik, Koordination und Sozialkompetenz, sprechen für das Konzept, für eine Erweiterung der Teilnehmerzahl und Häufigkeit der Durchführung. Insgesamt erscheint mir die Schule sehr offen für die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Berufsgruppen. Therapeuten, Psychologen und Ärzte sind aber dennoch lediglich Besucher zu Zwecken der jährlichen Untersuchungen und nicht integraler Bestandteil des heterogenen Teams.
Astrid-Lindgren-Schule - Schule für Geistigbehinderte in Halle (Saale)
Das Team der Astrid-Lindgren-Schule besteht aus Pädagogen, pädagogischen Mitarbeiterinnen, medizinischem Betreuungspersonal (Krankenschwestern), zwei Ergotherapeutinnen und einem Physiotherapeuten. Seit September 2000 wird die Schule von einer Beratungslehrerin aus dem Landesbildungszentrum für Blinde und Sehgeschädigte begleitet, die spezielle Angebote für schwer sehgeschädigte und blinde Schüler macht (vgl. HOMEPAGE ASTRID-LINDGREN-SCHULE). In einer zweiwöchigen Zusammenarbeit mit der Schule erlebte ich das klassische additive Modell (vgl. Kap.4, 4.2.2). Vertreter der Kunsttherapie, der Logopädie, der Ergotherapie und der Physiotherapie sind Angestellte der Schule, Teil des Kollegiums und besitzen ihre eigenen Räumlichkeiten, in denen die Schüler zu Unterrichtszeiten, vorwiegend in Einzeltherapie, Förderung erfahren.
Kardinal-von-Galen-Haus - Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung mit angeschlossenem Internat in Dinklage
Die Homepage der Einrichtung informiert über die enge Verzahnung und gegenseitige Ergänzung von Unterricht und therapeutischer Förderung im Schulalltag. Die Schüler erhalten Einzel- oder Gruppentherapie und Therapeuten begleiten die Fächer Sport, Schwimmen, Reiten und Psychomotorik durch ihr Fachwissen. Aufgrund des umfangreichen Therapiebedarfs der Schüler werde das Therapieangebot fest angestellter Mitarbeiter durch die Einbindung therapeutischer Mitarbeiter aus ortsansässigen Praxen ergänzt. Auch diese Therapeuten arbeiten in der Regel in den Räumen der Schule und im Rahmen des pädagogischen Konzepts. Die Therapien finden während der Unterrichtszeit statt. Ein Orthopäde, ein Neurologe sowie mehrere Orthopädiemechanikerfirmen kommen regelmäßig in die Einrichtung. Dieses Zusammenwirken gewährleiste eine individuelle und ganzheitliche Förderung der Schüler. Speziell die Ergotherapie unterstütze und begleite Schüler, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Ziel sei es, ihnen selbstständiges Handeln bei den Aktivitäten des täglichen Lebens und in ihrer Freizeitgestaltung zu vermitteln. Durch gezielte Behandlungsmethoden und eine sehr umfassende Hilfsmittelberatung, werde die ganzheitliche Förderung jedes Schülers erreicht. Handlungskompetenzen im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung der Lebensqualität seien vorrangige Ziele.
In enger Zusammenarbeit mit den Eltern, den Lehrern, den pädagogischen Mitarbeitern und gegebenenfalls dem Internat erhalte jeder Schüler die bestmögliche individuelle Förderung. Die ergotherapeutische Behandlung erfolge auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung. Aufgrund der Diagnose des Arztes werden die ergotherapeutischen Maßnahmen, der Umfang und die Frequenz der Behandlung festgelegt. Außerdem bietet die Schule Therapeutisches Reiten/ Voltigieren, einen Psychologischen Dienst und Mobile Dienste an. Es wird angegeben, dass eine qualifizierte Zusammenarbeit verschiedener Fachkompetenzen unabdingbar sei, um der heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden (vgl. HOMEPAGE KARDINAL-VON-GALEN-HAUS).
Aus meinen Erfahrungen an dieser Schule kann ich berichten, dass bei außerordentlich großzügiger personeller, räumlicher und materieller Ausstattung, vorwiegend nach dem additiven Modell (siehe dazu Kap.4, 4.2.2) gearbeitet und gehandelt wird. Die Therapeuten holen die Kinder zu bestimmten Unterrichtszeiten aus ihrer Klasse ab, in separaten Therapieräumen findet dann die einzel- oder gruppentherapeutische Förderung statt. Zu Themen, wie der gemeinsamen Förderplanung oder interdisziplinären Fallreflexionen, können keine konkreten Angaben gemacht werden, da Praktikanten die Teilnahme an internen Fortbildungen, Fallgesprächen, Teamsitzungen und Schulkonferenzen verwehrt wurde.
Sophie-Scholl-Schule - Inklusive Gesamtschule in Gießen
"Multiprofessionelle Klassenteams", bestehend aus Lehrkräften, Erziehern, Sozialpädagogen, Heilerziehungspflegern, Zivis und BSJs, Schulhelfern/ "Integrationshelfern", Unterrichtassistenzen und Fachkräften, wie Schreiner, Biologe, Ökotrophologe, begleiten die heterogenen Lerngruppe dieser Schule. Gearbeitet werde nach ganzheitlichen Konzepten, wie dem "Bewegten Lernen, Lernen in gesunder Rhythmisierung, Wechsel von Anspannung und Entspannung". Im Schulkonzept wird eindrücklich betont und gefordert: "Therapie in den Unterricht einbeziehen!". Erklärt wird, dass diese Forderung mittels einer Kooperation mit benachbarten therapeutischen Praxen (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie) im Schulalltag, Kooperation mit Lerntherapeuten und Kooperation mit Frühförderung" umgesetzt werde (vgl. HOMEPAGE SOPHIESCHOLL- SCHULE).
Wie aus den Informationen des Internetauftritts der Schule ersichtlich wird, sind viele verschiedene Fachbereiche Teil des "Multiprofessionellen Klassenteams". Allerdings gelten nicht als integraler Bestandteil eines "multiprofessionellen Teams". Therapeuten kommen bei Bedarf zu Besuch oder werden nach der Schule von den 'unterstützungsbedürftigen' Kindern besucht.
Freie Schule Leipzig (FSL)
Der Internetauftritt der Schule gewährt einen Einblick in das Schulkonzept, in dem das Team für wichtig erklärt, "interdisziplinär Erkenntnisse [zu] gewinnen und [zu] handeln". Das Team der FSL ist genauso heterogen wie ihre Schülerschaft. Die Kinder und Jugendlichen werden von ausgebildeten Erziehern, Sozialpädagogen, Pädagogen verschiedener Schulformen, Fachkräften unterschiedlicher Bereiche, engagierten Eltern, sowie von Praktikanten und Honorarkräften begleitet. An der Schule arbeitet kein Therapeut.
Aus der vierwöchigen Praxis an dieser Schule kann berichtet werden, dass der Unterstützungsbedarf besonders nach psychologisch-therapeutisch ausgebildetem Personal für besondere Schüler ebenso wie für die Lernbegleiter hoch einzuschätzen ist. Nach Aussage einer Mitarbeiterin, wolle die Schule sich keine Psychologen "in die Schule holen". Bei Bedarf nach medizinisch- therapeutischer Unterstützung leite das Kollegium die jeweiligen Eltern mit ihrem Kind an ortsansässige ambulante Beratungsstellen weiter. Um der heterogenen Schülerschaft und deren individuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können, besucht das Team aus Lernbegleitern im vierteljährigen Rhythmus eine Supervision, geleitet von einer Psychologin der Kinder- und Jugendmedizin, in der aktuelle herausfordernde Situationen , besondere Kinder und der adäquate Umgang besprochen werden. Trotz dieser externen Unterstützung führten stark herausfordernde Situationen eines Schülers und die Überforderungstendenzen von Seiten des Teams aus Erwachsenen schlussendlich zu einem Ausschluss des besonderen Kindes.
In den allgemeinbildenden und alternativen Schulformen ließ sich beobachten, dass vorzugsweise unqualifiziertes Personal, wie Integrationshelfer, Zivildienstleistende, Praktikanten, usw. für die fachspezifische Unterstützung eingesetzt wird. Andreas HINZ äußert sich zu dieser "aus finanziellen Aspekten gespeiste Problem einer Tendenz zur Dequalifizierung des Personals" (HINZ 2007, 27f.) im Kontext der Integration Schwermehrfachbehinderter.
"Mittlerweile werden eher Integrationshelfer - in vielen Fällen Zivildienstleistende - statt pädagogischer Fachkräfte zur Unterstützung von Kindern mit Mehrfachbehinderung eingestellt. Die bestehenden Barrieren in den Köpfen wie in finanziellen Töpfen für eine uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen sind nach wie vor erheblich" (ebd.).
Scheinbar halten besonders Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation, geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung, die Integration therapeutischer Elemente in den Unterrichtsalltag für bedeutsam und bemühen sich um ein pädagogisch- therapeutisches Zusammenwirken zum Wohle der ganzheitlichen Begleitung des Kindes. Fraglich bleibt, ob die allgemeinbildenden Schulen das Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik, mit dem Ziel, die Voraussetzungen zum Lernen für alle Kinder zu schaffen und damit Partizipation zu ermöglichen, für überflüssig halten oder ob es sich eher um ein 'nostalgisches' Kooperationsproblem zwischen Therapie und Pädagogik handelt. Der Befund meiner persönlichen Erfahrungen bestätigt zunächst die Ausgangsfragestellung der Arbeit und soll nun im Folgenden kritisch hinterfragt werden. Ausgangspunkt der Betrachtung stellt die immer heterogener werdende Schülerschaft dar, für die es gilt, alle zur Verfügung stehenden Ressourcen zu mobilisieren, um Teilhabe zu ermöglichen.
Für die Kooperation von Therapie und Pädagogik existieren bisher kaum Konzepte oder Modelle der Zusammenarbeit. In der schulischen Praxis gibt es allerdings verschiedene Arbeitsweisen, in denen der medizinisch- therapeutische auf den pädagogischen Fachbereich trifft. Die Anstellungsbedingungen von Therapeuten und auch die Intensität interdisziplinären Handelns unterscheiden sich dabei erheblich voneinander. Dieser Teil der Arbeit widmet sich der Darstellung ausgewählter Konzepte interprofessioneller Zusammenarbeit. Da die einzelnen Konzepte teilweise sehr komplex sind, können sie in dem vorgegeben Rahmen lediglich verkürzt dargestellt werden.
Ausgangspunkt dieses "Organisationsmodells für die Umsetzung gemeinsamen Unterrichts von schwerstmehrfachbehinderten (SMB) und anderen Schülerinnen und Schülern [stellt] die Vielfalt der individuellen Ausprägungen von sozialen und emotionalen, kognitiven und motorischen Entwicklungsbesonderheiten der Schüler [dar]" (REISINGER-HAUBER 1996, 169). Von den Entwicklern und Teilnehmern wird "das hierarchische Prinzip der homogenen Lerngruppierungen [...] in der konkreten Praxis [...] schon seit längerem als unpraktikabel erlebt. Individualisierung, Kleingruppenbildung und flexible Unterrichtsorganisation sind daher schon lange die Antwort der Schulen auf eine nicht mehr passende äußere Struktur" (ebd. 169). REISINGER-HAUBER erklärt 1996, dass dieser beschriebene Umstand "vor 10 Jahren an [...] [der] Schule zu einer konzeptionellen Initiative, an der damals etwa 25 Lehrkräfte aller in der Schule vertretenden Lehrergruppen beteiligt waren (SonderschullehrerInnen, Grund- und HauptschullehrerInnen, FachlehrerInnen für Geistigbehinderten- Schulen, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten) [führte]" (ebd. 170). In zahlreichen und intensiven Sitzungen nach Unterrichtsschluss, konzipierte das Team der Schule eine neue innere Struktur die im Folgenden als 'Blockteamkonzept' (BTK) bezeichnet wird (vgl. ebd. 170). Das Hauptanliegen kann wie folgt beschrieben werden: Die SMB Schüler sollten nicht mehr in eigenständigen Klassen unterrichtet werden, sondern eingegliedert in eine Gemeinschaft mit den anderen Kindern ihrer Altersstufe. Das Mitarbeiterteam trage die Verantwortung dafür, dass die Lernanliegen aller Kinder berücksichtigt und eingelöst werden. Der Grundsatz hierbei laute: "Soviel Gemeinsamkeit wie möglich und soviel Für-sich-sein wie nötig" (ebd. 172). Die innere Organisation des pädagogischen Feldes sei Aufgabe des verantwortlichen Teams gewesen, das sich freiwillig zusammengesetzt und gemeinsam eine Förderkonzeption für alle Kinder erstellt habe (vgl. ebd. 172). Jedes Blockteam besteht aus Lehrkräften, Therapeuten und Betreuern, die sich unter dem Primat der Freiwilligkeit zusammenfinden, um den Sympathiefaktor als Motor für gelingende Teamarbeit und Motivation zu nutzen. Die Organisation und Durchführung von Elternabenden findet jeweils gemeinsam statt und jedes Team entscheidet und plant verantwortlich, welcher Unterricht bzw. welche Fördermaßnahme in welcher Organisationsform stattfindet. Unterricht kann dabei im gesamten Blockteam, Klassenunterricht, Gruppenunterricht, Kleingruppenunterricht oder in Einzelförderung organisiert werden. Wie viele Kleingruppen- oder Einzelförderungen Schüler des Blockteams benötigen, ergibt sich aus ihrer individuellen Lernausgangslage (vgl. ebd. 173) denn "Grundlage eines jeden Blockteamplanes [...] ist eine intensive und ausführliche Diskussion und Erörterung der Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse jedes einzelnen Schülers. Dies geschieht in einer oder mehreren, unmittelbar am Schuljahresbeginn stattfindenden Blockteamsitzungen, an denen alle [...] teilnehmen" (ebd. 174). Rückblickend auf die Realisierung des Konzepts stellen alle Beteiligten fest, dass "die Erfahrungen mit dem BTK [...] die organisatorische Grundstruktur des 'Blockteams', das aus zwei Klassen besteht, bestätigt [haben]" (ebd. 176). Außerdem habe sich herausgestellt, dass das räumliche Benachbartsein der Klassen- und Gruppenräume eine unverzichtbare Voraussetzung für die Arbeit eines Blockteams ist. Alleine dadurch würden zahlreiche gemeinschaftsfördernde Begegnungen entstehen, "die das gegenseitige Miteinanderumgehen und Kennenlernen möglich machen" (ebd. 176). Der ursprünglich eigens für die Kinder mit Schwermehrfachbehinderungen eingerichtete Raum biete auch für andere Kinder, die Ruhe suchen, "eine willkommene Gelegenheit, sich aus überfordernden, hektischen Situationen herauszunehmen" (ebd. 176). Primär stehen immer die Bedürfnisse der Schüler den Bezugspunkt für Entscheidungen dar. Die Durchführung des BTK habe allen Beteiligten verdeutlicht, dass "ein gut funktionierendes BT [...] ein hohes Maß an Planungsaktivität am Schuljahresanfang [erfordert]. Die Mitarbeiter müssen in dieser Zeit überdurchschnittlich viel Zeit in Teamsitzungen investieren. Grundsätzlich erforderlich ist eine qualitativ gut durchdachte äußere und innere Differenzierung" (ebd. 179). Und doch lohnt sich dieses Engagement, denn "das Bedürfnis vieler SMB-SchülerInnen nach dem Erleben von Lebendigkeit, das Sich- wohlfühlen unter aktiven Kindern [und] viele fundamentale Förderbedürfnisse lassen sich im Rahmen eines gemeinsamen Unterrichts einlösen" (ebd. 179). Die Teilnehmer des Blockteams empfehlen, dass "vor allem ein am Projektunterricht orientiertes Unterrichtskonzept [...] das Anliegen eines gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen [...] realisieren [kann]" (ebd. 181). Daneben seien Phantasie, Offenheit und Humor unverzichtbare Voraussetzungen zum Gelingen dieser Unterrichtsansatz zum Wohle der Schüler (vgl. ebd. 181). Akzeptanz, Respekt und Anerkennung anderer Berufsgruppen seien gewachsen. Viele, die vorher mit der Schülergruppe der SMB nie in engere Berührung kamen, mussten innerhalb ihres Blockteams auf freiwilliger Basis eine Schwelle überschreiten, unter Umständen sogar innere Widerstände abbauen, hatten aber gleichzeitig die Chance, ganz neue, positive Erfahrungen in diesem Feld zu sammeln. Die psychisch wie physisch schwierige Arbeit mit den Schülern werde durch das BK auf deutlich mehr Schultern verteilt. Die gemeinsame Verantwortlichkeit schweiße ein Team zusammen, in dem jeder auf den anderen angewiesen ist. "Für Einzelkämpfer in Einzeldisziplinen [sei dort] kein Platz" (ebd. 181).
Wie aus den persönlichen Praxiserfahrungen hervorgeht, kann diese Form der Zusammenarbeit von Pädagogik und Therapie als vorherrschendes Arbeitsmodell an (Förder-)Schulen angesehen werden. Die Berufsgruppen "arbeiten in aufeinander abgestimmten, aber in getrennten Raum-Zeit-Kontinuen nebeneinander her und verfügen nur über ein stark begrenztes Wissen voneinander" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 169). Der Austausch findet vorwiegend 'zwischen Tür und Angel' statt, die Grenzen der einzelnen Fachkompetenz werden dabei möglichst nicht durchbrochen und auch das Verlangen danach besteht selten. Die Redewendung "Jeder kocht sein eigenes Süppchen" wird als passend angenommen, wobei die Zutat das Kind darstellt. Um diesen Vergleich weiterzuführen, kommt dem Klassenlehrer, in der Rolle des Chefkochs, eine zentrale Aufgabe zu. Er teilt die Zutaten in die unterschiedlichen Töpfe auf und überwacht den Kochprozess. Für das Kind bedeutet diese Vorgehensweise, Erfahrungen zusammenhangloser Einzelaktivitäten. Das größte Problem des additiven Modells stellt die Intransparenz der künstlich geschaffenen Maßnahmen und die damit verbundenen Übertragungsschwierigkeiten für das Kind in seinen Alltag dar. "Durch eine fehlende gemeinsame Handlung kann es langfristig zu Konflikten zwischen den Mitarbeitern, Therapiemüdigkeit bei den Schülern und allgemeiner Frustration bei allen Beteiligten kommen" (ebd. 170). Auch KOBI widmet sich dem additiven Konzept und erachtet es als Arbeitsweise, in der, "erzieherisch-unterrichtliche und therapeutisch-funktionelle Aktivitäten "verstundenplant" (KOBI 1986, 90) werden. Seines Erachtens komme es zwar zum "informellen Kontakten auf der Lehrer-/ Therapeuten-Ebene, nicht aber im Erlebnis- und Verhaltensbereich des Patienten-Schülers und Schüler- Patienten" (ebd. 90).
Zufällig stieß ich im Rahmen des Servers [inklusion jetzt!] auf einen Beitrag, der sich mit 'iFP', der interdisziplinären Förderplanung, auseinandersetzte. Ausgangspunkt dieser webbasierten 'Zusammenarbeit' verschiedener Professionen ist die Sachlage aus der Praxis, dass "Kinder mit angepassten Lernzielen [...] häufig von mehreren Personen betreut [werden]" (ILERN.CH). Wenn gleichzeitig mehrere Fachdisziplinen an der Bildung und Förderung eines Schülers beteiligt seien, "verfolgen sie sozusagen ein gemeinsames 'Projekt'. Dieses 'Projekt' ist dann überzeugend umgesetzt, wenn gesichert ist, dass sich die Beteiligten verbindlich austauschen, um ihr Vorgehen zu koordinieren" (LIENHARD/JOLLER/METTAUER 2011, 132). Nach Auffassung der Entwickler, könne der interdisziplinäre Abgleich der Förderziele mit Hilfe einer Google Tabellen- Vorlage mit definierten Lese- und Schreibberechtigungen realisiert werden. Die grundlegenden Merkmale, ein möglicher Ablauf und ein Zugang zu einer Beispiel-Vorlage des iFP sollen ihm Folgenden vorgestellt werden.
Das Konzept der interdisziplinären Förderplanung ist nach Ansicht der Entwickler charakterisiert durch seine Flexibilität (die formatierten Tabellen werden mit Google Tabellen erstellt. Die können individuell angepasst werden), die Webbasis (der Zugriff auf die Tabellen ist von jedem PC mit Internetzugang möglich), den Schutz durch ein Passwort (der Administrator vergibt die Berechtigungen an Mitglieder mit Benutzername und Passwort), die Benachrichtigung bei Änderungen (alle beteiligten Fachpersonen erhalten ein Email, sobald eine Veränderung an der Förderplanung vonstatten geht), die kostenlose Nutzung (abgesehen von dem zeitlichen Aufwand für das Einrichten, die Einführung und den Support ist die Nutzung der iFP kostenfrei), die zeitgleiche Bearbeitung (eine zeitgleiche Bearbeitung ist möglich, da die Datei immer automatisch auf dem aktuellsten Stand ist) sowie die lokale Bearbeitung (das Abspeichern und Bearbeiten der Datei/des Förderplans auf dem lokalen PC ist möglich).
Meines Erachtens besitzt die 'iFP' grundsätzlich das Potential, einen funktionalen Anteil am Prozess der gemeinsamen Förderplanung zu tragen. Eine gemeinsame 'mediale Akte', in der alle Beteiligten ihre Dokumentation 'veröffentlichen' ist praktisch und zweckmäßig. Allerdings möchte ich davon absehen, an dieser Stelle von Kooperation, im Sinne von Zusammenarbeit, zu sprechen. Die am Entwicklungsprozess des Kindes beteiligten Professionen dokumentieren zwar auf einer gemeinsamen Plattform, treten aber weder in persönlichen Dialog miteinander, noch interagieren sie im Rahmen der indirekten Unterstützung im konkreten Alltag der Kinder. Letztlich kommt diese Form interdisziplinären (obwohl der Begriff hier meiner Auffassung nach nicht angemessen ist) Handelns dem additiven Modell recht nah. Allerdings ist der Grad der Anonymität noch höher. Die Isolation als Resultat der Mediatisierung hat mit dieser Form der 'Interdisziplinarität' nun auch Einzug in die Begleitung und Unterstützung des Kindes genommen.
In Förderschulen für Körper- und Geistigbehinderte in Baden-Württemberg arbeiten Pädagogen und Therapeuten durch schulorganisatorische Vorgaben zusammen. Physiotherapeuten und Ergotherapeuten erwerben nach einem Vorbereitungsdienst über drei Unterrichtshalbjahre einen Fachlehrerstatus. Ziel ist, gemeinsam mit den anderen Lehrkräften der Schule den jeweiligen Erziehungs- und Bildungsauftrag erfolgreich und verantwortlich wahrzunehmen. Hierfür vermittelt die Ausbildung die erforderlichen fachlichen und didaktischen Einsichten, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie die Kompetenz zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrkräften (vgl. FACHSEMINAR REUTLINGEN 2000). Aufbauend auf einer bereits abgeschlossenen Ausbildung zum Erzieher (für den Fachlehrer an Schulen für Geistigbehinderte) bzw. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Arbeitstherapeuten (für den Fachlehrer an Schulen für Körperbehinderte) erfolgt die Ausbildung in eineinhalb Jahren in Vollzeitform. Hier wird "der Fachlehreranwärter während der Ausbildung mit der Anwärterbesoldung für den Gehobenen Dienst vergütet" (HOMEPAGE PÄDAGOGISCHES FACHSEMINAR KARLSRUHE). Ziel der Ausbildung ist "einerseits, das angesammelte berufliche Selbstverständnis und die vorhandene berufliche Kompetenz der Ergotherapeuten sowie der Physiotherapeuten zu bewahren und auszubauen, andererseits pädagogische und psychologische Grundkenntnisse sowie Handlungskompetenzen neu zu vermitteln und mit der beruflichen Qualifikation als Therapeuten in Verbindung zu bringen" (FACHSEMINAR SONDERPÄDAGOGIK REUTLINGEN 2011). Angesichts dieser Übereinkommen könnte man davon ausgehen, dass die gemeinsame Aufgabe beider Berufsgruppen mit dem gleichen Status nun geklärt ist. Allerdings ist und bleibt fraglich, ob in der Realität ein gemeinsames Unterrichten tatsächlich stattfindet, oder ob die Fachlehrer durch das Unterrichten von (Neben-)Fächern, wie Sport, Kunst oder Hauswirtschaft, dem Lehrer lediglich eine Entlastung für sein Unterrichten der Kulturtechniken bieten sollen.
In ihrem Werk "Fehlstart in der Schule. Rückschlag im Leben. Sensorische Integration als Hilfe beim Schulstart" (2000) legen die beiden Autoren HORST/HORST als gemeinsam handelnde und reflektierende heilpädagogische Praktiker die Ergebnisse ihrer Entwicklungsarbeit mit Kindern vor, die Mühe beim Einstieg in das schulische Lernen haben. Ihr Ziel ist es, aus den Startschwierigkeiten in der Schule keinen Fehlstart ins Leben entstehen zu lassen. Sie gehen in ihrer Arbeit von den Erkenntnissen der amerikanischen Therapeutin Jean Ayres aus, die das Konzept der 'sensorischen Integrationstherapie' (SI) entwickelte und transformieren ihren Ansatz in die Wirklichkeit eines schweizerischen schulischen Anfangsunterrichts (vgl. HORST/HORST 2000, 7). Im Vorwort geben die beiden Autoren an, dass es ihnen ein Bedürfnis ist, "es (bei ihren Schülern) gar nicht erst zu großen Leistungsrückständen und Lücken kommen zu lassen, mit allen Folgeerscheinungen einer negativen Selbstbewertung" (ebd. 7). "In der Einschulungsklasse werden die Kinder während zwei Schuljahren auf den Übertritt in die 2. Regelklasse vorbereitet" (ebd. 53), erklären die Pädagogen und schildern in ihren Vorüberlegungen verschiedene Beobachtungen ihrer Schüler im Anfangsunterricht. Die Art der Beobachtung kann man aus der folgenden Beschreibung ablesen:
"G. hat Mühe mit dem Spracherwerb, verdreht oft Silben und kann sich neue Begriffe schlecht merken. G. ist sehr impulsiv und ablenkbar. Er kann kaum einige Minuten ruhig sitzen. Seine Bewegungen sind vielfach ungesteuert. Auch die feinmotorische Koordination fällt G. schwer. Dies macht sich besonders beim Zeichnen und Schreiben bemerkbar.
T. ist sehr ablenkbar und arbeitet bei schriftlichen Arbeiten sehr langsam. Er braucht daher immer wieder unterstützende Begleitung durch die Lehrkraft. Grobmotorisch fallen seine oft überschießenden Bewegungen auf, die er schlecht kontrollieren kann.
R., ein großer schlacksiger Junge [...] arbeitet besonders im sprachlichen bereich sehr langsam. Die grobmotorische Bewegungsplanung ist noch mangelhaft ausgebildet. R. gerät leicht aus dem Gleichgewicht und fällt hin. Auch die feinmotorische Kontrolle kostet ihn große Anstrengung.
P. [...] hat im Schulzimmer seine Ohren oft überall und arbeitet daher sehr langsam. Die feinmotorische Kontrolle gelingt nicht immer gut. Die Buchstaben wirken noch unbeholfen, und der Entwicklungsrückstand macht sich auch in seinen Zeichnungen bemerkbar" (HORST/HORST 2000, 54f.).
Das weitere Vorgehen der Pädagogen, soll an einem Jungen, beispielhaft für alle Schüler, dargestellt werden. Zunächst wurde der Junge bei einer 'SI'- Therapeutin getestet, um einen Befund zu erlangen, um bei dieser anschließend eine sensorische Integrationstherapie zu beginnen. Gleichzeitig stellten sich die Pädagogen die Frage, wie sie in der Schule seine Therapie unterstützen könnten. Die zuständige Therapeutin gab den Pädagogen im Folgenden einige Empfehlung, bezüglich anzuschaffender Materialien und Medien, die sensorische Erfahrungen für die Kinder ermöglichen. Die Pädagogen statteten sich mit einem Riesenkreisel, einer Tellerschaukel und einem Rollbrett aus, denn der Wunsch, die Therapie im Unterricht zu unterstützen, "hatte in dem Schulalltag etwas in Bewegung gebracht" (ebd. 11). Die verantwortlichen Pädagogen wollten mehr über das therapeutische Konzept der 'SI' in Erfahrung bringen und beschäftigten sich mit den zugrundeliegenden theoretischen Hintergründen (vgl. ebd. 11f.). Nach und nach begannen die Pädagogen immer mehr therapeutische Elemente in ihren Unterricht zu integrieren, wobei sie betonen, dass "besonders problematische Fälle [...] natürlich weiterhin in die sensorische Integrationstherapie [vermittelt wurden]" (ebd. 14). So entstand das Förderprogramm "Sensorische Integration im Erstunterricht". Eine fachliche Beratung ermöglichte die Schulbehörde den Pädagogen und fand in Form von Supervisionen bei einer Therapeutin für 'SI' statt. Die Evaluation löste folgende "spiralförmige Bewegung aus: Programm - Evaluation - Anpassung des Programms - Evaluation - erneute Anpassung usw." (ebd. 14f.). Die durchführenden Pädagogen des Förderprogramms stellen den Zusammenhang zwischen sensomotorischen Erfahrungen und Lernen fest und erklären:
"Damit die Einschulung erfolgreich sein kann, müssen (bestimmte) sensorische Integrationsvorgänge abgeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, so können Schwierigkeiten beim Erlernen der Kulturtechniken und Lernbehinderungen die Folge sein. Obwohl fehlende sensorische Integration bei vielen Kindern nicht der Grund für die Einschulung in der Einschulungsklasse ist, stellen wir eine Häufung diese Problematik in unseren Klassen fest..." (ebd. 24f.).
Erkannt hat hier das pädagogische Personal einer Regelschule, dass jedes ('normale') Kind besondere und individuelle Unterstützungsbedürfnisse besitzt, es Hilfestellungen in unterschiedlichen (Lebens-)Bereichen benötigt und dass dieser Bedarf nicht zwangsläufig eine Diagnose zur Voraussetzung hat. "Die Wirkung der sensorischen Stimulation auf die Konzentrationsfähigkeit wird erweitert auf die Lern- und Leistungsprozesse, Lernen ist Arbeit und Spiel, beweglich und fest. Bewegung ist Grundlage des Lernens. Kognition und Motorik bilden eine Einheit" (ebd. 8). Die Notwendigkeit, sich als Berufsgruppe neue und fremde Aufgabenfelder, berufsfremde Ansätze zu erschließen, wird in den Beiträgen aus der schweizerischen Schulpraxis deutlich. Allerdings bleibt fraglich, ob diese 'Eigenfortbildung' ein zukünftiges Modell der Zusammenarbeit darstellen soll und kann. Ein Modell, das die Abgrenzung, den Verbleib ausschließlich im eigenen Kompetenzbereich, unterstützt. Mir stellt sich die Frage, ob nicht solch ein Vorgehen mit besonderen Unterstützungsbedürfnissen, Rivalitätsgefühle provoziert und Überforderungstendenzen zur Folge hat. In dem Werk von HORST und HORST wird der Rezipient im Vorwort vom Herausgeber (INSTITUT FÜR SONDEPÄDAGOGIK ZÜRICH) dazu angeregt, sich "ein Netz von subjektiver Reflexivität [zu spannen], von sonderpädagogisch tätigen Menschen, die handeln und sich noch beim Handeln zuschauen können" (ebd. 8). Diese Empfehlung ist zunächst zugunsten der Kooperation innerhalb der eigenen Berufsgruppe löblich, widerspricht allerdings grundlegend dem Gedanken der Interdisziplinarität und Multiprofessionalität, letztlich dem Leitbild der Inklusion, Gedanken und Wissen zum Wohle des Kindes zu teilen, anzunehmen und abzugeben.
Norbert STOELLGER überschreibt seinen Artikel mit den Worten: "Sind Förderzentren kaschierte Sonderschulen?" (STOELLGER 1997, 23) und wirft damit Fragen nach Funktionen und Aufgaben von Förderzentren auf. VERNOOIJ setzt nach, in dem er bezüglich Sonderpädagogischer Förderzentren nach "Fortschritt oder Täuschungsmanöver" (VERNOOIJ 1992 in STOELLGER 1997, 23) fragt. Der Begriff des "Etikettenschwindels" wird in dem Zusammenhang genannt und FEUSER metaphorisiert, es handle sich bei dem Konzept der Förderzentren doch nur "um alten Wein in neuen Schläuchen" (FEUSER 1992 in STOELLGER 1997, 23). Kritisch betrachtet wird der 'scheinbare' Abschluss einer Reform (zur Weiterentwicklung der organisierten sonderpädagogischen Förderung in unserem Schulsystem) durch Abnahme des Namensschildes von Sonderschultüren, um ein solches lediglich mit der veränderten Aufschrift 'Förderzentrum' wieder anzubringen. Nach Ansicht STOELLGERs sind "Sonderpädagogische Förderzentren Sonderschulen, die auch an der Aufgabe der pädagogischen Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher in Allgemeinen Schulen - in Regelklassen oder in Integrationsklassen - beteiligt sind" (STOELLGER 1997, 24). Gegenwärtig betreiben "einige sonderpädagogische Förderzentren [...] nur ambulante Sonderpädagogik, indem sie sich um Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kümmern, die die Allgemeinen Schulen besuchen. Sie sind als sonderpädagogische Förderzentren gewissermaßen 'Sonderschulen ohne Schüler'" (STOELLGER 1997, 24) und den Beteiligten wird die Möglichkeit zur Bindung und Beziehung verwehrt. Mitarbeiter erhalten in diesem Modell nicht die Chance, 'echte' Beziehungen zu den Schülern aufzubauen. Es stellt sich die Frage, ob diese Ausgangslage für beide Seiten befriedigend und förderlich sein kann und wird. OPP beschreibt das sonderpädagogische Förderzentrum als "mehr als eine Sonderschule, es ist eine Weiterentwicklung der Sonderschule. Es greift auf der schulorganisatorischen Ebene die Idee der Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in das allgemeine Schulwesen auf und realisiert sie ein stückweit, aber nicht vollständig" (OPP 1996 in STOELLGER 1997, 24). Das sonderpädagogische Förderzentrum trage nach Heimlich zu einer "Pluralisierung sonderpädagogischer Förderkonzepte" im Spannungsfeld "zwischen Separation und Integration" (HEIMLICH 1996 in STOELLGER 1997, 24) bei. Die Entwicklungsanfänge und -intentionen dieses Konzepts beschreibt STOELLGER wie folgt:
"Die Sonderschulen stellten den allgemeinen Schulen für solche behinderten Schüler, die diese besuchen konnten wollten oder sollten, die zusätzliche sonderpädagogische Unterstützung in Form Mobiler Dienste, zusätzlichen sonderpädagogischen Stützunterrichts, Mitarbeit in Zwei- Lehrer- Systemen in Integrationsklassen zur Verfügung, und sie entwickelten sich so zu Sonderpädagogischen Förderzentren, die in den allgemeinen Schulen eine sonderpädagogischen Infrastruktur schufen" (STOELLGER 1997, 25).
OTTE beschreibt eine positive Entwicklung, die mit der Gründung von Sonderpädagogischen Förderzentren einhergeht, da diese unter bestimmten regionalen Bedingungen mitunter dazu führe, dass keine Sonderschulklassen mehr gebildet werden und alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ in der allgemeinen Schule beschult werden können und müssen (vgl. OTTE 1996 in STOELLGER 1997, 25). Gegen diese optimistische Haltung stellt STOELLGER, dass man den Erfolgsmeldungen, in der ein oder anderen Region endlich der Zustand erreicht zu haben, in dem die Sonderschule keine Schüler mehr habe, mit einer gewissen Vorsicht begegnet werden solle, weil nicht ohne weiteres daraus geschlossen werden könne, dass hier nun "die utopische Zielvorstellung einer Allgemeinen Schule als 'Schule ohne Aussonderung' tatsächlich realisiert worden sei" (STOELLGER 1997, 27f.). Auch Hans WOCKEN entgegnet kritisch, dass "die strittigen Fragen, ob Förderzentren regionale oder überregionale Einrichtungen sind, ob sie eine mono- oder multiprofessionelle Ausrichtung haben, und ob sie ambulant und/ oder stationär arbeiten [...] all diese offenen Probleme werden in harmonisierender Weise miteinander vermengt" (WOCKEN 1995). Seines Erachtens seien "Förderzentren [...] diesem Verständnis zufolge Sonderschulen, die neben der bisherigen Sonderschularbeit nun auch ambulante Dienste anbieten. Funktion und Aufgaben der bisherigen Sonderschule bleiben unverändert, die ambulante Unterstützung von Kindern mit besonderen Förderbedarfen tritt ergänzend als neue Aufgabe hinzu" (ebd.). Zusammenfassend stellt der Autor heraus, dass "in zugespitzter Prägnanz [...] Förderzentren als eine 'Sonderschule mit Ambulanz'" (ebd) definiert werden könne.
Diese dargestellten Meinungen zur Thematik verdeutlichen den Zwiespalt und akuten Diskussionsbedarf. Im Rahmen dieser Arbeit geht es schwerpunktmäßig um die Präsentation aktueller Konzepte und Modelle der Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf eine Ausdehnung des Themas verzichtet und auf die komprimierte kritische Auseinandersetzung mit solch 'sonderpädagogischen Ambulanzen in Form 'Mobiler Diensten' im Rahmen des Ausblicks in Kapitel sieben verwiesen.
Auf der Suche nach Konzepten, die Hoffnung auf interdisziplinäre Zusammenarbeit von den unterschiedlichsten Professionen 'rund um das Kind' von Anfang an geben, begegnete mir zum Ende meiner Recherchen das Modellprojekt 'Kompetenzzentrum'. Dieses Konzept stellt in meinen Augen einen hoffnungsvollen Ausblick für die Realisierung verschiedenster Forderungen dieser Arbeit dar. Im Gegensatz zu dem Konzept der Förderzentren, in dem der 'kompetente Kofferpädagoge' seine Mobilen Dienste von Schule zu Schule anbietet, mal hier mal dort für die Dauer einer Fördereinheit einkehrt und dann weiterzieht, packen im Konzept des Kompetenzzentrums die jeweiligen Bezugspersonen des entsprechenden Kindes die Koffer, um abgestimmt auf die heterogene Schülerschaft, Unterstützung und Kompetenzen zu erlangen. Sei es im Bereich der Neurologie, der Psychotherapie, der Logopädie oder weitere Professionen, die ihren Beitrag zum vernetzten Lernen, zum Kompetenztransfer im Rahmen der gegenseitigen Fortbildung eines Kompetenzzentrums leisten. Für eine positive Entwicklung und erfolgreiches Lernen braucht das Kind Beziehungen. Beziehungen zu Gleichaltrigen, aber eben auch erwachsene Vorbilder und Begleiter, die emotional wie sprachlich, durch Mimik und Gestik auf seine Welt- und Selbsterfahrung reagieren. Resonanz ist wichtig, damit das Kind Sicherheit und Vertrauen erfährt. Sicherheit ist jedoch nicht nur essentiell bedeutsam für die Entwicklung des Kindes, auch Erwachsene bedürfen einer gewissen Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit Heterogenität. Da die Forderung nach Allwissenheit und 'Allround-Talenten' zu Überforderung führt, zeigt der Modellversuch des 'Kompetenzzentrums' einen Gegenentwurf zu den bisherigen Konzepten der Zusammenarbeit auf. In Dresden wird das Kompetenzzentrum derzeit als Teil eines Modellversuchs geplant, welches in freier Trägerschaft umgesetzt werden soll. Unter dem Begriff des Kompetenzzentrums stellt sich der Träger TSA (Thüringer Sozialakademie) folgendes vor: Ein Kompetenzzentrum muss sehr bedarfsgerecht und flexibel zur Verfügung stehen. Je nach Erfordernis der aktuellen Bedarfe der Kinder wird das Kompetenzzentrum strukturiert und personell besetzt. Dieses Konzept stellt einen Gegenentwurf zu dem Modell der Mobilen Dienste dar. Im Kompetenzzentrum werden die Kompetenzen und Qualifizierungen der im Schuldienst Tätigen durch die Anleitung und Beratung des im Kompetenzzentrum anzutreffenden multiprofessionellen Teams erweitert. Jeder an der Arbeit mit dem Kind Beteiligter wird für seine individuelle Arbeit kompetent gemacht. Die Weitergabe und Abgabe von fachspezifischem Wissen an andere Berufsgruppen baut Hemmungen und Ängste der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen ab und fördert die Kooperation. Auf Bezugsperson-Ebene erfahren das Kind und auch das Kollegium Kontinuität und Verlässlichkeit statt stetig wechselnder, durchreisender (Lern-)Förderer.
Auch in einem Kompetenzzentrum bildet nur die gemeinsame Sichtweise auf den Menschen die Basis funktionaler Kooperation. In der ökosystemischen Theorie könnte eine Möglichkeit bestehen, das vorherrschende Spannungsverhältnis und die gegenseitigen Abgrenzungstendenzen in eine Balance zu bringen.
Veränderte Schülerschaft = Verändertes Lernen Wie kann Heterogenität gegenwärtig und zukünftig begegnet werden?
Die UN- BEHINDERTENRECHTSKONVENTION (im Folgenden UN- KONVENTION) bezieht alle existenziellen Lebensbereiche auf bürgerlicher, politischer, wirtschaftlicher sowie sozialer und kultureller Ebene ein. In ihren 50 Artikeln spricht sie politische Teilhabe, Bildung und Arbeit, Freiheit und Sicherheit der Person, Meinungsfreiheit sowie Gesundheit und Wohnen, Familie, Freizeit und Kultur an (vgl. UN- KONVENTION 2008, 18F.). Für die soziale Teilhabe im Bereich der Bildung ist vor allem der Artikel 24 von großer Bedeutung. Seit März 2009 verpflichtet sich Deutschland mit diesem Artikel ein "inclusive educational system" (ebd.) zu gewährleisten und somit einen Zugang zum allgemeinen Schulwesen für ALLE zu ermöglichen. Mit dieser neuen Rechtslage besteht für jeden Bürger ein geltender Anspruch auf einen Bildungsweg im allgemeinen Bildungswesen und eben nicht die zwingende Zuweisung an spezielle Einrichtungen, aufgrund der ‚Feststellung' eines erhöhten Unterstützungsbedarfes. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit besonderem Förderbedarf keinen Ausschluss vom allgemeinen Bildungssystem wie vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen erfahren (vgl. ebd.).
Prozesse der Enthospitalisierung, Deinstitutionalisierung, Integration und Inklusion, führen zu heterogenen Lerngruppen. Heterogenität sollte Achtung geschenkt werden, denn sie wird als ‚Schatz' für das Lehren, Lernen und das Miteinander verstanden. Hinsichtlich dieser Heterogenität erhält der sehr kontrovers diskutierte Begriff der Therapie im Sinne einer indirekten Unterstützung (wieder) seinen berechtigten und legitimen Platz innerhalb einer sich als 'ganzheitlich' verstehenden Pädagogik, in der die volle soziale Teilhabe gewährleistet werden muss (vgl. GOLL 1996, 164). Das Pädagogische Prinzip, nachdem jedes Kind nicht nur den Bedarf sondern auch das Recht auf eine individuell ausgerichtete Unterstützung hat, verlangt nach einer umfassenden Pädagogik und Didaktik und diese Ganzheitlichkeit setzt eine Vielfalt an Kenntnissen und Kompetenzen voraus, die erst in Multiprofessionellen Teams ihre Realisierung finden. Die angemessene Begleitung heterogener Lerngruppen stellt eine pädagogische Herausforderung und bei Missachtung der Bedürfnisse ALLER auch schnell eine Überforderung aller Beteiligten dar. Einrichtungen, die den Anspruch an sich erheben, ALLE willkommen zu heißen, müssen auch ALLE gewillt sein, ALLE erforderlichen Professionen in das Team aufzunehmen, damit benötigte Kompetenzen für eine ganzheitliche Erziehung, Bildung, Pflege, Therapie und Beratung vorhanden sind und Kompetenztransfer zum Wohle des Kindes stattfinden kann. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass "mit dem aufgezeigten Wandel des Personenkreises ein Wandel der pädagogischen Aufgabenstellung im Sinne ihrer qualitativen und quantitativen Expansion einhergeht" (ebd. 164). Das prägende Qualitätsmerkmal der Unterstützung ist die Bereitstellung eines multiprofessionellen Angebotes der indirekten Unterstützung, Betreuung und Assistenz. Wie die Bereiche Pädagogik, Pflege und Therapie, im Sinne einer ganzheitlichen Förderung, in einem zusammengesetzten Team aus Vertretern verschiedener Disziplinen, einen harmonischen Dreiklang ergeben können, stellt vielerorts (noch) ein ungelöstes Problem dar (vgl. ebd. 165). Der Eindruck einer auferlegten 'Zwang- bzw. Schein- Kooperation' lässt sich nicht verstecken. Es scheint, als stückele man das große Ganze wieder in seine Einzelteile auf, ordne es je nach Verschiedenheit und behandele diese Einzelheiten in Einzelförderung, um die behinderten Teile zu heilen, zu fördern, zu beseitigen. Deshalb kann man mit Recht die Frage stellen, ob es dem Prinzip der Ganzheitlichkeit entspricht, wenn man für eine speziell ausgewählte Therapie aus dem 'Therapiedschungel' der Dyskalkulie-Schulung, des LRS-Trainings, der Psychomotorik-Schule, der Kunst- und Maltherapie, der Hochbegabten-Förderung oder dem ADS-Training, das Kind für eine bestimmte Zeit des Tages in einen extra dafür eingerichteten, künstlich erschaffenen Raum steckt. Wie die Praxiserfahrungen zeigen, sind diese dann überwiegend fern ab des restlichen Schullebens zu finden. In einer festgelegten Zeit lässt man dem Kind eine exklusive Zuwendung durch einen Erwachsenen zukommen und entfernt es dadurch aus seinen Alltagsbezügen. Dass diese therapeutischen Maßnahmen zu Schulzeiten und im gleichen Gebäude stattfinden, stellt eine Ausnahme dar. Die gängige Vorgehensweise sieht vor, dass die Kinder direkt nach Schulschluss mit ihren Eltern den 'Therapiemarathon', der mit Nachhilfe beginnt, dann bei der Wahrnehmungsschulung fortgesetzt, mit physiotherapeutischen Bewegungsübungen zur Verbesserung der Feinmotorik weitergeführt wird, um dann kurz vor dem Abendbrot noch schnell die Gesamtkörperkoordination in der Psychomotorik-Gruppe zu trainieren, zurücklegen müssen. Freie Zeit, um eigene Interessen und Hobbys auszuleben, bleibt in solch einem ausgefüllten Tag für das Kind (mit seiner Familie) kaum.
Man kann schlussfolgern, dass in Schulen eher ein Einzelkämpfertum vorherrscht. Pädagogen wünschen keine anderen (qualifizierten) Personen über einen längeren Zeitraum in ihrer Klasse, verwehren anderen Berufsgruppen Einblicke in die eigene Unterrichtsarbeit und erkennen trotz bester Absichten nicht die Vorteile für sich, sondern fühlen sich kontrolliert und überfahren (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 165). Der Regelfall ist, dass die Therapeuten nicht an den regulären Team-Gesprächen teilnehmen, keinen vollwertigen und anerkannten Teil des Teams darstellen.
In der Schulpraxis wurde deutlich, dass Pädagogen und Therapeuten nur selten von sich aus den Kontakt zueinander suchen, vielmehr bleibt es bei oberflächlicher Terminabsprache oder 'Behandlungsaufträgen'. Weder in den Förderschulen noch in allgemeinbildenden Schulen konnten gemeinsam geplante und durchgeführte Unterrichtsstunden beobachtet werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dem therapeutischen Personal der direkte Bezug zum schulischen Alltag des Kindes fehlt, da sie vorwiegend separiert vom restlichen Kollegium und additiv tätig sind. Immer wieder kristallisiert sich der Ursprung und der Ansatz funktionaler Kooperation und 'echter' Interdisziplinarität heraus: Sympathie und Verbundenheit. Eine entscheidende Wendung würde diesem Sachverhalt zukommen, wenn allen Beteiligten bewusst wird, dass sich die berufliche Intention therapeutischer und pädagogischer Professionen gar nicht beträchtlich voneinander unterscheidet. Beide Bereiche, Therapie und Pädagogik, "teilen das Anliegen, die Persönlichkeit des Kindes zu stärken" (ebd. 257). Die Kenntnis voneinander sowie gegenseitige Akzeptanz, Verständnis und Offenheit, reichen für Prozesse funktionaler Kooperation und 'echter' Interdisziplinarität nicht aus, vielmehr bedarf es zusätzlich günstiger institutioneller zeitlich- struktureller Rahmenbedingung und vor allem einer einvernehmlichen (inklusiven) Grundhaltung und gemeinsamer (inklusiver) Werte. Bereits die Inhalte der Schulkonzepte unterscheiden sich dahingehend, dass die entsprechenden Institutionen das Miteinander von Therapeuten und Pädagogen explizit aufnehmen, stark lehrerorientiert ausgerichtet sind oder das Team vornehmlich mit pädagogischem Personal besetzt ist. In Einrichtungen, an denen Therapeuten nicht den 'Abrechnungs-Barrieren' ausgesetzt sind, entwickeln sich deutlich mehr gemeinsame Versionen und Visionen pädagogisch-therapeutischer Momente. Die vorherrschende Hierarchie auf der Ebene des Gehalts, der gesellschaftlichen Anerkennung, dem Status der Anstellung sowie die Exklusion therapeutischen Personals aus dem pädagogischen Team, lassen starke Zweifel an sogenannten multiprofessionellen und interdisziplinären Teams aufkommen.
Wenn man ehrlich ist, kristallisiert sich nämlich die Wahrnehmung eines Hierarchiegefälles heraus, welches zugunsten der Pädagogen ausfällt. Festgemacht wird dieses unter anderem an der besseren Bezahlung, der Festanstellung oder des Beamtenstatus gegenüber den Zeitverträgen, dem Selbstwertgefühl, der Zeit der Anwesenheit in der Schule und dem Grad der Akademisierung durch den Studienabschluss (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 318). Aus diesen Gründen ist eine gegenseitige Wertschätzung und authentischer Beziehung zueinander so entscheidend und das nicht erst im Berufsalltag, wo die Schere meist schon sehr weit auseinander geht und die Wege sich selten zufällig treffen, sondern bereits zu Ausbildungszeiten. Dem Inklusionsgedanken widersprechen solch soziale Ungleichheiten, da jedem Menschen die gleiche Würdigung für gleiche Leistung und Verantwortung zusteht. Und darum geht es schließlich, um die verantwortungsvolle und existentielle Bedeutung der Begleitung des Kindes in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Je enger und intensiver beide Berufsgruppen kooperieren, desto stärker lernen sie voneinander. Sie entwickeln ein breiteres Verständnis, gewinnen Sicherheit, behalten dabei eine gewisse Unwissenheit zu Gunsten des lebenslangen Lernens und lassen ursprünglich fachfremde Elemente in die eigene Arbeit einfließen, um der ganzheitlichen Unterstützung des Kindes gerecht werden zu können. Der aktuelle Denkansatz, in der ein Pädagoge allumfassendes Wissen zu diversen therapeutischen Konzepten, didaktischen Methoden der Binnendifferenzierung, erforderlichen Kompensationsstrategien, zu verschiedenen medizinischen Krankheitsbildern und deren Auswirkungen, zur adäquaten Hilfsmittelversorgung und günstigstenfalls auch zur Inneneinrichtung eines Snoezelraumes besitzt, wird mit Sicherheit zu Überforderungstendenzen bei allen Beteiligten führen. Jede Profession hat seine Daseinsberechtigung. Eine therapeutische Ausbildung ist dabei mit ihren Inhalten ebenso umfassend und anspruchsvoll, wie ein Pädagogikstudium. Würde man nun versuchen, beides in einem Studium zu vereinen, um komplett unabhängig und autonom vom anderen Fachbereich agieren zu können, dann wird dies schneller als man denkt in der Isolation und im Einzelkämpfertum, verharrend im eigenen 'Expertentum' enden. Eine verantwortungsvolle Begleitung ist abhängig von 'echter' Zusammenarbeit, intensivem Austausch, gemeinsamer Problemlösung und ehrlicher Kommunikation, um den Kindern und Jugendlichen die inklusiven Grundwerte, wie Gleichheit, Grundrechte, Freude, soziale Teilhabe, Lernen, Gemeinde, Achtung der Heterogenität, Vertrauen, Nachhaltigkeit, Mitgefühl, Ehrlichkeit, Mut und Freude (BOOTH 2009), vorzuleben.
Die Erfahrung zeigt uns, dass solch eine verantwortungsvolle Aufgabe angenehmer und erfolgreicher zu bewältigen ist, wenn die Beteiligten zusammenhalten, nicht jeder 'sein eigenes Süppchen kocht' und dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden darf, dass 'viele Köche den Brei verderben' können. Jede Profession bleibt Ansprechpartner und Verantwortlicher für ihren Fachbereich, die Arbeit geht dabei aber 'Hand in Hand'. Damit Kooperation funktional bleibt, sollte Lernen für ALLE einen lebenslanges 'Projekt' bleiben. Die Pädagogen, die 'zuerst da waren', müssen lernen "dass die Therapie Voraussetzungen und Bedingungen schaffen kann, damit Unterricht und Lernen überhaupt erst stattfinden kann" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 90).
Zusammenfassend bedarf es einer dringend einer "Institutionalisierung der Interdisziplinarität" (ebd. 319), damit, um es klassisch therapeutisch auszudrücken, aus "Antagonisten Agonisten" (ebd.) werden und ein interdisziplinäres Team entstehen kann.
GOLL überschreibt "Transdisziplinarität als Weiterentwicklung pädagogischen Denkens und Handelns" (GOLL 1996, 164). An dieser Stelle führt der Autor nicht nur einen neuen Begriff ein, essentiell ist, was dieser impliziert. Der Begriff der Transdisziplinarität fordert die Elemente, die der multidisziplinäre und interdisziplinäre Ansatz der Zusammenarbeit scheinbar nicht zu realisieren vermocht haben. Begründet wird die Einführung dieses 'neuen' Begriffs mit den "Bemühungen um eine ganzheitliche Pädagogik [im Zuge derer] eine Abkehr von traditionellen multi- oder interdisziplinären Modellen der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team [erfolgte]" (GOLL 1996, 165). Der Autor erklärt, dass "der transdisziplinäre Ansatz mehr und mehr an Bedeutung [gewann], insbesondere in der pädagogisch- therapeutischen Arbeit mit Menschen, die einen hohen Bedarf an verschiedenen und spezialisierten Hilfen aufweisen" (ebd. 165). Alle, aber speziell diese Menschen seien auf das fein abgestimmte Zusammenspiel der verschiedenen medizinischen, pädagogischen und therapeutischen Interventionsmaßnahmen existentiell angewiesen, was in der Praxis durch eine ebenso harmonische Zusammenarbeit der Spezialisten aus den verschiedenen Berufsgruppen erreicht werden könne (vgl. ebd. 165).
Abschließend sollen GOLLs Ausführungen dazu dienen, die Vorteile und Probleme einer transdisziplinären Praxis gegenübergestellt werden, um herauszuarbeiten, ob sich ein transdisziplinäres Zusammenwirken unterstützend oder hemmend auf Prozesse des Kompetenztransfers und Vernetzung auswirkt. Während in multi-und interdisziplinär angelegten Teamstrukturen "Menschen nach dem 'Fließbandprinzip' durch eine Vielzahl von 'Expertenhänden' gehen" (ebd. 170f.), bleibe in einem transdiziplinären Team die Konstanz des persönlichen Bezuges und die Ganzheitlichkeit der Hilfen erhalten. Daher eigne sich der transdisziplinäre Ansatz in besonderem Maße für eine Pädagogik, welche die Beziehungs-Ebene in den Vordergrund stelle. Die personelle Konstanz sowie die Einbettung pädagogisch-therapeutischer Angebote in relevante und durchschaubare Lebenszusammenhänge würden das aus multi- und interdisziplinären Ansätzen bekannte Problem, dass einige wenige Förder- bzw. Therapiesitzungen pro Woche nicht ausreichen, um stabile Erfolge zu erzielen, umgehen (vgl. ebd. 171). Darüber hinaus biete der transdisziplinäre Ansatz den Bezugspersonen die Möglichkeit, sich im Laufe der Arbeit eine Vielzahl praktischer Kenntnisse anzueignen (Kompetenztransfer), die ansonsten ein "wohlgehütetes Geheimnis" (ebd.) der verschiedenen Disziplinen bleiben. Die Teilung von Wissen findet zu Gunsten des Kindes statt. Bei der Forderung nach Kompetenztransfer sollte die Gefahr einer Überforderung der beteiligten Bezugspersonen nicht unterschätzt werden. Durch eine verantwortungsvoll erarbeitete und realistisch formulierte Förderplanung im Rahmen gemeinsamer Teamsitzungen lassen sich Überforderungssituationen ALLER weitgehend vermeiden. Im ehrlichen Dialog stellen Unsicherheiten und Unwissenheit den Inhalt und die Voraussetzung 'echter' Interdisziplinarität dar. Um Züge menschlicher 'Lücken' zuzulassen, braucht es verlässliche und tragbare Beziehungen. Den 'Experten' muss bewusst sein, dass bei der "Implementation transdisziplinärer Teamstrukturen" (ebd. 171f.) zuweilen tiefgreifende Ängste und Widerstände überwunden (Kap.2, 2.4) und traditionelle Berufsrollen auf- und disziplinspezifischen Kompetenzen weitergegeben werden müssen (vgl. ebd.). Im gemeinsamen Handeln können intensive Lernprozesse in Gang gesetzt werden und es entwickelt sich ein gegenseitiges Wissen über die Denk- und Arbeitsweise der jeweils anderen Person - man lernt sich kennen! Nach dem Grundsatz "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile" bedeutet auch Teamarbeit qualitativ immer etwas Ganzheitlicheres als die Summierung von Einzelleistungen (vgl. BEHRINGER/HÖFER 2005, 86).
Das nächste Kapitel widmet sich anhand der Darstellung gemeinsamer Ziele von Therapie und Pädagogik, den Vorteilen eines heterogenen Teams für ALLE und der Umsetzung inklusiver Grundwerte durch 'echte' Interdisziplinarität, mit dem Ziel, bisher Geschildertes zu hinterfragen und zu untermauern.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik
- 5.2 Therapieimmanenter Unterricht als Form der Kooperation
- 5.3 Potenziale unterrichtsimmanenter Therapie für ALLE
- 5.4 Inklusive Grundwerte als Begründung für Therapieimmanenz- Therapieimmanenz als Begründung für Inklusive Grundwerte
- 5.5 Ausbalancierung des Spannungsfeldes durch eine ökosystemische Sichtweise auf den Menschen
Bei aller pädagogisch-therapeutischer Unterstützung, betont KOBI, "das Kind von den Sein- sollens- Ansprüchen ins einfach So- sein zurückkehren zu lassen" (KOBI 1986, 92). Er fordert die Beteiligten auf, das Kind so sein zu lassen, wie es ist. Frei von fest geschriebener Therapie und spezieller Förderung, es wachsen zu lassen und in diesem Prozess zu begleiten (vgl. ebd. 92).
Dieser Forderung nach indirekter Unterstützung und Begleitung mit dem Ziel der Partizipation ALLER, widmet sich dieser Teil der Arbeit. Die vorherigen Kapitel deckten gegenwärtige Abgrenzungstendenzen zwischen Pädagogik und Therapie und mögliche Verursacher und Verstärker auf. Aktuell sind Regeleinrichtungen in Deutschland fast ausschließlich pädagogisch orientiert und durch eben solches Fachpersonal besetzt. Therapeuten, die hinzukommen, haben zunächst keinen Platz bzw. erreichen meist nur den 'Separat-Status'. Verfügen über separate Räumlichkeiten, haben separate Anstellungsbedingungen inne und rechen separat ab. Das vorherrschende additive Modell (vgl. Kap.4, 4.2.2) spricht für sich. Im Interesse des Kindes sollte es ein großes Anliegen darstellen, die starren Grenzen zwischen den 'Experten' aufzuweichen und 'professionelle Distanz' abzubauen.
Die Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik werden herausgearbeitet, die Bedeutsamkeit und Notwendigkeit des Zusammenwirkens beider Berufsgruppen für die volle Teilhabe jeden Kindes zu konstatieren. De Herausforderungen dieser diffizilen Verbindung, besonders hinsichtlich der sich vielerorts zugetragenen 'Zwang-Kooperation' und hinsichtlich des Umgangs mit besonders herausfordernden Lerngruppen, liegen auf der Hand. Pädagogen sind darum bemüht, jedes Kind, unabhängig von seinen spezifischen Besonderheiten, als Teil der Gruppe zu sehen. Sie wollen alle Schüler gleich behandeln, niemanden aussondern. Therapeuten dagegen haben das einzelne Kind, das existente Defizit und seine Möglichkeiten, mit der Besonderheit umzugehen, im Fokus. Sie besitzen eine Vorstellung, wie Kinder innerhalb ihrer Grenzen Erfahrungen machen können. Entscheidend bei allen Unterschieden ist, dass diese beiden Sichtweisen für das Kind in der Gruppe von großer Bedeutung sind - Mehrperspektivität ermöglicht Ganzheitlichkeit.
Damit jedes Kind seinen Platz in der Gruppe findet und die volle Teilhabe gesichert wird, ist es erforderlich, dass sich alle am Entwicklungsprozess Beteiligten die Frage stellen, was die Gemeinsamkeiten einer Lerngruppe sind. Obwohl beide Berufsgruppen voneinander Abstand nehmen, bloß nicht 'in einen Topf geworfen werden wollen', lassen sich bei genauer Betrachtung der Ziele beider Arbeitsbereiche Übereinstimmungen feststellen. Die Berücksichtigung und Bedeutsamkeit der individuellen Möglichkeiten, Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Einzelnen stellen die Grundlage therapeutischer Förderung wie pädagogischer Förderung dar (vgl. BACH 1979 in SOWA/ RISCHMÜLLER 1996, 62). Steht für beide Berufsgruppen doch das Kind im Zentrum, so sollte genau an diesem Punkt, da er schon deckungsgleich ist, die Zusammenarbeit von Pädagogen und Therapeuten ansetzen. So können vermehrt pädagogische und therapeutische Momente in ein gemeinsames Konzept einfließen (vgl. SOWA/ RISCHMÜLLER 1996, 62). JANSEN plädiert für ein Zusammenwirken von Physiotherapie und Ergotherapie in der natürlichen Umgebung des Kindes, was dem Klassenzimmer, einem Lern-Ort, an dem das Kind einen Großteil seines Alltags verbringt, entspräche. Auch für den Therapeuten sollte die Therapiesituation den Bedürfnissen des Kindes entsprechen und in seine alltäglichen Lebenssituationen zu übertragen sein (vgl. JANSEN 1983 in SOWA/RISCHMÜLLER 1996, 63). Er spricht sich somit gegen das vorherrschende additive Modell, gegen künstlich geschaffene und separate Therapieräume und für echte Lebensräume aus. HEDDERICH und DEHLINGER stellen fest, dass "Unterricht [...] stets von Zielen geleitet, mit Inhalten ausgefüllt und mittels verschiedener Methoden realisiert [wird]" (HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 30). Was die Ziele betrifft, könne es in der schulischen Förderung nicht darum gehen, pädagogische Ziele und therapeutische Ziele als etwas voneinander Unabhängiges zu legitimieren (vgl. ebd.). Beide Berufsgruppen ergänzen sich in der Arbeit mit einer immer heterogener werdenden Schülerschaft gegenseitig. Diese Tatsache führt zur Notwendigkeit, Ziele dialogisch auszuhandeln und im kontinuierlichen Evaluationsprozess zu modifizieren. Oberstes Ziel muss schließlich sein, dem Kind die bestmöglichen Bedingungen zum Lernen zu schaffen, damit es sich so selbstbestimmt wie nur möglich die Welt aneignen kann. Dabei gilt die Prämisse, dass alle Ziele und Handlungen für das Kind sinnstiftend und alltagsbezogen sind, damit es das Erlernte in den Alltag transferiert und genutzt werden kann. Neben der Alltagsund Handlungsorientierung, stellt die ganzheitliche Sichtweise einen wichtigen Faktor interdisziplinären Zusammenwirkens dar. SPECK beschreibt diesen Zusammenhang als ganzheitliches Denken, das sich "gegen eine Zergliederung der Wirklichkeit des behinderten Kindes durch ein spezialisiertes Förderwesen [wendet]. Der ganzheitlich denkende Mitarbeiter [...] ist deshalb um eine möglichst weitreichende interdisziplinäre Kooperation bemüht" (SPECK 1987 in WILKENS 1992, 42).
Bei einer ganzheitlichen Förderung darf die Gesamtpersönlichkeit eines Kindes, das Zusammenspiel und die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Entwicklungsbereiche, nicht unberücksichtigt bleiben. Die Bewegung beispielsweise stellt einen Teil der kindlichen Persönlichkeit dar. Physische, psychische und emotionale Besonderheiten können das 'Bewegungshandeln' beeinflussen und umgekehrt (vgl. JAWAD 1987 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 32). Nach MAIER-MICHALITSCH, einer Pädagogin und Therapeutin, bedeutet Handlungsorientierung, "Bewegung als Element des Handelns zu verstehen. Dies findet Ausdruck in dem Begriff 'Bewegungshandeln', der besagt, dass einerseits Haltung und Bewegung Handlungen ermöglichen und andererseits in Handlungen Haltungen und Bewegungen geübt, gefestigt und erweitert werden" (MAIERMICHALITSCH 2009, 95). "Wer diese Einheit akzeptiert", so die Autorin, "wird in der Therapie nicht an Haltung und Bewegung isoliert und damit aus ihrem sinngebenden Kontext herausgelöst arbeiten, da dies keine Bedeutung für das Kind in seiner Lebenswelt darstellt. Haltung und Bewegung sollen für das Kind Teil einer selbst initiierten, eigenaktiven, gewollten Handlung sein, in der es seine Lösungsstrategien (aktiv) mit einbringen kann. Haltung und Bewegung entfachen sich demnach im Handeln, nicht vor dem Handeln" (ebd. 95). Ergotherapeutin MOSTHAF zeigt die für den gemeinsamen Zielfindungsprozess bedeutsamen Schritte auf. Ihrer Auffassung nach ist "von besonderer Bedeutung [...], dass Physiotherapeut und Ergotherapeut gemeinsam mit dem verantwortlichen Lehrer nach realisierbaren, die Therapie unterstützenden Möglichkeiten suchen, in welchen Stellungen das Kind dem jeweiligen Unterricht folgen kann". Geeignete Hilfsmittel, das Einrichten des Arbeitsplatzes im Klassenzimmer und ein dem Kind angepasster Wechsel der Stellungen während des Tages seien von großer Wichtigkeit, gehöre es zur Aufgabe des Ergotherapeuten, beim Lehrer Verständnis für diese Maßnahmen zu gewinnen. Dieser Forderung werde man am ehesten gerecht, "wenn der Lehrer nicht vor vollendete Tatsachen und Anordnungen gestellt, sondern in die Vorüberlegungen, die zu Maßnahmen führen müssen und damit in die Entscheidung, wie sie realisiert werden können, miteinbezogen wird" (MOSTHAF 1983, 285).
An dieser Stelle wird erneut die Notwendigkeit gemeinsamer Teamsitzungen und interdisziplinärer Planung innerhalb einer einheitlichen Konzeption deutlich. STEDING und BECKER setzen sich mit den pädagogischen Fragestellungen in der Ergotherapie auseinander. Nach Ansicht der beiden Autoren, werden die Bereiche "Bildung und Erziehung vor allem als Aufgaben der Familie, der Schule und anderer pädagogischer Einrichtungen angesehen. Störungen in den Bereichen Entwicklung und Lernen [gehören] eindeutig zum ergotherapeutischen Arbeitsauftrag" (STEDING/BECKER 2006, 129). Ein Beispiel soll den gemeinsamen Auftrag von Therapie und Pädagogik verdeutlichen:
"Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln ist keine Aufgabe von Ergotherapeuten. Hat ein Kind jedoch Schwierigkeiten eine dieser Fertigkeiten zu erlernen, kann Ergotherapie notwendig sein, um mit dem Kind und seiner Familie (und allen weiteren am Entwicklungsprozess Beteiligten) an den Voraussetzungen zum Lernen zu arbeiten, wie z.B. Haltungskontrolle, Graphomotorik, visuelle Wahrnehmung, Mengen- und Größenwahrnehmung, Konzentration und Aufmerksamkeit, Versorgung mit adaptiven Hilfen, etc." (ebd. 129).
Außerdem legen die Autoren dar, dass Therapeuten auch an der Bildung selbst Anteil haben, denn zum Bildungsbegriff der die Emanzipation des Menschen als Ziel definiert, gehöre es auch, dem Kind und seinen Angehörigen die notwendigen Kenntnisse und Bewältigungsstrategien zu vermitteln, um mit der Krankheit, der Behinderung oder sonstigen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben führen zu können (vgl. ebd. 130). Das Handlungsprinzip 'Hilfe zur Selbsthilfe' durch indirekte Unterstützung, untermauert diese Aussage.
Zusammenfassend ist auf beiden Ebenen festzuhalten, dass sich sowohl Therapie als auch Pädagogik als Hilfe für das Kind definieren. Beide Professionen finden den Sinn ihrer Maßnahmen im Wohl des Kindes, welches sie aber aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. "Therapie steht dabei unter dem Regulativ der Gesundheit, wohingegen Pädagogik auf Bildung hin orientiert ist" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 149). In der Therapie hat die Körperlichkeit einen hohen Stellenwert. Im Gegensatz dazu neigen die Pädagogen zu einer vom körperlichen Zustand losgelösten Sichtweise des Lernens als Verhaltensänderung. Den körperlichen Möglichkeiten des Schülers, sich die Welt anzueignen, wird im pädagogischen Handeln keine große Aufmerksamkeit gewidmet. SOWA und RISCHMÜLLER machen hinsichtlich dieser 'Ignoranz' von Seiten der Pädagogik darauf aufmerksam, dass effektive und sinnvolle "Verhaltensbeeinflussung [...] erst eingesetzt werden kann, wenn die Befindlichkeit des Leibes durch Therapeuten [...] so gestaltet wird, dass eine Verhaltensbeeinflussung überhaupt erst möglich wird" (SOWA/RISCHMÜLLER 1996, 26). Auch MAIERMICHALITSCH betonen, dass "die gemeinsame Aufgabe von [...] Therapie und Pädagogik [...] bereits durch den Auftrag der Schule, eine Ausrichtung auf die Selbstverwirklichung in sozialer Integration" (MAIERMICHALITSCH 2009, 150) gegeben sei. Übergeordnet gehe es nämlich darum, dem Kind zunächst ein positives Selbstwertgefühl zu geben. Durch Motivation und Anregung könne der Lernprozess zwar gelenkt werden, dennoch sei beiden Professionen bewusst, dass Ziele nur bei einer intensiven Eigenaktivität, bei vorhandener intrinsischer Motivation des Kindes erreicht werden können.
Die 'Hilfe zur Selbsthilfe, mit dem Ziel der Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit und letztlich der Selbstbestimmung, ist beiden Berufsgruppen ein Anliegen. Entscheidend ist nun, diese Gemeinsamkeiten in eine gemeinsame Konzeption zusammenfließen zu lassen und daraus wiederum gemeinsame Handlungen zu schöpfen. "Auch wenn unterschiedlich ausgebildete Fachkräfte eingesetzt sind, müssen sich für die Schüler [...] die unterschiedlichen fachlichen Sichtweisen in einem einheitlichen Erziehung- und Unterrichtskonzept darstellen" (DRAVE/RUMPLER/WACHTEL 2000 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 150). MAIER-MICHALITSCH spricht sich für einen therapieimmanenten Unterricht aus und fasst zusammen, dass "bei allen Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik und gleichzeitig allen Wesensunterschieden beider Systeme nur der Mittelweg genommen werden [kann], der nämlich therapeutische Maßnahmen in die pädagogische Arbeit integriert, statt sie additiv oder nach Unterrichtsschluss hinzuzufügen" (ebd. 151). Der Schüler mit seinen Bedürfnissen wird in den Mittelpunkt allen Geschehens gesetzt. Für diesen gemeinsamen Weg werden beide Berufsgruppen davon ausgehen müssen, dass die Auswahl von Zielen stets die Bezogenheit auf andere Personen und die Sachumwelt garantiert, denn "die Teilhabe am Üblichen und die Einbeziehung in das gemeinsame Leben aller kann nur gelingen, wenn die Ziele der schulischen Förderung nicht nur individuelle, sondern auch auf die Anforderungen von außen bezogene Ziele sind" (SCHWEINS 1996, 32). Das Ergebnis therapeutischer und pädagogischer Prozesse soll sich im alltäglichen Leben, in der Wirklichkeit eines Menschen zeigen.
Als ehemalige Schülerin, Ergotherapeutin und jetzt Studentin für ein Lehramt, welches sich, im Zuge der Bewegungen im deutschen Bildungssystem in der universitären Ausbildung sowie in der pädagogischen Praxis den Leitlinien einer inklusiven Pädagogik verpflichten muss, halte ich es für verantwortungslos und egozentrisch, pädagogische und therapeutische Ziele als etwas voneinander Unabhängiges zu legitimieren. Es muss bei der Begleitung von Entwicklungsprozessen darum gehen, dass sich alle beteiligten Berufsgruppen auf gemeinsame Grundlagen der Begründung und Rechtfertigung von Zielen zum Wohle des Kindes einigen.
"Synergetische Zusammenarbeit benötigt Teamfähigkeit und gelingendes Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Persönlichkeiten" (FEUSER 1980, 335).
Bisher wurde deutlich, dass zwischen Pädagogik und Therapie mehr Gemeinsamkeiten bestehen als vermutet. Entscheidend ist nun der Umgang mit diesem Wissen - die adäquate und sinnvolle Umsetzung der vorhandenen Gemeinsamkeiten im interdisziplinären Handeln.
Der folgende Teil der Arbeit widmet sich den Aufgaben und Funktionen eines interdisziplinären Teams und deren Realisierung in einem therapieimmanenten Unterricht.
Allen voran stellt der gemeinsame Zielfindungsprozess eine große Herausforderung interdisziplinären Zusammenwirkens dar. SCHWEINS zeigt auf, dass "die Zusammenarbeit im Prozess zur Zielfindung, der Bestimmung der individuellen Lernausgangslage [...] einen hohen Stellewert für die zukünftige Basis der Interdisziplinarität" (SCHWEINS 1996, 27) besitzt und stellt gleichzeitig fest, dass die Auswahl adäquater Ziele gegenwärtig offenbar (noch) ein Problem darstellt, da die beiden Berufsgruppen mit unterschiedlichen 'Brillen' auf die Besonderheiten eines Kindes blicken. Damit die Differenz der therapeutischen und pädagogischen Ziele für ein und denselben Schüler nicht zu groß ausfällt, biete sich nach Ansicht des Autors eine Diagnostik, Planung und Evaluation im interdisziplinären Team an. Bei allen Unterschieden professioneller Kompetenz müsse gemeinsam eine Ebene gefunden werden, die die gemeinsame Verantwortung permanent und sicher zum Ausdruck bringt (vgl. SCHWEINS 1996, 28). Aktuell werde Zusammenarbeit vorwiegend als additive Beitragsleistung verstanden. Die beteiligten Professionen müssten sich aber darüber bewusst werden, "dass sich die jeweiligen fachspezifischen Beiträge zur schulischen Förderung gegenseitig beeinflussen und bedingen" (ebd. 28). Der Autor fordert die Berufsgruppen auf, "das Gemeinsame herauszufinden und zu verantworten" (ebd. 28). Im Idealfall werden alle für den Schüler wichtigen Entscheidungen der schulischen Förderung und die das Lernen vorbereitenden Maßnahmen von den Berufsgruppen gemeinsam getroffen. Diese gemeinsamen Entscheidungen schließen ein, dass deren Realisierung gemeinsam überdacht wird (vgl. ebd. 29). SCHWEINS gibt zu bedenken, dass die Forderung nach Zusammenarbeit der verschiedenen Berufgruppen in unseren Schulen vielfach nur realisiert werden können, wenn Pädagogen und Therapeuten bereit sind, nach Unterrichtsschluss in gemeinsamen Besprechungen (Supervisionen, Teamsitzungen, etc.) die "schwierigen Prozesse der Legitimation und Präzisierung von Zielen und Inhalten zu bewältigen" (ebd. 42). Nur so könne die gemeinsame (Fall-) Besprechung ein wesentliches Element von Unterrichtsvorbereitung werden (ebd. 42).
Ein Team zu sein bedeutet auch, Abgrenzung und Ausschluss zu vermeiden und sich aktiv auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zur Überwindung von 'Professioneller' Distanz zu begeben. Das Zusammenwachsen und anschließende Zusammenwirken in einem interdisziplinären Team hält einige Herausforderungen bereit. Auf Seiten der Therapeuten, führt ein Verständnis, das lediglich die handwerkliche Ebene berücksichtigt, "im multiprofessionellen Team zu einem starken Abgrenzungsbedarf und wird als technokratisches Handeln erlebt" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 143). MAIER-MICHALITSCH betont, dass "erst das professionelle therapeutische Handeln in der Verknüpfung von universalistischer Wissensanwendung und hermeneutischem Fallverstehen [...] dazu [führt], dass berufliche Abgrenzungen überwunden und inter- und transdisziplinäres Arbeiten möglich wird. Transdisziplinarität zeigt sich in der gemeinsamen Zielsetzung der unterschiedlichen Berufgruppen, um das Wohlbefinden [aller] Kinder in der Lebensbegleitung zu ermöglichen" (ebd. 143). Für die therapeutischen Teammitglieder bedeutet therapieimmanentes Arbeiten, dass "Fachinhalte [...] im Team vertreten [werden], eine kritische Auseinandersetzung in Bezug auf eine multiperspektivische Betrachtung geführt, Mitarbeiter angeleitet und Maßnahmen evaluiert werden" (ebd.). Dies gelinge nur, wenn das eigene Therapie- und Berufsverständnis im Sinne der Inklusion auch von pädagogischen Inhalten erweitert werde und auf eine fundierte Wissensgrundlage zurückgegriffen werden könne (vgl. ebd.).
'Echte' Zusammenarbeit heißt, dass jedes Mitglied seine persönlichen Fähigkeiten, Begabungen, Interessen und Erfahrungen, sein Berufsprofil und seine fachspezifischen Ansichten in das Team einbringt. Die Basis bildet ein gemeinsames Leitbild, das die Grundwerte von Inklusion birgt und schätzt. Das Wirken im Team hält so viele Vorteile für alle Beteiligten bereit. Ein großer gemeinsamer Wissensschatz entsteht, die Kompetenzen jedes Einzelnen erweitern sich und die Sinnhaftigkeit allen Handelns wird erst dann ausreichend erfasst. Interdisziplinäre Teams sind kreativer (in der Problemlösung) als Einzelpersonen, weil das Ganze, das Gemeinsame hinterfragt, kritisch reflektiert und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Das Agieren als Team führt außerdem zu gemeinsamen (Erfolgs-) Erlebnissen und Momenten, in denen interdisziplinäre Arbeit nicht nur Anstrengung und Kompromissbereitschaft, sondern auch "Freude bereitet, die Leistungsfähigkeit steigert und Überlastungsfaktoren reduziert" (ebd.).
Voraussetzung für das Gelingen therapieimmanenten Unterrichts ist die eigene positive Einstellung zum Kind und die Bereitschaft, Arbeitsstrukturen zu verändern, was bei allen Beteiligten eine Umstellung erfordert. Durch neue Anforderungen und Erfahrungen verändert sich der berufliche Alltag und damit dieser Prozess als Bereicherung und nicht als zusätzliche Belastung wahrgenommen wird, ist eine Phase besonders intensiver Zusammenarbeit und regelmäßigen Austauschs der Eltern, Pädagogen, Therapeuten und zusätzlicher externer Berater wünschenswert (vgl. ALY/ALY/TUMLER 1987). HOFMANN erweitert das multiprofessionelle Team aus Erwachsenen um die meines Erachtens wichtigste Profession: die Kinder, indem er den Klassenverband mit dessen individuellen Kompetenzen, als Team hinzufügt. Nach Ansicht HOFMANNs werde die Bedeutung der Gruppe häufig unterschätzt. Es sei nämlich nicht beliebig und unwichtig, das und wann man einen Schüler aus seinem Verband zur Therapiesitzung zieht. Eine Schülergruppe stelle nicht nur eine Ansammlung von Individuen dar, die auf den ein oder anderen gut verzichten kann, sondern stehe "für einen ideografischen Entwicklungsprozess, gemeinsame Erfahrungen und einen Ort, an dem diese gemeinsamen Erfahrungen das Lernen strukturieren" (HOFMANN 2007 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 165f.). Im gemeinsamen Handeln können starre Organisationsformen leichter aufgebrochen werden, neue Mitarbeiter sind leichter zu integrieren und jeder einzelne entwickelt sich durch die 'Spiegelung' seines Verhaltens weiter und macht wertvolle Selbsterfahrungen. Ähnlich dem 'Teachers-teaching-Teachers'- Programm, wie es in New Brunswick praktiziert wird, birgt die gegenseitige (Weiter-) Bildung große Stärkungsfaktoren. Die Beteiligten haben gleichermaßen das Recht und die Möglichkeit, Schwäche, Unsicherheit und Unwissenheit ohne einen Anflug von Schamgefühlen zu zeigen, Überforderungstendenzen und Ängste können reduziert werden und inklusive Strukturen haben die Chance zu wachsen. Mehrmals wurde in dieser Arbeit das Merkmal 'echt' in Verbindung mit Interdisziplinarität erwähnt. In der Veröffentlichung von Judith HOLLENWEGER, die mit dem einschlägigen Titel "Reduktionismus und Defektorientierung. Vom interdisziplinären Umgang mit Unsicherheit" überschrieben ist, stieß ich erstmals auf dieses kleine Adjektiv, das Großes verdeutlichen soll.
"Die gemeinsame Sprache und gemeinsame Handlungsmuster bilden die Basis für eine gemeinsame berufliche Identität. In der interdisziplinären Zusammenarbeit, die heute allseitig gefordert wird, ergeben sich aus diesen Prozessen der beruflichen Sozialisation und der Ausbildung einer beruflichen Identität große Probleme. Diese Ambivalenz entsteht, da die erreichte Sicherheit [...] einer bestimmten Berufsgruppe [...] einerseits das Bedürfnis nach einer Vermittlung der eigenen Erkenntnisse an andere Fachdisziplinen [weckt], diese [...] jedoch andererseits Prozesse der eigenen Identitätsbestätigung und entsprechende Abwehrmechanismen aus[bildet]" (HOLLENWEGER 1996, 188).
Eine interdisziplinäre Reflexion werde eher als Angriff auf die Berufsidentität und als externe Korrektur erlebt. "Echte Interdisziplinarität" (ebd.) könne allerdings nur dann entstehen, wenn im Bezug auf die eigenen Grundlagen und Glaubenssätze ein Maß an Ungewissheit und im Bereich der persönlichen Identität eine gewisse Unsicherheit zugelassen werden kann (vgl. ebd.). Den Zugang zu dieser 'echten' Interdisziplinarität über (normalerweise Schwäche- anzeigende) Unwissenheit und Unsicherheit, zeigt meines Erachtens eine komplett neue Sichtweise auf Kooperationsfähigkeit auf. Der Artikel bewegte etwas in mir. Die große Hürde zur Zusammenarbeit und die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen, erschienen mir nun nicht mehr allzu hoffnungslos und unerreichbar. Mit Sicherheit erlebt jede Profession, jeder 'Experte' Kritik zunächst als unangenehm. Man sollte aber davon absehen, es als Bedrohung der persönlichen und beruflichen Identität zu werten. Dennoch ist es kein Zufall, dass heute interdisziplinäre Zusammenarbeit dort am erfolgreichsten gelingt, wo Sympathie vorhanden ist, wo "somit die eigene Identität genügend Sicherheit erfährt oder dort, wo ein gemeinsames Paradigma oder ein gemeinsamer Glaubenssatz fachliche Abgrenzungen überwindet" (ebd.). Es ist auch richtig und wichtig, dass "persönliche Beziehungen [...] Unterschiede in der beruflichen Sozialisation ausgleichen [können], weil somit genügend Vertrauen vorhanden ist, um die erlebte Spannung und Verunsicherung wettzumachen. Ein gesundes Maß an emotionaler Sicherheit und geistiger Bestimmtheit ermöglichen es, die eigenen Puzzleteile und blinden Flecke zur Diskussion zu stellen und kreative Verbindungen und neue Konzepte entstehen zu lassen" (HOLLENWEGER 1996, 189). Aber entscheidend ist - und das ist 'neu', immer wieder auch Unsicherheit und Unbestimmtheit zuzulassen, die eigenen Grundlagen in Frage zu stellen und in der interdisziplinären Zusammenarbeit auch vermehrt zu diskutieren (vgl. ebd. 189). HOLLENWEGER beschließt ihre Ausführungen mit der etymologischen Herkunft des großen deutschen Wortes "Sicherheit, das seine Wurzeln in secura [hat] und [...] soviel [bedeutet] wie ohne Sorgen, aber auch ohne Sorgfalt und ohne Pflege" (ebd. 189). Die Autorin appelliert an jeden am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten, "sich mit der Möglichkeit des eigenen Irrtums auseinander [zu] setzen und gerade den am meisten geschätzten und vertrauten Grundlagen ein Stück kritische Sorgfalt angedeihen [zu] lassen" (ebd. 189).
Nun ist es an den Erwachsenen, den 'Professionellen', den Schritt in die Unsicherheit und Unbestimmtheit zu wagen - 'echte' Interdisziplinarität zu leben, damit folgende Potentiale therapieimmanenten Unterrichts zu Gunsten des Kindes voll ausgeschöpft werden können.
Überall hört und liest man von den Auswirkungen unserer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft. Besonders betroffen sind die Kinder. Man kann den Kindern und Jugendlichen keinen Vorwurf machen. Wer kann schon der Reizüberflutung von Werbung, Video, Konsumzwang widerstehen? Nicht nur das vorgefertigte Spielzeug erlaubt nur noch einen vorgefertigten Umgang damit, auch in der Schule dominieren immer noch die genormten didaktisch- methodischen Unterrichtsformen. Schüler konsumieren im Unterricht vorwiegend vorgefertigte Inhalte und dabei geht nachweislich ein hoher Prozentsatz an Unterrichtszeit und Energie der Lernbegleiter für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, die Motivierung, das Schaffen und Beibehalten einer äußeren Ordnung und die Anpassung aller Kinder an das gleiche Lernniveau verloren. Den Druck geben die bevorstehenden Leistungskontrollen, bei denen alle Kinder gleichermaßen gut abschneiden sollen, damit sich in der nächsten Teamsitzung oder Schulinspektion bloß keine allzu große Kluft zwischen den Noten auftut, für die man sich zu rechtfertigen hat. Dieser Umstand unterstützt weder die Lehrergesundheit und noch die gesunde Entwicklung des Kindes. Nicht nur Ärzte diagnostizieren Bewegungsmangel, Haltungsschäden, vermehrt psychosomatische Störungen, Teilleistungs- und Konzentrationsschwierigkeiten, sowie Koordinations- und Wahrnehmungsprobleme bei Schulkindern, auch die große Nachfrage nach Lerntherapeuten, Lese- Rechtschreib- Hilfen, Lernprogrammen für den Computer, sowie der Zuwachs an Nachhilfeschülern und Kindern mit starkem Übergewicht machen auf die Gefahr der Verarmung der Bewegungs- und Sinneserfahrung in unserer Gesellschaft aufmerksam. Grundlegend kann man also sagen, dass nicht nur Kinder mit einem diagnostizierten Förderbedarf in den verschiedenen Entwicklungsbereichen den Bedarf und vor allem ein Recht auf bewegtes, aktives Lernen haben. Jedes Kind hat den Bedarf und das Recht auf Bildung und deren adäquate Vermittlung. Im Folgenden sollen diese Rechte weitergedacht und die Potenziale pädagogisch- therapeutischer Verfahren für ALLE verdeutlicht werden.
Wenn man in den Klassenzimmern der allgemeinbildenden Schulen ganz genau hinschaut, dann ließe sich als Träger der 'Diagnose- Brille' einiges an 'Auffälligkeiten' beobachten. Die 'normale', 'regelrechte' Schülerschaft der allgemeinbildenden (Regel-)Schulen und deren Leistungsstrukturen werden zunehmend inhomogener. Auch bei 'normal' entwickelten Kindern, ohne diagnostizierten Entwicklungsrückstand, fällt auf, dass die Bereitschaft zum Lernen, die Motivation und Neugier stetig sinken. Da stellt sich die Frage, ob es an den Kindern liegt, oder an der fehlenden Passung. Dazu zählt eine kindgerechte Pädagogik, eine Didaktik, die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, eine Umwelt die passend für deren individuelle Lernausgangslage gestaltet wird. Faktoren, die das Lernen hemmen, sind in den äußeren Bedingungen (Umweltfaktoren) zu finden, unter denen Kinder heutzutage aufwachsen. Leistungsstress, Bewegungsmangel, Hektik, mangelhafte Bindungen und Bezugspunkte, sowie Reizüberflutung durch Computer, Fernsehen und andere neue Medien. Bewegungsunruhe, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwäche, Wahrnehmungs- und Koordinationsdefizite, Schwierigkeiten in serialen Leistungen und Handlungsplanung, Passivität und mangelnde Sozialkompetenz sind sichtbare Auswirkungen (vgl. KÖCKENBERGER 2010, 60). KÖCKENBERGER stellt in seinem Buch "Chefstunde" (2010) dar, dass das Kind "während des Erlernens der Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen im herkömmlichen Schulunterricht [...] weiterhin gut funktionierende Bewegungs- und Wahrnehmungssysteme [benötigt]. Seiner Auffassung nach "sind (sie) notwendige Voraussetzungen, um die Lerninhalte aufnehmen, unterscheiden, vergleichen und verstehen zu können, genauso wie die Aufmerksamkeit uneingeschränkt oder ungeteilt dem momentanen Unterrichtsstoff widmen zu können" (ebd. 20).
Die Schaffung der Voraussetzungen zum Lernen, mit dem Ziel, Bildungsprozesse zu unterstützen, gelingt in der Kooperation besser als im Einzelkämpfertum. Das Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik in einem therapieimmanenten Unterricht birgt viele Vorteile für Kinder wie Erwachsene. Die Bedeutung therapeutischer Parallelangebot stellt CLOERKES im Zuge seiner Darstellung der Prinzipien von Integration bzw. gemeinsamen Unterricht an mehreren Stellen dar (CLOERKES 1997, 200f.).
-
Das "Prinzip der Dezentralisierung" (CLOERKES 1997, 201) besagt, dass personelle und materielle Hilfen dort zu gewähren sind, wo sie gebraucht werden und zur Bewältigung von Lern- und Alltagsproblemen beitragen. Fachdisziplinen, -fortbildungen und -material sind in das bestehende Team aufzunehmen, um ALLEN Kindern das Recht auf Bildung und die Teilhabe am Lernen zu gewähren. Das Prinzip der Dezentralisierung distanziert sich von isolierter Einzelförderung und Fachbesuchen (beispielsweise in Form von Mobilen Diensten oder von ambulanten Maßnahmen).
-
Das "Prinzip der Teamarbeit und des Teamteachings" (ebd. 201) umfasst die gemeinsame Planung, Durchführung und Reflexion aller integrativen Prozesse (begonnen bei der Bestimmung der Lernausgangslage beim Übergang von der Kita in die Schule). Für das Gelingen der integrativen Bemühungen ist es unerlässlich, dass nicht nur Sonder- und Regelpädagoge, sondern auch Vertreter aller anderen Disziplinen (Medizin, Therapie, etc.) interdisziplinär effektiv und kooperativ zusammenarbeiten und die Elternarbeit verstärken. Es muss davon abgesehen werden, Eltern zu Co- Pädagogen oder Co- Therapeuten zu deklarieren. Eltern bzw. Angehörige sind als Experten und kompetente Partner für die Erziehung und Bildung ihres Kindes, als Mitglied des interdisziplinären Teams anzusehen.
-
Das "Prinzip der integrierten Förderung und Therapie" (ebd. 202) beinhaltet, dass die Förderung und Therapie nicht reduziert oder ersetzt werden sollen, sondern besser auf die individuellen Bedürfnisse und die durch Integration veränderten Lebenszusammenhänge abgestimmt werden und vor allem so weit wie möglich im Kontext des Gruppen- oder Klassengeschehens durchgeführt werden müssen, damit niemand durch Förderung oder Therapie Ausgrenzungen und sozialen Ausschluss erfahren braucht. Hier spricht sich CLOERKES klar gegen additive Verfahren und für therapeutisch-pädagogische Intervention direkt in den Unterrichtsalltag aus.
"Integration darf nicht den Wegfall von Heilpädagogik und Therapie bedeuten" (LESIGANG 1983 in MAIERMICHALITSCH, 80). Mit dieser Aussage bezieht LESIGANG Stellung und spricht sich für ein Zusammenwirken von Pädagogik und Therapie im Gemeinsamen Unterricht aus. Die Vorteile therapieimmanenter Verfahren fasst MAIER-MICHALITSCH wie folgt zusammen:
"Erstens entfallen durch die Verlagerung der [...] Therapie [...] in den Schulbereich [...] zeitaufwendige Besuche (nach der Schule und in der Freizeit des Kindes) in niedergelassenen Praxen, zweitens kann die Therapie im natürlichen Umfeld des Kindes, dem Lebensraum Schule, handlungs- und problemorientiert stattfinden (Therapeuten erleben die Besonderheiten und Barrieren, die das Kind am Lernen be- hindern direkt vor Ort und können dementsprechend direkt intervenieren) und damit an Effektivität gewinnen und drittens kann der [...] Therapeut den (Pädagogen) [...] beratend zur Seite stehen, ihnen Sicherheit im Umgang gerade mit Kindern mit schweren [...] Besonderheiten vermitteln, Vorurteile abbauen helfen und damit die Integration (und Teilhabe ALLER) voranbringen" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 80).
Auch für HEDDERICH und DEHLINGER stellt "die Verzahnung von Therapie und Unterricht [...] für das Kind sinnstiftende Erfahrungssituationen her [...] und ist im Sinne einer ganzheitlichen Förderung erstrebenswert. Ein Nebeneinanderher von Therapie und Unterricht führt für das Kind zu unbefriedigenden Situationen. Es erfährt seinen Alltag als unzusammenhängende Einzelaktivitäten" (HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 57). Besonders hervorgehoben werden die bewegungsunterstützenden Maßnahmen, die gerade Kindern mit schwerster Behinderung als Hilfestellungen dienen sollen, Bewegung zu erleichtern, anzubahnen oder überhaupt erst möglich zu machen. Diese Hilfestellung kann direkt oder indirekt durch Fachpersonal oder durch entsprechende Medien, wie Lagerungskissen und Keile, speziell angepasste Rollstühle, Lifter oder Hilfsmittel, die die Aktivitäten des täglichen Lebens erleichtern, wie z.B. ergonomisches Essbesteck, Stiftverdickung, Greifhilfen, usw., erfolgen. Durch die bewegungsunterstützenden Maßnahmen wird der Muskeltonus reguliert, was wiederum als Voraussetzung zielgerichteter Bewegungen und Fokussierung gilt. Bewegung zählt zum elementarsten Bereich des Menschen, der verbunden mit der Wahrnehmung für das Kind den Ausgangspunkt bildet, die Umwelt zu erfahren, zu erkunden, sich mit ihr und ihr vertraut zu machen. Bewegung befähigt den Menschen, selbstbestimmt und zielgerichtet zu handeln, die Umwelt zu begreifen und sie mit zu gestalten, denn das Kind lernt handelnd in und durch Bewegung. An dieser Stelle wird klar, welch existentielle Bedeutung Bewegung für das Lernen hat und dass eine erfolgreiche Aneignung der Wirklichkeit eine selbstbestimmte und zielgerichtete Bewegungsfähigkeit zur Voraussetzung hat. Die Beeinträchtigung einer jeden Funktion führt zur Behinderung der Bewegung und über Bewegung kann auf jede Beeinträchtigung Einfluss genommen werden. Da die kindliche Entwicklung ein komplexer Vorgang ist, bei dem sich die Bereiche, Wahrnehmung, Motorik und Sprache gegenseitig bedingen, verstärken und hemmen, also in enger Wechselwirkung zueinander stehen, ist eine ganzheitliche und umfassende Sichtweise von elementarer Bedeutung (vgl. HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 21). Bei der Integration therapieimmanenter Angebote ist entscheidend, dass sie auf Individualität und Differenzierung beruhen, bei der aber die gesamte Gruppe, das Kind in seinem Klassenverband im Blick behalten und einbezogen wird. Denn hier steckt ein weiteres Potential, die Ressource Kind. Es fungiert allen voran als Experte ‚in eigener Sache' und wird aktiv in alle es betreffende Entscheidungs- und Handlungsprozesse mit einbezogen. Die Subjektposition, das Kind als Akteur und vollwertiges Mitglied des Multiprofessionellen Teams, trägt entscheidend dazu bei, dass inklusive Settings gelingen, die volle Teilhabe ALLER erfolgt. Inklusion stellt dann die Frage, wie nicht nur FÜR das Kind Lernwelten passend gestaltet, auch wie MIT ihm gestaltet und vor allem wie das Kind SELBST aktiv werden kann, es Akteur von Bildungsprozessen werden kann. Im Zuge dessen können die Begriffe 'Selbstbildung' und "selbstbestimmtes Lernen' genannt werden. Neben einem Team aus Erwachsenen ‚rund um das Kind' ist das Kind selbst in der Rolle des Begleiters, Assistenten, Freundes, Beraters, etc. ein großer Schatz, der für die ganzheitliche und interdisziplinäre Arbeit gewürdigt, anerkannt und genutzt werden sollte.
Das Lernen von Bewegungen kommt besser zustande, "wenn es sich langsam und gut dosiert, aus schon Gekonntem heraus entwickeln kann und von demselben unterstützt wird" (EBERT 1986, 297). Erweitert man diese Aussage EBERTs auf eine heterogene Lerngruppe, verbirgt sich dahinter ein Appell für den gemeinsamen Unterricht. In einer heterogenen Gruppe entwickelt sich etwas aus Gekonntem heraus und wird von demselben unterstützt. Eine inhomogene Gruppe von Menschen enthält meist ein Mitglied (ausgenommen dem Lehrer), der in einem bestimmten Bereich ein 'Könner' ist. Von diesen 'Könnern' erfährt man die sinnvollste Unterstützung überhaupt- lernt voneinander und miteinander. Im gemeinsamen Unterricht gibt es eine Vielfalt an 'Experten', die sich in den verschiedenen Bereichen gegenseitig unterstützen können. Diese Vorzüge lassen sich 1:1 auf ein heterogenes Team von Lernbegleitern übertragen. Ich möchte hervorheben, dass therapieimmanenter Unterricht nicht heißen kann, dass der Therapeut einmal die Woche für die Dauer einer Maßnahme Teil des Teams wird und den Rest der Zeit der Pädagoge, die unter Anleitung erfahrenen 'Therapie-Tipps' umsetzt. Therapieimmanenz bedeutet, dass Pädagogik und Therapie in aushandelnden jedem Kind seine individuelle Ausgangsposition für unterrichtliche Tätigkeiten, für erfolgreiches Lernen ermöglichen. Denn eines muss bei allen Prozessen des Zusammenwirkens herausgestellt werden: Heterogenität benötigt Differenzierung. Da Unterricht in erster Linie Gelegenheit zum Lernen bieten soll, zum Lernen von dem, was für das jeweilige Kind entsprechend seiner Stufe der Entwicklung angemessen und wichtig ist, um in die nächste Zone der Entwicklung zu gelangen, darf Lernen als Verhaltensänderung nie losgelöst vom körperlichen Zustand und den kognitiven und sozioemotionalen Möglichkeiten des Kindes betrachtet werden. So kann Lernen oft erst stattfinden, wenn bestimmte Voraussetzungen (wie beispielsweise eine gute Ausgangsposition), für und mit dem Kind gefunden und geschaffen wurden. Jede Form der Feinmotorik (z.B. beim Schreiben, Knoten oder Zähneputzen) ist abhängig von einer gesicherten Haltungs- und Bewegungskontrolle. In ähnlicher Weise können psychische, kommunikative, emotionale, soziale, visuelle und auditive Aktivitäten nur dann entwickelt werden, wenn die Voraussetzungen zum Lernen geschaffen, die individuellen Bedürfnisse beachtet werden. Auch Arbeitshaltungen, wie Durchhaltevermögen, Ausdauer und Konzentration bedürfen einer Balance zwischen An- und Entspannung, einer Rhythmisierung, die durch ganzheitliche Konzepte, wie die "Bewegte Schule" oder "Chefstunde" (siehe dazu auch Kap.6, 6.6) geschaffen werden kann.
Wie nun öfters beschrieben, liegt der Ausgangspunkt eines jeden unterrichtlichen Handelns beim Schüler, bei seinen persönlichen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Davon ausgehend plant der Mitarbeiter der Schule individuell und differenziert für und mit dem jeweiligen Kind. Das Lernen im Gleichschritt, bei dem jedes Kind, das nicht die passenden Fähigkeiten aufweist, durch "das Sieb der Schulweisheit" (RODARI) durchrutscht, ist längst nicht mehr realisierbar. Der Pädagoge wird bei der immer heterogener werdenden Schülerschaft schnell an seine Grenzen stoßen. All sein Fach-Wissen und sein Expertentum lassen sich bei diesem und jenem Kind nicht mehr anwenden. Immer wieder kommen den Pädagogen 'diese Kinder' mit ‚Disziplinstörungen', ‚Auffälligkeiten im emotionalen Bereich', ‚Konzentrations- und Koodinationsstörungen', ‚Unsicherheiten in der Feinmotorik', ‚Hochbegabungen' oder diversen ‚Sprachauffälligkeiten' unter. Diese Aufzählung ließe sich bis ins Unermessliche weiterführen.
Entscheidend ist, sich einzugestehen, dass man als Mensch Grenzen besitzt und nicht nur um den Schein zu wahren, tapfer durchhält. Jeder noch so fachlich ausgebildete Mensch sollte sich ab und zu Unsicherheit und Unwissenheit 'gönnen' dürfen. Denn wie bereits mehrfach erwähnt, zeugt diese Eigenschaft von Menschlichkeit und letztlich von 'echter' Interdisziplinarität. Überwindet man als Fachkraft seine Engmaschigkeit und sein Einzelkämpfertum, so ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten und Chancen, Heterogenität als Chance zu begreifen und die Initiative zu ergreifen, ihr mit Offenheit und Differenzierung zu begegnen. Eine ganzheitliche Sichtweise aller an der Bildung und Erziehung Beteiligten ist Voraussetzung einer Verzahnung verschiedener Fachbereiche. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, das Kind zu unterstützen, jedoch nicht unabhängig nebeneinander, sondern in einer Gemeinschaft, in Abstimmung mit dem Kind und gegenseitiger Anerkennung innerhalb eines ganzheitlichen interdisziplinären Konzepts. Unterricht soll einen Lebensraum darstellen, einen Raum, in dem sich alle wohl fühlen, in dem man ernst genommen und entsprechend seiner Bedürfnisse unterstützt wird, damit Fähigkeiten gezielt eingesetzt, erprobt und erweitern werden können. SOWA und RISCHMÜLLER sprechen in diesem Zusammenhang von "lernermöglichenden und lernerleichternden Maßnahmen" (SOWA/RISCHMÜLLER 1996, 18), die durch Therapieimmanenz in den Umgang mit dem Kind einzubeziehen sind. MAIER-MICHALITSCH stellt die Vorteile therapieimmanenten Unterrichts auf der Ebene des Schülers, der Eltern und des pädagogischen Teams zusammengefasst dar (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 179f.). Die Vorteile für das Kind liegen in der Realisierung einer ganzheitlichen Entwicklungsunterstützung. Je mehr Fachbereiche sich konzeptuell beteiligen, umso umfassender wird die direkte und indirekte Unterstützung und umso intensiver und verlässlicher werden die Beziehungen von dem Kind als eine Einheit empfunden. Gemeinsam entwickelte Ziele lassen sich zudem erfolgsversprechender umsetzen. Die flexible Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse des Kindes stellt im interdisziplinären Team eine weniger große Herausforderung dar, als im 'professionellen' Alleingang. Zeitlich und räumlich festgesetzte Therapiezeit, die jedem Kind per Rezept zusteht (maximal zweimal wöchentlich 45 Minuten), kann nach dem aktuellen Stand der Neurowissenschaften in Frage gestellt werden. Konkrete, für das Kind sinnhafte Alltagsübungen, die direkt in das Unterrichtsgeschehen integriert werden, müssen zumindest zusätzlich stattfinden, denn nur in einem strukturierten und vereinheitlichten Tagesablauf erkennt das Kind Zusammenhänge, die wiederum einen Sinnzusammenhang ergeben und entsprechend dem Motto "Nicht Übung, sondern Erfahrung!" (MILANI-COMPARETTI 1985) erfolgreicher verinnerlicht werden können. Die motorischen und kognitiven Lernprozesse werden in den Alltag des Kindes integriert und ergeben damit ein sinnvolles Ganzes, statt einer Zerstücklung in Fach- und Teilbereiche, welche das Kind gar nicht in der Lage ist, in Verbindung zueinander zu setzen und auf seinen Alltag zu übertragen. Alltagsbezüge sind für jeden Menschen wichtig, um Motivation und Energie für eine Sache aufbringen zu können. Neben sinnvollen Zusammenhängen erleben die Schüler ein Team, dass Solidarität und Zusammenhalt in Teambildungsprozessen vorlebt. Mitarbeitern einer Einrichtung, in denen Kinder aufwachsen, sollte ihre Vorbildfunktion stets bewusst sein. Kinder lernen mit und von ihnen nicht nur die Kulturtechniken, immer verstärkter werden die Sozialkompetenzen gewichtet.
Eltern werden die Vorteile kooperativen Handelns besonders in einem von allen Fachkräften unterschiedlicher Fachbereiche vertretenen, gemeinsamen Konzept, erfahren. Additiv angewandte oder ambulante Therapien, die, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, die dem Kind kaum Sinnzusammenhängen ermöglichen und oftmals verbleibende Freizeit entreißen, belasten auch Eltern zusätzlich. Außerdem können Eltern durch ein einheitliches Konzept mehr Vertrauen in die schulische Arbeit gewinnen, haben jederzeit die Möglichkeit in einen Dialog mit fachkundigen Bezugspersonen ihres Kindes zu treten und können die wertvolle Zeit am Nachmittag und Abend sinnvoll mit ihrem Kind füllen.
Der wohl größte Vorteil für die am Entwicklungsprozess Beteiligten liegt in der einmaligen Chance, voneinander zu lernen und somit ohne großen finanziellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand die tägliche Arbeit durch interne Fort- und Weiterbildungen sinnvoll bereichern. Viel Geld und wertvolle Freizeit investieren Pädagogen wie Therapeuten in Fortbildungen und Seminaren, die sich zum Teil über Jahre hinziehen, um sich eine weitere Unterrichts- oder Therapiemethode anzueignen, die der Kollege im Klassen- oder Therapieraum nebenan bereits anwendet und in der direkten Praxis anleiten könnte. Weiterhin besteht ein Vorteil darin, dass auftretende Probleme direkt besprochen und gemeinsame Lösungsstrategien entwickelt werden können. Häufig auftretende Probleme entstehen aber auch erst gar nicht, weil Zeit-, Kommunikations- und Koordinationsprobleme aufgrund mangelnden Austauschs durch eine Arbeitsstruktur des Miteinanders aufgehoben werden können. Überlastungs- und Überforderungstendenzen werden mit Hilfe funktionaler Kooperation und interdisziplinären Zusammenwirkens reduziert. Der Lernort Schule, an dem Kinder die meiste Zeit verbringen, eignet sich optimal zur Umsetzung handlungs- und alltagsorientierter Methoden und Maßnahmen, denn in einem natürlichen Umfeld zeigen Kinder auch die natürlichste Aktivität. Beste Voraussetzung für die Beobachtung und den Befund ist somit nicht die künstlich initiierte Ganganalyse, die Durchführung gezielter Beobachtungen oder das Veranstalten von Testsituationen zur Überprüfung von Wahrnehmungsbereichen, sondern eine ungezwungene, natürliche Situation in Klassenzimmer, Hofpause oder Sportunterricht. Eine Handlung gewinnt durch die Integration in den Alltag des Kindes an Effektivität. Die Bestimmung der Ausgangslage als gemeinsamer Prozess, in Kooperation entwickelte Entwicklungspläne und die Zielfindung 'in gemeinsamer Sache' lassen sich anschließend auch effektiver in Kooperation mit allen Beteiligten verwirklichen. "Nicht Fach- knowhow ist der bedeutendste Faktor, sondern das Umsetzen gemeinsamer Ziele!" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 180).
Jens BOENISCH (1999) beschreibt zehn Prinzipien für die schulische Integration körperbehinderter Kinder und Jugendlicher. Diese Prinzipien sind auf der Grundlage einer subjektiven Didaktik zu verstehen, was wiederum verstanden wird, als ein pädagogisches Konzept, welches den Schüler (das Subjekt) mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen ins Zentrum der Didaktik rückt. "Das Subjekt ist immer eingebunden in seine Lebenswelt und gebunden an seine strukturelle Organisation" (MATURANA/VARELA 1987 in BOENISCH 1999, 337). Diese Ausgangsbedingungen konstituieren, dass nicht der Lehrer der Lehrende ist, sondern dass Lernwelten geschaffen werden müssen, in denen sich die Schüler möglichst selbstständig Inhalte und Fähigkeiten entsprechend ihren Lernvoraussetzungen erarbeiten können. Bei näherer Betrachtung dieser zehn Prinzipien fällt auf, dass es sich mit Hinzufügung eines einzigen Prinzips durchaus auch um die 'elf Prinzipien inklusiver Pädagogik' handeln könnte. Neben den Prinzipien der entwicklungslogischganzheitlichen Didaktik, der Handlungsorientierung, des Interessens- und Erfahrensbezuges, der Kommunikation und Interaktion, der kritisch-konstruktiven Unterrichtsgestaltung, der Modellierung von Lernwelten, der Differenzierung und Individualisierung, der Gemeinsamkeit, des Zwei-Pädagogen- Systems und dem Prinzip des ökologisch-systemischen Bezuges (BOENISCH 1999, 338), kann m. E. durch Hinzufügung des Prinzips der Transdisziplinarität aus einer integrativen eine inklusive Pädagogik werden, in der Bildungsprozesse so gestaltet werden, dass die Vielfalt genutzt und die Teilhabe ALLER gesichert wird. Wenn alle Beteiligten nach diesen zehn bzw. elf Prinzipien und dem allgemeinen pädagogischen Prinzip 'Jedes Kind hat einen Unterstützungsbedarf' handeln, können Spannungsverhältnisse zu Gunsten des Kindes ausbalanciert und inklusive Strukturen möglich werden. Im sechsten Kapitel werden die einzelnen Prinzipien im Rahmen der Vorstellung didaktisch-methodischer Aspekte inhaltlich näher beschrieben.
Dieser Teil der Arbeit widmete sich dem Potenzial therapieimmanenten Unterrichts für ALLE. Aus den Erkenntnissen ergeben sich allerdings gleichzeitig vielfältige Forderungen für die Arbeit mit einer heterogenen Lerngruppe. Durch das Einfließen pädagogisch- therapeutischer Momente in den Unterrichtsalltag, lassen sich lernförderliche Bedingungen schaffen. Für den gemeinsamen Unterricht ist Interdisziplinarität, das Zusammenwirken verschiedener Professionen, essentiell notwendig, um Lernwelten passend für die vorhandene Vielfalt zu gestalten. Eine Darstellung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten dieses 'fruchtbaren' Zusammenwirkens, sowie deren Effekte und Auswirkungen auf die einzelnen Funktionsbereiche des Menschen, findet in Kapitel sechs statt.
Dieser Teil der Arbeit widmet sich einer ALLE willkommen heißenden Pädagogik- den Leitlinien, Grundwerten und Rahmenbedingungen einer inklusiven Pädagogik. Mit dem Artikel 24 der UN- KONVENTION wird jedem Bürger das Recht auf Teilhabe in der freien Gesellschaft und das Recht auf Bildung eingeräumt. Niemand soll durch Etikettierungsprozesse Ausschluss erfahren.
Seit Inkrafttreten dieses Beschlusses sind einige Jahre vergangen. In der Realität, der erlebten Praxis, fühlt sich diese 'Gastfreundschaft' eher erzwungen an und die 'Gastgeberqualitäten' sind ausbaufähig.
Der Begriff der Inklusion stellt ein Leitbild dar, das die Vielfalt in ihr Zentrum rückt. Entsprechend einer Pädagogik der Vielfalt, wie sie PRENGEL wegweisend beschreibt, geht es bei Inklusion um "eine völlige Entgrenzung der Heterogenität" (WOCKEN 2011, 112). Die Unterschiedlichkeit der Menschen stellt in diesem Zusammenhang kein zu lösendes Problem, sondern eine Normalität dar, an welche sich das System anpasst und nicht umgekehrt (ALBERS 2011, 9).
Auf die Frage wie die Forderungen des Artikel 24 der UN-KONVENTION konkret in der pädagogischen Praxis umgesetzt werden können, wie sich Bildungsinstitutionen auf den Weg der Inklusion begeben können, kann der INDEX FÜR INKLUSION Vorschläge bieten. Dieser wurde von BOOTH und AINSCOW entwickelt, um qualitativ gute Bedingungen für Lernen und sozialer Teilhabe in der gelebten Praxis bereitzustellen. Die Schlüsselkonzepte des Index sind ‚Barrieren für Lernen und Teilhabe' und ‚Ressourcen für die Unterstützung von Lernen und Teilhabe' (BOBAN/HINZ 2003, 9).
Andreas HINZ (2006) definiert den Grundgedanken der Inklusion als einen
"allgemeinpädagogische[n] Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen - und damit wird dem Verständnis der Inklusion entsprechend jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt" (HINZ 2006, 97).
Für die Vertreter des Inklusionsgedankens gibt es keine zu separierenden und segregierenden Gruppen von Schülern, sondern eine Schülergesamtheit, deren Mitglieder individuelle Bedürfnisse haben. Viele dieser Bedürfnisse werden von der Mehrheit geteilt und bilden die gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse. Alle Schüler haben darüber hinaus individuelle Bedürfnisse, darunter auch solche, für deren Befriedigung die Bereitstellung spezieller Mittel und Methoden notwendig bzw. sinnvoll sein kann. Damit die volle Teilhabe ALLER überhaupt erst möglich wird und die am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten allen Bedürfnissen gewachsen sind, ist ein interdisziplinäres Zusammenwirken ALLER essentiell wichtig. Die allgemeinen wohnortnahen Schulen müssen den Bedürfnissen ihrer Schülergesamtheit gewachsen und passend sein. Hier wird das bisherige Passungsproblem deutlich. Das Problem liegt nämlich nicht in der betreffenden Person selbst, sondern in den Umwelthindernissen, die die soziale Teilhabe erschweren. Die Lösung dieses Problems findet sich demzufolge in der Umgestaltung der Umwelt im Sinne einer inklusiven Gesellschaft, die die Bürgerrechte aller Bürger respektiert und zu realisieren hilft. Daraus leitet sich als primäre Herausforderung für alle Professionellen ab, nämlich zu einer Neugestaltung der Umwelt als inklusive Gesellschaft beizutragen und in diesem Rahmen Barrieren für das Lernen und die Teilhabe zu beseitigen. Den Abtransport, die Beseitigung dieser großen und schweren, ausgiebig er- und ausgebauten Last, Hemmschwelle, Behinderung, Sperre, Blockade und was sich sonst als Bezeichnung für 'Barriere' im Synonym-Wörterbuch nachschlagen lässt, ist nicht eine Berufsgruppe alleine in der Lage zu bewältigen. Für die Gestaltung barrierefreier Lern- bzw. Lebensräume werden viele verschiedene Kompetenzen, deren Vernetzung und Kooperation benötigt, um die Voraussetzungen zum Lernen und die volle Teilhabe ALLER zu schaffen. Meines Erachtens bedeutet Inklusion, dass eine Schule gar nicht erst in das Dilemma gerät, sich für die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden zu 'müssen', mit dem Ziel zusätzliche personelle, materielle und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Inklusion muss heißen, dass das Schulsystem die Mittel, die es bisher in die Exklusion investierte, für die Schaffung inklusiver Strukturen zur Verfügung stellt. Dies schließt die Zusammensetzung eines heterogenen Teams in jeder Schule, die bedarfsorientierte Anstellung erforderlicher Fachpersonen, sowie fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen ein. Jede Schule entscheidet individuell und demokratisch, für welche Mittel das vorhandene Kontingent an finanziellen (personellen und materiellen) Ressourcen beansprucht wird. Für THOMA und REHLE (2009) involviert eine inklusive Pädagogik "zahlreiche, unterschiedlich angesiedelte Positionen und Personen, die alle zusammenwirken müssen: Eltern, Schulverwaltung, Schulleitung, Lehrer, Fachlehrkräfte, usw...." (THOMA/REHLE 2009, 173). Die Autoren betonen weiter, dass "entscheidend für das Gelingen [...] ein Zusammenwirken aller Partner auf der Basis eines offenen und symmetrischen Dialogs [ist]" (ebd. 173). Ihrer Auffassung nach braucht "Inklusion [...] neben inklusiven schulischen Strukturen auch inklusive Unterrichtspraktiken und eine inklusive Kultur. Als entscheidendes, fundamentales Moment für gelingende Inklusion hat sich dabei der dritte Faktor- die inklusiv orientierte Einstellung der Beteiligten [...] erwiesen" (ebd. 174). Das übergeordnete Ziel jeder Schule und jeden Unterrichts muss sein, dass alle Kinder sich wohlfühlen. Sich wohl fühlen, dazu gehört in erster Linie frei von Ängsten und Schmerzen zu sein. Wohlbefinden entsteht außerdem durch eine Balance zwischen Entspannung und Anspannung, durch stabile Bindungen zu verlässlichen Bezugspersonen, durch authentische Kommunikation und ein angemessenes Nähe und Distanzverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Mitarbeitern und Mitschülern untereinander (vgl. HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 12). Wohlbefinden, Angstfreiheit, Kommunikation, Bindung und eine innere Balance sind Grundlage, um Lernen möglich zu machen und sollten dementsprechend Jedem ermöglicht werden. Die Schule als Lebensraum sollte dem Kind und den Mitarbeitern das Gefühl geben, angenommen, geschätzt und respektiert zu werden. Um das Ziel, dem Schüler eine Erweiterung seines Handlungsspielraumes zu ermöglichen, ihm Wohlbefinden und Sicherheit zu vermitteln, ist eine 'echte' und intensive Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen unabdingbar. Wissen und Fertigkeiten sollten ausgetauscht, weiterentwickelt und Förderkonzepte gemeinsam erstellt werden. Damit alle am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten gesund bleiben, muss Inklusion heißen, miteinander und voneinander zu lernen- Kind wie Erwachsener. Wie dargestellt, führt die Umsetzung inklusiver Grundwerte unweigerlich zur Begründung von Interdiszipinarität. Die therapeutisch-pädagogische Intervention im schulischen Alltag begründet den Inklusionsgedanken, die Teilhabe ALLER zu ermöglichen. Das beschriebene dynamische Beziehungsgefüge soll in folgendem Schaubild dargestellt werden:
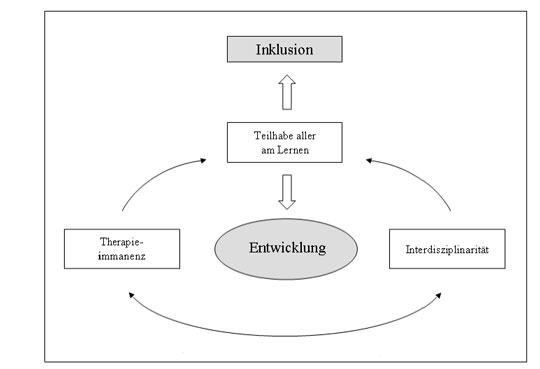
Abb. 4: Interdisziplinarität und Therapieimmanenz als Notwendigkeit inklusiver Pädagogik
Die unterschiedlichen und vielfältigen Rollen der an diesem Prozess Beteiligten, sind allesamt geprägt von Achtung, Anerkennung, Behutsamkeit, Aufmerksamkeit und einem offen Sein für Prozesse und Ergebnisse, für Ideen und Zweifel, für verschiedene Meinungen und Blickwinkel und für die volle Partizipation. Die Verbindung mit inklusiven Grundwerten, wie sie beispielhaft von Booth beschrieben wurden, wie den "Grundrechten", der "sozialen Teilhabe", der "Achtung der Heterogenität" werden an dieser Stelle offensichtlich. Ebenso macht für Booth "Mitgefühl", "Vertrauen", "Ehrlichkeit", "Mut " und "Freude" eine inklusive Grundhaltung aus. Mit dem dargestellten Schaubild möchte ich verdeutlichen, dass eine inklusive Pädagogik, deren Ziel die volle Teilhabe ALLER darstellt, ohne die therapeutisch-pädagogische Unterstützung durch ein interdisziplinäres Team nicht auskommt, genauso, wie therapeutisches Personal integraler Bestandteil eines pädagogischen Teams sein muss, um den Anspruch und die Wertevorstellungen einer inklusiven Grundhaltung zu erfüllen. Aus den Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Betrachtungen und den existenten Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik (siehe dazu Kap.5, 5.1), lässt sich feststellen, dass sich Therapieimmanenz und inklusive Pädagogik auf einen Nenner stützen, auf die Begleitung des Kindes in seiner Entwicklung, welche geprägt ist durch ein Lernen, das die Selbstbildung, Vielfalt und Teilhabe ALLER in den Fokus rückt.
Gegenwärtig ist es noch Gang und Gebe, dass Schüler wegen einer Eigenart aus der allgemeinen Schule ausgesondert werden. Dass die vorherrschende Struktur des Unterrichts mit seinen methodisch- didaktischen Konzeptionen bisher nicht in der Lage war bzw. ist, Schülern mit besonderen Bedürfnissen einzubeziehen, wird selten gefragt. Stattdessen wurde die Lösung in der Segregation 'dieser Kinder' in sogenannte Sonder- Einrichtungen gefunden. Doch wer bestimmt über eine Besonderheit und ab wann gilt diese Eigenart als zu sonderbar?
Am Bespiel eines Kindes mit einer infantilen Zerebralparese sollen die Besonderheiten, die mit diesem Krankheitsbild einhergehen an dieser Stelle knapp und im folgenden Kapitel (vgl. Kap.6, 6.5) detaillierter beleuchtet werden, um daran zu verdeutlichen, dass durch therapieimmanenten Unterricht die Teilhabe von Kindern mit festgestelltem Förderbedarf am gesellschaftlichen Leben keine Frage der Diagnose ist, sondern eine Frage der Kooperation der am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten und der Organisation innerhalb des Lebensraumes Schule. Durch eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit verursacht von einer Spastik oder Lähmung, ist das Kind von Geburt an deutlich in seiner Wahrnehmungsentwicklung beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigungen wirken sich wiederum auf allgemeine motorische Fertigkeiten, Sprache und auch Kommunikation aus. Dadurch wiederum sind der Aufbau sozialer Kontakte und eines selbstbestimmten Lebens deutlich erschwert. BACH hebt die soziologische Sicht hervor und betont, "dass es Behinderung als Eigenschaft oder Merkmal einer Person nicht gibt, sondern dass eine Behinderung nur besteht, wenn eine starke Diskrepanz zwischen einer Verhaltens- und Erlebnisdisposition und einer bestimmten Erwartung oder Anforderung unter bestimmten Bedingungen in einer bestimmten Situation vorliegt" (BACH 1991 in HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 13). Dieses Statement zeigt, dass eine Behinderung letztlich eine soziale Zuschreibung ist. Diese Zuschreibungen können Sicherheit und Orientierung geben, um zu wissen und zu entscheiden, wie und wo mit diesen Kindern umgegangen wird. Aktuell herrschen aufgrund der UNKONVENTION und der damit einhergehenden Rechte behinderter Menschen, große Unsicherheit, Überforderung und Skepsis in den allgemeinen Schulen. "Wie sollen wir 'diesen Kindern' gerecht werden? Wir sind doch gar nicht dafür ausgebildet und uns steht auch viel zu wenig Personal zur Verfügung! Unsere Schule hat doch gar nicht die baulichen Voraussetzungen für 'diese Kinder'! Also Rollstuhlfahrer, das kriegen wir noch gestemmt, aber so richtig schwere Behinderungen, das können wir einfach nicht!" Solche und ähnliche Aussagen hört man immer wieder, lauscht man 'inkognito' an den Türen der allgemeinen Schulen. In der Reduzierung dieser nachempfindbaren Unsicherheiten und Ängste der Pädagogen, der Stärkung einer inklusiven Kultur und um dem Drama um das 'behinderte Kind' ein wenig den 'Wind aus den Segeln zu nehmen', liegt die Begründung der unterrichtsimmanenten Therapie, die wiederum interdisziplinäres Handeln fordert, um dem Inklusionsgedanken genüge zu tun. Nach HINZ beinhalte die Praxis von Integration und Inklusion ein umfassendes System für alle, Grundlagen eines systemischen Ansatzes, die gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligter, sowie ein kollegiales Problemlösen im Team (vgl. HINZ 2002a, 359). Sich einem inklusiven Leitbild zu verpflichten heißt, die Institution Schule für ALLE passend und barrierefrei zu gestalten. Diese Aufgabe verlangt nach einem Team aus Lernbegleitern, die den Entwicklungsprozess jeden Kindes nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Diese indirekte Unterstützung kann nicht allein von Pädagogen geleistet werden. Medizinisch- therapeutisches Fachpersonal muss selbstverständlich integraler Bestandteil eines heterogenen Schulteams sein.
Besonders in der sonderpädagogischen Literatur ist das Verhältnis von Therapie und Pädagogik ein Thema chronischer Aktualität. Ihr Zusammenwirken kann als ambivalent bezeichnet werden. Das ambivalente Verhältnis resultiert mitunter aus einer unterschiedlichen ideologischen Herkunft und damit unterschiedlichen Sichtweisen des Kindes, was zu einer Herausforderung therapeutischer und pädagogischer Kooperation im Kontext Unterricht und Schule führt. KOBI führt die Differenzen auf die Unterschiede der Aufgabenstruktur zurück. Therapie habe medizinische und Pädagogik habe sonderpädagogische Aufgaben inne. Er hebt außerdem ein kooperatives Konzept zur pädagogischen und therapeutischen Zusammenarbeit hervor und führt aus, dass die Arbeit in einem Team mehr genutzt werden sollte, schon alleine aus dem Grund, bestimmte Förderziele im Alltag integrieren zu können, sinnstiftende Tätigkeiten zu vermitteln und Selbstständigkeit zu fördern (vgl. KOBI 1986, 82f.). Die Gemeinsamkeiten der Berufsgruppen sind nicht von der Hand zu weisen. Beide, Therapeut wie Pädagoge, initiieren Lernvorgänge und versuchen auf deren Ablauf einzuwirken. Neben KOBI teilen weitere Autoren diese Sichtweise. Nach BLEIDICK spielen "therapeutische Maßnahmen eine gewichtige Rolle für das 'Ingangkommen' des Erziehungs- und Bildungsgeschehens" (BLEIDICK 1978 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 103f.). Für THEUNISSEN schafft die Therapie Voraussetzungen für ein gemeinsames Lernen, Tun und Erleben (vgl. THEUNISSEN 1992 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 104). DUPUIS und KERKHOFF sprechen von einer Verzahnung der therapeutischen mit den unterrichtlichen Anliegen, wie es beispielsweise durch das Prinzip des therapieimmanenten Unterrichts geschieht (vgl. DUPUIS und KERKHOFF 1992 in MAIER-MICHALITSCH 2009,104). Für SPECK liegt in der Unsicherheit um die Frage "Was ist der Mensch?" das Grunddilemma unserer unzulänglichen interdisziplinären Zusammenarbeit. Ohne ein gemeinsames oder angenähertes Bild vom Menschen und von seiner Bestimmung ist Zusammenarbeit eigentlich nicht möglich (vgl. SPECK 1998 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 92). Dieser Annäherung legten sich einige ‚Steine in den Weg':
"Lange Zeit lag das naturwissenschaftliche Paradigma, in dem eine kausale Sichtweise von Krankheit und ihren Ursachen betont wurde [im Weg]. Diese Sichtweise veränderte sich durch eine sozialwissenschaftliche Vorstellung von Krankheit und Gesundheit, in der soziale, psychische und somatische Zusammenhänge in ihrer Verknüpfung besser zu erklären sind, sowie ein Entwicklungskonzept, das den Entwicklungskräften des Kindes in seiner Integration mit der Umwelt besondere Bedeutung beimisst" (BEHRINGER/ HÖFER 2005, 57).
Diese, das gesamte Leben des Menschen umfassende Sichtweise, setzt sich vor die Annahme, dass Entwicklung linear erfolgt. Erfahrungswelt und Entwicklung des Kindes beeinflussen sich wechselseitig. Das bedeutet, je vernetzter die Lebensbereiche miteinander sind, umso sinnvoller sind sie für die Entwicklung des Kindes. Das ökosystemische Entwicklungsmodell geht davon aus, dass Wahrnehmung, Lernen, Tätigkeit, Erleben, Rolle und Beziehung Entwicklung zirkulär vorantreibt (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 89). Demnach stellt die Förderung eines Teilbereiches innerhalb einer künstlich geschaffenen Umwelt eine sinnlose Beschäftigungsmaßnahme dar. Der systemische Ansatz gibt den am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten vielmehr die sinnvolle Aufgabe der Selbstorganisation. Das Kind wird über einen vertrauensvollen, dialogischen Prozess zur Selbstorganisation begleitet und unterstützt. Personen, die das jeweilige Kind zur Unterstützung und Begleitung benötigt, sollen ihm zustehen. Das Kind steht ihm Mittelpunkt jeden Handelns. In erster Linie steht der Mensch in der Rolle des Schülers, des Patienten, des Kindes seiner Eltern, etc. im Mittelpunkt. Bereiche, wie Schule, Familie und Freizeit bilden sich um das Kind herum, bedingen und beeinflussen sich teilweise gegenseitig. Im System 'Schule' bilden Unterricht und Therapie partiell eine Einheit, betreiben einen fließenden Austausch und eine enge Kooperation. Eltern werden in den Prozess der (Förder-) Konzeptionsentwicklung mit einbezogen und Pädagogen und Therapeuten veranstalten gemeinsame Fortbildungen, die auch partiell für Eltern geöffnet werden können (z.B. zum Thema: 'Stressabbau durch Massagen' oder 'Die Bedeutung der Bewegung für das Lernen'). Es sollten aber auch Grenzen bestehen, so dürfen die Eltern nicht als Co- Therapeuten fungieren und ebenso soll die kindliche Freizeit nicht mit eine 'Therapiemarathon' verplant werden. Die Pädagogen sind weiterhin darauf angewiesen, dass die Therapeuten durch ihre Arbeit die Voraussetzungen zum Lernen unterstützen. Die Therapeuten sind weiterhin darauf angewiesen, dass der Informationsaustausch über und mit dem Kind wie Pädagogen gelingt. Zielsetzung und Mittelpunkt jeglicher Konzepte sollte die Erreichung von Eigenaktivität und Selbstständigkeit des Kindes sein (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 92). Nach Auffassung von THOMA und REHLE stellt die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte einen wichtigen Aspekt im interdiziplinären Handeln dar. Die beiden Autoren betonen, dass es dabei darauf ankomme das traditionell im Hintergrund wirkende medizinische Modell mit dem 'bevorzugten' Blick des Lehrers auf die Defizite der Kinder in ein ökosystemisches Denkmodell überzuleiten. Dieses richte sich eher auf die von den Kindern geäußerten Bedürfnisse, Interessen und Potentiale und gehe entwicklungsorientiert vor. Demzufolge solle die individuelle Lernentwicklung sowie das spezielle Umfeld Ansatzpunkte für die Diagnose und Unterstützung bieten (vgl. THOMA/REHLE 2009 in MAIERMICHALITSCH, 90). Wie in Kapitel drei beschrieben, stellen die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Menschen eine große Herausforderung für die gemeinsame pädagogisch-therapeutische Arbeit dar. Doch dies bleiben bedauerlicherweise keine historischen Probleme, denn "wie früher der Arzt, sind heute Therapeuten immer noch die "Wanderer zwischen beiden Welten" (MEINHARDT 1987 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 143) - der Medizin und der Pädagogik. 'Zwei Welten' meint die gegensätzlichen Menschenbilder und Sichtweisen von Therapie und Pädagogik, die in einem gemeinsamen Arbeitsfeld aufeinander treffen" (MAIERMICHALITSCH 2009, 143). Therapeutische Berufe sind eng an die analytisch-naturwissenschaftlich orientierte Schulmedizin gebunden und seit über 100 Jahren geprägt vom Paradigma des Leib-Seele-Dualismus. Nur langsam wendet sie sich zunehmend mehr dem bio-psycho-sozialen Modell des Menschen zu. Nicht zuletzt durch das Klassifikationssystem ICF der WHO, worauf an späterer Stelle dieser Arbeit detaillierter eingegangen werden soll.
Kinder mit einem diagnostizierten Förderbedarf werden auf therapeutischer und pädagogischer Ebene entwickelt, gefördert und durch Maßnahmen behandelt. Diese drei Begriffe machen deutlich, wie fremdbestimmt der Entwicklungsprozess des behinderten Kindes abläuft. 'Professionelle' Distanz und strenge Abgrenzung der beteiligten Disziplinen, sowie speziell für ein Krankheitsbild zu- und vorbereitete 'Kunstwelten' behindern Partizipation, Beziehung und damit den Weg zur Inklusion. Der Fremdbestimmung im eher defizitär ausgerichteten Denkmodell steht das Empowerment- Modell (THEUNISSEN 1991), nach dem Menschen mit Behinderung als 'Experten in eigener Sache' in Erscheinung treten und das "bio-psycho-soziale Denkmodell" (HÜTER-BECKER 2000) gegenüber. Das neue Menschenbild, das aus Denkmodellen wie den beiden Genannten heraus entsteht, geht von einer als Leib-Seele-Einheit statt eines Leib-Seele-Dualismus aus. Der Mensch befindet sich demnach in einem dynamischen Austausch mit seiner Umwelt, in der er sich selbst organisiert. Folgt man diesem neuen Denkansatz, so kann Veränderung in einem Bewegungsverhalten nur stattfinden, wenn das Kind die Veränderung auch wünscht, sie als persönlich bedeutsam empfindet und sich somit eigeninitiativ, intrinsisch-motiviert und mitverantwortlich in den Prozess der Handlung einbringt. Der inzwischen vollzogene Perspektivwechsel von störungs- und defizitorientierten Betrachtungen hin zu kompetenzorientierten, ökosystemischen Ansätzen spiegelt sich auch in der Weiterentwicklung der Klassifikationssysteme von Behinderung (vom ICIDH hin zum ICF) der WHO wider (vgl. HEDDERICH/ HECKER 2009, 44). Im bio-psycho-sozialen Modell der ICF wird "ein an der Leiblichkeit orientierter Erziehungsbegriff" (NEUHÄUSER/KLEIN 2006, 76) abgebildet. Die WHO entwickelte 2001 das ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) als Nachfolger des ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) von 1980. Diese Entwicklung drückt einen Wandel hin zur Ressourcenorientierung aus. Das 'Vorgänger'-Klassifikationssystem beinhaltete Begriffe, wie Schädigung (impairments), Unfähigkeit (disabilities) und Behinderung (handicaps). Im ICF richtet sich der Fokus vermehrt auf die Kompetenzen und Herausforderungen des Menschen im Hinblick auf seine zu erfüllenden Umweltanforderungen. Wobei ich an dieser Stelle betonen möchte, dass es sich trotz allem weiterhin um ein System handelt, das zu Klassifizierung und Kategorisierungsprozessen dient und letztlich zu Stigmatisierungen führt. Im beruflichen Alltag als (Ergo-)Therapeutin wird man häufig mit diesem Klassifikationssystem konfrontiert. Muss man im Beruf des Therapeuten ohnehin schon viel zu oft die 'Defizitbrille' aufsetzen, um den Befund so ausführlich und vollständig wie möglich durchzuführen, so gibt das ICF eine Ressourcenorientierung vor. Vorhandene Fähigkeiten, Problemlösungs- und Kompensationsstrategien, Talente und Interessen des Menschen geraten vermehrt in das Blickfeld des Diagnostikers. Es geht im ICF um ein Konzept der funktionalen Gesundheit. Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit, der Aktivitäten und der Teilhabe werden unter expliziter Bezugnahme auf deren Kontextfaktoren betrachtet. Da dieses Klassifikationssystem in nahezu jedem medizinisch- therapeutischen Beruf präsent ist, halte ich es im Zuge meiner Arbeit und der Beschäftigung mit den Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit medizinischer und pädagogischer Professionen für erwähnenswert, dass das bio-psycho-soziale Modell des ICF der Lebenswirklichkeit der Betroffenen besser angepasst ist, als das vorherige System der ICDH. Insbesondere wird nun der gesamte Lebenshintergrund der Betroffenen berücksichtigt. Die ICF definiert Komponenten von Gesundheit und einige mit Gesundheit zusammenhängende Komponenten von Wohlbefinden, wie Erziehung, Bildung und Arbeit. Informationen über Diagnosen (ICD-10) in Verbindung mit Informationen über die Funktionsfähigkeit (ICF) und liefern ein breiteres und angemessenes Bild über die Gesundheit von Menschen oder Populationen, welches zu Zwecken der Entscheidungsfindung herangezogen werden kann (vgl. ICF 2005). Die detaillierte Darstellung und kritische Auseinandersetzung dieses Klassifikationssystems würde den Rahmen der Arbeit sprengen, stellt aber meines Erachtens ein interessantes und zu hinterfragendes Instrument, bezüglich der Erfüllung inklusiver Grundwerte, dar.
Eine komprimierte Darstellung zur Ausbalancierung möglicher Spannungsfelder führt MAIER-MICHALITSCH in drei Schritten auf, deren Kenntnisnahme und Ausführung das multiprofessionelle 'Wir-Gefühl' stärken und damit zu einer 'echten' Interdisziplinarität führen. Den ersten Schritt stellt die "Fokussierung möglicher Problemfelder" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 188) dar, der das Ansprechen und Aussprechen von Problemen und Ängsten, die auftreten könnten, beinhaltet. Bedingung ist der vertrauensvolle, 'abgedichtete Raum'. Im zweiten Schritt geht es um die "Fokussierung kindlicher Bedürfnisse" (ebd. 189). Für alle am Entwicklungsprozess Beteiligten steht das Kind im Mittelpunkt und wird als Gesamtheit wahrgenommen. Die Entwicklungsbereiche des Kindes gehören zusammen, bedingen sich gegenseitig. Der Prozess stellt eine Einheit dar und darf nicht durch verschiedenen Fachlichkeiten zerstückelt werden. Pädagogische und therapeutische Intervention sollen vom Kind als sinnvolles Ganzes empfunden werden, damit es nicht zu Ambivalenz- Gefühlen kommt. Entscheidend ist, dass das gemeinsame Ziel der gemeinsame Auftrag darstellt, das Kind in seinen individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen, zu unterstützen und ernst zu nehmen (vgl. ebd. 189). Der dritte Schritt, "Möglichkeiten und Hilfestellungen zur Überwindung von Konflikten" (ebd. 2009, 189f.) anzunehmen, meint Angebote zur Supervision, der Aufbau einer Gesprächskultur, regelmäßige Reflexion und Evaluation, sowie die grundlegenden Werte der Zusammenarbeit, wie Respekt, Toleranz, Offenheit und der 'Mut zur Unwissenheit'. Außerdem sollte eine Konfrontation und intensive Auseinandersetzung mit der anderen Profession bereits während der Ausbildung stattfinden, um das Verständnis füreinander aufzubauen und fachliche Barrieren abzubauen. MAIER-MICHALITSCH vergleicht die gelebte 'echte' und damit funktionale Interdisziplinarität mit einer "Symphonie: Viele verschiedene Instrumente, die einzeln nebeneinander her spielen, sind kaum anzuhören, erst wenn alle harmonisch zusammen spielen entsteht eine Symphonie - Wohlklang für unsere Sinne" (ebd. 191) - eine Wohltat für das Kind, wenn es dabei im übertragenden Sinn, die ‚erste Geige spielt'.
Auch KOBI bemüht sich um eine Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses und stellt "gewisse Lockerungsübungen" (KOBI 1986, 91) auf, die seiner Ansicht nach für "die sich gelegentlich verkrampfenden Verhältnissen zwischen Erziehung und Therapie [und] im Lebensinteresse des im Zweifrontenkrieg zwischen Therapie und Erziehung gelegentlich sich erschöpfenden Kind liegen" (ebd.): Die erste Lockerungsübung stellt nach Auffassung des Autors die "gemeinsame Zielfindung" (ebd.) dar. Der Aufwand, mit allen Beteiligten (Therapeut, Erzieher, Eltern, Kind) zusammen mittelfristige Ziel zu formulieren, lohne sich insofern, als sich aus Zieldefinitionen leichter methodische und damit auch fachspezifische Aktivitäten und personelle Besetzungen ableiten lassen (vgl. ebd.). Als zweite Lockerungsübung stellt KOBI die "Serialität" (ebd.) vor. Therapien bzw. pädagogische Förderprogramme sollen soweit als möglich nach entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten zeitlich gestaffelt werden (vgl. ebd.). Eine weitere Übung stellt die "Kontinuität" (ebd.) dar, in der es darum geht, bestimmtes methodisches Vorgehen nicht zu ändern, solange ein Kind damit Fortschritte erziele und beziehungsmäßig positiv darauf anspricht. Dasselbe gelte auch für personelle Bezüge (vgl. ebd.). Der Heilpädagoge hebt die Bedeutsamkeit der Bedürfnisse des Kindes nach adäquater Bindung und Anregung hervor und fordert, dass diese im Mittelpunkt jeden Handelns stehen müssen. Benötigt werden Bezugspersonen, die Verständnis und Verlässlichkeit vermitteln. Ebenso bedeutsam ist eine lernförderliche Umgebung, in der sich das Kind bestmöglich zu einem selbstbestimmten Menschen entwickeln kann. Seinen eingängigen Artikel schließt KOBI mit dem 'Aufhören' und einem Appell an alle Professionen, die sich der Arbeit an und mit dem Kind gewidmet haben und widmen werden, ab:
"Und endlich möchte ich an die große Bedeutung des Unterbrechens und des Aufhörens erinnern. Es gibt in jeder Therapie, in jeder Erziehung, einen Punkt, wo gegenüber einem [...] Kind alles Therapierbare therapiert, alles Förderbare gefördert ist und wo man den Mut und die Zuversicht aufbringen musste, aufzuhören und das Kind von den Sein- sollens- Ansprüchen ins einfach So- sein zurückkehren zu lassen" (ebd. 92).
Inhaltsverzeichnis
Dieses Kapitel stellt zugleich Ergebnis und Ausblick der theoretischen Analyse dar. Es werden Überlegungen zu einer inklusiven Didaktik, durchzogen von pädagogisch-therapeutischen Momenten, angestellt. Zahlreiche didaktisch-methodische Elemente und organisatorische Faktoren spielen zusammen, um das volle Potential inklusiver Pädagogik zu entfalten. Derzeit gibt es viele verschiedene didaktische Konzepte für den gemeinsamen Unterricht. Hierzu zählen beispielsweise offene Unterrichtsstrukturen, Binnendifferenzierung und Individualisierung, "ohne dabei Kooperation und Gemeinsamkeit aufzugeben" (SEITZ 2006). Fraglich bleibt bei der Vielzahl an "konzeptionellen Grundbausteinen" (ebd.), ob gemeinsamer Unterricht überhaupt eine spezielle didaktisch- methodische Organisation braucht, oder ob es "vielmehr um das Praktizieren einer 'guten' allgemeinen Didaktik für alle Kinder geht" (ebd.). Entscheidend ist, dass eine allumfassende Didaktik für den gemeinsamen Unterricht dringend erforderlich wird, da "die Heterogenität in Grundschulklassen [...] gegenwärtig nur noch artifiziell von der in Integrationsklassen abzugrenzen [ist]" (ebd.), wie in Kapitel vier (vgl. Kap.4, 4.2.5) beispielhaft beschrieben. Neben dem gemeinsamen Unterricht stellt bereits die flexible Schuleingangsphase Heterogenität dar, der auf konzeptioneller und personeller Ebene kompetent begegnet werden muss. In der interdisziplinären Zusammenarbeit aller an der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Beteiligter, findet sich ein konstruktiver Umgang mit Heterogenität, von dem vor allem das Kind profitiert. In diesem Teil der Arbeit soll nun eine "Kontur inklusiver Didaktik" (ebd.) mittels Therapieimmanenz in einer 'Schule für ALLE' erstellt werden.
In den vorherigen Kapiteln wurde deutlich, dass Interdisziplinarität einen offenen Umgang mit der eigenen Unsicherheit, Unwissenheit und Unbestimmtheit fordert. Statt sich um die Bedeutung von Schlagworten wie 'dialogisch', 'human', 'kooperativ' oder 'integrativ' zu streiten, müssen diese Prinzipien gelebt und in der interdisziplinäre Interaktion erlebt werden (vgl. HOLLENWEGER 1996, 185). Wahrscheinlich fühlen sich die 'Fachkräfte' aber gerade dort am sichersten, wo deren Grundlagen am wenigsten geprüft sind und ein Blick aus einer anderen Disziplin notwendig wäre (vgl. ebd.). Eine Reflexion im Team sowie Fremdwahrnehmung sind um einiges schwerer zu ertragen als eine Selbsterkenntnis oder Selbstkritik. Positiver wirkt sich auf das Selbstbild aus, in seinem eigenen Raum sein eigener Chef zu sein, sich nicht 'in die Karten gucken' zu lassen. Fraglich ist allerdings, ob diese Art und Weise des Einzelkämpfertums die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter und Schüler positiv beeinflusst und vorantreibt. Nina HÖMBERG setzt sich mit den Aspekten beruflicher Qualifikation bei Pädagogen, die Schüler mit schwersten Beeinträchtigungen in integrativen Klassen unterrichten, auseinander. Die Autorin betont, dass die Begleitung jedes Kindes in seiner Persönlichkeitsentwicklung mehr als eine 1:1 Betreuung (Lehrer - Schüler) benötige, sie auch weit über ein additives Modell hinausgehe. Die Arbeit im interdisziplinären Team und das Lernen im gemeinsamen Unterricht haben nach Auffassung der Autorin das Potential einen ganz neuen Bezugsrahmen zu bilden, machen jedoch ebenfalls spezifische Qualifizierung erforderlich (vgl. HÖMBERG 2003, 178). Als Grundvoraussetzung aller Konzepte erachtet HÖMBERG "die Kooperation verschiedener Berufsgruppen und Institutionen, aber auch die solidarische Zusammenarbeit mit den Eltern [...], um eine qualitätvolle Schule für die Bedürfnisse aller Kinder zu etablieren" (ebd. 179). Die Autorin sieht eine Gefahr für gelingende Interdisziplinarität, wenn es den Beteiligten nicht gelinge, produktive und kooperative Prozesse einzuleiten und damit die Verantwortung für Unterricht und Planung nicht als gemeinsames Anliegen verstanden werde (vgl. ebd. 180). Ines BOBAN betont den Beitrag eines Kompetenztransfers zur Planung und Umsetzung passender Unterrichtsangebote. Dieser Transfer komme dann zustande, wenn alle Beteiligten schätzen lernen, dass sie ausbildungsbedingt unterschiedliche Zugänge zu pädagogischen und didaktischen Situationen innehaben und dementsprechend Strukturen geschaffen werden müssen, die Diskussion und Austausch erlauben. Innerschulische Angebote, wie gemeinsame Fallbesprechungen, Supervisionen, Teamsitzungen, etc., könnten den Rahmen für einen solchen disziplinübergreifenden Austausch bieten. Die Autorin zeigt auf, dass Kooperation immer einen Balanceakt darstellt, bei dem die Spannungsverhältnisse, die integrativen und inklusiven Situationen immanent sind, oft als produktiv angesehen werden. Gemeinsame Bewältigungsstrategien zu entwickeln und im Dialog zu bleiben, gehören ihres Erachtens zu den entscheidenden Lernerfahrungen, die nicht nur Schüler, sondern auch alle am Entwicklungsprozess Beteiligten im gemeinsamen Unterricht machen können (vgl. BOBAN 1992). HÖMBERG stellt den Rollentausch heraus, der im Laufe der Zeit und bei guter Zusammenarbeit erlebt werde. "Die Beteiligten erwerben Kompetenzen, die jeweils eher der anderen Berufsgruppe zugeordnet werden" (HÖMBERG 2003, 188). Auch Nicola MAIER-MICHALITSCH führt verschiedene personenbezogene Voraussetzungen für funktionale Kooperation und 'echte' Interdisziplinarität auf. Der Abbau von Vorurteilen und Erwartungshaltungen trage entscheidend dazu bei, die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht zu behindern. Dabei spielen Prozesse der Offenheit und Wertschätzung gegenüber der anderen Berufsgruppe eine wichtige Rolle, um der anderen Berufsgruppe Wohlwollen und Kompetenz zu signalisieren. Die Autorin ist der Auffassung, dass die Eigenheiten anderer Berufsgruppen akzeptiert und Erwartungen an sie realistisch formuliert werden sollten.
Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, sich einem gemeinsamen Leitbild zu verpflichten, das die heterogene Schülerschaft und Mitarbeiter in ihren individuellen Bedürfnissen respektiert und wertschätzt, kann und wird den Kooperationsprozess im interdisziplinären Zusammenwirken enorm erleichtern, wenn nicht erst ertragreich machen. Auch Georg FEUSER nimmt sich den Herausforderungen an, die mit einem interdisziplinären Handeln im gemeinsamen Unterricht einhergehen und stellt die Veränderungen und Voraussetzungen für die am Prozess Beteiligten heraus. Unmissverständlich macht er klar, dass "an den Lehrer [...] höchste, subjektbezogene Ansprüche gestellt [werden]" (FEUSER 1987, 177). Die verantwortungsvolle neue Aufgabe werde von allen Beteiligten verlangen, "ständig selbst neu zu lernen, seine Einstellungen und Haltungen zu revidieren, lieb und stabilisierend gewordene Rollen abzulegen und neue zu übernehmen, und selbst die bisher Sicherheit, vor allem aber auch Anerkennung vermittelnde Praxis zugunsten einer neuen
aufzugeben" (FEUSER 1987, 174).
Bezogen auf die Berufsgruppen, die die Therapie einerseits und die Pädagogik andererseits vertreten, bedeutet das Zusammenwirken in einem interdisziplinären Team, das eigene berufsbezogene Selbstverständnis zu überdenken und gegebenenfalls zu modifizieren und gewiss zu erweitert, um allen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Um allerdings zu einer erweiterten Sichtweise zu kommen, die letztendlich wiederum zu einem Grundpfeiler von Zusammenarbeit werden kann, ist es notwendig, 'über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen', um sich mit Begrifflichkeiten, Inhalten, Zielen und Methoden der jeweils anderen Profession vertraut zu machen, sich den 'Fachfremden' zu öffnen. Insofern gilt die Forderung von Martin SOWA, dass die Vertreter beider Berufsgruppen im Sinne einer produktiven Zusammenarbeit lernen, den jeweils anderen zu verstehen und zu respektieren, um funktional zu Gunsten des Kindes tätig zu werden. Um das gegenseitige Verstehen und Verständnis zu erweitern, scheint es notwendig, auf mehreren Ebenen innovativ zu werden. Dieser Teil der Arbeit widmet sich den Ebenen der Ausbildung, Fortbildung und Schulorganisation (vgl. SOWA 1996, 187f.).
Wie bereits erwähnt, hat die Arbeit zum Ziel, Anstöße und Mut zum Wagnis 'Interdisziplinarität' zu geben. Den Grundstein für diese 'Mutprobe' legt vor allem die Ausbildung medizinischer wie pädagogischer Berufe. Bei der Ausbildung therapeutischer Fachkräfte sollte die Einzelbehandlung besonders im Arbeitsfeld der Pädiatrie kritisch hinterfragt werden. Das Kind lernt und lebt üblicherweise eingebettet in seinen sozialen Kontext. Innerhalb seiner Familie, seines Klassenverbandes, seines Freundeskreises, seines Sportvereins, etc. Der Ersatz von Einzelsituationen sollte deshalb zu Gunsten von Gruppenarbeit überdacht werden. Der angehende Therapeut muss sich bezüglich künstlich geschaffener Behandlungen die Frage stellen, ob jede seiner Handlungen in den Alltag übertragen werden kann, damit sich für das Kind sinnstiftende Tätigkeiten ergeben (vgl. SOWA 1996, 189). Die Therapie an der Schule bezieht ihre Tätigkeitsberechtigung bisher hauptsächlich aus dem Grund, dass in der Verzahnung von Therapie und Pädagogik das möglichst Optimale für den Schüler erreicht werden kann. Mit dieser Verzahnung ist der Aspekt der indirekten Unterstützung durch Interdisziplinarität angesprochen. Diese Forderung der Kompetenzvernetzung zum Wohle des Kindes, hat für die Ausbildung die Konsequenz, dass zu dem bisherigen Ausbildungsinhalt, der bestmöglichen Qualifizierung des Einzelnen bezüglich spezifischer therapeutischer Förderung, die Thematik der Teamarbeit, Kooperation und interdisziplinären Zusammenwirkens hinzukommen müssen. Martin SOWA zeigt mit folgender Aussage die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns im Kontext Schule auf: "Setzt man in der Industrie zunehmend auf die Teamfähigkeit und Teamarbeit, so erscheint dies für den therapeutischen und pädagogischen Bereich umso zwingender" (ebd. 190). In der Ausbildungsphase führt die Vermittlung medizinischtherapeutischen sowie gleichermaßen pädagogischen Basiswissens dazu, dass Pädagogik und Therapie sich besser verstehen, fördert das 'Sprechen der gleichen Sprache', das wiederum kann Abgrenzungstendenzen und professionelle Distanz reduzieren, was Grundvoraussetzung für ein gegenseitiges Verstehen und darauf aufbauend für ein gemeinsames Handeln ist. Auch MAIER-MICHALITSCH hebt den gemeinsamen Wissenserwerb über die Strukturen der Zusammenarbeit innerhalb der Ausbildungsphase hervor. Nach Auffassung der Autorin sollten nicht erst in der beruflichen Praxis die Strukturen der Zusammenarbeit auf die verschiedenen Disziplinen 'eindreschen', sondern bereits in der Ausbildung müsste Kooperation einen großen Stellenwert haben und an die angehenden Mitarbeiter einer Schule herangetragen werden (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 176). Pädagogen sollten beispielsweise im Rahmen ihres Studiums neben medizinischen Begriffen und Prozessen auch über die Zusammenhänge zwischen physischen und geistigen Haltungen informiert werden. Ebenso sollte die Ausbildung der Therapeuten um pädagogische Inhalte erweitert werden, um den Schüler mit seinen Bedürfnissen und die Voraussetzungen zum Lernen besser verstehen zu können. Letztendlich geht es um die ganzheitliche Sichtweise auf das Kind mit seinen individuellen Voraussetzungen. Diese müssen von seinen Bezugspersonen erkannt werden und Reaktionen sollten folgen, damit die Umweltfaktoren passend für das Kind gestaltet werden können und nicht das Kind mit den vorgefundenen Gegebenheiten zurecht kommen muss. Eine Änderung der Passung wird damit erneut gefordert (vgl. ebd. 177). SOWA zeigt auf, dass auszubildende Lehrer nicht von sich aus Fragen der Therapie und Pädagogik miteinander verbinden (vgl. SOWA 1996, 191). Ein Blick in viele Klassenzimmer zeige, dass zwar häufig Aspekte des handlungsorientierten Unterrichts bedacht werden, dass aber trotzdem das Haupttätigkeitsmerkmal von Unterricht anscheinend immer noch darin bestünde, am Tisch, auf einem vielleicht unangepassten Stuhl sitzend, zu lernen (vgl. ebd. 191). Hinzu kommen Forderungen an die Aufmerksamkeit und Konzentration über einen von außen festgesetzten Zeitraum. Wurden in der Ausbildung die Basisfertigkeiten vermittelt, die für den Mut zur Annäherung in der Praxis von Vorteil sein werden, so legen gemeinsame Fortbildungen den Grundstein kooperativen Handelns. Fortbildungen können die Plattform für Konfliktbewältigung und Spannungsabbau darstellen. Die Gewährleistung eines regelmäßigen Austauschs zwischen den am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten in internen Fortbildungen, Teambesprechungen, Konferenzen und Supervisionen sorgt für einen neutralen Boden des Informationsaustauschs, Klärung von Unstimmigkeiten und zur Evaluation. Fächerübergreifende Bereiche, wie beispielsweise die 'Unterstützte Kommunikation', 'Hilfsmittelversorgung', 'Lagerung und ergonomisches Sitzen', das 'Konzept der bewegten Schule' oder 'psychosomatische Beschwerden bei Schulkindern' könnten Themen für gegenseitige Fortbildungen sein, die wiederum zum Verständnis der Zielsetzung und der Notwendigkeit von Kooperation beitragen. BOENISCH weist auf die Tatsache hin, dass "Kooperationsschwierigkeiten [...]- auch nach 20-jähriger Integrationsdiskussion- immer noch zu den größten Problemen im integrativen Unterricht zählen und nicht selten Integrationsmaßnahmen gerade an den zwischenmenschlichen Problemen im Team scheitern" (BOENISCH 1999, 347). Er fordert deshalb, dass "integrationspädagogische Aus- und Fortbildung stärker als bisher auf das Rollenverständnis von Integrationspädagogen und auf den Umgang mit Konflikten in der Teamarbeit vorbereiten [muss]" (ebd. 347). WOCKEN hält die "kooperative Selbstberatung" im interdisziplinären Team als am besten geeignete Form einer begleitenden Fortbildung" (ebd.). Teamarbeit sei Fortbildung. Eine Fortbildung, die tagtäglich bezogen auf reale Kinder und im Kontext der konkreten Situation stattfinde. Die stetige kollegiale Unterrichtskritik und Evaluation habe unmittelbaren Bezug zur eigenen Unterrichtspraxis. Die kooperativen Austauschprozesse von Unterrichtsteams seien "eine Ausbildungssituation par excellance, wo [...] Theorie und [...] Praxis eine denkbar enge Verbindung eingehen. In kooperativen Arbeitszusammenhängen sind die [Beteiligten] selbst 'Subjekte und Träger' ihrer eigenen Fortbildung" (WOCKEN 1988). Eine konkrete Umsetzung dieser "kooperativen Selbstberatung" (ebd.), in der Therapie und Pädagogik gemeinsam Fortbildungen organisieren und deren Essenz Kompetenzvernetzung und -transfer darstellt, könnte wie folgt aussehen. Das pädagogische Personal wird gemeinsam mit weiteren Bezugspersonen des jeweiligen Kindes von fachlich versierten Therapeuten beispielsweise hinsichtlich der Versorgung und des Umgangs mit adäquaten Hilfsmitteln, verschiedener Lagerungstechniken und dem Selbsthilfetraining angeleitet. Therapeut und Pädagoge organisieren und gestalten gemeinsame fachübergreifende Projekte, planen außerschulische Exkursionen, widmen sich gemeinsam der Bestimmung der Lernausgangslage sowie der Zielformulierung. Damit all diese interdisziplinären Prozesse gelingen, ist ein intensiver und kontinuierlicher Austausch zwischen den beteiligten Bezugspersonen und das konsequente Einbeziehen des Kindes unverzichtbar. Die erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen sollen im Folgenden dargestellt werden.
Nachdem vorab die von der Persönlichkeit der Kooperationspartner abhängigen und durch Aus- und Fortbildung fördernden Bedingungen aufgezeigt wurden, sollen im Folgenden erforderliche organisatorische Konditionen aufgeführt werden, mit deren Erfüllung Interdisziplinarität als Qualitätsmerkmal erst gelebt werden kann (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 163). Damit Kooperation in der Praxis funktioniert muss interdisziplinäres Zusammenwirken im Schulkonzept verankert sein und von Seiten der Schulleitung befürwortet und gepflegt sowie immer wieder neu auf Anspruch und Wirklichkeit hin geprüft werden. Interdisziplinarität fordert genau wie Inklusion die gemeinsame Einstellung, das Schaffen einer Teamkultur. Aufgrund dessen ist es essentiell wichtig, dass die Mitglieder einer Einrichtung 'Inklusion und Interdisziplinarität' nicht nur zu 'werbewirksamen' Zwecken einsetzen, sondern nach den damit verbundenen Werten leben. Nur so wirkt Kooperation funktional, nur so funktioniert Inklusion. Institutionell-konzeptionelle Kooperation muss integraler Bestandteil eines Arbeitsverständnisses sein. Zeitstrukturen und Zeiträume sollten für Teamarbeit geschaffen, ermöglicht und selbstverständlich werden. In einer anonymen und stummen Kultur werden kooperative und inklusive Situationen misslingen. Damit dem Kind alle erforderliche Zeit und Zuwendung zukommen kann, sollten finanzielle, räumliche und technische Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und die Zusammenarbeit absichern. Hohe Relevanz besitzen auf organisatorischer Ebene festgesetzte Verbindlichkeiten in Form gemeinsam erstellter Regeln des Umgangs miteinander, damit das interdisziplinäre Agieren in einem gemeinsam gestalteten Unterricht, der jedem Kind gerecht werden will, abgesichert ist. Fachspezifische Sichtweisen sind aufgrund intensiver Dialoge und Diskussionen untereinander bekannt und bereichern das multiprofessionelle Team. Gemeinsame Fortbildungen (siehe dazu Kap.6, 6.3) dienen der gegenseitigen Annäherung. Außerdem sollten außerschulische Aktivitäten, Projekte, Elternabende, Hausbesuche, Feste und Exkursionen gemeinsam organisiert und gepflegt werden, um den Zusammenhalt und die Beziehungen untereinander zu stärken (vgl. BEHRINGER/HÖFER 2005, 28f. und MAIER-MICHALITSCH 2009, 163f.). Eine optimale 'Besetzung' einer Lerngruppe besteht aus einer heterogenen Schülerschaft sowie aus heterogenen Lernbegleitern, die gemeinsam auf die vielfältigen Bedürfnisse eingestellt und abgestimmt sind. Zudem ermöglicht eine Vielfalt des Personals ein befriedigendes Arbeiten für ALLE. Faktoren, wie Stress, Hektik oder Überforderung treten reduzierter auf, wenn weder Mitarbeiter noch Schüler zeitlich, psychisch und physisch überfordert werden. Als Vorbild für gelungene Inklusion und funktionale Kooperation kann die kanadische Atlantik-Provinz New Brunswick dienen, da hier "dem Anspruch, allen Alles nahe zu bringen" (HINZ 2006, 149f.) entsprochen werde. Kontinuierliche soziale Beziehungen und verlässliche Bezugspersonen sprechen für ein funktional kooperierendes Team, das interdisziplinär handelt (vgl. ebd.). Hier ist die "wohnortnahe 'Schule für alle' seit den 1990er Jahren Realität [...] - ohne eine einzige Sonderschule und ohne jede Sonderklasse" (ebd.), aus diesem Grund spricht Andreas HINZ von dem "'Nordstern' in Sachen Inklusion" (HINZ 2006). In New Brunswick werden Fachpersonen nach Bedarf der Schülerbedürfnisse und nicht nach Bedarf von Situationen oder zum Besetzen von freien Stellen, eingestellt. Erst wird danach gefragt, wen oder was die Mitglieder einer Einrichtung benötigen, um partizipieren zu können. Das heterogen besetzte 'Student- Services- Team' berät sich und klärt Konflikte und Unsicherheiten in gemeinsamen Curricula, wie beispielsweise im Prozess des 'Teamteachings' (vgl. ebd.).
Die Zunahme an Heterogenität in der Klasse fordert zwar keine grundsätzlich andere Pädagogik, dennoch ist eine allgemeine Pädagogik, der ein gemeinsames Menschenbild, damit einhergehende Grundwerte und eine an der Verschiedenheit der Kinder orientierte Methoden- und Konzeptauswahl zugrunde liegen, notwendig. Eine inklusive Didaktik wird immer durch die Heterogenität der Menschen in der Schule bestimmt. Es geht also nicht um die Suche nach entsprechend geeigneten Unterrichtsmethoden, sondern gefragt wird nach einem passenden Rahmen, in dem Lernen in einer inklusiven Schule stattfinden kann. Essentiell ist die kreative Gestaltung einer allgemeinen Lernwelt, in der ALLE partizipieren können. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieses wichtige Thema nur angerissen werden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der schon vorhandenen theoretischen Auseinandersetzungen.
Zum einen werden die Ausführungen von FEUSER,WOCKEN und MARKOWETZ zur Didaktik mit heterogenen Lerngruppen und zum anderen der Beitrag von SEITZ zum "Kern der Sache" herangezogen, um sich der Didaktik und Methodik inklusiven Unterrichts zu widmen.
Mit dem "Haus der Vielfalt" (WOCKEN 2011) beschreibt WOCKEN drei Säulen der Inklusion. Die "Vielfalt der Kinder", die "Vielfalt des Unterrichts" und die "Vielfalt der Pädagogen" bilden demnach das Fundament von Inklusion und den Rahmen für inklusive Situationen (ebd. 112). Nachdem diese Arbeit sich zum größten Anteil mit der Säule der "Vielfalt der Pädagogen" und den damit verbundenen Potentialen beschäftigte, soll in diesem Unterkapitel den passenden didaktisch-methodischen Rahmenbedingungen für den adäquaten Umgang mit der 'bunten' Vielfalt Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ziel ist, einen inklusiven Rahmen zu schaffen, in dem sich alle Kinder (‚Vielfalt der Kinder') allgemeine Bildung (‚Vielfalt des Unterrichts') mit aktiver pädagogischer Unterstützung (‚Vielfalt der Pädagogen') aneignen können" (ebd. 116).
MARKOWETZ macht deutlich, dass eine inklusive Pädagogik den Anspruch habe, "in heterogenen Lerngruppen die didaktischen Merkmale einer bildungstheoretischen (nach KLAFKI), subjektiven (nach KÖSEL), handlungsorientierten (nach GUDJONS), kommunikativen (nach WINKEL) und systemisch-konstruktivistischen Didaktik (nach REICH) im Unterrichtsalltag zur Wirkung kommen zu lassen" (MARKOWETZ 2003, 168).
Aus ökosystemischer Sicht, auf der Basis des Kind-Umfeld-Bezuges, lautet dementsprechend die allgemeine Ausgangsfrage für alle am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten "Welche Bedingungen müssen in der Schule und in der Klasse verändert werden, um den besonderen und individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kindes gerecht zu werden?" (ebd. 170). Neben den beschriebenen Ausführungen verschiedener Autoren, stellt SEITZ in ihrem Beitrag über eine inklusive Didaktik die "Frage nach dem Kern der Sache" (SEITZ 2006) aus der Sicht der Kinder, die Ausgangspunkt aller Überlegungen darstellt. Die Kinderperspektiven bilden für sie den 'Startpunkt' eines didaktischen Suchprozesses und folgende Aspekte tragen entscheidend zum Gelingen bei. Zum einen spricht sie die Gemeinsamkeit und Verschiedenheit der Lernausgangslagen der Kinder, eine Auffächerung der Kinderperspektiven, Selbstähnlichkeiten als didaktischen Ausgangspunkt, und zum anderen didaktische Strukturierungen an. Eine heterogene Schülerschaft fordert ihres Erachtens zwangsläufig Multiperspektivität, denn eine Öffnung der Schule für ALLE verlangt ein Konzept, das getragen wird von der Akzeptanz der Vielfalt. Ein Unterricht, in dem ALLEN gemeinsames Lernen gelingt, wenn eine anregende Lernumgebung und vielseitige Lernbegleiter "das Lernen am gemeinsamen Gegenstand genauso wie das Lernen in gemeinsamen (inklusiven) Lernsituationen und das Lernen in individuellen (exklusiven) Lernsituationen ermöglichen" (MARKOWETZ 2003, 177f.). Ähnlich dem Konzept des therapieimmanenten Unterrichts, plädiert auch FEUSER für eine durchgängige Integration aller Fördermaßnahmen in den individualisierten und differenzierten Klassenunterricht, der nach dem Prinzip des Lernens am gemeinsamen Lerngegenstand strukturiert ist. Selbst additive Förder- und Therapiemaßnahmen müssen sich dabei auf den von der ganzen Klasse gemeinsam bearbeitenden Gegenstand beziehen. Alle Schüler sollen deshalb auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau durchgängig miteinander kooperieren und an einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten (vgl. FEUSER 2002 in MARKOWETZ 2003, 173f.). Allerdings gilt bei diesem Ansatz, dass alle am Prozess Beteiligten für das Erkennen der Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der Lerngruppe sensibel sind. Alle Angebote sollten dementsprechend "so offen gestaltet sein, dass die Kinder [...] (Lern-) Momente selbst entdecken und dabei handelnd zeigen können, was für sie 'Kern der Sache' ist" (SEITZ 2006). Ebenso wichtig ist, bei diesem Prozess zu erkennen, "dass gerade der gemeinsame Unterricht mehr ist als die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand und aus systemisch-konstruktivistischer Sicht heterogene Gruppen mit oder ohne (externe) Hilfe [...] durchaus in der Lage sind, sich selbst zu organisieren und Dinge zu Inhalten zu erheben..." (MARKOWETZ 2003, 175). Insbesondere Kinder mit geistiger und schwermehrfacher Behinderung seien bisweilen so mit sich selbst und der Umsetzung ihrer eigenen Handlungspläne beschäftigt, dass ihre kooperative Beteiligung im gemeinsamen Unterricht eigentlich von den Lehrkräften kaum für möglich gehalten, aber dennoch um jeden Preis zu organisieren versucht wird. Nach Ansicht MARKOWETZ' befördern solche Maßnahmen eine "pädagogische Scheinintegration und Scheinkooperation, die auf Dauer weder dem Anspruch auf Bildung gerecht werden noch dem pädagogischen Förderund Therapiebedarf entsprechen kann" (ebd. 176). Aufgrund dessen fordert er, "behindertensoziologisch [...] solche Pseudokontingenzen abzulehnen, da sie soziale Distanz und neue Formen der Stigmatisierung hervorbringen" (ebd. 176). Anerkennung und Einbezogensein als vollwertiges Mitglied einer (Lern-)Gruppe, die Teilhabe am Unterrichtsgeschehen, unabhängig von Fähigkeiten und Unfähigkeiten, führt zwingend zur der Anerkennung exklusiv- individueller Lernsituationen als Grundform des gemeinsamen Unterrichts. Darunter sind durchaus auch jene unterrichtlichen Sequenzen zu verstehen, die Lehrkräfte fremd- und vorherbestimmen, aber didaktisch so vorstrukturieren und persönlich begleiten, dass ein entwicklungsförderndes Spielen, Lernen, Arbeiten in einem individuellen Curriculum möglich wird. Für ebenso wichtig erachtet MARKOWETZ, dass speziellen pädagogisch-therapeutischen Momenten für die Entfaltung persönlicher Kompetenzen und lebensweltlich bedeutsamen Fähigkeiten sowie individuell spezifischen lebenspraktischen Fertigkeiten Raum und Zeit gegeben wird (vgl. ebd. 177). Den Entwicklungsprozess gefährdende und kontraproduktiv seien didaktische Konzepte, wie sie in der Praxis häufig noch durchgeführt werden, in denen Schüler, die 'schwer' an gemeinsamen Lernsituationen zu beteiligen sind, statt sie gemeinsam zu unterrichten mehr und mehr und schließlich dauerhaft individualpädagogisch an den Lerninhalten der Klasse und an den Kindern vorbei unterrichtet, gefördert und therapiert werden (vgl. ebd. 177). Integration und Inklusion muss heißen, Separation und sozialen wie inhaltlichen Ausschluss zu vermeiden. Dies erfordert neben einem multiprofessionellen Zusammenwirken einen 'echten' und vertrauensvollen Umgang miteinander, damit die spezifischen Kompetenzen uneingeschränkt in die Praxis der Inklusion eingebracht werden und dem Kind zugute kommen können. Während sich spezielle Konzepte zur Beschulung 'schwer behinderter' Kinder in Sondereinrichtungen zumeist in sogenannten 'lebenspraktischen' Kompetenzen erschöpfen, wird es in inklusiv arbeitenden Institutionen als selbstverständlich erachtet, dass jedes Kind das Recht hat, "alles Wichtige über die Welt zu erfahren, weil es in dieser Welt lebt" (FEUSER 1999 in SEITZ 2007, 206). Ausgehend von selbstähnlichen Grunderfahrungen konstituiere sich inklusiver Unterricht vielmehr aus den individuellen Lernmöglichkeiten jedes einzelnen Kindes, denn erst dann erschließe sich der Lerninhalt in seinen verschiedenen Dimensionen (vgl. SEITZ 2007, 207). Die Autorin spricht sich an gegen additive und vorgefertigte Verfahren aus, indem sie fordert, dass "alle Angebote [...] allen Kindern gleichberechtigt neben anderen angeboten werden [sollten] und dabei zu beachten ist, dass sie nicht als additive 'Sinnesschulungen' angeboten werden, sondern von den Kindern selbst aus der tieferen Bedeutung des Lerninhalts heraus entwickelt werden können" (SEITZ 2007, 208). WOCKEN (1998) stellt die Ausschließlichkeit des 'gemeinsamen Gegenstandes' als Basis einer inklusiven Didaktik in Frage. Seines Erachtens sieht der gemeinsame Unterricht neben dem gemeinsamen Gegenstand auch gemeinsame Lernsituationen vor (vgl. WOCKEN 1998 in MARKOWETZ 2003, 171). Als Ergebnis entwickele sich so eine Lockerung, die es allen Kindern ermöglicht, den Inhalts- und Beziehungsaspekt ihres Unterrichts mit individuellen und gemeinsamen Lernsituationen zu füllen und damit auch Art und Umfang der Kooperation mitbestimmen zu können (vgl. ebd. 175). Nach MARKOWETZ sei die Frage nach, "wie viel Gemeinsamkeit und wie viel Individualität in welchen unterrichtlichen Darbietungs- und Organisationsformen der Gleichheit und Verschiedenheit der Schüler im integrativen Unterricht gerecht werden, um eine solidarische Kultur" (ebd. 162) entfalten zu können, entscheidend. Seiner Ansicht nach liegt die Antwort auf diese Frage nicht nur in der konsequenten "Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand" (nach FEUSER) oder den "Gemeinsamen Lernsituationen" (nach WOCKEN), sondern in einer "Triangulation des Lernens" bestehend aus: "1. der Theorie des Lernens am gemeinsamen Lerngegenstand, 2. der Theorie des Lernens in gemeinsamen Lernsituationen und 3. der Theorie des Lernens in exklusiv- individuellen Lernsituationen" (ebd. 163). Diese Triangulation diene auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik und Didaktik als Integrations- und Balanceleistung bisheriger Vorstellungen eines integrativ wirksamen und gemeinsamkeitsstiftenden Unterrichts (vgl. ebd. 178). Wie in Kapitel 5 (vgl. Kap.5, 5.3) angekündigt, sollen an dieser Stelle die einzelnen didaktischen Prinzipien dargestellt werden, die zur Realisierung integrativer bzw. inklusiver Grundwerte im gemeinsamen Unterricht entscheidend beitragen. Einführend ist zu sagen, "dass die Prinzipien auf der Grundlage einer subjektiven Didaktik (nach KÖSEL) zu verstehen sind, als pädagogisches Konzept, dass das Subjekt, also den Schüler mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen, ins Zentrum der Didaktik rückt. Das Subjekt ist eingebunden in seine Lebenswelt und gebunden an seine strukturelle Organisation" (MATURANA/VARELA 1987 in BOENISCH 1999, 340). Diese Ausgangsbedingungen konstituieren, dass nicht der Pädagoge, Erzieher, Therapeut oder Erwachsene der Lehrende ist, sondern dass Lernwelten geschaffen werden, in denen sich die Kinder möglichst selbstständig Inhalte und Fähigkeiten entsprechend ihren Lern-voraussetzungen erarbeiten können.
-
Das "Prinzip der entwicklungslogisch-ganzheitlichen Didaktik" soll verdeutlichen, dass "einem kleinschrittigen Unterricht" (KUHNERT 1972 in BOENISCH 1999, 353) ein ganzheitlicher Unterricht vorzuziehen ist. Kleinschrittiges Vorgehen, welches in Förderschulen häufig Anwendung findet, steht immer in der Gefahr des ausschließlichen Lehrervortrags, bei dem der Schüler leicht den Gesamtzusammenhang und somit das Verständnis für den Lernstoff verlieren kann. Eine Übertragung in den Alltag fällt umso schwerer (vgl. BOENISCH 1999, 353).
-
Das "Prinzip der Handlungsorientierung" gewinnt mit der Zunahme an neuen Medien in der kindlichen Lebenswelt und dem "Lernen aus zweiter Hand" (BOENISCH 1999, 354) immer mehr an Bedeutung. Mit der Einbindung handlungsorientierter Methoden und Konzepte in den allgemeinen Unterricht erwerben alle Kinder sensorisch-integrative Basiskompetenzen (vgl. Kap.4, 4.2.5), die für den Auf- und Ausbau kognitiver, sprachlicher und motorischer Kompetenzen grundlegend sind (vgl. ebd. 354).
-
Das "Prinzip des Interessens- und Erfahrensbezuges" beinhaltet den schülerorientierten Unterricht. Das Wissen um die Beziehungen, das soziale Umfeld, die Bezugspersonen, die Interessen und die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers ist ebenso bedeutsam, wie die Fähigkeit zur Empathie und der Kooperationsbereitschaft mit der Lebenswelt des jeweiligen Kindes (vgl. ebd. 354).
-
Das "Prinzip der Kommunikation und Interaktion" versteht Unterricht als "Lernen durch Kommunikation und Interaktion". Prozesse des Austauschs und der Auseinandersetzung mit anderen Menschen ermöglichen allen Beteiligten eine Stärkung der Ausdrucksfähigkeit und der Sozialkompetenz. Erwachsene, als Begleiter des Entwicklungsprozesses des Kindes, dienen dem Kind als Vorbild, als Modell für den Umgang miteinander, Kommunikation und Kooperation. Sie haben als Bezugsperson die wichtige Aufgabe, Beziehungen vorzuleben. Vom "Primat der Beziehungsseite" (REICH 1997 in BOENISCH 1999, 354) ist die Rede, in der die Inhaltsebene der Beziehungsebene im Unterricht generell untergeordnet ist (vgl. ebd. 354). Die Unterstützung kommunikativer und sozial-emotionaler Fähigkeiten stellt ein wichtiges Handlungsfeld der am Entwicklungsprozess Beteiligten dar, weil zu beobachten ist, dass sie bei vielen Kindern nur noch 'rudimentär' vorhanden sind. Kinder zeigen große Schwierigkeiten, Gefühle und Bedürfnisse sprachlich, gestisch und mimisch auszudrücken. Da "die Entwicklung des Ausdrucksverhaltens [...] stark vernetzt mit der emotionalen und der sozialen Entwicklung [ist]" (HAUPT 1996 in BOENISCH 1999, 354f.) kommt dem "Prinzip der Kommunikation und Interaktion", der Entwicklung und Erweiterung sozialer und emotionaler Kompetenzen in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung zu, um Inklusion als Ergebnis von Respekt, Solidarität und Toleranz überhaupt erst möglich zu machen.
-
Das "Prinzip der kritisch-konstruktiven Unterrichtsgestaltung" drückt die Selbsttätigkeit aus, die für ALLE die Basis bildet, sich im kritisch-konstruktiven Unterrichtsprozess die eigene Wirklichkeit und die individuellen Möglichkeiten der Verwirklichung des eigenen Lebens grundlegend selbsttätig und selbstbestimmt anzueignen (vgl. REICH 1997 in BOENISCH 1999, 355). "Schlüsselqualifikationen dafür sind Handlungs-, Demokratie-, Entscheidungs-, Verantwortungskompetenz und Autonomie" (BOENISCH 1999, 355).
-
Das "Prinzip der Modellierung von Lernwelten" behandelt die adäquate und individuelle Passung der Lernumgebung und -angebote. In diesen gestalteten und modellierten Lernwelten wird zwar themen- aber nicht methodengleich gearbeitet (vgl. ebd. 356). Lernort und Lernbegleiter werden passend für das jeweilige Kind gestaltet.
-
Das "Prinzip der Differenzierung und Individualisierung" hat die Anerkennung der vorhandenen Heterogenität in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen zum Thema. Nach BOENISCH liegt "das pädagogische Ziel [...] in der Überwindung selektierender Organisationsformen des Schulwesens durch individuelle Anpassung des Lernstoffs an das Leistungsniveau des Schülers sowie der Ausnutzung der sozialen Vorteile heterogener Lerngruppen" (ebd. 356f.).
-
Das "Prinzip der Gemeinsamkeit" impliziert die Gestaltung pädagogischer Bildungsprozesse, mit dem Ziel, eine Balance zwischen Verschiedenheit zuzulassen und Gemeinsamkeiten zu schaffen und zu finden. Bereits an anderer Stelle wurde dazu das "Lernen am gemeinsamen Gegenstand" (nach FEUSER) und der "Individualisierung des Einzelnen ohne das Gemeinsame zu verlieren" (nach WOCKEN) dargestellt (vgl. BOENISCH 1999, 357).
-
Das "Prinzip des Zwei-Pädagogen- Systems" konstituiert, dass offene Unterrichtsmethoden, der individualisierende und differenzierende Anspruch an Unterricht und die Forderung nach kontinuierlicher Förderdiagnostik sowie der engen Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, das traditionelle Aufgabenfeld von Regelschulpädagogen erheblich erweitern. Unterstützung erfahren sie deshalb von Fachkräften anderer Berufsgruppen. Diese bringen ihre jeweiligen Kompetenzen aus ihren unterschiedlichen Professionen zur Gestaltung eines inklusiven Unterrichts mit ein und bereichern sich dabei fach- und disziplinübergreifend. Dieser Kompetenztransfer führt zu einer erweiterten Professionalität im Prozess der Unterrichtsplanung und - durchführung. Die Arbeitsteilung erfolgt dann nicht mehr nach dem Status der Anstellung, sondern nach den Kompetenzen der erforderlichen Bedürfnisse (vgl. ebd. 357f.).
-
Das "Prinzip des ökologisch-systemischen Bezuges" besagt, "dass es nicht um die Integrationsfähigkeit des Kindes geht, sondern um die Integrationsfähigkeit der Schule" (ebd. 357). Wie bereits ausführlich in dieser Arbeit dargestellt (vgl. Kap.5, 5.5), hebt der öko- systemische Ansatz die Lebenswelt des Kindes hervor, um alle didaktischen und erzieherischen Aspekte zur Entfaltung kommen zu lassen. Zur Lebenswelt zählt in diesem Zusammenhang nicht nur die Eltern- Kind- Beziehung und der außerschulische Freundeskreis, sondern auch die Systembedingungen, in denen das Kind oder der Jugendliche beschult wird. Integrations- und Inklusionsprozesse sind immer abhängig von der Bereitschaft der Mitarbeiter, im Team kooperativ zusammenzuarbeiten, von den Kompetenzen des anderen lernen zu wollen, seinen Unterricht zu öffnen und nicht zuletzt von der schulamtlichen Zusage beziehungsweise juristischen Absicherung, dass die begonnene Inklusion auch noch nach der Primarstufe 'gültig' ist (vgl. ebd. 358).
-
Das "Prinzip der Transdisziplinarität" reiht sich an, um der Frage auf den Grund zu gehen, ob all diese Prinzipien allein von pädagogischen Mitarbeitern, einem homogenen Team aus Lernbegleitern umzusetzen sind oder ob eine heterogene Schülerschaft nicht auch ein Kollegium mit vielfältige Kompetenzen erfordert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Vielfalt gerecht zu werden? Die Realisierung inklusiver Grundwerte setzt einen gezielten Umgang mit Heterogenität voraus, legt dabei großen Wert auf Differenzierung und Individualisierung und verzichtet auf das Prinzip der Homogenität. Aus diesem Grund benötigt die inklusive Schule keine bestimmten Methoden oder Konzepte, vielmehr wird eine weitgehend flexible, differenzierte Anwendung unterschiedlicher Unterrichtsmethoden und organisatorischer Vorschläge in interdisziplinärem Zusammenwirken notwendig, um den Bedürfnissen aller Schüler gerecht werden zu können. Ansätze und Ideen für die konkrete Umsetzung einer "Didaktik der Potentialität" (SEITZ 2006) ist Anliegen des folgenden Unterkapitels.
"Je schwerer die Behinderung ist, umso notwendiger braucht ein Kind die vielfältigen Anregungen der nichtbehinderten Kinder, deren Bewegungen es mit den Augen verfolgen kann, deren Geräusche es mit den Ohren wahrnimmt, deren Gerüche es mit der Nase unterscheiden lernt, deren Hände es am eigenen Körper spürt" (SCHÖLER 1988 in HINZ 2007, 16).
Dieser Teil der Arbeit soll Ideen und Ansätze für einen pädagogisch-therapeutischen Unterricht im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit aufzeigen. Die konkreten Beispiele stellen eine Handreichung für die Praxis dar und sind Ergebnis und Veranschaulichung der dargelegten theoretischen Analyse. Grundsätzlich kann eine Realisierung indirekter Unterstützung in Form von Therapieimmanenz in der Arbeit mit gegenwärtigen pädagogisch-therapeutischen Konzepten, wie dem der "Chefstunde" (KLÖCKENBERGER 2010) oder der "Bewegte Schule" (ILLI 1995), unter Beachtung der individuellen Rhythmisierungsbedürfnisse stattfinden. Die detaillierte Darstellung der genannten Konzepte, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, eine intensive Auseinandersetzung mit der zugrundeliegenden Literatur vor einer geplanten Umsetzung wird allerdings empfohlen. Im Folgenden soll sich dem Krankheitsbild der Infantilen Cerebralparese (ICP) gewidmet werden, um anhand dessen die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns im gemeinsamen Unterricht aufzuzeigen. SCHMEICHEL gibt einen Einblick in die Geschichte des Zusammenwirkens verschiedener Berufsgruppen. Er zeigt auf, dass bereits "ALBERT HOFFA (+1907) die Bedeutung interdisziplinären Zusammenwirkens sehr differenziert in seinen Ansichten über die Behandlung der spastischen Gliederstarre, der infantilen Zerebralparese, beschrieben [hat]. Der Wert pädagogischer und psychologischer Einflüsse für die Kinder zeigt sich für HOFFA, wenn wohldosierte emotionale Zuwendung und Erfolgserlebnisse in der Kommunikation mit dem sprachbehinderten Kind das Interesse für Sprache und die Wahrnehmungsfähigkeit für Umweltgegebenheiten steigern können" (GROSCH 1969 in SCHMEICHEL 1983, 4). Mit der wachsenden Zuständigkeit der Orthopädie für Patienten mit komplexen Schädigungen unterschiedlicher Genese werde die Mitarbeit vieler Fachkompetenzen als notwendig anerkannt (vgl. SCHMEICHEL 1983, 3). Der ELTERNRAT DER LEBENSHILFE macht folgende Forderungen deutlich:
"Menschen mit schwerer Behinderung und hohem Hilfebedarf [...] gesellschaftliche Rechte ohne Wenn und Aber [haben]. Sie haben das Recht auf ein Leben in Würde. Sie haben das Recht auf Respektierung ihrer Einzigartigkeit. Sie haben das Recht auf Sinnerfüllung, Wohlbefinden und Lebensglück. Sie haben das Recht auf Bildung, Förderung, Begleitung und Unterstützung. Sie haben das Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sie haben das Recht auf Wahlmöglichkeiten, zu entscheiden, was ihnen gut tut, wie, wo und mit wem sie leben wollen. Wir alle müssen dazu beitragen, dass diese Rechte erlebbar werden" (ELTERNRAT DER BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 2002 in MÜLLER-ERICHSEN 2007, 9).
Diese Erwartungen, die Eltern für ihre Kinder beanspruchen, spiegeln die Notwendigkeit der indirekten Unterstützung durch Therapieimmanenz im gemeinsamen Unterricht wider. Oberstes Ziel muss sein, die Partizipation ALLER durch interdisziplinäres Zusammenwirken zu ermöglichen. FEUSER und SCHÖLER plädieren für einen gemeinsamen Unterricht und "wenden sich gegen Tendenzen zur Therapeutisierung und zu sonderpädagogischer Künstlichkeit in gesonderten Strukturen, in denen das fehlende Anregungspotenzial Gleichaltriger durch strukturierte Maßnahmen mit Förderung und Therapie zu kompensieren versucht wird" (vgl. FEUSER 1992 UND SCHÖLER 1988 IN MÜLLER-ERICHSEN 2007, 16). Kindliches Lernen findet am effektivsten im Alltag, im Umgang mit Mitschülern und beim Lösen von vielfältigen Alltagsherausforderungen statt. Zudem führt das 'aktive, bewegte Lernen' zu einer höheren Motivation und bewiesenermaßen zu nachhaltigem Lernen. Körperliche Aktivitäten in Verbindung mit Elementen aus der Rhythmik, die in den Unterrichtsalltag integriert werden, stellt für ALLE eine geeignete und bedeutsame Unterstützung des Lernens dar. Diese Aussage soll im Folgenden begründet werden.
Wie in den vorherigen Kapiteln deutlich wurde, stellt "Bewegungsförderung" die größte Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie dar. Die Unterstützung und Förderung von Bewegung als Maßnahme und Voraussetzung zum Lernen ist sowohl Anliegen der neuropsychologisch ausgerichteten Therapie, als auch ein Prinzip der pädagogisch- ganzheitlichen Förderung. Durch bewegungsunterstützende Maßnahmen, individuell ausgerichtete Adaption der Ausgangsposition, des Materials und der Versorgung mit benötigten Hilfsmitteln durch fachkundige Mitarbeiter, wird eine Regulierung des Muskeltonus erreicht und zielgerichtete Bewegung, Haltungskontrolle, Fokussierung und Konzentration erst möglich. Dieser Balance kommt eine große Bedeutung im Zusammenhang mit dem Lernen zu, denn Körperspannung gilt als Voraussetzung für Bewegung und die wiederum zählt zum elementarsten Bereich des Menschen, der, verbunden mit der Wahrnehmung, für das Kind den Ausgangspunkt bildet, die Umwelt zu erfahren, zu erkunden, sich mit ihr vertraut zu machen und in diesem Prozess Selbstvertrauen zu erlangen. Bewegung befähigt den Menschen, selbstbestimmt und zielgerichtet zu handeln, die Umwelt zu begreifen und sie mit zu gestalten. Das Kind lernt handelnd, es lernt in und durch Bewegung. Da die kindliche Entwicklung ein komplexer Vorgang ist, bei dem sich die verschiedenen Bereiche, Wahrnehmung, Motorik und Sprache gegenseitig bedingen, verstärken und hemmen, also in enger Wechselwirkung zueinander stehen, ist eine ganzheitliche und umfassende Betrachtung sogenannter 'Auffälligkeiten' von elementarer Bedeutung und Aufgabe des interdisziplinären Teams (vgl. HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 21). Das Kind kann nur dann Aktivitäten wahrnehmen und sich auf das Geschehen im Unterricht einlassen, wenn es sich in seiner momentanen Körperhaltung wohl fühlt, möglichst frei von Schmerzen und Ängsten ist, Entspannung erfahren und in der Ausgangsposition willkürliche Bewegungen ausführen kann. Diese Voraussetzungen zum Lernen gelten für ALLE, nicht nur für Kinder und Jugendliche mit einer ICP. Offenkundig handelt es sich bei unterstützenden Maßnahmen nicht ausschließlich um Hilfestellungen für Kinder mit schwerster Behinderung. Allerdings ermöglicht eine Unterstützung in genau diesen Bereichen allen die volle Teilhabe am Lernen im allgemeinen Unterricht. Dabei kann unterschieden werden zwischen der direkten Intervention durch eine kompetente Person und der indirekten Unterstützung durch entsprechende Lagerung, Medien oder den Einsatz von Hilfsmitteln. Vergleichbar mit dem interdisziplinären Zusammenwirken im Blockteamkonzept (vgl. Kap.4, 4.2.1), wird eine heterogene Lerngruppe entsprechend ihrer individuellen Lernausgangs- und Bedürfnislagen personell und materiell 'besetzt'. Das fachkundige Team schafft mittels beschriebener Unterstützung für ALLE die Voraussetzungen zum Lernen. Um die Realisierung inklusiver Grundwerte im gemeinsamen Unterricht (GU) durch Therapieimmanenz zu untermauern, möchte ich komprimiert die Besonderheiten der ICP herausarbeiten. "Unter einer infantilen Cerebralparese versteht man eine sensomotorische Störung als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung" (SOWA/RISCHMÜLLER 1988, 9f.). Diese cerebrale Bewegungsstörung äußert sich zum einen in der Haltung als auch Bewegung des Kindes. Besonders zielgerichtete Handlungen, das Aufrechthalten des Rumpfes und die damit verbundene Blickfokussierung, fallen den Kindern aufgrund des unregulierten Muskeltonus schwer. Das Lernen stellt einige Herausforderungen an das Kind. Beim Prozess des Schreibens fällt das Greifen und Halten des Schreibwerkzeugs und beim Verfolgen von Unterrichtsinhalten im Klassenraum (der Blick zur Tafel, die Kopfkontrolle, Blickfokussierung), schwer. Beim Prozess des Lesens muss die jeweilige Zeile mit den Augen verfolgt und gegebenenfalls das Buch, Arbeitsblatt, etc. fixiert werden. Im Bereich der Mathematik stellen selektive Fingerbewegungen als Zählhilfe und das Erkennen der Rechenkästchen Herausforderungen dar. Diese Beispiele aus dem (Schul-)Alltag des Kindes zeigen, wie komplex Unterrichtsinhalte aus Sicht eines Kindes teilweise ausfallen können. Diese könnten um etliche (Unterrichts-)Situationen erweitert werden. Entscheidend und ausschlaggebend für den Einsatz therapieimmanenter Maßnahmen ist, dass im engen Beziehungsgeflecht all diese komplexen Sachverhalte Auswirkungen auf die soziale, kommunikative, emotionale und psychische Entwicklung des Kindes haben. Genau aus diesem Grund ist es von enormer Wichtigkeit, dass auch Kinder mit einer 'schweren' Erkrankung in einem Kontext lernen, der sie nicht 'krank' macht, sondern unterstützend und entwicklungsförderlich wirkt. Dabei ist zu beachten, nach der Prämisse 'so viel wie nötig und so wenig wie möglich' zu handeln, damit sich ALLE in der Lebenswelt Schule psychisch und emotional sicher, stabil und vor allem selbstbestimmt entwickeln können. Aktive und passive Mobilisation zur Kontrakturprophylaxe, Muskelkräftigung und -dehnung zur Steigerung der Bewegungsfähigkeit und Reduzierung von Muskeldystrophie sind unverzichtbar, damit die Gesundheitsförderung des Kindes im Zentrum steht und bei allen negativen Auswirkungen einer ICP, die Lebensqualität soweit wie möglich erhalten bleibt. Allerdings ist im Gegensatz zu künstlich vorbereiteten Einzelbehandlungen bei der Form therapieimmanenten Unterrichts, die sinnstiftende Integration in den Alltag des jeweiligen Kindes entscheidend.
Das Kind sollte verstehen, wofür es was macht, es somit nicht behandelt, sondern gemeinsam mit ihm gehandelt wird. Die Therapeuten, als vollwertige Mitglieder des Teams, stellen im Rahmen therapieimmanenten Unterrichts, wichtige Bezugsperson und Interaktionspartner für alle Kinder und Erwachsenen dar. Die Vertrauensbasis darf nicht nur zwischen den speziell zu fördernden Kindern und der Therapeutin entstehen, sondern muss zwischen ALLEN geschaffen werden, ansonsten widerspricht dieses Konzept dem inklusiven Gedanken. Das stellt eine große Herausforderung dar. Einer gesamten Lerngruppe mit der angewandten Methode gerecht zu werden, darin steckt Ziel und Aufgabe des therapieimmanenten Unterrichts. Übergeht man diese Forderung, so wird nach kurz oder lang das additive Modell dominieren, in dem das Kind mit Unterstützungsbedarf aus seinem Klassenverband herausgezogen und separat behandelt wird (vgl. Kap.4, 4.2.2). Weitere Ausgangslagen und Bedingungen einer heterogenen Lerngruppe, die für die Integration pädagogisch-therapeutischer Momente sprechen, sowie Argumente für interdisziplinäres Handeln als Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Unterricht, sollen im Folgenden dargestellt werden. Statt an dieser Stelle die Symptome des Krankheitsbildes der ICP und für notwendig erachtete Therapie- und Fördermaßnahmen zur Behandlung dieser, aufzuführen, soll sich einzelnen Funktionsbereichen des Menschen zugewendet und daran die besonderen Bedürfnisse sowie das Potential therapieimmanenter Maßnahmen im gemeinsamen Unterricht für ALLE aufgezeigt werden.
Tonus und Haltung
Für alle Schüler besitzt ein Wechsel der Ausgangslage und Lernposition ausschließlich Vorteile. Der Mensch besitzt nicht die entsprechende körperliche Konstitution für langes Sitzen. Die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes ist seit langer Zeit ein Thema, mit dem sich Mediziner, Therapeuten, Arbeitgeber und Krankenkassen beschäftigen. Schüler sollen sich fünf Tage die Woche so statisch wie möglich auf einem unangepassten Holzstuhl sitzend konzentrieren. Um ALLEN, Kindern wie Erwachsenen, Raumerfahrungen und eine Balance zwischen Dynamik und Statik zu ermöglichen, sollte ein Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitspositionen innerhalb des Unterrichtsalltags stattfinden. Wieso sollte das Lernen nur an Stuhl, Tisch und Tafel gebunden sein? Auch ein Arbeiten in Bauchlage, Rückenlage, im Schneidersitz, stehend oder gehend ist möglich und durch Studien, wie "Bewegte Schüler - bewegte Köpfe - Unterricht in Bewegung- Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit?" von BREITHECKER (2002), belegt. Im Bereich der Forschung steht eine umfassende, systematische Überprüfung der Auswirkungen einer "Bewegten Schule" zwar bisher noch aus, einige empirische Arbeiten weisen aber auf vielfältige positive Effekte hin (BREITHECKER 2002; DORDEL 2000; GRÖBERT/KLEINE/PODLICH 2002; KAHL 1993; MÜLLER 2000). Zusammenfassend kann man sagen, dass mehr Bewegung im Schulalltag der Gesundheit und Entwicklung aller Kinder dient. Bewegung trägt nicht nur zu einer Steigerung der Lern- und Leistungsfähigkeit, sondern darüber hinaus auch zur Rhythmisierung bei - zu einem kontinuierlichen Wechsel von Statik und Dynamik (vgl. BREITHECKER 2002). Speziell im Primarstufenalter, vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr, fällt es Kindern schwer, über mehrere Minuten volle Aufmerksamkeit und Konzentration aufzubringen. Noch immer ist bei vielen Erwachsenen die Vorstellung des 'idealen Schülers' präsent, der rezeptiv aufmerksam und eher motorisch passiv dem kognitiv vermittelten Stoff zugewandt ist. Die körpersprachlichen Botschaften, die von Kindern zumeist unbewusst ausgesandt werden, lösen beim Gegenüber häufig Irritationen aus und werden entgegen der wahren Ursache als sogenannte 'Disziplinstörungen' wahrgenommen. Anflüge von schwacher Konzentration verbunden mit motorischer Unruhe im Unterricht sind Gegenstand von vielen unterschiedlich begründeten Lehrerklagen. Stillsitzende Kinder werden vom Lehrer als konzentriert und aufmerksam wahrgenommen. Viele Lehrkräfte fühlen sich angesichts spontaner motorischer Aktivitäten, wie dem Kippeln, diverser Klopfgeräusche mit Finger oder Schreibwerkzeug, Räkeln oder Gähnen, im Unterricht provoziert und respektlos behandelt. Ihren Ursprung haben diese Handlungen allerdings in einer Missachtung der individuellen Bedürfnisse, denn diese Tätigkeiten dienen dem Kind zur Regulation seines eigenen Rhythmisierungsdrangs. Die Konzentrationsschwäche ist ein hervorstechendes Charakteristikum der heutigen Schülerschaft. Hinzu kommen Hinweise auf eine erhebliche psycho- physische Belastung, der Kinder in der Schule ausgesetzt sind, wenn ihnen zusätzlich zu den ergonomisch ungünstig gestalteten Arbeitsplätzen ein wenig kindgemäßes Arbeitsverhalten abverlangt wird (vgl. Studie von BÖS/OPPER/WOLL 2002). Der Stundenrhythmus im 45-Minuten-Takt, sowie traditionelle lehrerorientierte Unterrichtsformen wie der Frontalunterricht, entsprechen weder den Rhythmisierungsbedürfnissen der Kinder, noch einer kindgerechten Pädagogik. (Heilpädagogische) Rhythmik (THEUNISSEN 2005, 158) ist konzeptionell vielfältig zu realisieren (durch Musik, Szenisches Spiel/Theater, Bewegungsspiele, Wahrnehmungsübungen etc.). Das Konzept der "Bewegten Schule" (ILLI 1995) erkennt die individuellen Rhythmisierungsbedürfnisse als Voraussetzung für das Lernen an, da Haltung, Lagerung, Arbeitsplatzgestaltung, Hilfsmitteleinsatz und Wechsel der Ausgangslagen einen wichtigen Beitrag leisten. Rhythmik bietet durch seine Variationsvielfalt allen Schülern individuelle Entwicklungsräume. Rhythmus hilft bei Bewegung, beim Ordnen und Gliedern von Bewegungs- und Handlungsplanung. Damit kann auch bei Kindern und Jugendlichen mit cerebralen Bewegungsstörungen eine Verbesserung der motorischen Kontrolle ermöglicht werden. Die Wahl der Unterrichtsmethode spielt zur Umsetzung der individuellen Rhythmisierungsbedürfnisse eine große Rolle. In offenen, schülerorientierten Unterrichtskonzepten lässt sich das Konzept der "Bewegten Schule" oder die "Chefstunde" besser umsetzen, als in stark strukturierten und lehrerzentrierten Unterrichtsformen. Für alle Kinder, auch denen mit cerebral bedingten Bewegungseinschränkungen, gilt, dass sie während des Schulalltags häufiger einen 'Lagerungswechsel' und damit den Wechsel zwischen Entspannung und Anspannung erfahren. Im körpernahen Umgang gelingen Entspannungsformen am effektivsten. Damit eine Vertrauensbasis zwischen den Schülern untereinander und zu den Erwachsenen entsteht, bietet sich die Annäherung durch pädagogischtherapeutische Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele an, die beispielsweise von SOWA mit "Die Autowaschstraße" (SOWA 1996, 112f.) oder von HORST und HORST mit dem "Hamburger Spiel" (HORST/HORST 2000, 115f.), dem "Kuchenbacken" (ebd. 81) oder einer Art des "Parcours" (ebd. 58f.) beschrieben werden.
Körperschema/ Körperwahrnehmung
Ein ausgeprägt entwickeltes Körperbewusstsein fehlt heutzutage vielen Kindern. Normalerweise wird es durch natürliche Bewegungserfahrungen mit dem eigenen Körper erworben. Aufgrund des beschriebenen Mangels an sinnlichen und sinnvollen Bewegungen, fehlen solche Erfahrungen bei (Schul-)Kindern vermehrt. Schwierigkeiten bei Haltungskontrolle, bilateralen Tätigkeiten, Koordination und in den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen können die Folge sein. Kinder mit einer infantilen Cerebralparese, sind durch die einhergehenden Bewegungsbeeinträchtigungen nur bedingt in der Lage, ihren Körper eigenständig zu erfahren und in verschiedene Stellungen zu bringen. Im Rahmen des GU kann den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Körper bewusst zu erleben und gezielt zu bewegen. Das Ziel ist, die Teilhabe ALLER. Realisiert werden kann dieser pädagogisch- therapeutische Anspruch unter dem Thema "Bewusstmachung des Körpers und der Körperteile- Umfahren der Körperumrisse", wie es von SOWA (1996, 116f.) beschrieben wurde. Mit Hilfe des Mitschülers, werden bei der Tätigkeit die eigenen physischen Begrenzungen erfahren. Bei dieser Art von Reizgebung werden die Bereiche der Kinästhetik angesprochen. Wichtig ist auch hier, dass das Kind als Ganzes, als Einheit 'angesprochen' wird.
Handlungsplanung
Die Planung und Umsetzung komplexe Handlungsabläufe fällt Kindern zunehmend schwer. Seien es Tätigkeiten aus dem täglichen Leben, wie das Anziehen und Zähneputzen oder die Bewältigung unbekannter Abfolgen, wie zum Beispiel das Schälen einer Gurke oder Annähen eines Knopfes. Als Betrachter dieser Tätigkeiten gewinnt man das Gefühl, als 'wisse die eine Hand nicht, was die andere mache'. Motorische Koordinationsübungen, wie der 'Purzelbaum' oder 'Hampelmann' werden zur Herausforderung. Dieses Phänomen lässt sich bei vielen Kindern beobachten und macht deutlich, dass einige zweckmäßige Bewegungsabläufe entweder verlernt oder gar nicht gelernt wurden. Bei Kindern mit cerebral bedingten Koordinations- und Konzentrationsschwierigkeiten können durch häufiges Demonstrieren und Wiederholen gleicher Bewegungsmuster, die Handlungsabläufe nach und nach verinnerlicht, Handlungsplanung entwickelt und damit Bewegung gelernt werden. Im Unterricht sollte genügend Raum und Zeit zur Übung und Differenzierung von Bewegung zur Verfügung gestellt werden, damit sich die medialisierten Kinder der heutigen Zeit wieder aktiv erfahren, was der eigene Körper in der Lage ist zu leisten.
Sozialverhalten und Kommunikation
In unserer heutigen Gesellschaft benötigen nicht ausschließlich Schüler mit Migrationshintergrund oder cerebral bedingten Sprach- und Sprechbeeinträchtigungen Unterstützung in der Kommunikation. Vermehrt stellen der mimische, gestische und verbale Ausdruck von Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen für viele Kinder eine große Herauforderung dar. Diese zunehmende 'Sprachlosigkeit' gilt auch als Verursacher und Verstärker für unsoziales und herausforderndes Verhalten. FOKUS ONLINE berichtet 2009 über das, "was Schüler krank macht". Wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Schülern. "Bereits jedes fünfte Kind hat psychosomatische Beschwerden, schon Erstklässler leiden unter Erfolgsdruck und Sozialstress ursächlich bedingt durch Ängste" (FOKUS ONLINE 2009). Angst sei aber nicht der einzige Grund für die Beschwerden. Viele Kinder leiden unter Mobbing, sind sozialer Ausgrenzung und Aggressionen ausgesetzt. Im Folgenden möchte ich die Ziele indirekter Unterstützung durch Therapieimmanenz in den Bereichen Sozialverhalten und Kommunikation für ALLE aufzeigen, um das Potential zu verdeutlichen. Für Schüler mit schweren Beeinträchtigungen im Bereich der Kommunikation und des Sozialverhaltens bedeutet der gemeinsame Unterricht eine wesentliche Unterstützung zur Sprach- wie Persönlichkeitsentwicklung, da sie in diesem Rahmen auf ein sprechendes und stabiles soziales Umfeld treffen, das ihre Mimik und Gestik, die grafischen Zeichen auf einer Kommunikationstafel oder die Worte einer elektronischen Sprechhilfe verstehen, richtig deuten und 'übersetzen' kann. Ein Umfeld, das gegenseitiges Verständnis und Vertrauen vorlebt und einfordert. Nur so erleben sich alle Kinder nicht mehr 'sprachlos'. Den Erfolg birgt und verleiht die heterogene Gruppe von Mitschülern. Die Stärkung bei Ängsten und unsicherem Verhalten, wie die Begleitung von Konflikten und Krisen erfolgt durch indirekte Unterstützung fachkundiger Bezugspersonen. An dieser Stelle wird die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit erneut transparent. Die besonderen Bedürfnisse, die sich in sogenannten 'Auffälligkeiten' äußern, bedürfen einer fachkundigen Intervention. Inklusion kann nur gelingen, wenn sich ALLEN und ALLEM gestellt wird. Ein Ausschluss und Aussonderung dieser 'System-Gefährdenden' in diverse Sondereinrichtungen, gefährdet Inklusion.
Vitalität und Kraft
Adipositas und Hypotonie bei Kindern nimmt stetig zu. Die Ursachen von Adipositas im Kindes- und Jugendalter sind neben genetischen Faktoren das menschliche Verhalten sowie Umwelt- und Lebensbedingungen. Übergewichtige Kinder sind nicht nur dem Risiko von Folgeerkrankungen ausgesetzt, sondern auch einem erhöhten Leidensdruck. In unserer heutigen mediengesteuerten Gesellschaft, in der Fußball 'gezockt' oder 'geglotzt', statt selber gespielt wird und in der Haustiere nicht mehr ausgeführt und versorgt werden, sondern über die neuen Medien nun virtuell auf- und erzogen werden, stellen Sauerstoffmangel, Bewegungsarmut, Kraftlosigkeit und ungesunde Ernährung die Ursachen und Risiken für Adipostias, Hypotonie und Konzentrationsschwächen dar. Die Zunahme des Fernseh- und Computerkonsums steht in direktem Zusammenhang mit der Zunahme des Übergewichts. Körperliche Inaktivität und gleichzeitiger Verzehr kalorienreicher Nahrungsmittel, zusätzlich angeregt durch die Werbung, äußert sich in einer allgemein schlaffen Körperhaltung und Passivität. Im Lebensraum Schule zeigen sich die Auswirkungen dieses Lebensstils und es gilt, diese häuslichen Versäumnisse auszuhalten, aufzuarbeiten und in gewisser Weise aufzuholen. Auch hier findet die Arbeit mit dem Konzept der 'Bewegten Schule' unter Beachtung individueller Rhythmisierungsbedürfnisse seine Berechtigung. Durch unterrichtsintegrierte Bewegungs- und Kräftigungsübungen können Körperspannung und spezifische Muskelgruppen in Verbindung oder im Wechsel mit kognitiven Anforderungen angesprochen werden. Bei aller Förderung und Forderung der beschriebenen Bereiche ist der "totale Verzicht auf jedwede Stimulation mit 'nacktem', d.h. aus dem Beziehungskontext herausgerissenen Reizen" (MILANI-COMPARETTI/ROSER 1982) entscheidend. Das Kind muss "als Protagonist, als Hauptakteur seiner eigenen Entwicklung" (ebd.) angesehen und anerkannt werden. Nach Ansicht der Autoren dienen 'sinnlose' Reize "nicht dazu, den Aufbau von Autonomie zu fördern, sondern behindern im Gegenteil die Eigenaktivität des Kindes" (ebd.). Vielmehr soll es darum gehen, die Vorschläge des Kindes wahrzunehmen, sie aufzunehmen und mittels Gegenvorschlägen in einen Dialog zu treten. Die von MILANI-COMPARETTI als "parametro propositivo" (Parameter des Vorschlags) bezeichnete "kreative Differenz zwischen Vorschlag und Gegenvorschlag" (MILANI-COMPARETTI 1985) führe dazu, dass die beteiligten Partner im dialogischen Prozess nie wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, sondern "gemeinsam etwas Neues entwickeln (Zustand der Kreativität)" (ebd.). Die Vermeidung reiner Stimulationsgaben in Form von Maßnahmen und Übungen wird zugunsten eigener Erfahrungen gefordert. "Nicht Übung, sondern Erfahrung!" (ebd.). Mit der Aussage: "Das Bewusstsein der Ganzheitlichkeit verbietet jede isolierte Funktionsförderung [...] einer umschriebenen Störung, die nicht in den Gesamtzusammenhang der physio-psychosozialen Situation des Kindes eingebettet ist" (ebd.) wendet sich MILANI-COMPARETTI eindrücklich gegen künstlich geschaffene isolierte Funktionsund Fördermaßnahmen. Zusammenfassend ist zu betonen, dass eine direkte oder indirekte Unterstützung in den beschriebenen Bereichen zu einer Steigerung der Lebensqualität ALLER führt.
Abschließen möchte ich diesen Teil meiner Arbeit mit den eindrücklichen Worten des chinesischen Philosophen KONFUZIUS (551 - 479 v. Chr.), der konstatiert, dass Lernen und Bewegung schon seit jeher zusammen gehören:
"Erzähle es mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun und ich verstehe."
"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht", besagt ein afrikanisches Sprichwort.
Wie einleitend beschrieben, benötigt jede Pflanze, jedes Individuum gewisse Komponenten, um 'gut' gedeihen zu können. Wasser, Luft und Sonne sind manchmal rar und können nicht aus eigenen Kräften heraus beschaffen werden. Benötigt wird Pflege und Unterstützung. Auf das Individuum übertragen bedeutet es, dass jedes Kind für 'gutes Gedeihen', eine 'gute' Umgebung, einen 'guten' Umgang und gute' Wegbegleiter und deren Unterstützung, braucht, die statt Zug und Druck auszuüben, durch ihre besonderen Kompetenzen und Erfahrungen, neben Wasser auch Wärme geben. Das Kind wird es mit Vertrauen gegenüber der Bezugsperson danken und damit die wichtigste Voraussetzung zum Lernen schaffen: die Bindung.
Das Kind muss bei jeder Entscheidung und allen Handlungen immer im Mittelpunkt stehen. Es ist dabei aber nicht nur ein stummer und passiver Genießer, sondern der eigentliche Experte seiner spezifischen Situation. Neben den erwachsenen Mitgliedern des interdisziplinären Teams, nimmt das Kind in der Rolle des Begleiters, Beraters oder Freundes einen hohen Stellenwert für den Anspruch einer multiprofessionellen und ganzheitlichen Pädagogik ein. Sich einem inklusiven Leitbild zu verpflichten beinhaltet für die volle Teilhabe ALLER Sorge zu Tragen. Dies erfordert, dass neben medizinisch-therapeutischem Personal ebenso das Kind integraler Bestandteil des interdisziplinären Teams ist.
Persönliche Konkurrenz- oder Rivalitätsgefühle und räumliche Distanzen müssen zum Wohle des gemeinsamen Nenners, des Kindes, genauso überwunden werden, wie das Verweilen im eigenen Kompetenzbereich aus augenscheinlicher Bequemlichkeit. Das 'echte' Interdisziplinarität auch immer mit Unsicherheiten und Ungewissheiten einhergeht, muss man als ausgebildete Profession erst lernen. Uns Erwachsenen ist auch hinsichtlich dieser Kompetenz das Kind erneut weit voraus und dient als großes Vorbild - das lernende und unvoreingenommene Kind als Mitglied einer heterogenen Lerngruppe. Das offene Kind im gemeinsamen Unterricht. Homogenität ver - führt zum Verweilen in eigenen Gefilden, Heterogenität fordert und fördert die Weiterentwicklung ALLER.
Es ist ersichtlich geworden, dass die Zunahme an Heterogenität in der Klasse keine grundsätzlich andere Pädagogik fordert, sondern eine an der Verschiedenheit der Kinder orientierte 'gute allgemeine' Didaktik durch ausgewählte Methoden und Konzepte, die gemeinsam unter Werten entwickelt wurde, an die alle Beteiligten glauben. Inklusionspädagogik hat den Anspruch an eine dynamische Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Perspektiven auf "das Heterogenitätsgeflecht von Lerngruppen" (SEITZ 2006). Aus ökologisch- systemischer Sicht auf der Basis des Kind-Umfeld-Bezuges ist dementsprechend die adäquate Passung pädagogische Bedingung. Barrieren im unmittelbaren Umfeld müssen beseitigt werden, um den besonderen Förderbedürfnissen gerecht zu werden. Macht man sich diese mehrperspektivische Herangehensweise zu Nutze, so werden aus Lehrern und Therapeuten Weg- und Lernbegleiter, deren Interesse und Neugier dem Kind und dessen unterschiedlichen Wegen zum Lernen gilt. Statt dem Blick durch die 'Defizit-Brille', können mit Blick durch die 'Neugier-Brille', "Kategorisierungen nach 'Begabungen', 'Behinderungen' oder sonderpädagogischen Förderbereichen didaktisch überwunden werden zugunsten einer "Didaktik der Potentialität" (ebd.), in der Kinder (mit Hilfe der Unterstützung, die sie benötigen) die selbstverständliche Chance erhalten, ihre individuellen Begabungsreserven auszuschöpfen und sich selbst in sozialer Eingebundenheit [...] weiterzuentwickeln" (SEITZ 2006). Nicht nur im Schulsystem herrscht ein Passungsproblem, ebenso passen die Grundwerte der Inklusion und die Entwicklungen auf gesellschaftlicher Ebene (noch) nicht zusammen. Es stellt sich die mir die Frage: "Sind wir noch nicht bereit für Partizipation statt Segregation?". Worin die Distanzierung und Abgrenzung zwischen medizinischen und pädagogischen Berufsgruppen, begründet ist, konnte (historisch) aufgearbeitet werden, jedoch ist es im Zuge der Inklusion an der Zeit, sich auch wirklich ALLEN zu öffnen, niemanden auszuschließen. Auch Barrieren, wie Gehalt, Arbeitszeit und Angestelltenstatus sollten zugunsten funktionaler Kooperation angeglichen und damit aufgehoben werden. Soziale Ungleichheit schafft nicht nur Frustration, sondern stärkt auch Konkurrenzgefühle, die Kooperation behindern und 'echte' Interdisziplinarität verhindern. Der Leidtragende ist das Kind, das eingeteilt in Systemen 'gehalten' wird und sich dort doch Jedes auf seine Art einem 'Förder- bzw. Therapiemarathon' unterziehen lassen muss. Es ist ein Trugschluss, dass Schüler von Regeleinrichtungen keinen Bedarf an besonderer Unterstützung haben. Auch diese Kinder strömen nach Schulschluss, begleitet von den Eltern, in diverse Förderstätten, von Nachhilfe über Lerntraining bis zur Hochbegabten-Förderung. Um diesem 'Therapiemarathon', den damit einhergehenden Stigmatisierungsprozessen entgegenzuwirken und gleichzeitig den Bedürfnissen ALLER gerecht zu werden, halte ich unterrichtsimmananente therapeutische Momente für sinnvoll und begründet.
Wie in dieser Arbeit ersichtlich wurde, ist die Hemmschwelle, medizinisches Personal, speziell Therapeuten als vollwertige Mitglieder des Teams allgemeinbildender, freier, alternativer Schulen aufzunehmen und anzuerkennen, noch recht hoch. Pädagogen scheinen es zu bevorzugen, unter ihresgleichen zu bleiben, eine Zusammenarbeit mit Berufsgruppen wie Erziehern, Heilerziehungspfleger, usw. wird dagegen akzeptiert. Unterstützend versperren oft persönliche Dispute, finanzielle und vor allem bildungspolitische 'Schranken' den Weg zur 'echten' Interdisziplinarität.
Einen gelungenen Weg und hoffnungsvollen Ausblick für die Realisierung verschiedenster Forderungen dieser Arbeit sehe ich im Konzept des Kompetenzzentrums (siehe dazu Kap.4, 4.2.7).
In erster Linie steht der Mensch in der Rolle des Schülers, des Patienten, des Kindes seiner Eltern im Mittelpunkt. Bereiche, wie Schule, Familie und Freizeit bilden sich um das Kind herum und beeinflussen sich teilweise gegenseitig. Im System 'Schule' bilden Unterricht und Therapie partiell eine Einheit hinsichtlich gemeinsamer Räumlichkeiten und eines einheitlichen gemeinsam erstellten Förderkonzeptes. Obwohl Eltern, Therapie und Unterricht sich in einem fließenden Austausch und Kooperation befinden, bleiben sie eigene Disziplinen, die ihre Schwerpunkte zur positiven Entwicklung des einzelnen Kindes beisteuern. Eltern werden in den Prozess der Konzeptionsentwicklung mit einbezogen und Pädagogen und Therapeuten veranstalten gemeinsame Fortbildungen, die auch partiell für Eltern geöffnet werden. Die Pädagogen sind darauf angewiesen, dass die Therapeuten durch ihre Arbeit die Voraussetzungen zum Lernen unterstützen. Die Therapeuten sind darauf angewiesen, dass der Informationsaustausch über das jeweilige Kind mit dem Pädagogen gelingt. Zielsetzung und Mittelpunkt jeglicher Konzepte sollte die Erreichung von Eigenaktivität und Selbstständigkeit des Kindes sein (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 92).
Bei allen Entscheidungen ist das Prinzip der Passung zu be- achten. Es darf nicht darum gehen, das Kind passend für die jeweilige Schule zu machen, sondern es muss darum gehen, die Lernwelt, die Umwelt an das Kind anzupassen, es indirekt zu unterstützen und auf seinem Weg zu einem selbstbestimmten Menschen zu begleiten.
Wie in dieser Arbeit ersichtlich wurde, benötigen nicht nur Schüler Unterstützung und Begleitung, auch den Lernbegleitern sollte stets hochqualifizierte Hilfestellung zur Verfügung stehen. Kooperation ist 'ein harter Job' und ein stetiger Lernprozess. Wie in Kapitel 4 deutlich wurde, führt die Heterogenität der Schülerschaft und die damit verbundenen Unsicherheiten und Überforderungstendenzen der Pädagogen dazu, dass sie die Lösung in einer Art 'Eigenfortbildung' das Konzept der 'Sensorischen Integrationstherapie' nach Ayres aneignen, mit dem Ziel sich zu helfen und den Bedürfnissen der Schülerschaft gerecht werden zu können. Mir stellt sich die Frage, ob diese Vorgehensweise Sinn der Sache sein kann. Meiner Auffassung nach verdeutlichen diese und ähnliche Umstände den Unterstützungsbedarf der Pädagogen und führen zu klaren Forderungen an die Aus- und Fortbildungsstätten pädagogischer und therapeutischer Berufe.
Im Zuge der Integration und Inklusion stellt die Interdisziplinarität im multiprofessionellen Team eine Notwendigkeit dar, um den Bedürfnissen der Kinder und Pädagogen gerecht zu werden, die Gesundheit zu fördern und sich gegenseitig zu unterstützen. Aktuelle Modelle, wie die Einrichtung Mobiler Dienste oder die Anstellung von Unterstützungslehrern, sind bedarfsorientiert und haben zum Ziel, stundenweise bestimmte Schüler individuell zu fördern, um damit den Pädagogen zu entlasten. Allerdings zeigt die Realität, dass solch 'halbherzige Teilzeitjobs' vielmehr dazu führen, dass Ängste und Überforderungen mehr werden und Inklusion als 'schwere Last' empfunden wird. Teamkompetenzen müssen bereits in der Ausbildung erworben und eingeübt werden, damit angehende Therapeuten und Pädagogen auf ihr zukünftiges Berufsbild eingestellt sind und eine Basis für funktionale Kooperation im gemeinsamen Berufbild geschaffen werden kann. Kontraproduktiv ist die Einstellung, die Therapie und einer mit ihr in Verbindung gebrachten Defektorientierung aus der Pädagogik komplett zu verbannen, sich von ihr zu distanzieren. Dies widerspricht den Grundwerten der Inklusion und den Forderungen der UN- KONVENTION. Ich halte es für wichtig, bereits im Rahmen der Ausbildung Vielfalt und deren Umgang kennenzulernen. Eine große Bereicherung könnten fachübergreifende Seminare darstellen, die von therapeutischen wie pädagogischen Berufsgruppen besucht werden. Weiterhin stelle ich mir im medizinisch-therapeutischen und pädagogischen Ausbildungsbereich, die abwechselnde oder gemeinsame Leitung und Planung von Veranstaltung durch therapeutisches und pädagogisches Fachpersonal sehr interessant und maßgeblich wegleitend für spätere Kooperationsfähigkeit vor. Genauso interessant wie notwendig halte ich beispielsweise eine Einführung in die Unterstützte Kommunikation durch ein Therapeuten- Pädagogen- Schüler- Team, welches den konkreten Umgang mit den Kommunikationsmitteln im Unterricht darstellt. Wünschenswert wären langfristig gesicherte Sonderabkommen beziehungsweise Rahmenverträge mit den Krankenkassen, die eine gemeinsame Finanzierung zusammen mit den Sozialhilfeträgern und Kultusministerien sicherstellen und damit jedem Schüler und Pädagogen unabhängig seines Bundeslandes ausreichende unterrichtsimmanente Therapie und der Einrichtung entsprechend dem jeweiligen Bedarf ausreichend Personal zur indirekten Unterstützung gewährleisten (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 99).
Finanzielle Ressourcen sollten bereitgestellt werden, damit der 'Rezept-Druck', den Krankenkassen verursachen, Ärzte verspüren und Therapeuten erleben, sich nicht auf die Kinder überträgt und in mangelhafter Unterstützung auswirkt. Sind Therapeuten angestellte und vollwertige Mitglieder des Teams, so verbessert dies nicht nur die Zusammenarbeit, sondern steigert auch Effektivität und Prävention. Grundsätzlich sollten in allen Bundesländern einheitliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen herrschen und eine konstante und langfristige Anstellung bei einem der heterogenen Schülerschaft angemessenen Stellenschlüssels sichergestellt sein, damit nicht nur die Schüler, sondern auch die Pädagogen von einem heterogenen Team aus Bezugspersonen profitieren. Dies bedeutet einen Ausbau der Vollzeitstellen, statt das derzeitige Therapieangebot auf rein abrechnungsfähige Therapiestunden zurückzuschrauben. Es ist notwendig, dass Therapeuten, Psychologen, Erzieher oder Pflegekräfte keine Sonderstellung erfahren, sondern unabhängig von ihrer Ausbildung, integraler Bestandteil eines Pädagogen- Teams sind. Nur so kann Interdisziplinarität funktionieren und die Teilhabe ALLER gewährleistest werden.
Von Seiten des Kultusministeriums ist eine allgemeine Aufklärung für ALLE über die Bedingungen und Voraussetzungen des Lernens notwendig, um die Immanenz pädagogisch-therapeutischer Unterstützung zu rechtfertigen und diesem Konzept Wertschätzung entgegenzubringen. Das Modell der 'abgekapselten' Therapeuten in ihrer Einzeltherapie prädestiniert die Finanzträger nämlich erst dazu, ihren Beitrag zum Isolierungsprozess der Therapeuten zu leisten. Therapeutische Leistungen werden mit der Zeit immer mehr aus dem allgemeinen Katalog und integrierten Angebot der Schule herausgenommen und in niedergelassene Praxen ausgelagert. Im Interesse der Eltern, die verwirrt im 'Therapie- und Förderdschungel' festsitzen, der Beschäftigten, deren Belastungsgrenzen erreicht sind und vor allem der Schüler, bei denen der 'Therapiemarathon' in der Freizeit zur völligen Erschöpfung und Frustration führt, sollte diesem Trend entgegengewirkt werden, um den Lebensraum Schule für ALLE qualitativ zu verbessern. Die KMK (Kultusministerkonferenz) sollte therapeutische Zielsetzungen, die Einfluss auf die pädagogische Arbeit und die interdisziplinäre Kooperation haben, in ihre aktuellen Empfehlungen mit aufnehmen, damit auch auf bildungspolitischer Ebene die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns transparent wird (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 342). Eine allgemeine Empfehlung, wenn nicht sogar einer als notwendig deklarierte Bedingung, wird eher nachgegangen und der 'glaubt' man eher, als einer Empfehlung unter Kollegen. Zusammenfassend sind von allen Beteiligten, die an der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes teilhaben dürfen, wie den Ausbildungsstätten (Einblick in fachfremde Bereiche und in kooperative Grundlagen geben), den ausgebildeten Fachkräften (interdisziplinäre Handlungskonzepte umsetzen), den Trägern (Rahmenbedingungen verbessern), den Fachverbänden (fachliche Standards und fachübergreifende Weiterbildungsangebote verbessern), den Kostenträgern (Bereitstellen finanzieller Ressourcen) und der Bildungspolitik (rechtliche Basis zur Interdisziplinarität schaffen) qualifizierte Hilfen einzufordern und erforderlich (vgl. ebd. 343).
Innerhalb dieser Arbeit ist deutlich geworden, dass bei jeder Art von Beziehung und Beziehungskonflikt immer das Kind mit seinen Handlungszielen im Mittelpunkt allen Bestrebens stehen muss. THURMAIR fasst dieses Selbstverständnis zusammen, indem er erklärt, dass
"im Selbstverständnis von Interdisziplinarität [...] das Bestreben [liegt], alles verfügbare Wissen und Können zu mobilisieren, um herauszufinden, was für ein Kind und seine Entwicklung gut und wichtig zu tun ist. Wenn es darum geht, einem Kind zu helfen und seinen Eltern Unterstützung und Begleitung anzubieten, darf nichts außer Acht gelassen werden. Augrund der vielfältigen Eingebundenheit der kindlichen Entwicklung muss die [die Schule] dabei auf ein vernetztes Wissen zurückgreifen können, das der Komplexität der kindlichen Entwicklung und den Lernmöglichkeiten gerecht werden kann. Das setzt ein intensiv zusammenarbeitendes Team voraus. Die Fachkräfte erreichen durch den jeweiligen Kompetenz- und Wissenstransfer eine berufsübergreifende Kompetenz. Die einzelnen Fachbeiträge sollten nun in einem integrierten (Förder-) Konzept einfließen und somit entsteht etwas Neues" (THURMAIR 1991, 16f.).
Funktionale Kooperation ist essentiell notwendig um die Teilhabe am Lernen ALLEN zu ermöglichen. Bedingung für das Handeln nach inklusiven Grundwerten ist 'echte' Interdisziplinarität.
Zum Abschluss meiner Arbeit möchte ich an den Kern jeden pädagogisch wie therapeutischen Handelns erinnern und mit einem modifizierten Zitat von DREYER meine Arbeit abschließen.
"Es ist das behinderte Kind, von dem alle lernen können" (DREYER 1993, 31). Diese Aussage möchte ich aufnehmen und erweitern, denn es ist DAS Kind, von dem ALLE lernen können. Es ist DAS Kind, das ALLE verbindet. Wir müssen es ernst nehmen.
ALBERS, T. (2011): Mittendrin statt nur dabei: Inklusion in Krippe und Kindergarten. München: E. Reinhardt.
BACH, H./HESSE, G. (1983): Sonderpädagogik im Grundriss. Leipzig: Carl Marhold.
BEHRINGER, L./HÖFER, R. (2005): Wie Kooperation in der Frühförderung gelingt. München: Reinhardt.
BERGEEST, H./HANSEN, G. (Hrsg.) (1999): Theorien der Körperbehindertenpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
BERNDT, H. (1968): Zur Abgrenzung und Integration der medizinischen und pädagogischen Arbeit an KÖ-Schulen. In: Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie 15, Heft 5, 486-489.
BIESALSKI, K. (1909): Umfang und Art des jugendlichen Krüppeltums und der Krüppelfürsorge in Deutschland. Hamburg/ Leipzig.
BLEIDICK, U. (1978): Pädagogik der Behinderten- Grundzüge einer Theorie der Erziehung behinderter Kinder und Jugendlicher. 3.Aufl., Berlin.
BLOEMERS, W./WISCH, F.-H. (2004): Heilpädagogik- Glossar. Frankfurt a. M.
BOBAN, I./HINZ, A. (2003): Index für Inklusion - Lernen und Partizipation in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität.
BOENISCH, J. (1999): Schulische Integration körperbehinderter Kinder und Jugendlicher. In: Beergest, H./ Hansen, G. (Hrsg.): Theorien der Körperbehindertenpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 337-360.
BÖS, K./OPPER, E./WOLL, A. (2002): Fitness in der Grundschule. Förderung von körperlich sportlicher Aktivität, Haltung und Fitness zum Zwecke der Gesundheitsförderung un Unfallverhütung. Endbericht. Forschungsprojekt der Universität Karlsruhe.
BREITHECKER, D. (2000): Lust auf Schule - Lust auf lernen. Mehr Gesundheit und Wohlbefinden am "Arbeitsplatz Schule" - Ein Projektbericht. Haltung und Bewegung 20 (4), 27-33.
CLOERKES, G. (1997): Soziologie der Behinderten: Eine Einführung. Heidelberg.
DORDEL, S. (2000): Veränderte Lebensbedingungen = Reduzierte motorische Leistungsfähigkeit ? Ein Beitrag zur Entwicklung der Gesamtkörperkoordination von Grundschulkindern. Gesundheitssport und Sporttherapie 16 (6), 209-216.
DRAVE, W./RUMPLER, F./WACHTEL, P. (2000): Empfehlungen zum Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. In: Ebd. Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung. Allgemeine Grundlagen und Förderschwerpunkte (KMK). Würzburg, 97-141.
DREYER, P. (1993): Auch Therapie ist gelebte Beziehung. In: Das band. Zeitschrift des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. 6/1993, 29-32.
DUPUIS, G./KERKHOFF, W. (1992): Enzyklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und der Nachbargebiete. Berlin.
EBERT, D. (1986): Muss die Krankengymnastin in der Frühförderung körperbehinderter Kinder ihre Rolle neu überdenken? In: Leyendecker, Ch./Fritz, A.: Entwicklung und Förderung Körperbehinderter. Forschungsgemeinschaft "Das körperbehinderte Kind" e.V. Edition Schindele. Heidelberg, 292-303.
FEUSER, G. (1980): ohne Titel. In: Holtz, K.-L.: Sonderpädagogik und Therapie. Bericht der 16. Arbeitstagung für Dozenten an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen Ländern. Rheinstetten, 319-343.
FEUSER, G./MEYER, H. (1987): Integrativer Unterricht. Solms-Oberbiel (Jarick).
FEUSER, G. (1992): Integration und/oder Kooperation: Wohin mit der "Sonder-" Pädagogik? In: vds- Fachverband für Behindertenpädagogik- Mitteilungen des Landesverbandes Bremen.
FEUSER, G. (2002): Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: Eberwein, H./Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. 6. Aufl. Weinheim/ Basel: Beltz 2002, 280-295.
GIDONI, E.A./LANDI, N. (1989): Therapie und Pädagogik ohne Aussonderung. 5. Gesamtösterreichisches Symposium. In TAFIE (Hrsg.), 77-94.
GOLL, H. (1996): Transdisziplinarität. Realität in der Praxis, Vision in der Forschung und Lehre- oder nur ein neuer Begriff?.In: Opp, G./Freytag, A./Budnik, I. (Hrsg.): Heilpädagogik in der Wendezeit. Brüche, Kontinuitäten, Perspektiven. Edition SZH/SPC, 164-174.
GRÖBERT, D./KLEINE, W./PODLICH, C. (2002): Zufriedener durch "Bewegte Schule"? Sportpädagogik 26 (3), 38-42.
HAUPT, U. (1996): Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen im Spannungsfeld von eigenen Entwicklungsimpulsen und fremdbestimmter Anleitung. In: Dörr, G.: Neue Perspektiven in der Sonderpädagogik. Düsseldorf, 99-117.
HEDDERICH, I./DEHLINGER, E. (1998): Bewegung und Lagerung im Unterricht mit schwerstbehinderten Kindern. München.
HEDDERICH, I./HECKER, A. (2009): Belastung und Bewältigung in integrativen Schulen. Dortmund: Klinkhardt.
HINZ, A. (2006): Inklusion. In: Bleidick/Antor (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer, 2006, 97- 99.
HINZ, A. (2006): Kanada- ein 'Nordstern' in Sachen Inklusion. In: Platte, A./Seitz, S./ Terfloth, K. (Hrsg.): Inklusive Bildungsprozesse. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 149-158.
HINZ, A. (2007): Elementare Unterstützungsbedürfnisse als Herausforderung an inklusive Pädagogik. In: Hinz, A. (Hrsg.): Schwere Mehrfachbehinderung und Integration. Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Marburg: Lebenshilfe- Verl., 15-41.
HÖMBERG, N. (2003): Kompetenz und Akzeptanz... Aspekte beruflicher Qualifikation bei Pädagogen/innen, die Schülerinnen und Schüler mit schwersten Beeinträchtigungen in integrativen Klassen unterrichten. In: Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Nordrhein- Westfalen e.V. (2003) (Hrsg.): Körperbehindertenpädagogik. Praxis und Perspektiven. Meckenheim.
HOFMANN, C. (2007): Wie aus Unterrichtsstunden Therapieeinheiten werden- Zur Therapeutisierung des pädagogischen Alltags.: In: VHN Vierteljahreszeitschrift Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete . 76 (4), 278-284.
HOLLENWEGER, J. (1996): Reduktionismus und Defektorientierung. Vom interdisziplinären Umgang mit Unsicherheit. In: Opp, G./Freytag, A./Budnik, I. (Hrsg.): Heilpädagogik in der Wendezeit. Brüche, Kontinuitäten, Perspektiven. Edition SZH/SPC, 184-191.
HORST, B./HORST, F. (2000): Fehlstart in der Schule. Rückschlag im Leben. Sensorische Integration als Hilfe beim Schulstart. Zürich.
HÜTER-BECKER, A. (2000): Der Paradigmenwechsel in der Physiotherapie und das Bobath- Konzept. In: Krankengymnastik, 52 (2), 277-282.
ILLI, U. (1995): Bewegte Schule. Die Bedeutung und Funktion der Bewegung als Beitrag einer ganzheitlichen Gesundheitsbildung im Lebensraum Schule. Sportunterricht 44 (10), 404-415.
JANZ, F. (2007): "Das klappt schon irgendwie...!" Konzeption und Planung der interprofessionellen Zusammenarbeit im Klassenteam von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen. In: Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. 76. Jg., (4), 302-314.
KAHL, H. (1993): Bewegungsförderung im Unterricht. Einfluß auf Konzentration, Verhalten und Beschwerden (Befinden) - Evaluationsergebnisse. Haltung und Bewegung 13 (2), 36-42.
KALBHENN, F. (1982): 150 Jahre Bayrische Landesschule für Körperbehinderte 1832-1982. Festschrift. München.
KOBI, E. E. (1986): Therapie und Erziehung. Ein chronischer Beziehungskonflikt? In: Geistige Behinderung, 2 (1986), 82-93.
KÖCKENBERGER, H. (2010): Bewegtes Lernen. Lesen, Schreiben, Rechnen mit dem ganzen Körper. Die "Chefstunde". Dortmund: Borgmann.
KOSKE, K. (1991): Beschäftigungstherapie und Unterricht in den Schulen für Körperbehinderte: Versuch einer Annäherung. Bad Idstein: Schulz- Kirchner.
KRAWITZ, R. (1992): Pädagogik statt Therapie. Vom Sinn individualpädagogischen Sehens, Denkens und Handelns. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
KREIE, G. (1985): Integrative Kooperation: Über die Zusammenarbeit von Sonderschullehrer und Grundschullehrer. Weinheim/ Basel: Beltz.
KUHNERT, S. (1972): Prinzipien der Unterrichts- und Erziehungsarbeit bei Körperbehinderten. In: Bläsig, W./Jansen, G.W./Schmidt, M.H.: Die Körperbehindertenschule. Berlin 1972, 43- 57.
LESIGANG, C. (1983): Physiotherapie. In: Haupt, U./Jansen, G.: Handbuch der Sonderpädagogik. Pädagogik der Körperbehinderten. Band 8. Berlin, 271- 280.
LIENHARD-TUGGENER, P./JOLLER-GRAF, K./METTAUER SZADAY, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt.
MAIER-MICHALITSCH, N. J. (2009): Physiotherapie an Schulen für Körperbehinderte. Im Spannungsfeld von Medizin und Pädagogik. Eine theoretische und empirische Auseinandersetzung. Oberhausen: Athena.
MARKOWETZ, R. (2003): Alle Kinder alles lehren! Aber wie?- Maßnahmen der Inneren Differenzierung und Individualisierung als Aufgabe für Sonderpädagogik und Allgemeine (Integrations-) Pädagogik auf dem Weg zu einer inklusiven Didaktik. In: Schnell, I./Sander, A. (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Klinkhardt- Verlag, Bad Heilbronn, 167-186.
MATURANA, H.R./VARELA, F.J. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern/ München.
MEINHARDT, J. (1987): Gesammelte Aufsätze zur Aufgabe des Arztes in der Schule. Reihe: Medizin und Pädagogik. Erziehung und Wirklichkeit. Band 3. Düsseldorf.
MILANI-COMPARETTI, A. (1985): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit- Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Milani-Comparetti, 16-27.
MOSTHAF, U. (1983): Ergotherapie. In: Haupt, U./Jansen, G.W. (Hrsg.): Handbuch der Sonderpädagogik - Pädagogik der Körperbehinderten. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 280-289.
MÜLLER, C. (2000): Was bewirkt die bewegte Schule? In: Laging, R./Schillack, G. (Hrsg.): Die Schule kommt in Bewegung. Konzepte, Untersuchungen und praktische Beispiele zur Bewegten Schule. Baltmannsweiler: Schneider-Verl, 194-203.
MÜLLER-ERICHSEN, M./FRÜHAUF, T. (2007): Einleitung. In: Hinz, A. (Hrsg.): Schwere Mehrfachbehinderung und Integration. Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Marburg: Lebenshilfe- Verlag, 8-14.
NEUHÄUSER, G./KLEIN, F. (2006): Heilpädagogik als therapeutische Erziehung. Basel/ München: Ernst Reinhardt.
OPP, G. (1996): Sonderpädagogische Förderung. Leitbegriff neuer heilpädagogischer Konzept- und Organisationsentwicklung. In: Schmidt, H.-F./Wachtel, P. (Hrsg.): Sonderpädagogische Förderzentren. Grundlegungen, Erfahrungen, Ausblicke. Materialien. Würzburg 1996, 9-21.
OTTE, G. (1996): Weiterentwicklung kleiner Förderschulen zu Förderzentren ohne eigene Schülerschaft- dargestellt am Beispiel des Förderzentrums Leezen (Schleswig-Holstein). In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 47, H.10, 420-422.
REICH, K. (1997): Systemisch-konstruktivistische Pädagogik.: Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik. Weinheim/Basel: Beltz.
REISINGER-HAUBER, L. (1996): Das Blockteamkonzept. Ein Organisationsmodell für die Umsetzung gemeinsamen Unterrichts von schwerst- mehrfach- behinderten und anderen Schülerinnen und Schülern. In: Sowa, M./Rischmüller, A. (Hrsg.): Schule in Bewegung. Zusammenarbeit von Therapie (KG/BT) und Pädagogik an Schulen für Körper- und Geistigbehinderte. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 169-186.
SCHÄFER, T. (1900): Evangelisches Volkslexikon: zur Orientierung in den sozialen Fragen der Gegenwart. Velhagen&Klasing.
SCHMEICHEL, M. (1983): Begrenzung des Lebens durch fortschreitende Körperbehinderungein Problem der Erziehung. In: Fröhlich, A. (Hrsg.): Dokumentation zur Situation Schwerstbehinderter. Sonderheft der Zeitschrift für Heilerziehung und Rehabilitationshilfen. Staufen/Breisgau.
SCHMEICHEL, M. (1983): Geschichtliche Determinanten für heutige Ansätze. In: Haupt, U./ Jansen, G. W. (Hrsg.): Handbuch der Sonderpädagogik- Pädagogik der Körperbehinderten. Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, 3-13.
SCHÖLER, J. (1988): Nichtaussonderung von "Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen". Auf der Suche nach neuen Begriffen. In: Eberwein, H. (Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim und Basel: Beltz, 83-90.
SCHWEINS, H. (1996): Pädagogen und Therapeuten in der schulischen Förderung- unterschiedliche Berufe im Dienste einer gemeinsamen Aufgabe. In: Sowa, M./Rischmüller, A. (Hrsg.): Schule in Bewegung. Zusammenarbeit von Therapie (KG/BT) und Pädagogik an Schulen für Körper- und Geistigbehinderte. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 15-45.
SEITZ, S. (2007): Kinder mit "schweren Behinderungen" in der Grundschule. In: Hinz, A. (Hrsg.): Schwere Mehrfachbehinderung und Integration. Herausforderungen, Erfahrungen, Perspektiven. Marburg: Lebenshilfe- Verlag, 206-212.
SHAPLIN, J.T. (1972a): Team- Teaching: Versuch einer Definition. In: DECHERT (Hrsg.), 19-36.
SOWA, M./METZLER, N. (1988): Der therapeutisch richtige Umgang mit behinderten Menschen. Dortmund: Verlag modernes lernen.
SOWA, M. (1996): Lasst uns miteinander reden und handeln. Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Aus- und Fortbildung. In: Sowa, M./Rischmüller, A. (Hrsg.): Schule in Bewegung. Zusammenarbeit von Therapie (KG/BT) und Pädagogik an Schulen für Körper- und Geistigbehinderte. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 187-209.
SOWA, M./RISCHMÜLLER, A. (1996): Pädagogik und Therapie an der Schule für KÖ/GB Gemeinsamkeiten und differenzierte Schwerpunktsetzung. In: Sowa, M./Rischmüller, A. (Hrsg.): Schule in Bewegung. Zusammenarbeit von Therapie (KG/BT) und Pädagogik an Schulen für Körper- und Geistigbehinderte. Dortmund: Verlag Modernes Lernen, 47-65.
SPECK, O. (1998): System Heilpädagogik: Eine ökologisch reflexive Grundlegung. 4. Aufl. München/Basel.
STEDING, A./BECKER, H. (2006): Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie. Stuttgart: Thieme.
STOELLGER, N. (1997): Das Sonderpädagogische Förderzentrum - Darstellung und Erläuterung eines Reformkonzepts. In: Hasemann, K./Meschenmoser, H. (Hrsg): Sonderpädagogische Förderzentren. Entstehung, Praxis, Perspektiven. Hohengehren: Schneider, 23-29.
THEUNISSEN, G. (1991): Heilpädagogik im Umbruch. Freiburg i. Breisgau: Lambertus.
THEUNISSEN, G. (2005): Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Regensburg: Klinkhardt.
THOMA, P./REHLE, C. (2009): Inklusive Schule. Leben und Lernen mittendrin. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
THURMAIR, M. (1991): Die Wirksamkeit von Frühförderung und Fragen an ihr Konzept. In: Frühförderung interdisziplinär, 10. Jg., 87ff.
UN (2008): Gesetz zum Übereinkommen der Vereinigten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderung sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008, Teil II Nr. 35, 1419-145;. http://files.institut-fuer-menschen-rechte.de/437/Behindertenrechtskonvention.pdf
VERNOOIJ, M.A. (1992): Von der Sonderschule für Lernbehinderte zum sonderpädagogischen Förderzentrum- Fortschritt oder Täuschungsmanöver? In: Sonderpädagogik, 22, H.3, 148-156.
WILKENS, R. (1992): Frühförderung im Spannungsfeld von Medizin und Pädagogik. Pfaffenweiler: Centaurus.
WOCKEN, H. (1991): Integration heißt auch: Arbeit im Team. Bedingungen und Prozesse kooperativer Arbeit. In: Pädagogik 1/1991, 19-22.
WOCKEN, H. (2011): Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen - Baupläne - Bausteine. Hamburg: Feldhaus.
WÜRTZ, H./SCHLÜTER, W. (1914): Uwes Sendung: ein deutsches Erziehungsbuch, mit besonderer Berücksichtigung der Krüppel. Leipzig: F.C.W. Vogel.
ALY, M./ALY, G./TUMLER, M. (1987): Kopfkorrektur. Ein behindertes Kind zwischen Alltag und Therapie. Berlin. http://bidok.uibk.ac.at/library/aly-therapie.html, Stand: 29.11.2011, 10.54
ALY, M. (1987): Probleme behinderter Kinder- Therapie als Hilfe oder Hindernis. In: Wunder, M./Sierck, U. (1987): Sie nennen es Fürsorge: Behinderte zwischen Vernichtung und Widerstand. 2.Auflage. Frankfurt a. M. http://bidok.uibk.ac.at/bib/therapie/mabuse_aly-therapie.html , Stand: 27.10.2011, 11.01
BREITHECKER, D. (2002): Bewegte Schüler- bewegte Köpfe- Unterricht in Bewegung- Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit? http://www.haltungbewegung.de/Data/Sites/4/media/Dokumente/Schule/Projekte/BAG4_D.pdf, Stand: 08.05.2011, 11.21
DVE- DEUTSCHE VERBAND DER ERGOTHERAPEUTEN http://www.dve.info/fachthemen/definition-ergotherapie.html, Stand: 03.12.2011, 13.56
FOKUS ONLINE http://www.focus.de/schule/schule/psychologie/schulpsychologe-was-schueler-psychischkrank-macht_aid_434490.html, Stand: 05.01.2012, 16.20?
HOMEPAGE ASTRID- LINDGREN- SCHULE http://www.sos-lindgren.bildung-lsa.de/als-neu/index.html, Stand: 21.11.2011, 12.02
HOMEPAGE FACHSEMINAR FÜR SONDERPÄDAGOGIK REUTLINGEN http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1279050/index.html?ROOT=1171649, Stand: 30.11.2011, 11.03
HOMEPAGE KARDINAL-VON-GALEN-HAUS http://www.kv-galen-haus.de/762/foerderschule/schulkonzept.html, Stand: 21.11.2011, 11.54
HOMEPAGE LBZ http://www.sos-lbzkb.bildung-lsa.de/schule/therapie/physio--und-ergotherapie/index.html, Stand: 21.11.2011, 11.12
HOMEPAGE PÄDAGOGISCHES FACHSEMINAR KARLSRUHE http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1155777/, Stand: 29.11.2011, 12.43
HOMEPAGE SOPHIE-SCHOLL-SCHULE http://www.inklusive-schule.de/wSchultagung/Veranstaltungen/Kassel/Vortraege/Wiltrud-Thies_-Laenger-gemeinsam-lernen--die-Sophie--Schule--Schule-Giessen_-Kassel_25.11.10.pdf , Stand: 21.11.2011, 11.28
ICF-ENDFASSUNG2005 http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf, Stand: 13.11.2011, 15.07
IFP- INTERDISZIPLINÄRE FÖRDERUNGPLANUNG http://www.ilern.ch/wordpress/?p=292 , Stand: 14.12.2011, 13.31
SEITZ, S. (2006): Inklusive Didaktik: Die Frage nach dem 'Kern der Sache'. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr.1, 2006. http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/15/15, Stand: 06.12.2011, 09.19
THE FREE DICTIONARY http://de.thefreedictionary.com/immanent, Zugriff: 04.12.2011, 11.44
WOCKEN, H. (1988): Integrative Prozesse. In: WOCKEN, H., ANTOR, G. & HINZ, A. (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Bilanz eines Modellversuches. Hamburg. 437-448. http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-prozesse.html, Stand: 07.01.2012, 16.36
WOCKEN, H. (1988): Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen. http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-kooperation.html, Stand: 11.12.2011, 14.04
WOCKEN, H. (1995): Sind Förderzentren der richtige Weg zur Integration? Erschienen in: Die Sonderschule 1995, Heft 2, 84-93. Nachdruck in: Sonderpädagogik in Niedersachsen 1995, Heft 2, und in: Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz 25 (1995), Heft 3 http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-foerderzentren.html, Stand: 6.11.2011, 11.24
WOXIKON http://synonyme.woxikon.de/synonyme/therapie.php, Zugriff: 03.12.2011, 11.52
Quelle:
Meike Risau: Therapieimmanenter Unterricht - Unterrichtsimmanente Therapie. Interdisziplinarität als notwendige Bedingung inklusiver Pädagogik
Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen, Eingereicht beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt, Landesprüfungsamt für Lehrämter am: 30.01.2012. Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz. Zweitgutachter: Dr. Tanja Kinne
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 17.04.2013
