Diplomarbeit, eingereicht an der Leopold Franzens Universität Innsbruck am Institut für Psychologie bei Univ.Prof. Rainer Thurnher, Berlin, Dezember 2004
Inhaltsverzeichnis
- 1.Einleitung
- 2.Theoretischer und methodischer Zugang
- 3. Erklärung von Begriffen im Zusammenhang mit dem Diplomarbeitsthema
- 4.Philosophische Äußerungen zu Krankheit und Behinderung
- 5.Versuch einer psychologischen bzw. psychoanalytischen Annäherung an Sartres Begriff der Freiheit und Kierkegaards Begriff der Angst.
- 6. Lebensgeschichtliche Betrachtungsweisen und existentielle Äußerungen von Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung dargestellt am Beispiel von sechs Betroffenen.
- 7. Übergreifende und vergleichende Aspekte der Interviews
- 8. Schlussbetrachtung
- 9. Literaturverzeichnis
- 10. Abbildungsverzeichnis
- 11. Anhang
Die Psychologie ist eine "junge" Wissenschaft; Jahrhunderte lang war es die Aufgabe der Philosophen sich mit existentiellen Fragen auseinander zu setzen, wie etwa Fragen nach der Daseinsberechtigung, dem Daseinssinn oder nach dem Warum bestimmter Daseinsbedingungen. Was mich zu diesem oben genannten Thema inspiriert hat, ist die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Dasein als Frau mit Behinderung und die Frage, inwieweit Krankheit oder Behinderung als belastende Bedingungen bzw. Grenzsituationen erfahren und dargestellt werden bzw. als solche dargestellt wurden.
Welche Auswirkungen könnten Deutungen vom Sinn und Schaden des Krankseins für den kranken oder behinderten Menschen haben? Wie wirken sich gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen auf das Dasein der einzelnen - behinderten oder kranken - Person aus? Denn Behinderung und chronische Erkrankung sind nicht nur Gegenstand individueller Auseinandersetzungen. So beschreibt Lanzerath (2000) die Einflüsse der Gesellschaft auf die Bewertung des Krankheitsbegriffs als ernst zu nehmend. In seinem Buch "Krankheit und ärztliches Handeln" meint der Philosoph, Biologe und Theologe Lanzerath, dass ein Krankheitsbegriff, der auf Natur, Gesellschaft und Subjekt verweise, auch sein Verhältnis zu anderen Schlüsselbegriffen erschließe, wie Gesundheit, Lebensqualität oder Behinderung. Ein so entwickelter Krankheitsbegriff orientiere sich daran, Kranksein als eine Weise des Menschseins zu fassen, und zwar so, dass die kommunikative Komponente des seine Befindlichkeit mitteilenden Menschen wesentlich zur Konstitution von Krankheit gehört (Lanzerath, 2000).
Auch Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts, wie z. B. Jean Paul Sartre, begreifen das Sein des Einzelnen als immer schon durch die Gegenwart des Anderen konstituiert. Für Sartre ist das Für-Andere-Sein ein wesentliches Merkmal des Menschen. Dies beinhaltet, nach Sartres Theorie, dass jede Selbstwahrnehmung des Menschen, die versucht ihn in seinem gegenwärtigen Sein zu erfassen, von der Anwesenheit des anderen abhängt (Sartre, 1943/1991). Lässt sich daraus nicht die logische Schlussfolgerung ziehen, dass die Wahrnehmung des eigenen Selbst als ein durch Behinderung oder chronische Erkrankung geprägtes, auch (zumindest zu einem gewissen Teil) von gesellschaftlichem Denken beeinflusst wird?
Zweifellos ist unser alltägliches Denken dahingehend ausgerichtet, sich an Normen zu halten bzw. zu orientieren. Geschwindigkeiten dürfen nicht überschritten, Gesetze müssen gehalten, Durchschnittsmaße berücksichtigt werden. Wert- und Normvorstellungen sind Konstrukte heutiger und vergangener Gesellschaftsformen, "Normalität wird ... hergestellt, und in dieseKonstruktion von Normalität fließen Bilder von Norm-Menschen ein ..." (Rommelspacher, 2004, S.5). Menschen, die "aus der Norm" fallen, den Normalitätsdefinitionen nicht entsprechen oder den Alltag nicht in einer Weise gestalten können, wie ihn die Gesellschaft als "normal" definiert, werden an den Rand gedrängt, ausgegrenzt. Dazu gehören unter anderem alte, kranke oder behinderte Personen. Ausgrenzung passiert dabei auf zwei Ebenen: der gesellschaftlichen, z. B. durch Unterbringung in Heime, und der persönlichen Ebene, unter anderem in Form von Kontaktmeidung.
Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, anhand philosophischer Äußerungen die Problematik der Ausgrenzung und Bewertung sog. "normabweichender" menschlicher Existenz darzustellen. Anschließend werden Menschen mit Behinderung zu Wort kommen, um durch ihre "alltagsphilosophischen" Aussagen zum Begriff Behinderung und chronische Erkrankung die angesprochene Thematik zu ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Philosophen haben sich in vielfältiger Weise mit existentiellen Fragen auseinandergesetzt, und diese philosophischen Betrachtungsweisen können nicht unabhängig von der jeweiligen Kultur und Gesellschaftsform betrachtet werden. In dieser Arbeit soll nun jene existentielle Frage nach dem Einfluss von gesellschaftlichem Denken auf das eigene Erleben von Behinderung oder Erkrankung angesprochen werden.
Die Auswahl der im Anschluss zitierten Philosophen erfolgte nicht systematisch und kann bei weitem nicht als erschöpfend betrachtet werden. Dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Sie erfolgte vor allem auf Grund folgender Überlegungen: Friedrich Nietzsche hat sich zum Begriff Krankheit dezidiert geäußert, seine eigenen Erfahrungen mit einbeziehend. In der Philosophie des Georg Wilhelm Friedrich Hegel wird der Krankheitsbegriff ebenfalls analysiert. Jean-Paul Sartres Philosophie zum Begriff der Freiheit und Sören Kierkegaards Ausführungen zum Begriff Angst haben mich dazu bewogen, diese mit psychologischen bzw. psychoanalytischen Erklärungsversuchen zu abwehrendem Verhalten allem "nichtnormalen" gegenüber zu vergleichen. Des Weiteren wird Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, angeführt. Er wirkte zwar als Arzt und Psychotherapeut, kann aber auch als Philosoph bezeichnet werden, denn seine Werke zeichnen ein Bild des Menschen, das weit über gängige psychologisch-anthropologische Modelle hinausführt (Frankl, 1996).
Der in der Schweiz lebende und Philosophie betreibende Alexandre Jollien schreibt zum Begriff Behinderung aus der Sicht des Betroffenen. Er wird im folgenden wiederholt zitiert, da er aus dem Blickwinkel des so genannten "Nicht-Normalen" über die gesellschaftliche Trennung in normal/anormal philosophiert und in seinen Arbeiten auffordert, den Blick auf die "Normalität" zu überdenken.
Dirk Lanzerath, der bereits in der Einleitung erwähnt wurde, wird ebenfalls mehrmals angesprochen.
Philosophen wie Sartre, Nietzsche oder Frankl sind Denker des 19. bzw. 20. Jahrhunderts. Ihr Denken hat eine persönliche Prägung, ist vom eigenen Erleben mitbestimmt.
Durch die Nähe des existenzphilosophischen Denkens zum konkreten Erleben eines einzelnen werden die Grenzen zwischen Philosophie und Psychologie durchlässig, und fließen bei Nietzsche oder Sartre Ansätze einer Wissenschaft der Psychologie ein, so ist bei dem Psychiater und Psychologen Frankl besonders deutlich, dass seiner Psychotherapie ein philosophisch begründetes Menschenbild zugrunde liegt.
In "Das Leiden am sinnlosen Leben - Psychotherapie für heute" zitiert er folgendes:
"...es sind unsere Patienten, die ihre philosophische Problematik an uns herantragen" (Frankl, 1977, S.103).
Und Friedrich Nietzsche äußert in seinem Werk "Die fröhliche Wissenschaft":
Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen, wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie, und für den Fall, dass er selber krank wird, bringt er seine ganze wissenschaftliche Neugierde mit in seine Krankheit .... was wird aus dem Gedanken selbst werden, der unter den Druck der Krankheit gebracht wird? Dies ist die Frage, die denPsychologen angeht: und hier ist das Experiment möglich. (Nietzsche, 1982, S.10f)
Im Anschluss an die philosophischen Betrachtungsweisen soll anhand qualitativer Sozialforschung auf der Grundlage empirisch erhobenen Materials die theoretische Fragestellung nochmals angesprochen werden.
Nach Mayring (1999) gehen die Wurzeln qualitativen Denkens weit zurück: Aristoteles (384 -322 v. Chr.) wird hier immer wieder als Urvater bezeichnet, denn er steht für ein Wissenschaftsverhältnis, das die Gegenstände als dem Werden und Vergehen unterworfen ansieht, sie durch ihre Intentionen, Ziele und Zwecke verstehen will und damit auch Werturteile in der wissenschaftlichen Analyse zulässt. "Die Erforschung des Menschen - genauer der Seele - ist für Aristoteles die Krone der Wissenschaft. Dafür ist aber ein eigenerwissenschaftlicher Zugang vonnöten" (Mayring, 1999, S.3).
In Fallstudien wird Material gesammelt, das "Aussagen über konkrete Wirklichkeit undWahrnehmungen dieser Wirklichkeit durch konkrete Personen zulässt" (Abels, 1975, S.330). Ähnliches wie Abels äußert Lesch (2003), wenn er sich für eine narrative Ethik ausspricht. Seiner Ansicht nach bliebe jede Ethik erfahrungsarm, würde sie nicht zunächst ihre Aufmerksamkeit auf jene authentischen Geschichten lenken, die über die Hintergründe und Voraussetzungen unserer Werturteile, Sehnsüchte, Ängste und Urteilskriterien Auskunft geben. Durch das Interesse für den Einzelfall werden vorschnelle Verallgemeinerungen vermieden, und durch ihre Sensibilität für den Kontext überschreite sie [die narrative Ethik] die Grenzen des persönlichen Ideals und eröffne Gesprächsperspektiven für eine grundlegendere Debatte über die Konturen der Gesellschaft, in der wir leben möchten - so Lesch. Dabei könne gerade die Auseinandersetzung mit Behinderungen bei sich selbst und anderen zu einem kritischen Gespür für die Wahrnehmung von Urteilskonflikten führen, die über den Einzelfall hinaus zum Nachdenken anregen.
Im empirischen Teil der Arbeit werden Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zu Wort kommen; das heißt: Der theoretische Teil dieser Arbeit bestimmt die Auswahl der "Fälle": es werden Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sein, die befragt werden sollen - und hierfür scheint der Forschungsansatz der Einzelfallstudie geeignet.
Lamnek (1995) beschreibt die Einzelfallstudie als den elementaren empirischen Zugang des interpretativen Paradigmas zur sozialen Wirklichkeit, der die Einzelperson in ihrer Totalität ins Zentrum der Untersuchung zu stellen trachtet.
Merkmale qualitativer Methodologie in Einzelfallstudien sind Offenheit, Kommunikativität, Naturalistizität und Interpretativität. Ein wichtiger Aspekt der Offenheit bezieht sich auf die Entwicklung hypothetischer Aussagen: Die Generierung theoretischer Konzepte ist offen für die Interpretationen und Deutungen der Alltagswelt.
Der Forschungsansatz der Einzelfallstudie "verhindert die Stereotypisierung und vorschnelle Strukturierung der Daten" (Witzel, 1982, S.79), weil sehr konkret auf den individuellen Fall eingegangen werden kann und erst dessen Deutungen zu interpretierenden Vermutungen führen. Wichtig ist dabei, dass die Äußerungen der zu untersuchenden Person in der Erhebungssituation nicht durch prädeterminierte Konzepte des Untersuchers beeinflusst werden. Um die Offenheit in der Entwicklung theoretischer Konzepte und Hypothesen zu verwirklichen, muss der untersuchten Person die Chance eröffnet werden, sich authentisch, also unbeeinflusst und natürlich zu äußern.
In der Phase der Datenerhebung finden sich die Merkmale Naturalistizität und Kommunikativität wieder. D. h. die qualitative Forschung bedient sich kommunikativer Erhebungstechniken und naturalistischer Untersuchungssituationen, wie sie z. B. narrative oder problemzentrierte Interviews darstellen - Formen des qualitativen Interviews. Dabei darf es nicht bei der reinen Reproduktion der Kommunikationsinhalte bleiben; Einzelfallstudien sollen interpretierend und typisierend sein.
Ausführliche und intensive Kommunikation mit der untersuchten Person bzw. die Betrachtung von Kommunikation dieser Person macht wissenschaftliche Interpretation möglich, denn "die soziale Realität wird als gesellschaftlich, ihr Sinn also durch Interpretation und Bedeutungszuweisung, konstruiert und nicht objektiv vorgegeben aufgefasst" (Lamnek, 1988, S 41).
Diese Aussage Lamneks kann mit einem Zitat von Wolfgang Jantzen, Behindertenpädagoge, verknüpft werden:
Behinderung kann nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. (Jantzen, 1992, zitiert nach Meiser & Albrecht, 1997, S.1)
Um für diese Arbeit Erkenntnisse erzielen bzw. Fallstudien realisieren zu können, eignet sich als Methode das problemzentrierte Interview (Lamnek, 1995):
Auf Basis vorangegangener philosophischer Aussagen, wird die Erhebungsphase bereits mit einem gewissen theoretischen Vorverständnis begonnen. Im problemzentrierten Interview wird zu Beginn des Gesprächs die erzählende Gesprächsstruktur festgelegt, jedoch bleibt die Bedeutungsstrukturierung der sozialen Wirklichkeit dem bzw. der Befragten allein überlassen. Es wird aber der interessierende Problembereich durch offene Fragen eingrenzt. Die Fragen ergeben sich aus der Beschäftigung mit philosophischen Texten und aus der bereits in der Einleitung angeführten bzw. im obigen Teil der theoretischen Ausführungen erwähnten zentralen Frage.
Mit Hilfe eines Tonbandgerätes wird das gesamte problemzentrierte Interview auf Tonband aufgezeichnet und später transkribiert.
Witzel (1989) bezeichnet das problemzentrierte Interview als eine "Methodenkombinationbzw. -integration" von unter anderem qualitativem Interview und biographischer Methode.
"Der Übergang zu einer biographischen - d. h. vom Ich aus strukturierten und verzeitlichten - Selbst- und Weltauffassung" wird dabei als bedeutsam angesehen (Kohli, 1986, S.432).
Zentrales Merkmal der theoretischen Voraussetzungen der biographischen Methode ist der Versuch zur Integration von "subjektiven und objektiven" Faktoren, d. h. es wird davon ausgegangen, dass das "Soziale" nur als Ergebnis einer ständigen Interaktion des individuellen Bewusstseins und der objektiven sozialen Wirklichkeit gesehen werden kann.
Wird nun die individuelle Lebensgeschichte verstanden als eine sich im Spannungsfeld zwischen subjektiver Gestaltungskraft einerseits und sozialen Determinanten und Einschränkungen andererseits befindende, so ist in dieser Arbeit besonders interessant zu analysieren, inwieweit in diesem "Spannungsfeld" der Freiheitsbegriff eines Jean Paul Sartre erfassbar bzw. erfahrbar ist.
Weiters eröffnet die Anwendung der Biographieforschung die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Lebens- und Wertauffassungen von Menschen zu informieren, vor allem aber auch über Wertauffassungen von Personen in durch chronische Erkrankung oder Behinderung gekennzeichneten Lebenssituationen.
Frankl schreibt:
Gewiss hat so manches im menschlichen Dasein seinen biographischen Stellenwert und, soweit es einen solchen Stellenwert hat, auch einen Ausdruckswert. Denn die Biographie ist letzten Endes nichts anderes als die temporale Explikation der Person: Im Leben, das da abläuft, im Dasein, das da abrollt, expliziert sich die Person, entfaltet sie sich, wird sie aufgerollt wie ein Teppich, der erst dann sein unverwechselbares Muster enthüllt. (Frankl, 1977, S.87f)
Zur Erhebung biographischer Daten wird häufig das offene Leitfadeninterview verwendet. Diese Interviewtechnik lässt sich gut mit der Absicht, problemzentrierte Interviews durchzuführen, verbinden. Durch einen Katalog anzusprechender Fragen können als wichtig erachtete Lebensphasen und Ereignisse dezidiert angesprochen werden und der Befragte kann ausführlich erzählend oder berichtend antworten, ohne sein Leben in einem "großen Zug" präsentieren zu müssen.
Die Auswertung des erhobenen Materials erfolgt, wie schon erwähnt, über den Weg der Interpretation: "Die Interpretation hat, wie es vielleicht das Alltagsverständnis des Begriffs nahe legt oder wie es von quantitativ-methodologischer Seite manchmal unterstellt wird, nichts mit "freischwebender" Spekulation über die Bedeutung von Äußerungen undHandlungen zu tun" (Lamnek, 1995, S.367).
Lamnek (1995) führt aus, dass es sich vielmehr um ein zweistufiges Verfahren handle:
1. Nachvollzug der individuellen Lebensgeschichte, d. h. die Rekonstruktion der Ereignisse und deren Bedeutung für den Handelnden und
2. die Konstruktion von Mustern, die aus den individuellen Ausformungen der Lebensgeschichten abgeleitet werden.
Folgendes ist von besonderer Relevanz:
In den durchgeführten Interviews wird es sich um Aussagen von Menschen handeln, die mit körperlichen Einschränkungen oder ihrem chronischen Krank-Sein leben. Ihr Wissen basiert auf gelebter Erfahrung. Leider wird dieser Erfahrung selten analytischer Charakter zugesprochen. "Vielmehr wird in der Fachliteratur die Perspektive der Wissenden, zugunsten
wissenschaftlicher Fakten, eliminiert" (Wolber, 1997, S.34).
"Nicht an der Anzahl der untersuchten Fälle bemisst sich, ob eine Strukturaussage als typisch gelten kann, sondern - gerade im Gegenteil - an der Schlüssigkeit der Rekonstruktion eines einzelnen Falls" (Bude, 1984, S.22).
Diesem Zitat Budes folgend wird sich die Arbeit auf den Einzelfall stützen und sich die Anzahl der interviewten Personen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung auf sechs beschränken.
Jede Studie wird eine Fallstudie per se sein, denn vieles ist nur individuell zu erfassen, wie z. B. das soziale und familiäre Umfeld des/der Interviewten, die Art der Behinderung bzw. der chronischen Erkrankung oder Alter und schulische bzw. berufliche Ausbildung.
In einem abschließenden Kapitel der Arbeit werden zusammenhängende Aspekte der Interviews mit philosophischen und existentiellen Aussagen verknüpft.
Inhaltsverzeichnis
Gesellschaften formen Begriffe und diese beeinflussen wiederum das Dasein des einzelnen.
Die nachfolgend definierten Begriffe scheinen wenig oder überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu stehen. Es lässt sich jedoch aus der Definition heraus ein Zusammenhang herstellen, der in dieser Arbeit aufgezeigt werden soll.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff "Behinderung" in der ICIDH-2 (International Classification of Functioning, Disability and Health) wie folgt:
1. Schädigung: Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur im Sinn einer wesentlichen Abweichung oder eines Verlustes.
2. Beeinträchtigung der Aktivität: Aus der Schädigung resultierende Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, eine Aufgabe oder Tätigkeit durchzuführen.
3. Beeinträchtigung der Partizipation: Ein nach Art und Ausmaß bestehendes Problem einer Person bezüglich ihrer Teilhabe in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation.
4. Umweltfaktoren: Sie beziehen sich auf die physikalische, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der die Menschen ihr Leben gestalten.
Hinsichtlich der Ursache wird unterschieden zwischen erworbener Behinderung (durch Umweltbedingungen, Unfälle bzw. Krankheiten) und angeborener Behinderung (durch Vererbung bzw. chromosomal oder durch pränatale bzw. perinatale Schädigung)
Weiters werden Behinderungen heute grob kategorisiert in körperliche Behinderungen, Sinnesbehinderungen, Lernbehinderungen, psychisch (seelische) und geistige Behinderungen. In nationalen und internationalen Statistiken wird versucht, die Zahl der Menschen mit Behinderungen in Prozentsätzen zu den sogenannten "Nichtbehinderten" anzugeben (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).
Behinderung ist also definiert und gleichzeitig in Prozentsätzen der Normabweichung klassifiziert. Klassifikation aber ist - nach den Philosophen Horkheimer und Adorno - nur "Bedingung von Erkenntnis, nicht sie selbst, und Erkenntnis löst die Klassifikation wiederum auf" (Mürner, 1996, S.198).
Nach Overdick-Gulden (2004) ist der Begriff Behinderung zu durchleuchten, nach dem, was er aussagt und nach dem, was er möglicherweise verschweigt. Denn er kann verschweigen und verzerren, wenn er Menschen dazu bringt, zwei Güteklassen menschlichen Lebens wahrzunehmen: das "vollwertige" nicht-behinderte Menschenleben einerseits und das der Behinderten andererseits. Wichtig ist folgendes: Will man sich mit existentiellen Fragen auseinandersetzen und diese je individuell beantworten, muss der Begriff Behinderung in einen breiteren als den gesetzlichen oder medizinischen Rahmen gesetzt werden.
Um an dieser Stelle Feuser zu zitieren, der Behinderung als eine von vielen möglichen Formen menschlicher Entwicklung verstanden haben will: "Wir werden nicht umhinkommen, Behinderung, Entwicklungsstörungen und psychische Krankheit als Konfliktlösungsstrategienzu begreifen" (Feuser, 1995, S.123).
Behinderung verstehen wir als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zu Wirkung kommen, der durch soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumtionsprozessen nicht entspricht. Sie definiert folglich einen sozialen Prozess und ist in diesem selbst wiederum eine wesentliche Variable. Davon unterscheiden wir humanbiologisch-organisch, neurophysiologisch und neuropsychologisch erklärbare Beeinträchtigungen eines Menschen, die als Bedingungen den Prozess der "Be"-Hinderung seiner Persönlichkeitsentwicklung im o.a. gesellschaftlichen Kontext auslösen und modifizieren. Die Grundstrukturen menschlicher Aneignungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse bleiben davon unberührt. Behinderung ist letztlich das Produkt der sozialen Beantwortung einer Beeinträchtigung eines Menschen. D. h. wir unterscheiden Beeinträchtigungen in der Entwicklung eines Menschen von seiner Behinderung als soziale Kategorie. Ferner verstehen wir, was im sozialen Kontext eines Menschen als Folge von Beeinträchtigungen resultiert und sich sichtbar dokumentiert (physisch, psychisch, sozial), als ein logisches Produkt seiner Entwicklung unter den für ihn gegebenen Bedingungen, die wir mit dem Begriff der Isolation beschreiben. (Feuser, 1989, zitiert nach Nickel, 1999)
Wikimedia Foundation (2004, 2004) definiert Krankheit als eine Störung der normalen körperlichen, psychischen und/oder seelischen Funktionen, die einen Grad erreicht, der die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eines Lebewesens subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ beeinflusst. Sozialversicherungsrechtlich wird unter Krankheit das Vorhandensein einer Störung verstanden, die eine Behandlung im Sinne von medizinischer Therapie und Krankenpflege erfordert und eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.
An dieser Stelle muss betont werden, dass Behinderung nicht gleichzusetzen ist mit Krankheit, wie es in vielen Fällen noch passiert. Menschen mit Behinderungen wehren sich dagegen, als krank wahrgenommen und bezeichnet zu werden. In Verbindung mit den oben beschriebenen Begriffsdefinitionen von "Behinderung" ist diese Abgrenzung der zwei Begriffe "behindert" - "krank" verstehbar.
Lanzerath (2000) spricht jedoch von fließenden Grenzen zwischen Behinderung und chronischen Krankheiten und betont den in beiden Fällen wichtigen Aspekt der Selbstauslegung und Bewältigung. Er schreibt:
Einen Zustand an sich selbst als eine Behinderung aufzufassen und dies nicht als eine Krankheit, sondern ... als "besondere Form der Gesundheit" zu empfinden, macht das Moment der Selbstauslegung ... deutlich. Denn obwohl es einen natürlichen Zustand gibt, der von Ärzten als pathologisch und normabweichend interpretiert und von der Gesellschaft als krankhaft eingestuft wird, ist die Sicht des oder der Betroffenen eine andere. Diese orientiert sich nicht an dem darunterliegenden biologischen Zustand und den damit verbundenen Häufigkeiten in der Bevölkerung, sondern vielmehr an der eigenen Kontingenzerfahrung und der Selbstauslegung der vorgegebenen und gleichzeitig aufgegebenen Natur in ihrer psycho-physischen Konstitution. (Lanzerath, 2000, S.240)
Philosophen früherer Jahrhunderte kannten keinen eigenen Begriff der Behinderung. Wenn hier von philosophischen Aussagen zum Thema Krankheit gesprochen wird, dann beziehen sich diese auch auf Aussagen zu Behinderung, denn je nachdem wie der Mensch Krankheit begreift und bewertet, bewertet er auch Behinderung.
Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist die Gesundheit "ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).
Hartmann (1997) definiert jenen Menschen als "gesund", der "mit oder ohne nachweisbareoder für ihn wahrnehmbare Mängel seiner Leiblichkeit, allein oder mit Hilfe anderer Gleichgewichte findet, entwickelt und aufrecht erhält, die ihm ein sinnvolles, auf die Entfaltung seiner persönlichen Anlagen und Lebensentwürfe eingerichtetes Dasein und die Erreichung von Lebenszielen in Grenzen ermöglicht, so dass er sagen kann: mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben" (Hartmann, 1997, zitiert nach Lanzerath, 2000, S.208).
Daher werde, so Lanzerath (2000), Gesundheit von uns häufig nicht als unser eigener Zustand begriffen; vielmehr würden wir unsere Gesundheit übersehen. So definiert er "gesund sein" als befreit sein von Einschränkungen und Problemen, die eine Reflexion auf sich selbst fördern würden.
Ursprünglich bezog sich der Begriff "Philosophie" auf eine Denktradition, die vom antiken Griechenland ausging. Er wird heute aber auch für asiatische Denktraditionen (östliche Philosophie) und eher religiöse Weltanschauungen verwendet. Daneben taucht der Begriff in jüngerer Zeit in übertragenem Sinn als Synonym für "Strategie" und "Konzept" insbesondere im Wirtschaftsjargon auf ("Unternehmensphilosophie").
Definitionen, was "Philosophie" eigentlich bedeute, gibt es beinahe so viele wie Philosophen. Dies betrifft bereits die klassischen Philosophen Athens. Auf Sokrates geht vermutlich die Auffassung vom Philosophieren als eines Hinterfragens des eigenen Wissens zurück: Philosophie ist nicht eine Weisheit, die man sich definitiv aneignen kann, sondern ein Verfahren, mit dem man sich immer wieder dieser als ideal gedachter Weisheit anzunähern versucht, sie aber nie endgültig besitzen kann. In diesem Sinne ist die sokratische Philosophie dialogisch. Eine Haltung, die Platon, der bedeutendste Schüler Sokrates, in der literarischen Gattung des philosophischen Dialogs perfektioniert hat. Hingegen betreibt Platons Schüler Aristoteles die Philosophie eher systematisch. Einflussreich war seine Unterteilung der Philosophie in die theoretische Philosophie (das Streben nach Wissen) und die praktische Philosophie (das Streben nach einer guten Lebensführung) (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).
Besonders interessant erscheint hier die Frage nach einer guten Lebensführung. Was ist Voraussetzung um "ein gutes Leben" führen zu können? Beinhaltet der Begriff "gut" weitere Begriffe, wie gesund, leistungsfähig, schön, ...? Auf diese Weise wird er zumindest in unserer modernen Industriegesellschaft definiert. Was bzw. wer stand den "Liebhabern der Weisheit" vor Augen, wenn sie vom menschlichen Sein und vom Menschen sprachen? Bezogen sie in ihre Überlegungen den Menschen in der Vielfalt seiner Situationen und Lebensstadien, seiner Freiheiten und "Behinderungen" ein?
Das Philosophieren ist als gelegentliches Nachdenken "über Gott und die Welt" ein allgemein-menschliches Phänomen. Schärfer gefasst, ist es die Art und Weise, wie Philosophen Philosophie betreiben.
Sokrates betrieb dies als Lebensaufgabe, indem er sich jahrzehntelang diskutierend und fragend seinen Mitbürgern zuwandte. Platon gründete zu diesem Zweck seine Akademie. Augustinus verstand darunter die "schauende Bewegung" (lat.: ratiocinatio) des menschlichen Geistes.
Kant machte auf diese besondere philosophische Tätigkeit aufmerksam, als er befand, man könne nicht Philosophie, sondern "nur philosophieren lernen". Er verlagerte also das philosophische Interesse vom System auf die Methode bzw. von der Vernunft-Dogmatik (Rationalismus) auf die Vernunft-Kritik (Kritizismus).
Bei Hegel hieß dann dieses "selbstkritische" Philosophieren "Phänomenologie des Geistes" oder "Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins" - mit einem Wort: Spekulation. Der neue Beobachtungsgegenstand, mit dem sich die Philosophie als Wissenschaft betreiben ließ, war also nur das Beobachten selbst. Im Deutschen Idealismus verwendete man dafür auch den Ausdruck "Intellektuelle Anschauung" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).
Im nachfolgenden Kapitel werden Philosophen zitiert. Es gibt vielfältige Gründe dafür, sich mit philosophischen Zitaten auseinander zu setzen, mit "Philosophen ins Gespräch zu kommen": etwa um konkrete Lebenssituationen zu durchdenken, eingefahrene Denkmuster zu erkennen und neue Perspektiven zu erfahren oder um Meinungen bzw. Werthaltungen und Ansichten zu analysieren.
Eugen-Maria Schulak schreibt:
"Philosophisch" heißt, dass sich die Dinge stets auch noch anders betrachten lassen, als sie sich uns zeigen, und dass die Vielfalt dieses "Anderen" der Wirklichkeit schon etwas näher kommt. "Philosophisch" heißt, das Selbstverständliche in Frage zu stellen sowie das Fragliche nicht unbedingt gleich zu beantworten.
Ein Praktiker der Philosophie ... wird zuhören um sich der Einstellungen, Werthaltungen und Weltbilder seines Gesprächspartners bewusst zu werden. Er wird ihn vorbehaltlos ernst nehmen. Im Unterschied zu einem Psychotherapeuten geht es dem Praktiker der Philosophie nicht um die Heilung psychischer Leiden, sondern um die Ermunterung zu einer sinnvollen und erfüllten Existenz - einer Existenz aus freien Stücken und kraft eigener Argumentation. (Schulak, 2004/2004)
Psychologie (griech., wörtl. übers. "Seelenkunde") ist die Wissenschaft vom Denken, Fühlen, Erleben und Verhalten des Menschen.
Seit der Gründung eines experimentalpsychologischen Laboratoriums an der Universität Leipzig durch Wilhelm Wundt im Jahre 1871 hat sich das Fach von seiner Ursprungsheimat, der Philosophie, gelöst und ist zu einer eigenständigen Disziplin mit vielen Teilbereichen geworden.
Maßgeblich war dabei auf der Seite der Humanpsychologie das Wirken von Sigmund Freud, Begründer der psychologischen Praxis, der Psychoanalyse. Das Problem, welches die angewandte Psychologie mit sich bringt, ist die Gefahr des manipulativen Eingreifens in das (seelisch-geistige) Leben anderer Menschen. So gesehen ist tatsächlich ein jeder psychologisch "begabt" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).
Inhaltsverzeichnis
Die in diesem Kapitel zitierten Philosophen können nicht losgelöst von der jeweiligen Epoche und Gesellschaftsstruktur, in der sie lebten, gesehen werden. Trotzdem wurde in dieser Arbeit auf eine zeitlich korrekte Aufzählung der Denker verzichtet, da in Bezug auf das Diplomarbeitsthema die zeitliche Abfolge eine untergeordnete Rolle spielt. Als wichtig erscheint hier das Bestreben, einen inhaltlichen Leitfaden und, wenn möglich, eine Verbindung zwischen den verschiedenen philosophischen Äußerungen herzustellen.
Nietzsche bezeichnet in seinem Werk "Die fröhliche Wissenschaft" das Leben als ein "Mittelder Erkenntnis" (1982, S.200). Für ihn ist Philosophie eng verknüpft mit der praktischen Lebensführung und er stellt die Frage, ob Philosophie "bisher überhaupt nur eine Auslegung der Leibes und ein Missverständnis des Leibes" (1982, S.12) gewesen sei. Er geht von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen aus, die Körper, Seele und Geist in Wechselwirkung zueinander begreift. "Krankheit und Gesundheit sind unter dieser Perspektive weder als streng zu definierende Zustände noch als Gegensätze aufzufassen, sie können weder eindeutig positiv noch negativ besetzt werden" (Carbone & Jung, 2000, S.20).
Für Nietzsche, der sich viele Jahre hindurch mit seinen eigenen schweren chronischen Erkrankungen auseinandersetzte, stellt dieses Thema nicht nur eine geistige, sondern eine existentielle Herausforderung dar: Krankheit könne der erste Schritt zu einer "höheren Gesundheit" sein; diese versteht Nietzsche jedoch nicht als definitives Ziel, sondern als individuelles Lebensprojekt. Wer auf die Herausforderung des Leidens mit dem Willen der Um- und Neugestaltung des eigenen Lebens reagiert, der hat Nietzsche zufolge eine Gesundheit erreicht, die Krankheit nicht ausgrenzt, sondern sie für sich fruchtbar zu machen, sie "an den Pflug" zu spannen weiß (Carbone & Jung, 2000).
... eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Gesundheiten des Leibes; und je mehr man dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder erlaubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das Dogma von der "Gleichheit der Menschen" verlernt, um so mehr muss auch der Begriff einer Normal-Gesundheit, ..., unseren Medizinern abhanden kommen. Und dann erst dürfte es an der Zeit sein, über Gesundheit und Krankheit der Seele nachzudenken und die eigentümliche Tugend eines jeden in deren Gesundheit zu setzten: welche freilich bei dem einen so aussehen könnte, wie der Gegensatz der Gesundheit bei einem anderen. (Nietzsche, 1982, S.134f)
Mit seinem Versuch, die "Leiblichkeit" zu rehabilitieren, tritt Nietzsche gegen eine zweitausendjährige Tradition an, die Denken und Bewusstsein stets in Zusammenhang mit Leibvergessenheit und Leibmissachtung brachte.
Nietzsche hat Einsichten der modernen Tiefenpsychologie vorweggenommen und lässt in seinen Äußerungen einen psychologischen Scharfblick erkennen. Er verstand es, hinter den Idealen und Idolen des Menschen, hinter "ewigen Wahrheiten" der Philosophie, der Metaphysik, der Religion und Moral, verdeckte Motive zu entdecken, den menschlichen Selbstbetrug, seine Triebe und Süchte, Irrtümer und Leidenschaften - also das "Menschliche, Allzumenschliche" (Carbone & Jung, 2000).
Er beschreibt aus eigener Erfahrung welche Chancen, Krankheit und Schmerz bieten und stellt die Frage, ob nicht Krankheit das gewesen sei, was den Philosophen häufig inspiriert habe.
Dies wird in seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe der "fröhlichen Wissenschaft" deutlich:
Und was die Krankheit angeht: würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? ... Erst der große Schmerz, jener lange langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, zwingt uns Philosophen, in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmütige, Verschleiernde, Milde, Mittlere wohinein wir vielleicht vordem unsere Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz "verbessert" -; aber ich weiß, dass er uns vertieft. (Nietzsche, 1982, S.13f)
Nietzsche zufolge ergeben sich Philosophen zeitweilig "mit Leib und Seele" ihrer Krankheit, machen gleichsam "vor sich selbst die Augen zu" und lernen durch Selbst-Befragung und "Selbst-Versuchung", mit einem feineren Auge nach allem zu sehen, das bisher philosophiert worden ist.
Gleichzeitig meint er aber auch: "Die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des Objektiven, Ideellen, Rein-Geistigen geht bis zum Erschrecken weit - und oft genug habe ich mich gefragt, ob nicht, im großen gerechnet, Philosophie eine Auslegung des Leibes und ein Missverständnis des Leibes gewesen ist" (Nietzsche, 1982, S.12).
Was Nietzsche hier ausdrückt, ist in Bezug auf das angesprochene Thema von besonderer Bedeutung: Er schreibt, dass hinter den höchsten Werturteilen, die im Verlauf der Geschichte gedacht wurden, Missverständnisse der leiblichen Beschaffenheit verborgen liegen, gedacht von einzelnen, aber auch von Ständen oder ganzen Rassen.
Nietzsche bezeichnet die bisherigen Antworten der Metaphysik auf die Frage nach dem Wert des Daseins als "kühne Tollheiten" und meint:
... und wenn derartigen Welt-Bejahungen oder Welt-Verneinungen in Bausch und Bogen, wissenschaftlich gemessen, nicht ein Korn von Bedeutung innewohnt, so geben sie doch dem Historiker und Psychologen um so wertvollere Winke, als Symptome, wie gesagt, des Leibes, seines Geratens und Missratens, seiner Fülle, Mächtigkeit, Selbstherrlichkeit in der Geschichte, oder aber seiner Hemmungen, Ermüdungen, Verarmungen, seines Vorgefühls vom Ende, seines Willens zum Ende. (Nietzsche, 1982, S.12)
Wem galt das Interesse früherer Epochen, wenn sie vom Menschen sprachen? Ist es jener Menschen-Typus von physisch-psychischer Harmonie, nach dem sich die klassische Antike sehnte?
Nietzsche hat jedenfalls alle bis dahin geltenden Werte und Wertkategorien in Frage gestellt, ja regelrecht verworfen, um dann, befreit von diesen, neue zu definieren.
Seine Ansichten zu den Begriffen "Gesundheit und Krankheit" bezieht er aus seinen eigenen Lebenserfahrungen. Er bezeichnet das Leben als "ein Mittel der Erkenntnis" und schreibt:
In media vita! - Nein! Das Leben hat mich nicht enttäuscht! Von Jahr zu Jahr finde ich es vielmehr wahrer, begehrenswerter und geheimnisvoller - von jenem Tag an, wo der große Befreier über mich kam, jener Gedanke, dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein dürfe - und nicht eine Pflicht, nicht ein Verhängnis, nicht eine Betrügerei. (Nietzsche, 1982, S.200)
In diesem Zitat kommt folgendes deutlich zum Ausdruck: Hier äußert sich ein Mensch, der nicht zulässt, dass seine körperlichen Beeinträchtigungen seine Einstellung zum Leben und seine Erkenntnisse über das Leben beherrschen, sondern das Gegenteil ist der Fall - er weiß sie sich nutzbar zu machen - "an den Pflug zu spannen":
" - Man errät, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener Zeit schweren Siechtums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch nicht für mich erschöpft ist" (Nietzsche, 1982, S.13).
Für Nietzsche ist Philosophie die "Kunst der Transfiguration": ein Philosoph setzt - nach Nietzsche - immer auch seinen körperlichen Zustand in geistige Form um, es steht ihm weder frei zwischen Seele und Leib zu trennen, noch zwischen Seele und Geist.
Leiblichkeit solle nicht mehr als abspaltbarer Aspekt der Existenz betrachtet werden, sondern die Abhängigkeiten und Bedürfnisse unserer leiblichen Seins sollen in unser Denken mit einbezogen werden.
Er betont, dass "erst auf der Basis eines ganzheitlichen, den Leib einbeziehenden Verständnisses seiner Selbst der Mensch die Kunst praktischer Lebensführung erlernt..." (Carbone & Jung, 2000, S.12). Der Gedanke, dass Gesundheit bzw. Krankheit nicht als Zustände betrachtet werden können, sondern immer auch in Beziehung stehen, zu der Bedeutung, die wir diesen Begriffen einräumen, ist hier wichtig. Und dieser Gedanke spielt auch in der Psychotherapie eine tragende Rolle - z. B. in der Logotherapie von Viktor. E. Frankl.
Nietzsche bezeichnet Krankheit als ein mächtiges Stimulans. Der Begriff Krankheit ist nicht einfach als das Gegenteil von Gesundheit zu definieren, sondern wird aus einem Denken, das in Gegensätze verhaftet ist, herausgelöst. Er fordert auf, Gesundheit und Krankheit als dasjenige zu begreifen, dem gegenüber der einzelne - vor dem Hintergrund seiner eigenen Existenzbedingungen - eine aktive Verantwortung trägt (Carbone & Jung, 2000).
Ein Zitat Nitzsches aus "Die fröhliche Wissenschaft" ist besonders interessant; unter dem Titel "Der Wille zum Leiden und die Mitleidigen" schreibt er:
Das, woran wir am tiefsten und persönlichsten leiden, ist fast allen anderen unverständlich und unzugänglich: Darin sind wir dem Nächsten verborgen .... Überall aber, wo wir als Leidende bemerkt werden wird unser Leiden flach ausgelegt; es gehört zum Wesen der mitleidigen Affektion, dass sie das fremde Leid des eigentlich Persönlichen entkleidet - unsre "Wohltäter" sind mehr als unsre Feinde die Verkleinerer unsres Wertes und Willens .... Die gesamte Ökonomie meiner Seele, und deren Ausgleichung durch das Unglück, das Aufbrechen neuer Quellen und Bedürfnisse, das Zuwachsen alter Wunden, das Abstoßen ganzer Vergangenheiten - das alles, was mit dem Unglück verbunden sein kann, kümmert den lieben Mitleidigen nicht: er will helfen und denkt nicht daran, dass es eine persönliche Notwendigkeit des Unglücks gibt, .... Nein, davon weiß er nichts: die Religion des "Mitleidens" (oder "das Herz") gebietet zu helfen, und man glaubt am besten geholfen zu haben, wenn man am schnellsten geholfen hat! Wenn ihr Anhänger dieser Religion dieselbe Gesinnung, die ihr gegen die Mitmenschen habt, auch wirklich gegen euch selber habt, wenn ihr euer eigenes Leiden nicht eine Stunde auf euch liegen lassen wollt und immerfort allem möglichen Unglücke von ferne her schon vorbeugt, wenn ihr Leid und Unlust überhaupt als böse, hassenswert, vernichtungswürdig, als Makel am Dasein empfindet: nun, dann habt ihr, außer eurer Religion des Mitleidens, auch noch eine andere Religion im Herzen, und diese ist vielleicht die Mutter von jener - die Religion der Behaglichkeit. Ach, wie wenig wisst ihr vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmütigen! denn das Glück und das Unglück sind zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander großwachsen oder, wie bei euch, miteinander - klein bleiben. (Nietzsche, 1982, S.212f)
Was Nietzsche hier über das Mitleiden äußert, soll an dieser Stelle näher analysiert werden:
In der gleichen Weise, in der er Krankheit und Gesundheit nicht als etwas Gegensätzliches versteht, begreift er auch Glück und Unglück nicht als zwei Gegensätze, ja er meint sogar, dass diese beiden nur zusammen "groß werden können". Dadurch können negativ besetzte Begriffe, wie Leid, Trauer, aber auch Krankheit oder Behinderung, eine völlig andere Bedeutung erhalten, denn sie schließen nicht von vornherein positiv Verstandenes aus. Krankheit und Behinderung werden, wie Gesundheit oder Leistungsfähigkeit, als sogenannte Zustände in ihrer Wertigkeit aufgehoben, aufgehoben in der Person, die all diese wert-besetzten Begriffe und Zustände in sich vereint und dadurch erst als Persönlichkeit hervorgeht. Hiermit wird ein anderes Wahrnehmen vom behinderten Menschen erst möglich gemacht: Es kann gefragt werden, ob Behinderung und Erkrankung vielleicht sogar wesenhaft zum Menschen gehört.
Vielleicht werden die Menschen und Zeiten durch nichts so sehr voneinander geschieden als durch den verschiednen Grad von Kenntnis der Not, den sie haben: Not der Seele wie des Leibes .... So aber scheint es mir bei den meisten jetzt zu stehen. Aus der allgemeinen Ungeübtheit im Schmerz beiderlei Gestalt und einer gewissen Seltenheit des Anblicks eines Leidenden ergibt sich nun eine wichtige Folge: Man hasst jetzt den Schmerz viel mehr als frühere Menschen und redet ihm viel übler nach als je, ja man findet schon das Vorhandensein des Schmerzes als eines Gedankens kaum erträglich. (Nietzsche, 1982, S.76f)
Nietzsche meint, dass die großen Fragezeichen am Wert alles Lebensin Zeiten gesetzt werden, in denen eine Verfeinerung und Erleichterung des Daseins schon aus "unvermeidlichen Mückenstichen des Leibes und der Seele" quälende, "blutige und bösartige" Befindlichkeiten macht.
Zuletzt bliebe noch die große Frage offen, ob wir der Erkrankung entbehren könnten, ...., und ob nicht namentlich unser Durst nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis der kranken Seele so gut bedürfe als der gesunden: kurz, ob nicht der alleinige Wille zur Gesundheit ein Vorurteil, eine Feigheit und vielleicht ein Stück feinster Barbarei und Rückständigkeit sei. (Nietzsche, 1982, S.135)
Was könnte Nietzsche damit meinen, wenn er den "alleinigen Willen zu Gesundheit" als Barbarei und Rückständigkeit bezeichnet?
Im geschichtlichen Verlauf sind häufig diejenigen, die sich unbehindert stark und geistig "gesund" fühlten, zu Behinderern im Leben ihrer Mitmenschen geworden. Nach Overdick-Gulden (2004/2004) reagiert man, in dem arteigene Grenzen missachtet, die persönliche "Zerbrechlichkeit" verdrängt und die unbestimmte Angst vor dem Nachlassen der Kräfte und das "Sein zum Tode" tabuisiert werden, buchstäblich "niederschmetternd" auf alle, die irgendwelche Schwächen zeigen. Man verdrängt alles, was die Grenzen des Menschen und somit auch die ureigenen aufdeckt, und will all jene ausmerzen, die solche prophetisch beleuchten.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet hat Nietzsches Version von Mitleid als "Lebensschwäche" oder "elitärem Selbstgenuss" zu tun mit dem Selbst-Mitleid einer Gesellschaft, die sich verbal zu solidarisieren weiß, dem Bemitleideten jedoch häufig mit spürbarer Zurückhaltung begegnet und das Negative, "Andersartige" als belastende Zumutung ablehnt.
Denn Andersheit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor eine Provokation, das Wahrnehmen von "Anderssein" lässt uns erahnen, in wie weit wir selbst Träger von Vor- und Werturteilen sind, die uns behindern. Im Erblicken von Nicht-Normalem, Ver-rücktem entdecken wir unsere eigene Unvollkommenheit (Overdick-Gulden, 2004/2004).
Aus dieser Angst heraus kann mitleidiges Verhalten für jenen, dem es gilt, nur eine Wertminderung darstellen. Die bemitleidete - die behinderte - Person wird in einer Weise wahrgenommen, die sie ihrer Persönlichkeit beraubt, denn der Mitleidige begreift nicht, dass die Person mit Behinderung ihr Da-Sein, ihre Identität kraft - und nichttrotz - ihrer Behinderung erfährt.
Vielleicht wäre Kierkegaards Verständnis von Mitgefühl als Solidarität hier eher angebracht. Kierkegaard, der im Kapitel 5.1 ausführlicher zitiert wird, schreibt zum Begriff Mitleid folgendes:
Erst wenn der Mitleidende in seinem Mitleid sich so zu dem Leidenden verhält, dass er im strengsten Sinne begreift, dass es seine Sache ist, um die es hier geht, erst wenn er sich so mit dem Leidenden zu identifizieren weiß, dass er, in dem er um eine Erklärung kämpft, für sich selber kämpft ... erst dann bekommt das Mitleid Bedeutung. (Kierkegaard, 2002, S.110)
Um wieder zu Nietzsche zurück zu kommen:
Nietzsche bezeichnet den Schmerz - gleich der Lust - als eine "arterhaltende Kraft ersten Ranges":
Ich höre im Schmerz den Kommandoruf des Schiffskapitäns: "zieht die Segel ein!" Auf tausend Arten die Segel zu stellen, muss der kühne Schifffahrer "Mensch" sich eingeübt haben, sonst wäre es gar zu schnell mit ihm vorbei, und der Ozean schlürfte ihn zu bald hinunter. (Nietzsche, 1982, S.198)
Wieder vereint Nietzsche zwei scheinbare Gegensätze, Schmerz und Lust, und hebt dadurch die ihnen zugeschriebenen Wertigkeiten auf. Der Schmerz wird erfahren als Signal, das uns auffordert, unsere Energie zu drosseln bzw. unser Dasein zu überdenken. Und wieder wird hier der ganzheitliche Aspekt bei der Beurteilung von Krankheit in den Vordergrund gestellt, die Einbeziehung der Psyche in das physische Geschehen. Nietzsche spricht hier jedoch noch einen weiteren Gedanken an, der vielleicht mit seinem Begriff des "Übermenschen" in Verbindung gebracht werden könnte: Er meint, dass es Menschen gäbe, die beim Herannahen des großen Schmerzes, beim "Heraufziehen des Sturmes", "den entgegengesetztenKommandoruf hören" und sich als stolz, glücklich und kriegerisch erleben. Diese heroischen Menschen seien die großen "Schmerzbringer" der Menschheit:
... jene wenigen oder seltenen, die eben dieselbe Apologie nötig haben wie der Schmerz überhaupt - und wahrlich! man soll sie ihnen nicht versagen! Es sind arterhaltende, artfördernde Kräfte ersten Ranges: und wäre es auch nur dadurch, dass sie der Behaglichkeit widerstreben und vor dieser Art Glück ihren Ekel nicht verbergen. (Nietzsche, 1982, S.198)
Wenn Nietzsche vom "Übermenschen" spricht, könnte er nicht jenen Menschen vor sich haben, der all diese Vielfalt in sich vereint, sowohl das als positiv bewertete, wie auch das negierte, und - diese Vielfalt an sich und in sich annehmend und akzeptierend - sich so vom "Herdenmenschen" distanziert?
Ein solcher Übermensch hätte aber dann nichts zu tun mit einem skrupellosen, über jede menschliche Moral erhabenen, "homo superior", wie er häufig interpretiert wird.
Nietzsche schreibt in Ecce homo, dass er in den Jahren seiner niedrigsten Vitalität aufhörte, Pessimist zu sein. Aus seinem Willen zum Leben, entwarf er seine Philosophie, erlernte eine Psychologie des "Um-die-Ecke-Sehns":
Von der Krankenoptik aus nach gesünderen Begriffen und Werten, und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewissheit des reichen Lebens hinuntersehn in die heimliche Arbeit des décadence-Instinkts - das war meine längste Übung, meine eigentliche Erfahrung, wenn irgendwohin wurde ich darin Meister. Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: erster Grund, weshalb für mich allein vielleicht eine "Umwertung der Werte" überhaupt möglich ist. (Nietzsche, 1977, S.42)
Diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel spricht auch Lesch (2003) an: Einen Perspektivenwechsel, der das Bewusstsein dafür schärft, dass der eigene Status der Stärke und Entscheidungskompetenz alles andere als selbstverständlich ist.
Auch die Arbeiten des Philosophie betreibenden Alexandre Jollien können als Möglichkeit eines Perspektivenwechsels angesehen werden. Jollien, der aus eigener Erfahrung einer Behinderung "Denkgewohnheiten im Umgang mit Normalität und Leistungsfähigkeit" (Lesch, 2003) herausfordert, bezieht sich in seinem Buch "Lob der Schwachheit" (1999/2001) unter anderem auf Nietzsche, dessen Philosophie er seinerseits als Herausforderung empfand. Jollien bezeichnet sein Interesse für Philosophie als eine Möglichkeit sich zu wappnen im Kampf gegen gesellschaftliche Vorurteile und Etikettierung. Zum Thema "Mitleid" meint er, dass das Mitleiden tiefer verletze als die Verachtung:
Ja, bloß kein Mitleid. Auch hier stimme ich Nietzsche zu. ... er hat Recht, wenn er das "geheuchelte Mitleiden" anprangert. Täglich begegne ich diesem gönnerhaften Blick, der vielleicht ehrlich glaubt, mir Freude zu machen, der jedoch meine Freiheit leugnet und ipso facto mich leugnet. (Jollien, 1999/2001, S.60)
Das Mitleid anästhesiere durch seine Schalheit, so Jollien, und unangebrachte Besorgnis enge die Freiheit des Bemitleideten ein. Somit wird der Mitleidende zum "Verkleinerer des Wertes und Willen" des Bemitleideten, um hier nochmals Nietzsche zu zitieren.
Schlussbetrachtungen
Friedrich Nietzsche hat eine Philosophie hervorgebracht, die sich deutlich von derjenigen seiner philosophischen Vorgänger unterscheidet, unabhängig davon, ob oder in welchem Umfang sich seine fortschreitende Erkrankung in seinen Werken widerspiegelt; und niemand wird leugnen können, dass sein philosophisches Gedankengut und sein psychologischer Scharfblick einer einzigartigen Persönlichkeit entspringen.
Der Name Nietzsche verweist auf einen weithin bekannten Philosophen des 19. Jahrhunderts und nicht auf einen den größten Teil seines Lebens an Krankheiten leidenden Menschen. Den gängigen Wertmaßstäben unserer Gesellschaft folgend, verführt jedoch der Anblick einer behinderten oder kranken Person meist dazu, vordergründig nur die Behinderung oder Erkrankung wahrzunehmen. Die Philosophie Nietzsches stellt dies in zweierlei Weise in Frage: Einmal in dem sie gängige Wertmaßstäbe und gedachte Wahrheiten verwirft, zum zweiten, da Nietzsche selbst in seinem und durch sein Schaffen widerlegt, dass Kranksein an sich schon eine existentielle Bedrohung darstellt. Nietzsche spricht, wenn er über Krankheit und Leiden philosophiert, als "Experte in eigener Sache", nur er selbst kann sich aus seiner Lebenserfahrung heraus in dieser dargestellten Weise philosophisch äußern.
Nietzsches Ansichten und Äußerungen zum Thema Krankheit lassen sich auch auf den Begriff Behinderung beziehen, denn die Grenzen zwischen Behinderung und chronischen Krankheiten sind fließend. Entscheidend seien in beiden Fällen Selbstauslegung und Bewältigung, so Lanzerath (2000, S.239).
Frankl, Begründer der dritten Wiener Schule nach Sigmund Freud und Gustav Adler, geht von einem Menschenbild aus, bei dem das Streben des Menschen nach Sinn im Mittelpunkt steht. "Seine" Logotherapie ist auf Sinnfindung für den einzelnen ausgerichtet.
Er definiert den Menschen als ein Wesen, das letztlich und eigentlich auf der Suche nach Sinn ist:
Der Mensch ist immer schon ausgerichtet und hingeordnet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er begegnet. So oder so: Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz. (Frankl, 1996, S.9)
In seinem Buch "Der leidende Mensch - Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie" schreibt er:
"Der unbedingte Mensch" ist zunächst der Mensch, der unter allen Bedingungen Mensch ist und auch noch unter den ungünstigsten ... Bedingungen Mensch bleibt - der Mensch, der unter keiner Bedingung sein Menschentum verleugnet, vielmehr in Unbedingtheit "zu ihm steht"
... diese Kennzeichnung des unbedingten Menschen ist eine ethische; sie entspricht einer moralischen ... Norm, einem Idealtypus. Neben diese normative sollensmäßige Definition stellt sich jedoch auch eine daseinsmäßige, ontologische, und im Sinne dieser Begriffsfassung ist der Mensch ein insofern unbedingter, als er in seiner Bedingtheit "nicht aufgeht"; insofern, als keine Bedingtheit imstande ist, den Menschen vollends "auszumachen"; insofern, als sie ihn zwar konditioniert, aber nicht konstituiert. Unter Bedingungen des Menschseins stehend, steht der unbedingte Mensch trotzdem zu seinem Menschsein: er trotzt den Bedingungen, inmitten deren Fülle er sich gestellt findet. In diesem, im ontologischem Sinne, ist der Mensch jedoch nur bedingt ein un-bedingter: er kann un-bedingt sein, aber er muss es nicht sein. (Frankl, 1996, S.66)
Frankl will aufzeigen, inwiefern der Mensch als un-bedingter bestehen kann, bestehen trotz aller Bedingtheit. Mit anderen Worten: es soll erwiesen werden, inwieweit der Mensch in seiner Bedingtheit - und in dieser Arbeit geht es um das durch Krankheit oder Behinderung "Bedingtsein" - immer auch schon über sie hinaus ist oder zumindest hinaus sein kann und über seine faktische Bedingtheit, über die Bedingtheit seiner "Faktizität" hinaus, in Un-bedingtheit zu "existieren" vermag.
Er spricht vom "Sinn des Leidens" und meint, worauf es ankomme, sei die Haltung, in der sich ein Mensch der Krankheit stelle, die Einstellung, mit der er sich mit der Krankheit auseinandersetze. "Das Wie des Tragens notwendigen Leidens birgt möglichen Sinn" (Frankl, 1977, S.80f).
Auch Lanzerath (2000) schreibt, dass die Evaluation von Krankheit im Kontext der Lebensführung den Betroffenen mit der Frage nach dem Sinn seines Daseins konfrontieren könne. Dies sei eine Konfrontation mit der eigenen kontingenten Existenz, die im Negativum des Krankseins auch etwas Positives erkennen lasse: die Krankheit als Aufruf zur Eigentlichkeit.
Weiters führt er an, dass vor allem von kunstschaffenden Menschen der Umstand geltend gemacht worden sei, dass Krankheitserfahrung und -erleben zumindest einen epistemischen Wert darstellen, der schon damit beginne, den Eigenwert des Lebens intensiver wahrzunehmen. Er bezieht sich auf den Schriftsteller M. Proust, der "das erheblich positive Potential des Krankheitserlebens für den persönlichen Erkenntnisgewinn und das literarische Schaffen, das sich ohne die Krankheitserfahrung nie hätte entfalten können", betont (Lanzerath, 2000, S.207).
Um zu Frankl zurückzukommen:
Ist es also nicht so, dass der Mensch eigentlich und ursprünglich darnach strebt, glücklich zu sein? Hat denn nicht selbst Kant zugegeben, dass dies der Fall sei, und nur hinzugesetzt, der Mensch solle auch darnach streben, des Glücklichseins würdig zu sein? Ich würde sagen, was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern ein "Grund" zum Glücklichsein. (Frankl, 1996, S.9)
Frankl meint, das Glück bzw. die Lust stelle sich von selber ein, sobald ein Grund zum Glücklichsein gegeben sei.
Für Kant ist "die Glückseligkeit die Folge der Pflichtbeobachtung" (Kant, 1797, zitiert nach Frankl, 1996, S.9) - Frankl führt dies weiter aus und überträgt Kants Aussage vom Bereich der Sittlichkeit auf den der Sinnlichkeit:
Denn im klinischen Alltag zeigt es sich immer wieder, dass es gerade die Abwendung vom Grund zum Glücklichsein ist, die den ... Menschen ... nicht glücklich werden lässt. Wodurch aber kommt diese pathogene Abwendung vom Grund zum Glücklichsein zustande? Durch eine forcierte Zuwendung zum Glück selbst, zur Lust selbst. (Frankl, 1996, S.9)
Könnte es nicht sein, dass gerade diese "forcierte Zuwendung zum Glück bzw. zur Lust selbst" auch mit ein Grund ist für die negative, abwertende Einstellung vieler sogenannter Gesunder gegenüber all jenem, das mit Krankheit oder Behinderung verbunden ist?
Frankl zitiert Kierkegaard, der einmal äußerte, die Tür zum Glück gehe nach außen auf und wer sie einzurennen versuche, dem verschließe sie sich, und erklärt dies folgendermaßen: Wovon der Mensch zutiefst und zuletzt durchdrungen sei, sei weder der Wille zur Macht (wie Gustav Adler meinte), noch der Wille zur Lust (wie Siegmund Freud propagierte), sondern ein Wille zum Sinn. Es geht Frankl um den personalen und konkreten Lebenssinn eines Menschen, dessen Erfüllung jedem einzelnen abverlangt und aufgetragen ist. Und allein dieser Lebenssinn ist für Frankl von therapeutischer Dignität (Frankl, 1977).
Seine Annäherung an existenzphilosophisches Gedankengut wird deutlich in der Äußerung:
Die Deutung von Sinn setzt voraus, dass der Mensch geistig ist, während die Erfüllung von Sinn voraussetzt, dass er frei und verantwortlich ist. Diese drei Existentialien sind uns selbstverständlich nur dann zugänglich, wenn wir ihnen in die noologische Dimension folgen, in die, aus der psychologisch-biologischen Ebene heraus, sich erhebend der Mensch ja überhaupt erst sich konstituiert; ... (Frankl, 1996, S.38)
Frankl ist also der Ansicht, dass die Einheit von Leiblichem und Seelischem noch nicht den ganzen Menschen ausmache. Zur Ganzheit des Menschen gehört vielmehr noch ein Drittes, gehört das Geistige wesentlich mit hinzu. Der Mensch hat Leib und Seele, aber er ist Geist. Der Mensch ist Einheit und Ganzheit in dem Sinne, dass sich das Geistige in ihm mit dem Leiblichen und Seelischen auseinandersetzt. "Immer nimmt der Mensch als Geist zu sich als Leib und Seele Stellung" (Frankl, 1996, S.112).
Unter dem Begriff "Geist" versteht Frankl die "Dimension der spezifisch humanen Phänomene", wie etwa das Phänomen der "Selbsttranszendenz", also der Fähigkeit des Menschen "über sich selbst hinaus zu gehen" und sich etwas (einer Aufgabe) oder jemandem (einer Person) zuzuwenden.
Tatsächlich geht menschliches Dasein immer schon über sich hinaus, weist es immer schon auf einen Sinn hin. In diesem Sinne ist es dem Menschen in seinem Dasein nicht um Lust oder um Macht, aber auch nicht um Selbstverwirklichung, vielmehr um Sinnerfüllung zu tun. (Frankl, 1977, S.93)
Die geistige Person ist durch eine psychophysische Erkrankung zwar störbar, aber nicht zerstörbar. Eine Krankheit kann den psychophysischen Organismus zerstören bzw. zerrütten, und dieser Organismus stellt den Spielraum der Person und deren Ausdrucksfeld dar. Das Eigentliche am Menschen jedoch, sein Geistiges, ist unzerstörbar, die geistige Person bleibt unberührt. Somit gilt: Die (geistige) Person ist nicht krank sondern hat eine Krankheit, und ein Arzt behandelt nur Krankheiten, aber nicht den Kranken selbst.
... denn wo wir nicht mehr Krankheiten behandeln, sondern kranke Menschen als solche, als Menschen, als geistige Personen, dort dürfte eigentlich auch schon nicht mehr von Krankheit die Rede sein: dort fallen alle nosologischen Kategorien fort, und dort - im Bereich personalen Geistes - stehen nur mehr noch die noologischen Kategorien zur Verfügung. Sie jedoch lauten längst nicht mehr "gesund - krank", sondern "wahr - falsch". (Frankl, 1996, S.108)
Auf Grund seines "Willens zum Sinn" strebt der Mensch danach, Sinn zu finden und zu erfüllen. Dies ist ihm möglich durch Verwirklichung von Werten. Frankl unterscheidet drei Wertkategorien: Der Mensch kann schöpferische Werte verwirklichen in dem er z. B. Aufgaben erfüllt, die sich ihm stellen. Er kann Erlebniswerte verwirklichen durch die Liebe zu einer anderen Person oder die Freude an der Natur, der Musik usw. und der Mensch kann Sinn finden in der Verwirklichung von Einstellungswerten, in dem er sich also einer Situation, etwas Unabänderlichem in bestimmter Weise stellt.
Die Aufgabe des Arztes ist es nun, so Frankl, nicht nur seine Patientinnen arbeits- oder auch genussfähig zu machen, sondern - in Bezug auf z. B. unheilbar Kranke - sie auch in ihrer Leidensfähigkeit zu unterstützen. Unter der Leidensfähigkeit versteht Frankl nun die Fähigkeit, das zu verwirklichen, was er - wie bereits erwähnt - als Einstellungswerte bezeichnet, denn nicht nur das Schaffen oder das Erleben, Begegnen, Lieben könne dem Dasein Sinn geben - so Frankl - sondern auch das Leiden. Frankl geht noch einen Schritt weiter, in dem er die Einstellung des Menschen zu Unabänderlichem nicht nur als irgendeine Möglichkeit bezeichnet, sondern als die Möglichkeit, den höchsten Wert zu verwirklichen und als die Gelegenheit, den tiefsten Sinn zu erfüllen:
Versuchen wir, die Frage zu beantworten, warum der Sinn, den das Leiden dem Menschen offeriert, der höchstmögliche ist. Nun, die Einstellungswerte erweisen sich insofern als ausgezeichnet gegenüber den schöpferischen und Erlebniswerten, als der Sinn des Leidens dem Sinn der Arbeit und dem Sinn der Liebe dimensional überlegen ist. (Frankl, 1977, S.81)
Denn - so Frankl - man kann davon ausgehen, dass sich der Homo sapiens aufgliedern lässt, und zwar in den Homo faber, der seinen Daseinssinn durch Arbeit erfüllt, in den Homo amans, der erlebend, begegnend und liebend seinem Leben Sinn gibt, und in den Homo patiens, den leidenden, sein Leiden leistenden Menschen. "Der Homo faber ist nun so recht, was man einen Erfolgsmenschen nennt; er kennt nur zwei Kategorien, und nur in ihnen denkt er: Erfolg und Misserfolg. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich sein Leben in der Linie einer Erfolgsethik" (Frankl, 1977, S.81).
Beim Homo patiens verhalte es sich, so meint Frankl, anders: Seine Kategorien heißen nicht mehr Erfolg und Misserfolg, sondern Erfüllung und Verzweiflung. Mit diesem Kategorienpaar stelle er sich jedoch senkrecht zur Linie aller Erfolgsethik, da "Erfüllung und Verzweiflung" einer anderen Dimension angehören.
Aus dieser dimensionalen Verschiedenheit aber ergibt sich ihre dimensionale Überlegenheit; denn siehe, der Homo patiens kann sich noch im äußersten Misserfolg, im Scheitern erfüllen. So hätte sich denn gezeigt, dass Erfüllung mit Misserfolg kompatibel ist, nicht anders als Erfolg mit Verzweiflung. Doch ist dies nur von der dimensionalen Differenz der zwei Kategorienpaare her zu verstehen. Freilich: Würden wir den Triumph des Homo patiens, seine Sinn- und Selbsterfüllung im Leiden, in die Linie der Erfolgsethik hineinprojizieren, so müsste er sich auf Grund der dimensionalen Differenz punktuell abbilden, das heißt, wie ein Nichts aussehen, als eine Absurdität imponieren. Mit anderen Worten: in den Augen des Homo faber muss der Triumph des Homo patiens Torheit und Ärgernis sein. (Frankl, 1977, S. 82) (siehe Abbildung 1)
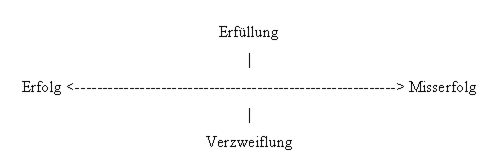
Abbildung 1 (Frankl, 1977, 81f)
Natürlich hat die Möglichkeit, schöpferische Werte zu verwirklichen, also dem Dasein handelnd zu begegnen, Vorrang gegenüber der Notwendigkeit, sich einem unabänderlichen Tatbestand zu stellen, also Einstellungswerte zu verwirklichen. Die Sinnmöglichkeit, die im Annehmen von Schicksalhaftem gegeben ist, steht zwar dem Wertrang nach über der Sinnmöglichkeit des Schaffens, "dem Leidenssinn kommt [also] der Primat zu", wie Frankl es ausdrückt, jedoch hat die "Sinnerfüllung im Schaffen" Priorität; denn "nicht schicksalhaft notwendiges, sondern unnötiges Leiden auf sich zu nehmen, wäre keine Leistung, vielmehrMutwille" (Frankl, 1977, S.82).
So gilt für Frankl folgendes: Kein Philosoph und auch kein Psychotherapeut könne einem kranken Menschen sagen, was der Sinn sei, wohl aber dass das Leben einen Sinn habe.
Und mehr als dies: dass es diesen Sinn behält unter allen Bedingungen und Umständen, und zwar dank der Möglichkeit, auch noch im Leiden einen Sinn zu finden, das Leiden auf der menschlichen Ebene in eine Leistung zu verwandeln und damit Zeugnis abzulegen von etwas, dessen der Mensch fähig ist, unter allen Umständen.
Frankl schreibt:
... - aber was die Möglichkeiten einer Sinnerfüllung anlangt, sind es sie [die Möglichkeiten] allein, die da vergänglich sind. Sobald sie nämlich einmal verwirklicht worden sind, sind sie es ein- für allemal; denn eine Möglichkeit, die wir in eine Wirklichkeit verwandelt haben, haben wir sozusagen ins Vergangen-sein hineingerettet, wo nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen ist, wo es aufbewahrt ist, wo es vor der Vergänglichkeit bewahrt ist. .... Wir sehen immer nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit - und übersehen die vollen Scheunen, in die wir die Ernte unseres Lebens eingebracht haben - die Taten, die wir getan, die Werke, die wir gewirkt, die Lieben, die wir geliebt haben, und die Leiden, die wir mit Mut und Würde durchgestanden. (Frankl, 1996, S.61f)
Diese, meint Frankl, machen den Wert eines Menschen aus. Es ist ein Wert, der sich aus der Vergangenheit herleitet, und nichts mit einer Nützlichkeit in der Gegenwart zu tun hat. Unsere Leistungsgesellschaft aber neigt dazu, den alten, behinderten oder kranken Menschen auf Grund seiner mangelnden Nützlichkeit abzuwerten.
Mit dem Begriff "lebensunwert" ist offensichtlich unnützes, nutzloses Dasein gemeint. Nur werde dabei - so Frankl - der Unterschied zwischen Nutzwert und Würde ignoriert:
Nutzwert mag gemessen werden an der Lebenstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit eines Individuums, also an dessen vitaler und sozialer Tauglichkeit; aber die Würde eines Menschen - eines Menschen als Person - bleibt ungeschmälert und unangetastet von jenem Verlust an Nutzwert, den diese geistige Person durch psychophysische Zerrüttung erleiden mag. (Frankl, 1996, S.109)
Um Immanuel Kant zu zitieren: "Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes ... gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist ... das hat eine Würde" (Kant, 1797, S.434). Der Mensch hat also nicht Wert, der Mensch hat Würde.
Mit Frankls Worten ausgedrückt: Die geistige Person steht hinter dem psychophysischen Krankheitsgeschehen, ihre Würde steht darüber - über der vital-sozialen Werteinbuße.
An den Arzt werden heutzutage Fragen herangetragen, die eigentlich nicht medizinischer, sondern philosophischer Natur sind - so Frankl. "Es hieße nur einen Rat von Kant befolgen, gedächten wir, die Philosophie als eine Medizin anzuwenden. Wenn sie perhorresziert wird dann liegt der Verdacht nahe, dass es aus der Angst heraus geschieht, mit dem eigenen existentiellen Vakuum konfrontiert zu werden" (Frankl, 1996, S.19).
Viktor E. Frankl spricht von "Dimensionen des Menschseins" (Frankl, 1979), von einer Dimensionalontologie, und führt zwei Gesetzte dieser Dimensionalontologie an, wobei er diese Gesetze mit Hilfe der Geometrie veranschaulicht:
Das erste Gesetz lautet folgendermaßen: Ein und dasselbe Ding, aus einer Dimension heraus in verschiedene Dimensionen hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bildet sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander widersprechen. Projiziert man z. B. ein Trinkglas mit der geometrischen Form eines Zylinders aus dem dreidimensionalen Raum in die zweidimensionalen Ebenen des Grund- und Seitenrisses hinein, dann ergibt dies im einen Fall einen Kreis, im anderen Fall ein Rechteck. Ein weiterer Widerspruch ergibt sich dadurch, dass die Projektion in jedem Fall eine geschlossene Figur erzeugt, das Trinkglas jedoch ein offenes Gefäß ist (siehe Abbildung 2).
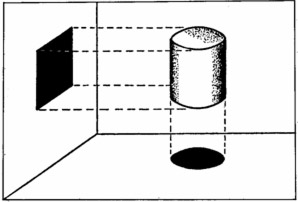
Abbildung 2 (1. Gesetz der Dimensionalontologie)
Das zweite Gesetz der Dimensionalontologie lautet: Nicht ein und dasselbe, sondern verschiedene Dinge, aus ihrer Dimension heraus und in ein und dieselbe Dimension hinein projiziert, die niedriger ist als ihre eigene, bilden sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander nicht widersprechen, sondern mehrdeutig sind. Projiziert man z. B. einen Zylinder, einen Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene hinein, dann ergibt dies in jedem Falle einen Kreis. Geht man davon aus, dass es sich um Schatten handelt, die der Zylinder, der Kegel und die Kugel werfen, dann sind diese Schatten insofern mehrdeutig, als man aus ihnen nicht darauf schließen kann, ob sie durch einen Zylinder, einen Kegel oder eine Kugel geworfen werden (siehe Abbildung 3).
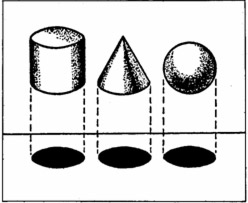
Abbildung 3 (2. Gesetz der Dimensionalontologie)
Frankl wendet nun das eben Gesagte auf den Menschen an:
Auch der Mensch, um die Dimension des spezifisch Humanen reduziert, und in die Ebenen der Biologie und Psychologie projiziert, bildet sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander widersprechen.
Denn die Projektion in die biologische Ebene ergibt somatische Phänomene, während die Projektion in die psychologische Ebene psychische Phänomene ergibt. Im Lichte der Dimensionalontologie aber widerspricht der Widerspruch nicht der Einheit des Menschen. Er tut es ebenso wenig wie der Widerspruch zwischen dem Kreis und dem Rechteck der Tatsache widerspricht, dass es sich um die Projektion ein und desselben Zylinders handelt. (Frankl, 1979, S.25f)
Frankl meint nun weiter: Die Einheit der menschlichen Seinsweise überbrücke die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Seinsarten, an denen sie teilhat, also Gegensätze wie Physe und Psyche. Diese Einheit lasse sich aber nicht in Ebenen finden, in die wir den Menschen projizieren; sie sei ausschließlich in der Dimension des spezifisch Humanen zu finden. "Es kann also nicht die Rede davon sein, dass wir das psychophysische Problem lösen. Es mag aber sehr wohl sein, dass die Dimensionalontologie ein Licht darauf wirft, warum das psychophysische Problem unlösbar ist" (Frankl, 1979, S.26).
Frankl führt weiter aus: Ein offenes Gefäß, projiziert in die Ebenen des Grund- und des Seitenrisses, ergibt geschlossene Figuren; bezogen auf das Problem der Willensfreiheit bedeutet dies, dass der Mensch sich in der biologischen Ebene als ein geschlossenes System physiologischer Reflexe abbildet, und in der psychologischen Ebene als ein geschlossenes System psychologischer Reaktionen. Die Projektion ergebe also wieder einen Widerspruch, so Frankl, da zum Wesen des Menschen seine "Weltoffenheit" gehöre. "Mensch sein heißt auch schon über sich selbst hinaus sein" (Frankl, 1979, S.26).
Die Geschlossenheit der Systeme physiologischer Reflexe oder psychologischer Reaktionen stehe aber im Lichte der Dimensionalontologie in keinem Widerspruch zur Menschlichkeit des Menschen, genauso wenig, wie die Geschlossenheit des Grund- und Seitenrisses des Zylinders einen Widerspruch zu dessen Offenheit bedeute.
Für Frankl haben die in den niedrigeren Dimensionen gewonnenen Befunde innerhalb dieser Dimensionen ihre Gültigkeit und er bezieht sich dabei auf die Reflextheorie Pawlows, den Behaviorismus von Watson oder die Psychoanalyse Freuds.
Wenn Frankl von "niedrigeren" bzw. "höheren" Dimensionen spricht, will er damit keineswegs eine Rangordnung oder ein Werturteil setzen: Denn mit höherer Dimension meint er eine umfassendere Dimension, welche die niedrigere in sich einschließt und einbegreift. Somit ist die niedrigere Dimension in der höheren durchaus im mehrdeutigen Sinne von Hegel "aufgehoben":
Womit wir auch schon dort angelangt wären, wo sich das zweite Gesetz der Dimensionalontologie auf den Menschen anwenden lässt: Projiziere ich nicht dreidimensionale Gebilde in eine zweidimensionale Ebene, sondern Gestalten wie Fedor Dostojewski oder Bernadette Soubirous in die psychiatrische Ebene, dann ist für mich als Psychiater Dostojewski nichts als ein Epileptiker wie jeder andere Epileptiker und Bernadette nichts als eine Hysterikerin mir visionären Halluzinationen. Was sie darüber hinaus sind, bildet sich in der psychiatrischen Ebene nicht ab. Denn sowohl die künstlerische Leistung des einen als auch die religiöse Begegnung der anderen liegt außerhalb der psychiatrischen Ebene. Innerhalb der psychiatrischen Ebene aber bleibt alles so lange mehrdeutig, bis es transparent wird auf etwas anderes hin, das dahinter stehen mag, das darüber stehen mag, gleich dem Schatten, der insofern mehrdeutig war, als ich nicht feststellen konnte, ob es der Zylinder, der Kegel oder die Kugel war, was den Schatten warf. (Frankl, 1979, S.28)
Abschließend kann folgendes gesagt werden: Für Viktor E. Frankl ist das Leibliche "bloße Möglichkeit".
Als solche ist es [das Leibliche] irgendwie offen nach etwas, das diese Möglichkeit verwirklichen könnte; denn an sich ist eine leibliche Möglichkeit nicht mehr und nicht weniger als die vom Biologischen her bereitgestellte Leerform - eine Leerform, die ihrer Erfüllung harrt. In diesem Sinne ist aber nicht nur das Somatische offen nach dem Psychischen, sondern auch dieses Seelische ist seinerseits offen nach dem Geistigen. Für den Forscher gilt es, dieses Offensein auch zu wahren. (Frankl, 1996, S.111)
Demnach haben die Biologie und die Psychologie - als die Wissenschaften von den leiblichen und psychischen Bedingtheiten der Menschen - die Türe offen zu halten; eine Türe, die aus dem Bereich der doppelten Bedingtheiten hinausführt. "...buchstäblich ins Freie führt: in den Bereich des Geistigen" (Frankl, 1996, S.111).
Schlussbetrachtungen
Es soll der Versuch unternommen werden, die Ausführungen Frankls herauszunehmen aus dem Bereich der Krankheit um sie anzuwenden auf den Bereich der Behinderung und um sie dort mit dem medizinisch-therapeutischen Modell von Behinderung in Verbindung zu bringen. Dabei lassen sich folgende Überlegungen anstellen: Das medizinische Modell von Behinderung, das Rehabilitations- und das Sonderpädagogik-Modell werden von Behindertenbewegungen als Defizit-Modelle bezeichnet, weil sie alle ein Defizit in Bezug auf Gesundheitszustand, Arbeitssituation und Lernfähigkeit definieren, welches korrigiert werden müsse, um den behinderten Menschen "normal" zu machen. Demzufolge kann auch die Prothese z. B. als Hilfsmittel zur Erlangung einer - allerdings oft problematischen - Normalität verstanden werden. In dem aber häufig versucht wird, den behinderten Menschen mit allen nur erdenklichen Mitteln in Richtung gesellschaftlicher Normvorstellungen hin zu therapieren, besteht die Gefahr, ihn seiner Individualität, seines "So-Seins", zu berauben. Denn wie will man einer Person gerecht werden, sie in ihrer Einheit und Ganzheit, ihrer Einzigartigkeit erfassen, wenn das Hauptaugenmerk auf (scheinbar) vorhandene Defizite gelenkt wird?
"Ich passte in das Korsett, aber das Korsett passte nicht zu mir. Mein androgynes Aussehen war verschwunden; stattdessen unterstrich das Korsett meine Weiblichkeit und meine Beeinträchtigung und ließ beide miteinander verschmelzen" (Gosling, zitiert nach Schmidt & Ziemer, 2004, S.17)
Frankl schreibt:
Im Gegensatz zum faktischen Ich ist das Selbst ein fakultatives. Es repräsentiert den Inbegriff der Möglichkeiten des Ich. Diese Möglichkeiten sind solche der Sinnerfüllung und Wertverwirklichung, und als solche sind sie Möglichkeiten, die nicht zuletzt in der Konfrontation des Menschen mit schicksalhaften Notwendigkeiten aufscheinen. Wer einen Menschen um diese Möglichkeiten betrügt, beraubt ihn des Selbst als des Spielraums, in dem das Ich atmet. (Frankl, 1996, S169)
Der Mensch ist in seinem Dasein Bedingungen unterworfen. Dabei kann es sich um biologische Bedingungen - wie z. B. Behinderung oder Krankheit - handeln, oder um psychologische oder soziologische Bedingungen. In diesem Sinne ist der Mensch nicht frei.
Er ist nicht frei von etwas, nicht frei von Bedingungen; jedoch ist er - nach Frankl - frei zu etwas; er ist frei zu einer Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen.
Wenn in den vorangegangenen Ausführungen vom "Leiden" gesprochen wurde, so ist hier zu betonen, dass grundsätzlich jedes menschliche Leben mit Leid verbunden sein kann.
Je mehr freilich eine Gesellschaft auf die Vorstellung von einem leidensfreien Lebensglück fixiert sei, so Lanzerath (2000), um so stärker stellen sich Bedingungen ein, die behinderten Menschen die Erfüllung ihrer sozialen Rollen sowie die Verwirklichung ihrer Lebensziele und -entwürfe zusätzlich erschweren.
Hegel hat sich in seiner "Naturphilosophie" dezidiert zum Begriff der organischen Krankheit geäußert. Im folgenden werden einige Hegel-Zitate aus seinen Aufzeichnungen über "Das Organische" in "Jenaer Systementwürfe III, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes", angeführt und anschließend nach Dr. Stefan Büttner (2003) näher erläutert:
Hegel beschreibt Krankheit als eine "Disproportion" zwischen Reizen und Wirkungsvermögen:
... - dies ist die wahre Bestimmung - Dies sind wahre Gegensätze, Reize, die Form des Daseins; der Organismus kann über seine Möglichkeit gereizt werden, weil er ebenso sehr ganze Einheit der Möglichkeit, Substanz, und Wirklichkeit des Selbsts, ganz unter der einen und der anderen Form ist; jenes theoretischer Organismus, dies praktischer. (Hegel, 1987, S.164f)
Nach Hegel ist ein krankheitsfreier Organismus nicht möglich; die Gesundheit des Organismus besteht gerade darin, krank werden zu können. Krankheit ist für ihn die notwendige Möglichkeit des Organismus: Der organisch kranke Mensch verwirklicht mit seiner Krankheit eine Bestimmtheit, die zu ihm als Lebewesen mit Notwendigkeit gehört. (Büttner, 2003)
Der Organismus also an sich selbst so auseinandertretend, dies ist der Begriff der Krankheit, der in seinem näheren Verlaufe zu betrachten; - Freiheit, Selbständigkeit beider Seiten, - wie Individuum und Staat, und dies die Substanz von jenem;... (Hegel, 1987, S.164f)
Er [der Organismus] hat ein selbstloses Bestehen der Systeme; er ist gereizt gegen das Wirkungsvermögen. Der Anfang der Krankheit ist, dass von irgend einer Seite, der Teil, das einzelne System, Bestehen gegen das Selbst gewinnt... - das seiende Ganze in einer Bestimmtheit; seine allgemeine Bestimmtheit ist, zu bestehen gegen das Selbst; aber die seiende Bestimmtheit, eine einzelne, die sich des Ganzen bemächtigt, statt des Selbsts; - so unmittelbar als isoliert, ist die Krankheit noch in ihren ersten Wegen. Aber so fern die Bestimmtheit Mittelpunkt, Selbst des Ganzen geworden, statt des freien Selbsts, bestimmtes Selbst - so ist die eigentliche Krankheit gesetzt. (Hegel, 1987, S.166)
Die eigentliche Konstitution der Krankheit ist nun, dass der organische Prozess sich nun in dieser befestigten Gestalt verläuft, in diesem Bestehen, d. h. dass die Prozesse eine Aufeinanderfolge bilden; - und zwar die allgemeinen Systeme auseinandergerissen, nicht unmittelbar eins sind, sondern diese Einheit durch die Bewegung, Übergehen des einen in das andere darstellen .... Der Organismus setzt sich als Ganzes gegen die Bestimmtheit; - er als Ganzes wird ein Bestehen, die einzelne krankhafte Affektion verwandelt sich in das Ganze, und diese Krankheit des Ganzen ist zugleich Heilung, denn es ist das Ganze, das in Bewegung gerät; - schlägt sich in den Kreis der Notwendigkeit auseinander; weil es Kreis, das Ganze. (Hegel, 1987, S.167)
Hegel sieht also in der Möglichkeit des Krank-Seins einen wesentlichen Aspekt des Gesund-Seins. Der Begriff Krankheit erlangt dadurch eine völlig andere Wertigkeit: Krankheit wird zu einer Ausdrucksform des lebendigen Organismus. Ersetzt man den Begriff "Krankheit" durch den - zu Hegels Zeiten nicht bekannten - Begriff "Behinderung", so erhält auch dieser eine spezifische Bedeutung: Behinderung kann so verstanden werden als ein mögliches - im Hinblick auf die Lebendigkeit des Organismus sogar - notwendiges Moment. (Büttner, 2003)
"... - die Bestimmtheit verwandelt sich zuerst in Bewegung, Notwendigkeit, ganzer Verlauf, und dieser in ganzes Produkt, und dadurch ebenso in ganzes Selbst" (Hegel, 1987, S.168).
Hegel denkt den Organismus als ein System von Organen, die einander wechselseitig erhalten. Jedes Organ ist selbständig, unmittelbar und unselbständig, vermittelt zugleich; die Organe sind füreinander Mittel und Zweck in einem. Durch dieses wechselseitige Spiel des Erzeugens, Erhaltens und Einschränkens bringt der Organismus sich permanent selbst hervor und ist somit ein sich selbst erzeugendes System. Er operiert als Einheit, als nicht beobachtbare, nicht lokalisierbare Einheit. Hegel bezeichnet sie als "negative Einheit".
Das Leben ist wesentlich diese vollkommene flüssige Durchdringung aller Teile desselben, a) Teile, d. h. solche, die gleichgültig gegen das Ganze sind; sie sind keine chemischen Abstraktionen; sondern substantielles, eigenes ganzes Leben - und ein Leben der Teile, welches in sich unruhig sich auflöst, und nur das Ganze hervorbringt. - Das Ganze ist die allgemeine Substanz, der Grund, als es die resultierende Totalität ist; - und es ist diese als Wirklichkeit; es ist das Eins, das in seiner Freiheit die Teile gebunden in sich enthält; es entzweit sich in sie, gibt ihnen sein allgemeines Leben, und hält sie als ihr Negatives, als ihre Kraft in sich; dies ist so gesetzt, dass sie an ihnen ihren selbständigen Lebenslauf haben, der aber das Aufheben ihrer Besonderheit und das Werden des Allgemeinen ist. Dies ist der Kreis, die Bewegung am einzelnen Wirklichen; das nicht Konstruierte, nicht absolut Gleichgültige füreinander. (Hegel, 1987, S.112)
Wenn Hegel vom "Negativen" spricht, dann meint er dies nicht im abwertenden Sinne: Die Einheit der wechselseitig sich erhaltenden Organe ist in keinem Organ zu lokalisieren, daher nur negativ, als "Abbild" verstehbar. Die Einheit des Organismus ist kein besonderer Zustand, sondern steht zu jedem Zustand in einem Negationsverhältnis und das wechselseitige Erhalten der Organe funktioniert, weil der Organismus permanent seinen jeweiligen Zustand aufhebt und damit erhält. Dies kennzeichnet nach Hegel Gesundheit: Es ist das Schweigen, das unauffällige Funktionieren der Organe.Gesundheit ist, wenn das Verweilen des Organismus in einem besonderen Zustand als Negation gefasst wird, ihrerseits Aufhebung dieser Negation ist und damit Rückführung des besonderen Zustandes in die allgemeine Lebendigkeit des Organismus.
Jedes Organ des Organismus kann sich - als Organ - gegen die Einheit des Organismus stellen; ja es muss dies sogar tun, weil es als Organ immer auch ein eigenes System ist und seine Selbständigkeit realisieren muss. Jeder Organismus kann demnach krank werden, weil er auch als gesunder die Selbständigkeit seiner Organe realisieren muss und damit als gesunder mit dem Moment der "Besonderung" auch das Moment der Fixierung der "Besonderung" an sich hat. Auf diese Weise lässt sich für Hegel "Krankheit alsNotwendigkeit" erklären.
Dies unterscheidet nach Hegel auch Krankheit von Gesundheit: Bei Krankheit funktionieren die Organe gerade nicht "lautlos" (Büttner, 2003).
Die Gesundheit besteht a) im gleichmäßigen Verhältnisse des Organischen zum Unorganischen - dass nicht Unorganisches für den Organismus ist, das er nicht überwinden kann; - nicht darin, dass ein Reiz zu groß oder zu klein ist für die Reizempfänglichkeit - er empfängt den Reiz, der zu groß oder zu klein ist. - Als Unorganisches an ihm selbst ist er der Vergrößerung oder Verminderung fähig - Disproportion seines Seins, und seines Selbsts - d. h. Freiwerden seines Daseins - keine Disproportion zwischen Faktoren, die innerhalb seiner auseinandertreten, Faktoren sind abstrakte Momente und können nicht auseinandertreten a) auch ist sich nicht mit der Disposition herumzustreiten - an sich krank ohne wirklich, angesteckt, ohne Übelsein - in seinem Dasein, ohne für sein Selbst; wesentlicher Unterschied; - der Organismus macht diese Reflexion selbst, dass was an sich, auch wirklich ist ... (Hegel, 1987, S.163)
Krankheit entsteht dadurch, dass der Organismus einen Außenreiz - also die Anforderungen der Umwelt - nicht mehr verarbeiten kann, er wird gegen sich selbst negativ. Normalerweise besteht der Organismus in der permanenten Aufhebung seines jeweiligen Zustandes, ist also ständig im Prozess. Die Krankheit stellt nun eine Fixierung dessen dar, wogegen sich die negative Einheit, der Prozess des Organismus ansonsten erfolgreich wendet. Nach Hegel beinhaltet jeder Umweltkontakt für den Organismus die Möglichkeit zur Krankheit. Gesundheit besteht nur so lange, wie die Fixierung permanent in die negative Einheit des Organismus zurückgeführt wird, also die mögliche Fixierung sogleich wieder aufgehoben wird (Büttner, 2003).
Um das Bedeutsame an Hegels Krankheitsbegriff nochmals hervor zu heben:
Er begreift den Organismus nicht als "an sich" krankheitsfrei, Gesundheit ist für ihn daher auch nicht ein durch das Fehlen von Krankheit gekennzeichneter Idealzustand. In der Krankheit realisiert der Organismus die in ihm bestehende Möglichkeit, krank werden zu können. Da der Organismus nicht prinzipiell als krankheitsfrei gedacht werden kann, ist somit auch nur der gesund, der auch krank werden kann.
Dies steht im Widerspruch zur weit verbreiteten und vor allem in unserer heutigen Gesellschaft gerne gedachten Idee des krankheitsfreien Menschen und der Vorstellung, einen durch Genmanipulation von Krankheitsdispositionen freien Menschen "erschaffen" zu können.
Hegel begreift Krankheit nicht als etwas, das dem Menschen fremd ist, ihn praktisch von außen "überfällt". Auch der gesunde Organismus hat bereits dasjenige Moment an sich, das in der Krankheit dann verselbständigt ist; im gesunden Organismus ist dieses Moment nur latent vorhanden, weil es ständig aufgehoben wird.
Damit ist Krankheit eine eigene Gestaltung des Organismus. Wesentlich ist hier der Gedanke, dass auch eine mögliche Destruktion oder Einschränkung nach den Gesetzmäßigkeiten des Organismus abläuft (Büttner, 2003).
Wenn Gesundheit nicht als Zustand (als Idealzustand) definiert wird, sondern als permanente Bewegung, als ein "der Krankheit abgerungener Prozess", verliert Krankheit den Charakter des Abnormalen und Verwerflichen. Das Gleiche kann dann auch über Behinderung gesagt werden: Der behinderte Mensch erfüllt mit seiner Behinderung eine der vielen möglichen Formen des Daseins und befindet sich nicht in einer defizitären Lebensform, die so weit als möglich und unter allen Umständen korrigiert gehört.
Daraus kann wiederum eine veränderte Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen resultieren, da sie nicht mehr als Personen in abweichendem und bedauerlichem Zustand gesehen werden. Behinderung wird so zu einer existentiellen Ausdrucksform, sie zeigt die Potentialität des Lebens und es gilt: Wer Behinderung abschaffen will, schafft den Organismus und damit den Menschen ab.
Abschließend soll hier nochmals erwähnt werden, dass diese Interpretation des Hegelschen Krankheitsbildes dem oben erwähnten Vortrag von Dr. Büttner entnommen wurde.
Schlussbetrachtungen
Ein anderer Aspekt der Hegelschen Philosophie scheint hier erwähnenswert und es soll der Versuch unternommen werden, ihn gedanklich mit den Begriffen Behinderung und Erkrankung in Verbindung zu bringen:
Hegel hat mit seinen Ausführungen über die Dialektik dem Begriff der Synthese einen tieferen Sinn gegeben. Er betrachtet die Dialektik nicht nur logisch, als eine Form unseres Denkens, sondern versteht sie auch ontologisch bzw. metaphysisch, als die "eigentümliche Form der Selbstbewegung der Wirklichkeit". Bei Hegel werden die beiden dialektischen Gegenpole These und Antithese durch die Synthese nicht eingeschränkt, sondern "aufgehoben" - und zwar aufgehoben in einem dreifachen Sinne, nach der dreifachen Bedeutung, den dieser Begriff in der deutschen Sprache hat: erstens: aufgehoben im Sinne von beseitigt, zweitens: aufgehoben im Sinne von bewahrt und damit lebendig erhalten und drittens: aufgehoben im Sinne von hinaufgehoben auf eine höhere Ebene, auf der beide Pole nicht mehr als sich ausschließende Gegensätze erscheinen.
Gegensätze schließen sich nach Hegel also nicht aus, im Gegenteil, jede Erscheinung deutet gleichsam von sich aus über sich hinaus auf ihren Gegensatz hin. Wie schon erwähnt, wendet Hegel dieses Prinzip nicht nur in seiner Wissenschaft der Logik an (Störig, 1998).
Wir können dieses dreistufige dialektische Schema Hegels auf viele Beispiele des menschlichen Daseins beziehen. Denn in der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Existenz erfährt der Mensch immer wieder Extreme und ist aufgefordert, diesen in irgendeiner Weise zu begegnen.
Das Denken unserer Kultur und Gesellschaft ist zum größten Teil dualistisch geprägt. Wir leben in Gegensätzen, wie schön - hässlich, normal - behindert, gesund - krank usw.
Dieser Dualismus hebt sich - bezogen auf Hegels Dialektik - auf, und zwar in der oben dargestellten, dreifachen Weise:
Das Verständnis von Behinderung als eines negativen Gegenpols zur Normalität kann aufgehoben im Sinne von beseitigt werden, in dem wir quasi im Prozess der Synthese Behinderung als einen normalen Bestandteil der Vielfalt menschlichen Lebens betrachten.
Der Begriff "behindert" wird aufgehoben im Sinne von bewahrt, wenn man ihn nicht als Begriff "an sich" betrachtet, also nicht als etwas Unbedingtes. Der Begriff "behindert" ist "an sich" gar nichts, bezogen auf die Person, die so bezeichnet wird, wird er ein Teil ihrer Persönlichkeit. Mit Hegels Worten formuliert: Ihr Sein ist ein Anders-Sein.
In der Synthese werden die gegenteiligen Bewertungen der Begriffe "behindert und normal" aufgehoben im Sinne von auf eine höhere Ebene gebracht, wenn es gelingt, die in der Wirklichkeit vorhandenen Widersprüche in sich aufzunehmen, in ihnen eine höhere Einheit zu finden. Ich möchte dies durch folgende Frage veranschaulichen: Wenn der Name Beethoven fällt - wer denkt da auch nur eine Sekunde lang an seine Gehörlosigkeit? Es ist die Musik, die sein Dasein prägte. Bezogen auf Hegels Dialektik könnte dies folgendes bedeuten: In Beethovens Kunst ist die Spannung zwischen ihm als dem Individuum und der Gesellschaft als der wertenden Macht aufgehoben.
Inhaltsverzeichnis
Kierkegaard gilt als Ahnherr des Existentialismus vor allem wegen der Unbedingtheit, mit der er den "existierenden" Einzelnen in den Mittelpunkt stellt (Störig, 1992)
Indem er hier erwähnt wird, soll der Versuch unternommen werden, einige seiner philosophischen Äußerungen zum Begriff Angst in Zusammenhang zu bringen mit den Begriffen Krankheit und Behinderung. Dies scheint möglich, wenn Behinderung als soziale Konstruktion verstanden und die persönliche Erfahrung einer abweichenden Körperlichkeit mit Hilfe von psychoanalytischen Konzepten betrachtet wird.
Häufig schließen Gesellschaften Menschen mit bestimmten - außerhalb der Norm stehenden - Daseinsformen aus, da deren Nähe (unbewusste) Ängste erwachsen lässt; sie ziehen Grenzlinien zwischen "gesund" und "krank" bzw. "behindert" und "nicht-behindert"; Grenzen, die der Bewältigung von Angst dienen.
Es scheint die Angst davor zu sein, einmal am eigenen Leibe erleben zu müssen, dass der Körper sich nicht mehr als Mittel zum Zweck nutzen lässt, dass ihm Grenzen gesetzt sind und das Leben einmal zu Ende gehen wird, dass der Körper Schmerzen bereiten kann und dass in ihm Prozesse ablaufen, seien es Emotionen oder Krankheiten, die sich trotz aller Bemühungen nicht beherrschen lassen und denen jeder ausgeliefert ist. (Richarz, 2003, S.44f)
Die Erfahrung von Ohnmacht und Abhängigkeit ist eine überaus Angst machende Erfahrung, die - vor allem in unserer westlichen Gesellschaft - durch unterschiedliche Verhaltensmuster, Reaktionsweisen und Einstellungen mehr oder weniger erfolgreich abgewehrt wird.
Sören Kierkegaard schreibt in seinem Werk "Der Begriff Angst":
Der Patient wurde entfernt, damit den andern nicht bange werden sollte. In unserer mutigen Zeit wagt man nicht, einem Patienten zu sagen, dass er sterben werde, man wagt nicht, den Pfarrer zu rufen, aus Furcht, er könne vor Schreck sterben, man wagt nicht, einem Patienten zu sagen, dass da in diesen Tagen einer an derselben Krankheit gestorben ist. Der Patient wurde entfernt, das Mitleid erkundigte sich nach ihm, der Arzt versprach, sobald wie möglich eine tabellarische und statistische Übersicht herauszugeben, um eine Durchschnittszahl zu errechnen. Und hat man eine Durchschnittszahl, dann ist alles erklärt. Die medizinisch-behandelnde Anschauungsweise sieht das Phänomen als rein physisch und somatisch an und macht es, wie Ärzte es öfter machen, ..., er nimmt sich eine Prise und sagt: Das ist eine bedenkliche Sache. (Kierkegaard, 2002, S.111)
Kierkegaard spricht hier von der "medizinisch-behandelnden Anschauungsweise" und vom "rein physisch und somatisch" angesehenen Phänomen, wobei unter Phänomen die "Angst als Urphänomen" zu verstehen ist. Was ist hier gemeint? Kierkegaard beschreibt eine Angst, die sich aus dem Inneren des Menschen entfaltet. In seiner Eigenschaft als Mensch fühlt der Mensch Angst und in der Angst wird der Mensch erschreckt über seine Stellung im Dasein, umgeben von Naturmächten im Äußeren und in seinem eigenen Innern.
Hier lässt sich eine Brücke bauen zur heutigen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung zwischen medizinisch-therapeutischen Sichtweisen von Krankheit bzw. Behinderung und der Definition von Behinderung als soziale Konstruktion:
Die heute übliche Konstruktion von Behinderung beruht, so Richarz (2003), auf einer Spaltung in gut und böse. Durch diese Spaltung soll das im Behinderten oder Kranken verkörperte "Böse, das Angst macht, auf magische Weise gebannt werden" (Milani-Compareti, 1986, zitiert nach Richarz, 2003, S.45).
"Damit wird deutlich, dass die Konstruktion von Behinderung auch die Bedeutung hat, das psychische Überleben von Nicht-Behinderten zu sichern oder zumindest zu erleichtern" (Richarz, 2003, S.45). Erst die Festlegung, was behindert oder krank ist, schafft den Freiraum, sich als nicht-behindert oder gesund definieren zu können.
Kierkegaard vergleicht die (subjektive) Angst mit Schwindligsein. "Derjenige, dessen Auge plötzlich in eine gähnende Tiefe hinunterschaut, der wird schwindlig." Er fragt nach dem Grund dafür und meint, es sei ebenso sehr das Auge des Menschen wie der Abgrund. "denn was, wenn er nicht hinabgestarrt hätte! So ist Angst der Schwindel der Freiheit, der entsteht, in dem der Geist die Synthese setzen will und die Freiheit nun hinabschaut in ihre eigene Möglichkeit und da die Endlichkeit ergreift". In diesem "Schwindel", so meint Kierkegaard, sinke die Freiheit ohnmächtig um. "Weiter kann die Psychologie nicht kommen und will es auch nicht" (Kierkegaard, 2002, S.57).
Besonders Kierkegaards Ausführungen zur "Angst vor demGuten" sind hervorzuheben. Er spricht vom "Dämonischen" und bezeichnet es als "ein unfreies Verhältnis zum Guten":
Man kann das Dämonische ästhetisch-metaphysisch betrachten. Das Phänomen fällt da unter die Bestimmung: Unglück, Schicksal usw. und lässt sich betrachten in Analogie dazu, geistesschwach usw. geboren zu sein. Dann verhält man sich mitleidend zum Phänomen. Aber wie das Wünschen die erbärmlichste aller Solokünste ist, so ist das Mitleid in dem Sinne, in dem es gewöhnlich verstanden wird, die erbärmlichste aller gesellschaftlichen Virtuositäten und Begabungen. Das Mitleid ist so weit entfernt, dem Leidenden zugute zu kommen, dass man in ihm eher bloß eine Freistatt für seinen Egoismus hat. Man wagt nicht, über derartiges im tieferen Sinne nachzudenken, und nun rettet man sich durch Mitleid. (Kierkegaard, 2002, S.109f)
Wie Kierkegaard den Begriff Mitleid verstanden haben will, damit er Bedeutung im positiven Sinne erlange, wurde bereits in den vorhergehenden Ausführungen über Nietzsche erwähnt und muss daher hier nicht nochmals zitiert werden. Aber, "... übernimmt das wahre humane Mitleid als Bürge und Selbstschuldner das Leiden, dann muss es erst ins reine darüber kommen, wieweit dies Schicksal und wieweit dies Schuld ist" (Kierkegaard, 2002, S.110).
Er meint, wenn man das Dämonische als Schicksal begreife, könne es jedem passieren. Dies sei nicht zu leugnen, auch wenn man alles Mögliche tue, "um durch Zerstreuungen usw. einsame Gedanken fernzuhalten." Einsame Gedanken fernhalten - könnte dies bedeuten, Auseinandersetzungen auszuweichen? Auseinandersetzungen weicht man aus, "um sich mit der herrschenden Normalität eins zu fühlen", so Rommelspacher (2004). Die herrschende Normalität wird durch Ausgrenzung bestätigt; jedoch verspricht "der Blick über die Grenzen der Normalität einen Ausstieg aus der Eindimensionalität der Vergleichbarkeit und dem Druck der permanenten Konkurrenz. Er vermittelt eine Ahnung von dem ganz anderen: der Infragestellung der Norm" (Rommelspacher, 2004).
Um wieder zu Kierkegaard und seine "Angst vor dem Guten" zurückzukommen: Die Angst des Individuums richtet sich auf das Böse. Diese Ausprägung steht - so meint Kierkegaard - von einem höheren Standpunkt gesehen im Guten: denn deshalb ängstigt sie sich vor dem Bösen. Die andere Ausprägung aber, so Kierkegaard, ist das Dämonische: Das Individuum steht im Bösen und ängstigt sich vor dem Guten. " ... das Dämonische ist ein unfreies Verhältnis zum Guten. Deshalb wird das Dämonische erst recht deutlich, indem es vom Guten berührt wird, welches dann von außen her an seine Grenze kommt" (Kierkegaard, 2002, S.109).
Kierkegaard hat, wie bereits erwähnt, das Dämonische unter anderem als Schicksal betrachtet, er betrachtet es aber auch unter dem Gesichtspunkt medizinischer Behandlung.
Dass ... so verschiedene Betrachtungsweisen möglich sind, zeigt die Zweideutigkeit des Phänomens, dass es in gewisser Weise in alle Sphären hineingehört, in das Somatische, Psychische, Pneumatische. Dies deutet darauf hin, dass das Dämonische einen weit größeren Umfang hat, als gewöhnlich angenommen wird, was sich daraus erklären lässt, dass der Mensch eine Synthese von Seele und Körper ist, die vom Geist getragen wird, weshalb eine Desorganisation der einen Sphäre sich in den übrigen zeigt. Wenn man aber erst darauf aufmerksam wird, welchen Umfang es hat, dann wird es sich vielleicht zeigen, dass verschiedene sogar von denen, die dieses Phänomen behandeln wollen, selbst darunter fallen und dass sich Spuren davon bei jedem Menschen finden. (Kierkegaard, 2002, S.112)
Die Angst als UrtatbestanddesMenschseins - das ist es, was Kierkegaard hier anspricht und nachfolgende Existenzphilosophen in ihrer Philosophie weiterführen.
Diese Angst erzeugende "Geworfenheit" in die eigene "Existenz" findet sich wieder in der Psychoanalyse und wird aufgegriffen in anderen psychologischen und psychosozialen Ansätzen, die der Kategorie "Angst" als Erklärung der Ablehnung von Behinderung und Krankheit eine große Rolle zuschreiben:
Die psychoanalytische Lehre geht von einer natürlichen, triebhaften Ablehnung von beeinträchtigten Menschen aus. Sie erklärt, diese Ablehnung werde gesellschaftlich stark sanktioniert und führe daher zu einer Schuldangst vor dem verinnerlichten Über-Ich. Dabei wirke die Schuldangst so stark, dass der triebhafte Impuls selbst gar nicht ins Bewusstsein dringt, sondern verdrängt werde. Neben dieser Verdrängung bewirke die Schuldangst weitere Abwehrmechanismen, wie Projektion und Rationalisierung, und dies bilde die Basis für die Ablehnung.
Die analytische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Niedecken spricht von "Phantasmen" und versteht darunter "jene psychischen Konfigurationen, in denen Gesellschaften ihre Herrschaftsstrukturen in den Individuen gesellschaftlich unbewusst absichern, sie wie unabänderlich und naturgegeben erscheinen lassen" (Niedecken, 1993, zitiert nach Nickel, 1999/2004).
Für Niedecken (1993) sind unsere Beobachtungen und Bilder, die wir von der Welt haben - und somit auch von behinderten oder kranken Menschen - häufig mit einem unterstellten Anders-Sein verschmolzen und werden damit zur Realität.
Gesellschaftliche Verhältnisse erschweren den Kontakt zu Menschen mit Behinderung: Stark marktorientierte Wettbewerbsformen oder die Separierung von als nicht leistungsfähig eingestuften Menschen schüren Ängste innerhalb einer Gesellschaft, die durch vorherrschende Ideologien und Vorurteile gefestigt werden (Nickel, 1999/2004).
Empirische Untersuchungen experimenteller Art weisen auf eine weitgehend unkontrollierbare Erregtheit beim Nichtbehinderten in Interaktion mit einer behinderten Person hin. So wurden unter anderem Forschungsergebnisse zur emotionalen Erregtheit in Konfrontation mit physisch abweichenden Personen in den systematischen Laborexperimenten von Kleck und Mitarbeitern erzielt (Kleck, 1966, 1968b, 1969; Kleck, Ono & Hastorf, 1966; Kleck et al., 1968). "Psychische Erregungszustände, Angst, Stress etc. äußern sich u. a. in exakt messbaren physiologischen Veränderungen des Hautwiderstands" (Cloerkes, 1985/2004). Kleck et al. (1966) berichten über signifikant geringere Hautwiderstandswerte als Anzeichen für psychischen Stress im Falle der plötzlichen Konfrontation mit einem körperbehinderten Interaktionspartner.
Das Bild, das der einzelne Mensch von sich selbst hat und das als "self-image" oder "Selbst" bezeichnet wird, beinhaltet auch die Vorstellung, die der einzelne von seinem Körper hat. Dieses wird als "body-concept" oder "body-image" bezeichnet. Da die westliche Gesellschaft Schönheit und körperlicher Integrität besondere Bedeutung zuschreibt, ist das Abweichen von diesen Standards auch von großer Bedeutung für das body-image des einzelnen. (Cloerkes 1985/2004)
Dieser hohe Stellenwert von Gesundheit und physischer Integrität führt nun zu einer vermehrten Angst, diese zu verlieren, und diese Angst wird beim Anblick von Behinderung oder Erkrankung aktualisiert. Aber nicht nur gesellschaftliche Normvorstellungen von Schönheit und Gesundheit erzeugen Angst; historisch gesehen resultiert Angst auch aus einer magischen Furcht vor Ansteckung und einer Urangst vor allem Fremden und Unerklärbarem.
Kognitive Konsistenztheorien nehmen an, dass Angstreaktionen nicht angeboren seien, sondern auf "kognitiven Dissonanzen" zwischen bekannten und fremdartigen Wahrnehmungen beruhen, wobei eine prinzipielle Konsistenz zwischen Meinungen, Gefühlen, Verhaltensabsichten und offenem Verhalten postuliert wird. Wenn ein Mensch
z. B. einer Hilfe bedürftigen Person gegenüber steht und bei deren Bitte um Hilfe zwar Abneigung empfindet, jedoch glaubt, gesellschaftlichen Konventionen folgend nicht ablehnen zu können, erzeugt diese Widersprüchlichkeit eine kognitive Dissonanz. Beim Versuch, diese Dissonanz zu verringern, wird diejenige Kognition verändert, deren Änderung den geringsten psychischen Aufwand erfordert. Durch diese Theorie werden vor allem ausweichende Verhaltensweisen Menschen mit Krankheit oder Behinderung gegenüber erklärt. (Nickel, 1999/2004)
Die "Angst" vor Behinderung oder Krankheit äußert sich also in vielfältiger Weise, sie äußert sich aber vor allem in ausgrenzenden Verhaltensweisen. Es soll an dieser Stelle jedoch nochmals betont werden, dass hier ausschließlich eine existentielle Angst gemeint ist, die nicht als Furcht vor etwas Bestimmten verstanden werden darf. Es ist nicht die Angst vor dem behinderten oder kranken Menschen als Person oder die Furcht vor einem medizinisch erklärbaren und rational verstehbaren körperlichen Zustand. Es ist eine das Dasein bedrohende, unbewusste Angst.
Existenzphilosophen wie Heidegger bezeichnen Angst als Grundbefindlichkeit des Daseins, lehnen jedoch "das Herzstück" der Philosophie Kierkegaards, den "religiösen Ausgangspunkt" (Kierkegaard, 2002, S.170), in ihrer Philosophie ab. Denn als christlicher Philosoph zeigt Kierkegaard eine Lösung auf: Der Mensch kann in der Enge der Angst wählen, er kann entweder ein höheres Reich der Freiheit betreten, oder in dem naturgebundenen Dasein bleiben.
Das Dämonische als Angst vor dem Guten bezeichnet Kierkegaard auch als "das Verschlossene":
Wir wollen nun das Verschlossene x sein lassen, und sein Inhalt sei auch x, d.h. das Entsetzlichste und das Unbedeutendste, das Schreckensvolle, von dessen Anwesenheit im Leben vielleicht nicht viele träumen, und die Bagatelle, auf die niemand achtet, was bedeutet dann das Gute als x? Es bedeutet die Offenbarung. (Kierkegaard, 2002, S.115f)
Wobei Kierkegaard hier anfügt, dass er zwar den Begriff "Offenbarung" gebrauche, man das Gute aber auch als "Durchsichtigkeit" bezeichnen könne.
Für Kierkegaard besteht das Tiefsinnige im Dasein darin, dass die Unfreiheit gerade sich selbst zum Gefangenen macht und somit das Dämonische sich selbst einschließt.
Die Freiheit ist beständig kommunizierend ..., die Unfreiheit wird immer verschlossener und will die Kommunikation nicht. Das kann man in allen Sphären beobachten. Es zeigt sich in der Hypochondrie und Grillenfängerei, es zeigt sich in den höchsten Leidenschaften, wenn diese im tiefen Missverständnis das Schweigsamkeitsprinzip einführen. Wenn die Freiheit nun die Verschlossenheit berührt, dann bekommt diese Angst. (Kierkegaard, 2002, S.113f)
Zeigt sich diese Unfreiheit vielleicht auch in gesellschaftlich festgeschriebenen Verhaltensweisen und unreflektierten, als "wahr" angenommenen Wert- und Norm-Vorstellungen? Kierkegaard beschreibt die Unfreiheit, das "Dämonische", als einen "Zustand" und meint, das Dämonische könne sich äußern "als Bequemlichkeit, die denkt: "ein andermal"; als Neugierde, die nicht mehr wird als Neugierde; als unredlicher Selbstbetrug; ...; als vornehmes Ignorieren; als dumme Geschäftigkeit usw." (Kierkegaard, 2002, S.126).
Verletzende Neugierde; Bequemlichkeit, die denkt "ein andermal"; Ignorieren ... sind das nicht jene ausgrenzenden Verhaltensweisen, die häufig auch behinderten oder kranken Personen gegenüber gezeigt werden?
Abschließend soll nochmals folgendes festgehalten werden: Diese Ausführungen über Kierkegaard werden ihm als dem religiösen Denker nicht gerecht. Es wurde hier lediglich der Versuch unternommen, seine philosophische Darstellung der Angst als "Urtatbestand des Menschseins" mit jener Angst zu vergleichen, die in sozialpsychologischen oder psychoanalytischen Erklärungsmodellen für ausgrenzendes Verhalten allem "Nicht-Normalen" gegenüber angesprochen wird.
Kierkegaard: die unbestimmte Angst vor dem "Nichtnormalen", "Fremden"
In "Das Sein und das Nichts" zeigt sich Sartres (1943/1991) psychologische Tendenz, wenn er versucht jenes Gefühl zu beschreiben, das einen Menschen ergreift, der sich plötzlich der immer schon gegebenen Anwesenheit der Anderen bewusst wird und sich selbst als gemeinschaftliches Wesen annimmt. Sartre nimmt in diesem Werk eine Ausweitung einer ursprünglich ontologisch relevanten Problematik auf eine psychologische Thematik vor. So geht er von der Frage, was das Sein des Menschen sein muss, um in ein Verhältnis zum Sein der Welt treten zu können, über zu der Überlegung, wie das Erleben des Menschen beschaffen sein muss, damit er den Anderen als seinen Seins-Partner wählt (Möbuß, 2000). Diese Fragestellung führt Sartre zu seiner Theorie der Freiheit: Das Wissen darum, dass der Mensch in jedem Augenblick seiner Existenz frei ist, und dass es keine Instanz gibt, die ihn hiervon freisprechen oder erlösen könnte.
Diese Freiheit realisiert sich aber nur im Rahmen dessen, was mir möglich ist, so dass dasjenige, was mir unmöglich ist, meine Freiheit nicht beeinträchtigen kann.
Die Freiheit, die meine Freiheit ist, bleibt total und unendlich; nicht weil der Tod sie nicht begrenzte, sondern weil die Freiheit dieser Grenze nie begegnet, ist der Tod durchaus kein Hindernis für meine Entwürfe; er ist nur ein anderweitiges Schicksal dieser Entwürfe. (Sartre, 1943/1991, S.941)
Meine Freiheit bewährt sich darin, dass ich das für mich Unabänderliche akzeptiere, was letztlich nichts anderes heißt, als dass ich die Verantwortung dafür übernehme. Ich verhalte mich so, als hätte ich das Ungewollte gewollt.
Hier lässt sich die Frage stellen, ob diese Definition des Begriffs der menschlichen Freiheit nicht auch für einen Menschen mit Behinderung eine besondere Bedeutung erlangen könnte. Denn Freiheit bedeutet hier nicht nur Übernahme, Akzeptanz und Anerkennung, sondern auch die Möglichkeit menschlichen Handelns angesichts einer von der Gesellschaft häufig definierten "ausweglosen" Situation; und zwar eines Handelns in Form eines Wählens:
Tatsächlich können Rasse, Gebrechlichkeit, Hässlichkeit nur in den Grenzen meiner eigenen Wahl der Minderwertigkeit oder des Stolzes erscheinen; anders gesagt, sie können nur mit einer Bedeutung erscheinen, die meine Freiheit ihnen verleiht; das bedeutet, noch einmal, dass sie für den anderen sind, für mich aber nur sein können, wenn ich sie wähle. (Sartre, 1943/1991, S.909f)
Nach Sartre könne der einzelne also nicht sein ohne sich zu wählen - und dieses Sich wählen, dieses Für-sich, verweise auf das Für andere:
Um das Sein des Einzelnen in seinem An-sich-sein vollständig erfassen zu können, sind für ihn zwei Fragen von besonderer Bedeutung; zum ersten die Frage nach der Existenz anderer und zum zweiten jene nach dem Seinsbezug zum Sein anderer. Sartre spricht dies in seinem Werk "Das Sein und das Nichts" an: Ich benötige andere, "um alle Strukturen meines Seins voll erfassen zu können" (1943/1991, S.407).
Durch den Blick des Anderen - auch wenn er zufällig oder absichtslos erscheint - eröffnet sich dem Angesehenen ein Zugang zur Erkenntnis seines Ich, der ihm sonst verschlossen bleiben würde. So genügt es, "dass der Andere mich anblickt, damit ich das bin, was ich bin" (Sartre, 1943/1991, S.473).
Hier kann vergleichend Lanzerath angeführt werden, der erklärt, dass Selbstauslegung und die damit verbundene Identitätsschaffung jedes einzelnen wesentlich über den Prozess der Sozialisation in Abhängigkeit von den Werten und Normen einer Gesellschaft verlaufen. In Bezug auf den behinderten oder kranken Menschen ist dies aber von besonderer Relevanz, denn dadurch "wird es behinderten Menschen, die eben diesen Normvorstellungen nicht entsprechen können, besonders schwer gemacht, ihre Identität zu finden" (2000, S.242f). Die Erfahrung für den Betroffenen, behindert zu sein, erschließe sich primär durch die Abweisung, Distanzierung, Missachtung und soziale Ausgliederung, d. h. in der Erfahrung, dass die eigene Entfaltung und Eingliederung in die Gesellschaft behindert werden, so Lanzerath.
Sartre schreibt:
Doch der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen mir und mir selbst: ich schäme mich meiner, wie ich Anderen erscheine. Und eben durch das Erscheinen Anderer werde ich in die Lage versetzt, über mich selbst ein Urteil wie über ein Objekt zu fällen, denn als Objekt erscheine ich Anderen. (Sartre, 1943/1991, S.406)
Hier führt Sartre den Begriff der "Scham" an und erklärt ihn folgendermaßen: "Die Scham ist ihrer Natur nach Anerkennung. Ich erkenne an, dass ich bin, wie Andere mich sehen" (1943/1991, S.406).
Für Sartre bedeutet diese Anerkennung gleichzeitig Verlust eigener Möglichkeiten: In dem Moment, in dem der Mensch sich als denjenigen akzeptiert, den der andere in ihm sieht, verzichtet er auf seine weiteren Möglichkeiten in der Zukunft (Möbuß, 2000). Im Blick des Anderen wird der Mensch demnach mit der Freiheit konfrontiert, die ihm allerdings hier als die Freiheit des Anderen begegnet. Diese Freiheit des Anderen ist zwar einerseits unverzichtbares Kriterium der Selbstsicht des Menschen, andererseits liefert sich der so Erblickte dem Urteil des Anderen rückhaltlos aus und setzt dessen Freiheit über die eigenen nun unverwirklicht bleibenden Möglichkeiten.
So erfahre ich den Andern durch den Blick konkret als freies und bewusstes Subjekt, das macht, dass es eine Welt gibt, indem es sich auf seine eigenen Möglichkeiten hin verzeitlicht. Und die unvermittelte Anwesenheit dieses Subjekts ist die notwendige Bedingung jedes Gedankens, den ich mir über mich selbst zu machen versuche. (Sartre, 1943/1991, S.488)
Sartre beschreibt hier die ungewöhnliche Macht, die der Blick eines Anderen auf die eigene Selbstwahrnehmung ausüben kann: Angeblickt-werden ist immer zugleich ein über das eigene Sein Aufgeklärt-werden (Möbuß, 2000).
In der Relation zu den "Anderen", die das "Anderssein" erst konstituiert, beginnt aber auch der Stigmatisierungsprozess: Bei Urteilen über behinderte Menschen stehen "Negativ-Eigenschaften", die gegen den "Normalzustand" abgehoben werden, im Vordergrund, ohne dass deren Entfaltungsmöglichkeiten wahrgenommen werden. Statt das "Seltene" und "Anderssein" als Aspekt einer "normalen Variabilität" anzusehen, wird das "Häufige" normativ genommen (Lanzerath, 2000, S.243).
Behinderungen sind von sozial festgelegten Normen und Werten abhängig; dadurch wirkt sich die Wahrnehmung eines "Defektes" auf das Hineinwachsen in die Gesellschaft aus und ist von Bedeutung für das Erlernen eines für das gesellschaftliche Miteinander notwendigen Rollenrepertoires. Nicht die physische Funktionseinschränkung ist daher existentiell entscheidend, sondern die dadurch erlittene Verkürzung sozialer Kontakte, die "von anderen" in Frage gestellte Identität.
Jollien (1999/2001) bezieht sich in diesem Zusammenhang ebenfalls auf Sartre und dessen Begriff der réification [Verdinglichung]: "Die "réification" besteht darin, den anderen zu verdinglichen. Sie reduziert den anderen auf ein Attribut, sieht in ihm bloß eine Eigenschaft oder einen Fehler, sie versteinert ihn und blockt dadurch jegliche Evolution ab" (S.45).
Nach Lanzerath (2000) lässt der Kontrollverlust über den eigenen Körper oder über die Lebenssituation, der mit einem Krankheitserleben einhergehen kann, ein Gefühl der Unsicherheit entstehen. Die damit verbundene "Hilfserwartung" werde als eine der "Fundamentalerfahrungen des Menschen" bezeichnet. Der Blick des Anderen, wie Sartre ihn bezeichnet, sei daher eine wichtige Größe bei der Auslegung der eigenen Krankheitssituation.
Rommelspacher (2004) führt bezogen auf den behinderten Menschen an, dass im Messen an der Norm Behinderte ständig ihr Nicht-normal-Sein erfahren und so der unmittelbaren Erfahrung ihrer selbst entfremdet werden. Bei Nichtbehinderten dagegen löse die Begegnung mit Behinderten Irritationen aus und aktiviere Ängste, was die eigene "Normalität" und "Unbeschädigtheit" betreffe. Dieser "Normalität" versichert man sich vielfach auf Kosten der anderen und zwar in Form einer abwehrenden Identifikation. Die eigenen Erfahrungen körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen werden abgespalten und auf den "Anderen" als das "ganz Andere" projiziert, um sich so von dem anderen und den eigenen unerwünschten Anteilen zu distanzieren (Rommelspacher, 2004)
Menschliche Existenz ist immer das Ergebnis des komplizierten Verhältnisses von Behauptung und Verzicht oder, wie Sartre es bezeichnet, von Anerkennung und Negation. Nach Sartre vermag nur der Mensch ein verantwortungsbewusst agierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, der sich seiner Seinsweisen und seiner Wirkung auf den anderen bewusst ist (Möbuß, 2000).
Um wieder Sartre zu zitieren:
Obwohl ich über unendlich viele Arten verfüge, mein Für-Andere-Sein zu übernehmen, kann ich nicht umhin, es zu übernehmen. ... in der Wut, im Hass, im Stolz, in der Scham, im angeekelten Zurückweisen oder im freudigen Beanspruchen muss ich wählen, das zu sein, was ich bin. So entdecken sich die Unrealisierbaren dem Für-sich als "zu realisierende-Unrealisierbare". Sie verlieren deswegen nicht ihren Charakter von Grenzen; ganz im Gegenteil, als objektive, äußere Grenzen bieten sie sich dem Für-sich als zu verinnern dar. (Sartre, 1943/1991, S.910)
Die gängige Sichtweise, behinderte oder chronisch kranke Menschen seien "potentiell Unglückliche", hängt mit der Vorstellung zusammen, dass ein gelingendes Leben uneingeschränkte Bedingungen voraussetzt. Dabei werde übersehen, so Lanzerath, dass dieses Gelingen erst aus dem Verhältnis erwachse, das der Mensch nicht nur zu seinen Entfaltungspotentialen, sondern auch zu deren Grenzen einzunehmen vermag (2000, S.250).
Andererseits sind solche Grenzen durch Behinderung oder chronische Erkrankung kein Anlass dafür, Behindertsein als eine besondere Seinsform hoch zu stilisieren, sondern es geht vielmehr darum, Behinderung und chronische Erkrankung als natürlichen Bestandteil des Menschseins zu akzeptieren.
Weiters meint Sartre: "Doch gerade weil es meine Grenze ist, kann es nicht als Grenze eines gegebenen Seins existieren, sondern als Grenze meiner Freiheit" (Sartre, 1943/1991, S.910).
Hier soll nochmals das Besondere an Sartres Freiheitsbegriff hervorgehoben werden: Sartres Freiheit ist existentiell, sie betrifft das gesamte menschliche Sein, denn sie schafft die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, dass der Mensch sich durch Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen zu dem macht, der er sein wird (Möbuß, 2000).
Der Mensch ist frei, von Geburt an und ohne jede Einschränkung. Die Freiheit ist keine besondere Möglichkeit menschlichen Seins, sondern dessen Existenz - zunächst genau so umfassend und unbestimmt wie diese. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht jeder Mensch in seinen konkreten Lebensbedingungen bestimmten Zwängen unterliegt. Die Tatsache der Begrenztheit des Lebens und die Tatsache von Einflüssen, die wiederum Bedingungen schaffen, werden durch diesen Freiheitsbegriff nicht geleugnet. "Die menschliche-Realität begegnet überall Widerständen und Hindernissen, die sie nicht geschaffen hat; aber diese Widerstände und Hindernisse haben Sinn nur in der freien Wahl und durch die freie Wahl, die die menschliche-Realität ist" (Sartre, 1943/1991, S.845f).
Nach Sartre begegnet "der Mensch ... Hindernissen nur auf dem Feld seiner Freiheit. Mehr noch: es ist unmöglich, a priori zu entscheiden, was beim Hindernischarakter eines einzelnen Existierenden dem rohen Existierenden und was der Freiheit zukommt. Denn was für mich Hindernis ist, wird es für einen andern nicht sein" (1943/1991, S.844).
Durch eine Aussage Jolliens (1999/2001), der über die Schwachheit als "erfahrbares Hindernis im Leben" philosophiert, soll das eben Zitierte veranschaulicht werden: "Das schwache Individuum stellt nicht notwendigerweise eine Last für den Anderen dar. Jeder verfügt frei [Hervorhebung v. Verf.] über seine Schwachheit, es ist an ihm, klug davon Gebrauch zu machen" (1999/2001, S.138). Alexandre Jollien schreibt in seinem Buch "Lob der Schwachheit" über seine Erfahrungen als Behinderter in der Begegnung mit anderen: Zwar bedeute die Akzeptanz der eigenen Schwachheit einen permanenten, häufig einsamen Kampf, bei dem die Wahrnehmung des anderen oft zu einem Hindernis werde, aber seine "Unfähigkeit, eine vollkommene Unabhängigkeit zu erlangen", zeige ihm auch täglich die menschliche Größe, die darin bestehe, "das Geschenk der Gegenwart des Anderen zu genießen und zu versuchen, die eigene bescheidene zerbrechliche Präsenz anzubieten" (Jollien, 1999/2001).
Wenn sich das Individuum also nicht in jener abstrakten Freiheit verlieren will, die als Inbegriff aller Bindungslosigkeit manchem erstrebenswert erscheint, deren Sinn Sartre jedoch bestreitet, dann muss es das Wagnis eingehen, dem anderen zu vertrauen, sich seinem Blick auszuliefern (Möbuß, 2000).
Dies eröffnet einen völlig anderen Blickwinkel auf den Begriff der Freiheit. Die Freiheit, wie Sartre sie verstanden haben will, ist eine Freiheit, in die der Mensch "geworfen" ist, zu der er "verurteilt" ist.
Nach Sartre setzt die Existenz des anderen meiner Freiheit eine faktische Grenze, "denn durch das Auftauchen des andern erscheinen gewisse Bestimmungen, die ich bin, ohne sie gewählt zu haben. Ich bin ja ... schön oder hässlich, einarmig usw. Alles das bin ich für den andern, ohne Hoffnung, diesen Sinn, den ich draußen habe, erfassen oder gar verändern zu können" (Sartre, 1943/1991, S.901f). Aber "ich kann mich als durch Andere begrenzt nur erfassen, insofern der Andere für mich existiert, und nur, indem ich mein Für-Andere-sein auf mich nehme, kann ich machen, dass der Andere für mich als anerkannte Subjektivität existiert" (Sartre, 1943/1991, S.906). Hier findet sich die Verurteilung zu Freiheit wieder, die Sartre als Faktizität bezeichnet. Ich kann nicht sein, ohne mich zu wählen:
... ich kann mich gegenüber dem, was ich (für den andern) bin, weder total absentieren - denn zurückweisen ist nicht sich absentieren, sondern ebenfalls übernehmen - noch es passiv ertragen (was in gewissem Sinn auf das gleiche hinausläuft); in der Wut, im Hass, im Stolz, in der Scham, im angeekelten Zurückweisen oder im freudigen Beanspruchen muss ich wählen,das zu sein, was ich bin. (Sartre, 1943/1991, S.910)
Sartre schreibt: "Für ... den Körper, den Anderen, die Funktion usw. gibt es ein "Frei-sein-für...".... Die Freiheit ist total und unendlich, was nicht sagen will, dass sie keine Grenzen habe, sondern dass sie ihnen nie begegnet. Die einzigen Grenzen, auf die die Freiheit jeden Augenblick stößt, sind die, die sie sich selbst auferlegt und von denen wir anlässlich der ... Umgebung ... gesprochen haben" (1943/1991, S.913f).
Jollien (1999/2001) spricht davon, dass die Wahrnehmung des anderen unsere Persönlichkeit forme und strukturiere; sie könne aber auch lähmen, verurteilen, verletzen. Die Freiheit des einzelnen besteht darin zu wählen, wie er der Wahrnehmung des anderen begegnet, welche Bedeutung er dem Anderen und Anderssein beimisst und in welcher Weise bzw. in welchem Ausmaß er "den Blick des anderen als lähmenden, verletzenden und verurteilenden" zulässt. Hier werden die subjektiven und sozialen Dimensionen des Menschseins angesprochen.
Es sind auch die Dimensionen des subjektiven und sozialen, die den Begriffen Behinderung und Krankheit ihre Bedeutung verleihen - und dies wird auch aus den philosophischen Ausführungen Sartres zu den Begriffen "der Freiheit" und "des Anderen" erfahrbar.
Inhaltsverzeichnis
Wir sind immer schon in Geschichten verstrickt, die uns sagen, was für ein Mensch wir eigentlich sein möchten und welche Zwänge uns daran hindern, diesem Ideal zu folgen. Es wäre daher eine Illusion, sich auf einen neutralen Beobachterpunkt zurückziehen zu wollen, um von dort aus allgemein gültige Normen aufzustellen. (Lesch, 2003)
Nach Mayring (1999) sollen in der Einzelfallanalyse sowohl die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person als auch der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund betont werden. Damit jedoch ihre wissenschaftliche Verwertbarkeit sicher gestellt sei, müsse sich die Fallanalyse an einen groben Vorgehensplan halten. Für Mayring sind hierfür fünf Punkte zentral:
Als 1. Punkt nennt er die Formulierung der Fragestellung der Fallanalyse. Dadurch soll explizit gemacht werden, was mit der Fallanalyse bezweckt werden soll. Die Forschung setzt an konkreten, gesellschaftlichen Problemen an, die im Vorfeld analysiert wurden.
2. Punkt: Die Falldefinition, wobei die Bestimmung des Falles von der Fragestellung abhängig ist.
3. Punkt: Die Bestimmung der Methode; 4. Punkt: Die Aufbereitung und Kommentierung des Materials mit einer anschließenden Fallinterpretation.
Als 5. Punkt nennt Mayring die Einordnung des einzelnen Falles in einen größeren Zusammenhang.
In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang in Form eines Gesprächs bzw. Interviews eine besondere Rolle, da subjektive Bedeutungen sich nur schwer aus Beobachtungen ableiten lassen. Die Gesprächspartner sind die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte (Mayring, 1999).
"Qualitative Forschung zielt nicht auf die Erfassung quantitativer Merkmalsverteilungen oder statistischer Durchschnittswerte, sondern auf die Entschlüsselung subjektiver Aussagen und darin enthaltener, verallgemeinerungsfähiger Aussagetypiken" (Schmidt-Grunert, 1999, S.55).
Dies kennzeichnet den Unterschied von qualitativen und quantitativen Forschungsverfahren im Hinblick auf Repräsentativität, Reliabilität, Validität und Explizierung:
1. Bezüglich der Repräsentativität und somit der Frage nach der Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der ausgewiesenen Forschungsergebnisse ist zu bemerken, dass bei interpretativen Auswertungsverfahren die Anzahl der Untersuchungspersonen eine nachrangige Rolle spielt. Die argumentative Kraft der Untersuchungsergebnisse hat zu überzeugen (Schmidt-Grunert, 1999).
2. Um Reliabilität - also Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Daten - zu erzielen, muss bei qualitativen Erhebungsverfahren darauf geachtet werden, dass die Untersuchungssituation möglichst authentisch ist bzw. im Alltag stattfindet und die Untersuchungsperson möglichst frei erzählen kann.
3. Der Validität - der Frage nach der Gültigkeit der erhobenen Daten - kann wiederum dadurch Rechnung getragen werden, dass die Interpretationen in einer Forschungsgruppe gemeinsam diskutiert werden. Ist dies nicht der Fall, also kann die Interpretation des Datenmaterials nicht von mehreren Forschern gemeinsam vorgenommen werden, ist eine systematisch-methodische Vorgehensweise im Hinblick auf die Validierung besonders wichtig.
4. Eine intensive Explikation bzw. Darlegung der Bedeutungen wird erzielt, indem sich der Interviewer durch Rückfragen und Nachfragen bei den Befragten rückversichert.
Wichtig ist, dass im Forschungsprozess dokumentiert wird, auf welchem Weg die Auswertungsergebnisse erzielt wurden. Die Transparenz ist "ein wesentliches Kriterium für die wissenschaftliche Ausgewiesenheit und Objektivität einer qualitativen Untersuchung, da darüber der Erkenntnisweg für andere nachvollziehbar wird" (Schmidt-Grunert, 1999, S.50).
In diesem Sinne wurde folgendermaßen vorgegangen:
Wie bereits mehrfach erwähnt, stand folgende Fragestellung im Mittelpunkt: Inwieweit beeinflusst gesellschaftliches Denken das eigene Erleben von Behinderung oder chronischer Erkrankung? Ziel der Interviews war zu eruieren, welchen Zugang die Interviewpartner zu den Begriffen "Behinderung" und "chronischer Erkrankung" haben bzw. auf welche Weise sie sich zu gesellschaftlichen Wert- und Normvorstellungen äußern.
Da das Untersuchungsinteresse dieser Arbeit dem eigenen Erleben von Behinderung oder chronischer Erkrankung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Norm- und Wertvorstellungen galt, wurden als Interviewpartner Menschen mit einer körperlichen Behinderung ausgewählt. Die Eingrenzung der Interviewpartner auf Personen mit körperlichen Einschränkungen erfolgte auf Grund folgender Überlegungen: Der Begriff "Behinderung" ist weit gefasst - im Kapitel 3.1 wurden allgemein übliche Definitionen bzw. Klassifikationen des Begriffs genannt. Die Einbeziehung von Personen mit z. B. einer Lernbehinderung hätte eine differenzierte Formulierung der Leitfragen notwendig gemacht, um sich deren Bedürfnissen in Bezug auf Kommunikation und Erfahrungsaustausch anzupassen. So musste schon allein aus zeitlichen Gründen eine bestimmte Eingrenzung vorgenommen werden. Die Interviewpartner sollten sich zu Begriffen äußern, die im allgemeinen Sprachgebrauch und öffentlichen Diskussionen immer wieder im Zusammenhang mit den Begriffen Behinderung oder chronische Erkrankung genannt werden, und dabei ihre eigenen Erfahrungen im sozialen, gesellschaftlichen Umfeld reflektierend miteinbeziehen. Gerade Personen mit Lernschwierigkeiten wird jedoch die Möglichkeit, sich mit solchen Erfahrungen zu konfrontieren und darüber zu reflektieren, erschwert, da sie zu der aus dem öffentlichen Leben noch am stärksten ausgegrenzten Personengruppe gehören. Ziel der Arbeit war es daher auch, aufzuzeigen, dass die Äußerungen der Interviewpartner, die aus dem eigenen Erleben des gesellschaftlichen Umfelds resultieren, vergleichend auf Menschen unterschiedlicher Seinsweisen bzw. "Behinderungen" bezogen werden können.
Die befragten Personen haben ihre Behinderung von Geburt an - entweder auf Grund eines Geburtsfehlers oder auf Grund einer fortschreitenden Muskelerkrankung - und leben nicht in Heimen oder betreuten Wohngemeinschaften, sondern gestalten ihr Leben mit Hilfe von persönlicher Assistenz. Die Auswahl von Personen, die von Geburt an mit einer Behinderung leben, erfolgte zum Teil bewusst, und zwar auf Grund der Überlegung, dass diese Personengruppe mit ihrem "Behindert-sein" bzw. "chronischem Krank-sein" sozusagen in eine Gesellschaft "hineingewachsen" ist und womöglich schon früh unterschiedliche Erfahrungen im Kontakt mit ihrem Umfeld gemacht hat. Zum Teil ergab sich die Auswahl aber auch im Zuge der Suche nach Interviewpartnern.
Das Alter der befragten Personen ist weit gestreut und beträgt zwischen 27 und 45 Jahre. Durchgeführt wurden die Interviews mit 2 weiblichen und 4 männlichen Personen.
Als Interviewform wurde - wie in Kapitel 2.2 bereits angesprochen - das problemzentrierte Interview gewählt.
Die Entscheidung hierfür lässt sich folgendermaßen begründen: Diese Gesprächsform lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, ist jedoch auf eine bestimmte Problemstellung zentriert, auf die der Interviewer immer wieder zurückkommt und die er anhand eines Interviewleitfadens anspricht (Mayring, 1999).
Die Interviewten wurden durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollten aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren.
Ein Zitat Witzels (2000) soll die Entscheidung für diese Interviewform zusätzlich begründen:
Bezogen auf das Problemzentrierte Interview ist der Erkenntnisgewinn sowohl im Erhebungs- als auch im Auswertungsprozess ... als induktiv-deduktives Wechselverhältnis zu organisieren. Das unvermeidbare, und damit offen zulegende Vorwissen dient in der Erhebungsphase als heuristisch-analytischer Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten. (Witzel, 2000, S.2)
Es ist also nicht beabsichtigt, Vorannahmen und Erwartungen des Forschers über den Untersuchungsgegenstand auszuschließen. Die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse sind jedoch zu reflektieren, ihr Einfluss ist zu kontrollieren und offen zu legen.
Die Gespräche bestanden aus drei Teilen, nämlich den Sondierungsfragen, den Leitfadenfragen und den Ad-hoc-Fragen.
"Sondierungsfragen sind ganz allgemein gehaltene Einstiegsfragen in eine Thematik. Dabei soll eruiert werden, ob das Thema für den einzelnen überhaupt wichtig ist, welche subjektive Bedeutung es für ihn besitzt" (Mayring, 1999, S.52).
Im Folgenden wurde zur Sondierung bzw. zur Einleitung die Frage nach der bisherigen Lebensgeschichte gestellt.
Witzel (2000) weist darauf hin, dass die durch diese Frage enthaltenen Informationen - insbesondere in Kombination mit einer offenen Frage - einen Gesprächseinstieg erleichtern. Als offene Frage wurde z. B. jene nach der Gestaltung eines ganz "normalen" Alltags formuliert.
Gerade durch die Anwendung des problemzentrierten Interviews als biographisches Interview werde deutlich, so Witzel (2000), wie Gesprächsentwicklung gefördert werden kann; nämlich dann, wenn Erzählungen von Lebensgeschichten oder erlebten Begebenheiten angeregt werden. Die biographische Methode verweise auf den Aspekt der Entwicklung von Deutungsmustern im Rahmen der individuellen Auseinandersetzung mit sozialer Realität.
Ad-hoc-Fragen wurden spontan gestellt, wenn sie für die Themenstellung oder Erhaltung des Gesprächfadens von Bedeutung waren, wenn z. B. Unklarheiten über den Erzählinhalt auftraten.
Am Ende des Interviews wurde der befragten Person die Möglichkeit zur Gesprächsergänzung aus ihrer Sicht eingeräumt. Die hierzu gestellte Frage war jene, nach Bereichen, die der Interviewte für wichtig hält, die jedoch nicht angesprochen wurden.
Nach Witzel (2000) soll der Leitfaden den Kommunikationsprozess als eine Art Hintergrundfolie begleiten. Damit ist eine Kontrolle gegeben inwieweit einzelne Elemente im Laufe des Gesprächs behandelt worden sind.
Konkret wurden hier Fragen zur Lebenssituation, zur kognitiven Situationseinschätzung, zu subjektiven Belastungen und eventuellen Bewältigungsversuchen gestellt. Weiters wurde gezielt um Begriffsdefinitionen gebeten. Im Anhang der Arbeit sind die einzelnen Fragen des Interviewleitfadens aufgelistet.
Girtler (1992) bezeichnet die Interviewsituation dann als ideal, wenn "die Rolle des Interviewers ... zu der des Zuhörers [wird], dem der andere sich darstellen und öffnen will" (S.162). Dabei soll der Interviewte sich in der Position des Partners sehen, wofür wiederum die Herstellung einer Vertrauensbasis Voraussetzung ist.
Diesen Überlegungen Rechnung tragend wurde als Interviewsituation die gewohnte Umgebung, also die jeweilige Wohnung der interviewten Personen gewählt. Als ein weiterer "Vertrauen schaffender" Aspekt kann sicherlich auch bezeichnet werden, dass die fragende Person ebenfalls eine Behinderung hat. Der Kontakt zu den Interviewpartnern wurde über eine Organisation hergestellt, die an Menschen mit Behinderungen persönliche Assistentinnen und Assistenten vermittelt; die erste Kontaktaufnahme erfolgte per Telefon.
Die Interviews dauerten alle zwischen einer dreiviertel bis ganzen Stunde.
Die Aufzeichnung erfolgte - im Einverständnis mit den Interviewten - mittels eines Tonbandgerätes. Dieses Vorgehen erlaubte im Gegensatz zu Gesprächsprotokollen die authentische und präzise Erfassung des Kommunikationsprozesses.
Wenn sprachliche Färbungen, wie Dialekt und Sprachfeinheiten, nicht von Interesse sind, sondern die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wird die "Technik der Übertragung in normales Schriftdeutsch" bevorzugt. Diese kam hier zur Anwendung, da sich die befragte Person mit Behinderung oder chronischer Erkrankung als Expertin in eigener Sache äußerte, und somit in erster Linie Inhaltliches von Bedeutung war.
Durch das Tonband nicht erfasste Eindrücke, wie z. B. Gesprächsdynamik, nonverbale Reaktionen oder auch Gesprächsergänzungen der Interviewpartner, wurden in einem Postskriptum schriftlich festgehalten. Das Postskriptum zu einzelnen Interviews ist im Anhang der Arbeit dokumentiert.
Hier kam die phänomenologische Analyse zur Anwendung, und zwar auf Grund folgender Überlegungen:
Bei dieser Analysetechnik wird an der Perspektive der einzelnen Menschen angesetzt, an ihren subjektiven Bedeutungsstrukturen, ihren Intentionen (Mayring, 1999). Ziel der Analyse soll sein, zum Wesen der Dinge vorzustoßen, nicht an der Oberfläche der Erscheinungen stehen zu bleiben.
Dabei ist ein Kerngedanke die Variation: Ein vorgegebenes Phänomen - hier war es die Auseinandersetzung mit Begriffen wie "Behinderung" bzw. "chronische Erkrankung" aus dem Blickwinkel der eigenen Betroffenheit - wird in unterschiedlichen Kontexten - hier sind es Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen - verglichen. Was dabei invariant bleibt, soll Hinweise auf das Wesen des Phänomens geben.
Die phänomenologische Analyse wird schrittweise durchgeführt:
Erst muss der Analytiker einen Durchgang durch das gesamte Material vollziehen, um den generellen Sinn des ganzen aufzuschließen. Dieser allgemeine Eindruck vom gesamten Material ist sehr wichtig für die weiteren Schritte, denn das Vorgehen ist weniger formalisiert, muss also im Einzelfall immer inhaltlich begründet werden. In einem zweiten Materialdurchgang wird dann versucht, in Hinblick auf das zu untersuchende Phänomen Bedeutungseinheiten zu bilden. Wo wird der Gegenstand angesprochen? Wo sind wichtige Aussagen zu finden? (Mayring, 1999, S.86)
Diese Sequenzierung ermöglicht dann den dritten Schritt, nämlich die Bedeutungseinheiten nacheinander auf das Phänomen hin zu interpretieren. Die interpretierten Bedeutungseinheiten werden in einem vierten Schritt miteinander verglichen, verknüpft und zu einer generellen Phänomeninterpretation synthetisiert (siehe Abbildung 4).
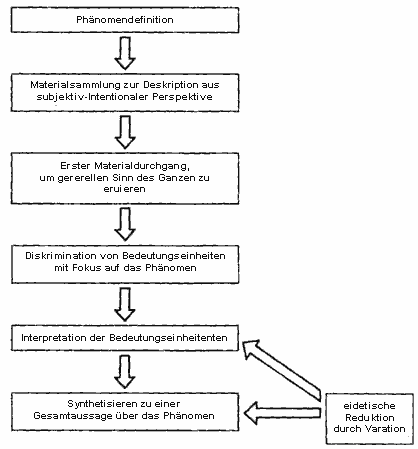
Abbildung 4 (Ablaufmodell phänomenologischer Analyse)
Die phänomenologischen Orientierung in der gegenwärtigen Forschungslandschaft will vor allem eine deskriptive Funktion erfüllen: Es soll eine breitere Einsicht in wichtige Gegenstandsbereiche aus der Perspektive der betroffenen Subjekte entfaltet werden.
Bei den durchgeführten problemzentrierten Interviews war mit dem Gesprächsleitfaden bereits eine Systematik vorgegeben, der die Auswertung folgen konnte. Diese Systematik erleichterte die vergleichende Analyse der Interviews:
Bildung von Bedeutungseinheiten - Wo sind wichtige Aussagen zu finden? - und Interpretation der Bedeutungseinheiten
Interviewpartnerin A ist Rollstuhlfahrerin, auf Grund eines Geburtsfehlers behindert und lebt in einer Wohngemeinschaft mit einem Mann, der ebenfalls körperbehindert ist. Sie hat, wie sie berichtet, ihre Kindheit größtenteils in einem Heim oder in Krankenhäusern verbracht und nur selten bei ihren Eltern.
Aus, wie sie meint, "physischen und psychischen Gründen" ist es ihr nicht gelungen einen Beruf zu erlernen, sie arbeitete in Behindertenwerkstätten, verbringt nun ihren Alltag zu Hause und organisiert diesen zum Teil mit Hilfe von persönlicher Assistenz, die sie selbst einteilt und anleitet, zum Teil erhält sie Unterstützung durch eine Sozialarbeiterin.
Die Frage nach Schwierigkeiten, welche die Gestaltung des Alltags erschweren und die sie in Zusammenhang mit ihrer Behinderung bringt, beantwortet sie folgendermaßen:
"Also für mich ist schwierig z.B. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da ist einmal auch die Orientierung - ich hab nicht so gute Orientierung - was ich natürlich vielleicht auch noch trainieren kann, könnte, aber dann auch noch, ja, in den Bus erst mal hineinzukommen, das ist schon sehr schwierig. Du musst ja dann mal kämpfen, können Sie mal Platz machen? Ja, das find ich schon sehr schwierig."
Interviewpartnerin A schildert Umweltbedingungen, die sie in ihrer Mobilität, Flexibilität und Spontaneität einschränken: Viele öffentliche Verkehrsmittel sind noch nicht mit Rampen ausgestattet und somit für Rollstuhlfahrerinnen nicht barrierefrei zugänglich. Ebenso beschreibt sie das Verhalten anderer, die "nicht Platz machen", als Problem. Den Behindertenfahrdienst in Anspruch zu nehmen, bedeutet langes Vorherplanen, spontane Entscheidungen für Außenaktivitäten sind dann schwer möglich: "Wir haben hier auch einen Telebus ... Das heißt, wenn ich was planen möchte, muss ich ja mindestens eine Woche vorher das planen und das empfind ich als schwierig."
Bei ihrer Angabe von Problemen wird deren Untrennbarkeit von Außen- bzw. Umweltfaktoren deutlich. Das, was die Interviewpartnerin als problematisch bezeichnet, ist nicht "schicksalhaft" gegeben. Die Probleme, die sie schildert - das Verhalten anderer, die "nicht Platz machen", die Unzugänglichkeit der Verkehrsmittel und die fehlende Möglichkeit zur Spontaneität - stehen für sie nur mittelbar mit ihrer Behinderung in Verbindung. Dies macht sie deutlich durch ihre Aussage: "Aber zu meiner Behinderung: da hab ich nicht so Probleme, ich kann mich jetzt ganz gut annehmen. Ich bin auch so bestrebt, das, was ich kann, auch zu machen. Ja, manchmal vielleicht auch über meine Grenzen zu gehen."
Sie erklärt, mit ihrer Behinderung kein Problem zu haben, in Interaktion mit ihrer Umwelt sieht sie sich jedoch als Frau mit Behinderung immer wieder mit Problemen konfrontiert. Die scheinbare Ambivalenz dieser Aussagen wird verstehbarer, wenn man folgendes bedenkt: Interviewpartnerin A hat ihre Behinderung von Geburt an, sie ist Teil ihrer Person, ihrer Persönlichkeit. Dies wird deutlich, wenn sie davon spricht, dass sie sich jetzt ganz gut annehmen könne - sie kann sich als Frau mit Behinderung annehmen. Von ihrem Umfeld erfährt sie sich jedoch nicht in gleicher Weise angenommen - und dies bereitet ihr Probleme.
Ihre Behinderung, also das, was im Alltagsjargon als "schicksalhafter" und nicht änderbarer Tatbestand bezeichnet werden würde, ist für sie "annehmbar" und stellt somit auch nicht die Problematik ihres Alltags dar. Ihre "nicht so gute Orientierung" ist für sie "natürlich vielleicht auch noch trainierbar", und sie ist auch bestrebt, manchmal "über ihre Grenzen zu gehen". "Über ihre Grenzen gehen" bedeutet für sie zum Beispiel sich für kurze Zeit aus ihrem Rollstuhl zu erheben, um ohne Hilfe zur Toilette zu kommen, und dies kostet sie - wie sie berichtet - sehr viel Anstrengung und Energie.
Frage nach der Definition von "Herausforderung":
Hierin besteht ihrer Meinung nach auch ihre alltägliche "Herausforderung": Zu lernen, sich besser zu orientieren, sich mehr Mobilität und Selbständigkeit zu sichern. "Zu lernen also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu recht zu kommen, zu orientieren; eventuell auch mal ohne Einzelbetreuung leben zu können, also nur mit Pflegeassistenz, wäre mal so eine Herausforderung, oder so eine Idee von mir." Hier wird die rein subjektive Bedeutung des Begriffes "Herausforderung" deutlich. Im Alltag ist der Mensch ständig mit Forderungen konfrontiert, sei es, dass sie ihm von anderen gestellt werden, sei es, dass er sie sich selbst stellt. Welcher Art diese Forderungen bzw. Herausforderungen sind, ist individuell, von Persönlichkeits- Lebens- und Umweltfaktoren abhängig und entzieht sich somit jeder objektivierbaren Wertung. Sich dies zu verdeutlichen, heißt dann aber auch folgende Schlussfolgerung zu ziehen: Ein Mensch, der sich das Erhalten seiner körperlichen Kräfte als persönliches Ziel gesetzt hat, ist weder zu bemitleiden, weil er etwas anstrebt, das andere wiederum als Selbstverständlichkeit bewerten, noch zu heroisieren, weil er in der Lage ist diese Intention als Herausforderung zu wählen, sondern zu respektieren in seiner subjektiven Bedeutungsgebung. Respektiert zu werden heißt aber auch anerkannt, angenommen und nicht ausgeschlossen zu werden.
In ähnlicher Weise wie den Begriff "Herausforderung" umschreibt Interviewpartnerin A den Begriff "Lebensqualität":
"Also, Lebensqualität, ja, dass ich das kann, also dass ich das was ich kann, mir erhalte." Außerdem meint sie zu "Lebensqualität": "Ja, dass ich wirklich mein Leben auch bestimmen kann, dass ich sagen kann: heut will ich das machen und das will ich nicht machen; z. B. bei Krankenhäusern und im Heim ist es ja so, da wurde ja viel bestimmt, da wurde man nicht gefragt, möchtest du das lernen, sondern wurde einem aufdiktiert, du hast das jetzt zu machen, ob man will oder nicht. Das fand ich halt irgendwie sehr schlimm."
Hier spricht sie von den Erfahrungen ihrer Kindheit und ihres frühen Erwachsenenalters, verbracht im Behindertenheim bzw. Krankenhaus. Aus diesen Erfahrungen heraus definiert sie Lebensqualität als Entscheidungsfreiheit bzw. Freiheit, das alltägliche Leben selbst gestalten zu können. Wie wichtig ihr diese Freiheit ist, betont sie auch im Anschluss an das Interview, indem sie nochmals auf ihre Erfahrungen als betreute Person in Krankenhäusern und Behindertenwerkstätten verweist. Die Aussage hierzu ist im Postskriptum festgehalten. In Heimstrukturen aufzuwachsen bedeutete für sie, sich einem straff organisierten Alltag einer kleineren Gemeinschaft unter zu ordnen. Sich individuell zu entfalten und eigene Möglichkeiten zu entdecken bzw. zu verwirklichen, kann dadurch erschwert werden. Interviewpartnerin A lebt nun in einer eigenen Wohnung, gemeinsam mit ihrem ebenfalls körperbehinderten Freund, und wird von persönlichen Assistentinnen bei jenen alltäglichen Verrichtungen unterstützt, die sie auf Grund ihrer Behinderung nicht alleine ausführen kann. Wann und auf welche Weise diese Verrichtungen ausgeführt werden, liegt in ihrer Entscheidungskompetenz. Daher - "sieht sie so im Nachhinein" - hat sie "für sich auch eine Lebensqualität" erreicht.
Die Frage, was für sie "Glück" bedeutet, beantwortet sie auf folgende Weise:
"Also hier mit ihm zusammen zu wohnen halt und sich zu verstehen und einfach Harmonie, ..., dass man was machen kann." Dieser Satz "dass man was machen kann" ist sehr allgemein gehalten. Sie setzt hier nicht eine bestimmte Fähigkeit dem Glück gleich, erwähnt kein bestimmtes Können als Voraussetzung für "Glücklichsein", sondern lässt die Fähigkeit "was machen zu können", also dieses "etwas", undefiniert. Wichtig erscheint ihr die Möglichkeit, entscheiden zu können, etwas zu machen; die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, ihm Rahmen dessen was ihr machbar ist. Glücklichsein wird somit von ihr als ein Zustand definiert, der keinen spezifischen körperlichen Bedingungen unterworfen ist, wie Gesundheit zum Beispiel.
Ganz anders hingegen definiert sie "Leid":
"Leid, das ist, wenn ich heut Schmerzen hab, ich bin oft ein bisschen depressiv, das macht mir halt zu schaffen." Interviewpartnerin A leidet, wenn sie körperliche Schmerzen verspürt oder sich in depressiver Stimmung befindet. Schmerzen und depressive Stimmungen kommen und gehen, sind keine dauerhaften Phänomene, und somit ist auch "Leiden" für sie kein dauerhafter Zustand. Sie bringt nicht zum Ausdruck, dass sie ihr Leben als Frau mit Behinderung als leidvolles Leben definiert haben möchte, auch wenn sich bei ihr Schmerzen oder depressive Verstimmungen einstellen können, sondern sie spricht davon, dass ihre Behinderung für sie "normal" sei, und würde gerne auch vom gesellschaftlichen Umfeld als "normal" wahrgenommen werden.
Deutlich wird dies, als sie auf den Normalitätsbegriff angesprochen wird:
[es] "wäre für mich Normalität gewesen in eine Schule integriert zu werden." Hier deutet sie an, dass sie die gängigen Vorstellungen der Gesellschaft wie ein "normales" Leben verlaufen solle (also Schule, Ausbildung, Beruf) übernommen hat, sich selbst aber aus dieser Normalität ausgeschlossen fühlt. "Ich hab es nicht geschafft, eine Ausbildung zu machen, aus körperlichen und psychischen Gründen. Und dann noch die Werkstatt: eine Werkstatt ist für mich nicht Normalität, weil ich bin ja nicht irgendwie geistig behindert, bin körperbehindert."
Aus dieser und einer späteren Aussage des Interviews geht hervor, dass sie nicht als "geistig behindert" wahrgenommen werden möchte. Sie - als Frau mit einer körperlichen Behinderung - steht ihrer Meinung nach dem gesellschaftlichen Bild von Normalität näher als ein Mensch mit geistiger Behinderung. Damit drückt sie aber auch aus, dass sie nicht nur gängige gesellschaftliche Vorstellungen von Normalität übernommen hat, sondern auch gewisse Wertvorstellungen.
Die Frage, ob sie es "geschafft" hätte, eine Ausbildung zu machen, wenn sie in eine Schule integriert worden wäre - das heißt, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, gemeinsam mit nicht körperbehinderten Schülern unterrichtet zu werden - bleibt offen und ist auch rein spekulativ. Aber dieses für sie Ausgeschlossensein aus gesellschaftlichen Normalitätsstandards kommt auch durch folgende Aussage zum Tragen: "Normal wäre, wenn ich ohne weiteres die BVG [öffentliche Verkehrsmittel] benutzen könnte, oder wenn ich jetzt halt ganz normal arbeiten könnte ... Hier bin ich jetzt in einem Wohnfeld - wohnen ja hier Nichtbehinderte und Behinderte - das find ich normal jetzt."
Das Ausgeschlossensein von dem, was andere als "normal" bezeichnen, resultiert für sie nicht aus ihrer körperlichen Einschränkung, sondern aus den baulichen Barrieren und der mangelnden Rücksichtnahme und Ignoranz der Umgebung: "Behindert werden, das ist, wenn ich z. B. ein Gebäude nicht aufsuchen kann. Wenn alles zugänglich wäre, dann würde ich mich gar nicht als behindert fühlen. Die Umwelt, die macht es eigentlich, dass ich behindert bin... Wenn das jetzt alles so eingerichtet wäre, wäre ich ja für meine Begriffe nicht behindert."
Und darin besteht für sie der Unterschied zwischen den Wortpaaren "behindert sein" und "behindert werden":
Ihre Behinderung, ihr "behindert sein", wird ihr durch andere erst "bewusst gemacht": "Also ein Stück Behinderung bleibt mit dem An- und Ausziehen, wäre ja nur ein kleiner Teil, der größte Teil liegt ja auch in der Gesellschaft, dass man eben behindert wird." Interviewpartnerin A veranschaulicht ihre Aussagen, in dem sie eine Situation beim Arzt schildert, die ihr immer wieder passierte: Obwohl sie die Patientin ist, richtet der Arzt das Wort an ihre Begleitperson und ignoriert sie damit als Ansprechpartnerin. Durch dieses verletzende Verhalten wird ihr "ihre Behinderung dann wieder bewusst". "Würden sie auf mich direkt zugehen, würde ich das nicht so empfinden."
Sie erinnert sich an weitere Situationen, in denen sie das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören, anders zu sein oder nicht den gängigen Normvorstellungen zu entsprechen: "Na ja, die BVG z. B., also entweder sie helfen gar nicht, oder sie helfen so überfürsorglich, dass man dann mit der Hilfe auch nichts anfangen kann. Sie wollen den Rollstuhl einfach so anpacken, wo ich dann sage, das geht jetzt so nicht ... oder auch so: die steht hier im Weg, also nehme ich sie mal - ganz konkret beim Arzt: ich hab richtig Angst bekommen, weil der hat mit blockierten Bremsen versucht, den Rolli zu bewegen." Interviewpartnerin A schildert hier Begebenheiten, welche die Frage aufkommen lassen, ob sie als Ansprechpartnerin überhaupt wahrgenommen wird. Wird sie als Person gesehen, die einen Rollstuhl fährt oder ist es der Rollstuhl, der in erster Linie ins Blickfeld ihrer Mitmenschen rückt? Für Interviewpartnerin A scheint die zweite Antwort zuzutreffen und sie drückt dies durch folgende Aussage aus: "Dann bemerk ich schon, dass ich irgendwie eigentlich nicht existiere als Mensch, ich bin so eine Art Möbelstück, das rückt man mal kurz zur Seite, weil man möchte da mal durch."
Auf die Frage, warum Menschen ihrer Umgebung sich in dieser Weise verhalten, antwortet sie:
"Ja, sie sind unsicher, sie wissen nicht, wie soll ich jetzt auf einen Menschen mit Behinderung reagieren? Das ist einfach so, weil sie es nicht wissen. Weil sie nicht so oft damit in Berührung kommen." Hier knüpft sie wieder an bereits Gesagtes an, an Aussagen, die in Zusammenhang mit ihrem Empfinden stehen, von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. "Wenn jetzt z. B. mehr Behinderte auf der Straße wären und es alltäglich wäre, dass man jetzt mit dem Bus fährt, also vermehrt, dann wäre es vielleicht für die Menschen, für die Nichtbehinderten normaler." Sie macht deutlich, dass es ihrer Meinung nach die den behinderten Menschen ausgrenzenden Umweltfaktoren sind, die verhindern, dass der behinderte Mensch als alltäglich und somit als "normal" im Straßenbild wahrgenommen wird. Ihre Umwelt erlebt sie häufig als ihr gegenüber feindlich eingestellt, das Verhalten der Leute auf der Straße empfindet sie immer wieder als verletzend und es "kostet sie zu viel Energie", sich ständig damit konfrontiert zu sehen. Ihre Reaktion darauf ist ein Sich-zurück-ziehen-wollen: "Ich selber merk manchmal, dass ich dann doch nicht so mag, einfach raus zu gehen, weil ich mir den Stress auch nicht antun will jetzt zu kämpfen, ob ich jetzt mal bitte den Platz da bekommen könnte, oder so, kostet mir zu viel Energie."
Dadurch, dass dem Menschen mit Behinderung die Teilnahme am öffentlichen Leben erschwert wird, bleibt in der Begegnung zwischen einer behinderten und nicht-behinderten Person häufig etwas Befremdendes zurück. Interviewpartnerin A drückt dies so aus: "Und dann bekommen auch viele das Bild vermittelt, die sind doof, und ja, die zucken, z. B. Spastiker, das sieht für die sowieso schon mal ganz böse aus. Da ist zu wenig Aufklärung." Mit der Aussage, "da ist zu wenig Aufklärung" deutet sie bereits eine Möglichkeit an, wie die - für sie als Frau mit Behinderung - belastenden Umweltbedingungen, wenn auch nicht ganz beseitigt, so doch zumindest verbessert werden könnten: Notwendig wäre "Aufklärung"; Aufklärung aber bedeutet Konfrontation, Auseinandersetzung mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, Abbau von bestehenden Vorurteilen durch Auf-einander-zugehen und Kommunikation. An einem Beispiel aus ihrem Alltag erläutert sie, wie wichtig ihr Aufklärung und dieses Auf-einander-zugehen wären:
"Ich hab es mal mit einem Kleinkind erlebt. Das fand meinen Rollstuhl ganz toll und wollte da mal gucken... Und die Mutter riss das Kind einfach vom Rollstuhl weg: Nun komm da mal weg! Da meinte das Kind dann so: Die hat ja auch einen Baggi! Warum sitzt die im Baggi? Na, weil sie das Bein gebrochen hat. - So eine Antwort halt, ja ich denk mir immer, kann sie es ihm wohl richtig erklären: kann halt nicht laufen, ist so geboren; versteht auch ein dreijähriges Kind, denk ich mir."
Hinter diesem und ähnlichen Verhalten steckt ihrer Meinung nach keine böse Absicht oder Mutwille, sondern solches Verhalten resultiert aus einer Unsicherheit ihres Gegenübers heraus, aus einer Angst, sie "was falsches zu fragen". Hier spricht sie Berührungsängste an, die entstehen, wenn sich Menschen in ihrer Begegnung als "anders" und fremd erleben:
"Ich denk auch, dass sie so reagieren aus Angst, ja, mich anzusprechen, mich was Falsches zu fragen, mich zu verletzen, und dann lieber schnell weg, dann kann man ja nichts Falsches machen."
Interviewpartner B ist 27 Jahre alt, von Geburt an auf Grund eines Geburtsfehlers körperbehindert, Rollstuhlfahrer und lebt mit seiner Lebensgefährtin, die ebenfalls körperbehindert ist, im gemeinsamen Haushalt. Unterstützt werden beide durch persönliche Assistenz. Er hat nach eigenen Angaben eine "sehr schöne Kindheit" erlebt, zusammen mit seinem älteren nichtbehinderten Bruder, und ist - wie er meint - "familiär normal aufgewachsen": "... das war alles sehr unverkrampft, meine Eltern haben mich auch so erzogen, ganz normal, jetzt ohne großartig so: Oh, mein Gott, unser Sohn ist behindert, wir müssen ihn jetzt von vorne bis hinten bemuttern... die Situation war so, dass meine Eltern gesagt haben: Nein, unser Sohn soll nicht gleich so mit Hilfsmittel vollgestopft werden. So ein bisschen das Normale kennen lernen."
Den Begriff "Normalität" erwähnt Interviewpartner B schon zu Beginn des Interviews häufig: Er wurde "normal erzogen", durfte "das Normale kennen lernen", besuchte eine "normale Grundschule". Diese Betonung der Normalität seiner Kindheit lässt vermuten, dass er es als keine Selbstverständlichkeit empfindet, als Kind mit Behinderung in dieser Weise aufgewachsen zu sein. Dies wiederum deutet auf zwei gesellschaftliche Normalitätsfelder hin: Behinderte Kinder wurden - und werden auch heute noch - nicht selten getrennt von ihrer Familie in eigens dafür eingerichteten Behindertenheimen erzogen und einem speziellen Förderprogramm, das der Behinderung entgegenwirken soll, unterzogen. So wird - zumindest in einigen westlichen Kulturen - Normalität für behinderte Kinder definiert. Es wird jedoch auch als normal, und somit als gut und wünschenswert, angesehen, wenn Kinder im Kreise ihrer Familie groß werden und so eine enge Beziehung zu den Eltern aufbauen können. Interviewpartner B durfte nach eigenen Angaben trotz Behinderung diese Normalität eines nichtbehinderten Kindes erleben.
"Ja, absolutes intaktes Familienleben, war sehr schön. Ich hab eine ganz normale Grundschule besucht, dann bin ich weiter gegangen auf eine Körperbehindertenschule..."
Interviewpartner B ist seit 9 Jahren berufstätig, er arbeitet nach eigenen Angaben im kaufmännischen Bereich in einem Dienstleistungsunternehmen.
In seiner Freizeit arbeitet er gerne am Computer, hört Musik oder liest "ab und zu mal eine Kurzgeschichte". Sein Hobby, die Arbeit am Computer, hat er - wie er anführt - dann auch zu seinem Beruf gemacht.
"Ich hab auch eine Zeit lang im Chor gesungen, ..., mit Behinderten und Nichtbehinderten, das war eine sehr schöne Erfahrung, auch sehr schön unverkrampft, war einfach schön, ..."
Er verwendet hier zum zweiten mal den Ausdruck "unverkrampft", und zwar immer in Verbindung mit seiner Schilderung über Kontakte zu nichtbehinderten Personen: Er hatte in seiner Kindheit nach eigenen Angaben eine "unverkrampfte" Beziehung zu seinen Eltern und seinem älteren, nichtbehinderten Bruder und die Begegnung mit den nichtbehinderten Chormitgliedern war ebenfalls "unverkrampft". Unternimmt man den Versuch, eine entsprechende synonyme Bezeichnung für diesen Ausdruck zu finden, lassen sich am ehesten Worte wie "unproblematisch" oder "offen" finden, möglicher Weise auch "vorurteilsfrei" oder "gelöst". Er hebt mehrmals hervor, dass er diese Erfahrungen des Miteinander als "sehr schön" empfand, und bringt damit zum Ausdruck, welche Bedeutung für ihn dieses "unverkrampfte" Umgehen mit seiner Person hat. Er spricht dies auch noch einmal an, nach Beendigung des Interviews, als er hervorhebt, wie wichtig er es empfindet mit seiner Umwelt zu kommunizieren.
Auf Wünsche oder Pläne für die Zukunft angesprochen, meint er, Zukunftspläne und Wünsche hätte er viele. Als Beispiel führt er an, dass er sehr reiselustig und -interessiert sei und in "absehbarer Zeit" wieder verreisen möchte. Auch hätte er den Wunsch, die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin zu festigen, so dass "eine spätere Hochzeit nicht ausgeschlossen" sei. Hier unterscheidet sich Interviewpartner B von den meisten der anderen interviewten Personen, die angaben, keine Pläne für die Zukunft zu haben.
Die Antworten auf die Frage nach Zukunftsplänen können nur sehr individuell, persönlich und entsprechend der jeweiligen Lebenssituation, der Interessen und persönlichen Umstände beantwortet werden. Interviewpartner B führt Ziele an, die sicherlich von vielen in seinem Lebensalter in ähnlicher Weise angestrebt werden. Trotzdem müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, wie z. B. die notwendigen finanziellen Mittel, um reisen zu können. Interviewpartner B ist berufstätig und verfügt somit über ein Einkommen, das es ihm ermöglicht, seine Reiselust zu befriedigen. Es kann auch festgehalten werden, dass er seine Wünsche und Pläne in keinen Zusammenhang mit seinen körperlichen Einschränkungen als Rollstuhlfahrer bringt, sondern diese völlig unabhängig davon sehen kann.
Die Frage, ob es Probleme im Alltag gibt, die er in Zusammenhang mit seiner Behinderung sieht, beantwortet Interviewpartner B folgendermaßen:
"Alltagsprobleme gibt es immer, aber ich denke, ich hab sie ganz gut im Griff soweit." Er führt Probleme an, die auftreten können, weil er ein Leben als Rollstuhlfahrer führt, meint jedoch, dass diese lösbar oder zumindest ausgleichbar wären. "... also, ich bin ja tätig als kaufmännischer Angestellter und arbeite so mit Akten, also schon der Aktentransport ist für mich in dem Rahmen halt nicht möglich, eben weil ich im Rollstuhl sitze, und da hab ich keine Probleme damit mal einen Kollegen zu bitten... Es ist immer eine Sache, wie man es organisiert. Hier im privaten [Bereich] ist es ganz klar abgesichert durch die Assistenz, also ich geh mit Assistenz einkaufen, ..., ja aber ansonsten gibt es also schon so Situationen, aber da müsst ich jetzt sehr darüber nachdenken, ja also ich denk, es läuft ganz gut." Hier scheint er folgendes auszudrücken: Die Tatsache, dass es problematische Alltagssituationen gibt, die ihm als Rollstuhlfahrer begegnen, belastet ihn nicht in einer Weise, dass er sich permanent damit auseinander setzen muss oder will. Er betont dies durch Aussagen, wie "ganz gut im Griff haben" oder "es läuft ganz gut".
Frage nach seiner Definition von Lebensqualität:
Lebensqualität definiert Interviewpartner B unter anderem als "sich wohl fühlen können." Dazu gehören für ihn Dinge zu tun, die Spaß machen, wie Musik hören z. B., aber auch in seinem Beruf tätig zu sein. "Ich muss mich wohl fühlen, es gehört ganz klar die Arbeit dazu, weil die Arbeit ist für mich ein ganz wichtiger Teil, wenn ich nicht arbeiten würde, ganz klar, würde ich nicht das Geld bekommen, um mir etwas Schönes für mich ganz persönlich leisten zu können, ins Kino zu gehen, ja wie gesagt, raus zu gehen, Musik zu hören, in Konzerte usw., das ist alles für mich Lebensqualität." Die Art und Weise, wie Interviewpartner B hier "Lebensqualität" definiert, ist sicherlich eine gängige Umschreibung des Begriffs und lässt darauf schließen, dass - zumindest in westlichen Gesellschaftsstrukturen - Lebensqualität mit der Erreichung eines gewissen Lebensstandards gleichgesetzt wird. Da für ihn die Möglichkeiten gegeben sind, sich diesen Standard zu sichern, hat sein Leben, wie er meint, auch Qualität: "... ich muss mich hier wohl fühlen und das ist für mich ganz klar so." Er weist in keiner Weise darauf hin, dass seine Behinderung eine Einschränkung seiner Lebensqualität bedeuten könne.
Definition der Begriffe "Glück" und "Leid":
Den Begriff Glück umschreibt er in ähnlicher Weise wie "Lebensqualität": "... also wenn ich jetzt z. B. etwas Schönes sehe, etwas Schönes erlebe, dann macht mich das schon glücklich." Er setzt Glück auch mit der Erreichung von Erfolg gleich. "Es sind Situationen, beispielsweise wenn ich etwas geschafft habe, in der Arbeit, ..., das macht mich dann einfach glücklich, weil die Energie, die ich aufgebracht habe in meiner Tätigkeit, ganz egal ob im geschäftlichen oder privaten, hat Erfolg gehabt, und das macht mich dann schon sehr glücklich." Auch hier wird wieder deutlich, dass eine Definition von "Glück" nur auf rein subjektiver Ebene erfolgen kann und auch nur auf dieser Ebene mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel "Erfolg" in Zusammenhang gebracht werden kann. Da "Glück haben" oder "glücklich sein" Zustände sind, die wohl kaum lostgelöst von einer Person gesehen und damit als abstrakte Begriffe Bestand haben können, ist auch eine Objektivierung nicht möglich. Wenn "Glücklich sein" und "Erfolg haben" aber keine objektivierbaren Größen sind - lässt sich daraus nicht schließen, dass sie auch durch Begriffe wie "Gesundheit" oder "Leistungsfähigkeit" nicht erklärbar sind?
Auch die Möglichkeit Leid zu erfahren ist für ihn an subjektives Empfinden gebunden, jedoch führt er eine Unterteilung von Leid in drei Bereiche durch und nimmt dadurch eine gewisse Loslösung seiner Person von der Leid-Definition vor:
" ... also ich denk, da gibt es so drei Facetten, einmal das persönliche Leid, wenn es mich selber betrifft, das Leid von anderen, mir nahestehenden Menschen und das, was so im Gesellschaftlichen passiert."
Zum Begriff "Herausforderung" meint er:
"Herausforderung ist eigentlich jeder Tag, also aufzustehen, sich selber Ziele zu setzen, sie nach Möglichkeit so gut es eben geht zu erreichen, ..., das klappt nicht immer, aber ich denke schon, da kann ich auch Beispiele bringen aus meiner Arbeitssituation, das passiert täglich, dass man etwas erreicht, oder eben auch nicht."
Interviewpartner B hält seine Definition sehr allgemein, führt kein konkretes Beispiel für eine "ihn herausfordernde Situation oder Tätigkeit" an, vermittelt aber durch seine Umschreibung eine für ihn positive Bewertung des Begriffes: "... das ist schon eine Herausforderung, jeden Tag zu erleben, also man wird da schon gefordert, auch im positiven Sinn." Seinem Empfinden nach wird er im alltäglichen Leben und in seiner Arbeit gefordert, "herausgefordert" und erlebt dies als positiv. Es ermöglicht ihm sich Ziele zu setzen und zu erreichen, Erfolg zu haben und damit Glücksmomente zu erfahren.
Frage nach der Definition der Begriffes Normalität:
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Normalität bereitet Interviewpartner B jedoch Schwierigkeiten. "Normalität, also ich hab ein Problem mit dem Begriff, also nicht mit dem Begriff an sich, weil, also für mich ist mein Leben normal, weil das ist meinLeben." Schon zu Beginn des Interviews verwendet er den Begriff "normal". Er beschreibt, dass seine Kindheit "normal" verlaufen sei, und scheint dabei eine allgemein übliche Vorstellung von Normalität, eine von der Gesellschaft definierte Normalität zu meinen. Hier spricht er nun von "seiner" Normalität, die sich durchaus von jener anderer Menschen unterscheiden kann. "Normalität,also ich find, das ist für jeden unterschiedlich, also ich denke schon, mein Leben, so wie es jetzt läuft und gut weiter laufen wird, ist für mich Normalität... Also das ganze Leben ist für mich, so wie ich lebe, Normalität." Er deutet an, in einer Gesellschaft zu leben, die eine Normalität definiert, der er möglicherweise nicht entspricht: "Es mag für jemanden anders wieder anders aussehen, aber für mich ist es, ja, normal. Mit dem eigenen Handicap umzugehen, Herausforderung - haben wir ja grad besprochen, also jeder Tag ist für mich eine Herausforderung - aber das ist für mich, ja, meine Normalität, einfach zu leben, Spaß am Leben zu haben, das ist für mich normal, meine Normalität."
Zu den Begriffen "behindert sein" und "behindert werden" erklärt er:
"Ich bin behindert, aber ich sehe mich nicht so." Hier trennt Interviewpartner B klar zwischen seiner körperlichen Gegebenheit, die für ihn die Benutzung eines Rollstuhls notwendig macht, und der subjektiven Einschätzung derselben. "Aber für andere Menschen bin ich behindert. Die Behinderung an sich ist für mich kein Problem, weil ich nehme mich so an, wie ich bin."
Er nimmt für sich eine Wertung der Begriffe "behindert sein" und "behindert werden" vor und bezeichnet bauliche Barrieren, auf die er im Alltag immer wieder stößt, als die eigentliche Behinderung; diese bewertet er auch als Problem: "Die Behinderung findet eher so beim Einkaufen statt, ..., also ein Beispiel, man will an ein Regal ran und kommt da nicht ran, ..., oder wenn der Gang zu schmal ist, das ist für mich Behinderung, das muss nicht sein, aber mit der Behinderung an sich hab ich kein Problem, weil ich bin ich, das ist für mich normal. Im Straßenverkehr ist auch ganz klar eine Behinderung; wenn der Bordstein zu hoch ist, muss ich auch sehen, wie ich da rüberkomme." Er betont, dass "sein Handicap", wie er es bezeichnet, ihm keine Probleme bereite. Seine Behinderung ist Teil seiner Persönlichkeit und er drückt dies aus in dem er meint: "... weil ich bin ich."
Auf die Frage, ob er sich an Situationen erinnere, die ihm das Gefühl vermittelten, nicht dazu zu gehören, anders zu sein, antwortet er:
"Ja, in der Schule war ganz klar, na ja, Hänseleien gab es schon und damit ganz klar auch Verletzungen, also "Krüppel", "Spasti", ja aber auch da war für mich erstaunlich zu sehen, dass meine Klassenkameraden immer geholfen haben, also ich durfte mir der Unterstützung meiner Klassenkameraden durchaus sicher sein..."
Interviewpartner B gibt an, Erfahrungen gemacht zu haben, die ihm das Gefühl vermittelten von anderen ausgeschlossen zu werden, weist aber gleichzeitig darauf hin, immer auch das Gegenteilige erfahren zu haben, nämlich in seinem "So-sein" angenommen zu werden.
"... wenn jemand auf der Straße gesagt hat, wenn wir unterwegs waren, "he, du Krüppel", dann standen die [Klassenkameraden] schon da und haben gesagt "he, sag mal". Also einmal hab ich ja selber gelernt, denjenigen dann darauf anzusprechen, wie er jetzt dazu kommt, mich so zu betiteln, aber das war schon interessant, auch so diese Sensibilität von Nichtbehinderten in meiner Klasse, also es war eine sehr schöne Klassengemeinschaft."
Hier erklärt er, dass er diese für ihn positiven Erfahrungen des Angenommenwerdens machen konnte, weil er die Möglichkeit hatte gemeinsam mit behinderten und nichtbehinderten Kindern die Schule zu besuchen. Dies ermöglichte ein Kennenlernen "auf beiden Seiten": "... ja, ich find es halt wichtig, dass beide Seiten aufeinander zugehen, beide sagen, hier sind wir, ..."
"Und ich bin halt ein Anhänger des integrativen Gedanken, ja, miteinander nicht jeder für sich, sondern, nur wenn man aufeinander zugeht - ist jetzt egal ob gehandikapt oder nicht - ... dann kann man, ich sag mal, die Welt verändern, bisschen besser machen."
Für ihn ist die Möglichkeit, sich seinem Umfeld mitteilen zu können, von großer Bedeutung. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das gemeinsame Heranwachsen mit behinderten und nichtbehinderten Schülern sich positiv auf sein weiteres Leben auswirkte und beschreibt dies nochmals mit den Sätzen: "Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich, genauso wie es auch im Privatleben war, also in meiner Familie, gut vorbereitet in meinem weiteren Lebensweg, also ich war immer schon daran interessiert, was vor meiner Haustüre passiert, also jetzt nicht unbedingt immer nur mit Rollstuhlfahrern zusammen, sondern halt beide, ..."
Wieder geht er auf den Begriff der Normalität ein und nimmt eine Unterteilung in zwei Normalitätswelten vor: Zum einen kennt er seine private, persönliche Normalität, denn sein Leben mit persönlicher Assistenz oder die Benutzung eines Rollstuhls um sich fortzubewegen ist für ihn normal. Es gibt aber auch eine von der Gesellschaft konstruierte Normalitätswelt, in die er sich als Rollstuhlfahrer nicht vollkommen integriert fühlt. Diese beiden Normalitätswelten zu verknüpfen, so dass seine Lebensweise, die für ihn Normalität darstellt, aufgenommen wird in das gesellschaftliche Verständnis eines "normalen" Lebens, dies würde für ihn die eigentliche Normalität darstellen. "Wir sind hier in Deutschland noch ein bisschen weg von der Normalität, damit meine ich nicht meine persönliche, ..., ich muss halt ganz klar sagen, es wird von der Gesellschaft noch nicht so wahrgenommen, auch wenn man als Gehandikapter in seinem privaten Umfeld Normalität für sich selber geschaffen hat, aber die Normalität hier, also draußen in der Gesellschaft, ist längst nicht so, obwohl wir da, ich denke, auf gutem Weg sind."
Er hat, nach eigenen Angaben, eine solche Normalität als Kind erfahren dürfen, da er nicht in einem Heim für behinderte Kinder aufgewachsen ist, sondern - wie die meisten nichtbehinderten Kinder auch - im Hause seiner Eltern.
In seiner heutigen Situation als Mann mit einer körperlichen Behinderung empfindet er das Gefühl "anders" zu sein, von anderen als "nicht normal" angesehen zu werden, immer wieder, vor allem dann, wenn er sich in einem Umfeld aufhält, in dem er nicht bekannt ist. "Es gibt schon so Situationen beim Einkaufen, die Leute gucken dann manchmal so komisch, hier weniger, weil die Leute hier schon [an mich] gewöhnt sind in dem Areal, aber es gibt schon noch Anfeindungen auf der Straße." Auch hier deutet er darauf hin, dass das Empfinden von Fremdheit und Andersartigkeit durch Integration abgebaut werden kann, denn dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, sich aneinander "zu gewöhnen" und miteinander zu kommunizieren. Er veranschaulicht dies auch anhand einer Situation, der er in ähnlicher Weise immer wieder begegnet: "... Was mich dann stört ist, wenn man auf der Straße ist und ein kleines Kind z. B. guckt, ist ja interessant so ein Rollstuhlfahrer, und die Eltern dann meinen "der ist krank", also "der sitzt halt im Rollstuhl weil er krank ist; der hat ein kaputtes Bein" - was weiß ich - und da werde ich dann schon ... das gefällt mir selber nicht, weil ich hab dann schon des öfteren mal gebracht, dass ich gesagt habe: "Erzählen Sie ihrem Kind bitte nichts falsches, das stimmt einfach nicht, Ihr Kind hat die Möglichkeit mich zu fragen." Ich hab da so eine kindgerechte Version ... ja und dann sind die Eltern immer ganz erstaunt, wie jemand der gehandikapt ist, so offen mit seinem eigenen Handikap, sag ich mal, umgehen kann und es anderen erklären kann. Weil sie wissen es selber nicht und kürzen es für ihr Kind gleich mal so ab: der ist halt krank, oder der hat ein gebrochenes Bein ... und es traut sich halt keiner zu fragen, ..., warum sitzt du im Rollstuhl?"
Interviewpartnerin A berichtete in ihrem Interview von ähnlichen Erfahrungen mit Kindern, deren interessierten und neugierigen Fragen und dem abwehrenden Verhalten der Eltern, und ebenso wie sie empfindet auch Interviewpartner B das Interesse der Kinder als eine Möglichkeit, Barrieren und Vorurteile im zwischenmenschlichen Umgang abzubauen. Diese Möglichkeit wird aber durch die Reaktionen der nichtbehinderten Erwachsenen vereitelt, "weil man manifestiert ja dann so ein Bild, das Bild wird dann ja quasi weiter getragen, wenn die Mutter oder der Vater seinem Kind sagt, jemand der im Rollstuhl sitzt, der ist halt krank oder hat halt ein gebrochenes Bein, dass ..., ja ich würde mir wünschen, dass da einfach offener damit umgegangen würde."
Auf die Frage, warum Menschen sich ihm gegenüber abweisend verhalten, weiß Interviewpartner B keine Antwort: "Ja das kann ich nicht so sagen, weil ich bin ein offener Mensch, ich hab kein Problem damit, ..., also ich hab kein Problem gefragt zu werden, warum kannst du das nicht. Also ich hab kein Problem, mich damit auseinander zu setzen."
Problematisch ist für ihn nicht, dass er zur Fortbewegung einen Rollstuhl benutzen muss, sondern dass ihm die Fortbewegung im Rollstuhl durch bauliche Barrieren und verletzendes Verhalten erschwert wird. Er meint jedoch auch: "Ich denke, das Interesse ist schon gewachsen, es wird ja auch in den Medien berichtet über Menschen mit Behinderung, es ist ja kein so großes Tabuthema mehr. Die Frage ist nur, wie wird es dann in der Familie, sag ich mal, aufbereitet."
Hier weist er nochmals darauf hin, dass es wichtig wäre, schon Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit der Thema Behinderung auseinander zu setzen. Dies wird seiner Meinung nach möglich durch ein gemeinsames Heranwachsen und durch Etablierung des "integrativen Gedankens" bzw. durch ein "Aufeinander-zugehen". Er glaubt, dass es nicht leicht sein werde, in der Gesellschaft, in der er lebt, diesen integrativen Gedanken zu verwirklichen, sieht es aber auch als wichtig an, dass er selbst, als ein - wie er sich bezeichnet - "offener Mensch" das Angebot zur Kommunikation und somit zum Kennenlernen macht. "Aber Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, werden sich immer umdrehen, immer gucken, die wird es immer geben ... bloß, wie schafft man es dann, dass Leute sich trauen zu fragen? ... Ich denke, das ist auch schwierig, also man kann halt immer nur das Angebot machen."
Interviewpartnerin C ist, wie sie erzählt, in ihrem Elternhaus aufgewachsen, zusammen mit einem nichtbehinderten Bruder. Sie ist 41 Jahre alt, Diplom-Sozialarbeiterin und hat außerdem noch eine Ausbildung zur Hospizhelferin, systemischen Familienberaterin und Peer Councelerin gemacht. Sie erwähnt, dass sie noch bis Ende des Monats erwerbstätig sein werde, danach jedoch arbeitslos und nicht damit rechne, eine neue Arbeitsstelle zu bekommen. Auf Grund einer fortschreitenden Muskelerkrankung sitzt Interviewpartnerin C seit ihrer Kindheit im Rollstuhl.
Sie lebt alleine, mit "rund-um-die-Uhr"-Assistenz: "Die Assistenten hab ich mir selbst gesucht und als sogenannte behinderte Arbeitgeberin angestellt. Ich habe 24 Stunden Assistenz und es werden tatsächlich alle 24 Stunden bezahlt... Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich tatsächlich zu jeder Zeit auf die Leute zurückgreifen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie dafür nicht bezahlt werden was sie machen."
Hier spricht Interviewpartnerin C etwas für sie Grundlegendes an: Auf Grund ihrer Behinderung ist sie im Alltag auf sehr viel Unterstützung und Hilfe angewiesen. Dieses Angewiesen-sein auf andere bedeutet aber hier nicht notwendigerweise vollkommene Passivität und Abhängigkeit. Als "behinderte Arbeitgeberin" übernimmt sie einen aktiven Part, in dem sie sich ihre Assistenten selbst auswählt und anleitet. Entscheidend ist dabei ihre Position als Arbeitgeberin, die es ihr ermöglicht, sich die notwendige Hilfe als Dienstleistung einzukaufen. Damit bekommt die Hilfe am behinderten Menschen einen ganz anderen Stellenwert: Sie wird nicht mehr als eine altruistische Handlung an Bedürftige verstanden. Interviewpartnerin C drückt dies aus, in dem sie betont, wie wichtig es ihr ist, zu jeder Zeit "auf Leute zurückgreifen zu können", ohne das Gefühl zu haben, dass diese dafür nicht bezahlt werden.
Die Frage nach eventuellen Plänen oder Wünschen für die Zukunft wird von Interviewpartnerin C mit "Nein, leider nicht." beantwortet.
"... also Wünsche zu entwickeln, Ziele zu entwickeln ... ich finde das einfach total schwierig, Wünsche zu entwickeln, weil alles das, was ich mir wünschen könnte, da sagt mir mein Kopf, dass es eh nicht zu realisieren ist. Was auch ganz viel einfach mit meiner Assistenzbedürftigkeit zu tun hat." Ihr "Nein" auf die Frage nach Zukunftsplänen ist kein Nein, das ausdrückt, es wären keine Wünsche und Pläne vorhanden, im Sinne eines Gefühls "wunschlos" oder "planlos" zu sein. Da deren Realisierbarkeit aber für sie nicht oder nur schwer vorstellbar ist, empfindet sie es auch als sehr schwierig, sich überhaupt mit Zukunftsperspektiven auseinander zu setzen: "Also das ist, glaub ich, mein größtes Problem. Ich hab halt eine fortschreitende Behinderung und bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich mit 27 sterben werde, jetzt bin ich 41 und mein größtes Problem ist einfach, dass ich mir für dieses Alter keine Gedanken mehr gemacht habe. Jetzt steh ich an dem Punkt, dass ich mir überlege, was ich halt mit den restliche Jahren mache..." Dieses mangelnde Vertrauen an die Realisierbarkeit von Möglichkeiten, das sie auch als "ihr größtes Problem bezeichnet", führt sie zurück auf ihre fortschreitende Erkrankung und der damit verbundenen zunehmenden "Assistenzbedürftigkeit", denn für alltägliche Verrichtungen - z. B. im Haushalt oder bei der Körperpflege - benötigt sie die Unterstützung ihrer Assistenten. Sie gibt an, davon ausgegangen zu sein, mit Ende zwanzig sterben zu müssen, was darauf hinweist, dass sie schon in frühester Jugend darüber aufgeklärt wurde, dass ihre Krankheit fortschreitend verläuft. Sie hat jedoch mehrere Ausbildungen gemacht, einen Haushalt gegründet, den sie mit Hilfe ihrer Assistenten führt, und ist bis dato einem Beruf nachgegangen. Dies zeigt, dass sie in ihrer Vergangenheit Pläne verwirklicht und Wünsche realisiert hat, unabhängig von der Entwicklung ihres Krankheitsverlaufes. Nicht außer Acht lassen sollte man jedoch, dass Interviewpartnerin C zu Anfang berichtete, im darauffolgenden Monat ihre Erwerbtätigkeit zu verlieren und keine Aussicht auf eine neue Arbeitsstelle zu haben. Ein Umstand, der eine einschneidende Erfahrung und eine tiefgreifende Veränderung bedeutet, und zwar unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht. So könnte ihre Aussage "Jetzt steh ich an dem Punkt, dass ich mir überlege, was ich halt mit den restlichen Jahren mache ..." auf zweifache Weise verstehbar werden: Einmal steht sie gerade vor einer entscheidenden Veränderung ihres Lebens, zum zweiten ist es für Interviewpartnerin C unumgänglich, dass sie in ihre Planungen ihre körperliche Verfassung bzw. Erkrankung mit einbezieht.
Schwierigkeiten, die in ihrem Alltag auftreten können, sieht Interviewpartnerin C immer im Zusammenhang mit ihrer Behinderung.
"Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, die in meinem Alltag auftreten und nicht mit meiner Behinderung zu tun haben." Anders, als die zwei befragten Personen der vorangegangenen Interviews, führt sie keine Unterscheidung durch in Probleme, auf die sie als Rollstuhlfahrerin im Umgang mit der Gesellschaft stößt und in Probleme, die zu tun haben könnten mit ihrer persönlichen Einstellung zu ihrer körperlichen Einschränkung. Sie führt auch keine konkreten Beispiele für alltägliche Schwierigkeiten an, geht aber im weiteren Verlauf des Interviews nochmals auf diese Thematik ein, und zwar im Zusammenhang mit ihren Äußerungen zu den Begriffen "behindert sein - behindert werden".
Den Begriff "Lebensqualität" definiert Interviewpartnerin C auf unterschiedliche Weise:
"Ein Kriterium für Lebensqualität ist sicherlich die Möglichkeit, in ausreichendem Maße Hilfe und Unterstützung zu bekommen, wenn man so wie ich darauf angewiesen ist. Lebensqualität ist für mich verbunden mit einer ausreichenden finanziellen Sicherung." Interviewpartnerin C setzt hier Lebensqualität ebenfalls mit dem Erreichen eines gewissen Lebensstandards gleich, wofür wiederum ausreichend finanzielle Mittel erforderlich sind. Zusätzlich benötigt sie als Frau mit Behinderung noch in ausreichendem Maße Hilfe und Unterstützung. Da diese Voraussetzungen bisher für sie gegeben waren, hat sie sich nach eigenen Angaben "Lebensqualität geschaffen".
"Aber Lebensqualität hat für mich vor allem mit eigener Genussfähigkeit zu tun, also die Lebensqualität als solche zu empfinden... also ich glaube, dass ich die Lebensqualität, die ich mir tatsächlich geschaffen habe, nicht als solche empfinde." Hier führt sie eine Erweiterung des Begriffes durch: Ihr Leben besitzt "Qualität" in einer Weise, wie es auch den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht, das heißt, sie kann die materiellen und kulturellen Angebote der Gesellschaft nützen, auch als Frau mit Behinderung, da sie in ausreichendem Maße Assistenz in Anspruch nehmen kann. Trotzdem führt sie an, die Lebensqualität, die sie tatsächlich besitzt, nicht als solche zu empfinden und begründet dies durch eine weitere Aussage bzw. Definition des Begriffes: "Lebensqualität hat für mich ganz viel zu tun, ... eben ... dass man die Möglichkeit hat ... das, was man geschaffen hat, zu teilen mit jemanden, also über das Mitteilen hinaus halt auch mit jemanden zu teilen." Ihr fehlt jemand, der mit ihr zusammen das genießt, was für sie Lebensqualität bedeutet.
Aus diesem Empfinden heraus ist auch ihre Umschreibung der Begriffe "Glück" und "Leid" verstehbar.
Sie setzt "Glück" mit "Zweisamkeit" gleich und meint: "Für mich bedeutet Glück Zweisamkeit, teilen, also Leben teilen, alles das, was man sich geschaffen hat, was man schaffen möchte ... Ziele zu teilen, Wünsche zu teilen..." Diese Form von Glück scheint ihr schwer realisierbar und sie drückt dies dadurch aus, dass sie meint, sie versuche "für sich" Glück als Abwesenheit von Leid zu definieren. "... dass ich halt sage, eigentlich müsst ich mich glücklich schätzen, weil ich nicht krank bin. Eigentlich müsst ich mich glücklich schätzen, weil ich eine schöne Wohnung habe, weil ich eigentlich alles habe, was man braucht, um glücklich zu sein." Hier wird wieder die subjektive, individuelle und persönliche Komponente von "glücklich sein" oder "Glück haben" angesprochen. Glücklich sein bzw. Glück haben hat auch damit zu tun, welchen Stellenwert man bestimmen Dingen im Leben einräumt. Sie führt nicht ihre chronische Erkrankung bzw. Behinderung als Grund dafür an, dass sie sich nicht in dem Maße glücklich schätzt, wie sie "eigentlich sollte", sondern begründet es mit der fehlenden Zweisamkeit, der fehlenden Möglichkeit, das, was ihr Glück bereiten könnte, mit jemanden zu teilen.
Nach eigenen Angaben ist es ihr nicht gelungen, Glück als Abwesenheit von Leid zu definieren, denn sie empfindet ihr Leben als Frau mit Behinderung nicht als ein glückliches Leben, auch wenn sie, wie sie selbst anführt, ihre Behinderung nicht als Leid betrachtet: "Leiden hat ab einem bestimmten Punkt auch etwas mit körperlicher Krankheit zu tun, aber das ist etwas, das für mich einfach noch kein Thema ist, weil ich einfach noch nie so krank gewesen bin, das ich meine körperliche Verfassung als Leid oder leiden empfunden habe."
Sie leidet nicht an ihrer körperlichen Einschränkung, sondern an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Im Zusammenhang damit, wie andere Personen ihr gegenübertreten, erfährt sie Leid: "Ich kenn den Begriff Leid in dem Zusammenhang oder in dem Begriff Mitleid... ich leide eben oft daran, wie mit mir umgegangen wird... im ganz normalen Alltag. Also wie fremde Menschen mich betrachten, mir gegenübertreten bzw. mich halt nicht betrachten. Darunter leide ich, also einfach an den gesellschaftlichen Verhältnissen."
Auch ihre Umschreibungen der Begriffe "Herausforderung" und "Normalität" stehen unter anderem in einem bestimmten Zusammenhang mit ihrem Verständnis von "Glück", denn sie meint:
"Meine größte Herausforderung ist eben die, das Leben zu genießen. Also die Lebensqualität, die ich erreicht habe, auch als solche wahrzunehmen. Ja, das ist meine Herausforderung... Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich eine Ausbildung schaffen werde, ..., dass ich die Assistenz bekomme, die ich brauche, ..., dass ich es schaffen werde, eine schöne Wohnung zu finden ... Aber, wie gesagt, die Herausforderung, die ich halt eben sehe, mit dieser Behinderung ein glückliches Leben zu führen, an dieser Herausforderung bin ich gescheitert." Nach ihrer Definition von "Glück", "Lebensqualität" und "Leid" könnte die Frage, warum sie an ihrer ganz persönlichen Herausforderung "gescheitert" ist, so beantwortet werden: Weil ihr eine Person fehlt, mit der sie ihr Leben teilen kann, und weil sie darunter leidet, wie die Gesellschaft auf sie als Frau mit Behinderung reagiert.
"Also ich denke, ..., das, was andere Menschen für große Herausforderungen halten, jetzt, bei einem schwerstbehinderten Menschen oder bei einem schwerstpflegebedürftigen Menschen wie mir, diese Herausforderungen habe ich alle gemeistert. Also ich habe eine Berufsausbildung, ich habe meine eigene Wohnung, ich habe eine umfassende, gut organisierte Assistenz usw. ... Aber das ist für mich aber auch nie die Herausforderung gewesen." Sie grenzt sich klar davon ab, ihr Leben, wie sie es jetzt führt und bisher geführt hat, als Herausforderung zu sehen. Für sie ist es Normalität, auch wenn ihre Umgebung, wie sie meint, es anders sieht:
"... in meinem Alltag bedeutet Normalität auch behindert zu sein, weil der allergrößte Teil meiner Freunde und Freundinnen tatsächlich behindert ist. In meinem Alltag bedeutet Normalität schwul oder lesbisch zu sein, weil viele meiner Freunde und Freundinnen homosexuell sind. Für mich hat Normalität vor allen Dingen immer was damit zu tun, in welchen Zusammenhängen ich lebe. Ich lebe halt in Zusammenhängen, wo alles das normal ist, im Sinne von es ist üblich, es ist nichts Ungewöhnliches."
Der "Tenor ihrer Umgebung", wie sie es bezeichnet, ist aber Bewunderung: Sie hätte ihr Leben erfolgreich "gemeistert", so vieles "geschafft", sich Herausforderungen gestellt. Daraus könnte man aber schließen, dass ein Alltag, wie Interviewpartnerin C ihn führt, aus gesellschaftlicher Sicht immer noch ungewöhnlich, im Sinne von schwer vorstellbar und unüblich für Menschen mit Behinderungen erscheint. Als Frau mit Behinderung ein Leben zu führen, das aus gesellschaftlicher Perspektive als normal im Sinne von üblich verstanden wird, wird in ihrem Falle als außergewöhnlich bezeichnet. Sie empfindet es jedoch nicht als ungewöhnlich und veranschaulicht dies, indem sie noch eine ganz persönliche Definition des Begriffs "Normalität" äußert: "Normalität bedeutet für mich mit 41 Jahren verheiratet zu sein, eine schöne Wohnung zu haben oder ein kleines Haus, 2 Kinder, möglichst ein Junge und ein Mädchen." Hier führt sie an, dass sie es als normal empfände, ein Leben zu leben, das sie für sich auch ganz persönlich als "glückliches Leben" definiert.
Zu den Begriffen "behindert sein und behindert werden" meint sie:
"Über die Tatsache, dass ich behindert bin, kann ich traurig sein... Es gibt immer wieder Situationen, wo trotz der besten Gegebenheiten ich einfach traurig darüber bin, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann." Interviewpartnerin C nimmt hier eine Unterscheidung vor: Sie fasst ihre Behinderung nicht als ein ihr auferlegtes Leid auf, in dem Sinne, dass sie permanent unter der Tatsache behindert zu sein leidet. Es können jedoch immer wieder Situationen auftreten, in denen ihre körperliche Einschränkung sie traurig macht. Worunter sie leidet, hat sie bereits an einer früheren Stelle des Interviews deutlich gemacht: Sie leidet unter "den gesellschaftlichen Verhältnissen". Sie bringt es hier noch einmal zur Sprache, als sie sich zu "behindert werden" äußert:
"Behindert werden ist für mich verbunden mit dem Begriff Wut, Wut und ungeheure Aggression... für mich ist beides [behindert sein und behindert werden] eine sehr alltägliche Erfahrung. Also ich bin behindert und das jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe genauso wie wenn ich abends ins Bett gehe. Und es ist so, dass ich tatsächlich jeden Tag die Erfahrung mache, behindert zu werden. Von ... baulichen Gegebenheiten, von menschlicher Ignoranz, von allem Möglichen. Aber bei letzterem ist es halt so, dass es das ist, woran ich verzweifeln kann. ... es ist etwas, wo ich halt immer wieder spüre, es ist die reine Ignoranz, die dazu führt, dass ich behindert werde." Interviewpartnerin C spricht hier nochmals von der "alltäglichen Erfahrung" behindert zu sein. Diese ist für sie Normalität im Sinne von nichts Ungewöhnliches, Teil ihres alltäglichen Lebens, sie "steht damit auf und geht damit zu Bett".
Auch "behindert werden" ist für sie eine alltägliche Erfahrung. Sie versteht darunter, als Rollstuhlfahrerin immer wieder auf bauliche Barrieren zu stoßen und mit Verhalten konfrontiert zu werden, das sie verletzt und das sie als Ignoranz bezeichnet. Diese alltäglichen Erfahrungen kann sie aber nicht als "normal" akzeptieren, sie empfindet dabei Wut und Aggression. Sie macht immer wieder die Erfahrung, dass ihre Bedürfnisse als Rollstuhlfahrerin ignoriert werden, dadurch, dass ihr z. B. der Zugang zu Gebäuden verwehrt ist oder aber auch, dass sie als Person und vor allem auch als Frau "übersehen" wird. "Da ist mir erst klar geworden, dass ich meistens übersehen werde, und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich drei oder vier oder fünf Köpfe kleiner bin als die Leute und die über mich hinwegblicken, sondern das hat einfach damit zu tun, dass die Leute mich aus ihrem Blickfeld ... eliminieren."
Die Frage, was sie mit den Worten "der Blick des anderen" assoziiert, beantwortet Interviewpartnerin C mit der Erzählung einer Situation, die sie erlebte, als sie 12 Jahre alt war:
"Was mir einfällt zum Blick des anderen ist meine erste Begutachtung für meinen Schwerbehindertenausweis. Für mich war das einfach ganz, ganz schrecklich, weil ich halt zum ersten Mal ... ja, dass ich behindert bin, dass ich anders bin, das wusste ich schon, aber mir ist in dem Moment klar geworden, was die anderen Leute sehen. Und was sie sehen, das ist halt, was weiß ich, krumme Füße, krumme Arme, krumme Beine, also alles ist krumm und stimmt nicht. Und der Arzt hat es damals auch ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht. Der hat dann zum Schluss zu mir gesagt: Nein, bei Ihnen stimmt ja gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht aufgefallen, dass an mir aber schon gar nichts stimmte."
Hier drückt sie folgendes aus: Nicht die Tatsache sich von anderen zu unterscheiden, war damals - und ist heute - für sie schwer zu ertragen, sondern auf welche Weise dieser Unterschied bewertet wurde und wird. Ihr Körper wurde begutachtet und vermessen und ihre Körpermaße mit Maßen verglichen, die der "Norm" eines 12-jährigen Kindes entsprechen. Durch dieses Gemessen-werden an der Norm und durch die Beurteilung des Arztes wurde ihr bewusst gemacht, dass die Umgebung ihre Behinderung und ihr damit verbundenes Aussehen als "nicht-stimmig" und somit negativ bewertet. Und diese wertende Haltung der anderen beeinflusst wiederum das eigene Empfinden darüber behindert zu sein bzw. die eigene Einstellung zum Leben als behinderter bzw. chronisch kranker Mensch.
Sie bringt dies in ihren ergänzenden Äußerungen am Ende des Interviews zum Ausdruck:
"Was ich noch ergänzen möchte ist halt, ich glaube, dass ganz entscheidend ist für diese Begriffe wie Lebensqualität und Glück ... wie meine Eltern mir als Kind begegnet sind und meiner Behinderung begegnet sind... Ich glaube, wenn ich so wenig anfangen kann mit dem Begriff Leid, dann hat das auch ganz klar damit zu tun, dass meine Mutter vor allen Dingen behindertes Leben mit Leid gleichgesetzt hat."
Ihr wurde vermittelt, dass Glück nicht vereinbar wäre mit ihrem Dasein als behinderte Frau, und diese ihr entgegengebrachte Haltung prägte, wie sie berichtet, entscheidend ihr Dasein. Dies macht deutlich, wie sehr der "Blick des Anderen" Einfluss nehmen kann auf die Wahrnehmung des eigenen Selbst.
Interviewpartner D ist auf Grund einer Muskelerkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen.
"Die Muskelerkrankung hatte ich schon von Geburt an."
Er ist 45 Jahre alt, behinderter Arbeitgeber, das heißt, er organisiert sich den Alltag mit Unterstützung von persönlichen Assistenten, lebt allein und ist im Vorstand eines Dienstleistungsbetriebes zur Vermittlung von persönlicher Assistenz tätig.
Er wurde in Sonderschulen für behinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet, immer verbunden mit Heimunterbringung, und beschreibt die Erfahrung, als Kind vom Elternhaus getrennt worden zu sein, als traumatisch: "Das war für mich ein ziemliches Trauma gewesen vom Elternhaus wegzukommen. Die ersten sieben Jahre war ich auf einer staatlichen Schule, die letzten Jahre dann auf einer kirchlichen, die kirchliche war mitten in der Stadt und hatte ein paar integrative Ansätze, da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, über so was wie Zukunft nachzudenken." Interviewpartner D ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Dort gab es, wie er berichtet, für ein Kind mit Körperbehinderung keine Alternative zur Sonderschule mit Heimunterbringung. Die letzte Schule, auf der er sich befand, hatte jedoch "ein paar integrative Ansätze" - das heißt, er hatte Möglichkeiten, sich auch außerhalb des Behindertenheimes und außerhalb eines Umfeldes von Schulpersonal und Betreuern aufzuhalten und so in Kontakt mit nicht behinderten Personen seines Alters zu kommen. Wenn er davon spricht, dass er dadurch erst auf die Idee gekommen sei, "über so was wie Zukunft" nachzudenken, so scheint er damit ausdrücken zu wollen, dass ihn diese "integrativen Ansätze" erst ermutigten, sich ein Leben außerhalb von Heimstrukturen vorzustellen.
"Gleichzeitig waren dort die linken Ideen des Westens auch angekommen, über Diakonschüler und so - und da hatten wir eben die Idee, eine Kommune zu machen ..." Gemeinsam mit anderen behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gründete er eine Wohngemeinschaft auf dem Land: "... das war halt so ein Agreement, auf der einen Seite waren wir, die wir Hilfe brauchten, bei unseren alltäglichen Verrichtungen, auf der anderen Seite waren junge Leute da, ..., die nicht so in dieses genormte DDR-sozialistische Alltagsleben sich einfügen konnten und wollten, ..."
Interviewpartner D studierte Theologie und ist, nachdem er einige Jahre in einer Kommune lebte, nach Berlin gezogen: "... als Assistenzflüchtling, weil es hier halt viel bessere Bedingungen gab und gibt, ..." Er spricht von sich als "Assistenzflüchtling" und meint damit folgendes: Um sich als Mensch mit einer körperlichen Behinderung ein Leben selbstbestimmt mit Unterstützung durch persönliche Assistenten zu organisieren, müssen bestimmte gesellschaftspolitische Voraussetzungen gegeben sein. Vor allem sind finanzielle Mittel erforderlich, um den Bedarf an persönlicher Assistenz abdecken zu können. Diese Voraussetzungen waren für ihn in einem größeren Ausmaß in der Großstadt gegeben. Interviewpartner D geht am Ende des Interviews auf den Begriff der "persönlichen Assistenz" nochmals näher ein. Die Äußerungen sollen vorweg genommen werden, da sie unterstreichen, welche Bedeutung er der Möglichkeit einräumt, als Person mit Behinderung persönliche Assistenz in Anspruch nehmen zu können:
"Ich denke, da spielt Assistenz, überhaupt der Assistenzgedanke, eine ganz starke Rolle, und dass es eben nicht mehr darum geht, du erleidest etwas und dann kommt eine große Hilfsorganisation und hilft dir, sondern dass es darum geht, dass, wenn deine Möglichkeiten eingeschränkt sind, du die Mittel in die Hand bekommst das auszugleichen, also auch in deinem Sinne das ausgleichen zu können."
Interviewpartner D beschäftigt als Arbeitgeber Assistenten und kann somit den Alltag seinen Vorstellungen entsprechend gestalten. Er arbeitet im Bündnis für "Selbstbestimmtes Leben", einer Bewegung von Menschen mit Behinderungen, die sich auf sozialpolitischer Ebene für die Belange von behinderten Personen einsetzt, und betreibt Öffentlichkeitsarbeit, vor allem zu den Themen "Leben mit persönlicher Assistenz" und "Behinderung und Sexualität." Besonders letzteres ist ein auch heute noch in der Öffentlichkeit stark tabuisiertes Thema und - wie Interviewpartner D es ausdrückt - "eines der größten Diskriminierungsfelder für behinderte Menschen noch, vor allem, weil man da auch selbst so wenig einfordern kann, weil das Gegebenheiten sind in der Wahrnehmung." In der heutigen, westlichen Gesellschaft wird offen mit dem Begriff "Sexualität" umgegangen. Das Recht einer Person, ihre Sexualität leben zu können, ist ein allgemein anerkanntes gültiges Menschenrecht und wird auch als notwendige Vorrausetzung für ein physisches und psychisches Wohlbefinden verstanden. Wenn Interviewpartner D von "einem der größten Diskriminierungsfelder für behinderte Menschen" spricht, so scheint er damit ausdrücken zu wollen, dass bezogen auf den behinderten Menschen diese Offenheit im Umgang mit Sexualität noch nicht gegeben ist. Er spricht auch von "Gegebenheiten in der Wahrnehmung" und könnte damit folgendes meinen: Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft; Leistungsdenken und die Orientierung an vorgegebenen Idealen von Schönheit und Körperlichkeit stehen im Vordergrund. Der Gedanke, dass auch ein Mensch mit körperlichen Einschränkungen, der diesen Idealen nicht entspricht, Sexualität auf seine individuelle Weise leben kann, ist scheinbar nur schwer vorstellbar.
Auf Wünsche oder Pläne für die Zukunft angesprochen meint Interviewpartner D:
"Zukunft - hab ich nie gehabt ... also als Muskelkranker wird einem immer erzählt, dass man demnächst zu sterben hat, von daher ist es mit Zukunftsplänen immer nicht so toll, hab nie groß welche gehabt ..."
Er antwortet hier in ähnlicher Weise wie Interviewpartnerin C im vorangegangenen Interview: Beide geben an, sich auf Grund ihrer fortschreitenden Erkrankungen über Zukunftspläne keine Gedanken gemacht zu haben. Beide haben jedoch ein Studium abgeschlossen, einen Beruf ausgeübt und sich die notwendige Hilfe im Alltag in Form von persönlicher Assistenz organisiert. Eine gewisse Widersprüchlichkeit in seiner Äußerung zu Zukunftsplänen zeigt sich auch darin, dass er zu Beginn des Interviews erzählt, "über so was wie Zukunft" nachgedacht zu haben. Interviewpartner D ist also nicht in Passivität verharrt, obwohl ihm, wie er berichtet, immer erzählt wurde, demnächst sterben zu müssen.
Die eigenen körperlichen Gegebenheiten beeinflussen sicherlich das Denken und Handeln, sie sollen auch nicht verdrängt werden, sondern müssen mit einbezogen werden in eventuelle Lebensplanungen. So hat auch eine fortschreitende Erkrankung Einfluss darauf, wie über die eigene Gegenwart und Zukunft nachgedacht, wie darüber geurteilt und dementsprechend gehandelt wird. Ob aber überhaupt Zukunftsperspektiven wahrgenommen und realisiert werden, ist von Umwelt-, vor allem aber auch von Persönlichkeitsfaktoren abhängig und kann so gesehen unabhängig von körperlichen Gegebenheiten wie einer Erkrankung gesehen werden. Entscheidend ist sicherlich auch, wie Zukunftsplanung definiert wird, ob als weitläufige Lebensplanung oder schrittweises Nachdenken über die nächsten Monate oder Jahre.
Der Begriff "Lebensqualität" ist für Interviewpartner D negativ besetzt.
"Ich bin jemand, der das Wort nicht leiden kann. Ich finde, dass das in enger Nachbarschaft liegt mit lebenswertem und gleichzeitig lebensunwertem Leben... Ich denke, wenn man von Qualität redet, ist das heute oft eine Produktfrage." Hier geht er besonders auf das Wort "Qualität" ein, und dieses Wort unterliegt seiner Meinung nach immer einer Wertung: Wenn etwas Qualität hat, dann ist es qualitativ hochwertig, ist wertvoll bzw. wird positiv bewertet. Verbunden mit dem Begriff "Leben" heißt dies aber für ihn, dass Leben bewertet wird:
"... das Leben ist kein Produkt, das Leben ist auch kein Konsumartikel ..., es ist eine Anmaßung zu sagen, es hätte Qualität oder nicht."
Soll jemand darüber entscheiden, was ein Leben qualitativ hochwertig macht und was nicht? Kann jemand darüber urteilen, ob ein Leben Qualität hat oder nicht? Dies sind Fragen, die seiner Ansicht nach nur mit einem "Nein" beantwortet werden können und vor allem auch nur mit nein beantwortet werden dürfen. Daher ist es für ihn auch schwierig, dem Begriff "Lebensqualität" etwas Positives abzugewinnen, auch wenn dieser in der Öffentlichkeit häufig genannt wird:
"Lebensqualität ist ein schwieriges Wort, es wird heute sehr gern darüber geredet, auch Behinderte fordern natürlich gerne Lebensqualität ein, und da sind auch verschiedene Parameter, so was wie Mobilität und ähnliches, aber im Grunde genommen glaub ich, ist das die falsche Herangehensweise."
Mit dem Begriff "Lebensqualität" können unterschiedliche Vorstellungen verknüpft sein. Eine allgemein übliche Definition wäre, Lebensqualität mit einem bestimmten westlichen Lebensstandard gleichzusetzen - und dazu gehört auch die Möglichkeit, sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können. Wird Lebensqualität auf diese Weise verstanden, können Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden, da ihnen schon allein durch bauliche Barrieren der Zugang zu kulturellen gesellschaftlichen Angeboten häufig erschwert wird. Dies könnte Interviewpartner D meinen, wenn er davon spricht, dass Behinderte "Lebensqualität in Form von Mobilität" einfordern.
Trotzdem sollte seiner Meinung nach auch in Zusammenhang mit diesen berechtigten Forderungen nicht der Begriff "Lebensqualität" verwendet werden.
Zu den Begriffen "Glück und Leid" äußert sich Interviewpartner D auf folgende Weise:
"Ja, ich denke es ist beides eine ganz subjektive Geschichte. Ob wir etwas als beglückend oder leidvoll erleben, hat sehr viel mit unseren Gegebenheiten, unseren Befindlichkeiten zu tun, natürlich auch damit, wie die Umgebung etwas bewertet."
Hier spricht er folgendes an: Nur der einzelne selbst kann beurteilen, ob und in welchem Ausmaß er unter einer Situation, einer Gegebenheit oder einer Erfahrung leidet. Daher ist es auch für Außenstehende nicht nachvollziehbar, ob das Leben eines Menschen ein leidvolles Leben ist oder nicht. Bezogen auf den behinderten Menschen bedeutet dies:
"... jeder Behinderte weiß, dass - also hat zumindest öfter die Erfahrung schon machen müssen, dass - die Umgebung, umso weniger sie mit dem Menschen selber zu tun hat, der eine Behinderung hat, viele Dinge in dessen Leben als leidvoll und schrecklich einordnet, die überhaupt nicht leidvoll und schrecklich sind - und - andersherum sind manche Dinge sehr leidvoll, die von der Umgebung gar nicht als solche wahrgenommen werden. Dass Behinderung per se auch immer als Leid mitgedacht oder -gefühlt wird, das ist tatsächlich eine Umgebungsgeschichte."
Interviewpartner D bringt hier seine eigenen Erfahrungen ein: Die Tatsache, eine fortschreitende Erkrankung zu haben, bedeutet auch ein "immer größeres Abgeben, immer stärkere Schmerzen und eine immer größere Einschränkung der Möglichkeiten" - trotzdem sieht er darin nicht ein permanentes Leiden. Er spricht von "Einschnitten" im Leben, von Erfahrungen, die mit Schmerzen und Leid verbunden sind, die es jedoch nicht rechtfertigen, das Leben eines Menschen mit Behinderung als leidvolles Leben zu definieren.
"Aber selbst innerhalb solcher Erkrankung und Behinderung, wie ich sie z. B. auch habe, ist das kein permanentes Leiden ... Ich denke sogar, dass es gar nicht so von Bedeutung ist, wie sehr ein Mensch eingeschränkt ist durch Behinderung, ob er sich wohl fühlt und ob er sich verwirklichen kann, oder ob er sich unwohl fühlt, da spielen viele Faktoren eine Rolle, ..., vielleicht hängt es überhaupt nicht von Faktoren ab."
Seiner Meinung nach ist das Empfinden zu leiden ein sehr subjektives Empfinden. Er beurteilt es daher auch als schwierig, ja vielleicht sogar als unmöglich, nachzuvollziehen, ob ein Mensch leidet bzw. warum er unter bestimmten Bedingungen und Umständen mehr oder weniger leidet als ein anderer. Wichtig sei, so Interviewpartner D, den Menschen und seine Empfindungen wahrzunehmen und zu respektieren und sich vor Augen zu halten, dass es zweitrangig ist, ob man glaubt, in einer ähnlichen Situation auf gleiche oder andere Weise zu empfinden: "... wenn jemand leidet, dann leidet er und dann liegt es an der Umgebung, an uns, das zu würdigen und ihn zu unterstützen, und wenn jemand nicht leidet, dann leidet er auch nicht und dann muss man ihm das nicht einreden nur weil er im Rollstuhl sitzt."
Eine Person mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann unter ihrer Behinderung leiden. Sie kann aber auch darunter leiden, dass ihre Behinderung als Leid definiert wird, denn "Leid" und "leiden" sind Begriffe, die in der heutigen westlichen Gesellschaft stark negativ besetzt sind. So könnte eine Person, deren Leben als leidvoll betrachtet wird und die daher bedauert und bemitleidet wird, sich fragen, ob ihr Dasein nicht an sich abgewertet wird.
Interviewpartner D bezeichnet es als "irrige Meinung", wenn "Leute denken, ja, wenn das Leben glückvoll ist, dann ist er lebenswert, dann hat es Qualität, und wenn es leidvoll ist dann hat es keinen Wert."
Seiner Meinung nach kann ein Leben nie nur glückvoll und nie nur leidvoll sein. "... ich denke auch, es gibt kein Glück ohne die entsprechende Portion Leid dazu."
Er beschreibt beides als Erfahrungen, die zum Leben eines Menschen dazu gehören, die wichtig sind, weil sie die Persönlichkeit eines Menschen formen, sie prägen und den Menschen erst zu der Person machen, als die er wahrgenommen wird: "... und ob nun eine starke Lust oder ein starker Schmerz da ist, das sind beides Erfahrungen, ohne die wir als Person nicht das wären was wir sind oder gar nicht das werden können, was wir dann werden oder werden könnten."
Hier scheint er folgendes ausdrücken zu wollen: Ein Mensch, der um die Möglichkeit gebracht wird, auch leidvolle Erfahrungen zu machen, dem könnte auch etwas Entscheidendes vorenthalten werden, nämlich die Möglichkeit, sich diesen Erfahrungen zu stellen, ihnen auf ganz individuelle Weise zu begegnen und dadurch seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.
Die Leiderfahrung ist für Interviewpartner D ein wichtiger Bestandteil des Lebens, ebenso wie das Erleben von Glück. Er setzt sich im Interview intensiv mit dem Leid-Begriff auseinander, erwähnt den Begriff "Glück" nur in dem Zusammenhang, dass er Leid als "die andere Seite des Glücks" bezeichnet. Für ihn sind diese beiden Begriffe nicht trennbar. Sie sind auch nicht objektivierbar. Glück oder Leid zu empfinden ist ein subjektives Empfinden, ein Zustand, der individuell wahrgenommen und bewertet wird, daher kann ein Leben auch nie nur als leidvolles oder glückliches Leben bezeichnet werden. "... die schönste Verliebtheit, die stärkste Euphorie anhand eines neuen Jobs und so weiter, ebenso wie die schlimme Depression wegen schwerer werdender Krankheit ..., das hält nie in dem Maße so stark an, dass das ein ganzes Leben, eine ganze Existenz permanent prägt..."
Eine bestimmte Gegebenheit im Leben eines Menschen, wie z. B. eine körperliche Behinderung, kann daher auch nicht einfach als Leid definiert werden:
"... es ist überhaupt nicht gegeben, dass Behinderung gleich Leid ist, ich glaub, es ist überhaupt nicht gegeben, dass bestimmte Lebensumstände mehr Leid bedeuten als andere, nur wenn man das objektivieren will ist das gegeben, aber ich glaub, man kann das nicht objektivieren."
Seiner Ansicht nach will die Mehrzahl der Menschen dieser Gesellschaft all das, was sie mit Leid gleichsetzt, ausgrenzen bzw. verdrängen, um ihre Vorstellung von einem glücklichen Leben zu verwirklichen. Sie werde aber an diesem Versuch scheitern, so Interviewpartner D, denn Glück könne nie gleichgesetzt werden mit dem Vorhandensein bestimmter, von der Gesellschaft hochgehaltener Werte, wie Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Wenn vom Wert des Lebens gesprochen wird, dann kann darunter nur das Leben in der Gesamtheit seiner Erfahrungen verstanden werden, und keine dieser Erfahrungen, die ein Mensch macht, würde es rechtfertigen, von einem wertlosen Leben zu sprechen. Daher kann auch kein Mensch einem anderen das Recht zu leben absprechen oder darüber urteilen, welches Leben "lebenswert" ist und welches nicht. Da "Glück" und "Leid" keine objektivierbaren Größen sind, kann nur die Person selbst darüber urteilen, welche ihrer gelebten Erfahrungen sie als glückvoll und welche sie als leidvoll einstufen würde.
Interviewpartner D meint auch, es sollte keiner Person die Möglichkeit genommen werden sich die Frage zu stellen, ob sie die in der Vergangenheit als leidvoll erlebten Erfahrungen gegenwärtig in gleicher Weise beurteilen würde: "Ich kenne viele Querschnittgelähmte z. B., die sagten nach ihrem Unfall, im ersten viertel-halben Jahr, wollten die nicht mehr leben ... Und dann kam aber auch eine Phase, wo sie ihre neuen Lebensumstände angenommen haben, wo sie sich arrangiert haben und wo es ihnen gut ging damit ... Ähnlich ist es mit Menschen, wenn sie alt werden. Das ist doch auch ein Prozess des Abgebens, des weniger Werdens und auch ein Prozess des mehr Werdens in einer anderen Ebene, ich will nicht sagen Wirklichkeit. Jedenfalls es steckt die Chance dazu drin ... und das, was man als leidvoll empfinden würde, also die Abnahme der Körperfunktion, der Gedächtnisfunktion, Abhängigkeit, weniger Mobilität und all das, ist in einem Sterbeprozess auch eine ganz wichtige Sache oft; Leute, die sich darum bringen, ..., die bringen sich um ganz zentrale existentielle Erfahrungen, ..."
Für ihn sind das Leben und auch der Tod keine "Dinge", über die man verfügen kann: "... und deswegen kann man da nicht darüber reden, ob es [das Leben] Qualität hat oder nicht ... und deswegen kann man auch nicht darüber verfügen, wann es denn zu Ende sein soll, wie es denn sein soll und was sein soll."
Auf die Frage nach den Begriffen "normal" und "Normalität" angesprochen meint Interviewpartner D:
"Ja, es gibt verschiedene Normalitätsfelder. Ich kann mich auch nie in meiner Gänze in diese Normalitätsfelder einbringen."
Ein Normalitätsfeld ist sein unmittelbares Umfeld. Dazu gehören seine Verwandten, Freunde, Assistenten und alle, mit denen er zusammenarbeitet, und in diesem "Normalitätsfeld" ist er als Mann mit Behinderung und Rollstuhlfahrer - wie er beschreibt - normal. Außerhalb dieses unmittelbaren Umfeldes, in der Nachbarschaft z. B., "da ist das schon nicht mehr ganz so normal, die Leute gucken, sind befremdet, ..." Je häufiger er sich jedoch in diesem Umfeld aufhält, je öfter er im nachbarschaftlichen Feld gesehen wird, mit den Leuten in Kontakt kommt, um so "normaler" wird er für sie, wie er meint. Als drittes Normalitätsfeld beschreibt er das gesellschaftliche: "... gesellschaftlich gesehen bin ich schon sehr unnormal, also pass ich nicht in das Übliche, dass man sich eben bewegt, für sich selber sorgt und ähnliches."
In diesen Normalitätsfeldern erfährt bzw. erlebt er sich also entweder als "normal" oder als "unnormal". Dies hat seiner Meinung nach sehr viel damit zu tun, ob er von den anderen, von seinen Mitmenschen, von seinem Umfeld als "üblich" oder "alltäglich" wahrgenommen wird oder nicht. Als üblich oder alltäglich kann wiederum nur wahrgenommen werden, was nicht fremd ist. Somit ist es notwendig, in Kontakt mit anderen zu kommen, in Beziehung mit ihnen zu treten, um als "normal" angenommen zu werden.
"Ja, das ist die eine Ebene, also dass Normalität hergestellt wird durch Alltäglichkeit und durch häufigen Kontakt, also dass etwas so lange unnormal bleibt, wie es keine Kontakte gibt."
Interviewpartner D veranschaulicht das eben Gesagte anhand eines Beispiels: Er hat seine Behinderung von Geburt an, doch erst ab dem Alter, in dem Babys üblicherweise zu laufen beginnen, wurde er als nicht normal wahrgenommen, wie er meint. "... und auch mit drei Jahren im Kinderwagen ist noch nicht so unnormal wie mit 13 im Rollstuhl..." Ob er sich als 13jähriger Junge im Rollstuhl als normal oder unnormal erlebte, hing davon ab, in welchem Umfeld er sich befand. In der unmittelbaren Umgebung der Sonderschule, in der körperbehinderte Kinder zum Alltag gehörten, galt er als normal, nicht jedoch außerhalb dieses "Normalitätsfeldes". Da in seiner Schulzeit in der DDR behinderte Kinder in Schulen und Heimen getrennt von nicht behinderten Kindern aufwuchsen, stellten sie kein "übliches" bzw. "alltägliches" Bild in der Gesellschaft dar.
"... und es gibt Felder, da bin ich normal, es gibt Feder, da bin ich nicht normal, da muss ich meine Normalität regeln und manchmal muss ich auch meine Unnormalität verteidigen, ... da ist es wichtig, dass das Andere anerkannt wird und der Normalisierungsprozess so läuft, dass man weiß, es gibt das Andere, und dass es beachtet wird und nicht so rum, dass das alles so in eins genommen wird."
Hier spricht er auch noch folgendes an: Es geht nicht nur darum, dass man als behinderter Mensch einbezogen wird in das, was die Gesellschaft als "normal" definiert, dass man die Möglichkeit bekommt Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, teil zu nehmen am gesellschaftlichen Leben; es geht vor allem auch darum, den behinderten oder chronisch kranken Menschen als Person wahrzunehmen. Dies bedeutet, ihn mit all seinen Bedürfnissen, Notwendigkeiten, Fähigkeiten und Wünschen wahrzunehmen, diese zu respektieren und anzuerkennen - das "Andere" anzuerkennen, wie Interviewpartner D es formuliert. Dies bedeutet aber auch, die in der Gesellschaft übliche Vorstellung von Normalität zu überdenken und sich zu fragen, was die Ursache dafür ist, dass Personen sich als anders, fremd und nicht normal erleben müssen.
Bei seinen Überlegungen zum Begriff "Herausforderung" geht Interviewpartner D auf den Begriff "Normalität" nochmals ein:
"Also so könnte ich Herausforderung verstehen, dass Menschen, die nicht in die übliche Normalität passen, trotzdem ihre Normalität leben können und in die Gesamtheit integriert sind damit." Er sieht es einmal als eine Herausforderung für die Gesellschaft an, Ausgrenzungen zu beseitigen und Bedingungen zu schaffen, die es dem behinderten Menschen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen, definiert den Begriff Herausforderung aber auch als Forderung des behinderten Menschen an die Gesellschaft, ein Leben "leben zu können das ihm entspricht". "Herausforderung besteht eher darin, dass ich fordere, dass ich es herausfordere, dass diese Gesellschaft ein Lebensraum auch für mich ist."
Er lehnt es ab, im Zusammenhang mit dem behinderten Menschen die Herausforderung darin zu sehen, dass der Mensch mit Behinderung "sozusagen sein schweres Los meistert". Er bezeichnet dies als ein gängiges "Klischee" der Gesellschaft und hält dem entgegen, dass "viele Behinderte, zumindest schwer behinderte Menschen, besonders lebensuntüchtig sind, weil viel von ihnen fern gehalten wird, weil sie besonders behütet werden und auch besonders separiert werden. Umso mehr wird´s dann als toll empfunden, wenn sie normal leben, aber das ist nicht toll, das ist eben so normal wie bei anderen Leuten auch."
Wenn ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung sich schwer tut, ein Leben zu führen, das den gängigen gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität entspricht, so kann dies seiner Ansicht nach nicht einfach darauf zurück geführt werden, dass eine körperliche Einschränkung häufig ein gewisses Angewiesensein auf die Hilfe anderer bedeutet. Für Interviewpartner D sind es auch gesellschaftliche Gegebenheiten, wie fehlende Integration und Einrichtungen, in denen behinderte Personen getrennt von nicht behinderten leben, die eine Ausgrenzung vom gesellschaftlichen Leben bedeuten und den behinderten Menschen zusätzlich einschränken bzw. - wie er es nennt - "lebensuntüchtig" machen. Dadurch können bestehende Vorurteile, wie z. B. das Bild vom behinderten Menschen als das einer hilfsbedürftigen, unmündigen Person, nur schwer abgebaut werden, und dies ist seiner Meinung nach auch ein Grund dafür, dass es als besondere "Leistung" angesehen wird, wenn ein Mensch mit Behinderung ein in die Gesellschaft integriertes Leben führt.
Diese Problematik wird von Interviewpartner D auch angesprochen, als er sich zu den Begriffen "behindert sein - behindert werden" äußert:
"Ich denke, es gibt beides - also - ich habe durch bestimmte körperliche Einschränkungen tatsächlich Einschränkungen und die werde ich auch nie, nie in Gänze ausgleichen können... Auf der anderen Seite, eine größere Integration wäre schon gut... ich denke auch, dass Behindert-sein durch bestimmte körperliche Gegebenheiten bei weitem nicht so groß ist oder sein müsste, wenn es noch mehr Ausgleiche gäbe."
Ein solcher "Ausgleich", wie er es bezeichnet, wäre z. B. in einem sozialpolitischen Umfeld gegeben, in dem jede behinderte Person die Möglichkeit hätte, ihr Leben unterstützt von persönlicher Assistenz zu gestalten: "Also ich denke, ich erhalte in einer ziemlich optimalen Weise Assistenz. Aber es gibt tausend andere in meiner Lage, die das nicht erhalten und die deshalb wesentlich mehr behindert werden."
Eine Behinderung bzw. fortschreitende Erkrankung stellt eine körperliche Einschränkung dar und mit dieser "zurecht zu kommen" ist - wie er meint - eine "persönliche Anforderung" an Menschen, die mit einer Behinderung leben: "also nicht, dass man die [Einschränkung] per se frisst und sich arrangiert, aber dass man guckt was geht und das, was nicht geht, in irgend einer Weise so in sein Leben integriert, dass man selbst damit klar kommt und andere auch."
Dies könnte heißen: Eine Behinderung als Teil einer Persönlichkeit wahrnehmen und annehmen, sie nicht leugnen, sondern integrieren bzw. auch die Forderung stellen, sie integrieren zu können in das (persönliche und gesellschaftliche) Leben.
Um es nochmals zu betonen: Er spricht hier nicht von einer besonderen Herausforderung, der sich ein behinderter oder chronisch kranker Mensch stellen muss, sondern von einer persönlichen Anforderung an den Menschen mit Behinderung, sich mit der Gegebenheit seiner körperlichen Einschränkung auseinander zu setzen.
Aber das Empfinden "behindert zu sein" ist nicht nur ein rein subjektives, sondern in großem Ausmaß auch vom gesellschaftlichen Umfeld abhängig. Es ist abhängig davon, auf welche Weise man wahrgenommen wird - als mündiger Bürger der Gesellschaft oder als hilfsbedürftige unmündige Person - und es ist abhängig davon, in welchem Ausmaß man in das gesellschaftliche Leben integriert ist - ob Bedingungen herrschen, die den Zugang zum öffentlichen Leben erschweren oder Möglichkeiten gegeben sind, seine persönlichen Vorstellungen zu verwirklichen, unabhängig davon, ob körperliche Einschränkungen gegeben sind oder nicht.
"Und ich denke, es gibt eine gesellschaftliche Anforderung, dass die Hilfen, die nötig sind, gegeben werden, und zwar auf eine Art und Weise, die es demjenigen, der sie erhält, ermöglichen sich zu verwirklichen."
Zu Ende des Interviews geht er nochmals auf "Behinderung" als gesellschaftliches Konstrukt ein:
"... also das ist gut zu wissen - die Idee, dass das Konstrukt ganz in unserer Hand liegt, das denk ich wieder nicht - aber das zu dekonstruieren ist schon immer eine schöne Angelegenheit oder eine wichtige Sache, dass man also die Grenzziehung nicht verstärkt, sondern eher aufweicht ..."
Geht man davon aus, dass alles was mit dem Begriff "Behinderung" in Zusammenhang gebracht wird - also dass Vorstellungen, Meinungen und Werturteile über Behinderung - Konstruktionen der Gesellschaft sind, sich aus der Gesellschaft heraus entwickelt haben, so ist auch die Möglichkeit gegeben diese zu ändern. Dies meint Interviewpartner D, wenn er von "dekonstruieren" spricht. Er bezeichnet die Dekonstruktion von gesellschaftlichen Werturteilen als wichtige Sache und gibt zu verstehen, dass es auch Aufgabe der behinderten Person ist, an einer Änderung des Konstruktes "Behinderung" mitzuwirken. Dies bedeutet, Meinungen, Vorstellungen und Wertungen der Gesellschaft bezogen auf Behinderung nicht als gegeben zu nehmen, sondern zu reflektieren, wodurch bzw. warum diese für den behinderten Menschen verletzend oder ausgrenzend sein können.
Eine Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Behinderung ist nicht nur für den behinderten Menschen wichtig, sondern für eine Gesellschaft allgemein von Bedeutung, und die Tendenz zu einer solchen Auseinandersetzung ist - nach Meinung von Interviewpartner D - auch gegeben: "... also die Tendenz wird davon unterstützt, dass viel mehr Leute für sich ... realisieren, dass in ihrer persönlichen Biographie Behinderung sehr wohl eine ganz realistische Möglichkeit ist. Also durch höheres Alter und erweiterte medizinische Möglichkeiten ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie zum Ende ihres Lebens oder eben auch schon viel eher ... behindert werden können ..."
Dass Menschen sich damit auseinandersetzen, das zeigt sich für ihn auch in der aktuellen Sterbehilfediskussion. Er hat im Interview deutlich gemacht, dass er es für falsch hält, wenn eine Gesellschaft versucht Krankheit und Behinderung dadurch zu begegnen, dass sie über Möglichkeiten diskutiert diese "zu eliminieren".
Eine andere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Begriff "Behinderung" - und die für ihn einzig richtige - ist, sich bewusst zu machen, ... dass man die Nachteile einer Behinderung ausgleichen kann und dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist."
Behinderung als gesellschaftliches Konstrukt birgt die Möglichkeit in sich, Menschen zusätzlich zu "behindern". Interviewpartner D bezeichnet es als "gesellschaftliche Aufgabe", dem entgegenzuwirken. Dabei spielt das Konzept der persönlichen Assistenz, wie er meint, eine wichtige Rolle: "Der Assistenzgedanke ist der, dass du die Person bleibst, die die Herrschaft über das eigene Leben behält ... das, find ich, ist eine ganz wichtige Idee und ich denke auch, die wird sich trotz aller sozialpolitischen Verschärfungen weiter durchsetzen. ... dass die Mittel in die Hände derer kommen, die die Hilfe brauchen..."
Er organisiert sein Leben mit Hilfe von persönlichen Assistenten und ist als körperbehinderter Mann, als "Assistenznehmer", auch gleichzeitig Arbeitgeber, das heißt: Er ist verantwortlich für die Vergabe der Assistenzarbeit und das Managen seiner Assistenten. So beschreibt er aus eigener Erfahrung eine Möglichkeit, wie eine gegebene körperliche Einschränkung im Alltag kompensiert werden kann.
Interviewpartner E hat, wie er berichtet, eine spastische Lähmung auf Grund eines Sauerstoffmangels bei der Geburt und ist daher auch zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen. Er ist bei seinen Eltern aufgewachsen, zusammen mit einem nicht behinderten Bruder, und besuchte eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder. Die Jahre, die er bei seinen Eltern und seinem Bruder lebte, bezeichnet er als "ganz schöne Jahre". Er bewertet also wie Interviewpartner B die Tatsache, dass er als behindertes Kind bei seinen Eltern aufwachsen konnte, als "schön".
Interviewpartner E schloss die Schulausbildung mit der mittleren Reife ab. "... und dann war ich drei Jahre zur Berufsausbildung im ... Reha-Zentrum [Rehabilitationszentrum] für überwiegend Querschnittsgelähmte, aber mich haben sie da auch aufgenommen, da wurde ich zum Bürokaufmann ausgebildet ..." Mit den Worten "aber mich haben sie da auch aufgenommen" scheint er darauf hinweisen zu wollen, dass in Rehabilitationszentren vor allem Menschen aufgenommen werden, die ihre Behinderung auf Grund eines Unfalls haben, er jedoch seit seiner Geburt behindert ist.
Interviewpartner E arbeitete ca. 15 Jahre im Betrieb seiner Eltern, war verheiratet und hat aus dieser Ehe drei Söhne. Die Ehe wurde geschieden, seit der Scheidung lebt er als Rentner alleine und wird, wie er erklärt, "von dem Pflegedienst mit Assistenz versorgt."
"... ich hab ein paar feste Termine in der Woche, so regelmäßig Krankengymnastik und dass ich auch Logopädie habe, das ist mir sehr wichtig, dass ich auch Fremden gegenüber verständlich bin, dass mich jeder gut verstehen kann, und dann bin ich ab und zu, also auch regelmäßig, in psychologischer Beratung ..." Er betont, wie wichtig es ihm ist, sich anderen verständlich machen zu können, mit seinem Umfeld kommunizieren zu können. Ein entscheidender Teil der menschlichen Kommunikation ist die verbale Kommunikation. Da der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in der Gesellschaft ein hoher Stellenwert eingeräumt wird, ist seine sprachliche Einschränkung womöglich auch jener Bereich, in dem er die stärkste Ausgrenzung erfährt. Am Ende des Interviews spricht er in seiner Antwort auf die Frage nach Situationen, die ihm das Gefühl vermittelten "anders" zu sein, diese Problematik an; ein Teil seiner Antwort soll hier vorweg genommen werden: "Ja, das ist im Bereich meiner Sprache, wo Menschen reagieren und einfach nur mir antworten damit sie antworten, aber ich weiß genau, aus dem wie sie antworten und was sie antworten, dass sie mich nicht verstanden haben und ihnen das auch zu unangenehm ist, nachzufragen, was ich jetzt gesagt habe."
Er erwähnt, dass er in regelmäßiger psychologischer Beratung ist, führt dies aber nicht näher aus. Seine im Anschluss wiedergegebenen Äußerungen zu den Begriffen "Glück" "Leid" oder "Zukunft" könnten die Vermutung aufkommen lassen, dass er sich zum Zeitpunkt des Interviews in einer bedrückten Stimmungslage befand. Die Ursachen für eine depressive Verstimmung können vielfältig sein. Er wurde nicht konkret dazu befragt und daher kann hier auch nicht näher darauf eingegangen werden.
Zur Frage nach der Gestaltung seines Alltags führt er noch an, dass er täglich die Zeitung liest, gerne am Computer schreibt und regelmäßig Kino-, Theater- oder Konzertbesuche unternimmt. "... mittlerweile bin ich dran, ... , einen Roman zu schreiben, aber mal gucken, was daraus wird ..."
Er hat also alltägliche Interessen, denen er nachgeht, und beschäftigt sich mit Zukunftsgedanken in dem Sinne, dass er den Wunsch äußert, einen Roman zu verfassen. Diese Aussagen lassen sich wiederum schwer mit einer depressiven Verstimmung in Einklang bringen.
Als er jedoch direkt nach Wünschen oder Plänen für die Zukunft angesprochen wird, fällt seine Antwort wieder in einer Weise aus, die auf eine gedrückte Stimmungslage hinweisen könnte:
"Ach, vor der Zukunft hab ich sowieso ziemlich Angst. Ich denk mir auch, es reicht jetzt auch was ich gelebt habe, will gar nicht so viel älter werden, ich hab halt Angst, dass ich nicht mehr das an Versorgung bekomme, was ich brauche."
Hier spricht er eine konkrete Existenzangst an, die damit in Zusammenhang steht, dass er als Mann mit Behinderung auf Hilfe im Alltag angewiesen ist. Diese Hilfe in Form von persönlicher Assistenz wird aus öffentlichen Geldern finanziert, und er befürchtet, durch Sparmaßnahmen im sozialen Bereich die Unterstützung im bisherigen Ausmaß nicht mehr zu erhalten. Er scheint eine starke Abhängigkeit von der Gesellschaft zu verspüren, die ihm möglicherweise die notwendige Versorgung nicht mehr geben will oder kann. Es hängt also von gesellschaftspolitischen Bedingungen ab, ob er das Leben, das er in der jetzigen Weise gestaltet, weiter führen kann, und dieser Gedanke erzeugt in ihm ein starkes Gefühl der Hilflosigkeit. So könnte seine Äußerung "nicht älter werden zu wollen" auch verstanden werden.
Als er nach Problemen gefragt wird, die in Zusammenhang mit seiner Behinderung stehen könnten, meint er:
"Nein, die gibt es nicht. Ich bin, wie schon erzählt, von Geburt an behindert und ich kenn es gar nicht anders."
Für Interviewpartner E stellt seine Behinderung keine Beeinträchtigung dar, denn er weiß sie zu kompensieren, er hat sie "von Geburt an und kennt es nicht anders".
Seine Angst vor der Zukunft und damit vor dem älter werden bringt er also nicht unmittelbar in Verbindung mit seinen körperlichen Einschränkungen. Nicht seine eingeschränkte Mobilität und Sprachfähigkeit machen ihn hilflos, sondern die bestehenden sozialpolitischen Gegebenheiten.
In seinen Definitionen zu "Lebensqualität", "Leid" oder "Herausforderung" nimmt er immer Bezug zu seiner Behinderung:
"Lebensqualität, das ist, ja wenn ich mein Leben führen kann, wie ich es mir vorstelle. Dazu gehören funktionierende Hilfsmittel, also der E-Rolli [Elektrorollstuhl], wenn der kaputt ist und ich bin auf einen Faltschieberollstuhl angewiesen, das ist schon für mich eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität." Auch eine ausreichende Unterstützung durch persönliche Assistenz bedeutet für ihn "Lebensqualität": "... also wenn ich nicht wüsste, wo ich Hilfe herkriege die ich brauche, damit ich so leben kann wie ich mir das vorstelle, das ist dann auch eine Einschränkung der Lebensqualität." Sein Leben besitzt also so lange Qualität, so lange er Hilfsmittel und Assistenzstunden in einem Ausmaß zur Verfügung hat, das ihm erlaubt, seine gegebene körperliche Behinderung zu kompensieren und den Alltag in gewohnter Weise zu gestalten. Denn ein Elektrorollstuhl ermöglicht es ihm, sich selbst fortbewegen zu können, und mit Hilfe seiner Assistenten ist es ihm möglich, das Theater oder Kino aufzusuchen.
Er hat jedoch Angst, diese Möglichkeiten in Zukunft nicht mehr zu haben und damit an Lebensqualität zu verlieren.
Dies würde für ihn dann auch bedeuten, leiden zu müssen:
"Leid, ja Leid ist eine Unfreiheit zu haben. Wenn ich eingeschränkt bin in meiner Mobilität, ich hab es ja mit dem Rollstuhl gesagt, also wenn der kaputt ist, wenn ich kein Geld mehr habe, wenn ich krank bin z. B. und die Therapie nicht mehr bekomme, die nötig wäre. Also das ist eine Einschränkung für mich und das ist auch Leid. Das ist Leid, das bewusst hervorgerufen wird."
Er selbst erwähnt den Begriff "Einschränkung" nie im Zusammenhang mit seiner körperlichen Behinderung, sondern empfindet ein "Eingeschränkt-sein" erst dann, wenn die Mittel fehlen, um seine Behinderung zu kompensieren. Dann ist er tatsächlich eingeschränkt in seiner Mobilität, eingeschränkt im Empfinden von Lebensqualität, erst dann ist er "unfrei" und leidet. Seinem Umfeld scheint jedoch nicht bewusst zu sein, dass er nicht leidet, weil er zur Fortbewegung einen Rollstuhl benötigt, sondern dass er leidet, wenn ihm die Möglichkeit zur Fortbewegung im Rollstuhl genommen wird. Dieses Leiden ist dann für ihn ein von der Gesellschaft erzeugtes Leiden.
Zum Begriff "Glück" äußert er sich in einem einzigen Satz:
"Glück ist eine Illusion, was es im Grunde gar nicht gibt."
Seiner Meinung nach ist es ihm möglich, ein Leben zu führen, das frei von Leid ist, das ihm das Gefühl gibt, Lebensqualität zu besitzen und das - wie er später noch ausführt - ihn täglich vor Herausforderungen stellen kann. Er zweifelt jedoch an, ob es möglich ist, ein glückliches Leben zu führen. Glück ist, wie er meint, eine Illusion. Seine Aussage zum Begriff "Glück" ist sehr allgemein gehalten. Er spricht nicht davon, dass sein Leben unglücklich verläuft, sondern bezeichnet allgemein Glück als etwas, "was es im Grunde gar nicht gibt."
Bei seiner Umschreibung des Begriffes "Herausforderung" nimmt er wieder unmittelbar Bezug zu seinen vorangegangenen Äußerungen:
"Herausforderung, da kann ich Ihnen auch ein Beispiel sagen, ..., ich hab jetzt 8 Stunden am Tag Assistenz, natürlich kann ich nicht ausschließen, dass ich in den 16 Stunden, in denen niemand bei mir ist, dass ich da überhaupt keine Hilfe brauche... Das ist z. B. für mich eine Herausforderung, das trotzdem zu schaffen."
Wie bereits erwähnt, organisiert er seinen Alltag mit Hilfe von persönlicher Assistenz. Mit den ihm zur Verfügung stehenden 8 Assistenzstunden täglich kann er, wie er meint, ein Leben führen, wie er es sich vorstellt. Die 8 Stunden Assistenz am Tag stellen jedoch auch eine Grenze dar: Weniger Unterstützung würde für ihn eine Einbuße seiner Lebensqualität und sogar Leid bedeuten, mit diesen 8 Stunden an täglicher Hilfe auszukommen, ist für ihn eine Herausforderung.
Zum Begriff "Normalität" äußert sich Interviewpartner E mit folgenden Worten:
"Wenn ich den Begriff höre, dann werde ich sowieso wütend, weil normal gibt es nicht, weil wo will man das festmachen? Woran will man das festmachen?"
Der Begriff "Normalität" erzeugt in ihm, ebenso wie der Begriff "Glück" negative Emotionen. Für ihn haben beide Begriffe - "Glück" und "Normalität" - keine Bedeutung. Beides sind jedoch Worte, die in der Gesellschaft häufig genannt werden und positiv besetzt sind. Dass er diese beiden Begriffe als nicht gegeben definiert, kann sicherlich unterschiedlich begründet werden, vor allem werden seine bisherigen Lebenserfahrungen mit eine Rolle spielen. Er will nicht näher darauf eingehen. Was hier jedoch auffällt ist, dass er auch nicht von "seiner Normalität" spricht, wie es die anderen Interviewpartner getan haben, also keine individuelle Beschreibung dieses Begriffes wiedergibt, sondern das Wort an sich ablehnt.
Er stellt die Frage, "woran man Normalität festmachen" solle, und scheint damit folgendes ausdrücken zu wollen: Wenn man davon ausgeht, dass die Vorstellung darüber, was normal ist und was davon abweicht, von der Gesellschaft vorgegeben ist, so kann gesagt werden: Die Gesellschaft "konstruiert" Normalität. Interviewpartner D hat in vorangegangenen Interview den Begriff "konstruieren" ebenfalls genannt. Er sprach davon, dass die Gesellschaft "Behinderung" konstruiere. Interviewpartner E stellt nun die Frage, nach welchen Kriterien "Normalität" konstruiert werde: Woran will eine Gesellschaft Normalität, wie er es bezeichnet, "festmachen"? Seiner Meinung nach ist dies nicht möglich. Sein Umfeld bzw. die Gesellschaft hat jedoch Normen und Normalität "geschaffen" und er hat vielleicht die Erfahrung gemacht, dieser Norm nicht zu entsprechen, aus der Normalität seines Umfeldes herauszufallen. Dies könnte ein Grund für ihn sein, Wut zu empfinden, wenn er das Wort "Normalität" hört.
Nach den Begriffen "behindert sein - behindert werden" befragt, meint er:
"Ja ich bin natürlich behindert, das ist einfach ein Zustand. Viele die mich kennen, sagen auch, in meinen Augen bist du gar nicht behindert, du hast nur einen Rollstuhl, weil du nicht laufen kannst, und das ist für mich eigentlich eine Beleidigung ..." Er erklärt, dass er seine Behinderung als gegeben annimmt, er verlangt aber auch, dass sein Umfeld ihn in gleicher Weise als den respektiert der er ist, und damit auch seine Behinderung annimmt und respektiert. "Ich bin ganz gerne so wie ich bin, natürlich Sachen, die einem persönlich nicht gefallen, die gibt es immer, aber die gibt es ja bei den Nichtbehinderten auch, insofern sind wir ja da wieder gleich was die persönliche Eitelkeit angeht."
Er möchte als Rollstuhlfahrer, als Mann mit Behinderung, wahrgenommen und angenommen werden. Äußerungen, wie "im Grunde bist du nicht behindert" empfindet er als beleidigend, denn damit wird ihm etwas abgesprochen, das Teil seiner Person ist, seine Person mit geprägt hat. Für ihn sind solche Aussagen mit einer Wertung verbunden: Wenn seine Behinderung von anderen negiert wird, so kann daraus die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sein "Behindert-sein" negativ gesehen wird. Da jedoch seine Behinderung Teil seines persönlichen Seins ist und er - wie er sagt - "so geboren ist" und auch so angenommen werden möchte, erfährt er durch das Negieren seiner Behinderung eine Abwertung seiner Person. "... also ich bin behindert, ich bin so geboren und ich möchte auch nicht behindert werden. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ..., behindert werden, ja, ich denke, das geht so in den Bereich, wenn Hilfsmittel nicht funktionieren, dass ich damit behindert werde."
Zu Beginn des Interviews hat Interviewpartner E erklärt, dass ihm die Tatsache eine Behinderung zu haben, keine Probleme bereite. Problematisch wird es für ihn, wenn ihm Möglichkeiten und Mittel genommen werden, seine Behinderung und damit seine körperliche Einschränkung zu kompensieren. Ist dies der Fall, dann "wird er behindert", wie er meint, und bekommt das Gefühl vermittelt, eingeschränkt zu sein.
Er hat die Frage, ob es Probleme in seinem Alltag gebe, die er mit seiner Behinderung in Verbindung bringe, verneint. Als er jedoch nach Situationen gefragt wird, die ihm das Gefühl vermittelten "anders zu sein", meint er:
"Beispiele gibt es ja immer wieder, konkret fällt mir jetzt keines ein, ja aber die gibt es immer wieder."
Vor allem auf Grund seiner Sprachbehinderung erfährt er immer wieder Situationen, in denen ihm Unverständnis und Ablehnung entgegengebracht wird. Denn seine Art zu sprechen bringt seine Zuhörer in Verlegenheit, macht sie unsicher, da er sich in einer Weise artikuliert, die es notwendig macht, "genau zuzuhören" und öfter nachzufragen: "... Wenn man sich umhört, wie sauber zur Zeit überall gesprochen wird, da wird man ja blöd angeguckt, wenn man Dialekt spricht und so. Ja die Behinderung meiner Sprache ist, wenn Sie so wollen, ja auch ein Dialekt, das ist jetzt zwar nicht landschaftlich bezogen, aber auf meine Behinderung, und da ist es schon bisschen arg müßig, einfach schwierig, noch mal genau zuzuhören. In unserer heutigen Gesellschaft da muss alles schön sein, da muss alles schnell gehen, da darf nicht angeeckt werden."
Hier wird die scheinbare Gegensätzlichkeit seiner Aussagen, nämlich einerseits kein Problem mit seiner Behinderung zu haben, jedoch andererseits Situationen der Ausgrenzung zu empfinden, verstehbar: Seine Geh- und Sprachbehinderung ist etwas, das ihm vertraut ist, sie ist Teil seiner Persönlichkeit. Er hat sich mit seiner Behinderung in vielfältiger Weise erfahren und erlebt und müsste sein ganzes bisheriges Leben und auch sich selbst ablehnen, würde er sein "Behindert-sein" als ein Problem an sich beurteilen. Er bezeichnet seine Art zu Sprechen als "Dialekt", womit er auch deutlich macht, dass eine körperliche Gegebenheit auf sehr vielfältige und unterschiedliche Weise wahrgenommen und nie einer einheitlichen objektivierbaren Beurteilung unterzogen werden kann. Daher erfährt er Probleme auch nur in Kontakt mit seiner Umwelt, z. B. dann, wenn er auf Grund seiner Sprechweise von anderen missverstanden wird und ihr Verhalten ihm gegenüber als Unsicherheit und Ablehnung empfindet. Er wird von anderen bewertet und da, wie er meint, "in der heutigen Gesellschaft alles schön sein und schnell gehen muss", wird sein langsames und ungewöhnliches Sprechen von seinen Zuhörern abgewertet, als Problem beurteilt. Somit wird seine Behinderung ein Problem für andere und auf diese Weise auch ein Problem für ihn, da er sich mit seinem Umfeld und den Meinungen, Äußerungen und Bewertungen, die ihm entgegen gebracht werden, auseinandersetzen muss.
Interviewpartner F ist Rollstuhlfahrer auf Grund einer spastischen Lähmung und hat, wie er berichtet, die ersten 20 Jahre seines Lebens in einem Heim für behinderte Kinder verbracht. "Und da war ich ... 20 Jahre hab ich da gelebt ... mit Erziehern, so richtig wie man das kennt halt." Durch diesen Satz setzt er voraus, es müsse allgemein bekannt sein, wie das Heranwachsen in einem Heim abläuft, und auch, dass es in der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, üblich ist, dass ein Kind mit Behinderung in einem Heim aufwächst.
Er hat 12 Jahre lang bei einem Fernsehsender gearbeitet, ist jedoch seit kurzem arbeitslos, da die Firma den Standort gewechselt hat und er, um dort weiterhin zu arbeiten, ebenfalls seinen Wohnort hätte wechseln müssen.
Seinen Alltag gestaltet er, wie er beschreibt, in üblicher Weise: "... ich mach eigentlich das, was jeder macht, einkaufen gehen, ausgehen, meine Freundin besuchen, so halt ... Ich mach nichts Welt bewegendes."
Auf Pläne für die Zukunft angesprochen meint er:
"Ich will an die Musikschule. Aber andere Pläne hab ich nicht. Also ich mach Musik, und ich will das richtig lernen, ich mach das jetzt autodidaktisch, schon sein 16 Jahren ..."
Die Fragen nach seinem gegenwärtigen Leben und nach Zukunftsplänen beantwortet er ohne in irgend einer Weise Bezug zu seiner Behinderung zu nehmen. Weder erwähnt er die notwendige Gestaltung des Alltags mit Hilfe von persönlicher Assistenz, wie es z. B. Interviewpartnerinnen A und C getan haben, noch stehen seine Äußerungen zur Zukunft in unmittelbaren Zusammenhang mit seiner körperlichen Behinderung, wie dies bei Interviewpartner D und E, oder Interviewpartnerin C der Fall war.
Erst als er nach Problemen im Alltag gefragt wird, die er mit seiner Behinderung in Zusammenhang bringt, geht er auf sein Leben mit persönlicher Assistenz ein und nimmt dabei in sehr positiver Weise Bezug:
"... also ich hab die selben Probleme wie du, glaub ich, mit der Umwelt auch ..., aber sonst eigentlich nicht, weil für alles andere hab ich meine Assistenten... Und ich hab ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Assistenten. Einige davon würde ich sogar zu meinen Freunden zählen und darum hab ich eigentlich keine großen Probleme damit."
Wieder ist es nicht eine körperliche Einschränkung an sich, die als problematisch bezeichnet wird, sondern die Probleme ergeben sich für Interviewpartner F - so wie für die meisten der anderen Interviewpartner auch - aus der Interaktion mit seiner Umwelt: "... ich hab halt die Probleme, dass ich "angemacht" werde, wie jeder andere auch. Oder dass man mich irgendwo nicht rein lässt, oder dass ein Klo zu eng ist... Aber sonst hab ich eigentlich nichts wo ich sagen würde, da macht mir meine Behinderung große Probleme." Die Tatsache einer Behinderung kann nie einer objektiven Beurteilung unterzogen werden, da "eine Behinderung haben" immer bezogen ist auf die Person, die diese Behinderung hat. Daher kann eine Behinderung auch nicht einfach als "ein Problem" definiert werden. Interviewpartner F macht dies deutlich, in dem er erklärt, dass es zwar Bereiche gibt, wo sein Leben als Rollstuhlfahrer für ihn zum Problem werden kann, dass es aber auch Bereiche gibt, wo es möglich ist zu verhindern, dass eine Behinderung überhaupt zu einem Problem wird. Wenn er davon spricht, dass er das Problem hat "angemacht" zu werden, so drückt er damit aus, dass er immer wieder auf Verhaltensweisen stößt, die ihm das Gefühl vermitteln, als Rollstuhlfahrer ausgegrenzt bzw. nicht angenommen zu werden. Es nervt ihn, wie er meint, wenn er "ständig danach gefragt wird", warum er im Rollstuhl sitze.
Für ihn ist ein wichtiger Aspekt, der verhindert, dass er seine Behinderung - vor allem aber seine Mobilitätseinschränkung - als Problem erlebt, die Möglichkeit, Hilfe durch persönliche Assistenz in Anspruch nehmen zu können.
Dies wird auch deutlich, als er sich zum Begriff "Lebensqualität" äußert:
"Also Lebensqualität, dass man die Dinge tun kann, die man tun will ... Und so lange ich ... wenn ich auf das Amt gehen kann, wenn ich muss, wenn ich in die Kneipe gehen kann, wenn ich will, wenn ich meine Freundin besuchen kann, wann ich will... dann hab ich ein gutes Leben. Und wenn das halt nicht ist, weil ich keine gute Assistenz hab, dann habe ich keine gute Lebensqualität. " Er bezeichnet sein Leben als ein "gutes Leben", so lange er nicht daran gehindert wird, seinen Alltag in gewohnter Weise zu gestalten. Dazu benötigt er aber die Hilfe seiner Assistenten. Wenn er, wie er erklärt, "Probleme mit seinen Assistenten hat", dann wird sein Leben schwer. Damit drückt er wiederum aus, dass er Schwierigkeiten in seinem Leben nicht unmittelbar auf seine Behinderung bezieht, sondern auf fehlende Möglichkeiten die Behinderung in optimaler Weise zu kompensieren.
"Glück" definiert er als einen kurzen Moment der Freude:
"Ich bin, glaub ich, nicht sehr glücklich. Ich bin eher zufrieden, weil Glück ist ja immer ein ganz kurzer Moment, ein schönes Konzert, ein nettes Wort von meiner Freundin oder wenn ich mich mit meinem Assistenten gut verstanden habe... also ich kann nie sagen, dass mich eine bestimmte Sache immer glücklich macht..."
Ebenso wie "Glück" ist auch "Leid" für ihn kein Zustand, der permanent andauern kann. Er bezeichnet sein Leben als Rollstuhlfahrer nicht als ein "leidvolles Leben", weist aber dennoch darauf hin, dass seine körperliche Einschränkung ihn in Situationen bringen kann, in denen er leidet: Wenn er z. B. Schmerzen verspürt, weil er vergessen hat seine Medikamente zu nehmen. Oder wenn er sich immer wieder rechtfertigen muss, warum er Unterstützung in einem Ausmaß benötigt, wie er sie derzeit bekommt: "... daran merk ich also schon meine Behinderung, dass ich mich immer mit irgend jemanden unterhalten muss, der mich nicht kennt, der gar nicht weiß ... z. B. hatte ich neulich meine Begutachtung hier, ..., die hat mir dann meine Bewilligung gelassen. Aber ich muss halt jedes Mal neu diskutieren, kennst du, glaub ich, auch, ob der Bedarf, den man hat, jetzt bleiben kann oder darf."
Er kann seine Behinderung auch als leidvoll erfahren, allerdings ist es dann häufig ein Leiden, das von anderen hervorgerufen wird, weil seine Bedürfnisse als Mann mit Behinderung nicht entsprechend wahrgenommen werden und er dadurch in die Situation des "Bedürftigen", des Bittstellers gebracht wird: "... ich leide darunter, dass für alles, das man braucht, ich bei irgend einem Amt erst mal eine Ablehnung kriegen muss, damit ein anderes Amt das dann wieder macht, oder auch nicht ... da leide ich darunter und das verkompliziert mein Leben."
Interviewpartner F ist auf Grund eines Geburtsfehlers behindert. Seiner Meinung nach wäre die "Allgemeinheit" verpflichtet ihm die nötige Unterstützung zu gewähren, denn "hätte die Hebamme, oder es war ein Arzt, ein bisschen besser aufgepasst, wäre ich nicht behindert."
Er spricht in dem Zusammenhang auch davon, dass ein Arzt "sein Leben verpfuscht hätte": "also, verpfuscht im Sinne von, ich kann halt nicht auf Bäume klettern, so, oder ich kann halt kein Auto fahren, ich brauch halt immer jemanden, der mich herum fährt ... ja, und das ärgert mich und da leid ich auch darunter." Hier zeigt sich eine gewisse Ambivalenz in seinen Aussagen, die auch bei anderen Interviewpartnern gegeben war: Er bezeichnet sein Leben einerseits als gut, unproblematisch und zufriedenstellend, andererseits aber auch als "verpfuscht" da er "nicht auf Bäume klettern oder Auto fahren kann" bzw. in vielen Bereichen auf die Hilfe anderer angewiesen ist.
Die Frage "Was wäre, wenn ich nicht behindert wäre?" ist sicherlich eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Sie ist aber nicht beantwortbar und auch in einem gewissen Sinne problematisch, da sie an Gegebenheiten vorbei gestellt wird. Die Frage "Was ist notwendig, um die Gegebenheit meiner Behinderung nicht zu einem Problem werden zu lassen?" lässt Antwortmöglichkeiten zu, ist also beantwortbar und führt dazu, Behinderung nicht als Problem wahrzunehmen. Auf diese Weise könnte die zeitweilige Gegensätzlichkeit in den Aussagen auch erklärt werden.
Die Beantwortung der zweiten Frage definiert Interviewpartner F dann auch als "seine Herausforderung":
"Was ist eine Herausforderung? Alles das kriegen, was einem zusteht. Eine Herausforderung ist für mich immer das Optimum zu bekommen und nicht zu sagen, es geht auch z. B. mit einer Stunde [Assistenz] weniger. Geht nicht! Das ist eine Herausforderung ... Ja und mein Team so gut zusammen zu halten, dass wir miteinander zufrieden sind, sowohl die Leute, die für mich arbeiten, als auch ich ... und dass alles so läuft, das sehe ich als Herausforderung an."
Zu den Begriffen "normal" und "Normalität" äußert er sich wie folgt:
"[Es] ist immer ein Blickwinkel... wenn ich draußen herum fahre und da ist dann eine Treppe, dann ist das wohl normal, weil 95 % der Bevölkerung können die halt nehmen. Insofern ist das halt normal. Das ist eine reine Definitionssache, was normal ist."
"Normalität" ist für ihn all das, was eine Mehrzahl in der Gesellschaft als normal definiert bzw. konstruiert. Als Person mit Behinderung macht er die Erfahrung, dass er häufig aus dieser "Normalität" herausfällt, also zu jener Minderheit gehört, die nicht der Normalität entspricht. Dadurch stößt er immer wieder auf Probleme, wenn er sich im gesellschaftlichen Umfeld bewegt, z. B. auf bauliche Barrieren. Dies ärgert ihn zwar, er muss es aber, wie er meint, mehr oder weniger hinnehmen, denn würde er sich ständig darüber aufregen, würde es ihn psychisch belasten. "... man kann überall einfordern, dass noch was anders sein kann. [Das] kann man sein ganzes Leben lang machen und dann ist man traurig und depressiv und das will ich nicht und darum nehme ich das hin ... mehr oder weniger."
Hier spricht er etwas an, das aus seinem Interview immer wieder heraus zu hören ist:
Sein Umfeld definiert, was normal ist - normal ist z. B. eine Treppe benutzen zu können - und da er nicht in dieses Normalitätsbild passt, ergeben sich für ihn Probleme. Würde er sich ständig mit diesen Problemen auseinander setzten, würde dies bedeuten, sich ständig damit zu konfrontieren, dass eine Mehrzahl in der Gesellschaft ihn als "nicht normal" und seine Behinderung als problematisch wahrnimmt. Dies würde ihn, wie er meint, traurig und depressiv machen. Er selbst nimmt sich als "normal" wahr und sieht in seiner Behinderung kein Problem.
Dies geht auch aus seinen Umschreibungen der Begriffe "behindert sein - behindert werden" hervor.
"Ich sehe mich nicht als behindert, weil ich bin so auf die Welt gekommen ..., das ist wie ich bin und das sind meine Voraussetzungen. Aber ich frage mich nicht jeden Tag, ob das behindert ist." Seine Behinderung wird ihm erst "bewusst gemacht", wenn andere ihm durch ihr Verhalten oder durch Äußerungen mitteilen, dass sie ihn als "anders" erleben. "... dann fang ich an, mich damit zu beschäftigen und das behindert mich vielleicht."
Der "Blick des Anderen" kann also dazu führen, dass er seine Person, sein "So-sein" in Frage stellt. Er meint, seine Behinderung falle ihm immer nur dann auf, wenn er "durch irgend was oder irgend jemanden behindert werde".
Und behindert wird er dann, wenn ihm das Gefühl vermittelt wird, nicht dazu zu gehören, nicht dem Normalbild zu entsprechen. Das kann z. B. passieren, wenn er mit seiner Freundin unterwegs ist, wie er erklärt: "... dann wird immer gesagt, der ist ja behindert, was gibst du dich mit dem ab?"
Er versucht, solche Situationen zu meiden, in denen er das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören. "Also Leute, die mich nicht ernst nehmen, da will ich auch gar nicht dazu gehören, das ist dann so eine Trotzreaktion. Wenn die nicht wollen, dass ich dazu gehöre, dann will ich das meistens auch nicht."
Er zieht sich also zurück, wenn er das Gefühl vermittelt bekommt, nicht in die Gesellschaft integriert zu sein. Gleichzeitig deutet er aber durch seine Äußerungen an, dass dadurch die Problematik "behindert zu werden" nicht beseitigt werden könne, da "stereotype Bilder" von Behinderung in der Gesellschaft erhalten blieben. "Ja, und die Masse weiß einfach zu wenig. Es ist ja allgemein bekannt, [dass] wenn man eine Sache nicht kennt, hat man Angst davor..."
Auf einen Aspekt dieses Interviews soll abschließend noch näher eingegangen werden: Interviewpartner F ließ immer wieder Worte wie "kennst du, glaub ich, auch" oder "gleich wie du" einfließen, was darauf hinweist, dass er sich in seinen Ausführungen verstanden glaubte.
Da seine Interviewpartnerin ebenfalls Rollstuhlfahrerin ist, ging er davon aus, dass ihre Erfahrungen ähnliche sind, und konnte sich so zu den einzelnen Themen äußern ohne lange überlegen zu müssen, welche Formulierung wohl am besten seine Meinung wiedergebe.
Dies schuf ein Gesprächsklima, das sicherlich diesem, aber auch den übrigen Interviews förderlich war.
Inhaltsverzeichnis
Vergleich der Bedeutungseinheiten und Verknüpfung zu einer generellen Phänomeninterpretation
Mit der Arbeit wurde die These aufgegriffen, dass Behinderung und chronische Erkrankung nicht nur Gegenstand individueller Auseinandersetzungen sind. Daher sollte der Frage nachgegangen werden, welche Auswirkungen Deutungen vom Sinn und Schaden des Krankseins für den kranken oder behinderten Menschen haben könnten. Es wurden 6 Interviews mit Personen mit Behinderung durchgeführt, in denen die Interviewpartner zu ihrem Dasein befragt wurden, und zwar einem Dasein vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Norm- und Wertvorstellungen.
Lanzerath (2000) erklärt, dass Selbstauslegung und die damit verbundene Identitätsschaffung jedes einzelnen wesentlich über den Prozess der Sozialisation in Abhängigkeit von den Werten und Normen der Gesellschaft verlaufen.
Die Interviewpartner haben diesen "Prozess der Sozialisation" auf unterschiedliche Weise durchlebt, sie sind zum Teil in Heimen, zum Teil in der Familie aufgewachsen, haben unterschiedliche Schulen besucht oder Berufe erlernt. Gemeinsam ist allen, dass sie mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt kamen, und diese ihre Identität mit formte bzw. Teil ihrer Identität wurde. Interviewpartner B drückt dies folgendermaßen aus: "... mit der Behinderung an sich hab ich kein Problem, weil ich bin ich, das ist für mich normal" (S.72). Interviewpartner E meint: "Ich bin ganz gerne so wie ich bin, natürlich Sachen, die einem persönlich nicht gefallen, die gibt es immer..." (S.99). Interviewpartner F äußert: "Ich sehe mich nicht als behindert, weil ich bin so auf die Welt gekommen ..., das ist wie ich bin und das sind meine Voraussetzungen" (S.105). "Für mich ist Behinderung - ich bin so geboren - normal. Ich kenn ja nichts anders" (Interviewpartnerin A, S.64).
Die Interviewpartner sprechen von "ihrer" Normalität und sie sprechen von ihrem Empfinden, dass sich diese "ihre Normalität" von den gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität unterscheidet: "Normalität, also ich hab ein Problem mit dem Begriff, also nicht mit dem Begriff an sich, weil, also für mich ist mein Leben normal, weil das ist mein Leben ... Es mag für jemanden anders wieder anders aussehen, aber für mich ist es, ja, normal" (Interviewpartner B, S.71). Interviewpartnerin C meint: "In meinem Alltag bedeutet Normalität auch behindert sein, weil der allergrößte Teil meiner Freunde und Freundinnen tatsächlich behindert ist" (S.79). Interviewpartner D beschreibt unterschiedliche Normalitätsfelder, in denen er sich entweder als normal oder nicht normal erlebt. Sein unmittelbares Umfeld ist das Normalitätsfeld, in dem er als normal wahrgenommen wird. Aber "... gesellschaftlich gesehen bin ich schon sehr unnormal, also pass ich nicht in das Übliche, dass man sich eben bewegt, für sich selber sorgt und ähnliches" (S.89f). Auch Interviewpartner B spricht von unterschiedlichen Bereichen der Normalität: "Wir sind hier in Deutschland noch ein bisschen weg von der Normalität, damit meine ich nicht meine persönliche, ..., ich muss halt ganz klar sagen, es wird von der Gesellschaft noch nicht so wahrgenommen, auch wenn man als Gehandikapter in seinem privaten Umfeld Normalität für sich selber geschaffen hat ..." (S.73).
[Es] ist immer ein Blickwinkel ... wenn ich draußen herum fahre und da ist dann eine Treppe, dann ist das wohl normal, weil 95 % der Bevölkerung können die halt nehmen. Insofern ist das halt normal" (Interviewpartner F, S.104).
Alle Interviewpartner empfinden in ähnlicher Weise: So bald sie sich außerhalb ihres persönlichen Umfeldes aufhalten, bekommen sie immer wieder das Gefühl vermittelt als "anders" bzw. "nicht normal" wahrgenommen zu werden. Durch bauliche Gegebenheiten, wie für Rollstuhlfahrer nicht zugängliche Gebäude, oder durch das Verhalten anderer, nicht behinderter Personen erleben sie Situationen der Ausgrenzung und machen die Erfahrung, behindert zu werden. "Also ein Stück Behinderung bleibt mit dem An- und Ausziehen, wäre ja nur ein kleiner Teil, der größte Teil liegt ja auch in der Gesellschaft, dass man eben behindert wird" (Interviewpartnerin A, S.65).
Interviewpartner D formuliert folgendermaßen: "Ich denke es gibt beides [behindert sein und behindert werden], ich habe durch bestimmte körperliche Einschränkungen tatsächlich Einschränkungen und die werde ich auch nie in Gänze ausgleichen können ... Auf der anderen Seite, eine größere Integration wäre schon gut ... ich denke auch, dass Behindert-sein durch bestimmte körperliche Gegebenheiten bei weitem nicht so groß ist oder sein müsste, wenn es noch mehr Ausgleiche gäbe" (S.91). Interviewpartner F erzählt, seine Behinderung werde ihm "bewusst gemacht", wenn andere ihm durch ihr Verhalten oder durch Äußerungen mitteilen, dass sie ihn als "anders" erleben. "... dann fang ich an, mich damit zu beschäftigen und das behindert mich vielleicht" (S.105).
Die Verhaltensweisen, mit denen die Interviewpartner im gesellschaftlichen Umfeld immer wieder konfrontiert werden, bezeichnen sie als unsicheres, ängstliches Verhalten, als Verlegenheit oder Ignoranz. Interviewpartnerin A meint: "Ja, sie sind unsicher, sie wissen nicht, wie soll ich jetzt auf einen Menschen mit Behinderung reagieren? Das ist einfach so, weil sie es nicht wissen, weil sie nicht so oft damit in Berührung kommen" (S.66). "Ich denk auch, dass sie so reagieren aus Angst, ja, mich anzusprechen, mich was Falsches zu fragen, mich zu verletzen, und dann lieber schnell weg, dann kann man ja nichts Falsches machen" (Interviewpartnerin A, S.67).
"Ja, und die Masse weiß einfach zu wenig. Es ist allgemein bekannt, [dass] wenn man eine Sache nicht kennt, hat man Angst davor..." (Interviewpartner F, S.105).
Solchem Verhalten begegnen zu müssen kostet sie Energie, macht sie wütend oder lässt sie den Wunsch verspüren, sich zurück zu ziehen. "Behindert werden ist für mich verbunden mit Wut, Wut und ungeheurer Aggression ... Und es ist so, dass ich tatsächlich jeden Tag die Erfahrung mache, behindert zu werden. Von baulichen Gegebenheiten, von menschlicher Ignoranz, ... bei letzterem ist es halt so, dass es das ist, woran ich verzweifeln kann ... es ist etwas, wo ich halt immer wieder spüre, es ist die reine Ignoranz, die dazu führt, dass ich behindert werde." (Interviewpartnerin C, S.80). Interviewpartnerin A beschreibt ihr Verlangen, sich zurück ziehen zu wollen, mit folgenden Worten: "Ich selber merk manchmal, dass ich dann doch nicht so mag, einfach raus zu gehen, weil ich mir den Stress auch nicht antun will ..., kostet mir zu viel Energie" (S.66). Ebenso argumentiert Interviewpartner F: "Also Leute, die mich nicht ernst nehmen, da will ich auch gar nicht dazu gehören ... Wenn die nicht wollen, dass ich dazu gehöre, dann will ich das meistens auch nicht" (S.105).
Allerdings kann dieses Gefühl anders zu sein bzw. als nicht normal wahrgenommen zu werden ihrer Ansicht nach auch nur verringert werden, wenn die Möglichkeit geschaffen wird, in Kontakt mit anderen zu treten. Die Teilnahme am öffentlichen Leben müsste erleichtert werden, denn nur so können Vorurteile und Unsicherheiten in der Begegnung abgebaut werden. Interviewpartner D spricht vom gesellschaftlichen Konstrukt "Behinderung", das auf diese Weise "dekonstruiert" werden könne. "Ja, das ist die eine Ebene, also dass Normalität hergestellt wird durch Alltäglichkeit und durch häufigen Kontakt, also dass etwas so lange unnormal bleibt, wie es keine Kontakte gibt (S.89). Interviewpartnerin A meint: "Wenn jetzt z. B. mehr Behinderte auf der Straße wären und es alltäglich wäre, dass man jetzt mit dem Bus fährt, also vermehrt, dann wäre es vielleicht für die Menschen, für die Nichtbehinderten normaler" (S.66). Die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen, also in die Gesellschaft integriert zu sein, ist ein zentrales Anliegen aller Interviewpartner. Der integrative Gedanke spielt für sie eine wichtige Rolle. Interviewpartner B berichtet darüber, wie positiv er das gemeinsame Heranwachsen mit behinderten und nicht behinderten Schülern empfunden habe. "Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich, ..., gut vorbereitet auf meinem weiteren Lebensweg, also ich war immer schon daran interessiert, was vor meiner Haustüre passiert, also jetzt nicht unbedingt immer nur mit Rollstuhlfahrern zusammen, sondern halt beide, ... ja ich find es wichtig, dass beide Seiten aufeinander zugehen, beide sagen, hier sind wir, ..." (S.72f). Interviewpartner D bringt die Forderung nach Integration in folgendem Satz zum Ausdruck: "... es gibt eine gesellschaftliche Anforderung, dass die Hilfen, die nötig sind, gegeben werden, und zwar auf eine Art und Weise, die es demjenigen, der sie erhält, ermöglichen, sich zu verwirklichen" (S.92).
Die Wahrnehmung des eigenen Selbst als ein durch die Umgebung bewertetes und beurteiltes Selbst zieht sich wie ein roter Faden durch alle Interviews.
Existenzphilosophen wie Sartre (1943/1991) begreifen das Sein des Einzelnen als immer schon durch die Gegenwart des Anderen konstituiert. Er beschreibt die Macht, die der Blick des Anderen auf die eigene Selbstwahrnehmung ausüben kann, denn "... ich kann mich gegenüber dem, was ich (für den anderen) bin, weder total absentieren ... noch es passiv ertragen ...; in der Wut, im Hass, im Stolz, in der Scham, im angeekelten Zurückweisen oder im freudigen Beanspruchen muss ich wählen, das zu sein was ich bin" (Sartre, 1943/1991, S.910).
Interviewpartnerin C erzählt, wie sehr die wertende Haltung der anderen ihr Empfinden darüber, behindert zu sein, beeinflusste. Um einen Schwerbehindertenausweis zu erhalten, musste sie sich einer ärztlichen Begutachtung unterziehen. Sie meint, bis zu diesem Zeitpunkt wäre ihr nicht aufgefallen, dass an ihr gar nichts stimme "... ja, dass ich behindert bin, dass ich anders bin, das wusste ich schon, aber mir ist in dem Moment klar geworden, was die anderen Leute sehen. Und was sie sehen, das ist halt ... krumme Füße, krumme Arme, krumme Beine, also alles ist krumm und stimmt nicht" (Interview C, S.81). Auch Interviewpartnerin A berichtet über den "Blick des Anderen". Er trifft sie vor allem dann besonders, wenn sie das Empfinden hat, dass es der Rollstuhl ist, der in erster Linie ins Blickfeld ihrer Mitmenschen rückt, und nicht sie als Person. "Dann bemerk ich schon, dass ich irgendwie eigentlich gar nicht existiere als Mensch, ich bin so eine Art Möbelstück, das rückt man mal kurz zur Seite, weil man möchte da mal durch" (S.65).
Jollien (1999/2001) spricht davon, dass dadurch wie andere uns wahrnehmen, unsere Persönlichkeit geformt und strukturiert werde. Der "Blick des Anderen" trägt wesentlich dazu bei, auf welche Weise das eigene Dasein beurteilt wird, und er trägt auch dazu bei, auf welche Weise Glück oder Leid erfahren wird.
Die Interviewpartner umschreiben Begriffe wie "Herausforderung", "Glück" und "Leid" oder "Lebensqualität" auf sehr persönliche Art und nehmen dabei immer wieder auch auf ihr Leben als Personen mit Behinderung Bezug. Sie bezeichnen ihr Leben als Menschen mit Behinderung jedoch nie als leidvolles Leben, sondern weisen darauf hin, dass die Tatsache behindert oder chronisch krank zu sein, nicht gleichbedeutend mit Leiden ist. "Leiden hat ab einem bestimmten Punkt auch etwas mit körperlicher Krankheit zu tun, aber das ist etwas, das für mich einfach noch kein Thema ist, weil ich einfach noch nie so krank gewesen bin, dass ich meine körperliche Verfassung als Leid oder leiden empfunden habe" (Interviewpartnerin C, S.78). Interviewpartnerin C meint, sie kenne den Begriff Leid in dem Zusammenhang, oder in dem Begriff Mitleid. "... ich leide eben oft daran, wie mit mir umgegangen wird ... im ganz normalen Alltag. Also wie fremde Menschen mich betrachten, mir gegenübertreten bzw. mich halt nicht betrachten."
Ein mitleidiger Blick kann als sehr verletzend empfunden werden. Ein Zitat Nietzsches bringt dies treffend zum Ausdruck: "... es gehört zum Wesen der mitleidigen Affektion, dass sie das fremde Leid des eigentlich Persönlichen entkleidet - unsre "Wohltäter" sind mehr als unsre Feinde die Verkleinerer unsres Wertes und Willens ..." (1982, S.212). Jollien (1999/2001) bezieht sich auf Nietzsche und schreibt, dass das Mitleiden tiefer verletze als die Verachtung. Das Mitleiden anästhesiere durch seine Schalheit, so Jollien. Somit wird der Mitleidende zum "Verkleinerer des Wertes und Willens" des Bemitleideten, wie Nietzsche es ausdrückt.
Interviewpartner D meint: "... jeder Behinderte weiß, dass ... die Umgebung, umso weniger sie mit dem Menschen selber zu tun hat, der eine Behinderung hat, viele Dinge in dessen Leben als leidvoll und schrecklich einordnet, die überhaupt nicht leidvoll und schrecklich sind ... Dass Behinderung per se auch als Leid immer mitgedacht oder -gefühlt wird, das ist tatsächlich eine Umgebungsgeschichte" (S.86). Hier soll nochmals Nietzsche zitiert werden: "Das, woran wir am tiefsten und persönlichsten leiden, ist fast allen anderen unverständlich und unzugänglich: Darin sind wir dem Nächsten verborgen ... Überall aber, wo wir als Leidende bemerkt werden, wird unser Leiden flach ausgelegt ..." (1982, S.212).
Interviewpartner F berichtet ebenfalls, dass er unter den "gesellschaftlichen Verhältnissen" leide. "... ich leide darunter, dass für alles, das man braucht, ich bei irgend einem Amt erst mal eine Ablehnung kriegen muss, damit ein anderes Amt das dann wieder macht, oder auch nicht ... da leide ich darunter und das verkompliziert mein Leben" (S.102). Und Interviewpartner E definiert Leid als eine Unfreiheit, in die er kommen würde, wenn ihm auf Grund von Einsparungen jene Mittel genommen würden, die er benötigt, um sein Leben in bisheriger Weise zu gestalten.
Die Art und Weise wie die Interviewpartner sich zum Begriff "Leid" äußern zeigt, wie sehr das Gefühl zu leiden ein persönliches und individuelles ist. Die Tatsache eine Behinderung oder chronische Erkrankung zu haben ist für sie nicht gleichbedeutend damit leiden zu müssen, auch wenn ein Leben mit Behinderung immer wieder Erfahrungen mit sich bringt, die als leidvoll empfunden werden. Interviewpartnerin C spricht dies mit folgenden Worten an: "Über die Tatsache, dass ich behindert bin, kann ich traurig sein... Es gibt immer wieder Situationen, wo trotz der besten Gegebenheiten ich einfach traurig darüber bin, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann" (S.80).
Eine körperliche Behinderung zu haben, bedeutet für die Interviewpartner keine Einschränkung ihrer Lebensqualität. Sie erklären, Lebensqualität dann zu besitzen, wenn ihnen die Gesellschaft bestimmte, für sie notwendige Voraussetzungen schafft. "Ein Kriterium für Lebensqualität ist sicherlich die Möglichkeit, in ausreichendem Maße Hilfe und Unterstützung zu bekommen, wenn man so wie ich darauf angewiesen ist. Lebensqualität ist für mich verbunden mit einer ausreichenden finanziellen Sicherung" (Interviewpartnerin C, S.77). Interviewpartner E meint: "Lebensqualität, das ist, ja wenn ich mein Leben führen kann, wie ich es mir vorstelle. Dazu gehören funktionierende Hilfsmittel, ..." (S.97). Ebenso definiert Interviewpartner F Lebensqualität: "... dass man die Dinge tun kann, die man tun will ... wenn ich auf das Amt gehen kann, wenn ich muss, wenn ich in die Kneipe gehen kann, wenn ich will, ..., dann hab ich ein gutes Leben. Und wenn das halt nicht ist, weil ich keine gute Assistenz hab, dann hab ich keine gute Lebensqualität" (S.102). Wie sehr die eigenen persönlichen Erfahrungen mit gesellschaftlichen Gegebenheiten bei der Definition von Lebensqualität mit eine Rolle spielen, geht auch aus der Äußerung von Interviewpartnerin A hervor: "Ja, dass ich wirklich mein Leben auch bestimmen kann, ..., z. B. bei Krankenhäusern und im Heim ist es ja so, da wurde ja viel bestimmt, da wurde man nicht gefragt, möchtest du das lernen, sondern wurde einem aufdiktiert..." (S.63).
Auch ihre Umschreibungen des Begriffes "Herausforderung" sind ganz persönliche. Sie distanzieren sich von einem - wie sie meinen - gängigen gesellschaftlichen Bild, das die Herausforderung eines Menschen mit Behinderung darin sieht, dass er seinen Alltag trotz Behinderung "meistert":
"Also ich denke, ..., das, was andere Menschen für große Herausforderungen halten, jetzt, bei einem schwerstbehinderten Menschen oder bei einem schwerstpflegebedürftigen Menschen wie mir, diese Herauforderungen habe ich alle gemeistert. Also ich habe eine Berufsausbildung, ich habe meine eigene Wohnung, ich habe eine umfassende, gut organisierte Assistenz usw." (Interviewpartnerin C, S.79). Der "Tenor ihrer Umgebung", erklärt sie, wäre Bewunderung, denn sie hätte ihr Leben erfolgreich "gemeistert", so vieles "geschafft", sich Herausforderungen gestellt. "Aber das ist für mich aber auch nie die Herausforderung gewesen" (S.79).
Interviewpartner D spricht sich ebenfalls gegen das - wie er es bezeichnet - gängige gesellschaftliche "Klischee" aus, dem zu Folge bei einem behinderten Menschen die Herausforderung darin bestünde, "sein schweres Los" zu tragen (S.90). Er meint: "Herausforderung besteht eher darin, dass ich fordere, dass ich es herausfordere, dass diese Gesellschaft ein Lebensraum auch für mich ist" (S.90). Auf gleiche Weise definiert Interviewpartner F den Begriff "Herausforderung": "Eine Herausforderung ist für mich immer das Optimum zu bekommen und nicht zu sagen, es geht auch z. B. mit einer Stunde [Assistenz] weniger. Geht nicht! Das ist eine Herausforderung" (S.104).
Interviewpartner D bezeichnet es als "irrige Meinung", wenn "Leute denken, ja, wenn das Leben glückvoll ist, dann ist es lebenswert, dann hat es Qualität, und wenn es leidvoll ist dann hat es keinen Wert." Ein Leben kann seiner Meinung nach nie nur glückvoll oder nur leidvoll sein. Daher gibt es für ihn auch "kein Glück, ohne die entsprechende Portion Leid dazu" (S.87). Beides seien Erfahrungen, die zum Leben eines Menschen gehören, die wichtig sind, weil sie die Persönlichkeit eines Menschen formen und den Menschen erst zu der Person machen, als die er wahrgenommen wird: "... und ob nun eine starke Lust oder ein starker Schmerz da ist, das sind beides Erfahrungen, ohne die wir als Person nicht das wären, was wir sind oder gar nicht das werden können, was wir dann werden oder werden könnten" (Interviewpartner D, S.87).
Auch Nietzsche begreift Glück und Unglück nicht als zwei Gegensätze. Er spricht davon, dass diese nur zusammen "groß werden können": "Ach, wie wenig wisst ihr vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmütigen! denn das Glück und das Unglück sind zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander großwachsen oder, wie bei euch, miteinander - klein bleiben(Nietzsche, 1982, S.213). Nach Nietzsche können also Begriffe wie "Glück" oder "Leid" weder eindeutig positiv noch negativ besetzt werden. "Krankheit" und "Gesundheit" sind für ihn ebenfalls "keine streng zu definierenden Zustände oder Gegensätze" (Carbone & Jung, 2000). Der Gedanke, dass Gesundheit und Krankheit, ebenso wie Glück und Leid, nicht als Zustände betrachtet werden können, sondern immer auch in Beziehung stehen zu der Bedeutung, die man diesen Begriffen einräumt, ist hier wesentlich. Krankheit oder Behinderung werden - wie Gesundheit oder Leistungsfähigkeit - als sogenannte Zustände in ihrer Wertigkeit aufgehoben, aufgehoben in der Person, die all diese wertbesetzten Begriffe und Zustände in sich vereint und dadurch erst als Persönlichkeit hervorgeht.
Viktor E. Frankl spricht vom "unbedingten Menschen" und schreibt: "... der Mensch [ist] ein insofern unbedingter, als er in seiner Bedingtheit "nicht aufgeht"; insofern, als sie ihn zwar konditioniert, aber nicht konstituiert" (1996, S.66). Er meint damit folgendes: Der Mensch ist in seinem Dasein Bedingungen unterworfen. Es können biologische Bedingungen, wie z. B. Behinderung oder Krankheit, oder psychologische und soziologische Bedingungen sein. In diesem Sinne ist der Mensch nicht frei. Er ist nicht frei von Bedingungen, jedoch frei zur Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen.
Die Interviewpartner haben in vielfältiger Weise zu ihren Lebensbedingungen Stellung genommen. Gemeinsam ist allen, dass sie "den Blick des Anderen" häufig als verletzend und wertend erleben. Sie erklären, auf Grund ihrer Behinderung gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden, fühlen sich außerhalb ihres privaten Umfeldes in ihrem So-Sein oft nicht angenommen. Dies problematisiere ihr Dasein, die Behinderung "an sich" stelle nicht das Problem in ihrem Leben dar. "Aber zu meiner Behinderung: da hab ich nicht so Probleme, ich kann mich jetzt ganz gut annehmen. Ich bin auch so bestrebt, das, was ich kann, auch zu machen ..." (Interviewpartnerin A, S.62). Interviewpartner E meint, als er nach Problemen im Alltag gefragt wird, die er mit seiner Behinderung in Zusammenhang bringe: "Nein, die gibt es nicht. Ich bin, wie schon erzählt, von Geburt an behindert und ich kenn es gar nicht anders" (S.96). Und Interviewpartner F antwortet: "... also ich hab die selben Probleme wie du, glaub ich, mit der Umwelt auch ... , aber sonst eigentlich nicht, weil für alles andere hab ich meine Assistenten ... ich hab halt die Probleme, dass ich angemacht werde, wie jeder andere auch. Oder dass man mich irgendwo nicht rein lässt, oder dass ein Klo zu eng ist... Aber sonst hab ich eigentlich nichts, wo ich sagen würde, da macht mir meine Behinderung große Probleme" (S.101f).
Interviewpartner B: "Alltagsprobleme gibt es immer, aber ich denke, ich hab sie ganz gut im Griff soweit" (S.69). Und er erklärt: "Ich bin behindert, aber ich sehe mich nicht so" (S.71). Er unterscheidet zwischen seiner körperlichen Gegebenheit, die für ihn die Benutzung eines Rollstuhls notwendig macht, und der subjektiven Einschätzung der selben. "Aber für andere Menschen bin ich behindert. Die Behinderung an sich ist für mich kein Problem, weil ich nehme mich so an, wie ich bin" (S.72).
Die Probleme, welche die Interviewpartner beschreiben, sind Probleme, auf die sie als Rollstuhlfahrer im Umgang mit der Gesellschaft stoßen. Im Kontakt mit anderen, durch deren Äußerungen, Meinungen, Bewertungen erfahren sie sich als "Problem für andere". Sie selbst beschreiben ihre körperlichen Einschränkungen als - zumindest zu einem großen Teil - "ausgleichbar", "kompensierbar" und "annehmbar".
Lanzerath (2000) schreibt, dass je nach dem wie eine Gesellschaft "Krankheit" definiere, sie auch Begriffe wie Gesundheit, Lebensqualität oder Behinderung definiere. Wichtig sei aber, dass die kommunikative Komponente des seine Befindlichkeit mitteilenden Menschen wesentlich zur Konstitution von Krankheit gehöre.
Die hier wiedergegebenen Aussagen der Interviewpartner bestätigen dies in eindrucksvoller Weise.
Auf seine Interpretation der Begriffe "behindert sein" und "behindert werden" angesprochen, meint Interviewpartner D unter anderem: "... ich denke ..., dass Behindert-sein durch bestimmte körperliche Gegebenheiten bei weitem nicht so groß ist oder sein müsste, wenn es noch mehr Ausgleiche gäbe" (S.91). Für ihn wäre ein solcher "Ausgleich" in einem sozialpolitischen Umfeld gegeben, in dem jede behinderte Person die Möglichkeit hätte, sich ihr Leben unterstützt von persönlicher Assistenz zu gestalten. "Also ich denke, ich erhalte in einer ziemlich optimalen Weise Assistenz. Aber es gibt tausend andere in meiner Lage, die das nicht erhalten und die deshalb wesentlich mehr behindert werden" (S.91).
Alle sechs Interviewpartner organisieren ihr Leben mit Hilfe von persönlicher Assistenz. In ihren Interviews betonen sie immer wieder, welche Bedeutung es für sie habe, ihren Alltag auf diese Weise leben zu können. Daher soll an dieser Stelle nochmals näher darauf eingegangen werden:
In der Öffentlichkeit ist der Gedanke, dass ein behinderter Mensch sich die notwendige Hilfe und Unterstützung in selbstverantwortlicher Weise organisieren kann, immer noch wenig verbreitet. Für den behinderten Menschen bedeutet Selbstbestimmung jedoch die Chance und Möglichkeit, ein in die Gesellschaft integriertes und gleichberechtigtes Leben zu führen. Interviewpartner D drückt dies folgendermaßen aus: "... dass es eben nicht mehr darum geht, du erleidest etwas und dann kommt eine große Hilfsorganisation und hilft dir, sondern dass es darum geht, dass, wenn deine Möglichkeiten eingeschränkt sind, du die Mittel in die Hand bekommst das auszugleichen, also auch in deinem Sinne ausgleichen zu können" (S.83). Das Konzept der persönlichen Assistenz spielt dabei eine wichtige Rolle. Um dieses Konzept aber realisieren zu können, müssen bestimmte gesellschaftspolitische Voraussetzungen gegeben sein. Vor allem sind finanzielle Mittel erforderlich, um den Bedarf an persönlicher Assistenz abdecken zu können. Diese Voraussetzungen waren für Interviewpartner D in einem größeren Ausmaß in Berlin gegeben, weshalb er vom Land in die Stadt gezogen ist, als "Assistenzflüchtling", wie er es bezeichnet (S.82).
Interviewpartnerin C äußert sich zu ihrem Leben als Assistenznehmerin auf folgende Weise: "Die Assistenten habe ich mir selbst gesucht und als sogenannte behinderte Arbeitgeberin angestellt. Ich habe 24 Stunden Assistenz und es werden tatsächlich alle 24 Stunden bezahlt ... Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich tatsächlich zu jeder Zeit auf die Leute zurückgreifen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie dafür nicht bezahlt werden was sie machen" (S.75). Bei ihrer Definition von "Lebensqualität" nimmt sie ebenfalls Bezug auf ihr Leben mit persönlicher Assistenz: "Ein Kriterium für Lebensqualität ist sicherlich die Möglichkeit, in ausreichendem Maße Hilfe und Unterstützung zu bekommen, wenn man so wie ich darauf angewiesen ist ..." (S.77). Interviewpartnerin A betont, wie wichtig es ihr sei, ihr Leben "auch bestimmen" zu können (S.63). Sie wird bei alltäglichen Verrichtungen von ihren Assistentinnen unterstützt, es liegt aber in ihrer Entscheidungskompetenz, wann und auf welche Weise die Verrichtungen ausgeführt werden. Daher habe sie "für sich auch eine Lebensqualität" erreicht, so Interviewpartnerin A. Auch Interviewpartner E erklärt, dass sein Leben so lange Qualität besitze, so lange er Hilfsmittel und Assistenzstunden in einem Ausmaß zur Verfügung habe, das ihm erlaubt, seine gegebene körperliche Behinderung zu kompensieren und den Alltag in gewohnter Weise zu gestalten: "... also wenn ich nicht wüsste, wo ich Hilfe herkriege die ich brauche, damit ich so leben kann wie ich mir das vorstelle, das ist dann auch eine Einschränkung der Lebensqualität" (S.97). Interviewpartner F beschreibt in seinem Interview immer wieder, warum es ihm so wichtig sei, ein gut funktionierendes Assistententeam zu haben. Er meint, er habe in seinem privaten Umfeld keine größeren Probleme, "weil für alles andere hab ich meine Assistenten ... Und ich hab ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Assistenten. Einige davon würde ich sogar zu meinen Freunden zählen und darum hab ich eigentlich keine großen Probleme ..." (S.102). Sein Leben bezeichnet er als ein gutes Leben, so lange er nicht daran gehindert werde, es in seinem Sinne zu organisieren - eine Vorraussetzung hierfür ist jedoch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von persönlicher Assistenz.
Abschließend soll hier nochmals Interviewpartner D zitiert werden. Er erklärt, warum das Konzept der persönlichen Assistenz eine so große Rolle für den behinderten Menschen spielt: "Der Assistenzgedanke ist der, dass du die Person bleibst, die die Herrschaft über das eigene Leben behält ... das, find ich, ist eine ganz wichtige Idee und ich denke auch, die wird sich trotz aller sozialpolitischen Verschärfungen weiter durchsetzen" (S.93). Er meint, gleichgültig wie groß bzw. klein die finanziellen Ressourcen in Zukunft sein werden, allein die Idee "dass die Mittel in die Hände derer kommen, die die Hilfe brauchen" ließe sich nicht mehr aufhalten und würde viel verändern in der "Hilfeerbringungs-Landschaft".
"... eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Gesundheiten des Leibes; und je mehr man dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder erlaubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das Dogma von der "Gleichheit der Menschen" verlernt, um so mehr muss auch der Begriff einer Normal-Gesundheit, ..., unseren Medizinern abhanden kommen." (Nietzsche, 1982, S.134)
Wenn ich dieses Zitat Nietzsches zu Ende der Arbeit nochmals anführe, so deshalb, weil Nietzsche hier Aussagen trifft, die im Wesentlichen die Thematik dieser Arbeit aufgreifen: Nietzsche meint, es gäbe keine Gesundheit "an sich", man könne also keine Norm aufstellen, aus der eindeutig hervorgehe, was als "gesund" bzw. was als "krank" zu definieren sei. Der Versuch, den Begriff einer "Normal-Gesundheit" zu konstruieren, sei gescheitert, so Nietzsche.
Normvorstellungen sind Konstrukte vergangener und heutiger Gesellschaftsformen. Die Gesellschaft - ein Interviewpartner spricht von "der Mehrzahl der Leute" - bewertet, wer oder was der Norm entspricht. Dies birgt aber zwangsläufig die Gefahr in sich, dass Menschen, die diesen Normalitätsdefinitionen nicht genügen, ausgegrenzt werden. Unabhängig davon, ob diese Ausgrenzungen bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt geschehen - sie verletzen und werten ab, denn sie vermitteln das Gefühl, als nicht normal wahrgenommen zu werden. Die Interviewpartner beschreiben dieses Gefühl in ihren Interviews immer wieder. Sie sprechen aber auch von ihrer Normalität, ihren Vorstellungen bzw. ihrem Erfahren von "Glück" oder "Leid", von "Lebensqualität" oder einer "Herausforderung" und erklären, dass ihr Behindert-sein bzw. chronisch Krank-sein sie nicht daran hindere, diese Erfahrungen zu leben. Sie bezeichnen sich und ihr Leben als normal und möchten als Menschen mit Behinderungen auch von ihrem Umfeld in ihrem So-Sein anerkannt und als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Ihre Behinderungen sind Teil ihrer Persönlichkeiten.
Auch Nietzsche fordert in seinem Zitat, man solle "das Dogma von der Gleichheit der Menschen verlernen" und das Einzigartige und Unvergleichliche wieder in den Vordergrund stellen.
Wie zu Beginn erwähnt, wurde ich zum Thema dieser Arbeit unter anderem auch auf Grund der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Dasein als Frau mit Behinderung inspiriert. Mir ist bewusst, dass ich dadurch mit einem gewissen Vorverständnis an den empirischen Teil der Arbeit herangegangen bin und damit auch der Kritik einer nicht vorurteilsfreien Haltung ausgesetzt. Ich habe jedoch versucht, dem wissenschaftlichen Kriterium der Objektivität dadurch Rechnung zu tragen, dass ich die einzelnen Schritte der Durchführung der Interviews und der anschließenden Auswertung so transparent wie möglich gemacht habe.
Die Interviewpartner haben als "Experten in eigener Sache" zu ihrem Dasein als Menschen mit Behinderungen Stellung genommen. Sie haben deutlich gemacht, dass die Tatsache, eine Behinderung zu haben, keiner objektiven Wertung unterzogen werden kann. Es ist, wie Lanzerath (2000) es ausdrückt, eine Sache der "Selbstauslegung"; eine Behinderung sollte nicht losgelöst von der Person, die diese Behinderung hat, beurteilt werden.
Einen Zustand an sich selbst als eine Behinderung aufzufassen und dies nicht als eine Krankheit, sondern ... als "besondere Form der Gesundheit" zu empfinden, macht das Moment der Selbstauslegung ... deutlich. Denn obwohl es einen natürlichen Zustand gibt, der von Ärzten als pathologisch und normabweichend interpretiert und von der Gesellschaft als krankhaft eingestuft wird, ist die Sicht des oder der Betroffenen eine andere. Diese orientiert sich nicht an dem darunterliegenden biologischen Zustand und den damit verbundenen Häufigkeiten in der Bevölkerung, sondern vielmehr an der eigenen Kontingenzerfahrung und der Selbstauslegung der vorgegebenen und gleichzeitig aufgegebenen Natur in ihrer psycho-physischen Konstitution. (Lanzerath, 2000, S.240)
Dieser Aussage Lanzeraths möchte ich abschließend folgende Worte hinzufügen: Hätte ich - als einer Frau mit Behinderung - drei Wünsche frei, so wäre unter diesen Wünschen, die ich erfüllt haben möchte, niemals jener, "gesund" zu werden, also quasi aus dem Rollstuhl zu steigen. Dies mag im ersten Moment für viele unglaubwürdig und unverständlich klingen, und ich selbst - als das Selbst, das nach Frankl ein fakultatives ist - kann es nur so erklären: Die Person, die ich jetzt bin, bin ich auf Grund meiner Erfahrungen, Erlebnisse, auf Grund meiner bisherigen Lebensgeschichte, und meine Behinderung ist Teil dieser Geschichte. Das was ich tue, wie ich handle und lebe, tue ich nicht trotz meiner Behinderung, sondern mit ihr, sie ist Teil meiner Persönlichkeit, meiner Identität. Mir aus einer sicher gutgemeinten, jedoch mitleidigen Intention heraus ein Leben ohne meine Behinderung zu wünschen, würde bedeuten, mich meiner Identität berauben zu wollen. Folgendes Zitat soll das eben gesagte unterstreichen: "Wenn ich sage, dass ich eine behinderte Frau bin, dann spreche ich nicht von der Tatsache, dass ich eine Beeinträchtigung habe. Ich spreche über meine Identität" (Linton, zitiert nach Monaghan, 1998/2004).
Abels, H. (1975). Lebensweltanalyse von Fernstudenten (Qualitative Inhaltsanalyse - theoretische und methodische Überlegungen). Hagen: Werkstattbericht.
Benjamin, J. (2002). Der Schatten des Anderen (Intersubjektivität - Gender - Psychoanalyse). Frankfurt, Basel: Stroemfeld.
Bude, H. (1984). Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen - eine Antwort auf die Frage, was die Biographieforschung bringt. In M. Kohli & G. Robert (Hrsg.), Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven. (S.7-28). Stuttgart.
Büttner, S. (2003). HEGELS KRANKHEITSBEGRIFF ALS INTERPRETAMENT FÜR DAS VERSTÄNDNIS VON BEHINDERUNG - NEBST EINEN BLICK AUF DIE MODERNE BIOMEDIZIN. Manuskript präsentiert auf dem Thüringentag für Philosophie, Deutschland.
Cloerkes, G. (1985). Einstellung und Verhalten gegenüber Behinderten. Eine kritische Bestandsaufnahme internationaler Forschung. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://bidok.uibk.ac.at/library/cloerkes-einstellung.html (Stand:22.11.2005, Link aktualisiert durch bidok).
Feuser, G. (1995). Behinderte Kinder und Jugendliche: Zwischen Integration und Aussonderung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt.
Feuser G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik (Integration auf den Begriff gebracht). [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www2.uibk.ac.at/bidok/library/schule/feuser-didaktik.html [04-08-25]. [zitiert nach Nickel, S. (1999). Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur. [Online im Internet] Verfügbar unter:WWW:http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-einstellungen.html (Stand:22.11.2005, Link aktualisiert durch bidok).
Frankl, V. E. (1977). Das Leiden am sinnlosen Leben (Psychotherapie für heute). Wien: Herder.
Frankl, V. E. (1979). Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. München: Piper Verlag GmbH.
Frankl, V. E. (1996). Der leidende Mensch (Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie). Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.
Girtler, R. (1992). Methoden der qualitativen Sozialforschung: Anleitung und Feldarbeit. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag
Gosling, J. (2004). [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.jugo.co.uk/cylife3.htm [zitiert nach Schmidt, B. M. & Ziemer, G. (2004). Verletzbare Orte. Zur Ästhetik anderer Körper auf der Bühne. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.ith-z.ch (Fenster: Verletzbare Orte) [04-08-28]].
Hartmann, F. (1997). Sittliche Spannungslagen ärztlichen Handelns. In D. von Engelhardt (Hrsg.), Ethik im Alltag der Medizin. Spektrum der medizinischen Disziplinen. (S.1-13). Basel.
Hegel, G. W. F. (1987). Jenaer Systementwürfe III. Naturphilosophie und Philosophie des Geistes. Hamburg: Felix Meiner Verlag GmbH.
Jantzen, W. (1992). Allgemeine Behindertenpädagogik (Band 1). In U. Meiser & F. Albrecht (Hrsg.), Krankheit, Behinderung und Kultur (S.1). Frankfurt am Main: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
Jollien, A. (2001). Lob der Schwachheit. Zürich: Pendo Verlag Gmbh. (Original erschienen 1999: Éloge de la faiblesse).
Kant, I. (1797). Metaphysik der Sitten, "Zweyter Theil, Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre". Königsberg: "bey Friedrich Nicolovius" [zitiert nach Frankl, V. E. (1996). Der leidende Mensch (Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie). Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber.].
Kant, I. (1797). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 2, AA, S.434. Kierkegaard, S. (2002). Der Begriff Angst. In Lieselotte Richter (Hrsg.). Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
Kleck, R. (1966). Emotional arousal in interactions with stigmatized persons. Psychological Reports, 19, 1226.
Kleck, R. (1968a). Self-disclosure Patterns of the non-obviously stigmatized. Psychological Reports, 23, 1239-1248.
Kleck, R. (1968b). Physical stigma and nonverbal cues emitted in face-toface interaction. Human Relations, 21, 19-28.
Kleck, R. (1969) Physical stigma and task oriented interactions. Human Relations, 22, 53-60.
Kleck, R., Ono, H. & Hastorf, A. H. (1968). Effects of stigmatizing conditions on the use of personal space. Psychological Reports, 23, 111-118.
Kleck, R., Ono, H. & Hastorf, A. H. (1966). The effects of physical deviance upon face-to-face interaction. Human Relations, 19, 425-436.
Kohli, M. (1986). Normalbiographie und Individualität (Zur institutionellen Dynamik des gegenwärtigen Lebenslaufregimes). In J. Friedrichs (Hrsg.), 23. Deutscher Soziologentag 1986. Sektions- und Ad-hoc-Gruppen. (S.432-435). Opladen: Westdeutscher Verlag.
Lamnek, S. (1988). Qualitative Sozialforschung (Band 1 Methodologie). München, Weinheim: Beltz, Psychologische Verlagsunion.
Lamnek, S. (1995). Qualitative Sozialforschung (Band 2 Methoden und Techniken). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlagsunion.
Lanzerath, D. (2000). Krankheit und ärztliches Handeln. Zur Funktion des Krankheitsbegriffs in der medizinischen Ethik. Freiburg/München: Verlag Karl Alber Gmbh
Lesch, W. (2003). Narrative Ansätze der Bioethik. In M. Düwell & K. Steigleder (Hrsg.), Bioethik. Eine Einführung (S.184-199). Frankfurt am Main.
Mayring, P. (1999). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz, Psychologische Verlagsunion.
Milani-Compareti, A. (1986). Von der "Medizin der Krankheit" zu einer "Medizin der Gesundheit". In Paritätisches Bildungswerk - Bundesverband e. V. (Hrsg.), Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Frankfurt am Main: Mattes Verlag GmbH.
Möbuß, S. (2000). Sartre. Freiburg im Breisgau: Herder.
Monaghan, P. (1998). Chronicle of Higher Education. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.uic.edu/org/sds/articles.html [04-08-28]. [zitiert nach Schmidt, B. M. & Ziemer, G. (2004). Verletzbare Orte. Zur Ästhetik anderer Körper auf der Bühne. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.ith-z.ch (Fenster: Verletzbare Orte) [04-08-28]].
Müller, K. E. (1996). Der Krüppel; Ethnologia passionis humanae. München: Verlag C. H. Beck.
Mürner, Ch. (1996). Philosophische Bedrohungen (Kommentare zur Bewertung der Behinderung). Frankfurt: Europäischer Verlag.
Nickel, S. (1999). Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.bidok.uibk.ac.at/library/nickel-einstellungen.html (Stand:22.11.2005, link aktualisiert durch bidok).
Niedecken, D. (1993). Geistig Behinderte verstehen. München: dtv [zitiert nach Nickel, S. (1999). Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-einstellungen.html (Stand:22.11.2005, Link aktualisiert durch bidok)
Nietzsche, F. (1977). Ecce Homo (Wie man wird, was man ist). Frankfurt am Main: Insel Verlag.
Nietzsche, F. (1982). Die fröhliche Wissenschaft. Frankfurt am Main: Insel Verlag.
Nietzsche, F. (2000). Langsame Curen (Ansichten zur Kunst der Gesundheit). In M. Carbone & J. Jung (Hrsg.). Freiburg in Breisgau: Herder.
Overdick-Gulden, M. (2004). Unbehindert und schön wie Apoll? [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.aerzte-fuer-das-leben.de/body_unbehindert_und_schon_wie_apol.html [04-08-24].
Richarz, B. (2003). Behinderung als Trauma - Über die Verleugnung, die Ausgrenzung und die Ausmerzung abweichender Körperlichkeit. In G. Hermes & S. Köbsell (Hrsg.), Disability Studies in Deutschland - Behinderung neu denken! Dokumentation der Sommeruni 2003 (S.42-50). Kassel: bifos e. V.
Rommelspacher, B. (2004). Behindernde und Behinderte. Politische, kulturelle und psychologische Aspekte der Behindertenfeindlichkeit. In Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. (Hrsg,), Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik. Rundbrief, 16, 5-17.
Sartre, J.- P. (1991). Das Sein und das Nichts (Versuch einer phänomenologischen Ontologie). Hamburg: Rowohlt Verlag. (Original erschienen 1943: L´etre et le néant. Essai d´ontologie phénoménologique).
Schmidt, B. M. & Ziemer, G. (2004). Verletzbare Orte. Zur Ästhetik anderer Körper auf der Bühne. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.ith-z.ch (Fenster: Verletzbare Orte) [04-08-28].
Schmidt-Grunert, M. (Hrsg.) (1999). Sozialarbeitsforschung konkret: problemzentrierte Interviews als qualitative Erhebungsmethode. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Schramml, T. (2000). Psychische Krankheit aus philosophischer Sicht. Frankfurt am Main: Fischer.
Schulak, E. M. (2004). WAS HEISST PHILOSOPHISCH. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://www.philosophische-praxis.at [04-08-19].
Störig, H. J. (1992). Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
Wagner, U. (1989). Blicke auf den dicken Körper. Gegen die Unterwerfung unter die Schönheitsnorm. Frankfurt: Brandes & Apsel [zitiert nach Wolber, E. (1997). Es ist unsere Gesellschaft die behindert, nicht die Behinderung. In U. Meiser & F. Albrecht (Hrsg.), Krankheit, Behinderung und Kultur (S.33-68). Frankfurt am Main: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation.].
Wikimedia Foundation. (Hrsg.) (2004). Behinderung. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung [04-08-19].
Wikimedia Foundation. (Hrsg.) (2004). Gesundheit. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit [04-09-06].
Witzel, A. (1982). Verfahren der qualitativen Sozialforschung (Überblick und Alternative). Frankfurt.
Witzel, A. (1989). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.), Qualitative Forschung in der Psychologie (Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder). (S.227-256). Heidelberg: Asanger.
Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung. Forum: Qualitative Social Research. [Online im Internet] Verfügbar unter: WWW: http://qualitative-research.net/fqs [04-09-23].
Wolber, E. (1997). Es ist unsere Gesellschaft die behindert, nicht die Behinderung. In U. Meiser & F. Albrecht (Hrsg.), Krankheit, Behinderung und Kultur (S.33-68). Frankfurt am Main: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
Abbildung 1: (Frankl, 1977, S.81f), S.30
Abbildung 2: 1. Gesetz der Dimensionalontologie, S.32
Abbildung 3: 2. Gesetz der Dimensionalontologie, S.32
Abbildung 4: Ablaufmodell phänomenologischer Analyse, S.60
Inhaltsverzeichnis
Einleitungsfrage:
Frage nach persönlicher Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
Würden Sie mir bitte ein wenig von Ihrer Vergangenheit erzählen?
Von Ihrer Kindheit?
Wo und wie sind Sie aufgewachsen?
Fragen zur Lebenssituation:
Wie leben Sie gegenwärtig, was machen Sie zurzeit?
Wie gestalten Sie Ihren Alltag?
Gibt es Pläne, die Sie für die Zukunft haben?
Gibt es etwas, das Sie erreichen möchten?
Frage nach subjektiven Belastungen:
Gibt es Schwierigkeiten, die die Gestaltung des Alltags erschweren und mit der eigenen Behinderung in Verbindung gebracht werden?
Frage nach kognitiven Situationseinschätzungen:
Frage nach der Definition von "Lebensqualität", von "Glück", von "Leid".
Was bedeutet für Sie Lebensqualität?
Was bedeutet für Sie Glück?
Was bedeutet für Sie Leid?
Frage nach der Definition von "Herausforderung".
Was verstehen Sie unter einer Herausforderung?
Frage nach der Definition von "Norm" und "normal".
Was bedeutet normal?
Wie würden Sie Normalität definieren?
Frage nach der Definition von "behindert sein" und "behindert werden".
Was bedeutet für Sie "behindert sein"?
Was bedeutet für Sie "behindert werden"?
Frage nach der Erinnerung an ein Erlebnis mit dem Gefühl "nicht dazuzugehören".
Können Sie sich an ein Erlebnis oder ein Ereignis erinnern, bei dem Sie das Gefühl hatten, da gehöre ich jetzt nicht dazu?
Oder ein Erlebnis oder Ereignis, wo Sie dachten: Ich bin anders?
Frage nach Reaktionen und Verhaltensweisen "anderer", die immer wieder erlebt werden.
Wie verhalten sich andere Menschen Ihnen gegenüber?
Wie reagieren diese auf Ihre Behinderung?
Frage nach der Begründung für bestimmte erlebte Reaktionen von Nicht-Behinderten.
Warum reagieren Menschen so?
Frage nach möglichen Bewältigungsversuchen:
Ereignisse, die Sie belasten; Verhalten anderer, das Sie stört - wie gehen Sie damit um?
Schlussfrage:
Mit meinen Fragen bin ich nun am Ende angelangt. Für mich wäre es noch interessant zu erfahren, ob Sie noch Ergänzungen haben oder Bereiche für wichtig halten, die nicht angesprochen wurden?
1. Interview A, am 19. 10. 2004
Also, ja, größtenteils im Heim aufgewachsen; also vorher Krankenhausheim, ab und zu war ich mal bei meinen Eltern, aber, ja, allzu großen Teil im Krankenhaus oder Heim.
Bin halt zu Hause und hab also Einzelbetreuung. Verbringe meinen Tag so wie ich grad Lust zu hab, manchmal geh ich spazieren oder ins Kino oder bin auch viel zu Hause, ja dann ist ja auch, durch die Krankengymnastik, ist wieder ein Teil weg. Also, ich hab 5 Stunden Pflege am Tag, organisiere das halt - also was ich eben brauche für den Tag - selbständig. [Und ihr wohnt zu zweit hier?] Ja.
[Pläne, Wünsche für die Zukunft?]
Nein, eigentlich nicht.
[Schwierigkeiten im Alltag, die mit der Behinderung in Verbindung gebracht werden?]
Also für mich ist schwierig z. B. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da ist einmal auch die Orientierung - ich hab nicht so gute Orientierung - was ich natürlich vielleicht auch noch trainieren kann, könnte, aber dann auch noch, ja in den Bus erst mal hinein zu kommen, das ist schon sehr schwierig. Du musst ja dann mal kämpfen, können Sie mal Platz machen? Ja, das find ich schon sehr schwierig. Wir haben hier auch einen Telebus [Behindertenfahrdienst], aber das wird eben auch - weil's so teuer ist - zunehmend schwieriger. Das heißt, wenn ich was planen möchte, muss ich ja mindestens eine Woche vorher das planen und das empfind ich als schwierig, weil dann hab ich es geplant, und wie es dann ist, mag ich vielleicht dann nicht mehr. Also Spontaneität ist da nicht so. Aber zu meiner Behinderung: da hab ich nicht so Probleme, ich kann mich jetzt ganz gut annehmen. Ich bin auch so bestrebt, das, was ich kann, auch zu machen. Ja manchmal vielleicht auch über meine Grenzen zu gehen. Das kannst du dir vielleicht jetzt nicht so vorstellen, aber ich könnt schon einmal am Tag alleine einen Transfer machen, also von der Toilette in den Rollstuhl und aufstehen, aber es ist schwierig, für den weiteren Verlauf brauch ich dann doch Unterstützung. Es kostet mich halt sehr viel Energie, aber es ist mir wichtig, und dadurch bleibt mir dann nicht mehr so viel Kraft für Außenaktivitäten, obwohl ich schon gern ins Kino geh.
[Lebensqualität?]
Also, Lebensqualität, ja, dass ich das kann, also dass ich das was ich kann, mir erhalte. Also für mich wäre es halt keine Lebensqualität, wenn ich nur auf Hilfe angewiesen wäre; mit Toilettengehen also, das ist mir zu wichtig, wenn das wegfallen würde, das ich da Hilfe brauchen würde, das wäre für mich, oder ist für mich einfach undenkbar. Ich hab eine Zeit auch einen neuen Rollstuhl gehabt, also bekommen, da haben sich Probleme eingestellt, da musste ich halt auch ganz schön kämpfen und war auch sehr wütend, weil ich gedacht hab, ich schaff das nicht: jetzt brauch ich vielleicht, jetzt kann ich z. B. nicht mehr auf dir Toilette und hab es mir dann auch erarbeitet, weil ich gesagt habe, nein, also, Lebensqualität bedeutet alleine, also einmal oder zweimal am Tag Toilettengänge zu machen oder halt aufzustehen, ja, wenn das wegfallen würde, ja, dann wüsste ich nicht. Ja, dass ich wirklich mein Leben auch bestimmen kann, dass ich sagen kann: heut will ich das machen und das will ich nicht machen; z. B. bei Krankenhäusern und im Heim ist es ja so, da wurde ja viel bestimmt, da wurde man nicht gefragt, möchtest du das lernen, sondern wurde einem aufdiktiert, du hast das jetzt zu machen, ob man will oder nicht. Das fand ich halt irgendwie sehr schlimm. Und auf der einen Seite bin ich auch wiederum dankbar, dass sie so streng waren, weil dadurch hab ich jetzt halt für mich auch eine Lebensqualität. Also sehe ich so im Nachhinein.
[Glück? Leid?]
Also hier mit ihm zusammen zu wohnen halt und sich zu verstehen und einfach Harmonie, also dass der Alltag so harmonisch abläuft, dass man was machen kann. Oder für mich ist auch Glück, wenn ich einmal ganz entspannt im Bett liegen kann und fernsehen kann.
Leid, das ist, wenn ich heut Schmerzen hab, ich bin oft ein bisschen depressiv, das macht mir halt zu schaffen.
[Herausforderung?]
Jetzt im Moment, das mit dem neuen Rollstuhl; zu lernen also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu recht zu kommen, zu orientieren; eventuell auch mal ohne Einzelbetreuung leben zu können, also nur mit Pflegeassistenz, wäre mal so eine Herausforderung, oder so eine Idee von mir. Ja, mit meiner neuen Sozialarbeiterin, das funktioniert halt nicht so, also menschlich ist das in Ordnung aber wenn es dann so um Arztbegleitung geht, ist dann schon wieder schwierig. Da denk ich mir schon manchmal, ist schon einfacher mit Assistenz zu gehen, da muss ich nicht so viel planen. [Du lebst mit Assistenz und Sozialarbeiterin?] Ja genau. Dummerweise ist das an die Wohnung hier gebunden. Ich wollt mich mal erkundigen ob das rechtens ist hier, ob ich wirklich raus muss, wenn ich mich verselbständige. Ob ich hier raus muss, wenn ich mich nicht von den sozialen Mitarbeitern betreuen lasse. Die Wohnung ist für mich halt so zugeschnitten, eine andere Wohnung wäre für mich ein Unfallrisiko, mit dem Fallen. Hier bin ich ja trainiert. Deshalb bin ich nicht erpicht, hier auszuziehen. Aber das muss ich dann mal sehen. Das ist so ein Ziel vielleicht, zu gucken.
[Normalität?]
Normal wäre, wenn ich ohne weiteres die BVG benutzen könnte. Oder wenn ich jetzt halt ganz normal arbeiten könnte. Ich hab es nicht so geschafft, eine Ausbildung zu machen, aus körperlichen und psychischen Gründen. Und dann noch die Werkstatt: eine Werkstatt ist für mich nicht Normalität, weil ich bin ja nicht irgendwie geistig behindert, bin körperbehindert, ja, wäre für mich Normalität gewesen in eine Schule integriert zu werden. Hier bin ich jetzt in einem Wohnfeld - wohnen ja hier Nichtbehinderte und Behinderte - das find ich als normal jetzt.
[behindert sein, behindert werden]
Behindert werden, das ist, wenn ich z. B. ein Gebäude nicht aufsuchen kann. Wenn alles zugänglich wäre, dann würde ich mich gar nicht als behindert fühlen. Die Umwelt, die macht es eigentlich, dass ich behindert bin. Na ja, ich kann mich ja nicht so bewegen, also überall sind Stufen, und na ja, für mich ist die Behinderung - ich bin ja so geboren - normal. Ich kenn ja nichts anderes. Wenn das jetzt alles so eingerichtet wäre, wäre ich ja für meine Begriffe nicht behindert. Also ein Stück Behinderung bleibt mit dem An- und Ausziehen, wäre ja nur ein kleiner Teil, der größte Teil liegt ja auch in der Gesellschaft, dass man eben behindert wird. Also ich empfinde es so. Also z. B. bei Ärzten: o. k., ich brauch halt jemanden, der mich begleitet, weil ich hab manchmal Probleme, einfach etwas aufzunehmen, aber ich bin ja nicht geistig behindert, ich bin körperbehindert. Dann passiert es mir oft so, dass der Arzt mit meiner Begleiterin spricht, statt zu sehen, ich bin ja der Patient. Sie ist ja eigentlich nur dazu da, mir Hilfestellung zu geben. Z. B. sag ich: "Pass auf, dein Job ist es, hör bitte zu, weil ich nicht so schnell aufnehmen kann und erklär es mir nochmals in Ruhe, weil der Arzt hat nicht Zeit, es nochmals alles zu erklären." Und dadurch wird mir auch meine Behinderung dann wieder bewusst. Würden sie auf mich direkt zugehen, würde ich das nicht so empfinden.
[Erinnerungen an Situationen mit dem Gefühl "nicht dazu zu gehören"]
Na ja, die BVG z. B., also entweder sie helfen gar nicht, oder sie helfen so überfürsorglich, dass man dann mit der Hilfe auch nichts anfangen kann. Sie wollen den Rollstuhl einfach so anpacken, wo ich dann sage, das geht so jetzt nicht, weil sie können den eh jetzt nicht so zur Seite rücken. So eine Situation kommt halt auch oft, oder auch so: die steht hier im Weg, also nehme ich sie mal - ganz konkret beim Arzt: ich hab richtig Angst bekommen, weil der hat mit blockierten Bremsen versucht, den Rolli zu bewegen. Dann bemerk ich das schon, dass ich irgendwie eigentlich nicht existiere als Mensch, ich bin so ne Art Möbelstück, "das rück ich mal kurz zur Seite, weil ich möchte da mal durch." - Das kann ich jetzt so als konkrete Situation sagen.
Ja sie sind unsicher, sie wissen nicht, wie soll ich jetzt auf einen Menschen mit Behinderung reagieren? Das ist einfach so, weil sie es nicht wissen. Weil sie nicht so oft damit in Berührung kommen. Ich selber merk manchmal, dass ich dann doch nicht so mag, einfach raus zu gehen, weil ich mir den Stress auch nicht antun will jetzt, zu kämpfen, ob ich jetzt mal bitte den Platz da bekommen könnte, oder so. Kostet mir zu viel Energie, eigentlich wäre es ja besser, das zu tun. Es sind offensichtlich noch zu wenige Behinderte auf der Straße, so dass es exotisch wirkt. Wenn jetzt z. B. mehr Behinderte auf der Straße wären und es alltäglich wäre, dass man jetzt mit dem Bus fährt, also vermehrt, dann wäre es vielleicht für die Menschen, für die Nichtbehinderten, normaler. Und dann bekommen auch viele das Bild vermittelt, die sind doof, und ja, die zucken, z. B. Spastiker, das sieht für die sowieso schon mal ganz böse aus. Da ist zu wenig Aufklärung. Ich hab es mal mit einem Kleinkind erlebt. Das fand meinen Rollstuhl ganz toll und wollte da mal gucken. Ich hatte nichts dagegen, weil Kinder dürfen alles fragen, die wollen ja lernen. Und die Mutter riss das Kind einfach vom Rollstuhl weg. Aber es war ja keine Gefahr, ich hatte ja alles ausgestellt: "Nun komm da mal weg", da meinte das Kind dann so: "Die hat ja auch einen Baggi, warum sitzt die im Baggi?", "Na weil sie das Bein gebrochen hat". So eine Antwort halt, ja, ich denk mir immer, kann sie es ihm wohl richtig erklären: kann halt nicht laufen, ist so geboren; versteht auch ein dreijähriges Kind, denk ich mir. Ich denk auch, dass sie so reagieren aus Angst, ja, mich anzusprechen, mich was Falsches zu fragen, mich zu verletzen, und dann lieber schnell weg, dann kann ich ja nichts Falsches machen.
Oder was ich auch manchmal sehr behindernd finde, ich kann ja nicht so gut mit Kleingeld bezahlen, das dauert dann eben, dann frag ich dann: können Sie mir mal helfen? und oft ist es dann so: "ich hab jetzt keine Zeit, bezahlen Sie mal mit einem großen Schein". Aber ich kann ja nicht immer mit einem großen Schein bezahlen. Dann hab ich auch so Sachen erlebt, z. B. bei der Sparkasse, wollt ich Geld abheben, also, "können Sie mir Ihre Reihen sagen, dann helfe ich Ihnen Ihre Karte da reinstecken." Also das find ich ja ganz nett, aber ich würde es nie tun, dann ist sie ja weg. Sind schon solche witzigen Situationen; wurde jetzt grad eingerichtet, die Sparkasse, und dann wollt ich Geld einzahlen und kam da nicht ran, da meinte sie, "da müssen Sie das Geld jemanden geben". Ich sag, ich gebe doch nicht jemanden Fremden mein Geld, würden Sie auch nicht tun. So ganz selbstverständlich: Behinderte haben das zu machen. Und so was ärgert mich dann wiederum, die wussten ja, die bauen um, da könnten sie doch gleich tiefer bauen, gibt doch schon länger Rollstuhlfahrer hier, ganz viele. So was ärgert mich dann.
2. Interview B, am 22. 10. 2004
Ich bin 1977 hier in Berlin geboren, also 27 Jahre alt, habe eine sehr schöne Kindheit erlebt, habe noch einen Bruder, der nicht behindert ist, also wir sind familiär halt, sag ich mal, normal aufgewachsen. Mein Bruder ist nicht behindert, und das hat mir in meiner persönlichen Entwicklung sehr geholfen, also, wenn ich jetzt als Einzelkind geboren wäre, weiß ich nicht, dann wäre mein Leben sicher anders verlaufen, also einfach weil man nimmt sich ja den älteren Bruder als Vorbild auch so ein bisschen, nein das war alles sehr unverkrampft, meine Eltern haben mich auch so erzogen bzw. ganz normal auch jetzt ohne großartig so: "oh, mein Gott, unser Sohn ist behindert, wir müssen ihn jetzt von vorne bis hinten bemuttern" und also, elterliche Liebe war immer dabei, aber so mit Lifter oder speziellem Pflegebett, also alles was da so dazugehört, war halt nicht so, bei meinen Eltern so vorhanden, hätte sein können aber die Situation war so, dass meine Eltern gesagt haben: "nein, unser Sohn soll nicht gleich so mit Hilfsmittel voll gestopft werden". So ein bisschen das Normale kennen lernen, was natürlich auch ein bisschen physische Anstrengung manchmal für meine Eltern bedeutet hat, so mit dem Umsetzten, ich bin ja nicht in der Lage mich irgendwie so zu bewegen, also Laufen jetzt beispielsweise, aber im Rollstuhl schon, aber wenn ich den Rollstuhl nicht hätte, würde es halt nicht gehen. Und ich hab mit 5 Jahren meinen ersten Rollstuhl erst bekommen, bis dato saß ich im Baggi, das war mit zunehmendem Alter auch schwierig, weil wenn man dann einkaufen gegangen ist, hat man schon so etwas skeptische Blicke von älteren Herrschaften gekriegt, "du bist so ein großer Junge, steig doch mal aus deinem Kinderwagen aus, und, die arme Mutter". Die haben halt nicht begriffen, dass es zu der Zeit für mein Alter noch keinen Rollstuhl gab, also ich hab erst mit 5 dann einen richtigen Rollstuhl bekommen.
[also Sie sind bei Ihren Eltern aufgewachsen?]
Ja, absolutes intaktes Familienleben, war sehr schön. Ich hab eine ganz normale Grundschule besucht, dann bin ich weiter gegangen auf eine Körperbehindertenschule, und hab dann da 2x meinen Hauptschulabschluss bestätigt bekommen. Und bin seit 9 Jahren berufstätig bei einem Dienstleistungsunternehmen hier in Berlin, im kaufmännischen Bereich.
Also, mein Alltag sieht so aus, ich mache gerne Sachen mit Computer, ich hör gerne Musik, ich hab auch eine Zeit lang im Chor gesungen, in einem Integrationschor, mit Behinderten und Nichtbehinderten, das war eine sehr schöne Erfahrung, auch sehr schön unverkrampft, war einfach schön, wir hatten auch schöne Konzerte, ja, war einfach schön, und dann les ich auch ab und zu, mal eine kleine Kurzgeschichte les ich schon ganz gern, und bin durch meine berufliche Tätigkeit auch sehr eingespannt, macht mir auch sehr viel Spaß, ich kann wirklich sagen, ich hab mein Hobby, die Arbeit am PC, zum Beruf gemacht. Ich bin Vermittler zwischen dem Kunden und unserem technischen Bereich, also wir machen Gebäudemanagement, der Kunde ruft bei uns an und bestellt z. B. eine Fensterreinigung, und diesen Kunden betreu ich dann, ja, also alles was Kalkulation angeht, Preisgestaltung usw.
Pläne für die Zukunft gibt es viele, also, ich hab noch vor, Reisen zu machen, bin sehr reiseinteressiert und auch sehr reiselustig, das ist jetzt ein paar Jahre eingeschlafen, aber ich bin grad dabei für mich wieder was neues zu entdecken. Seit 2002 leb ich allein, also ausgezogen von meinem Elternhaus, und ja, weil es doch was anderes ist, wenn man alleine wohnt, die ganze Planung usw., also was ja sonst doch normalerweise die Eltern für einen ein bisschen mit übernommen haben, ja das muss man doch dann alleine planen - aber ich bin da schon wieder dran und in absehbarer Zeit möchte ich wieder mal verreisen. Oder mit meiner Lebensgefährtin geht es ganz gut, wir verstehen uns sehr gut und vielleicht gelingt es uns, die Beziehung so weit zu festigen, dass eine spätere Hochzeit nicht ausgeschlossen ist. Ich denke, ja, das sind so erreichbare, ja Wünsche, das würde jetzt zu weit gehen, ja, aber das sind so die Beispiele.
[Probleme, die m Alltag auftreten und mit der Behinderung in Zusammenhang gebracht werden?]
Alltagsprobleme gibt es immer, aber ich denke, ich hab sie ganz gut im Griff soweit, also wenn ich einmal meine berufliche Laufbahn so nehme, also ich bin ja tätig als kaufmännischer Angestellter und arbeite so mit Akten, also schon der Aktentransport ist für mich in dem Rahmen halt nicht so möglich, eben weil ich im Rollstuhl sitze, und da habe ich keine Probleme damit mal einen Kollegen zu bitten, können Sie mir mal die Akte herunter geben vom Schrank, ich muss da jetzt was machen. Es ist immer eine Sache, wie man es organisiert. Hier im privaten ist es ganz klar abgesichert durch die Assistenz, also ich geh mit Assistenz einkaufen, ich geh mit dem Assistenten auch mal ins Kino, ja aber ansonsten gibt es also schon so Situationen, aber da müsst ich jetzt sehr darüber nachdenken, manchmal kommt man auch von einer Situation, also von hier auf gleich, gewissermaßen, hier jetzt ein Beispiel zu nennen, ist ein bisschen schwierig, ja, also ich denk, es läuft ganz gut.
[Frage nach der Lebensqualität?]
Lebensqualität ist für mich, wenn ich quasi etwas tue, was mir Spaß macht, also wenn ich es schaffe neben der Arbeit - wobei die Arbeit ganz klar für mich zur Lebensqualität dazu gehört - auch so für mich mal so lebe, mal schöne Musik höre, rausgehe, zum einkaufen, also das ist für mich, das alles ist Lebensqualität. Ich muss mich wohl fühlen, es gehört ganz klar die Arbeit dazu, weil die Arbeit ist für mich ein ganz wichtiger Teil, wenn ich nicht arbeiten würde, ganz klar, würde ich nicht das Geld bekommen, um mir etwas schönes für mich ganz persönlich leisten zu können, ins Kino zu gehen, ja wie gesagt raus zu gehen, Musik zu hören, in Konzerte usw., das ist alles für mich Lebensqualität. Und die Assistenz sichert das ganz klar für mich auch ab, also, auch wenn ich hier zu Hause Tätigkeiten mache, die zum Haushalt dazu gehören, auch das ist für mich Steigerung der Lebensqualität, ich bin eine sehr ordentlicher Mensch, ich hab es gern ja gemütlich, ordentlich, ich mach mir ab und zu auch mal eine Kerze an, das alles ist für mich Lebensqualität, es muss für mich rund sein, ich muss mich hier wohl fühlen und das ist für mich ganz klar so.
[Frage nach Umschreibungen der Begriffe Glück und Leid?]
Glück, ja wie soll ich jetzt Glück definieren? Also, ich denke das ist ein ganz, also, wenn ich jetzt z. B. was schönes sehe, was schönes erlebe, dann macht mich das schon glücklich, oder also meine Lebensgefährtin hat grade Abitur bestanden, das ist für mich schon auch ein gewisser Glücksmoment weil ich sie da hindurch begleitet habe, weil wir echt zusammen standen und das gemeinsam durchlebt haben, das mit zu bekommen, die Abiturverleihung und so, das ist dann schon ein ganz klares Glücksgefühl. Es sind so Situationen, beispielsweise wenn ich auch etwas geschafft habe, in der Arbeit, hab ein gutes Gespräch mit einem Kunden gehabt, das macht mich dann einfach glücklich, weil die Energie, die ich aufgebracht habe in meiner Tätigkeit, ganz egal ob im geschäftlichen oder privatem, hat Erfolg gehabt, und das macht mich dann schon sehr glücklich.
Leid, ja, Leid ist jetzt, wenn was ganz schlimmes passiert, also, z. B. hatten wir, also meine Lebensgefährtin hatte eine schwierige OP vor sich und hat sie jetzt abgeschlossen, ist frisch operiert, also ist jetzt fertig damit, und ich leide dann schon sehr darunter, also es ist nicht immer das persönliche Leid, also, sondern auch das, was man so mitbekommt, im politischen Bereich, ich bin auch sehr politisch interessiert. Der Rechtsruck, der hier in Deutschland leider gerade wieder an Popularität gewinnt, zumindest kommt es mir so vor, darunter leid ich schon, also wenn man es mitbekommt durch die Nachrichten usw. das macht mich schon traurig; ist ja auch schon Leid, also ich denk, da gibt es so drei Facetten, einmal das persönliche Leid, wenn es mich selber betrifft, das Leid von anderen mir nahe stehenden Menschen und das was so im Gesellschaftlichen passiert.
[Herausforderung?]
Herausforderung ist eigentlich jeder Tag, also aufzustehen, sich selber Ziele zu setzten, sie nach Möglichkeit, so gut es eben geht, sie zu erreichen, das ist, ja, das klappt nicht immer, aber ich denke schon, da kann ich auch Beispiele bringen aus meiner Arbeitssituation, das passiert täglich, dass man was erreichtoder eben auch nicht, also, aber man muss sich schon bemühen, also, für mich ist es ganz klar, wenn ich aufstehe, also wenn der Tag beginnt, werde ich ja jeden Tag herausgefordert, also jetzt nicht unbedingt negativ besetzt, würde ich sagen, das ist schon eine Herausforderung, jeden Tag zu erleben, also, man wird da schon gefordert, auch im positiven Sinn.
[Normalität?]
Normalität, also ich hab ein Problem mit dem Begriff, also nicht mit dem Begriff an sich, weil, also für mich ist mein Leben normal, weil das ist mein Leben. Und für andere Leute ist wieder ein anderes normal, also der Begriff Normalität, also, in meinem Privatleben, die Assistenz ist für mich Normalität damit zu leben, mit meiner Familie umzugehen ist für mich Normalität, mit Kollegen umzugehen ist für mich Normalität, also Normalität ist, ja, der Begriff, kann man nicht so sagen, Normalität, also, ich find das ist für jeden unterschiedlich, also, ich denke schon, mein Leben, so wie es jetzt läuft und gut weiter laufen wird, ist für mich Normalität. Wenn ich raus geh auf die Straße, dann ist für mich das was ich dort sehe, erlebe, was ich dort mache, auch Normalität und wenn ich arbeite, dann ist das für mich auch Normalität, also das ganze Leben ist für mich so wie ich lebe Normalität, es mag für jemanden anders wieder anders aussehen, aber für mich ist es, ja, normal. Mit dem eigenen Handicap umzugehen, Herausforderung, haben wir ja grad besprochen, also jeder Tag ist für mich eine Herausforderung, aber das ist für mich, ja, meine Normalität, einfach zu leben, Spaß am Leben zu haben, das ist für mich normal, meine Normalität.
[behindert sein und behindert werden?]
Behinderung ist, also wenn man es mal an einem Beispiel festmacht, ich bin behindert aber ich sehe mich nicht so. Aber für andere Menschen bin ich behindert, die Behinderung an sich ist für mich kein Problem, weil ich nehme mich so an wie ich bin, die Behinderung findet eher so beim Einkaufen statt, dass man halt einkaufen geht, also ein Beispiel, man will an ein Regal ran und kommt da nicht ran, ich muss halt den Assistenten bitten, mir etwas runter zu holen, oder wenn der Gang zu schmal ist, das ist für mich Behinderung, das muss nicht sein, aber mit der Behinderung an sich hab ich kein Problem, weil ich bin ich, das ist für mich normal. Im Straßenverkehr ist auch ganz klar eine Behinderung wenn der Bordstein zu hoch ist, muss ich auch sehen, wie ich da rüberkomme. Ich würde mir nicht zutrauen große Wege jetzt alleine zurück zu legen, also hier in der Siedlung, am Markt das würde noch gehen, aber auf der Straße, ja, da hab ich Probleme. Also ich alleine im Straßenverkehr, ist nicht mein Ding. Weil ich auch nicht dreidimensional sehe, sondern nur zweidimensional, also, da schlägt dann mein Handicap voll zu. Aber es ist kein Problem, ich komme ja trotzdem raus, aber halt alleine ist es doof.
[Erinnerung an Situationen, verbunden mit dem Gefühl, nicht dazu zu gehören]
Oh ja, oh ja, also in der Schule war es so, ich bin ja auf eine Grundschule gegangen, es ist ja eine Integrationsschule, wo Behinderte und nicht Behinderte zusammen gehen, also Integrationsklassen. Wir waren damals in der Klasse 15 Schüler insgesamt, davon drei behinderte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich, genau so wie es auch im Privatleben war, also in meiner Familie, gut vorbereitet in meinem weiteren Lebensweg, also ich war immer schon daran interessiert, was vor meiner Haustüre passiert, also jetzt nicht unbedingt immer nur mit Rollstuhlfahrern zusammen, sondern halt beide, weil ich denke, beide Seiten können sich auch nur, ja, ich find es halt wichtig, dass beide Seiten aufeinanderzugehen, beide sagen, hier sind wir, und, ja ich denke schon, wir sind hier in Deutschland noch ein bisschen weg von der Normalität, damit meine ich nichtmeine persönliche sondern es, ja ich muss halt ganz klar sagen, es wird von der Gesellschaft noch nicht so wahrgenommen, auch wenn man als Gehandikapter in seinem privaten Umfeld Normalität für sich selber geschaffen hat, aber die Normalität hier, also draußen in der Gesellschaft, ist längst nicht so, obwohl wir da, ich denke, auf gutem Weg sind. Und ich bin halt ein Anhänger des integrativen Gedanken, ja, miteinander, nicht jeder für sich, sondern, nur wenn man aufeinander zugeht, ist jetzt egal ob gehandicapt oder nicht, wenn man aufeinander zugeht, dann kann man, ich sag mal, die Welt verändern, bisschen besser machen, also ich denke, jeder hat in seinem Leben eine Aufgabe, jetzt nicht dass ich sag, ich will jetzt die Welt unbedingt besser machen, aber wenn ich es geschafft habe mir Freunden, mit Bekannten etwas gemeinsam zu machen und es dann quasi weiter getragen wird, dann wird's einfach für uns alle angenehmer.
Ja, in der Schule war ganz klar, na ja, Hänseleien gab es schon und damit ganz klar auch Verletzungen, also "Krüppel", "Spasti", ja aber auch da war für mich erstaunlich zu sehen, dass meine Klassenkameraden immer geholfen haben, also ich durfte mir der Unterstützung meiner Klassenkameraden durchaus sicher sein, wenn jemand auf der Straße gesagt hat, wenn wir unterwegs waren, "he du Krüppel", dann standen die schon da und haben gesagt, "he sag mal", also einmal hab ich ja selber gelernt, denjenigen dann darauf anzusprechen, wie er jetzt dazu kommt, mich so zu betiteln, aber das war schon interessant, auch so diese Sensibilität von Nichtbehinderten in meiner Klasse, also es war eine sehr schöne Klassengemeinschaft. Dann gibt es hin und wieder mal Situationen beim Einkaufen, ganz klar, wenn ich jetzt z. B. an der Kassa steh und man kramt da mit dem Kleingeld und man kommt nicht so schnell damit zurecht, ja aber ich mach es halt dann schon so, weil ich halt feinmotorisch nicht so gut drauf bin, dass ich dann der Assistenz sage, hier hast du mein Portmonee, bitte such mal das Kleingeld raus. Es gibt schon so Situationen beim Einkaufen, die Leute gucken dann manchmal so komisch, hier weniger weil die Leute hier schon gewöhnt sind in dem Areal, aber es gibt schon noch Anfeindungen auf der Straße. Also gerade von den Jugendlichen, also Samstag abends, wenn sich alle fertig machen zur Disco, dann gibt's schon so, na, zumindest komische Blicke. Obwohl, ich muss ganz klar sagen, mir macht es nichts mehr aus. Mir macht es nicht mehr so viel aus, sollen sie gucken, ich mein, ich guck ja auch. Was mich dann stört ist, wenn man auf der Straße ist und ein kleines Kind z. B. guckt, ist ja interessant so ein Rollstuhlfahrer, und die Eltern dann meinen, "der ist krank", also der sitzt halt im Rollstuhl, weil er krank ist, der hat ein kaputtes Bein oder was weiß ich, und da werd ich dann schon, das gefällt mir selber nicht, weil ich hab dann schon des öfteren mal gebracht, dass ich gesagt hab, "erzählen Sie Ihrem Kind bitte nichts falsches, das stimmt einfach nicht, Ihr Kind hat die Möglichkeit mich zu fragen." Ich hab da so eine kindgerechte Version, ich sag dann halt, ich kann nicht laufen, weil Frühgeburt. Ich hab zu wenig Sauerstoff bekommen und das Zentrum das das Laufen steuert, ist halt bei mir defekt, also gibt es nicht. Und dann sind die immer ganz erstaunt, die Eltern, wenn ich dem Kind das so erkläre, wie es dazu kommt, nämlich Frühgeburt, zu wenig Sauerstoff bekommen, ja und dann sind die Eltern immer ganz erstaunt, wie jemand, der gehandicapt ist, so offen mit seinem eigenen Handcap, sag ich mal, umgehen kann und es anderen erklären kann, weil sie wissen es selber nicht und kürzen es für ihr Kind gleich mal so ab, der ist halt krank oder der hat ein gebrochenes Bein oder was weiß ich und, es traut sich halt keiner zu fragen, he, du sitzt im Rollstuhl, warum sitzt du im Rollstuhl? Also, erleb ich ganz, ganz selten.
[Warum fragen die Leute nicht?]
Ja das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich bin ein offener Mensch, ich hab kein Problem damit, ich hab dann ein Problem damit, wenn so falsche Informationen einfach weiter gegeben werden, weil man manifestiert ja dann so ein Bild, das Bild wird ja dann quasi weiter getragen, wenn die Mutter oder der Vater seinem Kind sagt, jemand der im Rollstuhl sitzt, der ist halt krank oder hat halt ein gebrochenes Bein, ja, ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr, offener damit umgegangen würde.
Ich weiß nicht, wie man es generell löst. Ich denk, jeder muss so seinen Weg finden, also ich hab kein Problem gefragt zu werden, warum kannst du das nicht? Also, ich hab kein Problem, mich damit auseinander zu setzen. Ich denke, das Interesse ist schon gewachsen, es wird ja auch in den Medien berichtet über Menschen mit Behinderung, es ist ja kein so großes Tabuthema mehr. Die Frage ist nur, wie wird es dann in der Familie, sag ich mal, aufbereitet. Aber Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, werden sich immer umdrehen, immer gucken, die wird's immer geben. Man kann den Leuten ja nicht verbieten zu gucken, sollen sie. Bloß, wie schafft man es dann, dass Leute sich trauen zu fragen? weiß ich nicht. Ich denke, das ist auch schwierig, also man kann halt immer nur das Angebot machen.
3. Interview C, am 10. 11. 2004
Aufgewachsen bin ich in meinem Elternhaus mit meinem nicht behinderten Bruder. In einer Kleinstadt am linken Niederrhein bei Duisburg.
Ich lebe alleine, mit "rund um die Uhr" - Assistenz und war, nein bin noch bis Ende des Monats erwerbstätig und werde dann arbeitslos werden und gehe davon aus, dass ich danach auch nicht noch mal eine Arbeitsstelle bekommen werde.
Die Assistenten hab ich mir selbst gesucht und als sogenannte "behinderte Arbeitgeberin" angestellt. Ich habe 24 Stunden Assistenz und es werden tatsächlich alle 24 Stunden bezahlt. Also es gibt keine Nachtpauschale, jede Stunde, die die Assistenten arbeiten, wird bezahlt. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich tatsächlich zu jeder Zeit auf die Leute zurückgreifen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, dass sie dafür nicht bezahlt werden was sie machen.
[Pläne für die Zukunft?]
Nein, leider nicht! Also, das ist glaub ich mein größtes Problem. Ich hab halt eine fortschreitende Behinderung und bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich mit 27 sterben werde, jetzt bin ich 41 und mein größtes Problem ist einfach, dass ich mir für dieses Alter keine Gedanken mehr gemacht habe. Jetzt steh ich an dem Punkt, dass ich mir überlege, was ich halt mit den restlichen Jahren mache, und, also Wünsche zu entwickeln, Ziele zu entwickeln ... ich finde das einfach total schwierig, Wünsche zu entwickeln, weil alles das, was ich mir wünschen könnte ... da sagt mir mein Kopf, dass es eh nicht zu realisieren ist. Was auch ganz viel einfach mit meiner Assistenzbedürftigkeit zu tun hat.
[Wenn Sie nochmals zurückblicken in die Vergangenheit, welche Ausbildung haben Sie gemacht?]
Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin. Also ich hab erst sehr lange Jura studiert, 18 Semester, weil ich halt gerne Menschen mit Behinderung juristisch vertreten hätte, gerichtlich und außergerichtlich. Und habe das leider nicht geschafft und habe dann eine Ausbildung oder ein Studium als Sozialarbeiterin gemacht und habe danach noch eine Qualifikation gemacht zur Peer Counclerin, Hospizhelferin und in systemischer Familienberatung.
[Schwierigkeiten, Probleme im Alltag, die Sie mit ihrer Behinderung in Zusammenhang bringen?]
Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, die in meinen Alltag auftreten und nicht mit meiner Behinderung zu tun haben. Also, das kann ich überhaupt nicht mehr trennen. Das einzige also was ich ... mir ist halt Ordnung und Sauberkeit in meiner Wohnung sehr wichtig. Das sind, denk ich, meinen höchsten Werte. Das ist etwas, dass ich von meiner Mutter übernommen habe, die nicht behindert war. Das ist tatsächlich ein Problem, weil ich immer unzufrieden bin wie meine Wohnung aussieht und ich die halt immer noch ein bisschen sauberer hätte und noch ein bisschen sauberer. Also ich glaub, das ist unabhängig von meiner Behinderung. Aber ansonsten, glaub ich, stehen meinen alltäglichen Probleme schon im direkten Zusammenhang zu meiner Behinderung.
[Lebensqualität?]
Lebensqualität...? Ein Kriterium für Lebensqualität ist sicherlich die Möglichkeit, in ausreichendem Maß Hilfe und Unterstützung zu bekommen, wenn man so wie ich darauf angewiesen ist. Lebensqualität ist für mich verbunden mit einer ausreichenden finanziellen Sicherung. Aber Lebensqualität hat für mich vor allem mit eigener Genussfähigkeit zu tun, also die Lebensqualität als solche zu empfinden. Das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich ... also ich glaube, dass ich die Lebensqualität, die ich mir tatsächlich geschaffen habe nicht als solche empfinde.
Lebensqualität hat für mich ganz viel zu tun, ... eben ... dass man die Möglichkeit hat einfach ... das, was man geschaffen hat zu teilen mit jemandem, also über das Mitteilen hinaus halt auch mit jemandem zu teilen.
[Frage nach der Definition von Glück und Leid]
Für mich bedeutet Glück Zweisamkeit, teilen, also Leben teilen, alles das, was man sich geschaffen hat, was man schaffen möchte, Ziele zu teilen, Wünsche zu teilen. ...Glück ist ... für mich, also für mich versuche ich immer Glück als Abwesenheit von Leid zu definieren, ... dass ich halt sage, eigentlich müsst ich mich glücklich schätzen, weil ich nicht krank bin. Eigentlich müsste ich mich glücklich schätzen, weil ich eine schöne Wohnung habe, weil ich eigentlich alles habe was man braucht um glücklich zu sein. Und Leid ...? ... was ist Leid?
Mit dem Begriff Leid kann ich eigentlich sehr, sehr wenig anfangen, also das ist einfach nicht mein Begriff. Ich kenn den Begriff Leid in dem Zusammenhang oder in dem Begriff Mitleid, ja, das ist etwas von dem ich weiß, dass Menschen wie ich sich das nicht wünschen wollen. Ich denke auch, dass es etwas ist, was ich mir nicht tatsächlich wünsche, sondern eher Mitgefühl für meine Situation.
Leiden, also damit kann ich etwas anfangen, ich leide eben oft daran, wie mit mir umgegangen wird. Was weiß ich, ... im ganz normalen Alltag. Also wie fremde Menschen mich betrachten, mir gegenübertreten bzw. mich halt nicht betrachten. Darunter leide ich, also einfach an den gesellschaftlichen Verhältnissen.
Und Leiden hat ab einem bestimmten Punkt auch etwas mit körperlicher Krankheit zu tun, aber das ist etwas, das für mich einfach noch kein Thema ist, weil ich einfach noch nie so krank gewesen bin, dass ich meine körperliche Verfassung als Leid oder leiden empfunden habe.
[Herausforderung?]
Meine größte Herausforderung ist eben die, das Leben zu genießen. Also die Lebensqualität, die ich erreicht habe, auch als solche wahrzunehmen. Ja, das ist meine Herausforderung.
Also ich denke, die großen, nein das stimmt nicht, das, was andere Menschen für große Herausforderungen halten jetzt bei einem schwerstbehinderten Menschen oder bei einem schwerstpflegebedürftigen Menschen wie mir, ... diese Herausforderungen habe ich alle gemeistert ... also ich habe eine Berufsausbildung, ich habe meine eigene Wohnung, ich habe eine umfassende, gut organisierte Assistenz usw. usw. Also diese Herausforderungen, die ... ja ... also ... das ist eben auch der Tenor meiner Umgebung, ja, also: Was hast du alles geschafft! Welchen Herausforderungen hast du dich gestellt! Ja und welche Herausforderungen hast du halt auch sehr erfolgreich gemeistert! Aber das ist für mich aber auch nie die Herausforderung gewesen. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich eine Ausbildung schaffen werde. Ich hab nie daran gezweifelt, dass ich die Assistenz bekomme, die ich brauche. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es schaffen werde eine schöne Wohnung zu finden und auch zu pflegen. Aber, wie gesagt, die Herausforderung, die ich halt eben sehe, mit dieser Behinderung ein glückliches Leben zu führen, an dieser Herausforderung bin ich bisher gescheitert.
[Normalität?]
Normalität bedeutet für mich mit 41 Jahren ...verheiratet zu sein, eine schöne Wohnung zu haben oder ein kleines Haus ... 2 Kinder, möglichst ein Junge und ein Mädchen. Das bedeutet für mich Normalität ... Aber in meinem Alltag bedeutet Normalität auch behindert zu sein, weil der aller größte Teil meiner Freunde und Freundinnen tatsächlich behindert ist. In meinem Alltag bedeutet Normalität schwul oder lesbisch zu sein, weil viele meiner Freunde und Freundinnen homosexuell sind. Für mich hat Normalität vor allen Dingen immer was damit zu tun, in welchen Zusammenhängen ich lebe. Ich lebe halt in Zusammenhängen wo alles das normal ist, im Sinne von es ist üblich, es ist nichts Ungewöhnliches. Also unnormal heißt für mich einfach etwas wo ich erstmal irritiert reagiere, wo ich denke, das ist doch anders als das, was ich gewohnt bin. Für mich wäre jetzt unnormal, wenn einer meiner Bekannten oder Freunde sich faschistisch äußern würde, das wäre in meinem Lebensumfeld nicht normal.
[Behindert sein, behindert werden?]
Was fällt mir dazu ein ... das Begriffspaar "Trauer und Wut".Über die Tatsache, dass ich behindert bin, kann ich traurig sein. Kenne ich auch: andere Menschen die behindert sind und die darüber traurig sind ... manchmal. Es gibt immer wieder Situationen, wo trotz der besten Gegebenheiten ich einfach traurig darüber bin, dass ich bestimmte Sachen nicht machen kann.
Behindert werden ist für mich verbunden mit dem Begriff Wut, Wut und ungeheure Aggression, weil das für mich immer ... behindert werden, denk ich, ist eine ganz ... für mich ist beides eine ganz alltägliche Erfahrung. Also ich bin behindert und das jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe genauso, wie wenn ich abends ins Bett gehe. Und es ist so, dass ich tatsächlich jeden Tag die Erfahrung mache, behindert zu werden. Von, was weiß ich, von baulichen Gegebenheiten, von menschlicher Ignoranz, was weiß ich, von allem Möglichen. Aber bei letzterem ist es halt so, dass es das ist, woran ich verzweifeln kann, wenn ich halt merke, dass ich mit meiner Wut, mit meiner Aggression, ... letztendlich nutzt mir das nichts ... ja und ... und es ist etwas, wo ich halt immer wieder spüre, es ist die reine Ignoranz, die dazu führt, dass ich behindert werde. Gegen diese Ignoranz kann ich nur ganz vereinzelt was unternehmen ... also erfolgreich.
[Der Blick des Anderen?]
Dazu fällt mir ein, dass ... bei mir arbeiten ganz überdurchschnittlich viele Männer ... bzw. in all den Jahren haben 4, nein 5 Frauen bei mir gearbeitet. Und es gab in Deutschland mal vor Jahren eine Diskussion, dass behinderte Frauen oder eine behinderte Frau, ich weiß es nicht mehr genau, mal in der Öffentlichkeit gesagt hat, ich wünschte, die Männer würden mir hinterher blicken und mir hinterher pfeifen. Daraufhin sind natürlich alle feministischen behinderten Frauen über diese arme Frau hergefallen, weil man sich das als Frau natürlich nicht wünschen darf sondern, keine Ahnung, es ein Ausdruck des Patriarchat ist oder was auch immer. Und ich mir aber unter diesem "Frauen hinterher blicken" oder "jemandem hinterher blicken" nicht viel vorstellen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, als bei mir zum ersten mal eine sehr attraktive Assistentin gearbeitet hat. Und wir uns auf der Straße bewegt haben und ich plötzlich gemerkt habe, es drehen sich tatsächliche alle Männer um und schauen sie an. Da ist mir erst klar geworden, dass ich meistens übersehen werde und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich 3 oder 4 oder 5 Köpfe kleiner bin als die Leute und die über mich hinwegblicken, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass die Leute mich aus ihrem Blickfeld, weiß ich nicht, eliminieren.
So, das ist das eine, das andere ist, was mir einfällt zum Blick der anderen, ist meine erste Begutachtung für meinen ersten Schwerbehindertenausweis. Damals war ich 12 und ich musste mich in einem ausgesprochen hässlichen Raum von meinem Vater "Splitter-Faser- nackt" ausziehen lassen und wurde dann komplett vermessen. Also nicht nur die Länge jedes einzelnen Körpergliedes, sondern auch der Winkel, was weiß ich, in dem meine Füße, meine Knie oder sonst was sich bewegen ließen. Und da hab ich mich einfach gefühlt wie ein Stück Fleisch bei der Fleischbeschau. Für mich war das einfach ganz, ganz schrecklich, weil ich halt zum ersten mal ... ja, dass ich behindert bin, dass ich anders bin, das wusste ich schon, aber mir ist in dem Moment klar geworden, was die anderen Leute sehen; und was sie sehen, das ist halt, was weiß ich, krumme Füße, krumme Arme, krumme Beine, also alles ist krumm und stimmt nicht. Und der Arzt hat es damals auch ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht, der hat dann zum Schluss zu mir gesagt: Nein, bei Ihnen stimmt ja gar nichts, aber seien Sie froh, Sie haben eine schöne aristokratische Nase. Bis zu dem Zeitpunkt war mir nicht aufgefallen, dass an mir aber auch gar nichts stimmte ... ja das ist der Blick dann ...
[Ergänzungen]
Was ich noch ergänzen möchte, ist halt, ich glaube, dass ganz entscheidend ist für diese Begriffe wie Lebensqualität und Glück ... dass dafür halt ganz entscheidend ist, wie meine Eltern mir als Kind begegnet sind und meiner Behinderung begegnet sind. Es ist so, dass ich meinen Eltern da nicht mehr böse bin, weil ich weiß, dass sie es so gemacht haben, wie sie es konnten, also so gut wie sie es konnten. Aber tatsächlich hat es dazu geführt, dass für mich klar war, von Anfang an, dass Glück etwas ist, was nicht zu vereinbaren ist mit meinem Dasein als behinderte Frau. Oder dass Lebensqualität lediglich bedeuten kann, die Anhäufung von materiellen Werten.
Ich glaube, wenn ich so wenig anfangen kann mit dem Begriff Leid, dann hat das auch ganz klar damit zu tun, dass meine Mutter, vor allen Dingen, behindertes Leben mit Leid gleichgesetzt hat. Und immer wieder ganz empört reagiert hat, wenn sie mitbekommen hat, dass behinderte Frauen mit einer vererblichen Behinderung ein Kind bekamen. Weil es für sie einfach unverantwortlich war noch mehr Leid in dies Welt zu bringen.
4. Interview D, am 11. 11. 2004
geboren bin ich in der DDR, in Thüringen, war schon damals so schwer behindert, dass ich nicht laufen konnte, also die Muskelerkrankung hatte ich eigentlich schon von Geburt an. Es kam deshalb für mich auch - wie das in der DDR üblich war - nur eine Sonderschule in Frage, das heißt also auch nur mit Heimunterbringung. Das war für mich ein ziemliches Trauma gewesen vom Elternhaus wegzukommen. Die ersten sieben Jahre war ich auf einer staatlichen Schule, die letzten Jahre dann auf einer kirchlichen, die kirchliche war mitten in der Stadt und hatte ein paar integrative Ansätze, da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, über so was wie Zukunft nachzudenken, gleichzeitig waren dort so - die linken Ideen des Westens sind da auch angekommen, über Diakonschüler und so - und da hatten wir eben die Idee eine Kommune zu machen, wo die Schwerbehinderten ihre Pflege - über Assistenz, solche Worte kannten wir nicht - von Mitgliedern erhalten, das war halt so ein Agreement, auf der einen Seite waren wir, die wir Hilfe brauchten, bei unseren alltäglichen Verrichtungen, auf der anderen Seite waren junge Leute da, wie Künstler oder Punks oder ähnliche, die nicht so in dieses genormte DDR-sozialistische Alltagsleben sich einfügen konnten und wollten, und so ist das dann tatsächlich Realität geworden, also ich hab in der DDR, in Thüringen, ziemlich lange - d. h. also 11 Jahre DDR und dann noch mal 5 Jahre im Westen, also 16 Jahre da auf dem Land in Ost-Thüringen in einer WG gewohnt. Ich hab Theologie studiert, hab dann ein paar Jahre als Prediger gearbeitet, bei der evangelischen Kirche, war dann auch Kommunalpolitiker, nach der Wende - ja - habe Karten gelegt später, als ich bei der Kirche - na rausgeflogen bin ich nicht - es hat sich nach der Wende dann aber in der Kirche vieles anders gestaltet als ich das wollte und für gut hielt. Ja dann bin ich 1994 in Berlin gelandet als Assistenzflüchtling, weil's hier halt viel bessere Bedingungen gab und gibt, als es im ehemaligen Osten oder überhaupt außerhalb von Berlin ist.
Ja, hier bin ich seit 2000 behinderter Arbeitgeber, sitz im Vorstand von "Ambulante Dienste", dem größten Anbieter von Assistenz in Berlin, mach was im Bündnis für Selbstbestimmtes Leben, Öffentlichkeitsarbeit, hat alles sehr viel mit Assistenz zu tun - ja - Sexybilities ist auch noch eine Initiative von mir, Behinderung und Sexualität. Das streift Assistenz auch nur am Rande - das Thema ist, wie wird Behinderung auch erotisch wahrgenommen, überhaupt, wie sieht sich der moderne Mensch heute in Bezug auf Sexualität, und wie geht das mit Behinderung einher, also das ist eigentlich noch eines der größten Diskriminierungsfelder für behinderte Menschen noch, vor allem weil man da auch selbst so wenig einfordern kann, weil das Gegebenheiten sind in der Wahrnehmung. - Ja, ich glaube - ach so - Zukunft - hab ich nie gehabt - also als Muskelkranker wird einem immer erzählt, dass man demnächst zu sterben hat, von daher ist es mit Zukunftsplänen immer nicht so toll, hab nie groß welche gehabt.
[Lebensqualität]
Ja, Lebensqualität, - ich bin jemand, der das Wort nicht leiden kann. Ich finde, dass das in enger Nachbarschaft liegt mit lebenswertem und gleichzeitig lebensunwertem Leben, also da sind wir so in der Euthanasie- und Sterbehilfediskussion drin. Ich denke, wenn man von Qualität redet, ist das heute oft eine Produktfrage. Das Leben ist kein Produkt, das Leben ist auch kein Konsumartikel oder irgend so was, es ist eine Anmaßung zu sagen, es hätte Qualität oder nicht. Wer ist denn der Hersteller? - klassisch primitiv naiv: wir sind die Konsumenten und Gott ist der Hersteller und dann gucken wir welches Prädikat, welchen Qualitätsstempel es kriegen kann; oder ein bisschen differenzierter, sind wir selbst die Hervorbringer und selbst die Konsumenten? Ist auch Blödsinn, also ich denke, Lebensqualität ist ein sehr schwieriges Wort, es wird heute sehr gern darüber geredet, auch Behinderte fordern natürlich gerne Lebensqualität ein, - und - da sind auch verschiedene Parameter, so was wie Mobilität und ähnliches, aber im Grunde genommen glaub ich, ist das die falsche Herangehensweise.
[Glück und Leid]
Ja, ich denke es ist beides eine ganz subjektive Geschichte. Ob wir etwas beglückend oder leidvoll erleben, hat sehr viel mit unseren Gegebenheiten, unseren Befindlichkeiten zu tun, natürlich auch damit, wie die Umgebung etwas bewertet, aber, jeder Behinderte weiß, dass - also hat zumindest öfter die Erfahrung schon machen müssen, dass die Umgebung, umso weniger sie mit dem Menschen selber zu tun hat, der eine Behinderung hat, viele Dinge in dessen Leben als leidvoll und schrecklich einordnet, die überhaupt nicht leidvoll und schrecklich sind - und - andersherum sind manche Dinge sehr leidvoll, die von der Umgebung gar nicht als solche wahrgenommen werden. Dass Behinderung per se auch immer als Leid mitgedacht oder -gefühlt wird, das ist tatsächlich eine Umgebungsgeschichte. Jeder der behindert ist, kann das so pur nicht sehen, natürlich gibt es Behinderung oder Erkrankung die fortschreitend sind, die deshalb auch immer größeres Abgeben, immer stärkere Schmerzen, immer größere Einschränkung der Möglichkeiten ergeben; zu sagen, es wäre kein Leid ist auch eine Leugnung; aber auch innerhalb solcher Erkrankung und Behinderung, wie ich sie z. B. auch habe, ist das kein permanentes Leiden, sondern das sind eben bestimmte Einschnitte, die dann solche Dinge immer wieder mit sich bringen. Ich denke sogar, dass es gar nicht so von Bedeutung ist, wie sehr ein Mensch eingeschränkt ist durch Behinderung, ob er sich wohl fühlt und ob er sich verwirklichen kann oder ob er sich unwohl fühlt, da spielen viele Faktoren eine Rolle, und vielleicht, wag ich mal sehr ketzerisch zu sagen, vielleicht hängt es überhaupt nicht von Faktoren ab. Aber, also das sind dann nur Behauptungen, Untersuchungen kann man dazu schlecht machen; also man kann natürlich jedes Sich-unwohl-fühlen, jedes Zögerlich-sein, jedes Sich-nicht-verwirklichen, jedes - ich sag mal in Anführungsstrichen - "in die falsche Ecke geraten" - ich weiß nicht ob man wirklich in der falschen Ecke sein kann, aber Leute behaupten das oft von sich, dass sie es wären - das kann man zurückführen auf alle möglichen Kindheitstraumata und was es nicht alles noch gibt, und man kann aber Vergleichsgruppen heranziehen, die haben ähnliches erlebt und ähnliche Empfindlichkeiten und mit denen ist es dann anders, und genauso ist es mit Leuten, die Schmerzen leiden, manche sind davon fasziniert im schmerzvollen Sinne und andere wieder weniger - ich will damit nicht sagen, es liegt an jedem selbst, das, find ich, ist eine der miesesten Wahrheiten unserer Zeit. Ich denke nur einfach, wenn jemand leidet, dann leidet er und dann liegt es an der Umgebung, an uns, das zu würdigen und ihn zu unterstützen, und wenn jemand nicht leidet, dann leidet er auch nicht und dann muss man ihm das nicht einreden, nur weil er im Rollstuhl sitzt.
Jetzt sind wir völlig am Glück vorbeigeschrammt, weil wir so leidfasziniert sind. Ich denk auch, Glück ist noch mal was anderes - also eigentlich ist das Leid die andere Seite von Glück, die Leidenschaft kann auch sehr glückvoll sein, und ich denk auch, es gibt kein Glückohne die entsprechende Portion Leid dazu. In der großen Liebe ist es immer so, mal abgesehen davon, dass du auch wieder verlierst, oder verlieren kannst oder Teile davon verlierst und dass das mitunter tödliche Schmerzen bereitet, ist es ja auch so, dass in der Begegnung mit einem anderen Menschen Punkte kommen, wo du an deinem Abgrund stehst, oder an dem des anderen, also wo man das gar nicht auseinander dividieren kann, wenn man es von der Gesamtheit sieht, was Glück ist und was Leid ist, und ob nun eine starke Lust oder ein starker Schmerz da ist, das sind beides Erfahrungen ohne die wir als Person nicht das wären was wir sind, oder gar nicht das werden können, was wir dann werden oder werden könnten. Ich denke aber, dass es eine total irrige Meinung ist - (also ich spreche immer wie so ein Inquisitor, total irrige Meinung) - wenn Leute denken, ja wenn das Leben glückvoll ist, dann ist es lebenswert, dann hat es Qualität und wenn es leidvoll ist dann hat es keinen Wert - und die schlimmere Konsequenz ist dann, Leben, das Leid bereitet, das sollte man verhindern; also die ganze Sterbehilfediskussion und auch die Diskussion der Abtreibung von Menschen, die aller Wahrscheinlichkeit nach behindert werden könnten. Also die Gesamtheit der Gesellschaft will das Leiden sozusagen immer weiter ausgrenzen, verdrängen, und will trotzdem das Glück - und kriegt aber immer weniger Glück dadurch. Und im Leben des einzelnen ist das genauso. - Ja, also ich denke die Idee, Behinderte müssen leiden, ist schon Unfug; ich glaub die leiden nicht mehr und nicht weniger als andere Menschen auch, selbst wenn sie sogenannte Umstände ertragen müssen, in denen sie weniger Lebensqualität haben, auch das in Anführungsstrichen, also in Heimen untergebracht sind, wenig Kontakte zur Außenwelt haben, Kommunikationsprobleme, Mobilitätsprobleme, Anerkennungsprobleme, weniger Sex, schlechteres Essen, oder was es nicht sonst alles so gibt; also selbst wenn das so ist, denk ich, vom Individuum her, gibt es ein Maß an Leid, das man wahrnimmt, und auch Möglichkeiten der Wahrnehmung von Glück, das hält sich subjektiv gesehen, denk ich, immer halbwegs die Waage, wenn es aus dem Gleichgewicht herausfällt wird es als etwas besonders Schlimmes oder Schönes empfunden, je nachdem, aber dies aus diesem Gleichgewicht heraus sein, das dauert nie lange, also die schönste Verliebtheit, stärkste Euphorie anhand eines neuen Jobs usw., ebenso die schlimme Depression wegen schwerer werdender Krankheit oder Langeweile vor dem Fernseher, das hält nie in dem Maße so stark an, dass das ein ganzes Leben, eine ganze Existenz permanent prägt. Es gibt Existenzen, die brauchen das Leiden, die werden auch immer einen guten Grund haben das zu thematisieren, ich will das auch gar nicht abwerten, und es gibt Existenzen die sind eher diesbezüglich verdrängend und die wollen eher lustig sein, auch die werden das arrangieren, und ob du da im Rollstuhl sitzest, eine geistige Behinderung hast oder blind bist, ist, glaub ich, zweitrangig und - oder andersherum, also 1. Punkt: es ist überhaupt nicht gegeben, dass Behinderung gleich Leid ist, ich glaub, es ist überhaupt nicht gegeben, dass bestimmte Lebensumstände mehr Leid bedeuten als andere, nur wenn man das objektivieren will, ist das gegeben, aber ich glaub, man kann das nicht objektivieren.
Und selbst wenn es so wäre, dass es objektivierbar ist - es ist ja so, dass manche Menschen mehr leiden als andere, das ist schon so -, ist das kein Grund die, die mehr leiden, vom Leben auszuschließen, ob sie es wollen oder nicht, auch das noch dazu; diese ganze Patientenverfügung, wo die Naivität dahinter steht, ja wenn ich mal abhängig bin, will ich nicht mehr leben, die gehen ja immer von der Jetzt-Situation aus in der sich die Leute befinden und nicht von der Situation, in der sie dann drin sind. Ich kenne viele Querschnittgelähmte z. B., die sagten nach ihrem Unfall, im ersten viertel-halben Jahr, wollten die nicht mehr leben, und wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, hätten sie sich die Spritze geben lassen, also wenn das auch noch propagiert worden wäre: "Ja willst du denn nicht sterben"? Und dann kam aber auch eine Phase, wo sie ihre neuen Lebensumstände angenommen haben, wo sie sich arrangiert haben und wo es ihnen gut ging damit. Spätestens nach drei, vier Jahren sieht das für die meisten so aus. Ähnlich ist es mit Menschen, wenn sie alt werden, das ist doch auch ein Prozess des Abgebens, des weniger Werdens und auch ein Prozess des mehr Werdens in einer anderen Ebene, ich will nicht sagen Wirklichkeit, jedenfalls es steckt die Chance dazu drin, das ist nicht automatisch so. Und das, was man dann als leidvoll empfinden würde, also die Abnahme der Körperfunktion, der Gedächtnisfunktion, Abhängigkeiten, weniger Mobilität und all das, ist in einem Sterbeprozess auch eine ganz wichtige Sache oft; Leute, die sich darum bringen weil sie sagen: "Jetzt will ich die Spritze haben", die bringen sich um ganz zentrale existentielleErfahrungen, bringen sich um das Rundsein ihrer Person.
Ich denk oft an eine Geschichte eines Menschen, der sich mit seiner Geliebten heftig gestritten hat, voller Brass ins Auto steigt und einen schweren Unfall baut. Er kann sich nicht mehr artikulieren, aber er wünscht sich nichts mehr - später als er im Hubschrauber liegt - als sie noch einmal zu sehen und - na ja, er hat aber eben diese Patientenverfügung dabei, dass in einem solchen Fall keine lebensverlängernde Maßnahmen getroffen werden, also sieht er sie nicht noch mal. - so was weiß man nicht vorher. Also der Tod und auch das Leben in einem umfassenderen Sinne sind keine verfügbaren Dinge, die sind größer als wir selbst und deswegen kann man da nicht darüber reden, ob es Qualität hat oder nicht, als ob es jemand machen und konsumieren würde. Und deswegen kann man auch nicht darüber verfügen, wann es denn zu Ende sein soll, wies denn sein soll und was sein soll.
[Normalität, normal?]
Ja, es gibt verschiedene Normalitätsfelder, also ich kann mich auch nie in meiner Gänze in diese Normalitätsfelder einbringen, weil - nein, ich versuch´s erst mal so: Ich mit meinem Rollstuhl und der Unfähigkeit mich zu bewegen, meinem krummen Kreuz und meinen dicken Füßen und was es sonst noch alles gibt, ich bin in dem Umfeld, also in meiner Wohnung, in meiner Verwandtschaft, unter meinen Assistenten, Freunden, und Leuten die mit mir arbeiten, bin ich da normal. In meiner Nachbarschaft hier, da ist das schon nicht mehr ganz so normal, die Leute gucken, sind befremdet, natürlich, je öfter sie mich sehen, je mehr sie mit mir zu tun haben, umso normaler wird es wieder. Die Verkäuferin von da vorn oder irgend jemand der nur mal so aus dem Fenster raus sieht, für den bin ich schon weiterhin eine Sensation oder was fremdes, aber trotzdem eben alltäglich. Und jemand, der hier vorbeikommt, und mal ein Glas Wein mittrinkt oder so mit mir quatscht, da wird das immer weniger, dass das fremd ist und trotzdem, wenn man den Kreis jetzt noch größer zieht, gesellschaftlich gesehen bin ich schon sehr unnormal, also pass ich nicht in das Übliche, dass man sich eben bewegt, für sich selber sorgt und ähnliches. Behinderung wird ja nach WHO so definiert, dass man in seiner Altersgruppe wesentlich abweicht von dem üblichen, und deswegen sag ich immer, ich bin nicht von meiner Geburt an behindert sondern von meinem ersten Lebensjahr, also von da an wo andere Babys so allmählich angefangen haben zu laufen, von da an wurde es immer unnormaler und auch mit drei Jahren im Kinderwagen ist noch nicht so unnormal wie mit 13 im Rollstuhl, also das wurde sozusagen immer unnormaler Allerdings in der Schule für Körperbehinderte, in der ich war, war das wiederum überhaupt nicht unnormal. Wir hatten in der DDR so ein System, wo das Gesundheitssystem sozusagen vordringlich war, und deshalb alle anderen Definitionen auch geschluckt hat. So sind wir auch in die Schule gegangen mit Scheuermännern, also Leuten, die so eine Rückenkrankheit hatten, die man gar nicht sah - die waren auch immer nur ein viertel bis halbes Jahr an unserer Schule - und für die waren wir auch erst mal unnormal - die für uns natürlich nie, so herum ist es auch mit der Normalität und Unnormalität, aber so bald die ein paar Tage da waren, waren wir natürlich überhaupt nicht mehr unnormal.
Ja, das ist die eine Ebene, also dass Normalitäthergestellt wird durch Alltäglichkeitund durch häufigen Kontakt, also dass etwas so lange unnormal bleibt, wie es keine Kontakte gibt. Im Bereich von Erotik ist das noch mal anders in Bezug auf Körperbehinderung, da scheut man den Kontakt damit er sich nicht normalisiert, denke ich. Das hat sicher eine Menge Gründe, die man auch im Biologischen und sonst wo suchen kann, auf jeden Fall ist das so, und hier eine Normalität herzustellen, ist, glaub ich, noch problematischer als anderswo und ich denk auch nicht, dass das immerzu und insgesamt gelingen kann - also einzelne Menschen können das sicher in Bezug auf andere einzelne Menschen, man möchte ja sowieso - es sei denn man arbeitet als Prostituierte - nicht sozusagen permanent das Sexobjekt für alle sein, sondern ja nur für konkrete Menschen. Aber es ist insgesamt schwieriger für behinderte Leute. Und hat man es dann trotzdem geschafft, einen Partner zu finden, kommt es oft vor, dass man schneller als sonst erotisch zu normal wird. Das ist ja das selbe, wie wenn man ganz unnormal ist, da fällt ja der Sex auch wieder weg, also eine bestimmte Fremdheit muss ja auch da sein um eine Nahbeziehung zu schaffen. Diese erotisierende Fremdheit verfällt meist schneller als in anderen Beziehungen, wenn der Partner in Pflege und Assistenz mit eingebunden wird, wenn er sie häufig sogar alleine bewältigen muss.
Ja, was wollt ich zur Normalität noch sagen, ja, die Felder sind nicht nur, wie ich gesagt hab, geographisch, die Felder sind immer auch - wie ich mit der Erotik grad angedeutet hab - eben auch thematisch, und es gibt Felder, da bin ich normal, es gibt Felder, da bin ich nicht normal, da muss ich meine Normalität regeln und manchmal muss ich auch meine Unnormalität verteidigen, auch das gehört ja dazu, also wenn wir darum kämpfen, dass es weniger Treppen gibt oder mehr Aufzüge, da müssen wir ja gerade auf unsere Unnormalität abheben und die auch behaupten; und auch in Bezug auf Lernbehinderte oder ähnliche Sachen, da ist es wichtig, dass das andere anerkannt wird und der Normalisierungsprozess so läuft, dass man weiß, es gibt das andere, und dass es beachtet wird.
[Herausforderung?]
Ja, man denkt, - oder wenn man Herausforderung hört und Behinderung, gibt's ja das Klischee, dass sozusagen der tapfere Krüppel sein schweres Los meistert und dass das die Herausforderung ist und, also ich glaube das ist Blödsinn. Ich denke sogar, dass vieleBehinderte, zumindest schwer behinderte Menschen, besonders lebensuntüchtig sind, weil viel von ihnen fern gehalten wird, weil sie besonders behütet werden und auch besonders separiert werden, umso mehr wird's dann als toll empfunden, wenn sie normal leben, aber das ist nicht toll, das ist eben so normal wie bei anderen Leuten auch.
Herausforderung find ich in dem Zusammenhang trotzdem wichtig, weil hinter der Herausforderung steht ja oft die Forderung; die Herausforderung besteht ja darin, dass ich sozusagen meine Umgebung herausfordere, ich fordere, dass ich ein Leben leben kann, was mir entspricht, und nicht dem Klischee, also dass ich nicht in einem Heim leben muss, dass ich nicht für jede Fahrt durch die Stadt einen extra Fahrdienst brauche, dass ich in eine Kneipe reingehen kann oder in ein Kino, und dass es da nicht nur keine Stufen gibt, sondern dass es da auch ein Klima gibt, in dem ich nicht so unnormal bin. Also die Herausforderung besteht eher darin, dass ich fordere, dass ich es herausfordere, dass diese Gesellschaft ein Lebensraum auch für mich ist, und dass ich hier in etwa gleiche Möglichkeiten habe, wie andere Leute auch. Also so könnte ich Herausforderung verstehen, dass also Menschen, die nicht in die übliche Normalität passen, trotzdem ihre Normalität leben können und in die Gesamtheit integriert sind damit. Das ist eine Herausforderung für die Gesellschaft, nicht dass die Gesellschaft alles tun muss, sondern dass es tatsächlich Forderungen von dieser Seite sind, die dann auch ausgehandelt werden. Es gibt keine Gesellschaft die sagt: "Also gut, dann machen wir das." Es ist ja eher so, dass man um jeden Scheiß ewig kämpfen muss.
[behindert sein - behindert werden?]
Ich denke es gibt beides - also - ich habe durch bestimmte körperliche Einschränkungen tatsächlich Einschränkungen und die werd ich auch nie, nie in Gänze ausgleichen können. Und die ideale rollstuhlgerechte Welt wäre ja auch scheißlangweilig und absolut bescheuert. Also, wenn es in jedem Haus einen Aufzug gäbe und keine Bordsteinkante, und auch die hohen Gipfel der Alpen in der richtigen Steigung und Asphaltweg bis nach oben, und jedes historische Gebäude, die engen Eingänge weg, und - da könnte man so viel bringen - es wäre absurd, diese Forderung. Auf der anderen Seite, eine größere Integration wäre schon gut und da wird ja auch immer wieder drum gestritten. Ich denke auch, dass "behindert sein" durch bestimmte körperliche Gegebenheiten bei weitem nicht so groß ist oder sein müsste, wenn es noch mehr Ausgleiche gäbe. Ich z. B. erhalte in einer ziemlich optimalen Weise Assistenz. Aber es gibt tausend andere in meiner Lage, die das nicht erhalten und die deshalb wesentlich mehr behindert werden. Und ich denke, es gibt eine gesellschaftliche Anforderung, dass die Hilfen, die nötig sind, gegeben werden und zwar auf eine Art und Weise, die es demjenigen, der sie erhält, ermöglichen, sich zu verwirklichen.Aber es gibt eben auch die persönliche Anforderung, dass man - im eigenen Interesse - mit den Einschränkungen, die da sind, zurecht kommt - also nicht dass man die per se frisst und sich arrangiert, aber dass man guckt was geht und das, was nicht geht, in irgend einer Weise so in sein Leben integriert, dass man selbst damit klar kommt und andere auch.
[Ergänzungen?]
Ja, Behinderung als Konstruktion; also, die Idee, dass das Konstrukt ganz in unserer Hand liegt, das denk ich wieder nicht. Aber das zu dekonstruieren ist schon immer eine schöne Angelegenheit, oder, ist eine wichtige Sache, dass man also die Grenzziehung nicht verstärkt, sondern eher aufweicht, und ich denke das passiert heute ganz umfänglich, also die Tendenz wird davon unterstützt, dass viel mehr Leute für sich - also es vielleicht nicht unbedingt realisieren im Bewusstsein, aber das wird immer klarer - realisieren, dass in ihrer persönlichen Biographie Behinderung sehr wohl eine ganz realistische Möglichkeit ist. Durch höheres Alter und erweiterte medizinische Möglichkeiten ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie zum Ende ihres Lebens oder eben auch schon viel eher durch Unfall oder eine Krankheit behindert werden können. Der eine Reflex darauf - also wenn man es jetzt mal polarisiert - ist diese ganze Sterbehilfegeschichte, wo man sagt, wenn das mal so sein sollte, ist es für mich so unannehmbar, so weit weg, dann will ich tot sein. Und der andere Reflex ist schon auch, dass man eben sieht, dass man die Nachteile einer Behinderung ausgleichen kann, und dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Ich denke, da spielt Assistenz, überhaupt der Assistenzgedanke, eine ganz starke Rolle und dass es eben nicht mehr darum geht, du erleidest etwas und dann kommt eine große Hilfsorganisation und hilft dir, sondern dass es darum geht, dass wenn deine Möglichkeiten eingeschränkt sind, du die Mittel in die Hand bekommst das auszugleichen, also auch in deinem Sinne das ausgleichen zu können.
Der Assistenzgedanke ist der, dass du die Person bleibst, die die Herrschaft über das eigene Leben behält, und dass die anderen dazu da sind, das mehr oder weniger Handwerkliche, kann auch sozialarbeiterisch Handwerkliche sein, zu übernehmen; aber du bist die Person, die die Deutungshoheit behält. Das, find ich, ist eine ganz wichtige Idee, und ich denke auch, die wird sich trotz aller sozialpolitischen Verschärfungen weiter durchsetzen. Ich denk sogar, dass - egal wie groß bzw. klein in Zukunft die Ressourcen sein werden - allein die Idee, dass die Mittel in die Hände derer kommen, die die Hilfe brauchen, eine ganz zentrale Sache sein wird und dass wir da viel verändern werden in der Hilfeerbringungs-Landschaft.
5. Interview E, am 12. 11. 2004
Ich bin spastisch gelähmt, ich hatte einen Sauerstoffmangel bei der Geburt und ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen, ich hab einen nicht behinderten Bruder und, ja, ich war bei meinen Eltern praktisch bis Mitte 20, ganz schöne Jahre, war Schule, ich bin also in Westdeutschland aufgewachsen, in Osnabrück, da bin ich zur Sonderschule für Körperbehinderte gegangen, hab da meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann war ich ein Schuljahr in Hannover im Internat, hab da den erweiterten Hauptschulabschluss gemacht, das ist gleichzusetzen mit der mittleren Reife, und dann war ich drei Jahre zur Berufsausbildung im Heidelberger Reha-Zentrum für überwiegend Querschnittsgelähmte, aber mich haben sie da auch aufgenommen, da wurde ich zum Bürokaufmann ausgebildet und nach der Ausbildung hab ich ungefähr 20 Jahre, ja oder 15 Jahre ist wohl besser, bei meinen Eltern im Betrieb gearbeitet, wir haben ein Busfahrunternehmen für Behinderte und da hab ich so die Büroarbeit gemacht und dann hab ich meine Frau kennen gelernt im Urlaub, dann haben wir 87 geheiratet und 89 kam unser erster Sohn zur Welt, ja und dann sind daraus 3 Söhne geworden und dann haben wir uns 2000, ja 2000, getrennt und die Scheidung kam und seitdem lebe ich hier in Berlin und werde von dem Pflegedienst mit Assistenz versorgt.
Also ich bin Rentner und, ja, ich hab ein paar feste Termine in der Woche, so regelmäßig Krankengymnastik und dass ich auch Logopädie habe, das ist mir sehr wichtig, dass ich auch Fremden gegenüber verständlich bin, dass mich jeder gut verstehen kann, und dann bin ich ab und zu also auch regelmäßig in psychologischer Beratung bei Lebenswege [Assistenzvermittlungsunternehmen], da ist ein körperbehinderter Psychologe, der macht Beratung für uns Assistenznehmer, auch für Assistenten, wenn die Bedarf haben halt, da teilt er auch Termine aus. Ja, was ich so prinzipiell mache, weiß ich nicht, kann ich Ihnen gar nicht sagen, auf jeden Fall geht die Zeit ruck zuck um, ich nehme mir jeden Tag sehr viel Zeit um die Zeitung zu lesen, ich schreibe gerne am Computer, mittlerweile bin ich dran, ja also sag immer, einen Roman zu schreiben, aber mal gucken, was daraus wird und ja, fernseh gucken natürlich, und ich gehe auch gut aus, dass ich regelmäßig ins Kino fahre, im Theater bin ich oft zu finden, und manchmal zu Konzerten.
[Wünsche oder Pläne für die Zukunft?]
Ach, vor der Zukunft hab ich sowieso ziemlich Angst. Ich denk mir auch, es reicht jetzt auch was ich gelebt habe, will gar nicht so viel älter werden, ich hab halt Angst, dass ich nicht mehr das an Versorgung bekomme, was ich brauche. Weil das öffentliche Geld zu knapp wird, sagen sie zumindest, ob das so stimmt, das zweifle ich auch oft an, weil wenn ich sehe, dass die Forschungsausgabe immer erhöht wird und im sozialen Bereich, im Bildungsbereich eingespart wird, das passt eigentlich nicht.
[Probleme im Alltag, die auf die Behinderung zurückgeführt werden?]
Nein, die gibt es nicht. Ich bin, wie schon erzählt, von Geburt an behindert und ich kenn es gar nicht anders.
[Frage nach seiner Definition von Lebensqualität]
Lebensqualität das ist, ja wenn ich mein Leben führen kann, wie ich es mir vorstelle, dazu gehören funktionierende Hilfsmittel, also der E-Rolli, wenn der kaputt ist und ich bin auf einen Faltschieberollstuhl angewiesen, das ist schon für mich eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Ich brauch auch, ja, Hilfe, auf die ich mich verlassen kann, von Assistenz, wenn das nicht wäre, also wenn ich nicht wüsste, wo ich Hilfe herkriege, die ich brauche, damit ich so leben kann wie ich mir das vorstelle, das ist dann auch eine Einschränkung der Lebensqualität.
[Frage nach seiner Definition von Glück und Leid]
Glück ist eine Illusion, was es im Grunde gar nicht gibt.
Leid, ja, Leid ist, eine Unfreiheit zu haben. Wenn ich eingeschränkt bin in meiner Mobilität, ich hab es ja mit dem Rollstuhl gesagt, also wenn der kaputt ist, wenn ich kein Geld mehr habe, wenn ich krank bin z. B. und die Therapie nicht mehr bekomme, die nötig wäre. Also das ist eine Einschränkung für mich und das ist auch Leid. Das ist Leid, das bewusst hervorgerufen wird. Wenn ich nicht mehr die Gymnastik bekomme, die ich brauche, wenn ich das mir überlege, das ist für mich Leid.
[Frage nach seiner Definition von Herausforderung]
Herausforderung, da kann ich Ihnen auch ein Beispiel sagen, eine Sparmaßnahme, und natürlich, ich hab jetzt 8 Stunden am Tag Assistenz, natürlich kann ich nicht ausschließen, dass ich in den 16 Stunden in denen niemand bei mir ist, dass ich da überhaupt keine Hilfe brauche. Ja, wie mach ich das dann, dass ich trotzdem das erreiche, obwohl der Assistent schon Feierabend hat? Das ist z. B. für mich eine Herausforderung, das trotzdem zu schaffen.
[Normalität?]
Wenn ich den Begriff höre, dann werd ich sowieso wütend, weil normal gibt's nicht, weil wo will man das festmachen? Woran will man das festmachen? Also das geht gar nicht, ich find das einen Begriff, der sehr unzufrieden macht.
[behindert sein - behindert werden]
Ja ich bin natürlich behindert, das ist einfach ein Zustand. Viele die mich kennen, sagen auch "in meinen Augen bist du gar nicht behindert, du hast nur einen Rollstuhl, weil du nicht laufen kannst", und das ist für mich eigentlich eine Beleidigung, auch wenn es als Kompliment vielleicht angelegt ist, aber also ich bin behindert, ich bin so geboren und ich möchte auch nicht behindert werden. Da gibt's ja sehr viele Möglichkeiten, und ja, ja also ich bin ganz gerne so wie ich bin, natürlich Sachen, die einem persönlich nicht gefallen, die gibt's immer, aber die gibt es ja bei den Nichtbehinderten auch, insofern sind wir ja da wieder gleich was die persönliche Eitelkeit angeht. Und behindert werden, ja, ich denke, das geht so in den Bereich, wenn Hilfsmittel nicht funktionieren, dass ich damit behindert werde.
[Beispiele für Situationen, verknüpft mit dem Gefühl, nicht dazu zu gehören]
Beispiele, gibt's ja immer wieder, konkret fällt mir jetzt keines ein, ja, aber die gibt es ja immer wieder.
Also, ja, das ist im Bereich meiner Sprache, wo Menschen reagieren und einfach nur mir antworten damit sie antworten, aber ich weiß genau, aus dem, wie sie antworten und was sie antworten, dass sie mich nicht verstanden haben und ihnen das auch zu unangenehm ist, nachzufragen, was ich jetzt gesagt habe.
[Warum reagieren Menschen so?]
Erstmal meine Sprachmelodie, meine Art zu sprechen, sie anzuhören, das ist ja schon nicht leicht. Wenn man sich so umhört, wie sauber zur Zeit überall gesprochen wird, da wird man ja blöd angeguckt, wenn man Dialekt spricht und so. Ja, die Behinderung meiner Sprache ist, wenn Sie so wollen, ja auch ein Dialekt, das ist jetzt zwar nicht landschaftlich bezogen, aber auf meine Behinderung, und da ist es schon bisschen arg müßig, einfach schwierig, noch mal genau zuzuhören. In unserer heutigen Gesellschaft da muss alles schön sein, da muss alles schnell gehen, da darf nicht angeeckt werden.
6 Interview F, am 15. 11. 2004
Kann ich machen. Ich bin in meinem Heim aufgewachsen, dem größten Heim in der Bundes Republik, dem evangelischen Johannesstift. Und da war ich ... 20 Jahre hab ich da gelebt ...mit Erziehern, so richtig wie man das kennt halt.
Oh Gott! Was mach ich? Ich bin jetzt seit kurzem arbeitslos, ich hab gearbeitet, 12 Jahre lang, für den Fernsehsender NTV. Im Moment bin ich also ... ich bin halt arbeitslos, wie 4,5 Millionen andere auch. Ich mein, die sind halt umgezogen, und ich bin nicht mitgezogen. Und wie gestalte ich meinen Alltag? Kann ich schwer sagen, ich mach eigentlich das, was jeder macht, einkaufen gehen, ausgehen, meine Freundin besuchen, so halt. Ich mach nichts Welt bewegendes.
[Pläne oder Wünsche für die Zukunft?]
Ich will an die Musikschule. Aber andre Pläne hab ich nicht. Also ich mach Musik und ich will das richtig lernen, ich mach das jetzt autodidaktisch, schon seit 16 Jahren und will´s halt richtig lernen. So, und da will ich halt in die Musikschule. Aber sonst hab ich eigentlich keine größeren Pläne.
[Was für Musik?]
Ich spiel in Cover Bands, in Discos und Kneipen und so, ich mach Country, ich mach Perkussion, also Rhythmus unterstützende Instrumente.
[Probleme im Alltag, die in Zusammenhang mit der Behinderung gesehen werden?]
Schwere Frage, Probleme hab ich eigentlich immer, nur dann, ... also ich hab dieselben Probleme wie du, glaub ich, mit der Umwelt auch, aber sonst eigentlich nicht, weil füralles andere hab ich meine Assistenten ... wie sag ich das ... ich hab halt die Probleme, dass ich angemacht werde, wie jeder andere auch. Oder dass man mich irgendwo nicht rein lässt, oder dass ein Klo zu eng ist. Aber sonst hab ich jetzt keine spezifischen, außer Gesundheitsprobleme, die mit meiner Behinderung zu tun haben, weil bei allem anderen helfen mir meinen Assistenten.
Und ich hab ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Assistenten. Einige davon würde ich sogar zu meinen Freunden zählen, und darum hab ich eigentlich keine großen Probleme damit.
Also man hat so "larie-farie"-Probleme, wenn man halt ... weil man halt immer dasselbe gefragt wird. Warum sitzt du im Rollstuhl? Kennst du auch, und das nervt. Aber sonst hab ich eigentlich nichts wo ich sagen würde, da macht mir meine Behinderung große Probleme.
[Wie viel Assistenz hast du?]
14 Stunden am Tag.
[Lebensqualität?]
Also Lebensqualität ... dass man die Dinge tun kann, die man tun will, auch wenn man sie tun muss.Und so lange ich ... wenn ich auf´s Amt gehen kann, wenn ich muss, wenn ich in die Kneipe gehen kann, wenn ich will, wenn ich meine Freundin besuchen kann, wann ich will ... dann hab ich ein gutes Leben. Und wenn das halt nicht ist, weil ich keine gute Assistenz habe, dann habe ich keine gute Lebensqualität. Wenn ich die Dinge tun kann, die ich will oder muss, dann hab ich ein gutes Leben und wenn ich mich gut mit meinen Assistenten verstehe. Also mein Leben wird dann schwer, wenn ich Probleme mit meinen Assistenten habe über die Arbeit, oder privat.
[Frage nach seiner Definition von Glück]
Was ist Glück? Weiß ich nicht! Ich bin, glaub ich, nicht sehr glücklich. Ich bin eher zufrieden, weil Glück ist ja immer ein ganz kurzer Moment. Ein schönes Konzert, ein nettes Wort von meiner Freundin oder wenn ich mich mit meinem Assistenten gut verstanden habe, an dem Tag, dann bin ich glücklich für einen kurzen Moment, aber ich bin eher zufrieden, also ich kann nie sagen, dass mich eine bestimmte Sache immer glücklich macht, das kann ich nicht sagen.
[Leid?]
Leid, ja wenn ich Schmerzen hab. Also wenn ich körperlich nicht gut "beieinander" bin ... Wenn ich vergessen hab, meine Medikamente zu nehmen und ich dadurch irgendwie nicht körperlich beieinander bin und dann Schmerzen hab, dann leide ich. Und ich leide darunter, dass für alles das man braucht, ich bei irgend einem Amt erstmal eine Ablehnung kriegen muss, damit ein anderes Amt das dann wieder macht, oder auch nicht. Da leide ich drunter und dass verkompliziert mein Leben. So, also da leid ich darunter, und das macht mein Leben kompliziert.
Und daran, um die Frage noch mal anders zu beantworten, von vorhin, daran merk ich also schon meinen Behinderung, dass ich mich immer mit irgend jemandem unterhalten muss, der mich nicht kennt, der gar nicht weiß ... z. B. hatte ich neulich meine Begutachtung hier, da saß mir zum Glück einen Frau gegenüber, die nicht ganz so fit ist, die hat mir dann meine Bewilligung gelassen. Aber ich, ich muss halt jedes Mal neu diskutieren, kennst du glaub ich auch, ob der Bedarf, den man hat, jetzt bleiben kann oder darf. Das ist so ein bisschen, das ist mühsam und das ärgert mich. Denn ich denke, dass es keinen Frage seinen darf ob man es kriegt, weil ... ich habe da noch die Sache, dass ich durch einen Geburtsfehler behindert bin. Hätte die Hebamme, oder es war ein Arzt, ein bisschen besser aufgepasst, wäre ich nicht behindert. Und deshalb hab ich überhaupt nicht dieses ich muss dankbar sein, sondern das steht mir zu. Eigentlich bin ich sogar der Meinung, müsste das Krankenhaus oder der Arzt, weil eigentlich hat damit die Allgemeinheit, also die hat damit natürlich zu tun, aber ... eigentlich müsste das im direkten ausgeglichen werden, dann wäre das OK. Also ich hab da, ich empfinde da keinen Dankbarkeit, dass ich das kriege, sondern das steht mir zu, weil mir ein Arzt mein Leben verpfuscht ..., also verpfuscht im Sinne von ich kann halt nicht auf Bäume klettern, so, oder ich kann halt kein Auto fahren, ich brauch halt immer jemanden der mich herum fährt, ja, und das ärgert mich und da leid ich auch drunter.
[Herausforderung?]
Was ist eine Herausforderung? Alles das kriegen, was einem zusteht. Eine Herausforderung ist für mich immer das Optimum zu bekommen und nicht zu sagen, es geht auch, z. B. mit einer Stunde weniger. Geht nicht! Das ist eine Herausforderung, also das begreife ich immer wieder als Herausforderung, weil man muss das ja klar machen ... also immer wieder so gut zu argumentieren, dass niemand kommen kann und sagen, dem können wir aber eine Stunde wegnehmen, weil das ist, das geht nicht. Also das ist herausfordernd.
Aber sonst? Ja, meine Musik, da besser zu werden, das ist auch eine Herausforderung für mich.
Ja und mein Team so gut zusammen zu halten, dass wir miteinander zufrieden sind, sowohl die Leute die für mich arbeiten, als auch ich. Ich sehe das sowieso eher als Gesamtbild und nicht ich bin ... Also natürlich hat man immer ... Also der Behinderte ist ja immer der Sagende, aber ich halt auch nichts von ... Es gibt auch Hilfenehmer, da ist der Assistent gar nichts, der ist Arm, Fuß und Handgelenk, das muss oft so sein und ich finde, dass das auch wichtig ist, aber manchmal oder manche Hilfenehmer vergessen, dass das auch Menschen sind. Wobei ich aber auch der Meinung bin, dass es da auch welche gibt, die das zu sehr sehen und sich da abhängig machen und zu sehr in die Bittstellersituation kommen, und das will ich nicht, und dass das alles so läuft, das sehe ich als Herausforderung an.
[Normalität]
Da gibt es einen ganz einfachen Begriff: Normal ist all das, was 95 % der Bevölkerung dafür halten. Also ich bin normal, weil, wenn ich sage, dass ich alles bin, also ich als Mittelpunkt meines ..., dann bin ich normal.
Ist immer ein Blickwinkel. Aber wenn ich draußen herum fahr, und da ist dann eine Treppe, dann ist das wohl normal, weil 95 % der Bevölkerung können die halt nehmen. Insofern ist das halt normal. Das ist eine reine Definitionssache, was normal ist.
[Findest du das in Ordnung, dass eine Mehrzahl Normalität definiert?]
Ich nehme das hin. Also, ich mach mir ..., also ich ärger mich drüber, weil wo man eine Treppe bauen könnte, da kann man auch einen Aufzug bauen. Den können Kinder benutzen, Frauen mit Kinderwagen, Leute, ... also so, den können halt alle benutzen, könnte man auch einen Aufzug hinbauen. Und darüber ärger ich mich dann schon, dass das nicht ist. Also das man nicht einfach überall auch noch einen Aufzug hinbaut, weil, würde es überall beides geben, könnte man sich immer entscheiden was man will, und das wäre schon besser. Aber im Großen und Ganzen muss ich das hinnehmen sonst werde ich ja irre, sonst werde ich ja "bekloppt im Kopf", wenn ich mich jedes Mal darüber aufregen würde. Und es ist ja auch so, dass mir meine Assistenten dabei helfen eine Treppe zu überwinden. Die ziehen dann den Rollstuhl die Treppe hoch und insofern ist es immer ein kleines Ärgernis, weil man muss immer gucken, kann der das, wie viele hat er schon, geht's ihm gut, dass er das machen kann. Insofern ärgert mich das dann, aber im Großen und Ganzen nehmen ich es hin, denn sonst wäre ich ja den ganzen Tag depressiv. Es gibt überall was herum zu meckern und man kann überall einfordern, dass noch was anders sein soll. Kann man sein ganzes Leben lang machen und dann ist man traurig und depressiv und das will ich nicht und darum nehme ich das hin, mehr oder weniger.
[behindert sein - behindert werden]
Behindert sein ... Wir waren ja eben bei dem Normalitätsbegriff ... ich sehe mich nicht als behindert, weil ich bin so auf die Welt gekommen, und das sind meine, das ist wie ich bin, und das sind meine Voraussetzungen. Aber ich frag mich nicht jeden Tag, ob das behindert ist. Weil ich bin so auf die Welt gekommen und ich werde die Welt auch so wieder verlassen. Und alles darum herum muss man halt gucken, wie das geht.
Meine Behinderung wird mir immer dann ganz extrem bewusst, wenn alle außerhalb meines Teams anfangen mir zu erzählen, du bist behindert und dadurch bist du anders. Und dann fang ich an mich damit zu beschäftigen und das behindert mich vielleicht. Oder das behindert mich auch, wenn da eine Treppe ist, wo auch ein Aufzug sein könnte, da muss ich Umwege fahren, eventuell ... das behindert mich. Aber meine Behinderung stellt in meinem ureigensten Leben kein Problem dar. Ich hab eine Freundin wie andere auch, ich gehe aus, ich hab nette Assistenten, so, und das ist OK so. Meine Behinderung fällt mir immer nur dann auf, wenn ich behindert werde durch irgendwas oder von irgend jemanden, aber sonst eigentlich nicht.
[Reaktionen anderer Menschen, die du auf deine Behinderung zurückführst?]
Ja, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und wir laufen Hand in Hand, dann wird immer gesagt, der ist ja behindert! Was gibst du dich mit dem ab? Und insofern, dann gehöre ich nicht dazu, denn das entspricht nicht dem Normalbild ... da sind wir wieder bei normal, nämlich bei der Masse, dem Normalbild. Aber sonst? Weiß ich nicht! Ich vermeide solche Ereignisse auch. Und wenn, dann geh ich da recht forsch mit um, also sehr herausfordernd. Mein Leben zu meistern ist für mich die größte Herausforderung.
Aber eine Situation, wo ich nicht dazu gehöre ... Weiß ich nicht. Also Leute, die mich nicht ernst nehmen, da will ich auch gar nicht dazu gehören, das ist dann so ne Trotzreaktion. Wenn die nicht wollen, dass ich dazu gehöre, dann will ich das meistens auch nicht.
Ja ... und die Masse weiß einfach zu wenig. Es ist ja allgemein bekannt, wenn man eine Sache nicht kennt, hat man Angst davor. Ich krieg teilweise Fragen gestellt, die erstaunlich sind, wenn ich unterwegs bin. Essen Behinderte dasselbe wie normale Menschen? Oder, wie alt werden Behinderte? Also, das sind Fragen ... und wenn ich genervt bin, denk ich mir auch nur immer, so was fragst du für eine Scheiße? Aber wahrscheinlich weiß der das nicht und dann soll der halt fragen. Ich bin der Meinung es, ja, gibt keine ... Keine dummen Fragen gibt es nicht, aber auch eine dumme Frage kann man beantworten, wenn man Zeit und Geduld hat. Und wenn ich die hab, beantworte ich die und wenn ich die nicht hab, oder nicht haben will, beantworte ich die nicht ... zum Beispiel.
Oder ... Wie geh ich, wie gehen Behinderte, wenn sie eine Freundin haben, mit ihrer Freundin um? Weiß ich nicht! Weil ich mit meiner Freundin umgehe, wie ich mit meiner Freundin umgehe, und wie andere das machen, weiß ich nicht. Also, ganz oft so stereotype Sachen; sind alle Behinderten so? Und das finde ich manchmal ganz amüsant aber meistens nicht.
1. Interview A, am 19. 10. 2004
Interviewpartnerin A meinte vor Beginn des Interviews, sie sei ein wenig aufgeregt und neugierig auf die Fragen. Die Situation entspannte sich aber bald nach Beginn des Interviews und die Interviewpartnerin zeigt sich interessiert und bemüht, die Fragen zu beantworten.
Sie will sich nach Beendigung des Interviews zu dem Begriff Lebensqualität nochmals äußern: Interviewpartnerin A kann aus physischen und psychischen Gründen nicht arbeiten und muss daher von Sozialhilfe leben. Sie wird - nach eigenen Beschreibung - dadurch zum Bittsteller und empfindet dies als demütigend, da andere Personen sie einstufen würden und über sie gesprochen werde; dies wird von ihr als belastend erlebt. Im Krankenhaus werde man entmündigt - so die Interviewpartnerin - in Behindertenwerkstätten werden einem die Arbeiten zugeteilt, man dürfe bestimmte Arbeiten nicht machen.
2. Interview B, am 22. 10. 2004
Interviewpartner B hat täglich 6 Stunden persönliche Assistenz; das heißt, über den Tag verteilt nimmt er die Hilfe von Assistenten und Assistentinnen in Anspruch, die ihn in Haushalts- und pflegerischen Tätigkeiten unterstützen. Im Umgang mit seinen Assistenten, aber auch außerhalb seines Privatbereiches sei ihm Kommunikation besonders wichtig, betont er nochmals.
3. Interview C, am 10. 11. 2004
4. Interview D, am 11. 11. 2004
5. Interview E, am 12. 11. 2004
Interviewpartner E kann auf Grund seiner spastischen Lähmung nicht fließend sprechen.
Er benötigt zur Formulierung eines Satzes länger als die anderen Interviewpartner, und es war ersichtlich, dass das Sprechen für ihn Anstrengung bedeutet. Trotzdem erklärte er sich bereit, das Interview durchzuführen und zeigte sich auch sehr interessiert. Insgesamt wurde aber für dieses Interview weniger Zeit einkalkuliert als für die übrigen Interviews.
6. Interview F, am 15. 11. 2004
Interviewpartner F lebt alleine und hat 14 Stunden persönliche Assistenz am Tag.
Quelle:
Christine Riegler: Philosophischer und psychologischer Zugang zu den Begriffen Behinderung und Erkrankung
Diplomarbeit, eingereicht an der Leopold Franzens Universität Innsbruck am Institut für Psychologie bei Univ.Prof. Rainer Thurnher, Berlin, Dezember 2004
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 21.11.2005
