Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit
Teil 1: Von der Antike bis zur Industrialisierung, Teil II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart, Innsbruck: Skriptum , 4. vollständig überarbeitete Auflage 2012
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Von der Antike bis zur Industrialisierung
- I. Armut und Not in der europäischen Antike
- II. Elend und Barmherzigkeit: Ansichten der Armut im Mittelalter und in der frühen Neuzeit
- III. Arbeiten, Helfen, Strafen: Ursprünge der Vergesellschaftung der Armut
- IV. Armutsverhältnisse und Armenpolitik in Stadt und Land Salzburg
- V. Armutsverhältnisse, Armenpolitik und Psychiatrie in Tirol und Südtirol
- Literatur
- Zusätzliche Texte und Materialien
- Fragen zur Selbstevaluation
- Beispiele für Themen schriftlicher Arbeiten
- Lösung der Frage von S. 105:
- Teil II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart
-
I. Fabrik und Proletariat: Die sozialen Folgen der Industrialisierung und die Politisierung der Armut
- 1. Die Industrialisierung und die Entstehung des Proletariats
- 2. »Da graute einem« - Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Industriearbeiter/innen
- 2. »Massenhaftes Sterben und Verkümmerung« - Die besondere Gefährdung der Frauen
- 3. »Hohläugig und bleich wie der Tod« - Die Kinderarbeit
- 4. »Gott segne den edlen Menschenfreund« - Die Malmène'sche Kinder-Beschäftigungsanstalt
-
II. Vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg
- 1. Armut - Keim der Revolution
- 2. Alte Rezepte für neue Probleme
- 3. Die Geburt des Sozialstaates. Neuordnung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie
- 4. Maßnahmen zum Schutz der ArbeiterInnen
- 5. Die Einführung der Sozialversicherung
- 6. Staatlicher Liberalismus und christlich-bürgerliche Wohltätigkeit
- 7. Der Erste Weltkrieg: "Geburtshelfer" des modernen Wohlfahrtsstaates?
- 8. Die Gnade der Wohltätigkeit und das Recht auf Hilfe
- 9. Die Zwischenkriegszeit
- III. Fürsorge als Beruf: Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit
-
IV. Führerprinzip und Rassenpolitik - Zur Faschisierung des Sozialen in der NS-Diktatur
- 1. Verstaatlichung und Säuberung der Fürsorge
- 2. Soziale Not als Rassenschande - Ausmerzung statt Hilfe im NS-Staat
- 3. Vernichtung »unwerten« Lebens: Sterilisation und Tötung der »Minderwertigen«
- 3. Sozialarbeiter/innen als Täter/innen und Mitläufer/innen
- 5. »Fremdrassige Belastungen« und »Zigeuner«: Nationalsozialistischer Rassismus in Stadt und Land Salzburg
- 6. »Plötzlich und unerwartet verstorben«: Ermordung unwerten Lebens in Tirol und Südtirol
- V. Von der Fürsorge zur Sozialen Arbeit: Sozialpolitik und Soziale Arbeit in der Nachkriegszeit
- VI. Die Ökonomisierung der Hilfe: Sozialpolitik und Soziale Arbeit in der Gegenwart
Inhaltsverzeichnis
Wer sich in die Verhältnisse längst vergangener Gesellschaften vertiefen will, darf nicht von heutigen Gegebenheiten ausgehen, auch nicht von den populären Images etwa "der Römer" oder "der Griechen". Andere Zeiten hatten nicht nur andere Sitten, sondern in vielen Hinsichten auch grundlegend andere An-sichten über die Dinge des Lebens. Das gilt in besonderer Weise auch für die Denkweisen und Umgangs-weisen in Bezug auf Armut und Not.
"Deine Sprache verrät dich ja": Mit dieser Vorhaltung versuchten dem Neuen Testament zu Folge die Gegner Jesu dessen Jünger und ängstlichen Leugner Petrus die Anhängerschaft an den Galiläer Jesus nach-zuweisen. Tatsächlich sind die Unterscheidungen, die eine Sprache für einen Sachverhalt trifft, wichtige Hinweise darauf, wie eine Gesellschaft diesen Sachverhalt wahrnimmt, welche oft unbewussten Vorstellungen und Mentalitäten damit verbunden sind, z.B. mit der in der gesamten Antike erheblichen Problematik der Armut.
|
Athen |
Rom |
Bedeutung |
|
pûnej pénes |
pauper |
nicht reich, zur Arbeit gezwungen |
|
pt'coj ptóchos |
egens: darbend, bedürftig inops: ohnmächtig, hilflos, mittellos, bedürftig indigens: bedürftig tenuis: unbedeutend, ärmlich, schwach |
Arm |
|
pt'coj ptóchos |
mendicus |
Bettler |
Wie man an den im Unterschied zu Griechenland mehrfachen Bezeichnungen für "arm" sieht, unterschieden die Römer zwischen Reichen einerseits und unterschiedlichen Graden von Armut. Reich zu sein wird als einziger gesellschaftlich erwünschter Status angesehen, dem gegenüber alle anderen Lebenslagen abgewertet werden. Als "arm" (pauper) galt ihnen bereits jemand, der seinen Lebensunterhalt mit seiner Hände Arbeit verdienen musste. Wer auch das nicht vermochte, war dagegen "arm" (egens ... ) in unserem heutigen Sinn. Dabei unterscheiden die Bezeichnungen noch zwischen verschieden Konnotationen der Armut: als subjektiver Mangel an Lebensmöglichkeiten (egens, indigens) oder als Mangel an Macht und Ansehen (inops, tenius). In beiden Gesellschaften, der griechischen wie der römischen, stehen auf der äußersten Stufe der Armut jene, die sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln verschaffen müssen, die ptóchoi der Griechen und die mendici der Römer: die "die mit den Händen sprechen" (manu dicere), die mit erhobenen Händen um Almosen bitten - übrigens auch ein aus der Antike entlehntes Wort: eleemosyne heißt im Griechischen "Mitleid". Nicht von ungefähr ist dieser Begriff erst im Mittelalter in Gebrauch gekommen, denn Mitleid gegenüber den Armen ist in der Antike, zumal in der römischen, keine vorherrschende Attitüde.
Die römische Gesellschaft ist eine nach mehreren Kriterien geschichtete: Die Demarkationslinien gesellschaftlicher Anerkennung und Berechtigung verlaufen zwischen dem Freien (ingenuus) und den Sklaven (servus) auf der einen Seite und - innerhalb der Freien - zwischen dem Bürger (cives) und dem Fremden (peregrinus). "Die schwerste Stufe der Minderung der Rechtsfähigkeit war erreicht, wenn man Bürgerrecht und Freiheit zugleich verlor" (Prell 1988, 29). Populus, die Bürgerschaft, wird nochmals in Plebejer und Patrizier unterteilt. Das Kriterium ist hierbei völlig offen und unangefochten das Vermögen. Über den gesellschaftlichen Rang entschied letztlich der Zensor.[1] Bei aller bisweilen durchscheinenden Skepsis rechtfertigen zahlreiche römische Schriftsteller den Primat des Vermögens als Voraussetzung der dignitas, des gesellschaftlichen Ansehens.
Die soziale Stellung des Römers bestimmte sich durch seine dignitas, sein Ansehen. Das Ansehen einer Person wurde durch vielerlei Faktoren beeinflusst: durch das Alter, das Geschlecht, die Abstammung, die Bildung, den ausgeübten Beruf, den Rechtsstatus, die Zugehörigkeit zu einem der oberen Stände, durch Ruhm, Ehre, Reichtum, Macht, Klientenzahl, durch Freigebigkeit, durch die Übernahme von öffentlichen Ämtern und Funktionen und nicht zuletzt durch charakterliche Eigenschaften und Tugenden. Dignitas besaßen vor allem die Senatoren. Tiberius[2] unterstützte verarmte Senatoren und verhinderte dadurch, dass jemand aus honestas paupertas seinen Rang (dignitas) einbüßte. Für Seneca[3] zählt Tugend mehr als Reichtum, jedoch verschafft auch in seinen Augen eine Verbesserung der materiellen Lage mehr dignitas. Doch die dignitas wird von ihm kritisch gesehen: »Was immer das ist, Marcia, was uns äußerlich Glanz verleiht, Kinder, Ämter, Reichtum, weite Atrien und von der ausgeschlossenen abhängigen Menge gefüllte Vorräume. ein berühmter Name, eine vornehme und schöne Gemahlin, und das übrige. von ungewissem und tüchtigem Zufall abhängend - von Fremdem und Geliehenem stammt der Glanz« (Seneca, Dialogi 6,10,1). Die zentralen sozial relevanten Merkmale innerhalb der freien Bürgerschaft waren Vermögen und erst an zweiter Stelle die charakterliche Eignung. Nach Horaz[4] leben Jung und Alt nach dem verwerflichen Motto: »0 Bürger, Bürger, Geld muss man als erstes erstreben. Tugend erst nach dem Geld« (Horaz, Epistulae 1,1,53 f.). Juvenal bekräftigt dies: »Soviel Geld einer im Kasten hat. soviel Wertschätzung genießt er« (Juvenal, Satiren 3.143 f.). Seneca der Ältere lässt in seinen Controversiae einen gewissen Porcius Latro sprechen: »Aber nichts in den menschlichen Angelegenheiten zeigt klarer die Tugenden: das Vermögen hebt auf den Rang der Senatoren, das Vermögen trennt den römischen Ritter vom gemeinen Volk (plebs), das Vermögen befördert den Rang in den Lagern, das Vermögen sucht die Richter auf dem Forum aus« (Seneca Controversiae2.1.17). Als unter Tiberius die Verschuldung viele um Haus und Hof brachte, hatte dies den Verlust von Stellung und Ruf zur Folge. Wegen ihres geringen Ver¬mögens schieden Senatoren freiwillig aus ihrem Stand aus. Mit Hilfe des Vermögens konnte man in die angesehenen oberen Stände gelangen, ein Vermögen befähigte zu Freigebigkeit und sozialen Lei¬stungen, wodurch das soziale Ansehen stieg, ein Vermögen zwang nicht zu entehrender Arbeit. Bestimmte Beamtentypen wurden sogar nach ihrer Besoldungsgruppe benannt. Die sexagenarii, centenarii, ducenarii erhielten ein Salär von 60.000, 100.000 bzw. 200.000 Sesterzen (Prell 1997, 39).
Den obersten Rang nahmen die Senatoren ein.[5] Senator konnte man nur werden, wenn man über ein Vermögen von mindestens 400.000, seit Augustus[6] von 1 Mill. Sesterzen verfügte.[7] Mit dem breiten Purpur-streifen auf der Tunika und ihren roten Schuhen unterschieden sich die Senatoren als hohe Würdenträger sichtbar vom gewöhnlichen Volk, im Theater waren die vorderen Sitze für sie reserviert.[8] Das Vermögen der Senatoren bestand in Grundbesitz und daraus erfließendem Einkommen sowie in Geldverleih, Vermietung und Verpachtung. Der nächst niedrigere aber immer noch sehr hohe Rang war der Ritterstand. Mindest-vermögen hier: 400.000 Sesterzen. Ritter trugen einen schmalen Purpurstreifen und einen goldenen Ring. Dann kamen die Dekurionen, die je nach Stadt immer noch mindestens 20.000 bis 100.000 Sesterzen besitzen mussten, und dahinter die Augustalen, deren die Aufgabe die Pflege des Kaiserkults war. Im allgemeinen waren derartige gesellschaftlichen Ränge erblich, bisweilen wählbar, zunehmend aber entschieden die Kaiser, wer ihnen angehörte oder nicht. Sie halfen gelegentlich auch verarmten Senatoren finanziell aus der Verlegenheit. [9]
|
Rang |
Mindestbesitz |
|
Capite census |
365 Asse |
|
Proletarius |
1.500 Asse |
|
Augustalis |
20.000 Sesterzen |
|
Decurio |
20.000 - 100.000 |
|
Equester |
400.000 |
|
Senator |
4000.000 - 1 Mill. |
Alle anderen BürgerInnen gehörten der plebs an, auch populus, turba, multitudo oder vulgus genannt. Sie mussten ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen. Mit der abnehmenden politischen Bedeutung der plebs in der Kaiserzeit zeigt sich auch eine wachsende Verachtung des Volkes von Seiten der Oberschichten. Bei der augustäischen Volkszählung des Jahres 4 u.Z. wurden die Einwohner unter 200.000 Sesterzen erst gar nicht gezählt, »aus Furcht, sie könnten darüber in Unruhe versetzt und rebellisch wer-den« (Cassius Dio 55,13,4).
Die direkte politische Macht der plebs war bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. merklich zurückgegangen, um in der Kaiserzeit fast gänzlich zu verschwinden. Das staatliche Interesse weiter Teile der großstädtischen plebs reduzierte sich auf die Getreideverteillungen, die Lebensmittelpreise und die Aufführungen im Zirkus. Seneca schildert die Menge als grausames und unmenschliches Zirkuspublikum, dem der Anblick des Todes Freude bereitet. Und dies scheint sich bis in die späte Kaiserzeit nicht geändert zu haben. Rein juristisch gesehen bildete die plebs eine Einheit im Sinne des Bürgerstandes. Für Sallust[10] galt die gesamte plebs urbana als arm und charakterlich verdorben. Jedoch musste auch den Zeitgenossen auffallen, dass sich die Plebs aus den verschiedensten Gruppen zusammensetzte. Manche antike Autoren heben diese Differenzierungen hervor. Für sie ist die Plebs keine uniforme Masse, sondern es gibt in ihr Abstufungen nach Charakter und wirtschaftlicher Situation. Der Bettler als ein homo »plebis ultimae« (Seneca Dialogi 2.13.3) gehört nach Seneca zur untersten Stufe der Plebs. Tacitus[11] trennt den populus in eine pars integra et magnis domibus adnexa[12] und in die »plebs sordida et circo ac theatris sueta«[13] (Tacitus, Historien 1,4,3). Zu ersterem, dem der Nobilität enger verbundenen Teil, zählen wohl auch die Klienten.[14] Den zweiten Teil der Plebs, der im Staat nur eine Gewährleistung von Brot und Spielen sieht, stellt Tacitus auf eine Stufe mit den deterrimi servorum[15]. Die vernacula multitudo[16] sei gewohnt, sich nicht im Zaum zu halten, und nicht imstande, Mühen zu ertragen. Klar treten hier soziale Werturteile der Oberschicht zu Tage. Auch für Manillus ist das Volk nicht eine einheitliche Masse: »Und wie das Volk (populus) in den riesigen Städten geteilt wird und Senatoren (patres) die Herrschaft besitzen, die Ritter den nächsten Rang, und du siehst, wie das Volk (populus) unterm Ritter, der müßige Pöbel (vulgus iners) unter dem Volk steht und vollends ein namenloses Gewühl (turba) ist, also gibt's auch im riesigen Kosmos ein Staatengebilde« (Manillus 5,734 -738). Autoren der Oberschicht wie Cicero, Horaz und Tacitus belegen die Plebs häufig mit pejorativen Adjektiven. Für Cicero ist sie die sentina urbis, der Abschaum der Stadt, ein elendes und hungriges Gesindel (misera ac ieuna plebecula) und ein Blutsauger der Staatskasse (Cicero, Epistulae ad Atticum 1,16,1 und 1,19,4). Juvenal fühlte sich durch die immensa nimiaque plebs[17] bedrängt und bedroht Horaz nennt die plebecula an Zahl stärker, an Verdienst und Rang geringer als die Ritter, ungebildet, plump und stets zum Raufen bereit. Mit Gastmählern und Klelderspenden könne die ventosa plebs[18] geködert werden (Horaz, Epistulae 2.1.182.185 und 1.19.37 f.). Das Wort vulgus beinhaltet eine persönliche, subjektive Wertung der Autoren. Das vulgus als der gemeine Pöbel stellte in ihren Augen innerhalb der Plebs die untere, ethisch niedrigste Ebene dar. Es wird als profanum. stolidum, inops, ignavum, iners, indoctum, impudens, imprudens, credulum und imperitum[19] (so Horaz und Tacitus) abgewertet. Plebs und Sklaven werden häufig auf eine soziale Stufe gestellt (Prell 1997, 34).
Einen bedeutend besseren Ruf genießt die plebs rustica, die auf dem Land lebende Bauernschaft, die das Ackerland der Patrizier bewirtschaftet:
Die plebs rustica, also sämtliches freie Volk, das auf dem Lande außerhalb der Städte lebte, setzte sich aus Kleinbauernfamilien, freien Saisonarbeitern, Wanderarbeiten Knechten, Mägden, Hirten und Fischern zusammen. In kleineren Orten waren auch Handwerker und Kleinhändler vertreten. Da ein Leben auf dem Lande und die Landarbeit in den Augen der Oberschicht erstrebenswert und tugendhaft waren, ist ihr Urteil über die plebs rustica eher wohlwollend. Die arme, kärgliche Lebensweise auf dem Lande wird dabei als »Schule der Sparsamkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit« (Cicero) gesehen, Eigenschaften, die bei der plebs urbana nicht zu finden sind. Doch der einfache Bauer wird auch als dumm dem ehrenhaften Städter gegenübergestellt, und an so mancher Stelle wird die Arroganz des Städters gegenüber dem Landmann sichtbar (Prell 1997, 34 f.).
Die Zahlen der zu den einzelnen Rängen Gehörigen, schwanken bei einer Gesamtbevölkerung im Italien zu Augustus Zeiten von ca. 7,5 Mill. erheblich. Etwa 3 Mill. waren Sklaven, je nach Kaiser zwischen 200 und 1000 Senatoren, etwa 20.000 Ritter. Einige Tausend dürften Dekurionen gewesen sein, nicht mehr als 200 Augustalen. Diesen höheren Rängen stehen nach Seneca multi milia von Armen gegenüber, eine recht unpräzise Angabe, jedenfalls aber multi wie auch Cicero schreibt.[20] Für die Stadt Rom "lassen die hohe Bevölkerungszahl und die in der Literatur angeprangerten schlechten Lebensbedingungen auf ein hohes Armutspotential schließen. Sicherlich gelang es dem Großteil der Bevölkerung nicht, finanzielle Ressourcen zurückzulegen oder Besitztümer anzuhäufen. Die Masse der Römer lebte von der Hand in den Mund und war von absoluter Armut besonders bei Preissteigerungen von Nahrungsmitteln bedroht" (Prell 1997, 66 f.).
Die grundlegende Zuordnung in der römischen Gesellschaft verläuft aber nicht ausschließlich nach dem Kriterium arm oder reich. Ein Senator konnte verarmen, ein freigelassener Sklave zu ansehnlichem Vermögen kommen. Über den gesellschaftliche Rang entscheidet in erster Hinsicht die Zugehörigkeit zu den Freien oder den Sklaven und in zweiter Hinsicht jene zu einem der angesehenen ordines oder zur niederen plebs. "Erst innerhalb dieser Kategorien ist zwischen (relativ) arm und (relativ) reich zu unterscheiden." (ebd., 43).
In der Antike galt Reichtum als Voraussetzung für persönliches Wohlergehen und soziale Wertschätzung, Armut und die mit ihr verbundene Notwendigkeit, körperlich zu arbeiten, dagegen als Schande. »Ich hasse arme Leute«, steht auf einem pompejanischen Garffito zu lesen: »Wenn jemand etwas für nichts haben möchte, ist er ein Dummkopf. Er sollte dafür bezahlen«. Bereits die gewöhnliche paupertas wurde von den Römern als äußerste Schande und Entehrung erlebt. »Schmutzige Armut bleibe fern meinem Heime«, fleht der Dichter Horaz (Epistulae 1,2,94-97),[21] Armut ist »das unerträglichste aller Übel im menschlichen Leben« (Lukian, Gall. 1).[22] Wohl gab es Ausnahmen von dieser allgemeinen Überzeugung: Sokrates[23] lebte in Ar-mut und hielt Reichtum "weder für erforderlich noch unbedingt hilfreich" (Finley 1993, 33); Plato[24] verlangte von den Philosophen den Verzicht auf Besitz. Es gab soziale Aussteiger wie Krates von Theben,[25] der seinen gesamten Reichtum aufgab, und Philosophen, die jegliche Pflege der leiblichen Bedürfnisse ablehnten, wie den Kyniker Diogenes[26] in seinem berühmten Fass. Aber diese Ausnahmen bestätigen eher die Regel als sie zu widerlegen. Auch die stoischen Philosophen Roms plädieren immer wieder dafür, unverschuldete Armut nicht als Schande anzusehen. Es käme beim Menschen nicht darauf an, mahnt Seneca, »wie viel Acker er unter dem Pflug hat, wie viel Kapital er ausleiht, von wie viel Menschen er gegrüßt wird, auf wie kostbarem Bett erliegt, aus wie funkelndem Becher er trinkt, sondern wie gut er ist« (Epistulae 76,15) und Apuleus[27] verteidigt sich vor Gericht mit den Worten:»... nimm einmal an ... ich wäre deshalb arm, weil mir das Schicksal Reichtum missgönnt hat und, wie es so oft geht, ein Vormund ihn veruntreut oder ein Feind geraubt oder mein Vater ihn mir nicht hinterlassen hat: sollte man das einem Menschen zum Vorwurf machen - die Armut -, was doch keinem Tiere als Schuld angerechnet wird ... ?« - (Apologia 21,1 f,). Dennoch muss Seneca bereits für seine Zeit einräumen: »Schließlich ist die Gesinnung so weit verkommen, dass paupertas eine Beleidigung und ein Vorwurf ist, verächtlich den Reichen, verhasst den Armen« (Epistulae 115,11). Cicero hatte diese Verachtung auf die gesamte arbeitende plebs ausgedehnt: »Pöbel und Ab-schaum« sei sie, »Blutsauger der Staatskasse, armseliges und hungriges Gesindel« (ad Atticum 1,12,11). Die mendici vor allem, die Bettelarmen, die gar nichts hatten, galten weniger als nichts. Als vorbildlich rühmt Valerius Maximus (6, 8, 11)[28] jenen Sklaven, der seinen Herrn vor den Verfolgern gerettet hatte, indem er einen Bettler tötete: »Als er bemerkte, dass die blutdürstigen Soldaten über sie herfallen wollten, schaffte er seinen Herrn bei Seite, ergriff einen armen (egenentem) alten Mann, schlug ihn tot, und legte ihn auf den Scheiterhaufen, und sagte, dort brenne er«. Die Armen, so Artemidor,[29] »gleichen einfachen, unbekannten Orten, wo man Mist und sonstigen Müll hinwirft, die Reichen aber den heiligen Bezirken der Götter« (Oneirokritika 2,9).
"Wege aus der Armut" sieht Marcus Prell (1997, 232) auf drei Feldern:
|
Selbsthilfe |
Außerstaatliche Fremdhilfe |
Staatliche und kaiserliche Maßnahmen |
|
Arbeit |
Familie |
Landverteilung (Kolonisation) |
|
Militärdienst |
Private Wohltäter |
Congiarien und Spenden |
|
Kriminalität |
Patrone |
Alimentarstiftungen |
|
Prostitution |
Kollegien |
Miet- und Schuldenerlasse |
|
Selbstverkauf in Sklaverei |
||
|
Kindesaussetzung und -verkauf |
||
|
Migration |
||
|
Betteln |
||
|
Kollektives Handeln |
Da eine regelmäßige und verlässliche öffentliche Hilfe in der Antike nicht etabliert war, ist die eigene Vor-sorge für die Lebensfristung für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von größter Bedeutung. Neben der Arbeit, die nicht immer zu bekommen war, gab es eine Reihe mehr oder weniger legitimer Möglichkeiten, sich selbst zu helfen.
Als "wirklich frei" galt den Römern nur der Reiche, "denn er war nicht zur Arbeit gezwungen" (ebd., 146). Lohnarbeit ist in der allgemeinen Meinung nach Cicero[30] (De officiis1,150-51) »eines Freien nicht würdig und niedrig«.Handwerk sei eo ipso eine »niedriges Gewerbe. Denn eine Werkstatt kann keinen freien Geist atmen«. Arbeit war Sklavenarbeit, auch wenn sie von freien Handwerkern oder Tagelöhnern verrichtet wurde. Wiederum ist es Cicero, der der Verachtung am deutlichsten zum Ausdruck verhilft:
Zunächst werden die Erwerbszweige missbilligt, die sich der Ablehnung der Menschen aussetzen, wie die der Zöllner, der Geldverleiher. Eines Freien unwürdig und schmutzig sind die Erwerbsformen aller Tagelöhner, deren Arbeitsleistung, nicht handwerkliche Geschicklichkeit erkauft werden. Denn es ist bei ihnen gerade der Lohn ein Handgeld für ihre Dienstleistung. Für schmutzig muss man auch diejenigen halten, die von den Großhändlern Waren einhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Denn sie dürften nichts voranbringen, ohne gründlich zu lügen. Es gibt aber nichts Schändlicheres als Unwahrhaftigkeit. Alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Am wenigsten kann man die Fertigkeiten gutheißen. die Dienerinnen von Genüssen sind: "Fischhändler, Metzger, Köche, Geflügelhändler und Fischer" wie Terenz[31] sagt. Füge. wenn es gefällt, hier hinzu: Salbenhändler, Tänzer und die ganze Zunft der Schausänger. [...] Wenn der Handel im kleinen Rahmen erfolgt. so muss man das für schmutzig erachten; wenn dagegen im großen und umfangreichen Geschäft, indem er vieles von überallher beibringt und es vielen ohne Betrug zur Verfügung stellt, dann darf man ihn durchaus nicht tadeln (Cicero, De officiis 1, 150 f.).
Die positive Bewertung des Reichtums wurde untermauert von der Überzeugung, dass persönliche Unabhängigkeit und Zeit zur Muße zu den Vorbedingungen der Freiheit gehörten. »Denn zu einem freien Manne«, schrieb Aristoteles[32] (Rhetorik 1367a 32), »gehört es, dass er nicht unter der Beschränkung durch einen anderen lebt«. Aus dem Zusammenhang der Stelle wird klar, dass seine Auffassung von einem Leben unter Beschränkung sich nicht ausschließlich auf Sklaven bezog, sondern sich auch auf Lohnarbeit erstreckte, auf alle Leute, die wirtschaftlich abhängig waren (Finley 1993, 39). Wie wir bereits gesehen haben, spiegelt sich diese Mentalität im Sprachgebrauch. Auch die griechischen Worte ploutos und penia, üblicherweise wiedergegeben mit ,Reichtum' und ,Armut', hatten noch einen anderen Unterton, den Veblen (1971, 27) "die Unterscheidung zwischen Heldentat und Plackerei" nennt. "Ein plóusios war jemand, der reich genug war, um von seinem Einkommen anständig zu leben (wie wir sagen würden), ein penes war das nicht. Letzterer musste nicht mittellos oder gar im wahrsten Sinne arm sein ... aber er war gezwungen, sich ständig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kurz, penía bedeutete den harten Zwang zu schuften, während der Almosenempfänger, der Mann, der wirklich ganz mittellos war, normalerweise ptóchos, Bettler, genannt wurde und nicht pénes" (Finley 1993, 38).
Einzige Ausnahme von der generellen Verachtung der Arbeit war die Bauernarbeit. Da die Mehrheit der römischen Patrizier ihr Vermögen großem Grundbesitz verdankten, und die Bauern-Krieger ständig in Bereitschaft waren, für Rom in den Krieg zu ziehen, galt die Verwaltung und Bearbeitung des Grundbesitzes als ehrenhaft. Mit seiner Lehrschrift Georgica hat der Dichter Vergil[33] dem Landleben und den Bauern ei rühmliches Denkmal gesetzt.
Eine etwas höhere Achtung brachten die griechischen Schriftsteller der Arbeit entgegen. Sie gilt ihnen als "Heilmittel" gegen Armut (Prell 1997, 150). »Du aber bist ein kerngesunder Mensch, hast Hände und Füße und doch solche Angst vor dem Hunger? Kannst du nicht Wasser schöpfen, nicht schreiben? Nicht Kinder unterrichten, nicht jemandem Türhüter sein [...] Jeder Taglöhner, jeder Schuster findet einen, der ihm etwas zu verdienen gibt. Sollte ein guter Mann niemand finden?«, fragt etwa Epiktet[34] (Dissertationes 3.26.7). Zumindest für das Rom der Republik, in der es eine "stets und überall vorhandene Arbeitslosigkeit" gab (Mrozek 1989, 119, zit.n.ebd., 163), hätte der Philosoph unrecht. In den Zeiten reichlich bautätiger Kaiser wie Augustus oder Claudius wird es leichter gewesen sein, Arbeit zu finden.
Die Verachtung der Arbeit ging aber nur von der Oberschicht aus. Die Arbeiter selbst verfügten über ein hohes Selbstwertgefühl, das mit ihrer Arbeit verbunden war. Nicht selten ließen sie sich auf ihren Grabsteinen mit ihren Berufsinsignien darstellen - freilich nur, sofern sie sich ein Grabmal leisten konnten. Viele von ihnen schlossen sich zu Zünften (collegiae) zusammen, Vereinigungen, die eher gesellschaftlichen Zusammenkünften und religiösen Riten dienten als der Interessensvertretung. Tatsächlich aber war das Leben der meisten arbeitenden Menschen ein ständiger Existenzkampf.
Die "einzige institutionalisierte Möglichkeit" gesellschaftlichen Aufstiegs in Rom war das Militär (Alföldy 1984, 129). Um den Preis der Gefährdung des Lebens im Kampf sicherte er ein regelmäßiges Einkommen ebenso wie eine Versorgung im Alter. Zwar verdiente einer als Legionär etwas weniger als ein Taglöhner, aber bei seiner Ausmusterung nach 20 Jahren Dienstzeit konnte er mit einer hohen Abfindung rechnen, unter Augustus immerhin 3.000 Denare, "mehr als den dreizehnfachen Jahressold" (Prell 1997, 177) oder mit der Zuteilung eines Landbesitzes.
Für das Alltagsbewusstsein der Römer korreliert Armut mit Kriminalität: Cicero wirft in einer Rede vor dem Senat Räuber, Plünderer und »arme Schlucker, zur gleichen Hoffnung auf die altgewohnten Raubzüge verleitet« in einen Topf (Catilinariae Orationes 2,20), für Seneca ist die Kriminalität ein durch die Not erzwungener Ausweg: »Sag nämlich einem von denen, die vom Raub leben, ob sie in den Besitz der Dinge, die sie sich durch Straßenraub und Diebstahl verschaffen, lieber auf gute Art kommen wollen: wünschen wird der, dessen Lebensunterhalt darin besteht, herumzulungern und Passanten auszuplündern, lieber jene Dinge zu finden als zu entreißen; niemanden wirst du ausfindig machen, der nicht der Schlechtigkeit Gewinn ohne Schlechtigkeit genießen will« (Dial. 7,24,1). "Armut zwingt, alles zu begehen" sagt Horaz (Carmina 3,24). Es gab Resozialisierungsversuche, etwa die Einziehung zum Heer oder die Ansiedlung von Piraten durch Pompeius. Auch in der Rechtsprechung wurde die Notsituation berücksichtigt. Freigelassene, Klienten oder Taglöhner, die ihre Herren bestahlen, wurden nicht unbedingt auf Diebstahl angeklagt. Sklaven konnten ja gezüchtigt werden, bei Diebstahl einer Sklaven-Prosituierten wurde Wollust als Motiv anerkannt (Prell 1997, 247). "Gewöhnliche Banditen traf jedoch die volle Härte des Strafgesetzes. Sie mussten in die Arena, wurden gekreuzigt oder auf Pfähle gespießt" (ebd., 248).
»Ist dir nicht bekannt, dass wir bettelarm sind, und denkst du nicht mehr daran, was wir alles von ihm erhielten und wie wir den vergangenen Winter verbracht hätten, wenn uns nicht Aphrodite ihn gesandt hätte« (3 ), so lässt Lukian in den Hetairikoi Dialogoi (Hetärengespräche) die Mutter die Tochter tadeln, die sich dem Freier verweigert hat. »Auf anderer Weise können wir mit dem Leben nicht fertig werden, liebe Tochter«, so eine andere, die nach dem Tod des Mannes, eines angesehenen Kupferschmieds, zunächst sein Werkzeug verkauft hatte und sich dann mit Weben, Wollerzeugung und Spinnen durchgeschleppt hatte: »So zog ich dich auf, meine Tochter, und wartete auf das, was ich erhoffte« (6). Was sie erhofft hatte, bedeutete für die Tochter den "Anfang einer Prostituierten-Karriere" (Prell 1997, 249). Bereits ihre Entjungferung hatte für drei Monate zum Leben der beiden gereicht.
Prostitution ist zwar schändlich, aber erlaubt. Als turpes (sittlich verkommen) galten Prostituierte und als ehrlos, dennoch war Prostitution nicht verboten. Sklavinnen und Sklaven hatten ihren Herrn ohnedies zur Verfügung zu stehen, freie Römerinnen mussten ihr Gewerbe beim Ädilen[35], anmelden. Es gab aber feine Unterschiede: Frauen, deren Großväter, Väter oder Ehemänner Ritter waren, durften sich nicht prostituieren und Senatorensöhnen war die Ehe mit einer Prostituierten verboten. Prostituierte mussten eine eigene Klei-dung tragen, eine dunkle Toga über einer kurzen Tunica. »Solange sie sich vor aller Augen bewegen, er-wecken sie den Eindruck höchster Vornehmheit, von Sauberkeit und Eleganz«, schreibt Terenz in seiner Komödie Eunuchus, und verbergen so »die Einsicht in ihr Elend, ihren Schmutz und ihre Gemeinheit, in das Leben, das sie, stets geplagt von Hunger, einsam, voller Schmach, zuhause führen« (932-940). Lupae, die Wölfinnen, nannte man die Ärmsten unter ihnen, die sich im Schutz der Mausoleen an den Ausgängen der Stadt wahllos jedermann feilboten. Im öffentlichen Bewusstsein und vor dem Gesetz wird Armut nicht als Entschuldigung anerkannt. Der Verkauf oder die Vermietung von Kindern für sexuelle Zwecke ist seit dem 3. Jh. v.u.Z. verboten, wird aber dennoch praktiziert. Erst unter Domitian[36] (51-96) wird die Kastration und die Prostitution von Kindern generell verboten, der Verkauf von Kindern erst Jahrhunderte später.
Die Praxis, eigene Kinder als Sklaven zu verkaufen war eine gängige Praxis unter freien Römern, besiegelt mit regelrechten Kauffverträgen und Quittungen:
Maximus Batonis hat von Dasius Verzonis Pirusta ein Mädchen namens Passia oder wie sie sondt heißen mag, ungefähr 6-jährig, als Körbchenträgerin zum Pries vom 205 Denare gekauft und in Besitz genommen.
Es wird festgehalten, dass das Mädchen gesund ist, weder wegen Diebstahls, noch anderer Vergehen entlassen, weder flüchtig noch entlaufen. Sollte aber jemand, ausgenommen Maximus Batonis, dem diese Sache jetzt gehört, Ansprüche auf das Mädchen oder einen Anteil an ihm durchsetzen und begründetermaßen Eigentums- oder Besitzrechte geltend machen können, fordert Maximus Batonis in guten Treuen den Betrag und nochmals soviel, für den das Mädchen gekauft worden ist, und Dasius Verzonis Pirusta verpflichtet sich in guten Treuen dazu (Fontes Iuris Romani Anteiustiniani III, Nr. 87, zit.n. Bühler 1990, 438 f.).
Der Vertrag ist von 7 Zeugen unterschrieben und die ordentliche Abwicklung wird durch eine Quittung bestätigt:
Von Maximus Batonis den Betrag von - 205 - Denaren für das oben erwähnte Mädchen erhalten und entgegengenommen zu haben bestätigt. Dasius Verzonis. Ausgestellt zu Kartum in den Kalenden des April am 16, im 2. Jahr der Regierung des Titus Aurelius Caesar Antonius Pius, im 2. Jahr des Konsulats des Bruttius und des Praesens (ebd., 439).
In besonderer Weise gefährdet waren Kinder in Zeiten von Hungersnöten und Kriegen. So berichtet etwa Josephus Flavius[37] von einer Belagerung Jerusalems um das Jahr 70, während der Kinder und Erwachsene verhungerten, und eine Frau ihre eigens Kind tötete und verzehrte. Anlässlich einer Gesetzesnovelle beschreibt Kaiser Valentinian III[38] das Ausmaß der Not während des Krieges in Italien:
Es ist wohlbekannt, wie vor kurzem ein scheußlicher Hunger in ganz Italien gewütet und die Menschen gezwungen hat, ihre Kinder bzw. ihre Eltern zu verkaufen, um dem drohenden Tod zu entgehen. So sehr hat einen jeden die erbärmliche Abgezehrtheit und die Blässe der Sterbenden erschreckt, dass alle Liebe, mit der uns die Natur ausstattet, vergessen ging, und man sich dazu hinreißen ließ, sein eigenes Fleisch und Blut zu veräußern: denn es gibt nichts, zu dem Überlebensangst nicht anstiften könnte. Nichts ist dem Hungernden allzu verwerflich, nichts ist ihm verboten. Sein einziges Bestreben geht dahin, irgendwie zu überleben. Besonders schlimm ist es, so meine ich, wenn dabei die persönliche Freiheit zugrunde geht, während das Leben seinen Fortgang nimmt und von den Widerwärtigkeiten der niedrigsten Sklaverei vergällt wird, so dass man sich schämen muss, dem Untergang entronnen zu sein (ebd., 430).
Erst im Jahr 326 wurde die so genannte Schuldknechtschaft abgeschafft, durch die ein Schuldner oder eines seiner Kinder bis zur Abzahlung seiner Schuld in die Knechtschaft seines Gläubigers geriet. Freilich nur in der westlichen Hälfte des Reiches. Wie wir aus ägyptischen Papyri wissen, war die Praxis im Osten noch Jahrhunderte später üblich:
Von seinen Gläubigern wurde er [ein Freund des Verfassers, B.R.] gezwungen, all sein Eigentum zu verkaufen, sogar die Kleider, die seine Scham bedeckten. Und als auch diese verkauft waren, konnte er kaum die Hälfte des Geldes für seine Gläubiger zusammenkratzen, die - diese unbarmherzigen und gottlosen Leute - ihm all seine Kinder, sozusagen noch Säuglinge, weggenommen hatten. Wir schreiben Dir diesen Brief, um dich zu bitten, du mögest helfen, soweit Deine Mittel es immer gestatten, damit er seine Kinder loskaufen kann (ebd., 433).
Es dauerte bis zur Regentschaft von Kaiser Justinian, bis dieses Vergehen endgültig als solches gewertet und verboten wurde. Im Jahr 556 verfügt der Kaiser:
Nachdem wir festgestellt haben, dass man sich an verschiedenen Orten unseres Reiches in dem Sinne vergeht, dass Gläubiger sich unterstehen, die Kinder ihrer Schuldner als Pfänder oder für Sklavenarbeit in Verhaft zu nehmen oder weitervermieten, verbieten wir dies aufs strengste und befehlen, dass, wen sich jemand so etwas hat zuschulden kommen lassen, er nicht nur seines früheren Guthabens verlustig geht, sondern dazu zu verurteilen ist, demjenigen, den er solchermaßen verhaftet hat oder seinen Eltern darüber hinaus eine eben so große Summe zu bezahlen, und dass er dazu noch von den Behörden seines Wohnortes der Körperstrafe zu unterziehen ist, da er sich die Frechheit herausgenommen hat, eine frei Person wegen einer Geldschuld zu verhaften, zu verdingen oder in Pfand zu nehmen (ebd., 434).
Vom 1. Jh. v.u.Z. bis in das 4. Jh. u.Z. gibt es einen stetigen Zuzug von Landbevölkerung nach Rom. Die Ursachen bestehen in der Vertreibung von Kleinbauern durch Großgrundbesitzer, in Bürgerkriegen und in der Attraktivität des vermeintlich besseren Lebens in der Großstadt. Getreideverteilungen zögen »Faule, Bettler und Strolche aus ganz Italien nach Rom«, klagt Sallust,[39] sie zögen »das Nichtstun in der Stadt einer undankbaren Arbeit vor« (De Conjuratione Catilinae 37,7). »Aus dem ganzen Erdkreis« schreibt Seneca, strömen die Menschen in Rom zusammen (Dialogi 12,6,2 ff.), manche Teile Italiens, wähnt Strabo,[40] seien bereits entvölkert (Geographika 5,3,1). Die Politik reagiert mit Landverteilungen, die Überbevölkerung der Stadt bewirkt Emigration. 80.000 wandern allein um 46 v.u.Z. in die Kolonien aus, in der Mehrzahl landlose Veteranen und verarmte Proletarier. Die Abwanderung ging so weit, dass Cäsar ein Ausreiseverbot erließ.
In Griechenland wurden im Krieg eroberte Gebiete durch das Los an Kleruchen (Aussiedler) verteilt, die das Bürgerrecht behielten. Die dadurch begründeten Kolonien (Kleruchien) blieben mit dem Mutterland verbunden.
Auf der äußerst untersten Stufe standen die mendici (mendicus: der Bettler). »Sie stehen Tag und Nacht Frost aus; sie liegen auf der bloßen Erde, haben gerade nur so viel zu essen, wie die äußerste Not er-heischt und bringen es doch beinahe so weit, dass sie nicht sterben können« (Epiktet,[41] Dissertationes 3,26,6).[42] In Griechenland waren sie von der Gesellschaft ausgeschlossen, in Italien wurden sie verachtet. Phänomene, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen, werden auch aus Rom berichtet: Verkleidung, Vortäuschung von Verkrüppelung, auch die Verstümmelung von Kindern:
Über das Ausmaß des Bettelwesens in Italien wissen wir jedoch so gut wie nichts. Überstieg die Zahl der Bettler den in einer jeden Gesellschaft vorhandenen natürlichen Grundstock? Bettlerumzüge wie im Mittelalter sind nicht überliefert. Auf alle Fälle muss es eine beträchtliche Zahl an Bettlern gegeben haben, da keine staatlichen Sicherungssysteme gegen Krankheit, Alter und Invalidität existierten. Das römische Recht sah eine Unterstützungspflicht armer oder verarmter Eltern durch ihre Kinder oder Freigelassenen vor. Jedoch die ganz Armen, die unverheiratet und kinderlos waren, mussten bei Arbeitsunfähigkeit zum Betteln gehen. Zum unfreiwilligen Bettler konnten die allein stehenden Alten, Kranken, Behinderten, der kinderlose Tagelöhner, der Arbeitslose, der invalide Veteran, der vertriebene Bauer, der kranke Freigelassene, der entflohene Sklave, das Findel- und das Waisenkind oder die arbeitsunfähige Witwe werden, also alle die, die nicht durch Arbeit für ihr Auskommen sorgen konnten und nicht unter dem Schutz einer Familie oder eines Patrons standen. Auch der Schiffbrüchige, der beim Untergang sein Hab und Gut verloren hat, taucht öfters in der Literatur als Bettelnder auf (Prell 1997, 73).
Auch eine föderalistische Verteilung des Bettlerproblems kommt gelegentlich zum Tragen, etwa unter Alexander Severus.[43] "Personen, die zu nichts mehr taugten, überwies er an einzelne Gemeinden, die für deren Unterhalt zu sorgen hatten, damit sie nicht als Bettler lästig fielen" (Prell 1997, 73). Ebenso die in späteren Zeiten so durchgehende Unterscheidung zwischen echten und unechten Bettlern: »Alle, die umher-schweifende Bettelei betreiben und damit auf der Straße ihren Lebensunterhalt suchen, sollen untersucht und die Beschaffenheit ihrer Körper und die Rüstigkeit ihres Alters gemustert werden (Codex Justinianus 11,26; Codex Theodisianus 14,18,6). Derlei "Gesindel" aufzuspüren, konnte durchaus vorteilhaft sein: »Die Faulenzer sowie solche, die wegen nicht vorhandener Schwäche kein Mitleid verdienen, sollen, wenn sie vom Sklavenstand sind, demjenigen zum Eigentum werden, der sie fleißig und eifrig aufgespürt hat, diejenigen aber, die Freigeborene sind, soll derjenige, der ihre Liederlichkeit angezeigt und bewiesen hat, im ewigen Kolonat behalten« (ebd.).
Von einer schaurigen Geschichte berichtet Seneca in seinen Controversiae (10, 4-20), in denen fingierte Rechtsfälle zusammengestellt sind. Dabei wird ein Sachverhalt vorgetragen und anschließend diskutiert. Im Fall der Mendici Debilitati, der zum Krüppel gemachten Bettler, hatte ein Mann ausgesetzte Kinder bei sich aufgenommen. Um vom Mitleid der Leute leben zu können, verkrüppelte er gewaltsam die Findelkinder, Indem er dem einen die Augen ausstach, einem anderen die Fußgelenke brach, ein Bein zerquetschte oder die Oberschenkel zertrümmerte. Er ließ sogar manchen die Zunge herausschneiden, denn Unfähigkeit zu Betteln ist eine Art des Bettelns. Die Kinder wurden sodann zum Betteln auf die Straße, in unterschiedliche Stadtbezirke und zu verschiedenen Haustüren geschickt. Sie erschienen auf Hochzeiten als unglücksbringendes Omen. Bei öffentlichen Opfern galten die Verkrüppelten als dunkle Vorzeichen. Seine Grausamkeit lohnte sich für den Mann, denn viele empfanden Mitleid mit den Verkrüppelten. Aufgrund der misericordiapublica fand er sein Auskommen. Interessant an diesem Fall, mag er wahr sein oder nicht, ist die aufgezeigte unterschiedliche Einstellung der Menschen zu den verkrüppelten Kindern. Während die einen dem Mann Unmenschlichkeit vorwarfen, hoben andere hervor, dass er den Kindern das Leben gerettet habe und ein Leben als verkrüppelter Bettler besser als der Tod sei (ebd., 74).
Auch das Motiv der Verdächtigung des Almosens als Heranzüchtung von Bettlern taucht auf: »der dir das erste Mal etwas gab, ist verantwortlich, denn er machte dich faul«, lässt Plutarch[44] (Moralia 135 E) einen Spartaner die Weigerung begründen, einem Bettler etwas zu geben. In besonderer Weise verächtlich er-scheinen den Römern die Juden und Jüdinnen unter den Bettlern, »die, die von Haus aus das Betteln schon gelernt« haben (Martial 12.57,13) und sich als Wahrsager/innen und Traumdeuter/innen andienen. Obgleich es unter den Juden, von denen in der Kaiserzeit zwischen 15.000 und 40.000 trotz einzelner Beschränkungen offiziell anerkannt in Rom lebten, durchaus Wohlhabende gab, die als Händler, Geldverleiher, Handwerker oder selbständige Arbeiter ihren Lebensunterhalt verdienten, war "die Lage der meisten Juden von Armut und, wie Martial und Juvenal bekunden, von Bettelarmut gekennzeichnet" (ebd., 75).
Eine äußerste Möglichkeit, dem bedauernswerten Schicksal des Bettelns zu entgehen, bestand in Rom darin, sich selbst als Sklaven zu verkaufen. Sie war freilich mit dem Verlust des höchsten gesellschaftlichen Gutes verbunden: dem Verlust der Freiheit als römischer Bürger.
"Zu einem solidarischen Handeln der Unterprivilegierten" ist es nach Prell (1997, 254) in Rom nie gekommen. Dennoch gab es Aufstände, in der Republik zahlreicher als in der Kaiserzeit. Ein Höhepunkt war zweifellos die Reform der Gracchen, die als Volkstribunen gegen massiven Widerstand der Großgrundbesitzer Landverteilungen durchzusetzen versuchten (s.u.). Im Jahr 75 v.u.Z. gab es Hungerunruhen in Rom. Später nutzten Politiker wie Cäsar den Unmut der Hungernden in Rom für ihre Herrschaftsinteressen und stachelten die plebs urbana zu Tumulten an. Es waren auch gar nicht immer die Armen, die protestierten, sondern oft genug Anhängerschaften bestimmter Machtpolitiker wie z.B. bei Catilinas[45] vergeblichem Staatsstreich im Kampf um das Konsulat. In der Kaiserzeit wandelt sich der "Mob" zur unpolitischen Masse. Hierher ge-hört die zum geflügelten Wort gewordene Klage Juvenals[46] über die Entpolitisierung der römischen Plebs: »Schon lange, seit wir unsere Stimmen niemandem mehr verkaufen, kümmert sich Menge um nichts: Das Volk, das einst Imperium, die Fasces, die Armee, kurz, alles verlieh, zieht sich jetzt zurück: Nach zwei Dingen lechzt es nur - nach Brot und Spielen« (Satiren 10, 77-81). Der Kaiser »wusste nämlich, dass man das römische Volk zu allererst durch zwei Dinge in der Hand behält, mit Getreideversorgung und mit öffentlichen Schauspielen. Die Herrschaft des Kaisers wird nicht weniger nach ihren Vergnügungen beurteilt als nach ernsten Dingen«, weiß der römische Anwalt Fronto.[47] Häufig waren Aufstände von Sklaven die Ursache von Unruhen. Bis zum Ende des 2. Jh. gab es nur 16 Unruhen im kaiserlichen Rom, nur 6 davon ausgelöst durch Hungersnöte. Im 3. Jh. gab es 29 Aufstände, darunter nur 2 Hungerrevolten (ebd., 254 f.). Über die Ursachen dieser Friedfertigkeit der Armen sind die Historiker uneins. Während manche deren Anpassung an die gesellschaftliche Hierarchie ins Treffen führen, meinen andere, unter ihnen unser Gewährsmann Prell, dass "der Grund für die fehlende Interessensgemeinschaft" in der "heterogenen Sozial-struktur der Unterschicht zu suchen" sei (Prell 1997, 256).
Auf Grund der nur in geringem Maße und nicht verlässlich etablierten Strukturen öffentliche Hilfe ist die private Wohltätigkeit für die Notleidenden der Antike von essentieller Bedeutung.
In den nur in geringem Maße um das Schicksal der Armen bekümmerten Gesellschaften der Antike hatte die Unterstützung durch Familie und private Wohltäter eine besonders große Bedeutung. Selbstverständlich hatten Eltern die Unterhaltspflicht für ihre Kinder, aber auch umgekehrt: Kinder waren verpflichtet, ihre Eltern für den Fall der Verarmung zu unterhalten, desgleichen Patrone ihre freigelassenen Sklaven, auch das gelegentlich umgekehrt.
Private Wohltätigkeit nimmt in Rom und Italien großen Raum ein. Ihre Formen, von denen wir aus hunderten Dankinschriften Kenntnis haben, sind vielfältig:
Hilfe für Freunde und Bekannte
Spenden an Gemeinden für Infrastruktur
Finanzierung öffentlicher Unterhaltung Speisung
Schenkungen und Vermächtnisse
Theater (Gebäude und Veranstaltungen)
Straßenerhaltung
Die Palette von privater Wohltätigkeit in Rom und Italien ist breit gefächert. Sie reicht von der Hilfe für Bekannte und Freunde bis zur Unterstützung ganzer Gemeinden durch Ausgaben für Infrastruktur, Unterhaltung und Speisung. Viele Schenkungen und Vermächtnisse kamen der Allgemeinheit zugute und entlasteten den Staat finanziell. Theater wurden auf Privatinitiative erbaut, Straßen unterhalten. Geehrt wurden die Wohltäter durch Dankesinschriften, und so birgt das epigraphische Material wertvolle Informationen. [...] An die 200 Inschriften belegen private Bautätigkeit, knapp 300 Inschriften bezeugen Geld- und Lebensmittelverteilungen [...] Anschauliche Beispiele finden sich in den literarischen Quellen. Q. Arrius ließ beim Begräbnis seines Vaters viele Tausende bewirten. Lucullus[48] soll an die römische Bevölkerung die unglaubliche Menge von vier Millionen Litern Wein als Congiarium ausgegeben haben. Der Konsul Lucius Cornellus Balbus[49] übertraf nach Cassius Dio[50] seine Zeitgenossen an Reichtum und Freigebigkeit so weit, dass er bei seinem Tode jedem Römer 100 Sesterzen vermacht haben soll. Agrippas Freigebigkeit erstreckte sich auf die Verteilung von Öl und Salz sowie die kostenlose Bäderbenutzung. Er ließ außerdem im Theater Gutscheine auf die Köpfe des Volkes niederregnen, die man gegen Geld, Kleider und andere Präsente einlösen konnte. Zahlreiche Kaiser folgten später dieser Art des Schenkens. Bei seinem Tode im Jahre 12 v.Chr. hinterließ Agrippa[51] den römischen Bürgen seine Gärten und das Bad. Augustus verteilte in seinem Namen an jeden Bürger 400 Sesterze. Manch einen Mäzen trieben die öffentlichen Aufwendungen in den Ruin.
Apuleius[52] bringt in seiner Apologie als Entschuldigung für seine prekäre Finanzlage freigebiges Verhalten vor: »Denn ich habe vielen meiner Freunde Hilfe gebracht und sehr vielen Lehrern Dank abgestattet, habe auch die Töchter einiger durch eine Mitgift unterstützt (Apuleus Apologia 23,2). Beliebt war die Einrichtung einer Stiftung, sei es zu Lebzeiten oder testamentarisch. Das Kapital wurde meist in Land investiert, und von der Rendite bestritt man die laufenden Aufwendungen. Ein Großteil der Stiftungen zählt zum Typ der Alimentarfonds zur Kinderunterstützung. Andere Dauer-Stiftungen trugen die Kosten für jährliche Feste, für die Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bädern und für die Ausrichtung von Spielen. In den Städten kam es in der Kaiserzeit häufig zu Sportula Verteilungen in Bargeld oder Naturalien. Eine besondere Form dieser Spenden waren Verteilungen im Gedächtnis an den Kapitalfondgründer. So blieb die gewissermaßen erkaufte Erinnerung an den Wohltäter lebendig und jeder, der der Zeremonie beiwohnte, wurde bedacht. Die Empfänger waren somit nicht die Bedürftigen, sondern die Anwesenden. Dabei ist eine soziale Diskriminierung analog zur gesellschaftlichen Hierarchie zu erkennen. Bei Geldverteilungen erhielten die Dekurionen den höchsten Betrag, etwas weniger die Augustalen und noch weniger, seinem sozialen Stand entsprechend, das gewöhnliche Volk. [...] Meist erhielten Frauen weniger als Männer, manchmal sogar nichts (Prell 1997, 264 f.).
Die Motive dieser Freigiebigkeit waren vielfältig und nicht immer nur altruistisch. Die "Freude am Geben" war wohl eines der Motive, aber nicht das einzige. Die "Erwartung von Vergeltung", der "Wunsch nach Ehre und Ansehn" und "politischer Ehrgeiz" kamen dazu (Bolkestein 1939/1967, 317-20, zit.n.Prell 1997, 267). Nach anderen Autoren wird die philanthropia (Menschenfreundlichkeit) sogar durch die eigennützigen Motive der philotimia (Ehrsucht) und philodoxia (Ruhmessucht) dominert (Hands 1968, 12, zit.n.ebd.): "Die Reichen erhalten von den Armen Ehre, Achtung, Ruhm, Status sowie soziale und politische Treue. Die Popularität verschafft ihnen Zugang zu Ehrenämtern und Führungspositionen innerhalb der munizipalen Verwaltung" (ebd.). Die Motive und Praktiken der Wohltätigkeit waren Thema moralischer Erörterungen. Wer Geld besitzt, so etwa Cicero, für den gezieme sich benificentia und liberalitas (Wohltätigkeit und Freigiebigkeit). Der Lohn dafür sei der amor multitudinis (die Liebe der Massen), Ruhm und Ehre. Helfendes Handeln sei besser als die Gabe von Geld, weil es im Unterschied zu Geld nicht ausgehen könne. Jedenfalls sollte Geld nur an "geeignete, notleidende Leute" gegeben werden "und mit Maßen" (ebd.). Freigebigkeit dürfe nicht in Verschwendungssucht ausarten und Zuschüsse zu öffentlichen Anlagen seien "kurzlebigen Geschenken an die Masse, wie Gelage, Fleischverteilungen, Gladiatorenspiele und Tierhatzen" vorzuziehen (ebd.).
Seneca rechnet auch "Trostworte" zu den beneficia, das »Hinwerfen einer Münze« genüge keinesfalls. Und er lehnt jede Eigennützigkeit ab: »Nicht nach einem Gewinn hasche ich aufgrund einer Wohltat, nicht nach Genuss, nicht nach Ruhm; zufrieden damit, einem einen Gefallen zu tun, werde ich zu dem Zweck geben, dass ich tue, was nötig ist" (De beneficiis 3 u.ö.). Konsequenter Weise bezeichnete er die Wohltat ohne jede Romantik als socialis res, eine soziale Tatsache. In einer umfangreichen, 54 u.Z. verfassten Schrift De beneficiis (Von den Wohltaten) erläutert er moralische Probleme der liberalitas: die Undankbarkeit auf der einen, den Stolz auf der anderen Seite. Die Auseinandersetzung mit einer Unzahl fast skurriler Probleme der Wohltätigkeit zeigt, wie wenig es um die Not der Armen und wie sehr um eine die Vermögenden kenn-zeichnende Geste geht: "Etwa ob man wegen einer Undankbarkeit gerichtlich belangt werden könne, ob eine Sklave seinem Herrn Wohltaten erweisen kann, ob man einem Undankbaren auch Wohltaten erweisen soll, ob der Sohn für die Wohltaten, die der Vater empfangen hat, dankbar sein soll, ob man dem Weisen, der doch schon alles besitzt, noch etwas schenken kann, und schließlich gar, ob man ein Unglück herbei-wünschen soll, um sich Möglichkeiten der Hilfe zu schaffen" (Jens 1988, 15,5). Ein frühes Zeugnis für die Romantisierung der Armut durch das Bildungsbürgertum, wie es in unterschiedlichen Formen in der Geschichte der Armut immer wieder auftauchen wird. Die wahren Armen haben solche derlei müßige Spielereien wohl nicht gelesen.
Die Bewertung altruistischer Tugenden ist subtil und kompliziert: Liberalitas und beneficientia gehören ebenso wie clementia (Milde) und misericordia (Mitleid) zum Tugendkatalog der Römer, bleiben aber im Schatten der umfassenderen nationalen Ideale einer nach Vermögen und Herkunft geschichteten Gesellschaft der Stärke, die sich das Recht und den Auftrag der Herrschaft der Oberen über die Unteren und der Römer über alle anderen zusprach. Von diesem absoluten Herrschaftswillen her kommt vor allem die Tugend der misericordia unter Druck. Nach den Stoikern ein "Krankheit der Seele" (Prell 1997, 268), nach Cicero eine Quelle des Kummers und nach Seneca »eine Fehlhaltung einer schwächlichen Seele, die beim Anblick fremden Elends niedersinkt«, ein »seelisches Leidwegen des Anblicks fremden Elends oder Trauer aufgrund des fremden Unglücks, das [...] Menschen widerfährt, die es nicht verdient haben« (De clementia 2 u.ö.). Diese Verachtung des Mitleids erinnert an die Theatertheorie des Aristoteles, der sich vom kathartischen Erleben der Tragödie die Reinigung von den lebensuntauglichen Emotionen phóbos und éleos (Furcht und Mitleid) versprach (vgl. Rathmayr 1996, 52 ff.).
Nach Arthur Hands (1968) weist die Kritik am Mitleid durch Seneca oder Cicero darauf hin, "dass Mitleid den Römern nicht fremd war, ja dem Großteil des Volkes zueigen war" (Prell 1997, 268). In der bei Historikern nicht seltenen Manier, auf postulierte anthropologische Konstanten zu verweisen, beruft sich Hands darauf, "dass Mitleid als eine natürliche menschliche Reaktion bereits vorhanden war" (ebd.) - genau das ist aber die Frage. Es spricht manches dafür, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse Roms so gelagert waren, dass prosoziale Emotionen, Empathie und Altruismus darin wenig Entwicklungsmöglichkeiten vorfanden. Wie sonst könnte man sich das offensichtliche Vergnügen von Tausenden an den widerlichen Abschlachtungen und Zerfetzungen menschlicher Körper in den römischen circenses erklären (vgl. Wertheimer 1986, Rathmayr 1996). Jedenfalls aber war Mitleid nicht das Motiv für die Freigiebigkeit der Reichen. "Man gab in erster Linie, um von seinen Mitmenschen verehrt und bewundert zu werden und nicht um zu helfen" (ebd., 269). Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Armut gar nicht das Kriterium war: "Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Bedürftigkeit bei privaten Alimentarstiftungen kein Auswahlkriterium war. Nutznießer der Wohl-tätigkeit waren der Staat, die Freunde und Verwandten, aber nicht die Armen an sich." (ebd.). Sehr wohl aber mussten die Empfänger der Gaben wert sein. Auch hier ist Cicero deutlich: "Sie sollten höhere Tugenden aufweisen, Hochachtung entgegenbringen, in einem besonderen Beziehungsverhältnis zum Geber stehen und Gegenleistung erbringen" (ebd.). Trotz all dieser eigennützigen Motive hat die private Wohltätigkeit "wesentlichen Anteil an der Verbesserung der Lebensbedingungen in den Städten", wenn auch nicht an der Lösung des Armenproblems. Es habe "lediglich manch Armer gelegentlich eine zusätzliche Hilfeleistung" erhalten (ebd.). Von dem seit alters her im römischen Recht verankerten Prinzip des do ut des konnten die am aller wenigsten profitieren, die nichts zu geben hatten.
Eine für die römische Gesellschaft eigentümliche Einrichtung war das Klientelwesen, das zwar tausenden ärmeren Menschen zugute kam, dessen eigentlicher Zweck aber nicht die Linderung der Armut sondern die Hebung von Ansehen und Einfluss der Reichen war. Zu den vielen Pflichten der Klienten gehörte die Morgenaufwartung bei ihrem Patron.[53]
»Oder soll ich die verlogene Gewinnfängerei eines bezahlten Guten-MorgenWünschers (mercennarii salutatoris mendacissimum aucupium), der um die Schwellen der Männer von Einfluss schwirrt und den Schlaf der Großmächtigen aus Gerüchten zu erahnen sucht, etwa für ehrenvoller einschätzen? Denn wenn er fragt, was drinnen im Haus geschieht, dann halten es die Sklaven nicht einmal für der Mühe wert, ihm eine Antwort zu geben«. Das Bild, das der im 1. Jh. lebende Agrarschriftsteller Columella hier vom Alltag der Klienten in der frühen Kaiserzeit entwirft, ist alles andere als schmeichelhaft und beneidenswert - aber es ist nach Ausweis zahlreicher Parallelquellen durchaus zutreffend" (Weeber 2001, 211).
Das war nicht immer so gewesen. In republikanischer Zeit war das Verhältnis zwischen cliens und patronus von größerem gegenseitigem Respekt geprägt; da rangierten die Verpflichtungen des Patrons gegenüber den Klienten direkt hinter denen gegenüber Eltern und Mündeln und noch vor denen gegenüber Gästen und Familienangehörigen. Ursprünglich wohl aus einer streng geregelten Form abhängiger Arbeit hervorgegangen (cliens: der Gehorchende), entwickelte sich das Klientelverhältnis (clientela) auf der Grundlage einer moralisch-religiösen, nicht juristischen Treueverpflichtung (fides) zu einer wechselseitigen Unterstützungs-Beziehung mit klarer Rollenverteilung: Der Patron als der gesellschaftlich Einflussreichere hatte seine Klienten vor allem bei Rechtsgeschäften zu beraten und ihnen bei Prozessen Rechtsbeistand zu leisten. Er hielt gewissermaßen die Hand über sie und gab ihnen die Sicherheit, dass ein Mächtigerer über sie "wachte", an den sie sich jederzeit wenden konnten, wenn sie in Schwierigkeiten welcher Art auch immer gerieten. Bezeichnend für dieses auf Vertrauen gegenüber dem Partner mit dem "längeren Arm" gegründete Verhältnis ist die Ausweitung des Patronats im Zuge der römischen Expansion: Die in mancher Hinsicht schwer drangsalierten Bewohner einer Provinz taten gut daran, sich einen einflussreichen Politiker in Rom zu suchen, der ihre Interessen wahrnahm. Ganze Gemeinden und Provinzen wurden so zu Klienten eines einzigen bzw. seiner Familie.
Als Gegenleistung hatte der Klient dem patronus seine guten Dienste anzubieten. Das waren in der Frühzeit Arbeitsleistungen, Gefolgschaft im Krieg und finanzielle Beiträge bei außergewöhnlichen Belastungen des Patrons. Wichtiger wurde im Laufe der Zeit aber die politische Unterstützung: Es war die moralische Pflicht eines Klienten, seinen patronus bei der Bewerbung um ein Amt tatkräftig durch sein tatsächliches Abstimmungsverhalten ebenso wie durch seine Präsenz, seinen Beifall bei dessen Auftritten und geeignete 'Stimmungsmache' zu unterstützen.
Auch ein demonstratives Umsichscharen vieler Klienten brachte dem Patron ganz augenfälliges Sozialprestige ein; daraus entwickelte sich die morgendliche Begrüßung (salutatio) des Patrons, zu der sich alle seine Klienten einzufinden hatten. Dieses Ritual wurde in der Kaiserzeit zur wichtigsten Pflicht der Klienten - kein Wunder, denn durch die Veränderung im politischen System, die den Kaiser in seinem Selbstverständnis sozusagen zum Ober-Patron aller Römer werden ließ, trat die politische Bedeutung des Klientelwesens ganz hinter die gesellschaftliche Funktion zurück: Anerkannt war, wer am Morgen ein möglichst volles Atrium "vorweisen" konnte, und so eilten denn ganze Heerscharen von Klienten in aller Herrgottsfrühe durch die Straßen Roms, um dem patronus ihre Aufwartung zu machen. Die salutatio fiel in die erste und zweite Stunde des Tages - also kurz nach Sonnenaufgang -, so dass sich viele Klienten schon in der Dunkelheit auf den Weg machen mussten. Wer sich von einem Gastmahl spät auf den Heimweg begab, stieß bereits auf Klienten, die zu ihren officia antelucana (Vorlicht-Pflichten) eilten. Sturm, Hagel und Schneefall, weite Wege und Straßenschmutz waren keine Entschuldigungsgründe, die Ausnahmen zu der ehernen Visiten-Regel zuließen. Und da es um Repräsentation ging, hatten die Klienten in ordentlicher Kleidung zu erscheinen: Es waren ja freie Römer, die gefälligst ihr "Ehrenkleid", die wollene Toga, anzulegen hatten - und zwar auch an heißen Sommertagen!
Ihre morgendliche Beflissenheit wurde vielen Klienten schlecht gelohnt. Nicht nur, dass sich im von Klienten manchmal regelrecht voll gestopften Atrium aus Geschrei, Eifersüchteleien und Streit um den Vorrang hässlichen Szenen ergaben oder man sich die Gunst des Türstehers mit Bestechungsgeldern erkaufen musste; auch der Empfang durch den Patron selbst kam in vielen Häusern einer tagtäglichen Demütigung gleich. Der Gruß der Klienten gegenüber ihrem dominus oder gar rex (Herr; König) wurde mit einem ebenso schlichten wie stereotvpen ave (sei gegrüßt!) erwidert, wobei sich "Inhaber" großer Klienten-Scharen von einem nomenclator die Namen der salutatores nennen ließen. Manche Patrone gaben durch ein herzhaftes Gähnen zu erkennen, was sie von ihrem Gegenüber hielten, noch ungehobeltere ließen sich in Gegenwart der Klienten derart gehen, dass sich Martial[54] über einen geizigen Patron so lustig machen kann: »Also ich finde nichts anders, um dich als Freund zu erachten, Crispus, als dass du vor mir immer ganz ungeniert - furzt«. Der Gipfel schäbiger Klienten-Behandlung war freilich erst da erreicht, wo sich der Patron schlicht verleugnen ließ und die Schar der Klienten »nach all den tausend Mühen« (Martial zit.n.Weeber, ebd., 213) kurzerhand wieder nach Hause geschickt wurde.
Die Präsenzpflicht des Klienten beschränkte sich nicht auf die Audienz am Morgen. Auch bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit scharten viele Patrone gern eine respektheischende Zahl von Klienten um sich bzw. um ihre Sänfte, für die die "niederen Freunde" - so eine beliebte euphemistische Umschreibung für Klienten im Verkehrsgewühl der Hauptstadt mit rüden Mitteln Platz schaffen mussten. Die öffentlichkeitswirksame Begleitung zu Besuchen bzw. in die Thermen gehörte ebenfalls zu den Pflichten der Klienten - und nicht zuletzt bildeten sie eine lautstarke Claque bei mehr oder weniger gelungenen Auftritten des Patrons als Redner oder Dichter.
Für welchen Gegenwert nahmen die vielen Klienten - ihre Zahl dürfte Im kaiserzeitlichen Rom in die Zehntausende gegangen sein - die Mühen, Unannehmlichkeiten und die teilweise entwürdigende Behandlung in aller Regel freiwillig in Kauf? Es waren in der Kaiserzeit hauptsächlich materielle Vergünstigungen, die sie an ihren patronus banden. An der Spitze stand eine Art Tagessold, der ihnen meist bei den morgendlichen Audienzen ausgehändigt wurde. Im 1.Jh. n. Chr. scheinen pro Tag centum quadrantes, (100 Viertelas), also 25 As oder gut sechs Sesterzen eine Art "Regelentgelt" gewesen zu sein - keine Summe, von der man seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten konnte, geschweige denn den einer ganzen Familie, aber immerhin so etwas wie eine Aufwandsentschädigung für die Klienten.
Als ausschließliche Existenzgrundlage reichte im allgemeinen nicht einmal das rückgratloseste Antichambrieren aus - auch dann nicht, wenn der Klient ab und zu einen abgetragenen Mantel, eine gebrauchte Toga oder ein Geldgeschenk außer der Reihe erbetteln konnte. Großzügige Patrone stellten "verdienten" Klienten auch schon einmal eine unentgeltliche Wohnung oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung, doch waren das genauso Ausnahmen wie die Schenkung eines kleinen Landguts.
Üblicher war dagegen eine Einladung von Klienten zum Essen: Bei der morgendlichen Aufwartung vom Patron zum Abendessen "gebeten" zu werden, war der sehnlichste Wunsch. Und das, obwohl die schmachvolle Behandlung sich dort oft genug fortsetzte! Es war eher die Regel als die Ausnahme, dass man die Klienten beim Tafeln ihren Status als geduldete "Schmarotzer" deutlich spüren ließ: Sie bekamen häufig minderwertige Speisen und billigere Weine als die anderen Gäste vorgesetzt, und auch die Diener behandelten sie vielfach mit Herablassung und schlechtem Service. Darüber hinaus kam es gar nicht so selten vor, dass die Klienten auch noch als Zielscheibe schlechter Witze herhalten mussten und sie unter Anspielung auf ihre Bedürftigkeit der Lächerlichkeit preisgegeben wurden.
Solche Beköstigungen im Hause des Patrons galten als cena recta, als "eigentliches Mahl", bei dem mancher Klient sich freilich ebenso ungeniert benahm wie sein Gastgeber. Als Ersatz für diese - je nach Zahl der Klienten recht aufwändigen und umständlichen - Gemeinschaftsessen setzte sich im 1. Jh. eine "Rationalisierung" durch: Die Klienten erhielten eine sportula (ein Körbchen) mit Lebensmitteln, ausgehändigt. Aber auch das war nur eine Übergangsform, die binnen kurzem durch das reine Geldgeschenk abgelöst wurde, von dem bereits die Rede war. Wenn Quellen von der sportula sprechen, so ist damit in der Regel der Klienten-Sold in klingender Münze gemeint war - ein Detail, das sich in die Tendenz der Entpersonalisierung des Klientel-Verhältnisses gut einfügt.
Es war, wie schon das Eingangszitat Columellas zeigt, beileibe kein reines Vergnügen, Klient in Rom zu sein. Wer sich trotzdem dazu hergab, musste vieles einstecken und das Rückgrat mächtig krümmen. Insofern verwundert es nicht, wenn Klienten am Saturnalienfest die Chance des "Karnevals" wahrnahmen und ihrem Frust freien Lauf ließen. Die Rache des kleinen Mannes gewissermaßen - nicht gerade geschmackvoll, aber doch verständlich - aus der Sicht eines reichen Patrons, dem Lukian die empörte Klage in den Mund legt: »Wenn wir Reichen uns aber auch vieles gefallen lassen wollen, so war doch das Verhalten der Armen bei der Tafel ganz unerträglich. Nicht zufrieden, sich den Wanst voll zu stopfen, bis nichts mehr hineinwollte, schämten sie sich nicht, sobald sie über Gebühr getrunken hatten, bald einem schönen Knaben, der ihnen den Becher reichte, die Hand zu streicheln, bald sich mit der Geliebten oder sogar mit der Gemahlin des Herrn Freiheiten herauszunehmen; und wenn sie dann zuletzt den Speisesaal voll gespien hatten, zogen sie am folgenden Tag noch über uns her und erzählten, wie sie an unserer Tafel hätten hungern und dürsten müssen« (Lukian, zit.n. Weeber, ebd., 215).
Das Verhältnis zwischen patronus und cliens war also ursprünglich eines zwischen dem Kleinbauern und einem Großgrundbesitzer. Die gegenseitige fides bedeutete Schutz auf der einen und Kriegsdienst, Fron-dienst und andere Dienstleistungen auf der anderen Seite. In der Republik wurde daraus eine politische Anhängerschaft des Patrons. Gegen rechtliche Beihilfe vor Gericht und die Zuteilung von sportulae dienten die clientes der politischen Unterstützung und dem Ansehen des Patrons, in der Kaiserzeit vor allem seinem Prestige, je mehr - bisweilen bis zu hundert und mehr - Klienten desto angesehener der Patron. Das Klientelwesen war eine bis in Details geregelte Angelegenheit. Der Klient hatte dem Patron seine Morgen-aufwartung zu machen, wo er seine Sportel, oft ein feststehender Betrag, erhielt mit dem er "Kleidung, Miete, den Eintritt ins Bad und Liebesdienste" bezahlen konnte (Prell 1997, 262). Er hatte hinter Sänfte des Patrons zu den Gerichtsverhandlungen am Forum zu laufen. Oberstes Ziel der Klienten war die Einladung zur coena, dem Abendessen der Römer.
Klientelen waren erblich, aber bei weitem nicht alle römischen Bürger, insbesondere nicht die große Zahl der Zuwanderer, hatten zu ihnen Zugang. Eine umfassende Lösung des Armutsproblems ist das Klientelwesen jedenfalls nicht: Nach alle Klienten waren arm und bei weitem nicht alle Armen hatten einen Patron. »Den armen aber braven Mann«, schreibt Plinius (Epistulae10,93), »den sieht man als Ganoven an. Der Reiche, ist er sonst auch schlecht, gilt als Klient für gut und recht«. In besonderer Weise zeigt das Verhältnis der freigelassenen Sklaven zu ihren Patronen, ihren ehemaligen Herrn, die Unverhältnismäßigkeit des Kleinetelwesens. Sie waren verpflichtet, ihn im Fall der Verarmung zu unterstützen, nicht nur ihn, auch sei-ne Eltern und Kinder. Vererbt ein Freigelassener mehr als 100 Sesterzen und hat er weniger als 3 Kinder steht seinem Patron ein gleicher Anteil wie den Kindern zu. "Umgekehrt", so Prell (1997, 263) im Unter-schied zu Finley (s.o.) "scheint diese Verpflichtung nicht gegolten zu haben."
Darüber hinaus gab es Vereine wie etwa die Collegia tenuiorum (tenuis: schwach, bedürftig). Solche Kollegien können Berufsgenossenschaften, Handwerksvereinigungen, Kulturverbände oder Begräbnisvereine sein. Sie "erfüllen soziale Funktionen wie Geselligkeit, Gruppengefühl, Solidarität und Ritualisierung" (Prell 1997, 258). Die collegia tenuiorum waren für alle Schichten, Frauen wie Männer, zugänglich, dienten der Verehrung eines Schutzgottes, veranstalteten gemeinsame Essen und Gedächtnisfeiern, es wurden sportulae (Geschenkkörbchen ursprünglich mit Speisen, später mit Geld) verteilt und für eine anständige Bestattung gesorgt. Die Beitrittsgebühr konnte z.B. 100 Sesterzen, d.i. der 25fache Tageslohn eines Arbeiters) und eine Amphore Wein betragen, der monatliche Mitgliedsbeitrag 5 Asse. Wer länger als 6 Monate nicht be-zahlte, ging der Hauptleistung des Vereins, der Finanzierung des Begräbnisses verlustig. Die Mitglieder hatten der Reihe nach als magistri cenarum (Speisemeister) bei Festtagsmahlen für Räumlichkeiten, einen Diener, eine Amphore Wein, Brot für 2 Asse und vier Sardinen pro Person aufzukommen. Für die ganz Armen war das alles zu kostspielig. Nach Prell (1997, 260) waren diese Vereine "keine Armengenossenschaften oder Wohltätigkeitsvereine zur Linderung der Not von Bedürftigen". (Prell 1997, 260). Es scheint, dass es die Bessergestellten unter den Armen waren, die den Kollegien angehörten. Das zeigt sich etwa darin, dass die Größe der sportulae dem Rang der Mitglieder entsprach: wer höher gestellt war, hatte mehr zu bekommen.
Was aber unternahm der Staat gegen die Armut, die zumindest in der Hauptstadt zu manchen Zeiten epidemische Ausmaße anzunehmen drohte? Auch hier war Prell zu Folge, "das Motiv der Maßnahmen nicht die Philanthropie" (ebd., 270). Eine gezielte Armenpolitik wird nicht erkennbar. "Eine staatliche Sozialpolitik im modernen Sinne ls Ausdruck einer besonderen Verpflichtung des Staates oder der Gemeinschaft gegenüber den sozial Schwachen und Benachteiligten hat es nie gegeben. Solche Vorstellungen lagen jenseits des Denkhorizonte der Antike" (Weeber 2001, 333). Staatliche Maßnahmen im Sinn öffentlicher Für-sorge gab es nur vereinzelt. Aristoteles (Athenaion Politeia XLIX 4) berichtet von einem derartigen Gesetz in Athen, das Personen »die nur Besitz in den Grenzen von drei Minen haben und körperlich behindert sind, sodass sie keinerlei Arbeit verrichten können [...] öffentlich zum Unterhalt zwei Obolen pro Tag zu geben« seien (Kudlien 1988, 95 f.). Mit Ausnahme der Alimentarstiftungen Trajans[55] (siehe unten) wissen wir erst aus der Spätzeit des Reiches von strukturellen Maßnahmen einzelner Kaiser. Im 4. Jh. beauftragt Konstantin[56] seinen Stellvertreter in Italien mit der Versorgung mittelloser Eltern:
In allen Städten Italiens soll ein Gesetz auf Bronze- oder Wachstafeln oder auf Leinwand geschrieben verkündet werden, das die Hand der Eltern vor den Kindern zurückhält und ihre Einstellung zum Besseren wendet. Bemühe dich von Amts wegen, dass, wenn Eltern Nachkommen haben, die sie wegen ihrer Armut nicht aufziehen können, ihnen unverzüglich Nahrung und Kleidung zukommt, da die Pflege der neugeborenen keinen Aufschub duldet. Dazu soll die öffentliche wie auch die private Hand Beiträge leisten (zit.n. Bühler 1990, 431).
Ein ähnlicher Befehl erging an die Provinzen in Afrika:
Wir haben vernommen, dass die Bewohner der Provinz aus Mangel am Lebensnotwendigen ihre Kinder verkaufen oder verpfänden. Wenn sich darum jemand findet, der, durchaus mittellos, seine Kinder nur mit größten Schwierigkeiten durchbringt, soll ihm, bevor es zum Schlimmsten kommt, durch die öffentliche Hand geholfen werden in dem Sinne, dass es den Prokonsuln, den Provinzvorstehern und den obersten Finanzbeamten in ganz Afrika zustehen soll, allen, die sie in großer Bedürftigkeit vorfinden, die erforderliche Unterstützung zu gewähren und ihnen ohne Verzug aus den öffentlichen Lagerhäusern alles Nötige zuteilen zu können. Es widerspricht durchaus unserer Überzeugung, dass Menschen vor Hunger zugrunde gehen oder zu einer verwerflichen tat Zuflucht nehmen müssen (ebd, 431 f.).
Spektakuläre Maßnahmen, darunter die hochmodern anmutende und - zumindest in Österreich - bis heute nicht verwirklichte Ideen des Sozialstaates bleiben Utopie: Xenophon macht den Athenern den Vorschlag, die Einkünfte der Polis so zu verbessern, dass alle Bürger ein Rente bekommen und auf Arbeit zu ihrem Lebensunterhalt nicht mehr angewiesen sind, ein "Wohlfahrts- und Versorgungsstaat, der natürlich utopische Wunschvorstellung bleiben musste", wie Kudlien (1988, 97) anmerkt. Eine "zugleich mitleiderfüllte wie sozialbewusste Hilfe für die Armen schlechthin" wird sich erst in der christlichen Antike herausbilden. Den-noch gibt es eine Reihe von Einzelmaßnahmen, die auch den Armen zu Gute kommen oder das Abgleiten in die Armut verhindern.
Die Parole tabulae novae (neue [Schuld]tafeln), was bedeutet, dass die alten Schulden gelöscht werden, war die Ausnahme. Unter Cäsar und Augustus gab es Zins- und Mieterlasse, unter Augustus und Tiberius kostenlose Darlehen, unter späteren Kaisern Billigkredite und Maßnahmen gegen Wucherzinsen. Konzentrierte staatliche Maßnahmen bestanden in der Landverteilung, in der Getreideverteilung und in Alimentarstifungen.
Die nach Prell (ebd., 271) "bedeutendste sozialpolitische Maßnahme" bestand in der Zuteilung von ager publicus, von staatlichem Grundbesitz. Begünstigte waren Veteranen und Zivilbürger, unter ihnen auch Arme. Die Größe des Grundbesitzes war seit frühester Zeit umstritten und es gab mehrfach Bemühungen, sie nach oben hin zu begrenzen. Verwüstungen durch Krieg und die Kriegsdienstverpflichtung setzten vor allem den Kleinbauern zu. Andererseits lieferten gewonnene Kriege den Großgrundbesitzern zahlreiche Sklaven. Sie versuchten deshalb, die Kleinbauern zu vertreiben und deren Felder mit den neuen, billigen Arbeitskräften zu bewirtschaften. Die Folgen: Verarmung der Landbevölkerung, Überbevölkerung in Rom auf Grund der Landflucht und ein Problem mit der Rekrutierung von Soldaten, da Sklaven nicht zum Militär-dienst verpflichtet waren. Die spektakulärste Landreform versuchte der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus[57] 133 v.u.Z. durchzusetzen. Mit der lex sempronia agraria wurde der Landbesitz wurde mit 500 Joch begrenzt und das freie Land durch ein Dreimännerkollegium an besitzlose Römer verteilt. Eines der Hauptmotive war die Versorgung der Soldaten (vgl. Ungern-Sternberg 1988, 167 f.). T. S. Gracchus in seiner ersten Rede vor dem Volk:
Die wilden Tiere, welche in Italien hausen, haben ihre Höhle, jedes weiß, wo es sich hinlegen, wo es sich verkriechen kann - die Männer aber, die für Italien kämpfen und sterben, sie haben nichts außer Luft und Licht. Heimatlos, gehetzt irren sie mit Weib du Kind durch das Land [...] vielmehr kämpfen und sterben sie für anderer Wohlleben und Reichtum. Herren der Welt werden sie genannt und haben nicht eine Scholle Landes zu eigen (Plutarch, Tiberius Gracchus 9).
Soldaten, aber auch alle anderen römischen Bürger sollten ihren gerechten Anteil am ager publicus, am öffentlichen Grund und Boden, wie am gesellschaftlichen Wohlstand haben. Heftiger Widerstand der Sena-toren und Großgrundbesitzer blieb nicht aus. Tiberius Gracchus und dreihundert seiner Anhänger wurden noch im gleichen Jahr erschlagen. Der Bruder und Nachfolger, Gajus Gracchus[58] setzte die Landverteilung fort, allerdings nicht im Mutterland, sondern in Kolonien in und außerhalb Italiens. 121 wurde auch Gajus ermordet. Die Landfrage blieb ungelöst, die bestehenden Besitzrechte hatte sich durchgesetzt. Unter den Kritikern der »Gleichmacherei in den Besitzverhältnissen« auch Cicero (zit.n. Prell 1997, 275). Die Begünstigten, die »aus bitterster Armut« in den Überfluss geraten, würde »die ungewohnte Lebensweise berauschen« (zit.n. ebd., 276). Eine letzte große Landverteilung, von der 50.000 Personen profitiert haben sollen, brachte Julius Cäsar auf den Weg. In der Kaiserzeit wurde Land nur mehr an Veteranen verteilt, lediglich der sozial aufgeschlossene Nerva[59] verteilt noch einmal Land an Zivilisten. Die Motive der Landverteilungen sieht Prell neben persönlichen Machtinteressen der Protagonisten nicht vorwiegend in der Armutsbekämpfung, sondern in der Stärkung der Wehrkraft, in der Reduzierung der sentina urbis, des Auswurfs der Stadt, wie die verarmte Bevölkerung genannt wurde, und in der Bearbeitung von brach liegendem Land.
Frumentationes wurden die Verteilungen von Getreide durch den römischen Staat genannt, seit 123 v.u.Z. ein "Grundpfeiler römischer Sozialpolitik" (Prell ebd., 279). Wiederum war es Gracchus, der das erste Getreidegesetz durchsetzte. Die lex frumentaria des Gajus Sempronius Gracchus sah das Recht auf die frumentationes für jeden römischen Bürger vor, "ob arm oder reich, ob ledig oder Familienvater" (ebd.). Damit wurde jedem Bürger eine zunächst vom Staat subventionierte, später kostenlose Getreideration (5 Scheffel = ca. 50 Liter) pro Monat garantiert. Voraussetzung war eine persönliche Meldung und ein Wohnsitz in Rom. Die Zahl der Begünstigten schwankt zwischen 150.000 und 300.000. Kürzungen gab es immer wieder, dass allerdings Arme davon ausgenommen waren, ist unwahrscheinlich. Fremde und andere Personen ohne Bürgerrecht wurden jedenfalls ausgeschieden. Unter Augustus wurden tessarae eingeführt, eine Art Lebensmittelmarken, deren Vorlage einmal im Monat zum Getreidebezug berechtigte. Manche Historiker meinen, dass es "eine privilegierte Gruppe" sei, die in den Genuss der Zuteilungen kam (Veyne 1988, 402). Bekannt ist der Fall des Konsulars L. Calpurnius Piso Frugi, eines sehr reichen Römers, der sich ostentativ um seine Getreideration anstellte, da Gajus Gracchus ja »seinen Besitz« (mea bona) - als diesen betrachte-te er unverhohlen die Staatskasse - verteile. Zu den Privilegierten gehörten bestimmte staatliche Beamte wie Flötenspieler und Trompeter, sowie seit Nero die Soldaten der Prätorianergarde. Ab dem Ende des 2. Jh. wurden auch andere Lebensmittel verteilt: Olivenöl, Schweinefleisch, Wein oder Weizenbrote anstelle des Getreides. Leben konnte man von dieser Getreidezuteilung ohnedies nicht. Ihr Nährwert betrug 3000 bis 4000 Kalorien. "Damit konnte man eine Familie mit 3 - 4 Köpfen nicht satt bekommen, von den übrigen Lebenshaltungskosten ganz zu schweigen" (Weeber 2001, 335).
Wenn nicht Armut das eigentliche Kriterium der Zuteilung war, was waren dann die Motive der Kaiser? Prell (ebd., 284) meint, dass sie als "Patrone über das gesamte Volk" die Gepflogenheit übernahmen, die Klienten zum Essen einzuladen. Die Hintanhaltung von Aufruhr, Loyalität gegenüber dem Herrscher und dessen Popularität waren weitere Motive. Bereits Aristoteles begründet die Zuwendungen der Oligarchen an das Volk mit "einer Art Gegenseitigkeitsgeschäft: Die Vornehmen bleiben im Besitz der wichtigsten Ämter und zahlen für den Ausschluss des Demos von der Herrschaftsausübung gleichsam als Lohn großartige Opfer-feste, öffentliche Bauten und Speisungen" (Kloft 1988, 152). Dennoch ist die Getreide- und Brotverteilung auch ein wesentlicher Beitrag zur Linderung der Armut. Die Armen waren zwar nicht ihre einzigen oder bevorzugten Nutznießer, sie gehörten aber jedenfalls auch zu den Begünstigten. Erst gegen Ende des 4. Jh. ist ausdrücklich von jenen die Rede, die »keine Mittel zum Lebensunterhalt aus anderen Quellen haben«. Für sie ist das panis gradilis, das auf den Stufen eines Gebäudes verteilte Brot, bestimmt.
Außerhalb Roms lag die Zuständigkeit für die Getreideversorgung und -verteilung bei den Stadtpolitikern. Von Rhodos etwa berichtet der Geograph Strabon:
»Die Einwohner von Rhodos tragen große Sorge für das Volk, obgleich sie keine demokratische Verfassung besitzen; denn sie suchen gleichwohl die Menge der Armen am Leben zu erhalten. So wird nämlich das Volk mit Getreide versorgt und die Reichen greifen den Bedürftigen unter die Arme nach Väterbrauch; und es existieren bestimmte Leiturgien,[60] die der Lebensmittelbesorgung dienen; so hat der Arme seinen Lebensunterhalt und der Stadt fehlt es andererseits nicht an notwendigen Leuten, besonders im Hinblick auf die Schifffahrt« (Strabo[61] XIV 2,5).
Für die Finanzierung sorgt außerhalb Roms also nicht der Staat, sondern ausschließlich die vermögende Bürgerschicht. Begünstigte waren nur ordentliche Bürger, nicht die ptóchoi, die Bettelarmen, die selbst gar nichts hatten, und keinesfalls die Fremden.
In der ägyptischen Stadt Oxyrynchos (heute: Al Bahnasa) wurden während der griechischen und römischen Herrschaft wurden große Mengen von Aufzeichnungen der Verwaltung regelmäßig auf Müllhalden vor der Stadt entsorgt, viele davon blieben erhalten. Aus ihnen lässt sich ersehen, auf wie hohem bürokratischen Niveau im 3. Jh. u.Z. die Getreidezuteilung dieser Stadt organisiert war. Wir erfahren, dass bei einer Einwohnerzahl von 25.000 die Zahl der Berechtigten 4000 betrug, 3000 davon epikrithéntes, Personen, die ihre Bürgerschaft durch eine Überprüfung nachgewiesen hatten und möglicherweise auch der gehobeneren Klasse angehörten. Auch sie versicherten in ihren Anträgen, dass sie kein Getreide hatten. Wenn einer dieser Kornempfänger starb, konnte durch Losentscheid ein anderer in diesen numerus clausus nachrücken:
»An Aurelius Plution, den Schreiber der Kornverwaltung von Aurelius Abinoumis, Sohn des Ammonius, Enkel des Didymos, Mutter Tauris, aus der bedeutenden Stadt der Oxyrhynchiten.
Ich bin im Stadtteil Gymnasiumstraße registriert, die Untersuchung des Bürgerstatus erfolgte im 11. Jahr; ich bin im gegenwärtigen Jahr zwei (?) 20 Jahre alt. Nachdem ich durch Losverfahren gemäß Beschluss des hochmächtigen Rates einen freigewordenen Platz erhalten habe, nehme ich für meine Person den Platz des Tryphon ein, des Sohnes des Apollonius, Enkel des Apollonius, Mutter Xenarchis, der im gleichen Stadteil geführt und nun gestorben ist. Ich stelle für meine Person den Antrag auf Aufnahme in die unentgeltliche Getreideverteilung« (Papyri Oxyrhynchi 2894 III 1-22).
So lautet das Ansuchen eines Nachrückers, dem die Namen öffentlicher Zeugen angeschlossen sind, die seine Identität und seinen Wohnort bezeugen. In den einzelnen Stadtvierteln wird über die Zuteilung genauestens Buch geführt. In Bezug auf die Mehrheit der Bezieher, war also nicht die Armut, sondern die Aufnahme in die Liste der bezugsberechtigten Bürger das Kriterium. Weitere 900 Personen begründen ihr Ansuchen um die dórea tou siterésiou (das Geschenk der Getreideversorgung) mit übernommen städtischen Dienstleistungen als Wächter oder städtische Eseltreiber. Unter ihnen können auch Freigelassene sein, und sie gehörten sicher nicht zu den Wohlhabenden. 100 Antragsteller schließlich sind Jugendliche, die nur den Namen ihrer Mutter angeben, vermutlich also illegitime Kinder, die kein Bürgerrecht besaßen aber auch nicht rechtlos waren.
Jeder erhielt monatlich 1 Artabe, das sind nach römischem Maß etwa 4,5 Modii, also ca. 40 Liter Getreide. Name, Datum und Menge wurden nach den drei Gruppen unterschieden exakt aufgezeichnet, "eine hoch-bürokratische Angelegenheit, die einen umfänglichen Verwaltungsapparat erforderte" (Kloft, ebd., 143). Einen Getreidesekretär (grammateus siterésiou), ein Sachverständiger (gnostér), der die Identität der Petenten feststellte und diakritai, die Zweifelsfälle entschieden, Phylarchen, die die Stadtlisten führten und, nicht zuletzt, das Verteilungspersonal selbst: Beamte, die die Berechtigungsmarken austeilten und Speicherarbeiter, Sackträger und Austeiler, die das Getreide, immerhin 120.000 Tonnen pro Jahr, lagern und verteilten. An der Verteilungsorganisation in Oxyrhynchos, die ähnlich auch in Alexandrien und anderen Städten üblich war, zeigt sich nach Kloft (1988, 154), "dass in der antiken Getreideversorgung eine Einrichtung vorliegt, die ihrer Intention nach langfristig auf Behebung von Ernährungsschwierigkeiten und auf Sicherung einer bürgerlichen Schicht in ihrem ganz unterschiedlichen Status angelegt war. Ihre Herkunft und ihre Rückkoppelung an die Großzügigkeit privater Geber" sei ebenso wenig "ein Einwand gegen den öffentlichen Zuschnitt ihrer Hilfsmaßnahmen wie die Tatsache, "dass man darin vielfach auch eine vorbeugende Maßnahme gegen soziale Unruhe und Aufstände gesehen hat" (ebd.).
Antike Großstädte wie Athen oder Rom unternahmen Vielerlei, um die Getreideversorgung auch in schwierigen Zeiten sicher zu stellen. Das Arsenal der Maßnahmen geht weit über das hinaus, was heutige Politik angesichts der gegenwärtigen Ernährungskrise zustande bringt. Die Athener versuchten es mit langfristigen Handelsverträgen, militärische Eskortierung ihrer Getreideschiffe, Exportbeschränkungen, Vermeidung von Spekulation und Preisabsprachen, Mengenbeschränkungen für den Ankauf und Gewinnbeschränkungen beim Verkauf und Ehrungen und Privilegien für fremde Händler, um ihnen Handel mit Athen attraktiv zu machen. In Zeiten von Versorgungskrisen, wurde der Tagesordnungspunkt "Getreideversorgung" als zweiter bei jeder Hauptvolksversammlung (zehn Mal pro Jahr) behandelt (Kohns 1988, 114 f.). In Rom wurden die Gratisverteilungen von Getreide forciert und Brot, Öl, Wein und Fleisch verbilligt abgegeben, nicht selten durch private Wohltäter finanziert. Schiffseigentümern wurden Privilegien eingeräumt um den Import von Lebensmitteln zu beschleunigen (ebd., 115).
Je schwieriger die Versorgungslage war, desto höher stiegen die Preise an und in desto entferntere Destinationen mussten die Städte ihre sitonai (Getreidekäufer) aussenden. Besonderen Engpässen versuchte man mit amtlichen Preisbeschränkungen Herr zu werden, die allerdings wenig zielführend waren. Sie schreckten auswärtige Händler ab und trieben die einheimischen in den Ruin. Um das zu vermeiden, subventionierte etwa Tiberius im Jahr 19 u.Z. den von ihm festgesetzten Höchstpreis für Getreide gegenüber den Händlern, ein Verfahren, das auch in Griechenland geübt wurde. Noch drastischere Maßnahmen waren nur unter Androhung massiver Strafen möglich: Kohns (ebd., 116) berichtet von einem Fall in Antiochien. Dort wurde in den Jahren 92/93 ein Höchstpreis für Getreide festgelegt, eine genaue Deklaration der Bestände verfügt und ein Verkaufszwang für die Vorräte verfügt, die das Saatgut und den Eigenverbrauch überstiegen. Zuwiderhandeln hatte den Einzug aller überschüssigen Bestände zur Folge. Zur Durchsetzung der Maßnahmen wurde eine Prämie für Anzeigen ausgelobt.
Zu noch drastischeren Mitteln konnten Städte greifen, die sich, etwa am Bosporus, in einer strategisch vorteilhaften Lage befanden: "Byzantion, Chalkedon oder Kyzikos wussten in Notfällen ein probates Auskunftsmittel. Sie sicherten sich ihren Lebensmittelbedarf durch Kapern vorbeifahrender Schiffe" (ebd., 117). Ob Berichte über gezielte Bevölkerungsreduzierungen, wie sie etwa Herodot[62] aus Babylonien überliefert, den Tatsachen entsprechen, wird von den Historikern bezweifelt. Dort sollen 522 v.u.Z. alle Frauen mit Ausnahme der Mütter und einer Frau pro Mann, die "zur Essenszubereitung erforderlich gewesen" sei (ebd., 118), getötet worden sein. Die ersten, die ausgewiesen wurden, um die Zahl der Esser zu verringern, waren stets die Fremden. Unter Augustus wurden während einer längeren Notzeit der Jahre 5-7 n.u.Z. "alle Fremden mit Ausnahme der Ärzte und Lehrer, die Gladiatoren, ein Teil der Haussklaven und alle zum Verkauf bestimmten Sklaven" ausgewiesen (ebd., 119). Wenn es überhaupt nichts mehr gab, aßen die Menschen "Notnahrung der schlimmsten Art - Blätter, gekochtes Leder, Gras, Mäuse und in vergleichsweise seltenen Fällen Menschenfleisch" (ebd., 120 f.).
Das Maß einer congius (3,2 Liter) gab der Verteilung von Geschenken durch Kaiser oder andere Reiche den Namen, den »Conguarien«, von Zeit zu Zeit veranstalteten Verteilungen von Naturalien oder Geld durch die Kaiser. So soll Julius Cäsar auf 22.000 Tischen die gesamte römische Bürgerschaft gespeist haben, bei seinen fünf Triumphen ließ er Getreide, Öl und Geld an alle Bürger verteilen. Regierungsantritte, Thronjubiläen, Rückkehr aus Feldzügen oder die Eröffnung neuer Prachtbauten waren Anlässe für conguaria. 40 Millionen Sesterzen hat Augustus, der freigiebigste unter den römischen Kaisern während seiner Amtszeit an die Römer verteilt. Die Getreideempfänger (plebs frumentaria), in spezielle Listen eingetragene Personen und Soldaten erhielten jeweils zwischen 250 bis 400 Sesterzen. Nicht wenig Geld, wenn man bedenkt, dass man für einen Sesterz eine einfache Hauptmahlzeit oder einen halben Liter Wein bekam, und der Tageslohn eines Legionärs etwa 4 Sesterzen betrug, womit sein Tagesbedarf gedeckt war. Freilich waren die congiaria keine Einkünfte, mit denen man rechen konnte, sondern von der liberalitas principis abhängig. Unter dem Prinzeps Augustus gab es diese Freigiebigkeit sieben Mal.
Was es sonst noch alles gab, lässt sich bei Prell (ebd., 286) nachlesen:
Man hielt öffentliche Speisungen und außerordentliche Lebensmittelverteilungen ab. Hadrian gewährte eine Gewürzspende zu Ehren seiner Schwiegermutter. Antoninus Pius ließ unentgeltlich Wein, Öl und Weizen an das Volk verteilen. Caracalla machte sich beim Volk durch die Verteilung von Mänteln beliebt. Heliogabal soll beim Antritt des Konsulats dem Volke Ochsen, Kamele, Esel und Hirsche geschenkt haben, später dann eine neue Art der Verlosung eingeführt haben, wobei man Bären, Gold, aber auch nur Mäuse oder Lattichstengel gewinnen konnte. Aurelian schenkte dem Volk langärmlige Tuniken und Schweißtücher. Geschenke verschiedenster Art wurden in Form von Gutschein-Bällchen unter das Volk bei den Spielen oder im Theater geworfen, was bereits Agrippa getan hatte. Diese sicherlich beim Volk beliebten Gewinnspielchen sind von Kaisern wie Calligula, Nero, Titus, Domitian und Hadrian überliefert.
Es dürfe, ermahnt Plutarch die Regierenden »der Staatsmann bei den gebräuchlichen Spenden sich nicht kleinlich zeigen, wenn seine Mittel Großzügigkeit gestatten. Die Menge hasst nämlich den Reichen, der von seiner Fülle nicht miteilt, mehr als den Armen, der sich am Staatsgut vergreift.« (Moralia 822 A u.B).
Alimentarstiftungen, von Privaten oder von Kaisern gegeben, können Kindern aus der Plebs zu Gute kommen.
Die römischen Alimentarstiftungen waren ein weiteres Betätigungsfeld privater Großzügigkeit. Sie hatten die Kinderfürsorge zum Ziel und wurden von Privatleuten und von den Kaisern unterhalten. Aus Italien sind insgesamt sechs private Allmentarstiftungen nachgewiesen. Heivius Basila vermachte den Bewohnern der Stadt Atina 400.000 Sesterzen, »dass aus deren Einkünften den Kindern. solange bis sie volljährig sind, Getreide und nachher einmalig 1.000 Sesterzen gegeben werden« In einem Brief an seinen Freund Satuminus berichtet Plinius[63] von seinen alljährlichen Zuwendungen an freigeborene Kinder, die er anstelle von Wettspielen oder Gladiatorenkämpfen spendete, und die auch bei Kinderlosen Beifall gefunden hätten. Seinem Freund Caninius rät er, seinem Beispiel zu folgen: »Ich habe statt der 500.000 Sesterzen, die ich für die Alimentierung freigeborener Knaben und Mädchen ausgesetzt hatte, ein Stück Ackerland von erheblich höherem Werte aus meinem eigenen Besitz dem Geschäftsführer der Gemeinde übereignet und es dann gegen eine jährliche Rente von 30.000 Sesterzen zurückgenommen. Auf diese Weise gehört das Kapital ungefährdet der Gemeinde, der Zinseingang ist gesichert, und das Grundstück wird, da sein Ertrag die Rente weit übersteigt, stets einen Pächter finden, der bereit ist, es zu bewirtschaften. Ich weiß wohl, dass ich bedeutend mehr ausgeworfen habe. als meine Stiftung zu erfordern schien. [...] aber man muss die öffentlichen Interessen höher stellen als die persönlichen (Plinius, Epistulae 1.88.10.ff.) [...] Die Altersgrenzen waren von Ort zu Ort unterschiedlich. Eine Stiftung aus dem afrikanischen Sicca sieht Alimenta für Knaben im Alter von 3 bis 5 Jahren, für Mädchen von 3 bis 13 Jahren vor, im italienischen Florentia bis ins Alter von 14 Jahren für Knaben, in Tarracina bis 16 Jahre für Knaben und 14 für Mädchen. 249 In Sicca erhielten die Jungen monatlich 10 Sesterzen, die Mädchen 8 Sesterzen. In Tarracina 20 Sesterzen die Jungen, 16 Sesterzen die Mädchen (Prell 1997, 266).
Unter Nerva[64] werden die Alimentarstiftungen vermehrt und über Rom hinaus ausgedehnt, 50 solche Stiftungen gab es auf italienischem Gebiet, also keinesfalls in allen 400 Städten. Unter Trajan[65] wurde Italien in Alimentationsbezirke eingeteilt. Aus Veleia, einer Stadt in der Emilia Romagna, ist auf einer Tafel genau erhalten, wie die Alimentarstiftung Trajans, »unseres besten und obersten Herrn und Kaisers« ausgesehen hat:
Die Inschrift auf der sogenannten Tafel von Veleia besagt, dass die Gemeinde von Kaiser Trajan 1.044.000 Sesterzen als Kapitalfond zugewiesen bekommen hatte. Dieses Geld wurde an die örtlichen Grundbesitzer verliehen. Diese mussten ihre Grundstücke als Pfand geben und erhielten abhängig von der Grundstücksgröße entsprechende Darlehen. Mit den jährlich zu entrichtenden fünfprozentigen Zinszahlungen wurden die ausgewählten Kinder und Jugendlichen versorgt. In Veleia wurden jährlich 300 Kinder mit einem Gesamtbetrag von 52.200 Sesterzen unterstützt, darunter 263 eheliche Knaben, 35 eheliche Mädchen, 1 unehelicher Knabe und 1 uneheliches Mädchen ... Knaben aus legitimer Ehe bekamen 16 Sesterzen im Monat, Mädchen 12. Kinder aus nicht legitimer Ehe erhielten 12 bzw. 10 Sesterzen (Prell 1997, 288).
Seit Trajans Nachfolger Hadrian[66] erhalten Knaben bis zum 18. und Mädchen bis zum 14. Lebensjahr dieses "Kindergeld". Hauptsächliches Motiv der Kaiser wird wohl eine Steigerung der Eheschließungs- und der Geburtenrate gewesen sein, die Förderung der Landwirtschaft durch Kredite mag ein zusätzliches Motiv gewesen sein. Auch hier scheint die Armut der Begünstigten nicht das Kriterium der Zuteilung gewesen zu sein. Als Zielgruppe werden nicht die wirklich Armen, pauperes oder inopes genannt, sondern plebs, plebs urbana, cives, ingenui etc., also anerkannte Bürger der Stadt (vgl. Mrozek 1988, 155). Bedürftige können zu den Begünstigten gehören, werden aber nicht bevorzugt. Es könnte sogar sein, dass die Empfänger, deren Zahl festgelegt war, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Wie alle anderen Benefizien der principes waren auch die alimenta Auszeichnungen für die Empfänger und Zeichen der Freigiebigkeit des Kaisers, die diesmal den Kindern zugute kamen.
Der seit Hendrik Bolkestein (1939) oft wiederholten These, es habe im Altertum so gut wie keine nennenswerte Armenpflege gegeben, widerspricht Ingomar Weiler (1988) mit Hinweis auf griechische Quellen, die in eine andere Richtung weisen. Am Beispiel der Witwen- und Waisen versucht er zu zeigen, dass es schon früh Reglungen zu deren Unterstützung gegeben hat. Bereits im 6. Jh. v.u.Z. wurde unter Solon verfügt, dass die Söhne Gefallener auf Staatskosten unterhalten und erzogen werden und die panhoplía, die Aus-rüstung als Soldaten, auf Staatskosten erhalten sollen. Wie weit sich eine Unterstützung auch auf die Töchter bezog, ist umstritten. Einer aus dem 4. Jh. stammenden Inschrift ist zu entnehmen, dass sie eine Braut-ausstattung erhalten, und dass auch die Eltern der Gefallenen unterstützt werden. Verwaiste Kinder nicht im Krieg gefallener Väter sollten von der mütterlichen Familie aufgenommen werden, ihr Vermögen blieb ihnen bis zur Volljährigkeit gesichert. In Athen und anderen Großstädten gab es einen Waisenpfleger bzw. ein Kollegium von Männern, die vor allem für die Verteidigung der Rechte der Waisen gegenüber den Vor-mündern zu sorgen hatten. Namhafte Philosophen wie Plato machen die Waisenfürsorge zu ihrem Anliegen.
Auch die Witwenfürsorge habe früh eingesetzt, vorausgesetzt die Frauen führten ein vorbildliches Leben, in dem sie sich »der sie beherrschenden Natur nicht als unterlegen erweisen« und »bedenken, dass nicht besprochen zu werden unter den Männern in Lob und Tadel ihre höchste Ehrung sei«, wie Perikles[67] sie ermahnt (Weiler 1988, 24). Die rechtlichen Bestimmungen besagen im Allgemeinen, dass eine Witwe ohne Kinder samt ihrer Mitgift und möglicherweise einem Teil des in der Ehe Erwirtschafteten in das Haus ihres Vaters zurückkehrt. Sind unmündige Kinder da, bleibt sie unter dem Schutz des Vormundes im Haus des Gatten, sind großjährige Kinder vorhanden, haben diese für die Mutter zu sorgen. Auch die Aufnahme in die Familie des verstorbenen Gatten ist möglich. Witwen haben (im Unterschied zu Ehefrauen) das Recht, Töchter zu verheiraten oder Söhne in die Lehre zu geben. Wenn sie beim Tod des Mannes schwanger sind, haben sie das Recht, das Kind auszusetzen. Bei Wiederverheiratung - in den ersten Jahrhunderten verpönt, später empfohlen - geht der Besitz des früheren Mannes auf die Kinder über.
Von einer ausreichend entwickelten sozialen Fürsorge will trotz dieser Maßnahmen auch Weiler nicht sprechen. Zu zahlreich sind die Zeugnisse bitterster Not von Witwen und ihren Kindern. Wie sehr auch die über-lieferten Fürsorgemaßnahmen von den Ungleichheitsgewichten der antiken griechischen Gesellschaft durchzogen sind, scheint Weiler nicht zu bekümmern: Nicht nur, dass das Gros der Regelungen die Versorgungspflicht nicht dem Staat, sondern den Privaten, insbesondere den Familien auferlegt. An jeder einzelnen der Vorkehrungen sieht man überdies, dass Frauen unter der Vorherrschaft der Männer stehen, Knaben mehr wert sind als Mädchen und der Krieg verdienstvoller als der Friede.[68]
Die Stigmatisierung Behinderter gehört "zum formalen und inhaltlichen Bestand aller antiken Religionen, sowohl der Hochreligionen als auch des Volksglaubens" (Grassl 1988, 36). Wie makelbehaftete Opfertiere gelten Behinderte als unrein, es werden ihnen gefährliche magische Kräfte zugeschrieben oder sie werden "als Inkarnation des Bösen" betrachtet (ebd.). Bis in den Götterhimmel hinein reichen Spott und Verachtung. »Oh, hätten sie nimmer gezeuget!« klagt der verkrüppelte und von Aphrodite verspottete Hephaistos seine Eltern an, keine Geringeren als Zeus und Hera (Homer, Ode 8, 312). Behinderten war der Zutritt zum Priesteramt und zu öffentlichen Ämtern verwehrt, wenn es auch Ausnahmen gab bis hin zu griechischen Königen und römischen Kaisern wie Claudius,[69] Septimius Severus,[70] Maxentius[71] oder Constans,[72] die alle schwer gehbehindert waren. Sie alle aber "hatten in verschiedener Weise unter ihrem Schicksal zu leiden, sei es, dass man sie darob erst gar nicht zu Herrschaft gelangen lassen wollte oder darin ein billiges Angriffsziel fand" (ebd., 37).
Verkrüppelte Neugeborene wurden ausgesetzt, "ein Verfahren, dem Philosophen und Mediziner ihre ausdrückliche Zustimmung gaben" (ebd., 38). »Was das Großziehen von Kindern betrifft«, so etwa Aristoteles, »so sollte gelten, dass kein deformiertes Kind großgezogen werden sollte; wo aber die herrschenden Sitten das Aussetzen von Neugeborenen verbieten, sollte eine Grenze für die Erzeugung von Nachkommen gesetzt werden« (zit.n. deMause 1977, 47) Es sei nicht »Zorn, sondern Vernunft, das Unbrauchbare von dem gesunden abzusondern«, bekräftigt der Römer Seneca: »Tolle Hunde bringen wir um; einen wilden und unbändigen Ochsen hauen wir nieder, und an krankhaftes Vieh, damit es die Herde nicht anstecke, legen wir das Messer, ungestalte Geburten schaffen wir aus der Welt, auch Kinder, wenn sie gebrechlich sind und mißgestaltet zur Welt kommen, ersäufen wir« (ebd.). Leute aus dem Volk wussten es noch gröber zu sagen: Ein Mann, so etwa einer namens Aristippus, könne mit seinen Kindern tun, was er wolle, denn »werfen wir nicht auch unsere Spucke, unsere Läuse und dergleichen unnütze Dinge von uns, obgleich sie von uns selbst erzeugt worden sind?« (zit.n.ebd., 48). Neugebore wurden auf ihre Lebenstüchtigkeit regelrecht getestet, indem man sie in Wein oder kaltem Wasser badete. Weil aber nur Neugeborene ausgesetzt werden durften - zu einem Zeitpunkt, wo sie nach allgemeiner Ansicht noch keine Menschen sind - und zum Zeit-punkt der Geburt spätere Missbildungen in vielen Fällen nicht erkennbar waren, gab es trotzdem "im Altertum zu allen Orten und Zeiten genügend von Geburt an behinderte Personen" (Grassl 1988, 37)
Aus der römischen Sitte, die Art der Behinderung in die Namensgebung aufzunehmen, die besonders in der Oberschicht gebräuchlich war, schließt Grassl auf eine gewisse Tendenz zur Nichtdiskriminierung Behinderter. »Es birgt sich dahinter die schöne Sitte, Blindheit oder sonst ein körperliches Gebrechen nicht als entehrende Schande zu betrachten, sondern als etwas Vertrautes hinzunehmen, indem man es beim Namen nennt«, heißt es bei Plutarch[73] (Corionlanus-Alkibiades 11,6). Andererseits erfahren wir von Behinderten, die ihr Handicap nicht als solches gelten lassen wollen, es verbergen oder durch Kleidung kompensieren, "was wiederum Spott in der Umgebung provoziert." (ebd., 40). Wie immer, "die realen Möglichkeiten waren ... von den ökonomischen Ressourcen des einzelnen abhängig" (ebd., 41). Was die staatlichen Hilfen betrifft, waren auch hier Kriegsinvalide bevorzugt. Ab dem 5. Jh. v.u.Z. erhalten in Athen Behinderte unterhalb einer bestimmten Vermögensgrenze 1 Obole pro Tag. Ebenfalls nur in Athen gab es eine Bezeichnung für alle Behinderte: adynatoi, die Schwachen, die ohne jede Kraft sind. Anderswo hing die Unter-stützung wohl weiterhin von der Gnade der jeweiligen Herrscher ab oder von den ökonomischen Bedingungen der Region. In Amorgos, einer kleinen, kargen Insel in der Ägäis konnte der Bürger "froh sein, wenn ihm für sich und seine Familie der Beitrag zum Fest erlassen wurde und er mehrere Tage lang auf Kosten eines Mitglieds der Oberschicht trinken und essen konnte." (Ruschenbusch 1988, 45). In Rom scheint sich die staatliche Hilfe überhaupt auf Kriegsinvaliden und Veteranen zu beschränken, auch für diese kein Recht, sondern ein Gnadenakt. Die Beurteilung dieser Tatsache durch den Althistoriker wirkt hier beinahe schon zynisch: "Doch darf deswegen nicht schon auf mangelndes soziales Gewissen geschlossen werden, worauf ja auch das vielfach belegte Bettelwesen abzielt" (ebd., 43 f.). Grass' Verweis auf die soziale Ausgleichsfunktion von oikos, amicitia, familia und patronus ist hier sicher einschlägiger.
Wer die Position eines öffentlichen Arztes anstrebte, musste im antiken Griechenland "nachweisen, dass schon jemand (durch ihn) von einer Krankheit befreit wurde", so Platon im Gorgias (514 d 7). Kein schlechtes Verfahren der Qualifikationsprüfung, sollte man meinen, dem freilich zu Platons Zeiten kaum ein über-prüfbares Wissen über Krankheiten und noch weniger eines über Heilverfahren gegenüber stand. Paläopathologen, die an antiken Leichen u.a. Arthrose, Knochentuberkulose, Arteriosklerose, Nieren- und Lebererkrankungen nachgewiesen haben, wissen heute mehr über die Krankheiten der Antiken als diese selbst (vgl. Kudlien 1988, 76). Dementsprechend ist das Vertrauen in die Kunst der Ärzte nicht allzu groß. »Wenn es dein Schicksal ist, von dieser Krankheit zu genesen: ob du einen Arzt hinzuziehst oder nicht: du wirst gesund; desgleichen, wenn es dein Schicksal ist, von dieser Krankheit nicht zu genesen: ob du einen Arzt hinzuziehst oder nicht - du wirst nicht genesen; in jedem Fall ist es dein Schicksal; also ist es ohne Belang einen Arzt hineinzuziehen« - so fatalistisch etwa Cicero (de fato 128). »Der Arzt ist nichts weiter als eine Gemütsberuhigung« - so Petronius[74] (Satyricon 42), keine Kunst sei unsicherer als die ärztliche - so Plinius der Ältere (Naturalis historia XXIX 2). Wer wissen wollte, ob er gesund wird, wandte sich eher an ein Orakel als an einen Arzt (ebd., 78). Oder besser gleich an die Götter, wobei man freilich wissen musste, welche der heimischen oder importierten Gottheiten wofür zuständig war, wer "Herr der Gebärmutter" oder Spezialist für Säuglinge war, welche Gemme oder welches Amulett wofür gut war (ebd., 79).
Zu machen Zeiten und in manchen Regionen wurden öffentliche Ärzte eingesetzt, bisweilen durch eine Hiatrikon-Steuer finanziert. Diese waren verpflichtet, alle Kranken unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit zu behandeln, wenn auch so mancher sich davon zu exkulpieren wusste. Eine Ehreninschrift konnte dagegen erhalten, wer "für alle in gleicher Weise zur Verfügung stand, Arme und Reiche, Sklaven und Freie" (Cohn-Haft 1956, 49, zit.n.ebd., 86). Keinesfalls aber waren die Armen eine in besonderer Weise berücksichtigte oder beachtete Zielgruppe der antiken Medizin. "Der explizite ,Armenarzt', als ausdrücklich so proklamierter ,Armenfreund' ist eine neuzeitliche Erscheinung" (ebd., 87). In der Antike galt armen Kranken gegenüber, was gegenüber Armen insgesamt galt: Euérgesia bzw. beneficium war gegenüber den Verarmten der eigenen Schicht angebracht, die der gewährten Wohltat auch würdig waren und sie, sei es durch Dankesbezeugung oder durch spätere eigene Wohltaten, zurückgeben konnten: do ut des. Kudlien (1988) geht davon aus, dass zahlungsunfähige Arme nur die einfachst mögliche und kurze Behandlung erhielten.
Krankenhäuser im modernen Sinn gab es nicht. Bezeugt sind lediglich spezielle ampla valetudinaria (Gesundheitsräume, grch.: hiatréia) auf großen Landgütern, vielleicht auch in machen Städten, oder Lazarette für Soldaten. Die dort übliche Behandlung wird in einer Weise geschildert, die an das heute üblichen Ritual der Visite erinnert: Platon beschreibt in den Nomoi (720 c/d) "dass der hier beschäftigte Arzt eilig von einem Patienten zu anderen »springt« und rascheste (offenbar allersimpelste) Therapieanweisungen gibt" (ebd., 93). Für die Behandlung von Haussklaven sorgten in Griechenland deren Herrn, jedenfalls so lange ihre Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt werden konnte. In Rom konnten kranke Sklaven auch getötet oder auf der insula Aesculapi, einer Tiberinsel, auf der sich das Heiligtum Äskulaps befand, ausgesetzt werden. Cato empfiehlt, solchen Sklaven die Nahrung auf ein Minimum herab zu setzen, eine Auffassung, die entgegen aller sonstigen sozialen Ethik sich in abgewandelter Form sogar bis in das Neue Testament erhalten hat: »Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen« (2 Thess. 3,10). Sklaven in Bergwerken waren überhaupt nicht abgesichert. Freie in Lohnarbeitsverhältnissen mussten Fehltage nacharbeiten. Selbst für die bescheidenste Lebensfristung war ein aufrechtes und ununterbrochenes Arbeitsverhältnis die Voraussetzung, Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit war existenzbedrohend. Für arme Kranke, die nicht in einem óikos oder einer familia Zuflucht fanden, blieb nur der Tod.
Auf eine wie lange Tradition bis heute übliche Argumente gegen soziale Hilfe zurückblicken können, zeigt eine Legende aus der altgriechischen Stadt Kyme: "Als hier dem Rat der Antrag unterbreitet wurde, dem blinden Homer »seinen Unterhalt zu gewähren«, sprach eines der Ratsmitglieder dagegen mit dem Argument »wenn die Stadt die Blinden zu füttern für gut befinde, werde man einen Haufen unnützen Volkes nach Kyme ziehen«" (ebd., 96). "Ein volles Gewahrwerden der sozialen Verknüpfung von Armut und Krankheit" war, wie Kudlien zu Recht feststellt, "recht eigentlich erst Sache des Christentums" (ebd., 100).
[1] Die Vermögensverhältnisse wurden regelmäßig durch den Zensus erhoben, in dem alle Bürger ihr Vermögen offen legen mussten
[2] Tiberius Julius Caesar Augustus, röm. Kaiser 14 - 37
[3] Lucius Annaeus Seneca, röm. Philosoph, 1 - 65
[4] Quintus Horatius Flaccus, röm. Dichter, 65 - 8 v.u.Z.
[5] Einen noch höheren, freilich in der Kaiserzeit nur mehr nominalen Rang hatten die nobiles, die Konsuln während der Republik und ihre Nachkommen
[6] "Der Erhabene", Beiname von Gaius Octavius, Adoptivsohn Cäsars, erster römischer Kaiser, 30 v.uZ - 14 n.u.Z.
[7] Zum Geldwert vgl. Anm. 4. Wenn man 1 Sesterze mit ~ 6 € rechnet, hätte der Besitz eines Senators zu Augustus Zeiten 6 Mill. € zu betragen.
[8] Kaum weniger wichtig als die äußeren Insignien des Ranges waren die Titel: "Die Zugehörigkeit zu einem Rang äußerte sich in der Titulatur. So gab es bei den Senatoren die Abstufungen clarissimi, spectabiles, illustres, illustresmagnificentissimi und illustres gloriosissimi. Bereits seit dem 2. Jahrhundert führten die Mitglieder des Senatorenstandes den offiziellen Titel clarissimus, der ihr Ansehen und ihre soziale Position unterstrich. Die Ritter, die hinter den Senatoren den zweiten Rang in der gesellschaftlichen Hierarchie einnahmen, schmückten sich ebenso mit Ehrentiteln. Prätorianerpräfekten wurden als eminentissimi, Prokuratoren als perfectissimi oder egregii bezeichnet" (Prell 1997, 38 f.)
[9] Der heutige Wert der römischen Währung ist schwierig zu bestimmen. Man geht davon aus, dass 1 Denar (= 4 Sesterzen = 16 Asse) in etwa dem Tageslohn eines römischen Arbeiters oder nach heutiger Währung ca. 15 - 25 € entsprach. Der reine Materialwert dieser Silbermünze verringerte sich im Lauf der Zeit durch Beimengung anderer Metalle. Zu Kaiser Augustus' Zeiten betrug der Silberwert des Denares nur mehr etwa 2 €, im 3. Jahrhundert u.Z. war er fast silberfrei. Dem begehrten Metall verdanken wir übrigens bis heute den geriffelten Rand mancher Münzen. Um die vielfach geübte Praxis zu unterbinden, Münzen abzufeilen oder zu beschneiden und so das Silber zu stehlen, versah man die serrati mit einem "gesägten" Rand (serra = Säge).
[10] Gaius Sallustius Crispus, röm. Geschichtsschreiber und Politiker, 86 - 35 v.u.Z.
[11] Publius Cornelius Tacitus, röm Historiker, 58 - 120
[12] "unbescholten und im Besitz großer Häuser"
[13] "niederträchtig und an Circus und Theater gewöhnt"
[14] siehe unten
[15] "die geringsten der Sklaven"
[16] "die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung"
[17] "die immense und übermäßig große Plebs"
[18] "die aufgeblähte Plebs" - Es könnte auch sein, dass Horaz hier tatsächlich an Winde" denkt.
[19] "gewöhnlich, dumm, arm, faul, ungeschickt, ungebildet, schamlos, unklug, leichtgläubig und unerfahren"
[20] Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 v.u.Z., römischer Politiker, Anwalt und Philosoph, Schriftsteller, berühmtester Redner Roms, Konsul im Jahr 63 v.u.Z.
[21] Quintus Horatius Flaccus, 65 - 27 v.u.Z., bedeutender römischer Dichter. Der Beiname Flaccus bedeutet "Schlappohr"
[22] Lukian von Samosata, ~120-180, griechischer Satiriker
[23] griech. Philosoph, ~ 469 - 399 v.u.Z.
[24] griech. Philosoph, ~ 427 - 348 v.u.Z.
[25] griech. Philosoph, ~ 365 - 288 v.u.Z.
[26] griech. Philosoph, ~ 499 - 428 v.u.Z.
[27] Lucius Apuleius, 125-170, antiker Schriftsteller und Philosoph
[28] röm. Schriftsteller und Anekdotensammler zur Zeit des Tiberius
[29] Artemidor von Daldis, 2. Jh., griech. Traumdeuter und Wahrsager, Verfasser der "Traumdeutung" (Oneirokritika)
[30] Marcus Tullius Cicero, röm. Philosoph und Politiker 106 - 43 v.u.Z.
[31] Publius Terencius Afer, röm. Komödiendichter, ~ 195 - 159
[32] griech. Philosoph, 384 - 322 v.u.Z.
[33] Publius Vergilius Maro, röm. Dichter, 70 - 15 v.u.Z.
[34] griech. Philosoph, ~ 50 - 138
[35] Die zunächst zwei, später sechs Ädile der Stadt Rom waren für die Ordnung in der Stadt, den Verkehr, die öffentlichen Veranstaltungen, den Zustand der Gebäude etc. verantwortlich
[36] Titus Flavius Domitianus, röm. Kaiser, 51 - 96
[37] röm.-jüdischer Historiker, 37 - 100
[38] Flavius Placidus Valentinianus, röm. Kaiser, 425 - 455
[39] Gaius Sallustius Crispus, 86-34, röm. Geschichtsschreiber und Politiker
[40] griech. Geograph, ~ 64 v.u.Z - 24 n.u.Z.
[41] griech. Philosoph, ~ 50 - 125
[42] griech. Philosoph, 54 - 138
[43] Severus Alexander, röm. Kaiser, 222 - 235
[44] griech. Schriftsteller und Philosoph, 86 - 34
[45] Lucius Sergius Catilina ,~ 108 - 62, röm. Politiker, bekannt durch die von ihm angeführte Catilinarische Verschwörung
[46] Röm. Satiriker, ~ 60 - 127; Juvenal bezieht sich hier auf die republikanische Zeit, als die politischen Amtsträger noch von den stimmberechtigten Bürgern gewählt wurden, auch die Konsuln, denen die Rutenbündel (fasces) vorangetragen wurden.
[47] Marcus Cornelius Fronto, 100 - 170, röm. Grammatiker, Rhetoriker und Anwalt
[48] Lucius Licinius Lucullus, röm. Senator und Feldherr, 74 - 155
[49] röm. Konsul, 1. Jh. v.u.Z.
[50] röm. Schriftsteller und Politiker, 163 - 229
[51] Marcus Vipsanius Agrippa, ~ 64 - 12 v.u.Z.
[52] antiker Schriftsteller, ~ 123 - 170
[53] Die folgende Schilderung des Klientelwesens (S. 12-14) ist dem Lexikon "Alltag im Alten Rom" von Karl-Wilhelm Weeber (2001) entnommen
[54] Marcus Valerius Martialis, ~ 40 - 104, röm. Dichter
[55] siehe unten
[56] Marcus Ulpius Traianus, röm. Kaiser, 306 - 337
[57] Tiberius Sempronius Gracchus, röm. Volkstribun im Jahr 133 v.u.Z.
[58] Gaius Sempronius Gracchus, Volkstribun in den Jahren 123 und 122 v.u.Z. Die Brüder Tiberius Sempronius und Gajus Gracchus, "die Gracchen", sind Urheber der Gracchischen Reformen
[59] Marcus Cocceius Nerva, von 96 bis 98 röm. Kaiser
[60] Der Begriff bezeichnet ursprünglich keine religiösen Rituale, sondern Werke (griech: erga) der Reichen für die Bevölkerung (griech.: leithos) wie Ausspeisungen, Unterhaltungsveranstaltungen, etc.
[61] "Der Schielende", griech. Geschichtsschreiber und Geograf, ~ 63 v.u.Z. - 23 n.u.Z.
[62] Herodot von Halikarnassos, 490/80-425 v.u.Z., griech. Historiograph, Verfasser von 9 Bänden "Historien"
[63] Gaius Plinius Secundus Major (der Ältere), röm. Gelehrter, 23 - 79
[64] Marcus Cocceius Nerva, röm. Kaiser 96 - 98
[65] Marcus Tulpius Traianus, röm. Kaiser, 98 - 117
[66] Publius Aelius Hadrianus, röm. Kaiser, 117 - 138
[67] griech. Staatsmann, ~ 490 - 429 v.u.Z., führender Politiker der Athenischen Demokratie
[68] Kriegerwitwen waren nach dem ersten Weltkrieg die historisch erste Gruppe der österreichischen Bevölkerung, die statt des Ansuchens um Armenfürsorge ein staatlich zugesprochenes R e c h t auf eine Rente erhielten
[69] Tiberius Claudius, röm. Kaiser 41 - 54
[70] Lucius Septimius Severus, röm. Kaiser, 193 - 211
[71] Marcus Aurelius Valerius Maxentius, röm. Kaiser 306 - 312
[72] Flavius Julius Constans, röm. Kaiser 337 - 350
[73] griech. Schriftsteller, ~ 45 - 125
[74] Titus Petronius, röm. Senator und Autor, 14 - 64
Inhaltsverzeichnis
Für die christliche Tradition und damit für das gesamte Mittelalter ist Armut nicht bloß ein soziales Problem sondern ein Element religiöser Ideologie. In der Theologie des Neuen Testamentes wird Armut als besondere Heilsverheißung idealisiert - ein Bruch sowohl mit der jüdischen als auch mit der klassischen Tradition. Die bekannte Verachtung der körperlichen Arbeit in der gesamten Antike fasst Otto Oexle wie folgt zusammen:
Die antiken und die christlichen Sozialauffassungen stimmen darin überein, dass Armut und Arbeit sich gegenseitig bedingen und definieren. Antike und Christentum unterscheiden sich aber in der Bewertung dieser Verknüpfung. Das Urteil antiker Autoren über Armut und Reichtum war "vollkommen eindeutig und unkompliziert": Reichtum "war notwendig und war gut; er war eine unerlässliche Voraussetzung für ein angenehmes Leben; und das war eigentlich alles"; eine Maxime wie das neutestamentliche »Selig sind die Armen" (Lk. 6,20; Mt. 5,3) gehörte deshalb "grundsätzlich nicht in die griechisch-römische Vorstellungswelt" (Hunecke 1983, 490). Antike Autoren definierten den Armen durch sein Angewiesensein auf körperliche Arbeit. Die Unterscheidung von »reich« und »arm« trennte deshalb die von ihrem Vermögen Lebenden von jenen, die ihren Lebensunterhalt durch Arbeit gewinnen mussten - gleichgültig, ob sie im rechtlichen Sinne Freie oder Sklaven waren. Das Urteil der Antike über die körperliche Arbeit war eindeutig und grundsätzlich negativ. Körperliche Arbeit hob die rechtlich-soziale Unterscheidung zwischen Freiheit und Unfreiheit (Sklaverei) auf; der für Lohn Arbeitende wurde eben dadurch zum Sklaven [...] Für einen Freien aber gab es [nach Cicero] nichts, was »einträglicher« und »angenehmer«, aber auch nichts, was »würdiger« war, als die Landwirtschaft (agricultura), womit freilich nicht die bäuerliche Arbeit gemeint war, sondern Grundbesitz, der allein die einem Freien angemessenen Tätigkeiten erlaubte, weil er von der Nötigung zur Arbeit befreite. Körperliche Arbeit machte den Menschen deshalb ungeeignet für die politische Betätigung, weil [nach Plato] die Arbeit den Leib verkrüppelt, die Seele und den Geist entstellt und unedel macht. Bauern, Handwerker oder Kaufleute können deshalb kein Bürgerrecht haben, wie Aristoteles erläuterte: »denn zur Entwicklung der Tugend wie zur Ausübung staatsmännischer Tätigkeit bedarf es der Muße«. Oder, noch einmal mit den Worten Ciceros: »Alle Handwerker üben eine schmutzige Tätigkeit aus, denn eine Werkstatt kann kein ingenuum haben«, wobei ingenuus ebenso »frei« wie auch »edel« und »anständig« bedeutet. Der in einer Werkstatt (officina) Arbeitende wird also intellektuell wie auch ethisch verurteilt. Reichtum und das Frei-Sein von körperlicher Arbeit galten als die Voraussetzungen ethischer Vervollkommnung, intellektueller Entfaltung und politischer Betätigung des Menschen (Oexle 1986, 73).
Ganz anders der Stellenwert von Arbeit und Armut in den christliche Quellen:
In der entgegengesetzten Bewertung der »Arbeit« und der »Armut« hat das Christentum eine universalgeschichtlich bedeutsame Revolution der Denkart heraufgeführt. Die bekanntermaßen radikale Verurteilung des Reichtums im Neuen Testament und die hohe Schätzung der Armut sind aufs engste verknüpft mit einer positiven Bewertung der körperlichen Arbeit. In der Verkündigung Jesu erhielt die Arbeit einen hohen ethischen Rang, wie zahlreiche Gleichnisse, z.B. das von den Arbeitern im Weinberg zeigen. Vor allem aber wird dies sichtbar in der Tatsache, dass die Verkündigung des Evangeliums selbst als Arbeit bezeichnet und der körperlichen Arbeit gleichgestellt wurde: der Jünger ist Arbeiter für die Ernte, und er ist als Arbeiter seines Lohnes wert. Als »Arbeiter« ist der Jünger aber zugleich ein »Armer«; die Nachfolge Christi bedeutet, dass er alles aufgegeben hat (Mk. 10,28 ff.), und die Aussendung zur Verkündigung des Evangeliums ist an die strengen Bedingungen der Armut gebunden (Mk. 6,7 ff.). Auf derselben Linie liegt der dem Apostel Paulus zugeschriebene Grundsatz: »Wenn einer nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen«; denn wer nicht arbeitet, lebt »unordentlich« und ist »unnütz«; der Christ soll also »durch ruhiges Arbeiten« seinen Unterhalt erwerben (2 Thess. 3,10 ff.). In »Gelassenheit« soll er seiner Arbeit und seinem Erwerb nachgehen, damit er auch den Armen zum »Lebensnotwendigen« verhelfen kann (Eph. 4,28; Thess. 4,11 ff.).
Es definieren sich also auch im Christentum »Armut« und »Arbeit« wechselseitig, doch werden beide in das klare Licht einer entschieden positiven Bewertung gerückt. Dadurch wurden die Arbeitswelt und das Alltagsleben der »vielen«, die in der antiken Literatur nur in der Komödie, in der Satire und im Roman, also in »niederen« Literaturgattungen dargestellt werden konnten, zum ersten Mal ernst genommen: die Evangelien des Neuen Testaments zeigen die Entstehung einer geistigen Bewegung in der Tiefe des alltäglichen Volkes, mitten aus dem zeitgenössischen alltäglichen Geschehen heraus (Oexle 1986, 73 f.).
Wie meist in der Geschichte gibt es aber verbindende Traditionen zwischen antiken und christlichen Auffassungen: Einerseits hat die Glorifizierung der freiwilligen Armut durch das Christentum ihre Vorläufer in den kynischen und stoischen Philosophien der Griechen und Römer, andererseits lebt die antike Missachtung der Armut in der negativen Bewertung der unfreiwilligen Armut fort: "Während die freiwillige Armut aus religiösen Gründen hochgeachtet wurde, blieb die unfreiwillige auch im Mittelalter mit negativen Wertungen behaftet: Armut wurde mit Unmoral, Dummheit, Unehrlichkeit identifiziert" (Sachße/Tennstedt 1983, 38).
Arm sind im Mittelalter nicht nur diejenigen, denen es an materiellen Lebensgrundlagen fehlt oder die physisch schwach, also behindert, krank oder gebrechlich waren, sondern auch die, die nicht »potentes« waren, "jeder, dem es an Ansehen und Einfluss gebrach, dessen Rechte beeinträchtigt waren, der sich nicht mit der Waffe verteidigen konnte, dem es an Wissen fehlte, der sich im Zustand der Vereinsamung und der Verlassenheit befand. Zu den »Schwachen« in diesem Sinne gehörten die klassischen Gruppen der Armut: Witwen, Waisen und Gefangene, aber auch Pilger und Fremde" (Oexle 1986, 78).
Armut war im christlichen Mittelalter aber nicht nur ein in Demut zu ertragendes Los der Armen, sondern auch eine gottgewollte Möglichkeit für die Reichen, ihre irdischen Sünden abzubüßen und sich den Himmel zu verdienen. Sie gilt nicht mehr als selbstverschuldete Schande, sondern als gottgegebenes Los und als "Himmelsleiter" sowohl für die Armen als auch für jene, die ihnen freigiebig helfen. Grundlegend für die Auffassung der Mittelalterlichen war die Botschaft der Heiligen Schrift.
Sowohl in den Evangelien wie in der patristischen Literatur wird die Armut als ein geistiger Wert gepriesen, den man erreichen kann gleichgültig, ob man sich im Zustand materiellen Reichtums oder Mangels befindet. Die fundamentalen Werte in der Ökonomie des Heils sind Demut und Entsagung. In der Ausdrucksweise der Bibel und in der frühchristlichen Literatur bemerkt man deutlich eine Gleichsetzung von paupertas (Armut) und humilitas (Demut): Demut und Entsagung sind die beiden Begriffe, die den Bedeutungsumfang des frühchristlichen Lobs der Armut umschreiben. Die maßgebende Dimension, die der Armut in diesem Lobpreis zugeschrieben wird, ist ihre Freiwilligkeit, die für die Funktion, welche die evangelischen Ideale im Laufe des Mittelalters erfüllen von großer Bedeutung sein wird. Die Armut Christi war die Frucht eines freiwilligen Verzichts auf Göttlichkeit und Königswürde, und nach diesem Vorbild ist es lobens- und nachahmenswert, wenn man der Macht, dem Reichtum und der Herrschaft, die man besitzt, freiwillig entsagt. Die frühchristliche Literatur rühmt aber sogleich auch die äußeren Zeichen von Entsagung und Demut, in denen sich materielle Entbehrung äußert: Ärmlichkeit der Kleidung, Leben ohne Einkommen und Besitz, ohne ein eigenes Haus, mit einem niedrigen sozialen Status (nicht selten kommt es hier zu der bezeichnenden Gleichsetzung mit dem Status des Fremden), unter den täglichen Leiden und Kasteiungen, die ein Leben in Entbehrung mit sich bringt (Geremek 1988, 28).
Auf der Seite der Vermögenden entspricht der Doktrin der Armut das Lob der Barmherzigkeit:
Parallel und komplementär zu dieser Doktrin der Armut ist das Lob der Barmherzigkeit, die als allgemeine Plicht aufgefasst wird. Die Universalität des Geschenks - als Mittel zur Festigung der menschlichen Beziehungen und als Zeichen der Absicht, Eintracht zwischen den Menschen und den Gruppen zu schaffen - bekommt im Christentum eine neue sowohl geistige wie institutionelle Dimension. Das Almosen ist ein Mittel zur Abbüßung der Sünden, und so bedeutet das Vorhandensein von Armen in der christlichen Gesellschaft, dass der Heilsplan sich erfüllt. In der Vita Eligii ist diese Vorstellung in geradezu klassischer Weise formuliert: »Gott hätte alle Menschen reich erschaffen können, aber er wollte, dass es auf dieser Welt Arme gibt, damit die Reichen Gelegenheit erhalten, sich von ihren Sünden freizukaufen« (Geremek 1988, 29).
»Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt« - so steht es im Neuen Testament (Mk 10,25). Mit dem Bild der Himmeleiter hat die christliche Theologie eine Formel gefunden, den Reichen, die nach der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion nun auch zur Gemeinschaft der Kirche gehörten, einen legitimen Ort im Reich Gottes zu verschaffen. Man kann von einer "ei-genartigen Tauschbeziehung" sprechen: "Für die ihm gewährte Unterstützung sichert der Bettler dem Almosengeber geistliche Unterstützung durch das Gebet". (Geremek 1988, 62). »Wie das Wasser das Feuer löscht«, heißt es in einer Spruchsammlung um 1230, »so löscht das bereitwillig dargereichte Almosen die Sünden« (Veits-Falk 2000, 82). »Seelengeräte« wurden dementsprechend die Messen, Gebete und Fürbitten genannt, die in den frommen Stiftungen, Vermächtnissen und Anniversarien den Begünstigen aufgetragen wurden: Geräte, die quasi mechanisch das Seelenheil der Stifter, insbesondere ihr beschleunigtes Aufsteigen aus dem gefürchteten Fegefeuer in den Himmel befördern sollten.

Bild: Die "Pfinzinger Männer". Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 78
Sowohl in der Form, die ihm das Frühchristentum gab, als auch in jener, die es im Laufe des Mittelalters an-nahm, enthielt das Ethos der Armut somit die unübersehbare Antinomie zwischen dem heroischen Modell der Entsagung und dem Gebot, den Bedürftigen zu helfen. Im ersteren Falle bedeutete es einen vom christlichen Lebensideal geforderten, aber auch in einem gewissen Sinne elitären Weg der Vollkommenheit; im letzteren Falle setzte es die materiellen Unterschiede zwischen Reichtum und Armut notwendig voraus. Man könnte die zuvor angeführten Worte aus der Vita Eligii geradezu umkehren: Der Reichtum der einen ist notwendig, damit den Armen geholfen werden kann. Das Lob des Almosens enthält nicht nur die Erlösungschance für die Reichen, sondern es sanktioniert auch den Reichtum, ist dessen ideologische Rechtfertigung. Das Lob der Armut gilt somit der Vollkommenheit einiger Auserwählter, die ihrer gesellschaftlichen Rolle freiwillig entsagen und ein christliches Leben verwirklichen; das gängige Modell eines christlichen Lebens besteht darin, dass man sich das Heil erwirbt, indem man die Kirche unterstützt, für neue Gotteshäuser spendet und kirchlichen Einrichtungen Schenkungen macht. In der Ökonomie des Heils ist eine gewisse Aufgabenverteilung oder auch, wenn man so will, eine "Arbeitsteilung" sui generis innerhalb der societas christiana vorgesehen: [...] Die Einteilung der christlichen Gesellschaft in »diejenigen, die beten, diejenigen, die kämpfen, und diejenigen, die arbeiten« - das klassische Modell des gesellschaftlichen Bewusstseins der ersten, agrarischen Epoche des Mittelalters - sanktionierte gerade diese Rolle der Kirche bei der Administration des Heils, wobei zu den diesseitigen sozialen Aufgaben der kirchlichen Institutionen auch die Armenhilfe gerechnet wurde (Geremek 1988, 35).
Die mittelalterliche Armutstheologie unterscheidet zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut:
Die Doktrin der christlichen Barmherzigkeit führt vom 12. Jahrhundert an in das theologische Denken eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Armut ein. Nach Gerhoh von Reidlersberg, einem der bedeutendsten theologischen und sozialen Denker des 12. Jahrhunderts, geht es um die Unterscheidung zwischen den »Armen mit Petrus« (pauperes cum Petro) und den »Armen mit Lazarus« (pauperes cum Lazaro). Unter den ersteren ist es vor allem der Klerus, für den Armut das bestimmende Unterscheidungsmerkmal sein sollte; die freiwillige Armut, die der deutsche Theologe in die kirchliche Disziplin und in das organisierte Klosterleben einführen möchte, ist ein geistiger Wert, der die Macht innerhalb der Kirche und die Vermittlungsrolle der Vollkommenheit im Umgang mit Gott legitimiert. Die andere Familie von Armen wird symbolisiert durch die Gestalt des armen Lazarus aus dem Evangelium. Pauper Lazarus bezieht sich auf die Armut des Laien, deren Wesen die materielle Not ist (»paupertas quae est in penuria«): Sie wird konkret aufgefasst, im Kontext der Fürsorgepflicht, die der Kirche und den Gläubigen obliegt (Geremek 1988, 36).
Gänzlich frei von dem aus der Antike bekannten Prestigestreben scheint aber auch die christliche Armen-fürsorge nicht zu sein:
Unter moralischem Aspekt interessiert sich die christliche Doktrin vor allem für den, der die Hilfe gewährt. Die Praxis der mittelalterlichen Wohltätigkeit liefert viele Beispiele für Handlungen, die man als Ausdruck tiefen Mitgefühls und der Verinnerlichung jener Grundwerte auffassen kann, die dem Gebot der Nächstenliebe zugrunde liegen. Doch sowohl das großherzige Austeilen von Almosen an den Pforten der Klöster als auch die karitativen Stiftungen und individuelle Schenkungen haben etwas Ostentatives, nehmen die Form eines Schauspiels an, bei dem sich die Zurschaustellung der eigenen Frömmigkeit mit der äußerlichen Darstellung des eigenen Sozialprestiges verbindet (ebd.).
Zwar war die Versorgung der Armen im Mittelalter Aufgabe sowohl der weltlichen als auch der kirchlichen Machthaber. Ludwig der IX., der Heilige[75] verteilte nach seinem Biografen überall wo er hinkam Almosen, machte Schenkungen an »Kirchen, Leprosorien, Spitäler, Herbergen für Pilger, und er beschenkte Söhne und Töchter der verarmten Adelsfamilien«. Zudem ließ er täglich Essen unter den Armen verteilen, die nicht in Spitälern unterkamen, »nicht gerechnet diejenigen, die an seiner Tafel aßen und denen er bisweilen selbst das Brot schnitt und zu trinken einschenkte« (zit.n. Geremek 1988, 57). Tatsächlich waren es aber vor allem die Bischöfe und in noch viel größerem Ausmaß die Klöster, die sich der Armen annahmen.
Armenfürsorge wurde seit jeher von der Kirche, d.h. von den Bischöfen geübt. Aufgrund der kirchenrechtlichen Norm, dass von den kirchlichen Einkünften ein Viertel den Armen zu geben sei, entstanden im Bereich der bischöflichen Kirchen Institutionen der Armenpflege, die auch durch ein gewisses Maß an Schriftlichkeit (Armenlisten, Matrikeln) Dauer in der Zeit erlangten. Der Schutz der pauperes gehörte aber auch zu den Pflichten des Herrschers. Bemerkenswert ist die Armengesetzgebung in den Kapitularien Karls des Großen vor und nach 800. Auch in späterer Zeit gibt es erstaunliche Beispiele königlicher Armenfürsorge. König Heinrich IV. (1056-1106) hat nicht nur mit eigener Hand regelmäßig Arme und Kranke gespeist und versorgt, sondern auch die Armenpflege institutionalisiert, indem er auf seinen Königshöfen (cortes) Stipendien für Arme einrichtete, über die ebenfalls Buch geführt wurde. Nach dem Vorbild der Herrscherethik wurde die Pflicht zum Schutz der Armen und 'Schwachen' dann auch Teil der Ethik des Adels, der Ritter und überhaupt aller, die Waffen führten (Oexle 1986, 79).

Bild: Die Hl. Elisabeth spendet Almosen (1507). Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 51
Tatsächlich waren es aber vor allem die Bischöfe und in noch viel größerem Ausmaß die Klöster, die sich der Armen annahmen:
Am bedeutsamsten aber waren im Bereich der Armenfürsorge des frühen Mittelalters gewiss die Leistungen der Klöster. Im Kloster war jeder Ankömmling - so forderte es die Benedikt-Regel - wie Christus selbst zu empfangen, was vor allem für Fremde und Arme galt. Die ungewöhnlichen Leistungen, die von den monastischen Kommunitäten des frühen und hohen Mittelalters für Arme erbracht wurden, lassen sich, wie neuere Forschungen gezeigt haben, sogar quantifizieren, insofern sie ursächlich mit dem Totengedächtnis verknüpft waren, dessen schriftliche Grundlagen vielfach erhalten sind. Die »spröde und tendenzlose Buchführung« der Totenbücher (Nekrologien) mittelalterlicher Klöster erschließt die ökonomischen Dimensionen der monastischen Armenfürsorge, weil für jeden Toten, dessen Name am Todestag von der Klostergemeinschaft kommemoriert wurde, ein Armer versorgt werden musste. Im Hochmittelalter haben diese religiös begründeten Sozialleistungen viele Klöster an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht oder gar in die Verarmung gezwungen. Man begreift dies, wenn man bedenkt, dass etwa in dem berühmten Kloster Cluny vor der Mitte des l2. Jahrhunderts 300 Mönche lebten, während im Laufe eines Jahres für die 10.000 verstorbenen Cluniacenser, deren Memoria begangen wurde, l0.000 Arme mitverpflegt werden mussten. Und auch nach einer Kürzung der täglichen Memorien auf höchsten 50 waren immer noch 18.000 Armenspeisungen im Jahr zu erbringen, »bei weitem mehr, als eine Großstadt damals Einwohner hatte«, ungeachtet der Tatsache, dass die Einkünfte der Abtei zu jener Zeit zurückgingen. So lässt sich an der Verarmung von Klöstern im Hochmittelalter die »Stärke ihres Gemeinschaftsbewusstseins« erkennen, das sich in freiwillig erbrachten sozialen Leistungen äußerte (Oexle 1986, 80).
Daneben blieben die Primärverbände, Familie und Grundherrschaft, wesentliche Träger der Fürsorge für ihre verarmten Mitglieder. Schon seit dem frühen Mittelalter bildeten sich zusätzlich private Hilfsgemeinschaften, die "Gilden" (conjurationes), später der Zünfte im Bereich des Handwerks, die einander Hilfeleistung in Not und Gefahr schworen. Freilich musste man erst in den Genuss der Mitgliedschaft bei einer solchen Vereinigung kommen, um Schutz und Hilfe von ihr erwarten zu können. Gerade die Zünfte protegieren durch hohe Aufnahmegebühren die vermögenden Handwerker, wehren die ärmeren und die lohnabhängigen ab oder gewähren ihnen bei verringerten Tarifen nur verminderte Rechte, die sie gerade von den Für-sorgemaßnahmen ausschließen (Sachße/Tennstedt 1998, 26).
Um die Unterstützung einer Gilde, Zunft oder Bruderschaft zu erhalten, musste man Mitglied sein und sich an genau umrissene Verhaltensnormen halten. Je mehr sich der Bevölkerungsdruck vergrößerte, desto schärfer wurden die Voraussetzungen gefasst. In der Frühen Neuzeit schloss man zum Beispiel die unehelich Geborenen als »unehrlich« vom Erlernen der zünftischen Handwerke aus. Aber auch um Beihilfen kirchlicher oder städtischer Institutionen zu erhalten, war ein gewisses Sozialkapital notwendig: in der Regel das Bürgerrecht oder zumindest lange Arbeit in der Stadt, ein guter Leumund oder ähnliches. Dabei konnte die Fürsprache von Familienangehörigen, Arbeitgebern oder städtischen Bediensteten helfen.
Bewusst wurden Verwandtschafts-, Paten- und Klientelverhältnisse eingegangen, um sie im Notfall nutzen zu können. Der Heuerling sicherte seine Position, indem er den Bauern, der ihm ein Stück Land verpachtete und für den er als Tagelöhner arbeitete, als Paten seiner Kinder wählte. Indem er weitere Bauern oder ihre Familienangehörigen als Paten hinzuzog, wurden weitere Beziehungen geschaffen, die die Möglichkeit weiterer Arbeitsverhältnisse bargen und die künftige Position der Kinder sicherten. Starben die Eltern, so bestand wenigstens die Hoffnung, dass die Paten die Versorgung übernahmen. (Rheinheimer 2000, 98).
Die freiwillige Armut als Nachfolge Christi wird im Mittelalter im Mönchstum, in den Bettelorden und in religiösen Lebensgemeinschaften von Frauen (Beginen) gepflegt, die als Verwirklichung des christlichen Gebots der caritas auch bedeutsame Funktionen in der Armenfürsorge übernehmen. Sowohl von den kirchlichen als von den laizistischen Bewegungen gehen Gründungen von Institutionen der Kranken- und Armenfürsorge aus: Hospize, Hospitäler und Stifungen.
Der bemerkenswerteste und bedeutsamste Indikator der neuen Armut des Hochmittelalters aber ist unbestreitbar die seit dem 11. Jahrhundert in vielfältigen Formen zutage tretende Bewegung der freiwilligen Armut aus religiösen Gründen. Sie manifestierte sich zunächst innerhalb des Mönchtums, z.B. im neuen Orden der Zisterzienser, im Laufe des I2. Jahrhunderts aber mehr und mehr auch als religiöse Laienbewegung vor allem in der Stadt. Die neuen Stadtlandschaften, am Niederrhein und in den Niederlanden, im Rhonegebiet, in Oberitalien, wurden so die Zentren der neuen religiösen Bewegung, die zum Teil auch häretisch war oder in die Häresie abgedrängt wurde. Ihr Höhepunkt liegt in der Zeit vor und nach 1200. Damals entstanden auch neue Formen des Mönchtums, die sog. Bettelorden: der von Dominikus gegründete Predigerorden (Dominikaner) und der Franziskanerorden, der seine Gründung auf Franziskus von Assisi zurückführte. Sie wollten nicht nur die individuelle Armut des einzelnen Mönchs verwirklichen, sondern praktizierten darüber hinaus, zumindest in ihren Anfängen, eine weitgehende Armut der ganzen klösterlichen Gemeinschaft. Ein Teil der Armutsbewegung war, schon seit dem 11. Jahrhundert, die religiöse Frauenbewegung. Sie manifestierte sich zunächst im Zustrom von Frauen zu den neuen monastischen Richtungen des 12. und 13. Jahrhunderts, fand dann aber ihren Ausdruck auch in den seit der Zeit um 1200 sich überall bildenden Hausgemeinschaften und Gruppen der sog. Beginen, die in Armut und von ihrer Hände Arbeit lebten. In allen diesen Erscheinungsformen der religiös motivierten und freiwillig übernommenen Armut ging es darum, die Bedingungen der unfreiwilligen, der aufgezwungenen Armut in allen ihren materiellen, physischen und psychischen Dimensionen anzunehmen, nackt dem nackten Christus nachzufolgen und in der Identifikation mit den Armen diesen zu helfen und die Armut zu überwinden. So führte die Bewegung der freiwillig übernommenen Armut zu Wandlungen auf dem Gebiet der Armenfürsorge, die man unter dem Stichwort einer »Revolution der caritas« treffend zusammengefasst hat. Diese »Revolution« bestand vor allem darin, die »standesgemäße« Armenfürsorge hinter sich zu lassen, weil man in der freiwilligen Annahme der »Unanständigkeit« der Armut jegliche Ständegrenzen überwinden wollte. Was dies für den einzelnen bedeutete, lässt sich im Hinblick auf das Leben des Franziskus von Assisi oder der Elisabeth von Thüringen in größter Anschaulichkeit erkennen (Oexle 1986, 84).
Neben den kirchlichen Einrichtungen und Vereinigungen entstanden im 112. Jh. zunehmend auch solche, die von bürgerlichen Schichten getragen wurden.
Die Bewegung der freiwilligen Armut hat um 1200 auch zu neuen Formen der Institutionenbildung geführt; sie zeigt sich in der Gründung einer großen Zahl neuer Spitäler, Armen- und Leprosenhäuser. Das Spital als Institution der Armenfürsorge ist natürlich nichts Neues; Spitäler gab es schon im früheren Mittelalter, wobei vereinzelt Könige, in größerer Zahl die bischöflichen Kirchen, vor allem aber die Klöster und Stifte als Träger in Erscheinung traten. In der Zeit der Vermehrung der unfreiwilligen Armut wird nun aber das Spital seit dem I2. Jahrhundert mehr und mehr aus der Bindung an Kloster und Stift entlassen. Neben die auch jetzt noch neu gegründeten klösterlichen und stiftischen Spitäler traten mehr und mehr von bruderschaftlichen Vereinigungen getragene. Es bildeten sich neue entweder 'ritterliche' oder 'bürgerliche' Spitalorden, so z.B. die Johanniter (Hospitaliter) und der Deutsche Orden bzw. der Antonierorden und der Heilig-Geist-Orden, die sich seit 1200 verbreiteten. Ein bedeutender Faktor in der Armenfürsorge schließlich waren vor allem seit dem 13 . Jahrhundert die durch Stiftungen des städtischen Bürgertums entstehenden Spitäler; so hat sich das Spitalwesen 'kommunalisiert' und 'verbürgerlicht' (Oexle 1996, 85).
Über das gesamte Mittelalter bestimmt eine dominante und gesellschaftlich akzeptierte Form der "Eigen-vorsorge" das Schicksal der Armen: das Betteln. "Das Betteln ist eine durchaus legitime Form individueller Reproduktion und unterliegt in der mittelalterlichen Gesellschaft keiner Ächtung" (Sachße/Tennstedt 1998, 29). Die Bettler waren einerseits gesellschaftlich akzeptierte Arme, denen Almosen zu geben zum erwarteten und normalen Verhalten derer zählte, die es vermochten. Almosen wurden »in ungeheuerer Menge verteilt" (Geremek 1988, 54). In normalen Zeiten, wenn nicht Hungersnöte oder Naturkatastrophen besondere Not verursachten, war diese Hilfe ausreichend und es war leicht, sie zu erlangen. Es war in gewisser Weise »verlockend, das Betteln zu seiner Lebensweise zu machen" (Geremek 1988, 54).
Die Almosenverteilung fand nämlich an bestimmten Tagen statt, so dass sich für die Bettler eine Art von Reisekalender ergab. Das bezog sich vor allem auf die Klöster, bei denen man von vornherein wusste, wann eine Verteilung stattfinden würde, und die daher Arme von weither anzogen; für die Bettler ergaben sich auf diese Weise bestimmte Marschrouten von Kloster zu Kloster, und überall konnten sie auf die tägliche Unterstützung rechnen, wobei die Verteilungen aus Anlass eines Festes besondere Anziehungskraft besaßen. Auch Verteilungen aus testamentarischen Hinterlassenschaften zogen Arme aus einem weiten Umkreis an, in dem sich die Nachricht verbreitet hatte; Testamente vom Anfang des 14. Jahrhunderts aus dem südfranzösischen Forez lassen erkennen, dass die Verteilung gewöhnlich nach der Ernte stattfand, was für die Erben sehr bequem war, und dass sie in einem Umkreis von zehn bis fünfzehn Kilometern um den Wohnort des Verstorbenen bekannt gemacht wurden. Eine ähnliche Praxis verfolgen auch die karitativen Einrichtungen in den Städten, besonders dann, wenn die Verteilung der Almosen für eine Bruderschaft eine Prestigeangelegenheit ist und sie anlässlich ihres jährlichen Festmahls auf spektakuläre Weise ihre Frömmigkeit zu beweisen sucht (ebd., 53).
Die Armen sind in vielfältiger Weise in das Alltagsleben der mittelalterlichen Dörfer und Städte eingebunden. Sie sind nicht nur verlässliche Gäste bei allen großen Festen, es haben auch sowohl die Klöster als auch die weltlichen Wohltäter ihrer "Hausarmen", jene, die sie ständig versorgen und die in den Klöstern in liturgische Geschehnisse eingebunden sind, wie etwa die Fußwaschung am Gründonnerstag.
Das Abbüßen der Sünde der Macht und des Reichtums nimmt also eine rituelle und streng institutionalisierte Form an und gewährt einer bestimmten Zahl von Personen, für welche die Armut gewissermaßen zum Beruf wird, eine Pfründe, die ihnen eine sichere Existenz garantiert. Auch die Hilfe, die einer bestimmten Zahl von Armen von den Spitälern und den kirchlichen Institutionen regelmäßig gewährt wurde, nahm den Charakter der "besoldeten Armut" an. Die mittelalterlichen Spitäler und Herbergen nahmen außer umherziehenden Armen - hauptsächlich Pilgern - auch Arme auf, die ständig in ihnen wohnten (Geremek 1988, 56 f.).
Neben fallweisen Bettlern gibt es Nebenerwerbsbettler, "das sind zumeist unselbständige Lohnabhängige, die ihr Einkommen nach Feierabend durch Bettelei aufbessern. Und es gibt eine große Zahl von Berufsbett-lern, also durchaus gesunden und arbeitsfähigen aber arbeitsunwilligen Individuen, die es vorziehen, ihren Unterhalt durch Betteln zu erwerben". Für sie wird Betteln zu einer professionellen Tätigkeit, zu der eine angemessene "Berufskleidung" und entsprechende "Techniken" der Berufsausübung gehören. "Auch das mittelalterliche Berufsbettlertum wird daher nicht mit einem gesellschaftlichen Unwerturteil belegt, wie wir es heute mit der Kennzeichnung »arbeitsfähig, aber arbeitsunwillig« verbinden mögen. Die Bettler sind viel-mehr eine anerkannte Berufsgruppe wie andere auch. In manchen Städten sind sie zu regelrechten Zünften zusammengeschlossen, und es ist zwar nicht häufig, aber keineswegs ungewöhnlich, dass Bettler über ein zu versteuerndes Vermögen verfügen" (Sachße/Tennstedt 1998, 29 f.).
In den Predigten des Pisaner Dominikaners Giordano da Rivolto (1260-I311) wird das Almosen ausdrücklich als Tausch- und Vertragsverhältnis bezeichnet: Im Austausch für diesseitige Güter bietet der Bettler seinem Wohltäter das Gebet an, und er ist verpflichtet, den Vertrag einzuhalten. [...] Das schlägt sich auch in der Haltung der Bettler selbst nieder, die sich ihrer Nützlichkeit bewusst sind. Das Vertragsverhältnis verschafft den Bettlern eine Stellung innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und bestimmt zugleich die äußeren Formen ihrer Existenz. Als Beruf aufgefasst, bringt das Betteln bestimmte professionelle Techniken, Gebräuche und kooperative Organisationsstrukturen hervor (Geremek 1988, 63).
Zum professionellen Betteln gehört ein bestimmtes "Outfit":
Das Aussehen des Bettlers ist nicht nur ein Zeichen seines sozialen Status, sondern auch Bestandteil seiner Berufstechnik. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Kleidung. Die Ikonographie stellt die Bettler in Lumpen gekleidet und häufig barfuß dar; in dem häufig vorkommenden Motiv des hl. Martin, der seinen Mantel mit den Armen teilt, wird der Bettler gelegentlich nackt dargestellt, so auf einem Kapitell der Abtei Fleury-Saint-Benoltsur-Loire (Anfang des 11. Jh.). Das Werk der Barmherzigkeit, »den Nackten zu kleiden«, wird in der Form dargestellt, dass der Arme einen Mantel erhält oder seine Lumpen durch ordentliche Kleider ersetzt werden. In der satirischen Literatur kommt immer wieder das Motiv des Bettlers vor, der die erhaltenen Kleider verkauft und die Lumpen anbehält, weil er so die Vorübergehenden leichter auf sich aufmerksam macht und ihr Mitleid weckt (ebd.).

Bild: Allerlei Arten des Bettelns (Kupferstich nach Hieronymus Bosch). Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 67
Wie zahlreiche Geschichten, die sich um das Bettelwesen ranken, belegen, gilt die Zurschaustellung körperlicher Gebrechen als probate Methode, Mitleid zu erwecken:
Für das Aussehen des Bettlers hat der Körper fundamentale Bedeutung. Zu den Techniken des professionellen Bettelns gehört allem, dass man seine Gebrechen, Krankheiten und körperlichen Mängel geschickt zur Schau stellt [...] Die Berechtigung zum Betteln beruhte vor allem auf körperlicher Gebrechlichkeit, und sie in geeigneter Form zu betonen war ein Mittel, das Betteln zu legitimieren und Mitleid zu erwecken [...] Die Aufdringlichkeit des Verlangens nach Almosen entspricht der Aufdringlichkeit des physischen Aussehens (ebd.).
Dass das eigene Gebrechen als berufliche Technik eingesetzt wird, belegt das in der mittelalterlichen Literatur häufig wiederkehrende Thema des Lahmen, der gegen seinen Willen auf wundersame Weise geheilt wird. Zwei Lahme wurden, als sie von der bevorstehenden wunderbaren Heilung erfuhren, von großem Schrecken gepackt, und einer sprach zu dem anderen: »Bisher lebten wir in ruhiger Muße. Niemand stört uns, alle haben Erbarmen mit uns. Wir brauchen nur das zu tun, was uns gefällt. Kurz, wir verbringen unsere Tage im Wohlstand. Würden wir durch ein Wunder wieder gesund, dann müssten wir uns mit körperlicher Arbeit befassen, an die wir nicht gewöhnt sind. Wir könnten nicht mehr von Almosen leben«. [...] Die Bettler können schlafen, wann sie wollen, sie haben immer zu essen und zu trinken, und erst wenn sie geheilt wurden, begannen für sie die Unannehmlichkeiten. Die beiden beschließen deshalb, so rasch wie möglich zu fliehen, und in der Eile nehmen sie die Krücken, auf die sie sich beim Betteln zu stützen pflegen, auf die Schulter: Auf diese Weise vollzieht sich das Wunder doch noch.
[...] Die Ausübung des Bettlerberufes erfordert, dass der Grund der Bitte um Almosen sichtbar gemacht wird. [...] Die Familie musste sich auf den Straßen zeigen, damit man sah, wie zahlreich und elend sie war. Kinder, besonders die Kleinsten, waren ein hervorragendes Mittel, um Mitleid und Erbarmen zu erwecken. Sie wurden deshalb häufig speziell von Frauen zum Betteln in der Öffentlichkeit benutzt; anderer Zeichen von Gebrechlichkeit oder Schwäche bedurfte es dann nicht. (Geremek 1988, 63 f.)
Betteln kann Organisationsformen annehmen, die es einem normalen Gewerbe nicht unähnlich erscheinen lassen:
In der berufsmäßig betriebenen Bettelei finden wir eine Nachahmung verschiedener Organisationsformen des städtischen Gewerbelebens. Ein charakteristisches Beispiel ist der am Ende des 14. Jahrhunderts in der Bretagne zwischen zwei Bettlern geschlossene Jahresvertrag, in dem der eine als »Unternehmer« auftritt und dem anderen gegen sämtliche Einnahmen aus der Bettelei einen regelmäßigen Lohn verspricht. Von einer anderen - allerdings literarisch überlieferten - Vertragsform berichtet Sacchetti in der Novelle von den drei florentinischen Blinden, die beschlossen, eine »Kompanie« zu gründen, also eine Bettlergesellschaft, in der sämtliche erbettelten Almosen allwöchentlich gleichmäßig aufgeteilt werden sollten (Geremek 1988, 64).
In mancher Hinsicht ist das Leben von Bettler/innen jenem von Gauklern und Künstlern nicht unähnlich. Das Verhalten der Bettler/innen unterliegt aber stets der öffentlichen - und das heißt vor allem, der kirchlichen - Kontrolle:
Zwischen dem ambulanten Künstler und dem Bettler gab es übrigens, was die Lebensweise und den Erwerb des Lebensunterhalts betrifft, bemerkenswerte Übereinstimmungen. Die Bettler benutzten verschiedene Musikinstrumente (einige wurden sogar als »Bettelinstrumente« bezeichnet), sangen und erzählten Geschichten. Es gab eine breite Palette von Rufen, mit denen die Bettler auf sich aufmerksam machten. Bezeichnend ist das Verbot, das der Bischof von Straßburg im Jahre 1317 gegen die Beginen aussprach: Sie durften nicht mit dem Ausruf »Brot, im Namen Gottes!« betteln, sondern mussten die gleichen Klagerufe benutzen wie die übrigen Bettler (Geremek 1988, 63 ff.).

Bild: Bettelnarr und Familie (Albrecht Dürer, 1494): Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 60.
Inhaltsverzeichnis
Für die Entstehung von Armut als massenhaftes gesellschaftliches Problem sind im wesentlichen drei Voraussetzungen maßgeblich: Das große Bevölkerungswachstum seit dem 11. Jh. die großen Epidemien seit dem 14. Jh. und ein mehr oder weniger permanent anhaltender Kriegszustand, insbesondere der große 30ig jährige Krieg.
Zwischen dem 10. und 14. Jh. verdoppelte sich die Bevölkerung des heutigen Europa, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands z.B. von ca. 6 auf ca. 13 Millionen. Diesem rasanten Anstieg der Zahl der Menschen konnte die ökonomische und soziale Entwicklung nur teilweise gerecht werden. Einerseits durch die Vergrößerung des bewohnbaren und fruchtbaren Territoriums, d.h. durch Rodung und Trockenlegung landwirtschaftlich nutzbaren Bodens bzw. kriegerische Expansion. Andererseits durch eine Binnenwanderung verarmter Landbevölkerung in die Städte, deren Zahl und Wachstum enorm anstieg: von einigen Hundert auf einige Tausend zwischen 1200 und 1350. Durch den beginnenden Fernhandel, die Landflucht, die Kreuzzüge und die Pilgerfahrten zu fernen Zielen wie Santiago, Rom oder Jerusalem entstand "eine Mobilität von bislang unbekanntem Ausmaß" (Sachße/Tennstedt 1983, 40).
Das Bevölkerungswachstum und seine sozialen Folgen bewirkten eine bisher ungekannte Vermehrung der Armen in Stadt und Land bestand. Durch diese Entwicklung wurde die feudale Ordnung, die auf Ortsfestigkeit und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Herrschaft und einem bestimmten Stand - jedermann war entweder Adeliger, Kleriker, Bauer oder als abhängiger Tagelöhner, Landstreicher oder Bettler eben ein gesellschaftlicher Outcast - gegründet war, durcheinander gebracht. Die Folge davon war eine allenthalben merkbare Vermehrung der Armut und der Armen.
Wer seinen Geburtsort, seine Heimat verließ, verließ damit auch die Verbände, die ihm Schutz und Hilfe in Notlagen gewährten: die Familie und die Grundherrschaft. Er war auf sich selbst gestellt und in Notfällen aufs Betteln und die Spendenbereitschaft seiner Mitmenschen verwiesen. Der Fremde und der Arme werden daher weitgehend identifiziert; und aus dem Problem der Heimatlosigkeit gewinnt die Entwicklung der Armenfürsorge auf Jahrhunderte hin ihre Dynamik. Mit der neuen Mobilität des Hochmittelalters nahm die Zahl derer zu, die außerhalb der angestammten Schutzverbände lebten und in Notfällen nicht auf diese zurückgreifen konnten. Es entstand also eine neue Form der Bedürftigkeit (Oexle 1986, 82 f.).
Von der Zuwanderung sind insbesondere die Städte betroffen:
Der ökonomische Aufschwung der Städte war von Anfang an mit einer tiefen sozialen Gliederung der Bevölkerung in pauperes und potentes verbunden. Und in den Städten wurden auch zuerst die Umrisse der »neuen Armut« deutlich: Die städtische Armutsbevölkerung rekrutierte sich vor allem aus den ökonomisch Unselbständigen, den Lohnarbeitern, Handwerksgesellen, Tagelöhnern, Mägden, deren soziale Situation vor allem deshalb gefährdet war, weil ihre Einkommensquelle unsicher war. Die Angehörigen der handwerklich unqualifizierten oder gering qualifizierten Berufe waren besonders betroffen: die Tagelöhner im städtischen Wein-, Garten- und Ackerbau, die Tagelöhner im Baugewerbe und die unqualifizierten Kräfte aus der Textilproduktion. Bei günstiger Konjunkturlage mochten hinreichend Arbeitsplätze für sie vorhanden sein. Bei Absatzschwierigkeiten wurden sie als erste arbeitslos. Die genossenschaftlichen Hilfseinrichtungen der Zünfte waren ihnen verschlossen, sodass sie ohne einen primär zuständigen Schutzverband auf sonstige Unterstützung angewiesen waren. Hier begann sich die Identifikation von Armut und Arbeit zu lockern. Zu den pauperes zählten die Genannten weil sie zu den Arbeitenden zählten und daher zu denen, deren Ansehen und gesellschaftlicher Einfluss gering war. Arm im Sinn von »mittellos« wurden sie aber vor allem dann, wenn sie ihre Arbeit verloren also zu Nicht-Arbeitern wurden. Auch diesem »neuen« Armutsbegriff hafteten die Normen der feudalen Ständeordnung noch an. Arm ist nicht nur, wem das Lebensnotwendige fehlt (primäre Armut), sondern auch der, dem das Standesnotwendige mangelt (sekundäre Armut). Arm in diesem weiteren Sinne - so schätzt man - waren mehr als die Hälfte, arm im engeren Sinne ca. 10-20% der Stadtbevölkerung (Sachße/Tennstedt 1983, 40 f.).
Der "Schwarze Tod", vermutlich durch Wanderratten vom zentralasiatischen Hochland importiert, erreicht das mittelalterliche Europa in den Jahren 1347/48 und verursacht bis in das Jahr 1352 an die 25 Millionen Todesfälle. In unterschiedlich heftigen Wellen wütete die Pest bis in das 17./18. Jahrhundert. Sie bewirkte nicht nur eine Halbierung der Bevölkerung sondern war auch ein entscheidender Auslöser für massenhafte Verelendung und Armut. Zwar bildete sich im Rücken der Epidemie eine emporkommende Schicht, die sich den Überschuss an Agraprodukten, die eigentumslosen Territorien und Güter sowie den erhöhten Bedarf an Konsum- und Luxusgütern nach Pestepidemien zunutze machte und eine Wurzel des späteren Bürgertums ausmacht, "an den erschreckenden Ausmaßen des durch Krankheit und Entwurzelung ausgelösten Elends kann aber kein Zweifel sein" (Oexle 1986, 87).
Die augenfälligste Folge des »Schwarzen Todes« war ein Massensterben, das nicht nur das seit dem 11. Jahrhundert andauernde Bevölkerungswachstum bedeutete, sondern einen drastischen Bevölkerungsrückgang bewirkte, der im einzelnen regional recht unterschiedlich war, durchgängig aber die Städte härter traf als die Landbevölkerung. Dennoch hatte das Sterben auch auf dem Lande ein solches Ausmaß, dass ganze Dörfer verlassen wurden und Landstriche verödeten. Von 12 bis 13 Millionen etwa schrumpfte die Bevölkerung in Deutschland auf etwa 8 bis 9 Millionen. Die Wüstungen des Spätmittelalters erklären sich aus einer infolge des Bevölkerungsrückganges einsetzenden Agrarkrise: Es kam zu einem - angesichts der geschrumpften Bevölkerung relativen Überangebot an Agrarprodukten. Die Folge war ein nachhaltiger Verfall der Agrarpreise, wodurch sich die Lebensverhältnisse der Bauern und Lohnarbeiter, aber auch der Grundherren bedeutend verschlechterten. Auf der anderen Seite bewirkte der Bevölkerungsrückgang eine Verknappung von Arbeitskräften, wodurch sich der Freiheitsspielraum der Landbevölkerung gegenüber dem Grundherrn erhöhte. Schon hieraus ergab sich eine gewisse Lockerung der Verbindlichkeiten des feudalen Personalverbandes. Vor allem aber resultierte die in jener Zeit einsetzende Fluktuation der Bevölkerung aus einer Abwanderung in die Städte, die eine eigentümliche Faszination auf die Zeitgenossen ausgestrahlt haben (Sachße/Tennstedt 1983, 34).
Wesentlich dramatischer als auf dem Lande waren die Folgen der Pest in den Städten:
Hier waren die Folgen des großen Sterbens ganz anders als auf dem Lande. Schon der Einbruch der Seuche selbst, die panische Angst, die sie in den engen Mauern der Stadt unter den Bewohnern hervorrief, bewirkte moralisch-kulturelle Desorganisations- und Entgrenzungserscheinungen in der Bevölkerung. So schreibt Giovanni Boccacio, für dessen Novellenzyklus »Das Dekameron« die Pest in Florenz (1348) den Rahmen bildet: »Da waren manche, die dachten, dass ein mäßiges Leben [...] die Widerstandskraft fördere [...] Von der gegenteiligen Meinung geleitet, behaupteten andere, die sicherste Arznei bei einem solchen Übel sei, reichlich zu trinken, sich gute Tage zu machen, mit Gesang und Scherz umherzuziehen, jeglicher Begierde, wo es nur möglich sei, Genüge zu tun und über das, was kommen werde, zu lachen und zu spotten; und so wie sie es sagten, setzten sie es auch nach ihren Kräften ins Werk: bei Tag und Nacht zogen sie, um ohne Maß und Ziel zu trinken, bald in diese, bald in jene Schänke, viel lieber aber noch in fremde Häuser, wenn sie nur dort etwas gemerkt hatten, was ihnen Freude und Lust war. Und das konnten sie reichlich tun, weil jedermann all sein Eigentum gerade so wie sich selber aufgegeben hatte, als ob sein Leben verwirkt gewesen wäre«. Und an anderer Stelle: »In der all so verheerenden Not unserer Stadt war das ehrwürdige Ansehen der Gesetze, der göttlichen wie der menschlichen, schier völlig gesunken und vernichtet, weil ihre Verweser und Vollstrecker sowie die anderen entweder tot oder krank waren oder weil es ihnen an Gehilfen gebrach, dass sie keine Amtshandlung vornehmen konnten: aus diesem Grunde war jeglichem erlaubt zu tun, was er wollte«. Vor allem aber führten die enormen Bevölkerungsverluste dazu, dass der Reichtum der Überlebenden sich zum Teil drastisch vermehrte. Das Aussterben ganzer Familien führte zu einer Konzentration der vorhandenen Vermögen in den Händen weniger, zum Beispiel wurden große Vermögen völlig herrenlos und zum Gegenstand mehr oder minder skrupelloser und erfinderischer Okkupation. »Wie viele stolze Paläste, wie viele prächtige Häuser, wie viele adelige Wohnsitze, einst voll von Gesinde und Herren und Damen, standen nun leer bis auf den letzten Knecht! Wie viele altangesehene Geschlechter, wie viele Erbschaften, wie viele berühmte Reichtümer blieben ohne einen rechtmäßigen Nachfolger«, schreibt Boccacio hierzu. Natürlich müssen wir die Verhältnisse in den deutschen Städten weniger prachtvoll, beengter vorstellen als in der mittelitalienische Metropole. Grundsätzlich waren die Probleme aber dieselben (Sachße/Tennstedt 1983, 35).
Auch nach dem Ende von Pestepisoden waren die sozialen Auswirkungen noch erheblich:
Neben dem neu entstandenen Reichtum war es auch das Gefühl der Befreiung von den Ängsten und Qualen der Seuche, das die Bevölkerung nach deren Abklingen in einen Zustand hektisch-taumelnder Lebenslust versetzt zu haben scheint. »Gleich nach dem Erlöschen der Pest« - heben die Limburger und die Berner Chronik gleichmäßig hervor - »begann das Volk zu jubeln, zu fressen, zu saufen und sich üppig zu kleiden«. [...]
Ökonomisch führte dies zu einer gesteigerten Nachfrage nach Konsumgütern, die angesichts der auch in den Städten vorhandenen außerordentlichen Knappheit an Arbeitskräften einen starken Preisanstieg gewerblicher Produkte nach sich zog. Dies wiederum verbesserte die Reprotionschancen für die Stadtbevölkerung und verstärkte die aufgrund der Agrarkrise ohnehin vorhandene Zuwanderungstendenz. Die »goldene Zeit« des Bürgertums begann, eine Zeit ökonomischer kultureller Blüte der Städte; die Zeit des »Frühkapitalismus«, prunkvoller Sakral- und Profanbauten, verfeinerter Lebensformen, künstlerischer Entfaltung, gesteigerter Luxusbedürfnisse.
[...] Die Kehrseite ökonomischen Aufschwungs und kultureller Blüte der Städte seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bildete die rasche Ausweitung der städtischen Armutsbevölkerung. Die Zuwanderung vom Lande vergrößerte ja vor allem die Unterschicht. So entstand mit der Heranbildung der ersten 'Großstädte' zugleich ein städtisches Proletariat, das die Städte mit Armutsproblemen neuer Qualität und neuen Ausmaßes konfrontierte. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts begannen daher in den Städten neuartige Formen des gesellschaftlichen Umgangs mit Armut herauszubilden, die die Entwicklung der modernen Armutsfürsorge nachhaltig beeinflussen sollten. (Sachße/Tennstedt 1983, 35 f.)
In besonderer Weise hatten die Juden unter der Pest zu leiden. Der Vorwurf des »Brunnenvergiftens« durch das Hineinwerfen von Tierkadavern führte seit der Mitte des 14. Jh. zu Serien von Pogromen und Vertreibungen (Münch 1992,108; Girard 1992). Auf andere Weise wurden Frauen zu Objekten kollektiver Phobien. "Die Angst der Menschen, hervorgerufen durch Epidemien, Kriege und wirtschaftliche Veränderungen ist eine der Ursachen der Hexenprozesse (Rheinheimer 2000, 93).

Bild: Pestarzt mit Schutzbekleidung (1656). Aus: Ulbricht, Otto: Die leidige Seuche. Köln u.a.: Böhlau, 2004, Umschlagabbildung
Bis zu 70% der Bevölkerung waren in einzelnen Gegenden im Verlaufe des von 1618 bis 1648 datierten 30jährigen Krieges ausgerottet worden. So sehr die oft jahrelang verlassenen oder verwüsteten Böden wieder der Bewirtschaftung bedurften, so wenig Arbeitskräfte waren am Land noch vorhanden und, auf der anderen Seite, so wenig Abnehmer für die Agrarprodukte. Zu der durch die Folgen des langen Krieges verschärften traditionellen Armut kommt mit der Vergrößerung des Anteils von Manufakturarbeitern in den Städten, "eine neue Qualität von Armut", die Sachße/Tennstedt als "Frühproletariat" bezeichnen: "Die signifikante Ausweitung der städtischen Bevölkerungsgruppe, die neben ihrer Arbeitskraft über keinerlei weitere Subsistenzmöglichkeiten verfügt und daher bei vorübergehender oder dauernder Unmöglichkeit der Verwertung derselben notwendig auf die Armenfürsorge verwiesen ist" (Sachße/Tennstedt 1998, 99) Ebenso nimmt die Zahl der verarmten Handwerker zu, die mit den neuen Produktionsmethoden nicht mehr konkurrieren können.
Die Entstehung und Entwicklung zentralisierter Manufakturen ist in der Tat aufs engste verknüpft mit der merkantilistischen Gewerbepolltik absoluter Staaten im 17- und 18. Jahrhundert. Kein Staat, der nicht solche Betriebe eingerichtet, angeregt oder gefördert, kein Landesherr, der nicht seine spezielle Vorliebe für diesen oder jenen Produktionszweig gehabt hätte. Zentralisierte Manufakturen entstanden und entwickelten sich vornehmlich in Bereichen, in denen eine standardisierte Massenproduktion für einen größeren Markt (Textil-, Waffenmanufakturen) oder aber eine Produktion für den gehobenen Bedarf einer zahlungskräftigen Kundschaft (Seiden-, Spitzen- und Porzellanmanufakturen) stattfinden konnte. Mit Abstand die größte Bedeutung hatte in ganz Deutschland die Textilmanufaktur: die Woll-, Baumwoll-, Leinen- und Seidenverarbeitung. Nun darf man die quantitative Bedeutung zentralisierter Manufakturen, ihren Anteil an der gesamten gewerblichen Produktion im 17. und auch im 18. Jahrhundert nicht überschätzen. Die Manufakturen "sind kennzeichnend für das 17. / 18. Jahrhundert nicht durch die Höhe ihres Anteils an der gesamten gewerblichen Produktion, als vielmehr durch ihre Neuartigkeit und die Fülle der sie betreffenden kameralistischen Überlegungen und Maßnahmen und als Versuch, neue Wege zu gehen" (Lütge 1966, 366).
Das Interesse der Fabriksherrn war freilich nicht in erster Linie das Wohlergehen der Arbeitenden, sondern der zu erzielende Gewinn. "Diejenigen, welche dem Armenwesen vorstehen und aufmerksam auf die Personen sind, welche ihre Hilfe begehren", heißt es noch in einer Schrift aus dem Jahr 1785, "kommen über ein, daß der sehr geringe Lohn vieler Arbeitender der ersten Hand bey den Manufakturen die allgemeinste Ursache unverschuldeter Armut sey; ein Ursache, welche auch bey blühendem handel forrtwirkt, und durch keine Weise Anstalten der Regeierung ganz aufgehoben werden kann" (zit.n. Sachße-Tennstedt 1983, 96).
Die Lebensverhältnisse des manufakturellen Frühproletariats waren kümmerlich. Während die wenigen hochqualifizierten Fachkräfte ein gedeihliches Auskommen hatten, waren die Einkommen der zunehmenden Zahl un- und angelernter Arbeiter bescheiden. Die Lohnentwicklung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war - bei steigenden Preisen - fallend und trieb immer mehr Arbeiterfamilien an den Rand des Existenzminimums - und darunter. [...] Armut blieb die Signatur des absolutistischen Zeitalters in Deutschland (ebd., 105 f.)
Wenn man von Absolutismus spricht, darf man allerdings die Verhältnisse in England oder Frankreich nicht mit jenen im "Heiligen Römischen Reich" deutscher Nation verwechseln. Während dort absolutistische Herrscher wie Heinrich IV oder Ludwig XIV ihre Macht in der Tat absolut ausübten, war das Reich nach dem 30ig jährigen Krieg in mehr als 300 mehr oder weniger souveräne Territorien zerfallen, in denen Fürsten, Grafen, Herzöge, Äbte, Stadtherrn oder Könige wie in Preußen diese Macht innehatten, während der Kaiser zu einer Randfigur wurde. "Die absolutistische Staats- du Gesellschaftsordnung bedeutete somit nicht die Auflösung der feudalen Gesellschaft, sondern ihre Reorganisation unter neuen Bedingungen." Die Unterschiede zwischen Reichen und Armen wurden dadurch nicht eingeebnet, sondern es wurde sowohl die ständische Hierarchisierung wie auch die Ausgrenzung gesellschaftlicher Randgruppen verfestigt" (ebd., 92).
Es vermehrte sich sowohl die Zahl der sesshaften Armen als auch jene des sogenannten Fahrenden Volkes: »Adel, Studenten, Schüler, Singmädchen, entlassene Lehrer und Scribenten, verabschiedete Soldaten, um der Religion willen Verjagte, Gebrechliche aller Art, Collecteurs für Kulturstätten und für Abgebrandte wogen hier als Bettler von Ort zu Ort wie Trümmer einer gewaltigen Sturmzeit vorüber«, steht in einem Bettelregister aus Thüringen nach dem Krieg zu lesen (zit.n. ebd., 101). In besonderer Weise waren Frauen in Not betroffen, auf die sich die Vorurteile ihres Geschlechts und ihrer Armut bezogen.
In der zweiten Hälfte des 18. Jh. treten vermehrt Räuber- und Diebesbanden auf, die mit großer Brutalität in Dörfer oder Häuser reicher Bürger einfallen und sie ausrauben. Wildernde Bauernbanden setzen sich, oft mit Unterstützung der Bevölkerung, gegen das herrische Gehabe der adeligen Großgrundbesitzer zur Wehr.
Bei diesen Räuber- und Diebesbanden lassen sich von ihrer sozialen Zusammensetzung, ihrer Vorgehensweise und ihrer Organisationsform her grundsätzlich zwei unterschiedliche Typen unterscheiden. Den ersten Typus kann man als «Vagantenbande» bezeichnen. Er rekrutierte sich ganz wesentlich aus der umfangreichen Vagantenpopulation, die für ganz Europa im beschriebenen Zeitraum charakteristisch war. Er bildete gleichsam den «harten Kern» der umherziehenden Bettler, Landstreicher und Gelegenheitsdiebe, denen die absolutistische Gesellschaft keine legale Reproduktionsmöglichkeit bot, der als Antwort auf die gesellschaftliche Ausgrenzung bewusst die organisierte Kriminalität setzte. Neben den «harten Professionellen» gab es die Vielzahl der Helfer und Helfershelfer, Hehler, Wirte, die Unterschlupf gewährten, Kooperanten im Einzelfall usw. Die Vagantenpopulation war also nicht nur Rekrutierungsfeld, sondern auch Operations- und Rückzugsbasis für die Banden. Sie hatten ein erstaunlich ausgedehntes Operationsfeld, was sich aus ihrer eigentümlichen Organisationsform erklärt. Die Anführer nebst einem Stab erfahrener Experten reisten eigens für das jeweilige Unternehmen zum Teil von weither an. Sie warben an Ort und Stelle einheimisches Personal, das nach der Durchführung des Unternehmens sofort ausgezahlt und wieder entlassen wurde, während die Kerngruppe alsbald andernorts erneut zuschlug. Ein markantes Beispiel dieses Typs von Bande ist die «Große Niederländische Bande», die im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert in weiten Teilen Deutschlands - in Norddeutschland bis nach Lübeck hinüber, im gesamten Rheingebiet bis in die Höhe von Mainz und im süddeutsch- schwäbischen Raum - ihr (Un-)Wesen trieb. Sehr viel weniger mobil und kühn, aber schon zu Lebzeiten außerordentlich populär war die Bande des Schinderhannes (bürgerlich: Johannes Bückler). Er operierte vor allem in seiner Heimat, dem Hunsrück. 1802 wurde er ergriffen und 1803 nach einem aufsehenerregenden Prozess geköpft.
Ganz anderer Art und sehr viel seltener waren dagegen die Banden der «Bauernbanditen». Sie entstammten der lokalen, sesshaften bäuerlichen Bevölkerung. Diese bildete zugleich ihre Operationsbasis und ihr Unterstützungspotential. Die Aktionen dieses Typs von Bande waren weniger auf materiellen Gewinn abzielende Raubzüge als vielmehr Widerstandsaktionen gegen die lokale Obrigkeit bzw. Rache für erlittenes Unrecht. Von besonderer Bedeutung war in diesem Zusammenhang häufig die Wilderei. Da die Jagd das herrschaftliche Vergnügen par excellence und das Wild insofern exemplarisches Objekt des Herrschaftsanspruchs der feudalen Herrenschicht war, enthielt die Wilderei stets ein Element symbolischer Auflehnung, das den Wilderer schnell zum Freiheitskämpfer aufwertete. Dieser Typus von Bande thematisierte also unmittelbar die Ungerechtigkeiten der feudalen Herrschaftsordnung. Die einzig bedeutende Bande dieser Art im 18. Jahrhundert in Deutschland war die des «Bayerischen Hiesel» (bürgerlich: Matthias Klostermayer), die in den 60er Jahren im schwäbisch-bayerischen Raum operierte. Die Organisation der Banden der Bauernbanditen war in der Regel stabiler und mehr auf Dauer gestellt als die der Vaganten. Ihren Rückhalt fanden sie in der örtlichen Bevölkerung. Sie konnten daher nicht ohne weiteres das Terrain wechseln, da ihnen andernorts die Unterstützung fehlte (ebd., 98 f.).
Aufgrund der schlechten Verkehrsverhältnisse und der territorialen Bewegungseinschränkungen waren die Verwaltungen der einzelnen Herrschaften gegenüber den Banden weitgehend machtlos. Durch Diebeslisten mit möglichst genauer Beschreibung von Bandenführern oder -mitgliedern versuchte man, ohne viel Erfolg, dem Treiben Einhalt zu gebieten, was erst am Beginn des 19. Jahrhunderts einigermaßen gelang. Für das 15. und 16. Jahrhundert schätzen Sachße/Tennstedt (1998, 27 f.) in den Städten den Anteil der Armen auf 80% der BewohnerInnen ein, ein Drittel davon sind primäre Arme, Menschen also, die auf keine Weise imstande sind, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zustande zu bringen. Massenelend in diesem Aus-maß überforderte die bestehenden staatlichen und kirchlichen Einrichtungen ebenso wie die individuelle Mildtätigkeit und die genossenschaftliche Solidarität. Die althergebrachten Hospitäler, in denen sich unter-schiedslos Alte, Kranke, Arme jeden Alters, Waisen und andere Übriggebliebene sammelten, konnten der neuen Quantität und Qualität der Not nicht mehr gerecht werden.
Die öffentliche Politik hat lange Zeit auf diese Entwicklungen nicht reagiert. Nach wie vor blieb die Fürsorge für die Armen Aufgabe der Kirche und der vielfach überforderten Klöster sowie der privaten Gilden, der Zünfte und der barmherzigen Christen. Langfristig aber erforderte und bewirkte das wachsende Ausmaß der Armut neue Formen des städtischen und staatlichen Eingriffs.
Ein Teil der Maßnahmen der zentralen Mächte hing unmittelbar mit den Pestepidemien zusammen. In einer Situation der Knappheit von verfügbaren Lohnarbeitern war die Unterstützung arbeitsfähiger Armer gesellschaftlich nicht mehr erwünscht. Wer imstande war, zu arbeiten, durfte nicht durch individuelle oder gesellschaftliche Mildtätigkeit dem Markt entzogen werden.
Eben diese Absicht ist der Ausgangspunkt einer tiefgehenden Veränderung in der Auffassung von der Armut und in den Verhaltensweisen gegenüber den Armen, die eine epochale Zäsur darstellen, weil sie das Verhältnis von »Armut« und »Arbeit« neu definieren. Dies sei an einigen frühen Beispielen verdeutlicht.
Von den genannten Regelungen der Wirtschaftsgesetzgebung um 1350 seien aus den deutschen Territorien die Tiroler Wirtschaftsordnungen vom Dezember 1349 und vom Januar 1352 erwähnt, die »dez todes wegen, der in dem Lande ist gewesen, und besunderlich umb antwaerkleut und arbaiter, die ungewonlichen und unzeitlichen lon vordernt und haben wellent«, nicht nur das Lohnniveau von 1344 vorschrieb, sondern auch die Freizügigkeit von Handwerkern und Bauern aufhob und einen allgemeinen Arbeitszwang erließ. Explizit wurde dann der Zusammenhang von »Armut« und »Arbeit« in den gleichzeitig erangenen Gesetzen in England und Frankreich. Schon im Juni 1349 hat in England und König Eduard II. von England die allgemeine Arbeitspflicht für alle Männer und Frauen unter 60 Jahren, gleich welchen Standes, angeordnet, unter der Voraussetzung, dass sie gesund und arbeitsfähig sind, jedoch nicht Handel treiben, kein Handwerk ausüben und auch nicht vom eigenen Vermögen leben (Oexle 1986, 91).
Wie bereits beim Übergang von der Antike zur christlichen Sozialethik ist es auch diesmal die gesellschaftliche Neubewertung der Arbeit, die den Wandel des Umgangs mit Armut und Armen begleitet und mit herbeiführt.
Selbstverständlich liegen die Wurzeln dieser neuen Wahrnehmung des Verhältnisses von »Armut« und »Arbeit« nicht nur in den konjunkturellen und demographischen Vorgängen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts begründet. Zu den Voraussetzungen dieser Wandlung gehört die allmähliche Neubewertung der körperlichen Arbeit seit Beginn des Hochmittelalters. Seit der Wende zum 11. Jahrhundert hat man die körperliche Arbeit (zunächst als Arbeit des Bauern) immer mehr als für die Gesellschaft unentbehrlich erkannt. Die seit dem 11./12. Jahrhundert entstehenden Städte waren wesentlich von Gruppen und Schichten getragen, deren Leben durch körperliche Arbeit definiert wurde. Das seit dem hohen Mittelalter in den Städten entstehende 'neue' Bürgertum war wesentlich durch freie Arbeit definiert, was den mittelalterlichen und auch den neuzeitlichen 'Bürger' vom antiken grundsätzlich unterscheidet. Die positive Bewertung der Arbeit wurde in diesem Vorgang entscheidend gefördert. Die uns im frühen und hohen Mittelalter noch begegnenden Einschränkungen in der positiven Bewertung der Arbeit, die sich über Thomas von Aquin und Augustinus bis ins Neue Testament zurückverfolgen lassen, fielen nunmehr weg oder traten in den Hintergrund. Arbeit wurde deswegen keineswegs um ihrer selbst willen geschätzt, wohl aber, weil sie den Lebensunterhalt sicherte. Eben dies aber war, im Spätmittelalter, die Voraussetzung für die kontradiktorische Gegenüberstellung von »Arbeit« und »Armut« (Oexle 1986, 91 f.).
Arbeit wird in Verbindung mit den Anfängen der bürgerlichen Konkurrenzwirtschaft zum moralischen Gebot für alle anständigen Menschen. Das seit der christlichen Antike tradierte Pauluswort "Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen"(2 Thess. 3,10) erhält neues Gewicht.
Der Armut wird ab nun mit dem Zwang zur Arbeit begegnet und in weiterer Folge wird Arbeit als Mittel zur Bekämpfung der Armut verstanden. Bettelei wird nur mehr bei religiös motivierten Armen (Bettelmönche, Pilger) oder evident Arbeitsunfähigen (Aussätzige, Krüppel) toleriert. Allen, die »lieber müßig betteln wollen, als ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu gewinnen«, droht der englische König eine Gefängnisstrafe an, ebenso denen, die ihre Faulheit noch durch Almosen unterstützen:
Da viele gesunde Bettler es ablehnen zu arbeiten, solange sie von erbettelten Almosen leben können, und sich so dem Nichtstun, der Sünde, zuweilen gar der Räuberei und anderen Verbrechen hingeben, darf niemand unter Androhung der oben genannten Gefängnisstrafe Leuten, die arbeitsfähig sind, unter dem Schein der Religiosität oder des Almosens etwas geben oder ihr Herumlungern fördern, damit man sie auf diese Weise zwingt, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu erwerben.
Ebenso heißt es in der großen Ordonnance König Johanns II. von Frankreich vom Februar 1350, und zwar gleich im ersten Artikel, dass in Paris und Umgebung viele Männer und Frauen herumlungerten, zu keiner Arbeit bereit seien, bettelten und in Kneipen und Bordellen sich herumtrieben. Deshalb wird angeordnet,
dass solche untätigen Leute, die Würfel spielen oder auf der Straße singend und bettelnd herumziehen, Männer wie Frauen, gleich welchen Alters oder Standes, gleichgültig ob sie ein Handwerk gelernt haben oder nicht, - unter der Voraussetzung, dass sie gesund sind - einer Arbeit nachgehen sollen, mit der sie ihren Lebensunterhalt gewinnen.
Anderenfalls sollen sie Paris und die Orte der Umgebung »innerhalb von drei Tagen« verlassen. Es werden Gefängnisstrafen angedroht, im Wiederholungsfall der Pranger; wer zum drittenmal erwischt wird, soll gebrandmarkt und verbannt werden. Ferner soll der Bischof und der bischöfliche Offizial der Pfarrgeistlichkeit und den Angehörigen der Bettelorden mitteilen, dass sie in ihren Predigten den Leuten einschärfen, es dürften an gesunde und arbeitsfähige Personen keinerlei Almosen mehr gegeben werden; als Empfänger von Almosen seien nur noch Blinde, Krüppel und andere »Elende« (»miserables personnes«) zulässig. Schließlich wird der Leitung und dem Personal der Spitäler befohlen, dass sie - Kranke und Krüppel wiederum ausgenommen - Bettler und Arme ohne festen Wohnsitz (»pauvres passans«, »Wanderarme«) nur noch für höchstens eine Nacht beherbergen dürfen.
Arme, die nicht arbeiten, werden zu asozialen Elementen. Der »betrügerische Bettler« wird zur populären literarischen Figur, etwa im »Scharlatan-Spiegel« oder im »Narrenschiff« des Sebastian Brandt aus dem 15. Jh. Während ein Schreiber des 15. Jahrhunderts die Zeitgenossen noch ermahnte: »Wahrhaftig, kein Mensch sollte den Armen spielen, wenn er das Notwendige hat«, weiß es ein französischer Satiriker ein Jahrhundert vorher schon ganz genau: »Verräter, Neider, Gotteslästerer» seinen die Armen, »hochmütig und voller Missgunst und Habgier«. Sie "betrügen bei der Arbeit, versuchen sich um sie zu drücken, und was sie verdienen, verfressen und versaufen sie" (Geremek 1988, 42). Martin Luther befand in seiner Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation«, dass »nicht einer auf des anderen Arbeit müßig« gehen dürfe. »Ehe das einer umb die Kosten oder umb weniger Geld arbeitete, ehe gang er müssig auf Bettel« klagte 1523 die Straßburger Bürgerschaft. "Dass die Arbeit häufig nicht genug einbrachte, um einen Menschen zu ernähren, wurde nicht gesehen [...] ins Auge fiel nur das Symptom" (Rheinheimer 2000, 93).

Bild: Betrügerischer Bettler (1713). Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 111
Die Ursachen dieser Entwicklung liegen nicht nur in der Massenarmut. Sachße/Tennstedt halten es für möglich, "dass es weniger um eine drastische quantitative Zunahme des Phänomens als vielmehr eine Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Wertung des Bettelns ist, die die Ursache der zeitgenössischen Klagen bildet" (Sachße/Tennstedt 1998, 36). In einer zunehmend nach Marktmechanismen funktionierenden Gesellschaft übernehmen neue Formen der Armenfürsorge die Funktion, die Menschen an die neuen Verhältnisse anzupassen.
Max Weber hat die »Marktvergesellschaftung« als schlechthin konstituierend für die Existenz einer Stadt angesehen. Damit tritt im Rahmen der feudalen Gesellschaft ein völlig neuartiger Typ von gesellschaftlichem Verkehr auf, der an die Menschen völlig neuartige Anforderungen stellt. Wenn der Lebenszusammenhang und damit die Persönlichkeitsstruktur des »mittelalterlichen Menschen« in einer vorwiegend agrarisch produzierenden, traditionalen Gesellschaft von dem natürlichen Rhythmus des Jahres- und Tagesverlaufs, von dem Ablauf und der Dauer konkreter Verrichtungen und der Art und Weise konkret-sinnlicher Bedürfnisse bestimmt war, dann produzieren die Gesetzmäßigkeiten des Marktes einen vollständig neuen Lebensrhythmus. Dieser erfordert Disziplin, Zeitökonomie und Abstraktionsvermögen; das Vermögen, kurzfristige Bedürfnisse zugunsten längerfristig zu erreichender Ziele zurückzustellen, im voraus zu planen; abstrakte Tüchtigkeit und Erwerbsstreben. All dieses sind die Normen und Einstellungen der handwerklichen Mittelschicht der spätmittelalterlichen Städte, deren Lebenszusammenhang ja wesentlich durch die Produktion für und die Reproduktion durch den Markt gekennzeichnet ist, keineswegs aber die Persönlichkeitsmerkmale des »mittelalterlichen Menschen« überhaupt. [...] Die Fürsorgereform erweist sich damit als Instrument der Anpassung an die marktbezogenen Normen der handwerklichen Mittelschicht, die damit aus dem Status »subkultureller Werte zum allgemein verbindlichen Maßstab« erhoben werden. Dies ermöglicht, den Bettler als eine Bedrohung der moralischen Normen und damit auch der politischen und sozialen Ordnung zu identifizieren. Die Fürsorgereform greift also spezifisch mittelständische Interessen auf und kann daher auf Unterstützung durch das Handwerk rechnen. Sie dient gleichermaßen der Stabilisierung des Rats als verselbständigter öffentlicher Gewalt gegenüber den ihn tragenden Bürgern; der Produktion von Disziplin und Gehorsam als Gegenstück der obrigkeitlichen Zuständigkeit zur Regelung sozialer Konflikte: der Produktion des Bürgers als Untertan, und sie ermöglicht dem - durch die Instabilitäten des Marktes selbst permanent vom sozialen Abstieg bedrohten - Handwerk eine eindeutige Abgrenzung nach unten (Sachße/Tennstedt 1998, 37).
Die Maßnahmen der städtischen Armenfürsorge sind somit ein wirksamer Beitrag zur Disziplinierung der untersten Bevölkerungsschichten und zur Einübung von Tugenden wie Fließ, Ordnung und Gehorsam.
Es wäre allerdings ein Missverständnis, diesen Disziplinierungsprozeß als Produktion von Arbeitskräften für eine - infolge veränderter Produktionsformen - sprunghaft gewachsene Nachfrage zu begreifen. Eine solche hat - jedenfalls in Deutschland - zu dieser Zeit nicht existiert. Die Zusammenhänge sind komplexer: Es handelt sich um die Umerziehung, eben die Disziplinierung einer Gruppe von Menschen, die völlig anderen Lebensgrundsätzen folgt, als sie der sich entfaltende Tauschverkehr benötigt; einer Gruppe, für die Arbeit allererst das Mittel zur Befriedigung konkreter Bedürfnisse bildet und der jedes abstrakte Erwerbsstreben fehlt. Worum es also geht, ist die Verankerung neuzeitlicher Rationalität und Ökonomie in der Persönlichkeitsstruktur der Angehörigen der unteren und untersten Bevölkerungsschichten; die »Zurichtung« eines neuen Menschentypus, der über die Fähigkeiten und die Motivation des Lohnarbeiters verfügt und damit um die Schaffung einer unerlässlichen Voraussetzung für die Entfaltung bürgerlicher Produktion. Dass dieser Prozess nicht gradlinig und widerspruchsfrei verläuft, zeigen die immer wieder überlieferten Klagen, dass die Bettelknechte bei ihrer Arbeit: der Durchsetzung des Bettelverbots oder der Fernhaltung oder Ausweisung fremder Bettler von Einwohnern behindert oder beschimpft werden. Die jahrhundertealten Traditionen der mittelalterlichen Gesellschaft sind tief verwurzelt. Sie treten immer wieder in Widerspruch zu den neuartigen gesellschaftlichen Anforderungen und Denkweisen, die sich erst in einem langwierigen Prozeß des Umdenkens und der Umerziehung durchsetzen (ebd., 38).
Die Armut wird im Zuge dieser Entwicklung zu einer öffentlichen Gefahr, deren sich die Kommunen erwehren müssen und zu einem Makel, dessen sich die Armen schämen müssen. Ein »Schandmal« nennt der Sraßburger Prediger Alexander Berner das Bettelzeichen und so manche Arme weigerten sich, es zu tragen. Die Auffassung des Frankfurter Verlegers Sigmund Feyerabend, der 1568 meinte, dass eine Stadt nicht nur Reiche haben müsse, die den Armen »handtreichung und hülf beweisen«, sondern auch Arme, »welche den Reichen mit Handwercken und sonst zuarbeiten geschickt seyen« (zit.n. Jütte 1986, 104), mag für die einheimischen Bettler noch gelten. Die fremden werden auf Anweisung der städtischen Räte ausgeforscht und aus den Städten verjagt.
Das Motiv des »unwürdigen Armen« - so wird er bald genannt werden - wird nicht bloß von der Ökonomie des Marktes zur Rekrutation von Arbeitskräften bzw. der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel zur Versorgung der Armen getragen. Es ist auch ein ideologisches und identifikatorisches Motiv der aufsteigen-den bürgerlichen Gesellschaft, für die individuelle Existenz nur mehr als Ergebnis individueller Leistung denkbar ist. Das wird dann und für jene Teile der Bevölkerung prekär, die aus gesellschaftlichen Gründen nicht in die Lage kommen, ihr Brot durch Arbeit zu verdienen: die Arbeitslosen. Sobald Arbeit für jeden Armen zur Pflicht wird, fallen jene Armen aus der öffentlichen Fürsorge heraus, die nicht die Möglichkeit erhalten zu arbeiten. Diese nach dem Ende der Pestepidemien stark anwachsende Schicht trifft die populäre Diffamierung als arbeitsscheue Betrüger doppelt ungerecht. Sie erleiden ein unverschuldetes Armuts-schicksal und gleichzeitig gesellschaftliche Ausgrenzung und Diffamierung. Da die Ausschließlichkeit der Alternative Armut oder Arbeit die Möglichkeit arbeitswilliger aber arbeitsloser Armer nicht zulässt, verschwinden sie aus der offiziellen Beachtung und finden sich in hämischen Traktaten und Abbildungen als Tachinierer und Schmarotzer wieder. Gleichzeitig legitimiert ihre abschreckende Existenz die private Hartherzigkeit und die öffentliche Beschränkung der Armenfürsorge und sie dient der Motivation und der Reputation der "Fleißigen und Tüchtigen". Steigende Arbeitslosigkeit bewirkt um 1600 lediglich
eine Welle obrigkeitlicher, staatlicher wie städtischer Reglementierungen und Ansätze zu einer »Armenpolitik« im Sinne der Zentralisierung, der Kontrolle und der Einschärfung der Arbeitspflicht. Diese Prinzipien blieben ebenso wie die jetzt noch schärfer gezogene Trennungslinie zwischen "würdigen« und "unwürdigen" Armen die Grundlage der europäischen Armenpolitik bis zum 19. Jahrhundert. Vor allem hat sich diese Unterscheidung des nicht arbeitsfähigen (»würdigen«) vom arbeitsscheuen und deshalb »unwürdigen« Armen durchgesetzt. Bei diesen »unwürdigen« Armen handelte es sich freilich vielfach um arbeitslose, unterbeschäftigte und unterbezahlte Arme, deren Situation nicht wahrgenommen wurde oder wahrgenommen werden konnte, - was eine der erstaunlichsten Merkwürdigkeiten der frühneuzeitlichen Armutsgeschichte darstellt. Erst um 1800, an der Wende zur Moderne, begann man die »arbeitende Armut« zu entdecken (Oexle 1986, 94 f.).
Gesellschaftliche Ideologien und populäre Mentalitäten folgen keinesfalls bloß rationalen Einsichten oder Überlegungen. Autoren wie Max Weber, Norbert Elias und Michel Foucault, vgl. Breuer 1986) haben die gesellschaftlichen Vorgänge, die sich nicht nur in der Armutsverwaltung sondern gleichzeitig auch im Militär, in den staatlichen Regierungsstäben, vor allem aber in den Schulen und Internaten vollzogen als Sozialdisziplinierung theoretisch gefasst. Damit ist gemeint, dass soziale Abweichung nicht mehr bloß dann, wenn sie manifest wird, gesellschaftlich sanktioniert wird, sondern dass ein formelles und informelles Kontrollsystem errichtet wird, das die Verletzung sozialer Normen von vornherein ausschließen und angepasstes Verhalten quasi automatisch herbeiführen soll. Dies geschieht dadurch, dass so gut wie alle lebenswichtigen Vorgänge der gesellschaftlichen Individuen an ihnen vorgegebene Strukturen, Verfahrensweisen und Regeln gebunden werden, sodass nicht diszipliniertes Verhalten einem Selbstausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben und einer Verunmöglichung privaten Überlebens gleichkommt. Für die der Hilfe Bedürftigen bedeutet das, dass das Erlangen dieser Hilfe die strikte Einhaltung der Verhaltensgebote voraussetzt, an die die städtischen und staatlichen Machthaber die Unterstützungsleistung binden.
Der Soziologe Norbert Elias hat diesen über Jahrhunderte sich entwickelnden Prozess der Anpassung menschlicher Psychen an die gesellschaftlichen Normen als "gesellschaftlichen Zwang zum Selbstzwang" beschrieben (Elias 1976). Während in der vormodernen Gesellschaft die Menschen durch äußeren Druck von seiten der Feudalherrschaften und der staatlichen Gewalt an der Verletzung gesellschaftlicher Regeln gehindert werden mussten, sollen sie in zunehmend vernetzteren Gesellschaften deren Einhaltung aus eigenem Antrieb gewährleisten. Impulsive, leidenschaftliche und unkontrollierte Ausbrüche ursprünglicher ungebändigter Triebhaftigkeit, insbesondere ungezügelte Gewaltausbrüche sollen durch abwägendes, rationales und langfristig kalkuliertes Handeln ersetzt werden. Zentraler Mechanismus für diesen Wandel der menschlichen Psychen ist die Belegung von immer mehr Handlungsweisen mit Scham- und Peinlichkeits-gefühlen, die mit der Zeit die gewohnten Wahrnehmungsweisen ersetzen und von den Menschen als ihre natürlichen Reaktionsweisen erfahren und als von ihnen selbst gewollte Handlungen verinnerlicht werden sollen (vgl. Rathmayr 2012).
Der französische Sozialphilosoph Michel Foucault (1969; 1973; 1977) zeigt am gesellschaftlichen Umgang mit Krankheit, Wahnsinn, Kriminalität, Sexualität und Erziehung, wie sich das Kontrollsystem der alten Gesellschaften, das in der direkten und grausamen Bestrafung der ungebärdigen Körper bestand, zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert zu einem System lückenloser, teils unmerklicher Verhaltensdisziplinierung entwickelt, die nicht mehr aus brutaler Machtausübung, sondern aus penibler Überwachung räumlicher und zeitlicher Handlungsvorgaben, genauer Vorschreibung von Verhaltensweisen und einer immer lückenloseren Erforschung und Verwissenschaftlichung aller menschlichen Handlungsweisen, insbesondere der Sexualität, entwickelt hat. Soziale Kontrolle und Disziplinierung wird zunehmend nicht mehr durch Befehl, Drohung und Strafe ausgeübt, sondern durch Belehrung, Übung und Anordnung im Sinn zeitlich-räumlicher Verhaltensvorgaben. Durch immer detaillierteres Wissen drüber, wie man selbst, die Welt, das soziale Zusammenleben funktioniert, das sich, wiewohl interessengeleitetes Herrschaftswissen, als neutrale Sach-kenntnis ausgibt, soll das gesellschaftlich erwünschte Verhalten bis in die kleinsten Körperbewegungen hinein gelernt und automatisiert werden.
Robert Jütte zeigt, wie solche Disziplinierungsmaßnahmen in der städtischen Armenfürsorge in der Früh-neuzeit funktionierten. Sie betrieben einerseits die Vertreibung insbesondere der fremden Bettler/innen aus den Städten:
Disziplinierung muss nach Michel Foucault nicht nur als Prozess räumlicher Abschließung, sondern auch als Parzellierung verstanden werden. Eine Ansammlung von Bettlern und Vagabunden stellte in den Augen der städtischen Obrigkeit eine ernste Bedrohung für den inneren Frieden dar. Es musste daher alles versucht werden, um eine Anhäufung von solchen Personengruppen in der Stadt zu vermeiden. So bekamen z.B. die Kirchmeister der insgesamt 19 Pfarreien vom Rat der Stadt Köln die Anweisung, zusammen mit den Kirchen-dienern in ihren Pfarrsprengeln nachzuforschen, »was für frembde Mulenstoisser (d.h. müßiggängerisches Gesindel) in der Statt syn und den [...] anzusagen sich inwendig acht dagen uß der Statt zu versehen«. [...] Ähnlich parzellierend, d.h. Duldung des Almosensammelns von Einheimischen in der Stadt, Absonderung und Ausweisung fremder Bettler als komplementäre Maßnahme, verfuhren auch andere deutsche Reichsstädte, darunter Frankfurt am Main, wo der Rat sogar die Segregation der Bettler außerhalb der Stadtmauern nicht als ausreichend empfand und gegen die Beherbergung der fremden Bettler in den umliegenden Dörfern energisch vorging, da »solche Gäst nicht allein bey Tage deß Bettels und Umbstürtzens in der Statt / sondern auch bey nächtlicher Weil deß stelens uff dem Felde sich befleissen / und den leuthen uff ihren Aeckern / Wiesen und Weinbergen allerhandt veruntreuwen«. Diese Maßnahmen sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zahlreichen städtischen Unruhen im 16. und 17. Jahrhundert zu sehen, welche die städtische Obrigkeit in ihrer Verschwörungstheorie bestärkten, auch wenn eine direkte Beteiligung solcher Personengruppen wohl schwerlich nachzuweisen ist. Nichtsdestoweniger waren die politischen Führungsschichten besorgt, dass der schwelende innerstädtische Konflikt von außen Nahrung erhalten könnte. Für sie ging es daher in erster Linie darum, den sozialen »Gefahrenherd« zu isolieren und zudem möglichst klein zu halten. Dieser soziale Prozess war Teil des Disziplinierungsvorganges, von dem das gesamte Armenwesen erfasst wurde. Die Bettelgesetzgebung hatte vor allem armenpolizeilichen Charakter (Jütte 1986, 105).
Andererseits bewirkten sie eine Unterscheidung der Bettler/innen nach mehr oder weniger großer Berechtigung:
Disziplinierung - wie sie von Michel Foucault verstanden wird - beruht außerdem auf Hierarchisierung und Klassifizierung. Es mussten Kriterien gefunden werden, die es erlaubten, die vielfältigen Erscheinungsformen der Armut zu unterscheiden. Nur so war es möglich, die geeigneten Vor- und Fürsorgemaßnahmen zu treffen. Die Armen wurden in der Folge in die unterschiedlichsten Kategorien eingeteilt. Man unterschied beispielsweise einheimische und fremde Bettler, arbeitsunfähige und arbeitsscheue Almosenempfänger, »würdige« und »unwürdige« Bedürftige. Letztere Unterscheidung traf z.B. eine Kölner Bettlerordnung aus dem ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, indem sie den Gewaltrichtern, die man am besten als höhere Polizeidiener ansprechen kann, auferlegte, alle auf der Straße angetroffenen Bettler zur Rede zu stellen und diejenigen, die kein Zeugnis ihres ehrbaren Lebenswandels vorweisen konnten, sofort aus der Stadt zu weisen.
Die Klassifizierung - wie sie oben näher beschrieben wurde - schlug sich auch schriftlich nieder. Bettel- und Almosenordnungen enthielten Beschreibungskriterien oder häufig sogar einen enumerativen Definitionsversuch der Begriffe »Armut« und »Bedürftigkeit«. Auf dieser Grundlage konnten »Armenregister« in den verschiedenen Städten entstehen. In der hessischen Kleinstadt Marburg erfolgte z. B. die Registrierung der Hausarmen in einer eigens dafür hergerichteten Kladde mit der Aufschrift »Buch der verordneten Armen« (ebd.,105 f.).
In dritter Hinsicht führten sie zu einem wachsend effektiven Überwachungsapparat, sowohl was das Verhalten der Armen betrifft, als auch wie und für wen öffentliche Armenfürsorge funktionieren sollte.
Die ständige Beobachtung ist notwendiger Bestandteil des Disziplinierungsvorganges. [...] In fast allen deutschen Reichsstädten - und dazu zählen auch so bedeutsame wie Köln und Frankfurt am Main - beanspruchte der Rat seit dem 16. Jahrhundert die Oberaufsicht über das Armenwesen. Unterschiede zwischen katholischen und protestantischen Städten gab es zwar, sie waren aber höchstens gradueller Art. Als weltliche Obrigkeit behauptete der Magistrat fortan die gesamte Disziplinargewalt im Bereich der Armen- und Sozialfürsorge. In seinem Auftrag ahndete die Armenverwaltung Verstöße gegen die Almosen- und Bettelordnungen.
Eine sinnvolle Kontrolle in der armenfürsorgerischen Praxis ließ sich nur dann durchführen, wenn eine Aufgliederung der Überwachung erfolgte. Diesem Zweck (losgelöst von den sonstigen administrativen Aufgaben) diente in der Reichsstadt Frankfurt am Main die weitverzweigte Kastenamtsverwaltung, an deren Spitze sechs vom Rat bestellte Pfleger standen. Die Stadt Köln dagegen, die reformatorisches Gedankengut von ihren Mauern fernzuhalten wusste und im katholischen Lager blieb, machte sich die Kirchspielorganisation zunutze und betraute Kirchmeister und Armenprovisoren mit Kontrollaufgaben und ordnete gelegentlich Visitationen an. So befahl beispielsweise der Rat der Stadt Köln gegen Ende des 16. Jahrhunderts »den Kirchmeisteren oder provisoren wie man sonst will den hoip leuden [...], dass densellige Ein jeglicher in seinem Kirspell oder under seiner Fahnen (d.h. in dem betreffenden militärischen Bezirk der Bürgerwehr) die Rechte armen gemeltes zeichen uff der Broist und dessen Bedelers Namen von der verordenten dair uff geschriben herinnen auch fleissig acht zu haben dass sowoll weiber alß Menner der gesontheit und Juegendt deß leibs gemeltes zeichen vheig (verlustig) sein sollten«. Auch in Frankfurt mussten die Bediensteten des Almosenkasten sich eidlich verpflichten, regelmäßig Erkundigungen einzuziehen, sowie die persönlichen Verhältnisse der Armen zu überprüfen und gegebenenfalls den Pflegern des Gemeinen Kastens Bericht zu erstatten (ebd., 106)
Im Bereich der geschlossenen Armenpflege lag die Disziplinaraufsicht bei den Provisoren des Hospitals bzw. beim Hospitalmeister selbst, der am ehesten ein Auge auf die ihm anvertrauten Armen werfen konnte. Im Falle des gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Köln gegründeten Armen- und Arbeitshauses war es das sogenannte »Congregationsamt«, welches darauf achten sollte, dass [...] »die Armen im Hospital notdurfftig wohl verpflegt, in guter Disciplin und Arbeit gehalten [...], die Allmosen ordentlich colligirt / und vornemblich keine Betteler in den Kirchen / auff den Strassen / und an den Hauseren künfftig hin nach dem Tag / dass die Armen-Spendt im Hospital eröffnet seyn wird / mehr gefunden / gelitten / und geduldet werden mögen«. Die Folge war, dass im 16. und 17. Jahrhundert sich ein differenzierter Polizei- (sprich: Verwaltungs-) Apparat auszubilden begann, der allmählich eine enorme Machtfülle bekam. Die Armen waren die ersten, die diese Intensivierung verspürten. Ein deutliches Zeichen für die zunehmende soziale Kontrolle in diesem Bereich ist das Anwachsen der Zahl der Bettelvögte oder Polizeidiener mit ähnlichen Aufgaben in den einzelnen Städten. In Köln beispielsweise verdoppelte man 1555 die Anzahl der Gewaltrichter (von zwei auf vier) und stellte jeden einzelnen insgesamt zwei Diener zur Seite, und zwar mit der ausdrücklichen Begründung, dass die itzige zeit, werlt und leutt geschynde und Boese' seien. (ebd., 107).
Durch Hausbesuche, Visitationen der Pfarreien, Anwesenheitskontrollen in den Spitälern und in den Gotts-diensten wurden die Armen auf ihre Unterstützungsberechtigung kontrolliert. Neueingebürgerte durften während des ersten Jahres keine städtischen Almosen beziehen. In machen Städten erhielten die Spendenempfänger Bleimarken, auf denen Roggenbrote dargestellt waren ('Röggelchen') und die sie gegen Brote eintauschen konnten.
Damals nahm die »Sozialbürokratie« ihren Anfang: Immer neue Registrierungs-, Auflistungs- und Tabellierungstechniken [...] wurden von einfallsreichen Beamten der Armenverwaltungen entwickelt. Der bedürftige und notleidende Mensch wird so zum »Sozialfall«, der zwar eine individuelle Prüfung erfährt, sich aber gleichwohl in bestimmte Kategorien fügt, so dass er zusammen mit anderen schematisierbar wird (ebd., 111).
Arbeitsscheu oder ein im Sinne der verordneten Sittsamkeit ausschweifendes Leben wurde streng bestraft. Zwar wurde - eine bemerkenswerte Einsicht - gegenüber der Prügelstrafe zur Vorsicht gemahnt, denn würden »solche Buben [...] mit Ruten ausgehauen, so gäben sie hernach, weil an Ehren geschmäht und unter den Handwerkern nicht mehr geduldet, erst recht Diebe und Straßenräuber ab«, wohingegen »durch harte Arbeit schon mancher der Faulheit und des Müßiggangs entwöhnt und zur Besserung gebracht worden sei« (Jütte 1986, 111). Arbeit galt als der Königsweg zur Lösung des Armutsproblems, die Erziehung der Armen zu Arbeitsdisziplin als wichtigste sozialpolitische Aufgabe. »Durch Kargheit der Nahrung und Härte der Arbeit« sollten nach dem niederländischen Humansten Luis Vives die Armen von "Müßiggang, Bettel und Vagabundage bekehrt werden" (Stekl 1986, 119). Dieser Aufgabe hatten sich nicht nur die städtischen Armenpfleger und ihre Gehilfen zu widmen, sondern auch die Verwalter der Institutionen, in den sich Kranke, Arme und auf andere Weise Beeinträchtige sammelten: die Hospitäler, die Pilger- und Elendenherbergen, die Waisenhäuser und die Gefängnisse.
Nicht immer freilich hatten die strengen Vorschriften die erwünschte Wirkung. Beauftragte wie Betroffene erfanden gelegentlich Möglichkeiten der Umgehung:
Die Überwachung der Armen nahm sich in der Wirklichkeit aber anders aus als auf dem Papier. Man muss sich davor hüten, die Effektivität der Kontrolle zu überschätzen. Aus Augsburger Quellen wissen wir beispielsweise, dass die Hausarmen sich nach einiger Zeit an die Visitationen gewöhnt und rechtzeitig Vorsorge getroffen hatten, indem sie an den betreffenden Tagen ihren Wohnungen einfach fernblieben. Auch ließ die Zuverlässigkeit der dortigen »Gassenhauptleute«, denen in Augsburg in den einzelnen Bezirken die Nachprüfung aufgetragen war, in vielen Fällen zu wünschen übrig. In Köln kam 1567 sogar das Gerücht auf, dass die Diener des Gewaltrichters, die für die Überwachung der Bettler zuständig waren, »Stichpfenninck«, d.h. Bestechungsgelder, annahmen (ebd., 107).
Kirchenmänner versuchten, das Gebot der christlichen Nächstenliebe und dessen Nutzen für das eigene Seelenheil den neuen Anforderungen anzupassen. Um beides, die christliche Almosenpraxis und das neue Arbeitsethos möglich zu machen, wiesen sie jene den mildtätigen Privatpersonen, dieses den öffentlichen Behörden zu. Der Aufruf des berühmten Straßburger Dompredigers Geiler von Kaysersberg an die Gemeinden, eine Ordnung zu schaffen, »nach der die kräftigen Bettler oder Kinder, die ihr Brot verdienen könnten, zur Arbeit angehalten und allein die Armen und zur Arbeit Unfähigen zum Almosen zugelassen würden« (Sachße/Tennstedt 1998, 56) entsprach dem Trend der Zeit.
Mit der Zersplitterung des deutschen Reiches in über dreihundert souveräne Territorien nach dem 30-jährigen Krieg beginnt die Epoche des Absolutismus, der unumschränkten Herrschaft der Landesherrn, denen ab jetzt auch die »Regulierung der Armut« unterstellt ist. Die seit dem Mittelalter üblichen Strategien von Armenversorgung und Bettelbekämpfung bleiben bis zum Ende des 16. Jh. die Mittel, die auch die absolutistischen Staaten anwenden. Zwar sind nach wie vor die Gemeinden für ihre Armen zuständig, sie werden aber landesherrlichen Anordnungen unterstellt. Die Armenfürsorge wird verstaatlicht. Allenthalben werden Almosenämter oder Armenkassen eingesetzt.
Die Grundstrukturen dieser Almosenämter oder Armenkassen sind dabei im 17. und 18. Jahrhundert überall in Deutschland im Wesentlichen dieselben: Unter der Oberaufsicht eines Gremiums ehrenamtlicher Honoratioren obliegt die eigentliche Durchführung der Armenversorgung einer je unterschiedlichen Anzahl beruflicher und besoldeter Armenpfleger (inspectores, Armenvögte, Almosenschreiber etc.). Sie haben sowohl die Empfangsberechtigung der Betroffenen zu überprüfen als auch die Verteilung der Unterstützung vorzunehmen bzw. die Betroffenen in entsprechende Einrichtungen (Armenhäuser, Hospitäler) zu überweisen. Die Armenversorgung besteht in Unterstützungsleistungen in Geld und/oder in Naturalien - die Verteilung von Brot spielt hier nach wie vor eine bedeutsame Rolle - oder wie gesagt in der Gewährung von Pflege, Versorgung und Behandlung in den dafür vorgesehenen Einrichtungen. Die Berechtigung zum Empfang der jeweiligen Leistung wird für einen bestimmten Zeitraum erteilt (in der Regel zwischen drei Monaten und einem Jahr) und auf einem Schreiben vermerkt, das der Berechtigte bei Empfang der Leistung vorzuweisen hat. Die Leistungen müssen die Berechtigten (soweit es nicht um stationäre Pflege geht) an bestimmten Tagen zu bestimmten Stunden in den Räumen des Almosenamtes selbst abholen, wobei durch mangelndes Personal öfter Terminschwierigkeiten auftauchen, die vielfältige Beschwerden der Betroffenen nach sich ziehen. (Sache/Tennstedt 1998, 107).
Als "das eigentlich neue, das »bürgerliche« Element der Fürsorge" (Sachße/Tennstedt 1998, 23) gelten die "Bettel-, Armen- und Almosenordungen" des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit. Die Obrigkeiten gingen, der Zeit entsprechend, bei all diesen Vorkehrungen mithilfe autoritärer Verordnungen vor.
Die älteste erhaltene Bettelordnung, jene der Stadt Nürnberg aus der Zeit um 1370 zeigt in allen Details die neuen Auffassungen. Sie unterstellt das Betteln der Aufsicht eines städtischen Armenpflegers, der die entsprechende Lizenz zu vergeben hatte, was durch die Aushändigung eines Bettelzeichens geschah, das jeweils für ein halbes Jahr Gültigkeit hatte. Die Vergabe dieses Zeichens war an ein rechtsförmliches Verfahren gebunden, das auf der durch Eid gesicherten Aussage glaubwürdiger Personen beruhte, dass der Betreffende des Almosens tatsächlich bedürftig sei. Über die erteilten Lizenzen wurde Buch geführt. Außerdem hatten an zwei festgesetzten Tagen im Jahr, nämlich zu St. Michael (29. September) und zu St. Walpurgis (1. Mai) alle Bettler der Stadt zu erscheinen, damit die Bedürftigkeit und also das Recht auf das Tragen des Bettelzeichens neu überprüft werden konnte. [...]
Die Nürnberger Bettelordnung von 1478 hat die Erlaubnis zum Bettel davon abhängig gemacht, dass diese Bettler - ausgenommen Lahme, Blinde und Krüppel - an Werktagen nicht müßig vor den Kirchen herumsitzen, sondern spinnen oder eine andere Arbeit tun, die zu verrichten sie in der Lage sind (Oexle 1986, 88 ff.).

Bild: Kastendiener, Austeilung von Geldalmosen (Frankfurt/M. 1531). Aus:Sachße-Tennstedt 1983, 84

Bild: Bettelausweis in Hanau (1763). Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 124
In Summe markieren alle diese Maßnahmen einen Wandel von der »Armenfürsorge« zu einer obrigkeitlichen »Armenpolitik« (Oexle 1986, 90). Die Prinzipien dieser im 15. Jh. einsetzenden öffentlichen Armuts-verwaltung haben Christoph Sachße und Florian Tennstedt auf den Begriff gebracht. Die Maßgaben dieser neuen Politik der Armut sind gekennzeichnet durch Kommunalisierung, Bürokratisierung, Rationalisierung und Pädagogisierung.
Kommunalisierung
Dabei ist mit »Kommunalisierung« zum einen gemeint, dass die Armenfürsorge »verweltlicht« wurde, das heißt, aus der Zuständigkeit der Kirche in die der weltlichen Obrigkeit überging. Zum anderen aber, dass sie in örtliche Zuständigkeit, also in die der Städte und Gemeinden übernommen wurde. Der Übergang der Armenfürsorge von der Kirche als einer universellen, räumlich nicht begrenzten Institution auf die Gemeinde als Gebietskörperschaft brachte notwendig ihre lokale Beschränkung mit sich. Das bedeutete, dass jede Stadt nur mehr die Verantwortung für die 'eigenen' Armen übernehmen und alle fremden möglichst schnell loswerden wollte. Der Ausschluß der fremden Bettler ist von den frühesten Bettelordnungen an ein dominantes Thema der Neuordnung der Armenfürsorge (Sachße-Tennstedt 1983, 43)
Es gilt das "Heimatprinzip", dem etwa in Österreich in großen 'Bettelschüben' Rechnung getragen wurde:
»Von einem Sammellager bei Linz aus ging zweimal im Jahr der Schub, der aus mehreren Hunderten Personen bestand, unter starkem militärischen Schutz nach Bayern und von hieraus auf verschiedenen Routen von Territorium zu Territorium weiter [...] Jeder Ausgewiesene wurde nach einem langen Marsch am jeweiligen Geburtsort abgeliefert, wobei es vielfach zu fast kafkaesken Szenen kam. So wurde beinahe zehn Jahre lang bei jedem Schub ein Mann mitgeführt, der seit 40 Jahren in Österreich als Hausierer lebte und eben zufällig als Soldatenkind in Coburg geboren war, den ansonsten aber auch nichts mit Coburg verband, weshalb die Stadt jedesmal seine Aufnahme verweigerte. Ein 16jähriger Schneiderlehrling, ebenfalls ein Soldatenkind, gab an, er habe gehört, er sei in Furth geboren, könne aber nicht sagen, welches Furth gemeint sei. Die Nürnberger Nachbarstadt weigerte sich ihn aufzunehmen, sandte ihn zurück und in den nächsten Jahren tauchte er mit jedem Schub wieder auf, bis endlich im Zuchthaus in Schwabach ein Platz fur ihn frei wurde«.
Weit entfernt also davon, das Armutsproblem der Lösung näher zu bringen, dienen die Bettlerschübe im Gegenteil seiner Verschärfung. Durch sie wird geradezu eine heimatlose, unstete Armutsbevölkerung produziert, deren Sesshaftigkeit systematisch verhindert und damit die Chance, je wieder eine geregelte Existenz aufzubauen ebenso systematisch verstellt. (Sachße/Tennstedt 1998, 111).
Rationalisierung
Mit dem Stichwort »Rationalisierung« ist vor allem das Bemühen um die Herausbildung feststehender Kriterien, die zum Empfang von Unterstützungsleistungen berechtigen, angesprochen. Im Zuge des Prozesses der Reform der städtischen Armenfürsorge im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert wurden dabei die Arbeitsfähigkeit bzw. -unfähigkeit, die Familiensituation und das Arbeitseinkommen immer deutlicher als Anknüpfungspunkte für die öffentliche Unterstützung herausgearbeitet [...] In dem Maße, wie Unterstützung nur noch bei Vorliegen bestimmter Kriterien gewährt werden sollte, entstand die Gefahr des Missbrauchs und es stellte sich die Frage nach der Überprüfung des Vorliegen der festgelegten Kriterien. Die Versuche einer Rationalisierung der Armenfürsorge waren daher begleitet vom allmählichen Aufbau von Institutionen, die die Einhaltung der festgelegten Voraussetzungen der Unterstützung überprüfen und ihre Verteilung organisieren sollten.
Bürokratisierung
Die Rationalisierung der Fürsorge folgte also ihre 'Bürokratisierung'. Zwischen den Bedürftigen und den wohltätigen Spender begann sich eine »Sozialbürokratie« zu schieben, die die Kriterien der Verteilung der Spenden festlegte und über ihre Einhaltung wachte. Die allmähliche Entstehung einer Sozialverwaltung lässt sich von den frühesten bekannten Bettelordnungen an verfolgen. So knüpfte die bereits erwähnte Nürnberger Bettelordnung von 1370 die Berechtigung zum Betteln an das Tragen eines Bettelzeichens (»der stat zeichen«) und schrieb zugleich vor, dass dieses Zeichen ausschließlich von dem eigens vom Rat hiefür bestellten Mann, dem Pinot Weygel, vergeben werden dürfte. »Und wen der pignot weigel ein zeichen gibt, dez namen sol er schreiben in ein puch«, heißt es dort weiter. In der Figur des Armenvogts sind also die Elemente neuzeitlicher Verwaltung schon angelegt. In ihr tritt die städtische Sozialverwaltung in ihrer frühesten und schlichtesten Form in Erscheinung. Solange es ausschließlich um die Reglementierung des Bettelns in den Städten ging, blieb die städtische Verwaltung in diesem Bereich - sowohl vom personellen Aufwand wie von der Kontrollkapazität her- bescheiden. Erst in dem Maße, wie das Betteln immer mehr verboten und durch kommunale Unterstützungsmaßnahmen ersetzt wurde, wurden die städtischen Almosenämter mit dem Zuwachs an Aufgaben auch personell immer umfangreicher und zogen die polizeiliche Kontrolle an sich. Die Finanzen wurden in einem einheitlichen Haushalt zentralisiert: dem »Großen Almosen« oder »Almosenkasten«. Für das Personal der neu entstehenden Fürsorgeverwaltung war ein Dualismus kennzeichnend, der [...] die Struktur der Armenverwaltung auf Jahrhunderte hin bestimmte: die Unterscheidung von ehrenamtlichen Leitungspositionen, die in Regel von Mitgliedern des städtischen Rates besetzt wurden, und besoldeten Hilfskräften, denen der unmittelbare Kontakt mit den Armen oblag. Die direkte Ausgabe des Almosens durch die »Kastenherrn« selbst bildete daher hier die Ausnahme. Üblich dagegen war die Verteilung durch Almosenknechte, die die Armen in ihren Wohnungen aufsuchten und die zugleich die Pflicht zur Prüfung und Kontrolle der Bedürftigkeit der Betroffenen hatten.
Mit der Entwicklung feststehender Kriterien der Bedürftigkeit und Instanzen zu ihrer Überprüfung trat Armut als soziales Problem ins Bewusstsein der Zeitgenossen; erst in diesem Prozess entstand überhaupt eine abgrenzbare gesellschaftliche Gruppe der »Bedürftigen«. Der sozio-ökonomische Bedeutungsgehalt des Armutsbegriffs gewann damit eine neue Dimension: die »Bedürftigkeit«. Damit wurde nicht der materielle Besitzstand, sondern eine soziale Beziehung bezeichnet, das Verhältnis der Gesellschaft zum Armen, ihre Verpflichtung dem Armen gegenüber. Die Definition der Bedürftigkeit zieht also die Grenze für die gesellschaftliche Unterstützungspflicht.
Sinnfälligen Ausdruck fand diese soziale Dimension des Problems in den Bettelzeichen, die den sichtbaren Ausweis der Berechtigung zum Betteln bzw. zum Almosenempfang bildeten. Diese Zeichen, erdacht, um den wahrhaft Bedürftigen die ihm zustehende Unterstützung gegen allerlei Gauner und böse Buben zu sichern, waren zugleich Sinnbilder der beginnenden Stigmatisierung einer gesellschaftlichen Randgruppe. Sie bezeichneten nicht nur die Grenzlinie zwischen »guten« und »schlechten« Bettlern: sie markierten auch die beginnende gesellschaftliche Randstellung, die Ächtung von Armut. Die Bürokratisierung der Fürsorge bedeutete zugleich die Formierung einzelner Unterstützungsempfänger zur Randgruppe der Armen.
Pädagogisierung
Ein weiteres Merkmal der Neuordnung der Armenfürsorge im Deutschland des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts war ihre »Pädagogisierung«. In ihr kamen der gewandelte gesellschaftliche Bezugsrahmen der Unterstützung der Armen, ihre Entwicklung zu einer sozialpolitischen Strategie deutlich zum Ausdruck. Auch das traditionelle mittelalterliche Almosen war mit Pflichten für den Empfänger verbunden: Er hatte Fürbitte für das Seelenheil des Spenders zu leisten. Im Laufe des 15. Jahrhunderts trat daneben allmählich die Arbeitspflicht als weiteres Element [...] Und in den Armenordnungen, insbesondere des beginnenden 16. Jahrhunderts, häuften sich die Kritik an Müßiggang und Völlerei, an Trunk und am Spiel. Hier wurde ein regelrechter Moral- und Verhaltenskodex für die Unterstützungsempfänger aufgestellt. Sie sollten sich »ingezogen, still, fromblich, ehrlich und unverwislich halten«. Wirtshäuser und andere Stätten des Lasters hatten sie bei Strafe des Entzugs des Almosens zu meiden, und wenn ein Armer aufs Zechen ganz und gar nicht verzichten mochte, so sollte ihm »solichs bei seinem Weib, Kindern oder heuslichen wonung zuthun unverpoten sein, auf das der gleichen fullerey, spill, gottslastern und andere übelthaten, so aus solichen teglichem zechen ervolgen, abgestellt werden«. Auch auf die Einhaltung der Familienmoral wurde geachtet, und wo Eheleute nicht oder Nicht-Eheleute beieinander wohnten, konnte dies ein Grund für den Entzug der Unterstützung sein. Das erwähnte Bettelzeichen diente als Instrument zur Durchsetzung dieser Verhaltensregel. Die pädagogische Intention wurde zum Wegbereiter faktischer Stigmatisierung. (Sachße/Tennstedt 1983, 43-46, siehe auch 1998, 30 - 35).
In Hamburg mussten die unterstützten Bettler zweimal im Jahr eine Katechismusprüfung ablegen und wer in Danzig die Prüfung der Gebete nicht bestand, verlor das Bettelzeichen. (Rheinheimer 2000, 101 f.). Die Bettelzeichen hatten nicht nur die Funktion, die von der Stadt betreuten Armen als solche kenntlich zu machen. Sie wurden, wie etwa der Rat der Stadt Köln zu wissen gibt, auch verordnet, um das Prinzip der Kommunalisierung durchzusetzen. 1000 solcher Zeichen aus Blech gab der Rat in Auftrag, »damit die In-heimische vor den uißwendig bedler erkandt, und gemelte uißwendige uißgewiesen mochten werden«. (Jütte 1986, 105). Angesichts einer wachsenden Diskriminierung der Armen hatte ihre öffentliche Kenn-zeichnung durch Bettelmarken aber auch kontraproduktive Auswirkungen, da man ihrem Träger »dester minder trawt und nit mer Arbeit geben will«, so 1531 ein Straßburger Armendiakon (Rheinheimer 2000, 102).
Die entschiedenste Zuspitzung einer auf der Arbeitswilligkeit der Bedürftigen aufgebauten Armutspolitik besteht in der Errichtung von Werk-, Zucht- und Arbeitshäusern ab dem Ende des 16. Jh. In den Zucht- und Arbeitshäusern für Männer bzw. den Spinnhäusern für Frauen erreichte diese Politik im 17. und 18. Jahr-hundert ihren Höhepunkt (Marzahn/Ritz 1984; Stekl 1978; 1986; Sachße/Tennstedt 1998, S. 113 ff.). »Unser deutsches Vaterland ist nun im Stande, wenigstens 60 Zucht- und Arbeitshäuser aufzuweisen«, schreibt 1786 ein Schriftsteller (Sachße/Tennstedt 1998, 113). Zwar geht die Vergesellschaftung der Armut mit der Übernahme der einst vorwiegend kirchlichen Armenfürsorge in die Hände des neuen säkularen Staates einher, in den Organisationsstrukturen leben aber die alten kirchlichen und klösterlichen Prinzipien fort (Treiber/Steinert 1980). Nicht umsonst setzte die Frankfurter Zuchthausordnung von 1696 nicht nur fest, dass »sämtliche Hausgenossen, junge und alte, von allen strafbaren Lastern, auch vom Müßiggang, Muthwillen, undienlichen Worten und Wercken« abgehalten werden, sondern auch »zu rechter Erkenntnis ihres Christentums, zu liebreicher stiller ßeißiger Arbeit, und allem gottseligen Leben« geführt werden sollen (Stekl 1986, 121).
Der hohe Stellenwert von Arbeit in den Konzepten und in der Vollzugspraxis der Zucht- und Arbeitshäuser ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, welche während des 17. und I8. Jahrhunderts unterschiedliche Wirkungskräfte und Verflechtungen aufwiesen. Die Reformation hatte die sittliche Qualifizierung des weltlichen Berufslebens vorgenommen, der »asketische Protestantismus« mit dem Ideal rastloser, disziplinierter Arbeit eine verstärkte Rationalisierung des Lebens gefördert, der Humanismus Arbeit als natürliche Veranlagung und als Voraussetzung für individuelle Selbstentfaltung betrachtet. Dieser Tugendkodex entsprach durchaus den Interessen aller Trägergruppen der neuen kapitalistischen Ökonomie. Erhöhter Arbeitskräftebedarf nach den Bevölkerungsverlusten im Dreißigjährigen Krieg, wachsende innere Migration sowie zentrale Inhalte der merkantilistischen Wirtschaftslehren beschleunigten eine Neuorientierung der Wohlfahrts- und Kriminalpolitik. Erneute Betonung der Arbeitspflicht aller Armen, verstärkter Kampf gegen Bettel und Vagabundage, Ausbau der Polizeiapparate sowie Verbreitung der Freiheitsstrafe mit konsequenter Nutzung der Arbeitskraft der Häftlinge waren wichtige Elemente nunmehr gesamtstaatlicher Strategie. Die Zucht- und Arbeitshäuser bildeten dabei einen Apparat, der in erster Linie eine veränderte Einstellung zur Arbeit diente, internalisieren sollte und dabei auch die 'eigentlichen Bedürfnisse' von Arbeitsunwilligen und Kriminellen festlegte (ebd., 125).
Die Arbeit in den Zuchthäusern hatte zwei Zwecken zu dienen: der Gewöhnung an ordentliche Beschäftigungen und der Strafe:
Nicht-Arbeit galt nicht nur als persönliche Lasterhaftigkeit, sondern aufgrund ihrer üblichen Begleiterscheinungen als öffentliches Sicherheitsrisiko. Die Ermittlung von selbstverschuldeter Armut durch die Organe öffentlicher Armenpflege musste daher Strafe nach sich ziehen. Dieser Gedanke war den Humanisten des 16. Jahrhunderts ebenso geläufig wie den Philanthropen des 18. Jahrhunderts. Schon im Amsterdamer Zuchtbaus beschäftigte man männliche Insassen mit dem kräfteraubenden Raspeln überseeischer Hölzer für die Verwendung in der Färberei. Gerade wegen ihrer Eignung für Strafzwecke und als kontinuierliche Übung, wie es in einer städtischen Verordnung l599 hieß, zog man diese anstrengende Produktionsform der effizienteren durch Windmühlenenergie vor. Wie in Deutschland bestand auch in Österreich die Absicht, in den Zucht- und Arbeitshäusern »schwere, zu einer Buß der ad labores condemnierten Leuthe [...] dienende« Arbeiten anzuordnen: so z. B. Holzschneiden, Marmorschneiden, Steinstoßen, Aushubarbeiten, Festungsbau u.a. (ebd., 125 f.).

Bild: Tretmühle und Raspeln im Hamburger Zuchthaus. Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 138
Für den Staat bedeuteten die Arbeitshäuser aber auch eine Möglichkeit, durch die Produktion von Gütern Gewinn zu erwirtschaften:
Der Staat, welcher die Zucht- und Arbeitshäuser häufig als Experimentierfelder manufakturener Produktion benützte, trachtete eine Intensivierung der Arbeitsleistung des einzelnen sowie eine extensive Verwertung des Produktionsfaktors Arbeit zu erzielen. Man griff somit allgemein auf Tätigkeiten zurück, welche leicht erlernbar waren, geringen Kapitaleinsatz erforderten, nach der Entlassung günstige Beschäftigungschancen versprachen und auch aus gesamtwirtschaftlichen Erwägungen expansionsfähig schienen. Dabei bot sich vor allem der Bereich der Textilherstellung an. Dieser damals wohl bedeutendste Gewerbezweig wurde noch vorwiegend händisch betrieben; Produktionssteigerungen waren nur durch Vergrößerung von Betrieben bzw. durch Erweiterung der Vertriebssysteme zu erzielen. Die große Bedeutung von Arbeit als Produktionsfaktor macht die Bestrebungen verständlich, dass Kameralisten wie später die Industriepädagogen die Umwandlung von Arbeitsunwilligen zu einsatzbereiten Lohnarbeitern anstrebten.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür schien die Festlegung eines allgemein verbindlichen Leistungsrahmens, welcher gegebenenfalls nach kurzer Einschulung zu erreichen war. Lag die Bemessung des Arbeitsquantums im Ermessen der jeweiligen Anstaltsverwaltung, waren der Willkür kaum Schranken gesetzt. Im allgemeinen entsprach das Arbeitsausmaß dem geübter freier Lohnarbeiter. Das vor allem in Brandenburg-Preußen verbreitete Moden der Entreprise, der Verpachtung der Zucht- und Arbeitshäuser an Privatunternehmer, zeigt jedoch, dass physische Konstitution und Berufserfahrung der Insassen kaum berücksichtigt wurden. [...] Wohl gab es schärfste Kontrollen durch hierzu bestellte Mithäftlinge und durch die Verwaltung. Diese konzentrierten sich aber in erster Linie auf eine kontinuierliche und einigermaßen fehlerfreie Arbeitstätigkeit, kaum aber auf richtige Arbeitshaltung und rationelles Produzieren (wofür gewöhnlich auch eine entsprechende Ausstattung fehlte). Gewöhnung an mechanische Arbeitsvollzüge war das Hauptziel, welches allerorten mit schärfsten Repressivmahnahmen durchgesetzt werden sollte. (ebd., 126).
Die Strafen waren streng und grausam. In der Anstalt, wo alle Insassen in gleicher Weise entehrt waren, gab es keinen Grund, auf die Prügelstrafe zu verzichten und sie wurde, neben Essenentzug und Pranger im Übermaß angewendet. "Kostschmälerung, Arrest, Fesselung, körperliche Züchtigung, vor allem die Geißelung mit Ruten oder mit dem Stock oder dem Tauende" waren gängige Strafmethoden. "In Amsterdam und später auch in Bremen ließ man Insassen auf dem »hölzernen Pferd« reiten, einem Holzgestell mit scharfen Kanten und peitschte ihnen zusätzlich den Rücken". Den Opfern solcher "Zähmung" nützte es wenig, dass im empfindlicheren 18. Jh. aufgeklärte Schriftsteller eine Moralisierung der Strafrituale verlangen: Es müsse »die Stunde feierlich-traurig sein« und »das Wort der Ermahnung (ja nicht der Schimpfrede) mit dem Zeichen der Peitsche gepaart bleiben« (Marzahn/Ritz 1984, 51). Auf der anderen Seite wurden durch das Auszahlen fixer, wenn auch niedriger Löhne Leistungsanreize gegeben, nicht immer mit dem gewünschten Effekt: So mancher Insasse kaufte sich mit dem verdienten Geld bei anderen Häftlingen oder beim Aufsichtspersonal von der Arbeitsverpflichtung los.
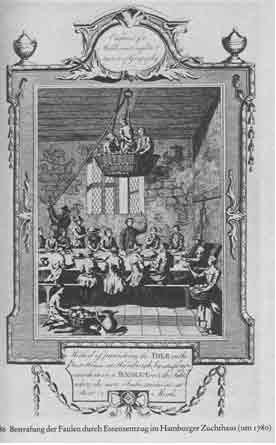
Bild: Bestrafung: Essensentzug im Hamburger Zuchthaus (um 1780). Aus: Sachße-Tennstedt 1983, 139

Bild: Geißelpfahl im Zuchtuahs von Amsterdam. Aus: Marzahn/Ritz 1984, 59, 59
Weit über die Kriminalitäts- und Armutsverwaltung hinaus besorgten die Zucht- und Arbeitshäuser eine für die herkommende kapitalistische Gesellschaft unerlässliche Erziehungsaufgabe. Menschen, die bisher das Ausmaß ihrer Arbeit vom Wetter, von der Zufälligkeit der Aufträge oder Gelegenheiten, vor allem aber von der Notwendigkeit für ihr persönliches Fortkommen abhängig gemacht hatte, mussten an eine regel-mäßige ununterbrochene Arbeitstätigkeit gewöhnt werden. Als warnendes Beispiel galt der zeitgenössischen Publizistik ein Faulpelz, der "in einem Wasserkeller um sein Leben zu pumpen hatte, und so von der Lebensnotwendigkeit der Arbeit überzeugt wurde (Stekl 1986, 129), eine der sarkastischen Wundergeschichten aus den Miracula San Rispini redivivi, in denen 1612 in Form sarkastischer Form erzählt wird, wie im Amsterdamer Zucht- und Arbeitshaus »St. Labor (Arbeit), St. Ponus (Strafe) und St. Raspinus (Raspel)« arbeitsscheue Insassen geheilt werden.
»Lamprecht N. von N. von Natur und Gliedern starck und grad, hatte diesen Gebrechen, dass er ob wol gern ein Arbeydt verrichtet (wann sie sich selbst gethan) war doch sein Klag, daß er den Schweiß nicht riechen kondt, und wenn er den empfunde, ihm gleichsam ein Ohnmacht zugieng, dessen Eltern nun hatten so viel von der Wol- und Wallfahrt zu der Klaussen auff dem heiligen Berg zu Amsterdam[76] gehört, dass sie kurtz entschlossen, dass ihr Patient auch dahin ein Pilgramsfahrt solt verrichten. Nachdem er nun mit einem Schreiben, darin seine Gebrechen vermeldt, zu Amsterdam in einer andern Meynung angekommen ist, alsbald ist er auß dem Gasthauß in der Klausen abgeholt worden, seine Devotion zu S. Pono und Raspino zu thun, da er sich dann gantz übel gehaben, und sein Opffer zu gedachten heiligen nicht verrichten können oder wollen, on geachtet er zum offtermal mit dem Tag Oly[77] wol geschmirt worden, derwegen man zu dem eussersten Mittel geschritten und eine andere Khur an die hand genommen. Nemlich im vestibulo oder Eingang deß Zuchthauses ist ein rinnend Wasser und darneben eine Camera mit zwo Wasserpompen, eine außwendig, die ander inwendig, in dieselbig ward der patient geführet, dass er ein appetit zu S. Pono mit dem außpompen bekommen möcht, also ward erstlich das Wasser zu ihm so tief biß an die Knie, förter biß an den Gürtel und als ihn noch kein Andacht zu S. Pono ankommen wolt, vollends biß unter die Arm und endlich biß an den hals eingepompt und eingelassen, Da er nun befunden, dass die Schweißsucht ihn verlassen und geförchtet, dass er ersauffen möcht, hat er S. Pono in einer Fury angefangen dass Opffer mit großer Andacht zu verrichten, die Pompe erwischt und so lang und viel gearbeytet, biß er deß Wassers mit außpompen erledigt worden, da er dann die schweißsucht nicht mehr empfunden und bekennen müssen, dass er darvon genesen, derhalben er dann herauß genommen und zu ander nützlicher Arbeit angewiesen und gehalten worden. Biß endlich nach 3 Jahren seine Eltern dem heiligen S. Pono zu Ehren das Zuchthauß mit einer Summe Gelt verehret und den Nimmerschweißsüchtigen wider zu Haus kommen lassen.' (Marzahn/Ritz 1984, 150)
Das Wesen der Zucht- und Arbeitshäuser zeigt sich in den Inschriften über ihren Portalen. Improbis coer-cendis et et quos deseruit sanae mentsi usura custodiendis will das Leipziger Zuchthaus sich widmen, der »Zähmung der Unehrlichen und der Bewachung der Wahnsinnigen«. Labore nutrior, labore plector, steht an der Pforte des Hamburger Werk- und Zuchthaus: »Durch Arbeit werde ich ernährt, durch Arbeit werde ich bestraft«. Über dem Eingang in Amsterdam thront eine Frau mit Geißel zwischen zwei gefesselten Insassen, unter ihr ein Wagen, von wilden Tieren gezogen und von einem peitschenschwingenden Fuhrmann gelenkt: Virtutis est domare, quae cuncti pavent lautet die Inschrift, »Der Tugend steht es zu, zu zähmen, was alle fürchten«. Eine Zähmung, deren Mittel das Wiener Zucht- und Arbeitshaus nach 1723 über seinem Eingangstor mit Labore et fame bekundet: »Durch Arbeit und Hunger«.
Zu den Insassen der Zucht- und Arbeitshäusern gehörten, zunächst unterschiedslos, auch die »ungehorsamben Kinder«, wie sie im Fall des 1673 in Wien Leopoldstadt errichteten Hauses genannt werden. Auch sie sollten durch »stethe Arbeit« von »allerhandt Laster und andere unzimbliche beginnungen, auch ungebührenden ungehorsamb« abgebracht werden. (Feldbauer 1980, 27). Ab dem frühen 18. Jh. werden sie von den übrigen Insassen getrennt und erhalten in bescheidenem Ausmaß auch Unterricht. Entscheidendes Ziel der Unterbringung aber war, dass sie wie alle »dem Staate durch Fleiß und Arbeit nützlich zu werden« lernen, ferner »die Einführung von allerhand Manufakturen und Fabrikation von bisher im Land nicht hervorgebrachten Waren« und »dass arme, vater- und mutterlose Menschen, auch andere arme Kinder, welche wie Schafe ohne Hirten gingen, des zu ihrer Seligkeit nötigen Unterrichts und der zu Gewinn und Erhaltung ihres Lebens höchst nötigen Anleitung zu Künste und Arbeiten erführen«. So formuliert 1710 der Herzog von Wittenberg die Aufgaben des Stuttgarter Waisen-, Zucht- und Arbeitshauses, Vorbild für ähnliche Gründungen in Wien, Graz oder Brünn. (ebd., 29; 32). 118 der 457 der in den ersten Jahren dort auf-genommenen Kinder kamen durch die ihnen auferlegte Arbeitsbelastung, das schlechte Essen und die unzulänglichen hygienischen Verhältnisse ums Leben.
Mit der Repression der Armen und der gesellschaftlichen Durchsetzung von Arbeit als Zwang und Strafe wächst freilich auch der Widerstand der Betroffenen, der Arbeiter und der Armen. Auch der so genannte "Beamtenwiderstand" fällt in diese Kategorie. Der erst im Aufbau befindliche Beamtenapparat muss von den Obrigkeiten immer wieder ermahnt werden, die Maßnahmen gegen die Bettler zu exekutieren. (Sachße/Tennstedt 1998, 110). Die Anfänge einer Wohlfahrts- und Fürsorgearbeit, die nicht mehr nur auf Repression und Kontrolle setzt, sondern auf Unterstützung und Hilfe, lässt freilich auf sich warten. Ihr geht eine quantitative wie qualitative Intensivierung der sozialen Deklassierung und Proletarisierung durch die industrielle Revolution voraus, die soziale Revolutionen zur Folge hat.
Im Laufe des 17. Jh. Entwickelten sich auch die ersten Ansätze zu einer Gesundheitspolitik der öffentlichen Hand. Allein die enorme Ansteckungsgefahr während der Pestzeiten und die Beseitigung der zahlreichen Toten erforderte entschlossenes Eingreifen. Häuser und Straßen mussten desinfiziert werden, die Toten beseitigt, Pestfriedhöfe außerhalb der Stadtmauern angelegt werden. Die Überlebenden mussten vor Plünderung und Raub geschützt werden. Erste Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge durch Hygiene und die Sicherung ärztlicher Versorgung kamen in Gang.
Lag die Pflege der Gesundheit, soweit sie überhaupt jemals öffentlich zur Diskussion stand, bis weit ins 16. Jahrhundert ausschließlich in kirchlicher Obhut, in Händen der Familien und Kommunen oder in Händen einzelner Wunderheiler, begann sich die Obrigkeit seit dem 17. Jahrhundert sukzessive für das Gesundheitswesen zu engagieren. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts konzentrierte sie sich auf drei Schwerpunkte: auf die Verbesserung der Apotheken, die Professionalisierung der Ärzteschaft und die Institutionalisierung des Hebammenwesens. Erste Krankenhäuser gab es zu Anfang des 19. Jahrhunderts (van Dülmen 1992, 140).
Aus dem Inhalt der Verordnungen kann man ersehen, wie sehr es mit der Versorgung der Kranken im Argen lag, sieht man etwa an den Anweisungen, die den Apothekern gegeben wurden:
Die bestehenden Apotheken wurden angewiesen, nur »mit gueten newen, frischen und gerechten Materialien« umzugehen und »wissentlich kein verbotten oder gefehrlich Stuck« zu verkaufen. Die Gefahr der Vergiftung war bekannt. Der Apotheker sollte deshalb nur eigenhändig die Medikamente herstellen bzw. verkaufen und dies nicht seiner Frau und seinen Dienern anvertrauen. Diese Verpflichtung war nötig, da Apotheker nicht selten noch anderen Beschäftigungen nachgingen. Schließlich durften sie - von Ausnahmen abgesehen - kranke Leute nur mit ärztlicher Erlaubnis kurieren. Hier spielten nicht nur die Berufsinteressen der Ärzte eine Rolle, sondern auch die öffentliche Sorge um eine halbwegs ordentliche Versorgung der Kranken.
Desgleichen begannen die Behörden die ärztliche Tätigkeiten zu regeln:
Noch bemerkenswerter sind die Anweisungen an die »Ärzteschaft« bzw. diejenigen, die für die Heilung und Gesundung zuständig waren, denn professionelle Ärzteschaft bildete sich erst in einem langen Prozess seit 17. Jahrhundert heraus. Die Adressaten des Staates waren bis dahin »Apotheker, Chimisten, Barbiere, Oculisten, Stein- und Bruchschneider, Storger, Landfahrer, Quacksalber, Bader, Schlangenfänger, Kräuterer, Zahnbrecher, Hirten, Schäfer und Scharfrichter«. Seit dem I7. Jahrhundert wurde deren spezielles »Handwerk« verboten und ihre Tätigkeit sukzessive unter Kontrolle der Obrigkeit gestellt. Erst im 18. Jahrhundert ergingen auf Druck der akademischen Ärzte generelle Verbote für alle Heilkundigen der Jahrmärkte. Nach der Landesordnung von Württemberg 1621 durften sich Barbiere und Bader erst als Wundärzte betätigen, wenn sie von der Obrigkeit als »examiniert, erfahren und darzu taugenlich befunden« worden waren, »alles, das er erlernet hab, aller Wunden Art und Eigenschaften von der Scheitel an dem Menschen bis auf die Fersin hinab, und wiß, was für Wundtrank, Band, Pflaster und andere Nordurft zu jeder Wunden, Schäden und Beinbrüchen gehörig sein, und wisse auch underschidlich zu hailen und guten Unterschid im Hailen zu haben, in Haupt-, Hirn- und beinschrötigen Wunden, tief oder flach Wunden oder Schäden, sie seien im Fleisch, Nerven, Adern oder dergleichen gehauen, gestochen, geschossen, mit oder ohne Geschwulst, schmerzlich oder unschmerzlich. Item, wie und welcher Gestalt mit allerlei Beinbrüchen, Geschweren, Apostemen, alt und neu Schäden, Schützen, Bränden auch andern mehr Krankheiten, der Wundarznei underwerfen, zu handlen seie, und ob deren jeder die gebräuchliche, erfahrne Wundtrank, Simplicia und Composita, Salben, Pfaster, der Bänd, Atzungen und ander nottürftig Arzneien und Instrumenta, zu jeder Wunden, Schäden, Beinbrüchen und allen dergleichen Gebrächen gehörig, kennen«. Zu einer wissenschaftlich-akademischen Ausbildung der Ärzte kam es erst im späten I8. und 19. Jahrhundert (van Dülmen 1992, 240).
Die Kontrolle aller für die Gesundheit und Heilung zuständigen »Künste« bzw. das Verbot an bestimmte Personengruppen, sich als Heilkundige zu betätigen, stand am Anfang der staatlichen Gesundheitspolitik. Bald kontrollierte sie auch die einzelnen ärztlichen Praktiken. Verboten wurde es, »Fieber und Krankheiten durch Kreuzmachung, auch andere in Gottes Wort verbotene Mittel (als dass sie eines und das andere zu sonderbar gewehlten Zeiten und Tagen mit sonderbaren Worten, Bezeichnungen, Segensprechen und anderen dergleichen nichtswurdigen Umstanden, sonderlich bei Kindbetterinnen fürnehmen) zu heilen« (van Dülmen 1992, 241).
Besonderes Augenmerk galt dem Verhalten der Hebammen, und das nicht nur aufgrund der bis in das 18. Jahrhundert extrem hohen Kinder- und Müttersterblichkeit. Die »weisen Frauen« standen im wegen des Verdacht, bei Abtreibungen behilflich zu sein.
In der Ungeschicklichkeit der Hebammen schien ein Hauptgrund der großen Mütter- und Kindersterblichkeit zu liegen. Deswegen verlangte man eine besonders strenge Kontrolle. Im 16. und 17. Jahrhundert sollten in den Städten ehrbare Frauen die Aufsicht übernehmen und seit dem 18. Jahrhundert musste sich jede Hebamme einer offiziellen Prüfung durch ein Ärztegremium unterziehen. Als Hebammen sollten nur »fromme, erbare, gottsförchtige und erfahrne Weiber« genommen werden, heißt es bereits zu Beginn des I7. Jahrhunderts, die zuvor »von den hierzu Verordneten examiniert und erforschet, ob sie in allen Sachen, einer Hebammen zu wissen notwendig, gnugsamlich Wissenschaft« haben. Von einer Hebamme erwartete man aber nicht nur einen ehrbaren Ruf und gute Kenntnisse, sondern auch eine christliche Lebensführung. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sie sich der »leichtfertigen Reden, aller abergläubischen Segen und anderer Abgötterei gänzlich enthalten«, vielmehr die gebärenden Frauen christlich trösten müsse, wozu ein Unterricht bei einem Geistlichen angeraten sei. Wenngleich bei der Ausbildung von Hebammen bis zum Ende des I8 Jahr¬hunderts hin die wissenschaftlichen Kenntnisse immer in den Vordergrund ruckten - es wurden eigene Kollegien eingerichtet - legte doch der Staat auch weiterhin ein starkes Gewicht auf ihre moralische Qualifikation. Nach einer Verordnung von I776 mussten in Gotha Hebammen folgenden Eid leisten:
»Ihr sollet geloben und schwören, dass ihr eurer vorgesezten Obrigkeit in allem treu und gewärtig seyn, euch in eurem anbefohlenen Amt fleißig, sorgfältig, und verschwiegen erweisen, eines christlichen und ehrbaren Wandels befleißigen, alle abergläubische Händel fliehen und meiden, wenn ihr zu kreisenden Weibern erfordert werdet, alsobald ohnweigerlich und ohne Verzug bey Armen so wohl als bey Reichen, erscheinen, und ihnen nach äußersten Vermögen beyspringen, in schweren Fällen andere erfahrene Hebammen und die Medicos zu Rathe ziehen, die schwachen Kinder alsobald mit der heiligen Taufe versehen lassen, oder im Nothfall selber taufen, zu Abtreibung oder Verderbung der Frucht nicht rathen, noch behülflich seynn, und allem denjenigen was in der Medicinal-Ordnung euerthalben erwähnet worden, treulich nachkommen wollet« (van Dülmen 1992, 242).
Schon im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert erkannte man den Zusammenhang zwischen dem Dreck auf den Straßen und der Krankheitsanfälligkeit der Menschen vor allem bei Seuchen. Aus diesem Grund drängte die Obrigkeit auf die Erhaltung »einer guten und gesunden Luft« durch Reinigung der Straßen sowie die Verlegung der Friedhöfe an den Stadtrand. Besonders die Misthaufen vor den Häusern sollten verschwinden, Karren und Wagen so gebaut werden, dass kein Mist mehr auf die Straße fiel (ebd.)
Inhaltsverzeichnis
Im 18. Jh. liefern lokale Professoren wie Augustin Schelle[78] (1792 - 1805) die ideologischen Grundlagen für den gesellschaftlich-politischen Umgang mit sozialer Not in Stadt und Land Salzburg. Schelle betrachtet als »Arme« diejenigen Menschen, »die aus Mangel an Glücksgütern, den größten Theil der äußerlichen Bequemlichkeiten oder gar den nöthigen Lebensunterhalt sich nicht verschaffen können«. Dabei wird unter-schieden zwischen »wahren Armen, das ist solchen, die durch alle Anstrengungen ihrer Kräfte, durch allen möglichen Fleiß und Thätigkeit sich nicht so viel erwerben können, als zu ihrem Lebensunterhalt und zu einigen der gemeinsten Bequemlichkeiten hinreicht und anderen, die wenn sie nur nicht zu träge wären, sich selbst durch Mühe und Arbeit die Nothdurft und einige Bequemlichkeit verschaffen, und der mildernden Beiträge anderer entbehren könnten« (Veits-Falk 2000, 81). Die Definition folgt in allem den Vorstellungen der liberalen Ökonomen, mit Ausnahme der Tatsache, dass den Armen nun über das bloße Überleben hinaus ein gewisses Maß an »Bequemlichkeiten« zugestanden wird.
Der Aufhebung sozialer Unterschiede wird dabei keinesfalls das Wort geredet, im Gegenteil, der Unter-schied zeigt sich gerade in der Verhältnismäßigkeit der den Armen zustehenden Mittel der Lebensfristung. »Der Arme befriedigt die Bedürfnisse seines Magens durch ein paar Groschen eben so gut, wie der Reiche mit ein paar Thaler. Ein paar Thaler sind also dem Reichen zur täglichen Nahrung ebenso notwendig wie dem Armen ein paar Groschen« (ebd., 83, Anm. 572). Um das aufklärerische Gebot der Gleichheit aller Menschen mit der politischen Doktrin bürgerlicher Vorherrschaft vereinbar zu machen, werden den an sich Gleichen unterschiedliche Bedürfnisse zugedacht, die die ungleiche Behandlung rechtfertigen. Auch sonst legitimiert diese Sozialphilosophie die faktische Sozialpolitik des frühkapitalistischen Staates. Zwar dürfe die Obrigkeit das Almosengeben nicht verbieten, denn "dann würde sie ein zentrales menschliches Bedürfnis, nämlich Notleidende zu unterstützen, verletzen". Sie dürfe es aber dann, wenn die Notleidenden in einer staatlichen Anstalt versorgt würden. Dann sei es sogar "staatliche Pflicht, den Bettel abzustellen" (ebd., 83).
Bemerkenswert aber ist die Abweichung der Begründung der Mildtätigkeit von der christlichen Tradition. Nicht mehr die Nachfolge Christi oder die Verzeihung der Sünden sind die Motive der Barmherzigkeit. Nächstenliebe erwächst nicht aus dem Gebot Gottes sondern aus der Natur des Menschen »Der weise Schöpfer« habe sich »der Selbstliebe bedient, uns auch das Wohl anderer Menschen interessant, ja zum Bedürfnis zu machen [...] Die Neigung, sich mitzutheilen, und das Gute, das man genießt, zu vervielfältigen, ist der Seele so eingepflanzt, als der Trieb, sich zu erhalten« (ebd., 82).
Für den Staat, in Salzburg verkörpert durch den Domherrn und Grafen Spaur,[79] Leiter der städtischen Armenkommission und Autor des Buches »Über die Pflicht des Staates die Arbeitsamkeit zu fördern, die Betteley abzustellen und die Armen zu versorgen« bleibt die Arbeitspflicht die oberste Maxime. Desgleichen für Kaspar J. Stephan in seiner Schrift »Bewährte Vorschläge und Hülfsmittel zur Verminderung und Abhülfe der Noth und des Brodmagels unter den Armen«:
Läßt man Arme faulenzen; so verdienen sie nichts! Es fehlet ihnen also ganz das Mittel sich auf die einzig erlaubte Art Brod zu verschaffen. Die Arbeitsamkeit sollte also überall bey den Armen betrieben werden. Es ist also doch nicht hübsch, dass man sie haufenweise lieber betteln als arbeiten und dadurch etwas verdienen läßt (ebd., 85).
In diesen und andern Schriften begegnen wir der üblichen Armenschelte. Die Armen sind »träge, unbetriebsam und unbehülflich« und »auf keinen Fall darf man jemanden, der sich mit einer Arbeit nähren könnte, müßig gehen lassen« oder die milde Gabe zu einer »Belohnung der Arbeitsscheu, ein Reiz zum betteln« verkommen lassen (ebd., 85 ff.). Noch die Berichte seiner Armenfürsorger über höchst unhaltbaren Zustände nimmt Graf Spaur als Beleg für die »Wahrheit«, dass es den unwürdigen Armen besser geht als den wahren Armen. 1802 vermerkt das Protokoll der Armenkommission,
dass durch die fleißige Nachsuchung in den Wohnungen der Armen vorgefundene Noth außerordentlich ist. Mehrere Familien, vorzüglich erkrankte Weibspersonen wurden ohne Bett, mit verfaulten Lumpen zugedeckt, in verfaultem Stroh liegend und in Zimmern gefunden, in denen der Gestank unerträglich war. Auch Kinder, die jenen Kranken betteln mußten, fand man in dem vernachläßigsten Zustand bey diesen. Überhaupt erprobt sich die Wahrheit, dass der weniger dürftige und Bettler beßer, als der wahre Arme lebe, der in gänzlicher Hilflosigkeit, ohne dass sein erbärmliches Schicksal bekannt wird, verschmachten muß.' (ebd., 115).
Einfühlsame Anteilnahme am Los der Bettler ist rar. Immerhin zeigt sich der Stiftungsverwalter Josef Kendler »betroffen, wenn man durch an jene reichlichen Unterstützungen das Elend keineswegs behoben, wenn man ganze Scharen von Bettlern regelmäßig durch die Strassen streifen sieht, wenn man überall, und täglich von den Klagen der Noth gerührt wird«. Noch die bitterste Not weiß die bürgerliche Scheinmoral zur Bestärkung der von ihr arrogierten Grundsätze der Ordentlichkeit und Bescheidenheit zu verwerten, indem sie diese Tugenden den einen Armen in übertriebener Form zuspricht, um sie den anderen umso mehr absprechen zu können. Der würdige Arme, weiß das »Salzburger Intelligenzblatt« 1809, »fühlt seine Menschenwürde, die der Bettler bereits weggeworfen hat«, er »begnügt sich mit Wenigem«, er »wird den Anderen sicher nicht mit Bitten lästig fallen«. Er arbeitet, »so lange er durch Arbeiten sich nähren kann [...] Kommt es so weit, dass er zur fremden Unterstützung seine Zuflucht nehmen muß, so geschieht dieß mit Schamhaftigkeit. Ein saures Geschäft ist ihm das Almosensammeln und Almosennehmen« (ebd., 116). Anliegen dieses rührseligen Armenlobes ist nicht das Mitleid mit den Armen, sondern die propagandistische Ächtung des Bettelns. Nur der Arme, den man nicht sieht, ist ein würdiger Armer. Das ebenso rührselige Motiv, dass die Armen den noch Ärmeren von dem Wenigen geben, das sie haben, ist ein beliebtes Motiv der bürgerlichen Malerei (ebd., 154 ff.).

Bild: Der Pfennig der armen Witwe (Danhauser 1839). Aus: Veits-Falk 2000
Wie anderswo auch war das Hauptaugenmerk der öffentlichen Behörden auf die Bekämpfung des Bettler-wesens gerichtet, das während der bayrischen Regierung (1810 - 1816) ihren Höhepunkt erreichte. Aufgegriffene Bettler wurden mit der Aufschrift »Bestrafter Bettler zur Genugthuung für das Amt und das Publikum« vor dem Polizeihaus aufgestellt(ebd., 176). Vor 1800 mussten aufgegriffene Bettler in Salzburg mit Brandmarkung und Körperstrafen rechnen. Die österreichische Herrschaft setzte 1834 ein Kopfgeld von 6 Kronen für jeden ergriffenen Bettler aus, das Pflegegericht Zell am See drohte ertappten Spendern Strafen bis zu drei Gulden an. Sternsingen, Neujahrssammlungen und der »Brandbettel«, der so genannten »Abbrändlern« zustand und häufig von durch diese beauftragten und nicht immer ehrlichen Sammlern durchgeführt wurde, wurden verboten. An Durchzugsstraßen, Kreuzungen und Stadttoren wurden Tafeln angebracht, die in Wort und Bild verkündeten, dass »der Bettel bey Vermeidung des Schubs und anderweitiger Strafen verbothen sey«. Bettelvögte, Bettelrichter oder Gerichtsdiener waren mit der »Säuberung« der Straßen von »liederlichen und unerwünschten Personen« beauftragt. Sie durften aber selbst keine Verhaftungen vornehmen, waren allgemein verhasst, schlecht bezahlt und häufig bestechlich. Fremde Bettler erhielten einen »Laufzettel« mit der kürzesten Route in ihre Heimatgemeinde und wurden abgeschoben (ebd., 175 ff.).
Immer wieder wurde die "übertriebene Wohltätigkeit der Bevölkerung" (ebd., 176) als Ursache der Zunahme des Bettelwesens kritisiert. Das Gegenteil war freilich der Fall. Es war die mangelnde Versorgung der Armen, die so viele Menschen zwang, betteln zu gehen. "Manche Gemeinden tolerierten das Betteln nicht nur, sondern verwiesen ihre Armen sogar ausdrücklich darauf, um Kosten zu sparen". So wies etwa der Armenvater von Bramberg im Pinzgau den Vater einer fünfköpfigen Familie an »sich seine Subsistenz durch Bitten von Haus zu Haus zu suchen« (ebd., 177).
In besonderer Weise von der Not betroffen waren weibliche Arme und ihnen galt auch die besondere Schelte der Zeitgenossen, in der sich die allgemeinen Vorurteile gegenüber »Weibsbildern« mit den besonderen gegenüber Armen verbanden. Faulheit, Liederlichkeit und sexuelle Lasterhaftigkeit wurden den Bettlerinnen in besonderem Ausmaß nachgesagt. Die Vernachlässigung der Kinder, aus denen nur wieder Arme, Diebe oder, was die Mädchen betraf, Dirnen werden konnten, die »der Arbeit entwöhnt« und »zum Dienen nicht mehr fähig« waren galt die Entrüstung und Sorge der Zeitgenossen (ebd., 121 f.).
Fremden Bettlern aus Böhmen und Ungarn oder dem »Gesindel aus Tirol, das sich [...] einschleicht« (ebd., 128) gegenüber war die Einstellung der Bevölkerung ambivalent. Einerseits galten sie als besonders aggressiv und grob, andererseits waren die Einheimischen "auch von sich aus an den Fahrenden, besonders an Tauschgeschäften mit ihnen interessiert: Geschirr, Stoffe, Strickwaren, Bänder, Tabak, Gewürze und dergleichen, aber auch Nachrichten und Unterhaltung wurden gegen Geld, Nahrungsmittel und das Gewähren einer Unterkunft ausgetauscht".
Angesichts der seit der Säkularisierung des geistlichen Kurfürstentums (1802) mit wechselndem Kriegs-glück mehrmals wechselnden Herrschaften ist die staatliche Armenbetreuung Stückwerk geblieben (ebd., 133 ff.). Bereits 1668 hatte Erzbischof Max Gendorf von Kuenberg die erste »Commission« zur Verteilung des Almosens begründet, durch die die »Armenbeschau« eingeführt wurde und Arbeitsfähige von der Unterstützung ausgeschlossen werden sollten. 1785 und in einem zweiten Anlauf 1799 setzte der letzte regierende Erzbischof, Hieronymus Graf Colloredo neuerlich eine Armenkommission ein. Er war es, der den Domkapitular Friedrich Graf von Spaur zu ihrem Vorsitzenden ernannte. Eine erste Armenkonskription er-mittelte in der Stadt, die damals ca. 25.000 Einwohner hatte, ca. 630 Unterstützungswerber, deren Anspruchsberechtigung nun genauestens geprüft wurde. "1802 mussten für das Ansuchen um eine Unterstützung bereits der Taufschein, die Aufenthaltsbewilligung, das Dienstzeugnis und eventuelle ärztliche Atteste vorgelegt werden. Die städtischen Viertelmeister hatten zuerst schriftlich Auskunft über die Lebensumstände des Armen zu geben, danach entschied die Kommission, ob der Bedarf zu einer Beihilfe bestand und traf die entsprechenden Anweisungen (ebd., 135).
Neben dem »Gemeinen Stadtalmosen«, das sich aus Spenden, Vermächtnissen und Strafgeldern speiste, wurde die Almosenkasse aus Staatszuschüssen, Steuergeldern und verschiedenen Gebühren (Tanzgelder, Tabakabgaben, Lottosteuer, Getreideschilling) gefüllt. Stets durch den Ansturm Bedürftiger überfordert, versuchte die »Almosens Austheilungs Kommission«, wie sie sich selbst einmal ironisch bezeichnete (ebd., 138) irgendwie der Lage Herr zu werden, ohne das Ausmaß der Armut wirklich verringern zu können. In Suppenanstalten wurde an tausende Arme die so genannte »Rumfordsuppe« ausgegeben, benannt nach dem englischen Physiker Benjam Thompson, Graf von Rumford, der in Bayern die Kartoffel und Massen-ausspeisungen für die Armen mit dieser besonders nahrhaften Suppe eingeführt hatte.
Während der bayrischen Herrschaft (1810 - 1816) wurde durch die Erfassung des Stiftungsvermögens, das freilich auch zur Sanierung der Staatsfinanzen verwendet wurde, die Erhebung der Armen sowie durch die Einführung von »Subskriptionsbücher«, in die regelmäßige monatliche Spenden eingetragen wurden, ebenso die Bürokratisierung vorangetrieben wie die Mittelbeschaffung verbessert, Errungenschaften die während der folgenden Herrschaft der Habsburger wieder vernachlässigt wurden. Die Armenkasse hatte immer weniger Geld zur Verfügung, die allgemeine Not stieg, ebenso die Hürden, die Arme zu überwinden hatten, um eine Unterstützung zu erhalten. 1816 wurde eine Kommission »zur Anschaffung von billigem, minder edlen, aber doch gesundem Brot eingerichtet« (ebd., 143), das dreimal in der Woche in zwei Salzburger Bäckereien an die Armen ausgegeben wurde Das billige Brot holten sich nur die Allerärmsten, das waren 1947 immerhin ca. 150 am Tag, das ebenfalls billige Pferdefleisch, dessen Verkauf in Salzburg und Hallein erlaubt wurde, fand dagegen "bei jeder Schlachtung reißenden Absatz" (ebd., 145). 1849 wurde die Armenfürsorge den Gemeinden übertragen und die Hürden zur Erlangung einer Unterstützung wurden weiter erhöht.
1861 traf die Armen- und Stiftungssektion folgende Anweisungen bezüglich der offenen Armenpflege, die wiederum Ausdruck von stärkeren Bürokratisierungsbestrebungen und strengeren Kontrollmaßnahmen sind. Die städtische Stiftungsverwaltung sollte zuerst einen »Abhörungsbogen« ausfüllen und dann von den Parteien zum Pfarrer gebracht, von diesem dem Bezirksvorsteher, beziehungsweise dem Stadtarzte zugetheilt und dann der Verwaltung zum Behufe der Vorlage an die Armenkommission übermittelt werden«. Anschließend sollten die Unterstützungswerber in Hinkunft »ohne Unterschied und mit alleiniger Ausnahme von Krankheitsfällen« ihre Bitten mündlich vor der Armenkommission vortragen und ihre Unterstützung beim Bezirksvorsteher selbst abholen« (ebd., 145).
Anspruchsberechtigte Arme konnten ein »bestimmtes«, d.h. regelmäßiges Wochenalmosen in Form eines festen Geldbetrages erhalten oder gegen Vorlage eines Almosenbillets ein »unbestimmtes« in Form von Nahrungsmitteln, Kleidung und Arznei.
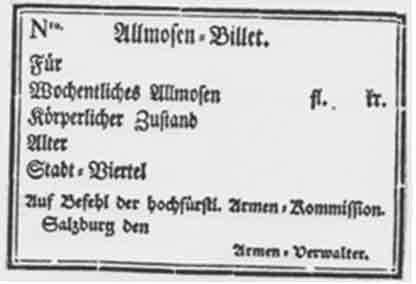
Bild: Almosen-Billet, Salzburg. Aus: Veits-Falk 2000
1893 übernahm die Stadt Salzburg das Elberfelder System.[80] Es wurden vier Armenbezirke eingeteilt, die von ehrenamtlichen Armenpflegern betreut wurden. Die Tätigkeit der Armenkommission fasst wie folgt zusammen:
Die Armenkommission, als ständige Einrichtung ein Kind der Aufklärung, organisierte die offene städtische Armenfürsorge über einhundert Jahre lang. Sie überstand zwar die diversen Regierungswechsel, reduzierte allerdings ihr Engagement in der Armutsbekämpfung merklich, was auf allgemeine "Zeiterscheinungen" und die personelle Zusammensetzung der Kommission zurückzuführen ist. Idealisten und Praktikern folgten Kommissionsmitglieder, denen die Sorge um das Armenwesen kein echtes Anliegen mehr war, sondern zu deren beruflichen Verpflichtung sie gehörte. Einige fortschrittliche, bereits in der "ersten Phase" der Armenkommission gewonnene, Erkenntnisse wurden nicht weiter verfolgt, geschweige denn ausgeführt. Eine diesbezügliche Ausnahme bildete lediglich die kurze bayrische Regierungsperiode (ebd., 145 f.).
Neben der staatlichen war auch in Salzburg die private und kirchliche Armenfürsorge von großer Bedeutung. Auf kirchlicher Seite war es insbesondere der 'Katholischen Frauenverein', der sich verarmter Frauen und Kinder annahm, sowie die Klöster St. Peter, Nonnberg, das Franziskaner- und Kapuzinerkloster. In der Stadt Salzburg waren Kirchen, Klöster und Friedhöfe Hauptanziehungspunkte für Bettler.
An den Klosterpforten wurde regelmäßig eine warme Mahlzeit ausgeteilt [...] und man konnte bei geistlichen Brüdern und Schwestern stets mit einem Almosen rechnen. Eine regelrechte Ansammlung von Bettlern war am Domplatz anzutreffen. Die Kirchgänger gaben an diesem "heiligen" Ort besonders bereitwillig eine Geldspende, und diese Tatsache nützten professionelle und unfreiwillige Bettler aller Altersgruppen. Für die um Almosen Bittenden war auch wichtig, dass im Bereich der Kirche der Aktionsradius der weltlichen Obrigkeit eingeschränkt war, das heißt die Bettler lebten an diesem Ort vom Widerspruch der tatsächlichen Almosenpraxis und der bettelfeindlichen Abschaffungspolitik der Obrigkeit. Außerdem wurde die in der Hofküche übrig gebliebene Suppe, die so genannte 'Hüttelsuppe', bis 1799 in einer, in den Dombögen befindlichen Hütte an bestimmte Arme, vor allem an ehemalige Hofbedienstete, sowie 2 Portionen Brot, die »Hofrocken« genannt wurden, ausgeteilt. Die Brotspende wurde an diesem Ort noch bis 1804 fortgesetzt und dann in einen monatlichen Geldbetrag von einem Gulden umgewandelt. Am Friedhof war der Gedanke an den eigenen Tod nicht fern; in der Hoffnung, sich durch ein kleines Almosen den Weg in den Himmel ebnen zu können, klingelte auch hier - wie auf Anton Danreiters Ansicht vom Sebastiansfriedhof zu sehen ist - der Geldbeutel häufig. Prozessionen boten neben Hochzeiten und Begräbnissen ebenfalls gute Gelegenheiten, Almosen zu bekommen. Die Salzburger Gassen- und Haustürbettler waren allgegenwärtig. Ständig in Bewegung, nahmen sie innerhalb der Stadt rasche Ortswechsel vor, so konnten sie, wenn sie den Arm des Gesetzes fürchten mussten, rasch untertauchen. Jeden Freitag durchstreifte die Bettelschar, die sich vor allem aus Bettlerinnen mit Kindern zusammensetzte, die Straßen der Städte Salzburg und Hallein, zog in die Häuser und forderte Geld- und Brotspenden. Die mehr oder weniger professionellen Bettler stammten fast ausschließlich aus der Stadt und dem unmittelbaren Umland. [...] Weniger statisch als das Sitzen auf Plätzen und gezielter als der Gassenbettel, wurde der Haustürbettel - häufig bei bekannten Familien - betrieben. Neben den Bettlern auf den Straßen und den "unsichtbaren" Armen in den Häusern gab es noch die armen alten bzw. kranken Menschen, die in den städtischen Versorgungshäusern untergebracht wurden. (ebd., 107).

Bild: Bettler im Sebastiansfriedhof, Salzburg um 1735. Aus: Veits-Falk 2000, 106

Bild: Armenausspeisung in einem Salzburger Kloster, um 1770. Aus: Veits-Falk 2000, 106)
Weltliche Armutsinitiativen wurden von Vereinen wie dem »Museum« oder dem »Rupertusverein« und, nachdem das Vereinsgesetz ab 1867 ihre Gründung erlaubte, auch den Arbeitervereinen getragen. Bei festlichen Anlässen und Staatsbesuchen verteilten weltliche wie geistliche Würdenträger Geschenke oder richteten Stiftungen ein, reiche Bürger "versuchten, sich durch großzügige Spenden an die Armen Anerkennung und Prestige zu verschaffen" (ebd., 154 f.).
Der Seekirchner Selfmademan Mathias Bayrhammer, alias »Geldhiasl«, wurde zur Legende. 111.800 Gul-den, das ist der Gegenwert von 23 städtischen Wohnhäusern, stiftete er bereits zu seinen Lebzeiten, »um von den Zinsen 55 armen, gebrechlichen und erwerbsunfähigen Gemeindemitgliedern der Stadt Salzburg für immerwährende Zeiten den Unterhalt zu sichern und damit die Stadt zu entlasten«, mehr als Doppelte nochmals in seinem Testament (ebd., 156 ff.). Ganz in mittelalterlicher Manier verlangte er dafür die Abhaltung von Seelenmessen, Fürbitten und Gebeten. Das Motiv mag, wie Veits-Falk vermutet, freilich nicht mehr bloß sein Seelenheil gewesen sein, sondern der Wunsch, als großer Wohltäter über seinen Tod hinaus im Gedächtnis zu bleiben.
Bemühungen um eine geschlossenen Armenpflege waren wenig erfolgreich. »Abstine aut sustine« steht noch heute über dem Tor des ehemaligen Pestlazaretts St. Rochus zu lesen, das 1754 als Korrektionsanstalt genutzt wurde: "Leid' oder meid'" (ebd., 182). Weitere Versuche scheiterten meist am Geld, einzig die 1844 vom Verein Museum aus gegründete Beschäftigungsanstalt hielt sich bis 1852. Insgesamt 100 Arbeiter konnten dort VerPfegung, Unterkunft und Lohn erhalten. Eine 1865 von der Gemeinde gegründete An-stalt für 60 bis 80 Personen bestand bis 1883. Mehrere Institute zur Diensbotenerziehung entstanden ab 1850: die Armekinder-Anstalt im Benediktinerinnenstift Nonnberg, die Erziehungs- und Beschäftigungsanstalt für weibliche Dienstboten im Bruderhaus und die Dienstbotenerziehungsanstalt im ehemaligen Waisenhaus Münn. Weitere Anstalten befanden sich in der Festung und im St. Johannschlößl am Mönchsberg (1800 - 1813) sowie neben der freiwilligen Beschäftigunganstalt in Münn (1813 - 1816). Mangels eigener Möglichkeiten wurden Delinquenten in das Arbeitshaus Linz oder St. Martin bei Schwaz in Tirol und bis Laibach verschickt.
Die Einrichtungen für Kranke waren höchst unzulänglich. Die seit dem Mittelalter existierenden Hospitäler befanden sich in einem entsetzlichen Zustand. Das bereits seit 1327 bestehende 'Bürgerspital', in dem verarmte alte Bürger Aufnahme finden konnten, machte 1863 einen so verwahrlosten Eindruck, dass wenn dieses »Haus statt eines Versorgungshauses eine Strafanstalt wäre, die einzelnen Wohungszellen von dem inspizierenden Justiz - Commissär gewiß als der selbst gegen Verbrecher zu übenden Humanität entgegen erklärt und diese Art der Bewohnung abgestellt worden wäre« (ebd., 150).
Daneben gab es seit 1496 das durch die Stiftung der Fleischhauerwitwe Dorothea Glimpf errichtete »Bruderhaus« in der Linzer Gasse, in das erkrankte Dienstboten bis zu ihjrer gesiundung aufgenommen wurden, wobei der Dienstgeber für deren Verpflegung zu sorgen hatte. Durchreisenden Armen oder Kranken wurde ein Aufenthalt von acht Tagen gewährt. Besser gestellte hatten die Möglichkeit, sich einen Alterssitz im Bruderhaus zu kaufen, der ihnen Unterkunft, Verpflegung und Betreuung im Krankheitsfall garantierte. Für geistig Behinderte gab es im Bruderhaus einen »Narrenkäfig« und seit 1562 »Kötter« für »Irre« und »Tob-süchtige«.1898, mit der Eröffnung der vereinigten Versorgungsanstalten in Nonntal, wurde das Brudserhaus geschlossen, 1909 wurde es als Rettungsstation wieder eröffnet, zuletzt diente der »Bruderhof« als Station der Freiwilligen Feuerwehr Salzburg.
Der "Weibertrakt« des St. Erhard-Spitals beim Kloster Nonntal, etwa 1310 von der Äbtissin Margarethe von Gebind errichtet, diente vor allem der Versorgung notleidender Klosterangehöriger, später des Domkapitels, zeitweise aber auch Pest- und Aussatzkranken. 1678 wurde von Domkapitewl auch ein Der jüngere »Männertrakt« errichtet. 1898 wurden beide Spitäler aufgelassen.
1813 wurde das »Kronhaus«, ein Armenhaus in der Griesgasse errichtet, das ebenfalls 1896 geschlossen wurde.
Noch heute als Landespflegeanstalt betrieben wird das bereits 1272 erwähnte »Leprosenhaus« in der Lehener Straße, das als »Siechenhaus«, »Sondersiechen«- oder »Arme-Sünder-Siechenhaus« durchgehend genutzt wurde.
1898, im Jahr des »glorreichen Regierungsjubiläums Sr. Majestät des Kaisers' Franz Josef« wurde der Neubau eines städtischen Versorgungshauses im Nonntal, eine Landesblindenanstalt, eine Taubstummen-anstalt und eine Irrenanstalt eröffnet.
1844 wurde von Karoline Auguste von Bayern (1792 - 1973), Gattin Kaiser Franz I., die erste »Kinderbewahranstalt« in Hallein gegründet, 1846 jene in der Stadt Salzburg »Kinderbewahranstalt« gegründet, damit die armen Eltern der Kinder arbeiten können, ihre Geschwister »von der Sorge um jüngere Geschwister befreit« und »vor Verrenkungen und Mißgestalt als Folgeerscheinung des Tragens der Geschwister bewahrt« werden und »in die Schule gehen« können und die Kinder selbst »Gesundheit und Kraft« erlangen, sich ihr »Brot einst selbst zu verdienen« (ebd., 153). Die Akzeptanz dieser Einrichtung war enorm: Von 1846 bis 1852 wuchs die Zahl der Kinder von 120 auf 219 an.
Neben der Kinderbewahranstalt war Auguste Karoline die Erziehung weiblicher Dienstboten, die Besserung verwahrloster Knaben in der Erziehungsanstalt auf Edmundsburg[81] am Mönchsberg, sowie die Mädchenerziehung im Kloster der Ursulinen in Elsbethen-Glasenbach ein besonderes Anliegen.
Auf dem Land oblag die Armenfürsorge den Gemeinden. 1827 wurden die bereits um 1790 von einem Privatmann gegründeten »Pfarrarmeninstitute«, denen der Ortspfarrer vorstand, offiziell mit der Sammlung Verteilung der Almosen betraut. Damit hatte sich der josefinische Staat zwar eine kostenlose Organisation verschafft, "die der Kirche die ihr traditionell zugedachte Rolle der tätigen Nächstenliebe übertrug und sie in personeller, erzieherischer und auch sicherheitspolitischer Hinsicht für öffentliche Zwecke heranzog [...] und die Kirche auch zur Mittelaufbringung organisatorisch und religiös-emotional nutzte", allerdings ohne durch-schlagenden Erfolg. "Kirche und Gemeinde schoben sich gegenseitig den größeren Anteil an der Armenunterstützung zu, was aber nicht zu einer Über-, sondern zu einer Unterversorgung der Betroffen führte" (ebd., 169).
Ledige oder elternlose Kinder versuchte man "anzustiften", d.h. bei Bauern am Land oder Bürgern in der Stadt gegen Geld in Pflege zu geben. Nicht immer mit dem Einverständnis der Mütter, denen die Kinder bisweilen mit Gewalt weggenommen wurden. Für die Pflegeltern dagegen war die Anstiftung vorteilhaft. Sie erhielten Geld und eine zusätzliche Arbeitskraft, die, "nach dem zehnten Lebensjahr mehrere Jahre hindurch ihren Zieheltern gegen Kost und Logis dienen" musste. (ebd., 136).
Ein wesentlicher Faktor der Armenverwaltung war das Einlagewesen. Die »Einleger« waren meist ausgediente Bauernknechte und -mägde, die auf den Bauernhöfen oft nur weniger als das Allernötigste erhielten, um ihr Leben fristen zu können. Man warf ihnen vor, die erbettelten Kreuzer gleich wieder zu versaufen und bedauerte, dass sie »als Schwächlinge und körperlich preßhafte Menschen keiner körperlichen Züchtigung unterzogen werden können«. Geistig Behinderte wurden als »ganz geistlose Menschen« verachtet, die »auch durch Straffen nicht wohl zur Ordnung zu verhalten sind« (ebd., 123). Die Salzburger Armenordnung von 1754 verfügte, dass die Bezirksgerichte anerkannten Armen für begrenzte Zeit Unterkunft und Verpflegung bei hiezu fähigen Gemeindemitgliedern zuzuweisen hatten. Die Einleger mussten so von Quartier zu Quartier wandern und waren entsprechend unbeliebt.
Eine jährliche »Musterung« sollte jene aussortieren, die noch oder wieder arbeitsfähig waren und als Dienstboten vermittelt werden konnten. Die Beschreibung der 35 Personen, die das Landgericht Bischofshofen 1784 in die »Bettler Anlegung« aufnahm zeigt beides: die Handicaps der Einleger und die verächtliche Art, wie sie beschrieben werden:
So befanden sich unter den insgesamt 35 angelegten Personen zum Besispiel die »stockblinde« Marai Mayrin, die »etlich 70 Jahr alt« war, die »irrsinnige« 53jährige Magdalena Marhoferin, eine alte Schorr Tochter von Haidberg, die »gegen 60 Jahr alt und wegen Beinbruchs zur Arbeit unfähig war«, Anna Neukamin, die »etlich 50 Jahr alt und stimmloß« war, der 50jährige ehemalige Dienstknecht Simon Lottermoseer der einen Schlaganfan erlitten hatte, Mathias Kenner, ein »krumper Haftelmacher und Fassbinder«, der sechsjährige Sohn des »abgehausten Bäckermeisters« Philipp Gschwandel, ein »natürliches« Kind der ledigen Schuhmacherstochter Margareth Petraschin und der 15jährige »blödsinnige« Blasy Hopfgärtner. (ebd., 167).
Manche Bauern versuchten, sich durch Leistung einer Geldunterstützung von der Verpflichtung zur Einlage loszukaufen. Ab 1800 wurde Einlegbauern ein Bettlergeld bezahlt, was zum sogenannten "Armenlizitieren" führte: Die Einleger kamen dorthin, wo am wenigsten verlangt und wo ihnen dann auch am wenigsten geboten wurde. Auch die "Perpetuierung" von Einlegern für längere Zeit, manchmal auf Lebenszeit gegen Kostenersatz wurde gelegentlich ausgehandelt.
Der Einleger war rechtlos, wurde von den zahlreichen Quartierträgern als "lebende Steuer" betrachtet und war der Verachtung aller ausgesetzt. Obwohl sich die Regierung der Problematik des Einlagewesens bewusst war, unternahm sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Versuche, diese Art der Armenversorgung abzuschaffen. Das Kreisamtszirkular von 1827 empfahl die Einlage als nachahmenswerte Institution, 1831 wurde sie durch eine Regierungsverordnung den Behörden als eine, für das Land ideale Versorgung »eingeschärft«. l834 unterstrich ein weiteres Zirkular des Kreisamts die Bedeutung als kostengünstige Einrichtung. Auch als die Armenfürsorge zur Gemeindeangelegenheit erklärt worden war, hielt man weiterhin an der Einlage fest. Eine Abschaffung schien auch schwierig, denn es gab kaum Alternativen. In den wenigen Arbeitshäusern war die Kapazität viel zu gering, um auch nur annähernd eine funktionierende Armenfürsorge gewährleisten zu können. Durch das Armengesetz von 1874 konnte dann auch de iure die Verpflichtung zur Einlage durch Zahlung einer Verpflegsgebühr abgelöst werden. Die meisten Gemeinden hoben in der Praxis von allen Steuerträgen eine Geldumlage für die Einlegerverpflegung ein und bezahlten den Herbergsgebern eine Verpflegsgebühr. Die Einlage von Haus zu Haus hielt sich bis ins 20. Jahrhundert und konnte trotz häufiger Aufforderungen des Landtags ab den 1860er Jahren nicht abgeschafft werden. Erst mit 1. April 1939 wurde sie in Osterreich gesetzlich aufgehoben und lief in manchen Gemeinden dann allmählich aus (ebd., 168).
In Städten und Märkten gab es außerhalb der Stadt Salzburg Spitäler oder Bruderhäuser, an die Hundert an der Zahl, die aber insgesamt nur eine Aufnahmekapazität von höchstens an 1000 Personen hatten und deshalb "kaum eine Verbesserung der ländlichen Armenversorgung" erzielten (ebd., 172).
[78] 1742 - 1805, Rektor der Universität Salzburg
[79] Friedrich Franz Joseph Graf von Spaur, Domherr und Schriftsteller in Salzburg, 1756 - 1821
[80] Ausführliche Darstellung siehe Teil II
[81] Die von den Mönchen zu St. Peter betreute Erziehungsanstalt hatte keinen guten Ruf. Unter Salzburger war es üblich, aufmüpfigen Kindern mit der "Edmundsburg" zu drohen.
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte Tirols und Südtirols ist auf das Engste mit der Zugehörigkeit zu wechselnden Reichen, Herrschaften und Staaten verbunden:
|
ab 59 v.u.Z. |
Römische Provinzen Rätien, Noricum, Ventia et Histeria |
|
ab 479 |
Ostgoten, Franken, Langobarden, Bajuwaren, |
|
6. bis 11. Jh. |
Herzogtum Bayern (Hl. Röm. Reich deut. Nation) |
|
12. Jh. |
Grafschaft Tirol |
|
ab 1363 |
Habsburgerreich |
|
1805 |
Kurfürstentum Bayern |
|
1810 |
Königreich Italien |
|
1813 |
Kaiserreich Österreich |
|
1919 |
Südtirol zum Königreich Italien |
|
1922 |
Italien Mussolinis |
|
1827 |
Teilung in die Provinzen Trient (Trentino) und Bozen (Südtirol) |
|
1939 |
Option |
|
1948 |
Autonomiestatut, Region Trentino - Südtirol |
|
1957 ff. |
Bewaffneter Widerstand |
|
1972 |
Südtirol-Paket: Autonomiestatut für die Provinz Bozen |
Entsprechend diesen wechselnden Zugehörigkeiten veränderten sich auch die sozialen Verhältnisse ein-schließlich des Umgangs mit Armut, Not, Krankheit und sozialer Deprivation.
Der Umgang mit individueller und sozialer Not folgt in Tirol und Südtirol im wesentlichen den Entwicklungen im Rest von Europa. Die Armen des Mittelalters und der frühen Neuzeit wurden durch wohltätige Stiftungen unterstützt, wie jene der Anna Katharina, Gemahlin Leopold V. (1619 -1632 Statthalter von Tirol und Vorderösterreich) und Stifterin des Servitenklosters, dem sie auferlegte, »alle Sonnabende oder Feiertage 3 Armen die Frauentafel und 12 Kr. zu reichen und 14 armen Studenten täglich Suppe und Brot zu verabfolgen« (Armenpflege der Provinzialhauptstadt Innsbruck 1831, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 45).
Erste Einrichtungen öffentlicher Armenversorgung waren Spitäler in den Bezirken und Städten, »von wo aus ain jedes gericht seine arme Leut« versorgen sollte (Beimrohr 1988, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996,36), z.B. das von Kaiser Maximilian errichtete Kaiserspital, Haus Nr. 3 am Domplatz in Innsbruck. Mit Spitälern in unserem heutigen Sinn sind diese Einrichtungen nicht zu vergleichen. In ihnen befanden sich Menschen aller Lebenslagen, Kranke, Arme, Waisenkinder, Alte, Gebrechliche usw. Oberster Zweck war die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Reinigung der Stadt und des Landes von allen un-sauberen und störenden Elementen. »Ain solche Ordnung soll mit den armen gehalten werden, es sol niemant von haus zu haus petteln gen, damit lotterei, viel unnutz volk, das wol arbeiten mag, abghert wird", heißt es in der Ordnung des ersten Innsbrucker Stadtspitals, das 1307 am Marktgraben eröffnet wurde. Wöchentliche Arztbesuche gab es erst seit 1630. Noch 1816 finden sich im Parterre des Spitals »neun Behältnisse für Wahnsinnige; 40 Betten sind von alten, blödsinnigen, z.T. unheilbaren Pfründnern besetzt« (Universität Innsbruck 1969, 20, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 100). 1817 wurde das Spital der Medizinischen Fakultät übergeben, 1869 wurde der Neubau der Innsbrucker Klinik am heutigen Standort eröffnet.
Seit dem 16. Jahrhundert schrieben Almosenordnungen die Versorgung der Armen den Geburtsgemeinden vor. Anspruch hatte wer mindestens 10 Jahre ansässig oder im Dienst war. Der Bettel wurde auch in Tirol und Südtirol massiv eingeschränkt. Es wurden Bettelzeichen aus Blei ausgegeben, um die berechtigten von den unbefugten Bettler/innen zu unterscheiden, die nachhaltig verfolgt und bestraft wurden. Bewaffnete Aufseher machten regelmäßig "Jagd auf Bettler, Vaganten und ähnliches Gesindel" (Schadelbauer 1958, zit.n. ebd., 40). Wer erwischt wurde, wurde geprügelt und mit einem "T" auf der rechten Schulter gebrandmarkt, es sei den es handelte sich um einen jungen Bettler: dann begnügte man sich mit Prügeln und fünf Tagen Arrest. Gewohnheitstäter landeten im Kräuterhaus am Innsbrucker Domplatz, von 1514 bis 1889 landesfürstliches Gefängnis, so benannt, weil dort der beliebte Kräuterwein hergestellt wurde, oder auf einer Galeere im Mittelmeer.
Seit 1725 existiert auch in Innsbruck ein Zucht- und Strafarbeitshaus, das heutige Turnusvereinshaus in der Innstraße, unterschieden in eine freiwillige und eine zwangsweise Anstalt. »In die erstere werden Leute wegen beharrlichen Müßigganges, wegen fortgesetzten unsittlichen Wandels oder wegen Gewohnheitsbettelns abgegeben. Die freiwillige Anstalt verschafft Arbeit im Hause, oder sie behielt die Armen mit rohen Stoffen zur Verarbeitung in ihren Wohnungen gegen einen angemessenen Lohn. Die gewöhnlichste Beschäftigung ist das Spinnen und Weben« (Staffler 1842, 444, zit.n. ebd., 42). Die Intention des Hauses ist dieselbe wie anderswo. »Kein Plan den Armen Hülfe zu bringen verdient Berücksichtigung«, heißt es in der ersten Innsbrucker Armenordnung, »wenn er nicht dahin abzweckt, sie in den Stand zu setzten, dieser Hülfe entbehren zu können« (Armenpflege der Provinzialhauptstadt Innsbruck 1831, (Staffler 1842, 444, zit.n. ebd., 44). Seit 1825 gibt es auch in Schwaz ein Provinzialarbeitshaus.
Über ein organisiertes System öffentlicher Armenfürsorge verfügte Innsbruck seit 1772. Die Armendeputation betraute angesehene Adelige, Bürger und Geistliche mit der Registrierung, Überwachung und Versorgung der Armen und verwaltete den Sadtalmosenfond, in den die Spenden der Innsbrucker/innen flossen, die in Listen erfasst wurden. Das freie Verteilen von Almosen wurde verboten. Ab 1820 wurde die Armen-deputation von der Armendirektion und ihren Kommissionen abgelöst, die nunmehr der Kommunalverwaltung unterstanden. Aus diesen entwickelte sich letztlich das Stadtalmosenamt, Vorläufer des heutigen Sozialamtes. In nicht weniger als 130 Paragraphen regelten die 1830 erlassenen Statuten dieses Amtes den gesellschaftlichen Umgang mit Armut und Not bis in die letzten Details.
Lange Jahrhunderte wurden gesellschaftliche Randgruppen, Arme, Bettler, Vaganten, Narren und Kriminelle unterschiedslos in allen Einrichtungen interniert. "Es ging darum, die Sicherheit des Landes zu bewahren und die Straße vom "Gesindel" zu befreien. Der extreme Pauperismus der frühindustriellen Zeit brachte die Menschenmasse hinter Schloss und Riegel und ließ die bestehenden Leprosorien, Armenhäuser, Arbeitshäuser, Zucht- und Strafarbeitshäuser aus allen Nähten platzen" (Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 47). Als erste wurden die "Narren" aus der Menge der Ausgesonderten nochmals ausgesondert. 1784 In Wien wurde auf dem Gelände des Allgemeinen Krankenhauses der noch heute - als Museum - bestehende Narrenturm errichtet, weitere Irrenanstalten folgten in allen Reichsteilen, auch in Tirol und Südtirol
Auch die Geschichte der institutionellen Behandlung der Irren und der Psychiatrie in Tirol und Südtirol folgt im Wesentlichen dem Verlauf in anderen Ländern Europas, wie er bei Foucault (1973) oder Dörner (1984) beschrieben wurde. Sie ist demnach eine Geschichte der Einsperrung und Ausgrenzung mit zum Teil barbarischen Methoden und auch für Italien gut dokumentiert. In mehreren Büchern hat etwa Giuseppe Pantozzi (1989; 1997) diese Geschichte der Einschließung und Ausschließung der Wahnsinnigen beschrieben. Die folgende Darstellung orientiert sich vor allem an der Zusammenfassung in den Arbeiten von Getraud Egger (1999) und Juliane Halper-Zenz / Angelika Presslauer (1996).
Die Absonderung der geistig Behinderten hat nach Foucault ihre Vorläufer in den unzähligen Leprosorien des Mittelalters, in denen die Leprakranken von der übrigen Bevölkerung abgesondert wurden. An die 19.000 solcher Häuser soll es im Europa des 13. Jahrhunderts gegeben haben und die Mehrzahl von ihnen stand nach dem Verschwinden der Lepra im 15. Jahrhundert leer. "Die Lepra verschwindet, die Leprakranken sind fast vergessen, doch die Strukturen bleiben. Oft kann man an denselben Orten zwei oder drei Jahrhunderte später die gleichen Formeln des Ausschlusses in verblüffender Ähnlichkeit wiederfinden. Arme, Landstreicher, Sträflinge und ‚verwirrte Köpfe' spielen die Rolle, die einst der Leprakranke innehatte" (Foucault 1973, 23). Zwei Jahrhunderte später übernimmt der Wahnsinn die Rolle der Lepra "als Heimsuchung in den Ängsten der Menschen" und ruft "gleich ihr Reaktionen der Trennung, des Ausschlusses und der Reinigung" hervor (ebd., 25).
In den Jahrhunderten dazwischen war die Ausgrenzung der "Wahnsinnigen" nicht minder rigide, wenn auch in anderen Formen. Eine davon ist das Narrenschiff, eigentlich ein Motiv heroischer oder satirischer Literatur - am bekanntesten das 1494 erschienene Narrenschyff ad Narragoniam von Sebastian Brant - dem aber eine grausame Wirklichkeit entsprach: "Diese Schiffe, die ihre geisteskranke Fracht von einer Stadt zur anderen brachten, gab es wirklich. Es geschah oft, dass die Irren ein Wanderleben führten. Häufig jagte man sie aus der Stadt und ließ sie in der freien Landschaft umherlaufen, wenn man sie nicht einer Gruppe von Händlern oder Pilgern anvertraute" (ebd., 25 f.). Diese ließen sie häufig in irgendeiner Stadt zurück, wo ihr Schicksal von neuem begann. Wie etwa ein Mann wie Martin Luther über den Umgang mit geistig Behinderten dachte, sieht man an einer Episode aus seinen Tischgesprächen:
Vor acht Jahren war zu Dessau eins das ich, Doctor Martinus Luther, gesehen und angegriffen hab, welches zwölf Jahr alt war, seine Augen und Sinne hatte, dass man meinete, es wär ein recht Kind. Dasselbige thät nichts, denn es nur frass, und zwar so viel als irgend vier Bauern oder Drescher. Es frass und schiss und seichte, und wenn man es angriff, so schrie es. Wenns übel im Haus zuging, dass Schaden geschah, so lachte es und war fröhlich, gings aber wohl zu, so weinete es. Diese zwo Tugend hatte es an sich. Da sagte ich zu dem Fürsten von Anhalt: Wenn ich da Fürst oder Herr wäre, so wollte ich mit diesem Kinde in das Wasser, in die Molde, so bei Dessau fleusst und wollte das homicidium wagen! Aber der Kurfürst zu Sachsen, so mit zu Dessau war, und die Fürsten zu Anhalt wollten mir nicht folgen. Da sprach ich: So sollten sie in der Kirchen der Christen ein Vaterunser beten lassen, dass der liebe Gott den Teufel wegnehme. Das thäte man täglich zu Dessau; da starb dasselbige Wechselkind im anderen Jahre danach. Also muss es da auch sein. Als Luther darauf gefragt wurde, warum er solches gerathen hätte, antwortete er, dass er's gänzlich dafür hielte, dass solche Wechselkinder nur ein Stück Fleisch, eine massa carnis, seien, da keine Seele innen ist, denn solchs könnte der Teufel wohl machen, wie er sonst die Menschen, so Vernunft, ja Leib und Seele haben, verderbt, wenn er sie leiblich besitzet, dass sie nicht hören, sehen, noch etwas fühlen, er machte sie stumm, taub, blind. Da ist denn der Teufel in solchen Wechselbälgen als in ihrer Seele« (zit.n. Halper-Zenz/Presslauer 1996, 13).[82]
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts übernimmt das Thema des Wahnsinns die Rolle, die in den großen Pestzeiten der Tod innehatte. In Erzählungen und Satiren, in Beschwörungen, akademischen Reden und ausgelassenen Narrentänzen beginnen die Aufführungen des Wahnsinns die zentrale Rolle zu spielen. Die Erfahrung des Todes hat quasi als permanente Erfahrung der Nichtigkeit das gesamte Leben ergriffen. Es geht nicht mehr bloß um das memento moris, um die Mahnung der Menschen an die Unerbittlichkeit des zu erwartenden Todes, sondern um die Zeichen des Endes der Welt überhaupt: "Das Ansteigen des Wahn-sinns, seine stumme Invasion zeigt, dass die Welt ihrer letzten Katastrophe nahe ist" (ebd., 35). In einem dreitägigen Mysterienspiel aus dem Jahr 1495, das in Bozen alljährlich in der Karwoche aufgeführt wurde, "sind der Glaubensabfall, die Dummheit, Blindheit, Wut und Maßlosigkeit Ausdruck des Dämonischen und der Besessenheit. Damit entziehen sich diese Verhaltensweisen der eigenen Verantwortung, sind noch nicht psychologisiertes, eigens und selbst verursachtes Laster" (Egger 1999, 3).
Im 16. Jahrhundert bildet sich die Wahrnehmungsform des Wahnsinns heraus, die für die folgenden Jahr-hunderte, wenn nicht bis heute, prägend geblieben ist: Sie besteht in der Koppelung des Wahnsinnsbegriffes an den Begriff der Vernunft. In der Tat können wir seitdem Wahnsinn nicht anders denken als das Gegenteil der Vernunft, wobei wir die Vernunft als das stabile Maß konzipieren, von dem der Wahnsinn abweicht. Foucault vermag dagegen zu zeigen, dass das Verhältnis zwischen Wahnsinn und Vernunft historisch ein wechselseitiges ist: "Der Wahnsinn wird eine Bezugsform der Vernunft, oder vielmehr Wahnsinn und Vernunft treten in eine ständig umkehrbare [besser: reziproke, B.R.] Beziehung, die bewirkt, dass jede Wahnsinnsform ihre sie beurteilende, bemeisternde Vernunft findet, jede Vernunft ihren Wahnsinn hat, in dem sie ihre lächerliche Wahrheit findet. Wahnsinn und Vernunft werden aneinander gemessen, und in dieser Bewegung reziproker Beziehungen weisen beide einander ab, stützen sich aber gegenseitig" (Foucault 1973, 51).
Die Etablierung des Wahnsinns als das Gegenteil der Vernunft ist das Erbe erst des 17. Jahrhunderts. Menschen, »deren ohnehin kleines Gehirn durch widerliche Ausdünstungen aus ihrer schwarzen Galle so sehr aufgeweicht wird, dass sie hartnäckig und im Ernst behaupten, sie seinen Könige, da sie bettelarm sind, oder in Purpur gekleidet, da sie nackt sind« - so charakterisiert der Philosoph Descartes (1596 -1650) die Wahnsinnigen (Descartes[83] 1956, 29, zit.n. ebd., 68). Das vernünftige Subjekt, "das sich die Verpflichtung auferlegt, das Wahre wahrzunehmen", muss den Wahnsinn von sich weisen (ebd., 70). Der Wahnsinn und mit ihm die Wahnsinnigen werden aus der Gesellschaft der Vernünftigen ausgeschlossen. Zusammen mit den Armen, den Arbeitslosen und den Kriminellen werden sie in die seit dem 17. Jahrhundert in großer Zahl geschaffenen Häuser der Internierung eingeliefert oder - seltener - in den »Tollkisten«, eigenen Abtei-lungen der Spitäler bzw, in eigens errichteten »Narrentürmen« eingesperrt. Seit der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts ist der Wahnsinn an dieses Gebiet der Internierung und an die Geste, die ihm dieses Gefängnis als seine natürliche Bleibe zuwies, gebunden" (ebd., 71). Unterschiedslos werden die Wahnsinnigen den Störenfrieden zugezählt, die in den Zuchthäusern (s.o.) zu Arbeit und Ordnung umerzogen werden sollen.
Seit dem 16. Jahrhundert existieren in Italien gesonderte Anstalten für infermi di mente, wie sie etwa in der 1548 in Rom gegründeten Casa di Santa Maria della Pietà, einer Gründung der Jesuiten, genannt werden. Für die Irren, die »nackt durch die Stadt gehen, ausgelacht, geschlagen werden« sei es, wie es in der Anerkennungsbulle Papst Pius IV heißt, nötig, »in ein Haus aufgenommen zu werden, das mit Betten und anderen notwendigen Dingen ausgestattet ist« (zit.n. Egger 1999, 14). Eine gezielte Behandlung der »auf liebe-volle Weise« dem Krankenhaus zugeführten Irren lag nicht in der Absicht und wohl auch nicht in den Möglichkeiten der Patres, vielmehr sollten diese, vielfach wohl obdachlose Arme und Vaganten, durch das Gebet geläutert und geheilt werden.
In Florenz, Bologna, Genua, Mailand, Parma und Reggio Emilia entstehen im 17. Jahrhundert ähnliche Anstalten, allesamt keine medizinischen Einrichtungen, sondern solche, die Ordnung schaffen sollen. "Alle Anstalten erfüllen eine Rolle der Fürsorge und der Repression, haben einerseits die Aufgabe, den Armen zu helfen und enthalten andererseits aber auch Kerkerzellen, in denen die Menschen wie Tiere gehalten werden" (ebd., 15). »Für den Fall, dass es Ketten, Fesseln und andere Mittel braucht, um sie zu binden", heißt es im Statut der Verwahranstalt »Santa Dorotea« in Florenz, 1643 von den Karmelitern gegründet, sind »auch diese von den Patienten mitzubringen«. Über die Einhaltung der Ordnung habe der Leiter der Anstalt zu wachen, der auch »die Schlüssel der carceri« verwahrte und allein über die Aufnahme von »Geistes-kranken beiderlei Geschlechts, ohne Unterschied des Standes, des Vermögens und der Herrschaftszuge-hörigkeit« entschied (ebd.).
Am Ende des 18. Jahrhunderts ändert sich die gesellschaftliche Wahrnehmung des Wahnsinns neuerlich, und damit auch der Umgang mit den Betroffenen. In den nun entstehenden Irrenanstalten oder Asylen, die ausschließlich den »Geisteskranken«, so die neue Bezeichnung, vorbehalten sind, sollen diese nicht bloß eingeschlossen, sondern auch medizinisch und psychologisch behandelt werden. Ob dadurch "die Irren von ihren Ketten und Käfigen befreit wurden", bezweifelt Foucault: "In den Mauern solcher Internierungshäuser trafen Pinel und die Psychiatrie des neunzehnten Jahrhunderts die Geisteskranken an; obwohl sie sich rühmten, sie »befreit« zu haben, behielten sie - das sollten wir nicht vergessen - die alten Internierungs-praktiken bei" (Foucault 1973, 71). Die oberste Maxime ist neben der Behandlung der Kranken immer noch deren Zurückführung in den Schoß der gesellschaftlichen Ordnung, in der sie dem Gemeinnutzen dienen sollen. »Die schönste, die erhabenste Pflicht des Arztes gegenüber der Gesellschaft ist es«, schreibt der französische Außenminister Edouard Thouvenel,[84] »durch seine philanthropische Kunst allerorten und je-derzeit nicht nur um die Erhaltung der gesellschaftlichen Gesundheit oder, wo sie verloren, um ihre Herstellung zu ringen, sondern überdies die Moral auf festen Boden zu gründen und der Obrigkeit anzuzeigen, wie der Müßige zur Arbeit, der Lasterhafte zur Tugend und der Arme zu Wohlstand und Glück zu bringen sei« (zit.n. Egger 1999, 24).
Der Zurückführung zur Ordnung dient die Ordnung der Anstalt. Kinder und junge Mädchen trennt der französische Psychiater Philippe Pinel[85] in seinen Pariser Anstalten, der Bicêtre und später der Salpêtrière, von den Alten, die Arbeitsfähigen von den Kranken, die Frauen von den Männern und die Wahnsinnigen nach ihren Symptomen, die "Tobenden" von den "Manischen" und den "Depressiven" usw., so als ob die gleichen Symptome die gleichen Ursachen hätten, denen die gleichen Behandlungen entsprächen (ebd., 26). Innerhalb der Asyle gilt eine minutiöse äußere Ordnung, die die innere Ordnung bei den Kranken wieder herstellen soll. Das alles wird garantiert durch die absolute Autorität des Arztes. "Da der Wahnsinn Unordnung, Charakterleere und Willenlosigkeit ist, muss der Kranke zunächst einen fremden, aber vernünftigen Willen (die Vernunft des Arztes) verinnerlichen und dadurch seine eigene Unruhe und Unordnung bezwingen" (ebd., 27). Pinel: »Stets muss ihrer Vorstellung ein einheitlicher Mittelpunkt von Autorität gegenwärtig sein, damit sie lernen, sich selber zu beherrschen und ihr heftiges Wesen zu zähmen. Ist aber dieses Ziel erreicht, so heißt es nur noch ihr Vertrauen und ihre Achtung zu gewinnen, um sie mit dem Abklingen der Krankheit und dem Einsetzen der Genesung zum vollständigen Gebrauch ihrer Vernunft zurückzuführen« (zit.n. ebd., 27 f.).
Wenn auch die überkommenen Methoden der Absonderung und der Einschließung der Geisteskranken fortgesetzt werden, so scheinen in den Methoden der Behandlung doch auch neue Gesichtspunkte aufzutreten. So wendet sich etwa Vincenzo Chiarugi, Facharzt für Haut- und Geisteskrankheiten, der 1785 die Leitung der altehrwürdigen S. Dorothea in Florenz übernahm, gegen die Praktiken der "Ketten, Verwahrung und Überwachung" (ebd., 31) und fordert den Respekt gegenüber den Kranken. Geisteskrankheiten sind nach Chiarugi Krankheiten des Körpers, des Gehirns, die durch chemische und physikalische Mittel geheilt werden können. Aber selbst dort, wo ein humanerer Umgang propagiert wird, ist die Behandlung der Kranken noch immer grausam genug: "Die Mittel der Wahl sind: Opium, Äther, Nieswurz, [...] kalte Duschen, heiße Bäder, Abführmittel, Schläge mit Brennessel, usw. Die Ketten der unruhigen Patienten ersetzt er durch Lederriemen" (ebd., 32).
1813 erlässt der von Napoleon eingesetzte Regent des Kaiserreiches Neapel ein "Gesetz zur Betreuung der Irrsinnigen, in dem [...] weder von der Gefährlichkeit der Irren noch vom vorbeugenden Schutz der Gesellschaft oder der Verpflichtung zur Überwachung und erst recht nicht von den Polizeimaßnahmen die Rede ist. Als Ziel der Reform der Gesundheitsvorsorge für die Irrsinnigen wird auch hier die Heilung angegeben" (ebd. 33). In der neu gegründeten Anstalt von Aversa bei Neapel dagegen setzen die Ärzte nicht auf Arzneimittel sondern auf psychologische Behandlung, auf "Tanz, Spiel, Theater Musik und Spaziergänge" (ebd.).
Ähnliche Wege beschreitet Pietro Baron Pisani, Leiter der 1824 gegründeten Real casa dei matti (Königliches Irrenhaus) in Palermo. Angewidert »vom unerträglichen Gestank, der von diesen schmutzigen Kerker-zellen« der alten Anstalt ausströmte, sollten die Methoden der neuen Anstalt der »Förderung der Prinzipien der Menschlichkeit« dienen (zit.n. ebd., 34). Wie bei Pinel sollten die Kranken durch Disziplin, Arbeit und Ordnung geheilt werden.
Die Ätiologie und Methodologie der Psychiatrie verlagert sich von der Polizei auf die Medizin und innerhalb dieser auf das organmedizinische Paradigma. Während die Mediziner bis etwa 1800 stets seelische körperliche und soziale Ursachen von Krankheiten annahmen, engt sich eine naturwissenschaftlich verstandene Medizin nun immer mehr auf organische Ursachen ein, auch für Geisteskrankheiten. "Geisteskrankheiten sind Krankheiten des Gehirns", lautete der Lehrsatz Wilhelm Griesingers,[86] eines der Begründer der modernen Psychiatrie. Desgleichen der in Wien und Paris tätige Psychiater Franz Joseph Gall,[87] Begründer der "Kranologie", durch die die Charaktereigenschaften und die Intelligenz einer Person an der Form des äußeren Schädels festgestellt werden sollte.
Die Auffassung, dass Irresein eine Gehirnkrankheit ist, wurde auch von italienischen Psychiatern wie Giovanni Bonacossa[88] (1804 - 1878) in Turin, Francesco Bini,[89] Nachfolger Chiarugis[90] in Florenz, Carlo Livi[91] in Siena und Andrea Verga,[92] Begründer der zu ihrer Zeit berühmten "Mailänder Schule" der Psychiatrie. Nur wenige, wie Serafino Biffi,[93] der die öffentlichen Irrenanstalten seiner Zeit massiv kritisierte und für die Patienten landwirtschaftliche Betriebe und Pflegeplätze bei Familien forderte - "Einrichtungen, für die die Zeit noch nicht reif war" (ebd., 41).
Am Ende des 19. Jahrhunderts kommt es in Italien zu einem massiven Ansteigen der Irrenanstalten, deren Zahl sich zwischen 1874 und 1899 von 37 auf 106 erhöhte. Zur selben Zeit setzten Bemühungen um ein einheitliches Psychiatriegesetz ein, die 1904 in das so geannte »Giolitti-Gesetz«[94] mündeten. Dieses Gesetz, das bis 1978 gültig war, verfügte u.a. (ebd., 44):
Die zeitlich unbegrenzte Zwangseinweisung bei Erregung öffentliche Ärgernisses (z.B. Nacktheit) oder Selbst- bzw. Fremdgefährdung (z.B. Nahrungsverweigerung, Suizidgefahr) durch richterliche Verfügung
Die provisorische Einweisung auf Antrag Dritter durch Richter oder Bürgermeister, die nach 30 Tagen in ein definitive umzuwandeln war
Den Verlust der bürgerlichen Rechte der Eingewiesenen und deren Entmündigung
Die Abschaffung oder zumindest Beschränkung von Zwangsmaßnahmen, wobei nur Dritte, nicht die Kranken ein Einspruchsrecht hatten
Die Entlassung Geheilter oder Gebesserter auf Probe nach Beurteilung durch den Anstaltsleiter und die endgültige Entlassung durch das Tribunal
Seit 1930 wird die Eintragung der Aufnahme in eine Irrenanstalt in das Strafregister eingetragen und eine Anstalt für geisteskranke Rechtsbrecher gegründet. 1931 werden alle Ärzte verpflichtet, Patienten, die »gefährlich sind oder den Verdacht dazu erregten« (Art. 153 der Polizeigesetze, zit.n. ebd., 45) zu melden. Seit 1940 kann die Polizei auf die Register der Irrenanstalt zugreifen. Zunehmend wird die von Geisteskranken möglicherweise ausgehende Gefahr zum bestimmenden Regulativ für ihre Internierung und Behandlung. War ursprünglich die Unterscheidung zwischen Wahnsinn und Normalität eine totale, eine Person zur Gänze erfassende Qualifizierung, so führte die Erkenntnis, dass es auch eine bloß situativ oder partiell auftretende Verwirrung gibt, zu einer neuen Einschätzung der Gefährdung. Diese »Monomanie« genannte Abnormität konnte bei Gesunden oder bei Geheilten jederzeit (wieder) ausbrechen. Die Grenze zwischen Geisteskrankheit und Kriminalität wurde dadurch fließend: "Brandstiftung, Querulanz, Stehlen, Mord, Trinken, erhöhtes Liebesbedürfnis u.v.m. wurden in der Folge zu Monomanien (Pyromanie, Dipsomanie, Erotomanie, Megaölomanie ...) erklärt" (ebd., 46) - eine beinahe grenzenlose Ausweitung der Zuständigkeit der Psychiatrie, die ihr das Verhältnis von Justiz und Psychiatrie verstörte: Während die Richter den Psychiatern die Verharmlosung von Verbrechen vorwarfen, beklagten die Psychiater, "dass sie Wahnsinnige schuldig sprachen" (ebd.).
Die Geschichte der Behandlung Geisteskranker in Tirol und Südtirol bezieht sich vor allem auf die wichtigsten Einrichtungen, die in dieser Region hierfür geschaffen wurden, auf die Spitäler seit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, die Sondersiechenhäuser der Pestzeit und vor allem auf die beiden großen Anstalten in Hall i. Tirol und Pergine im Trentino. Die Verschleppung und Tötung Geisteskranker, der wie überall im "Deutschen Reich" auch in Tirol in Südtirol zahlreiche Geisteskranke zum Opfer fielen, wird im zweiten Teil dieses Skriptums behandelt, in dem der NS-Zeit ein eigener Abschnitt gewidmet ist.
|
Einen hervorragenden Zugang zur Geschichte der psychiatrischen Anstalten, insbesondere der Patient/innen und Mitarbeiter/innen in Tirol, Südtirol und Trient seit 1830 bietet neuerdings das Projekt "Psychiatrische Landschaften", durchgeführt vom Institut für Geschichtswissenschaft & Europäische Ethnologie und dem Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck, sowie dem Südtiroler Landesarchiv und dem Verein "Geschichte und Region" in Bozen. Neben dem Buch "Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patientinnen und Patienten im historischen Raum Tirol seit 1830" (Dietrich-Daum u.a. 2011) steht eine umfassende Open-Source-Dokumentation zur Verfügung (http://www.psychiatrische-landschaften.net ) sowie der Katalog der Ausstellung "Ich lasse mich nicht länger für einen Narren halten" (Heidegger u.a. 2012) und das Filmdokument "Die [un]sichtbare Arbeit. Zur Geschichte der psychiatrischen Pflege im historischen Tirol von 1830 bis zur Gegenwart" mit einem umfangreichen didaktischen Apparat für Auszubildende und Schüler/innen. |
In Tirol ist das älteste auffindbare Zeugnis für die Unterbringung von Geisteskranken ein bereits im 14. Jahrhundert bestehender mit Eisengittern umgebener Verschlag beim Stadtturm in Innsbruck, von den Bewohner/innen als Narrnhäusl bezeichnet. Bis 1788 wurden dort Personen mit auffälligem Verhalten oder solche, die die Stadtordnung übertraten, eingesperrt. Ansonsten entwickelte sich der Umgang mit Geistes-kranken auch in den Regionen des heutigen Tirol und Südtirol aus der Tradition der Lepra und der Pest. Spitäler, Leprosorien, Sondersiechenhäuser gab es seit dem 14. Jahrhundert in allen größeren Städten Tirols und manche von ihnen existierten bis in das 19. Jahrhundert.
Innsbruck, Domplatz: Kaiserspital Maximilian I.
Innsbruck, St. Nikolaus: 1313 - 1789
Hall i. Tirol: seit 1354
Schwaz: seit 1476/77
Rattenberg: seit 1454
Kufstein, Bürgerspital: 1606 - 1847
Imst, Heilig Geist Spital: seit 1540
Lienz: 13./14. Jh. - 1800
Kitzbühel: 1380 - 1828
Zweck dieser Häuser, in denen auch Personen, die an Krebs, Syphilis, Hautkrankheiten o.ä. litten, soweit sie »bey der Statt geboren und erzogen« worden waren, untergebracht wurden, war nicht medizinische Behandlung oder Heilung, sondern ausschließlich die Ausschließung. Aufgrund der Ansteckungsgefahr sollten die Gesunden vor den Kranken geschützt werden, während diese ihre Krankheit, eine Strafe Gottes, mit Geduld ertragen sollten, um sich den Himmel zu verdienen. Selbst nach ihrem Tod wurden die Kranken zusammen mit anderen »Ureinen« - Henkern, Hingerichteten, Selbstmörderinnen oder Dirnen - auf eigenen Siechenfriedhöfen bestattet: Die gesellschaftliche Reaktion auf moralische Defizienz war die gleiche wie jene auf physische: Ausschließung aus der Zughörigkeit zu den Normalen (Halper-Zenz/Preßlauer 1996,26 ff.)
Von der Anstalt der Sondersyechen zu St. Nikolaus ist eine Anstaltsordnung aus dem Jahr 1529 erhalten. Die Leitung hatte ein Siechenvater mit seiner Frau, der Siechenmutter zu besorgen. Aussätzige, die sich in das Innsbrucker Siechenhaus einkauften, hatten eine Reihe von vorgeschriebenen Gegenständen mitzubringen: eine Maßkandl, ein Tischtuch, ein Handzwechl (Handtuch), 2 Pfannen, 3 Schüsseln und 3 Täler (Teller), 2 Karnier (Taschen), ein Wasserschaff, ein Badkübel und 11 Köpfl zu lassen (Schröpfköpfe). Zum Hereinkaufen musste der Syeche dem Gesinde ein gutes Mahl oder einen Gulden geben (Hye 1986, zit.n. ebd., 27). Ihren Unterhalt mussten sich die Kranken durch Almosen und Bettel selbst verdienen. Auch dafür gab es strenge Regeln: Außerhalb de Wohnortes nur alle 3 Wochen (»damit die Leute nicht beschwert würden«), nicht acht Tage vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten, drei Tage nicht im Umkreis einer Meile vor und nach Kirchtagen, auf denen er/sie bettelte, wobei der einträglichere Kirchtagsbettel auf alle Bettler/innen zu gleichen Teilen aufgeteilt wurde. Gesunde Personen, also etwa die Angestellten des Siechenhauses durften nicht betteln, es sei denn »dass die armen Leut Krankheit halben selbst nicht danach hätten gehen können«. Aussätzige hatten mit Horngebläse oder einer Klapper auf sich aufmerksam zu machen, um die Menschen von sich fernzuhalten. Sieche durften sich nicht in Wirtshäusern aufhalten und hatten auch sonst ein sittsames Leben zu führen. »Zog ein Siecher mit einer, die nit sein Eheweib ist übers Land« durfte er nicht beherbergt werden oder vor Kirchen betteln, ehe er sich »von solchem unziemlichen Wesen« getrennt hatte. (ebd., 28).
Als am Ende des Mittelalters die Lepra in Europa ausstarb, verschwanden nicht auch die mit ihr verbundenen Anstalten. Sie "dienten Jahrhunderte später dem Ausschluss und der Verwahrung von Bettlern, Landstreichern, Armen, Kranken, Siechen und »verwirrten Köpfen«" (ebd.,, 16). In ähnlicher Weise wie die Lepra wirkte der Umgang mit der Pest als Modell für den Umgang mit Außenseitern und Geisteskranken. Anfang 1349 wurde Tirol vom europaweit grassierenden »Schwarzen Tod« erfasst, im Jahre 1512 wütete die Pest erneut und forderte allein in der Stadt Innsbruck 700 Opfer. Die letzte Pestepidemie traf Tirol in den Jahren 1611/12. Die Angst vor der Ansteckung führte zur Etablierung rigider Disziplinarmaßnahmen, die die BürgerInnen schützen sollten "vor der Pest, vor den Aufständen, vor den Verbrechen, vor der Landstreicherei, vor den Deserteuren, vor den Leuten, die ungeordnet auftauchen und verschwinden, leben und streben" (Foucault 1977, zit.n. Halper-Zenz/Presslauer 1996, 18). Es zeigt sich hier, dass herrschaftlich-staatliche Maßnahmen zwar ihren Ausgang und ihre Legitimation von bestimmten Gefährdungspotentialen nehmen, aber dann zu einer Ausweitung auf die Gesellschaftsstruktur insgesamt, auf alles Störende und Ungeregelte tendieren. Es entsteht, was Michel Foucault die "Disziplinargesellschaft" nennt, eine Gesellschaft, die alles und jede/n an ihre Regeln bindet, keine Abweichung von der Norm mehr duldet. Die "Macht formiert sich zur Abwehr eines außerordentlichen Übels" (Foucault 1977, zit.n. ebd.) und erhebt sich zur totalen Kontrolle des gesellschaftlichen und individuellen Lebens.
In Städten, in denen die Pest drohte, wurde das betroffene Gebiet abgeriegelt, es wurde in Viertel eingeteilt, die von Intendanten und für einzelne Straßenzüge von Syndici überwacht wurden. Provisores sanitatis Gesundheitsvorsorger) hatten die Befugnis, alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche an-zuordnen. Niemand durfte sein Haus verlassen, Nahrung und Getränke wurden über hölzerne Kanäle verteilt, um mit den Kranken nicht in Berührung zu kommen. Im Februar 1611 ordnete Erzherzog Maximilian an "in Innsbruck und Hall die von alters her gebräuchlichen Wachen aufzustellen und alle Maßnahmen zu er-greifen, die in der Vergangenheit bei dergleichen Bedrohungen durch Epidemien getätigt worden waren" (Schretter 1982, zit.n. ebd.,30). Im Falle von Innsbruck hieß das, dass nicht nur an den Statdtoren Wachen aufgestellt wurden, sondern auch in den Außenbezirken: an der Kettenbrück (damals: Mühlauer Brücke), bei der Weiherburg, an der Sillbrücke oberhalb von Wilten und am Steg über den Sillrechen, an der Pradler Brücke und am Georgentor (heute: Altes Landhaus). Die Warenzulieferung aus gefährdeten Gegenden und das Hausieren wurde untersagt, Verbote, die trotz strenger »Leib- und Gutsstrafen« aus Not oft genug durchbrochen wurden. Fremde Landstreicher und Bettler wurden vertrieben. Mit Ausnahme von Bittprozessionen und Gottesdiensten wurden Menschenansammlungen stark eingeschränkt, Feste außer Hochzeiten - und bei diesen höchstens drei Tische - wurden verboten. Tierhaltung war verboten, Hunde und Katzen wurden nachts eingefangen und weggeschafft.
Größter Nachdruck wurde auf die lückenlose Feststellung der Erkrankten gelegt. Die Apotheken hatten täglich Listen abzuliefern, Viertelmeister suchten alle Häuser ab, um Erkrankte aufzuspüren. Befallene Häuser wurden mit einem weißen Kreuz gekennzeichnet und gesperrt, die Kranken wurden zwischen 21h und 4h morgensvon den Totengräbern in das Bresthaus gebracht, die Angehörigen in Ventilierhäuser. Das Innsbrucker Bresthaus, »ein altes, enges, hilzenes, unsauberes, dem gesunden Lufft übel erpauttes Haus«, stand auf der Kohlstatt (heute: Weinhardt-Str. 2), betreut von einem Brudermeister und seiner Frau, einer Köchin und einer Wäscherin sowie Leichengräbern und Aussäuberern (Desinfektoren). In die Ventilierhäusern, von Hietern verwaltete primitive hölzerne Baracken nahe dem Bresthaus und im Saggen, wurden Angehörige und Rekonvaleszenten zur Quarantäne verbracht. Kein Wunder, dass viele die Infektion zu verheimlichen versuchten, um die Verbringung in das Brest- oder Ventilierhaus zu vermeiden.
Außerhalb der Siedlungen, auf der Kohlstatt, in St. Nikolaus und in Hötting, wurden eigene Pestfriedhöfe angelegt, deren Gräber tiefer waren und mit Kalk und Lehm beschüttet wurden. Jeden Tag wurde dort ein großes Feuer angezündet, um die Luft zu reinigen. Das Geschäft der Ärzte übten die Bader aus, in seuchenfreien Zeiten Betreiber öffentlicher Bäder mit dem Amt des Totenläßls, der die amtliche Totenschau durchführte. In Pestzeiten hatten sie die Kranken zu visitieren, und das Ausmaß der Krankheit sowie die Behandlung zu beurteilen. Darüber hinaus gab es Wärterinnen, die infizierte Kranke zu pflegen hatten, Frauen, die die Toten in Leinensäcke einnähen mussten, Leichenträger, die die Verstorbenen nachts zum Friedhof karrten und Totengräber, denen auch die Säuberung der Latrinen oblag. Sie alle wurden in eigenen Häusern untergebracht und durften sich nicht mit der Bevölkerung vermischen.
Bei der letzten der drei großen Pestepidemien in Innsbruck starben 222 Personen, die meisten von ihnen "aus der unteren Bevölkerungsschicht wie Dienstboten, Totengräber, Zuträger, Wärterinnen, Aussäuberinnen, Köchinnen, Mägde, Ammen, Witwen und einfache Handwerker" (Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 35), die wenigsten aus der vermögenden Oberschicht. Wesentlich mehr Bewohner traf es in Schwaz, wo 2.224 Personen verstarben, an die 30% der Bevölkerung. Unternehmer wie die Bergwerksbetreiber hatten dort lange versucht, den Ausbruch der Seuche herunter zu spielen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Das 1307 am Marktgraben errichtete Spital nahm wohl lange Zeit auch Geisteskranke auf, bis es 1817 der medizinischen Fakultät übergeben und in verschiedene Abteilungen gegliedert wurde. Eine Irrenabteilung ist seit 1839 belegt. Aufgenommen wurden vor allem unheilbare Irre bei Vorliegen eines ärztlichen Zeugnisses auf Antrag der Vormundschaftsbehörde, keinesfalls von Privaten, oder durch Einlieferung von der Polizei, »um einen Wahnsinnigen unschädlich zu machen«. Das ärztliche Zeugnis hat »die Art des Wahnsinns, ob nämlich periodisch oder anhaltend, allgemein oder partiell, von stiller oder tobender Natur, etc., sowie auch die bisherige Dauer desselben« zu enthalten, die Krankengeschichte »muss alles enthalten, was auf die Entstehung, die Art und Dauer des Wahnsinns sowie auch auf das etwa schon eingeschlagene Heilverfahren Bezug hat. (ebd., 38). An diesen Bestimmungen zeigt sich bereits ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Geisteskrankheit. Einerseits ist man sensibel geworden für die Gefahr der Denunziation oder der Abschiebung von unliebsamen oder unbequemen Personen ins Narrenhaus. Die Einweisung wird jetzt den Privaten untersagt und eine Behörde delegiert. Andererseits gilt Geisteskrankheit nun als Krankheit, für die es eine ärztliche Diagnose und Behandlungsmethoden bedarf.
Eigene Irrenanstalten entstehen in Tirol erst ab dem 19. Jahrhundert. Bis dahin hielten sich geisteskranke in den familiären und kommunalen Strukturen auf, manche von ihnen auch in Tirol als Einleger bei vermögen-den Bauern, die für sie zu sorgen hatten. Diese "Intergation" darf man allerdings keinesfalls nostalgisch verklären. »Die Arbeitsunfähigen bleiben ganz sich selbst überlassen, versinken immer mehr in Stumpfsinn, werden vielfach verhöhnt, oft mißhandelt, liegen im Schmutz, besäet mit Ungeziefer, vor den Häusern oder auf den Ofenbänken, sind nur allzu oft Zielscheibe rohesten Spottes [...] Wieder andere werden in einem abgelegnen Winkel des Hauses oder in einem Stalle eingesperrt, bekommen oft geradezu ekelhafte Nahrung, die sie gierig verschlingen; überall erregen sie Abscheu und Ekel« - so beschreibt ein Zeitgenosse das Schicksal der Behinderten im Salzburger Land (zit.n. Aus der Schmitten 1985, 102). Es besteht kein Anlass anzunehmen, dass die Verhältnisse in Tirol und Südtirol sich wesentlich unterschieden hätten. Vor der Gründung der Irrenanstalten "gab es Pantozzi zufolge keine gesonderten Initiativen, die auf eine Behandlung oder Betreuung der Irren ausgerichtet waren. Solange das Verhalten der Irren im Familienverband tragbar war, lebten sie dort und waren in ihrer großen Mehrheit frei. Sobald deren Grenze der Belastbarkeit überschritten war, wurden sie gefesselt, gefangen gehalten und/oder ihrem Schicksal und damit er Bettelei, dem Hohn und Gespött überlassen. Irrenversorgung war somit Teil der allgemeinen Armenversorgung" (Egger 1999, 52). In Ermangelung anderer Möglichkeiten landeten Geisteskranke auch in den allgemeinen Krankenhäusern sowie in jeder Art Armenanstalt, die es gab: "Im Jahre 1837 waren in den gemeindeeignenen Einrichtungen (Versorgungshaus, Pfründnerhaus, Armenheim oder Spital genannt) von Tirol 1550 Geisteskranke untergebracht, während es in den allgemeinen Krankenhäusern nur 410 waren" (Proch, zit.n. ebd.).
Angesichts dieser Zustände neigen Historiker der Psychiatrie dazu, die "Anstaltslösung" für einen Fortschritt zu halten (vgl. Pantozzi 1990, 24). Die beiden hauptsächlichen Orte, an denen Geisteskranke aus Tirol und Südtirol interniert wurden, waren Pergine im Trentino und Hall in Tirol. Je nach wechselnder politischer Zuständigkeit wurden Geisteskranke oder solche, die dafür gehalten wurden, in die eine oder andere dieser Anstalten eingeliefert.
Als Kaiser Franz I. im Jahr 1824 verfügte, die Fürsorge für die Geisteskranken als staatliche Aufgabe wahrzunehmen, erschien die Errichtung öffentlicher Irrenhäuser, in Tirol die Irrenanstalt in Hall, unvermeidlich. Etwa fünfzig Jahre nach der Errichtung des Narrenturms am Gelände des von Kaiser Joseph II. erbauten Allgemeinen Krankenhauses, der ersten Irrenanstalt Europas, in deren 139 engen Zellen ab nun die Geisteskranken festgehalten wurden, und etwa fünfzig Jahre vor der Anstalt von Pergine wird 1830 in Hall in Tirol die k.k. Provinzial Irrenanstalt eröffnet. Aufgenommen sollten nur »eigentliche Irre, sowohl heilbare als auch unheilbare« werden, »nicht aber bloß Blödsinnige und dabei unschädliche Individuen« (Laschan 1847, 213, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 52). Für die Letzeren müsse »auf andere Weise« gesorgt werden. Diese Anordnung zeigt, dass das Interesse des Staates vor allem die Beseitigung der Störung und die Ein-schließung der Störenden ist. Wie weit allerdings die Ettikettierung als "wahnsnnig" gefasst wird, zeigt eine gesetzliche Bestimmung unter Josef II., nach der »jeder, der die Religion verleugnet und so tief sinkt, dass er dem Allmächtigen frevelhaft flucht, als Irrer angesehen werden und in ein Irrenhaus als Gefangener gehalten werden muß, bis man sicher ist, dass er sich gebessert hat« (Egger 1990, 82). Der Katalog, den Franz Tschallener, zweiter Direktor der Anstalt von 1834 -1854, den Ärzten zur Erstellung einer "brauchbaren Krankengeschichte" vorgab, enthielt neben Fragen zur Gesundheit der Eltern und Geschwister und zur Körperkonstituion des/r Patient/in auch solche zu dessen Erziehung, zu Onanie, Raufereien, Spielleidenschaft, zur religiösen Einstellung und zur politischen Gesinnung. Religiöses Schwärmertum, Glaubenszweifel, Freigeistertum oder Neuerungssucht galten als Symptome (ebd., 53).
Bis 1874 darf die Aufnahme auch in Hall nicht auf der Basis privater Ansuchen erfolgen, sondern nur auf Vorschlag der Vormundschaftsbehörde oder des Gerichts. In besonderen Fällen darf die Polizei jemanden einliefern, wofür nachträglich die Rechtfertigung einzuholen ist. In allen Fällen entscheidet aber der Anstaltsleiter über die Aufnahme. Innerhalb der Anstalt gab es drei Zahlungsklassen, die sich nach Kosten und Komfort unterschieden. Zweibettzimmer, kärgliche Möbel, Strohmatratzen und Bettzeug in der untersten, allgemeinen Klasse, in der sich die unentgeltlich Aufgenommenen und die Patient/innen der dritten Klasse befanden; Einzelzimmer für heilbare Kranke in der zweiten Klasse, in der 30 Kr. zu entrichten waren; eigene Wärter/innen, bessere Einrichtung, Servietten, Handtücher, besseres Essen und feineres Geschirr für 50 Kr. in der obersten Klasse. Nur wenige konnten sich das leisten. 1875 befinden sich in der 1. Klasse 3 Männer und 5 Frauen, in der 2. Klasse 17 Männer und 6 Frauen, während in der 3. Klasse 149 Männer und 163 Frauen untergebracht waren. (ebd., 55).
Der Primararzt und Direktor der innerhalb der Anstalt uneingeschränkte Autorität genießt, ist seinerseits der staatliche Aufsicht unterworfen und verantwortlich. »Seine vorzügliche Pflicht ist, die ihm mitgeteilte Amtsinstruktion genau zu befolgen und darüber zu wachen, dass auch die Irrenhausbeamten und die Dienerschaft die ihnen in ihren Instruktionen und Verhaltensvorschriften empfohlenen Obliegenheiten genau erfüllen. Deshalb ist es eine seiner ersten Pflichten, fleißige und genaue Nachsicht unvermutet und zu verschiedenen Stunden in der Anstalt zu pflegen und gewissenhaft und unabhängig dahin zu wirken, dass die Hauptzwecke der Anstalt möglichst erreicht, dabei aber durchaus die strengste Ordnung, welche auch eine zweckmäßioge Tagesordnung der Irren in sich begreift, und die genaueste Oekonomie beachtet werde« (Laschen 1847, 214, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 55). Die Aufnahme und Entlassung der Patient/innen, die Zuweisung zu den unterschiedlichen Abteilungen, die Speiserationen, die Art der Behandlung, die Zuweisung von Arbeit, Ausgeherlaubnis, Zimmerarrest und Strafen: alles unterliegt der Entscheidung des Anstaltsleiters. Auch wissenschaftliche Forschung wird ihm aufgetragen. Monatlich hatte er einen Bericht abzufassen, sowohl über die in der Anstalt verweilenden als auch über die entlassenen oder verstorbenen Insassen, in dem die »Geisteszerrüttungen mit ihren Ausgängen« dargestellt werden mussten, »dass auch ein wissenschaftlicher Gewinn hiervon zu erwarten ist« Verstorbene waren »geeignet zu öffnen« und bei besonderem Interesse anatomisch zu präparieren (ebd., 56).
Der Personalstand betrug zur Eröffnung bei ca. 75 Insassen neben dem Leiter zwei Ärzte, sieben bis acht Wärterinnen und zehn bis elf Wärter. Das Personal war ungeschult und strengsten Regeln unterworfen. »Die Strafen saumseliger, nachlässiger, dem Trunke ergebener, zänkischer und grober Wärtersleute sind Emahnung, Androhung schärferer Ahndung, Hausarrest an dienstsfreien Tagen und endlich die gänzliche Dienstentlassung« (Laschan 1847, zit.n. ebd. 1996, 62). Darüber hinaus gab es eine Verwaltung, der auch die Hauspolzei unterstand, die für Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen hatte, sowie eine geistliche Abteilung, bestehend aus dem Kirchendiener (gleichzeitig Hausmeister) und einem Kaplan, der neben dem Lesen der Messe, dem Beichthören, der Sendung der Sterbesakramente den Kranken geistlichen Beistand zu leisten hatte »worüber die Mitwirkung zur Heilung der Irren auf psichischem Weg mitbegriffen ist« (ebd., 63).
Die Patient/innen wurden, nach Geschlechtern getrennt, vier unterschiedlichen Abteilungen zugewiesen:
-
die heilbaren und ruhigen
-
die heilbaren und unruhigen
-
die unheilbaren und gefährlichen
-
die tobenden
Der Tagesablauf war streng geregelt, die Anstalt war ringsum von einer Mauer umfriedet, die Fenster waren vergittert waren, die Türen hatten kleine Schlitze zur Beobachtung der Kranken und an den Toren waren Wächter postiert. Ordnung und Arbeit galten nicht nur als sittliche Erfordernisse, sondern auch als therapeutische Mittel, »Müßiggang und gedankenloses Umhertreiben oder Hinstarren der Irren ist zu verhüten« (ebd., 66). Tischler-, Schneider- und Schusterwerkstätten werden eingerichtet, Männer wie Frauen werden zum Arbeiten verhalten: »Männer für die gewöhnliche Hausarbeit, wie die Reinigung der Geschirre, Lokalien, Holztragen, bei Feldbau, Gartenarbeiten, zur Erhaltung der Wege und der Zurichtung des Brennhlzes, Beihilfe bei Maurer- und Tischlerarbeiten, in der Ausspeisküche und bei den Anstaltsbediensteten«, Frauen zur »Neuanfertigung der Bettgeräthe und Wäschegattungen und der weiblichen Kleidungen, sowie deren Ausbesserung, Spinnen, sämtliche Hausarbeiten, Beihilfe bei der Feld- und Gartenarbeit und in der Ausspeisküche« (ebd., 67 f.). So sehr die Zustände den Arbeithäusern ihrer Zeit ähnelten, es gab es in den Irrenanstalten auch manches, das der Erholung und Zerstreuung der Patient/innen dienen sollte. In Hall gab es Gartenbänke, eine Kegelbahn, eine Schaukel, einen Polz- und Taubenschießplatz, Musikinstrumente und Spiele, gemeinschaftliche Spaziergänge, gelegentliche Tanzveranstaltungen und ein »Christbaum-Bescherung mit Zelten und Kleinigkeiten" zu Weihnachten (ebd. 68 f.)
Bereits dem ersten Direktor der Anstalt, Anton Pascoli (1830 -1834) kostete die Verletzung der Vorschriften die Stellung. Auf Grund von »Beschuldigungen wegen falscher Gutachten, sowie wegen mangelnder Disziplin unter Ärzten und Personal und grobem Verhalten den Karnken gegenüber« wurde er abgesetzt.
Sein Nachfolger Dr. Johann Tschallener leitete die Anstalt 20 Jahre lang (1834 - 1854). Tschalleners ärztliches Handeln war von der Vorstellung bestimmt, dass sowohl Milde als auch Strenge für einen Heilerfolg bei psychisch Kranken wichtig seien. In seiner Darstellung der Anstalt (1842) beschrieb er seine Vorstellung von richtiger Behandlung: »[...] dieser Geist sey der der Güte, der Ermahnung, des Bittens, der Drohung, und wenn alles dieses nichts fruchtet, aber erst dann auch der Geist der Beschränkung, des Ernstes, der Strenge, und selbst der Strafe, wie bei unsorgsamen, eigensinnigen, halsstärrigen und verbosten Kindern«.[95]
Nach Gertraud Egger waren "Zwangsmaßnahmen und folterähnliche Torturen nicht nur eine spezielle Vor-liebe von Tschallener" (Egger 1999, 54), sondern die zu seiner Zeit probaten und allgemein üblichen Prozeduren:
Lehmann zufolge zielten die Methoden des 18. und 19. Jh. insgesamt darauf ab, die Patienten und Patientinnen durch das Hervorrufen von Schmerz Ekelgefühlen sowie durch die Ausschaltung ihres Willens zu 'heilen'. Zum Repertoire der "Heiler" gehörten die mechanischen Therapien (Anketten, Zwangsschaukelmaschinen, Hitzeboxen, Fußschellen, Zwangsjacken, Zwangsanzüge mit Drahtmasken ... ), optische und akustische Therapien (grelles Licht, Dunkelzimmer, Donnerschläge und Tiergeheul ... ), thermische Therapien (brennender Siegellack, Dampfschwefelbäder, eiskalte Duschen, Eismützen, Untertauchen ... ) und chemische Therapien (Ätzmittel, Giftkräuter, Brech- und Schlafmittel ... ). Dazu kamen noch die psychologischen und pädagogischen Mittel, zu denen Furchteinflößen, Auspeitschen, Überwachung, Beeinflussung, Hypnose, Suggestion, Beschimpfungen etc. zählen. Medizinische Mittel waren Clitorisverätzungen, Clitorisentfernungen und Castrationen besonders bei den sog. hysterischen Frauen, Aderlaß und Schröpfung, Blutegel, Lumbalpunktionen, Kolibakterienbehandlung, Adrenalektomie (Durchtrennung von Nervenfasern des Sympathikus) u.v.a. (ebd., mit Verweis auf Lehmann 1990, 13-21 und Pantozzi, 1989, 30-35).
Der erste in der Medizingeschichte bekannte Kunstfehler-Prozess im Jahr 1811, betraf nicht ohne Grund einen Irrenarzt (Bericht nach WIKIPEDIA, Stichwort "Anton Ludwig Ernst Horn")
Hintergrund des ersten Arzthaftungsprozesses in Deutschland war eine langwierige Auseinandersetzung zwischen dem Psychiater Anton Horn, und einem Dr. Heinrich Kohlrausch, beide an der Berliner Charité tätig. Am 1. September 1811 verstarb eine Louise Thiele, 21 Jahre alt, die wegen einer "schweren Gemütserkrankung" seit 21. August in Behandlung war, während sie auf Anweisung Horns zur Beruhigung in einem sogenannten "Sack" eingeschlossen war:
Um elf Uhr Vormittags wurde, ihres beständigen Schreiens wegen, ihr die Zwangsjacke angezogen, doch nur lose, und sie in einen Sack gesteckt und auf die Erde gelegt. Hier lag sie unter beständigem Schreien bis gegen halb 4 Uhr, wo sie plötzlich ruhig wurde. Durch diese plötzliche Ruhe aufmerksam gemacht, ging die Aufwärterin zu ihr, nahm ihr den Sack ab, und fand sie fast leblos. Sie brachte sie aufs Bette, wo sie noch einige Mal zuckte und dann verschied.
Am folgenden Tag erfolgte eine Anzeige von Kohlrausch gegen Horn, in der er den Tod der Kranken einer fehlerhaften Behandlung Horns zuschrieb. Dieser hätte die wegen ihrer Angstzustände unruhige Kranke nicht nur mit einer "Zwangsweste" fesseln lassen, sondern dazu noch über längere Zeit in den besagten Sack gesteckt und auf der Erde liegen lassen. Nachdem die Kranke kurz nach Öffnen des von Kohlrausch als "Sterbesack" bezeichneten Bändigungsgerätes verstorben war, hätte Horn einen Tod infolge Apoplexia post mania diagnostiziert. Tatsächlich trat der Tod durch Erstickung ein, was die Autopsie bewies. Im weiteren Zusammenhang erwähnt Kohlrausch dann andere, seiner Ansicht nach ebenfalls zweifelhafte Behandlungsmethoden Horns:
Drehen auf der "englischen Schwungmaschine"
Begießen mit Wasser
Verabreichung von Brech- und Abführmitteln
Einreibungen mit "Authenrieths Märtyrersalbe" von auf dem rasierten Schädel, wodurch künstlich Geschwüre hervorgerufen werden sollten
Tartarus emeticus (Brechmittel)
Verbrennungen durch Moxibustion (Erwärmung einzelner Körperstellen)
Auffällig bei den von Horn verwendeten Therapien scheinen vor allem die Rotationsgeräte gewesen zu sein, zu denen die genannte "englische Schwungmaschine" gehört. Dabei handelt es sich um einen Stuhl, auf dem der Kranke festgeschnallt wurde und der anschließend in schnelle Rotation versetzt werden konnte. Geradezu überwältigend muss aber ein von Horn installiertes Drehbett gewesen sein, das mit Pfeilern, Balken und Zahnrädern einen ganzen Raum ausfüllte und Drehgewindigkeiten von 120 Umdrehungen pro Minute erreichte. Der denkbare therapeutische Nutzen bei der Behandlung von Geisteskrankheiten ist aus heutiger Sicht unerfindlich und erschien offenbar schon damals als sehr zweifelhaft. Die verstorbene Thiele war zuvor (erfolglos) mit kalten Bädern, Drehen, Haarseil, Brechmitteln und Sack behandelt worden.
Auf die Anzeige Kohlrauschs hin wurde zunächst ein medizinisches Gutachten eingeholt, in dem lediglich die Todesursache festgestellt wurde, ohne auf die Umstände des Todes weiter einzugehen, da diese dem Gutachter Dr. von Könen nicht bekannt waren. Der ging einfach davon aus, dass, insofern das "in den Sack stecken" eine offenbar häufig praktizierte Methode war, diese eben deshalb als unbedenklich anzusehen sei. Darauf wurde die Einleitung einer Untersuchung am 10. Oktober zunächst abgelehnt. Da es aber durch diesen Todesfall bereits ein erhebliches öffentliches Aufsehen gab, wies der Justizminister auf ein Schreiben des Staatsrats Sack hin das Kammergericht am 26. Oktober an, eine förmliche Untersuchung gegen Horn einzuleiten.
Mit der Abfassung eines alle Aspekte des Falles berücksichtigenden Gutachtens wurde, nachdem am 2. November das Verfahren eröffnet worden war, der Arzt Johann Christian Reil beauftragt. Das Gutachten spricht Horn von allen Vorwürfen frei, insbesondere wird festgestellt, dass
die Behandlung (vom "Sack" abgesehen) völlig schulmäßig gewesen sei, da der Gebrauch von Zwangsmitteln und Prügeln bei Wahnsinnigen schon seit ältester Zeit völlig üblich sei
es entgegen dem ersten Gutachten sich nicht notwendig um einen Erstickungstod handeln müsse, vielmehr ein Entweichen des "Lebensprinzips"
der "Sack" keineswegs als ursächlich anzusehen sei, vielmehr: "Sie starb zwar in einem Sack, wie andere in ihrem Hemde sterben, aber daraus folgt noch nicht, dass sie durch denselben starb."
Der Sack sei nämlich aus Leinwand und durchaus luftdurchlässig, wie Reil durch ein Experiment mit einem Huhn bewies, das nicht erstickte, sondern nach 12 Stunden im Sack immer noch frisch war, obwohl Vögel bekanntlich für "Suffokation" anfälliger als Menschen seien. Insgesamt meint er, dass der Sack ein vergleichsweise sanftes Instrument zur Therapie psychisch Kranker sei.
"Die Mittel, mit welchen er experimentirt", fährt der Gutachter, seine Philosophie des Arztberufes erläuternd, fort, "sind meistens heroischer als ein lumpiger Sack; Mohnsaft, Sublimat, Arsenik, so tödtlich als heilsam; und der Gegenstand, mit welchem er experimentirt, das Höchste unter dem Monde, das Leben des Menschen, und zu-gleich das Zerbrechlichste. Könnte es wohl ein unglücklicheres Verhältnis als das des praktischen Arztes geben, wenn er unter diesen Umständen bei jedem Todesfall noch eine Criminaluntersuchung zu fürchten hätte?
Das Kammergericht erwies sich als für Reils Argumentation aufgeschlossen und sprach am 20. April 1812 Horn von allen Vorwürfen frei. Kohlrausch verließ im Juni 1813 Berlin und legte seine Stellung an der Charité nieder.
"Mittel der Wahl" nach Christian Reil, Gutachter im Cox-Prozess:
Stürzen in Wasser, Aufziehen am Strick, Stockschläge, Authenrietsche Maske, Hungerkuren, Glühende Eisen
Cox-Schaukel
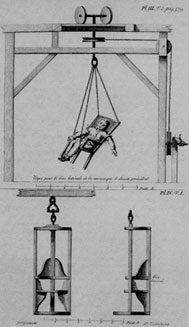
Die so genannte »Cox-Schaukel«, von dem englischen Arzt Joseph Cox entwickelt, ist ein an Seilenbefestigter nach hinten geneigter Stuhl, an dem der Patient festgeschnallt und in schnelle Rotation (bis zu 100 Umdrehungen pro Minute) versetzt wurde. Von den dabei auftretenden Symptomen (Übelkeit, Schwindel, Desorientierung, bis zu Bewusstlosigkeit) erwartete man sich heilende Wirkung.
Ähnlich funktioniert der Horn'sche Drehstuhl, auf den oben erwähnten Anton Horn zurück zu führen, der unter Tschallener in Hall verwendet wurde. Tschallener versuchte auch den Zwangsstuhl zu perfektionieren, u.a. indem er einen Leibhäfn einbaute, so dass der Patient beliebig lang an den Stuhl gefesselt werden konnte. Zwangsmittel gehörten für Tschallener zu den notwendigen therapeutischen Mitteln. Für Tobende empfahl er »enge, im Notfall schmerzende Beschränkung mittels des Spensers und den Händen auf dem Rücken oder mittels des Sessels. [...] Dieser Kranke muss seine Ohnmacht in den ersten Tagen hier fühlen und muss es einsehen« (Tschallener 1842, zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 72).
Johann Autenrieth begründete in den 1790er Jahren eine psychiatrische Abteilung an der Universität Tübingen. Auf ihn gehen die Autenriethsche Birne, ein dem Patienten in den Mund gestecker Knebel, der mit einem Lederriemen am Kopf befestigt wurde und die Authenriethsche Maske, eine über den Kopf gestülpte Maske aus festem Leder, die nur Mund und Nase frei ließ, sowie die Autenriethsche Pustelsalbe zurück, mit der die Brechreize oder Hautentzündungen herbei geführt wurden. Dass solche Maßnahmen keinesfalls die Ausnahme waren, zeigt das Autenrieth den Dichter Hölderlin mithilfe der Maske "behandelte". (vgl. Niessen 2005, 195).
Anmerkung der Bidok-Redaktion: Abbildung fehlt
Autenriethsche Maske und Knebel
Für Tschallener ist der Gehorsam der Patient/innen die entscheidende Voraussetzung für ihre Heilung: »Wer nicht gehorcht, muss dazu genötigt werden. Schon die Würde des Arztes erfordert dies. Der Arzt muss ein Vater sein, die Kinder aber müssen dem Vater gehorchen. Gehorchen sie nicht, so herrschen sie, herrschen sie aber, so sind sie für die Erziehung und Bildung verloren« (Tschallener, zit.n. Halper-Zenz/Presslauer 1996, 57). Mit dieser Haltung berief er sich auf den wohl berühmtesten Psychiater seiner Zeit, Philippe Pinel, seit 1794 leitender Arzt am Hôpital Salpêtrière in Paris. Den Wahnsinnigen sei »die Überzeugung einzuprägen, dass sie einer höheren Gewalt untergeordnet sind. [...] Diese Vorstellung erweckt ihre Verstandes-Funktion, hemmt unsinnige Ausschweifungen. [...] [Die Irren] gewöhnen sich daran, sich einen Zwang anzutun [...] ein erster Schritt der Genesung« (ebd., 71). Aus der Verwendung der alltäglichen Bezeichnungen für die Zwangsgeräte lässt sich auf deren gefühlte Normalität für die Applikation bei Geisteskranken schließen: Der Sessel ist der Zwangsstuhl, der Spenser die Zwangsjacke. »Güte«, so Tschallener, sei »die Basis der Irrenbehandlung und meine Rechte, wie Ernst und Strenge meine linke Hand«. In welche dieser beiden Richtungen der Arzt tendiert, sieht man an dem Zusatz: »allein ich verschwende sie nicht mehr, diese Güte« (ebd.).
Der Schulterschluss mit der Zwangspädagogik der Aufklärung liegt auf der Hand und wird auch vollzogen. »Die psychische Kur des Wahnsinns ist nichts anderes als die Erziehungskunst (Pädagogik) auf den Wahnsinn angewendet, und die nämlichen regeln und Mittel jeder Erziehung sind es auch hier«, so vermag Tschallener einen anderen Großen zu zitieren, Johann Chr. Hufeland, Leibarzt der königlichen Familie in Preussen und zeitweilig Leiter der Charité in Berlin, dessen ärztliche Hilfe Goethe, Schiller, Herder und Wieland in Anspruch nahmen: »Gehorsam heißt nichts weiter, als die Gewohnheit, seinen eigenen Willen einem anderen unterordnen, und dadurch lernt man am besten, ihm auch dem höchsten Willen, der Vernunft unterzuordnen; daran muß also der Wahnsinnige zuerst gewöhnt zu werden: ebensowie ein eigenes Kind. In allen Dingen, in Kleinigkeiten, muß er gehorchen lernen. Absichtlich muß oft das Entgegegesetzte von dem empfohlen werden, was er will. Strafen und Belohungen ebenso wie bei Kindern« (ebd., 72 f.). Zuerst müsse ihnen der Kopf gebrochen werden, schreibt Tschallener über die Tobenden: »Habe ich diesen Kranken den Kopf einmal gebrochen, so erkennen sie mich als ihren Gebieter und bei derlei Kranken ist die Furcht der Zauberstab des Irrenarztes.« Erst dann hätten Mitleid und Güte einen Sinn »und die Kranken erkennen in mir ihren zärtlichen Freund, ihren Wohltäter« (ebd. 73).
Die Ambivalenz dieser Oszillation zwischen despotischer Unterwerfung und paternalistischer Zuwendung den Irrenärzten der ersten Generation ebenso wenig bewusst, wie ihr eigener Anteil an diesem grausamen Spiel. Die abgewehrten eigenen Ängste und die grandiose Vernunftideologie kommen nicht ins Bewusst-sein. Den aus dem damals noch ländlichen Ischgl stammenden Johan Tschallener bewahrt eine prekäre Mischung aus bäuerlicher Sturheit und angelesener Erziehungsideologie vor solchen tieferen Einsichten. »Über den Kopf«, so schreibt er, »dürfe sich der Psychiater durchaus keinen Kranken wachsen lassen« (ebd., 74).
Dass, wie manche Psychiater bis heute meinen, solche Praktiken zu ihrer Zeit allgemein üblich und deshalb entschuldbar seien, ist ein bloß vorgeschobenes Argument. Das zeigt sich bereits an Tsachlleners Nachfolger Josef Stolz (1854 - 1877) der die autoritären und gewalttätigen "Behandlungen" nicht fortsetzte. Er bereiste Einrichtungen der Irrenbetreuung in ganz Europa und wurde so der Rückständigkeit des Haller Betriebes gewahr. Unter dem Einfluss der englischen No-restraint-Bewegung lehnte er Zwangsmaßnahmen ab oder beschränkte sie auf das äußerst Notwendige. Nachdem in England ein Patient durch eine Zwangsjacke zu Tode gekommen war, wurden dort weitestgehend auf die Fesselung verzichtet. Stolz wandte anstelle der Zwangsjacke für tobende Patient/innen die Isolierzelle an, sie wirke »weniger aufreibend als Zwangsstuhl, etc. auch wenn es länger dauert«. Sein Vorgänger Tschallener war nach seinem Urteil »ein guter praktischer Arzt und ein rechtschaffener, unbeugsamer, herschsüchtiger Charakter, aber ohne alle Vorbildung in der Psychiatrie", der seine Patienten »bald mit verschwenderischer Milde, bald mit härtester Strenge zu beherrschen versuchte. Direkter Zwang zur Umkehr zur Vernünftigkeit und mechanische Beschränkung bis zur absichtlichen Peinlichkeit [d.i. Schmerzhaftigkeit, B.R.] gesteigert, bildeten eine praktische Verirrung seiner fehlerhaften Ansichten« (ebd., 76).
Dennoch waren die "humaneren" Mittel, die Stolz "als Notbehelf und Schutz" gegenüber "gefährlichen Irren" in Anwendung brachte, noch immer einigermaßen inhuman: "So empfahl Stolz für Kotschmierer und -esser und sich entkleidende Geisteskranke gezielte Aufsicht, Entziehung von sonst erlaubten Genüssen, Erfrischungen und Erheiterungen und das Tragen von schwer zerreißbaren Röcken (am Genick mit einer Schaubenschnalle verschlossen), bei Onanie eine »innerliche Darreichung« von Brom-Kalium, Morphium bei nächtlicher Unruhe, Opium bei aufgeregter Melancholie und »prolongierte Bäder bei heftiger Aufregung«." (ebd., 77). Trotz der zunehmenden Möglichkeit und Praxis medikamentöser Sedierung berichtet Stolz im Zeitraum von 1854 bis 1967 noch von 27 Kranken, die durch Bettgurten, Drahtvisiere oder Spenser fixiert wurden, darunter "ein 46jähriger Schneider, der an »teilweiser Verrücktheit« litt" und einen Siuzidversuch unternommen hatte. "Er war seither ununterbrochen an den Händen beschränkt und forderte diese Behandlung, einmal daran gewöhnt, von selbst. Er erhielt eine leichte Beschränkung der Arme durch den Spenser 2.558 3/4 Tage lang (ebd., 77 f.).
Bereits unter Tschallener war für unruhige Kranke eine eigene Abteilung, das so genannte Tobhaus errichtet worden. Unter Stolz' Nachfolgern, Anton Nagy (1877 - 1892), Josef Offer (1892 - 1912) und Matthias Wassermann (1913 - 1919) wurde die Anstalt kontinuierlich vergrößert. Um 1900 hatte die Haller Irrenanstalt eine Kapazität von 300 Patient/innen, immer noch zu wenig für die hohe Zahl der Anwärter/innen, die im Kronland Tirol bereits 1875 mit 785 angegeben werden. Als Beginn einer psychiatrischen Ausbildung gilt die erste Vorlesung des Gerichtsmediziners von Hofmann über »gerichtliche Psychonosologie« angesehen (Hinterhuber 1993, 15., zit.n. ebd., 100), die von Josef Stolz weitergeführt wurde. Die Innsbrucker Klinik hatte zu diesem Zeitpunkt außer einer Irrenbeobachtungsstation für 10 Personen keine Einrichtung für geistig Behinderte. 1889 wurde die erste Lehrkanzel für Psychiatrie und Nervenpathologie eingerichtet. Erst 1937 erhielt die Psychiatrie und die Neurologie einen eigenen Neubau. Die Universitätspsychiatrie sah sich auf die Erforschung von Geisteskrankheiten verpflichtet und beanspruchte deshalb "heilbare und interessante" Patient/innen für sich, die chronischen und "schwierigen" sollten von der Anstaltspsychiatrie versorgt werden (Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 103).
Wie lange die Tradition "peinlicher" Behandlungsmethoden nachwirkte - und nachwirkt? - zeigt der Fall der Innsbrucker Psychiaterin Maria Nowak-Vogl, bis in die 1970er Jahre Leiterin der Kinderbeobachtungsstation der Innsbrucker psychiatrischen Klinik. Die von ihr angewandten Methoden sind, nachdem frühere Verfahren niedergeschlagen wurden, neuerdings wieder Gegenstand von Ermittlungen. Wie der ORF Tirol berichtet, wurden "sexuell auffällige Mädchen mit der Tiermedizin Epiphysan[96] ruhig gestellt, Kinder gefesselt und in dunkle Räume gesperrt, Bettnässer mit Elektroschocks behandelt: Lange bekannt waren die menschenverachtenden Zustände an der ‚psychiatrischen Kinderbeobachtungsstation' in Innsbruck in den 70er-Jahren. Die ORF-Sendung "Teleobjektiv" zeigte bereits 1980 die mehr als zweifelhaften Therapiemethoden von Maria Nowak-Vogl und ihrem Team auf. Danach folgten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die wie-der niedergelegt wurden. 2010 machte Historiker Horst Schreiber in seinem Buch "Im Namen der Ordnung" erneut auf die Missstände aufmerksam und ließ Opfer zu Wort kommen". Die streng katholische Psychiaterin Nowak-Vogl hat nach Schreiber, "einen Kreuzzug gegen Onanie und sexuelle Übererregtheit" geführt, Jähzorn mit Röntgenstrahlen "behandelt" und die Heimunterbringung zahlreicher Kinder veranlasst. Dass von Psychiatern derartige Methoden immer noch mit dem Hinweis auf die zu ihrer Zeit üblichen Standards kommentiert werden,[97] ist kein Anlass zur Beruhigung. Die Tatsache, dass sie über lange Jahrzehnte nicht Ausnahmereaktionen verirrter Einzelner waren, sondern zum Mainstream der Psychiatrie gehörten, ist ja gerade das Beunruhigende.
Taubstumme galten bis in das 18. Jahrhundert als nicht bildungsfähig, Hilfen für sie gab es nur sporadisch von Seiten der Kirche, etwa von dem in Bozen geborenen Franzikanermönch Romedius Knoll (1727-1796), der sich früh darum bemühte, »wie den hilflosen geschöpften, die der Verwahrlosung und dem Gespött der Menschen preisgegeben waren, durch Vermittlung von Bildern das kummervolle Dasein erleichtert und ihr zeitliches und ewiges Heil erreicht werden könnte« (Böhm 1948, 11 zit.n. Halper-Zenz/Preßlauer 1996, 56). In seiner Katholischen Normalschule für die Taubstummen, die Kinder und andere Einfältigen, zum gründlichen sowohl als leichten Unterricht in dem Christenthume (Titel seiner 1788 veröffentlichten Schrift) unter-richtete er in Brixen und in Hall taubstume Kinder, indem er ihnen religiöse Bilder zeigte und deren Inhalt laut erläuterte.[98]
In Frankreich (1770) und in Wien (1779) waren um diese Zeit bereits Tabstummeninstitute gegründet worden. 1828 war es auch in Tirol so weit: Das Landes-Gubernium beauftragte Kreisamt Pustertal »zur Errichtung der geplanten Taubstummenanstalt in der Stadt Brixen die erforderlichen Maßnahmen zu reffen« (ebd., 87). Der Innsbrucker Geistliche Johannes Amberg (1802 -1882) wurde als Leiter ausersehen und erwarb das Auenhaus (Dal Rio) in Brixen. Ziel der neuen Einrichtung sollte über die rein religiöse Erziehung Knolls hinaus sein: »gehörlose Kinder zu religiösen, moralischen und brauchbaren Menschen zu bilden. Sie sollten befähigt werden, sich ihren Unterhalt durch angemessene Beschäftigung selbst zu erwerben« (Böhm 1948, 15, zit.n. ebd., 88). Finanziert von einem auf Spenden beruhenden Taubstummenfonds wurde das Haus 1830 mit acht Zöglingen eröffnet, die aus 36 Bewerber/innen ausgewählt worden waren. Die Auswahl war an strenge Kriterien gebunden. Die sieben bis höchstens zwölf Jahre alten Kinder mussten aus legitimen Ehen stammen, katholisch sein, bzw. mussten die Eltern zustimmen, dass sie katholisch erzogen wurden, sie durften nicht "blödsinnig" sein und keine weiteren körperlichen Behinderungen oder Krankheiten haben. Arme Kinder und Waisenkinder sollten bevorzugt aufgenommen werden.
Nach mehreren Umzügen übersiedelte das Institut 1835 in die Nagglburg, das alte Solenbad-Gebäude in Hall und bot nun Platz für 40 deutsch- wie italienischsprachige Kinder. 1842 wurde für die italienischen Kin-der ein privates Taubstummeninstitut eröffnet. Das Tiroler Institut übersiedelte 1979 nach Mils in ein neu errichtetes mächtiges Gebäude, wo es als Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik bis heute besteht.
1898 wurde in unmittelbarer Nähe der Taubstummenanstalt in Mils bei Hall das dort seit längerem bestehende Armenhaus erworben. Das Haus war, wie der Leiter der Taubstummenanstalt ganz im Stil der Ar-menschelte seiner Zeit schreibt, übel beleumdet: Es wurde »zur selbigen Zeit von betrunkenen, arbeits-scheuen und arbeitslosen Individuen beiderlei Geschlechtes und von ungefähr 20 Kindern« bewohnt, die natürlich ohne jede Erziehung aufwachsen mußten« (Hauschronik St. Josef, zit.n. ebd.,1996, 94). Tatsächlich befand sich das Haus in einem erbärmlichen Zustand und war von Notleidenden alle Couleurs überfüllt: Arme, Kranke, Alte, verwaiste oder verlassene Kinder, usw. 1893 wurde auf Initiative des Milser Bürger-meisters Josef Tiefenthaler und des Pfarrers Anton Jörg ein neues Haus für »Arme und Cretene« (Hauschronik) errichtet. Die Leitung 1898 den Barmherzigen Schwestern von Zams übertragen, »die sich in christlicher Nächstenliebe aller Armen und Kranken und Hilfsbedürftigen annehmen und pflegen« (Hauschronik, zit.n. ebd., 96). Nach einer Unterbrechung in der NS-Zeit, wo 69 Insassen in die Tötungsanstalt Hartheim überstellt wurden, existiert des Soziale Zentrum St. Josef bis heute. Es umfasst derzeit zehn Wohngruppen. Werkstätten und eine Sonderschule.
Wie viele andere kirchliche und weltliche Einrichtungen richten sich auch gegen das St. Josefs-Haus Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe. Eine 1980 als Hilfspflegerin tätige Frau hatte die "Erziehungsmethoden" miterlebt und Tagebuch geführt. "Es gab kalte Duschen, Zwangsjacken, Beschimpfungen, Fußtritte und die Insassen wurden stundenlang im Klo eingesperrt", erzählte die Zeugin gegenüber ORF Radio Tirol. Habe ein Kind erbrochen, habe es das Erbrochene wieder aufessen müssen, schilderte sie. Die damals 22-Jährige habe sich an das Jugendamt und das Land Tirol gewendet, aber niemand habe ihr damals Gehör geschenkt. Sie sei als Lügnerin und Nestbeschmutzerin beschimpft und aufgefordert worden, ihre Auf-zeichnungen zu verbrennen (derSTANDARD.at). Ein von der Staatsanwaltschaft eingeleitetes Verfahren wurde eingestellt. Zu den jetzt wieder aufgegriffenen Vorwürfen teilt die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern mit: Es sei richtig, "dass Mitte der 70er Jahre Vorwürfe gegen Betreuerinnen der oben genannten Behinderten- und Pflegeeinrichtung in Mils erhoben wurden. Sowohl unsere Gemeinschaft als auch die staatlichen Ermittlungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Land Tirol) wurden darauf umgehend tätig und sind diesen Vorwürfen nachgegangen. Nach umfangreichen Untersuchungen durch die Ermittlungsbehörden wurden sämtliche Erhebungen eingestellt!" Gleichwohl versprach sowohl der Orden als auch die Landesregierung die Aufklärung der Vorwürfe.[99]
Die südlichen Landesteile fühlten sich gegenüber den nördlichen benachteiligt und forderten eine eigene Anstalt für italienischsprachige Patient/innen. Die Haller Anstalt sei »für die Bedürfnisse Welschtirols weder hinreichend noch nützlich« und »Tiroler italienischer Nationalität« würden »schlechter behandelt als die Deutschen« (Klebelsberg 1931, zit.n. ebd., 80). Mit der Errichtung einer zweiten Irrenanstalt im Trient wurde dieser Forderung entsprochen.
Die Irrenanstalt von Pergine war für die Südtiroler Bevölkerung ein Begriff. "Von Pergine", schreibt Gertraud Egger, "das wusste ich schon als Kind, kam niemand so schnell wieder, die meisten nie." Allein mit dem Namen der Anstalt konnte man Kindern drohen. "Man lehrte uns eine eigenartige Mischung aus Angst, Verachtung und Mitleid gegenüber allen jenen, die auch nur einmal in Pergine waren. ‚Pergine' war ein Schimpfwort, drohende Strafe nicht nur bei Alkoholismus und Wut, war permanente Einschüchterung." Wie so oft stabilisierten die "Gesunden" ihre Normalität mithilfe der Abwehr der Ausgegrenzten. "Pergine mach die Tore auf, da kommt der/die ... in vollem Lauf, setzt sich auf das Fensterbrett und schreit: I bin der Ober-tepp!" (Egger 1999, 48).
Am Eingang der 1882 für heilbare und gefährliche - also nicht für chronische - Geisteskranke gegründeten Irrenanstalt von Pergine stand ein Schild: »Eintritt bei Geldstrafe von zwei Gulden oder Verhaftung verboten.« Die Einschließung der Geisteskranken war total und bedeutete deshalb auch den Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Anstalt war mit einem Landwirtschaftsbetrieb verbunden, auf dessen Feldern Patienten zu arbeiten hatte, "Arbeitsverweigerung wurde als Symptom der Krankheit bewertet, Arbeitswillen hingegen bestätigte die beginnende Besserung" (ebd., 57). Die Aufforderung an die Krankenpfleger, "den Kranken jene Höflichkeit zu erweisen, die man ihrer Stellung schuldete, als sie noch gesund waren", versteht Egger so, "dass man armen Menschen nur einen geringen Respekt entgegenbringen musste." Die Direktoren der Anstalt verfügten über "despotische Macht, deren Kontrolle und Befehlsgewalt alles unterlag" (ebd.).
Die Behandlungsmethoden waren in Pergine, wie in Italien insgesamt, äußerst rückständig. Während in England und Frankreich bereits fortschrittliche Verfahren angewandt wurden, waren hier weiterhin die "klassischen Methoden" state of the art. Die unselige Tradition der Annahme, dass krampf- und schockerregende Verfahren Psychosen heilen könnten - basierend auf der Beobachtung, dass z.B. Epileptiker gegen Psychosen immun seien - führte zu einer Favorisierung dieser Methoden. Dabei darf man über der Feststellung, dass schon diese Grundannahme falsch ist, die dahinter wirksame Mentalität der Psychiater nicht vergessen: "Heilung" im Sinne der Wiedererlangung des Status der Vernunft mit allen Mitteln zu betrieben, einschließlich der Zufügung von Schmerzen und dem Risiko der Verletzung und letztlich des Todes. Die Psychiatrie steckte bis weit in das 20. Jahrhundert tief in der Kontroll- und Korrektionspädagogik der Aufklärungszeit, die in der Anpassung der "Zöglinge" an das von den Erwachsenen bestimmte Verhalten ihren obersten Zweck sah, der die angewandten Zwangsmittel heiligte (vgl. Rutschky 1977; Glantschnig 1987; deMause 1980). Die Psychoanalyse Freuds, durch die die Eindeutigkeit der Unterscheidung zwischen "Normalen" und "Abnormalen" relativiert und psychische Krankheit als Folge überfordernden Normalitätsdruckes denkbar und ihre Behandlung als therapeutischer Dialog anstatt psychiatrischer Zwangsmaßnahmen sinnvoll wurde, wurde von führenden Psychiatern wütend bekämpft.
1917 hatte der österreichische Psychiater Julius Wagner von Jauregg (1857 - 1940) die Malariatherapie eingeführt. Durch die Injektion der Erreger sollten heilsame Fieberschübe und Krämpfe hervorgerufen werden.[100] Ebenfalls auf einen Österreicher, den Psychiater Manfred J. Sakel (1900 - 1957) geht die Behandlung Schizophrener mit Insulin-Schocks zurück, die er geradezu missionarisch in Österreich, Deutschland und den USA zu verbreiten versuchte. Wie manche der "Neue Behandlungsmethode der Schizophrenie" (Buch-titel Sekel 1935) auf der Verallgemeinerung eines Zufalls.[101] Im Privatsanatorium Lichterfelde, wo Sekel morphiumsüchtige Schauspieler/innen und Künstler/innen behandelte, war einer Frau irrtümlich eine zu hohe Dosis Insulin verabreicht worden. Durch den aufgetretenen hypoglykämischen Schock hatte sich die Morphiumsucht verringert. Im Vorwort zu Sakels Buch schreibt der Leiter der psychiatrischen Uniklinik Wien Pötzl, dass die Resultate zwei- bis dreimal besser seien als die optimistischsten Statistiken über unbehandelte Verläufe der Schizophrenie.
Auch der Elektroschock, eine der verbreitesten Methoden der Psychiatrie, wurde durch einen Zufall entdeckt. Der italienische Psychiater Uogo Cerletti, von 1946 bis 1959 Präsident der italienischen Psychiatrischen Gesellschaft, hatte in Schlachthöfen gesehen, dass Schweine vor der Schlachtung mit Stromschlägen beruhigt wurden, eine Methode, die er nach Tierversuchen mit Hunden auch auf Patient/innen in Irrenanstalten anwandte. Dass diese Methode, die zu so heftigen Krämpfen führt, dass Knochenbrücke auftreten und Hirnschäden verursacht werden, in der Psychiatrie immer noch verwendet wird, ist eine der bittersten Einsichten in den Mangel an Lernfähigkeit dieser Disziplin. Egger (1999, 81 f.) zitiert hierzu die Aussagen führender Psychiater in Tirol und Südtirol aus den 1990er Jahren, die zeigen dass die "Elektroschlaftherapie", wie sie neuerdings verharmlosend genannt wird, neben einer wachsenden Zahl von Kritikern immer noch ihre Verteidiger findet:
Bruno Frick (Privatklinik Grieserhof Bozen und langjähriger Leiter des Stadlhofs in Pfatten): "Solange wir nicht besser mit Psychopharmaka umgehen können, brauchen wir den Elektroschock."
Lorenzo Toresini (Triest, seit Anfang '99 Primar der SE West, Meran): "Die Nicht-Anwendung steht außer Diskussion. [...] Außerdem fällt sein Comeback [des Elektroschocks] dort auf fruchtbaren Boden, wo der Sinn der Psychiatriereform nicht verstanden worden ist."
Josef Schwitzer Innsbrucker Klinik, mittlerweile Primar der SE Nord, Brixen): "Die Ethik gebietet es, dem Patienten ein schweres, langdauerndes Leiden zu erleichtern, wenn die Möglichkeit dazu besteht."
Roger Pycha (Oberarzt der psychiatrischen Abteilung in Bruneck): "Bei manchen Krankheitsbildern fällt die Relation Wirkung-Nebenwirkung zugunsten der Elektroschlaftherapie aus." Er räumt jedoch ein, daß es eine "hohe Rückfallquote" gibt.
Ernesto Arreghini (KH Trient): "Eher bringen wir uns um, als den Elektroschock anzuwenden" (in: Südtirol profil, 06.03 1995).
Vielleicht die schlimmste der schlimmen Methoden der Psychiatrie ist die die Lobotomie, ein bis in die 1950er Jahre häufig durchgeführter chirurgischer Eingriff, bei dem Nervenverbindungen im vorderen Stirn-lappen durchtrennt werden. Die Patienten werden dadurch passiv und verlieren "das kritische Vermögen und jeden Realitätsbezug". Sie werden nach den zynischen Worten eines amerikanischen Psychiaters "ziemlich gute Bürger" (Egger 1999, 80). Die Vereinfachung dieser Methode durch den italienischen Psychiater Fiamberti, die ermöglichte, dass sie nicht nur von Chirurgen, sondern auch von Psychiatern durchgeführt werden konnte, wurde als Fortschritt begrüßt.
Die hauptsächlichen Mittel zur Behandlung psychischer Krankheiten sind in der Gegenwart aber Psychpharmaka.
"Bis zwölf Uhr fühlte ich keine subjektive Änderung, dann hatte ich den Eindruck, schwächer zu werden und zu sterben. Es war sehr angsterregend und quälend. [...] Um dreizehn Uhr fühlte ich mich unfähig, mich über irgend etwas aufzuregen."
Mit diesen Sätzen dokumentierte die Psychiaterin Cornelia Quarti am 9. November 1951 ihren ersten Selbstversuch mit Chlorpromazin, dem ersten in der Medizin bekannten Neuroleptikum. Neuroleptika bewirken, vornehmlich durch eine Beeinflussung der Neurotransmitter eine Verminderung der Übertragung von Nervenimpulsen und dadurch im günstigsten Fall eine Reduzierung von Symptomen wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Übeerregtheit, wobei die Nebenwirkungen enorm sind. "Wir verwandeln den see-lisch leidenden vorübergehend in einen hirnanatomisch kranken Menschen", so beschreiben etwa Klaus Dörner und Ursula Plog (1980, 377 zit.n. Lehmann 1990, 94) die Wirkung von Neuroleptica in ihrem Lehrbuch der Psychiatrie.
Während des Ersten Weltkrieges musste die Anstalt in Pergine für das Militär geräumt werden, die Patient/innen wurden im gesamten Gebiet von Österreich-Ungarn verteilt. Nachdem 1919 Südtirol dem König-reich Italien zugesprochen wurde, wurden auch die Südtiroler Patient/innen aus Hall nach Pergine verlegt. Benito Mussolini, der 1922 an die Macht kam, plante eine "Stadt der Geisteskranken", in der der österreichische mit dem italienischen Teil verbunden werden sollte. "Obwohl nicht der gesamte Plan verwirklicht werden wird, wächst die ursprünglich für 240 Kranke konzipierte Anstalt innerhalb von fünfzig Jahren zu einer gespenstischen Riesenanlage mit 750 Betten an" (ebd. 59). 1927 wird die Provinz Venetia Tridentina zweigeteilt, Trient und Bozen werden selbständige Provinzen. Pergine wurde 1978 für die Provinz Trient geschlossen, für Südtiroler Patient/innen blieb es aber aus Mangel an eigenen Einrichtungen noch bis 2002 geöffnet. Da die Provinz Bozen sich weigerte, eine eigene psychiatrischen Anstalt einzurichten, mussten weiterhin alle Südiroler Patient/innen nach Pergine, in eine Anstalt übrigens, in der sie, da dort keine Südiroler Pfleger/innen arbeiteten, "im Gespräch mit Ärzten und Pflegern nie ihre Muttersprache benutzen konnten". Die Provinz Bozen blieb "psychiatrisches Ödland" (ebd.).
1938 entschloss sich die Provinz Bozen endlich zu einem ersten bescheidenen Schritt. Der in Pfaffen leer-stehende »Stadlhof«, vorher eine Besserungsanstalt für verwahrloste Jugendliche, wurde, zunächst als Außenstelle von Pergine und seit 1963 unter eigener Verwaltung, als beschäftigungstherapeutische Anstalt für chronische Psychiatriepatient/innen eingerichtet. Die Versorgung der ca. 150 Kranken aller Altersstufen war erbärmlich: "Anwesenden Arzt gab es im Stadlhof keinen; nur 1x pro Woche kam der Gemeindearzt von Branzoll vorbei." Auch das beschäftigungstherapeutische Konzept ging nicht auf. "Es überrascht nicht, dass es die »Kranken« selbst waren, die die Arbeit nicht als Therapie empfanden, sondern als das, was sie wirklich war: harte Arbeit, die ihnen nicht zugute kam, sondern der wirtschaftlichen Rentabilität des Betriebes. Am frühen Morgen zogen sie auf die Felder, legten Sümpfe trocken, produzierten Obst, Gemüse und Blumen, betrieben Viehzucht und die Landwirtschaft und kehrten erst am späten Abend zurück." Die von den Zuständigen der Provinz Bozen propagierte »wiederkehrende Seelenruhe dank der edlen Arbeit auf den Feldern« stellte sich dabei nicht ein. Statt dessen erkannte man immer deutlicher, "dass der Arbeit allein keine therapeutische Wirkung zukam [...] Nur ca. 10% der Insassen des Stadlhofes (1940 waren es 120) konnten nach Hause zurückkehren; für den großen Rest hatte die mühsame Arbeit in den Weinbergen nur das Ziel, einer möglichen Verschlechterung ihres Zustandes eventuell vorzubeugen" (ebd. 60).
Nachhaltige Veränderungen im Umgang mit Geisteskranken wurden erst im Gefolge der umfassenden Gesellschaftskritik möglich, die ab den 1960er Jahren von sozialen Bewegungen in ganz Europa artikuliert wurde. Die konservativ-disziplinären Methoden der Irrenanstalten waren angesichts dieser gesellschaftlichen Situation nicht mehr tragbar. Deren Zustand in Italien wurde von kritischen Psychiatern mit dem deutschen Begriff "Lager" charakterisiert: "Das Ziel der Therapie bestand überwiegend in der physischen und psychischen Ruhigstellung der geistig Kranken, teilweise bis zu ihrer vollkommen (körperlichen) Unbeweglichkeit: Zwangsjacke, Anbinden an Stühle oder Bänke im Sommer, Einschließen in Eisenkäfigbette für mehrere Stunden oder ganze Tage, bei ‚Aufmucken' ‚la strozzeria' (ein großes Nasses tuch wird so eng um das Gesicht gebunden, dass es zu Erstickungsanfällen kommt" (Weber-Unger 1984, zit.n. Egger 1999, 85).
Die Psychiater Franco Basaglia (1924 - 1980), ab 1961 Leiter des Psychiatrischen Krankenhauses in Gorizia (Görz) und ab 1972 in Triest, und Agostino Pirella veröffentlichen in Berichten und Fotodokumentationen die Zustände in den Psychiatrischen Kliniken in Görz, Triest und Arezzo, von denen sich jene in anderen italienischen Städten kaum unterschieden: "Die Patienten durften sich innerhalb der Anstalt nicht frei bewegen trugen Anstaltskleidung, hatten alle Rechte verloren, durften keine Meinung äußern und waren Opfer permanenter Zwangsmethoden. Widerspruch, Apathie, diffuse und offene Gewaltbereitschaft und zunehmende Regression wurden als Symptome und ‚Beweis' der Krankheit abgetan, anstatt darin - zumindest auch - die Auswirkungen der institutionellen und gesellschaftlichen Behandlung zu sehen" (ebd., 86).
Zu den ersten Maßnahmen Basaglias in Görz gehörten deshalb "die Abschaffung der schlimmsten Zwangsmethoden, die Rückgabe der persönlichen Kleidung, die Einführung gemeinsamer Versammlungen und die Öffnung einiger Abteilungen" (ebd.). Das Bemerkenswerte an den Reformen, die Basaglia und andere auf den Weg brachten, besteht unter anderem darin, dass sie nicht von einem eingeengten medizinischen Blickwinkel getragen wurden, sondern von einer breiten intellektuellen Auseinandersetzung mit philosophischer, soziologischer und sozialpsychologischer Theorie und Gesellschaftskritik wie etwa die Analyse von Asylen als totale Institutionen des amerikanischen Interaktionalisten Goffman, die Krankheit nicht als individuellen Defekt, sondern als gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Phänomen begreift. Nicht zuletzt durch die Unterstützung linker Parteien und Gewerkschaften gelang es 1978 ein neues Psychiatrie-gesetz in Italien durchzusetzen, "das wohl fortschrittlichste Europas" (Bopp 1980 ,75, zit.n. ebd., 87).
Die italienische Psychiatriereform hatte bereits Jahrzehnte vorher ihre Vorläufer in anderen Ländern. Bereits 1947 gründete der Engländer Maxwell Jones im Londoner Hendorson-Spital die erste Therapeutische Gemeinschaft, in der die Zangsmaßnahmen und die Medikamente durch Psychotherapien und tägliche Versammlungen der Patienten und der Betreuungsteams ersetzt wurden Jones u.a. 1976). Im Zentrum des Geschehens sollte nicht die "Behandlung" der Patienten stehen sondern soziales Lernen. Das bedeutete einen therapeutischen Dialog statt einseitig diagnostischer Ermittlung und medizinischer Anweisung, der von der Arzt-Patient-Dyade auf die gesamte Gemeinschaft ausgedehnt werden sollte, demokratische Beziehungen zwischen Psychiater/innen, Pfleger/innen und Patient/innen, offene Kommunikation und Information, Delegation von Entscheidungen auf die unterste mögliche Ebene, permanente Reflexion der Prozesse mit allen und die Schaffung möglichst vieler Gelegenheiten zu sozialem Lernen, z.B. im Tanz, bei Festen oder mit Theater und Film (ebd. 88, nach Bopp 1980, 25).
Freilich wurden zunächst nur wenige Anstalten in England, Schottland oder den USA nach diesem Modell reformiert. Nicht wenige Versuche scheiterten an den Widerständen der etablierten psychiatrischen Institutionen und/oder einer auf die Isolierung der Irren eingestellten sozialen Umwelt und Politik. Die Reform drängte deshalb aus den Anstalten hinaus und zog dadurch nicht nur stärkeren öffentlichen Widerstand auf sich, sondern auch eine Spaltung in den Reihen der Reformer: Die Reform und die mit ihr verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen mit den fortschrittlichen Kräften in Politik und Parteien zu befördern - die pragmatische Position Basaglias - oder gegen jede etablierte Politik - die revolutionäre Position der "68er" - das waren die strategischen Alternativen, die leidenschaftlich vertreten wurden. Entscheidendes Kriterium war die Öffnung der Anstalten. "Alle Forderungen nach psychosozialen Ambulatorien, Tagesklinik, Hilfe bei Arbeitssuche und dem Aufbau einer Gerontopsychiatrie wurden entweder ignoriert oder abgelehnt" (ebd., 91), auch in der Kommune von Görz, weshalb Basaglia die Klinik 1968 verließ. 1971 wurde dort das Experiment eingestellt.
Die Reform war dadurch nicht aufzuhalten. Zahlreiche Anstalten in ganz Italien übernahmen Elemente der "antiinstitutionellen", "demokratischen" oder "kritischen" Psychiatrie, wie sie sich bezeichnete. Basaglia selbst reformierte die Psychiatrie von Parma und später in Triest, Pirella in Arezzo, Jervis, ein anderer Mit-streiter in Görz die psychiatrischen Dienste in Reggio Emilia. Ähnliche Bemühungen gab es in Ferrara, Reggio Calabria und Perugia. Reihenweise wurden Entwürfe für Reformgesetze vorgelegt und abgelehnt. 1968 gelang es immerhin, die Eintragung in das Strafregister abzuschaffen und die Möglichkeit einer freien Aufnahme gesetzlich zu verankern. Die Anstellung mindestens eines Anstaltpsychologen wurde zur Pflicht gemacht, die Anstaltsgröße auf maximal 125 Patient/innen und maximal 5 Abteilungen beschränkt. Extramurale Einrichtungen wurden nur ermöglicht, nicht vorgeschrieben.
Der letztendliche Durchbruch der Reform ist einer Reihe von Dynamiken zu verdanken, die in dieselbe Richtung wirkten: dem revolutionär/reformatorischen Impetus der 68er Bewegung; der Zusammenarbeit der Reformer mit allen relevanten sozialen Gruppen, von der Familie bis zu den Kommunalbehörden, den Gewerkschaften, Betrieben und Schulen; der Verbreitung grundsätzlicher Kritik an gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und Ausbeutung durch linke Bewegungen weit über intellektuelle Kreise hinaus und letztlich das innenpolitische Taktieren der Mehrheitsparteien zwischen der 68er Bewegung, Forderungen radikaler Bürgerparteien und der wachsenden Verbreitung der Psychiatriereform.[102] Unter maßgeblicher Verantwortung Basaglias wurde ein neues Psychiatriegesetz (Nr. 180) erarbeitet und zusammen mit einem neuen Gesundheitsreformgesetz (Nr. 833) am 15.05.1978 in Kraft gesetzt.
Die Irrenanstalten werden durch das neue Gesetz nicht abgeschafft, aber sie verlieren ihren Rang als exklusive und obligatorische Einheiten der psychiatrischen Behandlung. Entscheidend war, dass die psychiatrischen Dienste aus der Oberhoheit der Gerichte heraus genommen und dem Gesundheitswesen eingegliedert wurden. Damit rückte an Stelle von Gericht und Polizei und an Stelle von Verwahrung und Überwachung das Recht auf psychische Gesundheit, der/ie Patient/in bleibt grundsätzlich freie/r Bürger/in, auch in Bezug auf die Behandlungsmethoden. Vorrangig soll diese Behandlung außerhalb von Krankenhäusern stattfinden. Das Gesetz sieht vor, dass die bestehenden psychiatrischen Anstalten bis 1996 zu schließen sind und dass ab 1981 keine Neuaufnahmen mehr gestattet sind. An den allgemeinen Krankenhäusern sind eigene psychiatrische Abteilungen zu errichten. Wohl auf Grund des Zeitdruckes wurde allerdings eine Reglung für die manicomi giudiziari (Irrenhäuser für Gesetzesbrecher) "schlicht vergessen" (Egger 1999, 95).
Zwangseinweisungen sind unter Wahrung der persönlichen Würde und der bürgerlichen Rechte der Betroffen nur möglich, wenn akute psychische Veränderungen dringende therapeutische Maßnahmen erfordern, der/ie Patient/in solche Maßnahmen nicht akzeptiert und es keine Möglichkeit einer geeigneten Therapie außerhalb des Krankenhauses gibt. Alle drei Bedingungen müssen zutreffen. Solche Einweisungen müssen vom Bürgermeister angeordnet, von zwei Ärzten bestätigt und binnen 48 Stunden dem Vormundschaftsrichter vorgelegt werden. Bei einer Dauer von über 7 Tagen ist der gesamte Vorgang zu wiederholen. Innerhalb von 10 Tagen kann jede/r beim Bürgermeister oder beim Landesgericht gegen die Einweisung berufen, auch der Kranke selbst. Die Behörden haben dann innerhalb von 10 Tagen zu entscheiden. Nicht mehr das Kriterium der Selbst- Und Fremdgefährdung oder des öffentlichen Skandals steht im Vordergrund. Sondern die "therapeutische Notwendigkeit". Nicht mehr "die Gefahr, sondern die Krankheit steht (zumindest theoretisch) im Vordergrund" (ebd., 96).
Nicht zu unrecht versieht Gertraud Egger ihr Kapitel über Südtorls Psychiatrie der letzten 50 Jahre mit dem Untertitel "Passivität und Ignoranz" (ebd., 100 ff.). Die Errichtung ausreichender Betreuungseinrichtungen für Geisteskranke wurde von der Provinz Bozen nach Kräften verhindert. Erst 1971 entschloss man sich zur Einrichtung von drei Zentren für geistige Gesundheit in Bozen, Brixen und Bruneck. Mit wie wenig Nach-druck die Provinz dieses Anliegen verfolgte, zeigt der Personalstand dieser Zentren: "Der Personalstand jener Zeit spricht Bände: i die Zentren von Brixen du Bruneck kam alle Tage ein Arzt aus Innsbruck, und der teilbeschäftigte Arzt des Zentrums Boten musste seinen Dienst auch in Meran und Schlanders leisten. Ihnen zur Seite standen nur wenige Krankenschwestern und noch weniger Sozialassistent/innen (1982 gab es in ganz Südtirol 19). In zwei Stunden mussten 50-60 Patienten ‚behandelt' werden. Zwei Minuten pro Geschichte, Krankheit und Leid. Zuhören, Hinsetzen, Händedruck, Kopf-frei-machen, menschliche Wärme u.a.m. war von vornherein unmöglich" (ebd., 102). Ein 1976 verabschiedetes Landesgesetz, das neben den Zentren für geistige Gesundheit Abteilungen an den Krankenanstalten, Wohnheime und Einrichtungen für Tages- bzw. Nachtbetreuungen vorsah, hatte auf Grund des Personalmangels nur geringe Auswirkung: Zwei Wohnheime in Bozen und Sterzing konnten ganze 18 Personen aufnehmen, akut Kranke landeten weiterhin in Pergine, in Innsbruck oder in Hall.
Nach dem gesamtstaatlichen Psychiatriegesetz 180/833 war auch Bozen gezwungen, zu handeln, noch-mals allerdings äußerst zögerlich. Es wurde eine erste Abteilung im Bozner Allgemeinen Krankenhaus mit 15 Betten eingerichtet, erst 1994 folgte eine zweite und eine weitere in Bruneck. Zusätzlich gab es weiterhin 50 Betten für chronisch Kranke im Stadlhof und - für begüterte Patient/innen eine psychiatrische Abteilung im Privatsanatorium Bozen-Gries. Wie wenig das alles war, zeigen die Zahlen: Im Jahr 1991 wurden in Innsbruck und Hall 277 Patient/innen aus Südtirol aufgenommen, 1993 waren es bereits über 300 (Hinterhuber/Meise 121, n. Egger 103).
Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Psychiatriegesetzes "war die Lage der Psychiatrie in Südtirol trotz zu-nehmendem Wohlstand der Provinzhöchst unzulänglich und der ausgerufene ‚Notstand' nur eine Um-schreibung für die Nicht-Existenz von Diensten" (ebd., 106). 1988 arbeiten in der Psychiatrie insgesamt 92 Ärzte, Pfleger/innen und Sozialbetreuer/innen, mehr als die Hälfte davon in Bozen, ganze 40 im Rest des Landes, vier- bis achtmal weniger als in vergleichbaren Regionen, und kein einziger niedergelassener Psychiater. Erst seit 1994 gibt es eine psychiatrische Abteilung in Bruneck, seit 1997 in Brixen, alle überbelegt, mit Notbetten am Gang.
1996 verbschiedet die Südtiroler Landesregierung den Psychiatrieplan 2002, nach dem Psychiatriegesetz eigentlich eine überflüssige Maßnahme: Es ginge nicht um Neue Pläne oder Gesetze, sondern um deren Verwirklichung. Immerhin hat die Erstellung eines nunmehr "eigenen" Psychiatrieplanes der Versorgung in Südtirol "offensichtlich Flügel verliehen" (ebd., 112). Nach einem Bericht der Landesregierung wurden bis 1998 neben den Abteilungen der Krankenhäuser (50 Betten) neue extramurale Einrichtungen und Behandlungsmöglichkeiten errichtet: Day- and Night Hospitals, Rehabilitatinszentren, Übergangswohnheime und Wohnheime, Wohngemeinschaften, Berufstrainingszentren und Treffpunkte, insgesamt an die 200 Betten bzw. Plätze, womit 63,6% der im Plan vorgesehenen Kapazitäten und 54% der vorgesehenen Stellen erreicht waren. "Wir haben gut gearbeitet", resümiert der Bericht der Landesregierung (Das Land Südtirol, März '98, zit.n. ebd.).
[82] Als Wechselbälger galten Kinder des Teufels, die dieser nachts heimlich gegen ein Neugeborenes ausgetauscht hatte. Nach dem 1486 verfassten Malleus Maleficiarum (Hexenhammer) könne man sie daran erkennen, dass sie »ständig heulen und niemals wachsen, selbst wenn vier oder fünf Mütter zur Verfügung stehen, um sie zu stillen« (zit.n. deMause 1980, 25).
[83] René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650
[84] Edouard Thouvenel, frz. Außenminister, 1861/62
[85] Philippe Pinel, frz. Psychiater, Leiter des Hôpital Salpêtrière, 1745 -1826
[86] Wilhelm Grisinger, dt. Psychiater, 1917 - 1868
[87] Franz Josef Gall, dt. Arzt, 1758 - 1828
[88] Giovanni Stefano Bonacossa, ital. Psychiater, 1804 - 1878 Francesco Bini, ital. Psychiater, 1815 - 1898
[89] Francesco Bini, ital. Psychiater, 1815 - 1898
[90] Vincenzo Chiarugi, ital. Psychiater, 1759 - 1820
[91] Carlo Livi, ital. Psychiater, 1823 - 1877
[92] Andrea Verga, ital. Psychiater, 1811 - 1895
[93] Serafino Biffi, ital. Psychiater, Verfasser von Studien über Irrenhäuser und Geisteskranke, 1822 - 1899
[94] Giovanni Giolitti, 1842 - 1928, italienischer Ministerpräsident
[96] Epiphysan wird bei Kühen zur Vermeidung des Brunftverhaltens angewendet.
[97] Hartmut Hinterhuber, bis vor kurzem Psychiatrie-Chef in Tirol, sagte gegenüber dem ORF, für ihn sei die angebliche Anwendung von Röntgenstrahlung völlig unverständlich. Die aus heutiger Sicht indiskutablen pädagogischen Ansichten Nowak-Vogls bedaure er, aber sie seien ebenso wie die Ablehnung von Onanie "Mainstream", also allgemeine Sichtweisen, gewesen. Schließlich sei Nowak-Vogl 1972 von der geisteswissenschaftlichen Fakultät zur außerordentlichen Professorin ernannt worden.
[98] Knoll ist auch mit einer Reihe von Erfindungen für bettlägrige Kranke hervor getreten, u.a. mit einer speziell konstruierten Leibschüssel.
[99] Zur Heimerziehung in Tirol siehe: Schreiber, Horst / Arora, Steffen: Heimerziehung in Tirol. Innsbruck u.a.: StudienVerlag 2010.
[100] Wie gut sich derartige "Heilmethoden" in die Philosophie der Mainstream-Psychiatrie fügten, zeigt sich daran, dass Wagner von Jauregg 1927 der Nobelpreis für seine Verdinste um die Psdachiatrie verliehen wurde.
[101] Einen besonders krassen Fall stellt der Innsbrucker Psychiater Hubert Urban dar, der Multiple-Sklerose Patient/innen aufgrund der Annahme, dass Chines/innen nicht an dieser Krankheit leiden, temporär die Gallenkanäle abklemmte um dadurch Gelbsucht zu erzeugen. Einer Frau mit großem Kropf entfernte er die Schilddrüse und ersetzte sie durch jene eines Kalbes. Diese und andere Patient/innen haben die Eingriffe nicht überlebt.
[102] Die 1978 in Bologna gegründete Bewegung Demokratische Psychiatrie zählte bereits am Beginn 3000 Mitglieder.
Alföldy, G.: Römische Sozialgeschichte. Wiesbaden: Steiner Verlag 31984.
Aus der Schmitten, Inghwo: Schachsinnig in Salzburg. Zur Geschichte einer Aussonderung. Salzburg: Umbruch 1985.
Beimrohr, Wilfried: Die öffentliche Armenfürsorge in Tirol vom 16. - 19. Jahrhundert. In: Weiss, Sabine (Hg.): Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann Rainer. Innsbruck 1988.
Bockmann, Hartmut: Das Mittelalter. Ein Lesebuch aus Texten und Zeugnissen des 6. bis 16. Jahrhunderts. München, C.H.Beck 21989.
Bolkestein, Hendrik: Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ütrecht: Oosthoek 1939 (Nachdruck: Groningen: Bouma 1967).
Bopp, Jörg: Antipsychiatrie. Theorien, Therapien, Pilitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1980.
Breuer, Stefan: Sozialdisziplinierung. Probleme und Problemverlagerungen eines Konzepts bei Max Weber, Gerhard Oesterreich und Michel Foucault. In: Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Soziale Sicherheit und Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986, 45 - 69.
Bühler, Gottfried: Das Kind und seine Umwelt im Laufe der Zeiten. Eine Dokumentation. Bd.1: Antike. Zürich: Verlag Hans Rohr 1990.
Das Land Südtirol: Monatszeitschrift der Südtiroler Landesverwaltung. Bozen: März 1998.
Dietrich-Daum, Elisabeth / Kuprian, Hermann J.W. / Siglinde Clementi / Maria Heidegger / Michaela Ralser (Hg.): Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patienten und Patientinnen im historischen Raum Tirol seit 1830. Innsbruck: university press 2011.
Delumeau, Jean: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts. 2 Bde. Reinbek/Hamburg, Rowohlt 1985.
deMause, Lloyd: Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1977.
Dörner, Klaus: Bürger und Irre. Fankfurt/M.: Europ. Verlagsanstalt 21984.
Dörner, Klaus / Plög, Ursula: Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie. Bonn: Psychiatrie Verlag 1994.
Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. Bd. 2: Dorf und Stadt im 16. - 18. Jahrhundert. München: C.H.Beck 1992.
Egger, Gertraud: Irrengeschichte - irre Geschichten. Zum Wandel des Wahnsinns unter besonderer Berücksichtigung seiner Geschichte in Italien und Südtirol. Innsbruck: Diplomarbeit 1999.
Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation. 2 Bde. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976.
Engelke, Ernst: Theorien sozialer Arbeit. Eine Einführung. Freiburg/Breisgau: Lambertus 1999.
Finley, Moses I.: Die antike Wirtschaft. München: dtv 31993 [USA 1984].
Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1976.
Foucault, Michel: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frankfurt/M.; Suhrkamp 1973.
Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit. 3 Bde., Frankfurt/M.: Suhrkamp 1977 - 1986.
Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1969.
Geremek, Bronislaw: Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. München/Zürich: Artemis 1988.
Girard, RenÈ: Ausstoßung und Verfolgung. Eine historische Theorie des Sündenbocks. Frankfurt/M.: Fischer 1992.
Grassl, Herbert: Behinderte in der Antike. Bemerkungen zur sozialen Stellung und Integration. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 35-44
Halper-Zenz, Juliane / Preßlauer, Angelika: Vom Umgang mit Armen, Irren und Behinderten in Tirol. Vom Ausschluss zur Disziplinierung zur Integration. Innsbruck: Diplomarbeit 1996
Hands, A.R.: Charities an Social Aid in Greece and Rome. London 1968
Heidegger, Maria / Di Pauli, Celia / Noggler, Lisa / Clementi, Siglinde / Ralser, Michaela / Dietrich-Daum, Siglinde / Kuprian, Hermann J.W. (Hg.): Ich lasse mich nicht länger für einen Narren halten - Non vi permetterò più de farmi passare per matto. Bozen/Bolzano: Edition Raetia 2012.
Hinterhuber, Hartmann: Psychiatrie im Aufbruch. 100 Jahre Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck. Innsbruck: Verlag Integrative Psychiatrie
Hunecke, Volker: Überlegungen zur Geschichte der Armut im vorindustriellen Europa. In: Geschichte und Gesell-schaft 9/1983, 488 ff.
Hye, Franz-H.: Die Stadtteile Innsbrucks. Innsbruck: Stadtarchiv 1986.
Jens, Walter (Hg.): Kindlers Neues Literaturlexikon. 21. Bde. München: Kindler Verlag 1988
Jones, Maxwell: Prinzipien der therapeutischen Gemeinschaft. Soziales Lernen und Sozialpsychiatrie. Hgg. v. Edgar Heim. Bern u.a. 1976.
Jütte, Robert: Disziplierungsmaßnahmen in der städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit. In: Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Soziale Sicherheit und Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986, 101 - 48.
Klebelsberg, Ernst: 100 Jahre Heil- und Pflegeanstalt. In: 100 Jahre Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nerven-kranke in Hall in Tirol. Hall 1931.
Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988
Kloft, Hans: Das Problem der Getreideversorgung in den antiken Städten: Das Beispiel Oxyrhynchos. In: Ders. (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 123-154
Kohns, Hans P.: Hungersnot und Hungerbewältigung in der Antike. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 103-121
Korff, Gottfried: Bilder der Armut, Bilder zur Armut. In: Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Bettler Gauner und Proleten. Armut und Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Ein Bild-Lesebuch. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1983, 13-32.
Kudlien, Fridolf: "Krankensicherug" in der griechisch-römischen Antike. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 75-102
Laslett, Peter: Wie schlecht ging es den Bauern wirklich? Hunger und Krankheit im vorindustriellen England. Aus: Ders.: Verlorene Lebenswelten. Geschichte der vorindustriellen Gesellschaft. Frankfurt/M.: Fischer TBV 1991, 149 - 184.
Lehmann, Peter: Der chemische Knebel. Warum Psychiater Neuroleptika verabreichen. Berlin: Antipsychiatrieverlag 21900
Lütge, Friedrich: Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Berlin u.a. 31966.Marzahn, Christian / Ritz, Hans-Günther (Hg.): Zähmen und Bewahren. Die Anfänge bürgerlicher Sozialpolitik. Bielefeld, AJZ 1984.
Marzahn, Christian / Ritz, Hans-Günther (Hg.): Zähmen und Bewahren. Die Anfänge bürgerlicher Sozialpolitik. Bielefeld, AJZ 1984.
Mrozek, Stanislaw: Die privaten Alimentarstiftungen in der römischen Kaiserzeit. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaß-nahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 155-166
Münch, Paul: Lebensformen in der frühen Neuzeit. Frankfurt/M./Berlin: Propyläen 1992.
Niessen, Gerhard: Kulturgeschichte seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Klett-Cotta 2005.
Oesterreich, Gerhard: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Berlin 1969.
Oexle, Otto G.: Armut und Armenfürsorge im Mittelalter. In: Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhr-kamp 1986, 73 - 99.
Pantozzi, Giuseppe: Die brennende Frage. Geschichte der Psychatrie in den Gebieten von Bozen und Trient. Autonome Provinz Bozen - Südtirol 1989.
Pantozzi, Giuseppe: Die Psychiatrie in Italien. Ideen und Gesetzgebung im Laufe der Geschichte. Autonome Provinz Bozen- Südtirol 19997.
Pirella, Agostino: Sozialisation der Ausgeschlossenen. Praxis einer neuen Psychiatrie. Reinbek: Rowohlt 1986.
Prell, Marcus: Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im antiken Rom. Von den Gracchen bis Kaiser Diokletian. Stuttgart: Steiner 1977
Rathmayr, Bernhard: Die Rückkehr der Gewalt. Faszination und Wirkung medialer Gewaltdarstellung. Wiesbaden: Quelle & Meyer 1996
Rathmayr, Bernhard: Selbstzwang und Selbstverwirklichung. Bausteine zu einer historischen Anthropologie der abendländischen Menschen. Bielefeld: transcript Verlag 2011.
Rheinheimer, Martin: Arme, Bettler und Vaganten. Überleben in der Not 1450 - 1850. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2000.
Rochow, Friedrich E.: Versuch über Armenanstalten und Abschaffung aller Bettelei. Berin 1789.
Ruschenbusch, Eberhard: Sozialstruktur und Fürsorge: Das Modell Amorgos. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 45-53
Rutschky, Katharina (Hg.): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehug. Berlin: Ullstein 61993.
Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Jahrbuch der Sozialarbeit 4 - Geschichte und Geschichten. Reinbek: Rowohlt 1981.
Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Bettler Gauner und Proleten. Armut und Armenfürsorge in der deut-schen Geschichte. Ein Bild-Lesebuch. Reinbek: Rowohlt 1983.
Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Soziale Sicherheit und Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986.
Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd.1 (21998): Vom Spätmit-telalter bis zum 1. Weltkrieg; Bd. 2 (1988): Fürsorge und Wohlfahrtspflege 1971 - 1929; Bd. 3 (1993): Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus. Alle: Stuttgart/Berlin/Köln: Kolhammer
Schadelbauer, Karl: Das Stadtspital im Jahre 1830. Innsbruck: Stadtarchiv 1958.
Schreiber, Horst / Arora, Steffen: Im Namen der Ordnung. Heimerziehung in Tirol. Innsbruck u.a.: StudienVerlag 2010.
Schretter, Bernhard: Die Pest in Tirol 1611- 12. In: Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, Neue Folge Bd. 12/13, 182.
Shaw, Brent D.: Der Bandit. In: Giardina, Andrea (Hg.): Der Mensch der römischen Antike. Frankfurt/M./New York: Campus 1991, 336-381
Staffler, J.J.: Tirol und Vorarlberg. 2 Bde. Innsbruck 1842.
Stekl, Hannes: »Labore et fame« - Sozialdisziplinierung in Zucht- und Arbeitshäusern des 17. und 18. Jahhunderts. In: Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian (Hg.): Soziale Sicherheit und Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986, 119 - 142.
Stekl, Hannes: Österreichs Zucht- und Arbeitshäuser 1671 - 1920. Institutionen zwischen Fürsorge und Strafvollzug. Wien 1978
Treiber, Hubert / Steinert, Heinz: Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die 'Wahlverwandtschaft' von Kloster- und Fabrikdisziplin. München: Moos1980.
Ulbricht, Otto (Hg.): Die leidige Seuche. Pest-Fälle in der frühen Neuzeit. Kölln u.a.: Böhlau 2004
Ungern-Sternberg, Jürgen von: Überlegungen zum Sozialprogramm der Gracchen. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 167-185
Veblen, T.: Theorie der feinen Leute. München 1971.
Veits-Falk, Sabine: "Zeit der Noth". Armut in Salzburg 1803 - 1870. Salzburg, "Verein der Freunde Salzburger Geschichte" 2000, 58 - 74
Veyne, Paul: Brot und Spiele. Gesellschaftliche Macht und politische Herrschaft in der Antike. Frankfurt/New York: Campus 1988 [zuerst: Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'une pluralisme politique. Paris1976].
Weeber, Karl-W.: Alltag in Rom. Düsseldorf: Patmos 62001.
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck 51972.
Weiler, Ingomar: Witwen und Waisen im griechischen Altertum. Bemerkungen zu antiken Randgruppen. In: Kloft, Hans (Hg.): Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik. Horn: Verlag F. Berger und Söhne 1988, 15-33
Wertheimer, Jürgen (Hg.): Ästhetik der Gewalt. Frankfurt/M.: Athenäum 1986
Whittaker, Charles R.: Der Arme. In: Giardina, Andrea (Hg.): Der Mensch der römischen Antike. Frankfurt/M/New York: Campus 1991, 305-336
Stichworte Arbeit; Arbeitslosigkeit; Arbeitsvertrag; Arbeitszeit. Aus: Weeber: Alltag in Rom. Düsseldorf: Patmos 62001
Vermächtnis eines Münchner Pfarrers, um 1300. Aus: Boockmann, Hartmut: Das Mittelalter. Ein Lesebuch aus Texten und Zeugnissen des 6. bis 16. Jahrhunderts. München, C.H.Beck 21989, 155 f.
Ankunft in Augsburg bei Nacht, 1580. Aus: Delumeau, Jean: Angst im Abendland. Die Geschichte kollekti-ver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts. Reinbek/Hamburg, Rowohlt 1985, 10 f.
Kollektive Verhaltensweisen in Pestzeiten. Aus: Delumeau 1985, 140 - 199
Frauen in Not. Aus: Rheinheimer, Martin: Arme, Bettler, Vaganten. Überleben in der Not 1450 - 1850. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 2000, 55 - 90
Sebastian Brandt über die Bettler. Aus: Sachße, Chritsoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfür-sorge in Deutschland. Bd.1 (21998): Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg. Stuttgart u.a.: Kohlhammer 1998, 49 f.
Nürnberger Bettelordnungen, 14. Jh. Aus: Sachße / Tennstedt 1998, 63 f.
Zeitgenössische Beschreibungen des Amsterdamer Zuchthauses und des Spinnenhauses. Aus: Marzahn, Christian / Ritz, Hans-Günther (Hg.): Zähmen und Bewahren. Die Anfänge bürgerlicher Sozialpolitik. Biele-feld, AJZ 1984, 151 ff.
Bremer Zuchthausordnung, 1609. Aus: Marzahn/Ritz 1984, 155 ff.
Übernahme des Hamburger Zuchthauses, 1790. Aus: Marzahn/Ritz 1984, 185 ff.
Zeugnisse des Widerstandes gegen die Festnahme von Bettlern. Aus: Sachße Tennstedt 1998, 157f. und: Marzahn / Ritz 1984, 60 f.
Rumfordsche Suppenanstalt in Hanau. Aus: Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian (Hg): Bettler, Gauner und Proleten. Armut und Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Reinbek, Rowohlt, 1983, 69
Armutsursache Geschlecht am Beispiel Salzburg. Aus: Veits-Falk, Sabine: "Zeit der Noth". Armut in Salz-burg 1830-1870. Salzburg: Verein der Salzburger Geschichte 2000, 58-74
Aufenthaltsorte und -dauer der Einlegerin Elisabeth Reischl in Koppl (1829). Aus: Veits-Falk 2000.
-
Wie wurde Armut in der Antike eingeschätzt?
-
Welche Formen der Selbsthilfe gab es in der römischen Antike?
-
Welche Formen der privaten Wohltätigkeit gab es in der römischen Antike?
-
Worin bestand das Klientelwesen in der römischen Antike?
-
Was waren die Motive privater Wohltätigkeit in der römischen Antike?
-
Welche Formen der öffentlichen sozialen Hilfe gab es in der römischen Antike?
-
Worin bestehen die wesentlichen Unterschiede zwischen der antiken, der christlichen und der gegenwärtigen Armutsauffassung?
-
Inwiefern bedingten sich im MA Armut und Mildtätigkeit gegenseitig?
-
Worin besteht die Bedeutung der Kirche und der Klöster in der mittelalterlichen Armenfürsorge?
-
Wie ist die mittelalterliche Einstellung zum Betteln und worin zeigt sie sich?
-
Worin bestehen die wesentlichen Ursachen der Massenarmut im Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit?
-
Durch welche Faktoren wurde am Ende des MA der Übergang von kirchlich/ privat/ herrschaftlicher Fürsorgepraxis zu obrigkeitlicher Armutspolitik bewirkt und wie unterschieden sich diese beiden Konzeptionen?
-
Wie unterscheidet sich die Bewertung der Arbeit in der Antike, im Christentum und in der beginnenden Neuzeit?
-
Worin bestand die besondere Armutsgefährdung der Frauen?
-
Worin besteht der Zusammenhang zwischen Armenfürsorge und Disziplinierung?
-
Worin bestehen die gesellschaftlichen Ursachen für die Verdächtigung der "unredlichen" Armen in der frühen Neuzeit?
-
Welche Grundprinzipien der Armenfürsorge haben sich ab dem 16. Jh. herausgebildet und wie verhalten sie sich zu den gegenwärtigen Strukturen der Sozialen Arbeit?
-
Welche Institutionen der Armutsverwaltung haben sich im 17. Und 18. Jh. herausgebildet.?
-
Welche sozialpolitische und sozioökonomische Ideologie steht hinter den Zucht- und Arbeitshäusern?
-
Aus welchen Gründen und wie beginnt die Gesundheitsfürsorge eine öffentliche Aufgabe zu werden?
-
Wie manifestieren sich die allgemeinen Entwicklungen der Armenpolitik in Salzburg?
-
Wie verlief die Geschichte der Armenfürsorge, des Umgangs mit Behinderung und die Geschichte der Psychiatrie in Tirol und Südtirol?
-
Welcher Ideologie würden Sie den folgenden Satz zuordnen? "Lohnarbeiter, die ihre Arbeitskraft vermieten, sind Arme, die durch ihre Handarbeit ihren täglichen Lebensunter-halt verdienen"
Lösung siehe S. 107 unten
Die Themen schriftlicher Arbeiten können von den Teilnehmern/innen selbst gewählt werden. Eine Abstimmung mit dem LV-Leiter in der LV oder per E-mail ist möglich, aber nicht vorgeschrieben. Die folgenden Beispiele sind Vorschläge, es können aber auch eigene Themen gewählt werden.
Bei der Ausarbeitung sollte großer Wert auf genaue Rezeption von und kritische Auseinandersetzung mit der verwendeten Literatur, eine zusammenhängende Gedankenführung, Veranschaulichung von Zusammenhängen durch detaillierte Beispiele aus Geschichte und Gegenwart sowie eine anregende sprachliche Gestaltung und Gliederung des Textes gelegt werden.
-
Überblick über die Gesamtentwicklung des gesellschaftlichen Umgangs mit Armut von der Antike bis zum Beginn der Industrialisierung
-
Inhaltliche Zusammenfassung und kritische Bewertung eines Kapitels des Skriptums
-
Inhaltliche Zusammenfassung und kritische Bewertung eines Aufsatzes oder Kapitels eines Buches aus der angegebenen Literatur, z.B.
-
Prell, Marcus: Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im antiken Rom
-
Sachße Tennstedt: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd.1
-
Sachße-Tennstedt: Bettler, Gauner und Proleten
-
Geremek, Bronislaw: Geschichte der Armut
-
Rheinheimer: Arme, Bettler und Vaganten
-
Stekl: Österreichs Zucht- und Arbeitshäuser
-
Feldbauer: Kinderelend in Wien
-
Marzahn/Ritz: Zähmen und Bewahren
-
Breuer: Sozialdisziplinierung. Probleme und Problemverlagerungen eines Konzepts
-
Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft.
-
Foucault: Überwachen und Strafen
-
Treiber/Steinert: Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen
-
Ulbricht, Otto (Hg.): Die leidige Seuche
-
Thematisch orientiertes Essay zu einem sozialarbeitsgeschichtlichen Thema, z.B.
-
Der Beitrag von Christentum und Kirche zur Armutsfrage
-
Die besondere Notsituation der Frauen in der Geschichte der Armut
-
Die Grundprinzipien der Armutsverwaltung in Geschichte und Gegenwart
-
Erarbeitung von Erklärungszusammenhängen gegenwärtiger Strukturen der sozialen Arbeit aus ihrer Geschichte, z.B.: Vergleich heutiger Sozialgesetzgebung mit MA/Neuzeit, z.B.:
-
Vergleich der derzeitigen Sozialunterstützung mit spätmittelalterlichen Armenordnungen (z.B. Mindestrente, Studienförderung, Kindergeld, etc.)
-
Gegenwärtige politische Aussagen und Medienbotschaften zu sozialen Problemen: Parallelen und Unterschiede etwa zur Bettlerbeschimpfung in der frühen Neuzeit
-
Sozioökonomische Einflüsse auf die Entstehung und Verwaltung sozialer Defizite
-
Systeme der KlientInnenkontrolle in der sozialen Arbeit: Geschichte und Gegenwart
-
Textbearbeitung und Textproduktion, z.B.
-
Zusammenfassung und inhaltliche Analyse von Senecas De beneficiis, 1. Buch (Text bei Google: http://archive.org/details/luciusannaussen00sengoog, dort auch als Hörbuch).
-
Zusammenfassung und Analyse der Nürnberger Bettelordnungen (siehe Texte)
-
Analyse der Rede anlässlich der Übernahme des Amsteerdamer Zucht- und Arbeitshauses (siehe Texte)
-
Eigene Recherche, z.B.:
-
Lokalhistorische Recherche: Nachforschung in Archiven, Jahrbüchern, Stadtarchiv, Landesarchiv Gemeindedokumentationen etc. zur Salzburger/Tiroler/Innsbrucker Armengeschichte, zur Entwicklung der Fürsorge, zu lokalen Geschichten und Institutionen sozialer Probleme
-
Spüren Sie die historischen Orte sozialer Versorgung (Spitäler, Pestorte, Heime, etc.) in Salzburg oder Tirol/Südtirol (siehe Skriptum über Salzburg bzw. Tirol/Südtirol) mithilfe von Literatur oder Besuchen auf und dokumentieren Sie deren Geschichte und jetztige Funktion (Beschreibung, Fotodokumentation, Interviews).
-
Vergleiches Sie die aktuellen Bettelgesetze Salzburgs oder Tirols mit den frühneuzeitlichen Bettelordnungen (siehe Texte)
Die Äußerung stammt von dem mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin (1225 - 1274). Sie ist ein Beleg dafür, dass im 13. Jh. körperliche Arbeit immer noch wie in der Antike als Zeichen gesellschaftlicher Unterlegenheit galt. Die auffällige Ähnlichkeit in der Diktion mit Karl Marx zeigt, wie wenig man Begriffen eine überzeitliche Bedeutung unterstellen darf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Industrialisierung und die Entstehung des Proletariats
- 2. »Da graute einem« - Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Industriearbeiter/innen
- 2. »Massenhaftes Sterben und Verkümmerung« - Die besondere Gefährdung der Frauen
- 3. »Hohläugig und bleich wie der Tod« - Die Kinderarbeit
- 4. »Gott segne den edlen Menschenfreund« - Die Malmène'sche Kinder-Beschäftigungsanstalt
Das 19. Jahrhundert ist eine Epoche grundlegenden sozialen Wandels. Es ist charakterisiert durch die bürgerlich-städtische Gesellschaft als dominante Lebensform und die kapitalistisch-industrielle Markt-wirtschaft als dominante Wirtschaftsform. Jahrhunderte lang gültige Ordnungen in Gesellschaft und Wirtschaft werden durch neue Gesetze, Jahrhunderte lang tradierte Produktionsweisen durch neue Technologien abgelöst.
Im Jahr 1807 wird in Preußen die Befreiung der Bauern von persönlicher Dienstbarkeit verfügt, d.h. es wird die Abhängigkeit von der Grundherrschaft beendet. »Nach dem Martinitage 1810 gibt es nur freie Leute« heißt es im so genannten »Oktoberedikt« von 1807. Im Jahr 1848 erfolgt derselbe Schritt in Österreich. Mit einer Reihe weiterer Reformen wie der Abschaffung der Zünfte und der Aufhebung von Standesschranken geht die Epoche des Feudalismus, mit der Einführung erster demokratischer Elemente in die Stadt- und Staatsregierungen die des Absolutismus zu Ende.
1810/11 wird in Preußen die Gewerbefreiheit eingeführt, 1818 werden die Binnenzölle abgeschafft, 1834 fallen mit der Errichtung des Deutschen Zollvereins die innerdeutschen Zollschranken und damit entscheidenden Handelshemmnisse in dem immer noch in über 30 Königreiche, Fürstentümer und Stadtstaaten zersplitterten Deutschland. Österreich, seit 1804 unter Franz I. Kaisertum schließt sich dem Zollverein nicht an.
Am 1. November 1867 wird in Preußen das Freizügigkeitsgesetz erlassen. Damit sind alle Bürger der Staaten der deutschen Staaten nördlich des Mains, die im Norddeutschen Bund zusammengetreten sind, aufenthalts- und niederlassungsberechtigt.
Wenn man bedenkt, dass es mit Ausnahme der vorgeschichtlichen Sammler- und Wildbeutergesellschaften eine solche Freiheit in der gesamten bisherigen Geschichte der Menschen nie und nirgends vorher gegeben hat, kann man die Tragweite dieser Liberalisierung ermessen. An ihr wie an vielen anderen Bestimmungen, wie der Liberalisierung der Gewerbeordnung von 1869, wird auch das Prinzip der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jh. erkennbar: Bürgerliche Freiheiten werden in dem Maße gewährt, wie sie durch die wachsende ökonomische Potenz des besitzenden Bürgertums erzwungen, den Interessen des expandierenden Industrie- und Handelskapitalismus förderlich und der Beruhigung des revolutionären Potentials der Proletarier dienlich sind, sofern diese nicht durch Repressionsmaßnahmen unter Kontrolle gehalten werden können.
1835 wird zwischen Nürnberg und Fürth die erste Strecke der Dampfeisenbahn eröffnet, 1861 die Kaiserin-Elisabeth-Westbahn in Österreich. Zur gleichen Zeit werden immer mehr dampfgetriebene oder mechanische Maschinen zur Produktion eingesetzt. Bergbau, Hüttenwesen, Metallverarbeitung und Textilindustrie werden zu den prosperierenden Wirtschaftszweigen einer neuen industrialisierten kapitalistischen Ökonomie. Zwischen 1830 und 1870 steigen in Deutschland die Exporteinnahmen von zwei Millionen auf über eine Milliarde Mark.
Bürgerliche Befreiungsbewegungen, Liberalisierung des Handels und Industrialisierung der Produktion sind die entscheidenden Dynamiken der politischen, sozialen und ökonomischen Umwälzung der europäischen Gesellschaften seit dem 19. Jahrhundert. Innerhalb dieser Dynamiken sind allerdings die ökonomischen Kräfte die entscheidenden. Dem Staat geht es um die "Gewährleistung der Produktionsbedingungen für die Industrie - gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung" (Hering/Münchmeier 2000, 21). Die sozialen Folgen dieser Entwicklung, "die durch eine erhebliche Vergrößerung des Angebots, steigende Konkurrenz, Rationalisierungsdruck, sinkende Preise und sinkende Löhne ge-kennzeichnet ist, sind Landflucht, Verelendung durch konjukturabhängige Massenarbeitslosigkeit und Zerstörung der traditionellen Lebenszusammenhänge sowie zunehmende soziale Unruhen" (ebd.).
Die Entwicklung ist widersprüchlich. Einerseits verbessern sich die Lebensbedingungen der Menschen durch die Ausweitung der medizinischen Versorgung und die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion durch bessere Anbaumethoden und Düngung. Geringere Säuglingssterblichkeit und höhere Lebenserwartung führen zu einem außerordentlichen Bevölkerungswachstum. Ab der Mitte des 18. Jh. steigt die Bevölkerungszahl stark an, für das Gebiet des heutigen Deutschland z.B. von ca. 17 auf ca. 56 Millionen. Gleichzeitig verlagert sich die Bevölkerung vom Land in die Städte. Um 1820 sind Deutschland Berlin und Hamburg die einzigen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern, zusammen 307.000. 1905 gibt es bereits 41 Großstädte mit zusammen 11,5 Millionen Einwohnern.
Die Beschäftigung verschiebt sich im gleichen Zeitraum vom primären (Landwirtschaft) zum sekundären (Handwerk und Industrie) und tertiären Sektor (Handel, Dienstleistungen). Die industrielle Produktion "ist noch längst nicht fortgeschritten genug, um das drastische Missverhältnis zwischen Arbeitssuchenden und offenen Arbeitsstellen auffangen zu können. Es entsteht eine neue, aus den Bindungen der Ständegesellschaft heraus fallende Armut" (ebd., 26). Die neue Gewerbefreiheit führt zu großem Konkurrenzdruck, in dem wenige Großbetriebe eine Vielzahl von kleinen Handwerksbetrieben in die Pleite treiben und damit das Heer jener vergrößern, die in den Fabriken Arbeit suchen. Zwischen 1850 und 1870 verdoppelt sich die Einwohnerzahl von Wien auf bis zu 820.000 Menschen. Der Großteil dieser Menschen lebt in den Arbeiterbezirken, "zusammengepfercht in Zinskasernen und Massenquartieren" (Denscher 1981, 52).
Auch die "Bauerbefreiung" bewirkt zunächst keine ökonomische Besserstellung der Landbevölkerung, im Gegenteil. Da die Bauern, um ihr Land in das Eigentum zu übernehmen, einen erheblichen Teil davon an die Gutsbesitzer abtreten mussten, waren zahlreiche kleinere Höfe nicht mehr überlebensfähig. Missernten und Schutzzölle gegen den landwirtschaftlichen Export taten ein übriges.
Jahr für Jahr gaben Tausende von Bauern auf, die gerade erste "befreit" worden waren. Ihr Land fiel ihren Gläubigern, in der Regel dem alten Grundherrn zu, bei dem sie sich nun günstigstenfalls als Tagelöhner oder Häusler verdingen konnten. Die meisten Opfer dieses "Bauernlegens" versuchten jedoch in der Industrie oder in den Städten Arbeit zu finden [...] In dem Maße, in dem die Entwicklung der Industrie voranschritt, kamen brotlose Handwerker hinzu. Ein Heer von Männern, Frauen Kindern Greisen zog von Ort zu Ort und füllte die Städte auf der Suche nach Arbeit. Infolge der schlechten Entwicklungsbedingungen der Industrie bleiben die Bemühungen um ein neues Auskommen oft vergeblich. Diejenigen, die Beschäftigung fanden, mussten sich häufig den schlimmsten Ausbeutungsbedingungen unterwerfen, die ihre Arbeitskraft binnen kurzem zerstörten. (Landwehr/Baron 1983, 15 f.).
Der öffentliche Umgang mit Armut ist stets von einer sich moralisch gebenden, lobbyistischen Rhetorik der vorgeblichen Arbeitsscheu der Armen und der Erziehung zur Arbeit begleitet, die das tatsächliche Ausmaß der Armut und deren gesellschaftliche Ursachen durch die Beschuldigung der individuellen Armen verschleiert.
Dagegen wendet sich am Ende des 19. Jh. eine neue Strategie, die soziale Enquête. Durch die umfassende Dokumentation der tatsächlichen Armutsverhältnisse sollten zugleich deren großes Ausmaß und die Notwendigkeit staatlicher Abhilfe dokumentiert werden und empirische Grundlagen für Umfang und Möglichkeiten sozialer Fürsorge geschaffen werden.
[...] mussten wir in einem breiten Bett unter dem Dache drei Mann zusammen schlafen, und zeitweise kam auch noch ein Lehrling hinzu. Da graute Einem bei der Hitze, wenn man zu Bett musste, und konnte schlecht schlafen, und Abends war man froh, wenn Feierabend war und Morgens war man noch viel froher, wenn man, ganz in Schweiß gebadet, wieder aus dem Bett konnte.
So schildert ein Arbeiter die Wohnverhältnisse des Proletariats. (zit.n. Hering/Münchmeier 2000, 42). Nicht weniger trist waren die Wohnverhältnisse der ArbeiterInnen zuhause. 18% der Wohnungen in Hamburg hatten um 1880 nur ein Zimmer, 49% in Berlin, 55% in Dresden, 70% in Chemnitz. "Das einzige Zimmer der kleinen Mietskaserne diente für unsere sechsköpfige Familie daheim gleichzeitig als Wohn- und Schlafraum, als Küche und - obendrein als Werkstatt meines Vaters" (Weber-Kellermann 1979, 165).
Aus einem Schreiben der Stadt Chemnitz an die Regierung des Landes aus dem Jahr 1798:
Hierzu käme, als eine andere und erheblichere Krankheits- und Sterblichkeitsursache das wegen Mangel an Wohnungen zu häufige und enge Beisammenwohnen der hiesigen meistenteils armen und dahero von groben, unverdaulichen Nahrungsmitteln lebenden Einwohnern, um von deren traurigen Lage sich recht lebhaft zu überzeugen, man Geistlicher oder Arzt sein müsste, indem man hier oft in einem mittelmäßigen Hause 50, 60 bis 80 und in mancher einzelnen Stube 12, 14, ja in den mit mancherlei stinkenden und der Gesundheit nachteiligen Farbendünsten erfüllten Kattundruckereistuben 20 bis 60 Menschen zählen könnte, die wechselweise ihre zum Teil kranken Ausdünstungen wieder in sich schlucken; wobei derselbe (der Stadtphysikus Dr. Freytag) sich zugleich als Beweis auf die in der Chemnitzer Vorstadt an der Bernsbach gelegenen, vor einigen Jahren bloß zu Mietwohnungen angebauten 3 Müllerschen Häuser beziehet, als in welchen zusammen 247 arme Menschen wohnen. Hierzu kommt noch, dass selbst der Hauptnahrungserwerb der hiesigen Einwohner als Beförderungsmittel der Sterblichkeit anzusehen ist. Denn die mehresten hiesigen Bürger sind Weber und ihre Anzahl Lehrlinge und Gesellen ungerechnet, an tausend. Diese alle wohnen, wie schon gedacht, mit Weibern, Kindern, Gesellen, Lehrlingen, Wollmacherinnen und Spinnerinnen so enge beisammen, dass man sich in den mehresten Werkstätten kaum rühren kann, und wo kleine Kinder sind, stehen die Betten noch dazu in den Winkeln der Stube.
In ihrer "Jugendgeschichte einer Arbeiterin" schreibt Adelheid Popp[103] 1909:
Es war ein kalter, strenger Winter, und in unserer Kammer konnten Wind und Schnee ungehindert hinein. Wenn wir morgens die Tür öffneten, so mussten wir erst das angefrorene Eis zerhacken, um hinaus zu können, denn der Eintritt in die Kammer war direkt vom Hofe, und wir hatten nur eine einfache Glastür [...] Heizen konnten wir daheim nicht, das wäre Verschwendung gewesen, so trieb ich mich auf der Straße, in den Kirchen und am Friedhof herum. Ein Stück Brot und ein paar Kreuzer, um mir Mittags etwas kaufen zu können, bekam ich mit. Das Weinen musste ich immer gewaltsam zurückdrängen, wenn meine Bitte um Arbeit abgewiesen wurde und ich aus dem warmen Raum wieder hinaus musste. Wie gern hätte ich alle Arbeit getan, um nicht so frieren zu müssen (zit.n. ebd., 165 f.).
Zeitgenössischen Schilderungen wie etwa Viktor Adlers[104] Bericht über die Lage der Ziegelarbeiter ist zu entnehmen, wie groß die Wohnungsnot in den Städten und wie elend die Wohnverhältnisse der Arbeiter/innen waren. Hohe Krankheits- und Sterblichkeitsraten waren die Folge. In den Betrieben wie in den ihnen zugehörigen Schlaf- und Arbeitsräumen war die Situation noch schlechter. Es herrschte Platz-mangel und schlechte Luft, in den Werkshallen fehlte jegliche Unfallverhütung.
Vor 1848 gab es in Österreich so gut wie keine staatlichen Sozialmaßnahmen für erwachsene Arbeiter/innen. Solche seien, wie die Hofkanzlei argumentierte, bedenklich, weil ein Eingriff des Staates "durch Verrückung des natürlichen Verhältnisses seinen Zweck verfehlen, die Hemmung der Entwicklung der Industrie und endlich die Verschlimmerung der Lage der arbeitenden Klassen insofern sie mit ihrer Subsistenz auf den Fabrikserwerb gerichtet sind, zur Folge haben" würde (ebd., 18). Das Einkommen der Mehrheit der Arbeiter/innen lag unter dem Existenzminimum.
Vergleicht man diese für ein menschenwürdiges Dasein notwendigen Budgets mit unserer Einkommensliste, so drängt sich die Überzeugung auf, dass, wenn eine Familie, wie es in den ersten 6 - 10 Jahren einer Arbeiterfamilie der Fall ist, auf das Einkommen des Mannes allein angewiesen ist, 70% der Arbeiterbevölkerung ihre Lebensbedürfnisse in der hier postulierten Weise nicht befriedigen können.
So heißt es in einer Erklärung des Vogelsang-Kreises, eines nach dem christlichen Sozialreformer Karl von Vogelsang[105] benannten Vereines. Wenn schon die Arbeit eine Familie kaum ernähren konnte, führten Krankheit, Unfälle, Arbeitslosigkeit und Alter vollends in die Verarmung.
Etwa ein Viertel der Industriearbeiter war um 1840 arbeitslos, ein weiteres Viertel hatte so eingeschränkt Arbeit, dass sie ihre Familien nicht ernähren konnten. Krankheit oder Gebrechen waren weitere häufige Ursachen von Arbeitsunfähigkeit (Ruppert 1986, 176). Erst die politische Organisierung der Arbeiter/innen um und nach 1848 führte zu einer Änderung. Nach einer Phase der totalen Repression bis in die Sechziger Jahre wurden der Arbeiterbewegung allmählich gewisse Rechte eingeräumt: die Vereinsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und weitere staatbürgerliche Rechte (1867) sowie das Koalitionsrecht (1870). Es entstanden rasch Selbsthilfevereine der Arbeiter/innen, Sparvereine, Konsumvereine, Genossenschaften Arbeiterbildungsvereine und Gewerkschaftsvereine als "Mittel, unsere Interessen zum Ausdruck zu bringen und sie zu wahren" (Gründungsdokument des Wiener Arbeiterbildungsvereines 1867, zit.n. ebd., 30).
Die Armutssituation wirkte sich besonders drastisch auf die proletarischen Frauen aus (vgl. Neef 1988). Die meisten von ihnen mussten neben den Kindern für einen Hungerlohn arbeiten. "Die immer mehr zunehmende industrielle Beschäftigung auch der verheirateten Frau ist namentlich bei Schwangerschaften, Geburten und in der ersten Lebenszeit der Kinder, während diese auf die mütterliche Nahrung an-gewiesen sind, von den verhängnisvollsten Folgen: massenhaftes Sterben und Verkümmerung", schreibt August Bebel[106] 1878 (zit.n. Hering/Münchmeier 2000, 43). Auch das neue Versicherungswesen (siehe unten) schützt die Frauen nicht nachhaltig. Bis zum Ersten Weltkrieg gibt es keine Witwen- und Waisenversorgung, nach dem Tod des Mannes waren Frauen mittellos, es sei denn er war durch einen Arbeitsunfall umgekommen. »Es gilt daher heute in den besitzlosen Klassen als ein "Glück", wenn ein Familienvater nicht durch natürliche Todesursache, sondern durch Unfall ums Leben kommt«, schreibt die Sozialreformerin Alice Salomon 1907 (S. 330, zit.n. ebd., 44).
"Wochenarbeitszeiten von bis zu 90 Stunden, lange Arbeitswege, keine Arbeitspausen, keine Sonntags-ruhe, gesundheitsgefährdende und unfallträchtige Arbeitsbedingungen" (Hering/ Münchmeier 2000, 24) für Männer, zaghafte und kaum kontrollierte Erleichterungen für Frauen und Kinder, die aufgrund der geringeren Löhne zur wachsenden Konkurrenz männlicher Arbeiter werden. Als miserabel bezahlte Verkäuferinnen oder als Dienstmädchen haben es die Frauen noch schlechter. Sie haben keinen eigenen Schlafraum, keinen Feierabend und sind sexuelles Freiwild für den Hausherrn und seine Söhne. Werden sie schwanger, werden sie hinausgeworfen und landen nicht selten als Prostituierte auf der Straße, ein Schicksal zu dem es aufgrund der geringen Löhne für viele keine Alternative gibt. Eine Näherin etwa verdient 1 Mark pro Tag und braucht 26 Mark monatlich für Essen und Wohnen, die sie mit Sonn- Feier- und arbeitslosen Tagen nicht zusammenbringt, von Kleidung und anderen Ausgaben gar nicht zureden. "Wie sollen diese Mädchen leben, wenn sie nicht ihre Zuflucht zu dem schmachvollen und traurigen Nebenerwerb der Prostitution nehmen?", fragt Anna Pappritz[107] (zit.n. ebd., 45).

Bild: Schlafsaal für Frauen, Asyl für Obdachlose, Berlin um 1900
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, Männern und Kindern des Proletariats in den Städten sind, fassen wir die Fakten noch einmal zusammen, durch einen grundsätzlichen Mangel an jeglichem Schutz gekennzeichnet: überleben kann man nur, solange man arbeitet. Wer alt ist oder krank wird, ist verloren. Die traditionelle Absicherung durch den - auch noch so kleinen - Hof und den Familienverband ist nicht mehr da. Man wohnt in Elendsquartieren zur Miete, kalt und feucht, selten in mehr als der Küche und einem Zimmer. Die Löhne in den Fabriken und bei den Dienstboten reichen kaum dazu aus, weitere Personen mitzuernähren oder etwas für das Alter oder den Krankheitsfall zurückzulegen. Die kleinen Kinder bleiben unbeaufsichtigt, die größeren werden zur Mitarbeit herangezogen. Die Einhaltung der ohnehin im besten Fall auf sechs Jahre begrenzten Schulpflicht wird nur sporadisch überprüft. (zit.n. Hering/Münchmeier 2000, 25).
Von über 2 Mill. 1902 in Deutschland geborenen Kindern starben 65.000 bei der Geburt, 500.000 inner-halb der ersten 5 Lebensjahre an Unterernährung, Krankheit oder aufgrund von Unfällen. Doppelt so viele aus der proletarischen Schicht wie aus der begüterten und viermal so viele uneheliche Kinder wie eheliche. "Es unterliegt wohl keinem Zweifel", schreibt Isidor Singer über die Verhältnisse in Nordböhmen, "dass die starke Vertretung der Weiber in den Fabriken und die auf die Schwangerschaft der Arbeiterin bisher keine Rücksicht nehmende Anhaltung zur Arbeit diese hohen Ziffern verschulden" (Singer 1885). Es ist aber nicht nur die Ausbeutung der Frauen, es ist vielmehr die Ausbeutung der Kinder selbst, die Krankheit und Tod, in jedem Fall aber den Nerlust von Lebenschancen für die Kinder verirsachen.
In den Schriften der pädagogischen Aufklärer ist häufig von der "Erziehung zur Industrie" die Rede. Darin deutet sich nicht nur der ethymologische Zusammenhang zwischen Fleiß (lat.: industria) und industrieller Arbeit an, sondern auch der Zusammenhang zwischen einer auf die individuellen Voraussetzungen ökonomischer Veränderungen zielenden Pädagogik. Arbeit gilt den einen als Allheilmittel gegen die allenthalben lauernde Unkeuschheit und Wollust, den anderen als probates Mittel gegen den Wahn-sinn, den dritten als Beitrag zum Nutzen des Staates und seiner Ökonomie. Muße ist ungesund, Müßig-gang ein Verbrechen an der Gemeinschaft. Bettler und Landstreicher werden in Arbeitshäusern, andere sozial Gestrandete in Armen-, Gefangenen-, und Waisenhäusern interniert und dort rigoros zur Arbeit angehalten.
Für die Kinder der unteren Schichten wurden »Industrieschulen« eingerichtet, die Lernen und Arbeiten verbinden und anstelle der landläufigen Schulen, denen die Förderung der Dummheit, Faulheit und Nutzlosigkeit vorgeworfen wurde, der Umformung der Kinder zu brauchbaren Arbeitern dienen sollten. Das Gros der Kinder der Armen freilich kommt nicht einmal in den Genuss solcher Bildungsmöglichkeiten, es wird schlicht und einfach zur Kinderarbeit gezwungen.
Am 14. April 1775 beschwert sich Friedrich II. - der Große - von Preußen, dessen »landesväterliche Gesinnung« stets darauf gerichtet ist, seine »Untertanen glücklich zu machen« bei seinem Minister Zedlitz über das Versäumnis, die Kinder der Bauern, die noch zu klein sind für die schwere Bauernarbeit, an die Spinnräder zu setzen:
Die Bauern auf dem Lande lassen ihre Kinder müßig umherlaufen und halten sie zu nichts an. Kinder von 8 und 9 Jahren können zwar bei der Wirtschaft nichts helfen, doch könnten sie, wenn sie aus den Schulen kommen, spinnen und damit schon ihr Brot verdienen, es würden auch ordentliche Wirte aus ihnen werden, statt dass sie von Jugend auf zur Faulheit sich eignen: Ich werde es demnach sehr gerne sehen, wenn Ihr Euch angelegen sein lasset, wie die jungen Kinder auf dem Lande, die weiter nichts zu tun im Stande sind, mehr zum Spinnen zu gewöhnen, wie solches in den Schlesischen und Sächsischen Gebirgsgegenden geschieht. Die Woll-Fabrikanten klagen so über den Mangel von Spinnern: Auf solche Art würde diesem Mangel abgeholfen werden, die Leute selbst auch mehr verdienen können.
Zwanzig Jahre später lassen sich die tristen Umstände, unter denen Kinder arbeiten müssen, nicht mehr verbergen. Aus den preußischen Provinzen langen Berichte über die unzumutbaren Zustände in den Fabriken ein, in denen Kinder arbeiten:
Am auffallendsten war mir das Gebäude und die Einrichtung der Spinnereien der Gebrüder Busch, die eher einer Mördergrube als einer Fabrik gleich sieht. Die Säle sind so niedrige, dass man unwillkürlich mit gebücktem Kopfe durch sie hindurchschreitet, weil man besorgt, an die Decken zu stoßen, was denn doch nicht möglich ist; so überfüllt, dass man angsthaft seine Kleidungsstücke zu wahren hat, um nicht bei der geringsten Bewegung hier ein Tuch, dort einen Rockzipfel der Maschine preiszugeben und von ihr zerfetzen zu lassen; die Luft in den Sälen und die Wände mit dem Schmutze des zu verarbeitenden Materials und mit faserigten Partikelchen des Stoffes ganz angefüllt und überkleidet; die Kinder, dementsprechend, wahre Gebilde des Jammers, hohläugig und bleich, wie der Tod.
[...] die Kinder selbst, die in Reih und Glied sitzend arbeiten, bald sich vor, bald wieder rückwärts biegen, alle aber fast taktmäßig dieselben Bewegungen und dasselbe Geräusch machen, gemahnen den Beobachter an Maschinen; sie sind aber gesund, stark und heiter und aufgeweckt, selbst mutwillig und ausgelassen, und, wäre nicht doch des Sitzens zu viel, man könnte sie für wohl hier aufgehoben halten. Allein wenn auch in Aachen überhaupt morgens und abends eine Stunde weniger gearbeitet wird als in Bonn, der Schulbesuch der Kinder ist hier ebenso schlecht bestellt als dort. Für die Zukunft der Kinder wird also auch in Aachen nicht gesorgt.
In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf; bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt. Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders, wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht. (Cornu 1954, zit.n. Hering/Münchmeier 2000, 25).
Die Prügelstrafe war als Zuchtmittel für Kinder gang und gäbe, sie wurde zwar Mitte des 18.Jh. verboten, aber die Sanktionen waren so geringfügig, dass sich dadurch nichts änderte. Über die Verhältnisse in Chemnitzer Fabriken berichtet ein Beobachter:
An manchen Orten besteht der Unterschied zwischen Zuchthaus und Fabrik nur darin, dass in ersterem die Prügelstrafe erlaubt ist, in letzterem bei den Erwachsenen nicht. An den unglücklichen Kindern wird das Prügelrecht oft in empörender Weise selbst von Subalternen und den oberen Arbeitern ausgeübt. Wollen die Eltern der Kinder den Brotherrn verklagen, so bezahlt dieser ruhig einige Taler Strafe, schickt Eltern und Kind fort und es bleibt beim alten (ebd.).
Es sei, berichtet der geheime Finanzrat Sack von einer Reise durch die Provinz »ein mit der Sache selbst verbundenes Übel, dass die Kinder, denen diese Art der Beschäftigung frühen Verdienst gibt, mehrenteils ungesund und zu Krüppeln werden und sich in älteren Jahren desto schlechter ernähren können«.
Kinderarbeit ist aber keineswegs eine Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeit für die Kinder, sondern sie hat System, wie Friedrich Engels (1947, 78) feststellt:
Der frischeingewanderte, im ersten besten Stalle kampierende Irländer, der selbst in einer erträglichen Wohnung jede Woche auf die Straße gesetzt wird, weil er alles versäuft und die Miete nicht bezahlen kann, der würde ein schlechter Fabrikarbeiter sein; daher muss den Fabrikarbeitern soviel gegeben werden, dass sie ihre Kinder zu regelmäßiger Arbeit erziehen können - aber auch nicht mehr, damit sie nicht den Lohn ihrer Kinder entbehren.
Keines »unter den vielen schweren Verbrechen des Kapitalismus«, schreibt die Sozialistin Clara Zetkin,[108] »über welche die Geschichte zu Gericht sitzen wird, ist keines brutaler, grausiger, verhängnisvoller, wahnwitziger, mit einem Worte: himmelschreiender als die Ausbeutung der proletarischen Kinder«, die sie mit dem »bethlehemitischen Kindermord« vergleicht:
Ausbeutung der proletarischen Kinder durch das Kapital, was besagt das anderes als Raub von Gesundheit und Lebenskraft, von Kinderlust und Bildungsmöglichkeit, als Vernichtung von Leib und Seele der heranwachsenden Geschlechter, als Raub und Vernichtung, begangen an den schwächsten, wehrlosesten und schutzbedürftigsten aller Gesellschaftsmitglieder. Der Kapitalismus packt mit harter Faust das proletarische Kind, das schon vor seiner Geburt durch die rücksichtslose Ausbeutung von Mutter und Vater bedroht und geschädigt wurde. Er peitscht es mittels der Not oder der Unwissenheit der Eltern in die Fabrik, in die Werkstatt, in die Ziegelhütte, zum Straßenhandel, zum Rübenverziehen und Viehhüten, zum Kegelaufsetzen und Warenaustragen oder in die mörderische Hausindustrie. Hier gliedert er es seiner Profitmühle ein, die auspresst, was von Muskel- und Nervenkraft in Gold verwandelt werden kann, und die ein armseliges, körperlich und geistig zermalmtes Geschöpf entlässt.
Das Ausmaß der Kinderarbeit ist, wie die Enquêten zeigen, enorm. Um die Jahrhundertwende mussten im deutschen Reich ca. 1 Million Kinder arbeiten, erst 1903 wurde Kinderarbeit unter 12 Jahren verboten. Der Arbeitstag der Kinder dauerte bis zu 12 Stunden, im Falle August Bebels, Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (1869), der 1853 mit 13 Jahren seine Drechslerlehre begann, etwa von 5h morgens bis 7h abends, "ohne Pause", wie er in seiner Lebensgeschichte schreibt (Weber-Kellermann 1979, 158). Erschien der Fabriksinspektor, wurden die Kinder angehalten, niedrigere Arbeitszeiten anzugeben, wobei 10 Stunden immerhin auch für jugendliche Arbeiter/innen erlaubt waren. Die noch jüngeren Kinder "mussten überhaupt schleunigst den Fabriksaal verlassen" (ebd.).
Auch das Ausmaß der Arbeitszeit der Kinder ist enorm. In den 1830er Jahren beträgt sie noch täglich 15 Stunden. Um 1840 stellt eine Untersuchung in Niederösterreich fest, dass schulpflichtige Kinder täglich bis zu 15 Stunden arbeiten und dass sie auch Nachtarbeit verrichten müssen. Ein Entwurf der Hof-kanzlei, nach dem Kinderarbeit vor dem 9. Lebensjahr verboten werden, bis zum 12. Jahr nur 10 und bis zum 16. nur 12 Stunden betragen soll, wurde nach langen Verhandlungen von den Unternehmern abgelehnt. Erst 1859 kommt es zur Einigung in Form einer neuen Gewerbeordnung. Es wird ein Arbeitsverbot für Kinder unter 10 Jahren festgelegt, für Kinder von 10 - 12 Jahren mussten größere Betriebe ein Bewilligungschreiben des Gemeindevorstandes vorlegen, das an die Möglichkeit des Schul-besuches neben der Arbeit gebunden war. Wie wenig solche Vereinbarungen eingehalten wurden, zeigen zeitgenössische Quellen: »Es ist allgemein bekannt«, heißt es in einem Bericht der Reichenberger Handelskammer, »dass gegen die ausdrückliche Bestimmung der Gewerbeordnung bisher in den Fabriken Kinder von 8 - 14 Jahren ebenso lange arbeiten wie Erwachsene« (zit.n. Tálos 1980, 22).
In Österreich wurde die Kinderarbeit durch staatliche Behörden einerseits gefördert, andererseits versuchte der Staat die schlimmsten Auswirkungen auf die Kinder einzudämmen. Die 1781 eingeführten Schulpflicht sollte auch für arbeitende Kinder gelten, allerdings ohne die Fabriksarbeit zu behindern.
Durch zweckmäßige Maßregeln für die gehörige physische und geistige Ausbildung derselben, insbesondere durch Schuleinrichtungen, ließe sich wohl am sichersten dem Zustande der Rohheit und unvollkommenen Entwicklung der Kräfte des Geistes und des Körpers, worin sich die Fabrikarbeiter im Durchschnitt befinden, entgegenarbeiten.
[...] da dem Staat sehr daran gelegen ist, dass soviele in Fabriken arbeitende Kinder einerseits nicht in der rohen Ungewissheit [gemeint ist: Unwissenheit, B.R.], der Mutter wilder Sittenlosigkeit aufwachsen, andererseits aber den Fabriken die nötigen Hände, der geringen Klasse der Verdienst nicht entzogen wird, so ist überall nach Beschaffenheit der Umstände die Einrichtung zu treffen, dass diese Kinder teils in einer Abendschule, teils an Sonn- und Feiertagen von dem Ortsseelsorger und Schullehrer den unentbehrlichen Unterricht gegen Bezahlung des Fabrikinhabers und der Eltern erhalten. Auch ist darauf zu sehen, dass solche Kinder vor dem Antritt des neunten Jahres nicht ohne Not zur Fabriksarbeit aufgenommen werden (zit.n. Tálos 1980, 17).
Das Interesse Kaiser Joseph II[109] zu Wien gilt 1781 der Behebung der »Ungewissheit« der Kinder, in noch größerem Maße aber ihrer Verfügbarkeit für die Arbeit in den Fabriken, in denen nur an ihren »Händen« Interesse besteht. 1786 verfügt der Kaiser, dass Mädchen und Knaben in den Schlafsälen der Fabriken zu trennen sind, dass die Kinder »alle Wochen wenigstens einmal durch Waschen und Kämmen am Leib zu reinigen und zu säubern« seien und dass jedes Kind sein eigenes Bett haben sollte.
Die hohen und steigenden Zahlen von zum Militärdienst untauglichen Rekruten sind ein Hinweis auf den schlechten Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen. Zwischen 1870 und 1882 stiegen die "wegen Gebrechen zurückgestellten oder gelöschten" Wehrpflichtigen in Wien von 637 auf 721, in Graz von 620 auf 773 und in Innsbruck von 604 auf 790 (ebd., 24 f.). Für den Miltärdienst tauglich waren in diesen Städten nur 2 - 300 von tausend jungen Männern. Der Staat reagiert auf diese alarmierenden Zahlen wie auch sonst häufig auf soziale Missstände: administrativ. Es wird eine zusätzliche Tauglichkeitstufe eingeführt, "bedingt tauglich" und das Einberufungsalter hinaufgesetzt.
Der von Jürgen Kuczynski dokumentierte Fall eines Berliner Textilfabrikanten führt das triste Los der Kinder drastisch vor Augen. Er zeigt auch, wie schwierig und langwierig es für die staatlichen Behörden war, selbst den schlimmsten Auswüchsen dieser Kinderausbeutung, die sich zynisch als Kinderfreundlichkeit ausgab, Einhalt zu gebieten (Kuczynski Bd. 19, 1968, S. 42 ff.).
1825 wurde in Berlin die »Malmène'sche Kinder-Beschäftigungsanstalt« gegründet, ein Beispiel für die als Wohltätigkeit getarnte Ausbeutung von Kindern. 1837 steht in der »königlich privilegierten Berlinischen Zeitung« zu lesen:
Was eines edlen Zweckes willen, dem beharrlichen Streben des Einzelnen möglich ist, davon hatte Referent kürzlich eine überraschende Überzeugung. Einige zwanzig sehr wohl gekleidete Knaben in hellgrünen Jacken, schwarzen Beinkleidern und dergleichen Mützen schritten ordnungsmäßig durch die Straßen zum Brandenburger Tore hinaus und erregten nicht nur wegen der anständigen, tüchtigen und sauberen Kleidung, sondern auch wegen ihres gesunden, lebensfrohen Äußeren das freudige Erstaunen aller Vorübergehenden.
Mit Anderen folgte auch Schreiber dieses dem Zuge, sah die munteren Spiele der Knaben und erfuhr, dass es Kinder ganz armer Eltern sind und zu einer Beschäftigungs-Anstalt gehören, welche von einem vor dem Schönhauser Tore wohnenden Bürger unserer Stadt, Herrn Malmène, in seinem Hause, auf eigene Kosten errichtet ist, worin die Knaben bis zur Erlernung eines Handwerks bleiben, von ihm beköstigt, völlig bekleidet, kurz wie eigne Kinder verpflegt und erzogen werden.
Seinen Bericht über »dies seltene Werk wahrhafter Wohltat vor Gott« schließt der Schreiber mit einem frommen Wunsch für den Wohltäter: »Gott segne den edlen Menschenfreund«. Eine etwas andere Sicht der Dinge ergibt eine Inspektion der Malmène'schen Anstalt durch den Polizeiinspektor. Er berichtet am 18. März 1941:
Zu weiterer Erledigung der hohen Verfügung vom 14. d.Mts. begab ich mich am 16. d. nachmittags 21/2 Uhr zu dem Malmène, um dessen Anstalt zu recherchieren. Ein kaum zu überschreitender Schmutz machte es mir schwierig, in das Haus zu gelangen. Flut und Treppen ließen den Besen vermissen, und dies Äußere machte mich beinahe glauben, dass ich in eines der Häuser geraten sei, die von einer Zahl kleiner Familien aus der Hefe des Volkes bewohnt sind. Malmène war abwesend, seine Gattin, in einem dem Äußern des Hauses entsprechenden Costüme [...].
Der Anzug der Knaben war ebenfalls nicht empfehlend und stach grell gegen ihr öffentliches Erscheinen ab. [...] Dielen und Wände waren durchaus schmutzig. Die in drei Stufen eine Treppe höher befindlichen Lagerstätten der Knaben waren in demselben Zustande.
Malmène erfreut sich aber weiterhin ungebrochen der Unterstützung nicht nur der Presse, sondern auch hoher Beamter, mächtiger Fabrikanten und - des Königs. Einzig die Polizei steht der Umwandlung seiner Anstalt in eine »Knaben-Erziehungs- und Beschäftigungsanstalt«, so sein Antrag vom 10. Juli 1841, skeptisch gegenüber: Malmène hatte eine Vorstrafe wegen Betrugs und war wegen grober Unsittlichkeit an Knaben in Untersuchungshaft gewesen. Der Polizeipräsident ordnet eine Untersuchung an. Aus dem Bericht:
Zahl der beschäftigten Kinder: Es befinden sich in der Anstalt im ganzen 40 Knaben, wovon 6 das 9. Jahr noch nicht, 12 das 14. schon zurückgelegt haben.
Arbeitszeit: Arbeitsbeginn um 6.00 morgens, Arbeitsende um 1/2 8 abends; Arbeitstag 131/2 Stunden mit 31/2 Stunden Pausen.
Wohnzustände: Die Reinlichkeit im Hause und in Bettwäsche lässt manches zu wünschen übrig, außerdem findet der große Übelstand statt, dass sechzehn Kinder je zwei in einem Bette zusammen schlafen.
Bezahlung und Finanzierung: Er gibt aber an, dass er von jedem Taler, den der Knabe verdient, 13 Silber-groschen für sich zur Bestreitung der Auslagen, Farben und als seinen eigenen Arbeitsverdienst abzieht, so dass dem Knaben nur 17 Silbergroschen in ein dazu bestimmtes Hauptbuch zugute geschrieben und auf seinen Unterhalt verrechnet werden.
Die Kinder, deren Arbeitstag fast 14 Stunden beträgt, erhalten also keinen Pfennig ausbezahlt.
Malmène behauptet, Opfer mannigfacher Art zu bringen [...] Da er indes außer einem Grundstück, welches ihm nur freie Wohnung und sonst keinen Ertrag gewährt, kein Vermögen und keine anderen Erwerbsquellen als die Strickmuster-Colorier-Anstalt besitzt: so ist klar, dass diese ihm und seiner zahlreichen Familie den Unterhalt gewährt.
Allgemeiner Charakter der Anstalt: Nach diesen Ermittlungen kann das Malmènesche sogenannte Institut als eine Wohltätigkeits- oder Erziehungsanstalt, wofür sie in öffentlichen Blättern ausgegeben worden, allerdings nicht betrachtet werden. - Dasselbe erscheint vielmehr lediglich als ein industrielles Privatunternehmen. [...] Zu einer öffentlichen Anerkennung oder umgekehrt, zu einer Unterdrückung dieser Anstalt ist kein Grund vorhanden.
Die Kritik der Polizei verhindert die positive Bescheidung des Antrags nicht. Politik und Presse bleiben der Anstalt weiterhin gewogen. Erst das Bekanntwerden eines peinlichen "Vorfalls" bringt den Anstalts-leiter in gewisse Schwierigkeiten. Am 18. August 1851 Berichtet die »Vossische Zeitung«:
Am 10. d. M. ging einem bei der Sicherheitsabteilung des Königlichen Polizeipräsidiums angestellten Kriminal-Polizeileutnant von glaubhafter Seite die Nachricht zu, dass in der hiesigen Malmèneschen Erziehungs- und Beschäftigungsanstalt ein Knabe an einer Kette geschlossen im Keller gefangen gehalten werde. Zur Feststellung des dieser Angabe zugrunde liegenden Tatbestandes begab sich der Polizeileutnant sofort nach der Anstalt. Hier traf man den 15jährigen Knaben (Zögling der Anstalt) in einem Kellergelaß gefangen, und zwar an einer eisernen Kette, die ihm ziemlich fest um den Leib geschlungen und mit einem Schlosse versehen, während das andere Ende der Kette an einem Klotz befestigt war, so dass, wenn der Knabe sich von der Stelle fortbewegen wollte, er den ziemlich schweren Klotz mitschleppen musste. Sein Lager bestand aus einem Strohsacke, der an der Erde lag. Auf Befragen erklärte der Vorsteher der Anstalt dem recherchierenden Beamten, dass dieser Knabe, welcher sich bereits am 11. Juli d. J. mit einem anderen Zöglinge aus der Anstalt heimlich entfernt hatte, jedoch in Luckenwalde ergriffen und in dieselbe zurückgebracht worden war, wiederum am 21. Juli d. J. mit einem anderen Zöglinge entlaufen sei, auch den Lezteren zur Flucht verführt habe. Derselbe sei in Trebbin angehalten und ihm am 30. v. M. wieder zugeführt worden. Wegen dieses Entweichens sei gegen diesen Knaben unter Zustimmung des Kuratorii der Anstalt eine 14tägige Karzerstrafe, während welcher er nur einen Tag um den anderen warmes Essen erhalten sollte, nebst drei Rutenstreichen festgesetzt worden. Diese Strafe werde jetzt gegen ihn vollstreckt und habe derselbe bereits 10 Tage davon verbüßt. Der Polizeileutnant ließ den Knaben seiner Fesseln entledigen und vermittelte die Aufnahme desselben im Friedrichs-Waisenhause. Der gefangene Knabe war übrigens während seiner 10tägi¬gen Haft nicht ein einziges Mal an die freie Luft geführt worden und klagte über Schwindel, als der Beamte mit ihm ins Freie trat. Der amtliche Bericht des recherchierenden Beamten ist der Königlichen Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfügung zugegangen.
Weit davon entfernt, sich wegen der Misshandlung des Kindes betreten zu fühlen, geht das Kuratorium der Anstalt in einer Replique auf den Zeitungsbericht zum Angriff über:
Da das im Souterrain gelegene Karzer, dessen Fenster mit der Straße parallel liegt, mit eisernen Traillen nicht versehen ist, so beschloss das Kuratorium, den S. zur Vermeidung fernerer Fluchtversuche, an einen 12 Pfund wiegenden Holzklotz mit einer Kette zu schließen, der ihn aber keineswegs verhindert, wenn er ihn trägt, herumzugehen. Das Kuratorium ist seitens des Königlichen Ministerii des Innern als Aufsichtsbehörde der Malmèneschen Anstalt bestätigt und glaubte daher wohl mit Recht hoffen zu dürfen, dass wenn Denunzianten-Anzeigen über die Anstalt bei einem Königlich Hochlöblichen Polizeipräsidium eingingen, zunächst das Kuratorium zum Bericht aufgefordert werden würde.
Gestern aber haben zwei Herren, von denen sich der eine später als Kriminalpolizeileutnant Bormann legitimierte, sich an den Vorsteher der Anstalt Herrn M. mit der Frage gewendet: "Sie haben hier wohl Privatgefängnisse?", haben das Karzer öffnen lassen, und obschon sie überzeugt, dass an dem Körper des Knaben durch die Anlegung des Klotzes keine Spuren von Nachteilen zu ersehen waren und trotz aller Protestation seitens des Herrn M. den Knaben mit sich fortgeführt.
Das Kuratorium muss gegen diese Eingriffe in die Disziplinarstrafen der Anstalt Verwahrung einlegen und bittet ein Königliches Hochlöbliches Polizeipräsidium gehorsamst, nicht nur den Knaben S., dessen Strafzeit in 4 Tagen vorbei gewesen wäre, sofort der Anstalt wieder zuführen zu lassen, sondern auch in ähnlichen Fällen nicht mit dem Vorsteher der Anstalt, der nur die vom Kuratorium diktierte Strafe zu vollstrecken hat, vielmehr direkt mit dem Kuratorium oder einem Mitgliede desselben in Verbindung zu treten.
Die Verteidigungsstrategie ist perfekt: Die Strafe ist eine unvermeidliche Maßnahme, der Anstaltleiter nur Ausführungdsorgan des Kuratoriums und die Aufdecker - Denunzianten! Die Vossische Zeitung wird durch einen Wink von oben zur Räson gebracht und hat am 21. August, zwei Tage nach dem Bericht, vollstes Verständnis für diese »praktische Strafe«. Die Zeitung verzichtet nicht auf den populistischen Verweis auf die redlichen Arbeiter, denen es viel schlechter geht als dem undankbaren Knaben im Karzer, für den sie nur Spott übrig hat. Was Wunder, wenn ihn, den Schwindler, schwindelt:
Die verschiedenen Gerüchte, welche seit einigen Tagen über einen Vorfall in der Malmèneschen Anstalt im Publikum kursieren, gaben uns Veranlassung, uns durch eigene Anschauung von dem ganzen Institut näher zu informieren [...]
Seit dem zwanzigjährigen Bestehen der Anstalt werden Knaben, welche sich eines und desselben Vergehens öfters schuldig gemacht haben, also rückfällig sind, dadurch bestraft, dass ihnen ein Stück Holz von der Größe eines Kubikfußes, zirka 12 Pfund schwer, an den Leib befestigt wird, und zwar lediglich aus dem Grunde, um sie bei etwaigen Fluchtversuchen allgemein kenntlich zu machen. Wie praktisch diese Strafe ist, ergibt am besten der Umstand, dass im Jahre 1846 ein so bestrafter und entflohener Kabe, der sich das Holz von einem Schlosser wollte lösen lassen, durch diesen verhaftet, dem Königlichen Polizeipräsidium zugeführt und von dieser Behörde nebst demselben Holzstück, welches jetzt das Tages-gespräch bildet, der Anstalt zurückgegeben wurde. Ein in den Zeitungen bereits veröffentlichtes Aktenstück, ein Schreiben des Kuratorii der Anstalt an das Königliche Polizeipräsidium vom 11. August, hat das Sachverhältnis klar dargestellt, und wenn hier und da darüber gesprochen ist, dass dem inhaftierten Knaben S. nur einen Tag um den anderen warmes Essen gegeben wurde, so möge man bedenken, dass manche Knaben vor ihrer Aufnahme in die Anstalt gar nicht gewusst haben, wie warmes Essen schmeckt, und dass wir leider viele, viele Arbeiter haben, die sich kaum einmal in der Woche des warmen Essens erfreuen können. Wenn endlich der Knabe bei seiner Vernehmung über Schwindel geklagt hat, obschon sein Karzer hell und luftig war und er sich jede beliebige Bewegung machen konnte, so ist das bei einem Knaben, der eben wegen Schwindels bestraft worden war, nicht zu verwundern.
Herr Malmène wird rehabilitiert. Erst ein weiterer noch schlimmerer Vorfall derselben Art führt allerdings am 18. Mai 1954 zu einem neuerlichen Eingreifen der Polizei. Diesmal gehen die Polizisten klüger vor: Sie führen den betroffenen Knaben, wie die »Haude- und Spenersche Zeitung« meldet, noch in Ketten dem Untersuchungsrichter vor:
Die Kette war aber so fest um den Leib geschlossen, dass solche dem Knaben nicht nur beim Atmen heftige Schmerzen verursachte, sondern dass solche auch den Genuss von Speisen erschwerte; es war unmöglich, zwischen die Kette und den Leib des Knaben einen Finger einzubringen. Hiervon haben sich der Staatsanwalt und der Untersuchungsrichter des Königlichen Stadtgerichtes, denen der Knabe noch im gefesselten Zustande von den beiden Polizeibeamten vorgeführt wurde, persönlich überzeugt. Der Knabe trug die Kette bereits acht Tage und acht Nächte lang um den Leib; derselbe hatte mit dieser Kette auch des nachts auf einem harten Lager schlafen müssen, und er war von dem Herrn Malmène verurteilt worden, sechs Wochen lang diese Kettenstrafe zu erdulden.
Der Grund für die harte Strafe war, dass der Junge zu seiner Mutter entlaufen war. An seinem Körper wurden Spuren »sehr heftiger Misshandlungen« festgestellt. Das Gesäß war von »Rutenhieben in einer Weise dunkelblau gefärbt und zerfleischt, wie solche selten gefunden«. Gegen Malmène wurde eine gerichtliche Voruntersuchung eingeleitet.
Nun ist auch die Sympathie der »Vossischen Zeitung« zu Ende. Am 1. Juni 1854 lässt sie einen »Freund von Zucht und Sitte« heikle Fragen stellen:
Gesetzt den Fall, es gäbe einen Mann, der nicht bloß wegen Betruges, sondern auch wegen mit un-mündigen Kindern getriebener Unsittlichkeiten kriminell bestraft wäre - und dieser selbige Mann hätte eine Anstalt und diese Anstalt nennte er eine "Erziehungs-Anstalt" -, dürfte es von Polizei und von Schule wegen gestattet werden, dass ein solcher Mann eine solche Anstalt hätte und sich davon Vorsteher nennt? ¬Um Auskunft bittet ein Freund von Zucht und Sitte.
Am 4. Juni 1854 berichtet die Zeitung ferner, dass sich Malmène zur Disziplinierung der Kinder eines »ungewöhnlich schweren aus Leder hart geflochtenen Kantschuhs« sowie des »spanischen Bockes« bedient:
Dieser spanische Bock wird dadurch gebildet, dass dem zu züchtigenden Knaben die Hände zusammengeschnürt worden sind, dann sind die Knie des Knaben zwischen die Ellenbogen gepresst, und es ist in dieser Situation ein starker Stock zwischen das Ellenbogengelenk und das Kniegelenk durchgesteckt worden, so dass das Zurückziehen der Knie zwischen den Ellenbogen unmöglich gemacht ist. Die Gerichtszeitung erläutert diese sinnreiche Stellung durch eine förmliche Abbildung. Der menschliche Körper bildet in solcher eine bewegungslose wehrlose Fleischmasse, welche bequem jedweder Züchtigung unterworfen werden kann, und bei welcher namentlich das Gesäß des Menschen so scharf angespannt wird, als es nur möglich ist.
Das angespannte Gesäß deutet wohl jene Stelle an, die »jedweder Züchtigung« unterworfen wurde. Endlich, am 15. Juni 1854, berichtet die »Vossischen Zeitung«:
Die in letzter Zeit so vielfach besprochene Malmènesche Erziehungs- und Beschäftigungsanstalt ist gestern früh infolge eines gemeinschaftlichen Beschlusses der Königlichen Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidii polizeilich geschlossen worden. Als Kommissar für die Ausführung dieser Maßregel von seiten des Polizeipräsidii ist der Polizeidirektor Herr Stieber abgeordnet worden. Der Staatsanwalt Herr Nörner wohnte dem Akt der Schließung persönlich bei. Die Knaben der Anstalt sind ihren Angehörigen durch Polizeibeamte zugeführt worden, und wo dergleichen nicht vorhanden sind, ist anderweitig für die Unterbringung der Kinder angemessen gesorgt. Herr Malmène selbst ist dem Vernehmen nach polizeilich verhaftet worden.
Maßnahmen wie diese sind äußerst selten und finden nur in den schlimmsten Fällen und unter dem Druck einer protestierenden Öffentlichkeit statt. Den Grund dafür gibt der Oberpräsident von Magdeburg in einem Schreiben an den preußischen Staatskanzler, der sich um das Schicksal der arbeitenden Knaben nicht zuletzt deshalb Sorgen macht, weil sie nicht mehr für das Militär tauglich sind, mit bemerkenswerter Offenheit an: Den Fabriken Arbeiter und vor allem solche »von der am wenigsten kostbaren Klasse derselben, den Kindern« zu entziehen, würde die inländischen Fabrikate verteuern und »die schon jetzt schwer zu ertragende Konkurrenz des Auslandes, wo ähnliche Maßnahmen nicht stattfinden, noch mehr begünstigen«. Die heute im Unterschied zu damals andere Bedeutung des Wortes "kostbar" spiegelt höchst aufschlussreich die Auswirkung der kapitalistischen Konkurrenzlogik auf die ihr unterworfenen Subjekte wider: Da die Kinderarbeit wenig kostet, sind die Kinder, die sie verrichten, auch wenig kostbar.
[103] Adelheid Popp, 1869 - 1939, österreichische Frauenrechtlerin und Sozialistin, musste ab dem 3. Schuljahr in der Fabrik arbeiten. Aufgrund der Organisation eines Frauenstreiks mehrmals eingesperrt, seit 1918 Wiener Gemeinderätin, seit 1919 Nationalrätin, Gründerin des Vereins sozialdemokratischer Frauen und Mädchen (1918) und Vorsitzende des Internationalen Frauenkomitees. Schriften: 1909: Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin; 1915: Erinnerungen: Aus meinen Kindheits- und Mädchenjahren; 1929: Der Weg zur Höhe: die sozialdemokratische Frauenbewegung Österreichs.
[104] Viktor Adler, 1852 - 1918, österreichischer Politiker, Armenarzt in Wien. Gründer der Zeitschrift Gleichheit (1886, 1889 verboten) und der Arbeiterzeitung (1889), mehrfach angeklagt und arretiert. 1888 Begründung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und deren erster Vorsitzender, 1918 Staatssekretär des Äußeren der provisorischen Nationalregierung unter Karl Renner.
[105] Karl von Vogelsang, 1818 - 1890, katholischer Publizist, Politiker und konservativer Sozialreformer. Wegbereiter der Christlichsozialen Bewegung, Vorläufer der Christlichsozialen Partei (1893). Schriften: 1881: Die Bauernbewegung in den österreichischen Alpenländern; 1883: Die Konkurrenzfähigkeit in der Industrie; 1883/84: Die materielle Lage das Arbeiterstandes in Österreich; 1884: Zins und Wucher; 1886: Gesammelte Aufsätze über socialpolitische und verwandte Themata.
[106] August Bebel, 1840 - 1913, einer der Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (1869), zeitweilig Unternehmer, Mitglied des Reichstages, 192 Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Im so genannten "Hochverrats-prozess 2 Jahre in Haft. Schriften (Auswahl): Die Frau und der Sozialismus (1879); Wie unsere Weber leben (1879); Zur Lage der Arbeiter in den Bäckereien (1890); Aus meinem Leben (1910/11/14).
[107] Anna Papritz, 1861 - 1939, deutsche Frauenrechtlerin. Schriften (Auswahl): Vorurteile (1894); Herrenmoral (1903); Die schaftlichen Ursachen der Prostitution (1903); Prostitution und Abolitionismus (1917); Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung (1924).
[108] Klara Zetkin, 1857 - 1933, deutsche Sozialistin und Frauenrechtlerin, Herausgeberin der Frauen-Zeitschrift Die Gleichheit, Mitglied der SPD, später der KPD; Reichstagsabgeordnete, Mitbegründerin der Zweiten Internationale, Initiatorin des Internationalen Frauentages. 1882 - 1890 in Paris, 1833 in der Sowjetunion im Exil. Präsidentin der Internationalen Arbeiterhilfe, Mitglied des Zentralkomitees der KPD und des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale. Schriften (Auswahl): Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage (1899); Zur Frage des Frauenwahlrechts (1907); Wir klagen an; Ich will dort kämpfen, wo das Leben ist (1922); Eine Auswahl von Schriften und Reden (Berlin: Dietz Verlag 1955); Ausgewählte Reden und Schriften (Berlin: Dietz Verlag 1957 -1960).
[109] Josef II, 1741 - 1790, röm..dt. Kaiser 1765 - 1790
Inhaltsverzeichnis
- 1. Armut - Keim der Revolution
- 2. Alte Rezepte für neue Probleme
- 3. Die Geburt des Sozialstaates. Neuordnung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie
- 4. Maßnahmen zum Schutz der ArbeiterInnen
- 5. Die Einführung der Sozialversicherung
- 6. Staatlicher Liberalismus und christlich-bürgerliche Wohltätigkeit
- 7. Der Erste Weltkrieg: "Geburtshelfer" des modernen Wohlfahrtsstaates?
- 8. Die Gnade der Wohltätigkeit und das Recht auf Hilfe
- 9. Die Zwischenkriegszeit
Die politischen Verhältnisse zwischen dem Beginn des 19. Jahrhunderts und dem Ausbruch des 1. Weltkrieges sind durch einander widersprechende Tendenzen gekennzeichnet:
Partikularismus und Markt
Die auf Wachstum und überregionalen Handel ausgerichtete Industrie verlangt nach großräumigen, zentral gesteuerten politischen Strukturen, in denen sie ihre ökonomischen Interessen entfalten kann, während etwa Deutschland noch aus 25 unabhängigen Staaten besteht. Das führt in Deutschland zur Reichsgründung (1871) und damit zur Möglichkeit gesamtstaatlicher Sozialgesetzgebung.
Liberalismus und ökonomische Krisen
Ökonomische Krisen wie der Gründerkrach (1873) und die ihm folgende "Große Depression" (1873 - 1890) stellen den Fortschrittsoptimismus in Frage und bewirken die Ausweitung der staatlichen Zuständigkeit. Der "Nachtwächterstaat" wird zum "Interventionsstaat" (Hering/Münichmeier 2000, 38).
Soziale Unruhen und öffentliche Ordnung
Die ökonomischen Krisen bewirken vermehrte Arbeitslosigkeit und damit die Gefahr von Arbeiterunruhen und radikalen politischen Umstürzen. Die Forderung der Sozialreformer nach Verbesserung der staatlichen Fürsorge für die Arbeiter wird damit zum Anliegen der an öffentlicher Ruhe und Ordnung interessierten besitzenden Klassen.
Die Politik versucht diesen widersprüchlichen Dynamiken im Wesentlichen mit drei Strategien gerecht zu werden:
Polizeistaatliche Unterdrückung sozialrevolutionärer Tendenzen
Der ersten Strategie dienen in Deutschland die "Sozialistengesetze", in denen die Sozialistische Partei verboten wird (1878-1890), in Österreich die brutale Unterdrückung der Arbeiterbewegung nach 1848.
Zentralisierung der Sozialgesetzgebung und der Sozialfürsorge
Der zweiten Strategie dient die Ausweitung der gesamtstaatlichen Zuständigkeit und die Bildung zentraler Organisationsformen, in denen die Hunderte von privaten Wohlfahrtsorganisationen zusammengefasst werden sollen. Dem entspricht in Deutschland der 1880 gegründete "Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit", der nach eigenem Anspruch beabsichtigt, "auf die Gesetzgebung einzuwirken, eine auf Vorbeugung gerichtete Wohltätigkeit zu befürworten und nicht zum Letzten: auch auf diesem Gebiet ein alle Glieder des Reiches umschließendes Band zu knüpfen" beabsichtigt (ebd., 58).
Soziale und ökonomische Absicherung der Arbeiter
Die entscheidende Neuerung besteht aber in der Einführung bzw. Reform der Sozialversicherung, durch die die ArbeiterInnen bei Unfall und Krankheit und Invalidität sowie im Alter unterstützt werden.
Liberalistische Ideen kamen den asozialen Tendenzen der aufkommenden kapitalistischen Unternehmerideologie entgegen. Die Theorien eines Adam Smith[110] etwa, der das Gesetz allen ökonomischen Handelns der »invisible hand« des Marktes überließ und überzeugt war, "dass sich das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen von selbst herstellen" würde, "wenn jeder nur seinem wohlverstandenen Eigeninteresse folgen würde", während "durch Eingriffe des Staates und Unterstützung der wirtschaftlich Schwachen" nur "der Wille zur Anstrengung aller Kräfte im Interesse des Gemeinwohls geschwächt" würde (Landwehr/Baron 1983, 22; Engelke 1999, 66 ff., 91 ff.). Oder der Bevölkerungstheorie des Thomas R. Malthus, der angesichts des natürlich begrenzten Lebensmittelvorrates eine ebenso natürliche Bevölkerungsbegrenzung durch Katastrophen, Hungersnöte, Krankheiten und Kriege für notwendig und jedes Almosen für jene »Unglücklichen, welche in der großen Lebenslotterie eine Niete gezogen haben« (zit.n. ebd., 23) als Beitrag zur Unterstützung einer ungesunden Bevölkerungsvermehrung vor allem im Bereich der Armen ablehnte.
Je größer die Zahl der von Verelendung bedrohten Menschen anwuchs und je weniger der liberalistische Staat intervenierte, desto mehr wurde das soziale Problem zum Politischen, es drohte, wie es bürgerliche Kommentatoren ausdrücken, »der Pöbel zum Proletariat« zu werden. "Bedrohliche Symptome", schreibt ein Zeitgenosse des Weberaufstandes in Schlesien (1847), "der Unzufriedenheit zeigten sich schon Ende des Winters 1843". Weder die Fabriksherrn noch der Staat seien aber bereit gewesen, sich der "unglücklichen Arbeiter anzunehmen". Die Unterdrückung bürgerlicher Freiheitsideale durch den Polizeistaat einerseits und die Proletarisierung der Arbeiter durch die kapitalistischen Unternehmer andererseits bilden den sozialen Sprengstoff, der zur Mitte des Jahrhunderts an vielen Orten in Europa zu Aufständen und Revolutionen führte. Hohe Arbeitslosigkeit und geringer Lohn für rücksichtslos ausbeuterische Arbeitsverhältnisse treiben die Menschen nicht nur in Preußen auf die Straße.
Auch die Bürger kämpften gegen den absolutistischen Staat, insbesondere für die Pressefreiheit. Am 13. März 1848 demonstrieren Studenten in der Wiener Herrengasse, Arbeiter schließen sich ihnen an. Der Polizeikommandant lässt schießen, es gibt die ersten Toten. Die Folge ist die Bewaffnung der Auf-ständischen, Fabriken und Maschinen werden zerstört. Der Kaiser gibt fürs erste nach: Die Zensur wird aufgehoben, die Pressefreiheit gewährt, eine konstitutionelle Verfassung versprochen. Der verhasste Fürst Metternich muss Wien fluchtartig verlassen. Nach einem beständigen Hin- und Her zwischen den Kaiserlichen und den Aufständischen beginnt am 16. Oktober der »Kampf um Wien«. Regierungstreue Truppen umzingeln die Stadt und ziehen am Nachmittag des 31. Oktober siegreich durch das Burgtor. »Es ist alles umsonst, wir sind wieder verraten und verkauft«, so gibt ein Arbeiter die Lage der Aufständischen wieder.
Er sollte nicht Recht behalten. Zwar werden zunächst alle demokratischen Arbeitervereine aufgelöst, die Führer hingerichtet, ein "Terrorsystem gegen die demokratische Bewegung" errichtet. "Die historische Entwicklung konnte aber nicht aufgehalten werden" (Kucera 1981, 31). Bereits im September 1848 hatte der Kaiser den Reichstagsbeschluss zur Aufhebung des bäuerlichen Untertanenverhältnisses sanktioniert. Die bürgerlichen Freiheiten müssen unter dem Druck der ökonomischen und politischen Entwicklung Zug um Zug gewährt werden. Unter demokratischer Beteiligung verstehen die liberalen Bürger freilich nicht die Beteiligung der Arbeiter, die ihnen zur Durchsetzung ihrer Rechte willkommen waren. Während dem vermögenden Unternehmertum zunehmenden Einfluss auf die Regierung zugestanden wird, bleibt das wachsende Proletariat ausgeschlossen.
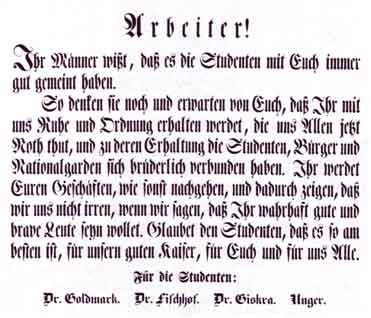
Faksimile: Aufruf der Studenten an de Arbeiter, Wien 1848
In einer Stadt wie Salzburg gärt es zwar auch, es kommt aber zu keinen gewaltsamen Auseinanderset-zungen. Brotteuerung und Bierpreiserhöhung führen 1845 zu ersten Unruhen. Den Bauern wurde vor-geworfen, Getreide aus Spekulationsgründen zurück zu halten. Aber nicht das »Jammergeschrei der von äußerster Not heimgesuchten Familien, nicht die Scharen derer, die vom Hunger getrieben die Straßen, die öffentlichen Plätze und Häuser belagerten« bewirkte das Eingreifen des Magistrats zur Verhinderung weiterer Preissteigerungen, sondern »die Gefahren, welche ein zur Verzweiflung getriebenes Proletariat über den Besitzstand zu bringen vermag« (Veits-Falk 2000, 29). Die 48er Revolution in Wien wurde von den Salzburgern bejubelt, ihr Scheitern verzögerte auch hier die demokratische Entwicklung. Erst 1861 genehmigte Franz Joseph den Ländern eine eigene Landesordnung, im März dieses Jahres fanden die ersten Landtagswahlen statt. Die Lage der Armutsbevölkerung wurde dadurch kaum verbessert.
Die überwiegend bäuerliche Bevölkerung in Tirol und Südtirol interessierte sich kaum für die Ideale der bürgerlichen Revolutionäre, deshalb blieb es hier auch im Revolutionsjahr ruhig. So ruhig, dass 1848 der Kaiser, Ferdinand I. mit seinem gesamten Hofstaat nach Innsbruck floh, um sich vor den Revolutionären in Sicherheit zu bringen. Auch bei den Innsbrucker Studenten hatte sich die anfängliche Begeisterung für die Revolution bald in eine reaktionäre Gesinnung gewandelt. 300 von ihnen formierten sich zur I. Akademischen Kompanie und zogen für Gott und Vaterland ins Feld (Egger 2012). Im Archiv der Innsbrucker Universität finden sich Hinweise, dass nach 1848 Studenten, die auf Grund ihrer Beteiligung an der Revolution in Wien Studienverbot hatte, trotz der Einwände der Universität, in Innsbruck zum Studium zugelassen wurden.
Für die zur Masse anwachsende Schicht eigentumsloser und arbeitsloser Lohnarbeiter, das industrielle Proletariat, reichen die tradierten Methoden der Armenfürsorge nicht mehr hin. Hier "wächst eine Bevölkerungsschicht heran, deren Reproduktion davon abhängt, ob sie immer wieder einen Grundbesitzer oder Unternehmer finden, der ihre Arbeitskraft kauft, aus der potentiell jeder Einzelne arm und unter-stützungsbedürftig ist" (Landwehr/Baron 1983, 12). Notgedrungen beginnt der Staat die Lösung des Armenproblems an sich zu ziehen. Die Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten des Jahres 1794, nach denen es dem Staate zukommt, »für die Ernährung und Verpflegung derjenigen Bürger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaffen« können, sind allerdings noch ganz im alten Geist verfasst. Einmal nimmt das Gesetz diejenigen aus, »die von anderen Privat-personen, welche nach besonderen Gesetzen verpflichtet sind« erhalten werden können.« (zit.n. ebd., 15).
Denjenigen, welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit, ihren und der ihrigen Unterhalt selbst zu verdienen, ermangelt, sollen Arbeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten gemäß sind, angewiesen werden.« Diejenigen aber »die nur aus Trägheit, Liebe zum Müßiggang oder anderen unordentlichen Neigungen die Mittel, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen nicht anwenden wollen, sollen durch Zwang und Strafen zu nützlichen Arbeiten unter gehöriger Aufsicht angehalten werden [...] Veranlassungen, wodurch ein schädlicher Müßiggang, besonders unter den niederen Volksklassen genährt, und der Trieb zur Arbeitsamkeit geschwächt wird, sollen im Staate nicht geduldet werden (ebd,).
Fremde Bettler sollen außer Landes gewiesen, auch Einheimischen »soll das Betteln nicht gestattet, sondern dieselben an den Ort, wohin sie gehören und wo für sie nach den Vorschriften gegenwärtigen Titels gesorgt werden muss, zurückgeschafft werden« (ebd.).
Dieses Heimatrecht war das erste traditionelle Prinzip der Armenfürsorge, das den gesellschaftlichen Veränderungen nicht standhielt. Weder wollten die Grundherrn für ihre entlassenen und vielfach verarmten Bauern und Dienstboten zahlen, noch hatte der Staat ein Interesse, die durch die ökonomischen Veränderungen ausgelöste Mobilität zu verringern. "Die Verfügbarkeit ausreichender Mengen ungebundener Arbeitskräfte an jedem Ort lag durchaus im Interesse der Industrie" (Landwehr/Baron 1983, 16). Das Gesetz über die Aufnahme anziehender Personen und das preußische Armengesetz von 1842 schufen erstmals die Möglichkeit, Arme samt ihren Familien an ihren neuen Aufenthaltsorten zu unter-stützen. Die Voraussetzung war ein Alter von 26 (ab 1894: 18, ab 1908: 16) Jahren, drei Jahre (ab 1855 ein, ab 1871 zwei Jahre) ununterbrochenen Aufenthalts ohne öffentliche Unterstützung und der Nachweis, dass die Person beim Zuzug noch nicht verarmt war. Wer jemals eingesperrt oder Angehöriger eines Häftlings war, war ausgeschlossen. Das Prinzip des Heimatwohnsitzes wich dem Prinzip des »Unterstützungswohnsitzes«, das 1871 im gesamten im selben Jahr gegründeten 2. Deutschen Reich mit Ausnahme Bayerns - dort galt bis 1913 das Heimatrecht - und des eben von Frankreich eroberten Elsass-Lothringen Gesetzeskraft erlangte. Zusätzlich wurden Landarmenverbände eingerichtet. Sie kamen für den Unterhalt derer, die keinen Unterstützungswohnsitz hatten, entweder an ihren Wohnorten auf oder versorgten sie in eigenen Häusern.
Auf diese Unterstützungen gab es keinen Rechtsanspruch,[111] noch war die Höhe der Zuwendung geregelt. Die Hilfsbedürftigen sollten nur das Nötigste zum Leben bekommen, die Unterstützung dürfe keinesfalls »als Aufmunterung wirken, sich in den Stand der Armen zu begeben« (zit.n. ebd., 18). Für Personen, die bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit in einem festen Arbeitsverhältnis als Dienstboten oder Handwerker standen, waren die Dienstherrn oder der Betrieb zuständig. Um sich dieser Verpflichtung zu entziehen, versuchten viele Dienstgeber, die Hilfsbedürftigen, z.B. schwangere Frauen, vorher zu entlassen.
Die Höhe der gewährten Unterstützung oblag den örtlichen bzw. städtischen Armenverbänden und konnte zwischen ihnen um das fünf- bis zehnfache differieren. Die vielen unterschiedlichen Ausführungsgesetze, Zuständigkeits- und Kostenerstattungsprobleme verursachten "eine Fülle von erst-, zweit- und letzinstanzlichen Entscheidungen, die auch für den Eingeweihten kaum noch überschaubar war. Zugleich stellten sie an die ausführenden Gemeinden Anforderungen, die nur durch den Ausbau immer umfangreicherer Verwaltungsapparate bewältigbar waren, die insbesondere in den großen Städten auch den Betroffenen immer undurchschaubarer und anonymer gegenübertraten" (ebd., 1983, 22).
Durch die anhaltende Depression wurde das System des Unterstützungswohnsitzes wenige Jahre nach seiner Einführung einer Belastungsprobe ausgesetzt, die es beinahe nicht überstanden hätte. Die Städte und Gemeinden beklagten sich bitter über die steigenden Armenpflegekosten, die angeblich vor allem durch Zugereiste verursacht wurden. Lautstark wurde die Zurücknahme des Unterstützungswohnsitzgesetzes, eine erneute Einschränkung der Freizügigkeit und sogar die Rückkehr zum Heimatrecht verlangt. Dies ging bis zu entsprechenden Vorstößen im Reichstag. Solche Tendenzen riefen wiederum weitblickende Kreise auf den Plan, die die industrielle Entwicklung des jungen Deutschen Reiches bedroht sahen. Eine Untersuchung etwa für Berlin ergab, dass die Hauptkosten der Armenpflege aus laufenden Unterstützungen gar nicht von den Zugezogenen, sondern ganz überwiegend von solchen Einzelpersonen und Familien verursacht wurden, die schon zehn Jahre und länger in der Stadt lebten; die bis zu zwei Jahre Ansässigen machten weniger als 1% aus. Eine Flut von Schriften beschäftigte sich mit der anscheinend dringend notwendigen Reform der Armenpflege; das Thema beherrschte öffentliche und private Diskussionen. (ebd., 28).
In vieler Hinsicht bleiben in den neuen Maßnahmen die alten Mentalitäten präsent. Es werden noch nicht "die Grundlagen der modernen Sozialarbeit gelegt, die ganz anderen Prämissen und Strukturprinzipien folgen wird. Es handelt sich stattdessen um eine Umbruchsituation, in der die alten Erklärungs-muster und Hilfsstrukturen noch wirksam sind, aber den gewachsenen Anforderungen angepasst wer-den müssen. Es entsteht auf allen Ebenen eine Gemengelage von alt und neu" (Hering/Münchmeier 2000, 28). Die unterstützten Armen kommen nicht in den Genuss des ebenfalls 1871 eingeführten all-gemeinen und gleichen Wahlrechts und sie haben keine bürgerlichen Ehrenrechte. Wer nicht für sich sorgen kann, gilt auch als nicht fähig, mitzubestimmen. Einen Rechtsanspruch auf soziale Hilfe schloss auch das Unterstützungswohngesetz aus.
Versuche der Problembewältigung stellen die ersten Ansätze zu einer gemeindezentrierten Armenfürsorge dar, die als »Hamburger« und in erweiterter Form als »Elberfelder System« bekannt wurden. Das Hamburger System baut auf einer großen Zahl ehrenamtlichen Armenpfleger auf, die mittels standardisierter Erhebungsbogen Einzelfallüberprüfung für die städtische Armenpflege und vor allem der Zuweisung in eines ihrer Armenhäuser, darunter eine Spinnschule für Frauen und eine für Kinder vornehmen. In Elberfeld, dessen Einwohnerzahl sich seit 1800 innerhalb von 80 Jahren von zehn- auf hunderttau-send vergrößert hat, wird ab 1853 die ganze Stadt in kleine »Quartiere« aufgeteilt, die zu Armenbezirken zusammengefasst werden.
Diese Quartiere sind kleine Wohneinheiten, in der Regel ein paar Häuserblocks, von denen es in Elberfeld ca. 140 gibt. Jeweils 14 Quartiere werden zu einem Bezirk zusammengefasst, der von einem auch ehrenamtlich arbeitenden Bezirksvorsteher betreut wird. Der Armenpfleger wohnt in seinem Quartier und kümmert sich im Durchschnitt um drei bis vier Personen bzw. Familien. Dadurch ist er für die Hilfesuchenden schnell zu erreichen, hat sie jedoch seinerseits auch immer im Blick. Er kennt ihre Lebensumstände genau und ist Zeuge ihrer Entwicklung. Um nicht zu eng in die nachbarschaftlichen Bindungen hineinzugeraten, hat er über seine Entscheidungen bezüglich der zu bewilligenden finanziellen Zuwendungen dem Bezirksvorsteher und mit diesem zusammen der städtischen Armenverwaltung Rechenschaft abzulegen.
Das System erweist sich im Sinne der Absichten der liberalistischen staatlichen Politik als höchst erfolgreich, namentlich, wie Hering/Münchmeier (2000, 31) anmerken durch "das Absinken der Zahl der Unterstützungsanträge", weshalb es von zahlreichen deutschen Städten übernommen wird. Probleme gibt es allerdings in den Massenquartieren der Armen der Großstädte. "Hier wird es schwierig, ehrenamtliche Armenpfleger zu finden, die in der Nachbarschaft ansässig sind. Schwierigkeiten bereiten auch die hohe Mobilität und die steigende Komplexität der Problemlagen, denen die unausgebildeten Helfer sich nicht mehr gewachsen fühlen." (Hering/Münchmeier 2000, 31 f.) Eine stärkere Zentralisierung der Organisation durch die Einrichtung eines eigenen Armenamtes, und die Reduzierung der Aufgaben der Armenpfleger auf die Zuarbeit zu diesem Amt durch die Überprüfung der Bedürftigkeit durch so genannte »Abhörbögen« und die Entgegennahme und Weiterleitung von Unterstützungsanträgen versucht man dieser Probleme Herr zu werden.
Wie man sieht, sind die Ansätze einer gemeindezentrierten Armenpflege zuvörderst auf die Effektivierung und Rationalisierung des Systems der öffentlichen Armutsverwaltung gerichtet und nicht auf das individuelle und soziale Schicksal der Armen, eine Auseinandersetzung die in den folgenden Jahrzehnten eine wesentliche Dynamik zur Erneuerung der sozialen Arbeit werden sollte.
Am Beginn der 1870er Jahre wurden Maßnahmen der Sozialpolitik, soweit sie überhaupt erfolgten, noch keineswegs als eine Verantwortung des Staates für die arbeitenden Menschen verstanden, sondern als politische Taktik zur Verhinderung von Unruhen.
»Von beiden Seiten ist der Gedanke in den Vordergrund gestellt worden«, heißt es 1871 nach einem Treffen zwischen dem deutschen Reichskanzler Bismarck[112] seinem österreichischen Gegenüber Beust[113] in Gastein, »nicht allein in der Hervorkehrung des polizeilichen Standpunktes [...] die Mittel zu beschwören und Gefahren zu verursachen, die allerdings ernster und drohender als je an die positive Ordnung der Staaten und an die heutigen Prinzipien ihrer Regierungen herangetreten sind. Fürst Bismarck vielmehr und Graf Beust begegneten sich in dem Entschlusse, die Frage vom höheren Standpunkt der staatlichen Fürsorge zu beurteilen« (zit.n. Tálos 1981, 34).
Hier kündigt sich ein Paradigmenwechsel an, der freilich erst in den 1880er Jahren nach einer Wirtschaftskrise, dem Niedergang der Liberalen und der Etablierung einer konservativen Regierung realisiert wurde. Die neue Sozialpolitik versteht sich als Doppelstrategie im Sinne Bismarcks und Beusts. Die Repressionsmaßnahmen gegenüber der Arbeiterbewegung werden fortgesetzt. 1884 wird über Wien, Korneuburg und Wiener Neustadt der Ausnahmezustand verhängt, in den Folgejahren werden eine Reihe von Gesetzen gegen die "gemeingefährlichen Tendenzen des Sozialismus" erlassen. Die Regierenden erkennen aber, dass Repression allein nicht ausreicht. Ein Abgeordneter zum Reichsrat:
Die gärende Bewegung, welche sich der arbeitenden Klassen immer mehr bemächtigt, kann durch bloße Worte und Versprechungen und auch durch die schärfsten polizeilichen Repressivmaßnahmen weder ge-hemmt noch gedämpft werden. Diese Lawine wird in ihrem verheerenden Sturze durch Bajonette nicht aufgehalten werden, sie kann und wird nur an der Sonne positiver sozialer und politischer Reformen schmelzen (zit.n. ebd., 43).
Ziel der Reformpolitik, die von christlichsozialen Ideen wie sie etwa der konservative Sozialreformer Karl Freiherr von Vogelsang vertrat, nachhaltig beeinflusst wurde, war der Kampf gegen Liberalismus und Kapitalismus, auf der einen und die Verhinderung der Entstehung einer revolutionären Arbeiterschaft auf der anderen Seite. Dem Industriekapitalismus wurde die Zersetzung der Gesellschaft, die Zerstörung der »produzierenden Stände«, der Bauern und Handwerker durch die Geld- und Kreditwirtschaft und die Entmenschlichung der Arbeiter zu »geistig verkrüppelten Maschinenbestandteilen« (ebd., 44) vorgeworfen. Dem wurde die Idee einer stufenweise aufgebauten Gesellschaft aus genossenschaftlich organisiertem Groß- und Kleingewerbe, Handwerken und Bauern entgegengestellt, die durch Gewerbebefähigungsnachweis, Schutzzölle und Unteilbarkeit der Bauernhöfe vor dem zerstörerischen Zugriff der Konkurrenz und des Geldes geschützt werden sollten. Der Schutz der Arbeiter folgte dem in der langen Geschichte der Armut wohl etablierten konservativen Formel der Bindung von sozialer Hilfe an obrigkeitliche Kontrolle.
Eine ernsthafte Sozialreform darf jedoch nur die genannt werden, welche die Umgestaltung dieser für Kirche, Gesellschaft und Staat verlorenen, nur den Zwecken der Geldmacher dienenden, zwischen willenloser, würdeloser Knechtschaft und ebenso würdeloser Empörung hin- und hergerissenen Sklavenheere in wertvolle Glieder der organisierten Gesellschaft fest im Auge hat (Vogelsang, zit.n. ebd., 45).
Der konservative Sozialreformer Graf Taaffe[114] schafft erstmals die gesetzlichen Grundlagen für eine wirksame staatliche Sozialpolitik. In rascher Folge werden das Gewerbeinspektorengesetz und die Gewerbeordnungsnovelle (1883), das Bergarbeitergesetz (1884), das Unfallversicherungsgesetz (1887) und das Krankenversicherungsgesetz (1888) verabschiedet. "Der Staat behauptet damit für sich eine außerökonomische Kompetenz für den gesellschaftlichen Bereich und macht sich zudem zum Adressaten von Forderungen nach Veränderungen in der sozialen Lage von Produktionsgruppen" (ebd., 41). Er zieht sich nicht mehr wie in der gesamten bisherigen Geschichte der Armut zurück auf die Linderung - oder Diffamierung - der Not, sondern erweitert seine Zuständigkeit auf die Veränderung der strukturellen Bedingungen, einschließlich vor allem der ökonomischen, die die Not hervorbringen. Darüber,
dass dem Staate die imperiale Aufgabe zufällt, in die chaotischen, das Elend erzeugenden, wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart ordnend einzugreifen und im Gesetzgebungs- sowie im Verwaltungswege dem Elend präventiv und repressiv entgegenzuwirken - darüber sind die Kulturvölker einig,
hält das parlamentarische Protokoll anlässlich der Debatte über das Gewerbeinspektionsgesetz pathetisch fest (zit.n. ebd., 47). Nur der Staat habe die Kraft "den wirtschaftlichen Egoismus des Individuums, wo dies nicht freiwillig geschieht, den Interessen der Allgemeinheit unterzuordnen" (ebd., 48).
Zum Schutz der ArbeiterInnen wurden unter Taaffe drei Gesetze verabschiedet: Das Gewerbeinspektorengesetz von 1883, das Bergarbeitergesetz von 1884 und die Gewerbeordnungsnovelle von 1885.
Dieses 1883 eingeführte Gesetz definierte die Aufgaben der Gewerbeinspektoren, deren Wahrnehmung allerdings von ihrer Anzahl abhing, die im Einvernehmen zwischen dem Handels- und dem Innenminister festzulegen war, und die wie man annehmen konnte so gering bleiben würde wie bisher. Wohl ein Grund dafür, dass das Gesetz einigermaßen problemlos über die Bühne ging. Nach § 5 hatten die Gewerbeinspektoren zu überprüfen:
-
Die Vorkehrungen und Einrichtungen, welche die Gewerbeinhaber, zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter, sowohl in den Arbeitsräumen als auch in den Wohnräumen, falls sie solche beistellen, zu treffen verpflichtet sind; 2. Die Verwendung von Arbeitern, die tägliche Arbeitszeit und die periodischen Arbeitsunterbrechungen; 3. Die Führung von Arbeitsverzeichnissen und das Vorhandensein von Dienstordnungen, die Lohnzahlungen und Arbeitsausweise; 4. Gewerbliche Ausbildung der jugendlichen Hilfsarbeiter" (zit.n. ebd., 52).
Wesentlich umstrittener war das 1884 verabschiedete Bergarbeitergesetz, das insofern ein Meilenstein in der österreichischen Sozialgesetzgebung ist, als es zum ersten Mal einen Maximalarbeitstag einführt: Die Dauer einer Schicht wurde mit 12, die maximale effektive Arbeitszeit mit 10 Stunden festgesetzt. Um jede einzelne Bestimmung wurde gefeilscht, insbesondere um das im Entwurf vorgesehene Arbeitsverbot für Kinder unter 14 Jahren, wo die Unternehmer letztlich eine Ausnahmeregelung für 12 - 14 jährige Kinder durchsetzten. Auch die Maximalarbeitszeit wurde durch die Ermächtigung der Berghauptmannschaft zur Gestattung von Überschichten »im Falle außerordentlicher Ereignisse« (§ 3) auf-geweicht. Aber immerhin: das Prinzip staatlicher Vorschriften für die Arbeitszeit war gegenüber der bisherigen Ideologie der freien Vereinbarung durchgesetzt. Das so genannte Trucksystem, die Entlohnung der Arbeiter/innen mit Waren, wurde abgeschafft.
Bei diesem Gesetz, das 1885 in Kraft trat, prallten die unterschiedlichen Interessen am heftigsten aufeinander. Die Frage der Maximalarbeitszeit stellte sich nochmals generell. Während der Regierungsentwurf argumentierte, sie müsse als »Verletzung der individuellen Freiheit eigenberechtigter Personen vermieden werden«, sah ein Referentenentwurf die 60-Stunden-Woche, ein Kinderarbeitsverbot unter 14, eingeschränkte Arbeitszeit für Jugendliche (6 Stunden bis 16, 10 Stunden bis 18 Jahren) und Frauen zwischen 16 und 21 (10 Stunden) vor. Mit der Begründung, »dass der Normalarbeitstag von 11 Stunden die schwerste Schädigung bezüglich der Leistungsfähigkeit unserer Industrie bedeutet«, wandten sich »die gehorsamst und ehrerbietigst« unterzeichneten Industriellen der mechanischen Webwarenindustrie vertrauensvoll an das Hohe Haus der Abgeordneten mit der dringenden und ehrfurchtsvollen Bitte, dasselbe möge »für die mechanische Webwarenindustrie aber keinesfalls eine Arbeitszeit unter zwölf Stunden am Tag bestimmen« (zit.n. ebd., 55).
Im Endeffekt wurde der Normalarbeitstag mit 11 Stunden festgesetzt und dem Handelsminister bzw. der Gewerbebehörde ein Ausnahmrecht zugestanden, von dem diese, wie die Berichte der Gewerbeinspektoren zeigen, reichlich Gebrauch machte: 1886 wurden 434, 1893 bereits 682 Überzugsbewilligungen erteilt (ebd., 77). Die Regelung galt allerdings nur für die Fabriksarbeiter/innen. Kleingewerbe und Landwirtschaft hatten nach wie vor ungeregelte Arbeitszeiten.
Die Kinderarbeit wurde bis 12 Jahre gänzlich und bis 14 Jahre in den Fabriken verboten, wogegen von Seiten der Opposition mit der alten Ideologie des Erziehungswertes der Arbeit argumentiert wurde: »Sie werden einen großen Teil jener Kinderschar, die sich auf jeweilig 11.000 beläuft, der sittlichen Verwilderung und dem Vagbundentum entgegentreiben« (zit.n. ebd., 58).
Ähnlich kontrovers verliefen die Debatten um das Verbot der Nachtarbeit von Frauen, die - typisch für die konservative Haltung der Sozialreformer - letztlich mit dem Argument durchgesetzt wurde, "die Frau gehöre überhaupt nicht in die Fabrik, sondern ins Haus. Das Verbot nur der Nachtarbeit der Frau sei bereits ein Zugeständnis an die Industrie" (ebd., 58).
Insgesamt wird an den Reformgesetzen und der mit ihnen verbundenen Argumentation der Reformer sichtbar, dass neben der Sorge um das Schicksal der ArbeiterInnen und der Angst vor sozialen Unruhen auch eine handfeste Antifabriksgesetzgebung im Sinne des Kleingewerbes und der Bauern gegen die Konkurrenz des Industriekapitalismus am Werk war.
Zwar gab es bereits vorher Regelungen zur Absicherung von Arbeiter/innen bei Unfällen, sie kamen aber nur einem Teil der Arbeiter/innen und auch diesen in unterschiedlichem Ausmaß zugute und waren nicht ausreichend. So galt etwa die Haftpflicht des Unternehmers nur, wenn diesen ein Verschulden traf. Die von allen Parteien befürwortete Lösung bestand in der zwangsweisen Einführung der Kranken- und Unfallversicherung für alle Arbeitnehmer/innen, die von beiden Seiten finanziert werden sollte, ohne jeden staatlichen Zuschuss auszukommen hatte und in von Arbeitnehmern und Unternehmern selbst verwalteten Versicherungsanstalten organisiert werden sollte.
In dem 1887 verabschiedeten Gesetz wurde mit dem Argument der geringeren Unfallgefahr und der ökonomischen Gefährdung der Betriebe das Kleingewerbe und die Landwirtschaft von der allgemeinen Versicherungspflicht ausgenommen. Den Grund dafür weiß ein Abgeordneter der Opposition nur zu genau, er bestehe darin »dass in der Großindustrie die Arbeiterschaft ihnen kompakt organisiert gegen-übersteht, während die Arbeiterschaft im Kleingewerbe und in der Landwirtschaft mehr versprengt ist, der Organisierung bis jetzt entbehrt und sich in vollständiger Isolierung befindet« (zit.n. ebd.).
In die Frage der Aufteilung der Kosten, insbesondere des Anteiles der Arbeitnehmer gab es erhebliche Meinungsunterschiede. Viele erachteten die durch Arbeitsunfälle entstehenden Kosten als reine Produktionskosten, die zur Gänze von den Unternehmern zu tragen seien. Unter dem Einfluss der Konservativen einigte man sich letztlich auf einen Arbeitnehmeranteil von 10% und eine drittelparitätische Verwaltung der Unfallversicherung durch Unternehmer, Arbeitnehmer und Vertreter des Innenministeriums.
Die Leistungen der Unfallversicherung und deren Begründung spiegeln die herrschenden Ansichten über Arbeit und Arbeiter/innen wieder. Verunfallte erhielten nach 4 Wochen Karenzzeit bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit 60% des Verdienstes, bei teilweiser entsprechend weniger. Witwen und erwerbsunfähige Witwer von Unfalltoten erhielten 20%, eheliche Kinder bis 15 Jahre 15%, uneheliche 10% und Doppelwaisen 20%. Die niedrigen Sätze wurden damit begründet, »dass einerseits der Unterhalt des Getöteten selbst nicht mehr zu bestreiten und andererseits der Unterhalt einer Arbeiterfamilie schon bei Lebzeiten des Familienhauptes in der Regel teilweise durch die Arbeit der Frau und der Kinder beschafft wird« (zit.n. ebd., 64). "Der Festlegung der Leistungen in der Unfallversicherung lag das Bild einer vollerwerbstätigen Arbeiterfamilie zugrunde, d.h. die Vorstellung. dass die Reproduktion der Arbeiterfamilie durch alle Familienmitglieder getragen wurde" (ebd.).
Erst mit der Einführung der Zwangsversicherung wurde das enorme Ausmaß der Arbeitsunfälle sichtbar, die von 1890 bis 1897 von 16.041 auf 69.283 pro 10.000 Vollarbeiter anstiegen, also von 16 auf nahezu 70%.
Das Gesetz zur allgemeinen Krankenversicherung trat 1888 in Kraft. Zwar gab es zur Absicherung bei Krankheit in Form von Fabrikskassen, Genossenschaftskassen und Vereinskassen bereits umfangreichere Vorkehrungen als bei Unfällen. "Um jedoch die vorhandenen Lücken auszufüllen und zukünftigen vorzubeugen", erachtete es der Staat als seine Aufgabe, "im sozialen Getriebe den Mangel an Können oder Wollen nötigenfalls durch Zwang zu supplieren und zum Krankenversicherungszwang zu greifen" (zit.n. ebd., 65). Ausgenommen werden diesmal nur die Land- und Forstarbeiter, für sie gilt die freiwillige Beitrittsmöglichkeit.
Die Leistungen der Krankenversicherung bestehen in der kostenlosen ärztlichen Versorgung; 60% des üblichen Lohnes ab 3 Tagen bis zu 20 Wochen; 20 übliche Taglöhne an Beerdigungskostenbeitrag an die Hinterbliebenen im Todesfall. Die bisherigen Betriebs- und Genossenschaftskassen sowie die von Arbeitervereinen gegründeten Freien Hilfs- oder Vereinskassen sowie die Bruderläden der Bergarbeiter blieben bestehen und wurden den neuen Bestimmungen angepasst. Neu eingerichtet wurden die Bezirkskassen, die alle bisher noch nicht anderweitig Versicherten aufnahmen, und die Baukrankenkassen für Straßen-, Eisenbahn-, Kanal-, Strom- und Dammbauten.
Mit Ausnahme der Vereinskassen, die zur Gänze von Arbeitern verwaltet wurden, wurden die Kranken-kassen zu zwei Drittel von Arbeiter- und zu einem Drittel von Unternehmervertretern verwaltet. Die Bei-träge wurden zu zwei Dritteln von den Arbeitnehmern und zu einem von den Unternehmern aufgebracht.
Die Jahre zwischen 1890 und 1918 sind nach Emmerich Tálos von "Stagnation, Reduktion und marginalem Ausbau der Sozialpolitik" gekennzeichnet (ebd., 94). In diesem Zeitraum wurden lediglich gering-fügige Korrekturen an den bestehenden Regelungen vorgenommen: Der Arbeiterschutz wurde auf bisher nicht erfasste Gruppen ausgedehnt, die Sonn- und Feiertagsbestimmungen verbessert, eine 6-, später 4-stündige Stundenbeschränkung der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe verfügt und die Arbeitszeit für Grubenarbeiter auf 9 Stunden pro Schicht reduziert. In endlosen Verhandlungen wurden die Ladenschlusszeiten im Handel auf 8 Uhr abends festgesetzt und der Urlaub für Handelsgehilfen mit 10 Tagen bis 3 Wochen je nach Dienstdauer. 1906 wurde aufgrund internationaler Vereinbarungen endlich das Nachtarbeitsverbot für Frauen in industriellen Betrieben verfügt. Die Reichweite von Unfall und Krankenversicherung wurde ausgedehnt. Die einzige sozialpolitische Neuerung ist das 1906 beschlossene Pensionsgesetz für Privatbeamte, durch das erstmalig eine Altersrente gesetzlich verankert wurde. Das Gesetz privilegiert allerdings die Angestellten gegenüber den Arbeiter/innen privilegierte und spaltet die Arbeiterschaft, ein bis heute nicht zur Gänze gelöstes Problem.
In dem Maße als staatliche Versicherungen soziale Risiken abgesichereten begann sich die immer noch kommunal organisierte Armenfürsorge noch weiter als bisher zurück zu ziehen. "Bevor die kommunale Armenfürsorge als Nothilfe zum Einsatz kam, waren zumeist familial-freundschaftliche Netzwerke oder gar private Wohltätigkeit und ihre Einrichtungen im Spiel, dann erst kames zur Abklärung, ob etwaige Sozialversicherungsansprüche bestanden" (Melint 2003, 140).
Ursprung der österreichischen Sozialpolitik ist demnach weder die offensive Übernahme der Forderun-gen der Notleidenden durch den Staat noch die revolutionäre Durchsetzung dieser Forderungen gegen den Staat, sondern dessen taktische Nachgiebigkeit zur Verhinderung einer solchen Revolution. Die Auswirkungen dieser Paradigmatik staatlicher Sozialpolitik in der Phase ihrer Entstehung sind bis heute sowohl in der "maßvollen" Zurückhaltung der Gewerkschaften bei Streiks und Lohnabschlüssen und in dem großen politischen Einfluss der "Sozialpartnerschaft" erkennbar als auch in den politischen Krisen, die dann entstehen, wenn - wie etwa in den Auseinandersetzungen um eine Pensionsreform der Mitte-Rechts-Regierung[115] - staatliche Sozialpolitik die Abstimmung mit den organisierten Vertretungen der betroffenen Bevölkerungsschichten, insbesondere den Gewerkschaften, aufkündigt.
Ein weiteres bis heute dominierendes Prinzip österreichischer Sozialpolitik wird bereits in diesen Anfängen erkennbar. Die in Österreich mit kurzen Ausnahmen regierenden oder zumindest einflussreich mit-regierenden christlich-bürgerlich-Konservativen binden soziale Reformen für die »geringen Klassen« stets an Zugeständnisse für die mittleren und oberen. So handelte bereits Taaffe: Die »mannigfachen Schranken gegen die Überanstrengung der Arbeiter«, bildeten, wie es ein Abgeordneter ausdrückte, erst »den dritten und hoffentlich nicht letzten Schritt« der Sozialreformen (zit.n. ebd., 43). Zuerst wurde durch die Senkung der Zensusgrenze von 10 auf 5 Gulden das Wahlrecht für das Kleinbürgertum er-leichtert, durch eine Schulgesetznovelle die Schulpflicht reduziert - auch das im Interesse des Kleingewerbes und der Kinder beschäftigenden Industrie -, durch die Einschränkung der Gewerbefreiheit die Konkurrenz verringert und die bäuerliche Erbfolge wieder ermöglicht: alles Maßnahmen, die dem Mittel-stand zugute kamen. Maßnahmen zugunsten der Bedürftigen sind nur dann mehrheitsfähig, wenn sie auch den Begüterteren Vorteile bringen, wie etwa in der Ende der 1990er Jahre geführten Kontroverse "Karenzgeld für alle, die es brauchen" oder "Kindergeld für alle", oder in der Schonung bestimmter Gruppen (Bauern, Beamte) sichtbar wird.
Die konkrete Erfahrung der Hilfsbedürftigkeit erweist sich als not¬wendiges und zugleich widerständiges Motiv gegenüber abstrakten staatlichen Kalkulationen der Beschränkung des Einsatzes öffentlicher Mittel samt deren sozialphilosophischen Begrün¬dungen. Die staatlichen Behörden vertreten nach wie vor einen extrem restriktiven Ansatz:
Im Mai 1880 traf man sich auf der Jahrestagung der »Gesellschaft für die Verbreitung von Volksbildung«, wo man beschloss, für den Herbst eine Versammlung deutscher Armenpfleger nach Berlin einzuberufen [...] Der Berliner Staatssekretär A. Emminghaus [...] stellte fest, dass die Staatsgewalt - obwohl nach liberalistischen Prinzipien dazu weder befugt noch verpflichtet - gegenwärtig noch gezwungen ist, sich des Armenwesens anzunehmen. Diese Aufgabe hat sie jedoch nicht so sehr der Armen wegen, sondern um der Gesamtheit willen wahrzunehmen. Oberster Grundsatz ist deshalb die Vermeidung jedes Unterstützungsanspruchs; dem Bedürftigen darf kein einklagbares Recht auf Hilfe zugestanden werden. Dies hätte notwendig die allgemeine Einführung von Armensteuern zur Konsequenz. Vor allem für vorübergehende Unterstützungen müssten die Mittel ausschließlich aus freiwilligen Spenden aufgebracht werden. Der Staat und die kommunalen Organe müssen sich darauf beschränken »diejenigen Hülflosen [...], die einer individualisierenden Armenpflege nicht bedürfen« - sprich: bei denen Hilfe zur Selbsthilfe aussichtslos ist - in Anstalten unterzubringen; dafür können auch Steuermittel eingesetzt werden. Im übrigen hat der Staat durch die Strafgesetze »Mittel zur gewaltsamen Unterdrückung des Bettels« zur Verfügung zu stellen. »Mit arbeitsfähigen Armen hat sich das Armengesetz nicht zu befassen.« Wer nicht der Polizei auffällt, mag sich von der freiwilligen Fürsorge unterstützen lassen. Doch auch hier muss der Staat dafür sorgen, »dass die Würdigkeit und Dürftigkeit von Fall zu Fall genau und gewissenhaft untersucht, und mit größter Gewissenhaftigkeit in der Wahl des für jeden einzelnen Fall geeignetsten Mittels verfahren werde.« Es sollte sichergestellt werden, dass jeder arbeitsfähige Hilfsbedürftige nur in dem Maße und nur so lange unterstützt wurde, wie es notwendig war, um ihn wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Es müsste auf jeden Fall verhindert werden, dass er in seinen Bemühungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, nachließ, weil ihm etwa »das öffentlich dargereichte Brod [...] süßer schmecke, als das selbsterworbene« (zit.n. Landwehr/Baron 1983, 29).
Die geforderte Unterscheidung zwischen tatsächlicher und bloß vorgegebener Bedürftigkeit war aber unter den Bedingungen der herrschenden Massenarmut kaum möglich. Je restriktiver sich die staatliche Armenpolitik gebärdete, desto dringender wurde nach wie vor die außerstaatliche Armenfürsorge nach-gefragt.
Gerade darin aber sahen die Gründer des Deutschen Vereins[116] das Problem. Wie sollte man in dieser Zeit der Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit den Überblick bewahren und die Einhaltung dieser Prinzipien überwachen, von denen die Sicherung des erreichten Standes der Arbeitserziehung der Lohnabhängigen und damit die Chancen für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg abhingen? Die Erwerbslosen, die auf der Suche nach einem neuen Auskommen die Städte überfluteten, hüteten sich in der Regel, die Unterstützung der öffentlichen Armenbehörden nachzufragen. Das Freizügigkeitsgesetz erlaubte es auch dem Mittellosen, sich an jedem Ort des Deutschen Reiches aufzuhalten, so lange er nicht durch Betteln oder andere strafbare Handlungen auffiel. Gerade dazu aber boten die kirchliche Wohltätigkeit und die privaten Vereine, die allerorten wie Pilze aus dem Boden schossen, reichlich Gelegenheit. Die Bürger sahen sich angesichts der offensichtlich von Tag zu Tag schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage und der damit zunehmenden Bedrohung gezwungen, zur Unterstützung der Notleidenden etwas zu tun, die sich nicht dazu durchringen konnten, die öffentliche Zwangsarmenpflege in Anspruch zu nehmen - sei es aus empfindlichem Ehrgefühl, sei es, weil sie Polizeimaßnahmen und Rückverweisung an den Herkunftsort fürchteten. In der Stadt Dresden wurden Mitte der achtziger Jahre 200, in Hannover 300 Wohltätigkeitsvereine gezählt; eine Aufstellung für Berlin weist 1896 über 1000 private Einrichtungen auf, die meist auf sehr spezifischen Gebieten tätig waren (ebd.).
Der öffentlichen Armenfürsorge, in Preußen seit 1842 gesetzliche Verpflichtung des Staates, steht weiterhin eine große Zahl von Initiativen und Einrichtungen der »freien Liebesthätigkeit« gegenüber und deren Träger sind nach alter Tradition noch immer hauptsächlich die Kirchen, allen voran die katholische. Namentlich Frauenorden gründen und betreuen "Waisen- und Armenhäuser, Zufluchtsstätten und zahlreiche Schulen und Erziehungsanstalten" und leisten damit "einen wesentlichen Beitrag zur Betreuung in Not Geratener" (Hering/Münchmeier 2000, 33). Neben den Kirchen sind es vor allem die Frauen, die sich der privaten Armenfürsorge annehmen, der 1849 gegründete freisinnige »Frauenverein zur Unterstützung der Armenpflege" etwa und sein konservatives Gegenstück, der »Vaterländische Frauen-verein«, gegründet 1866. In den katholischen Frauenorden und in den emanzipatorischen Frauenvereinen entstehen auch die ersten Ansätze zur Professionalisierung der sozialen Arbeit: Ausbildungsgänge für Armen- und Krankenpflegerinnen und Kindergärtnerinnen. Vielfach sind diese Initiativen von heraus-ragenden Einzelpersönlichkeiten getragen, deren Engagement von, »genialer Güte« bewegt war, wie die Zeitgenossen es formulieren, und die eine bedeutende Rone für die Entwicklung der sozialen Arbeit spielen.
Gegen die Privatwohltätigkeit wurde jedoch lauter als jemals zuvor der Vorwurf erhoben, »den Bettel großzuziehen« statt ihn einzudämmen und zu bekämpfen; wütende Reaktionen besonders von kirchlicher Seite waren die Folge. Nicht die steigende Not der durch die Wirtschaftskrise auf die Straße geworfenen Lohnabhängigen rief nämlich die Elite der deutschen Gemeindeverwaltungen auf den Plan, sondern die Bemühungen der Bürger, diese Not zu lindern. Nicht der Mangel an Mitteln, die Hilflosen zu versorgen, war das Problem, sondern die Gefahr, dass zu viel getan werden könnte. »Zu viele Helfer und zu wenig Ordnung in der Hülfe! [...] Die Grundbedingung alles staatlichen Lebens ist zunächst die Arbeit für die Selbsterhaltung. Erst da, wo diese nicht ausreicht oder nicht mehr möglich ist, beginnt die Pflicht der werktätigen Nächstenliebe, beginnt die Hülfsbedürftigkeit. Jede unzeitige Gabe ist ein Unrecht, begangen an dem Einzelnen, der sie empfängt, und an der Gesellschaft, deren Ordnung sie stört«.
Die Unterordnung der Wohltätigkeit unter ökonomische Prinzipien, die man bisher wie in Elberfeld durch örtliche Maßnahmen zu erreichen versucht hatte, war nun zu einem allgemeinen Problem geworden. Die Frage, wie dem Wohltätigkeitssinn der Bürger die erforderlichen Zügel angelegt werden können, ist die Gründungsidee des Deutschen Vereins. Darin liegt zugleich der Widerspruch beschlossen zwischen dem unabdingbaren sozialen Engagement der Bürger einerseits und der Erfüllung der von nüchternen ökonomischen Erwägungen geprägten gesellschaftlichen Funktion der sozialen Arbeit andererseits, der bis heute seine Aktualität nicht verloren hat. (ebd., 30).
Der Zugang der kirchlichen Armenfürsorge bleibt dagegen die tätig ausgeübte christliche Nächstenliebe, weshalb die katholische Kirche lange Zeit die Zusammenarbeit mit der staatlich organisierten Wohlfahrtspflege ablehnt. Die Auffassungsunterschiede zwischen religiös motivierter kirchlicher Hilfsmoral und ökonomisch kalkulierter öffentlicher Armenpflege waren zu groß.
Die Auseinandersetzungen drehten sich vor allem um die Stellung der kirchlichen Armenpflege. Man konnte sich mit der Behandlung des Problems durch die Kirchengemeinden deshalb nicht zufrieden geben, weil diese zur Ausmerzung der Unterstützungswillkür christlicher Nächstenliebe nicht fähig waren. Die seit Errichtung der städtischen Selbstverwaltung tonangebenden Fabrikanten forderten im Sinne wirtschaftsliberalistischer Grundsätze die Unterordnung der Liebestätigkeit unter ökonomische Prinzipien. In Zeiten der Massenarbeitslosigkeit wurde immer wieder darüber geklagt, dass trotz wachsender Almoseneinnahmen das Bettlerunwesen auf den Straßen größer statt geringer wurde. Es breitete sich die Auffassung aus, dass religiös motiviertes Helfen um des Helfens willen die Armut eher groß zog als sie zu beseitigen. Schließlich wurde den Kirchen die Befugnis des Almosengebens genommen. Sie wurden auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben der geschlossenen Armenpflege beschränkt; nur zu diesem Zweck durften sie ihre Almoseneinnahmen behalten (ebd., 24).
Erst mit dem 1897 in Freiburg gegründeten »Caritas-Verband« schafft die Kirche "eine in das Gesamtspektrum der sozialen Einrichtungen integrierte Wohlfahrtsorganisation" (Hering/ Münchmeier, 33).
Anders die evangelische Kirche. Sie "ist im Gegensatz zur katholischen Kirche grundsätzlich bereit, mit den kommunalen Stellen zusammenzuarbeiten und versucht schon frühzeitig, mit diesen eine sinnvolle Arbeitsteilung zu vereinbaren" (Hering/Münchmeier 2000, 33). Waisenheime, Wöchnerinnen-Asyle, die süddeutsche Rettungshausbewegung oder das berühmte Rauhe Haus[117] in Hamburg gehören ebenso zu dieser Arbeit wie die Diakonissen- und Bruderhäuser, die sich vor allem der Krankenpflege widmen und die Innere Mission, die "in Reaktion auf die Revolutionsereignisse von 1848 ins Leben gerufen wird: Gegen die ‚verderblichen Tendenzen' des Kommunismus und bürgerlichen Atheismus soll die innere Mission zu einer christlichen Selbstbesinnung und zur Koordination der zerstreuten Aktivitäten der christlichen Liebestätigkeit führen" (Hering/Münchmeier 2000, 34).

Bild: Das "Rauhe Haus"
Einen massiven Einschnitt stellen die Kriegsjahre und die dem Krieg folgenden Jahre dar. He-ring/Münchmeier betrachten es als Fortschritt, dass das enorme Ausmaß der Not dieser Zeit auch das Ausmaß der sozialen Fürsorge gesteigert hat. "Auch wenn der erste Weltkrieg in Deutschland zur Niederlage geführt hat, so ist doch zumindest die Wohlfahrtspflege zu den Gewinnern zu zählen" (He-ring/Münchmeier 2000, 86, vgl. auch Hering 1990). Auch wenn zutrifft, dass das Ausmaß und die Notwendigkeit sozialer Arbeit durch die unvorstellbare Desolation und Not, die der Krieg mit sich brachte, intensiviert wurden, erscheint es doch problematisch, diese Tatsache als "Gewinn" zu bezeichnen. 800.000 Zivilisten sind, wie die Autoren selbst berichten, in diesem Krieg allein in Deutschland gestorben, "vor allem Frauen und Kinder" (ebd., 81).
Auch das Ausmaß der Verarmung der Menschen ist enorm. "Obwohl sich das Kriegsgeschehen weitgehend außerhalb der Landesgrenzen abspielt, wird die gesamte Bevölkerung, vor allem durch den eklatanten Mangel an Nahrungsmitteln und Brennmaterial, in Mitleidenschaft gezogen" (ebd.). Aufgrund der Stilllegung ganzer Industriezweige wie der Textilindustrie verschärft sich nach Kriegsausbruch die Arbeitslosigkeit, auch hier sind wieder besonders die Frauen betroffen. "Frauenarbeit in allen Schichten ist entbehrlich geworden. Und wo sollen Arbeitsplätze für diese Tausenden entstehen?", schreibt Gertud Bäumer[118] 1930, zit.n. ebd.). Vollbeschäftigung entsteht erst wieder, nachdem die Kriegsindustrie und die Munitionsfabriken angelaufen sind. Damit entstehen allerdings neue Probleme. Die Belastung der Arbeiterinnen in den Fabriken und das dadurch verursachte Betreuungsdefizit der Kinder ist so groß, dass ein eigenes Fürsorgewesen für Arbeiterinnen geschaffen werden muss, das sich um Kinder, Jugendliche und die Frauen selbst kümmert (ebd. 89).
Der Kriegssold, den die Männer bzw. das Kriegswitwengeld, das die Frauen erhalten, ist in vielen Fällen selbst bei den Begüterten zu gering, um Personal oder Mieten zu bezahlen, und bei den ärmeren, um eine Familie zu erhalten. Es entsteht ein Teufelskreis zwischen steigendem Wohnungsbedarf und steigenden Wohnungspreisen, steigender Arbeitslosigkeit und sinkenden Einkommen. »Die Familie, der Vater im Felde, die Mutter vielfach auf Erwerbsarbeit oder von all den Mühen und Umständlichkeiten der »Bezugsscheine« belastet, verlor vielfach ihre bergende Kraft« (Bäumer 1833, zit.n. ebd., 83). "Die Kohlrübe ist das Ernährungssymbol auch des vierten Kriegswinters 1917/18. Kriegskochbücher werden propagiert "um selbst noch aus Kohlrüben schmackhafte Speisen zu zaubern" (ebd., 82) und Volksküchen werden eingerichtet. Erbitterter Widerstandswille, Hunger und Kälte in Deutschland führen zu Beginn des neuen Jahres zu Massenstreiks, an denen sich im Laufe des Frühjahres 1,5 Millionen Arbeite-rinnen und Arbeiter beteiligen" (ebd., 80). Rathäuser werden gestürmt und Lebensmittelläden geplündert. "Der Zorn der Frauen richtete sich sowohl gegen die ineffiziente und ungenügende staatlich-kommunale Rationalisierungspraxis, als auch gegen die Ladeninhaber, die ihre Ware immer häufiger unter der Hand zu exorbitanten Preisen verkauften" (Frevert 1986, zit.n. ebd., 80). Hamsterkäufe jener, die noch Geld haben, bewirken eine zusätzliche Verteuerung der Lebensmittel

Foto: Kriegsküche im 1. Weltkrieg
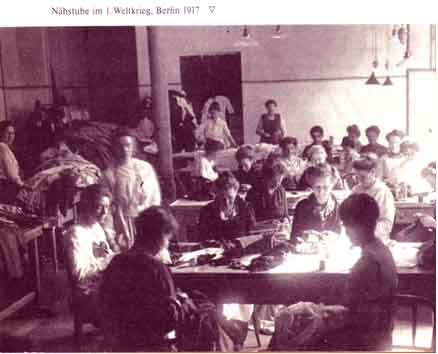
Foto: Nähstube im 1. Weltkrieg

Foto: Hungernde vor einer Armenküche in Berlin, 1922
Von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung der sozialen Arbeit ist die Fürsorge für Angehörige von Militärpersonen, Kriegerwitwen und Kriegswaisen. Mit ihnen entsteht zum ersten Mal in der Geschichte der Armut eine soziale Gruppe, der gegenüber das wohlfeile Argument der "selbstverschuldeten Armut" nicht verwendet werden kann, weil es ja die staatliche Politik selbst ist, durch die sie in ihre Lage gekommen sind: »Die spezifischen Umstände des Krieges erlauben es, die Schuldfrage bei dem Zustandekommen sozialer Not einer neuen Sichtweise zu unterziehen« (Bäumer 1916, 5, zit.n. He-ring/Münchmeier 2000, 87). Auf diese Weise bahnt sich ein Paradigmenwechsel der Ideologie der Für-sorge von epochaler Bedeutung an. »Das Soziale ist selbstverständlich geworden wie das Nationale«, schreibt Gertrud Bäumer unmittelbar nach dem Krieg. »Nicht mehr Zugeständnis an die Benachteiligten, sondern die Selbsterhaltung der Gemeinschaft« (Bäumer ebd., zit.n. ebd., 86).
Da die aufgrund des Krieges Notleidenden einen Rechtsanspruch auf staatliche Hilfeleistung haben, "fällt die zuvor mit der Fürsorgeunterstützung verbundene Diskriminierung weg. Not ist zum Menschen-schicksal geworden - und Fürsorge zum »Dienst am Volksganzen«" (ebd., 87). "Die extreme Zunahme der Problemfälle von Kriegsbeginn an erfordert deren maximale Differenzierung - und gleichzeitig geeignete Maßnahmen zur Vereinheitlichung der von Zersplitterung gekennzeichneten Angebotsvielfalt. Immerhin: Die Frage, ob fürsorgerische Tätigkeit einer qualifizierten Ausbildung bedarf, wird von keiner Seite mehr gestellt; Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Hilfskräften ist so groß, dass die zahlreich gegründeten Sozialen Frauenschulen kaum mit der Ausbildung nachkommen" (ebd., 86 f.).
Auch in diesem Entwicklungsprozess sind wiederum die Frauen führend. Der 1914 gegründete Nationale Frauendienst forciert zugleich fachlich professionelle Sozialarbeit und die Gleichberechtigung von Frauen: Sozialarbeit von Frauen soll unter weiblicher Führung erfolgen, "das Prinzip einer weiblichen Basis unter männlicher Führung wird abgelehnt" (ebd., 88), und soziale Arbeit soll, so weit wie möglich, bezahlte Arbeit sein. Die Zusammenarbeit des nationalen Frauendienstes mit den neuen städtischen und staatlichen zentralen Fürsorgebehörden, der Kriegsfürsorge und ab 1916 dem Kriegsamt bleibt freilich konflikthaft. Nicht überall dürfen die Frauen an den Beratungen der Behörden teilnehmen und durch die Heeresleitung wird der Spielraum der Wohlfahrtsverbände insgesamt stark eingeengt.
Was die Hoffnung auf eine Ausweitung des Rechts auf Fürsorge über den vom Krieg betroffenen Personenkreis hinaus betraf, waren die Hoffnungen von Gertrud Bäumler freilich übertrieben. Bis dahin sollten es noch einige Jahrzehnte vergehen.
Noch während des Krieges waren Jugendämter eingerichtet (1916) und eigene Ministerien mit sozialen Aufgaben geschaffen worden: das Ministerium für soziale Fürsorge (1917) und das Ministerium für Volksgesundheit (1918). Nach dem ersten Krieg und dem Ende der Monarchie kam es unter wechseln-den politischen Bedingungen zu einem wachsenden Ausbau der Sozialgesetzgebung. Bereits 1918 kam der 8-Stundentag für die Fabriken, durch dessen Einführung die große Arbeitslosigkeit nach dem Krieg gelindert werden sollte. Für den sozialdemokratischen Staatssekretär für Soziale Fürsorge in Wien, Ferdinand Hanusch[119] wird die hohe Arbeitslosigkeit, ganz im Sinn der auch gegenwärtig laufenden Diskussionen, zum Argument für Arbeitszeitverkürzung:
Es geht nicht an, dass auf der einen Seite zehntausende Menschen länger als acht Stunden, zehn und elf Stunden arbeiten, während andererseits viele zehntausende Menschen vollständig arbeitslos sind und nicht den nötigen Erwerb zu finden vermögen. Diese achtstündige Arbeitszeit ist in diesem Fall keine prinzipielle Frage, sondern sie ist nur eine Notstandsmaßregel und wird natürlich auch nur als ein solche betrachtet werden können (zit.n. ebd., 186).
Die "Notstandsmaßregel" wurde 1919 auf alle Betriebe ausgedehnt und ist seitdem erhalten geblieben.
Mit dem Betriebsrätegesetz, das Betriebsräte in fabriksmäßigen Einrichtungen mit über 20 Beschäftigten und Vertrauensleute in allen übrigen Betrieben über 5 Beschäftigten vorsah, wurde erstmals die innerbetriebliche Interessensvertretung auf eine gesetzliche Basis gestellt.
Kinder- und Frauenarbeit wurden weiter beschränkt, die Krankenversicherung auf alle Beschäftigten ausgedehnt und die Leistungen im Pensionsgesetz der Angestellten erhöht. 1920 wird die gesetzliche Arbeitslosenversicherung eingeführt, 1927 wird nach langen Verhandlungen endlich auch ein Arbeiter-versicherungsgesetz erlassen, das Kranken-, Unfall- Alters- und Invaliditätsversicherung umfasst. Die Alters- und Invalidenversicherung bleibt allerdings bloß eine provisorische Fürsorgemaßnahme ohne wirkliche Realisierung.
Die allgemeine Fürsorge bleibt auch nach dem Ende der Monarchie in der Zuständigkeit der Länder und Kommunen. Die Länder führen die Armengesetzgebung aus der Monarchie weiter oder erlassen neue Armengesetze. Grundprinzip bleibt das Heimatrecht, das mögliche Unterstützung an die aufrechte Staatsbürgerschaft, einen Rechtsanspruch gab es nach wie vor nicht: "Arme konnten auch traditionsgemäß keine bestimmte Art der Unterstützung verlangen, und erst recht konnte man kein unbedingtes Recht auf laufende Unterstützung einfordern" (Melinz 2003, 144).
Mit der Weltwirtschaftskrise wuchs das Armutsproblem in enormem Maße an. Gleichzeitig wurde mit der Auflösung des Parlaments durch Engelbert Dollfuß im März 1933 und dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der freien Gewerkschaften im Februar 1934 die entscheidende Triebfeder der sozialen Errungenschaften, die Arbeiterbewegung, ausgeschaltet. Die Betriebsräte wurden abgeschafft, die Selbständigkeit der Interessensvertretungen der Arbeiterschaft wurden durch staatlich verordnete Werksgemeinschaften, Einigungsämter, Vertrauensleute und Personalvertretungen stark eingeschränkt, da »betriebsparlamentarische, aus dem Klassengeiste geschaffene Einrichtungen« mit »dem Wesen autoritärer Staatsführung« nicht "»gut vereinbar« seien" (Richard Schmitz,[120] zit.n. Tálos 1981, 260). Streiks wurden verboten.
Die Regierung wurde nicht müde, die Aufrechterhaltung der - freilich von den "parteipolitischen Übertreibungen" gereinigten - sozialen Errungenschaften zu betonen. Eine "Politik der Sachlichkeit" sollte anstelle "parteipolitischer Demagogie" Platz greifen (ebd., 259), worunter vor allem die Sozialdemokraten verstanden wurden. Sachlichkeit hieß vor allem Kürzung der Sozialleistungen und Sozialabbau. Mit dem neuen Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz von 1935 sollte die Sanierung der Sozialversicherung vorangetrieben werden. Nicht zu unrecht weist Melinz in einer Fußnote darauf hin, dass "inhaltliche wie auch akteursbezogene Analogien zu den jüngsten ‚Reformen' im Sozialversicherungsbereich, der bereits vorgenommen und wie auch der geplanten in ganz frappanter Weise auf der Hand liegen" (ebd., 147, Anm. 60). Diese Politik "erzeugte in den 1930er Jahren jene Massennotstände, die immer mehr Menschen zwangsmobilisierte[n] Während die einen ‚auf die Walz' gingen versuchten die anderen, durch Betteln ihr eigenes Überleben sowie das ihrer Kinder und Familien zu sichern." Der Staat reagierte autoritär: "In dieser Situation packte ‚Ständestaat' die alten Rezepte wieder aus, armenpolizeiliche Disziplinierungsstrategien kamen wieder voll zum Tragen" (ebd., 148). Wieder einmal richtete sich die Ordnungsmacht gegen die "Bettlerplage" in Stadt und Land. In der Gemeinde Schlögen in Oberösterreich wurde sogar ein Arbeits(haft)lager errichtet. Insgesamt erinnert die Situation in bemerkenswerter Weise an die gegenwärtige, einschließlich der in mehreren Ländern und Städten (Wien, Graz, Salzburg) verhängten Bettelverbote.
Das Bettelverbot, das vor einer Woche in der Steiermark beschlossen wurde, verbietet Betteln generell - mit der höchsten Geldstrafe: 2000 Euro. Gemeinden können aber Bettelzonen ausrufen. In Wien wird seit 2010 nur gewerbsmäßiges Betteln mit 700 Euro bestraft. Aggressives Betteln und Betteln Minderjähriger waren in Wien und Graz bereits verboten. Niederösterreich verbietet gewerbsmäßiges Betteln, Betteln von Tür zu Tür und Betteln mit Minderjährigen seit Dezember. In Vorarlberg herrscht generelles Bettelverbot, Notleidende dürfen aber um Ausnahmen ansuchen. In Kärnten wird diese Woche ein Gesetz gegen aggressives, gewerbsmäßiges und Betteln von Kindern verboten, in Oberösterreich werden noch Details verhandelt. Im Burgenland ist nur in Eisenstadt "aufdringliches" Betteln und Betteln mit Kindern, bei Strafen von bis zu 1100 Euro untersagt. In Tirol ist seit 1976 aggressives Betteln und in Salzburg seit 2009 generell Betteln verboten. Gegen Salzburg und Wien liegen Klagen beim Verfassungsgerichtshof.[121] (DER STANDARD, 22.2.2011)
Wie nahe selbst jüngste Maßnahmen an die klassische Disziplinierungspolitik heran reichen, lässt sich z.B. an der Straßenverkehrsordnung in Graz ablesen. Dort ist, um gegen Obdachlose und Bettler/innensicherheitspolizeilich vorgehen zu können, die Verhängung einer Geldstrafe wegen "unbegründetem Stehenbleiben" auf dem Gehsteig vorgesehen (Straßenverkehrsordnung, & 78, zit.n. Melinz 2003, 158).
Sozialleistungen werden zur abhängigen Variable der Wirtschaftsleistung erklärt, ohne dass gesagt wird, welchen Anteil am erwirtschafteten Bruttosozialprodukt sie beanspruchen dürfen »Sozialpolitik ist ein Teil der Wirtschaft, sie steht nicht vor der Wirtschaft, sie ist nur auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse auch in ihrem Ausmaß bestimmt« schreibt 1934 der Nationalökonom Josef Dobretsberger (zit.n. ebd., 260). Sozialpolitik findet eine neue, der wirtschaftlichen Sachlichkeit angemessene Begrün-dung: Ihre Aufgabe wird darin gesehen, dass sie "zu einem großen Teile die durch Wechselfälle des Lebens in Frage gestellte Konsumkraft der Versicherten erhält" (Franz Spalowski 1934, zit.n. ebd., 261). Auch dies eine Begründung, die - inzwischen von allen politischen Lagern - in den gegenwärtigen Debatten immer wieder zu hören ist. "Der sozialen Dauerkrise konnte der ‚Ständestaat' mit seinen wohlfahrtspolitischen Philosophien und der entsprechenden Praxis nicht beikommen, er trug sogar zur Verschärfung sozialer Existenzbedingungen bei", schreibt Melinz (ebd., 148). Das sollten konservative Politker der Gegenwart bedenken.
[110] Adam Smith, 1723 - 1790, schottischer Moralphilosoph, Begründer der klassischen Nationalökonomie. Hautschrift: Unter-suchungen über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker (1776).
[111] Landwehr/Baron (1983, 18) merken hiezu an: "Bei dieser Rechtsstellung des Hilfebedürftigen, die ihn in der Rolle des Almosenempfängers belässt, ist es formaljuridisch bis zum BSHG von 1962 geblieben."
[112] Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönausen, 1815 - 1898. 1862 - 1890 Ministerpräsident von Preußen, 1871 - 1890 Reichskanzler des Deutschen Reiches.
[113] Friedrich Ferdinand Graf von Beust, 1809 - 1886. 1866 - 1871 österreich-ungarischer Außenminister und zeitweilig auch Reichskanzler
[114] Eduard Graf Taaffee, 1833 - 1895. 1869 - 1893 Innenminister und Ministerpräsident von Österreich
[115] Regierung ÖVP/FPÖ (BZÖ), 1999 - 2008
[116] Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge wurde 1880 gegründet und hat derzeit ca 2.500 Mitglieder Seine Mitglieder sind sämtliche Träger Sozialer Hilfe, sowohl die politischen als auch die praktischen Institutionen, Ausbildungseinrichtungen etc. Er sieht seine Aufgabe in der Förderung Sozialer Arbeit.
[117] In das vom Begründer der Inneren Mission, Johann H. Wichern (1808 - 1881) Ruge Hus (eigentlich: Rotes Haus), eine Bauernkate in der Umgebung Hamburgs, wurden straffällige oder verwahrloste Kinder- und Jugendliche aufgenommen. Die 1833 gegründete Stiftung Rauhes Haus besteht noch. Gegenwärtig erbringt sie im Raum Hamburg soziale Leistungen in unterschiedlichsten Lebensbereichen und fördert die Lebensqualität in Hamburg. Mit ihren rund 1.000 Mitarbeitern bietet sie Betreuung und Bildung für mehr als 3.000 Menschen an 100 Standorten. Neben Sozialpsychíatrie und Altenhilfe sowie Behindertenhilfe stellt das Rauhe Haus Bildungsangebote von der Grundschule bis zu Studium und Beruf bereit.
[118] Gertrud Bäumer, 1873 - 1954, deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin, Lehrerin, Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine (1910 - 1919); Aufbau des Nationalen Frauendienstes; Leiterin des Sozialpädagogischen Institutes, einer höheren Fachschule für Wohlfahrtspflegerinnen; Redakteurin der Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung Die Frau; Reichtagsabgeordnete der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (1920 - 1932); Ministerialrätin für Jugendwohlfahrt und Schulwesen (1920); Delegierte zum Völkerbund in Genf (1933). 1933 von den Nationalsozialisten ihrer Ämter enthoben; In der Nachkriegszeit an der Gründung der CSU beteiligt. Schriften (Auswahl): 1901: Handbuch der Frauenbewegung; Frauenbewegung und Sexualethik; 1936: Adelheid - Mutter der Königreiche (Roman über die Ehefrau Otto I., Kaiserin im 10. Jh.).
[119] Ferdinand Hanusch, 1866 - 1923. Österreichischer Sozialdemokrat und Abgeordneter zum Reichsrat, Gründer der Arbeiterkammer.
[120] Richard Schmitz, 1885 - 1954. 1933/34 Christlichsozialer Sozialminister, 1934 - 38 Bürgermeister von Wien.
[121] In einer jüngsten Entscheidung hat sich der Verfassungsgerichtshof gegen landesweite Bettelverbote ausgesprochen.
Inhaltsverzeichnis
Die gegen Ende des 19. Jh. einsetzende Professionalisierung der sozialen Arbeit wird durch zwei Dynamiken vorangetrieben: das wachsende Ausmaß der sozialen Not einerseits, das durch die ehrenamtliche Mitwirkung in der öffentlichen Armenverwaltung und das private soziale Engagement nicht mehr bewältigt werden kann, und das in der bürgerlichen Frauenbewegung früh erkannte Potential der Sozialarbeit als einer beruflichen Tätigkeit von Frauen, die sie ausüben können, "ohne dabei ihre Weiblichkeit zu verleugnen" (Hering/Münchmeier 2000, 49). Solange "Helfen, Heilen, Tränentrocknen" (ebd.) als Naturbestimmung der Frauen gilt, ist Sozialarbeit neben den traditionellen Frauenberufen der Gouvernante oder der Privatlehrerin eine Berufsperspektive für Frauen, die sich nicht mehr auf Heim und Herd beschränken lassen wollen, vor allem für jene, die unverheiratet bleiben und nach dem bürgerlich-männlichen Zeitgeist "angeblich ihren Daseinszweck grundsätzlich verfehlt haben" (ebd.).
Ehrenamtliche Arbeit bleibt freilich bis zum Ersten Weltkrieg noch der Normalfall. Die ausschließlich von Männern dominierte öffentliche Armenverwaltung leistet nachhaltigen Widerstand gegen die Aufnahme von Frauen. Da werde, wie Robert Wilbrandt[122] 1906 berichtet »von den männlichen Armenpflegern ein energischer Widerstand geleistet und mit Amtsniederlegung gedroht« (zit.n. ebd., 2000, 50). Vielfach schaffen sich die Frauen die entsprechenden sozialen Organisationen und Arbeitsfelder selbst. Sie sind es, die in der freien Wohlfahrtspflege Kranke und Alte pflegen, Kinder betreuen, Hausbesuche machen etc. Darüber hinaus gehen von der Frauenbewegung zahlreiche Neugründungen von Vereinen und Initiativen aus, die neue Felder sozialer Arbeit erschließen, Arbeiterinnenwohnheime etwa oder Asyle für ledige Wöchnerinnen.
Dabei spielen erste Schritte zu einer beruflichen Ausbildung eine entscheidende Rolle. 1874 begründet die Fröbel-Nichte Henriette Schrader-Breymann[123] in Berlin das erste an einen Kindergarten angeschlossene Seminar für Kindergärtnerinnen, dem bald eine Arbeitsschule, ein Hort und eine Hauswirtschaftsschule folgen, in der die »höheren Töchter« zusammen mit den Arbeitermädchen die Haushalts-führung lernen sollen: die einen, weil das bisher das Personal für sie erledigte, die anderen, weil die soziale Not die Führung eines ordentlichen Haushaltes gar nicht zuließ (ebd., 51).
Kenntnisse für soziale Arbeit werden zunächst in Vorträgen und Tagungen, ab 1893 in der Bildung von sogenannten »Gruppen« von Sozialarbeiterinnen als Organisatorinnen und Teilnehmerinnen. Letztendlich werden die Vortragsreihen zu Jahreskursen mit einem feststehenden, verpflichtenden Programm zusammengefasst. Wesentliche Initiatorinnen dieser Programme sind Anette Schwerin[124] und Alice Salomon.[125] Sie haben erkannt, dass "sowohl Berufsstellungen wie ein Berufsstand mit Berufsernst, Berufstreue und Berufstradition erst entstehen würden, sobald Ausbildungsstätten vorhanden seien" (Alice Salomon 1927, zit.n. Hering/Münchmeier 2000, 53). "Einführung in die Armenpflege", "Tätigkeit in Krippen, Kindergärten und Horten", "Erziehungslehre" und "Einführung in die Volkswirtschaft" waren die Fächer des Berliner Jahreskurses, der bald in Hannover nachgeahmt wird.
1908 wird, ebenfalls von Alice Salomon, die erste Sociale Frauenschule eröffnet, nicht zufällig in eben jenem Pestalozzi-Fröbel-Haus, in das bereits die erwähnte Kindergärtnerinnen und Hauswirtschafts-schule umgezogen waren. Die Ausbildung dauert jetzt 2 Jahre und die neue Einrichtung hatte alle Merkmale einer Schule: "Alice Salomon war eine langweilige Lehrerin, fing mit der Dreifelderwirtschaft an und kam, wie das in Deutschland so üblich war, nie bis zur Gegenwart", schreibt Hedwig Wachen-heim, eine der frühen Schülerinnen über die Gründerin der Schule, während sie von anderen Lehrerinnen regelrecht begeistert ist. (zit.n. ebd., 54). Bis 1927 gibt es in Deutschland bereits dreiunddreißig solcher Frauenschulen, davon neun in freier Vereinsträgerschaft, zwölf in evangelischer, fünf in katholischer und sieben in städtischer bzw. staatlicher Trägerschaft .
Mit der wachsenden Zahl der Schulen entstehen jene Probleme, die die Sozialarbeitsausbildung bis heute begleiten. Bereits 1917 bemüht sich Alice Salomon um eine Vereinheitlichung der Lehrpläne und einen allgemeinbildenden Ansatz und scheitert an der Betonung der berufsbezogenen Kenntnisse durch die Schulen und die Ministerien. Andererseits scheitern die Ministerien mit der Forderung nach einem übergeordneten Stellenwert der Gesundheitsfürsorge. Die soziale Arbeit, so die Argumentation der Schulen, dürfe nicht der Oberaufsicht von Medizinern unterstellt werden. Sowohl die schwierige Abstimmung des Verhältnisses von Theorie und Praxis als auch die heikle Abgrenzung gegenüber anderen Institutionen des Sozialbereiches datieren also aus den Anfängen der Professionalisierung der sozialen Arbeit. Die Forderung nach einer eigenständigen Fürsorgewissenschaft wird zwar allenthalben erhoben, in der Praxis der Schulen bildet sich aber eher eine Anwendungswissenschaft heraus, die verschiedene Disziplinen der Individual- und Sozialwissenschaften (Psychiatrie, Hygiene, Volkswirtschaft, Soziologie, Psychologie, Pädagogik) auf die unterschiedlichen Praxiserfordernisse bezieht. Es entstehen unterschiedliche Profile einzelner Schulen mit stärkerer Betonung auf medizinischen, volks- oder hauswirtschaftlichem oder verwaltungstechnischem Schwerpunkt. Die Vereinheitlichung findet weniger durch die Bildung einer gemeinsamen Theoriebasis statt, sondern durch die gemeinsame Orientierung an einem pädagogischen, nahezu pädagogisierenden Prinzip. Die sozialen Verhältnisse sollen nicht durch politische Aktion, sondern durch die Heranbildung einer sozialen Gesinnung bei den individuellen Menschen verändert werden.
Durch den hohen Bedarf an ausgebildeten Sozialarbeiterinnen während und nach dem Ersten Weltkrieges erhalten vermehrt Frauen aus den unteren Schichten Zugang zu den Frauenschulen. Die sozialen Unterschiede werden spürbar. "Auch die führenden Vertreterinnen des nationalen Frauendienstes und die Dozentinnen der Sozialen Frauenschulen sind ein Leben mit Haushälterinnen, Köchinnen und Sekretärinnen gewöhnt, ein Umstand, der vor allem den Schülerinnen, die nicht aus dem Besitzbürgertum stammen [...] auffällt" (ebd., 90). Hatten die einen nur »die schmalen Einkünfte, die nur für eine knappe Ernährung reichten und ein kümmerliches Fenster zum Hinterhof«, so befanden sich »unsere Lehrerinnen und Vorgesetzten, die aus wohlhabenden, teilweise sogar begüterten Familien stammten [...] noch immer auf dem Sockel« (Erika Runge, zit.n. Hering/Kramer 1984, 47). Die Diskrepanz wird bei der Frage der Bezahlung besonders deutlich. Während die finanziell unabhängigen bürgerlichen Gründerinnen der Frauenschulen lediglich für die Abdeckung der Unkosten und für weitgehend ehrenamtliche Arbeit eintreten - vorgeblich, um nicht von der Bürokratie abhängig zu werden, vielleicht aber auch, um den Beruf zur Wahrung des Niveaus den höheren Töchtern vorzubehalten - bestanden die Frauen aus dem Kleinbürgertum und aus der Arbeiterschaft auf einem ausreichenden Lohn.
1916 wird der erste Berufsverband der Sozialarbeiterinnen gegründet. Der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen nahm nur Frauen mit absolvierter Sozialer Frauenschule auf und trat für deren Interessen ein. Auch hier deuten sich bereits Entwicklungen an, die die Berufsvertretung bis heute begleiten: Der eher bürgerlich orientierte Verband grenzt sich von den sozialistischen Gewerkschaften ab, desgleichen ergeben sich Spannungen zwischen den kommunalen Beamtinnen und den Mitarbeiterinnen der freien Träger.
Nach Hering/Münchmeier wurden "in diesen Jahren des ersten Weltkrieges bis hinein in die Anfänge der Weimarer Republik die Strukturen in Ausbildung und Praxis geschaffen, die noch heute das Berufsbild der sozialen Arbeit bestimmen" (ebd., 92). Die historischen Wurzeln der professionellen Sozialarbeit reichen aber zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts: "Aus der Verbindung bürgerlicher Sozialreform und bürgerlicher Frauenbewegung ist auch die moderne, berufliche Sozialarbeit in Deutschland hervorgegangen: aus einer Verknüpfung des eigentümlich konservativen Emanzipationsideals der bürgerlichen Frauenbewegung, der ‚geistigen Mütterlichkeit' mit den vielfältigen Ansätzen des Ausbaus und der Ausdifferenzierung der kommunalen Wohlfahrtspflege" (Schachße 1986, 9).
In Österreich setzt die institutionalisierte Ausbildung zu Sozialarbeitsberufen vergleichsweise spät ein. Die Vereinigten Fachkurse für Volkspflege, 1912 von Ilse Arlt[126] eingerichtet. In rascher Folge werden weitere Schulen eingerichtet:
1915 Fürsorgekurse der deutschen Frauen (Graz)
1916 Social Caritative Frauenschule für Wien und Niederösterreich
1917 Akademie für Soziale Verwaltung der Stadt Wien
1918 Evangelische Soziale Frauenschule
1922-1930 Fürsorgeschule des Landes NÖ (Baden)
1926 Landespflege und -fürsorgeschule Riesenhof (Linz)
Durch die NS-Zeit und den zweiten Weltkrieg wurden diese Entwicklungen abrupt unterbrochen. Die Schulen waren vom NSV übernommen worden, die Lehrkräfte durch regimetreue Leute ersetzt, die Gebäude vielfach zerstört. Man musste gewissermaßen von vorne beginnen. Ein »unwahrscheinlich primitiver Anfang«, wie Fides von Gontard, eine der Pionierinnen, schreibt:
Das erste Halbjahr, Sommer 1946, bin ich jeden Tag in Kassel herumgezogen und habe aus Trümmern Öfen gezogen und Rollglas für Fenster. Wir haben ein Haus auf dem Bresselberg gekriegt. Dort im Erdgeschoß hat alles angefangen. Wir hatten in den Unterrichträumen auch die Betten stehen. Wenn jemand krank war, konnte er vom Bett aus am Unterricht teilnehmen. Im ersten Winter mussten wir die Briketts mit-bringen, im Wald schlugen wir Holz ohne Erlaubnisschein. Wir mussten uns die Dozenten zusammensuchen, wir hatten keine Ahnung, was ein Lehrplan war, wir mussten aus dem Nichts eine Ausbildung gestalten" (Hering/Kramer 1994, 120).
Erst ab den 60er Jahren beginnt sich in Deutschland wieder eine qualifizierte Ausbildung zu entwickeln. Die Ausbildungszeit wird auf drei Jahre verlängert, der Status der Schulen erhöht und die Zugangsvoraussetzungen werden präzisiert. Die Aufwertung zum Hochschulrang und die Verwissenschaftlichung der Ausbildung bewirkt eine Erhöhung des Status der Sozialarbeiter/innen, die nicht weiter bloß "Hand-langerinnen" der Beamten sind, sondern mit diesen zusammen Mitarbeiter/innen in einem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD).
In Österreich ist zwar auch ein bemerkenswerte quantitativer und qualitativer Ausbau der Ausbildungs-einrichtungen zu konstatieren, der Schritt zur universitären Ausbildung wurde aber bisher nicht gemacht. Derzeit besteht ein mehrfach geschichtetes Ausbildungssystem, das sich aus den folgenden Schultypen zusammensetzt:[127]
Fachschulen für Soziale Berufe (FSB): Berufsbildende Mittlere Schulen (BMS), Ausbildungszeit: 3 Jahre ab der 9. Schulstufe
Berufsbildende höhere Schulen (BHS): Derzeit nur Ausbildungszweige an technisch/wirtschaftlich orientierten BHS, z.B. Bad Ischl: Ausbildungszweig Sozialmanagement.
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik: Bis 1993 Bildungsanstalten für Erzieher, 5 Jahre, Berufsqualifikation: Heime, Horte, Tagesheimstätten, Wohngemeinschaften, Beratungsstellen, Freizeitpädagogik, außerschulische Jugendarbeit, etc.
Private Ausbildungseinrichtungen für Soziale Berufe: Große Vielfalt (ca. 30) von Lehranstalten, Fachschulen und Lehrgänge mit eigenem Organisationsstatut, von privaten Vereinigungen oder von Religionsgemeinschaften.
Ausbildung zur Lebens- und SozialberaterIn: Lehrgang, Ausbildungsdauer: 5 - 6 Semester + 2 -4 Semester Berufspraktikum. Berufsqualifikation: Beratung und Betreuung von Menschen in Problem- und Entscheidungssituationen: Persönlichkeits-, Kommunikations-, Konflikt-, Ehe., Partner-schafts-, Familien-, Erziehungs-, Sexual-, Berufsberatung, Mediation, Supervision, Krisenintervention.
Akademien für Sozialarbeit: Zugangsvoraussetzung Matura, seit 2005/06 in Fachhochschulen über-geführt.
Fachschulen für Soziale Arbeit: 12 in Österreich, Zugangsvoraussetzung Matura, Ausbildungszeit: bis 2006/07 6 Semester, Berufsqualifikation: alle Sozialberufe.
Bachelor/Masterstudien: seit 2007/08 Umstellung der Fachschule auf das "Bologna-System", Bachelor: 8 Semester, Master: 2 Semester
2. Geschichte der Sozialarbeit als Frauenarbeit[128]
Berufliche Sozialarbeit wird bis um 1900 ausschließlich von Männern ausgeübt. Öffentliche Armenpflege darf nur von Personen mit Wahlrecht ausgeübt werden: also nur von Männern. Seit dem ersten Drittel des 19. Jh. gibt es privat organisierte Wohltätigkeitsarbeit von Frauen. Insbesondere durch den "patriotischen Taumel" (Zeller 1994, 17) nach der Niederlage Napoleons (1813) bildeten sich Vereine zur Versorgung der Verwundeten, die sich nach den Befreiungskriegen als freiwillige Armenpflegerinnen-Vereine organisierten. Schirmherr war der Landesfürst.
Amalie Sieveking[129] (1894 - 1959) unterstellte den von ihr in Hamburg gegründeten Weiblichen Verein für die Armen und Krankenpflege als erste nicht adeliger Aufsicht, sondern leitete ihn selbst.
Ab der Mitte des 19. Jh. gibt es immer mehr Töchter aus bürgerlichen Haushalten, die nach einer eigenen Erwerbstätigkeit streben, was aber zunächst noch tabu war. Die Entwicklung der "Mütterlichkeit als Beruf" (Sachße 1986) hing eng mit der Entstehung der Frauenbewegung zusammen.
1865 fand die erste Deutsche Frauenkonferenz statt, geleitet von Louise Otto[130] und Auguste Schmidt.[131] Ergebnis: Gründung des Allgemeinen deutschen Frauenvereines.
1894: Zusammenschluss der Frauenvereine zum Bund deutscher Frauenvereine mit einem radikalen und einem gemäßigten Flügel.
Auch die ersten Arbeiterinnenvereine wurden von bürgerlichen Frauen gegründet. Um 1890 spaltete sich die proletarische Arbeiterbewegung von der bürgerlichen ab.
1896: Auf der 16. Jahresversammlung des Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit wurde gegen heftigen Protest der bisher ausschließlich männlichen Armenpfleger, die die Konkurrenz der zudem aus höheren Schichten stammenden Frauen fürchteten, beschlossen, auch fähige Frauen als Armenpflege-rinnen zuzulassen.
1901: Der preußische Städtetag sprach sich für Armenpflegerinnen aus.
Ebenfalls um die Jahrhundertwende entstanden die konfessionellen Frauenorganisationen:
1894/95: Evangelische Frauenbewegung (Elisabeth Gnauck-Kühne, Paula Müller-Otfried)
1903: Katholische Frauenbewegung (Emilie Hopmann, Hedwig Dransfeld)
1904: Jüdische Frauenbewegung (Bertha Pappenheim[132] Lina Morgenstern, Jeanette Schwerin, Alice Salomon)
Eine Reihe von Entwicklungen waren für die Einbeziehungen der Frauen maßgeblich:
Die Dynamik der Frauenbewegung
Die Bewährung der ersten in der Armenpflege tätigen Frauen
Das schwindende Prestige der ehrenamtlichen Fürsorgetätigkeit bei Teilen der männlichen Armenpfleger
Der Einfluss der englischen Fürsorgereformen
Das 1900 in Kraft getretene bürgerliche Gesetzbuch, das Frauen die Vormundschaft ermöglichte
Das preußische Fürsorgegesetz von 1901
Die verfassungsmäßige Gleichstellung der Frau 1919
Hauptsächliche Arbeitsbereiche der Frauen waren die Volksküchen, die Säuglingsfürsorgestellen, die Jugendfürsorge und die Wohlfahrtsämter:
1866: Erste Berliner Volksküche
1900: Erstes Jugendfürsorgeerziehungsgesetz
1905: Gründung des Deutschen Bundes für Mutterschutz und Sexualreform durch Helene Stöcker,[133] Einrichtung von Ehe- und Sexualberatungsstellen, Heimen für unverheiratete Mütter, Kampf um rechtliche Besserstellung unehelicher Kinder
1907: Erste Zentralstelle für Jugendfürsorge in Berlin. Leiterin: Frieda Duensing
In den Fürsorgeorganisationen blieben die Leitungspositionen bis auf wenige Ausnahmen Männern vorbehalten.
Lina Morgenstern:[134] Begründerin der ersten Berliner Volksküche (1866), in der durch Genossenschaftseinkauf preiswerte Lebensmittel zum Selbstkostenpreis verwendet wurden.
Jeanette Schwerin:[135] Initiatorin der ersten »Jahreskurses zur beruflichen Ausbildung in der Wohlfahrts-pflege« (1899).
Alice Salomon:[136] Mitarbeiterin und Nachfolgerin von Anette Schwerin; Leiterin der ersten Sozialen Frauenschule in Deutschland (1908); Gründerin der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Internationale Vorkämpferin für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit; 1937 vor den Nazis nach USA emigriert.
1893: Verein Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit in Berlin
1899: Jahreskursus zur Beruflichen Ausbildung in der Wohlfahrtspflege in Berlin, Leitung: Anette Schwerin
1904: Gründung des Kursus zurAusbildung für christliche Liebestätigkeit im Kapellenheim durch den evang. Theologen Adolf Stöcker, 1905 übernommen vom Verein zur Fürsorge für die weibliche Jugend der Inneren Mission.
1905: Einjährige Christlich-soziale Frauenschule des Deutschen evangelischen Frauenbundes in Hannover
1908: Überkonfessionelle zweijährige Soziale Frauenschule in Berlin, Leitung: Alice Salomon

Foto: Gebäude der ersten Frauenschule, Berlin-Schöneberg, Karl-Schrader-Str., 1914
1909: Gründung einer Sozialen Frauenschule der Inneren Mission Berlin (Bertha von der Schulenburg)[137]
1911: Gründung einer Katholischen Sozialen Frauenschule in Heidelberg (Maria Gräfin von Graimberg)[138]
1912: Erster Fachkurs für Volkspflege in Wien
1917: Erste Konferenz Sozialer Frauenschulen. Mindestanforderungen für die Zulassung, Bemühung um einheitliche Curricula
1920: Erste Ausbildungs- und Prüfungsordnung
2 Jahre Theorie, 1 Jahr Praxis
Mindestalter bei Abschluss 24 Jahre
Inhalt der Ausbildung war nach Alice Salomon nicht bloß die sozialtechnische Kompetenz, sondern eine humanistische und sozialpädagogisch/sozialethische Grundorientierung. Pädagogik (nach Nohl, Spranger) und Psychologie (nach Bühler, Freud und Adler) waren zentrale Ausbildungsinhalte.
ab 1920: Kurse der Arbeiterwohlfahrt für 12.000 in der sozialen Wohlfahrt tätige Frauen aus der Arbeiterschicht, 1928 als Arbeiterwohlfahrt-Schule mit explizit sozialistischer Fürsorgeorientierung, zugänglich für Frauen und Männer aus der Arbeiterschicht, 1933 von den Nazis aufgelöst.
1925: Gründung der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit durch Alice Salomon: Fortbildungskurse für alle Fürsorgeberufe und Funktionen, Ausbildung von Dozentinnen für die Sozialen Frauenschulen, 1933 von den Nazis geschlossen.
Fachbücher aus der Pionierzeit:
Alice Salomon: Einführung in die Volkswirtschaftslehre, 1909
Leitfaden für die Wohlfahrtspflege, 1921
Öffentliche und private Wohlfahrtspflege, 1923: Ratgeber für Ärzte, FürsorgerInnen und BeamtInnen
Soziale Diagnose, 1926: Erste Theorie des Helfens, basierend auf dem amerikanischen "social case-work"
Die Ausbildung zum sozialen Beruf 1927
Siddy Wronsky[139]: Quellenbuch zur Geschichte der Wohlfahrtspflege, 1925
Soziale Therapie: Erste systematische Aufarbeitung von Akten der Fürsorge für Unterrichtszwecke (mit Alice Salomon), 1926
Sozialtherapie und Psychotherapie in den Methoden der Fürsorge 1 (mit Arthur Korn-feld), 1932
Methoden inividualisierender Fürsorge in Deutschland (mit Hans Muthesius), 1928
Methoden der Fürsorge, 1930
Marie Baum[140]: Familienfürsorge, 1927
Die Inhalte der sozialen Frauenschulen waren an den fortschrittlichen Wissenschaften ihrer Zeit orientiert: an einer kritischen Ökonomie, an der Psychoanalyse, an Sozialreform, an der persönlichen Würde der Betroffenen, an der Befähigung der Klient/innen zur Selbsthilfe
1932: Zahl der Sozialen Frauenschulen (Wohlfahrtsschulen) im Deutschen Reich: 33, in Preußen: 21. Die Schülerinnen mussten Schulgeld bezahlen und selbst für ihre Unterkunft aufkommen.
Die Arbeitsverhältnisse der kommunalen Sozialfürsorgerinnen waren desolat. Die 48-Stundenwoche war verpflichtend, faktisch ergaben sich oft 60 bis 80 Wochenstunden. In den Städten konnten 30.000 Bewohnerinnen auf eine Fürsorgerin kommen. Warme Mahlzeiten, Bahnfahrten, Übernachtungen wurden im allgemeinen nicht erstattet. Ansteckungsgefahr, Erschöpfung und Krankheit waren durch 6 Wochen Gehaltfortzahlung und eine Krankenversicherung nur notdürftig abgesichert, eine Unfallversicherung gab es nicht. Die Bezahlung galt als Entgegenkommen, Tarifsätze konnten erst durch mühselige Verhandlungen durchgesetzt werden und reichten nicht zum Leben: 40 bis 50% des Gehalts machte allein die Miete für ein möbliertes Zimmer aus. Nur etwa die Hälfte der kommunalen Fürsorgerinnen erreichte eine ausreichende Alterssicherung. Die übrigen waren auf die niedrigen Sätze der Angestelltenversicherung und auf ihre Angehörigen angewiesen.
Die allmählich entstehenden Berufsverbände waren gegen die mächtige Bürokratie weitgehend machtlos:
1910: Bericht über Die Frauen in der Armen- und Wohlfahrtspflege Deutschlands beim Internationalen Kongress für Armenpflege und Wohltätigkeit in Kopenhagen, erstattet von Dorothea Hirschfeld
1916: Die Sozialdemokratin Hedwig Wachenheim[141] fordert die Schaffung einer eigenen Berufsorganisation für soziale Berufskräfte.

Faksimile: Hedwig Wachenheim, Die Berufsorganisation der sozialen Hilfsarbeiterin. In: Blätter für die Soziale Arbeit Nr.4, 8. Jg., 1916
1916: Gründung des ersten überkonfessionellen Deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen (DVS), nur Absolventinnen einer Sozialen Frauenschule werden aufgenommen. Erste Vorsitzende: Adele Beerensson[142]
1916: Gründung des Vereins katholischer deutscher Sozialbeamtinnen. Erste Vorsitzende: Helene Weber[143]
1918: Zusammenschluss von DVS und konfessionellen Berufsverbänden zur Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände der Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands. Ab 1921 Herausgabe der Zeitschrift Soziale Berufsarbeit (bis 1935)
1918: Offizielle Eingabe des DVS an die preußischen Stadtverwaltungen: Forderung eines Stundenplans für Aufstiegschancen weiblicher Sozialangestellten, bessere Anstellungsbedingungen für diese
1919: Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
1921: Gründung des Verbandes der evangelischen WohlfahrtspflegerinnenDeutschlands. Leiterin: Bertha von Schulenburg
Zwischen DVS und AWO herrschte Dissens in Bezug auf die Strategie. Der Dienst am Volksganzen sei kein Klassenkampf, argumentierten die einen, eine unpolitische Art, Berufskämpfe zu führen, sei eine Illusion, die anderen.
1925: Die Sozialistischen Fürsorgerinnen sprechen sich für eine Zusammenarbeit mit dem DVS aus. Das Verhältnis zwischen "bürgerlichen" und "sozialistischen" Fürsorgerinnen bleibt spannungsgeladen.
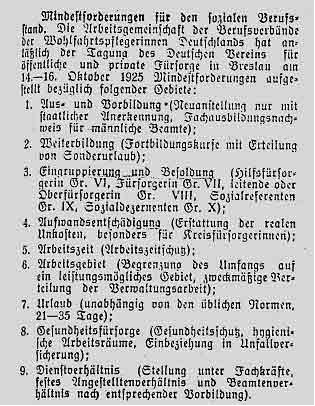
Faksimlie: Mindestforderungen für den sozialen Berufsstand des Berufsverbandes der Fürsorgerinnen, 1925
1925 veranlasst das Volkswohlfahrtsministerium eine Fragebogenaktion unter 3000 Fürsorgerinnen in Preußen, deren niederschmetternde Ergebnisse am 39. Deutschen Fürsorgetag in Breslau vorgestellt werden. Auch diese Aktion blieb folgenlos: Das Volkswohlfahrtsministerium bot in Berlin Turnkurse für Fürsorgerinnen an, um der körperlichen Erschöpfung durch Bewegung entgegen zu wirken. Die Amts-leiter gewährten hierfür allerdings keine Dienstfreistellung.

Faksimile: Berufskleidung für Fürsorgerinnen, 20er Jahre
Seit dem Ende der 1920er Jahre sind auch die Sozialarbeiterinnen mit einem verschärften Arbeitslosigkeitsproblem konfrontiert.

Faksimile: Die stellenlose Wohlfahrtspflegerin
Männliche Sozialarbeiter sind häufig Rechts- oder Verwaltungskundige ohne sozialarbeiterische Ausbildung. Ihre Betätigungsfelder liegen vor allem in der Ermittlung in der Armenpflege, in sozialreformerischem Engagement, in der Administration (Vereinssekretäre, Anstaltsleiter, Verwaltungsbeamte), in Erziehungsanstalten, Lehrlingsheimen, Kinderschutzkommissionen, Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung war allgemein anerkannt, auch von Frauen, z.B. Alice Salomon: Frauen = Pflege; Männer = Leitung, Administration.
Brüder- und Diakonenschulen von Hans Wichern[144] (1808 - 1881)
1921: Gründung des ersten Berufsverbandes: Deutscher Verband für Wohlfahrtspfleger
1923: Erster 15-monatiger Jugendpflegekurs für Männer in Berlin. Lehrer u.a.: Siegfried Bernfeld
1925: Erweiterung der Kurse zur Wohlfahrtsschule, ab 1927 staatliche Anerkennung als Ausbildungs-stätte für Männer
1927: Staatliche Prüfungsordnung und Anerkennung von Wohlfahrtspflegern in Preußen.
Bis 1932: 4 staatlich anerkannte Wohlfahrtschulen für Männer
In der Wohlfahrtverwaltung behalten nach wie vor die Männer die Oberhand. "Männliche" Sozialarbeit wird vor allem als Jugendpflege verstanden. Die "mütterliche" Sozialarbeit bleibt bei den Frauen.
1933: 1.454 (d.s. 11,5%) männliche Wohlfahrtspfleger im deutschen Reich; Steigerung während der NS-Zeit: 1939: 1.825 (d.s. 10,5 %).

Faksimiles: Stellenangebote Männer - Frauen
Nach dem ersten Weltkrieg drängen 10 Millionen deutscher Soldaten in den Arbeitsmarkt zurück. Die Demobilmachungsvorschriften beordern die erwerbstätigen Frauen zurück in die Landwirtschaft und in die Familien. Ihre Stellen sollten wieder von den zurückgekehrten Männern eingenommen werden. Männer mit geringer Ausbildung und Berufschancen verdrängen vorwiegend in der Jugendpflege die in den sozialen Frauenschulen qualifizierten Frauen. Die gemeinsame Ausbildung von Frauen und Männern wird weitgehend abgelehnt (Ausnahme: Berliner Arbeiterwohlfahrtschule). Zwar werden im Deutschen Reich 1919 die Frauen verfassungsrechtlich gleichgestellt, das bedeutet aber keine Gleichberechtigung in den beruflichen Chancen. Frauen werden wieder in ihre traditionellen Rollen zurückgedrängt oder bestenfalls als billige bis kostengünstige Helferinnen im Sozialwesen akzeptiert. Viele Sozialarbeiter-innen arbeiten ohne Bezahlung oder sie werden selbst zu Klientinnen der Fürsorge.
Es zeigt sich allerdings, dass die nicht ausgebildeten Männer ihren Aufgaben zum Teil nicht gewachsen sind. Die Rückkehr entlassener Frauen in den Sozialdienst wird gefordert und findet vielfach auch statt.
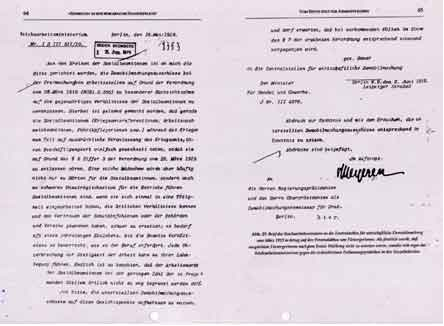
Faksimile: Brief des Reicharbeitsministers vom März 1919
Durch die massive Finanzknappheit und die Zusammenfassung der Spezial-Fürsorgezweige in die Einheits- bzw. Familienfürsorge - ideologisch als Unterstützung der "Keimzelle der Gesellschaft" begründet, im wesentlichen aber eine Sparmaßnahme - nach dem ersten Weltkrieg entstand für die Sozialarbeite-rinnen erhöhter Arbeitsdruck, Schematisierung und Bürokratisierung der Tätigkeit und erhöhte Kontrolle.
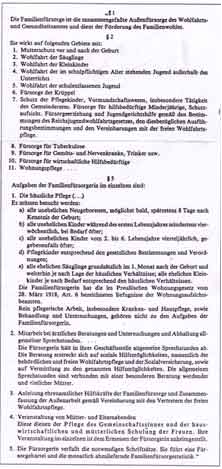
Faksimile: Dienstanweisung für die kommunale Familienfürsorge 1925
Ab den 20er Jahren setzen Bemühungen zur Sozialreform ein, die ein "menschenwürdiges Dasein für alle" Staatsbürger/innen zu schaffen beabsichtigen, ohne dieses Versprechen in der Praxis einzulösen. Es werden Wohlfahrtsämter unter kommunaler Leitung eingerichtet, deren Vorgesetzte aus den Magistraten stammten und meist keine soziale Ausbildung haben. Zur effektiven sozialen Arbeit fehlt weithin das Geld. Es wird rationalisiert: Arbeitsdruck und -kontrolle steigen, teure Spezial-Fürsorgezweige wer-den aufgelöst und in die allgemeine Familienfürsorge integriert. Die Familienfürsorge wird die Normalform der sozialen Fürsorge.
1924: Eine Steuernotverordnung bringt Einnahmequellen für die soziale Wohlfahrt.
1924: Reichsfürsorgepflichtverordnung und Reichsgrundsätze regeln Voraussetzungen und Ausmaß der öffentlichen Fürsorge.
Das Tätigkeitsprofil und die Ausbildung der Frauen entsprach nicht den in den städtischen Verwaltungshierarchien für höhere Positionen vorgesehenen Laufbahnschemata (z.B. Gymnasium, Universität). Sie wurden deshalb auf den untersten Stufen als "Gehilfinnen" eingestellt, dienst- und besoldungs-rechtlich den Schreibkräften, Parkwächtern oder Tierpflegern gleichgestellt.
Man braucht die Frauen [...] nur dafür, dass sie in Wind und Wetter herumlaufen und die Elendsquartiere aufsuchen. [...] Entscheidungen zu fällen, Selbständigkeit zu haben, ist nicht weiblich. [...] Wenn gesagt wird, die Frau sei für die Wohlfahrtspflege besonders geeignet, so heißt das: [...] dass man sich ihrer nur bedient; dass sie Zubringerdienste zu leisten hat." (Oberfürsorgerin Ida Solttmann 1930, zit.n. Zeller 1994, 109).
Wo sie höheren Rängen gleichgestellt wurden, wurden sie finanziell um einige Gehaltsklassen niedriger eingestuft. Ältere Fürsorgerinnen wurden gekündigt bevor sie pensionsberechtigt wurden, Abteilungen, für die sich kein männlicher Bewerber fand, aufgelöst. Die "Domäne" der Frauen war nicht der gut bezahlte und entscheidungsbefugte Innendienst, sondern der Außendienst: die Ermittlung und Betreuung der Hilfsbedürftigen vor Ort. Die Fürsorgerinnen durften keine Maßnahme ohne Wissen ihres Büro-vorgesetzten treffen, die zwischen Unterstützungsempfängern und Hundesteuerzahlern kaum zu unter-scheiden wussten. Die Beamten brauchten lediglich "Laufmädchen für die Ermittlungen". "Höhere" Positionen anzustreben galt als "weibliche Schmutzkonkurrenz".
[122] dt. Wirtschaftswissenschaftler, 1875 - 1954
[123] Henriette Schrader-Breymann, 1887 - 1899, dt. Pädagogin, Enkelin und Mitarbeiterin Fröbels, Ausbildungs-einrichtungen für Kindergärtnerinnen und "weiblich-mütterliche Kräfte" in Watzum und Berlin
[124] Jeanette Schwerin, 1852 - 1899, Mitbegründerin der Berliner Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfs-arbeit, Herausgeberin des Centralblattes des Bundes Deutscher Frauenvereine, erster Jahreskursus zur Ausbildung für soziale Berufsarbeit.
[125] Alice Salomon, 1872 - 1948, bedeutendste Initiatorin der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und der Entwicklung von Sozialarbeit als Beruf. Nachfolgerin von Jeanette Schwerin beim Jahreskursus in Berlin, Leiterin der überkonfessionellen Sozialen Frauenschule, Gründerin der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, 1933 Zurücklegung aller Ämter, 1937 Emigration in die USA.
[126] Ilse Arlt, 1976 -1960, Wegbereiterin einer Fürsorgewissenschaft und einer auf diese bezogenen Ausbildung professioneller Sozialarbeiterinnen, Gründerin der Vereinigten Fachkurse für Volkspflege in Wien (1912), 1938 als "Halbjüdin" Berufsverbot, nach dem Krieg Wiedereröffnung der Schule (1946 - 1950). Schriften: Die Grundlagen der Fürsorge (1921); Wege zu einer Fürsorgewissenshaft (1958).
[127] Vgl. zum Ganzen: Hofer 2005
[128] Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse, Personen, Institutionen und Entwicklungen nach: Zeller, Susanne: Geschichte der Sozialarbeit als Beruf. Bilder und Dokumente (1893-1993). Pfaffenweiler: Centaurus 1994.
[129] Amalie Sievelking, 1794 - 1859, Krankenpflegerin im Hospital eines Hamburger Armenviertels, Gründerin des ersten Vereins für Armen- und Krankepflege.
[130] Louise Otto, dt. Frauenrechtlerin und Schriftstellerin, Initiatorin der ersten deutschen Frauenbewegung, Herausgeberin einer Frauenzeitung (1849 -- 1853), 1850 durch die »Lex Otto«, mit der Frauen die Herausgabe von Zeitungen in Sachsen wurde, verboten.
[131] Auguste Schmitt, Lehrerin und Schriftstellerin, 1833 - 1902, mit Louise Otto Gründerin des Allgemeinen deutschen Frauenvereins
[132] Bertha Pappenheim, 1859 - 1936, Psychoanalytikerin und Frauenrechtlerin, Patientin Sigmund Freuds ("Anna O")
[133] Helene Stöcker, 1869 - 1943, dt. Frauenrechtlerin und Sexualreformerin und Pazifistin, vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet.
[134] Lina Morgenstern, 1830 - 1909, dt. Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Sozialaktivistin, Begründerin der ersten Volksküche in Berlin
[135] siehe Anm. 22
[136] siehe Anm. 23
[137] Bertha Gräfin von Schulenburg, 1861 - 1840, Gründerin des Berliner Kursus zur Ausbildung junger Mädchen und Frauen in christlicher Liebestätigkeit der Inneren Mission, Leiterin der ersten Evangelischen Sozialen Frauenschule.
[138] Maria Gräfin von Gaimberg, 1979 - 1965, Gründerin der ersten Katholischen Sozialen Frauenschule in Heidelberg.
[139] Marie Baum, 1874 - 1964, Gewerbeinspektorin, Leiterin der Sozialen Frauenschule in Hamburg, Universitätslehrerin in Heidelberg.
[140] Siddy Wronsky, 1883 - 1947, Lehrerin für behinderte Kinder, Dozentin in der Deutschen Frauenschule und in der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, 1934 nach Isreal emigriert, Gründung der ersten Sozialarbeiterinnen-Ausbildung in Palästina.
[141] Hedwig Wachenheim, 1891 - 1969, dt. Fürsorgerin, Politikerin (SPD) und Publizistin (Zeitschrift "Arbeiterwohlfahrt"), bei Alice Salomon ausgebildet, Leiterin der ersten Ausbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Berlin. 1935 in die USA emigriert.
[142] Adele Beerensson, 1879 - 1940, Geschäftsführerin der Berliner Mädchen und Frauengruppenfür soziale Hilfsarbeit, und des Deutschen Verbands der Sozialbeamtinnen, Lehrerin in der Sozialen Frauenschule, 1933 nach England emigriert.
[143] Helene Weber, 1881 - 1962, Gründerin der Katholischen Sozialen Frauenschule in Köln, erste Ministerialrätin in Deutschland (für Soziale Ausbildung und Jugendfragen), führende Rollen in der katholischen Frauenbewegung, Redakteurin der Zeitschrift Soziale Berufsarbeit (1933 von den Nationalsozialisten abgesetzt).
[144] Johann Hinrich Wichern, 1808 - 1881, Gründer des Rauen Hauses in Hamburg (1833).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Verstaatlichung und Säuberung der Fürsorge
- 2. Soziale Not als Rassenschande - Ausmerzung statt Hilfe im NS-Staat
- 3. Vernichtung »unwerten« Lebens: Sterilisation und Tötung der »Minderwertigen«
- 3. Sozialarbeiter/innen als Täter/innen und Mitläufer/innen
- 5. »Fremdrassige Belastungen« und »Zigeuner«: Nationalsozialistischer Rassismus in Stadt und Land Salzburg
- 6. »Plötzlich und unerwartet verstorben«: Ermordung unwerten Lebens in Tirol und Südtirol
In den 30er Jahren gab es in Deutschland 6 Mill. Arbeitslose. Die Arbeitslosenunterstützung, im Deutschen Reich erst 1927 eingeführt, und die Sozialhilfe wurden aufgrund der großen Zahl der Unterstützungsbedürftigen in mehreren Schüben abgesenkt.
Die Reaktion des Staates auf die Wirtschaftskrise waren Steuerhöhungen, Lohnsenkungen, Preisrege-lungen und vor allem Sozialabbau. "Wir alle fürchten die Vormittage", schreibt die Sozialfürsorgerin Martha Wedel unter dem Titel "Ablehnen" in der "Wohlfahrtswoche" des Jahrgangs 1932,
an denen die Benachrichtungen über die Kürzungen hinausgegangen sind, und den ganzen Tag noch klingen uns die Klagen in den Ohren. Wie kann ich denn ein Kind von 10 Mark ernähren? Ich kann doch keine billigere Wohnung bekommen! Da schicke ich mein Kind eben nicht zur Schule, wenn es keine Schuhe hat! Ich will einen Atlas für mein Kind; es soll nicht dumm bleiben! Tränen, Jammer, Groll in allen Abstufungen, verschieden nach Temperament bis zu den beiden extremen Drohungen mit Selbstmord oder Vernichtung des Systems" (zit. n. Sachße/Tennstedt 1992, 37).
Ziel der staatlichen Wohlfahrtspolitik war nicht länger "der Schutz der Arbeitnehmer vor den Risiken des kapitalistische Arbeitsmarktes, sondern "die Sicherung der wirtschaftliche Interessen der Unternehmer, die seit Jahren bereits gegen die ihrer Ansicht nach untragbaren Kosten des Wohlfahrtsstaates protestiert hatten" (ebd. 1992, 39).

Foto: Arbeitslose vor dem Arbeitsamt Berlin-Neukölln, 1929/30. AUS: Landwehr/Baron 1983, 127
Das änderte sich mit der Machtergreifung Hitlers von Grund auf. Die hohe Arbeitslosigkeit war ein enormer sozialer Sprengstoff, den sich die Nationalsozialisten zur Nutze machten. Zwar hatte bereits die Regierung Papen[145] ein staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm eingeführt aber erst Hitler machte "die Rettung des deutschen Arbeiters durch einen gewaltigen und umfassenden Angriff gegen die Arbeitslosigkeit" zum Hauptziel seiner Wirtschaftspolitik (Rundfunkaufruf vom 1. Februar 1933, zit n. ebd., 39 f.).
Die sozialen Probleme des Deutschen Reiches waren enorm. Zur Zeit der Machtübernahme waren 40% der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos. Die Mittel zu seiner "Lösung" des Problems waren äußerst fragwürdig: Ausschaltung der Gewerkschaften, Diskriminierung der Frauen am Arbeitsmarkt, Staats-schulden, Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit. Die Vermittlung Jugendlicher zur Arbeit auf dem Land, 400.000 allein im Jahr 1933, der "Reichsarbeitsdienst", "Notstandsarbeiter" (1933: 600.000), "Ehestandsdarlehen" für Frauen, die ihren Arbeitsplatz räumten, Kampagnen gegen das "Doppelverdienertum" und die Anordnung einer möglichst beschränkten Verwendung von Maschinen gehörten zu den Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung (Landwehr/Baron 1983, 174). Empfänger von Unterstützungsgeldern mussten mancherorts bis zu 8 Stunden täglich in kommunalen Projekten arbeiten und darüber hinaus nachweisen, dass sie bei mindestens 25 Unternehmern pro Woche um Arbeit vorstellig geworden waren. In der zu großzügig und falsch verteilten öffentlichen Fürsorge sah die NSDAP eine der Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit. Zusätzlich wurden "Arbeitslosigkeitsstatistiken geschickt umstrukturiert, um mit manipuliertem Zahlenmaterial die Bevölkerung beeindrucken zu können" (Zeller 1994, 133).
In der Wahrnehmung der Bevölkerung hatte aber der Rückgang der Arbeitslosigkeit Priorität. Tatsächlich verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in der »Ostmark« zwischen 1938 dem Jahr des »Anschlusses« und 1939 von 401.000 auf 156.000. Zudem verfügten die Nationalsozialisten eine Reihe von Verbesserungen bzw. Neuerungen im Sozialbereich. 100.000 "Ausgesteuerte" erhielten wieder die Arbeitslosenunterstützung, die Unterstützung der Familienangehörigen von eingezogenen Soldaten wurde wieder eingeführt, und zwar zu höheren Tarifen als im Ersten Weltkrieg, Leistungen der Reichsversicherung, wie die Sozialversicherung nun hieß, wurden teilweise verbessert. Die bereits 1927 im Stände-staat beschlossene, aber auf Grund der Wirtschaftskrise nicht vollzogene Alterspension für Arbeiter wurde eingeführt.
Die nationalsozialistische Wohlfahrtspolitik war durch die Forderung der Selbsthilfe und den Vorrang der Förderung der wertvollen statt der minderwertigen Teile des Volkes geprägt. Zentrale Organisation der nationalsozialistischen Fürsorgepolitik war die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV), die sich aus mehreren Wohlfahrtsvereinigungen der NSDAP in der Weimarer Republik entwickelt hatte und 1933 zur Parteiorganisation wurde. Neben ihr waren nur noch die evangelische Innere Mission, die Caritas und das Rote Kreuz anerkannt, alle anderen, wie die Sozialdemokratische Arbeiterwohlfahrt, wurden aufgelöst, ihr Eigentum wurde von der NSDAP übernommen, ihre Einrichtungen von nicht regimetreuen Mit-arbeitern brutal gesäubert. Dem Fürsorgesystem der Weimarar Republik warfen die Nationalsozialisten "eine angeblich beispiellose »Mittelverschwendung« bei den gewährten Unterstützungssätzen" zu (ebd., 136).
Wesentliche Aktivitäten der NSV waren das Winterhilfswerk (WHW), in dessen Rahmen jährlich hunderte Millionen Reichsmark, Kleider und Sachspenden für die Notleidenden gesammelt wurden. »Keiner soll hungern! Keiner soll frieren!«, lautete die Losung, die aufgrund der undurchsichtigen Finanzgebarung viele nicht so recht glauben wollten, weshalb sie WHW mit »Waffenhilfswerk« oder »Wir hungern weiter« übersetzten. Als die Ehefrauen von Goebbels und Göring sich "mit Zobel und Nerz bekleidet" 1942 unter die Straßensammler mischten, "wurden abfällige Bemerkungen der Passanten so laut, dass die beiden Damen bald Zuflucht in ihren Autos suchten" (ebd., 191).

Faksimile: "Keiner soll hungern! Keiner soll frieren!

Foto: Hermann Göring bei einer Straßensammung für das Winterhilfswerk

Foto: Kleidersammlung des Winterhilfswerkes, 1934
Es war wohl Goeppels, der als erster das propagandistische Potential der sozialen Wohlfahrt erkannte. Er verhalf der NSV zur Unterstützung durch Hitler und die Partei und machte das Winterhilfswerk zur einheitsstiftenden Volksbewegung, Gemeinschaft eines »opferbereiten Volkes«, nach dem Slogan: »Deutsches Volk, hilf dir selbst«. Die Spende "wurde zur rituellen Verwirklichung der Volksgemeinschaft, in der Sammler wie Spender - als Bestandteile des Volkes - ihre Verantwortung für dieses ein-lösten" (ebd., 124 f.). Zugleich war das WHW ein Instrument der Disziplinierung und Kontrolle. Auch hier sollten die Nutznießer nur die »Wertvollen« und »Erbgesunden« sein, die »Asozialen« und »Arbeits-scheuen« mussten ausgeschieden werden.[146] Erich Hilgenfeld, seit 1933 Reichsbeauftragter für das Winterhilfswerk bringt dessen politische Aufgabe klar zum Ausdruck:
Wir müssen auch in der Wohlfahrtspflege bewusst wieder den Weg zu unserem Volke zurückfinden. müssen auch hier uns lossagen von jener undeutschen Art des Almosengebens und Almosenempfangens, von jener Verantwortungslosigkeit, die dem germanischen Menschen im Grunde so fremd ist. Es ist ein Gedanke, der die ganze Vorstellungswelt unserer Vorfahren durchzieht, dass jeder Mensch Verantwortung trägt nicht nur für sich selbst. sondern auch für seine Familie und für die höchste Gemeinschaft seines Staates! [...]
Die Idee der Volksgemeinschaft muss Ausgangspunkt und Ziel auch unserer Arbeit sein. die aus dem Herzen ihre größten Kräfte zieht. Wir wollen unsere Hilfe an den Hilfsbedürftigen nicht als Almosen geben, wir wollen vielmehr mit ihr in jedem Betreuten die Überzeugung erwecken, dass er die Pflicht hat. für diese Leistungen aus der Gemeinschaft wieder selbst Leistungen an die Gemeinschaft zu erbringen. Das gewaltigste Erziehungsmittel zur Volksgemeinschaft wird nie allein das bloße Wort, sondern stets die Tat und das Opfer sein, ebenso wie auch aus dem Opfer von Langemarck,[147] aus dem Opfer des Weltkrieges die Frontgemeinschaft, die Volksgemeinschaft herausgewachsen ist.
In dieser tagtäglichen Erziehung zum Opfer, in dieser dauernden Bereitschaft zum Einsatz für das große Ganze, nicht in den gesammelten Ziffern der Leistungen liegt die ausschlaggebende Bedeutung des Winterhilfswerkes. Andere Regierungen vor uns haben Notstandsmaßnahmen durchgeführt. haben Kohlen und Lebensmittel gesammelt, haben Wärmestuben eingerichtet und sehnten sich nach der Zeit, wo sie dieser lästigen Einrichtung wieder endlich ledig sein würden. Wir Nationalsozialisten haben von Anfang an das Winterhilfswerk, wie das schöne Wort des Führers sagt, als eine stolze Herzensangelegenheit betrachtet. Das Winterhilfswerk wird nach den Worten des Führers auch in allen kommenden Wintem durchgeführt werden, nicht deshalb, weil wir glauben, dass wir die Not im Winter nie beseitigen werden, sondern weil das Winterhilfswerk eine ständige Erziehungsaufgabe für das deutsche Volk sein soll. In den unzähligen Gaben zum WHW, in den Millionen Helfern, die sich uns zur Verfügung stellen, erblickt nicht nur der Führer, nicht nur ganz Deutschland, sondern die ganze Welt den Gradmesser für die Opferfähigkeit unseres Volkes auch in ernsteren Zeiten (Hilgenfeld 1937, zit.n. Zeller 1994, 142).
Auf ähnliche Weise funktionierten Mutter und Kind (MuK), das Ernährungshilfswerk das Tuberkulosehilfswerk oder das Künstlerhilfswerk. Aufgabe von MuK war »der deutschen Mutter in körperlicher, geistiger und seelischer Not beizustehen, einem deutschen erbgesunden Kinde zu gesunder Fortentwicklung zu verhelfen« (Goebbels 1934, zit. n. ebd., 128). Mütterberatung, Mütter- und Kindererholung am Land und vor allem der Ausbau der Kindergärten von ca. 7.000 im Jahr 1928 zu ca. 20.000 bei Kriegsausbruch., viele davon Erntekindergärten zur Entlastung der Frauen in der Landwirtschaft.
In besonderer Weise widmeten sich die Nationalsozialisten der Jugend »als Trägerin unserer nationalen Zukunft« (Hitler), auch hier nur der »erbgesunden« Jugend, der »Heranzüchtung kerngesunder Körper«, dem »artgesunden Nachwuchs«, der Volksgemeinschaft verpflichtet und ergeben. 1936 verfügte das Gesetz über die Hiltler-Jugend (HJ): »Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitler-Jugend zusammengefasst« (§ 1). Die Jugendorganisation der NSDAP wurde damit zur Zwangsorganisation für alle Jugendlichen. Der Reichsjugendführer war nun für die HJ, den NS-Schüler- und den NS-Studentenbund zuständig, die Mitgliederzahl stieg von 50.000 (1928) auf 8 Mill. (1939), das sind 2/3 aller deutschen Jugendlichen). Das evangelische Jugendwerk wurde der HJ angeschlossen, die katholischen Jugendverbände bis 1939 geduldet, dann verboten. Der NSV zog die Kompetenzen in der Jugendfürsorge zunehmend an sich und entmachtete die Jugendämter.
Am massivsten griffen die Nationalsozialisten in die Fürsorgerziehung ein. Sie prangerten die gemein-same Unterbringung »heterogenster Elemente« an: »Da waren Schwachsinnige leichten und mittleren Grades neben volltauglichen jungen Menschen, Körperbehinderte neben Epileptikern und sittlich gänzlich Verkommenen, Erbkranke neben Umweltgeschädigten, alles in bunten Haufen durcheinander gewürfelt. Oft über Jahre hinaus waren diese Menschen, die sich aus natürlichen Gründen niemals zu einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft vereinigen können, zusammengekoppelt und in ihrer Entwicklung behindert« (Alfred Späth 1938/39, zit. n. ebd., 163). Die neue Dreigliederung der Heime nahmen die Nationalsozialisten nach ihren eugenisch-rassischen Kriterien vor. Die »Wertvollen« und »Erbgesunden« sollten von den »Minderwertigen«, den »Asozialen« und den »gänzlich Unerziehbaren« geschieden werden. Für die Ersteren wurden halboffene NSV Jugendheimstätten eingerichtet, die sie nach einem Jahr wieder verlassen sollten. Für die Letzteren wurden eigene Bewahranstalten errichtet, und für die auch von diesen abgewiesenen gab es Jugendschutzlager, in Deutschland in Moringen (Niedersachsen) für männliche und in Uckermark (Mecklenburg Vorpommern) für weibliche Jugendliche, die wie Konzentrationslager geführt wurden.
1936 wandelten die Nationalsozialisten die Arbeitslosenunterstützung, die ein Recht der Versicherten darstellte, in die Reichfürsorge für Arbeitslose um. Die Arbeiter hatten weiterhin ihre Beiträge zu entrichten, diese bewirkten aber kein Recht auf Unterstützung mehr. Eine solche wurde nur mehr bei Bedürftigkeit und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gewährt. »Asozial ist, wer aus Arbeitsscheu Arbeitsmöglichkeiten beharrlich nicht nutzt oder nicht genutzt hat oder die Bemühungen, ihm Arbeit zu verschaffen beharrlich verweigert« (Martin Zschuke 1942, zit. n. ebd., 227). Derartige »Arbeitsscheue« waren von jeder Unterstützung ausgeschlossen und wurden in vielen Fällen der Polizei übergeben.
Eine der ersten Maßnahmen nach der Annexion Österreichs an das Deutsche Reich durch Hitler war die Verordnung über die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich, die im wesentlichen der "Zerschlagung der Arbeiterbewegung und der Beseitigung der Interessenorganisationen" (Talos 1981, 291) diente. Mit dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit wird anstelle der Reste von Interessensvertretung, die der Ständestaat noch übrig gelassen hatte, das autoritäre Führerprinzip ein-geführt. "Der verantwortliche Leiter des Betriebes besitzt die alleinige Entscheidungskompetenz in allen Angelegenheiten des Betriebes [...] Die Unternehmer als Führer und die Arbeitnehmer als Gefolgschaft stehen in einem gegenseitigen Treueverhältnis" (ebd., 291).
Im Bereich der Sozialversicherung wurden die bestehenden Regelungen im Wesentlichen beibehalten, in einigen Bereichen verbessert. So wurde 1939 die Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung nach deutschem Vorbild realisiert. Auch im Versicherungswesen wurde allerdings die Selbstverwaltung aufgehoben und das Führerprinzip eingeführt. Die Arbeitslosenversicherung wurde 1939 aufgelöst. Insgesamt erreichten aber die Nationalsozialisten die Kürzungen in der sozialen Fürsorge nicht durch Änderung der Gesetze sondern durch radikale Kürzung der Reichszuschüsse an die Gemeinden.
Für die Sozialarbeit und die Sozialarbeiter/innen hatte die Machtergreifung der Nationalsozialisten dramatische Folgen:
1931/33 Einführung des "Freien" Wohlfahrtsverbandes der Nationalsozialistischen Volkswohl¬¬fahrt (NSV), organisatorisch repräsentiert durch das Hauptamt für Volkswohlfahrt
1933: Auflösung des Bundes der deutschen Frauenvereine; freiwillige oder zwangsweise Angliederung zahlreicher Frauenvereine an die Deutsche Frauenfront
1934: Auflösung der Liga der freien Wohlfahrtsverbände. Nur mehr die NSV, die Innere Mission und die Caritas werden als Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege anerkannt. Die Arbeiterwohlfahrt wird aufgelöst, die Jüdische Wohlfahrtspflege ausgeschlossen. Die NSV wird als führende Wohlfahrtsorganisation (16 Mill. Mitglieder) etabliert.
Nur widerwillig und vorübergehend will sich die NSV noch der kirchlichen Verbände bedienen. Sie sollen sich um jene Menschen kümmern, die nach NS-Ideologie kein Lebensrecht haben und langfristig ausgemerzt werden sollen.
Wir haben die Führung der Freien Wohlfahrtspflege übernommen, wir übernehmen nun auch die Führung in allen übrigen Gebieten des Reiches. Als fernes Ziel schwebt uns eine einzige Organisation vor Augen, die im Ständestaat sich diesen besonderen Aufgaben zuwendet. Wir haben vorerst von dieser Arbeit den caritativen Organisationen der Kirche die Aufgabe zugewiesen, sich jenen Kranken zu widmen, denen wir nicht mehr helfen können. Diese Aufgabe erfüllen sie aber unter unserer Führung. Wir müssen hier bei unserer Arbeit daran denken, daß es unser Ziel ist, diese Aufgaben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer weiter herabzumindern. Wir wollen durch unsere Maßnahmen der Gesundheitsführung in der Zukunft alles Kranke ausschalten. Es wird also hier im weiteren Verlauf der Entwicklung Anstalt um Anstalt überflüssig werden müssen (Hilgenfeldt 1933, zit. n. Zeller1994, 134).
Die Sozialarbeit von Frauen wird von den Nationalsozialisten zunächst als »Doppelverdienertum« gebrandmarkt, Frauen sollten ins Haus oder in die Hausarbeit zurückkehren. Lokale Parteiorganisationen üben Druck aus, Frauen zu entlassen oder setzten Obergrenzen für das Familieneinkommen fest. Aller-dings mit wenig Erfolg: Frauen sind billige Arbeitskräfte und blieben deshalb begehrt. 1933 sind immer noch 11.500 der insgesamt 13.000 in der sozialen Wohlfahrt Tätigen weiblich.
Wirkungsvoll waren die einschränkenden Maßnahmen aber bei den weiblichen Beamten, die allerdings nur 1% der Beamten insgesamt ausmachten: Deren Entlassung wurde erleichtert, geringere Gehälter für Frauen wurden gesetzlich ermöglicht, die Pragmatisierung wurde ihnen erst ab dem 35. Lebensjahr zugestanden. Das Reichsgesetz gegen die Überfüllung von deutschen Schulen und Hochschulen des Jahres 1933 setzte zudem einen numerus clausus für Frauen von höchstens 10% aller Studierenden fest. Damit hatten noch weniger Frauen die Möglichkeit, die Voraussetzungen für den Beamtenstatus zu erwerben. Höhere Positionen für Frauen wurden damit so gut wie unmöglich.
Dazu kamen die Säuberungen aus rassistischen oder politischen Gründen. Bereits im April 1933 wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen, durch das »politisch unzuverlässige« Beamt/innen wie die Fürsorgerinnen der sozialdemokratischen Arbeiterwohlfahrt, vor allem aber jüdische Beamt/innen in den Ruhestand versetzt werden könnten. Ab August 1934 wurden Jüdinnen an den Wohlfahrtsschulen nicht mehr zugelassen.
Die Säuberungen waren teilweise so radikal, dass sie selbst der NS-Innenminister für übertrieben hielt:
Der in den letzten Monaten seitens verschiedener Bezirksfürsorgeverbände durchgeführte Abbau von Für-sorgerinnen (Wohlfahrtspflegerinnen) ist stellenweise über das gebotene Maß hinausgegangen. Selbstverständlich musste auch der Stand der Fürsorgerinnen von solchen Elementen gereinigt werden, die ihrer Persönlichkeit nach dem nationalen Staate Dienste nicht leisten konnten. Es liegt jedoch nicht im Sinne des nationalsozialistischen Staates, grundsätzlich alle weiblichen Beamten und Angestellten ihres Geschlechts wegen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Die öffentliche Wohlfahrtspflege kann zu einer sachgemäßen und sparsamen Durchführung ihrer fürsorgerischen Aufgaben die Mitwirkung von fachlich vorgebildeten Fürsorgerinnen nicht entbehren ( zit. n. ebd., 190).
Wie viele andere Pionierinnen der Sozialarbeit wurde 1937 auch die prominenteste Persönlichkeit der beruflichen Sozialarbeit in Deutschland zur Emigration gezwungen. Bereits 1933 hatte sie alle ihre Ämter niedergelegt. In ihren Lebenserinnerungen schreibt sie:
Auslandsreisen‹ zu erscheinen. Nach einem vierstündigen Verhör erhielt ich den Befehl, Deutschland innerhalb von drei Wochen zu verlassen [...] Ausgeschlossen und des Landes verwiesen zu werden, war noch ein Zeichen besonderer Wertschätzung, obwohl es als Demütigung gemeint war (Salomon 1983, 295, zit.n. Zeller 194, 161).Die Gestapo forderte mich im Mai 1937 auf, am folgenden Morgen zu einem ›Bericht über meine
Nach elfjährigem Exil starb Alice Salomon 1948 vereinsamt in New York.
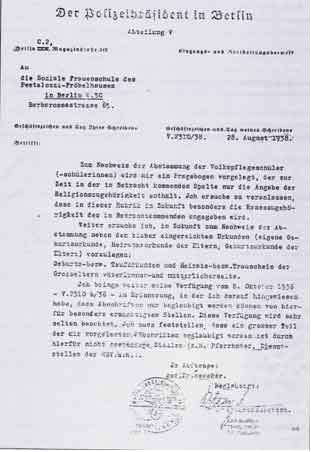
Faksimile: Schreiben des Polizeipräsidenten von Berlin: "Nachweis der Abstammung der Volksschüler"
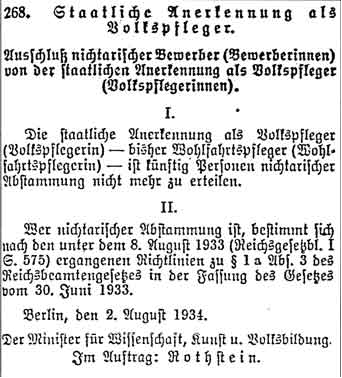
Faksimile: Ausschluß nichtarischer Bewerber (Bewerberinnen)
Mit dem Ausbau der nationalsozialistischen Volksfürsorge entstand neuer Bedarf an Fachkräften. Waren 1933 noch über 1000 Sozialarbeiter/innen arbeitslos, so gab es 1938 bereits 1000 freie Stellen. Die schlechten Arbeitsbedingungen und die niedrigen Gehälter waren die Hauptursachen für den zu geringen Nachwuchs an Sozialarbeiter/innen. Da aber immer noch die Mehrzahl der Beschäftigten nicht Angestellte der NSV sondern der öffentlichen Träger waren, wollte man die Gehälter nicht generell er-höhen. Die Tarifverordnung des Jahres 1938 brachte für die Mehrzahl der "Volkspflegerinnen" nichts oder sogar weniger, die Angestellten der NSV behielten dagegen ihre höheren Gehälter.
Auch die Ausbildung wird dem NSV unterstellt. Die Konferenz der sozialen Frauenschulen Deutschlands, Alice Salomons Gründung von 1917 wird in den Reichzusammenschluss der staatlich anerkannten Schulen für Volkspflege umbenannt und umorganisiert, Salomon wird als Leiterin abgelöst. Die In-halte der Ausbildung werden der NS-Ideologie angepasst: »Nicht Nationalökonomie sondern National-biologie« war nach Hermann Althaus (zit.n. ebd., 194) die Maxime: Nationalsozialistische Weltanschauung und Volkspflege und insbesondere Erb- und Rassenkunde wurden nun zu wesentlichen Schwer-punkten der Ausbildung. Versuche zu einer reichseinheitlichen Gestaltung der Lehrpläne scheiterten aber an unterschiedlichen Auffassungen.
Alle diese Maßnahmen wurden nach 1938 auch in der »Ostmark« umgesetzt. Das Wiedervereinigungsgesetz mit dem Deutschen Reich sah die Einführung der deutschen Rechtsvorschriften vor, die durch eine Reihe von Verordnungen vorgenommen wurde. Mit der 1. Verordnung über die Einführung fürsorgerechtlicher Vorschriften im Lande Österreich (1938) wurden die Fürsorgerecht (Fürsorgepflicht, Anspruchsberechtigung, Ausmaß der Unterstützung) deutschen Vorschriften angeglichen, mit der 2. Verordnung (1939) die Organisation der Fürsorge. In den Ländern wurden durch die Fürsorgeüberleitungsverordnung die Rechtsvorschriften angepasst. Das Heimatrecht wurde beseitigt und durch das Aufenthaltsprinzip ersetzt. Als unterste Organisationseinheiten wurden Bezirksfürsorge-Verbände (B-FV) eingerichtet, denen die Landesfürsorge-Verbände (L-FV) der sieben »Reichsgaue« gegenüber standen. Unterstützungsanträge waren beim Fürsorgeamt des jeweilig B-FV oder beim Bürgermeister einzubringen. Die allgemeine Fürsorge war für nach der 2. Verordnung für die "früheren Ortsarmen" und die "Wohlfahrtserwerblosen" (Personen ohne Arbeitslosenunterstützung) gedacht, die "vermeintlich anständigen ‚Volksgenossen' " (Melinz 2003, 150). Daneben gab es eine um 25% höhere gehobene Fürsorge, die im nationalsozialistischen Sinn besonders "würdigen" Personen zugestanden wurde. Das konnten Kleinrentner sein, oder Kriegsversehrte und deren Hinterbliebene. Die von den Versorgungsämtern ausbezahlte soziale Fürsorge galt ebenfalls den Kriegsgeschädigten. Die außerordentliche Fürsorge war unter Verwaltung der L-FVen Behinderten vorbehalten.
Durchgängige und durchorganisierte Grundlage nationalsozialistischer Fürsorgepolitik war die erbbiologische und rassenhygienische Ideologie. »Um der Gesunderhaltung unseres Volkes willen muss darum eine nationalsozialistische Volkswohlfahrt eine Befürsorgung Minderwertiger ablehnen bzw. auf eine Mindestmaß einschränken unter gleichzeitiger Abdrosselung des kranken Erbstroms« (Althaus 1935, zit.n. Landwehr/Baron 1983, 175). Bedürftige nicht arischer Abstammung wurden ab 1938 völlig von der Fürsorge ausgeschlossen. »Minderwertige« sollten ausgeschieden werden, die »Wertvollen« dagegen wurden besser versorgt: 1938 wurde die Sozialversicherung zur Volksversicherung ausgebaut, die Handwerker wurden in die Rentenversicherung und die Rentner in die Krankenversicherung einbezogen. 1941 wurden die Richtsätze der Volksfürsorge für die »erbgesunde« deutsche Bevölkerung erhöht, nach Kriegsbeginn wurden die Kriegsopferversorgung und der Unterhalt für die Familien Wehrpflichtiger aufgewertet.
Das Hilfswerk Mutter und Kind (MuK), sollte Familienfürsorge auf erbbiologischer Grundlage betreiben. Es wurde ein Netz von Hilfs- und Beratungsstellen aufgebaut, bereits 34.000 im Jahr 1941. Die Ziele des MuK waren rassenhygienisch - nur »wertvolles« Leben wurde gefördert, krankes, schwaches, minderwertiges sollte ausgemerzt werden. Deutsche Frauen sollten ihre Bestimmung in der Mutterschaft erkennen und möglichst viele deutsche Kinder gebären.
In der Zielsetzung "alles Kranke auszumerzen" zeigt sich die dominierende Richtung nationalsozialistischer Wohlfahrtspolitik: eine sozialdarwinistische Ideologie, eugenisch bis zur Sterilisation und Liquidation Behinderter, rassistisch bis zum Genozid. Schon vor der Machtübernahme der Nazis hatten konservative Ideologen »die Züchtung des risikolosen Massenmenschen« durch die soziale Fürsorge gegeißelt, und Fürsorgeempfänger als »meistens körperlich und geistig Minderwertige, Kranke und Asoziale« gebrandmarkt, »die die Fürsorge häufig in der unerhörtesten Weise ausbeuten« und für die man »gesunde und vollwertige Personen nicht opfern« darf (Jens Paulsen im Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 1929, zit. n. Sachße/Tennstedt 1992, 48). Den »Stamm der Fürsorgeempfänger«, heißt es in einer 1932 veröffentlichten Schrift über die »lrrwege der Sozialen Fürsorge«,
bilden allenthalben körperlich oder geistig, meistens körperlich und geistig Minderwertige, Kranke und Asoziale, die die Fürsorge häufig in der unerhörtesten Weise ausbeuten. Für diese Personen darf man Gesunde und Vollwertige jedenfalls nicht opfern (zit.n. ebd., 654).
Solchermaßen »defekte Menschen« (Hitler, Mein Kampf 1934, 279) sind für den nationalsozialistischen Staat ein unerträglicher Kostenfaktor, der abgebaut werden muss:
Bei der überaus starken Belastung unseres Volks mit Steuern, Sozialabgaben und Zinsen dürfen wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, daß der Staat an einen Umbau der gesamten Gesetzgebung und eine Verminderung der Lasten für Minderwertige und Asoziale heranzugehen haben wird. Wie sehr die Ausgaben für Minderwertige, Asoziale, Kranke, Schwachsinnige, Geisteskranke, Krüppel und Verbrecher heute das Maß dessen überschreiten, was wir unserer schwer um ihre Existenz ringenden Bevölkerung zumuten dürften, ersehen wir aus den Kosten, die heute vom Reich, von den Ländern und den Kommunen zu ihrer Versorgung aufgebracht werden müssen [...] Es kostet der Geisteskranke etwa 4 RM den Tag, der Verbrecher 3,50 RM, der Krüppel und Taubstumme etwa 5 - 6 RM den Tag, während der ungelernte Arbeiter nur etwa 2,50 RM, der Angestellte 3,60 RM, der untere Beamte etwa 4 RM den Tag zur Verfügung haben. Das sind Folgen einer übertriebenen Fürsorge für das Einzelindividuum, die den Arbeitswillen der Gesunden ertöten und das Volk zu Rentenempfängern erziehen muß. Andererseits belasten sie die wertvollen Familien derart, daß Abtreibung und Geburtenverhütung die Folge davon sind. Was wir bisher ausgebaut haben, ist also eine übertriebene Personenhygiene und Fürsorge für das Einzelindividuum ohne Rücksicht auf die Erkenntnisse der Vererbungslehre, der Lebensauslese und der Rassenhygiene. Diese Art moderner Humanität und sozialer Fürsorge für das kranke, schwache und minderwertige Individuum muß sich für das Volk im großen gesehen als größte Grausamkeit auswirken und schließlich zu seinem Untergang führen.
Um das drohende Unheil abzuwenden, ist eine Umstellung des gesamten öffentlichen Gesundheits-wesens, des Denkens der Ärzteschaft und eine Wandlung der Aufgaben unter dem Gesichtspunkt der Rassenhygiene, der Bevölkerungs- und Rassenpolitik vonnöten. Erst wenn der Staat und das Gesundheitswesen als Kern ihrer Aufgaben die Vorsorge für die noch nicht Geborenen anstreben, können wir von einer neuen Zeit und von einer aufbauenden Bevölkerungs- und Rassenpolitik reden" (aus einer Rede Wilhelm Fricks, zit.n. Sachße/Tennstedt 1992, 50 f.).
Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen, das die Zwangsterilisation »erbkranker« Menschen vorsieht. Auch dieses Gesetz hatte seinen Vorlauf in der medizinischen Lehre und in der Politik der präfaschistischen Ära: Bereits 1932, also vor Hitlers Macht-ergreifung, war der preußischen Regierung ein Entwurf für ein Reichssterilisationsgesetz vorgelegt worden, das eine - allerdings freiwillige - Sterilisation erbkranker Menschen vorsah.
Wenige Monate nach Hitlers Amtsantritt sorgte aber nun ein eingefleischter Nationalsozialist, der gerade neu ernannte preußische »Sonderkommissar für Volksgesundheit«, Dr. Leonardo Conti, dafür, dass mit Dr. Arthur Gütt ein bisheriger Außenseiter innerhalb der Ärzteschaft auf einen einflussreichen Posten in der Abteilung Volksgesundheit des Reichsinnenministeriums gelangte. Gütt, der bereits im Jahre 1923 Kreisleiter der NSDAP gewesen war und ein Jahr später Hitler seine selbstverfassten »rassenpolitische[n] Richtlinien« zur »Unfruchtbarmachung kranker und minderwertiger Menschen« hatte zukommen lassen, umgab sich mit einer Gruppe von Bevölkerungs- und Rassen-»Experten«.
Gemeinsam überarbeiteten sie bis zum Juli den im Vorjahr im preußischen Gesundheitsamt vorbereiteten Gesetzentwurf so, dass er nun als entscheidenden Punkt die zwangsweise Sterilisation von Menschen mit den unterschiedlichsten physischen oder psychischen Erbkrankheiten (einschließlich chronischem Alkoholismus) vorsah. Mit der Vorbereitung des Gesetzes, von dem nach offizieller Darstellung sowohl die einzelne Familie als auch die Gesellschaft insgesamt profitieren sollte, hatte Hitler direkt nichts zu tun. Die Vorbereitungsarbeit geschah aber indem Bewusstsein, dass man damit den von Hitler geäußerten Ansichten entsprach. Und als der Entwurf dem Kabinett vorgelegt wurde, erhielt er trotz der Einwände Papens, dem die Haltung der Katholiken zum Gesetz Sorgen bereitete, gleich die Zustimmung des Reichskanzlers. Vom Appell des Vizekanzlers, Sterilisationen nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen zuzulassen, wollte Hitler nichts wissen und sagte apodiktisch, dass »alle Maßnahmen berechtigt« seien, die »der Erhaltung des Volkstums dienten«. Die vorgesehenen Schritte seien vom Umfang her gering und außerdem - wie er mit merkwürdiger Logik hinzufügte - »auch moralisch unanfechtbar, wenn man davon ausgehe, daß sich erbkranke Menschen in erheblichem Maße fortpflanzten, während andererseits Millionen erbgesunder Kinder ungeboren blieben«. Vom nationalsozialistischen Standpunkt aus stellte dieses Gesetz zwar nur einen ersten bescheidenen rassenpolitischen Eingriff dar, die Folgen waren aber alles andere als geringfügig: Bis zum Ende des Dritten Reiches wurden gemäß den Bestimmungen des »Erbgesundheitsgesetzes« rund 400.000 Opfer zwangssterilisiert (Kershaw 2002, Bd.1, 615)
Erbkrank im Sinn dieses Gesetzes ist, "wer an angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem (manisch-depressivem Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem Veitstanz, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit oder schwerer erblicher körperlicher Missbildung" leidet (Sachße/Tennstedt 1999, 10 1). Auch schwerer Alkoholismus gilt als Indikation.
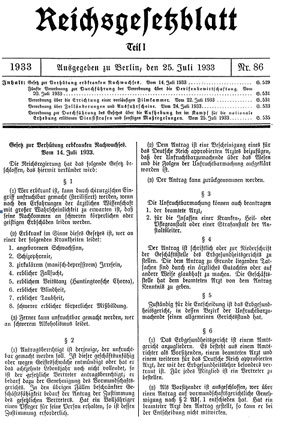
Faksimile: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
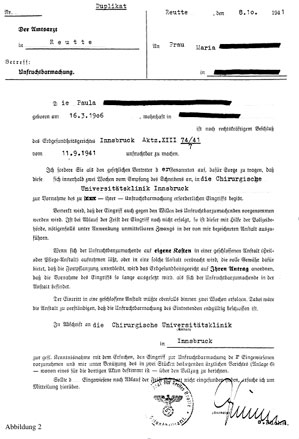
Faksimile: Bescheid zur »Unfruchtbarmachung«
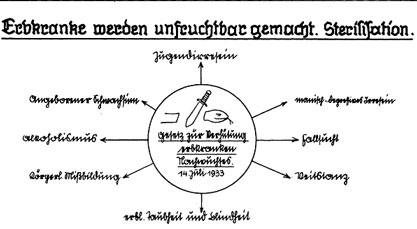
Faksimile: Schulbuchillustration »Erbkranke werden unfruchtbar gemacht«
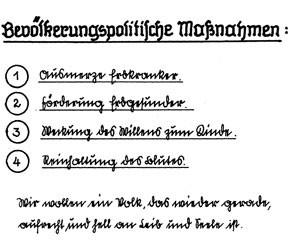
Faksimile: Schulbuchillustration »Bevölkerungspolitische Maßnahmen«

Faksimile: Schulbuchillustration »Bastarde o. Mischlinge unter den Menschen«
Bezüglich der katholischen Kirche mussten die Nationalsozialisten sich keine Sorgen mehr machen. Eine Woche vor dem Kabinettsbeschluss des Sterilisierungsgesetzes war das Reichskonkordat mit dem Vatikan paragrafiert worden. "Das Konkordat sollte am 20. Juli mit großem Pomp unterzeichnet werden" (Kershaw 2002, Bd.1, 616). Am 10. September wurde es vom Vatikan ratifiziert.
1935 wird das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre erlassen, das die Ehe zwischen Juden und Deutschen verbietet. Ebenfalls 1935 das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, das »Erkrankten« im Sinne des Gesetzes die Ehe untersagt. Durch das 1935 erlassenen Reichsgesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens wurden die Gesundheitsfürsorgerinnen den Amtsärzten unterstellt. Sie hatten »durch Hausbesuche und in den Beratungsstunden die Ermittlungen und Feststellungen zu unterstützen«, die von Ärzten im Sinn der »Erb- und Rassenpflege« anzustellen waren. Die Sozialarbeiter/innen waren verpflichtet, Anzeigen und Berichte im Sinne des »Blutschutzgesetzes« und des »Ehegesundheitsgesetzes« zu erstatten. Institutionelle Basis dieser Rassenpolitik sind die neu gegründeten Gesundheitsämter.
Das Gesundheitsamt hat die natürliche Bevölkerungsbewegung in seinem Bezirk zu verfolgen, das wertvolle Erbgut in unserem Volke zu pflegen und hierauf insbesondere bei der Eheberatung zu achten. Es hat die im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses dem beamteten Arzt übertragenen Aufgaben zu erfüllen und bei der Bekämpfung des Geburtenrückgangs nachdrücklich mitzuwirken. [...] Die gesundheitliche Volksbelehrung, durch die allgemein anerkannte Grundsätze auf dem Gebiete des Gesundheitswesens und der Erblehre und Rassenpflege Gemeingut der Bevölkerung werden sollen, ist vom Gesundheitsamt im engen Einvernehmen mit den die gleichen Ziele verfolgenden Organisationen der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei durchzuführen. Eine Unterstützung durch die frei praktizierenden Ärzte ist anzustreben. (RGBI. 1935, S. 177 f., zit.n. Zeller 1994, 165).
Wesentliches Element der Strategie zur Durchsetzung nationalsozialistischer Politik ist die Bindung so lebenswichtiger und unvermeidlicher Lebensvorgänge wie Geburt, Eheschließung, etc. an staatliche Genehmigungen. Zunächst erfolgten die amtsärztlichen Überprüfungen bei Anträgen auf das Ehestandsdarlehen, ab Jänner 1935 war bei allen Verehelichungen eine Begutachtung der »Ehetauglichkeit« gesetzlich vorgeschrieben. Der Bericht einer bei der Beratungsstelle für Erb- und Rassenpflege in Berlin angestellten Volkspflegerin aus dem Jahr 1938 zeigt, wie penibel, einerseits, und wie routinemäßig, andererseits, diese menschenfeindlichen Kontrollen gehandhabt wurden. »Im ganzen«, schreibt die Berichterstatterin, »ist die Arbeit in der Erb- und Rassenpflege überaus interessant und abwechslungs-reich, besonders durch das Verhandeln mit den verschiedensten Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, mit Gesunden und Kranken.« Das sei es auch, »was einen immer wieder für das feheln des Azßendienstes entschädigt« (Archiv der Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik Berlin-Schöneberg 1986. Zit.n. Zellere 1994, 214):
Der Standesbeamte fordert bei der Bestellung des Aufgebotes die Beibringung eines Ehetauglichkeitszeugnisses, sei es auf Grund seiner eigenen Feststellungen bei dem üblichen Befragen, sei es auf Veranlassung des Gesundheitsamtes. Auch wenn der Grund für das Sperren des Aufgebotes nur bei einem der Verlobten liegt, müssen sich beide bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt der Untersuchung unterziehen. Außer dieser ärztlichen Untersuchung wird von der Beratungsstelle aus eingehende Sippenforschung getrieben, und zwar hauptsächlich durch die Verkartung der nächsten Famlienangehörigen - Eltern und Geschwister - nach den Richtlinien für die Tätigkeit der Erb- und Rassenpflege aus dem Jahr 1938, das bedeutet die Benachrichtigung der Gesundheitsämter der Geburtsorte der Einzelnen.
Außerdem gehört selbstverständlich zu der Bearbeitung die Einsichtnahme von Akten, die über das Leiden bzw. über die Lebensführung der Prüflinge Auskunft geben können. Es werden z.B. regelmäßig die etwa bestehenden Akten der Bezirksfürsorge eingesehen. Auch geht immer eine Anfrage an die Erbbiologische Zentralkartei im Hauptgesundheitsamt, die ja gleichzeitig Geburtsortkartei für alle Berliner Bezirke ist, so dass von dort mitgeteilt werden kann, ob und wo weitere Vorgänge über den Betreffenden vorhanden sind. Nach Abschluss der Ermittlungen wird das Ehetauglichkeitszeugnis bzw. die ablehnende Bescheinigung, wenn ein Ehehindernis vorliegt, ausgestellt, und zwar vom Gesundheitsamt der Braut.
Im Falle einer Ablehnung ihres Antrages auf das Ehetauglichkeitszeugnis haben die Verlobten die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung von den Vorschriften des Ehegesundheitsgesetzes beim Polizeipräsidenten Berlin zu stellen. Nach der schriftlichen Antragstellung reicht das Gesundheitsamt unter Beifügung sämtlicher vorhandenen Akten und Unterlagen einen eingehenden Bericht einschließlich eigener Stellungnahme ein.
Häufig wird den Verlobten bei Aushändigung der ablehnenden Bescheinigung vom Arzt direkt der Rat gegeben, einen Befreiungsantrag zu stellen. Will z.B. eine Unfruchtbargemachte einen Mann heiraten, der nach dem Ergebnis der Untersuchung sowie der angestellten Ermittlungen erbbiologisch wenig wertvoll erscheint, ja, vielleicht sogar erheblich belastet ist, so wird zunächst wiederum die Ehe verboten werden müssen, da formell bei der Braut ein Ehehindernis besteht. Ein Befreiungsantrag würde aber auf jeden Fall befürwortet und vom Polizeipräsidenten auch bewilligt werden, da durch eine Eheschließung dieser beiden Verlobten wertvolles Erbgut dem Volksganzen nicht verloren gehen würde. Solche ähnlichen Fälle gäbe es noch viele aufzuzählen (Archiv der Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik Berlin-Schöneberg 1986. Zit.n. Zeller 1994, 214)
Die Gesetze erhielten auch in Österreich Geltung. In der von Hans Pfundtner und Reinhard Neubert herausgegebenen Sammlung des Neuen deutschen Rechts heißt es dazu:
So wie der Nationalsozialismus unser Volk vor dem Hinabrollen in den Abgrund des Bolschewismus bewahrt hat, so ist es auch Aufgabe der nationalen Regierung, das deutsche Volk vor dem drohenden Rassentod zu bewahren. Es ist nicht nur der Rückgang in der Volkszahl, der zu den schwersten Bedenken An-lass gegeben hat, sondern in gleichem Maße die mehr und mehr in Erscheinung tretende Beschaffenheit unseres Volkes. Während die erbgesunden Familien mit ganz geringen Ausnahmen zum Ein- und Kein-Kind-System übergegangen waren, pflanzten sich unzählige Minderwertige und erblich Belastete fort, deren kranker und asozialer Nachwuchs der Gesamtheit zur Last fällt (Pfundtner/Neubert 1938, zit.n. Talos 1981, 293 f).
Dementsprechend wurde bei bestimmten Krankheiten und Behinderungen Sterilisation und Eheverbot vorgeschrieben, für den »erbgesunden« Nachwuchs dagegen wurden die Mutterschutzbestimmungen erweitert. Nur mehr gesunde und leistungsfähige Arme hatten Anspruch auf Unterstützungen der NSV, die »Minderwertigen« und »Erbkranken« wurden nach Überprüfung durch die neu geschaffene Bürokratie des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ausgeschlossen.
1934 wird gegen den Widerstand des Finanzministeriums, der Kommunen, Teile der NSDAP und der NSV das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens beschlossen, das dem Staat die Ober-hoheit über alle Gesundheitseinrichtungen verschafft, womit die rassistische Gesundheitspolitik flächendeckend durchgesetzt werden sollte. Die Kontrolle der »Erbgesundheit« wird allen Maßnahmen der Fürsorge und vielen staatlichen Akten (Eheschließung, Anstellung, medizinische Behandlung usw.) vorgeschaltet, um die »Ausmerzung« der »Minderwertigen« zu beschleunigen. Massenhafte Zwangs-sterilisierungen sind die Folge. Allein im Jahr 1937 führten die Gesundheitsämter 2,502.554 solcher Überprüfungen durch. Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Anstaltleiter - sie allen waren verpflichtet, verdächtige Wahrnehmungen zu anzuzeigen und kamen dieser Verpflichtung eifrig nach.
Bereits in Mein Kampf war Hitler für die Sterilisierung unheilbar Kranker eingetreten:
Es ist eine Halbheit, unheilbar kranken Menschen die dauernde Möglichkeit einer Verseuchung der übrigen gesunden zu gewähren. [...] Die Forderung, dass defekten Menschen die Zeugung anderer ebenso defekter Nachkommen unmöglich gemacht wird, ist eine Forderung der klarsten Vernunft. [...] Hier wird man, wenn nötig zur, unbarmherzigen Absonderung unheilbar Erkrankter schreiten müssen - eine barbarische Maßnahme für den unglücklich davon Betroffenen, aber ein Segen für die Mit- und Nachwelt (Hitler, zit.n. ebd., 352)
1935 kündigte Hitler auf Drängen des Reichsärzteführers Gerhard Wagner an, "er werde im Falle eines Krieges »die Euthanasiefragen aufgreifen und durchführen«, weil »ein solches Problem im Kriege glatter und leichter durchzuführen ist«. Widerstand, der von Seiten der Kirchen zu erwarten sei, würde dann weniger Wirkung haben als in Friedenszeiten" (ebd., 353 f.)
Die »Vernichtung unwerten Lebens« war lang vorher von Juristen und Psychiatern wie Karl Bundung und Alfred Hoche gefordert worden. Ihr Argument war ein ökonomisches: Staatliches Geld sollte nicht für jene ausgegeben werden, die nichts zur Produktivität beitrugen, sondern nur eine Belastung waren. Mit der von Hitler erteilten Erlaubnis bekam jene Minderheit von Ärzten in überfüllten und unterdotierten psychiatrischen Anstalten Oberwasser, die schon bisher die Tötung unheilbar Kranker gefordert hatten.
Die Mentalität, die zur Tötung der Geisteskranken führte, war keine Schöpfung Hitlers. Besonders nach der katastrophalen Reduzierung öffentlicher Mittel während der Jahre der Wirtschaftskrise hatte die Errichtung der Diktatur ab 1933 den Freibrief für Ärzte und Psychiater geliefert, das bislang Undenkbare zu denken. Ansichten von Minderheiten, die selbst in einer krisengeplagten Demokratie noch eingedämmt wurden, konnten nun zur Mehrheitsströmung werden. Der Prozess gewann an Tempo. Im Jahre 1939 spürten Ärzte und Pfleger, die mit den psychiatrischen Anstalten zu tun hatten, was nun erwartet wurde. Das gleiche galt von der ärztlichen Bürokratie, die die Zahnräder der Tötungsmaschinerie schmierte. Das Meinungsklima in der allgemeinen Öffentlichkeit war zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr ungünstig. Wenn es auch starke Vorbehalte gegen die Euthanasie gab, insbesondere unter Menschen mit kirchlichen Bindungen, so waren doch andere dafür, vor allem, so scheint es, wenn es um geisteskranke oder behinderte Kinder ging. Die Menschen waren zumindest bereit, das schreckliche Geschehen passiv hinzunehmen" (ebd., 351 f.)
Nach 1935 begann Gerhard Wagner die Bevölkerung auf das Euthansieprogramm vorzubereiten:
Offensichtlich ermutigt durch Hitlers Bemerkung über die Aussicht auf ein Euthanasieprogramm im Krieg, trieb Reichsärzteführer Wagner Diskussionen darüber voran, wie die Bevölkerung darauf vorbereitet werden solle. Es wurden Berechnungen über die Kosten der Unterhaltung der Geistes- und Erbkranken veröffentlicht, die suggerierten, dass mit den gewaltigen Ressourcen, die auf »nutzlose Esser verschwendet« würden, für das Volk viel Gutes getan werden könne. Man schickte Kameraleute in die Irrenhäuser, um das deutsche Publikum mit geeigneten Filmsequenzen zu schockieren und es von der Notwendigkeit zu überzeugen, die als Abschaum der Gesellschaft Vorgeführten zum Wohle der gesamten Bevölkerung zu vernichten. Das Rassenpolitische Amt der NSDAP produzierte zwischen 1935 und 1937 fünf Stummfilme dieser Art. Hitler schätzte einen dieser Streifen, »Erbkrank«, hergestellt 1936, so sehr, dass er eine Folgeproduktion als Tonfilm unter dem Titel »Opfer der Vergangenheit« in Auftrag gab und dafür sorgte, dass er 1937 in allen deutschen Kinos gezeigt wurde.
1936 wurden die Kirchen gezwungen, die Patienten ihrer Heilanstalten in staatlich kontrolliert psychiatrische Anstalten zu verlegen, die dadurch noch mehr überfüllt wurden. Ab 1938 gab es in der »Kanzlei des Führers der NSDAP«, einer vor allem mit den an Hitler gerichteten Briefen der Bevölkerung befassten Einheit, entschiedene Bemühungen, die Euthanasie in die Praxis umzusetzen. Man legte ihm Briefe von Eltern vor, die um den »Gnadentod« für ein schwer behindertes Kind baten. Hitler erteilte in solchen Einzelfällen den Ärzten persönlich die Vollmacht, "die Euthanasie in seinem Namen durchzuführen" (ebd., 356). Es wurden Studien zur Durchführbarkeit des Euthanasieprogramms gemacht, sowie ein Gutachten zur Reaktion der Kirchen in Auftrag gegeben. In diesem gab der Moraltheologe der Philosophisch - Theologischen Akademie Paderborn, selbst ein Verfechter der legalen Sterilisierung und der Tötung Geisteskranker zu erkennen, "dass ein geschlossener Widerstand der katholischen Kirche nicht zu erwarten sei" (ebd., 357). Nach dem Überfall auf Polen und damit dem Beginn des Krieges autorisierte Hitler den Massenmord an Geisteskranken. Sein dies bezügliche schriftlich Anweisung wurde höchst geheim gehalten, Widerstand dagegen führte zum Amtsverlust.
"Irgendwann im Oktober ließ Hitler eine seiner Sekretärinnen auf seinem persönlichen Briefpapier und zurückdatiert auf den 1. September 1939, also den Tag des Kriegsausbruchs, einen einzigen Satz tippen:
Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann.
Hitler griff dann nach einem Federhalter und schrieb seinen Namen unter dieses lapidare, pauschale Todesurteil" (Kershaw 2002, Bd.2, 349)
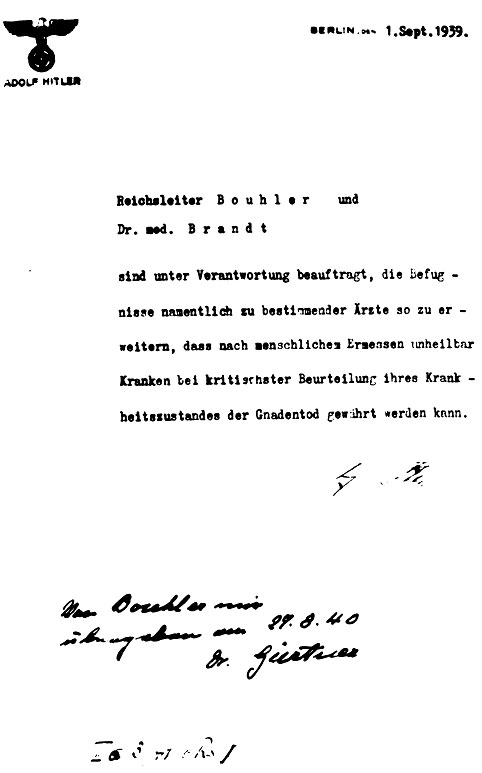
Faksimile: »Führerbefehl« zur Gewährung des »Gnadentodes«
Damals war die Tötung von Geisteskranken, die Hitler zuvor mündlich autorisiert hatte, bereits eine Weile im Gange. Es entsprach weder Hitlers Stil noch seinem Instinkt, todbringende Anordnungen in schriftlicher Form zu erteilen. Der Grund, warum er das in diesem Fall - und nur dieses eine Mal - tat, hing mit den Schwierigkeiten zusammen, die sich in einem Land ergaben, das vermeintlich immer noch ein Rechtsstaat war. Es ging also um das Dilemma jener, die ohne klare Autorisierung versuchten, insgeheim eine Organisation zur Realisierung eines mörderischen Auftrags zu schaffen. Doch selbst unter diesen Umständen wurde dafür gesorgt, dass möglichst wenige Personen von schriftlicher Mordvollmacht wussten. Erst zehn Monate später, am 27. August 1940, bekam schließlich der Reichsminister der Justiz, Franz Gürtner, ein Faksimile dieses von Hitler erteilten Auftrags zu sehen. Der Minister sah sich inzwischen wachsender Kritik ausgesetzt, denn unvermeidlicherweise sickerte mehr und mehr über Vorgänge, die als gesetzwidrig angesehen wurden, in die Öffentlichkeit durch (ebd.).
Ein »Führerbefehl« hatte für Nationalsozialisten Rechtskraft. Wer sich ihm widersetzte wurde seines Amtes enthoben:
Tatsächlich gab es für die ergriffenen Maßnahmen keine rechtliche Grundlage. Hitler weigerte sich ausdrücklich, ein Euthanasiegesetz zu schaffen, und wollte so der Entstehung einer lästigen Bürokratie und gesetzlichen Einschränkungen entgegenwirken. Selbst nach den Rechtsauffassungen der NS-Zeit konnte Hitlers schriftlich erteilter Auftrag nicht als formaler Führererlass betrachtet werden. Es konnte daher nicht den Charakter eines Gesetzes besitzen. Aber ein Führerbefehl, welche rechtliche Bedeutung er auch immer haben mochte, wurde dennoch als verbindlich betrachtet. Dies galt auch für Reichsjustizminister Gürtner. Nachdem er einmal mit eigenen Augen gesehen hatte, dass Hitlers Wille hinter der Liquidierung der Geisteskranken stand und dass diese Maßnahme nicht das Werk von untergeordneten Größen der Partei war, die ohne Vollmacht handelten, gab er seine Versuche auf, aus rechtlichen Erwägungen die Tötungen zu blockieren oder zu regeln. Lothar Kreyssig, ein mutiger Amtsgerichtsrat, hatte wegen des krassen Unrechtscharakters der Aktion Protestbriefe an den Reichsjustizminister geschrieben. Nachdem man ihm Hitlers Autorisierung zeigte, hatte Kreyssig betont, dass selbst auf der Grundlage der positiven Rechtstheorie Unrecht nicht Recht werden konnte. Daraufhin erteilte ihm Gürtner eine sehr einfache Antwort: »ja, wenn Sie den Willen des Führers als Rechtsquelle, als Rechtsgrundlage nicht anerkennen können, dann können Sie nicht Richter bleiben«. Kreyssig wurde kurz darauf in den Ruhestand versetzt (ebd. 350).
Noch vor Hitlers schriftlicher Anweisung war das Euthanasieprogramm angelaufen. Seitens der Ärzte wurde angegeben, dass etwa 60.000 Patienten »in Frage kommen würden« (ebd., 358). Es wurde die Reichsarbeitsgemeinschaft der Heil- und Pflegeanstalten gegründet, die die Anzahl der zu Tötenden in den Krankenanstalten erhob und über die Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft die Transporte organisierte. Sitz dieser Organisationen war Berlin, Tiergartenstraße 4, weshalb die gesamte Organisation den Decknamen T4 erhielt. Hitler verlangte strengste Geheimhaltung und »eine komplett unbürokratische Lösung des Problems« (ebd., 358).
Das ärztliche Personal der Hell- und Pflegeanstalten traf unter den eigenen Patienten die Auswahl für die Einbeziehung in die Euthanasieaktion. Auch diese Mediziner »arbeiteten dem Führer entgegen«, ob dies nun ihre bewusste Motivation war oder nicht. Die Namen derjenigen Patienten, die für die Euthanasie vor-gesehen waren, wurden mit einem roten Kreuz markiert. Die verschont bleiben sollten, versah man mit einem blauen Minuszeichen. Die Tötungen, meist unter Einsatz von Kohlenmonoxyd, wurden von Ärzten durchgeführt, die nicht zur Teilnahme gezwungen waren. Die Morde fanden in ausgewählten Anstalten statt, darunter Grafeneck, Hadamar, Bemburg, Brandenburg, Hartheim und Sonnenstein.
Während der T4-Aktion erkannte der Gauleiter von Pommern, Franz Schwede-Coburg, sehr schnell die neuen Möglichkeiten. Er arbeitete im Oktober 1939 eng mit der SS zusammen, um die Anstalten in der Nähe der Ostseestädte Stralsund, Swinemünde und Stettin zu »säubern«. Es sollte Platz für Volksdeutsche aus dem Baltikum sowie für eine SS-Kaserne in Stralsund geschaffen werden. Die Patienten wurden aus den Heimen geholt, nach Neustadt in der Nähe von Danzig transportiert und dort durch Kommandos von SS-Leuten erschossen. Gauleiter Erich Koch übernahm dieses Verfahren sofort. Er sorgte dabei auch für die Bezahlung der Kosten der »Evakuierung« von 1.558 Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten in seinem Gau Ostpreußen, die von einem SS-Trupp liquidiert wurden, der von Wilhelm Koppe zur Verfügung gestellt wurde, dem neuernannten Polizeichef in Arthur Greisers Reichsgau Posen. Hier handelte es sich um das »Sonderkommando Lange«, das bald in Greisers eigenem Gau eingesetzt werden sollte und sich versuchsweise mobiler Gas-LkWs bediente, um die Geisteskranken in diesem Teil des annektierten Polen zu töten. Bis Mitte 1940 hatten diese regionalen »Aktionen« das Leben von schätzungsweise l0.000 Opfern gekostet.
Im August 1941 wurde die Aktion T4 eingestellt, genauso heimlich, wie sie begonnen wurde. Die von den Ärzten im Spätsommer festgelegte Zahl von zu tötenden Zielpersonen war bereits überschritten. Im Rahmen der Aktion T4 sollen bis zu diesem Datum 70.000 bis 90.000 Patienten Hitlers Euthanasieprogramm zum Opfer gefallen sein. Da die Tötungen sich weder auf die Aktion T4 beschränkten noch 1941 mit der Einstellung dieser Maßnahme endeten, dürfte die Gesamtzahl der Opfer der nationalsozialistischen Bestrebungen zur Liquidierung von Geisteskranken nahezu das Doppelte der genannten Zahlen betragen haben. (ebd., 358 f.).
Die bürgerliche Frauenbewegung und die beruflichen Sozialarbeiter/innen setzten der nationalsozialistischen Machtübernahme kaum Widerstand entgegen: "Die Hoffnungen auf das neue Regime und die Bereitschaft zur Kooperation mit ihm waren groß und verbreitet" (ebd., 188):
Wir stehen an einer Zeitenwende. Was unser Vaterland in den letzten Wochen der nationalen Erhebung erlebt hat, greift tief in unser persönliches Leben ein, aber nicht minder tief in unsere berufliche Arbeit. Wir Sozialarbeiter sind schicksalsverbunden mit unseres Volkes Not und seiner Sehnsucht nach Aufstieg und Größe. Wir nehmen leidenschaftlichen Anteil an dem Geschehen der Zeit. Jeder Einzelne ist bereit zu Opfern und zu restloser Hingabe an Volk und Vaterland. Wir begrüßen den Willen der Regierung zum Ausgleich der Klassengegensätze, zur Ertüchtigung der Jugend, zur Gesundung der Familie. Alle unsere Arbeit war schon in der Vergangenheit Dienst am Volke, Pflege der Jugend und Familienhilfe. Dem großen Werk des sozialen und kulturellen Aufbaus Deutschlands war unser Leben immer geweiht, und auch die Zukunft wird uns bereit finden zu starkem Helferwillen für alle Schichten des deutschen Volkes" (Erläuterung der Vorsitzenden der Berufsverbände, Helene Weber, an ihre Mitglieder, 1933, zit.n. ebd.).
Soziale Arbeit bleibt auch unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Diktatur "Ausdruck und Teil der Gesellschaft, in der sie auf vielfältige Weise wirkt" Die "Verstrickung der Sozialen Arbeit in die menschenverachtende Praxis des Dritten Reiches" (Kappeler, 2000, 631) ist erheblich. "Die mögliche Duldung, aktive Beteiligung oder engagierte Verhinderung der nationalsozialistischen Verbrechen an Millionen für abweichend und minderwertig erklärten Menschen werden somit zum unausweichlichen Mittelpunkt jeder deutschen Sozialpädagogik-Geschichte dieses Jahrhunderts" (Schrapper 1993, 273) Der Begriff "Hilfe", der das berufliche Selbstverständnis der sozialen Arbeit konstituiert, erwies sich im NS-Staat als "ein in wechselnden politischen und weltanschaulichen Konstellation beliebig zu verwendender Joker" (Kappeler 2000, 634).
Infolge einer Umbewertung sogenannter problematischer Fürsorgegruppen (z.B. Suchtkranke, Behinderte, Obdachlose, Arbeitsunwillige etc.) begrüßten jetzt auch zahlreiche Fürsorgerinnen in offiziellen Verlautbarungen die veränderten Aufgabenstellungen »im neuen Staat«.
Erb- und Rassenpflege, Mütterschulung und Säuglingsfürsorge bildeten nun die Grundlagen der NS-Volkspflege. Die veränderten Zielsetzungen einer Volkspflege wurden den Fürsorgerinnen und anderen Sozialkräften nicht einfach umstandslos aufgezwungen. Sie sind von vielen Fürsorgekräften auch weitgehend mitgetragen worden. Insofern haben die sozialen Berufskräfte zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie ihren aktiven Beitrag geleistet. Nationalsozialistische Volkspflege hieß also - bei manchen vordergründigen sozialpolitischen Teilerrungenschaften vor allem für »förderungswürdige« (deutsche) Mütter, Kinder und Jugendliche - Rassenhygiene und Einteilung der Hilfsbedürftigen in »wertvolle« und »wertlose« Fürsorgegruppen. NS-Volkspflege bedeutete zunächst »Auslese« und später nach Kriegsbeginn dann in grauenhafter Realisierung bevölkerungspolitischer Zielsetzungen schließlich sogar physische Vernichtung hilfsbedürftiger und wehrloser Menschen (Zeller 1994, 137).
In einem langen 1934 verfassten Brief an den Vormund eines Mündels, das unter das Gesetz zur Verhütung erbkrankens Nachwuchses gefallen war, versucht die evangelische Fürsorgerin Gerda Lucas, »Beauftragte des Staates«, wie sie sich selbst nennt, und »Dienerin am Wort Gottes« zur Akzeptation der Maßnahme - wohl der Zangssterilisation - zu bewegen. Ihre Argumentation ist paradigmatisch, sowohl für die Gewissensnöte, in die Sozialarbeiterinnen durch die nationalsozialistische Ideologie geraten als auch für das Ausmaß der Rationalisierung, mit dem sie ihre Anpassung an das Regime zu recht-fertigen versuchen. Sie könne, schreibt sie, die Not des Vormunds wohl verstehen, glaube aber andererseits, »dass wir diese Notals Gefährdetenfürsorgerinnen der Inneren Mission um des Evangeliums willen und um unseres Volkes willen in uns überwinden müssen« (zit.n. Zeller 1994, 201). Mit großere Selbstverständlichkeit vertritt die Fürsorgerin die Notwendigkeit der Zwangssterilisation im Sinne des Erbgesundheitsgesetzes und den Einsatz der Sozialfürsorgerinnen zu deren Durchführung. Das Gesetz sei eine »für die Gesundung unseres Volkes eine große Hilfe«:
Haben nicht gerade wir Fürsorgerinnen immer schon mit tiefen Sorgen die Massen schwachsinniger, schwer belasteter Menschen beobachtet, deren Schicksal so oft ins Dunkle der Verwahrlosung und Kriminalität verlief und die unser Volksleben aufs schwerste belasteten? Haben wir nicht selbst manches Mal vergeblich mit Kiniken und Ärzten verhandelt ob nicht ein sterilmachender Eingriff dennoch möglich sei, wenn einer unserer gefährdeten Schützlinge bedenkenlos ein lebensschwaches Kind nach dem anderen zur Welt brachte, dessen Dasein nach menschlichem Ermessen für es selbst und seine Umgebung nichts als eine drückende Last sein würde? (ebd.).
Den »scheinbaren« Widerspruch zwischen dem Gebot Gottes und dem Eingriff des Staates versucht sie mithilfe einer Argumentation zu entkräften, die den Staat insgesamt zum Diener der göttlichen Ordnung hochstilisiert:
Wir sind es gewohnt, immer wieder in allen Fragen unserer Arbeit unsere Orientierung am Wort Gottes zu finden, und es ist verständlich, dass wir hier auch in dieser Stunde fragen: Ist der im Gesetz gebotene, weit reichende Eingriff, der den Menschen durch Menschen- und Staatsmacht außerhalb einer vom Schöpfer sehr ausdrücklich gebotenen Funktion: Die Zeugungskraft, mit dem Schöpferwillen Gottes, mit den Geboten des Evangeliums vereinbar? Nicht wahr, hier stehen scheinbar einmal wieder ›Gesetz‹ und ›Evangelium‹ als unvereinbare Gegensätze vor uns, und es ist ja nur gut wenn wir das Unvereinbare mit aller bedrückenden Wucht empfinden. Es ist hier genauso, wie in all den zahlreichen Lebensbezirken, in die der Staat hart und autoritär eingreift, mit einer Gewalt die er sich auch anscheinend selbst gegeben hat. Aber er tut es doch um der irdischen Ordnung willen: ohne ihn würden wir Menschen in unserer schmerzlichen, unaufhebbaren Unvollkommenheit erst recht in Sünde, Chaos und Anarchie verfallen. Darum ist ›die Obrigkeit von Gott gesetzt‹, und wir müssen ihr gehorchen nach Gottes Willen. Wenn menschliche Erkenntnis und Wissenschaft die Möglichkeit schaffen, schlechte Erbmasse aus einem Volk auszuschalten, dann sollen wir diese Errungenschaft als von Gott geschenkt annehmen: wenn der Staat sie ün Gesetz verwertet, dann tut er es um der Gesunderhaltung und Gesundwerdung des Vokes willen, die zu pflegen ihm zur Ausgabe von Gott gesetzt ist (ebd., 201 f.)
Die Zwangssterilisation setzt sie mit »lebensgefährliche Operationen und den Impfzwang« gleich, die Christen ja auch »um der Gesunderhaltung des Einzelnen willen bejahen« würden. Während die Katholiken »aus diesem Dilemma in die reine Luft ihrer Moraltheologie geflüchtet« seine, wüssten sich die Protestanten »mitten in diese Welt gestellt.« Und das hieße einerseits »in vollem Umfang der Obrigkeit zu gehorchen« und andererseits, »in die notwendige Schärfe einer staatlichen Zucht und in die Leid bringenden Tatsachen des Gesetzes die Verkündigung von Erlösung und Gnade, von der ewigen Liebe Jesu Christi zu tragen, die jedes Leid umwandelt und überwindet« (ebd., 202). Mit dieser von ihr postulierten »Doppelstellung des Christen in der Welt« sucht sie dem Widerspruch zwischen dem Gebot Gottes und der Gewalt des Staates zu entgehen und findet letztlich sogar im Leiden an dieser »Paradoxie des Christentums« etwas Gutes: »In den schweren Gängen zu unseren Mündeln im Bereich der Sterilisationsfrage« würden »seltene Möglichkeiten beseligender Verkündigung liegen«, die sie darin sieht, dass es »vor Gott kein lebensunwertes Leben« gibt, »er sieht nur das Herz an und nimmt den zu sich, der ihn von ganzem Herzen liebt« (ebd.).
Hinter diesem Pathos der Verkündigung taucht eine sexualängstlich unterfütterte Law-and-Order-Mentalität auf, die die Gebote Gottes und des Staates auf die gleiche Ebene stellt:
Es gehört ferner auch zum Begriff des Opfers, dass der Sterilisierte tapfer und ohne Wanken die Gefahren bekämpfe, die in seiner neuen Situation liegen: Der Triebhaftigkeit zu verfallen, was bei der Erlahmung seines Geschlechtsempfindens sehr stark im Bereich der Möglichkeit liegt; und dies nun bei unseren Gefährdeten! Das heißt doch für uns: Die Lebensgemeinschaft zwischen Mündel und Vormund noch enger zu knüpfen, und nach dem Eingriff den Kampf gegen alle Versuchungen in dem Schützling noch unbedingter zu führen. Sind wir evangelischen Vormünder nicht geradezu die wichtigsten Mitarbeiter bei diesem Gesetz, weil wir verantwortlich sind für die Gestaltung des Lebens unserer sterilisierten Mündel in Zucht, Ordnung und Ehrfurcht vor den Geboten Gottes und des Staates? (ebd.).
In beidem, »Gott und der Obrigkeit in vollem Umfang zu gehorchen«, bestehe die »Doppelseitigkeit unserer Aufgabe.« Den Inhalt der staatlichen Gesetze in Frage zu stellen, kommt in dieser Sichtweise nicht in den Blick. Wohl auch deshalb nicht, weil die Fürsorgerin mit die Zwangssterilisation »Gefährdeter« für eine notwendige Gesundheitsmaßnahme hält. Mit eben dem doppelten Verweis, auf Gott und Hitler, beendet sie ihr Schreiben.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Doppelseitigkeit unserer Aufgabe, die voll im Diesseits und voll im Jenseits liegt, Ihnen lieb zu machen. Das soll nicht heißen, dass sie damit verkleinert oder bagatellisiert werde. Der Konflikt ist für uns in jedem einzelnen Falle da, weil wir Gott und der Obrigkeit in vollem Umfang zu gehorchen haben. Gott sei Dank, dass dieser Konflikt von uns so ernst genommen wird! Wir müssen durch ihn hindurch; die Frage unserer Gewissenshaltung bleibt nach meiner Erfahrung entscheidend, weil wir eben unseren Mündeln gegenüber in solch vielfältiger Hinsicht verpflichtet sind: nämlich als Beauftragte des Staates, aber auch als Diener am Wort. Dazu helfe uns allen Gott!
In Treue und mit Heil Hitler Ihre [...]
Der folgende Bericht der Referentin im Centralausschuss für Innere Mission, deren oberstem Gremium, der über »Die Sozialarbeiterin in der Volksgemeinschaft« aus dem Jahr 1933 bringt eine so gut wie vollständige Identifikation mit der nationalsozialistischen Wohlfahrtspflege, einschließlich ihrer eugenischen Implikationen zum Ausdruck. (Abgedruckt in: Nationalsozialistischer Volksdienst, Organ der NS-Volkswohlfahrt 1,1933, H3., 67 ff. Zit.n. Zeller 1994, 203 ff.):
Von den gegenwärtigen Wandlungen im Staats- und Volksleben wird in ganz besonderem Maß auch die Wohlfahrtspflege betroffen. Auch bei ihr muss sich zeigen, daß der Nationalsozialismus keine politische Bewegung, sondern eine Welt- und Lebensanschauung ist. Schon heute ist nationalsozialistische Wohlfahrtspflege, wie sie sich vor allem in der NS-Volkswohlfahrt darstellt, ein fest umrissener Begriff. Aus dem Totalitätsanspruch des neuen Staates heraus ist auch die deutsche Wohlfahrtspflege unter nationalsozialistische Führung genommen. Wie auf allen anderen Gebieten, so auch auf dem der Wohlfahrtspflege, hat der Nationalsozialismus bereits in kurzer Zeit den Beweis erbracht, dass wahre Wohlfahrtspflege im nationalsozialistischen Geist zum Sozialismus der Tat führen muss. Denn dazu ist das Winterhilfswerk, zu dem der Führer das ganze deutsche Volk aufrief, geworden. Der Unterschied zwischen der früheren marxistisch-liberalistischen Wohlfahrtspflege und der Volkswohlfahrt von heute, zwischen dem Wohlfahrtsstaat und dem Dritten Reich tritt spürbar zutage und lässt die große Linie deutlich erkennen. Der Nationalsozialismus kämpft nicht gegen die Symptome der Not, sondern er geht den Grundübeln an die Wurzel. Er weicht ab von der marxistischen Auffassung, dass die Schäden unseres Volkes nur in wirtschaftlichen Nöten liegt. Schon die ersten Gesetze des neuen Staates berühren aufs engste die Volkswohlfahrt. Das Arbeitsbeschaffungsgesetz greift, wie kaum ein Gesetz je zuvor, hinein in die Fürsorge für ein Volk. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gibt völlig neue Grundlagen für die Wohlfahrtspflege. Es vollzieht sich die Abkehr von einer irregeleiteten Fürsorge, die ihre Kraft in erster Linie einsetzte für alles Kranke und Schwache, während das Gesunde nicht mehr zu erhalten war. Ein völliger Umbruch muss sich in der Wohlfahrtspflege vollziehen, um diese Arbeit mit der Idee des Nationalsozialismus zu durchdringen, auch da, wo an sich sachlich gute Arbeit geleistet ist oder erste wertvolle Ansätze vorhanden sind.
Die Wohlfahrtspflege hat heute im nationalsozialistischen Staat nur Berechtigung, wenn sie als ein sozialer Dienst am Volke geübt wird, die Volksgemeinschaft bildet.
Als Beauftragte für die Ausübung der durch den Staat geregelten Wohlfahrtspflege tritt den Volksgenossen die Sozialarbeiterin entgegen, sie ist das Bindeglied zwischen dem Auftraggeber und dem Hilfsbedürftigen. Dieses Bindegliedes bedarf es immer, gleich ob es sich um die Fürsorge des Wohlfahrtsamtes handelt oder eines freien Vereins, ob es beamtete Kräfte sind oder ehrenamtliche Helfer. Auch in der nachbarlichen Hilfe von Mensch zu Mensch stehen sich Objekt und Subjekt der Hilfe gegenüber. [...]
In den Kreisen der Sozialarbeiter besteht eine große Bereitschaft zur Mithilfe am Neuaufbau des Staates. Oft haben sie schwer gelitten unter den Methoden eines Wohlfahrtsstaates und besonders unter der ›religiösen Neutralität‹, die zum Kampf gegen das Christentum und bis zum Verbot der Kindergebete und der religiösen Feiern in den Anstalten führte. So haben sich aus diesen Reihen mutige Kämpfer für die Bewegung des Nationalsozialismus gefunden, die heute befreit wieder ihren sozialen Dienst im wahren Sinne tun dürfen. In diesen Kreisen weiß man besonders unserem Führer zu danken, dass er das Christentum als ein Fundament des neuen Staates ansieht. Denn hier liegen die Kräfte für den selbstlosen Dienst am Nächsten, von hier aus ist wieder ein Aufbau und Erstarken der sittlichen Kräfte unseres Volkes möglich.
Die Arbeitsgebiete der Gesundheitsführung, der Bevölkerungspolitik und Rassenpflege stellen neue Anforderungen an die Sozialarbeiterinnen, indem sie ihnen die Aufgabe zuweisen, die praktische Erziehungsarbeit des Volkes, die besonders auch in einer Schärfung der Gewissen bestehen muss, zu tun. Diese wichtigen Gesetze würden zweck- und seelenlos sein, wenn nicht eine große Erziehungsarbeit und ein Aufklärungsdienst einsetzten. Hier muss die Sozialarbeiterin an der Front stehen mit ihren Erfahrungen und mit ihrem Einfluss.
Die Umstellung der Gesundheitsfürsorge auf eine Gesundheitsführung wird gerade auf die Wohlfahrtspflegerinnen befreiend wirken, die unter dem Negativen ihres fürsorgerischen Tuns an aussichtslosen Fällen gelitten haben. Aus der nun einsetzenden vorbeugenden Fürsorge, dem Schutz des Gesunden, wird wieder hoffnungsfreudige Zuversicht für die Arbeit entspringen. Eine wahre Fürsorgerin mit mütterlichem Herzen leidet an der Hoffnungslosigkeit eines ›Falles‹, als sei es ein Glied der eigenen Familie. In dieser seelischen Verbundenheit liegt der so starke Kräfteverbrauch der Sozialarbeiterinnen, die die Not des anderen als eigene tragen und deshalb auch die Not eines ganzen Volkes erfassen können.
Die Fragen der Ausbildung der Sozialarbeiterinnen werden vom Nationalsozialismus aufgegriffen werden müssen. Die junge Generation der Sozialarbeiterinnen muss aus der Idee des Nationalsozialismus heraus geschult werden für die Zukunftsaufgaben einer deutschen Volkswohlfahrt. Es muss abgewichen werden von dem Spezialistentum in der Ausbildung. Ein Einheitstyp der Wohlfahrtspflegerin auf der Grundlage der Familenfürsorge muss geschaffen und Rassenpflege muss im Vordergrund stehen. Vor allem aber muss mit der übersteigerten wissenschaftlichen Ausbildung auf den Wohlfahrtsschulen gebrochen werden, die zu Intellektualismus und Überproblematik führte. Die hauswirtschaftliche Schulung muss vor allem stärker berücksichtigt werden.
Das Fundament des nationalsozialistischen Staates ist die Familie. Der Dienst der Sozialarbeiterin gilt der deutschen Familie und ihrer Gesunderhaltung. So soll auch eine recht betriebene Wohlfahrtspflege den neuen Staat bauen helfen, damit auch sie dazu beitrage, Deutschland wieder stark zu machen, und Deutschland ist stark, wenn sein Volk gesund ist.
Jürgen Reyer (1991) erklärt den äußerst befremdlichen Befund der Funktionallsierung der sozialen Für-sorge für die eugenische und rassistische NS-Politik mit der in der eugenischen Lehre immer schon geforderten Einbeziehung der Fürsorgemaßnahmen in ihre Strategien:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von der rassenhygienischen Argumentation ein Druck ausging in Richtung der Kontrolle der Einrichtungs- und Maßnahmeformen der Sozialhygiene, Sozialen Fürsorge und Wohlfahrtspflege. Nicht umstandslose Abschaffung des auf diesen Gebieten erreichten, sondern dessen Funktionalisierung im Interesse der »Aufartung« und der »kommenden Generationen« war die mittelfristige strategische Perspektive der Rassenhygiene. Funktionalisierung bedeutet dabei vor allem, den Vorrang des Individualprinzips in der Sozialhygiene und Sozialen Fürsorge aufzuheben und alle ihre Leistungen am »generativen Volkswohl« auszurichten (Reyer 1991, 49, zit. n. Kappeler 2000, 63 6).
Da es noch keine eigenständige Fürsorgewissenschaft gab, habe es keine etablierte Instanz gegenüber der Funktionalisierung und Infiltrierung durch die Rassenhygiene und Eugenik gegeben. Manfred Kappeler vermag diese entlastende Erklärung nicht zu teilen:
Implizit behauptet der Autor damit, auf dem Hintergrund einer heute in der Sozialen Arbeit aktuellen Debatte, dass eine eigene "Sozialarbeitswissenschaft" als akademische Repräsentanz der Sozialen Arbeit die "Funktionalisierung und Infiltrierung" durch die Rassenhygiene/Eugenik hätte verhindern können, was man im Anbetracht der Beteiligung akademisch und professionell "gereifter" Disziplinen und Berufe (Naturwissenschaftler, Technologen, Juristen, Theologen, Mediziner etc.) an der sozialrassistischen Praxis im nationalsozialistischen Deutschland bezweifeln muss (Kappeler 2000, 638).
Bereits seit den 20er Jahren hatte sich eine Theorie und Praxis der »Sozialhygiene« innerhalb der Sozialen Arbeit gebildet, die die rassenhygienische Einteilung der Menschen und »Höherwertige« und »Minderwertige« mit vollzog. Führende Protagonistlnnen der Sozialen Arbeit wie Alice Salomon, Gertrud Bäumer, Christian J. Klumker, Hans Mathesius, Wilhelm Pollikeit oder Frieda Duensig, alle zwischen 1860 und 1890 geboren, hatten dieses "klassifizierende Denken mehr oder weniger mit dem Zeitgeist eingeatmet" (ebd., 639).
Der starke rassenhygienische Druck, der Ende der 20er Jahre die Soziale Arbeit in die Defensive brachte, war über drei Jahrzehnte von ihr selbst systematisch mit hergestellt worden durch die Bilder, die sie, um sich selbst von Teilen des Klientels abgrenzen zu können, aber auch um sich in selbstloser Opferhaltung zu inszenieren und ihre Forderungen nach Anerkennung, Geld und sozialpolitischen Einfluss zu begründen, der Öffentlichkeit und der "wissenschaftlichen Publizistik" lieferte (ebd., 640).
Dieser Effekt entsteht nach Kappeler dadurch, dass die Repräsentant/innen der Sozialen Arbeit ihre Notwendigkeit stets damit begründen, dass sie auf gefährdete oder gefährliche Gruppen innerhalb der Bevölkerung verweisen und dem Staat gegen angemessene Ausstattung mit Geld und Ressourcen Vorbeugung (Prävention) und Abhilfe (Intervention) versprechen. Sozusagen im Rücken dieser Argumentation werden aber eben diese Gruppen erst gebildet und im allgemeinen Bewusstsein verankert:
Mit ihrer Argumentation von "Gefährdung und Prävention" produziert die Soziale Arbeit auch heute wieder aus sich heraus klassifizierende und stigmatisierende "Stereotypen", die dann von "relevanten Kräften" in der Gesellschaft gegen die so "gekennzeichneten" Individuen und Gruppen aber auch gegen die Soziale Arbeit selbst gerichtet werden, verbunden mit dem Vorwurf, sie habe gegebene Versprechungen nicht erfüllt und sei an ihren gesellschaftlichen Aufgaben gescheitert. Es muss nur lange genug behauptet werden, dass die individuellen "Dekompensationserscheinungen" bei "immer mehr" Menschen "immer krassere" Formen annehmen, damit diese Bilder irgendwann reale Gewalt bekommen und sich gegen ihre Produzentlnnen selbst wenden (ebd., 64 1).
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es vor allem der "Realitätsschock" angesichts der Elends-verhältnisse in der proletarischen Bevölkerung, für deren Lebensweise die weitgehend bürgerlichen Sozialarbeiter/innen keine kulturellen Deutungsmuster zur Verfügung hatten. Sie mussten sich "diese Leute" in der sinnlichen Bedeutung des Worts "vom Leibe" und natürlich auch "von der Seele" halten (ebd.).
In dieser "helfenden Beziehung" [...] entstanden als ein Mittel der abwehrenden Selbstverteidigung, gepaart mit purem Nicht-Verstehen und als "Barmherzigkeit" ausgegebenem bürgerlichen Hochmut gegenüber den "ungebildeten einfachen Volksgenossen", das Denken und die Sprache des Sozialrassismus, dem die Rassenhygiene/Eugenik lediglich ein sprachlich verdichtetes und scheinbar theoretisch-wissenschaftlich begründetes "System" lieferten, in das die durch das allgemeine klassifizierende Denken, das alle Elemente dieses "Systems" schon in sich vorgebildet hatte, lediglich "eingespeist" zu werden brauchten, um zum eugenischen "Aha-Erlebnis" gerade bei den Praktiker/innen der Sozialen Arbeit zu führen, die "an der Front der Armut und des Elends eingesetzt" waren, (ein beliebter und geschätzter Topos der Zeit).
Das rassenhygienische/eugenische Deutungsmuster brachte handfeste Erleichterungen, denn es "erklärte" nicht nur scheinbar sinnfällig die bedrückenden Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag, sondern erleichterte das fürsorgerische Gewissen, weil es die vorurteilsgeladene Distanzierung genauso rechtfertigte wie die regelmäßig ergriffenen Maßnahmen [...], mit denen die Unverbesserlichen, die alle wohlgemeinten Angebote der Hilfe ignorierten oder zurückwiesen - und ihrer gab es viele - angeblich vor sich selbst und die Gesellschaft tatsächlich vor ihnen geschützt werden sollten (ebd., 641 f).
In diesem "paternalistischen Hilfe-Theorem" (ebd., 642) setzen die Helfenden
sich selbst als Subjekte und die Hilfebedürftigen werden schon in der nur gedachten "Annäherung" zu Objekten gemacht. In diesem Verhältnis werden Ambivalenzen von Neugier und Abscheu, Faszination und Verurteilung, Milde und Härte und auch von Abwehr und Verlangen produziert (ebd.)
Sichtbarer Ausdruck dieser Ambivalenzen sind die so genannten "Heimskandale" in den Fürsorgeanstalten der 20er Jahre. Kritikern an der klassifizierenden und selektierenden Praxis dieser Heime, wie etwa dem Künstler und Publizisten Peter M. Lampel[148] wurde vorgeworfen, sie seinen in sozialromanti-scher Naivität den gewieften Fürsorgezöglingen auf den Leim gegangen" (ebd., 645). Überfüllte Anstalten, mangelnde Mittel und Personal angesichts in der Wirtschaftskrise wachsendem sozialer Verelendung bewirkten in einer als Problemabwehr konzipierten Sozialfürsorge die Plausibilität von Ideen der "Menschenökonomie" (ebd.), d.h. die Lösung der sozialen Probleme durch die Verringerung der Zahl derer, die Probleme hatten. Der nationalsozialistische Staat, der sich anschickte, diese Politik in die Tat umzusetzen, traf auf diese Weise auf bereitwillige Zustimmung:
Die Aktiven der Sozialen Arbeit gehörten weitgehend zu den Übereinstimmenden, und viele prominente Einzelne, fast alle in Fachzeitschriften, Trägerorganisationen und Berufsverbänden begrüßten den nationalen "Führerstaat", der das "Chaos" in ihrem ureigensten Bereich in "Ordnung" verwandeln sollte und gelobten ihre Mitarbeit bei diesem Projekt. Die einen mit begeistertem Überschwang, die anderen mit dem Gestus der Einsichtigen, die im Interesse des "Ganzen" bereit sind, in beruflicher und nationaler Pflichterfüllung persönliche "Opfer" zu bringen, die vom "Gebot der Stunde und der nationalen Not" gefordert waren (ebd.).
Nach Kappeler musste das Gros der Sozialfürsorger/innen nicht erst durch Vorgesetzte und auf Linie gebracht oder durch Propaganda zum Umdenken gezwungen werden. Sie gaben vielmehr ein interessiertes Publikum für die eugenischen und rassenhygienischen Ideen ab, die in der Fachliteratur, in Aus-bildungsstätten, in Vortragsveranstaltungen und in lokalen rassenhygienischen Arbeitskreisen verbreitet wurden:
Ein eugenischer Agitator mit den rhetorischen Fähigkeiten Muckermanns füllte - das wussten und fürchteten sogar die nationalsozialistischen Rassenhygieniker - mühelos einen Saal mit 3000 Plätzen. Unter den freiwilligen Zuhörer/innen werden viele aus der Sozialen Arbeit gewesen sein. Schließlich wollten fast alle Professionellen der Sozialen Arbeit mit ihrem beruflichen Engagement der "Volksgesundheit" dienen bzw. zur "Gesundung unseres deutschen Volkes" beitragen und bezogen von diesem nationalen Fokus ihres Denkens Motivation und Kraft für ihren alltäglichen "Dienst", der sich im "Chaos der auflösenden Republik" schwer genug gestaltete. Wer damals nicht rassenhygienisch/eugenisch dachte, zumal als Angehörige(r) einer Profession, die im Zentrum der "Bevölkerungsfrage" agierte, war nicht "auf der Höhe der Zeit". Die da nicht mitmachten, die "Indifferenten", wie Grotjahn sie genannt hätte, hielten sich zwar abseits, aber sie protestierten nicht gegen das sozialrassistische klassifizierende Denken. Diesen "Stillen" ging zwar, wie man aus manchen kolportierten Witzen über die "Eugenetiker" sehen kann, "der ganze Rummel" auf die Nerven, aber eben nur "der Rummel" von dessen "berechtigtem Kern" auch unter ihnen noch viele überzeugt waren. Es gab die stehende Rede von den "rassenhygienischen Übertreibungen", vor allem in kirchlichen und sozialdemokratischen Kreisen, die aber regelmäßig mit dem bedeutsamen "Aber ..." weitergeführt wurde. Diese Sprachregelung war von den kirchlichen Eugenikern, die als geschickte "Kanzelredner" gute Rhetoren waren, selbst entwickelt und verbreitet worden, was man bei Muckermann für die Katholiken und bei Harmsen/Happich für die Protestanten und bei Fetscher für die sozialdemokratische Arbeiterbewegung und bis zu seinem Tod auch bei Grotjahn sehen kann" (ebd.).
Sozialhygienische Beiträge finden sich in Zeitschriften wie Soziale Praxis, einem sehr populären sozial-fürsorgerischen und sozialpolitischen Blatt, und Die Frau, Zeitschrift der bürgerlichen Frauenbewegung, zwei Medien in denen führende Persönlichkeiten der Sozialen Arbeit schreiben, (ebd., 655-724). Neben Juristen, Ärzten, Politikern, die offen eugenische und rassenhygienische Maßnahmen fordern, äußern sich auch führende Frauen aus der Gründergeneration der Sozialen Arbeit. 1906 etwa Helene Simon, Mitstreiterin von Alice Salomon und Gertrud Bäumer in einem Artikel über »Entartung«. Darin überträgt sie, obwohl selbst keine Sozialdarwinistin, "die Terminologie der Rassenhygiene wie selbstverständlich auf soziale Verhältnisse". Prekäre Wohnungs- und Arbeitsverhältnisse würden »zu körperlicher und seelischer Entartung« führen« (ebd., 676). Die unbekümmerte Verwendung dieses Vokabulars deutet auf die Selbstverständlichkeit hin, die rassenhygienischem Gedankengut zukam. 1933 begrüßt die Soziale Praxis ausdrücklich das von den Nationalsozialisten verabschiedete Sterilisierungsgesetz. Es verwirkliche "die in letzter Zeit immer dringlicher erhobene Forderung, die Sterilisierung zu eugenischen Zwecken zu ermöglichen, es sehe vor, Personen durch chirurgische Eingriffe unfruchtbar zu machen, bei denen nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit" zu erwarten sei, "dass ihre Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden" (zit. n. ebd., 702 f).
Auch Die Frau verbreitet in manchen Beiträgen rassenhygienisches Gedankengut. Ebenso bemerkenswert ist aber, wie sehr sich führende Theoretiker/innen der sozialpädagogischen Frauenbewegung wie Getrud Bäumer und selbst Alice Salomon den Ideen der Volksgemeinschaft anschließen, wie unkritisch sie den ersten Weltkrieg kommentieren, wie nachdrücklich sie den »Dienst am Vaterland« einfordern, von den Männern im Krieg, von den Frauen zuhause. »Notwendig - unantastbar« sei »die Anerkennung der untilgbaren Kraft, die wir Volkstum nennen«, so Bäumer in einem Kommentar zur »Kanzlerrede« Hitlers. »Ein Geschlecht, das dem Vaterland die gleiche opferbereite Treue entgegenbringen kann, wie die Väter es taten«, so Salomon 1915 in einem Beitrag über »Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der gefallen Krieger« ohne jede Infragestellung des Krieges und Erwähnung der »Opfer«, die der Krieg in anderen »Vaterländern« verursacht.
Dass völkisches, eugenisches und rassenhygienisches Gedankengut bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten auch unter Sozialfürsorger/innen weit verbreitet war, dass die Knappheit der Mittel angesichts wachsender Zahlen von Hilfsbedürftigen ökonomische Überlegungen der Verminderung der Anspruchsberechtigten plausibel machten und dass klassifizierendes Denken insgesamt Methoden der Auslese den Weg bereitet, bedeutet freilich nicht notwendiger Weise, dass die Mehrheit der Sozialarbeiter/innen - trotz weitgehende Duldung, wenn nicht aktiver Unterstützung nationalsozialistischer Gesetze und Verordnungen - auch der Zwangssterilisation oder der Ermordung Behinderter zu-stimmten. "In der Geschichtsschreibung war der Gewissenskampf der Schwestern und vieler Ärzte sowie deren Verzweiflung beim Abtransport der ihnen anvertrauten Pfleglinge noch nie Gegenstand der Forschung" Die Aufarbeitung der "inneren Geschichte der Betroffenen, der Angehörigen und der Pflegepersonen" (Hinterhuber 1995, 3) steht also noch aus. Andererseits kann an dem hohen Ausmaß der aktiven Beteiligung oder stillschweigenden Duldung der mörderischen Praktiken der NS-Vernichtungsmaschinerie kein Zweifel bestehen. Für Tirol stellt Hartmut Hinterhuber fest: "Immer wieder war auch festzustellen, dass viele Tiroler als Ärzte und Juristen, als Parteigenossen und Mitarbeiter in Options-stellen in das damalige Geschehen so weit verstrickt waren, dass die Grenzen zur Mittäterschaft bereits überschritten worden sind" (ebd., 2).
Auch in Salzburg nahmen die Nationalsozialisten die Bevölkerung dadurch ein, dass sie die Arbeitslosigkeit nahezu beseitigten. Waren 1938 noch 10.735 Menschen ohne Arbeit, so reduzierte sich deren Zahl bereits 1939 auf 2.502 Nicht-Vermittelbare bzw. Saisonarbeiter. Eine der Maßnahmen war der Bau der Reichsautobahn, ein Prestigeprojekt Hitlers, mit dem weit über die Verkehrsbedeutung hinaus symbolischen Charakter für die Einheit des Volkes verband:
Der Widerspruch, der zwischen der technischen Entwicklung des Motors und den infolge der ungenügenden Betreuung in den letzten Jahrzehnten sehr begrenzten Gegebenheiten der Straße bestanden hatte, wird nun beiseite geräumt. Die Straßen des Führers werden sich zu großen Schlagadern des Verkehrs entwickeln, die nicht nur dazu beitragen, das deutsche Volk politisch und wirtschaftlich zu einer stärkeren Einheit zu verschmelzen, sondern auch die letzten Reste partikularistischen Denkens zu beseitigen (Die Straße, 1936, Nr. 1, S. 8, zit.n. Sachs: Automobil, 67).
Das zweite Großprojekt war das Tauernkraftwerk in Kaprun, der Salzburger Flughafen wurde ausgebaut, zahlreiche Landesstraßen und Güterwege wurden staubfrei gemacht und reichsdeutsche Gäste, die mit KdF-Zügen[149] in Salzburg ankamen, belebten den Fremdenverkehr. Günstige Kredite und der deutsche Markt als Absatzgebiet für Lebensmittel verbesserte die Situation in der Landwirtschaft, die Aufwertung des Schillings gegenüber der Reichsmark kam dem Handel zugute. Beeinträchtigt wurde diese Entwicklung allerdings durch empfindliche Preissteigerungen, in Salzburg vor allem verursacht durch den Fremdenverkehr und die Festspiele.
Bereits 1938 wurden die Reichsgesetze in Österreich eingeführt: Gemeindeordnung, Fürsorgerecht, Nürnberger Rassegesetze, Ehegesetz, Standesamtsgesetz, Polizeirecht, Reichswehrrecht. Erstes Anliegen der Nationalsozialisten nach dem "Anschluss" war in Salzburg - wie auch anderswo -, den Beamtenapparat zu säubern. »Führende Köpfe des gegnerischen Systems, die auch weiterhin Gefahrenherde bilden können« sollten »beseitigt«, dagegen sollten gegenüber »zahlreichen Volksgenossen ehemals gegnerischer Gesinnung, die sich auf minderwichtigen Posten befinden [...] die schärfsten Maßnahmen eher vermieden werden«.[150] Beamt/innen, die sich bisher mit illegaler NS-Unterstützung verdient gemacht hatten, wurden befördert, Maßnahmen des NS-Regimes, die dazu angetan waren, "das Ethos der Pflichterfüllung und Staatstreue der Beamten für seine Zwecke zu instrumentalisieren (Hanisch 1997, 50). Reichsdeutsche Beamte wurden nach Salzburg versetzt und Salzburger Beamte ins Reich. Zahlreiche Stellen wurden mit jungen NS-Juristen besetzt. Alle Beamt/innen hatten gemäß der nationalsozialistischen Philosophie der Rassenreinheit einen Ariernachweis abzugeben.
Es ist daher hoch an der Zeit, dass wir endgültig mit solchen ausgesprochen fremdrassigen Belastungen unseres arischen und naturnahen Innenlebens aufräumen und zu der den deutschen Gemüt einzig und allein zustehenden Wahrheit zurückkehren.
So Prof. Eduard Tratz, ein angesehener Salzburger Naturwissenschaftler in darwinistischer Manier (zit.n. ebd., 52):
Das Leben des einen setzt häufig den Tod des anderen voraus. So war es immer und wird es immer sein, so lange die Erde Leben zeugt: Aus diesem ewigen Naturgesetz heraus hat jedes Lebewesen um sein Dasein zu kämpfen, gleichgültig, ob es Pflanze, Tier oder Mensch ist.
Einen »Menschen ohne Feind gibt es nicht, und wenn doch, dann ist er eine Niete, die beseitigt werden muss« (ebd.).
Nach Hanisch (ebd., 152) scheint Salzburg bei der »Ausmerzung« von im Sinne der Rassenideologie minderwertigen Menschen "besonders aktiv gewesen zu sein". Schon bei der Zwangssterilisierung übertraf die Zahl der 1940 gestellten 52 Anträge Wien um das Vierfache. Im Frühjahr 1941 wurden 400 Menschen nach Hartheim verbracht, die unter Mitwirkung von Ärzten, Gemeinde- und Fürsorgebehörden mit Meldebögen erfasst worden waren. "Bürgermeister und Ortsgruppenleiter fingen an, ‚Idioten und Kretins', die noch in privaten Haushalten oder in Armenhäusern lebten, zu sammeln und in die Anstalten zu schicken, um das Gemeindbudget zu entlasten" (ebd. 152).
Während bei der Deportation von Einheimischen noch mit größter Geheimhaltung vorgegangen wurde, konnten sich die NS-Schergen bei der »Endlösung« der "Zigeunerfrage" auf die Zustimmung der Bevölkerung stützen. Diese "wandernde Rasse, die das deutsche Volk nur bestielt und begaunert" (ebd. 153) sollte endgültig beiseite geschafft werden. Zunächst vertrieb sie die Polizei von einem Gau in den anderen, 1939 erließ Heinrich Himmler einen Festsetzungserlass. Die Gemeinden versuchten deshalb die "Zigeuner" los zu bringen, um die Kosten der Festhaltung zu vermeiden. In Salzburg, zunächst auf der Rennbahn, dann in Leopoldskron, wurden in einem Lager 160 "Zigeuner" interniert, »teilweise so primitiv und selbst für normale Witterungsverhältnisse so unzureichend, dass schon aus dieser Tatsache allein gewisse Gefahrenmomente sowohl für die Untergebrachten, wie aber auch für die Stadtbevölkerung entstehen«[151] Dass die "Zigeuner" zwar das Lager verlassen, die Stadt Salzburg aber nicht betreten durften, erzürnte die Landesbauernschaft:
Wenn man sich zwar beeilt, die Stadt gegenüber den Zigeunern abzuriegeln, andererseits aber eine größere Anzahl Zigeuner in einem offenen Lager außerhalb der Stadt zusammenzieht und die umliegende Landbevölkerung damit gleichsam zu einem Jagdgebiet für die Zigeuner macht, dann ist das ein Messen mit zweierlei Maß, aus welchem deutlich eine Minderbewertung der Landbevölkerung gegenüber dem Städter spricht. Es muss doch heute selbstverständlich sein, dass der Bauer ein gleich geachteter und gleich schutzwürdiger Volksgenosse ist wie jeder Städter.[152]
»Die Stimmung in der Bevölkerung des Gaues Salzburg, vornehmlich aber die Gauhauptstadt selbst« habe »einen tiefgründigen Hass gegen die Zigeuner erzeugt«, weshalb die Polizei »um baldige Entscheidung und Verfügung« bitte, »was nunmehr in Bezug auf das Zigeunerunwesen hier geschehen soll«.[153] Ab Herbst 1940 wurde das Lager in Leopoldskron mit Stacheldraht umgeben, polizeilich bewacht, und durfte nur mehr mit einem Erlaubnisschein verlassen werden. Nachts war selbst das Aufsuchen der Abortanlage nur jeweils einer Person gestattet. Die Männer wurden zur Arbeit bei der Glanregulierung getrieben. Im März/April 1943 wurden die ca. 300 Salzburger "Zigeuner" nach Auschwitz de-portiert. Das Lager wurde aufgelöst.
Die Einstellung der Mehrheit der Bevölkerung charakterisiert Hanisch als "widerwillige Loyalität". Manche Indikatoren sprechen allerdings dafür, dass die Zustimmung oder zumindest die stillschweigende Duldung größer war als in anderen Teilen Österreichs. So war etwa der Prozentanteil der etwa 30.000 Parteimitglieder mit 10% größer als in Wien. Bei den Sammlungen des Winterhilfswerkes erzielte Salz-burg jeweils Rekordergebnisse. Die Geburtenrate stieg auf das Doppelte an: Neben Danzig gehörte Salzburg zum kinderreichsten Gau des Reiches, es wurde zum »Gau der vollen Wiegen« erhoben (Hanisch 1997, 194).
Für Nord- und Südtirol liegt eine detaillierte Untersuchung der NS-Tötungsdelikte vor. Hartmann Hinterhuber hat das Schicksal von insgesamt 502 Tiroler/innen, "die infolge einer psychischen Störung oder einer Mehrfachbehinderung von den Nationalsozialisten ermordet worden sind", an die 233 hievon aus dem Psychiatrischen KrankenhausHall, dokumentiert (Hinterhuber 1995). Auch in den anderen Einrichtungen schlug die NS-Tötungsmaschinerie zu. Aus dem St.-Josefs-Institut in Mils wurden 67 schwerbehinderte Kinder abtransportiert, aus den Heimen für alte und behinderte Menschen in Ried i.Oberinntal, Imst und Nassereith 68 Personen. Sie alle wurden in Schloss Hartheim oder in Niedernhart bei Linz getötet. Auch der entschlossene Einsatz der Oberin der Barmherzigen Schwestern im Institut Mariatal in Kramsach für Kinder mit intellektuellen Defiziten konnte nicht verhindern, dass alle 61 Kinder nach Hartheim "verlegt" und ermordet wurden. Die Schwester wurde verhaftet, die Güter der Schwesterngemeinschaft beschlagnahmt. Eine Schwester schildert später den Abtransport der Kinder so:
Im Juni (oder Juli?) 1941 kam ein Schreiben, dass die Pfleglinge aus der Anstalt Mariatal abgeholt werden und in eine Anstalt kommen, wo es ihnen besser geht [...] Nach zwei Tagen, morgens in aller Früh, kamen fünf SS-Leute mit zwei großen Autobussen: Im Verbringen in die Autos spielte sich mancher Kampf ab. Ein ganz braver Bub mit 6 Jahren wurde von der Tante abgeholt: Beim Ausgang wurde ihr der Kleine weggerissen und ins Auto verbracht. Ein 14 jähriger Bub verkroch sich im Dach, wo die Männer nicht hin konnten. Alle Kunst, ihn heraufzubringen, war vergeblich. Eine Schwester musste den Versuch machen: Als er die Schwester sah, kam er von selbst herauf - um das Los der anderen zu teilen. Ein 16 jähriger Bub lag schwer krank im Bett. Ich bat den Kleinen dazulassen, er sterbe ja ohnehin gleich. Es war umsonst. Er musste zu den anderen ins Auto [...] Unter den Entführten waren einige größere, ältere Buben und Mädchen, die willig und tüchtig Haus- und Gartenarbeiten verrichteten. Auf die Bitte, diese dazulassen, versprach man, sie wiederzubringen: Es kam aber niemand mehr zurück!
Nach zwei bis drei Wochen erschienen SS-Leute, erklärten im Auftrag des Reichsstatthalters unser Heim als beschlagnahmt: Binnen 2 Stunden mussten wir das Haus verlassen, mitgenommen werden durfte nur das aller Notwendigste (zit.n. ebd., 105 f.).
Aus dem Ospedale Psichiatrico in Pergine, dem Stadlhof und anderen Einrichtungen im Trentino wurden 299 Kranke in das Deutsche Reich abtransportiert, ohne dass diese Kranken, denen ja die bürgerlichen Rechte entzogen waren, für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert hatten. "Da wenige Monate nach der Deportation der Kranken aus Pergine in einem mutigen Artikel des ‚Volksboten' mit aller Deutlichkeit auf die Vernichtung psychisch Kranker und Behinderter im Deutschen Reich hingewiesen wurde, kann mit Sicherheit angenommen werden, dass das offizielle Italien bereits zu dieser Zeit von der laufenden ‚Euthanasie' Bescheid wusste und sich trotz dieses Wissens bereit fand, die Südtiroler Patienten des Psychiatrischen Krankenhauses Pergine der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie auszuliefern" (ebd., 60).
Die Dokumentation zeigt, dass es Kritik und Widerstand von katholischen Kreisen, aber auch von einer Minderheit von Ärzten und Angestellten der Psychiatrischen Anstalten gab, dass dieser aber gegen die Macht der NS-Ärzte und ihrer Helfer/innen, die die Deportation und Ermordung der Kranken organisierten, sowie gegen die große Zahl der Mitläufer/innen, die deren Anordnungen notgedrungen gehorchten oder sie bereitwillig unterstützten, nichts auszurichten vermochten. So haben etwa der ärztliche Leiter des Psychiatrischen Krankenhauses in Hall, Primarius Klebelsberg, und der Vorstand der Psychiatrisch-Neurologischen UIniversitätsklinik in Innsbruck, Univ.Prof. Dr. Helmut Scharfetter, mehr als hundert Kranken das Leben gerettet, indem sie erwirkten, dass sie von den Transportlisten gestrichen wurden. Andererseits stimmte Klebelsberg dem Abstransport von insgesamt 233 Patient/innen aus Hall zu oder er konnte ihn zumindest nicht verhindern. "Setzten sich Primarius Klebelsberg und Prof. Scharfetter auch mutig für die Rettung vieler Patienten ein, waren sie doch mit dem System in einem Ausmaß verstrickt, das ihnen nicht erlaubte, sich prinzipiell öffentlich zu äußern und dem Protest der Angehörigen durch ihre Autorität Gewicht zu verleihen" (ebd., 81)
Zwar wurde die Aktion T4 1941 auf Grund des wachsenden Widerstandes und der befürchteten Publizität beendet, die "wilde Euthanasie" dauerte aber noch bis zum Kriegsende an und kostete weitere 350 Südtiroler/innen das Leben. "In vermehrtem Umfang wandten sich nun NS-Ortsgruppenleiter oder beauftragte Ärzte direkt an die Familien der Behinderten oder ‚selektionierten' das ‚Patientengut' von Heimen und Krankenanstalten. In verschiedenen Krankenhäusern fanden die Propagandisten der ‚Ausmerzung nicht lebenswerten Lebens' bereitwillig kooperierende Helfershelfer oder erpressbare Mitarbeiter" (ebd., 110). Eine Mischung von Nichtwissen, Halbwissen, Nicht-Wissen-Wollen und Verdrängung bewirkte auch bei vielen, die den Abtransport der Kranken in die Tötungsanstalten nicht befürworteten, jene Zurückhaltung und jene teilweise Beteiligung, die aus einer rückblickenden Sicht so schwer verständlich ist.
Die "Bilanz des Grauens" (ebd., 117) ist unvorstellbar. Allein in Hartheim, einer der fünf Tötungsanstalten, wurden während der offiziellen Dauer der Aktion T4 18.269 Personen ermordet,[154] insgesamt wird die Anzahl der dort Ermordeten mit über 30.000 angenommen. Hauptverantwortlich für die Deportation und Tötung der Kranken in Tirol waren der Leiter des Gauamtes für Volksgesundheit Dr. Hans Czermak, Dr. Rudolf Lonauer, Direktor der Pflegeanstalt Niedernhart/Linz und Dr. Georg Rennno, Arzt in Hartheim. "In Hartheim wurde, wie in allen Vernichtungshäusern, mit einer unvorstellbaren mörderischen Professionalität vorgegangen. Die Vergasung erfolgte in großen Räumen, die als Duschen getarnt waren. Während die Leichen beseitigt wurden, wurden bereits in den Schreibstuben, die als Schein-Standesämter deklariert waren, genormte Beileidsbriefe an die Angehörigen abgesandt" (ebd., 32).
Sehr geehrte ... !
Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Tochter, Ihr Sohn, die/der am ... in die hiesige Anstalt verlegt werden musste, hier am ... plötzlich und unerwartet an einer ... verstorben ist. Bei der schweren geistigen Erkrankung bedeutete für die Verstorbene/den Verstorbenen das Leben eine Qual. So müssen Sie den Tod als Erlösung auffassen. Da in der hiesigen Anstalt Seuchengefahr herrscht, ordnete die Polizeibehörde sofortige Einäscherung des Leichnams an. Wir bitten um Mitteilung, an welchen Friedhof wir die Übersendung der Urne mit den sterblichen Überresten der/des Heimgegangenen durch die Polizeibehörde veranlassen sollen. Etwaige Fragen bitten wir schriftlich hierher zu richten, da Besuche hier gegenwärtig aus seuchenpolizeilichen Gründen verboten sind (zit.n. ebd.).
Wie wenig glaubwürdig derartige Mitteilungen für de Angehörigen oder diejenigen waren, die die Augen nicht mutwillig, aus Angst oder Oberflächlichkeit verschlossen, zeigt ein Flugblatt, das 1940/41 in Wien verfasst wurde: »Kein anständiger Mensch kann mehr in dieser Partei bleiben, die kaltblütig und überlegt kranke und alte Leute mordet«, heißt es dort.

Faksimile: »Nazikultur«: Flugblatt, Wien 1940/41

Fotografie: Schloss Hartheim, Oberösterreich
Über die Deportationen und die Tötungen kommunizierten Lonauer und Czermak wie über das Normalste der Welt. In ihrer Korrespondenz bezeichnen sie die Ermordung der Kranken als »Behandlung«:
»Sehr geehrter Herr Kollege«, schreibt Dr. Lonauer am 5. November an Dr. Czermak,
Bitte entschuldigen Sie, dass ich so lange nichts von mir hören ließ [...] Es ist [...] in absehbarer Zeit nicht möglich, dass Dr. Renno oder ich nach HALL kommen, um dort die vorgesehenen Patienten zu behandeln [...] Mit den von HALL nach Niedernhart übernommenen Patienten hatte ich keinerlei Schwierigkeiten und ist die Abwicklung vollkommen reibungslos verlaufen. [...] Ich bin daher zu der Überzeugung gekommen. daß diese Behandlungsmethode (gemeint ist die Tötung durch Medikamente. H. H.) praktischer und reibungsloser ist, als die frühere. Außerdem erlaube ich mir, Sie aufmerksam zu machen, dass ich bisher vom Gau Innsbruck für die Abholung von Kranken aus Hall kein Benzin ersetzt bekommen habe (zit.n. ebd., 43).
Am 12. November antwortet Dr. Czermak den »Lieben Kameraden Dr. Lonauer«
Vielen Dank für Ihr liebes Schreiben vom 5. 11. Ich bin sehr befriedigt, dass Ihre Behandlungsmethode so erfolgreich ist. Auch hier hat sich gar kein Anstand ergeben und hoffe ich, dass Dr. Renno bald in der Lage ist, die Methode in HALL einzuführen, wodurch sich die Transportkosten, vor allem der Kraftstoffaufwand einsparen ließe (zit.n. ebd.).
Lonauer nahm sich 1945 das Leben, nachdem er seine Frau und seine Kinder getötet hatte. Czermak wurde 1945 in Untersuchungshaft genommen, 1949 zu acht Jahren schweren Kerkers verurteilt und 1950 frei gelassen. Die Ärztekammer Tirol und das Professorenkollegium der Medizinischen Fakultät Innsbruck befürworteten seine Wiederzulassung zum ärztlichen Beruf, die letztlich vom Landesgericht Innsbruck abgelehnt wurde. Renno tauchte als "Dr. G. Reinig" unter, 1970 wurde ein Verfahren gegen ihn wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt.
Das vielfach zur Entlastung heran gezogene Argument, man habe es "nicht gewusst" erscheint angesichts des Ausmaßes und der Dauer der Tötungsmaschinerie nicht glaubhaft. Dazu Hartmut Hinterhuber (ebd., 121 f.):
Es ist eine Illusion anzunehmen, ein Verbrechen von der Dimension der "Euthanasieprogramme" könnte geheimgehalten worden sein. Um die "Ausmerzung nicht lebenswerten Lebens" vorzubereiten und durchzuführen, bedurfte es der Mitwirkung zahlreicher Dienststellen, Organisationen und Unternehmen sowie von Krankenanstalten und Fürsorgeeinrichtungen: der kommunalen Behörden und der Sozialverwaltungen, der Gerichte, die - auch in den betreffenden Jahren - die Aufnahme in psychiatrische Krankenhäuser zu überwachen hatten, es bedurfte der Beamten der Reichsbahn, die Züge und Begleitpersonal bereitstellten, der Standesämter, die an den betreffenden Tötungsanstalten massenhaft Totenscheine auszustellen hatten, vieler Ärzte und Pflegepersonen, der NS-Ortsstellenleiter u.v.a.m. Das Räderwerk der Tötungsmaschinerie reichte weit über die Psychiatrie und die Vemichtungsstätten hinaus. Das immer wieder behauptete Nichtwissen war und ist in den allermeisten Fällen ein Nichtwissen-Wollen, eine Weigerung, bestimmten Beobachtungen nachzugehen, Fragen zu stellen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Allerdings steht fest: Über die Todesfabriken selbst, vor allem über die Art, wie dort gemordet wurde, erfuhr der Durchschnittsbürger nichts Näheres.
Der mit bürokratischer Gründlichkeit geplante, industriemäßig betriebene tausendfache Mord, diese nie erlebte Dimension des Verbrechens überforderte die Vorstellungskraft selbst jener, die dem nationalsozialistischen System auch jede mögliche Unmenschlichkeit zutrauten.
Für die "Endlösung" wie für die "Euthanasie" gilt dasselbe: Es ist zwar richtig, dass nur wenige Deutsche alles darüber wussten, aber auch nur sehr wenige wussten nichts. Man musste die Namen der Tötungsstätten und der Euthanasieanstalten nicht gehört haben, um zu wissen, dass psychisch Kranke und Behinderte umgebracht wurden. Die "normal"" Reaktion bestand und besteht darin, das unerhört Schreckliche, die Wahrheit über die Tötung Tausender, nicht wahrhaben zu wollen, sondern sie abzuwehren und zu verdrängen. Wegsehen und weghören sind in allen Diktaturen antrainierte Totstellreflexe. Dass Menschen wie Ungeziefer ausgerottet wurden (psychisch Kranke und Behinderte wurden genauso wie Juden unter dem Titel "zur Entlausung" oder "zur Desinfektion" in die Tötungsfabriken gebracht), klang zu unwahrscheinlich, als dass der Durchschnittsbürger dem ohne weiteres Glauben schenken mochte. Die Ungeheuerlichkeit der Nachricht behinderte mehr noch als die amtlich verordnete Geheimhaltung die Verbreitung dieses Wissens und die volle Erfassung der fürchterlichen Realität.
[145] Franz von Papen, 1889 - 1969, 1932/33 dt. Reichskanzler, ab 1933/34 Vizekanzler im Kabinett Hitler.
[146] Theodor W. Adorno verweist in einem Aufsatz auf die Doppeldeutigkeit des Mottos des WHW "Niemand darf hungern, niemand darf frieren": Das konnte auch heißen, wer hungert oder friert, wird ausgemerzt.
[147] In der so genannten "Ersten Flandernschlacht " des ersten Weltkrieges verloren die Deutschen 2000 Soldaten vor allem freiwilliger Regimenter. Die Niederlage wurde propagandistisch zu einem Siegesmythos umgedichtet: "Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange ‚Deutschland, Deutschland über alles' gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie. Etwa 2.000 Mann französischer Linieninfanterie und sechs Maschinengewehre erbeutet", berichtete die Oberste Heeresletitung am 11. November 1914.
[148] Lampel veröffentlichte 1929 das Buch "Jungen in Not - Berichte von Fürsorgezöglingen" und schrieb das Theaterstück "Revolte im Erziehungshaus", beides zusammen mit Fürsorgezöglingen erarbeitet.
[149] KdF: nationalsozialistische Freizeitorganisation »Kraft durch Freude«
[150] Gauleiter Rainer am 7. Juli 1939, zit.n. Hanisch 1997, 50
[151] Bericht der Kriminalpolizei an das Reichssicherheitshauptamt (zit.n. Hanisch 1997, 153 f.)
[152] Die Landesbauernschaft an die Kriminalpolizei (zit.n. Hanisch 1997, 154 f.)
[153] Bericht der Kriminalpolizei an das Reichssicherheitshauptamt (zit.n. Hanisch 1997, 154)
[154] Diese Zahl beruht auf einer 1945 in Hartheim gefundenen Statistik, in der die Zahl der Opfer pro Monat - in der Mehrzahl der Monate Mai 1940 bis September 1942 über tausend, im August 1940 allein 1.740 - penibel aufgeführt ist.
Inhaltsverzeichnis
"Je näher man an die Gegenwart heranrückt, desto schwieriger wird es, mit ausreichender Distanz die historischen Entwicklungen zu überblicken", so leiten Hering/Münchmeyer (2000, 189) ihr Kapitel über die Nachkriegszeit ein. "Der Historiker wird eben - je näher er sich bis an die Gegenwart heranwagt - ein Zeitgenosse." Im Falle der Sozialarbeit kommen eine Reihe weiterer Schwierigkeiten hinzu: "Die Handlungsfelder sind besonders seit den sechziger Jahren enorm ausdifferenziert und vielgestaltig erweitert worden, die Zahl der Beschäftigten ist entsprechend angewachsen [...] Ansätze, Konzepte, Vorgehensweisen, Handlungsfelder, Einrichtungen und Maßnahmen sind so komplex und vielfältig geworden, dass eine zusammenfassende Darstellung ihrer Entwicklung kaum alle Facetten und Aspekte erfassen kann. Ferner hat die Sozialarbeit ihr Selbstverständnis verändert; sie versteht sich nicht mehr nur als Nothilfe angesichts sozialer Probleme, sondern als einen eigenständigen Bereich, der Sozialisations-, Bildungs- und Beratungsangebote sowie Infrastrukturleistungen für alle Kinder, Jugendlichen und Familien, aber auch für gesellschaftliche Ziele, wie die Herstellung gleicher Lebenschancen, sozialen Ausgleich und Erhöhung der Lebensqualität insgesamt erbringt" (ebd., 189). Soziale Arbeit hängt immer stärker von gesellschaftspolitischen Entwicklungen - Stichwort: "Krise des Sozialstaats" - ab und soll zugleich immer eingehender die Besonderheiten regionaler und klientelspezifischer Erfordernisse berücksichtigen.
Um sich die katastrophalen Folgen des Zweiten Weltkrieges zu vergegenwärtigen, muss man sich nur die unvorstellbare Zahl der Toten vor Augen führen: 55 Millionen Menschen haben in diesem Krieg ihr Leben verloren, 6 Millionen Deutsche und österreichische Soldaten und Zivilpersonen, 20 Millionen in Russland, 6 Millionen in Polen, 8 Millionen der Westaliierten, 430 Soldaten und Zivilpersonen in Italien, Millionen in den deutschen und österreichischen Konzentrationslagern, 6 Millionen davon Juden und Jüdinnen.
Hering/Münchmeier (2000) schildern das Ausmaß der Verwüstung und der Not in Deutschland. Kinderlandverschickung, Konzentrationslager, Kriegsgefangenschaft und die Auflösung der Wehrmacht haben ein Riesenheer verstreuter Menschen produziert: 25 Millionen Deutsche befinden sich bei Kriegsende nicht an ihrem Wohnort. Ihre ehemaligen Wohnsitze sind, zumindest in den Städten in einem hohen Ausmaß zerstört: 31% der Großstadtwohnungen in Deutschland sind gänzlich zerstört, weitere 45% beschädigt. Allein aus dem Osten Deutschlands strömen elf Millionen Flüchtlinge in den Westen, "die nicht mehr als ein Bündel an Besitztümern mitbringen" (ebd., 194). Deutschland ist "ein Land der Greise und Frauen": 37 Millionen Frauen, 29 Millionen Männer, von denen über 70% unter 18 oder über 60 sind.
Der allgemeine Arbeitszwang, der nach dem Krieg verordnet wird, trifft unter diesen Bedingungen vor allem die, die da sind: die Frauen. Zu allererst geht es um die Beseitigung der riesigen Schuttmengen in den Städten. Die Kubikmengen, die Klaus-J. Ruhl (1984, 165) z.B. für deutsche Städte errechnet hat, sind gewaltig: Allein in Berlin sind es 50 Millionen cbm, die von den "Trümmerfrauen" zu beseitigen sind. Wer keine Arbeitsbescheinigung vorweisen kann, erhält in die ersten Monaten nach dem Krieg keine Lebensmittelkarte, wobei die Tagesration ohnedies kaum zum Überleben ausreicht. Eine Studie des evangelischen Hilfswerks wiest für die Jahr 1946/47 nur zwischen ~ 900 bis 1000 Kalorien aus. Der Schwarzmarkt blüht. Selbst für ein bescheidenes Leben fehlen die fundamentalen Voraussetzungen, Wohnungen, Medikamente, Lebensmittel, von besonderen Genüssen wie Alkohol, Zigaretten, Schokolade oder Kaffee gar nicht zu reden - es sei denn, dass jemand "gute Beziehungen" zu den ‚Besatzern' hatte (ebd., 195), Verhältnisse die nach dem Krieg besser verheimlicht wurden:
Welche Frau gibt schon gerne zu, für eine Stange Zigaretten, Whisky oder Schokolade, für ein wenig Unterhaltung bei Jazz und belegten Brötchen eine Verhältnis mit einem Besatzungssoldaten eingegangen zu sein? Die Erinnerung, Geliebte eines GI gewesen zu sein, muss gründlich verdrängt werden, denn dabei war schließlich eigenes Zutun im Spiel. Wer freiwillig mit Amis ‚ging', konnte kein Opfer sein - oder doch? (Hering 1994, 194).
Zwar gibt es Aufräumarbeit genug, aber an bezahlter Erwerbsarbeit fehlt es. 1949 sind in Deutschland 1.2 Millionen Menschen arbeitslos, 1950/51 ist die Arbeitslosenrate noch bei 10%.
Die tristen Verhältnisse bestimmen die Anforderungen an Soziale Arbeit: Flüchtlingsfürsorge, Betreuung von Kriegsversehrten und Hinterbliebenen und Bekämpfung von Krankheiten (Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose) werden neben der Dringlichkeit einer Neuregelung der Arbeitslosenversicherung zu vordringlichen Aufgaben. Die seit Anfang des 19. Jh. anstehende Alternative zwischen einem System um-fassender staatlich verordneter Sozialversicherung und staatlich wie privat organisierter Fürsorge spitzt sich zu und führt "zu lang anhaltenden Diskussionen" (ebd., 196). Während in Ostdeutschland die Entscheidung für den Staat fällt, entsteht in Westdeutschland ein "sowohl als auch" (ebd.).
Zunächst sind die Altlasten aus der NS-Zeit zu entfernen. Zwar haben sich die gesetzlichen Regelungen aus der Weimarer Republik über die NS-Zeit hinweg erhalten[155], es muss aber die Zentralisierung der gesamten Fürsorge im NSV rückgängig gemacht werden und es müssen die in der NS-Zeit verbotenen freien Träger wieder erlaubt und zum Teil erst wieder aufgebaut werden. Der aliierte Kontrollrat derogiert die NS-Gesetze zur Familien-, Beamten- und Rassenpolitik, löst vom Winterhilfswerk bis zum NSV und dem Rassenpolitischen Amt alle NS-Organisationen auf und macht damit "den Weg frei für einen Neuanfang" (ebd., 197). Die unselige Verbindung zwischen den Gesundheitsämtern und der Fürsorge, die den rassistischen Aussonderungsmaßnahmen und Vernichtungen zuarbeitete, wird beendet. Die Gesundheitsverwaltung wird dem Medizinbereich eingegliedert, ebenso werden die Jugendämter aus der Gesundheitsverwaltung ausgegliedert und nunmehr "eindeutig (‚sozial-)pädagogisch' und nicht mehr sozialhygienisch verstanden." Die Konkurrenz um die führende Disziplin in der Sozialfürsorge ist damit entschieden: "Die Pädagogik und nicht die Medizin wird endgültig zur Leitwissenschaft der Sozialarbeit" (ebd., 205).
Schaltstelle der Erneuerung wird, obwohl selbst teilweise durch NS-Aktivitäten belastet, der 1946 wieder errichtete Deutsche Verein, wesentliche Träger der Fürsorge werden, da den Sozialversicherungen weitgehend das Geld fehlt, die Kommunen. Geld ist freilich ohnedies "als Tauschmittel weitgehend außer Kraft gesetzt". Die kärglichen Mittel, die die Fürsorge verteilt., sind "wesentlich unattraktiver als z.B. die aus dem Ausland kommenden Care-Pakete mit Nahrungsmitteln und Kleidung oder die Möglichkeiten des Tauschhandels auf dem Schwarzmarkt" (ebd., 199).
Der Deutsche Verein setzt sich allerdings verstärkt für einen Rechtsanspruch auf soziale Hilfe ein, einerseits um den Not Leidenden die bürokratischen Hürden zu ersparen, vor allem aber, um die Soziale Arbeit von Aufgaben der materiellen Fürsorge zu entlasten und ihr wieder ihre eigentliche Bestimmung zu ermöglichen: "ein sozialpädagogisch orientierter Sozialisations- und Beratungsbereich zu werden, der Leistungen nicht nur für Problemgruppen, sondern [...] für die Gesamtheit der Bevölkerung, insbesondere für Familien, Kinder und Jugendliche erbringt" (ebd.). Seit den 1950er Jahren wird in Deutsch-land der Sozialstaat umfassend ausgebaut, immer mehr Unterstützungsleistungen werden zu Rechts-ansprüchen an Versicherungen oder Versorgungseinrichtungen.
Am 30.06.1961 wird das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) verabschiedet, das diese Ansprüche vereinheitlicht und endgültig kodifiziert. Ein historischer Moment: Erstmals besteht damit in Deutschland ein Rechtsanspruch auf soziale Hilfe. Im Gesetz heißt es:
Wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen, und auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht.
In dem Maße, in dem der Sozialstaat ausgebaut wird, wird die soziale Arbeit von den vorwiegend der Linderung materieller Not gewidmeten Diensten entlastet. Der Wandel der Aufgaben der sozialen Für-sorge von materieller zu sozialpädagogischer Unterstützung zeigt sich in der Veränderung der Bezeichnungen: "Aus ‚Fürsorge' wird ‚Sozialhilfe', aus ‚Jugendfürsorge' und ‚Jugendwohlfahrtspflege' wird ‚Jugendhilfe', aus ‚Wohlfahrtspflege' als Sammelbegriff der neue umfassende Begriff ‚Soziale Arbeit'." (ebd., 200).
Was diese Entwicklungen für die Organisation, die Praxis und das Berufsverständnis der Sozialen Arbeit bedeutet, findet sich bei Hering/Münchmeier ausführlich dargestellt. Unmittelbar nach dem Krieg bedeuten die "enormen quantitativen und qualitativen Hilfsanlässe" eine "enorme Herausforderung und zugleich eine große Unübersichtlichkeit", die alle Ordnungen sprengt:
Wie schon nach dem ersten Weltkrieg lassen sich auch jetzt die traditionellen Grenzen zwischen normalen und problematischen Lebensverhältnissen und damit zwischen Hilfsbedürftigen und nicht Hilfsbedürftigen, zwischen schicksalhaft-schuldlos und schuldhaft Verelendeten usw. in keiner Weise aufrechterhalten und handhaben. Nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit ist nach Vorkriegsmaßstäben hilfsbedürftig, auch wenn sie die Hilfe der Fürsorgestellen nicht in Anspruch nehmen. Für ein Verständnis der Fürsorgearbeit, das traditionelle auf die Behandlung von abweichendem Verhalten und von Randgruppen bezogen ist, liegt darin zugleich eine große Unübersichtlichkeit: Die bisher gültigen Maßstäbe von Normalität, ordentlicher Lebensführung, von positivem Familienleben und tüchtiger Erziehung sind nicht nur durcheinander geraten, sondern vielerorts auf die Situation gar nicht anwendbar (ebd., 201).
Die Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Handlungsfeldern werden "brüchig und unscharf", die "Abgrenzungen zwischen den Spezialisierungen" werden eingerissen, von den Fürsorgearbeiter/innen wird die pragmatischen Fähigkeit verlangt, "sich auf die vielerlei Seiten der problematisch gewordenen Lebenslagen gleichzeitig einzulassen" (ebd.).
So sehr diese Analyse auf die Verhältnisse unmittelbar nach dem Krieg zutrifft, so sehr zeigt sich darin auch die Verabsolutierung eines Verständnisses von Sozialer Arbeit, das von einem geordneten Spartenbetrieb für homogene Teilklientele, die mit je spezialisierten Methoden betreut werden, ausgeht und dessen Ziel in der Herstellung normaler traditioneller Verhältnisse in Familien, Erziehung und Jugend besteht. Insofern ist diese Analyse typisch für die weitere Geschichte der professionellen Sozialen Arbeit, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland: Diese folgt überwiegend der Tendenz der Stabilisierung der gegebenen Verhältnisse. Deren kritische Hinterfragung und erst recht die gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit den allgemeinen Strukturen, die die zu behandelnden Krisen erst verursachen, hat es so schwer, zum integralen Bestandteil sozialarbeiterischer Berufsidentitäten zu werden.
Die Problematik dieser Ordnung von Zuständigkeiten zeigt sich indes gerade angesichts der alle Ressourcen und Kompetenzen überfordernden Not nach dem Krieg. Etablierte Problemlösungsformen wer-den erneut fraglich. Der enorme Flüchtlingsstrom lässt die Frage der Zuständigkeit - Geburtsort oder Wohnort - wieder aufleben. Welcher Wohnsitz sollte gelten, der gemeldete oder der tatsächliche? Wer etwa, fragt eine Caritas-Mitarbeiterin, sollte »die durchreisenden Trecks, wo die Leute Hunger und Durst hatten an den Bahnhöfen« versorgen, »aus welchen Mitteln sollte denn die Suppe gekocht werden oder der Tee oder Kaffee, den die Leute brauchten?« Die traditionelle Fürsorgestruktur, die davon ausging, dass die große Mehrheit ihrer Klientel einen festen Wohnsitz hatte, war mit dem Ansturm der Flüchtlinge heillos überfordert: »Da war die öffentliche Wohlfahrt hilflos, weil keine Zuständigkeit gegeben war« (zit.n. Landwehr/Baron 1983, 231). Die privaten Wohlfahrtsverbände waren eher geeignet und wohl auch bereit, unbürokratisch Hilfe zu leisten, auch "weil sie sich am ehesten über mangelnde Rechtsgrundlagen und Unsicherheiten bezüglich der Zuständigkeit hinwegsetzen können" (ebd., 203). Letzt-endlich wurde vereinbart, dass in allen Fällen der tatsächliche Wohnsitz zählen sollte. Die Flüchtlinge versuchte man möglichst gleichmäßig auf alle Landesteile zu verteilen, was weitere lange Wege und damit verbundene Versorgungsanstrengungen bedingte. Die Unterstützung der Flüchtlinge verzehrte einen Gutteil der vorhandenen Mittel, ihre Integration in den neuen Wohnorten dauerte Jahrzehnte.
Wenig überraschend verursachte die allgemeine Notsituation eine neuerliche Betonung des Ausschlusszusammenhangs zwischen sozialer Fürsorge und Arbeitsfähigkeit. »Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten, hat keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt" (BSG § 25, Abs. 1). Das Neue ist nicht der Arbeitszwang, der ja seit Jahrhunderten zu den Prinzipien öffentlicher Fürsorge gehört, sondern die Tatsache, dass die Herstellung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit jetzt zu den prominenten Aufgaben der Gesundheits- und Sozialfürsorge wird. Wer physisch krank ist, soll möglichst rasch gesund werden, wer gesund ist und nicht arbeiten will, wird als psychisch krank angesehen. "Der traditionelle Arbeitszwang, durch den man in den Arbeitshäusern des 19. Jahrhunderts Asoziale zur Tätigkeit anhielt, wird durch den Gedanken der Rehabilitation psychischer Störungen ersetzt. Die Arbeitsunwilligen gelten nun nicht mehr als überflüssige Schmarotzer der Gesellschaft, sondern werden individualisiert betrachtet als Personen, die sich durch ihre Anpassungsschwierigkeiten um Anerkennung und Lebensqualität bringen" (ebd., 204). Das die gesamte Sozialgeschichte begleitende Problem jener, die arbeiten wollen oder wieder arbeitsfähig gemacht werden, kann auch dadurch nicht gelöst werden: "Diese Therapeutisierung der Arbeitsverweigerung gelingt allerdings nur, solange die Gesellschaft durch Vollbeschäftigung genug Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, um jedem Arbeitswilligen Arbeit zu geben." (ebd.).
Mit der Linderung der Not und dem Ausbau des Sozialstaates geht eine Veränderung des Paradigmas der sozialen Arbeit Hand in Hand. Sozialer Arbeit geht es nicht mehr bloß, vielleicht sogar nicht mehr vordringlich, um materielle Hilfe, sondern um soziale Pädagogik: um die Unterstützung aller - nicht nur der belasteten - Menschen, im Prozess der Selbstwerdung und Lebensbewältigung. Erfolge in dieser Hinsicht verspricht man sich vor allem von der Gruppenpädagogik, die in zunehmendem Maße das bisher dominierende case work ablöst.
Die Philosophie der Gruppenpädagogik geht nicht bloß implizit, sondern ganz explizit davon aus, dass sie eine Lebensform vermittle, die als solche einen demokratischen Lebensstil sowie demokratische Lernprozesse transportiere. Sie geht von der Prämisse aus, dass jede Gruppe, ob spontan gebildet oder unter An-leitung von Gruppenpädgagogen, zur Bereicherung der Erfahrungen, Kenntnisse und Handlungssicherheit von Individuen beitrage, also auf ihre Mitglieder eine sozialisierende, sie an die Werte und Normen der Gruppe anpassende Wirkung habe (ebd., 215).
Die Betonung der Zusammengehörigkeit der Gruppe schließt allerdings die Gefahr ein, jene die nicht harmonisieren auszuschließen. Möglicherweise sind das vor allem jene, auf die sich die Bemühungen der Sozialarbeit vor dem Paradigmenwechsel gerichtet hat: die ökonomisch Zurückgebliebenen, die in psychischen oder sozialen Krisen Befindlichen, die Nonkonformen und die von denen, die dazu gehören, Ausgeschlossenen.
Jugendbewegung und Jugendarbeit haben im Deutschen reich seit der Wende zum 20 Jahrhundert eine große Tradition.
Die klassische Jugendbewegung entwickelt sich seit 1900 in Deutschland. Entstanden in Berlin-Steglitz aus dem "Ausschuss für Schülerfahrten", unterstützt durch progressive Lehrer wie Ludwig Gurlitt, entfaltet sich der "Wandervogel" bald in den bunt-vielfältigen Formen kleiner Gruppen, häufig untereinander zerstritten und miteinander konkurrierend, die für diese autonomen Versuche einer Organisation der Jugend typisch sind. Die gemeinsame Programmatik dieser Bewegung wird sichtbar, als sich 1913 in demonstrativer Konkurrenz zur Jahrhundertfeier der Völkerschlacht von Leipzig die führenden Vertreter der Jugendbewegung auf dem Hohen Meißner (im Werra-Tal) treffen, um der sich selbst feiernden Erwachsenenwelt die eigenen Ansprüche entgegenzusetzen: Im Aufruf zur Versammlung werden die Forderungen "einer edlen deutschen Jugendkultur" vorgetragen, in der die Jugend nicht mehr nur ein "Anhängsel der älteren Generation" darstellt, "aus dem öffentlichen Leben ausgeschaltet und auf eine passive Rolle angewiesen" ist, sondern "beginnt sich auf sich selbst zu besinnen" und selbstbestimmt, "unabhängig von den trägen Gewohnheiten der Alten und von den Geboten einer hässlichen Konvention sich selbst ihr Leben zu gestalten", "jugendlichem Wesen" entsprechend. Das geschieht zwar aus "reiner Begeisterung für höchste Menschheitsaufgaben", schließt aber auch ein, dass diese Jugend "jederzeit bereit ist, für die Rechte ihres Volkes mit dem Leben einzutreten" und "auch im Kampf und Frieden des Werktags ihr frisches, reines Blut dem Vaterlande weihen" will. Der "billige Patriotismus" wird dagegen kritisiert und mit den eigenen Programmsätzen konfrontiert: "Befreiungskampf gegen den Alkohol", "Veredelung der Geselligkeit", "ein inniges Verhältnis zu Natur und Volkstum", eine neue Schule und "freies Wandern", verdichtet in der abschließenden Schlussformel: "Die Freie deutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten" (; Tenorth 2000, 217 f., Zitate aus Mogge 1985, 177).
Es beginnt das Zeitalter der Jugendorganisationen:
Etwa 40 % aller Jugendlichen gehören irgendeinem Verein oder Verband an, aber doch nur zu einem ganz geringen Teil in Bünden und Gruppen der klassischen Jugendbewegung. Von allen Jugendlichen, die mit ihren Organisationen im "Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände" vertreten sind, waren (1927) nur knapp 1 % in Bünden der alten Jugendbewegung, dagegen 10,6 % in evangelischen, 18 % in katholischen und 8,6 % in sozialistischen Jugendorganisationen, aber 37 % in Sportverbänden und etwas mehr als 10 % über den Beruf organisiert, z.B. in Gewerkschaften (Tenorth 2000, 220).
Die neuen Jugendorganisationen waren freilich überwiegend Männerbünde:
Frauen waren relativ zur Altersgruppe nicht nur deutlich geringer organisiert (zu 26%), in der männerbündischen Ideologie der Jugendbewegung war ihr Platz auch immer unsicher. [...]
Unbeschadet der Präsenz von Frauen innerhalb der Jugendbewegung vor und nach 1918, wird man aber sagen müssen, dass diese Bewegung bis 1933 im wesentlichen nicht eine Bewegung der "Jugend", sondern eine Bewegung der "Jungen", also eine männlich dominierte und von männerbündischen Idealen inspirierte Bewegung ist. Dafür spricht nicht nur der Organisationsgrad von Frauen innerhalb der alten und neuen Jugendbewegung, sondern auch das Selbstverständnis der Hauptvertreter und die intensiv geführte Auseinandersetzung und Kontroverse über den "Feminismus" in der Jugendbewegung sowie das Verständnis von Sexualität. Dabei ist die homo-erotische Komponente im Selbstbild der Jugendbewegung schon vor 1914 nicht nur von Gegnern vermutet, sondern in der Selbstdarstellung der Jugendbewegung, vor allem bei ihrem einflussreichen Theoretiker Hans Blüher, auch eindeutig eingestanden worden. [...]
Formen der Jugendarbeit, die in der Jugendbewegung ausgebildet worden waren - Fahrt und Lager, Gesang und Gesellungsformen, Kleidung und Grußrituale - dringen zugleich in den Alltag der Jugend insgesamt ein. Sie überformen deren Leben, unabhängig von der sonstigen ideologischen und politischen Zu-rechnung (Tenorth 2000, 220 f.).
Viele in der Jugendbewegung entwickelte Formen sind "als Anregung und kritischer Stachel bis heute wirksam" (ebd., 221):
[...] die demokratischen Elemente der Selbstverwaltung und fraglos akzeptierten Koedukation der Geschlechter, die man bei den "Falken" oder in den Sommerlagern und Kinderrepubliken der "Kinderfreunde" findet; die universale Einbindung in milieuspezifische Erwartungen, die etwa die sozialistischen Jugendorganisationen zeigen. Hier, in der Verbindung einer Formenwelt, die innerhalb der sozialen Bewegungen ausgebildet worden war, mit den lebensweltlichen Mustern der Ordnung des Generationenverhältnisses werden auch die pädagogischen Innovationen geboren, die an den 20er Jahren bis heute imponieren: vom Kindertheater bis zur neuen Kinder-Literatur, von selbstbestimmten Kinderrepubliken bis zur Koedukation, in Versuchen einer begründbaren Sexualpädagogik, wie in Berlin oder Wien, zusammen mit neuen Formen der Arbeiterbildung und -kultur. Diese Fülle an Erziehungskonzepten und Bildungsprogrammen wird mit Konsequenzen entwickelt, die als Anregung und kritischer Stachel bis heute wirksam sind (Tenorth 2000, 221).
Die Jugendbewegung ist aber nicht eigentlich nur eine "Jugend"-Bewegung. Es sind vielmehr die Jugenbilder der Erwachsenen und deren die Jugend als Zukunft der Gesellschaft gerichteten Hoffnungen und Ängste (Roth 1983), die der Bewegung gesellschaftliche Bedeutung verleihen:
Die "Jugend" und die "junge Generation" werden zu Begriffen, mit denen die Gesellschaft insgesamt ihre Zukunft neu zu denken versucht. Damit gerät die generationsspezifische Kultur nicht nur in die Nähe zur Freizeitindustrie, in der Realisierung wird sie zugleich auf die primären Merkmale sozialer Differenzierung zurückgeworfen: auf Klassenlage, Schichtung, Milieu und Konfession, materielle Lage und regionale Plazierung, und sie wird zunehmend stärker eingebunden in die Mechanismen der Öffentlichkeit, die schon bald den Mythos Jugend und die Hoffnung auf die junge Generation funktionalisieren. Die Jugend muss einen Verlust an Autonomie in Kauf nehmen, den sie bis in die 1960er Jahre nicht kompensieren kann (Tenorth 2000, 222).
Patriotismus als Ideal und Führerprinzip als Organisationsform machen die Jugendbewegung zusätzlich anfällig für die politische Funktionalisierung, die im Nationalsozialismus vollzogen wird:
Seit 1933 findet der Mythos der Jugend in der Zwangsorganisation der Hitler-Jugend (HJ) ein unrühmliches Ende. 1934 werden die letzten ungebundenen Gruppen, z.T. freiwillig, z.T. mit Druck, in die HJ integriert, wenn sie sich nicht selbst auflösen oder ganz verboten werden, wie die sozialistischen Organisationen. Zwar wird die HJ, mitsamt dem BDM für die weiblichen Jugend, selbst erst 1939 eine Pflichteinrichtung, der alle Jugendlichen beitreten mussten, ihre verhängnisvollen Wirkungen auf das Jugendleben werden indes schon früher sichtbar. Für die Jugendlichen selbst ist die Attraktivität bald geschwunden, die z.B. auf dem Lande mit dem Angebot jugendlicher Aktivitäten frei von Kirche und Gemeinde verbunden war. Die Einbindung in Leistungswettbewerbe und Berufswettkämpfe, die von der HJ mit organisiert werden, ersetzen auf Dauer auch nicht ein selbstbestimmtes Jugendleben. Von einer Autonomie der Jugend kann keine Rede sein, so dass bald Resistenzformen - von bürgerlichen Swing-Gruppen relativ unpolitischer Natur bis zu explizitem politischem Jugend-Widerstand - sich entwickeln. Die Ausbeutung als dominante Form des politischen Umgangs mit der Jugend wird noch im Weltkrieg in der Verpflichtung der Jugendlichen zum Flakhelfer dokumentiert, in dem als Symbol einer geopferten Zukunft die Jugend einem verbrecherischen Staat noch in seinem Untergang dienstbar gemacht wird (Tenorth 2000, 222).
Die Massenarbeitslosigkeit der Nachkriegsjahre traf, wie immer, besonders die Jungen. Arbeitsplätze fehlten ebenso wie Ausbildungsplätze und damit jede sichere Zukunftsorientierung. Die Romantik der "Wandervögel" der Zwischenkriegszeit hat sich zum Elend des "Vagabundierens" Jugendlicher verkehrt. Mit Jugendaufbauwerken, Jugenddörfern, Jugendsiedlungen und Aufbauheimen versucht man dieser Wanderjugendlichen Herr zu werden, ihnen Berufsausbildung und Arbeitsmöglichkeiten zu vermitteln.
Mehr als 510.000 heimat- und berufslose Jugendliche sind in Not und gefährden die gesunde, kulturelle, wirtschaftliche, soziale, politische und soziologische Entwicklung des deutschen Volkes. Sie warten auf Ar-beit, warten auf Ausbildung, hoffen auf eine neue Heimat.
So beschreibt eine Dankschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk 1949 die Lage (zit.n. ebd. 206). Angesichts der Aussichtslosigkeit der Situation wird von manchen sogar die Wiedereinführung des Arbeitsdienstes der 30er und 40er Jahre gefordert. 1951 wird der erste Bundesjugendplan vorgelegt, dessen zentrales Anliegen ebenfalls die Jugendarbeitslosigkeit ist. Erst mit dem so genannten "Wirtschaftswunder" ab den 50er Jahren verbessern sich die Verhältnisse - und zwar mit einer Geschwindigkeit, die niemand vorsehen konnte: Während zu Anfang der 50er die Zahl der Arbeitslosen noch 10% beträgt, gibt es an deren Ende bereits einen Mangel an qualifizierten Fachkräften, eine "Bildungskatastrophe" wird ausgerufen und die "Mobilisierung der Begabungsreserven" gefordert (ebd., 207).
Die Jugendarbeit der Nachkriegsjahre setzt die Tradition der dichotomisierenden Jugendkonstrukte des 19. Und 20, Jahrhunderts, wie sie Lutz Roth (1983, vgl. Rathmayr 1998) beschrieben hat, fort. Die all-gemeinen Ansichten über "die Jugend" orientieren sich weniger am tatsächlichen Verhalten junger Menschen als an den Vorstellungen und Phantasien Erwachsener über sie. Ein einheitliches Jugend-konzept esistiert in unserem Kulturbereich erst seit weniger als hundert Jahren. Erst seit so kurzer Zeit gibt es eine einheitliche Vorstellung von "Jugend" oder "Jugendlichen" als einer alle jungen Menschen zusammenfassenden Bevölkerungsgruppe.
Bei dieser "Erfindung des Jugendlichen", so Roth, waren vor allem zwei Tendenzen am Werk, die bis heute die allgemeine Meinung und den Umgang mit Jugendlichen nachhaltig bestimmen: eine zunehmende Enteignung der Selbstkonzeption konkreter Jugendlicher durch öffentliche Zuschreibungen und eine angstvolle, abwertende Haltung gegenüber Jugendlichen als potentiell sittlich gefährdeten Existenzen, die nur durch ein hohes Maß an Kontrolle und Erziehung zu wertvollen Gesellschaftsmitgliedern gemacht werden können. Die Vereinheitlichung der "Jugend" als Gegenstand gesamtgesellschaftlicher Einstellungen erfolgte unter dem Kriterium des Wohlverhaltens, von dem der öffentliche Umgang mit Jugendlichen seitdem dominiert wurde.
Unabhängig davon, wie sie sich selbst präsentieren, werden Jugendliche nach Maßgabe der Vorstellungen Erwachsener von einem angemessen, ordentlichen Verhalten beurteilt. Sie sind von vornherein in die unausweichliche weichliche Dichotomie von Idealisierung und Dämonisierung eingespannt, vor der aus alle ihre Handlungen bewertet werden. Belanglose Verhaltensweisen wie das Aufstehen oder Sitzenbleiben in öffentlichen Verkehrsmitteln werden zu Kardinalfragen von prinzipieller Bedeutung hochstilisiert. Wer sitzen bleibt, wird als "typischer" Vertreter der "heutigen" - d.h. rücksichtslosen - Jugend" abgewertet, wer Platz macht als erfreuliche Ausnahme glorifiziert - beides gleich peinlich und einengend für die konkreten Jugendlichen. Deren eigene Sichtweise hat auf die Beurteilung durch Erwachsene wenig Einfluss: "Entwickelt und verbreitet wurden die Jugendkonzepte immer von jenen, die sich berufsmäßig um Jugendprobleme zu kümmern hatten: Minister und Lehrer, Feldherrn und Fürsorger. Die Bilder dieser Urheber und Mitträger der Konzepte für richtiges Jungsein zeigten immer dasselbe Strickmuster der Triebunterdrückung und Disziplinierung: Ordnung und Sauberkeit, sexuelle Enthaltsamkeit, Anstand, Sitte, und das erste und letzte Gebot etwa der Arbeitsfleiß, Jugendkonzepte wurden von der Obrigkeit gegen die Jugend erdacht, verfasst und umgesetzt" (Roth 1983, 140).
Die Jugendarbeiter der Nachkriegsjahre stammen zum Großteil aus der Jugendbewegung der Vor-kriegsjahre und teilen deren idealisierendes Pathos: »Unsere Gruppen wollen die Keimzellen des neuen Menschentums sein«, heißt es in im Bericht über ein Treffen, »vor uns steht kristallklar die von allem schädlichen Beiwerk befreite Persönlichkeit und die von jeglichem Schlagwort entledigte und wahre Gemeinschaft der Jugend.« Wie sehr er selbst sich der Schlagworte bedient, wird dem Autor nicht klar, aber »Unser Weg ist klar: - Jede Jugendgruppe eine Keimzelle neuen Menschentums« (zit.n. Rosen-wald/Theis 1984, 210 f.).
Wie wenig die Beschwörung der Jugend als Zukunft der Gesellschaft noch dem Selbstverständnis der Jugendlichen entspricht, "wird gegen Ende der 50er Jahre unübersehbar deutlich. Die Jugendverbände selbst rufen die Krise der Jugendarbeit aus: mangelnde Beteiligung der Jugend an den Veranstaltungen, schrumpfende Mitgliederzahlen, mangelnde Eigeninitiative der jugendlichen Verbandsmitglieder, Vorherrschen von Betriebsamkeit, Ratlosigkeit hinsichtlich der Formen" (Hering/Münchmeier 2000, 210). In der Not der Machkriegsjahre und erst recht in den Jahren der beginnenden Wirtschaftswunders orientiert sich das Verhalten Jugendlicher zunehmend nicht mehr an den Normen der Erwachsenen. Der jugendliche Teil der Bevölkerung entwickelt sich als eigenständiger Träger von Zukunftserwartungen und Zukunftshoffnungen, auch Zukunftsängsten, die sich nicht mehr als Übernahme oder Ablehnung entsprechender Vorstellungen der Erwachsenen verstehen, sondern als Ausdruck eigenständiger Lebenserwartungen der Jugendlichen selbst. Das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist dadurch grundsätzlich asymmetrisch geworden. Während die Mehrzahl der Erwachsenen Jugendliche immer noch als "Jugendliche" im historisch gebildeten, gesellschaftlich abwertenden und pädagogisch einschränkenden Sinn definiert und sich selbst konsequenterweise als deren übergeordnete Autoritäten und Vorbilder, konzipieren Jugendliche sich selbst als gleichwertige und gleichberechtigte Bürger. Die "aus der Tradition der Jugendbewegung übernommenen asketischen Ideale (einfaches leben, Sparsamkeit, Selbstdisziplin, Lager und Fahrt statt Tourismus usw.)" (ebd..) sind nicht mehr vermittelbar.
Diese Asymmetrie ist umso wirksamer, als die moderne Konsumgesellschaft nicht mehr die Version der Erwachsenen, sondern jene der Jugendlichen unterstützt. Dadurch wird die Sicht Erwachsener zur bloß subjektiven Idealisierung, während die Jugendlicher zur objektiven Gesellschaftstatsache reüssiert. Das Jugendkonzept Erwachsener wird weder mehr von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung unter-stützt, noch sind "die" Jugendlichen bereit, sich auf die von ihm definierten Merkmale "des" Jugendlichen festschreiben zu lassen. Sie sind gewissermaßen erwachsene Kinder: In der Art, wie sie institutionell in die Gesellschaft eingefügt sind, als abhängige Söhne und Töchter in Familien, als unselbständige Schüler und Lehrlinge in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, sind sie Kinder; In der Art, wie sie in die nichtinstitutionellen Bereiche der Gesellschaft eingefügt sind, sind sie dagegen erwachsen- als voll-gültige Konsumenten, als ernstzunehmende Träger von Beziehungs-, Freizeit- und Unterhaltungsaspirationen, als Adressaten unterschiedsloser medialer, ökonomischer und anderer kultureller Einflüsse. An die Stelle der idealistischen Zumutung verallgemeinerter Jugendkonzepte tritt der realistische Zustand objektiver Vereinheitlichung der Jugendlichen durch die Verhaltensstandards der modernen Konsumgesellschaft.
In den 1950er Jahren bahnt sich jene Entwicklung an, die in den 60er Jahren zur Revolte und in den 70er Jahren zur Vielfalt der Jugendkulturen und ab den 80er Jahren zu jener Eigenständigkeit des Jugendlebens geführt hat, die wir heute vorfinden. Junge Menschen machen ihre Abschiebung in ein pädagogisch geschaffenes Ghetto nicht mehr mit. Sie sind allergisch geworden gegenüber der Doppelmoral einer faktisch immer hedonistischeren, in Erziehungsfragen aber noch immer moralischen Gesellschaft. Sie erwarten mit großer Selbstverständlichkeit die Partizipation an der Welt der Erwachsenen, wie sie ist. Sie sind immer weniger bereit, auf die Errungenschaften des Erwachsenenlebens zu verzichten, auf seine Freuden wie auf seine Laster.
Die Jugendverbände versuchen zögerlich, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. In der so genannten Erklärung von St. Martin wird betont, das sie sich »nicht vom gesellschaftlichen Leben isolieren.« Ein »autonomes Jugendreich« werde »nicht angestrebt« (zit.n. ebd., 211). Wie sehr die öffentliche Moral noch die Familie als einzig zuständige Erziehungsinstanz auffasst, wird an eine heute fast skurril anmutenden Vorgang deutlich. Der im Jugendwohlfahrtsgesetz Anspruch einer Zuständigkeit nicht bloß für gefährdete Jugendliche, sondern für die Sozialisation der Jugendlichen insgesamt, musste erst rechtlich durchgesetzt werden: 1967 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass "eine sozialpädagogisch und präventiv ausgerichtete Jugendpflege [...] eine öffentliche Aufgabe neben und ergänzend zur Familien-erziehung sein könne.
Für ein sich wandelndes Selbstverständnis der Jugendsozialarbeit sind die immer noch autoritär geführten Erziehungsheime zunehmend nicht mehr tragbar. Deren Reform freilich ist mühsam und stößt nicht zuletzt deshalb auf massive Widerstände, weil autoritäre Erziehungsauffassungen auch außerhalb der Heime gang und gäbe sind. Erst durch die Heimkampagnen der 1960er Jahre gelingt es allmählich, Großheime zu verkleinern, das Heimpersonal besser zu qualifizieren und neuen pädagogischen Methoden auf den Weg zu helfen.
Die Familienpolitik der Nachkriegsjahre ist in einem dezidierten Sinn restaurativ. Sie will nicht nur die durch den Krieg verursachten sozialen Probleme beheben und die Familien unterstützen, sondern be-treibt dieses Anliegen mit einem Pathos der Familie als "Keimzelle des Staates", das der Ideologie des NS-Regimes gar nicht so unähnlich ist:
Die Familie ist eine vom Schöpfer gewollte und bestimmte Lebens-, Liebes- und Schicksalsgemeinschaft, aufgebaut auf: Ehrfurcht, Treue, opferbereite Liebe. Zerstörend wirken: a) Untreue, Unsauberkeit, Arbeits-scheu, Genusssucht, Unkenntnis der beruflichen und häuslichen Pflichten und Arbeiten; b) reiner Materialismus und des Doppelverdienens (Knies 1954, 3, zit.n. ebd.).
Die tatsächliche soziale Wirklichkeit, in die hinein derartige Phrasen gesagt werden, ist eine gänzlich andere. Die überkommene Rollenverteilung ist durch den Krieg aufgelöst worden. Frauen mussten traditionelle Männerrollen übernehmen und unter äußerst schwierigen Bedingungen für den Lebensunterhalt sorgen. Was von der NS-Demagogie und konservativen Famlienideolog/innen als »Doppelverdienertum« gebrandmarkt wurde, war auch noch nach dem Krieg überlebensnotwendig: Zwischen 1945 und 1958 stieg die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland von 2,9 auf 6,5 Millionen.
Die neue Familienfreundlichkeit hatte etwas ganz anderes im Sinn: Die mit der erzwungenen Übernahme von bislang den Männern vorbehaltenen Domänen wieder in die alten patriarchalischen Bahnen zu lenken und den Männern, sobald sie aus Krieg und Gefangenschaft zurück kehrten die angestammte Position im Familiensystem wieder frei zu räumen. Es wiederholte sich ein Vorgang, der bereits nach dem Ende des ersten Weltkrieges vor sich gegangen war, und die im Krieg geschehene Emanzipation von Frauen rückgängig machen sollte. Hinter der neuen Familieneuphorie verbarg sich die Sorge der Männer, dass die Frauen, die sich daran gewöhnt hatten, "Lohnarbeit zu verrichten und einen Haushalt ohne Mann zu organisieren", in Zukunft "die Ungleichheit in der heterosexuellen Beziehung nicht länger gefallen lassen würden" (Grossmann 1983, 42). Wieder einmal muss die gefährdete Jugend als wohlfeile Begründung konservativer Politik herhalten: »Man kann heute sagen«, teilt der Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 1952 mit,
dass die nach dem Krieg befürchtete Zerstörung des sittlichen Gefüges und die Gefahr der allgemeinen Verwilderung der Jugend durch die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und die der Familie inne-wohnenden Kräfte im großen und ganzen abgewendet worden ist (zit,n. Hering/Münchmeier 2000, 208).
Den real existierenden Familien kommt die neue Politik trotz aller restaurativen Ideologie zu Gute. 1953 wird ein Familienministerium eingerichtet, das sich um Kindergeld, Steuerfreibeträge für Familien, Er-mäßigungen und Wohnungen für Familien kümmert. In den Kommunen entstehen Abteilungen für Familienfürsorge, freilich auch diese mit konservativem Einschlag: "Kurse für Nähen, Hauswirtschaft und Gesundheitspflege [sollen] die Mütter und die Familien stärken" (ebd.). Im gesamten Bundesgebiet wer-den Familienberatungsstellen eingerichtet.
Nach der Reihe entstehen kirchliche und überkonfessionelle Familienorganisationen wie der Familienbund deutscher Katholiken oder die Evangelische Aktionsgemeinschaftfür Familienfragen, bzw. der Deutsche Familien-Verband und der Bund der Kinderreichen Deutschlands, alle 1954/55 in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Familienorganisationen zusammengeschlossen.
Dass die Bemühungen der Familienpolitik und der Familienfürsorge hinter den gesellschaftlichen Erfordernissen zurück bleiben, wird besonders am Problem der Erwerbstätigkeit der Frauen sichtbar. Einerseits erweisen sich "alle Versuche der Politiker und Behörden, den Umfang der Frauenerwerbstätigkeit zurückzuschrauben, als nur begrenzt effektiv", andererseits erhöhen sie "den moralischen Druck auf die Frauen" (ebd.) Nicht zuletzt der Papst ist es, der den Frauen ins Gewissen redet:
Das Haus, in dem die Frau die Königin ist, bildet das Zentrum und die Stätte ihres hauptsächlichen Wirkens. Aber in der jetzigen Ordnung der Dinge hat die Industrie mit ihren riesigen Fortschritten einen Wandel ohnegleichen herbeigeführt. Sie hat eine große Zahl von Frauen gezwungen, den häuslichen herd zu verlassen und ihre Arbeit in den Fabriken, in den Büros und Geschäften zu verrichten. Welches ist eure Pflicht unter diesen Umständen? Sorget dafür, dass die Familie das Heiligtum eures Lebens sei« (Pius XII "Zu den Aufgaben der Frau" in: Frau und Mutter, Nr. 12, 1958, 194, zit.n. ebd.).
Dass eine Frau freiwillig ihr Königreich um einen außerhäuslichen Arbeitsplatz erweitert, hält der Papst nicht für möglich. Die Folgen dieser rückwärts gewandten Ideologie tragen die Familien, insbesondere die Frauen, bis heute. Sie ist dafür verantwortlich, dass, insbesondere für die bis zu 3-jährigen, keine oder keine ausreichenden Möglichkeiten der außerfamilialen Kinderbetreuung geschaffen wurden und werden, Ursache nicht nur der Doppelbelastung vieler Frauen, sondern auch der sinkenden Kinderzahl in den mittel- und südeuropäischen Ländern, mit Ausnahme jener, die dieser Ideologie nicht gefolgt sind.
Wenn auch die Protestbewegungen der 1960er Jahre nicht unmittelbar Reaktionen auf soziale Missstände zurück zu führen waren, sondern politische Ursachen wie den Vietnamkrieg, die Rüstungsindustrie oder gesellschaftliche wie die Verdrängung der NS-Schuld, die Auswüchse des Kapitalismus, die Zerstörung der Natur bzw. die autoritären Strukturen in Staat, Bildungsinstitutionen, Familie und Erziehung, so hatten sie doch erhebliche Auswirkungen auf die Soziale Arbeit. Als Beispiele nannte He-ring/Münchmeier (ebd., 227):
Die Heimkampagnen und Jugendzentrumsbewegungen, die Entwicklung von politischer Bildung und Friedenspädagogik, der Aufbau von Gemeinwesenarbeit in Trabantenstädten [...], die Kritik an der männlichen Orientierung der Jugendarbeit (Jugendarbeit ist Jungenarbeit) mit der Entwicklung einer autonomen Mädchenarbeit, der Aufbau von Notrufen, Mütterzentren und Frauenhäusern, die Erprobung von neuen Formen der Kleinkindbetreuung wie z.B. Tagesmüttermodelle, Kinderläden und Mutter-Kind-Projekte.
Neben den fortdauernden Problemen deprivilegierter Bevölkerungsschichten bilden sich Formen einer "neuen Armut" heraus, die quer zu den sozialen Schichten liegen, und auf die klassische Sozialpolitik nicht eingestellt ist: Alte Menschen, allein erziehende Mütter (Eltern), Behinderte, Pflegebedürftige, Schulversager und - immer noch - Langzeitarbeitslose, die inzwischen auch Akademiker/innen sein können.
Ein erster Effekt dieser Entwicklungen ist der forcierte Ausbau des Personals in der sozialen Arbeit und dessen Qualifizierung. In Deutschland wird die Ausbildung in Fachhochschulen für Sozialwesen organisiert, in Österreich in Sozialakademien, die wie die Ausbildung in Salzburg später in Fachhochschulen für Soziale Arbeit umgewandelt werden. Zwischen 1950 und 1997 wächst die Zahl der im sozialen bereich Berufstätigen von 67.000 Personen auf über 1 Million an.
Was die Sozialarbeit selbst betrifft, gehen Hering/Münchmeier (ebd., 231) davon aus, dass deren Handlungsbedingungen "in der ‚Krise' der sozialen Modernisierungspolitik, im Aufbrechen problematischer Effekte und Widersprüche sozialstaatliche Politik (‚Spezialisierung', ‚Bürokratisierung', ‚Klientilisierung'), v.a. aber durch die Folgen des Umbaus der Arbeitswelt und die staatliche Finanzierungskrise unübersichtlich und widersprüchlich" werden, eine Diagnose, die sie bereits dem Beginn der Nachkriegszeit gestellt hatten. Sozialarbeit werde "dazu in Anspruch genommen, die Folgen gesellschaftlicher Entwicklung bei verschiedensten Problemgruppen kompensatorisch zu bearbeiten (Schulstress, Drogen, Ausbildungskrise, erschwerte Übergänge in den Erwerbsbereich, Anwachsen alternativer Lebensorientierungen)." Sie erhalte dadurch "den Charakter einer sozialen Infrastruktur der Lebensbewältigung und wird stärker einem sozialpolitischen (statt sozialpädagogischen) Steuerungsmodus unterworfen" (ebd.). Sollte in dieser Betrachtungsweise ein insgeheimes Bedauern mitschwingen, wäre das ähnlich problematisch wie die von Lehrer/innen und Schulpolitikern vorgebrachte Klage über wachsende Sozialisationsdefizite von Schüler/innen, deren Behebung unzulässiger Weise den Schulen zugemutet werde. Einrichtungen sozialer Hilfe dürfen sich nicht auf die ungestörte Fortsetzung einmal übertragener oder gewählter Teilaspekte ihres Beitrages zur Bewältigung individueller Krisen beschränken, sondern müssen diesen Beitrag nach den jeweiligen Erfordernissen richten. Das Argument der Systemkonformität kompensatorischen Handelns ist, so alt es ist, dann unzutreffend, wenn soziale Arbeit zugleich die gesellschaftlichen Ursachen dieser Krisen öffentlich macht und politische Lösungen einfordert.
Am Ende ihres Buches jedenfalls stellen Hering/Münchmeier unmissverständlich klar: "Die Soziale Arbeit muss im Zusammenhang gesehen werden mit der sozialgeschichtlichen Entwicklung der Lebensverhältnisse und Lebenslagen von Familien, Kindern und Jugendlichen und den Problemkonstellationen, die sich daraus herleiten" (ebd., 234). Fügt man zu den Familien, Kindern und Jugendlichen noch die Alleinerziehenden, die Älteren, die Behinderten, die Arbeitslosen, die Homosexuellen, die Migrant/innen, usw. dazu oder spricht man besser überhaupt von den Menschen in Gesellschaft, dann hätte man zumindest das Klientel der Sozialen Arbeit angemessen bestimmt.
In Österreich wurde nach der NS-Ära ein Überleitungsgesetz erlassen, um die rassistischen Einschläge der NS-Sozialgesetze zu eliminieren. Die massenhaft Hunger und Not leidenden Menschen, darunter die mehr als 500.000 Kriegsopfer, konnten weder aus den Kassen der Gemeinden noch aus der Staatskasse bzw. den Töpfen der Versicherungen ausreichend versorgt werden. Im Laufe der Jahre bemühte man sich, die zu niedrigen Renten und Pensionen zu erhöhen und 1954 durch das Rentenbemessungsgesetz auf eine neue Basis zu stellen. Sukzessive wurde das Versicherungssystem auf alle Personengruppen ausgedehnt und 1955 durch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz rechtlich vereinheitlicht. "Was den Bereich der Armut bzw. der Fürsorge betrifft, so herrschte Ende der 1950er Jahre der Glaube vor, ‚mit dem umfassenden Ausbau der Sozialversicherung seine alle wesentlichen Probleme gelöst und die Fürsorge infolgedessen zum Absterben verurteilt' (Drapalik 1974, 78, zit.n. ebd., 153), eine Prognose, die sich als "Wunschdenken" erwies (ebd.). Tatsächlich basiert die Sozialpolitik in Österreich damals wie heute auf zwei Netzen. Den Sozialversicherungen und der Fürsorge, die seit den 70er Jahren "Sozialhilfe" und seit 2010 "Bedarfsorientierte Mindestsicherung" genannt wird. Allerdings verringerte sich die Zahl der Sozialhilfeemfänger/innen beträchtlich: Waren es 1945 noch über 50.000, so erhielten 1973 nur mehr 6.000 Personen dauerhafte soziale Unterstützung. Motor dieser Entwicklungen in der 2. Republik war die für die Österreich kennzeichnende Konsenspolitik der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft, deren Repräsentanten die Interessen der von ihnen vertretenen Bevökerungsgruppen artikulierten und untereinander aushandelten (Gewerkschaft, SPÖ: Arbeitsrecht, Leistungen der Sozialversicherung, Wirtschaft, ÖVP: Selbständige, Familien).
Die Sozialfürsorge blieb auf Länderbasis gesetzlich verankert und ist es bis heute, da alle Bemühungen um ein bundesweit einheitliches Fürsorgegesetz scheiterten. Die Ländergesetze übernahmen eine Reihe der in den NS-Gesetzen vorgesehenen Regelungen. So wurde etwa der Unterschied zwischen all-gemeiner und gehobener Fürsorge beibehalten. Der niedrigere Richtsatz der allgemeinen Fürsorge "fand zum Beispiel Anwendung auf Staatenlose, Ausländer, arbeitsscheue und unwirtschaftliche Personen sowie solche, die den berechtigten Anordnungen der zuständigen Stellen zuwiderhandeln".[156]
Die Gesetze repräsentieren "das Weiterbestehen der traditionellen Logik der Fürsorge mit ihrem uneinheitlichen Leistungsniveau, ihrer familialistischen Ideologie und der steten Sehnsucht, nach ‚Würdigen' und ‚Unwürdigen' zu unterscheiden. Zudem manifestiert sich der Grundsatz, dass die Fürsorgeunter-stützungs-Richtsätze in gehörigem Abstand zu den niedrigsten Löhnen am Arbeitsmarkt bleiben sollten, um zu vermeiden, dass Fürsorgeunterstützung zur ‚attraktiven' Alternative zur Lohnarbeit werden könnte. So sieht etwa die steirische Landerregierung vor, dass das Einkommen eines Hilfsbedürftigen samt der Unterstützung 85% des früheren Einkommens nicht übersteigen darf, und "dass der Bedarf eines Hilfsbedürftigen, der seinen Familiezusammenhang verlassen hat, um durch die Trennung eine höhere Unterstützung zu erreichen, so zu bemessen ist, als ob er noch zur Gemeinschaft gehörte" (zit.n. ebd., 155).
1975 wurden in allen Ländern neue Sozialhilfegesetze (LSHG) beschlossen. Sozialhilfe beruht seitdem "auf drei Pfelern" (ebd., 156):
"Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs" (mit Rechtsanspruch)
"Hilfe in besonderen Lebenslagen"
"Soziale Dienste": z.B. Essen auf Rädern, Heim- Haushaltshilfen, Besuchsdienste, Hauskranken-pflege - für alle, auch nicht Bedürftige zugänglich, Kostenbeteiligung je nach Haushaltseinkommen
Seit den 1980er Jahren kommt es aufgrund schwächeren Wirtschaftswachstums, höherer Arbeitslosigkeit, längerer Lebensdauer und mehr Pflegebedürftiger zu Leistungseinschränkungen und einer restriktiveren Handhabung der Zugangsbedingungen. Der markanteste Einschnitt ist die so genannte "Pensionssicherungsreform" der ÖVP/FPÖ-Regierung, die für die Pensionsempfänger eine Reihe von Kür-zungen bzw. nachteilige Berechnungsformen brachte.
Die Tendenzen wiesen im Kern auf ein Steuerungsmodell, demzufolge der ‚passive' Sozialleistungsempfang durch eine (hoheitlich kontrollierte) Aktivierung der Leistungsbezieher (bevorzugt erwerbsloser Menschen) abgelöst werden soll. Damit werden die klassischen Elemente der Sozialdisziplinierung wieder sichtbar. Der Transformationsprozess wird zudem durch Privatisierungstendenzen sozialer Sicherheit unterfüttert, sodass es zwangsläufig zu einem neuen ‚Wohlfahrtsmix' kommt. Darüber hinaus wird seit Jahren seitens der Politik eine Propagandaoffensive zu Gunsten der Aufwertung des sozialen Ehrenamtes betrieben, womit zivilgesellschaftliches Engagement wider verstärkt als Bürgertugend, aber auch als (billige) Ergänzung zu kostspieligen professionellen sozialen Dienstleistungen zur Wirkung gebracht werden soll. In den zentralen Bereichen des Systems der sozialen Sicherheit und gleichermaßen im Bereich der Landes-Sozialpolitiken wurde gleichsam als roter Faden stets auf die Kürzung von Leistungsansprüchen und die Verschärfung der Zugangsbedingungen zu Sozialleistungen als Feinsteuerung bei vermeintlich knappen oder leeren Haushaltskassen zurückgegriffen (ebd., 159).
[155] Das Sozialrecht der 1920er Jahre ist nach wie vor in Kraft: Die Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht (RFV) vom 13.12.1924; Die Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß öffentlicher Fürsorge (RGr) vom 4.12.1924; Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz(RJWG) vom 9.7.1923 und Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 1.7.1923.
[156] Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung, 1963, zit.n. Melinz 2003, 154.
Inhaltsverzeichnis
Die Formel "Geht`s der Wirtschaft gut, geht's den Menschen gut" unterstellt ein Verständnis von Wirtschaft als willfährige Zuarbeiterin zu einem gerechten und sozial aufmerksamen Staatswesen. Sie unterschlägt, dass dies zwar ein möglicher Effekt wirtschaftlicher Prosperität sein kann, aber nicht notwendiger Weise ist, und dass das primäre Interesse der Wirtschaft nicht das Wohlergehen der Bürger sondern die Erzielung von Gewinn ist. Die Formel zielt deshalb vor allem darauf ab, den Staat zu veranlassen, es der Wirtschaft gut gehen zu lassen, verbunden mit der hinterrücks lauernden Drohung, dass es ansonsten dem Staat und seinen Bürgern schlecht gehen könnte. Die Bindung der Sozialbudgets an die Wirtschaftsentwicklung wird immer dann prekär, wenn die Wirtschaftskraft stagniert oder zurück geht. Ob das, wie in der gegenwärtigen Finanzkrise, die Wirtschaftstreibenden selbst verschuldet haben oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
Unabhängig von der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung neigt eine (neo)liberale Ideologie überdies dazu, Sozialausgaben mit dem Argument den Überlastung der Staatsausgaben oder des krassierenden Missbrauch in der Quantität und in der Zugänglichkeit auf ein Mindestmaß zu beschränken. Beispiel dafür sind der Thatcherimus in Großbritannien oder die Reagan-Ära in den USA: Bei der Übernahme der Präsidentschaft durch Reagan verfügte die USA über das ausgeglichenste Budget seit langem. Dennoch ließ der Präsident verkünden, man müssen den Gürtel enger schnallen und er würde mit eiserner Axt die Verschwendung von Billionen Dollars, unter anderem für soziale Maßnahmen, bekämpfen. In Österreich hat sich als deren populistische Verhetzungsvariante, den "Sozialschmarotzern" müsse das Handwerk gelegt werden (deMause 1984). »Österreich braucht ein leistungsfähiges und treffsicheres Sozialsystem, das Benachteiligte und Bedürftige schützt und fördert«, so Bundeskanzler Schüssel in seiner Regierungserklärung im Februar 2000. Und: »Der Missbrauch von staatlichen Transferleistungen ist jedoch unsozial und unsolidarisch. Er muss konsequent abgestellt werden« (zit. n. Rosenber-ger/Schmid 2003, 96).
In der Sozialstaatstheorie wird zwischen einer "lohnarbeitszentrierten" (Bismark'scher Typus) und einer "universalistischen" Ausrichtung (Beveridge-System) unterschieden (vgl. Rosenberger/Schmid 2003, 98). Während lohnarbeitszentrierte Systeme durch Beiträge der Erwerbstätigen finanziert werden, erfolgt die Finanzierung universalistischer Systeme über Steuern. Der österreichische Sozialstaat ist eine Mischform: Während Leistungen der Sozialversicherungen an - vorwiegend männlicher - Erwerbstätigkeit orientiert sind, werden Familienbeihilfen und Sozialbeihilfen aus Steuermitteln bestritten. In jedem Fall kann staatliche Wohlfahrspolitik "umfassend" oder "residual" sein:
Der umfassende Typus ist darauf angelegt, die Absicherung individueller Risiken (Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall/Behinderung) solidarisch zu tragen. Aber nicht nur Schutz vor klassischen Risiken, sondern auch redistributive Anliegen wie soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit gehören zu den Zielen. Soziale Rechte, auf welche der/die Einzelne Anspruch hat, fördern gesellschaftliche Teilhabe und wohl auch Demokratisierungsprozesse und gründen auf dem politischen Konsens kollektiver Solidarität (ebd., 98 f.).
Residuale Sozialpolitik unterläuft diese Gesamtsolidarität und versucht, die Verantwortung des Staates auf ein Minimum zu beschränken, und das Übrige der Initiative der Betroffen bzw. der Bürger und dem Spiel der freien Marktkräfte zu überlassen. "Markt und Familie sind dann für die Vorsorge zuständig, der Staat zieht sich auf Anti-Armutspolitik für die »wirklich«, d.h. für die zu definierenden Bedürftigen zu-rück" (ebd., 99).
Eine Reihe von lange feststehenden Voraussetzungen, auf denen der Sozialstaat aufbaut, haben sich in den letzten Jahren verändert. Stichworte: Die Internationalisierung der Wirtschaft; die Verlängerung der Lebenszeit; sinkende Kinderzahl; steigende Arbeitslosigkeit. Der Sozialstaat bekommt deshalb Finanzierungsprobleme, die Gesellschaft eine neue Armutsproblematik und es entstehen neue Anforderungen an die Sozialpolitik
Das Ausmaß der Armut ist trotz des Ausbaus der sozialen Sicherungsmaßnahmen immer noch beträchtlich. "Armut und soziale Ausgrenzung betreffen in einer der heute weltweit wohlhabendsten Gesellschaft nach wie vor eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen" (Wetzel 2003, 122) 11% der österreichischen Bevölkerung sind armutsgefährdet, d.h. ihr gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen liegt unter 60% des Median Pro-Kopf-Einkommens.[157] 4% von ihnen sind akut armutsgefährdet, d.h. dass lebensnotwendige Kosten nicht mehr ausgebracht werden können: Miete, Betriebskosten, Heizkosten, Kleidung, soziale Kontakte, z.B. Einladung von Bekannten zum Essen). 200.000 Menschen haben im Winter keie Heizmöglichkeit, 400.000 Frauen über 60 Jahre bekommen keine Pension, 30% der Arbeitslosen erhalten keine Versicherungsleistung.
Dabei ist Armut nicht von vornherein mit materieller Verelendung bzw. absoluter Armut gleichzusetzen. Mit steigendem gesamtwirtschaftlichen Wohlstand verändern sich die Vorstellungen über gesellschaftliche Standards und die Voraussetzungen für eine Partizipation daran. Armut und Ausgrenzung sind daher im Kern immer relativem auf die Bewertung einer in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang der Verteilung des verfügbaren Wohlstandes der Gesellschaft und der sozialen Chancen zu setzenden Lebenslage zielende Begriffe (ebd.).
Armut ist keineswegs auf bestimmte gesellschaftliche Randgruppen beschränkt: "Jede/r kann - zumindest in einzelnen Lebensabschnitten - zur Randgruppe werden" (ebd.). Langzeitarbeitslosigkeit, zu ge-ringes Einkommen ("working poor"), atypische Beschäftigungsverhältnisse (Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete Beschäftigung) sind wachsende neue Armutsrisiken. Traditionelle Sicherungssysteme wie Familie und Verwandtschaftsnetze werden brüchig, die "Zone der Verwundbarkeit" und der "Entkoppelung" weitet sich gegenüber der "Zone der Integration" aus, (ebd., 128). Die sozialstaatlichen Sicherungssysteme sind gefordert, "insbesondere dann, wenn sie wie in Österreich, wesentlich dem Idealtypus eines konservativ-korporatistischen wohlfahrtsstaatlichen Arrangements mit den hier zugrunde liegenden Leitbildern der traditionellen Ehe und Familie sowie des Normalarbeitsverhältnisses bzw. der Normalerwerbsbiografie entsprechen" (ebd., 129). Die derzeitige österreichische Politik zeichnet sich durch non decisions, klassisch korporatistisch-konservative Maßnahmen und wenige neue Perspektiven aus. Ein im Wesentlichen an das "männliche Ernährermodell" anknüpfendes Wohlfahrtssystem wie das österreichische wird einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die wie sinkende Heirats- und steigende Scheidungsraten zeigen, von einem "Bedeutungsverlust des traditionellen Ehe- und Familienmodells" gekennzeichnet ist, nicht mehr gerecht (ebd., 128).
"Im Unterschied zur Politik des Ausbaus der Nachkriegsjahrzehnte ist die reale Sozialpolitik der letzten Jahre von Anpassung, von der Unterordnung sozialpolitischer Ziele unter budget- und wirtschaftspolitische Prioritäten sowie von Restriktionen und Kürzungen bei Leistungen geprägt" (Tálos 2006, S. 92 f.). Einschränkung der staatliche Risikovorsorge, Aufwertung der betrieblichen und privaten Vorsorge und eine verstärkte Familialisierung der Sozialpolitik sind die Folgen. Immerhin wurden einzelne Transfer-leistungen wie das Kindergeld oder das Pflegegeld nicht mehr am Erwerbs-, sondern am Staatsbürgerschaftsprinzip orientiert. Andererseits benachteiligt das immer noch am Versicherungsprinzip orientierte Pensionsrecht Frauen auf Grund von Kindererziehung sowie aus Gründen traditioneller Rollenvorstellungen: "Beispielsweise verfügen immer noch 4 von 10 Frauen im Alter über keine eigenständige Absicherung, da sie keine ausreichenden Versicherungszeiten vorweisen können".[158] Freie Dienstnehmer/innen und Selbständige sind von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen, langzeitarbeitslose Frauen erhalten keine Notstandhilfe, da diese an das Arbeitslosengeld angekoppelt ist: "Bleibt das zweite soziale Sicherungsnetz, die Sozialhilfe [bzw. die Mindestsicherung, B.R.], die allerdings durch vielfältige Problemlagen markiert ist" (ebd., 131, vgl. Drimmel 2003).
Sieglinde Rosenberger und Gabriele Schmid (2003) konstatieren seit 2000[159] eine für's Erste paradox anmutende Veränderung des österreichischen Sozialsystems: "Das neoliberal-konservative Regierungsprojekt besteht sowohl aus Leistungsrückbau als auch als Leistungsausbau. Der Trend geht nicht eindeutig in eine Richtung, die Kombination von diesen Trends bedeutet aber Umbau" (ebd., 97). Diese These wird durch die Zahlen des Regierungsübereinkommens ÖVP/FPÖ Regierung bestätigt: Einsparungen von 3 Mrd. Schilling bei Sozialtransfers, Arbeitslosenversicherung, Unfall- Kranken- und Pensionsversicherung und vor allem durch "Treffsicherheit" (7 Mrd. Schilling) stehen 12,8 Mrd. Schilling an zusätzlicher Familienförderung und 15 Mrd. Schilling an Entlastung der Unternehmen durch Senkung der Lohnnebenkosten gegenüber.
Eine einschneidende Veränderung stellt die Zurückdrängung bzw. Aufkündigung der Sozialpartnerschaft dar. "Die traditionelle Konsenskultur in wirtschafts- und sozialpolitischen Problemstellungen wurde insbesondere im ersten Regierungsjahr aufgegeben, entschieden wurde jenseits sozialpolitischer Interessensabstimmung, Stellungnahmen der Arbeitnehmer/innenorganisationen bleiben nahezu völlig unberücksichtigt, eine Akkordierung erfolgte allerdings mit den Wirtschaftsverbänden" (ebd. 103). Die Zusammensetzung des Hauptverbandes der Sozialversicherungen, dessen Arbeitnehmer/innenvertreter/innen bisher nach den Ergebnissen der Arbeiterkammerwahlen beschickt wurden, wurde zugunsten des Regierungs- und Parteieneinflusses geändert. Insgesamt werden "Arbeitswelt und Rechte der Arbeitnehmer/innen zunehmend negativ konnotiert", während "der Ausbau der familienpolitischen Leistungen" in positiven Bildern und Begrifflichkeiten vermittelt wird (ebd. 104).
Die "sozialpolitische Architektur" habe "seit 2000 in Österreich eine neues Design erhalten" (ebd., 102). Unter dem Druck der FPÖ wurde ein so genanntes "Treffsicherheitspaket" geschnürt, das vor allem Leistungskürzung und verstärkte Kontrolle für Arbeitslosenbezieher/innen enthielt.
Aufbereitet wurde das Treffsicherheitspaket durch eine jahrelang mehr oder weniger heftig geführte Skandalsierungsdebatte, die gegen einzelne Personen bzw. Personengruppen mobilisierte. Bestimmten Menschen wurde unredliches Verhalten unterstellt und Leistungen des Sozialstaates wurden als nicht rechtens dargestellt - die Ärztin, die kein Karenzgeld braucht; die Hoteliersgattin, die sich arbeitslos meldet; die Hofratswitwe, die in der »Friedenszinswohnung« mit Beamtenpension ihr Hündchen füttert; die Alleinerziehende, die in Lebensgemeinschaft lebt und erhöhtes Karenzgeld bezieht; der Arbeitslose, der arbeitsunwillig ist und pfuscht etc.
Missbrauch in den Raum zu stellen und auf dieser emotionellen Basis Kürzungen zu legitimieren - dieses Vorgehen ist nicht neu. Neu hingegen ist, dass neben den Diffamierungen nun auch positiv klingende Begriffe auf der Agenda standen. Schrieb die Expert/innengruppe von der Notwendigkeit der »Schließung sozialer Lücken«, so sprach der FPÖ-Klubobmann später vom »Schließen der Schlupflöcher« um Missbrauch zu vermeiden (ebd., 108).
Wesentliche Prinzipien der neuen Sozialpolitik ist eine "Neuordnung der Aufgabenverteilung zwischen staatlicher und privater Sozialverantwortung", die mit einer "drohenden Unfinanzierbarkeit" des Sozial-staates und "geringer sozialer Treffsicherheit" begründet wird (Regierungsprogramm 2000, zit.n. ebd., 106). Eine von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe, schlug sowohl Kürzungen als auch Erweiterungen der Sozialleistungen, wie etwa die "Behindertenmiliarde" vor. Realisiert wurden lediglich die Kürzungen. Entgegen der öffentlichen Versicherung, besonders die Schwächsten zu unterstützen, waren gerade diese - Migrant/innen, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Mehrkinderfamilien - von den Maßnahmen - Kürzungen des Arbeitslosengeldes, der Notstandshilfe, Besteuerung der Unfallrente - am schlimmsten betroffen.
Die so genannte "Unfinanzierbarkeit" des Sozialsystems hängt eng mit seinem überwiegend lohnfinanzierten Modus zusammen. "In Zeiten steigender Kapitaleinkommen entzieht sich ein Teil der verfügbaren Einkommen der solidarischen Finanzierung" (ebd., 112). Wie wenig die Rhetorik der Unfinanzierbarkeit mit den Tatsachen zu tun hat, zeigt sich z.B. am Beispiel des Arbeitslosengeldes: Nach den vorgenommen Kürzungen lukrierte der Staat zwischen 2000 und 200238 Mrd. Schilling Überschuss, der in das allgemeine Budget floss.
An der propagandistisch am meisten ausgeschlachteten Neuerung des Kindergeldes zeigt sich besonders, dass es nicht um die Unterstützung der Ärmsten geht und schon gar nicht um Gerechtigkeit, sondern um familialistische und oberschichtorientierte Politik. Das bisher erwerbsarbeitsbezogene Karenz-geld, das den Ausfall des Verdienstes der Frauen kompensierte, war den konservativen Politikern ein Dorn im Auge, weil dieses Geld ja nur Arbeiterinnen zu Gute kam, nicht jedoch den Frauen, die im Sin-ne der Bürgerlichen ihren Mutterpflichten im eigentlichen Sinn nachkamen.
Das Kinderbetreuungsgeld, das die frühere Elternkarenzregelung ablöst, steht für einen sozialpolitischen Prinzipienwechsel: Die Höhe der Leistung bleibt zwar nahezu unverändert, der Anspruch ist aber von der Erwerbstätigkeit entkoppelt. Es handelt sich nun um keine Lohnersatzzahlung mehr, sondern um eine finanzielle Unterstützung für die Kinderbetreuung. Bisher wurde die Karenzgeldleistung mit der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit und dem dadurch entstehenden Einkommensausfall begründet, nun gibt es Geld für die Kinderbetreuung. Es handelt sich also um keine Versicherungsleistung mehr, sondern um eine Beihilfe. Die Entkoppelung von der Erwerbszentriertheit kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Dauer des Bezugs vom Kündigungsschutz losgelöst ist. Zusammenfassend: Die Anbindung an die Erwerbsarbeit wird aufgegeben sowie vorgeblich Wahlfreiheit über die Ausschüttung einer undifferenzierten Geldleistung verwirklicht. Wie aber betreuungspflichtige Eltern faktisch Kleinkinderbetreuung mit Erwerbstätigkeit organisatorisch vereinbaren können, bleibt offen; die mangelhaft gestalteten Schutzrechte für Eltern in der Arbeitswelt werden weiter unterlaufen (ebd., 114).
Die wohl einschneidendste Maßnahme im Sozialbereich, die Pensionsreform war schon vor der Ära Schüssel, erfuhr aber von 2002 - 2004 als "Pensionssicherungsreform (© Wolfgang Schüssel) ihre volle Ausgestaltung. Auch sie besteht ausschließlich aus Kürzungen: Anhebung des Pensionsalters, Abschläge bei Frühpension, Kürzung der Pensionsansprüche von Witwen, Ausdehnung des Durchrechnungszeitraums, Verringerung der Anpassung auf den Weggebracht worden.
Die von der "schwarzblauen" Regierung verordneten Maßnahmen blieben auch während der folgenden großen Koalitionen im Wesentlichen erhalten, neue Probleme kamen hinzu. Eines davon ist der wach-sende Bedarf an Pflege für alte Menschen, dem der Sozialstaat seit 1993 derzeit mit einem nach 7 Pflegestufen gestaffelten Pflegegeld entspricht, das die Betreuungskosten nicht annähernd abdeckt. Aus der Geschichte des Sozialstaates, insbesondere seines Beginns in den 1870er Jahren könnte man wissen, dass soziale Probleme, die eine große Zahl von Menschen betreffen, auf die Dauer nicht durch staatliche Zuschusssysteme, sondern nur durch verpflichtende Versicherungen gelöst werden können. Keine der derzeit regierenden Parteien wagt sich allerdings an die Aufgabe der Einführung einer Pflegeversicherung heran.
Die wohl umfassendste Neuerung der jüngsten Zeit war die so genannte "Bedarfsorientierte Mindestsicherung" (BMS), die bisherige Sozialhilfe ersetzt und damit zumindest das Ärgernis länderweise unter-schiedlicher Richtsätze aus der Welt schafft.[160] In den heftigen Auseinandersetzungen, die der Einführung voraus gingen, wurde die klassische Frage nach dem Verhältnis von Arbeit und Fürsorge neuer-dings aufgerollt. Während sich bürgerliche und rechte Politiker entschieden gegen die ihrer Meinung nach drohende Arbeitsverweigerung auf Grund eines garantierten Grundeinkommens wandten, befürworteten Sozialdemokraten und Grüne das Grundeinkommen als Alternative zur bisherigen Sozialhilfe. Der Kompromiss bestand in der Gewährung einer Bedarfsorientierten Mindestsicherung bei streng kontrollierter Arbeitsverpflichtung. Auf der Internetseite des Arbeitsmarktservice heißt es:
Wer eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung bezieht und arbeitsfähig ist, muss auch zur Aufnahme einer Arbeit bereit sein. Hier gelten die Zumutbarkeitsbestimmungen wie bei Bezieher/innen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, d.h. wird im Zuge einer Arbeitsvermittlung eine zumutbare Arbeit nicht angenommen, kann die Bedarfsorientierte Mindestsicherung von der gewährenden Stelle bis zur Hälfte gestrichen werden (http://www.ams.at/sfa/23618.html ).
Außerdem muss ein/e Antragssteller/in "zunächst ihre/seine eigenen Mittel (Einkommen und Vermögen) zur Bestreitung ihres seines Lebensunterhalts einsetzen." Ausgenommen sind lediglich "selbst bewohnte Häuser und Eigentumswohnungen, berufs- oder behinderungsbedingte benötigte Kraftfahrzeuge oder Ersparnisse bis zu einem Betrag von rund € 3.866".[161] Der Genehmigung geht eine Bedarfsprüfung und eine Vermögensprüfung voraus.
Der Richtsatz beträgt derzeit für Alleinstehende und Alleinerziehende 773 €, für (Ehe)Paare 1.160 €, für Personen in einer Wohngemeinschaft ohne gegenseitige Unterhaltsansprüche, z.B. Geschwister 579, für Kinder mindestens 139 €. Wie man sieht, folgt die BMS der über Jahrtausende tradierten Formel des Arbeitszwangs als Voraussetzung sozialer Hilfe: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.« Die Alter-native eines staatlich garantierten Grundeinkommens ist in der Logik das Kapitalismus nicht denkbar: Geld ohne Leistung kann nicht gewährt werden. Das würde die Toleranz derer, die - freilich für ein wesentlich besseres Einkommen - die Mühe der Arbeit auf sich nehmen, bei weitem überfordern. In der Angst, jemand könnte ein bescheidenes Auskommen, ohne arbeiten zu müssen, einem besseren leben als Arbeiter/in vorziehen, spiegelt sich die Last, die die moderne Leistungsgesellschaft den Menschen auferlegt ebenso wie die Sorge der staatlichen Instanzen, eine relevante Zahl von Menschen könnte sich weigern, diese Last zu tragen.
|
Text: Tálos, Emmerich: Sozialstaat Österreich. Probleme und Veränderungen. In: Rosenberger, Sieg-linde / Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven. Wien: Mandel-baum Verlag 2003, 80 - 95. |
|
Text: Rosenberger, Sieglinde / Schmid, Gabriele: Treffsicher. Sozialpolitik zwischen 2000 und 2002. . In: Rosenberger, Sieglinde / Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven. Wien: Mandelbaum Verlag 2003, 96 - 120. |
Moderne Soziale Arbeit Unterscheidung besteht in geringerem Ausmaß in mit materiellen Notsituationen befasster Fürsorgearbeit und stärker in mit psychischen Krisen und pädagogisch-sozialisatorischer Unterstützung befasster Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik. Die Absicherung der materiellen Subsistenz wurde weitgehend von den sozialstaatlichen Versicherungssystemen übernommen, wenn sich auch zeigt, dass deren Leistungen einerseits kontinuierlich reduziert werden und andererseits einer Reihe neuer Armuts- und Existenzkrisen nicht mehr gerecht werden. Es kommt wieder deutlicher ins Bewusst-sein, was eigentlich bereits am Beginn der professionellen Sozialen Arbeit, etwa bei Alice Salomon, klar war: "Sozialarbeit als Arbeit mit materiell Verelendeten befasst sich zwangsläufig mit Problemen der Entwicklung von Handlungs- und Bewältigungskonzeptionen der Betroffenen, wie sie auch in der Erziehung und Bildung diskutiert werden und - Sozialpädagogik schaut zunehmend auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die für Erziehung und Bildung vorausgesetzt werden müssen sowie auf allgemeine Fragen der Hilfe, Unterstützung, Beratung und Förderung" (Wilhelmstätter 2005, 24).
Das Problem einer Beschreibung des Aufgaben- und Methodenspektrums Sozialer Arbeit - dieser Überbegriff hat sich inzwischen heraus gebildet - besteht also nicht in der peinlichen Unterscheidung nach dem Kriterium "materielle" oder "sozialpädagogische" Hilfe, sondern in der weiten Zerstreutheit der Tätigkeitsfelder und Handlungsweisen Sozialer Arbeit, ein Problem das im übrigen auch eine der bezugswissenschaften betrifft, die Pädagogik (vgl. Rathmayr 2012). Die Beispielhafte Auflistung von Berufsfeldern auf der Hompage der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Salzburg zählt an die 25 Punk-te und endet mit "usw.":
Beratungsstellen, Jugendämter, Jugendzentren, sozialpädagogische Familienhilfe, sozialtherapeutische Wohngemeinschaften, Bewährungshilfe, soziale Dienstleistungen für (körperlich, psychisch, geistig, sinnesmäßig, usw.) beeinträchtigte Menschen, Altenhilfe/Altenarbeit, Krankenhaussozialarbeit, Sachwalterschaft, soziale Suchtkrankenhilfe, Suchtprävention, soziale Dienstleistungen für wohnungslose Menschen, Schuldenberatung, soziale Berufspädagogik, betriebliche Soziale Arbeit, soziale Rehabilitation, Arbeitsassistenz, interkulturelle Soziale Arbeit, soziokulturelle Arbeit in Stadtteilen bzw. Gemeinden, usw.
Wie man sieht, enthalten die Aufgabenfelder sowohl genuin fürsorgerische als auch genuin sozialpädagogische Elemente. Die Beschreibung des Studiengangs versucht, wie der Studiengang selbst, diese vielfältigen Tätigkeitsprofile auf einige wenige Kompetenzcluster herunter zu fahren, die der Ausbildung angehender Sozialer Arbeiter/innen als Grundlage dienen:
"Social Work" (= Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Sozialmanagement) ist eine weltweit verbreitete Disziplin, die sich mit der Theorie und Methodik der professionellen Aktivierung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen beschäftigt.
Umfangreiches Wissen über die Problemlagen von Menschen, theoretisch fundierte Methodik der aktivierenden Sozialen Arbeit, Management sozialer Dienstleistungen bilden das Qualifikationsprofil des Studiums. Besonders wichtig ist auch juristisches und ökonomisches Know-how.
ExpertInnen für Soziale Arbeit müssen sich oft in konfliktreicher Beziehungsarbeit bewähren. Professionelles Handeln im Spannungsfeld zwischen Einfühlung (Empathie) und Abgrenzung erfordert nicht nur Wissen und Können sondern auch gediegene Persönlichkeitsbildung.
Den zahlreichen Spezialisierungen Sozialer Arbeit entsprechen beinahe eben so viele methodische Zugänge. Karl Wilhelmstätter hat in seiner Dissertation eine Überblick über diese Methoden gegeben und versucht, ein Ordnung in ihre Vielfalt zu bringen, warnt aber zugleich davor, auf eine "Supermethode" zu spekulieren, "die alle Facetten der Arbeit abdeckt" (Wilhelmstätter 2005, 161). Zwar gebe es "übergreifende Phasen von Hilfeprozessen", dennoch müssen Sozialarbeiter/innen "über einen breiten Fundus an methodischen Möglichkeiten verfügen" (ebd.), "die unterschiedlichsten Personen, Problemen, Situationen, Organisationen und Arbeitsfeldern angemessen sind. Die Frage, welche Methode zu welchem Fall ‚passt', kann nur im Einzelfall geklärt werden" (Müller/Galuske, 490, zit.b. ebd., 161 f.). Es scheint, dass es in der Sozialen Arbeit nicht ein Methodenproblem im Sinne nicht ausreichend zuhandener Methoden, sondern ein Anwendungsproblem dieser Methoden gibt, für das die Hinweise auf die Offenheit und die kontextbezogene Wahl wenig hilfreich ist. Zu vermuten ist, dass Sozialarbeiter/innen in der Praxis bestimmte Routinen entwickeln, die sich in bestimmten Handlungskontexten als praktikabel erwiesen haben und mit der Situation des/er Klienten, mit der persönlichen Berufsauffassung sowie mit den institutionellen Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden können.
Thomas Rauschenberger hat seine Überlegungen "zur Struktur des sozialpädagogischen Handelns" unter den provokanten Titel "Bezahlte Nächstenliebe" gestellt. Er vergleicht den/die moderne Soziale Arbeiter/in mit der Person des Wirtes im Gleichnis von "Barmherzigen Samariter", einer "Urszene heutiger Sozialer Arbeit:
Meine These ist, dass weniger im barmherzigen Samariter als vielmehr in der Person des Wirtes bereits Merkmale einer modernen Sozialen Arbeit enthalten sind. Denn er, der Wirt, wird von dem Samariter beauftragt, gegen Geld und Entlohnung den Hilfebedürftigen zu beherbergen, zu versorgen und wieder gesund zu pflegen. Und er hat eigens Räume für Gäste, er hat ihre Unterbringung und Bewirtung zu seinem Beruf gemacht und er lebt von der Versorgung und Pflege dieser vorübergehend bei ihm verweilenden Menschen. Wurde der barmherzige Samariter, der Helfer aus Mitleid, zum antiken Sinnbild christlicher Nächstenliebe, so müssten wir den Wirt in dieser Geschichte wohl zum ersten neutestamentlich überlieferten Helfer einer bezahlten Nächstenliebe, sozusagen zum Leitbild der modernen personenbezogenen sozialen Dienstleistungen ernennen (Rauschenbach 2000, 158).
Aus der Zeit ihrer Begründung im 19. Jahrhundert habe moderne Soziale Arbeit eine Reihe in der von Strukturmerkmalen übernommen, die sich zu einander in einem Spannungsverhältnis befinden. Deren erstes besteht in der Einbeziehung des Engagements und der persönlichen Bereitschaft der Klient/innen in die Konzeption der sozialen Hilfe:
Wirkungen zu erzielen bei Menschen, denen mit Mitleid, milden Gaben (also Geld), mit rechtlichen Verordnungen oder nacktem äußeren Zwang allein nicht mehr beizukommen war, die aber die »neue Welt« [...] integriert werden mussten [...] diese Aufgabe hätte Salomon mit »Beeinflussung« umschrieben, dieser Prozess ließe sich mit Münchmeier (als »Pädagogisierung« bezeichnen (ebd., 163).
Die Idee, "dass der Mensch erziehbar und bildsam ist" ist eine zentrale Idee der Aufklärung, die sich auch bei Alice Salomon findet:
Erst langsam gewinnt die Erkenntnis an Boden, dass es sich in einer großen Zahl von Fällen, mit denen der Wohlfahrtspfleger zu tun hat, darum handelt, die Haltung des Menschen, seine Einstellung zu ändern (Salomon 1927, 62, zit,n. ebd., 161).
Hier werde "etwas formuliert, was die Doppelbödigkeit und die Dialektik der Aufklärung, was die Ambivalenz im Prozess der Zivilisation zutage fördert: Die Freisetzung und Entdeckung des Subjekthaften im Menschen seiner »inneren Natur«, der »Psyche« - und der gleichzeitig mögliche Zugriff auf dieses Innenleben" (ebd.).
Das zweite aus der Gründungsphase der Sozialen Arbeit übernommene Strukturmerkmal besteht darin, "soziale Probleme in den gegebenen Verhältnissen und nicht gegen sie anzugehen" (ebd.). Soziale Arbeit sei dadurch "als Ersatzleistung für politische Veränderung" missbrauchbar geworden. Mary Richmond und Alice Salomon entfalteten in ihren Schriften "stellenweise mit einer - heute würden wir wohl sagen - polizeiähnlichen Logistik Methoden der Ermittlung und Nachforschung", die "Effizienz, Rationalität und »gerechte« Verteilung zwischen den Armen, nicht aber zwischen den Armen und Reichen versprachen":
Eine Gesellschaftsordnung mit einer deutlichen Trennung zwischen »oben« und »unten« sollte damit auch nicht angetastet werden. Es ging vielmehr darum, die nur scheinbar Verwundeten, die am Rande des Weges liegend Simulanten herauszufiltern. Oder wie Müller dies provokant formuliert: Wegbereitend für die Soziale Arbeit war nicht die Verberuflichung einer bis dahin spontanen mitmenschlichen Hilfstätigkeit, sondern ihr »Gegenteil: die Funktion der Trennung zwischen ‚guten' und ‚schlechten' der Hilfe Bedürftigen, die Substitution spontaner Barmherzigkeit durch die professionelle Entscheidung, wer im Interesse der Herstellung der Persönlichkeitsstruktur des (damals) modernen Lohnarbeiters Hilfe erhält und wem sie verweigert werden muss« (Müller 1982, 32, zit.n. ebd., 163 f.).
Im Lichte einer Geschichte der Armut und Fürsorge, die weiter zurück denkt als bis in das 19. Jahrhundert, erscheint diese Einschätzung übertrieben und hat dennoch etwas für sich. Zwar geht die Unterscheidung zwischen "würdigen" und "unwürdigen" Armen und die Ausgrenzung der Letzeren zumindest bis in den Anfang der Neuzeit zurück und wurde keineswegs erst von den Pionier/innen der professionellen Sozialen Arbeit erfunden, ebenso die Kontrolle und Disziplinierung der Armen. Und selbstverständlich diente soziale Fürsorge stets der Konformität der bestehenden Gesellschaften und niemals deren Revolution, im Gegenteil: Häufig verstanden Staaten soziale Hilfe als Strategie, Umstürze zu vermeiden.
Es trifft aber zu, dass Soziale Arbeit ab nun mit dem Ethos der Umerziehung verbunden wird, und dass ihr Ziel nicht bloß die Linderung der Not, sondern auch die Wiederherstellung der Arbeitskraft ist.
Damit aber war ein Knoten in die Soziale Arbeit und ihre Handlungsstruktur eingewoben, der entscheidend für die ganze spätere Entwicklung bleiben sollte. Es war sozusagen die Institutionalisierung eines Zwiespaltes, die Verfestigung einer doppelten Struktur im materialen Kein sozialpädagogischen Handelns: Hilfe und Kontrolle, Wohlwollen und Misstrauen, Verständigung und Beeinflussung (ebd., 164).
Ob Soziale Arbeit deshalb "eine bedauernswerte, vielleicht gar moralisch verwerfliche Entpolitisierung, sprich: als eine individualisierende Umdefinition gesellschaftlicher, ökonomisch und politisch verursachter Problemlagen verstanden werden muss, wie dies Münchmeiers (1981) Analyse nahezulegen scheint" (ebd.), dessen ist sich Rauschenbach nicht so sicher. "Damit Sozialarbeiter nicht zu »Rittern von der traurigen Gestalt«, zu einer imaginären Wirklichkeit, zu einem schrulligen Don Quichotte des 20. Jahrhunderts werden und damit Soziale Arbeit auch nicht zu einem großangelegten Raubritt, zu einem »Raub der Utopie« wird", müsse sie sich "angesichts der ihr innewohnenden Konten und Paradoxien schonungslos selbst befragen, warum sie das macht, wie sie es macht, und was sie bewirkt.
Mit der Etablierung sozialstaatlicher Versicherungssysteme ist moderne Soziale Arbeit weitgehend von der Verteilung materieller Güter entlastet. Das Problem der Unterscheidung zwischen Berechtigten und Nicht-Berechtigten hat sich in die staatlichen Bürokratien verlagert und - ein historisch gesehen enormer Wandel - das Problem der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel hat sich erledigt: "Wer vorab festgelegte Kriterien erfüllt, hat Anspruch auf entsprechende Leistungen - und zwar unabhängig davon, was er damit macht und was dieses Geld bewirkt" (ebd., 167).
Wenn der Bereich der materiellen Hilfe größtenteils wegfällt, stellt sich die Frage nach den Aufgaben Sozialer Arbeit neu. Rauschenbach formuliert diese Aufgaben im Rahmen einer von ihm angenommen Bestimmung menschlicher Existenz insgesamt:
Dabei lasse ich mich von der Idee leiten, dass Arbeit und Erziehung die beiden großen Menschheitsaufgaben, sozusagen das a priori menschlicher Existenz und Geschichte schlechthin sind. Ich meine damit die Sicherstellung des materiell-phsyischen Überlebens der Gattung auf der einen Seite sowie die Gewährleistung ihres Fortbestehens durch das Heranwachsen der nächsten Generation auf der anderen Seite. Um beides sicherzustellen, müssen also neben der Produktion von Sachgütern -Nahrung, Kleidung, Unterkunft im weitesten Sinne - mithin genauso grundlegende lebens- und handlungsfähige Subjekte (und das heißt auch lohnarbeitsfähige) hergestellt werden (ebd. 169).
Auf der Ebene der Subjekte bedeutet dies "Sozialisation, kulturelle Reproduktion und soziale Integration" (ebd., 169 f.): Die Förderung der Entwicklung stabiler Persönlichkeiten, die über die erforderlichen Kulturtechniken (Fertigkeiten und Wissen) verfügen und in die Wertstrukturen und Lebensverhältnisse der Gesellschaft eingebunden sind. Ausgehend von diesen Annahmen bestimmt Rauschenbach das Was Sozialer Arbeit wie folgt:
Abgekürzt und abstrakt formuliert, kann man Soziale Arbeit von dieser Warte aus als ein gesellschaftlich erzeugtes, an die Gesellschaft der Moderne gekoppeltes, sekundäres System von sozialen Dienstleistungen verstehen, das subsidiär an der Vermeidung von größtenteils andernorts verursachten Defiziten in den Bereichen von Moral, Bildung und Erziehung mitarbeitet. Mit anderen Worten: Soziale Arbeit ist ein zwar über die Medien Recht und Geld, also über Gesetze und Entlohnung konstituiertes gesellschaftliches Instrument, das jedoch mit Mitteln der Interaktion, der persönlichen Beziehung und des Vertrauens nachrangig Defizite von Moral, Bildung und Erziehung bearbeitet (ebd-., 170)
Der Ton liegt dabei auf "nachrangig": Soziale Arbeit tritt dort auf den Plan, wo die primären Institutionen der Bildung (Schule) oder Sozialisation (Familie) ihre Ziele nicht erreichen:
Verhaltensauffälligkeiten, Motivationsprobleme, Jugendkriminalität, Langeweile im Jugendhaus, Arbeit mit Nichtsesshaften, Suchtkranken und Trebegängem, Lebens- und Sinnprobleme in Beratungsstellen, Folgeprobleme schulischen Versagens, Straßensozialarbeit mit Jugendgangs und Hooligans, Folgeprobleme jugendlicher Arbeitslosigkeit oder sogenannte Anpassungsprobleme von ausländischen Bevölkerungsgruppen - immer geht es hierbei unter anderem auch um Probleme der Anpassung, der Einbindung oder der Ausgrenzung, der Herstellung, der Wiederherstellung oder der Veränderung von Wert-, Moral- und Sinnstrukturen, geht es um die Verknappung der Ressource »gesellschaftliche Solidarität« (ebd.).
So sehr man Rauschenbachs Analyse bis zu diesem Punkt folgen kann, so wenig erscheint seine Konsequenz für das Wie der Sozialen Arbeit nachvollziehbar. Er geht - mit Recht - davon aus, dass Soziale Arbeit bezahlte Arbeit ist, mit allen Konsquenzen:
Sie ist eine Arbeit auf Zeit, mit Dienstzeiten, mit vorheriger Ausbildung, mit Rechten und Pflichten, mit zugemuteten und vorenthaltenen Aufgaben. Sie ist häufig eine Tätigkeit in übergeordneten Institutionen, in »Sozialkonzernen« und vemetzten bürokratischen Organisationen. Sie basiert auf einem rechtlichen Fundament und auf Verordnungen, ist weder eine Privatangelegenheit noch freiwillig, sondern in aller Regel öffentlich als sozialstaatliche Indienstnahme organisiert (ebd., 171).
Er geht weiter - und nochmals mit Recht - davon aus, dass ein entscheidendes Merkmal Sozialer Arbeit darin besteht, "dass KlientInnen zu aktiven Mitproduzentinnen in der Sozialen Arbeit werden: ohne sie, ohne ihre sachbezogene Kooperation geht so gut wie nichts" (ebd.).
In einem dritten Schritt trifft er dann zwei Annahmen, die mit Fug und Recht bezweifelt werden können. Die erste besteht darin, dass eine persönliche Vertrauensbeziehung, die die Voraussetzung für die Mit-wirkung der Klient/innen an der die Veränderung bewirkenden Interaktion ist, im Rahmen einer bezahlten Tätigkeit nicht möglich ist:
In dieser beruflich-sozialen Dienstleistungsarbeit sind SozialarbeiterInnen herausgefordert, etwas herzustellen, zu bewegen und zu beeinflussen, etwas zu verändern. Für diese Tätigkeit werden SozialarbeiterInnen jedoch - und das ist das erste Dilemma - bezahlt. Sie werden nicht einfach als Menschen aktiv, als Privatmenschen oder als Freunde, nein: Sie arbeiten vielmehr als bezahlte Helferlnnen. Nächstenliebe wird hiermit zum Tauschwert, käuflich, wird eben »bezahlte Nächstenliebe«. Richard Münchmeier bringt dies auf den Punkt, wenn er formuliert: »Sozialer Arbeit eignet wesenhaft der Zwang, den Berufscharakter auf der Handlungsebene immer wieder 'einzuschmelzen' und in eine möglichst persönliche Beziehung umzuformen. Soziale Arbeit [...] lebt davon, den beruflichen Charakter in der Arbeit von Mensch zu Mensch vergessen zu machen« (1981, 157). Oder wie Aloys Fischer dies bereits in den 20er Jahren für die bezahlte berufliche Tätigkeit in bürokratischen Institutionen formuliert hat: »Beamtentum hat einen unpersönlichen Charakter, soziale Hilfe beruht auf persönlichem Vertrauen« (Fischer 1954, 320) - (ebd.).
Um diesem Dilemma zu entgehen, müssten Sozialarbeiter/innen deshalb die Illusion einer Beziehungs-normalität vorspielen, die tatsächlich nicht besteht. Sie müssen "IllusionskünstlerInnen sein, die sich verwandeln und die vielleicht schwierigste Rolle, die Rolle »Mensch« spielen können (ebd. 172). Andere Autoren haben für dieses Dilemma noch deftigere Ausdrücke gefunden: Ottomeyer spricht von "liebenswürdigem Schein", Dießenbacher von Handeln "im Geiste doppelter Heuchelei"
Rauschenbachs zweite Annahme ist, dass auf der des/r Klient/in keine Bereitschaft besteht, eine Veränderung im Sinn der sozialarbeiterischen Intervention zuzulassen:
Wenn aber Soziale Arbeit Veränderungen sowohl im Denken, Handeln und Fühlen als auch in der Moral bewirken soll, ohne hierfür äußeren, erkennbaren Zwang anwenden zu können, und wenn dieser Prozess der Problembearbeitung gleichzeitig unter dem Vorbehalt einer fehlenden, zumindest nicht automatisch vorhandenen Einsicht in die eigene Hilfs- und Veränderungsbedürftigkeit auf der Seite der KlientInnen in Gang gesetzt werden soll, dann muss sie ihre Absicht um der Sache und des fachlichen Erfolges willen verdeckt halten.
Sie muss, um dies mit Habermas (1981a) zu formulieren, bis zu einem gewissen Punkt »verdeckt strategisch« handeln. Und das heißt nichts anderes, als dass Sozialpädagoglnnen in vielen Situationen - erstens - letzten Endes weder einfach offen, ehrlich, authentisch und - vor allen Dingen - absichtslos in einem strengen Sinne handeln können, da sie sonst ihr Ziel nicht erreichen würden. Aber sie können - zweitens - auch nicht »offen strategisch« handeln, d. h. den KlientInnen zu verstehen geben, dass sie nichts anderes von ihnen wollen als das Bewirken einer Änderung an und in ihnen, weil ihre aktive Beteiligung zum Erreichen dieses Zieles eine Voraussetzung ist. Und schließlich stoßen - drittens - auch die Medien Geld und Recht als Alternativen hierzu ebenso auf offenkundige Grenzen: Mit Geld und Gesetzen allein lassen sich beispielsweise keine Suchtprobleme überwinden. Statt dessen wird das Handlungsmedium der Interaktion zur entscheidenden Basis.
Während man dieser allerletzten Konsequenz wieder zustimmen kann, erscheinen die vorherigen Schlüsse, die insgesamt darauf hinaus laufen, dass die Klient/innen nicht nur "praktisch vergessen oder es für sie nebensächlich wird, dass dies eine bezahlte und berufliche, vielleicht nicht einmal freiwillige Beziehung ist" (ebd., 173), sondern auch dass sie, was die Veränderung der Klient/innen betrifft, ihre Absichten verbergen, wenig überzeugend.
Rauschenbach erste Annahme ist, dass es nicht möglich ist, bzw. das Vertrauensverhältnis stören würde, wenn der/die Sozialarbeiter/in dem/r Klient/in die beruflichen Rahmenbedingungen seiner/ihrer Arbeit nicht verbergen, sondern diese voraussetzen bzw., wo nötig, offen legen würde. Das genau aber ist es, was im Großteil sozialarbeiterischer Interaktionen geschieht. Einerseits sind wohl wenige Klient/innen so naiv anzunehmen, dass sich eine/e Sozialarbeiter/in aus purer Nächstenliebe ihnen zu-wendet, nichts dafür bezahlt bekommt und ihnen unbegrenzt zur Verfügung steht. Andererseits spricht nichts dagegen, die professionellen Möglichkeiten und Grenzen der sozialarbeiterischen Intervention offen zu legen, nicht zuletzt, weil sie im praktischen Vollzug ja ohnedies offen gelegt werden, spätestens dann, wenn ein/e Sozialarbeiter/in auf seine/ihre begrenzte Zeit verweist, mit dem/r Klient/in Ziele vereinbart und deren Erreichung nachfragt, usw. Ein Blick auf die Praxis so gut wie aller therapeutischen Verfahren hätte hier schon für Klarheit sorgen können: Die Rahmenbedingungen Zeit und Geld sind dort nicht zu verbergende Umstände, vielmehr ist deren Offenlegung Teil der vom therapeutischen Prozess erwarteten Wirksamkeit.
Ebenso unrealistisch erscheint die zweite Annahme, dass die Kooperation von Betroffenen nicht erreicht werden könne, wenn man die von Ihnen erwarteten Veränderungen nicht vor ihnen verbirgt. Dies setzt einerseits ein völlig defizitäres Bild von Klient/innen voraus, als wären diese gegenüber Veränderungen resistent, und geht zweitens davon aus, dass Einsicht in die Notwendigkeit von und die Bereitschaft zu Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen nicht gegen anfängliche Widerstände kommunikativ bzw. bewirkt werden kann. Auch hier wäre ein Blick auf das verwandte Feld der Psychotherapie hilfreich: Die "Leidenseinsicht" und damit die Einsicht in die Problematik der eigenen Situation ist dort nicht Gegenstand der Vermeidung, sondern konstitutive Voraussetzung eines möglichen Therapieerfolges.
Nicht von ungefähr geht Rauschenbach selbst davon aus, dass das "bewusst verdeckt-strategische Handeln" (ebd., 173) nicht die Idealform sozialarbeiterischer Interaktion ist, sondern "eine durch Vertrauen stabilisierte und gekennzeichnete Situation" (ebd.). Nichts spricht allerdings dafür, dass diese Situation umso eher erreicht werden kann "je mehr es gelingt, die unpersönlichen und Misstrauen erweckenden Kostitutionsbedingungen sozialpädagogischer Handlungssituationen nach und nach »vergessen zu machen«" (ebd.).
Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wenn die Erfahrungen in der Praxis Sozialer Arbeit in wachsendem Maße ergeben, dass deren institutionelle Bedingungen den Prozess der sozialen Hilfe erschweren oder verunmöglichen, dann sollte man von Sozialarbeiter/innen nicht erwarten, dass sie dies durch das Vorspiel eines illusionären Theaters verbergen, sondern dass sie diese Erfahrungen kritisch in die eigenen Institutionen einbringen und versuchen, dort - und nicht nur bei ihren Klient/innen - Veränderungen zu bewirken. Und: Wenn die Erfahrungen in der Praxis der Sozialen Arbeit in wachsendem Maße ergeben, dass die gesellschaftlichen Bedingungen Notsituationen und Krisen erzeugen, die mit den Möglichkeiten der Sozialpädagogik nicht mehr bearbeitbar sind, dann würde es zur Professionalität von Sozialarbeiter/innen gehören, diese Erfahrungen in gesellschaftskritische Diskurse einzubringen. Eine ,wie Wolfgang C. Müller befürchtet, "bedauernswerte, vielleicht gar moralisch verwerfliche Entpolitisierung" bzw. "eine individualisierende Umdefinition gesellschaftlicher, ökonomisch und politisch verursachter Problemlagen" (ebd. 164) würde Soziale Arbeit gerade dann bewirken, wenn sie ihren Klient/innen anstelle der realen, unter gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen statt-findenden Interaktionssituation das Theater einer offenen und restlos persönlichen Beziehung vorspielen würde.
Amus, Gesine (Hg.): Hinterhof, Keller und Mansarde. Einblicke in das Berliner Wohnungselend 1901-1920. Reinbek: Rowohlt 1982
Bäumer, Gertrud: Soziale TZukunftsfragen. In: Die Frau 24(1916)
Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus. Berlin. Dietz 1994 [1878]
Cornu 1954, Auguste: Karl Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk, Bd. 1. Berlin: Aufbau Verlag 1954
deMause, Lloyd: Reagan's Amerika. Eine psychohistorische Studie. Frankfurt: Fuldaer Verlagsanstalt 1984
Denscher, Bernhard (Hg.): Tagebuch der Straße. Wien: Öst. Bundesverlag 21981
Drimmel, Nikolaus: Armut trotz Sozialhilfe. In: Tálos, Emmerich (Hg.): Bedarfsorientierte Grundsicherung. Wien: Mandelbaum Verlag 2003
Egger, Matthias: "Für Gott, Kaiser und Vaterland zu Stehen oder zu Fallen ..." Die Aufzeichnungen Joseph Hundeggers aus dem Revolutionsjahr 1848 Band 1. Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2012
Engelke, Ernst: Soziale Arbeit als Wissenschaft: eine Orientierung. Freiburg/Brg.: Lambertus Verlag 1993
Engelke, Ernst: Theorien der sozialen Arbeit. Freiburg/Brg.: Lambertus Verlag 1998
Frevert, Ute: Frauengeschichte zwischen bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2007
Grossmann, Anita: Die »neue Frau« und die Rationalisierung der Sexualität in der Weimarer Re-
publik. In: Snitow, A. / C. Stansell / S. Thompson (Hrsg.): Die Politik des Begehrens. Sexualität,
Pornographie und neuer Puritanismus in den USA. Berlin 1985, S. 38 - 62
Hanisch, Ernst: Gau der guten Nerven. Die nationalsozialistische Herrschaft in Salzburg 1938 - 1945. Salzburg u.a.: Verlag Anton Pustet 1997
Hering, Sabine: Die Kriegsgewinnlerinnen. Praxis und Ideologie der deutschen Frauenbewegung im Ersten Weltkrieg. Paffenweiler: Centaurus Verlag 1990
Hering, Sabine: Keinen Dank für Veronika Dankeschön. Eine andere Art der Völkerverständigung. In: Dies.: Und das war erst der Anfang. Geschichte und Geschichten bewegter Frauen. Zürich: elef-Verlag 1994
Hering, Sabine: Die Anfänge der Frauenforschung in der Sozialpädagogik. In: Friebertshäuser u.a. (Hg.): Sozialpädagogik im Blick der Frauenforschung. Weinheim: Dt. Studien-Verlag 1997, 31-43
Hering, Sabine / Kramer, Edith: Aus der Pionierzeit der Sozialarbeit. Elf Frauen berichten. Weinheim u.a.: Beltz 1984
Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: Geschichte der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim u.a.: Juventa 2000.
Hinterhuber, Hartmann: Ermordet und vergessen. Nationalsozialistische Verbrechen an psychisch Kranken und Behinderten in Nord- und Südtirol. Wien, Innsbruck: Verlag Integrative Psychiatrie 1995
Hofer, Norbert: Die Entwicklung der Sozialarbeit in Österreich. Ausbildungsformen - Genderaspekte - Gehalts-entwicklung. Wien: Hausarbeit 2005.
Kappeler, Manfred: Der schreckliche Traum vom volkommenen Menschen. Rassenhygiene und Eugenik in der Sozialen Arbeit. Marburg: Schüren 2000
Kershaw, Ian: Hitler. 2 Bde. München: dtv 2002
Kniesz, Berta: Familienkude und Familienpflege. Recklinghausen: Paulus Verlag 1954
Kucera, Josef: 1848 Revolution. In: Denscher, Bernhard (Hg.): Tagebuch der Straße. Wien: Öst. Bundesverlag 21981, 29-31
Kuczynski, Jürgen: Studien zur Geschichte der Lage des arbeitenden Kindes in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart = Die Geschichte der Lage der Arbeiter von 1789 bis zur Gegenwart, Bd. 19,1. Berlin: Akademie Verlag 1968
Landwehr, Rolf / Baron, Rüdeger (Hg.): Geschichte der Sozialarbeit. Hauptlinien ihrer Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Weinheim und Basel: Beltz 1983.
Lange-Appel, Ute: Von der allgemeinen Kulturaufgabe zur Berufskarriere im Lebenslauf. Frankfurt/M. u.a.: Lange 1993
Maier, H. (Hg.): Who is Who in der sozialen Arbeit. Freiburg/Brg.: Lambertus Verlag 1998
Melinz, Gerhard: Armutspolitik und Sozialversicherungsstaat: Entwicklungsmuster in Österreich (1860 bis zur Gegenwart). In: Österreich in Geschichte und Literatur 47,2003, H 2b - 3, 136 - 161.
Müller, Wolfgang C.: Wie Helfen zum Beruf wurde, Bd. 1: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883-1945. Weinheim und Basel: Beltz 41994
Neef, Anneliese: Mühsal ein Leben lang. Zur Situation der Arbeiterfrauen um 1900. Köln: Pahl-Rugenstein 1988
Niemeyer, Christian: Klassiker der Sozialpädagogik. Einführung in die Theoriegeschichte einer Wissenschaft. Weinheim und München: Juventa 1998
Rathmayr, Bernhard: Von der Konkurrenz der Lebensalter zur Solidarität der Generationen. In: Herbert Janig / Bernhard Rathmayr (Hg.): Wartezeit. Studien zu den Lebensverhältnissen Jugendlicher in Österreich. Innsbruck: Österreichischer Studienverlag 1994
Rathmayr, Bernhard: Selbstzwang und Selbstverwirklichung. Bausteine zu einer historischen Anthroplogie der abendländischen Menschen. Bielefeld: transcript Verlag 2011
Rathmayr: Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Weinheim u.a.: Beltz 2012
Rauschenbach, Thomas: Das sozialpädagogische Jahrhundert. Analysen zur Entwicklung der Sozialen Arbeit in der Moderne. Weinheim und München: Juventa 1999
Rosenberger, Sieglinde (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven Wien: Mandelbaum Verlag 2003.
Rosenberger, Sieglinde / Schmid, Gabriele: Treffsicher. Sozialpolitik zwischen 2000 und 2002. In: Dies. (Hg.): Sozialstaat, 96 - 120
Rosenwald, Walter / Theis, Bernd : Enttäuschung und Zuversicht. Zur Geschichte der Jugendarbeit in Hessen 1945 - 1950. München: DJI Materialien 1984
Roth, Lutz: Die Erfindung des Jugendlichen. Weinheim u.a.: Juventa 1983
Ruhl, Klaus-J. (Hg.): Deutschland 1945. Alltag zwischen Krieg und Frieden in Berichten, Dokumenten und Bil-dern. Darmstadt u.a.: Luchterhand 1984
Rupert, Wolfgang (Hg.): Die Arbeiter. Lebensformen, Alltag und Kultur. München: C.H. Beck 1986.
Sachs, Wolfgang: Die Liebe zum Automobil. Ein Rückblick in die Geschichte der Wünsche. Rein¬bek: Rowohlt 1990
Sachße, Christoph: Mütterlichkeit als Beruf. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986
Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 2: Fürsorge und Wohlfahrtspflege 1871 - 1929. Stuttgart u.a.: Kohlhammer 1988
Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 3: Der Wohlfahrts-staat im Nationalsozialismus. Stuttgart u.a.: Kohlhammer 1992
Salomon, Alice: Die Ausbildung zur sozialen Berufsarbeit. In: Die Frau 24(1917), 263 - 276
Salomon, Alice: Die Ausbildung zum sozialen Beruf. Berlin: Heymans 1927
Salomon, Alice: Charakter ist Schicksal. Lebenserinnerungen. Hrsg, von R., Baron / R. Landwehr. Weinheim: Beltz 1983
Schilling, Johannes: Soziale Arbeit. Entwicklungslinien der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. Neuwied, Kriftel: Luchterhand 1997
Thole, Werner / Galuske, Michael / Gängler, Hans (Hg.): KlassikerInnen der Sozialen Arbeit. Sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten. Ein Lesebuch. Neuwied u.a.: Luchterhand 1998
Singer, Isidor: Untersuchungen über die Socialen Verhältnisse des Nord-Oestlichen Böhmen: Ein Beitrag zur Methode Social-Statistischer Untersuchungen. Leipzig: Duncker & Humblot 1885.
Rosenberger, Sieglinde / Schmid, Gabriele: Treffsicher. Sozialpolitik zwischen 2000 und 2002
Tálos, Emmerich: Staatliche Sozialpolitik in Österreich. Wien: Verlag für Gesellschaftspolitik 1981
Tálos, Emmerich: Sozialstaat Österreich. Probleme und Veränderungen. In: Rosenberger, Sieglinde / Talos, Em-merich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven. Wien: Mandelbaum Verlag 2003, 80-95.
Tálos, Emmerich: Vom Siegeszug zum Rückzug. Sozialstaat Österreich 1945 - 2005. Innsbruck u.a.: StudienVerlag 2006
Tenorth, Heinz-E.: Geschichte der Erziehung. Einführung in die Grundzüge ihrer neuzeitlichen Entwicklung. Weinheim u.a.: Juventa 2000
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Kindheit. Frankfurt/M.: Insel Verlag 1979, 156-169 (Auch als Taschenbuch: Frankfurt/M.: Insel Verlag 1997)
Wendt, Wolf Rainer: Geschichte der Sozialen Arbeit. Stuttgart: Enke Verlag 41995
Wetzel, Petra: Soziale Ausgrenzung und Armut. In: Rosenberger, Sieglinde / Talos, Emmerich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspektiven. Wien Mandelbaum Verlag 2003, 121-131
Wilhelmstätter, Karl: Moden oder Methoden? Theoretische Grundlagen des methodischen handelns in der Sozialen Arbeit. Salzburg: Dissertation 2005.
Zeller, Susanne: Geschichte der Sozialarbeit als Beruf. Paffenweiler: Cenataurus 1994
Reyer, Jürgen: Alte Eugenik und Wohlfahrtspflege - Entwertung und Funktionaliisierung der Fürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.1991
Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 3: Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus. 1992
Labisch, Alfons: Homo hygienicus. 1992
Schnurr, Stefan: Sozialpädagogen im Nationalsozialismus - eine Fallstudie zur sozialpädagogischen Bewegung im Übergang zum NS-Staat 1997.
Engelke, Ernst: Theorien der Sozialen Arbeit. 1998
Hammerschmidt, Peter: Die Wohlfahrtsverbände im NS-Staat - die NSV und die konfessionellen Verbände im Gefüge der Wohlfahrtspflege des Nationalsozialismus. 1999
Kappeler, Manfred: Der schreckliche Traum vom vollkommenen Menschen. Rassenhygine und Eugenik in der sozialen Arbeit. Marburg: Schüren 2000
Becker-Lenz, Roland: Professionalität in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag 22009
Birgmeier, Bernd R. (Hg.): Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorie(n). Wiesbaden. VS Verlag 2009
Böhnisch, Lothar: Gespaltene Normalität. Lebensbewältigung und Sozialpädagogik an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft. Weinheim und München 1994
Kessl, Fabian (Hg.): Soziale Arbeit ohne Wohlfahrtsstaat? Weinheim u.a.: Juventa 2009
Kleve, Heiko / Wirth, Jan V.: Die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft. Baltmannsweiler: Schneider 2009
Kronauer, Martin: Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus. Frankfurt/M. 2002
May, Michael: Aktuelle Theoriediskurse sozialer Arbeit. Wiesbaden VS Verlag 22009
Michel-Schwartze, Brigitta (Hg.): Methodenbuch soziale Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag 22009
Rauschenbach, Thomas: Das sozialpädagogische Jahrhundert. Analysen zur Entwicklung Sozialer Arbeit in der Moderne. Weinheim und München 1999
Scherer, H. / Sahler, Irmgard (Hg.): Einstürzende Sozialstaaten. Argumente gegen den Sozialabbau. Wiesbaden 1998
Schmidt, Manfred G.: Sozialpolitik in Deutschland. Historische Entwicklung und internationaler Vergleich. Opladen 21998
Thiersch, Hans: Das sozialpädagogische Jahrhundert. In: Rauschenbach, Thomas / Gängler, Hans (Hg.): Soziale Arbeit und Erziehung in der Risikogesellschaft. Neuwied u.a. 1992, S. 9 - 23
Wagner, Leonie (Hg.): Soziale Arbeit und Soziale Bewegungen. Wiesbaden: VS Verlag 2009
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz: Sozialbericht. Wien 2009
Fink, Marcel / Riesenfelder, Andreas / Tálos, Emmerich: Schöne neue Arbeitwelt? Geringfügige Beschäfti-gung und freie DienstnehmerInnen. In: Zeitschrift für Sozialreform 2/2003
Förster, Michael: Armutsgefährdete und arme Personen. In: Sozialbericht. Wien 1999, 197-215
Pantucek, Peter: Soziale Arbeit in Österreich. In: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid (Hg.): Wörterbuch Soziale Ar-beit. 52005, 796-801
Tálos, Emmerich: Sozialpolitik zwischen konservativer Tradition und neoliberaler Orientierung. In: Kurswechsel 16 (2001),17-29
Tálos, Emmerich: Bedarfsorientierte Grundsicherung. Wien 2003
Wetzel, Petra: Armutsgefährdung trotz Erwerbsarbeit und sozialstaatlicher Sicherung. In: Tálos, Emmerich (Hg.): Bedarfsorienierte Grundsicherung. Wien 1973
Stoffplan an Wohlfahrtsschulen, 1930. Aus: Zeller, Susanne: Geschichte der Sozialarbeit als Beruf. Pfaffenweiler: Centaurus 1994, 75 ff.
"Hauptsache wir leben!" Sozialpolitik und Sozialarbeit der Nachkriegszeit in Deutschland. Aus: Hering, Sabine / Münchmeier, Richard: Geschichte der sozialen Arbeit. Weinheim und München: Ju-venta 2000, 194-221
Ausbau und Krise. Die Entwicklung der sozialen Arbeit von den 60er zu den 90er Jahren. Aus: ebd., 223-237
Sozialpolitik in der zweiten Republik. Nachkriegszeit in Österreich. Aus: Tálos, Emmerich: Staatliche Sozialpolitik in Österreich. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik 1981, 304-386
Rauschenbach, Thomas: Soziale Arbeit, soziales Risiko und inszenierte Solidarität. Aus: Ders.: Das sozialpädagogische Jahrhundert. Weinheim du München 1999, 231-268
Rückzug des Sozialstaates? Aus: Tálos, Emmerich: Vom Siegeszug zum Rückzug. Sozialstaat Österreich 1945 - 2005. Innsbruck u.a.: StudienVerlag 2006, 36-95
Talos, Emmerich: Sozialstaat Österreich. Probleme und Veränderungen. In: Rosenberger, Sieglinde / Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspekti-ven. Wien: Mandelbaum Verlag 2003, 80-95
Wetzel, Petra: Soziale Ausgrenzung und Armut. In: Rosenberger, Sieglinde / Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialstaat. Probleme, Herausforderungen, Perspekti-ven. Wien Mandelbaum Verlag 2003, 121-131.
Die Themen schriftlicher Arbeiten können von den Teilnehmern/innen selbst gewählt werden. Eine Ab-stimmung mit dem LV-Leiter in der LV oder per E-mail ist möglich, aber nicht vorgeschrieben. Die folgenden Beispiele sind Vorschläge, es können aber auch eigene Themen gewählt werden.
Bei der Ausarbeitung sollte großer Wert auf genaue Rezeption von und kritische Auseinandersetzung mit der verwendeten Literatur, eine zusammenhängende Gedankenführung, Veranschaulichung von Zusammenhängen durch detaillierte Beispiele aus Geschichte und Gegenwart, eventuell Konfrontation mit eigenen Erfahrungen in der Sozialen Arbeit oder ähnlichen Kontexten, sowie eine anregende sprachliche Gestaltung und Gliederung des Textes gelegt werden.
Darstellung eines Abschnittes der Geschichte der Sozialen Arbeit seit der Industrialisierung. Herausarbeitung der gesellschaftlich-sozialen Problematik, der erfolgten sozialen / sozialarbeiterischen Maßnahmen und deren kritische Analyse:
-
Industrialisierung und Proletariat
-
Kinderarbeit
-
Liberalismus und Austrofaschismus -
-
Erster Weltkrieg
-
Entstehung der professionellen Sozialarbeit
-
Zwischenkriegszeit und Entstehung des Sozialstaates
-
NS-Faschismus und Zweiter Weltkrieg
-
Nachkriegszeit
-
Zweite Republik
Herausarbeitung von strukturellen Dynamiken der jüngeren Geschichte der sozialen Arbeit, z.B.:
-
Zentralisierung/Verstaatlichung
-
Politische Stabilisierung
-
Feminisierung
-
Faschisierung
-
Zusammenhänge zwischen Sozialer Arbeit und ökonomischer Entwicklung
-
Destabilisierende Entwicklungen in der Gegenwart.
Kritische (!) Darstellung einer wichtigen Institution aus der Geschichte/Gegenwart der Sozialen Arbeit
-
Caritas
-
Diakonie
-
Jüdische Wohlfahrt
-
Volkshilfe
-
etc.
Kritische (!) Darstellung einer wichtigen Persönlichkeit aus der Geschichte/Gegenwart der Sozialen Arbeit, z.B.:
-
Alice Salomon
-
Frauen aus der Frauen- Arbeiterbewegung
-
Graf Taffie
-
andere
Kritische (!) Darstellung einer wichtigen Strömung aus der Geschichte/Gegenwart der Sozialen Arbeit, z.B.:
-
Settlements
-
Pädagogik der Unterdrückten
-
Case - Work
-
Gruppenpädagogik
Die Bedeutung der Frauenbewegung für die Entwicklung der sozialen Arbeit
Entwicklung der sozialpädagogischen Handlungsfelder
Darstellung der Entwicklung des Sozialstaats in Österreich
Konturen und Probleme Sozialer Arbeit in der Gegenwart
Eigene Recherche:
-
Recherchieren Sie die laufenden Debatten um Bettelverbote in Salzburg, Graz, Wien etc.
Textanalyse:
-
Rekonstruktion der Argumentationsweise des "Briefes an einen Vormund" von Gerda Lucas (Zeller 1994, 201 - 203, vgl. Skriptum, Teil II, Abschnitt IV, 3)
-
Bericht der Referentin im Centralausschuss für Innere Mission über »Die Sozialarbeiterin in der Volksgemeinschaft« aus dem Jahr 1933 (Zeller 1994, 203 ff. vgl. Skriptum, Teil II, Abschnitt IV, 3)
Eigene Themen anhand der im Skriptum angegebenen oder weiterer Literatur.
Der Anhang enthält Übersichten zu Formen der Soztialen Arbeit, die im Skriptum nicht behandelt wer-den: Settlement-Bewegung, Social Case-work, Social Group-work
Settlement-Bewegung
Settlement bedeutet Niederlassung Gebildeter in einer armen Nachbarschaft mit doppeltem Zweck: die Lebensverhältnisse der Armen kennen zu lernen und zu helfen; Voraussetzung für die Hilfe ist die Kenntnis der Lebensverhältnisse der Betroffenen
Den Settlements gingen theoretische Vorarbeiten an den Universitäten voraus, insbesondere ein Kritik des Manchester Liberalismus
1867 "University Extension Movement": Öffentliche Vorlesungen in Oxford und Cambridge
Arnold Toynbee, Nationalökonom (1852-1883): Ferien im Londoner Armenviertel Whitechapel
1884 Samuel und Henrietta Barnett: Erstes Settlement "Toynbee Hall": Muster und Vorbild für alle Gründungen; heute: Stadtteilarbeit
Die Settler betrachten sich als Nachbarn der Armen: Sympathie, Freundschaft, Bildung durch persönliche Beziehung, Überwindung von Klassengegensätzen; Ziel: soziale und geistige Emanzipation, Wege zur Selbsthilfe
Die Aktivitäten beziehen sich auf Kinder- und Jugendarbeit, Rechtsberatung, Erwachsenenbildung, Kulturveranstaltungen sowie auf Forschung und Dokumentation der Armutsverhältnisse
Vor allem Studenten ziehen als "Residents" in die Settlements, die um 1900 46 Häuser umfassen
Weltweit gab es um 1900 hunderte Settlements in 12 Ländern
1926 wird die "International Federation of Settlements and Neighbourhood Cetners" (IFS) in Amsterdam gegründet, die bis heute existiert
USA:
1986 Erste "Neighbourhood Guild" gegr. V. Stanton Cott = University Settlement bis heute
"Hull House" in Chicago, gegr. von Jane Adams
1911 "National Federation of Settlements and Neighbourhood Centers": über 400 Niederlassungen
Community Organizing:
Saul Alionsky 1909 - 1972: Aktionen, Aufbau von Bürger-Organisationen in den Slums von Chicago
Alinski, Saul: Anleitung zum Mächtigsein. Göttingen: Lamuv Verlag 21999
Lateinamerika:
Paulo Freire, Brasiliien 1921-1997
Alphabetisierung, Pädagogik der Unterdrückten
1946 Alphabetisierungskurse für Fabrikarbeiter: Lesen und Schreiben für Erwachsene in 40 Stunden
1963 20.000 "Kulturzirkel" für 2 Mill. Analphabeten
Der Ablauf des Alphabetisierungsprogramms (nach Wikipedia):
-
Die Autoritäten des Dorfes werden aufgesucht, um ihr Einverständnis zum Alphabetisierungspro-gramm einzuholen.
-
Das Leben und das Vokabular der Gemeinschaft wird untersucht.
-
16 generative Wörter werden kodiert und auf Dias, Poster, usw. geschrieben. Da Portugiesisch eine "Silben-Sprache" ist, können aus verschiedenen Silben neue Wörter gebildet werden.
-
Eine sog. "Entdeckungskarte", auf der einzelne Silben abgebildet sind, wird entwickelt.
-
Ein Raum im Dorf wird angemietet.
-
Koordinatoren, keine Lehrer, werden ausgewählt und ausgebildet.
-
Ein "Kulturkreis", keine Klasse, wird gebildet. Er besteht aus 25 bis 30 Teilnehmern.
Wenn die Gruppe sich gebildet hat, läuft es weiter wie folgt:
-
Einmal die Woche trifft sich die Gruppe für eine Stunde ca. 6- bis 8-mal.
-
Die ersten Sitzungen werden dazu benutzt, die Unterschiede zwischen Natur und Kultur anhand der 10 Dias zu analysieren.
-
In der nächsten Sitzung wird das erste generative Wort gebildet - mit Hilfe der "discovery-card". Am Ende werden die Teilnehmer aufgefordert, neue Wörter aus den Silben zu bilden.
-
In den verbleibenden Sitzungen werden die anderen generativen Wörter einzeln eingeführt. Die Teilnehmer schreiben und lesen in den Sitzungen, drücken ihre Meinung aus und schreiben sie auf. Sie lesen Zeitungen und diskutieren über lokale Ereignisse.
1964 Staatsstreich, Alphabetisierungsgruppen verboten
Literatur:
Freire, Paulo: Pädagogik der Unterdrückten. Reinbek: Rowohlt 1973
Dabisch, Joachim / Schulze, Heinz: Befreiung und Menschlichkeit. Texte zu Paulo Freire. München 1991
Figueroa, Dimas: Aufklärungsphilosophie als Utopie der Befreiung in Lateinamerkia. Die Befreiungs-theorien von Paul Freire und Gustavo Gutiérrez. Frankfurt/N.Y. 1989
Deutschland
Walter Classen, 1874 - 1954, Theologe, Pfarrer: Aufenthalt in Toynbee; Erste Settlementversuche nach englischem Muster scheitern in Hamburg: keine Mitarbeiter
1901 Neues Konzept: Volksheim, gesponsert von Fabriksbesitzern und Kaufleuten, unpolitisch; Zielgruppe: besser situierte Arbeiterschaft
Volksheime in Karlsruhe, Leipzig, Worms, Stuttgart
1925 "Deutsche Vereinigung der Nachbarschaftssiedlungen"
NS-Zeit durch Anpassung überlebt
Nach Weltkrieg II: Vor allem Kulturarbeit
Heute: "Theater in der Merschnertraße", zwei Kindertagesstätten, eine Ferieneinrichtung
Friedrich Siegmund-Schultze, 1985 - 1969, Theologe, Pfarrer in Berlin, Besuche in Toynbee Hall und Hull House
1911 Gründung eines echten Settlements mit ca. 20 Settlern im Berliner Osten, gefördert vom amerikanischen Industriellen Carnegie: Bildungsveranstaltungen, Clubs f. Kinder u. Jugendliche, Debattenforen, kulturelle und Freizeitaktivitäten
"Kaffeeklappe" für unterste Arbeiterschicht: "Schlafburschen" erhalten zeitweilig Bett, Imbiss, kein
Alkohol
1913 "Soziale Arbeitsgemeinschaften" als Trägerorganisationen in vielen Städten
Weltkrieg I: Freiwillige Mitarbeiter werden eingezogen = hauptamtlicher Mitarbeiter
1933 verhaftet und exiliert
1940 SAG verboten
nach Weltkrieg II: DDR = keine Wiedererrichtung möglich
Werner Picht, 1887 - 1965, Besuche in Toynbee Hall
1913: Buch "Toynbee Hall und die englische Settlementbewegung". Tübingen: Mohr 1913
"Toynbee Hall hat unter allen englischen Settlements die beste Tradition. Es ist, wie kein anderes, unmittelbar herausgewachsen aus der Einflußsphäre der sozialen Idealisten, ja es bildet, wenigstens in seiner Konzeption, den kongenialsten Versuch zur Verkörperung ihrer Ideale. Hier war ihre Forderung an die Gebildeten erfüllt, sich nicht mit Geld von ihren Verpflichtungen den unteren Volksklassen gegenüber loszukaufen, sondern das eigene Leben einzusetzen. Hier wurden praktische Sozialreformer herangebildet, welche aus persönlicher Erfahrung die Schäden kannten, die sie zu bessern suchten. Hier waren Menschen, die ohne Scheu den Abgrund der Klassengegensätze überschritten und wie niemand zuvor vermittelten zwischen hüben und drüben, Vorurteile zerstreuten, und jenseits aller sozialen Kämpfe ein gemeinsames Menschlichkeitsideal aufrichteten." (Picht 77)
"Wer den Vorzug hat, in Toynbee Hall aufgenommen zu sein, der weiß, dass er damit in einen Freundeskreis eingetreten ist, dem anzugehören, ganz abgesehen von aller sozialen Arbeit, eine menschliche Bereicherung bedeutet. Wie aber, muß gefragt werden, ist diese Gemeinschaft sozialer Arbeiter dem menschlichen Teil ihrer Aufgabe gerecht geworden, der bezeichnet wird durch das Wort ,Nachbarschaftsidee'? Und hier hat die Kritik einzusetzen. Es ist fraglos vieles geleistet worden [...[ Aber Nachbarn ihrer Nachbarn zu werden haben sie nicht verstanden. [...] Toynbee Hall ist, um es einseitig auszudrücken, zum ‚politischen Settlement' geworden. Es ist mehr interessiert an Fragen des öffentlichen Lebens als am Leben des einzelnen Menschen. Das System seiner Klassen und der damit verbundenen Vereinigungen, das wertvoll war als neutraler Boden, auf dem bei gemeinsamer Tätigkeit Resident und Arbeiter sich finden konnten, hat diesen Sinn völlig verloren. Kaum eine Klasse wird von einem Mitglied des Settlements unterrichtet; diese Arbeit wird fast ganz von bezahlten oder unbezahlten Hilfskräften geleistet. Und an den Studienvereinen nehmen Residents auch nur gelegentlich Anteil." (ebd, S, 80
"Es ist die Frage, ob es nicht besser ist, wenn der Besitzende in seiner gegebenen Umgebung bleibt, als wenn er sein Heim mitten unter Elend und Not in ihren sichtbarsten und ans Herz greifendsten Formen aufschlägt, ohne die natürlichen Pflichten des Nachbarn zu erfüllen." (ebd..S.81)
"Siedlungsheim" in Berlin-Charlottenburg
"Jüdisches Volksheim" im Berliner Scheunenviertel
Nach Weltkrieg II: Zahlreiche "Nachbarschaftsheime" in der BRD bis heute. Kulturarbeit, Bildungsarbeit etc.
60er Jahre: Gemeinwesenarbeit wird kommunalpolitische Methode: Gestaltung von Plätzen, Sanierung, Kommunikation in Stadtrandsiedlungen, Spielplätze, Aufgabenhilfe, Therapieangebote
Österreich:
1901 Überkonfessionelles Settlement in Wien-Ottakring, gegründet Von Else Federn, Pionierin der Wiener Frauenbewegung; 1938 aufgelöst
Jüdisches Volksheim "Beeth Haam" (Haus des Volkes) Jüdische Toynbee Halle, gegründet von dem Zionisten Leon Kellner
1901-1938 und 1946-2003: Verein Wiener Settlement
Wien: Bassena Stuwerviertel, Verein
Familien- und Kommunikationszentrum Bassena 10
Nachbarschaftszentren des Vereins "Wiener Hilfswerk" in vielen Bezirken
Sozialmedizinisches Nachbarschaftszentrum Unterpenzing
Stadtteilzentrum Bassena
Frauenbank Schöpfwerk:
für verarmte Frauen, die mit den "Transferzahlungen" (Sozialhilfe, Mietzinsbeihilfe, Familienbeihilfe, Ausgleichszahlungen) nicht auskommen, denen Strom und Heizung abgedreht wird (einschalten kostet 60/70 €, Zahnarztspritze 12 €)
100 Euro für 1 Jahr aufs Sparbuch, anonyme Kredite zu ausgehandelten Bedingungen für Heizung, Strom, Miete, Lebensmittelgutscheine, Zinsen: Kreditnehmerin: 2 % als Zucker, Gelierzucker, Kre-ditgeberin: Naturalien (Marmelade, Säfte, Kräutertees) und Dienstleistungen (Fenster putzen, Baby-sitting, Haustiere betreuen), max. 150 €.
Literatur:
Sachße, Christoph / Thenstedt, Florian: Müttterlichkeit als Beruf. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986, 125-137 ... und dortige Literaturangaben
Social Casework = Soziale Einzelfallhilfe
Mary Ellen Richmond 1861-1928:
Arbeit und Erfahrung bei der Charity Organization Society in Baltimore
1917 Werk "Social Diagnosis": systematische Darstellung der Tätigkeit und Vorgehensweise von Sozialarbeitern
Grundprinzip: "Dort ansetzen, wo der Klient ist"; Aufsuchende soziale Arbeit, Armenbesuch
DieR SozialarbeiterIn ist das wichtigste Instrument der Sozialarbeit
Richmond "stellte das Verhältnis von Individuum und sozialer Umwelt, die Frage nach den gestaltenden Kräften der individuellen Persönlichkeit und deren Beeinflussbarkeit durch sozialarbeiterische Interventionen ins Zentrum der Überlegungen. [...] Armut - so schrieb sie - lässt sich weder allein mit individuellem Versagen noch ausschließlich mit gesellschaftlichen Bedingungen erklären. Sie ist stets Ausdruck der wechselseitigen Bedingung und Bedingtheit beider. [...] genaue Ermittlung des Notstands und Mobilisierung aller verfügbaren individuellen und sozialen Ressourcen. Im Zentrum stand dabei die Familie als unmittelbarer Bezugsrahmen.
Ermittlungs- wie Vermittlungstätigkeit war: Ermittlung des Notstandes, Prüfung der Arbeitswilligkeit, Unterscheidung zwischen "würdigen" und "unwürdigen" Armen und Mobilisierung notwendiger Abhilfen. [...] Vorläufer sowohl der aufsuchenden Familienarbeit der Allgemeinen Sozialdienste als auch der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Allerdings war Social Casework trotz Einbezugs der sozialen Umgebung hauptsächlich auf die Bildung der Persönlichkeit und auf Selbstverantwortung gerichtet. Die Erwartung, mit Casework Armut wirksam einzudämmen, erfüllte sich nicht, da ihre Reichweite auf Grund dere Arbeit mit einzelnen Fällen begrenzt ist. In Deutschland wurde der Ansatz von Richmond von Alice Salomon aufgegriffen: "Ihr entscheidendes Buch ‚Soziale Diagnose' erschien 1926 und enthielt viele nützliche Ratschläge für Hausbesucherinnen, die auch bei der Ausbildung von Kriminalpolizistinnen hätten hilfreich sein können" (Müller 1996, 16)
Literatur:
Müller, Wolfgang C.: Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine Methodengeschichte der Sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa 2006, S. 120-177
Social Groupwork / Gruppenpädagogik
Entstanden in den 30er Jahren in der kirchlichen Arbeit, Arbeit mit schwierigen Kindern und Jugendlichen der USA im Zusammenhang mit der Vermehrung sozialer Gruppen: Jugendorgansationen, Clubs der settlements, Nachbarschaftsgruppen, Ferienlager, YMCA (1851), YWCA (1860), Scouts (1910) etc.
Im gleichen Zeitraum entstand die Gruppenforschung (Gruppenbildungsprozess, Führungsstil, Gruppenklima, Verhältnisse zwischen Gruppen) und die Gruppendynamik (Kurt Lewin: T-Gruppen)
Als "Mutter der Gruppenpädagogik" gilt:
Gisela Konopka 1910-2003: jüdische Sozialarbeiterin in Deutschland und USA
1968 Publikation "Soziale Gruppenarbeit: ein helfender Prozess", das Standardwerk der Sozialen Gruppenarbeit, die sie wie folgt definierte:
"Soziale Gruppenarbeit ist eine Methode der Sozialarbeit, die den Einzelnen durch sinnvolle Gruppenerlebnisse hilft, ihre soziale Funktionsfähigkeit zu steigern und ihren persönlichen Problemen, ihren Gruppenproblemen oder den Problemen des öffentlichen Lebensbesser gewachsen zu sein."
In Deutschland wurde die Gruppenarbeit nach Weltkrieg II besonders propagiert. Gruppenfähigkeit wurde als Möglichkeit zur Förderung demokratischer Einstellungen und des sozialen Zusammenlebens angesehen. Wichtigstes Zentrum war das von den Amerikanern gegründete Haus Schwalbach, die "Schwalbacher Spielkartei", eine Sammlung von Gruppenspielen wird noch heute verwendet.
In den 50er Jahren wird die Gruppenpädagogik wird zu der Methode der Sozialarbeit schlechthin
Problem: Mittelschichtorientierung, Umgang mit "nicht Gruppenfähigen" "Schwererziehbare"
Literatur:
Müller, C Wolfgang: Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine Methodengeschichte der Sozialen Arbeit. Wein-heim und München: Juventa 2006, S. 68-83
Konopka, Gisela: Die Geschichte der Gruppenpädagogik. In: Müller, Wolfgang C. (Hg.): Gruppenpädagogik. Auswahl aus Schriften und Dokumenten. Weinheim 1987
Gemeinwesenarbeit
Lebensverhältnisse innerhalb eines Gemeinwesens (Stadtteil, Dorf) sollen insgesamt durch verschiede-ne Maßnahmen verbessert werden: Einbeziehung der Betroffenen, Ansetzen bei deren Interessen und Bedürfnissen, Mobilisierung von Selbsthilfekräften
Literatur:
Boulet, Jaak u.a.: Gemeinwesenarbeit. Eine Grundlegung. Bielefeld 1980
Klöck, Thilo: Solidarische Ökonomie und Empowerment. Jahrbuch Gemeinwesenarbeit 6, AG SPAK, München 1999
Müller, C Wolfgang: Wie Helfen zum Beruf wurde. Eine Methodengeschichte der Sozialen Arbeit. Wein-heim und München: Juventa 2006, S. 22-51; 198-235
Roessler, Marianne u.a. (Hg.): Gemeinwesenarbeit und Bürgerschaftliches Engagement. Eine Abgrenzung. Wien 2000
Riess, Heinz u.a. (Hg.): Hoffnung Gemeinwesen. Innovative Geminwesenarbeit und Problemlösingen im bereich lokaler Ökonomie., Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Benachteiligung. Neiwied 1997
Schnee, Renate: Vorlesungsbegleitendes Skriptum Gemeinwesenarbeit. Internet
Staub-Benasconi, Silvia: Systemtheorie. Soziale Probleme und Soziale Arbeit: Lokal, national, international. Oder: Vom Ende der Bescheidenheit. Bern, Stuttgart, Wien 1995
Quelle:
Bernhard Rathmayr: Armut und Fürsorge. Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit
Teil 1: Von der Antike bis zur Industrialisierung, Teil II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart. Innsbruck: Skriptum, 4. vollständig überarbeitete Auflage 2012
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 15.05.2013
[157] Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Zum Beispiel ist für die Werte 4, 1, 37, 2, 1 der Median 2, nämlich die mittlere Zahl in 1, 1, 2, 4, 37. Allgemein teilt ein Median eine Stichprobe, eine Anzahl von Werten oder eine Verteilung in zwei Hälften, so dass die Werte in der einen Hälfte kleiner als der Medianwert sind, in der anderen größer (Wikipedia).
[158] Die Anrechnung von "Erziehungszeiten" versucht dem entgegen zu wirken. Mit einer Anrechnungszeit von maximal 48 Monaten nach der Geburt des ersten Kindes bleibt der Effekt allerdings gering.
[159] 2000 - 2002 regierte das Kabinett Schüssel II, die so genannte "schwarz-blaue Koalition" zwischen ÖVP und der FPÖ.
[160] Z.B. betrug der Richtsatz im Burgenland 382 €, in Oberösterreich 496 €. Durch Zuschläge einzelner Bundesländer zum Mindestrichtsatz der BMS sind allerdings wieder leichte Unterschiede entstanden.
[161] Basisinformation des Bundesministeriums für Soziales zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung
