Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck eingereicht von MMag. Plangger Sascha Michael; Erstbegutachter: Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger; Zweitbegutachter: Ao.Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil Arbeit und Behinderung
- II. Teil Arbeit, Armut und Ausschluss
- III. Teil Die Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung
- IV. Teil Empirische Studie zum Modell SPAGAT Vorarlberg
- V. Teil: Anerkennung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Die Arbeit bzw. die moderne und normative Auffassung von Arbeit als Erwerbstätigkeit, bestimmt wesentlich das Verhältnis der Menschen zur Gesellschaft und gleichzeitig das Verhältnis von Integration und Ausschluss und von Normalität und Behinderung. Durch den Ausschluss von Menschen mit Behinderung aus der Arbeitswelt, die als Lebenswelt wesentlich die soziale Teilhabe ermöglicht, wird Behinderung als Ausnahmezustand im Sinne eines chronischen Existenzkonflikts erfahren. "Dieser chronische Konflikt findet darin seinen Ausdruck, dass individuelle Handlungsoptionen nicht mit den Anforderungen der Alltagswelt übereinstimmen bzw. an diesen scheitern." (Kleinbach 1994, 18) Im Laufe der vorliegenden Arbeit wird dieser Zusammenhang dargestellt. Das Scheitern stellt jedoch kein persönliches Versagen der Betroffenen dar, sondern es spiegelt gesellschaftliche Bedingungen, die unfähig sind auf Heterogenität und Alterität zu reagieren. Behinderung stellt damit kein individuelles und wesenhaftes Merkmal einer Person dar, sondern ist als soziale Kategorie zu interpretieren.
Diese Interpretationsarbeit wird im ersten Teil der Arbeit angegangen. Vor allem wird Behinderung im Kontext von Erwerbsarbeit und sozioökonomischen Bedingungen analysiert. Außerdem wird ein Augenmerk auf die Arbeitswelt geworfen, die sich zunehmend rasanter verändert und nicht mehr genügend Arbeit, d.h. bezahlte Arbeit, für alle zur Verfügung stellen kann. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und an gesellschaftlichen Statuspositionen wird immer mehr zum Privileg einiger weniger. Globalisierung und Liberalisierung der Märkte setzen massive gesellschaftliche Ausschlussmechanismen in Bewegung. Für viele Menschen führen diese zu prekären Lebenssituationen und zu porösen Existenzgrundlagen. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens birgt die Hoffnung dieser Misere abzuhelfen.
Im vierten Kapitel wird ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Arbeit geworfen. Die Auffassung von Arbeit in der Antike unterscheidet sich wesentlich von der christlichen Arbeitslehre und diese wiederum von einem protestantisch geprägten Arbeitsbegriff, der unser modernes Arbeitsethos bestimmt.
Wie sich im Laufe der Epochen der Arbeitsbegriff wandelte, wandelte sich in Abhängigkeit dazu auch die Bedeutung von Armut und damit änderten sich die Formen des Ausschlusses der nicht arbeitenden Bevölkerung. Die ineinanderlaufenden Entwicklungen von Arbeit, Armut und Ausschluss werden im zweiten Teil der Arbeit nachgezeichnet. Dabei konzentriert sich der Fokus vor allem auf den gesellschaftlichen Ausschluss von behinderten Menschen.
Das 18. Jahrhundert markierte, durch die Geburtsstunde der modernen Gesundheits- und Sozialpolitik, eine Schwelle. Waren vorher, aus moralischen Gründen, behinderte Menschen, Libertins, Verbrecher, Kranke, Landstreicher, Wahnsinnige usw. gemeinsam in den Zucht- und Arbeitshäusern interniert, so entwickelte sich jetzt ein differenzierteres Ordnungssystem heraus, welches klare Kategorisierungen und Zuordnungen der verschiedenen Abweichungen ermöglichte. So wurden zuerst alle arbeitsfähigen, aber arbeitsunwilligen Personen aus den Anstalten entlassen. Im Zuge der Reformen wurden "geistig" behinderte Menschen gemeinsam mit psychisch Kranken in eigenen Heil- und Irrenanstalten untergebracht. Damit bahnt sich die Psychiatrie als eigenständige Wissenschaft ihren Weg. Ihre Geschichte verläuft wenig ruhmreich. Sie, die Psychiatrie, erzählt uns eine Geschichte der Unterdrückung, der Repression durch Arbeit, der Eugenik und der Auslöschung von tausenden behinderten Menschen im "Dritten Reich".
Vor dem Hintergrund dieser Verbrechen regte sich in den 1950er Jahren erstmals Widerstand gegen die unmenschliche Unterbringung von Menschen mit Behinderung in den großen Heil- und Irrenanstalten. Die Institutionalisierung wurde von der Deinstitutionalisierungsphase abgelöst. Normalisierung und Selbstbestimmung wurden zu handlungsleitenden Prinzipien im Behindertenbereich. Von diesen hängte wesentlich der Anspruch auf die Integration der Betroffenen in die Gesellschaft ab. Doch vor allem für schwerer beeinträchtigte Menschen gerann dieser Anspruch zur unerfüllten Hoffnung. Damit war die Deinstitutionalisierung an ihre eigenen Grenzen gestoßen und die Phase "Leben mit Unterstützung" bahnte sich an. Diese Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem werden im dritten Teil ausführlich behandelt.
Im vierten Teil lege ich eine Studie zum Modell SPAGAT Vorarlberg vor. SPAGAT ist ein Modell zur Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Ergebnisse zu den einzelnen Ablaufphasen und Bausteinen im Integrationsprozess, aber auch zu den Auswirkungen der beruflichen Integration werden präsentiert. Modelle zur Unterstützten Beschäftigung entwickelten sich im Laufe der dritten Phase, dem Leben mit Unterstützung. Paradigmatisch wird dabei der Empowerment-Ansatz als handlungsleitendes Prinzip forciert. Das Empowerment-Paradigma beansprucht, das Normalisierungs- und Selbstbestimmungsparadigma abzulösen.
Im fünften Teil wird die Theorie der Anerkennung von Axel Honneth auf die Phasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung übertragen. Honneths stufenförmig ausgeführte Theorie der Anerkennung basiert auf reziproken Anerkennungsverhältnissen. Die jeweiligen Anerkennungsweisen, vor allem die rechtliche Anerkennung (Gleichstellung) und die soziale Wertschätzung (Solidarität), korrespondieren mit zentralen gesellschaftstheoretischen Positionen des Liberalismus und Kommunitarismus und diese korrespondieren wiederum mit dem Selbstbestimmungsparadigma und Empowerment-Ansatz. Sie werden in diesem Zusammenhang ausführlicher geschildert und kritisch bewertet.
Honneth ist bemüht, fürsorgliche, liberale und kommunitaristische Prinzipien in ein wechselseitiges Austauschverhältnis zu bringen. Dabei kulminieren die jeweiligen intersubjektiven und reziproken Anerkennungsweisen im Begriff der sozialen Wertschätzung und Solidarität. Doch weder Honneth, noch kommunitaristischen und liberalen Theorien gelingt es, eine Ethik der Anerkennung zu entwerfen bzw. einen Impuls für moralisches Handeln gegenüber dem Anderen ausfindig zu machen. An dieser Stelle, im dritten Kapitel des vierten Teils, wird die Soziologie Zygmunt Baumans und die Ethik von Emmanuel Lévinas ins Spiel gebracht und aufgezeigt, wie Anerkennung, Verantwortung und Gerechtigkeit gegenüber dem Anderen ermöglicht wird.
Inhaltsverzeichnis
"Seit dem Beginn der Neuzeit und vor allem mit dem Beginn der Moderne und der Industrialisierung ist Arbeit in wachsendem Maße zum bestimmenden Merkmal des Lebens geworden." (Wulf 2000, 32) Vor allem gilt dies für unsere heutigen Industriestaaten, die sich durchweg als Arbeitsgesellschaften definieren und auf dem Prinzip der Erwerbsarbeit beruhen. Die Erwerbsarbeit bestimmt in unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft das gesamte soziale Leben der Menschen und damit einhergehend ihren sozialen Status. "Neben dem familialen und sozialen Leben bestimmen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft den Sinn ihres Lebens am stärksten über Arbeit. [[...]] Die Teilhabe an der gesellschaftlich organisierten Arbeit sichert die soziale Anerkennung des Einzelnen. Arbeit hat eine subjektive, eine soziale und eine gesellschaftliche Bedeutung. [...] Die mit Arbeit verbundenen Werte und Normen strukturieren und gestalten das Leben. Zu ihnen gehören Werte wie Motivation und Engagement, Rationalität und Präzision, Gewissenhaftigkeit und Pflichterfüllung, Kreativität und Innovationsbereitschaft. Schon in der Kindheit wird die Übernahme dieser Werte angestrebt. Später werden sie kontinuierlich angewandt und eingeübt. Die Arbeitswelt wird schließlich die gesellschaftliche Institution zur Einschreibung dieser Werte in die Körper der Arbeitenden." (Wulf 2000, 33)
Mit Erwerbsarbeit verdienen wir in erster Linie das Geld, mit welchem wir unsere Existenz, im Sinne primärer Bedürfnisse wie Essen, Kleidung und Wohnung, absichern. Die existenzielle Absicherung wirkt weit in die Zukunft hinein. An das Einkommen sind die wichtigsten Sozialleistungen gekoppelt, Unfall- und Krankenabsicherung, Sozial- und Rentenabsicherung. Darüber hinaus hat Erwerbsarbeit eine ordnende Funktion, sie gibt dem Leben Raum- und Zeitstrukturen vor. Der Arbeitende wechselt zwischen Arbeitsplatz und dem Zuhause und zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Vor allem durch den zeitlichen Rhythmus besitzt die Arbeit eine Orientierungs- und Strukturierungsfunktion für das Leben. Indirekt wirkt sie sich damit auf die biographischen Lebenszusammenhänge aus. Die Jugend wird durch die schulische Sozialisierung auf die Arbeitswelt vorbereitet. Das Erwachsenenalter ist durch die berufliche Tätigkeit bestimmt und im Alter zieht sich der Mensch aus der Arbeitswelt allmählich wieder zurück.
Arbeit strukturiert nicht nur Raum- und Zeiterfahrungen, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen. Sie vermittelt und konstituiert soziale Interaktionen. Erwerbstätige verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz und sind dort in ein soziales Umfeld eingebettet. "Auf diese Weise trägt sie zur weitergehenden Sozialintegration bei. Der Bezug des Individuums zu seiner Umwelt wird erweitert; dies entlastet nicht nur primäre soziale Netze, sondern vergrößert auch das Potential an Anregungen, Informationen und Handlungsmöglichkeiten." (Bieker 2005, 15) Durch die Arbeit gelingt es dem Menschen, sich als soziales Wesen zu fühlen und in kooperativer Weise mit Anderen aktiv zu sein.
Eine weitere Funktion liegt in der sozialen Komponente, die durch die Arbeit wesentlich bestimmt wird. "Was machst du", lautet meistens einer der ersten Sätze, wenn man mit jemandem eine Konversation beginnt. Die Antwort verrät dann zugleich die soziale Stellung des Gegenübers. Ob jemand Bauarbeiter oder Bankangestellter ist, erzeugt ein gesellschaftliches Bild, mit dem bestimmte Erwartungen und Ansprüche verbunden sind. Durch einen angesehenen Beruf stärkt sich das soziale Prestige und damit verbunden das eigene Selbstkonzept. Ein positives Selbstkonzept und eine günstige Identitätsentwicklung bedingen sich wiederum wechselseitig.
Durch die Arbeit, die uns zum einen in einen sozialen Kontext integriert, der wesentlich den eigenen Selbstbezug mit konstituiert, erhalten wir zum anderen auch die Möglichkeit als Teil an einem größeren Ganzen zu partizipieren: "Über die Erwerbsarbeit wird der Einzelne über seinen persönlichen Rahmen hinaus in kollektive Ziele und Zwecksetzungen eingebunden." (Bieker 2005, 15)
Jede dieser Sinn- und Bedeutungsdimensionen von Arbeit kann sich ins Negative verkehren, wenn eine Person ihre Arbeit verliert, keine bekommt oder noch nie eine hatte. Arbeitslose sind oftmals prekären Lebenssituationen ausgesetzt. In vielen Fällen steht durch Einkommensausfälle und durch den Verlust ökonomischer Sicherheit die eigene Existenz auf dem Spiel. Gewünschte oder gewohnte Lebensstandards lassen sich nicht mehr aufrecht erhalten. Ordnende Lebenszusammenhänge gehen verloren. Den Erwerbslosen steht zwar ein hohes Maß an freier Zeit zur Verfügung, das sie jedoch nicht mehr selbstaktiv zu füllen vermögen. Wesentliche Interaktionsformen versanden, monotone und abwechslungsarme Alltagsstrukturen nehmen überhand. Arbeitslosigkeit führt zur sozialen Isolation, denn Betroffene brechen oft aus Schamgefühl soziale Bindungen und Kontakte hinter sich ab. Sie selbst sehen sich als deplatziert und wertlos. Dieses Gefühl der sozialen Nutzlosigkeit wird den Betroffenen indirekt vermittelt. Langzeitarbeitslosigkeit wird von der Erwerbsbevölkerung immer auch als individuelles Fehlverhalten interpretiert. Jeder von uns kennt die Stammtischsprüche: "Sie sind nur zu faul, um zu arbeiten, als Sozialschmarotzer lassen sie sich lieber vom Staat erhalten." Derartige Urteile über arbeitslose Mitbürger bewirken soziale Diskriminierungen und die gesellschaftliche Degradierung, führt selbstverständlich zum Verlust sozialen Ansehens und zum Verlust eines positiven Selbstwertgefühls.
Menschen, die einer Arbeit nachgehen, erhalten für sich ein bestimmtes Aktivitätsniveau aufrecht. Sie sind zumeist körperlich und sozial aktiver als Erwerbslose. Körperliche und psychische Gesundheitsprobleme lassen sich bei Arbeitslosen im Vergleich zu erwerbstätigen Menschen überproportional nachweisen. Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet gleichzeitig auch den Ausschluss von wichtigen Wissens- und Erfahrungsressourcen. Sie haben, in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt, nicht die Möglichkeit in praktischer Weise ihr Wissen weiterzuentwickeln. Schlüsselqualifikationen gehen verloren, die, um eine Arbeit zu finden, von jedem Arbeitgeber eingefordert werden. Somit schließt sich der Teufelskreis von Ausschluss und Ausgeschlossenbleiben, denn je weiter sich die Anforderungen des Arbeitsmarktes nach oben bewegen, um so größer wird die Diskrepanz zu den erforderlichen Kompetenzen.
Erwerbsarbeit bestimmt individuelle und soziale Lebensweisen. Die dargestellten Funktionsweisen bedingen sich wechselseitig. Diese Wirkungs- und Funktionszusammenhänge lassen sich mit Pierre Bourdieus Kapitaltheorie darstellen. Er löst darin den Kapitalbegriff aus seiner eng definierten und herkömmlichen ökonomischen Bedeutung der Profitmaximierung heraus und erweitert ihn durch alle Formen des sozialen Austausches. "Eine allgemeine ökonomische Praxiswissenschaft muss sich [...] bemühen, das Kapital und den Profit in allen ihren Erscheinungsformen zu erfassen, um die Gesetze zu bestimmen, nach denen die verschiedenen Arten von Kapital (oder, was auf dasselbe herauskommt, die verschiedenen Arten von Macht) gegenseitig ineinander transformiert werden." (Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht 1997, 52)
Bourdieu geht es vor allem darum, zu schauen, wie sich ökonomische Voraussetzungen auf soziale, kulturelle und gesellschaftliche Prozesse auswirken und übertragen. Er unterscheidet vier Kapitalsorten, wobei das ökonomische Kapital eine primäre Funktion ausübt. Der Arbeitende veräußert seine Arbeitskraft und erhält als Äquivalent dafür einen Lohn. Dieser Tausch stellt in den allermeisten Fällen die Grundlage dar, um ökonomisches Kapital zur materiellen Existenzsicherung anzuhäufen. Darüber hinaus stellt der Tausch auch die Basis bereit, abhängig vom Tauschwert, weiteres Kapital, in kultureller, sozialer und symbolischer Form zu akkumulieren.
Kulturelles Kapital liegt in objektiver Form vor, "beispielsweise in Form von Büchern, Gemälden, Kunstwerken, Maschinen oder technischen Instrumenten." (Schingel 2000, 86) Konkret bedeutet das, dass man sich mit Geld Bücher, Computer, Maschinen usw. kaufen kann. Damit man die Geräte bedienen kann, um sie zweckmäßig einzusetzen, benötigt man inkorporiertes Kulturkapital. Darunter versteht Bourdieu bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensformen. Der Computer z.B. ist nutzlos, solange ich nicht verstehe, wie ihn zu bedienen. "Denn was wäre ein Buch ohne Leser, eine Maschine die niemand bedienen kann? Ein Kunstgegenstand ohne entsprechende ästhetische Dispositionen des Betrachter? Nichts anderes als das rein materielle Substrat der entsprechenden Objekte, das sich gänzlich auf den (ökonomischen) Materialwert des Papiers, des Metalls, der Leinwand reduziert." (Schingel 2000, 88)
Inkorporiertes Kulturkapital erwirbt man vor allem durch Bildung. Und durch Bildung erwirbt man zugleich institutionalisiertes Kulturkapital in Form von Bildungstiteln (z.B. Schul-, Lehr- und Hochschulabschlüsse etc.). Bildungstitel sind für Bourdieu immer auch Legitimitätsnachweise, die zu einem Beruf oder zu einer Arbeit befähigen und dadurch auch mehr oder weniger erfolgreiche Erwerbskarrieren ermöglichen.
Inkorporiertes und institutionalisiertes Kulturkapital ist nicht veräußerbar, es haftet den jeweiligen Personen, die es erworben haben, unmittelbar an. Um sich dieses Kapital anzueignen, muss - so Bourdieu - Zeit investiert werden. Der Umgang mit dem Computer muss erlernt werden, der Abschluss einer Hochschule verlangt Zeit zum Lernen. Zeit ist Geld; je mehr jemand davon hat oder verdient, umso leichter kann er sich bei technischen Gräten oder Computersystemen usw. auf dem neuesten Stand halten. Und je wirksamer ein junger Mensch durch seine Familie finanziell abgesichert ist, umso einfacher gelingt ihm die Anhäufung kulturellen Kapitals und die Profitmaximierung aufgrund exklusiver Bildungswege und Hochschultitel. Exklusivität in der Ausbildung verschafft natürlich Vorteile am Arbeitsmarkt und damit wiederum höhere ökonomische Kapitalrenditen.
Die dritte Kapitalsorte ist nach Bourdieu das soziale Kapital: "Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen." (Bourdieu 1997, 63) Akkumulation von Sozialkapital erfordert unermüdliche Beziehungsarbeit. "Bei der Beziehungsarbeit wird Zeit und Geld und damit, direkt oder indirekt ökonomisches Kapital verausgabt." (Bourdieu 1997, 67) Zusätzlich bestimmen die kulturellen Voraussetzungen bzw. das Kulturkapital, den Zugang zu exklusiven Gesellschaftskreisen. D.h. je intensiver jemand Beziehungen knüpft, pflegt und aufrechterhält, je mehr Zeit und Geld er für diese Beziehungsarbeit investiert, desto höher werden die dadurch erzielten Profitmöglichkeiten. Sozialkapital ist hauptsächlich mit der Reproduktion kulturellen und ökonomischen Kapitals verbunden.
Akkumuliertes ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital lässt sich letztendlich in symbolisches Kapital transferieren. Es steigert die Kreditfähigkeit einer Person in der Art und Weise ihres gesellschaftlichen Status. "Zustande kommt symbolisches Kapital mittels gesellschaftlicher Anerkennungsakte, die bestimmten Akteuren oder gesellschaftlichen Gruppen einen ‚Kredit' an Ansehen und damit ein bestimmtes Prestige einräumen." (Schingel 2000, 92) "Kurzum, jeder ‚Kredit' an legitimer gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung stellt ein symbolisches Kapital dar, das seiner Konstitutionslogik nach unabhängig von dem objektiven ökonomischen und kulturellen Kapital ist. Faktisch gesehen jedoch ist es wohl in den allermeisten Fällen nur im Verein mit den anderen Kapitalformen anzutreffen, wobei es in der Lage ist, deren spezifische Effizienz und Wirksamkeit zu steigern." (Schingel 2000, 91)
Symbolisches Kapital bestimmt die gesellschaftliche Stellung einer Person. Menschen, die von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind, über geringes ökonomisches, kulturelles und auch über wenig soziales Kapital verfügen, sind damit von vornherein gesellschaftlich diskreditiert. Nach Bourdieu hängt Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung mit der Anhäufung der drei Kapitalarten und ihrer Transformation zusammen. Anerkennung basiert auf einem Tauschakt und unterliegt letztendlich einem ökonomischen Wertgesetz. Ökonomische Voraussetzungen bestimmen jedoch nicht nur den gesellschaftlichen Status, sondern sie wirken mitunter auch an der Konstituierung von Behinderung mit.
A) Behinderung
In der vorliegenden Arbeit vertrete ich einen soziologischen Behinderungsbegriff. Ein Grund liegt darin, dass die Behindertenrolle sozial und kulturell vorherbestimmt wird. Sie konstituiert sich wesentlich durch einen normativ geprägten Arbeitsbegriff. Im Zuge der Disability Studies konnten viele latente gesellschaftliche Bedingungen aufgedeckt werden, die behinderte Menschen zu Menschen zweiter Klasse degradieren und in keiner Weise mit den funktionellen Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen in Verbindung stehen. Behindert ist man nicht, sondern man wird es! So lautet die Prämisse, die sich stringent durch die hier versammelten Themen hindurch zieht. Außerdem werden die Themen Arbeit, Erwerbstätigkeit, Arbeitsgesellschaft usw. als soziale Phänomen schwerpunktmäßig und am fruchtbarsten durch die Soziologie erforscht. Aus diesem Grund scheint ein soziologischer Behinderungsbegriff angebracht, um eine methodische Kompatibilität zu gewährleisten.
Eine soziologische Definition von Behinderung bleibt "immer ‚relativ' in Abhängigkeit vom sozialen Zusammenhang." (Cloerkes 2007, 2) Wenn Behinderung als relative Kategorie gedacht wird, so liegt dem Begriff keine medizinische oder sonderpädagogische Definition von organischer oder psychischer Schädigung zugrunde. Relativität bedeutet demnach immer auch, dass sich Anschauungen und mit ihnen die Dinge wandeln und verändern. So auch das Phänomen Behinderung, dessen Gesicht sich im Laufe der Geschichte stets anders zeigte und in Zukunft veränderbar bleibt. Und damit scheint die Hoffnung verbunden, die in Anlehnung an Foucaults Schlusssatz in seinem Werk Die Ordnung der Dinge zum Ausdruck kommt, "dass [Behinderung] [...] verschwindet, wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand." (Foucault 1974, 462)
Soziologische Erklärungsversuche betrachten Behinderung als Interaktionsstörung, hervorgerufen durch gesellschaftliche Kontexte. Definitionen, die auf Schädigungen und Defizite beruhen, klammern zumeist gesellschaftliche Reaktionsweisen aus. Schädigung wird als zentral objektivierbare Abweichung von der Norm verstanden und durch medizinische oder sonderpädagogische Diagnoseverfahren festgelegt. Als Gegenantwort können jedoch Studien und wissenschaftliche Arbeiten angeführt werden, die Behinderung wesentlich vor dem Hintergrund sozio-ökonomischer und kultureller Bedingungen analysieren und dazu eindeutige Ergebnisse liefern. Behinderung wird dabei als sozialer Bewertungs- und Abwertungsprozess verstanden. Cloerkes schlägt eine soziologische Definition von Behinderung vor, die den intersubjektiven Aspekt ins Zentrum rückt: "Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen, oder seelischen Bereich, der allgemein ein entscheidender negativer Wert zugeschrieben wird. ‚Dauerhaftigkeit' unterscheidet Behinderung von Krankheit. ‚Sichtbarkeit' ist im weitesten Sinne das ‚Wissen' anderer Menschen um die Abweichung. Ein Mensch ist ‚behindert', wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist." (Cloerkes 2007, 8)
Behinderung ist demnach das Produkt einer gesellschaftlichen Interaktionsstörung:. "Devianz ist im wesentlichen das Resultat sozialer Reaktionen. Im Mittelpunkt des Interesses steht nicht die Frage, wer abweicht, sondern wie die anderen den ‚Abweichler' definieren. Abweichendes Verhalten liegt dann vor, wenn eine Verhaltensweise negativ sanktioniert (bestraft) wird: Abweichendes Verhalten ist jedes Verhalten, das die Leute so etikettiert." (Cloerkes 2007, 163) Nach Cloerkes verletzt eine behinderte Person normative Erwartungshaltungen; Behinderung unterliegt jedoch auch zugleich einem ständigen gesellschaftlichen Interpretationsprozess. "Die Menschen ordnen sich gegenseitig und selbst ein, sobald sie miteinander in soziale Beziehungen treten. Die Identität (auch die abweichende Identität) einer Person bestimmt sich letztlich aus solchen Etikettierungen, Typisierungen, Bewertungen." (Cloerkes 2007, 164) Aufgrund dieser Interpretations-, Bewertungs- und Definitionsprozesse entsteht eine Diskrepanz zwischen abweichenden Merkmalen und Eigenschaften und den für als normal angesehenen gesellschaftlichen Vorstellungen. Solche Prozesse führen zur Stigmatisierung von Personen oder Personengruppen. "Der Terminus Stigma wird also in Bezug auf eine Eigenschaft gebraucht [...], die zutiefst diskreditierend ist, aber es sollte gesehen werden, dass es einer Begriffssprache von Relationen, nicht von Eigenschaften bedarf." (Goffmann 1967, 11) D.h., dass bestimmte Eigenschaften nicht per se diskreditierend wirken, vielmehr entwickelt sich das Stigma bzw. das abweichende Merkmal erst im Kontext sozialer Beziehungen und Bewertungen. Das Stigma wird jedoch derart generalisiert und überhöht, dass es zur alleinigen Seinsbestimmung des Stigmatisierens wird. Stigmatisierungen können schwerwiegende Folgen haben: "Auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe droht Diskriminierung durch formellen oder informellen Verlust von bisher ausgeübten Rollen, es kommt zu Kontaktverlust, zu Isolation und Ausgliederung. Auf der Ebene der Interaktion orientiert sich alles am Stigma, die Person und ihre Biographie wird in diesem Sinne umdefiniert. Die Interaktionen sind durch Spannungen, Unsicherheit und Angst erschwert. Auf der Ebene der Identität drohen daher erhebliche Gefährdungen und Probleme." (Cloerkes 2007, 171)
Integration und gesellschaftliche Teilhabe spielen eine entscheidende Rolle zur Unterbindung von Stigmatisierungsprozessen, denn dadurch eröffnen sich Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, die Vorurteile abzubauen helfen und im Gegenzug die Entfaltung eines positiven Selbstbildes fördern. "Die Identitätsentwicklung behinderter Menschen verläuft bei Integration insgesamt günstiger. Integration löst die alten Bilder von Menschen mit Behinderung zugunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern auf. Das Fremdbild bleibt nicht länger hypothetisches Konstrukt, sondern wird im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration nachvollziehbar und überprüfbar. Das Bild von Behinderten wird insgesamt realitätsgerechter. Es muss zwischen den Polen Nähe und Distanz ausbalanciert und gegebenenfalls täglich immer wieder neu hergestellt werden. Integration nimmt alle Interaktionspartner in die Pflicht, über sich selbst, über den anderen und über die die beiden umgebende dingliche Welt zu reflektieren. Integration bietet keine Garantie für durchgängige vorurteilsfreie Meinungen und das völlige Ausbleiben von Stigmatisierungen, aber sie trägt ganz entschieden dazu bei, sich ungünstigen Einflüssen zu widersetzen und die eigene psychische Integrität zu bewahren. Langfristig ist zu erwarten, dass von Integration mehr Toleranz für Menschen, eine größere Angstfreiheit aller und eine geringere Neigung zu identitätsstabilisierenden Stigmatisierungsstrategien ausgehen wird." (Cloerkes 2007, 201)
B) Arbeit und Behinderung
Menschen mit Behinderung sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Arbeitslosenstatistiken zeigen jedoch nicht das volle Ausmaß des Ausschlusses aus der Arbeitswelt. Viele Betroffene scheinen in den Statistiken nicht auf, da sie geschützte Werkstätten besuchen, Arbeitsrehabilitations- und ähnliche Qualifizierungsmaßnahmen absolvieren oder zuhause leben bzw. in Heimen untergebracht sind. Insofern gibt es keine absoluten Zahlen zur Erwerbslosigkeit von Menschen mit Behinderung. "Menschen mit Behinderung sind fast vollständig vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt und werden so im Arbeitsleben zu ‚unsichtbaren Bürgern' [...] Sie tauchen einfach im normalen Arbeitsleben nicht auf." (Doose 2006, 67)
Durch die Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt sind viele Betroffene auf Sozialhilfe angewiesen, sie sind nicht in der Lage ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. "Menschen mit Behinderung beziehen ihr Einkommen aus deutlich unterschiedlichen Quellen [...] Jüngere Nichtbehinderte (24 - 45 Jahre) finanzieren (mit 75 Prozent) in deutlich stärkerem Maße ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit als es gleichaltrige Behinderte tun (52 Prozent). Für jeden fünften behinderten Menschen hingegen stellen Pensionen und Renten bereits in dieser Altersgruppe eine wichtige Einkommensquelle dar, bei Nichtbehinderten ist dies nicht mal bei einem Prozent der Fall. Bei den Älteren (45 bis 65 Jahren) ist dies noch deutlicher ausgeprägt: nur knapp jeder dritte Behinderte finanziert seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit, im Gegensatz zu mehr als der Hälfte der Nichtbehinderten (56 Prozent)." (Rauch 2005, 28)
Als Sozialhilfeempfänger verfügen sie schlussendlich über geringe finanzielle Ressourcen und damit - im Sinne Bourdieus - über weniger Möglichkeiten soziales und kulturelles Kapital zu akkumulieren und dieses in symbolisches Kapital zu transferieren. Armut, Behinderung und mangelnde gesellschaftliche Anerkennung bedingen sich wechselseitig.
Armut ist jedoch nicht nur die Folge von Behinderung, sondern auch eine nicht zu vergessende Ursache von Behinderung. Studien, die diesen Kausalzusammenhang analysierten zeigen, dass "das Risiko behindert zu werden, [...] mit sinkender Sozialschichtzugehörigkeit oder ‚Armut' [steigt], und zwar prinzipiell für alle Behinderungsarten [...]." (Cloerkes 2007, 90) Deutlich zeigt sich dies bei lernbehinderten Schülern. Cloerkes verweist auf drei markante Merkmale: A) 90% der Sonderschüler - die Studien beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland - stammen aus den unteren Sozialschichten. Wobei auch Eltern von Sonderschülern niedere Schul- und Ausbildungsqualifikationen und eine höhere Arbeitslosenrate aufweisen. B) Die Familien von Sonderschülern weisen eine höhere Kinderzahl zum statistischen Durchschnitt auf, sie leben in schlechten Wohngegenden und auf engem Raum zusammen. C) Die familiäre Sozialisation zeichnet sich durch Normrigidität, mangelnder Zukunftsorientierung, restringierte Sprachformen usw. aus, damit steht sie in Opposition zu schulischen Erziehungszielen. (Vgl. Cloerkes, 2007, 95f.)
Solche sozialen Aspekte beeinflussen im hohen Maße auch biosoziale Faktoren. Kinder aus Unterschichten sind z.B. gefährdet, körperlich benachteiligt zu werden, "was sich dann als Störung der Sinnesfunktion, als Sprachbeeinträchtigung oder als leichte hirnorganische Defekte (ohne absolute Kausalität für die Lernschwäche) manifestiert." (Cloerkes 2007, 95) Wie erwähnt gelten diese Zusammenhänge für alle Behinderungsarten. Angehörigen aus Unterschichten fehlt zum Teil das notwendige Wissen zur Früherkennung und Vorsorge "während der Schwangerschaft, im Umfeld der Geburt und im Säuglingsalter [...] die Risiken aufgrund nicht optimaler ärztlicher Versorgung steigen. Vieles spricht dafür, dass die Qualität des ärztlichen Handelns schichtspezifische Unterschiede aufweist." (Cloerkes 2007, 96) Außerdem stoßen Angehörige aus sozialen Unterschichten auf offenkundige Zugangsbarrieren bei Ämtern, Behörden und Gesundheitsdiensten. "Typisch sind sprachliche Barrieren und eine allgemeine Unfähigkeit, gesellschaftliche Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Unser liberales System benachteiligt offensichtlich Bevölkerungsteile, die es nicht gelernt haben, sich kompetent durchzusetzen." (Cloerkes 2007, 96)
Mit sinkender Sozialschichtzugehörigkeit steigt das Risiko behindert zu werden und aufgrund von Behinderung "beginnt eine Veränderung der individuellen Position innerhalb der Sozialstruktur, die [...] als Absinken bzw. Abwärtsmobilität gekennzeichnet werden kann." (Jantzen 1974, 103) Behinderung, Armut und gesellschaftliche Diskreditierung sind ein und derselbe Mechanismus. Das ökonomische Kapital spielt, wie Bourdieu in seiner Kapitaltheorie zeigte, eine entscheidende Rolle, denn: "Behindert wird vor allem der, der arm ist, und wer behindert ist, wird arm." (Cloerkes 2007, 99)
Damit stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. Grundlegend zielen die Lösungsvorschläge daraufhin ab die Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung zu forcieren. Die prekäre Lage der Betroffenen wird vor allem vor dem Hintergrund der beruflichen Integration ins Erwerbsleben diskutiert. Für Menschen mit Behinderung scheinen jedoch die Hürden für die berufliche Integration fast unüberwindbar zu sein. Und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt geben kaum Anlass zur Zuversicht. Die Zeiten wirtschaftlicher Prosperität und der Vollbeschäftigung sind vorbei. Den Anforderungen des Arbeitsmarktes sind nicht nur behinderte Menschen nicht mehr gewachsen, sondern auch für Nichtbehinderte werden die Zugangsmöglichkeiten enger und sind härter umkämpft. Unser liberales Wirtschafts- und Arbeitssystem ist in eine Phase eingetreten, in der immer weniger Menschen benötigt werden, um den Bedarf an Produkten und Dienstleistungen zu decken. Dennoch, oder gerade auch deshalb, werden von den Unternehmen und Konzernen noch nie da gewesene Gewinne und Kapitalerträge eingefahren. Massenarbeitslosigkeit gehört zur zukünftigen Voraussetzung einer liberalen Gesellschaftsordnung, innerhalb der einige wenige in ungeahntem Wohlstand leben, während der Rest der Bevölkerung prekären Lebenssituationen ausgesetzt ist. "Aktuell gilt daher wohl der Satz, dass die Gewinne von heute die Massenentlassungen von morgen und die noch höheren Gewinne von Übermorgen sind." (Koehnen 2007, 33)
Wohin sich unsere Arbeitsgesellschaft bewegt und welche Entwicklungen vor dem beschriebenen Hintergrund doch Anlass zur Hoffnung geben, soll im nächsten Kapitel ausgeführt werden.
Die Arbeitsgesellschaft befindet sich in einem Umwälzprozess. Herkömmliche Basisprämissen wie kollektive Lebensmuster, Vollbeschäftigung, Sicherheit, National- und Sozialstaat verlieren ihre Legitimität. Ulrich Beck beschreibt diesen Umbruch als Transformationsprozess von der Ersten hin zur Zweiten Moderne im Sinne einer reflexiven Modernisierung. "'Reflexive Modernisierung' meint den Übergang von der Ersten, nationalstaatlich geschlossenen, zu einer Zweiten, offenen, riskanten Moderne generalisierter Unsicherheit, und zwar in der Kontinuität ‚kapitalistischer' Modernisierung, die ihre national- und sozialstaatlichen Fesseln abstreift." (U. Beck 2007, 47)
Der Neoliberalismus löst das Modell einer sozial geprägten Marktwirtschaft ab, das auf "'naturwüchsig' unterstellten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen" (U. Beck 2007, 49) aufbaute. Dadurch geraten eben diese Rahmenbedingungen und Werte wie die nationalstaatlich organisierte Volkswirtschaft, die Vollbeschäftigung, die ökonomische Hegemonie des Mannes über die Frau usw. ins Schwanken. "Begriffe wie ‚Ambivalenz', ‚Unschärfe', ‚Widerspruch', aber auch ‚Ratlosigkeit' gewinnen an Bedeutung, und diese Bedeutung scheint mit den Umwälzungen zu wachsen und nicht abgebaut zu werden." (U. Beck 2007, 49)
Durch Unsicherheit und Ambivalenz und vor dem Hintergrund wachsender Arbeitslosigkeit gewinnt die Erwerbsarbeit, die zunehmend knapper wird, für das einzelne Individuum einen noch zentraleren Stellenwert. "Je knapper Arbeit wird, umso bedeutsamer wird die individuelle Partizipation an der Arbeitsgesellschaft für die persönliche Statusdefinition und das Gefühl, nicht zu dem exkludierten Drittel der Arbeitsmarktverlierer zu gehören." (Bieker 2005, 14)
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 21. Jahrhundert erleben durch die Erschließung neuer ausländischer Märkte, durch neue Formen globalen Wirtschaftens und globaler Arbeitsteilung sowie durch den Einsatz neuer Technologien und durch die Zunahme von nicht benötigten Arbeitskräften eine noch nie da gewesene Entgrenzung, die das herkömmliche und klassische Bild der Arbeitsgesellschaft grundlegend verändert. "Das Wirtschaftswachstum unter den heutigen Weltmarktbedingungen macht die Vorstellung klassischer Vollbeschäftigung, also Arbeitsplätze auf Lebenszeit mit Karrieren und allem, was dazu gehört, obsolet. Dies geschieht ganz offensichtlich in der Industrieproduktion, aber - was meist verheimlicht wird - gerade auch dort, wo viele Hoffnungsschwangere die neuen, attraktiven Arbeitsplätze für alle entstehen sehen: im Dienstleistungssektor der Wissensgesellschaft. Gerade im Brennpunkt des technologischen Fortschritts wird automatisiert, umgebaut, zerlegt, ins Ausland verlagert, laufen immer neue Rationalisierungswellen mit unabsehbarem Ausgang an. Alle Beschwörungen der guten alten Vollbeschäftigung und ihre Tugenden werden daran nichts ändern, ganz egal, was Politiker versprechen." (U. Beck 2007, 125)
Wir leben in einer Zeit, in der Vollbeschäftigung im Widerspruch zum gesellschaftlich produzierten Reichtum steht und die Zahl derer, die für diese Akkumulation erforderlich ist, wird in Zukunft um ein vielfaches geringer gehalten werden können. "Arbeitslosigkeit macht offenbar, wie viel Reichtum wir ganz ohne Arbeit schaffen können. Nie war individuelle Leistung entbehrlicher als heute. Längst beruht Produktivität darauf, dass Menschen im Weltmaßstab kooperieren und Maschinen einsetzen." (Exner, Rätz und Zenker 2007, 21)
Jedoch auch unter jenen, die einer Arbeit nachgehen, wird nur ein geringer Teil einen sicheren und guten Job haben. Sie, diese Privilegierten, bilden dabei die Spitze eines Systems und je weiter man sich von dieser entfernt, desto prekärer werden die Arbeitsverhältnisse und die Einkommens- und Lebenssituationen. "Prekarität bezeichnet genau den Zustand lohnarbeitender Menschen, ihre Arbeitskraft frei oder freigesetzt immer wieder auf dem Markt zum Verkauf anzubieten und darauf zu hoffen und zu warten, dass jemand diese Arbeit braucht, wertschätzt und dem Wert beziehungsweise der Wertschöpfung entsprechend bezahlt." (Wichtericht 2007, 97) Das Endmontagewerk von Toyota bietet ein gutes Beispiel wie Prekarisierungsstrategien funktionieren und wie sie zum Kalkül und zur Profitmaximierung global agierender Konzerne beitragen.
Bei Toyota sind beispielsweise nur ca. 10% - 15% der beschäftigten Arbeiter an der Fertigstellung des Endprodukts beteiligt. Das Endmontagewerk bildet die "Spitze einer Pyramide [...], die auf einer Basis von insgesamt 45.000 Zulieferbetrieben ruht. Je weiter sich diese von der Spitze entfernen, umso stärker arbeiten sie nach dem tayloristischen[1] Prinzip: 171 Zulieferer "ersten Ranges" stellen vollständige Teilstücke bereit, die in Zusammenarbeit mit der Mutterfirma entwickelt wurden; 5.000 Zulieferer zweiten Ranges versorgen die Zulieferer ersten Ranges mit Komponenten; und 40.000 Zulieferer dritten Ranges liefern die Teile für letztere. Je weiter man sich von der Spitze entfernt, desto geringer werden das technische Niveau der Unternehmer, die Ausbildung des Personals und die Löhne. Bei den computergesteuerten und roboterisierten Zulieferbetrieben ersten Ranges, die zwischen 100 und 500 Personen beschäftigen, liegen die Löhne 20% unter den der Mutterfirma. Bei den Zulieferern mit weniger als 100 Arbeitnehmern liegen sie 45% niedriger und für prekäre, unregelmäßige und in Stücklohnbezahlte Arbeit häufig noch tiefer." (Gorz 2000, 69)
Das Outsourcing von Produktions- und Anfertigungsbereichen ermöglicht dem Mutterkonzern hohe Kosteneinsparungen und führt gleichzeitig, aufseiten der Zulieferbetriebe, zu einem enormen Konkurrenzdruck und zu einer hohen Abhängigkeit, da ihr wirtschaftliches Überleben vielfach von dem einen Auftrag abhängig ist. Die Mutterfirma kann die Preise diktieren und zugleich Konjunkturrisiken auf die Zulieferer abwälzen. Die Zulieferer können diesen Druck zumeist nur durch die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse abfedern und letztendlich lasten Konkurrenzdruck und Konjunkturschwankungen auf den Schultern der einzelnen Mitarbeiter. Flexibilisierung bedeutet vor allem eines, die Auflösung klassischer Arbeitsverhältnisse. Durch die Liberalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes fungieren die einzelnen Arbeitnehmer quasi nur noch als selbständige Dienstleister. Ihre Dienste können vom Unternehmer jederzeit eingefordert oder aufgekündigt werden, wenn ihre Kompetenzen und ihre Arbeitskraft nicht mehr gefragt sind. Das Unternehmen selbst gewinnt dadurch zunehmend an Autonomie, es steht ihm frei, "aus einem unerschöpflichen Reservoir von individuellen Dienstleistern aller Art diejenigen herauszufischen, die die besten Dienstleistungen zum niedrigsten Preis anbieten." (Gorz 2000, 74) Gesetzlich und gewerkschaftlich geregelte Arbeitsverhältnisse verwässern. Der Arbeitnehmer ist angehalten, seine Arbeitskraft am Markt anzubieten und selbst wie ein Unternehmen zu agieren. Der Arbeitnehmer wandelt sich zum "Arbeitskraftunternehmer" (Bröckling 2007, 47) und die Maximen unternehmerischen Handelns bestimmen das Verhältnis der Individuen zu sich selbst und zu den anderen hin. Der Arbeitskraftunternehmer signalisiert, "eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft [...], die den bisher vorherrschenden ‚verberuflichten Massenarbeitnehmer des Fordismus' wenn nicht ablöst, so ihm doch zur Seite tritt und ‚als Leittyp für die künftige Arbeitswelt' die ‚fortgeschrittenste Form subjektiver Produktivkraft' verkörpert." (Bröckling 2007, 47) Die Losungen für diesen neuen Typus subjektiver Produktivkraft lauten: "[...] erstens eine erweiterte Selbstorganisation und -kontrolle der Arbeitstätigkeit durch die Arbeitenden, zweitens einen Zwang zur verstärkten Ökonomisierung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und -leistungen und drittens eine zunehmende Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung [...] Für die Arbeitskraftunternehmer verschwimmen die Grenzen zwischen Erwerbstätigkeit und Freizeit, Berufs- und Privatleben, und der Ökonomisierungsdruck erfasst alle Bereiche des Alltags." (Bröckling 2007, 48)
Der Arbeitskraftunternehmer fungiert rundum als unternehmerisches Selbst und stößt dabei permanent auf Grenzen und auf Überforderungen: "Das unternehmerische Selbst ist ein ‚erschöpftes Selbst'. Weil die Anforderungen unabschließbar sind, bleibt der Einzelne stets hinter ihnen zurück, weil der kategorische Komparativ des Marktes einen permanenten Ausscheidungswettkampf in Gang setzt, läuft er fortwährend Gefahr, ausgesondert zu werden. Anerkennung ist gebunden an Erfolg, und jedes Scheitern weckt die Angst vor dem sozialen Tod." (Bröckling 2007, 289) Der entgrenzte Arbeiter muss sich "beständig an eine Welt anpassen, die eben ihre Beständigkeit verliert, an eine instabile, provisorische Welt mit hin und her verlaufenden Strömungen und Bahnen. Die Klarheit des sozialen und politischen Spiels hat sich verloren. Diese institutionellen Transformationen vermitteln den Eindruck, dass jeder, auch der Einfachste und Zerbrechlichste, die Aufgabe, alles zu wählen und alles zu entscheiden, auf sich nehmen muss." (Ehrenberg 2004, 222) Die neoliberale Ideologie der neuen Arbeitswelt beruht auf dem Prinzip der Flexibilisierung. Flexibilisierung als neue, aber erzwungene Selbständigkeit des Arbeiters, ist die Antwort auf alle ökonomische, sozialstaatliche und gesellschaftliche Krisen. Der für die Menschen damit eingeleitete Ausnahmezustand, wird zugleich zu ihrem Normalzustand im Zeitalter globalisierter Märkte. Der Kapitalismus kehrt zu sich selbst zurück. Nach Gorz führen diese Entwicklungen zu vormodernen sozialökonomischen Bedingungen: "‚Fürchtet euch und zittert!' Die ideologische Botschaft hat sich geändert. Aus der Losung: ‚Egal welche Arbeit, Hauptsache eine Lohntüte' wurde: ‚Egal wie viel Lohn, Hauptsache eine Arbeit.' Anders gesagt: Seid zu allen Zugeständnissen und Demütigungen, zu jeder Art von Unterwürfigkeit und Niederträchtigkeit im Konkurrenzkampf bereit, wenn ihr einen Arbeitsplatz wollt oder er auf dem Spiel steht; denn, ‚wer seinen Arbeitsplatz verliert, verliert alles' so lautet, wenn schon nicht die allgemeine Gefühlslage, so doch zumindest die Botschaft des herrschenden Diskurses." (Gorz 2000, 80)
Für Ulrich Beck sind die Formen der Prekarisierung und Flexibilisierung Folgen einer "politischen Ökonomie der Unsicherheit, Ungewissheit und Entgrenzung." (Beck 2007, 106) die er unter dem Begriff ‚Risikoregime' subsumiert. Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung sind wesentliche Dimensionen, an denen entlang sich das Risikoregime ausbreitet. Globalisierung setzt z.B. eine "noch gar nicht absehbare soziale Enträumlichung von Arbeit und Produktion in Gang." (Beck 2007, 106) Internationale Konzerne agieren in Sekundenschnelle über den ganzen Globus hinweg, bedrohen nationale und lokale Arbeitsmärkte und setzen sich dabei über staatliche Regelungen, Gesetze, gewerkschaftliche Rechte und Bürokratien hinweg.
Digitalisierung ermöglicht Globalisierung durch weltumspannende Kommunikation in Echtzeit. Die neuen Technologien verändern das Bild des typischen Arbeiters, der sich als High-Tech-Arbeits-Nomade über alle physischen Grenzen hinweg setzt. Er ist vernetzt und trotzdem isoliert. Von zuhause aus ist er zu jeder Tageszeit- und Nachtzeit abrufbereit. Beck sieht die neuen Kommunikationstechnologien, die die Arbeitswelt zukünftig in einem noch viel höheren Maße prägen werden, als eine neue Art der Alphabetisierung mit all ihren Gefahren des Ausschlusses. "Wer die Computersprache nicht beherrscht, sieht sich aus dem Kreis gesellschaftlicher Kommunikation ausgeschlossen." (Beck 2007, 107)
Globalisierung und Digitalisierung führen zur Atomisierung des arbeitenden Menschen. Dieser ist auf sich allein gestellt und muss die Kompetenzen und Fähigkeiten haben sich auf individualisierte Arbeitsverhältnisse einzustellen. Phasen von Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit werden sich zukünftig in verstärktem Maße abwechseln. Das Risikoregime provoziert Diskontinuität und fragmentierte Erwerbsbiographien. Ohne kontinuierliche Erwerbsarbeit droht vor allem die Erosion der Mittelklasse. Gerade diese ist auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen, um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten.
Eine weitere Folge des Risikoregimes und der Diskontinuität im Arbeitsverhältnis ist der Zerfall sozialer Bindungen und Engagements. Viele Menschen sind heute schon gezwungen mehrere Jobs anzunehmen, oder den ‚einen' Job über ein unerträgliches Zeitmaß hinaus auszudehnen. "Die Folge ist, dass Millionen praktisch nicht mehr zu Hause, sondern an ihrem Arbeitsplatz wohnen und dementsprechend die Zeit und die Energie fehlen, die früher für freiwilliges Engagement verfügbar waren." (Beck 2007, 154)
Die momentane Situation ist durch tiefgreifende soziale, ökologische, ökonomische und technische Umstrukturierungsprozesse gekennzeichnet. Die verschiedenen Lebenswelten der Menschen, vor allem die Arbeitswelt ist kaum mehr eindeutig und kontingenzfrei. "Die Gesellschaft der radikalisierten Moderne setzt, wo sie sich aus den traditionellen Ständegesellschaften heraus entwickelt und Hierarchien durch differenzierte Funktionssysteme wie Wirtschaft, Recht, Politik, Wissenschaft und Kunst ersetzt hat, auf Desintegration." (Dungs 2006, 23) Die neoliberalen Werte und Ideale verschärfen die Desintegration der Individuen und forcieren Strategien der Responsibilisierung. Der Staat zieht sich aus seiner sozialen Verantwortung zurück, denn da "es immer komplizierter wird, gesellschaftliche Prozesse (sozial, ökologisch, ökonomisch, technisch) in geordneten Bahnen zu halten, wird die Verantwortung dafür zunehmend auf die handelnden Individuen verlagert (Responsibilisierung). Auch die Risikoquellen (z.B. das Risiko für Arbeitslosigkeit, eine genetische Erkrankung, Armut) wird im Falle einer Fehlentscheidung oder eines Schadeneintritts bei den Einzelnen lokalisiert." (Dungs 2006, 23)
Dem Individuum wird die alleinige Verantwortung seiner Lebensführung übertragen. Zurückgeworfen auf sich selbst, haben die Individuen die Freiheit ihr Leben zu wählen, etwas zu machen, wofür nur sie selbst verantwortlich sind. Die "Zuspitzung auf die Zuweisung von Verantwortung zieht neue Grenzen des Sozialen und schafft neue Markierungen der Ordnung sowie neue Möglichkeiten, aus ihr herauszufallen [...] Das Überschreiten des Randes kann jetzt gleichbedeutend sein mit endgültiger, sozialer Ausgliederung [...], weil unter dem Diktat der Eigenverantwortung nur interessiert, wer mithält. Wer herausfällt, hat damit bewiesen, dass ihm oder ihr der nötige Wille fehlt." (Krasmann 2000, 201)
Prekarisierung, Responsibilisierung, Entsolidarisierung, Exklusion, Individualisierung sind wesentliche Merkmale neoliberaler Gesellschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme. Vielen neoliberalen Kritikern stellt sich die Frage, wie dem Einhalt geboten werden kann. "Die Gesellschaft muss so eingerichtet werden, dass flexible, diskontinuierliche und sich wandelnde Arbeitsverhältnisse nicht länger zum Verfall von Gesellschaft führen, sondern zu neuen Formen von Gesellschaftlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt." (Gorz 2000, 108)
Für Gorz leitet eine Gesellschaft der Solidarität und des Zusammenhalts das Recht auf ein ausreichendes und sicheres Einkommen nicht mehr allein von einer festen, bezahlten und kontinuierlichen Arbeit ab. Allen Menschen muss demnach ein ausreichendes Einkommen garantiert werden, das von dem Prinzip der Erwerbsarbeit entkoppelt ist. "Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens würde, das ist das Erste und das Wichtigste, die Arbeit vom Zwang befreien, der heute auf ihr liegt. Das gälte für die Menschen, die Lohnarbeit leisten, wie auch für jene, die keine Erwerbsarbeit (mehr) finden und daher auf Unterstützung aus allgemeinen Quellen angewiesen sind." (Ehlers 2007, 148)
Weiters soll ein jeder die freie Entscheidung über den Nutzwert seiner Zeit und ihren Tauschwert haben. D.h. jedem soll die Entscheidung überlassen werden, ob er im herkömmlichen Sinne arbeiten will, oder ob er lieber anderen Aktivitäten nachgeht. Zurzeit besitzen die Unternehmen und die Betriebe die souveräne Verfügungsgewalt über einen wesentlichen Teil der Lebenszeit und damit über die Lebensverhältnisse ihrer Mitarbeiter. D.h. Mitarbeiter, auf "die die Firma angewiesen ist, [haben] eine der Konjunktur und den Jahreszeiten entsprechende flexible Arbeitszeit. Die anderen mit befristeten, prekären Beschäftigungsverhältnisse, die Fernarbeit-, Teil- und Aushilfskräfte, arbeiten in Intervallen, unregelmäßig oder überhaupt nicht. Das jährliche Gesamtarbeitsvolumen würde zwar, obwohl abnehmend, auf eine wachsende Zahl von Erwerbstätigen verteilt [...], aber so, dass sich niemand mehr sicher sein kann: Die Erwerbstätigen fürchten um ihre Stelle, und für ungefähr die Hälfte von ihnen (und bald für die Mehrheit) machen die Begriffe normale Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung keinen Sinn mehr." (Gorz 2000, 135)
Aufgezwungene flexible Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnisse führen gezwungenermaßen zu Einkommensverlusten und zu prekären sozioökonomischen Situationen. Diskontinuität und Flexibilisierung einerseits und Prekarisierung andererseits müssen jedoch keinen immanenten Zusammenhang widerspiegeln, wenn die Phasen der Nicht-Arbeit durch ein Grundeinkommen wettgemacht werden. Diskontinuität im Arbeitsverhältnis kann nach Gorz für alle Betroffenen positive Folgen haben. Denn wenn sie finanziell durch das Grundeinkommen abgesichert ist, kann sie zur Wiederaneignung von persönlicher Lebenszeit und ökonomischer Sicherheit führen. "Es ist also möglich, die Diskontinuität der Arbeit, die Flexibilisierung ihrer Dauer und des Personalstands als eine Quelle von Sicherheit - und eben nicht von Unsicherheit - und als Form des Anspruchs auf ‚Zeitsouveränität' zu begreifen. Sie erlaubt [...] in Bewegung zu bleiben, neue Lebensformen und neue Aktivitäten auszuprobieren." (Gorz 2000, 139)
Damit ist ein weiterer Aspekt angesprochen. Theoretiker des bedingungslosen Grundeinkommens gehen davon aus, dass die Wiederaneignung der Zeit zugleich den Aktivitätsgrad einer Gesellschaft förmlich potenzieren würde. Individuelle und kollektive Interessen und Aktivitäten können sich dadurch ungehindert entfalten, da sie nicht mehr dem Rentabilitätsanspruch und dem ökonomischen Wertgesetz unterliegen. Neue, kreative, künstlerische, politische und soziale Lebensweisen könnten sich ungehindert entfalten; gesellschaftliche und zwischenmenschliche Beziehungen erhalten neue Ausdrucksformen und Qualitäten. Für Gorz besitzt jeder Mensch das Bedürfnis zu werken, zu wirken und zu handeln, um vom anderen anerkannt zu werden. Dieses Bestreben bezeichnet er als Bedürfnis nach Multiaktivität. Das Grundeinkommen entkoppelt dieses Bedürfnis vom allgemeinen Wertgesetz der Erwerbsarbeit und setzt es frei. "Im Lebensalltag können sich dann vielfache Aktivitäten gegenseitig ablösen und abwechseln, ohne dass deren Entlohnung und Rentabilität noch notwendige Bedingungen oder gar ihr Ziel wären. Die sozialen Beziehungen, die Kooperationszusammenhänge, ja der Lebenssinn eines und einer jeden werden nur mehr durch diese nicht vom Kapital verwerteten und aufgewerteten Aktivitäten hervorgebracht. Die Arbeitszeit hört schließlich auf, die gesellschaftlich vorrangige Zeit zu sein." (Gorz 2000, 103)
Das Grundeinkommen, als Gegenmodell zur Arbeitsgesellschaft, ermöglicht die Freisetzung kreativer und neuer Lebensweisen und darauf aufbauend neue Formen der Solidargemeinschaften. Das Grundeinkommen ist ein Einkommen, das prinzipiell an alle Mitgliedern der Gemeinschaft ausgezahlt wird und ist nicht an die Bedürftigkeit der Person gekoppelt, wie Sozialrenten oder Arbeitslosengeld. Es ist daher keine neue Form der Grundsicherung, weil es nicht am Ende der Einkommensverteilungsprozesse ansetzt, sondern an deren Anfang steht, indem es vor der Erwerbstätigkeit angesiedelt ist und alle weiteren Einkommen darauf aufbauen. Sozialhilfe knüpft derzeit an ein System der Bedürftigkeitsprüfung an und wird gewährt, wenn die betroffene Person keine andere Möglichkeit hat, ihr Einkommen selbst zu bestreiten. Sie wird dann auf den Status eines Sozialhilfeempfängers reduziert und unter den wachen Blick des Sozialsystems und unter die moralische Kontrolle der Gesellschaft gestellt. Die Betroffen befinden sich permanent unter Legitimationsdruck, ihre Lebensweise entsprechend ihrer Bedürftigkeit anzupassen. Vom Sozialhilfeempfänger wird ein idealtypisches Verhalten eingefordert, das dem eines würdigen Bedürftigen entsprechen soll. Entspricht er diesem nicht, gerät er schnell in Verdacht, auf Kosten der Gesellschaft zu leben, Missbrauch zu betreiben und kriminell zu handeln. Sozialhilfe empfangen bedeutet demnach, sich einem straffen moralischen Kodex zu beugen, sich gesellschaftlichen Werten unterzuordnen, sich einem Kontrollsystem zu unterwerfen und Tugenden zu folgen, die für den Normalbürger bei weitem nicht in dieser rigiden Form gelten. Das Grundeinkommen, das am Beginn und nicht am Ende des Erwerbsprozesses angesiedelt ist, unterbindet von vorn herein derartige Formen sozialer Disziplinierung und Diskriminierung. Ein Grundeinkommen erhöht die Selbstbestimmung des Einzelnen und baut Abhängigkeiten ab. Es erhöht damit auch die individuellen Handlungs- und Freiheitsspielräume, da die Individuen selbst entscheiden können, welcher Art von Tätigkeit sie nachgehen wollen.
Das Grundeinkommen basiert vor allem auch auf der Idee der sozialen Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Teilhabe. Derzeit ist ohne ein Einkommen die Teilhabe an der marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaft unmöglich und fast ausschließlich über die Beteiligung am Erwerbsleben realisierbar. Durch das Grundeinkommen erweitern sich die Angebote und Möglichkeiten zur Teilhabe, und ihre Wege müssen nicht mehr ausschließlich über die Erwerbsarbeit führen.
Eine Gesellschaft, die durch ein Grundeinkommen derart gestaltete Rahmenbedingungen gewährleistet, könnte behinderten Menschen viele Chancen eröffnen. Zum einen würden sie den Status von Sozialhilfeempfängern verlieren und als sozial gleichberechtigte Bürger Anerkennung erfahren. Zum anderen gilt heute immer noch die Integration in die Arbeitswelt als Königsweg, um soziale Teilhabe zu realisieren. Die oben beschriebenen Tendenzen zur Diskontinuität und Flexibilisierung der Erwerbsarbeit werden diesen Weg um ein beträchtliches Maß erschweren, und herkömmliche Prinzipien der Arbeitsrehabilitation wie Arbeitswille, Arbeitsverhalten und Arbeitsfähigkeit, werden keine Garantie für die berufliche Integration mehr bilden. "Wahrscheinlich ist, dass die Erwerbsbeteiligung auf absehbare Zeit Leitwährung der Sozialintegration bleiben wird. Jedoch darf nicht übersehen werden, dass die Sozialintegration von Menschen mit oder ohne Behinderung auch weiterhin nicht allein über herkömmliche Formen der Erwerbsintegration gewährleistet werden kann. Sie muss sich auch in der Zeit vollziehen, in der Menschen nicht ökonomisch wertschöpfend aktiv sind." (Bieker 2005, 22) Durch die Sicherung eines Grundeinkommens soll es Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. "Um die öffentliche und politische Akzeptanz eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erhöhen, gilt es also, verstärkt an der Veränderung des vorherrschenden Lohnarbeitsethos zu arbeiten, hin zu einem umfassenderen Tätigkeitsethos, das die vielfältigen Wertdimensionen menschlichen Lebens und Zusammenlebens betont. Erst ein solches Ethos würde die sozialen und finanziellen Werte nicht derart stark aneinander binden wie heute üblich. Und es würde die vielfältigen nicht oder unzureichend monetär und öffentlich anerkannten Tätigkeiten und Werte sowie experimentelle Lebens- und Arbeitsformen, die ein demokratisches Zusammenleben und die Lebensfreude der Einzelnen befördern, entsprechend aufwerten und öffentlich anerkennen." (Maiss 2007, 147)
Die Debatte ums Grundeinkommen ist zugleich vom Bemühen getragen, den Arbeitsbegriff aus seinem engen Verständnis von Erwerbsarbeit herauszulösen bzw. vom Wertgesetz zu entkoppeln. Diese Sichtweise würde das Verhältnis von Arbeit, Individuum und Gesellschaft grundlegend verändern. Der Begriff Arbeit würde seine herkömmliche Bedeutung verlieren und sich aus dem Kontext der veränderten gesellschaftlichen Praxis neu definieren.
Jeder Begriff nährt sich aus einem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontext, der die Bedeutung und den Gebrauch reguliert. Ferdinand de Saussure hat als Wegbereiter der modernen Linguistik und Semiotik auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. "Mit de Saussure wird Sprache nicht mehr als Abbildung einer bereits bestehenden Wirklichkeit gedacht, sondern die Arbitrarität von Zeichen hervorgehoben. Zeichen bestehen aus einem Signifikat (dem Bedeuteten) und einem Signifikant (dem Bedeutenden). Letzteres ist z.B. das gesprochene oder geschriebene Wort ‚Frau', das auf das Konzept ‚Frau' verweist. De Saussure stellt nun die These auf, dass kein notwendiger Zusammenhang zwischen Signifikat und Signifikant besteht, vielmehr handelt es sich stets um eine arbiträre (beliebige) Beziehung. [...] Arbitrarität heißt nun aber keineswegs, dass jedes Mittel einer Sprachgemeinschaft einen Signifikanten beliebig interpretieren kann: Wenn nicht mehr feststeht, mit welcher Bedeutung das rote Ampellicht verbunden ist, dann ist ein entsprechendes Verkehrschaos leicht vorstellbar. Arbitrarität besagt hier nur, dass mit der roten Farbe des Ampellichts das Konzept ‚Anhalten' vorgegeben ist. Damit es diese spezifische Bedeutung erhält, bedarf es gesellschaftlicher Konventionen. Zeichensysteme, seien sie sprachlicher oder nichtsprachlicher Art, sind deshalb stets soziale Gebilde, die den Zeichengebrauch regulieren." (Stäheli 2000, 17)
Jeder Begriff, der durch Konventionen festgelegt wird, wirkt gleichzeitig repressiv, indem er sich von all jenen Aspekten abgrenzt, die zu seinen inhaltlichen Prämissen konträr verlaufen. Begriffe und die damit zusammenhängenden Identifikationen und Kategorisierungen bilden sich durch Dichotomisierungen. "So ist beispielsweise die Kategorie Mann nur denkbar, wenn sie sich von etwas anderem abgrenzt, wie zum Beispiel von der Kategorie Frau. Die zweite Kategorie wird dabei lediglich zu einer als sekundär betrachteten Ergänzung für die erste." (Moebius 2003, 9) Das zweite Glied wird durch das erstere, als entgegengesetzte, degradierte und exkludierte Seite konstituiert; es ist dem ersten Glied zweitrangig nachgereiht und wird von diesem normativ eingeschränkt und objektiviert. Im Laufe des abendländischen Zivilisationsprozesses hat sich die Arbeit als zentrale Kategorie entwickelt und im Sog ihres Siegeszugs wurde das soziale Phänomen Behinderung wesentlich, als degradierte und exkludierte Seite durch den Ausschluss aus der Arbeitswelt, mit konstituiert.
Die moderne Bedeutung, als Erwerbsarbeit, entfaltete der Begriff Arbeit erst ab dem 18. Jahrhundert. Zuvor bedeutete sie "ohne Anstrengung, Mühe-los zu sein". Im Germanischen leitete sich der Begriff "arbeiten" vom Wort "arbejo" ab. Dieses Urwort weißt wiederum Verbindungen zum indo-europäsichen "orbh" und zum lateinischen "orbus" auf. Orbh und orbus bedeuten im eigenlichen Sinne "verweist zu sein" bzw. " einer Sache oder Person beraubt zu sein". Aus dem Begriff "arbejo" "entstand das germanische Ar-ejidiz / arbejidiz (= Mühsal/Not) und daraus wiederum das althochdeutsche arbeit, arabeit, arebeit [...], das in allen germanischen Dialekten Entsprechungen hat; so auch im altenglischen earfo_(e), das aber später durch die Begriffe work und labor ersetzt wurde." (B. Weingart 2007, 2)
Diese althochdeutsche Bedeutung von Arbeit, als Mühsal, Plage und Leid blieb bis in das Neuhochdeutsch hinein aufrecht. Erst durch Martin Luther und im Englischen durch Adam Smith erhielt das Wort seinen modernen Sinn.
Der Wandel des Arbeitsbegriffs und die damit verbundenen Bedeutungszusammenhänge werden in den folgenden Kapiteln vertieft. Im zweiten Teil der vorliegenden Studie wird die Wechselwirkung zwischen Arbeit, Armut und Ausschluss analysiert, um dann aus dieser Perspektive die Genealogie der sozialen Konstituierung von Behinderung herauszuarbeiten.
In der Antike wurde körperliche Arbeit verachtet. Der Status des freien Bürgers war unvereinbar mit der Verrichtung körperlicher Tätigkeiten. "Einfache Arbeit" galt als schimpfliche Knechtschaft: "Für den Griechen diente Arbeit lediglich der Erzeugung und Beschaffung für die Erhaltung des Lebens notwendiger Güter." (Wulf 2000, 38) Sie wurde hauptsächlich von den Sklaven und unfreien Bürgern verrichtet. Wer arbeiten musste, war von der Gesellschaft der freien Bürger prinzipiell ausgeschlossen. Wer die Notdurft des Lebens verrichten musste, war kein vollwertiges Gesellschaftsmitglied. Diese Konzept von Arbeit verläuft konträr zu unserer gegenwärtigen Auffassung.
Das gesamte politische und soziale Leben galt im antiken Griechenland der Erhaltung der Freiheit des Bürgers. "In die Sklaverei zu geraten war ein böseres Schicksal als der Tod, [...] weil sich dadurch eine Verwandlung in der Natur des Betroffenen vollzog, in der aus einem Menschen ein Wesen wurde, das sich nicht mehr entscheidend von einem Haustier unterschied." (Arendt 2001, 101) Der Sklave musste all jene Tätigkeiten ausführen, die für einen unfreien Bürger unwürdig waren. Freiheit und Arbeit konterkarierten sich. Die Freiheit des Bürgers bestand in der Tugend, sich von äußeren Zwängen und passiv erlittener Gewalt loszureißen. Freiheit war die Kunst, sich aller Zwänge zu entledigen, die als Ursache einer sklavischen Seele gelten. Gerade aus diesem Grund benötigten die freien Bürger ihre Sklaven. "Im Altertum war die Einrichtung der Sklaverei nicht wie später ein Mittel, sich billige Arbeit zu verschaffen oder Menschen zwecks Profit ‚auszubeuten', sondern der bewusste Versuch, das Arbeiten von den Bedingungen auszuschließen, unter denen Menschen das Leben gegeben ist. Was dem menschlichen Leben mit anderen Formen tierischen Lebens gemeinsam ist, galt als nicht-menschlich. Dies ist natürlich auch der Grund, warum man annehmen konnte, die Sklaven hätten eine nicht-menschliche Natur." (Arendt 2001, 101)
Die Freiheit der Griechen spielte sich innerhalb der Polis ab. Alle Angelegenheiten wurden dort vermittels der Worte geregelt und nicht durch Zwang und Gewalt. Dies widersprach nämlich dem Gesetz der Freiheit und war gleichsam präpolitisch, so wie die Arbeit, die auf das Leben Unterwürfigkeit und Zwang ausübte. Die Polis war der öffentliche Bereich zur Entfaltung der Freiheit. Von ihr unterscheidet sich der private Bereich des Haushalts. Der private Bereich war die Sphäre der Herrschaft und Beherrschten und damit unpolitisch und der Polis nicht zugänglich. "Die Polis unterschied sich von dem Haushaltsbereich dadurch, dass es in ihr nur Gleiche gab, während die Haushaltsordnung auf Ungleichheit geradezu beruhte. Freisein bedeutete ebenso ein Nichtbefehlen, wie es die Freiheit von dem Zwang der Notwendigkeit und den Befehlen eines Herren beinhaltet. Freisein hieß weder herrschen noch beherrscht werden. Innerhalb des Haushaltsbereichs konnte es also Freiheit überhaupt nicht geben, auch nicht für den Herren des Hauses, der als frei nur darum galt, weil es ihm freistand, sein Haus zu verlassen und sich in den politischen Raum zu begeben, wo er unter seinesgleich war. [...] Gleichheit, die in der Neuzeit immer eine Forderung der Gerechtigkeit war, bildete in der Antike umgekehrt das eigentliche Wesen der Freiheit: Freisein hieß, frei zu sein von der allen Herrschaftsverhältnissen innewohnenden Ungleichheit, sich in einem Raum zu bewegen, in dem es weder Herrscher noch Beherrschte gab." (Arendt 2001, 42)
Wer frei sein wollte, musste sich von allen sklavischen Tugenden lösen. Die Polis war Inbegriff des Wohllebens, sie war der Ort an dem sich das bloße Leben in ein gutes Leben transzendierte. "Das ‚Recht- und Gut-Leben', wie Aristoteles das Leben der Polis nannte, war daher nicht so sehr besser, sorgloser oder edler als das gewöhnliche Leben, als es von anderem Rang und anderer Qualität war. Es war gut nur in dem Maße, in dem es ihm gelungen war, der Lebensnotwendigkeit Herr zu werden, sich von Arbeit und Werk zu befreien und den allen Geschöpfen eingeborenen Lebenstrieb in gewissem Sinne zu überwinden, so dass es der Knechtschaft durch den biologischen Lebensprozess bis zu einem hohen Grad entronnen war." (Arendt 2001, 46)
Voraussetzung für ein freies und autonomes Leben war damit die Nicht-Arbeit, im Gegensatz zu heute, wo die Nicht-Arbeit, als Arbeitslosigkeit, zur Untugend und moralischen Verwerflichkeit degradiert. Die Aufwertung der Arbeit vollzog sich erst durch die Einflussname des Christentums.
Durch die jüdisch-christliche Tradition gewann die Arbeit Schritt für Schritt eine positive Bedeutung. Die christliche Arbeitslehre zeigte jedoch eine sehr ambivalente Einstellung, denn Arbeit galt zugleich als Fluch und Segen, als Strafe und göttlicher Wille. Die Geringschätzung der Arbeit reichte bis weit in das Mittelalter hinein. Die althochdeutsche Übersetzung vermittelt ein Bild der Arbeit als Mühe und Qual. Allerdings bewertete das Christentum die Arbeit neu. Mit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies beginnt für das Christentum die Geschichte der Menschheit, aber zugleich auch die Notwendigkeit zur Arbeit als Tätigkeit und Überlebensfrage. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist eng verknüpft mit der Notwendigkeit zur Arbeit. "Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden, von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück." (Gen 3, 17-20) Auch später, im Neuen Testament, wird die Arbeit zentral thematisiert.
"Die verbreitete griechisch-römische Maxime, dass das Frei-Sein von körperlicher Arbeit die höchste Form des Lebens sei, weil nur dieses Frei-Sein die Möglichkeit zu politischer Tätigkeit und zu einem ethisch vollkommenen Leben eröffne, wird hier in ihr Gegenteil verkehrt." (Oexle 2000, 70) Um diesen Wandel nachvollziehen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass das Christentum anfänglich eine von den Unterschichten getragene revolutionäre Bewegung war, die bewusst, durch die Thematisierung der Arbeit, eine Gegenposition zu den damals vorherrschenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen setzte. Die körperliche Arbeit wurde daher zentral und positiv bewertet, weil sie unmittelbar das Leben der armen Bevölkerung auszeichnete. Seit und durch Augustinus wurde die Arbeit dann Stück für Stück von ihrer Sündhaftigkeit gereinigt. Er vertrat den Standpunkt, dass "Arbeit gerade nicht eine Folge der Sünde sei, sondern dass sie von Anfang an dem Menschen zugewiesen werde, damit durch seine Arbeit die göttliche Schöpfung weitergeführt werde." (Oexle 2000, 71)
Vor allem in den neu entstehenden monastischen Gruppen und Mönchsorden wurde diese neue Bewertung der Arbeit stark mitgetragen, denn "für alle diese in Gütergemeinschaft und deshalb auch Gemeinwirtschaft lebenden Gruppen ist gemeinsame körperliche Arbeit konstitutiv. Die Pflicht zur Arbeit der Mitglieder sicherte einerseits die Existenz der Gemeinschaft und zum anderen war sie die Voraussetzung ihrer karitativen Tätigkeit. In der Benediktinerregel "Ora et labora" kommt diese Grundhaltung deutlich zum Ausdruck. Der Benediktinerorden erweiterte diese Auffassung, indem bereits das Nichtstun eine Gefahr für die Seele bedeutet (otiositas inimica est animae - Müßiggang / Nichtstun ist der Feind der Seele). Damit wird nun die griechische Maxime ganz in ihr Gegenteil verkehrt. Diese Auffassung war nicht nur ideologisches Beiwerk sondern konkrete Praxis. In den Mönchsorden werden die Arbeitsregeln "immer wieder eingeübt, sie werden durch Vorlesen und Hören in die Gehirne und durch den dazugehörigen Tagesrhythmus der monastischen Gruppen in die Körper eingeschrieben." (Oexle 2000, 72) Bereits hier finden wir die ersten praktischen Techniken zur Disziplinierung der Körper durch die Arbeit, die zu Beginn der Moderne auf alle Bevölkerungsschichten und Gesellschaftsbereiche übertragen wird.
Im frühen Mittelalter war die Ökonomie als zentrale Größe noch nicht erfunden. Die Arbeit war eingebettet in die Lebenszusammenhänge der Menschen, sie war vor allem subsistente Tätigkeit. Die statische Struktur der mittelalterlichen Ständeordnung bestimmte durch Geburt, welcher sozialen Schicht man angehörte und parallel dazu, welche ökonomische Stellung man einnahm. Diese Ordnung spiegelte in den Augen der Menschen einen göttlichen Willen wider. Die Rebellion gegen die göttliche Ordnung hätte den gesellschaftlichen Ausschluss nach sich gezogen und damit den sicheren sozialen, aber auch physischen Tod. Die Ständeordnung hatte eine äußerst funktionale Bedeutung, d.h. "‚Gesellschaft' besteht durch die Kooperation der drei Stände." (Oexle 2000, 72) Jede Abweichung von ihr hätte das Machtgefüge zwischen Adel, Klerus und Bauer zum Schwanken gebracht. In dieser funktionalen Kooperation hatten die Bauern die Aufgabe körperliche Arbeit zu erledigen, "freilich stets in Ambiguität: als gesellschaftliche Notwendigkeit wie als Mühsal." (Oexle 2000, 74) Die Bauern waren der Stand, der körperlich arbeitete, der Klerus und der Adel entzogen sich vollkommen dieser gesellschaftlichen Aufgabe.
Wiederum war es später die körperliche Arbeit, die als Instrument der Kritik ins Feld gegen den Müßiggang des Adels und Klerus geführt wurde, um ständische Unterschiede anzuprangern. Vor allem Franz von Assisi forderte: "Die nicht arbeiten können, sollen es lernen, nicht des Lohnes, sondern des Beispiels wegen und um den Müßiggang zu vertreiben." (Oexle 2000, 75) Damit ist die Forderung begründet, die Arbeit auf alle Gesellschaftsteile hin auszuweiten. Es sollte jedoch noch dauern bis dieses Paradigma durch die Reformation als Kritik gegen die Obrigkeit auf fruchtbaren Boden fiel. "Die Arbeit wird in der Reformation zum Gebot Gottes für alle - ohne Unterschied des Standes. Nach oben wird die Untätigkeit des Adels getadelt, nach unten wird die Duldung des Bettelns untersagt." (Gronemeyer 1991, 32) Die Arbeit wird zum unwiderruflichen Ethos gottesfürchtigen Lebens. Luther gibt dieser Gesinnung ihren klarsten Ausdruck in seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation (1520), in der er die paulinischen Forderungen zitierte: "Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen". (Vgl. Paulus: Der zweite Brief an die Thessalonicher. Zurechtweisung der Müßiggänger: 3, 6-12) Für Luther geht jede Form des Müßiggangs auf Kosten derer, die arbeiten, daher missbilligt er ihn beim Adel genauso wie beim "arbeitsunwilligen" Bettler. Durch die Arbeit, so die Meinung der Reformationsbewegung, wird der Mensch zum Vollstrecker des göttlichen Willens. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die irdische Tätigkeit der geistlichen Arbeit und Muße übergeordnet. Jede Art irdischer Tätigkeit erhielt den selben Stellenwert und keine war gegenüber einer anderen besser oder schlechter. Die Arbeit diente nicht mehr nur dem Wohle der Seele, wie Thomas von Aquin lehrte, sondern sie stand im Dienste der Menschheit. Sie wird zur Pflicht für alle, "der sich auch der Adel und vor allem der Geistliche nicht mehr entziehen konnte - der Eigenwert der vita contemplativa wurde beträchtlich eingeschränkt - und zum anderen wurde der zunehmende Bettel und unchristliche Müßiggang als Werk des Teufels bekämpft. [...] Alle Menschen sollten zu strenger Arbeit verpflichtet sein, wenn sie Anrecht auf Nahrung und Lebenssicherung haben wollten." (van Dülmen 2000, 81)
Die Arbeit avancierte zur alles beherrschenden Kategorie, die von nun an ökonomische, soziale, politische und individuelle Bereiche besetzte. Arbeit wird von nun an nicht mehr, wie im frühen Mittelalter, als Subsistenzwirtschaft definiert, sondern als Instrument zur Produktion von Waren, gesellschaftlichen Reichtums und Wohlstands. Dieser Arbeitsbegriff steht nun an der Schwelle zum Übergang in die neuzeitliche Arbeitsgesellschaft des 17. Jahrhunderts.
An der Schwelle zur Neuzeit entwickelte sich die Arbeit zur Matrix gesellschaftlicher Ordnung und Organisation und zur treibenden Kraft der am Horizont sich abzeichnenden kapitalistischen Ökonomie und Produktionsweise.
Die große Leistung zu Beginn der Neuzeit war, dass die Arbeit aus dem engen privaten Raum der Subsistenzwirtschaft herausgeführt wurde, um sie zur öffentlichen Angelegenheit hochzustilisieren. Dabei kam der Mensch der mittelalterlichen Ordnung völlig unter die Räder, er war nicht mehr in die statische Ständeordnung eingebettet, sondern transformierte zur Arbeitskraft. Die nun mehr produzieren konnte, als wie für das eigene Überleben notwendig war: "[...] es ist der Kraftüberschuss des menschlichen Körpers, und nicht die Arbeit selbst, worin das eigentliche ‚Produktive' des Arbeitens besteht." (Arendt 2001, 105) Die Arbeit als konkrete Tätigkeit wird zur abstrakten Größe, zum Kalkül und zur Tauschware. Eine Mutation der Arbeit stand bevor, denn "von nun an wird der Wert produziert, seine Referenz ist die Arbeit, sein Gesetz die allgemeine Äquivalenz aller Arbeiten. Der Wert gehört hinfort zu einer ganz bestimmten rationalen Ausübung menschlicher Arbeit (gesellschaftlicher Arbeit). Er wird messbar und infolgedessen auch der Mehrwert." (Baudrillard 2005, 22) Der Mensch verkommt zur Ware Arbeitskraft, die nunmehr allein den Gesetzen des freien Marktes gehorcht. "Mit der Freisetzung der Arbeitskraft aus ihrem Lebenszusammenhang und mit ihrem Auftauchen als Ware ergibt sich auch die Zerstörung der sozialen Gemeinschaft der Zünfte und Gilden, die neben ihrer ökonomischen Funktion ein Netz der sozialen Sicherheit bildeten, das sich zunehmend verliert [...]." (Tilg 2003, 92)
Der sich nun frei entfaltende Kapitalismus benötigte eine Vielzahl neuer Arbeitskräfte. Um den Bedarf zu stillen, wurde die ländliche Bevölkerung aus ihrer Leibeigenschaft entlassen. In Massen strömten diese nun in die neuen Produktionsstätten und städtischen Ballungszentren. Damit waren massive soziale Probleme vorprogrammiert. Karl Marx bemerkte, dass die Menschen nun "doppelt frei" seien; "frei von ihrer existenziellen Abhängigkeit vom Grundherren, frei aber auch von dessen Schutz und vor allem vom Eigentum. Das zwingt sie, ihren einzigen Besitz zu verkaufen, ihre Arbeitskraft - und führt sie in eine neue Unfreiheit. Vor allem sie und ehemalige Handwerker bilden die neue Klasse der Arbeiter. Wegen ihrer großen Zahl ist menschliche Arbeitskraft im frühen Kapitalismus billig wie Dreck." (Daniels und Schmitz 2006, 22) Der Überschuss an Arbeitskraft führte zu einer Niedriglohnpolitik, wodurch die Arbeiter kaum ihre Existenz und die der Familie sicherstellen konnten.
Die neuen Produktionsweisen und die zunehmende Mechanisierung der Produktion verlangten den Arbeitern eine noch nie da gewesene Disziplin ab. Sie mussten sich dem Rhythmus der Maschine und den vorgegebenen Arbeitszeiten fügen. Die über Jahrhunderte hinweg sedimentierten Gewohnheiten und Verhaltensweisen und die "explosiven, augenblicklichen und diskontinuierlichen Energien des Menschen" (Gronemeyer 1991, 41) mussten transformiert und gezähmt werden. Die Strategien zur Instrumentalisierung des Verhaltens zielten vor allem auf die Körper der Individuen ab sowie auf die gesamten Lebenszusammenhänge der Menschen:
-
Migration:
Der arbeitende Mensch wird aus seinen traditionellen Bindungen herausgelöst. Dies bedeutet Loslösung aus seiner örtlichen und kulturellen Verankerung. Er wird gezwungen in die Städte abzuwandern, in eine für ihn fremde Umgebung. In England werden z.B. Arbeitswerber eingesetzt, die übers Land ziehen, um aus der ländlichen Bevölkerung Arbeiter anzuwerben. Durch die Migration vom Land in die Stadt "trat der Arbeitsplatz, an dem Erwerbsarbeit geleistet wurde und die Sphäre des Hauses / der Familie auseinander." (Kocka 2001, 9) Die Arbeit entwickelt sich nun zu einem ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsystem, das sich von der alltäglichen Daseinsverrichtung abtrennt.
-
Zeitdisziplinierung:
Wie erwähnt müssen sich die "neuen Arbeiter" an andere Zeitrhythmen gewöhnen. In England werden in den Arbeitervierteln Wecktrupps eingesetzt, die darauf achten sollen, dass die Arbeiter pünktlich erscheinen
-
Einführung von Ticketsystemen:
Damit die Arbeiter kontinuierlich in den Fabriken erscheinen, wird der Lohn erst nach den abgeleisteten Tagen bezahlt.
-
Einführung von Kontrollsystemen:
Vorarbeiter, Lochzeitkarten usw.
Die Wirkungen dieser Disziplinarmaßnahmen und Kontrollsysteme waren beträchtlich und sie sedimentierten sich allmählich in den Köpfen der arbeitenden Bevölkerung und bestimmten letztlich ihre Lebensvollzüge. Die Arbeit wird zum "Anthropogem" des Menschen. "Die Mechanisierung kehrt die Menschwerdung um. Nicht länger geht es um eine Selbsterzeugung des Menschen durch seine Arbeit, sondern Arbeit als anthropogemes Apriori erzeugt den Menschen. [...] Das Leben für die Arbeit, die sich wiederum an die Maschinisation von Gesellschaft und Welt gebunden sieht, bringt den modernen Menschen aus dem Kontext der Mechanisierung heraus erst hervor." (Ahrens 2000, 60) Die Arbeit ergreift als "fundamentale Repression" (Baudrillard 2005, 28) den ganzen Menschen, beherrscht seine gesellschaftlichen Beziehungen und seine "moderne" Subjektivität und Identität. "Indem der Begriff der Arbeit bis in den Einzelnen hinein ausgedehnt wird, Arbeit keine äußerliche Tätigkeit mehr ist, sondern originäre Form einer sich selbst bewussten, sich selbst verwirklichenden Menschlichkeit, transformiert sich auch das Bild des Menschen. Dieser verfügt über wenig mehr als über die Sehnsucht nach einer Arbeit, mit der er sich sozial integrieren könnte." (Ahrens 2000, 60)
Die Moderne führte einen verbissenen Kampf um die totale Mobilisierung der Arbeitskraft, ohne die die kapitalistische Produktion nicht möglich gewesen wäre. "In der Tat hat sich die gesamte Geschichte des Staates um ein dringendes Bedürfnis nach Arbeitskraft gedreht, eine unersättliche Forderung, von der man [...] noch Spuren in allen Verwaltungstexten und Schriftwechseln findet: von der Proletarisierung durch Marius bis zu der durch Ludwig XIV (‚Wer dem König einen Gefallen tun will, schenkt ihm einen Sträfling'), bis zu der Mahnung Albert Speers (‚Bringen sie die russischen Kriegsgefangenen nicht um, überlassen wird das der Arbeit'[2]) oder den Berichten der Kolonialbehörden (‚Ohne Arbeitskraft keine Kolonien, und wir können einpacken') [...] Die Zwangsverpflichtung der Zivilbevölkerung zur Arbeit, ihre Erfassung und Domestizierung durch paramilitärische Apparate vollzieht sich in Europa, jenseits des Atlantiks und in Übersee gleichzeitig [...]." (Virilio 1978, 11)
Der Siegeszug der Arbeit ist untrennbar mit dem Los derer verknüpft, die als Verlierer unter die Räder geraten. Ihre Geschichte ist die Geschichte von Armut und gesellschaftlichem Ausschluss, der letztendlich, im 20. Jahrhundert, in die Vernichtung von Abermillionen von Menschen in den Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslagern des Dritten Reichs mündete.
[1] Anmerk. d. A.: Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) war der Begründer des Scientific Management. Das tayloristische Prinzip beruht auf der Rationalisierung von Arbeitsprozessen. Arbeitsausführungen sind in einfache Elementarbewegungen unterteilt. Jede Elementarbewegung muss innerhalb eines entsprechenden Zeitrahmens klassifiziert werden. Trennung von Hand- und Kopfarbeit und Auslese und Anpassung der Arbeiter an die untergliederten Arbeitsabläufe sind weitere Komponenten rationalisierter Arbeitsprozesse.
[2] Anmerk. d. A.: In dieser Aussage kulminiert die gesamte Ideologie der Konzentrationslager als "Vernichtung durch Arbeit". (Vgl. Gedenkstätte Buchenwald 2007, S. 154 ff. und S. 169 ff.)
Inhaltsverzeichnis
Arbeit und Armut bildeten bereits in der Antike eine chiastische Beziehung. In der Antike stand diese Beziehung jedoch konträr zu den Entwicklungen, die durch die christliche Morallehre im Abendland in Gang gesetzt wurden. In der Antike stand die Verbindung Reichtum und Frei-Sein im Gegensatz zur Armut und Unfreiheit. Die christliche Lehre verurteilte seit dem Beginn des Mittelalters den monetären Reichtum und verkehrte die griechische Dichotomie von Reichtum und Armut in ihr Gegenteil: "Entsprechend dem biblischen Wort, eher gehe ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel komme, stehen nach allgemein akzeptierter Auffassung die Armen und Besitzlosen Gott prinzipiell näher als die Reichen und Wohlhabenden. Deshalb kann der Arme für den Reichen ein Mittler zu Gott sein." (Fandry 1990, 27)
Die Sprache der Bibel war in dieser Beziehung eindeutig und diejenigen, die die Worte der Bibel verkündigen und sich Gott hingeben, sollen auf alle Formen irdischer Güter verzichten. Arbeit und Armut waren die Grundpfeiler christlicher Mission. Die praktische Umsetzung erfolgte dann ab dem 4. Jahrhundert durch die Gründung erster monastischer Gemeinschaften. Die positiven Grundhaltungen zur Arbeit und zur Armut kamen in den Ordensregeln klar zum Ausdruck. Benedikt verpflichtete seine Ordensbrüder dazu, jeglichen Privatbesitz abzugeben, um sich der Arbeit und dem Gebet zu widmen (ora et labora). Außerdem forderte er, dass den Armen und Bedürftigen zu helfen sei, denn die materiellen Reichtümer, die man unter den Armen verteilt, verwandeln sich zu ewigen Reichtümern im Himmelreich. Der klösterliche Gemeinbesitz blieb daher auch auf das Lebensnotwendigste beschränkt.
Durch diese Grundhaltung spielten die Klöster bis ins Hochmittelalter hinein eine wichtige Rolle in der Armenfürsorge und wurden zu Zentren für die Almosenvergabe. Das Kloster Cluny in Frankreich erbrachte im 12. Jahrhundert bis zu 18.000 Armenspeisungen pro Jahr. Vom Kloster Salem wird berichtet, dass "jeden Mittwoch und Samstag vor dem Klostertor Almosen, und an zwei bestimmten Feiertagen im Jahr [...] zusätzlich je ‚2500 Brodlein' gebacken [wurden] sowie Mahlzeiten und Geldspenden ausgegeben [wurden]. (Fandry 1990, 30) Gegen Ende des Mittelalters verausgabten sich die Klöster dermaßen, dass einige am Rand des Ruins standen; Armenfürsorge galt jedoch bis dahin als fester Bestandteil klösterlichen Gemeinschaftslebens. Der Fremde und arme Bettler sei zu Empfangen wie Christus selbst, so lautet die Regel klösterlicher Nächstenliebe.
Neben den Klöstern sahen sich auch wohlhabende Adelige zur Almosenvergabe verpflichtet. Karl der Große (Regierungszeit von 768 - 814) legte seine Vorstellung zur Armenfürsorge in den Kapitularien fest: "Liebet euren Nächsten wie euch selbst, und reicht nach euren Kräften den Armen Almosen dar. Die Fremden nehmt in eure Häuser, besucht die Kranken, übt den Gefangenen Barmherzigkeit." (Häßler und Häßler 2005, 16) Die Mitleidsethik spielte eine staatstragende Rolle und Armenpflege war in den Augen der Obrigkeit ein wichtiger Teil sozialer Ordnung. "In den Städten vermachen die wohlhabenden und reichen Bürgern für ihr Seelenheil den Armen und Siechen testamentarische Spenden, >>up dat se Got vor my bidden<< oder >>um von den Armen den ewigen Lohn zu erwerben<<." (Fandry 1990, 30) Almosen wurden zu bestimmten Feier- und Namenstagen oder während Reichstagen und Kaiserwahlen massenhaft ausgegeben. Die verarmten Bevölkerungsschichten zogen von Stadt zu Stadt, von Kloster zu Kloster, von Grundherr zu Grundherr, um in den Genuss der zahlreichen Almosenspenden zu kommen. In schlechten Zeiten reichten diese oftmals nicht aus, um die Bedürfnisse der Umherziehenden zu stillen.
Ab dem 10. Jahrhundert entstanden innerhalb der Klöster Hospitäler, in denen kranke und umherziehende Bettler Unterkunft und Verpflegung fanden. In den Städten gründeten die Klöster und wohlhabenden Bürger selbständige Hospitäler. "Finanziert werden die Hospitäler von der Kirche, aber mehr noch von Grundherren durch Schenkungen von Grundstücken und bäuerlichen Abgaben. So manche kriegerischen und räuberischen Feudalherren packte am Ende seiner Tage das Entsetzen vor den drohenden ewigen Höllenqualen angesichts all seiner Untaten gegen wehrlose Bauern und Bürger. Da wirkte oft das Versprechen der Kirche, durch Stiftungen von Vermögen könne der Sünder seine Chancen auf Gnade beträchtlich erhöhen. Viele Hospitäler kommen so zu ansehnlichem Vermögen." (Fandry 1990, 37)
Aufnahme und Unterkunft fanden jedoch nur jene, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr durch das Betteln bestreiten konnten. Das Hospital von damals gewährte im Unterschied zu heute keine medizinische und ärztliche Versorgung. Zudem regelte es den Lebensalltag der Bedürftigen sehr streng, die "Bewohner" mussten in Keuschheit leben und sich dem Gebet widmen. Wer sich dem widersetzte wurde bestraft oder hinausgeworfen.
Die Wahrnehmung von Behinderung war im Mittelalter eine andere als heute. Sie war bestimmt durch die Differenz von potens und pauper. Armut war ein sozialer Tatbestand, der die ständisch-feudalen Herrschaftsverhältnisse widerspiegelte. Der Arme (pauper) wurde dem Starken (potens) als gesellschaftlicher Archetypus gegenübergestellt. "Der Arme war in seiner Subsistenz auf andere angewiesen" (Oexle 1986, 77) und bedurfte des Schutzes, da er sich aufgrund bestimmter Ereignisse nicht mehr "standesgemäß" halten konnte. "So gibt es nicht nur den Armen im materiellen, physischen und rechtlichen-sozialen Sinn, sondern auch den ‚armen' Kleriker, den ‚armen' Ritter und den ‚armen' Adeligen." (Oexle 1986, 79) Armut verkörperte einen Zustand von sozialer Schwäche, Mangel und Bedürftigkeit, "wobei es nicht nur um das Fehlen physischer Kraft und materieller Güter (Geld, Nahrung, Kleidung) geht, sondern insgesamt um einen Mangel an sozialer Stärke, die ein Ergebnis von sozialem Ansehen und Einfluss, Waffengewandtheit und Rechtsposition, von Gesichertsein durch soziale Bindungen, aber auch von Wissen und politischer Macht." (Sachße und Tennstedt 1983, 39) Zur Gruppe der Armen zählten nicht nur materiell verarmte Personen, sondern auch alte und behinderte Menschen, die auf Unterstützung angewiesen und in allen Ständeschichten vertreten waren.
Im Zuge des Mittelalters bildeten, zusätzlich zur Kirche und dem Adel, auch Gilden, Stände und ähnliche eingeschworene Gemeinschaften eine zusätzliche Säule in der Armenfürsorge. "Die soziale Kraft dieser Formen der Gruppenbildung beruht in der Freiwilligkeit, in der Selbstbindung des einzelnen durch Konsens und Vertrag mit anderen, was der gegenseitige Eid sichtbar machte. Stets aber gehörte zu den Zielen solcher genossenschaftlicher Gruppen auch die Hilfe gegenüber Not leidenden Dritten, also gegenüber Armen, die nicht Mitglieder waren. Die bedeutenden und vielschichtigen Wirkungen der Gilden zeigten sich dann erst recht seit dem 11. Jahrhundert, als dieser Teil der Gruppenbildung in immer wieder neuen Zusammenhängen und ‚Verhältnissen der Desorganisation' sich durchsetzen und differenzierten." (Oexle 1986, 81)
Armut war im Mittelalter kein geächtetes Phänomen, sie gehörte zum alltäglichen Bild, mit dem vor allem die städtische Bevölkerung ständig konfrontiert war. Die christliche Lehre der Nächstenliebe war damals ein ‚sozialpolitisches Programm' getragen von Adel und Klerus. Der Arme hat darin eine klar definierte religiöse Funktion: "Die Reichen sind für die Erlösung der Armen geschaffen und die Armen für die Reichen." (Fandry 1990, 28)
Seit dem Hochmittelalter, ca. ab dem 15. Jahrhundert, gerät diese Einstellung gegenüber der Armut ins Wanken. Die tolerante Einstellung gegenüber Armut und Bettelei der landlosen Bevölkerungsmassen, die ab dem 12. Jahrhundert zunahm, wandelte sich allmählich in ihr Gegenteil. Die Bettelei war bis dahin feste Grundlage und Quelle zur Selbsthilfe und Existenzsicherung. Sie war durchaus eine legitime Form der Reproduktion und wurde in verschiedenster Form ausgeübt. "Von Bettelei ernährten sich nicht nur diejenigen, für die es aufgrund individueller Notlagen, insbesondere Arbeitsunfähigkeit, keine andere Entfaltungsmöglichkeit gibt. Daneben gibt es >>Nebenerwerbsbettler<<, das sind zumeist unselbständige Lohnabhängige, die ihr Einkommen nach Feierabend durch Bettelei aufbessern. Es gibt eine große Zahl von Berufsbettlern, also durchaus gesunden und arbeitsfähigen, aber arbeitsunwilligen Individuen, die es vorziehen, ihren Unterhalt durch Bettelei zu erwerben." (Sachße und Tennstedt 1998, 29)
Bettelei war gesellschaftlich keineswegs verachtet und zu den Bedürftigen und Berufsbettlern gesellten sich noch die Mitglieder der Bettelorden, die sich aus religiösen Motiven dieser Tätigkeit widmeten. "Für die religiösen Bettler ist die Kennzeichnung ‚arm' im Sinne eines materiellen Notstands kaum noch griffig. Denn einerseits verzichten die Angehörigen der Bettelorden freiwillig auf weltliche Güter, andererseits häufen sie - eben durch Bettelei - zwar nicht zu ihrem persönlichen Nutzen, aber zu dem der Kirche z.T. erhebliches Vermögen an. Der Reichtum der Bettelorden wird dann im 15. Jahrhundert folgerichtig immer stärker zum Zielpunkt der Kritik des städtischen Bürgertums." (Sachße und Tennstedt 1998, 30)
Das 15. und 16. Jahrhundert war die goldene Zeit der Stadtentwicklung, und der Handel und das Handwerk erlebten einen noch nie da gewesenen Aufschwung. Das Bürgertum erfuhr einen sozialen Aufstieg, der ihren politischen Einfluss stärkte. Ein weiteres prägnantes Merkmal dieser Epoche waren die Auswirkungen der Bevölkerungszunahme der vorigen Jahrhunderte, die "einen Teil jener umfassenden sozialen Prozesse [bewirkte], in die auch die ‚neue' Armut des Hochmittelalters hineinzustellen ist. Bei aller Vorsicht quantitativer Angaben für diese frühen Jahrhunderte der europäischen Geschichte wird man doch von der Tatsache ausgehen dürfen, dass sich in den meisten Ländern Europas zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert die Bevölkerung mindestens verdoppelt hat." (Oexle 1986, 82)
Im Sog dieser demographischen Entwicklung verstärkten sich soziale Probleme aufgrund der konstanten Zunahme von Armut. Man darf sich vorstellen, dass im Spätmittelalter die Hälfte aller Stadtbewohner in Armut lebten. Betroffene der "neuen" Armut im ausgehenden Mittelalter sind vor allem "selbständige Handwerker mit geringem Einkommen und Vermögen, die daher von ökonomischen und außerökonomischen Krisen in besonderem Maße bedroht sind. Die unselbständigen Lohnabhängigen, insbesondere die unqualifizierten Tagelöhner. Die Angehörigen ‚unehrlicher' Berufe [z.B. Prostituierte, Totengräber, Spielleute, fahrendes Volk usw.] [...] [und] die Witwen, Weisen Krüppel und Kranken." (Sachße und Tennstedt 1998, 28)
Die Zunahme von Armut evozierte eine Reihe von Fragen und Antworten; vor allem die freiwillige Armut aus religiösen Gründen wurde zunehmend kritisiert. "Die Stadtbürger kritisierten die Bettelorden, deren Mitglieder sich aus religiösen Gründen - um Gott in absoluter Armut nahe zu sein - vom Betteln ernähren. Die Bürger beschuldigen die Bettelorden, unter Vorspiegelung der Besitzlosigkeit in Wirklichkeit Reichtümer zu erbetteln. Und über die Kritik an den Bettelorden hinaus wird dann sehr schnell die ‚Bedürftigkeit' aller Bettler zum Thema, denn viele Bürger empfinden das Betteln als störend und lästig." (Fandry 1990, 41)
Die gesellschaftlich legitimierte und tolerierte Bettelei und die nicht regulierte Almosenpraxis, nach dem Motto "wer bittet, dem wird gegeben", wird einer grundlegenden Kritik unterzogen. Restriktive Maßnahmen wurden gegen diese Formen und Haltungen ins Feld geführt. Vor allem die damals entstehenden Bettel- und Armenverordnungen geben darüber Auskunft. Sie zielen darauf ab, die Armut und vor allem die Bettelei aus dem gesellschaftlichen Wahrnehmungs- und Wertehorizont zu verdrängen. "Dieser Entwicklungsprozess lässt sich unter vier Aspekte erfassen: dem der Kommunalisierung, Rationalisierung, der Bürokratisierung und der Pädagogisierung." (Fandry 1990, 30)
Unter dem Aspekt der Kommunalisierung lassen sich alle Tendenzen subsumieren, die eine Verlagerung der Armenfürsorge aus dem Hoheitsgebiet der Kirche hin ins Einflussgebiet weltlicher Institutionen durchsetzen. Bereits durch die Gilden und Bruderschaften wurde die Armenfürsorge teilweise säkularisiert und das Monopol der Kirche ins Schwanken gebracht. Ab dem 15. Jahrhundert übernehmen jedoch zunehmend die öffentlichen Institutionen die Almosenvergabe, mit dem Ziel sie zu kontrollieren. Armenkassen bzw. der so genannte "arme Kasten" werden eingeführt, durch Stadträte oder Bettlervögte verwaltet, um Almosen nur noch an wirklich Bedürftige auszubezahlen. Die willkürliche und persönliche Almosenvergabe wird nun von den Armenkassen übernommen. Dies ist zugleich auch die Geburtsstunde des Sozialhilfeempfängers aufgrund von Bedürftigkeitsprüfungen.
Im Zuge der Kommunalisierung werden gezielte Maßnahmen gegen Bettelei und Armut getroffen. Die Bettelei wird reglementiert und sanktioniert. So verbietet die älteste deutsche Bettelordnung der Stadt Nürnberg das Betteln in und um Kirchen und macht es vom Tragen eines Bettlerzeichens abhängig. Bettlerzeichen werden nur an ortsansässige und "wirklich" Bedürftige ausgehändigt; ortsfremde Bettler werden aus den Städten vertrieben. Die Gemeinden sehen sich für die Ortsfremden nicht mehr verantwortlich. "Der Übergang der Armenfürsorge von der Kirche als einer universellen, räumlich nicht begrenzten Institution auf die Gemeinden als Gebietskörperschaft brachte notwendig ihre lokale Beschränkung mit sich." (Sachße und Tennstedt 1983, 43) Bei großen Hungersnöten öffnet man jedoch die Stadttore und verköstigt tausende von Bettlern. Die beschriebenen Maßnahmen lassen sich jedoch schwer umsetzen und werden erst ab dem 16. Jahrhundert in vollem Umfang durchgesetzt.
Neben den ortsfremden geraten auch die "unwürdigen" Bettler ins Visier zunehmender Restriktionen und wer ein Bettlerzeichen bekommen will, muss sich bestimmten Verhaltensnormen, Moralvorstellungen und vorgegebenen Ansprüchen fügen. Damit ist ein weiterer Schritt getan mit dem Ziel, die Armenfürsorge zu rationalisieren. Die Armen und Bettler, die nach Almosen verlangen, werden genau klassifiziert und kategorisiert, um die würdigen von den unwürdigen Bedürftigen zu unterscheiden. Als unwürdige Bettler gelten die ortsansässigen arbeitsfähigen, aber arbeitsunwilligen Personen. Sie werden vom Almosensystem ausgeschlossen; ihnen wird damit ein jahrhundertealtes bewährtes Fürsorgemodell vorenthalten, mit vielseitigen Konsequenzen.
Die "Unwürdigen" avancieren zur Projektionsfläche sozialer und gesellschaftlicher Ängste, indem ihre Präsenz eine gewisse Unsicherheit in den Köpfen des aufstrebenden Bürgertums erzeugte. "Die Reaktion war Ausgrenzung, Abgrenzung und obrigkeitliche Kontrolle. So war das späte Mittelalter eine Zeit der Ausgrenzung städtischer Randgruppen. Das städtische Bürgertum fühlte sich in seiner sozialen Position bedroht und reagierte mit der Stigmatisierung von Minderheiten." (Sachße und Tennstedt 1983, 47)
Die bürgerlichen Ideale korrelierten zu dieser Zeit mit der damaligen, über Jahrhunderte hinweg sedimentierten Lebensführung vieler Menschen. Das Bürgertum, zu dem vor allem Handwerker und Kaufleute zählten, erreichte seinen Wohlstand durch ein arbeitsames, auf Fleiß und Disziplin beruhendes Leben. "Die stete Propagierung von Arbeitsamkeit und Fleiß sowie die entsprechende Ächtung von Faulheit, Müßiggang und Bettelei dienten daher als notwendige Maßnahmen zur Gewährleistung des Wohlstandes und Reichtums der Handwerker und Kaufleute. Und die Bettelei erschien nun der neuen bürgerlichen Sicht doppelt schädlich: Sie verringerte die Gesamtzahl aller verfügbaren Arbeitskräfte und bot ein schlechtes Beispiel für die beschäftigten Arbeitskräfte - auch deshalb sollten die Bettler unbedingt aus dem Straßenbild verschwinden." (Fandry 1990, 47)
Nicht nur die unwürdigen (arbeitsunwilligen), sondern auch die würdigen (arbeitsunfähigen) Bettler werden mit einem bürgerlichen Wertekanon konfrontiert, der ihre Lebensführung unter ein besonderes Reglement stellt. Almosenempfänger müssen sich von Gasthäusern fern halten, dürfen kein ausschweifendes Leben führen und Bettelei sowie Glückspiel ist ihnen verboten. Die Übertretung wird mit dem Ausschluss aus dem Fürsorgesystem bestraft. Bescheidenheit, Gehorsam und Unterordnung werden ständig kontrolliert, um die Almosenempfänger nach bestimmten Werten, Normen und Moralvorstellungen zu erziehen, im Sinne der Pädagogisierung sozial Bedürftiger.
Hausbesuche und Visitationen sind die beliebtesten Überwachungsmethoden. Außerdem werden die Bettlerzeichen nur für einen bestimmten Zeitraum vergeben, um sie nach einer eingehenden Bedürftigkeitsprüfung neu auszustellen. Fürsorge, Kontrolle und Pädagogisierung vereinen sich zu sozialpolitischen Ordnungsmaßnahmen. Diese würden wirkungslos bleiben ohne einen funktionierenden Verwaltungsapparat. Die Wurzeln moderner Sozialverwaltungen und polizeilicher Exekutivorgane lassen sich daher bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. "[I]m 16. Jahrhundert [...] [begann] sich ein differenzierter Polizei-(sprich: Verwaltungs-)Apparat auszubilden [...], der allmählich eine enorme Machtfülle bekam. Die Armen waren die ersten, die diese Intensivierung verspürten. Ein deutliches Zeichen für die zunehmende Kontrolle in diesem Bereich ist das Anwachsen der Zahl der Bettlervögte oder Polizeidiener [...]" (Jütte 1986, 104)
Der neuartige Überwachungs- und Kontrollapparat sollte die zweckmäßige kommunale Almosenvergabe gewährleisten. Arbeitsunwillige wurden zunehmend zu öffentlichen Bauarbeiten herangezogen und die Almosenempfänger wurden auf die Einhaltung der propagierten Sittlichkeit hin überprüft. Alle Maßnahmen, die seit dem Ende des Mittelalters bzw. zu Beginn der Neuzeit ihre Wirkungen entfalteten, können unter dem Aspekt der Sozialdisziplinierung erfasst werden. "Sozialdisziplinierung bedeutete also nicht zuletzt Erziehung zur Arbeit und Einübung von Arbeitsdisziplin. Daneben wurde den Armen ein bürgerlicher Verhaltenskodex anerzogen, dessen Grundbestandteile Gehorsam, Fleiß, Demut, Bescheidenheit, Mäßigung, Sittsamkeit und Gottesfurcht waren. Auch von den arbeitsunfähigen Almosenempfängern wurde erwartet, dass sie sich tugendhaft [...] verhielten." (Jütte 1986, 112)
"Die Lebensbedingungen der auf Almosen angewiesenen Armen bleibt noch jahrhundertelang geprägt durch das Nebeneinander und Gegeneinander von reglementierter Almosenvergabe der Gemeinden und der traditionell tief verwurzelten Almosenspende der einzelnen Bauern und Bürger. Bettler missachten die Almosenordnungen aus existenzieller Not, im Bewusstsein des guten alten Rechts auf individuelles Betteln. Viele Stadtbewohner beharren auf herkömmlichen Anschauungen und Gewohnheiten, geben den Bettlern weiterhin individuell Almosen, schmähen und verspotten die städtischen Bettelknechte und hindern sie an der Durchsetzung der neuen Ordnung." (Fandry 1990, 47) Was zu Beginn, im 15. und 16. Jahrhundert, eher noch bescheiden ausfiel, da die Umstellung jahrhundertelanger Traditionen und Gewohnheiten nicht reibungslos verlief, wird ab dem 17. Jahrhundert in den Zucht- und Arbeitshäusern zur total institutionalisierten Form der Sozialdisziplinierung , weiterentwickelt.
Mitteleuropa erwacht aus den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs. Die Länder sind ausgeblutet; Zerstörung, unfruchtbare Landgegenden, Hunger, Seuchen und Tod bestimmen die Lebensverhältnisse der Menschen. Wirtschaftliche und soziale Strukturen sind nach dem Krieg zerstört, viele Menschen stehen vor dem Nichts und sind auf der Flucht. Noch Jahre danach zieht ein Strom entwurzelter und heimatloser Menschen durchs Land. Das Betteln bleibt für viele die einzige Alternative um zu überleben. "Mehr schlecht als recht ernähren sich durch Betteln zwischen 10 und 25 Prozent der Bevölkerung. ‚Um den Müßiggang zu steuern und das Volk zur Arbeitsamkeit anzugewöhnen', um den Unternehmern Arbeitskräfte für die neuen Manufakturen zuzuführen, sollen alle Bettler von den Straßen verschwinden, sollen alle Arbeitsfähigen zur Arbeit gezwungen werden." (Fandry 1990, 54)
Das Betteln wird prinzipiell in allen Ländern Mitteleuropas verboten und strengstens überwacht. Wer dennoch bettelt, wird in die neu entstandenen Zucht- und Arbeitshäuser gesteckt. Geographisch entstehen die ersten Zwangs- und Arbeitsanstalten in den großen städtischen Ballungsgebieten zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Bremen 1609, Hamburg 1620, Danzig 1929, Paris 1656 etc. Ab dem 18. Jahrhundert werden sie im großen Stil erbaut und fassen tausende von Insassen. Störenfriede, Libertins jeglicher Couleurs, Kriminelle, Arbeitsunwillige, Wahn- und Schwachsinnige wurden dahin verfrachtet. Sie alle bildeten ein "Hindernis für die Organisation der Gesellschaft nach den damals entwickelten ökonomischen Normen." (Foucault 2003, 627) Das Zuchthaus bzw. die Inhaftierung soll auf die Arbeitsmoral der Menschen einwirken, damit die wirtschaftlich geschwächten Länder durch effiziente Arbeitskräfte einen Aufschwung erleben. Den "Züchtlingen" soll die Arbeitsmoral förmlich eingeimpft werden und dafür werden sie voll und ganz dem Regime der Zwangsarbeit unterworfen. "Man schloss sie ein, weil sie außerhalb der Arbeit standen, aber wenn sie erst eingeschlossen waren, befanden sie sich mitten in einem neuen Arbeitssystem." (Foucault 2003, 629) Die Inhaftierung war ein radikaler Schnitt im Leben der Menschen. Die Ideologie der Zwangsarbeit verfolgte durch den gesellschaftlichen Ausschluss das Ziel, durch Züchtigung und Disziplinierung die Menschen gesellschaftsfähig, d.h. arbeitswillig zu machen. Das Arbeits- und Zuchthaus spiegelte die Werte einer idealen Arbeitsgesellschaft und zugleich bot es die Antwort auf alle sozialen Probleme.
Im Zuchthausmodell kulminieren vier sozialpolitische Entwicklungstendenzen zu einer einzigen Synthese: "1. Die Tradition der ‚stationären' Armenpflege, der Hospitäler, Armen- und Waisenhäuser; 2. Der Gedanke der Arbeitserziehung, der seit dem spätmittelalterlichen, reichsständischen Armenordnungen die Armenfürsorge zunehmend dominiert und im protestantischen wie humanistischen Denken gleichermaßen entwickelt wurde; 3. Die beginnende Auflösung von Todes- und Körperstrafen durch Freiheitsentzug und Zwangsarbeit als Instrument des Strafvollzugs; 4. Schließlich das neu entstehende landesherrliche Interesse an der produktiven Nutzung möglichst aller verfügbaren Arbeitskräfte im Dienste merkantiler Wirtschaftsförderung." (Sachße und Tennstedt 1998, 115)
Das Zuchthaus lieferte viele Antworten auf sozialpolitische Probleme; so z.B. dienten die Anstalten nebenbei als Experimentierfelder für neue Produktionsprozesse. Zeit- und Arbeitseinteilung, die Zergliederung von Arbeitsabfolgen in Teilschritte, die schnell und leicht erlernbar waren, waren mitunter Innovationen aus den Arbeitshäusern. Vor allem die Textilindustrie, die derartige Produktionsformen schnell adaptierte, fand Verwendung für die Insassen von Anstalten. "So sind es gerade die größten Textilproduzenten, die sich in ihrer Produktion am intensivsten auf die Verwendung von Zwangsarbeitskräften stützen. Der Textilunternehmer Lange lässt u.a. in den Arbeitshäusern in Berlin und Potsdam arbeiten, sein Konkurrent Wegely im Zuchthaus in Spandau. Im Bereich der Textilverarbeitung bilden also Zwangsanstalten und Großbetriebe ein Verbundsystem, in dem sich beide Teile wechselseitig ermöglichen und bedingen. Nirgends ist die für einen Großbetrieb erforderliche Anzahl von Arbeitern zur damaligen Zeit leichter zu beschaffen als in den Zwangsanstalten. Umgekehrt: nirgends bieten sich bessere Möglichkeiten für die produktive Verwendung der in den Anstalten einsitzenden Züchtlinge als in den neu entstehenden Großbetrieben." (Sachße und Tennstedt 1998, 119)
Die Arbeits- und Zuchthäuser erfüllten sowohl ökonomische wie bürgerliche Wertvorstellungen. Einerseits garantierten sie ein Reservoir an Arbeitskräften, aus dem sich die neuen Manufakturen und Großbetriebe bedienten und andererseits garantierten sie die Erziehung zur Arbeit. Die wahllos inhaftierten Bevölkerungsmassen sollten durch die Erziehung zur Arbeit gesellschafts- und integrationsfähig gemacht werden. Die Diktatur der Arbeit war ein wesentlicher Charakter der Anstalten; jegliche individuelle Facette, natürliche Regung und persönlicher Ausdruck wurden im Keim erstickt. Das Arbeitsdispositiv ergreift den ganzen Menschen, wirkt auf Körper, Geist und Seele. Die gesamten Maßnahmen waren darauf ausgerichtet. Schon beim Eintritt ins Zuchthaus wurde der Züchtling mit "einem ‚Willkommen' begrüßt, d.h. einer gehörigen Tracht Prügel, mit der ihm unmissverständlich klar gemacht wird, dass er nun mehr dem besonderen Anstaltsregiment unterliegt, dem er sich widerspruchslos zu fügen hat." (Sachße und Tennstedt 1998, 118) Der Tagesablauf war auf die Sekunde hin geplant. Um 5.00 Uhr aufstehen, Nachtruhe ab 22.00 Uhr, dazwischen 13 Stunden arbeiten, mit wenigen kurzen Unterbrechungen für Mahlzeiten und Gebet. "Genaue Zeiteinteilung war mehr als bloße ‚Betriebsordnung'. Sie verweist auf jene ‚Diktatur der Pünktlichkeit', welche das gesamte öffentliche Leben in wachsendem Ausmaß erfasst. Seit dem 14. Jahrhundert hatten es Schlaguhren ermöglicht, langsam von ‚nicht rationalen' Formen der Zeitbestimmung, wie Sonnenaufgang und -untergang oder Sonnenstand, abzugehen." (Stekl 1986, 121)
Neben der Zeit wird auch der Raum, in Form rationalisierter Architektur, als Mittel zur Disziplinierung eingesetzt. Die Anstalten waren eine in sich abgeschlossene Struktur. Kontakte zur Außenwelt waren nicht möglich und die Bewegungsfreiheit der Insassen war auf ein Minimum beschränkt, jede menschliche Regung wurde überwacht. In den Zellen wurden unvermutete Visitationen durchgeführt, der Züchtling war sich nie sicher, ob er überwacht wurde oder nicht. Damit war er gezwungen, sich selbst zu kontrollieren und die Machtmechanismen zu internalisieren. Foucault hat diese materialisierte und internalisierte Form der Überwachung als Panoptimismus beschrieben. Vorbild war Benthams Panopticon bzw. "die Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische Funktionieren der Macht sicherstellt. Die Wirkung der Überwachung ‚ist permanent, auch wenn ihre Durchführung sporadisch ist'; die Perfektion der Macht vermag ihre tatsächliche Ausübung überflüssig zu machen; der architektonische Apparat ist eine Maschine, die ein Machtverhältnis schaffen und aufrechterhalten kann, welches vom Machtausübenden unabhängig ist; die Häftlinge sind Gefangene einer Machtsituation, die sie selber stützen. [...] Zu diesem Zweck hat Bentham das Prinzip aufgestellt, dass die Macht sichtbar, aber uneinsehbar sein muss; [...]." (Foucault 1991, 258)
Der Freiheitsentzug arbeitsunwilliger Individuen stellte eine Gegenmaßnahme zu ihrer ausschweifenden und ungezügelten Lebensführung dar. Der Arbeitszwang innerhalb der Anstalten wirkte dabei als verlängerter Arm gesellschaftlicher Arbeitspflicht. Armut war in den Augen der wohlhabenden Bürger im 17. und 18. Jahrhundert ein selbstverschuldeter Zustand, der durch Nicht-Arbeit hervorgerufen wird. "Die ‚liederlichen' und ‚muthwilligen' Bettler wollen in ihrer moralischen Verkommenheit nicht arbeiten, sondern auf Kosten anderer Leute angenehm leben." (Fandry 1990, 77) Dieser ideologische Hintergrund führte schlussendlich zur Auflösung der traditionellen Armenfürsorge durch Klöster, Stiftungen, Hospitäler und Zünfte. Für den absolutistischen Staat war die Armenfürsorge nebensächlich, er konzentrierte sich aufs höfische Prestige, auf den Ausbau militärischer Strukturen und auf exorbitante Prachtbauten nach Versailler Vorbild. Die Finanzmittel wurden vor allem diesen Zwecken zugeführt. Gemeinden und kommunale Strukturen wurden durch die Zentralisierung des Steuerwesens finanzielle Mittel entzogen, welche zuvor der Armenfürsorge zugute kamen. In der Folge wurden Sozialleistungen knapp gehalten, oder gar nicht bezahlt. Kommunen reduzierten ihre Armenfürsorge nur noch auf Bedürftige der Heimatgemeinden. "Theoretisch müsste dieses Konzept aufgehen, doch angesichts der räumlichen Mobilität der Bevölkerung als Folge der sozialökonomischen Entwicklung (Städtewachstum) ist es einfach praxisfremd." (Fandry 1990, 81) Durch die Kriegswirren wurden sie aus ihren Heimatorten herausgerissen, als Soldaten und Flüchtlinge zogen sie als Heimatlose durchs Land. Als Umherziehende bekamen sie keine Unterstützung und durch sogenannte "Bettlerschübe" und polizeiliche Razzien wurden sie ständig vertrieben. "Können sie das betreffende Gebiet aus eigener Kraft nicht verlassen, lädt man sie auf Karren und transportiert sie in den so genannten ‚Bettelfuhren' ab. Nachbargemeinden und -territorien verweigern manchmal die Übernahme der Bettelfuhren; die Behinderten und Kranken müssen wieder zurückgefahren und unwillig weiter verpflegt werden, bis ein Versuch klappt, sie über die Grenzen abzuschieben." (Fandry 1990, 81)
Oft kam es zu regelrechten "Betteljagden", die Arbeitsunfähigen wurden abgeschoben und die arbeitsfähigen Bettler wurden ins Arbeitshaus gesteckt. "Erneute Betonung der Arbeitspflicht aller Armen, verstärkter Kampf gegen Bettelei und Vagabondage, Aufbau der Polizeiapparate sowie Verbreitung der Freiheitsstrafe mit konsequenter Nutzung der Arbeitskraft der Häftlinge waren wichtige Elemente nunmehr gesamtstaatlicher Strategien. Die Zucht- und Arbeitshäuser bildeten dabei einen Apparat, der in erster Linie eine veränderte Einstellung zur Arbeit internalisieren sollte [...]." (Stekl 1986, 126) Arbeitszwang, Strafen und Überwachen waren die Mittel um den "homo laborans" zu formieren. Zu diesem Zweck wurden Methoden und Instrumente entwickelt, die direkt über den Körper auf die Psyche wirkten. Arbeitsmoral und Verhaltenscodes wurden den Insassen förmlich ins Gedächtnis gebrannt. Die Steigerung der Arbeitsmoral und die Besserung des Verhaltens waren die alleinigen Kriterien, um aus den Anstalten entlassen zu werden. Arbeitsrehabilitation verfolgte immer auch eine Sozialisierungsabsicht, durch die Einüben von Verhaltens-, Anstands- und Sittenvorschriften sollten die Menschen lernen rational zu handeln und Affekthandlungen zu vermeiden. "Die Selbstkontrolle wurde allerdings durch Fremdkontrolle ergänzt. [...] Nicht nur das Personal hatte hier Aufsichtskompetenzen, auch Mithäftlinge machte man solches zur Pflicht. Wer strafbare Handlungen anderer verschwieg und sie nicht dem Stab anzeigte, dem drohte dieselbe Strafe wie dem Übeltäter. Diese Strategien öffnete nicht nur der Denunziation Tür und Tor. Diese Taktik aller ‚totalen Institutionen' gestattete es auch den Verwaltungsorganen, Lücken in der Überwachung zu schließen und Solidarisierungsversuche zwischen den Häftlingen zu unterbinden." (Stekl 1986, 138) Solche Modelle zur Überwachung der Insassen zerstören gleichzeitig jegliche Formen der Solidaritätsgemeinschaft und füllten das Machtvakuum zwischen der Anstaltsführung und den Inhaftierten. In den Arbeits- und Konzentrationslagern des Nationalsozialismus wurden diese Modelle adaptiert und auf die Spitze getrieben. Die SS setzte Häftlingsfunktionäre ein und von "diesen wurde unbedingte Ausführung der Befehle verlangt, das heißt eine aktive Beteiligung an der Durchsetzung des Lagerregimes, an der Überwachung der anderen Häftlinge, an der Organisation der Zwangsarbeit und später an der Aussonderung."[3] (Buchenwald 2007, 99)
Ein weiterer Erziehungsanspruch der Anstalten liegt in der Hinführung der Häftlinge zu einer bescheidenen und tugendhaften Lebensführung. Mäßigkeit, Sparsamkeit und Konsumverzicht galten damals als Inbegriff moralischen Verhaltens. Und im Sinne der protestantischen Wirtschaftethik waren diese Werte Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum und Wohlstand. "Derartige Leitgedanken galten bei den Ökonomen des 17. und 18. Jahrhunderts auch für die armen Bevölkerungsschichten; dies gewiss auch deshalb, weil die bürgerlichen Standards ihrerseits selbst wieder Rang und gesellschaftliche Stellung anzeigten. In erster Linie erwartete man sich aber von der Einschränkung und Umschichtung des Nahrungsmittelverbrauchs ebenfalls eine entscheidende Ankurbelung der industriellen Produktion. Der ‚arbeitende Arme' war also nicht nur als billige Arbeitskraft von Interesse [...] [sondern] man [sah] in ihm [...] auch den Konsumenten. Armsein galt aus dieser Perspektive jedoch nicht bloß als Zustand, sondern als erzwungener maßen rationelle Verhaltensweise, welche die bescheidenen Ressourcen rationell einzuteilen verstand." (Stekl 1986, 139) Deswegen wurden Essensrationen für die Insassen der Arbeitshäusern sehr knapp gehalten, um die Menschen an ein Leben in demütiger Armut zu gewöhnen. "Mangelnde Ernährung in Zusammenhang mit völlig ungenügenden hygienischen und sanitären Verhältnissen und einer ebenso ungenügenden medizinischen Versorgung führen in einigen Anstalten zu einer erschreckend hohen [...] Sterblichkeit." (Sachße und Tennstedt 1998, 119)
Am Ende des 18. Jahrhunderts kam Widerstand gegenüber der massenhaften Einsperrung breiter Bevölkerungsschichten auf. Der Grund lag jedoch nicht in einer humaner werdenden Auffassung, sondern im Interesse einer liberalen Wirtschaftspolitik, die "freie" Arbeitskräfte benötigte. Denn ein zahlenmäßig umfangreicher freier Arbeitskräftepool erfüllte den Zweck, die Arbeitslosenrate in die Höhe zu treiben. D.h. die Industrie benötigt Arbeitslose, damit sie die Lohnforderungen ihrer Arbeiter in den Keller treiben konnte. "Um Lohnforderungen abzuwehren, möglichst geringe Löhne zahlen und die Produktionskosten möglichst niedrig halten zu können, mussten die Unternehmer über eine Arbeitslosenreserve verfügen, aus der sie bei Bedarf Arbeitskräfte rekrutieren konnte. Dass diese berüchtigte Reservearmee des Kapitalismus, von der Marx sprach, geschaffen werden musste, war damals am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts allen Politikern und Unternehmern vollkommen klar. Daran waren die großen Internierungsanstalten des 17. und 18. Jahrhunderts, die überschüssige Arbeitskräfte wie einen Schwamm aufsaugten, nun nicht nur unnötig, sondern geradezu schädlich." (Foucault 2003, 630) Alle, die arbeiten konnten wurden nun aus den Anstalten entlassen; wer nicht arbeiten konnte blieb drinnen, das waren letztlich die sogenannten Irren, Schwachsinnigen, Kranken, deren Störungen "charakterliche oder psychologische Ursachen hatten." (Foucault 2002, 164)
Für Foucault wurde damit ein neuartiges Ausschlusssystem geschaffen, das für bestimmte Gruppen, die nun genau klassifiziert und differenziert wurden, das Arbeits- und Zuchthaus ersetzen sollte. Es entstand ein Krankenhaussystem, das zwei Gesichter besaß: "auf der einen Seite ein Krankenhaus, das all jene, die aus körperlichen Gründen nicht arbeiten konnten, aufnehmen und nach Möglichkeit heilen sollte: auf der anderen Seite ein Krankenhaus, das all jene aufnahm, die aus anderen als körperlichen Gründen nicht arbeiten konnten, also aus Gründen, die man schon bald als psychologisch bezeichnete." (Foucault 2003, 631) Damit war die Geburt des "Geisteskranken" und die der Psychiatrie und Heilanstalten besiegelt. Eine neuartige, auf medizinische Terminologien beruhende Klassifikation ermöglichte erstmals einen differenzierten Blick auf "geistig behinderte" bzw. "kranke" Menschen. Damit beginnt eine Periode, die die Fürsorge auf neue Beine stellen wird und sich auf Ausschluss, Therapie, Rehabilitation und Heilung beruft. Dieser Wandel, der im eigentlichen Sinne kein Wandel ist, sondern die Funktionsweise des Arbeitshauses lediglich auf die Psychiatrie überträgt, stellt unter anderem den Beginn der modernen Behindertenarbeit dar.
Menschen mit Behinderung nahmen wahrscheinlich immer schon eine gesellschaftlich marginale Position ein, darum wäre es falsch, ihren Status zu idealisieren. Behinderte waren auch in den vergangenen Jahrhunderten Projektionsflächen für Ängste und verschiedene Vorurteile. Die heutige Wahrnehmung von Behinderung unterscheidet sich jedoch wesentlich von der mittelalterlichen oder von den Vorstellungen nachfolgender Epochen.
Die mittelalterlichen Reaktionsweisen gegenüber behinderten Personen waren vielschichtig, die Spannweite erstreckte sich vom Mitleid, über Spott und Hohn bis zur religiösen Überhöhung. "Aufgrund der überragenden Bedeutung der Religion im geistigen Leben des Mittelalters drückten sich (heute so genannte) psychotische Vorstellungen häufig in religiösen bzw. religiös interpretierbaren Formen aus." (Fandry 1990, 14) Wahnvorstellungen wurden als "religiöse Erscheinungen" oder als das Gegenteil, "teuflische Besessenheit" interpretiert. Religiosität, Aberglaube und christliche Nächstenliebe bildeten das Konglomerat worauf die Beziehungen zu behinderten Menschen beruhten. Der Wechselbalg war z.B. die Ausgeburt eines tief verwurzelten Aberglaubens. "Nach heidnischer Vorstellung war dies ein missgestaltetes nichtmenschliches Wesen (falsches Kind), das die elbischen Wesen der Unterwelt (Trolle, Kobolde, Elfen, Wichtelmännchen, Zwerge) anstelle des gesunden Menschenkinds (bevorzugt Knaben), das zur Veredlung des eigenen Geschlechts benötigt wurde, zurückließen. Nach christlichem Aberglauben waren es Teufel und Hexen, die sich der reinen Seele der unschuldigen Kinder bemächtigen wollten und an deren Stelle ein satanisches Wesen zurückließen." (Mattner 2000, 22)
Andererseits waren behinderte Familienmitglieder oft gut in die Hausgemeinschaft des Mittelalters integriert. Alle Mitglieder der Hausgemeinschaft bewirtschafteten gemeinsam den Bauernhof und produzierten nahezu sämtliche benötigten Nahrungsmittel, Kleidung und Gerätschaften selbst. Diese in sich geschlossenen Wirtschaftformen räumten behinderten Menschen viel Platz ein, sie verrichteten kleinere und weniger anspruchsvolle Tätigkeiten. Der Schutz der "schwächeren Familienmitglieder" wurde auch durch das frühe mittelalterliche Recht gewährleistet. Menschen mit geistigen Behinderungen, die als "Törichte", "Dumme", "Schwachsinnige" oder "Irre" bezeichnet werden, wurden zwar von der Rechtssprechung ausgeschlossen - ihr Wort war nicht rechtsgültig; im Gegenzug durfte über sie aber auch nicht gerichtet werden - und doch waren die Hausgemeinschaften verpflichtet sie zu behüten und zu beschützen.
Durch die gesellschaftliche Ausdifferenzierung ab dem Spätmittelalter zeichnete sich ein zunehmender Ausschluss von Menschen mit Behinderung ab. Die auf Subsistenzwirtschaft beruhenden Hausgemeinschaften lösten sich auf, viele behinderte Menschen fielen aus dem sozialen Gefüge der Familie heraus und mussten sich, um Almosen bettelnd, selbst durchs Leben schlagen. Die Klöster wurden Zufluchtsstätten und Umfeld behinderter Menschen. Mancher trat sogar als Laienbruder in die Klostergemeinschaft ein. Der Adel gab seine behinderten Mitglieder gern in die Obhut der Klöster, ausgestattet mit Schenkungen für eine standesgemäße Lebensführung. Der Großteil fand in den klösterlichen Hospitälern Unterkunft und Verpflegung. "Bis zum 15. Jahrhundert leben die geistesgestörten Bewohner des Hospitals mit anderen Siechen und Pfründnern zusammen. Im 15. Jahrhundert beginnt man Zellen in den Spitalsgebäuden einzurichten, teils innerhalb der bestehenden Häuser, teils als Anbau oder als Neubau auf dem Spitalsgelände, wo die Irren - und zur Strafe auch die ungehorsamen Kranken - eingesperrt wurden. [...] Einige Funktionen der alten Hospitäler werden in neu gegründete Einrichtungen verlagert." (Fandry 1990, 39) Es entstanden Hospitäler, die je nach Funktion bestimmte Gruppen von Bedürftigen und Behinderten aufnahmen (z.B. nahmen Hospitäler, die dem Heiligen St. Anton gewidmet waren, vorzüglich Epileptiker auf). In den Städten wurden tobende Irre, in so genannte "Tollkisten" gesperrt, in denen sie sich wieder beruhigen sollten, um nach einiger Zeit wieder freigelassen zu werden.
Die meisten behinderten Menschen gehörten zu den armen Schichten. Bettelnd und unstetig zogen sie übers Land, sie traf dasselbe Schicksal wie die anderen vagabundierenden und entwurzelten Volksmassen. "Nur bei offensichtlich Unzurechnungsfähigen wurde ein Schiffer oder Fuhrmann beauftragt, sie fortzuschaffen. Er brachte sie in den Heimatort - sofern er feststellbar war - oder ließ sie irgendwo stehen, ohne dass sich jemand um ihr weiteres Schicksal kümmerte." (Häßler und Häßler 2005, 25) Die Säkularisierung der Armenfürsorge ging mit dem gewaltsamen Ausschluss und der Isolierung von geistig und psychisch behinderten Menschen einher. Die Zeiten, da Almosen selbst in allgemeinen Notzeiten ein Überleben sicherten, waren vorbei.
Der Siegeszug der frühkapitalistischen Arbeitsgesellschaft im 16. und 17. Jahrhundert rückte nun nicht nur die Armut und Arbeitslosigkeit in die Nähe eines Strafbestands, sondern auch den "Schwachsinn". Die neue Arbeitsmoral setzte ein hartes Ausschlusssystem in Gang, und zwar gegenüber allen Formen des Wahnsinns und des normabweichenden Verhaltens. Das Bürgertum als Siegerin der gesellschaftlichen Umwälzprozesse etablierte neue Werte-, Moral- und Verhaltensvorschriften, die ihren politischen und sozialen Status festigten und abweichende Lebensformen degradierten. "Die Standesehre der höfischen Kreise weitete sich aus zur Familienehre, auch oder gerade in bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen. Das Ansehen und der Status in der Gemeinschaft werden nicht nur mit der wirtschaftlichen Grundlage der Familie und ihrer Herkunft verbunden, sondern im engeren mit dem Verhalten der einzelnen Mitglieder im Familienverbund." (Häßler und Häßler 2005, 40)
Den behinderten Menschen traf dies im besonderen Maße. Zum einen setzte ein behindertes Familienmitglied die Ehre und die gesellschaftliche Anerkennung der gesamten Familie aufs Spiel, so dass sie vor den Blicken der Öffentlichkeit versteckt und eingesperrt wurden. Zum anderen sind sie "unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Menschen" (Mattner 2000, 27), zu einer finanziellen Belastung für die gesamte Familie geworden; sie waren nutzlos und überstrapazierten die finanziellen Lebensgrundlagen. Vor dem Hintergrund der neuen Moral, der wirtschaftlichen Entwicklungen und der ökonomischen Mechanismen, sank die Toleranz gegenüber behinderten Menschen auf ein Minimum, was zu ihrer totalen Isolierung führt.. Außerdem bedeutete normabweichendes Verhalten in den Augen des Bürgertums, eine Gefahr für die soziale Ordnung. Der "Irre" und "Schwachsinnige" deckte, gemeinsam mit den Verbrechern, Betrügern, Hochstaplern, Prostituierten, Libertins, Dieben, Vagabunden, Trunk- und Spielsüchtigen usw. das gesamte Spektrum asozialen Verhaltens ab. All jene Gruppen zog es ab dem 17. Jahrhundert in den Bannkreis der Zucht- und Arbeitshäuser. Rasende und Tobende wurden in gesonderte Räume gebracht und in Ketten gelegt. "Wer nicht von sich aus die nötige Einsicht für ein normgerechtes Verhalten aufbrachte, musste durch Arbeit mit wechselndem Grad der Schwere zur Besserung gebracht werden. Für die Schwachsinnigen blieb es wohl der Kreislauf zwischen Arbeit - Essen - Schlafen. Darüber waren sich auch die Wärter im Klaren. Denn die häufigste Strafe für die im Allgemeinen harmlosen Schwachsinnigen waren Essens- und Schlafentzug." (Häßler und Häßler 2005, 43)
Zu bemerken ist, dass der "Irre" und "Schwachsinnige" nicht als solcher ins Arbeitshaus eingekerkert wurde, sondern als jemand, der sich nicht den gesellschaftlichen Normen und insbesondere der Arbeitsmoral fügte. Man behandelte ihn nicht als Kranken, sondern als Menschen, der unfähig ist, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Der behinderte Betroffene war Gleicher unter Gleichen, der nicht aufgrund seiner Beeinträchtigung inhaftiert wurde, sondern aufgrund seines moralischen Fehlverhaltens. Ins Arbeits- und Zuchthaus wurden nicht nur behinderte Menschen aus den armen Bevölkerungsschichten interniert, sondern quer durch alle Sozialschichten war das Arbeits- und Zuchthaus ein beliebter Ort, um sich dieser Individuen zu entledigen. In Frankreich z.B. wandten sich Adelige "direkt an die Zentralgewalt, das heißt an den König, und baten um einen lettre de cachet oder eine ähnliche Verfügung, die es ihnen ermöglichte, sich der betreffenden Personen zu entledigen und sie internieren zu lassen. Familien aus dem Bürgertum oder dem einfachen Volk wandten sich an die regionale Macht [...]." (Foucault 2003, 618) Diese weit verbreitete Abschiebepraxis wurde mit dem Argument erbracht, dass die "Irren" und "Schwachsinnigen" nicht nur für die Familie, sondern für die gesamte Bevölkerung eine soziale Gefahr bedeuteten. Eine zeitweilige Internierung mündete dann schnell in lebenslange Haft und in die dauerhafte Lösung eines unangenehmen Problems.
Seit dem Mittelalter - sicher aber auch in den vorangegangenen Epochen - wurden Menschen mit Behinderung vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Denn nach Foucault weist jede Gesellschaft Grenzen auf, die durch Regeln und Zwänge definiert sind. Durch diese Grenzziehung gewinnt sie ihre Identität. In jeder Gesellschaft gab und gibt es Menschen und Verhaltensformen, die diese Grenzen überschreiten und von gesellschaftlichen Teilbereichen ausgeschlossen sind. Foucault verweist dabei auf vier maßgebliche Ausschlusssysteme: Arbeit, Familie, Spiel und Diskurs. Der Ausschluss aus einem Bereich führt jedoch nicht zwangsmäßig zum Ausschluss aus einem anderen, d.h. einem Arbeitslosen wird z.B. nicht verboten zu heiraten. Der besondere Status des "Irren, "Schwachsinnigen", "geistig Behinderten", ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass er seit dem Ende des Mittelalters langsam aus allen vier Bereichen, aus der Arbeit, der Familie, dem Spiel und dem Diskurs ausgeschlossen wird. Der Ausschluss aus dem System der Arbeit und der Familie wurde bereits beschreiben. Anzumerken bleibt, dass sich in diesen Bereichen die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung kaum verändert hat. "Geistige Behinderung" und Arbeitslosigkeit bilden einen offenkundigen Zusammenhang. Von der Sonderstellung innerhalb der Familie bzw. von der Ausgrenzung aus dem familialen System kann dasselbe gesagt werden. Sexualität und Reproduktion sind Themen, über die zwar diskutiert wird, die in der Praxis jedoch Scheu, Scham und Abwehr hervorrufen.
Auf den Ausschluss aus dem Spiel (oder Fest) und aus dem Diskurs soll an dieser Stelle näher eingegangen werden. In allen Gesellschaften hatte das Fest eine wichtige Funktion für das soziale Zusammenleben. Das Fest ist jener Moment, in dem die gesellschaftliche Ordnung durchbrochen wird. Es steht außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung, es leitet einen undifferenzierten Zustand ein, der im genauen Gegensatz zur Struktur der Gesellschaft steht und zur Inversion der Normen führt: "der Sklave ist König; der König Sklave". Das archaische Fest löste autoritäre Positionen auf, leitete eine Statusumkehrung ein und hatte damit die Funktion, immanente gesellschaftliche Spannungsverhältnisse, die gezwungenermaßen durch die soziale Ordnung und Differenzierung entstehen, abzuleiten und zu kanalisieren. Durch das Fest ereignet sich ein sozio-emotiver Zustand, der die menschliche Gemeinschaft zusammenschweißt, indem er die Unterschiede auflöst und die vorher herrschenden Machtverhältnisse von neuem regeneriert, aber nicht umstrukturiert.
Ein wichtiges Fest im Mittelalter war das Narrenfest; während der Festzeit verkleideten sich die Menschen so, dass sich ihr sozialer Status ins Gegenteil verkehrte. Das Narrenfest war das einzige nicht-religiöse Fest. "[E]s war das Fest der verkehrten Religion, das Gegenfest, das Fest der Gegenreligion, gleichsam ein Vorspiel zu Luthers Reformation. Interessant ist jedenfalls, dass gerade das einzige Fest, das nicht unter der Regie der Kirche stattfand, als das Fest der Narrheit verstanden wurde. Statt der Ordnung übernahm der Wahnsinn die Herrschaft in der Stadt." (Foucault 2003, 624)
Solche Feste wurden im Laufe der Geschichte zusehends verdrängt. Der Wahnsinn in Form des Gegenfestes, als integrativer Teil und als Regenerationspotential gesellschaftlicher Ordnung, ist verschwunden.
Das vierte Ausschlusssystem welches Foucault benennt ist das des institutionellen Diskurses. Im Mittelalter hatte die Rede des Irren, in der Figur des Hofnarren,[4] eine besondere Bedeutung. Der Hofnarr repräsentierte eine Figur, die "die moralischen Werte der Communitas im Gegensatz zur Zwangsmacht der höchsten politischen Herrscher" (Turner 1989, 108) symbolisierte und: "In geschlossenen oder strukturierten Gesellschaften symbolisierte das marginale oder ‚inferiore' Mitglied oder der ‚Außenseiter' oft das ‚Gefühl für Humanität' [...]." (Turner 1989, 109) Der Hofnarr repräsentierte eine Gegenmacht und spiegelte die Bedürfnisse und die Bedürftigkeit des kleinen Volkes. Der Hofnarr hält dem Herrscher den Spiegel vor, er verankert ihn im Alltag und in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Im 18. Jahrhundert verschwand die Figur des Hofnarren von der Bildfläche höfischer Kreise.
Der Wahnsinn nahm laut Foucault in allen Gesellschaften und zu allen Zeiten eine Randposition zu den vier gesellschaftlich relevanten Bereichen (Arbeit, Familie, Spiel/Fest und Diskurs) ein, gleichzeitig spielte er aber auch eine integrative und eine für die Gesellschaft zum Teil konstitutive Rolle. Diese Wirkung hat er zu Beginn der Moderne verloren; in ihr wird er ausgeschlossen, unterworfen und als medizinische Kategorie verobjektiviert. Als eigene Entität ist der Wahnsinn erstmals am Anfang des 19. Jahrhunderts in Erscheinung getreten. Im Zuge der Industrialisierung wurde eine Arbeitskraftreserve, d.h. ein Heer von arbeitslosen Menschen benötigt, um die Lohnforderungen der Arbeiter in den Keller zu treiben. Eine Strategie dafür lag in der Auflösung der Arbeitshäuser. Wer arbeiten konnte, wurde aus den Anstalten entlassen, der Rest blieb in den nun modifizierten Arbeitshäusern als Irren- und Heilanstalten eingesperrt; das waren die Irren und Wahnsinnigen nun als Patienten, mit charakterlichen oder psychologischen Störungen. "Deshalb ist aus dem Irren in unseren Gesellschaften der Geisteskranke geworden. Der Geisteskranke ist nicht die endlich entdeckte Wahrheit des Wahnsinns, sondern dessen spezifische kapitalistische Ausprägung [...]." (Foucault 2003, 632)
Behinderung als kulturell verstandene Kategorie wird wesentlich von hegemonialen Diskursen hervorgebracht. Am Beispiel einer Aussage, die ein Betreuter einer geschützten Werkstatt im Rahmen eines Interviews mir gegenüber äußerte, will ich die performative Macht von Diskursen kurz darlegen.
"Geistig behindert bin ich nicht! Dass ich geistig behindert bin, hab ich von meiner Mutter. Die sagt das schon und sie sagt: Ja, weil ich geistig behindert bin, bin ich auch bei der Lebenshilfe."
Das Zitat widerspiegelt eine Anrufungsszene, die Mutter ruft ihren Sohn in den Status eines "geistig Behinderten". Die Aussage der Mutter steht zugleich jedoch im Widerspruch zum Selbstbild des Sohnes. Die Frage, die sich daraus ergibt lautet: Warum beschreibt die Mutter eine Realität und weshalb ist die Aussage des Sohnes falsch?
Deleuze und Guattari geben darauf den Hinweis, dass die Sprache, "noch bevor sie zum Gegenstand der Linguistik wird, eine Angelegenheit der Politik" (Deleuze und Guattari 1992, 193) und eine Markierung der Macht ist. Macht verweist in seiner etymologischen Betrachtung auf das Wort "Können", von dem es abstammt und im Sinne von "Vermögen" gebraucht wurde. (Kluge: Etymologisches Wörterbuch 1999) "Die früheren Verwendungsformen lassen erkennen, dass ‚Macht' nicht erst nachträglich auf Möglichkeiten im Bereich des sozialen Geschehens übertragen wurden; ihre originäre Bedeutung entwickelt sie gerade im Hinblick auf jene Vorgänge, bei denen ein Mensch über andere Menschen etwas ‚vermag'. Das ‚Vermächtnis' ist, wörtlich genommen, also nicht der Akt, in dem jemandem etwas ‚vermacht' wird, sondern vielmehr die ausdrückliche Übertragung einer Handlungsmacht. Macht indiziert die Chance, ein Tun und Lassen zu beeinflussen; ihr Grundtypus liegt nicht in der Bearbeitung von Gegenständen, sondern in der möglichen Verfügung über sich und über andere - und nur insofern auch über Gegenstände. Das ursprüngliche Anwendungsfeld des Machtbegriffs ist das menschliche Handeln, so wie es im sozialen Kontext wahrgenommen werden kann." (Gerhardt 1996, 11)
Macht als menschliches Handeln oder das Vermögen zu Handeln ist notwendig, um sich gegen eine andere Macht abzugrenzen bzw. zur Wehr zu setzen. "Eine Macht entsteht somit erst in der Opposition zu anderen Mächten. "Vermögen der Verfügung über andere Macht - das ist Macht." (Gerhardt 1996, 14) Durch diese spezifische Leistung entstehen im sozial-gesellschaftlichen Gefüge Differenzierungen. "Die Verfügung einer Macht über eine andere Macht bringt eine Rollenverteilung mit sich, die jedes Machtverhältnis charakterisiert. Die Verfügung kann nur bei entsprechendem Machtgefälle gelingen. Im Verfügungsanspruch liegt das Streben nach Überlegenheit, denn nur aus der Position des Überlegenen kann die Verfügung wirksam sein." (Gerhardt 1996, 14) Macht ist von ihrer Begrifflichkeit her also auf soziale Prozesse bezogen und im Augenblick ihres Auftretens entstehen soziale und gesellschaftliche Konstellationen, in der sie für Spannung, Abhängigkeit, aber auch für Ordnung sorgt. Hinsichtlich unserer Anrufungsszene lässt sich folgern, dass die Mutter gegenüber ihrem Sohn einen überlegenere soziale Position bezieht. Sie besitzt die Macht, ihn als geistig behindert zu bezeichnen; in der Anrufung geht die Macht eine Verbindung mit der Sprache ein.
Angenommen, die Mutter würde ihrem Sohn Glauben schenken? Die Werkstattleitung, die Betreuer und Erzieher würden dutzende Argumente gegen ihren Glauben ins Feld führen. Sie würden die ärztliche Diagnose der Chromosomenabweichung aus der Schublade ziehen, sie würden auf das psychologische Funktionsprofil verweisen, das einen IQ im Bereich von 35/40 attestiert, also eine mittelschwere geistige Behinderung. Sie würden die Erfahrungen der Schule heranziehen, wo ihr Sohn im achten Schuljahr immer noch nicht über das Niveau eines Schulanfängers hinauskam. Schon damals zeichneten sich wenige Entwicklungsmöglichkeiten ab. Weiters würde man auf sein Sozialverhalten hinweisen, auf seine geringe Leistungsfähigkeit, auf seine Unselbständigkeit in allen Lebensbereichen und sie würden die richterliche Verfügung zur Entmündigung vorlegen. All diese einzelnen Indizien und Aussagen würden sich dabei zu einem einzigen Diskurs formieren, der die geistige Behinderung des Sohnes unwiederbringlich und wahrhaftig bezeugt. Sie würden der Mutter eindringlich bedeuten, zur Vernunft zu kommen und die Realität zu akzeptieren, wenn sie nicht Gefahr laufen will, sich lächerlich zu machen. Die Mutter würde erkennen, dass es besser ist, die Worte in den Dienst einer bestimmten Ordnung zu stellen, dass es nicht angebraucht ist, sie nach Lust und Laune und im guten Glauben zu verwenden. Denn "die Sprache ist nicht dazu da, um geglaubt zu werden, sondern um zu gehorchen und Gehorsam zu verschaffen." (Deleuze und Guattari 1992, 106)
Das Zitat und die weiterführenden Gedanken zeigen, dass eine individuelle Aussage keinen Wert hat, insofern sie sich nicht auf einen Kontext bezieht, der das definiert, kontrolliert und beherrscht, was im Sprechakt gesagt wird. Der Sohn unterliegt einem fatalen Irrtum, denn die Fakten liegen auf dem Tisch, die Diagnose "geistige Behinderung" passt! Jeder, die Werkstattleitung, die Betreuer, Psychologen, Ärzte und Pädagogen bestätigen die Aussage der Mutter und nicht zuletzt findet sie dadurch zu ihrer Wahrheit. Die Wahrheit wird durch das kollektive Gefüge und durch den hegemonialen Diskurs, der sich nach bestimmten Codes und Formationsregeln bildet, erzeugt und gefördert. Die Aussage des Sohnes ist und bleibt ein sinnloses Gerede, lärmendes und delirierendes Sprechen.
Wissen und Macht sind Garanten der Wahrheit. Macht begründet Wissen und umgekehrt, woraus der Sprechakt das Vermögen bezieht, einen angerufenen Anderen als soziales Subjekt zu konstituieren. Der Diskurs erzeugt Materialität und er zwingt das Subjekt in den Rahmen einer bestimmten Interpretation, in der sich Wissen, Wahrheit und Macht vereinen. "Jeder Punkt der Wissensbildung ist zugleich ein Ort der Machtausübung. Wissen und Wahrheit sind an Machtwirkungen gebunden; sie bilden eine Dimension und Wirkmöglichkeit von Macht. Macht zeigt sich darin, dass etwas zum Gegenstand des Wissens wird und Wahrheitswirkungen hervorbringt. Was als Wahrheit gilt, ist ja nichts anderes als ein diskursiver Effekt. Wahrheit ist hervorgebracht. Macht ist hier ein dezentriertes, regelgeleitetes Operieren mit geordneten Elementen eines übersubjektiv aufgebauten Systems, als diskursiv-, wirklichkeits- und wahrheitskonstituierende Macht, die Menschen in den semantischen Rahmen einer bestimmten Weltauslegung zwängt." (Bublitz 2002, 25)
Die Wahrheit des Diskurses, seine Materialität, die Verschränkung von Macht und Wissen ist deshalb wirksam, da er sich ständig von einem Subjekt, durch einen Text, durch eine Aussage, durch einen Sprechakt usw. wiederholen und zitieren lässt. Die verschiedenen Autoritäten, in unserem Falle die Betreuer, Ärzte, Pädagogen und Psychologen usw., sprechen nicht alle zur selben Zeit, sie wiederholen und zitieren jedoch immer wieder die Konventionen und Normen, von denen sie die Autorität ableiten, den Sohn als geistig behindert zu konstituieren. Sie markieren die Grenzen der Person, in Abgrenzung zu den gesellschaftlichen Werten und Normen. Sie wiederholen die Grenzen, die Abweichungen und produzieren damit die geistig behinderte Person.
Judith Butler bezeichnet den Mechanismus der Anrufung und die gleichzeitige Konstituierung des sozialen Subjekts als performativen Sprechakt. Der performative Sprechakt erzeugt ein Subjekt in Abhängigkeit von dem, der es benennt. Die interpersonale Beziehung ist nichts anderes, als die Anrufung eines Subjekts durch ein anderes, das durch den Diskurs die Autorität erhält, sein Gegenüber zu benennen. Durch die Benennung und Anrufung wird der oder die Andere in eine symbolische Ordnung eingeführt und ins soziale Leben einberufen. Als "angerufene Wesen [sind wir] von der Anrede des anderen abhängig." (Butler 2006, 48) Als Adressat einer Anrufung wird man, performativ, im Augenblick der Äußerung, als Subjekt konstituiert.
Darin wird deutlich, "dass die Macht abgeleitet ist und dass ihr Ursprung nicht im sprechenden Subjekt selbst liegt." (Butler 2006, 58) Die Einberufung des Subjekts in seine gesellschaftliche Position vollzieht sich durch den autoritären Charakter der Anrufung und "aufgrund der Zitatdimension des Sprechaktes oder aufgrund der Geschichtlichkeit der Konvention, die den Augenblick der Äußerung übersteigt und ermöglicht." (Butler 2006, 58)
"Die Anrufung versucht nicht, eine bereits existierende Realität zu beschreiben, sondern eher eine Realität einzuführen, was ihr durch das Zitat der existierenden Konvention gelingt. Die Anrufung ist ein Sprechakt, dessen ‚Inhalt' weder wahr noch falsch ist, weil ihre erste Aufgabe gar nicht in der Beschreibung besteht. Ihre Absicht ist vielmehr, ein Subjekt in der Unterwerfung zu zeigen und einzusetzen, sowie seine gesellschaftlichen Umrisse in Raum und Zeit hervorzubringen. Ihr reiteratives Verfahren hat den Effekt, ihre ‚Position' über die Zeit hinweg zu sedimentieren." (Butler 2006, 59) Die Anrufung übersteigt letztlich die Autonomie und die Zeit des Subjekts. Durch den performativen Sprechakt wird lediglich der Diskurs eines Macht/Wissensverhältnisses zitiert, wiederholt und gefestigt. Die diskursive Macht verfährt in gewisser Weise ohne Subjekt und zugleich erzeugt und konstituiert es das rufende und angerufene Subjekt. "Dies bedeutet nicht, dass es keine Individuen gibt, die schreiben und diese Formen verbreiten, sondern lediglich, dass diese Individuen nicht die Urheber des Diskurses sind, den sie weiterleiten, und dass ihre Absichten, wie stark sie auch immer sein mögen, letztendlich die Bedeutung des Diskurses nicht kontrollieren. Obgleich das Subjekt zweifellos spricht und es kein Sprechen ohne Subjekt gibt, übt das Subjekt nicht die souveräne Macht über das aus, was es sagt." (Butler, Hass spricht 2006, 60)
Das Subjekt nimmt im Zusammenspiel von Macht, Wissen und Diskurs eine ambivalente Rolle ein, es wird in die Welt gerufen, als soziales Subjekt konstituiert und erkennbar und gleichzeitig erfährt es darin seine Begrenzung und Unterwerfung. Das Subjekt ist in seiner Existenz von diesen Bedingungen abhängig. Die Macht zeigt darin ihren produktiven Charakter; entwirft und produziert sie - entgegen aller Repressionstheorien - doch das Subjekt durch die Unterwerfung. "Subjektivation bezeichnet den Prozess des Unterworfenwerdens durch die Macht und zugleich den Prozess der Subjektwerdung." (Butler 2001, 8)
In dem Augenblick, in dem das Subjekt von sich "Ich" sagt, durch diesen selbstreflexiven Akt, reflektiert es sich vor dem Hintergrund diskursiver Normen, Werte und Konventionen. Das Subjekt ist sich im Moment seiner Bestimmung, im Augenblick seines Denkens, Fühlens, Handelns seiner Selbst immer schon enteignet. "Insofern streichen die Möglichkeitsbedingungen des Subjekts und seine Handlungsmacht, seine diskursive Einsetzung und Anrufung, letztendlich die Möglichkeiten seiner Autonomie und Autogenes durch." (Bublitz 2002, 105) Ein "Ich", welches von sich Rechenschaft abgibt, muss erkennen, dass es gar keine eigene Geschichte von sich selbst hat, "die nicht zugleich Geschichte seiner Beziehung - oder seiner Beziehungen - zu bestimmten Normen ist." (Butler 2003, 20)
Die diskursiv-symbolische Ordnung weist dem Subjekt einen Status zu, der ihn als anerkennbares Subjekt einzusetzen oder auch auszusetzen vermag. Die Anrufung bzw. die symbolische Ordnung entscheidet, ob jemand die Autorität erhält, Kraft seiner Aussage, Wirklichkeit und Wahrheit zu erzeugen und die Möglichkeit besitzt ein anerkanntes Subjekt zu sein. Die Anrufung ist zugleich auch eine Anerkennungsszene. In unserem Beispiel formuliert die Mutter eine Wahrheit, die sich auf das gesamte diskursive Formationssystem und auf das kollektive Gefüge bezieht, qua dessen Autorität die Behinderung ihres Sohnes definiert wird. Die Mutter bezieht im Gegensatz zum Sohn eine anerkannte Position. Der Sohn steht außerhalb der symbolischen Ordnung, seine Aussage findet keine Anerkennung und keinerlei Autorität. "Es gibt eine Sprache, die die Begegnungen einrahmt. Eingebettet in diese Sprache findet sich eine Gruppe von Normen für das, was Anerkennbarkeit ausmacht und was nicht." (Butler 2003, 42)
Innerhalb dieser normierten und normierenden Wahrnehmung durch den anderen besteht die Gefahr, dass der behinderte Mensch seine Souveränität verliert, dass seine Worte nur Schall und Rauch sind, höchstens Gelächter hervorrufen, um angesichts der Autorität seines Gegenübers zu verstummen. "Wie immer er sich und seine Welt auch begreifen und entwerfen mag: Ist er im Wahrnehmungsfeld der ‚Behindernden' erst einmal fixiert, wird er von dort aus in seiner Persönlichkeit zunächst auf die Aspekte seiner Abweichung vom idealen Körperbild reduziert. Indem der ‚Behindernde' den ‚Behinderten' so für sein eigenes idealisiertes Selbstbild verfügbar macht, gewinnt jener auf tragische Weise ein Bewusstsein seiner selbst. Einmal der Verdinglichung durch den ‚Behindernden' ausgesetzt, kann sich der ‚Behinderte' nur schwer außerhalb des Horizontes jener fremden Wahrnehmung auf sich beziehen. Ihm wird der Status eines Objekts zugewiesen, das einer Bewertung unterliegt und in seiner Selbsteinschätzung veranlasst, tatsächlich jenes Objekt zu sein, das der andere taxiert, beurteilt und damit für sich instrumentalisiert hat." (Rösner 2002, 312)
[3] Benedikt Kautsky, Häftling in Buchenwald, schreibt: "Für die Häftlinge, die sich an der Lagerverwaltung beteiligten, ergab sich ständig eine Reihe von schwer lösbaren Problemen, denn sie hatten Befehle der SS entgegenzunehmen und durchzuführen. Sie wirkten also dem Lager gegenüber sozusagen als der ‚verlängerte' Arm der SS, andererseits vermochten sie gerade dadurch, dass die SS sich vielfach um die Ausführung ihrer Befehle im einzelnen nicht mehr kümmerte, und sich bei dem sprunghaften Anwachsen der Lager seit 1938 sich nicht mehr kümmern konnte, die Brutalität vieler Befehle wesentlich abzumildern, wenn sie es nicht vorzogen, sie noch zu verschärfen. Für die Leiter der Häftlingsautonomie ergab sich daher eine große Machtfülle - erstaunlich groß für jeden, der die inneren Verhältnisse nicht beobachten konnte - und mit der Macht kamen alle Versuchungen, die die Macht mit sich bringt. Blockälteste und Capos waren Herren über Leben und Tod der ihnen anvertrauten Häftlinge und sie haben in zahlreichen Fällen von dieser Macht Gebrauch gemacht. Mir ist kein Fall bekannt worden, dass einer dieser Häftlingsfunktionäre von der SS zur Verantwortung gezogen worden wäre, weil er einen Mithäftling zu Tode brachte. Gerade wegen dieser Macht war es daher das denkbar größte Interesse der Häftlinge, das sie ausgeübt wurde von Personen, die sie nicht für ihren eigenen Zweck missbrauchten. Wo dies geschah, wurden die Verhältnisse in den Lagern völlig unerträglich. Die SS hatte in verschiedenen Lagern verschiedene Methoden, aber im wesentlichen konnte man in dieser Hinsicht die Lager in zwei Gruppen einteilen: solche, in denen kriminelle Häftlinge (im Lagerjargon Berufsverbrecher oder nach der Farbe ihrer Abzeichen ‚Grüne' genannt), und solche, in denen politische Häftlinge (nach ihrem Abzeichen ‚Rote' genannt) die Lagerverwaltung in Händen hatten. Man musste ein gehöriges Maß an Robustheit und innerer Unbedenklichkeit mit sich bringen, um sich auf diese Weise zu einem Werkzeug der SS herzugeben. Mit den Kriminellen, bei denen diese Eigenschaften als selbstverständlich anzusehen sind, teilten von den Politischen - sofern es echte Politische waren und nicht irgendwelche Verbrecher, denen die SS aus irgend einem Grund den roten Winkel verliehen hatte - nur die Kommunisten diese Eigenschaften, und ich habe mehr als einen von ihnen so völlig in der Gedankenwelt des Lagers aufgehen sehen, dass er in seiner Wirkung gegenüber seinen Mithäftlingen von einem Berufsverbrecher nicht mehr zu unterscheiden war." (Buchenwald, 2007, S. 100)
[4] Der Hofnarr war bis weit in die Neuzeit hinein eine feste Institution an den europäischen Adelshöfen. "Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts gewann das Phänomen der Hofnarren ständig an Bedeutung und ebbte erst zum Ende des 18. Jahrhunderts ab." (Häßler/Häßler 2005, S. 33) Einige dieser Hofnarren erhielten für ihre Dienste und zur Belustigung und Unterhaltung des Adels ein festes Gehalt. Ihren Dienst verrichteten sie nicht nur für den Hochadel, sondern auch für Adelsfamilien minderen Ranges und zuweilen auch für gutbetuchte Kaufleute. Die Hofnarren mussten jedoch auch viel Spott und Hohn über sich ergehen lassen, der Spaß hatte in manchen Fällen tragische Folgen und führte zum Tod. "Die häufigen Trinkgelage der höfischen Gesellschaft, bei denen an die Narren besonders hochprozentige Getränke im Übermaß gereicht wurden, um sich an den durch Trunkenheit noch mehr enthemmten hilflosen Gestalten zu ergötzen, führten zu einer regelrechten Berufskrankheit für Narren: Leberzirrhose." (Ebd. S. 35) Zu trauriger Berühmtheit gelangten dabei der Hofnarr Friedrich Taubmann (1565 - 1613) tätig am Dresdner Hof und Jakob Paul Gundling am Hof des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I.
Inhaltsverzeichnis
"Im Zeitraum von sechs Wochen nach Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses sind alle in den Schlössern, kirchlichen Häusern, Zucht- und Polizeihäusern oder irgendwelchen anderen Gefängnissen auf Grund von lettres de cachet oder auf Befehl von Vertretern der exekutiven Gewalt inhaftierten Personen, sofern sie nicht rechtmäßig zur Einkerkerung verurteilt worden sind, sofern keine Anklage wegen eines mit Leibesstrafe bedrohten Verbrechens gegen sie erhoben ist oder ihre Väter, Mütter, Großväter, Großmütter oder nahe Verwandte nicht durch Eingaben und Ersuche, die sich auf schwerwiegende Tatsachen stützen, ihre Verhaftung veranlasst haben, und endlich, sofern sie nicht wegen Wahnsinns eingeschlossen sind, auf freien Fuß zu setzen." (nach Castel 1979, 38)
Dieses in Frankreich erlassene königliche Dekret vom 27. März 1790 leitete einen Wendepunkt ein. Die damaligen Zucht- und Arbeitshäuser waren ein Sammelsurium "asozialer" oder durch gesundheitliche Gebrechen aus der Gesellschaft ausgeschlossener Individuen. Herzog von La Rochefoucault-Liancourt beschreibt die Situation im Bicêtre - der Pariser Anstalt für Kranke, Kriminelle, Obdachlose und irre Männer - folgendermaßen: "Das Haus von Bicêtre umfasst kostenlos aufgenommene Arme, Kostgeld zahlende Arme (wobei man vier verschiedene Klassen von Kostgeld unterscheidet), Männer, epileptische Kinder, Skrofulöse [tuberkulöse Haut- und Lymphknotenerkrankung], Paralytiker [Kinderlähmung oder Halbseitlähmung], Wahnsinnige, Menschen, die auf Order des Königs oder auf Haftbefehl des Parlaments ihr eingeschlossen sind und von denen nur ein Teil über Unterhalt verfügt, auf Befehl der Polizei festgenommene oder wegen Diebstahls oder andere Vergehen verurteilte Kinder, Kinder ohne Fehl und ohne Krankheit, die kostenlos aufgenommen wurden; endlich Männer und Frauen, die wegen Geschlechtskrankheiten behandelt werden. Also ist dieses Haus gleichzeitig Hospiz, Hôtel-Dieu, Erziehungsanstalt, Hospital, Zucht- und Besserungshaus." (Castel 1979, 94)
Das königliche Dekret und die Freilassung aller erwähnten Personen war zugleich auch Anlass für eine umfassende Reform. Diese stand in Frankreich in enger Verbindung mit dem Namen Philipp Pinels (1745 - 1825). Pinel war damals der führende Irrenarzt und gilt im Allgemeinen als derjenige, der im Bicêtre die Irren und Wahnsinnigen von ihren Ketten befreite. Ab 1795 wurde er Direktor der Salpêtriere und setzte dort die Reformbewegung fort.
Pinels besonderes Verdienst war die Klassifizierung des institutionellen Raums. Im Konkreten bedeutete dies: "Allgemeine Ordnung in der Verteilung der Kranken: Überweisung der Kinder und der jungen Mädchen an Waisenhäuser; Entfernung der Sechzigjährigen, der Ehegatten und Ehefrauen, ‚häusliche Gemeinschaften' genannt, die man in einem einzig den Frauen bestimmten Hospiz nicht mehr dulden soll; allgemeine Aufgliederung desselben Hospizes in mehrere Abteilungen der älteren, arbeitsfähigen Mädchen von den Siebzigjährigen, den Personen, die sich nach langen Jahren von der Arbeit zurückgezogen haben, den Paralytikern, den Epileptikern, den Geisteskranken, den von Krebs befallenen Frauen, ‚unheilbar' genannten, wobei jede dieser Abteilungen ihre eigenen Gebäude und separaten Höfe haben; Einrichtungen von Werkstätten zum Schneidern, Stricken, Klöppeln und für andere Arbeiten der gesunden Frauen; schließlich ein Speisesaal für das Personal. Dies alles sind echte Zeugnisse einer allgemeinen und verantwortlichen Ordnung an einem Ort, wo früher ungezählte Missbräuche und äußerste Verwirrung herrschten." (Castel 1979, 93)
Pinels Klassifizierung und Systematisierung ermöglichte, die einzelnen Krankheiten mit ihren Besonderheiten und Merkmalen wahrzunehmen und führte damit zu einer stärkeren Ausdifferenzierung des institutionellen Raums. Die Verbrecher und rechtlich Verurteilten wurden ausgesondert und in Gefängnissen untergebracht. Arme Alte, Krüppel und Sieche wurden in Anstalten für Unheilbare untergebracht. Die Hospitäler standen vor allem für heilbare Kranke offen. Die Irren und Wahnsinnigen, die nun erstmals als eigene Kategorie als Geisteskranke auftauchten, wurden in psychiatrischen Idioten- und Heilanstalten interniert. Damit waren die unterschiedlichen Zweige der Gesundheits- und Sozialpolitik, wie wir sie heute noch kennen begründet: 1) Krankenversorgung, 2) Behindertenhilfe, 3) Altenpflege und 5) Armenfürsorge.
Durch die Umgruppierungen, durch die Differenzierung nach Symptomen und die methodische Verteilung der Irren hat eine Rationalität der Krankheit stattgefunden, um die herum sich allmählich ein irrenärztliches und psychiatrisches Wissen zu formieren begann. Dieses Wissen, das den Wahnsinn nicht mehr als moralische Verfehlung, sondern als Geisteskrankheit begreifbar machte, führte zu einer neuartigen Asylpraxis, die nicht mehr auf Züchtigung beruhte, sondern auf Heilung und Therapie. Die Psychiatrie war geboren und damit die systematische Institutionalisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen.
Diese durch Pinel eingeleitete Institutionsreform stellt für V. J. Bradley die erste von drei Phasen im Versorgung-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung dar (siehe Abbildung 1). Jede Phase ist durch einen Paradigmenwechsel gekennzeichnet, der dadurch eingeleitet wird, dass herkömmliche Erklärungen, Anschauungen und Wissensbestände der Realität nicht mehr entsprechen und durch andere ersetzt werden müssen. Damit vollzieht sich eine veränderte Sichtweise gegenüber dem jeweiligen Wissens- und Wahrnehmungsgegenstand, denn die Theorie und die Methode ist immer abhängig von ihrem Gegenstand, den sie behandelt und umgekehrt ist die Beschreibung ihres Gegenstands immer abhängig von der Sichtweise des jeweiligen Theoretikers. Im Bereich der Behindertenhilfe änderten sich deshalb der Rahmen der Dienstleistungserbringung, die Planungs-, Kontroll- und Entscheidungskontexte und parallel zu den Problemdefinitionen wandelten sich zugleich die Lösungsansätze.
Im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Institutionsreform, "werden Menschen mit Behinderung primär als Patienten gesehen, die in Institutionen nach medizinischen und pflegerischen Maßstäben betreut werden. Die hierfür aufgestellten Betreuungs- und Versorgungspläne werden durch entsprechende Fachkräfte kontrolliert, Entscheidungen dem Stand fachlicher Theorie und Praxis folgend gefällt, wobei die Priorität für den entsprechenden Personenkreis bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen gesehen wird. Das entscheidende Problem ist in dieser Phase die Behinderung, die Schädigung, das Defizit des Individuums, das es durch Behandlung und Therapie zu lösen gilt." (Boban und Hinz 2005, 134)
Die Institutionsreform endete in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Beginn der Deinstitutionalisierung. "Nun wird nicht mehr von Patienten, sondern von Klienten gesprochen, die außerhalb von Institutionen und daher in unterschiedlichen Formen von Wohngruppen, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, Sonderschulen und im Sonderunterricht der allgemeinen Schule nach dem entwicklungspsychologischen und oft auch verhaltenstherapeutischen Modell zu fördern sind. Dafür werden von Teams in interdisziplinärer Übereinkunft individuelle Erziehungs-, Förder-, Therapie- und Qualifizierungspläne aufgestellt, die auch von ihnen kontrolliert werden. [...] Das vorrangige Ziel dieser Förderung ist die Tüchtigkeit, das größte Problem wird entsprechend in der Abhängigkeit und Unselbständigkeit der Klienten gesehen. [...] Heute und zukünftig geht es dagegen nach Bradley um etwas Anderes: Das Hilfesystem verfolgt das Konzept ‚Leben mit Unterstützung' [...] und spricht weder von Patienten noch von Klienten, sondern von Bürgern. Bürger leben selbstverständlich in üblichen Wohnungen als Mieter oder Eigentümer, gehen in die wohnortnahen üblichen Kindergärten und Schulklassen, arbeiten in üblichen Betrieben oder Behörden und verbringen ihre Freizeit in den üblichen Gruppierungen. Sie brauchen nicht primär Pflege, Betreuung oder Förderung, sondern Assistenz - und zwar nach dem Modell individueller Unterstützung [...]." (Boban und Hinz 2005, 134)
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Phasen detaillierter beschrieben, vor allem auf die Phase "Leben mit Unterstützung" wird ausführlich eingegangen und Ergebnisse aus der Studie über das Arbeitsintegrationsmodell Spagat Vorarlberg werden präsentiert.
|
Fokus |
Institutionsreform |
Deinstitutionalisierung |
Leben mit Unterstützung |
|
Person |
Patient/in |
Klient/in |
Bürger/in |
|
Rahmen von Dienstleistungen |
In der Institution |
In Wohngruppen, geschützten Werkstätten, Sonderschulen |
In üblichen Wohnungen, Betrieben, Schulen... |
|
Alltagstheoretische Basis der Arbeit |
Pflegerisches / medizinisches Modell |
Entwicklungspsycho-logisches / verhaltens-therapeutisches Modell |
Modell individueller Unterstützung |
|
Dienstleistung |
Pflege / Betreuung |
Förderung |
Assistenz |
|
Planungsmodell |
Betreuungs- und Versorgungspläne |
Individuelle Erziehung-/Förder- und Qualifizierungspläne |
Gemeinsame persönliche Zukunftsplanung |
|
Kontrolle durch |
Stand von fachlicher Theorie und Praxis |
Teamübereinkunft |
Persönlicher Unterstützerkreis |
|
Priorität bei |
Grundbedürfnisse |
Tüchtigkeit |
Selbstbestimmung in sozialer Kohäsion |
|
Problemdefinition |
Behinderung, Schädigung, Defizit |
Abhängigkeit, Unselbständigkeit |
Umwelthindernisse für Teilhabe |
|
Problemlösung |
Behandlung, Therapie |
Förderung in der am wenigsten einschränkenden Umwelt |
Neugestaltung der Umwelt als inklusive Gesellschaft |
Im Zuge der Institutionsreform wurden spezielle Unterbringungsanstalten für "Geisteskranke" geschaffen. "Die Sondereinrichtungen für Behinderte sind ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Die alten Hospitäler, Armenhäuser, Arbeits- und Zuchthäuser hatten behinderte Menschen nur wegen ihrer Armut und Bedürftigkeit oder wegen ihrer angeblichen Kriminalität aufgenommen, nicht aber aufgrund ihrer Behinderung. Weil aus der Minderung der Arbeitsfähigkeit oftmals Armut und Bedürftigkeit und damit Zwang zur Gesetzesübertretung folgten, lebten relativ viele behinderte Menschen in Hospitälern, Armenhäusern und Arbeits- und Zuchthäusern. Aber auch hier - wie in der gesamten Gesellschaft - sah man sie primär als Arme, Bedürftige oder Kriminelle, erst sekundär als körperlich, geistig oder psychisch Behinderte. Daher differenzierte man die Insassen innerhalb dieser Einrichtungen kaum nach ihren Behinderungen und sonderte lediglich die so genannten tobenden Irren aus, die man in Zellen einsperrte. Hospitäler, Armenhäuser, Arbeits- und Zuchthäuser waren also nicht Einrichtungen für Behinderte, sondern Institutionen, in denen auch Behinderte lebten." (Fandry 1990, 113)
Denjenigen, die zu dieser Zeit nicht in den Anstalten untergebracht waren und zuhause lebten, ging es vielfach nicht besser. Sie wurden unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt, in einer Ecke des Stalls oder in einem abgelegenen Raum angekettet und mit Nahrung versorgt. Der Grund lag darin, dass sich die betroffenen Familien und Angehörigen wegen ihres behinderten Mitglieds schämten. Die häusliche Pflege in dieser versunkenen Welt war eine Horrorgeschichte.
"Den geistesgeschichtlichen Hintergrund der Entstehung von Sondereinrichtungen für Behinderte bildete die Aufklärung." (Fandry 1990, 113) Diese betrachtete prinzipiell alle Menschen als vernunftbegabte Wesen und als Gleiche unter Gleichen. Parallel zur Aufklärung gewann das naturwissenschaftliche Denken an Einfluss. Gerade durch die Vernunft kann der Mensch die Gesetze der Welt erkennen und Wissenschaft betreiben. Die Vernunft bleibt dabei nicht nur neutrale Beobachterin, sondern sie gibt sich ein Instrumentarium in die Hand, um auf kausale Naturzusammenhänge einzuwirken. Im Zuge dieser Entwicklung wird der Mensch Erkenntnissubjekt und zugleich, vor allem innerhalb der Humanwissenschaften, zum Erkenntnisobjekt. Auf dem Menschen kann durch Erziehung eingewirkt werden, so lautete das pädagogische Credo und ein ausgesprochener Erziehungsoptimismus leitete sich daraus ab. Erziehung gilt gleichermaßen für alle, auch für psychisch und geistig behinderte Menschen. Schlussendlich folgte hieraus das Bestreben zur Heilung und Therapie dieser Personengruppe.
In den neu entstehenden Irren- und Heilanstalten soll dieser Auftrag erfüllt werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Euphorie noch ungebrochen. Die Heilung und Therapie der Geisteskranken setzte dabei auf einen starken Ordnungsbegriff, denn der Wahnsinn galt als Folge einer unordentlichen und unmoralischen Lebensführung. Folglich lautete die erste Devise: Einsperren ist die beste Therapie. Auf dieses Prinzip stützte sich das gesamte Paradigma der Institutionsreform und alle weiteren Maßnahmen wurden von ihm abgeleitet. Vor allem Pinel trat als Verfechter dieses Prinzips in den Vordergrund und schrieb: "Nichts ist im allgemeinen so angenehm für einen Kranken als sich im Schoße seiner Familie zu befinden, und darin die Pflege und den Trost einer liebevollen und mitleidigen Freundschaft zu empfinden, dass ich nur schwer eine traurige, aber durch wiederholte Erfahrung bestätigte Wahrheit ausspreche, nämlich die Notwendigkeit, die Irren fremden Händen anzuvertrauen und sie von ihren Eltern zu isolieren. Ihre wirren Ideen, die aus ihrer Umgebung herrühren; ihre Reizbarkeit, die immerfort von imaginären Gegenständen erregt wird; Schreie, Drohungen, Szenen der Unterordnung und sonderbare Handlungen; eine umsichtige aber energische Zucht, die strenge Überwachung des Personals, dessen Rohheit und Unerfahrenheit man gleichermaßen fürchten muss, verlangen eine Reihe von Maßnahmen, die der besonderen Art der Krankheit entsprechen, welche nur in den dafür geschaffenen Anstalten angewandt werden können." (Castel 1979, 99)
Ein zweites Axiom, welches sich von dem Prinzip des Einsperrens ableitet, beruht auf den Vorgaben einer strengen Lebensführung in den Anstalten. Auf die Unordnung des Geistes - "der Wahnsinn ist dieses Zuviel, das ein Mangel ist: Erregung, Exzess, Ausbruch, Maßlosigkeit, Liederlichkeit, Impulsivität, Unberechenbarkeit, Bedrohlichkeit" (Castel 1979, 127) - kann nur mit Ordnung geantwortet werden. Einschluss und Ordnung verspricht Heilung und die Irrenanstalt bedingt "eine Milieuveränderung, die zu einer Umkehrung der Werte führt: fortan ist die ‚normale' Welt der Ort, an dem die Unordnung sich reproduziert, während der große Asylfriedhof zu einem Raum geworden ist, in dem die Vernunft sich entfaltet und die Wahnsinnigen sich mit dem Gesetz versöhnen." (Castel 1979, 100)
Das dritte Axiom lenkt die Aufmerksamkeit auf die Autorität des Arztes, der die Ordnung der Vernunft durch seine Person verkörpert. Der Direktor der Irrenanstalt Hall i. Tirol, Dr. Johann Tschallener beschreibt dazu: "Hab ich diesen Kranken den Kopf aber einmal gebrochen, so erkennen sie mich als ihren Gebieter und bei derlei Kranken ist die Furcht der Zauberstab des Irrenarztes." (Klebelsberg 1931, 11) Das Arzt-Patienten Verhältnis ist damit an sich schon eine therapeutische Beziehung. Die Unterwerfung unter die Autorität des Arztes war Anzeichen allmählicher Genesung. Klebelsberger fährt mit seinen Ausführungen über Tschallener fort, indem er bemerkt, dass dieser eine außerordentliche Güte und Fürsorge gegenüber den Kranken zeigte. Sobald sie Anzeichen der Heilung zeigten, "lud er dieselben zu sich in seine Familie ein oder unternahm mit ihnen Ausflüge in die nähere oder weitere Umgebung von Hall, führte sie auch, sofern es ihr Zustand erlaubte, in die Haller Gesellschaft ein, damit sie langsam wieder zur Freiheit zurückfinden [...]." (Klebelsberg 1931, 11)
Die Freiheit gründet jedoch im Unterwerfungsakt des Patienten gegenüber der Autorität des Arztes. Erst wenn die Vernunft die Unvernunft besiegt, der Arzt gegen den Patienten gewinnt, kann der Geisteskranke seine Menschlichkeit zurückgewinnen. Das ist die "Grundlage eines außerordentlich subtilen Spiels von Gewalttätigkeit und Rückgabe der Vernunft, von Beziehung und Befreiung, das die ganze Geschichte des therapeutischen Verhältnisses prägen wird." (Castel 1979, 102)
Das Einsperren in die Anstalt, die streng geregelte Lebensführung und die Unterwerfung unter die Autorität des Arztes haben therapeutischen Charakter. All jene Maßnahmen werden als moralische Therapie bezeichnet. Eine wesentliche Säule ist die Arbeit. Die Arbeit beherrschte in den Anstalten den Lebensalltag der Patienten. Wiederum dient der Arbeitswillen als Gradmesser der Genesung und zugleich als Anzeichen der Erkrankung. Müßiggang, Arbeitsverweigerung und Untätigkeit, all dies "konnte je nach ihren Begleitumständen als Zeichen von Geisteskrankheit und damit als Einweisungsbegründung gedeutet werden." (Burkhardt 2003, 157) Moralische Therapie war somit immer auch Arbeitsrehabilitationstherapie. "Da die Arbeit Ordnung, Regelmäßigkeit und Disziplin lehrt [bald wird es heißen, dass sie ‚resozialisiert'], wird sie mehr und mehr zur Achse der moralischen Behandlung." (Castel 1979, 271)
Die Psychiatrie und die angewandten therapeutischen Verfahren haben im Laufe der Zeit einige Wandlungen und Rückschläge erfahren. Die Arbeit als Therapie gilt jedoch bis heute im Bereich der Behindertenhilfe als uneingeschränktes und zum Teil unreflektiertes Instrument zur Resozialisierung und Rehabilitation der Betroffenen.
Lange Zeit stand der arbeitstherapeutische Charakter im Vordergrund, erst allmählich entdeckte man die Patienten als billige Arbeitskräfte, deren kostenlose Arbeit das ökonomische Gleichgewicht der Anstalt aufrechterhielt. So etwa Dr. Berthier: "Zerstreuen, regulieren, beschäftigen - das sind die einfachen und fundamentalen Ziele der Arbeit in unseren Heilanstalten, denn wie Franklin sagt, wer nichts tut, tut leicht Böses. [...] Was am Beginn nur ein Mittel des Zeitvertreibs oder der Disziplin war, wurde so durch eine glückliche Erweiterung zu einer wertvollen Einnahmequelle unseres Budgets." (Castel 1979, 271)
Vor allem nach dem 1. Weltkrieg sollte diese "glückliche Erweiterung" im Sinne des ökonomischen Nutzens, unter dem Vorwand der Arbeitstherapie, gewinnbringend forciert werden. Am Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Heilungsaspekt, der innerhalb der Anstalten erzielt werden sollte an Boden. Unter den Psychiatern herrschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts allgemeine Resignation. Die Einrichtungen waren vollkommen überfüllt, Anstalten mit bis zu 1.000 Patienten waren keine Seltenheit. Vielerlei Gründe waren für den Anstieg der Patientenzahlen verantwortlich:
-
Der Gegenstandsbereich der Psychiatrie weitete sich aus und "vielfältige Formen abweichenden Verhaltens oder Leistungsminderung [wurden] mit psychiatrischen Begriffen belegt und damit psychiatrisiert. [...]." (Fandry 1990, 127)
-
Eine Umverteilung von Kranken (Redistributionseffekt) fand statt. "Im Laufe des 19. Jahrhunderts werden immer mehr psychisch Kranke aus der Familie oder dem Armenhaus in eine Anstalt verlegt. Dies hatte jedoch nichts mit einer steigenden Anzahl von Geisteskranken zu tun, sonderlich schlicht mit einer Neuorganisation der Pflege." (Shorter 1999, 83)
-
Die tatsächliche Zunahme von bestimmten Formen der Geisteskrankheit während des 19. Jahrhunderts. "Zwischen 1880 und 1900 stieg das Risiko des Durchschnittsbürgers deutlich, irgendwann in seinem Leben von einer gravierenden psychischen Krankheit heimgesucht zu werden." (Shorter 1999, 88) Krankheiten wie die Neusyphilis, ein syphilitischer Befall des zentralen Nervensystems, und Trinkerpsychosen nahmen überproportional zu. In England stieg der Alkoholkonsum im 19. Jahrhundert, also zwischen 1800 und 1900, um 57 Prozent an. In den Pariser Irrenanstalten wurde ein Drittel aller Männer wegen Trunksucht eingewiesen.
Die Psychiatrie befand sich in einer Ausnahmesituation und konnte dem Ansturm der Patienten nicht standhalten. Überstrapazierte Auslastungskapazitäten und Personalmangel waren die Folge, was die Möglichkeit von Behandlung und Beschäftigungstherapie stark einschränkte. Die Psychiatrie stand dieser Situation damals hilflos gegenüber. Von den Heil- und Irrenanstalten ist nur mehr ihr Name geblieben, längst waren sie in Wirklichkeit zu Zwangs- und Verwahrungsanstalten degradiert, in denen man statt zu helfen die Patienten ruhigstellte.
Durch die angesprochene Redistribution und der weiteren Ausdifferenzierung des institutionellen Raums wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusätzlich spezielle Anstalten für die so genannten "geistig Behinderten" geschaffen. Vorher wurden sie wie alle anderen in Irrenanstalten untergebracht. Die Führung der neuen Idiotenanstalten wurde an karitative Vereine und Kirchen übertragen und diese waren dann maßgeblich beteiligt, das gesellschaftliche Bedürfnis zur Unterbringung der Betroffenen zu schüren. "Offensichtlich entsprachen die Gründungen der Anstalten für geistig Behinderte einem gesellschaftlichen Bedürfnis, denn vielfach überstieg die Zahl der Anmeldungen sehr schnell die Zahl der vorhandenen Anstaltsplätze." (Fandry 1990, 145)
Vor allem geistig behinderte Menschen waren zu dieser Zeit vielen Diskriminierungen ausgesetzt. Sie wurden als gesellschaftliches Ordnungs- und Sicherheitsrisiko eingestuft. Das Risiko, welches von dieser Personengruppe ausging sollte eben durch die Anstaltsunterbringung begrenzt werden. "Neben Gutmütigkeit zeigen Blödsinnige auch ‚eine gewisse Verschmitztheit, Bosheit, Lügenhaftigkeit und Rachsucht'." So die einhellige Meinung und "sie würden ‚durch ihre Leidenschaften, Rachsucht, Zorn, sinnliche Begierden auf die Bahn des Verbrechens getrieben. Namentlich sind es am gewöhnlichsten Brandstiftung, Mord und Vergehen gegen die Sittlichkeit, deren sie angeklagt werden.' Derartige Behauptungen belegen die Autoren allerdings nie mit statistischen Daten einer überdurchschnittlichen Kriminalitätsrate geistig Behinderter. Sie führen bestenfalls einige wenige Beispiele an, darunter immer wieder denselben Vorfall in einem Heim für verwahrloste Kinder aus der Hälfte des 19. Jahrhunderts - ein geistig behinderter Junge hatte nach einem Peitschenhieb den Heimleiter schwer erwürgt. Mindestens bis 1930 schrieben die ‚Fachleute' für geistig Behinderte diese Geschichte voneinander ab und ‚bewiesen' so die ‚Gefährlichkeit' geistig behinderter Menschen." (Fandry 1990, 146)
Mit dem Aufbau von Idiotenanstalten wurde, wie zu Beginn mit den Irrenanstalten, ein bestimmter Heilsoptimismus verbunden. Die therapeutischen Methoden und die damit erhofften Heilungschancen wurden aus dem Umfeld der Psychiatrie adaptiert, sie gründeten letztendlich auf die von Pinel formulierten Ordnungsprinzipien. Auch die Arbeitstherapie fand ihre prominente Rolle - dieselben Parallelen - auch in den Idiotenanstalten wurde der therapeutische Charakter der Arbeit durch das ökonomische Kalkül verlängert.
In den Idioten- wie in den Irrenanstalten konnten durch den Arbeitseinsatz der Patienten in den hausinternen Werkstätten und Landwirtschaftsbetrieben umfangreiche Kosteneinsparungen erzielt werden. Der Ökonomisierungsdruck brachte jedoch die perfidesten Formen hervor, die Motivation zur Arbeit wurde durch die Gewährung oder Entziehung kleiner Privilegien erzielt und ‚gute Kranke', also leistungsfähige Patienten, wurden aus wirtschaftlichen Motiven oft ein Leben lang eingesperrt. Die Eigeninteressen der Anstalten überlagerten Heilungs- und Therapiezwecke. "Die Entlassung von erwachsenen älteren, arbeitsfähigen Zöglingen ist nicht anzuraten, da diese zum Betriebe der Oeconomie und in den Gärten beschäftigt werden und sich nützlich machen und so dazu beitragen, die Anstalten mit eigenen Producten zu versorgen und evtl. einen guten Gewinn hieraus erzielen." (Wulff 1887, 37)
Die Anzahl der Insassen in den Idiotenanstalten stieg bis Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft an. 1862 gab es in Deutschland 12 Idiotenanstalten mit 350 Insassen. 1874 steigerte sich die Zahl auf 30 Anstalten mit 2.000 Insassen und 1904 verzeichnete man 100 Einrichtungen mit insgesamt 23.000 Insassen (Vgl. Fandrey, 1990, S 148) Wie die Irrenanstalten konnten auch sie den Anspruch auf Heilung- und Therapie nicht mehr annähernd erfüllen. Beide Institutionen degradierten zu Verwahrungsanstalten, in denen desolate Zustände zu hohen Sterblichkeitsraten durch Tuberkulose führten.
Einige Eltern und Betroffene äußerten Kritik, nun hatten aber Anstaltsleiter, Ärzte und Pädagogen immer wieder die Gefahr beschworen, die von den Betroffenen ausgeht: "Diese seien kriminell verführbar oder häufig selbst kriminell; zudem könnten sie gesunde Kinder sittlich gefährden. [...] Der Idiotismus wird ‚als ein ansteckendes Übel betrachtet', und es verbreitet sich die Furcht, ‚dass der Idiot alles um sich [...] idiotisch mache'." (Fandry 1990, 153)
Während der Kriegsjahre 1914-1918 starb fast jeder fünfte Anstaltsbewohner an Unterernährung. Die Zahl der Insassen begann sich stark zu reduzieren. Leichtere Fälle wurden jetzt wieder entlassen, damit sie sich für die Kriegswirtschaft nützlich machen konnten. Nach dem Krieg stieg die Zahl wieder rasant an und übertraf bald das Vorkriegsniveau. Die Anstalten waren wieder bis unter die Decke überfüllt und die Arbeitstherapie erlebte einen neuerlichen Aufschwung. Vor allem Hermann Simon, der als Begründer der Arbeitstherapie angesehen werden kann, richtete seine Kritik gegen die übliche Ruhigstellung der Patienten und ihre Isolierung von der Umwelt. "Statt dessen sollte durch aktives Handeln das in dem Patienten noch steckende ‚gesunde Geistesleben' mit aller Energie gefördert und gleichzeitig konsequent allen als krankhaft empfundenen Äußerungen mit jeglichen zur Verfügung stehenden Mitteln begegnet werden." (nach Sierck 1992, 36)
Simon entwickelte ein System, das fast alle Patienten in die Anstaltsarbeit integrierte. Er machte aus den Anstalten wieder Arbeitshäuser. "Sein Anspruch alle Patienten zum Arbeiten zu bringen, deckte sich mit dem Anliegen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Anstalten zu erreichen." (Sierck 1992, 38) Jedes Mittel zur Unterwerfung der Insassen unter den Arbeitszwang kam ihm dabei gelegen. "Denn Simon verstand seine Arbeit als eine Aufgabe, die zum sichtbaren Erfolg führen musste. Sein pädagogisches Ansinnen beinhaltet einen Kampfbegriff, der Widerspruch nicht dulden konnte [...]: denn erstes Erfordernis ist die Wahrnehmung des Gemeinwohls, und nicht irgendeine Rücksichtnahme auf den dem Gemeinwohl widerstrebenden einzelnen." (Sierck 1992, 37)
Der Wert eines Menschen bemisst sich dabei am nötigen Maß seiner zu erbringenden Arbeitsleistung. Damit knüpft Simon direkt an die Lebenswertdebatte der sozialdarwinistisch orientierten Eugenik an. Idiotie und Irresein werden als letztes Glied in der Kette "psychopathischer Anlagen oder Degenerationsveranlagung" (Shorter 1999, 150) gesehen. 1931 hielt Simon vor einem Kreis evangelischer Akademiker eine diesbezüglich denkwürdige Rede über "Minderwertigkeit" und "Ballast-Existenz". Die Rede stand unter dem Motto der Leistungseffizienz von Patienten in den Anstalten angesichts der angespannten ökonomischen Situation durch die Wirtschaftskrise. Er verweist darauf, dass sich der Wert eines Menschen nach seinem Leistungsniveau bemessen muss. Nur, indem er Leistung erbringt, hat er auch einen Wert für die Allgemeinheit. Im O-Ton hört sich dies folgendermaßen an: "Im übrigen sind für die Allgemeinheit minderwertig: alle, die - sei es infolge ungenügender Veranlagung oder fehlerhafter Entwicklung zu einer vollwertigen Leistung nie gelangt sind oder - bei Kindern - nie gelangen können: die Idioten, Schwächlinge, die immer wieder sofort versagen, sobald eine ernstere Leistung von ihnen verlangt wird. Denn die wirklichen Taugenichtse, Schädlinge, Verbrecher, alle die an Zahl dauernd zunehmenden Menschen, die sich den Pflichten des Gemeinschaftslebens nicht fügen wollen oder können - wobei ‚Können' auch nur eine sehr relative Sache ist. Denn fast alle ‚können', wenn sie müssen." (Sierck 1992, 38) Simon vergisst im Laufe des Vortrags auch nicht, auf das Kosten-Nutzen-Kalkül einzugehen, er führt an, wie teuer eine "Ballast-Existenz" den Staat zu stehen kommt und welche finanziellen Mittel der Volksgemeinschaft dadurch entzogen werden. "Die Fürsorge kommt nur dem Schwachen und Minderwertigen, dem wenig Widerstandsfähigen, also dem Lebensuntüchtigen zugute. Der Tüchtige braucht sie nie. Dadurch Verhinderung des natürlichen Ausmerzungsprozesses [...] Zusammen über 12.000.000 Minderwertige oder 1/5 der Bevölkerung [...]." Simon weist schlussendlich darauf hin, dass wieder gestorben werden muss. "Es fragt sich nur, welche Millionen sterben müssen. Der Tod ist und bleibt auch eine Erlösung." (nach Sierck 1992, 38)
Ziel jeglicher therapeutischer Handlung kann somit nur die Rückgewinnung und Erhöhung der Leistungseffizienz der Patienten bedeuten bzw. die Verwertung ihrer Restleistungsfähigkeit für die ökonomische Reproduktion und Unabhängigkeit der Anstalten. Der Leistungsunfähige und Schwache stellt vor diesem Hintergrund eine einzige Provokation gegenüber den Gesunden und Tüchtigen dar. "Das psychiatrische Handeln war schon zu dieser Zeit greifbar in die Nähe der ‚Vernichtung lebensunwerten Lebens' gerückt." (Sierck 1992, 41)
Der Nationalsozialismus lieferte die notwendigen Handlungskompetenzen für die von Simon formulierten Aufgaben. Simon stand mit seinen Anschauungen nicht allein. Er war ein Kind seiner Zeit, eugenisches und erbbiologisches Gedankengut gepaart mit sozialdarwinistischen und rassenideologischen Anschauungen gehörte in den 1920er Jahren zum wissenschaftlichen, gesellschafts- und sozialpolitischen Common Sense. Der Nationalsozialismus war letztlich die praktische Antwort auf all die aufgeworfenen Fragen und die "logische Konsequenz jenes Zweigs der Eugenik, der dem sozialdarwinistischen Auslesegedanken verhaftet blieb." (Weingart, Kroll und Bayertz 1988, 171)
1939 begann die T4-Aktion zur Vernichtung erwachsener Geisteskranker. Die Betroffenen wurden über Meldebögen erfasst und aus den Heilanstalten direkt in die Tötungsanstalten wie Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein etc. gebracht. Bis zu Beendigung der T4-Aktion im Jahre 1941 wurden zwischen 80.000 und 100.000 behinderte Menschen ermordet. "Das Ende der T4-Aktion bedeutete aber noch nicht das Ende der Behindertenmorde: Mancher Anstaltsleiter oder Arzt tötete aus eigenem Antrieb Anstaltsinsassen, meist durch Luminal oder Veronal. In verschiedenen Anstalten lässt man bereits 1940 Bewohner durch gezielte Unterernährung sterben. Das bayrische Innenministerium forderte Ende 1942 Heime und Anstalten auf, ihre ‚unproduktiven' Behinderten schlecht zu ernähren. Allein in der Anstalt Eglfing-Haar sterben an den Folgen der Unterernährung mehr als 400 Patienten. Ab Sommer 1941 sonderten Psychiater in deutschen Konzentrationslagern kranke und arbeitsfähige Häftlinge zur Tötung aus. [...] Ein Ministererlass vom 18.08.1939 verpflichtet Hebammen und ärztliche Geburtshelfer, alle Neugeborenen mit diagnostizierter ‚Idiotie, Morbus Down [...], Mikrozephalie, Hydrozephalie und Missbildungen und Lähmungen jeder Art' dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Lediglich aufgrund der vorliegenden Meldebögen urteilen dann drei Gutachter eines neu gebildeten ‚Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden' über Leben und Tod der Kinder. [...] Bis Kriegsende wird diese Aktion ohne Unterbrechung fortgeführt und bleibt geheime Reichssache. Nach Abbruch der Mord-Aktion T4 im Sommer 1941 erweitert man die Kinder-Morde auf Jugendliche bis zu 16 Jahren, mit Sonderermächtigung auch auf einzelne Erwachsene. Ungefähr 5000 Kinder fallen diesem Mord-Programm zum Opfer." (Fandry 1990, 194)
Die Beendigung der T4-Aktion fiel mit der Anweisung an die KZ zusammen, das blinde Morden dort zu unterlassen. 1941 erlitt die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie erste empfindliche Rückschläge und zugleich hat der ungeheure Bedarf an Soldaten zu einem prekären Arbeitskräftemangel geführt. "Die Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherheits-, erzieherischen oder vorbeugenden Gründen allein steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwergewicht hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin verlagert." (Buchenwald 2007, 134) Mit diesen Worten wandte sich 1942 Oswald Pohl, Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungsamtes, an Himmler, um die Vernichtungslager auf "arbeitsfähige" Häftlinge zu durchforsten, die man dann der Rüstungsindustrie zuführen müsse. Rassenideologisches und erbbiologisches Gedankengut und Rassengesetze wichen einer ökonomischen Rationalität. Jeder, der in irgendeiner Form wirtschaftlich verwertbar war, musste der Rüstungsindustrie zugeführt werden. Arbeits- und leistungsunfähige Personen wurden in den Vernichtungslagern zurückgelassen und direkt in den Tod geschickt. Die anderen konnten ihren Tod durch harte Arbeit in den Konzentrationslagern hinauszögern. Letztendlich erreichte der Arbeitsbegriff damals seine perfideste Ausprägung. Arbeits- und Leistungsfähigkeit entschieden nicht nur über gesellschaftlichen Ausschluss oder Teilhabe, sondern über Leben und Tod.
Während des 2. Weltkriegs wurden zahlreiche Anstalten aufgelöst und diejenigen, die die "Schreckensjahre" in den verbliebenen Einrichtungen überlebten, blieben großteils auch nach 1945 in psychiatrischer Verwahrung. Während der Nachkriegsjahre wurden viele zerstörte Einrichtungen wieder aufgebaut und füllten sich wieder mit Patienten.
Paradigmatisch hielt man an der traditionellen Psychiatrie der Vorkriegsjahre fest. "Kaum ein Psychiater interessierte sich für einen möglichen Zusammenhang von traditioneller psychiatrischer Lehrmeinung und nationalsozialistischem Patienten-Mord, für den Zusammenhang zwischen psychiatrischem Dogma der Erblichkeit und Unverständlichkeit von Psychosen und Theorien der Rassenhygiene, nationalsozialistischer Ideologie und Mordaktion." (Fandry 1990, 212)
Erst in den 1970er Jahren beginnt diese psychiatrische Vormachtstellung zu bröckeln, bis dato lebte in Deutschland jedes dritte Kind mit einer geistigen Behinderung unter 16 Jahren in einer Anstalt. Die anderen lebten meist zuhause, ausgeschlossen von der Gesellschaft und außerhalb der Lebensbereiche wie Schule und Arbeitswelt. 1958 gründeten engagierte Eltern in Deutschland die Lebenshilfe, mit dem Anspruch, die Lebenssituation ihrer behinderten Kinder zu verbessern. Die Lebenshilfe verfolgte den "Ansatz der gezielten Förderung und Rehabilitation. [...] Durch systematische rehabilitative Anstrengungen sollten die Defizite geistig behinderter Menschen soweit wie möglich kompensiert werden, um ihnen eine Eingliederung in die Gesellschaft, insbesondere auch in bestimmte Bereiche des Arbeitsmarktes zu ermöglichen." (Schädler 2002, 57)
Die Lebenshilfe favorisierte vor allem teilstationäre Modelle und Einrichtungen. "Das wohnortnahe, teilstationäre Konzept der Lebenshilfe war anfangs ganz bewusst und öffentlich als Alternative zur Anstaltsunterbringung entwickelt worden. Geistig behinderte Kinder sollten gefördert werden können, ohne dass eine dauerhafte Trennung von der Familie zu erfolgen hatte. Die Anstalten waren für viele Eltern geistig behinderter Kinder immer noch verbunden mit dem Grauen der Euthanasieprogramme und dem Bild der bloßen Pflege- und Verwahrungsanstalten." (Schädler 2002, 56)
In den Augen der traditionellen Psychiatrie war das Lebenshilfekonzept eine einzige Provokation und wurde heftig angegriffen und attackiert: "Ihr geht in der Lebenshilfe den falschen Weg, wenn ihr durch Teilzeiteinrichtungen den geistig behinderten Menschen der Grausamkeit seiner Umwelt aussetzt, anstatt ihn im Schonraum der Vollzeiteinrichtungen hiervor zu bewahren." (Lebenshilfe 1983, 60)
Die Lebenshilfe lehnte sich inhaltlich an das aus Skandinavien stammende Normalisierungsprinzip an. Bedeutende Vertreter dieses Ansatzes waren in den 1960er Jahren der Däne Erik Bank-Mikkelsen und der Schwede Bengt Nirje. Der Normalisierungsgedanke war auf das Prinzip normaler Lebensmuster und Lebensbedingungen für Menschen mit geistigen Behinderungen ausgerichtet. Bank-Mikkelsen: "Als Ziel der modernen Betreuung von geistig Behinderten sehen wir die möglichst weitgehende ‚Normalisierung' der Lebensbedingungen an. Für Kinder bedeutet Normalisierung, dass sie in einer ihnen gemäßen, wenn möglich in der gewohnten Umgebung leben und spielen, in den Kindergarten und später in geeignete Schulen gehen. Erwachsene sollen das Recht haben, ihr Elternhaus zu verlassen und schließlich einer geregelten Beschäftigung nachzugehen. Für Kinder wie für Erwachsene gehört eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung zur Gestaltung eines normalen Lebens. So streben wir die Eingliederung der Behinderten in die Gemeinschaft auf jede nur mögliche Weise an. Wir wollen ihnen helfen, von ihren Fähigkeiten Gebrauch zu machen, so begrenzt sie auch immer sein mögen. Wie andere Menschen haben die Behinderten ein unabdingbares Recht auf die bestgeeignete Behandlung, Förderung und Eingliederung. Ebenso unbestreitbar ist, dass jeder Umgang mit ihnen in ethisch einwandfreier Weise gestaltet werden muss." (Bank-Mikkelsen 1974, 76)
Normalisierung bedeutet in diesem Sinne die Gewährleistung und die Annäherung an normale Tages-, Wochen- und Jahresrhythmen, an normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus, an den normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung und an normale Wohn- und Arbeitsumgebungen, bzw. Umweltbedingungen und Strukturen, die den gewohnten Verhältnissen und Lebensumständen der jeweiligen Gesellschaft so nah wie möglich kommen und entsprechen.
Die Grundsätze des Normalisierungsprinzips verweisen zugleich auch auf bestimmte Einschränkungen, da stets von geeigneten und gemäßen Strukturen gesprochen wird im Sinne von Sondereinrichtungen. Eine bedingungslose Integration aufgrund der begrenzten Fähigkeiten von Menschen mit geistigen Behinderungen ist nicht anzustreben. Die teilstationären Sondereinrichtungen besitzen jedoch in den Augen der Befürworter zweierlei Vorteile: Zum einen erhalten die Betroffenen einen notwendigen Schutz- und Schonraum, ohne den sie der gesellschaftlichen Übermacht ausgeliefert wären und zum anderen bieten diese die bestmögliche Lernumgebung zur Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne der Rehabilitation geistig behinderter Menschen. Im Bereich der Arbeitsrehabilitation entstanden die ersten geschützten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die die berufliche Integration der Betroffenen in die Arbeitswelt anstreben.
Das teilstationäre Konzept der Lebenshilfe sollte nach den ersten Anfeindungen bald seine herausragende Bestätigung finden. Im Zuge der Antipsychiatrischen Bewegung, zu der u.a. namhafte Psychiater wie F. Basaglia, R.D. Laing, I. Goffmann und T. Szasz zählten, formierte sich zu Beginn der 1970er Jahre eine starke Opposition gegenüber dem herkömmlichen und traditionellen Psychiatriemodell. Die Psychiatrie wurde als eine Institution der Gewalt entlarvt, die wesentlich Mitschuld am Leid der betroffenen Personen trägt und endogene Krankheiten, wie Schizophrenie und Psychosen, nicht zuletzt erst durch die Institutionalisierung mit verursacht. "Der Geisteskranke ist vor allem deswegen krank, weil er ein Ausgeschlossener ist, von allen im Stich gelassen, ein Mensch ohne Rechte, mit dem man machen kann, was man will." (Basaglia 1978, 29) Die Abschiebung von psychisch Kranken und geistig behinderten Menschen stellt in den Augen der Antipsychiatrischen Bewegung ein gesellschaftliches Grundmuster dar, das all jene ins Abseits drängt, die den Ansprüchen der Industriegesellschaft nicht genügen oder sich den Werten und Normen der modernen Arbeitsgesellschaft nicht fügen wollen und können. Für Basaglia ist der Geisteskranke "insofern anders, als er die Grundlagen der Norm in Frage stellt; so wird eine medizinisch-rechtliche Kategorie geschaffen, um ihn abzugrenzen und zu isolieren." (Basaglia und Basaglia Ongaro 1972, 23)
Basaglia und andere Vertreter der Antipsychiatrischen Bewegung forderten die radikale Auflösung der totalen Institutionen. "Freiheit heilt" lautete ihre Devise und damit verbunden war der Anspruch eines veränderten gesellschaftlichen Umgangs mit den betroffenen Personen: "Indem Behinderte in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden, wird der Gesellschaft das Leid wieder zurückgegeben, dessen sie sich entledigen wollten, indem sie es aussperrten. Im Umgang mit den Leidenden soll sie selber rücksichtsvoller und toleranter werden gegenüber der menschlichen Natur allgemein. Es bedeutet, der verhängnisvollen Gewohnheit, nach der Menschen benutzt und ins Abseits gebracht werden, wenn sie nicht mehr benützt werden können, entgegenzuwirken." (Innerhofer und Klicpera 1986, 54)
Von diesen Entwicklungen und Bestrebungen im Bereich der Behindertenhilfe blieben die politischen Instanzen nicht unberührt. In der Bundesrepublik Deutschland setzte der Bundestag 1971 eine Enquete-Kommission ein, die fünf Jahre später ihren Bericht zur Lage der Psychiatrie veröffentlichte. Der Bericht fiel für die damalige Psychiatrie verheerend aus. Unter anderem wurde die Fehlplatzierung von ca. 17.500 geistig behinderten Menschen in psychiatrischen Anstalten angeprangert und darauf hingewiesen, "dass eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müsse. Überalterung der Bausubstanz, katastrophale Überfüllung in gewissen Bereichen, Unterbringung in Schlafsälen, unzumutbare sanitäre Verhältnisse" (Häßler und Häßler 2005, 40) waren weitere schwere Vorwürfe und Kritikpunkte. Im Bericht wurde die rasche Enthospitalisierung gefordert und damit begann das Paradigma der Deinstitutionalisierung in der Praxis zu greifen. Die traditionellen Anstaltsmodelle, als "totale Institutionen" kritisiert, gerieten unter Druck. Zusätzlich kam die Mittäterschaft von Anstaltsverantwortlichen und psychiatrischen Ärzten an den Tötungsaktionen während des Nationalsozialismus ans Tageslicht.
Diese Entwicklung stärkte dem teilstationären Lebenshilfekonzept den Rücken. Ab Mitte der 1970er Jahre hatte die Lebenshilfe nun gegenüber den psychiatrischen Großanstalten einen wesentlichen Modernisierungsvorsprung. Sie konnte sich aus ihrem Schattendasein als Elternvereinigung befreien und sich als kooperativer Fach- und Trägerverband im Feld der Behindertenhilfe etablieren. Ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland folgten in anderen europäischen Ländern so z.B. in Italien, wo mit dem Gesetz 180 aus dem Jahre 1978 die bedingungslose Auflösung der Großeinrichtungen und psychiatrischen Verwahrungsanstalten eingeleitet wurde.
Die geschützte Werkstatt etablierte sich im Zuge der Deinstitutionalisierung als Rehabilitationsmodell für die Wiedereingliederung von Personen, die nicht, nicht wieder bzw. noch nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind bzw. sein können. Geschützte Werkstätten sind vornehmlich Auffangbecken für all diejenigen Menschen, die durch Krankheit, Behinderung und/oder psychischen Leiden nicht am "normalen" Arbeitsleben teilhaben können bzw. davon ausgeschlossen sind, da sie den Anforderungen nicht bzw. nicht mehr nachkommen können. Die Werkstatt soll diesen Personen die Möglichkeit geben, eine sinnvolle Beschäftigung auszuüben, Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. Der damit verbundene Anspruch ist es, durch Förderung, Rehabilitation und Arbeitstraining, die Integration und Wiedereingliederung der Betroffenen in den Arbeitsmarkt zu erreichen.
Zwar ist die geschützte Werkstatt in den Augen ihrer Befürworter der ideale Ort, an dem Menschen arbeiten können, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind eine Arbeit zu finden, aber hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Integration hat sie sich als Sackgasse erwiesen. Bis heute werden sie "ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht, möglichst viele Menschen mit Behinderung nicht nur auf Tätigkeiten im gesellschaftlichen Arbeitsleben vorzubereiten, sondern auch auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln und eine arbeitsbezogene oder berufliche Eingliederung zu unterstützen [...] Einschlägigen Untersuchungen zufolge ist der Anteil derjenigen Menschen mit geistiger Behinderung, die aus einer Werkstatt für behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln ausgesprochen gering [...] Begründet wird dies vor allem mit der derzeitig schlechten wirtschaftlichen Situation und Lage auf dem Arbeitsmarkt. In Wirklichkeit aber sind die meisten Werkstätten für behinderte Menschen gar nicht daran interessiert, ihre ‚Leistungsträger' ins gesellschaftliche Arbeitsleben zu entlassen. Würde ein solches Ziel fokussiert, kämen womöglich erhebliche ökonomische Probleme auf die Werkstätten für behinderte Menschen zu, die ihre Existenz gefährden könnten." (Theunissen 2005, 340) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist demnach nicht nur Auffangbecken für diejenigen, die aufgrund ihrer Behinderung aus der Arbeitswelt hinausgedrängt werden, sondern zugleich Einschluss-System, welches diejenige nicht frei gibt, denen sie ihre ökonomische Reproduktion und ihr wirtschaftliches Überleben verdankt. Hier zeigen sich, unter dem Aspekt der Ökonomisierung, starke Parallelen zu den Entwicklungen der Irrenanstalten in den 1920er Jahren.
In geschützten Werkstätten sind die Betroffenen daher deutlich dem Zwang zur Arbeit unterworfen. "In vielen dieser Werkstätten führte der Weg über die Beschäftigungstherapie zur produktiven Arbeit. [...] Die pädagogischen Ideale und der Aspekt der Verwertbarkeit auch geringer Arbeitsleistung flossen in den Behindertenwerkstätten zusammen. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit setzte sich mehr und mehr durch und bestimmte die Ausrichtung der Einrichtungen. Aus dem Blick geriet die Persönlichkeit der behinderten Menschen, in den Mittelpunkt rückte das Wohlergehen des Unternehmens Werkstatt." (Sierck 1992, 109) Diejenigen, die aufgrund ihrer "Arbeitsunfähigkeit" aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, finden sich somit inmitten eines Arbeitssystems - der geschützten Werkstatt - wieder. Die Arbeit definiert schlussendlich die pädagogischen Ziele, Inhalte und die Ausrichtung dieser Sondereinrichtungen. Arbeitstherapeutische Ansätze spielen dabei wiederum eine wesentliche Rolle. Durch sie sollen die Klient/innen der Werkstätten Werte wie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Sorgfalt, Pünktlichkeit, Disziplin und Fleiß trainieren. Tugenden also die es ermöglichen, am freien Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wie erwähnt haben diese vordergründigen Ziele zumeist nur Alibicharakter.
Die gesellschaftliche Integration der geschützten Werkstätten scheint widersprüchlich. "Volkswirtschaftlich sind die Werkstatt-Beschäftigten in unseren gesellschaftlichen Arbeitsprozess eingebunden, ihre Arbeitsproduktion im Wirtschaftskreislauf einbezogen. Die behinderten Beschäftigten arbeiten nicht isoliert zu Hause, sondern gemeinsam in ihrem Betrieb. Insofern leisten die Werkstätten eine gesellschaftliche Integration ihrer Beschäftigten. Aber die behinderten Beschäftigten arbeiten nur mit anderen Behinderten zusammen, sie bleiben nur unter ihresgleichen, sie bleiben als Behinderten-Gruppe sozial isoliert. [...] Indem unsere Gesellschaft verschiedene Menschen aufgrund eines gemeinsamen Merkmals - geistig behindert - zur Arbeit ausschließlich in Sondereinrichtungen isoliert, trägt sie zur Konstituierung der besonderen sozialen Gruppe ‚geistig Behinderter' wesentlich bei. [...] Die Werkstatt für Behinderte ist in diesem Rahmen eine Institution, welche die individuelle Isolation behinderter Menschen aufhebt, ihre soziale Isolierung als gesellschaftliche Randgruppe jedoch reproduziert." (Fandry 1990, 238)
Indes führt der Produktions- und Arbeitsaspekt der geschützten Werkstätten zu einem weiteren Ausschluss, der all die betrifft, die kein Mindestmaß an verwertbarer Leistung erbringen. Ihnen steht der Zugang in die Tagesstätten für schwermehrfach behinderte Personen offen. Die Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe der Betroffenen schwindet dabei auf ein Minimum, denn der Königsweg zur gesellschaftlichen Integration führt vorwiegend und letztendlich über die Schiene der Arbeitsrehabilitation und beruflichen Integration. Die geschützte Werkstatt wirkt selbst noch am Ausschluss ihrer Zielgruppen mit, und dies in zweifacher Hinsicht: zum einen gibt sie ihre Leistungsträger nicht frei, denen sie ihr wirtschaftliches Leben verdankt und zum anderen drängt sie leistungsunfähige Betroffene in die Tagesstätten für schwermehrfach behinderte Personen ab. Die Werkstatt widerspiegelt damit auf paradoxe Weise im Kleinen die umfangreiche Exklusion von Menschen mit Behinderung im sozial-gesellschaftlichen Bereich. Wie dieser bringt sie an ihrem Ende ein differenziertes Betreuungs- und Pflegesystem hervor, das je nach Schädigung leistungsunfähige Menschen in geeignete Tagesstätten, z.B. für psychisch Kranke, für schwermehrfach Behinderte, für Menschen mit schweren Wahrnehmungsstörungen und Autismus etc. abdrängt.
Der Vielfalt an individuellen Verhaltens- und Lebensstilen wird dabei kaum Rechnung getragen und Aufmerksamkeit geschenkt. "Entscheidend ist, dass sich die Rehabilitation von Beginn an als eine Institution konstituiert hat, deren Träger die Definitionsmacht darüber haben, welche physischen und psychischen Möglichkeiten eines Menschen ‚brauchbar' sind und welche nicht. Für kranke, behinderte oder erschöpfte Personen gilt seither als notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer Rehabilitationsmaßnahme, dass sie sich der Verfügung über jeden Bereich ihrer psychischen Identität unterordnen und der Enteignung ihrer Körper zustimmen. Dabei decken sich manche Anforderungen mit Wünschen oder sozialen Bedürfnissen behinderter Menschen. Sie wollen ‚dazugehören', aus der Objektrolle herauskommen. Inwieweit der vorhandene Anpassungsdruck einzelne Menschen Dinge tun lässt, die von staatlichen Planungen instrumentalisiert werden, ist allgemein nicht zu beantworten. Sicher ist, dass behinderte Menschen in der Vergangenheit wie in der Gegenwart fast keine selbst geschaffenen Freiräume besitzen, in denen sie entwickeln und fördern können, was sie wollen. Die historisch gewachsenen Formen der institutionellen und sozialen Aussonderung bedingen eine Sprachlosigkeit und Handlungsunfähigkeit, die mit den tatsächlichen körperlichen oder geistigen Besonderheiten nur wenig zu tun haben, aber in die Denkschablone über ‚die Behinderten' passen. Es gab und gibt nur wenige Hinweise dafür, dass behinderte Personen für sich das Wort ergreifen. Und das verfestigt wiederum die Sichtweise vom behinderten Menschen als Objekt der sie betrachtenden und behandelnden Fachwelt." (Sierck 1992, 12)
Geschützte Werkstätten wirken vielfach entmündigend für die betroffenen Personen bzw. für ihre Klienten. In einem sehr eindringlichen Artikel schildert Dietmar Raffeiner, seit 25 Jahren Betreuer in einer geschützten Werkstatt in Südtirol, diese Situation als Kolonisation von Menschen: "Überhaupt glaube ich, dass einer der größten Fehler, den wir Betreuer machen, darin liegt, dass unser Tun mit geistig behinderten Menschen immer ‚sinnvoll' für etwas sein muss. Als ‚sinnvoll' wird immer das bezeichnet, was ein Mittel für einen Zweck darstellt. Fast keinem Menschen in der Werkstatt wird es gestattet, nach seinen irrtumsfrohen Vorstellungen zu leben. Von der Wiege bis zur Bahre entscheiden wir Betreuer, ohne Pausen des Erbarmens, bis in die intimsten Sphären der Persönlichkeit von geistig behinderten Menschen hinein. Fast ausschließlich versuchen wir, solche Menschen für unsere Zwecke ‚dienstbar' zu machen. [...] Vielleicht müssen wir Betreuer in den Werkstätten, um einen Begriff aus der Landwirtschaft zu verwenden, unsere Anstrengungen wieder mehr darauf hin konzentrieren, aus den Monokulturen des Arbeits- und Produktivitätsdenkens auszusteigen und hineinfinden zu einer Vielfelderwirtschaft, in der die Arbeit das Leben nicht mehr dominiert, sondern sich nur mehr als ein Element von vielen ins Leben einfügt. Wo dies geschieht, könnte Raum frei werden für eine humanere Kultur und Lebensgestaltung. Dies könnte zur Folge haben, dass in einer Werkstatt Individualität wieder sichtbar wird und nicht nur das Herstellungsvolumen eines monströsen Gesamtapparates. Jemand, der seine Eigenheiten nicht sichtbar machen kann, wird stumpf, stirbt innerlich ab und dient höchstens noch als abschreckendes Beispiel, ähnlich einer Vogelscheuche." (Raffeiner 2007, 2)
Die Auflösung der Großanstalten im Zuge der Deinstitutionalisierung führte lediglich zu einer graduellen Verbesserung der Situation behinderter Menschen. "Das Dilemma ist, dass manche Humanisierungen und halbe Öffnungen von Einrichtungen keinen eigentlichen Wandel initiiert, sondern mehr zu einer ‚Kolonialisierung' und Anpassung [...] führt, die den Zielen eigener Entwicklung von behinderten Personen nicht entspricht, sondern weiterhin an die Institution bindet und lebenslange Karrieren von Bedürftigen begründet." (Schönwiese 2000) Die Lösung der großen Fragen wie Entfaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten, die Verhinderung sozialer Exklusion und die Wertschätzung gegenüber Menschen mit Behinderung, steht noch an. Die Ausgliederung von Betroffenen aus psychiatrischen Anstalten in teilstationäre Einrichtungen wie Wohnheime und geschützte Werkstätten hat wenig mit Integration zu tun, sie sind und bleiben Sondereinrichtungen mit all den negativen Konsequenzen. "Wie Quecksilber, wenn es zu Boden fällt und in viele kleine Kügelchen zersiebt, in dem kleinsten Teil giftig bleibt, kann Enthospitalisierung in neue Räume der Ausgrenzung hinein, kaum mehr als ein Etikettenschwindel sein, vor allem, wenn sie bei den alten Denkweisen über Menschen mit Behinderung bleibt und bei den alten Praxen des sozialen Verkehrs, der durch Drinnen und Draußen und von Abhängigkeit, Macht und Herrschaft der Betreuer gegenüber den Betreuten charakterisiert ist." (Feuser 1998, 4)
Bis in die 1970er Jahre hinein war es im Bereich der Behindertenhilfe selbstverständliche Praxis, Menschen mit Behinderung in Großanstalten zu internieren. Mit dem Bekanntwerden der skandalösen und menschenunwürdigen Zustände wurde dieses Modell, das ausschließlich unter dem medizinischen Blick die Schädigung, die Defizite und Symptome einer Behinderung ins Licht der therapeutischen Maßnahmen rückte, allmählich von der Phase der Deinstitutionalisierung und von teilstationären Modellen abgelöst. Handlungsleitendes Paradigma war das Normalisierungsprinzip. Förderung und Rehabilitation standen nun im Mittelpunkt, "[e]s ging darum, etwas aus einem behinderten Menschen zu machen. Gefördert wurden die von der helfenden Instanz gesetzten Normen, und das war in der Regel Verselbständigung und soziale Anpassung an die Gesellschaft." (Theunissen 2002, 2) Das Erbe der Institutionalisierung wog schwer, die Problematik der Verdinglichung und Fremdbestimmung von Menschen mit Behinderung, wie am Beispiel der geschützten Werkstätten gezeigt wurde, konnte nicht gelöst werden. Vor allem die Betroffenen selbst blieben bei diesen Entwicklungen außen vor und ihre Sicht der Dinge war nicht gefragt. Sie hatten sich lediglich den Anpassungs- und Repressionsdruck zu fügen, den das Normalisierungsprinzip und die Rehabilitation abverlangt, um Aussicht auf gesellschaftliche oder berufliche Integration, was auf dasselbe hinausläuft, zu haben.
Bereits vor 30 Jahren wurde diese Kritik von Menschen mit Behinderung selbst formuliert. "Zunächst gab es politische Aktionen von Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, die sich in einem selbstorganisierten Zusammenschluss einer ‚Krüppelbewegung' gegen Diskriminierung, Benachteiligung, Unterbringung und Fremdbestimmung in Pflegeheimen, Behindertenanstalten oder auch Psychiatrien wandten." (Theunissen 2002, 4) Nach dem Vorbild der amerikanischen Independent Living-Bewegung und People First, entstanden im deutschsprachigem Raum Selbstvertretungsorganisationen, die sich als Experten in eigener Sache auswiesen und sich selbst zu organisieren versuchten. Diese Gruppierungen fordern vor allem Unterstützungsmodelle und persönlichen Assistenz ein und berufen sich vornehmlich auf das handlungsleitende Prinzip des Empowerment. "Ziel der Empowerment-Praxis ist es, die vorhandenen (wenn auch vielfach verschütteten) Fähigkeiten der Adressaten sozialer Dienstleistungen zu autonomer Alltagsregie und Lebensorganisation zu kräftigen und Ressourcen freizusetzen, mit deren Hilfe sie die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt gestalten können. Empowerment - auf eine kurze Formel gebracht - ist das Anstiften zur (Wieder-)Aneignung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Lebens." (Herriger 2005, 2)
Die Ursprünge des Empowerment liegen in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1970er Jahre. "Für die Herausbildung des Empowerment-Konzepts war insbesondere der Emanzipationskampf der Afroamerikaner von kaum zu überschätzender Bedeutung. [...] Wichtige Impulse in Richtung Empowerment gingen aber auch von den verschiedenen Richtungen des Feminismus, den Gruppierungen der Neuen Linken, sowie den vielfältigen Selbsthilfe-Initiativen aus." (Bröckling, Krasmann und Lemke 2004, 56) In der heutigen Lesart fußt der Empowerment-Ansatz auf zwei Säulen: Wichtig ist "die aktive Aneignung von Macht, Kraft, Gestaltungsvermögen durch die Machtlosigkeit und Ohnmacht Betroffenen selbst. [...] Empowerment bezeichnet hier also einen selbstinitiierten und eigengesteuerten Prozess der (Wieder-)Herstellung von Selbstbestimmung in der Gestaltung des eigenen Lebens. Diese Definition betont somit den Aspekt der Selbsthilfe und der aktiven Selbstorganisation der Betroffenen." (Herriger 2005, 1) Zum anderen geht es um die professionelle Unterstützung von Autonomie und Selbstgestaltung. "Der Blick richtet sich hier also auf die Seite der Mitarbeiter psychosozialer Dienste, die Prozesse der (Wieder-) Aneignung von Selbstgestaltungskräften anregen, fördern und unterstützen und Ressourcen für Empowerment-Prozesse bereitstellen. Empowerment ist in diesem Wortsinn programmatisches Kürzel für eine psychosoziale Praxis, deren Handlungsziel es ist, Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärken aneignen und Muster solidarischer Vernetzung erproben können." (Herriger 2005, 1) Auf der Seite der helfenden Berufe bedeutet dieser Ansatz, dass diese ihre eigene Expertenmacht stark einschränken müssen, um sie in den Dienst der Betroffenen zu stellen und nur soviel Hilfe anbieten, wie nötig bzw. wie von den Betroffenen selbst eingefordert wird. "Insofern heißt Empowerment keinesfalls, auf das Moment der Unterstützung und Fürsorge zu verzichten. Es wird der Tatsache Rechnung getragen, dass schwerstbehinderte Menschen ohne die Unterstützung durch Angehörige oder professionelle Vertreter nicht auskommen. [...] Der Begriff der Selbstbestimmung wird keinesfalls mit dem ‚ungebundenen Selbst' gleichgesetzt, sondern orientiert sich an einem in sozialen Bezügen eingelassenes Selbst." (Rösner 2002, 376) Ein entscheidendes Element dabei ist die Teilhabe der Betroffenen an Entscheidungsprozessen, die ihre Lebensgestaltung und soziale Lebenswelt betreffen. Auf sozialpolitischer Ebene "hat die Entwicklung von handlungsmächtigen Strukturen Priorität, die die Betroffenen zur Selbstorganisation sozialer Dienste und Leistungen befähigen." (Stark 1996, 163)
Auf dieser Basis entwickelte sich im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung das Modell der Unterstützten Beschäftigung. Dem Konzept liegt ein verändertes Verständnis von Behinderung und Integration zugrunde, mit dem Ziel, das traditionelle Rehabilitationsmodell zu überwinden. "Entsprechend wurde die Forderung aufgestellt, dass kein Mensch aufgrund seiner Behinderung vom Leben in einzelnen Gesellschaftssegmenten ausgeschlossen werden darf und in seiner Selbstverwirklichung irgendwelche gesellschaftlich bedingten Einschränkungen erfahren darf." (Schartmann 1995, 3)
Die simulierten Sonderwelten der Arbeitsrehabilitation tragen nur in den seltensten Fällen zur Integration in die Arbeitswelt bei. "Die traditionelle Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation setzen bisher meist auf vorbereitende Qualifizierung von Menschen mit Behinderung. Dabei treten Probleme mit der in der Regel außerbetrieblichen Organisation der Qualifizierung auf. Die Qualifizierungsangebote entsprechen häufiger nicht dem Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes. Selbst in gut ausgestatteten Lehrwerkstätten ist die Simulation von betrieblichen Arbeitsvollzügen nur bedingt möglich. Neben den aktuellen fachlichen Anforderungen sind insbesondere der Simulation einer realistischen Betriebskultur Grenzen gesetzt." (Doose 2005, 2)
Der Deinstitutionalisierung, im Sinne der Normalisierung, liegt ein rehabilitatives Paradigma zugrunde, das entscheidend mit der vertrauten Leitdifferenz operiert: Arbeitsfähig- / Arbeitsunfähigkeit. Die Betroffenen werden so lange in Sonderräumen und durch Sondermaßnahmen gefördert und rehabilitiert, bis sie die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, die für den Integrationserfolg ausschlaggebend sind. Mitunter müssen sie sich ständig als Mängelwesen fühlen, ohne Kompetenzen und Fähigkeiten, bzw. mit Kompetenzen und Fähigkeiten, die es aber nicht wert sind beachtet zu werden. Durch den methodischen Ansatz der Unterstützten Beschäftigung wird die Arbeits- und Leistungsfähigkeit nicht mehr als Gradmesser gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten verstanden. Konträr zum traditionell-rehabilitativen Anspruch und seinem pädagogischen Reduktionismus, verläuft die Praxis - im Sinne des Empowerment - die mit Unterstützter Beschäftigung in Zusammenhang steht, folgendermaßen: Sie orientiert sich an den Fähigkeiten, an den Potentialen und an der subjektiv empfundenen Lebensqualität der Betroffenen, sie fördert die Chancengleichheit und den Schutz vor Diskriminierung, eröffnet Selbstbestimmung- und Wahlmöglichkeiten, sie akzeptiert unkonventionelle Lebensentwürfe auch im Berufsalltag und fördert die Teilhabe aller Menschen am Arbeitsleben, unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung. Prinzipiell wird also kein Mensch aufgrund der Behinderung vom Anspruch auf Unterstützte Beschäftigung ausgeschlossen.
"Mit der Formulierung dieser Prinzipien war gleichzeitig ein radikaler Perspektivenwechsel im doppelten Sinne verbunden: zum einen wurde der Staat nicht mehr als großzügiger Finanzier von Sozialprogrammen angesehen, durch den behinderte Menschen die Gelegenheit zur Beschäftigung erhalten, sondern als ein Gebilde, welches Menschen mit Behinderung vom öffentlichen Erwerbsleben ausschließt. Es wurde nun als Aufgabe des Staates angesehen, für eine Chancengleichheit zur Teilhabe am sozialen Leben für alle Bürger des Landes - auch für behinderte Menschen - zu sorgen. Zum anderen wurden behinderte Menschen von dankbaren und geduldigen Empfängern staatlicher Subsidien zu Personen, die aktiv ihre Interessen vertraten, von behandelten Objekten staatlichen Großmutes zu sich-selbst-bestimmen-wollenden Subjekten." (Schartmann 1995, 4)
Im Folgenden werde ich das Modell der Unterstützten Beschäftigung, die methodischen Vorgehensweisen, die philosophischen Grundlagen usw. am Beispiel des Projekts SPAGAT Vorarlberg näher herausarbeiten, um im IV. Teil der Arbeit die Ergebnisse der Evaluationsstudie ausführlich zu schildern.
SPAGAT orientiert sich an den Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. SPAGAT ist eine Dienstleistung, die im Rahmen des Instituts für Sozialdienste Vorarlberg und als Alternative zum Besuch der geschützten Werkstatt angeboten wird. Zielgruppe sind Jugendliche mit schweren Behinderungen, die nach dem Schwerstbehinderten-Plan unterrichtet werden, einen höheren Förderbedarf aufweisen und über ein sehr geringes Leistungsvermögen verfügen. Damit wird der Forderung nachgekommen, niemanden aufgrund der Schwere seiner Behinderung von der Maßnahme zur Unterstützten Beschäftigung auszuschließen. Stefan Doose, Wegbereiter der Unterstützten Beschäftigung in Deutschland, erklärt diesen Anspruch folgendermaßen: "Wir müssen mit den Menschen mit schweren Behinderungen anfangen und zwar eigentlich mit denen mit den schwersten Behinderungen. Wenn wir gezeigt haben, dass ‚Unterstützte Beschäftigung' mit diesen Menschen möglich ist, das wir diese Menschen in integrativen Arbeitsverhältnissen unterstützen können, dann wird die Integration von Menschen mit leichteren Behinderungen folgen." (Doose 1997, 270)
Das Projekt SPAGAT orientiert sich inhaltlich an den international definierten Kriterien zur Unterstützten Beschäftigung:
-
Integration in einen Betrieb des ersten Arbeitsmarktes
Ein wesentliches Element ist die Integration in einen "normalen" Betrieb. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Personen synergetische Effekte erzeugt und zu Formen solidarischer Selbstorganisation führt. Außerdem werden dadurch Kommunikations- und Beziehungsmöglichkeiten erweitert, die sich günstig auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen auswirken. Erst im Dialog mit seiner Umwelt entwickelt sich der Mensch andauernd fort und je vielfältiger die Dialogfülle ist, umso vielfältiger erscheinen die jeweiligen Entwicklungsmöglichkeiten. "In Analogie dazu hat jeder Mensch, so können wir [...] annehmen, zwar endliche, aber nicht vorhersagbar viele Entwicklungsmöglichkeiten (En). Er kann in Anbetracht der Unumkehrbarkeit biographischer (Lebens-)Zeit nur die nicht mehr nützen, die er schon gelebt hat. Bleiben also selbst für einen schwerst beeinträchtigten Menschen En-1 Möglichkeiten seiner Veränderung und damit eine unvorhersagbare Fülle an weiteren Entwicklungsmöglichkeiten." (Feuser 2006, 12) Entwicklung wird dann begrenzt, wenn Menschen aus Lebenszusammenhängen ausgeschlossen werden und sich ihre Dialogmöglichkeiten mit der Umwelt reduzieren.
-
Regulär bezahlte Arbeit nach branchenüblichen Tarifen
Es wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch ein Recht auf "richtige Arbeit für richtigen Lohn" hat, d.h. der Betrieb bezahlt dem oder der Mitarbeiter/in mit Behinderung einen branchenüblichen Lohn. Als grundlegend für die Betriebe, um dieser Forderung im Rahmen regulärer Arbeitsverhältnisse nachzukommen, sind dabei die Lohnkostenzuschüsse. Der Betrieb bezahlt die effektiv erbrachte Leistung, die Differenz zum Gesamtlohn wird von der öffentlichen Hand bezuschusst.
-
Regionalität des Arbeitsplatzes
Das Arbeitsverhältnis bzw. der oder die verschiedenen Arbeitsplätze der Person befinden sich im regionalen Umfeld zum Wohnort der Betroffenen. Dadurch lassen sich bestehende Ressourcen im Lebensumfeld leichter einbeziehen und nutzen und gleichzeitig erschließen sich Potentiale für die sozial-gesellschaftliche Integration.
-
Arbeitsplatztraining (Jobcoaching)
Im Gegensatz zu den geschützten Werkstätten und traditionellen Rehabilitationsmaßnahmen wird die Qualifizierung der Betroffenen vor Ort, d.h. im Betrieb und nicht im außerbetrieblichen Rahmen, durchgeführt. Damit werden keine wichtigen Lernmomente und -situationen ausgespart, die für die berufliche Integration von Bedeutung sind. "In der Praxis hat sich [...] gezeigt, dass Menschen bei der Qualifizierung außerhalb von Realsituationen häufig im System stecken bleiben und nicht adäquat auf die Anforderungen vorbereitet werden." (Doose 1997, 116)
Das Jobcoaching steht unter dem Motto "Erst platzieren und dann trainieren". Es wird hauptsächlich - gemeinsam mit den Betroffenen - von den Mitarbeiter/innen bzw. Integrationsberater/innen der Integrationsfachdienste (Jobcoach) durchgeführt. Im kooperativen Prozess steht dabei nicht die Anpassung der Person an die Arbeitsbedingungen, sondern die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Person im Vordergrund.
-
Flexible, zeitlich unbegrenzte und individuelle Unterstützung
Um die berufliche Integration nachhaltig und erfolgreich zu gestalten, ist die individuelle, flexible und zeitlich unbegrenzte Unterstützung der Betroffenen notwendig. Die psychosoziale Langzeitbegleitung wird von den Mitarbeiter/innen der Integrationsfachdienste gewährleistet. "Unterstützte Beschäftigung umfasst die individuelle Unterstützung bei der beruflichen Zukunftsplanung, Arbeitsplatzsuche, Arbeitsplatzanpassung, Qualifizierung und bei Problemen am Arbeitsplatz." (Doose 2006, 116)
-
Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung
Da Unterstützte Beschäftigung, so wie in Vorarlberg mit dem Modell SPAGAT, eine Alternative zur geschützten Werkstatt darstellt, ist bereits die Wahlmöglichkeit von Menschen mit Behinderung im Bereich der Arbeit gegeben. Die Wahl- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten werden jedoch während des gesamten Prozesses gewährleistet. Die betroffenen Personen werden stets in alle für sie relevanten Planungsschritte einbezogen, ganz zentral in die Zukunftsplanung und in die Arbeitsplatzwahl. "Es geht darum, dass Menschen mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, ihr Leben bezogen auf Lebensziel und Lebensstil selbst zu entscheiden. Die Angebote und professionellen Unterstützer/innen sind so ausgerichtet, dass für und mit der Hauptperson ein bewusstes und zielgerichtetes Handeln möglich wird. Verbesserte Lebensqualität bedeutet daher, zwischen akzeptablen Möglichkeiten selbstbestimmt wählen zu können." (Hömberg, Burtscher und Ginnold 2001, 6)
-
Mentorenprinzip
Das Mentorenprinzip wird von Schartmann als Natural Support Variante (Vgl. Schartmann, 1995, ???) bezeichnet. Neben dem Job-Coaching wurde es als weitere Stütze zur langfristigen Aufrechterhaltung des Arbeitsplatzes eingeführt, denn es "zeigt sich, dass trotz gut strukturierter und intensiver Begleitung viele aus unterschiedlichen Gründen ihren Arbeitsplatz wieder verloren." (Schartmann 1995, 7) Der Grund war, dass sich das Job-Coaching zu sehr auf das Arbeitsplatztraining konzentrierte, aber den weiteren Kontext des betrieblichen Alltags aussparte. "Als externe, betriebsfremde Fachleute, mit dem Ziel der beruflichen Integration behinderter Menschen, waren Job Coaches oft von den informellen Kommunikationsprozessen unter den alteingesessenen Mitarbeitern des Unternehmens ausgeschlossen und hatten aufgrund ihrer nicht vorhandenen Vorkenntnisse über das Unternehmen und die Mitarbeiter auch kaum eine Möglichkeit, an diesen informellen Kommunikationsprozessen sinnvoll zu partizipieren." (Schartmann 1995, 7) Die Job Coaches taten sich schwer die Akzeptanz des behinderten Mitarbeiters im Betrieb zu fördern. Die "natürliche Sozialisation" des neuen Mitarbeiters mit Behinderung konnte dadurch nicht im herkömmlichen und gewünschten Maße gewährleistet werden. "Durch die - zumindest anfangs recht häufige - Präsenz des Job Coaches am Arbeitsplatz kann zudem die Einsicht vermittelt werden, dass zur Interaktion mit einem behinderten Menschen ein besonders geschulter Fachmann notwendig ist. Auch dies kann eine Kommunikationsbarriere darstellen, durch die im Endeffekt eine soziale Distanz zu dem behinderten Menschen aufgebaut werden kann." (Schartmann 1995, 8)
Das Job-Coaching führte so zu einem ungewollten Sonderstatus für den behinderten Mitarbeiter im Betrieb. Um die Barriere zwischen ihm und den Mitarbeitern abzubauen, begann man natürliche Unterstützungsressourcen und informelle Kommunikationsprozesse zu unterstützen und aufzubauen. Aus diesem Prozess heraus entwickelte sich die Mentoren-Variante. Ein innerbetrieblicher Mitarbeiter übernimmt die Begleitung und Unterstützung des behinderten Mitarbeiters im Betrieb. Der Job Coach initiiert zwar weiterhin alle wichtigen Schritte der Arbeitsplatzentwicklung, er zieht sich jedoch langsam aus dem Betrieb zurück und die weitere Unterstützung wird vom Mentor übernommen. Der Job Coach tritt erst wieder ins Geschehen ein, wenn dies vonseiten des Mentors, Arbeitgebers oder Mitarbeiters mit Behinderung gewünscht wird. Der Mentor, der idealerweise schon länger im Betrieb arbeitet und die informellen Kommunikationsprozesse und die Betriebskultur kennt, kann den neuen Mitarbeiter mit Behinderung in die filigranen Beziehungsstrukturen und Betriebsprozesse einführen. Er übernimmt eine wichtige Vermittlerrolle, "als Initiator wechselseitiger Annäherungsprozesse mit Brückenfunktion zwischen den Arbeitskollegen und dem neuen Mitarbeiter." (Schartmann 1995, 9)
Die einzelnen Phasen im Integrationsprozess werden passgenau umgesetzt, da sie sich wie Bausteine ineinanderfügen. Im SPAGAT Modell lassen sich vier wesentliche Phasen unterscheiden, die von den Integrationsberater/innen koordiniert, organisiert und begleitet werden. Die Rolle des Integrationsberaters ist dabei sehr wichtig, deckt vielfältige Bereiche ab und verlangt eigenverantwortliches und kompetentes Handeln. Elisabeth Tschann, Leiterin der Abteilung Dialog am Institut für Sozialdienste Vorarlberg und verantwortlich für das Modell SPAGAT, listet in ihrer Diplomarbeit folgende Tätigkeiten und Aufgaben auf:
-
Konstituierung der Unterstützerkreise, Moderation der Zukunftsplanung und aller weiterer Treffen im Unterstützerkreis.
-
Vernetzung der Information untereinander und nach außen.
-
Persönliches Kennenlernen der Wohn-, Lebenssituation und Bezugspersonen bei jedem Jugendlichen.
-
Begleitung der Jugendlichen während ihres letzten Schuljahres, z.B. Kennenlernen der Schulsituation, Beteiligung an berufsbezogenen Unterrichtsthemen und Projekten.
-
Begleitung der Jugendlichen auf Schnupperplätze und zu sonstigen externen berufsrelevanten Erkundungen.
-
In Kooperation mit den Mitgliedern der Unterstützerkreise: Eruierung beruflicher Möglichkeiten im privaten und öffentlichen Umfeld eines jeden Jugendlichen.
-
Dokumentation und Sammlung aller Kriterien und Informationen zum Entwicklungsbericht jedes Jugendlichen.
-
Begleitung während der Arbeitserprobung ‚training on the job', Wahrnehmung von Belastungsgrenzen, Betriebsatmosphäre, Arbeitsplatzentwicklung und -anpassung usw.).
-
Krisenintervention und Prozessverantwortung für die langfristige Nachhaltigkeit des Arbeitsverhältnisses.
-
Zusammenarbeit mit dem Mentor, um auftretende Schwierigkeiten vor Ort zu lösen.
(Tschann 2005, 44)
Wie erwähnt lassen sich bei SPAGAT vier Phasen im Integrationsprozess unterscheiden, die im Folgenden näher ausgeführt werden:
-
Die Zukunftsplanung und die Unterstützerkreise
Im Konzept der Unterstützten Beschäftigung sind individuelle Zukunftsplanungen und Unterstützerkreise Schlüsselelemente. Die Jugendlichen mit Behinderung kontrollieren, als zentrale Entscheidungsträger, alle Entscheidungen. Persönliche Zukunftsplanungen sind ein methodischer Ansatz, der Ende der 1980er Jahre in den USA unter dem Namen "Person centered planning" entwickelt wurde. Bei den Zukunftsplanungen geht es darum, gemeinsam mit der Hauptperson über ihre Zukunft nachzudenken, ihre Fähigkeiten und Stärken aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, sich Ziele zu setzen und planbare Schritte umzusetzen.
Eine Zukunftsplanung ist dann sinnvoll, wenn Menschen an einem Punkt stehen, an dem sie allein nicht mehr weiter kommen und dabei die Unterstützung und freundschaftliche Hilfe anderer Menschen benötigen. Die Gründe können vielfältig sein. Speziell für Menschen mit Behinderung ist diese Form der Planung und Unterstützung fruchtbar, ihre Zukunft soll sich nicht zufällig ereignen oder entlang institutionell vorgeschriebener Karrieren verlaufen. Die Orientierung an der Person, an ihren individuellen Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen ist maßgebend. Die Interessen und Wünsche der Person stehen im Vordergrund. Diese Stärken-Perspektive ermöglicht Phantasien, Träume und Visionen zu entwickeln und Lebensverläufe jenseits vorgeschriebener institutioneller Lebenswege auszudenken, vorzubereiten und zu beschreiten. Eine Zukunftsplanung eignet sich für fast alle Entscheidungsprozesse des Lebens, sie kann sich auf die Schullaufbahn ebenso beziehen, wie auf die Berufswahl und Berufsausbildung, auf die Freizeitgestaltung und auf den Wohnbereich.
Zukunftsplanungen werden immer im Rahmen von Unterstützerkreisen durchgeführt, wobei der Einbezug des familiären und sozialen Umfelds wichtig ist; aber auch Vertreter von Institutionen können einbezogen werden - vorausgesetzt, die betroffene Person will dies, denn sie entscheidet letztlich, wer eingeladen wird. Der Unterstützerkreis bzw. die einzelnen Personen helfen, vielfältige Perspektiven und Ressourcen um die Hauptperson zu erschließen. Die Umsetzung der Handlungsperspektiven, Ziele und Optionen werden gemeinsam im Unterstützerkreis und mit der Hauptperson angegangen. "Persönliche Zukunftsplanungen stellen eine neue Form der Planung der Unterstützung für Menschen mit Behinderung dar. Die traditionelle Hilfeplanung in der Behindertenhilfe wird als einer eher institutionelle Hilfeplanung charakterisiert, dem die veränderte Sichtweise einer eher individuellen Hilfeplanung entgegengestellt wird." (Van Kan und Doose 1999, 84)
Abbildung 2 (Vgl. Van Kan & Doose 1999, S. 84)
|
Institutionelle Hilfeplanung |
Persönliche Zukunftsplanung |
|
Orientierung an Behinderung |
Orientierung an der individuellen Person |
|
Betonung der Defizite und Bedürfnisse |
Suche nach Fähigkeiten und Stärken |
|
Ziel: oft reduziert von negativen Verhaltensweisen |
Ziel: Erweiterung der Lebensqualität |
|
Hilfeplanung abhängig vom professionellen Urteil, oft standardisierte Tests und Begutachtung |
Hilfeplanung abhängig von der Person, Familie, Freunde und Fachleute, verlangt mit der Person Zeit zu verbringen, um sie kennenzulernen, und gemeinsam eine gute Beschreibung zu erarbeiten |
|
Schriftliche Berichte |
Geschichten, Episoden von Menschen, die die Person gut kennen |
|
Sieht die Person im Kontext der verfügbaren Maßnahmen und Behinderteneinrichtungen, dies sind oft Lebensräume speziell für Menschen mit Behinderung |
Sieht die Person im Kontext des regulären Lebens in der Region |
|
Professionelle Distanz durch Betonung der Unterschiede |
Bringt Menschen zusammen durch die Identifizierung von Gemeinsamkeiten |
|
Staatlich geregelte Verfahrensweisen, Blickrichtung Kostenträger |
Verfahrensweisen nicht vorgeschrieben, Blickrichtung planende Person |
|
Person ist an der Erstellung der Hilfeplanung (oft nur teilweise) nicht beteiligt |
Person steuert den Plan und die Aktivitäten |
|
Zielrichtung: Stärkung und Ausbau der Institutionen durch Angebot geeigneter Maßnahmen |
Zielrichtung: Stärkung und Verwirklichung der Ziele des Planenden durch das Angebot geeigneter individueller Maßnahmen, lernende Organisation |
In der traditionellen Hilfeplanung bestimmt die Orientierung an die Behinderungsart und an das institutionelle Leistungsangebot, wie jemand zu wohnen, zu arbeiten und zu leben hat. Die Betroffenen werden paradoxerweise in ein System integriert, das im hohen Maße desintegrativ wirkt, insofern die Grenzen des Systems die Grenzen der Lebensmöglichkeiten sind. Unterstützerkreise hingegen operieren jenseits institutioneller Vorgaben und Grenzen; die Person mit ihren Fähigkeiten und Stärken steht im Mittelpunkt und auf sie hin werden individuelle Maßnahmen umgesetzt.
Beim SPAGAT beginnt der Integrationsprozess für jeden Jugendlichen mit einer persönlichen Zukunftsplanung. Denn es ist "unabdingbar, dass die Analyse der momentanen Situation, von Problemen sowie die Planung von Perspektiven gemeinsam mit der Person angegangen wird, um die es geht [...] Als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft hat die Person zur Klärung etwas beizutragen, und sie hat auch das Entscheidungsrecht darüber, welche potentiellen Helfer/innen hereingeholt werden sollen. Zumindest aber hat sie das Recht, dass nicht ohne ihre Anwesenheit über ihre Zukunft entschieden wird." (Hinz 1996, 5)
Nach Elisabeth Tschann wird bei SPAGAT die Zukunftsplanung mit dem Jugendlichen allein begonnen, erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt die Zusammenarbeit mit dem Unterstützerkreis. Dieser entwickelt sich dann jedoch zum Kern und zum Dreh- und Angelpunkt im Integrationsprozess. (Vgl. Tschann, 2005, 50) Der Unterstützerkreis wird von den Integrationsberatern aufgebaut und initiiert. Er besteht aus einer Kerngruppe, bestehend aus dem Jugendlichen und seinen Eltern, teilweise aus Geschwistern, Verwandten oder Freunden der Familie. Je nach Themenstellung werden zu weiteren Treffen auch andere Personen hinzugezogen. "Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich eine Arbeitserprobung anbahnt, werden teilweise sowohl Arbeitgeber als auch Mentoren eingeladen. Bei diesen Treffen geht es vor allem um Erfahrungsaustausch: Welche Unterstützung erwartet sich der Betrieb, welche Erfahrungen machen sie mit dem Jugendlichen, was beschäftigt den Jugendlichen. Wo gibt es Unsicherheiten und wie kann man schwierige (Anfangs-)Situationen verändern." (Tschann 2005, 52)
Bei SPAGAT werden konkrete Aufgaben im Unterstützerkreis angegangen:
-
Es wird ein Fähigkeitsprofil erstellt. Vorlieben, Begabungen und Möglichkeiten werden erfasst. Die unterschiedlichen Perspektiven und Beobachtungen der am Unterstützerkreis beteiligten Personen werden vernetzt.
-
Aufgrund der Fähigkeitsanalyse und der vernetzten Beobachtungen werden benötigte Rahmenbedingungen für die Arbeit des Jugendlichen formuliert (z.B. Atmosphäre am Arbeitsplatz usw.).
-
Mögliche Arbeitsfelder werden definiert. Hierbei ist ein hohes Maß an Kreativität erforderlich, denn zumeist sind reguläre Arbeitsplätze für Menschen mit schweren Behinderung nicht in herkömmlicher Weise zu finden, sie müssen oft erst entdeckt und erfunden werden. (Vgl. Tschann, 2005, 56)
-
Arbeitsplatzakquisition: Arbeitgeber für die Schnupperphase werden ausfindig gemacht. "Es gilt, die Ressourcen, die Kenntnisse der regionalen Arbeitsmarktstruktur und die Beziehungen der Mitglieder des Unterstützerkreises zu nützen" (Tschann 2005, 57), denn es ist erwiesen, dass der Großteil der Arbeitsplätze durch informelle Kontakte und nicht über institutionelle Vermittlung gefunden wird.
-
Nachbearbeitung der Schnupperphase: Die Hypothesen der Zukunftsplanung werden während des Schnupperns evaluiert und die Erfahrungen dienen als Grundlage für die weitere Planung.
-
Mitarbeit bei der Lösung von Schwierigkeiten: "[t]rotz guter Vorbereitung und Planung ist mit Schwierigkeiten zu rechnen; dass nicht alle Arbeitserprobungen erfolgreich zu einem Dauerarbeitsplatz führen, war und ist auch in Zukunft zu erwarten. Oft kann ein Fehler oder auch ein Scheitern den Schlüssel zum nächsten Schritt beinhalten. Die Schwierigkeiten gemeinsam mit allen Beteiligten zu reflektieren und darauf aufbauend konstruktive Lösungen zu entwickeln, ist eine Hauptaufgabe des Unterstützungskreises in der nachschulischen Phase. Die Themen sind vielfältig und beziehen sich nicht nur auf die berufliche Eingliederung." (Tschann 2005, 58)
-
Der Unterstützerkreis soll auch die Familie unterstützen, z.B. bei der Herstellung der Erstkontakte zu den Arbeitgebern durch die Mitglieder des Unterstützerkreises. Eltern erleben solche Aufgaben zumeist in der Rolle des "Bittstellers" und der Unterstützerkreis kann in solchen Situationen eine entlastende Funktion haben. Der Unterstützerkreis soll der Familie das Gefühl geben, dass sie mit ihren Schwierigkeiten nicht allein ist, sie sollen ein Stück gelebter Solidarität erfahren.
-
Durch den Unterstützerkreis soll letztendlich auch die integrative Idee weiter getragen werden.
-
Die Schnupper- und Orientierungsphase
Nach der Zukunftsplanung, wenn konkrete Ergebnisse vorliegen, werden für die Jugendlichen verschiedene Schnupperpraktika organisiert. Diese werden individuell auf die Situation hin angepasst und von den Integrationsberater/innen begleitet. Sie dauern durchschnittlich zwei Wochen und werden in verschiedenen Betrieben durchgeführt, damit die Jugendlichen einen konkreten Einblick in verschiedene Arbeits- und Tätigkeitsbereiche erhalten. Ziel der Schnupperphase ist die Überprüfung der Ergebnisse der Zukunftsplanung. Außerdem können während der Schnupperphase bereits potentielle Arbeitgeber gefunden werden bzw. Fehlerquoten bei der Auswahl von Betrieben für eine Arbeitserprobung minimiert werden.
-
Die Arbeitserprobungsphase
Nach der Schnupperphase beginnt eine dreimonatige Arbeitserprobung in einem Betrieb, in dem sich der Jugendliche und der Arbeitgeber ein Anstellungsverhältnis vorstellen können. In dieser Probezeit werden verschiedene Rahmenbedingungen und günstige Faktoren abgeklärt. Der Arbeitsplatz wird an den Jugendlichen angepasst, z.B. durch spezielle Hilfsmittel, durch die Festlegung der Arbeitszeiten, durch den Abbau architektonischer Barrieren etc. Während der Arbeitserprobung, aber auch darüber hinaus, findet das Job-Coaching am Arbeitsplatz statt. Die Arbeitserprobungsphase dient auch dazu, einen geeigneten und potentiellen Mentor im Betrieb zu finden, der in seine neue Tätigkeit eingeführt wird.
-
Anstellung im Betrieb und psychosoziale Langzeitbegleitung
Die Anstellung im Betrieb ist in Vorarlberg rechtlich durch den integrativen Arbeitsplatz geregelt. Dieser sieht vor, dass die überwiegende Leistungsfähigkeit unter 50% liegen muss, damit der Lohnkosten- und Mentorenzuschuss im Ausmaß der Leistungsminderung bezahlt wird. Der Lohnkostenzuschuss unterliegt einer Obergrenze. Die Leistungsminderung wird jährlich von einem Gutachter neu bewertet, aufgrund seines Berichts erfolgt die Höhe der finanziellen Förderung.
Die Nachhaltigkeit des Arbeitsverhältnisses wird zudem durch die Krisenintervention vonseiten der Integrationsberater/innen erreicht, sie sind für alle Akteure vertrauliche Ansprechpartner. Die Unterstützung und Begleitung der Jugendlichen ist zeitlich nicht begrenzt und Interventionen sind jederzeit möglich. "Integrative Arbeitsplätze können dann langfristig aufrecht erhalten werden, wenn eine Betreuung des Arbeitsplatzes gesichert ist. Dazu gehören regelmäßige Gespräche mit den Mentoren, verlässliche Kontakte mit den Arbeitgebern und den Jugendlichen." (Tschann 2005, 88)
Inhaltsverzeichnis
Die vorliegende Studie wurde von mir vor drei Jahren durchgeführt und die Ergebnisse werden hiermit erstmals veröffentlicht. Ziel der Evaluation war, die definierten Kriterien der Unterstützten Beschäftigung und die einzelnen Bausteine im Integrationsprozess auf ihre Wirkungen hin zu überprüfen. Besonders berücksichtigt wurden die Zusammenhänge zwischen der beruflichen Integration und der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen mit Behinderung. Auch die Auswirkungen der Unterstützten Beschäftigung auf die sozial gesellschaftliche Teilhabe wurden im Rahmen der Evaluation erforscht.
Dabei kamen qualitative und quantitative Forschungsverfahren zum Einsatz. Im Rahmen der qualitativen Evaluierung wurden insgesamt 39 Personen - Jugendliche mit Behinderung, Eltern, Mentoren und Arbeitgeber - durch Gruppen- und Einzelinterviews befragt:
Abbildung 3: Übersichtstabelle Interviewdurchführung
|
Einzelinterviews |
Gruppeninterviews |
|||||
|
Mentoren |
1 Pers. |
2 Pers. |
4 Pers. |
3 Pers. |
2 Pers. |
12 Pers. |
|
Eltern |
1 Pers |
2 Pers. |
3 Pers. |
2 Pers. |
3 Pers. |
11 Pers. |
|
Integrationsberater |
4 Pers. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 Pers. |
|
Jugendliche |
0 |
3 Pers. |
2 Pers. |
3 Pers. |
4 Pers. |
12 Pers. |
|
6 Interviews |
12 Interviews |
39 Pers. |
Außer der qualitativen Datenerhebung wurde zusätzlich ein Fragebogen eingesetzt. Dabei wurden Eltern, Mentoren und Arbeitgeber befragt; die Rücklaufquote betrug 42%, in absoluten Zahlen waren dies 62 ausgefüllte Fragebögen.
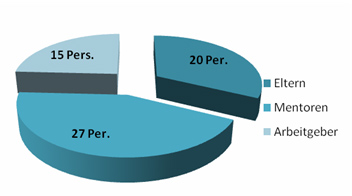
Abbildung 4: Beteiligung Fragebogenerhebung
Die Jugendlichen wurden in die Fragebogenerhebung nicht einbezogen. Ein solches Instrument eignet sich kaum für die Befragung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, denn die Fragestellungen und Bewertungskriterien verlangen einen hohen Abstraktionsgrad, der für die Betroffenen kaum ohne fremde Hilfe zu bewältigen ist.
Soziale Systeme, Organisationen oder Institutionen sind lebende, dynamisch sich verändernde Strukturen und einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Empirische Forschungsmethoden müssen auf diese unstabile Situation angemessen reagieren. Dabei sind zentrale Aspekte zu berücksichtigen. Z.B. müssen Evaluationsverfahren und Forschungsinstrumente auf Sprache und individuelle Kommunikationsformen reagieren. Sozialforschung muss dem Besonderen Rechnung tragen. Sie darf sich nicht ausschließlich auf abstrakte Fragen konzentrieren, sondern muss konkrete Probleme bewältigen, die in bestimmten Situationen auftreten. Die Rückkehr zum Lokalen ist darüber hinaus ein weiterer Aspekt. Handlungen, Interaktionen zwischen den Akteuren, Erfahrungen und Wissensformationen müssen im Kontext konkreter Situationen untersucht werden. Darüber hinaus spielt die Zeit eine wesentliche Rolle, bzw. die Rückkehr zum Zeitgebundenen, denn das Lokale ist stets in einem historischen Kontext verortet.
Gerade qualitative Forschungsverfahren haben deshalb in den letzten Jahren verstärkt Eingang in die Sozialforschung gefunden. Gerade auch deshalb, weil den quantitativen Instrumenten ein zu einseitiges, naturwissenschaftliches Denken unterstellt wurde. Beide Ansätze haben jedoch Stärken und Schwächen. Mayring vertritt daher die Position, "Analysestrategien differenziert dort einzusetzen, wo sie angemessen sind, wo sie ihre Stärken entfalten können [...]." (Mayring 2001) Einen Vorteil kann dabei die Kombination beider Methoden bieten. Für die Evaluation des Modells SPAGAT wurde ein Verallgemeinerungsmodell für die Methodenkombination gewählt. "Hier besitzen die qualitativen Elemente einen höheren Stellenwert, da zunächst eine qualitative Studie komplett durchgeführt und ausgewertet und erst in einem zweiten Schritt mit quantitativen Mitteln verallgemeinert und abgesichert wird." (Mayring 2001)
Qualitative Analysen im Vorfeld können zu einem besseren Verständnis der Gesamtsituation beitragen. Man setzt sich mit subjektiven Meinungen der befragen Personen auseinander. Dabei versucht man, das Geschehen von "innen" heraus zu verstehen. "Verstanden werden soll die Sicht eines Subjekts (oder mehrerer Subjekte), der Ablauf sozialer Situationen [...] oder die auf eine Situation zutreffenden kulturellen bzw. sozialen Regeln." (Flick 2002, 49) Qualitative Forschung trägt den subjektiven Ansichten und Konstruktionen Rechnung. Sie berücksichtigt die Vielfalt und den Pluralismus gesellschaftlicher und sozialer Situationen. "Der rasche soziale Wandel und die resultierende Diversifikation von Lebenswelten konfrontieren Sozialforscher zunehmend mit sozialen Kontexten und Perspektiven, die für sie so neu sind, dass ihre klassischen deduktiven Methodologien - die Fragestellungen und Hypothesen aus deduktiven Modellen ableiten und an der Empirie überprüfen - an der Differenziertheit der Gegenstände vorbeizielen. Forschung ist dadurch in stärkerem Maße auf induktive Vorgehensweisen verwiesen: Statt von Theorie und ihrer Überprüfung auszugehen, erfordert die Annäherung an zu untersuchende Zusammenhänge "sensibilisierende Konzepte" in die - entgegen einem verbreiteten Missverständnis - durchaus theoretisches Vorwissen einfließt." (Flick 1999, 10)
Qualitative Forschung trägt kein fertiges Erklärungsmodell an den Forschungsgegenstand heran, um ihn dadurch zu analysieren und zu erforschen, sondern eruiert in einem sozialen Forschungsfeld, in dem sich soziale Beziehungen und Konstruktionen abspielen und entwickeln von innen heraus ein Modell aus den vielfältigen Meinungen, Perspektiven und intersubjektiven Konstruktionen. In der SPAGAT-Studie wurden aus den qualitativen Ergebnissen Fragestellungen für die Fragebogenerhebung entwickelt. Dadurch ließen sich die Ergebnisse aus beiden Verfahren verdichten und absichern. Die Auswertung der Fragebogenerhebung erfolgte mit der Statistiksoftware SPSS (Superior Performing Software Systems). Die Interviews und verbalen Daten wurden mit dem computergestützten sozialwissenschaftlichen Verfahren GABEK-WinRelan ausgewertet.
Die Methode GABEK[5] (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) wurde von Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck entwickelt. Grundlage von GABEK sind philosophische Konzepte des Verstehens, Erklärens, Lernens und der Gestaltwahrnehmung. GABEK ermöglicht die Vernetzung und Nutzung von Wissensressourcen (Meinungen, Wissen, Wertehaltungen und emotionalen Einstellungen) zur Planung und Evaluierung von Maßnahmen.
Als Ausgangstexte für eine GABEK-Analyse dienen z.B. umgangssprachliche Äußerungen aus einer offenen Befragung. Sie werden mithilfe des PC-Programms WinRelan© zu einem transparenten Meinungsnetz verdichtet, das Überzeugungen, Wissen über Ursachen und Wirkungen, Wertehaltungen und emotionale Einstellungen in Form von "sprachlichen Gestalten", "Hypergestalten", "Gestaltenbäumen", "Wirkungsnetzen", "Bewertungsprofilen" usw. miteinander vernetzt. "Dabei ist jeder Schritt der Auswertung intersubjektiv rekonstruierbar und überprüfbar. Methodologische Untersuchungen haben gezeigt, dass das Verfahren in hohem Maße die Kriterien der Zuverlässigkeit und Gültigkeit erfüllt. [...] GABEK-Projekte unterscheiden sich von quantitativ konzipierten Projekten nicht nur a) durch offene Befragungen, bei denen jeder Befragte sagen kann, was ihm/ihr gerade wichtig erscheint. Es unterscheidet sich auch b) durch die qualitative Auswertung und Vernetzung aller Antworten, c) durch eine ganzheitliche Darstellung der komplexen Meinungsvielfalt, d) durch die Formulierung der Ergebnisse in der Sprache der Befragten, die e) computerunterstützt interaktiv abgefragt und überprüft werden können und f) durch eine hierarchische Ordnung der Ergebnisse im Sinne ihrer Relevanz für die Befragten." (Zelger 2001, 1)
GABEK-Ergebnisse können durch Assoziationsnetze, durch den Gestaltenbaum, durch Bewertungslisten, durch das Wirkungsgefüge und durch die Relevanzanalyse dargestellt werden.
-
Assoziationsnetze
Das Assoziationsnetz besteht aus Begriffen, deren Verbindungslinien Assoziationen zwischen den Begriffen sind. "Dieses sprachliche Netz dient wie eine Landkarte zur Orientierung in der Meinungslandschaft. Häufige Assoziationen sind wie stark befahrene Straßen, selten wie Wege, die die Ortschaften verbinden. Wenn wir von einem Orientierungspunkt uns anderen Begriffen annähern, lernen wir die Meinungslandschaften kennen. Wir können einen Maßstab wählen, in dem nur die häufig verwendeten Begriffe mit den häufigsten Assoziationen vorkommen. Oder wir können den Maßstab so verkleinern, dass wir alle Assoziationen rund um einen ausgewählten Begriff lesen können. So verwenden wir das Assoziationsnetz einer befragten Personengruppe, um uns einen Überblick über ihre Meinungen zu verschaffen, um Begriffe zu klären, um Widersprüche zu identifizieren oder um themenbezogenen Texte auszuwählen." (Zelger 2008)
Beispiel:
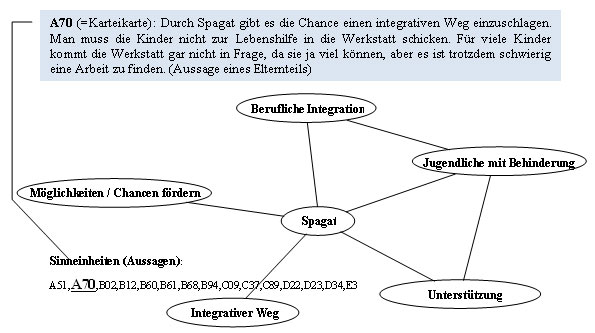
Abbildung 5: Beispiel Assoziationsgraphik
Diese Assoziationsgraphik zeigt die weiteren Begriffe, die mit "Spagat" assoziiert werden. Dabei wurde das Netz einer Komplexitätsreduktion unterzogen, d.h. es werden nur jene Beziehungen zwischen den Ausdrücken aufgezeigt, die mit mindestens 15 Sätzen unterlegt sind. Die Verbindungslinien sind mit Aussagen aus den Interviews unterlegt und die Ergebnisse somit intersubjektiv nachvollziehbar.
-
Der Gestaltenbaum
"Der Gestaltenbaum ordnet die Äußerungen aller Beteiligten hierarchisch. Die Inhalte an der Spitze [...] sind besonders wichtig, weil ihnen viele Erfahrungen und Meinungen von befragten Personen entsprechen.
Die Strukturierung der verbalen Daten in Form eines Gestaltenbaums (wie er auf der folgenden Seite zu sehen ist) erlaubt es, die Ergebnisse stark zusammengefasst oder auch fein detailliert zu betrachten: Jede Ebene stellt die Situation als ein Ganzes dar, jedoch mit mehr oder weniger Details. Kurze Zusammenfassungen auf den höheren Ebenen werden jeweils durch Textgruppen aus den tiefer liegenden Ebenen begründet oder gerechtfertigt." (Zelger 2008)
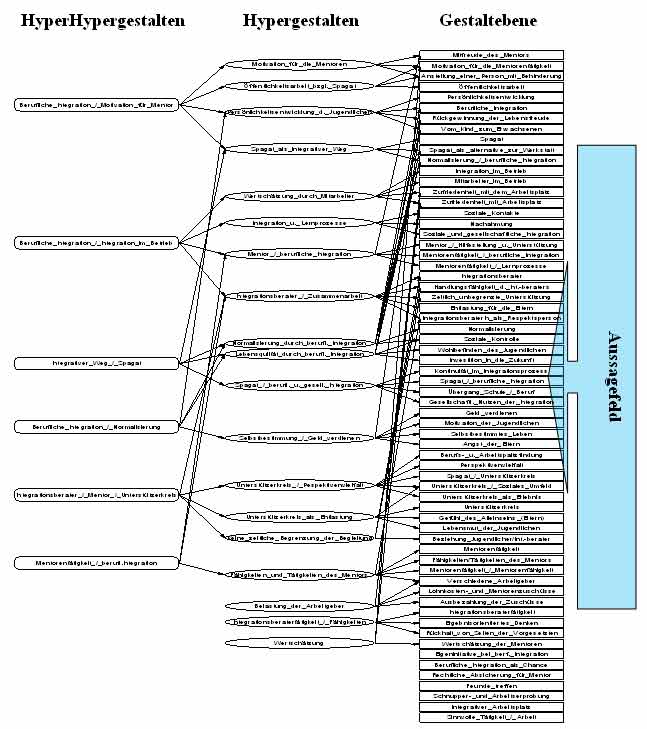
Abbildung 6: Beispiel Gestaltenbaum
-
Bewertungsliste
In umgangssprachlichen Texten kommen immer auch Bewertungen zum Ausdruck: "Merkmale, Gegenstände, Eigenschaften, Situationen oder Prozesse werden von den betroffenen Personen nicht nur beschrieben, sondern auch positiv oder negativ bewertet." (Zelger 2008) Diese Bewertungen werden in der Bewertungsliste aufgezeigt.
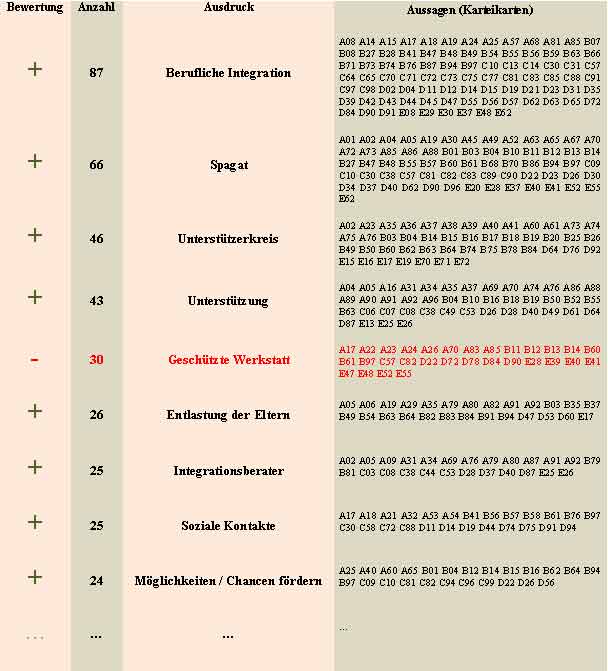
Abbildung 7: Auszug aus der Bewertungsliste
-
Das Wirkungsgefüge
Umgangssprachliche Texte bringen nicht nur Beschreibungen und Bewertungen zum Ausdruck, sondern auch Annahmen über Ursachen und Wirkungen. "Das sind Meinungen über Wirkungszusammenhänge, die oft durch empirische Erfahrungen über längere Zeit gewonnen wurden oder auch durch Gespräche mit anderen Personen. Solche Kausalannahmen können wir als Argumente zur vernünftigen Steuerung unserer Handlungen heranziehen. Zustände oder Merkmale, die sich nach der Meinung der befragten Personen verändern können, nennen wir Variablen. Kausalannahmen werden durch Pfeile zwischen Variablen dargestellt. Dabei wird das Wachstum des beeinflussten Merkmals durch einen Pfeil und dessen Abnehmen durch eine Linie mit Kreisen dargestellt." (Zelger 2008)
Durch das Wirkungsgefüge können Ziele und Maßnahmen identifiziert werden, um positive bzw. negative Wirkungen abzuschätzen. Kausalannahmen werden durch Pfeile zwischen den Variablen dargestellt:
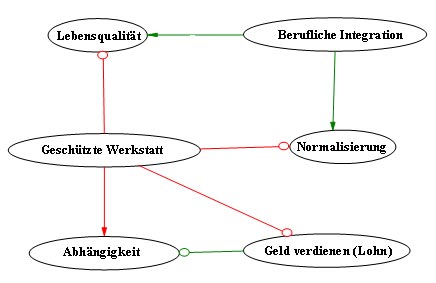
Abbildung 8: Beispiel Kausalnetzgraphik
Interpretationsbeispiel:
Die "Berufliche Integration" wirkt sich positiv auf die "Normalisierung" der Lebenssituation der Jugendlichen aus. Von der "Geschützten Werkstatt" gehen negative Wirkungen aus, insofern "Normalisierung" und "Lebensqualität" negativ abnehmen...
Mögliche Kausalwirkungen:
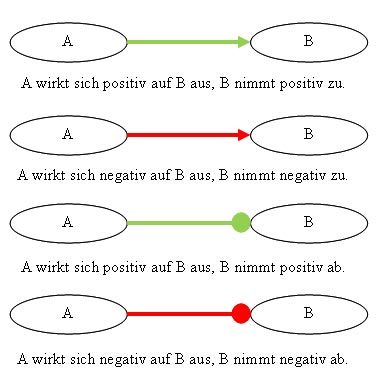
-
Relevanzanalyse
Alle dargestellten Ergebnisse führen zur Frage, wie sie gewichtet werden können, um ihre Relevanz im Kontext GABEK-Analyse zu eruieren. Um diese Fragen zu beantworten, werden drei Kriterien vorgeschlagen:
"1. Merkmale und Zusammenhänge, die in der obersten Zusammenfassung des Gestaltenbaums noch auftauchen, sind wichtiger als jene, die nur auf tieferliegenden Ebenen vorkommen, weil die Inhalte auf der obersten Ebene des Gestaltenbaums in mehr Situationen anwendbar sind. 2. Wenn in den Bewertungslisten viele Personen ein Merkmal positiv bewerten, dann ist das ein Hinweis auf dessen Wichtigkeit. 3. Der dritte Weg der Gewichtung führt über die Kausalannahmen: Die originalen Antworten der Befragten enthalten nicht nur Beschreibungen und Bewertungen, sondern auch theoretisches Alltagswissen. Dieses Wissen kommt u.a. zum Ausdruck in den Vermutungen über Ursache-Wirkungsbeziehungen. Wenn ein Merkmal, das als Ursache aufgefasst wird, viele Wirkungen nach sich zieht, dann ist das Merkmal wichtig." Durch die Relevanzanalyse können alle Gewichtungen vorgenommen werden und zugleich schafft man sich einen Überblick.
Beispiel: Relevanzanalyse nach Kausalannahmen
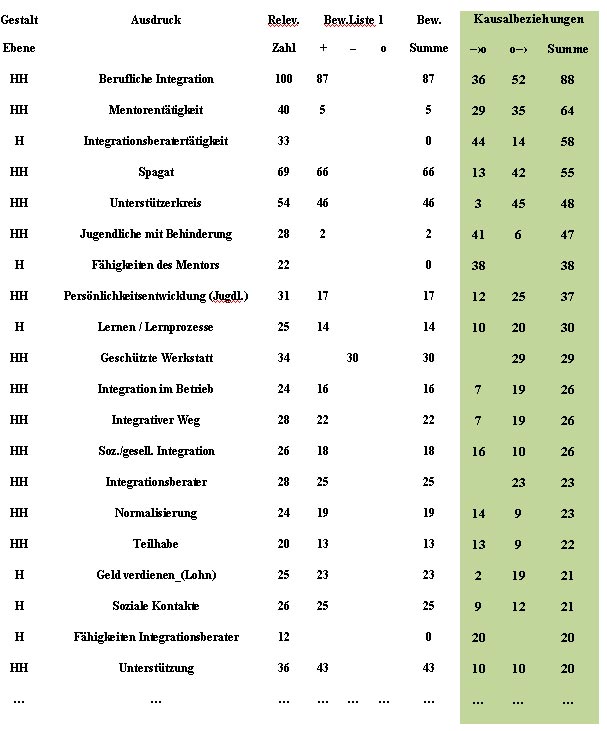
Der Erfolg einer Studie hängt wesentlich vom Aufbau und der Formulierung der Fragestellung ab. Für die qualitative Evaluation wurde für jede Personengruppe ein eigener Fragebogen eingesetzt, der offene und teilstrukturierte Fragestellungen kombinierte.
Die offene Fragestellung hat den Vorteil, dass der Interviewpartner ungezwungen sprechen und seine reichhaltigen Erfahrungen einbringen kann. Offene Fragen erlauben dem Befragten, ganz nach eigenem Gutdünken, auf persönliche Erfahrungen und auf Stellungnahmen einzugehen. Damit werden die verbalen Daten in hohem Maße für Problemlösungen relevant. Die Befragten werden dabei nicht gezwungen, sich für spezifische Alternativen zu entscheiden.
Die Form des teilstrukturierten Fragebogens dient als Leitfaden, um die im Vorfeld gebildeten Schwerpunkte zu thematisieren. Teilstrukturierte Fragen sollen jedoch trotz aller inhaltlichen Vorgaben genügend Freiraum für individuelle Äußerungen und Positionen lassen. "Der Leitfaden dient als Orientierung bzw. Gerüst und soll sicherstellen, dass nicht wesentliche Aspekte der Forschungsfrage im Interview übersehen werden. Das Interview muss jedoch nicht strikt nach der zuvor festgelegten Reihenfolge der Fragen des Leitfadens verlaufen. Auch hat der Interviewer selbst zu entscheiden, ob und wann er detailliert nachfragt und ausholende Ausführungen des Befragten unterstützt bzw. ob und wann er bei Ausschweifungen des Befragten zum Leitfaden zurückkehrt." (Mayer 2006, 37) Die direkte Fragestellung durch das persönliche Interview soll dem jeweiligen Interviewpartner vermitteln, dass er als Gegenüber mit seinen Meinungen ernst genommen wird und nicht lediglich als eine Befragungsnummer existieret. Insgesamt muss darauf geachtet werden, eine künstliche Gesprächssituation zu vermeiden.
Inhaltlich wurde der Fragebogen für die qualitative Studie so konzipiert, dass alle relevanten Themen von jeder Personengruppe angesprochen werden konnten. Im ersten Themenkomplex wurde nach der Zufriedenheit der Akteure mit dem Modell SPAGAT gefragt. Im zweiten Themenblock wurden die Auswirkungen der beruflichen Integration auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen mit Behinderung diskutiert. Im nächsten Themenfeld wurde die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Personengruppen besprochen. Im letzen Block standen die jeweiligen Ablaufphasen und Bausteine zur Diskussion.
Es wurden, wie erwähnt, Einzel- und Gruppeninterviews durchgeführt. Gruppeninterviews bieten einige Vorteile, da sie gegenüber Einzelinterviews den Zeitaufwand beträchtlich reduzieren. Außerdem sind durch Gruppeninterviews erhobene Daten stärker kontextgebunden, denn eine "kleine Anzahl von [...] Individuen, die zu einer Diskussions- und Informationsgruppe zusammengebracht werden, sind ein Vielfaches gegenüber einer repräsentativen Stichprobe wert. Solch eine Gruppe, die gemeinsam ihren Lebensbereich diskutiert und ihn intensiv prüft, wenn ihre Mitglieder sich widersprechen, wird mehr dazu beitragen, die den Lebensbereich verdeckenden Schleier zu lüften als jedes andere Forschungsmittel [...]." (Flick 2002, 170)
Die Interviews wurden im Einverständnis mit den Gesprächspartnern auf Tonband aufgenommen. Das bietet für den Interviewer erhebliche Erleichterungen, da er sich auf das Gespräch und den Leitfaden konzentrieren und Gesprächssituationen differenziert wahrnehmen kann. Die Sicht des Gesprächspartners steht stets im Mittelpunkt. Der Interviewer kann zwar Kontroll-, Sondierungs- und Verständnisfragen stellen, er muss jedoch gewillt sein, sich auf die Einzigartigkeit einer Lebensgeschichte einzulassen und versuchen, die Lebensschicksale in ihrer Einmaligkeit und in ihrer Allgemeinheit zu verstehen. In der Interviewsituation muss eine gewaltfreie Kommunikation zwischen Interviewer und Interviewtem herrschen, der Interviewer muss sich an seinen Gesprächspartnern orientieren und sich mehr oder weniger auf ihre Ausdrucksform und ihre Sprachebene einstellen. Nach Bourdieu ist wichtig, "eine Beziehung des aktiven und methodischen Zuhörens zu schaffen, das vom reinen Laisser-faire des nicht-direktiven Interviews genauso weit entfernt ist wie vom Dirigismus eines Fragebogens." (Bourdieu 1997, 782)
Der Fragebogen für die quantitative Datenerhebung wurde teilweise aufgrund der qualitativen Ergebnisse entwickelt. Er bestand zudem aus einem allgemeinen und personenspezifischen Teil. Im ersten Themenblock des allgemeinen Teils war wiederum die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren Thema. Der zweite Teil behandelte allgemein das Thema und den Stellenwert der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Im nächsten Themenbereich wurden Daten zu den einzelnen Ablaufphasen und Bausteinen erhoben. Im vierten Teil stand die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen mit Behinderung im Mittelpunkt. Im fünften und letzten Teil wurden gruppenspezifische Themen abgefragt.
Im Folgenden werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse kombiniert und anhand der zentralen Themenbereiche dargestellt.
Zu den Ablaufphasen und Bausteinen zählen die Zukunftsplanung und die Unterstützerkreise, die Schnupperphase als Orientierungspraktikum, die Arbeitserprobung, die zuletzt in ein Anstellungsverhältnis mündet.
-
Die Zukunftsplanung und der Unterstützerkreis:
Aus den Interviews geht hervor, dass der Unterstützerkreis und die Zukunftsplanung als Dreh- und Angelpunkt für die berufliche Integration der Jugendlichen gelten. Der Unterstützerkreis wirkt laut den einzelnen Aussagen unterstützend bei der Berufsfindung, bei der Fähigkeitsanalyse und bei der Arbeitsplatzakquisition. Der Unterstützerkreis entfaltet sein Potential vor allem durch den Einbezug des sozialen Umfelds.
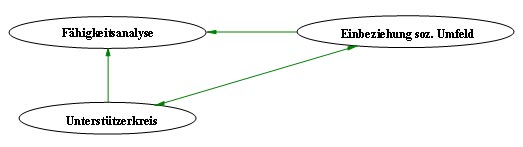
Abbildung 10: Kausalgraphik ‚Unterstützerkreis'
Vor allem für die Fähigkeitsanalyse ist der Unterstützerkreis wertvoll. Durch folgende exemplarische Aussage eines Elternteils wird dies eindrucksvoll belegt: "Im Unterstützerkreis werden die Fähigkeiten und Qualitäten der Kinder herausgefiltert, bei ihr (der Tochter) waren dies eben die Kontaktfreudigkeit und die Kommunikationsfreude. Sie ist sehr gern unter Menschen! Daher mussten wir eine Arbeit finden, wo dies passieren kann. Sie hat jetzt vier Arbeitgeber und führt ein ganz buntes Leben, das ist für unsere Tochter sehr wichtig." (Zitat Elternteil Karteikarte A23)
Weitere Aussagen geben einen eindeutigen Hinweis darauf, dass durch die Einbeziehung des sozialen Umfelds im Unterstützerkreis verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, die sich gegenseitig befruchten. Jeder einzelne Teilnehmer am Unterstützerkreis kennt den Jugendlichen mit Behinderung auf seine Weise, er nimmt ihn aus einer anderen Perspektive wahr. Diese verschiedenen Informationen und Perspektiven runden das Gesamtbild ab und bieten einen wichtigen Beitrag. "Durch den Unterstützerkreis kommen einfach verschiedene Sichtweisen zusammen. Wir Eltern haben ja oft eine allzu enge Sichtweise. Im Unterstützerkreis treffen so viele Meinungen aufeinander, die man als Vater oder Mutter oft gar nicht sieht, die aber sehr hilfreich und wertvoll sind." (Zitat Elternteil Karteikarte A36)
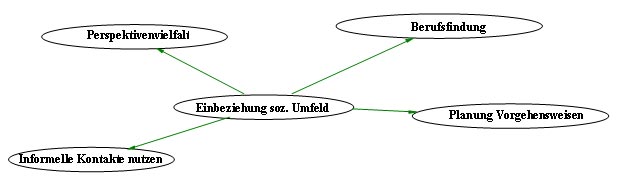
Abbildung 11: Kausalgraphik ‚Einbezug soziales Umfeld
Der Unterstützerkreis ist als informelles Netzwerk vor allem auch dann wichtig, wenn Arbeitgeberkontakte angebahnt werden müssen. Die einzelnen Mitglieder im Unterstützerkreis kennen das regionale Umfeld und Geschehen, sie kennen vielfach auch potentielle Arbeitgeber und stellen mitunter die ersten Kontakte zu diesen her. Die Mitglieder unterstützen die Planung und die Vorgehensweise aller notwendigen Schritte auf dem Weg zur beruflichen Integration. Aufseiten der Eltern führt der Unterstützerkreis zu einer großen Entlastung und zu einem Gefühl der Solidarität: "Der Unterstützerkreis ist nicht nur für die Jugendlichen wichtig und für die berufliche Integration. Sondern auch für uns Eltern! Wir haben vielfach Angst! Angst, andere um Hilfe zu fragen. Daher war ich vom Unterstützerkreis ziemlich überrascht, wie viel Unterstützung man bekommt. Wir haben uns mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern zusammengesetzt. Was da für unterschiedliche Ansichten und Neues rauskamen war ungemein schön! Es gab kein Tabuthema, jeder sieht das Kind anders, man bekommt ein anderes Bild vom eigenen Kind, man sieht es plötzlich anders und das ist ganz wichtig." (Zitat Elternteil Karteikarte B23)
Im Rahmen der Befragung wurden noch zahlreiche weitere Wirkungen, die vom Unterstützerkreis ausgehen, genannt. Insgesamt kann das Resümee gezogen werden, dass der Unterstützerkreis als wertvolles Planungsinstrument wahrgenommen wird. Im Unterstützerkreis werden außerdem wertvolle Erfahrungen reflektiert, die der Jugendliche während seiner Schnupper- und Arbeitserprobungsphasen macht. Der Unterstützerkreis gibt Orientierung und Sicherheit und dient vor allem auch als Instrument zur Krisenintervention und leistet so einen wichtigen Beitrag, um langwährende und stabile Arbeitsverhältnisse aufrecht zu erhalten.
Im Fragebogen konnten die Eltern bzw. Elternteile die einzelnen Funktionen bewerten. Die folgenden Ergebnisse zeigen ein äußerst positives Bild:
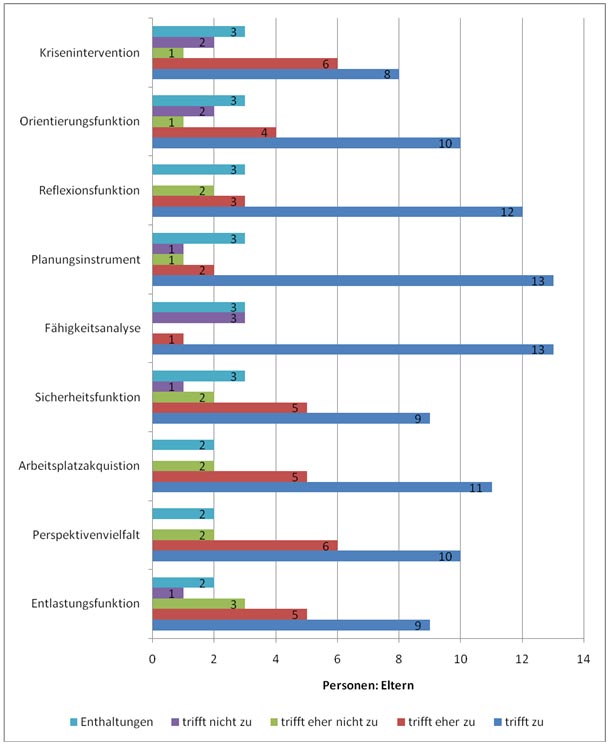
Abbildung 12: Bewertung: Funktionen des Unterstützerkreises
Auf die Frage, inwiefern der Unterstützerkreis insgesamt eine wichtige Rolle im Prozess der beruflichen Integration der Jugendlichen spielt, antworten 12 Eltern, dass er sehr wichtig ist. 4 Eltern geben an, dass er in ihrem Fall eine wichtige Rolle spielte. Nur zwei Eltern sind der Meinung, dass er nicht so ausschlaggebend war.
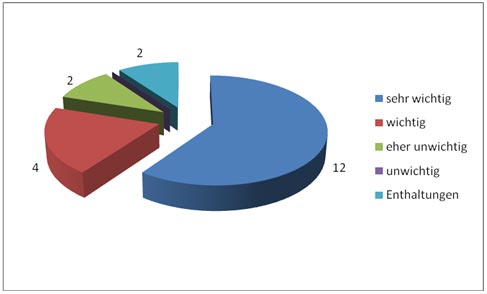
Abbildung 13: Die Rolle des Unterstützerkreises im Integrationsprozess
Die Jugendlichen selbst haben den Unterstützerkreis als sehr ermutigend und positiv erlebt. Er leistet aus ihrer Sicht Hilfestellung und Unterstützung im Integrationsprozess, er wird als wesentlich im Rahmen der Fähigkeitsanalyse erachtet und sie unterstreichen, dass sie als Hauptpersonen stets im Mittelpunkt der Planung standen. Der Unterstützerkreis wird von allen Jugendlichen als eine wertvolle Erfahrung geschildert: "Zuerst gibt es beim SPAGAT den Unterstützerkreis, das ist sehr gut gegangen. Die Leute haben über mich geredet. Sie haben sich dann überlegt, was ich tun kann - alle gemeinsam haben sich das überlegt. Alle gemeinsam haben dann geholfen und mich unterstützt. Das war sehr schön." (Zitat Jugendlicher Karteikarte G64)
Weitere exemplarische Aussagen waren: "Der Unterstützerkreis hat mir geholfen, einen Job zu suchen. Die haben alle mit mir geredet. Die haben aufgeschrieben, was ich gut kann und ich habe alles erzählt, was mir gefällt. Dann haben sie für mich einen Job in der Schule gesucht. Zuvor bin ich aber noch schnuppern gewesen." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D76)
"Der Unterstützerkreis hat mir gut gefallen. Die Leute haben mir weitergeholfen. Das war aufregend und auch wichtig für mich. Ich habe gesehen, dass ich nicht allein bin, dass mir geholfen wird. Im Unterstützerkreis ist immer von meinen Fähigkeiten gesprochen worden, alle haben davon geredet, was ich alles kann." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D92) Hier spricht der Jugendliche das Gefühl der Solidarität an und die einzelnen Zitate belegen, dass sich die Betroffenen durch den Unterstützerkreis wertgeschätzt und anerkennt fühlten.
Auf den Aspekt der Wertschätzung und der Anerkennung weisen zudem auch zahlreiche Aussagen von Eltern hin: "In der Schule hört man immer nur: Hier und da fehlt es, hier und da hat das Kind Mängel, dies und das kannst du nicht. Im Unterstützerkreis hat man die Fähigkeiten hervorgehoben, das was unser Sohn kann! Seine Besonderheiten! Das alles zu hören war eine wertvolle Erfahrung für das Kind. Jedes unserer Kinder hat Fähigkeiten und wenn es die von den verschiedensten Leuten hört, dann tut das einfach nur gut. Die Kinder werden sehr stark aufgebaut." (Zitat Elternteil Karteikarte B26) Oder: "Jeder Jugendliche erfährt den Unterstützerkreis sehr individuell. Aber allgemein gesagt ist er etwas ganz Besonderes. Er bedeutet unheimlich viel, was Selbstwertgefühl und Mut anbelangt. Die Jugendlichen stehen im Mittelpunkt. Sie sind die Chefs und das ist toll. So viele Leute reden über ihn, was er für ein besonderer Mensch ist! Es sind lauter Leute dabei, die gemeinsam mit dem Jugendlichen die Zukunft planen." (Zitat Elternteil Karteikarte E16)
Im Unterstützerkreis kommt eine Stärken-Perspektive zum Tragen. Und er erweist sich, im Übergang in die Berufswelt, als eine wichtige Form der "Lebensweg-Begleitung" (Herriger, Grundlagentext Empowerment 2005, 3) und durch den Einbezug des sozialen Umfelds, im Sinne der Empowerment-Praxis, "als normative Enthaltsamkeit der Helfer [...] [durch den] Verzicht auf entmündigende Expertenurteile im Hinblick auf die Definition von Lebensproblemen, Problemlösungen und Lebensperspektiven [...]." (Herriger, Grundlagentext Empowerment 2005, 3) Außerdem weisen die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass der Unterstützerkreis ein hilfreiches Instrument für die Ressourcendiagnostik ist. Die Mitglieder im Unterstützerkreis kennen das regionale Umfeld, leisten Unterstützung bei der Arbeitsplatzfindung und stellen Arbeitgeberkontakte her. Im Sinne einer prozessbegleitenden Reflexion, beraten die Mitglieder gemeinsam mit dem Betroffenen über die Erfahrungen der Schnupper- und Arbeitserprobungsphase. Hindernisse auf dem Weg zur beruflichen Integration werden gemeinsam besprochen und eventuell "weiterführende Hilfeverfahren neu organisiert." (Herriger, Grundlagentext Empowerment 2005, 5) Durch den Unterstützerkreis wird um dem Betroffenen ein soziales Netzwerk aufgebaut, das in verschiedenen Lebenssituationen der Belastung spürbare Entlastung und Hilfestellung zu geben vermag. Diese Ansätze der Empowerment-Praxis und sozialen Netzwerkarbeit "zielen auf Beziehungsnetzwerke, die auf gewachsenen familiären, verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen aufbauen und die ein relativ hohes Maß an Vertrautheit implizieren. Ziel der Arbeit ist es, Verbindungen, die sich in der Zeit gelockert haben, enger zu knüpfen, bestehende Risse in der Textur der Beziehungen zu kitten, emotionale Belastungen und Beziehungshypotheken zu mindern und die Unterstützungsbeiträge der Mitglieder des privaten Netzwerkes zu einem gemeinsamen Ganzen zu verknüpfen.
An dieser Stelle soll noch auf den Aspekt der Selbstnarration und Biographiearbeit eingegangen werden. Im Vorfeld der Zukunftsplanung setzen sich die Integrationsberater mit den Träumen, Bedürfnissen und Berufswünschen der Jugendlichen auseinander. Tschann schreibt, dass es für die erfolgreiche berufliche Integration sehr wichtig ist, "dass die Jugendlichen den Mut haben, ihre Träume auszusprechen, uns teilhaben lassen an ihren inneren Bildern. Dort wo die Träume sind, dort steckt auch Kraft und Sehnsucht, manchmal auch der größte Schmerz." (Tschann 2005, 46) D.h. die Beschäftigung mit den Träumen, Sehnsüchten und Wünschen benötigt zugleich eine intensive Auseinandersetzung mit der lebensgeschichtlichen Vergangenheit der Jugendlichen. Aus der Vergangenheit können Wege erschlossen werden, die Orientierung für zukünftige Schritte auf dem Weg in die Arbeitswelt bieten. Zukunft braucht Herkunft; die Träume müssen einem lebensgeschichtlichen Zusammenhang zugeordnet werden, um sie im Kontext zu erschließen. Tschann bringt in ihrer Diplomarbeit das Beispiel von Jürgen, einem Jugendlichen mit Behinderung, der Krankenpfleger werden wollte. "Er hatte sehr konkrete Vorstellungen von den Aufgaben eines Pflegers, da seine beiden Großeltern bis zu ihrem Tod bei ihnen zu Hause gepflegt wurden." (Tschann 2005, 50) Sein Berufswunsch steht insofern in einem unmittelbaren Zusammenhang mit früheren Erfahrungen. "Immer wieder, wenn Jürgen seinen Wunsch Pfleger oder auch Arzt zu werden äußerte, bekam er von seinem Umfeld die Antwort, dass das einfach ‚nicht gehe'. Jürgen beharrte aber darauf, wusste, dass er einen guten Kontakt zu alten Menschen hatte, und hielt ganz stark an dieser Kompetenz fest. Er verschloss sich immer mehr, wenn es um Zukunftsfragen ging, wollte sich und seine Träume vor Ironie und mitleidigem Lächeln schützen." (Tschann 2005, 50) Seine Integrationsberaterin hielt jedoch am Wunsch des Jugendlichen fest. Sein Berufstraum und die damit verbundenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen sind nämlich Grundbedingungen für die eigene Selbstwertschätzung und für ein Gefühl von Lebensgelingen. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit den Träumen der Jugendlichen eröffnet "Möglichkeitsräume, in denen der Einzelne Sprache finden kann und in der reflexiven Aneignung der lebensgeschichtlichen Erfahrungen Werkzeuge für die Bearbeitung des Zurückliegenden und Orientierung für das noch unbekannte Zukünftige gewinnen kann." (Herriger 2005, 5)
-
Die Schnupperphase
Die Schnupperphase stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg in die berufliche Zukunft der Jugendlichen dar. Sie findet in Betrieben statt, die ideale Tätigkeitsfelder für die Jugendlichen bieten, die im Unterstützerkreis eruiert wurden und z.T. durch die Mitglieder des Unterstützerkreises akquiriert werden. Die Integrationsberater suchen gemeinsam mit dem Jugendlichen die Betriebe auf, um Arbeitssituationen und Tätigkeitsbereiche konkret zu erleben. Im Zeitraum von durchschnittlich zwei Wochen finden mehrere Schnupperpraktika statt. Dabei können zugleich die Ergebnisse und Hypothesen der Zukunftsplanung überprüft werden. Die Erfahrungen der Schnupperphase werden im Unterstützerkreis wiederum reflektiert.
Die Jugendlichen benötigen während der Schnupperphase intensive Begleitung vonseiten der Integrationsberater. Sie sind mit neuen Situationen konfrontiert, die verschiedene und völlig neue Wege eröffnen. Die Begleitung gewährleistet dabei das nötige Maß an Sicherheit und Orientierung.
Auch für die Betriebe ist die Begleitung ausschlaggebend. Viele Betriebe haben keine Erfahrung mit Menschen mit schweren Behinderungen. Ohne Begleitung, Beratung und Unterstützung wären viele nicht bereit, die Verantwortung für ein solches Praktikum zu übernehmen. Die Integrationsberater spielen bereits ab diesem Zeitpunkt eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den Mitarbeitern des Betriebs und den Jugendlichen. Gleichzeitig erhält der Betrieb Informationen über das Modell SPAGAT und über den integrativen Arbeitsplatz.
Die Schnupperphase bietet allen involvierten Personen Orientierung. Der Jugendliche bekommt konkrete Einblicke in Arbeitsbereiche, um zu entscheiden, ob ihm die Tätigkeiten entsprechen oder nicht: "Ich war schnuppern. Ich habe im Altersheim geschnuppert, aber da war es mir in der Küche viel zu heiß und dann habe ich einen anderen Job bekommen. Schnuppern war wichtig. So habe ich mehrere Jobs kennen gelernt. So hab ich sagen können, welche Arbeit mir gefällt und welche nicht." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D77)
Weitere exemplarische Stellungsnahmen vonseiten verschiedener Personen unterstreichen die Orientierungsfunktion der Schnupperphase:
Arbeitgeber: "Die Schnupperphase war eine wichtige Phase. Man kann sich da schon seine Vorstellungen machen, wie es weitergehen soll. Für uns war diese Zeit wichtig, auch um zu sehen, wie die Kundschaft reagiert. Aber positiver kann man nicht reagieren. Da hat jeder gesagt, dass man es super findet, wenn der C. hier arbeitet." (Zitat Arbeitgeber Karteikarte D51)
Elternteil: "Die Schnupperphase war sehr wichtig für die Orientierung und für die weiteren Schritte. Die Schnupperphase war eine wichtige Orientierung für uns Eltern, für den Jugendlichen, aber auch für die Arbeitgeber. Bis zuletzt hat sich an einem solchen Schnupperplatz eine Anstellung ergeben." (Zitat Elternteil Karteikarte A44)
Mentor: "Die Schnupperphase war für mich sehr wichtig. Es war eine wichtige Chance für den Jugendlichen und für mich als späteren Mentor. Wir sind in dieser Zeit so weit gekommen, dass wir uns gesagt haben, dass wir es probieren [Arbeitserprobung]. Auch der S. war an diesem Punkt. In der Schnupperphase ist es zur Bereitschaft gekommen, dies zu probieren. Während der Schnupperphase hat man auch die Integrationsberaterin kennen gelernt - ja, es war eine wichtige Phase für uns alle." (Zitat Mentor Karteikarte C32)
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der qualitativen Evaluation war, dass während der Schnupperphase auf die Träume und Wünsche der Jugendlichen eingegangen wird. Viele Jugendliche assoziieren mit ihrer zukünftigen Arbeit verschiedene Wünsche und Träume. Im Sinne einer ressourcenorientierten Sozialarbeit müssen diese unterstützt werden, da sie wichtige Motivationsquellen darstellen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. "In der traditionellen Hilfeplanung im Behindertenbereich werden Träume dagegen häufig als Problem angesehen. Es würde zu schmerzhaften Verletzungen führen, wenn wir die unterstützten Menschen mit Behinderung nach ihren Träumen fragen würden. Damit würden Hoffnungen geweckt, die nie befriedigt werden können. Den hochfliegenden Träumen würde dann der viel schmerzhaftere Fall folgen. Es besteht sowieso die Gefahr, dass einige der betreuten Menschen in Träume flüchten, um der unangenehmen Realität zu entgehen." (Van Kan und Doose 1999, 96) Unerfüllte Träume und Wünsche, denen nicht nachgegangen wird, können jedoch zur Blockierung der Person führen. Deshalb werden im SPAGAT Realisierungschancen konkret erkundet und in gangbare Schritte umgewandelt. Dabei können verschiedene Dinge ausprobiert werden, um zu sehen, ob sie dem Jugendlichen wirklich gefallen und zu ihm passen. Nicht zuletzt erkennt der Jugendliche oft selbst, dass seine Träume nicht eins zu eins in die Realität umgesetzt werden können und er gewinnt daraus die Offenheit, andere gangbare Wege einzuschlagen: "Unsere Tochter hatte den Wunsch auf einer Babystation zu schnuppern, da sie Babys sehr gern hat. Es war für uns klar, dass dort nie eine Anstellung erfolgt, aber es war wichtig, dass sie diesen Wunsch sich für kurze Zeit erfüllen konnte. Sie war voll begeistert. Sie hat die Babys zu den Müttern gebracht und hat Tee ausgeteilt. Sie hat innerhalb der Schnupperphase bei Spagat nur sehr gute Erfahrungen gemacht und konnte probieren, welche Arbeit ihr gut tut und gefällt. Man wollte ihr einmal ermöglichen auf der Babystation zu arbeiten, weil das ihr innigster Wunsch war." (Zitat Elternteil Karteikarte B88) Eine weitere exemplarische Aussage zu der selben Thematik ist: "Unser Sohn hatte den Wunsch, als Koch zu arbeiten. Das war für uns Eltern ganz unreal, dass er in einer Küche arbeitet. In der Schnupperphase hat man diesen Wunsch ernst genommen und er durfte in einer Küche arbeiten. Es hat sich aber sehr schnell rausgestellt, auch für unseren Sohn, dass das nicht die geeignete Arbeit ist. Es war aber wichtig, dass er diesen Wunsch ausleben konnte." (Zitat Elternteil Karteikarte A78)
Die folgende Kausalgraphik zeigt die gesamten wesentlichen und positiven Wirkungen, die von der Schnupperphase ausgehen:
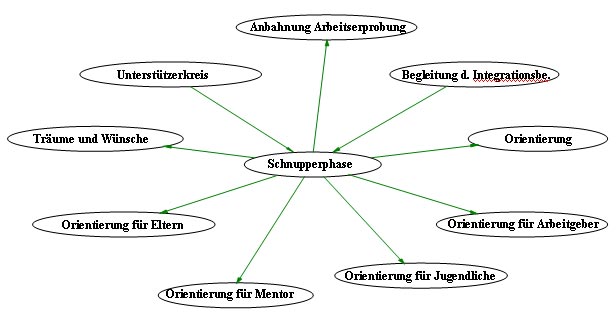
Orientierung für Mentor
Auch die Ergebnisse der Fragebogenerhebung geben einen klaren Hinweis darauf, dass die Schnupperphase eine wichtige Funktion für die berufliche Integration der Jugendlichen erfüllt. 99% der befragten Personen gaben an, dass der Schnupperphase bei SPAGAT eine wichtige bis sehr wichtige Funktion zukommt.
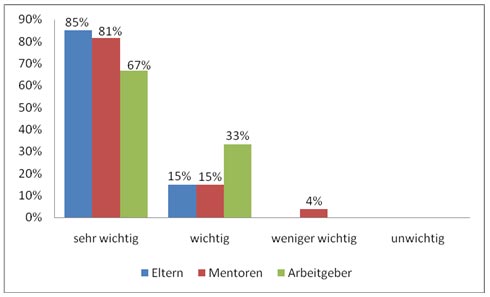
Abbildung 15: Bewertung ‚Schnupperphase'
-
Die Arbeitserprobung
An die Schnupperphase schließt die Arbeitserprobung an. Meistens wurde bereits während der Schnupperhase eine passende Arbeitsstelle für den Jugendlichen gefunden. An diesem Arbeitsplatz kann nun die konkrete Arbeitsplatzanalyse, die Arbeitsplatzanpassung und die Qualifizierung am Arbeitsplatz erfolgen. Die dreimonatige Arbeitserprobung wird wieder intensiv vonseiten der Integrationsberater begleitet. Sie wird dazu genutzt, einen innerbetrieblichen Mitarbeiter als Mentor aufzubauen. Im Rahmen der Arbeitsplatzanpassung werden z.B. technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt oder Arbeitsprozesse mit Hilfe von Piktogrammen oder Fotos festgehalten. Die Arbeitszeit und die Pausen werden individuell auf die Bedürfnisse des Jugendlichen abgestimmt.
Der Qualifizierung am Arbeitsplatz kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Unter Realbedingungen werden berufsbezogene Fertigkeiten trainiert, berufliche Kompetenzen ausgebildet und Lernprozesse ermöglicht. Der Jugendliche lernt Arbeitsabläufe und den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen kennen, außerdem bekommt er Einblick ins gesamte Arbeitsumfeld (Verwaltungsbüros, Lager, Sanitäranlagen usw.). Während der Arbeitserprobung ist es wichtig, dass der Jugendliche Handlungssicherheit im neuen Umfeld gewinnt. Während dieser gesamten Zeit wirkt der Integrationsberater als wichtigste Unterstützung für den Jugendlichen. In allen Prozessen und Entscheidungen wird der Jugendliche eingebunden; er soll sich mit seiner Arbeit identifizieren. Die Arbeit soll sowohl für den Betrieb als auch für den Jugendlichen sinnvoll sein, denn dadurch bekommt er Anerkennung vonseiten der Mitarbeiter und gewinnt daraus die notwendige Selbstschätzung.
An die Arbeitserprobung als Vorstufe des Anstellungsverhältnisses werden wiederum konkrete Erwartungen und Hoffnungen geknüpft. Um diesen gerecht zu werden, übt die Arbeitserprobung für alle involvierten Akteure eine Orientierungsfunktion aus. Bei den Arbeitgebern herrschen im Vorfeld der Anstellung eines behinderten Menschen Ängste vor. Sie assoziieren mit Behinderung Arbeitsunfähigkeit, mangelnde Leistungsbereitschaft, Leistungsausfall, eingeschränkte Arbeitskraft, besonderer Kündigungsschutz etc. Durch die Arbeitserprobung können viele unbegründete Ängste aus dem Weg geräumt werden.
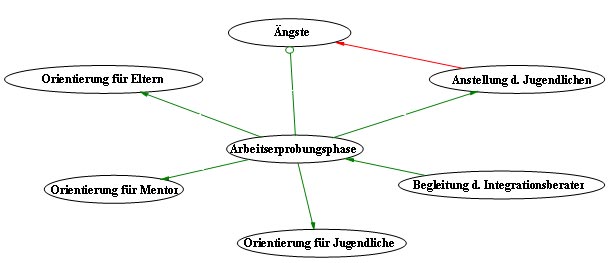
Abbildung 16: Kausalgraphik ‚Arbeitserprobung'
Insgesamt wurde die Arbeitserprobung von allen Personengruppen als eine wichtige Phase im Integrationsprozess bezeichnet.
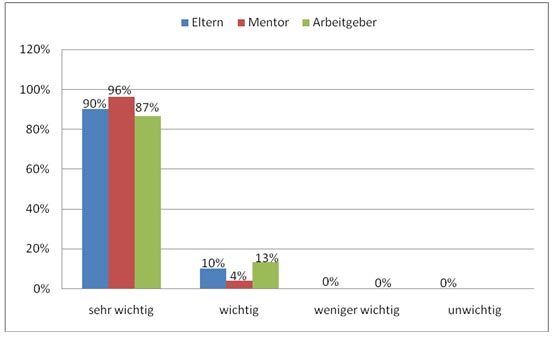
Abbildung 17: Bewertung ‚Arbeitserprobung'
Arbeitsplätze werden im regionalen Umfeld der Jugendlichen gesucht. Durch die Regionalität werden wichtige Ressourcen erschlossen. Vor allem für den Aufbau sozialer Kontakte ist dieser Aspekt zentral. "Unsere Tochter arbeitet im Dorf, in einem Geschäft und im Altersheim. Sie ist von daher immer präsent. Die Leute kennen sie und das ist sehr wichtig. Wenn sie zu Hause wäre oder in einer geschützten Werkstatt, würde man das nicht zustande bekommen." (Zitat Elternteil Karteikarte A17)
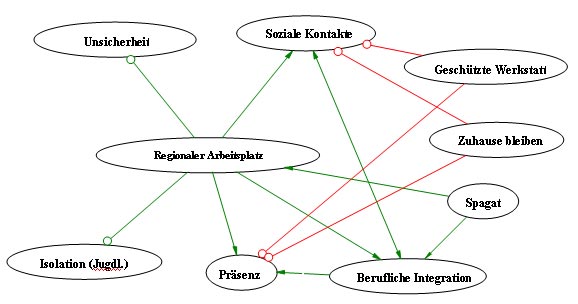
Abbildung 18: Kausalgraphik ‚regionaler Arbeitsplatz'
Die Regionalität des Arbeitsplatzes, die durch SPAGAT gewährleistet wird, spielt eine zentrale Rolle im Bereich der beruflichen Integration. Berufliche Integration im regionalen Umfeld erhöht die sozialen Präsenz des Jugendlichen, die durch den Besuch der geschützten Werkstatt verloren ginge. Durch den regionalen Arbeitsplatz wird gleichzeitig die soziale Isolation des Jugendlichen positiv abgebaut. Der Jugendliche wird in ein Umfeld integriert, das ihm vertraut ist und Unsicherheit wird zugunsten von Sicherheit abbaut. Auch in der Fragebogenerhebung wurde die Regionalität als zentraler Aspekt betont:
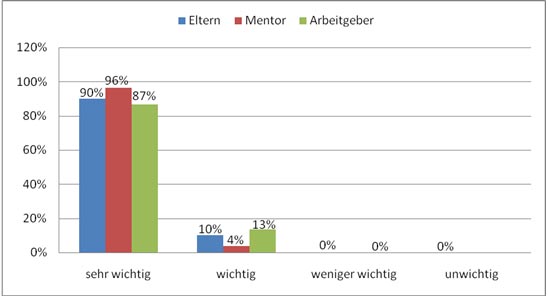
Abbildung 19: Bewertung ‚Regionalität des Arbeitsplatzes'
-
Die Anstellung im Betrieb
Die Arbeitserprobung mündet in ein Arbeitsverhältnis und der Jugendliche mit Behinderung wird als Mitarbeiter im Betrieb angestellt. Er erhält für die regulär geleistete Arbeitszeit den kollektivvertraglich festgesetzten Lohn. Die Leistungsminderung des Jugendlichen und der Leistungsausfall des Mentors, der durch die Begleitung entsteht, werden dem Arbeitgeber durch die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse zurückerstattet. Der Integrationsberater begleitet und unterstützt bei Bedarf weiterhin den Mentor, den Jugendlichen, den Arbeitgeber und die Eltern. Vor allem in Krisensituationen interveniert er und leistet Unterstützung. Auch der Unterstützerkreis trifft sich weiterhin, um Veränderungen zu begleiten.
Menschen mit geistigen Behinderungen sind in der Regel den Anforderungen am Arbeitsmarkt nicht gewachsen. Das betriebliche Interesse ist auf leistungsfähige und flexibel einsetzbare Arbeitskräfte ausgerichtet. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass den Arbeitssuchenden vielfach die nötigen Qualifikationen und die Arbeitserfahrung fehlen. "Arbeitsplätze werden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf der Grundlage von normierten Berufsbildern vermittelt [...] Menschen, die diesen Normen nicht entsprechen, werden so Möglichkeiten genommen, ihre Arbeitskraft anzubieten; unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten können sie im Prozess der Arbeitsvermittlung nicht bestehen. Die Qualifikation, die Menschen mit Behinderung z.B. aus der Werkstatt für Behinderte mitbringen, erweisen sich in vielen Fällen als unzureichend für die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes." (Boban und Hinz 2005, 239) Am Arbeitsmarkt steht das Leistungskriterium im Mittelpunkt, welches an der erbrachten Dienstleistung oder in Form eines fertiggestellten Endprodukts festgemacht wird. Menschen mit Behinderung können dieser Erwartungshaltung vielfach nicht gerecht werden. Bei SPAGAT wird der Arbeitsbegriff daher beträchtlich erweitert. Das Leistungskriterium tritt zu Gunsten anderer Werte in den Hintergrund. D.h. jedoch nicht, "dass keine im klassischen Sinn erwartete Leistung eingefordert werden darf, mitnichten, gerade das wäre eine fatale Missinterpretation. Es soll und muss nur eine Auseinandersetzung stattfinden, die eine differenzierte Gesamtheit darzustellen versucht, ohne die Dominanz normorientierter Anpassungserwartungen zu Normalitätsstandards zu erheben und derart implizit einen kritiklosen Anpassungsvorgang zu induzieren. Sollten wir nur Abbilder von oft schwierigen Arbeitszuständen schaffen, erschweren wir die Integrationsbemühungen. Wenn wir also beispielsweise Lernbereitschaft, den Mut und Ausdauer des Versuchs von Jugendlichen ebenso zu sinnbringenden Kriterien erheben, wird das Bündel an Werten - solcher, die entstehen, nicht produziert werden - weiter ausgeformt." (Weibl 2007)
Die Anstellung eines Jugendlichen mit Behinderung ist gekoppelt an die Tatsache, "dass das Beschäftigungsverhältnis sowohl den Erwartungen des Betriebs als auch den Möglichkeiten und Bedürfnissen des Arbeitnehmers mit Behinderung gerecht wird." (Boban und Hinz 2005, 240)
Die Schnupper- und Arbeitserprobungsphasen sind Maßnahmen, die den Arbeitgebern und den Mentoren Orientierung bieten und die Entscheidung zu einer regulären Anstellung erleichtern. Ökonomische Bedenken vonseiten der Arbeitgeber werden durch die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse minimiert. Durch die Mentorenzuschüsse fällt es den Betrieben leichter, einen innerbetrieblichen Mitarbeiter für die Unterstützung des Jugendlichen bereitzustellen. Insgesamt stellen die Zuschüsse eine finanzielle Entlastung für die Arbeitgeber dar, die ansonsten durch die Anstellung eines Jugendlichen mit schweren Behinderungen entstehen würden.
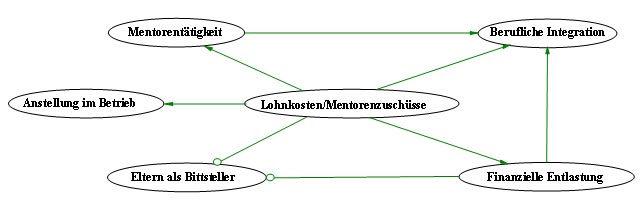
Abbildung 20: Kausalgraphik ‚Lohnkosten- u. Mentorenzuschüsse'
Auch die Eltern empfinden die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse als entlastend, da sie sich dadurch nicht als Bittsteller gegenüber dem Betrieb empfinden müssen: "Beim SPAGAT ist es sehr wichtig, dass die Betriebe durch Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse unterstützt werden und einen Ausgleich erhalten. Ohne diese Zuschüsse würde es sicher nicht so gut funktionieren und durch die Zuschüsse kommen wir Eltern nicht in eine Bringschuld, das ist für uns Eltern ein ganz gutes Gefühl." (Zitat Elternteil Karteikarte A03)
Die finanziellen Zuwendungen für den Betrieb sind fundamental für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung. Ein Integrationsberater bringt diesen Aspekt auf den Punkt: "Wichtig für die Zusammenarbeit sind die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse. Sie bieten eine wichtige Rahmenbedingung für die berufliche Integration. Ohne diese Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse wäre die berufliche Integration in einem Betrieb nicht möglich. Man würde fast keine Betriebe finden können, die einen Jugendlichen anstellen." (Zitat Integrationsberater Karteikarte E68)
Die folgenden beiden Diagramme zeigen die Ergebnisse zu den Bewertungen der Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse:
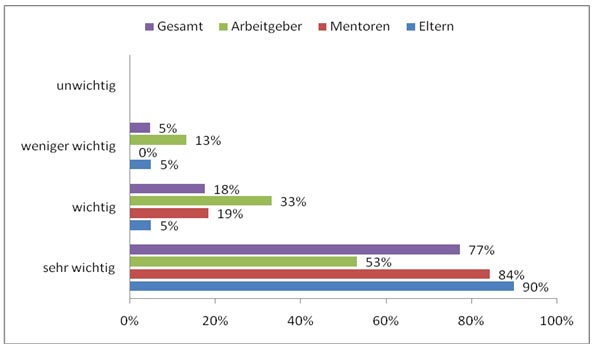
Abbildung 21: Bewertung ‚Lohnkostenzuschüsse'
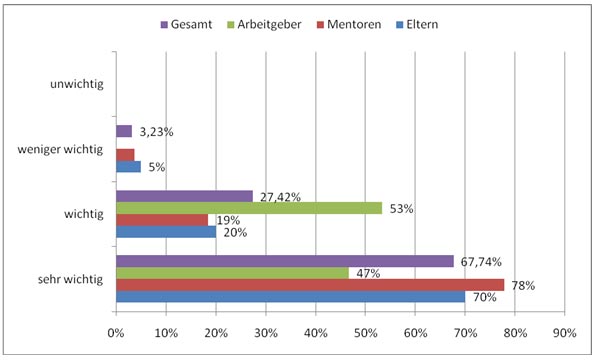
Abbildung 22: Bewertung ‚Mentorenzuschüsse'
Ein weiterer zu beachtender Punkt im Konzept der Unterstützten Beschäftigung ist das Kriterium der sinnvollen Beschäftigung. D.h. die Arbeitstätigkeit muss für beide Personen, für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter mit Behinderung, sinnvolle Aspekte beinhalten. Durch eine ressourcenorientierte Integrationspraxis wird dies bei SPAGAT gewährleistet und indem der Jugendliche eine sinnvolle Tätigkeit ausübt, wird zugleich auch die betriebsinterne Integration erleichtert. Damit entsteht ein wechselseitiges Verhältnis, das auf gegenseitiger Anerkennung beruht: Der Jugendliche erhält für seine geleistete sinnvolle Arbeit vonseiten der Mitarbeiter Wertschätzung und dies wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl des Betroffenen aus. "Das ist ja ein Punkt vom SPAGAT, wo es nicht darum geht, die Jugendlichen hier und da ein bisschen zu integrieren, sondern man versucht seine Fähigkeiten zu nutzen und diese für den Betrieb sinnvoll einzusetzen. Die Jugendlichen sind dadurch auch richtig zufrieden, weil sie wirklich sehen, dass sie was sinnvolles tun können." (Zitat Integrationsberater Karteikarte E51) Und "[a]ls Integrationsberater muss man die Fähigkeiten haben, diese ‚wenigen' Ressourcen der Jugendlichen sinnvoll in einem Betrieb einzusetzen. D.h., dass sie für einen Betrieb sinnvolle Arbeit leisten. Als Integrationsberater versuche ich die Ressourcen der Jugendlichen zu nutzen, dies führt dazu, dass man für sie eine sinnvolle Beschäftigung im Betrieb findet. Dies führt wiederum zu einer besseren Integration im Betrieb, weil der Arbeitgeber und die Mitarbeiter sehen, dass dieser Mensch für den Betrieb auch was Sinnvolles tut." (Zitat Integrationsberater Karteikarte E63)
Ressourcendiagnostik und ressourcenorientierte Sozialarbeit im Sinne von SPAGAT bedingen eine spiralförmige Aufwärtsbewegung, die bis hin zur Integration und Wertschätzung der Jugendlichen mit Behinderung im Betrieb führt. Im Rahmen einer ressourcenorientierten Sozialarbeit stellt die Behinderung keinen zentralen Fokus dar, Potentiale werden aus den vorhandenen Fähigkeiten der Betroffenen abgeleitet und die auszuführenden Arbeitstätigkeiten im Betrieb orientieren sich an diesen bzw. werden daran angepasst. Ein gelungenes Beispiel dafür bietet folgende Aussage eines Mentors: "Die E. ist schwer behindert. Das spielt aber keine Rolle bei der beruflichen Integration und bei der Arbeit. Man muss halt schauen, was für sie zumutbar ist und was sie kann. Aus der Sicht des Betriebs macht sie sehr sinnvolle Arbeit, sie macht vielseitige Arbeiten und sie ist nicht mehr wegzudenken. Der Betrieb ist beim Überlegen, ob man sie nicht höher einstufen soll, weil sie wirklich Leistung bringt. In ihren Arbeitsbereichen bringt sie sehr wohl Leistung und der Betrieb hat was davon." (Zitat Mentor Karteikarte B34)
Durch die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse werden ökonomische Bedenken und die Überbewertung der Arbeitsleistung zugunsten anderer Faktoren zur Seite gerückt. Für einige Arbeitgeber steht vor allem auch die soziale Verantwortung im Vordergrund. "Man kann Integration leben und nicht nur davon reden", meinte ein Arbeitgeber, "denn auch geistig behinderte Menschen steht ein Platz in der Gesellschaft und in der Wirtschaft zu. Wir können von ihnen lernen!"
Weiters ist die psychosoziale Langzeitbegleitung eine grundlegende Bedingung, um Arbeitsverhältnisse langfristig zu erhalten. Vor allem für die Mentoren ist es wichtig, dass die Integrationsberater in schwierigen Situationen ihnen beiseite stehen und wenn nötig intervenieren: "Wichtig ist, dass der Integrationsberater für alle Beteiligten ein permanenter Ansprechpartner ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Obwohl er sich mit der Zeit immer mehr zurückzieht bleibt er ein Ansprechpartner und schaltet sich ein, wenn es Probleme gibt. Es ist wichtig, dass es keine zeitliche Begrenzung in der Begleitung durch den Integrationsberater gibt." (Zitat Mentor Karteikarte B81) Die Mentoren bekommen dadurch den für sie notwendigen Rückhalt, Hilfestellung und Unterstützung und sind in schwierigen Situationen nicht auf sich allein gestellt. Die Sicherheit, die die psychosoziale Langzeitbegleitung gibt, erleichtert insgesamt die berufliche Integration und ist ein Garant dafür, dass Arbeitsverhältnisse auch in Krisensituationen nicht aufgelöst werden.
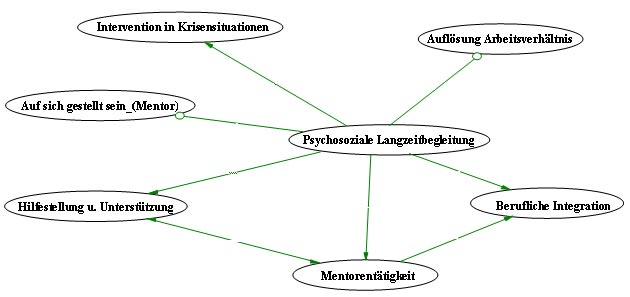
Abbildung 23: Kausalgraphik ‚psychosoziale Langzeitbegleitung'
Die Integrationsberater und die Mentoren sind die beiden stützenden Figuren, die für die berufliche Integration der Jugendlichen mit Behinderung ausschlaggebend sind. An dieser Stelle werden die Rollen der beiden Akteure genauer betrachtet.
-
Die Mentorentätigkeit
Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung weisen eindeutig auf die zentrale Rolle des Mentors hin; 100% der befragten Personen geben an, dass die Rolle des Mentors für den Prozess der beruflichen Integration ausschlaggebend ist.
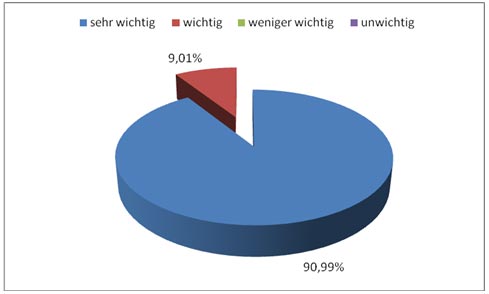
Abbildung 24: Bewertung ‚Rolle des Mentors im Integrationsprozess' N=62
Der Mentor unterstützt Lernprozesse, indem er geeignete Arbeitstätigkeiten für den Jugendlichen sucht und ihn in diese einarbeitet. Er ist Ansprechpartner für den Jugendlichen, er bietet dem Jugendlichen Sicherheit, Orientierung und den nötigen Rückhalt. Insgesamt ist der Mentor im Betrieb eine wichtige Vertrauens - und Begleitperson für die Jugendlichen.
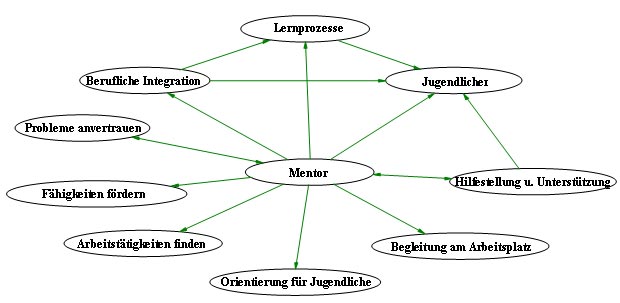
Abbildung 25: Kausalgraphik ‚Mentorenprinzip'
"Als Mentor muss man schon immer dabei sein bei der Arbeit. Man kann z.B. den I. nicht allein lassen - er macht auch gern mal einen Blödsinn - da muss man schon nachschauen. Man kann nicht sagen, den stelle ich jetzt da hin und er muss für zwei Stunden dort seine Arbeit machen, das funktioniert nicht. Es ist schon wichtig, dass diese Jugendlichen bei der Arbeit immer Kontakt mit dem Mentor oder anderen Mitarbeitern haben. Man kann sie nicht allein lassen oder irgendwie abschieben." (Zitat Mentor Karteikarte C61)
In den Gesprächen mit den Mentoren kamen viele Faktoren zur Sprache, die für die Arbeit mit den Jugendlichen mit Behinderung wichtig sind. Daraus lässt sich ein ganzes Kompetenzkompendium erschließen: Ein Mentor soll die Fähigkeit haben, für den Jugendlichen adäquate Arbeitsfelder zu gestalten, Verständnis gegenüber dem Jugendlichen aufzubringen und Entwicklungen des Jugendlichen zu fördern und zu begleiten. Außerdem wurde angegeben, dass der Mentor dem Jugendlichen klare Grenzen zeigen muss, die Begleitung erfordert eine konsequente Haltung vonseiten des Mentors. Geduld und Einfühlungsvermögen sind weitere Voraussetzungen. Der Mentor braucht das notwendige Gespür, um situative Befindlichkeiten des Jugendlichen wahrzunehmen. Der Mentor muss Situationen einschätzen können und benötigt soziale Fähigkeiten. Toleranz, aber auch Kreativität und Lockerheit sind weitere wichtige Fähigkeiten.
Die folgende Kausalgraphik bietet einen gesamten über die erwähnten Fähigkeiten und Voraussetzungen zur Ausführung der Mentorentätigkeit:
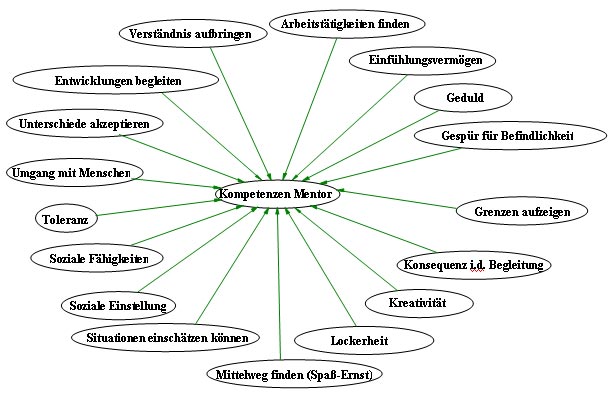
Das aus der qualitativen Studie eruierte Kompetenzinventar wurde den Mentoren im personenspezifischen Teil der Fragebogenerhebung zur Bewertung vorgelegt. An erster Stelle rangiert die Geduld, die dem Jugendlichen gegenüber zu erbringen ist, an zweiter Stelle steht das Einfühlungsvermögen und an dritter Stelle wurde die soziale Einstellung als notwendige Voraussetzung zur Ausübung der Mentorentätigkeit angegeben.
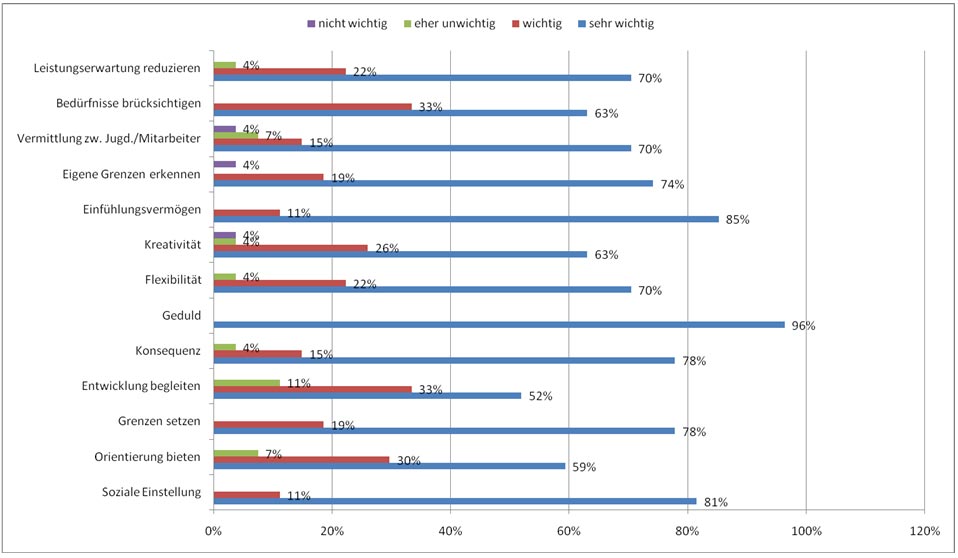
Abbildung 26: Bewertung ‚Kompetenzinventar'
Die qualitative Studie war vom Interesse geprägt herauszufinden, was einen Mentor motiviert, diese Rolle zu übernehmen. Zum einen wurden die bereits erwähnten Rahmenbedingungen wie die Mentorenzuschüsse formuliert. Zum anderen wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass die alltäglich zu leistende Arbeit durch die Mentorentätigkeit eine zusätzliche Sinn- und Bedeutungsdimension im Sinne einer sozial-verantwortlichen Komponente erhält: "Ich finde SPAGAT ist eine wahnsinnig gute Sache. Mein Chef hat mich gefragt, ob ich bereit wäre mit einem Jugendlichen mit Behinderung zu schaffen. Zuerst war das schon eine Überwindung und ich war nicht überzeugt, dass dies gut gehen wird. Heute ist dies aber eine große Erfüllung für mich, es ist eine wahnsinnig schöne Sache, weil ich das Gefühl habe, dass ich was Gutes tu. Indem die E. hier arbeitet, ist ein menschlicher Aspekt in meine Arbeit als Koch hinzugekommen." (Zitat Mentor Karteikarte E20)
Als weitere Motivationsquelle nennen die Mentoren die Freude, die sie verspüren, wenn die Jugendliche Fortschritte machen und es ihren "Schützlingen", aber auch den Eltern dabei gut geht: "Für mich als Mentor ist interessant, dass man dabei ist. Wenn ich sehe, er hat was Neues erlernt, dann freue ich mich. Am Anfang hat man gesagt, man muss froh sein, wenn er überhaupt was macht. Ich habe aber die Tätigkeiten langsam gesteigert, mittlerweile holt er die Kübel und bringt sie zurück, er trägt die Lieferscheine hinein und noch viel mehr. Man freut sich, wenn man das sieht, was er alles erlernt hat - logisch darf man ihn nicht überbelasten." (Zitat Mentor Karteikarte D04) Gleichzeitig werden die Fortschritte der Jugendlichen auch als Bestätigung der Mentorentätigkeit angesehen. Die Mentoren erhalten dadurch auch ein positives Feedback vor allem vonseiten der Eltern und damit auch ein hohes Maß an Wertschätzung. Weiters ist für die Mentoren wichtig, dass sie mit anderen Mentoren in Kontakt kommen. Um dies zu unterstützen werden bei SPAGAT eigene Mentorentreffen organisiert.
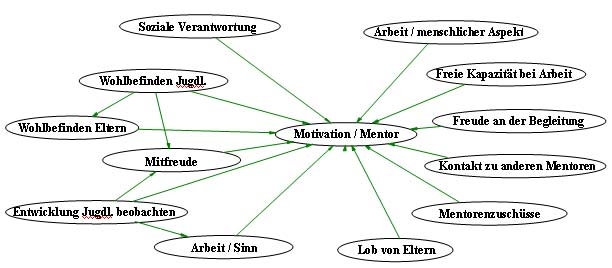
Abbildung 27: Kausalgraphik ‚Motivation / Mentoren'
Auch in der Fragebogenerhebung kommt zum Ausdruck, dass die sozial-verantwortliche Komponente, die zur alltäglichen Arbeit hinzutritt, eine wichtige Motivationsquelle darstellt.
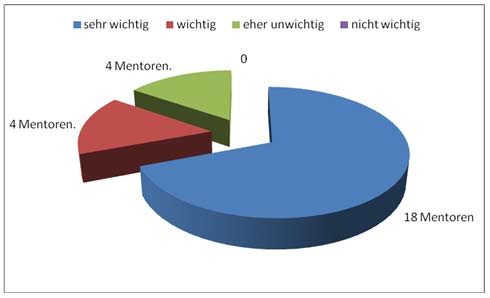
Abbildung 28: Bewertung ‚Motivationsquelle soziale Verantwortung'
-
Die Integrationsberatung
Die Integrationsberater haben beim SPAGAT ein Bündel an Aufgaben zu bewältigen. Oberstes Prinzip ist die Eigenverantwortlichkeit. Sie müssen hohe fachliche Kompetenzen besitzen, aber auch beziehungsrelevante Aufgaben im Netzwerk der Akteure managen. Insofern erfüllen sie im gesamten Integrationsprozess wichtige Mediatorenfunktionen. Sie müssen ständig das Netzwerk zwischen den Jugendlichen, den Arbeitgebern, den Mentoren, den Mitgliedern des Unterstützerkreises und den Eltern unterstützen und alle Interessensebenen im Gleichgewicht halten. Der persönliche Kontakt zu allen ist ausschlaggebend, um Prozesse und Entwicklungen zu beobachten, zu begleiten und gegebenenfalls zu intervenieren. Die Integrationsberater sind für den reibungslosen Informations- und Kommunikationsfluss zwischen allen Akteuren verantwortlich. Der Grad des Informationstransfers hängt dabei eng mit der Vertrauensbasis zusammen, die sie zwischen allen herstellen müssen. Dabei ist wichtig, dass die Integrationsberater neutrale Positionen einnehmen; sie haben die Aufgabe, zwischen allen gleichermaßen zu vermitteln. Im gesamten Prozess spielt die Kreativität eine wichtige Rolle. Die Integrationsberater sind ständig mit neuen Situationen und Herausforderungen konfrontiert, die individuelle Lösungen evozieren. Die Integrationsprozesse verlaufen individuell und orientieren sich an der Person des Jugendlichen. Bis zu einem bestimmten Grad können sich die Integrationsberater an Anhalts- und Orientierungspunkte halten, sie sind jedoch auch mit Situationen konfrontiert, die kreative Lösungswege und Improvisationstalent abverlangen.
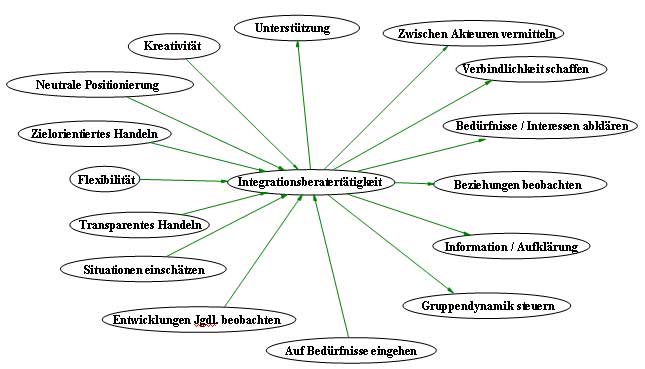
Abbildung 29: Kausalgraphik ‚Integrationsberatertätigkeit'
Die Begleitung und Unterstützung durch die Integrationsberater funktioniert bei SPAGAT sehr gut. Die Ergebnisse zeigen, dass 69% (49 Personen) die Begleitung als sehr gut einstufen. 27% der Befragten bewerten die Begleitung mit gut. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Integrationsberater auf die Interessen, Anliegen und Bedürfnisse der einzelnen Akteure eingehen; 100% (62 Personen) bewerten diesen Aspekt mit gut bis sehr gut.
Die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Studie belegen eindeutig, dass die berufliche Integration die Lebensqualität der Jugendlichen positiv beeinflusst hat. Außerdem wirkte sie sich auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen bemerkbar aus. Viele von ihnen haben an Lebensfreude, Selbständigkeit und Selbstbewusstsein gewonnen. Die Arbeit und die sozialen Kontakte wirken sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl aus. Negative Verhaltensformen haben im Zuge der beruflichen Integration deutlich abgenommen. Seit sie arbeiten, sind sie psychisch ausgeglichener und entwickelten ein angemessenes Sozialverhalten. Die folgende Graphik zeigt alle Bereiche auf, in denen Entwicklungen durch die berufliche Integration der Jugendlichen stattgefunden haben.
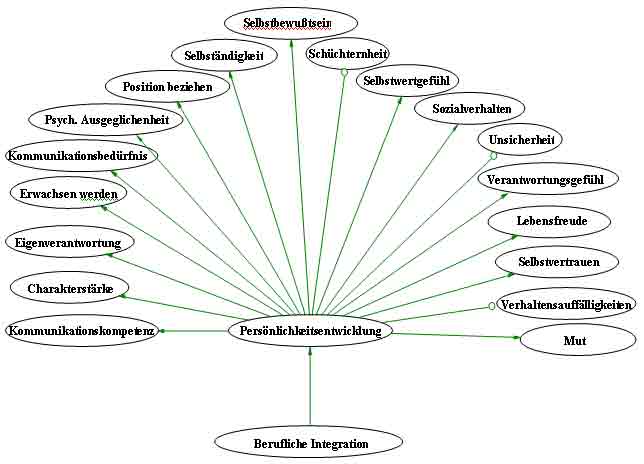
Abbildung 30: Kausalgraphik ‚Persönlichkeitsentwicklung'
In den Interviews wird klar zum Ausdruck gebracht, dass der integrative Weg durch SPAGAT herausfordernder für alle Beteiligten ist, aber die damit verbundenen positiven Wirkungen stehen im Vordergrund: "Für mich als Mutter wäre es schon einfacher, wenn die Tochter um 8.00 Uhr in die Werkstatt fahren würde und am Abend zurückkommt, denn dann könnte ich meinen Tag besser planen. Dies ist jetzt bei SPAGAT nicht in diesem Umfang möglich. Aber wenn ich sehe, dass es meiner Tochter gut geht, dann geht es auch mir gut. Wenn sie in einer Werkstatt wie ein Blümchen eingehen würde, weil sie sich nicht entfalten kann, dann würde es mir dabei auch nicht gut gehen. Ich hätte schon mehr freie Zeit, aber es würde mir nicht gut dabei gehen. Wenn ich sehe, wie selbständig sie geworden ist, wie aufrecht und voller Freude sie nach Hause kommt, dann ist das für mich die größte Lebensqualität. Es heißt nicht, dass wenn ich viel freie Zeit für mich hätte, dass es mir dabei gut gehen würde. Mir geht es gut, wenn es meiner Tochter gut geht." (Zitat Elternteil Karteikarte B22)
Die Lebensqualität der Jugendlichen steht in einem unmittelbaren Verhältnis zur Lebensqualität der gesamten Familie. Die erreichte Lebensqualität führt zudem zu einer hohen Umwegrentabilität: "Bei dem ganzen SPAGAT gibt es aber eine hohe Umwegrentabilität, weil die Menschen gesund bleiben! Weil sie mutig werden! Weil sie an Lebensfreude gewinnen und man erspart sich da vieles. Diese Leute brauchen keinen Doktor, keinen Psychiater, keinen Therapeuten mehr - ein glücklicher Mensch braucht niemanden. Das ist ja die große Rentabilität am ganzen SPAGAT." (Zitat Elternteil Karteikarte B68)
Insgesamt wird von allen befragten Personen angemerkt, dass die Jugendlichen maßgebliche Fortschritte machten, seitdem sie durch SPAGAT beruflich integriert wurden. Insgesamt haben nur 4 Personen von 62 angegeben, dass kaum bzw. keine Entwicklungsfortschritte bemerkbar waren.
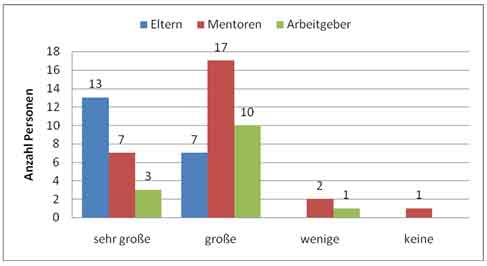
Abbildung 31: Bewertung ‚Entwicklungsfortschritte bei den Jugendlichen'
Das folgende Balkendiagramm gibt einen Überblick über die Bewertung der einzelnen personenbezogenen Entwicklungsbereiche der Jugendlichen:
Entwicklungsbereiche:
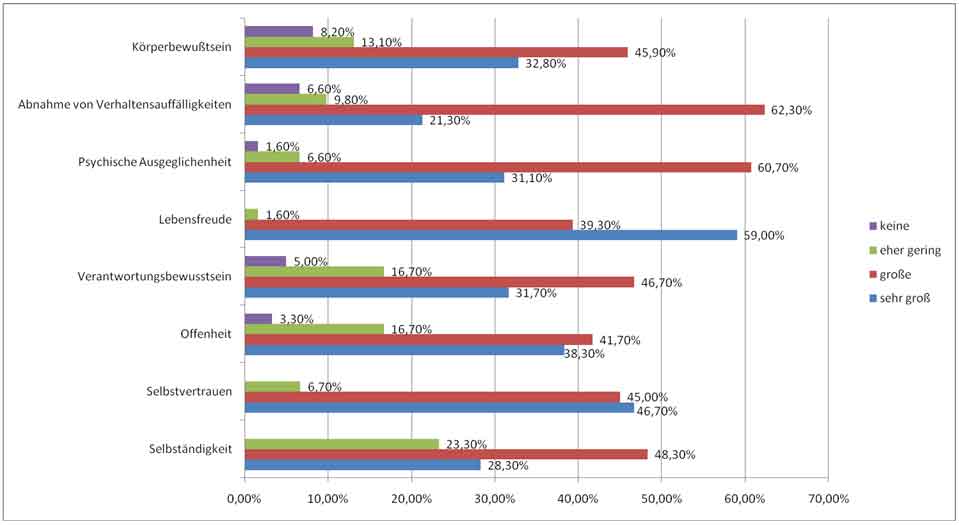
Abbildung 32: Bewertung ‚Entwicklungsbereiche'
Neben den Fortschritten auf der Persönlichkeitsebene der Jugendlichen zeigt die berufliche Integration weitere positive Wirkungen. Vor allem wurde erwähnt, dass SPAGAT eine Alternative zur geschützten Werkstatt darstellt. Fähigkeiten werden als Ressourcen genutzt, die Lebensqualität erhöht sich, eine Normalisierung der Lebenslage geht damit einher: "Als Mutter oder Vater denkt man ja andauernd darüber nach, was aus dem Kind nach der Schule werden kann. Man weiß, das und jenes geht nicht - das liegt einem auf dem Magen. Die berufliche Integration und die wieder gewonnene Normalität wirkt sich auf alles positiv aus. Die ganze berufliche Integration durch SPAGAT hat auf allen Seiten zur Normalität geführt: für das Kind, für uns Eltern und für die ganze Familie." (Zitat Elternteil Karteikarte B74) Für die Jugendlichen eröffnen sich vielfältige Chancen wie z.B. die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe aufgrund der beruflichen Integration. SPAGAT eröffnet Selbstbestimmungsmöglichkeiten, vor allem, da die Jugendlichen Geld verdienen und somit über eigene finanzielle Ressourcen verfügen. Die geschützte Werkstatt wird von den Eltern eher als Schutz- und Schonraum empfunden, indem der Schwerpunkt der Begleitung auf die Betreuung gelegt wird. Wichtige Aspekte wie Selbstbestimmung, Normalisierung und gesellschaftliche Teilhabe gehen damit verloren.
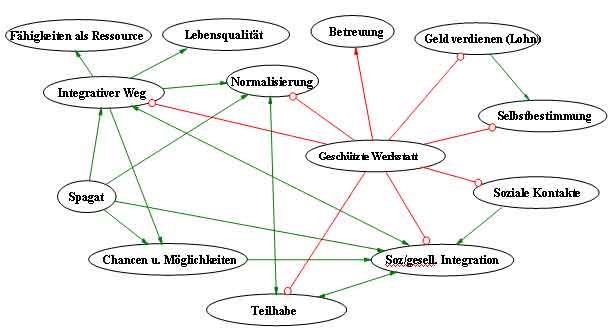
Abbildung 33: Kausalgraphik ‚SPAGAT als Alternative zur geschützten Werkstatt'
Die Fragebogenerhebung unterstreicht dieses Ergebnis. Es wird bestätigt, dass das Modell SPAGAT und die dabei realisierte berufliche Integration von Jugendlichen mit schweren Behinderungen eine wichtige Alternative zur geschützten Werkstatt ist:
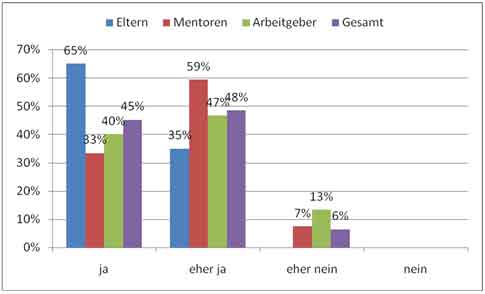
Abbildung 34: Bewertung ‚SPAGAT als Alternative zur Werkstatt'
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Befragung der Jugendlichen, denn sie sind letztendlich die Instanz, die über die Qualität der Maßnahmen zur beruflichen Integration zu entscheiden haben.
Aus ihrer Sicht hat die berufliche Integration durch SPAGAT insgesamt zu einer höheren Lebensqualität geführt. "Unter Lebensqualität verstehen wir [...] gute Lebensbedingungen, die mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden zusammengehen. In einer allgemeineren Definition ist die Lebensqualität von Individuen und Gruppen bestimmt durch die Konstellation [...] der einzelnen Lebensbedingungen und Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Unter Lebensbedingungen verstehen wir die beobachtbaren, tangiblen Lebensverhältnisse: Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen und soziale Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung.
Unter subjektivem Wohlbefinden verstehen wir die von den Betroffenen selbst abgegebenen Einschätzungen über spezifische Lebensbedingungen, aber auch generell kognitive und emotive Gehalte wie Hoffnungen und Ängste, Glück und Einsamkeit, Erwartungen und Ansprüche, Kompetenzen und Unsicherheiten, wahrgenommene Konflikte und Prioritäten." (Zapf 1984, 23)
Durch SPAGAT werden objektive Lebensverhältnisse realisiert. Die Jugendlichen haben eine Arbeit, sie beziehen ein Einkommen und sind in ein normales betriebliches Umfeld integriert. Dadurch hat sich die Lebensqualität für sie verbessert und sie haben an Selbständigkeit gewonnen: "Durch die Arbeit bin ich viel selbständiger geworden. Am Morgen fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. Jeden Morgen freue ich mich, dass ich in dieser Schule arbeiten kann und auf die Arbeit im Altersheim freue ich mich auch. Durch die Arbeit geht es mir gut. Wenn ich nur zuhause wäre, dann wäre es mir sehr langweilig. Durch die Arbeit habe ich viel Abwechslung. Im Zug und im Bus treffe ich immer viele Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Das ist wichtig für mich." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D74) Soziale Kontakte sind für die Jugendlichen wichtig, wie auch die folgende exemplarische Aussage klar zum Vorschein bringt: "Ich habe bei der Arbeit viele Leute kennen gelernt, das sind jetzt meine Freunde. Manchmal gehen wir zusammen was trinken. Wir haben jetzt auch eine Betriebsfeier gehabt, das hat mir gut gefallen. Auch in der Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D91)
Möglichkeiten, um ein selbständiges Leben zu führen, eröffnen sich vor allem, weil die Jugendlichen ein Einkommen beziehen und über eigenes Geld verfügen, das sie selbst investieren, was sie unabhängiger macht. "Das Geldverdienen find ich toll. Eigenes Geld verdienen ist toll. Da kann ich mir ein Fahrrad kaufen oder eine CD und auch Kleider kann ich kaufen. Das brauchen nicht mehr die Eltern kaufen. Zuerst war es ungewohnt, eigenes Geld zu verdienen. Es ist fein, nicht mehr die Eltern fragen zu müssen. Wenn man Geld verdient, dann ist man unabhängiger." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D60)
Ein anderer Jugendlicher führt eine ähnliche Argumentation an: "Mit meinem Lohn bin ich sehr zufrieden. Es ist toll, eigenes Geld zu verdienen. So bin ich von den Eltern nicht so abhängig. Ich kann mir eigene Sachen kaufen. Auch kann ich Kleider kaufen, die meiner Mama nicht so gut gefallen, aber mir schon. Ich bin viel selbständiger geworden, seit ich eigenes Geld verdienen kann." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D84)
Über eigene finanzielle Ressourcen zu verfügen bestimmt den Grad an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit: "Ich spare mein Geld, dass ich etwas habe, wenn ich älter bin. Ich möchte auch eine Videokamera kaufen. Dafür spare ich, ich habe schon einen Kurs gemacht und jetzt freue ich mich darauf. Ich möchte in Urlaub fahren, dafür spare ich auch." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D88)
Im Vergleich mit jenen, die eine geschützte Werkstatt besuchen und dort ein geringes Taschengeld beziehen, fühlen sich die Jugendlichen unabhängiger: "Ich möchte auch nicht zur Lebenshilfe. Meine Freundin arbeitet bei der Lebenshilfe. Die bekommt nur ein Taschengeld, keinen Lohn. Das wäre kein Leben für mich! Ich will selbständig sein und mein eigenes Geld verdienen." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D83)
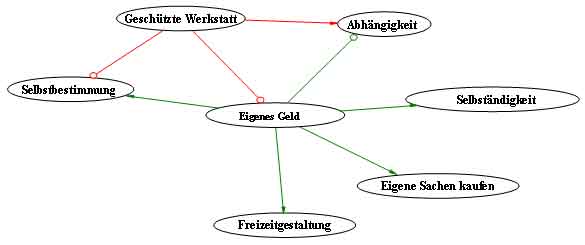
Abbildung 35: Kausalgraphik ‚Eigenes Geld verdienen'
Außerdem werden die Arbeitsbedingungen von den Jugendlichen als positiv beschrieben. Sie geben an, dass sie eine verantwortungsvolle Aufgabe im Betrieb haben, die Tätigkeiten sind abwechslungsreich und diese Aspekte wirken insgesamt sehr motivierend. "Am Morgen fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. Jeden Morgen freue ich mich, dass ich in dieser Schule arbeiten kann und auf die Arbeit im Altersheim freue ich mich auch. Durch die Arbeit geht es mir gut. Wenn ich nur zuhause wäre, dann wäre alles langweilig." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D78) Eine weitere exemplarische Aussage lautet: "Ich mache meine Arbeit gewissenhaft. Ich habe auch Verantwortung bei der Arbeit. Ich muss sie richtig machen, das ist wichtig." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D67) Die abschließende Aussage rundet das Thema ab: "Am besten gefällt mir das Kochen mit der I. Gemüse klein schneiden. Tisch decken und Handtücher falten. Ich mache ganz verschiedene Sachen hier in der Schule. Ich bin in der Küche und auch im Sekretariat. Dort gefällt mir am besten das Aktenvernichten. Am besten gefällt mir, dass ich für bestimmte Arbeiten verantwortlich bin. Die Büroarbeit gefällt mir ganz gut. Ich kopiere Sachen - mir gefällt alles im Büro. Mit den Mitarbeitern komme ich sehr gut aus." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D69)
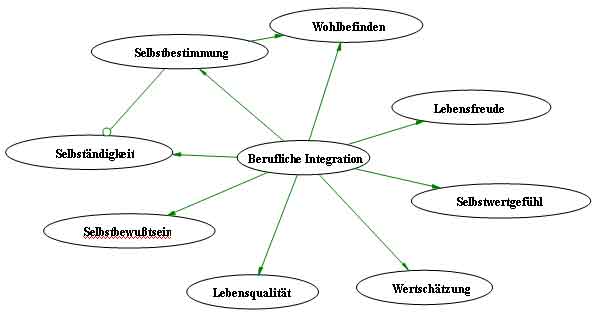
Abbildung 36: Kausalgraphik ‚Berufliche Integration aus der Sicht der Jugendlichen'
Die Ergebnisse zeigen, dass durch die berufliche Integration, abseits exklusiv institutioneller Maßnahmen, persönliche Fähigkeiten, individuelle Eigenschaften und Lebensweisen vom sozialen Umfeld der betroffenen Personen wertgeschätzt werden. Wie bereits gesagt wirken sich die integrativen Bemühungen äußerst positiv auf die individuellen Entwicklungen und auf das psychische Wohlbefinden der Jugendlichen mit Behinderung aus. Durch die soziale Mitgliedschaft und der Teilhabe an der Arbeitswelt realisieren sich intersubjektive Momente der Anerkennung und Wertschätzung und damit solidarische Beziehungen untereinander. Die Jugendlichen selbst geben an, Wertschätzung und Solidarität zu erfahren. Damit gelangen sie zu einem positiven Selbstbezug. Dieser drückt sich wiederum in Form der gewonnenen Lebensqualität und Lebensfreude aus, in gestärktem Selbstvertrauen, in Selbständigkeit und in größerem Selbstwertgefühl - also der Erfahrung innerhalb der Gemeinschaft, einen unverwechselbaren Wert zu besitzen. "Seit ich arbeite bin ich selbständiger geworden. Mir geht es jetzt viel besser als vorher. Ich weiß jetzt, dass man mich brauchen kann und das ist sehr wichtig." (Zitat Jugendlicher Karteikarte D63)
Das Modell SPAGAT fußt auf dem Prinzip der Unterstützten Beschäftigung. Unterstützte Beschäftigung ist der dritten Phase - dem Leben mit Unterstützung - im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung zuzuordnen. Bei SPAGAT beruht die Unterstützung der betroffenen Jugendlichen auf drei Fundamenten: auf die persönliche Unterstützung durch den Integrationsberater, auf die innerbetriebliche Unterstützung durch den Mentor und auf der sozialen Unterstützung durch den Unterstützerkreis.
Durch das Modell SPAGAT wird den Jugendlichen mit schwerer Behinderung das Recht auf Arbeit eingeräumt. Sie haben die Möglichkeit, sich für den Besuch einer geschützten Werkstatt oder für eine reguläre Arbeit am ersten Arbeitsmarkt zu entscheiden. Bei SPAGAT steht im Gegensatz zur geschützten Werkstatt die persönliche Unterstützung im Vordergrund. D.h. für jeden Jugendlichen mit Behinderung wird ein individueller Lebensweg geplant und umgesetzt.
Dem Unterstützerkreis wird dabei eine wesentliche Funktion zugeschrieben. Durch den Einbezug des sozialen Umfelds werden im Rahmen dieses sozialen Kontextes gemeinsam mit dem Betroffenen wichtige Schritte in die berufliche Zukunft geplant. Der Unterstützerkreis bildet um den Jugendlichen ein stabiles soziales Netzwerk, das ihn langfristig begleitet. Gemeinsam mit dem Unterstützerkreis wird die persönliche Zukunftsplanung für den Jugendlichen angegangen. Die Zukunftsplanung wird vor allem von den Jugendlichen als eine besondere Erfahrung geschildert, denn ihre Fähigkeiten, Wünsche und Berufsträume stehen im Mittelpunkt und werden ernst genommen. Die Jugendlichen, aber auch die Eltern merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Der Unterstützerkreis festigt solidarische Beziehungen. Durch die Zukunftsplanung und im Unterstützerkreis erfahren vor allem die Jugendlichen Anerkennung und Wertschätzung.
Die Jugendlichen üben über alle Phasen der beruflichen Integration Kontrolle aus. Im Sinne der Empowerment-Praxis werden sie in alle Entscheidungen einbezogen. Von der Zukunftsplanung über die Schnupper- und Arbeitserprobungsphase bis hin zur Anstellung werden ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Dabei werden entmündigende Formen minimiert und Selbstbestimmungsmöglichkeiten erhöht. Die Entscheidungen der Jugendlichen werden jedoch immer in sozialer Kohäsion mit den Mitgliedern des Unterstützerkreises, mit den Integrationsberatern, aber auch mit den Mentoren und Arbeitgebern diskutiert und umgesetzt.
Eine wesentliche Maßnahme, um die Teilhabe an der Arbeitswelt zu realisieren, sind die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse. Durch sie werden wesentliche Barrieren beseitigt, die ein Anstellungsverhältnis in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes ermöglichen. D.h. die Anstellung einer Person mit einer schweren Behinderung darf zu keiner ökonomischen Belastung für den Betrieb führen. Die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse bauen diese Belastung ab. Dabei muss berücksichtigt werden, dass beim SPAGAT Arbeitsplätze vor allem in kleinen und mittelgroßen Betrieben gefunden werden, die rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, Menschen mit Behinderungen anzustellen. Durch die Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse werden Umwelthindernisse für die Teilhabe an der Arbeitswelt erfolgreich abgebaut und sie bewirken, dass die Betriebe soziales Engagement und gesellschaftliche Verpflichtungen wahrnehmen können.
Durch die Arbeit, aber auch durch den Unterstützerkreis, fühlen sich die Jugendlichen als anerkannte und wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft. Die Erfahrung als Gleiche unter Gleichen an einer Gemeinschaft zu partizipieren wirkt sich positiv auf die persönliche Entwicklung der Jugendlichen aus. Vor allem zeigen die Ergebnisse der Studie, dass sie sich selbst als wertgeschätzte Individuen fühlen. Außerdem sind sie als Lohnverdiener finanziell unabhängiger und können selbstbestimmter und selbstständiger leben. Formen der Abhängigkeit, der Entmündigung und Unselbständigkeit werden dadurch reduziert und dies führt im Gegenzug zu einer höheren Lebensqualität für die Jugendlichen mit Behinderung.
Inhaltsverzeichnis
Lange Zeit hindurch und mit dem Beginn der Institutionalisierung von Menschen mit Behinderung wurde der Akzent maßgeblich auf ihre Betreuung und Rehabilitation gelegt. Die Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitstüchtigkeit waren die Instanzen, die wie ein Damoklesschwert über die Möglichkeit der gesellschaftlichen Integration und dem sozialen Ausschluss schwebten. Rehabilitation bezeichnete dabei stets die Anstrengung mit geeigneten Mitteln die Fähigkeiten der Personen wiederherzustellen bzw. Fertigkeiten anzutrainieren, um sie gesellschaftskompatibel und integrationsfähig zu machen. Rehabilitation hat das Ziel, den Betroffenen einen Wertekanon zu inkorporieren, sie zur Tüchtigkeit und Selbständigkeit zu erziehen, um Autonomie und Selbstbestimmung zu erlangen. Die Rehabilitation zielt auf die Veränderung von unerwünschten Verhaltensweisen ab. Die Betroffenen sollen sich im Sinne der Arbeitsrehabilitation an Arbeits- und Zeitabläufe und an vorgegebene Strukturen und Normen gewöhnen und anpassen. Der Rehabilitationserfolg zeigt sich in der positiven Veränderung der Verhaltensweisen und Einstellungen. Die Rehabilitation wirkt wie ein Flaschenhals, durch den die Betroffenen hindurch müssen, um Integration und Teilhabe zu erfahren. Viele Betroffene, vor allem Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erreichen die Anforderungen, die die Rehabilitation an sie stellt, nie und bleiben meist ein Leben lang in geschützten Einrichtungen.
SPAGAT richtet den Fokus nicht auf die Rehabilitationspraxis. Die Teilhabe an der Arbeitswelt ist an keine wesentlichen Vorbedingungen geknüpft. Die Integrationsmöglichkeiten bemessen sich nicht an den Voraussetzungen und Defiziten der behinderten Personen. Integration ist vielmehr eine gesellschaftliche Leistung und benötigt strukturelle Voraussetzungen im Sinne von Zugangsmöglichkeiten durch die Beseitigung von Umwelthindernissen und orientiert sich an den persönlichen und individuellen Ressourcen. SPAGAT steht für ein neues Paradigma: Leben mit Unterstützung und Empowerment. Empowerment setzt auf die Selbstbemächtigung problembetroffener Personen, auf professionelle Unterstützung von Autonomie und Selbstgestaltung, auf soziale Gerechtigkeit, auf demokratische Partizipation, auf Ressourcenorientierung, auf Netzwerkförderung und bürgerschaftliches Engagement.
Empowerment und Leben mit Unterstützung eröffnen Momente der Selbstbestimmung, der Wertschätzung und Anerkennung. In Anbetracht der vorangegangenen Phasen, der Institutionsreform und Deinstitutionalisierung, kann nun auch von einem moralischen Fortschritt in der Anerkennung von Menschen mit Behinderung gesprochen werden. Integration und Anerkennung stehen in einer unmittelbaren Nachbarschaft; Integration würde ihr emanzipatorisches Potential verlieren, wenn sie nicht zugleich die Anerkennung des anderen einfordern würde. Nicht zuletzt gewinnt der andere durch die Anerkennung sein soziales Dasein und einen positiven Bezug zu sich selbst.
Wie sich dieser Fortschritt nun ausnimmt, welche Konsequenzen daraus abzuleiten sind, welche Veränderungen daraus resultieren, aber auch Fragen nach den Grenzen und Gefahren der paradigmatischen Handlungsansätze, wie Normalisierung, Selbstbestimmung und Empowerment sollen im Kontext sozialwissenschaftlicher Theorien in den nächsten Kapiteln erörtert werden.
Axel Honneth entwickelt in seinem Buch "Kampf um Anerkennung" eine Stufentheorie, die sich an Hegels dialektischem Anerkennungsprozess orientiert. Er meidet jedoch den spekulativen Charakter und versucht seine Anerkennungstheorie rein empirisch zu begründen. Honneth übernimmt Ansätze von G. H. Mead, das das Verhalten eines einzelnen Individuums vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Ganzen analysiert. "Das heißt also, dass wir das Verhalten des Individuums im Hinblick auf das organisierte Verhalten der gesellschaftlichen Gruppe erklären, anstatt das organisierte Verhalten der gesellschaftlichen Gruppe aus der Sicht des Verhaltens der einzelnen Mitglieder erklären zu wollen." (Mead 1968, 45)
In Anlehnung an Mead behauptet Honneth, dass sich das selbstreflexive Ich aufgrund gesellschaftlich normativer Voraussetzungen bildet. Innerhalb dieses Bezugsrahmens gewinnt der einzelne allmählich seinen praktischen Selbstbezug. Das Ich kann sich selbst erst vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Normen in den Blick bekommen. D.h. das einzelne Individuum wird durch die Gesellschaft ins soziale Leben gerufen. Der sozialpsychologische Aspekt Meads und die hegelsche Struktur des dialektischen Anerkennungsprozesses werden zum Kern der Auseinandersetzung, um soziale Anerkennungsverhältnisse zu erklären. Honneth unterschiedet drei Formen der intersubjektiven Anerkennung, die sich stufenweise entwickeln und sich gegenseitig bedingen:
-
Die Primärbeziehung (Liebe und Freundschaft)
-
Das Rechtsverhältnis (Recht)
-
Die Wertegemeinschaft (Solidarität)
Die Primärbeziehung wird als Gefühlsbindung und emotionale Zuwendung beschrieben, die nur zwischen wenigen Personen bestehen kann, also durch kleine und direkte Beziehungen. Als Beispiel nennt Honneth die Eltern-Kind-Beziehungen, intime Zweierbeziehungen und enge Freundschaftsbeziehungen. "In der reziproken Erfahrung liebevoller Zuwendung wissen beide Subjekte sich darin einig, dass sie in ihrer Bedürftigkeit voneinander abhängen." (Honneth 2003, 153)
Die zweite Anerkennungsform geht über die Primärbeziehung hinaus und betrifft die rechtliche Anerkennung des Subjekts. Durch die zuerkannten Rechte findet die einzelne Person als gleichberechtigtes Individuum Anerkennung und moralischen Respekt in Form von Gleichbehandlung. Die Rechtssubjekte erkennen sich wechselseitig dadurch an, dass sie demselben Gesetz gehorchen und in individueller Autonomie über moralische Normen vernünftig zu entscheiden vermögen.
Das formale Recht konstituiert die Person als vollwertiges Mitglied eines staatlichen Gemeinwesens, dadurch werden dem einzelnen bürgerliche Recht zuerkannt und er kann sich als Gleicher unter Gleichen fühlen. Die Zuerkennung grundlegender Rechte konstituiert die Autonomie der Person, die soziale Wertschätzung wird dabei noch nicht tangiert. Daher führt Honneth im Kontext einer konkreten Wertegemeinschaft noch die dritte Form der Anerkennung als soziale Wertschätzung und Solidarität ein. Auf der Stufe der Solidarität geht es nun nicht mehr nur "um die empirische Anwendung allgemeiner, intuitiv gewusster Normen [...], sondern um die graduelle Bewertung konkreter Eigenschaften und Fähigkeiten; daher setzt sie auch stets [...] ein evaluatives Bezugssystem voraus, das über den Wert solcher Persönlichkeitszüge auf einer Skala von Mehr oder Weniger, von besser oder Schlechter informiert." (Honneth 2003, 183) D.h., die Wertschätzung einzelner Individuen hängt wesentlich von der sozialen Wertschätzung ihrer Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen ab. Solidarität meint die Wertschätzung einzelner Individuen aufgrund bestimmter Fähigkeiten und Eigenschaften, durch die sie eine besondere Wertschätzung innerhalb der Gemeinschaft erfahren. "Solidarität ist also gekennzeichnet durch einen gemeinsamen Wertebezug, durch eine gemeinsame, wechselseitige Orientierung an ein und derselben Zielsetzung. Also, zunächst: Solidarität ist [...] durch geteilte Werte gekennzeichnet, die es zweitens dann erlauben, die Tätigkeiten oder Leistungen des anderen als wertvoll auch für sich selber zu erfahren." (Honneth 2008, 6) Honneth betont, dass diese Form der Anerkennung an einen gemeinsamen sozialen Wertehorizont gebunden ist und auf ein symmetrisches Verhältnis zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft beruht.
Die Verwirklichung der drei Anerkennungsmomente führt beim einzelnen Menschen zu einem positiven Selbstbezug und zu einem positiven Bewusstsein über sich selbst. Denn wie sich der Einzelne wahrnimmt, hängt wesentliche von diesen intersubjektiven Beziehungsformen ab. Das positive Erleben primärer Beziehungen in Form emotionaler Zuwendung "schafft das Maß an individuellem Selbstvertrauen, das für die autonome Teilnahme am öffentlichen Leben die unverzichtbare Basis ist." (Honneth 2003, 174) Aus der emotionalen Zuwendung heraus erwächst das Selbstvertrauen. Voraussetzung ist jedoch zugleich die Achtung des jeweils Anderen, als autonomes Individuum, mit eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen. Diese Achtung wird durch das Recht anerkannt. Als Rechtssubjekt erhebt die Person über den Rahmen der Primärbeziehung hinaus den Anspruch, dass ihre Bedürftigkeit in gleicher Weise wie die der anderen zur Erfüllung gelangt. Dadurch entsteht eine Selbstbeziehung in dem Bewusstsein der Sicherheit über die eigene Achtungswürdigkeit. Als Rechtssubjekt erhält der Einzelne die Gewissheit, dass bestimmte Ansprüche eine soziale Erfüllung erhalten, wenn im Gegenzug jeder bereit ist, normative Verpflichtungen dem anderen gegenüber einzuhalten. Diese Erfahrung kommt im reflexiven Selbstbezug der Selbstachtung zum Ausdruck
Die umfassende Anerkennung des Anderen ergibt sich durch die dritte Anerkennungsform der Solidarität. Die Konstituierung der Person als Rechtssubjekt stellt die Voraussetzung dar, dass sie als Individuum mitsamt ihren persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften innerhalb einer Gemeinschaft Wertschätzung genießt. Aus der Erfahrung, als besonderes Individuum mit eigenen Fähigkeiten einen für die Gesellschaft unverwechselbaren Wert zu besitzen, resultiert die Überzeugung in den eigenen Wert, was als Selbstschätzung zum Ausdruck kommt.
Die Selbstschätzung, die aus der sozialen Wertschätzung resultiert, hängt wesentlich von einem historisch wandelbaren Bezugssystem ab, "innerhalb dessen sich der Wert der charakteristischen Eigenschaften einer Person messen lässt." (Honneth 2003, 184) D.h., dass soziale Wertschätzung eng mit einem gesellschaftlichen Wertehorizont verknüpft ist, der aufzeigt, welche individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten in einer Gemeinschaft die notwendige Beachtung erhalten.
Die drei Anerkennungsformen sind die Basis, auf der sich intersubjektive Beziehungen abbilden und zur gelungenen Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Zugleich kann jedoch auf jeder Stufe die Anerkennung der Person verfehlt werden und umschlagen in a) psychische Demütigung, b) in die Entrechtung und in sozialen Ausschluss und c) in die Entwertung der Lebensform der Person. Die drei Grundformen der Missachtung, die mit den jeweiligen Anerkennungsstufen korrelieren, verkehren sich zugleich zu einem negativen Selbstbezug und wirken so verletzend auf die Persönlichkeit der Betroffenen.
Die physische Demütigung bezeichnet Honneth als die elementarste Form der Missachtung, dem Menschen werden dabei alle Möglichkeiten entzogen, frei über seinen Körper zu verfügen. Formen der psychischen Demütigung sind Misshandlung, Missbrauch, Vergewaltigung, Folter usw. "Diese Missachtung der selbstverständlichen Respektierung der autonomen Verfügung über den eigenen Leib zerstört etwas im Subjekt, was erst im Verlauf der Sozialisation auf der Basis emotionaler Zuwendung mühsam errichtet wurde - die Integration von leiblichen und seelischen Verhaltensqualitäten nämlich - und damit das Vertrauen in sich selbst." (Katzenbach 2004, 5)
Die zweite Form der Missachtung ist die Entrechtung und der soziale Ausschluss, der darin besteht, dass bestimmte Individuen von bürgerlichen Rechten und damit auch von der Gesellschaft strukturell ausgeschlossen bleiben. Damit ist nicht nur die Einschränkung der persönlichen Autonomie gemeint, sondern zusätzlich die Erfahrung, nicht als vollwertiger und gleichberechtigter Interaktionspartner anerkannt zu sein. Diese Erfahrung geht einher mit der Geringschätzung der eigenen Achtungswürdigkeit und mit einem hohen Maß an Demut und sozialer Scham.
Als dritte Missachtung nennt Honneth die Entwertung der Lebensform. "Hier ist die gesellschaftliche Wertehierarchie so beschaffen, dass sie einzelne Lebensformen und Überzeugungsweisen als minderwertig oder mangelhaft herabstuft, und damit den betroffenen Subjekten die Möglichkeit nimmt, ihren eigenen Fähigkeiten einen sozialen Wert beizumessen." (Katzenbach 2004, 5) Dies führt unweigerlich zur sozialen Entwürdigung, Beleidigung und Degradierung der Person. Momente der Selbstverwirklichung werden unterminiert und die Chance, sich als geschätztes Wesen zu fühlen, schwindet.
Abbildung 37: Struktur sozialer Anerkennungsverhältnisse. Vgl. Honneth 2003, S. 211
|
Anerkennungsformen |
Primärbeziehung |
Rechtsverhältnis |
Wertegemeinschaft |
|
(Liebe) |
(Gleichberechtigung) |
(Solidarität) |
|
|
Anerkennungsweisen |
Emotionale Zuwendung |
Achtung |
Soziale Wertschätzung |
|
Selbstbeziehung |
Selbstvertrauen |
Selbstachtung |
Selbstschätzung |
|
Missachtungsformen |
Physische / psychische Demütigung |
Entrechtung / sozialer Ausschluss |
Entwertung der Lebensform |
Im Folgenden soll der Nachweis erbracht werden, dass diese Anerkennungsformen mit den jeweiligen Entwicklungsstufen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung korrelieren. Dabei lassen sich anhand der Institutionsreform, Deinstitutionalisierung und dem Leben mit Unterstützung Anerkennungsweisen gleichermaßen abbilden wie auch Missachtungsformen nachweisen. Die Tabelle auf der folgenden Seite bietet hierfür einen ersten und allgemeinen Überblick:
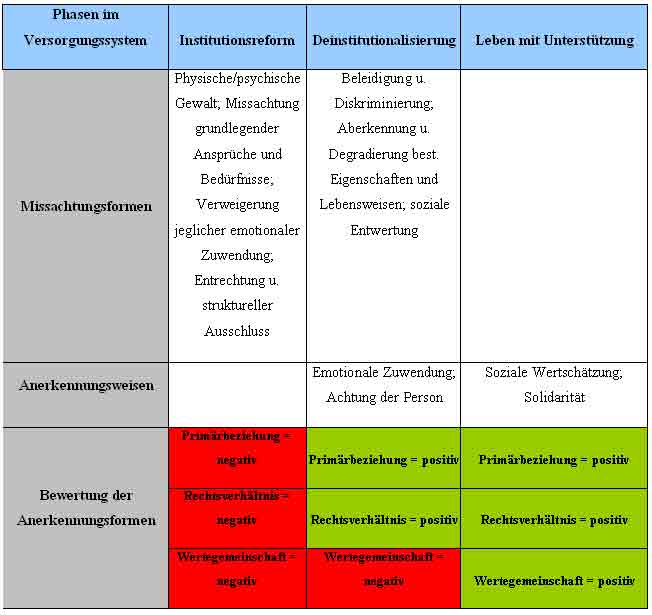
Die Institutionsreform zeichnete sich dadurch aus, dass den Betroffenen in den Großanstalten kaum ein menschenwürdiges Leben vergönnt war. Die Insassen wurden nach pflegerischen und medizinischen Maßstäben betreut und versorgt. Sie waren Patienten, psychisch und geistig Erkrankte, die man durch akkurate Behandlungen und Therapien heilen kann. In den Anstalten lebten die Insassen auf engstem Raum zusammen und das Vorgehen innerhalb der Anstaltsmauern blieb der Öffentlichkeit verschlossen. Am Eingangsportal der Tiroler Irrenanstalt in Pergine, die im Jahr 1882 eröffnet wurde, prangte z.B. die Inschrift: "Eintritt bei Geldstrafe von zwei Gulden oder Verhaftung verboten." (Pantozini 1989, 45) Die Anstalten waren Gefängnisse. Ihr Innenleben wurde vor den öffentlichen Blicken hermetisch abgeschirmt. Dies verwundert nicht, wenn man weiß, welcher menschlichen Tragödie die Betroffenen tagtäglich ausgesetzt waren. Selbst die Behandlungsmethoden zeugen von einer menschenverachtenden Praxis. Beliebte medizinisch-therapeutische Methoden, neben der Arbeitstherapie waren:
-
Die Malariatherapie:
Den Patienten werden dabei Malariaerreger injiziert, um die geistigen und psychischen Erkrankungen durch das hervorgerufene Fieber zu heilen. Die Therapie wurde von Julius Wagner von Jauregg 1917 eingeführt. Für seine medizinischen Leistungen und die für die therapeutische Bedeutung der Malaria-Impftherapie zur Behandlung progressiver Paralysen erhielt er 1927 den Nobelpreis für Medizin.
-
Die Insulinschock-Therapie:
Sie wurde vor allem zur Behandlung von Depressionen und Psychosen eingesetzt. Mit Hilfe von Insulin wurde die Unterzuckerung des Körpers herbeigeführt. Der Patient fiel in ein künstliches Koma. Bei wiederholter Anwendung führte diese Therapie zu irreversiblen Hirnschädigungen und in einigen Fällen auch zum Tod.
-
Die chirurgische Therapie:
Die chirurgische Therapie, auch als Lobotomie oder Leukotomie bezeichnet, stellt einen operativen Eingriff ins Gehirn dar, bei dem das Gewebe der Stirnlappen durchtrennt wurde. Schwerwiegende Persönlichkeitsveränderungen waren die Folge. Der Eingriff führte zum Verlust jeglichen Realitätsbezugs und zum geistigen und gefühlsmäßigen Tod. Die chirurgische Therapie wurde vor allem bei depressiven und psychotischen Patienten durchgeführt. Egas Moniz führte diese Behandlungstechnik erstmals 1935 bei einem Menschen durch. Er bekam 1949 den Nobelpreis für Medizin. Die Lobotomie wurde von Freeman und Watts zu einer populären Technik innerhalb der Psychiatrie weiterentwickelt. Freeman operierte in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts ca. 3.600 Patienten. In einigen Staaten Europas wurde diese Behandlung bis weit in die 1980er Jahre hinein beibehalten.
-
Die Elektrokrampf-Therapie:
Die EKT (Elektrokrampf-Therapie) wurde von dem Psychiater Ugo Cerletti entwickelt. Er hat die Methode in einem Schlachthaus kennen gelernt. Er beobachtete, dass die Schweine durch den Stromstoß nicht getötet wurden, sondern lediglich bewusstlos waren. Die EKT wurde infolge zur Behandlung psychischer Störungen angewandt. EKT führte häufig zu Kiefer-, Arm- und Wirbelbrüchen und bei mehrmaliger Anwendung zu Hirnschädigungen und Leistungsausfällen. Hinsichtlich des Behandlungserfolgs meint der EKT-Betroffene Alfred Deisenhofer lapidar: "Ein direkter massiver Angriff auf das Gehirn, auch in Narkose, ist eine sehr viel heimtückischere Sache, wirkt direkt auf die Persönlichkeit und macht wehrlos und hilflos. Er heilt nicht, sondern verletzt!" (Deisenhofer 2000)
Die Behandlungsmethoden zeugen von Gewalt und physischer Demütigung. Anstaltspatienten waren in prekärer Weise der Willkür ärztlicher Expertise ausgesetzt, jegliche emotionale Zuwendung blieb ihnen verwehrt. Priorität hatte einzig und allein die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse und die Durchführung von verschiedenen therapeutischen Maßnahmen an ihrem Körper. Paradigmatisch für die rechtliche Missachtung der Patienten war außerdem, dass ihnen in einigen Ländern wie in Italien mit der Einweisung in die Irren- bzw. Heilanstalt automatisch der rechtliche Personenstatus aberkannt wurde. (Vgl. Pantozzi 1997, 141 - 150)
Mit Honneth könnte nun argumentiert werden, dass während der Institutionalisierungsphase die Beziehungen zu den Patienten bzw. Anstaltsinsassen von Missachtungsformen wie der physischen Demütigung, des rechtlichen und sozialen Ausschlusses und der Entwürdigung der Lebensform dominiert waren. Die Patienten waren physischen und psychischen Misshandlungen ausgesetzt, sie war als Personen entrechtet und von der restlichen Gesellschaft ausgeschlossen.
Erst durch die Deinstitutionalisierung während der 1970er Jahre zeichnete sich ein moralischer Fortschritt in der Beziehung zu den Betroffenen hin ab. Im Zuge des Normalisierungsprinzip wurden die Betroffenen als rechtlich autonome Personen anerkannt. Ihnen wurden grundlegende Bürgerrechte gewährt. Sie sollten als Gleiche unter Gleichen das Recht haben, so weit wie möglich unter normalen Bedingungen zu leben. Im Sinne der Integration und Normalisierung wurden gemeindenahe Kleinstrukturen errichtet. Man konzentrierte sich auf entwicklungspsychologische und verhaltenstherapeutische Rehabilitationsmaßnahmen und Fördermodelle. Im Zuge der Umsetzung des Normalisierungsprinzips "war es nämlich zu einer veränderten Sicht gekommen, indem Menschen mit Behinderungen nicht mehr nur im Lichte von Schädigung, sondern gleichfalls von Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen und gesellschaftlicher Benachteiligung wahrgenommen wurden. Schulprobleme, Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten behinderter Menschen wurden nun nicht mehr einzig und allein als individuelles (schädigungsbedingtes) Versagen gesehen, als ebenso bedeutsam galten jetzt auch institutionelle Bedingungen, die als Barrieren für gelingende Entwicklungen erkannt und für das Versagen (mit-)haftbar gemacht wurden." (Theunissen 2002, 2)
Die Rehabilitation findet dabei in der für die Betroffenen am wenigsten einschränkenden Umwelt statt, sprich in speziell für sie ausgewiesenen Sonderwelten: in geschützten Werkstätten, geschützten Wohnstrukturen, Sonderschulen usw. Die Förderung, die zum Schlüsselbegriff der Rehabilitation wurde, sollte so weit wie möglich von störenden Einflussfaktoren verschont bleiben. Die primäre Unselbständigkeit der Person soll überwunden werden, um die Integration der Betroffenen in die Welt der Nichtbehinderten zu ermöglichen und Normalität im umfassenden Maße zu garantieren. Integration führt dabei über einen indirekten Weg, "über eine besondere individual-soziale Förderung als Voraussetzung für mehr Gemeinsamkeiten im späteren Leben." (Speck 1991, 289) Das Normalisierungsprinzip formulierte damit nicht nur das Recht auf Normalität, sondern gleichzeitig eine indirekte Pflicht zur Normalisierung der Lebensumstände, Lebenssituation, Lebenslagen und Lebensstilen der Betroffenen. Akzeptanz und Anpassung liegen dabei sehr eng beieinander. Im Hinblick auf die Einhaltung der Normen unterliegen die Betroffenen einem Repressionsdruck. Die Rollenzuschreibungen und Normsetzungen sind dabei eindeutig verteilt, nicht die Betroffenen besitzen die Definitionsmacht darüber, was Normalität ist, sondern die Gesellschaft der Nichtbehinderten setzt die Kriterien voraus, die ein normales Leben repräsentieren. Theunissen schreibt: "Es ging darum, etwas aus einem behinderten Menschen zu machen. Gefordert wurde die von der helfenden Instanz gesetzte Norm, und das war in der Regel Verselbständigung und soziale Anpassung an die Gesellschaft." (Theunissen 2002, 2)
Das Normalisierungsprinzip findet seine normative Begründung außerdem in einem rechtlichen Gleichstellungsgrundsatz und in der Forderung nach Wahl- und Partizipationsmöglichkeiten, die denen der Nichtbehinderten entsprechen. "Als ein umfassendes Konzept für das politisch-rechtliche, administrative, pädagogische und soziale Handeln hat das Normalisierungsprinzip Reformen bewirkt [...], und Zielsetzungen wie z.B. Selbstbestimmung den Weg bereitet." (I. Beck 2006, 105) Rösner weist darauf hin, dass das Recht allein die Anerkennung von Menschen mit Behinderung nicht genügend berücksichtigt. "So richtet man das Augenmerk zu sehr darauf, dass das Ziel einer gerechten Gesellschaft in der rechtlichen Sicherung individueller oder gruppenbezogener Entscheidungsfreiheit liegt. Doch die Frage muss auch sein, welche weiteren sozialen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit alle Individuen von der ihnen rechtlich gewährten Freiheit zum guten Leben auch tatsächlich Gebrauch machen können. Die Möglichkeiten eines guten Lebens können im Rahmen eines Rechtssystems allein nicht garantiert werden; denn um Wege der Selbstverwirklichung beschreiten zu können, bedarf es eines neuen ‚Ethos', einer neuen Einstellung unterhalb des Rechtscodes." (Rösner 2002, 85) Der Normalisierungsgedanke bleibt durch die Gegenüberstellung von Behinderten und Nicht-Behinderten geprägt und man gibt vor, die Unterschiede durch Integration und Normalisierung aufzulösen. Die Andersartigkeit und Verschiedenheit wird nicht ertragen und soll "normalisiert" werden.
Das Deinstitutionalisierungsmodell mit seiner grundlegenden Ausrichtung auf das Normalisierungsprinzip ist gegenwärtig die vorherrschende Handlungspraxis im Umgang mit behinderten Menschen. Sie sind als rechtlich autonome Personen anerkannt und vor willkürlichen Übergriffen geschützt, die soziale Wertschätzung bleibt ihnen jedoch weiterhin verwehrt. Ihre individuellen Lebensweisen, ihre Andersartigkeit und Verschiedenheit werden zumeist nicht als achtenswürdig innerhalb des gesellschaftlichen Kontexts angesehen. Die Rehabilitationspraxis versucht darum, den Betroffenen so weit wie möglich gesellschaftlich achtenswürdige Fertigkeiten zu vermitteln. Dabei bleibt der Betroffene auf ein Versorgungsobjekt fixiert, dem eigene Strategien zur Bewältigung seines Lebens entzogen werden und sein Dasein besitzt für die Gemeinschaft keinen relevanten Wert. Dieses wertlose Behindert-Sein wird zwar toleriert, bleibt jedoch von der Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und Fürsorge der Mitmenschen abhängig. Der Behinderte bleibt eine Belastung für die anderen, denn wer "sich nicht ‚normal' verhält, muss entweder intensiver betreut oder therapiert werden. [...] Die angestrebte Erweiterung der Möglichkeiten des Behinderten, sich selbständig, als Subjekt, zu erleben, verkehrt sich dadurch leicht ins Gegenteil. Der Behinderte aber muss sich solange als andersartig und unzureichend empfinden, solange er den Druck von Pädagogik und Therapie auf sich gerichtet fühlt." (Gaedt 1999, 10)
Rehabilitationskonzepte, die auf die Integration durch Normalisierung beruhen und das Ziel haben, durch pädagogische Interventionen die Betroffenen "zu verbessern" ziehen vielfach stigmatisierende Wirkungen nach sich. Denn "Erfolg bedeutet in der Rehabilitation, normal zu funktionieren und zurückzukehren in den allgemeinen Arbeitsmarkt, in die Welt der Normalen, die ihr Brot selber verdienen. Je nach Rehabilitationseinrichtung schaffen das etwas 70% - 95% der Klient/innen nicht, und wir wissen im Voraus, dass dieses Ziel unter den heutigen Bedingungen oft nicht erreicht werden kann. Die meisten Menschen, die berufliche Rehabilitation benötigen, sind sehr krank [Domingo und Baer beziehen sich auf psychisch kranke Menschen], und viele von ihnen werden nie ein ganzes Pensum arbeiten können. Sie werden jedoch weitertrainiert, um dieses unerreichbare Ziel zu erreichen - die Normalität. Psychisch Behinderte normaliseren zu wollen, beinhaltet eine klare Wertung: Normal sein hat mehr wert als psychisch krank zu sein. Das ist stigmatisierend." (Domingo und Baer 2003, 356)
Der soziale Ausschluss aus der Wertegemeinschaft geht einher mit der sozialen Entwertung der Lebensweisen, denn "ist [...] diese gesellschaftliche Wertehierarchie so beschaffen, dass sie einzelnen Lebensformen und Überzeugungsweisen als minderwertig oder mangelhaft herabstuft, dann nimmt sie den davon betroffenen Subjekten jede Möglichkeit, ihren eigenen Fähigkeiten einen sozialen Wert beizumessen. Die evaluative Degradierung von bestimmten Mustern der Selbstverwirklichung hat für deren Träger zur Folge, dass sie sich auf ihren Lebensvollzug nicht als auf etwas beziehen können, dem innerhalb ihres Gemeinwesens eine positive Bedeutung zukommt; für den Einzelnen geht daher mit der Erfahrung einer solchen Entwertung typischerweise auch ein Verlust an persönlicher Selbstschätzung einher, der Chance also, sich selber als ein in seinen charakteristischen Eigenschaften und Fähigkeiten geschätztes Wesen zu verstehen zu können." (Honneth 2003, 217)
Die Selbstschätzung der eigenen Fähigkeiten und Lebensweisen wird durch die verhinderte soziale Wertschätzung und mangelnde Solidarität negiert. Solidarität ist nach Honneth "unter den Bedingungen moderner Gesellschaft [...] an die Voraussetzung von sozialen Verhältnissen der symmetrischen Wertschätzung zwischen individualisierten (und autonomen) Subjekten gebunden; sich in diesem Sinne symmetrisch wertzuschätzen heißt, sich reziprok im Lichte von Werten zu betrachten, die die Fähigkeiten und Eigenschaften des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis erscheinen lassen. Beziehungen solcher Art sind solidarisch zu nennen, weil sie nicht nur passive Toleranz gegenüber, sondern affektive Anteilnahme an dem individuell Besonderen der anderen Personen wecken: denn nur in dem Maße, in dem ich aktiv dafür Sorge trage, dass sich ihre mir fremden Eigenschaften zu entfalten vermögen, sind die uns gemeinsamen Ziele zu verwirklichen." (Honneth 2003, 210)
Die Deinstitutionalisierungsphase und die damit zusammenhängenden Reformen der Normalisierung, Integration und Partizipation erfreuen sich jedoch auch positiver Wirkungen. Im Sinne des moralischen Fortschritts, der sich durch die rechtliche Anerkennung und Autonomie der Person auszeichnet, konnten vor allem körperlich Beeinträchtigte die Umorientierung der Behindertenhilfe für sich nutzen. "Vor allem ihnen gelang es, die neuen Paradigmen für sich zu mobilisieren. Mit Hilfe des Rehabilitationssystems, das während der Reformära der sozialliberalen Koalition zu Beginn der siebziger Jahre installiert wurde, erhielten sie Zugang zum Bildungssektor und zum Arbeitsmarkt. Damit bekamen sie Qualifikationen und finanzielle Ressourcen in die Hand, die es ihnen ermöglichten, für ein Leben außerhalb der Anstalt zu kämpfen. Es ist daher kein Zufall, dass aus der Generation der ‚Rehabilitanden' diejenigen hervorgingen, die ab Ende der Siebziger die westdeutsche Behindertenbewegung initiierten und zu Beginn der achtziger Jahre Selbstbestimmung einforderten." (Waldschmidt 2003, 18) Für Schwerbehinderte, aber auch psychisch kranke und vor allem für geistig behinderten Menschen, ergaben sich aus den neuen Paradigmen jedoch kaum Möglichkeiten der sozialen Wertschätzung und Solidarität.
Der nicht eingelöste Anspruch auf soziale Wertschätzung und Anerkennung löste Kritik aus und forderte die Emanzipation und Teilhabe ein. Die Stimme erhoben diesmal die Betroffenen selbst, die bislang in dem Zusammenhang völlig ignoriert wurden und die sich nun gegen Verdinglichung und Fremdbestimmung zur Wehr setzten. In dem Maße, wie das Selbstbestimmungsrecht von den körperbehinderten Menschen forciert wurde und einen für behinderte Menschen zu einseitigen Autonomiebegriffs hervorbrachte, auf den später noch kritisch eingegangen wird, entwickelte sich in Anlehnung und in Abgrenzung dazu der Empowerment-Ansatz. Seine Vertreter fordern Emanzipation statt Integration. "Empowerment versteht sich dabei nicht als eine systemaffirmative Interventionsmethode, sondern als parteinehmende Instanz für die Belange Betroffener, die als kompetente Experten in eigener Sache gelten." (Theunissen 1997, 379)
Der Empowerment-Ansatz überwand das Normalisierungsprinzip und einen einseitigen Autonomiebegriff und entwickelte sich im Zuge der dritten Phase, dem Leben mit Unterstützung, zum paradigmatischen und handlungsleitenden Grundansatz in der Sozialarbeit heraus. Empowerment heißt keinesfalls, unter Einklagung des Selbstbestimmungsrechts, auf das Moment der Unterstützung und Fürsorge zu verzichten. "Geistig behinderte Menschen können nicht einfach unter der Parole der Selbstbestimmung in die ‚Normalität' entlassen werden und sich damit selbst überlassen bleiben. Empowerment zielt vielmehr darauf ab, assistierende Hilfe in einer Qualität und Quantität zu organisieren, dass sowohl Möglichkeiten der Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit als auch mehr individuelle Autonomie realisiert werden können." (Theunissen und Plaute 1995, 18) Das Empowerment-Konzept greift Selbstbestimmungsgedanken auf, begründet Selbstbestimmung jedoch nicht durch ein "'ungebundenes Selbst', sondern orientiert sich an einem in soziale Bezüge eingelassenen Selbst." (Rösner 2002, 376) Darüber hinaus wird das Konzept von zwei weiteren normativen Grundüberzeugungen getragen: "So gelten als politische Leitwerte einer "Empowerment-Philosophie" ebenso Verteilungsgerechtigkeit wie auch kollaborative und demokratische Partizipation [...] Mit Verteilungsgerechtigkeit zeigt sich die politische Dimension von Empowerment in Form einer kritischen Bezugnahme auf die gesellschaftliche Macht- und Güterverteilung. Die Vertreter des Empowerment-Konzepts geben damit der Auffassung Ausdruck, dass Wohlstand und Macht in unserer Gesellschaft ungleich verteilt sind und dass unterprivilegierten sozialen Gruppen bzw. Menschen in gesellschaftlich marginaler Position der Zugang zu allgemeinen öffentlichen Diensten, zum Gesundheits- und Bildungssystem sowie zur Arbeitswelt erschwert wird. Der dritte Grundpfeiler des Empowerment-Konzepts ist die Teilhabe der Betroffenen an Entscheidungsprozessen, die ihre personale Lebensgestaltung und ihre unmittelbare soziale Lebenswelt betreffen." (Rösner 2002, 377)
Die Empowerment-Perspektive zielt letztendlich auf die Einbindung des Subjekts in das Gemeinwesen und geht, vor allem durch die weithin verpflichtende Fürsorge, von der Gemeinschaftsangewiesenheit von Individuen aus. Empowerment setzt sich letztlich zum Ziel, den Werterahmen innerhalb einer Gemeinschaft so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung darin einen unverwechselbaren Wert erhalten und die Solidarität innerhalb der bestehenden Gesellschaft erweitert wird. Durch die soziale Wertschätzung sollen sie im selbstreflexiven Akt Selbstschätzung erfahren, "denn nur dank des kumulativen Erwerbs von Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung, wie ihn nacheinander die Erfahrungen von jenen drei Formen der Anerkennung garantiert, vermag eine Person sich uneingeschränkt als ein sowohl autonomes wie auch individuiertes Wesen zu begreifen und mit ihren Zielen und Wünschen zu identifizieren." (Honneth 2003, 271)
Anhand der Darstellung des SPAGAT_Projekts hoffe ich dabei gezeigt zu haben, wie durch das Modell der Unterstützten Beschäftigung und den Empowerment-Ansatz in der Phase "Leben mit Unterstützung", Menschen mit schweren kognitiven Behinderungen innerhalb einer Gemeinschaft Solidarität erfahren können und durch soziale Wertschätzung einen positiven Selbstbezug in Form von Selbstachtung entwickelten. Somit kann nach Honneth argumentiert werden, dass im Zuge der dritten Phase, dem Leben mit Unterstützung, die Anerkennungsweise von Menschen mit Behinderung im Begriff der sozialen Wertschätzung und Solidarität kulminiert.
Im vorangegangenen Kapitel wurden die drei Anerkennungsweisen in Beziehung zu den Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung gesetzt. Dabei kann festgehalten werden, dass während der Institutionalisierungsphase physische Demütigung durch Vernachlässigung, durch das Zufügen von physischem und psychischem Schmerz und von Gewalt das Verhältnis zu den Patienten bestimmte. Personenrechte und gesellschaftliche Teilhabe wurden ihnen vorenthalten. Erst während der zweiten Phase, der Deinstitutionalisierung, veränderte sich dieses Verhältnis. In den 1950er Jahren setzten sich vor allem Eltern gegenüber der psychiatrischen Verwahrung zur Wehr. Paradigmatisch hierfür kann die Gründung der Elternvereinigung Lebenshilfe verstanden werden. Diese Anfänge waren von einer Fürsorgeethik bestimmt, die einen menschenwürdigen Umgang mit den Betroffenen forderten. Es entstanden die ersten teilstationären Einrichtungskonzepte, die im Sinne des Normalisierungsprinzips eine so weit wie möglich reichende Angleichung der Lebenssituation von Betroffenen an die der Normalbevölkerung anstrebten. Auf legislativer Ebene führte das Normalisierungsprinzip dazu, dass den Menschen mit Behinderung allmählich das Recht auf persönliche Integrität, Autonomie und Selbstbestimmung zuerkannt wurde. Antidiskriminierungsgesetze wurden verabschiedet, die jede Form von Diskriminierung und Benachteiligung auf Grund von Behinderung verboten. Damit führte die Phase der Deinstitutionalisierung zur moralischen Anerkennung der leiblichen Integrität und zur rechtlichen Gleichstellung der Betroffenen durch Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgrundsätze. Viele Betroffene, vor allem körperlich beeinträchtigte Personen, konnten diese Umorientierung der Behindertenhilfe für sich mobilisieren und sie forcierten zunehmend das Selbstbestimmungsrecht für behinderte Menschen.
Doch Selbstbestimmung allein und die rechtlichen Grundlagen dazu führten nicht für alle Betroffenen zur gewünschten gesellschaftlichen Integration. Als Gleicher unter Gleichen zu leben verlangt in einem hohen Maße eine Anpassung an soziale Normen, Werte und Verhaltensweisen. Vor allem für schwerer behinderte Menschen, wie geistig Beeinträchtigte und schwer psychisch Kranke, gelten nach wie vor vorbereitende rehabilitative Maßnahmen als Grundvoraussetzung und Vorstufe für die spätere gesellschaftliche Integration. Ihre individuellen aber verschiedenartigen Verhaltens- und Lebensweisen werden dabei als defizitär erfahren und sie sollen an normale Verhaltensweisen angeglichen werden. In der beruflichen Rehabilitation bedeutet dies das Antrainieren traditioneller Leistungskriterien wie Pünktlichkeit, Geschwindigkeit, Initiative, Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen usw. Die defizitäre rehabilitative Sichtweise wirkt gleichzeitig diskreditierend und stigmatisierend, denn vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Werte werden ihre individuellen Lebensweisen und ihre Verschiedenartigkeiten nicht als achtungswürdig empfunden. Die Betroffenen selbst können sich dabei nur als Menschen zweiter Klasse fühlen, die zwar Fürsorge und rechtliche Anerkennung erfahren, als Individuen, mit eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen, jedoch kaum auf gesellschaftliche Wertschätzung und Teilhabe hoffen können. Das dritte Anerkennungsmoment, als solidarische Zuwendung, das sich auf gemeinschaftliche Lebenskontexte bezieht, wodurch der einzelne Mensch Achtung und Wertschätzung für sein individuelles Sosein erfährt und seinen jeweiligen Betrag für ein Gemeinwesen leistet kann, bleibt vielen Betroffenen im Zuge der Deinstitutionalisierungsphase immer noch verwehrt.
Erst die Phase "Leben mit Unterstützung" scheint diesen Anspruch für Menschen mit Behinderung einlösen zu können. Als handlungsleitendes Prinzip gilt der Empowerment-Ansatz, der alle drei Anerkennungsformen berücksichtigt: Die emotionale Zuwendung als Fürsorge in Form von Unterstützung, die Anerkennung der Autonomie der Person in Form des Rechts auf Selbstbestimmung und die solidarische Zuwendung, in der Form sozialer Wertschätzung und Solidarität durch netzwerk- und gemeinschaftsfördernde Maßnahmen. Dabei wird der defizitorientierte rehabilitative Blick zugunsten einer ressourcen- und stärkenorientierten Sichtweise überwunden. Es wird davon ausgegangen, dass Zugangsbarrieren und gesellschaftliche Umwelthindernisse Teilhabemöglichkeiten verhindern, die durch gezielte Maßnahmen wie Barrierefreiheit und gerechte Ressourcenverteilung überwunden werden können. Am Beispiel von SPAGAT konnte aufgezeigt werden, dass im Bereich der beruflichen Integration vor allem aufseiten der Betriebe ökonomische Barrieren bestehen, Menschen mit schweren Behinderungen anzustellen. Diese Barrieren können durch Lohnkosten- und Mentorenzuschüsse überwunden werden und damit die Teilhabe schwer behinderter Mensch an der Arbeitswelt ermöglichen. Ein weiteres Empowerment-Zeugnis bietet der Unterstützerkreis; durch ihn werden soziale Ressourcen in Form selbstorganisierter Gruppenzusammenschlüsse genutzt. "An dieser Stelle steht Empowerment für eine professionelle Praxis, die sich - kontrapunktisch zu paternalistischen Modellen - durch eine neue Kultur des Helfens auszeichnet." (Theunissen 2006, 82) Der Selbstbestimmungsaspekt kommt im Empowerment-Konzept darin zur Geltung, dass die Betroffenen in Entscheidungen einbezogen werden, Gehör finden, Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten. "Empowerment-Prozesse zielen auf die Stärkung der Teilhabe der Bürger an Entscheidungsprozessen, die ihre personale Lebensgestaltung und ihre unmittelbare soziale Lebenswelt betreffen. Sie zielen auf die Implementierung von Partizipationsverfahren, die ihren Wünschen und Bedürfnissen nach Mitmachen, Mitgestalten, Sich-Einmischen in Dienstleistungsprodukten und lokaler Politik Rechnung tragen und eine eigenverantwortliche Gestaltung von lokalen Umwelten zulassen." (Herriger 2005, 4) Empowerment steht für die Stärkung der Gemeinschaft und für die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements.
Der Empowerment-Ansatz entwickelte sich in Opposition zum Selbstbestimmungsgrundsatz, dessen Kern darin liegt, "das Subjekt - verstanden als freier Bürger, d.h. ausgestattet mit unveräußerlichen Rechten - vor den Übergriffen des Staates und seiner Institutionen zu schützen, so wird aus der Empowerment-Perspektive gerade die Einbindung des Subjekts in das Gemeinwesen thematisiert." (Katzenbach 2004, 15)
Honneths Anerkennungsweisen finden eine globale Entsprechung in den jeweiligen Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung. Spiegelbildlich können dabei auch gesellschaftstheoretische Positionen abgebildet werden. Die emotionale Zuwendung entspricht einem Fürsorgedenken staatlicher Wohlfahrt, welches ab den 1960er Jahren die Behindertenarbeit im Zuge der Deinstitutionalisierung bestimmte. Die rechtliche Anerkennung, die im Behindertenbereich ab den späten 1970er Jahren in den Selbstbestimmungsanspruch behinderter Menschen mündete, würdigt die Position des Liberalismus. Die solidarische Zuwendung, abgebildet durch die dritte Phase "Leben mit Unterstützung" und dem Empowerment-Ansatz, nimmt den Gesichtspunkt des Kommunitarismus, als Gegenbewegung zum Liberalismus, auf. Im Folgenden werden die Positionen des Liberalismus im Zusammenhang mit der Selbstbestimmung behinderter Menschen und die des Kommunitarismus im Zusammenhang mit dem Empowerment-Ansatz, näher beleuchtet. Dabei werden die Unterschiede herausgearbeitet und zugleich die Gefahren beider Ansätze abgebildet, denn sowohl liberale als auch kommunitaristische Theorien versuchen, Anerkennung an Voraussetzungen zu binden, die den Anderen annektieren und ihn in seiner Andersheit und Differenz auszulöschen drohen.
Selbstbestimmung hat sich in einer neoliberalen Gesellschaft zu einem janusköpfigen Begriff gewandelt und hat sich dabei zum Leitprinzip eines postmodern verfassten Lebensstil hochstilisiert. Auch innerhalb der Behindertenpädagogik konnte sich die Selbstbestimmungsidee zu einem zentralen Begriff entwickeln. Wurde sie anfangs der 1980er Jahre vor allem vonseiten körperbehinderter Menschen propagiert, wurden Selbstbestimmungsforderungen in den 1990er Jahren auch von geistig behinderten Menschen, wie etwa bei People First erhoben und als Zielsetzungen formuliert. Dabei zielen die Forderungen auf die Angleichung an das gesellschaftlich übliche Maß an Selbstbestimmung ab und orientieren sich vor allem an den Gleichheitsgrundsätzen, die in den Grundgesetzen verankert sind und den Wunsch propagieren, so leben zu wollen, wie alle andern auch. Die Idee der Selbstbestimmung erhebt damit den Anspruch der Betroffenen, als Gleiche unter Gleichen behandelt zu werden und ist eindeutig Honneths Anerkennungsdimension des Rechts zuzuordnen.
Von Kritikern des Selbstbestimmungsansatzes in der Behindertenpädagogik wird jedoch vermerkt, dass in der einschlägigen Fachliteratur der Begriff "eigentümlich unbestimmt bleibt". (Katzenbach 2004, 10) Der Begriff wird vor allem von seiner negativen Seite her, also von der Fremdbestimmung her, entworfen. "Selbstbestimmung scheint sich aus der Gegenüberstellung zur Fremdbestimmung mehr oder weniger von selbst zu verstehen." (Katzenbach 2004, 11) Dadurch droht ihm das Schicksal, allmählich zu einer Modefloskel zu verkommen. Um Klarheit in diese Begriffsirritationen zu bringen, führe ich an dieser Stelle zuerst seine traditionellen Bestimmungen und seine sprachgeschichtlichen Hintergründe näher aus.
Nach Waldschmidt bildete sich der Wortteil "Selbst" erst im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, als eigenständiger Begriff heraus. "Ursprünglich von einem Demonstrativpronomen stammend, entsteht allmählich ein reflexiver Bedeutungsgehalt: Wie in einen Spiegel schauend entdeckt das Individuum sein ‚Ich', seine ‚Identität', kurz, sein ‚Selbst'." (Waldschmidt 2003, 14) Der Wortteil Bestimmung besitzt zwei verschiedene Bedeutungsdimensionen: a) Einen "Befehl über etwas" im Sinne "personale Macht erteilen" und b) eine "Benennung" im Sinne "eine Klassifikation durchführen". "Somit verweist Selbstbestimmung von der Wortgeschichte her auf ein einzelnes Wesen, das sich erkennt, indem es sich definiert und zugleich Macht über sich ausübt. In anderen Worten, der Selbstbestimmungsbegriff bündelt selbstreferentielle, erkenntnistheoretische und individualistische Facetten sowie Aspekte von Macht und Herrschaft." (Waldschmidt 2003, 14) Für Rösner, in Anlehnung an Adorno und Horkheimer, heißt Selbstbestimmung damit zugleich immer auch "gewaltsame Beherrschung des Selbst" (Rösner 2002, 354); Beherrschung des Selbst bedeutet, dass der Mensch, unter dem Diktat der Selbstbestimmung, sich seiner Vernunft bedienen soll, um frei und autonom zu sein. Diese Korrespondenz zwischen Vernunft, Freiheit und Autonomie ist historisch im Kontext der Aufklärungsphilosophie belegt. Die Freiheit des Menschen als Leitideal der Aufklärung bedeutet, sich vom Schicksal, von Vorherbestimmungen und Affekten zu lösen, sich der Vernunft zuzuwenden, um aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten. Mit dem Wahlspruch: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" formuliert Kant das rationalistische Emanzipationsziel. "Die Menschen als vernünftige Wesen gehören einem Reich der Zwecke an und unterstehen moralischen Gesetzen, die ihnen nicht von einer äußeren Instanz auferlegt werden, sondern die sie sich selbst geben: Sie sind mit einem Wort autonom. Die Autonomie ist Bedingung der Sittlichkeit, weil sie Voraussetzung der Freiheit ist: Frei ist nicht, wer tut was ihm beliebt, sondern wer selbstgegebenen Gesetzen gehorcht. Wer dagegen auf Grund von Gesetzen handelt, die von einem Machthaber, von ‚der Gesellschaft', von Gott gegeben sind, ist fremdbestimmt; er gehorcht, weil er auf Vorteile hofft oder mindestens gewisse Nachteile vermeiden möchte." (Röd 1996, 168) In der Ethik Kants bedeutet Selbstbestimmung die Bestimmung des Willens und des Handelns nach den Maßstäben der individuellen Vernunft, die ihm zu einem autonom handelnden Subjekt werden lässt.
John Rawls hat in Anlehnung an Immanuel Kant 1975 eine neoliberale Theorie der Gerechtigkeit entworfen. Er vertritt die Auffassung, "dass eine politische Ethik nicht ein bestimmtes Konzept des guten Lebens und des Glücks postulieren solle, weil solche Konzepte völlig zufällig und unterschiedlich zustande gekommen und für die Realität miteinander konkurrierender und inkommensurabler Konzepte des Guten blind seien." (Moebius 2001, 15) Auch wenn alle Menschen den Wunsch haben, glücklich zu sein, so bestehen ganz unterschiedliche Glücksvorstellungen, die jedoch allgemeine und universale Bedingungen für ihre Verwirklichung benötigen. D.h. man benötigt keine Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Konzeptionen des Glücks, die eine höchste Form des Glücks abbilden, sondern benötigt werden Bedingungen, die eine gerechte und faire Koordination der unterschiedlichen Glückskonzepte regeln. In diesem Zusammenhang gelangt Rawls zu einem Konzept von Gerechtigkeit und Fairness, welches seine Begründung in der Setzung eines Urzustandes (original position) findet. "Im wesentlichen funktioniert der Urzustand wie folgt: Wir sind eingeladen, uns vorzustellen, welche Prinzipien wir zur Lenkung unserer Gesellschaft wählen würden, wenn wir uns im Voraus entscheiden müssten, ohne vorher zu wissen, welche konkrete Person - ob reich oder arm, stark oder schwach, glücklich oder unglücklich - wir sein werden, und ohne vorher unsere Interessen, Ziele oder Konzeptionen des Guten zu kennen. Diese Prinzipien - diejenigen, die wir in dieser fiktiven Situation wählen würden - sind die Prinzipien der Gerechtigkeit. Mehr noch: Falls sich ein solches Verfahren als funktionstüchtig erweist, setzten die Prinzipien nicht einmal besondere Zwecke voraus." (Sandel 1993, 24)
Durch diese Position wird das Recht dem Guten gegenüber höher gestellt. Gewährleistet wird dies durch die Konzeption des "ungebundenen Selbst" (Vgl. Sandel 1993, 24 - 26) - der Person im Urzustand - die gegenüber Zwecken und Zielen unabhängig ist, die sich in einem präsozialen Zustand befindet und folglich von jeder Geschichte und Gemeinschaft losgelöst ist. "Von den Diktaten der Natur und den Sanktionen sozialer Rollen befreit, wird das menschliche Subjekt als souverän gesetzt und zum Autor der einzigen überhaupt existierenden moralischen Bedeutung erklärt. Als Teilhabenden an der einen praktischen Vernunft oder als am Urzustand Beteiligten steht es uns offen, Gerechtigkeitsprinzipien zu schaffen, die keinen Beschränkungen durch vorgängig gegebene Präferenzordnungen unterliegen. Und als gegenwärtiges, individuelles Selbst sind wir frei, unsere Ziele und Zwecke ohne Rücksicht auf eine solche Ordnung, auf Gewohnheiten, auf eine Tradition oder auf einen ererbten Status auszuwählen." (Sandel 1993, 25) Für Rawls ist das ungebundene Selbst ein vernunftfähiges Subjekt, das dann selbstbestimmt ist, wenn es sich selbst von allen äußeren Bedingungen absetzt und sich als erfahrungsunabhängiges und autonomes Subjekt konstituiert. Gleichzeitig wird damit "die Selbstbestimmung der ‚Unvernünftigen' [...] relativ schnell eingeschränkt und in Frage gestellt. [...] Vor allem psychisch kranke und geistig behinderte Menschen werden in ihrer Selbstbestimmung beschnitten, weil ihnen ein vernünftiger Wille nicht zuerkannt wird." (Waldschmidt 2003, 15) Diese Feststellung hat zum einen, seit der Moderne, den Ausschluss von Menschen mit Behinderung stets auch legitimiert. "Zum anderen aber ist Selbstbestimmung ein im Dienste des Neoliberalismus instrumentalisiertes Programm, das auf die Souveränität, die Eigenverantwortlichkeit, die Flexibilität, die Macht und den Erfolg des Subjekts setzt." (Dederich 2003, 3) Vor dem Hintergrund neoliberaler Werte veränderte sich auch die Zielrichtung der Behindertenhilfe. "Nun geht es darum, auch bei der Personengruppe der Behinderten Bewegung herzustellen, sie dazu zu bringen, mit zu eilen im Strom der Zeit, sich einzureihen auf den Autobahnen und in den Kommunikationsnetzen mit zu surfen." (Waldschmidt 2003, 18)
Selbstbestimmung als neoliberales Pflichtprogramm führt so zu einer "nachholenden Befreiung" behinderter Menschen; die gesellschaftlichen Prozesse der Individualisierung und Autonomisierung der Menschen bergen jedoch zwei Enden: "Für die Forderung nach Selbstbestimmung bietet offensichtlich die neoliberale Moderne den entscheidenden Raum. Sie ermöglicht auch denjenigen, die bislang vor den Toren der bürgerlichen Gesellschaft standen, die Chance zur Individualisierung, die Freiheit des bürgerlichen Subjekts. Für behinderte Menschen beinhaltet die Verwirklichung von Selbstbestimmung tatsächlich eine nachholende Befreiung. Als Nachzügler unter den traditionellen aus der Gesellschaft Ausgegrenzten (neben den Arbeitern, Frauen und ethischen Minderheiten) können nun endlich auch sie elementare Bürgerrechte für sich beanspruchen. Gleichzeitig aber müssen sie sich vorsehen angesichts einer gesellschaftlichen Situation, die von fortgeschrittener Individualisierung geprägt ist. Die unkritische Propagierung des Autonomiekonzepts kann in der aktuellen Situation leicht dazu führen, sich in den Fallstrick des Neoliberalismus zu verheddern. Ganz allein für sich verantwortlich zu sein, ohne Anspruch auf Hilfe und Unterstützung - das ist sicherlich nicht die Freiheit, welche die Behindertenbewegung ursprünglich im Sinne hatte, als sie sich die Autonomieforderung auf die Fahnen schrieb." (Waldschmidt 2003, 17)
Der Neoliberalismus ist durchdrungen von der Idee des flexiblen und autonomen Menschen, der losgelöst von traditionellen Bedingungen existiert und selbstbestimmt sein Leben erfolgreich bestreiten kann. Aber mit dem "Appell an das selbstbestimmte Subjekt verabschiedet sich der bisherige Wohlfahrtsstaat, um das Management von Lebensrisiken vermehrt auf das Individuum zu übertragen." (Rösner 2002, 371) Diese neuen Strategien des Selbstmanagements und der Responsibilisierung, die Verlagerung der Verantwortung auf das einzelne handelnde Individuum, führen zu radikalen gesellschaftlichen Umwälzungen und zur Individualisierung und Atomisierung sozialer Strukturen. Hauptsächlich werden damit die tradierten Werte der klassischen Arbeitsgesellschaft aufgelöst. Im Zuge der Neoliberalisierung und Globalisierung wurde "die Arbeitsgesellschaft [...] tendenziell in eine Konsumgesellschaft transformiert." (Junge 2006, 33) Damit zeichnet sich für Bauman eine Abwendung vom Arbeitsethos hin zu einem Konsumethos ab.
Im Rahmen des Ersteren hatte die Arbeit einen kulturellen Eigenwert. Sie diente nicht nur zur eigenen Reproduktion, sondern zielte zusätzlich auf die "Gewinnung und Sicherung kultureller Identität und Teilhabe" (Junge 2006, 32) ab. Die Arbeit erfüllte damit eine gesellschaftliche Funktion und wurde moralisch aufgeladen. Jeder wurde dazu verpflichtet, seine Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Wer nicht arbeitete, sich verweigerte, verfehlte die gesellschaftlichen Standards und wurde von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. "Diese Exklusion wird zwar von sozialen Institutionen der Unterstützung, wie etwa Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe abgemildert. Aber diese Unterstützung trägt die Kehrseite der sozialen Kontrolle mit sich. Kontrolle über die Lebensbedingungen der Armen, die sich diesen Institutionen anvertrauen müssen. Diese Verschränkung von Exklusion, Unterstützung und Kontrolle ist nach Bauman gesellschaftlich nötig, um die Möglichkeit einer normativen Integration über einen geteilten Arbeitsethos aufrecht zu erhalten." (Junge 2006, 32)
Im Übergang zum Konsumethos veränderten sich nun die Bedingungen: "War Armut in der Arbeitsgesellschaft noch auf das Unvermögen zum Verkauf der eigenen Arbeitskraft bezogen und auf die damit unmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, so wird in der Konsumgesellschaft Armut anders definiert: Armut bedeutet jetzt, zuzugeben, dass man nicht in der Lage ist, die richtige Konsumwahl zu treffen [...] Und damit tritt etwas Folgenschweres für den Umgang mit Armut ein: Arme und das Phänomen der Armut werden aus dem gesellschaftlichen Kontext exkludiert. Denn für sie trifft ja zu, dass sie dem gesellschaftlichen Programm der Freiheit der Wahl [als Selbstbestimmung] aufgrund von individuell zugeschriebener Unfähigkeit [Responsibilisierung] nicht folgen können." (Junge 2006, 33)
Damit hängt nun auch eine veränderte Form der sozialen Integration zusammen: "Für diejenigen, für die die Teilhabe an den Konsumchancen möglich ist, ist die Verführung durch die Konsumchancen das Mittel zur individuellen Integration in den gesellschaftlichen Zusammenhang. Für diejenigen, die diese Wahlchancen nicht mehr haben, steht nur noch das Mittel der aus der Arbeitsgesellschaft stammenden panoptischen Kontrolle oder Repression zur Verfügung." (Junge 2006, 34)
Das Konsumethos überschreitet die Formen der normativen Integration. In einer pluralistischen Welt kann das einzelne Individuum aus einer Vielzahl von Lebensstilen wählen und selbst entscheiden, welcher Nachahmung es sich aus freien Stücken unterwirft. "Indem man wählt, welchen Star oder welches Vorbild man nachahmen möchte, wählt man zugleich die Form der Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung, die erst die Nachahmung erfolgversprechend erscheinen lässt. Unter diesen Bedingungen arm zu sein bedeutet vor allem, sich als unfähig zu erfahren. Unfähig, die richtige Wahl zu treffen [...] Daraus resultiert das Gefühl sozialer Degradierung, mit der Konsequenz, dass das innere Exil aufgesucht wird, der Rückzug von gesellschaftlichen Aktivitäten und Konsumchancen angetreten wird. Wenn diese Tendenz nun gepaart ist mit einem Wiedererstarken des Arbeitsethos bei denjenigen, die noch über Arbeit verfügen, so ist die gesellschaftliche Zweiteilung vollständig." (Junge 2006, 35)
Wie steht nun die Gesellschaft den Ausgeschlossenen gegenüber? "[S]ie steht dieser letzten Gruppe indifferent gegenüber und betrachtet sie als depraviert. Es werden weniger Mittel eingesetzt, um diesen Gruppen zu helfen, weil die Unfähigkeit als eine individuelle Zugerechnete rekonstruiert wird und folglich die Armen sich selbst überlassen werden. [...] Die daraus resultierende Gesellschaftsformation ist [...] die einer atomisierten, auf individuellen oder auch idiosynkratrischen Entscheidungen beruhende Gesellschaft. [...] Eine atomisierte, individualisierte Vergesellschaftung ist in den Augen Baumans die Konsequenz des Übergangs von der Arbeitsgesellschaft der Moderne zu einer Konsumgesellschaft der Postmoderne." (Junge 2006, 36)
Für das postmoderne und ungebundene Individuum geht innerhalb einer neoliberalen und globalisierten Welt der Verlust jeglicher Solidarität einher. Kommunitaristische Theorien versuchen an dieser Schwelle anzusetzen, um das entwurzelte Individuum wieder in die ethische Obhut einer solidarischen Gemeinschaft einzubinden.
Auf das Empowerment-Konzept als neues Paradigma in der sozialen Arbeit wurde an anderer Stelle eingehend Bezug genommen. Erwähnt wurde auch, dass es sich in Abgrenzung zu einem einseitig akzentuierten Selbstbestimmungsbegriff heraus entwickelte. "Das Verhältnis von Individualität und Sozialität wird jeweils vom anderen Pol aus betrachtet. Das Empowerment-Konzept schließt damit unverkennbar an eine Denktradition an, die in der Sozialphilosophie mit dem Titel Kommunitarismus diskutiert wird." (Katzenbach 2004, 15)
Die Grundüberzeugung kommunitaristischer Vertreter ist, dass eine "Gesellschaft, die sich konsequent auf atomisierte, voneinander isolierte und ihrem Eigeninteresse folgende Individuen stützen will, [...] dadurch ihre eigenen Grundlagen [untergräbt]. Das liberale Menschenbild hatte anfangs eine befreiende Wirkung gegenüber althergebrachten Ordnungen, die liberale Gesellschaft selbst war aber für ihr Funktionieren immer auch auf Bürgerengagement angewiesen." (Reese-Schäfer 1995, 7) Gemeinschaft ist konstitutiv für moralisches Handeln. Kommunitarier wie McIntrye, Walzer, Etzioni usw., stellen die Interessen der Gemeinschaft über die Einzelbedürfnisse und individuellen Wünsche. Sie vertreten den Standpunkt, dass die Gesellschaft und das soziale Zusammenleben nur durch die Bindung zwischen Individuen funktionieren. Diese Bindungen bestimmen, wer wir sind und was wir werden, sie eröffnen den Raum für die Konstituierung von Gemeinschaft, sozialem Zusammenleben und moralischen Engagements.
Diesen Bindungen sind wir als Individuen verpflichtet, denn "das Zusammenleben mit anderen Menschen ist eben ein moralisches Engagement. Es bindet uns auf unerwartete Art und Weise." (Walzer 1999, 25) McIntyre insistiert darauf, dass die Voraussetzungen für Gerechtigkeit und moralisches Verhalten nur durch die und innerhalb der Gemeinschaft gegeben sind. Ohne Gemeinschaft und ohne soziale Identität kann man nicht zu einem moralischen Menschen werden, da moralisches Handeln ständig auf Regeln zurückgreifen muss, "wie sie in einer bestimmten Gemeinschaft verkörpert sind." (McIntyre 1993, 93)
"Im allgemeinen werden Individuen nur in einer Gemeinschaft zur Moral fähig, werden durch sie in ihrer Moral gestützt und werden in der Weise zu moralischen Handelnden, in der andere Leute sie und das anerkennen, was man ihnen schuldet und auch was sie schulden, wie auch in der Weise, in der sie sich selbst erkennen." (McIntyre 1993, 92) Ein autonomes ungebundenes Selbst, ohne soziale Bindungen, ist demnach als ein moralisches Subjekt unvorstellbar. Der Verlust von Gemeinschaft führt dazu, dass die Menschen keine Maßstäbe vorfinden, nach denen sie zu moralischen Urteilen gelangen. Die kommunitaristische Auffassung von Moral verläuft konträr zum liberalistischen Menschenbild. Der Liberalismus entwirft ein abstraktes Individuum, das aufgrund rationaler Abwägungen moralisch handelt. So "verlangt die liberale Moral von mir, einen abstrakten und künstlichen - vielleicht sogar unmöglichen - Standpunkt einzunehmen, nämlich den Standpunkt eines rationalen Wesens als solchem, das auf die Anforderungen der Moral nicht als Vater (oder Mutter) oder Bauer oder Mittelstürmer antwortet, sondern als rational Handelnder der (oder die), losgelöst von aller sozialen Partikularität" existiert und "der in seiner Unparteilichkeit zur Wurzellosigkeit [...] verdammt ist." (McIntyre 1993, 94)
Die Idealvorstellung des Liberalismus und Neoliberalismus ist ein Mensch, der in einer Situation lebt, die vergleichbar mit der Robinson Crusoes ist, der also in absoluter Freiheit leben und handeln kann. Und diese Freiheit des Individuums ist "das höchste Ziel aller sozialen Einrichtungen." (Friedman 1971, 32) Die Gewährleistung dieser Freiheit kann nur dann erzielt werden, wenn äußere Mächte und Zwänge eliminiert, verteilt und zerstreut werden. Der Rolle des Staates und seiner Institutionen wird dadurch eine geringe Bedeutung zugesprochen. Der Staat hat nur ein Mindestmaß an Chancengleichheit, Schutz des Individuums und Verhinderung von Diskriminierung sicherzustellen. Vor allem jedoch sollte er die notwendigen Rahmenbedingungen eines freien Marktes gewährleisten, der alle politischen und sozialen Bereich von selbst reguliert, denn "wirtschaftliche Freiheit als solche macht einen bedeutenden Teil der ganzen Freiheit aus." (Friedman 1971, 29) Ziel ist eine weitgehende Selbststeuerung der Märkte, die nach der Theorie automatisch zu optimalen Verhältnissen führen müsse. Die Verantwortlichkeit und Verwirklichung ethischer Grundsätze ist demnach ausschließlich beim Individuum anzusiedeln und wird nicht durch eine moralische Gemeinschaft begründet. Die Gemeinschaft und die sozialen Bindungen der Menschen untereinander stellen keine Bedingung für ethische Grundsätze dar. Gerechtigkeit, Gleichheit, Selbstbestimmung und Autonomie werden durch soziale Beziehungen eher verhindert als verwirklicht.
Der Kommunitarismus will durch die Stärkung der Bürgergesellschaft diesen neoliberalen Spielarten Einhalt gebieten. Selbstbezogener Individualismus bedroht danach alle Formen der Solidarität, zerstört den Gemeinsinn und das Verantwortungsbewusstsein. Nur aus der Gemeinschaft heraus lassen sich moralische Urteile ableiten, denn sie sind gesellschaftliche Konstruktionen und keine individuellen Angelegenheiten liberaler Individuen.
Soziale Gerechtigkeit liegt im reziproken Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Im kommunitaristischen Manifest wird dieses symmetrische Gerechtigkeitskonzept in den Mittelpunkt gestellt: "Jedes Mitglied der Gemeinschaft schuldet allen übrigen etwas, und die Gemeinschaft schuldet jedem ihrer Mitglieder etwas." (1994, 37)
Soziale Gerechtigkeit verlangt nach verantwortungsvollen Individuen in einer verantwortungsbewussten Gemeinschaft. "Die Kommunitarier setzen daher der Kategorie Gesellschaft, die nach dem Modell der fairen Vertragspartnerschaft konzipiert ist, die Kategorie Gemeinschaft entgegen, die sich eben durch einen gemeinsamen Wertehorizont und die daraus abgeleiteten intersubjektiven Verpflichtungen auszeichnet. Mit anderen Worten: das soziale ‚Bindemittel' in der Gemeinschaft besteht nach Ansicht der kommunitaristischen Denker nicht in der Vertragstreue, sondern in der persönlichen Identifikation der Mitglieder mit der Gemeinschaft, der sie angehören." (Katzenbach 2004, 17)
Wenn der Kommunitarismus und der Empowerment-Ansatz über die Idee der Selbstbestimmung und des Liberalismus hinausgehen, dann liegt der Grund darin, dass sie sich an den Kategorien der Gemeinschaft orientieren. Damit handeln sie sich jedoch auch Folgeprobleme ein, die darin bestehen, "dass sich hinter dem diffus verwendeten Begriff der Gemeinschaft eine nicht ungefährliche romantische Sehnsucht nach Harmonie und Gemeinsamkeit verbirgt [...]." (Katzenbach 2004, 17)
Die Hauptkritik an den "selbsternannten Sprechern postulierter Gemeinschaft" (Bauman 1995, 75), die die moralischen Werte in die "heimliche Obhut einer nativen Gemeinschaft legen" (Ebd. S. 56) ist, dass sie eher dem Gruppenerhalt und den kollektiven Interessen dienen und somit das moralische Subjekt eher unterminieren. Ethisches Handeln kann nicht allein durch gesellschaftliche Werte und Ideale begründet werden, denn diese entbinden den Einzelnen eher aus der Verantwortung und heben ihn im kollektiven "Wir" auf. Außerdem muss beachtet werden, dass eine auf gemeinschaftliche Werte rückgebundene Ethik eine Zweckerwägung oder Kosten-Nutzen-Abwägung erfolgt. Handlungen lassen sich demnach als nützlich und nutzlos einstufen, Präferenzen werden gesetzt und Abstufungen getroffen. "Das Denken vom Zweck einer moralischen Handlung geht davon aus, dass es sich auszahlt, moralisch zu sein." (Moebius 2001, 56) Moral wird dadurch zum kalkulierenden Maßstab, nach einem reziproken Verhältnis gedacht und auf die Ebene einer "gesellschaftlichen Transaktion" (Bauman 1995, 91) degradiert. Sie postuliert moralisches Verhalten zum Wohle der Gemeinschaft, das vorteilhaft zum Einzelnen zurückkehrt. Die Verantwortlichkeit und die ethische Beziehung wird in einem "Wir" aufgehoben, das dem Einzelnen, durch Sozialisierung, Erziehung und Aufklärung, ein moralisches Gewissen einprägt und die Kriterien für moralisches Verhalten vorgibt.
Die Gesellschaft und die gemeinsamen Ideale und Werte sind jedoch noch lange kein Garant moralischer Integrität, sondern sie bieten vielfach auch Voraussetzungen für unmoralisches Handeln, indem die Bedürftigkeit des Einzelnen nicht in ihrer Singularität und Einmaligkeit wahrgenommen werden, sondern ständig vor dem Hintergrund gemeinschaftlich geteilter moralischer Erwägungen erfolgt. Diese Erwägungen rufen eher den Einzelnen in die Pflicht, als dass die Bedürftigkeit des Einzelnen die moralische Verantwortung der Vielen herausfordern würde.
Diese Umkehrung der moralischen Beziehung kann unter bestimmten Bedingungen moralisches Verhalten ganz und gar außer Kraft setzen und manipulieren. Aus gesellschaftlichen Werten deduzierte Moralvorstellungen haben z.B. im Dritten Reich zu beispiellosen Verbrechen geführt; man denke an die Verfolgung und an die Tötung der Abermillionen Juden, Sinti, Roma, Menschen mit physischen und psychischen Behinderungen und Andersdenkenden. "Oder polemisch gefragt: Waren etwa diejenigen, die dem sozialen Konsens zuwiderliefen und Juden, Jüdinnen, Kommunist/innen u.A. unter ihren Sofas, in Hausnischen oder in Kellern versteckten und deren Leben retteten, unmoralisch? War da mehr am Werk als ein sozial produziertes moralisches Verhalten? Um dieses moralische Phänomen zu beschreiben, reicht eine Erklärung von Moral, die sich darauf stützt, dass moralisches Verhalten aus der gemeinschaftlichen Übereinstimmung, dem kollektiven Bewusstsein und der Gesellschaft erwächst, nicht aus." (Moebius 2001, 108)
Die Quelle von Moral, die die gesellschaftliche Autorität durchbricht und auflöst, damit Menschen in einer Beziehung fundamentaler Verantwortung zueinander treten, wird sowohl in kommunitaristischen, aber auch in liberalen Ansätzen verkannt. Auch Honneth gelingt es in seiner Stufentheorie der Anerkennung nicht, diesen Impuls moralischen Handelns ausfindig zu machen. Die genannten theoretischen Positionen verfehlen die grundlegende intersubjektive Anerkennung des Anderen, aus der heraus Verantwortung für den Anderen im eigentlichen Sinne erst ermöglich wird. Im letzten Kapitel dieser Arbeit wird nun, in Anlehnung an Bauman und Lévinas, der Versuch unternommen, eine Theorie der Anerkennung und Verantwortung zu entwerfen, die sich jenseits reziproker und symmetrischer Gerechtigkeitsmodelle bewegt. Eine Anerkennung, die auf herrschaftliche Zugriffe, auf Aneignung, Anpassungsdruck, Unterwerfung und Ausschluss verzichtet und die "den anderen radikal freigibt, das heißt, seine Einzigartigkeit oder sein von mir unendlich unterschiedenes Wesen anerkennt und aus der Wechselseitigkeit der Erwartungen entlässt." (Gamm 2000, 214)
Zum Schluss dieser Arbeit sollen die soziologische Theorie Baumans und die Ethik von Lévinas ins Spiel gebracht werden. Bauman vertritt eine semiotische Kulturtheorie. Für ihn gilt die Ambivalenz als ein Grundmerkmal von Vergesellschaftungsprozessen. Ambivalenz bedeutet "die Möglichkeit, einen Gegenstand oder ein Ereignis mehr als nur einer Kategorie zuzuordnen" (Bauman 1995, 13) Im Rahmen einer semiotischen Kulturtheorie geht der Ambivalenz die Ambiguität voraus. Ambiguität bedeutet "das sprachtheoretische Problem der Herstellung begrifflicher Zu- und Einordnungen [...], während Ambivalenz sich auf den Bewertungsprozess im Erleben und Handeln bezieht. [...] Ambiguität bezieht sich auf ein Klassifikationsproblem, hingegen wird Ambivalenz durch konkurrierende, das Handeln orientierende Werte und ihre Bewertung hervorgerufen." (Junge 2006, 67) Ambiguität auf der sprachlichen Klassifikationsebene schlägt in ambivalente Handlungsorientierungen und Wertebezüge um. "Um das Chaos zu bewältigen, greift der Mensch auf von ihm selbst erzeugte kulturelle Ordnungsschemata zurück, um Kontrolle über das Chaos herzustellen." (Junge 2006, 67)
Die semiotische Kulturtheorie Baumans geht davon aus, dass durch manifeste Begrifflichkeiten und Wissensordnungen über sprachliche Codes kulturelle Ordnung, geschaffen wird. "Kultur ist ein Hilfsmittel, um die Vielzahl möglicher sinnhafter Deutungen der Welt auf eine begrenzte Zahl zu reduzieren. Ordnung meint bei Bauman Wissensordnungen. Diese sind aber, und dort liegt das Einfallstor für Ambiguität und in dessen Folge für Ambivalenz, niemals erfolgreich. Es gibt kein Klassifikationssystem, das alle Phänomene einzuordnen vermag. Vielmehr enthält jedes Klassifikationssystem Reste des nicht Klassifizierbaren. Diese Reste können sich verselbständigen und bieten dann Möglichkeiten zum Entwurf alternativer Ordnungen." (Junge 2006, 68)
Kurz gesagt: Keine gesellschaftliche Ordnung, kein Klassifikationssystem ist perfekt, in jedem besteht die Möglichkeit Ambiguität zu erzeugen, aus der ambivalente Handlungs- und Erlebnisorientierungen resultieren. Die Postmoderne stellt nun die Erfahrung einer unmöglichen Moderne dar, die unermüdlich darauf abzielt, Ambivalenz zu vermeiden. "Wenn Moderne der Versuch zur Etablierung einer eindeutigen Klassifikationsordnung ist, so ist die Postmoderne die Einsicht in das notwendige Scheitern dieses Versuchs." (Junge 2006, 70)
Diese Erkenntnis führt dazu, dass ethisches Handeln von keinem ideologischen Maßstab mehr vermessen werden kann. "Ethisches Verhalten in der Postmoderne stellt sich den Ambivalenzen und ist gekennzeichnet durch die Übernahme von Verantwortung für den Anderen." (Junge 2006, 76) Ethisches Verhalten lässt sich von keinem Ordnungssystem, sei es der Liberalismus oder der Kommunitarismus, herleiten. "Moralisches Handeln ist dabei das Resultat einer ethischen Entscheidung vor jeder sozial regulierten sozialen Beziehung, das Ergebnis präsozialer Verantwortung für den Anderen [...]." (Junge 2006, 77)
Hierin liegt das Verbindungsstück zwischen Baumans soziologischer Theorie der Ambivalenz und der Ethik von Lévinas. Diese Ethik geht davon aus, dass moralisches Handeln aus keinem symmetrischen Verhältnis zwischen den Menschen ableitbar ist. Die moralische Situation wird als asymmetrisch aufgefasst. Die Verantwortung liegt bei demjenigen, der durch den anderen mit seiner moralischen Verantwortung konfrontiert wird. Hier liegt die Zurückweisung jeglicher formalen und inhaltlich begründeten Ethik.
Im Mittelpunkt des Denkens von Emmanuel Lévinas steht der Andere, die Beziehung zum Anderen als ethisch transzendente Erfahrung der Nähe. Einer Nähe, die nicht durch Wissen, Verstehen, und Erkennen zugänglich ist, sondern in ihrer Offenheit sich jeglicher Objektivierung entzieht. Lévinas widmet seine Aufmerksamkeit dem Anderen, der jenseits von soziologischen, psychologischen, historischen, pädagogischen und ethnologischen Bestimmungen liegt. Seine Denken kreist vor allem um das Verhältnis von Erkenntnis und zwischenmenschlicher Beziehung. Kein Denken und keine Wissenschaft kann dabei den Anderen in seiner Totalität erschließen. "Für Lévinas ist Erkenntnis eine Ordnung, die unmöglich zum anderen führen kann, den man gerade nicht verselbigen, begreifen, identifizieren kann, zumindest nicht, wenn man ihm gerecht werden, ihn nicht einfach vereinnahmen möchte." (Staudigl 2000, 36)
Für Lévinas gründet das abendländische Denken in Totalitätsansprüchen. Die abendländische Philosophie zeichnet sich durch eine Tradition aus, "in der das Selbe das Andere dominiert." (Lévinas 1999) Und der Erkenntniswille liegt darin, "das Individuum, das als einziges existiert, nicht in seiner Singularität, die nicht zählt, zu nehmen, sondern in seiner Allgemeinheit, von der allein es Wissenschaft gibt." (Lévinas 1999, 190) Dabei basiert die Beziehung zum Anderen auf Kategorisierungen und intentionale Akte. Dadurch ist die zwischenmenschliche Begegnung zum Anderen in seiner Andersheit und Singularität bedroht. Der Andere wird zum Alter Ego, der unter der Verfügungsmacht objektivierender Strukturen steht und nicht in seiner absoluten Andersheit gedacht wird.
Lévinas versucht diese objektivierenden und kategorisierenden Beziehungsmuster, die das Verhältnis zum Anderen bestimmen als Logik des "Selben", die seit Parmenides die abendländische Philosophie gefangen hält, zu durchbrechen. Jegliches Verstehen, so Lévinas, ist notwendig dazu verurteilt, den Anderen zu verfehlen. Es bezieht sich auf ontologische Erkenntnisstrukturen, die einen Kontext von kausalen Beziehungen und Verweisungszusammenhängen erschließen, in denen der Andere wie in einem Netz gefangen ist. Dabei wird der Andere analog zum Alter Ego begriffen, der als Alter Ego aufgrund synchroner Erfahrungen und symmetrischer Beziehungen auf das Selbe reduziert bleibt.
Lévinas führt in seiner Ethik eine starke Andersartigkeitsbehauptung ein und erschüttert damit die jahrtausendalten Fundamente. "Was Lévinas in die Philosophie einführt, ist offenbar die Preisgabe jeder Möglichkeit, den anderen Menschen in den Begriff ‚Ich' einzuholen, d.h., ihn in irgendeiner Weise analog [...] zu mir zu begreifen. Im Hinblick auf den anderen Menschen versagt analogische Übertragung." (Taureck 1997, 49)
Der Andere bleibt der mir radikal Fremde. Er steht außerhalb meines Erkenntnisvermögens, es gibt keine Korrelation zwischen meinem Denken und dem Anderen. Ich kann den anderen nicht denken! Lévinas spricht diesbezüglich auch von einer anarchischen Situation und von einer radikal heteronomen Erfahrung, "die sich nicht in kategoriale Bestimmungen konvertieren kann und deren Bewegung zum anderen hin sich nicht in der Identifikation wiedergewinnt, eine Bewegung, die nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt." (Lévinas 1999, 195)
Die Beziehung zum Anderen wird in einer Situation erfahren, die noch vor der Zeit des Gesagten, der Präsenz, des Verstehens und des Logos liegt. Diese Beziehung ist anarchisch und ihre Erfahrung verläuft diachron. D.h. sie, die Situation, ist ohne Herrschaft und Anfang. Der Andere übersteigt darin jede soziale Rolle und Festschreibung und jegliche Idee, die ich mir von ihm machen kann. Der Andere ist reine Transzendenz, er sprengt den Rahmen kategorischer Grenzen. Der Andere ist der Überschuss, der über mein Denken hinaus geht, er ist die Idee des Unendlichen. "Die Idee des Unendlichen ist also die einzige, die uns etwas lehrt, was wir nicht schon wissen." (Lévinas 1999, 197) In dieser Unendlichkeit, ohne Anfang und Ursprung, begegnet mir der Andere. Dort beginnt die soziale Beziehung zum Anderen, die Beziehung zu seiner Einzigartigkeit, Alterität und absoluten Exteriorität, die ohne Vermittlung erfolgt, anarchisch ist und vor jeder Ordnung, jenseits des Seins liegt.
Der Andere entzieht sich meiner Erkenntnis und in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht ereignet sich die ethische Beziehung zwischen dem Einen und dem Anderen. Das Ich wird vom Anderen in seine Verantwortung gerufen und als ethisches Subjekt konstituiert. "Der ‚mir' begegnende Andere macht ‚mich' erst zu einem verantwortlichen Subjekt. Verantwortung für den Anderen ist die wesentliche, primäre und grundlegende Struktur zur Ermöglichung von Subjektivität. Ethik folgt nicht aus Subjektivität, sondern vielmehr ist Subjektivität grundlegend ethisch. Subjektivität meint hier eine Beziehung zu sich, die erst über die Beziehung bzw. über das Ereignis des Anrufs des anderen entsteht [...] Die Beziehung zum Anderen ist es, welche die Beziehung zu ‚sich selbst' erst begründet, in der das ‚Ich' sich in seiner Einzigkeit findet." (Moebius 2003, 54)
Durch den Anderen wird das Subjekt in seine Verantwortung gerufen, die es nicht übertragen oder an einen anderen abgeben kann. Es hat nicht die freie Wahl oder die autonome Entscheidungskraft sich dieser Verantwortung zu entziehen. Das Subjekt wird in der Beziehung von Angesicht zu Angesicht vom Anderen erwählt. Subjektivität beruht demnach nicht auf einem Vermögen oder Können, sondern auf dem passiven Erdulden des Anderen. Lévinas beschreibt diese Erwählung als ein besessen oder befallen werden vom Anderen. Das Subjekt befindet sich in einer Passivität und in einer Beziehung zum Anderen, die es nicht selbst auswählen kann. "Die Verantwortung für den Anderen - in ihrer Vorzeitigkeit gegenüber meiner Freiheit, in ihrer Vorzeitigkeit in bezug auf die Gegenwart und die Vorstellung - ist eine Passivität, die passiver ist als jede Passivität - Ausgesetztsein dem Anderen, ohne dieses Ausgesetztsein selbst noch einmal übernehmen zu können, rückhaltloses Ausgesetztsein, Ausgesetztheit des Ausgesetztseins [...]." (Lévinas 1998, 50)
Die Begegnung von Angesicht -zu Angesicht wird von Lévinas als ein durch und durch asymmetrisches Verhältnis beschrieben, ohne intentionale Erwartungshaltungen und Tauschbeziehungen. Das Ich hat nach Lévinas immer ein Mehr an Verantwortung und soll sich vom Anderen keine Gegenleistung erwarten. Der Andere darf nicht auf meine Erwartungshaltung hin reduziert werden, man würde ihn verfehlen und in die Logik des Selben zurückfallen. "Eine solche Wechselseitigkeit ist das Kennzeichen der ökonomischen Beziehung, deren Kreislauf durch die Regeln des gegenseitigen Nutzens beherrscht wird; sie erfasst nicht die Einzigartigkeit des ethischen Verhältnisses, bei dem das Ich gegenüber dem Anderen zurücktritt." (Mosès 1993, 357)
Damit lässt sich die Beziehung des Einen zum Anderen nicht mehr als ein Kampf um Anerkennung beschreiben, bei dem es darum geht, sich ständig auf selber Augenhöhe mit allen anderen zu bewegen. Im Kampf um Anerkennung kämpft der Eine gegen den Anderen für den Gewinn von Macht und Prestige. Das Ich kämpft dabei immer um seine eigenen Interessen, um sie zu bewahren oder auszubauen. Bei Lévinas handelt es sich um eine selbstlose Beziehung zum Anderen, ausgezeichnet durch Desinteresse. "Die Absetzung der Souveränität des ‚Ich' ist die soziale Beziehung zum anderen Menschen, die selbst-lose (des-inter-essé) Beziehung, ein Sich-Lösen vom je eigenen Sein." (Moebius 2003)
Die desinteressierte, asymmetrische Beziehung zum Anderen führt zu einem Ich, das Verantwortung trägt, hervorgerufen durch das Antlitz des Anderen: "Intersubjektive Beziehung [ist] eine nicht-symmetrische Beziehung [...] In diesem Sinne bin ich verantwortlich für den Anderen, ohne Gegenseitigkeit zu erwarten, und wenn es mich das Leben kosten würde. Die Gegenseitigkeit ist seine Sache [...] [Ich bin verantwortlich] gemäß einer totalen Verantwortlichkeit [...] Das Ich hat immer ein Mehr an Verantwortlichkeit als alle anderen." (Lévinas und Nemo 1986, 75)
In der asymmetrischen Begegnung zwischen dem Einen und Anderen ereignet sich eine Irritation durch das Hinzutreten des Dritten. "Gesellschaft beginnt sensu stricto mit dem Dritten. Die ursprüngliche, naive Zusammengehörigkeit des Ich und Du hat aufgehört, unberührt oder unbefangen zu sein." (Bauman 1995, 169) Diese von Lévinas geteilte Annahme kehrt das moralische Verhältnis um, ermöglicht Gesellschaft und eröffnet die Sphäre der Gerechtigkeit. Der Übergang vom Anderen zum Dritten, von der Verantwortung zur Gerechtigkeit konstituiert ein paradoxes, spannungsreiches Verhältnis. "Wenn die Nähe mir allein den Anderen und niemanden sonst zur Aufgabe machte, hätte es kein Problem gegeben - nicht einmal im allgemeinsten Sinne des Wortes. Die Frage wäre nicht entstanden, auch das Bewusstsein nicht und ebenso wenig das Selbstbewusstsein. Die Verantwortung für den Anderen ist eine Unmittelbarkeit, die der Frage vorausgeht: eben Nähe. Sie wird gestört und wird zum Problem mit dem Eintritt des Dritten. Der Dritte ist anders als der Nächste, aber auch ein anderer Nächster und doch auch ein Nächster des Anderen und nicht bloß ihm ähnlich. Was also sind sie, der Andere und der Dritte, was sind sie, der Eine-für-den-Anderen? Was haben sie einander getan, welcher hat Vortritt vor dem Anderen? Der Andere steht in einer Beziehung mit dem Dritten, für den ich nicht gänzlich verantwortlich sein kann, selbst wenn ich - vor jeder Frage - für meinen Nächsten allein verantwortlich bin." (Lévinas 1998, 343)
Das Verhältnis zum Dritten ist für Lévinas genauso persönlich wie zum Anderen hin, nur versammelt der Dritte die gesamten Menschen, zu denen ich in einer räumlichen Distanz stehe. Insofern stört der Dritte die Nähe zum Anderen. Die Verpflichtung im Hinblick auf den Dritten verlangt nach einem Maß, nach Prinzipien und Regeln. Das Ich wird zum Vergleich der unvergleichlich Einzigen gezwungen. Der Dritte ist aber genauso wie der Andere. Die Pluralität der Menschen ist immer schon in die Beziehung zum Anderen miteinbezogen. "Dazu kommt, dass die Gerechtigkeit in der Welt nicht nur aus der ethischen Unendlichkeit meiner Verantwortung für die anderen durchgesetzt werden kann. Denn ich bin für den Anderen und den Dritten verantwortlich, nicht aber für die Beziehung meines Nächsten zum Dritten und des Dritten zu meinem Nächsten, die ich immer nur von außen, als Dritter, erfahren kann. Deswegen muss mein Verlangen nach Gerechtigkeit auch ein Verlangen nach Institutionen sein, nach geschriebenen Gesetzen und nach einem Staat, die die Gerechtigkeit gewähren sollen." (Delhom und Hirsch 2005, 13)
Die Gesellschaft und das Zusammenleben der Menschen benötigt die Gerechtigkeit und das Recht. Recht und Gerechtigkeit bleiben jedoch für Lévinas durch den Anderen begrenzt. Das Recht und die notwendigen staatlichen Institutionen dürfen nicht aus der Verantwortung gegenüber dem Anderen entlassen werden. Die Verantwortung gegenüber dem Anderen bestimmt die Sphäre des Rechts und der Gerechtigkeit. Die Bedürftigkeit des Einzelnen ist der einzige Grund und die einzige Legitimität des Rechts. Das Recht bleibt durchdrungen von dieser ethischen Beziehung der Verantwortung. Das Recht lässt sich nur dadurch rechtfertigen, insofern es den Anderen verteidigt: "Das Allgemeine muss in der konkreten Verantwortung der Einzelnen bleiben." (Stegmaier 2002, 206)
Die Universalität der Gerechtigkeit bleibt an die singuläre Verantwortung gebunden. Die Autorität des Rechts erhebt sich nicht aus sich selbst heraus über die einzelnen Individuen hinweg, es muss jederzeit abänderbar sein und seine Autorität einbüßen können. Für Lévinas existieren keine universalen und überzeitlichen Kriterien. Die Gerechtigkeit steht in einer irreduziblen Beziehung zum unendlich Anderen und bleibt von ihm wachgerufen. Es deutet sich bei Lévinas "eine Entkörperung der Gerechtigkeit an, die stets - im Sinne einer >>messianischen Zeit<< [...] - eine zu-kommende bleibt. Mit >>zukommend<< ist gemeint, dass man zu keinem Zeitpunkt genau sagen kann, jetzt existiert Gerechtigkeit oder - in Zukunft - wird es eine genau definierte Gerechtigkeit geben. Die Öffnung des Zu-kommenden bedeutet ein Engagement hinsichtlich der ethischen Gerechtigkeit, das eine Irreduzibilität des Versprechens anerkennt, ein messianisches Moment, das nicht inhaltlich bestimmt werden darf/kann, ohne in Gewalt oder Instrumentalisierung zu führen." (Moebius 2003, 67)
Die Gerechtigkeit als Gerechtigkeit muss in Bewegung bleiben, es existiert keine kontinuierliche Stabilität des Rechts und der Politik. Der Andere hat Vorrang vor der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit bleibt eine immer zu-kommende, sie erschöpft sich niemals im Recht. Sie bleibt im Kommen und ist nie gegenwärtig, weil sie "von der Idee einer unendlichen Gerechtigkeit ausgeht: unendlich ist diese Gerechtigkeit, weil sie sich nicht reduziert, auf etwas zurückführen lässt, irreduktibel ist, weil sie dem anderen gebührt, dem Anderen sich verdankt; dem anderen verdankt sie sich, gebührt sie vor jedem Vertragsabschluss, da sie vom Anderen aus, vom Anderen her gekommen, da sie das Kommen des Anderen ist, dieses immer anderen Besonderen." (Derrida 1991, 51)
Die Bewegung der Gerechtigkeit verschiebt und unterbricht immer wieder die Bedeutung und die Elemente einer sozialen und symbolischen Ordnung. Gerechtigkeit ist Anerkennung der Ambivalenz, d.h. Anerkennung des Überschusseses der jede gesellschaftliche Ordnung übersteigt und ins Schwanken bringt. Anerkennung bleibt im Spannungsverhältnis zwischen der Gemeinschaft und der Alterität des Anderen stets in der Schwebe. Sie kennt keinen geschlossenen Erwartungshorizont, kein berechnendes Maß, sie ist die Dimension ausstehender Ereignisse. "Die Gerechtigkeit ist der Zukunft geweiht, es gibt Gerechtigkeit nur dann, wenn sich etwas ereignen kann, was als Ereignis die Berechnung, die Regeln, die Programme, die Vorwegnahmen usw. übersteigt. Als Erfahrung der absoluten Andersheit ist die Gerechtigkeit undarstellbar, darin liegt die Chance des Ereignisses und die Bedingung der Geschichte. Die Bedingung einer zweifellos unkenntlichen Geschichte, unkenntlich für jene, die zu wissen meinen, wovon sie genau sprechen - mag es um die Sozialgeschichte, um eine Geschichte der Ideologie, um ideologische, politische oder juridische Geschichten gehen." (Derrida, Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autoriät. 1991, 56)
Ethik ist bei Lévinas und Bauman kein allgemeines Gesetz und kein detailliert ausgearbeiteter Regelkatalog. Eine Ethik ohne verallgemeinerbare Handlungsmaximen muss in jedem einzelnen Fall, in dem gehandelt wird neue Regeln aufsuchen und erfinden. Für die Handlungsebene und für die Praxis der sozialen Arbeit bedeutet dies, stets in einer ambivalenten Situation zu agieren, um die Alterität des Anderen nicht durch vorherbestimmte Kategorien und Ordnungen auszulöschen. "Gerade die ambivalente Situation, die sich bei einer Nicht-Vorhandenheit von Regeln ergibt, die Ambivalenz oder Unentscheidbarkeit, nicht zu wissen, ob jetzt gut oder schlecht gehandelt wurde, fordert auf, jedes Mal neu und situationsgemäß zu entscheiden. [...] Damit verantwortlich gehandelt werden kann, gilt es immer, in dieser Unentscheidbarkeit zu entscheiden. Gäbe es diese Unentscheidbarkeit nicht, wäre die freie Entscheidung oder die Verantwortlichkeit gar nicht möglich, sondern lediglich eine Verwirklichung eines bestimmbaren Wissens oder ein Abspulen von Handlungsprogrammen als Konsequenz einer vorherbestimmten Ordnung." (Moebius 2003, 57)
Was ich in Anlehnung an Baumans soziologischer Theorie und durch die Ethik von Lévinas unterstreichen will, ist die Ereignishaftigkeit des Anderen. Diese radikale Alterität des Anderen übersteigt unser Denken und jede Form der Erkenntnis. Darin liegt die Unmöglichkeit ihn zu vereinnahmen, ihn auf Kategorien und auf eine vorherbestimmte Ordnung festzuschreiben.
Insgesamt habe ich sichtbar zu machen versucht, dass durch den modernen und normativen Arbeitsbegriff eine zentrale soziale und gesellschaftliche Kategorie geschaffen wurde, die im umfassenden Maße die Anerkennungswürdigkeit des Menschen bestimmt. Dieser Arbeitsbegriff ist durchdrungen von der inhärenten Leitdifferenz Arbeit / Nicht-Arbeit und darunter werden weitere Unterscheidungen subsumiert wie Arbeitsfähigkeit / Arbeitsunfähigkeit, oder aus postmoderner Sicht, Konsumfähigkeit / Konsumunfähigkeit. Aus diesen Unterscheidungen bezieht der moderne Arbeitsbegriff den Modus, gesellschaftliche Formen der Inklusion oder Exklusion zu legitimieren. Vor allem Menschen mit Behinderungen zählen zu den Verlierern der modernen Arbeitsgesellschaft. Für sie bewirkte die Leitdifferenz über einen langen Zeitraum hinweg die Unmöglichkeit gesellschaftlicher Teilhabe. Nicht zuletzt ist auch die Kategorie der Geisteskrankheit, so Foucault, eine moderne Erscheinung, die sich im Zuge einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft herausbildete und im Laufe des 19. Jahrhunderts die Entstehung von psychiatrischen Heilanstalten mit sich brachte.
Die schrecklichste Ausformung erreichte der moderne Arbeitsbegriff im 20. Jahrhundert, in den Konzentrations- und Vernichtungslagern des Dritten Reichs, wo er über Leben (Arbeitsfähigkeit) und Tod (Arbeitsunfähigkeit) von Millionen von Menschen entschied. Um so zynischer wirkt die Inschrift über den Eingangstoren der Konzentrationslager von Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg: Arbeit macht frei!
Nicht zuletzt führte dieses schreckliche Verbrechen an der Menschheit ab den 1960er Jahren zu einem sensibleren Umgang mit Menschen mit Behinderung, die bis dahin ausschließlich in psychiatrischer Verwahrung waren oder zu Hause weggesperrt wurden und damit von der Gesellschaft gänzlich ausgeschlossen blieben. Der in den Nachkriegsjahren aufgebaute neue soziale Wohlfahrtsstaat führte auch im Behindertenbereich zu einer Umorientierung. Die soziale Fürsorge löste ein einseitig geprägtes medizinisches und vielfach unmenschliches Verständnis ab, die Bedürftigkeit und Menschlichkeit behinderter Personen gelangte zur Anerkennung.
Im Zuge der Umsetzung des Normalisierungsprinzips wurde die Deinstitutionalisierung zugunsten der totalen Institutionalisierung von Menschen mit Behinderung gefordert und eingelöst. Im Laufe der 1970er Jahre wurden den Betroffenen auf der Basis von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzen allmählich grundlegende Personenrechte zuerkannt. Vor allem körperbehinderte und sinnesbeeinträchtigte Menschen konnten diese rechtliche Anerkennung für sich nutzen und im Sinne der Selbstbestimmung ausweiten. Für sie realisierten sich dadurch umfassende Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Für schwerer Beeinträchtigte, wie geistig behinderte und psychisch kranke Menschen, führte die rechtliche Gleichstellung und das Paradigma der Selbstbestimmung nicht zur erhofften Integration. Ihr Leben spielte sich weiterhin innerhalb der Grenzen geschützter Strukturen ab. Hier erweist sich der Arbeitsbegriff wiederum als Mittel zur Repression. Arbeitsrehabilitation lautete die Losung als Anpassung der Menschen und Angleichung des abweichenden Verhaltens an das normative Arbeitsethos. Akzeptanz und Repression bilden dabei die zwei Seiten ein und der selben Medaille.
Das Selbstbestimmungsprinzip wurde in den letzten 15 Jahren zunehmend auch von geistig behinderten Menschen, wie denen der People First Bewegung, eingefordert. Waldschmidt spricht in diesem Zusammenhang von einer nachholenden Befreiung, die im Hinblick neoliberaler Tendenzen in Politik und Wirtschaft kritisch zu bewerten ist. Kritisch deshalb, da im Zuge des Neoliberalismus und postmodernen Lifestyles das Selbstbestimmungsrecht sich insgesamt zur Selbstbestimmungspflicht hin verschoben hat und sich vor allem auf die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung ungünstig auswirkt.
Diese neoliberalen Tendenzen verlangen nach einem flexiblen und ungebundenen Selbst. Soziale Einbindungen und Verantwortungen werden zugunsten eines frei handelnden Individuums aufgegeben. Neoliberale Theoretiker verlangen den Rückzug staatlicher Fürsorge und die Eigenverantwortlichkeit (Responsibilisierung) vernünftiger Subjekte. "Neoliberalismus und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung scheinen aus dieser Sicht - unglückselig - miteinander verquickt." (Katzenbach 2004, 13)
Vor dem Hintergrund des Neoliberalismus und in Abgrenzung zu einem individualistischen und atomisierten Menschenbild eröffnete sich im Namen des Kommunitarismus eine neue Debatte zur Stärkung gemeinschaftsfördernder Einbindungen und Werteüberzeugungen. In die Sozialarbeit fand im Zuge dieser Diskussion das Empowerment-Prinzip Eingang, welches die Deinstitutionalisierungsphase zugunsten eines Lebens mit Unterstützung ablöste. Am Modell SPAGAT wurde diese dritte Phase im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung am Beispiel der Unterstützten Beschäftigung ausführlich dargestellt.
Kommunitaristische Denkansätze sind jedoch der Kritik ausgesetzt, dass die Stärkung der Gemeinschaft gleichwohl auch zu "eine[r] Rückkehr in die Fesseln moderner traditional geprägter Formen der sozialen Integration" (Junge 2006, 87) führen kann. Im Bereich der sozialen Arbeit wird die Stärkung und die Verpflichtung der Gemeinschaft oft dazu genutzt, Kosteneinsparungen zu erzielen. SPAGAT wird vom Land Vorarlberg vor allem auch deshalb finanziert, da damit gegenüber geschützten Werkstätten Kosteneinsparungen von bis zu 30% erzielt werden. Diese Rentabilitätsansprüche kommen natürlich der Gesellschaft im Ganzen zu Gute. Integration misst sich dann dabei lediglich am Wert, den sie für die gesamte Gemeinschaft besitzt. Gemeinschaftliche Werte und Ziele erheben sich dabei über die Bedürftigkeit des einzelnen Individuums. Hinsichtlich der Unterstützten Beschäftigung kann zudem kritisch angemerkt werden, dass wiederum die Arbeit den Rahmen vorgibt, der gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Auch beim Modell SPAGAT, das durch einen elastischeren Arbeitsbegriff über einen Toleranzkorridor verfügt, bleibt dieser nur so breit, "wie es die Vorstellungskräfte und die psychischen Handlungsmöglichkeiten derjenigen zulassen, die seine Ausmaße festlegen und argumentativ benutzen." (K. Exner 2007, 31)
Aus dieser Feststellung heraus kann gefolgert werden, dass das Selbstbestimmungsparadigma, aber auch das Empowerment-Paradigma Gefahr laufen, die Anerkennung des Anderen zu verfehlen. Reziproke Anerkennungsverhältnisse, wie Honneth sie in seiner Stufentheorie der Anerkennung entwirft - die in der vorliegenden Arbeit exemplarisch mit den jeweiligen Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung in Beziehung gesetzt wurden - bilden keinen Impuls für moralisches Handeln. Für Bauman verfehlen liberale und kommunitaristische Ansätze die moralische Beziehung zum Anderen, weil keine gemeinschaftlichen Werte und Bindungen (Kommunitarismus) und weil keine transzendentalen und universalen Normen oder die Situation der "Original Position" (Liberalismus) eine wirkliche Begegnung mit dem und den Anderen ermöglichen. Denn, "der Schlüssel zu einem so großen Problem wie der sozialen Gerechtigkeit [liegt für Bauman und Lévinas] in einem (scheinbar) so kleinem Problem wie dem moralischen Urakt" (Bauman 1999, 125), als Verantwortung für den Nächsten, in der Beziehung zum Anderen und in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht.
Im Rückblick des Gesagten lautet nun die entscheidende Frage, welche Gesellschaftsform nun in Zukunft Gestalt annehmen könnte. Vielleicht eine zu-kommende Demokratie? Eine zu-kommende Demokratie auf der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens? Eine zu-kommende Demokratie der sozialen Gerechtigkeit, die für das Ereignis des Anderen offen bleibt und uns aus den Fallstricken des Arbeits-/Konsumethos befreit? "Der Ausdruck ‚kommende Demokratie' steht zweifellos für eine kämpferische und schrankenlose politische Kritik [...] Das ‚Kommende' (l' à venir<<) bezeichnet nicht nur das Versprechen, sondern auch, dass die Demokratie niemals existieren wird im Sinne von gegenwärtiger Existenz: nicht nur weil sie aufgeschoben wird, sondern auch weil sie in ihrer Struktur stets aporetisch bleiben wird." (Derrida, Schurken 2003, 123) "Eine kommende und im Kommen bleibende Demokratie müsste eine Gleichheit zu denken aufgeben, die mit einer bestimmten Asymmetrie, mit der Heterogenität und der absoluten Singularität nicht bloß nicht unvereinbar ist, sondern sie vielmehr erfordert, uns an sie bindet, uns zu ihnen aufbrechen lässt - von einem Ort aus, der unsichtbar bleibt und mir doch von fern einen Weg weist [...]." (Derrida 2000, 443)
Im bedingungslosen Grundeinkommen liegt das Potential einer Gleichheit, die für die Heterogenität der Menschen und für die Alterität des Anderen sensibel bleibt. Ein Grundeinkommen, welches befreit ist vom engen Zusammenhang zwischen Arbeit und Einkommen, eröffnet auch denjenigen, die ihre Arbeitskraft nicht verkaufen können, weiterhin Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. "Ein staatlich garantiertes Grundeinkommen hat für Bauman zweierlei Funktion, die Abhängigkeit des Arbeitseinkommens vom Verkauf der Ware Arbeitskraft zu lösen und zur Wiederbelebung der agora beizutragen, weil dann das Recht auf politische Teilnahme ebenfalls vom Arbeitseinkommen entkoppelt wird." (Junge 2006, 86)
"Man muss ‚Anerkennen' als ein gleichsam flottierendes, frei bewegliches, extrem fragiles Medium betrachten, das schon beim Versuch, es in die eigene Reichweite oder Gewalt zu bringen, augenblicklich zerstört wird," schreibt Gerhard Gamm. (Gamm 2000, 214). Was er damit meint, lässt sich als Schluss der vorliegenden Arbeit gebrauchen: Die Anerkennung des Anderen kann sich nur durch stetige Spannungen und Bewegungen hindurch ereignen und in der Offenheit und Unabgeschlossenheit des Raums für das Zu-kommende und Kommen des Anderen.
All dies ist weitaus lebens- und praxisnaher als es erscheinen mag. Denn auch wenn es sich beim geschilderten Prozess des Anerkennens um eine zunächst theoretische Kategorie handelt, betrifft er den Kern der sozialen Arbeit in all seinen Facetten: die Wahrnehmung des Anderen, den Umgang mit ihm, das Sich-auf-ihn-einlassen; es geht um Fragen von Verantwortung und Vertrauen. Noch stehen wir ganz am Anfang einer Kultur des Anerkennens. Die Frage nach der "Machbarkeit" oder der "Umsetzbarkeit" bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen sollte zu diesem Zeitpunkt nicht gestellt werden. Zu leicht ließen sich solcherlei Fragen als Alibi missbrauchen, um sich den eigentlichen drängenden Herausforderungen zu entziehen. Denn eines ist klar: So wenig sich die Relevanz der genannten Fragen in Abrede stellen lässt, so wenig können sie anthropologische Abhängigkeiten negieren. Behält man aber im Hinterkopf, dass es immer und in erster Linie darum geht, gesellschaftliche Einschränkungen abzubauen und die wechselseitige, obig skizzierte Anerkennung zum Leitbild einer neuen Ethik der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zu machen, werden sich zukünftig auch die konkreten, praktischen Probleme der Umsetzung angehen lassen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn sie nicht schon vor Beginn der Bemühungen als Vorwand einer Verhinderung genutzt werden. Vielmehr gelingt es einem richtig verstandenen anerkennungstheoretischen Ansatz, nicht nur zum Nachdenken anzuregen, sondern auch zum entschlossenen Handeln.
Ahrens, Jörn, "Die Arbeit am Begriff. Konturen der Flexibilisierungsdiskussion," in: Ders., Jenseits des Arbeitsprinzips? Vom Ende der Erwerbsarbeit., Tübingen: Edition Diskord, 2000
Arendt, Hannah, Vita activa oder vom tätigen Leben, Zürich, München: Piper Verlag, 2001
Bank-Mikkelsen, Erik, "Die staatliche Fürsorge für geistig Behinderte in Dänemark," in: Kugel, Robert/ Wolfensberger, Wolf, Geistig Behinderte - Eingliederung oder Bewahrung, Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1974
Basaglia, Franco, Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1978
Basaglia, Franco/ Basaglia-Ongaro, Franca, Die abweichende Mehrheit. Die Ideologie der totalen sozialen Kontrolle, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1972
Baudrillard, Jean, Der symbolische Tausch und der Tod, Berlin: Matthes & Seitz Verlag, 2005
Bauman, Zygmunt, Postmoderne Ethik, Hamburg: Editionsverlag, 1995
-, Postmoderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1995
-, Unbehagen in der Postmoderne, Hamburg: Edition Verlag, 1999
Beck, Iris, "Normalisierung," in: Antor, Georg/ Bleidick, Ulrich (Hrsg.), Handlexikon der Behindertenpädagogik, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2006
Beck, Ulrich, Schöne neue Arbeitswelt, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2007
Bieker, Rudolf, "Individuelle Funktionen und Potentiale der Arbeitsintegration", in Rudolf, Bieker, Teilhabe am Arbeitsleben, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2005
Boban, Ines/ Hinz, Andreas, Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen - ein Ansatz auch für das Leben mit Unterstützung in der Arbeitswelt, in Bieker, Rudolf (Hrsg.), Bd. Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2005
Bourdieu, Pierre, Das Elende der Welt, Konstanz: UVK Universitätsverlag, 1997
-, Die verborgenen Mechanismen der Macht, Hamburg: VSA-Verlag, 1997
Bröckling, Ulrich, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjetivierungsform, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2007
Bröckling, Ulrich/ Krasmann, Susanne/ Lemke, Thomas, Glossar der Gegenwart, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004
Bublitz, Hannelore, Judith Butler. Hamburg: Junius Verlag, 2002
Buchenwald, Gedenkstätte, Konzentrationslager Buchenwald 1937 - 1945, Wallstein Verlag, 2007
-, Konzentrationslager Buchenwald 1937- 1945, Wallstein Verlag, 2007
Burkhardt, Maria Marga, Krank im Kopf. Patientengeschichten der Heil- und Pflegeanstalt Illenau 1842-1889, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorwürde, Philosophische Fakultät der Albert-Ludwig-Universität i.B., 2003
Butler, Judith, Hass spricht, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2006
-, Kritik der ethischen Anerkennung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003
-, Psyche der Macht, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2001
Castel, Robert, Die psychiatrische Ordnung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979
Cloerkes, Günther, Soziologie der Behinderten, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007
Daniels, Arne/ Schmitz, Stefan, Die Geschichte des Kapitalismus. Vom Webstuhl zum World Wide Web, München: Wilhelm Heyne Verlag, 2006
Dederich, Markus, "www.beratungszentrum-alsterdorf.de." 22.05.2003 www.beratungszentrum-alsterdorf.de/cont/GibteseinRechtaufanderssein(3).pdf (Zugriff am 27.07.2008)
Deisenhofer, Alfred, http://www.bpe-online.de/infopool/gesundheit/pb/deisenhofer.htm (Zugriff am 26.07.2008)
Deleuze, Gilles/ Guattari, Felix, Tausend Plateaus, Berlin: Merve Verlag, 1992
Delhom, Pascal/ Hirsch, Alfred, Im Angesicht der Anderen, Berlin: Diaphanes Verlag, 2005
Derrida, Jacques, Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autoriät, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991
-, Politik der Gastfreundschaft , Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2000
-, Schurken, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003
"Die Stimme der Gemeinschaft hörbar machen. Ein Manifest amerikanischer Komunitarier über Rechte und Verantwortung in der Gesellschaft," in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nr. 56), 1994
Domingo, Anna/ Baer, Niklas, "Stigmatisierende Konzepte in der beruflichen Rehabilitation," Psychiat Prax (Georg Thieme Verlag), Nr. 30 (2003): 355-357
Doose, Stefan, Unterstützte Beschäftigung im Übergang Schule-Beruf, "BIDOK Volltextbibliothek." 16.03 2005 http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-uebergang.html (Zugriff am 27.07. 2008)
Doose, Stefan, "Unterstützte Beschäftigung. Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich," http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-vergleich.html
-, Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht, Marburg: Lebenshilfe Verlag, 2006.
Dülmen, Richard van, "Arbeit in der frühneuzeitlchen Gesellschaft," in: Kocka, Jürgen/ Offe, Claus, Geschichte und Zukunft der Arbeit, Frankfurt / New York: Campus Verlag, 2000
Dungs, Susanne, Anerkennung des Andern im Zeitalter der Mediatisierung, Hamburg: LIT Verlag, 2006
Ehlers, Kai, "Regionales Wirtschaften durch Grundeinkommen?," in: Rätz, Werner/ Zenker, Birgit / Exner, Andreas (Hrsg.), Grundeinkommen. Soziale Sicherheit ohne Arbeit, Wien: Szolnay Verlag, 2007
Ehrenberg, Alain, Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004
Exner, Andreas/ Rätz,Werner/ Zenker Birgit, "Die Krankheit der Arbeitsgesellschaft und ihre Heilung," in: Rätz, Werner/ Zenker, Birgit / Exner, Andreas (Hrsg.), Grundeinkommen, Wien: Zsolnay Verlag, 2007
Exner, Karsten, Kritik am Integrationsparadigma im Behindertenbereich, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag, 2007
Fandry, Walter, Krüppel, Idioten, Irre. Zur Sozialgeschichte behinderter Menschen in Deutschland, Stuttgart: Silberburg Verlag, 1990
Feuser, Georg, Lebenslanges Lernen für Menschen mit geistiger Behinderung, "BIDOK Volltextbibliothek." 13.06.1998 http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-lebenslang_lernen.html (Zugriff am 27. 07.2008)
-, Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration - "Geistigbehinderte gibt es nicht!", "BIDOK Volltextbibliothek." 25.09.2006 http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-menschenbild.html (Zugriff am 27.07. 2008)
Flick, Uwe, Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaft, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1999
-, Qualitative Sozialforschung, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2002
Foucault, Michel, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974
-, Dits et Ecrits Bd. II, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2002
-, Dits et Ecrits Bd. III, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003
-, Überwachen und Strafen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991
Friedman, Milton, Kapitalismus und Freiheit, Stuttgart: Seewald Verlag, 1971
Gaedt, Christian, "www.downsyndrom-netzwerk.de." 1999 www.down-syndrom-netzwerk.de/bibliothek/pdf/gaedt.pdf (Zugriff am 27.07.2008)
Gamm, Gerhard, Nicht nichts, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2000
Gerhardt, Volker, Der Wille zur Macht, Berlin/New York: Walter de Gruyter Verlag, 1996
Goffmann, Erving, Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität,. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1967
Gorz, André, Arbeit zwischen Misere und Utopie, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2000
Gronemeyer, Reimer (Hrsg.), Der faule Neger. Vom weißen Kreuzzug gegen den schwarzen Müßiggang, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1991
Häßler, Günther, und Frank Häßler, Geistig Behinderte im Spiegel der Zeit. Vom Narrenhäusl zur Gemeindepsychiatrie, Stuttgart/New York: Goerg Thieme Verlag, 2005
Herriger, Norbert, "Empowerment und Engagement," in: Soziale Arbeit 44, 1996, 209-301
-, www.empowerment.de. 12. 02 2005 http://www.empowerment.de/grundlagentext.html (Zugriff am 27.07.2008)
Hinz, Andreas, "Geistige Behinderung und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche - Überlegungen zur Erfahrungen und Perspektiven,"in: Sonderpädagogik 16/ 1996, 144-153
Hömberg, Burtscher, und Ginnold, "Framing the Future. Zukunftskonferenzen und Wege zur beruflichen Integration," in: Bönisch, Jens/ Bünk, Christof (Hrsg.), Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation, Karlsruhe: Von Loepper Literaturverlag, 2001
Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003
-, "Für eine post-traditionale Solidarität: Konsensfindung und soziale Bindung unter Bedingungen des Wertepluralismus",
-, http://www.gcn.de/Kempfenhausen/Zyklus1/downloads/honneth.pdf (Zugriff am 27.07.2008)
Innerhofer, Paul/ Klicpera, Christian, Integration, Solidarität contra Selbstentfaltung, in: Thalhammer, M. (Hrsg.), Gefährdungen des behinderten Menschen im Zugriff von Wissenschaft und Praxis. München: Reinhardt Verlag, 1986, 49-64
Jantzen, Wolfgang, Sozialisation und Behinderung. Studien zu sozialwissenschaftlichen Grundfragen der Behindertenpädagogik, Gießen: Focus Verlag, 1974
Jütte, Robert, "Disziplinierungsmechanismen in der städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit," in: Sachße, Christoph/ Tennstedt, Florian (Hrsg.), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986
Junge, Matthias, Zygmunt Bauman: Soziologie zwischen Moderne und Flüchtiger Moderne, Wiesbaden: VS-Verlag, 2006
Kan, Peter van/ Doose, Stefan, Zukunftsweisend. Peer Counseling & Persönliche Zukunftsplanung, Kassel: Bifos Schriftenreihe, 1999
Katzenbach, Dieter, "Universität Frankfurt." 2004 http://web.uni-frankfurt.de/fb04/katzenbach/seminare/WS0304/Anerkennung.pdf (Zugriff am 27.072008)
Klebelsberg, Ernst, "Festschrift 100 Jahre Heilanstalt- und Pflegeanstalt Hall i. Tirol. 31. Oktober 1931." Ferdinandeum Innsbruck, 1931
Kleinbach, Karlheinz, Zur ethischen Begründung einer Praxis der Geistigbehindertenpädagogik, Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, 1994
Kluge, Friedrich/ Seebald, Elmar, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin/New York: Walter de Gruyter Verlag, 1999
Kocka, Jürgen, "These zur Geschichte und Zukunft der Arbeit," http://www.bpb.de/files/G7VSG2.pdf (Zugriff am 27.07.2008)
Koehnen, Volker, "Soziale Sicherung im freien Fall - Erwerbsgesellschaften ohne Erwerbsarbeit," in: Rätz, Werner/ Zenker, Birgit / Exner, Andreas, Grundeinkommen, Wien: Zsolnay Verlag, 2007
Krasmann, Susanne, Gouvernementalität der Oberfläche, Aggressivität abtrainieren beispielsweise, in: Bröckling, Ulrich/ Krasmann, Susanne/ Lemke, Thomas (Hrsg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000, 194-226
Lebenshilfe, Bundesvereinigung, 25 Jahre Lebenshilfe, Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 1983
Lévinas, Emmanuel, Die Spur des Anderen, Freiburg/München: Alber Verlag, 1999
-, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg/München: Alber Verlag, 1998
Lévinas, Emmanue/ Nemo, Philippe, Ethik und Unendliches. Gespräche, Graz/Wien: Passagen Verlag, 1986
Maiss, Maria, "Der Traum von einem qualitätsvolleren Leben," in: Grundeinkommen. Soziale Sicherheit ohne Arbeit., Rätz, Werner/ Zenker, Birgit / Exner, Andreas, Grundeinkommen, Wien: Zsolnay Verlag, 2007
Mattner, Dieter, Behinderte Menschen in der Gesellschaft, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2000
Mayer, Horst, Interview und schriftliche Befragung, München/Wien: Oldenbourg Verlag, 2006
Mayring, Philipp, Forum Qualitative Sozialforschung. 2001 http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm (Zugriff am 27.07.2008)
McIntyre, Alasdair, "Ist Patriotismus eine Tugend?," in: Honneth, Axel (Hrsg.), Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaft., Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993
Mead, George Herbert, Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968
Moebius, Stephan, Die soziale Konstituierung des Anderen. Grundrisse einer poststrukturalistischen Sozialwissenschaft nach Lévinas und Derrida, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2003
-, Postmoderne Ethik und Sozialität, Stuttgart: Ibidem Verlag, 2001
Mosès, Stèphan, "Gerechtigkeit und Gemeinschaft bei Emmanuel Lévinas," in: Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1993
Oexle, Gerhard Otto, "Arbeit, Armut, Stand im Mittelalter," in: Kocka, Jürgen/ Offe, Claus, Geschichte und Zukunft der Arbeit., Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2000
Oexle, Gerhard Otto, "Armut, Armutsbegriff und Armenführsorge im Mittelalter," in: Sachße, Christoph/ Tennstedt, Florian (Hrsg.), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung., Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986
Pantozini, Gusseppe, Die brennende Frage. Geschichte der Psychiatrie in den Gebieten von Bozen und Trient, Bozen: Autonome Provinz Bozen - Südtirol, 1989
Raffeiner, Dietmar, Arbeit - ausschließlich unser Leben? BIDOK Volltextbibliothek. 2007 http://bidok.uibk.ac.at/library/raffeiner-arbeit.html (Zugriff am 27.07.2008)
Rauch, Angelika, "Behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt," in: Bieker, Rudolf, Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2005
Reese-Schäfer, Walter, Was ist Kommunitarismus?, Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag, 1995
Röd, Wolfgang, Der Weg der Philosophie Band II, München: C.H. Beck Verlag, 1996
Rösner, Hans-Uwe, Jenseits normalisierender Anerkennung, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2002
Sachße, Christoph/ Tennstedt, Florian, Bettler, Gauner und Proleten. Hamburg: Rowohlt Verlag, 1983
-, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Bd.I: Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1998
Sandel, Michael, "Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst," in: Honneth, Axel Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993
Schädler, Johannes, Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe unter Bedingungen institutioneller Beharrlichkeit: Strukturelle Voraussetzungen der Implementierung Offener Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, Siegen, 2002
Schartmann, Dieter, Soziale Integration durch Mentoren, "BIDOK Volltextbibliothek." 1995 bidok.uibk.ac.at/library/schartmann-mentoren.html (Zugriff am 27.07.2008)
Schingel, Markus, Pierre Bourdieu zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag, 2000
Schönwiese, Volker, "Grundfragen der Arbeit in der Behindertenpädagogik," in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Nr. 4/5/2000, S. 64-68
Shorter, Edward, Geschichte der Psychiatrie, Berlin: Fest Verlag, 1999
Sierck, Udo, Arbeit ist die beste Medizin. Zur Geschichte der Rehabilitationspolitik, Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 1992
Speck, Otto, System Heilpädagogik: Eine ökologisch reflexive Grundlegung, München/Basel: Reinhardt Verlag, 1991
Stäheli, Urs, Poststrukturalistische Soziologie, Bielefeld: Transcript Verlag, 2000
Stark, Wolfgang, Empowerment: Neue Handlungskompetenzen in der psychosozialen Arbeit, Freiburg i.B.: Lambertus Verlag, 1996
Staudigl, Barbara, Ethik der Verantwortung: Die Philosophie Emmanuel Lévinas' als Herausforderung für die Verantwortungsdiskussion und Impuls für die pädagogische Verantwortung, Würzburg: Dissertation, 2000
Stegmaier, Werner, Levinas, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2002
Stekl, Hannes, "Labor et fame - Sozialdisziplinierung in Zucht- und Arbeitshäusern des 17. und 18. Jahrhunderts," in: Sachße, Christof/ Tennstedt, Florian (Hrsg.), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986
Taureck, Bernhard, Emmanuel Lévinas, Hamburg: Junius Verlag, 1997
Theunissen, Georg, "Empowerment," in: Antor, Georg/ Bleidick (Hrsg.), Handlexikon der Behindertenpädagogik, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2006
-, "Lebensperspektiven ohne Erwerbsarbeit - Arbeitsmöglichkeiten und tagesstrukturierende Maßnahmen für schwerst mehrfachbehinderte Menschen," in: Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung, von Rudolf Bieker. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2005
-. "Inclusion - Partizipation - Empowerment. Leitbegriffe für eine Praxis des Miteinanders", http://www.assista.org/files/georg_theunissen.pdf (Zugriff am 27.07.2008)
Theunissen, Georg/ Plaute, Wolfgang (Hrsg.), Handbuch Empowerment und Heilpädagogik, Freiburg: Lambertus Verlag, 1995
Thimm, Walter, "Kritische Anmerkungen zur Selbstbestimmung in der Behindertenhilfe," in: Zeitschrift für Heilpädagogik 48, 1997: 222-232
Tilg, Bernhard, Alterität, Differenz, Rassismus, Kritik, Arbeit, Kapital, Innsbruck: Dissertation Universität Innsbruck, 2003
Tschann, Elisabeth, Ich möchte Arbeiten, Innsbruck: Diplomarbeit. Universität Innsbruck, 2005
Turner, Victor, Struktur und Antistruktur, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1989
Virilio, Paul, Fahren, fahren, fahren, Berlin: Merve Verlag, 1978
Waldschmidt, Anne, "Selbstbestimmung als behindertenpolitisches Paradigma - Perspektiven der Disability Studies", http://www.bpb.de/files/Q72JKM.pdf
Walzer, Michael, Vernunft, Politik und Leidenschaft. Defizite liberaler Theorie, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1999
Weibl, Thomas Karl, Arbeitsintegrationsprojekt SPAGAT in Vorarlberg. Analyse eines Modellversuchs. Dissertation an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens- Universität, Innsbruck: Dissertation, 2007
Weingart, Brigitte, 2007, www.ethikprojekte.ch/texte/arbeit.htm (Zugriff am 27.07.2008).
Weingart, Peter, Jürgen Kroll, und Kurt Bayertz, Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988
Wichtericht, Christa, "Prekär arbeiten, prekär leben. Neoliberale Politik und Konzernstrategien," in: Rätz, Werner/ Zenker, Birgit / Exner, Andreas, Grundeinkommen, Sicherheit ohne Arbeit, Wien: Zsolnay Verlag, 2007
Wulf, Christof, Die Geste der Arbeit, in: Ahrens, Jörn (Hrsg.), Jenseits des Arbeitsprinzips? Tübingen: Edition Diskord, 2000
Wulff, Die Erziehungs- und Pflegeanstalten für geistesschwache Kinder zu Langenhaven bei Hannover 1862 - 1886, Hannover, 1887
Zapf, Wolfgang, "Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität," in: Glatzer, Wolfgang/ Zapf, Werner (Hrsg.), Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt, 1984
Zelger, Josef, Innsbruck, 2001
-. www.gabek.com. 2008. http://www.gabek.com/index.php?id=187 (Zugriff am 27.07.2008))
Quelle:
Sascha Michael Plangger: Integration und Behinderung in der modernen Arbeitswelt
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck eingereicht von MMag. Plangger Sascha Michael; Erstbegutachter: Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger; Zweitbegutachter: Ao.Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 13.10.2009
