Forschungsbericht, entstanden im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Bremen, finanziert durch die Kroschke-Stiftung
Inhaltsverzeichnis
- Besondere Familien - Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihre Kinder?
- Danksagung
- 1. Stand der Forschung zur Unterstützung von Eltern mit Lernschwierigkeiten
- 2. Fragestellungen für das Forschungsprojekt
- 3. Partizipative bzw. inklusive Forschung
- 4. Erhebungsmethoden
- 5. Untersuchungsgruppe
- 6. Durchführung der Erhebung
- 7. Auswertung/ Methoden
-
8. Ergebnisse und Interpretation der quantitativen Auswertung
- 8.1 Ergebnisse zur Untersuchungsgruppe
- 8.2 Ergebnisse zur Zufriedenheit der Eltern mit der kindbezogenen Hilfe
- 8.3 Zufriedenheit mit der Hilfe im Alltag
- 8.4 Ergebnisse zur familiären Lebensqualität (FQoL)
- 8.5. Erfahrungen mit dem Jugendamt
- 8.6. Ergebnisse zu den Fremdunterbringungen
- 8.7 Ergebnisse zum sozialen Netzwerk
- 8.8 Methoden der Unterstützung
- 9. Ergebnisse der qualitativen Auswertung
- 10. Beantwortung der Fragestellungen
- 11. Schlussfolgerungen
- Literatur
- Anhang
Besondere Familien - Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lernschwierigkeiten[1] und ihre Kinder?
[1] In diesem Beitrag wird die Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet, da der im Deutschen noch weithin gebräuchliche Begriff der geistigen Behinderung sich auf ein traditionelles Verständnis von Behinderung bezieht, das modernen Entwicklungsauffassungen nicht genügt und von vielen Betroffenen als diskriminierend empfunden wird (vgl. Mensch zuerst - Netzwerk People first Deutschland e.V., http://www.people1.de ). Sofern auf englischsprachige Literatur Bezug genommen wird, wird die dort gewählte Begrifflichkeit beibehalten.
Das hier beschriebene Forschungsprojekt über "besondere Familien" basiert auf dem Zusammenwirken vieler Personen. Ganz besonders möchten wir uns bei Nina Kirks und Yvonne Schooff bedanken, die uns als partizipative Forscherinnen unterstützt haben. Auch unseren Interviewpartner_innen sowie den Einrichtungen, die uns dabei halfen, die Interviewpartner_ innen zu finden gilt unser Dank. Unsere Forschungsarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Förderung durch die Kroschke Stiftung für Kinder. Hierfür und für die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter_innen der Kroschke Stiftung möchten wir uns ebenfalls herzlich bedanken.
Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) im Jahr 2008 (in Deutschland 2009) ist das Recht von Menschen mit Behinderung auf Elternschaft international anerkannt und auch rechtlich verankert. In Artikel 23 fordert die BRK explizit in Bezug auf die Elternschaft behinderter Menschen die Beseitigung von Diskriminierung und die Gleichberechtigung. Ausdrücklich untersagt sie die Trennung des Kindes von seinen leiblichen Eltern wegen einer Behinderung. Es heißt dort:
(1) Die Vertragspartner treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass
a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatte eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird
...
c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.
(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf jedoch das Kind auf Grund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden.
Damit hat die angemessene Unterstützung von Familien mit behinderten Elternteilen eine entsprechend hohe Bedeutung bekommen, um diesen Rechtsanspruch realisieren zu können. Eine Unterscheidung nach körperlichen oder kognitiven Behinderungen findet an keiner Stelle statt, d.h. Menschen mit Lernschwierigkeiten sind selbstverständlich eingeschlossen.
Im englischsprachigen Raum hat die Fachdiskussion um die Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten und insbesondere um angemessene Unterstützungsformen einige Jahre früher als in Deutschland bereits in den 1980er Jahren begonnen. Neben dem rein quantitativen Ausbau von (in der Regel ambulanten) Unterstützungsangeboten ging es dort vor allem um Fragen der inhaltlichen Gestaltung von Angeboten. Denn immer wieder zeigte sich in der Praxis, dass Unterstützungsangebote entweder nicht angenommen wurden oder ohne Erfolg blieben. Als mögliche Ursache hierfür wurde identifiziert, dass die Unterstützungsangebote nicht immer geeignet gestaltet waren.
Seit den 1990er Jahren wurden international zahlreiche Studien durchgeführt, die die Wirkung von ganz unterschiedlichen Unterstützungsprogrammen für Eltern mit Lernschwierigkeiten zum Gegenstand hatten. Als Voraussetzungen für den Erfolg von Unterstützungsprogrammen können folgende Merkmale benannt werden:
-
ein individueller Zuschnitt auf die jeweiligen Bedürfnisse der Eltern,
-
das Einüben der Fertigkeiten im Feld künftiger Anwendung sowie
-
die systematische und konkrete Ausgestaltung der Programme (vgl. Feldman 2010, 123f).
Jenseits verschiedener theoretischer Ansätze und unterschiedlicher Ausgestaltung der Programme haben sich die Grundhaltungen und die Einstellungen der Professionellen gegenüber den Eltern als essentiell erwiesen. Ein akzeptierender und respektierender Umgang der Fachkräfte mit den Eltern ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterstützung. Konkretisiert finden sich solche Haltungen auf einer Liste von 'Dos' und 'Don'ts' von McGaw (2004, 232), z.B.:
-
'Take time to ask and listen to what parents want'.
-
'Build on and emphasize parents' strengths rather than their weaknesses."
-
'Do not make parents responsible for the failure of your teaching programme.'
-
'Do not label, patronize or stigmatize.
Ein lange unterschätzter Faktor für das Realisieren elterlicher Kompetenzen und das Gelingen von Elternschaft sind die sozialen Ressourcen und die Unterstützung, über die Eltern verfügen.
"Supportive people surrounding the parents are a significant source of empowerment. Parents who are visible to and integrated with benevolent social networks have, in general, much better child outcomes than those, who are not, as happens in 'socially excluded' families." (Hoghughi 2004, 13)
Dieser allgemeine Zusammenhang ist durch zahlreiche Studien erwiesen; d. h. alle Eltern sind auf soziale Netzwerke angewiesen. Eltern, die in sozialer Isolation leben, haben es schwerer, elterliche Kompetenzen zu verwirklichen als sozial gut integrierte Eltern. Für Eltern mit Lernschwierigkeiten ist die Tatsache, dass sie sehr häufig zu den "socially excluded families" gehören, gut belegt (vgl. z.B. McConnell u. a. 2008, Mirfin-Veitch 2010). Für diese Eltern scheint es besonders schwierig zu sein, am Gemeinwesen teilzuhaben, private Netzwerke zu knüpfen, diese aufrecht zu erhalten und zu nutzen. Zwar wurde nach McConnel u.a. (2008) in den letzten 10 Jahren bei den Interventionen verstärkt der Faktor der sozialen Isolation der Eltern berücksichtigt, was in den Studien zu positiven Ergebnissen geführt hat. Dennoch fokussieren die meisten Interventionsstudien ausschließlich auf elterliches Wissen und Fertigkeiten und auf die individuelle Ebene von Eltern oder Kind, während die sozialen Netzwerke ebenso wie die institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Gemeinwesens trotz ihrer enormen Bedeutung außen vor bleiben - Faktoren, die sich im Rahmen von Untersuchungen zur familiären Lebensqualität (Family Quality of Life, FQoL, vgl. Isaacs et al. 2007) als sehr bedeutsam erwiesen haben.
Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurde in Australien in den letzten Jahren mit dem Programm "Healthy Start: A National Strategy for Parents with Intellectual Disabilities and Their Children" ein Modell entwickelt, das flächendeckend die Kapazitäten des sozialen Systems entwickeln soll, indem es sich einerseits an PraktikerInnen wendet und ihnen Wissen und Fertigkeiten zur Verfügung stellt, andererseits Ressourcen zur Elternbildung und zur Gemeindeentwicklung anbietet, um Eltern mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen (vgl. McConnell u. a. 2008). Das Modell basiert auf der Entwicklung von Partnerschaften zwischen lokalen Verwaltungen und Fachkräftenetzwerken (http://www.healthystart.net.au/ ) und wurde von der australischen Regierung mit 2,3 AUS$ gefördert. Wie aus dem Titel ersichtlich ist, werden dabei Eltern und Kinder gleichermaßen in den Blick genommen.
Daneben sind z.B. in den USA und auch in Großbritannien Unterstützungskonzepte für Eltern mit Lernschwierigkeiten entstanden, die aus der Independent-Living-Bewegung kommen und ursprünglich von körperlich beeinträchtigten Eltern für andere Eltern mit körperlichen Beeinträchtigungen entwickelt wurden. Ein wichtiges Ziel bei diesen Organisationen liegt im Empowerment der behinderten Eltern. 1998 wurde die kalifornische Organisation "Through the Looking Glass" (TLG) zum ersten National Center on Parents with Disabilities in den USA. Nach eigenen Angaben hat TLG seit 1982 mehr als 70.000 Eltern, Beistände (advocates) und Fachkräfte fortgebildet. Seit 1990 wird ein spezielles Programm für Eltern mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. TLG fördert auch die Kinder von behinderten Eltern etwa durch Stipendien (vgl. www.lookingglass.org ). Ähnliche Ziele werden in Großbritannien u. a. mit der Herausgabe der Fachzeitschrift Disability, Pregnancy & Parenthood (http://www.dppi.org.uk/about.php ) verfolgt, an der behinderte Eltern maßgeblich beteiligt sind. Auch bei diesen Organisationen werden den kommunalen bzw. gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hohe Bedeutung zugemessen.
In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten hinsichtlich der Thematik behinderter Eltern ebenfalls eine Entwicklung vollzogen. 1999 wurde der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V. gegründet, der sich als Selbsthilfebewegung von betroffenen Eltern versteht (http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/ ). Eltern mit Lernschwierigkeiten waren dort zunächst nicht repräsentiert. Für die Unterstützung von dieser Gruppe von Eltern wurde im Jahr 2002 von 13 Einrichtungen bzw. Projekte die Bundesarbeitsgemeinschaft "Begleitete Elternschaft"(BAG) gegründet (vgl. Bargfrede 2008), um über ihren Zusammenschluss und einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch eine breitere und wirksamere, professionelle Unterstützung zu erreichen (http://www.begleiteteelternschaft.de/index.php?main_id=21 ). Mittlerweile gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, die sich insbesondere in rechtlichen und politischen Fragen als sinnvoll erweist. In der "BAG Begleitete Elternschaft" sind inzwischen (Stand 2011) ca. 30 Einrichtungen bzw. Projekte vertreten, die ambulante und/oder stationäre Unterstützung für Eltern mit Lernschwierigkeiten und/oder psychischen Beeinträchtigungen anbieten. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es in Deutschland bislang keine flächendeckende Struktur zur Unterstützung von Eltern mit Lernschwierigkeiten. Das hat zur Folge, dass den Eltern nach wie vor in vielen Regionen keinerlei professionelle Unterstützung zur Verfügung steht, obwohl eine deutliche Zunahme dieser Elternschaften in Deutschland zu verzeichnen ist und immer mehr Eltern mit ihren Kindern zusammen leben (Pixa-Kettner 2007).
Vor diesem Hintergrund gab es für das vorliegende Forschungsprojekt folgende Vorüberlegungen und Schwerpunktsetzungen. Trotz evtl. methodischer Probleme (s. unten) sollten die betroffenen Eltern/ Familien in dieser Untersuchung ausschließlich selbst zu Wort kommen, um die spezifischen Unterstützungsbedürfnisse aus Sicht der betroffenen Familien zu erkunden und Konsequenzen zur Verbesserung vorhandener oder zur Entwicklung neuer Unterstützungskonzepte formulieren zu können. Von einer ergänzenden Befragung Dritter wurde bewusst abgesehen, da es um die subjektive Sicht der Familien ging.
Viele Familien mit einem Elternteil mit Lernschwierigkeiten leben nach wie vor in dem Dilemma, abhängig von Unterstützung zu sein, die sie gleichzeitig jedoch auch als Kontrolle und Fremdbestimmung erleben. Hier stellt sich die Frage, welche Rolle die Art der erhaltenen Unterstützung spielt, d. h. ob die Eltern eine professionelle Unterstützung erhalten oder früher erhalten haben, die den Standards in der Fachliteratur entspricht und wie sie diese beurteilen.
1) Fragestellung 1: Wie viel und welche Unterstützung erhalten die Eltern/ Familien aktuell im Kontext ihrer Elternschaften bzw. haben sie früher erhalten? Wie beurteilen die Eltern Umfang und Qualität der erhaltenen Unterstützung, sowohl rückblickend als auch aktuell?
Außerdem scheint für die Gesamtsituation von Eltern und Kindern wichtig zu sein, wie zufrieden die Eltern mit ihrem Leben außerhalb des Bereichs Elternschaft sind, d. h. wie die familiäreLebensqualität (FQoL) hinsichtlich finanzieller, beruflicher, gesundheitlicher, freizeitorientierter und sonstiger Bedürfnisse geprägt ist, z.B. welche Angebote in der jeweiligen Lebensumwelt der Familien vorhanden sind, die von den Familien barrierefrei genutzt werden können. Auch diese Aspekte sollten aus der Sicht der Eltern bzw. Familien erhoben werden.
2) Fragestellung 2: Wie beurteilen die Eltern ihre familiäre Lebensqualität in den verschiedenen Bereichen und in welchen Bereichen haben sie Unterstützung zur Verbesserung der Situation erhalten oder würden gerne Unterstützung erhalten?
Ferner scheinen die Größe und Qualität des sozialen Netzwerkes von Familien ein wichtiger Faktor für das Gelingen einer Elternschaft zu sein, da alle Menschen, Erwachsene wie Kinder, leiden, wenn sie keine befriedigenden sozialen Kontakte haben. Insbesondere bei alleinerziehenden Müttern und deren Kinder ist die Gefahr sozialer Isolation hoch. Diese Gefahr wird für Eltern mit Lernschwierigkeiten dadurch erhöht, dass immer noch Mutter-Kind-Paare bzw. Familien in Deutschland gezwungen sind, ihre vertraute Umgebung zu verlassen, wenn sie mit ihrem Kind zusammen leben möchten, da es in ihrer Region an einem passenden Unterstützungsangebot fehlt. Wegen der nachgewiesenen hohen Bedeutung des sozialen Netzwerkes sollte dieses im Rahmen des Forschungsprojektes nicht nur über Interviewfragen, sondern außerdem mit einem gesonderten Verfahren (Netzwerkkarte) untersucht werden.
3) Fragestellung 3: Wie viele soziale Kontakte haben die befragten Eltern und in welchen Feldern ihrer sozialen Umwelt sind diese Personen verortet? Wie eng erleben sie diese Kontakte und wie beurteilen die Eltern deren emotionale Qualität? In welchen Bereichen kommen die Kontakte zum Tragen?
Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention leben viele Eltern sowie auch Kinder in dem Bewusstsein, von einer Fremdunterbringung der Kinder bedroht zu sein, auch dann, wenn den Eltern kein elterliches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Gerichtsurteile und überstürzte Fremdplatzierungen zeigen, dass es immer noch vorkommt, dass eine sog. Geistige Behinderung der Mutter/Eltern allein ausreicht, um eine Kindeswohlgefährdung und fehlende elterliche Kompetenz festzustellen (vgl. Falldarstellungen in Pixa-Kettner 2008). Dabei ist Fremdunterbringung als eine Maßnahme einzuschätzen, die i. d. R. eine schwere Belastung für die betroffenen Kinder darstellt und das Kindeswohl nachhaltig beeinträchtigen kann, obwohl die Maßnahme der Fremdunterbringung eigentlich zu dessen Sicherung veranlasst wurde. Im Rahmen des Forschungsprojekts ist deshalb von Interesse, welche Erfahrungen die Eltern mit dem Jugendamt machen bzw. gemacht haben, ob sie Erfahrungen mit der Fremdunterbringung von Kindern haben und falls ja, wie sie die damals erhaltene Unterstützung sowie die erfolgte Fremdunterbringung aus heutiger Sicht bewerten.
4) Fragestellung 4: Welche Erfahrungen haben die befragten Eltern mit dem Jugendamt gemacht? Falls sie die Fremdplatzierung von einem oder mehreren ihrer Kindern erlebt haben, wie beurteilen sie die damals erhaltene Unterstützung vor und nach der Trennung von ihrem Kind und wie sehen sie die Fremdplatzierung aus heutiger Sicht?
Die Forderung nach partizipativer Forschung, die im angloamerikanischen Raum seit einigen Jahren diskutiert wird und aus den Disability Studies hervorgegangen ist ("Nichts über uns - ohne uns", vgl. Hermes & Rohrmann 2006), wurde dort ursprünglich für die Gruppe der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen postuliert, wird aber zunehmend auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten diskutiert und erprobt, wobei wiederum im angloamerikanischen Raum einige Jahre früher damit begonnen wurde (vgl. Walmsley 2001). Der Grundgedanke ist, dass selbst betroffene Menschen die besten Expert_innen ihrer Situation sind und deshalb in Forschungsvorhaben nicht nur passiv als Beforschte oder mit ihrer subjektiven Sicht z.B. als Interviewpartner_innen vorkommen können, sondern dass sie auch als Forschungspartner_innen in den Forschungsprozess einbezogen werden können. In diesem erweiterten Sinne wird der Begriff der inklusiven Forschung verwendet (vgl. Buchner u. a. 2011, 6f). Für ein Forschungsprojekt, bei dem es vorrangig um die Zufriedenheit mit Unterstützung bzw. mit Unterstützungsangeboten geht, erscheint die Beteiligung selbst betroffener Expert_innen besonders naheliegend.
Bei Buchner u. a. (2011, 8) findet sich der Hinweis, dass
"verschiedene Ebenen von Einbindung möglich (sind): von der Mitwirkung in einzelnen Phasen bis hin zur Initiierung und kompletten Kontrolle des Forschungsprozesses durch Menschen mit intellektueller Behinderung."
Die Realisierung des inklusiven Forschungsansatzes im Rahmen unseres Forschungsvorhabens sollte sich auf die Zusammenarbeit im Vorfeld der Datenerhebung und bei der Beurteilung der erhobenen Ergebnisse beschränken, da ein weitergehender Anspruch auf inklusive Forschung im Rahmen dieses zeitlich stark beschränkten Projektes nicht möglich gewesen wäre. Für die Umsetzung mussten zunächst interessierte Eltern gewonnen werden. Der Abbau von sprachlichen Barrieren durch Fachsprache oder komplizierten Satzbau spielt bei inklusiver Forschung eine zentrale Rolle, weshalb eine Projektbeschreibung in Leichter Sprache[2] erstellt und an Einrichtungen bzw. Projekte der Begleiteten Elternschaft verschickt wurde (s. Anhang 1). Mit Hilfe von Fachkräften, die gezielt evtl. in Frage kommende Mütter oder Väter ansprachen, gelang es uns, in zwei Fällen positive Antwort zu erhalten. Eine der Mütter lebte in einer stationären Einrichtung in Hamburg, die andere wurde in Bremen ambulant unterstützt. Die ursprünglich als dritte Teilnehmerin vorgesehene erwachsene Tochter einer Mutter mit Lernschwierigkeiten sagte nach anfänglicher Bereitschaft ihre Teilnahme aus zeitlichen Gründen leider ab. Die Teilnehmerinnen wurden für ihre Mitwirkung an der inklusiven Forschungsgruppe mit jeweils 50€ pro Treffen bezahlt. Dies erwies sich als wichtig, da es den Müttern ihre Rolle als gefragte Expertin in eigener Sache deutlich machte. Die Treffen wurden durch Einladungen in Leichter Sprache sowie durch Protokolle vom vorangegangenen Treffen (ebenfalls in Leichter Sprache) vorbereitet (s. Auszüge in Anhang 2).
Insgesamt fanden über den Verlauf des Forschungsprojektes zwischen November 2010 und August 2011 vier Treffen der inklusiven Forschungsgruppe statt. Zunächst sollten sich die Gruppenmitglieder kennen lernen. Außerdem stellten die Projektmitarbeiterinnen das Forschungsprojekt vor. Im Folgenden regten sie zur Ideensammlung für Interviewfragen bezüglich hilfreicher oder nicht hilfreicher Unterstützung beim Elternsein an. Es folgte das probeweise Durchspielen eines mittlerweile erstellten Interviewleitfadens inkl. der sozialen Netzwerkkarte (vgl. Pkt. 4), woraus sich wichtige Hinweise für die sprachliche und optische Gestaltung des Materials sowie für die Interviewdurchführung ergaben. Abschließend erfolgte eine Diskussion am Beispiel zweier sehr unterschiedlicher Netzwerkkarten aus den Interviewerhebungen über Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lebensformen sowie ein Meinungsaustausch über erste vorliegende Ergebnisse bezüglich Unterstützungserfahrungen.
Durch die unterschiedlichen Wohnorte der Teilnehmerinnen war der organisatorische Aufwand für die vier Treffen erheblich. Außerdem mussten die Mütter jeweils für eine Betreuung ihrer Kinder für die Zeit der Treffen sorgen.
Inhaltlich betrachtet bezog sich die Partizipation der Teilnehmerinnen hauptsächlich darauf, auf die von den hauptamtlichen Forscherinnen eingebrachten Materialien oder Fragen zu reagieren, was zu einigen Verbesserungen der Interviewkonzeption und interessanten Überlegungen für die Auswertung geführt hat. Für eine aktivere, selbst fragende (forschende) Beteiligung wären erheblich mehr Treffen erforderlich gewesen, um sich in den ungewohnten Rollen zurecht zu finden, was allerdings den zeitlichen und finanziellen Rahmen dieses Projekts gesprengt hätte.
[2] Hier wie in allen folgenden Fällen, in denen Materialien in Leichter Sprache erstellt wurden, stammen die Bilder überwiegend aus: Mensch Zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. (Hrsg.) (2008), Das neue Wörterbuch für Leichte Sprache, Kassel oder sie wurden als frei zugängliche Bilder dem Internet entnommen.
Im Zuge der Entwicklung der Erhebungsinstrumente stellte sich uns die Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt, Menschen mit Lernschwierigkeiten nach ihren eigenen Sichtweisen und Erfahrungen zu befragen, und welche Interviewmethoden für dieses Vorhaben geeignet sind. Aufgrund des besonderen Erfahrungshintergrunds von Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren spezieller Lebenssituation müssen hierbei einige Besonderheiten im Blick behalten werden.
In mehreren Untersuchungen wurde zum Beispiel festgestellt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aufgrund ihrer von institutioneller Betreuung und/ oder Unterbringung geprägten Lebensumstände bei Interviews in besonderem Maße zu Antwortstrategien neigen, die bezwecken, soziale Anerkennung für die Antwort zu erhalten, somit ihre Antwort an dem orientieren, was vermutlich erwartet bzw. sozial erwünscht wird (vgl. Hagen 2001, 104f, zur Diskussion vgl. Buchner & Koenig 2011, 3f). Dazu kommt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals wenig Übung darin haben, ihre Unzufriedenheit und eigene Wünsche zu äußern, sich eine eigene Meinung zu bilden und für diese einzutreten. Wenn Menschen aufgrund von zum Teil fremdbestimmten, isolierenden Lebensbedingungen über einen eingeschränkten Erfahrungs- und Wissenshorizont verfügen, beeinträchtigt dies die Ausbildung der Fähigkeit, die eigene Lebensqualität zu beurteilen, evtl. zu kritisieren und andere Vorstellungen und Wahlmöglichkeiten zu entwickeln (vgl. Hagen 2001, 109, Klauß & Janz 2011, 53).
Wenn man einen Menschen interviewt, der unter institutioneller Betreuung steht, ist es in besonderem Maße wichtig, der zu befragenden Person die eigene Rolle als Interviewerin und Ziel und Zweck des Interviews transparent zu machen: Dies beinhaltet, deutlich zu machen, dass die Interviewerin keine Angehörige der Institution ist, auch der Institution gegenüber der Schweigepflicht unterliegt und dass alle Daten anonymisiert werden. Vor dem Hintergrund, dass Menschen mit geistiger Behinderung Befragungssituationen oftmals aus Begutachtungen kennen und somit die Assoziation mit einem Test naheliegt (vgl. Hagen 2001, 107), ist ebenso darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme am Interview und die Beantwortung einzelner Fragen auf Freiwilligkeit beruhen und dass das Interview kein Gutachten oder Test ist, wie folgender Interviewausschnitt aus dem Interview mit Frau Moritz untermauert:
Frau Moritz: Muss ich jetzt den Idiotentest machen?
Interviewerin: Nein! Das kennen Sie, ´n Idiotentest?
Frau Moritz: Jaaa!
Interviewerin: Das ist gar kein Test, überhaupt nicht!
Frau Moritz: Da musst ich beim Gesundheitsamt Idiotentest machen, ich denk, wo bin ich denn jetzt gelandet.
Interviewerin: Uiuiui.
Frau Moritz: Da ham sie mich gleich mich getestet, ob ich ganz dicht bin im Kopf oder bekloppt.
Bei den Vorüberlegungen zur Gestaltung der Interviewsituation kann sich die Frage ergeben, ob es für Menschen mit Lernschwierigkeiten evtl. hilfreich ist, wenn bei einer Befragung oder einem Gespräch eine vertraute Person anwesend ist, die ggf. "übersetzen" und auch Informationen ergänzen kann; dies ist jedoch umstritten (vgl. ebd. 107f). Die Anwesenheit einer vertrauten Person kann zwar einerseits zu einem größeren Gefühl der Sicherheit beitragen, andererseits beeinflusst sie aber die Interviewsituation und die Interviewperson; ebenso kommt es vor, dass die Interviewperson der Unterstützungsperson die Gesprächsführung überlässt (insbesondere, wenn die Unterstützungsperson ein Mitglied der Institution oder der Familie ist). Untersuchungen zeigen, dass Fremdaussagen zum Teil in hohem Maße von den Selbstaussagen abweichen. Dies ist jedoch kein Beleg für die Unglaubwürdigkeit der Betroffenen; vielmehr ein Hinweis darauf, dass sich aus verschiedenen Perspektiven mit den jeweiligen Erfahrungshorizonten unterschiedliche Einschätzungen, Bewertungen und Aussagen ergeben, die aber durchaus individuell sinnhaft sind. Hagen empfiehlt aus diesem Grund, "anstatt also Selbstaussagen Betroffenerfür unglaubwürdig zu erklären, (ist) den jeweiligen Bedingungen ihres Zustandekommensnachzugehen" (Hagen 2001, 109).
Insbesondere dann, wenn, wie im Falle unseres Vorhabens, die subjektive Sicht der Interviewten im Mittelpunkt steht, ist somit davon abzusehen, Fremdaussagen hinzuzuziehen oder eine Unterstützungsperson an dem Interview teilnehmen zu lassen. Um dennoch eine sichere Interviewsituation herzustellen, in der es der/dem Interviewpartner_in möglich wird, sich mitzuteilen, sollte das Interview in einer vertrauten, privaten Umgebung stattfinden und auf die Benutzung der "Leichten Sprache" (einschließlich non-verbaler Kommunikationsmittel) geachtet werden.
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Überlegungen entwickelten wir ein Erhebungsinstrumentarium, in dem verschiedene Methoden kombiniert werden. Dadurch erhofften wir uns, erwartete Schwierigkeiten und evtl. auftretende Unsicherheiten in der Kommunikation minimieren bzw. vermeiden zu können. Durch das Zurückgreifen auf verschieden Zugänge und Hilfsmittel wollten wir unseren jeweiligen Interviewpartner_innen ermöglichen, sich über unterschiedliche Modalitäten mitteilen zu können.[3]
Im Verlauf dieser Auseinandersetzung mit der Eignung verschiedener Erhebungsinstrumente entschieden wir uns nach gründlicher Prüfung des FQoL-Fragebogens, der in seiner Originalfassung für Familien mit einem behinderten Angehörigen (nicht speziell für behinderte Eltern) konzipiert wurde, nicht den gesamten Fragebogen zu verwenden, da er sehr umfangreich ist, also einen separaten Termin erforderlich gemacht hätte. Außerdem hätte ein Teil der Fragen vermutlich von den Eltern nicht selbst beantwortet werden können, sondern hätte die Befragung von unterstützenden Fachkräften erforderlich gemacht, was mit der Konzeption der Studie nicht vereinbar war. Deshalb wurden die relevantesten Bereiche des FQoL als Einzelfragen in den Interviewleitfaden zur erhaltenen Unterstützung und Zufriedenheit integriert. Dies betraf insbesondere Fragen zur finanziellen Situation der Familie, zur beruflichen und gesundheitlichen Situation der Eltern, zur Wohnsituation, zur Mobilität, zur sozialen Einbindung und zur Freizeitbzw. Urlaubsgestaltung der Familie.
Neben dem so ergänzten leitfadengestützten Interview zur erhaltenen Unterstützung und deren Beurteilung wurden Informationen über das soziale Netzwerk der Familien erhoben. Außerdem wurde erfragt, welche Unterstützungsmethoden die Familien kennengelernt haben und wie sie diese einschätzen. Ein Interview umfasste somit fünf Teile:
(A) Einleitung
Einleitend nahmen wir zunächst Bezug auf die Projektbeschreibung in Leichter Sprache, die unseren Interviewpartner_innen zum Teil schon bekannt war. Wir erklärten Inhalt, Zweck und Ziele der Interviews und des Forschungsprojektes und stellten uns unseren Interviewpartner_innen vor und gaben Gelegenheit für evtl. Fragen. Wir betonten die Punkte Freiwilligkeit, Schweigepflicht und Anonymisierung. Dies erschien uns angesichts der Kontaktvermittlung über die Fachkräfte der Unterstützung leistenden Einrichtungen besonders wichtig. Ebenso erklärten wir, dass das Interview kein Test ist, in dem es "richtig" oder "falsch" gibt, sondern dass vielmehr alles richtig und wichtig ist, was gesagt wird, und dass es jederzeit erlaubt ist, auf eine Frage nicht zu antworten, wenn man dies nicht möchte oder kann. Vor Beginn des Interviews fragten wir nach Erlaubnis, das Gespräch aufzuzeichnen.
(B) Leitfadengestütztes Interview
Für die Durchführung der Interviews wurden vier verschiedene Gesprächsleitfäden entwickelt: für Eltern/Mütter von Kindern unter 4 Jahren, für Eltern/Mütter von Kindern von 4 bis 11 Jahren, für Eltern/Mütter von Kindern ab 12 Jahren einschließlich erwachsener Kinder und für Eltern/ Mütter fremdplatzierter Kinder (s. Anhang 3). Alle Gesprächsleitfäden umfassten neben einer allgemeinen Erzählaufforderung gut 20 Einzelfragen Diese betrafen die jeweils erhaltene Unterstützung für die Bereiche "elterliche Aufgaben" (6 bis 10 Fragen), "Alltagsorganisation" (3 Fragen) sowie die erwähnten Bereiche der "familiären Lebensqualität" (FQoL, 11 bis 12 Fragen). Es wurde jeweils nach der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit der früher und/oder aktuell erhaltenen Unterstützung und nach den jeweiligen Unterstützungspersonen gefragt. Bei Bedarf wurden die Gesprächsleitfäden an die vorgefundene familiäre Situation angepasst, wenn z.B. mehrere Leitfäden auf die familiäre Situation zutrafen.
(C) Erhebung des sozialen Netzwerkes
Aufgrund der besonderen Bedeutung, die soziale Netzwerke für das Gelingen von Elternschaft und damit für das Wohlergehen der Kinder haben, wurde der Erhebung des sozialen Netzwerkes der Eltern besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In Anlehnung an das vom Familiy Support & Services Project (2000) entwickelte Verfahren "Support Interview Guide" wurden die Anzahl, Bedeutung und Qualität der sozialen Kontakte der ausgewählten Familien erhoben. Die soziale Netzwerkkarte kann hierbei für die Interviewerin im Gesprächsverlauf (sowie in der späteren Interpretation) eine Hilfe sein, den Ausführungen der Befragten über ihr soziales Netzwerk zu folgen, Personen, Namen und Beziehungen richtig einzuordnen und dem Erzählten eine Struktur zu geben. Dem/ der Erzähler_in kann die grafische Darstellung seines/ ihres Netzwerkes helfen, alle relevanten Personen zu berücksichtigen, sich selbst über seine/ ihre Beziehung zu den Personen und deren Stellenwert klar zu werden und dies nach außen verständlich zu machen. Um die Befragten nicht zu überfordern und eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, haben wir, anstatt die Grundkarte von der befragten Person selbst gestalten zu lassen, wie im family Support & Services Project 2000 mit einer festgelegten Grundkarte mit vorgegebenen Sektoren gearbeitet (vgl. auch Hintermair 2009, 201), die folgendermaßen aussah:
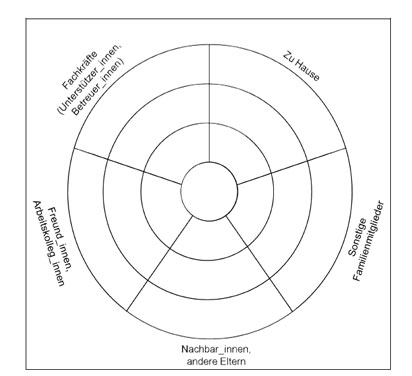
Abb. 1: Netzwerkkarte
In den Kreis in der Mitte der Netzwerkkarte wurde der Name der interviewten Eltern geschrieben und sie wurden aufgefordert, zu überlegen, welche Menschen in ihrem Leben eine Rolle spielen. Vorgegeben waren fünf Sektoren, die nacheinander abgefragt wurden:
-
Zu Hause (eigener Haushalt)
-
Sonstige Familienmitglieder
-
Nachbar_innen, andere Eltern (bei den stationär unterstützten Elternteilen fallen darunter auch Mitbewohner_innen)
-
Freund_innen, Arbeitskolleg_innen
-
Fachkräfte.
Die Namen der genannten Personen wurden auf einen Klebezettel geschrieben, den Sektoren zugeordnet und entsprechend ihrer Bedeutung näher (=wichtig) oder weiter weg (=nicht so wichtig) geklebt. Wurden von den interviewten Eltern Personengruppen genannt, die nicht weiter als jeweils eigenständige Kontaktpersonen differenziert werden konnten, so wurden diese in der Auswertung lediglich als ein Kontakt gezählt, z.B. wurden Paare von den Interviewten häufig als nicht genauer unterscheidbarer Kontakt aufgeführt ("Schwester und Schwager", "Großeltern" oder "Nachbarn"); es kam auch vor, dass von "vier Brüdern" die Rede war, ohne dass zu diesen eine je individuelle Beziehung erfragt werden konnte. In jedem Falle richteten wir uns danach, wie die Kontakte von den Eltern eingestuft wurden.
Anschließend fragten wir nacheinander zu den einzelnen Personen(gruppen) ab,
-
wie lange der Kontakt schon besteht,
-
wie häufig ein Kontakt stattfindet (inklusive Telefonate) und
-
anhand einer Smiley-Skala, wie die Qualität des Kontaktes ist ("Freuen sie sich, wenn sie Kontakt haben? Ist es mal so, mal so? Oder ärgern sie sich über den Kontakt und sind froh, wenn er vorbei ist?").
Im nächsten Schritt fragten wir nach der Art des sozialen Kontaktes zu den einzelnen Personen( gruppen). Wir forderten unsere Interviewpartner_innen auf, zu überlegen, ob sie von der jeweiligen Person
-
praktische Hilfe erhalten (practical support),
-
emotionale Hilfe erhalten (emotional support),
-
Informationen und gute Ratschläge erhalten (information support)
-
oder mit ihr etwas gemeinsam unternehmen (companionship support).
Um die Beantwortung zu erleichtern, wurden hierfür jeweils Beispiele mit entsprechenden Bildkarten vorgelegt, von denen zwei im Folgenden abgebildet sind. (Die beiden anderen Bildkarten sind im Anhang 4 zu finden).

Abb. 2: Bildkarten zur Art des sozialen Kontaktes
(D) Erhebung der Unterstützungsmethoden
In diesem Teil wollten wir über einen weiteren methodischen Zugang die positiven und negativen Erfahrungen der Familien mit der Unterstützung erkunden, die sie von Fachkräften oder von Privatpersonen erhalten haben, wobei uns auch interessierte, wie sie bestimmte Vorgehensweisen beurteilten, unabhängig davon, ob sie diese auch persönlich erfahren haben. Hierfür stellten wir - ebenfalls mit der Hilfe von Bilderkarten, Beispielen und kurzen Erklärungen in Leichter Sprache - neun verschieden Methoden der Unterstützung vor. Wir fragten die Interviewpartner_ innen, ob sie diese Methoden kennengelernt haben, und baten sie, diese anhand einer Smiley-Skala zu beurteilen. Sechs Methoden bezogen sich auf die Art, wie Unterstützer_ innen (vor allem Fachkräfte, aber auch Familienangehörige oder Mitbewohner_innen) den Eltern Hilfen geben:
-
Erklären mit Worten
-
Genaue Anweisungen geben
-
Erklären mit Materialien
-
Gemeinsam machen
-
Aufgaben übernehmen
-
Eltern entlasten.
Drei Methoden bezogen sich auf spezielle Arbeitsmethoden/ Unterstützungsangebote von Fachkräften oder Institutionen:
-
Gruppen-Angebote
-
Video-Home-Training
-
Patenschaften.
Im Folgenden finden sich Beispiele für die Bildkarten zu den Methoden 5 und 6 (die übrigen Bildkarten befinden sich in Anhang 5):

Abb. 3: Bildkarten zu den Unterstützungsmethoden
(E) Abschluss
Zum Schluss des Interviews bedankten wir uns bei unseren Interviewpartner_innen und fragten, ob Interesse besteht, die Ergebnisse des Forschungsprojekts in Leichter Sprache zugeschickt zu bekommen.
Unser Ziel war es, eine möglichst heterogene Gruppe von Eltern mit Lernschwierigkeiten zu befragen, um Einblick zu bekommen in verschiedene Lebenssituationen und vielfältige Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen der Unterstützung, dabei lag der Schwerpunkt auf professioneller Unterstützung. Wir haben bei der Suche nach Interviewpartner_innen auf folgende Merkmale geachtet:
-
Form der Betreuung: ambulant oder stationär;
-
Lebensform der Eltern: allein erziehende Elternteile oder gemeinsam erziehende Elternpaare;
-
Wohnort der Kinder: Eltern, die mit ihrem/ihren Kind(ern) zusammenleben, und Eltern, deren Kind(er) fremdplatziert wurde(n);
-
Alter der Kinder;
-
gleichmäßige Verteilung der Interviews auf verschiedene Orte (Vermeidung unverhältnismäßig vieler Interviews in derselben Einrichtung[4]).
Allen Interviewten gemeinsam ist das Eingebundensein in ein Hilfesystem, das entweder explizit Eltern mit Lernschwierigkeiten unterstützt oder Betreutes Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung und/oder Sozialpädagogische Familienhilfe anbietet. Wir haben zunächst telefonischen
Kontakt zu einschlägigen Einrichtungen in Norddeutschland aufgenommen. Bis auf zwei sind diese Einrichtungen Mitglied in der BAG Begleitete Elternschaft. Alle haben sich bereits eingehend mit diesem Arbeitsfeld beschäftigt. Im zweiten Schritt haben wir den kooperierenden Einrichtungen eine Projektbeschreibung in Leichter Sprache zugeschickt mit der Bitte, sie an interessierte Eltern weiter zu geben bzw. sie mit den Eltern gemeinsam zu lesen. Daraufhin meldete sich eine Mutter selbstständig telefonisch bei uns zurück und bekundete ihr Interesse, interviewt zu werden. Die anderen Interviewverabredungen wurden über die Einrichtungen getroffen. Einigen Müttern/Eltern war es wichtig, die Verabredung selbst zu treffen, andere haben das Telefonieren den Fachkräften überlassen. Zum Teil war es für die Mütter/Eltern schwierig, über das Telefon zu kommunizieren, so dass sie hierfür Assistenz bekamen. Unser geplantes Vorhaben, evtl. auch jugendliche bzw. erwachsene Kinder zu interviewen, konnte nicht realisiert werden. Einige dieser Kinder wurden angefragt, haben jedoch abgelehnt.
Insgesamt wurden 11 Einrichtungen in Norddeutschland angefragt. In 10 Einrichtungen kamen ein oder mehrere Interviews zustande, so dass wir 22 Interviews in zehn norddeutschen Städten bzw. Gemeinden der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Brandenburg führen konnten.
[4] An einem Ort kamen vier Interviews zustande; an zwei Orten drei Interviews; an fünf Orten zwei Interviews, an zwei Orten jeweils ein Interview.
Alle 22 Interviews fanden zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2011 bei den Familien zu Hause statt.
Wir haben uns bemüht, die Vorgespräche mit den Fachkräften der Einrichtungen auf das Organisatorische zu beschränken. Da unsere Fragestellung ausschließlich auf die Sicht der Eltern bezogen ist, wollten wir vermeiden, durch Äußerungen und Beurteilungen der Fachkräfte vorinformiert und somit in unserer Offenheit den Eltern gegenüber beeinflusst zu werden (vgl. Punkt 4). Die Interviews wurden mit den Elternteilen (bzw. deren Lebenspartnern) alleine geführt. Die zum Teil zur Begrüßung anwesenden Fachkräfte verabschiedeten sich in der Regel schnell. In vier Fällen waren jüngere Kinder während des Interviews (phasenweise) anwesend.
Bei den sieben gemeinsam erziehenden Elternpaaren verliefen die Interviews unterschiedlich: In fünf Fällen waren beide Elternteile anwesend und wurden gemeinsam interviewt (ebenso wurde die Netzwerkkarte für beide gemeinsam erstellt). In einem Fall war nur der Vater anwesend, die Mutter wollte nicht interviewt werden; in einem anderen Fall war es der Vater, der nicht interviewt werden wollte und nur kurz anwesend war. Bei den drei Müttern, die getrennt von ihren Kindern mit neuem Partner leben, war der Lebenspartner in einem Fall beim Interview dabei, aber Hauptinterviewpartnerin war die Mutter; in den beiden anderen Fällen wurde das Interview ausschließlich mit der Mutter geführt, der Partner war nur kurz anwesend.
Die ersten acht Interviews haben die Projektleiterin und die Projektmitarbeiterin gemeinsam geführt, wobei in wechselnden Rollen eine Interviewerin das Gespräch führte und die andere vor allem Nachfragen stellte und bei der Netzwerkkarte assistierte. Die übrigen Interviews führte die Projektmitarbeiterin alleine.
Die Interviews dauerten im Durchschnitt eineinhalb bis zwei Stunden, wobei das längste Interview drei Stunden lang war, das kürzeste eine Stunde. Der Aufforderung, frei zu erzählen, kamen unsere Interviewpartner_innen unterschiedlich nach. Einige taten dies gerne und ausführlich, in anderen Fällen bestimmte unser Leitfaden das Gespräch. Es zeigte sich, dass Fragen nach konkreten Daten anstrengend für viele der Interviewpersonen, oft schwer zu beantworten waren und somit Stress verursachten (z.B. "Wie alt war Ihr Kind damals?" "Wie lange ist dasher?" "Seit wann haben Sie die Betreuung?"). In der Regel empfahl es sich, derartige Fragen zu umschreiben und an Bespielen zu verdeutlichen (z.B. "konnte Ihr Kind damals schon krabbeln"?), und nicht daran festzuhalten, konkrete zeitliche Abläufe genauestens zu klären, sondern es bei ungefähren Antworten zu belassen.
An der Netzwerkkarte haben fast alle Interviewpersonen sehr engagiert mitgearbeitet. Die Nutzung der Materialien lockerte die Atmosphäre - nach einem teilweise für unsere Interviewpartner_ innen anstrengenden, aufwühlendem (weil schwere Themen betreffenden) Gespräch - spürbar auf; es wurde neues Interesse und Neugierde geweckt. Vielen machte es Spaß, zu überlegen, welche Personen eine Rolle spielen, und welche Bedeutung diese in ihrem Leben haben.
Die Bildkarten und die Smiley-Skalen wurden in vielen Fällen als Kommunikationsmittel genutzt; einigen Interviewpartner_innen fiel es offensichtlich leichter, auf Symbole und Bilder zu zeigen, anstatt sich verbal mitzuteilen.
In wenigen Fällen ließ die Konzentration und die Lust, mitzuarbeiten, im Laufe des Interviews deutlich nach; es zeigte sich, dass es eine hohe Anforderung war, sich über einen so langen Zeitraum zu konzentrieren.
Da die Interviewpersonen der Aufnahme des Interviews zustimmten, konnten alle 22 Interviews mitgeschnitten werden. Die Interviews wurden in allen Teilen, einschließlich der Erhebung der Sozialen Netzwerkkarten sowie der Teile, in denen mit Bildkarten und Smiley-Skalen gearbeitet wurde, verschriftlicht. Bis auf wenige Passagen, die für die Fragestellung nicht relevant waren, wurden die Interviews wörtlich, mit Hilfe der Transkriptionssoftware F4 transkribiert. Eine Liste mit den dabei verwendeten Transkriptionszeichen befindet sich in Anhang 6. Im Ergebnis liegen pro Interview zwischen 8 und 24 Seiten (im Durchschnitt 17 Seiten) transkribierter Text vor. Während der Transkription wurden alle Personennamen, Namen der Institutionen und Orte anonymisiert.
Für die Auswertung wurden die erhobenen Daten und die Antworten zu den leitfadengestützten Interviews (Erhebungsmethoden Teil B) kategorisiert und die Ergebnisse mit Hilfe statistischer Methoden unter Zuhilfenahme von SPSS quantitativ ausgewertet. Die Kategorien folgen im Wesentlichen den Fragen der Gesprächsleitfäden, wobei ggf. mehrere thematisch korrespondierende Fragen zusammengefasst wurden. Ergänzend wurden besonders typische oder besonders aussagekräftige Zitate aus den transkribierten Interviews zu den jeweiligen Kategorien zur Veranschaulichung hinzugefügt. Die Auswertung der Sozialen Netzwerkkarten (Erhebungsmethoden Teil C) und der Unterstützungsmethoden (Teil D) erfolgten ebenfalls quantitativ mit ergänzenden Zitaten. Zusätzlich wurden markante Themen der Interviews herausgearbeitet und einzelne Fallvignetten erstellt, um auch die qualitative Dimension der erhobenen Informationen auszuschöpfen.
Inhaltsverzeichnis
- 8.1 Ergebnisse zur Untersuchungsgruppe
- 8.2 Ergebnisse zur Zufriedenheit der Eltern mit der kindbezogenen Hilfe
- 8.3 Zufriedenheit mit der Hilfe im Alltag
- 8.4 Ergebnisse zur familiären Lebensqualität (FQoL)
- 8.5. Erfahrungen mit dem Jugendamt
- 8.6. Ergebnisse zu den Fremdunterbringungen
- 8.7 Ergebnisse zum sozialen Netzwerk
- 8.8 Methoden der Unterstützung
Zunächst werden Informationen zur genaueren Kennzeichnung der Familien gegeben. Diese ergeben sich zum Teil aus den zugrunde gelegten Auswahlkriterien und wurden dann im Vorgespräch mit Fachkräften erhoben, zum Teil entstammen sie den Interviews mit den Eltern.
Betreuungs- und Wohnform der Familien
Von den 22 interviewten Familien werden 14 Familien ambulant und acht Familien stationär betreut. Die Untersuchungsgruppe setzt sich zusammen aus 12 allein erziehenden Müttern, die jeweils zur Hälfte ambulant und stationär betreut werden, und sieben Elternpaaren, die ihre Kinder gemeinsam erziehen. Von den sieben gemeinsam erziehenden Elternpaaren werden zwei Familien stationär und fünf ambulant betreut. Drei Mütter, deren Kinder alle fremdplatziert sind, leben ohne Kinder mit einem neuen Partner zusammen.
Tab. 1 : Wohnform der befragten Familien
|
Form der Betreuung |
||||
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Mutter allein erziehend |
6 |
6 |
12 |
54,5 |
|
Eltern gemeinsam erziehend |
5 |
2 |
7 |
31,8 |
|
Mutter ohne Kind(er) mit neuem Partner |
3 |
0 |
3 |
13,6 |
|
Häufigkeit |
14 |
8 |
22 |
100 |
|
Prozent |
63,6 |
36,4 |
100 |
Alter der Eltern
Die interviewten Eltern waren zum Zeitpunkt des Interviews im Alter zwischen 22 und 51 Jahren, das Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre.
Anzahl der Kinder
Die 22 Elternteile bzw. -paare haben insgesamt 39 Kinder. Von den 22 Eltern(teilen) haben
zehn Eltern ein Kind und acht Eltern haben zwei Kinder. Drei Eltern haben drei Kinder und eine
Mutter hat vier Kinder (die durchschnittliche Kinderzahl beträgt 1,8 Kinder).
Tab. 2: Anzahl der Kinder pro Familie
|
Anzahl der Kinder pro Familie |
Häufigkeit |
Prozent |
|
1 Kind |
10 |
45,5 |
|
2 Kinder |
8 |
36,4 |
|
3 Kinder |
3 |
13,6 |
|
4 Kinder |
1 |
4,5 |
|
Gesamt |
22 |
100 |
Alter und Wohnort der Kinder
Fast die Hälfte der 39 Kinder (46%) sind im Alter von null bis fünf Jahren. 12 Kinder sind zwischen sechs und zehn Jahre alt, neun Kinder sind 11 Jahre und älter (ein Kind ist schon erwachsen).
Acht der 22 Familien sind von einer Fremdplatzierung eines oder mehrerer Kinder betroffen: 14 der 39 Kinder (35,8%) leben nicht bei ihren leiblichen Eltern, sondern sind fremdplatziert. Von den fremdplatzierten Kindern leben 7 Kinder in einer Pflegefamilie, fünf Kinder bei der Herkunftsfamilie der Eltern und zwei Kinder in einem Heim[5].
Tab.3: Alter und Wohnort der Kinder
|
Wohnort der Kinder |
||||||||
|
Alter der Kinder |
Leibliche Mutter |
Beide Elternteile |
Pflegefamilie |
Herkunftsfamilie |
Heim |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
0-2 Jahre |
7 |
3 |
0 |
1 |
0 |
11 |
28,2 |
}46,1% |
|
3-5 Jahre |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
17,9 |
|
|
6-10 Jahre |
2 |
3 |
3 |
4 |
0 |
12 |
30,8 |
|
|
ab 11 Jahre |
4 |
1 |
2 |
0 |
2 |
9 |
23,1 |
|
|
Häufigkeit |
16 |
9 |
7 |
5 |
2 |
39 |
100 |
|
|
Prozent |
41,0 |
23,1 |
17,9 |
12,8 |
5,1 |
100 |
||
|
= 64,1% |
= 35,8 % |
Psychosoziale Situation der Eltern
Die Ergebnisse zur psychosozialen Situation der Eltern wurden nicht ausdrücklich erfragt, sondern ergaben sich aus dem freien Interviewteil. Somit stellen sie eine Mindestgröße dar.
|
Häufigkeit* |
Prozent |
|
|
Elternteil körperbehindert/ chronisch krank |
6 |
27,3 |
|
Elternteil psychisch belastet/ mit Suchtproblematik |
8 |
36,4 |
|
Mütter von Gewalterfahrung betroffen |
7 |
31,8 |
|
Elternteil aus problematischer Herkunftsfamilie |
13 |
59,1 |
*Mehrfachzuordnungen
Zu erkennen ist, dass gut ein Viertel der Elternteile mit einer Körperbehinderung oder einer chronischen Erkrankung lebt. Etwas mehr als ein Drittel der Elternteile berichten von einer psychischen Belastung/ Erkrankung bzw. von ihrer Psychiatrieerfahrung und/ oder einer Suchtproblematik. Mindestens sieben der 22 Mütter, also fast ein Drittel, sind nach ihren Angaben von Gewalterfahrungen seitens der Väter ihrer Kinder betroffen. Fast 60% der Eltern haben selbst eine problematische Herkunft und thematisieren mindestens einen der folgenden Punkte:
-
Problematische Beziehung zu ihrer oft großen Herkunftsfamilie (mit vielen Geschwistern), Beziehungsabbruch zu ihren Eltern;
-
schwierige Kindheit mit alkoholkranken Eltern;
-
Herkunftseltern, die ebenfalls Familienhilfe in Anspruch nehmen/genommen haben und unter gesetzlicher Betreuung stehen, Erfahrungen mit dem Jugendamt haben;
-
eigene Heimaufenthalte in der Kindheit.
Auf einige Eltern treffen mehrere der in Tab. 4 genannten Punkte zu, so dass eine Kumulierung von Risikofaktoren auftritt (vgl. Tab. 5).
Tab. 5: Anzahl und Häufigkeit der psychosozialen Belastungen
|
Anzahl der Belastungen |
Häufigkeit |
|
Keine |
2 |
|
1 |
10 |
|
2 |
7 |
|
3 |
2 |
|
4 |
1 |
|
Gesamt |
22 |
Nur bei zwei der interviewten Eltern(teile) wird keine der genannten Belastungen erwähnt, in einer Familie waren alle vier Belastungen vorhanden.
Entwicklungssituation der Kinder
Gut 50% der Kinder gelten als sog. Regelkinder ohne Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen. 15 der 39 Kinder (fast 40%) werden als entwicklungsauffällig bezeichnet. Hierunter fallen die Kinder, von denen wir erfahren haben, dass sie seit der Geburt beeinträchtigt sind (dies waren 5 Kinder), die auf Förderschulen gehen, sowie auch die Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule als Kinder mit besonderem Förderbedarf gelten. Über die restlichen 10% haben wir keine Angaben erhalten.
Prozent
Tab. 6: Entwicklungssituation der Kinder
|
Besonderer Förderbedarf |
Häufigkeit |
Prozent |
|
Ja |
15 |
38,5 |
|
Nein |
20 |
51,3 |
|
fehlende Angaben |
4 |
10,3 |
|
Gesamt |
39 |
100 |
Folgendes Diagramm zeigt das Alter der Kinder bzgl. einer sog. Beeinträchtigung/ eines besonderen Förderbedarfs (N=35):
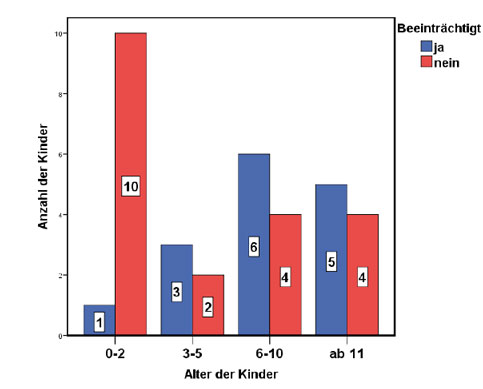
Abb. 4: Entwicklungssituation und Alter der Kinder
Interpretation
Der Anteil der fremdplatzierten Kinder liegt mit 35,8% einige Prozentpunkte niedriger als in einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2005 (vgl. Pixa-Kettner 2007), was mit einem höheren Anteil von jüngeren Kindern in der vorliegenden Stichprobe ebenso zu erklären wäre wie mit der Auswahl der interviewten Eltern über die auf Elternschaft spezialisierten Unterstützungsdienste.
Die Zahlen hinsichtlich der psychosozialen Situation der Familien bestätigen Ergebnisse vorangegangener Untersuchungen, wonach Eltern mit Lernschwierigkeiten oftmals aus Herkunftsfamilien mit vielfältigen Belastungen kommen und häufig kein intaktes Elternhaus erlebt haben (vgl. z.B. Llewellyn & McConnell 2010, Pixa-Kettner & Bargfrede 2004). Ebenso bestätigen die Ergebnisse, dass der Faktor "Eltern mit Lernschwierigkeiten" selten isoliert, sondern in vielen Fällen in Kombination mit anderen Risikofaktoren auftritt. Angesichts dieser Hintergrundbedingungen ist es nicht verwunderlich, dass mit 5 von 39 Kindern (das entspricht 12,8%) relativ viele Kinder bereits bei der Geburt als behindert diagnostiziert wurden. Ein höherer Anteil organi21 scher Beeinträchtigungen der Kinder von Eltern mit Lernschwierigkeiten war auch in internationalen Studien zu finden (vgl. z.B. McConnell u. a. 2003) und wird mit dem schlechteren gesundheitlichen Status der Mütter sowie mit einer schlechteren medizinischen Versorgung in der Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Eine dennoch unauffällige Entwicklung von gut der Hälfte der Kinder steht ebenfalls in Einklang mit internationalen Studien (z.B. Faureholm 2010, McGaw 2004, 220f). Die Anzahl der entwicklungsauffälligen Kinder steigt in der Altersstufe der Kindergarten- und Grundschulkinder. Dies ist zum Einen dadurch zu erklären, dass mit Eintritt in die Kita oftmals erst Entwicklungsverzögerungen deutlich werden; zum Anderen werden Kinder von Eltern mit Lernschwierigkeiten vermutlich zum Teil präventiv aufgrund ihres familiären Hintergrunds als Kinder mit besonderem Förderbedarf eingestuft.
Nach der Zufriedenheit mit der Hilfe, die auf die Kinder bezogen ist bzw. war, haben wir mit verschiedenen Einzelfragen gefragt. Diese waren auf folgende Themen bezogen: Versorgung, Pflege und Förderung des Kindes, Kinderkrankheiten, Arztbesuche, Erziehungsfragen, Kontakt zu Kita und Schule. Zum besseren Verständnis haben wir unsere Fragen zum Teil sehr detailliert und situationsbezogen gestellt. Bei der Darstellung der Ergebnisse fassen wir einzelne Fragen zusammen.
Zufriedenheit mit der aktuellen professionellen Hilfe
Nachfolgende Tabelle zeigt die Zufriedenheit stationär und ambulant betreuter Eltern mit der professionellen Hilfe, die sie aktuell bei der Versorgung, Förderung und Erziehung ihres Kindes erhalten. Diese Fragestellung war nur für 19 Befragte zutreffend, da die drei Frauen, deren Kinder alle fremdplatziert sind, keine auf das Kind bezogenen Hilfen erhalten. Es ist eine hohe Zufriedenheit mit der professionellen Hilfe zu verzeichnen: Fast drei Viertel der Eltern (14) äußern, dass sie mit der professionellen Hilfe, die sie erhalten, insgesamt zufrieden sind; ein Viertel äußert sich eher unzufrieden.
Tab. 7. Zufriedenheit mit der aktuellen Hilfe bei der Versorgung, Förderung und Erziehung der Kinder
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
||
|
ohne jede Einschränkung zufrieden mit der professionellen Hilfe |
5 |
5 |
10 |
52,6 |
|
|
insgesamt zwar zufrieden mit der professionellen Hilfe, aber mit Einschränkungen |
3 |
1 |
4 |
}73,7 |
|
|
insgesamt unzufrieden mit der professionellen Hilfe |
3 |
2 |
5 |
47,4 |
26,3 |
|
Gesamt |
11 |
8 |
19 |
100 |
100 |
Betrachtet man die neun Eltern(teile) (fast die Hälfte der befragten), die nur mit Einschränkungen zufrieden bzw. insgesamt unzufrieden mit der professionellen Hilfe sind, näher, so werden hierfür verschiedene Gründe genannt, die sich bei einigen Eltern(teilen) summieren (vgl. Tab. 8). Sechs Eltern(teile) akzeptieren zwar, dass eine professionelle Unterstützung notwendig ist, empfinden diese jedoch als Einmischung und Kontrolle. Das ist fast ein Drittel der befragten Elternteile. Hier überwiegt deutlich der Anteil der ambulant betreuten Eltern gegenüber den stationär betreuten Familien. Vier Eltern(teile) sind unzufrieden mit der bei ihnen arbeitenden Fachkraft oder der Art der Unterstützung.
|
ambulant |
stationär |
Gesamt |
Prozent* |
|
|
ambivalent: professionelle Hilfe ist nötig, aber wird auch als Kontrolle, Einmischung empfunden |
5 |
1 |
6 |
31,6 |
|
zum Teil unzufrieden mit der Fachkraft und/ oder der Art der Unterstützung |
2 |
2 |
4 |
21,1 |
|
zum Teil unzufrieden mit der professionellen Hilfe, wegen zu vieler verschiedener Ansagen |
1 |
2 |
3 |
15,8 |
*Die Prozentzahlen sind auf alle 19 befragten Eltern(teile) bezogen (Mehrfachzuordnungen waren möglich)
Drei Eltern(teile) formulieren, dass sie unzufrieden darüber sind, dass die Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten, unterschiedliche Ansagen machen, so dass es keine klaren Anweisungen gibt, wie die Eltern sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Dies ist für die betroffenen Eltern verwirrend, was Frau Ibach folgendermaßen ausdrückt:
"(...) einige hatten gesagt, ich dürfte stillen, ja, schön (LACHT), andere sagten, ich dürfte nicht stillen, da hab ich gesagt, ja was ist denn nun?".
Herr Olbrich formuliert dies so:
"Und die Betreuer müssten auf jeden Fall sich mal einklängig sein, was überhaupt richtig und was falsch ist, weil jeder hat seine eigene Meinung hier."
In folgendem Interviewausschnitt beschreibt Frau Reuter, die ambulant unterstützt wird, ihre Überforderung mit zu vielen verschiedenen Unterstützer_innen und unterschiedlichen Anweisungen:
Frau Reuter: Das ist, ich brauch Hilfe, aber, das ist zu viele (5 SEK. UNV.) bei mir eindichtet (3 SEK. UNV.) dann, ist das alles neblig für mich.
Interviewerin: Wenn zu viele Leute hier immer hinkommen?
Frau Reuter: Ja.
Interviewerin: Und viele verschiedene Sachen?
Frau Reuter: Andere sagt dies, andere sagt das, andere sagt dies, dann krieg ich Wolken, und dann geh ich raus einfach in Park, und eine rauchen, dass ich echt klare Kopf habe.
Interviewerin: Ja, verstehe.
Frau Reuter: Das ist jetzt der redet, eine Ton, und, ph, ich versteh das überhaupt nicht, paar Wörter ist für mich schwierig ist.
Interviewerin: Ja.
Frau Reuter: Ich sag, hä. was will der von mir denn überhaupt? (LACHT)
Unabhängig von der Beurteilung der professionellen Hilfe kritisieren vier Eltern(teile), dass sich ihr privates Netzwerk zu sehr in die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder einmischt. Dies betrifft im stationären Rahmen die Mitbewohnerinnen/ andere Eltern; im ambulanten Rahmen wird hier auf die Herkunftsfamilie Bezug genommen.
Zufriedenheit mit der professionellen Hilfe früher
Der Grad Zufriedenheit mit der Hilfe, die die Eltern früher erhalten haben, ist deutlich geringer als die Zufriedenheit mit der aktuellen Hilfe. "Früher" umschreibt dabei einen individuell unterschiedlichen Zeitraum. Dieser kann relativ kurz zurückliegen (z.B. bei jüngeren Kindern die Zeit direkt nach der Geburt) oder länger (z.B. die Erfahrungen mit einem inzwischen älteren Kind).
Nur 23% der Eltern äußern sich als insgesamt zufrieden mit der früher erhaltenen Hilfe. Auffällig ist, dass über die Hälfte der Befragten angibt, keine (passende) Hilfe erhalten zu haben.
Tab. 9: Zufriedenheit mit der kindbezogenen Hilfe "früher"
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
||
|
insgesamt zufrieden mit der professionellen Hilfe |
4 |
1 |
5 |
22,7 |
|
|
ambivalent: Hilfe nötig, aber in der Form nicht erwünscht (zu viel; Ablehnung des Jugendamtes) |
3 |
0 |
3 |
13,6 |
|
|
keine passende Hilfe (Mutter-Kind-Heim, Überforderung durch zu viele verschiedene Hilfen) |
3 |
6 |
9 |
40,9 |
|
|
"Ich hatte leider keine Hilfe" |
2 |
1 |
3 |
13,6 |
}54,5 |
|
Hilfe nicht erwünscht |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
|
fehlende Angaben |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Untersucht man den Zusammenhang zwischen der erhaltenen Hilfe und der Frage, ob die Kinder fremdplatziert wurden (s.Tab.9), überrascht folgendes Ergebnis nicht: Von den acht Familien, die von einer Fremdplatzierung betroffen sind, gaben drei Familien an, gar keine Hilfe, vier Familien keine passende Hilfe erhalten zu haben und eine Familie steht der damals erhaltenen Hilfe ambivalent gegenüber.
Tab. 10 : Zufriedenheit mit der kindbezogenen Hilfe früher und Fremdplatzierung der Kinder
|
Zufriedenheit früher |
Von Fremdplatzierung betroffen? |
|||
|
Häufigkeit |
Prozent |
Ja |
Nein |
|
|
insgesamt zufrieden mit der professionellen Hilfe |
5 |
22,7 |
0 |
5 |
|
ambivalent: Hilfe nötig, aber in der Form nicht erwünscht (zu viel; Ablehnung des Jugendamtes) |
3 |
13,6 |
1 |
2 |
|
keine passende Hilfe (Mutter-Kind-Heim, Überforderung durch zu viele verschiedene Hilfen) |
9 |
40,9 |
4 |
5 |
|
ich hatte leider keine Hilfe |
3 |
13,6 |
3 |
0 |
|
Hilfe nicht erwünscht |
1 |
4,5 |
0 |
1 |
|
fehlende Angaben |
1 |
4,5 |
0 |
1 |
|
Gesamt |
22 |
100 |
8 |
14 |
Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule
Zu der Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule haben wir von 15 Familien Angaben erhalten (zwei Angaben fehlen; für die anderen Familien war diese Frage nicht zutreffend, da sie aufgrund der Fremdplatzierung oder des Alters des Kindes [noch] keine Erfahrung in diesem Bereich haben).
Von den 15 Eltern(teilen) äußert sich der Großteil (73%) als zufrieden mit der Hilfe. In einem Fall ist keine Hilfe nötig; drei Eltern(teile) formulieren, dass sie unzufrieden sind, da sich die Fachkräfte zu sehr in diesen Bereich einmischen.
Tab. 11: Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
keine Hilfe nötig |
1 |
6,7 |
|
Zufrieden |
11 |
73,3 |
|
unzufrieden, Helfer_innen mischen sich ein |
3 |
20,0 |
|
Gesamt |
15 |
100 |
25% aller 22 Eltern(teile) äußern ihre Sorgen und Gedanken darüber, dass sie ihren Kindern später nicht bei den Hausaufgaben werden helfen können, und ihre damit zusammenhängendevAngst vor einer Fremdunterbringung. So formuliert Herr Uhlenbrock:
Herr Uhlenbrock: Nee, mein anderes Problem, dass später mal, weil wir ja, weil wir alles können, so ne, wir können nicht lesen und schreiben, dass, dass wir da noch Unterstützung kriegen, mit Hausaufgaben machen.
Interviewerin: Ja. Das wünschen Sie sich?
Herr Uhlenbrock: Ja.
Interviewerin: Ja. Das gibts ja bestimmt.
Herr Uhlenbrock: Das will ich, ich will nicht den Pflegeeltern geben, oder da, wo die andere ist. [...]
Interviewerin: Nee. Sie wollen, dass Maik bei ihnen lebt//
Her Uhlenbrock: Ja.
Interviewerin: und Sie brauchen ein bisschen Hilfe.
Herr Uhlenbrock: Bei der, bei der, dass da immer so Lehrer kommt dann und Hausaufgaben macht.
Interviewerin: Hhm, ja. Das gibts doch aber auch, ne.
Frau Nauke spricht über ihr Bedauern darüber, dass sie ihrem Sohn aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten nicht selbst in der Schule helfen kann:
"Also ich kann ihm da nicht helfen, obwohl ich´s gerne möchte. Aber ich kann´s halt nicht, weil ich bin auf die Sonderschule gegangen. (...)"
Begleitung bei kindbezogenen Terminen
Die Frage, ob die Eltern Begleitung bei Terminen erhalten und wie zufrieden sie damit sind, bezog sich auf unterschiedliche Bereiche, z.B. Arztbesuche, Termine in der Schule u.ä. Der Großteil der Eltern (über 82%) zeigt sich zufrieden mit der Situation: Entweder sie benötigen keine Begleitung von professioneller Seite, da sie dies privat organisieren, oder aber sie erhalten bei Bedarf Begleitung und beurteilen dies positiv. Drei Eltern(teile) äußern Kritik, dass sie ihre Termine lieber ohne Begleitung einer Fachkraft wahrnehmen würden, dies aber nicht zugelassen wird. Vergleicht man in dieser Frage die Zufriedenheit der ambulant und stationär betreuten Eltern, ist zu erkennen, dass die stationär betreuten Eltern alle bei bestimmten Terminen die Begleitung einer Fachkraft erhalten (in zwei Fällen unerwünscht). Die fünf Eltern(teile), die ihre Termine alleine bewältigen, werden alle ambulant betreut.
Tab.12: Begleitung bei kindbezogenen Terminen
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
||
|
keine professionelle Hilfe nötig, machen wir privat |
5 |
0 |
5 |
22,7 |
|
|
gut, wenn eine Fachkraft mitkommt |
7 |
6 |
13 |
59,2 |
} 81,9% |
|
ich möchte keine Begleitung, aber darf zum Teil nicht ohne |
1 |
2 |
3 |
13,6 |
|
|
fehlende Angaben |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Interpretation
Die unterschiedliche Zufriedenheit mit der aktuellen und der früheren Hilfe kann so gedeutet werden, dass das in den letzten 10 bis 15 Jahren spürbar ausgebaute Angebot der speziellen Hilfen für Eltern mit Lernschwierigkeiten inzwischen bei diesen Eltern angekommen ist, immerhin berichten 12 Eltern(teile), dass sie früher gar keine (3) oder keine passende (9) Hilfe erhalten hätten. Allerdings ist auch denkbar, dass es den Eltern leichter fällt, sich rückblickend kritisch zu äußern. Was ihre aktuelle kindbezogene Unterstützung angeht, wird von etwa einem Viertel der Befragten Kritik geübt, wobei u. a. unerwünschte Einmischung bzw. Bevormundung moniert und mehr Autonomie bei der Wahrnehmung von Terminen gewünscht werden.
Unsere Fragen nach der Zufriedenheit mit der Hilfe im Haushalt umfassten die Bereiche Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen etc., Wohnung kindersicher einrichten bzw. Wohnung renovieren, sowie auch Zeitplanung und Geldeinteilung.
Hilfe bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt
Gut 30 % der Eltern geben an, dass sie die alltäglichen Aufgaben im Haushalt ohne professionelle Hilfe erledigen (dies sind, bis auf eine Familie, alles ambulant betreute Eltern). Der Rest der Familien äußert sich zufrieden mit der Hilfe, die sie erhalten, mit Ausnahme einer stationär betreuten Mutter, die über fehlende Hilfe beim Einkaufen klagt.
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
keine professionelle Hilfe nötig |
6 |
1 |
7 |
33,3 |
|
zufrieden mit der Hilfe |
7 |
6 |
13 |
61,9 |
|
zu wenig Hilfe* |
0 |
1 |
1 |
4,8 |
|
Gesamt |
13 |
8 |
21** |
100 |
*Die Mutter benötigt Begleitung beim Einkaufen, sie ist beim Einkaufen mit ihrem Baby überfordert.
** Diese Frage bezieht sich nur auf 21 Familien, da eine Mutter, deren Kinder fremdplatziert sind, zur Zeit nur im Rahmen der gesetzlichen Betreuung Unterstützung erhält.
Hilfe bei der Geldeinteilung
Bis auf eine Familie erhalten alle Familien Hilfe bei der Geldeinteilung. Über 60% der Eltern äußern sich zufrieden damit. Die Hälfte der stationär betreuten Eltern klagt über zu wenig Taschengeld. Zwei ambulant betreute Eltern halten die Hilfe zwar für nötig, empfinden sie jedoch als unangenehme Kontrolle und Einmischung. Eine stationär betreute Familie erhält zu wenig Hilfe und äußert Bedarf nach mehr Unterstützung beim Sparen.
Tab.14: Hilfe bei der Geldeinteilung
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
keine Hilfe nötig |
0 |
1 |
1 |
4,5 |
|
zufrieden mit der Hilfe |
12 |
2 |
14 |
63,6 |
|
unzufrieden: zu wenig Taschengeld |
0 |
4 |
4 |
18,2 |
|
ambivalent: Kontrolle/ Einmischung nötig, aber unangenehm |
2 |
0 |
2 |
9,1 |
|
zu wenig Hilfe |
0 |
1 |
1 |
4,5 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Zufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung
18 der 22 Familien stehen in Bezug auf ihre Finanzen unter gesetzlicher Betreuung, der Großteil äußert sich hiermit als zufrieden. Vier Familien, die alle ambulant unterstützt werden, beschreiben sogar, dass die gesetzliche Betreuerin für sie eine große Unterstützung in vielen Lebensbereichen darstellt/e, nicht nur bezüglich finanzieller Fragen (z.B. als Gesprächspartnerin, emotionale Unterstützung, als die Kinder fremduntergebracht wurden). Drei Familien sind zur Zeit unzufrieden und vermissen ihre frühere gesetzliche Betreuerin (Wechsel wegen Umzug in die stationäre Einrichtung bzw. in einem Fall Umzug, um in der Nähe der fremdplatzierten Kinder zu sein). Für eine Familie ist die gesetzliche Betreuung keine große Hilfe, hier besteht der Wunsch nach mehr Hilfe beim Sparen.
Tab.15: Zufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
keine gesetzliche Betreuung nötig |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
gute Hilfe |
10 |
4 |
14 |
63,7 |
|
ich vermisse meine alte gesetzliche Betreuerin |
1 |
2 |
3 |
13,6 |
|
keine große Hilfe, ich brauche mehr Hilfe beim Sparen |
0 |
1 |
1 |
4,5 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Interpretation
Mit der alltäglichen Unterstützung äußern die befragten Eltern im Großen und Ganzen hohe Zufriedenheit. Kritische Anmerkungen bezüglich zu geringer Unterstützung sind sehr selten. Allerdings formulieren immerhin zwei ambulant unterstützte Familien Kritik hinsichtlich der mit der Unterstützung verbundenen Einmischung in ihre Privatsphäre. Die Knappheit finanzieller Ressourcen wird nur von stationär unterstützten Eltern kritisch erwähnt, dort immerhin von der Hälfte der Befragten, die hier vermutlich Handlungsspielraum vermissen. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Eltern ihre gesetzliche Betreuung nicht als Einschränkung, sondern als gute Hilfe erlebt.
Nachfolgend stellen wir die Ergebnisse zur familiären Lebensqualität vor. Hierunter fallen folgende Bereiche:
-
Finanzielle Situation
-
Berufliche Situation
-
Wohnsituation
-
Gesundheitliche Situation
-
Freizeitangebote/ Urlaubsgestaltung und Weiterbildung für die Eltern
-
Teilhabe an Angeboten im Stadtteil
-
Entlastung der Eltern (Babysitten)
a) Finanzielle Situation
Etwas mehr als die Hälfte der Familien äußert sich als insgesamt zufrieden mit ihrer finanziellen Situation, fast ein Drittel der Familien als eher unzufrieden (drei fehlende Angaben). Bei den Familien mit ambulanter Betreuung überwiegt die Zufriedenheit, wohingegen die Mehrheit der Familien, die in stationärer Betreuung leben, sich eher unzufrieden äußern, wie es sich bereits in dem vorangegangenen Punkt abzeichnete.
Tab.16: Finanzielle Situation
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
eher zufrieden |
10 |
2 |
12 |
54,5 |
|
eher unzufrieden |
2 |
5 |
7 |
31,8 |
|
fehlende Angaben |
2 |
1 |
3 |
13,6 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
b) Berufliche Situation
Zufriedenheit der Kindesmütter
Von den 20 Müttern, von denen wir Angaben zu der Zufriedenheit mit ihrer beruflichen Situation erhalten haben, sind vier Mütter nicht berufstätig. Die sieben Mütter, die zum Zeitpunkt der Befragung in Elternzeit waren, haben wir zu ihrer beruflichen Situation vor und ihren Perspektiven nach der Elternzeit befragt und entsprechenden Kategorien in der Tabelle zugeordnet (somit gibt es 27 Zuordnungen).
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit* |
Prozent |
|
|
zufrieden, keine WfB |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
rundum zufrieden in der WfB |
1 |
5 |
6 |
27,3 |
|
zufrieden in der WfB, weil "Hauptsache Arbeit" |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
Unterstützungsbedarf, Arbeit "draußen" zu finden |
4 |
1 |
5 |
22,7 |
|
in Elternzeit |
4 |
3 |
7 |
31,8 |
|
nicht berufstätig |
4 |
0 |
4 |
18,2 |
|
fehlende Angaben |
1 |
1 |
2 |
18,2 |
*Mehrfachzuordnungen
Eine Mutter arbeitet nicht in der WfB, sondern ist auf dem freien Arbeitsmarkt beschäftigt. Sechs Mütter geben an, mit ihrer Arbeit in der WfB rundum zufrieden zu sein und sich nichts anderes zu wünschen. Vier Mütter sind froh, überhaupt eine feste Anstellung zu haben, und schätzen die Sicherheit in der WfB. Fünf Mütter formulieren auf Nachfragen, dass sie Interesse an einer Arbeit auf dem freien Arbeitsmarkt hätten, hierfür aber mehr Unterstützung benötigen ürden, wie zum Beispiel in folgendem Interviewausschnitt mit Frau Nauke deutlich wird:
Interviewerin: Naja, ein anderer Job wär ja auch vom Geld her interessanter, ne?
Frau Nauke: Richtig, ne.
Interviewerin: Aber es ist schwierig. Ja.
Frau Nauke: Ist schwierig. Und ich denk mir auch, äh, wenn man draußen das nochmal versuchen würde, dann müssten das zwar schon Leute sein, die sich da ein bisschen Mühe mit einem geben, dass man das dann doch irgendwie dann doch kapieren tut, ne.
Interviewerin: Ja, die sich echt auch ein bisschen Zeit nehmen, und die das//
Frau Nauke: Ja. Aber ich denk mal, solche Leute gibt´s nicht.
Interviewerin: Ja ich weiß nicht, wie das hier ist, also es gibt ja schon auch solche Hilfen, ne, (,,,)Aber da brauch man eben so ´n Dienst//
Frau Nauke: Ja, richtig.
Interviewerin: der einen da ein bisschen unterstützt.
Frau Nauke: Hmh, stimmt. Ja bei uns haben ja auch schon öfters welche woanders angefangen, und dann haben sie es doch nicht geschafft, oder, dann sind sie wieder gekommen. Ne, ja.
Interviewerin: Ja, wahrscheinlich gibt es auch so ne bestimmte Sicherheit, ne, in der Werkstatt, da kennt man sich dann aus.
Frau Nauke: Richtig.
Interviewerin: Aber es ist irgendwie auch langweilig vielleicht, ne, oder nicht so anspruchsvoll.
Frau Nauke: Naja, gut, wir haben unsere Ecke, wo wir sitzen, mit unseren Freundinnen und so.
Interviewerin: Ahja, na gut, das ist auch viel wert!
Frau Nauke: Genau! (...)
Zufriedenheit der Kindesväter
Wir haben von fünf der sieben befragten Väter Angaben zu ihrer beruflichen Situation erhalten, von denen zwei Väter langzeitarbeitslos sind. Ein Vater äußert sich als rundum zufrieden in der WfB; zwei Väter äußern Lust und Interesse, außerhalb der WfB zu arbeiten, sehen diesbezüglich aber keine Perspektiven, so formuliert Herr Uhlenbrock:
Interviewerin: Und Sie wollen auch den Beruf beibehalten, oder hätten Sie auch Lust, was anderes zu machen?
Herr Uhlenbrock: Ich würde gern was anderes machen gerne. Aber wer nimmt mich durch meine Behinderung?
Interviewerin: Ja, ist schwierig.
Herr Uhlenbrock: Hmh.
Tab.18: Zufriedenheit der Kindesväter mit ihrer beruflichen Situation
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
rundum zufrieden in der WfB |
1 |
0 |
1 |
14,3 |
|
Unterstützungsbedarf, Arbeit "draußen" zu finden |
0 |
2 |
2 |
28,6 |
|
arbeitslos, verschiedene Gründe, z.B. Krankheit |
2 |
0 |
2 |
28,6 |
|
fehlende Angaben |
2 |
0 |
2 |
28,6 |
|
Gesamt |
5 |
2 |
7 |
100 |
c) Wohnsituation
Bei der Darstellung der Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der Wohnsituation haben wir neben der Kategorie "zufrieden - unzufrieden" auch die Kategorie "Wohnort frei gewählt - nicht frei gewählt" entwickelt, da uns dieser Aspekt in den Interviews mehrfach begegnet ist. So ist es bei allen Eltern, die stationär betreut werden, nicht ihre freie Wahl gewesen, in die stationäre Einrichtung zu ziehen. Herr Uhlenbrook formuliert dies so:
Interviewerin: Ach es hieß schon, das Kind soll wegkommen, oder?
Herr Uhlenbrock: Ja.
Interviewerin: Von wem aus?
Herr Uhlenbrock: Von das Jugendamt. Weil wir doch ja behindert sind, wir können nicht lesen und schreiben. Und damit wir das besser machen können, sind wir hierher gezogen.
Interviewerin: Ahja, dann hat jemand gesagt, es gibt in X., Sie können nach X. ziehen und dann können Sie Maik behalten?
Herr Uhlenbrock: Ja.
Dennoch geben mit Ausnahme eines Eltern(teils) alle an, zurzeit zufrieden mit ihrer Wohnsituation zu sein. Allerdings ist für alle stationär betreuten Familien das Ziel, in eine eigene Wohnung zu ziehen, wie z. B. für Frau Pape:
Interviewerin: Also Sie, darf ich nochmal fragen, so mit dieser Hilfe, wie es hier (...), wie es in X. ist, sind Sie eigentlich zufrieden hier, dass Sie jetzt hier sein können?
Frau Pape: Hmh.
Interviewerin: Und warum wollen Sie gerne wieder wegziehen?
Frau Pape: Ja, ich möchte selbständig sein, und ich sagen, das ist mein Bereich, und mein Kind!
Tab.19 : Wohnsituation
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
zufrieden, frei gewählt |
10 |
0 |
10 |
45,5 |
|
zufrieden, aber nicht frei gewählt |
0 |
7 |
7 |
31,8 |
|
zufrieden mit der Wohnung, aber Ärger mit den Nachbarn |
2 |
0 |
2 |
9,1 |
|
unzufrieden, zu nah am Büro der Betreuer (aber frei gewählt) |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
unzufrieden, weil nicht frei gewählt |
1 |
1 |
2 |
9,1 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Von den ambulant betreuten Eltern sagen gut zwei Drittel, dass sie mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. Zwei Familien berichten von Ärger mit ihren Nachbarn, einer Familien liegt die Wohnung zu nah am Büro des Trägers, der sie unterstützt (Gefühl der Kontrolle), und eine Familie hat ihren Wohnsitz nicht frei gewählt, sondern wohnt zur Zeit nur übergangweise in der Wohnung, um in der Nähe der fremdplatzierten Kinder zu sein.
d) Gesundheitliche Situation
Wie unter Punkt 8.1 (Tab. 4) berichtet, lagen bei mindestens sechs Elternteilen (27,3%) eine körperliche Behinderung oder eine chronische Erkrankung vor und bei 8 Elternteilen (36,4%) eine psychische Belastung und/ oder Suchtproblematik. Um zu erfahren, ob die Eltern im Falle einer akuten Erkrankung ausreichende Unterstützung haben, wurde ihnen die Frage gestellt, ob sie Hilfe haben, wenn sie selbst einmal krank sind oder wenn sie unglücklich sind. Der Großteil (gut 70%) beurteilt die Situation im Falle einer eigenen Erkrankung als unproblematisch: Acht Befragte gaben an, dass die Fachkräfte sie im Krankheitsfall unterstützen (Begleitung zum Arzt, Entlastung im Haushalt und mit den Kindern oder als Gesprächspartner_in), wie z.B. Herr Franke in folgendem Interviewausschnitt formuliert:
Interviewerin: Jetzt nochmal was anderes, Eltern sind ja auch nur Menschen, Eltern können auch mal krank werden, Eltern können mal unglücklich sein oder auch miteinander Streit haben, gibt es denn irgend ´ne Anlaufstelle, wo Sie hinkönnen?
Herr Franke:(...)Unterstützung da, einfach Unterstützung da. Also das merken dann schon unsere Betreuer, und die sagen dann schon, ne, du, äh, lass uns mal zusammensetzen, ne. (...) Oder die helfen uns auch, wenn wir flach liegen, die ham auch schon gesagt, wenn ihr mal beide flach liegt durch nen ganz komischen Zufall, ne, also, wir helfen denn, ne. (...) Also da ist Verlass da (...). Da hast du schon Hilfen, ne, also da brauch man sich dann keinen Kopp machen.
Drei Eltern(teile) berichten von ausreichender privater Unterstützung, und vier sowohl von professioneller als auch privater Hilfe. Drei Eltern formulieren abwehrend, dass sie keine Hilfe brauchen oder möchten, wenn es ihnen schlecht geht, sondern dann alleine sein wollen. Drei Eltern(teile) geben an, dass ihnen Unterstützung fehlt bzw. gefehlt hat, wenn sie sich unglücklich fühlen, so Frau Ibach zum Beispiel:
Interviewerin: Und wenn Sie einfach mal unglücklich sind? Das kommt ja nun auch mal vor.
Frau Ibach: Ja. Desöfteren!
Interviewerin: Ja?
Frau Ibach: Jja
Interviewerin: Gibt´s dann hier jemand, mit dem Sie reden können?
Frau Ibach: (SCHWEIGT)
Interviewerin: Oder was machen Sie dann?
Frau Ibach: Nja.
Interviewer: Wenn Sie unglücklich sind.
Frau Ibach: Wenn ich mit den Leuten rede hier, dann hab ich das Gefühl, das geht wieder bababababap, und dann heißt es, ich hab was gesagt (LACHT) (SEUFTZ).
Interviewerin: Hmh. Also ist nicht so ganz einfach?
Frau Ibach: Nee nee.
Tab. 20: Hilfe bezüglich der gesundheitlichen Situation
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
||
|
zufrieden, professionelle Hilfe |
3 |
5 |
8 |
38,1 |
|
|
zufrieden, private Hilfe |
2 |
1 |
3 |
14,3 |
} 71,4 |
|
zufrieden, private und professionelle Hilfe |
4 |
0 |
4 |
19,0 |
|
|
ich möchte/brauche keine Hilfe, ich regel das alleine |
2 |
1 |
3 |
14,3 |
|
|
unzufrieden, Hilfe fehlt/ hat früher gefehlt |
2 |
1 |
3 |
14,3 |
|
|
fehlende Angaben |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
e) Freizeitangebote/ Urlaubsgestaltung und Weiterbildung für die Eltern
Für diesen Bereich wurde nach Angeboten zur Gestaltung von Wochenenden und Urlaub gefragt, außerdem nach Gruppen- und Weiterbildungsangeboten.
Angebote am Wochenende
Fast zwei Drittel der Familien äußern sich zufrieden mit der Unterstützungssituation am Wochenende (15 von 22 Eltern): 11 ambulant und zwei stationär betreute Familien haben hierbei keinen Unterstützungsbedarf; zwei stationär betreute Familien äußern sich zufrieden mit den Angeboten, die sie erhalten. Ein stationär unterstütztes Elternpaar beklagt sich über Langeweile und zu wenige Angebote am Wochenende. Eine ambulant unterstützte Mutter hingegen stört die Betreuung am Wochenende. In fünf Fällen fehlen die Angaben.
Tab. 21: Unterstützungssituation am Wochenende
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
keine professionelle Hilfe nötig (Familie, privates Netz) |
11 |
2 |
13 |
59,1 |
|
zufrieden mit den Angeboten |
0 |
2 |
2 |
9,1 |
|
zu wenig Angebote am WE |
0 |
1 |
1 |
4,5 |
|
mich/uns stört, dass es Betreuung am WE gibt |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
fehlende Angaben |
2 |
3 |
5 |
22,7 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Urlaubsangebote
Zu Urlaubsangeboten seitens der Träger - hiermit sind Familienfreizeiten sowie Kindergruppenreisen
gemeint - haben sich 14 Eltern geäußert: Neun Familien äußern sich zufrieden, vier
brauchen keine Angebote, da sie ihren Urlaub privat organisieren, und eine Mutter würde lieber
alleine mit ihrem Kind wegfahren, darf dies aber (noch) nicht.
Tab. 22: Urlaubsangebote
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
zufrieden |
9 |
40,9 |
|
brauchen wir nicht, machen wir privat |
4 |
18,2 |
|
Mutter möchte mit ihrem Kind alleine wegfahren, darf aber nicht |
1 |
4,5 |
|
fehlende Angaben |
8 |
36,4 |
|
Gesamt |
22 |
100 |
Gruppenangebote/ Weiterbildungsangebote für Eltern mit Lernschwierigkeiten
Die stationär betreuten Eltern zeigen sich bis auf einen Fall (fehlende Angabe) alle zufrieden mit den Gruppenangeboten wie Mütterfrühstück, Babymassage, Erziehungsthemen usw. Dies ist bei den ambulant betreuten Eltern anders: Hier äußern acht Familien, dass es zu wenig Angebote gebe bzw. gab. Dies betrifft zur Hälfte die drei Mütter, die von ihren Kindern getrennt leben und beklagen, dass ihnen derartige Angebote früher gefehlt haben. Drei Mütter mit älteren Kindern bedauern, dass die Gruppenangebote für Mütter sich hauptsächlich an Mütter mit Babys und Kleinkindern richten.
Tab.23: Gruppenangebote
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
mag ich nicht |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
Zufrieden |
5 |
7 |
12 |
54,5 |
|
zu wenig Angebote |
8 |
0 |
8 |
36,4 |
|
fehlende Angaben |
0 |
1 |
1 |
4,5 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
f) Teilhabe an Angeboten im Stadtteil
Sechs Eltern(teile) berichten, dass sie an Gruppenangeboten im Stadtteil, wie Bildungsangeboten,
Mutter-Kind-Treffen, Schwimmkursen o. ä. teilnehmen. Vier Eltern würden gerne an mehr
Angeboten teilnehmen, brauchen hierfür aber mehr Unterstützung. Frau Nauke beschreibt dies
in folgendem Interviewausschnitt:
Frau Nauke: Ja das hat ich dann so mitgemacht, in der Gemeinde, so, Kirche, und.
Interviewerin: In der Kirchengemeinde?
Frau Nauke: Ja, genau, da war das, da war auch so ne Krabbelgruppe, und, da war das alles so, doch.
Interviewerin: Da haben Sie sich #wohlgefühlt#?
Frau Nauke: #Aber# mh, naja gut, ich hab nicht so den Anschluss gefunden, und. Ja, weil manche Mütter, die ham sich unterhalten, und denn haste dann da gegessen, und du weißt nicht was du sagen sollst, sagste was Verkehrtes, oder sagste nichts Verkehrtes, hab ich gesagt, hälste lieber deinen Mund (LACHT) Das ist immer besser, ne. Na gut, und manchmal so, angesprochen vielleicht schon, ne, also diejenigen dann mich dann, ne. Naja, ich war da so ein bisschen gehemmt halt. Weil, ich weiß das, weil wie ich mir damals, äh, also wo ich schwanger war, so so ein Kursus mitgemacht, mit de Schwangerschaft, und dann hab ich dann immer schon mein Herz pochern gehört, öh, hoffentlich sagste nichts Verkehrtes, davor hab ich dann meistens auch so ein bisschen Angst gehabt. So vorstellen und so, obwohl es ist ja nix, ne, schlimmes halt, aber es war halt so, ne.
Interviewerin: Ja. Und in so Gruppen, ne, da mussten Sie auch alleine hingehen, kannte man niemanden, oder?
Frau Nauke: Hmh. Ja, richtig. [...]
Interviewerin: Und ist das dann einfacher, wenn jemand mitkommt in solche Gruppen?
Frau Nauke: Doch.
Interviewerin: Ahja, dann ist es nicht ganz so schwierig?
Frau Nauke: Nö, hhm.
Frau Ibach, die in einer stationären Einrichtung lebt, formuliert, dass es evtl. Berührungsängste anderer (nicht betreuter) Mütter von außen gibt, an Angeboten der stationären Einrichtung teilzunehmen:
"Manchmal fänd ich´s auch nett, wenn andere von außen dazukämen. Aber ich hab manchmal das Gefühl, die trauen sich nicht weil wir dann etwas Betreute sind. * Vielleicht haben die auch Angst davor. ** Keine Ahnung."
Vier Eltern(teile) lehnen Angebote dieser Art ab. Hiervon lehnt eine Familie jegliche Gruppenangebote ab, die anderen möchten explizit nicht an gemischten Angeboten teilnehmen.
Tab. 24: Teilhabe an Angeboten im Stadtteil
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
ich nehme gerne teil |
4 |
2 |
6 |
27,3 |
|
ich würde gerne daran teilnehmen, aber Unterstützung fehlt |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
möchte ich nicht |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
fehlende Angaben |
4 |
4 |
8 |
36,4 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
g) Entlastung als Eltern - Babysitten
Ein Punkt, nach dem wir explizit gefragt haben, der aber auch von den Müttern selbst angesprochen wurde, ist die Frage, ob die Eltern/Mütter einen Babysitter hatten/haben. Die Mütter, denen ein Babysitter fehlt/gefehlt hat (23%), betonen, dass sie dies sehr belastet habe. Bei den allein erziehenden Müttern übernehmen hauptsächlich Fachkräfte das Babysitten.
Tab.25: Babysitter und Lebensform der Familie
|
Babysitter |
||||||||
|
privat |
Fachkräfte |
fehlt |
hat damals gefehlt |
wird nicht benötigt |
Fehlende Angaben |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Mutter allein erziehend |
12 |
54,5 |
||||||
|
Eltern gemeinsam erziehend |
7 |
13,8 |
||||||
|
Mutter ohne Kind(er) mit neuem Partner |
3 |
13,6 |
||||||
|
Häufigkeit |
5 |
6 |
1 |
4 |
5 |
1 |
22 |
100 |
|
Prozent |
22,7 |
27,3 |
4,5 |
18,2 |
22,7 |
4,5 |
100 |
|
|
= 22,7 |
Setzt man die Frage des Babysitters mit der Form der Betreuung in Verbindung, fällt folgendes Ergebnis auf: Alle stationär betreuten Eltern, die einen Babysitter nutzen oder genutzt haben, geben an, hierfür die Hilfe von Fachkräften in Anspruch zu nehmen. Dies liegt im stationären Rahmen nahe. Die ambulant betreuten Eltern, die einen Babysitter nutzen oder genutzt haben, berichten dagegen nur in einem Fall von Unterstützung von einer Fachkraft, die restlichen fünf Eltern(paare) geben private Babysitter an. Die fünf Mütter, die aussagen, dass ihnen ein Babysitter fehlt oder gefehlt hat, sind alle ambulant betreute Mütter.
Tab.26: Babysitter und Form der Betreuung
|
ambulant |
stationär |
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
privat |
5 |
0 |
5 |
22,7 |
|
Fachkräfte |
1 |
5 |
6 |
27,3 |
|
fehlt |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
hat damals gefehlt |
4 |
0 |
4 |
18,2 |
|
wird nicht benötigt |
2 |
3 |
5 |
22,7 |
|
wird nicht benötigt |
1 |
0 |
1 |
4,5 |
|
Gesamt |
14 |
8 |
22 |
100 |
Interpretation
Was die verschiedenen Bereiche familiärer Lebensqualität angeht, äußern sich die Befragten durchgehend mehrheitlich zufrieden. Erst bei genauerer Betrachtung ergeben sich einige Bereiche, denen im Zuge der Unterstützung der Familien größere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. So scheint die finanzielle Situation stationär unterstützter Familien unbefriedigend zu sein, möglicherweise wegen zu geringer eigener Entscheidungsspielräume. Was die berufliche Situation angeht überrascht zunächst die von einigen Befragten ausdrücklich geäußerte Zufriedenheit mit der Arbeit in einer WfB, um nicht arbeitslos zu sein. Hier scheint angesichts einer angespannten Arbeitsmarktlage die Bereitschaft, sich zu bescheiden, sehr stark entwickelt zu sein. Fasst man die Antworten der Mütter und Väter zusammen, so taucht dennoch insgesamt sieben Mal der Wunsch nach einer Arbeit außerhalb der WfB auf, verbunden mit dem Hinweis, dass hierfür Unterstützung erforderlich wäre. In Bezug auf die Wohnsituation ist offenbar für eine kleine Gruppe von Eltern der Mangel an Selbstbestimmung Anlass für Unzufriedenheit. Hinsichtlich der gesundheitlichen Situation fällt auf, dass hier Fachkräfte in hohem Maße in die Unterstützung involviert sind, deutlich mehr als private Unterstützer_innen. Im Bereich von Freizeit-/ Urlaubs- und Gruppenangeboten zeichnet sich ab, dass die Zufriedenheit im stationären Bereich zwar groß ist, im ambulanten Bereich passende Gruppenangebote aber aus Sicht der Mehrheit der Eltern eindeutig fehlen. Um an Stadtteilangeboten teilnehmen zu können, bräuchten einige Eltern mehr Unterstützung, als sie bislang erhalten. Auch der Bedarf an Elternentlastung/ Babysitten ist bei ambulant unterstützten Eltern nicht immer zur Zufriedenheit geregelt. Das private Netzwerk mancher Eltern scheint hier nicht auszureichen und Fachkräfte springen offenbar nur selten dafür ein.
Insgesamt ergibt sich in Bezug auf die familiäre Lebensqualität das Bild, dass die hohe Bedeutung, die die aufgeführten Bereiche für die Lebenszufriedenheit der Eltern und damit für das Wohlbefinden ihrer Kinder haben, von Seiten professioneller Unterstützung nicht immer genügend wahrgenommen wird. Insbesondere einer befriedigenden beruflichen Situation sowie Angeboten, die der Stärkung der sozialen Eingebundenheit der Familien in Gruppen und in ihre Wohnumgebung dienen, sollten noch stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um so einer Isolation der Familien und ihrer Kinder vorzubeugen. Die insgesamt von den befragten Eltern eher selten und manchmal erst auf Nachfragen geäußerten problematischen Punkte sind angesichts der bekannten Tendenz, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten sich eher zustimmend äußern und mit Kritik zurückhalten (s. Kap. 4), umso stärker zu gewichten.
Bei der Darstellung der Erfahrungen der Eltern mit dem Jugendamt unterscheiden wir aufgrund der verschiedenen Erfahrungen innerhalb einer Familie mit mehreren Kindern zwischen aktuellen und früheren Erfahrungen. Zusätzlich wird dargestellt, ob die Eltern angeben, dass sie Angst vor dem Jugendamt hatten oder haben, da es z.B. Fälle gibt, in denen die Familien aktuell zwar gute Erfahrungen gemacht, aber dennoch weiterhin Angst vor dem Jugendamt haben, z.B. aufgrund von früheren Erlebnissen. Vergleicht man die Qualität der aktuellen und vergangenen Erfahrungen, ist zu erkennen, dass aktuell nur in zwei Fällen von schlechten Erfahrungen berichtet wird; dahingegen äußert die Hälfte aller Eltern(teile), dass sie früher schlechte bis ambivalente Erfahrungen gemacht haben. Frau Köhler formuliert:
Frau Köhler: Und das Jugendamt, weiß ich nicht, manche Sachen, es gibt auch gute Sachen beim Jugendamt, es gibt auch schlechte Sachen beim Jugendamt. Und, da hab ich auch so ne kleine schlechte Erfahrung miterlebt vom Jugendamt, da konnt ich auch ne zeitlang nicht arbeiten mit das Jugendamt, das ist, die ham mir echt wehgetan, ich war echt enttäuscht, und//
Interviewerin: #als die da Rosa weggenommen haben quasi#
Frau Köhler: #wie die mich auch behandelt haben# genau, wie die mich auch behandelt haben, ganz schlimm * Dass ich ne Rabenmutter wäre, also, ne ganz schlimme Mutter wäre, so, da hätten, das hätten die anders machen müssen mit mir.
Tab. 27:Erfahrungen mit dem Jugendamt
|
aktuell |
Prozent |
früher |
Prozent |
|
|
keine Erfahrungen |
6 |
27,3 |
4 |
18,2 |
|
gute Erfahrungen, Jugendamt ist/war eine Hilfe/gibt Sicherheit |
6 |
27,3 |
3 |
13,6 |
|
Kontakt ist in Ordnung, kein Stress |
6 |
27,3 |
2 |
9,1 |
|
ambivalent |
0 |
0 |
5 |
22,7 |
|
schlechte Erfahrungen |
2 |
9,1 |
6 |
27,3 |
|
fehlende Angaben |
2 |
9,1 |
2 |
9,1 |
|
Gesamt |
22 |
100 |
22 |
100 |
Bei dem Thema, ob die Eltern Angst vor dem Jugendamt haben, ist eine bemerkenswerte Umkehrung der Situation festzustellen: Drei Eltern(teile) äußern, dass sie aktuell Angst haben, 18 Eltern äußern aktuell keine Angst. Die Situation früher war genau umgekehrt: Drei Eltern äußern, sie hätten damals keine Angst gehabt, wohingegen 15 Eltern(teile) angaben, dass sie damals Angst hatten.
Tab. 28: Angst vor dem Jugendamt
|
aktuell |
Prozent |
früher |
Prozent |
|
|
Angst |
3 |
13,6 |
15 |
68,2 |
|
keine Angst |
18 |
81,8 |
3 |
13,6 |
|
fehlende Angaben |
1 |
4,5 |
4 |
18,2 |
|
Gesamt |
22 |
100 |
22 |
100 |
Frau Pape sagt, sie habe zur Zeit keine Angst mehr, da sie sich in der stationären Betreuung sicher fühlt; als sie noch ambulant unterstützt wurde und in einer eigenen Wohnung lebte, hatte sie Angst vor dem Jugendamt:
Interviewerin: Also ich hab das schon gehört, dass manche Eltern davon berichten, dass sie Angst haben vor dem Jugendamt?
Frau Pape: Ja ich auch, öfter.
Interviewerin: Ja? Hmh. Dass Ihnen das Kind weggenommen wird?
Frau Pape: Ja, oder so. Ich hab jetzt keine mehr, Angst, früher so, ähm, Paul war bei meinem, wir zusammen wohnen, eigene Wohnung und so, da hatte ich Angst, Panik, wenn die kommen, oder so. Und so, hier im// kein Problem.
Interviewerin: Also hier fühlen Sie sich dann sicher?
Frau Pape: Ja, die Betreuer sind da, und wir (LEISE, 3 SEK. UNV.) ich hab noch hier ein Schutz, noch.
Frau Janick beschreibt, dass das Jugendamt ihr ihre bestehende Angst vor einer Kindeswegnahme nehmen konnte; für sie bedeutet das Jugendamt Sicherheit:
Frau Janick: Hmh, am Anfang von der Schwangerschaft hat ich Angst, dass mir sie halt weggenommen wird durch die Lernschwäche und//
Interviewerin: Hmh, also als Sie wussten Sie sind schwanger, da hatten Sie erst ein bisschen//
Frau Janick: Ja, da hat ich Angst.
Interviewerin: Ja. * Und wie hat dann das Jugendamt reagiert, was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Frau Janick: Also, dass es eigentlich kein Grund ist, mit ner Lernschwäche einer Mutter das Kind wegzunehmen.
Interviewerin: Hat Ihnen jemand erklärt?
Frau Janick: Hmh, ja.
Interviewerin: Also vom// auch das Jugendamt auch ?
Frau Janick: Das Jugendamt.
Interviewerin: Sie hat also, hat Sie eher beruhigt?
Frau Janick: Ja.
Interviewerin: Ahja.
Frau Janick: Und zur Zeit auch so ein bisschen, dass ich manchmal sage ach, ist alles in Ordnung, können sie gucken, und, sie ham immer halt bestätigt, das ist alles in Ordnung, Ella hat alles, was sie braucht, das sind hier keine Gründe, irgendwie das Kind wegzunehmen oder so.
Interviewerin: Hmh, aber Sie kennen das schon, dass es irgendwie so ´n Thema ist.
Frau Janick: Ja.
Interviewerin: Hmh. Dann ham Sie eher ne Unterstützung vom Jugendamt.
Frau Janick: Ja.
Interpretation
Auch in diesem Punkt kann die Diskrepanz zwischen aktuellen und früheren Erfahrungen mit einer Antwortneigung der Befragten zu tun haben, die damit zusammenhängt, dass es oft schwerer fällt, über aktuell problematische Situationen zu berichten als diese rückblickend zu benennen. Wahrscheinlicher ist es aber, dass die Eltern aktuell wirklich weniger schlechte Erfahrungen mit den Mitarbeiter_innen des Jugendamts machen, weil dort inzwischen ein besserer Informationsstand hinsichtlich der Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten vorliegt. Außerdem dürfte die Unterstützung durch einen auf die Begleitung dieser Familien spezialisierten Dienst tatsächlich einen gewissen Schutz vor unvorhersehbaren Interventionen von Seiten des Jugendamtes darstellen.
Fragen zur Fremdunterbringung betrafen 12 Familien: acht Familien, deren Kinder dauerhaft fremdplatziert sind, und vier Familien, die vorübergehend von einer Fremdunterbringung ihres Kindes betroffen waren/sind.
Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Fremdunterbringung
14 Kinder sind zum Zeitpunkt der Interviews fremdplatziert: Nach Auskunft der Eltern sind vier Kinder sofort nach der Geburt in eine Pflegefamilie gekommen, acht Kinder waren bei der Fremdplatzierung im Kleinkindalter; ein Kind ist im Grundschulalter in einem Heim untergebracht worden, und ein Kind im Teenageralter (als vorübergehende erzieherische Maßnahme, Ziel ist eine Rückführung).
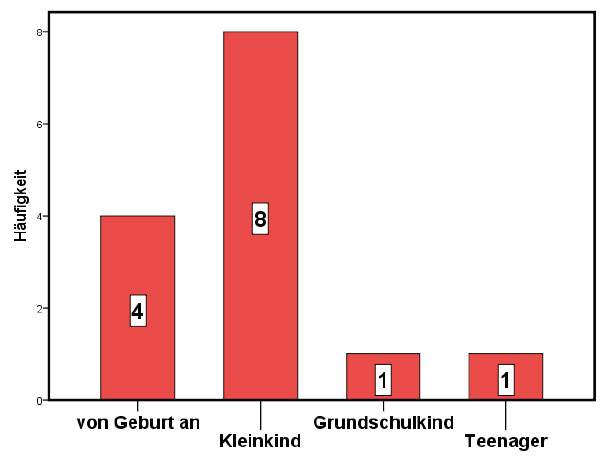
Abb. 5: Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Fremdplatzierung
Gründe für die Fremdunterbringung
Bei der Suche nach den Gründen für die Fremdunterbringung haben wir sechs Kategorien gebildet; Mehrfachzuordnungen waren möglich: In einem Fall gab die alleinerziehende Kindesmutter an, sie sei aufgrund ihrer schweren akuten Erkrankung mit der Versorgung ihres Kindes überfordert gewesen. Der am meisten genannte Grund für die Fremdunterbringung ist "Gewalt durch den Kindesvater". Hiermit einher ging in allen Fällen eine psychische Überforderung und Erschöpfung der Kindesmutter. In einem Fall berichteten die Eltern, dass ihnen die Versorgung ihrer Kinder aufgrund deren schwerwiegender Beeinträchtigung und dem damit verbundenen hohen Pflegeaufwand nicht zugetraut worden sei. In zwei Fällen gaben die Eltern an, mit den Erziehungsproblemen überfordert gewesen zu sein, in vier Fällen habe es keine passende Hilfe gegeben bzw. es habe die Unterstützung gefehlt, die notwendigen Hilfen zu organisieren.
|
Häufigkeit* |
|
|
Überforderung der Kindesmutter durch eigene akute Erkrankung |
1 |
|
Gewalt durch den Kindesvater |
6 |
|
Psychische Überforderung und Erschöpfung der Kindesmutter |
6 |
|
Überforderung der Eltern aufgrund Beeinträchtigung der Kinder |
1 |
|
Überforderung der Eltern mit der Erziehung |
2 |
|
fehlende passende Hilfen |
4 |
*Mehrfachzuordnungen
Gerichtsverhandlung und Sorgerecht
Bei einem Viertel der von einer Fremdunterbringung betroffenen Familien fand nach Auskunft der Eltern eine Gerichtsverhandlung statt. Bei einem Drittel war dies nicht der Fall. Über die restlichen fünf Familien fehlen uns die Angaben.
Tab.30: Gerichtsverhandlung
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
mit Gerichtsverhandlung |
3 |
25,0 |
|
ohne Gerichtsverhandlung |
4 |
33,3 |
|
"wissen wir nicht mehr" |
2 |
16,7 |
|
fehlende Angaben |
3 |
25,0 |
|
Gesamt |
12 |
100 |
Der Großteil der Eltern (10 Familien) gibt an, dass sie das Sorgerecht für ihre fremdplatzierten Kinder behalten haben, in zwei Fällen sei das Sorgerecht entzogen worden.
Einbeziehung der Herkunftseltern in den Prozess der Fremdunterbringung
Zwei Drittel der Eltern(teile) berichten, dass sie in den Prozess der Fremdunterbringung mindestens insofern eingebunden waren, dass sie die Pflegefamilie bzw. das Heim mit aussuchen konnten und Einfluss darauf hatten, dass die Geschwisterkinder zusammenbleiben konnten.
Tab.31: Einbeziehung der Herkunftseltern
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Einbeziehung: z.B. bei Auswahl der Pflegestelle |
8 |
66,7 |
|
keine Einbeziehung |
3 |
25,0 |
|
fehlende Angaben |
1 |
8,3 |
|
Gesamt |
12 |
100 |
Frau Moritz wurde in die Fremdunterbringung ihrer Kinder insofern einbezogen, dass das Jugendamt mit ihr gemeinsam dafür Sorge trug, dass ihre beiden Kinder in derselben Pflegefamilie untergebracht wurden:
Frau Moritz: Und dann wollten die ja Tobias, und da war ein Elternteil, Tobias! (UNTERBRECHUNG DURCH KATZE). Und dann war, ähm, wollten ein Elternpaar, mein Ex-Mann und ich wollten, dass die Kinder zusammen bleiben. So, es wird ja immer gehört, die Kinder werden im Heim getrennt oder bei die Pflegeeltern, und da hatten wir Unterstützung vom Jugendamt, von Frau Baier, oder ich weiß nicht wie die heißt, von Frau Baier, und da hat mein Ex-Mann und ich gesagt, ich möchte das, wenn die Kinder, Geschwister zusammenbleiben. Und da war ein Elternpaar, die wollten nur Tobias haben, nur Tobias! Und da haben die Pflegeeltern, das Jugendamt gesagt, beide oder keine (KLATSCHT IN DIE HÄNDE ZUR VERSTÄRKUNG DER WORTE). Und dann haben die ein Elternpaar gefunden, das ist Frau Anton, und dann hatten wir auch ein Gespr// vorgestellt, und da haben die gesagt zum Jugendamt, wir nehmen die beide Kinder. Und da hab ich gesagt, ist in Ordnung, bin ich damit einverstanden.
Interviewerin: Ach so, Sie wurden gefragt, ob Sie einverstanden sind?
Frau Moritz: Ja also, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ist schon lange her, und, ne, aber wir haben nur gesagt, beide oder keine. Weil wir das ´n paarmal schon gehört haben, die Kinder sind in ne Pflege, und dann getrennt. Und, und, äh, Olaf und Tobias passen sich auf sich gegenseitig auf. So und das will ich auch.
Frau Köhler hat ihre Behandlung als leibliche Mutter, deren Kind direkt vom Krankenhaus aus in einer Pflegefamilie untergebracht wurde, als sehr demütigend in Erinnerung:
Interviewerin: Und, äh, also Rosa kam aus dem Krankenhaus in eine//
Frau Köhler: Pflegefamilie. Und ich bin ja auch mitgefahren, damit ich weiß wo Rosa wohnt, und dadurch ham die mich (3 SEK UNV.), hier hat Ihre Tochter ihr Zimmer, da hat Ihre Tochter. Und ich wurde nicht beachtet, da wurd ich aus dem Krankenhaus, wo die, wo die, wo die restlichen Untersuchungen gemacht wurden von Rosa, wenn ein Kind entlassen wird, also, die Mutter entlassen wird, wird auch das Kind untersucht, ich war als ob ich nicht da wär, die ham mich richtig mies behandelt. Und dadurch, dadurch ham die mir wehgetan, deswegen hat ich auch, war ich auch verschlossen beim Jugendamt.
Frau Teschner beschreibt, dass ihr niemand die Fremdunterbringung ihrer Tochter erklärt hat:
Interviewerin: (...) Wissen Sie denn, warum Nadine damals weg musste?
Frau Teschner: Ja, ich hab sie im Krankenhaus, äh, also, doof gehalten, also nicht richtig.
Interviewerin: Als sie ganz, gerade geboren war?
Frau Teschner: Hmh.
Interviewerin: Ham die gesagt, Sie haben sie nicht richtig gehalten?
Frau Teschner: Nee, die haben gar nichts gesagt! Ham das gesehen und dann gleich angerufen.
Interviewerin: Sie ham gleich das Jugendamt angerufen?
Frau Teschner: Hmh.
Interviewerin: Ohne mit Ihnen darüber zu reden?
Frau Teschner: Ham mit mir gar nicht geredet darüber.
Trennungsbegleitung
Zwei Mütter, deren Kinder fremduntergebracht wurden, beklagen, dass ihnen Unterstützung bei der Verarbeitung der Trennung gefehlt hat, wie folgender Interviewausschnitt mit Frau Conradi beschreibt:
Interviewerin: Aber jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, die Rückfahrten, die warn immer schlimm für Sie, ne.
Frau Conradi Ja.
Interviewerin: Wenn Sie dann * praktisch * Mona wieder abgegeben haben und dann ohne Ihr * Kind * zurückfahren mussten. Hatten Sie denn da irgend ne Möglichkeit, mit jemand drüber zu sprechen, ich mein die war ja damals auch noch ganz klein, und dann gab's auch Herrn Clemens noch nicht.
Herr Clemens (Verlobter): Nee da gab's mich noch nicht.
Interviewerin: Hatten Sie denn da irgendjemand, den Sie// der Ihnen da n bisschen zugehört hat, Ihnen drüber weggeholfen hat. Mussten Sie ganz alleine damit zurecht kommen?
Frau Conradi: Ja.
Interviewerin: Keinen?
Frau Conradie: Hmh (VERNEINUNG).
Interviewerin: Keine Hilfe.
Frau Conradi: Ich hatte keine Hilfe.
Interviewerin: Keine Unterstützung. Hmh.
Eine Mutter wurde von einer Fachkraft des Betreuten Wohnens unterstützt. In vier Fällen war die gesetzliche Betreuerin eine wichtige Unterstützungsperson für die Mütter im Trennungsprozess.
Tab.32: Trennungsbegleitung
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Unterstützung hat gefehlt |
2 |
16,7 |
|
Unterstützung durch Fachkraft |
1 |
48,3 |
|
Unterstützung durch die gesetzliche Betreuerin |
4 |
33,3 |
|
fehlende Angaben |
5 |
41,7 |
|
Gesamt |
12 |
100 |
Besuchskontakt
Alle Eltern geben an, dass sie Besuchskontakt zu ihren Kindern haben (oder für den Zeitraum der vorübergehenden Inobhutnahme hatten), der Großteil regelmäßig, in zwei Fällen findet bzw. fand nur selten ein Treffen statt. Bis auf eine Ausnahme berichten alle Eltern(teile), dass sie den Kontakt zu ihren Kindern ohne professionelle Hilfe aufrecht erhalten. In den meisten Fällen wird ein positiver Kontakt zu den Pflegeeltern beschrieben, wie z.B. von Frau Köhler:
Frau Köhler: Jo. Und Rosa geht's auch gut, Rosa geht's auch gut, weil ich auch gut mit der Pflegefamilie gut klarkomme, und, ja.
Interviewerin: Hmh. Ham die auch noch mehr Kinder?
Frau Köhler: Ja. (...)
Interviewerin: Und wie oft sehen Sie sich?
Frau Köhler: Alle vierzehn Tage. Aber ich, die war ja, ab und zu mal in gewissen Abständen schläft sie auch hier. Ich zelte mit der Pflegefamilie.
Interviewerin: Mit den Eltern zusammen?
Frau Köhler: Weihnachten feiern wir zusammen mit der Familie, ich kenn die ganzen Freunde, ich kenn die ganze Familie. Ich wurde wie mit aufgenommen.
Interviewerin: Ach, Sie wurden so´n bisschen mit aufgenommen?
Frau Köhler: Ja.
Tab.33: Besuchskontakt
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
ja regelmäßig, ohne Hilfe |
8 |
66,7 |
|
ja, regelmäßig, am Anfang mit Hilfe |
1 |
8,3 |
|
selten |
2 |
9,1 |
|
fehlende Angaben |
1 |
8,3 |
|
Gesamt |
12 |
100 |
Rückblickende Beurteilung der Fremdunterbringung
Bei einigen der Interviews ergab es sich, dass die Eltern darüber sprachen, wie sie aus ihrer
heutigen Sicht die zurückliegende Fremdunterbringung ihrer Kinder beurteilen. Frau Köhler
berichtet z.B.:
Interviewerin: (...)Und ham Sie dann zugestimmt, dass Rosa wegkommt, damit Sie die anderen//
Frau Köhler: Ja, weil ich mich, weil ich mich irgendwie vom Jugendamt, also wie soll ich sagen, och sie sind ja noch ein kleines Kind, oder so, ich hab mich wirklich unterbuttern lassen auch so, und, im Nachhinein ist es so, das läuft gut, das ist gut, dass Rosa jetzt in der Pflegefamilie ist, und, sie meinte auch, Rosa meint auch schon zu mir, sie will ne eigene Busfahrkarte, dass sie regelmäßig zu mir kommt. Weil ich das, weil ich's immer aufrecht gehalten habe!
Auch Frau Moritz äußert sich zu diesem Thema:
Interviewerin: Und dann warn Sie traurig, dass die Kinder nicht zu Ihnen zurückgekommen sind?
Frau Moritz: Ja, aber, teilweise bin ich auch froh, wenn die da sind, weil Frau Anton mehr Zeit für die Kinder hat, die Förderungen, und, sportmäßig, das kann ich ja nicht.
Interviewerin: Das ist die Pflegemutter?
Frau Moritz: Das ist die Pflegemutter, die kümmert sich da drum. Und äh, die, wenn die Sport haben, fahren die da mit ihr hin, oder die fahren mit ihr in Urlaub, das kann ich ja nicht. So, und, äh, wenn was ist, dann rufen die bei mir an, und sagen das, so und so, und wir besprechen das zusammen, und, die akzeptieren das, und.
Interviewerin: Hmh, ham Sie sich jetzt so damit abgefunden?
Frau Moritz: Ja, es ist schwer, ne, aber ich hab die, die haben mir ja jedes Jahr Fotos geschickt, wie die sich entwickeln, haben auch gesprochen wie die Schule ist, und, ich bin zufrieden, ich sach, ich brauch keinen Geniesohn, ich brauch keinen, hier Superlativ Sohn, und so, wenn ihr mal Fünfen schreibt, das ist mir auch egal, aber, ich brauch keinen Genie-Sohn.
Frau Conradi kommt zu folgender Einschätzung:
Frau Conradi: Und jetzt kann ich so locker darüber erzählen.
Interviewerin: Ja gut. Jetzt ist Gras drüber gewachsen, ne.
Frau Conradi: Ja(...)Denn ich weiß, dass Mona dahinten gut geht.
Interviewerin 2: Das ist wichtig.
Frau Moritz: Da hat sie die Schule auch noch. * Da hat sie nicht weit zu laufen. * Da wird sie gefördert.(...) Was ich NICHT kann * Kann ich auch nicht.
Interpretation
Körperliche und psychische Belastungen zusammen mit Gewalterfahrungen sowie fehlende Hilfen sind nach Aussagen der Befragten für den Großteil der Fremdplatzierungen verantwortlich. Nur in vergleichsweise wenigen Fällen wird Überforderung durch Erziehungsaufgaben, also fehlende elterliche Kompetenz als Hauptgrund genannt. Selbst wenn diese Selbsteinschätzungen der Eltern aus Sicht Außenstehender nicht immer zutreffen würden (was nicht Gegenstand der Untersuchung war), steht außer Frage, dass die oben aufgeführten vielfältigen psychosozialen Belastungen in den Familien bei den Fremdplatzierungen eine entscheidende Rolle spielen.
Als positiv ist zu bewerten, dass zwei Drittel der Eltern berichten, sie seien an der Suche nach einer geeigneten Unterbringung ihrer Kinder beteiligt gewesen; die hohe Bedeutung eines respektvollen Umgangs mit den abgebenden Eltern wird aus den Schilderungen betroffener Mütter deutlich. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass etliche Eltern angeben, in der Phase der Trennung von ihren Kindern professionelle Unterstützung erhalten zu haben, was der Regelfall sein sollte. Diese günstigen Bedingungen sind möglicherweise die Voraussetzung dafür, dass die große Mehrheit der Eltern regelmäßigen Kontakt zu ihren Kindern hat, ein Faktor, der für die Entwicklung der Kinder aus heutiger Sicht von hoher Bedeutung ist (vgl. z.B. Sozialpädagogisches Institut im SOS Kinderdorf e.V. 2004).
Bei der Auswertung der Netzwerkkarte ist zunächst von Interesse, wie groß das Netzwerk der Eltern ist und auf welche sozialen Bereiche es sich verteilt. Insgesamt nennen die 22 interviewten Eltern(teile) 265 Kontaktpersonen.
Aus Tabelle 34 geht hervor, dass die Eltern(teile) durchschnittlich 12 Kontaktpersonen[6] angeben, die sich auf die vier Bereiche so verteilen, dass das familiäre Netzwerk mit 4,09 Kontaktpersonen am größten ist, das entspricht einem Anteil von 34%, gefolgt von professionellen Kontaktpersonen mit 3,73 Kontaktpersonen (entspricht 30,9%), während Freund_innen mit 2,27 und Nachbar_innen mit 1,95 Kontaktpersonen (entspricht 18,9 bzw. 16,2%) deutlich seltener genannt werden. Das kleinste Netzwerk findet sich mit durchschnittlich 10,86 Kontaktpersonen bei den gemeinsam erziehenden Eltern, während allein erziehende Mütter im Durchschnitt fast zwei Kontaktpersonen mehr nennen. Die Variationsbreite der genannten Kontaktpersonen liegt zwischen 7 und 20.
|
Netzwerk Familie |
Netzwerk Nachbar_innen |
Netzwerk Freund_innen |
Netzwerk Fachkraft |
Gesamtsumme |
||
|
Lebensform der Familie |
Mutter allein erziehend (N=12) |
48* 4,00 |
28 2,33 |
31 2,58 |
47 3,92 |
154 12,83 |
|
Eltern gemeinsam erziehend (N=7) |
26 3,71 |
12 1,71 |
13 1,86 |
25 3,57 |
76 10,86 |
|
|
Mutter ohne Kind (er) mit neuem Partner (N=3) |
16 5,33 |
3 1,00 |
6 2,00 |
10 3,33 |
35 11,66 |
|
|
Gesamtsumme (N=22) |
90 4,09 |
43 1,95 |
50 2,27 |
82 3,73 |
265 12,05 |
|
|
Prozentualer Anteil |
34,0% |
16,2% |
18,9% |
30,9% |
||
|
Form der Betreuung |
Ambulant (N=14) |
59 4,21 |
21 1,50 |
30 2,14 |
47 3,36 |
157 11,21 |
|
Stationär (N=8) |
31 3,88 |
22 2,75 |
20 2,50 |
35 4,38 |
108 13,50 |
|
|
Gesamtsumme (N=22) |
90 4,09 |
43 1,95 |
50 2,27 |
82 3,73 |
265 12,05 |
*Oberer Wert: Summe der jeweiligen Kontakte, unterer Wert: Durchschnittswert
Gruppiert man die Ergebnisse danach, ob die Eltern stationäre oder ambulante Unterstützung erhalten, so zeigt sich, dass die durchschnittliche Anzahl der professionellen Kontaktpersonen bei den stationär begleiteten Eltern mit 4,38 die der familiären Kontaktpersonen (3,88 Kontakte) sogar noch übertrifft und dass die Kontaktzahl stationär begleiteter Eltern(teile) mit durchschnittlich 13,50 Kontaktpersonen insgesamt am höchsten liegt.
Von besonderem Interesse erscheinen die sozialen Kontakte, die von den Eltern frei gewählt werden können, also die Bereiche "Nachbar_innen" (einschließlich anderer Eltern und bei stationären Einrichtungen auch Mitbewohner_innen) sowie "Freund_innen" einschließlich Arbeitskolleg_innen. Aus Tab. 35 ist ersichtlich, dass jeweils drei der interviewten Eltern(teile) keinerlei Kontakte in diesen Bereichen angeben (jeweils knapp 14%), wobei bei keinem Elternteil beide Bereiche betroffen waren. Am häufigsten (13 bzw. 11 mal) werden zwei oder drei Kontakte genannt. Nur vier Eltern(teile) verfügen nach eigenen Angaben über mehr als drei Freund_innen und nur zwei über mehr als drei nachbarliche Kontakte.
Tab. 35: Häufigkeit und Anzahl der Nennungen von Netzwerkkontakten in den Bereichen "Nachbar_innen" und "Freund_innen"
|
Bereich "Nachbar_innen" |
Bereich "Freund_innen" |
|||
|
Anzahl der genannten Kontakte |
Häufigkeit der Nennungen |
Prozent |
Häufigkeit der Nennungen |
Prozent |
|
Keine |
3 |
13,6 |
3 |
13,6 |
|
1 |
4 |
18,2 |
4 |
18,2 |
|
2 |
10 |
45,5 |
5 |
22,7 |
|
3 |
3 |
13,6 |
6 |
27,3 |
|
4 |
1 |
4,5 |
2 |
9,1 |
|
5 |
0 |
--- |
2 |
9,1 |
|
6 |
1 |
4,5 |
0 |
--- |
|
Gesamt |
22 |
22 |
Dies lässt sich auch an den folgenden Abbildungen erkennen.
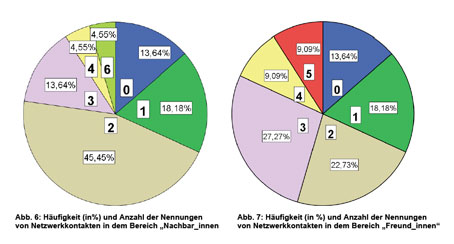
Abb. 6: Häufigkeit (in%) und Anzahl der Nennungen von Netzwerkkontakten in dem Bereich "Nachbar_innenAbb. 7: Häufigkeit (in %) und Anzahl der Nennungen von Netzwerkkontakten in dem Bereich "Freund_innen"
Neben der Anzahl der Kontakte interessierte auch die Bedeutung, die die Kontakte für die befragten Eltern(teile) haben, weshalb sie gebeten wurden, die genannten Kontaktpersonen in der Netzwerkkarte im inneren, mittleren oder im äußeren Ring des Kreises einzuordnen, je nachdem, wie bedeutsam oder eng der jeweilige Kontakt aus ihrer Sicht ist. Erwartungsgemäß steht der Bereich Familie bei den wichtigsten Kontakten an erster Stelle, drei Viertel der familiären Kontaktpersonen werden als sehr bedeutsam eingeschätzt. Aber auch 60% der Fachkräftekontakte werden in den inneren Ring eingeordnet, während Freund_innen und Nachbar_innen deutlich seltener diese Bedeutung beigemessen wird (vgl. Tab. 36).
Tab. 36: Häufigkeit der Einordnung der Kontakte nach ihrer Bedeutung, getrennt für die vier Bereiche
|
Bereich |
||||||||
|
Einordnung der Kontakte |
Familie |
Nachbar_innen |
Freund_innen |
Fachkräfte |
||||
|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
|
innen (= wichtig) |
68 |
75,6 |
16 |
37,2 |
21 |
42,0 |
49 |
59,8 |
|
Mitte |
16 |
17,8 |
14 |
32,6 |
22 |
44,0 |
24 |
29,3 |
|
außen |
6 |
6,7 |
13 |
30,2 |
7 |
14,0 |
9 |
11,0 |
|
Summe der Kontakte |
90 |
43 |
50 |
82 |
Die im Folgenden dargestellten, weiteren Nachfragen zur genaueren Kennzeichnung der sozialen Netzwerke der Eltern konnten nicht für alle angegebenen Kontaktpersonen erfragt werden, da bei manchen die Fragen nicht passend erschienen. Sie wurden z.B. nicht gestellt bei fremdplatzierten Kindern, die im sozialen Netzwerk der Eltern auftauchten, oder bei Geschwistern der Eltern, die sich noch im Kindesalter befanden. Daraus erklären sich die zahlenmäßigen Abweichungen gegenüber der Tab. 34.
Art der Beziehungen
Danach gefragt, wie lange die Beziehungen schon Bestand haben, ergab sich naturgemäß im Bereich der Familie ein hoher Prozentsatz von Beziehungen, die seit über 5 Jahren bestehen. Auch bei den Freundschaften gaben die Interviewten bei der Hälfte der genannten Personen an, dass die Beziehungen schon länger als 5 Jahre andauerten, während Nachbarschaftskontakte zum größten Teil erst seit kürzerer Zeit bestanden. Bei den Fachkräften hielten sich nach Auskunft der Eltern(teile) neuere und ältere Kontakte in etwa die Waage, die meisten bestanden zwischen 1 und 5 Jahren (s. Tab. 37).
Tab. 37: Dauer der Beziehungen in den vier sozialen Bereichen
|
Bereich |
||||
|
Dauer der Beziehung |
Familie |
Nachbar_innen |
Freund_innen |
Fachkräfte |
|
kürzer als 1 Jahr |
2 |
18 |
9 |
24 |
|
ca. 1 bis 5 Jahre |
3 |
16 |
17 |
34 |
|
länger als 5 Jahre |
69 |
9 |
24 |
24 |
|
Summe der Kontakte |
74 |
43 |
50 |
82 |
Zusätzlich wurde erfragt, wie oft ein Kontakt stattfindet (inklusive Telefonate) und wie die emotionale Qualität des Kontakts beurteilt wird. Bezüglich der Kontakthäufigkeit ergaben sich auffällig viele tägliche Kontakte mit Nachbar_innen, wobei diese Kategorie (wie berichtet) in stationären Einrichtungen auch Mitbewohner_innen umfasst, mit denen sich zwangsläufig tägliche Kontakte ergeben. Auch im Freundeskreis ist der Anteil täglicher Kontakte mit ca. der Hälfte der Kontakte relativ hoch, hierzu zählen (wie berichtet) auch Arbeitskolleg_innen. Die familiären Kontakte verteilen sich über die ganze Breite des Spektrums, während bei den Fachkräften ein bis zwei Kontakte pro Woche am häufigsten genannt werden (47%).
Tab. 38: Häufigkeit der sozialen Kontakte
|
Bereich |
||||
|
Häufigkeit der Kontakte |
Familie |
Nachbar_innen |
Freund_innen |
Fachkräfte |
|
z. Zt. kein Kontakt |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ein paar Mal im Jahr |
26 |
3 |
15 |
18 |
|
2mal im Monat |
22 |
5 |
1 |
13 |
|
1-2mal pro Woche |
13 |
9 |
10 |
37 |
|
täglich |
13 |
26 |
24 |
13 |
|
Summe der Kontakte |
74 |
43 |
50 |
82 |
Die emotionale Qualität der Kontakte wurde anhand einer Smiley-Skala erfragt. In allen Bereichen überwiegen die positiv beurteilten Kontakte, dies sind insgesamt über 70%. Eindeutig negativ werden nur etwa 5% aller Kontakte beurteilt.[7] Fasst man die eindeutig negativ beurteilten Kontakte und die mittlere Kategorie zusammen, so schneiden die Fachkräfte mit nur etwa einem Fünftel weniger erfreulicher Kontakte am günstigsten ab, danach kommen mit ca. einem Viertel die Freund_innen einschließlich Arbeitskolleg_innen und mit knapp einem Drittel die Familienmitglieder. Der höchste Anteil weniger erfreulich beurteilter Kontakte findet sich mit 44% im Bereich der Nachbar_innen bzw. Mitbewohner_innen (vgl. Tab. 39, Abb. 8 - 11).
Tab. 39: Emotionale Qualität der sozialen Kontakte
|
Bereich |
||||||||||
|
Qualität des Kontaktes |
Familie |
Nachbar_innen |
Freund_innen |
Fachkräfte |
Gesamt |
|||||
|
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
|

|
52 |
70,3 |
24 |
55,8 |
38 |
76,0 |
64 |
78,0 |
178 |
71,5 |
|

|
17 |
23,0 |
15 |
34,9 |
9 |
18,0 |
17 |
20,7 |
58 |
23,3 |
|

|
5 |
6,8 |
4 |
9,3 |
3 |
6,0 |
1 |
1,2 |
13 |
5,2 |
|
Summe der Kontakte |
74 |
43 |
50 |
82 |
249 |
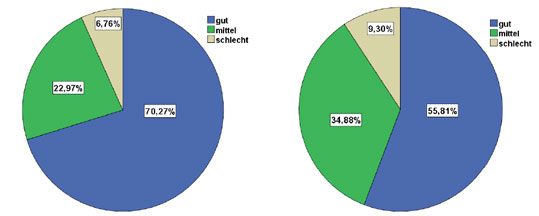
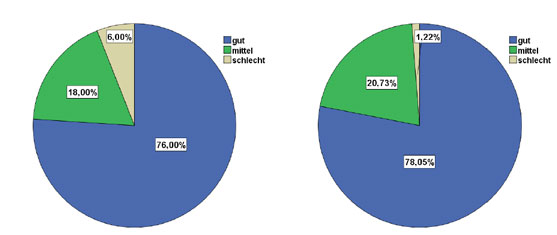
Art des sozialen Kontaktes
Bei der Frage nach der Art des sozialen Kontakts ist von Interesse, welche Kontaktpersonen für welche sozialen Situationen als Ansprechpartner_innen fungieren. Dies wurde - wie dargestellt - mit vier Bildkarten erfragt, und zwar für jede der genannten Kontaktpersonen, soweit sie den Kategorien zuzuordnen waren. Mehrfachnennungen waren möglich. Die folgende Darstellung zeigt zunächst die Verteilung der Netzwerkkontakte auf die vier Bereiche.
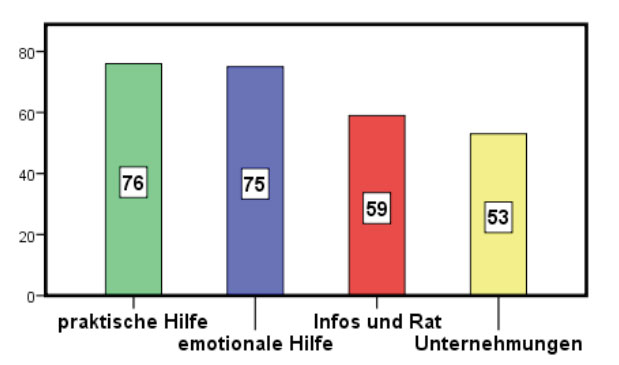
Mehrfachnennungen möglich
Betrachtet man für jede Kontaktart, welchem Netzwerkbereich sie zuzuordnen ist, ergibt sich das folgende Bild.
Praktische Hilfe
Wie Abb. 13 zu entnehmen ist, stehen bei der praktischen Hilfe die Fachkräfte mit ca. zwei Dritteln der Kontakte an erster Stelle. Danach kommen Familienmitglieder mit ca. einem Fünftel, während der Freundeskreis einschließlich Nachbar_innen eine untergeordnete Rolle spielt. Bei stationär lebenden Elternteilen zeigt sich letzteres sogar noch ausgeprägter.
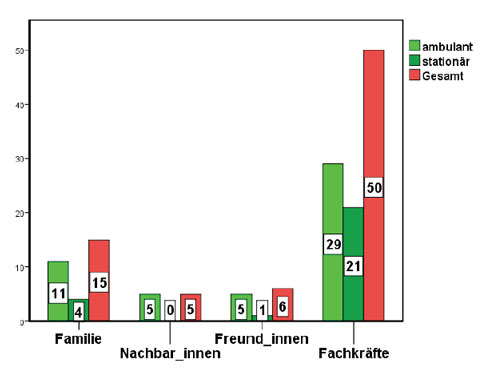
Abb. 13: Verteilung von "praktischer Hilfe" auf die Netzwerkbereiche
Emotionale Hilfe
Bezüglich emotionaler Hilfe gaben die Eltern an, dass sie diese etwa zu gleichen Teilen von Familienmitgliedern und von Fachkräften erhalten (vgl. Abb. 14), wobei die Fachkräfte bei den ambulant betreuten Eltern etwas häufiger genannt wurden als bei den stationär lebenden.
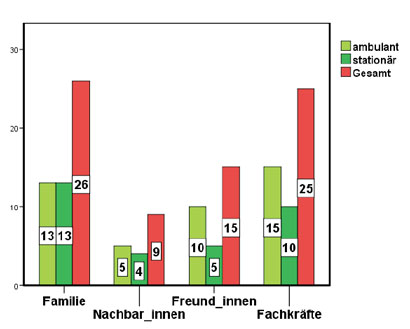
Abb. 14: Verteilung von "emotionaler Hilfe" auf die Netzwerkbereiche
Informationen und Rat
Soweit es um "Informationen und Rat" geht, stehen nach Auskunft der Eltern die Fachkräfte
eindeutig an erster Stelle. Dies gilt für ambulant und stationär begleitete Eltern gleichermaßen
(vgl. Abb.15).
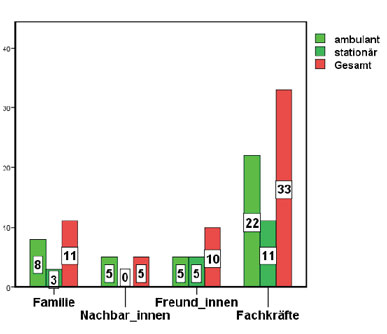
Abb. 15: Verteilung von "Informationen und Rat" auf die Netzwerkbereiche
Unternehmungen
Bei den Unternehmungen ergibt sich ein anderes Bild. Hier stehen nach Auskunft der Eltern die Familienmitglieder an erster und die Fachkräfte an letzter Stelle (vgl. Abb. 16). Allerdings unterscheiden sich die Verhältnisse bei ambulant und stationär lebenden Eltern: Stationär lebende Eltern unternehmen weniger mit ihrer Herkunftsfamilie, dafür mehr mit Mitbewohner_innen, während bei ambulant betreuten Eltern Unternehmungen mit Nachbar_innen oder anderen Eltern am seltensten genannt werden.
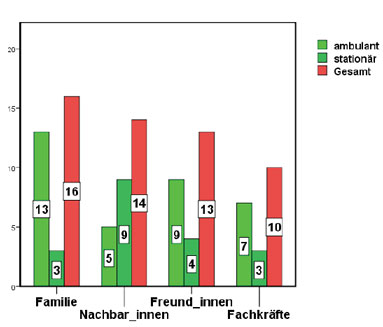
Abb. 16: Verteilung von "Unternehmungen" auf die Netzwerkbereiche
Interpretation
Die Ergebnisse zum sozialen Netzwerk der befragten Eltern zeigen - wie berichtet - bei einer durchschnittlichen Anzahl von 12 Kontaktpersonen eine recht große Variationsbreite von 7 bis 20 Personen. Interessant ist, dass sich der Großteil der Kontakte (zwei Drittel) auf Familienangehörige und Fachkräfte verteilt, während die Netzwerke der Freund_innen und Nachbar_innen zusammen nur etwa ein Drittel ausmachen. Dies kann als Hinweis auf eine fehlende bzw. geringe soziale Einbindung der Eltern und damit vermutlich auch ihrer Kinder in ihre jeweiligen Kommunen gewertet werden. Als besonders gravierend ist zu werten, dass einige Eltern keinen einzigen Kontakt im Bereich der Freund_innen oder im Bereich der Nachbar_innen nannten. Bedenkt man den hohen Anteil von Eltern mit einem problematischen familiären Hintergrund, so wird verständlich, dass den Fachkräften in diesen Familien ein außerordentlich hoher Stellenwert zukommt. In ähnliche Richtung geht das Ergebnis zur persönlichen Bedeutung der genannten Kontaktpersonen für die Eltern. Auch hier spielen Fachkräfte nach den Familienangehörigen eine weitaus wichtigere Rolle als Freund_innen und Nachbar_innen. Beispielhaft schildert dies Frau Moritz:
Also für mich ist die keine Betreuerin, so Art, ich nenn die jetzt nicht als Betreuerin oder, als Freundin, so, Gabi ist wie Freundin. Und ich habe auch, weil ich ja immer von X. (FRÜHERER TRÄGER) Wechselei gehabt hab, sind die Betreuer immer gewechselt, und da hat ich am Schluss kein Vertrauen mehr gehabt, gar nichts mehr, war aus, ich hatte kein Vertrauen, mein Mann war schwer, bei mir ranzukommen, ich hatte kein Vertrauen. Und, jetzt hab ich auch * bisschen Angst, oder so * ich hab Angst, wenn jetzt schon wieder Betreuungswechsel ist, davor hab ich Angst, ganz große (...)
Hinsichtlich der emotionalen Qualität der Kontakte, erreicht der Bereich der Nachbar_innen sogar den höchsten Anteil an weniger erfreulichen Kontakten, während die Fachkräfte noch deutlich vor den Familienangehörigen und sogar etwas positiver als die Freund_innen eingestuft werden. Für die verschiedenen Hilfebereiche ergibt sich, dass Fachkräfte besondere Bedeutung für "praktische Hilfe" und für "Informationen und Ratschläge" haben, was nicht weiter überrascht, da dies ja teilweise zu ihren Aufgaben gehört. Dass ihnen bei der "emotionalen Hilfe" eine fast ebenso hohe Bedeutung zukommt wie Familienmitgliedern und eine weitaus höhere als Freund_innen ist dagegen bemerkenswert. Lediglich im Bereich "Unternehmungen" stehen die Fachkräfte an letzter Stelle, wenngleich sie auch da noch fast ein Fünftel der genannten Personen ausmachen.
Vergleicht man die Ergebnisse zum sozialen Netzwerk der befragten Eltern mit denen einer ähnlich angelegten Studie von Llewellyn & McConnell (2002) in Australien, so zeigen sich interessante Parallelen. Zu berücksichtigen ist, dass dort über die Hälfte der befragten Mütter mit einem Partner und immerhin 15% in der eigenen Herkunftsfamilie lebten, familiäre Kontakte also naturgemäß einen höheren Stellenwert einnehmen als bei der von uns untersuchten Gruppe. Die durchschnittliche Kontaktzahl in der australischen Studie lag bei 8,1 mit einer Variationsbreite von 2 bis 16 Kontakten, also insgesamt etwas niedriger als in der vorliegenden Untersuchung. Hinsichtlich der verschiedenen Netzwerke betraf fast die Hälfte der Kontakte Familienmitglieder (in unserer Studie ca. ein Drittel) und es zeigt sich auch hier ein bemerkenswert niedriger Anteil an Freund_innen und Nachbar_innen. 27% der befragten Mütter nannten keinerlei Kontakte in diesen Bereichen, während dies in unserer Studie nicht vorkam. Allerdings wurden bei uns - wie erwähnt - zu Freund_innen auch Arbeitskolleg_innen und zu Nachbar_innen auch andere Eltern sowie (in stationären Einrichtungen) auch Mitbewohner_innen gezählt. Llewellyn & McConnell (2002, 29) resümieren,
"... that these mothers do not live in a social vacuum, but many are socially isolated. Generally speaking, there are family members in their lives, but they remain isolated from their local communities because of the absence of friends and neighbours in their support networks."
Auf die vorliegende Studie bezogen wäre zu ergänzen, dass neben Familienmitgliedern auch Fachkräfte im Leben der Eltern eine wichtige Rolle spielen. Ihre Teilhabe am außerfamiliären Leben und an nicht-professionellen sozialen Kontakten scheint jedoch ebenfalls bedenklich gering entwickelt zu sein, was auch auf die soziale Eingebundenheit der Kinder Auswirkungen haben kann. Kritische Phasen im familiären Leben, Zeiten besonderer Unterstützungsbedürftigkeit, wie sie in allen Familien auftreten können, können für diese Familien besonders negative, manchmal verhängnisvolle Auswirkungen haben (wie z.B. die Fremdunterbringung eines Kindes), weil sie nicht auf ein entsprechend entwickeltes soziales Netzwerk zurückgreifen können und professionelle Hilfe nicht immer im erforderlichen Umfang möglich ist.
Auf welche Art und Weise Fachkräfte, aber auch andere Personen des sozialen Netzwerkes die Eltern unterstützen und wie die Eltern diese Methoden der Unterstützung beurteilen, war Inhalt des letzten Teils der Interviews. Für die neun verschiedenen Unterstützungsmethoden ergab sich folgendes Bild, wobei die Ergebnisse bei der zweiten Methode eine differenzierte Betrachtung von zwei Unterpunkten erforderlich machten, da die auf der Karte gegebenen Beispiele (s. Anhang S. XIX) von den Eltern uneinheitlich beurteilt wurden (vgl. Tab. 40).
|
nicht bekannt |
gut |
mittel |
Schlecht |
Gesamt |
|||||
|
Häufigkeit |
% |
Häufigkeit |
% |
Häufigkeit |
% |
Häufigkeit |
% |
Häufigkeit |
|
|
1 Erklären mit Worten |
1 |
4,5 |
17 |
77,3 |
4 |
18,2 |
- |
22 |
|
|
2a Genaue Anweisungen geben |
4 |
18,2 |
5 |
22,7 |
3 |
13,6 |
10 |
45,5 |
22 |
|
2b Einmischen/ Kritisieren vor den Kindern |
5 |
22,7 |
- |
- |
3 |
13,6 |
14 |
63,6 |
22 |
|
3 Erklären mit Materialien |
12* |
54,6 |
8 |
36,4 |
2 |
9,1 |
- |
- |
22 |
|
4 Gemeinsam machen |
- |
- |
19 |
86,4 |
3 |
13,6 |
- |
- |
22 |
|
5 Aufgaben übernehmen |
14 |
63,6 |
- |
- |
2 |
9,1 |
6 |
27,3 |
22 |
|
6 Eltern entlasten |
- |
- |
19 |
86,4 |
3 |
13,6 |
- |
- |
22 |
|
7 Gruppenangebote |
1 |
4,5 |
16** |
72,7 |
3 |
13,6 |
2 |
9,1 |
22 |
|
8 Video-Home- Training |
17 |
77,3 |
4 |
18,2 |
1 |
4,5 |
- |
- |
22 |
|
9 Patenschaften |
5 |
22,7 |
8*** |
36,4 |
4 |
18,2 |
5 |
22,7 |
22 |
* davon 6mal:"leider nicht, es müsste mehr geben",
** davon 5mal:"gut, aber gibt es leider zu wenig",
*** 6mal: "gut, könnte ich mir vorstellen", 2mal: "gut, gab es damals leider nicht"
Eindeutig positive Beurteilungen erhalten die Methoden "Erklären mit Worten" (17), "Gemeinsam machen" und"Eltern entlasten" (je 19). Auch Gruppenangebote werden mehrheitlich positiv beurteilt (16), wobei in fünf Fällen bemerkt wurde, dass es davon nicht genug gebe. Zweimal werden sie allerdings abgelehnt. Überwiegend negativ wird erwartungsgemäß beurteilt, wenn Unterstützer_innen sich einmischen oder vor den Kindern Kritik äußern. Demgegenüber gehen die Meinungen darüber, wie "Genaue Anweisungen geben" zu beurteilen ist, auseinander. Nur knapp die Hälfte der befragten Eltern(teile) findet dies schlecht, während 8 der 22 Befragten dies "gut" oder zumindest "mittel" finden. Dass Eltern z.T. sehr genaue Vorstellungen davon haben, welche Form der Unterstützung sie benötigen, zeigt folgender Interviewausschnitt:
Interviewerin: Und dieses, dass jemand ganz genau sagt, wie es gemacht werden soll?
Frau Ibach: Hmh (ZUSTIMMEND).
Interviewerin: Finden Sie gut?
Frau Ibach: Ja! Wenn man das mir vernünftig erklärt, und nicht für mich für dumm erklärt! (LACHT).
Interviewerin: Also mal * kommt drauf an, wie es gemacht wird?
Frau Ibach: Ja.[...].
Interviewerin: Und dass sich jemand * Sie kritisiert oder einmischt? Kennen Sie noch nicht so?
Frau Ibach: Hmh, kritisieren kenn ich, ja in ... (MUTTER-KIND-HEIM) genauso wie hier auch schon öfter, wenn Wolfgang Dienst hatte.
Interviewerin: Und wie finden Sie das?
Frau Ibach: (ZÖGERT) Dass ich gesagt habe, jetzt hörst du mir mal zu, was ich überhaupt meine! Und er soll sich nicht mich einmischen. Und, ich bin noch nicht mal fertig mit reden, dann denken die schon was an was anderes. Aber mich dann erst mal zuhören, das tun die relativ wenig.
Interviewerin: Also den Teil finden sie dann * blöd?
Frau Ibach: Ja!
Interviewerin: Aber dass Sie ganz genau gesagt kriegen, wie Sie was machen sollen, finden Sie eigentlich gut?
Frau Ibach Ja!
Interviewerin: Hmh. Aber Ihnen soll gut zugehört werden?
Frau Ibach: Genau!
Das "Erklären mit Materialien" wird von keinem Elternteil als schlecht beurteilt, jedoch geben 12, also mehr als die Hälfte der Eltern an, diese Unterstützungsmethode nicht zu kennen, was von 6 von ihnen ausdrücklich bedauert wird.
Wenig bekannt ist die Methode des Video-Home-Trainings, wird aber von denjenigen, die sie kennen (5), überwiegend als gut (4) oder zumindest mittel (1) beurteilt. Über Patenschaften, die bis auf fünf der befragten Eltern allen bekannt war, gehen die Meinungen stark auseinander, acht positiven stehen fünf negative Beurteilungen gegenüber. Bleibt noch festzuhalten, dass fast zwei Drittel der Eltern angeben, dass sie noch nicht erfahren haben, dass Aufgaben von Unterstützer_innen übernommen wurden, die sie lieber selber machen würden. Die acht Eltern( teile), denen dies schon widerfahren ist, beurteilen dies erwartungsgemäß überwiegend (6) als schlecht.
Interpretation
Schließt man aus den Antworten der Eltern auf die bevorzugten Unterstützungsmethoden professioneller und privater Helfer_innen, so scheinen das gemeinsame Tun und die Entlastung der Eltern am weitesten verbreitet zu sein, diese Methoden waren ausnahmslos allen Eltern bekannt. Auch Gruppenangebote und verbale Erklärungen sind mit je einer Ausnahme den Eltern bekannt. Das Erklären mit Materialien, also z.B. mit Hilfe von Anleitungen in Leichter Sprache scheint bedauerlicherweise noch nicht regelmäßig verwendet zu werden, was zumindest bei professioneller Unterstützung zu erwarten wäre und auch von einigen Eltern ausdrücklich gewünscht wird. Anders als in englischsprachigen Ländern stehen hier möglicherweise noch nicht genügend öffentlich zugängliche Materialen zur Verfügung.
Den von den Eltern zumindest teilweise negativ bewerteten Methoden ist gemeinsam, dass sie mit Eingriffen in die elterliche Entscheidungsbefugnis zu tun haben, nämlich wenn Helfer_innen sich in die Erziehung einmischen, genaue (vielleicht zu genaue) Anweisungen geben oder Aufgaben übernehmen, die die Eltern gar nicht abgeben wollen. Auch bei Patenschaften sehen einige Eltern möglicherweise diese Gefahr.
Obwohl auch Gruppenangebote von zwei Eltern(teilen) negativ beurteilt werden, scheint hier ein erheblicher Bedarf zu bestehen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen in Punkt 8.4 zur familiären Lebensqualität, wo ebenfalls ein Fehlen von geeigneten Gruppenangeboten deutlich wurde.
[5] Eins der im Heim lebenden Kinder lebt zum Zeitpunkt der Interviews voraussichtlich nur vorübergehend in einem Wohnheim als Erziehungsmaßnahme; die Eltern gehen davon aus, dass es nach erfolgreicher Maßnahme wieder zu ihnen zurückkehrt.
[6] Unter den Begriff Kontaktpersonen fallen gelegentlich auch Personengruppen, wie auf S. 14 beschrieben.
[7] Dies kann auch mit der Befragungsmethode der "Netzwerkkarte" zusammenhängen, obwohl ausdrücklich betont wurde, dass auch negative Kontakte genannt werden sollen, wenn sie eine Rolle im Leben der Befragten spielen. Im Allgemeinen fallen einem eher positive Kontakte ein, wenn man über sein soziales Netz nachdenkt.
Inhaltsverzeichnis
Aufgrund der teils strukturierten und teils offenen Interviewmethode kamen neben den direkt erfragten Themen in etlichen Fällen Themen und Einschätzungen zur Sprache, die sich in der quantitativen Auswertung nicht hinreichend abbilden lassen, die aber für das Verständnis der Gesamtsituation der Familien und damit für die Frage ihrer erfolgreichen Unterstützung von hohem Interesse sind.
Im Folgenden werden solche markanten Themen/ Einschätzungen der interviewten Eltern(teile) im Überblick dargestellt und anhand von Zitaten aus den Interviews und mit Hilfe von Fallvignetten veranschaulicht. Dadurch sollen zum Einen kritische Aspekte der Unterstützungserfahrungen der Familien herausgearbeitet und zum Anderen wichtige Lebensthemen der Familien veranschaulicht werden. Die Themen betreffen unterschiedliche Ebenen, die strukturelle/ institutionelle ebenso wie die kommunikative/ zwischenmenschliche Ebene. Die Kenntnis dieser Themen kann in der professionellen Arbeit mit den Familien vielleicht das Einfühlungsvermögen für die Anliegen und Bedürfnisse der Familienmitglieder verbessern.
Jedes Interview wurde verschiedenen Themen zugeordnet, die sich während der Auswertung als "roter Faden" herauskristallisierten und somit als markant für die Fallgeschichte bezeichnet werden können - weil sie von dem Eltern(teil) immer wieder angesprochen wurden, oder weil sie sich aufgrund ihrer Betonung/ Gewichtung als "Lebensmotto" bzw. Lebenseinstellung des/der Interviewten abzeichneten. Es wurden 14 verschiedene Themen erarbeitet und Mehrfachzuordnungen vorgenommen (pro Interview zwei bis sechs Themen). Tabelle 41 stellt die einzelnen Themen und deren Häufigkeit dar.
Für ausgewählte Themen werden im Folgenden Erläuterungen gegeben und zur Veranschaulichung besonders markante Ausschnitte aus den Interviews oder Fallvignetten aufgeführt.
|
Ambulant (N=14) |
Stationär (N=8) |
Gesamt* (N=22) |
Prozent |
|
|
1. stolz/froh, das Leben (wieder) zu bewältigen |
5 |
4 |
9 |
41,0 |
|
2. Gewalterfahrungen |
4 |
3 |
7 |
31,8 |
|
3. professionelle Hilfe gibt Sicherheit |
4 |
3 |
7 |
31,8 |
|
4. Kämpfen für die eigenen Rechte |
2 |
5 |
7 |
31,8 |
|
5. Fremdbestimmung, keine Mitsprache (Gefühl von Abhängigkeit, keine Wahl zu haben) |
4 |
2 |
6 |
31,8 |
|
6. professionelle Hilfe = Einmischung in die familiäre Privatsphäre |
5 |
1 |
6 |
27,3 |
|
7. Stolz, Kinder zu haben |
4 |
2 |
6 |
27,3 |
|
8. Zufriedenheit durch Engagement (Lernen/Beruf/Hobby/Lebensplanung) |
2 |
4 |
6 |
27,3 |
|
9. Zufriedenheit in der Familie, dem Umfeld |
4 |
1 |
5 |
22,7 |
|
10. zufrieden geben mit dem, was ist |
3 |
2 |
5 |
22,7 |
|
11. Verpflanzung |
0 |
4 |
4 |
18,2 |
|
12. Einmischung durch Andere (Mitbewohner_innen, Herkunftsfamilie) |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
13. Misstrauen "Fremden" gegenüber, kein Vertrauen |
3 |
1 |
4 |
18,2 |
|
14. Überforderung |
3 |
0 |
3 |
13,6 |
*Mehrfachzuordnungen
Stolz/froh, das Leben (wieder) zu bewältigen
In neun Interviews wird besonders deutlich, wie stolz und froh die Eltern(teile) sind, ihr Leben (nach zum Teil sehr schweren Zeiten) trotz aller Schwierigkeiten zu bewältigen. Frau Gebhard ist sehr stolz auf das, was sie alles alleine schafft und wiederholt dies während des Interviews mehrfach:
Frau Gebhard: Nein, das mach ich immer alleine, ich hab jetzt in meinem Handy ´nen Wecker, meistens sag ich auch die Betreuer Bescheid, dass sie mich vorher anklingeln, oder ich stell mir ´nen Wecker, ansonsten mach ich ALLES alleine, auch den Haushalt!
Interviewerin: Ahja, das heißt Mahlzeiten zubereiten.
Frau Gebhard: Mach ich alles alleine!
Frau Köhler betont:
Frau Köhler: Also zum größten Teil mach ich das alles alleine. Also ich nimm, äh, ich benutz die nicht so, also es gibt ja auch Familien, die benutzen so, so, solche Helferinnen als Taxi, wenn man´s so nimmt, die ärgern sich manchmal auch drüber, aber, ich seh zu, dass ich meine Sachen alleine mache.
Interviewerin: Das ist Ihnen auch wichtig?
Frau Köhler: Genau. [...]
Interviewerin: Ham Sie noch irgendwas aufm Herzen, oder was ist Ihnen wichtig, nochmal zu sagen * zu Ihrer ganzen Situation mit Hilfe?
Frau Köhler: Also ich finds wichtig, dass ich das alleine gut, gut hinkriege, und, ja, und (SEUFZT). Ja und da werd ich weiterhin auch mir Hilfe holen, ähm, irgendwie und Hilfe bean// irgendwie, was sagen, ja, ist brenzlig, und ***
Professionelle Hilfe gibt Sicherheit
In sieben Interviews ist für die Eltern(teile) bedeutend, dass die professionelle Hilfe ihnen Sicherheit vermittelt.
Herr Olbrich betont: (...) Also wenn´s Not am Mann sind, dann sind sie richtig da, also das ist kein Problem (...).
Für Frau Moritz ist es wichtig, dass sie ihre Unterstützer_innen immer erreichen kann:
Frau Moritz: Ja, ich bin sehr, ich fühl mich jetzt wohler, und fühl mich jetzt sehr zufrieden, die sind auch alle da, man kann man auch, wenn was ist, abends oder so, ich hatte mal, vor paar Jahren, vor zwei Jahren// (...).
Interviewerin: Also wenn Sie mal ne Sorge haben, dann können Sie die Betreuer_innen auch abends anrufen?
Frau Moritz: Ja, auch abends anrufen, das konnt ich bei X. (FRÜHERER TRÄGER) nicht (...)
|
Frau Pape Ja, die Betreuer sind da, und wir (...) ich hab noch hier ein Schutz, noch. Frau Pape, Anfang 30, und ihr 8-jähriger Sohn Paul, der als geistig behindert gilt und eine Förderschule besucht, leben seit einigen Jahren in einer stationären Einrichtung. Frau Pape ist sehr zufrieden mit ihrer derzeitigen Lebenssituation: Sie ist sozial gut integriert innerhalb der Einrichtung und ist mit der Unterstützung, die sie dort erhält, zufrieden und fühlt sich wohl. Sie ist stolz auf ihren Arbeitsplatz und geht gerne zur Arbeit, vor allem wegen des guten Kontakts zu ihrer Chefin und den Kolleginnen. Frau Pape ist alleinerziehend und hat nur sporadischen Kontakt zu Pauls Vater. Nach der Geburt von Paul, über die beide Eltern sehr glücklich waren, lebte die Familie zusammen in einer eigenen Wohnung und wurde vom betreuten Wohnen und verschiedenen Mitarbeiter_innen des Jugendamts unterstützt. Nach kurzer Zeit fühlte Frau Pape sich überfordert und gestresst mit einem kleinen Baby und so vielen unterschiedlichen Helfer_innen. Dazu kam eine schwierige Beziehung zu ihrem Partner mit gewalttätigen Übergriffen gegenüber ihr und ihrem Sohn. Frau Pape war psychisch überfordert und suchte Hilfe in einer Klinik. Um eine Fremdunterbringung zu verhindern, nahm Frau Papes Mutter ihre Enkelin zu sich. Als diese aufgrund gesundheitlicher Probleme an ihre Grenzen kam, bot sich Pauls Tante väterlicherseits an, Paul aufzunehmen. Als es Frau Pape wieder besser ging, bestand sie darauf, selbst für ihren Sohn zu sorgen. Daraufhin wurde sie vom Jugendamt vor die Wahl gestellt, Paul in eine Pflegefamilie zu geben oder aber gemeinsam mit ihm in eine stationäre Einrichtung zu ziehen. Frau Pape ist glücklich über die Möglichkeit, in der Einrichtung zu leben und somit mit ihrem Sohn zusammen sein zu können. Sie fühlt sich sehr sicher dort und braucht nun, im Gegensatz zu früher, keine Angst mehr vor dem Jugendamt haben, dass Paul ihr weggenommen wird. Trotzdem möchte sie, sobald es geht, mit Paul gemeinsam selbständig leben und wieder in ihre Heimat zurückziehen. Ihr ist es sehr wichtig, eine eigene Wohnung und ihren eigenen Bereich zu haben. Als Vorbereitung auf den Auszug trainiert sie zur Zeit mit Paul, dass dieser sich mehr in ihrem privaten Wohnbereich innerhalb der Einrichtung aufhält und sich mehr auf seine Mutter bezieht. Als nervig an dem Leben in der Einrichtung empfindet sie es, dass sich die anderen dort lebenden Mütter ständig in ihre Erziehung einmischen. Ebenso ist sie unzufrieden mit ihrer finanziellen Situation und wünscht sich mehr Taschengeld. Gut findet sie, dass ihre Privatsphäre innerhalb der Einrichtung geachtet wird, z.B. wird immer angeklopft oder geklingelt, bevor jemand ihren Bereich betritt. Frau Pape hat einen guten Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie, von der sie sich auch emotional unterstützt fühlt. Außerfamiliär besteht ihr soziales Netz aus ihrem Freund, der wie ihre Familie in ihrer Heimatstadt lebt, Mitbewohnerinnen der Einrichtung, früheren und aktuellen Kolleg_innen und früheren und aktuellen Fachkräften. Sie hängt sehr an ihren früheren Unterstützer_innen vom ehemaligen betreuten Wohnen und freut sich schon darauf, wieder von ihnen unterstützt zu werden, wenn sie mit Paul in einer eigenen Wohnung in ihrer Heimat lebt. Für Paul könnte dies eine große Umstellung werden, von einer stationären Einrichtung mit vielen Bezugspersonen und anderen Kindern vor Ort in eine Wohnung alleine mit seiner Mutter zu ziehen. |
Kämpfen für die eigenen Rechte
In sieben Interviews nimmt das Kämpfen für die eigenen Rechte einen hohen Stellenwert ein. Frau Ibach und Frau Lange beschreiben in folgenden Interviewsausschnitten, wie sie um ihre Rechte als Mutter kämpfen. Frau Ibach schildert eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der stationären Einrichtung um einen Termin beim Kinderarzt, den sie lieber alleine wahrnehmen wollte:
Frau Ibach: Ich hab das x-mal gesagt, dass ich alleine gehe, ich hab das sonst auch alleine gemacht, fünf Monate in ... Ja, und dann war Wolfgang wohl hinterhergelaufen. Und dann nachher, nach der Untersuchung, wir waren wieder hier mit Jette und sagte er nur, "ja ich bräuchte wohl das gelbe Heft". "Nee das kriegst du nicht, das bleibt bei der Mutter!" Ja, dann war der so sauer, ich war sauer. "Ja was willst denn jetzt das gelbe Heft?" Ich sag, "das gelbe Heft ist das Untersuchungsheft, das kriegst du nicht! Das haben die erzählt, das bleibt bei der Mutter, und dann bleibt das bei der Mutter!" (LACHT).
In Frau Langes Schilderung geht es um die Fremdunterbringung ihres dritten Kindes:
Frau Lange: Und hab dann gesagt, ja was, äh, wie soll das denn jetzt hier dann weitergehn? *** Dem Jugendamt hab ichs auch gesagt * dass ich mir eine bessere Lösung wünsche, die wie auch immer aussehen sollte, äh, ´ne bessere Lösung wäre schon nicht schlecht. Naja, die bessere Lösung vom Jugendamt war * Pflegeeltern. Ich hab gesagt, um Gottes Willen, was soll denn das? Ich bin dann zu der Leiterin von, von dem Mutter-Kind-Heim gegangen, und hab gesagt, äh, ich weiß nicht was das soll. Schon wieder diese Wegnahme-Geschichte. Ich hab die Schnauze voll, ich will eigentlich Malte behalten. Was heißt hier eigentlich, ich will ihn behalten! Das ist MEIN Sohn * ICH bin die Mutter und habe dementsprechende Rechte! Und ich hoffe, dass Sie mir helfen können, weil Sie mir das damals gesagt haben, dass Sie das dann machen, wenn es dann soweit ist. * (...)
Fremdbestimmung, keine Mitsprache (Gefühl von Abhängigkeit, keine Wahl zu haben)
In sechs Interviews wird bei den Eltern(teilen) ein grundlegendes Lebensgefühl von Fremdbestimmung
und Abhängigkeit deutlich. Die Eltern berichten von ihren Erfahrungen, in Entscheidungsprozesse
bezüglich ihrer Zukunft und der weiteren Hilfeplanung nicht ausreichend mit
einbezogen zu werden. Dies verdeutlicht folgender Ausschnitt aus dem Interview mit Frau
Ibach:
Interviewerin: Und wie kam das, dass Sie dann hierhin gezogen sind?
Frau Ibach: Von das Jugendamt aus, von dem Herrn Rauschert, den ich nicht leiden mag.(...) Interviewerin: Jugendamt hat gesagt, Sie müssen hier hin, oder?
Frau Ibach: Ja, die hatten zu mir damals gesagt, entweder du gehst in eine Einrichtung, darfst das Kind behalten, ne, und wenn du da nicht gehst, dann musst Jette abgeben.
Interviewerin: Ui.
Frau Ibach: Das war damals, wo ich noch schwanger war. Dann hieß es immer, Gespräche, die ersten beiden warn immer ohne mich stattgefunden, da war ich richtig sauer * ich mag Herrn Rauschert heute nicht. (...) Ja, und dann beim dritten Gespräch durft ich dabei bleiben, beim vierten Gespräch mußt ich die Hälfte vom Gespräch raus, obwohl es um mich und Jette ging! (...) wenn es um Herrn Rauschert gegangen wär, müßte ich Jette abgeben, nachdem er gehört habe, dass sie einen Herzfehler hat.
Interviewerin: Weil der befürchtet hat, Sie können sich nicht gut um sie kümmern?
Frau Ibach: Genau. [...]Nee, aber der war auch richtig streng. Ja und im März ist dann auch wieder Besprechung.
Interviewerin:Und der hat dann gesagt, Sie dürfen sie behalten, wenn Sie hierhin ziehen.
Frau Ibach: Hmh.
Interviewerin: Und dann ham Sie eingewilligt, hier hin zu ziehen?
Frau Ibach: Nicht freiwillig!
Interviewerin: Nicht freiwillig.
Frau Ibach: Hmh. Ich wollte auch nicht mehr hierhin ziehen.
Das Gefühl, keine Wahl zu haben, nicht gehört zu werden und sowieso nichts bewirken zu können,
wird zum Beispiel in folgendem Ausschnitt aus dem Interview mit Frau Adler und ihrem
Mann deutlich:
Frau Adler: Und das, äh (...) wenn ich äh, Kritik übe, oder verübe (...) äh * es * es wir immer so abgetan, so nach dem Motto, äh, " das ist so, und das muss so sein", also da wird gar nicht drüber * diskutiert, so
Interviewerin: es ändert sich nichts, ne.
Frau Adler: es ist einfach beschlossene Sache, Punkt, Basta, Peng.
Herr Adler: Und darüber wird auch gar nicht, da drüber geredet.
Frau Adler: So nach dem Motto, entweder, so nach dem Motto, du hast dich jetzt, äh, damit abzufinden, und du hast dich zu fügen
Interviewerin: Oder, sonst?
Frau Adler: oder, oder es gibt Ärger.
Interviewerin: Das ist also nicht genauer bekannt, welcher Ärger das ist, sondern nur dass es Ärger ist.
Frau Adler: Äh, ja, Ärger, äh in dem Sinne, ähm, ich habe, äh genau// genauso wie Klaus (ihr Mann), Herrn Koch gegenüber auch schonmal meinen Mund aufgemacht, und habe mich dann mit ihm zusammen wenig später bei Frau Müller im Büro gesehen.
Interviewerin: Ah ja, da werden Sie dann dahin zitiert und müssen dann //
Frau Adler: Ja, also so nach dem Motto, beim Ambulant Betreuten Wohnen DARF man zwar seine Meinung äußern, aber Wehe du machst das.
|
Familie Adler (...) also ist das mehr oder weniger auch ein Stück Abhängigkeit (...) das ist ein blödes Gefühl, ganz ehrlich, also, das ist ein total doofes Gefühl." Frau und Herr Adler, beide Anfang 30, leben zusammen mit ihrer 4jährigen Tochter Anna in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Frau Adler ist durch Cerebralparese körperbehindert. Beide Eltern arbeiten Vollzeit in einer WfB. Anna ist bis zum Nachmittag in einem Kindergarten. Frau Adler ist zusammen mit einer jüngeren Schwester in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Sie hat versucht, nach der Schule eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk zu machen, die sie zu ihrem Bedauern nicht geschafft hat. Ihre Arbeit in der WfB gefällt ihr nicht besonders gut, sie weiß die Vorteile der Beschäftigung in der WfB zwar zu schätzen, hätte aber lieber etwas "mit Köpfchen". Um sich beruflich zu verändern, bräuchte sie allerdings Unterstützung. Das Paar hat sehr gute Beziehungen zu Frau Adlers Familie. Ihre Schwester und deren Familie lebt in derselben Stadt und unterstützt sie bei Bedarf, z.B. verbringt Anna häufig die Wochenenden und auch den Urlaub bei ihrer Tante, was die Eltern als Entlastung empfinden. Herr und Frau Adler organisieren ihren Haushalt zum großen Teil selbständig, wobei sich Herr Adler hauptsächlich um Anna kümmert. Neben dem Haushalt leistet er auch die erforderliche Unterstützung für seine körperbehinderte Frau. Der Alltag beginnt für die Familie um 6 Uhr. Herr Adler bringt Anna mit dem öffentlichen Bus zum Kindergarten, bevor er zu seiner WfB fährt. Frau Adler wird von einem Fahrdienst zur Arbeit abgeholt. Nachmittags holen die Eltern Anna meistens gemeinsam im Kindergarten ab und fahren dann mit dem öffentlichen Bus nach Hause. Außerfamiliär haben Frau und Herr Adler etwas privaten Kontakt zu Arbeitskolleg_nnen aus der WfB, die ebenfalls Kinder haben und mit denen sie sich zu besonderen Anlässen treffen. Da sie schon lange in derselben Region leben, fühlen sie sich zwei ehemaligen Erzieherinnen freundschaftlich verbunden, von denen eine Frau Adler noch von früher kennt. Der Kontakt ist aber eher locker. Von professioneller Seite erhält die Familie wöchentlich einige Stunden Unterstützung. Beide Eltern haben ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Unterstützung. Einerseits fühlen sie sich darauf angewiesen, da die professionelle Unterstützung auch in Notfällen, z.B. falls Herr Adler einmal krank ist, einspringt. Auch in Fragen der richtigen Erziehung und der finanziellen Planung möchten sie sich durchaus beraten bzw. unterstützen lassen. Gleichzeitig ist ihnen ihre Selbständigkeit wichtig und sie sind stolz darauf, was sie alles alleine schaffen. In dieser Hinsicht erleben sie die derzeitige Unterstützung als unbefriedigend. Sie empfinden die Besuche der Fachkraft als eine massive Einmischung in ihr Privatleben und erleben auch andere Aktivitäten der Fachkraft als übergriffig. Insbesondere fühlen sie sich in ihren Kompetenzen und in ihrer Lebensleistung nicht immer respektiert und finden, dass ihre Kritik nicht ernst genommen wird. Aus diesem Grund ist es auch schon zu Konflikten gekommen, sowohl mit dem unterstützenden Dienst als auch zwischen den Eltern, da Herr Adler weniger diplomatisch vorzugehen scheint als seine Frau und Frau Adler in der Folge neuen Ärger mit dem unterstützenden Dienst befürchtet. |
Professionelle Hilfe = Einmischung in die familiäre Privatsphäre
In sechs Interviews ist für die Eltern bestimmendes Thema, dass die professionelle Hilfe als
Einmischung in die familiäre Privatsphäre empfunden wird, wie zum Beispiel in folgendem Interviewausschnitt
mit Frau Adler deutlich wird:
Frau Adler: Ja ja, ABER, äh, Herr, Herr Koch möchte über alles informiert sein. Auch äh, über die Sache, äh, was äh, bei den Elternabenden besprochen ist, oder äh, über diese Sache, über dieses Thema zum Beispiel, ob Anna zum Feriendienst im Kindergarten angemeldet wird, und wann //
Interviewerin: #und haben Sie das Gefühl, dass Ihnen da was weggenommen wird?#
Frau Adler: #und wann#, und wann Anna vom Feriendienst abgeholt wird so, darüber möchte Herr Koch
Interviewerin: Bescheid wissen
Frau Adler: PRÄZISE informiert sein.
Interviewerin: Und da haben Sie das Gefühl, das nimmt Ihnen was weg.
Frau Adler: Ja, äh, das ist //
Interviewerin: Ihnen nicht recht.
Frau Adler: Das ist für mich irgendwie äh, wie eine //
Interviewerin: Einmischung.
Frau Adler: Wie eine dritte Person, die sich, äh, in die Familie drängt, ja, und äh, mir irgendwie, äh, mir irgendwie das Gefühl gibt , du kannst mit diesen Informationen ja sowieso nichts anfangen, bitte äh, sag mir lieber bescheid.
Interviewerin: Das heißt, in Ihre eigenen Angelegenheiten sich einmischt.
Frau Adler: Also, äh, hab ich, äh, muß ich ganz ehrlich sagen, tschuldigung den Ausdruck, aber, äh, ich hab wirklich manchmal das Gefühl, ähm, dass, äh, dass ich in der Hinsicht äh, so behandelt wäre, als, äh, würde ich das geistig nicht verstehen, was abläuft.
Frau Reuter beschreibt, dass sie zwar Hilfe benötigt, aber in ihrem Privatleben unbedingt auch freie Zeit braucht, in der keine Unterstützer_innen zu ihr nach Hause kommen.
Interviewerin: Jeden Tag kommt jemand?
Frau Reuter: Jeden Tag kommt gar keiner, das ist aber jeden Tag jemand kommen SOLLTE ** dann geh ich flüchten.
Interviewerin: Das ham Sie gesagt, das wollen Sie nicht, dass jeden Tag einer kommt?
Frau Reuter: Ja.(...)Dienstag ist O.K., Montag ist auch O.K., aber übertriebene Sachen, nä, ich hab selber auch Leben, ich muss einkaufen, ich muss das machen, ich kann doch nicht Hause hocken.
In folgendem Interviewausschnitt wird deutlich, welche Bedeutung die Achtung der Privatsphäre in einer familiären Betreuungssituation einnimmt. Frau und Herr Huber, bei denen anfangs eine ohnehin sehr belastende 24-Stunden-Betreuung in der eigenen Wohnung installiert wurde, schildern dies so:
Interviewerin: Und wie fanden Sie das?
Herr Huber: * Schwierig. *
Interviewerin: Immer jemand im Haus, ne.
Herr Huber: Immer im Haus, hier nach dieser 24Stunden, immer jeder ´n anderer.
Interviewerin: Immer wieder andere, hmh.
Interviewerin 2: Die haben dann immer gewechselt.
Herr Huber: Immer gewechselt. Einer kam rein ohne klopfen, hat , hat hat einer ´n Schuh vor´n Kopf gekriegt von mir.
Frau Huber: (LACHT) Wenn halbwegs im Schlaf ist.
Herr Huber: Nee, ich war ja schon wach, ich hab ja schon nachts geguckt ob alles in Ordnung ist, da kommt sie rein ohne klopfen, Schuh genommen, buing.
Frau Huber: Ja, beinah.
Interviewerin 2: Hmh. Aber das war ihnen auch zuviel.
Interviewerin: Und dann war´n Sie wahrscheinlich froh/
Herr Huber: wenn sie n paar Stunden weg waren.
Interviewerin: Ja.
Herr Huber: (LACHT)
Zufriedenheit durch Engagement (Lernen/Beruf/Hobby/Lebensplanung)
In sechs Interviews ist als Faktor, der zur grundlegenden Zufriedenheit beiträgt, das Engagement
für eigene Ziele erkennbar - Engagement dafür, sich selbst weiterzuentwickeln, etwas
neues zu lernen, sich für ein Hobby, im Beruf oder für eine bessere Wohnperspektive zu engagieren.
Dies wird in folgenden Zitaten deutlich:
Herr Olbrich: Deswegen hab ich auch mein Hobby viel. Ich mache Figuren, ich spiele, ich baue, ich modelliere, deswegen arbeite ich jetzt auch in ´ner Töpferei in X. (WERKSTATT) (...) und da hab ich auch meinen Therapeuten, den Herrn Schödel, und den hab ich schon seit ein paar Monaten schon, geht gut, er ist ein sehr guter Therapeut, macht sehr viele Anregungen, erklärt auch einiges, wie was wie falsch machen, oder wie, Anregungen sind auch sehr gut. Und da lern ich auch, meine eigenen Stärken wieder zu finden, und dann, nicht nur zu sehen, was damals war, vor Jahren **
Frau Köhler beschreibt:
Frau Köhler: (...) und ich hab auch gesagt, ich brauch VOLLE Unterstützung.* Volle Unterstützung vom Jugendamt, ne, so. Und die finden das auch toll, ich war schon beim Eltern-Gordon-Training war ich.
Interviewerin: Welches Training?
Frau Köhler: Eltern-Gordon-Training, das ist so ein Training für Erziehungshilfen.
Interviewerin: Ahja. Dann machen Sie also so nen Kurs mit?
Frau Köhler: Hab ich auch schon gemacht. Also ich hol mir so einige Tipps.
Interviewerin: Ja klasse.
Frau Köhler: Und die nehm ich so mit.
Interviewerin: Und dann kriegen Sie auch das, was Sie brauchen?
Frau Köhler: Genau.(...)
Familie Uhlenbrock zum Beispiel hat als Ziel, für das sie sich einsetzt, eine andere Wohnperspektive vor Augen:
Herr Uhlenbrock: In ne eigene Wohnung!
Interviewerin: Das ist der Plan?
Herr Uhlenbrock: Ja.
Interviewerin: Wenn Maik größer ist, oder?
Herr Uhlenbrock:Ja.
Interviewerin: Oder finden Sie es ganz, würden Sie ganz gerne einfach hier immer wohnen?
Herr Uhlenbrock: Nä, nicht für immer. Ich will doch draußen wohnen! Ne eigene Wohnung, und dann oben über Betreutes Wohnen.(...)In X. war es ja auch so, da war´n wir auch im Betreutes Wohnen, da ham sie auch uns betreut. Und das will ich ja auch mit Maik auch so machen. Dass se nach ´m rechten guckt.
Interviewerin: Das ist gut, wenn jemand nach ´m rechten guckt, oder?
Herr Uhlenbrock: Ich war zufrieden. Und das will ich mit Maik auch, nach ´m Rechten guckt.
Zufriedenheit in der Familie, dem Umfeld
Bei fünf Familien geht aus den Interviews hervor, dass sie mit ihrem Leben, das sich im Wesentlichen im familiären Rahmen und einem eng umgrenzten Umfeld abspielt, zufrieden sind und dass sie keine Ausweitung ihres sozialen Netzes anstreben, wie z.B. in folgenden Interviewausschnitten mit Herrn und Frau Beutel deutlich wird:
Frau Beutel: Oder wir gehen hier auf den Spielplatz, nehmen Kaffee mit raus, und dann//
Interviewerin: Ah Picknick.
Frau Beutel: und dann trink ich mit Nachbarn nen Kaffee.
Interviewerin: Ah das ja schön
Frau Beutel :Und die spieln dann im Sandkasten, und Schaukeln.[...]
Herr Beutel: Und wir gehen meistens hier hinten an der Bahn lang, und gucken, und winken die Züge.(...)
Interviewerin: Ja, hätten Sie da gern mehr Angebote, fehlt Ihnen da was, hätten Sie da gerne?
Herr Beutel: Wochenende spielen wir meistens hier mit die Kinder alleine, oder gehen zum spielen.
Interviewerin: Hmh. Also da fehlt ihnen eigentlich nichts
Herr Beutel: Nein. (...)
|
Familie Huber "Nee, nee, brauchen wir nicht. Wir gehen Wochenende auch alleine weg mit ihm." Herr und Frau Huber (beide Ende 30) leben zusammen mit ihrem 10-jährigen Sohn Lukas in einer eigenen Wohnung. Sie haben außerdem noch einen 9-jährigen Sohn, Julius, der 10 Wochen zu früh und mit erheblichen Beeinträchtigungen geboren wurde. Dieser lebt in einer Pflegefamilie. Herr Huber ist auf einem Außenarbeitsplatz seiner WfB im Schichtdienst berufstätig. Frau Huber hat früher in der WfB gearbeitet und ist derzeit nicht berufstätig, was sie auch nicht vermisst. Lukas wird morgens von einem Fahrdienst zur Schule gebracht, er gilt als sog. Integrationskind und wird von den Eltern als sehr lebhaft und unruhig beschrieben. Nach der Schule ist Lukas zu Hause bei seiner Mutter. Herr und Frau Huber waren schon vor Lukas' Geburt verheiratet. Zur Familie von Herrn Huber bestehen gute Kontakte, z.B. fahren Herr und Frau Huber im Urlaub mit Lukas zu den Großeltern, in den Ferien besucht Lukas seine Großeltern auch alleine. Zur Familie von Frau Huber besteht kein Kontakt. Lukas hatte als Neugeborener Probleme mit der Nahrungsaufnahme. In der ersten Zeit nach seiner Geburt erhielten Herr und Frau Huber in ihrer Wohnung eine 24-Stunden-Betreuung. Diese Zeit haben sie als "schwierig" in Erinnerung, weil ständig wechselnde Leute in ihre Wohnung kamen. Einer der Mitarbeiter habe nicht einmal angeklopft habe, bevor er in ihr Zimmer kam. (Dagegen haben sie sich gewehrt.) Als Julius geboren wurde, kam dieser direkt vom Krankenhaus in ein Heim, wo die Eltern ihn besuchen und versorgen konnten. Von dort aus sollte er in eine Pflegefamilie vermittelt werden. Dagegen haben Herr und Frau Huber mit Unterstützung ihrer gesetzlichen Betreuerin geklagt, aber den Prozess verloren. Das Sorgerecht haben die Eltern behalten und sie konnten auch die Pflegefamilie mit aussuchen. Inzwischen sind Herr und Frau Huber mit dieser Regelung versöhnt und haben selbst Zweifel, ob sie den gesundheitlichen Problemen (schweres Asthma, Herzfehler) von Julius gewachsen wären. Sie haben regelmäßigen Kontakt mit den Pflegeeltern und jedes zweite Wochenende kommt Julius für einige Stunden zu ihnen zu Besuch. Ab und zu gibt es dann zwischen den Kindern kleine Reibereien. Zum Jugendamt haben Herr und Frau Huber inzwischen ein gutes Verhältnis und keine Angst, dass ihnen auch Lukas weggenommen werden könnte. Die Aufgaben im Haushalt erledigt Frau Huber im Wesentlichen alleine, wobei die Mitarbeiter_innen vom Ambulant Betreuten Wohnen dreimal in der Woche kommen und zumindest beim Einkaufen helfen. Bei der Geldeinteilung erhält Familie Huber Unterstützung von ihrer gesetzlichen Betreuerin. Außerdem kommen von einem anderen Dienst (Familienhilfe) zweimal wöchentlich Mitarbeiter_innen für Lukas, mit denen Frau Huber gelegentlich Konflikte hat, vielleicht weil sie sich in die Arbeit mit Lukas zu wenig einbezogen fühlt. Trotz der angedeuteten Verhaltenssauffälligkeiten berichten die Eltern - auch auf Nachfrage - kaum von Erziehungsproblemen mit Lukas. Vielleicht nehmen sie dies nicht so wahr oder es ist ihnen unangenehm. Zwischen den Diensten scheint es keine Kooperation zu geben. Zu Elternabenden oder anderen Veranstaltungen in Lukas' Schule geht Herr Huber, sofern er nicht arbeiten muss. Frau Huber geht nicht dorthin, sie fühlt sich dort nicht wohl und hat auch niemanden, der bei Lukas bleiben würde. Abgesehen von den Fachkräften haben Herr und Frau Huber wenig soziale Kontakte. Beide Eltern nennen bei der Erhebung ihres sozialen Netzwerkes keine Freunde oder Freundinnen. Sie leben eher zurückgezogen und auf ihre Familie bezogen. Sie möchten auch keine Hilfe, um neue Kontakte zu knüpfen. |
Zufrieden geben mit dem, was ist
Durch fünf Interviews zieht sich die Lebenseinstellung der Eltern(teile), sich mit dem zufrieden zu geben, was ist; sich mit der Situation abzufinden. Dies wurde zum Beispiel an dem Thema der beruflichen Perspektiven deutlich. Frau Janick klingt resigniert, als sie formuliert:
Interviewerin: Und, ähm, war´n Sie denn eigen// ähm, hätten Sie auch Lust, nochmal was anderes zu lernen oder zu arbeiten, außerhalb der Werkstatt?
Frau Janick: Nee ich glaub nicht, dass ich da was kriegen würde, mit ner Lernschwäche.
Frau Emmerich beschreibt:
Frau Emmerich:(...). Ich arbeite in der ... (NAME WERKSTATT), auch mit beeinträchtigten Menschen.(...) mit beeinträchtigten Menschen, fr//, also das ist ne anerkannte (UNTERBRECHUNG DURCH DAS KIND), das ist ne anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Jetzt heißt es beeinträchtigt, früher sagte man noch behindert.
Interviewerin 2: Ja.
Interviewerin: Da arbeiten Sie?
Frau Emmerich: Den Job hab ich wenigstens n Leben lang, also ich brauch keine Angst haben, arbeitslos zu werden. (...) Ja und, den Job hab ich auch von Frau Wolle gekriegt, ich sag, war ich mit ihr beim Arbeitsamt, ich sag, mach wat de willst, ich hab auch zu jemandem vom Arbeitsamt gesagt, "ich geh nicht anschaffen, ich vertick keine Drogen, und ich putz auch keine Toiletten, auf irgendwelchen Bahnhöfen, der Rest ist mir egal." Weil 1-Euro Jobs, ja gut, dann haste mal 6 Monate Arbeit, hockste wieder zu Hause, ja was is ´n das, und dann sitzte da und warteste irgendwann mal wann de den nächsten -Euro Job abkriegst, nee.
Interviewerin: Das heißt, deswegen war ´n Se eigentlich ganz froh, dass Sie da in der Werkstatt anfangen konnten?
Frau Emmerich: Vor allen Dingen den Job hab ich ´n Leben lang, also ich brauch keine Angst haben, arbeitslos zu werden. Und das ist das Beste. Gut sein Vater verdient zwar auch, kümmert sich kaum um seinen Sohn, wenn er´s endlich man gebacken kriegt. Ja * und ich habe keine Lust, ein Leben lang von Hartz 4 zu leben. (...)
Interviewerin: Naja aber so wahnsinnig viel verdienen Sie ja in der Werkstatt auch nicht, ne.
Frau Emmerich: Naja im Jahr wenn´s hochkommt zweitausend, zweifünf. Besser, besser als gar nichts.
In folgendem Interviewausschnitt mit Frau Gebhard wird eine ähnliche Einstellung deutlich:
Interviewerin: Und sind, hätten Sie Interesse dran, ne andere Arbeit zu finden, und?
Frau Gebhard: Nä.
Interviewerin: Nicht. Also nicht dass Sie jetzt sagen, oh, die sollten mir mal ´n bisschen bei helfen, dass ich mal ne andere// Sie gehen da ganz gerne hin?
Frau Gebhard: Ja.
Interviewerin: Was machen Sie da, in welchem Bereich?
Frau Gebhard: Äh, ich bin im Montagebereich, ne also im Moment packen wir Werkzeug ein (...).
Interviewerin: Das ist ´ne Abteilung, in der Sie ganz gerne sind?
Frau Gebhard: Hmh.
Interviewerin: Ach, haben Sie auch schon mal andere Sachen da gemacht?
Frau Gebhard: Jaha, verschiedene Sachen.
Interviewerin: War das besser, oder?
Frau Gebhard: Nö. Geht so, ne.
Interviewerin: Mal so mal so.
Frau Gebhard: Hauptsache, man hat Arbeit, ne!
Verpflanzung
Für vier der stationär unterstützten Eltern(teile) ist die sogenannte "Verpflanzung", die meist mit dem Umzug in eine stationäre Einrichtung einhergeht, ein bedeutsames Thema. Deutlich wurde ein Gefühl der Entwurzelung (Heimweh, Trennung von der Herkunftsfamilie und dem sozialen Netz).
|
Frau Ibach Dass ich mit Jette bald wieder zurück möchte nach meine Heimat! Frau Ibach ist Anfang 40 und lebt mit ihrer anderthalbjährigen Tochter Jette in einer stationäre Einrichtung der Begleiteten Elternschaft. Frau Ibach ist alleinerziehend. Zu Jettes Vater besteht zur Zeit kein Kontakt; Frau Ibach hat den Kontakt abgebrochen, da seine ablehnende Reaktion auf ihre Schwangerschaft sie sehr verletzt hat. Jette ist mit einem Herzfehler und anderen Komplikationen zur Welt gekommen. Der Herzfehler wurde erfolgreich operiert. Jette hat sich gut entwickelt, bedarf aber in vielen Bereichen besonderer Förderung. Frau Ibach wirkt sehr stolz auf ihr Kind und ihre Mutterschaft. Zur Zeit ist Frau Ibach in Elternzeit. Vor ihrer Schwangerschaft war sie in der Werkstatt für behinderte Menschen tätig und hat sich in ihrer letzten Arbeitsgruppe sehr wohl gefühlt, weil ihr der Chef gut gefallen hat, dort hat sie gerne gearbeitet. Sie hofft, ihre alte Arbeit nach der Rückkehr in ihre Heimat wieder aufnehmen zu können. Frau Ibachs großes Ziel und ihr Wunsch ist es, sobald wie möglich nach Hause zurückkehren zu dürfen. Der Umzug in die stationäre Einrichtung, die weit von ihrer Heimatstadt entfernt ist, war für Frau Ibach keine freie Entscheidung, sondern die einzige Möglichkeit, um mit Jette zusammen leben zu dürfen. Seitdem noch pränatal der Herzfehler ihres Baby diagnostiziert wurde, war das Jugendamt der Auffassung, dass Frau Ibach nicht für Kind sorgen könne und erwog eine Fremdunterbringung. Nach der Geburt von Jette musste Frau Ibach einige Wochen im Krankenhaus verbleiben und wusste bis kurz vor der Entlassung nicht, wo und ob sie mit ihrer Tochter zusammen leben würde. Nach einigen Monaten in einem Mutter-Kind-Heim, die Frau Ibach als sehr stressig empfunden hat, ist sie schließlich in die stationäre Einrichtung für begleitete Elternschaft gezogen, nicht freiwillig, wie sie ganz klar formuliert. Frau Ibach, die sich gewünscht hatte, mit Jette zu ihrer in derselben Stadt lebenden Tante zu ziehen, ist über diese Entscheidung des Jugendamtes nach wie vor sehr wütend und traurig. Frau Ibach kritisiert, dass sie bei grundlegenden Entscheidungen ihr Leben betreffend nicht mit einbezogen wurde und Dinge über ihren Kopf hinweg entschieden wurden, sie fühlt sich manchmal behandelt wie ein kleines Kind, das nicht ernst genommen und dem nicht zugehört wird. Für sie bedeutet der Umzug eine Verpflanzung, sie fühlt sich abgeschnitten von ihrem sozialen Netz, das sich neben ihrer Tante und ihren Geschwistern, zu denen sie engen emotionalen Kontakt hat, hauptsächlich aus Mitarbeiter_innen des Betreuten Wohnens, der Werkstatt und Kolleg_innen zusammensetzt. Frau Ibach hat, obwohl sie unfreiwillig dort lebt, zu etlichen Mitarbeiter_innen der stationären Einrichtung ein positives Verhältnis. Allerdings fühlt sie sich in vielen Bereichen in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt, ihr gefällt der strikte Tagesablauf nicht, sie möchte mehr alleine entscheiden und unternehmen. Ihr fehlt jemand, mit dem sie reden kann, wenn sie traurig ist und sie fühlt sich oft einsam. In der Einrichtung kann sie nicht so gut mit jemandem über ihre Sorgen sprechen, weil sie befürchtet, dass dann schlecht über sie geredet wird. Hilfreich und entlastend findet sie, dass ihr Jette ab und zu abgenommen wird, wenn sie gestresst ist, und jederzeit jemand erreichbar ist. Sie unternimmt aber ungern etwas ohne Jette, sondern nur, wenn es unbedingt sein muss, weil sie kein Vertrauen hat, dass die Mitarbeiter_innen sie so versorgen, wie sie es für richtig hält. Dass Frau Ibach ihren Aufenthalt in der Einrichtung nur als vorübergehend wahrnimmt, wird daran deutlich, dass sie sich dagegen sperrt, ihre Berufstätigkeit wieder aufzunehmen, sowie Jette in der dortigen Kita vor Ort anzumelden. Frau Ibach bedauert es, dass sie keinen Kontakt zu nicht behinderten Müttern hat, die außerhalb der Einrichtung leben, und vermutet, dass hier Berührungsängste zu den in der Einrichtung lebenden Müttern bestehen. |
Misstrauen "Fremden" gegenüber, kein Vertrauen
In vier Interviews wird ein grundlegendes Misstrauen und fehlendes Vertrauen anderen Menschen gegenüber deutlich. Frau Reuter formuliert:
Interviewerin: Wenn Sie sich mal unglücklich fühlen, können Sie dann mit jemandem reden?
Frau Reuter: *** Nee eigentlich nicht.
Interviewerin: Keine Freundin?
Frau Reuter: Ich traue gar keine.
Interviewerin: Hmh.
Frau Reuter: Weil meine, äh, dass ich irgendwas sage, dann geht sie da petzen, da petzen.
Interviewerin: Bei Ihrer Freundin? Hmh.
Frau Reuter: Und dann hinterher krieg ich die große Salat.(...)
Herr Franke und Frau Fritz beschränken ihre sozialen Kontakte aufgrund von Misstrauen gegenüber Anderen auf ihre Familie und die ihnen vertrauten Unterstützungspersonen:
Herr Franke: Äh, wir sind eigentlich so eher lieber Familie als alles andere.
Interviewerin: Sie wollen gar nicht so.
Frau Fritz: Nä.
Herr Franke: Weil, ganz einfach, man kann auch an falsche Freunde geraten.
Interviewerin: Ja gut, kann man, hmh.
Herr Franke: So und in dem Moment, wo du an falsche Freunde geratest, die können dir irgendwas, können dir was von der Wohnung auslabern, weißt du, dann steht das Amt wieder vor der Tür und sowas brauch ich nicht.
Interviewerin: Das heißt, das ist so ´n bisschen auch Schutz.
Herr Franke: Dann arbeite ich lieber mit de Betreuer zusammen, oder wir fahren zur Familie runter, die wissen schon. (...)
Obwohl auch bei der qualitativen Auswertung positive Äußerungen einen breiten Raum einnehmen, ganz besonders der Stolz darauf, das Leben (wieder) zu bewältigen, wird bei einer genaueren Betrachtung der wörtlichen Äußerungen der Eltern und ihrer Familiengeschichten schnell deutlich, wie viel schmerzhafte oder zumindest schwierige Erfahrungen hinter diesem Stolz und der ebenfalls öfters geäußerten Zufriedenheit liegen. Manche Eltern haben viel in Kauf genommen und bringen große persönliche Opfer, um mit ihren Kindern zusammen leben zu können, sei es, dass sie einen Umzug in einen entfernten Ort hinnehmen müssen, dass sie mit Personen kooperieren müssen, die sie nicht mögen oder dass sie sich damit arrangieren müssen, dass ihre Privatsphäre drastisch beschnitten wird.
Angesichts der oft schwierigen familiären Verhältnisse, die die meisten Eltern in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben, und vor dem Hintergrund schlechter Erfahrungen mit "falschen Freunden", hat für viele die Zuverlässigkeit der professionellen Hilfe und die dadurch erreichte Sicherheit eine hohe Bedeutung. So geben sich manche einfach zufrieden damit, wie es ist und äußern keine weiteren Wünsche. Hin und wieder klingt dabei etwas Resignation durch. Allerdings können alle interviewten Eltern(teile) recht genau benennen, was ihnen an einer aktuellen oder früheren Unterstützung nicht gefällt.
Einige Eltern sind stärker zukunftsorientiert und schöpfen daraus Kraft. Sie machen Pläne, setzen sich Ziele, auch für ihre persönliche Weiterentwicklung, oder kämpfen für ihre Rechte. Aber auch sie gehen davon aus, dass sie auf die Unterstützung durch Fachkräfte angewiesen sind, sei es im Alltag oder gegenüber Ansprüchen des Jugendamtes, und gehen damit ganz selbstverständlich um. Die von uns befragten Familien haben offenbar die Tatsache, dass sie professionelle Unterstützung erhalten, in ihr Leben integriert.
Was die verschiedenen Haltungen der Eltern im Einzelnen für die Kinder in diesen Familien bedeuten, ist schwer zu ermessen. Eines zumindest dürfte sich den Kindern vermitteln, nämlich dass sie eine ganz große Bedeutung für ihre Eltern haben und dass diese Vieles auf sich nehmen, um mit ihnen zusammen sein zu können.
Auf der Grundlage der dargestellten quantitativen und qualitativen Ergebnisse können nun die in Punkt 2 entwickelten Fragestellungen beantwortet werden. Da unsere Interviewpartner_innen bewusst nicht nach Gesichtspunkten der Repräsentativität ausgewählt wurden, sondern die Stichprobe kriterienorientiert zusammengestellt wurde, um gezielt bestimmte Lebens- und Unterstützungssituationen in den Blick zu nehmen (vgl. Punkt 5), ist nicht auszuschließen, dass die von uns erzielten Ergebnisse tendenziell eine positivere Situation zeichnen als sie für Eltern mit Lernschwierigkeiten im norddeutschen Raum im Allgemeinen zutrifft. Die von uns interviewten Eltern werden fast alle von Diensten unterstützt, die sich auf die Begleitung dieser Eltern spezialisiert und langjährige Erfahrung damit haben. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Eltern in besonders konfliktträchtigen Fällen von den Fachkräften nicht auf die Interviews angesprochen wurden, ebenso wie wir keine Eltern befragen konnten, die evtl. in der Folge von Konflikten die Unterstützung abgebrochen haben. Schließlich ist die in Punkt 4 berichtete Neigung zu berücksichtigen, wonach Menschen mit Lernschwierigkeiten nur zögerlich Kritik äußern und wenig Übung darin haben, eigene Wünsche und Vorstellungen zu äußern, was durch unseren methodischen Zugang zwar gemindert werden sollte, aber möglicherweise nicht immer ganz ausgeräumt werden konnte. Umso höher sind die dennoch auftauchenden kritischen Sichtweisen der Eltern zu gewichten.
Fragestellung 1 lautete: Wie viel und welche Unterstützung erhalten die Eltern/ Familien
aktuell im Kontext ihrer Elternschaften bzw. haben sie früher erhalten? Wie beurteilen die
Eltern Umfang und Qualität der erhaltenen Unterstützung, sowohl rückblickend als auch
aktuell?
Insgesamt bezeichnet sich die große Mehrheit der befragten Eltern als zufrieden mit der Hilfe, die sie aktuell erhält. Diese grundsätzliche Zufriedenheit könnte Ausdruck einer gewissen Dankbarkeit sein, da die Eltern sich darüber bewusst sind, dass sie auf Unterstützung angewiesen sind, um ihre Kinder behalten zu können. Zugleich scheinen die meisten Eltern ausreichend Hilfe bei den verschiedenen Aufgaben zu erhalten, die ihnen als Eltern obliegen und schätzen auch die Unterstützung im Alltag (soweit sie diese benötigen) bis auf wenige Ausnahmen positiv ein. Dennoch erfährt diese grundsätzliche Zufriedenheit, bei fast der Hälfte der Eltern eine gewisse Einschränkung. Diese Eltern thematisieren das Problem, dass die einerseits erwünschte und benötigte Hilfe zugleich Kontrolle und eine Einmischung in ihren privaten Bereich darstellt. Dieses wird bei der ambulanten Unterstützung sogar häufiger problematisiert als bei der stationären, vielleicht weil ein stationärer Aufenthalt immer mit stärkeren Eingriffen verbunden ist, aber als eine Übergangslösung gesehen wird, in der der Privatbereich nur vorübergehend eingeschränkt ist, während ambulant unterstützte Eltern dauerhaft mit solchen Eingriffen leben müssen. Gleichzeitig orientiert sich ihre Lebenssituation stärker an einer gesellschaftlichen Normalität, in der die Wohnung einen höchst privaten und geschützten Bereich darstellt.
In manchen Fällen richtet sich die Kritik auch gegen die Art und Weise, wie die Hilfe von bestimmten Fachkräften geleistet wird. Nicht immer scheinten der in der Fachliteratur geforderte individuelle Zuschnitt auf die Bedürfnisse der Eltern sowie der akzeptierende und respektierende Umgang mit den Familien (vgl. S. 4) im Vordergrund zu stehen.
Bemerkenswert ist, dass sich die Eltern mit der früher erhaltenen Hilfe deutlich weniger zufrieden zeigten und über die Hälfte beklagt, dass damals keine oder keine passende Hilfe verfügbar gewesen sei. Hier ist zu vermuten, dass in der von uns untersuchten Region in den letzten Jahren eine Verbesserung der Versorgungssituation eingetreten ist.
Fragestellung 2 lautete: Wie beurteilen die Eltern ihre familiäre Lebensqualität in den verschiedenen Bereichen und in welchen Bereichen haben sie Unterstützung zur Verbesserung der Situation erhalten oder würden gerne Unterstützung erhalten?
Zu den verschiedenen Bereichen der familiären Lebensqualität äußern sich die Befragten überwiegend zufrieden. Durchaus überraschend ist die Einschätzung der Eltern bezüglich ihrer Arbeit in der WfB, die von mehreren Interviewten als das kleinere Übel gegenüber einer ansonsten drohenden Arbeitslosigkeit gesehen wird. Ungeachtet dessen wird in etlichen Fällen auf Unterstützungsbedarf bei der Suche nach Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt hingewiesen, dem offenbar bisher nicht entsprochen wurde. Was die Wohnsituation angeht, scheinen die meisten Eltern mit ihrer Wohnung ganz zufrieden zu sein, problematisch ist in vielen Fällen aber deren geographische Lage. Insbesondere für stationär unterstützte Eltern stellt ihre "Verpflanzung" in eine andere Region ein großes Problem dar. Hinsichtlich der gesundheitlichen Situation erhalten die meisten Eltern von Fachkräften die erforderliche Unterstützung, private Hilfe scheint hier nicht auszureichen. An den Freizeit- und Urlaubsangeboten äußern die befragten Eltern zwar wenig Kritik, da aber insgesamt nur gut ein Viertel der Familien angibt, allgemeine Angebote im Stadtteil oder in der Kommune wahrzunehmen, bedeutet dies, dass die übrigen Familien kaum am gesellschaftlichen Leben außerhalb der sie unterstützenden Einrichtungen oder außerhalb ihrer Familien teilhaben (s. dazu auch die Ergebnisse zum sozialen Netzwerk). So wird verständlich, warum die Mehrheit der ambulant unterstützten Eltern gerne mehr Gruppenangebote hätte.
Fragestellung 3 lautete: Wie viele soziale Kontakte haben die befragten Eltern und in welchen Feldern ihrer sozialen Umwelt sind diese Personen verortet? Wie eng erleben sie diese Kontakte und wie beurteilen die Eltern deren emotionale Qualität? In welchen Bereichen kommen die Kontakte zum Tragen?
Die Eltern berichten insgesamt von wenig sozialen Kontakten (durchschnittlich 12), wobei der größte Teil auf Familienangehörige und Fachkräfte entfällt und die Netzwerke der Freund_innen und Nachbar_innen besonders klein sind. Einige Eltern nennen keinen einzigen Kontakt im Bereich der Freund_innen oder im Bereich der Nachbar_innen. Auch hinsichtlich der persönlichen Bedeutung der Kontakte stehen die Familienangehörigen und Fachkräfte an vorderster Stelle, erst mit großem Abstand folgen Freund_innen und Nachbar_innen. Der hohe Stellenwert von Fachkräften im Leben der befragten Familien zeigt sich auch daran, dass diese in allen Hilfebereichen eine wichtige Rolle spielen: Nicht nur in Alltagsfragen ("praktische Hilfe" und "Informationen und Ratschläge"), wo sie an vorderster Stelle genannt werden, sondern auch im Bereich "emotionale Hilfe" werden sie fast so häufig genannt wie Familienangehörige. Freund_innen und Nachbar_innen spielen wiederum nur eine untergeordnete Rolle.
Betrachtet man diese Ergebnisse, so wird ein Dilemma deutlich. Fachkräfte spielen im Leben der interviewten Familien eine große Rolle, weil die Familien nicht auf ein unterstützendes soziales Netzwerk in ihrem persönlichen Umfeld zurückgreifen können. Zusätzlich dazu, dass ihre Netzwerke meistens nicht sehr groß sind, sind die Mitglieder der Netzwerke zum Teil selbst auf Unterstützung angewiesen und deshalb als Ansprechpartner_innen nur bedingt geeignet. Umgekehrt könnte es aber auch sein, dass die Eltern kein größeres soziales Netzwerk entwickeln, weil Fachkräfte in ihrem Leben eine so große Rolle spielen und einer Erweiterung der sozialen Einbindung der Familien nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wird - sei es im Bereich beruflicher Möglichkeiten, sei es bezüglich einer stärkeren Einbindung der Familien in allgemein zugängliche Angebote der Kommunen. Insbesondere für die Kinder in diesen Familien wäre aber eine solche Erweiterung ihres Umfeldes von hoher Bedeutung.
Fragestellung 4 lautete: Welche Erfahrungen haben die befragten Eltern mit dem Jugendamt gemacht? Falls sie die Fremdplatzierung von einem oder mehreren ihrer Kindern erlebt haben, wie beurteilen sie die damals erhaltene Unterstützung vor und nach der Trennung von ihrem Kind und wie sehen sie die Fremdplatzierung aus heutiger Sicht?
Bei den Erfahrungen mit dem Jugendamt muss zwischen aktuellen und früheren Erfahrungen unterschieden werden, da sich hier große Diskrepanzen zeigen. Während in Bezug auf "frühere" Erfahrungen eine deutliche Mehrheit der betroffenen Eltern von schlechten oder zumindest ambivalenten Erfahrungen berichtete, gilt dies für "aktuelle" Erfahrungen nur für zwei von 14 Eltern. Dementsprechend ist auch der Anteil der Eltern, die angeben, Angst vor dem Jugendamt zu haben, deutlich gesunken (von 15 auf 3 der 22 Eltern).
Es kann vermutet werden, dass sowohl ein besserer Informationsstand hinsichtlich der Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten bei den Jugendämtern als auch die Tatsache, dass fast alle befragten Eltern (inzwischen) eine Unterstützung durch einen auf begleitete Elternschaft spezialisierten Dienst erhalten, für die Veränderungen ausschlaggebend sind. Was Fremdplatzierungen angeht berichten zwei Drittel der Eltern, dass sie an der Suche nach einer geeigneten Unterbringung ihrer Kinder beteiligt gewesen seien, was als eine wichtige psychologische Unterstützung der Familien in der Trennungsphase zu werten ist und vermutlich einige Eltern rückblickend zu einer positiven Beurteilung der Fremdplatzierung kommen lässt. Etliche Eltern berichteten außerdem von professioneller Unterstützung in der Phase der Trennung von ihren Kindern, einigen hat dies allerdings gefehlt. Die Tatsache, dass drei Viertel der Eltern angeben, regelmäßigen Kontakt zu ihren fremdplatzierten Kindern haben, kann als Indikator für einen überwiegend günstigen Verlauf der erfolgten Fremdplatzierungen gewertet werden, der auch für das Kindeswohl von hoher Bedeutung ist.
Die von uns befragten Familien zeigen sich in ihrer Mehrheit im Großen und Ganzen als zufrieden, sowohl mit der aktuellen Unterstützung, die sie in Bezug auf ihre Elternschaft erhalten, als auch mit ihrer sonstigen Lebenssituation. Damit dürften sie sich sowohl von den Menschen mit Lernschwierigkeiten unterscheiden, die vor ein bis zwei Jahrzehnten "gewagt" hatten, Eltern zu werden, als auch von der großen Gruppe der Eltern mit Lernschwierigkeiten, deren Familien auch heute noch in vielen Regionen Deutschlands eine solche Unterstützung vorenthalten wird und die stattdessen mit ungerechtfertigten Trennungen und Fremdplatzierungen konfrontiert sind.
Trotz der von vielen Befragten geäußerten grundsätzlichen Zufriedenheit mit der Unterstützung, die sie als Familien erhalten, werden auch einige problematische Punkte deutlich. Manche der im Folgenden ausgeführten Punkte haben ihre Ursache vielleicht in unausweichlichen Spannungsfeldern, die jede auf den privaten Bereich abzielende Unterstützung mit sich bringt. Andere Punkte könnten aber durch Veränderungen auf Seiten der unterstützenden Dienste und durch veränderte Rahmenbedingungen zumindest abgemildert werden.
Bereich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Inklusion fördern!
-
Unterstützung der Eltern, am kommunalen Leben teilzunehmen
Nur wenige der befragten Eltern(teile) berichten, dass sie an regulären Angeboten in ihremWohnumfeld teilnehmen und somit am kommunalen Leben teilhaben. Zweifellos fehlt nochin vielen gesellschaftlichen Bereichen eine Kultur der Inklusion, die den Familien eine solcheTeilnahme erleichtern würde, so dass manche Eltern ganz bewusst Begegnungen mit nichtbehindertenMenschen vermeiden, die sie oftmals als unangenehm oder verunsichernd erleben(z.B. Elternabende). Einzelne Familien scheinen sich auch in einer Art "Behindertenmilieu"eingerichtet zu haben, was in der Folge zu einer immer stärkeren Isolation führt unddamit auch Auswirkungen auf die soziale Situation der Kinder hat. Um hier den Teufelskreisvon behindert sein und behindert werden zu durchbrechen, ist zu fordern, dass die Unterstützungskonzeptefür Familien mit Lernschwierigkeiten dieses Thema stärker fokussierenund entsprechende Forderungen nach barrierefreien[8] Angeboten an die Kommunen richten, aber auch Familien stärker darin unterstützen, die vorhandenen regulären Angebote wahrzunehmen.
-
Unterstützung der Eltern bei der Suche nach Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt
In ähnlicher Weise gilt dies für den Bereich der Berufstätigkeit der Eltern. Vor allem im Hinblick auf die Bedeutung der elterlichen Berufstätigkeit für die Situation der Kinder sollte denjenigen Eltern, die daran interessiert sind, jede mögliche Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt zuteil werden. Auch Formen der unterstützten Beschäftigung mit entsprechender Arbeitsassistenz sollten genutzt werden.
-
Unterstützung der Eltern und Kinder bei der persönliche Weiterentwicklung
Als ein Faktor für Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ergab sich in einigen Interviews, dass diese Eltern(teile) sich persönlich weiterentwickeln wollen und Ziele haben, die ihnen wichtig sind Die Lebenszufriedenheit von Eltern hat einen hohen Einfluss auf das Familienklima und damit auch auf die dort lebenden Kinder. Menschen mit Lernschwierigkeiten erfahren im gesellschaftlichen Raum meist wenig Anerkennung. Umso wichtiger erscheint es, sie dabei zu unterstützen, sich persönliche Ziele zu setzen und sich weiter zu entwickeln.
Bereich der Angebotsstruktur für Familien mit Unterstützungsbedarf: Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote entwickeln!
-
Ausweitung von Unterstützungsangeboten über die Fläche:
Diejenigen Eltern, die davon betroffen waren, haben ihre "Verpflanzung", also den Zwang, ihre bisherige Umgebung zu verlassen, um eine für sie passende Unterstützung zu erhalten, als einschneidende negative Erfahrung erlebt, die die ohnehin brisante soziale Situation der Familien in den meisten Fällen noch verschärft. Für Menschen, die kein großes soziales Netz haben und die in der Regel auch nicht über die Möglichkeiten verfügen, regelmäßig zu reisen, kann ein solcher erzwungener Ortswechsel zum Abbruch wichtiger sozialer Beziehungen und damit zu einer zusätzlichen Belastung führen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kinder, die evtl. selbst soziale Verluste erleiden und außerdem mit Eltern zusammen leben, die sich einsam und unglücklich fühlen. Als Konsequenz ist zu fordern, dass mehr geeignete Unterstützungsangebote vor Ort bereitgestellt werden.
-
Unterstützung "aus einer Hand" oder in enger Kooperation der beteiligten Dienste
Soziale Dienste, die sich auf die Begleitung von Eltern mit Lernschwierigkeiten und deren Kinder spezialisiert haben, können den betroffenen Familien umfassende Unterstützung geben, bei der sowohl die Interessen der Kinder als auch die der Eltern berücksichtigt werden. Die Unterstützung erfolgt dann meist "aus einer Hand", d. h. die Familien werden im günstigen Fall von einer überschaubaren Anzahl von Mitarbeiter_innen unterstützt, die über behindertenpädagogische Qualifikationen verfügen und untereinander in Austausch stehen. Fehlt ein solcher spezialisierter Dienst, kommt es vor, dass Familien von verschiedenen, unabhängig arbeitenden Diensten unterstützt werden, die nicht kooperieren und nur zum Teil über behindertenpädagogische Qualifikationen für die Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten verfügen. Dies führt gelegentlich zu unangemessenem Umgang mit den Eltern, verursacht oft Unruhe in den Familien und zieht Verwirrung der Eltern mit der Folge abnehmender Kooperationsbereitschaft nach sich, die leider oft den Eltern angelastet wird anstatt der ungeeigneten Unterstützung.
-
Ausweitung des Patenschaftsmodell
Das Patenschaftsmodell wurde 2001 für Kinder von belasteten Eltern konzeptioniert und seitdem vor allem als Entlastung für Familien mit psychisch krankem Elternteil im Krisenfall (insbesondere längerem Klinikaufenthalt) umgesetzt. Pat_innen können als vertraute Personen im jeweiligen Lebensumfeld für die vorübergehende Unterbringung der Kinder in einer familiären Krisensituation eingesetzt werden (vgl. Trepte 2008, 83ff). Für Familien mit Eltern mit Lernschwierigkeiten steht nicht so sehr der Krisenfall mit Klinikaufenthalt im Vordergrund. In Anbetracht des beschriebenen meist kleinen sozialen Netzes dieser Familien kann das Patenschaftsmodell als Möglichkeit der Netzwerkförderung, gerade auch für die Kinder, angesehen werden (vgl. Lenz u.a. 2010, 162f). Schwerpunkt und wesentliche Aufgabe dieser Form der Unterstützung ist die Gestaltung eines unbeschwerten Alltags für das Kind durch die Patenfamilien an festgelegten Nachmittagen und/oder Wochenenden. Den Kindern werden verbindliche außerfamiliäre Bezugspersonen zur Seite gestellt, was ihnen im Sinne der Resilienzförderung die Möglichkeit zusätzlicher außerfamiliärer Bindungserfahrungen eröffnet. Außerdem erhalten sie die Chance, andere Familienstrukturen kennenzulernen. Die Eltern erhalten Entlastung durch Zeiten ohne ihre Kinder mit dem Wissen, dass diese gut aufgehoben sind.
In den Interviews dieser Studie wurde bestätigt, dass trotz gewisser Skepsis das Modell der Patenschaft für einige Müttern/ Eltern als Unterstützungsform in Frage käme. Somit sollte ein Patenschaftsmodell für Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihre Kinder, das auf die Bedürfnisse dieser Familien zugeschnitten ist und dessen Konzept den Eltern sensibel vorgestellt wird, in die Unterstützungsangebote aufgenommen werden.
Bereich der Ausgestaltung der professionellen Unterstützung: Weitere Professionalisierung der Unterstützungsarbeit!
-
Angemessener Umgang von Fachkräften mit den betroffenen Eltern/ Familien:
Ein akzeptierender und respektierender Umgang der Fachkräfte mit den Familien ist der Schlüssel für eine gelingende Unterstützung. Dazu gehören so einfache wie selbstverständliche Höflichkeitsregeln wie die Achtung der Privatsphäre einer Person (z.B. durch Anklopfen bzw. Klingeln an der Haustür). Im weiteren Sinne fällt darunter aber auch, ob die Familienmitglieder mit ihren je individuellen Lebensentwürfen ernst genommen werden, ob ihr Recht auf Mitsprache respektiert wird, ob sie in ihrer Kompetenz als Eltern anerkannt und unterstützt werden und damit auch von ihren Kindern als kompetente Eltern erlebt werden können. Im Kern geht es um die Frage, ob eine Unterstützung vom Umfang und vom Inhalt tatsächlich die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Familie trifft oder ob sie von den Familienmitgliedern eher erduldet wird als dass sie als hilfreich empfunden wird. Trotz eines hohen Anteils zufriedener Äußerungen scheinen hier die professionellen Angebote nicht immer passgenau auf die Bedürfnisse der Familien zugeschnitten zu sein. Hier eine noch größere Sensibilität zu entwickeln und die Eltern auch in ihren Kompetenzen und Stärken wahrzunehmen, könnte eine wichtige Aufgabe professioneller Fortbildung sein.
-
Abbau von Fremdbestimmung:
Auch Eltern mit Lernschwierigkeiten haben ein Anrecht darauf, in die Entscheidungen, die ihr Leben und das Leben ihrer Kinder betreffen, von Anfang an einbezogen zu werden und diese zu verstehen. Es kommt einer zusätzlichen Behinderung gleich, wenn erwachsene Menschen erleben, dass sie keinen Einfluss auf wichtige Lebensentscheidungen nehmen können und sich selbst in der Rolle eines Kindes wiederfinden. In unseren Interviews sind wir auf erstaunlich große Bereitschaft von Eltern gestoßen, sich von bestimmten Notwendigkeiten überzeugen zu lassen oder sich damit zu arrangieren, wenn ihnen die Möglichkeit zur Einsicht gegeben wurde. Fremdbestimmung der Eltern dürfte auch Auswirkungen auf die Kinder haben. Wenn Eltern das Gefühl haben, keine Wahl und keine Handlungsmöglichkeiten zu haben, wenn ihnen die Selbstwirksamkeitsüberzeugung fehlt, wird es auch für ihre Kinder schwieriger sein, diese in der Resilienzforschung als besonders wichtig erkannte Eigenschaft zu entwickeln (vgl. z.B. Wustmann 2009). Damit steigt das Risiko, dass die Kinder den sozialen Kontext ihrer Eltern auch in ihrem späteren Leben nicht verlassen.
-
Bereitstellen von passenden Lern- und Informationsangeboten
Menschen mit Lernschwierigkeiten verfügen oftmals über geringe Lesefertigkeiten, lernen langsamer und benötigen beim Lernen mehr Wiederholungen, um sich Informationen einzuprägen. Obwohl fast alle befragten Eltern von professionellen Diensten unterstützt wurden, hatte mehr als die Hälfte der Eltern noch nicht erfahren, dass ihnen etwas mit Hilfe von Materialien erklärt wurde. Das Hilfsmittel der Leichten Sprache scheint in der Arbeit mit den Familien noch nicht sehr verbreitet, obwohl dies einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung komplexer Inhalte im Zusammenhang der Entwicklung und Erziehung von Kindern leisten könnte. Dieses Defizit ist weniger den einzelnen professionellen Diensten anzulasten als den Trägern der Einrichtungen, die bislang zu wenig Wert auf die Erstellung von Materialien legen, die es Eltern mit Lernschwierigkeiten ermöglichen würden, für sie wichtige Informationen aufzunehmen. Hierzu gibt es im angloamerikanischen Raum wertvolle Anregungen, die für hiesige Verhältnisse adaptiert werden könnten.
Als abschließende Empfehlung sei auf die Notwendigkeit regelmäßiger Fortbildungsangebote für Fachkräfte, die in dem anspruchsvollen Bereich der begleiteten Elternschaft arbeiten, hingewiesen. In diesem Rahmen könnte eine Sensibilisierung für die hier dargestellten Themen stattfinden, sowohl auf der Ebene der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als auch im Bereich der weiteren Professionalisierung der alltäglichen Arbeit gemäß den Standards der internationalen Fachliteratur, wie dies in Einzelfällen bereits begonnen hat (vgl. LAG Begleitete Elterschaft Brandenburg-Berlin).
[8] Barrierefreiheit umfasst nicht nur die physische Zugänglichkeit z.B. bei körperlichen Einschränkungen, sondern zielt auf den Abbau von Barrieren aller Art ab, z.B. auch durch Verwendung von Leichter Sprache.
Bargfrede, Stefanie (2008): Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung in Deutschland. In: Pixa-Kettner, U. (Hrsg.): Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder. Heidelberg, 2. Aufl., 283 - 299
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (Hrsg.) (2010): UNBehindertenrechtskonvention. Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff 30.3.1012)
Buchner, Tobias & König, Oliver (2011): Von der Ausgrenzung zur Inklusion: Entwicklung, Stand und Perspektiven des gemeinsamen Forschens. In : DIFBG (Hrsg.), Forschungsfalle Methode? Partizipative Forschung im Diskurs. Dokumentation der Jahrestagung der DIFGB 18. - 19. November 2010 (Kassel), Leipzig, 2-16
Buchner, Tobias, Koenig, Oliver & Schuppener, Saskia (2011): Gemeinsames Forschen mit Menschen mit intellektueller Behinderung. In: Teilhabe, 50, 1, 4-10
Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft (2008): http://www.begleiteteelternschaft.de/index.php?main_id=11 (Zugriff am 29.3.2012)
Bundesverband behinderter Eltern e.V. (bbe e.V.) (2011): http://www.behinderteeltern.de/Papoo_CMS/ (Zugriff am 24.8.2011)
Disability, Pregnancy & Parenthood international (2011): http://www.dppi.org.uk/journal/index.html (Zugriff am 24.8.2011)
Family Support and Services Project (2000): Support Interview Guide, University of Sidney: http://sydney.edu.au/health_sciences/afdsrc/parents/resources/interview_guide.shtml (Zugriff am 29.3.2012)
Faureholm, Jytte (2010): Children and Their Life Experiences. In: Llewellyn, G., Traustadóttir, R., McConnell, D. & Sigurjónsdóttir, H. B. (Hrsg.): Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures. Chichister, 63 - 78
Feldman, Maurice A., (2010): Parenting Education Programs In: Llewellyn, G., Traustadóttir, R., McConnell, D. & Sigurjónsdóttir, H. B. (Hrsg.): Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures. Chichister, 121 - 136
Hagen, Jutta (2001): Ansprüche an und von Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung in Tagesstätten. Aspekte der Begründung und Anwendung lebensweltorientierter pädagogischer Forschung. Marburg: Lebenshilfe-Verlag
Hermes, Gisela & Rohrmann, Eckhard (Hrsg.): "Nichts über uns - ohne uns!" Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung. Neu-Ulm: AG SPAK Bücher
Hintermair, Manfred (2009): Arbeiten mit der Sozialen Netzwerkkarte als Möglichkeit vertiefenden Verstehens in Forschung und Praxis. In: Janz, Frauke & Terfloth, Karin (Hrsg.): Empirische Forschung im Kontext geistiger Behinderung. Heidelberg: Winter, 193-213
Hoghughi, Masud (2004): Parenting - An Introduction. In: Hoghughi, M. & Long, N. (Hrsg.): Handbook of Parenting. Theory and research for practice. London, 1 - 18 75
Isaacs, Barry J., et al. (2007): The International Family Quality of Life Project: Goals and Description of a Survey Toll. In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (4), 3, 177-185
Klauß, Theo & Janz, Frauke (2011): Forschung mit Menschen mit Behinderungen: Gibt es Risiken und Nebenwirkungen? In: DIFBG (Hrsg.), Forschungsfalle Methode? Partizipative Forschung im Diskurs. Dokumentation der Jahrestagung der DIFGB 18. - 19. November 2010 (Kassel), Leipzig, 46-58
Landesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft Brandenburg-Berlin (2012): http://www.begleitete-elternschaft-bb.de/62.html ,(Zugriff am 29.3.2012)
Lenz, Albert, Riesberg, Ulla, Rothenberg, Birgit & Sprung, Christiane (2010): Familie leben trotz intellektueller Beeinträchtigung. Begleitete Elternschaft in der Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag
Llewellyn, Gwynnyth & McConnell, David (2002): Mothers with learning difficulties and their support networks. In: Journal of Intellectual Disability Research, 46, 17-34
Llewellyn, Gwynnyth & McConnell, David (2010): Looking Back on Their Own Upbringing. In: Llewellyn, G., Traustadóttir, R., McConnell, D. & Sigurjónsdóttir, H. B. (Hrsg.): Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures. Chichister, 33 - 47
McConnell, David, Llewellyn, Gwynnyth, Mayes, Rachel, Russo, Domenica & Honey, Anne
(2003): Developmental profiles of children born to mothers with intellectual disability, in:
Journal of Intellectual & Developmental Disability, 28, 122-134
McConnell, David, Matthews, Jan, Llewellyn, Gwynnyth, Mildon, Robin & Hindmarsh, Gabrielle (2008): "Healthy Start." A National Strategy for Parents with Intellectual Disabilities and Their Children. In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5, 194 - 202
McGaw, Susan (2004): Parenting Exceptional Children. In: Hoghughi, M. & Long, N. (Hrsg.): Handbook of Parenting. Theory and research for practice. London, 213-236
Mensch Zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. (Hrsg.) (2008), Das neue Wörterbuch für Leichte Sprache, Kassel
Mensch zuerst - Netzwerk People first, Deutschland e.V.: http://www.people1.de ,(Zugriff am 29.3.2012)
Mirfin-Veitch, Birgit (2010): Citizenship and Community Participation. In: Llewellyn, G., Traustadóttir, R., McConnell, D.& Sigurjónsdóttir, H. B. (Hrsg.): Parents with Intellectual Disabilities. Past, Present and Futures. Chichister, 95 - 106
Parenting Research Centre (2010): Healthy Start, Practitioners supporting parents with learning difficulties and their children, http://www.healthystart.net.au/ (Zugriff am 24.8.2011)
Pixa-Kettner, Ursula (2007): Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland: Ergebnisse einer zweiten bundesweiten Fragebogenerhebung. In Geistige Behinderung 46, 4, 309-321
Pixa-Kettner, Ursula (Hrsg.) (2008): Tabu oder Normalität? Eltern mit geistiger Behinderung und ihre Kinder. Heidelberg, 2. Aufl.
Pixa-Kettner, Ursula & Bargfrede, Stefanie (2004): Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung - ein soziales Problem? In: Wüllenweber, E. (Hrsg.), Handbuch sozialer Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung - Fremdbestimmung, Benachteiligung, soziale Ausgrenzung und Abwertung. Stuttgart, S. 78 - 88
Sozialpädagogisches Institut im SOS Kinderdorf e.V., (Hrsg.) (2004): Herkunftsfamilien in der Kinder- und Jugendhilfe. Perspektiven für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. München: Eigenverlag
Through the Looking Glass (TLG) (2011): http://www.lookingglass.org/home (Zugriff am 19.08.2011)
Trepte, Horst-Volkmar (2008): Patenschaften und Psychoedukation für Kinder psychisch kranker Eltern. In: Lenz, Albert & Jungbauer, Johannes (Hrsg.) : Kinder und Partner psychisch kranker Menschen. Belastungen, Hilfebedarf, Interventionskonzepte. Tübingen: dgvt-Verlag
Walmsley, Jan (2001): Normalisation, Emancipatory Research and Inclusive Research in Learning Disability. In: Disability & Society, 16, 2, 187-205
Anmerkung der bidok Redaktion:
Der Anhang kann unter http://bidok.uibk.ac.at/download/pixa-familie-anhang.pdf herunter geladen werden.
Quelle:
Ursula Pixa-Kettner, Kadidja Rohmann: , Universität Bremen Besondere Familien - Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihre Kinder?Forschungsbericht, entstanden im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Bremen, finanziert durch die Kroschke-Stiftung
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 19.03.2013
