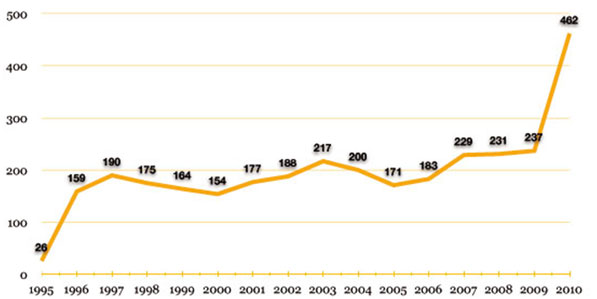Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines/einer Master of arts (MA); eingereicht bei Apl. Prof. Dr. Anna Bergmann, Fakultät für Bildungswissenschaften; Institut für Erziehungswissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Diese Arbeit befasst sich mit den kontroversen Diskussionen über Pränataldiagnostik und mit der Frage, ob es um die bestmögliche Versorgung für Mutter und Kind geht oder ob es sich um eine Qualitätskontrolle des Fötus handelt mit einer einhergehenden Selektion.
Das Ziel der Medizin ist schon lange nicht mehr nur die Heilung von Krankheiten. Es geht immer mehr um Prävention; um die Verhinderung von Krankheiten.[1] Diese Entwicklung zeigt sich deutlich in der Schwangerenvorsorge. Die Pränataldiagnostik hat sich bereits in den 1980er und 1990er Jahren zum Routineeingriff etabliert und ist heute nicht mehr aus der Schwangerschaftsvorsorge weg zu denken.[2]
Viele Kritiker merken an, dass die vorgeburtlichen Tests einen selektiven Charakter haben. Es bestehe eine große Diskrepanz zwischen den diagnostischen und den therapeutischen Möglichkeiten. Zudem kommt die Mehrzahl der Neugeborenen ohne Behinderung zur Welt.[3] „Die meisten Schwangeren erwarten ein gesundes Kind. Bei nur etwa 5% der Schwangerschaften ist mit einer kindlichen Fehlbildung oder Erkrankung zu rechnen.“[4]
Durch einen im Jahr 2012 neu auf den Markt gekommenen Bluttest wurden die Diskussionen um Vorsorge und Selektion während der Schwangerschaft wieder präsenter. Kritiker warnen vor der Gefahr, dass durch den „PraenaTest“ eine neue „Zuchtwahl menschlichen Lebens“[5] etabliert werde. Sie befürchten, dass die Zahl der Abtreibungen durch den Test weiter ansteigen könnte. Doch wie konnte es so weit kommen, dass heute Spätabtreibungen legal sind und dass Föten lediglich aufgrund der Diagnose „Down-Syndrom“ bis zum errechneten Geburtstermin abgetrieben werden dürfen.
Die Arbeit beschränkt sich auf eine Darstellung der Entwicklungen der Eugenik und der damit verbundenen Selektionspraxis in Deutschland.[6] In Deutschland wurde die Eugenik und ihr Erfolg so stark wie in keinen anderen Ländern, erklären die Autoren Peter Weingart, Jürgen Kroll und Kurt Bayertz, die die Geschichte der Rassenhygiene in Deutschland erforscht haben.[7] Zudem überwiegt oft das Vorurteil, dass eugenisches Denken und eine damit einhergehende Selektion von Menschen mit Behinderung lediglich zu Zeiten des Nationalsozialismus vorherrschten. Diese Arbeit soll jedoch aufzeigen, dass die Ideen einer „leistungsstarken“ Bevölkerung und die damit verbundene Kontrolle des Gebärverhaltens in Deutschland bereits vor dem Nationalsozialismus und auch danach wirksam waren. Eugenik und Rassenhygiene sind nicht alleine mit der nationalsozialistischen Zeit zu identifizieren. Sie waren und sind eine internationale Erscheinung. Schon Michel Foucault hat die Biopolitik als ein zentrales Charakteristikum der Moderne überhaupt analysiert.[8]
Die Sozialwissenschaftlerin Anne Waldschmidt spricht daher auch von einer „neuen“ und einer „alten Eugenik“[9]. Die Erziehungswissenschaftlerin Maria Wolf betont, dass eugenisches Denken die unterschiedlichsten wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereiche zwar berührt, es aber im 20. Jahrhundert in den Bereichen der Pädagogik und der Medizin die größte Wirksamkeit entwickelt hat.[10] Frauen werden durch die Medizin pädagogisch sozialisiert und das generative Verhalten wird dadurch manipuliert.
„Die Pränatale Diagnostik sozialisiert Frauen zum Glauben, dass sie über medizinische Eingriffe in ihren Körper die Gesundheit ihres erwarteten Kindes kontrollieren und die Angst vor sozialen Konsequenzen im Falle der Geburt eines behinderten Kindes in den Griff bekommen können.“[11]
Die Pränataldiagnostik betrifft demnach nicht nur den medizinischen Bereich, sondern geht weit darüber hinaus. Diese Arbeit beleuchtet diese verschiedenen Aspekte der Pränataldiagnostik.
Im ersten Kapitel werden die Wurzeln der Rassenhygiene und Eugenik dargestellt. Denn die Selektion von Menschen mit Behinderung ist keine neue Erfindung und geht zurück auf Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Der Historiker Michel Foucault hat diese Entwicklungen unter dem Begriff „Biopolitik“ analysiert.[12] Foucault stellt den Versuch, die einzelnen Körper unter bevölkerungspolitischen Prämissen zu optimieren, in den Kontext der Industrialisierungsgeschichte und untersucht die Machtmechanismen, die zwischen Staat und Medizin für dieses Ziel maßgeblich sind.[13] Seine theoretischen Erklärungsansätze stelle ich im ersten Kapitel dar.
Anschließend wird die Entwicklung der Rassenhygiene, Eugenik und Geburtenpolitik in Deutschland beschrieben. Die Historikerinnen Anna Bergmann und Cornelie Usborne haben die Eingriffe in den „Frauenkörper“ und in den „Volkskörper“ beschrieben und aufgezeigt, wie sehr die Optimierung der Bevölkerung mit der Kontrolle des weiblichen Körpers und der Sexualität zusammenhängt.[14] Die Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik waren wichtige Bestandteile der Rassenhygiene, um eine von ihnen behauptete „Degenration“ aufzuhalten und diese als Instrument der Optimierung der Bevölkerung zu nutzen.[15]
Schließlich werden die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit hinsichtlich der Kontinuität und Brüche dieser Biopolitik beleuchtet. Im Nationalsozialismus hat die Eugenik durch den Rassismus ihren Höhepunkt erfahren.[16] Die Nachkriegszeit stand schließlich unter der Prämisse „Bruch mit dem Nationalsozialismus und dem Rassismus“, dennoch wurden viele rassistische Linien weitergezogen. Dies wird mit der Forschung der Autorin Daphne Hahn gezeigt, die sich mit der Biopolitik der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt hat.[17] Als letzte Etappe wird die Entwicklung der Präventivmedizin nachgezeichnet, denn das Ziel der Medizin war die Minimierung von „Erbkrankheiten“, welches bis heute nicht aufgegeben worden ist.[18]
Dieser historische Rückblick soll verdeutlichen wie die Inanspruchnahme von pränataldiagnostischen Untersuchungen zur Selbstverständlichkeit geworden ist und welche Motive dahinter stecken.
Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Untersuchungsmethoden mit ihrem medizinischen Hintergrund, anhand der Publikationen des Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Jens Pagels, erklärt.[19] Dabei werde ich die diskutierten Möglichkeiten der Pränataldiagnostik beleuchten und u.a. mit Hilfe der Autorinnen Eva Schindele und Monika Hey, die dem Thema Pränataldiagnostik kritisch gegenüber stehen, die Gefahren und Komplikationen für die einzelnen betroffenen Frauen erklären.[20] Anschließend stelle ich die gesetzlichen Grundlagen dar, in denen festgelegt ist, bis wann und mit welcher Begründung ein Fötus abgetrieben werden darf.[21] Außerdem ziehe ich Statistiken heran, die verdeutlichen, dass es eine Zunahme von eugenisch motivierten Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland gibt.[22]
Abschließend wird die neueste Untersuchungsmethode im Bereich der Pränataldiagnostik vorgestellt, der sogenannte PraenaTest. Dieser Bluttest ist 2012 auf den Markt gekommen und hat eine erneute Debatte über die Bedeutung der Selektion im pränataldiagnostischen Feld ausgelöst. Mittlerweile wurde er weiterentwickelt und ist inzwischen schwangeren Frauen zugänglich.[23]
Im dritten Kapitel wird die Pränataldiagnostik als kulturelle Praxis beleuchtet. Um diese Dimension zu verdeutlichen, wird die Idee der medizinischen Selbstverantwortung vorgestellt. Soziologen, wie z.B. Peter Wehling oder Willy Viehöver und auch Erziehungswissenschaftlerinnen, wie Maria Wolf, sprechen von einem kulturellen Wahrnehmungswandel, der von der naturwissenschaftlichen Medizin initiiert worden ist.[24] So haben sich nicht nur die Möglichkeiten verändert, die zur Verfügung stehen, sondern auch der Druck auf die Patientinnen ist forciert worden. Die Pränataldiagnostik manövriert werdende Mütter in eine neue Zwangslage, aus der es keinen Ausweg gibt.
Weiterhin erkläre ich, wie die Pränataldiagnostik nicht nur den Blick auf das Ungeborene verändert hat, sondern auch die Wahrnehmung der gesamten Schwangerschaft.[25] Die Sozialwissenschaftlerin Eva Schindele beschreibt diesen Wandlungsprozess an dem Verschwinden der Vorstellung der Schwangerschaft als eine „Zeit der guten Hoffnung“ und der Verwandlung zu einer Phase der ständigen Risiken.[26]
Anschließend wird das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ vorgestellt und seine Position zum „PraenaTest“ wiedergegeben. Diese Initiative wurde 1994 von Hebammen, Ärzten, Beratern und Mitarbeitern aus der Behindertenselbsthilfe gegründet und leistet Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Pränataldiagnostik.[27] Das Netzwerk warnt vor der biopolitischen Funktion des Bluttests, die Perfektionierung der Selektion von Menschen mit Down-Syndrom noch zu radikalisieren.[28]
Am Ende des dritten Kapitels werden die Vorgehensweisen bei Spätabtreibungen nach pränataler Diagnose erklärt. Für diesen Teil ziehe ich die Publikationen des Sozialwissenschaftlers Manfred Spieker heran, der die Gewalttätigkeit der Spätabtreibungen zur Diskussion stellt. Spieker hinterfragt diese Selektionspraxis am Beispiel von Grenzfällen und problematisiert die Methoden der Spätabtreibungen insgesamt.[29]
Im letzten Kapitel dieser Arbeit stelle ich zwei Fallbeispiele vor. Diese zwei Erfahrungsberichte sollen zeigen, was die Pränataldiagnostik auslösen und welche Folgen sie haben kann und wie Grenzen überschritten werden. Die Geschichte von Monika Hey zeigt die Seite der Mutter auf.[30] Die Geschichte von Tim, der als „Oldenburger-Baby“ bekannt wurde nachdem er seine eigene Abtreibung überlebte, zeigt welche Konsequenzen die Diagnose „Down-Syndrom“ für das Ungeborene hat.[31]
[1] Vgl. Wehling, Viehöver 2011, S. 7ff.
[2] Vgl. Wolf 2008, S. 544.
[3] Vgl. Feldhaus-Plumin 2012, S. 14.
[4] Trautmann, Merz 2007, S. 3.
[5] SpiegelOnline (Gesundheit): Ungeborenes Leben: Bluttest auf Down-Syndrom kommt in die Praxen. http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.
[6] Vgl. zur Geschichte der Rassenhygiene und Eugenik in Deutschland: für das Deutsche Kaiserreich: Bergmann 1998; für die Weimarer Republik: Usborne 1994; für den Nationalsozialismus: Bock 1986; für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Hahn 2000; einen Überblick geben: Weingart, Kroll, Bayertz 1988. Vgl. zur aktuellen Entwicklung der Selektionspraxis: Waldschmidt 1995; Schindele 1990; Spieker 2005. Vgl. zur österreichischen Entwicklung: Wolf 2008. Vgl. zur Entwicklung der Biopolitik: Foucault 1999.
[7] Vgl. Weingart, Kroll, Bayertz 1988, S. 22.
[8] Vgl. Foucault 1999, S. 276.
[9] Waldschmidt 1995, S. 360.
[10] Vgl. Wolf 2008, S. 57.
[11] Ebd., S. 634.
[12] Vgl. Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). 1999.
[13] Vgl. ebd., S. 280.
[14] Vgl. Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität. Die medizinische Bemächtigung des Lebens. 1998. Und: Usborne, Cornelie: Frauenkörper – Volkskörper. Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik. 1994.
[15] Vgl. Bergmann 2001, S. 29.
[16] Vgl. Foucault 1999, S. 297.
[17] Vgl. Hahn, Daphne: Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach 1945. 2000.
[18] Vgl. ebd., S. 295.
[19] Vgl. Pagels, Jens: Pränataldiagnostik. Wissen, was stimmt. 2011.
[20] Vgl. Schindele, Eva: Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko. 1995. Und: Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. 2012.
[21] Vgl. Bundesministerium der Justiz, http://www.gesetze-im-internet.de/index.html.
[22] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html.
[23] Vgl. LifeCodexx, http://www.lifecodexx.com/.
[24] Vgl. Wehling, Peter; Viehöver, Willy: Entgrenzung der Medizin – Transformationen des medizinischen Feldes aus soziologischer Perspektive. 2011. Und: Wolf, Maria A.: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000. 2008.
[25] Vgl. Schindele 1990, S. 32.
[26] Vgl. Schindele 1995, S. 13.
[27] Vgl. Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm), http://www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-themen/praenataldiagnostik/netzwerk-gegen-selektion-durch-praenataldiagnostik.html.
[28] Vgl. Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/Termine/2012-03-20-Netzwerk_Praenataldiagnostik.pdf.
[29] Vgl. Spieker 2005.
[30] Vgl. Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. 2012.
[31] Vgl. Spieker, Manfred: Der legalisierte Kindermord. Zur Problematik der Spätabtreibungen. 2005. Und: Kilimann, Gisela; Kilimann, Udo: Er sollte sterben, doch Tim lebt! – Eine Abtreibung und ihre Folgen. ARD, ausgestrahlt am 16.03.2005.
Inhaltsverzeichnis
2.1 Biopolitik[32]
„Eines der größten Versprechen der Moderne ist die Befreiung des Körpers von allem Schicksalhaften und Zufälligen.“[33]
Der Soziologieprofessor Thomas Lemke definiert Biopolitik als „die Politik, die sich mit dem Leben (griech.: bíos) befasst.“[34] Laut Lemke ist der Begriff Biopolitik eingebettet in die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandene „Lebensphilosophie“. Die sogenannten Lebensphilosophen strebten eine Aufwertung des „Lebens“ an und zwar „zu einer fundamentalen Kategorie und zum normativen Kriterium des Gesunden, Guten und Wahren“[35].
Die Soziologin Daphne Hahn definiert Biopolitik wie folgt: „Sie [die Biopolitik] bezeichnet den Eintritt des Lebens und seiner Mechanismen in einen Prozess planmäßiger Steuerung.“[36] Als Grundlage dazu dienen Vorhersagen, Messungen und Schätzungen über die Bevölkerung, die als Ziel eine staatliche Regulierung haben. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kam es zur Etablierung einer Medizin, deren Hauptaufgabe die „öffentliche Hygiene“ war und die zu einer allgemeinen Medikalisierung der Gesellschaft führte. Die Medizin vereinnahmte immer mehr Lebensbereiche, die zuvor außerhalb ihres Aufgabenbereichs lagen. So verdeutlicht Hahn:
„Verschiedene Techniken zur Unterwerfung der Körper und zur Kontrolle der Bevölkerung entstanden und eröffneten die Ära der Bio-Macht als Technologie, deren Ziel es ist, in der Bevölkerung auftretende Zufallsereignisse auszuschalten, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignissen vorherzusehen und auf diese einzuwirken.“[37]
Der französische Historiker und Philosoph Michel Foucault beschreibt Biopolitik als eine „spezifisch moderne Form der Machtausübung“[38]. Für ihn stellt Biopolitik keine Erweiterung der Politik dar, sondern verändert diese durch reformulierte Konzepte. „Biopolitik steht für eine Konstellation, in der die modernen Human- und Naturwissenschaften und die aus ihnen hervorgehenden Normalitätskonzepte das politische Handeln strukturieren und dessen Ziele bestimmen.“[39] Daher ist Biopolitik laut Foucault nicht auf die Entstehung neuer Techniken zu reduzieren. Thomas Lemke hebt drei Verwendungsweisen des Begriffes „Biopolitik“ in der Foucaultschen Gesellschaftsanalyse hervor:
-
Biopolitik als Zäsur im politischen Denken und Handeln.
-
Biopolitik als ein wichtiger Bestandteil bei der Entstehung des modernen Rassismus.
-
Biopolitik als eine besondere Kunst des Regierens.[40]
Laut Foucault ist Medizin Macht-Wissen, das nicht nur auf jeden einzelnen Körper abzielt, sondern gleichzeitig auch auf die gesamte Bevölkerung. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu bemerken, dass Gesundheit und Fortschritt im biopolitischen Kontext gleichbedeutend sind. Jene Prozesse und Techniken, die der Optimierung der einzelnen Körper sowie der gesamten Bevölkerung verhelfen, werden als „gesundheitsfördernd“ verstanden. Jene, die dies nicht gewährleisten, werden hingegen pathologisiert. Gesundheit wurde zur „Richtschnur des öffentlichen wie privaten täglichen Lebens“[41]. Die Disziplinierung auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene sollte gesunde und funktionsfähige Körper hervorbringen. In diesem Sinne bedeutete „Gesundheit“ nicht Wohlbefinden, sondern Optimierung.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts entsteht eine neue Machttechnologie, die nicht mehr die einzelnen Körper der Individuen kontrolliert und reguliert, sondern den kollektiven Körper der Bevölkerung, so Foucault. Die Bevölkerung wird laut Foucault beispielsweise in Geburten- und Sterblichkeitsraten und nach qualitativen und quantitativen Kriterien beurteilt. Die neuen Techniken der Macht befassen sich nicht mehr mit dem „Körper-Menschen“, sondern mit dem „Gattungs-Menschen“[42] und dies mit „massenkonstituierenden“[43] Eingriffen.
Die Regulierung der Bevölkerung wird seit der Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Zentralinstanz Staat organisiert und nicht nur durch einzelne Institutionen, wie es bei der Disziplin der Fall ist. So hat der Staat beispielsweise Daten über die Bevölkerung erhoben - wie Statistiken zur Lebensdauer. Es ist jedoch zu beachten, so Foucault, dass Disziplin und Regulierung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Für Foucault ist „die Vereinnahmung des Lebens durch die Macht“[44] ein grundlegendes Phänomen des 19. Jahrhunderts: „[...] wenn Sie so wollen, eine Machtergreifung über den Menschen als Lebewesen, eine Art Verstaatlichung des Biologischen oder zumindest eine gewisse Tendenz hin zu dem, was man die Verstaatlichung des Biologischen nennen könnte.“[45]
In diesem Zusammenhang führt Foucault an, dass der Souverän das Recht über Leben und Tod innehat, „daß er sterben machen und leben lassen kann“[46]. Wenn der Souverän töten kann, dann besitzt er dadurch auch das Recht darüber, leben zu lassen. Dieses Recht hat sich transformiert, so Foucault, und zwar zu dem Recht, „leben zu machen und sterben zu lassen“[47]. Foucault erklärt, dass es durch die Geburtenkontrolle zu einer „Biopolitik“ kommt, die sich nicht nur mit dem Problem der Fruchtbarkeit befasst, sondern auch mit dem Problem der Sterblichkeit. Hierbei liegt der Fokus jedoch nicht mehr auf Epidemien, die zum Tod führen; stattdessen wird der Fokus auf die Dauer, Intensität, Ausdehnung, Form, usw. der vorherrschenden Krankheiten gelegt. Es geht um die Faktoren, die das Leben schwächen und sich durch das gesamte Leben ziehen. Daher muss die Medizin unter anderem für die öffentliche Hygiene sorgen.
„Das souveräne Recht über den Tod verschwindet nicht, sondern wird einer Macht untergeordnet, die sich die Sicherung, Entwicklung und Verwaltung des Lebens auf die Fahnen geschrieben hat. [...] Auf dem Spiel steht nicht mehr die juridische Existenz eines Souveräns, sondern das biologische Überleben einer Bevölkerung.“[48]
Der Biopolitik geht es um die Zufälligkeiten innerhalb einer Bevölkerung, die es durch Sicherheitsmechanismen einzudämmen gilt. Es geht daher um die Optimierung des Lebens durch Mechanismen, die die „biologischen Prozesse der Menschengattung“[49] regulieren.
Foucault unterscheidet zwischen zwei Serien der Macht, sagt jedoch zugleich, dass sie sich nicht wechselseitig ausschließen. Das eine sind die Disziplinen, die durch Institutionen auf die einzelnen Körper einwirken; das andere sind die Regulierungsmechanismen, die durch den Staat auf die Bevölkerung und deren biologische Prozesse einwirken. Als Beispiel für die Verbindung beider Serien nennt Foucault die Sexualität. Einerseits wurde sie ab dem Ende des 18. Jahrhunderts als körperliches Verhalten Gegenstand von Disziplinarkontrolle und ständiger Überwachung, andererseits ist sie durch die Möglichkeit der Fortpflanzung Gegenstand biologischer Prozesse, welche die gesamte Bevölkerung betreffen und vom Staat reguliert werden.
Hinzu kommt der Blick der Medizin auf die Sexualität. Zum einen können auf der individuellen Ebene - ohne disziplinarische Kontrolle - Krankheiten entstehen und zum anderen können auf der Ebene der Bevölkerung - ohne Regulierungsmechanismen und durch das Weitergeben von „schlechtem Erbgut“ - „beeinträchtigte“ Nachkommen entstehen. „Die Sexualität befindet sich an der Kreuzung von Körper und Bevölkerung. Folglich gehört sie zur Disziplin, aber auch zur Regulierung.“[50]
In diesem Zusammenhang erklärt Foucault weiter, dass die Medizin über ein „Macht-Wissen“[51] verfügt, das sowohl Einfluss auf den Körper als auch auf die Bevölkerung hat. Durch die Disziplinierungs- und Regulierungsmechanismen entsteht eine Definitionsmacht, die normierend wirkt. „Die Norm, das ist das, was sich auf einen Körper, den man disziplinieren will, ebenso gut anwenden läßt wie auf eine Bevölkerung, die man regulieren will.“[52] Eine Normalisierungsgesellschaft ist demnach eine Gesellschaft, in der die Norm der Disziplin und die Norm der Regulation verknüpft sind. Diese Macht, die Einfluss auf den einzelnen Körper sowie auf die Bevölkerung hat und somit das Leben vereinnahmt hat, nennt Foucault „Bio-Macht“[53].
Schließlich fragt Foucault, wie diese Macht, deren Ziel das Leben ist, das Recht zu töten haben kann.
„Wie kann eine solche Macht töten, wenn es stimmt, daß es im Wesentlichen darum geht, das Leben aufzuwerten, seine Dauer zu verlängern, seine Möglichkeiten zu vervielfachen, Unfälle fern zu halten oder seine Mängel zu kompensieren? Wie ist es einer politischen Macht unter diesen Bedingungen möglich zu töten, den Tod zu fordern [...]? Wie kann diese Macht, die wesentlich die Hervorbringung von Leben zum Ziel hat, sterben lassen?“[54]
Foucault sagt, dass hier der Rassismus „als grundlegender Mechanismus der Macht“[55] ins Spiel kommt. Der Rassismus führt Zäsuren im biologischen Feld und selektive Kategorien wie „höherwertiges“ und „minderwertiges Leben“ ein. Zusätzlich zu der Hierarchisierung von „Lebenswertigkeiten“ errichtet der Rassismus auch „eine Beziehung zwischen meinem Leben und dem Tod des Anderen“[56]. Es kann demnach eine Lebensverbesserung erreicht werden durch das Töten von anderen, die sich als „Verteidigung der Gesellschaft“ geriert. Somit geht es darum, eine „biologische Gefahr“ abzuwenden durch die „Eliminierung der Rassen“ und durch die „Reinigung der Rasse“[57].
„Wenn die Normalisierungsmacht das alte souveräne Recht zu töten ausüben möchte, muß sie sich des Rassismus bedienen.“[58] Foucault merkt an dieser Stelle an, dass er unter Töten in diesem Zusammenhang nicht nur den direkten Mord, sondern auch Formen des „indirekten Mordes“[59] versteht, d.h. beispielsweise Vertreibung oder auch Abschiebung.
Abschließend bemerkt Foucault noch, dass der Rassismus und die Bio-Macht ihren absoluten Höhepunkt im Nationalsozialismus erreicht hatten, jedoch nach dem NS-Regime keineswegs verschwunden sind. So nennt er als ein Beispiel den biologischen Rassismus gegenüber Geisteskranken u.a., der in sozialistischen Staaten zum Greifen kam.
Eine „Lebensverbesserung“ und die „Verteidigung der Gesellschaft“ werden somit durch die Beseitigung, Vermeidung und Tötung von „lebensunwertem Leben“ erreicht. „Foucault zufolge ist der Rassismus Ausdruck einer gesellschaftlichen Spaltung, die durch die biopolitische Vorstellung einer permanenten und abschließbaren Reinigung des Gesellschaftskörpers angetrieben wird.“[60]
Der im Nationalsozialismus verwendete Begriff des „´Volkskörper[s]´ bezeichnete nun eine autoritär geführte, hierarchisch strukturierte und rassisch homogene Gemeinschaft“[61]. Eine zentrale Vorstellung im nationalsozialistischen Gesellschaftskonzept war die Ideologie, dass soziale Verhältnisse und politische Probleme auf biologischen Ursachen beruhen würden. Zusätzlich herrschte die Auffassung, dass es eine natürliche Hierarchie zwischen den „Rassen“ gebe, die auf „erbbiologischer Güte“[62] beruhe, was zu der Schlussfolgerung führe, dass man alle „Rassen“ und auch die einzelnen Individuen jeweils unterschiedlich behandeln müsse. Zwei wichtige Eigenschaften der nationalsozialistischen Biopolitik waren „die rassenhygienische und erbbiologische Grundierung der biopolitischen Programmatik sowie deren Kombination mit geopolitischen Ideen“[63]. In der NS-Zeit versuchte man Zufälligkeiten, die in biologischen Prozessen vorkamen, durch die wissenschaftlichen Möglichkeiten auszuschalten.
Foucault bemerkt, dass der „Prozess der Optimierung der Bevölkerung“[64] jedoch keineswegs nach dem Nationalsozialismus beendet gewesen sei. Die Idee der „Biologisierung der Politik“ ist nicht allein auf den Nationalsozialismus oder auf Deutschland zu beschränken. Eugeniker, Rassenhygieniker und Genetiker aus der westlichen Welt versuchten durch wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Möglichkeiten, den Menschen zu steuern, zu optimieren und zu „verfeinern“. „Die biopolitischen Visionen waren nicht nur grenzübergreifend, sie erfassten auch nicht-staatliche Akteure und soziale Bewegungen.“[65]
Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es spektakuläre biotechnologische Innovationen. So wurden beispielsweise die pränataldiagnostischen Untersuchungen zum festen Bestandteil der „Schwangerenvorsorge“ und neue Reproduktionstechniken (z.B. künstliche Befruchtung) wurden entwickelt. Dadurch, dass die Reproduktions- und Gentechnologien immer bedeutsamer wurden, kamen Fragen zum ethischen Fundament des wissenschaftlichen Fortschritts auf. Die Grenze zwischen Natur und Kultur musste politisch und rechtlich neu bestimmt werden. Es galt unter anderem festzulegen, „welche technologischen Verfahren unter welchen Bedingungen zulässig sind“, oder auch welche Forschungsanstrengungen mit öffentlichen Geldern finanziert werden und welche eher verboten werden sollten. Biopolitik bezeichnet in diesem Zusammenhang „die kollektive Aushandlung und Verständigung darüber, ob das, was technologisch möglich ist, auch gesellschaftlich akzeptiert werden soll“[66].
Die „Verteidigung der Gesellschaft“, wie Foucault es genannt hat, stellt somit auch heute noch für viele eine „Lebensverbesserung“ dar. Wurde diese früher eher offensichtlich mittels Kastration, Sterilisation und durch Tötung von „lebensunwertem Leben“ erreicht, sind wir heute soweit, dass die Verhinderung von „lebensunwertem Leben“ unter dem Deckmantel der „Schwangerenvorsorge“ und der „Sorge um Mutter und Kind“ fortgeführt werden kann.
„Der Begriff [Biopolitik] steht spätestens seit der Jahrtausendwende für administrative und rechtliche Regulierungsprozesse, die Grundlagen und Grenzen biotechnologischer Interventionen bestimmen [...].“[67]
Im folgenden Kapitel wird nun dargestellt, wie die Biopolitik durch die Rassenhygiene, Eugenik, Abtreibungspraxis und Strafverfolgung zu einer selektiven Regulierungsmacht aufgestiegen ist.
2.2 Entwicklung der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland[68]
„Das Ideal der Vervollkommnung und Gesundung begleitete die Entwicklung der Moderne, begann sie allmählich zu durchdringen und mit den Aussichten, die die naturwissenschaftlich begründeten Humanwissenschaften boten, schien dieses Ziel allmählich näherzurücken und nicht mehr nur Utopie zu bleiben. Gegründet auf die Ambitionen, alles Unkontrollierbare und Ungesunde auszuschalten, entstanden auf legitimer wissenschaftlicher Grundlage und inspiriert durch deren aktuellste Erkenntnisse an verschiedenen Orten moderne Theorien und Praktiken zur Verbesserung der Bevölkerung und ihrer Individuen.“[69]
Die bevölkerungspolitische Diskussion war im 19. Jahrhundert von der Angst vor Überbevölkerung beherrscht. Innerhalb eines Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung in Deutschland auf mehr als das Doppelte an. Gegen Ende des Jahrhunderts vollzog sich ein Meinungswandel in Deutschland und die Bevölkerungszunahme wurde nicht mehr als Bedrohung angesehen, sondern als Zeichen der militärischen Macht und des nationalen Fortschritts. Die langsam eintretende „Abnahme der Fruchtbarkeit“ wurde schließlich als „Vorbote eines nationalen Niedergangs“[70] gewertet. Die Geburtenrate in Deutschland nahm tatsächlich innerhalb von drei Jahrzehnten spürbar ab. Der Grund dafür war, dass in einer Ehe durchschnittlich weniger Kinder geboren wurden.
„Der Hauptunterschied zwischen dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert bestand darin, daß die Familien viel kleiner waren, die Kinder erst nach einigen Ehejahren geboren wurden und die Frauen nach der Geburt ihres letzten Kindes noch jünger waren.“[71]
Da die demographischen Veränderungen mit sozio-ökonomischen Entwicklungen in Deutschland zusammenfielen, war es schwierig für die zeitgenössischen Beobachter einen Grund für die angebliche „Entvölkerung“[72] festzulegen. Dadurch entstanden verschiedene Erklärungsansätze, um den drohenden Geburtenrückgang aufzuhalten. Die Historikerin Cornelie Usborne fasst die drei großen Bevölkerungstheorien zusammen:
-
Rassenhygiene (wie Eugenik in Deutschland oft genannt wurde): Darwins Lehre von der natürlichen Auslese und Fortschritte in der Genetik führten zu der Überzeugung, die Bevölkerungsentwicklung sei steuerbar. Im Gegensatz zu Malthus, der glaubte, die demographische Entwicklung verlaufe nach unveränderlichen Gesetzen, waren die Anhänger der Rassenhygiene davon überzeugt, daß die „Rasse“ medizinisch verbessert werden könnte.
-
Neomalthusianismus: Malthus` Gedankengut tauchte in den Anleitungen zur Geburtenkontrolle wieder auf und wurde in Form von Werbematerial für Verhütungsmittel verbreitet. Es richtete sich hauptsächlich an die unteren Schichten, denen Geburtenkontrolle als das Mittel gegen wirtschaftliche Not gepredigt wurde.
-
Pronatalismus: Die Überzeugung, daß der militärische, wirtschaftliche und kulturelle Einfluß einer Nation sich im Wesentlichen von der Größe seiner Bevölkerung herleitet, führte zu der Auffassung, der Staat solle an allererster Stelle die Geburtenrate steigern. Andere Maßnahmen zur Förderung des Bevölkerungswachstums wie z.B. die Reduzierung der Säuglingssterblichkeit galten als zweitrangig.[73]
Die verschiedenen Theorien waren alle jeweils mit einem Zugriff auf den „Frauenkörper“[74] verbunden und wurden mit den Methoden zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften verwirklicht, d.h. Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung.
Das erklärte Ziel des Staates war eine „Bevölkerungsmaximierung“[75], welche die Politik unter anderem durch die Abtreibungspraxis gefährdet sah. Seit 1871 stand eine Abtreibung durch §218 unter Strafe (Zuchthaus oder Gefängnis), was Frauen jedoch nicht davon abhielt, sie zu praktizieren. Aus Angst vor Strafe führten viele Frauen gefährliche „Selbstabtreibungen“ durch, bei denen unzählige mit ihrem Leben bezahlten. Das Gesetz gegen Abtreibung sollte eigentlich Leben retten, bewirkte jedoch nur zu oft das Gegenteil. Die Angst vor Bestrafungen und die Schwierigkeit ärztliche Hilfe für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden, trieb unzählige Frauen zu gefährlichen Selbstabtreibungen, z.B. mit heißen Umschlägen, alkoholischen Mixturen oder auch mit der sogenannten Mutterspritze.
Seit den 1880er Jahren wurden neue Techniken wie beispielsweise Pessare, Kondome oder Schwämmchen gebrauchsanleitend in der neuaufkommenden „neomalthusianischen Erziehungsliteratur“[76] erklärt. Eltern wurden von neomalthusianisch gesinnten Ärzten „moralisch verpflichtet“, freiwillige Geburtenkontrolle bei „erblicher Belastung“, Krankheit und sozialem Elend zu praktizieren. „Frauen wurden als ‘Nährboden für die nächste Generation’ - den es allerdings zu pflegen und nicht auszubeuten galt - für die ‘Volksgesundheit’ aufgewertet […].“[77] Die Neomalthusianer befürchteten wie die Rassenhygieniker eine „Verschlechterung der Rasse“. Die Ursache sahen sie jedoch nicht in den „minderwertigen Erbanlagen“ wie die Eugeniker, sondern in der Überbevölkerung. Deshalb „propagierten sie nun Geburtenkontrolle als Schlüssel zum menschlichen Fortschritt“[78].
Gleichzeitig forderten einige Ärzte ein striktes Verbot von Empfängnisverhütung. Durch diese Forderungen und die sogenannte Moraldebatte wurde ab 1900 der Handel mit Verhütungsmitteln reglementiert. Der „Unzuchtsparagraph“ verbot „die öffentliche Anpreisung und Ausstellung von ´Gegenständen, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt sind´“[79].
Das traditionelle Leitbild der Frau, die einen „Naturinstinkt“ hat Kinder zu gebären, war nach wie vor präsent. Man wies die Frauen auf ihren angeborenen „Willen zur Mutterschaft“ hin und versuchte sie geradezu zu überreden, keine Verhütungsmittel zu verwenden.[80]
Trotz der tödlichen Risiken scheuten Frauen nicht vor dem Gebrauch von Verhütungsmitteln zurück. Die Produktion und Verbreitung der Verhütungsmittel entzogen sich der ärztlichen Kontrolle und kurbelten den Schwarzmarkt an. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurden beispielsweise Scheidenspülungen, Abtreibungsinstrumente, Flüssigkeiten und Kondome mit präzisen Gebrauchsanweisungen angeboten. Da die meisten Verhütungsmittel nur für Frauen gedacht waren, wurden sie zum „Subjekt der Befreiung vom sozialen Elend“[81] erklärt. Mit Bezeichnungen wie „Paradieskugel“, „Frauenglück“ und „Ladies Friend“ wurde die „moderne Frau“, die sich durch Rationalität, Erotik und Intelligenz auszeichnete, angesprochen. Damit wurde das traditionelle Frauenbild der „kindertriebhaften, asexuellen, fruchtbaren Mutter“[82] verabschiedet und das Leitbild - die „Neue Frau“[83] - der Zwanzigerjahre angekündigt. Die „eigenständige Frau“ sollte nämlich Sexualität und Fortpflanzung zu trennen wissen. Die Empfängnisverhütung erlaubte eine „rationalisierte Sexualität“[84] und konnte als Methode der Geburtenkontrolle für die eugenische Forderung nach der „biologischen Verbesserung der Rasse“[85] instrumentalisiert werden. „Denn abgesehen von den mörderischen Effekten und Konstruktionen der meisten neuen Geburtenkontrolltechniken war Verhütung vom ersten Moment ihrer Erfindung und Popularisierung an für die Eugenik instrumentalisiert.“[86]
Am meisten wurden giftige und ätzende Injektionen von Frauen für „Selbstabtreibungen“ verwendet, die viele das Leben kostete. Die Anzahl der Todesopfer der „kriminellen Abtreibung“ wurde von den Ärzten vor allem unter dem Aspekt der „Schädigung der Volksgesundheit“[87] betrachtet. Es wurde gefordert, dass der Gebrauch von Verhütungsmitteln und Abtreibungsinstrumenten unter medizinische Kontrolle gebracht werde. Beispielsweise sollte eine ärztliche Rezeptpflicht für die Abtreibungsinstrumente eingeführt werden, jedoch nicht ihr absolutes Verbot.
Die „Regulierung der Fortpflanzung“ benötigte das Wissen über Empfängnis- und Schwangerschaftsverhütung sowie deren Popularisierung bei dem Teil der Bevölkerung, deren Nachwuchs „unerwünscht“ war. Auf der einen Seite sollte unter anderem durch spezielle Fürsorgemaßnahmen die Geburt von „erbgesunden“ Kindern unterstützt werden; parallel sollten „unerwünschte Geburten“ verhindert werden.[88]
„Denn Gynäkologen waren weit davon entfernt, die Anwendung der neuen Verhütungsmittel grundsätzlich abzulehnen. Vielmehr forderten sie eine Politik des Gebärzwangs in Verbindung mit der Legalisierung einer ärztlichen Entscheidungsmacht über die Abtreibung. Diese scheinbare Paradoxie manifestierte sich am deutlichsten in den beiden Kategorien des Aborts: Die ‘verbrecherische Fruchtabtreibung’ einerseits und die ‘künstliche Schwangerschaftsunterbrechung’ andererseits.“[89]
Die Medizin als objektive Wissenschaft genießt einen hohen Autoritätsstatus in unserer Gesellschaft. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sie durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Definitionsmacht erhalten, mit der sie über „lebenswert“ und „lebensunwert“ und somit über Leben und Tod entscheiden kann. Die Medizin verspricht, durch den wissenschaftlichen Fortschritt Krankheiten, Leiden und Tod verhindern zu können. „Das 19. Jahrhundert markiert mit seinem radikalen Aufstieg der Naturwissenschaften einen historischen Höhepunkt in der Herrschaftsbeziehung von Geist und Natur.“[90]
Die Bevölkerungspolitik und die Rassenhygiene wurden stark durch medizinisches Denken geprägt. Die medizinischen Erklärungsmuster schienen äußerst plausibel zu sein. Die Ärzte beobachteten wie sich das Gebärverhalten veränderte und erkannten als erste, welches Ausmaß die Abtreibungspraxis bereits angenommen hatte.
„Die ´gesunde Familie´ galt als Grundlage eines blühenden ´Volkskörpers´, ja des Volkes überhaupt. Die meisten Ärzte waren Verfechter der Sozialhygiene und forderten daher von der Medizin mehr als nur die Sorge für die Gesundheit des einzelnen. [...] In medizinischen Abhandlungen war eine ´gesunde Familie´ fast immer gleichbedeutend mit einer kinderreichen.“[91]
Der Begriff der Eugenik - die Lehre vom „Wohlgeborensein“ - war terminologisch gleichbedeutend mit der in Deutschland 1885 durch den Arzt Alfred Ploetz (1860-1940) eingeführten „Rassenhygiene“, welche Synonym war für „sexuelle Hygiene“, „Zeugungshygiene“ und „Vererbungshygiene“[92]. Die „Eugenik“ bzw. die „Rassenhygiene“ umfasste die medizinische und staatliche Kontrolle der „Fortpflanzung“ und „Vererbung“. Eugenik und Rassenhygiene können daher als Vorläufer der später aufkommenden Biopolitik verstanden werden.
Rassenhygieniker bezogen sich auf die darwinistische Evolutionstheorie und befassten sich mit der „Entwicklungsfähigkeit“ aller „Rassen“. So definierte Ploetz „Rassenhygiene“ als die „´Lehre von der optimalen Erhaltung und Vervollkommnung der menschlichen Rasse´“[93].
„Degeneration“ galt als „Erbkrankheit“, die dementsprechend den „Volkskörper“ bedrohen würde. Der Rassenhygiene ging es um eine „leidfreie“ Gesellschaft und um die Verhinderung „erbkranken Nachwuchses“. Dafür war ein staatlich legitimiertes Abtreibungs- und Sterilisationsrecht biopolitisch durchzusetzen. Mit diesem Recht wurde ein Selektionsprogramm verfolgt, welches die medizinische „Ausmerze“[94] von „Degenerierten“ zum Ziel hatte. Rassenhygieniker und Eugeniker gingen davon aus, dass die „natürliche Selektion“ durch die Gesundheitspolitik und die Armenfürsorge außer Kraft gesetzt worden sei. Dem wollten sie durch die „sexuelle Auslese“[95] entgegenwirken. Dies bedeutete, dass bereits die Geburt von „minderwertigem Leben“ verhindert werden sollte.
Die „positive Eugenik“ sollte durch „Zuchtwahl“ die Verbesserung des Erbguts erzielen, während die „negative Eugenik“ die Beseitigung von „defektem Erbgut“ erreichen sollte. Die Eugenik bzw. die Rassenhygiene wurde zur einer „Disziplin zur Steuerung und Kontrolle der menschlichen Erbgesundheit“[96]. Rassenhygieniker stützten sich hierbei auf den Darwinismus, der besagte, dass die „Natur“ nach den Gesetzen der Selektion funktioniere und dass die „natürliche Selektion“ eingebettet war in ein System der „Höherentwicklung“[97]. Mediziner stellten die Frage nach der „Fortpflanzung“ und der „Qualität“ nun unter den Aspekt der Vererbung. Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Anna Bergmann resümiert:
„Das Besondere der rassenhygienischen und eugenischen Idee war, daß sie einen expliziten Doppelcharakter beanspruchte: sie war zum einen an solide wissenschaftliche Erkenntnis gebunden und forderte zum anderen radikale politische Konsequenzen durch eine tiefgreifende medizinische Kontrolle des Gebärverhaltens, der Sexualität, der Geschlechterbeziehungen, des Heiratsverhaltens, also der im 19. Jahrhundert gerade erst zur Privatheit deklarierten Sphären von Ehe, Familie und Sexualität.“[98]
Die Rassenhygiene verfolgte immer wieder die Vorstellung einer „leidfreien“ Gesellschaft, womit „Glück“ verbunden wurde, um die Auslese bzw. Selektion zu rechtfertigen. Rassenhygienische Maßnahmen sollten zu einem vollendeten Glückszustand führen. „Die ‘Vervollkommnung des Volkskörpers’ verfolgte die Idee einer harmonischen Gesellschaft, die von ‘glücklichen, gesunden, und arbeitsfreudigen’ Menschen geprägt war […].“[99]
Die Rassenhygiene verwendete den Geburtenrückgang für ihre Argumentationen und behauptete, dass die „Höherwertigen“ sich weniger als die „Minderwertigen“ fortpflanzen würden. In diesem Zusammenhang führte Alfred Ploetz den Begriff der „Kontraselektion“ ein. Die „Auslese der Schwachen“ sei beispielsweise durch Tätigkeiten von Kinderärzten außer Kraft gesetzt, weshalb eine staatliche „Fortpflanzungs-Kontrolle“[100] nötig sei. „´Vererbung´, ´Auslese´ und ´Entartung´ - in diesen drei Schlüsselbegriffen läßt sich die rassenhygienische und eugenische Doktrin einschlägig zusammenfassen.“[101]
Rassenhygiene und Eugenik formierten sich in den Industrieländern im ausgehenden 19. Jahrhundert. Durch den rassenhygienischen und eugenischen Diskurs beeinflusst, wurde 1910 in Deutschland eine politische Diskussion geführt, bei der es um den Geburtenrückgang und um die Frage nach Quantität und „Qualität“ der Bevölkerung ging. Das Gebären musste durch Gesetze und durch die Medizin kontrolliert werden. Das Ziel war die „Rationalisierung der Fortpflanzung“[102], d.h. eine durch die Politik bzw. den Staat legitimierte „Fortpflanzungsauslese“[103], die durch die Naturwissenschaften angeleitet wurde. Es ging darum, die weibliche „Natur“ zu kontrollieren und zu rationalisieren. „Rationalisierung und Vernichtung waren daher von Anfang an miteinander gepaart, weil es um die Verhinderung gesellschaftlich unangepaßter menschlicher Existenz ging, und zwar auf dem geburtenpolitischen Weg.“[104]
Erste Kosten-Nutzen-Rechnungen begannen durch Preisausschreibungen, die seit 1900 rassenhygienische Fragestellungen beinhalteten. So gab es beispielsweise 1910 ein Preisausschreiben mit der Frage „Was kosten die schlechten Rassenelemente den Staat?“[105] in der Zeitschrift „Die Umschau“. Der Aufgabenstellung des Preisausschreibens ist unter anderem folgendes zu entnehmen:
„In allen Veröffentlichungen, welche sich mit der Verbesserung unserer Rasse beschäftigen, wird darauf hingewiesen, welche Unsummen der Staat, die Kassen und der Privatmann direkt und indirekt für Irrenhäuser, Zuchthäuser, Kranke ausgeben, an Personen, die eigentlich nicht geboren sein sollten, die sich selbst und den Mitmenschen eine ständige Last sind, die infolge verfehlter Anschauungen mitgeschleppt werden und der Mitwelt wie eine Bleikugel an den Beinen hängen, die Tausende und Tausende tüchtiger Bürger von nützlicher Arbeit abwenden, um sie für sich selbst als Wärter, Beamte, Ärzte usw. in Anspruch zu nehmen. Wir arbeiten fast mehr für die gesellschaftlichen Krüppel, als für eine organisierte Aufzucht der guten gesunden Elemente!“[106]
Durch die Frage nach den entstehenden Kosten durch „erbkranken Nachwuchs“ rückte die Sterilisation in den Vordergrund, da diese eine schnelle und vor allem kostengünstige und effektive Methode darstellte, um „gesellschaftliches Leiden“ zu lindern bzw. vollends zu verhindern.[107]
Im Zusammenhang mit dem Geburtenrückgang wurde die Frage nach der „Degeneration“ und „Entartung“ gestellt. Die „Entartung“[108] wurde als eine Ursache für mögliche Unfruchtbarkeit in bestimmten Bevölkerungsgruppen diskutiert; beispielsweise schrieb man Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus oder Geisteskrankheiten negative Auswirkungen auf die „natürliche Fortpflanzung“ zu. „Ob der Geburtenrückgang schlicht ein Phänomen der `Entartung´ war, stellte sich als eine der ersten Fragen überhaupt.“[109]
In der Zeit zwischen den 50er Jahren des 19. Jahrhundert und dem Beginn des Ersten Weltkrieges entstand die Degenerationslehre mit einem „Katalog der Minderwertigkeit“[110], der folgendes beinhaltete:
-
Tödliche und damals unheilbare Krankheiten (z.B. Tuberkulose, Syphilis oder Epilepsie)
-
Soziale Abweichungen (z.B. Arbeitsscheue, Bettelei, Vagabundieren)
-
Außereheliche Lebensformen und sexuelle Praktiken (z.B. uneheliche Mutterschaft, Prostitution, Homosexualität)
-
Psychische Leiden (z.B. Schizophrenie, manische Depression)
-
Politische Bewegungen, die den Staat und die Geschlechterordnung kritisierten (z.B. Anarchismus, Feminismus, Sozialismus)
-
Angeborene körperliche Abweichungen (z.B. Blindheit, Gehörlosigkeit, Spaltungen des Gaumens)[111]
Der Geburtenrückgang wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg zum Hauptgegenstand politischer Diskussionen. Politiker, Ökonomen und Mediziner sahen diese Entwicklung als den nahenden „Rassentod“[112] und als Gefahr für den deutschen Nationalstaat an. Durch den Kriegsbeginn im August 1914 wurde die Bevölkerungspolitik noch brisanter. Die Befürchtungen bezüglich des Geburtenrückgangs in Verbindung mit unzähligen Kriegsopfern verliehen der Bevölkerungsdiskussion zeitweise „hysterische Züge“[113]. „Volkskraft wurde jetzt mehr denn je mit Wehrkraft gleichgesetzt. Kinder wurden zu einem der wichtigsten ´Rohstoffe´ des Landes.“[114]
Die vielen Opfer auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges verstärkten bei vielen die Sorge über den gefürchteten Geburtenrückgang. Die Bevölkerungspolitik der Weimarer Republik war eine Mischung aus Kontinuität und Wandel. „Die veränderten politischen Machtverhältnisse und die sozialen Verschiebungen nach dem Krieg hatten zu einer neuen Definition des Problems geführt: Man setzte nun auf Wohlfahrt statt auf Pronatalismus, auf ´gesündere´ und nicht einfach nur ´mehr Kinder´.“[115] Die konservativen Gruppierungen hielten am Model der „Degeneration“ fest und sahen beispielsweise in der nichtehelichen Geburtenrate eine Gefahr für den „Volkskörper“.
„Die Vorstellungen von ´Rasse´, ´Nation´, ´Auslese´, ´Wehrkraft´ hatten sich vor dem Hintergrund des Darwinismus präzisiert.“[116] Die geburtenpolitische Debatte beschäftigte nicht nur die Frage nach der Quantität, sondern vor allem auch die nach der „Qualität“ der Bevölkerung. Mediziner und die rassenhygienische und eugenische Bewegung propagierten die Geburtenpolitik als „medizinischen Eingriff in einen ´kranken Volkskörper´“[117]. Darwins Theorien zur „natürlichen Auslese“ und zum „Kampf ums Dasein“[118] wurden aufgegriffen.
Im Zuge der Medikalisierung der Bereiche Kultur, Politik, Geschlecht und Gesellschaft wurden Ärzte zu Experten für die soziale Frage. Durch den Aufstieg der Naturwissenschaften und ihre damit einhergehende Definitionsmacht konnte die Medizin die menschliche Natur in verschiedene Kategorien einteilen. „Gesundheit“ wurde als biopolitisch machbares Ziel definiert. Die Geburtenpolitik erhielt langsam aber sicher einen „totalitären Charakter“[119], da man die Kreation eines „neuen Menschen“[120] anstrebte.
Rassenhygiene und Eugenik hatten großen Einfluss an den Universitäten, da sie seit 1909 in Deutschland mit zur medizinischen Ausbildungen gehörten, wobei Berlin und München die „Hochburgen“ waren. Der erste Lehrstuhl für Rassenhygiene wurde schließlich 1923 in München an Fritz Lenz vergeben, der später während des NS-Regimes SS-Ärzte ausbildete und Mitglied der NSDAP war. Bis zum Ende der 1920er Jahre hatte sich die Eugenik als Wissenschaft so weit etabliert, dass sie durch die verbreitete Ansicht, dass man auf eine „degenerierte Bevölkerung“ zusteuere, schließlich den „endgültigen Schritt in die Praxis“[121] machen konnte.
In den 1920er Jahren wurden Eugenik und Rassenhygiene von vielen politischen Strömungen vertreten. Das Gesundheitsparadigma beherrschte Themen wie Ernährung, Sport und Körperhygiene und wurde von Ärzten, Naturheilkundlern und Hygienikern propagiert. Es entstand ein neues „Körperbewusstsein“ und die „Rationalisierung der Sexualität“ wurde zum Ziel gemacht.[122]
Durch staatliche Untersuchungen stellte man fest, dass es immer mehr „kriminelle Abtreibungen“ gab und ein entsprechender „Schwarzmarkt“ für Verhütungsmittel existierte. Eine Abtreibung galt als Tötungsdelikt. Schließlich forderte der Preußische Innenminister eine Zusammenarbeit von Frauenkliniken, Krankenhäusern und der Polizei, was zum Auftakt einer Politik gegen das sogenannte Abtreibungsgeschehen führte. Zusätzlich gab es Gesetze, mit denen der Handel mit Verhütungsmitteln und „Kontrazeptiva“ kriminalisiert war. Ziel war die Wiederherstellung der „Sittlichkeit“ und dass die Geburtenkontrolle grundsätzlich in ärztliche Hände kam. „Die Geburtenkontrolle war von staatlicher Seite zum ´Mißstand´ erklärt und mit Kriminalisierung beantwortet worden.“[123]
„Medizinische Techniken der Sterilisation, Kastration und operativen Abtreibung standen im Zentrum des rassenhygienischen Programms, um die Todeslogik der Selektionsgesetze in eine Zeugungslogik zur Fabrikation einer ‘unsterblichen Rasse’ zu wenden.“[124]
Um den „Volkskörper“ zu „schützen“, wurde die Kriminalisierung der Fortpflanzung von „entarteten Personen“ gefordert. In diesem Zusammenhang forderten Gynäkologen und Psychiater bereits seit der Jahrhundertwende, dass Ärzten die Sterilisation aus folgenden Gründen erlaubt werden sollte:
„1. zu direkten Heilzwecken [...] bei Neurosen und Psychosen [...]; 2. zur Verhütung der Schwangerschaft, um die Frau vor einer Gefahr für Leben und Gesundheit zu bewahren; 3. aus sozialpolitischen und rassenhygienischen Gründen, um a) einen verbrecherischen oder krankhaften Trieb, insbesondere Geschlechtstrieb zu beseitigen [...] und b) um einen verbrecherischen oder degenerierten oder geisteskranken (mit einem Worte rassenhygienisch betrachtet minderwertigen) Nachwuchs zu verhüten“.[125]
Sterilisationen sollten jedoch keine selbstbestimmte Empfängnisverhütung darstellen, sondern sollten lediglich für diejenigen möglich sein, deren Nachwuchs unerwünscht war.[126] Gleichzeitig forderten Rassenhygieniker, dass Ärzte und Staat gegen „willkürliche Geburtenbeschränkung“[127] und die sogenannte „Abtreibungsseuche“[128] vorgehen sollten, um die Steigerung der Quantität und auch der „Qualität“ der Bevölkerung zu gewährleisten. Eine ärztliche und eine von Frauen selbst durchgeführte Abtreibung sollten unterschiedlich bewertet werden, indem „[...] die Kriminalisierung von abtreibenden Frauen einerseits und die staatliche Kompetenzzuschreibung gegenüber Medizinern andererseits verrechtlicht werden sollten“[129].
Die Diskussion um den Geburtenrückgang kam den Gynäkologen hierbei zu Gute. Geburtenregulierende Maßnahmen wurden in den 1920er Jahren als „Rationalisierung der Fortpflanzung“ verstanden. Zunächst wurde dieser Prozess durch Staat und Gesetze reguliert, bis er schließlich großen Einfluss auf Denk- und Verhaltensweisen der Menschen hatte.[130]
Der Gynäkologe und Eugeniker Max Hirsch (1877-1948) erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Absicht und der Zweck den Arzt vom Verbrecher unterscheiden würden. Sowohl der Geburtenrückgang als auch die Geburtenkontrolle kamen der Eugenik entgegen, da einerseits die Geburt von „minderwertigem Leben“ verhindert werden und andererseits die „Aufzucht“ von „vollwertigen“ Kindern gewährleistet werden sollte. Unter dem Leitbild „Frauen als ´Erhalterinnen der Nation´“[131] wurden diese im Zusammenhang mit dem Vererbungsparadigma „eugenisch nach mütterlichen Kapazitäten, Schönheit und Stillfähigkeit gemustert“[132].
In den Jahren 1930 bis 1933 legten Rassenhygieniker und Eugeniker immer wieder Gesetzesentwürfe vor, welche die eugenische Sterilisation legalisieren sollten. Der Konflikt bzw. das scheinbare Paradox hierbei war, dass keine allgemeine Erlaubnis zur Sterilisation gegeben werden sollte, sondern nur für diejenigen, die „minderwertigen“ Nachwuchs haben würden. Es ging schließlich nicht nur, wie bereits erwähnt, um die Verhinderung von „unerwünschtem“ Nachwuchs, sondern auch um die Förderung von „erbgesundem Nachwuchs“.[133] Das eugenische und rassenhygienische Programm erreichte schließlich seinen ersten großen Höhepunkt in der Geburtenpolitik der Nationalsozialisten.
Zwischen 1900 und 1934 entwickelten Gynäkologen an die 100 verschiedenen Techniken, um Frauen zu sterilisieren, es existierte jedoch nur eine für Männer. Somit standen den Nationalsozialisten 1933 mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ unzählige Sterilisationstechniken zur Verfügung. „Vor dem Hintergrund dieser chirurgischen Techniken postulierten und praktizierten Rassenhygieniker eine ‘Reinigung’ des ‘Volkskörpers’ von medizinisch klassifizierten ‘Degenerierten’ […].“[134]
2.3 Die Selektionspraxis im Nationalsozialismus[135]
Wenige Monate, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, radikalisierten sie eugenische Konzepte und setzten ein erstes Gesetz zur Legalisierung der eugenischen „Unfruchtbarmachung“ durch.[136] Ab 1927 galt durch ein Urteil des Reichsgerichts ein Schwangerschaftsabbruch bei „drohender Gefahr für Leben und Gesundheit der Mutter“[137] als straffrei. So wurde 1935 die medizinische und eugenische Indikation für Schwangerschaftsabbrüche erstmals durch ein Gesetz eingeführt. Im Nationalsozialismus ging es einerseits um die Förderung von „erbgesunden“ Nachkommen und andererseits um die Verhinderung von „minderwertigem“ Nachwuchs. Daher gab es das Abtreibungsverbot und den Zwang zur Abtreibung gleichzeitig.[138] „Das Charakteristische der nationalsozialistischen Frauenpolitik war nicht der Gebärzwang, sondern der staatlich organisierte Zugriff auf die weibliche Gebärfähigkeit von zwei Seiten.“[139]
Im Jahr 1933 setzte „der Angriff gegen die behinderten Menschen in den Heil- und Pflegeanstalten […] mit Sterilisation und eingeschränkter Grundversorgung“[140] ein. Bei der Sterilisationspolitik ging es um die „Reinigung des Volkskörpers“[141] und die Verhinderung von „biologisch minderwertigem Erbgut“. Die meisten Sterilisationen wurden aufgrund von psychischen und geistigen Behinderungen durchgeführt. In den folgenden Jahren wurden in den Mordanstalten verschiedene Methoden der Massensterilisation erprobt, mit dem Ziel, nach dem erhofften „Endsieg“, „ethnisch und eugenisch unerwünschte Frauen“ in ganz Europa sterilisieren zu können.[142]
Als Erweiterung der bisherigen Gesetzesentwürfe folgte das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ am 1. Januar 1934, wodurch eine Unfruchtbarmachung unter Zwang möglich wurde. Das Gesetz beinhaltete ein genaues Diagnoseschema für Personen, die von der Fortpflanzung ausgeschlossen sein sollten.[143] Die quantitativ wichtigste Gruppe, die es zu sterilisieren und dadurch von der Fortpflanzung auszuschließen galt, war die der „Schwachsinnigen“. In den ersten drei Jahren fällten die Sterilisationsgerichte bereits 200.000 für und nur rund 25.000 Beschlüsse gegen eine Sterilisation. 1936 waren die Gerichte bereits soweit „eingespielt“, dass 98 Prozent der Beschlüsse tatsächlich zur Sterilisation führten.[144]
1935 fügte man dem Sterilisationsgesetz schließlich einen Abtreibungsparagraphen hinzu, der besagte, dass bis zur sechsten Schwangerschaftswoche aus eugenischen Gründen abgetrieben werden durfte.[145] „Die rechtlichen Möglichkeiten für Eingriffe in den Körper wurden in den Jahren nach Einführung des Gesetzes schrittweise erweitert und schlossen später die Kastration sowie den eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch ein.“[146]
Jeder einzelne wurde nach dem Nutzen für die Gesamtheit bewertet. Denen, die der leistungsorientierten Norm nicht entsprachen, sollte die Fortpflanzung verwehrt bleiben.[147] „Den Frauen wurde eingeschärft, daß nicht das Kinderkriegen, sondern die ´Aufartung zum Ziele des Staates geworden´ sei.“[148] Die nationalsozialistische Sterilisationspolitik war nur der Startschuss zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Ging es zunächst bei der „Erb- und Rassenpflege“ noch um die „Verhütung“, ging man kurz darauf über zur „Vernichtung“. Wobei die Sterilisation als die „humanere“ Alternative zum Töten propagiert wurde.[149]
Wie der amerikanischen Historiker Henry Friedlander resümiert, stand die „Tötungsmaschinerie“[150] bei Kriegsausbruch am 1. September 1939 bereit und das Morden konnte beginnen. Das sogenannte Knauer-Baby war der Auslöser für Hitlers „Euthanasie“-Programm körperlich und geistig behinderter Kinder. Für die Mordaktionen war die Kanzlei des Führers der NSDAP (KdF) zuständig, welche keine staatliche Behörde war, sondern eine eigenständige Organisation. Dadurch bedingt und da nur wenige Menschen mit der Angelegenheit vertraut waren, konnte die KdF die Mordaktionen steuern, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Es wurde die fiktive Organisation „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden“ ins Leben gerufen, die die Rolle der KdF verschleiern sollte. Diese Behörde, deren Adresse[151] nur ein Postfach war, existierte lediglich auf dem Papier. So unterzeichneten auch die Leiter des Reichsausschusses jegliche Dokumente mit einem Decknamen. Im Frühjahr 1939 wurden Meldebögen eingeführt, die zur Erfassung der zu tötenden Kinder dienten. Das Reichsministerium des Innern (RMdI) ordnete am 18. August 1939 die „Meldepflicht für mißgestaltete Neugeborene“ an. Dieser Erlass war „streng vertraulich“ zu behandeln. Hebammen und Ärzte waren verpflichtet, Neugeborene und Kinder unter drei Jahren zu melden im Falle von:
-
„Idiotie sowie Mongolismus (besonders Fälle, die mit Blindheit und Taubheit verbunden sind),
-
Mikrozephalie [abnorme Verkleinerung von Umfang und Inhalt des Schädels],
-
Hydrozephalus [Wasserkopf] schweren bzw. progressiven Grades,
-
Mißbildungen jeder Art, besonders Fehlen von Gliedmaßen, schwere Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule usw.,
-
Lähmungen einschl. Littlescher Erkrankung [spastische Diplegie].“[152]
Die auszufüllenden Formulare waren nur eine Seite lang und ließen keinen Platz für ausführliche Beschreibungen. Das RdMI gab folgende Begründung für die Meldebögen an: „Zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf dem Gebiete der angeborenen Mißbildung und der geistigen Unterentwicklung ist eine möglichst frühzeitige Erfassung der einschlägigen Fälle notwendig.“[153] Die wahren Gründe wurden nicht offen dargelegt. Die Hebammen und Ärzte gaben die ausgefüllten Meldebögen beim zuständigen Gesundheitsamt ab, welches diese dann zum Reichsausschuss weiterleitete. Dort urteilten drei Gutachter über Leben und Tod der Kinder.
„Die Gutachter notierten ihr Urteil über jedes geprüfte Kind neben ihrem Namen auf Blättern, die den Briefkopf ‘Reichssausschuß’ trugen, aber von der KdF ausgegeben wurden. Für ausführliche Kommentare war kein Platz. Ein schlichtes Pluszeichen (+) bedeutete Aufnahme in das Programm, d.h. die Tötung des Kindes; ein Minuszeichen (-) bedeutete, das Kind durfte weiterleben.“[154]
Der Reichsausschuss richtete sogenannte Kinderfachabteilungen als Mordstationen ein, die Kliniken angegliedert waren. Für die Mordstationen warb die KdF ausgewählte Ärzte an, von denen sich nur wenige nicht bereit erklärten beizutreten. In einigen Mordstationen wurden Forschungseinrichtungen gegründet, die Experimente mit den Kindern vor und auch nach ihrer Ermordung zur Herstellung von Präparaten durchführten. Die Ärzte wandten unterschiedliche Tötungsmethoden an, beispielsweise Morphiuminjektionen, verhungern lassen oder die Verabreichung von Luminal (Schlafmittel). Die Überdosen der Medikamente führten zunächst zu medizinischen Komplikationen (z.B.: Pneumonie) und schließlich zum Tod. Dadurch konnten die Ärzte einen „natürlichen Tod“ feststellen. Der Befehl, ein Kind zu töten, wurde vom Reichsausschuss erteilt, wobei der Begriff „Ermächtigung zur Behandlung“[155] verwendet wurde, um den Mythos vom Gnadentod aufrecht zu erhalten. Durch einen Runderlass des Reichsausschusses sollten die Einwände von Eltern gegen die Einweisung der Kinder in die „offenen Kinder- und Jugendfachabteilungen“ entkräftet werden. Reichten die Argumente des Runderlasses nicht aus, so wurden die Eltern auch mit Hilfe von Drohungen (Entziehung des Fürsorgerechts) gezwungen. Schätzungen zufolge wurden mindestens 5.000 Kinder in diesem Zusammenhang ermordet.
Zusätzlich führte man während der NS-Diktatur bei etwa 350.000 bis 450.000 Frauen und Männern aus eugenischen und rassenpolitischen Gründen Sterilisationen durch. Diese Zahlen beruhen auf späteren Schätzungen von Forschern und Behörden. Hitler hatte im Mai 1936 die Veröffentlichung von genauen Zahlen verboten, um Unruhen in und außerhalb von Deutschland zu vermeiden.[156]
2.4 Die Geburtenkontrolle in der Nachkriegszeit[157]
Deutschland war nach dem Krieg von 1945 bis 1949 von den Alliierten besetzt und in vier Besatzungszonen aufgeteilt – die amerikanische, die britische, die französische und die sowjetische Besatzungszone. Aus der sowjetischen Besatzungszone ging die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mit einer sogenannten Volksdemokratie hervor. Die drei anderen Besatzungszonen wurden zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) mit einer parlamentarischen Demokratie. Die Alliierten gaben nach und nach ihre politische Kontrolle jeweils an die BRD und die DDR ab.
Nach Kriegsende waren die gesetzlichen Regelungen für Schwangerschaftsabbrüche äußerst chaotisch und nicht wirklich eindeutig. Die Alliierten Besatzungsmächte fällten keine eindeutige Entscheidung für den § 218. Diese Rechtsunsicherheiten hielten bis in die 1950er Jahre an.
Im Folgenden werden jeweils die Geburtenkontrolle und der Umgang mit den Bestimmungen zu Sterilisationen und Schwangerschaftsabbrüchen in der BRD und in der DDR dargestellt. Zunächst werden die Bestimmungen der Bundesrepublik vorgestellt.
Nach 1945 wurden in der alliierten Besatzungszone bzw. der späteren BRD die „Erbgesundheitsgerichte“ nicht wieder eröffnet, ohne deren Zustimmung zwangsweise Sterilisationen nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ nicht durchgeführt werden konnten. Somit war zwar die Praxis beendet, nicht aber die gesetzliche Grundlage abgeschafft. Allgemeingültige gesetzliche Regelungen für die nationalsozialistischen Sterilisationsgesetzgebungen legten die Besatzungsmächte nach dem Krieg nicht fest. Als Rechtfertigung für die Beibehaltung des Gesetzes wurden wissenschaftliche und historische Gründe sowie Vergleiche mit ausländischen Gesetzen und Handhabungen mit eugenischen Sterilisationen genannt.
Den Forderungen nach Wiedergutmachungen von Zwangssterilisierten ging man nicht nach, lediglich denen, die aufgrund ihrer „Rasse“ sterilisiert worden waren. Wenn jedoch entschieden wurde, dass die „eugenische“ Diagnose „zu Recht“ zu einer Sterilisation geführt hatte, „d.h. entsprechend dem ´Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses´“[158], wurden weder die damaligen Ärzte noch die Richter zur Rechenschaft gezogen. Freiwillige Sterilisationen aus medizinischer, eugenischer oder kriminologischer Indikation würden nicht gegen den „Schutz der menschlichen Würde“[159] verstoßen.
„Die rechtliche Situation zur Regelung der Sterilisation blieb mit der Unsicherheit über die Anwendung einzelner Paragraphen des ´Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses´ weiterhin unklar. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit eines unfruchtbarmachenden Eingriffes unterschied in der Rechtspraxis zwischen einer freiwilligen Unfruchtbarmachung sowie ihrer zwangsweisen Durchführung.“[160]
Es wurden juristische Beiträge verfasst, die die Wiedereinführung der richterlich angeordneten Sterilisation empfahlen. Als Gründe wurden sowohl die „Verbesserung des Erbguts“ genannt, um den „Verfall der Bevölkerung“[161] zu verhindern, als auch finanzielle Einsparungen, die dadurch möglich wären. Es handelte sich eindeutig um eugenische Argumentationsmuster. Erbbiologische und medizinische Forschungen untermauerten die Anerkennung der juristischen Empfehlungen, dass eugenische Regulierungen nötig seien. Einerseits beseitige die Medizin Krankheiten und vermindere Leid, andererseits behindere sie damit gleichzeitig die „natürliche Selektion“, wodurch „krankes Leben“ nicht verhindert werde. Daher wurde von der Medizin gefordert, dass sie lediglich „positive Effekte“ erzielen solle und zwar durch eine „bewusst und künstlich gelenkte Selektion“[162]. Daher gab es vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 1960 immer noch keine endgültige Aufklärung über die Legitimität des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Diese Argumentationen waren bereits typisch für die Rassenhygiene in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – die Medizin sollte „kranken“ Nachwuchs verhindern und „gesunden“ Nachwuchs fördern. Die „Rationalisierung der Fortpflanzung“ war wie bereits zu Beginn des Jahrhunderts ein wichtiges Thema.
In der Alliierten Besatzungszone und späteren BRD wurde nach dem Krieg lediglich die Todesstrafe für Verhütung und Abtreibung in der Gesetzgebung, die aus der NS-Zeit stammte, aufgehoben. Ansonsten gab es keine einheitliche gesetzliche Regelung, weshalb jedes westliche Land selber entschied, inwieweit beispielsweise Schwangerschaftsabbrüche bestraft werden sollten. Der Paragraph des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, der besagte, dass eine Schwangerschaftsunterbrechung aus medizinischer Indikation zugelassen sei, blieb auch nach 1945 bestehen.
„Die gesetzlichen Bestimmungen wie beispielsweise die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch und zur Verwendung von Schwangerschaftsverhütungsmitteln, die nach 1945 zur Erhaltung und Vermehrung der Bevölkerung beitragen sollten, waren und blieben bis in die fünfziger Jahre hinein dieselben, die zur Bevölkerungsregulierung bis zum Nationalsozialismus angewendet sowie während dieser Zeit durch neue Gesetze ergänzt wurden.“[163]
Ein Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation war somit in den westlichen Besatzungszonen nach Kriegsende möglich, wenn das Leben oder die Gesundheit der werdenden Mutter gefährdet war. Der medizinische Abbruch war die einzig legale Möglichkeit und zudem die einzige Regelung über die sich alle Länder der BRD weitestgehend einig waren. Es wurde jedoch diskutiert, ob man den Abbruch aus eugenischen Gründen legalisieren solle. Die Schwierigkeit hierbei bestand jedoch darin, dass „gesunder Nachwuchs“ gefördert werden und „lebensunwertes“ Leben hingegen verhindert werden sollte. Das Problem war, dass die technischen Möglichkeiten noch nicht so weit entwickelt waren, dass man exakte Voraussagen über Schädigungen des Ungeborenen hätte machen können. „Gesunder Nachwuchs“ sollte schließlich nicht durch einen eugenisch indizierten Abbruch verhindert werden. „Da bevölkerungspolitische Ziele in der Förderung des Bevölkerungszuwachses und nicht in deren weiterem Schwund bestanden, nahmen individuelle Interessen von Frauen nur einen untergeordneten Rang ein.“[164] Die eugenische Ideologie brach somit auch nach dem Krieg nicht ab, und die Sorge um „kranken“ Nachwuchs war weiterhin Gegenstand von geburtenpolitischen Diskussionen.
Ärzte in der BRD befürchteten Anfang der 1950er Jahre, dass Frauen durch die wachsende Selbstständigkeit und die unabhängige Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft, ihre „naturgegebene Gebärpflicht“[165] vergessen würden. So wurde versucht, insbesondere junge Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft durch moralische Manipulation vom Abbruch abzuhalten.
Im Jahr 1960 kam es in der BRD schließlich zu einer Neudefinition. Aus der „eugenischen Indikation“ wurde die „kindliche Indikation“ und das Hauptargument war nicht mehr das sogenannte Volkswohl, sondern die „individuelle Belastung“, die es zu vermeiden galt. Diese neuen Formulierungen dienten dazu, Abstand vom Nationalsozialismus zu gewinnen, um endlich - wie bereits vorher erhofft - „vergessen“ zu können. Somit wurde zwar die nationalsozialistische bzw. rassistische Formulierung abgeschafft, nicht aber in Frage gestellt.
In der BRD gab es Bestrebungen, Institutionen zur Bevölkerungskontrolle einzurichten. Ehe- und Familienberatungsstellen sollten die Bevölkerung schließlich beeinflussen und kontrollieren. Die Familie wurde als Schnittstelle zwischen Individuum und Staat angesehen und musste daher beeinflusst werden, um die Bevölkerungsreproduktion steuern und kontrollieren zu können.
Hierbei wurde allein den Medizinern die Kompetenz zur Beratung zugeschrieben, da sie über das Wissen vom menschlichen und insbesondere vom weiblichen Körper verfügten. Ein wichtiger Bestandteil der Beratung waren Infektions-, Geschlechts- und Erbkrankheiten, die es zu vermeiden galt. Mit der Zeit war das Ziel der Beratungen immer mehr die Verhinderung von „geistigen Störungen“. Ehepaare sollten „gesunde“ Kinder bekommen. Dahinter lag das Konzept, dass nur eine „gesunde“ Ehe, eine glückliche Ehe sei. Zusätzlich wurde Frauen das traditionelle Rollenbild zugeschrieben, das besagte, dass sie Hausfrau, Mutter und Ehefrau sein sollte. Die Ausübung eines Berufes würde nur zu einer zusätzlichen Belastung führen, die man vermeiden könne, da dies der Aufgabenbereich der Männer sei. Frauen sollten sich wieder vollkommen der Aufgabe des Gebärens und der Mutterschaft widmen.
„Argumentiert wurde mit der dauerhaften körperlichen und psychischen Überbelastung der Frauen durch die Wahrnehmung sowohl der produktiven als auch der reproduktiven Aufgaben, die vom medizinischen Standpunkt zu unvermeidlichen gesundheitlichen Schäden der Frau führen würden [...].“[166]
Frauen standen nicht viele Möglichkeiten zur Empfängnisverhütung zur Verfügung. Die wenigen, die es gab, waren zudem rezeptpflichtig. Frauen mussten daher regelmäßig zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Ärzte und Gynäkologen wollten wieder mehr Kontrolle über den (weiblichen) Körper erlangen. „Kinder sollten nicht verhütet werden, sondern geboren werden.“[167] Die Gynäkologie erhielt dadurch eine biopolitische Verantwortung, die vorher bei der Eugenik lag.
„Mitte der fünfziger Jahre waren als Folge eines immensen internationalen Aufschwunges der humangenetischen Forschungen auch die Möglichkeiten zur Diagnostizierung von Erbgutveränderungen schnell vorangeschritten und gingen mit einer zukunftsweisenden, bahnbrechenden Entwicklung einher.“[168]
Einer der ersten Fortschritte in der Chromosomenanalyse war die Festlegung des genetischen Geschlechts. Nach Untersuchungen von chromosomalen Abweichungen benannte man 1959 eine Chromosomenstörung „Trisomie des kleinen Autosomen 21“. Das sogenannte Down-Syndrom brachten Forscher und Ärzte mit dem fortgeschrittenen Alter der Mutter in Verbindung. Das „Down-Syndrom“ wurde immer präsenter, da man von immer mehr Fällen erfuhr. 1962 trat die Humangenetik schließlich wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit. Hatte sie bis dahin eher unbemerkt geforscht, so tastete sie sich nun vorsichtig nach vorne mit „maßvoller“ Erbgesundheitspflege.
Mit den Modernisierungs- und Individualisierungsprozessen in der 1960er Jahren setzten neue Legitimierungsversuche für biopolitische Kontrolle ein. Eugenische Maßnahmen konnten nicht mehr mit Zwang durchgesetzt werden. Sie wurden vielmehr durch neue Argumentationen, die auf die individuell zu tragenden Lasten hinwiesen, die Freiwilligkeit und Motivation der Individuen legitimiert. Man orientierte sich argumentativ daher nicht mehr an der allgemeinen „Volksgesundheit“, sondern an den individuellen Bedürfnissen und Interessen. Die Begriffe „Glück“ und „Leid“ hielten Eingang in die Argumentationen, wobei weibliche Selbstbestimmung nicht übergangen werden sollte.
„Eugenische Zwecke behielten ihre gesellschaftliche Relevanz, in dem sie in ein legitimes Konzept individueller Lebensplanung, also auch Familienplanung integriert wurden und so im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen neue Bedeutung erlangen konnten.“[169]
Auch in den 1960er Jahren war der quantitative Bevölkerungszuwachs nach wie vor ein wichtiges bevölkerungspolitisches Ziel in der Bundesrepublik. 1961 wurde die „Pille“ auf den Markt gebracht. Diese ließ sich zur „Beschränkung der Vererbung unerwünschter Eigenschaften und Merkmale“[170] verwenden. Die hormonelle Verhütung war eine „zeitlich begrenzte Unfruchtbarkeit“[171] und erwies sich als sehr sicher. Sie stellte eine Regulierungsmethode dar, welche die Zufälligkeiten der Natur bzw. des weiblichen Menstruationsmechanismus ausschaltete. Die „Pille“ stellte einen weiteren Schritt in der Kontrolle über den weiblichen Körper dar und konnte für bevölkerungsregulierende Maßnahmen verwendet werden.
1969 wurde in der Bundesrepublik die Sterilisation bei bestimmten Indikationen als Methode zur Empfängnisverhütung zunehmend anerkannt und unabhängig von der Rechtslage etablierte sie sich daraufhin zu Beginn der 1970er Jahre. Sterilisationen hatten den Vorteil gegenüber anderen Verhütungsmitteln (wie beispielsweise der „Pille“), dass sie nur wenige Nebenwirkungen hervorriefen. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hatte sich die Einstellung der bundesdeutschen Ärzte und auch der Öffentlichkeit so gewandelt, dass auch ohne gesetzliche Regelung alle großen Kliniken die Tubensterilisation durchführten. Zudem wurden inzwischen medizinische Kriterien und Indikationen immer mehr mit sozialen verknüpft. Es setzte sich trotz fortschreitender Tolerierung jedoch keine allgemeine Popularisierung der Sterilisation durch und sie blieb äußerst unerwünscht.
„Bis Mitte der achtziger Jahre war die Tubensterilisation in der Bundesrepublik als lange Jahre umstrittene Kontrazeptionsmethode eine zwar reglementierte, aber gängige Verhütungsform geworden, eine Entwicklung, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden relativ einfachen und sicheren Techniken ablief.“[172]
Einige der Sterilisationen misslangen und die Frauen wurden ungewollt schwanger. Ärzte wurden daraufhin auf Schadensersatz verklagt; gefordert wurde der Unterhaltsbetrag für das ungewollte Kind. Gründe für die Rechtsurteile waren beispielsweise Behandlungsfehler oder auch Einwilligungsmangel.
In der BRD wurden schließlich erst 1974 die letzten Paragraphen des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ außer Kraft gesetzt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass - trotz scheinbarer Bemühungen - Rassenhygiene und Eugenik nach dem Krieg nicht verschwunden sind. In der BRD wurden einige Umformulierungen vorgenommen, um den Abstand vom Nationalsozialismus zu signalisieren. Die Geburtenpolitik strebte allerdings weiterhin die Verhinderung von „krankem“ Nachwuchs an, sowie die gleichzeitige Förderung von „gesunden“ Nachkommen. Frauen sollten „gesunden“ Nachwuchs gebären, um den Bevölkerungszuwachs sowohl quantitativ als auch qualitativ zu sichern. Verhütung, Abtreibungen und Sterilisationen sollten diesem Ziel dienen. Die biopolitische Kontrolle wurde allerdings nicht mehr wie zur NS-Zeit mit Zwang durchgesetzt. Die Sorge um den Nachwuchs sollte immer mehr zur individuellen Verantwortung werden. Die Familienberatungsstellen sollten durch die Individualisierung die Biopolitik vorantreiben. Die Beratungen hatten die Verhinderung der Geburt „kranker“ Kinder zum Ziel. Die Medizin beseitige Krankheiten und vermindere Leid. Diese Argumentation der Rassenhygiene wurde in der BRD wieder aufgenommen. Es gab eine eugenische Kontinuität, trotz der (vermeintlichen) Distanzierung vom Nationalsozialismus. So wurden Denkmuster und Argumentationen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegriffen, auf die sich teilweise auch schon die Nationalsozialisten bezogen hatten.
Im Folgenden wird nun der Umgang der Deutschen Demokratischen Republik mit der Geburtenkontrolle und mit den Bestimmungen zu Sterilisationen und Schwangerschaftsabbrüchen dargestellt.
In der sowjetischen Besatzungszone bzw. der späteren DDR wurde 1946 veranlasst, sämtliche nationalsozialistischen Gesetze, die mit Zwangssterilisationen zusammenhingen, außer Kraft zu setzen. Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ gehörte u.a. dazu. Aus der Not der Nachkriegszeit heraus beschloss man in der DDR, zunächst das Strafgesetzbuch in der Fassung von 1931 als gültig zu erklären.
„De facto war damit eine rechtliche Situation geschaffen, in der Eingriffe in den Körper mit dem Ziel der Unfruchtbarkeit gesetzlich nicht mehr geregelt waren. Auf sowjetisch besetztem Territorium existierte nunmehr keine legale Grundlage für die Durchführung von Sterilisationen mehr.“[173]
Nach der allgemeinen Außerkraftsetzung der nationalsozialistischen Gesetze wurde der weitere juristische Umgang mit Beteiligten und Betroffenen den jeweiligen Ländern übergeben. Die Sowjets wollten einen deutlichen Schlussstrich unter die NS-Zeit ziehen, wobei die Aufarbeitung des Faschismus und seiner Folgen ausblieb.
Die illegalen Abtreibungen wurden in der Nachkriegszeit nicht weniger, wofür unter anderem unzählige Vergewaltigungen von Frauen durch alliierte Soldaten der Anlass waren. Bedingt durch die vielen Vergewaltigungen gab es in der DDR die Erlaubnis zur Abtreibung mit „ethischer“ Indikation. So durften Frauen einen Abbruch vornehmen lassen, die durch einen sowjetischen Soldaten vergewaltigt worden waren, nicht aber nach einer Vergewaltigung durch einen Deutschen.[174] Es handelte sich somit um einen „vorgeschobenen“ Grund und um eine rassistisch begründete Legalisierung der Abtreibungen.
Im Jahr 1947 wurde in einigen Bundesländern festgelegt, dass Frauen in den ersten drei Monaten bei ungewollter Schwangerschaft abtreiben dürfen. Kommissionen von Ärzten und Sozialfürsorgerinnen u.a. entschieden über die Durchführung der Abtreibungen. Illegal durchgeführte Abtreibungen waren weiterhin strafbar.[175] Abbrüche nach einem „Sittlichkeitsverbrechen“[176] oder nach medizinischer Indikation (Lebensgefahr für die werdende Mutter) waren somit erlaubt, wobei strenge Fristen zur Meldung bestanden. Schwangerschaftsabbrüche sollten lediglich von autorisierten Ärzten durchgeführt werden. Selbstabtreibungen oder Abtreibungen durch Dritte waren strafbar, selbst in den ersten drei Monaten, in denen ein Abbruch normalerweise straffrei gewesen wäre.
Ein zusätzliches Kriterium für einen Abbruch war die persönliche und schriftliche Einwilligung der Schwangeren, wobei es auch einige Ausnahmen gab, wenn die Schwangere beispielsweise dazu nicht in der Lage war. Der erhoffte Rückgang von illegal durchgeführten Abbrüchen blieb dennoch aus. Daher entstand aus dem starken Anstieg illegaler aber auch legaler Schwangerschaftsabbrüche die Forderung nach Empfängnisverhütung in der DDR.
Die Nachkriegszeit war gekennzeichnet durch den schlechten Gesundheitszustand der Menschen, der sich in einer niedrigen Lebenserwartung, einer hohen Säuglingssterblichkeit und weit verbreiteten Infektionskrankheiten widerspiegelte, so Hahn. Der Neuaufbau des öffentlichen Gesundheitswesens erschien für die DDR daher unumgänglich, und ein System zur genauen medizinischen Kontrolle sollte entwickelt werden. „Die gesetzlich geregelte Kontrolle ordnete sich in ein hierarchisch aufgebautes System, in dem regionale hygienisch-epidemiologische Stellen sowie übergeordnete Zentralstellen die Gewährleistung einer effizienten Kontrolle versprachen.“[177] Das Ziel war, durch zentralistisch organisierte Gesundheitsstrukturen, eine staatlich kontrollierte einheitliche gesundheitliche Fürsorge für alle Bürger zu gewährleisten, denn sämtliche „Maßnahmen zur Förderung der Volksgesundheit zählten von Anbeginn der DDR-Gründung zu den wichtigsten politischen Aufgaben [...]“[178].
Mit der Zeit wurde das Augenmerk immer mehr auf „geistige Krankheiten, Störungen und Abweichungen“ gelegt. Ein Ziel war die Vermeidung von „unzweckmäßiger Fortpflanzung“[179]. Man hielt in der DDR an dem Konzept der „Degeneration“ weiterhin fest und wollte die Fortpflanzung von „Geisteskranken“ beschränken, beispielweise durch eine Meldepflicht innerhalb eines neuen „Irrenrechts“[180]. Auch das bürgerliche Familienmodell war in der DDR zum Leitprinzip für alle Lebensformen erhoben worden, wobei die Gleichberechtigung der Geschlechter 1949 gesetzlich verankert wurde. Es entstand das Bild einer scheinbaren Familienidylle.
Bis 1950 waren die Indikationen für Schwangerschaftsabbrüche in der DDR erweitert; so gab es die medizinische, ethische, eugenische und auch eine sozial-medizinische Indikation. Schlechte Wohnverhältnisse und eine schlechte finanzielle Lage waren die Hauptgründe für Abtreibungen. Trotz der vermehrten Genehmigungen nahmen die illegalen Abtreibungen nicht wie erhofft ab.[181] Daher wurden 1950 die Ländergesetze zu Abtreibungen durch das „Gesetz über den Mutter- und Kindschutz und die Rechte der Frau“ aufgehoben. Legal waren nun noch Abtreibungen aus medizinischen und eugenischen Gründen. Gesundheitsschutz und vor allem Geburtenzunahme waren die erklärten Ziele.[182]
Die Einschränkung der Indikationen war ganz im Sinne des pro- und antinatalistischen Prinzips. Da die „Erhaltung und Förderung von Leben“[183] im Mittelpunkt stand, fielen die Entscheidungen meist zugunsten der Schwangerschaft und gegen die Frau aus. Nach der Liberalisierung bzw. Lockerung des Gesetzes zur Abtreibung in sogenannten Notzeiten – beispielsweise aufgrund der unzähligen Vergewaltigungen unmittelbar nach Kriegsende oder auch aufgrund der fehlenden materiellen Absicherungen - wurden die Bestimmungen nun wieder verschärft.
Ab 1950 war die soziale und ethische Indikation illegal, da der Staat nun die materielle Subsistenz und die Reproduktion seiner Bürger wieder sichern könne. Die DDR wollte keine wirtschaftliche Schwäche mehr zeigen und berief sich auf ihr oberstes Ziel, die Gesundheit der Bürger zu erreichen.
Die Anzahl der medizinisch genehmigten Abbrüche ging nach 1950 stark zurück. Die gesunkenen Abbruchzahlen wurden als sozialer Erfolg gewertet und als Ausdruck für das Gelingen des politischen Systems funktionalisiert. Das „Lebensrecht des Fötus“ wurde dem Recht auf Selbstbestimmung der Frau übergeordnet. Der Anspruch auf Gleichberechtigung schien nicht das Selbstbestimmungsrecht über den eignen Körper mit einzuschließen. „Die Verantwortung des Staates, die Existenz seines Volkes abzusichern, korrespondierte direkt mit der Verpflichtung der einzelnen Bürger, die generative Reproduktion der Gesellschaft zu gewährleisten.“[184] Man könnte daher sagen, dass das „Gesetz über den Mutter- und Kindschutz und die Rechte der Frau“ implizit ein Abtreibungsverbot aus biopolitischen Gründen beinhaltet hat.
Durch die fehlende Aufarbeitung der Vergangenheit und das Verschweigen von Kontinuitäten bezüglich der eugenischen Indikation waren Ansätze zur Bevölkerungsoptimierung möglich. Die Bevölkerung sollte nicht den Eindruck erhalten, dass es biopolitische Kontinuitäten zum Nationalsozialismus gab. Durch Rationalität und Wissenschaftlichkeit wurde versucht, sich auf die bereits vor der NS-Zeit erworbenen Erkenntnisse zu beziehen, um so eine Distanzierung vom „Erbgesundheitsgesetz“ zu erreichen. Zusätzlich wurden die verschiedenen Praktiken, Sterilisation und Tötung von „unwertem Leben“ verschiedenen historischen Abschnitten zugeordnet, wodurch eine differenzierte Bewertung möglich war. „Euthanasie“ wurde als Praktik des Nationalsozialismus verstanden und Sterilisation demgegenüber als wissenschaftlich legitimierte Regulierungspraktik definiert.
Die DDR verwendete den Begriff des „Heilzwecks“ zur Legitimation von ärztlichen Eingriffen. Ärztliches Handeln galt als straffrei, solange es gesundheitsfördernd war. Ziel war es, „gesunde, willensstarke und leistungsfähige“[185] Menschen zu haben, um den Sozialismus aufzubauen. Um diese an den Körper gebundenen Normen umzusetzen erhielten die Mediziner eine relative Autonomie.
In der DDR wurden Forderungen zur Legalisierung von Sterilisationen immer in Verbindung mit den Indikationen für Schwangerschaftsabbrüche diskutiert. Man verwies auf die gesetzlichen Handhabungen in anderen Ländern und auf die Argumente der Leistungsfähigkeit. Die Betroffenen seien Zeit ihres Lebens auf Hilfe angewiesen und würden daher eine Last darstellen. Wenn bereits bei früheren Schwangerschaften die Diagnose „Abweichung“ gestellt worden war, so war dies als Absicherung bei der aktuellen Schwangerschaft ausreichend. Kosten und Nutzen wurden stets gegeneinander abgewogen, wobei dies nicht all zu oft zu Gunsten des Kindes ausfiel. „Aufwand und Nutzen wurden in ein Verhältnis gesetzt. Bedurfte es großer gesellschaftlicher Aufwendungen, weil die Person auf permanente Fürsorge angewiesen ist, kam das einer Rechtfertigung zur Verhinderung ihrer Geburt gleich.“[186]
Die Ausbildung der Mediziner vor und während des Krieges hatte immer auch Erblehre beinhaltet. „Da es offenbar schwierig war, der Genetik und der Wirkmacht ihrer wissenschaftlichen Erklärungen vollständig abzuschwören“[187], war das Ergebnis eine „DDR-spezifische Eugenik“[188]. Es sollten ungünstige Vererbungen und Umwelteinflüsse verhindert und gleichzeitig günstige gefördert werden. Die praktische Umsetzung von erbmedizinischen Indikationen war jedoch problematisch, da eine eindeutige Prognose während der Schwangerschaft nicht möglich war. Man musste auf die Frage der Wahrscheinlichkeit zurückgreifen, wobei diese bei min. 51 Prozent festgelegt wurde, wie schon beim „Erbgesundheitsgesetz“ in der NS-Zeit. Da aufgrund der ungenauen Prognosen die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass man auch „gesunden Nachwuchs“ verhinderte, gab es eine weitreichende Ablehnung der erbmedizinischen Indikation in der DDR. „Jegliche Regulative ordneten sich einer an Zuwachs orientierten quantitativen Steuerung der Bevölkerung unter.“[189]
Ab den 1960er Jahren begann dennoch langsam eine Liberalisierung gegenüber Empfängnisverhütungsmitteln, deren Erfolg direkt mit der Hoffnung auf Planbarkeit und der Beherrschung der Natur verbunden war.
Ausgehend von internationalen „Trends“ und aus Angst vor der Zunahme illegaler Aborts wurden die gesundheitlichen Folgen eines Abbruchs neu gedeutet. Die Familienpolitik der DDR verbreitete das Zwei-Kinder-Familienmodell. Mitte der 1960er Jahre kam es schließlich zu einer Liberalisierung der Schwangerschaftsabbrüche. Ohne eigene Auseinandersetzungen und ganz nach dem Vorbild des Westens wurden daher auch soziale Faktoren miteinbezogen.
„Vor dem Hintergrund des stetigen Ringens um internationale Anerkennung und der großen Bedeutung eines sozialen Gesundheitssytems als Repräsentation des gesellschaftlichen Fortschritts, musste die Indikation zum Schwangerschaftsabbruch nahezu zwangsläufig um soziale Faktoren erweitert werden.“[190]
Am 21. April 1969 erließ das Ministerium für Gesundheitswesen der DDR ein Gesetz zur Legalisierung der Sterilisation – die „Instruktion über die irreversible Kontrazeption bei der Frau“ – und nannte als Ziel die Erhaltung von Gesundheit und Leben; dies seien Normen einer modernen Gesellschaft. Das einzige Ziel sollte die weibliche Gesundheit sein und nicht etwa eine Verhütungspraxis. Freiwilligkeit und eine medizinische Diagnose waren Voraussetzungen für die Unfruchtbarmachungen, wobei eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Frau bestehen musste. „Die Pflicht des Staates, die Gesundheit seiner Individuen zu erhalten, in dem er sie vor massiv auftretenden gesundheitlichen existenzbedrohenden Gefahren schützt, mündete [...] zwangsläufig in regulierende Eingriffe.“[191]
Die „Instruktion über die irreversible Kontrazeption bei der Frau“ sollte in der DDR einheitliche Kriterien schaffen für standardisierte Genehmigungsverfahren, um beispielsweise individuelle Beeinflussung weitestgehend auszuschließen. So beinhaltete die Instruktion unter anderem eine Meldepflicht, damit keine nach diesem Gesetz durchgeführte Unfruchtbarmachung unerfasst blieb. Man musste einen Antrag stellen für eine Sterilisation oder auch für einen Schwangerschaftsabbruch. Der häufigste Grund für solch einen Antrag war eine „geistige Störung“ mit dem Vermerk „Intelligenzminderung“. Obwohl eine eugenische Indikation in der „Instruktion über die irreversible Kontrazeption bei der Frau“ nicht vorgesehen war, reichten „angeborene Anomalien“ doch meist als Grund aus. „Damit konzentrierten sich die Unfruchtbarmachungen auf einen Kreis von Frauen, deren Zustimmungsfähigkeit die Forderung nach absoluter Freiwilligkeit kaum erfüllen konnte.“[192] Auch soziale Kriterien führten zu äußerst vielen Bewilligungen, wozu beispielsweise Alkoholismus oder auch Herumtreiben zählten.
Bis Anfang der 1970er Jahre war in der DDR eine vollständige Freigabe von Abbrüchen jedoch nicht vorgesehen. Frauen forderten mit der Zeit allerdings immer stärker die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, da sie Gleichberechtigung und eigenes Entscheidungsrecht wollten. 1972 wurde ein Gesetz erlassen, das jeder Frau das Recht gab, den Zeitpunkt und die Anzahl der Kinder selbst zu bestimmen. Innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen konnte daher jede Frau die Schwangerschaft unterbrechen lassen.[193] Durch das „Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft“ wollte die DDR der BRD lediglich zuvorkommen. Durch das Gesetz wurden Modernisierungsprozesse zur Planbarkeit und Ausschaltung biologischer Zufälle sowie zur Individualisierung deutlich. Illegale Schwangerschaftsabbrüche hatten auch nicht durch die Liberalisierungen und Ergänzungen der Indikationen abgenommen, wie eigentlich erhofft.
„Nach dem in der Vergangenheit äußerst restriktiven Umgang mit empfängnisverhütenden Mitteln und dem Verbot des Schwangerschaftsabbruches waren neue und umfassende Wahl- und Entscheidungschancen für Frauen zur Gestaltung ihrer eigenen Biographie entstanden.“[194] Die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen fügte sich insofern in die Politik der DDR ein, da sie der erwünschten Berufstätigkeit der Frauen entgegen kam. Aus der immer noch bestehenden Angst vor einem Geburtenrückgang wurde zeitgleich zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs eine Geburtenförderung eingeleitet, die beispielsweise Prämien für Geburten beinhaltete.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das oberste Ziel in der DDR die biopolitische Gesundheit der Bürger war. Wie auch in der BRD, wollte man sich in der DDR vom Nationalsozialismus distanzieren. Geburtenförderung und gleichzeitige Verhinderung von „unzweckmäßiger Fortpflanzung“[195] waren in der DDR jedoch wichtige biopolitische Ziele. Durch Rationalität und Wissenschaftlichkeit wurde versucht, sich auf die bereits vor der NS-Zeit erworbenen Erkenntnisse und auf internationale Erfahrungen zu beziehen. Die „Volksgesundheit“ war das oberste Ziel, welche sich durch die „Leistungsfähigkeit“ und „Gesundheit“ der Bevölkerung äußern sollte. Wobei „Gesundheit“ in diesem Zusammenhang nicht als „Wohlergehen“ zu verstehen ist. „Gesundheit“ und „Leistungsfähigkeit“ waren in der DDR sehr körperbezogene Normen, die eher als „Optimierung“ zu verstehen sind. Eine „DDR-spezifische Eugenik“ entstand, deren Ziel die Verhinderung ungünstiger Vererbungen und Umwelteinflüsse und die gleichzeitige Förderung günstiger war. Auch hier sind wie bei der BRD Parallelen zu rassenhygienischen Argumentationsmustern zu erkennen.
Die gesetzlichen Unsicherheiten zeigen sich deutlich in der Nachkriegszeit durch die ständigen Gesetzesänderungen. Sowohl die DDR als auch die BRD versuchten jeweils auf ihre Art mit dem Vergangen umzugehen. So wurden beispielweise die Argumentationen der Geburtenpolitik in die jeweilige vorherrschende Politik eingegliedert. In der BRD sollte die Frau sich wieder auf ihre Rolle der Mutter und Hausfrau besinnen, um „gesunde“ Kinder zu gebären. In der DDR wurde hingegen die Möglichkeit der Geburtenkontrolle durch Verhütung als Chance gesehen, dass Frauen ebenfalls arbeiten gehen konnten, ohne gleichzeitig zu einem „ungünstigen“ Zeitpunkt schwanger zu werden. Die Möglichkeit der Familienplanung durch Verhütungsmittel sollte für die Geburt „gesunder“ Kinder förderlich sein.
Sowohl in der BRD als auch in der DDR war das Ziel sich vom Nationalsozialismus zu distanzieren und die „Gesundheit“ der Bevölkerung zu garantieren. Vor allem das Thema „Abtreibung“ wurde immer wieder zum Thema gesellschaftlicher und politischer Diskussionen.
Durch das Aufkommen der neuen Frauenbewegung in den 1960er Jahren wurde weltweit und auch beispielsweise in der BRD die Abschaffung des § 218 StGB gefordert. Die Frauen forderten tatsächliche Gleichberechtigung. Sie wollten die Kontrolle über ihre Sexualität und ihre Gebärfähigkeit wieder selber haben.[196] 1975 änderte man schließlich den § 218, wodurch ein Schwangerschaftsabbruch während der ersten drei Schwangerschaftsmonate straffrei wurde.
Seit etwa Mitte der 1980er Jahre versuchten westdeutsche Lebensschützer das „Lebensrecht des Embryos“ durchzusetzen. Sie behaupteten, dass der Embryo ein „Lebensrecht“ habe, das über dem Grundrecht der Frau stehe. Das Problem an dieser These ist jedoch, dass die Verfassung nur einem geborenen Menschen subjektive Rechte einräumt. Vor der Geburt greift lediglich eine „Schutzpflicht“ des Staates, „dafür zu sorgen, daß der hohe Rang des Rechtsguts werdendes Leben nicht mißachtet wird“[197]. Die Pflicht zum Beratungsverfahren stellt diesen Lebensschutz dar, zu dem man bzw. der Staat verpflichtet. „Es [das Beratungsverfahren] will symbolisch eine Gebärpflicht normieren, praktisch aber keine Frau zur Geburt zwingen.“[198]
Am 21. August 1995 wurde das „Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz“ beschlossen, das das Abtreibungsrecht von 1975 nochmals verfestigte. Gemäß diesem Gesetz ist eine Abtreibung zwar nicht rechtmäßig, aber mit Indikation straflos. Die Frauen sind jedoch dazu verpflichtet, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Durch diese „Zwangsberatung“ haben Frauen nicht das volle Recht auf Entscheidungsfreiheit.[199] Dieses Gesetz ist eine Art Kompromiss, da es die Fristenregelung im Grundgesetz bestätigt, aber gleichzeitig auch die Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs deutlich macht. Die Kosten für eine Abtreibung müssen die Frauen jeweils selber tragen.[200] „Nicht die Abtreibung, sondern das Unterlassen der Sozialberatung ist strafbar.“[201]
Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der Präventivmedizin und der Humangenetik dargestellt. Die Etablierung der Vorsorgemedizin begann bereits in der DDR und BRD und fügte sich jeweils in die Geburtenpolitik ein mit der Idee der Prävention und der Verhinderung von „krankem“ Nachwuchs. Die Pränataldiagnostik wurde dadurch nach und nach zur „normalen“ Schwangerenvorsorge.
2.5 Humangenetik und Präventivmedizin ersetzen die Rassenhygiene[202]
Durch die Entwicklung der Pränataldiagnostik gaben die Frauen ihre „Macht“ ab und Ärzte übernahmen peu à peu die Verantwortung für Schwangerschaften. Es bedurfte dafür einer allgemeinen Akzeptanz der humangenetischen Beratung, die durch öffentliche Verbreitung von Informationen gewährleistet werden und zu einem langsamen Einstellungswandel führen sollte. Nicht mehr nur der richtige Zeitpunkt für das „Wunschkind“ war wichtig, sondern auch, dass dieses Kind gesund bzw. „genetisch gesund“ ist. Hierfür war eine enge Zusammenarbeit von Gynäkologen und Humangenetikern im Rahmen von Beratungsstellen erforderlich. Der „gefürchtete“ Geburtenrückgang sollte durch die Etablierung der Pränataldiagnostik aufgehalten werden. Niemand müsste mehr aus Angst vor einem „belasteten“ Kind auf Nachwuchs verzichten; das war das erklärte Ziel. Durch die pränatale Diagnostik sollte festgestellt werden, ob der freiwillige Verzicht auf Kinder überhaupt notwendig sei.
Das Ziel des medizinischen Wirkens sollte die Minimierung von „Erbkrankheiten“ und nicht deren Erzeugung sein. Aus diesem Grund wurde von Gegnern der Sterilisation nunmehr der Blick auf mögliche psychische Folgen der Sterilisationen gelenkt. In der DDR bezog man sich auf die Forschungen zu psychischen Folgen der Sterilisationspraxis in der BRD. Es wurde immer wichtiger, „Gesundheit“ im biopolitischen Sinne nicht nur zu erhalten, sondern diese auch von vorneherein wahrscheinlicher zu machen. Durch die Entwicklung zur Präventionsmedizin etablierten sich Wissenschaft und Techniken, welche die Prognoseunsicherheit verringern sollten.
Da Sterilisationen immer auch die Gefahr bargen, „gesunden Nachwuchs“ zu verhindern, wurde die Prognostik durch die Förderung der humangenetischen Prävention vorangetrieben. Sterilisationen sollten schließlich erst durchgeführt werden, wenn sicher war, dass „kranker Nachwuchs“ geboren werden würde. Mit einer sichereren Prognostik konnten beide Ziele, Geburtenförderung und Verhinderung von „unwertem Leben“, verfolgt bzw. gewährleistet werden. Durch die Fokussierung auf die Humangenetik etablierte sich schließlich die genetische Indikation als Teil der freiwilligen Indikation in der BRD.
Auch in der DDR zielte die Gesundheitserziehung immer mehr auf das Konzept der Prävention ab. Frauen wurden vor allem zum Forschungsgegenstand von vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Durch die komplexen Anforderungen an Frauen, wie beispielsweise die Doppelbelastung als erwerbstätige Mutter, galt es, ihre Gesundheit besonders zu fördern. Im Bereich der Geburtshilfe konzentrierte man sich auch, wie Daphne Hahn hervorhebt, auf die Verbesserung technischer Überwachungsverfahren der Schwangerschaft und Geburt:
„Eine Modernisierung der Geburtshilfe wurde [...] als technische Modernisierung verstanden und spiegelte sich in der Einführung teurer und komplizierter technischer Apparate zur Überwachung von Geburt und Schwangerschaft wider, die zu einer präziseren Registrierung von Normabweichungen in der Lage waren. Damit tauchten wiederum neue Risiken auf, die es geradezu erforderlich erschienen ließen, sich diesen technischen Apparaten anzuvertrauen, um nicht der Gefahr des Vorwurfs der Gleichgültigkeit und Unbekümmertheit gegenüber neuem Leben ausgesetzt zu sein.“[203]
Ab Mitte der 1950er Jahre kam die Ultraschalltechnologie in der Gynäkologie immer mehr zum Einsatz. Ursprünglich war sie von der Militärforschung entwickelt worden, um U-Boote zu sondieren. Der britische Geburtsmediziner Ian Donald hatte im Jahr 1958 durch die ultrasonographische Darstellung eines Fötus den Grundstein zur Pränataldiagnostik gelegt. In den darauffolgenden Jahrzehnten hatte sich die Ultraschalltechnik andauernd weiterentwickelt, wodurch die Auflösung der Bilder immer detailreicher wurde. Bis Mitte der 1960er Jahre entwickelte man auch die Amniozentese, mit deren Hilfe man fötale Zellen untersuchen kann.
Individuelle Verhaltensweisen zur „persönlichen Gesunderhaltung“[204] bildeten sich immer mehr zur Norm heraus, so z.B. auch der periodische Gang zum Gynäkologen spätestens seit der Einführung der „Pille“. Das Wissen um die vermehrten Möglichkeiten und um die individuelle Verantwortung förderte die Entwicklung. Es vollzog sich eine „Medikalisierung“ der Geburtenkontrolle und der Schwangerschaft.
Im Laufe der 1970er Jahre etablierte sich in der Folge die genaue Dokumentation von Schwangerschaften und deren Analyse. Durch „Geburten-Dokumentations-Systeme“[205] konnte man qualitativ hohe Vergleiche durchführen, dafür wurden jegliche Daten von ungeborenen und geborenen Kindern festgehalten. Bereits 1977 gab es in der Bundesrepublik 41 genetische Beratungsstellen, womit man dem Beispiel der USA folgte.
Diese Beratungsstellen konnten erst durch den Fortschritt der Techniken der pränatalen Diagnostik tatsächlich etwas auf biopolitischer Ebene bewirken. Auch das Wissen über Empfängnisverhütung war eine wichtige Voraussetzung für das „Funktionieren“ der Beratungsstellen, da man gewissen Personengruppen von der Kinderzeugung abraten wollte. Durch die vermehrten Diagnosemethoden und die neuen Erkenntnisse über genetische Abweichungen und Fehlbildungen konnten die Beratungsstellen immer weiter ausgebaut werden. „Mit umfangreichen labortechnischen Voraussetzungen und einem beachtlichen Potential an Wissenschaftlern und Ärzten mit fundierten humangenetischen Kenntnissen schwang sich die Humangenetik rasch zur klinischen Hilfswissenschaft auf.“[206]
In diesem Kontext ist zu beachten, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass die Beratungsstellen eine scheinbar gefährliche Massenkrankheit verhindern könnten und die unumgängliche Konsequenz der Forschung darstellen. Es ist jedoch nicht zu unterschlagen, dass die Beratungsstellen augenfällig gewissen Familien vom Kinderwunsch abraten sollten, was eindeutig eine Selektionspraxis darstellt.
Die präventive Geburtshilfe konnte durch die fortschreitende Technisierung eine völlig neue und vor allem präzisere Art der Überwachung der Schwangerschaft anbieten, so beispielsweise fötale Zelluntersuchungen zur Feststellung von bestimmten Chromosomenabweichungen[207]. Durch die neuen Prognosemöglichkeiten konnte man Gesundheit als Normzustand festlegen, dem der Fötus durch die Humangenetik unterworfen wurde.
Die pränatale Diagnostik stellte eine neue Technologie zur Bevölkerungsregulierung dar, die sowohl antinatalistisch als auch pronatalistisch war. Einerseits sollten Kinder aufgespürt werden, die wegen Normabweichungen nicht mehr geboren werden sollten, und andererseits sollte festgestellt werden, ob potenziell vorbelastete Kinder tatsächlich „krank“ sind oder nicht doch geboren werden könnten bzw. sollten. „Nichts anderes beabsichtigte humangenetische Beratung als die Verhütung von Nachkommen mit ´schweren Erbkrankheiten´[...].“[208] Das Ziel war und ist deutlich – eine klare Selektion, um „lebensunwertes Leben“ und die Geburt „kranker“ Kinder zu verhindern.
Die Geburtenförderung war Mitte der 1970er Jahre in der Bundesrepublik ein zentrales Argument für die Etablierung der Pränataldiagnostik. Die pränatale Diagnostik sei geburtenfördernd und würde daher den „kontinuierlichen Bevölkerungsschwund“[209] hemmen. Auch verwendete man die Begriffe „Leid“ und „Glück“ für Legitimierungen, um auf schwere individuelle Schicksale aufmerksam zu machen, die mittels humangenetischer Beratung verhindert werden könnten.
In der DDR wurde u.a. mit den Möglichkeiten der Verringerung der Säuglingssterblichkeit und den verbesserten Überlebenschancen von Frühgeborenen argumentiert. Zudem wurde die Zukunft sehr bedrohlich ausgemalt, da sich so viele erblich bedingte Krankheiten verbreiten würden, wenn nicht reagiert würde. Kontrolle, Steuerung und Beeinflussung waren unabdingbar, um „Erbkrankheiten“ bzw. „Missbildungen“ zu verhindern. Die Darstellung der vermeintlichen Häufigkeit und Ausbreitung von „Missbildungen“ verstärkte solche Argumentationen. Humangenetische Beratung und Pränataldiagnostik fügten sich in die bereits in der DDR verbreitete präventive Gesundheitserziehung ein.
In diesem Argumentationsmuster werden „Erbkrankenheiten“ wiederum als „Massenphänomen“ dargestellt, welches unbedingt bekämpft werden muss. Die einzige Lösung dieses „Massenphänomens“ scheint dieser Logik nach gezielte Selektion zu sein. Präventivmedizin scheint die einzig mögliche und logische Maßnahme darzustellen. So merkt auch Hahn an, dass durch die angstbesetzten Prophezeiungen über sich rasch verbreitende „Erbkrankheiten“ an die Verbreitung von Infektionskrankheiten während der Kriegs- und Nachkriegszeit erinnert wurde. „Das wissenschaftliche Erkennen der genetischen Verantwortlichkeit pathologischer Erscheinungen und ihre Regulierung trat damit als legitimes Forschungsfeld und medizinisches Handlungsziel in den Komplex biopolitischer Kontrolle.“[210]
Die individuelle Verantwortung gegenüber dem eigenen Körper hatte sich in den Jahren zuvor bereits als Norm durchgesetzt. Die Humangenetiker bezogen sich für die Legitimation auf internationale Forschungen und betonten immer wieder die Unabhängigkeit von der Eugenik. Als Ziel der humangenetischen Beratung wurde fortwährend die Förderung der bestmöglichen Therapie genannt, was wiederum als lebens- und gesundheitsfördernd definiert wurde.
Zur Kontrolle der Ärzteschaft wurden in den 1970er Jahren sogenannte Ethikkommissionen gegründet. Diese aus Medizinern bestehenden Gremien sollten die Ärzte in ihren Forschungsarbeiten zum Schutz der teilnehmenden Patienten und Probanden beraten. Ein wesentliches Ziel der Kommissionen war auch die Verhinderung von staatlicher Reglementierung und die Wahrung der Forschungsfreiheit. Diese Selbstkontrolle wurde jedoch nicht mit dem Hinweis auf die medizinischen Verbrechen während der NS-Zeit, sondern mit medizinischen Humanexperimenten in den USA zwischen 1836 und den 1960er Jahren begründet.
Ende der 1970er Jahre hatte sich schließlich die Humangenetik auch in der DDR weitestgehend etabliert. Zu Beginn hatten meist nur Eltern, die bereits ein „missgebildetes“ Kind hatten, von der humangenetischen Beratung Gebrauch gemacht. Mit der Zeit ließen sich jedoch auch immer mehr kinderlose Eltern beraten, die eine „genetische Belastung“ von vorneherein ausschließen wollten.
„Das lange Zeit auf pronatalistische Ziele gerichtete Prinzip der bewussten Familienplanung erfuhr nun eine Erweiterung um qualitative Faktoren, nach der eine genetisch erworbene Krankheit nicht mehr als unausweichlicher Schicksalsschlag aufgefasst wurde, sondern als beeinflussbar in die Lebensgestaltung einging.“[211]
Die Amniozentese als eine mögliche Untersuchung im Rahmen der Pränataldiagnostik hatte in den Anfangsjahren (Ende der 1960er Jahre) den Ruf, sehr risikohaft zu sein, was jedoch ihrer Etablierung keinen Abbruch tat. Die Möglichkeit eines Spontanaborts durch die Fruchtwasseruntersuchung wurde in Verhältnis zum Erkenntnisgewinn gesetzt. Risiko und allgemeiner Nutzen wurden gegenüber gestellt. „Das bedeutet, jeder vorgeburtlich diagnostizierte Defekt, der zu einer Abtreibung führte, wurde rechnerisch mit einem durch den Eingriff ausgelösten Abbruch aufgewogen.“[212] Anfang der 1980er Jahre erweiterte sich das Repertoire der Pränataldiagnostik um die Chorionzottenbiopsie, deren Ziel die genetische Analyse von Zellen war.
Zunächst sollten vor allem die Eltern Gebrauch von Pränataldiagnostik machen, bei denen ein erhöhtes Risiko für „genetische Defekte“ bestand. So waren beispielsweise ältere Frauen eingeschlossen, da man einen Zusammenhang zwischen dem Alter der werdenden Mutter und der Wahrscheinlichkeit vom Auftreten des „Down-Syndroms“ vermutete.
Die Fruchtwasseruntersuchung verbreitete sich rasch als fester Bestandteil der Schwangerenvorsorge, obwohl die Wahrscheinlichkeit, bei fortgeschrittenem Alter einen „abnormen“ Befund zu erhalten, relativ gering war. Ab 1987 nahm in der BRD die Hälfte aller Schwangeren mit „altersbedingtem Risiko“ die pränatale Diagnostik in Anspruch. Im Laufe der Zeit machten immer mehr Frauen Gebrauch von Pränataldiagnostik, die keiner Risikogruppe mehr angehörten.
Ab Mitte der 1980er Jahre wurde von der Ärzteschaft immer wieder deklariert, dass die Wissenschaft sich von politischen Zielen „gereinigt“ habe. Diese Argumentation diente dazu, Abstand von der Rassenhygiene zu gewinnen. Reproduktionsmedizin und Humangenetik würden lediglich ihr Wissen zur Verfügung stellen, wobei die letztliche Entscheidung bzw. Verantwortung bei den Eltern liege. Die Eugenik sei vom NS-Regime missbraucht worden und würde dadurch oft missverstanden bzw. fehlinterpretiert. Sie sei jedoch nötig, um die Probleme der Nachkriegszeit zu lösen und müsse daher „reingewaschen“ werden. Die Erziehungswissenschaftlerin Maria Wolf erläutert dazu:
„Das Idealbild des Arztes als ´Gesundheitsführer der Nation´, das der Nationalsozialismus propagierte, wurde vom Idealbild des Arztes als ´Gesundheitserzieher´, im Bereich der Vorsorgemedizin abgelöst. Die Vorsorgemedizin sollte aus dem ´Krankheitswesen´ ein ´Gesundheitswesen´ machen [...].“[213]
Dieses Idealbild der Präventivmedizin, deren Hauptaufgabe die Verhinderung und nicht die Behandlung von Krankheiten ist, bleibt seit dem Aufstieg der Sozialhygiene Anfang des 20. Jahrhunderts der beständigste Punkt in medizinischen Diskursen. Als Grundlage für die Prävention dienen die Erkenntnisse der „Risikoprofilforschung“[214], wobei das Erforschen von Ursachen angeborener „Missbildungen“ ein essentieller Bestandteil ist.
Die Medizin verursachte selbst z.B. durch Verabreichung von Schlafmitteln wie Contergan während der Schwangerschaft Missbildungen bei ungeborenen Kindern.[215] Dadurch entstanden präzise Untersuchungen und Kontrollen zur Abklärung der Wirkung beispielsweise von Schlaftabletten. Eine Folge dieser Auswirkungen von Medikamenteneinnahmen während der Schwangerschaft ist die heutzutage selbstverständliche Untersuchung von Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt.
Durch die fortschreitende Erforschung der Ursachen angeborener Missbildungen kamen zu den endogenen auch immer mehr exogene Ursachen hinzu wie zum Beispiel Virus- und Infektionskrankheiten der Mutter oder auch Strahlen durch die Röntgendiagnostik. Zu bemerken ist, dass die Ursachen immer bei Müttern und seitens der Männer gesucht wurden. Erst seit den 1990er Jahren wird auch die Spermaqualität in den Blick genommen, jedoch nur am Rande. Die männliche Zeugungsfähigkeit wird dabei nicht durch eigenes Fehlverhalten, sondern durch Fremdeinwirkungen negativ beeinflusst, so die Annahme. Die männliche Zeugungsfähigkeit und –qualität wird - wenn - durch Handlungen am Arbeitsplatz oder im Krieg negativ beeinflusst, wofür der Mann jeweils nichts kann. „Männer werden damit nur aufgrund unverantwortlicher Handlungen anderer als Risiko für fötale Schädigungen thematisiert.“[216] Frauen stellen somit die größte Gefahr für die Gesundheit des Fötus dar. Diese Vorstellung der mütterlichen Verantwortung überwog bis Ende des 20. Jahrhunderts, stellt Maria Wolf fest. „Diese Geschlechterblindheit ist genuiner Teil der Entwicklungsgeschichte der Risikoforschung in der Reproduktionsmedizin, die jene Faktoren untersucht, die potenziell schädigende Wirkungen auf die Entwicklung des Fötus im Mutterleib haben.“[217]
„Innerhalb von 20 Jahren, von Beginn der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre etablierte sich die pränatale Diagnose zum reproduktionsmedizinischen Routineeingriff mit hohem gesellschaftlichen Kredit.“[218] Bis heute wird die Pränataldiagnostik mit der „Leidvermeidung“ und mit möglichen „Kostenreduktionen“ legitimiert. Das, was medizinisch machbar ist, gilt als perse vernünftig. Welche Kosten jedoch die humangenetische und reproduktionsmedizinische Forschung benötigt (hat), wird in kein Verhältnis gesetzt. „Dass im Jahr 2000 weltweit noch immer ca. 97% aller Kinder gesund zur Welt gekommen sind“[219], scheint hierbei ebenfalls völlig ausgeblendet zu werden.
Die Sozialwissenschaftlerin Anne Waldschmidt resümiert, dass sich die deutsche Humangenetik auch nach 1945 an der eugenischen Tradition orientiert hat. „Die Humangenetik als Erforschung der Erbkrankheiten [...] war immer dazu bestimmt, gezielt zur Verhütung und Selektion Erbkranker eingesetzt zu werden, in der modernen Sprache: zur Prävention.“[220] So ist bis heute hin das Ziel, die Anzahl der Kranken zu vermindern und die der Gesunden zu erhöhen. Lediglich die Verfahren und deren Verbreitung haben sich verändert. Das Ziel der Auslese sei dabei stets zentral geblieben, so Waldschmidt. Sie spricht daher von einer „alten“ und einer „neuen“ Eugenik.[221]
Die sogenannte alte Eugenik war eng verknüpft mit der „Rassenlehre“ und ein Teilbereich der staatlichen Bevölkerungspolitik. Sie wurde somit „von oben verordnet“ und notfalls auch gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt. Die „neue Eugenik“ findet hingegen durch die Medizin und unter Beteiligung der einzelnen statt. Sie wird heute mit der Zustimmung der Betroffenen durchgeführt. Die eugenischen Praktiken durchdringen allmählich alle Lebensbereiche unseres Alltags, stellt Waldschmidt fest.[222]
„Auf den ersten Blick humaner als die alte Eugenik, erweist die neue sich bei näherem Hinsehen als eine perfektionierte Variante. Sie hat eine Eigendynamik entwickelt und funktioniert quasi wie von selbst, weil sie ´von unten´, von der Frau und dem Mann auf der Straße getragen und ausgeübt wird und nicht von Polizei und Behörden befohlen ist.“[223]
Anne Waldschmidt kommt daher zu dem Schluss, dass sich die Eugenik von ihren „autoritären Wurzeln“ gelöst hat und zu einem „demokratischen Ansatz“ herangereift ist. Es ist keine Pflicht, sondern vielmehr ein Recht jeder einzelnen Person - niemand muss mit einem Kind mit Behinderung leben. Das Ergebnis ist, dass Selektion normal, vernünftig und selbstverständlich erscheint.[224]
Fortpflanzungsmedizin, Biologie und Genetik haben völlig neue Techniken des Eingriffs in den Bereich des menschlichen Lebens eröffnet, wodurch sie zum Gegenstand unzähliger Diskussionen in der Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit geworden sind, da sie bislang geltende Grenzen und Tabuschwellen überschritten haben. Mittels neuer Techniken sind neue Qualitätsmaßstäbe und neue Leitbilder von Perfektion entstanden. Durch die vermehrten Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik verändert sich die elterliche Verantwortung. Selektion wird durch Pränataldiagnostik mit ihrer „qualitativen Auswahl“ fortgeführt.[225]
Die neu entstandene Verantwortung, die jeder einzelne jeweils durch die Pränataldiagnostik trägt, beinhaltet u.a. laut der Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim folgende Punkte:
-
Vermeidung der Geburt „belasteter Kinder“
-
Aufgabe des Kinderwunsches
-
„Schwangerschaft auf Probe“
-
Schwangerschaftsabbruch bei „ungünstigem Befund“.[226]
Diese „neue“ Verantwortung beinhaltet jedoch auch eine scheinbare „neue Autonomie“. Einerseits wird es als „freie Entscheidung“ propagiert, gleichzeitig sind Frauen aber auch verantwortungslos, wenn sie die pränataldiagnostischen Angebote nicht in Anspruch nehmen. Frauen scheinen autonom entscheiden zu können, doch zur gleichen Zeit wird ein enormer Erwartungsdruck auf sie ausgeübt.
Die Frau trägt zudem nicht mehr nur die Verantwortung gegenüber sich selber, sondern auch der Gesellschaft, der Familie und dem ungeborenen Kind gegenüber. Wenn eine Frau sich bewusst gegen die pränatale Diagnostik entscheidet und ein behindertes Kind bekommt, dann ist sie dafür verantwortlich – sie ist verantwortlich dafür, dass ein Kind mit Behinderung zur Welt gekommen ist, dessen Geburt sie eigentlich auch hätte verhindern können, wenn sie denn gewollt hätte. Die vielen verschiedenen Ebenen der „Verantwortung“ lassen auch viele Möglichkeiten der Schuld entstehen, wodurch die Bereitschaft, die Tests und Untersuchungen zu nutzen, vorangetrieben wird. Es entsteht ein sozialer und auch moralischer Druck, der auf den Schultern der Frauen und Mütter lastet.[227]
Es ist die „neue“ Eugenik, die jeder mit vorantreibt unter dem Deckmantel der „Prävention“. Auch wenn es keine „von oben“ angeordnete Pflicht mehr ist, so fühlen sich doch viele werdende Mütter dazu verpflichtet die pränataldiagnostischen Angebote wahrzunehmen. Die Eugenik „von unten“ hat eine Eigendynamik entwickelt und funktioniert wie von selbst.[228] „Die Eugenik hat neue Gewänder erhalten; ihre Methoden sind modernisiert worden. Ausgereift und fast unsichtbar, hat sie längst in unserem Rücken Stellung bezogen und beeinflußt – über die Strategie des Sachzwanges – unmerklich unser Handeln.“[229] Das Resultat ist, dass die genetische Selektion als normal, vernünftig und selbstverständlich angesehen wird.[230]
[32] Vgl. grundlegend für das Folgende: Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76), 1999. S. 276-313. Und: Lemke, Thomas: Biopolitik zur Einführung. 2007. S. 47-70. Und : Hahn, Daphne : Modernisierung und Biopolitik. 2000. S. 32-40.
[33] Hahn 2000, S. 159.
[34] Lemke 2007, S. 9.
[35] Ebd., S. 19.
[36] Hahn 2000, S. 33.
[37] Ebd., S. 35.
[38] Lemke 2007, S. 47.
[39] Lemke 2007, S. 48.
[40] Vgl. ebd., S. 48.
[41] Hahn 2000, S. 38.
[42] Foucault 1999, S. 280.
[43] Ebd., S. 280.
[44] Foucault 1999, S. 276.
[45] Ebd., S. 276.
[46] Ebd., S. 278.
[47] Ebd., S. 278.
[48] Lemke 2007, S. 54.
[49] Foucault 1999, S. 285.
[50] Foucault 1999, S. 291.
[51] Ebd., S. 292.
[52] Ebd., S. 292.
[53] Ebd., S. 293.
[54] Ebd., S. 294.
[55] Foucault 1999, S. 295.
[56] Ebd., S. 296.
[57] Ebd., S. 299.
[58] Ebd., S. 297.
[59] Ebd., S. 297.
[60] Lemke 2007, S. 60.
[61] Ebd., S. 21.
[62] Lemke 2007, S. 21.
[63] Ebd., S. 22.
[64] Hahn 2000, S. 36.
[65] Lemke 2007, S. 26.
[66] Ebd., S. 39.
[67] Lemke 2007, S. 40.
[68] Vgl. grundlegend für das Folgende: Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität. Die medizinische Bemächtigung des Lebens. 1998. Und: Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität: Frauen zwischen Gebärzwang und Gebärverbot im 20. Jahrhundert. In: Groth, Sylvia; Rásky, Éva (Hrsg.): Sexualitäten. Interdisziplinäre Beiträge zu Frauen und Sexualität. 2001, S. 27-59. Und: Usborne, Cornelie: Frauenkörper – Volkskörper. Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik. 1994.
[69] Hahn 2000, S. 12f.
[70] Usborne 1994, S. 21.
[71] Ebd., S. 23.
[72] Ebd., S. 23.
[73] Usborne 1994, S. 24.
[74] Ebd., S. 11.
[75] Jerouschek 1996, S. 23.
[76] Der schottische Geistliche und Nationalökonome Thomas Robert Malthus (1766-1834) hatte 1798 als Lösung für die soziale Frage die Geburtenkontrolle proklamiert. Die Neomalthusianer diskutierten zwar später Krankheit und Armut ebenfalls in Verbindung mit Kinderreichtum, distanzierten sich allerdings von der malthusianischen Forderung nach allgemeiner sexueller Enthaltsamkeit.
[77] Bergmann 2001, S. 37.
[78] Usborne 1994, S. 26.
[79] Zit. n. Usborne 1994, S. 31.
[80] Vgl. Soden von 1996, S. 38-41.
[81] Bergmann 2001, S. 38.
[82] Zit. nach Bergmann 2001, S. 38f.
[83] Usborne 1994, S. 115.
[84] Usborne 1994, S. 27.
[85] Ebd., S. 27.
[86] Bergmann 2001, S. 39.
[87] Ebd., S. 39f.
[88] Vgl. Hahn 2000, S. 17.
[89] Bergmann 2001, S. 42.
[90] Bergmann 1998, S. 13.
[91] Usborne 1994, S. 30f.
[92] Bergmann 2001, S. 31.
[93] Zit. n. Bergmann 1998, S. 60.
[94] Bergmann 2001, S. 32.
[95] Bergmann 2001, S. 32.
[96] Weingart, Kroll, Bayertz 1988, S. 16f.
[97] Bergmann 1998, S. 92.
[98] Ebd., S. 60.
[99] Zit. n. Bergmann 2001, S. 33.
[100] Bergmann 1998, S. 67.
[101] Bergmann 1998, S. 70.
[102] Ebd., S. 14.
[103] Ebd., S. 14.
[104] Ebd., S. 15.
[105] Zit. n. ebd., S. 72.
[106] Anzeige in: Die Umschau 14, 1/1910, S. 21, zit. n. Bergmann 1998, S. 74.
[107] Vgl. Hahn 2000, S. 17.
[108] Bergmann 1998, S. 45.
[109] Ebd., S. 46.
[110] Bergmann 2001, S.29.
[111] Vgl. ebd., S.29.
[112] Bergmann 1998, S. 23.
[113] Usborne 1994, S. 36.
[114] Usborne 1994, S. 36.
[115] Ebd., S. 57.
[116] Bergmann 1998, S. 51.
[117] Ebd., S. 54.
[118] Zit. n. ebd., S. 51.
[119] Ebd., S. 56.
[120] Ebd., S. 56.
[121] Hahn 2000, S. 16.
[122] Vgl. Soden von 1996, S. 36f.
[123] Bergmann 1998, S. 33.
[124] Bergmann 2001, S. 34.
[125] Zit. n. Bergmann 2001, S. 34.
[126] Vgl. Hahn 2000, S. 18.
[127] Bergmann 1998, S. 166.
[128] Ebd., S. 166.
[129] Ebd., S. 166.
[130] Vgl. Hahn 2000, S. 16f.
[131] Bergmann 2001, S. 43.
[132] Ebd., S. 43.
[133] Vgl. Hahn 2000, S. 19.
[134] Bergmann 2001, S. 35.
[135] Vgl. grundlegend für das Folgende: Friedlander, Henry: Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. 1997.
[136] Vgl. Hahn 2000, S. 20.
[137] Czarnowski 1996, S. 58
[138] Vgl. ebd., S. 58f.
[139] Czarnowski 1996, S. 58.
[140] Friedlander 1997, S. 84.
[141] Bock 1995, S. 176.
[142] Vgl. ebd., S. 176f.
[143] Vgl. Hahn 2000, S. 20f.
[144] Vgl. Bock 1986, S. 233.
[145] Vgl. Bock 1995, S. 178.
[146] Hahn 2000, S. 21.
[147] Vgl. ebd., S. 21.
[148] Bock 1995, S. 179.
[149] Vgl. ebd., S. 180.
[150] Friedlander 1997, S. 84.
[151] Diese Adresse war die Tiergartenstraße 4 in Berlin, wodurch auch der Name die „T4“-Aktion entstanden ist.
[152] Friedlander 1997, S. 92.
[153] Ebd., S. 93.
[154] Ebd., S. 94.
[155] Friedlander 1997, S. 109.
[156] Vgl. Bock 1986, S. 230f.
[157] Vgl. grundlegend für das Folgende: Hahn, Daphne: Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach 1945. 2000.
[158] Hahn 2000, S. 62.
[159] Hahn 2000, S. 64.
[160] Ebd., S. 63.
[161] Ebd., S. 67.
[162] Zit. n. ebd., S. 68.
[163] Hahn 2000, S. 73.
[164] Ebd., S. 76.
[165] Ebd., S. 73.
[166] Hahn 2000, S. 82.
[167] Ebd., S. 88.
[168] Ebd., S. 90.
[169] Hahn 2000, S. 111.
[170] Ebd., S. 130.
[171] Ebd., S. 131.
[172] Hahn 2000, S. 141.
[173] Hahn 2000, S. 180.
[174] Vgl. Poutrus 1996, S. 76-79.
[175] Vgl. ebd., S. 82.
[176] Hahn 2000, S. 183.
[177] Ebd., S. 189.
[178] Ebd., S. 190.
[179] Ebd., S. 191.
[180] Ebd., S. 191.
[181] Vgl. Aresin 1996, S. 86ff.
[182] Vgl. Poutrus 1996, S. 83.
[183] Hahn 2000, S. 219.
[184] Hahn 2000, S. 232.
[185] Ebd., S. 205.
[186] Ebd., S. 211.
[187] Hahn 2000, S. 222.
[188] Ebd., S. 222.
[189] Ebd., S. 225.
[190] Ebd., S. 236f.
[191] Hahn 2000, S. 218.
[192] Ebd., S. 262.
[193] Vgl. Aresin 1996, S. 91f.
[194] Hahn 2000, S. 271.
[195] Ebd., S. 191.
[196] Vgl. Gerhard-Teuscher 1996, S. 104.
[197] Frommel 1996, S. 118.
[198] Ebd., S. 118.
[199] Vgl. ebd., S. 114.
[200] Vgl. Staupe, Vieth 1996, S. 9.
[201] Frommel 1996, S. 114.
[202] Vgl. grundlegend für das Folgende: Hahn, Daphne: Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach 1945. 2000. Und: Wolf, Maria: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000. 2008.
[203] Hahn 2000, S. 287.
[204] Ebd., S. 288.
[205] Ebd., S. 163.
[206] Hahn 2000, S. 163.
[207] Hierbei ist folgendes zu beachten: Zur Zeit geht man davon aus, dass in Deutschland unter 1.100 Neugeborenen ein Kind mit Trisomie 21 ist. (http://www.test.de/schwangerschaft/schwangerschaft/chromosomenstoerungen/haeuf/, Stand: 15.12.2010)
[208] Hahn 2000, S. 165.
[209] Ebd., S. 165.
[210] Ebd., S. 290.
[211] Hahn 2000, S. 295.
[212] Ebd., S. 170.
[213] Wolf 2008, S. 518.
[214] Ebd., S. 519.
[215] „Contergan war der Verkaufserfolg unter den Schlaftabletten Anfang der 60er Jahre. Zwanzig Millionen Pillen monatlich wurden auf dem Höhepunkt der Contergan-Konjunktur verkauft und auch schwangeren Frauen empfohlen, da sie keine Auswirkungen auf das Kind zeitigen würden. Die Folge war die Geburt von ca. 5.000 missgebildeten Kindern allein in Deutschland, von denen nur 2.500 überlebten.“ (Wolf 2008, S. 532f.)
[216] Wolf 2008, S. 530.
[217] Ebd., S. 528.
[218] Ebd., S. 544.
[219] Ebd., S. 546.
[220] Waldschmidt 1995, S. 358.
[221] Vgl. ebd., S. 358ff.
[222] Vgl. ebd., S. 360.
[223] Ebd., S. 360.
[224] Vgl. ebd., S. 360f.
[225] Vgl. Beck-Gernsheim 1996, S. 127ff.
[226] Vgl. Beck-Gernsheim 1996, S. 130.
[227] Vgl. ebd., S. 130ff.
[228] Vgl. Waldschmidt 1995, S. 358ff.
[229] Waldschmidt 1995, S. 361.
[230] Vgl. ebd., S. 361.
Inhaltsverzeichnis
„Erstmals in der Menschheitsgeschichte stehen jetzt aber Techniken zur Verfügung, die die Züchtung von Menschen, im Prinzip und unter Umgehung der ethischen Schranken zu erlauben scheinen. [...] Die Verbesserung der menschlichen Art rückt in den Bereich des Machbaren und in die Nähe des Vertretbaren.“[231]
3.1 Untersuchungsmethoden, Möglichkeiten und Komplikationen[232]
Grundsätzlich umfasst die pränatale Diagnostik sämtliche Untersuchungen, die während der Schwangerschaft durchgeführt werden. Mit der Zeit und bedingt durch den medizinischen Fortschritt, ist der Wunsch nach dem „perfekten Kind“ immer mehr in den Vordergrund gerückt.[233] Die Pränataldiagnostik befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen den Erwartungen der Eltern und den Möglichkeiten der Diagnose, erklärt der Gynäkologe Jens Pagels. Hierbei können „diagnostische Lücken“[234] entstehen, die zu Unsicherheiten führen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht zuletzt oft die Konsequenz der Pränataldiagnostik.
Bei der Diagnostik wird zwischen nicht-invasiven und invasiven Methoden[235] unterschieden. Zu den nicht-invasiven Untersuchungen gehört zunächst der Ultraschall. Im „Normalfall“ sind drei Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft vorgesehen. Der erste Ultraschalltermin dient zunächst dazu, festzustellen, ob sich das Ei richtig eingenistet hat und ob beispielsweise keine Eileiterschwangerschaft vorliegt, da diese für Frauen sehr gefährlich werden kann. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft und aufgrund der Größe des Embryos sind die meisten Entwicklungen noch nicht sichtbar, wodurch der Arzt ansonsten noch nicht viel feststellen kann.
Der zweite Ultraschalltermin (auch „Organultraschall“ genannt) wird um die 20. Schwangerschaftswoche durchgeführt und soll zeigen, ob der Fötus gewachsen ist und ob er sich weiterentwickelt hat. Der Arzt überprüft die Fruchtwassermenge, die Herztätigkeit und die Lage des Kindes und vergewissert sich, ob keine groben Abweichungen beim körperlichen Erscheinungsbild des Fötus vorliegen. Beim dritten Ultraschalltermin, der um die 30. Woche durchgeführt wird, werden weitestgehend die gleichen Merkmale untersucht.
Ein „Organultraschall“ um die 20. Schwangerschaftswoche ist „optimal“, da die Bedingungen, um die Organe des Kindes zu analysieren, zu diesem Zeitpunkt bestmöglich sind. Zum einen sind die Organe bereits so groß, dass man sie gut erkennen kann und zum anderen sind die Knochen-Strukturen noch nicht so weit ausgereift, dass der Schall nicht mehr durch das Gewebe dringen kann.
In der Regel suchen die Ärzte beim Ultraschall nach morphologischen Auffälligkeiten bei bestimmten Erkrankungen; was man als Marker bezeichnet. Ein sogenannter Marker ist die „Nackenfalte“, die meist bei einem der ersten Ultraschalltermine kontrolliert wird. In der frühen Phase der Schwangerschaft sammelt sich beim Fötus im Bereich des Nackens zwischen Haut und Nackenmuskulatur Flüssigkeit an. Dieser „lang gestreckte, schwarze Zwischenraum im Bereich des Nackens“[236] wurde Anfang der 1990er Jahre durch die verbesserte Bildauflösung bei Ultraschallgeräten entdeckt, wodurch der Begriff „Nackentransparenz“ entstand. Die Ärzte stellten fest, dass bei allen Föten um die 13. Schwangerschaftswoche die sogenannte Nackenfalte vorhanden ist. Normalerweise verschwindet diese Flüssigkeit im Laufe der Schwangerschaft. Bei Föten, bei denen mehr Flüssigkeit vorhanden ist, besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Irrtümlicherweise wird die Nackenfaltenmessung jedoch oft als ein Screening auf Trisomie 21 verstanden, da meistens diese Erkrankung hinter einer auffälligen Nackenfalte steckt.
Sogenannte Risikokalkulationen sind nicht einheitlich und beziehen jeweils verschiedene Parameter mit ein, deren Relevanz umstritten ist. Die Nackenfaltenmessung ist sehr schwierig und wird schnell ungenau, da der Fötus zum Zeitpunkt der Untersuchung lediglich fünf bis acht Zentimeter lang ist. Es existieren sehr viele Fehlerquellen bei der Untersuchung. Die sogenannte Nackenfalte befindet sich zum Zeitpunkt der Untersuchung im „Zehntelmillimeterbereich“[237].
Zusätzlich zur Nackenfaltenmessung werden Laborwerte der Mutter miteinbezogen. Diese sind jedoch weniger aussagekräftig als die Nackenfaltendicke. Die Ärzte sprechen hierbei von „harten“ Markern und von „weichen“ Markern. Dies führt zu einem Dilemma, denn die Schwangeren werden stark verunsichert. So liegt die Treffsicherheit für Trisomie 21 bei dieser Untersuchung beispielsweise bei nur 90 Prozent. Letztlich muss die schwangere Frau bzw. müssen die werdenden Eltern selber entscheiden, ob diese Untersuchungen in ihrem Fall notwendig sind. Vor allem sollte man vor der Durchführung der Untersuchungen über die möglichen Konsequenzen nachdenken, da es oft keine Therapiemöglichkeiten gibt.
Bei den Ultraschalluntersuchungen bestimmt der Arzt sämtliche Maße des Fötus und wertet diese mit Hilfe von Computerprogrammen aus. „Für fast alle Körperstrukturen existieren Richt- und Normwerte, und zwar für jedes Schwangerschaftsalter.“[238] Doch was ist, wenn der Fötus dieser Norm nicht entspricht?
Wenn beispielweise die Nackenfaltenmessung „auffällig“ ist, wird der Arzt der werdenden Mutter zu weiteren Untersuchungen raten, um eine Diagnose stellen zu können. Bei diesen Untersuchungen handelt es sich um invasive Eingriffe. Zu den invasiven Untersuchungen zählen diejenigen, bei denen eine Nadel benötigt wird, um in den Körper einzudringen, wie z.B. die Fruchtwasserentnahme (Amniozentese), die Entnahme von Plazentagewebe (Chorionzottenbiopsie) oder auch die Entnahme von Blut des Fötus durch die Nabelschnur.
Bei der Fruchtwasseruntersuchung sticht man mit einer Nadel durch die Eihaut der Gebärmutter, um ca. zehn Milliliter Fruchtwasser zu entnehmen. Diese Prozedur dauert ungefähr 60 Sekunden. Man kontrolliert währenddessen via Ultraschall die Lage des Fötus, um ihn möglichst nicht mit der Nadel zu verletzen. Die gewonnen Zellen des Kindes werden anschließend im Labor untersucht.
Eine mögliche Komplikation, die nach der Untersuchung auftreten kann, ist ein Blasensprung. Hier entsteht ein Loch durch die Nadelpunktion. Das Fruchtwasser entweicht und der Fötus wird für immer geschädigt - so z.B. an der Lunge; auch kann es zu vorzeitigen Wehentätigkeiten und einer Frühgeburt kommen. Im „Idealfall“ wird die Amniozentese erst nach der 15. Schwangerschaftswoche durchgeführt, da die Eihaut der Gebärmutter zu diesem Zeitpunkt verklebt und das Risiko eines Blasensprungs geringer ist.
Die Chorionzottenbiopsie ist bereits früher als die Amniozentese möglich; um die sechste bis achte Schwangerschaftswoche. Hierbei wird Gewebe aus der Plazenta entnommen. Dies geschieht mittels einer Punktion durch die Bauchdecke, die ebenfalls via Ultraschall kontrolliert wird. Dabei sollte vermieden werden, durch die Eihaut zu stechen, damit das Risiko eines Blasensprungs wiederum so gering wie möglich bleibt.
Bei dieser Untersuchung gibt es jedoch auch das Risiko einer Blutung oder einer Verletzung des Mutterkuchens. Die Plazenta besteht sowohl aus Zellen der Mutter als auch aus Zellen des Kindes. Um daher auszuschließen, dass ein anderes Erbgut analysiert wird, nimmt der Arzt der Mutter zusätzlich Blut ab, um es mit dem gewonnenen Erbgut aus der Plazenta zu vergleichen.
Das Risiko für Komplikationen ist bei einer Chorionzottenbiopsie etwas höher als bei einer Amniozentese, weshalb letztere wohl auch häufiger durchgeführt wird, obwohl sie erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft möglich ist. Zudem ist die Untersuchung des Fruchtwassers „einfacher“ und schmerzloser. Zu bedenken ist jedoch, dass ein Schwangerschaftsabbruch als mögliche Folge der Untersuchungsergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft schwieriger bzw. schmerzhafter für die Mutter ist.
Eine andere Möglichkeit zur Gewinnung und Untersuchung von Zellen des Kindes ist eine Blutabnahme durch die Nabelschnur. Dieses Verfahren ist ab der 18. Schwangerschaftswoche möglich und zudem risikobehafteter und schwieriger als eine Fruchtwasserentnahme. Das Problem ist nämlich, dass die Nabelschnurvene nur einige Millimeter dick ist und frei in der Fruchthöhle schwebt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sämtliche invasive Untersuchungen ein hohes Risiko für den Fötus beinhalten. Es kann jederzeit zu einem Abort, einer Frühgeburt oder anderen Komplikationen kommen. Diesem Risiko sollten sich die werdenden Eltern bewusst sein, bevor sie weiteren pränataldiagnostischen Untersuchungen zustimmen.
Die Medizin und insbesondere die Pränataldiagnostik versprechen Sicherheit, doch der Traum von Allwissenheit bleibt nur ein Traum. Unzählige geistige und körperliche Behinderungen können gar nicht festgestellt werden. Die Ärzte haben inzwischen immer größere Angst davor, dass sie eine Krankheit übersehen und den Ansprüchen nicht gerecht werden. Zudem kann das Übersehen eines „Defektes“ rechtliche oder finanzielle Konsequenzen für sie haben. Hierbei müssen vor allem auch die Patientinnen akzeptieren, dass jedes Untersuchungsverfahren seine Grenzen hat, merkt Pagels an. Ein „Mehr an Diagnostik“[239] kann hierbei auch oft zu größerer Unklarheit führen, was nicht außer Acht gelassen werden sollte. „Es wird deutlich, dass auch die genetischen Untersuchungstechniken ihre Tücken haben und nicht das halten können, was suggeriert wird: nämlich eine absolute Sicherheit.“[240] Die Pränataldiagnostik kann nur vereinzelte Krankheiten und Behinderungen beim Ungeborenen feststellen, wobei die Möglichkeiten der Therapie meist nicht vorhanden sind.
Es hat sich mit der Zeit eine Umwandlung von der schwangeren Frau zur Patientin mit Hochrisiken vollzogen. Durch die allgemeine Pathologisierung und beispielsweise durch die Normierungsfunktion des Mutterpasses wurde diese Umwandlung vorangetrieben. Die Krankenkassen und der Bundesausschuss der Ärzte haben 1968 den sogenannten Mutterpass in Deutschland eingeführt. Seitdem ist dieser mehrmals verändert worden. Bei der ersten Mutterschaftsvorsorgeuntersuchung erhält jede schwangere Frau in Deutschland einen eigenen Mutterpass, in dem Informationen zu den regelmäßigen Untersuchungen und den sogenannten IGeL-Zusatzuntersuchungen[241] zu finden sind. Der Mutterpass stellt eine genaue Dokumentation der Schwangerschaft dar und enthält Informationen für die Hebammen und Ärzte; z.B. Blutgruppe der Schwangeren, Medikamente welche die Schwangere einnimmt, bisherige „Auffälligkeiten“ während der Schwangerschaft, Risiken usw.. Die werdende Mutter soll ihren Mutterpass immer bei sich tragen.[242]
Im Mutterpass sind verschiedene Punkte bezüglich der Beratung und Vorsorge angeführt, die im Laufe der Schwangerschaft abgearbeitet werden sollen. Wenn der Arzt die Schwangerschaft auf Grund der im Mutterpass aufgeführten „Probleme“ als Risikoschwangerschaft einstuft, wird die werdende Mutter genauer „überwacht und betreut“. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die Frau als Patientin wahrgenommen und nicht mehr lediglich als werdende Mutter.
Die Ultraschalluntersuchung ist zu einem wichtigen Bestandteil der Schwangerschaftsüberwachung geworden und hat laut Pagels folgende Funktionen:
-
Früherkennung der Schwangerschaft
-
Beobachtung und Protokollierung des Wachstums des Kindes
-
„Planung“ der Geburt (Kaiserschnitt oder natürliche Geburt; je nach Lage des Fötus)
-
Frühe Diagnose von Erkrankungen
-
Früherkennung und Behandlung von Komplikationen
-
Diskussion über einen Schwangerschaftsabbruch bei schweren Erkrankungen ohne Aussicht auf Heilung.
Die drei letzten Punkte sind kritisch zu betrachten; welche „Erkrankungen“ sind gemeint und was kann unter „Behandlung“ verstanden werden. Nicht selten läuft es auf den letzten Punkt hinaus – Schwangerschaftsabbruch. Durch die ständige Weiterentwicklung des Ultraschalls wird der Blick in den Mutterleib immer genauer. „Es wird der Eindruck erweckt, der Fetus sei aus Glas und könne bis in das Letzte durchschaut werden.“[243]
„Es ist Aufgabe der PND [Pränataldiagnostik], mittels Ultraschall Hinweise auf Fehlbildungen zu erhalten, diese möglichst genau darzustellen und zu klassifizieren, damit in der Folge prognostische Aussagen bezüglich einer späteren, postnatalen Therapie gemacht werden können.“[244]
Eine Ultraschalluntersuchung reiche jedoch nicht zur genauen Analyse aus, so der Gynäkologe Jens Pagels. Welche „postnatalen Therapien“ er meint, erläutert er allerdings nicht. Es wird deutlich, dass die Ungeborenen auf Grundlage der Diagnose „klassifiziert“ werden. Die Folge dieser Klassifizierung ist nicht selten ein Schwangerschaftsabbruch, da es beispielweise beim Down-Syndrom keine „Heilungsmöglichkeit“ gibt und die Mutter sich gegen das Kind entscheiden kann.
Zu beachten ist, dass dieser Aufwand zur Aufspürung von Kindern mit Behinderungen in keinem Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen „Fehlentwicklung“ steht. Die fortschreitende Fahndung nach „Abweichungen“ bei Ungeborenen erweckt den Eindruck, dass für fast alle Kinder ein Risiko besteht. Die vermehrten Forschungen und Untersuchungen scheinen daher gerechtfertigt. Es ist jedoch Gegenteiliges der Fall, wie auch Maria Wolf feststellt:
„Dass im Jahr 2000 weltweit noch immer ca. 97% aller Kinder gesund zur Welt gekommen sind, dass somit bei den nicht gesunden Kindern von nur etwa 3% angeborenen Fehlbildungen ausgegangen werden kann und dass davon wiederum nur 1,5% genetisch bedingt sind, wurde in Zusammenhang mit einer ökonomischen Legitimierung der eigenen Forschungsprojekte nicht diskutiert.“[245]
Laut den Empfehlungen der gynäkologischen Gesellschaften sollten Frauenärzte den Frauen, die älter als 35 Jahre sind, die Möglichkeit der Pränataldiagnostik erläutern. Mit dem Alter der Mutter steige nämlich das Risiko für Chromosomenstörungen. Frauen, die 34 Jahre alt oder älter sind, werden daher automatisch über das Risiko von Chromosomenstörungen aufgeklärt. Diesen Frauen werden dann Statistiken mitgeteilt, d.h. wie hoch das Risiko ist, dass ihr Ungeborenes eine Chromosomenstörung hat. Diese Risikokalkulationen sind Richtwerte, die aufgrund von Screenings errechnet worden sind.
Bei Reihenuntersuchungen wird überprüft, wie oft die sogenannten Marker gefunden werden und wie viele der betroffenen Kinder schließlich tatsächlich krank sind und wie viele nicht. Anhand dieser Untersuchungen werden Risikoberechnungen erstellt, die den Müttern bei weiteren Überlegungen und Entscheidungen helfen sollen.
Diese Marker sind jedoch kritisch zu betrachten, da sie kommen und gehen und beispielsweise nur zu bestimmten Zeitpunkten der Entwicklung vorkommen. Manchmal glauben die Ärzte etwas „Neues“ gefunden zu haben, doch nach einer gewissen Zeit stellt sich das Gegenteil heraus. In dieser Zwischenzeit wurde der Marker allerdings anderen schwangeren Frauen schon genannt, was zwangsläufig zu Verunsicherungen führt.
„Was einer werdenden Mutter nach einer Untersuchung als prozentuale Wahrscheinlichkeit mit auf den Weg gegeben wird, ist also mit Vorsicht zu genießen. Leider hängt von dieser Statistik aber einiges ab: nämlich das Seelenheil der Schwangeren oder der Verlauf der gesamten Schwangerschaft.“[246]
Wenn eine Fehlbildung bei einer Untersuchung festgestellt wird, muss der Arzt der werdenden Mutter die Prognose und die möglichen Therapien erklären und wird sie gegebenenfalls an einen Spezialisten weiterleiten. Viele Fehlbildungen können jedoch nicht diagnostiziert werden. Selbst das Organscreening ist keine Garantie für die körperliche Unversehrtheit des Kindes. Beim Auftreten gewisser Fehlbildungen kann man (laut Ärzten) schon fast sicher sein, dass das Kind eine genetische Erkrankung hat. Es gibt allerdings auch Fehlbildungen, die nicht mit Chromosomenstörungen in Verbindung stehen. Eine absolute Sicherheit gibt es daher nicht.
Zudem kann eine genetische Störung nicht wirklich behandelt werden, da weder die Gene noch die Chromosomen „repariert“ werden können. Lediglich die Auswirkungen sind behandelbar. Die werdende Mutter muss daher genau abwägen, ob sie das Risiko weiterer genetischer Untersuchungen eingeht oder nicht. Der Gynäkologe wird ihr diese Untersuchungen schon alleine aus juristischen Gründen anbieten. Eine genetische Störung kann der Arzt dennoch nie hundertprozentig ausschließen. Jede Untersuchungsmethode hat ihre Grenzen und eine bestimmte Fehlerquote. So bemerkt Pagels in diesem Zusammenhang: „Es ist also durchaus denkbar, dass trotz Organscreening und trotz Fruchtwasserpunktion dennoch ein genetisch krankes Kind geboren werden kann.“[247]
Die werdenden Mütter erhoffen sich jedoch Sicherheit durch die zusätzlichen Untersuchungen und wollen alle Möglichkeiten der Pränataldiagnostik ausschöpfen. So werden auch auf der Internetseite zum Mutterpass die möglichen Risiken angesprochen:
„Normalerweise sind die Schwangerschaft und die Geburt nicht mit Erkrankungen oder krankhaften Veränderungen verbunden, aber manchmal können hierbei erhöhte Risiken für (bestimmte) Erkrankungen entstehen. Eine regelmäßige und sorgfältige Betreuung während der Schwangerschaft und Geburt hilft, solche Risiken oder Erkrankungen zu vermeiden, zu erkennen und entsprechend zu reagieren.“[248]
Welche Risiken und Erkrankungen gemeint sind, wird in diesem Fall nicht konkret angesprochen. Es wird auch nicht erwähnt, wie die „Vermeidung“ dieser Risiken oder Erkrankungen aussehen soll. Der Mutterpass wird lediglich als eine genaue Dokumentation der Schwangerschaft dargelegt; dass er dadurch eine bestimmte Norm festlegt, bleibt unkommentiert. Sämtliche Informationen beruhen auf Richtwerten, die nicht weiter hinterfragt werden und die vor allem schnell zum Stempel „Risiko“ führen. Zusätzlich wird Druck auf die schwangeren Frauen ausgeübt, alle Angebote wahrzunehmen, da der Mutterpass Auflistungen von Untersuchungen enthält, die durchzuführen sind.
Tatsache ist, dass Verunsicherungen entstehen und die werdende Mutter sich für oder gegen invasive Untersuchungen entscheiden muss. Erfahrung und Kompetenz des Untersuchers können hierbei eine wichtige Rolle spielen, vor allem vor dem Hintergrund, dass es bei den Untersuchungen jeweils einen gewissen Beurteilungsspielraum gibt, da, wie bereits erwähnt, die sogenannten Marker und deren Relevanz nicht immer einheitlich eingestuft und beurteilt werden. Durch diesen Spielraum innerhalb der „normalen Richtwerte“ erhält der Arzt eine enorme Definitionsmacht über „Anomalie“ und „Normalität“. Dies ist problematisch, wenn man bedenkt, dass allein der Arzt in eventuell grenzwertigen Situationen derjenige ist, der bestimmt, ob das Kind nun als „behindert“ gilt oder nicht. Schließlich sind es alles nur Wahrscheinlichkeiten und Richtwerte, die Spielraum für Interpretationen und Beurteilungen lassen.
Der Arzt ist gesetzlich dazu verpflichtet, die werdende Mutter vor den Untersuchungen über die möglichen Risiken, sowie die Vor- und Nachteile der Verfahren aufzuklären. Außerdem haben die Eltern die Möglichkeit, einen Facharzt für Humangenetik zu konsultieren, um mehr medizinische Informationen zu erhalten, oder zu einer psychosozialen Beratung zu gehen, um Entscheidungs- bzw. Lebenshilfe zu erhalten.[249]
Oft wird zusätzlich eine präzise Familienanamnese durchgeführt, um mehr Informationen für eine Diagnose zu erhalten. So werden bei einer Befragung unter anderem folgende Punkte geklärt: Familiengeschichte, mögliche Vorerkrankungen, Blutgruppenverträglichkeit, Medikamenteneinnahmen sowie vorherige Schwangerschaften, deren Verlauf und Ausgang. Doch damit sind nicht alle Fehlerquellen behoben.
Die 46 Chromosomen und die zwei Geschlechterchromosomen können untersucht werden, die mehreren Millionen Gene jedoch nicht. Durch eine Punktion erhält der Arzt Zellen vom Kind, mit denen er eine Chromosomenuntersuchung durchführt, um bestimmte Chromosomenstörungen auszuschließen bzw. zu bestätigen. Durch die Zählung der Chromosomen können gewisse Störungen mit fast hundertprozentiger Sicherheit erkannt werden, erklärt Pagels. Das Problem hierbei besteht darin, dass möglicherweise eine Krankheit zwar vorliegt, diese aber beispielweise nicht in jeder Zelle des Körpers vorhanden ist. Wenn der Spezialist also nur die gesunden und keine von den „kranken“ Zellen durch die Punktion erhält, wird die Diagnose falsch sein.
Zusätzlich kann es bei einer Punktion passieren, dass man Zellen der Mutter entnimmt und nicht die des Kindes, beispielsweise durch Blutungen. Dadurch könnte es auch zu einer Fehldiagnose kommen. „Es wird deutlich, dass auch die genetischen Untersuchungstechniken ihre Tücken haben und nicht das halten können, was suggeriert wird: nämlich eine absolute Sicherheit.“[250]
Es kann unter Umständen lebenswichtig für das Kind und die Mutter sein bestimmte „Fehlbildungen“ zu erkennen. Es ist beispielsweise wesentlich, einen Herzfehler oder einen offenen Rücken beim Fötus festzustellen, um im weiteren Verlauf die Geburt genau zu planen. Es gibt jedoch auch „leichte“ Störungen, deren Feststellung lediglich zur Verunsicherung der werdenden Mutter beitragen, die aber keine weitreichenden Folgen haben. So ist es z.B. für die Planung der Geburt unerheblich, ob das Kind einen Finger zu viel oder eine Lippenspalte hat. Das Dilemma bei solch einer Situation ist, dass beispielsweise ein „Klumpfuß“[251], eine leicht behandelbare Fehlbildung oder aber auch der Ausdruck einer Chromosomenstörung sein kann. Es ist immer zu bedenken, dass nicht jede „körperliche Fehlbildung“ zwangsläufig auch auf einer Chromosomenstörung beruht.
Ärzte und Kliniken, die pränatale Diagnostik anbieten, sind zwangsläufig immer wieder mit dem Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch konfrontiert. Dies sei meist der Fall, wenn der Fötus erkrankt oder wenn die Gesundheit bzw. das Leben der werdenden Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet sei, so Pagels. Zu bedenken ist, dass durch die Pränataldiagnostik der Wunsch nach einem „gesunden“ Kind und gleichzeitig auch der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer Behinderung verstärkt worden ist. Ohne die unzähligen Möglichkeiten der Untersuchungen konnte vorher pränatal nicht festgestellt werden, ob ein Kind eine „Fehlbildung“ haben wird oder nicht, wodurch der Wunsch nach Abtreibung aufgrund einer „Abweichung“ schwieriger zu rechtfertigen war.
Es gibt verschiedene Verfahren für Schwangerschaftsabbrüche, die jeweils auch vom Zeitpunkt der Schwangerschaft abhängen. Bis zur sechsten Schwangerschaftswoche wird ein Abbruch durch eine vorsichtige Ausschabung der Gebärmutter durchgeführt. Bei einem so frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft kann es auch sein, dass die Schwangere eine sogenannte Abtreibungspille nehmen muss, die gegen das schwangerschaftserhaltende Hormon Progesteron arbeitet, wodurch es in der Folge zu einer Abstoßung kommt. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche ist für einen Abbruch eine ambulante Operation nötig, die von der Scheide aus durchgeführt wird.
Ab der 15. bis zur 21. Schwangerschaftswoche ist die Entfernung des Fötus nicht mehr durch den Muttermund möglich, da er bereits zu weit entwickelt ist. Ein Schwangerschaftsabbruch zu diesem Zeitpunkt wird nur noch stationär durchgeführt. Die Schwangere erhält dann Medikamente, welche die Geburt einleiten. Diese „Abortinduktion“ kann mehrere Tage dauern. Nach der Ausstoßung des Fötus wird eine Ausschabung vorgenommen, um die Reste der Plazenta zu entfernen.
Bei einem Schwangerschaftsabbruch vor der 21. Schwangerschaftswoche sterben die Kinder laut Ärzten normalerweise während der „Geburt“. Ist die 21. Woche überschritten, ist das Kind grundsätzlich lebensfähig. Damit dieses Kind nach einem Abbruch nicht lebend zur Welt kommt, wird ein „Fetozid“ durchgeführt, d.h. dass dem Kind vor der Wehenanregung eine Lösung aus Kaliumchlorid in die Nabelschnur oder direkt ins Herz gespritzt wird. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass das Herz des Kindes aufhört zu schlagen. Wenn ein Kind allerdings dennoch lebend geboren wird, sind die Ärzte rechtlich und ethisch dazu verpflichtet, alles zu tun, damit das Kind überlebt.
Ein „misslungener“ Schwangerschaftsabbruch ist für den Arzt, vor allem aber immer für die Mutter sehr schwierig, da das Kind rechtlich im Mutterleib hätte sterben müssen. Dem Kind wurden in der Regel dann zusätzliche Schädigungen zugefügt und es steht an der Grenze zur Lebensfähigkeit. Der Arzt hat seinen „Behandlungsvertrag“[252] in so einem Fall nicht erfüllt und ist juristisch anfechtbar.[253]
Problematisch ist das Thema Schwangerschaftsabbruch immer, umso mehr, wenn die „normale“ Frist überschritten wird, wie auch Jens Pagels formuliert: „Der Abbruch nach dem Beginn der Lebensfähigkeit ist für Frauen und deren Familien besonders schwer. Es wird nicht nur die Grenze des Lebens überschritten, auch eine ethische Grenze wird grundsätzlich verletzt.“[254]
3.2 Rechtliche Grundlagen und Gesetze in Deutschland[255]
Wie bereits im letzten Kapitel angedeutet, sind Schwangerschaftsabbrüche (aufgrund einer pränatalen Diagnose) ein umstrittenes Thema, da ethische Grenzen berührt oder auch überschritten werden. In diesem Kapitel wird daher die rechtliche Lage in Deutschland bezüglich dieses Themas dargestellt.
Die Paragraphen bezüglich eines Schwangerschaftsabbruchs stehen im 16. Abschnitt des Strafgesetzbuches und fallen damit in den Bereich der „Straftaten gegen das Leben“[256]. Ein Schwangerschaftsabbruch ist heute laut §218 StGB in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig und strafbar. Das bedeutet, dass laut Gesetz generell ein Schwangerschaftsabbruch mit einer Freiheits- oder Geldstrafe bestraft wird. Als Ausnahme wird im § 218 folgendes angeführt: „Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.“[257]
So kann die schwangere Frau laut § 218a Abs. 1 den Schwangerschaftsabbruch verlangen und muss in diesem Fall mindestens drei Tage vor dem Eingriff bei einer anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gewesen sein. Der Schwangerschaftsabbruch muss infolgedessen von einem Arzt durchgeführt werden und es dürfen nicht mehr als zwölf Wochen seit der Empfängnis vergangen sein.
Eine schwangere Frau hat also das Recht, aus persönlichen Gründen innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen einen ärztlich durchgeführten Abbruch[258] durchführen zu lassen. Die Frau muss in diesem Fall den Abbruch ausdrücklich verlangen, und sie ist dazu verpflichtet eine Schwangerschaftskonfliktberatung aufzusuchen.[259] Die Beratung, die durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle erfolgt, „dient dem Schutz des ungeborenen Lebens“[260], besagt § 219 Abs. 1. Weiter heißt es in diesem Absatz:
„Sie [die Beratung] hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz.“[261]
Außerdem ist der Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig, wenn dieser „mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, [...] wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist“[262].
Im Abtreibungsstrafrecht gab es in Deutschland immer wieder neue Reformen, so auch im Jahr 1995. Am 29. Juni 1995 wurde die bis dahin „embryopathische“ Indikation aus dem § 218 gestrichen. Diese besagte, dass ein Schwangerschaftsabbruch aus eugenischen Gründen, also bei einer medizinisch prognostizierten Behinderung des Kindes bis zur 22. Woche nicht strafbar ist. Mit dieser Auslassung bzw. Umbenennung ging man u.a. Forderungen von Behindertenverbänden nach, da die „embryopathische“ Indikation eine Diskriminierung für Menschen mit Behinderung darstelle. Tatsächlich ist die „embryopathische“ Indikation jedoch nicht aufgegeben, sondern in die erweiterte medizinische Indikation eingegliedert worden.[263] Zudem ist die Frist für Schwangerschaftsabbrüche mit medizinischer Indikation seit der Reform von 1995 aufgehoben worden. Bei einem Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation gibt es keine zeitliche Begrenzung, und der Abbruch kann grundsätzlich bis zur Einsetzung der natürlichen Wehentätigkeit durchgeführt werden.[264] Die Aufhebung der zeitlichen Begrenzung wurde mit der Möglichkeit „einer Gefährdung des Lebens der Mutter während der gesamten Dauer der Schwangerschaft“[265] begründet.
Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn Lebensgefahr oder Gefahr von schwerwiegenden körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen für die Frau unter Berücksichtigung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse bestehen, wie es in § 218 a Abs. 2 beschrieben ist:
„Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.“[266]
Der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker sagt, dass diese „weichen Formulierungen“[267] es ermöglichen, jegliche Abtreibungswünsche nach der 12. Schwangerschaftswoche unter die medizinische Indikation zu subsumieren. Doch nicht nur Spieker schätzt die Formulierungen der Gesetzestexte problematisch ein:
„Kritiker weisen darauf hin, dass es sich bei der Abschaffung der embryopathischen Indikation um eine Mogelpackung handelt, um gesetzgeberische Verhüllungskunst. Denn faktisch hat sich an der Praxis nichts geändert. Bereits eine leichte Fehlbildung berechtigt heute zu einem Abbruch, wenn die Schwangere dies für eine unzumutbare Belastung hält. Die offizielle Begründung muss allerdings sein, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Geburt des Kindes Gefahren für Leben und Gesundheit der Mutter mit sich bringen.“[268]
Laut der Richtlinien zur pränatalen Diagnostik der Bundesärztekammer sind in jedem Fall jeweils das Risiko und der Nutzen für die Mutter und das Kind gegeneinander abzuwägen.[269] Dies erinnert sehr an die immer wiederkehrende Kosten-Nutzen-Logik, die als Legitimation der Verhinderung von „lebensunwerten Leben“ verwendet wurde und auch bis heute noch wird.
Des Weiteren erklärt die Bundesärztekammer, dass Pränataldiagnostik einen Informationsgewinn für die Mutter darstelle, der meist Sorgen und Befürchtungen um die Gesundheit des Kindes beseitigen würde. Falls sich doch herausstellen sollte, dass das Kind eine Erkrankung oder Behinderung hat, liege die Entscheidung bei der Mutter, ob sie die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs wahrnimmt oder nicht.[270]
Zum juristischen Hintergrund der pränatalen Diagnostik legt die Bundesärztekammer folgendes fest:
„Die rechtliche Bewertung muß zum einen das Lebensrecht des Ungeborenen (BVerfG vom 28. 5. 1993, Az.: 2 BvF 4/92) und zum anderen die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (GG Art. 2 Abs. 2) folgende Handlungsfreiheit der Frau/Eltern auf selbstbestimmte Mutterschaft/Elternschaft einbeziehen. Somit muß sich das ärztliche Handeln in der pränatalen Diagnostik an diesen beiden gleichermaßen grundrechtlich geschützten Positionen orientieren. [...] Die Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung des Kindes kann eine Voraussetzung nach §§ 218 ff. StGB für die Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Schwangerschaft und daher Anlaß für einen Schwangerschaftsabbruch sein.“[271]
Auf der einen Seite steht somit das „Lebensrecht des Ungeborenen“, das einhergeht mit der allgemeinen Gesetzwidrigkeit des Schwangerschaftsabbruches, und auf der anderen Seite stehen die Diagnose einer „schwerwiegenden Erkrankung des Kindes“ und die legale Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches. Diese Ausnahme ist deutlich eugenisch motiviert, da bei der Feststellung einer „schwerwiegenden Erkrankung“ das „Lebensrecht des Ungeborenen“ außer Kraft gesetzt wird und dieses Kind getötet werden darf. Somit besteht bis heute hin eine selektive Praxis, die auch durch die Gesetze nicht verhindert wird.
Bevor es jedoch zu Entscheidungen über Leben oder Tod kommt, sind die verschiedenen genetischen Tests durchzuführen, für die es ebenfalls gesetzliche Richtlinien gibt. Das Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen definiert u.a., was unter einer genetischen Untersuchung zu verstehen ist. So steht u.a. folgendes im § 3 des Gendiagnostikgesetzes:
„Im Sinne dieses Gesetzes 1. ist genetische Untersuchung eine auf den Untersuchungszweck gerichtete a) genetische Analyse zur Feststellung genetischer Eigenschaften oder b) vorgeburtliche Risikoabklärungeinschließlich der Beurteilung der jeweiligen Ergebnisse,[...]3. ist vorgeburtliche Risikoabklärung eine Untersuchung des Embryos oder Fötus, mit der die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen bestimmter genetischer Eigenschaften mit Bedeutung für eine Erkrankung oder gesundheitliche Störung des Embryos oder Fötus ermittelt werden soll [...].“[272]
Wichtig ist zu beachten, dass nicht nur invasive Untersuchungsmethoden unter das Gendiagnostikgesetz fallen, sondern auch nicht-invasive Untersuchungen. Somit gehören bereits der Ultraschall mit der Nackentransparenzmessung und auch ergänzende Bluttests bei der Mutter zu den genetischen Untersuchungen.
„Denn genau dieser Ultraschall ist eine außerordentlich entscheidende Maßnahme in der Pränataldiagnostik. Sozusagen eine Vorstufe der genetischen Diagnostik. Und sie kann in eine Indikation zu einem Schwangerschaftsabbruch einmünden, mit allen daraus gegebenenfalls entstehenden Konsequenzen.“[273]
Zudem beinhaltet das Gendiagnostikgesetz, wie auch das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch, einen Paragraphen über die Beratung der betroffenen Person. So hat man laut § 10 Abs. 2 das „Recht“, schriftlich auf die genetische Beratung zu verzichten.
„Bei einer prädiktiven genetischen Untersuchung ist die betroffene Person vor der genetischen Untersuchung und nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses durch eine Ärztin oder einen Arzt, die oder der die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 und 3 erfüllt, genetisch zu beraten, soweit diese nicht im Einzelfall nach vorheriger schriftlicher Information über die Beratungsinhalte auf die genetische Beratung schriftlich verzichtet. Der betroffenen Person ist nach der Beratung eine angemessene Bedenkzeit bis zur Untersuchung einzuräumen.“[274]
Nimmt die Frau die Beratung jedoch wahr, hat sie anschließend das Anrecht auf eine „angemessene“ Bedenkzeit. Absatz 3 des Gesetzes legt fest, wie die Beratung zu verlaufen hat - ergebnisoffen und allgemein verständlich. Im Rahmen dieser Beratung werden medizinische, psychische und auch soziale Fragen geklärt. Es sollte also auch um die möglichen Folgen und Konsequenzen gehen, die durch die genetischen Untersuchungen entstehen (können).
„Sie [die genetische Beratung] umfasst insbesondere die eingehende Erörterung der möglichen medizinischen, psychischen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit einer Vornahme oder Nichtvornahme der genetischen Untersuchung und ihren vorliegenden oder möglichen Untersuchungsergebnissen sowie der Möglichkeiten zur Unterstützung bei physischen und psychischen Belastungen der betroffenen Person durch die Untersuchung und ihr Ergebnis.“[275]
Für eine genetische Untersuchung bei einem ungeborenen Kind besagt Absatz 4 des Gesetzes folgendes: „Die verantwortliche ärztliche Person oder die Ärztin oder der Arzt, die oder der die Beratung angeboten oder vorgenommen hat, hat den Inhalt der Beratung zu dokumentieren.“[276]
Trotz der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der einzuhaltenden Fristen und der Beratungspflicht vor einem Schwangerschaftsabbruch untersagt kein Gesetz eine Spätabtreibung. Durch die 1996 in Kraft getretene Reform der erweiterten medizinischen Indikation standen die Türen für Spätabtreibungen weit offen. Bereits lebensfähige Föten können seitdem straffrei bis zum errechneten Geburtstermin abgetrieben werden.[277]
Manfred Spieker erklärt: „Die fatalste Konsequenz war die Aufhebung der 22-Wochen-Grenze für Abtreibungen nach einer Pränataldiagnostik, bei der eine Behinderung des Kindes festgestellt worden war und die Mutter erklärte, damit nicht leben zu können oder zu wollen.“[278]
Sämtliche Versuche der Bundesregierung seit 1995, ihren Fehler zu korrigieren, sind gescheitert. Die einzige Möglichkeit Spätabtreibungen einzudämmen, ist die strikte Trennung der medizinischen Indikation von der Pränataldiagnostik. Lediglich Spätabbrüche mit „vitaler“[279] Indikation dürften straffrei sein, so Spieker. Spätabtreibungen sollten nur durchgeführt werden, wenn eine „unmittelbare Gefahr für das Leben der Mutter“[280] besteht. Eugenisch motivierte Schwangerschaftsabbrüche müssten dagegen unterbunden werden. Deshalb gibt es für Manfred Spieker nur eine Lösung:
„Ein effektiver Ausschluß jeder embryopathischen oder eugenischen Indikation aus der medizinischen Indikation wäre der Schritt zur Unterbindung des grauenvollen Abtreibungsgeschehens. Um diesen Schritt zu vollziehen, muß sich der Gesetzgeber von der Angst befreien, den § 218 StGB erneut zur Diskussion zu stellen.“[281]
Kritiker und Befürworter der Pränataldiagnostik streiten immer wieder darüber, ob die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in den letzten Jahren durch die pränatalen Untersuchungen und Diagnosen ansteigen.[282]
„Im Berichtsjahr 2012 wurden in Deutschland 106 815 Schwangerschaftsabbrüche an das Statistische Bundesamt gemeldet. Das waren 2 100 Meldungen (1,9 %) weniger als im Vorjahr. [...] 39,9 % der Frauen hatten zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs noch keine Kinder geboren. Hier ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben. Von den Frauen über 30 Jahren entschieden sich 17,3 % gegen die Schwangerschaft, obwohl sie bisher kinderlos waren.“[283]
Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche insgesamt zwar ein wenig abgenommen hat in den letzten Jahren, aber dass die Anzahl der Abbrüche mit medizinischer Indikation dennoch angestiegen ist. Die Tabelle[284] zeigt wie viele Schwangerschaftsabbrüche es in den letzten Jahren insgesamt in Deutschland gab und mit welcher Indikation diese jeweils durchgeführt worden sind.
|
Rechtliche Begründung |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medizinische Indikation |
3,326 |
3,485 |
3,077 |
3,200 |
2,989 |
3,072 |
3,046 |
3,177 |
|
Kriminologische Indikation |
27 |
25 |
24 |
14 |
21 |
25 |
28 |
21 |
|
Beratungsregelung |
103,462 |
105,357 |
107,330 |
107,480 |
111,474 |
113,774 |
116,636 |
120,825 |
|
Insgesamt |
106,815 |
108,867 |
110,431 |
110,694 |
114,484 |
116,871 |
119,710 |
124,023 |
Die Anzahl der Spätabbrüche nach der 13. Schwangerschaftswoche hat in Deutschland in den letzten Jahren zugenommen. 1996 wurden 1.949 Schwangerschaftsabbrüche zwischen der 13. und der 23. Schwangerschaftswoche durchgeführt; 2009 waren es bereits 2.219. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche nach der 23. Woche lag 1996 bei 159 und 2009 bei 237.[285]
Im Jahr 2012 haben in Deutschland 104.069 Frauen vor der 12. Schwangerschaftswoche abgetrieben; 2.299 Frauen haben zwischen der 12. und der 21. Schwangerschaftswoche einen Abbruch durchführen lassen und in 447 Fällen wurde nach der 22. Schwangerschaftswoche abgetrieben.[286]
Folgende Graphik[287] verdeutlicht den kontinuierlichen Anstieg der jährlichen Spätabbrüche (d.h. nach der 23. Schwangerschaftswoche) in den letzten Jahren in Deutschland.
Abschließend ist zu bemerken, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamts nicht vollständig sind. Bis zum Jahr 2000 hat das Bundesamt dies auch immer in den Vorbemerkungen zu den Statistiken begründet. So würden manche Ärzte die vorgeschriebene Meldung verweigern oder den durchgeführten Schwangerschaftsabbruch in einer anderen „ärztlichen Gebührenordnung“ abrechnen, wodurch die Statistik viele Abtreibungen nicht erfassen kann. Seit 2011 wird dies nicht mehr vom Statistischen Bundesamt angemerkt, obwohl sich weder die Rechtsgrundlage noch die Meldeverfahren geändert haben.[288]
Der Direktor der Universitätsklinik Köln Peter Mallmann sagt, dass die Anzahl der Spätabtreibungen um ein Vielfaches höher ist, als die vom Statistischen Bundesamt angegebenen Zahlen. „´Die Zahlen sind dramatisch höher in allen Zentren (der medizinischen Maximalversorgung, M. S.), weil all diese Vorgänge ohne Dokumentation und vor allen Dingen ohne Publikation erfolgen.´“[289]
Durch die fehlende Dokumentation bleibt vor allem der Fetozid auf der Tagesordnung der Kliniken, so Mallmann. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) stellt ebenfalls fest, dass die Statistiken nicht korrekt sind. Berichte von Praxen und Kliniken zeigen deutlich, dass durchgeführte Spätabbrüche teilweise als Totgeburten registriert werden.[290] Wie hoch die Dunkelziffer letztendlich ist und wie viele Spätabtreibungen jährlich in Deutschland tatsächlich durchgeführt werden, lässt sich nur erahnen.
3.4 „PraenaTest“[291]
Die bisherigen Untersuchungsmöglichkeiten im Rahmen der Pränataldiagnostik (Ultraschall, Amniozentese, Chorionzottenbiopsie, usw.) sind inzwischen um einen scheinbar „harmlosen“ Bluttest erweitert worden. Seit Ende der 1990er Jahre wurde bereits an der Entwicklung dieses Bluttests gearbeitet.
„Im Frühjahr 2011 häuften sich die die Nachrichten über einen Bluttest, der mit hundertprozentiger Gewissheit Down-Syndrom schon im Blut der Schwangeren ermitteln soll – mit großem kommerziellen und medizinischen Potenzial, wie beteiligte Wissenschaftler betonen.“[292]
Der werdenden Mutter wird Blut abgenommen, welches im Labor untersucht wird, um festzustellen, ob das Ungeborene das sogenannte Down-Syndrom haben könnte oder nicht. Über die Plazenta gelangen Bestandteile der Erbanlagen des Fötus in den Blutkreislauf der Mutter. Dieses kindliche Erbmaterial aus dem Blut der Mutter wird untersucht, wodurch auch ohne Amniozentese oder Chorionzottenbiopsie genetische Aussagen über den Fötus gemacht werden sollen. „Nicht-invasiv und gefahrlos für das Kind soll der Test sein – das ist das erklärte Ziel. Das stimmt natürlich nur so lange, bis tatsächlich eine Trisomie 21 entdeckt wird.“[293]
Seit Herbst 2011 befindet sich dieser Test unter dem Namen „MaterniT21“ in den USA im freien Handel. Ab der zehnten Schwangerschaftswoche kann man den Bluttest durchführen lassen und nach acht bis zehn Arbeitstagen erhält man die Ergebnisse, die zu über 99 Prozent sicher sein sollen. Für eine definitive Diagnose ist jedoch weiterhin zur Absicherung eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Chorionzottenbiopsie nötig. Monika Hey, eine Fernsehredakteurin die sich aus persönlichen Gründen differenziert mit dem Thema Pränataldiagnostik beschäftigt, steht dem Ganzen eher kritisch gegenüber. Sie sieht in dem Bluttest nur einen „Zwischenschritt“ zur invasiven Diagnostik. Eine Diagnose wird weiterhin erst nach einer Fruchtwasseruntersuchung oder Chorionzottenbiopsie gestellt und der Bluttest kann diese nicht umgehen.
Das börsennotierte US-Unternehmen für Biotechnologie „Sequenom“ hatte nach einem Kampf um Wettbewerbsvorteile auf dem Markt und dem Zugeständnis, dass Testergebnisse gefälscht worden waren, sowie nach Sammelklagen von Investoren und der Einschaltung der Börsenaufsichtsbehörde den Bluttest schließlich auf den Markt gebracht. Im August 2011 wurde die Zusammenarbeit von „Sequenom Inc.“ und „LifeCodexx AG“ bekannt gegeben. Dies war die erste kommerzielle Partnerschaft im Bereich der nicht-invasiven Pränataldiagnostik von „Sequenom“ in Europa.
In einem Artikel im „SpiegelOnline“ vom 20. August 2012 wurde angekündigt, dass ein Bluttest auf Down-Syndrom in die Praxen kommt. Der sogenannte PraenaTest sei nun in über 70 gynäkologischen Praxen und Kliniken in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in der Schweiz verfügbar. Der Hersteller „LifeCodexx“ teilte mit, dass der Bluttest für Schwangere sei, die in der zwölften Schwangerschaftswoche oder weiter seien und bei denen ein erhöhtes Risiko für Trisomie 21 bei ihrem ungeborenen Kind bestehe.[294]
Kritiker sehen darin die Gefahr „der Zuchtwahl menschlichen Lebens“[295] und der Selektion. Man befürchtet ebenfalls, dass die Anzahl der Abtreibungen durch den Test ansteigen könnte. Hersteller und Befürworter betonen jedoch, dass der Test lediglich bei Frauen durchgeführt werden dürfe, „die ein erhöhtes Down-Risiko beim Ungeborenen haben“[296]. Wenn der Arzt ein erhöhtes Risiko feststelle, hätte er bisher die risikoreiche Fruchtwasseruntersuchung angeboten. Diese soll nun durch den Bluttest umgangen werden. Der Hersteller „LifeCodexx“ erklärte in einer Pressemitteilung, dass durch den Bluttest viele Leben gerettet werden könnten, da weniger Fehlgeburten infolge der invasiven Untersuchungen verursacht würden. Zudem kündigte der Unternehmensvorstand an, dass in naher Zukunft der sogenannte PraenaTest ebenfalls Trisomie 13 und 18 feststellen könnte.[297]
Das „Deutsche Ärzteblatt“ teilte in einem Artikel Anfang 2013 mit, dass inzwischen in knapp 200 Praxen und Kliniken der Bluttest angeboten wird. Trotz einiger Startschwierigkeiten bei der Markteinführung des Tests ist die Firma „LifeCodexx“ mit der Verbreitung zufrieden. „LifeCodexx“ erklärte, dass mehr als 1.000 Bluttests bereits im vergangenen Jahr durchgeführt worden sind. Die Marketingleiterin von „LifeCodexx“ teilte dem „Deutschen Ärzteblatt“ mit, dass bei 97 Prozent der Tests keine Trisomie 21 festgestellt wurde und bei knapp zwei Prozent der Fälle noch eine Fruchtwasseruntersuchung zur weiteren Abklärung erfolgt ist. Bei den restlichen Fällen (knapp zwei Prozent) konnte man kein eindeutiges Ergebnis feststellen.[298]
Bei einem positiven Ergebnis des Bluttests wird empfohlen, das Ergebnis nochmals durch eine Fruchtwasseruntersuchung zu bestätigen, da der „PraenaTest“ keine absolute Sicherheit bietet – der Test ist zu 95 Prozent sicher. Somit kann der Test nicht die Gefahren der Fruchtwasseruntersuchung umgehen, denen das Kind bei der invasiven Untersuchung ausgesetzt wird, obwohl dies oft die Argumentation bzw. Legitimation der Befürworter darstellt. Der Ethikexperte Otto P. Hornstein stellt daher die berechtigte Frage: „Wenn der nichtinvasive Test die invasiven Möglichkeiten nicht ersetzen kann, ist er dann nicht überflüssig?“[299]
Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen Hubert Hüppe (CDU) lehnt den Bluttest grundsätzlich ab, da er nicht mit den Menschenrechten vereinbar sei und weder einen medizinischen noch therapeutischen Zweck habe. So befürchtet beispielsweise auch der Diözesan-Caritasdirektor Frank Johannes Hensel, dass sich Eltern immer mehr dazu verpflichtet fühlen könnten, nur ein „gesundes“ Kind zur Welt zu bringen. Die gesellschaftlichen Erwartungen würden durch den Bluttest nur verstärkt.[300]
Der Präsident der Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery erklärt, dass sich das Rad der Pränataldiagnostik nicht mehr zurückdrehen lasse. Das Problem bestehe nicht in der neuen Diagnosemethode, sondern in den Konsequenzen der Pränataldiagnostik. Auch der Europaabgeordnete Peter Liese (CDU) ist der Meinung, dass die Pränataldiagnostik nicht mehr aufzuhalten sei und dass eine neue Methode, die „möglicherweise weniger Folgen als andere für Mütter und Kinder hat“[301], nicht verboten werden sollte. Liese bemerkt allerdings, dass die Einwände von Behindertenverbänden nachvollziehbar seien und eine, wie im Gendiagnostikgesetz vorgesehen, genetische Beratung in jedem Falle erforderlich sei. So plädiert Liese dafür, Familien, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, in die Beratung mit einzubeziehen.[302]
Ob der „PraenaTest“ allerdings weniger Folgen für Mutter und Kind hat, wie Peter Liese behauptet, ist in Frage zu stellen. Bei einem positiven Ergebnis des Bluttests werden im weiteren Verlauf wiederum invasive Methoden angewendet, die Fehlgeburten auslösen können. Vor allem aber wird der Bluttest die eugenisch motivierten Schwangerschaftsabbrüche nicht verhindern. Die Gesundheitswissenschaftlerin und Sozialarbeiterin Erika Feldhaus-Plumin erklärt, dass, bedingt durch die Diskrepanz zwischen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, die Pränataldiagnostik bis heute einen selektiven Charakter hat.[303]
Die Sozialwissenschaftlerin und Journalistin Eva Schindele resümierte schon 1990: „Geht es den Reproduktionstechnikern bislang vor allem um das Know-how der Kindererzeugung, zielen die gentechnischen Anstrengungen auf die Qualität des Nachwuchses.“[304] Schindele stellt fest, dass die Gynäkologie ein „neues Klientel“ hervorgebracht hat - den „intra-uterinen Patienten“[305]. Dies sollte bei den Entwicklungen auf dem Gebiet der Pränataldiagnostik nicht vergessen werden. Sämtliche neuen Tests und Untersuchungsmethoden sind häufig sehr teuer und versprechen den schwangeren Frauen immer wieder die absolute Sicherheit für ein „gesundes“ Kind. Der „PraenaTest“ ist dafür ein Paradebeispiel.
Am 13. Februar 2013 teilte „LifeCodexx“ mit, dass der Bluttest nun nicht mehr nur Trisomie 21 feststellen könne, sondern auch Trisomie 18 und 13 „mit hoher Sicherheit“[306]. So erklärt die medizinisch-wissenschaftliche Leiterin von „LifeCodexx“ Wera Hoffmann, dass sie mit der Testerweiterung einer wichtigen Forderung ihrer medizinischen Partner nachgekommen seien. Der „PraenaTest“ erkenne nun „über 90% aller relevanten pathologischen Veränderungen bedingt durch autosomale Chromosomenstörungen“[307], so Hoffmann. Auch Michael Lutz vom Vorstand der „LifeCodexx AG“ betont, dass der Test eine „sehr zuverlässige Methode zur Bestimmung fetaler Trisomien“[308] sei.
„LifeCodexx“ preist den Test in seinen Pressemitteilungen hoch an. Die Ergebnisse seien äußerst sicher. Die Schwangeren könnten oftmals beruhigt werden und die invasiven Untersuchungsmethoden mit ihren Risiken würden schließlich hinfällig.
„Mit seiner niedrigen Falsch-Positiv-Rate von 0,5% präzisiert er die frühe Fehlbildungsdiagnostik und kann so die Zahl der unnötigen invasiven Untersuchungen bei nicht betroffenen Schwangerschaften reduzieren. Damit ist er eine Ergänzung zur bisherigen nicht-invasiven Pränataldiagnostik, ohne das Risiko einer eingriffsbedingen Fehlgeburt wie bei invasiven Untersuchungsmethoden wie z.B. der Amniozentese.“[309]
Der Hersteller verspricht schwangeren Frauen damit die Sicherheit, dass ihr Kind „gesund“ sein wird. Schließlich seien die meisten durch ein negatives Testergebnis beruhigt. Diese Versprechungen und die positiv formulierten Pressemitteilungen können dazu führen, dass die werdenden Mütter relativ unbedacht den Bluttest durchführen lassen. Sie erhoffen sich eine Bestätigung, dass ihr Kind auf alle Fälle „gesund“ ist und bedenken meist nicht die möglichen Konsequenzen. Die große Schere zwischen Diagnose und möglichen Therapien wird ihnen beispielsweise von dem Hersteller „LifeCodexx“ nicht mitgeteilt.
Laut Eva Schindele ist eine Schwangerschaft ein Prozess, der immer unberechenbar bleibt. Die Medizin locke während dieses Prozesses mit dem Versprechen, eine Sicherheit garantieren zu können.[310] Schließlich ginge es nicht mehr um den „persönlichen Weg“, sondern lediglich nur noch um das „Produkt, das die Frau nach neun Monaten ´ausliefert´“[311]. Auch der Hersteller „LifeCodexx“ verspricht, durch seinen Bluttest eine Sicherheit in der Schwangerschaft geben zu können, dass das ungeborene Kind „gesund“ sein wird.
In einer Stellungnahme des „Deutschen Ethikrates“ zum Thema genetische Diagnostik wird auch der „PraenaTest“ erörtert. In dieser Expertise macht der „Deutsche Ethikrat“ unter anderem auf die Fehlerquote des Tests aufmerksam. Laut Ethikrat ist zu erwarten, dass der Anteil falscher Ergebnisse steigt, wenn der Test in Zukunft grundsätzlich auch bei schwangeren Frauen „mit geringerem Trisomie-Risiko“ durchgeführt wird. Gründe hierfür könnten die sinkenden Kosten des Tests sein sowie der immer früher mögliche Zeitpunkt der Testdurchführung. Weiter heißt es in der Stellungnahme des Ethikrates, dass es zu vermehrten Schwangerschaftsabbrüchen kommen könnte, wenn die Schwangeren bereits nach einem positiven Bluttest, ohne weitere Untersuchungen, einen Abbruch wünscht. Wenn dies eintreten sollte, wäre die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche mit der Zahl der ansonsten ausgelösten Fehlgeburten durch invasive Untersuchungsmethoden identisch. Schließlich liege das Risiko eines falschen positiven Testergebnisses bei nicht-invasiven Tests zwischen 0,2 bis 0,7 Prozent und das Risiko einer Fehlgeburt bei invasiven Untersuchungen bei 0,5 Prozent.[312] Oder wie Monika Hey es ausdrückt: „Im Klartext: Gesunde Kinder sterben, um die behinderten herauszufiltern.“[313]
Die Anzahl der (möglicherweise) „gesunden“ Kinder, die aufgrund von einem falschen Testergebnis abgetrieben werden, scheint egal zu sein. Schließlich würden durch den Test wenigstens die durch invasive Untersuchungen ausgelösten Fehlgeburten verhindert. Solch ein Kalkül ist beim Thema Pränataldiagnostik nicht selten. Auch Maria Wolf hat dies bereits festgestellt: „Die Kosten, die dem Gesundheitswesen durch ´pränatal verursachte Krankheitszustände´ erwuchsen, sollten durch die Verhinderung der Geburt missgebildeter Kinder als zukünftige PatientInnen gesenkt werden.“[314] Das Aufwiegen von „Verlusten“ scheint eine gängige Methode der Legitimation zu sein.
So scheint es in diesem Fall, dass der „Deutsche Ethikrat“ in seiner Stellungnahme die möglichen Konsequenzen des Bluttests „verharmlosen“ will. Die Konsequenzen der Pränataldiagnostik sind schließlich immer dieselben – entweder werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt oder Fehlgeburten ausgelöst. Denn „die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche nach einem falsch positiven Testergebnis [wäre] in etwa so hoch wie die Zahl der Fehlgeburten, die sich ereignen würden, wenn alle Schwangeren von vornherein eine invasive Pränataldiagnostik in Anspruch genommen hätten“[315]. Dass es sich hierbei um „gesunde“ Kinder oder um lebensfähige Föten handelt, wird scheinbar ausgeblendet. Die Tatsache, dass nach „kranken“ Kindern regelrecht gefahndet wird und auf diesem Weg „Verluste“ geschehen, wird nicht thematisiert, geschweige hinterfragt. Es scheint gesellschaftlich anerkannt zu sein, dass Ungeborene gar keine Chance bekommen und ihnen ihr Lebensrecht aufgrund einer Diagnose abgesprochen wird, laut der sie nicht „gesund“ sind.
„LifeCodexx“ begrüßt in einer Pressemitteilung die Stellungnahme des Ethikrates. So sei der Bluttest mehrheitlich positiv bewertet worden und erfülle zudem sämtliche gesetzliche Voraussetzungen. Außerdem schütze der Test das Leben des Ungeborenen und das der Mutter.
„Ein Verbot des Bluttests würde die im Grundgesetz verankerten Rechte der schwangeren Frau verletzen und ihr frühe und schonend zu gewinnende Erkenntnisse verwehren. Denn anders als invasive Verfahren, welche mit einem Fehlgeburtsrisiko einhergehen, schützt die nicht invasive Untersuchungsmethode des PraenaTest® das Leben und die Gesundheit sowohl des ungeborenen Kindes als auch der Mutter.“[316]
„LifeCodexx“ betont abschließend in der Pressemitteilung nochmals die bisherigen „Fortschritte“ in Bezug auf den Bluttest und die damit verbundenen Kosten:
„Der PraenaTest® ist weltweit der bisher einzige nicht-invasive molekulargenetische Bluttest zur Feststellung der fetalen Trisomien 21, 18 und 13, der als Medizinprodukt und In-Vitro-Diagnostikum in Europa verkehrsfähig ist. Bisher haben sich knapp 3000 Frauen für die Durchführung des PraenaTest® entschieden. Schon jetzt haben mehrere private und gesetzliche Krankenkassen in Deutschland und in der Schweiz die Kosten für den Bluttest übernommen.“[317]
Einen weiteren „Fortschritt“ beansprucht „LifeCodexx“ im Juli 2013: der Bluttest sei nun auch ab der vollendeten neunten Schwangerschaftswoche möglich. Dieser frühe Zeitpunkt in der Schwangerschaft zur Durchführung des Tests könne von Vorteil sein für „Risikoschwangere mit erblicher Vorbelastung“[318] und zur Absicherung einer bereits diagnostizierten fetalen Trisomie, da beispielsweise auch eine „belastende Wartezeit“[319] für die Schwangere minimiert werden könne.
Ungefähr zur selben Zeit hat der Hersteller „LifeCodexx“ den Preis für den „PraenaTest“ von 1.250 Euro auf 825 Euro reduziert. Inzwischen übernehmen auch immer mehr private und gesetzliche Krankenkassen teilweise oder komplett die Kosten für den Test, so die Information des Herstellers. Auf der Internetseite von „LifeCodexx“ kann ein Kostenvoranschlag erstellt werden, um herauszufinden, wie viel man schlussendlich selber zahlen muss.
Der „Deutsche Ethikrat“ hat in seiner Stellungnahme bereits angemerkt, dass es durch den sinkenden Preis zu einer weiteren Etablierung des Tests kommen könnte. Denn immer mehr schwangere Frauen erhielten die Möglichkeit, den Bluttest durchführen zu lassen. Monika Hey erklärt, dass sich die Fruchtwasseruntersuchung sehr schnell zum Standardverfahren in der Schwangerenvorsorge entwickelt hat, als diese 1976 von den gesetzlichen Krankenkassen in ihren Leistungskatalog aufgenommen worden war. Dies könnte nun auch beim „PraenaTest“ geschehen. Durch Vergünstigungen wird die Hemmschwelle geringer und immer mehr Frauen werden den Test in Anspruch nehmen.
Diese Entwicklung kündigt sich bereits jetzt an. So teilte „LifeCodexx“ im August 2013 auf seiner Internetseite mit: „LifeCodexx führt nahezu 6.000 PraenaTest®-Analysen im ersten Jahr durch.“[320] Zudem hätten knapp die Hälfte der Tests deutsche Praxen und Kliniken in Auftrag gegeben. Der Hersteller betont, wie in anderen Pressemitteilungen auch, der Test entlaste die meisten schwangeren Frauen und nehme ihnen die Angst vor einer möglichen Trisomie. „Der großen Mehrheit der Frauen (zirka 98%) konnte durch ein unauffälliges Testergebnis die psychische Belastung der Sorge und Ungewissheit genommen werden.“[321]
Michael Lutz vom Vorstand der „LifeCodexx AG“ erklärt, dass die Nachfrage des Tests den Erwartungen entspricht und der Bedarf in den letzten Monaten dementsprechend kontinuierlich gestiegen ist. Dies liege unter anderem darin begründet, dass die Ärzteschaft der neuen Untersuchungsmethode immer mehr Vertrauen schenke. Diese Aussage spiegelt wider, wie viel Vertrauen die werdenden Mütter zu ihren Ärzten haben und wie wichtig ihnen eine fachliche Meinung ist.
[231] Weingart, Kroll, Bayertz 1988, S. 15.
[232] Vgl. grundlegend für das Folgende: Pagels, Jens: Pränataldiagnostik. Wissen, was stimmt. 2011.
[233] Der medizinische Fortschritt ist immer auch mit Tier- und Menschenversuchen verbunden; dies sollte nicht außer Acht gelassen werden.
[234] Pagels 2011, S. 9.
[235] Bei nicht-invasiven Methoden dringt man nicht in den Körper ein; bei invasiven Methoden dringt man mit einer Nadel beispielweise in die Fruchtblase ein.
[236] Hey 2012, S. 49.
[237] Wegener 2007, S. 44.
[238] Pagels 2011, S. 72.
[239] Pagels 2011, S. 26.
[240] Ebd., S. 39.
[241] IGeL: Individuelle Gesundheitsleistung; d.h. die Krankenkassen übernehmen nicht die Kosten für diese zusätzlichen Untersuchungen.
[242] Vgl. Mutterpass, http://www.mutterpass.de/go/mutterpass/dg/themes/mutterpass.xhtml.
[243] Pagels 2011, S. 25.
[244] Ebd., S. 20.
[245] Wolf 2008, S. 546.
[246] Pagels 2011, S. 30.
[247] Pagels 2011, S. 36.
[249] Die zusätzlichen Beratungen erfolgen im Idealfall. Die Realität sieht oftmals anders aus; dies wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch deutlich.
[250] Pagels 2011, S. 39.
[251] Ebd., S. 75.
[252] Pagels 2011, S. 113.
[253] Die Problematik von Spätabbrüchen wird im Kapitel „Spätabtreibung nach pränataler Diagnose“ noch präziser dargestellt.
[254] Pagels 2011, S. 114.
[255] Vgl. grundlegend für das Folgende: Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html#BJNR001270871BJNE039004307.
[256] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html#BJNR001270871BJNE039004307
[257] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218.html.
[258] Den Abbruch muss ein Arzt durchführen; einer Hebamme ist es beispielsweise nicht erlaubt.
[259] Vgl. Pagels 2011, S. 98.
[260] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[261] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[262] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
[263] Vgl. Stiftung Ja zum Leben: Tim lebt! Geburtstag statt Todestag. http://www.tim-lebt.de/startseite/.
[264] Vgl. Spieker 2005, S. 15.
[265] Ebd., S. 15.
[266] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
[267] Spieker 2005, S. 15.
[268] Hey 2012, S. 88.
[269] Vgl. Bundesärztekammer 1998, S. A3241.
[270] Vgl. ebd., S. A3241.
[271] Ebd., S. A3241.
[272] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/gendg/.
[273] Hey 2012, S. 58.
[274] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/gendg/.
[275] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/gendg/.
[276] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/gendg/.
[277] Vgl. Spieker 2005, S. 22.
[278] Spieker 2005, S. 22.
[279] Ebd., S. 25.
[280] Ebd., S. 25.
[281] Ebd., S. 25.
[282] Vgl. Pagels 2011, S. 10.
[283] Statistisches Bundesamt Deutschland, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Aktuell.html.
[284] Statistisches Bundesamt Deutschland, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html.
[285] Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=8917965&nummer=240&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=19446707.
[286] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/RechtlicheBegruendung.html.
[287] Stiftung Ja zum Leben: Tim lebt! Geburtstag statt Todestag. http://www.tim-lebt.de/spaetabtreibung/.
[288] Vgl. Spieker 2005, S. 17.
[289] Zit. n. ebd., S. 17.
[290] Vgl. ebd., S. 17f.
[291] Vgl. grundlegend für das Folgende: Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2012. Und: LifeCodexx. Nicht invasive molekular genetische Pränataldiagnostik. http://www.lifecodexx.com/.
[292] Hey 2012, S. 165f.
[293] Ebd., S. 166.
[294] Vgl. SpiegelOnline 2012, http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.
[295] SpiegelOnline 2012, http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.
[296] SpiegelOnline 2012, http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.
[297] Vgl. SpiegelOnline 2012, http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html.
[298] Vgl. Klinkhammer, Richter-Kuhlmann 2013, S. A166.
[299] Zit. n. ebd., S. A167.
[300] Vgl. ebd., S. A167f.
[301] Ebd., S. A168.
[302] Vgl. ebd., S. A168.
[303] Vgl. Feldhaus-Plumin 2012, S. 14.
[304] Schindele 1990, S. 19.
[305] Ebd., S. 18.
[306] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatest_trisomies_13_18_21.html.
[307] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatest_trisomies_13_18_21.html.
[308] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatest_trisomies_13_18_21.html.
[309] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatest_trisomies_13_18_21.html.
[310] Vgl. Schindele 1990, S. 23.
[311] Ebd., S. 33.
[312] Vgl. Deutscher Ethikrat 2013, S. 64ff.
[313] Hey 2012, S. 64.
[314] Wolf 2008, S. 523.
[315] Deutscher Ethikrat 2013, S. 66.
[316] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/lifecodexxstellungnahmezumder.html.
[317] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/lifecodexxstellungnahmezumder.html.
[318] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatestjetztab9ssw.html.
[319] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/praenatestjetztab9ssw.html.
[320] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/6000praenatestimerstenjahr.html.
[321] LifeCodexx, http://lifecodexx.com/6000praenatestimerstenjahr.html.
Inhaltsverzeichnis
„Die Orientierung an genetisch begründeten Krankheitskonzepten und –klassifikationen verändert das Ziel medizinischen Handelns. An die Stelle einer reaktiven Heilkunst tritt eine prädiktive Maschinerie, die sich auf die aktive Verhinderung von Krankheiten spezialisiert und auf die Diagnose von Anfälligkeiten, Dispositionen und Risiken konzentriert.“[322]
Pränataldiagnostik ist immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die Fragen, ob ethische Grenzen überschritten werden und ob es sich um eine selektive Praxis handelt, können nur zu oft bejaht werden. Die Medizin gelangt an bisher festgesteckte Grenzen und Tabus, die immer öfters überschritten werden.
So sprechen die Soziologen Peter Wehling und Willy Viehöver von einer „Entgrenzung“ der Medizin, die wir in den letzten Jahren immer stärker erfahren würden. Die beiden Autoren beziehen sich u.a. auf die Bioethiker Robert Ranisch und Julian Savulescu. Sie vertreten den Standpunkt, Eltern hätten eine ethische „Verpflichtung“, nicht mehr nur Krankheiten ihrer Kinder zu behandeln, sondern auch deren Biologie zu verbessern. Wehling und Viehöver gehen davon aus, dass die Medizin über den Punkt der Heilung und auch den der Prävention bereits hinausgegangen sei. Es gehe immer mehr um die Optimierung des menschlichen Körpers und Geistes, wofür bereits gesunde und „normale“ Menschen mit medizinischen Mitteln und Techniken behandelt werden.[323]
Als einen Aspekt der „Entgrenzung“ der Medizin definieren Wehling und Viehöver die „Entzeitlichung“ der Krankheit. Diese „Entzeitlichung“ bedeutet:
„[...] dass sich das Verständnis von Krankheit zunehmend von zeitlich manifesten (akuten oder chronischen) Symptomen und Beschwerden ablöst und auf das Vorliegen bestimmter Indizien und Risikofaktoren (Genveränderungen, Übergewicht, hohe Blutfettwerte etc.) gleichsam ´vorverlagert´ wird“.[324]
Die Autoren erklären weiter, dass es sich nicht mehr nur um bloße Prävention handele, da oftmals bei vermeintlichen Krankheitsrisiken nur noch (wenn überhaupt) risikoträchtige Präventionsmaßnahmen vorhanden seien, wozu beispielsweise die prädiktive genetische Diagnostik zählt.[325]
Ein Beispiel für die „Entzeitlichung“ der Krankheit stellen genetische Untersuchungen dar. So rät Jens Pagels, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, u.a. zu genetischen Tests bereits vor einer Schwangerschaft: „Schon vor Eintritt einer Schwangerschaft kann eine dezidierte genetische oder laborchemische Untersuchung von Paaren sinnvoll sein.“[326] Selbst wenn Mutter und Vater gesund seien, heiße dies nicht, ihr zukünftiges Kind sei auch gesund. Daher könnten sich Eltern nach einer genetischen Untersuchung, bei der eine Risikokonstellation festgestellt wird, nochmals gründlich überlegen, ob sie unter diesen Umständen überhaupt ein Kind bekommen wollen, so Pagels.[327]
Die prädiktive Medizin hat den allgemeinen Anspruch, Krankheiten immer früher und besser zu erkennen, um diese dadurch zu vermeiden. Dazu muss sie jedoch alle Menschen zu PatientInnen machen, die der genetischen Überwachung bedürfen, um eventuelle zukünftige „Leiden“ - und seien sie noch so unwahrscheinlich - zu vermeiden.[328]
In den 1970er Jahren entstand, wie bereits ausgeführt, die Idee der „individuellen Gesundheitsverantwortung“, welche auch die „genetische Verantwortung“[329] beinhaltet. Ein Bereich der „genetischen Verantwortung“ ist die sogenannte Reproduktionsverantwortung; dies bedeutet die „Verhinderung von der Weitergabe genetischer Risiken“[330]. Diese Verantwortung beinhaltet die Sorge um gesunde Nachkommen. „Als ´verantwortlich´ erscheine die Vermeidung der Geburt vermutlich behinderter oder kranker Kinder“[331], was nur durch eine Abtreibung oder durch die Aufgabe des Kinderwunsches zu realisieren wäre.[332] Die Entscheidung bzw. Verantwortung für einen Schwangerschaftsabbruch liegt letztendlich bei den Eltern bzw. der Mutter. Die Verfahren pränataler Diagnostik werden als selbstverständlich und vor allem als vernünftig angesehen. Fürsprecher argumentieren in erster Linie damit, dass die Pränataldiagnostik wissenschaftliche Erkenntnisse liefere und dass zukünftiges „Leid“ vermieden werden könnte, sowohl bei zukünftigen PatientInnen als auch bei der Familie.[333]
Der Gynäkologe Jens Pagels drückt es folgendermaßen aus: „Im Falle einer tatsächlich vorliegenden Störung der Schwangerschaft übernimmt der Pränataldiagnostiker eine Lotsenfunktion.“[334] Die Entscheidung und vor allem die Verantwortung werden immer wieder auf die schwangere Frau abgewälzt. So bemerkt Pagels, dass die letztendliche Entscheidung für oder gegen Untersuchungen im Rahmen der pränatalen Diagnostik immer bei der werdenden Mutter selber liege. Weiter sagt er explizit, dass, nach einer entsprechenden Aufklärung über die „schwierige Situation“, die schwangere Frau auch selbst die Verantwortung übernehmen muss.[335]
Die Erziehungswissenschaftlerin Maria Wolf merkt dazu an, dass Reproduktionsmedizin und Humangenetik lediglich ihr Wissen zur Verfügung stellen, nicht aber die Verantwortung übernehmen. Es wird immer wieder betont, dass die Entscheidung letztendlich bei den Eltern liege. Wolf erläutert weiter, dass es eine Abgabe der Verantwortung durch die Wissenschaft gegeben hat, um sich von der Schuld des Nationalsozialismus zu befreien. Nicht jene, die das Wissen produzieren, sondern jene, die es anwenden, müssen daher die Verantwortung übernehmen.[336] „Eine ´verantwortete Forschung´, die Verantwortung auch von dem verlangt, der Wissen entwickelt, und nicht nur von dem, der es anwenden will oder soll, wurde bis heute nicht realisiert.“[337]
Schwangere Frauen, die sich dem Fortschritt der pränatalen Diagnostik entziehen, werden häufig als irrational verurteilt. Bereits die Möglichkeit eines „gesunden Kindes“ erzeugt einen sozialen Druck auf die Eltern. Reproduktionsmedizin und Humangenetik produzieren Bedürfnisse, die wiederum nur sie alleine befriedigen können. Durch die Etablierung der humangenetischen Familienberatung habe sich ein Beratungsmodell der „informierten Einwilligung“, der „informierten Zustimmung“ und der „nicht-direktiven Beratung“ durchgesetzt. Die Beratung soll zu einer „selbstbestimmten Entscheidung“ verhelfen. Die vermeintliche Entscheidungsfreiheit beinhaltet jedoch auch die Abwälzung der rechtlichen, ethischen und sozialen Verantwortung auf die Betroffenen. Das „Mehr“ an Selbstbestimmung und die Patientenrechte haben geradezu zu einer Entlastung der Medizin geführt.[338] „In der Verabsolutierung dieser Rechte liegt die Gefahr, dass sich die Medizin heute zunehmend auf Kosten der PatientInnen ihrer Verantwortung entledigt und damit entlastet.“[339] Diese „Verabsolutierung“, wie Wolf es nennt, ist sogar gesetzlich verankert. Im § 219 wird u.a. festgelegt, wie die „Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage“[340] ablaufen muss und dass die Betroffene selbst entscheiden muss. „Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen.“[341] Die Entscheidung muss die werdende Mutter alleine treffen. Das führt dazu, dass tatsächlich im Ernstfall die gesamte Verantwortung bei der Patientin liegt.
Aus der Angst heraus, eine Krankheit zu übersehen und rechtliche und finanzielle Konsequenzen zu erleiden, suchen Ärzte nach immer präziseren Untersuchungsmethoden, um Diagnosen stellen zu können.[342] Die Indikation wird zwar von einem Arzt gestellt, doch die werdende Mutter muss diese im Endeffekt selbst bewerten. Die schwangere Frau muss entscheiden, ob die Geburt eines „kranken“ Kindes für sie tragbar ist oder nicht.[343] „Die Medizin definiert und diagnostiziert, werdenden Müttern oder Eltern wird auf Grundlage dieses medizinischen Diagnosemonopols die Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes zugemutet.“[344]
Wolf spricht daher von einer „Dialektik der Freiheit“[345]. Einerseits wird den Frauen durch das Konzept der „informierten Zustimmung“ vorgetäuscht, dass sie selbst über ihren Körper entscheiden können, andererseits ist diese freie Entscheidung in letzter Konsequenz eine Entscheidung über Leben und Tod des eigenen Kindes. Die Medizin gibt damit die Verantwortung ab und hofft, sich somit von jeglicher „Schuld“ freisprechen zu können. Es bleiben den werdenden Müttern bei ihrer „freien“ Wahl nicht viele Alternativen.[346] So sagt Wolf beispielsweise, dass die Haupttätigkeit der Pränataldiagnostik bis heute in der „Verhinderung einer Geburt von Kindern mit Down-Syndrom“[347] liege.
Beim Thema Schwangerschaftsabbruch darf jedoch nicht vergessen, dass Frauen jahrzehntelang für dieses Recht gekämpft haben. Die Frauen wollten Selbstbestimmung und Autonomie erreichen und selber über ihren Körper entscheiden können. Der frühere Gebärzwang wurde durch die Fristenregelung aufgehoben und die sogenannten Stricknadelabtreibungen dadurch abgeschafft.[348] Es muss jedoch deutlich zwischen dem Recht auf eine Abtreibung in den ersten drei Monaten aus privaten Gründen (ohne jegliche eugenische Motivation) und der eugenisch motivierten Tötung eines lebensfähigen Fötus in der Spätschwangerschaft unterschieden werden.
Auch wenn Frauen autonomer entscheiden können, ob sie aus persönlichen Gründen die Schwangerschaft in den ersten drei Monaten abbrechen lassen, stellt sich die Frage, ob sie sich durch die Pränataldiagnostik nicht doch wieder in einer Zwangslage befinden – nur diesmal handelt es sich nicht um den Gebärzwang, sondern um den Zwang, Kinder mit Behinderung nicht auszutragen. Es ist der Zwang, unter allen Umständen ein „gesundes“ Kind zu gebären. Maria Wolf erläutert, dass schwangeren Frauen, die sich dem „Zwang zur medizinischen Kontrolle“[349] nicht fügen, oftmals vorgeworfen wird, ihre Kinder zu gefährden.[350]
Monika Hey, die selbst 1998 aus Unkenntnis einem Schwangerschaftsabbruch zustimmte und sich seitdem kritisch mit dem Thema Pränataldiagnostik beschäftigt, merkt ebenfalls an, dass Frauen durch die Pränataldiagnostik in eine neue Zwangslage gebracht werden. Hey stellt deshalb die Frage, ob eine Frau tatsächlich noch eine Wahl hat, wenn inzwischen bereits von allen werdenden Müttern erwartet wird, dass sie sich pränataldiagnostisch untersuchen lassen. Schon alleine der Begriff „Diagnostik“ sei nämlich trügerisch.[351] Das Dilemma besteht darin, dass zwischen den zur Verfügung stehenden diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten eine Diskrepanz besteht.[352] Von den etwa 70.000 invasiven pränataldiagnostischen Eingriffen, die jährlich in Deutschland durchgeführt werden, haben nur sehr wenige eine Therapie für das ungeborene Kind zur Folge. Zusätzlich werden 700 Fehlgeburten durch die invasiven Methoden in Kauf genommen. In einer Gesellschaft, in der alle optimal „funktionieren“ müssen, ist der Druck, dem ein Mensch mit Behinderung ausgesetzt ist, sehr hoch. So wird auch der Druck auf die werdenden Mütter erhöht.[353]
Hey resümiert daher folgendes: „Pränataldiagnostik stellt das Leben von Kindern infrage, die anders sind als die Norm. Und den Eltern wird zugemutet, eine Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes zu treffen. Das ist eine geradezu unmenschliche Anforderung.“[354] Weiter erklärt Hey, dass es inzwischen als naiv und verantwortungslos gilt, wenn eine Frau die Pränataldiagnostik nicht in Anspruch nimmt und ihr Kind keiner „Qualitätskontrolle“[355] unterzieht.
Ökonomisches Denken beherrscht inzwischen sehr viele Sphären unseres Lebens und beeinflusst die gesellschaftlichen Erwartungen an jeden einzelnen. So ist zu fragen, ob die werdende Mutter, die dem ökonomischen und dem sozialen Druck ausgesetzt ist, tatsächlich noch frei wählen kann. Bereits die Entscheidung für oder gegen pränatale Diagnostik wird stark beeinflusst, und der Frau wird die Verantwortung für eine eventuelle Tötung aufgebürdet.[356]
Um nun eine Entscheidung für oder gegen bestimmte Untersuchungen treffen zu können und die Verantwortung dafür zu übernehmen, müssen die schwangeren Frauen zunächst über Möglichkeiten, Risiken und Konsequenzen der Pränataldiagnostik Bescheid wissen. Im Rahmen einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in den Jahren 2003 und 2004 wurden „Daten zum Informationsstand und zu den Einstellungen schwangerer Frauen zur Pränataldiagnostik sowie deren Bewertung der ärztlichen Beratung und Behandlung erhoben“[357].
Die meisten der befragten Schwangeren (über 70 Prozent) hatten zusätzlich zu den drei empfohlenen Ultraschalluntersuchungen mindestens einen weiteren Ultraschall durchführen lassen, um Fehlbildungen auszuschließen. Über 40 Prozent der Befragten ließen auch die Nackenfaltenmessung durchführen. Eine Fruchtwasseruntersuchung haben vor allem Frauen ab 35 Jahren durchführen lassen. Jüngere haben hingegen eher nicht-invasive Verfahren in Anspruch genommen. Die Probandinnen wurden schließlich im Interview gefragt, ob sie wüssten, was „Pränataldiagnostik“ bedeute. Drei Viertel der Befragten antworteten mit „Ja“. Daraufhin wurden sie gebeten, „Pränataldiagnostik“ in einigen Worten kurz zu definieren bzw. zu erklären. Bei dieser Frage wurde deutlich, dass fast 40 Prozent der Frauen den Begriff falsch verstanden haben oder ihn erst gar nicht definieren konnten. Somit wusste etwa die Hälfte der schwangeren Frauen nicht, was unter Pränataldiagnostik zu verstehen ist, obwohl sie alle bereits in einer fortgeschrittenen Schwangerschaftsphase waren (20. bis 40. Woche).[358] In diesem Zusammenhang lässt sich die Frage stellen, wie diese Frauen überhaupt eine „informierte Entscheidung“ treffen konnten, die sie auch in Zukunft noch verantworten können.
Bei der Befragung der BZgA stellte sich ebenfalls heraus, dass Frauen durch Pränataldiagnostik eine Entlastung empfinden, aber gleichzeitig auch eine Belastung erfahren. Sie fühlen sich einerseits erleichtert durch die Aussicht auf eine ärztliche Bestätigung, dass das ungeborene Kind vollkommen gesund ist, und andererseits fühlen sie sich erdrückt durch das Risiko, dass man doch etwas finden könnte. Die pränatale Diagnostik löst somit ambivalente Gefühle bei den schwangeren Frauen aus. Die Frauen haben Angst davor, dass sie eine Entscheidung über Leben und Tod fällen müssen. Die Befragungsergebnisse haben schließlich gezeigt, dass die Frauen bei diesem ambivalenten Thema dazu tendieren, die Entscheidung für oder gegen Pränataldiagnostik an Fachleute abzugeben.[359] „Über die Hälfte der Schwangeren sagt, dass die Ärztin oder der Arzt ´sehr starken´ oder ´starken´ Einfluss auf die Entscheidung zur Durchführung von PND [Pränataldiagnostik] hatte.“[360]
Frauen verwechseln oftmals Pränataldiagnostik mit der allgemeinen Schwangerenvorsorge, bemerkt Monika Hey. Das Wissen über pränatale Diagnostik sei vorwiegend gering, und die werdenden Mütter würden sich meist erst über die Tragweite der Untersuchungsergebnisse bewusst, wenn es zu spät sei.[361] Auch bei der Befragung der BZgA wurde festgestellt, dass die Befragten zwar ausführlich über Ziel und Anlass der Untersuchungen aufgeklärt worden waren, nicht aber über die Sicherheit der Untersuchungsergebnisse oder über die Grenzen der Untersuchungsmöglichkeiten. Noch weniger Aufklärung gab es „über das psychische und ethische Konfliktpotenzial bei Vorliegen einer Behinderung des Kindes“[362] oder über die Alternativen zur Pränataldiagnostik. So wurde auch die Hälfte der Befragten erst gar nicht über die Möglichkeit einer weiterführenden psychosozialen Beratung informiert.[363]
Laut der Befragungsergebnisse sind Frauen nach einem „auffälligen“ Befund gut über die möglichen Ursachen der Entwicklungsstörung und über die Möglichkeit der Fortführung oder des Abbruchs der Schwangerschaft informiert worden. Allerdings wurden die Informationen zu den möglichen Folgen für sie und für ihre Familie von überwiegend „eher schlecht“ (36 Prozent) bis „schlecht“ (16 Prozent) eingestuft.[364] 71 Prozent der Frauen bemerkten zusätzlich, dass die Beratung über die „Möglichkeit der Vorbereitung auf ein Leben mit einem behinderten oder kranken Kind“[365] (sehr) schlecht war. Zusammenfassend kann daher gesagt werden:
„Zufrieden waren die Frauen mit der Beratung zu Themen, die definitiv in den medizinischen Bereich fallen. Defizite gibt es aus Sicht der Frauen, die einen auffälligen pränataldiagnostischen Befund hatten, auch hier hinsichtlich der Beratung bei Themen, die über das Medizinische hinausreichen.“[366]
Der Gynäkologe Klaus König weist darauf hin, dass zur Betreuung einer Schwangeren auch die Aufklärung über die Mutterschaftsvorsorge zählt. Die schwangeren Frauen müssen sich intensiv mit den pränataldiagnostischen Untersuchungsmethoden auseinandersetzen, denn schließlich, sagt König, „müssen die Mütter vollkommen allein entscheiden, wie sie mit dieser Statistik umgehen und welche Diagnostik sie in Anspruch nehmen wollen“[367]. Er erklärt, dass die Frauen ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, dem man jedoch nicht gerecht werden kann. Er warnt davor, Risikokalkulationen nicht mit Fehlbildungsdiagnostik zu verwechseln.[368] So ist beispielsweise auch das sogenannte „Frühscreening“, also die Nackenfaltenmessung und die damit verbundene Blutuntersuchung, keine vorgeburtliche Diagnose, sondern lediglich eine „Wahrscheinlichkeitsberechnung“ bzw. eine „Risikoabschätzung“.[369]
Die werdende Mutter erhält lediglich eine „Risikozahl“ (z.B. 1:500), die ihr aufzeigen soll, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt zu bringen. Das Problem hierbei ist, dass es eine „Falsch-positiv-Rate“ von über fünf Prozent gibt. Das heißt fünf von 100 Frauen wird mitgeteilt, dass bei ihnen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Down-Syndrom besteht, die sich jedoch im Verlauf weiterer Untersuchungen als falsch herausstellt. Auch kann der umgekehrte Fall eintreten und Frauen wird ein „Falsch-negatives-Ergebnis“ mitgeteilt. Diese Frauen lassen keine weiteren invasiven Untersuchungen durchführen und gebären doch ein Kind mit Down-Syndrom. Eine absolute Sicherheit gibt es somit nicht.[370]
Zudem fällt es einigen Frauen schwer, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, schließlich handelt es sich für sie um ihr zukünftiges Kind und nicht um eine statistische Größe. So kann man eine Wahrscheinlichkeit von 1:300, dass das Kind das Down-Syndrom haben wird, als ein Risiko von 0,3 Prozent mitteilen. Anders kann man auch sagen, dass in diesem Fall eine Wahrscheinlichkeit von 99,7 Prozent besteht, dass das ungeborene Kind kein Down-Syndrom hat. Die Formulierung der Mitteilung kann ausschlaggebend dafür sein, wie die zukünftige Mutter das Ergebnis aufnimmt – positiv oder negativ. Es wird deutlich, dass eine „von der medizinischen Praxis unabhängige Beratung“ vor und nach den Untersuchungen von Vorteil ist.[371]
Klaus König erklärt, dass sich das „Bild der Patientin“ gewandelt habe. Die Patientinnen wüssten immer mehr und informierten sich bereits im Vorhinein. „Ich mache nun 28 Jahre Praxis und habe Zeiten erlebt, wo ich der Entscheider war – das bin ich heute nicht mehr.“[372] Die Frage, ob die schwangeren Frauen nicht eine Verunsicherung erleben, weil sie sich mit den vielen diagnostischen Möglichkeiten befassen müssten, verneint König. Er meint, dass nur eine Verunsicherung bestünde, wenn sich die Patientin zu viel informiere oder wenn sie die Informationen „vom Intellekt her nicht verarbeiten kann“[373]. Es sei einfacher, wenn die Patientin ihn verstehe; schließlich müsse er über alle möglichen Angebote informieren.[374] Hier wird deutlich wie der Arzt die Verantwortung abgibt – er entscheidet nicht (mehr). Und das obwohl er einräumt, dass Patientinnen ihn nicht immer verstehen.
Claudia Schumann, Frauenärztin und Psychotherapeutin, betont, dass Pränataldiagnostik bereits mit dem ersten Ultraschall in der zehnten bis zwölften Woche beginnt. Daher müssten Frauen, die sich schon vorher informieren wollen und auch eine gewisse Bedenkzeit haben möchten, dies bereits in der achten oder neunten Woche tun. Eine ganzheitliche Aufklärung sei allerdings sehr schwierig und das Thema sei sehr weitreichend, so Schumann.[375] Pränataldiagnostik kann man „auch beim besten Willen kaum in der ganzen Fülle verständlich erklären und dann erwarten [...], eine Schwangere könne wirklich eine ´informierte Entscheidung´ fällen“[376]. Daher sei es verständlich, dass die meisten Frauen sich eine Entscheidungshilfe von ihrem Arzt erhoffen.
Wenn selbst Gynäkologen und Frauenärzte bemerken, dass es ein „Zu viel“ an Informationen geben kann und es eigentlich unmöglich ist, das gesamte Feld der Pränataldiagnostik verständlich zu erklären, dann können diese Ärzte nicht verlangen bzw. erwarten, dass Frauen alleine eine Entscheidung treffen und die Verantwortung für diese auch alleine tragen werden.
Zusätzlich stellt der Zeitpunkt der ersten pränataldiagnostischen Untersuchungen ein Problem dar: Die Nackenfaltenmessung wird um die zehnte Schwangerschaftswoche durchgeführt. Es handelt sich um einen Zeitpunkt, an dem die Frauen gerade erst sicher gehen können, dass sie schwanger sind. Die Realisierung der Schwangerschaft bzw. das Einstellen auf die neue Lebenssituation wird somit vom ersten Moment an von der Möglichkeit einer Behinderung des Kindes überschattet. Hildburg Wegener, Sprecherin des Netzwerks gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, erklärt, Frauen würden dadurch sofort zu Beginn der Schwangerschaft lernen, ihr ungeborenes Kind von außen mit einem beurteilenden Blick zu betrachten. Den Frauen sei zudem oft nicht klar, dass es keine Möglichkeiten der Therapie gibt, denn die Nackenfaltenmessung habe lediglich das Ziel, Ungeborene mit Fehlbildungen aufzuspüren.[377] „Sie nehmen das Angebot, durch den Test zu erfahren, ´ob ihr Kind gesund ist´, gerne an und glauben, das gehöre zu ihrer Verantwortung als Mutter.“[378]
Schwangere Frauen können sich bewusst gegen bestimmte Untersuchungen und gegen pränatale Diagnostik entscheiden. „Es besteht ein Konsens darüber, dass dem Recht auf Wissen gleichwertig ein Recht auf Nichtwissen gegenübersteht, was sich beispielsweise in der Ablehnung einer Ultraschalluntersuchung durch die Schwangere äußern kann.“[379] König sagt in diesem Zusammenhang, dass man es akzeptieren muss, wenn eine Frau nichts wissen möchte. Man müsse diese Frauen jedoch dennoch über die Konsequenzen aufklären, ohne ihnen allerdings einen Vorwurf zu machen. Die Frau müsse „eine bewusste, eine informierte Entscheidung“ treffen.[380]
Schumann erklärt, dass sie in ihrer Praxis nur wenige Frauen habe, die das „Recht auf Nichtwissen“ wahrnehmen. Manche von ihnen würden zudem im Laufe der Schwangerschaft immer wieder ein ungutes Gefühl bekommen, wenn man sie auf das Thema Pränataldiagnostik anspricht.[381] Denn, so Schumann, „sie ahnen: Wer keine PND [Pränataldiagnostik] macht und dann ein behindertes Kind bekommt, kann zu hören bekommen: ´So etwas muss es doch heute nicht mehr geben´“[382].
Es entsteht allerdings nicht nur ein Druck seitens der werdenden Mütter bzw. Eltern, sondern auch bei Ärzten. Pränataldiagnostik befindet sich in einem Spannungsfeld von Verantwortungsübernahme, ärztlicher Absicherung, informiertem Einverständnis und dem Verkauf von IGeL-Leistungen. Schwangere Frauen befinden sich durch die pränatale Diagnostik in einem Feld, das einerseits von Selbstbestimmung und gleichzeitig auch von der Abgabe von Verantwortung gekennzeichnet ist. Zum einen existiert ein festgeschriebenes System von Untersuchungen, zum anderen muss die „mündige Patientin“ eine informierte Entscheidung treffen. Dieses Spannungsfeld stellt auch die Ärzte vor ein Problem.[383] „Für Arzt und Ärztin bedeutet es eine Gratwanderung zwischen dem Wunsch, fürsorgend für die Schwangere da zu sein und der ihnen zugeschobenen Verantwortung für ein gesundes Kind, von der sie sich durch umfassende Aufklärung entlasten müssen.“[384]
So bemerkt auch Claudia Schumann, dass der Druck auf Frauenärzte durch die pränatale Diagnostik spürbar gewachsen ist. Die Qualität der Ultraschallgeräte beispielsweise und die Möglichkeiten der Beurteilung des Fötus seien immer weiter entwickelt worden und die Gynäkologen müssten ihre Praxen immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen, was sich als extrem schwierig erweise. Oft befinde sie sich in einem Dilemma: Einerseits wolle sie Schwangerschaften nicht unnötig als Risikoschwangerschaften einstufen, andererseits übernehme sie eine enorme Verantwortung, dass im weiteren Verlauf tatsächlich keine Fehlbildungen vorliegen und der Fötus sich „normal“ entwickelt.[385]
Mögliche haftungsrechtliche Konsequenzen üben zusätzlichen Druck auf die Ärzte aus. Die Möglichkeit, immer mehr zu sehen, wird zunehmend als „normal“ fingiert und dadurch von Frauen verstärkt eingefordert. „Insgesamt geht vielerorts der Trend dahin, alle Schwangeren für die ausführlichen Ultraschalluntersuchungen gleich in eine spezialisierte Praxis zu schicken, zumal damit auch der juristische Druck wegfällt.“[386]
Der Frauenarzt Klaus König erläutert, es komme allerdings auch schnell zur Benennung „Risikoschwangerschaft“, weil die anzukreuzenden Felder im Mutterpass sehr unpräzise sind. So gibt es den Punkt „Allergie“, der nicht genau unterteilt ist. Beim Ankreuzen von „Allergie“ kann es sich sowohl um für die Schwangerschaft relevante Allergien handeln als auch um nicht-relevante, wie beispielsweise eine Erdbeeren-Allergien. In der Statistik taucht schließlich jedoch auch die Schwangerschaft mit der nicht-relevanten Allergie als sogenannte Risikoschwangerschaft auf. Weiter verdeutlicht König, dass den Ärzten oft vorgeworfen wird, dass sie aufgrund der vorgeschriebenen Aufklärung Schwangerschaften zum Risiko machten. Dabei sei zu bedenken, dass im Mutterpass und den Mutterschaftsrichtlinien genau vermerkt sei, was gemacht werden müsse und dass die Ärzte sich lediglich daran hielten. Deshalb kläre er die Patientin über alle Möglichkeiten auf, damit sie dann selber entscheiden könne und abschließend ihm eine Bestätigung unterschreibt, dass sie jegliche Informationen erhalten und zur Kenntnis genommen habe. Abschließend betont König, dass die Entscheidung letztlich allein bei der Patientin liege und dass ihre Autonomie entscheidend sei.[387]
Es wird deutlich, dass die werdende Mutter durch die schriftliche Bestätigung, alle Informationen erhalten zu haben, wiederum die Verantwortung alleine tragen muss. Der Arzt möchte sich vor möglichen juristischen Konsequenzen schützen und hält sich deshalb an vorgegebene Klassifikationsdokumente (wie den Mutterpass). Er übergibt der schwangeren Frau jegliche Verantwortlichkeit.
So stellt sich die Frage, ob nicht auch ein Druck für die Frau entsteht, dennoch von pränataler Diagnostik Gebrauch zu machen, wenn sie unterschreiben muss, dass sie diese nicht möchte. Es wird eine Normalität suggeriert, welche die werdende Mutter durch ihre Unterschrift ablehnt, was schließlich zu einer Verunsicherung führen kann.
Der Bund Deutscher Hebammen berichtet, dass Frauen durch immer mehr und immer frühere Diagnostik große Verunsicherungen erleben, da sie sich unter Druck gesetzt fühlen, die Angebote der Pränataldiagnostik wahrzunehmen.[388] Denn: „Frauen befürchten, für die Geburt eines behinderten Kindes verantwortlich gemacht zu werden und ´selbst schuld´ zu sein.“[389]
Abschließend lässt sich feststellen: „An der Entscheidung für oder gegen PND kommt heute keine schwangere Frau vorbei.“[390] Die Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik wird heutzutage als ein Teil der elterlichen Verantwortung verstanden. Dies beruht einerseits auf der technischen Machbarkeit und andererseits auf der verbreiteten Angst vor einem Kind mit Behinderung. Pränatale Diagnostik wird von Gesellschaft und Medizin als „verantwortliches Handeln“ in der Schwangerschaft suggeriert.[391] Somit bringt Pränataldiagnostik die Eltern in eine Zwangslage, der sie nicht entkommen und in der sie keine autonome Entscheidung treffen können.
4.2 Schwangerschaft als Risiko[392]
Die kulturelle Sichtweise auf eine Schwangerschaft hat sich stark verändert, seitdem immer mehr die Gynäkologen und immer weniger die Hebammen diesen Verantwortungsbereich innehaben. Der Blick wird zunehmend auf den „riskanten biologischen Zustand“[393] gerichtet, welcher von der Medizin kontrolliert werden muss. Die werdende Mutter wird nicht mehr begleitet und unterstützt, sondern durch die nach Risiken fahndende Pränataldiagnostik auf ihre körperlichen Funktionen und biologischen Vorgänge reduziert, betont die Sozialwissenschaftlerin Eva Schindele. „Die Angst vor den Risiken hat die gute Hoffnung verdrängt.“[394] Maria Wolf spricht ebenfalls von einem Wahrnehmungswandel der Schwangerschaft durch die medizinische Schwangerenvorsorge. Ging es früher noch um die Feststellung der Schwangerschaft an sich, liegt heute das Hauptaugenmerk auf der Fahndung nach Missbildungen.[395]
Der Bund Deutscher Hebammen macht seinen Standpunkt bezüglich der Konsequenzen dieser „risikoorientierten Schwangerenvorsorge“[396] deutlich.
„Wir beobachten, dass der lebendige Prozess der Schwangerschaft mit seinen körperlichen, seelischen und sozialen Anteilen immer mehr zu einem überwachungspflichtigen Produktionsprozess wird. Der medizinische Umgang mit dem sich entwickelnden Kind wird zur Qualitätskontrolle, die schwangeren Frauen die technische Machbarkeit von gesunden Kindern vortäuscht.“[397]
Einerseits verbreitet die moderne Medizin Angst und Panik; gleichzeitig verspricht sie eine scheinbare Sicherheit und ein „gesundes“ Kind, solange schwangere Frauen das große Spektrum ärztlicher „Fürsorge“ in Anspruch nehmen. Werdende Mütter haben Angst davor, während der Schwangerschaft etwas falsch zu machen und begeben sich daher in medizinische Obhut. Schindele konstatiert in diesem Zusammenhang eine „Enteignung der Schwangerschaft durch die Medizin“[398]. Auch die Sichtweise auf den Körper der schwangeren Frauen hat sich verändert. Werdende Mütter sind sowohl körperlich als auch seelisch bei der Fahndung nach „kranken“ Kindern gefordert.
„Alle Ideen von dem heilen, möglicherweise auch perfekten Kind machen manchmal vergessen, daß das Kontrollieren der Qualität des Fötus nur über und durch den weiblichen Körper möglich ist: Schwangere Frauen bürgen mit ihrem Leib für dieses ´Kind im Bauch´, sie bangen und hoffen; sie sind es, die möglicherweise gezwungen sind, ihr ´Wunschkind´ tot zu gebären, und sie sind es auch, die mit Tränen und Verzweiflung eine solche Trennung verarbeiten müssen.“[399]
Eva Schindele erklärt, dass für Frauen die Schwangerschaft zu einem körperlichen Prozess zusammengeschrumpft ist, da die Medizin nur noch Szenarien von einem risikobehafteten Zustand verbreitet. Werdende Mütter haben die „Rolle des ´Produktionsapparates´“[400], der vom „medizinischen TÜV“[401] geprüft wird, weitestgehend akzeptiert. Durch die Sichtweise der Pränataldiagnostik, dass es ständig zu Komplikationen kommen kann, fühlen die Frauen sich „für die Auslieferung eines qualitativ guten ´Produktes´ verantwortlich“[402], so Schindele.
Das Leben von Kindern, die nicht der Norm entsprechen, wird in Frage gestellt und zukünftigen Eltern wird zugemutet, eine Entscheidung über Leben und Tod zu treffen. Monika Hey hebt den unmenschlichen Charakter dieser Anforderung hervor.[403] Die Schwangerschaft sei eine hochsensible Zeit, in der sich seelisch und körperlich vieles bei der werdenden Mutter verändert. Die Frau müsse zunächst realisieren, dass sie schwanger ist und sich darauf einstellen. Werdende Eltern müssten daher bereits vor der Schwangerschaft Informationen zum Thema Pränataldiagnostik erhalten. Sie sollten sich nicht erst während der Schwangerschaft mit den Möglichkeiten und vor allem den Konsequenzen auseinandersetzen müssen. So betont auch Monika Hey, dass die Aufklärung über die Risiken der Pränataldiagnostik während der sensiblen Zeit der Schwangerschaft viel zu spät erfolge.[404]
„Während es für die meisten Schwangeren heute selbstverständlich ist, die Angebote der Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, ist ihnen die Tragweite der Entscheidung für diese Art von Vorsorge meistens nicht bewusst. Worauf sie sich eingelassen haben, erfassen viele erst dann, wenn es zu spät ist. Dann, wenn ihre Kinder schon vor der Geburt in diagnostische Schubladen gesteckt werden. Und natürlich vor allem dann, wenn das Leben ihres Kindes infrage gestellt wird, weil es nicht der Norm entspricht.“[405]
Eva Schindele kritisiert, wie Frauen „in guter Hoffnung“ sich in einem Durcheinander von angeblichen Komplikationen und Risiken befinden, die sie selber meist gar nicht mehr überschauen können. Allen schwangeren Frauen werde eine Situation aufgedrängt, in der sie und ihr ungeborenes Kind von einem genetischen Risiko bedroht seien. Dieses suggerierte Risiko gelte es dann wieder auszuschließen, entsprechend der behaupteten Machbarkeit mit Hilfe pränataldiagnostischer Techniken. „In guter Hoffnung sein ist aus der Mode gekommen. [...] Deshalb neigen manche dazu, vorsichtshalber einfach alles wahrzunehmen, was die Medizin ihnen offeriert; so, glauben sie, könnten sie ihrem Wunsch nach einem gesunden Kind näher kommen.“[406]
In der sensiblen Zeit der Schwangerschaft ist diese Reaktion jedoch nicht verwunderlich, sagt Schindele. Die Frauen möchten sich „anlehnen“ können, unterstützt wissen und nicht ständig Entscheidungen treffen müssen. Doch genau das verlangt die Pränataldiagnostik von werdenden Müttern. Sie müssen entscheiden, welche Untersuchungen sie wahrnehmen und welche nicht, und in letzter Konsequenz müssen sie sich schließlich für oder gegen ihr Kind entscheiden.
Schwangere Frauen werden ständig verunsichert und hören dadurch immer weniger auf ihr eigenes „Bauchgefühl“. Der eigenen Körperwahrnehmung und Intuition wird misstraut. Stattdessen wird dem Urteil des Arztes und den Untersuchungsergebnissen vertraut. Schindele resümiert: „Das Wissen um Risiken ersetzt das Wissen um sich selbst und das Ungeborene.“[407]
Manche Ärzte, die Ultraschall-Screenings anbieten, sind beispielsweise der Meinung, dass allen schwangeren Frauen die Nachteile genannt werden müssen, wenn sie sich gegen die pränataldiagnostischen Untersuchungen entscheiden. Denn nicht die möglichen Folgen der Untersuchungen, sondern die Folgen der Unterlassung der Untersuchungen seien nicht ausreichend bekannt. Schließlich gebe es keine Schwangerschaft ohne Risiko.[408]
„Mit dem Argument, es gibt keine Nicht-Risiko-Schwangerschaft, müssen nach ihrer Einschätzung allen Schwangeren neben der Beratung über die Ultraschalluntersuchungen schon mit Beginn der Schwangerschaft gezielt weiterführende Ultraschalluntersuchungen angeboten werden.“[409]
Werdende Mütter werden durch solche Meinungen von Ärzten nochmals in ihrer Verunsicherung bestärkt. Die Angst, etwas falsch zu machen, wird durch die ständige Fokussierung auf Risiken immer präsenter.
Der Bund Deutscher Hebammen möchte werdende Mütter daher unterstützen und sie darin bestärken, wieder auf ihr „Bauchgefühl“ zu hören. Der Prozess der Schwangerschaft sollte nicht von einer rein medizinischen, nach Risiken fahndenden Sichtweise überschattet werden.[410]
„Wir Hebammen wollen Frauen in der Auseinandersetzung mit Pränataler Diagnostik bestärken, ihren eigenen Blick auf ihre Schwangerschaft, ihre Ethik, Haltungen und Gefühle ernst zu nehmen. Wir ermutigen Frauen, sich von einer einseitig medizinisch-technischen Sichtweise des Lebensabschnittes Schwangerschaft / Geburt abzugrenzen. Wir wünschen uns, dass sich Frauen in die gesellschaftliche Diskussion um Pränatale Diagnostik aktiv einmischen.“[411]
Durch die verschiedenen pränataldiagnostischen Untersuchungen wird die Bindung zwischen Mutter und Kind massiv beeinflusst. Schindele sagt, dass die schwangeren Frauen ihr Ungeborenes nicht mehr bedingungslos annehmen. Erst nach einem unauffälligen Befund würden sie es zu „ihrem Baby“ machen. „Dazu gibt es mit zunehmenden Diagnoseverfahren immer mehr ´Qualitätsstandards´, die scheinbar erfüllt sein müssen, um dieses heranwachsende Wesen auch akzeptieren zu können.“[412]
In der „Zeit der körperlichen Umstellungen“ sollten eigentlich das ungeborene Kind, die „Umwandlung zur Mutter“ und die Vorfreude im Vordergrund stehen. Doch das Abwägen von Vor- und Nachteilen der verschiedenen pränataldiagnostischen Untersuchungsmöglichkeiten überschattet bereits den Beginn der Schwangerschaft. „Frauen spüren, daß sich zwischen sie und das potentielle Kind das nüchterne Kalkül einer selektierenden Medizin drängt.“[413] Die Pränataldiagnostik stellt eine „Schwangerschaft auf Probe“[414] her und verändert grundlegend das Erleben der Schwangerschaft und die Bindung zwischen Mutter und Kind.
Hebammen erleben diese Veränderungen durch die Pränataldiagnostik mit und stehen ihr kritisch gegenüber: „Im Prozess der Diagnostik erleben Frauen emotionale und soziale Veränderungen, die ihre Schwangerschaft erheblich beeinträchtigen: ein ´Schwangersein auf Probe´, eine Störung der sich entwickelnden Mutter-Kind-Beziehung.“[415] Die „Enteignung der Schwangerschaft durch die Medizin“[416], wie Eva Schindele es nennt, ist so weit fortgeschritten, dass schwangere Frauen automatisch den Blick der Medizin auf ihre eigene Schwangerschaft übernehmen.
„Schwangere wissen intuitiv, daß es ihrem Kind im Leib dann gut geht, wenn sie sich wohl fühlen in der eigenen Haut. [...] Frauen möchten die Schwangerschaft als lebensfrohen und schöpferischen Prozeß erleben. Aber um das zu können, müssen sie zunächst einmal den medizinischen Risikoblick hinterfragen, denn sie haben die Bilder und Definitionen der Medizin inzwischen übernommen.“[417]
Doch allzu oft misstrauen Frauen ihrer Intuition. Sie überschätzen das „genetische Risiko“; gerade Frauen die älter sind als 35, so Schindele. Die werdenden Mütter greifen in ihrer Angst nach jedem Strohhalm – in diesem Fall ist der Strohhalm die Pränataldiagnostik. Durch die pränataldiagnostischen Untersuchungen können Risiken ausgeschlossen werden, so die Annahme. Diese Idee übernehmen die schwangeren Frauen von den Ärzten, wodurch die Verbreitung der Untersuchungen wiederum vorangetrieben wird. Es ist ein Kreislauf von Angebot und Nachfrage.
„Sehr deutlich wird dieser Zusammenhang, wenn man den Aufstieg der Humangenetik nachvollzieht. Wer hat in den siebziger Jahren schon von genetischen Risiken gesprochen? Irgendwann wurde die Fruchtwasseruntersuchung eingeführt, und die Humangenetiker starteten regelrechte Kampagnen, um den Menschen die Begrifflichkeiten überhaupt zu erklären. [...] Hat man ein diagnostisches Verfahren erst einmal in einer vermeintlichen Risikogruppe etabliert, kann man es bald auch auf andere Schwangerengruppen ausweiten. Dieser Prozeß ist zur Zeit bei der Pränataldiagnostik zu beobachten, das heißt, im Moment lernen alle Schwangeren, daß sie beziehungsweise ihr Kind von einem genetischen Risiko bedroht sind, welches sie (natürlich nur, wenn sie wollen) ausschließen lassen können.“[418]
Der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker spricht in diesem Zusammenhang von „einer Art Embryonen-TÜV“[419], der heutzutage existiert. Die Pränataldiagnostik hat sich weit von der einstigen Kontrolle besonderer Risikoschwangerschaften entfernt. Spieker fasst daher zusammen: „Hand in Hand mit der Verbreitung der Vorstellung, es gäbe ein Recht auf ein gesundes Kind, ja eine Pflicht gegenüber der Wellness-Gesellschaft, die Geburt behinderter Kinder zu vermeiden, ist sie zum Hauptgrund der Spätabtreibungen geworden.“[420]
4.3 „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“[421]
„Neuer Bluttest droht die vorgeburtliche Selektion von Menschen mit Down-Syndrom zu perfektionieren.“[422] Mit diesem Satz betitelt das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ 2012 seine Stellungnahme zur Markteinführung des „PraenaTests“. Die Pressemitteilung des Netzwerkes ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Test und seinem selektiven Charakter.
Unter dem Namen „Kritische Information und Beratung zu Pränataldiagnostik“ wurde das Netzwerk 1994 in Frankfurt gegründet. Drei Jahre später änderte die Vereinigung ihren Namen in „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“, da der Aspekt der Selektion betont werden sollte. Das Netzwerk dient zum Austausch von Erfahrungen u.a. für BeraterInnen, Hebammen, ÄrztInnen und auch MitarbeiterInnen aus dem psychosozialen Bereich. Das Netzwerk möchte „eine öffentliche Gegenstimme zur rasanten Entwicklung der Medizintechniken“[423] sein.
Durch Stellungnahmen, Gremienarbeiten und Materialien soll die kritische Haltung gegenüber der Pränataldiagnostik begründet werden und auf die selektiven Absichten sowie die damit verbundenen Risiken aufmerksam gemacht werden. „Die unterschiedlichen Gruppen des Netzwerkes einigt die grundsätzlich kritische Haltung gegenüber Pränataldiagnostik mit ihren selektiven Absichten und Zielrichtungen und dem am Risiko orientierten Umgang mit Frauen, die schwanger sind, waren oder werden wollen.“[424]
Als im Jahr 2012 der „PraenaTest“ auf den Markt kommen soll, erklärt das Netzwerk in einer Pressemitteilung zunächst das Verfahren des Bluttests und stellt die Argumentation der Hersteller und Befürworter dar. Die Entwicklung der neuen nicht-invasiven Pränataldiagnostik sei damit begründet worden, dass der Bluttest zu einem früheren Zeitpunkt in der Schwangerschaft eine sichere Diagnose geben könne. Dadurch könne auch ein Schwangerschaftsabbruch früher durchgeführt werden. Das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ argumentiert u.a. wie folgt gegen den „PraenaTest“:
„Der Test ist der letzte Schritt einer Entwicklung vorgeburtlicher Diagnostik, mit der zunächst in wenigen, schweren Ausnahmefällen die Geburt von Kindern mit schwer wiegenden genetischen Auffälligkeiten verhindert werden sollte und die heute zur Routine in der Schwangerenvorsorge geworden ist.“[425]
Das ursprüngliche Ziel, Frauen in seltenen Extremfällen eine Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob sie ein Kind mit einer schweren Behinderung bekommen möchten, sei längt vergessen, so das Netzwerk. Die Entwicklung der Untersuchungsmethoden in der Pränataldiagnostik ist rasant und vor allem rasch zur Routine in der Schwangerenvorsorge geworden. Wurde in den 1970er Jahren die Amniozentese entwickelt, folgte bereits in den 1980er Jahren die Chorionzottenbiopsie als weitere Untersuchungsmethode. Kurz darauf kamen der sogenannte Tripletest und Ende der 1990er Jahre schließlich die Nackenfaltenmessung hinzu. Die Verfahren wurden jeweils schnell zu Routinechecks und bleiben nunmehr nicht allein „seltenen Extremfällen“ vorbehalten. Der Bluttest ist nun die Perfektionierung der selektiven Tests, so das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“.
Ein weiterer Kritikpunkt gegen den Bluttest ist die damit verbundene Diskriminierung von Menschen mit Down-Syndrom. Der Test verfestige Vorurteile, obwohl das Grundgesetz Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen verbiete. Damit verstößt der Test gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, erklärt das Netzwerk. Das Recht eines jeden Menschen auf Inklusion und Förderung werde somit missachtet: „Menschen mit Down-Syndrom leiden nicht am Down-Syndrom, sondern an der gesellschaftlichen Diskriminierung.“[426]
Schließlich sei der Bluttest nur ein weiterer Schritt in die Richtung einer „routinisierten Frühselektion von ungeborenen Kindern, die nicht der genetischen Norm entsprechen“[427]. Das Netzwerk erklärt deutlich: „Die Nicht-invasive pränatale Diagnostik ist rein selektiv. Andere Handlungsoptionen als die Entscheidungsmöglichkeit, im Falle eines Befundes die Schwangerschaft abzubrechen, gibt es nicht.“[428]
Das Argument, dass die Diagnose „Down-Syndrom“ nicht zwangsläufig zum Schwangerschaftsabbruch führt, sondern die werdenden Eltern lediglich auf die neue Situation vorbereitet, sei vorgeschoben, denn dann müssten die Eltern die Diagnose „Down-Syndrom“ nicht zu einem so frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft erhalten. Sie könnten abwarten, ob beispielweise bei den Ultraschalluntersuchungen „Auffälligkeiten“ zu sehen sind. Das Netzwerk betont, dass die meisten Eltern sich für einen Schwangerschaftsabbruch nach der Diagnose „Down-Syndrom“ auch zu einem bereits fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Schwangerschaft entscheiden. Ein Schwangerschaftsabbruch sei daher nach einem Bluttest zwangsläufig die Konsequenz, da zu einem so frühen Zeitpunkt beispielsweise die Bindung zwischen Mutter und Kind noch nicht ausgeprägt ist. Daher kann es passieren, dass die Entscheidung für einen Abbruch in der 13. Schwangerschaftswoche oder früher der Mutter bzw. den Eltern leichter fällt. Auch die Statistiken sprechen dafür, erklärt das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“:
„Das Down-Syndrom gehört schon heute zu den Merkmalen, aufgrund derer Menschen vor der Geburt am häufigsten aussortiert werden. Die wenigen statistischen Daten in Deutschland deuten daraufhin, dass in neun von zehn Fällen ein vorgeburtlicher Befund eines Down-Syndroms in einen Schwangerschaftsabbruch mündet.“[429]
So werden Eltern, die bereits ein Kind mit Down-Syndrom haben, durch die vielen Untersuchungsmöglichkeiten mit der Frage konfrontiert, „ob sie das nicht hätten vermeiden können“[430]. Der Bluttest wird diese Auseinandersetzung noch mehr forcieren und den allgemeinen Druck auf Eltern verstärken.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Bluttest eröffnet „die medizintechnische Option für eine neue, scheinbar freiwillige, tatsächlich aber durch soziale Zwänge bestimmte Eugenik. Er wirft in aller Schärfe die Frage auf, was unsere Gesellschaft gegen eugenische Ziele, Praktiken und Wirkungen zu tun gedenkt.“[431]
Die Hemmschwelle für die Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik und einen eugenisch motivierten Schwangerschaftsabbruch wird durch den Test sehr weit herunter gesetzt. War die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen durch invasive Untersuchungsmethoden bisher größer als die Wahrscheinlichkeit, dass das Ungeborene tatsächlich beispielsweise das Down-Syndrom hat, haben Eltern bislang vielleicht eher auf Tests verzichtet. Der „PraenaTest“ allerdings ist „ungefährlich“, da er nicht-invasiv wirkt. Dennoch stellt er ein hohes Risiko für das Ungeborene dar, denn: „Es besteht unmittelbar die Möglichkeit, alle Schwangeren auf das Vorliegen eines Down-Syndroms zu testen und somit alle betroffenen Schwangeren vor die Entscheidung über einen Abbruch der Schwangerschaft zu stellen.“[432]
Das „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ fordert daher, dass der Bluttest nicht zum festen Bestandteil der allgemeinen Schwangerenvorsorge werden darf, denn er fördere aktiv die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Pränataldiagnostik wird in diesem Zusammenhang zu einer gesellschaftlichen Praxis, die aktiv die Diskriminierung, Ausgrenzung und vor allem Selektion von Menschen mit Behinderung vorantreibt, ohne in Frage gestellt zu werden.
4.4 Spätabtreibung nach pränataler Diagnose[433]
„Der Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik eines erkrankten oder behinderten Kindes stellt das unvollkommene Bemühen dar, eine im Kern nicht auflösbare Konfliktsituation zu beenden.“[434]
Pränataldiagnostik dient nicht der Vorsorge und nur sehr selten der Therapie kindlicher Erkrankungen. Der Bund Deutscher Hebammen ist daher der Meinung, dass das einzige Ziel die Selektion von Ungeborenen mit „abweichendem“ Befund ist. Es existiert keine Therapie für genetische Abweichungen und in der Regel führt eine solche Diagnose zum Schwangerschaftsabbruch. Die Hebammen erleben mit welche emotionalen Folgen diese Abbrüche für die Betroffenen haben.[435]
„Hebammen begleiten seit Jahren die dunkelste Seite von Pränataler Diagnostik, den Schwangerschaftsabbruch durch Geburtseinleitung. Am Ende der Kette der Diagnostik ohne Therapiemöglichkeit stehen die betroffenen Frauen, Paare und Kinder. Wir wissen um die Traumatisierung dieser Frauen, um die Auswirkungen der Traumata auf ihre Gesundheit, auf folgende Schwangerschaften und Geburten.“[436]
Abtreibungen aufgrund der Diagnose einer Behinderung nach Pränataldiagnostik sind bis zum Zeitpunkt der Geburt legal. Bei diesen Spätabtreibungen handelt es sich um eingeleitete Frühgeburten, bei denen die Frauen das Kind auf „natürliche Weise“ zur Welt bringen. Die „üblichen Abtreibungsmethoden“[437], wie beispielsweise Absaugen, reichen zu einem so späten Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht mehr aus.
Um eine Spätabtreibung einzuleiten, verabreichen die Ärzte Medikamente, die eine Geburt einleiten. Diese Wehen auslösenden Hormone heißen Prostaglandine. Im Verlauf dieser „eingeleiteten Geburt“ stirbt der Fötus in der Regel aufgrund der Enge des Geburtskanals und der noch nicht vollkommen entwickelten Widerstandskraft des kindlichen Schädels. Die Spätabtreibungen dauern meist mehrere Tage oder manchmal auch mehr als eine Woche und sind äußerst schmerzhaft. Die Mütter erhalten häufig keine Narkose, „weil sie an der tödlichen ´Frühgeburt´ aktiv mitwirken müssen“[438]. Dadurch können die Frauen „den Todeskampf ihres Kindes qualvoll spüren“[439].
Spätabtreibungen sind grauenvolle Vorgänge, erklärt der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker, da nicht selten Kinder getötet werden, die bereits außerhalb des Mutterleibs lebensfähig gewesen wären. Zudem gibt es Fälle, wo Kinder den Schwangerschaftsabbruch überlebt haben. „Die Lebendgeburt wird aus ärztlicher Sicht zur besonderen ´Komplikation´ einer Spätabtreibung.“[440]
Ein Fall, der Aufsehen erregte, ereignete sich im April 1999 in Zittau (Deutschland), wo ein Kind in der 29. Schwangerschaftswoche abgetrieben wird. Das Kind überlebt, woraufhin der Chefarzt der Frauenklinik das Kind erstickt, indem er Mund und Nase zuhält. Der Arzt wurde 2002 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.
Wenn ein Arzt sicher sein möchte, dass das Kind nicht lebend zur Welt kommt, vollzieht er einen sogenannten Fetozid vor der Geburt. Bei diesem Verfahren wird der Fötus bereits im Mutterleib mittels einer Kalium-Chlorid-Spritze in das Herz des Kindes oder in die Nabelschnurvene getötet. Durch diese Prozedur wird das letzte „Risiko“ einer Lebendgeburt vermieden.
„Der Fetozid, die Tötung des Kindes im Mutterleib durch eine Kalium-Chlorid-Spritze ins Herz, ist inzwischen besonders bei Spätabbrüchen nach der zwanzigsten Woche üblich. Frühgeborene sind, wie auch die Erfahrung bei Spätabbrüchen zeigt, bereits ab der zweiundzwanzigsten Schwangerschaftswoche außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig. Deshalb wird oft zur Vorbeugung ein lebensfähiges, aber behindertes Kind vor der Abtreibung mit einer Spritze ins Herz getötet. Diese Maßnahme ist rechtlich bis zum Einsetzen von Eröffnungswehen erlaubt, da erst mit Beginn des Geburtsvorgangs das Ungeborene juristisch als Mensch gilt.“[441]
Die Kinder, die bei Spätabbrüchen abgetrieben werden, sind meist außerhalb des Mutterleibs bereits lebensfähig. So kommen amerikanische Studien zu dem Ergebnis, „daß bei Abtreibungen jenseits der 25. Woche eine Überlebenswahrscheinlichkeit von rund 80% besteht“[442]. Der Bund Deutscher Hebammen kritisiert den Fetozid daher auch als ethisch nicht vertretbar. „Wir erleben den seit 1995 verstärkt betriebenen Fetozid (intrauterine Tötung des Kindes) [...], als eine für uns unerträgliche Zuspitzung der ethischen Problematik Pränataler Diagnostik.“[443]
Der Fetozid ist die Möglichkeit des Arztes, sich vor den rechtlichen Konsequenzen einer misslungenen Abtreibung zu schützen. Denn der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Ärzte nach einem misslungenen Schwangerschaftsabbruch den „Unterhaltsaufwand“ ersetzen und der Mutter Schmerzensgeld zahlen müssen. Der Bundesgerichtshof legte allerdings auch fest, „´das[s] nicht das Kind der Schaden sei´“[444], sondern die für die Eltern entstehenden „´wirtschaftlichen Nachteile´“[445].
Die umstrittenste Methode einer Spätabtreibung, bei der eine Lebendgeburt verhindert werden soll, ist die „Partial Birth Abortion“, die „Teilgeburtsabtreibung“. Bei dieser Prozedur wird das Kind mittels Zange so weit aus dem Geburtskanal gezogen, dass der Nacken sichtbar wird. Dann wird mit einem chirurgischen Instrument ein Loch in den Hinterkopf gestoßen, um das Gehirn des Kindes durch einen Katheter abzusaugen. Während dieses Geburtsvorgangs kann das Kind bereits mit Armen und Beinen strampeln, wenn es nicht zuvor narkotisiert wurde. Nachdem das Kind „gezielt umgebracht worden [ist], wird die Abtreibung vollendet“[446].
Diese Methode haben amerikanische Ärzte Anfang der 1990er Jahre entwickelt. In einem Lehrbuch von 1992 wird die Methode mit „Dilation and Extraction“ betitelt, was auf Deutsch „Ausweiten (den Gebärmutterhalskanal) und Herausziehen (den Fötus)“[447] bedeutet. Ihre Verteidiger sehen in dieser Methode für Spätabtreibungen auch einige Vorteile:
„Erstens bleibe dem abtreibenden Arzt die Zerstückelung des Babys erspart, die angesichts der Zähigkeit des fetalen Gewebes jenseits der 20. Woche oft schwierig sei. Zweitens verlagere diese Methode die emotionale Last einer Abtreibung, unter der die Mütter oft schwer zu leiden hätten, auf den Arzt, und drittens sei diese Methode auch ökonomischer, weil die Mutter die Klinik noch am gleichen Tag wieder verlassen könne.“[448]
In den USA breitete sich der Widerstand gegen die „Teilgeburtsabtreibung“ sehr schnell aus. Schließlich brachte die Methode das ans Tageslicht, „was bei allen anderen Abtreibungsmethoden im Verborgenen geschieht: daß Abtreibung die gezielte Tötung eines Kindes, mithin Mord ist“[449]. Der Senator Sam Brownback stellt fest, dass man es niemals erlauben würde, Hunde so zu behandeln, wie Kinder bei Spätabtreibungen behandelt würden.
Doch nicht nur in den USA sind die Methoden brutal, auch in Deutschland haben sich bereits grausame Fälle ereignet. Frauenärzte berichten in Fachzeitschriften, dass Kinder „liegengelassen“ wurden, um ihren Tod abzuwarten. In Kliniken sei es schon vorgekommen, „dass ´aus Versehen lebend geborene Kinder durch Nichtversorgung sterben gelassen werden´“[450]. So soll eine Ärztin gesagt haben: „´Das ist der berühmte Schuhkarton auf der Fensterbank´“[451]. Eine Kinder- und Frauenärztin habe daraufhin noch ergänzt: „´Kühlschranktür auf, Kind rein, Kühlschranktür zu. Da hört man es dann nicht mehr wimmern, und es geht schneller.´“[452]
Die Kosten-Nutzen-Rechnung scheint beim Thema Spätabtreibung aufzugehen. Die Eltern haben keine wirtschaftlichen Nachteile, die Ärzte bleiben bei erfolgreicher Durchführung von Unterhalts- und Schmerzensgeldansprüchen verschont und der Staat spart gegebenenfalls lebenslange Kosten für die Kinder. „Und die Kinder? Die Kinder kann niemand mehr fragen.“[453]
Pränataldiagnostik ist stark mit Kosten-Nutzen-Rechnungen verbunden. Denn auch wenn die Ärzte unter dem Etikett der „Leidvermeidung“ arbeiten, so kommt es doch spätestens bei der Diagnose einer potentiellen Behinderung meist zum Ratschlag zu einer Abtreibung. Es wird all zu oft deutlich, „´dass es sich um eine klare Selektion handelt und nicht nur um eine möglicherweise bessere Betreuung während der Schwangerschaft´“[454]. Die Angst, in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt zu werden, ist in Deutschland groß und dennoch wird teilweise mit den selben Argumenten (Leidvermeidung, Kosten-Nutzen) eine Selektion praktiziert.
„Die legale Möglichkeit [...] nach einer diagnostizierten Behinderung und entsprechender medizinischer Indikation ein Kind bis zum Zeitpunkt seiner Geburt abtreiben zu dürfen, ist [...] gleichzusetzen mit einer ´klammheimlichen Vernichtung lebensunwerten Lebens, (...) die sich lediglich anderer Begriffe bedient, um nicht in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt zu werden´.“[455]
Der Bund Deutscher Hebammen sieht in den inzwischen zur Routine gewordenen pränataldiagnostischen Untersuchungen mit ihren selektiven Konsequenzen eine Missachtung des Lebensrechts von Menschen mit Behinderung.[456]
Wie nah Spätabtreibung und Euthanasie beieinander liegen, verdeutlicht ein Fall, der 2003 in der Universitätsklinik Groningen (Niederlande) vorfiel. Vier schwerbehinderte und unheilbar kranke Kinder wurden mit der Zustimmung ihrer Eltern getötet. Die behandelnden Ärzte wurden nicht angeklagt und eine Sprecherin der Klinik sprach von einer „´Abtreibung nach der Geburt´“[457].
Solche „Sprachverwirrungen“ stehen immer zu Beginn von kulturellen Katastrophen, sagt Manfred Spieker. Nicht nur die „weichen Formulierungen“[458] bei Gesetzestexten, die viel Spielraum für Auslegungen lassen, zeugen von Euphemismen. Auch die Bezeichnung „Schwangerschaftsunterbrechung“ soll beschönigend wirken, wie Monika Hey feststellt. Schließlich wird nichts unterbrochen, was später wieder fortgesetzt werden kann.[459] Daher sagt Hey:
„Der Tod eines Ungeborenen ist keine Unterbrechung. Aber vielleicht wird an diesem Euphemismus deutlich, wie weit die Verdrängung geht. Wie groß der Tabubruch tatsächlich ist, wenn Ärzte töten. Sprachliche Verschleierung des Unaussprechlichen, das sich dahinter verbirgt.“[460]
Auch Spieker bemerkt, dass es naiv sei, zu behaupten, das Ziel eines Schwangerschaftsabbruchs sei die „Beendigung der Schwangerschaft“ und nicht „die Tötung des Kindes“[461].
Durch die Entwicklung zu einer „Eugenik von unten“[462] wird die Selektion kranker und behinderter Menschen gefördert. Das Endergebnis der Pränataldiagnostik ist heute in der Regel die Spätabtreibung eines Ungeborenen mit „abweichendem“ Befund. Die eugenisch motivierten Schwangerschaftsabbrüche sind als medizinische „Behandlung“ weithin anerkannt, obwohl eine Abtreibung keine Therapie im klassischen Sinne darstellt, erläutert Schindele.[463]
„Je früher die Selektion erfolgt, desto eher kann sie toleriert werden.“[464] Es scheint akzeptabler zu sein Ungeborene mit Behinderung abzutreiben, als der Tötung von Erwachsenen mit Behinderung zuzustimmen, wie es im Nationalsozialismus der Fall war. Die individuelle Entscheidung zur Abtreibung kann selbstverständlich nicht mit dem staatlich angeordneten Massenmord zur Zeit Hitlers gleichgesetzt werden. Und doch gibt es eine Verbindung zwischen Euthanasie und Spätabtreibung – die Bewertung des menschlichen Lebens.[465] Die Sozialwissenschaftlerin Anne Waldschmidt lässt daran keinen Zweifel:
„Es gibt doch eine Logik, die die Praxis der Pränataldiagnostik mit der der Euthanasie verknüpft. In beiden Fällen wird über den ´Wert´ des Lebens entschieden, ein Qualitätsurteil über ein Menschenleben gefällt. Ob sie subjektiv es will oder nicht: Die einzelne Frau, die sich für eine Pränataldiagnostik entscheidet, beteiligt sich an dieser Bewertung.“[466]
Diese Beteiligung jeder einzelnen Frau führt dazu, dass die „neue“ Eugenik funktioniert und sich rasch verbreitet. Ärzte helfen dabei, indem sie individuelles Leid vermeiden, so die Legitimationen. Pränatale Diagnostik und ein infolgedessen durchgeführter Schwangerschaftsabbruch sind inzwischen Teil eines „Dienstleistungsangebots“, das zwar von Ärzten realisiert, aber von den Frauen gefordert wird. Eugenisches Handeln ist zur individuellen „Heilbehandlung“ umdefiniert worden.[467]
Anne Waldschmidt sagt, dass die genetische Selektion zur Normalität wird. Sie sieht die Individualisierung und die „neue“ Eugenik sehr skeptisch. Denn: „Bald könnte es heißen, Menschen mit Behinderung hätten selbst Schuld an ihrem Schicksal und müßten ihr Leben folglich allein bewältigen. Sie seien schließlich nur Menschen, die eigentlich zu verhindern gewesen wären.“[468]
[322] Lemke, Kollek 2011, S. 175f.
[323] Vgl. Wehling, Viehöver 2011, S. 7ff.
[324] Ebd., S. 21.
[325] Vgl. ebd., S. 21.
[326] Pagels 2011, S. 47.
[327] Vgl. ebd., S. 48f.
[328] Vgl. Shakespeare 2003, nach Lemke, Kollek 2011, S. 176.
[329] Lemke, Kollek 2011, S. 180.
[330] Ebd., S. 180.
[331] Ebd., S. 181.
[332] Vgl. ebd., S. 179ff.
[333] Vgl. Wolf 2008, S. 546.
[334] Pagels 2011, S. 22.
[335] Vgl. Ebd., S. 32.
[336] Vgl. Wolf 2008, S. 504ff.
[337] Ebd., S. 507.
[338] Vgl. ebd., S. 549f.
[339] Wolf 2008, S. 550.
[340] Bundesministerium der Justiz, http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[341] Bundesministerium der Justiz, http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[342] Vgl. Pagels 2011, S. 26.
[343] Vgl. Schumann 2007, S. 41.
[344] Wolf, 2008, S. 620.
[345] Ebd., S. 630.
[346] Vgl. ebd., S. 630f.
[347] Ebd., S. 631.
[348] Vgl. Gerhard-Teuscher 1996, S. 104.
[349] Wolf 2008, S. 646.
[350] Vgl. ebd., S. 645f.
[351] Vgl. Hey 2012, S. 186f.
[352] Vgl. Trautmann, Merz 2007, S. 5.
[353] Vgl. Hey 2012, S. 187f.
[354] Hey 2012, S. 14.
[355] Ebd., S. 187.
[356] Vgl. ebd., S. 187f.
[357] Renner 2007, S. 7.
[358] Vgl. ebd., S. 7ff.
[359] Vgl. Renner 2007, S. 10.
[360] Ebd., S. 10.
[361] Hey 2012, S. 52.
[362] Renner 2007, S. 10.
[363] Vgl. ebd., S. 10.
[364] Vgl. Renner 2007, S. 10f.
[365] Ebd., S. 11.
[366] Ebd., S. 13.
[367] Lauer 2007, S. 33
[368] Vgl. ebd., S. 33.
[369] Vgl. Wegener 2007, S. 43.
[370] Vgl. ebd., S. 43.
[371] Vgl. Wegener 2007, S. 43f.
[372] Lauer 2007, S. 34.
[373] Ebd., S. 35.
[374] Vgl. ebd., S. 35.
[375] Vgl. Schumann 2007, S. 39.
[376] Ebd., S. 39.
[377] Vgl. Wegener 2007, S. 44.
[378] Ebd., S. 44.
[379] Trautmann, Merz 2007, S. 5.
[380] Vgl. Lauer 2007, S. 36.
[381] Vgl. Schumann 2007, S. 40.
[382] Schumann 2007, S. 40.
[383] Vgl. Ensel 2007, S. 48.
[384] Ebd., S. 48.
[385] Vgl. Schumann 2007, S. 41.
[386] Ebd., S. 41.
[387] Vgl. Lauer 2007, S. 35ff.
[388] Vgl. Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3.
[389] Ebd., S. 3.
[390] Schumann 2007, S. 41.
[391] Vgl. Haker 2012, S. 32.
[392] Vgl. grundlegend für das Folgende: Schindele, Eva: Gläserne Gebär-Mütter. Vorgeburtliche Diagnostik – Fluch oder Segen, 1990. Und: Schindele, Eva: Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko, 1995.
[393] Schindele 1990, S. 32.
[394] Schindele 1995, S. 13.
[395] Vgl. Wolf 2008, S. 628.
[396] Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3.
[397] Ebd., S. 3.
[398] Schindele 1990, S. 34.
[399] Schindele 1990, S. 9f.
[400] Schindele 1995, S. 84.
[401] Ebd., S. 84.
[402] Ebd., S. 84.
[403] Vgl. Hey 2012, S. 14.
[404] Vgl. ebd., S. 60.
[405] Ebd., S. 11.
[406] Schindele 1995, S. 85f.
[407] Ebd., S. 87.
[408] Vgl. Hey 2012, S. 51.
[409] Ebd., S. 51f.
[410] Vgl. Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 6.
[411] Ebd., S. 6.
[412] Schindele 1990, S. 183.
[413] Ebd., S. 185.
[414] Wolf 2005, S. 636.
[415] Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3.
[416] Schindele 1990, S. 34.
[417] Schindele 1995, S. 84.
[418] Ebd., S. 85.
[419] Spieker 2005, S. 18.
[420] Ebd., S. 18.
[421] Vgl. grundlegend für das Folgende: Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik. Anlage zur Pressemitteilung, Stellungnahme. Neuer Bluttest droht die vorgeburtliche Selektion von Menschen mit Down-Syndrom zu perfektionieren. Kall/Frankfurt, 2012.
[422] Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, S. 1.
[423] Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., http://www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-themen/praenataldiagnostik/netzwerk-gegen-selektion-durch-praenataldiagnostik.html.
[424] Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., http://www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-themen/praenataldiagnostik/netzwerk-gegen-selektion-durch-praenataldiagnostik.html.
[425] Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, S. 2.
[426] Ebd., S. 3.
[427] Ebd., S. 3.
[428] Ebd., S. 3.
[429] Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, S. 4.
[430] Ebd., S. 4.
[431] Ebd., S. 5.
[432] Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 2012, S. 5.
[433] Vgl. grundlegend für das Folgende: Lichte, Marijke: Deutschlands tote Kinder. Kindstötung als Folge von Gewalthandlung, sexuellem Missbrauch und Verwahrlosung. Eine historisch-soziologische Untersuchung zum Thema Infantizid, 2007. Und: Spieker, Manfred: Der legalisierte Kindermord. Zur Problematik der Spätabtreibungen. In: Die neue Ordnung. Herausgegeben vom Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg, 59 (2005) Heft 1, S. 15-27.
[434] Bundesärztekammer 1998, S. A3241.
[435] Vgl. Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3.
[436] Ebd., S. 3.
[437] Spieker 2005, S. 18.
[438] Ebd., S. 18.
[439] Ebd., S. 18.
[440] Spieker 2005, S. 16.
[441] Hey 2012, S. 112.
[442] Spieker 2005, S. 18.
[443] Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3f.
[444] Zit. n. Lichte 2007, S. 120.
[445] Zit. n. ebd., S. 120.
[446] Spieker 2005, S. 19.
[447] Ebd., S. 19.
[448] Ebd., S. 19.
[449] Ebd., S. 19.
[450] Zit. n. Lichte 2007, S. 120.
[451] Zit. n. ebd., S. 120.
[452] Zit. n. ebd., S. 120.
[453] Ebd., S. 121.
[454] Ebd., S. 118.
[455] Ebd., S. 119.
[456] Vgl. Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 4.
[457] Zit. n. Spieker 2005, S. 16f.
[458] Ebd., S. 15.
[459] Vgl. Hey 2012, S. 96.
[460] Ebd., S. 96.
[461] Spieker 2005, S. 23.
[462] Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 4.
[463] Vgl. Waldschmidt 1995, S. 358.
[464] Ebd., S. 385.
[465] Vgl. Waldschmidt 1995, S. 358.
[466] Ebd., S. 358.
[467] Vgl. ebd., S. 360.
[468] Ebd., S. 361f.
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Kapitel werden exemplarisch zwei Beispiele eines Schwangerschaftsabbruchs nach der Diagnose Trisomie 21 des Ungeborenen vorgestellt. Zum einen die Geschichte von Monika Hey, die - wie sie im Nachhinein feststellt – 1998 aus Unwissenheit dem Abbruch ihrer Schwangerschaft zustimmte, nachdem Trisomie 21 diagnostiziert wurde. Die zweite Geschichte handelt vom sogenannten Oldenburger-Baby, Tim, der 1997 seine Spätabtreibung überlebte. Diese zwei Beispiele veranschaulichen deutlich, welche Grenzen überschritten werden und welche Belastungen für Mutter und Kind bei der Diagnose Trisomie 21 entstehen können.
5.1 Die Geschichte von Monika Hey[469]
Die Fernsehredakteurin und inzwischen Supervisorin Monika Hey hatte etwa zehn Jahre nach einer Spätabtreibung den Mut, die medizinischen Unterlagen dieses Eingriffs in ihren Körper und ihr Leben anzufordern. „Ich habe mich entschieden, meine eigene Erfahrung mit Pränataldiagnostik zu veröffentlichen, weil mir scheint, dass werdende Eltern zunehmend unter Druck stehen, ein behindertes Kind abzutreiben. Und mit dieser extremen Belastung meistens allein bleiben.“[470]
Sie wollte sich mit dem Thema Pränataldiagnostik genauer auseinandersetzen, nachdem sie aus Unwissenheit einem Schwangerschaftsabbruch aufgrund eines diagnostizierten Down-Syndroms zugestimmt hatte. Denn wie sie selber sagt: „[...] hinter meiner eigenen Trauer entdeckte ich dabei sehr bald ein Thema, das über meinen eigenen Verlust weit hinausgeht.“[471]
Hey hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, dass sie mit 46 Jahren noch ein Kind bekommen könnte. Als sie mit Hilfe ihrer Gynäkologin realisiert, dass sie schwanger ist, befindet sie sich bereits Ende der neunten Woche. Hey ist überrascht, da sie damit nicht mehr gerechnet hatte. Sie kann ihr Glück kaum fassen. „Der Computer hatte einen kleinen Menschen fotografiert, der gekrümmt in meinem Bauch lag und der erst dann in mein Leben gekommen war, als ich aufgehört hatte, auf ihn zu warten.“[472] Voller Freude teilt sie ihrem Mann mit, dass sie schwanger ist. Alles scheint perfekt zu sein. „Ich war so beseelt von meinem Glück, dass ich mich in den nächsten Tagen dabei ertappte, selbst Menschen von der Schwangerschaft zu erzählen, die ich gar nicht besonders gut kannte.“[473]
Eine Freundin versucht die Euphorie zu bremsen und selbst ihre Mutter äußert Bedenken. Sie solle die ersten drei Monate erst einmal abwarten, da immer noch etwas passieren könnte. Auch ihr Mann Klaus bekommt Ratschläge, dass er sich besser nicht zu früh freuen solle. Statt sich mit ihr über ihre unverhoffte Schwangerschaft zu freuen, werden sie und ihr Mann von vielen Freunden gewarnt. Die meisten sprechen sofort mögliche Gefahren an, statt zunächst einmal zu gratulieren. Schließlich fragt auch eine Freundin, ob sie eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen lassen werde. Doch Hey ist sich sicher, dass sie keine Amniozentese möchte.
„Jemand sagte sehr direkt, ich als Spätgebärende würde doch sicher eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen lassen. Für sie war das selbstverständlich [...]. Ich fand ihre Frage trotzdem verletzend [...]. Warum durften wir uns nicht einfach freuen? [...] Ich wollte das Leben unseres Kindes nicht riskieren durch irgendwelche Nadeln, mit denen mir durch die Bauchdecke bis in die Gebärmutter gestochen wurde. Und vor allem wollte ich keine Entscheidung treffen müssen gegen dieses Kind, wenn der Befund auffällig sein sollte. Ich wollte unser Kind nicht nur auf Probe annehmen.“[474]
An den Reaktionen von Freunden und Familie lässt sich erkennen wie sehr die Sichtweise der Medizin übernommen wird. Hey befindet sich in einem „riskanten biologischen Zustand“[475], den die Medizin kontrollieren muss. Die Pränataldiagnostik muss zunächst sämtliche Risiken ausschließen.[476] Erst dann dürfen sich Monika Hey und ihr Mann freuen.
Doch Hey will sich nicht von ihrem Umfeld verunsichern lassen und ist sich sicher, dass sie das Richtige tut. Die meisten Kinder kommen schließlich gesund zur Welt, auch die von Frauen, die als „Spätgebärende“ medizinisch eingestuft sind. Sie will unter allen Umständen zuversichtlich bleiben. Selbst bei Frauen, die erst mit 46 schwanger werden, bekommen noch 95 von 100 ein Kind ohne genetisch bedingte Behinderung.
Monika Hey und ihr Mann einigen sich ziemlich schnell auf einen Namen: Leon soll das Kind heißen. Sie mögen den Klang des Namens und Hey gefällt es, dass er von hinten gelesen „Noel“ ergibt, die französische Übersetzung für Weihnachten, wo ihr Kind auch zur Welt kommen soll. Hey träumt in einer Nacht allerdings von „Lea“, woraufhin sie den Namen recherchiert. Sie findet ein Zitat aus der Bibel – „Lea hatte ein blödes Gesicht“[477].
Monika Hey macht sich nun Gedanken, war doch „blöd“ früher ein Ausdruck für „geistig behindert“. Jetzt denkt sie über all die Dinge nach, die sie noch in den ersten Schwangerschaftswochen getan hatte, die für ihr Ungeborenes schlecht gewesen sein könnten. Sie hatte noch nicht gewusst, dass sie schwanger war und hatte beispielsweise schwere Koffer getragen oder Röntgenaufnahmen machen lassen. Zum ersten Mal ist sie beunruhigt. „Ich sprach im Stillen mit meinem ungeborenen Kind und ich war glücklich über jedes Zeichen, das meine gute Hoffnung nährte.“[478]
Ungefähr eine Woche nach der Feststellung der Schwangerschaft hat Monika Hey wieder einen Termin bei ihrer Gynäkologin. Sie hat volles Vertrauen zu ihrer Ärztin und will, dass ihr Kind gut versorgt ist. Dieses Vertrauen in ihre Ärztin spiegelt das Bedürfnis „sich anlehnen zu wollen“ und „unterstützt zu werden“ wieder. Die Ärzte werden schon wissen, was gut für Mutter und Kind ist. Dieser Gedanke nimmt ein Stück weit die Angst vor möglichen Risiken und Komplikationen in der Schwangerschaft. Frauen vertrauen auf die Erfahrung und Meinung der Ärzte.[479]
Bei dem Arzttermin von Hey soll ein Bluttest durchgeführt werden, um Blutgruppe und mögliche Antikörper bestimmen zu können. Auch erhält sie eine Überweisung für einen Blutzuckerbelastungstest. Im Gespräch mit ihrer Gynäkologin erfährt sie von Untersuchungen, mit denen Chromosomenabweichungen festgestellt werden können. Doch Hey stand dem Thema bereits vor ihrer Schwangerschaft skeptisch gegenüber, da sie sich nicht vorstellen kann, mit der Gefahr einer möglichen Fehlgeburt durch eine Fruchtwasseruntersuchung umgehen zu können. Zudem kommt für sie ein Schwangerschaftsabbruch auch nach einem „problematischen Befund“ nicht in Frage. Aus diesen Gründen lehnt Hey die gendiagnostischen Untersuchungen entschieden ab. Ihre Gynäkologin enthält sich weiterer Informationen zu diesem Thema. „Das Thema ist für mich damit schnell erledigt. Ich will mich gar nicht erst verunsichern lassen. Will mich weiterhin auf mein Kind freuen dürfen.“[480]
Gegen Ende der zwölften Woche hat Hey einen weiteren Ultraschalltermin bei ihrer Gynäkologin, den sie nicht ablehnt, da sie alles tun will, um beispielsweise eine mögliche Unterversorgung ihres Kindes rechtzeitig feststellen und behandeln zu lassen. Die Ärztin führt einen Ultraschall durch und macht verschiedene Aufnahmen vom Ungeborenen. Währenddessen überlegt Hey, was sie für ihr Kind tun kann, und entscheidet sich im Dialog mit ihrer Gynäkologin, sich auf deren Erfahrungen zu verlassen, so wie es auch im Mutterpass empfohlen wird.
Doch während der Ultraschalluntersuchung merkt Hey, dass etwas nicht stimmt. Die Ärztin bleibt ruhig und teilt ihr ernst mit, dass sie eine Flüssigkeitsansammlung unter der Nackenhaut beim Fötus entdeckt hat. Sie empfiehlt ihrer Patientin, den Verdacht auf Trisomie 21 durch einen Spezialisten abklären zu lassen. Dann lässt sie Hey einen Moment alleine und geht ins Nebenzimmer. Hey beschreibt die Situation: „Ich war verwirrt. Was erwartete sie jetzt von mir? Sollte ich mich ganz schnell beruhigen, sie auf keinen Fall mit meinen Gefühlen belästigen? Was hatte sie mir da gerade erzählt? Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Verdacht auf Trisomie 21. Down-Syndrom.“[481]
Als die Ärztin zurückkommt, hat sie bereits einen Termin bei einem Spezialisten am nächsten Tag vereinbart. Er verfügt über ein hoch auflösendes Ultraschallgerät und ist spezialisiert auf Fruchtwasseruntersuchungen. Hey ist völlig verwirrt und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ihre Gedanken kreisen um die Ultraschalluntersuchung und ihre Folgen. „Dass schon dieser Test dazu dienen würde, frühzeitig nach Chromosomenabweichungen zu fahnden, hatte ich nicht gewusst, als ich dem Ultraschall zugestimmt hatte.“[482] Obwohl Hey zuvor die pränataldiagnostischen Untersuchungen entschieden abgelehnt hatte, befindet sie sich nun „mittendrin im Strudel der Pränataldiagnostik“[483]. Das „Recht auf Nichtwissen“[484] wurde bei Monika Hey missachtet.
Die festgestellte erhöhte Nackentransparenz gilt als sogenannter Marker für Chromosomenabweichungen. Ohne ihr Wissen und ihre explizite Zustimmung hatte die Ärztin nach einer „auffälligen“ Flüssigkeitseinlagerung gesucht. Diese Flüssigkeitsansammlung war bis 2009 die einzige der möglichen „Auffälligkeiten“ bei einer Ultraschalluntersuchung, die im Mutterpass als Beispiel erwähnt war. Diese Ultraschalluntersuchung ist daher sehr entscheidend, da die sogenannte Nackenfaltenmessung den ersten Schritt zu einer pränatalen Diagnose darstellt.
„Denn genau dieser Ultraschall ist eine außerordentlich entscheidende Maßnahme in der Pränataldiagnostik. Sozusagen eine Vorstufe der genetischen Diagnostik. Und sie kann in eine Indikation zu einem Schwangerschaftsabbruch einmünden, mit allen daraus gegebenenfalls entstehenden Konsequenzen.“[485]
Am nächsten Tag geht Monika Hey zusammen mit ihrem Mann Klaus zum vereinbarten Termin beim Spezialisten. Der Arzt zeigt ihnen auf einem großen Flachbildmonitor die Schwellung unter der Nackenhaut und weist auch auf noch andere Ödeme hin. Doch Hey sieht auf den Ultraschallbildern nur ihr „perfektes Kind“ und keine Anzeichen für ein „Down-Syndrom“. Sie kann dem Arzt gar nicht mehr richtig zuhören.
Der Arzt empfiehlt den werdenden Eltern beim anschließenden Beratungsgespräch eine Chorionzottenbiopsie zur weiteren Abklärung der Diagnose. Während des Gespräches haben Klaus und seine Frau das Gefühl, dass der Arzt ungeduldig wird, da sie der Untersuchung nicht sofort zustimmen wollen. Zudem besteht er auf eine schriftliche Bestätigung, sollten die beiden die Untersuchung tatsächlich ablehnen.
„Der Gynäkologe war ärgerlich geworden, als ich zögerte, sofort einer Chorionzottenbiopsie zur Gendiagnostik zuzustimmen. Und hatte gedroht, dann müsse er sich absichern. Brauche unsere schriftliche Bestätigung, dass er uns darüber aufgeklärt habe, wie schwerwiegend der Befund sei. Erst jetzt weiß ich, er fürchtete unser Kind als Schaden. Einen Schaden, für den er aufkommen müsste, wenn wir ihn später vielleicht auf Unterhalt verklagen sollten.“[486]
Monika Hey kann sich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem Motiv des Arztes und seiner Angst vor einer möglichen Schadensersatzklage auseinandersetzen. Sie hat eher das Gefühl, zu einer Untersuchung gedrängt zu werden, die sie gar nicht durchführen lassen will. Daher bittet sie um Bedenkzeit, ehe sie eine Entscheidung fällt. Die Diagnose des Ödems hat Hey völlig unerwartet getroffen, und sie weiß nicht recht, was sie nun tun soll. „Aber selbst wenn Leon behindert sein sollte, dann kann ich doch jetzt nicht so tun, als sei er nicht mein Kind! Soll ich sein Leben infrage stellen, weil er vielleicht nicht gesund ist?“[487]
Ihr Mann Klaus beginnt mit der Zeit, sich Sorgen um seine Frau zu machen. Der Arzt hatte davon gesprochen, dass das Kind die Schwangerschaft vielleicht nicht überleben würde, und wenn doch, würde es behindert zur Welt kommen. Klaus befürchtet zunehmend, dass seine Frau gesundheitlich bedroht sei, wenn sie das Kind austragen werde. Er ist von den „eindringlichen Warnungen des Arztes nicht mehr abzubringen“[488].
Schließlich entscheidet sich Monika Hey, die Punktion durchführen zu lassen. Im Nachhinein kann sie nicht mehr nachvollziehen, wie es zu diesem Entschluss kam. Sie hoffte vielleicht einfach, dass die Ärzte sich geirrt haben könnten und dies nach der Untersuchung zugeben müssten. Sie will den Termin ohne ihren Mann wahrnehmen, was sie jedoch bereits im Wartezimmer bereut. „Ich spürte den knirschenden Schmerz des Einstichs und sah die Nadel neben dem Kind auf dem Flachbildschirm. Bis ich vor Entsetzen die Augen schloss. Tränen liefen mir übers Gesicht. Ich fühlte mich mutterseelenallein.“[489]
Der Arzt erklärt ihr anschließend nochmals, dass ihr ungeborenes Kind nur geringe Überlebenschancen habe. Solche Ödeme würden oftmals zu Spontanaborten oder Totgeburten führen. „Die Sicherheit meines Kindes war erheblich infrage gestellt, seitdem die ersten Anzeichen für eine genetische Abweichung im Ultraschall erkennbar geworden waren. Inzwischen ging es für Leon um Leben und Tod.“[490]
Durch den Laborbefund wird die Vermutung der Gynäkologin schließlich bestätigt: die Diagnose lautet Down-Syndrom. Die Ärztin erläutert, ihr Kind werde schwere körperliche, geistige Behinderungen und erhebliche Organschäden haben. Es wäre mit Sicherheit ein Kind, um das man sich immer kümmern müsse. Hey fühlt sich wieder unter Druck gesetzt. Die Ärztin erklärt ihr, dass auch sie der Meinung ihres Kollegen sei, das Kind habe keine großen Überlebenschancen. Zudem bliebe ihr eine „richtige Geburt“ erspart, nur müsse sie sich schnell für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Hey versucht noch entgegenzusetzen, es gebe doch auch Familien mit behinderten Kindern, die von ihren Eltern geliebt und nicht im Stich gelassen würden. Die Ärztin antwortet daraufhin:
„Ja, manchmal würde man erst nach der Geburt feststellen, dass ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen sei. Und ja, die kleinen Mongölchen seien besonders sanft und liebenswert. Aber bei mir sei das anders, viel schlimmer, da die Probleme ja jetzt schon so deutlich sichtbar seien. Das habe ja schon der Ultraschall gezeigt.“[491]
Hey bekommt immer mehr das Gefühl, dass sie offensichtlich keine andere Wahl hat. Niemand macht ihr Hoffnungen. Die Ärztin setzt sie außerdem unter Druck, es sei nicht so einfach, einen Termin in einer Klinik zu bekommen, da die katholischen Krankenhäuser keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen würden. Hey ist wie benommen und weiß keinen Ausweg.
Ihre Ärztin vereinbart schließlich einen Termin in der Klinik am kommenden Montag. Die niederschmetternden Prognosen haben Hey „gelähmt". „Ich fühlte mich ohnmächtig, und ich schämte mich. Ich hatte dem Abbruch zugestimmt.“[492] Hey hatte vor ihrer Zustimmung keine Informationen darüber erhalten, was ihre Möglichkeiten waren. Sie hatte keinen Raum für eine freie Entscheidung bekommen. Auch wusste Hey damals nicht, dass es Beratungsstellen gibt, an die sie sich hätte wenden können, um über ihren „Konflikt“ zu sprechen.
„Anscheinend haben weder meine Gynäkologin noch der Arzt, der die Chorionzottenbiopsie durchführte, meine Bestürzung und mein Zögern, ihrem medizinischen Rat zu folgen, ernst genommen. Jedenfalls sind sie beide nicht auf die Idee gekommen, mich auf mögliche Unterstützung durch Menschen in einer Beratungsstelle hinzuweisen.“[493]
Monika Hey ist in der 15. Schwangerschaftswoche, als sie den Gang in die Frauenklinik macht. Dort wird ihr erklärt, dass der Schwangerschaftsabbruch durch eine künstlich eingeleitete Geburt erfolgen wird. Hey fühlt sich von ihrer Ärztin verraten, die ihr versichert hatte, dass ihr zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft eine „Geburt“ erspart bleiben würde. Hey bekommt immer mehr Angst und fühlt sich allein gelassen. Schließlich resigniert sie:
„Mein innerer Widerstand war bei meinem letzten Besuch in der Praxis der Gynäkologin zusammengebrochen. Denn was ich unbewusst gehört hatte, war, dass ich alles nur noch schlimmer machte, wenn ich mit dem Abbruch noch länger zögerte. Als sei dies der einzige Ausweg aus dem unerträglichen Konflikt. Als sei alles einfacher, wenn man denn nur Einsicht zeige. Als sei mein Zögern das Problem.“[494]
Während Hey und ihr Mann auf der gynäkologischen Station auf die Zuweisung eines Zimmers warten, flüstert eine Krankenschwester, sie hätten das Recht, ihr Kind bestatten zu lassen. Offiziell sei dies erst ab einem Geburtsgewicht von 500 Gramm möglich, aber sie könne sich durchsetzen.
Vor dem Eingriff wird nochmals eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Der Arzt schaut sich die Ödeme auf dem Ultraschall an. Anschließend muss Hey ein Formular unterschreiben: „Ich soll bestätigen, dass das Leben mit einem behinderten Kind für mich, unter Berücksichtigung meiner gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse, unzumutbar sei.“[495] Der Arzt erklärt Hey, es handele sich um eine reine Formsache.
Dieser Satz stammt aus dem Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation (§ 218a). Nach diesem Gesetz ist eine Abtreibung aufgrund einer pränatalen Diagnose unter folgenden Umständen legal:
„Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.“[496]
Eigentlich muss eine schwangere Frau ihren Selbstmord „androhen“, um deutlich zu machen, dass die Geburt des Kindes eine „schwerwiegende Beeinträchtigung“ ihres „seelischen Gesundheitszustandes“ bedeuten würde. Durch die Indikation und die schriftliche Bestätigung der Frau entledigt sich die Medizin sämtlicher Verantwortung. Die Indikation stellt der Arzt, aber die werdende Mutter muss diese selbst bewerten.[497] Die Frau hat entschieden, dass die Geburt des Kindes für sie unzumutbar ist und als Beweis dafür, gibt es die Unterschrift. „Die Medizin definiert und diagnostiziert, werdenden Müttern oder Eltern wird auf Grundlage dieses medizinischen Diagnosemonopols die Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes zugemutet.“[498] Doch dem Arzt von Monika Hey nach, handelt es sich lediglich um eine Formsache, die nicht weiter hinterfragt werden muss.
Nach der Untersuchung und dem Gespräch mit dem Arzt erhält Hey schließlich vaginal verabreichte Wehen auslösende Medikamente, um die Geburt einzuleiten. Die Ärztin erklärt ihr, dass in einigen Stunden alles vorbei sein wird. Es könnte auch länger dauern, aber sie ist zuversichtlich. Hey muss jetzt warten; warten „auf das Schlimmste, was mir im Leben je passiert ist“[499].
Am zweiten Tag in der Klinik hat Hey noch immer keine Wehen, so dass die Ärztin nochmals Wehen anregende Medikamente verabreicht. Am dritten Tag haben noch immer keine Wehen eingesetzt. Es ist der erste Juli. Die Ärztin verabreicht ihr inzwischen ein anderes Wehen förderndes Mittel und hofft, dass es bald losgeht. Der erste Juli ist auch jener Tag, an dem Monika Hey ihr Baby zum ersten Mal spürt.
„Heute habe ich Leon zum ersten Mal in meinem Leib gespürt. Ich war am späten Vormittag endlich wieder eingeschlafen, bewusst bemüht darum, der quälenden Warterei zu entfliehen. Als ich aufwachte, lag ich eingerollt auf meiner rechten Seite und spürte eine unbekannte Verhärtung links oben im Bauch. Wie ein handgroßes Ei. Mir kam es vor, als habe mein Kind sich, während ich schlief, so weit wie möglich vom vergifteten Muttermund entfernt.“[500]
Hey fühlt sich allein gelassen. „Ich war ein Fall und Leon eine pränatale Diagnose.“[501] Inzwischen haben die Ärzte eine Infusion mit einem weiteren Wehen fördernden Medikament verabreicht. Aus dem medizinischen Bericht erfährt Hey später, falls es an diesem Tag nicht zur „Ausstoßung der Frucht“[502] gekommen wäre, hätte man die Behandlung für einen Tag unterbrochen. Hey befindet sich zu diesem Zeitpunkt seit vier Tagen in der Klinik. „Noch barg mein Körper schützend das Ungeborene. Meine Seele hatte – davon war ich überzeugt – auch das dritte Abtreibungsmedikament neutralisiert.“[503]
Am fünften Tag wird die „Behandlung“ abgebrochen. Heys Körper soll zur Ruhe kommen. Die Unterbrechung ist jedoch nur eine eingeräumte „Galgenfrist“, ein Zurück gibt es schon lange nicht mehr. Hey wird mitgeteilt, dass es eine zusätzliche Möglichkeit gibt – eine Spritze, die direkt ins Herz des Kindes injiziert wird. Hey kommt sich immer „schäbiger“[504] vor, empfindet sich selbst immer mehr als Zumutung und würde am liebsten weglaufen.
Die Spritze ins Herz des Kindes, die Hey angeboten wird, ist der sogenannte Fetozid. Bei diesem Verfahren wird der Fötus bereits im Mutterleib mittels einer Kalium-Chlorid-Spritze in das Herz des Kindes oder in die Nabelschnurvene getötet. Durch diese Prozedur wird das letzte „Risiko“ einer Lebendgeburt vermieden. Der Fetozid ist die Möglichkeit des Arztes, sich vor den rechtlichen Konsequenzen einer misslungenen Abtreibung zu schützen. Die Kinder, die bei Spätabbrüchen abgetrieben werden, sind nämlich meist außerhalb des Mutterleibs bereits lebensfähig.[505]
Am sechsten Tag in der Frauenklinik setzen schließlich nach einer weiteren Infusion die Wehen ein. Hey hat unbeschreibliche Schmerzen, läuft im Zimmer auf und ab, krümmt sich auf dem Bett und weint laut ins Kissen. Die Krankenschwester gibt ihr ein Schmerzmittel, was jedoch keine Linderung herbeiführt. Als Hey die Pflegerin erneut ruft, spritzt diese etwas in die Kanüle des Tropfes mit der Bemerkung, dass sie das eigentlich gar nicht dürfe. Wie sich später herausstellt, handelte es sich um Morphium. Bevor Hey überhaupt versteht, was geschieht, hören die Schmerzen schlagartig auf und eine tiefe Müdigkeit setzt ein.
Eine Spätabtreibung dauert meist mehrere Tage oder manchmal auch mehr als eine Woche. Es ist für die Frau ein äußerst schmerzhafter Prozess, sowohl körperlich als auch seelisch. Die schwangeren Frauen erhalten häufig keine Narkose, da sie aktiv an der „Frühgeburt“ mitwirken müssen. Sie müssen pressen und können oftmals den Todeskampf ihres Kindes spüren.[506]
Nach einiger Zeit ruft Hey wieder die Schwester, die daraufhin eine Ärztin holen geht. „Wieder bin ich allein. Allein mit meinem Kind, dessen kleines Köpfchen ich in meiner Hand zwischen den Beinen spüre. Die Zeit bleibt stehen. Ewigkeit.“[507] Dann geht alles sehr schnell. Die Nabelschnur wird durchtrennt. Plötzlich wird Hey klar, „gleich nehmen sie mir mein Kind weg“[508]. Sie richtet sich mühsam auf. Die Krankenschwester legt ihr Leon in den Schoß. Als Hey es nicht mehr erträgt, mit ihrem Kind alleine zu sein, bittet sie ihren Mann, sofort in die Klinik zu kommen. Jetzt will sie gemeinsam mit ihrem Mann von Leon Abschied nehmen.
Unerwartet kommen Krankenschwestern ins Zimmer, während sie und ihr Mann mit dem toten Kind im Zimmer sind. Die Schwestern teilen mit, dass Hey sofort in den Operationssaal müsse. Das Kind nehmen sie in diesem Moment auch mit.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine Curettage bei Monika Hey durchgeführt, um auch die Reste der Plazenta zu entfernen und die Gebärmutter vorschriftsmäßig zu leeren. Nachdem Hey aus der Narkose wieder erwacht ist, erklärt ihr ein Arzt, dass es um ihre Gesundheit gegangen sei und ihr Kind keine Überlebenschancen gehabt hätte. Im medizinischen Bericht kann Hey später davon nichts lesen. Nirgendwo sind „totbringende Ödeme“[509] vermerkt. Im OP-Bericht steht lediglich „Trisomie 21 in der 15. SSW“[510].
„Inzwischen weiß ich: Kein Verfahren der Pränataldiagnostik kann mit Sicherheit die Schwere einer geistigen Behinderung feststellen, die ein Kind mit Trisomie 21 zu erwarten hat. Ebenso wenig wie das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigungen. Über Schweregrad und Ausprägung der erhobenen Befunde können nur bedingt Aussagen gemacht werden. [...] Aus den Berichten des Labors und des Krankenhauses lässt sich für Leon nur die Diagnose Trisomie 21 mit Sicherheit ablesen.“[511]
In dem an die Gynäkologin adressierten Abschlussbericht der Klinik heißt es, dass Hey ausdrücklich ihren dringlichen Wunsch nach einer Schwangerschaftsunterbrechung in einem Gespräch mit den behandelnden Ärzten geäußert habe. Diesen Wunsch hatte Hey jedoch nie ausgesprochen, und ihre Schwangerschaft ist nicht „unterbrochen“, sondern beendet worden, wie sie betont. „Leon war tot. Für immer.“[512] Erst als Hey ihre Krankenakte später ausführlich liest, fällt ihr auf, dass Leon „aufgrund eines vorläufigen Befundes getötet worden war“[513]. Der endgültige Laborbefund ist zehn Tage nach der eingeleiteten Geburt datiert. Ihre Gynäkologin teilt ihr bei einem späteren Termin lediglich mit, dass die Ambivalenz bleiben werde.
Hey resümiert ihre Erlebnisse:
„Für mich bleibt ungeklärt, ob Leon lebensfähig gewesen wäre. Bis heute weiß ich nicht, ob er wegen der Ödeme sterben musste oder einem Vollkommenheitswahn geopfert wurde. Mein Kind, so hatten die Ärzte mit der ganzen Autorität ihrer Profession gesagt, sei nicht lebensfähig. Inzwischen weiß ich, Trisomie 21 allein ist nicht tödlich. Leon hätte vielleicht leben können.“[514]
Monika Heys Geschichte ist exemplarisch für den Druck, dem werdende Mütter ausgesetzt sind. Auch wenn ihre Erlebnisse mehr als zehn Jahre zurückliegen, ist ihre Geschichte nach wie vor aktuell. Ärzte informieren die schwangeren Frauen über die möglichen Untersuchungen, da sie dazu verpflichtet sind. Diese Aufklärung kann werdende Mütter jedoch überfordern, da sie in solchen Momenten nicht verstehen, warum gerade ihnen zu pränataldiagnostischen Untersuchungen geraten wird. Denn auch heutzutage kommen viele Eltern erst während der Schwangerschaft mit dem Thema Pränataldiagnostik in Berührung.
Monika Heys Erlebnisse zeigen deutlich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Pränataldiagnostik und dem damit verbundenen Schwangerschaftsabbruch bereits vor der Schwangerschaft erfolgen sollte. Hey war durch die Diagnose Trisomie 21 überrumpelt und stand zwischen dem ärztlichen Interesse, sich vor finanziellen Ansprüchen schützen zu müssen, und der eugenischen Norm.
Das Fazit, das aus solchen Erfahrungen gezogen werden kann: Frauen sollten schon vor einer Schwangerschaft über die Möglichkeiten und die Konsequenzen von Pränataldiagnostik informiert werden. Die selektive Praxis und Konsequenz der Pränataldiagnostik wird in unserer Gesellschaft nicht offen thematisiert. Wie auch Monika Hey kommentiert:
„Als ich mich entschloss, über meine Erfahrungen mit pränataler Diagnostik zu schreiben, war mir längst klar, welche katastrophale Wirkung dieses traumatische Erlebnis für mich gehabt hatte. Und wie schwer es mir immer noch fiel, darüber zu sprechen. Aber ich hatte auch angefangen zu begreifen, dass ich mich mit einem in unserer Gesellschaft weitgehend unausgesprochenen Thema beschäftigte.“[515]
Auch Informationsbroschüren für werdende Mütter sind hinsichtlich der Thematisierung von Konsequenzen der Pränataldiagnostik dürftig. So sollten Gynäkologen grundsätzlich ihre Patientinnen vor einer Schwangerschaft über Möglichkeiten und Konsequenzen der Pränataldiagnostik informieren. So suchte Monika Hey auch in der Recherche für ihr Buch in der Praxis ihrer Gynäkologin vergeblich nach Informationsmaterial.
„Als ich während der Recherche zu diesem Buch in der Praxis meiner ehemaligen Gynäkologin darauf wartete, meine Krankenakte einsehen zu können, habe ich im Wartezimmer nach Informationsmaterial Ausschau gehalten, das Schwangere heute über Pränataldiagnostik und die möglichen Folgen rechtzeitig aufklärt. Es gab in der Praxis viel Lesestoff, und ich habe sorgfältig gesucht. Ich habe nichts gefunden.“[516]
Hey erhält lediglich auf Nachfrage von der Sprechstundenhilfe ein Informationsblatt zum Thema Ultraschall, allerdings mit dem Hinweis, dies sei eigentlich nur für schwangere Frauen. Doch auch diese Informationen sind dürftig und dienen mehr der Absicherung der Ärztin, als der Aufklärung der Patientin.
So ist beispielsweise in dem Informationsblatt nichts über die Nackenfaltenmessung und deren mögliche Konsequenzen zu erfahren. Es wird nur auf „übersteigerte Erwartungen an diese Methode der Untersuchung“[517] hingewiesen und erklärt, dass die Ärztin nicht „zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft alle Fehlbildungen und Veränderungen“[518] erkennen kann.
Die fehlende Aufklärung vor und auch während der Schwangerschaft führt dazu, dass Frauen wie Monika Hey in Situationen manövriert werden, die mit einer gewalttätigen Selektions- und Tötungspraxis verbunden und für Frauen als individualisierte Erfahrung unerträglich sind.
Die gesellschaftliche Normierung, die mit der pränatalen Diagnostik und den damit verbundenen Schwangerschaftsabbrüchen einhergeht, wird durch die Medizin, das Gesetz und die Praxis ständig thematisiert. Die Klassifikation von Menschen ist Teil dieser Normierung und scheint inzwischen völlig vernünftig und selbstverständlich. Zwischen den gesellschaftlichen Normierungen und persönlichen Erfahrungen zum Thema Pränataldiagnostik besteht ein Spannungsfeld. Die persönliche Seite findet in unserer Gesellschaft oftmals keine Stimme. Es haben nicht viele Frauen die Kraft und den Mut – wie Monika Hey – über ihre Erlebnisse zu sprechen. Auch Hey bemerkt, dass das Thema tot geschwiegen wird und dass sie deshalb auch ihre Erfahrungen aufgeschrieben hat. Es sind die traumatischen Erlebnisse, die weder in den medizinischen Informationen, noch in den Gesetzen angesprochen werden. Die schwangeren Frauen werden über die Möglichkeiten der Untersuchungen und deren medizinischen Folgen aufgeklärt, nicht aber über die persönliche Belastung. Dies hat auch die Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gezeigt: Die werdenden Mütter haben in der Befragung erklärt, dass sie wenig „über das psychische und ethische Konfliktpotenzial bei Vorliegen einer Behinderung des Kindes“[519] aufgeklärt worden sind. Über die Hälfte der Befragten wurde erst gar nicht über die Möglichkeit einer weiterführenden psychosozialen Beratung informiert.[520]
„Zufrieden waren die Frauen mit der Beratung zu Themen, die definitiv in den medizinischen Bereich fallen. Defizite gibt es aus Sicht der Frauen, die einen auffälligen pränataldiagnostischen Befund hatten, auch hier hinsichtlich der Beratung bei Themen, die über das Medizinische hinausreichen.“[521]
Die Geschichte von Monika Hey ist ein plakatives Beispiel dafür. Sie ist nicht genügend aufgeklärt worden und hat, wie sie selber sagt, aus Unwissenheit dem Schwangerschaftsabbruch zugestimmt. Ihre Geschichte ist wichtig um die persönlichen Erfahrungen einer schwangeren Frau hervorzuheben. Sie zeigt, dass ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer pränatalen Diagnose weit über die medizinischen Fakten hinausgeht und sehr traumatisierend sein kann. Die persönliche Seite wird im medizinischen Feld allzu oft vergessen.
5.2 „Das Oldenburger-Baby“[522]
Spätabtreibungen sind grauenvoll, „weil nicht selten Kinder getötet werden, die extrauterin bereits lebensfähig sind, ja sogar die Abtreibung überleben und damit Eltern und Mediziner, Staatsanwälte und Richter und nicht zuletzt Politiker in unlösbare Konflikte stürzen“[523]. Der wohl bekannteste Fall in Deutschland ereignete sich im Juli 1997 in einer Klinik in Oldenburg.
Tim, der als das „Oldenburger-Baby“ bekannt wurde, ist heute 16 Jahre alt. Tim wurde in der Schwangerschaft seiner Mutter als „Down-Syndrom-Kind“ kategorisiert und erlitt im Zuge seiner Abtreibung schwere zusätzliche Behinderungen. „Tim sollte abgetrieben werden, weil seine Mutter ihn nicht haben wollte, nachdem bei Tim das Down-Syndrom (Trisomie 21) diagnostiziert wurde.“[524] Seit 1998 lebt Tim bei seiner Adoptivfamilie. Die Sendung „Er sollte sterben, doch Tim lebt! – Eine Abtreibung und ihre Folgen“[525] gibt Tims Lebensgeschichte wieder. Die Adoptiveltern werden interviewt, ebenso der damalige behandelnde Arzt.
Tims leibliche Mutter[526] ist zum Zeitpunkt der Schwangerschaft 35 Jahre alt. Eine Schwangerschaft gilt in diesem Alter bereits als „Risiko“. Im sechsten Schwangerschaftsmonat wird bei einer Ultraschalluntersuchung ein „unklarer Befund“ festgestellt. Frau B. hatte bereits ein Kind durch eine Frühgeburt verloren. Sie zögert daher zunächst, aus Angst vor dem Risiko der Untersuchung, eine Amniozentese durchführen zu lassen, entscheidet sich aber doch dazu.
Anfang Juli 1997 berät ein Gynäkologe Frau B. aufgrund des Befundes der Fruchtwasseruntersuchung. Die Diagnose lautet Trisomie 21. Der Arzt vermerkt im Protokoll, dass Frau B. die Geburt eines behinderten Kindes rundweg ablehnt und mit Selbstmord droht für den Fall, dass sie ein behindertes Kind zur Welt bringen müsste. Für Tims Mutter gibt es nur eine Lösung: Schwangerschaftsabbruch. Tim soll in der 26. Schwangerschaftswoche wegen der Diagnose Down-Syndrom und „darauf beruhender seelischer Beeinträchtigung der Mutter“[527] abgetrieben werden.
„Die Abtreibung von Kindern, bei denen aufgrund einer Pränataldiagnostik eine mögliche Behinderung diagnostiziert wurde, ist juristisch bis zum Zeitpunkt der Geburt legal.“[528] § 218 a Abs. 2 besagt nämlich, dass eine medizinische Indikation vorliegt, wenn Lebensgefahr oder Gefahr von schwerwiegenden körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen für die schwangere Frau unter Berücksichtigung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse bestehen.[529] Frau B. kann somit unter dem Aspekt der „seelischen Beeinträchtigung“ die Abtreibung zu diesem bereits fortgeschrittenen Zeitpunkt der Schwangerschaft verlangen. Sie muss „lediglich“ ihren Selbstmord androhen, um die „seelischen Beeinträchtigungen“ zu verdeutlichen. Dadurch wird die Verantwortung auf die Frau abgewälzt. Sie verlangt den Schwangerschaftsabbruch; sie droht mit Selbstmord; für sie wäre die Geburt des Kindes eine Beeinträchtigung. Durch die medizinische Indikation kann sich die Medizin von der Verantwortung entledigen und übergibt sie der schwangeren Frau.
Am 17. Juli 1997 steht im Dienstplan eines jungen Assistenzarztes in einem Oldenburger Krankenhaus die Abtreibung bei Frau B. auf dem Programm. Der Arzt hat Dienst und keine wirkliche Wahl. Er muss den Eingriff vornehmen. Der damals behandelnde Arzt erklärt im Interview, dass in einem Fall wie bei Tim vorher zwischen den Interessen und Nöten der Mutter und dem Lebensrecht des Kindes abgewogen wird. Die Nöte der Mutter schienen größer, da sie sich ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom unter keinen Umständen vorstellen konnte.
Zur Einleitung der Spätabtreibung verabreichen die Ärzte ein Hormon (Prostaglandine), das Wehen auslöst. Eine solch „eingeleitete Geburt“ kann einige Tage dauern. In der Regel stirbt der Fötus im Verlauf der „Prozedur“, da die Strapazen zu groß sind. Für Tims Mutter sollte die Geburt möglichst schnell vorbei sein. Normalerweise kommen die Kinder bereits tot auf die Welt, erklärt auch der behandelnde Arzt.
„Es geht ja auch darum, dass dieses Kind eben nicht als lebendiges Kind, als lebendes Kind geboren werden soll. Weiterhin hatte ich bei den Abtreibungen bei denen ich vorher schon mitwirken musste oder mitwirkte, auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder durchweg bereits verstorben sind bei der Geburt. Es gibt aber auch viele Fälle bei denen das Kind zunächst einmal lebt, aber dann erst in den nächsten Minuten, manchmal auch Stunden stirbt.“[530]
Ein Schwangerschaftsabbruch wie bei Frau B. gehört nicht zu den Routineeingriffen in der Oldenburger Klinik. Die Ärzte beginnen mit der Einleitung des Schwangerschaftsabbruchs durch die Verabreichung des Wehen auslösenden Hormons. Nur zwei Tage erhält Frau B. alle vier Stunden ein Mittel zur Einleitung der Frühgeburt. Schließlich setzen die Wehen ein.
Zur Abtreibung per Frühgeburt liegt Tims Mutter nicht im Kreißsaal, da sie nichts von anderen Geburten mitbekommen will. Auch lehnt sie im Voraus ab, das Kind nach der Geburt zu sehen. In dem Dokumentarfilm erklärt der Arzt, dass vor dem Eingriff mit den Eltern abgesprochen wird, ob sie das Kind nach der „Prozedur“ noch einmal sehen möchten. Ihm war es laut eigener Aussage wichtig, dass das Kind nicht alleine sterben muss.
„Somit hatten wir die Funktion dieses Kind zu begleiten in seinen Tod; entweder wäre es schon als tot geboren zu erwarten gewesen oder als kurz danach sterbend, zu begleiten gewesen, darauf waren wir irgendwie gefasst.“ Weiter erzählt der Arzt: „Ich denke das ist auch etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, mir war es völlig fremd jetzt ein Kind, sagen wir jetzt einfach mal so wie eine Sache wegzuschmeißen oder so in die Ecke zu legen. Ich würde schon lieber ein Kind eben in Behütung wissen, also irgendwie auf den Armen haben, irgendjemand der das eben übernimmt diese Aufgabe.“[531]
Am 6. Juli 1997 kommt Tim um 01:00 Uhr nachts zur Welt. Er wiegt 690 Gramm und ist 32 Zentimeter groß. Tim wird in ein warmes Tuch gewickelt und der Arzt und die Schwestern erwarten zu diesem Zeitpunkt, dass Tim bedingt durch die Strapazen und den Stress der Geburt im besten Fall eine Stunde überlebt. Doch es kommt anders.
„Er [Tim] überlebte die Abtreibung, wurde in Tücher gewickelt und mit Schnappatmung und einer Herzfrequenz von 40/min liegengelassen, um seinen Tod doch noch herbeizuführen.“[532]
Schließlich handelt es sich nicht um eine „normale“ Geburt, bei der das Kind kräftig ist und alle sich freuen. Im Gegenteil, erklärt der Arzt, es ist ein Kind, dem man im ersten Moment gar nicht so leicht ansehen kann, ob es denn nun lebt oder schon tot ist.
„Das Kind liegt dort, streckt alle viere von sich, im wahrsten Sinne des Wortes und sieht durch die Geburtsmanipulation, durch diese Wehentätigkeit auch, von leichten Blutergüssen bedeckt aus, so dass man im ersten Moment gar nicht entscheiden kann, lebt das Kind denn oder stirbt es.“[533]
Entgegen den Erwartungen der Ärzte zeigt Tim um 02:00 Uhr nachts immer noch Lebenszeichen. Der behandelnde Arzt schaut nun jede halbe Stunde nach Tim. Die Hebammen wickeln das Baby weiterhin in gewärmte Tücher. Diese Situation, wie sie sich bei Tim entwickelte, hatte der Arzt selbst so noch nicht erlebt. Er erklärt, dass es nun darum ging abzuwägen. Sie hätten Tim schließlich nichts Böses gewollt, sondern mussten die Spätabtreibung durchführen im Rahmen ihres Dienstplanes.
„Nun kann man nicht gleich, wenn so ein Kind geboren ist, auch wenn es ein paar Schnaufer tut, sagen: So, das ist jetzt ein Kind, was leben will, also holen wir jetzt die Neonatal, also die Intensivstation und machen dort alles Mögliche. Denn das Kind ist ja vorher von uns auch durch diese Maßnahmen und durch die Geburt selber, die gerade im Fall von Tim eben auch nicht einfach war, eigentlich so stark geschädigt, dass man erwartet, es würde in den nächsten, in der nächsten Zeit dann auch versterben.“[534]
Fünf Stunden nach der Abtreibung stellt der Arzt im Oldenburger Krankenhaus fest, dass das Herz von Tim inzwischen regelmäßig schlägt. Dies ist von ihm so nicht erwartet worden. Das ist schließlich der Punkt an dem man „umschaltet“, erzählt der Arzt. Der Fokus muss auf das Leben des Kindes gelegt werden. Es ist eine völlig neue und für ihn unerträgliche Situation. Der Arzt berichtet:
„Ich habe das Kind bis dahin durch die Geburtseinleitung, durch alles eigentlich geschädigt, um es eben eigentlich auch zu töten, zu opfern für die Mutter. Und dann irgendwie muss ich jetzt alles tun, um das Kind eben zu retten, zu leben, ihm alles zukommen zu lassen, was es denn eben möglicherweise braucht.“[535]
Fast neun Stunden nach seiner Geburt wird Tim schließlich auf die Intensivstation verlegt. Tim hat seine Abtreibung überlebt. Einige Male noch gerät er in Lebensgefahr. Auf der Intensivstation versagen die Lungen und er erleidet Hirnblutungen. Tim wird in den ersten Monaten nach seiner Geburt mehrmals operiert, aber er überlebt. „Seine bleibenden Behinderungen hatten sich durch die lange Verweigerung einer sachgemäßen Versorgung verschlimmert.“[536]
An dieser Situation, wie sie sich bei Tim ergeben hat, wird die Problematik einer Spätabtreibung deutlich. Die Tötung innerhalb des Mutterleibs ist straffrei. Das bedeutet im Fall von Tim: Hätten die Ärzte ihm vor der „Geburt“ eine Kalium-Chlorid-Spritze ins Herz injiziert, d.h. den sogenannten Fetozid durchgeführt, wäre dies legal gewesen. Die Tötung nach der Geburt ist jedoch ein krimineller Akt. Das bedeutet, Tim hätte sofort nach der Geburt versorgt werden müssen, damit er die bestmöglichen Überlebenschancen hat. Es ist ein Interessenkonflikt entstanden, der gar nicht erst hätte entstehen dürfen. Tim wurde zunächst „liegen gelassen“, ehe er auf die Intensivstation gekommen ist, da die Ärzte davon ausgingen, dass er noch sterben würde. Tims Geschichte unterstreicht die These von Anne Waldschmidt: „Je früher die Selektion erfolgt, desto eher kann sie toleriert werden.“[537] Bei Tim ist die Selektion zu spät erfolgt, wodurch der Fall Aufsehen erregte und nicht mehr ohne weiteres toleriert werden konnte.
Frau B. ändert auch nach der misslungenen Abtreibung ihre Meinung nicht. Sie bleibt bei ihrem Entschluss, dass sie mit ihrem Kind nichts zu tun haben will. Sie will Tim nicht sehen. Als Tim sechs Monate alt ist, wird er vom Jugendamt als Adoptivkind seiner heutigen Familie vermittelt. Tims Adoptivvater erklärt im Interview, dass Tim durch die fehlgeschlagene Abtreibung und den Behandlungsabbruch nach der Geburt zusätzliche Probleme hat. „Das Down-Syndrom ist sicherlich eine Diagnose und ein Fall. Wäre er damals nicht abgetrieben worden, wären sicherlich viele Probleme, die Tim zusätzlich hat, er ist ja mehrfach schwerstbehindert, nicht aufgetreten.“[538] Mit dem Down-Syndrom sind nicht alle Behinderungen, die Tim hat, zu erklären. Es wird deutlich welche Strapazen die „Prozedur“ auch für das Kind bedeutet.
Seit Tims Geburt lief ein juristisches Verfahren gegen den behandelnden Arzt. Die leiblichen Eltern von Tim hatten den behandelnden Arzt u.a. angezeigt, weil Tim lebend zur Welt gekommen ist. Der Mutter sei dadurch Schaden zugefügt worden, da sie mit einem toten Kind gerechnet hatte. Diese Klage wurde jedoch abgewiesen. Gleichzeitig hatten die leiblichen Eltern auch wegen unterlassener Hilfeleistung geklagt. Der lebendgeborene Tim sei nicht ausreichend versorgt worden. Dieses Verfahren wurde zweimal eingestellt. Eine Vereinigung von Lebensschützern erzwang allerdings eine Wiederaufnahme. Im April 2004 kam es schließlich zu einem Urteil. Der Arzt wurde mit einer Geldstrafe in der Höhe von ungefähr 13.000 Euro laut § 220f Delikt der Körperverletzung bestraft.
Dies sind die Klagen vor denen sämtliche Ärzte Angst haben. Das ist auch der Grund dafür, dass viele Ärzte den Fetozid durchführen, um eine Lebendgeburt von vorneherein ausschließen zu können. Denn dann laufen sie erst gar nicht in Gefahr verklagt zu werden.
Tims leibliche Mutter benötigte seit Tims Geburt Psychotherapie, so Bekannte. Sechs Jahre nach Tims Geburt hat sich Frau B. schließlich das Leben genommen. Sie ist nie wieder gesund geworden. Tims leiblicher Vater behielt das Sorgerecht für Tim. Er steht noch in Kontakt mit Tims Adoptiveltern.
Dies zeigt, was für eine Belastung das Erlebte für Tims leibliche Mutter gewesen sein muss. Viele Frauen blenden die möglichen Konsequenzen einer Spätabtreibung aus. Selbst Monika Hey, bei der die Abtreibung „erfolgreich“ war, berichtet von einer großen Belastung.
„Bis es mich selbst betraf, hatte ich wenig darüber nachgedacht, was eine Frau empfindet, die ihr Kind abgetrieben hat. Die einem Schwangerschaftsabbruch zustimmt, obwohl sie sich mit ihrem ungeborenen Kind vielleicht schon innig verbunden fühlt. Das Tabu, über eine Abtreibung nach pränataler Diagnostik zu sprechen, ist groß. Und möglicherweise kommt zur selbstverständlichen Erwartung an Schwangere, sich pränataldiagnostisch untersuchen zu lassen, bis heute die Ignoranz gegenüber dem Schmerz derjenigen Eltern hinzu, die ihr Kind wegen eines problematischen Befunds nach solch einer Untersuchung abgetrieben haben.“[539]
Die mögliche Belastung durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung wird dauernd angesprochen im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik. Die Folgen einer Spätabtreibung werden hingegen nur wenig thematisiert. Tims Geschichte (oder auch die Geschichte von Monika Hey) zeigt jedoch, dass es dringend erforderlich ist, auch über die Spätabtreibungen und deren Konsequenzen offen zu sprechen.
Als die Adoptivmutter von Tim im Interview zur leiblichen Mutter von Tim befragt wird, antwortet sie: „Sie hat schon arge Probleme jetzt, denke ich, auch damit fertig zu werden und große Schuldgefühle.“ Die Frage, ob sie Wut empfinde gegenüber Tims leiblicher Mutter, beantwortet sie wie folgt: „Nee, eigentlich nicht. Weil ich schon denke, dass es eigentlich nicht ihre Schuld ist. Ich trau ihr das nicht zu, dass sie das aus Egoismus entschieden hat, ihn abzutreiben. Sondern einfach aus mangelnder Aufklärung.“[540]
Tims Adoptivmutter berichtet über Diskriminierungen, die sie erfahren muss als Mutter eines behinderten Kindes. Das Amt lehnt aus ökonomischen Gründen Anfragen für Kuren für Tim ab. So musste Tims Adoptivmutter sich schon anhören, dass Tim später nicht positiv zum Bruttosozialprodukt beitragen könne.
Diese Ablehnungen orientieren sich deutlich an Kosten-Nutzen-Rechnungen. Tim wird aufgrund seiner Behinderungen diskriminiert. Dies zeigt, dass die Kosten-Nutzen-Logik bis heute aktuell geblieben ist und keineswegs nur Anfang 1900 in öffentlichen Preisausschreiben Thema war, wie beispielsweise in der Ausschreibung „Was kosten die schlechten Rassenelemente den Staat?“[541] in der Zeitschrift „Die Umschau“ von 1910.[542]
Auch wenn solche Kosten-Nutzen-Rechnungen heute nicht mehr in Zeitschriften abgedruckt werden, sind Betroffene mit dieser Mentalität konfrontiert. So erklärt auch Tims Adoptivmutter, dass sie das Gefühl hat, ständig „betteln“ gehen zu müssen, um Unterstützung für Tim zu erhalten.
„Man hat ein konkretes Anliegen, was dem Kind auch zusteht, wie ein Gehwagen oder eine andere Hilfsmöglichkeit für sein Fortbewegen und wenn man dann auf dem Amt ist, dann kommt man sich vor, als würde man da um was betteln. Und so wird man auch ganz oft behandelt. Also, man hat dann schon ein schlechtes Gewissen, wenn man schon wieder was beantragen muss. [...] Also man mag das schon gar nicht mehr beantragen, obwohl das alles einem zusteht.“[543]
Tims Adoptiveltern setzten sich für Tims Rechte ein und haben die gemeinnützige Stiftung „Ja zum Leben“ gegründet. Diese Stiftung engagiert sich für die „Rechte der ungeborenen Kinder“. Tims Adoptiveltern möchten auf das Thema „Spätabbruch“ aufmerksam machen. Sie informieren auf der Internetseite „Tim lebt. Geburtstag statt Todestag“[544] beispielweise über gesetzliche Hintergründe und Initiativen, die sich für die Rechte von Ungeborenen einsetzen.
Tims Adoptivvater erzählt im Interview, dass er und seine Familie das Thema Spätabtreibung überhaupt nicht kannten. Ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass es das gebe. Sie sind erstmalig durch Tim mit diesem Thema in Berührung gekommen. Tims Adoptivvater steht dem Thema Spätabtreibung kritisch gegenüber und erklärt: „Tim hätte es besser haben können.“[545]
Tim ist lebend zur Welt gekommen. Die Spätabtreibung war misslungen. An dieser Geschichte wird deutlich, dass bei den Spätabbrüchen Kinder getötet werden, die außerhalb des Mutterleibs bereits lebensfähig sind. Tims Geschichte ist zudem kein Einzelfall.[546]
[469] Vgl. grundlegend für das Folgende: Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert, 2012.
[470] Ebd., S. 14.
[471] Ebd., S. 14.
[472] Ebd., S. 18.
[473] Hey 2012, S. 28.
[474] Ebd., S. 29f.
[475] Schindele 1990, S. 32.
[476] Vgl. Schindele 1995, S. 13.
[477] Hey 2012, S. 35.
[478] Ebd., S. 35.
[479] Vgl. Schindele 1995, S. 86f.
[480] Hey 2012, S. 43.
[481] Hey 2012, S. 47.
[482] Ebd., S. 48.
[483] Ebd., S. 54.
[484] Trautmann, Merz 2007, S. 5.
[485] Hey 2012, S. 58.
[486] Ebd., S. 61f.
[487] Ebd., S. 68.
[488] Hey 2012, S. 71.
[489] Ebd., S. 72.
[490] Ebd., S. 74.
[491] Ebd., S. 77f.
[492] Hey 2012, S. 78.
[493] Ebd., S. 80.
[494] Ebd., S. 86.
[495] Hey 2012, S. 87.
[496] Bundesministerium der Justiz, http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
[497] Vgl. Schumann 2007, S.41.
[498] Wolf, 2008, S. 620.
[499] Hey 2012, S. 95.
[500] Ebd., S. 101.
[501] Ebd., S. 103.
[502] Ebd., S. 104.
[503] Ebd., S. 111.
[504] Ebd., S. 113.
[505] Vgl. Lichte 2007, S. 119f.
[506] Vgl. Spieker 2005, S. 18.
[507] Hey 2012, S. 121.
[508] Ebd., S. 121.
[509] Hey 2012, S. 125.
[510] Ebd., S. 125.
[511] Ebd., S. 125f.
[512] Ebd., S. 130.
[513] Ebd., S. 150.
[514] Ebd., S. 155f.
[515] Hey 2012, S. 183.
[516] Ebd., S. 151.
[517] Hey 2012, S. 152.
[518] Ebd., S. 152.
[519] Renner 2007, S. 10.
[520] Vgl. ebd., S. 10.
[521] Ebd., S. 13.
[522] Vgl. grundlegend für das Folgende: Kilimann, Gisela; Kilimann, Udo: Er sollte sterben, doch Tim lebt! – Eine Abtreibung und ihre Folgen. ARD, ausgestrahlt am 16.03.2005, Teil 1-3. http://www.youtube.com/watch?v=csUI1Yv_TQk, http://www.youtube.com/watch?v=_JO3OcQqATc, http://www.youtube.com/watch?v=ED4llesl6mg. Und: Spieker, Manfred: Der legalisierte Kindermord. Zur Problematik der Spätabtreibungen. 2005.
[523] Spieker 2005, S. 15.
[524] Tim lebt! Geburtstag statt Todestag. Stiftung Ja zum Leben. http://www.tim-lebt.de/startseite/.
[525] Kilimann 2005.
[526] In dem Film wird Tims leibliche Mutter „Frau B.“ genannt. Diese Formulierung wird in dieser Arbeit übernommen.
[527] Spieker 2005, S. 16.
[528] Lichte 2007, S. 117.
[529] Vgl. Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html.
[530] Kilimann 2005.
[531] Ebd.
[532] Spieker 2005, S. 16.
[533] Kilimann 2005.
[534] Ebd.
[535] Ebd.
[536] Spieker 2005, S. 16.
[537] Waldschmidt 1995, S. 385.
[538] Kilimann 2005.
[539] Hey 2012, S. 14.
[540] Kilimann 2005.
[541] Zit. n. Bergmann 1998, S. 72.
[542] Vgl. ebd., S. 72.
[543] Kilimann 2005.
[544] Stiftung Ja zum Leben: Tim lebt! Geburtstag statt Todestag. http://www.tim-lebt.de/startseite/.
[545] Kilimann 2005.
[546] Vgl. Spieker 2005, S. 16. Siehe auch Kapitel „Spätabtreibung nach Pränataldiagnostik“ dieser Arbeit.
Im historischen Rückblick wurde verdeutlicht, wie sehr sich Staat und Medizin biopolitisch seit der Wende zum 20. Jahrhundert in Ehe, Familie und Geburtenkontrolle eingemischt haben. Die ständige Angst vor einem Geburtenrückgang und vor „krankem“ Nachwuchs legitimierte die Eingriffe in den weiblichen Körper und die fortschreitende Kontrolle der Schwangerschaft und Geburt.
Die Biopolitik beeinflusst das politische Handeln durch die Normalitätskonzepte, welche die Human- und Naturwissenschaften etablieren.[547] So hat der Historiker Michel Foucault erklärt, dass es ein Kennzeichen der Moderne ist unter biopolitischen Prämissen „leben zu machen und sterben zu lassen“[548]. Durch die Geburtenkontrolle kam es nämlich zu einer Biopolitik, die sich nicht mehr nur mit der Sterblichkeit, sondern auch mit der Geburtenrate unter Aspekten der „Qualität“ der Bevölkerung befasste. Die Dauer, Form, Intensität usw. von Krankheiten wurden immer wichtiger und das Hauptaugenmerk wurde auf „das biologische Überleben der Bevölkerung“[549] gelegt. Der Biopolitik geht es seither um die Zufälligkeiten innerhalb einer Bevölkerung, die es durch Sicherheitsmechanismen einzudämmen gilt.[550] Die „Eugenisierung der Fortpflanzung“[551] entsprang dem Wunsch alles Unberechenbare, Unvorhersehbare und Unkontrollierbare der menschlichen Natur auszuschalten und kapitalistischen Bedürfnissen nach einem „optimierten Volkskörper“ zu entsprechen. Biopolitik hat somit, wie auch Foucault hervorhebt, immer die Tendenz zur Selektion und beinhaltet einen rassistischen Kern. Der Rassismus hat in diesem Zusammenhang die selektiven Kategorien des „höherwertigen“ und „minderwertigen Lebens“ eingeführt.[552]
Das immer wiederkehrende Argument für die Einmischung in Familien- und Kinderplanung war die Leidvermeidung. Der Begriff „Glück“ und das Bild einer „leidfreien“ Gesellschaft wurden hierbei als Rechtfertigung für die Rassenhygiene verwendet.[553] Diese Überlegungen und Motive werden oft lediglich dem Nationalsozialismus zugeschrieben, doch die Geschichte zeigt, dass diese Ideen sowohl vorher bereits, als auch nachher international verbreitet waren und nie komplett verschwunden sind.
So wurden Kosten-Nutzen-Rechnungen bereits Anfang des 20. Jahrhunderts aufgestellt und auch die Argumentation der Leidvermeidung war bereits vor der NS-Zeit vorhanden.[554] Der Nationalsozialismus hat die Eugenik stark gefördert, wobei eine Kontinuität auch nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ festzustellen ist. Der „Prozess der Optimierung der Bevölkerung“[555] wurde fortgeführt. Der Umgang und die Formulierungen haben sich nach dem Nationalsozialismus verändert. Die Verantwortung für „gesunden“ Nachwuchs wurde individualisiert und die Medizin hat immer mehr Selbstverantwortung verlangt. Die „persönliche Gesunderhaltung“[556] wurde zur Norm und es vollzog sich immer mehr eine „Medikalisierung“ der Geburtenkontrolle und der Schwangerschaft. Verfahren, die zur Optimierung einzelner Körper und der gesamten Bevölkerung dienen, wurden prinzipiell als „gesundheitsfördernd“ definiert.[557] Durch ständig neu entwickelte Techniken wurden auch immer neue Risiken formuliert.[558] Reproduktionsmedizin und Humangenetik haben Bedürfnisse erzeugt, die nur sie alleine stillen können.[559]
In den 1970er Jahren etablierte sich schließlich durch das zentrale Thema der Geburtenförderung die Pränataldiagnostik. So wurde in der Bundesrepublik erklärt, dass die pränatale Diagnostik geburtenfördernd sei und daher den „kontinuierlichen Bevölkerungsschwund“[560] hemmen könnte. Außerdem könnten schwere individuelle Schicksale durch die Humangenetik vermieden werden. Die pränatale Diagnostik wurde allmählich zur neuen Technologie der Bevölkerungsregulierung.[561]
Als Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist festzuhalten: Die ursprüngliche Idee, nur spezielle risikobehaftete Schwangerschaften zu kontrollieren, ist nicht mehr aktuell, heute wird (beinahe) jedes Ungeborene kontrolliert und die Durchleuchtung von schwangeren Frauen ist zur Normalität geworden. Werdende Mütter sollen verantwortungsvoll handeln. Diese Verantwortung ist direkt mit der Norm eines „gesunden“ Kindes verbunden.
Die Sozialwissenschaftlerin Anne Waldschmidt spricht in diesem Zusammenhang von der „alten“ und der „neuen Eugenik“[562]. Durch die zunehmende Individualisierung hat sich die Eugenik verlagert. Früher wurde sie durch Zwang „von oben“ verordnet, heute verlangen die Frauen sie selber „von unten“. Sie haben den nach Risiken fahndenden Blick der Medizin verinnerlicht. Die Pränataldiagnostik arbeitet dabei unter dem Deckmantel der Prävention, doch das Prinzip der Selektion wurde beibehalten und mit technischen Mitteln modernisiert. Nach wie vor wird das menschliche Leben bewertet und ein Urteil gefällt. Jede Frau, die Gebrauch von pränataler Diagnostik macht, beteiligt sich an dieser Bewertung, ob sie will oder nicht.[563] Anne Waldschmidt fasst diese Entwicklung zusammen: „Früher wurde geborenes, heute wird ungeborenes Leben ausgelesen; die Auslese erfolgt entsprechend einer Bewertung nach Qualitätsmerkmalen.“[564]
In diesem Zusammenhang wird die Schwangerschaft nicht mehr als eine hoffnungsvolle Lebensphase betrachtet, sondern als ein risikoreicher Prozess, den es zu kontrollieren gilt. Entsprechend hat sich ein Wahrnehmungswandel der Schwangerschaft durch die Pränataldiagnostik vollzogen. Die „risikoorientierte Schwangerenvorsorge“[565] hat sich zu einem „Embryonen-TÜV“[566] entwickelt, und wie Eva Schindele erklärt, ist „in guter Hoffnung sein [...] aus der Mode gekommen“[567]. Die ständige Angst vor möglichen Risiken, vor denen die Medizin warnt, bringt werdende Mütter dazu, ihre „Macht“ abzugeben, wodurch eine „Enteignung der Schwangerschaft durch die Medizin“[568] entsteht.
Durch die Pränataldiagnostik entsteht ein direkter Eingriff in den weiblichen Körper. Der Wunsch nach einem „gesunden“ Kind wird von der Gesellschaft und der Medizin suggeriert und übt großen Druck auf die werdenden Mütter aus. Denn das was medizinisch machbar ist, scheint auch vernünftig zu sein. Dass 97 Prozent aller Kinder gesund zur Welt kommen, scheint hierbei keine Rolle zu spielen.[569] Durch die prädiktive Medizin werden alle Menschen zu Patienten gemacht, egal wie gering das Krankheitsrisiko tatsächlich ist.[570]
Es wird regelrecht nach „kranken“ Föten „gefahndet“, denn es geht nicht mehr nur um bloße Prävention, sondern um eine systematische Verhinderung der Geburt „behinderter“ Kinder. Die wenigen Präventionsmaßnahmen, die dabei zur Anwendung kommen, sind zudem meist sehr risikoträchtig.[571] Sowohl die Amniozentese, als auch die Chorionzottenbiopsie bergen die Gefahr einer Frühgeburt oder eines Aborts. Sämtliche nicht-invasive Untersuchungen, wie beispielsweise der Ultraschall, sind zwar nicht gefährlich, reichen aber für eine Diagnose nicht aus. Zur genaueren Abklärung müssen immer zusätzlich invasive Untersuchungsmethoden durchgeführt werden. Selbst der hoch angepriesene „PraenaTest“ ist lediglich ein „Zwischenschritt“ zur invasiven Diagnostik und kann diese nicht ersetzen.[572] Genetische Untersuchungen bergen zudem Fehlerquellen und können keine absolute Sicherheit geben, obwohl dies oft suggeriert wird.[573] So wird fünf von 100 Frauen eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ für Trisomie 21 mitgeteilt, die sich dann im Verlauf weiterer Untersuchungen als falsch herausstellt.[574]
Die Entwicklung der Testverfahren ist rasant. Der Zugang soll immer niedriger werden, damit immer mehr Frauen Gebrauch von pränataldiagnostischen Methoden machen und kein „krankes“ Kind übersehen wird. Die diagnostischen Möglichkeiten werden stets weiter entwickelt und hoch angepriesen. Die Pränataldiagnostik ist dadurch rasch zur Routine in der Schwangerenvorsorge geworden und wird längst nicht mehr nur in seltenen Extremfällen angewendet.[575] Doch die therapeutischen Aussichten werden demgegenüber stark vernachlässigt. Ob in diesem Zusammenhang noch von Diagnostik die Rede sein kann, stellt auch Monika Hey in Frage, denn in den meisten Fällen folgt aus der Diagnostik keine therapeutische Konsequenz.[576]
Bedingt durch die Diskrepanz zwischen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten hat die Pränataldiagnostik bis heute einen selektiven Charakter, denn die Therapiemöglichkeiten sind äußerst gering.[577] Dadurch kommt es immer öfters zu Spätabbrüchen. Die Zahlen sind in den letzten Jahren in Deutschland drastisch angestiegen. 1995 haben 26 Frauen nach 23. Schwangerschaftswoche abgetrieben, 2003 waren es bereits 217 und 2010 lag die Zahl schließlich bei 462.[578] Diese Potenzierung der Spätabtreibungen konnte nur unter der Bedingung ihrer Straffreiheit erfolgen.
Oft mündet eine pränatale Diagnose in einem Schwangerschaftsabbruch. Wenn eine Behinderung beim Ungeborenen diagnostiziert wird, darf die Frau den Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation verlangen.[579] Es gibt keine Frist für einen Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation und die Abtreibung kann grundsätzlich bis zum Beginn der Geburt, also bis zum Einsetzen der Wehen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass oftmals bereits lebensfähige Föten abgetrieben werden.[580] Eine medizinische Indikation liegt laut § 218a Abs. 2 vor, wenn Lebensgefahr oder Gefahr von schwerwiegenden körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen für die Frau unter Berücksichtigung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse bestehen.[581] Anders ausgedrückt: „Wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt.“[582] Das bedeutet, dass werdende Mütter den Selbstmord androhen müssen, sollten sie gezwungen sein ein „behindertes Kind“ auszutragen. Mit dieser Abwälzung der Verantwortung auf die jeweiligen Mütter wird „behinderten Kindern“ das Lebensrecht aberkannt. Hey bringt diese Dimension so auf den Punkt:
„Bereits eine leichte Fehlbildung berechtigt heute zu einem Abbruch, wenn die Schwangere dies für eine unzumutbare Belastung hält. Die offizielle Begründung muss allerdings sein, dass die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Geburt des Kindes Gefahren für Leben oder Gesundheit der Mutter mit sich bringen.“[583]
Die Medizin und auch das Gesetz wälzen hierbei die gesamte Verantwortung auf die schwangere Frau ab. Sie muss den Abbruch ausdrücklich verlangen und dies auch schriftlich bestätigen. Die Medizin stellt lediglich ihr Wissen zur Verfügung und die werdende Mutter muss dieses schließlich bewerten und auf dieser Grundlage über Leben und Tod ihres ungeborenen Kindes entscheiden.[584] Maria Wolf hält fest: „Die reproduktionsgenetische Medizin betont, dass der Schwangerschaftsabbruch nur auf Wunsch der Eltern durchgeführt wird und dass auch die Entscheidung, ob ein Leben lebenswert ist oder nicht, die Eltern zu verantworten haben.“[585] Die werdenden Eltern müssen also entscheiden, ob die „zumutbare Opfergrenze“[586] durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung überschritten wird oder nicht. Denn die Gesetzeslage erlaubt, dass bereits lebensfähige Föten aufgrund einer pränataldiagnostizierten Behinderung getötet werden.[587]
Meines Erachtens sollten Spätabbrüche lediglich dann legal sein, wenn tatsächlich körperliche Lebensgefahr für die werdende Mutter besteht oder beispielsweise aufgrund einer Vergewaltigung. Der Sozialwissenschaftler Manfred Spieker fordert, dass Spätabbrüche ausschließlich mit „vitaler Indikation“[588] straffrei sein sollten. Das bedeutet, dass eine „unmittelbare Gefahr für das Leben der Mutter“[589] bestehen müsste, um einen Abbruch zu rechtfertigen. Eugenisch motivierte Schwangerschaftsabbrüche sollten hingegen unterbunden werden. Spieker kommt zu dem Schluss: „Ein effektiver Ausschluß jeder embryopathischen oder eugenischen Indikation aus der medizinischen Indikation wäre der Schritt zur Unterbindung des grauenvollen Abtreibungsgeschehen.“[590]
Dass dieses Abtreibungsgeschehen tatsächlich gewalttätig und auch für die betroffenen schwangeren Frauen unzumutbar ist, zeigen verschiedene Fälle, die sich in Deutschland und in anderen Ländern ereignet haben. Spätabtreibungen sind eingeleitete Frühgeburten, bei denen der Fötus in der Regel während der „Prozedur“ stirbt. Die schwangeren Frauen müssen aktiv mitwirken bei diesen „tödlichen Frühgeburten“ und spüren oft den Todeskampf ihres Kindes, weil sie keine Narkose erhalten. Da die Möglichkeit einer „Lebendgeburt“ besteht, vollziehen viele Ärzte den sogenannten Fetozid, wodurch das Ungeborene bereits im Mutterleib stirbt.[591] Wie Anne Waldschmidt resümiert: „Je früher die Selektion erfolgt, desto eher kann sie toleriert werden.“[592]
Die Geschichte vom „Oldenburger-Baby“ verdeutlicht, auf welch schmalen Grad Spätabtreibungen erfolgen. Tim, der seine eigene Abtreibung überlebte, war als „Down-Syndrom-Kind“ bereits vor seiner Geburt als „nicht lebenswertes Kind“ kategorisiert worden und sollte aufgrund einer pränatalen Diagnose abgetrieben werden.[593] Am Beispiel seiner Geschichte wird deutlich, dass die Tötung nach der Geburt als krimineller Akt gewertet wird; die Tötung innerhalb des Mutterleibs allerdings juristisch vollends akzeptiert und daher straffrei ist. Hätte der Arzt bei Tim einen Fetozid durchgeführt, wäre er nicht verklagt worden. Durch die Tatsache, dass Tim jedoch lebend zur Welt gekommen ist und der Arzt ihm zunächst keine medizinische Versorgung hat zukommen lassen, wurde er wegen „lebensgefährlicher Körperverletzung“ zum Täter. Andere Fälle offenbaren ebenfalls wie nah „Euthanasie“ und Spätabtreibung beieinander liegen.[594] Maria Wolf stellt vor dem Hintergrund dieser Praktiken fest, dass die Haupttätigkeit der Pränataldiagnostik bis heute die Verhinderung einer Geburt von Kindern mit Down-Syndrom ist.[595]
Die steigenden Zahlen der Spätabbrüche zeigen, dass sich die Befürchtungen beispielsweise des „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“ bestätigen. Die Hemmschwelle für die Inanspruchnahme von pränataldiagnostischen Untersuchungen wird immer niedriger. Der „PraenaTest“ liefert hierfür ein Beispiel. Er ist nicht-invasiv und bereits in einem frühen Stadium der Schwangerschaft möglich, zudem sind die Kosten für den Test seit seiner Markteinführung 2012 bereits verringert worden.[596] Schwangere Frauen nehmen dadurch immer schneller und früher pränataldiagnostische Tests in Anspruch. Durch die Versprechungen, eine absolute Sicherheit bieten zu können, dass das Kind „gesund“ sein wird, wird die Bereitschaft von pränataler Diagnostik Gebrauch zu machen, gefördert. Das Problem hierbei ist, dass durch die gesellschaftliche Normierung die persönlichen Erfahrungen der werdenden Mütter oft in Vergessenheit geraten und viele Frauen die Angebote unüberlegt wahrnehmen.
„Alle Ideen von dem heilen, möglicherweise auch perfekten Kind machen manchmal Vergessen, daß das Kontrollieren der Qualität des Fötus nur über und durch den weiblichen Körper möglich ist: Schwangere Frauen bürgen mit ihrem Leib für dieses ´Kind im Bauch´, sie bangen und hoffen; sie sind es, die möglicherweise gezwungen sind, ihr ´Wunschkind´ tot zu gebären, und sie sind es auch, die mit Tränen und Verzweiflung eine solche Trennung verarbeiten müssen.“[597]
Monika Hey hat dies am eigenen Leib erfahren. Sie hat ihre Erfahrungen mit Pränataldiagnostik und einem damit verbundenen Schwangerschaftsabbruch aufgeschrieben, da sie davon ausgeht, werdende Eltern stünden zunehmend unter Druck ein Kind mit Behinderung abzutreiben, mit der damit einhergehenden Belastung seien sie zudem meist allein gelassen. Hinter ihrer eigenen Trauer entdeckte sie ein Thema, das nicht nur sie betraf und das vor allem über ihren eigenen Verlust weit hinausging.[598] Als Hey in der 13. Schwangerschaftswoche war, wurde bei ihrem ungeborenen Kind das Down-Syndrom diagnostiziert. Monika Hey stimmte auf Drängen der Ärzte hin einem Schwangerschaftsabbruch zu. Sie hatte von ihren Ärzten das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie keine andere Wahl habe, als ihr Ungeborenes abzutreiben.[599] Diese Geschichte ist beispielhaft für den Druck, den auf werdende Mütter ausgeübt wird.
Ein „gesundes“ Kind ist die Norm und die Ungeborenen, die dieser Norm nicht entsprechen, sollten abgetrieben werden, so wird es werdenden Müttern suggeriert. Eva Schindele erklärt, dass die Leistungsnorm in unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert hat, dass all jene, die solchen Normen nicht entsprechen, als „krank“ kategorisiert werden.[600] „Ich spreche von einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der Zweckrationalität, Kontrolle-über-sich-Haben und Funktionieren, um abstrakten Leistungsnormen zu genügen, zu en höchsten Idealen gehören.“[601] Die Pränataldiagnostik bietet die Möglichkeiten, dieser Norm gerecht zu werden bzw. ihr zumindest einen Schritt näher zu kommen. Durch die Untersuchungen können Kinder herausgefiltert werden, die dem Leistungsdruck nicht standhalten würden. So scheint die Selektion heute normal, vernünftig und selbstverständlich zu sein.[602]
Das Problem besteht jedoch nicht nur in der Tatsache, dass die Pränataldiagnostik einen selektiven Charakter hat. Die fehlende Aufklärung bezüglich dieses Themas ist besorgniserregend und ermöglicht erst die selektive Praxis in dem großen Maßstab. Viele Frauen sind sich der Konsequenzen und Folgen pränataldiagnostischer Untersuchungen nicht bewusst. Dies hat eine repräsentative Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ergeben. 40 Prozent der befragten Frauen konnten Pränataldiagnostik nicht in eigenen Worten erklären, obwohl sie schwanger waren und darunter viele außerdem zusätzliche Untersuchungen hatten durchführen lassen. Zudem waren die Befragten zwar über Ziel und Anlass der Untersuchungen informiert worden, nicht aber über die Sicherheit der Untersuchungsergebnisse oder die Grenzen der Untersuchungsmöglichkeiten.[603] „Über das psychische und ethische Konfliktpotenzial bei Vorliegen einer Behinderung des Kindes“[604] waren die Frauen fast gar nicht informiert worden. „Schon dieses Informationsdefizit allerdings wiederspricht der Vorstellung von der mündigen Patientin, die eine wohlüberlegte Entscheidung trifft.“[605]
In Anbetracht dieser fehlenden Aufklärung ist es verwunderlich, wie Ärzte von einer „informierten Entscheidung“[606] sprechen können. „Defizite in der ärztlichen Beratung werden insbesondere bei Inhalten sichtbar, die nicht eindeutig in den ärztlichen Zuständigkeitsbereich fallen.“[607] Die Aufklärung über die Risiken und die Konsequenzen der Pränataldiagnostik müssten bereits vor der sensiblen Zeit der Schwangerschaft erfolgen.[608] Die wenigsten Menschen wissen von dem unzumutbaren und gewalttätigen Abtreibungsgeschehen in Verbindung mit einer pränatalen Diagnose. Ebenfalls erfahren viele nichts über die Möglichkeit einer psychosozialen Beratung, die ergänzend zur medizinischen Aufklärung angeboten wird.
Das medizinische Feld der Pränataldiagnostik sollte meines Erachtens offener und differenzierter thematisiert werden, um auf den Selektionscharakter aufmerksam zu machen, damit so die Praxis der „neuen Eugenik“[609] ins öffentliche Bewusstsein dringt. So fordert auch Monika Hey vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen: „Mehr öffentliche Aufklärung wäre nötig, um eine angemessene Auseinandersetzung mit diesem Thema voranzutreiben.“[610]
[547] Vgl. Lemke 2007, S. 48.
[548] Foucault 1999, S. 278.
[549] Lemke 2007, S. 54.
[550] Vgl. Foucault 1999, S. 285.
[551] Wolf 2008, S. 412.
[552] Vgl. Foucault 1999, S. 295.
[553] Vgl. Bergmann 2001, S. 33.
[554] Vgl. Bergmann 1998, S. 72.
[555] Hahn 2000, S. 36.
[556] Ebd., S. 288.
[557] Vgl. Hahn 2000, S. 38.
[558] Vgl. ebd., S. 287.
[559] Vgl. Wolf 2008, S.549f.
[560] Hahn 2000, S. 165.
[561] Vgl. ebd., S. 165.
[562] Waldschmidt 1995, S. 358.
[563] Vgl. ebd., S. 358.
[564] Ebd., S. 358.
[565] Bund Deutscher Hebammen 2006, S. 3.
[566] Spieker 2005, S. 18.
[567] Schindele 1995, S. 85.
[568] Schindele 1990, S. 34.
[569] Vgl. Wolf 2008, S. 546.
[570] Vgl. Lemke, Kollek 2011, S. 176.
[571] Vgl. Wehling, Viehöver 2011, S. 21.
[572] Vgl. Hey 2012, S. 169f.
[573] Vgl. Pagels 2011, S. 39.
[574] Vgl. Wegener 2007, S. 43.
[575] Vgl. Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, S. 2.
[576] Vgl. Hey 2012, S. 187.
[577] Vgl. Feldhaus-Plumin 2012, S. 14.
[578] Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=8917965&nummer=240&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=19446707.
[579] Vgl. Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005302307.
[580] Vgl. Spieker 2005, S. 15.
[581] Vgl. Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005302307.
[582] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[583] Hey 2012, S. 88.
[584] Vgl. Wolf 2008, S. 504ff.
[585] Wolf 2008, S. 633.
[586] Bundesministerium der Justiz. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__219.html.
[587] Vgl. Spieker 2005, S. 15.
[588] Ebd., S. 25.
[589] Ebd., S. 25.
[590] Ebd., S. 25.
[591] Vgl. ebd., S. 18.
[592] Waldschmidt 1995, S. 385.
[593] Vgl. Spieker 2005, S. 16.
[594] Vgl. ebd., S. 16.
[595] Vgl. Wolf 2008, S. 631.
[596] Vgl. Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, S. 5.
[597] Schindele 1990, S. 9f.
[598] Vgl. Hey 2012, S. 14.
[599] Vgl. ebd., S. 77f.
[600] Vgl. Schindele 1990, S. 28.
[601] Ebd., S. 28.
[602] Vgl. Waldschmidt 1995, S. 361.
[603] Vgl. Renner 2007, S. 7ff.
[604] Ebd., S. 10.
[605] Hey 2012, S. 191.
[606] Schumann 2007, S. 39.
[607] Renner 2007, S. 13.
[608] Vgl. Hey 2012, S. 60.
[609] Waldschmidt 1995, S. 358.
[610] Hey 2012, S. 191.
Inhaltsverzeichnis
Aresin, Lykke: Schwangerschaftsabbruch in der DDR. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 86-95.
Beck-Gernsheim, Elisabeth: Was ist Leben? Neue Technologien, neue Ethik: die Pränataldiagnostik. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 127-134.
Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität. Die medizinische Bemächtigung des Lebens. Aufbau Taschenbuch Verlag. Berlin, 1998.
Bergmann, Anna: Die verhütete Sexualität: Frauen zwischen Gebärzwang und Gebärverbot im 20. Jahrhundert. In: Groth, Sylvia; Rásky, Éva (Hrsg.): Sexualitäten. Interdisziplinäre Beiträge zu Frauen und Sexualität. StudienVerlag. Innsbruck, Wien, München, Bozen, 2001, S. 27-59.
Bock, Gisela: Nationalsozialistische Geschlechterpolitik und die Geschichte der Frauen. In: Duby, Georges; Perrot, Michelle: Geschichte der Frauen. Band 5. 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Francoise Thébaud. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1995, S. 173-204.
Bock, Gisela: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1986.
Bund Deutscher Hebammen e.V: Hebammen-Standpunkte. Pränatale Diagnostik. Karlsruhe, 2006.
Bundesärztekammer: Richtlinien zur pränatalen Diagnostik von Krankheiten und Krankheitsdispositionen. Deutsches Ärzteblatt 95 (1998) Heft 50, S. A3236-A3242.
Czarnowski, Gabriele: Frauen als Mütter der „Rasse“. Abtreibungsverfolgung und Zwangseingriff im Nationalsozialismus. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 58-72.
Deutscher Ethikrat: Die Zukunft der genetischen Diagnostik – von der Forschung in die klinische Anwendung. Stellungnahme. Berlin, 2013.
Duden, Barbara: „Ein falsch Gewächs, ein unzeitig Wesen, gestocktes Blut“. Zur Geschichte von Wahrnehmung und Sichtweise der Leibesfrucht. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 27-35.
Ensel, Angelica: Schwanger und Kundin? Verantwortung und Zumutungen im Kontext pränataler Diagnostik. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 47-51.
Feldhaus-Plumin, Erika: Zur Frage pränataler Diagnostik als Routine und der Zweitrangigkeit psychosozialer Beratung. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Vorgeburtliche Untersuchungen. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2/2012), S. 14-17.
Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Aus dem Französischen: Ott, Michaela. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999.
Friedlander, Henry: Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung. Berlin Verlag, 1997.
Frommel, Monika: Zum Gebären verpflichtet? Zur aktuellen Diskussion des §218. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 114-119.
Gerhard-Teuscher, Ute: Frauenbewegung und §218. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 104-113.
Hahn, Daphne: Modernisierung und Biopolitik. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nach 1945. Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2000.
Haker, Hille: Verantwortliche Elternschaft und pränatale Diagnostik. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Vorgeburtliche Untersuchungen. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2/2012), S. 32-36.
Hey, Monika: Mein gläserner Bauch. Wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2012.
Jerouschek, Günter: Zur Geschichte des Abtreibungsverbots. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 11-26.
Klinkhammer, Gisela; Richter-Kuhlmann, Eva A.: Praenatest: Kleiner Test, große Wirkung. In: Deutsches Ärzteblatt, 110 (2013) Heft 5, S. A166-A168.
Lauer, Heike: Interview mit Dr. med. Klaus König, Berufsverband der Frauenärzte e.V.: „Auf uns lastet der Vorwurf, wir würden Schwangerschaft zum Risiko machen – so ist es nicht.“ In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 33-37.
Lemke, Thomas: Biopolitik zur Einführung. Junius Verlag, Dresden, 2007.
Lemke, Thomas; Kollek, Regine: Hintergründe, Dynamiken und Folgen der prädiktiven Diagnostik. In: Viehöver, Willy; Wehling, Peter (Hrsg.): Entgrenzung der Medizin. Von der Heilkunst zur Verbesserung des Menschen? Transcript Verlag, Bielefeld, 2011, S. 163-194.
Lichte, Marijke: Deutschlands tote Kinder. Kindstötung als Folge von Gewalthandlung, sexuellem Missbrauch und Verwahrlosung. Eine historisch-soziologische Untersuchung zum Thema Infantizid. Schardt Verlag, Oldenburg, 2007.
Pagels, Jens: Pränataldiagnostik. Wissen, was stimmt. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, 2011.
Poutrus, Kirsten: „Ein Staat, der seine Kinder nicht ernähren kann, hat nicht das Recht, ihre Geburt zu fordern.“ Abtreibung in der Nachkriegszeit 1945 bis 1950. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 73-85.
Renner, Ilona: Pränataldiagnostik: eine repräsentative Befragung Schwangerer. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 7-13.
Schindele, Eva: Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko. Rasch und Röhring Verlag, Hamburg, 1995.
Schindele, Eva: Gläserne Gebär-Mütter. Vorgeburtliche Diagnostik – Fluch oder Segen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1990.
Schumann, Claudia: Veränderungen in der gynäkologischen Praxis durch Pränataldiagnostik. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 38-42.
Soden von, Kristine: „§218 – streichen, nicht ändern!“ Abtreibung und Geburtenregelung in der Weimarer Republik. In: Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996, S. 36-50.
Spieker, Manfred: Der legalisierte Kindermord. Zur Problematik der Spätabtreibungen. In: Die neue Ordnung. Herausgegeben vom Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg, 59 (2005) Heft 1, S. 15-27.
Staupe, Gisela; Vieth, Lisa (Hrsg.): Zur Geschichte der Abtreibung. Unter anderen Umständen. Eine Publikation des Deutschen Hygiene-Museums. Neuauflage, Deutsches Hygiene-Museum, Dresden und edition ebersbach, Dortmund, 1996.
Trautmann, Kathrin; Eberhard, Merz: Pränataldiagnostik – Entwicklung, Errungenschaften, Ausblick. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 3-6.
Usborne, Cornelie: Frauenkörper – Volkskörper. Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik. Aus dem Englischen: Gräbener-Müller, Juliane; Usborne, Cornelie. Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster, 1994.
Waldschmidt, Anne: „Lieber lebendig als normal!“ Positionen der Behindertenbewegung zu Humangenetik und Pränataldiagnostik. In: Schindele, Eva: Schwangerschaft. Zwischen guter Hoffnung und medizinischem Risiko. Rasch und Röhring Verlag, Hamburg, 1995, S. 333-362.
Wegener, Hildburg: Kritische Betrachtungen zum Frühscreening. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung, Pränataldiagnostik. Herausgegeben von Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1/2007), S. 43-46.
Wehling, Peter; Viehöver, Willy: Entgrenzung der Medizin – Transformationen des medizinischen Feldes aus soziologischer Perspektive. In: Viehöver, Willy; Wehling, Peter (Hrsg.): Entgrenzung der Medizin. Von der Heilkunst zur Verbesserung des Menschen? Transcript Verlag, Bielefeld, 2011, S. 7-47.
Weingart, Peter; Kroll, Jürgen; Bayertz, Kurt: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1988.
Wolf, Maria A.: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar, 2008.
Bundesministerium der Justiz. JURIS. Gesetze im Internet. Berlin. http://www.gesetze-im-internet.de/index.html (aufgerufen am: 21.05.2013)
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik. Düsseldorf. http://www.bvkm.de/arbeitsbereiche-und-themen/praenataldiagnostik/netzwerk-gegen-selektion-durch-praenataldiagnostik.html (aufgerufen am: 23.08.2013)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Herausgegeben von Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn. http://www.gbe-bund.de/gbe10/pkg_isgbe5.prc_isgbe (aufgerufen am: 31.05.2013)
Kilimann, Gisela; Kilimann, Udo: Er sollte sterben, doch Tim lebt! – Eine Abtreibung und ihre Folgen. ARD, ausgestrahlt am 16.03.2005, Teil 1-3. http://www.youtube.com/watch?v=csUI1Yv_TQk, http://www.youtube.com/watch?v=_JO3OcQqATc, http://www.youtube.com/watch?v=ED4llesl6mg. (aufgerufen am: 27.08.2013)
LifeCodexx. Nicht invasive molekular genetische Pränataldiagnostik. http://www.lifecodexx.com/ (aufgerufen am: 02.06.2013)
Mutterpass. Weil Sie eins sind – sicher sein. FemailHealth®, Heinsberg. http://www.mutterpass.de/go/mutterpass/dg/themes/mutterpass.xhtml (aufgerufen am: 06.06.2013)
Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik. Anlage zur Pressemitteilung, Stellungnahme. Neuer Bluttest droht die vorgeburtliche Selektion von Menschen mit Down-Syndrom zu perfektionieren. Kall/Frankfurt, 2012. http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/Termine/2012-03-20-Netzwerk_Praenataldiagnostik.pdf (aufgerufen am: 23.08.2013)
SpiegelOnline (Gesundheit): Ungeborenes Leben: Bluttest auf Down-Syndrom kommt in die Praxen. http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/praenatest-bluttest-auf-down-syndrom-in-praxen-erhaeltlich-a-850952.html (aufgerufen am: 02.06.2013)
Statistisches Bundesamt Deutschland. Wiesbaden. Schwangerschaftsabbrüche. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html (aufgerufen am: 30.05.2013)
Stiftung Ja zum Leben: Tim lebt! Geburtstag statt Todestag. http://www.tim-lebt.de/startseite/ (aufgerufen am: 31.05.2013)
- Abort:
-
Fehlgeburt.
- Abortinduktion:
-
Ein induzierter Abort ist die absichtliche Beendigung der Schwangerschaft.
- Ambulant:
-
Der Patient darf nach der Behandlung wieder nach Hause und muss keine Nacht im Krankenhaus verbringen. Gegenteil von „stationär“.
- Amniozentese:
-
Fruchtwasseruntersuchung.
- Antinatalistisch:
-
Gegen die menschliche Reproduktion. Gegenteil von „pronatalistisch“.
- Chorionzottenbiopsie/Chorionbiopsie:
-
Untersuchung von Bestandteilen der Plazenta, die man mittels Punktion erhält.
- Degeneration:
-
Entartung (lat.).
- Endogen:
-
Im Inneren erzeugt (griech.), durch innere Ursachen erzeugt. Gegenteil von „exogen“.
- Exogen:
-
Durch äußere Ursachen erzeugt. Gegenteil von „endogen“.
- Fetozid:
-
Absichtliche Tötung des Fötus im Mutterleib.
- Indikation:
-
Heilanzeige.
- Invasive Methoden:
-
Medizinische Prozeduren, bei denen beispielsweise mit einer Nadel in den Körper eingedrungen wird. Gegenteil von „nicht-invasiv“.
- Kontrazeption:
-
Empfängnisverhütung.
- Marker:
-
Bestimmte Merkmale, die auf Krankheiten hinweisen. Es gibt harte und weiche Marker, die sich in ihrer Aussagekraft unterscheiden.
- Morphologisch:
-
Die äußere Erscheinung betreffend.
- Nackenfalte/Nackentransparenz:
-
Eine Flüssigkeitsansammlung unter der Haut im Nackenbereich des Ungeborenen. Eine erhöhte Nackentransparenz gilt als Marker für bestimmte Fehlbildungen.
- Nicht-invasive Methoden:
-
Medizinische Prozeduren, bei denen nicht mit einer Nadel o.ä. in den Körper eingedrungen wird. Gegenteil von „invasiv“.
- Ödem:
-
Eine Schwellung von Gewebe aufgrund einer Flüssigkeitseinlagerung.
- Pränataldiagnostik:
-
Vorgeburtliche Untersuchungen.
- Plazenta:
-
Mutterkuchen.
- Postnatal:
-
Nach der Geburt, Gegenteil von „pränatal“.
- Pronatalistisch:
-
Für die menschliche Reproduktion. Gegenteil von „antinatalistisch“.
- Screening:
-
Systematische Reihenuntersuchungen, um bestimmte Krankheiten oder Fehlbildungen zu finden.
- Stationär:
-
Der Patient wird für die Behandlung stationär aufgenommen; er muss (über Nacht) im Krankenhaus bleiben. Gegenteil von „ambulant“.
- Trisomie 21:
-
Down-Syndrom. Das 21. Chromosom ist dreifach vorhanden. Menschen mit Down-Syndrom weisen typische körperliche Merkmale auf und haben verschiedene kognitive Beeinträchtigungen.
Quelle
Dorothee Peterges: Pränataldiagnostik – Vorsorge oder Selektion?!Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines/einer Master of arts (MA); eingereicht bei Apl. Prof. Dr. Anna Bergmann Fakultät für Bildungswissenschaften; Institut für Erziehungswissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 08.07.2014