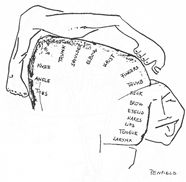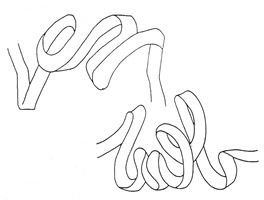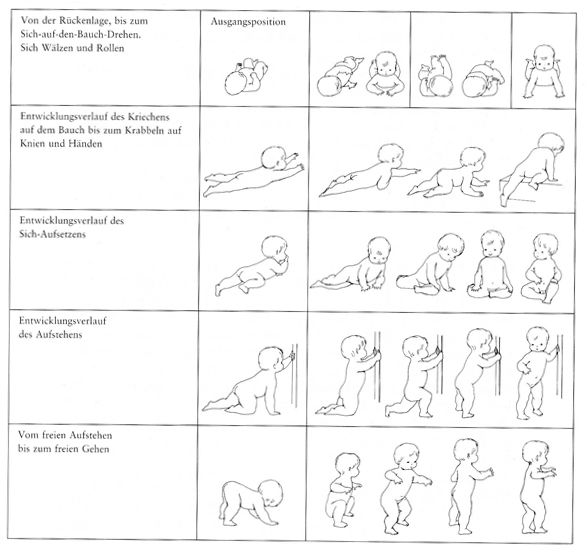Der Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu einer dialogischen Kultur der Entwicklungsbegleitung im Rahmen der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“.
Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Bachelor of Arts“ eingereicht bei Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese an der Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Erziehungswissenschaften der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Eröffnung von Entwicklung(spiel)räumen und Entwicklungsbegleitung
-
3. Frühförderung und Familienbegleitung
- 3.1 Ursprünge und Entstehung der Frühförderung
- 3.2 Die weitere Entwicklung der Frühförderung und ihr Wandel in der Bezeichnung
- 3.3 Heutiges Verständnis und Ziele von „Frühförderung und Familienbegleitung“ im deutschsprachigen Raum
- 3.4 Arbeitsprinzipien der „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 3.5 Mobile „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 3.6 Ablauf des Arbeitsprozesses in der „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 4. Der Begriff „Behinderung“ in der „Frühförderung und Familienbegleitung“
-
5. Verständnisse von Entwicklung im Rahmen der
„Frühförderung und Familienbegleitung“
- 5.1 Das lineare Entwicklungsverständnis in der „Frühförderung und Familienbegleitung“
-
5.2 Das nicht-lineare Entwicklungsverständnis in
der „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 5.2.1 Zur Person Adriano Milano Comparetti und seinen Errungenschaften in Italien
- 5.2.2 Zum Begriff Dialog
- 5.2.3 „Entwicklungsförderung im Dialog“ nach Adriano Milani Comparetti
- 5.2.4 Exkurs: Entwicklung im Dialog mit Natur und Umwelt: Ein Überblick zum Entwicklungsbegriff in der Systemtheorie und Chaostheorie
- 5.2.5 Weitere ausgewählte Konzepte, die ein nicht-lineares bzw. dialogisches Entwicklungsverständnis verfolgen
- 5.2.6 Die frühe Entwicklung des Kindes und die Bedeutung der Eltern (Mutter) - Kind - Interaktion aus psychoanalytischer Sicht
- 5.3 Folgerungen für die Entwicklungseinschätzung: Die mehrdimensionale Entwicklungsbeschreibung oder das Aufzeigen von Prognosen statt Diagnosen
-
6. Der Perspektivenwechsel von Förderung zu
Begleitung
- 6.1 Entwicklungs-Förderung
-
6.2 Entwicklungs-Begleitung
- 6.2.1 Zum Begriff „Begleitung“
- 6.2.2 Begleitung im Rahmen der Frühförderung und Familienbegleitung
- 6.2.3 Die Rolle der Begleitperson aufgezeigt anhand weiterer exemplarisch ausgewählter Konzepte, die für eine dialogische Entwicklungsbegleitung im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ bedeutend sein können
- 7. Zur Methodenauswahl
- 8. Resümee
- 9. Literaturverzeichnis
- 10. Abkürzungsverzeichnis
- 11. Anhang
- 12. Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
- 1. "Das Kind im Kopf des Orthopäden" (ebd. S. 80)
- 2. "Das Kind im Kopf des Neurologen" (Gidoni/Landi 1989, S. 79)
- 3. "Das wirkliche (reale) Kind“ (ebd. S. 82)
- 4. "Das Kind im Kopf des Psychologen" (ebd. S. 81)
- 5. „Von der ´Medizin der Krankheit´ zu einer ´Medizin der Gesundheit´“ (Milani Comparetti/Roser 1982, S. 82 zit. nach Milani Comparetti 1986, S. 25)
- 6. "erratische Spirale" (Ceruti u. Gidoni 1990 zit. nach von Lüpke 1986, S. 66)
- 7. "Verlauf der selbständigen Bewegungsentwicklung aus eigener Initiative“ (Pikler 2001, S. 35)
„Der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt.“ (Dannenbeck/Dorrance 2011, S. 208)
Dieses Zitat soll meine Motivation für die Themenwahl dieser Arbeit einleiten. Das Nachdenken, Reflektieren und Bewusstmachen der eigenen Haltung beeinflusst pädagogisch Tätige in ihrem Handeln und ihren Begegnungen mit Menschen. Dies gilt auch für das Arbeitsfeld der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“. Eine Sensibilisierung des Blicks und eine Erweiterung des Wissens über verschiedene Theorien und Ansätze kann dieses Nachdenken anregen sowie zur eigenen Entwicklung aber auch zur Weiterentwicklung einer inklusiven Gesellschaft einen Beitrag leisten (vgl. ebd., S. 208f.).
In der vorliegenden Arbeit werde ich der Frage nachgehen, welches Verständnis von Entwicklung es braucht, sodass es zu einem Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu einer dialogischen Kultur der Entwicklungsbegleitung im Rahmen der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“ kommen kann.
Schwerpunktmäßig wird dabei das Angebot Frühförderung behandelt. Auf Familienbegleitung wird in Ansätzen eingegangen. Dies rührt daher, da zur Beantwortung der Frage die intensivere Auseinandersetzung mit „Frühförderung“ notwendig ist. Dennoch kann die „Familienbegleitung“ nicht außer Acht gelassen werden, da sie im Prozess der Frühförderung eine wichtige Rolle spielt.
Mein Interesse am gewählten Thema rührt aus meinem bisherigen Ausbildungs- und Berufsweg und meiner damit verbundenen persönlichen und berufsspezifischen Entwicklung. Diese Entwicklung verlief nicht in geordneten Bahnen, sondern war begleitet von einem Wechselspiel von Gefühlen der Freude, Begeisterung, Euphorie, Irritation, Verunsicherung und Überforderung. Die Begegnung mit Menschen, insbesondere mit Kindern, waren dabei die wohl zentralsten Punkte. Immer wieder war und bin ich gefordert, mein Denken und Handeln, meine Einstellungen und Sichtweisen sowie mein konkretes Handeln in der Praxis zu überdenken und auch umzudenken. Das war immer wieder herausfordernd und erforderte manchmal auch das Einschlagen eines anderen Weges, mitunter auch einen Wechsel des Arbeitsplatzes bzw. auch des beruflichen Arbeitsfeldes.
Auch meine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung geschah prozesshaft über viele Jahre, begleitet von irritierenden, verunsichernden, unvergesslichen und berührenden Situationen und Aha-Erlebnissen.
Lernte ich in meiner ursprünglichen Ausbildung zur Sonderkindergartenpädagogin u. a. verschiedene Arten von Behinderung zu kategorisieren, Entwicklungsbereiche zu unterscheiden, Ziele zu formulieren und wie und auf welche Weise die entsprechende Förderung dazu aussehen kann, so führten die beruflichen Erfahrungen in der Praxis zum Umdenken. Ein Arbeiten auf von mir formulierten Zielen ausgerichtet, war mit der Zeit nicht mehr zufriedenstellend für mich, ebenfalls das einordnende Denken wurde mir in vermehrter Weise unangenehm und unangebracht, denn es schien meinen Blick einzuschränken.
Dieses Umdenken wurde zudem durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung im Rahmen der Universität verstärkt. Die wissenschaftliche Herangehensweise und Bearbeitung der Thematik eröffnete mir wieder neue Erkenntnisse und regt zu neuen Denkansätzen an. Dazu gehört der in der Vorlesung kennengelernte Ansatz „Entwicklungsförderung im Dialog“ von Adriano Milani Comparetti, der in besonderer Weise ansprechend und bedeutend für mich war. Zum einen bestätigte er auf wissenschaftlicher Ebene meine Wahrnehmungen, die ich im Laufe meiner Arbeit mit Kindern und deren Familien machte, aber nicht einzuordnen wusste. Zum Anderen erweckte dieser Zugang weiteres Interesse, mich mehr damit auseinander zu setzen.
Diese Ausführungen zu meinem persönlichen Zugang möchte ich mit einem Zitat von Ludwig-Otto Roser ergänzen. Es leitet treffend in die gewählte Thematik der Bachelorarbeit über und kann mich als Verfasserin und hoffentlich auch die LeserInnen herausfordern und bestärken, nicht auf einem Standpunkt stehen zu bleiben, sondern durch immer wiederkehrende Reflexion die Weiter-Ent-Wicklung anzuregen. Roser schreibt:
„Wer sich in Frage stellt und verändert, das Hergebrachte und Gewohnte bezweifelt, wer Konventionen und Formalitäten überschreitet, wer Wissen nur als eine provisorische Wahrheit empfindet, wer hilft, Ketten zu sprengen, ist ein unbequemer Mensch.“ (Roser 1998a, S. 122)
Zur Beantwortung der Fragestellung wähle ich die Methode der Literaturrecherche, wobei zusätzlich eigene Gedächtnisprotokolle aus der Praxis der „Frühförderung und Familienbegleitung“ mit einfließen. Zur besseren Erkennbarkeit und zur Abgrenzung zum theoretischen Text, wird für die Protokolle der Schrifttypus kursiv gewählt sowie der Zeilenabstand verringert.
Wenn ich in der gesamten Arbeit von Eltern spreche, sind auch Erziehungsverantwortliche bzw. Erziehungsberechtigte mit eingeschlossen.
In älteren Werken werden z. T. Begrifflichkeiten verwendet, die diskriminierende Wirkung erzeugen. Um mich von diesen zu distanzieren, setze ich sie unter Anführungszeichen.
Zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache wird das sog. Binnen-I eingesetzt. Um eine flüssige Lesbarkeit des Textes zu ermöglichen wird der Begriff „Frühförderperson“ verwendet. Dieser soll Frühförderinnen und Frühförderer zugleich ansprechen.
Im Folgenden gebe ich einen kurzen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel:
In Kapitel 2 wird auf die UN-Konventionen der Rechte der Menschen mit Behinderung, insbesondere der Kinderrechte in Bezug auf die Eröffnung von Entwicklungs(spiel)räumen und Entwicklungsbegleitung überblicksmäßig eingegangen. Diese Ausführungen sollen das Fundament der weiteren Arbeit darstellen.
Kapitel 3 dient der Begriffserklärung der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“. Die LeserInnen sollen einen Einblick in den Ursprung, die Entwicklung, das derzeitige Verständnis und Ziele sowie Arbeitsprinzipien und den groben Ablauf von „Frühförderung und Familienbegleitung“ gewinnen. Daraus sollen allgemeine Kenntnisse zum Arbeitsfeld geschaffen werden, die für das Verständnis der Zusammenhänge in den weiteren Kapiteln notwendig sind.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Begriff „Behinderung“ im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“. Um den Faden von Kapitel 2 weiter zu spannen, wird dabei auf die Sichtweise der WHO und der UN-Konvention eingegangen. Im Weiteren soll die psychoanalytische Betrachtung von Behinderung als Grundlage für die folgenden Kapitel dienen. Diese Auseinandersetzungen sind die Basis für die Reflexion möglicher eigener Abwehrmechanismen. Somit kann bereits dieses Kapitel den ersten Schritt für einen Perspektivenwechsel anzeigen.
Das Verständnis von Entwicklung hat sich in der „Frühförderung und Familienbegleitung“ im Laufe der Zeit verändert. Dies wird in Kapitel 5 anhand zweier konträrer Entwicklungsverständnisse dargestellt und näher erläutert. Zudem wird hier die psychoanalytische Sichtweise nochmals aufgegriffen um in den weiterführenden Kapiteln darauf aufbauen zu können.
Kapitel 6 setzt sich mit den Begrifflichkeiten „(Entwicklungs-) Förderung“ und „(Entwicklungs-) Begleitung“, wiederum im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“, auseinander. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Förderbegriff und den dahinter steckenden Mechanismen sowie folgernde Konsequenzen werden thematisiert. Daraufhin folgt die Befassung mit der dialogischen Begleitung der Entwicklung sowie der Rolle der Frühförderperson als BegleiterIn.
In Kapitel 7 wird, wie bereits angeführt, auf die Methodenauswahl dieser Arbeit und deren Beschreibung näher eingegangen.
Schließlich werden im 8. Kapitel in einem abschließenden Resümee noch einmal zentrale Aspekte der Arbeit zusammengefasst sowie Fragen für weiterführende Forschungsmöglichkeiten, die sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergeben, gestellt.
Inhaltsverzeichnis
Der heutigen, seit 2006 beschlossenen UN-Konvention[1] über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht ein wichtiger Paradigmenwechsel voraus. Nämlich jener, der die medizinische Sichtweise von Behinderung und den damit verbundenen „Heilungsgedanken“ hin zu einer sozialen Betrachtung von Behinderung und die damit einhergehenden Vorurteile, Stigmatisierungen und sozialen Barrieren in den Blick nimmt. Deshalb ist die von Marianne Schulze, der Vorsitzenden des Monitoringausschusses[2], formulierte Kernaussage der Konvention auch für diese Arbeit zentraler Bezugspunkt (vgl. Schulze 2011, S. 15). Diese besagt, dass
„Menschen mit Behinderung nicht länger als Objekte zu sehen [sind, J. Ö.], die des Mitleids und der Fürsorge bedürfen, sondern als Subjekte, die selbstbestimmt alle Menschenrechte barrierefrei und – wo notwendig mit Unterstützung – selbst verwirklichen können sollen (…).“ (ebd., S. 15)
In Bezug auf den Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu Entwicklungsbegleitung ist dieser Gedanke nicht nur leitendes Element, sondern impliziert zudem jene Auffassung, dass Menschen mit Behinderung nicht als Objekte angesehen werden dürfen, die spezifische und fremdbestimmte Förderung ihrer Entwicklung brauchen. Wenn, dann bedürfen sie nur jenes Maß an Begleitung und Unterstützung, um sich in ihrer Entwicklung auf selbstbestimmte Weise entfalten zu können. Die Formulierung einer Unterstützung „wo notwendig“, verweist auf die Notwendigkeit jener sensiblen, angemessenen und abgestimmten Begleitung, sodass Unterstützung nicht übergestülpt und Selbstbestimmung nicht gehemmt wird.
Aus diesem Grunde ist eine Auseinandersetzung mit der Konvention, dem eigenen Verständnis von Behinderung und Entwicklung sowie die Reflexion persönlicher Unsicherheiten und Ängste auch für „beruflich oder fachlich mit Behinderung befasste[n] Personen“ (Flieger/Schönwiese 2011, S. 27), eben auch für Frühförderpersonen und FamilienbegleiterInnen, eine wichtige Aufgabe. Diese kann als Voraussetzung dafür gelten, dass folgender Grundsatz der Konvention:
„die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität“ (ebd., S. 28), welchen ich für die vorliegende Arbeit besonders aufgreifen möchte, überhaupt bewusst und schließlich auch geltend gemacht werden kann (vgl. ebd., S. 27f.).
Adriano Milano Comparetti (1919-1968) (wessen Ansatz wir in Kapitel 5 noch genauer kennenlernen werden) wurde von seinem Freund und Kollegen Ludwig-Otto Roser deshalb als „unbequemer Mensch“ bezeichnet (siehe Zitat in der Einleitung), weil er sich vehement und konsequent für die Rechte des Kindes mit Behinderung, die Einhaltung seiner Würde und den respektvollen Umgang mit dem Kind einsetzte. Zur damaligen Zeit stieß er mit seiner Konzeption und seinem Denken bei vielen seiner KollegInnen auf Widerstand. Seine Bestrebungen und Bemühungen waren somit zugleich medizinischer, pädagogischer, als auch politischer Art (vgl. Roser 1998a S. 117ff.).
Die Kinderrechtskonvention (CRC) der Vereinten Nationen wurde am 20. 11. 1989 beschlossen und beschreibt sinngemäß in Artikel 23 die Rechte des Kindes mit Behinderung folgendermaßen (vgl. CRC 1990):
„Sie sieht unter anderem die Förderung der Selbstständigkeit von Kindern mit Behinderung vor. Auch das Recht von Kindern mit Behinderungen, die für die Betreuung notwendigen Mittel auf Antrag zu erhalten, wird in dieser Konvention anerkannt (Artikel 23 Abs. 2 CRC). Weiters sind Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Rehabilitation, die Vorbereitung auf das Berufsleben in Hinblick auf eine möglichst umfassende soziale Integration[3] und individuelle Entfaltung des Kindes in der Konvention als Rechte verbrieft, die explizit auch für Kinder mit Behinderungen Wirklichkeit werden sollen.“ (Artikel 23 CRC 1990, zit. nach Schulze 2011, S. 13)
Das Recht der Förderung der Selbstständigkeit und der individuellen Entfaltung des Kindes mit Behinderung wird hier explizit ausgedrückt und soll auch für die folgenden Ausführungen wegweisend sein.
Helmwart Hierdeis zeigt exemplarische Punkte auf, die unter die pädagogische Förderung der Selbstständigkeit des Kindes fallen, nämlich: „Spielräume für eigene Entscheidungen, Übertragung von Verantwortung, Aufbau von symmetrischen Beziehungen, einüben in kommunikatives Handeln, politische Mitwirkung“ (Hierdeis 2010) und betont dabei ein besonderes Augenmerk, auf „Menschen und Menschengruppen, die aufgrund von anthropogenen, sozialen und kulturellen Einschränkungen daran gehindert werden, ihr Recht auf Autonomie in vollem Umfang wahrzunehmen“ (ebd.), zu richten.
Die Begrifflichkeit der individuellen Entfaltung kann in die Begriffe „individuell“ und „Entfaltung“ aufgespalten werden. Laut dem Wörterbuch Duden bedeutet individuell „dem Individuum eigentümlich; von betonter Eigenart“ (Drosdowski, 1989, S. 303) und im Sinne von Selbstentfaltung die „Entfaltung der eigenen Anlagen und Fähigkeiten“ (Bibliographisches Institut GmbH 2013) oder im Sinne von Persönlichkeitsentfaltung die „Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.“ (ebd.)
Zudem wird in Artikel 23 (Abs. 1) ausdrücklich auf das Recht des „geistig oder körperlich behinderten Kind(es) ein erfülltes und menschenwürdigen Leben unter Bedingungen (…), welche die Würde des Kindes wahren“ (Artikel 23 CHC) hingewiesen. Diese Würde kann nur gewahrt werden, wenn die genannten Postulate Wirklichkeit werden.
Welchen Beitrag die „Frühförderung und Familienbegleitung“ zur Einhaltung dieser Rechte leisten kann und welche Aspekte kritisch zu hinterfragen und noch beachtet werden könnten, wird in den folgenden Kapiteln erarbeitet.
[1] Insgesamt arbeiteten 192 UN-Mitgliedstaaten in Form von verschiedenen Arbeitsgruppen am UN-Konventions-Text. Dabei waren auch Menschen mit Behinderung beteiligt bzw. leiteten manche Arbeitsgruppen an (vgl. Schluze 2011, S. 14).
[2] Der Monitoringausschuss, deren Mitglieder sich aus VertreterInnen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, der Entwicklungszusammenarbeit, der Wissenschaft und einer Menschenrechtsorganisation zusammensetzen, haben die Aufgabe, die Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen sowie Beratungs- und Vorbildfunktion zu sein. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, sind weisungsfrei und unabhängig in ihrer Funktion (vgl. ebd., S. 23).
[3] „Die Übersetzung verwendet den Ausdruck „Integration“, da der Originaltext auch von „social integration“ spricht, vgl. Artikel 23 (3) Kinderrechtskonvention (CRC).“ (ebd., S. 13)
Inhaltsverzeichnis
- 3.1 Ursprünge und Entstehung der Frühförderung
- 3.2 Die weitere Entwicklung der Frühförderung und ihr Wandel in der Bezeichnung
- 3.3 Heutiges Verständnis und Ziele von „Frühförderung und Familienbegleitung“ im deutschsprachigen Raum
- 3.4 Arbeitsprinzipien der „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 3.5 Mobile „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 3.6 Ablauf des Arbeitsprozesses in der „Frühförderung und Familienbegleitung“
In diesem Kapitel wird das Arbeitsfeld „Frühförderung und Familienbegleitung“ vorgestellt. Dazu wird auf die Ursprünge, die weitere Entwicklung bis zum heutigen Verständnis von Frühförderung, sowie deren Ziele eingegangen. Dadurch sollen Voraussetzungen für das Verständnis der weiteren Kapitel gelegt werden.
Die Einordnung der Ursprünge und der Entstehung von „Frühförderung“ sowie auch ihre weitere Entwicklung (siehe folgendes Kapitel) ist in unterschiedlicher Literatur nicht deckungsgleich nachvollziehbar. Anhand ausgewählter, im Bereich Frühförderung richtungsweisender AutorInnen, soll im Folgenden ein Versuch einer zusammenschauenden Darstellung gemacht werden:
In den 1950er Jahren, der Zeit in welcher Reifungstheorien[4] in Bezug auf Entwicklung vorherrschten, war das Konzept der „sensiblen Phasen[5]“ der kindlichen Entwicklung „das zentrale erste Argument für eine qualifizierte Förderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.“ (Steinebach 1992, S. 51) Nach Christoph Steinebach öffnete diese Annahme den Weg in Richtung Frühförderung, stellte jedoch noch kein eigenes Frühförderkonzept dar. (vgl. ebd. S. 51ff.)
Ähnlich ordnet Christoph Leyendecker die Wurzeln der Frühförderung in wissenschaftlichen Ansätzen aus Pädagogik, Psychologie und Medizin ein, welche sich mit der Förderung von Kindern noch sehr jungen Alters befassten. Derartige Ansätze wurden zum einen vom Arzt Itard (1775-1838) und seinem Schüler Seguin verfolgt, denen es um eine möglichst frühe Förderung für Kinder mit Behinderung ging. Zum Anderen von der Pädagogin und Ärztin Maria Montessori (1870-1952) sowie dem Pädagogen und Arzt Decroly (1878-1932). Beide gründeten eine frühe in die „natürlichen Kräfte der kindlichen Entwicklung nachfolgende Erziehung.“ (Jussen 1976 zit. nach Leyendecker 2008, S. 22)
„Von Itard stammt die Idee der sensorischen Anregung, Maria Montessori hat das selbsttätige Lernen in den Mittelpunkt gerückt und der nahezu vergessene Decroly betonte besonders eine an menschlichen Grundbedürfnissen orientierte Förderung behinderter Kinder.“ (ebd., S. 22)
Nach Leyendecker wurden mit diesen Ansätzen Grundideen für die Frühförderung, die auch noch in heutige Ansätze einwirken, geschaffen. Sie erfuhren jedoch erst in den 1960er und frühen 1970er Jahren Ausbreitung (vgl. ebd., S. 22).
So wurde im Jahr 1966 vom Europarat eine „Empfehlung für eine Frühförderung behinderter Kinder“ (Leyendecker 2008, S. 22) ausgesprochen. 1973 formulierte der deutsche Bildungsrat eine „Empfehlung zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher.“ (ebd.)
Somit gründet die Entstehungszeit der pädagogischen Frühförderung in Deutschland in den späten 60er und frühen 70er Jahren (vgl. ebd.), wo sie sich neben medizinisch-therapeutisch ausgerichteten Ansätzen der „Früherkennung“, „Frühdiagnostik“ und „Frühtherapie“, die im Bereich der Sozialpädiatrie angesiedelt waren, entwickelt hat (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 14, Pretis 2001, S. 16).
Erste Frühfördermaßnahmen in Österreich wurden in den 70er Jahren bei „sinnesgeschädigten Kindern“ (Pretis 2000, S. 121), insbesondere für Kinder mit einer Seh- oder Hörbeeinträchtigung, durchgeführt (vgl. ebd.).
Die verschiedenen Begriffe „Entwicklungsrehabilitation“, „heilpädagogische Früherziehung“ und „Frühe Hilfen“ standen zu Beginn mit „Frühförderung“ in Konkurrenz, wobei sich „Frühförderung“ immer mehr als Überbegriff etablierte und im deutschsprachigen Raum (außerhalb der Schweiz) durchsetzte. Das Angebot wird deshalb im Laufe der Zeit, v. a. in den 80er Jahren folgendermaßen definiert (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 14):
Frühförderung „(…) wird als Oberbegriff für die Gesamtaufgabe der Diagnostik, Förderung/Therapie, Elternberatung und Vernetzungsarbeit gesehen und ist aus seinem engeren pädagogischen Kontext gelöst, so dass er auch in medizinisch akzentuierten Kontexten verwendet wird.“ (Neuhäuser 1982, Schlack 1989 zit. nach Thurmair/Naggl 2000, S. 14)
Cornelia Köll-Senn, die sich im Jahr 2003 u. a. genauer mit dem Begriff „Frühförderung“ befasste, folgert dazu, dass dieser v. a. im anfänglichen Verständnis sowohl das pädagogische als auch medizinische Feld miteinschloss. Sie verweist darauf, dass durch die Aspekte der „Frühzeitigkeit“ und des dezidierten „Förder-Begriffs“ ein Eingreifen von außen in den kindlichen Entwicklungsprozess sowie ein funktionalistischer Ansatz erkannt werden kann (vgl. Köll- Senn 2003, S. 9).
„Der Begriff „Frühförderung“ vermittelt den Eindruck des Machbaren, des Technokratischen, des Beförderns und Irgendwo-Hinbringens, er lässt an Förderziele, Förderpläne und Förderprogramme denken (…). Im Begriff der Frühförderung scheinen der Wunsch des Kindes und seine Eigenaktivität nicht explizit auf – das mag in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Eltern, die sich auf der Suche nach einem passenden Angebot für ihr Kind befinden, oft falsche Vorstellungen über das Geschehen in der aktuellen Frühförderung wecken.“ (ebd.)
Wie sich Frühförderung und ihre Bezeichnung im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, wird im folgenden Kapitel beschrieben.
Nach Steinebach entstanden erste Frühförderkonzepte erst mit dem einsetzenden Wandel von den ursprünglichen Reifungstheorien hin zu lerntheoretischen Konzepten[6] Anfang der 60er Jahre. Nun folgten Frühförderkonzepte, die auf lerntheoretischen Annahmen, verhaltenstherapeutischen Grundlagen und später auch auf handlungstheoretische Ansätze[7] ausgerichtet wurden (vgl. Steinebach 1992, S. 53ff.).
In den 70ern kommt es zum Umschwung von den ursprünglichen kindzentrierten Ansätzen zu jenen Frühförderkonzepten, die auch die Umwelt[8] des Kindes inkludiert. So erhielt besonders in den 80er Jahren auch die Familie des Kindes in der Frühförderung[9] einen höheren Stellenwert, sodass auch Eltern und Geschwisterkinder in den Förderprozess mit einbezogen wurden (siehe dazu ausführlicher in Kapitel 3.5), wodurch Anfang der 90er Jahre auch systemtheoretische Ansätze[10] in die Frühförderung einflossen (vgl. ebd., S. 56f.).
Eine weitere Entwicklungslinie der Frühförderung ist in Bezug auf die Einbeziehung der Eltern und anderen „Fachpersonen“, sowie die Zusammenarbeit mit diesen zu erkennen. Von ursprünglichen Konzepten, wo gezielt „am Kind gearbeitet“ wurde, Förderung mehr den Charakter von Behandeln im medizinisch-therapeutischen Sinne hatte und Kinder den einzelnen „Heilbehandlungen“ (Leyendecker 2008, S. 23) einer Disziplin („allein planen – allein handeln“) (ebd.) mehr oder weniger ausgesetzt waren, folgten erst multidisziplinäre („nebeneinander handeln – nebeneinander planen“) (ebd.) und dann interdisziplinäre („miteinander planen – nebeneinander handeln“) (ebd.) Konzepte. Dieses Umdenken fand in Deutschland bereits ab Mitte der 70er Jahre (vgl. ebd., S. 22) und in Österreich in den frühen 80er Jahren (vgl. Pretis 200, S. 121) statt und schlug sich auch in der Entwicklung neuer Begrifflichkeiten wie „Interdisziplinäre Frühförderung“, „Frühförderung und Familienbegleitung“ oder „Komplexleistung Frühförderung“ nieder (vgl. Leyendecker 2008, S. 23ff.).
„Damit ist Frühförderung letztlich ein transaktionaler Trialog, das heißt ein Konzept, das sich aus einem Dreiergespräch der Verantwortlichen (Fachleute, Eltern, Kind) [die Reihenfolge sollte meiner Meinung nach genau umgekehrt erfolgen, J. Ö.] ergibt und über die einzelnen Disziplinen hinweg in einem gemeinsamen Handeln auch nicht als disziplinspezifische Behandlung, sondern wird stets disziplinübergreifend in einem gemeinsamen Handeln verwirklicht.“ (Leyendecker 2008, S. 32)
Diesen transaktionalen Trialog („miteinander planen – miteinander handeln“) (ebd.) in der Frühförderung bezeichnet Leyendecker als erstrebens- und wünschenswert, jedoch in der konkreten Alltagspraxis zum derzeitigen Stand nicht unbedingt leicht umsetzbar (vgl. ebd., S. 32).
Der Pädagoge Martin Thurmair und die Psychologin Monika Naggl, einflussreiche AutorInnen, PraktikerInnen und AusbildnerInnen im Bereich der Frühförderung, definieren diese und deren Ziel im Jahr 2000 folgendermaßen:
„Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, und auch für deren Eltern und andere Personen, die Elternfunktionen wahrnehmen. Frühförderung hat das Ziel, bei Behinderung und Entwicklungsgefährdung von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihrer Kompetenzen entfalten und sich in ihrer Lebenswelt integrieren können.“ (Thurmair/Naggl 2011, S. 13)
Daraus geht hervor, dass sich das Angebot einerseits an Kinder mit einer Diagnose einer „Behinderung“, einer „drohenden Behinderung“ und/oder „Entwicklungsverzögerung“, „Entwicklungsauffälligkeit“ oder „Verhaltensproblemen“ (ebd. S. 16ff.), in der Zeitspanne ab der Geburt bis hin zum Schuleintritt, richtet. Anderseits spricht das Angebot auch die Eltern des Kindes an. Der Bezug auf die Lebenswelt des Kindes schließt hier die Miteinbeziehung der möglichen Geschwisterkinder, sowie des weiteren sozialen Umfeldes wie beispielsweise befreundete Kinder, Nachbarskinder, Großeltern, Verwandtschaft, aber auch PädagogInnen aus Krabbelgruppen und Kindergärten mit ein (vgl. Steinebach 1992, S. 43).
Aus der beschriebenen Zielsetzung geht hervor, dass es sich um individuelle Hilfestellungen zur Entfaltung und Entwicklung handelt und nicht mehr wie im vorherigen Punkt beschrieben nach einheitlichen, curricularen Lernprogrammen zur Förderung „vorgegangen“ wird.
Bei den Formulierungen, die Thurmair und Naggl verwenden, stellt sich für mich jedoch die Frage, welches Verständnis von Behinderung dahinter steckt? Aus den Formulierungen geht hervor, dass Behinderung als Bedrohung und eine nicht „entsprechende“, oder nicht entsprechend „schnelle“ Entwicklung eine Gefährdung darstellt.
Ebenfalls richtungsweisender Autor in diesem Bereich ist der Psychologe Manfred Pretis, der bei der Definition des Begriffs „Frühförderung“ und dessen Zielen die Aspekte des Begleitens und der Selbstbestimmung zwar deutlicher formuliert, aber dennoch von außen bestimmte Förderung und das „Erreichen-Müssen“ von Zielen impliziert. Nach ihm „zielt die pädagogische Frühförderung auf die Begleitung des Kindes und der Eltern: Das Kind selbst bzw. die Eltern sollen mit ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten selbst- und fremdorientierte Ziele erreichen.“ (Pretis 2001, S. 16)
Auch hier nimmt die Förderung des Kindes immer noch eine bedeutende Rolle ein. Förderung wird weniger als be-fördernde, be-handelnde, be-lehrende oder be-ratende Frühförderung verstanden, die Kinder als auch Eltern in die Passivität drängen. Vermehrt ist eine begleitende Förderung sichtbar. Andererseits verwendet Pretis explizit auch die Orientierung an fremden Zielen (vgl. Speck 1995, S. 177 zit. nach Thurmair/Naggl 2011, S. 15), was wiederum der Forderung der UN- Konvention nicht entsprechen würde.
In meinen folgenden Ausführungen beziehe ich mich auf die Bezeichnung „Frühförderung und Familienbegleitung“, obwohl ich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig den Bereich „Frühförderung“ behandeln werde. Die Entscheidung der Verwendung beider Begrifflichkeit kommt daher, da sich die Begriffe nur schwer isoliert voneinander behandeln lassen und im Sinne meines Verständnisses einer Entwicklungsbegleitung von Kindern die Miteinbeziehung der Familie bzw. die Familienbegleitung nicht ausgeschlossen oder das Angebot „nur“ auf die „Frühförderung“ gekürzt werden kann. Die Setzung der Anführungszeichen erfolgt aus Gründen der besseren Lesbarkeit, um das Angebot als Ganzes auf einen Blick erkennbar zu machen.
Um die Arbeitsprinzipien der Frühförderung darzustellen, möchte ich mich an die Ausführungen von Thurmair und Naggl anlehnen. Sie formulieren folgende vier Standard- Grundprinzipien für die Arbeit der Frühförderung: Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung. Dadurch grenzen sie „Frühförderung und Familienbegleitung“ von anderen Angeboten für „Kinder mit Behinderung“ bzw. Eltern, die sich aufgrund der Entwicklung ihrer Kinder sorgen, ab (vgl. Thrumair/Naggl 2000, S. 25).
Die Ganzheitlichkeit bezieht sich laut angeführter Literatur in der Frühförderung auf mehrere Komponenten:
Zum Einen auf die Kombination von Diagnostik, Therapie und Förderung unter Bezug der Gesamtentwicklung des Kindes in seiner Lebensumwelt (vgl. ebd., S. 25). In ähnlichem Sinne hat auch Milani Comparetti „Ganzheitlichkeit“ verstanden. Er forderte deren unbedingten Respekt in seiner „Medizin der Gesundheit“ (siehe Kapitel 6.1.2) (vgl. Milani Comparetti 1986, S. 17).
Zum Anderen geht es in der Frühförderung auch darum, dass verschiedene mögliche Teilaspekte von Förderung und Therapie zu einem Konzept zusammengefasst werden. Das heißt, dass eine fachliche Öffnung erfolgen kann und nicht verschiedene Konzepte nebenher in eingeschränktem Blick angesetzt werden. Für das Kind und die Familie bedeutet diese Komponente im Idealfall, dass sie sich mit nur einer Person auseinandersetzen müssen, was für die gesamte Familie eine Erleichterung darstellen kann (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 25f.).
Der so verstandene, beide Komponenten einbeziehende, Ansatz der Ganzheitlichkeit entwickelt bei mir die Frage, ob eine derart ausgerichtete Ganzheitlichkeit überhaupt möglich ist? Kann eine Person „alles“, das „ganze Kind“ beobachten und erkennen?
Thurmair und Naggl formulieren dazu, dass es „sowohl das umfassend Integrierende, als auch das blind Spezialisierende […] in der Praxis der Therapie und Förderung nicht wirklich [gibt, J. Ö.].“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 26) Im Zuge dessen beschreiben Weiß, Neuhäuser und Sohns Ganzheitlichkeit auch als eine Utopie (vgl. Sohns 2010, S. 50).
Die Formulierung einer möglichst ganzheitlichen Beobachtung und Förderung bzw. Entwicklungsbegleitung kann diesem Dilemma meiner Meinung nach entgegenwirken.
Dass Ganzheitlichkeit, im Sinne einer Integration verschiedener Konzepte in der Praxis jedoch nicht immer zum Tragen kommt, zeigt die In-Anspruchnahme der Familien von zusätzlichen bzw. ergänzenden Therapien (z. B. Logopädie, Physiotherapie) neben „Frühförderung und Familienbegleitung“, wie es Thurmair und Naggl feststellen (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 26f.).
Gerade das Postulat der Ganzheitlichkeit hat im Bereich der Frühförderung auch für kritische Stimmen gesorgt, da dadurch die „beliebige Förderung“ bzw. Förderung nach den Vorlieben, Stärken und Ausbildungsschwerpunkten der jeweiligen Frühförderperson den Anschein erwecken kann (vgl. ebd. S. 26).
Auch Bierbach und Steinebach erkennen dies und verweisen auf die Gefahr, dass konkrete Förderung in der Praxis mit theoretisch-konzeptionellen Darstellungen nicht übereinstimmen können, wenn ein Gefangensein im eigenen Ansatz, das Übersehen anderer hervorruft oder wenn die Förderung gezielt am Kind ausgerichtet und dabei das soziale Umfeld übersehen wird (vgl. Bierbach/Steinebach 1992, S. 46).
Ganzheitlichkeit sagt also etwas darüber aus wie das Kind gesehen wird und wie die Förderung bzw. Begleitung gestaltet wird (vgl. ebd.) und deshalb bedarf es meines Erachtens die Auseinandersetzung und Reflexion der jeweiligen Frühförderperson mit diesem Begriffsverständnis für ihre Arbeit in der Frühförderung.
Protokoll: Ich starte als Frühförderin in einer „neuen“ Familie. Das frühgeborene Kind ist bei unserem ersten Kennenlernen bereits ein Jahr alt und lebt mit diesem Alter erst seit kurzer Zeit zuhause bei seinen Eltern. Sein erstes Lebensjahr verbrachte Simon auf der Klinik. Zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens hatte Simon Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie und wurde von der mobilen Kinderhauskrankenpflege jeden zweiten Tag besucht. Mit dem Einsetzen der Frühförderung sollte Ergotherapie und Logopädie allmählich reduziert werden um für Simon und seine Eltern die vielen Therapietermine und die langen Fahrtstrecken zu reduzieren.
Auf Einladung der Mutter begleitete ich sie bei einem Vernetzungsgespräch an der Klinik. Das Gespräch wurde hauptsächlich von Simons hauptverantwortlicher Ärztin, zwei weiteren Ärzten, einer Pflegerin und den Therapeutinnen geführt. Die Mutter wurde gelegentlich mit einbezogen. Ich nahm vorwiegend eine zuhörende Rolle ein, da ich mich am Gespräch nicht wirklich aktiv oder nur in kleinen Ansätzen beteiligen konnte. Am Ende des Gesprächsverlaufes wurden mir Aufträge für die Frühförderung erteilt (so empfand ich das jedenfalls damals). Verunsichert nahm ich diese zu Kenntnis und versuchte in den weiteren Frühfördereinheiten diese zwar nicht eins zu eins zu übernehmen, aber sie doch möglichst alle zu berücksichtigen. Ich nahm großen Druck wahr alle Übungsbereiche möglichst gut einfließen zu lassen.
Mit der Zeit taten sich aber Gefühle der Unsicherheit und der Überforderung auf sowie die Sorge, dass ich Simon nicht entsprechend gut genug fördern könnte. Auch die Überlegung ob nicht eine erfahrenere Frühförderin [11] (ich war damals in meinem ersten Jahr als Frühförderin tätig) geeigneter wäre stellte ich mir und schließlich auch in der Teamsitzung.
Nach mehreren Supervisionen und Gesprächen mit meinen Kolleginnen verringerte sich dieser Druck allmählich und ich konnte zunehmend erkennen, dass ich die Sichtweise der ÄrztInnen und Therapeutinnen [12] angenommen hatte und Simon nicht mehr in seiner Ganzheitlichkeit als Kind sah, sondern in Teilbereiche „gestückelt“ dachte. Erst nach dieser Erkenntnis konnte ich wieder Vertrauen in meine Beobachtungen legen, Simon möglichst ganzheitlich sehen und die Zeit unter weniger Förderdruck mit ihm erleben.
Heute würde ich mich bei einem derartigen Gespräch anders verhalten, derartige Aufträge (vielleicht nicht als Aufträge verstehen) nicht mehr argumentationslos annehmen und krampfhaft umsetzen, sondern Unterschiede von Therapie und Frühförderung aufzeigen bzw. diese v. a. mit der Mutter in Elterngesprächen thematisieren.
Die Familienorientierung - Bierbach und Steinebach sprechen in der gleichen Bedeutung von „Familienbezogenheit“ - wird von den letztgenannten AutorInnen als ein „konzeptioneller Grundbegriff“ (Bierbach/Steinebach 1992, S. 49) dargestellt und ist eine wichtige Säule besonders in der mobilen Frühförderung. Sie ist darauf bedacht, die Förderung der Kinder „in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten.“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 27)
Nachdem die Entwicklung des Kindes nicht (mehr) isoliert betrachtet, wie in Kapitel 3.2 angeführt, sondern aus dem familiären Kontext der Familie heraus verstanden wird, werden die Eltern als Verantwortliche geachtet und Anliegen der Eltern und der Frühförderperson aufeinander abgestimmt. Frühförderung bezieht sich somit auf das Kind und seine Familie. Demgemäß wird also nicht nur in der Familie sondern auch mit der Familie gearbeitet (vgl. ebd., S. 27). Sinngemäß formulieren auch Bierbach und Steinebach:
„Im Planen und Handeln muß die Bedeutung des Kindes für die Familie und die Bedeutung der Familie für das Kind berücksichtigt werden.“ (Bierbach/Steinebach 1992, S. 49)
Wie in den bisherigen Ausführungen aufgezeigt, spielt die Familie in der Frühförderung schon seit Langem eine Rolle. Jedoch hat sich das Verständnis des Begriffs Familie verändert. In den Anfangszeiten der Frühförderung wurde v. a. von der sog. „bürgerlichen Kleinfamilie [13] “ ausgegangen. Dieses Verständnis entspricht heute aber nicht mehr der Realität, sondern Familie wird weit vielfältiger betrachtet[14]. Mit dieser Veränderung geht auch eine andere Auffassung von Familienbezogenheit in der Frühförderung einher (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 27). Diese wandelnde Sichtweise soll anhand der von Otto Speck formulierten Modelle zur Elternarbeit aufgezeigt werden:
In den ursprünglichen Ansätzen wurden die Eltern als Laien angesehen und auch so behandelt. Demzufolge geht eine ungleichwertige Kompetenzzuschreibung, sprich die Nicht- Fachlichkeit der Eltern und die Rolle der Frühförderperson als ExpertIn hervor. In diesem Modell herrschte noch die Auffassung vor, dass Eltern zu belehren und anzuleiten seien (vgl. Speck 1988, S. 365).
Daraus entwickelte sich das Verständnis zu jenem Modell, wo Eltern als Ko-TherapeutInnen (ebd., S. 366), ich möchte dies erweitern mit Ko-Frühförderpersonen, angesehen wurden. Zwar verbesserte sich die Position der Eltern im Gegensatz zum vorherigen Modell, jedoch auch hier ist die Elternrolle eine problematische, denn Eltern sollten sozusagen die Nebenrolle des Ko-Therapierens und Ko-Trainierens, ich erweitere auch hier: die Nebenrolle des Ko-Förderns übernehmen. Die/der TherapeutIn bzw. in unserem Fall die Frühförderperson, war immer noch die/der SpezialistIn. In diesem Modell ging es darum, die elterliche „Kompetenz“ zu erweitern und die Eltern für das Training bzw. die Förderung zu Hause anzuleiten (vgl. ebd., S. 366). Die eigentliche Kompetenz der Eltern, im Sinne ihrer „Mutter und Vater Authentizität“ wie Speck es nennt sowie die Eltern-Kind-Beziehung spielte in diesem Modell keine Rolle bzw. geht überhaupt verloren. Besonders kritische Eltern wehrten sich zwar gegen diese aufgestülpten Rollen. Jedoch bleibt, besonders bei bereits verunsicherten Eltern die Gefahr, dass diese Rollen unhinterfragt angenommen werden (vgl. ebd. S. 367f.).
Dass in diesem Kontext und unter diesem Verständnis vorwiegend von Therapie und nicht von Förderung gesprochen wird ist auffallend und zugleich naheliegend, da in dieser Zeit v. a. noch ein defizitorientiertes und medizinisch-therapeutisch dominierendes Bild des Kindes sowie ein lineares Entwicklungsverständnis vorherrschte.
Das darauf folgende Modell sieht Eltern als Partner an.
„Partnerschaftliche Zusammenarbeit wird als Zusammenwirken von Teilhabern an einer gemeinsamen Aufgabe, als die gegenseitige Ergänzung von unterschiedlichen Sichtweisen und Systemen verstanden. Eltern und Fachleute gehören unterschiedlichen Systemen an, handeln deshalb auch aus unterschiedlichen Ansätzen heraus.“ (ebd., S. 371)
Der partnerschaftliche Ansatz wird von Biewer auch als Kooperationsansatz bezeichnet. (Biewer 2009, S. 204) Pretis spricht in diesem Zusammenhang von einer „Partnerschaftlichkeit als Handlungsauftrag“ [15] (Pretis 2001, S. 29) in der Frühförderung.
Leyendecker stellt ein darauf aufbauendes bzw. weiterentwickeltes - ursprünglich von Jürgen Kühl aufgezeigtes - Systemmodell auf. In diesem stellt die Frühförderperson eine fachkompetente Begleitperson dar (vgl. Kühl 2004, zit. nach Leyendecker 2008, S. 24f.).
In Bezug auf den Perspektivenwechsel von Förderung zu Begleitung folgere ich, dass bereits der Kooperations- und Partnerschaftsansatz den Weg in Richtung einer Familienbegleitung geöffnet hat und diese schließlich durch das Systemmodell verwirklicht werden kann.
„Vernetzung meint die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebene Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen.“ (Thrumair/ Naggl 2000, S. 30)
Sie bezieht sich einerseits auf das Kind, seine Familie und deren „informellen“ (Verwandte, Nachbarn, FreundInnen, andere soziale Kontakte) und „formellen“ (Kindergarten, Krippe, Eltern-Kind-Gruppen) Netzwerke, aber auch auf Angebote und Dienste in der Umgebung, die für die Familie von Bedeutung sein könnten. Auf letzteres bezogen ist es Aufgabe der Frühförderung, über Anlaufstellen zu informieren und Kontakte zu vermitteln (vgl. ebd.) sowie das „Engagement der Frühförderstelle für eine Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Ressourcen in der Region, um den Rechten der von ihr betreuten Kinder und Familien (Chancengleichheit, Benachteiligungsverbot) Geltung zu verschaffen.“ (ebd. S. 30)
Protokoll: Marie´s Eintritt und Integration in die Kinderkrippe stand bevor. Die Mutter bat mich um eine Begleitung bei einem ersten Gespräch in der Kinderkrippe.
Die Gesprächsrunde setzte sich zusammen aus der Mutter, der Krippenleiterin, der gruppenführenden Krippenpädagogin, einer Beraterin, einer Kindergarten- und Kinderkrippenkoordination und mir als Frühförderin zusammen. Mitunter ging es in dem Gespräch auch um den weiteren Kindergartenbesuch im Anschluss an die Krippe im darauf folgenden Jahr. Die Koordinatorin formulierte, dass sie es besser fände, wenn Marie in den Integrationskindergarten ginge (dieser ist ca. eine längere Fahrtstrecke pro Strecke vom Wohnort der Familie entfernt), weil sie dort am besten aufgehoben sei. Weiters formulierte sie, dass Marie ohnehin nicht in den Kindergarten im Ort (ebenfalls im Nachbarhaus der Familie) gehen könne, weil da räumlich zu wenig Platz für Marie´s großen Rollstuhl sei und die Gruppe bereits voll wäre. Die Mutter nickte (obwohl sie mir in einem Gespräch in der Vergangenheit erzählt hat, dass sie sich wünscht, dass Marie einmal nebenan in den Kindergarten gehen kann). Ich hielt mich anfangs zurück und wartete, ob Einwände ausgesprochen werden. Schließlich meldete ich mich zu Wort und erklärte, dass Marie das Recht den örtlichen Kindergarten zu besuchen nicht verwehrt werden darf und dass dabei der Rollstuhl kein Argument als Hindernis sein kann. Auf meine Aussage hin wurde das Thema Kindergarten vorläufig vertagt und wieder zu „Kinderkrippen-Themen“ übergegangen.
Es geht hier nicht darum, die anwesenden Pädagoginnen oder die Gemeindebedienstete abzuqualifizieren, sondern um aufzuzeigen, wie schnell die Rechte des Kindes bzw. der Eltern (oft unbewusst) übergangen werden. Marie´s Mutter verhielt sich im gesamten Gespräch eher zurückhaltend und deponierte ihren Wunsch (was ja eigentlich ihr Recht ist) erst nachdem die Frühförderperson ihr dazu den Raum geöffnet bzw. unterstützend zur Seite gestanden ist.
Wie aus dem Protokoll ersichtlich wird, gehört zu dem Bereich auch, dass die Eltern in der Artikulation ihrer Wünsche bei Bedarf durch die Frühförderperson gestärkt und unterstützt werden. Ebenso fällt in die Vernetzung, dass die Frühförderperson einen Überblick darüber gewinnt, wo es Ressourcen im informellen Netzwerk gibt, welche den Eltern Unterstützung und Hilfestellung bieten können. Zur Vernetzungsaufgabe gehört zudem, dass bei Wunsch der Eltern auch Kontakte zu anderen Eltern geschaffen werden, z. B. durch Elternabende im Beisein der Frühförderpersonen, zu bestimmten Themenschwerpunkten oder durch Elterntreffpunkte, wo Eltern unter sich sein können und von Seiten der Frühförderung nur die räumlichen Ressourcen bereitgestellt werden usw. (vgl. ebd. S. 31).
Interdisziplinarität meint, dass „eine fachlich gegebene Arbeitsteilung aufzuheben versucht“ (ebd., S. 28) wird. Auch dieses Grundprinzip ist eine wichtige Säule der Frühförderung und hat sich ebenfalls in seinem Verständnis weiterentwickelt.
„[S]tanden in der Anfangszeit noch die additiven und summativen Aspekte im Vordergrund (´das Kind braucht für seine Entwicklung in den jeweiligen Entwicklungsbereichen der Motorik, Kognition, Emotionalität… die jeweiligen Spezialisten, die sich aber abstimmen müssen`) […] haben sich in jüngerer Zeit durch die ganzheitlichere Betrachtungsweisen […], zum Teil neue Akzente der Kooperation und Arbeitsteilung ergeben (`Ich sehe das und das im Vordergrund, möchte aber gerne deine Einschätzung dazu hören…`).“ (ebd. S. 29)
Damit nicht jede Disziplin Sprichwort gemäß „ihre eigene Suppe kocht“, braucht es interdisziplinäre Arbeit. Diese kann entweder an einer Stelle (wenn dort verschieden ausgebildete Fachkräfte arbeiten) oder im Austausch mit angesiedelten Fachdiensten erfolgen. Denn Einschätzungen und Sichtweisen „können von einer Person oder Fachlichkeit allein nicht seriös geleistet werden“ (ebd.), wie schon im Punkt „Ganzheitlichkeit“ festgestellt wurde. Dazu ist die „Zusammenarbeit im Team, interdisziplinärer Fachaustausch, fallbezogene Absprache, kollegiale Beratung, fachliche Beratung durch Kolleginnen anderer Professionen, Hospitationen und anderes mehr“ (ebd. S. 30) notwendig.
Letzten Endes stellt jedoch die Voraussetzung für alles Genannte die Fähigkeit zum Dialog auch unter den sog. „Fachleuten“ dar (vgl. ebd. S. 28f.).
„Frühförderung ist ein gemeinde- und familiennahes Angebot, das von Frühförderstellen gemacht wird“ (Thurmair/Naggl 2000, S. 13). Dies kann einerseits direkt in regionalen Einrichtungen, andererseits aber auch in Form von Hausbesuchen, sprich „Hausfrühförderung“ oder „mobile Frühförderung“, stattfinden (vgl. ebd.).
Der Begriff „mobil“ findet vorwiegend im pädagogischen Bereich Verwendung und steht in Abgrenzung zum ambulanten Arbeiten, welches hauptsächlich im medizinischen Sektor begrifflich gebraucht wird (vgl. ebd., S. 208f.).
In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich auf die mobile Frühförderung in Form von Hausbesuchen, da meine eigenen Erfahrungen aus diesem Bereich stammen. Dazu verwende ich den Terminus „mobile Frühförderung und Familienbegleitung“.
Weiterer Grund für die Auswahl der mobilen Form der Frühförderung ist die Begleitung des Kindes und seiner Familie in deren gewohntem Umfeld, nämlich Zuhause in der Familie. Da die Lebenswelt kleiner Kinder die Familie (und erst allmählich hinzukommende befreundete Spielkameraden oder neue Umgebungen wie z. B. der Spielplatz oder die Kindergruppe) darstellt, kommt diese Form dem Prinzip der „Familiennähe“ bzw. „Familienorientierung oder Familienbezogenheit“ (siehe vorhergehendes Kapitel 3.4.2) besonders nahe. Hinzu kommt jener Aspekt, dass keine speziellen Hilfsmittel oder Materialien gebraucht werden, sondern vorhandenen Ressourcen (z. B. Lieblingsmaterialien des Kindes) können in der Familie genützt werden oder ohne großen Aufwand kann wenig mitgebrachtes Spielmaterialien ausreichen (vgl. ebd., S. 209f.).
Unter diesen Bedingungen kann das Wahrnehmen von Terminen außerhalb, die mit erhöhtem Energie und Zeitaufwand und oft als belastend empfundene Fahrt- und Wegstrecken, verbunden sein können, vermieden werden. Zudem kann die mögliche Isolation durch einen künstlichen „Förderraum“ im institutionellen Rahmen ausgeschalten werden. Die aufsuchende Struktur ermöglicht auch Familien, die ein ambulantes Angebot nicht wahrnehmen können, das In-Anspruch-Nehmen der Frühförderung. Aus diesem Grund kann von einer „leichten Erreichbarkeit“ besonders bei der mobile Form gesprochen werden (vgl. ebd., S. 210f.).
Unter den genannten Gesichtspunkten scheint mir die mobil aufsuchende Form der „Frühförderung und Familienbegleitung“, dem in der UN-Konvention geforderten Aspekt der Barrierefreiheit nahe zu kommen.
Ein Gegenargument dazu könnte jedoch sein, dass die mobile Form der Frühförderung und Familienbegleitung dem inklusiven Gedanken insofern nicht entgegenkommen kann, da sie eben gerade direkt in der Familie stattfindet und nicht gemeinsam unter anderen Kindern, wie z. B. im Kindergarten. Jedoch könnte dort das Prinzip der „Familienbezogenheit“ nur bedingt möglich sein bzw. müsste in alternativen Möglichkeiten stattfinden. Ein Beispiel, wie Frühförderung unter Einbezug und Austausch der Eltern in einer Gruppe stattfinden könnte, wird in Kapitel 6.2.3.1, anhand des „SpielRaum´s“ dargestellt.
In Bezug auf die ebenfalls in der UN-Konvention verankerte Forderung nach Recht auf Privatsphäre, ist die Frühförderperson in der mobilen Frühförderung besonders gefordert, jene Sensibilität, Zurückhaltung und Flexibilität aufzubringen, um dieses Recht respektvoll zu wahren. Dies bezieht sich sowohl auf räumliche Verhältnisse als auch auf das, „was die Frühförderin sieht oder hört, Familiengeschichten, Einkommensverhältnisse, religiöse Bindungen, Geschmack, Hygieneverhalten (…).“ (ebd., S. 220)
Thurmair und Naggl sprechen von erschwerten Bedingungen der mobilen Dienste, da sich diese in einem Spannungsverhältnis befinden. Einerseits ist die Frühförderperson Gast in der Familie und andererseits ist sie da um zu arbeiten und um einen Auftrag zu erfüllen. Nach ihnen kann sie beiden Rollen nicht gänzlich gerecht werden, weshalb es einer steten Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses bedarf (vgl. ebd., S. 215ff.).
Der Ablauf der Frühförderung und Familienbegleitung wird nach drei groben Punkten eingeteilt, die in diesem Kapitel überblicksmäßig dargestellt werden, sodass die Lesenden Vorstellungen vom konkret ablaufenden Arbeitsprozess entwickeln können. In meinen Ausführungen lehne ich mich wiederum an die AutorInnen Thurmair und Naggl, da deren Beschreibung im Wesentlichen auf die meisten Konzepte der Frühförderung angewendet werden kann.[16]
In der Eingangsphase steht der erste Kontakt zwischen Frühförderstelle und Familie im Zentrum. Diese Phase hat die Funktion der Orientierung und Information einerseits für die Eltern, andererseits auch für die Frühförderstelle. Eltern können beispielsweise Näheres in Bezug auf das Angebot, seine Struktur, Ablauf und Ziele erfahren. Dadurch können sie beurteilen, ob das Angebot für sie als Familie passend ist. Die Frühförderstelle kann sich am Kind und der neuen Familie orientieren, Anliegen und Erwartungen der Eltern erfahren und einschätzen, ob das Angebot entsprechen kann. Entscheiden sich die Eltern für das Angebot, kommt es im weiteren Verlauf zu einem Erst- und Anamnesegespräch mit der entsprechenden Frühförderperson, welches für beide die Basis der Zusammenarbeit darstellt. Im Weiteren kommt es zur Entwicklungsdiagnostik, worauf Schwerpunkte der Förderung erarbeitet werden. Dies wird von verschiedenen Frühförderstellen unterschiedlich gehandhabt. Entweder direkt an der Stelle mit den zuständigen Fachpersonen oder mit Hilfe von psychologischen, medizinischen, neurologischen Befunden, die Eltern mitbringen oder einholen. Die Eingangsphase wird schließlich mit einem Arbeitsbündnis abgeschlossen, welches gemeinsame Vereinbarungen in Bezug auf inhaltliche Schwerpunkte und formelle Rahmenbedingungen der Förderung beinhaltet (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 36f.).
Die Zeit der Phase der Förderung beschreiben Thrumair/Naggl folgendermaßen:
„In der Zeit der Förderung oder Therapie steht im Vordergrund, dem Kind entsprechend den vereinbarten Schwerpunkten therapeutische, psychologische oder pädagogische Unterstützung bei seiner Entwicklung zu geben, die Eltern fachlich zu beraten, und sie auch zu begleiten. Die Förderung steht in der Verantwortung einer bestimmten Person, der Frühförderin oder Therapeutin. Sie gestaltet diesen Prozess auf der Grundlage eines interdisziplinär abgestimmten und mit den Eltern auch vereinbarten Förderplans. Im Verlauf der Frühförderung bilanziert sie regelmäßig den Verlauf mit den Eltern, und bespricht das weitere Vorgehen. Bei besonderen Anlässen hält sie inne, und bespricht die auftretenden Fragen mit den Eltern.“ (ebd., S. 37)
Diesen Ausführungen blicke ich insofern kritisch entgegen, weil sie den Fokus stark auf das Handeln nach Schwerpunkten und Zielformulierungen ausrichten und dadurch die Notwendigkeit des Förderns zum Ausdruck bringen. Zudem erwecken die Ausführungen den Eindruck, dass die Frühförderperson zwar in Kommunikation und Austausch mit den Eltern steht, aber dennoch sie die „Ton-angebende-Stimme“ im Förderprozess darstellt. An dieser Stelle möchte ich auf das Kapitel 6.1.4 verweisen, wo ausführlich auf die Förderdiagnostik, den Förderplan und die Förderziele eingegangen und kritisch beleuchtet wird.
Wenn jedoch anstelle des Fördergedankens die Begleitung in dieser Phase im Mittelpunkt steht, dann können Angebote vom Kind aufgegriffen werden. In den regelmäßigen Elterngesprächen besteht dann die Möglichkeit die gemeinsamen Beobachtungen auszutauschen. Ausführlicher wird auf die Begleitung des Kindes in seiner Entwicklung und die Begleitung der Eltern in Kapitel 6.2 eingegangen.
In der Abschlussphase kommt es zum Prozess der Beendigung der Frühförderung mit dem Kind und der Zusammenarbeit mit den Eltern. Hier wird die Förderung mit dem Kind abgerundet, eventuelle Übergänge (z. B. Schuleintritt, neues Angebot) werden begleitet und der Verlauf wird gemeinsam mit den Eltern in einem Gespräch reflektiert bis es zum Abschied-Nehmen in den letzten Frühförder-Stunden kommt (vgl. ebd., S. 38).
[4] Die ursprüngliche Hypothese zur kindlichen Entwicklung basierte auf der Vorstellung von Reifung. Demnach geschieht Entwicklung aufgrund stattfindender innerlich-organischer Prozesse (vgl. Steinebach 1992, S. 51f.).
[5] Auf die Beobachtungen der Tierexperimente u. a. durch Konrad Lorenz und seinen Beobachtungen von Graugänsen (1963) wurde das Vorhandensein von „sensiblen Phasen“ der Entwicklung geschlossen. Es wurde von einer besonderen Bereitschaft für die Aufnahme äußerlicher Erfahrungen in diesen Phasen ausgegangen. Aus diesem Grunde war das Augenmerk v. a. auf die frühe Kindheit gelegt. Dadurch gewann Förderung der kindlichen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Außerdem wurde erkannt, dass auch die soziale Umwelt die kindliche Entwicklung beeinflusst (vgl. ebd., S. 51f.).
[6] Diese gehen zurück auf „Thorndike (1911), Guthrie (1935) und Skinner (etwa 1938) […]. Entwicklung galt nun, Anfang der 60er Jahre, als das Ergebnis eines Lernens durch spezifische Erfahrungen.“ (Steinebach 1992, S. 53)
In Lerntheorien besteht die Annahme, dass durch Reiz-Reaktions-Ketten bestimmte Verhaltensweisen erlernt werden (vgl. ebd.).
[7] In diesen Ansätzen wird das Kind als aktiv handelnd angesehen. „So spielen nach Bandura (1965) Aufmerksamkeit, Interesse oder kognitive Kompetenzen eine Rolle, wenn es um die Übernahme umfassender Verhaltensweisen durch Beobachtung geht.“ (ebd., S. 55)
Aus dieser Sichtweise entwickelt sich die Annahme, dass das sich zu entwickelnde Kind seine Entwicklung mitbestimmt. Die Bewältigung neuer Aufgaben, Krisen oder kritischer Lebensereignisse spielen bei dieser Annahme eine wichtige Rolle (vgl. ebd., S. 54f.). „Prinzipiell finden sich diese Annahmen wieder in den Theorien zur kognitiven Entwicklung nach Piaget (1973), zur Persönlichkeitsentwicklung nach Havighurst (1972), Rogers (1959/1987, vgl. Steinebach 1989) oder etwa zur Handlungssteuerung nach Miller (Miller/Galanter/Pribram 1968).“ (ebd., S. 55)
[8] Nun wurde davon ausgegangen, dass eine ansprechende Umwelt die Entwicklung des Kindes unterstützen konnte (vgl. Steinebach 1992, S. 56). „Der entscheidende Schritt zu einer differenzierten Beschreibung von Mensch-Umwelt-Beziehungen wurde von Bronfenbrenner (1978; 1981; 1989) entwickelt.“ (ebd., S. 57)
[9] Ausführlich zur familienbezogenen Frühförderung siehe: Steinebach, Christoph (1995) Familienentwicklung in der Frühförderung. Die Sicht der Mütter. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
[10] Das Konzept „Autopoiese“ von Maturana und Varela (1987) wurde als zentrales Konzept in den Systemtheorien angesehen (vgl. ebd., S. 60). Weitere Ausführungen zur Systemtheorie siehe Kapitel 5.2.4.
[11] Hier wird deshalb ausschließlich die weibliche Form genannt, da in unserem Team keine Frühförderer tätig waren.
[12] An dieser Stelle werden wiederum „nur“ die Therapeutinnen genannt, da kein männlicher Therapeut anwesend war, bzw. zu dieser Zeit mit Simon arbeitete.
[13] Eine „zum Stand der Bürger gehörig[en]“ (Müller 1985, S. 164) Familie.
[14] Im Bedeutungswörterbuch Duden wird Familie als „Gemeinschaft von Eltern [Erziehungsverantwortlichen, J. Ö.] und Kindern“ (ebd., S. 247f.) beschrieben. Somit steht offen, ob die Eltern verheiratet oder nicht (mehr) verheiratet sind, ob die Eltern im gemeinsamen oder in getrennten Haushalten wohnen. Es bleibt auch offen, ob von hetero-oder gleichgeschlechtlichen Elternteilen, oder von Patchwork-Familien gesprochen wird.
Das „Pädagogische Lexikon“ spricht im Jahr 1970 noch von einer „unvollständigen Familie“ wenn nur ein Elternteil vorhanden ist, sei es aufgrund von einer vorübergehenden oder dauerhaften Trennung der Eltern, Scheidung der Eltern oder verursacht durch den Tod eines Elternteils (vgl. Horney et. al. 1970, S. 862). Frühförderung hingegen sieht auch einen Elternteil mit dem Kind als eine Familie an, die sie begleitet.
In einer weiter gefassten Definition wird „Familie“ „als Gruppe aller verwandtschaftlich zusammengehörenden Personen“ (Müller 1985, S. 248) beschrieben. Für die Frühförderung scheint hauptsächlich die erst genannte enger gefasste Definition relevant. Die letzte genannte weitere Definition von „Familie“ wird dann bedeutsam, wenn beispielsweise auch Großeltern etc. mit einbezogen werden.
Helmwart Hierdeis definiert Familie auf deren Bedeutung für die Erziehungswissenschaft: „Für die Erziehungswissenschaft ist die Familie vor allem als der soziale Ort von Bedeutung, an dem die nachwachsende Generation „psychosozial erwachsen“ (Mollenhauer 1989, S. 605 zit. nach Hierdeis 1997, S. 661) werden kann und an dem die Erwachsenen ihre pädagogischen Funktionen – integriert in ihre sonstigen Lebensaufgaben und –perspektiven – in angemessener Weise erfüllen können.“ (Hierdeis 1997, S. 661)
[15] Ausführlich dazu in: Pretis, Manfred (2001): Frühförderung planen, durchführen, evaluieren. München: Ernst Reinhardt Verlag. S. 29-35.
[16] Zur weiteren Vertiefung beschreibt Pretis (2001) den Ablaufprozess der Frühförderung, eingeteilt in die Eingangsphase, die Phase der Förderdiagnostik, die Förderphase und die Phase der Reflexion und des Abschlusses besonders ausführlich in seinem Buch „Frühförderung planen, durchführen, evaluieren“ (siehe Literaturverzeichnis).
Inhaltsverzeichnis
„Es gibt keine mehr oder weniger eindeutige Definition von Behinderung. Die Auffassung von Behinderung hängt immer von theoretischen und praktischen/handlungsrelevanten Auffassungen und Herangehensweisen ab.“ (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 15)
So möchte ich im Folgenden auf drei Definitionen eingehen, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Dazu werden die Definition der WHO und der UN-Konvention in Kurzform dargestellt und im Weiteren wird auf die Definition von Behinderung aus psychoanalytischer Sicht genauer eingegangen. Diese halte ich für sehr aufschlussreich und wichtig für die eigene Auseinandersetzung der Frühförderperson in ihrer Arbeit mit dem Kind und der Familie. Dadurch sind Interaktionsdynamiken möglicherweise besser zu verstehen und einzuordnen.
„Im Einführungstext der ICF [Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, J. Ö.] heißt es, das Dokument habe sich fortentwickelt von einer Klassifikation der Krankheitsfolgen zur Klassifikation der Komponenten von Gesundheit.“ (DIMIDI/WHO 2005, S. 5 zit. nach Biewer 2009, S. 63)
Diesen Ansatz hat Adriano Milani Comparetti bereits vor mehr als 30[17] Jahren verfolgt, indem er für eine von der Krankheit entfernende hin zu einer gesundheitsorientierten Medizin plädierte (vgl. Aly, von Lüpke 1986, S. 13).
Verwendet und unterscheidet die WHO (Weltgesundheits-Organisation) in der ICF im Jahr 1980 noch die Begrifflichkeiten Schädigung (impairment), Beeinträchtigung und Leistungsminderung (disability) sowie Benachteiligung und Behinderung (handicap), so ersetzt und verändert die überarbeitete Version von 2001 (Waldschmidt 2005, S. 15) bzw. 2003 (Schönwiese 2011/12, S. 46) diese in ein Wechselwirkungsverhältnis von Körperfunktionen und –strukturen (impairment[18]), Aktivitäten (activity) der Personen und deren soziale und gesellschaftliche Partizipation (partizipation). Daraus geht hervor, dass sich das Verständnis von Behinderung von einem linearen Ansatz, wo zwar soziale Zusammenhänge mit einbezogen wurden, aber dennoch die medizinischen Aspekte dominierten, in ein interaktives Modell, verändert hat. Das neue Modell inkludiert umwelt/feld- und personenbezogene Faktoren (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 45ff., Waldschmidt 2005, S. 15f.).
Zusammenfassend kann Behinderung nach Auffassung der ICF als „das Ergebnis der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auf ihre funktionale Gesundheit“ (Schuntermann 2007, S. 34 zit. nach Biewer 2009, S. 63) definiert werden.
Jedoch sind bei der Analyse der ICF in Bezug auf ihre praktische Umsetzung der Klassifizierung kritische Gesichtspunkte zu erkennen: Schönwiese folgert, dass bei manchen Items zur Klassifizierung ein lineares Verständnis von Entwicklung überwiegt und daher die ganzheitliche Betrachtung zu kurz kommt (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 46).
Auch Waldschmidt argumentiert kritisch, dass es zwar zu einem Abwenden der medizinischen Normorientierung, aber dennoch zu einem Festhalten an der Norm und damit zu einer „flexiblen Normalisierung“ (Waldschmidt) im Kontext Behinderung kommt. (vgl. Waldschmidt 2003, S. 97 zit. nach Schönwiese 2011/12, S. 58)
Daraus ergibt sich für mich die Schlussfolgerung, dass die ICF mit ihrer neuen Sichtweise einen wichtigen Wandel eingeleitet hat, welcher nicht abgeschlossen ist und einer Weiterentwicklung bedarf. In Bezug auf Frühförderung lässt sich ableiten, dass Sichtweisen nicht zweifelsohne übernommen werden, sondern die Analyse von Sichtweisen stets erforderlich ist, um kritische Punkte erkennen und an diesen arbeiten zu können.
Auch die UN-Konvention bleibt nicht starr, denn laut ihrer Sichtweise bzw. Definition wird Behinderung nicht aus dem medizinischen und personenzentrierten Blickwinkel betrachtet, sondern be-hindert werden jene
„(…) Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Artikel 1 CRPD, zit. nach Schulze 2011, S. 16) angesehen.
Auch hier kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass Behinderung nichts von vornherein Gegebenes ist. Die Vorstellung des „Behindert-Werdens“ drückt auch die psychoanalytische Sichtweise von Behinderung aus.
Johannes Elbert und Dietmut Niedecken beschreiben den Begriff „Geistige Behinderung“ aus psychoanalytischer Sicht. Diese Ausführungen möchte ich aufgreifen, da sie mir auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Begriff Behinderung in der „Frühförderung und Familienbegleitung“ einleuchtend erscheinen.
Elbert beschreibt „Geistige Behinderung“ als etwas von der gesellschaftlichen Norm- Auffassung Abweichendes. Und was als Norm gilt, wird von Medizin, Psychiatrie und Sonderpädagogik bestimmt und verankert sich in den Köpfen der sog. ExpertInnen dieser Fachrichtungen, welche diese Normen bzw. Abweichungen feststellen. Aber auch in der Gesellschaft, die diese Normen im Laufe der Geschichte verinnerlicht hat. Mit der Diagnose wird dem Menschen, in unserem Fall dem nicht nach der Norm entsprechenden Kind, quasi ein „Stempel“ für die weitere Behandlung aufgedrückt. Mit Be-Handlung ist hier aber nicht allein die medizinische, psychiatrische oder sonderpädagogische Behandlung gemeint, sondern v. a. die sozialen Be-Handlungen. Darunter sind Bewertungen und Reaktionen auf die Norm-Abweichungen zu verstehen. Wenn diese als Schwächen und Defekte angesehen werden und die darauffolgenden Reaktionen Abwertung, Ablehnung, Aussonderung und Sonderbehandlungen darstellen, dann wird Behinderung erzeugt und wir können von „Behindert-Machen“ und „Behindert-Werden“ sprechen. Elbert spricht im Zuge dessen von einer „Formierung von geistiger Behinderung“ (Elbert 1982), im Speziellen hergestellt durch die genannten Handlungsfelder (vgl. Elbert 1982, S. 3ff.).
Weiters bringt er in seinem Artikel deutlich zum Ausdruck, dass Sichtweisen, Modelle, Ansätze und Theorien den Menschen nie ganz, sondern immer nur aus deren Blick betrachten und beschreiben und deshalb nicht den Menschen als Ganzes sehen. Aus diesem Grunde ist eine Hinterfragung pädagogischer Theorien, deren Grundannahmen, Auffassungen und damit verbundenen Wechselwirkungen wichtig und nötig (vgl. ebd., S. 3f.).
Auch Niedecken geht in ihren Ausführungen ihres Buches „Namenlos“ in die von Elbert aufgezeigte Denkrichtung. Sie schreibt jenen zwei Extremen, die vom lähmenden, aussichtslosen Abgeschlossen-Sein in Anstaltswesen (Sondereinrichtungen, Heime…) bis hin zum Förderenthusiasmus in Früherkennungs- und Frühförderungsinstitutionen reichen, institutionalisierende Funktionen zu. Die beiden Extreme hängen insofern zusammen, als dass durch größte Bestrebungen, mit neuestem Material, fantasievollen Angeboten und möglichst früher Förderung versucht wird, die Kinder doch in den Bereich der sog. Normalität zu bringen, um nicht im Anstaltswesen, sprich dem vorgestellten Ende des Ausgesondert- und Totgeschwiegen-Werdens, zu enden. Gefühle „von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, von fördernder Allmacht und verwahrender Ohnmacht“ (Niedecken 2003, S. 17) hängen somit näher zusammen, als es eigentlich den Anschein macht (vgl. Niedecken 2003, S. 16f.).
Wenn Niedecken den Begriff „Institution“ verwendet, bezieht sie sich dabei auf die Psychoanalytikerin Maud Mannoni, die darunter hierarchische Interaktionsstrukturen versteht, die zu festen Regelsystemen geworden sind. Diese stellen sich zwar anscheinend mehr als naturgegeben dar, sind aber v. a. wegen ihrer interaktiven Bedeutung von Gewichtigkeit (vgl. Mannoni 1972, S. 10 zit. nach Niedecken 2001, S. 17).
So gesehen ist es auch nach Niedecken nicht ein „Geistigbehindert-Sein“ aufgrund organischer oder genetischer Ursachen, sondern ein „Geistigbehindert-Werden“, aufgrund von Abschiebungen, Ängsten, Abgrenzungen und Zuschreibungen (vgl. Niedecken 2003, S. 18).
Auch Adriano Milani Comparetti (siehe Kapitel 6.1.2) beschreibt die aufgezeigten Mechanismen in ähnlicher Weise, denn Therapie und Förderung sind nach ihm keine „heilende Macht“, sondern der „Versuch, Normalität zu fördern“ (Milani Comparetti 1985, zit. nach Straßburg 1995, S. 76). Er äußerte Kritik gegenüber Organisationen der Behindertenbetreuungen und gegen Behinderteneinrichtungen und ist der Meinung, dass „Behinderung“ dazu benützt wird um Berufsgruppen zu rechtfertigen (vgl. ebd., S. 77).
Niedecken geht in ihrem Denken noch weiter, indem sie zurück in die Zeit des Nationalsozialismus geht, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten in Gaskammern getötet wurden, weil sie nach dem damaligen Verständnis keine Daseinsberechtigung hatten. Sie spricht in diesem Zusammenhang von „Fantasmen“[19], die unsere heutige Haltung gegenüber dem „Geistigbehindertsein“ immer noch bestimmen. In diesen Fantasmen herrschen unterschwellig immer noch Tötungsgedanken des Nationalsozialismus mit, wenn es um Abschiebung, Aussonderung und Besonderung von Menschen mit Lernschwierigkeiten geht. Niedecken spricht dabei von „Seelenmord“ (Niedecken 2003, S. 19), vom „Todesurteil der Gesellschaft“ (ebd., S. 40) und vom „gesellschaftlichen Mordauftrag“ (ebd. S. 47) (vgl. Niedecken 2003, S. 19ff.).
Der Institution „Geistigbehindertsein“ kommt auch noch eine zweite Funktion zu, nämlich dass wir Wahrnehmungen und Verhaltensweisen, welche wir selbst nicht mehr zulassen und ausleben dürfen (z. B. Triebe, Sehnsüchte), bei anderen als Störung bezeichnen, wenn diese zugelassen und gezeigt werden (vgl. ebd., S. 22).
Wenn Frühförderung, wie in Kapitel 3.3 und 3.4 aufgezeigt, ihre Prinzipien und Ziele an den unmittelbaren Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten scheint und in der möglichst frühzeitigen Förderung Präventionsmaßnahmen postuliert und danach vorgeht, dass Kinder durch das Setzen von gezielten Maßnahmen möglichst an die „normale“ Entwicklung herangebracht werden, dann handelt Frühförderung zum Zweck der späteren Nützlichkeit und Selbstständigkeit des Kindes und nach Ansicht Niedecken´s zugunsten von staatlichen Interessen. Denn nach ihr hat Frühförderung in ihren negativen Extremen genau diese Daseinsberechtigung. Kind, Eltern und Frühförderperson werden dadurch zu „Beauftragten des Staates“ (vgl. ebd., S. 142).
Protokoll: In den ersten Wochen in denen ich Ines im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ kennenlerne, schließe ich ihre Zurückhaltung und Angepasstheit auf die anfängliche Schüchternheit, da ich noch eine fremde Person für sie bin. Die anfänglichen aber auch die fortlaufenden Frühförderstunden mit Ines verlaufen immer (nach meiner damaligen Vorstellung) „wie am Schnürchen“ ab. Ines macht bei jedem Spiel mit, nimmt jeden Impuls von mir auf, verweigert sich nie und erntet von mir viel Lob und Anerkennung. Dennoch scheinen die Frühfördereinheiten für uns beide nicht wirklich beglückend. Erst mit der Zeit bemerke ich, dass Ines nur selten laut lacht und ihre Spontanität, Neugierde und Freude irgendwie gedrosselt zu sein scheinen.
Durch Gespräche mit der Mutter erfahre ich, dass Ines im Alltag ein, laut Mutter, „problemloses“, braves und „leicht zu führendes Kind sei“. Mein Unbehagen weitet sich im Lauf weiterer Frühförderstunden immer mehr aus und ich verspüre zunehmend den Wunsch, dass Ines sich endlich dazu entscheidet „Nein“ zu sagen, etwas zu verweigern, einmal nicht mitmacht und nicht mehr angepasst ist.
Ich war in meinem anfänglichen Loben und Anerkennen im Sog des auf Leistung und Normen getrimmten Denkens und im Sinne Niedeckens wohl auch „indirekte Handlangerin des Staates“. In diesen Momenten rückte Ines in ihrem Kindsein für mich in den Hintergrund und ich bestätigte durch mein Loben und Anerkennen ihr angepasstes Verhalten und verstärke dadurch ihre „Diagnose der Entwicklungsverzögerung“.
Wie Frühförderung und Familienbegleitung nicht in dem beschriebenen negativen Sinne, sondern in eine entgegengesetzte Richtung arbeiten bzw. wirken kann, wird ebenfalls in Kapitel 6.2 aufgezeigt.
[17] Die Auflösung des Rehabilitationszentrums (siehe auch Kapitel 5.2.1) erfolgte in den Jahren 1968 bis 1980. Bereits im Jahre 1979 sprach sich Milani Comparetti in der Öffentlichkeit kritisch gegenüber der stationären Einrichtung aus und verbalisierte sein Umdenken (vgl. Janssen 1986, S. 11).
[18] „Mittlerweile werden die Begriffe ´Schädigung´ und ´Beeinträchtigun´ bzw. ´Funktionsstörung´ als ´impairment´ zusammengefasst.“ (Waldschmidt 2005, S. 28)
[19] Niedecken verwendet in der 4. Auflage des Buches „Namenlos. Geistig Behinderte verstehen“ die Schreibweise „Fantasma (Mehrzahl: Fantasmen)“. Da ich den Begriff im Sinne Niedeckens gebrauche, schließe ich mich ihrer Schreibweise an.
Das Wörterbuch Duden schreibt die Synonyme „Sinnestäuschung“, „Trugbild“ dem Begriff „Phantasma“ (anerkannte Schreibweise) zu (vgl. Bibliographisches Institut GmbH 2013).
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Das lineare Entwicklungsverständnis in der „Frühförderung und Familienbegleitung“
-
5.2 Das nicht-lineare Entwicklungsverständnis in
der „Frühförderung und Familienbegleitung“
- 5.2.1 Zur Person Adriano Milano Comparetti und seinen Errungenschaften in Italien
- 5.2.2 Zum Begriff Dialog
- 5.2.3 „Entwicklungsförderung im Dialog“ nach Adriano Milani Comparetti
- 5.2.4 Exkurs: Entwicklung im Dialog mit Natur und Umwelt: Ein Überblick zum Entwicklungsbegriff in der Systemtheorie und Chaostheorie
- 5.2.5 Weitere ausgewählte Konzepte, die ein nicht-lineares bzw. dialogisches Entwicklungsverständnis verfolgen
- 5.2.6 Die frühe Entwicklung des Kindes und die Bedeutung der Eltern (Mutter) - Kind - Interaktion aus psychoanalytischer Sicht
- 5.3 Folgerungen für die Entwicklungseinschätzung: Die mehrdimensionale Entwicklungsbeschreibung oder das Aufzeigen von Prognosen statt Diagnosen
Verständnisse von Entwicklung stehen in engem Zusammenhang mit Auffassungen von Behinderung. Dennoch werden sie aufgrund der gewählten Fragestellung dieser Arbeit eigenständig behandelt, da dadurch eine genauere Beantwortung ermöglicht wird.
Je nach Verständnis und Auffassung des Begriffs „Entwicklung“ folgt wie bei der Auffassung von „Behinderung“ auch eine dementsprechende Haltung und Einstellung der Frühförderperson verbunden mit Handlungsweisen und Ansätzen in der Arbeit mit dem Kind und dessen Familie.
Je nach Bild vom Menschen hält sich auch die Frühförderperson an die entsprechenden Theorien von Entwicklung, die sich im Laufe der Zeit veränderten.
Im Folgenden werden die zwei konträren Auffassungen, wie sie in Ansätzen bereits in Kapitel 3 zum Ausdruck kamen, genauer dargestellt. Anschließend wird auf das Verständnis von Entwicklung aus psychoanalytischer Sicht eingegangen, da es eine Ergänzung zum „Behinderungs-Begriff“, der ebenfalls aus diesem Blickwinkel näher betrachtet wurde, darstellt.
Unter einem linearen Entwicklungsverständnis wird Entwicklung als in definierten, aufeinander ab folgenden Stufen verstanden. Der Entwicklungsverlauf stellt einen vorgegebenen Weg dar, welcher von rechts nach links und von unten nach oben zu verlaufen hat. Abweichungen, Rückwärtsschritte oder Pausen werden als krankhaft, nicht „normal“ angesehen und negativ bewertet. Die Vorstellung eines defizitären Kindes dominiert. Bewertungen und Vergleiche mittels genormten Entwicklungstabellen[20], Kategorisierungen[21] und medizinischen Klassifizierungen (z. B. ICD-10[22] und DSM-IV[23]) herrschen vor. Das Kind wird mit Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen der Erwachsenen z. B. von Eltern, Frühförderpersonen, TherapeutInnen, ÄrztInnen usw. konfrontiert, Ziele werden festgesetzt und zur Erreichung dessen darauf hingearbeitet. Das Kind wird gefördert und hat zu entsprechen (vgl. Roser 1998b, S. 170).
Dieses Verständnis herrscht vor allem in der traditionellen Heil- und Sonderpädagogik seit dem frühen 19. Jhd. und gründet in einer medizinisch-psychiatrischen Sicht von Behinderung und des menschlichen Entwicklungsprozesses, welches den Fokus auf die einzelne Person legt und das soziale Umfeld und die Lebensgeschichte des Menschen nicht mit einbezieht (vgl. Schönwiese 2011/12, S. 19, Biewer 2009, S. 19).
Die bereits oben erwähnten sonderpädagogischen Kategorien waren Folgen der Strukturierung des Sonderschulwesens in Deutschland. Lehrbücher und Grundlagenwerke der Sonderpädagogik gliederten sich in diese auf (vgl. Biewer 2009, S. 42f.), beispielsweise auch Karl Josef Klauer in „Grundriß der Sonderpädagogik“ aus dem Jahr 1973[24]. Klauer formuliert in einem Einführungsartikel eines Grundlagenbuches:
„Die Sonderpädagogik widmet sich Kindern und Jugendlichen, die in besonderer Weise auffällig sind und deshalb der besonderen Hilfe bedürfen. Ob es sich nun um irgendwie behinderte oder talentierte junge Menschen handelt oder ob es um Verhaltensauffällige geht, sie alle bedürfen spezieller Hilfe und Unterstützung.“ (Klauer 1992, S. 12f.)
Daraus resultiert die damalige Einstellung, der Notwendigkeit von Sonderbehandlungen und Sonderförderungen für alle jene Kinder (und Jugendliche), die sich nicht nach der vorgegebenen „Norm“ entwickeln. Weiters geht aus dieser Literatur die Unterteilung in verschiedene Schweregrade der Behinderung bzw. „behinderten Entwicklung“[25] hervor, die wiederum nach unterschiedlichen pädagogischen Konsequenzen zu fördern seien (vgl. ebd., S. 15).
So wird auch Frühförderung, wie bereits in Kapitel 3.1 und 3.2 erwähnt, seit ihren Anfängen in den 70er Jahren bis heute in „Frühförderung für blinde und sehbehinderte und gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder“ sowie die „allgemeine Frühförderung“ differenziert. Dadurch scheint in diesem Zusammenhang die frühere Einstellung in Bezug auf Kategorisierungen, auch heute noch fortlaufend gültig zu sein.
In Bezug dazu möchte ich noch einmal auf Johannes Elbert eingehen, welcher sehr deutlich gegen sonderpädagogische Theorien argumentiert, da diese besonders durch ihre Kategorienbildung segregierende Wirkung erzeugen (vgl. Elbert 1982, S. 2).
Wenn Elbert von „sonderpädagogischer Beziehung“ (ebd., S. 16) spricht, so beschreibt er damit das gegenseitige „Fremdbleiben“ in der Beziehung zwischen Kind und PädagogIn (vgl. ebd., S. 16). Dies kann v. a. auch dann auf die Frühförderung ausgelegt werden, wenn sich die Frühförderperson vorwiegend an Entwicklungstabellen, Raster und Einordnungen hält, die kindliche Entwicklung daran beurteilt und Fördermaßnahmen unter Anleitungen setzt.
Unter solch genannten Werken (z. B. Kiphard, Strassmeier, Ohlmeier – siehe Fußzeile 20) entsteht die Gefahr, dass bei der Frühförderperson sowie auch den Eltern der „ärztliche Blick“ [26], ich möchte in Anlehnung an Foucault diesen auch als „therapeutischen Blick“ oder „Förderblick“ nennen, Überhand gewinnt. (vgl. ebd., S. 21) Wie derartig ausgerichtete Sichtweisen der fachlich tätigen Personen den Blick auf das „wirkliche Kind“ verschleiern können, zeigen folgende Karikaturen von Gidoni und Landi in den Abbildungen 1-4 (vgl. Gidoni/Landi 1990, S. 79-82).
Diese spezifischen Blickrichtungen hätten wiederum Auswirkungen auf die weitere familiäre Sozialisation (vgl. Schönwiese 2011, S. 21) sowie nach Elbert in Anlehnung an Winnicott auch auf die Produktion eines „behinderten Selbst“ [27] bzw. „geistigbehinderten Selbst.“ [28] (Elbert 1982, S.4, 21)
Eine in Ansätzen veränderte Sichtweise geht aus dem noch jungen Buch von Klöck und Schorer „Übungssammlung Frühförderung“ (2011) hervor. Hier wird zwar in Kategorien, wie Wahrnehmung, Motorik, Kognition, umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten, Sozialverhalten und Sprache unterteilt, jedoch unterscheidet sich das Buch von anderen Werken (siehe z. B. Fußzeile 20), da es einerseits grundsätzlich von der Beziehungsqualität, die als Basis der Förderung angesehen wird, ausgeht. Andererseits auch, weil zu den einzelnen Übungen keine Altersangaben der Kinder mehr angegeben werden (die Altersangabe ist nur im Unterbuchtitel entsprechend für Kinder im Alter von 0-6 Jahren erwähnt), sondern die Übungsbeispiele nur den einzelnen Bereichen zugeordnet werden. So gesehen erzeugt das Buch weniger Druck und Vergleichsmöglichkeit als die bereits erwähnten älteren Werke. Die Autorinnen beschreiben es dennoch als „Heilpädagogische Übungssammlung“ (vgl. Klöck/Schorer 2011).
Die Übungen können als Anregung dienen und insofern einen positiven Beitrag für die Frühförderung darstellen, wenn sie unter der Voraussetzung eines Eingehens und individuellen Abstimmens und Variierens an die kindlichen Bedürfnisse und Interessen erfolgen (Näheres dazu siehe im folgenden Kapitel).
Dieses Verständnis von Entwicklung kann nicht zu einem Perspektivenwechsel beitragen, da der Förderaspekt, die Besonderung und das Manipulieren am Kind im Vordergrund stehen. Damit es zu einer Begleitung der kindlichen Entwicklung kommen kann, braucht es ein anderes Verständnis.
Verständnisse eines nicht-linearen oder dialogischen Entwicklungsverständnisses entwickelten sich im 20. Jhd. zunehmend, wie in Kapitel 3.2 und 3.3 aufgezeigt wurde, und waren zu früheren Zeit v. a. in reformpädagogischen Konzepten, wie z. B. der Pädagogik nach Maria Montessori[29], vertreten. Einige dieser Konzepte bauen auf dem folgenden Ansatz auf.[30] (vgl. Straßburg 1995, S. 78, Aly 1995, S. 88f., Aly 1997, S. 117f.).
Für mich ein besonders beeindruckendes und bedeutendes Konzept, mit dem Verständnis eines nicht-linearen Entwicklungsverständnisses, stellt jenes vom Kinderarzt, Kinderneurologe - und Psychiater Prof. Dr. Adriano Milano Comparetti dar. Das nicht mehr junge Konzept scheint in seiner Aktualität keineswegs an Bedeutung verloren zu haben. Besonders für die Arbeit mit Kindern und deren Familien im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ kann Milani Comparetti´s Ansatz wesentlich und wertvoll sein.
Nach einer kurzen Einführung zur Person von Adriano Milano Comparetti und seinen Errungenschaften in Italien (diese geben einen Einblick in die Entstehung bzw. Entwicklung seines Ansatzes und werden aus diesem Grunde ausgeführt), werde ich auf sein Konzept und dessen Weiterentwicklung ausführlicher eingehen.
Entscheidend dabei ist und da stimme ich mit Monika Aly und Hans von Lüpke mit ein, die den Nachruf für Milani Comparetti in der Verschriftlichung[31] der 1985 stattgefundenen Fachtagung „Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit – Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti“ verfassten (siehe Kapitel 4.2.1), dass sein Konzept nicht als Methode behandelt wird, sondern, dass dieses in unserem Denken, in unserer Sprache und in unseren Handlungen zum Ausdruck kommt und verinnerlicht wird (vgl. Aly/von Lüpke 1986, S. 15).
Milani Comparetti und seine Mitarbeiterin Anna E. Gidoni lieferten richtungsweisende Impulse für Berufsgruppen, Institutionen und die Forschung, welche sich mit der Entwicklungsförderung von Kindern und der Kooperation mit deren Eltern befassten[32] (vgl. Janssen 1996, S. 5f.).
Vorbildfunktion u. a. auch für die Frühförderperson kann Milani Comparetti auch deshalb zugesprochen werden, da er sowohl seine eigene praktische Arbeit und seine wissenschaftliche Forschung, als auch andere wissenschaftliche Auslegungen von KollegInnen immer wieder kritisch hinterfragte. Dadurch entwickelte er seine eigenen Sichtweisen und Konzepte immer weiter, wodurch sich aus der „Medizin der Krankheit“ (Milani Comparetti) der Ansatz der „Medizin der Gesundheit“ (Milani Comparetti) entwickelte (vgl. ebd., S. 9f.).
Das von ihm in Florenz (Italien) übernommene Reha-Zentrum „Centro di Educazione Motoria Nanna Torrigiani“ war in seiner damaligen Funktion „als eine stationäre Einrichtung zur Rehabilitation von Kindern mit Zerebralparese, (…) mit angeschlossener Sonderkindertagesstätte, Sonderschule und mit spezialisiertem Personal“ (ebd., S. 10) konzipiert. Nach 10-jähriger Tätigkeit entwickelte er eine völlig andere Konzeption, die er auf seine neuen Erkenntnisse und einer neuen Ansicht anpasste, nämlich „(…) daß Rehabilitation mit dem Einbeziehen in das normale Leben beginne und ohne dies zum Scheitern verurteilt sei“ (Milani Comparetti 1979, zit. nach Janssen 1996, S. 11) (vgl. Janssen 1996, S. 10f.).
Besonders „[h]ervorzuheben ist, (…) daß es sich um ein Konzept ganzheitlicher Gesundheitsförderung von Kindern handelt, das auf medizinischer Erfahrung aufbaut und von Medizinern in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen in jahrzehntelanger Arbeit erprobt und weiterentwickelt wurde.“ (ebd., S. 9)
Aus dieser Entwicklung folgt die Auflösung aller Sondereinrichtungen in Italien. Ende der 70er Jahre wurde gesetzlich verankert, dass jedes Kind in Italien das Recht auf den Besuch einer Regelschule hat (vgl. Aly/von Lüpke 1996, S. 13).
Das Bedeutungswörterbuch Duden beschreibt den Begriff „Dialog“ als „Gespräch zwischen zwei oder mehr Personen“ (Müller 1985, S. 179). Das Herkunftswörterbuch Duden erläutert diesen mit „Zwiegespräch, Wechselrede“ (Drosdodowski 1989, S. 125) und beschreibt seine Herkunft im 18. Jhd., wo es an das gleichbedeutende französische Wort „dialogue“ angelehnt wurde, welches auf das lateinische Wort „dialogus“ bzw. auf den griechischen Begriff „diálogos“, was so viel wie „Unterredung oder Gespräch“ bedeutet, zurückgeht (vgl. Drosdodowski 1989, S. 125).
Für die Ausführungen dieser Arbeit wird der Begriff „Dialog“ im Sinne von Aly und von Lüpke gebraucht: „Dialog bedeutet hier: eine gleichberechtigte Beziehung mit dem Kind entwickeln“ (Aly/von Lüpke 1996, S. 14) In dieser Formulierung stehen die Begriffe Geleichberechtigung und Beziehung im Fokus.
In Bezug auf die Begleitung von Kind und Eltern erweitert Hans von Lüpke die Definition wie folgt:
„Beim Dialog trifft sich, wer Entwicklung als einen offenen Prozeß im wechselseitigen Austausch versteht.“ (von Lüpke 1995, S. 69)
Von Lüpke schreibt dies in Anlehnung an Milani Comparetti, der in seiner Arbeit mit dem Kind, aber auch in seinem privaten Leben dem gemeinsamen Dialog größten Wert beimisst (vgl. von Lüpke 1995, S. 65ff.).
Milani Comparetti beschäftigte sich besonders mit dem kindlichen Bewegungsverhalten und insbesondere der fetalen Bewegungsentwicklung. Aufgrund seiner Beobachtungen kommt er zu der Erkenntnis, dass die Bewegungen des Fetus auf selbstständige Weise mit viel Kreativität erfolgen und nicht von Außenreizen abhängig sind. Er erkennt jenen Lebenswillen, der dem Individuum ein „Sich-Selbst-Aufbauen“ und im Weiteren die Fähigkeit in Beziehung treten zu können, ermöglicht. Mit diesem Wissen kommt es zum Umdenken von Milani Comparetti´s medizinischer Sichtweise. Er distanziert sich von Entwicklungsbeurteilungen, die nur den Reflexstatus überprüfen und von funktionalen Behandlungen, die einem Reiz-Antwort-Schema eines geschlossenen Kreises gleichen. (Abb. 5). Seine neue Sichtweise, in welcher er das Kind als „Hauptakteur seiner eigenen Entwicklung“ (Milani Comparetti 1986, S. 24) ansieht und die damit verbundene Haltung, prägen seinen Umgang mit Kindern in Behandlung und Therapie. Er spricht sich gegen isoliertes und aus dem Beziehungskontext herausgerissenes Therapieren und Fördern aus, da die Eigenaktivität zu wenig oder gar nicht beachtet wird. Weiters steht er für ein gemeinsames Aufeinander-Eingehen und meint damit, dass das Kind in seiner Eigenaktivität beobachtet wird, Vorschläge des Kindes aufgenommen werden und mit Gegenvorschlägen ein Dialog stattfinden kann. Dadurch kann Neues entdeckt werden und Entwicklung stattfinden. Diesen Mechanismus verbildlicht Milani Comparetti mit einer nach oben geöffneten und aufstrebenden Spirale (Abb. 5) (vgl. Milani Comparetti 1986, S. 23ff.).
Abbildung 5. „Von der ´Medizin der Krankheit´ zu einer ´Medizin der Gesundheit´“ (Milani Comparetti/Roser 1982, S. 82 zit. nach Milani Comparetti 1986, S. 25)
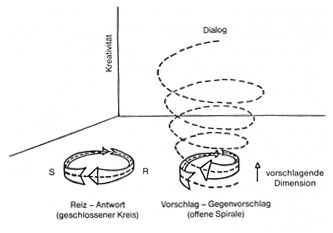
Parallelen lassen sich hierbei zur UN-Kinderrechtskonvention erkennen, wenn diese das Recht des Kindes auf „individuelle Entfaltung“ beschreibt und Milani Comparetti vom „Respekt vor der Eigenaktivität des Kindes, im Bewusstsein, daß nur das Kind allein sich selbst aufbauen kann“ (ebd., S. 25) spricht. Diesen Respekt - bzw. nach UN-Konvention - dieses Recht des Kindes gilt es, in Förderung und Therapie zu bewahren.
Die Weiterentwicklung des Milani-Konzepts erfolgte durch seine Schülerin und Mitarbeiterin Anna E. Gidoni. Sie entwickelte sein Bild der nach oben offenen Spirale weiter in eine „erratische [33] Spirale“ (Ceruti u. Gidoni 1990 zit. nach von Lüpke 1986, S. 65) oder auch das „Bild eines Bandes, einer Art Schärpe aus biegsamen Material, das seine Form behält oder von außen aufgeprägte Formen annimmt. Dieses Band dreht sich, es rollt sich ein, entwickelt sich, biegt sich rückwärts und springt nach vorn“ (Roser 1998b, S. 171) (siehe Abb. 6).
„Hier wird die Dimension der Kreativität nicht ausschließlich als eine gradlinig nach oben gerichtete Bewegung verstanden, sondern als eine, der alle Dimensionen offenstehen, auch die nach unten oder vorübergehend rückwärts gerichtete.“ (von Lüpke 1986, S. 64)
Entwicklung ist demzufolge nicht ausschließlich „vorwärts“, sondern auch abweichend, rückwärts und wieder vorwärts verlaufend zu sehen, wie es in Abb. 6 verbildlicht und im folgenden Exkurs zum Ausdruck kommt.
Protokoll: Ich begleite Eva, ein vierjähriges Mädchen bereits seit ihrem ersten Lebensjahr. In dieser Zeit durfte ich miterleben, wie Eva ihre eigene Mobilität entdeckte, indem sie sich im Alter von ungefähr 3,7 Jahren selbstständig von Rücken- in Seit- und Bauchlage drehen lernte. Sie begann ihren Kopf in Bauchlage immer längere Zeit aufzuheben und ihren Unterarmstütz in Bauchlage viel kräftiger einzusetzen. Umso enttäuschter wurde ich, als sie all dies nicht mehr zeigte und nicht mehr selbstständig durchführte. Eigene Gefühle der Frustration stiegen mit der Zeit in mir hoch. Zunehmend versuchte ich, Eva Anstöße zu einer Drehung zu geben und ihre Bewegungen mit zu bestimmen. Ich suchte nach Gründen warum Eva anscheinend Entwicklungsrückschritte machte, konnte dabei aber nur leere Vermutungen anstellen. Ich ertappte mich selbst dabei, dass ich Gefühle der Resignation entwickelte und eine Mischung aus Verzweiflung, Sorge und Ärger in mir hoch stiegen.
Im Rahmen einer Supervision konnte ich über diese Emotionen sprechen, sie mit Hilfe des Supervisors tiefergehend betrachten und herausfinden, dass ich ihre „Rückschritte“ als negativ bewertete und besorgniserregend einstufte und als solches auch verbalisierte. Weiters erkannte ich, dass ich selbst durch Eva´s Rückzug immer mehr aktiv wurde, Eva zu bespielen anfing, mein Tempo nicht mehr dem ihren anpasste und ihr eigentlich gar keine Chance mehr zum gemeinsamen Dialog gegeben habe.
In den nächsten Frühförderstunden mit Eva versuchte ich, mich ganz bewusst zurückzunehmen, durchzuatmen, zu sehen, hören, spüren und zu fühlen. In Ansätzen gelang es mir, die Zeit mit Eva in ihrer derzeitigen Entwicklung auszuhalten und nicht ständig an die Zeiten zu denken, in denen sie sich gedreht hatte… Möglicherweise gelang es mir gerade dadurch ihre Blicke und Bewegungen zu sehen, ihre Geräusche, die sie von sich gab zu hören, ihre Stimmung zu erahnen und darauf einzugehen bzw. ihr mit einem Gegenvorschlag zu begegnen, sprich im gemeinsamen Dialog mit ihr zu sein.
Das Mit-Aushalten ihres Weges, den dazugehörigen Pausen und Abweichungen fiel mir anfangs unheimlich schwer und erst im Nachhinein kann ich erkennen, wie wichtig diese für das Mädchen waren, denn dadurch konnte sie wohl auch ihre Autonomie zum Ausdruck bringen. Außerdem erkannte ich, dass die Erfahrungen mit Eva auch für mich sehr bedeutsam waren und zu meiner Weiterentwicklung beigetragen haben, denn mein Blick auf ihre Dialog-Vorschläge wurde dadurch wesentlich sensibilisiert. Inzwischen dreht sich Eva wieder je nach Lust und Motivation mehr oder weniger, stützt ihre Oberarme ab, hebt den Kopf und senkt ihn für Pausen wieder nieder und noch vieles, vieles mehr.
Wenn Milani Comparetti von Gegen-Vorschlag spricht, meint er damit nicht ein bloßes Imitieren des Gegenübers, denn das wäre nichts Gemeinsames und damit auch kein Dialog. Er versteht darin etwas „Anderes, nicht Gleiches“, das auf den Vorschlag folgt. Hans von Lüpke spricht von einer „Nicht-Mitteilbarkeit“ (von Lüpke 1986, S. 65), die zu einem ausschlaggebenden Faktor des Dialogs wird. Diese kann weder bildlich dargestellt, noch sprachlich treffend umschrieben werden (vgl. ebd. S. 65).
Sie wird im Dialog unter angeborener, nonverbaler Kommunikation, im gegenseitigen Wahrnehmen und Senden von Zeichen unter dem Aspekt der Beziehung wahrgenommen (vgl. ebd. S. 26).
Die Person, die einen Vorschlag macht (in unserem Falle das Kind) und jene Person (hier die Frühförderperson), die mit einem Gegen-Vorschlag reagiert, müssen also in einer für beide bedeutsamen Verbindung stehen, der den gemeinsamen Rahmen für den Dialog öffnet. Im Falle des oben beschriebenen Beispiels heißt das, dass ich Lea gerade dann, wo ich versucht habe nach meinen vorgegebenen Vorstellungen und Kriterien sie für bestimmte Übungen zu interessieren, das Gegenteil erreicht habe. Erst als wir auf der Ebene waren, wo wir Erfahrungen machten, die für uns gemeinsam Bedeutung hatten, setzte der Dialog wieder ein (vgl. ebd. S. 65f.).
Ein weiterer, mir sehr bedeutend erscheinender Punkt den Milani Comparetti herausstreicht, ist seine Erkenntnis, dass Entwicklung nur geschehen kann, wenn der kindliche Wille gegeben ist. Überall dort, wo gegen diesen und wider die kindliche Lust und Freude gefördert wird, wird das Wollen des Kindes ge- bzw. zerstört. Es kommt auf die Erfahrungen an, die ein Kind innerhalb seiner emotionalen Beziehungen machen kann und die für das Kind an Bedeutung erlangen und nicht das bloße Üben ist ausschlaggebend (vgl. Milani Comparetti 1986, S. 25).
In Bezug auf Kinder mit einer Behinderung spricht Milani Comparetti, meines Erachtens ebenfalls wieder konform im Sinne der UN-Konvention:
„Ganz gleich, welcher Art die Beeinträchtigung bzw. Schädigung ist, muß die Behandlungs- oder Fördermaßnahme so gestaltet sein, daß sie dazu beiträgt, die Eigenaktivität, d. h. die Autonomie des Kindes zu stärken und seine Beziehung mit der Umwelt, den Dialog, zu stabilisieren. Das Bewußtsein der Ganzheitlichkeit verbietet jede isolierte Funktionsförderung oder Therapie einer umschriebenen Störung, die nicht in den Gesamtzusammenhang der physio-psycho-sozialen Situation des Kindes eingebettet ist.“ (ebd., S. 27)
Protokoll: Für die nächste Frühförderstunde mit Michael habe ich zwei Kisten, eine davon gefüllt mit Kastanien, mitgebracht. Ich stellte mir vor, dass es für Michael motivierend sein könnte, wenn wir die Kastanien von einer in die andere Kiste „baggern“. Unsere Hand sollte die Baggerschaufel sein. Aufgrund einer einseitigen Körperlähmung fokussierte ich das Öffnen, Greifen und wieder Loslassen der rechten Hand. Michael griff anfangs meinen Vorschlag auf, doch begann er rasch das „Spiel“ zu verweigern, denn es war für ihn alles andere als lustbetont. Anstelle dessen holte er aus meiner mitgebrachten Kiste die Schnecke, eine Tierhandpuppe, die für ihn zu einem fixen Bestandteil der Frühförderung geworden ist, denn er fragt in jeder Stunde, ob ich die Schnecke beim nächsten Mal wieder mit bringe. Michael gab mir die Schnecke in die Hand. Ich interpretierte dies als eine Aufforderung sie mit meiner Hand zu spielen. Wir führten ein verbales Zwiegespräch. Schließlich begann er, die Schnecke mit den Kastanien (und zwar mit beiden Händen) zu füttern. Daraufhin erzeugte ich „Schmatzgeräusche“ und spielte das „Fütterspiel“ mit der Schnecke weiter. Michael lachte laut und forderte immer weitere Wiederholungen. Daraufhin begann er, die Kastanien als Symbol für bestimmte Nahrungsmittel und Speisen, die er benannte, zu verwenden und erwartete jedes Mal „Schmatz- und Schluckgeräusche“ (die er anscheinend unheimlich lustig fand). Letzten Endes waren wir recht ausdauernd mit diesem von Michael inszenierten und von mir aufgenommenem Spiel beschäftigt.
Meine damalige Idee, die Frühförderzeit mit Michael auf einer von mir entworfenen Spielidee zu beginnen, scheiterte daran, dass ich mit dem Baggerspiel nicht sein Interesse aufgriff und nicht in seine Lebenswelt mit eintauchte (er spielte in dieser Zeit auch im Alltag nicht mit Baggern, oder konnte auch momentan auf keiner Baustelle einem Bagger zusehen). Außerdem glich das Baggern mit der Hand einem funktionalen Üben, was für Michael alles andere als lustvoll und spannend war. Erst als die Schnecke mit ins Spiel kam konnte der Dialog stattfinden sowie Freude und Kreativität erfahrbar werden.
Nach Milano Comparetti´s Tod (1986) stellt sein Konzept die Basis für weitere Entwicklungen dar. Diese sind in der Säuglingsforschung, der Neurobiologie, der Rehabilitation und weiteren Konzepten wie dem Chaos-Konzept oder dem systemischen Ansatz zu finden.
„Die Gemeinsamkeit liegt in der grundlegenden Vorstellung, daß Entwicklung, ob „normal“ oder „gestört“, ein soziales Problem ist; etwas, das nicht als Eigenschaft der einzelnen Person zuzuordnen ist, sondern zwischen Personen entsteht.“ (Walthes 1993 zit. nach von Lüpke 1996, S. 69f.)
Walthes Aussage stellt einerseits wieder Bezug zur UN-Konvention her und leitet gleichzeitig ins nächste Kapitel über.
Im Folgenden wird deshalb überblicksmäßig auf die Sichtweise des Entwicklungsbegriffs in der Systemtheorie eingegangen, da Milani Comparetti´s Konzept dieser Sichtweise zugeordnet werden und dessen Verständnis auch für die Ausführungen in Kapitel 6 aufschlussreich sein kann.
Die Systemtheorie geht von einer natürlichen Entfaltung der Entwicklung aus. Huschke-Rhein bezeichnet dies als „internen Entwicklungsbegriff“. Um diesen zu verbildlichen, vergleicht er ihn mit dem Entwicklungsbegriff der Pflanzenwelt. Genauso wie die Pflanze sich selbstständig, autonom, aus ihrer eigenen inneren Dynamik heraus, in ihrem eigenen Tempo und ohne Fremdeinwirkung, unter der Voraussetzung der nötigen Rahmenbedingungen wie Luft, Wasser und Licht, entwickelt, kann auch die menschliche Entwicklung verlaufen, sofern sie nicht durch Eingriffe von außen (und dazu zählt Huschke-Rhein auch das pädagogische Eingreifen in den Entwicklungsprozess) gehemmt wird. Als „externen Entwicklungsbegriff“ bezeichnet er deshalb die Vorstellung der Notwendigkeit von Fördermaßnahmen, um die Entwicklung voranzutreiben (vgl. Huschke-Rhein 1997, S. 22f.).
Die Selbststeuerung einer Person bzw. eines Systems ist in der Systemtheorie ein zentraler Begriff und gerade deshalb stellt Huschke- Rhrein auch die Frage:
„Kann eine Person eigentlich später die Fähigkeit zu angemessener Selbststeuerung erlangen, wenn sie in ihrer Entwicklung schon hat `lernen` müssen, daß ihre Selbststeuerung vorläufig nicht nur nicht möglich, sondern vielmehr gar nicht erwünscht ist, weil sie ihr von zahlreichen anderen Personen und Institutionen – natürlich in bester Absicht und nur zwischenzeitlich – geradezu abgenommen wird?“ (ebd., S. 23)
Aus systemtheoretischer Sicht beantwortet er seine Frage insofern, als dass die Systemtheorie nicht von einer Subjekt-Objekt-Vorstellung ausgeht, sondern beide - das Kind und die erwachsene Person (beispielsweise die Eltern, die Frühförderperson) - als eigenständige Systeme ansieht, die jedoch in Zusammenhang stehen und in ihrem Zusammenwirken wieder ein eigenes System bilden. Alle Systeme entwickeln und verändern sich laufend, deshalb findet der Begriff der Transformation im systemtheoretischen Kontext häufig Verwendung (vgl. ebd., S. 27).
Die Chaostheorie[34] setzt naturwissenschaftliche Grundannahmen, „die für konstante, stabile Systeme galten und in diesem Rahmen Berechenbarkeit und Prognosen ermöglichten, außer Kraft“ (ebd., S. 35) und stellt ein Konzept, mit einem von Diskontinuität geprägten Entwicklungsverständnis, dar. Entwicklung verläuft hier in einem dynamischen Prozess, im Wechsel von berechenbaren und chaotischen Phasen ab (vgl. ebd., S. 26ff.).
Auch Krisen und Widersprüche sowie starke Gleichgewichtsschwankungen sind wichtige Einflüsse in der chaotischen Systemtheorie, die für das Vorhandensein von Kreativität unbedingt notwendig sind. Huschke-Rhein weist deshalb darauf hin, dass jedes „psychisch lebendige“ (ebd., S. 35) Kind mit diesen Begrifflichkeiten beschrieben werden kann (vgl. ebd., S. 35).
Als wichtige Grundannahme der Systemtheorie wird der Begriff „Autopoiesis“, von Maturana und Varela (1987) angesehen.
„Er besagt für den Menschen, daß die Operationsweise unseres Gehirns – und das gilt gleichermaßen für kognitive wie für emotionale Prozesse - `selbstreferentiell` ist, da allein im Rahmen der internen Systembildungen des jeweiligen Gehirns entschieden wird, welche von außen kommenden Einwirkungen `angeschlossen` werden und welche nicht, daß also jedes Gehirn auf Grund seiner physiologischen Operationsweise vollkommen und im prinzipiellen Sinne autonom ist.“ (Maturana/Varela 1987 zit. nach Huschke-Rhein 1997, S. 35)
Folglich ist für die Frühförderperson der Fokus der Beobachtung auf die „internen Entwicklungen“ (Huschke-Rhein) des Kindes zu legen und sich in ihrer Rolle vor allem als BeobachterIn und nicht als fördernde/r MacherIn zu definieren. Somit kann diese Sichtweise den Weg in Richtung Entwicklungsbegleitung ebnen.
Auch die Annahme einer diskontinuierlichen Entwicklung des Kindes, wo Unerwartetes und Unvorhersehbares als „Norm“ angesehen wird, kann der Frühförderung insofern zu gute kommen, als dass einerseits das Denken in linearen Entwicklungsstufen und andererseits der Gedanke der Allmacht der Förderung bzw. „Fachpersonen“ abgelegt werden kann und die PädagogInnen bzw. die Frühförderpersonen in deren Rolle als BegleiterInnen in Systemprozessen angesehen werden können. „[…] ihre höchste Kunst [ist dabei, dass sie J. Ö.] nicht mehr im Durchsetzen von Normen (Sollwerten) besteht, sondern darin, Systeme mit sanften Impulsen unter maximaler Einbeziehung der Selbststeuerungsfähigkeit aller Systemelemente zu steuern.“ (Huschke-Rhein 1997, S. 37) Die Begleitung der Entwicklung kann dadurch wesentlich abwechslungsreicher stattfinden (vgl. ebd., S. 36f.).
In diesem Kapitel wird in äußerst komprimierter Form das dialogische Entwicklungsverständnis von exemplarisch ausgewählten Konzepten vorgestellt.
Im Konzept der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler steht die freie Bewegungsentwicklung des Kindes im Vordergrund. Pikler legt - wie Milani Comparetti - größten Wert auf die selbstständige, selbstbestimmte und eigenaktive Entwicklung des Kindes, worin auch der Aspekt des Dialogs eine zentrale Rolle spielt (vgl. Straßburg 1995, S. 78).
In ihrer Konzeption differenziert sie nicht zwischen Kindern, die sich schneller oder langsamer entwickeln, sondern stellt jedem Kind die entsprechende Zeit, sich zu entwickeln, zur Verfügung. Zu den wichtigsten Faktoren, welche die freie Bewegungsentwicklung positiv beeinflussen können, zählt Pikler:
-
„Ein guter emotionaler Zustand des Säuglings, in dem er Lust zur Eigenaktivität hat. Dies kann nur auf der Basis einer guten Beziehung zwischen Erwachsenen und Säugling erreicht werden;
-
Kleidung, die die Bewegungsfreiheit nicht behindert;
-
Genügend Raum, um sich frei bewegen zu können;
-
Spielzeug, mit dem der Säugling nach Belieben ohne Gefahr selbständig spielen kann.“ (Pikler 2001, S. 116)
Entwicklung wird hier nicht gemäß dem linearen Verständnis in ab folgenden Stufen, wo vor allem der Fokus auf dem Zeitpunkt, wann das Kind die formulierten Stufen erreicht, gerichtet ist, sondern entscheidender Punkt stellt das wie dar. Denn Pikler unterstreicht die Wichtigkeit der Übergangsbewegungen und -positionen[35] (diese werden in Abbildung 7 ersichtlich) sowie Bewegungen in denen Exploration (z. B. ein Spielen mit den Fingern) stattfinden und somit die Basis für die weiterführende Bewegungsentwicklung gelegt werden kann. Ein (oft gut gemeintes) Einschreiten in die Entwicklung durch die Erwachsenen (z. B. an der Hand führen, obwohl das Kind noch nicht selbstständig gehen kann, ein Aufsetzen des Kindes durch den Erwachsenen,…) führt nach Pikler zu fehlerhaften und verkrampften Bewegungen, welche die Lust auf das selbstständige Üben und Erkunden trüben. „Ungeschickt“ wirkende Bewegungen sind nach Pikler nicht Folge von Pathologien, sondern aufgrund nicht angemessener Unterstützung des Erwachsenen hervorgerufen (vgl. ebd. S. 116f.).
Die amerikanische Psychologin Jean Ayres entwickelt das Konzept der „Sensorischen Integrationstherapie“[36], das sich durch seinen ganzheitlichen Blick auf das Kind auszeichnet. „Das Ziel dieser Therapie ist eine Verbesserung des Ablaufs der Hirnverarbeitungsprozesse und der sinnvollen Ordnung von Empfindungen“ (Ayres 1984 zit. nach Aly 1997, S. 118). „Dies geschieht durch `Stimulation` des Gleichgewichtssinnes (vestibuläres System), der Eigenwahrnehmung (propriozeptives System) und des Tastsinnes (taktiles System)“ (Aly 1997, S. 118).
Grenzen dieses Konzepts erkennt Monika Aly im Fokus, der v. a. auf den sichtbaren „Störungen“ liegt. Auch Raum und Zeit zur Entwicklung sowie das Umfeld, werden nach Aly zu wenig beachtet (vgl. Aly 1997, S. 118).
Ulla Kiesling, die ihren Ansatz „Sensorische Integration im Dialog“ auf der wissenschaftlichen Basis von Ayres´ Konzept[37] aufbaut, erkennt darin den fehlenden Dialog (vgl. Kiesling 2003, S. 13).
Kiesling geht davon aus, dass Kinder, die in ihrer Entwicklung gehemmt sind, „nicht mit sich selbst im Dialog sind“. Der Dialog stellt in ihrem Ansatz eine Art „Angebot und Nachfrage für Sinnesnahrung“ (Kiesling 2003, S. 39) dar. Durch den Dialog sowie dem Schaffen von Raum, in dem Vertrauen aufgebaut und ein gemeinsames Handeln stattfinden kann und der Zeit, sich zu entwickeln, kann sich das Kind in selbstbestimmter Weise jene Sinneswahrnehmungen einholen, die momentan unterversorgt sind (vgl. ebd., S. 39).
Den Dialog sucht sie auch mit den Eltern, der aufgrund eines beidseitigen Erfahrungs- und Beobachtungsaustausches erfolgen kann. Aber auch der Dialog zwischen Kind und Eltern, unter den Eltern als auch zwischen den Kindern, stellt einen wichtigen Bestandteil ihres Konzepts dar (vgl. ebd, S. 42f.).
Eine kritische Anmerkung meinerseits zum Konzept von Kiesling stellt ihre Ausgangstheorie, die besagt, dass manche Kinder nicht „mit sich im Dialog seien“ dar. Diese Formulierung kann möglicherweise die Annahme erwecken, dass das Kind selbst die Ursache für diesen „Fehl-Dialog“ ist. Aufgrund der vorangegangenen Kapitel können wir jedoch entgegenhalten, dass auch hier von einer subjektiven Perspektive der Erwachsenen ausgegangen wird und zudem das Kind nicht isoliert von seiner Umwelt und seiner Geschichte betrachtet werden kann.
In diesem Kapitel möchte ich mich wiederum auf Beobachtungen und Erkenntnisse von Dietmut Niedecken stützen und mich an deren Ausführungen für die Beschreibung des Verständnisses der frühkindlichen Entwicklung in Kombination mit der Mutter-Kind-Interaktion halten.
Im Mutterleib erfährt das Kind neben dem Gehalten- und Getragensein, der natürlichen Versorgung mit Nahrung, der entsprechenden Temperatur, den schaukelnden Bewegungen und der Begrenztheit auch Schwingungen und Schwankungen von Harmonie, woraus sich erste Strukturen des Erlebens bilden (vgl. Niedecken 2003, S. 52f.).
Die Wahrnehmung des Neugeborenen ist anfangs an eine Einheit von Körper und Psyche gebunden. Noch ganz zu Beginn ist das Kind auf die inneren Sinnesreize (Hunger, Wärme, Gleichgewicht) ausgerichtet, während die äußeren (sehen, hören, tasten) erst allmählich (ca. ab der dritten bis vierten Lebenswoche) bedeutend werden. Dabei ist der Säugling darauf ausgerichtet, dass seine Wahrnehmung im Einklang und Gleichgewicht ist und verfügt dazu über besondere Fähigkeiten. Der Säugling kann Stimmungslagen und Stimmungsschwankungen seiner umgebenden Umwelt, sprich seiner Eltern - im Besonderen seiner Mutter - wahrnehmen und bei Unbehagen entsprechend darauf reagieren, z. B. mit Schreien, Koliken usw. (vgl. ebd. S. 54).
Noch von der Umwelt abhängig, ist der Säugling in besonderer Weise auf das Einfühlungsvermögen, die Reaktionen und das Handeln seiner Mutter angewiesen. Um die Bedürfnisse des Kindes zu erschließen, muss sich die Mutter selbst auf die Ebene der nach innen gerichteten Wahrnehmung einlassen können, sich mit dem Kind identifizieren und in seine Bedürfnisse einfühlen können. Diese Fähigkeit nennt Niedecken „mimetische Kompetenz“ (ebd., S. 56). Das mimetische Verhalten verbildlicht sie mit einem Vergleich aus der Tierwelt, wenn sich z. B. das Chamäleon farblich an seine Umgebung anpasst (vgl. ebd., S. 55f.).
So stimmt auch die Mutter ihr Verhalten und Handeln auf das Kind und seine Äußerungen ab und stellt sozusagen einen Spiegel dar, mit welchem sie den kindlichen Äußerungen Bedeutung verleiht, was ein wichtiger Erfahrungsschritt in der Entwicklung des Kindes bedeutet (vgl. ebd., S. 55ff.).
„Spiegel ist die Mutter dem Kind von Geburt an immer da, wo sie seine Äußerungen aufgreift mit ihrer Antwort – mit der Stimme, dem Gesicht, ihren Bewegungen und Handlungen – dem Erleben des Kindes begegnet und es benennt; so zuverlässig, dass das Kind sich darin als Subjekt mit Wünschen, mit Vorlieben und Abneigungen, langsam selbst erkennen beginnt.“ (ebd., S. 57)
Dieses Spiegeln ist allerdings davon abhängig, wie die Mutter die Äußerungen des Kindes interpretiert. Wenn sie beispielsweise das Schreien des Kindes als Hunger deutet, benennt sie dieses und gibt ihm die Brust. Interpretiert sie das Schreien als Ärger, dann redet sie dem Kind zu und tröstet es. Für Niedecken stellt das Benennen ein „Eingriff in die Entwicklung“ dar, denn die Mutter lenkt dadurch in eine bestimmte Richtung. Werden Benennungen von der Mutter nun nicht nach den entsprechenden Bedürfnissen des Kindes interpretiert und benannt, kann das frustrierend für das Kind sein. Gleichzeitig erfährt das Kind aber auch die eignen und die Grenzen der Mutter, sofern die Frustrationen im Rahmen bleiben und nicht überwiegend vorhanden sind. Das Kind erkennt auf diese Weise, dass sein Schreien Wirkung hat, dass es manchmal warten muss bis es zur Bedürfnisbefriedigung kommt und dass es eine Umwelt gibt, mit der es in Kommunikation treten kann (vgl. ebd. S. 58).
Diese Erfahrungen prägen sich in die Erinnerungen des Kindes ein und es kann allmählich vertrauensvoll das Außen im Spiel entdecken. Die Entdeckung des Äußeren bzw. die allmähliche Öffnung der Zweierbeziehung zwischen Mutter und Kind und dadurch die Entdeckung von dritten Personen (z. B. des Vaters) sowie auch Gegenständen ist für die weitere Entwicklung des Kindes wichtig. Das Kind erfährt nun Interaktion auch außerhalb der lebensnotwendigen Äußerungen (Hunger, Kälte, Nässe…) wie beispielsweise bei seinen Entdeckungen im Spiel. Dabei sammelt es Erfahrungen der Allmacht und Ohnmacht, wodurch es „Handlungsspielraum“ (Niedecken 2003, S. 59) erfährt (vgl. S. 58f.).
„Diese Entwicklung, Öffnung der Zweier- zur Dreierbeziehung, geschieht nicht konfliktfrei-selbstverständlich: viel Enttäuschung muss das Kind aushalten über das eigene Nichtvollkommensein, viel Enttäuschung und Wut über die Mutter, die nicht grenzenlos verfügbar und auch nicht allmächtig ist.“ (ebd. S. 59)
Die Mutter muss diese Aggressionen (z. B. Beißen in die Brust, Hauen auf die Mutter) des Kindes aushalten und angemessen darauf reagieren können, d. h. keine Schuldzuweisungen aber auch keine Sanktionen erteilen. Zudem ist für Niedecken dabei entscheidend, dass die Mutter ihre eigenen Aggressionen nicht versteckt, sondern diese auch Berechtigung haben dürfen, dass sie diese verbalisiert und dadurch Vorbildfunktion für das Kind darstellt (vgl. ebd., S. 59f.).
Auch durch die dritte Person - meist ist dies der Vater - und dessen Umgang mit der Mutter erkennt das Kind die Eigenständigkeit der Personen, wodurch die Loslösung von der Mutter mehr und mehr erfahrbar werden kann. Diese Ablösung und Individuationsentwicklung ist bei Kindern mit einer „geistigen Behinderung“ oft nicht ausreichend möglich, was für die kindliche Entwicklung Folgen haben kann (vgl. ebd., S. 60). „Denn in dieser Entwicklung zum Dritten hin wird der Grundstein gelegt für lebendiges, eigenständiges Lernen. `Dritte` sind auch Symbole, Worte, Lieder, sogar Gedanken und Fantasien“ (Niedecken 2003, S. 60). Auch die Frühförderperson kann diese dritte Person darstellen, wie es im weiter unten angeführten Protokoll zum Ausdruck kommt.
„Sie [die dritten Personen, J. Ö.] machen es dem Kind möglich, sich eine Person oder ein Gefühl vorzustellen, unabhängig von ihrer Präsenz. Daraus kann sich dann selbstständiges Denken und eine realistische, auch kritische Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt entwickeln.“ (ebd. S. 60)
Protokoll: Zu Beginn der Frühförderung mit Elisabeth spielte ich vorwiegend mit ihrer Mutter, während sie auf Mutters Schoß oder neben der Mutter sitzend in der Beobachterrolle war. Allmählich begann sie, ihrer Mutter zu assistieren, indem sie für sie erst noch zögerlich aber immer häufiger und sicherer Handlungen im gemeinsamen Spiel tätigte. Im weiteren Verlauf konnten wir über längeren Zeitraum aktiv zu dritt die gemeinsame Zeit gestalten. Schließlich begann sich die Mutter mehr und mehr zurück zu nehmen, während es für Elisabeth immer selbstverständlicher wurde, dass sie mit mir in Interaktion ging. Die Mutter nahm immer mehr die beobachtende Rolle, bei uns am Boden sitzend, ein. Bis sie sich schließlich in einer Frühfördereinheit auf den Stuhl in der Nähe setzte und von dort aus, erst wieder mehr in einer aktiven und später mehr in der passiven Rolle, teilnahm. In den folgenden Frühförderstunden begann sie sich etwas im Abseits (es war ein offener Wohnraum) aufzuhalten, wo sie Elisabeth zwar sehen konnte, aber nicht mehr unmittelbar beteiligt war. Dies erweiterte die Mutter in weiteren Frühfördereinheiten, indem sie sich erst für kurze Zeit und später immer länger im Nebenraum aufhielt. Sie teilte ihr Weggehen Elisabeth immer mit, welche dies bestätigend (mit Kopf nicken, verbal oder Blickkontakt) zur Kenntnis nahm. Wenn Elisabeth ihre Mutter brauchte, konnte sie diese entweder aus dem Nebenzimmer holen oder nach ihr rufen. Nach weiteren Monaten wurden die Phasen, in denen die Mutter nicht im selben Zimmer war, immer länger. Für Elisabeth schien das kein Problem zu sein, sie konnte sich auf unser gemeinsames Tun intensiv einlassen und im Anschluss daran versuchten wir beide gemeinsam, der Mutter (die im oberen Stock unsere Stimmen und verbalen Dialoge mit anhören konnte) zu erzählen, was wir gemacht hatten. Eines Tages trat die Situation ein, dass die Mutter kurzzeitig das Haus verlassen musste. Für Elisabeth schien das kein Problem zu sein. Sie wusste, wo die Mutter hingeht, dass sie bald wieder kommen würde und dass wir sie anrufen könnten. In der darauffolgenden Stunde eröffnete mir die Mutter bei meinem Eintreffen, dass sie heute die Zeit nutzen möchte, um eine besonders wichtige Erledigung zu tätigen. Auch diese Idee war für Elisabeth ganz offensichtlich akzeptabel.
Die allmähliche Loslösung der ursprünglich sehr engen Mutter-Kind-Beziehung bzw. Symbiose konnten in den Elterngesprächen immer wieder gemeinsam thematisiert werden. Das Tempo und die Gestaltung überlies ich jedoch allein der Mutter, die ein äußerst sensibles Gespür für ihr Kind und seine Bedürfnisse zu haben schien.
In diesem, über Jahre ausgedehnten Prozess, könnte ich als Frühförderin die von Niedecken bezeichnete dritten Person dargestellt haben, die eine Öffnung der Zweierbeziehung unterstützend begleiten konnte.
Niedecken bringt die besondere Wichtigkeit des Spielraums für die kindliche Entwicklung in den ersten beiden Lebensjahren besonders deutlich zum Ausdruck. Die Mutter bzw. die erste Bezugsperson ermöglicht diesen „im Sinne von genügend sozialer Freiheit, Zeit und äußerer Unterstützung.“ (ebd., S. 61)
Jedoch kann „Spielraum […] fehlen, er kann zerstört, besetzt, unterminiert sein“ (ebd.). Die daraus ergebenden Folgen können eine Be-Hinderung der Entwicklung des Kindes bedeuten. Dies kann beispielsweise bei einem Mangel an Anregungen, Vertrauensbeziehung und Unterstützung des Kindes sowie bei nicht ausreichenden Erfahrungen in Bezug auf selbstständig etwas bewirken und entscheiden zu können, der Fall sein. „Es fehlen Interaktionsformen als Strukturbildung aus guten Erinnerungen“ (ebd. S. 62) und Gefühle der Entbehrung sowie „Interaktionsstörungen“ (ebd., S. 64) können sich einprägen. Dadurch kann ein Verweilen und Ausharren oder eine Retardierung der Entwicklung folgen und ein Weiterentwickeln erschwert oder nicht möglich sein (vgl. S. 60ff.).
Überall dort, wo Kinder keine oder nicht ausreichende Möglichkeiten für die Erkundung der „dreidimensionalen Welt“ haben, erlangen auch Personen, Symbole oder Worte keine Bedeutung[38], sondern sind konditioniert im Sinne des Behaviorismus (vgl. ebd. S. 64ff.).
Als Ausdruck des Mangels an Spielraum und Zuwendung suchen Kinder dann Bewältigungsversuche wie z. B. klammern, Kopf schlagen, kratzen, schaukeln oder nachplappern. Niedecken versucht, diese Handlungen zu verstehen und bezeichnet sie als „Symptomhandlungen“ (ebd. S. 64), mit denen das Kind versucht, sein inneres erschüttertes Gleichgewicht wiederzufinden (vgl. ebd., S. 64f.).
„So sind also Symptomhandlungen keineswegs sinnlose `Stereotypien`, als welche sie in der Geistigbehindertenpädagogik gerne bezeichnet werden. Sie sind Überlebenstechniken, in die ein großer Teil der Lebenskraft des geistig behinderten Menschen eingeht.“ (ebd., S. 67)
Niedecken erkennt weiters, dass Symptomhandlungen nicht nur Schuldgefühle der Mutter auslösen können, sondern in ihrer eigenen Erfahrungs-Analyse bringt sie zum Ausdruck, dass diese später auch bei BetreuerInnen und TheapeutInnen, wohl eben auch bei Frühförderpersonen, Gegenübertragungen auslösen und als Provokation erlebt werden können (vgl. ebd. S. 71). Aus diesem Grunde kommt auch der eigenen Reflexion wieder immense Bedeutung zu.
Niedecken beobachtet, dass Mütter aus „sozial benachteiligter Lage“ auf die Symptomhandlungen ihrer Kinder häufig mit Gleichgültigkeit reagieren. Hingegen „Mütter in sozial besserer Lage“ zeigen häufiger Schuld- und Angstgefühle (siehe Kapitel 6.1.2 und 6.1.3). Jedoch verweist die Autorin darauf, dass die zerstörten oder von Angst untergrabenen Spielräume häufiger vorkommen als vorenthaltene Spielräume (siehe Kapitel 5.2.5.1) (vgl. ebd., S. 71). Hier kann wiederum Bezug zu den „mütterlichen Fantasmen“ (Mannoni) hergestellt werden (siehe Kapitel 4.2).
Eingriffe von außen, z. B. durch Diagnosemitteilungen oder allein der Verdacht einer möglichen Diagnose können als Krisenauslöser mit angesehen werden und dazu führen, dass der „Defekt“ oder „drohende Defekt“ im Vordergrund steht. An dieser Stelle setzen oft Förderung und/oder Therapie ein, die das Kind unter Druck setzen können (siehe Kapitel 6.1). Nicht nur das Kind spürt diesen Druck, sondern auch die Eltern, deren Handlungen, Verhalten und Haltungen von diesem geprägt sind. Allein das Bewusstsein dieses Drucks und der Druckausübung hilft Eltern oft schon, eine zunehmend entspannte Haltung einzunehmen (vgl. Niedecken 2003, S. 71ff.).
„Angst und Schuldfantasien seiner [des Kindes, J. Ö.] Mutter nehmen ihm den Raum zum Spielen und Sich-Entfalten. Es entwickelt sich retardiert. Überwinden können Mutter und Kind die Krise erst, als es der Mutter gelingt, sich von ihren Angstfantasien frei zu machen und die Retardierung ihres Kindes nicht mehr als bedrohliche Behinderung, sondern als einen hilflosen Protest zu verstehen.“ (ebd., S. 73)
An dieser Stelle kommt der Frühförderperson insofern Bedeutung zu, als dass diese Eltern in dieser Erkenntnis unterstützend begleiten kann, sofern sie selbst nicht im Sog des Förderdrucks gefangen ist.
Es liegt in der Verantwortung all jener pädagogisch, therapeutisch, medizinisch Tätigen das Kind nicht auf die Diagnose und den damit einhergehenden Behinderungen zu reduzieren, sondern, dass Beobachtungen des ganzen Kindes angestellt werden. Demgemäß sollen Kinder in ihrer Vielfalt gesehen und nicht auf ihre Fähigkeiten hin verglichen werden (vgl. Roser 1998b, S. 177f.).
Milani Coparetti versucht nicht Pathologien zu bagatellisieren oder zu ignorieren, sondern verweist auf eine andere Sichtweise der Diagnostiker der „Medizin der Krankheit“ die es bei einer „beeinträchtigten Entwicklung“ braucht. Er sucht in seiner „Medizin der Gesundheit“ die „Normalität“ des Kindes. Damit ist nicht eine Normangleichung im Sinne des medizinisch- therapeutischen Paradigmas gemeint, sondern „daß im Gegenteil die bestehenden Normen revidiert werden, um dem behinderten Kind ein Leben mit seinem Defekt in der Gesellschaft zu ermöglichen.“ (Jäger 1986, S. 46f.)
Um die Gesundheit der „Normalität“ festzustellen braucht es nach Milani Comparetti keine komplizierten Testungen, sondern Beobachtungen und einfache Gespräche mit den Eltern um Ressourcen zu erfahren. Dabei stellen seine formulierten „Indices der Verhaltens- und Beziehungsweisen“ [39] (1982) bzw. die inhaltlich identen „Kriterien der Normalität“ [40] nach Noferi (1977) einen Anhaltspunkt dar. Denn diese einfachen Items bilden ein diagnostisches und prognostisches Instrument zugleich. Nur wenn Kriterien nicht zu erkennen sind, kann die Möglichkeit einer Pathologie bestehen, deren weitere Diagnose jedoch erst von den betreffenden Fachpersonen zu stellen ist (vgl. ebd., S. 46ff.).
„Die Pathologie erscheint somit als Ausnahme der Normalität.“ (ebd., S. 47)
Jedoch merkt Milani Comparetti an, dass Diagnosen in der „Gesundheitsmedizin“ eher im Hintergrund stehen und mehr die Prognosen von Bedeutung sind. Die Prognose im Sinne Milani Comparetti´s ist jene des Kindes und seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten (und nicht der Krankheit). Dabei betont er die Wichtigkeit, dass das Lebensumfeld des Kindes mit berücksichtigt wird um die Entwicklungsmöglichkeiten, zu denen er besonders die Beziehungsebene zählt, möglichst gut zu gestalten. An dieser Stelle räumt Milani Comparetti der Frühförderung besondere Bedeutung ein. Denn diese kann die Begleitung einer möglichst günstigen Entwicklungsumgebung fokussieren, anstelle des Durchführens von gezielten Übungsmaßnahmen (vgl. ebd., S. 49f.).
Schlussfolgernd lässt sich anmerken, dass Milani Comparetti medizinisch-technische Diagnoseinstrumente nicht für unangemessen hält, sondern im Gegenteil auch für nützlich ansieht, sofern die Diagnostik nicht allein auf diese reduziert wird. So folgern Aly und von Lüpke, dass Milano Comparetti auch Förder- und Therapiemaßnahmen nicht von Grund aus ablehnt. Auch hier trifft es zu, dass er diese befürwortet und als sinnvoll betrachtet, wenn diese nicht zum Üben um bestimmten Normen zu entsprechen oder Pathologien zu beseitigen, durchgeführt werden. Förder- und Therapiemöglichkeiten sollten nach ihm in den Alltag und normale Tätigkeiten einfließen, das Kind begleiten und somit seine Fähigkeiten und seine Selbstständigkeit erweitern, sowie beim Entdecken möglicher alternativer Fähigkeiten unterstützen, wie im Kapitel 6.2 u. a. gezeigt wird (vgl. Aly/von Lüpke 1986, S. 546 zit. nach Jäger 1986, S. 51f.).
[20] Zum Beispiel das Programm zur Entwicklungseinschätzung und Entwicklungsförderung „Frühförderung konkret“ (1981) von Walter Straßmeier. Er unterteilt die kindliche Entwicklung in fünf Bereiche: Selbstversorgung/Sozialentwicklung, Feinmotorik, Grobmotorik, Sprache und Denken/Wahrnehmung. Vom Säugling bis zum 5. Lebensjahr wird in Tabellen zum jeweiligen Bereich aufgelistet, was in den einzelnen Monaten zu beobachten ist und nennt dann entsprechende Fördervorschläge (mit Angaben zum Material, Vorgehen, Endziel) (vgl. Straßmeier 1981). Als Beispiel wird der Bereich „Selbstversorgung/Sozialentwicklung“ aufgezeigt: Bis zum 3. Lebensmonat sind die Kategorien „Kann Saugen und Schlucken“, „Greift nach Füßen oder bringt die Hand zum Mund“, „Macht Anstalten hochgenommen zu werden“ aufgelistet (vgl. ebd. S. 20).
Als weiteres Beispiel kann das „Sensomotorische Entwicklungsgitter“ vom Diplom-Sportlehrer Ernst Kiphard angeführt werden. In diesem Gitter werden Entwicklungsschritte bis zum 4. bzw. 7½. Lebensjahr des Kindes in folgende Entwicklungsbereiche unterteilt: Optische Wahrnehmung, Handgeschick, Körperkontrolle, Sprache, akustische Wahrnehmung und Sozialkontakt (vgl. Kiphard 1975, zit. nach Ohlmeier 1997, S. 161ff.).
Die Kinderärztin Gertrud Ohlmeier entwickelt auf Basis dieses Gitters ein eigenes Früherziehungsprogramm für Kinder mit Behinderung (erschienen im Jahr 1978) (vgl. Ohlmeier 1997, S. 75ff.). Auch in dieser Methode dominiert die Vorstellung einer linearen Entwicklung basierend auf einem medizinischen Modell von Behinderung.
[21] „Die deutschsprachige Sonderpädagogik unterscheidet seit den 1960er Jahren 9 verschiedene Kategorien oder Behinderungsformen: Blindheit, Sehbehinderung, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Lernbehinderung, geistige Behinderung, Verhaltensbehinderung oder Verhaltensstörung, Körperbehinderung und Sprachbehinderung.“ (Biewer 2009, S. 42)
[22] Mit ICD-10 wird „Die internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ („Internationale Classification of Deseases and Related Health Problems“) (ebd., S. 35) in der 10. Version abgekürzt. Einige Kapitel daraus sind besonders für den Bereich der Heilpädagogik relevant (Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen; Kapitel XVII: angeborene Fehlbildungen, Deformitäten, Chromosomenanomalien) (vgl. ebd., S. 35).
[23] „DSM [-IV (4. Version), J. Ö.] ist die Abkürzung für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“. Auf Deutsch bedeutet dies so viel wie „Diagnostisches und Statistisches Handbuch psychischer Störungen.“ (Biewer 2009, S. 37) „Klassifizierungen nach dem DSM-IV erfolgen primär nach Defizit-, Störungs- und Krankheits-Merkmalsgruppen. Es finden sich Begriffe wie geistige Behinderung, die sich auch in der ICD befinden. Darüber hinaus werden aber auch weitere klinisch-psychiatrische Zuschreibungen wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung sehr detailliert beschreiben (…).“ (ebd., S. 38)
[24] Zusätzlich zu den neun sonderpädagogischen Kategorien (siehe oben) werden in diesem Werk auch die Kategorien „Hochbegabung“ und „Schwerstbehindert“ hinzugenommen. Jeder Kategorie wird ein eigenes Kapitel gewidmet, außer der „Verhaltensauffälligkeit“, diese werden aber in der Unterteilung erwähnt (vgl. Klauer 1992, S. 13ff.).
[25] Diese werden unterschieden in „leicht“, „mittel“, „schwer“ und „extrem“ (vgl. ebd., S. 14f.).
[26] Michael Foucault schreibt dazu in seinem Buch „Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks“ aus dem Jahr 1988, erschienen in Fischer Wissenschaft.
[27] „Der Begriff vom „behinderten Selbst“ ist in Anlehnung an psychoanalytische Identitätskonzepte formuliert. WINNICOTT (1984, S. 182-199) zeigt in seinem Beitrag „Ich Verzerrung in Form des wahren und falschen Selbst“ wie durch Einschränkungen des Dialog-Aufbaues im Rahmen der frühkindlichen Entwicklung ein „falsches Selbst“ entstehen kann. Eine Verwendung dieses Konzepts zum Verständnis von Behinderung schaffenden Entwicklungsbedingungen für Kinder ist bei NIEDECKEN (1989) zu finden.“ (Schönwiese 2011/12, S. 20)
[28] Elbert beschreibt, dass durch das „geistigbehinderte Selbst“, welches durch sonderpädagogische Fördermaßnahmen erzeugt wurde, der Aufbau des „bürgerlichen Selbst“ (Goffmann 1972) verhindert werden kann (vgl. Elbert 1982, S. 21).
[29] Im 19. Jahrhundert, siehe Kapitel 3.2.
[30] In Kapitel 5.2.4, sowie 6.2.3 wird auf ausgewählte Konzepte, die ein nicht-lineares Entwicklungsverständnis vertreten sowie die Rolle der Entwicklungs-BegleiterIn dargestellt.
[31] Die Verschriftlichung erfolgte im Jahr 1986, deshalb wird im Text diese Jahreszahl zitiert.
[32] Aus diesem Grunde wurden die Beiträge der Fachtagung 1985 übersetzt und verschriftlicht und in einer 2. Auflage 1986 erweitert, um zu weiteren Fachdiskussionen anzuregen. Im Jahr 1995 folgte eine weitere Fachtagung mit dem Titel „Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani`.“ Beide Fachtagungen wurden von Hans von Lüpke und Edda Janssen im Jahr 1996 zusammengetragen und herausgegeben (vgl. Janssen 1996, S. 5).
[33] Die Bedeutung des Adjektivs „erratisch“ wird im Duden mit „im Schlingerkurs befindlich, abirrend, nicht stringent“ (Bibliographisches Institut GmbH 2013) beschrieben, was mit „abweichen“ übersetzt werden kann (vgl. ebd.).
[34] „`Chaos` ist dabei ein theoretischer Terminus, der nicht im ursprünglichen Sinne dieses Wortes verstanden werden darf, wenngleich er in eine entsprechende Richtung weist. `Chaos` ist wissenschaftstheoretisch ein Gegenbegriff zur tradierten Systemtheorie der klassischen Physik, womit bestimmte Systemzustände bezeichnet werden, denen die typischen Eigenschaften klassischer deterministischer Systeme fehlen, vor allem die Berechenbarkeit, die Vorhersehbarkeit und die vollständige mathematische Bestimmtheit – ohne daß nun deshalb schon das ´totale Chaos´ herrschen müßte, das wir mit diesem Begriff assoziieren.“ (Leinfellner 1989, Briggs/Peat 1990, Eilenberger 19990, Gerok 1990 zit. nach Huschke-Rhein 1997, S. 33)
[35] „Solche Bewegungen sind notwendig, um zum Beispiel aus der Rückenlage über die Seitenlage in die Bauchlage zu gelangen, oder um aus der Bauchlage über den seitlichen Ellenbogenstütz zum Seitsitz und damit zum Sitzen zu kommen. Übergangspositionen sind auch erforderlich, um sich vom Sitzen in den Bärenstand zum freien Stehen aufzurichten. Diesen wenig sichtbaren Bewegungsübergängen und Übergangspositionen wird meist keine besondere Bedeutung zugemessen: Je mehr der Säugling seine sichere Auflagefläche verläßt, um sich aufzurichten, vergrößert er seine Basis mittels eines Fußes, einer Hand oder des Unterarms, um sein Gleichgewicht zu sichern. Anfangs sind diese Abstützpunkte breiter, später werden sie enger, je nach Sicherheit des Kindes und auch durch die Verlagerung des Schwerpunktes – des Kopfs – nach oben. Es fühlt selbst, was es an Unterstützungsfläche braucht, vorausgesetzt, es hat den Zeitpunkt seiner Positionswechsel selbst gewählt. Übergangspositionen und Übergangsbewegungen sind für die Beweglichkeit des Kindes eine Voraussetzung, um sich sicher und geschmeidig bewegen zu können.“ (Pikler 1988, zit. nach Aly 1997, S. 110)
[36] Ursprünglich ist das Konzept als Therapie-Konzept, namens „Sensorische Integrationstherapie“ von Jean Ayres konzipiert worden (vgl. Aly 1997, S. 117). Ulla Kiesling entwickelt darauf basierend das Konzept „Sensorische Integration im Dialog“. In ihrem gleichnamigen Buch „Sensorische Integration im Dialog. Verstehen lernen und helfen, ins Gleichgewicht zu kommen“ spricht Ulla Kiesling jedoch TherapeutInnen, als auch PädagogInnen an (vgl. Kiesling 2003, S. 11).
[37] Ulla Kiesling bezieht sich in ihren theoretischen Aussagen auf das Buch „Bausteine der kindlichen Entwicklung“ von Jean Ayres (erschienen 1992 in Berlin: Springer-Verlag) und füllt diese mit vielfältigen Überlegungen, die sie aus mehr als 10 Jahren Praxiserfahrung anstellt (vgl. Kiesling 2003, S. 12).
[38] „Bei manchen – meist autistischen oder frühkindlich psychotischen – Menschen hat dieses Nachplappern durchaus auch Bedeutung. Es ist dann ein Kompromiss zwischen dem Versuch, die Realität einer bedrohlich strukturierten Welt im Kontinuum untergehen zu lassen, und dem Wunsch, trotzdem Einfluss auf sie zu nehmen.“ (Niedecken 2003, S. 68)
[39] Milani Comparetti´s „Indices der Verhaltens- und Beziehungsweisen“ wurden von Eckhard Jäger übersetzt und sind im (bereits vergriffenen) Buch „Italienische Verhältnisse“ insbesondere in den Schulen von Florenz von Jutta Schöler aus dem Jahr 1987 (siehe Literaturverzeichnis) aufgelistet und im Internet unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-italienische1.html#idp11156304 zu finden.
[40] Die „Kriterien der Normalität“ von Noferi, die inhaltlich mit den „Indices der Verhaltens- und Bewegungsweisen Milani Comparetti übereinstimmen, werden im Anhang angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 6.1 Entwicklungs-Förderung
-
6.2 Entwicklungs-Begleitung
- 6.2.1 Zum Begriff „Begleitung“
- 6.2.2 Begleitung im Rahmen der Frühförderung und Familienbegleitung
- 6.2.3 Die Rolle der Begleitperson aufgezeigt anhand weiterer exemplarisch ausgewählter Konzepte, die für eine dialogische Entwicklungsbegleitung im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ bedeutend sein können
Unter einem Perspektivenwechsel ist im bildungssprachlichen Gebrauch die „Betrachtungsweise oder -möglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus“ bzw. die „Sicht“ oder der „Blickwinkel“ (Bibliographisches Institut GmbH 2013), welche/n wir einnehmen, zu verstehen (vgl. ebd.).
Dieser Perspektivenwechsel drückt sich nicht nur in unseren Handlungen, in unserer Begegnung, Kommunikation und Interaktion mit dem Kind und seiner Familie, sondern auch in unserer Sprache, in der Wahl der Worte für Benennungen und Erklärungen aus (vgl. Straßburg 1996, S. 84).
„Denn, wie man spricht, so denkt man und wie man denkt, so handelt man.“ (Straßburg 1996, S. 84).
In Bezug auf den Perspektivenwechsel vom Förder- zum Begleitgedanken der kindlichen Entwicklung möchte ich an dieser Stelle Christoph Leyendecker zitieren, der Wesentliches auf den Punkt bringt:
„Außerdem kommt es in der Frühförderung weniger auf das an was vermittelt wird, sondern wie [Herv., J. Ö.] es vermittelt wird.“ (Leyendecker 2008, S. 31)
Die folgenden Unterkapitel wird über die Aussage dieses Zitates Aufschluss geben.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem traditionellen Begriff der Förderung, wie er vor allem in den 70er Jahren und in den Anfängen der Frühförderung verstanden wurde. Auch dieser Begriff hat sich in seinem Verständnis gewandelt, was v. a. am Ende des Kapitels zum Ausdruck gebracht wird.
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „fördern“ wird im Herkunftswörterbuch Duden mit „weiter nach vorn bringen“ (Drovsdowski 1989, S. 199) beschrieben. Der Begriff wird vom heute nicht mehr verwendeten „fürder“ abgeleitet (vgl. ebd.).
Im Zuge dieser Definition ist der Blick nach vorne gerichtet. Ob der Blick eine Möglichkeit der Abweichung, des Zurückgehens oder Anhaltens mit einschließt bleibt an dieser Stelle offen. Ebenso tut sich die Frage auf, ob die Notwendigkeit des „weiter nach vorn Bringens“ bereits ein Nicht- Ausreichen des momentanen Zustands impliziert?
Niedecken spricht in Anlehnung an Holthaus[41] im Zusammenhang mit Förderung von etwas „Fehlendem“ (vgl. Holthaus 1983, S. 21 zit. nach Niedecken 2003, S. 145), welches „durch unermüdliches und fantasievolles Fördern ausgeglichen werden [soll, J. Ö.]“ (ebd.).
Auch der verwandte Begriff des „forderns“, der von „verlangen, daß jemand oder etwas hervorkommt“ (Drovsdowski, 1989, S. 199) herrührt und in entsprechendem Sinn, soviel wie „von jmdm. eine Leistung verlangen, die alle Kräfte beansprucht“ (Müller 1985, S. 263) bedeutet, lässt die Frage offen, ob das bereits Vorhandene nicht ausreichend ist? In Bezug dazu stellt Niedecken folgenden Gedankengang an: „Niemand macht sich Gedanken darüber, ob wir das Kind nicht verunsichern, wenn wir ihm das Gefühl geben, man wolle es eigentlich anders als es ist.“ (Niedecken 2003, S. 19)
Zudem schwingt bei der Definition von „fordern“ ein Beeinflussen von außen - das Verlangen von jemand anderem - mit, was wiederum als eine Fremdbestimmung verstanden werden kann. Außerdem bleibt an dieser Stelle offen, wie dieses „von jemandem etwas Verlangen“ erfolgt? Ereignet es sich im Sinne einer nachdrücklichen Forderung, einer Aufforderung, einem Bestehen und Pochen auf etwas oder als ein Bitten oder Wünschen? (vgl. Müller 1985, S. 708).
Die zusammengesetzten Verben „heraus-fordern“ und „über-fordern“ (vgl. Müller 1985, S. 263) bringen Aspekte hervor, die in der Arbeit der Frühförderung enthalten sind. Die Frühförderperson muss sensible Beobachtungen anstellen, um die Gefahr des Ineinanderfließens und Vermischens der beiden Begrifflichkeiten rechtzeitig zu erkennen und dementsprechend agieren, sodass die Überforderung auf der Seite des Kindes, der Eltern aber auch der Frühförderperson selbst, sowie ein über das Kind und die Familie hinweg fördern verhindert werden kann.
Beide erläuterten Begrifflichkeiten lassen sich nach den bisherigen Ausführungen dem medizinisch-therapeutischen und heilpädagogischen Denken zuordnen.
So wird der Begriff „Förderung“ im Gesundheitswesen in Abgrenzung zu Rehabilitation[42] und Therapie[43] v. a. seit den 1970er-Jahren in der Heil- und Sonderpädagogik zentraler Bestandteil. Dies rührt v. a. durch das Normdenken und der Formulierung von Zielgruppen dieser Bereiche. So liegt es nahe, dass der Begriff „Förderung“ sich gerade in diesen Bereichen etabliert hat und im Sinne von „entwicklungsorientierte[m, J. Ö.] pädagogische[n, J. Ö.] Handeln“ (Biewer 2009, S. 86) im Kontext von Behinderung und „Entwicklungsbeeinträchtigung“ (Fornefeld, 1995) verwendet und als unerlässliche Aufgabe angesehen wird (vgl. Biewer 2009, S. 85ff.). Barbara Fornefeld schlägt deshalb den Begriff „Entwicklungsförderung“ vor. Sie verweist aber in kritischer Anmerkung darauf, dass das „Auf-den-Weg-bringen“ Passivität beim Kind und Aktivität bei PädagogInnen als Konsequenz hat (vgl. Fornefeld 1995, S. 90 zit. nach Biewer 2009, S. 87).
Daraus folgere ich, dass sich Förderung bzw. Entwicklungsförderung, im Sinne der Heil- und Sonderpädagogik verwendet, dem Postulat der UN-Konventionen nach Selbstbestimmung nicht gerecht werden kann, da diese nicht von der selbst bestimmten, sondern von einer förderbedürftigen Entwicklung ausgehen.
Nachdem sich auch „FrühFÖRDERUNG“ seit den 1970er-Jahren entwickelte, ist auch hier der so verstandene Fördergedanke im anfänglichen Denken und deren ursprünglichen Zielen, wie bereits in Kapitel 3.2 erwähnt wurde, zentral und wird auf das im vorigen Kapitel kennengelernte lineare Entwicklungsverständnis bezogen. Gemäß der Grundannahme, dass basale Funktionen die Voraussetzung für die Erreichung der nächsten Entwicklungsstufen seien, herrschte die Ansicht, dass durch eine möglichst frühzeitige Förderung die Entwicklung dementsprechend gelenkt und aufgeholt werden könnte, um möglichst bald die entsprechende Norm zu erreichen. Damit spielte auch die Vorstellung der Verhinderung oder gar Heilung von Behinderung mit eine Rolle (vgl. Leyendecker 2000, S. 14 zit. nach Leyendecker 2008, S. 23).
Die negative Sicht auf Behinderung und einer nicht „entsprechenden“ Entwicklung des Kindes und die Grundannahme einer Vorstellung vom förderbedürftigen, defizitären Kind geht aus den oben genannten Ausführungen hervor. Behinderung und Entwicklungsverzögerung scheinen nach dieser Ansicht eine Bedrohung zu sein, die es unbedingt zu vermeiden gelte und deshalb zu fördern sei (vgl. Leyendecker 2008, S. 23ff.).
Adriano Milani Comparetti erkennt, dass die von ihm so bezeichnete „Krankheitsmedizin“ den Menschen/das Kind in gesunde und kranke Teile splittet, was mit der Abspaltung von unbewussten Ängsten und Leid - Milani Comparetti bezeichnet es als „das verkörperte Böse“ [44]- zu tun hat. Dies rührt aus seiner Meinung, dass die Begegnung mit Behinderung Angst erzeugt. Um diese leichter ertragen zu können wird u. a. versucht, die Behinderung nicht wahrzunehmen, im Sinne eines Gleichmachens. Diese Abwehrmaßnahme wird von Milani Comparetti als die „Position der Verleugnung“ (Milani Comparetti 1986, S. 17) bezeichnet (vgl. ebd., S. 17).
Eine andere Form, die Angst abzuwehren, stellt die „schizo-paranoide Position“ (ebd.) dar. Nach dieser wird die Angst durch Therapieren und Fördern bekämpft. Folglich ist eine „wilde Rehabilitation“ möglich. Darunter versteht Milani Comparetti das Beanspruchen mehrerer verschiedener, parallel verlaufender Therapie- und Fördermaßnahmen (vgl. ebd., S. 17f.).
Wenn diese jedoch nicht zu den gewünschten Erfolgen oder Vorstellungen führen, kann es zu Enttäuschungen und daraus folgenden Aggressionen bei Eltern und Frühförderperson (bzw. TherapeutIn) führen, welche wiederum auf das Kind übertragen werden können. Diese Tatsache hat Donald Winnicott als „perverse Allianz“ (1978) bezeichnet und wird von Milani Comparetti aufgegriffen. Die „perverse Allianz“ kann soweit führen, dass das Kind und nicht mehr die Behinderung zum Objekt der Aggressivität wird und deshalb Ausgrenzungen, z. B. in Form von Sondereinrichtungen, Sonderbehandlungen stattfinden, wie bereits in Kapitel 4.2 aufgezeigt wurde. (vgl. ebd., S. 17ff.).
In der „depressiven Position“ (Milani Comparetti), als weitere Form der Angstabwehr geht es nicht um Ausgrenzung, sondern um das Eingliedern in die Familie, das soziale Umfeld und die Gesellschaft. Hier kommt es zur „Akzeptanz des Bösen“ (Milani Comparetti), d. h. zu einem Prozess, der Eltern ein Wahrhaben und Eingestehen ihrer Ängste ermöglicht und dadurch den Trauer- und Verarbeitungsprozess einleitet. Erst in dieser Phase kann Förderung, im Sinne des ganzheitlichen Denkansatzes der „Medizin der Gesundheit“ (Milani Comparetti) (siehe Kapitel 4.2.2), ablaufen (vgl. ebd, S. 19f.).
Auch Niedecken befasst sich mit Abwehrmaßnahmen. Sie spricht dabei einerseits von den Abwehrmaßnahmen der Eltern, andererseits aller, die mit be-hinderten Menschen zu tun haben. Sie meint damit den Wunsch nach Abgrenzung derer, die wir in unseren Augen als abhängig und unmündig ansehen. Diese Abwehrmaßnahmen stellen für sie den Grund für die Benützung von Formulierungen, denen immer auch Zuschreibungen mit einhergehen, dar. Allein durch sprachliche Gesten wird auf „die Anderen“ und damit eine Distanzierung verdeutlicht. Wir machen sie dadurch zu Objekten, die wir unter dem Aspekt der „Förderbedürftigkeit“ betrachten. So formuliert Niedecken:
„Wir nähern uns diesen Menschen nur (…) in aseptischer, gefühlsgereinigter Förder- Atmosphäre, um die Ansteckungsgefahr zu bannen.“ (Niedecken 2003, S. 21)
Die Einordnung in Klassifikationen und die mutmaßliche Notwendigkeit von Förderung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit spielt hier mit ein. „Die Abwehr in der Betonung des Anders-Seins gründet also in der Angst, durch das Siebmaß der Normalität durchzufallen.“ (ebd.) Das Klassifizieren und Formulieren von Diagnosen scheinen den Förderwahn mit auszulösen und zu berechtigen (vgl. ebd., S. 20f.).
Auch Frühförderung verwendet in der Beschreibung ihrer Zielgruppe bestimmte Zuschreibungen. In der Literatur wird dabei, wie bereits eingangs erwähnt, von „Kindern mit Behinderung“ oder „von Behinderung bedrohten Kindern“, aber auch von „Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen“ (und deren Familien) gesprochen (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S. 16f.).
Frühförderung „braucht“ Formulierungen und Diagnosen aus Befunden, damit einerseits die Finanzierung[45] gewährleistet sein kann. Andererseits aber auch um eine Abgrenzung gegenüber „anderen“ Kindern zu erzielen, denn das Angebot ist nur für jene Kinder zugänglich, die einen Befund und damit eine Diagnose in schriftlicher Form aufweisen können (vgl. Höck 2001, S. 126).
Demzufolge verweist Niedecken auf die Unverrückbarkeit von Diagnosen, denn sie schränken den Blick auf das Kind ein, hemmen und steuern unser Wahrnehmen, unser Denken und Handeln (vgl. Niedecken 2003, S. 37).
Protokoll: Ich durfte eine neue Familie übernehmen und erhielt im Vorfeld die Antrag- Unterlagen des Kindes. Aus einem entwicklungsdiagnostischen Befund entnahm ich u. a. die Diagnose „Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung mit ernsthafter sozialer Beeinträchtigung“. Als ich diese Worte las, hatte ich sofort innere Bilder vor mir, die Symptome zu dieser Diagnose widerspiegeln. Sofort schossen mir Gedanken in den Kopf, worauf ich in der Arbeit mit dem Kind zu achten und wie ich mich zu verhalten hätte, wie beispielsweise: „die gemeinsame Arbeit zu strukturieren, „liebevoll konsequente Grenzen“ aufzeigen, Berühren beim Ansprechen, Förderung der Körperwahrnehmung, Wechsel von Bewegungs- und Ruhesequenzen, Ablenkungsreize und Hintergrundgeräusche möglichst ausschalten, usw.“
Als ich Sabine kennenlernte, erhielt ich jedoch ein völlig anderes Bild von ihr, als ich erwartet hatte. Auch nach mehreren Frühfördereinheiten bzw. nach besserem Kennenlernen widersprachen meine eigenen Beobachtungen denen der Diagnose im Befund. Dies führte zu eigenen Verunsicherungen und Zweifeln, ob meine Beobachtungen auch „richtig“ seien, ob ich keinen falschen Blick und nichts übersehen hätte.
Meine eignen Fantasmen stiegen in dem Moment, als ich die Diagnose las, in mir hoch und entwickelten sich in meinen voreingenommenen Vorstellungen weiter, noch bevor ich Sabine überhaupt kannte. Nicht von mir erwartete Beobachtungen führten erst zu Zweifeln meiner fachlichen Kompetenz, noch bevor ich überhaupt auf die Idee kam, dass ich das Kind erstens in einer anderen Situation (als bei der stattgefundenen Testung) kannte und zweitens, dass meine „pädagogische Brille“ eine andere war, als jene der Entwicklungsdiagnostikerin im klinischen Setting.
Seit dieser für mich sehr einschneidenden Erfahrung versuche ich immer wieder Befunde erst nach meinem Kennenlernen mit dem Kind zu lesen. Wenn ich sie doch bereits im Vorfeld des Kennenlernens lese, bemühe ich mich, meine eigenen Fantasmen (dies kann ich erst heute diesem Wort zuordnen, zuvor dachte ich von eigenen Vorurteilen) zu erkennen, und die Tatsache der „verschiedenen Brillen“ und Kontexte im Hinterkopf zu behalten. Dadurch erhalten Befunde für mich und meine Arbeit nur mehr eine unwesentliche Rolle.
Diagnose-Mitteilungen können Eltern, aber auch Frühförderpersonen (wie aus dem Protokoll ersichtlich) in ihrem Selbstbewusstsein verunsichern. Unbewusste Tötungsphantasien (wie in Kapitel 4.2 beschrieben) können hervorgerufen werden und dadurch Schuldgefühle in den Eltern und/oder der Frühförderperson auslösen. An dieser Stelle erhält F(rühf)örderung oft einen Wiedergutmachungscharakter. Unter diesem Aspekt sind gerade Eltern, die ohnehin schon aufgrund der Diagnosestellung unsicher sind, anfällig dafür anstelle ihrer Elternrolle, die Rolle von Ko-TherapeutInnen bzw. Ko-Förderpersonen zu übernehmen (siehe Kapitel 3.5). Der Fördergedanke scheint auf diese Weise überhandzunehmen und Förderdruck wird auf das Kind ausgeübt (vgl. ebd. S. 146ff.).
Protokoll: Da Moritz seit seiner Geburt über eine Sonde ernährt wurde, erfolgte die Sondenentwöhnung nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen in einer Spezialklinik. Wieder Zu Hause hatte die Mutter einen genauen Essplan und bestimmte „Ess-Regeln“ zu erfüllen. Moritz spielte bei diesem Plan jedoch nicht mit. Mit der Zeit verweigerte er jegliches Nahrungs-und Trinkangebot, außer Joghurts, Pudding, gesüßten Brei, bestimmte Saftsorten und gezuckerten Tee. Moritz Mutter erfuhr von Seiten der ÄrztInnen, PflegerInnen und TherapeutInnen immer mehr Druck und den Vorwurf (so nahm sie es auf), dass diese einseitige Ernährung zu Mangelerscheinungen führe.
In der Frühförderung habe ich das Thema rund um das Essen mit Moritz ausgeklammert, da ich der Meinung war, dass dabei schon zu viele Personen involviert waren. Anstelle dessen versuchte ich bezüglich des Themas „Essen“ ausschließlich aktive Zuhörerin für die Mutter zu sein. Aufgrund einer zeitlich veränderten Frühfördereinheit (ich kam aufgrund eines anderen Termins erst am späteren Vormittag zu Moritz) ergab es sich, dass ich beim Füttern von Moritz dabei war und die Esssituation beobachten konnte.
Es war für mich schwer zu sehen und auszuhalten, wie verkrampft und gestresst die Mutter Moritz fütterte. Ich hatte den Eindruck, als ob ihr die große Hoffnung und Erwartung sozusagen „ins Gesicht geschrieben sei“, die bei jedem erneuten Löffel Pudding, den sie Moritz zu geben versuchte, mitschwangen. (Mir kam es damals so vor, als ob Moritz die Pudding-Löffel aufgedrängt wurden und Essen für ihn nichts Lustvolles, sondern Druck und vielleicht sogar Zwang bedeutete.)
Das Thema Essen beherrschte lange Zeit die ganze Familie und beanspruchte in den Elterngesprächen viel Raum. Deshalb versuchte ich in den Förderstunden und in den Gesprächen auch andere Themen, die beinahe unterzugehen schienen, hervorzuholen und Beobachtungen aus dem gemeinsamen Spiel im Gespräch anzusprechen, wo besonders Moritz´s Stärken zum Ausdruck kamen. Allerdings gelang mir das nicht wirklich, bzw. hatte ich den Eindruck, dass die Mutter all das gar nicht hören wollte oder konnte.
Heute stelle ich mir die Frage, welche Fantasmen Moritz Mutter „beherrschten“? Vermutlich jene, die ausdrücken, dass alles gut und richtig sei, was ÄrztInnen etc. der Mutter angewiesen oder geraten haben?
Im weiteren Verlauf erhielt die Mutter den Rat, Moritz nur mehr an gewissen Zeiten etwas zu essen und zu trinken zu geben, sodass er an den dafür vorgesehenen Zeiten richtig Hunger und Durst habe. Dazu äußerte die Mutter jedoch in einem Elterngespräch mit mir ihre Bedenken, denn sie war der Meinung, dass Moritz nicht so viel auf einmal trinken könne. Trotzdem befolgte sie die Anweisung der Ärzte und gab ihm zwischendurch auch keine kleinen Schlucke mehr, wie sie es sonst tat. Doch wirklich gut ging es der Mutter mit dieser Lösung nicht, das konnte sie in weiteren Elterngesprächen immer wieder verbalisieren. Ich versuchte die Mutter darin zu bestärken, ihr eigenes Gespür nicht außer Acht zu lassen.
Es scheint mir, dass die Mutter jeglichen Rat von Fachpersonen aufgenommen und umgesetzt hat, bis dahin, dass sie ihre mütterlichen Bedürfnisse und ihre eigenen Kompetenzen den fachlichen Anweisungen unterstellt und sich selbst nicht mehr wirklich wahrgenommen bzw. vielleicht auch erfahren oder lernen musste, dass ihre Einschätzung, ihre Kompetenzen, ihr Gefühl nicht gut genug, nicht wichtig genug seien.
Niedecken zeigt in ihrem Buch „Namenlos“ durch Beispiele sehr deutlich auf, wie durch Diagnosen und Zuschreibungen verursachte F(früh)ördermaßnahmen entfremdend sein, bzw. alle Alltagssituationen mit dem „Fördertouch“ infiziert werden können. Exemplarisch formuliert sie dazu:
„Einfach den Säugling halten, reicht nur beim `normalen` Kind, beim `geistigbehinderten` wird daraus die Halteförderung. Einfach etwas zeigen ist beim `geistigbehinderten`Säugling zu wenig, es müssen zugleich die Sekunden gezählt und geübt werden, bis das Kind ausreichend lange hinsieht.“ (Niedecken 2003, S. 148)
Fördern heißt in diesem Sinne: „das, was sie [die Eltern, J. Ö.] mit ihrem Kind tun würden, wäre es nicht durch die Diagnose ihren Wünschen entfremdet, all dies mit ihm ausdrücklich als Förderung dennoch tun, nur „besser, verdichteter, einfallsreicher, unermüdlicher.“ (ebd.)
Die Freude und Unbeschwertheit am gemeinsamen Beisammensein und im Spiel mit dem Kind wird umgelenkt in eine Freude, die erst dann auftritt, wenn die Erwartungen erfüllt wurden (vgl. ebd.).
Eine so verstandene Frühförderung beruht „auf einer mit Selbstentfremdung erkauften, normgesteuerten Interaktion mit dem Kind, in welchem alle Liebe, alle Lust der Eltern am Spiel als Mittel zum Zweck der Frühförderung umfunktioniert wird.“ (ebd., S. 148)
Aus diesen Ausführungen gehen Wirkungen und Folgerungen von Abwehrmechanismen und Fantasmen hervor, wie sie bei Eltern und sog. Fachpersonen zu finden sind. Entscheidend ist, dass die Betroffenen sich mit diesen auseinandersetzen, deren Ursprünge kennen, um mögliche auftretende Schuldgefühle, Ängste, Gefühlen der Ohnmacht, Trauer oder Wut einordnen, verstehen (vgl. ebd. S. 50f.) und im Weiteren auch aushalten können.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Abwehrmechanismen von pädagogisch, medizinisch, therapeutisch Tätigen stellt auch für Milani Comparetti die Voraussetzung für ein Umdenken dar:
„Erst die Überwindung der eigenen Ängste ermöglicht im Grunde die gesundheitsmedizinische Tätigkeit. Das heißt, der Übergang von der „Krankheits“- zur „Gesundheitsmedizin“ ist in der Tat eher mit einem Reifungsprozeß vergleichbar als mit einem einfachen Konzeptionswechsel. Man kann nicht die krankheitsmedizinische Sichtweise ablegen, ohne sich in irgendeiner Form mit sich selbst, seinen Ängsten, Schmerz- und Wutgefühlen auseinandergesetzt zu haben.“ (Milani Comparetti 1986, S. 20)
Wenn es uns nicht gelingt, eigene Schwächen zu erkennen und wir Abwehrmaßnahmen oder Abwehrtendenzen unter dem Deckmantel F(rühf)örderung (oder Therapie) verstecken, trägt die Abwehr in Form von Förder- oder Therapiemaßnahmen zur „Institution Geistigbehindertsein“, zum „(geistig) behindert gemachten Kind“ bei (vgl. Niedecken 2003, S. 127).
Dass Frühförderung aber auch gegenteilige, nämlich eine konstruktive und positive Wirkung haben kann, wenn sie entsprechend ausgeführt wird bzw. die angemessene Haltung dahinter steckt, drückt Niedecken im folgenden Zitat aus:
„Wenn sich die Fachleute der Abhängigkeit der Eltern und des Machtgefälltes bewusst sind, und wenn es ihnen gelingt, gemeinsam mit den Eltern und Kind an der Auflösung von Abhängigkeit und Macht zu arbeiten; wenn sie Eltern und Kind einfach beistehen können, eigene Problemlösungen zu entwickeln, anstatt ihnen Rezepte zu verordnen, scheinbaren Nichts ertragen, anstatt sie mit schnellen Förderrezepten zu überspringen, dann könnten solche frühen Hilfen durchaus zur Kritik am Fantasma und zu wirklicher Solidarisierung werden, anstatt die Institution „Geistigbehindertsein“ in ihrem Funktionieren abzusichern.“ (Niedecken 2003, S. 150)
In diesem Sinne kann Frühförderung einer Begleitung nahekommen oder entsprechen (siehe ausführlich in Kapitel 6.2).
Nach Niedecken führen Fantasmen, wie aufgezeigt, zu „entgleisten Interaktionsformen“
, welche die Wahrnehmungsfähigkeit beeinflussen und eine Verhinderung der Einfühlung seitens Eltern und Frühförderperson hervorrufen können. Wenn beispielsweise das Fantasma vorherrscht, dass alles was an Förderung für das Kind getan wird, zum Besten für das Kind sei, dann kann es das Erkennen und Einfühlen von möglicher Überforderung des Kindes be- und verhindern (vgl. Niedecken 2003, S. 90f.).
Wie drastisch diese fehlende Einfühlung für die kindliche Entwicklung sein kann, ist durch die Ausführungen zur „Mutter-Kind-Interaktion“, der Bedeutung des „Spielraums für die Entwicklung“ und der „Entwicklungsförderung im Dialog“ (siehe Kapitel 5.2.3) nachvollziehbar. Wenn Interaktionen auf die Zweidimensionalität beschränkt bleiben kann es dazu führen, dass das Kind die Reaktionen und das Verhalten der Eltern und der Frühförderperson, die durch das Fantasma behindert sind, nachahmt bzw. nach Niedecken „sinnentlehrt nach äfft“ und sich dementsprechend „typisch behindert“ (ebd., S. 91) verhält (vgl. ebd. S. 90ff.).
Niedecken schildert dazu ein eindrückliches Beispiel, das ich zum besseren Verständnis ihrer Theorie der entgleisten Interaktion und des Nachäffens der elterlichen Fantasmen, in zusammenfassender Form wiedergeben möchte:
Die neun Monate alte Susanne, ein „mongoloides“ Mädchen erhält einen Behindertenausweis, in dem eine Gehbehinderung deklariert wurde. Daraufhin überlegen die Eltern, Frühförderung zu initiieren und suchen eine Ärztin zur Untersuchung auf. Diese stellt fest, dass Susanne immer noch keine Anzeichen von Robb- oder Krabbelversuchen macht. Von nun an beobachten die Eltern Susannes Verhalten und Fortbewegungsversuche mit Angst und Sorge und müssen feststellen, dass Susanne immer noch weniger kann. Eines nachts beobachtet die Mutter Susanne im Vierfüßlerstand, einer Vorstufe des Krabbelns, in ihrem Bettchen. (vgl. ebd. S. 91)
Niedecken spricht im Zuge dessen vom „mimetischen Tabu“. Es „ist die aktuelle Abwehr, Unbewusstmachung, von beängstigenden Wahrnehmungen und Wünschen […]“ (ebd., S. 92), die auch in und durch Institutionen wie z. B. Sondereinrichtungen, Frühförderstellen durchgesetzt werden. Dadurch werden Handlungen, Verhalten und Äußerungen des Kindes so ausgelegt, dass es von Natur aus nur so sein kann und eben Förderung notwendig macht. In der auf Leistung ausgerichteten Kultur scheint das mimetische Tabu besonders dann zu herrschen, wenn die geforderte Leistung nicht nachgewiesen werden kann. Sprich, das Kind wird als behindert bezeichnet, weil beispielsweise die Diagnose „Down-Syndrom“ an ihm haftet und somit es in der Natur der Sache liege, dass es sich „geistig behindert“ verhalte. Auch hier sind nach Niedecken Interaktionen durch Fantasmen entgleist, die zur Einfühlungsverweigerung auch in Förderinstitutionen führen und den Gedanken der Allmacht der Förderung herbeiführen können (vgl. ebd. S. 92f.).
Wenn Fantasmen Eltern in ihrem Denken und Beobachten bereits stark beeinflussen, kann es für eine Frühförderperson, die sich mit ihren eigenen Fantasmen bereits auseinandergesetzt hat, dennoch schwierig sein, Eltern darauf aufmerksam zu machen, wie aus dem folgenden Protokoll hervorgeht (vgl. Köll-Senn 2003, S. 101):
Protokoll: Erika (3 Jahre) malte sowohl in der Kinderkrippe als auch zu Hause sehr häufig mit großflächig Wasserfarben. Auch in der Frühfördersituation setzten wir diesen Wunsch um. Erika zeichnete Kreise in verschiedenen Größen und Farben, was mich sehr erfreute und beeindruckte. Die Handlungsabläufe (Pinsel ins Wasser tauchen, in der Farbe rühren, auf dem Papier malen, wieder ins Wasser tauchen usw.) führte sie nahezu selbstständig durch (ich hielt dabei nur den Wasserbecher fest, der immer umzukippen drohte). Im Elterngespräch fragt mich die Mutter (sie wirkt dabei enttäuscht) warum Erika denn seit Wochen immer das Gleiche male und keine Veränderung bzw. Entwicklung sichtbar werde? (Sie bezog die wiederholende Tätigkeit auf den Verdacht von autistischen Zügen, der bei der letzten Entwicklungsdiagnostik geäußert wurde.)
Ich deutete das für Erika sehr lustvolle und wiederholende Kreis-Zeichnen auf das Wiederholen und Festigen einer gewonnen Fähigkeit, die sie wahrscheinlich so lange ausüben würde, bis sie bereit für weiteres Experimentieren sein würde. Ich wäre in dieser Situation nicht auf die Idee gekommen, diese Wiederholungen mit der Diagnose von „frühkindlichem Autismus“ zu assoziieren. Jedoch im Wissen, dass die Mutter möglicherweise in diesem Fantasma verhaftet zu sein schien und ihre Beobachtungen von diesem beeinflusst waren, konnte ich sie in ihrer Vermutung und Sorge durchaus sehr gut verstehen.
Dieses Kapitel wird deshalb gestreift, da in der ausgewählten Literatur von Thurmair/Naggl und Pretis die Förderdiagnostik und die Erstellung von Förderplänen als Bestandteil der Frühförderung zählen. Deshalb möchte ich in äußerst komprimierter Weise auf die Konzepte der genannten AutorInnen eingehen, um in den weiteren Ausführungen darstellen zu können, welche Veränderungen diesbezüglich erforderlich sind, dass es zu einem Perspektivenwechsel kommen kann.
Im Kapitel 3.6, welches den Ablauf der Frühförderung beschreibt, wird der Arbeitsvertrag erwähnt. An diese Stelle ordnen Thurmair, Naggl und Pretis die Förderdiagnostik im Rahmen eines Gespräches, das den Abschluss der Eingangsphase darstellt, ein. In diesem Rahmen beschreiben die AutorInnen von der Diagnosemitteilung (diese beschreibt den Eindruck der Frühförderperson) und einer Behandlungsempfehlung (dieses stellt das Angebot dar, das die Frühförderperson basierend auf dem, durch die Beobachtungen gewonnenen Bild vom Kind in der Familiensituation, den Eltern vorstellt) (vgl. Thrumair/Naggl 2000, S. 69f.).
Thurmair/Naggl sprechen von einer allgemeinen Diagnostik, sie kann auch als heilpädagogische Diagnostik bezeichnet werden, im Kontrast zur medizinischen oder psychologischen Diagnostik (vgl. ebd., S. 57).
Diese soll folgende Schwerpunkte beinhalten:
„[…] neben einem allgemeinen Überblick über den Entwicklungsstand des Kindes in den wichtigen Entwicklungsbereichen der Bewegung (grob- wie feinmotorisch), der Wahrnehmung und der sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten, vor allem auch um die sozial-emotionalen Möglichkeiten des Kindes, seine alltagspraktischen Kompetenzen, sein Spielverhalten, seine Motivation, Ausdauer und Kreativität, also um diejenigen Kompetenzen und Schwierigkeiten, die für die Gestaltung der späteren Therapie oder Förderung wichtig sein können.“ (ebd., S. 61)
Zu dieser Diagnostik gehört auch ein sog. Förderplan, der die weiteren Schwerpunkte der zu fördernden Entwicklungsbereiche ausdrückt (vgl. ebd., S. 72f.).
Laut Pretis soll die Diagnostik in der Frühförderung und Familienbegleitung in Bezug auf das Kind und seine psychosoziale Entwicklung, eingebettet in die Familie und das soziale Umwelt, ressourcenorientiert ausgerichtet sein (vgl. Pretis 2001, S. 74).
„Die psychosoziale Entwicklung bezieht sich vor allem auf die Möglichkeiten des Kindes, sich als autonom handelndes Wesen zu erleben. Förderdiagnostik schätzt ab, in welchen Bereichen […] das Kind sich aufgrund seiner möglichen Beeinträchtigungen als behindert bzw. als Handelnder erleben kann. Auf der Ebene der Elternarbeit erhebt sie mögliche Ressourcen der Eltern bzw. des sozialen Umfeldes. Diese Ressourcen dienen als Hilfe zur Selbsthilfe. […] Eine förderdiagnostische Abklärung der transdisziplinären Zusammenarbeit spielt erfahrungsgemäß eine bislang geringe Rolle, da dieser Bereich nicht in ausreichendem Maß als eigenständiger Förderschwerpunkt erkannt wird.“ (ebd., S. 74)
Methoden zur Diagnostik stellen laut Pretis anamnestische Informationen, die eigene Beobachtungen, Dokumente und standardisierte Verfahren dar. Letzteres versteht der Autor als Hilfsmittel, die eigenen und fremden Beobachtungen ergänzen und betont dabei, dass es fraglich ist, ob für die Zielgruppe Kinder überhaupt solche Verfahren sinnvoll einzusetzen sind (vgl. ebd., S. 76f.).
Zusammenfassend kann im Sinne Pretis gesagt werden, dass Förderdiagnostik nicht eine eindimensionale Einschätzung sein kann, sondern dass es - und dabei bezieht er sich auf Fisseni - „[…] ein multidimensionaler kommunikativer Prozess aller Beteiligten“ (Fisseni 1990 zit. nach Pretis 2001, S. 76) sein muss (vgl. Pretis 2001, S. 76).
Kritische Auseinandersetzung zum Thema Förderdiagnostik, Förderziele und ein Ausblick
Die Begriffe Förderdiagnostik und Förderplan bzw. auch Förderziel, wie sie auch von den im vorher beschriebenen Kapitel von den genannten AutorInnen für das Feld der Frühförderung, bezeichnet werden, implizieren, dass Fördern als notwendig erachtet wird und so gesehen, wiederum eine Betrachtung und ein Agieren und Intervenieren von außen darstellt.
Wenn die AutorInnen von der Beobachtung als einer Methode der Förderdiagnostik in der Frühförderung sprechen, so kann aus systemtheoretischer Sicht, in Anlehnung an Hans Eberwein, angemerkt werden, dass Beobachtung immer nur den Charakter des Vorläufigen hat und ein subjektives Bild darstellt, denn eine objektive Beobachtung und somit auch eine totale Beschreibung der Wirklichkeit sind nicht möglich (vgl. Eberwein 1997, S. 146).
Wenn Ziele starr aufgrund von bestimmten Beobachtungen, die wie wir gehört haben, eine subjektive Sicht der Förderperson darstellen, verfolgt werden, besteht zudem die Gefahr, dass „falsche Ziele“ bzw. für das Kind nicht entsprechende Ziele formuliert werden. Demzufolge kann es zu einer Fehlförderung kommen. Konsequenzen von einer solchen fehlgeleiteten Förderung wirken sich negativ auf das Kind in seiner Entwicklung aus und können ein Entwicklungsrisiko darstellen[46] (vgl. Haug-Schnabel 1997, S. 96ff.).
Nach Eberwein sollten die PädagogInnen als Ziel fokussieren, dass sie versuchen das Kind (besser) verstehen zu können (vgl. Eberwein 1997, S. 151) und nach von Lüpke und Voß sich auch nicht anmaßen, Ziele für das Kind und seine Familie zu setzen, denn:
„Die Helfer geben keine Ziele an, sie begleiten (von Lüpke, 1989), bieten einen Kontext für Erfahrungen, um damit die eigene Entwicklung zu „konstruieren“. Zuhören und Beobachten werden wichtiger als `Machen`.“ (von Lüpke/Voß 1993, S. 5f.)
Dass dies ermöglicht werden kann, braucht es wiederum den Dialog, um auch hier eine Verbindung zu Milani Comparetti herzustellen (vgl. ebd. S. 5).
Auch Cornelia Köll-Senn befasst sich mit dem Thema Förderziele und zeigt einen neuen Weg auf, wie diese in der Frühförderung integriert werden können: Sie weist darauf hin, dass es „darauf an[kommt, J. Ö.], wie diese Förderziele formuliert werden – und es ist durchaus möglich, gerade die Entfaltung der Autonomie des Kindes als zentrales Ziel anzunehmen und damit dem „Wunsch“ des Kindes als Individuum mit ganz eigenen Bedürfnissen Raum zu geben.“ (Köll-Senn 2003 S. 105)
Auch die Eröffnung von Spielräumen für das Kind, aber auch für die Eltern schlägt sie als Förderziele in der Frühförderung vor. Den Eltern Spielraum einräumen kann die Frühförderperson insofern, als dass sie den Eltern Raum für das Aussprechen ihrer Ängste, Sorgen und Belastungen gibt, sowie auch die Legitimation der eigenen Wünsche und Bedürfnisse der Eltern hervor streicht. In Bezug auf das Kind, kann die Frühförderperson weitere Förderziele darin sehen, dass sie die Eltern dafür sensibilisiert, die kindlichen Bedürfnisse, Äußerungen und Aktivitäten auch abseits der durch die Diagnose zustande gekommenen Fantasmen zu sehen (vgl. ebd.).
„Dies könnte dazu führen, dass letztendlich auch das Kind wieder mehr Spielraum für die Entfaltung seiner Eigenaktivität und seiner Eigenpersönlichkeit bekommt und sein Verhalten den Eltern wiederum Mut und Kraft gibt, einen individuellen Weg zu suchen, um mit der Behinderung des Kindes, mit den begleitenden Fachkräften aus dem therapeutisch und medizinischen Feld und mit den Menschen der sozialen Umgebung in einer für die Familie förderlich Weise umgehen zu können. Diese Überlegungen würden für die Frühförderin bedeuten, den Spielraum aller Familienmitglieder im Blick zu haben und ihre Maßnahmen darauf abzustimmen, diesen zu vergrößern bzw. zu öffnen.“ (ebd.)
Zusammenfassend stelle ich auch in diesem Kapitel fest, dass es auf die Haltung und Einstellung der jeweiligen Frühförderperson ankommt, wie sie die Begrifflichkeiten Förderdiagnostik, Förderpläne und Förderziele für sich und ihre Arbeit definiert. Verwendet sie die Begriffe in medizinisch-therapeutischer Auslegung, dann haben sie keinen Platz in der dialogisch begleitenden „Frühförderung und Familienbegleitung“. Setzt sie die Begriffe im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklungsbeschreibung und in dem von Köll-Senn aufgezeigten Sinn ein, dann können diese auch in der Frühförderung Raum gewinnen und wichtig sein.
Wenn Frühförderung als Entwicklungs-Begleitung angesehen werden soll, dann braucht es grundsätzliche Änderungen in Einstellungen und Arbeitsweisen der Frühförderperson.
Als Ausgangsgrundsatz für eine Entwicklungs-Begleitung möchte ich einen Gedanken von Sabine Höck auswählen. Sie formuliert im Zusammenhang dazu:
„Das Kind entwickelt sich – nicht wir es.“ (Höck 2001, S. 129)
Dieser einfach formulierte Satz kann in seinem Inhalt weitaus komplexer und aussagekräftiger sein, als es möglicherweise im ersten Moment vermuten lässt. Im Anschluss an die vorhergehenden Kapitel können wir mit dieser Aussage einen bedeutenden Perspektivenwechsel einleiten. Die Formulierung impliziert zudem, dass von einer kindlichen Autonomie und Selbstbestimmung ausgegangen wird und somit mit den geforderten Postulaten der UN-Konvention im Einklang steht.
Aber auch die im Zusammenhang mit Entwicklung veränderte Begrifflichkeit der „Begleitung“ beinhaltet dieses Umdenken.
Das Bedeutungswörterbuch Duden wird der Begriff „Begleitung“ nach drei verschiedenen Sinngehalten formuliert. Begleitung im Sinne von „Mitgehen“, „das Begleiten auf einem Musikinstrument“, sowie die „begleitende Person[en]“ (Müller 1985, S. 122). Nach dem Herkunftswörterbuch Duden wird der Begriff „Begleitung“ ab dem 18. Jhd. verwendet. Das Verb „begleiten“ entspringt aus dem im 17. Jhd. für diesen Begriff verwendeten Wort „führen“. Diese Wortbedeutung ist allerdings heute in einem abgeschwächten Verständnis gebraucht und zu „mitgehen“ übergegangen (vgl. Drosdowski 1989, S. 70).
Auch Sabine Höck stützt sich an dieser Wortbedeutung und bringt das umgangssprachliche Verständnis des Begriffs folgendermaßen zum Ausdruck:
„Im Alltagsverständnis gehen wir dabei von einer zeitweiligen Gemeinsamkeit aus, z. B. jemanden ein Stück Weg begleiten und in einer begrenzten Zeit. Dies beinhaltet auch die Einstellung: es handelt sich dabei um zwei Subjekte und nicht: einer ist dabei das Objekt des anderen.“ (Höck 2001, S. 127)
Auch die Begleitung in der Frühförderung findet in einem begrenzten Zeitrahmen, nämlich vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt statt. Jedoch sind der Beginn sowie das Ende der Begleitung in diesem Zeitfenster offen. Laut Pretis und Höck setzt Frühförderung bei einem Großteil der Kinder erst in einem Durchschnittsalter von 3,2 bzw. 3,4 Jahren ein. (vgl. Pretis 2000 S. 116, Höck 2001, S. 126) Auch für die Beendigung der Frühförderung entscheiden sich viele Eltern noch weit vor dem Schuleintritt. Dies kann daher rühren, dass der Bedarf an Begleitung nicht mehr weiter gegeben oder gewünscht ist oder dass zu einer anderen Form der Begleitung gewechselt wird (vgl. Höck 2001, S. 127f.).
Um weitere Aspekte der Begleitung herauszustreichen möchte ich die von Höck aufgegriffene Begriffsbedeutung im Sinne der „musikalischen Begleitung“ anführen, welche sie auf den Kontext Frühförderung zu übertragen versucht:
Höck vergleicht das Kind mit der SolistInnen-Rolle. Die/der SolistIn singt oder spielt die Hauptstimme, dessen Melodie für das ganze Lied oder Musikstück leitend ist. Dabei wird die/der SolistIn eine rhythmische und harmonische Begleitung als Basis geboten und nur an gewissen Stellen werden unterstützende Ausschmückungen oder Verstärkungen durch die Begleitung eingesetzt. Die Rolle der Begleitenden schreibt Höck den fördernden Personen, sprich der Frühförderperson zu. Als weitere Begleitform erweitert sie die Möglichkeit der neben- oder untergeordneten melodischen Gegenstimmen zur Hauptstimme (vgl. ebd., S. 127).
Daraus schließt Höck, dass die Dominanz im Förderprozess eindeutig beim Kind und seiner Familie und nicht bei der Frühförderperson liegt, denn die „Rolle der Begleitung ist immer die in Neben- oder Unterordnung und variiert von Stützung, Haltung vorhandener Kompetenzen, die eine Entwicklung ermöglichen, bis zum anregenden zeitweiligen Widerpart“ (ebd., S. 127). Hier können wir wieder Bezug auf Milani Comparetti´s Ansatz des Vorschlag und Gegenvorschlags nehmen und des geforderten Respekts von Seiten der Eltern bzw. der Frühförderperson vor der kindlichen Eigenaktivität und Selbstbestimmtheit in seiner Entwicklung (siehe Kapitel 5.2.3).
Höck folgert weiter, dass bei diesem Verständnis von Begleitung das Kind und die Eltern den Weg und das Ziel der Begleitung bestimmen und nicht die Frühförderperson. Allein von dieser aufgesetzte Ziel- und Förderpläne sind mit diesem Begleitungsverständnis nicht vereinbar. Begleitung in diesem Sinne grenzt sich deutlich von Heilung, Förderung oder Erziehung ab. Die so verstandene Begleitung schließt nicht aus, dass „Probleme vom Anfang weiter bestehen können, dass die Familie, das Kind eigene Ressourcen hat, sich auch andere Begleiter sucht“ (ebd., S. 128). Eine begleitende Person kann Familien insofern zur Seite stehen, als dass sie Möglichkeiten und Varianten des gemeinsamen Weges aufzeigt, ob diese jedoch in Anspruch genommen bzw. umgesetzt werden, entscheiden allein das Kind und seine Familie (vgl. ebd., S. 128).
Ganz im Sinne des in Kapitel 5.2 aufgezeigten nicht-linearen Entwicklungsverständnissen beispielsweise von Milano Comparetti wird, wie bereits oben erwähnt, auch die Begleitung der kindlichen Entwicklung unter dem Aspekts des Dialogs verstanden. Dies gelingt auch im Sinne von Höck vor allem dann, wenn wir
„behinderte Kinder […] vor allem [als, J. Ö.] Kinder und nicht vor allem behindert [oder in ihrer Entwicklung verzögert ansehen, J. Ö.] d. h., die Neugier, Motivation, Aufmerksamkeit für etwas hat auch viel mit Spontaneität, Freude, Spaß zu tun, Spiel ist nicht vorrangig zweckorientiert, Kinder, die sich ihrer Bindung, Beziehung zu Mutter/Vater sich sind, sind freudiger in der Erkundung Eroberung fremden Terrains. (Höck 2001, S. 130)
Diese von Höck dargestellten Aspekte können allerdings leicht übersehen werden, wenn wir unsere Haltung und unser Tun auf die Förderung von Defiziten ausrichten und versuchen Probleme zu bearbeiten (vgl. ebd.). Diese Sichtweise stimmt auch mit jener von Milano Comparetti überein, denn er formuliert:
„Eigenaktivität, Selbstaufbau, Beziehungsintentionalität und Ganzheitlichkeit sind die Begriffe, die aus gesundheitsmedizinischer Sichtweise das sich entwickelnde Individuum beschreiben. So ist auch ohne konkretes Beispiel nachvollziebar, wie im Falle einer beeinträchtigten Gesundheit oder Entwicklungsstörung die Förderung auszusehen hat. Ganz gleich, welcher Art die Beeinträchtigung bzw. Schädigung ist, muß die Behandlungs- oder Fördermaßnahme so gestaltet sein, daß sie dazu beiträgt, die Eigenaktivität, d. h. die Autonomie des Kindes zu stärken und seine Beziehung mit der Umwelt, den Dialog, zu stabilisieren. Das Bewußtsein der Ganzheitlichkeit verbietet jede isolierte Funktionsförderung oder Therapie einer umschriebenen Störung, die nicht in den Gesamtzusammenhang der physio-psycho-sozialen Situation des Kindes eingebettet ist.“ (Milano Comparetti 1985, S. 27)
Die Schülerin und Mitarbeiterin Milano Comparettis Anna E. Gidoni und ihre Kollegin Nerina Landi - beide sind Kinderneuropsychiaterinnen - bauen auf Milano Comparettis Erkenntnissen und Wissen auf. Sie beschreiben die Begleitungsfunktion des „unterstützenden Ich´s“, eine Funktion, die auch die Frühförderperson, neben der Rolle der dritten Person (Kapitel 4.2.2) erlangen kann.
In Kapitel 6.1.3 wurden, mit Bezug auf Niedecken, die Folgen von einer nicht öffnenden Zweier-Beziehung zwischen Mutter und Kind besprochen, nämlich die „gestörte oder entgleiste Interaktion“, die ein „Nachäffen“ (Niedecken) der von Fantasmen beherrschten mütterlichen Reaktionen nach sich zieht. Auch Gidoni und Landi thematisieren die Problematik der zu lange (oft über Monate und Jahre) andauernden Mutter-Kind-Symbiose bei Kindern „im Krankheits- oder Behinderungsfall“. Auch sie sprechen davon, dass Eltern in ihren Phantasievorstellungen vom idealen Kind träumen und versuchen, dieses für sie (noch) nicht existierende Kind durch Behandlungs- und Fördermaßnahmen zu „korrigieren“ (vgl. Gidoni/Landi 1990, S. 87). Diese Sichtweise kann Milani Comparetti´s „schizo-paranoider Position“ (Kapitel 6.1.2) zugeordnet werden.
In fördernde oder behandelnde Dienste werden deshalb von Eltern Erwartungen im Sinne einer Heilung oder Wiedergutmachung gesteckt, wie es auch in folgendem Protokoll zum Ausdruck kommt:
Protokoll: Bei einem Erstgespräch antwortete eine Mutter auf meine Frage welche Erwartungen sie an das Angebot und mich als Frühförderin hat, dass ich ihr sage was sie alles falsch machen würde und was sie tun könne, damit es mit Simon (in Bezug auf seine Entwicklung) besser geht und er „aufhole“.
Ein Vater antwortete auf dieselbe Frage, dass ich seine Tochter bis zum Schuleintritt wieder „hinbringen“ und dass sie „normal“ in die Schule gehen kann.
Diese Aussagen lösten im ersten Moment Überforderung und eine gewisse Sprachlosigkeit in mir aus. Dementsprechend rang ich nach den „richtigen“ Worten oder der „angemessenen“ Reaktion. Bei beiden Elternteilen hatte ich im Anschluss des Gesprächs ein Gefühl der Unzufriedenheit. Erst in meiner Reflexion im Anschluss an die Gespräche spürte ich, wie ich anders hätte reagieren können und welche Worte stimmiger gewesen wären. Die ausgesprochenen Erwartungen der Elternteile machten mich einerseits betroffen, da ich mich fragte, welche Erfahrungen und Erlebnisse die Eltern im Vorfeld wohl schon machten? Andererseits transportierten sie (Erwartungs-) Druck, welchen die Eltern vermutlich selbst erfuhren und auf meine Person als Frühförderin bzw. das Angebot „Frühförderung“ übertrugen. Erst in weiteren Gesprächen mit den Eltern konnte ich das „Erwartungs-Thema“ erneut aufgreifen und Worte finden.
Beide Eltern scheinen im Sinne Milani Comparetti´s in der „schizo-paranoiden Position“ des Umgangs und des Verarbeitens zu stecken. In der Hoffnung doch noch ihr Phantasie - bzw. Wunschkind „erhalten“ zu können, installierten sie möglicherweise Frühförderung, welche mit dem Gedanken bzw. der Erwartung des Heilens und Gesundmachens verbunden wurde.
Die Mutter scheint zudem sich selbst mit Schuldgefühlen zu belasten, die sie im Sinne Niedeckens durch Frühförderung auszugleichen oder wieder gutzumachen versuchte.
Während Eltern, die sich nach Milani Comparetti in der „schizo-paranoiden Position“ befinden, ihre Hauptenergie in Förderung und Fördermaßnahmen zu stecken scheinen, wird das „reale Kind“ (Gidoni/Landi) übersehen, welches in seiner Behinderung verhaften zu sein scheint. Dadurch entstehen laut Gidoni und Landi wiederum verwirrte und ambivalente Emotionen, die seitens der Eltern nicht wirklich einzuordnen seien. Doch genau dies wäre der springende Punkt, nämlich der Versuch die Emotionen - wenigstens in Ansätzen - zu verstehen um die für das Kind nachteilig auswirkenden Emotionen verringern und unser Handeln und Agieren von diesen zu befreien. Gidoni und Landi gehen in ihren Ausführungen speziell auf die Situation des Eintretens in die Schule ein, wenn sich diese Mechanismen bei der Lehrperson wiederholen. Denn auch deren Phantasievorstellungen vom „idealen“ und „realen“ Kind und Unterricht können auseinanderklaffen (vgl. Gidoni/Landi 1990, S. 87). Diese Gedankengänge erscheinen deshalb als erwähnenswert, da sie auch auf die Frühförderperson zutreffen können. Gidoni und Landi folgern im Weiteren:
„Dort, wo es der Schule [bzw. auch der Frühförderung, J. Ö.] gelingt, sich als Dienstleistung der Förderung von Kompetenzen und nicht als Abhängigkeit schaffende Dienstleistung zu profilieren, ist es auch möglich, die Kräfte des Ich- Bewußseins [Hervh. d. Verf.] der Eltern wiederzuerwecken und ihre Fähigkeiten zu fördern, ihr eigenes anderes Kind in der Welt zu begleiten im Bewußtsein, ihm Selbstsicherheit zu geben.“ (ebd., S. 87)
Die genannten Autorinnen sehen darin die Chance, dass von der Allmacht der Erwachsenen abgesehen und das Kind mit seinen Fähigkeiten, Möglichkeiten und seiner Art zu kommunizieren im Mittelpunkt steht. Überall dort, wo es gelang, dass Erwachsene ihre Emotionen erkannten, wo interdisziplinäre Konzepte zusammenarbeiteten und Emotionsverarbeitung möglich war, konnte Integration[47] stattfinden (vgl. ebd., S. 87f.).
Diese Aussage sehe ich auch für Frühförderung relevant, da dadurch ein Begleiten auf mehreren Ebenen möglich werden kann. In Anlehnung an Gidoni und Landi wird im Folgenden auf Begleitmöglichkeiten dreier für die Frühförderung relevanter Ebenen eingegangen, nämlich der persönlichen Ebene des Kindes, der familiären Ebene und der Ebene des Sozialen. Für die Begleitung der beiden erstgenannten Ebenen entwickeln die Autorinnen das Konzept des „Unterstützenden Ich´s“. Die Idee dahinter ist jene, dass „[e]ine außerhalb der Familie stehende, nicht konfliktuell vorbelastete, beruflich ausgebildete Person“ (ebd., S. 91) unterstützend zur Seite steht und sozusagen „ihr Ich herleihen (deshalb die Bezeichnung `unterstützendes Ich`) und dem behinderten Kind Verhaltensweisen und Funktionen zur Verfügung stellen, die seine Entwicklung zu erleichtern vermögen, andernfalls bliebe diese Entwicklung durch die Art der Mutter-Beziehung gehemmt.“ (ebd.)
Diese Vorkehrung kann somit einen Prozess der allmählichen Loslösung in Gang setzen, der ohne diese erstarrt wäre. Besonders dann, wenn Eltern Krisensituationen erlebten und mangelnde Zukunftsperspektiven ihrer Kinder und ihrer Familie vor Augen hatten, konnte sich das „unterstützende Ich“ als hilfreich zeigen, um festgefahrene Beziehungsstrukturen zu lockern und dadurch jene Entwicklung anzuregen, die neue Interessen zum Vorschein bringen und unerwartetes Agieren herbeiführen. Darin besteht auch die Vermittlerfunktion des „unterstützenden Ichs“ dem Kind Kontakte außerhalb zu öffnen, was in die letztgenannte Ebene eingeordnet werden kann (vgl. ebd., S. 90f.). Hier kann die Frühförderperson beispielsweise beim Suchen oder Aufsuchen von Eltern-Kind-Gruppen oder anderen Gemeinschaften, wie z. B. Fussballclub, Kinderchor etc. unterstützen.
Für Eltern kann dies wiederum bedeuten, dass durch den Dialog ihre Vorstellung vom Kind erweitert und vorige Schwierigkeiten unter neuem Licht betrachtet werden können und dadurch Auseinandersetzung und Verarbeitung möglich wird (vgl. ebd., S. 91).
Donald Winnicott bezieht „good enough“ v. a. auf „Muttersein (bzw. Vatersein) [48] “ und verwendet diesen Begriff im Zusammenhang mit dem physischen und psychischen Halten bzw. Haltgeben des Säuglings. Dadurch werden einerseits eine erste Beziehung zum Objekt (Beziehung zur Brust) hergestellt, Erfahrungen von Triebbefriedigung (z. B. Hunger stillen) gesammelt und andererseits kommt es zur „Ich-Organisation (d. h. Verstärkung des Ich´s des Säuglings durch das Ich der Mutter).“ (Winnicott 1974, S. 63)
Dieses Erleben, wird nach Winnicott durch die ausreichend gute mütterliche Fürsorge hergestellt und ist für ihn die Basis für „geistig-seelische Gesundheit des Individuums, im Sinne von Freisein von Psychose oder Psychoseneigung […]“ (ebd.) (vgl. Winnicott 1974, S. 62ff.).
Erfolgt diese Fürsorge und Zuwendung im Übermaß, d. h. reagiert die Mutter stets schon bevor der Säugling Signale äußert, so als ob sie noch verschmolzen wären[49], dann kann es „zu einem Dauerzustand der Regression und der Verschmolzenheit mit der Mutter [kommen, J. Ö.], oder er [der Säugling, J. Ö.] inszeniert eine totale Ablehnung der Mutter, selbst der scheinbar guten Mutter.“ (ebd. S. 66)
Bei einer nicht ausreichenden Fürsorge und Zuwendung bzw. Einfühlung kommt es nach Winnicott hingegen zu einer „Ich-Schwächung“ (ebd. S. 67), folglich zu Symptomen und zur Krankheit des Säuglings (vgl. ebd., S. 66). Dazu führt er weiter aus:
„Wenn die Bemutterung nicht gut genug ist, kann der Säugling nicht mit der Ich-Reifung anfangen oder die Ich-Entwicklung wird in bestimmten lebenswichtigen Aspekten notwendigerweise verzerrt.“ (ebd., S. 74)
Auch Milani Comparetti bezieht sich auf Winnicott und bringt seine Theorie des „good enough“ mit seiner Medizin der Gesundheit und dem ganzheitlichen Entwicklungsverständnis in Verbindung:
„Sowohl ein Zuwenig als auch ein Zuviel an Zuwendung und Förderung können für die Entwicklung des Kindes schädlich sein, entscheidend ist das „good enough“ wie es Winnicott formuliert hat.“ (Straßburg 1995, S. 76)
Wenn Milani Comparetti über ein Zuviel und Zuwenig an Förderung schreibt, so können wir davon ausgehen, dass er dabei einerseits die Quantität, andererseits auch die Qualität der Förderung in den Blick nimmt. Die in Punkt 6.1.2 kennengelernte „schizo-paranoide Position“, mit der er die „perverse Allianz“ in Zusammenhang bringt, kann an dieser Stelle in Erinnerung gerufen und in Bezug gesetzt werden.
Förderung im Sinne von „good enough“ in der Frühförderung setzt von der Frühförderperson ein sensibles Beobachten aus jener Brille, die das Kind in seiner menschlichen Ganzheitlichkeit wahrnimmt, voraus. Zudem bedarf es einer respektvollen, wertschätzenden Haltung gegenüber der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit des Kindes, sodass sich die Frühförderperson in die BegleiterInnen-Rolle begeben kann. In dieser Rolle muss sie in der Lage sein, jenes Einfühlungsvermögen aufzubringen, dass sie zwischen respektvoller Zurückhaltung und doch in angemessener Präsenz vorhanden sein und in den wechselseitigen Dialog treten kann. Unter diesen Voraussetzungen kann meines Erachtens eine begleitende Förderung bzw. Entwicklungsbegleitung stattfinden.
Der Aspekt des „gut genug sein Dürfens“ und „gut genug fördern Könnens“ kann möglicherweise Förderdruck, der auf die Frühförderperson übertragen wird oder den diese auf das Kind und die Familie ausübt, minimiert werden und für alle Beteiligten eine Entlastung darstellen.
Als weiteren Aspekt den wir aus Winnicotts Theorie auf die Frühförderung übertragen können, ist das Schaffen von Bedingungen, die gut genug sind, damit sich das Kind entwickeln kann (vgl. ebd. S. 83). Die Frühförderperson kann den Eltern dabei unterstützend und begleitend zur Seite stehen, wie es in Kapitel 6.2.3 dargestellt wird.
In Bezug auf die Person der jeweiligen TherapeutInnen bzw. ich übertrage dies wieder auch auf die Frühförderperson, folgert Winnicott letztendlich, dass auch diese zur Identifikation, Einfühlung und dadurch zum Verstehen der Bedürfnisse des Kindes und deren Befriedigung fähig sind, allerdings nicht in jenem Ausmaß wie die Mutter (und der Vater) dies tun können. Abschließend bemerkt er:
Wenn das Kind krank ist, besteht eine Krise, und die benötigte Therapie bezieht den Therapeuten persönlich ein, und die Arbeit kann auf keiner anderen Grundlage getan werden.“ (Winnicott 1974, S. 92)
Wenn Winnicott von einem Einbezug der persönlichen Seite der TherapeutInnen, ich beziehe wieder die Frühförderpersonen mit ein, spricht, dann schwingt hier erneut die eigene Haltung des jeweiligen Menschen mit und diese wiederum stellt die Basis für seine Beobachtungen und sein Agieren und Handeln im Zusammensein mit dem Kind und der Familie dar.
Dieses Kapitel spricht speziell die Frühförderperson in ihrer Rolle als Entwicklungs-BegleiterIn an. Anhand exemplarisch ausgewählter Konzepte, die sich in die Arbeit der Frühförderung integrieren lassen und an denen sich die Frühförderperson orientieren kann, soll die BegleiterInnen-Rolle in einem kurzen Überblick dargestellt werden.
Die BegleiterInnen-Rolle[50] im Sinne der Pädagogik nach Emmi Pikler ist keine lehrende, übende oder fördernde, sondern eine zurückhaltende, beobachtende und in Dialog tretende. Die begleitende Person gestaltet den entsprechenden Raum, freut sich gemeinsam mit dem Kind über seine selbstständige Exploration in der Bewegung, sowie alles Neue das gelernt werden konnte. In der Pflege und im Spiel kommentiert sie Handlungen und bereitet das Kind auf neue Handlungen vor[51] (vgl. Pikler 2001, S. 26f.).
Die aufgezeigten Parallelen zum Konzept von Milani Comparetti werden aus diesen Ausführungen (und jenen aus Kapitel 5.2.3) ersichtlich, dennoch äußert sich Milani Comparetti insofern kritisch, als dass er der Meinung ist, Pikler messe der Mutter bzw. den mütterlichen Kompetenzen eine zu geringe Rolle bei (vgl. Straßburg 1995, S. 78).
Sieht sich die Frühförderperson als BegleiterIn im Sinne Pikler´s, dann kann der von Milani Comparetti geäußerte Kritikpunkt für den Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ insofern relativiert werden, als dass die Begleitung sehr wohl auf das Kind und die Eltern ausgerichtet, d. h. auch die Eltern werden begleitet und nicht belehrt und nicht als „kompetenzerweiterungsbedürftig“ angesehen. Zu einer Begleitung der Eltern nach Pikler könnte das Unterstützen beim Herstellen des SpielRaumes, der Austausch gemeinsamer Beobachtungen und so die gemeinsame Erkenntnis von wichtigen Übergangspositionen und Übergangsschritten, ein gemeinsames Anpassen und Gewähren des kindlichen Entwicklungstempos, sowie die Begleitung der Eltern im Setzen von Impulsen darstellen.
Der Pikler-SpielRaum als begleitete Eltern-Kind-Gruppen nach dem pädagogischen Konzept von Emmi Pikler [52]
„Der Pikler-SpielRaum gibt Eltern die Möglichkeit, die Eigenaktivität ihrer Kinder zu beobachten und kennenzulernen. Ihre aufmerksame Anwesenheit und ihr Interesse für das Tun der Kinder schaffen eine Atmosphäre, in der sich diese sicher und wohl fühlen können und Zeit und Raum im freien Spiel beim Erkunden, Ausprobieren und Handhaben geeigneter Materialien genießen.“ (Pichler-Bogner o. A., S. 1)
Das Eingehen auf dieses Konzept erscheint mir deshalb wichtig, da es Grundsätze einer begleitenden mobilen Frühförderung in ein Gruppensetting verpackt und deshalb als eine geeignete Ergänzung zur mobilen Frühförderung darstellen kann. Sowohl die mobile Form, als auch das „SpielRaum-Konzept“ forcieren eine Entwicklungsbegleitung des Kindes, als auch die Begleitung der Eltern. Jedoch erfolgt die Begleitung in der „SpielRaum-Gruppe“ nicht ausschließlich durch die Frühförderperson, sondern Kinder und Eltern begleiten sich auch gegenseitig. Eltern können gemeinsam Beobachtungen anstellen, sich über Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig beraten.
Zudem kann die Gefahr, dass die Familie im häuslichen Raum in abgeschirmter Position verweilt oder/und die aufsuchende Form der „Frühförderung und Familienbegleitung“ als Sonderbehandlung wahrgenommen wird, durch die „SpielRaum-Gruppe“ vermieden werden.
Aus diesem Grunde schließe ich, dass das Konzept des „SpielRaum“ dem geforderten Inklusionsprinzip der UN-Konvention entsprechen kann und eine bedeutende Möglichkeit für die Weiterentwicklung der Frühförderung sein kann.
Damit soll die mobile Form der Frühförderung nicht negiert werden, denn sie hat, wie in Kapitel 4.3 aufgezeigt, auch wichtige Bedeutung (z. B. Begleitung in unmittelbarer Lebenswelt des Kindes, Verringerung von Terminen und das Wegfallen von Fahrtstrecken, Vernetzung im Wohnort usw.) und erfährt dadurch ihre Berechtigung. Dennoch scheint es, dass „Frühförderung und Familienbegleitung“ erst in Ergänzung mit dem „SpielRaum-Konzept“ dem Inklusionsprinzip gerecht werden kann. Aus diesem Grunde kann der „SpielRaum“ als Chance und erstrebenswerte Ergänzung für das Konzept der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“ darstellen, wo Familien je nach Bedarf beide Formen (oder auch nur eine Form) in individuellem Ausmaß beanspruchen und Teil davon sein können.
Auch Ulla Kiesling lehnt Förderkonzepte nach Behandlungsplan ab, sondern forciert - im Sinne Milano Comparetti´s und Emmi Pikler´s - die Rolle der Begleitperson als BeobachterIn und DialogpartnerIn. Auf diese Beobachtungen reagiert sie, gemäß Milani Comparetti, d. h. sie nimmt die Vorschläge auf und entgegnet mit Gegenvorschlägen bzw. auch umgekehrt. Kiesling spricht in diesem Sinne von einem „Nachfrage-Antwort“-Wechselspiel. Die TherapeutInnen oder PädagogInnen haben v. a. zu Beginn eine „In-Dialogt-tretende“ sowie „Dialog-vermittelnde“ Rolle (zwischen Eltern und Kind, Eltern untereinander und Kindern untereinander) und ziehen sich im Laufe der Zeit immer mehr in die BeobachterInnenposition zurück (vgl. Kiesling 2003, S. 43ff.).
[41] Hanni Holthaus, ist eine Mutter eines behinderten Kindes, die ihre Erfahrungen niedergeschrieben hat. Diese sind im Buch von Speck, Otto; Wranke, Andreas (Hrsg.) (1983): Frühförderung mit den Eltern. München: Ernst Reinhardt Veralg, S. 21-24 nachzulesen. Im selben Buch ist ebenso der Brief des Vaters Richard Krais auf S. 25-31 zu finden.
[42] „Der Begriff Rehabilitation wird vorwiegend im medizinischen Kontext verwendet und ist aus dem lateinischen „habilis“ abgeleitet, was so viel wie „fähig“ oder „geschickt“ bedeutet. Habilitation bedeutet daher die Herstellung, Rehabilitation bedeutet wörtlich die Wiederherstellung einer Fähigkeit.“ (Biewer 2009, S. 89) Im Kontext Behinderung wird der Begriff aber nicht in seiner wörtlichen Übersetzung verwendet, sondern auch dann wenn es um den erstmaligen Erwerb von Fähigkeiten geht (vgl. ebd., S. 88f)
[43] Der Begriff „Therapie“ wird im medizinischen Bereich im Sinne von Heilbehandlung verwendet. Therapie wird aber auch z. B. in der Psychologie, aber auch in der Heilpädagogik eingesetzt und zwar immer dann, wenn es quasi um ein Angleichen an die Norm geht. Therapie erfolgt aufgrund einer Ist- Stand Erhebung und einer damit einhergehenden Diagnose (vgl. Biewer 2009, S. 89f.).
[44] „Milani Comparetti benutzt (…) die Terminologie von Melanie Klein. Vgl. hierzu Melanie Klein 1972.“ (Jäger/vonLüpke 1996, S. 17)
[45] Zur Finanzierung der Frühförderung siehe beispielsweise: Sohns, Armin (2002): Die Komplexleistung Frühförderung im Rehabilitationsgesetz. In: Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Hilfen für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder, 21, S. 50-60.
[46] Gabriele Haug-Schnabel beschreibt in ihrem Artikel „Zur Diskussion: Entwicklungsrisiko durch Fehlförderung“ wie aufgrund nicht adäquater Ziele von außen kindliche Entwicklungsprozesse gehemmt, gestört und/oder verhindert werden können. Sie zeigt auf, dass Reifungsprozesse (exemplarisch stellt sie diesen Aspekt mit der Sauberkeitserziehung dar) durch gezielte Fördermaßnahmen nicht beeinflusst werden können und dass ungünstiges Umweltverhalten zu fehlgesteuerten Lernprozessen (aufgezeigt am Beispiel des Einnässens) führen kann (vgl. Haug-Schnabel 1997, S. 96ff.).
[47] Die AutorInnen sprechen deshalb von „Integration“ da sich nach den 70ern, der Zeit der Sonderinstitutionen und Rehabilitationsgedankens, vor allem in Italien erste Konzepte in Richtung (Schul-) Integration entwickelten (vgl. Gidoni/Landi 1990, S. 81ff.).
[48] Er bezieht sich im Kapitel „Die Rolle der mütterlichen Fürsorge“ in seinem Werk „Reifungsprozesse und fördernde Umwelt“ hauptsächlich auf die Mutter, vermerkt jedoch in Klammer immer wieder, dass auch der Vater angesprochen ist (vgl. Winnicott 1974, S. 62ff.).
[49] Winnicott geht von einer ursprünglichen Verschmelzung des Säuglings mit der Mutter ein, die sich erst lösen muss (vgl. Winnicott 1974, S. 66f.).
[50] Pikler spricht deshalb von der begleitenden oder betreuenden Person und nicht von den Eltern, da sie ihr Konzept in dem von ihr im Jahre 1946 begründeten Lozcy Institut umsetzte. In diesem Institut werden Kinder, deren Mütter krank oder verstorben sind, oder Kinder die aus anderen Gründen nicht in ihrer Familie aufwachsen können, langzeitig bis zu drei Jahren betreut (vgl. Pickler 2001, S. 23).
Wenn ich in den Ausführungen von BegleiterInnen spreche, so beziehe ich dabei die Eltern und auch die Frühförderpersonen mit ein.
[51] Ausführlich wird dies beschrieben in: Pikler, Emmi et. al. (2002): Miteinander vertraut werden. Erfahrungen und Gedanken zur Pflege von Säuglingen und Kleinkindern. 3. Aufl. Freiamt: Arbor Verlag.
[52] Siehe dazu auf der Homepage der Pikler-Hengstenberg-Gesellschaft: http://www.pikler-hengstenberg.at/pikler-spielgruppen-spielraum/spielgruppen.htm (Stand 2013-05-04), den Artikel von Daniela Pichler-Bogner „Der Pikler-SpielRaum: Begleitete Eltern-Kind-Gruppe nach dem pädagogischen Konzept von Emmi Pikler“: http://www.pikler-hengstenberg.at/pdf/Pikler-SpielRaum.pdf. (Stand 2013-05-04) sowie die Diplomarbeit „Gebt mir Raum und lasst mir Zeit“ – die Pädagogik Emmi Piklers am Beispiel des SpielRaum für Bewegung von Beate Klausner-Walter (siehe Literaturverzeichnis).
Gemäß des gewählten Themas und Inhalts meiner Bachelorarbeit sollte auch in deren Bearbeitung, nicht die Methode dominiert, sondern wie die Bearbeitung des Themas und die darin stattgefundene Entwicklung geschehen konnte, um letzten Endes die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantworten zu können.
Dennoch ist das Wissen und die Auswahl der geeigneten Methode wichtig, um nicht in der Orientierungslosigkeit zu enden, einen roten Faden zu verfolgen, das eigene Tun - in diesem Fall das wissenschaftliche Arbeiten - einordnen zu können, nachvollziehbar zu machen und schließlich zu einem Ergebnis kommen zu können.
Um diese Arbeit zu verfassen, wählte ich wie eingangs erwähnt, die Methode der Literaturrecherche. Den Ausgangspunkt dazu stellte die in der Einleitung formulierte wissenschaftliche Fragestellung dar. Das Forschungsmaterial bildeten die entsprechend ausgewählten Texte und Theorieansätze verschiedener AutorInnen, die auf ihre Positionen kritisch reflektiert, miteinander verglichen, analysiert und mit eigenen Gedanken ergänzt wurden.
Die theoretische Bearbeitung wurde zudem mit eigenen Gedächtnisprotokollen aus dem Praxisfeld der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“ und deren Analyse angereichert. Diese Methodenelemente wurden in Anlehnung an die sog. Handlungsforschung oder Aktionsforschung[53] durchgeführt, bzw. kommen dieser Forschungsmethode in Ansätzen am nächsten.
Da Aktionsforschung besonders im Bereich der Schulforschung angewendet wurde bzw. wird und der Erfahrungsschatz dort möglichst groß zu sein scheint, beziehe ich mich hauptsächlich auf das Werk von Altrichter und Posch „Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht“ und adaptiere ihre Ausführungen auf den Bereich „Frühförderung und Familienbegleitung“.
Die genannten Autoren zitieren John Elliott, der diese Forschungsmethode folgendermaßen definiert:
„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern [bzw. fachlich tätigen Personen, u. a. auch FrühförderInnen und FamilienbegleiterInnen, J. Ö.] selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.“[54] (Elliott 1981, S. 1 zit. nach Altrichter/Posch 2007, S. 13)
Ziel derartiger Forschung soll einerseits die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des betreffenden Praxisfeldes - in meinem Fall der „Frühförderung und Familienbegleitung“ - sein, andererseits auch die Erweiterung des Wissens und der beruflichen Kompetenz der PädagogInnen bzw. meiner eigenen als Frühförderin und Familienbegleiterin. Aber auch die Weitergabe der gewonnenen und in schriftliche Form gebrachten Kenntnisse an interessierte Eltern oder KollegInnen kann ein zusätzliches Ziel darstellen (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 13f.).
Altrichter und Posch beschreiben Lehrpersonen, die Aktionsforschung angestellt haben als reflektierte und reflektierende Personen, die sich an den positiven Seiten ihres Berufes erfreuen und nicht zufriedenstellende oder problematische Seiten nicht einfach hinnehmen, sondern verändern wollen. Der Reflexion des eigenen Handelns und der eigenen Einstellung kommt deshalb besondere Bedeutung zu, um nicht in der Erstarrung zu verharren, sondern für Änderungen offen zu sein (vgl. ebd., S. 13f.).
An diese Beschreibung möchte ich mich in Bezug auf meine Motivation zur Hinzunahme und Analyse von Gedächtnisprotokollen aus meinem Arbeitsfeld anlehnen, da sie u. a. den Wunsch und die Möglichkeit nach einem Überdenken des eigenen Standpunktes und der eigenen beruflichen, fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung impliziert.
Meine Gedächtnisprotokolle beschreiben eigene Erfahrungen, Situationen und Beobachtungen, die ich in meiner Rolle als Frühförderin und Familienbegleiterin machte. Sie basieren auf meinen Nachbereitungen, die direkt im Anschluss an die Frühförderzeit mit dem Kind, oder nach einem Gespräch mit Eltern oder „Fachpersonen“ in schriftlicher Form reflektiert wurden. Dabei erscheint es mir wichtig zu erwähnen, dass in jenen Momenten, in denen ich die Nachbereitung aufzeichnete, noch nicht wusste, dass ich diese zu einem späteren Zeitpunkt für wissenschaftliche Zwecke wieder gebrauchen würde. Somit hatte ich zwar schriftliche Dokumente in der Hand, die jedoch nicht auf systematische Weise (wie es vielleicht in Form eines Forschungstagebuches[55] geschehen hätte können) entstanden sind und auch für den Rahmen dieser Arbeit nicht die entsprechende (Ausdrucks-) Form aufwiesen. Diese Schwierigkeiten veranlassten mich, zum Zweck der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit, die Protokolle für die vorliegende Arbeit formell und ausdrucksmäßig umzuformulieren. In ihrem Inhalt und ihrer Sinnhaftigkeit wurden sie jedoch nicht verändert. Dabei war ich mir jener Gefahr bewusst, dass unbeabsichtigte Veränderungen möglicherweise trotzdem zustande kommen könnten, was wiederum eine veränderte Praxisdarstellung zur Folge hätte.
Dieses Problem tritt auch in der Aktionsforschung auf. Nach Altrichter und Posch weisen bereits vorliegende Daten zwar jene Stärken auf, dass ihnen meist höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, da sie unabhängig vom Forschungsprozess entstanden sind. Aber auch dass sie unter geringerem Zeitaufwand entstanden sind. Ihre Nachteile liegen darin, dass sie meist mehr Informationen enthalten, als dass sie von anderen, möglicherweise nicht mehr nachzukonstruierenden Bedingungen beeinflusst sein könnten. Dies kann die Interpretation erschweren und zu möglichen Interpretationsfehlern, verursacht u. a. durch Auslassungen, Fehlern und Vorurteilen führen. Um diese Gefahr zu verringern, empfehlen Altrichter und Posch das Hinzuziehen von weiteren Methoden der Datensammlung (vgl. ebd., S. 127f.).
Die Autoren greifen das Thema der Beobachtung auch unter jenen Aspekten auf, die diese verändern und beeinflussen können. Sie schreiben von „Diffusität“, „Vorurteilsbehaftetheit“ und von „Flüchtigkeit“ (ebd., S. 128), die sich bei einer Beobachtung ergeben können. Für eine möglichst ganzheitliche Beobachtung brauche es nach ihnen einen „Blick für die ganze Situation“ (ebd.) (sie nennen dies auch das intuitive „Sehen“), sowie die gezielte Prozessbeobachtung. Beide Formen sollten einander ergänzen und korrigieren, um letzten Endes die aufgezählten Schwierigkeiten verringern zu können (vgl. ebd., S. 128).
Auch meine eigenen Beobachtungen, Eindrücke und Erfahrungen, stellen jeweils meine subjektive Sicht der Wirklichkeit dar.
Gütekriterien in der Aktionsforschung werden auf jene Weise überprüft, „[i]ndem auf einen Forschungsprozess ein zweiter darüber gelegt wird“ [56] (ebd., S. 117). Dies folgt nach Prengel aus folgendem Grund:
„Unsere durch Standort und Wahrnehmungsmodus bedingte Perspektive ermöglicht und begrenzt zugleich unsere Erkenntnisse. Jenseits perspektivischer Begrenztheit und ohne das Bemühen um freilich immer vorläufig bleibende Entgrenzungen ist keine Erkenntnis möglich.“ (Prengel 2003, S. 611 zit. nach Altrichter/Posch 2007, S. 118)
Deshalb können weitere Perspektiven (durch andere Personen, andere Forschungsmethoden und aus Untersuchungen anderer, aber ähnlicher Situationen) helfen, eine eher vollständigere Wahrnehmung (jedoch auch hier in Begrenzung) zu erhalten (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 118).
Weiters möchte ich anmerken, dass sich manche Protokolle auf kurze Zeit- und Beobachtungssequenzen beziehen (beispielsweise das Protokoll mit Michael und der Schneckenhandpuppe in Kapitel 5.2.3) und andere einen weiteren Prozess in längerem Zeitraum über Monate oder Jahre verlaufend beschreiben (beispielsweise das Protokoll mit Eva und mir und dem „wiedergefundenen“ Dialog in Kapitel 5.2.3). Bei der Niederschrift der Protokolle variierte anfänglich die gewählte Zeitform (Präsens und Präteritum) in der die Protokolle verfasst wurden. Einerseits geschah dies, um sie den LeserInnen möglichst nachvollziehbar zu machen. Andererseits auch aufgrund einer teilweisen Vermischung von Reflexion und Analyse. Diese Vermischung geschah an manchen Stellen bewusst, da sie den Inhalt der Protokolle deutlicher zum Ausdruck brachten und ich es als sinnvoll ansah, einen direkten Theoriebezug anzustellen. An anderen Stellen geschah die Vermischung unbewusst, was auf eigene Unsicherheiten in der Methodenanwendung, aber v. a. durch die mögliche fehlende oder zu gering vorhandene Distanz von Theorie und Praxis bzw. auch aufgrund der Vermischung meiner Rollen als Forscherin und Praktikerin zurückzuführen sein kann. Erst in der Überarbeitung wurden die Protokolle auf eine einheitliche Zeitform angepasst. Das letztgenannte Problem war mir zwar als eventuell auftretende und zu beachtende Gefahr bewusst, dennoch konnte ich an manchen Stellen eine mögliche Vermischung vielleicht aufgrund „blinder“ Flecken, angestellter Vermutungen oder eigener Anteile (Übertragungen/Gegenübertragungen) nicht erkennen.
Aus diesem Grunde könnte die Hinzunahme einer weiteren Forschungsmethode nützlich sein, wie es beispielsweise Köll-Senn durchführte, indem sie Elementen der psychoanalytisch orientierten Sozialforschung zur Auswertung anwendete. Gerade in dieser Methode sind Übertragung und Gegenübertragung der ForscherInnen Teil der Analyse (vgl. Köll- Senn 2003, S. 196f.).
Die oben erwähnten Schwierigkeiten werden auch von Altrichter und Posch in Bezug auf die Aktionsforschung aufgegriffen. Sie erkennen, dass „eine gewisse Distanzierung von der Situation, zu der man selbst gehört“ (Altrichter/Posch 2007, S. 135), als Voraussetzung gilt, um „das Unerwartete und Ungewöhnliche im Alltäglichen und Normalen zu entdecken“ (ebd.) und gerade dazu können möglicherweise Lehrende bzw. Frühförderpersonen direkt in ihrer beruflichen Situation nicht (immer) in der Lage sein. Aus diesem Grunde empfehlen auch sie das Hinzunehmen einer weiteren Wahrnehmung durch eine dritte Person und einer anderen Perspektive (vgl. ebd., S. 135f.).
Dieser Kritikpunkt trifft insofern auch auf meine Situation zu, als dass ich parallel zur Erfassung dieser Bachelorarbeit im Arbeitsfeld „Frühförderung und Familienbegleitung“ tätig bin, also auch eine Vermischung oder auch Ergänzung und Anreicherung von Praxis und Wissenschaft in meinem täglichen Leben stattfindet. An dieser Stelle möchte ich jedoch wieder darauf hinweisen und damit den Kritikpunkt relativieren, dass die Nachbereitungen noch vor und nicht im Wissen, dass diese zur wissenschaftlichen Verwendung dienen sollten, entstanden sind, wie bereits oben erwähnt wurde. Dadurch kann ich zu behaupten wagen, dass ich als Praktikerin zum damaligen Zeitpunkt nicht durch die Forscherinnen-Rolle beeinflusst wurde. Was die entgegengesetzte Richtung betrifft, nämlich die Distanz der Forscherin zur Praxis, so kann ich, wie bereits erwähnt, keine Gewähr leisten, außer dass ich versucht habe, die beiden Bereiche bzw. Rollen für mich zu trennen.
Eine alternative Möglichkeit für weiterführende Aktions- oder Handlungsforschung in einer ähnlichen Situation, wo der Faktor Distanz möglicherweise eher gewahrt werden könnte, wäre die Analyse von schriftlichen Nachbereitungen von anderen Frühförderpersonen (die ich nicht kenne oder die in einer anderen Institution tätig sind). Außerdem würde ich für weiterführende Forschung im Sinne der Aktionsforschung, meine KollegInnen und auch Elternteile, zwecks weiterer Perspektiven und Wahrnehmungen stärker mit einbinden.
Was ethische Grundsätze angeht, so habe ich für diese Arbeit, wie eingangs angedeutet, die Namen der Kinder sowie in manchen Protokollen auch das Geschlecht der Kinder verändert und Situationen durch Weglassen oder Veränderungen so formuliert, dass die Anonymität der Kinder, Familien sowie anderen fachlich Tätigen gewahrt werden konnte, weshalb ich die Verwendung der Gedächtnisprotokolle vertreten konnte. Da diese Protokolle meine eigenen sind, erübrigte sich das Einholen des Einverständnisses der Protokollantin. Was das Aushandeln und Informieren aller Betroffenen[57] im Forschungs- und Veränderungsvorhaben betrifft, konnte ich in meinem Falle nicht anstellen. Diesen Punkt sah ich aber auch nicht als notwendig an, da die Gedächtnisprotokolle die Theoriearbeit anreichern, aber ich nicht eine nach Altrichter und Posch verstandene Aktionsforschung betrieben habe. Sollte dies eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, dann wären hier sowohl die Familien, als auch meine KollegInnen, VernetzungspartnerInnen und meine vorgesetzten Personen zu verständigen, bzw. deren Einverständnis einzuholen (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 122f.).
[53] In den weiteren Ausführungen halte ich mich in Anlehnung an Altrichter und Posch an den Begriff „Aktionsforschung“.
[54] Altrichter und Posch übersetzen John Elliott von der englischsprachigen Version ins Deutsche (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 13).
[55] Das Schreiben eines Forschungstagebuches stellt in der Aktionsforschung eine Begleitfunktion zum Forschungsprozess dar (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 30ff.). Dazu schreiben Altrichter und Posch im zweiten Kapitel ihres Buches „Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht“ auf S. 30-51 (siehe Literaturverzeichnis).
[56] „Bei der Objektivitätsprüfung werden die Beobachtungen einer zweiten Beobachtungsperson, bei der Reliabilitätsprüfung eine zweite Beobachtung zu einem anderen Zeitpunkt und bei der Validitätsprüfung ein methodisch unabhängiger Forschungsprozess über den ursprünglichen `darüber gelegt`.“ (Altrichter/Posch 2007, S. 117)
[57] Altrichter und Posch verwenden bewusst den recht weiten Begriff der „Betroffenen“ um zu verdeutlichen, da sich diese Gruppe aus direkt und indirekt betroffen zusammensetzt und oft auch erst im Laufe des Forschungsprozesses herausstellt, wer zu den Betroffenen noch zusätzlich hinzu gezählt werden muss (vgl. Altrichter/Posch 2007, S. 122f.).
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Kinderrechtskonvention fordern dezidiert das Recht jeden Kindes auf Selbstbestimmung und Eigenaktivität, sowie den Respekt vor dem individuellen Entwicklungstempo des Kindes. Alle pädagogisch Tätigen, eben auch Frühförderpersonen und FamilienbegleiterInnen, sind aufgefordert sich einerseits mit dem Begriff „Behinderung“ und dessen Verständnis, sowie andererseits mit den UN-Postulaten und deren eigenen Haltungen, Einstellungen und Arbeitsweisen kontinuierlich auseinander zu setzen und selbstreflexiv tätig zu sein, um nicht auf einem Standpunkt stehen zu bleiben, sondern um sich und die eigene Arbeitsweise weiter zu entwickeln.
Die Hinzuziehung psychoanalytischer Theorien konnte Aufschluss darüber geben, warum und wie „Behinderung“ zustande kommen kann und welche eigenen Ängste und Abwehrtendenzen von Frühförderpersonen und FamilienbegleiterInnen Handlungsweisen und Interaktionen unter Umständen stören oder hemmen können. Im Wissen der psychoanalytischen Ansätze können Eltern von der Frühförderperson möglicherweise besser verstanden und dadurch auch entsprechender begleitet werden.
Seit ihrer Entstehung bis in die heutige Zeit hat die Frühförderung eine stete Entwicklung ihres Angebots, ihren Grundprinzipien und Zielen durchlaufen, was auch auf einen Wandel im Entwicklungsverständnis zurückzuführen ist. So wirkt sich die Auseinandersetzung mit dem Begriff und dem Verständnis von „Entwicklung“ auf die Haltung und den Blickwinkel, von dem aus beobachtet wird, sowie auf die Arbeit mit dem Kind und seiner Familie aus.
Von ursprünglichen medizinisch-therapeutisch, sowie heil- und sonderpädagogisch ausgerichteten Ansätzen der Frühförderung, mit einem linearen Entwicklungsverständnis inne, wurde der Fokus v. a. auf den Aspekt des Förderns gelegt, um einen Ausgleich bzw. ein Verbessern der „Defizite“ beim Kind bzw. das Angleichen an die vorgegebene Norm zu erzielen. Es wurde dargestellt, dass derartige isolierte und funktionale „Förderarbeit“ in der Frühförderung nicht befriedigend für das Kind und seine Familie sein können. Denn ohne den stattfindenden Dialog und die damit einhergehende Beziehung kann eine Begleitung nicht entsprechend möglich werden.
Die Entwicklung der Frühförderung geht weiter bis hin zu Frühförder-Ansätzen, die von einem nicht-linearen Entwicklungsverständnis ausgehen. Dabei kann insbesondere der von Milani Comparetti aufgezeigte und gelebte Ansatz einer „Entwicklungsförderung im Dialog“ Möglichkeiten für die Frühförderung öffnen, unter denen die Beobachtung und der Dialog mit dem Kind zu zentralen Punkten in der Entwicklungsförderung bzw. -begleitung werden. Erst unter diesem Blick kann ein Perspektivenwechsel, der von gezielten Fördermaßnahmen und definierten Förderzielen hin zu einer dialogischen Begleitung der kindlichen Entwicklung stattfinden, wo nach Milani Comparetti die „Normalität der Gesundheit“ im Mittelpunkt steht. Bei einer solchen Begleitung stellt das Kind die Hauptperson und die begleitende Person die Nebenrolle dar. Auch die Begleitung der Eltern, sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen fachlich tätigen Personen geschehen stets in Ausrichtung auf das Kind und seinem möglichst Besten. Ein Entwicklungsverständnis einer begleitenden Frühförderung impliziert zudem, dass Ziele vom Kind und nicht von der Frühförderperson definiert werden.
Unter diesen Punkten kann die Frage aufkommen, ob die Bezeichnung „Früh-Förderung“ überhaupt noch aktuell ist? Doch geht mit einer veränderten Bezeichnung des Angebots, wie beispielsweise „Früh-Begleitung“ oder „Entwicklungsbegleitung“ gleichzeitig eine veränderte Haltung, Sicht - und Arbeitsweise der jeweiligen Frühförderperson mit einher? Im Anschluss an die abgehandelten Kapitel kann daraufhin geantwortet werden, dass der entscheidende Punkt nicht die Worte der Bezeichnung sind, sondern was die Frühförderperson und die/der FrühbegleiterIn unter „Förderung“ und „fördern“ versteht, wie und auf welche Weise sie/er das Kind in seiner Entwicklung betrachtet und fördert bzw. begleitet.
Weiterführende Themen und offene Fragen beziehen sich auf einen notwendigen und noch ausstehenden Perspektivenwechsel auf der politischen Ebene, besonders in Bezug auf die Finanzierung der „Frühförderung und Familienbegleitung“. Dazu stellt sich die Frage, wie eine andere offenere Regelung zustande kommen könnte, ohne dass Kinder schriftliche Diagnosebescheide vorweisen müssen, um das Angebot beanspruchen zu können?
Ein weiterer Punkt betrifft die Frühförder-Ausbildungssituation, denn darin wird mitunter eine Basis für die zukünftige Arbeit mit dem Kind und der Familie gelegt. Die Frage die dabei zu stellen wäre, ist jene, die den Blick nach der aktuellen Ausbildungssituation in Österreich ausrichtet und darauf ausgelegt ist, nach dem zugrundeliegenden Menschenbild und dem einhergehenden Entwicklungsverständnis zu fragen. Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, wäre jene ob in der Ausbildung auch psychoanalytische Ansätze aufgezeigt werden, welche als Unterstützung der Auseinandersetzung mit eigenen Abwehrtendenzen gesehen werden könnten und die Selbstreflexion der Auszubildenden anregen, sie dazu zu ermuntern und ermutigen könnten?
Aber auch in Bezug auf Arbeitsbedingungen von Frühförderpersonen, wo nach Grenzen und Ressourcen Ausschau gehalten wird, die eine entwicklungsbegleitende Frühförderung behindern bzw. möglich machen, könnte eine weiterführende „Frage-Richtung“ darstellen.
Zusammengefasst kann formuliert werden, dass ein nicht-lineares Entwicklungsverständnis, welches von der Eigenaktivität, Selbstbestimmung und dem Dialog ausgeht, es möglich macht, die kindlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und dadurch eine positive Beziehung aufgebaut und aufrecht erhalten werden kann, welche die Basis für die Entwicklungsbegleitung in der Frühförderung darstellt.
Die Rolle der Frühförderperson als Entwicklungs-BegleiterIn erfordert die entsprechende Sensibilität, Beobachtungs- und Dialog-, sowie Kommunikationsfähigkeit, sowie das Können ihre fachlichen Kompetenzen in der Begleitung in angemessener Weise einfließen zu lassen. Dazu braucht es, von Seiten der Frühförderpersonen und FamilienbegleiterInnen, wie erwähnt, anhaltende Reflexionen ihrer Arbeitsweise, Selbstreflexion, Weiterbildung und Weiterentwicklung, um der Gefahr, Ziele und Förderangebote einfach überzustülpen, auszuweichen.
Unter all den aufgezeigten Aspekten, die ein nicht-lineares Entwicklungsverständnis beinhalten, sowie unter all den oben genannten Fähigkeiten, die eine begleitende Frühförderperson im Sinne Winnicott´s „good enough“ aufzubringen vermag, kann eine dialogische Entwicklungsbegleitung im Rahmen der „Frühförderung und Familienbegleitung“ stattfindenden und somit der Weg der Inklusion gegangen werden. In diesem Sinne kann der Bogen zum Ausgangszitat dieser Arbeit
„Der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt.“ (Dannenbeck/Dorrance 2011, S. 208) geschlossen werden.
Altrichter, Herbert; Posch, Peter (2007): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung. 4. Aufl. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Aly, Monika; Lüpke, Hans von (1986): Nachruf für Professor Adriano Milani Comparetti. In: Janssen, Edda; Lüpke, Hans von (Hrsg.): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti (1985). Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani´ (1995). 2. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Mattes Verlag, S. 13-15. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/janssen-milani_vorwort.html (Stand 2013-06-27).
Aly, Monika (1997): Verzögerte Entwicklung – Überlegungen zur therapeutischen Begleitung und Behandlung von Kindern mit leichten Entwicklungsstörungen. In: Lüpke von, Hans von; Voß, Reinhard (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus- Verlagsgesellschaft, S. 109-119. Online im Internet: URL http://bidok.uibk.ac.at/library/aly-netzwerk_entwicklung.html (1994) (Stand 2013-06-27).
Ayres, Jean (1992): Bausteine der kindlichen Entwicklung. Berlin: Springer-Verlag.
Bibliographisches Institut GmbH (2013): Duden. Online im Internet: URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/Phantasma (Stand 2013-03-30).
Bierbach, Eva-Maria; Steinebach Christoph (1992): Grundbegriffe der Frühförderung. In: Finger, Gertraud; Steinebach, Christoph: Frühförderung. Zwischen passionierter Praxis und hilfloser Theorie. Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag, S. 42-49.
Biewer, Gottfried (2009): Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
CRC (1990): UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Online im Internet: URL: http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/un-konvention_ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf (Stand: 2013-05-18).
Dannenbeck, Clemens; Dorrance, Carmen (2011): Inklusion in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit – ein Fortbildungsmodul. In: Menschenrechte Integration Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Bad Hellbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 205-211.
Drosdowski, Günther (Hrsg.) (1989): Duden Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bd. 7. 2. Aufl. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag.
Eberwein, Hans (1997): Förderdiagnostik als ganzheitlicher Ansatz sonderpädagogischen Handelns. In: Lüpke, Hans von; Voß, Reinhard (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemischen Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, S. 142-151.
Elbert, Johannes (1982): Geistige Behinderung – Formierungsprozesse und Akte der Gegenwehr. In: Kasztantowiez, U. (Hrsg.): Wege aus der Isolation – Konzepte und Analysen der Integration Behinderter in Dänemark, Norwegen, Italien und Frankreich. O. A: G. Schindle Verlag, S. 1-46. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/elbert-formierungsprozesse.html (Stand 2013-04-19).
Flieger, Petra; Schönwiese, Volker (2011): Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Eine Herausforderung für die Integrations- und Inklusionsforschung. In: Menschenrechte Integration Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Bad Hellbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 27-35. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/download/inhaltsverzeichnis.pdf (Stand 2013-06-27).
Foucault, Michael (1988): Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frankfurt: Fischer Wissenschaft.
Gidoni, Anna E.; Landi Nerina (1989): Therapie und Pädagogik ohne Aussonderung. Italienische Erfahrungen. In: TAFIE (Hrsg.): Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. 5. Gesamtösterreichisches Symposium 1989. Innsbruck: Autoreneigenverlag der TAK, S. 77-94. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gidoni-italien.html (Stand 2013-06-27).
Haug-Schnabel, Gabriele (1997): Zur Diskussion: Entwicklungsrisiko durch Fehlförderung. In: Lüpke, Hans von; Voß, Reinhard (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus- Verlagsgesellschaft, S. 96-108.
Hierdeis, Helmwart (2010): Autonomie. Online im Internet: URL: http://www.inklusion-lexikon.de/Autonomie_Hierdeis.php (Stand 2013-03-30).
Horney, Walter; Ruppert, Johann Peter; Schultze, Walter (1970): Pädagogisches Lexikon. A-J. Bd. 1. Gütersloh: Bertelsmann Fachverlag.
Höck, Sabine (2001): Entwicklungsbegleitende Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Hilfen für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder, 20, S. 126-132.
Huschke-Rhein, Rolf (1997): Entwicklung als Aufgabe ökosystemischer Selbststeuerung. In: Lüpke, Hans v.; Voß, Reinhard (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus- Verlagsgesellschaft, S. 22-40. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/huschke-netzwerk_entwicklung.html (1994) (Stand 2013-06-27).
Janssen, Edda (1986): Einleitung. In: Janssen, Edda; Lüpke, Hans von (Hrsg.): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti (1985). Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani´ (1995). 2. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Mattes Verlag, S. 9-12. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/janssen-milani_vorwort.html#idp861040 (Stand 2013-06-27).
Jäger, Eckhard (1986): Einige Konsequenzen für die Praxis-Ausschnitte aus den Diskussionen. In: Janssen, Edda; Lüpke, Hans von (Hrsg.): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti (1985). Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani´ (1995). 2. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Mattes Verlag, S. 46-53. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/jaeger-milani_diskussion.html (Stand 2013-06-27).
Kiesling, Ulla (2003): Sensorische Integration im Dialog. Verstehen lernen und helfen, ins Gleichgewicht kommen. 4. Aufl. Dortmund: verlag modernes lernen.
Klauer, Karl, Josef (1992): Grundriß der Sonderpädagogik. Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiss.
Klausner-Walter, Beate (2008): „Gebt mir Raum und lasst mir Zeit“ – die Pädagogik Emmi Piklers am Beispiel des SpielRaum für Bewegung. Innsbruck, Univ., Dipl.-Arb. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/klausner-spielraum-dipl.html (Stand 2013-06-27).
Klöck, Irene; Schorer, Caroline (2011): Übungssammlung Frühförderung. Kinder von 0-6 heilpädagogisch fördern. 2. Aufl. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Köll-Senn, Cornelia (2003): Gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin. Innsbruck, Univ., Dipl.-Arb. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/koell-senn-familienbegleitung.html (Stand 2013-07-27).
Leyendecker Christoph (2008): Der Weg von der Behandlung zum gemeinsamen Handeln. In: Leyendecker, Christoph (Hrsg.): Gemeinsam handeln statt behandeln. Aufgaben und Perspektiven der Komplexleistung Frühförderung. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag, S. 22-33.
Lüpke, Hans von; Voß, Reinhard (1993): Einleitung. Entwicklung im Netzwerk – im Netzwerk der Entwicklung. In: Lüpke, Hans von; Voß, Reinhard (1997): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung. 2. Aufl. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, S. 1-9. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/luepke_voss-netzwerk_einleitung.html#idp745776 (1994) (Stand 2013-06-27).
Lüpke, Hans von (1986): Die vielfältigen Dimensionen des Dialogs. In: Janssen, Edda; Lüpke, Hans von (Hrsg.) (1986): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti (1985). Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani´ (1995). 2. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Mattes Verlag, S. 65-71. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/luepke-milani_dimensionen.html#idp102176 (Stand 2013-06-27).
Müller, Wolfgang (1985): Duden. Das Bedeutungswörterbuch. 2. Aufl. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag.
Niedecken, Dietmut (2003): Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. 4. Aufl. Neuwied, Kriftel, Berlin: Beltz Verlag.
Ohlmeier, Gertrud (1997): Frühförderung behinderter Kinder. 3. Aufl. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
Pichler-Bogner, Daniela (o. A.): Der Pikler-SpielRaum: Begleitete Eltern-Kind-Gruppe nach dem pädagogischen Konzept von Emmi Pikler. Online im Internet: URL: http://www.pikler-hengstenberg.at/pdf/Pikler-SpielRaum.pdf (Stand 2013-05-04).
Pikler, Emmi (2001): Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen. 3. Aufl. München: Pflaum.
Pikler, Emmi et. al. (2002): Miteinander vertraut werden. Erfahrungen und Gedanken zur Pflege von Säuglingen und Kleinkindern. 3. Aufl. Freiamt: Arbor Verlag.
Pikler-Hengstenberg-Gesellschaft Österreich (2004): Pikler-Hengstenberg-Gesellschaft. Verein zur Unterstützung von selbstbestimmtem Lernen und einem respektvollen Umgang mit Kindern, Erwachsenen und sich selbst. Online im Internet: URL: http://www.pikler-hengstenberg.at/pikler-spielgruppen-spielraum/spielgruppen.htm (Stand 2013-05-04).
Pretis, Manfred (2000): Frühförderung als Entwicklungschance. In: Hovorka, Hans; Sigot, Marion (Hrsg.): Integration(spädagogik) am Prüfstand. Menschen mit Behinderungen außerhalb von Schule. Innsbruck, Wien, München: Studien Verlag, S. 113-155.
Pretis, Manfred (2001): Frühförderung planen durchführen evaluieren. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Roser, Ludwig-Otto (1998a): Ein unbequemer Mensch. Erinnerungen an Prof. Dr. Adriano Milani- Comparetti. In: Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto Roser. Neuwied, Kriftel, Berlin: Hermann Luchterhand Verlag, S. 117-122. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-normalitaet.html#idp9237872 (Stand 2013-06-27).
Roser, Ludwig-Otto (1998b): Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der Lebenswelt behinderter Menschen. In: Schöler, Jutta (Hrsg.): Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto Roser. Neuwied, Kriftel, Berlin: Hermann Luchterhand Verlag, S. 169-182. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-normalitaet.html#idp9572096 (Stand 2013-06-27).
Schöler, Jutta (1987): „Italienische Verhältnisse“ insbesondere in den Schulen von Florenz. Berlin: Klaus Guhl. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-italienische1.html#idp11156304 (Stand 2013-06-25).
Schönwiese, Volker (2011/12): Grundlagen integrativer/inklusiver Pädagogik. Skriptum zur Lehrveranstaltung. Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck, S. 1-127.
Schulze, Marianne (2011): Menschenrechte für alle: Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In: Menschenrechte Integration Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Bad Hellbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 11-25. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schulze-menschenrechte.html (Stand 2013-06-27).
Sohns, Armin (2002): Die Komplexleistung Frühförderung im Rehabilitationsgesetz. In: Frühförderung interdisziplinär. Zeitschrift für Praxis und Theorie der frühen Hilfen für behinderte und entwicklungsauffällige Kinder, 21, S. 50-60.
Sohns, Armin (2010): Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel. Stuttgart: Kohlhammer.
Speck, Otto; Wranke, Andreas (Hrsg.) (1983): Frühförderung mit den Eltern. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Speck, Otto (1988): System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Steinebach, Christoph (1992): Entwicklungslinien. Vom kindzentrierten Üben zur systemischen Frühförderung. In: Finger, Gertraud; Steinebach, Christoph: Frühförderung. Zwischen passionierter Praxis und hilfloser Theorie. Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag, S. 50-63.
Steinebach, Christoph (1995) Familienentwicklung in der Frühförderung. Die Sicht der Mütter. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
Straßburg, Hans-Michael (1995): Konsequenzen des Milani-Konzeptes für die heutige interdisziplinäre Betreuung von Kindern mit Entwicklungsstörungen. In: Janssen, Edda; Lüpke, Hans von (Hrsg.): Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit. Konzept einer am Kind orientierten Gesundheitsförderung von Prof. Adriano Milani Comparetti (1985). Entwicklungsförderung im Dialog. Überprüfung des gegenwärtigen Stands von Praxis und Forschung an der `Leitlinie Milani´ (1995). 2. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Mattes Verlag, S. 72-85. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/strassburg-milani_konsequenzen.html (1996) (Stand 2013-06-27).
Straßmeier, Walter (1981): Frühförderung konkret. 206 lebenspraktische Übungen für entwicklungsverzögerte und behinderte Kinder. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Thurmair, Martin; Naggl, Monika (2000): Praxis der Frühförderung. Einführung in ein internationales Arbeitsfeld. München, Basel: Ernst Reinhardt.
Waldschmidt, Anne (2005): Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? In: Psychologie und Gesellschaftskritik, 1, S. 9-31. Online im Internet: URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/waldschmidt-modell.html (Stand 2013-06-27).
Winnicott, Donnald W. (1974): Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. München: Kindler Verlag.
|
z. T. |
zum Teil |
|
v. a. |
vor allem |
|
u. a. |
unter anderem |
|
d. h. |
das heißt |
|
sog. |
sogenannte |
|
Jhd. |
Jahrhundert |
|
vgl. |
vergleiche |
|
z. B. |
zum Beispiel |
|
bzw. |
beziehungsweise |
„Kriterien der Normalität (Nach Noferi 1977) [bzw. die „Indices der Verhaltens- und Bewegungsweisen“ nach Milani Comparetti 1982; J. Ö.][58]
Bewertung des Verhaltens als Ausdruck von Beziehungen
1- 2 Wochen: Wechsel zwischen Schlafen und Wachsein. Weinen und Sich-trösten-lassen (Körperkontakt, Stimme, Nuckeln). Nimmt Blickkontakt mit der Mutter während des Trinkens auf.
1 Monat: Rhythmischer Wechsel zwischen Schlafen und Wachsein, Weinen und Sich-trösten-lassen. Beginnende Fähigkeit, sich selbst oral zu trösten. Lächelt ein menschliches Gesicht an, das in seine Nähe kommt. Zeigt Aufmerksamkeit für Personen in Bewegung und für Töne. Erkennt den Zeitpunkt der Ernährung wieder.
2- ½ Monate: Rhythmischer Wechsel zwischen Schlafen und Wachsein. Weinen und sich-trösten-lassen; akzeptiert unterschiedliche Arten der Tröstung, lacht bei Zärtlichkeiten, erkennt Situationen wieder, die es regelmäßig erlebt (Nahrung, Ausgehen, Trockenlegen). Bringt schon längere Gutturale hervor und spielt mit den Tönen. Hat Interesse für angebotene Gegenstände und kann sie in der Hand halten.
6- 7 Monate: Weinen und sich-trösten-lassen; kann auch dann getröstet werden, wenn Gegenstände oder Personen ersetzt werden. Deutliche Bindung an den erwachsenen Partner, eindeutige Reaktionen auf Mimik und Stimmlage; Weinen und Protest, wenn es verlassen wird. Spielt mit Händen und Füßen. Streckt die Hand nach Gegenständen aus. Spricht identifizierbare Silben aus und kann sie wiederholen.
9 Monate: Sich-trösten-lassen; Angebote und aktives Aufsuchen von Alternativen. Deutliche Unterschiede im Verhalten zu vertrauten und fremden Personen. Kann Zweisilber aussprechen und wiederholen. Beginnt mit der Imitation von Gesten (Winken, In-die-Hände-klatschen, Grimassen). Reaktion auf die Untersuchung beim Kinderarzt.
12 Monate: Versteht einfache Sätze in einem vertrauten Zusammenhang und spricht einzelne Wörter. Versteht „nein“ und widersetzt sich Einschränkungen seiner Erfahrungsmöglichkeiten. Zeigt verführerische Variationen im Verhalten, läßt sich durch unterschiedliche Reaktionen beim Erwachsenen nicht verwirren. Kann die Interaktion von sich aus erfinderisch modifizieren (Wechselseitigkeit im Spiel, Schelmereien etc.). Reaktion auf die Untersuchung beim Kinderarzt.
15 Monate: Nimmt intensiv mit anderen Kontakt auf, auch mit sprachlichen Mitteln. Beginnt sich mit den Gleichaltrigen auszutauschen. Kann einige Zeit alleine spielen (mit Steckspielen und Gebrauchsgegenständen). Ist zur zeitlich verschobenen Imitation fähig (wenn das Vorbild bereits nicht mehr da ist).
18 Monate: Kann antworten (verbal oder mit Gesten), wenn es eine Frage betrifft. Versteht etwas komplexere Sätze und Pronomina, beginnt mit dem Gebrauch von Verben. Macht selbständige Versuche, bevor es auf den Erwachsenen zurückkommt (sich-auszieht, essen etc.).
2 Jahre: Kann Gesprochenes verstehen, auch wenn es nicht unmittelbar an das Kind gerichtet ist, dazu auch die Bedeutung von Adjektiven. Benutzt Pronomina (vor allem „ich“ und „du“) und Verben (vollständige Sätze); kann seine Wünsche ausdrücken. Beginnt damit, von Ereignissen zu erzählen und in vertrauten Situationen Vorhersagen zu machen.
2 ½- 3 Jahre: Erweitert das Spiel gelegentlich auf Gleichaltrige. Kann sich alltäglicher Dinge bedienen und sie mit Phantasie verarbeiten. Ist entzückt über Neuigkeiten, die ihm der Erwachsene überbringt, zu dem es Vertrauen hat. Beginnt damit, Gezeichnetem, Gesten etc. Bedeutung zuzuschreiben.“
(Noferi 1977 zit. nach Jäger 1986, S. 48f und vgl. Milani Comparetti 1982, S. 310 zit. nach Schöler 1987, o. A.)
[58] Wie in Kapitel 5.3 erwähnt, stimmen die „Kriterien der Normalität“ nach Noferi inhaltlich mit den „Indices der Verhaltens- und Bewegungsweisen“ von Milani Comparetti überein (siehe: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-italienische1.html#idp11156304)
Ich erkläre hiermit an Eides statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.
Ich erkläre mich mit der Archivierung der vorliegenden Bachelorarbeit einverstanden.
Quelle
Johanna Öttl: Vom Fördern zum Begleiten. Der Perspektivenwechsel von Entwicklungsförderung zu einer dialogischen Kultur der Entwicklungsbegleitung im Rahmen der mobilen „Frühförderung und Familienbegleitung“.
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 03.05.2018