Integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei a.o. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck, Innsbruck, März 2002. Zurück zur Indexseite
Inhaltsverzeichnis
-
1 Themenfokussierung - Kontextualisierung - Intention - Wissenschaftsverständnis
- 1.1 ZU MEINEM SELBSTVERSTÄNDNIS ALS (SONDER)-PÄDAGOGIN
- 1.2 MEIN SELBSTVERSTÄNDNIS EINER SCHULE FÜR ALLE
- 1.3 MEINE ROLLE ALS WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITERIN DER INTEGRATIVEN SCHULVERSUCHE IN VORARLBERG
- 1.4 ENTWICKLUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN
- 1.5 ZUM AUFBAU DER ARBEIT
- 1.6 DATENGRUNDLAGE
- 1.7 WIE SICH PERSÖNLICHES UND WISSENSCHAFTLICHES INTERESSE IN MEINEM WISSENSCHAFTLICHEN SELBSTVERSTÄNDNIS VERBINDEN
- 2 Integrative Pädagogik im Kontext des allgemein-pädagogischen Diskurses
- 3 Die »Vorarlberger Pionierklassen« - Schulversuchsklassen 1994/95 - 1998/1999: Äußere Organisation - Rahmenbedingungen - Hypothesen
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 ZU MEINEM SELBSTVERSTÄNDNIS ALS (SONDER)-PÄDAGOGIN
- 1.2 MEIN SELBSTVERSTÄNDNIS EINER SCHULE FÜR ALLE
- 1.3 MEINE ROLLE ALS WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITERIN DER INTEGRATIVEN SCHULVERSUCHE IN VORARLBERG
- 1.4 ENTWICKLUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN
- 1.5 ZUM AUFBAU DER ARBEIT
- 1.6 DATENGRUNDLAGE
- 1.7 WIE SICH PERSÖNLICHES UND WISSENSCHAFTLICHES INTERESSE IN MEINEM WISSENSCHAFTLICHEN SELBSTVERSTÄNDNIS VERBINDEN
Meine persönliche Geschichte mit den Themen »Integration« und Sonder-/Heilpädagogik begann vor bald 15 Jahren. Ich war damals Volksschullehrerin und kurz davor, mein Pädagogik-Studium abzuschließen. Im Herbst 1989 traten die Eltern von Isabella, einem so genannt[1] schwer-mehrfach behinderten Mädchen mit dem Wunsch an meine damalige Schule heran, ihre Tochter solle mit den Kindern aus der Nachbarschaft die Schule besuchen können. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Schulversuchsklassen zur sozialen Integration von Kindern mit Behinderung in Vorarlberg - die ersten beiden integrativ geführten Klassen sollten im Herbst des darauffolgenden Jahres in Lustenau und Andelsbuch entstehen. Ich befand mich damals eher auf dem Sprung aus der Schule hinaus, nicht aus Frustration oder burn-out, sondern weil ich eine neue Herausforderung suchen wollte. Der Lehrkörper meiner Schule war grundsätzlich offen für die Einrichtung einer Schulversuchsklasse, allerdings wollte sie niemand übernehmen.
Nach einer längeren Zeit des Überlegens entschied ich mich zunächst nur für diese Klasse - die Entscheidung sollte aber eine wichtige Weichenstellung für mein Leben werden. Ich gebe zu, dass ich anfangs durchaus meine Ängste hatte, unsicher war, zweifelte. Meine Zweifel rankten sich fast ausschließlich um das Thema der so genannten geistigen Behinderung. Ich hatte bereits Erfahrungen mit offenem Unterricht, hatte Elemente der Reformpädagogik in meinen Unterricht integriert, konnte mir gemeinsamen Unterricht von körperbehinderten oder sog. lernschwachen Kindern mit sog. ›normalen Kindern‹ sehr gut vorstellen - aber geistige Behinderung? Wie sollte ein Kind mit geistiger Behinderung in diesem Unterricht Platz finden, was sollte es in einer ›normalen‹ Schulklasse, wo doch das Erlernen der Kulturtechniken ein Schwerpunkt ist? Heute weiß ich, dass ich damals ge- und verfangen war in den gesellschaftlichen Vorurteilen, Bildern, Vorstellungen - die mit dem Begriff »geistige Behinderung « verknüpft waren. Ich kannte bis dahin niemanden mit einer »geistigen Behinderung« - die gesellschaftlichen Mechanismen der Ausgrenzung, der Segregation, welche die Eltern überwinden wollten, hatten bei mir völlig gegriffen. Menschen mit einer Körperbehinderung kannte ich aus meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis - die Integration von Menschen mit diesem ›label‹ oder ›Stigma‹ (Goffman 1967) hätte mir wahrscheinlich bedeutend weniger Kopfzerbrechen bereitet.
Nun, die vier Jahre mit Isabella und den anderen Kindern in der Volksschule sind schon lange vorbei. Es waren - und ich meine das völlig ohne Pathos - die schönsten und reichsten Jahre meines Lehrerinnen-Seins. Sowohl die theoretische Auseinandersetzung als auch die Praxis der Integration hatten mich völlig überzeugt: »Alle Kinder (Menschen, Anm. der Verfasserin) haben das Recht, in ihrem natürlichen sozialen Umfeld, inmitten unserer Gesellschaft in Achtung und Würde zu leben. Dies zu erreichen, betrachten wir als unsere Aufgabe. Dafür arbeiten wir, dafür kämpfen wir!« (Integration Vorarlberg)[2]
Dieser Programmatik - den Begriff Kinder ersetzt durch den Begriff des Menschen, also alle Altersstufen umfassend - habe ich mich seither verpflichtet. Diese Dissertation verstehe ich in diesem Sinne als Beitrag, als Dankeschön an jene Menschen - Mütter vor allem -, die mit so viel Engagement und Beharrlichkeit diesen oft nicht leichten Weg vom Rand zur Mitte hin gehen oder zu gehen versuchen.
Mein Zugang zur Heil-/Sonderpädagogik ist eng verknüpft mit der von Eltern initiierten Integrationsbewegung und der theoretischen Auseinandersetzung mit den Wurzeln, aus denen die Elternbewegung ihre Visionen, Argumente und Hoffnungen bezog - ohne immer explizit darauf zu verweisen: »Independent Living - Selbstbestimmt-Leben«, »Normalisierung«, »People first«, »Empowerment « - sind die bedeutendsten Konzeptionen, mit denen sich häufig Menschen mit Behinderung selbst zu Wort gemeldet und dabei eine ganze Menge von Sicherheiten, Normalitäten, Bewertungen, Selbstverständlichkeiten auf den Kopf gestellt haben. (Vgl. Miles-Paul 1992; Saal 1995) Sie waren es, die das Selbstverständnis der Sonderpädagogik radikal in Frage stellten, den selbsternannten Behindertenpädagogen ihre Kompetenz absprachen und diese stattdessen für sich selbst reklamierten (Experte in eigener Sache sein), respektlos die behinderten Menschen zugeschriebene Schutzbedürftigkeit ablehnten und selbstbewusst Assistenz einforderten anstelle von dankbarer Unterwürfigkeit, die Mitleid als heuchlerische Strategie der Abwehr entlarvten und stattdessen Respekt und Partizipation mit der nötigen Unterstützung einforderten. Die theoretische Auseinandersetzung mit diesen Positionen hat mein Selbstverständnis als Pädagogin nachhaltig verändert, wobei die Konfrontation dabei nicht immer einfach war: Immer wieder musste ich Positionen ›Betroffener‹ als überzogene Forderungen zurückweisen, mit Verweis auf die (schulische) Realität bzw. auf die Realitätsferne meine Identität als Pädagogin schützen, mein pädagogisches Handeln rechtfertigen. Mittlerweile sind viele dieser theoretischen Positionen zu meinem eigenen Selbstverständnis geworden, die anfängliche Abwehr ist einer produktiven Selbstverständlichkeit gewichen.
In den deutschsprachigen Ländern ist das Empowerment-Konzept (vgl. Theunissen 1995) mit einiger Verzögerung - erst zu Beginn der 80er Jahre - von Eltern mit Kindern mit Behinderungen rezipiert worden. Der Slogan »Recht statt Gnade«, mit dem die österreichische Elternbewegung um die Nicht-Aussonderung ihrer Kinder kämpfte, verweist eindeutig auf die Verortung der Bewegung in diesen theoretischen Positionen. Dass die Integrationsbewegung sowohl in Österreich als auch in Deutschland mehr eine Eltern- denn eine Betroffenenbewegung im engeren Sinne war, hängt vermutlich mit der noch immer unfassbaren Geschichte des Nationalsozialismus und der noch immer nicht wirklich erfolgten Auseinandersetzung zusammen: Ein Großteil der Menschen mit Behinderung, das Andere, wurde damals zu Tode gebracht, ermordet - sodass eigentlich jene Generation fehlte, die in den USA und später auch in den nordeuropäischen Ländern die Independent-Living Bewegung ins Leben rief. (Vgl. Egger 1990, Klee 1997)
Die Elternbewegung - und mit ihnen eine kleine Gruppe von Professionellen - kämpfte damals und heute eigentlich nicht für Integration[3], sondern für die Nicht-Aussonderung ihrer Kinder. Sie kämpften dafür, dass ihre Kinder im regionalen Umfeld verbleiben können, mit Geschwistern und Nachbarskindern denselben Kindergarten besuchen dürfen und nicht in einem Sonder-Kindergarten, abseits der Familie, speziell betreut werden. Der nächste Kampf war der für einen Platz in der Volksschule (Primarstufe), später in der Hauptschule (Sekundarstufe). Gemeinsam leben und lernen, eine Schule für alle Kinder wären schon damals die treffenderen Termini gewesen. Seit es die sog. »Integrationsbewegung« in Vorarlberg gibt, war ich Begleiterin und Mitstreiterin jener Eltern (Mütter), die für ihre Kinder Teilhabe und Partizipation an den allgemeinen gesellschaftlichen Institutionen, vornehmlich Schule und Kindergarten, forderten. Mittlerweile sind die ersten Kinder, die wir begleitet haben, Jugendliche oder junge Erwachsene. Die ersten sieben Jugendlichen - die alle nach der gängigen Klassifikation als schwer geistig oder schwer-mehrfach behindert gelten, leben noch immer ohne Aussonderung im regionalen Umfeld und haben mit dem Konzept der »Unterstützten Beschäftigung« Teilzeitarbeitsplätze am freien Arbeitsmarkt gefunden.
Ich bin also keine objektive Beobachterin von außen und gebe auch nicht vor, objektive Forschungsergebnisse präsentieren zu können (mehr noch zu wollen), die belegen oder überzeugen sollen, dass Inclusion[4] gut ist. Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen an gesellschaftlichen Prozessen, die Überwindung von Zuschreibungen medizinisch-pädagogischer, ethnischer, geschlechtlicher oder religiöser Art müssen nicht mehr belegt werden, sie sind in der Verfassung garantierte Rechte und Selbstverständlichkeiten in sich selbst als demokratische Gesellschaftsordnungen verstehenden staatlichen Gebilden. Meine Fragen kreisen seit langem um das WIE: Wie kann diese Vision - und unsere verfassungsrechtlich verankerten Normen der Gleichberechtigung und Unantastbarkeit der Würde aller Menschen sind weitab davon, gelebte Wirklichkeit zu sein - in unterschiedlichen Praxisfeldern, u. a. in der Schule, zumindest Schritt für Schritt in diese Richtung vorangetrieben werden?
Die Organisation eines Schulsystems ist immer auch Spiegel der jeweiligen Gesellschaft und ihrer Geschichte, gesellschaftliches Konstrukt, Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen. Nie in der Geschichte der Schule hat es bisher eine gemeinsame Schule für alle gegeben, bis heute waren und sind Schule und Bildung Privilegien unterschiedlichster Gruppierungen. Die stark gegliederten Schulsysteme Österreichs und Deutschlands spiegeln im Kern noch immer eine »sich ständisch gebärdende Gesellschaft« (Feuser 1993, 39), die subtil darauf achtet, die Bildungsprivilegien für Kinder bestimmter gesellschaftlicher Schichten zu erhalten. Alle Schulen - auch die Volksschulen - begnügten sich bis zum Beginn der Integrationsbemühungen mit einer Auswahl, waren in diesem Sinne ›Sonder‹-Schulen, Schulen für eine ausgewählte, ausgesuchte Gruppe von Kindern und jungen Menschen bzw. schlossen eine Gruppe von Kindern aus. Die Bestimmungen um den Terminus »schulunfähig« (§ 15 Schulpflichtgesetz) werden erst seit einigen Jahren äußerst sparsam angewendet. Diese Feststellung trifft insbesondere auf die Organisation der Sekundarstufe in Österreich zu: Das Gymnasium als ›Sonder‹-Schule für eine gesellschaftliche Gruppe, die sich von diesem Bildungsweg bessere Zukunftschancen für ›ihre‹ Kinder erwartet und andere davon ausschließt, die vor sozial unerwünschten Kontakten etwa mit Migrantenkindern, Verhaltensschwierigen oder auch Kindern aus niedrigeren sozialen Schichten schützen soll, um nur einige Motive zu nennen.
Sonderschulen entwickelten sich deshalb, weil die allgemeine Schule nicht fähig und auch nicht willens war, Kinder, die einer definierten Norm nicht entsprachen, zu unterrichten - insofern haben sich die Sonderschulen damit ein historisches Verdienst erworben: Sonderschulen entstanden als Lern-Orte für Menschen mit special needs, mit sog. besonderen Bedürfnissen. Dennoch sind sie »Ersatzlösungen«, »Notaufnahmelager« wie Hans Wocken sie bezeichnete. (Vgl. Wocken 1990, 55) Die langandauernde Praxis der Sonderbeschulung hat jedoch zu dem Bewusstsein geführt, hat diese fatale Denkkonstruktion etabliert, als ginge es nur so und gar nichts anders, als wäre die Sonderschule keine Auffangstation, sondern bester und einzig möglicher Lernort für Kinder mit als unterschiedlich definierten Norm-Abweichungen. Auch wenn in diesem Schon- und Schutzraum, in der Nische, unbestritten qualitätsvolle und menschlich wertvolle Arbeit geleistet wurde, viele pädagogische Erkenntnisse gewonnen und Methoden entwickelt wurden, bleibt das Faktum, dass die Sonderpädagogik unter dem Deckmantel der besonderen Förderung jene akzeptierten Begründungen lieferte und noch immer beharrlich verteidigt, um behinderte, entstellte, untragbare und andere nicht erwünschte Kinder auszugrenzen.
Inclusion hieße, eine Schule für alle zu entwickeln, die segregierenden Systeme Regelschule und Sonderschule aufzulösen, aber auch die unterschiedlichen Formen der Regelschulen, wie wir sie im Sekundarstufenbereich kennen, zu überwinden - nur insofern wird die hartnäckige Abwehr des schulischen Systems und der sich dahinter verborgen artikulierenden gesellschaftlichen Strömungen allzu verständlich. Dass gemeinsames Lernen von Menschen mit und ohne sog. Behinderung möglich ist, wissen wir aus vielen Beispielen, aus einer hinlänglich dokumentierten Praxis, vor allem aus dem Grundschulbereich. Nicht-Aussonderung in der Schule, das Gestalten von gemeinsamen Lern-Umgebungen ist keine unrealistische Utopie, sondern machbare Wirklichkeit. Es ist letztlich eine Frage der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und des politischen Willens, ob sich eine an den Werten von Humanität, Solidarität und Demokratie orientierte Pädagogik durchsetzt oder die utilitaristische Vorstellung einer Schule, deren Verständnis es ist, die Gesellschaft mit ihren leitmotivischen Paradigmen wie »Produktivität, Effizienz, Leistung« zu bedienen.
Die erste Voraussetzung für eine gemeinsame Schule für alle Kinder kostet
kein Geld, sie erfordert ein neues Denken - und das gleich auf mehreren
Ebenen:
Umkehr der Rechtfertigungspflicht
-
Die langandauernde Praxis der Aussonderung wie auch die Organisation der Sonderpädagogik in speziellen Einrichtungen für spezielle Behinderungsarten (Schulen für Körperbehinderte, für Geistigbehinderte, für Verhaltensauffällige, für Blinde usw. - vgl. Wolfensberger in Wendeler 1993) haben zur unhinterfragten Vorstellung geführt, dass Kinder mit special needs sich ihr Angebot an zentralen Lernorten abholen müssen. Wenn Eltern heute Nicht-Aussonderung wünschen und einfordern, bedarf es - trotz des gesetzlichen Anspruchs auf Wahlmöglichkeit in Österreich - in der Praxis immer noch der besonderen Legitimation. Dabei müsste es völlig umgekehrt funktionieren: Nicht das Normale, das Lernen im natürlichen sozialen Umfeld, zusammen mit anderen, muss besonders begründet werden, sondern die Ausnahme, die Aussonderung bedarf der Begründung. Ich weigere mich mit der Integrationsbewegung, überhaupt einen Grund anzugeben, warum wir gegen Trennung, gegen Ausgrenzung, gegen Isolation und für Gemeinsamkeit sind. Auch die noch so lange Tradition der klassischen Sonderschule als Lernort ist nicht Argument genug. (Vgl. Wocken 1990, 57)
Homogene Lerngruppen sind ein Artefakt
-
Sowohl Bildungspolitiker, Schulaufsichtsbeamte wie auch Lehrpersonen selbst müssen endlich Konsequenzen aus dieser Binsenweisheit ziehen. Wir müssen endlich akzeptieren, dass alle Kinder und Jugendlichen verschieden sind, auch wenn wir sie in Altersgruppen und Jahrgangsklassen zusammenfassen, die ›schulunreifen‹ von den ›schulreifen‹ trennen, die ›guten‹ von den ›schlechten‹, dass sie divergente Lernvoraussetzungen, Interessen, Lernstile, Kompetenzen mitbringen, aus verschiedensten Lebenswelten kommen und ihre biografischen Erfahrungen sich ganz individuell in ihre Persönlichkeiten eingeschrieben haben. Die Betonung liegt auf alle Kinder - nicht nur Kinder, die als behindert definiert werden. Wider die eigenen Schulerfahrungen, wider die Erfahrungen als Lehrende und wider wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse der Pädagogik und mittlerweile der Naturwissenschaften wird in der Praxis großteils am Konstrukt der homogenen Lerngruppe festgehalten. Mit dem Konstrukt der Homogenität geht häufig auch die Vorstellung einher, dass schulische Effizienz - was immer dann im Detail auch darunter verstanden werden mag - am ehesten über Belehrung und rezeptives Lernen und das Abprüfen von lexikalischem Wissen zu erzielen ist.
Lernen ist nicht dasselbe wie Wissensvermittlung
-
Im UNESCO-Bericht »Zur Bildung für das 21. Jhdt.«, den der damalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors 1997 verantwortete, heißt es: »Das Entscheidende für die Zukunft sind ›Kreativität, Sozial- und Handlungskompetenz der Jugendlichen‹. Die Bildungsaufgabe der Gegenwart heißt ›Stärkung der Persönlichkeit‹, im Zentrum stehen ›neue kultursoziale Schlüsselqualifikationen‹ wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Selbstverantwortung, Persönlichkeitsbildung, Teamfähigkeit, Kreativität, Erlebnisfähigkeit, Handlungskraft usw.« (zit. nach Reichen 2001, 164) In einer Zeit, in der sich das Wissen innerhalb kürzester Zeit vervielfacht, in der immer ausgeklügeltere Techniken der Vervielfältigung, Speicherung und Verbreitung von Wissen (Symbolvorräten) entwickelt werden, kann es doch nicht mehr Aufgabe der Schule sein, in einen von vornherein aussichtslosen Konkurrenzkampf mit diesen Medien zu treten. »Da ist sie (die Schule) sofort überrundet, da wird ihre Arbeit schal und erstarrt. Sie sollte und könnte informationstechnisch abrüsten und eine neue Kargheit des Wartens, Nachdenkens, Hinschauens üben.« (Rumpf, 1995, 55) Solange Schulverantwortliche und Lehrende den Bildungsauftrag nicht reflektieren und Schule als Ort der Wissensvermittlung missverstehen, wird gemeinsames Lernen nicht stattfinden können, wird Inclusion nicht möglich.
Entwicklung und Lernen als dialogisches Prinzip
-
Mit der Aussage von Martin Buber »Der Mensch wird am Du zum Ich« (Buber 1983, 37), erstmals 1919 niedergeschrieben, wird in genialer Zusammenfassung all das gesagt, was wir über menschliche Entwicklung auf der psycho-sozialen Ebene wissen. Für das Anliegen der Integration hat Feuser diesen Satz programmatisch ergänzt und erweitert: »Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind.« (Feuser 1993, 53) In der traditionellen Sichtweise halten wir für Lernen und Entwicklung in erster Linie das eigene Vermögen eines Menschen für ausschlaggebend (seine Intelligenz, seine Begabung, wie wir sagen) und seinen momentanen Zustand, z. B. die diagnostizierte Behinderung. Diese Zuschreibung nimmt die traditionelle Schule dann zum Anlass der Segregation und macht sich vehement daran, sie pädagogisch und therapeutisch zu korrigieren und zu normalisieren. Dabei beraubt sie behinderte wie nichtbehinderte Kinder einerseits wichtiger psychosozialer Momente für ihr Lernen und ihre Entwicklung und konserviert andererseits, was wir als Behinderung wahrnehmen, aber vorgeben, zu überwinden. Inclusion hieße, diese Paradoxie zu erkennen und sich dagegenzustellen.
In diesem Verständnis wird Behinderung als Behindert-werden, als Entwicklungsprozess verstanden, der maßgeblich vom DU, d. h. von der gesamten den Menschen umgebenden komplexen Lebenswelt, mitbeeinflusst wird. Diese Sichtweise deckt sich vollinhaltlich mit dem WHO-Behinderungsbegriff, der zwischen Impairments, Disabilities and Handicaps unterscheidet. (WHO 1995, 5f). Heute können wir auf eine Reihe von theoretisch unterschiedlichen Ansätzen aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen verweisen, die darin übereinstimmen, dass der kindliche Entwicklungsprozess vom aktiven Dialog, der zuerst über die (soziale) Mutter vermittelt wird, abhängig ist. (Vgl. Papousek 1994, Stern 1992, Dornes 1996, Petzold 1995; vgl. Kapitel 2) Mit anderen Worten: »Die kindliche Entwicklung kann als vom Kind aktiv gestalteter (Re-)Konstruktionsprozess der Wirklichkeit in Wechselwirkung mit seiner sozialen Umwelt verstanden werden.« (Schönwiese 2000, 66)
Zum Verhältnis von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik
-
Inclusion in der Schule hieße, letztlich die Trennung von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik zu überwinden. Für die derzeitige Situation im Übergang bedeutet dies, dass sich die Sonderpädagogik zum Primat der Integration bekennt und ihre Kompetenz und Unterstützung ambulant bzw. subsidiär zur Verfügung stellt. »Integration geht grundsätzlich vor Separation. Alle Sondereinrichtungen sind immer nur nachrangige Ersatzlösungen, Lernorte zweiter Wahl. Sonderschulen stehen zum allgemeinen Schulwesen in einem subsidiären Ergänzungsverhältnis, sie haben grundsätzlich keine eigenständige Existenzberechtigung. Die Existenz von Sonderschulen kann nicht prinzipiell und a priori begründet werden, sondern nur relativ, nämlich relativ im Ungenügen zur allgemeinen Schule.« (Wocken 1990, 57) In diesem Sinne wäre die Sonderpädagogik in erster Linie als subsidiärer, dezentralisierter Dienst für die allgemeine Pädagogik aufzufassen: Sie unterstützt Kinder und LehrerInnen der allgemeinen Schule, so, dass die Kinder mit special needs mit den andern Kindern und wie die andern leben und lernen können - in den USA wird dieses Prinzip mit »least restrictive environment« bezeichnet. Sie bringt aber auch die Kompetenz mit, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine ihnen gemäße Bildung und Erziehung erhalten, Lernangebote am Übergang zur »Zone der nächsten Entwicklung«. (Vgl. Wygotsky, in Papadopoulos 1999) Das Spannungsverhältnis von Gemeinsamkeit und special needs in einer Balance zu halten, ist Hauptarbeit integrativer Pädagogik. Es versteht sich von selbst, dass dieses Verhältnis auch nur als Denkmodell für den Übergang Berechtigung hätte, denn auch dieser Ansatz beinhaltet bereits die Segregation im Denken, die Akzeptanz einer Sonder- und Heilpädagogik und die Kategorisierung von Menschen in solche mit und ohne special needs. Langfristig müsste sich die Sonderpädagogik mit der Allgemeinen Pädagogik verbinden, in ihr aufgehen, in einer basalen, kindzentrierten Pädagogik, die auf jegliche Kategorisierung verzichtet. (Vgl. Feuser 1995)
Kreieren neuer Begrifflichkeiten - sorgsamer Umgang mit sprachlichen Kategorien
-
Sprache entlarvt vermutlich wie kein anderes Medium unser Denken, konstruiert und re-konstruiert Denken und schränkt es ein, tradiert über einge‹fleischte‹ Begriffe. Denken sperrt sich gegen eine rasche Verankerung neuer Denkmuster, ein Phänomen, was wir anhand vieler Begriffssetzungen im Inclusion-Diskurs belegen können. Viele der Begrifflichkeiten, die auch ich bisher verwendet habe und die sich vermutlich durch diese Arbeit durchziehen werden, sind Zeugen dafür, wie stark sich die Segregation und Segmentierung, die Kategorisierung und Klassifizierung in zwei Gruppen sowohl im Denken als auch in der sprachlichen Reproduktion festgesetzt haben. Wir sprechen von Menschen mit und ohne Behinderung, von SchülerInnnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) - wobei die Einteilung relativ willkürlich erfolgt[5] - und konstruieren dabei die Gruppe jener ohne besonderen Förderbedarf; die ›bedürftigen Mängelwesen‹ (Gronemeyer 1996, 35) und diejenigen, die mit weniger auskommen und gesellschaftlich auch billiger sind; wir sind und bilden zu SonderpädagogInnen[6] aus und festigen, beabsichtigt oder nicht, das exklusive Denken: Solange Menschen einer besonderen Pädagogik bedürfen und andere nicht, segregieren wir im Kopf und in der Praxis. Auch diese Paradoxie gälte es zu erkennen und sich dagegenzustellen, neue Begriffe zu kreieren und die Denk- und Sprachmuster der Segregation zu überwinden. (Vgl. Wilhelm/Bintinger 2001, 44)
Trotz vieler ausgesprochen positiver Beispiele von Nicht-Aussonderung sind wir im jetzigen schulischen und gesellschaftlichen Bereich noch weit von Inclusion entfernt, wenn man damit die Selbstverständlichkeit meint, dass Behinderung nicht als Besonderheit, sondern als normaler Seinszustand von Menschen aufgefasst wird und dass alle Kinder, unabhängig von ihren Ansprüchen und Bedürfnissen, eine gemeinsame und ihnen gemäße Bildung in ihrem regionalen Umfeld erhalten können. Und es wäre auch ein Fehlschluss zu glauben, dass die lange Tradition der gesellschaftlichen Produktion und Segmentierung von Behinderung, die Denkkonstruktion von Behinderung, durch eine gemeinsame Schule in ein paar Jahren verändert werden könnte. Ich sehe die gemeinsame Schule als einen notwendigen Weg, als Schritt im Übergang, Behinderung als normale und gesellschaftlich gleichberechtigte Seinsform zu erfahren. Eine grundsätzliche Veränderung des Menschenbildes, des Denkens und der sprachlichen Bezeichnungen - und erst das wäre Inclusion - ist noch Vision. Die Vision oder Utopie würde dann Realität, wenn sich die Begriffe und Bezeichnungen aufgelöst hätten, wenn wir sie nicht mehr benötigten.
Die ungeheure Radikalität und Tragweite von Inclusion formuliert Dreher: »Inklusiv denken bedeutet, bis an die Wurzeln unseres Denkens, unserer Gestaltung von Bildung und Weltkonstruktion nach Elementen zu graben, die es uns ermöglichen zu einer Überwindung der defizitären Sichtweise von Menschen zu finden.« (Dreher, in Bintinger 2001, 53) Hinzuzufügen wäre, dass dieser Prozess nicht nur für Menschen mit Behinderung zu gelten hätte, sondern für alle Denkkonstrukte, mit denen das Eigene über das Andere gestellt wird und damit das Andere über Be-Wertungen ausgeschlossen wird (Sprache, Religion, Kulturkreis).
Inclusion hieße, die Kategorisierung Behindert - Nicht-Behindert, Heil-/Sonderpädagogik - Allgemeine Pädagogik als Sprach-, Denk- und Wirklichkeitskonstruktionen zu verstehen, dieses Verstehen als ersten Schritt zur Veränderung zu sehen und im Übergang neue Bilder, neue Konstruktionen zu deren Überwindung zu entwickeln.
Nach meiner eigenen Unterrichtstätigkeit in einer Volksschul-Integrationsklasse wurde ich vom Landeschulinspektor für Sonderpädagogik und Integration mit der wissenschaftlichen Begleitung der Hauptschul-Integrationsklassen-Teams beauftragt. In der Zeit von 1994 bis zum Schuljahr 1999/2000 hatte ich in dieser Funktion die Möglichkeit, viele Teams auf ihrem Weg zur Integration - zu einer Schule für alle als Vision - zu begleiten. Ab dem Schuljahr 2000/2001 wurden für die wissenschaftliche Begleitung der Integrationsklassen im Sekundarstufenbereich vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur keine zusätzlichen Stunden mehr zur Verfügung gestellt, da zu diesem Zeitpunkt die Schulversuchsphase ausgelaufen waren und sämtliche Integrationsklassen als Regelklassen geführt wurden. Trotzdem wurde auf Drängen vieler HS-Teams und DirektorInnen eine Form der Begleitung ermöglicht: Über SCHILF-Veranstaltungen (schulinterne Lehrerfortbildung) konnte ich die Teams in einem reduzierten Stundenausmaß unterstützen und beraten.
Die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung sind im Rahmenkonzept des BMUKuS (Gruber/Petri 1989) für den Volksschulbereich geregelt. Sie wurden für die Hauptschule nicht eigens adaptiert und umfassten drei Schwerpunkte: Beratung, Betreuung und Evaluation. Auf der Ebene der Betreuung geht es in erster Linie darum, die LehrerInnen im Schulversuch pädagogisch zu unterstützen, um die Ziele des gemeinsamen Unterrichts von SchülerInnen mit und ohne Behinderung bestmöglich zu erreichen. Auf der Ebene der Entwicklung soll an der Ausarbeitung von Methoden, Materialien und Modellen einer integrativen Unterrichtsgestaltung mitgewirkt werden, die später in die allgemeine Schulpraxis übertragen werden können, um damit eine erfolgreiche Integration behinderter Kinder in einem größeren Umfang zu ermöglichen. Der Bereich der Evaluation wird im Rahmenkonzept nicht näher definiert, österreichweite Vorhaben wurden vom Zentrum für Schulversuche und Schulentwicklung koordiniert.
Für Günter Gorbach, Landesschulinspektor für Sonderpädagogik und Integration in Vorarlberg, war meine zentrale Aufgabe eine pädagogische: die Unterstützung der LehrerInnen mit dem Ziel, gemeinsamen Unterricht auf einem qualitativ möglichst hohen Niveau - entlang der folgenden Leitfragen - zu sichern: Wie muss Unterricht in der Hauptschule gestaltet werden, dass nicht nur ein Nebeneinander, sondern auch ein Miteinander entstehen kann? Werden die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf neben der sozialen Integration auch genügend auf ihrem Entwicklungsniveau, ihren individuellen Lernmöglichkeiten und -bedürfnissen gemäß, gefördert? Findet genügend Differenzierung auch für leistungsstarke Hauptschulkinder statt?
So war der Schwerpunkt meiner Arbeit in den ersten zwei bis drei Jahren, gemeinsam mit den Teams, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits formiert hatten, Unterrichtsstrukturen zu entwickeln, in denen gemeinsames Lernen stattfinden kann, diese zu dokumentieren und den nächsten Teams die gemachten Praxiserfahrungen zur Verfügung zu stellen. Ich hatte damals, bedingt durch die geringe Anzahl der Integrationsklassen[7] - die Möglichkeit, längerdauernde Unterrichtsbeobachtungen zu machen (zwei bis drei Tage hintereinander), mit den Teams Außen- und Innensicht zu reflektieren und nach Verbesserungen zu suchen. Aus dieser Arbeit - Teilnahme am Unterricht, Beobachtungen und Teambesprechungen - entstanden detaillierte Modellberichte von sechs Klassen, Innensichten von Schulen, die im Wesentlichen die Grundlage der Vorbereitungsarbeit mit neuen Teams darstellten und auch eine wichtige Grundlage dieser Forschungsarbeit darstellen.
In einem zweiten Schwerpunkt sollte das Augemerk auf die spezifische Förderung von Kindern mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf gelegt werden. Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass die Teams individuelle Förderpläne erstellen und sie bei diesem Prozess fachlich unterstützt werden. Diese Aufgabe war besonders in jenen Klassen wichtig, in denen ein nicht ausgebildeter Sonderpädagoge die Betreuung der Integrationskinder übernommen hatte. Einer Einführung in die Thematik der Förderdiagnostik (= pädagogische Diagnostik) folgten die Schritte der Förderplanung, wir legten gemeinsam Beobachtungsschwerpunkte und -kriterien fest. Nach einer längeren Zeit der Beobachtung und Dokumentation, des Austausches mit Eltern und auch Therapeuten formulierten wir primäre Schwerpunkte und suchten im Team gemeinsam nach Maßnahmen und Lernarrangements, wie diese individuelle Förderung bestmöglich realisiert, in den gemeinsamen Unterricht ›verwoben‹ werden kann.
»Integration beginnt in den Köpfen der Menschen« - dieser Satz von Jutta Schöler, einer Pionierin der Integrationsbewegung, wurde durch meine Praxiserfahrungen immer mehr bestätigt. Die Gestaltung integrativen Unterrichts stellt - wie bereits dargestellt - viele Fragen an die derzeitige Schulpraxis und rüttelt an liebgewordenen Strukturen und Denkmustern. Die Auseinandersetzung mit diesen Konstruktionen sollte und musste in der Vorbereitungsphase stattfinden, nicht erst während des ersten Schuljahres. So verlagerte ich den Schwerpunkt meiner Arbeit verstärkt auf die Vorbereitungszeit neuer Teams. Ich sah meine Aufgabe darin, oben genannte Fragen grundsätzlich zu thematisieren, die Gestaltungsmöglichkeiten integrativen Unterrichts vorzustellen, von Erfahrungen und Schwierigkeiten zu berichten, Vor- und Nachteile der jeweiligen Struktur gegenüberzustellen und damit den LehrerInnen Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Nach einer Phase des kollegialen Hospitierens in bestehenden Integrationsklassen wurden dann im Rahmen einer Klausurtagung mit einzelnen Teams gemeinsame Ziele erarbeitet und konkret geplant, wie offener und auch lehrerzentrierter Unterricht organisiert werden soll, was Einzelne unter teamteaching verstehen, welche Kompetenzen und Rollen die LehrerInnen übernehmen, wie die Leistungsfeststellung erfolgen soll und vieles andere mehr.
Neben Fragen der integrativen Unterrichtsgestaltung ist mir die Teamentwicklung zu einem großen Anliegen geworden. »Gute Chemie« ist sicherlich wichtig, vielleicht wichtiger als professionelle Teamarbeit, notwendig ist diese dennoch: Welche Teamkultur wollen wir, wie gehen wir LehrerInnen miteinander um, was ist notwendig für Zusammenarbeit, was förderlich, was hinderlich? Und vor allem: Wie organisieren wir unsere Teambesprechungen effizient?
Einer der größten Belastungsfaktoren für LehrerInnen in Integrationsklassen ist der hohe Zeitaufwand, den die gemeinsame Planung mit sich bringt. Die Entwicklung gut funktionierender Teamstrukturen hat entscheidende Bedeutung für die Zufriedenheit der LehrerInnen im Team und damit für das Gelingen gemeinsamen Unterrichts.
Die Jugendlichen aus den ersten beiden Vorarlberger Integrationsklassen sollten im Sommer 1998 die Hauptschule und auch ihre Schulpflicht beenden. Im Pilotprojekt SPAGAT[8] - einem Kooperationsprojekt zwischen Land Vorarlberg, Integration Vorarlberg (= Elterninitiative), der Schule und dem Institut für Sozialdienste als Träger - sollte erprobt werden, wie und ob die integrativen Prozesse auch für jugendliche SchulabgängerInnen mit schweren Behinderungen fortgesetzt werden können und wie sie mit dem Konzept der »Unterstützten Beschäftigung« (supported employment) in die Arbeitswelt eingegliedert werden können. Da der Brückenbau in die nachschulische Welt für alle Jugendlichen - mit und ohne Behinderung - in der Schule beginnen muss, startete dieses Projekt schon ein Jahr vor Schulende. Aufgabe der Schule war es, integrativen BOBI-Unterricht (Berufsorientierung und Bildungs-Information) zu gestalten, Erfahrungen zu sammeln, auszuprobieren. Einmal mehr war es meine Aufgabe, neben der konzeptionellen Mitarbeit in diesem Projektteam in meiner Doppelrolle als wissenschaftliche Begleiterin und Vertreterin von Integration Vorarlberg, die Teams bei der Vorbereitung zu unterstützen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Erfahrungen zu dokumentieren. Ergebnis dieser Arbeit war eine Handreichung voller Ideen[9], die wiederum den nächsten Teams als Arbeitsgrundlage zur Verfügung gestellt wurde.
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der Wunsch, den reichhaltigen Erfahrungsschatz, der aus der engen Zusammenarbeit mit den ersten Hauptschulteams entstanden ist, aufzuarbeiten, zu systematisieren, zu dokumentieren, zu reflektieren und diese Erfahrungen für andere Teams nutzbar zu machen.
Die ersten Teams in Vorarlberg - ich nenne sie Pioniere - stellten sich der anspruchsvollen Aufgabe, gemeinsamen Unterricht für alle Kinder zu ermöglichen - ein Ziel, das als politische Forderung, als Wunsch von Eltern und auch aufgrund einer Vielzahl von wissenschaftlichen Abhandlungen schlüssig begründbar ist und sich auf Kritik an der Schule ebenso wie erkenntnistheoretische Grundlagen über das Lernen berufen kann. Allein, die Praxis der Umsetzung in einem System, das historisch gewachsenen und gesellschaftlich erwünschten Bedingungen und Strukturen unterliegt, ist eine Herausforderung, die vermutlich noch immer mit Verunsicherung und Angst (Cuomo 1989), vor allem aber mit einer Zerreißprobe zwischen divergierenden Ansprüchen und Vorstellungen einhergeht. Neben der theoretischen Fundierung braucht es Praktiker, Menschen, welche die Visionen der Theorie mit Alltagsleben ausfüllen, auch wenn die Schritte erste Schritte und noch weit entfernt vom theoretisch formulierten Ziel, der Inclusion, sind.
»Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes
time. Vision with action can change the world!« (Bintinger 2001, 47)
Diesen Satz möchte ich als Leitmotiv an den Anfang meiner Arbeit stellen, die ich als Verbindungsglied zwischen Theorie und Alltagspraxis verstehen möchte, einer Alltagspraxis in einem bestehenden - integrationsfeindlichen - System, in einem System, dessen konstitutive Merkmale u. a. Segregation und Selektion sind. In meiner Doppelrolle - Praktikerin (Lehrerin in einer Integrationsklasse) einerseits und wissenschaftlich Arbeitende im Hauptschulbereich andererseits - habe ich die Theorie-Praxiskluft an mir selbst deutlich wahrgenommen. Selten habe ich mich von theoretisch-didaktischen Entwürfen aus der sog. Integrationspädagogik, z. B. Feusers Konzept des Lernens am gemeinsamen Gegenstand (vgl. Feuser 1995, 173ff) als Praktikerin geschätzt, ermutigt und unterstützt gefühlt, ich habe diesen und ähnliche Texte häufig als Visionen gelesen, als weit überhöhte Forderungen an Praktiker, die nur von pädagogischen Genies umzusetzen sind und welche die Spannungsfelder, in denen LehrerInnen in der öffentlichen Schule stehen, nicht zu kennen scheinen oder unberücksichtigt lassen - auch wenn sie sich explizit dagegen aussprechen. Oft haben mich diese Texte, die für das theoretische Verständnis so unabdingbar wichtig sind, die mein Denken auf den Kopf oder besser auf die Füße gestellt haben, als Praktikerin entmutigt, weil ich auf der Folie dieser Entwürfe die eigene Praxis - die ich im Alltag eigentlich als durchaus geglückt und befriedigend erlebte - immer wieder in Frage stellte und stellen musste. Sie haben mich teilweise auch zornig gemacht, weil ich ihre Wirkmächtigkeit als Praktikerin alles andere als ›empowering‹ und unterstützend empfand. Wirksam werden Theorien handlungspraktisch nämlich erst dann, wenn sie mit Leben gefüllt, d. h. umgesetzt werden, und dazu bedarf es, zumindest im schulischen System, der Praktiker. Konstruktivistisch ausgedrückt: Theoretische Konstrukte müssen mehr sein als »Symbolvorräte« (Reich 1999, 77) oder Beschwörungsformeln wissenschaftlicher Profis, die sich an universitäre Orte zurückziehen und sich mit sich selbst befassen im Sinne eines selbstreferentiellen Systems (vgl. Bourdieux 1992), sie müssen auch anschließbar - viabel - sein. Die Umsetzung von Theorien in einem bestehenden System kann nur in kleinen, kleinsten Schritten erfolgen und alle diese Schritte sind als Ermutigung zu sehen und als solche wertzuschätzen. In der Sprache der Systemtheorie und des Konstruktivismus heißt das: » ›Lehrende‹, ›Lernende‹ und ›Schule‹ stellen operational geschlossene Systeme dar, die eine jeweils spezifische Systemgeschichte und eine rekursive Systemstruktur haben. (...) Es bleibt uns nichts anderes übrig, als im Strom der Evolution des Bewusstseins zu bleiben und darin Wege und Konstruktionen zu versuchen, die anschlussfähig (›viabel‹) und gesellschaftlich akzeptabel sind, und so zu versuchen, diese personalen und sozialen Systeme allmählich umzugestalten.« (Kösel 1999, 105)
Viele LehrerInnen, die ich begleitet habe, haben sehr viel an Arbeit auf sich genommen, am ›nicht-segregativen‹ Weg im Hauptschulsystem mit zu bauen, Strukturen und Arbeitsweisen zu entwickeln, aber auch eigene Vorstellungen immer wieder zu reflektieren und neu zu formulieren, um gemeinsames Leben und Lernen möglich zu machen, eine Pädagogik der Vielfalt zu entwickeln. Der Einsatz dieser LehrerInnen kann meiner Meinung nach nicht hoch genug geschätzt werden. Sie sind PionierInnen der Integrationsbewegung und spielen im Puzzle jener Menschen, die sich um Nicht-Aussonderung bemühen, eine zentrale Rolle.
In einer Zeit, in der Ab- und Ausgrenzung, Des-Integration und Entsolidarisierung den politischen, ökonomischen, aber auch den allgemein-pädagogischen Diskurs bestimmen, schaffen sie Gegenbilder, Gegen-Wirklichkeiten. Diese anderen Bilder zu transportieren, halte ich für notwendig, wenn die winzige Gegenkraft nicht an der »Übermacht der Inhumanität« (Fragner 1999, 21) scheitern soll, wenn die Integrationsbewegung mehr werden soll als eine der vielen Reformbewegungen, die sich zwar ihre Nischenplätze zur Befriedung kleiner Gruppen erkämpft, insgesamt auf die Bildungsdiskussion jedoch marginalen Einfluss hat. In diesem Sinne begreife ich diese Forschungsarbeit zu den integrativen Schulerfahrungen in Vorarlberg auch als Teil eines Empowerment-Prozesses.
Gleichzeitig halte ich es aber auch für dringend notwendig, die von mir so bezeichneten kleinen und kleinsten Schritte in einen umfassenderen Zusammenhang zu stellen und auf der Folie von theoretischen Erkenntnissen über das Lernen zu reflektieren und zu begründen. Denn nur so kann meiner Meinung nach gewährleistet werden, dass diese Schritte mehr sind, anderes sind als ›alter Wein in neuen Schläuchen‹, wovor Georg Feuser schon anlässlich eines Symposions in Feldkirch, Vorarlberg, 1993 gewarnt hat, anderes als subtilere Formen und neuere Bezeichnungen von bereits Bestehendem, ›Behübschungen‹ oder Verschleierungen einer segregativen Praxis. Theorie in diesem Sinne verstanden wäre dann ein Wegweiser und Korrektiv, eine Orientierungshilfe, welche die Grundlage für die Überprüfung und Bewertung einzelner Schritte darstellen kann.
Zwischen den beiden Polen ›Praxisferne der Theorie‹ und ›Theoriefeindlichkeit der Praxis‹ zu vermitteln, wäre mein ganz persönliches Anliegen. Dieses Thema begleitet mich, wie vorher bereits beschrieben, seit ich mich als Lehrerin, als Forscherin und als Lehrende in der Lehreraus- und -fortbildung im schulischen System bewege. Je nach meinem jeweiligen Ort im schulischen System fühlte ich mich zwischen diesen beiden Polen immer wieder hin- und hergezogen, ich vermisste die theoriegeleitete Reflexion in der Praxis, wehrte mich gegen die einfachen Rezepte, die es in einem so komplexen System wie der Schule nicht geben kann, oder aber wünschte mir von der Theorie mehr Anknüpfungspunkte an die Praxis. Diese Überlegungen prägen meinen Zugang und erklären den Aufbau dieser Arbeit.
Daraus lassen sich für mich folgende Ziele für diese Forschungsarbeit ableiten:
-
Einmal geht es mir darum, die Arbeit der LehrerInnen-Teams sichtbar zu machen und damit auch wertzuschätzen. Den wissenschaftsrelevanten Ansatz für diese Haltung werde ich im Laufe der Arbeit transparent machen. Auch wenn die Forderung, das Recht oder auch nur der Wunsch nach gemeinsamem Lernen für Kinder/Jugendliche mit und ohne sog. Behinderung für mich außer Frage steht, ist dies doch leichter zu formulieren und theoretisch zu begründen, als diese Ansprüche in einer bestehenden Kultur und Struktur wie der Hauptschule umzusetzen. Kleine Schritte in der Praxis brauchen vielleicht mehr Kraft und Mut als der Entwurf theoretischer Konzepte auf Papier. Fachlehrersystem und äußere Differenzierung durch Leistungsgruppen kennzeichnen das System Hauptschule und bieten damit eine Voraussetzung, die integrativer Pädagogik entgegenstehen. Hauptschulen, besonders jene im Vorarlberger Rheintal, stehen in einem Konkurrenzkampf zur gymnasialen Unterstufe. Ohne an dieser Stelle auf die Gründe dafür einzugehen, es ist ein Faktum, dass Hauptschulen verstärkt um SchülerInnen kämpfen müssen. Die Wege und Kulturen sind unterschiedlich, viele Hauptschulen betonen jedoch den Leistungsaspekt der 1. Leistungsgruppe, versuchen aufzuzeigen, dass SchülerInnen der 1. Leistungsgruppen mindestens gleich gute Schulleistungen erbringen wie jene, die ein Gymnasium besuchen. Dieser und eine Reihe anderer Faktoren führen dazu, dass der Verzicht auf Formen der äußeren Differenzierung mit viel Risiko verbunden war und in den Schulen selbst keineswegs nur auf breite Akzeptanz bauen konnte.
-
Kern der Forschungsarbeit ist es deshalb, die Schritte hin zu einer Pädagogik der Vielfalt zu dokumentieren, wobei ich den Fokus ausdrücklich auf das Feld Unterricht und Unterrichtsorganisation richte - und damit andere, bedeutende Felder, wie etwa die Entwicklung von Teams und Teamarbeit oder aber die Zusammenarbeit mit den Eltern nur am Rande mit einbeziehe. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie ist es möglich, die immanent segregativen Strukturen zu überwinden, wie versuchten die Teams Unterricht zu organisieren und gemeinsames Lernen zu ermöglichen?
Dokumentieren bedeutet jedoch nicht deskriptives Aufzählen, sondern heißt für mich Systematisieren, Herausarbeiten von zunächst kaum sichtbaren Unterschieden und deren Wirkungen. Unterschiedliche Organisationsformen, Unterrichts-Konzepte und Methoden sollen beschrieben und auf ihre Stärken und Schwächen hin analysiert werden. Dokumentation heißt aber auch, diese Praxis in einem größeren Zusammenhang zu sehen, sie auf der Folie von Theorie zu reflektieren.
Dokumentierte Praxis, Beispiele von good practise wie auch Beispiele, die Problemfelder identifizieren, sind meiner Meinung nach notwendiger Input für schulische Veränderung und Weiterentwicklung.
-
Veränderte Unterrichtsformen, begriffliche Nomenklaturen wie erweiterte, neue, schülerorientierte, offene, schülerzentrierte Unterrichtsformen, begleiten und prägen als Schlagworte den pädagogischen Diskurs sowohl im Zusammenhang mit integrativer Pädagogik, finden sich jedoch zunehmend auch im allgemein-pädagogischen Kontext, werden in der Praxis meiner Meinung nach wenig präzise verwendet und definiert, wenig theoretisch begründet. In diesen Begriffen subsummiert sich ein Sammelsurium wenig konturierter Vorstellungen. Deshalb ist ein weiteres Ziel dieser Arbeit, diese Begriffe zu präzisieren, die Grundannahmen der integrativen Pädagogik in den Kontext allgemeiner Pädagogik zu stellen und Unterricht weniger aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen zu argumentieren, sondern mit Blickpunkt auf alle, auf Kinder, die als sog. nichtbehinderte Kinder gelten. Ich meine, dass die Bearbeitung des Themas aus dieser Perspektive ganz besonders wichtig ist, wenn man die Mühen der Veränderung nicht der Integration zuschreiben und damit letztlich wiederum als Gnadenakt gegenüber Kindern mit besonderen Bedürfnissen ausweisen will - und damit einmal mehr die Falle des segregativen Denkens bedient.
Diese Perspektive ist mir deshalb so besonders wichtig, weil sowohl LehrerInnen wie auch Eltern als Partner für Inclusion zu gewinnen sind. Feusers ›Mit dem Kopf durch die Wand-Postulat‹ »Integration ist zu realisieren, sonst wird sie nie sein« (Feuser 1995) teile ich einerseits, denn der Weg zu Inclusion braucht gemeinsames Erleben, um die Konstruktion von Behinderung überhaupt in Frage stellen zu können. Andrerseits weiß ich heute mehr als früher um die be- und einschränkenden Bedingungen, den geschlossenen Charakter in der Wirkmacht von Systemen. Integration, die nichts weiter ist als das räumliche Zusammenführen von Kindern mit und ohne Förderbedarf, die nicht getragen wird von der Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf diesen herausfordernden, auch risikoreichen Prozess der Veränderung einzulassen, wird die gängige Konstruktion von Behinderung zementieren und führt nicht unbedingt zu Gegenbildern und damit zur erhofften De-Konstruktion der Klassifizierung und Kategorisierung von Menschen. Eltern und ›Normalschüler‹ müssen ›angeschlossen‹ werden, die Unterrichtsbedingungen und die Form des Lernens muss aus der je eigenen Perspektive lohnend und bedeutsam sein, sonst wird Integration tatsächlich nicht sein, bzw. nicht werden können, auch wenn man sie organisatorisch erzwingen will. Was versteht man also unter diesen sog. offenen und erweiterten Lehrformen und mit welchen theoretischen Erkenntnissen lassen sie sich heute allgemein begründen? Welche Bedeutung haben sie aus der Perspektive der sog. Normalschüler, sowohl gegenwärtig als auch im Hinblick auf deren Zukunft? Der alleinige Rückgriff auf die Reformpädagogik, die ihre Theorien und Vorstellungen in einer völlig anderen Zeit unter völlig anderen gesellschaftlichen Bedingungen entwickelte, greift meiner Meinung nach zu kurz.
-
Alle Schritte auf dem Weg zu einer Pädagogik der Vielfalt sind ihrem Wesen nach ein permanenter Reflexionsprozess: ein Sich-Einlassen, Hypothesen-Bilden, Ausprobieren, Evaluieren, Korrigieren, Adaptieren, Verändern. Es ist dabei notwendig, immer wieder innezuhalten, die gemachten Erfahrungen zu sammeln, zu bündeln und zu reflektieren, zu schauen, wie die neuen Lernsysteme des integrativen Unterrichts von allen Beteiligten erlebt wurden, von den Jugendlichen in diesen Klassen, von LehrerInnen und Eltern, welche Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt wurden, welche Ängste und Hoffnungen existent waren, welche neuen Fragestellungen dazugekommen sind. Im Rahmen dieser Arbeit, die ich auch als Zwischenbilanz bezeichnen möchte, geht es um das Darstellen und Aufzeigen von positiv Erlebtem, von Erfolgen und Glück, genauso jedoch um das Registrieren und Formulieren von Enttäuschungen, das Benennen von Schwierigkeiten, um das Beschreiben von Problemfeldern und das Ernstnehmen von Zweifeln.
-
Die Praxisrelevanz dieser Forschungsarbeit liegt im Wesentlichen darin, alle diese vielfältigen Erfahrungen im Sinne eines Vademecums an andere LehrerInnen weiterzugeben, den Einstieg für diese Teams zu erleichtern und damit letztendlich auch jener Aufgabe zu entsprechen, die im Rahmenkonzept der wissenschaftlichen Begleitforschung formuliert wurde: Neue Teams sollen das Rad nicht wieder von vorne erfinden müssen, sollen auf Erfahrungen zurückgreifen können, sollen auf verschiedene Problemfelder sensibilisiert werden um ›Fallen‹ von vornherein umgehen zu können. ›Good practise‹ soll vorgestellt werden - nicht als theoretisch-didaktisch überhöhtes Konzept, sondern als machbarer Einstieg in bestehende Strukturen, als Ausgangspunkt für team-eigene Entwicklungsprozesse.
-
Ein weiteres Motiv für das Schreiben dieser Arbeit - weniger wissenschaftlichen als vielmehr politischen Charakters - hat mit der derzeitigen bildungspolitischen Diskussion zu tun: Es ist meine ganz persönliche Sorge, die ich mit vielen teile, dass im Zuge der bildungspolitischen Sparmaßnahmen dem noch immer sehr zarten, kleinen Pflänzchen des gemeinsamen Unterrichts Schaden zugefügt wird, dass Entwicklungsprozesse stagnieren bzw. rückläufig werden. Ich verweise dabei in allererster Linie auf die Frustration von engagierten LehrerInnen, die derzeit erleben müssen, wie wenig Engagement und Leistungsbereitschaft vom Arbeitgeber Bund wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Eine häufig anzutreffende Antwort - neben den unterschiedlichsten Boykottmaßnahmen, die derzeit in Vorarlberger Schulen durchgeführt werden - ist das Reduzieren von Engagement, ohne das jedoch eine Veränderung in Richtung Inclusion illusionär ist.[10] Die Dokumentation über die Erfahrungen erweist sich in diesem bildungspolitisch gesellschaftlichen Kontext als zeitgeschichtlicher Beleg und zeigt auf, was und wie viel motivierte MitarbeiterInnen zu leisten bereit sind.
Zusammengefasst lassen sich folgende inhaltlichen Schwerpunkte für die Arbeit formulieren:
-
Mit welchen organisatorischen Maßnahmen versuchten die ersten Vorarlberger Hauptschulteams, die immanent segregativen Strukturen in der Sekundarstufe ansatzweise zu überwinden? Die Veränderung dieser Strukturen ist eine Grundbedingung, eine Grundvoraussetzung dafür, dass integrativer Unterricht mit Zielsetzung Inclusion möglich wird.
-
Integrative Pädagogik wird im pädagogischen Alltagsdiskurs mit offenen, erweiterten, neuen Lehr- und Lernformen assoziiert, häufig ohne diese Begriffe zu präzisieren und theoretisch zu fundieren. Was ist darunter zu verstehen, wie lassen sich diese pädagogischen Schlagworte definieren, abgrenzen, und damit evaluieren? Welche Bedeutung haben sie aus der Perspektive von sog. NormalschülerInnen?
-
Integrative Pädagogik verweist mit Vorliebe auf die Reformpädagogik, die zu Beginn dieses Jahrhunderts entwickelt wurde. Wie und mit welchen gegenwärtigen theoretischen Erkenntnissen über das Lernen lassen sich Veränderungen in der Lernorganisation begründen?
-
Wie können diese theoretischen Konzepte, auf denen Inclusion basiert, in kleinen Schritten in die Praxis umgesetzt werden? Wie organisierten die Teams den Unterricht, welche Unterrichtskonzepte entwickelten sie, um Gemeinsamkeit und Individualität miteinander zu verknüpfen?
-
Welche Erfahrungen machten die Beteiligten, LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen? Welche Erwartungen wurden erfüllt, welche nicht, welche Fragestellungen sind hinzugekommen? Was erlebten die Beteiligten als Erfolg, aber auch, was erlebten sie als enttäuschend, schwierig?
-
Welche Schlüsse können aus diesen ersten Erfahrungen gezogen werden? Welche Wege sollten weiterentwickelt, welche korrigiert werden?
Die Arbeit gliedert sich im Überblick in drei große Abschnitte:
In einem ersten Abschnitt (Kapitel 2) geht es um die Auseinandersetzung mit Theorie und um den Stellenwert integrativer Pädagogik im allgemein-pädagogischen Diskurs, bzw. weiter gefasst, im theoretischen Diskurs rund um den Begriff des Lernens. Dieser Diskurs wird ja längst nicht mehr ausschließlich von den Geisteswissenschaften, der Pädagogik, Psychologie oder Philosophie geführt, auch naturwissenschaftliche Disziplinen (Neurobiologie, Evolutionsbiologie) beschäftigen sich zunehmend mit Fragen des Erkennens und Lernens. Die Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften und auch aus der Systemtheorie sind hochinteressant, vielfach bestärken sie die Ansätze der Reformpädagogik und können als zusätzliche (und auch zeitgemäßere) Argumentationshilfen dienen, warum schulisches Lernen in der tradierten Form in Frage gestellt werden muss, warum andere Formen des Lernens entwickelt werden sollten, warum Schule ›neu erfunden‹ (Voss, 1999) oder ›neu gedacht‹ (von Hentig, 1993) werden muss, und zwar unabhängig davon, ob der Fokus auf Inclusion oder nur auf die allgemeine Schule gerichtet ist. Veränderung von Schule auch aus der Perspektive naturwissenschaftlich fundierter Kritik zu argumentieren und einfordern zu können und nicht aus der - als Killerargument sehr wirksamen - Perspektive sozialromantischer, weltfremder PädagogInnen, halte ich für ausgesprochen hilfreich und wirkmächtig.
Die theoretischen Ausführungen sehe ich als Fundament für den zweiten großen Abschnitt (Kapitel 3 und 4), in welchem Unterrichtsorganisation, -konzepte und Methoden der ersten Hauptschul-Integrationsklassen dokumentiert, systematisiert und auf deren Tauglichkeit im Hauptschulsystem aus Sicht der LehrerInnen analysiert und reflektiert werden. Allerdings wäre diese Sichtweise alleine zu reduziert: Die Unterrichtspraxis, die ersten Schritte und Erfahrungen müssen mit den theoretischen Erkenntnissen aus dem ersten Abschnitt verknüpft, es müssen Linien herausgearbeitet werden, mittels derer man überprüfen kann, ob diese Schritte sich der Vision von Inclusion annähern oder trotz Veränderung letztlich segregative Denkmuster bewahren und verfestigen.
Um meinem eigenen Anspruch zu entsprechen, nämlich Theorie und Praxis zu verbinden, vor allem aber neue Teams auf der Grundlage der Empowerment-Haltung zu unterstützen, sollte sich dieser Teil als eine Art Handbuch lesen und ohne großen Aufwand in die Praxis übersetzen lassen. Dieser Wunsch soll sich sowohl in der Sprache als auch in der Gestaltung mit Fotos und detailliert ausgearbeiteten, expemplarischen Praxisbeispielen spiegeln.
In einem dritten Abschnitt geht es um Erfahrungen, Einschätzungen, um das Erleben von beteiligten Personen - Jugendlichen, Eltern, LehrerInnen, es geht darum, positiv Erlebtes, Erfolge, aber auch Enttäuschungen und Zweifell sichtbar zu machen. Keine rosarote Brille,[11] nach Möglichkeit keine blinden Flecken und Tabus, aber auch kein Fokussieren auf Schwierigkeiten.
Eine Fallstudie, ein Beispiel von good practise, von einem Lernsystem, das von allen Beteiligten durchwegs positiv erlebt wurde, stelle ich ganz bewusst an den Anfang dieses Kapitels. Wenn ein Großteil von 14-jährigen Jugendlichen sagt, sie würden von sich aus wieder eine Integrationsklasse wählen, dass sie noch immer gerne in die Schule gehen, dass Schule nicht langweilig war, wenn Eltern sich ausgesprochen positiv über die Entwicklung ihrer Kinder äußern, wenn LehrerInnen - trotz vielfacher Faktoren von Mehrbelastung - positive Bilanz über ihren beschrittenen Weg ziehen und diesen gemeinsam noch einmal gehen, sind das für mich Gegen-Bilder, Gegen-Wirklichkeiten, die Mut machen, Kraft und Zuversicht geben - eben ›empowering‹ wirken und deshalb einem größeren Kreis Interessierter zugänglich gemacht werden sollten.
Es gibt aber auch andere Bilder, die neben viel positiv Erlebtem Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Zweifel sichtbar werden lassen. Diese offen zu benennen und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, ohne sofort auf die Nicht-Machbarkeit oder das Nicht-Gelingen von Inclusion in der Sekundarstufe zu schließen, halte ich für eine Stärke. Theoretische Beschwörungsformeln oder der Blick durch eine rosarote Brille bringen uns nicht weiter, sie ernten häufig nichts weiter als Kopfschütteln und Achselzucken. Was es braucht, ist sehr genaues Hinschauen, ein offenes Benennen von Schwierigkeiten, die Suche nach Veränderung und die Überzeugung, dass der Weg der Inclusion der einzig mögliche ist, auch wenn er manchmal steil, holprig und steinig ist.
Während meiner 7-jährigen wissenschaftlichen Begleittätigkeit habe ich eine Fülle an Daten, Erfahrungen, Eindrücken und Bildern gesammelt. Diese Forschungsarbeit stützt sich sowohl auf systematische Erhebungen und Berichte, aber auch auf sehr viele Beobachtungen während der Klassenbesuche, die teilweise detailliert protokolliert vorliegen, auf viele Teamgespräche, Einzelgespräche mit LehrerInnen, Kriseninterventionen und damit auch auf eine Fülle persönlicher Erfahrungen. Am Anfang eines jeden Kapitels werde ich die Datengrundlagen und die methodische Vorgehensweise detailliert anführen.
Datengrundlage im Überblick:
Eine wichtige Datengrundlage sind Modellberichte der ersten sechs Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg während bzw. nach dem ersten Schuljahr. Diese Modellberichte beschreiben detailliert die Entstehungs-Geschichten, Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und die Unterrichtsorganisation sowie eine Einschätzung/Evaluation aus LehrerInnensicht nach einem Jahr. Auf diesen Modellberichten als Ausgangsbasis und deren Veränderungen im Laufe der nächsten Jahre beruhen im Wesentlichen die Ausführungen in Kapitel 3 und 4 (Unterrichtsorganisation) dieser Arbeit. Sie dienten auch schon zur Zeit meiner wissenschaftlichen Begleittätigkeit in Vorarlberg als Grundlage für die Vorbereitung neuer Teams.
An dieser Stelle möchte ich die ersten Schulstandorte und die Teams namentlich nennen:
-
HS Lustenau Kirchdorf: Isolde Hagen, Raimund Haslauer,Martin Spalt, Brigitte Schatzmann, Susanne Pannos.
-
HS Egg: Hannes Natter, Gertrud Faißt, Judith Schäfer, Edith Österle, Engelbert Bereuter.
-
HS Dornbirn Markt: Monika Dorner, Peter Haid, Peter Hämmerle, Sylvia Ollmann, Claudia Amann, Schreiber Margot.
-
HS Bürs: Karin Engstler, Josef Fritsche, Brigitte Lindenbauer, Bernd Neyer, Günter Mayr, Margret Heinzle-Nessler, Bernhard Morscher.
-
HS Bezau: Arno Scharler, Tone Bär,Monika Lenz, Gerda Mennel.
-
HS Schwarzach: Walter Bösch, Günter Keller, Michael Hartmann, Günter Hopfner, Werner Freitag, Dietmar Bickel.
Diese sechs Klassen bezeichne ich in der folgenden Arbeit als ›Pionierklassen‹. Auch wenn der Ausdruck in erster Linie der Abgrenzung gegenüber den nachfolgenden Klassen und deren Daten dient, will ich damit sehr wohl auch ausdrücken, dass sie tatsächlich eine unschätzbare Vorreiterrolle für die Entwicklung der Integration in der Sekundarstufe in Vorarlberg geleistet haben.
Eine weitere, systematisch erhobene Datengrundlage sind zehn autorisierte Erfahrungsberichte von Teams nach vier Jahren Hauptschulintegration. Diese Berichte waren Auftragsarbeiten des Landesschulinspektors für Sonderpädagogik und Integration in Vorarlberg. Methodisch gesehen wählte ich hier einen narrativ-reflektierenden Zugang - Gruppeninterviews mit Tonbandaufzeichnung, Bearbeitung der Transkripte mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1990, Niedermair 1991), Autorisierung durch die Teams. Hier ziehen die LehrerInnen Bilanz über vier Jahre soziale Integration, Stärken und Schwächen werden angesprochen, erfüllte und nicht erfüllte Hoffnungen, Einschätzungen zu unterschiedlichsten Bereichen (Entwicklung der sozialen Integration, Leistungsentwicklung der gesamten Klasse, Arbeiten im Team, Entwicklung der Integrations-Kinder, Einschätzung der Unterrichtsgestaltung u.a.)
In vier dieser Klassen befragte ich auch Eltern und Jugendliche nach ihren Erfahrungen, wobei ich freie Berichte und Einschätzungsskalen als Methode verwendete. Es war in erster Linie Wunsch der Lehrerteams, ehrliches und offenes Feedback zu erhalten. Auf den Erhebungen dieser Pionierklassen baut dasKapitel 5 auf.
Weitere Datengrundlage sind eine Fülle von Protokollen, die auf sog. ›Einsteigerklausuren‹ erarbeitet wurden. Damit sind in der Regel ganztägige Klausuren als Höhepunkt der Teamvorbereitung und als vorläufiger Endpunkt des Vorbereitungsprozesses gemeint. Neue Teams oder auch neue Schulen wurden von mir in meiner Rolle als wissenschaftliche Begleiterin in einem ersten Schritt über die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung und Organisation und die bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Erfahrungen anderer Vorarlberger Teams informiert. In einem zweiten Schritt hatten die KollegInnen die Möglichkeit, über kollegiales Hospitieren unterschiedliche Modelle in der Praxis zu sehen und direkt mit Kolleginnen über Vor- und Nachteile zu sprechen. Auf einer ganztägigen Klausur erarbeitete das Team dann unter Supervision der wissenschaftlichen Begleitung ihr Organisationsmodell, legte die Unterrichtsgestaltung fest - im Wesentlichen Anteil und Struktur offener Phasen mit lehrerzentriertem Unterricht, verständigten sich über Kompetenzen und legten Teamstrukturen fest. Diese Daten sind Grundlage für das Resümee, für Einschätzungen im letzten Abschnitt, wohin sich die Integration in Vorarlberg bewegt.
Daneben gibt es eine Reihe von Protokollen aus Unterrichtsbeobachtungen und Teambesprechungen, von Klausur-Ganz- oder Halbtagen mit vielen Teams auch in den höheren Stufen, mit Reflexion der Ist-Situation, Stärken- und Schwächen-Analysen, Veränderungsvorschlägen und Organisations- und Unterrichtsplanungen für das nächstfolgende Jahr.
Neben diesen in schriftlicher Form festgehaltenen Daten habe ich in den sieben Jahren jedoch eine ganze Menge von Beobachtungen und Eindrücken gesammelt, die das Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sog. Behinderung dokumentieren. Ich bin - zumindest in den ersten Jahren, in den Integrationsklassen ein- und ausgegangen, war in der Regel gern gesehener Gast und fühlte mich in der Rolle als »kritischer Freund« (Altrichter/Posch 1998, 18), wurde zu Festen, Projektpräsentationen und Elternabenden eingeladen. Meine Überzeugung - dass gemeinsames Lernen auch in der Sekundarstufe möglich und für alle bereichernd sein kann - wurzelt in diesen Bildern.
Mein Wissenschaftsverständnis ist stark geprägt von meinem persönlichen Werdegang, und damit eng verbunden mit der Frauenforschung und der feministischen Forschung.
Maria Mies formulierte 1978 für den deutschsprachigen Raum erstmals die »Methodischen Postulate zur Frauenforschung«. (Mies 1984, 7ff) Diese haben, wenn auch modifiziert, für mich nach wie vor Gültigkeit und finden sich als wissenschaftliches Selbstverständnis nicht nur in der Frauenforschung, sondern in vielen sozialwissenschaftlichen Ansätzen wieder, wie Marlis Krüger bereits 1987 darlegte. (Vgl. Krüger 1987)
Die Postulate, die damals in Abgrenzung zur ›herrschenden‹ Wissenschaftsauffassung formuliert wurden, beinhalten für mich nach wie vor substantielle Aussagen, Kernaussagen, die ich grundsätzlich akzeptiere. Allerdings tut meiner Meinung nach nicht die Abgrenzung zur ›herrschenden‹ Wissenschaftsauffassung Not, denn in den Wissenschaften werden unterschiedliche, kritische Ansätze und Methoden längst als legitime, konkurrierende, sich gegenseitig befruchtende Perspektiven von den meisten FachvertreterInnen nachdrücklich anerkannt. Eine klare Positionierung im Alltagskontext tut Not: Immer noch wird von Forschung erwartet - das zumindest ist meine subjektive Wahrnehmung - dass sie klare Ergebnisse liefert im Sinne objektiver, quantifizierbarer, repräsentativer Fakten. Forschung soll Gewissheit bringen, Legitimationsgrundlage sein - und wenn man so will, Verantwortung für politische Entscheidungen abnehmen. Aus diesem Grund habe ich zu Beginn meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Begleiterin auch gegen meine eigentliche Überzeugung soziometrische Verfahren[12] verwendet, um ›handfeste‹ Aussagen liefern zu können, um zu beweisen, dass Inclusion möglich ist und nicht zuletzt, um meine eigene Tätigkeit zu legitimieren. Ein Verständnis von Wissenschaft als Diskurs auf der Basis nachvollziehbarer Aussagen oder Denkkonstrukte scheint im Alltag wenig verankert zu sein.
Bezogen auf den Gegenstandsbereich dieser Arbeit, nämlich auf die Vision einer Schule für alle und in der weiteren Perspektive auf die Vision einer solidarischen Gesellschaft ohne Ausgrenzung, die von der Unantastbarkeit der Würde und dem Respekt von Menschen, unabhängig von Kategorisierungen jedweder Art ausgeht, kann Forschung weder zur Verifizierung oder zur Falsifizierung beitragen. Ob eine Gesellschaft und deren PolitikerInnen sich dieser Vision öffnen, sie aktiv mitgestalten oder in Ansprachen Worthülsen produzieren, ist eine Frage der politischen Verantwortung und letztlich eine Frage der Ethik.
Mit der Zusammenfassung der Kernaussagen in den Postulaten von Maria Mies
und deren Transfer in den Kontext dieser Arbeit möchte ich mein Wissenschaftsverständnis
präzisieren: (vgl. Niedermair 1991)[13]
Bewusste Parteilichkeit statt Wertfreiheit
-
Das Postulat der Wertfreiheit, der Neutralität und Indifferenz gegenüber den Forschungsobjekten wird ersetzt durch bewusste Parteilichkeit. Forschungssubjekt und -objekt sind beide Teil eines umfassenden gesellschaftlichen Zusammenhangs und unterschiedlichsten Werten verpflichtet. Diese Werte gilt es offen zu legen, nachvollziehbar und auch kritisierbar zu machen. Ich bekenne mich - wie bereits im vorigen Kapitel ausgeführt - uneingeschränkt zu Inclusion, zur größtmöglichen Partizipation aller Menschen an der Gemeinschaft.
Sicht von unten statt Sicht von oben
-
Die vertikale Beziehung zwischen Forscherin und Erforschten, die »Sicht von oben« wird ersetzt durch die »Sicht von unten«. Ein Blick in die Geschichte der Wissenschaft zeigt, wie diese jahrhundertelang ihre Herrschaftsmechanismen - einer der wichtigsten ist die wissenschaftliche Definitionsmacht - unter dem Deckmantel der Objektivität verbergen konnte. Diese Mechanismen wurden nicht erst von der feministischen Forschung aufgedeckt, sondern bereits von der Kritischen Theorie oder aber auch von den Konstruktivisten. »Sicht von unten« bedeutet, dass Wissenschaft nicht als messende, prüfende und kontrollierende Außeninstanz zu verstehen ist, sondern als Instanz, die mit Betroffenen (›Unterdrückten‹ bei Maria Mies) Entwicklungsprozesse begleitet und bewusst macht. Dieses Postulat der feministischen Forschung deckt sich inhaltlich mit den Grundannahmen des Empowerment-Konzepts.
Die kontemplative, uninvolvierte Zuschauerforschung wird ersetzt durch aktive Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen und die Integration von Forschung in diese Aktionen.
-
Auch wenn die Sprache sehr deutlich auf die Zeit und den Zeitgeist verweist, in der das Postulat entstanden ist und heute irgendwie antiquiert klingt, verweist es einerseits auf die Theorie-Praxis-Verbindung, andererseits auf den gesellschaftlichen und politischen Kontext, in welchen diese Forschungsarbeit eingebettet ist. Insgesamt geht es mir nicht um die Produktion von sterilen Forschungsergebnissen, Ziel ist vielmehr die Veränderung der Schule, die Vision einer Schule für alle - und in diesem Kontext sind Forschungsergebnisse notwendige und hilfreiche ›tools‹: Sie stellen »Beobachtungsergebnisse, Wirklichkeitsinterpretationen und Reflexionshilfen zur Verfügung « (Wieser 1994, 115), schärfen den Blick, provozieren Diskurse, können helfen, Vorurteile zu entkräften. In den unterschiedlichsten Rollen spiegelt sich dieses Postulat in meinem Leben und meiner Person wider - als Lehrerin, als wissenschaftlich Arbeitende, als langjähriges Vorstandsmitglied von Integration Vorarlberg und in dieser Funktion als Mitdenkerin und -streiterin mit Betroffenen - mein eigenes Selbstverständnis ist untrennbar mit diesen verschiedenen Rollen verflochten.
Die Veränderung des Status quo wird zum Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnis.
Der Forschungsprozess wird zu einen Bewusstwerdungsprozess, sowohl für die Forschungssubjekte als auch für die Forschungsobjekte.
Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Begleitforschung unter dem treffenden Titel: »Schulentwicklung und wissenschaftliche Begleitung - ein ›schlampiges Verhältnis‹ mit Folgen« greift Ilsedore Wieser diese Postulate auf und stellt sie in einen anderen Zusammenhang: »Mit der Verlagerung der Reformanstöße von oben nach unten hat sich auch in der wissenschaftlichen Begleitung ein Paradigmenwechsel vollzogen: die Wissenschaft kontrolliert nicht mehr ausschließlich aus der Ferne, ob die Entwicklung in die richtige Richtung läuft, sie versteht sich zunehmend als Handlungsforschung, die sich in den Schulalltag einmischt bzw. diesen mitgestaltet.« (Wieser 1994, 113) Auch die Handlungs- und Aktionsforschung (vgl. Horster 1994, Allgäuer 1998) ist in ihrem Erkenntnisinteresse von Anfang an auf gesellschaftliche bzw. auf pädagogische Praxis bezogen und vollzieht sich in direktem Zusammenhang mit der Praxis, mit der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, deren Reflexion und Veränderung.
Die Entwicklung der Handlungs- und Aktionsforschung ist eng mit John Elliott, einem der bekanntesten englischen Exponenten dieser »Bewegung« verknüpft. Er definierte Aktionsforschung wie folgt:
»Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.« (Elliott, in Altrichter/Posch 1998, 13) Das Motiv, Aktionsforschung zu betreiben, bestehe darin, »die Qualität des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten, zu verbessern«. (Altrichter/Posch 1998, 13) Zudem sollen die teilnehmenden LehrerInnen ihr Wissen und ihre berufliche Kompetenz ausweiten, dieses Wissen und die Erfahrungen publizieren und damit einer breiten Öffentlichkeit - Kolleginnen, Eltern, Schulaufsicht - zugänglich machen.
Handlungsforschung beobachtet/kontrolliert also nicht von außen oder oben, sondern greift als Forschung unmittelbar in die Praxis ein. Die Fragestellungen erwachsen aus der Praxis - im Falle dieser Forschungsarbeit kreisen sie um das Thema: Wie können wir Unterricht in der Sekundarstufe so organisieren, dass Kinder mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen können? Als das Wesentliche an der Aktionsforschung bezeichnen Altrichter/Posch » ... jedoch nicht die einzelnen Methoden. Vielmehr liegt es darin, daß das Handeln in der Praxis und das Schlüsse-Ziehen aus der Handlungserfahrung, dass also Aktion und Reflexion eng und immer wieder aufeinander bezogen werden«. (Altrichter/Posch 1998, 16)
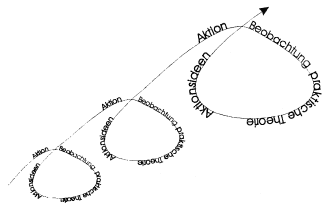
Der Kreislauf von Aktion und Reflexion (Altrichter/Posch 1998, 17)
Dieser sich permanent wiederholende Kreislauf von Aktion und Reflexion, den Altrichter/Posch mit einer nach oben führenden Spirale versinnbildlichen, charakterisiert präzise die Arbeitsweise mit den Teams, auf der diese Forschungsarbeit im praktischen Teil aufbaut: Beobachtungen von innen und außen, Beobachtungen der LehrerInnen im Team, Rückmeldungen von SchülerInnen und meine Unterrichtsbeobachtungen (angelehnt an die Methode der teilnehmenden Beobachtung) wurden auf Teamsitzungen zusammengetragen, analysiert, reflektiert, Hypothesen oder »praktische Theorien« gebildet, Organisationsformen oder Handlungsmuster bestätigt, verfeinert, weiterentwickelt, verändert oder aber auch verworfen.
Als weiteres wichtiges Merkmal der Aktionsforschung bezeichnen Altrichter/ Posch die »Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven« (Altrichter/Posch 1998, 17). Etwaige Diskrepanzen, subjektiv unterschiedliche Wahrnehmungen derselben Situation führen häufig zu besonders anregenden und bereichernden Auseinandersetzungen und sind in der Konstellation der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Begleiterin und Teams angelegt - vorausgesetzt, die wissenschaftliche Begleitung verpflichtet sich diesem Wissenschaftsverständnis und agiert nicht aus der kontrollierenden Sicht von oben.
Handlungs- bzw. Aktionsforschung hebt, wie die feministische Forschung, die Trennung zwischen Forschungssubjekt und -objekt, zwischen Forscherin und Praktikerin auf, da Forscherin und Praktikerin in einer Person ident sind. Bezogen auf die vorliegende Arbeit muss dieses Merkmal relativiert werden: Als wissenschaftliche Begleiterin war ich nicht Teil der Teams, die nach der Terminologie der Handlungsforschung die eigentlichen Forscher waren. Unser Verhältnis war gekennzeichnet durch enge Zusammenarbeit und engen Austausch, ich wurde von den Teams als unterstützend, nicht bewertend wahrgenommen, im Sinne eines »critical friend«. In den Phasen der Reflexion achtete ich ganz bewusst darauf und formulierte immer wieder, dass die Verantwortung, die Entscheidungen und die Kontrolle über »Aktionsideen« (Altrichter/Posch, 17) bei den Teams liegt, weil sie und nicht ich es waren, die diese ja auch in der Praxis umsetzen mussten. Hilfreich für meine Position als »critical friend« war sicherlich meine eigene Praxiserfahrung als Integrationslehrerin. Ich bin davon überzeugt, dass diese Praxiserfahrungen es waren, welche die Distanz zwischen den Teams und mir relativ gering hielt, weil wir so etwas wie einen »common ground« hatten.
Mit dem Schreiben dieser Dissertation bewege ich mich einen Schritt hinaus aus dem Praxisfeld. Die vielen Einzelerfahrungen lassen sich meiner Meinung nach systematisieren, sie lassen sich auf eine allgemeinere Ebene übertragen. Sie sind ein Haltepunkt, eine Zwischenbilanz auf der Spirale des Kreislaufs von Aktion und Reflexion - mit der Hoffnung, dass diese Arbeit ein Beitrag sein wird, diese fortzusetzen und zu erweitern.
[1] Das ›so genannt‹ verwende ich als Hilfsvokabel: Um verständlich zu bleiben, benutze ich die gängigen Kategorien ›geistige Behinderung‹, ›schwer-mehrfache Behinderung‹, Kinder mit ›Lernschwächen‹, auch ›normale‹ Kinder in Abgrenzung zu ›behinderten‹. Mit dem ›sogenannt‹ will ich darauf hinweisen, dass diese Kategorisierungen Wirklichkeits- und Denk-Konstruktionen sind, die theoretisch sehr leicht kritisiert und in Frage gestellt werden können, die sich in der Praxis als kaum brauchbare Zuschreibungen erwiesen haben und die ich persönlich, seit ich mit so bezeichneten Menschen zu tun habe, zum einen für unbrauchbar halte (und immer weniger weiß, was damit eigentlich bezeichnet wird), zum anderen für menschenunwürdig.
[2] »Integration Vorarlberg« ist ein Verein, der aus einer Elterninitiative entstanden ist und sich zum Ziel gesetzt hat, das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in sämtlichen Lebensbereichen zu unterstützen. Das Zitat stammt aus dem Präsentationsfolder. Kontakt: Ingrid Rüscher, Hof 368, A - 6866 Andelsbuch
[3] Integration wird laut Duden Fremdwörterbuch wie folgt definiert: »Wiederherstellung eines Ganzen«.
[4] Inclusion verwende ich im Sinne von: Aufhebung sämtlicher Kategorisierungen von Menschen - dieser Begriff bezeichnet die Vision.
[5] Siehe hierzu die unveröffentlichte Arbeit von Rita Arnsperger über die unterschiedliche Praxis der Zuteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich.
[6] Der besseren Lesbarkeit wegen werde ich mit der männlichen und weiblichen Form etwas ›schlampig‹ umgehen und mich nicht durchgängig auf eine Schreibweise festlegen.
[7] 1994/95 waren es zwei, 1995/96 sechs, 1996/97 neun Klassen, danach pendelte sich die Anzahl zwischen 20 und 25 Klassen pro Schuljahr ein.
[8] Siehe dazu: Claudia Niedermair: »Ich möchte arbeiten« Zur Gestaltung integrativer Übergänge zwischen Schule und Berufswelt für Jugendliche mit schweren Behinderungen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/5 1998, Graz.
Claudia Niedermair/Elisabeth Tschann: »Ich möchte arbeiten« Der Unterstützungskreis. Portraitsvon sechs Jugendlichen. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 4/5 1999, Graz
[9] Unveröffentlichte Handreichung: »Zukunftsplanung für Menschen mit Behinderung. Berufsorientierung - BOBI in Integrationsklassen« 1998. Eine verkürzte Ausgabe findet sich in der Reihe »Integration Sekundarstufe I« hrsg. vom Zentrum für Schulentwicklung, Bereich I, Klagenfurt, 2001
[10] Die gravierendste Verschlechterung für Integrationsklassen in der Sekundarstufe in Vorarlberg ist, dass es nicht mehr möglich ist, Teambesprechungsstunden lehrverpflichtungsmindernd geltend zu machen. Bis zum heurigen Schuljahr 2001/2002 war es möglich, Teambesprechungsstunden, die notwendige Voraussetzung für das Entwickeln von integrativen Strukturen sind, in die Lehrverpflichtung einzurechnen.
[11] Diese Begriffe sind Anlehnungen an den Buchtitel: »Blinder Fleck und rosarote Brille«, hrsg. von Meister-Steiner u.a., Innsbruck 1989
[12] Hanns Petillon: ST 3-7, soziometrischer Test für 3. bis 7. Klassen, hrsg. von Karlheinz Ingenkamp,
Beltz Test, 1980, den auch schon Hans Wocken in einer frühen Untersuchung verwendet hat.
[13] Siehe Diplomarbeit Niedermair 1991
Inhaltsverzeichnis
Der Aufbau dieses Kapitels basiert auf Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Praxisfeld der Hauptschule. Praktiker der Integration beziehen ihre theoretische Fundierung - wenn überhaupt - aus der Reformpädagogik, die anfangs des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichsten Ausformungen und Umfeldern entstanden ist. Wenig genau definierte Begriffe im thematischen Kontext des ›offenen Unterrichts‹ prägen den pädagogischen Diskurs in der Praxis. Die mit der Integration einhergehende Veränderung von Unterrichtsstrukturen und -formen wird in der Sekundarstufe in erster Linie aus der Perspektive von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf argumentiert, seltener jedoch in einem größeren Zusammenhang gesehen, als Notwendigkeit aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse über das Lernen, die für alle Kinder gelten und als gesellschaftspolitische Aufgabe im Zusammenhang mit dem Ziel von Bildung generell. Die Gliederung des Kapitels 2 folgt im Sinne einer heuristischen Vorgehensweise dieser Skizze.
Nach einer Definition integrativer Pädagogik werde ich versuchen, die unterschiedlichsten Facetten des Themenfeldes »offener Unterricht, neue/erweiterte Lehr- und Lernformen« zu beleuchten und näher zu bestimmen. In einem dritten Teil suche ich nach gegenwärtigen theoretischen Positionen, die eine Veränderung von Schule und Unterricht aus heutiger - und allgemeiner - Sicht begründen. Die Auswahl dieser Positionen ist sehr individuell gefärbt und folgt meinen persönlichen Suchbewegungen und Zugängen zu den Begriffen Lernen und Bildung: Überlegungen aus naturwissenschaftlicher Erkenntnisperspektive wie der Evolutionsbiologie (Varela/Maturana) oder aber auch der Neurobiologie, Überlegungen aus der philosophisch-konstruktivistischen Erkenntnistheorie, die Theorie des Kognitionspsychologen Howard Gardner sowie gesellschafts- bzw. ideologiekritische Annäherungen an den Begriff der Bildung (Hartmut von Hentig) werden vorgestellt und diskutiert. Alle diese Ansätze und Perspektiven formulieren mehr oder weniger radikal Kritik an der vorherrschenden Organisation des Lernens bzw. der Wissensvermittlung in Schulen und entwickeln theoretische und teilweise auch in der Praxis erprobte Gegenkonzepte.
Jedes Kind ist einzigartig, unverwechselbar, jedes Kind ist anders, unabhängig von einer möglichen Behinderung. Diese Vielfalt als Bereicherung, als Chance für alle - und nicht als Störung - zu sehen, gehört zum Menschenbild und ist Grundidee integrativer Pädagogik.
Integrative Unterrichtsgestaltung versucht, individuelles Lernen innerhalb einer Gemeinschaft von Verschiedenen zu ermöglichen, Unterschiede sichtbar zu machen, zu respektieren und schätzen zu lernen. Ziel ist es, den Unterricht so zu gestalten, dass alle Kinder, behinderte und nichtbehinderte, begabte und leistungsschwache, angepasste und weniger angepasste, in einer (Klassen)gemeinschaft ihren Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend lernen können.
Feuser definiert eine allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, die auf alle Kategorisierungen verzichtet und demnach radikal integrativ ist, wie folgt: »Alle Kinder und Schüler sollen in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen in Orientierung auf die ›nächste Zone ihrer Entwicklung‹ an und mit einem ›Gemeinsamen Gegenstand‹ spielen, lernen und arbeiten.« (Feuser 1995, 174) Die Spannungsfelder, die dieses Verständnis für die Praxis des integrativen Unterrichts vor allem in der Sekundarstufe miterzeugt und -konstituiert, werde ich unter Punkt 4.7 näher diskutieren, an dieser Stelle beschränke ich mich auf die Definition integrativen Unterrichts.
In Anlehnung an Feuser konkretisiert Bintinger gemeinsame Lernvorhaben. (Vgl. 2001, 56)
Gemeinsame Lernvorhaben
-
gehen von den Interessen, Bedürfnissen und Stärken der SchülerInnen aus;
-
berücksichtigen gesellschaftliche Erfordernisse;
-
ermöglichen bedeutungsvolles Lernen, d. h.
-
inhaltlich - fachliches Lernen (Wissen, Verstehen, Erkennen, Urteilen)
-
methodisch-strategisches Lernen (Methodenkompetenz: z. B. Exzerpieren, Strukturieren, Zitieren, Markieren, Nachschlagen, Entscheiden, Organisieren, Gestalten, Planen, Visualisieren, Ordnung halten, Arbeiten mit Lernkarteien, Gruppenarbeiten, Mnemotechniken, freies Reden, aktives Zuhören)
-
sozial-kommunikatives-kooperatives Lernen (Solidarität üben, Hilfestellung geben und akzeptieren, Annehmen, Zuhören, Begründen, Argumentieren, Fragen, Diskutieren, Gespräche leiten, Moderieren, Kooperieren)
-
affektiv-psychomotorisches Lernen (Selbstvertrauen und Selbstkompetenz entwickeln,
Identifikation und Engagement entwickeln, Werthaltungen aufbauen);
-
sind von LehrerInnen und SchülerInnen geplante pädagogische Situationen und/oder ergeben sich aus spontanen Lebenssituationen heraus;
-
beachten das Prinzip des multisensorischen und multimedialen Angebots;
-
gestehen jedem Kind individuelle Lernwege und Lernstile zu;
-
beinhalten das Prinzip der integrierten «therapeutischen« Hilfestellung.
Für Schley/Köbberling ist das Grundprinzip der Didaktik des gemeinsamen Unterrichts die Binnendifferenzierung, die sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren kann:
- Unterschiedliche Lernziele bei gleicher Aufgabenstellung
- unterschiedliche Lernangebote innerhalb einer gemeinsamen Struktur
- unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, unterschiedliche Themen und Strukturen bei gleichzeitigem Aufeinander-bezogen-Sein
- unterschiedliche Aufgabenstellungen und
- unterschiedliche Verwendung von Hilfsmitteln und Medien (vgl. Schley/Köbberling 1994, 155; Schley/Köbberling 2000).
»Lernen am gemeinsamen Gegenstand« (Feuser 1995, 178) ist die Kurzformel für integrativen Unterricht und meint im Kern, dass am gleichen Unterrichtsgegenstand, am gemeinsamen Lernvorhaben, unterschiedlichste Lernerfahrungen gemacht werden können.
Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Binnendifferenzierung - ob in der Sekundar- oder in der Grundstufe - erfordert, dass ein weit größeres Spektrum an Lernformen, an Lernaktivitäten zugelassen und angeregt wird, wie dies im konventionellen Unterricht erfolgt. Es erfordert die Gestaltung von adäquat strukturierten Lern- und Handlungsfeldern, von Lernumwelten. Die Form des fast ausschließlich frontal vorgetragenen Lehrstoffes, des lehrerzentrierten, eindimensional verlaufenden und linear gesteuerten Klassenunterrichts muss ergänzt werden durch eine stärkere Orientierung am Kind bzw. Jugendlichen. Die Erweiterung bezieht sich vor allem auf sinnliche Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten, die die Grundlage für die Entwicklung und Erweiterung von kognitiven Strukturen sind und damit Sicherheit und Orientierung in der Umwelt bedeuten - und dies gilt keineswegs nur für Kinder mit Beeinträchtigungen. In der Sonderpädagogik ist diese Einsicht meiner Meinung nach bereits heute stärker verankert, SonderpädagogInnen generieren ihr Wissen aus ihren Erfahrungen und Suchbewegungen im Gestalten von Lernmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung. Ein weiteres Grundprinzip ist es, das rezeptive Lernen und die Aneignung von lexikalischem Wissen durch aktives, selbstgesteuertes Lernen zu erweitern bzw. stärker zu gewichten. Nicht die Wissensfülle oder die Menge an durchgenommenem Lehrstoff werden als alleiniges Qualitätskriterium von Unterricht betrachtet, sondern der Erwerb der so genannten Schlüsselqualifikationen, wie eigenverantwortliches Lernen, selbständiges Arbeiten, Kooperationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, die Haltung zu ›lebenslangem‹ Lernen, Neugierde und Offenheit Neuem und Anderem gegenüber - Qualitäten, die für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung sind.
Damit reiht sich die Diskussion zur Didaktik integrativen Unterrichts lückenlos in eine Debatte ein, die zwar theoretisch schon seit längerer Zeit eine wichtige Rolle im pädagogischen Diskurs spielt, bisher in der Praxis zumindest in der Sekundarstufe - kaum Folgen gezeigt hat. Im Wesentlichen geht es meiner Meinung nach nämlich um weit mehr als um die didaktische Frage, wie gemeinsamer Unterricht von Menschen mit und ohne Behinderung geplant und durchgeführt werden kann. Es geht vielmehr um die grundlegenden Fragen: Was ist eigentlich Lernen, wie lernen wir? Was ist Bildung? Welchem gesellschaftlichen Auftrag folgt die Schule? Der theoretisch diskutierte Wandel ist meiner Meinung nach kein Wandel im methodischen Paradigma, sondern ein erkenntnistheoretischer Wandel, den man als einen Wandel vom »Instruktivismus zum Konstruktivismus« (Wolff 1997, 106) bezeichnen kann. Lernen lernen, Wege zur Autonomie der SchülerInnen sind Konnotationen des neuen Paradigmas, die auf diesen Wandel verweisen.
Die Kritik am herkömmlich konventionellen Unterricht und die Erweiterung bzw. Veränderung von Lernen werden längst nicht nur mehr von Pädagogen vertreten, die von zunehmenden Schwierigkeiten in der Praxis berichten, sondern werden gestützt vor allem aus der Kognitionspsychologie und der kognitiven Wissenschaft (Piaget, Gardner), aber auch durch die Philosophie des Konstruktivismus (von Foerster) und nicht zuletzt auch von Naturwissenschaftern, Biologen in erster Linie (Vester, Maturana/Varela), die sich mit der Funktionsweise unseres Gehirns auseinandersetzen. Der Biochemiker Frederic Vester, Mitglied des Club of Rome, schrieb in seinem Klassiker ›Denken, Lernen, Vergessen‹ schon 1978:
»Denn statt die Denkfähigkeit unseres Gehirns, also das Umgehen mit dem Stoff, zu entwickeln, wird dieses Gehirn in unseren Schulen und Universitäten immer noch herabgewürdigt zu einem - sogar noch falsch bedienten - Stoffspeicher.« (Vester 1999, 112)
In integrativen Klassen - vor allem dann, wenn sich die LehrerInnen bewusst für diese Unterrichtsarbeit entschieden haben - werden diese theoretischen Ansprüche umgesetzt. Innovative Unterrichtsvorstellungen und -konzepte, die unabhängig vom gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder diese ›anderen‹ Qualitäten verstärkt in den Mittelpunkt rücken, dessen zentrale Merkmale Individualisierung, Selbst- und Mitbestimmung, Eigenaktivität, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung und soziales Miteinander sind, werden auch unter dem Begriff schülerorientierter (offener) Unterricht, erweiterte Lehr- und Lernformen, subsummiert.
Daneben haben aber auch lehrerzentrierte (gebundene) Unterrichtseinheiten, in denen das Interesse von den LehrerInnen auf einen Gegenstand gelenkt und deren Ablauf von den LehrerInnen strukturiert wird, ihre Berechtigung. Mit der Polarisierung von offenen Lernformen als »gut« versus lehrerzentrierten Formen als »schlecht« wird eine innovative Entwicklung kaum konstruktiv unterstützt. Vielmehr ist es notwendig, dass LehrerInnen über vielfältige Methoden und didaktische Konzepte verfügen. Je breiter das Repertoire an Unterrichtsformen ist, desto eher finden sie Möglichkeiten, ein situationsadäquates, auf die Klassenverhältnisse abgestimmtes Lernumfeld zu gestalten und auch der Struktur des Lerngegenstandes zu entsprechen (Methodenmix). Allerdings führt kein Weg daran vorbei, die traditionellen Unterrichtsformen um offene Formen und ganzheitliche didaktische Konzepte zu erweitern, wenn man integrative Prozesse unterstützen und die Heterogenität der Gruppe und die Individualität jedes Kindes respektieren und auch neueste lerntheoretische Grundlagen berücksichtigen will.
Nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist in den letzten Jahren die Frage nach der Realisierung von schülerorientiertem, schülerzentriertem oder offenem Unterricht zu einem zentralen Diskursthema in der Pädagogik geworden. Die drei Begriffe werden dabei nahezu synonym verwendet, exakte Definitionen fehlen häufig. Viele Beiträge sind anregende und motivierende Beiträge aus der Praxis, von LehrerInnen geschrieben, Erfahrungsberichte, Anregungen, ohne bzw. mit wenig theoretischer Fundierung und meist auch ohne Darstellung der Wurzeln und des Zusammenhangs, aus denen sie sich entwickelt haben. Kommen theoretische Fundierungen vor, wird in der Regel auf die Reformpädagogik, und hier vor allem auf Montessori oder Freinet, verwiesen. Meist werden die Begriffe über unterschiedliche Bedingungen und Komponenten ‹umschrieben‹ - eingekreist. Allen Konzepten, Vorschlägen und Diskussionsbeiträgen ist jedoch eine veränderte Perspektive von Schule und Unterricht gemeinsam: Nicht die Schule und die über sie vermittelten gesellschaftlichen Ansprüche stehen im Mittelpunkt des pädagogischen Interesses, sondern das einzelne Kind, die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und eine Schule, die dies ermöglicht oder unterstützt. Anders ausgedrückt:
Die SchülerInnen sollen als Lernsubjekte ihr Lernen mitgestalten oder bestimmen, - je nach Radikalität des Ansatzes - und nicht nur mehr oder weniger passive Objekte eines »nicht sehr effektiven Eintrichterns« (Petri 1993, 12) und Wiedergebens von Lehrstoff sein: Die Lernenden sollen »sich nicht als Objekte, sondern als Subjekte unterrichtlicher Prozesse« (Huth 1986, zit. nach Petri, 10) erfahren. Im traditionellen Unterricht werden in der Regel die Lerninhalte von den Lehrpersonen vorgegeben, bei der Planung des Unterrichts zum Lerninhalt passende Strukturen überlegt - der Lehrstoff wird vorbereitend didaktisiert - und in der Klasse umgesetzt. Bei der Umsetzung können vielfältige Methoden und auch unterschiedliche Sozialformen zur Anwendung gelangen, nur von Frontalunterricht zu sprechen, ist eine grobe Simplifizierung, die leider nur allzu häufig im pädagogischen Alltag anzutreffen ist. Weitaus treffender ist der Ausdruck »lehrerzentrierter Unterricht«, der deutlich macht, dass im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens der über die Lehrperson ausgewählte und vom Lehrplan vorgesehene Lehrstoff und dessen Vermittlung an die Schülergruppe steht. Prinzipiell kann auch lehrerzentrierter (gebundener) Unterricht binnendifferenziert, auf unterschiedliche Lerntypen ausgerichtet, mehrkanalig, in sozialem Miteinander organisiert, es können also verschiedene der oben erwähnten Komponenten mitberücksichtigt werden. In der Regel assoziieren wir mit lehrerzentriertem Unterricht jedoch Frontalunterricht, der »auch heute noch das Verbale, das Wort und damit ganz bestimmte Eingangskanäle, Symbolassoziationen und Kodifizierungen ungemein bevorzugt - unter sträflicher Vernachlässigung ganzer Hirnpartien, die für das Lernen eingesetzt werden könnten, sich jedoch daran nicht beteiligen.« (Vester 1999, 125) Vermutlich ist dies der Grund für die häufig anzutreffende Pauschalabwertung frontalen Unterrichts. Diese von LehrerInnen gesteuerten, in der Regel linear angelegten Lernprozesse führen dazu, »daß alle mehr oder weniger im gleichen Tempo und zur gleichen Zeit etwa gleich lange das gleiche tun« (Wagner 1978, 17) - eine Diagnose, die auch nach bald 25 Jahren noch gültig ist. Dass eine derartige Konzeption und Struktur von Unterricht wenig bis keine Möglichkeiten zulässt, individuelle Interessen zu verfolgen und eigene Lernwege zu suchen, dürfte unumstritten sein. Organisationsformen, die das Lernsubjekt ins Zentrum des Unterrichts rücken wollen, werden im gängigen Diskurs unter dem Oberbegriff »offene Lehr- und Lernformen« zusammengefasst und sind wesentlicher Bestandteil der Diskussion zur inneren Schulreform. (Vgl. Einsiedler 1985; Jürgens 1994; Garlichs u.a. 1990)
Dieses Umdenken, dieser Paradigmenwechsel wird verständlich über die Kritik an der herkömmlichen Schule und ihren Vermittlungsformen und ist keineswegs eine junge, ›zeitgeistige‹ Erscheinung. Mehr oder weniger explizit beziehen sich die gegenwärtigen BefürworterInnen eines schülerorientierten Unterrichts auf die großen ReformpädagogInnen, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts für eine pädagogische Erneuerung der sog. Staatsschule eingetreten sind. Damit meine ich jene herausragenden Persönlichkeiten, deren Modelle der Reformpädagogik auch heute noch verbreitet und erfolgreich sind, wobei ich als Kriterium des Erfolgs zunächst einmal nur die Kontinuität und den Weiterbestand dieser Schulmodelle betrachte: Maria Montessori, Celestin Freinet, Peter Petersen mit der Jenaplan-Pädagogik, Helen Parkhurst mit der Dalton-Plan-Pädagogik und Rudolf Steiner mit der Waldorfpädagogik. Neben interessanten Spezifika, die die einzelnen Konzepte deutlich unterscheiden, gibt es eindeutige Gemeinsamkeiten. Die Reformpädagogik »(...) ist allgemein gekennzeichnet durch die Suche nach humaneren Formen in der Schule. Diese Suche ist auch heute noch immer aktuell. Fast alle Modelle der Reformpädagogik weisen ein gemeinsames pädagogisches Bemühen auf: das systematische Lernen und das persönliche Erleben in einen angstfreien Bildungsprozeß zu integrieren.« (Eichelberger 1995, 7) Die reformpädagogischen bzw. schulerneuernden Bemühungen erreichten in den späten 60er und 70er Jahren des 20. Jhs. eine neue Blüte. Ich verweise nur auf die starke Rezeption von Alexander Neills »Summerhill« mit dem Konzept der antiautoritären Erziehung, das er bereits in den 20er Jahren entwickelt hatte, es ist die Zeit der Gründung vieler sog. »Alternativschulen«: Glockseeschule Hamburg, Tvindschulen in Dänemark, Freie Schule Berlin u.a. (vgl. Borchert/Derichs-Kunstmann, 1979) und auch die Zeit der Rückbesinnung auf und Wiederentdeckung der Reformpädagogenpersönlichkeiten, die ich oben schon erwähnt habe. Das erste Freinet-Treffen Österreichs - an dem ich damals als Junglehrerin teilnahm und den Film »Den Kindern das Wort geben« sah, der mich nachhaltig geprägt hat - fand beispielsweise 1978 an der Universität Klagenfurt statt. Dennoch sind die Bemühungen damals Ansätze geblieben, einzelne Schulen blieben Inseln, Alternativ- und Privatschulen, glitzerten als bunte Punkte in einer Schullandschaft, die sich beharrlich gegen den Einzug von zusätzlichen, veränderten Lehr- und Lernstrukturen zur Wehr setzte. Als »Katastrophe der schulischen Praxis« kritisiert Vester dieses Beharren auf tradierten Strukturen: »Das Ganze (Frontalunterricht, Anm. d. V.) ist ein eklatantes Beispiel für die ungeheure Zähigkeit, mit der sich längst sinnlos gewordene Traditionen von Generation zu Generation fortpflanzen. Die Wurzel für diese Unterrichtsmethode liegt tief im Mittelalter, in der Klosterschule, in der Predigt mit ihrer Sitzordnung (...).« (Vester 1999, 125)
Die Hauptkritik an der traditionellen Schule hat Petri (Petri 1993, 10f) mittels inhaltsanalytischer Betrachtung umfangreicher schulkritischer Literatur des 20sten Jahrhunderts in wenigen Punkten zusammengefasst und mit Zitaten illustriert. Sie stimmen im Wesentlichen mit häufig geäußerten Meinungen von SchülerInnen, Eltern und Lehrerinnen überein.
-
Fremdbestimmung des schulischen Lernens - die Lernenden können sich damit nicht identifizieren;
-
der Lebensweltbezug fehlt;
-
Abspaltung von emotionaler Betroffenheit;
-
zu wenig Spielraum für Eigeninitiative und Selbstbestimmung der Lernenden;
-
manipulative geistige Fixierung der Lernenden;
-
defizitäres Lernen.
Nicht erwähnt wird bei dieser Übersicht die Angst, die lange Zeit ein völlig akzeptiertes Instrumentarium der allgemeinen wie auch der Schulpädagogik war und auch heute noch ist, wenngleich die Mechanismen subtilere geworden sind. Eine nahezu unüberschaubare Fülle an Literatur zu diesem Thema kann als Beleg dazu dienen: Katharina Rutschkys »Schwarze Pädagogik« (1988) oder Jörg Jeggis »Angst macht krumm« (1981), um nur einige wenige Klassiker auf diesem Gebiet anzuführen. Leistungsversagen verbunden mit Schulangst ist bei der hierarchisch gestuften und selektionsorientierten Organisation der Regelschule der Gegenwart und dem Erwartungsdruck, dem viele Kinder ausgesetzt sind, auch heute nicht zu vermeiden.
Es steht für mich außer Frage, dass die Schule um offene Formen erweitert werden muss. Großes Unbehagen sowohl bei der Durchsicht von pädagogischdidaktischer Literatur (Ratgeber-Literatur, Rezeptliteratur) zum Thema als auch bei Diskussionen in Lehrerkreisen bereitet mir persönlich die Theoriefeindlichkeit, wie ich es gerne bezeichne, die Verwendung und ständige Wiederholung von ›zeitgeistigen‹ Begriffen, die oft so vage und nichtssagend sind, Worthülsen, deren Inhalt auch bei näherem Hinschauen nicht erkennbar wird - oder was noch schlimmer ist, sich als »alter Wein in neuen Schläuchen« entpuppt, wovor Georg Feuser 1993 auf einem Symposium in Feldkirch gewarnt hat. Dieses Unbehagen verbunden mit einem Appell um grundsätzliche Reflexion, um Fundierung, um Analyse und klare Positionierung wird in neueren Publikationen zunehmend artikuliert. (Vgl. Gronemeyer 1996, Schirlbauer 1996, von Hentig 1993) Gemeinsam ist diesen mahnenden Stimmen, das Ganze - und damit die Gesellschaft mit ihrer Vermittlungsstruktur Schule - zu sehen, zu sehen, dass die vielen didaktischen Maßnahmen, die mit Humanisierung und Orientierung am Individuum begründet werden, dennoch in einem gesellschaftlich definierten Rahmen inmitten von Macht und Herrschaft umgesetzt werden - und dass dieser Rahmen mitzudenken und zu verändern ist. Mit großer Deutlichkeit distanzieren sie sich vom ›soft-learning‹, wie von Hentig die wie Pilze aus dem Boden sprießenden Lernmethoden bezeichnet, und dem Angriff auf die verkopfte Schule. Allerdings verteidigen diese AutorInnen damit keinesfalls die tradierte Regelschule mit ihren Lernmethoden, denn rezeptive Wissenswiedergabe ist nicht kritisch rationales Denken.
Im Folgenden möchte ich versuchen, den Terminus ›schülerorientierter Unterricht‹ näher zu fassen und die Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder verwendet werden, zu präzisieren und abzugrenzen. (Vgl. Eichelberger 1995, 8; Petri 1993, 13 ff)
Selbstbestimmung bzw. Mitbestimmung zu ermöglichen als Gegenbewegung zur Fremdbestimmtheit schulischen Lernens, ist eines der zentralen Postulate der BefürworterInnen schülerorientierten Unterrichts. Als Ziel ist es für mich unumstritten, ginge es doch dabei um das Einüben von demokratischen Haltungen, um das Aushandeln, Vereinbaren und Akzeptieren von Regeln, um Kompromissbereitschaft und Toleranz und um Partizipation - um Voraussetzungen für das, was im Schulorganisationsgesetz als oberstes Ziel formuliert wird:
»Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschaftsund Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken.« (SchOG § 2)
Allerdings trägt nicht alles, was unter dem Etikett Selbst- bzw. Mitbestimmung verkauft wird, diese Bezeichnung meiner Meinung nach zu Recht. Das Postulat ist die eine Seite, die Praxis die zweite - und dies sollte kritisch hinterfragt werden. Einem Schüler Wahlmöglichkeiten bei der Auswahl von Lernaufgaben zuzugestehen ist weit davon entfernt, Mitbestimmung zu sein, es kann ein erster Schritt auf dem Weg in Richtung Mitbestimmung sein. Dies soll jedoch nicht missverstanden werden in der Form, dass Wahlmöglichkeiten etwas Schlechtes oder abzulehnen wären, ganz im Gegenteil - ich plädiere nur für einen klaren Umgang mit Begriffen, spreche mich gegen die definitorische Unschärfe und Ungenauigkeit und dadurch Verschleierung aus, die vielen der in diesem Diskurs verwendeten Begriffe anhaftet.
In offenen Unterrichtsstrukturen können SchülerInnen auf unterschiedlichen Ebenen Wahlmöglichkeiten bzw. Mitbestimmung zugestanden werden, die langfristig zur Selbststeuerung von Lernprozessen und Eigenverantwortung führen sollen. Von Mitbestimmung kann man meiner Meinung dann sprechen, wenn SchülerInnen bei der Auswahl von Lernzielen und auch von Themen und Inhalten sowie hinsichtlich der Planung von Formen und Wegen des Lernens Freiräume zugestanden werden, von Wahlmöglichkeiten dann, wenn aus einem vom Lehrer (fremd-)bestimmten Angebot eine Auswahl getroffen oder die Reihenfolge der Durchführung von Aufgaben selbst eingeteilt werden kann.
Durch Mitbestimmung soll auf didaktischer Ebene erreicht werden,
-
dass sich die Jugendlichen mit den jeweiligen Lernzielen identifizieren;
-
dass sie sich mit Dingen beschäftigen, die für sie persönlich bedeutsam sind;
-
dass als Folge dessen die Motivation nicht eine extrinsische, sondern eine intrinsische ist;
-
dass sie Verantwortung für ihr Lernen, das Erreichen des selbst gesteckten Lernziels übernehmen - und dabei Prozesse der Selbststeuerung erfahren;
-
dass sie nicht aus reinem Pflichtgefühl oder mit Widerwillen, sondern mit Engagement arbeiten, um das von ihnen gesteckte Ziel zu erreichen - z. B. Neugierde zu befriedigen, ein Produkt herzustellen, eine Schwierigkeit zu überwinden, ein Problem zu lösen - und damit die Effizienz des Lernens gesteigert wird. (Vgl. Vaupel 1996)
Ob diese sehr wünschenswerten, idealtypischen Ansprüche in einem Lernsystem auch angestrebt bzw. umgesetzt werden oder ob es sich dabei um die unreflektierte Übernahme von zeitgeistigen Begriffen oder gar um ‹Etikettenschwindel‹ handelt, muss letztlich an den jeweiligen Praxisbeispielen bzw. Unterrichtsstrukturen überprüft werden. Eine sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Aufgaben, häufig als Wochenplanstruktur zu sehen, wird vermutlich von SchülerInnen zu Recht nicht als selbst gestecktes Ziel wahrgenommen und kaum zum Erreichen obiger Ziele beitragen können. Auch wenn das Angebot von Wahlmöglichkeiten in einer Klasse eine Reihe positiver Effekte nach sich ziehen kann, die ich keineswegs gering schätzen möchte - Wegnehmen von Druck durch Differenzierung, Motivationssteigerung, Verbesserung der Lernatmosphäre - kann dies nicht mit Selbst- und Mitbestimmung gleichgesetzt werden.
Selbstbestimmung bzw. Mitgestaltung der eigenen Lernaktivitäten setzt voraus, dass den Lernenden genügend Information und Unterstützung zur Verfügung stehen, um die Lernaufgaben möglichst selbstständig lösen zu können, dass sie Lernschritte zielführend planen und dass sie ihre Lernfortschritte weitgehend selbst kontrollieren und beurteilen können - Voraussetzungen also an die Gestaltung der Lernumgebung (in Anlehnung an Maria Montessoris »vorbereitete Umgebung«), an die Rolle der LehrerInnen (Moderation, Unterstützung statt Belehrung, Feedback) und die Fähigkeiten der SchülerInnen (Motivation und Selbststeuerung).
Selbst- und Mitbestimmung darf sich nicht allein auf die didaktische Ebene beschränken, um individuelle Fortschritte zu steuern, um möglichst effizientes individuelles Lernen zu gewährleisten. Selbst- und Mitbestimmung ist auch zu sehen als soziale Kategorie: das Einüben von Demokratie findet im Alltag statt und fordert das gemeinsame Aushandeln von Regeln, das gemeinsame Bearbeiten von Konflikten und verlangt von den Lehrenden, einen Teil ihrer »Macht« zu teilen. »Die Schule als polis« - die Schule als Gemeinwesen im Kleinen, so fasst Hartmut von Hentig seine Überlegungen zum Lernen von Selbst- und Mitbestimmung als Grundlage demokratischen Handelns zusammen. (Vgl. Punkt 2.3.4)
Mit dem Auftauchen der Theorien über unterschiedliche Lerntypen in den 1980er Jahren hat die Diskussion um die Individualisierung von Lernprozessen eine neuerliche Dynamik erhalten. Pädagogen haben zwar schon immer Unterschiede zwischen Lerntypen festgestellt, dennoch folgte die Pädagogik sowohl als Wissenschaft als auch als Praxis der Überzeugung, dass alle SchülerInnen auf ähnliche Weise lernen. (Vgl. Gardner 1996, 303) Das Aufbereiten von Lehrstoffen nach bestimmten Stufen und Schemata, unabhängig von Inhalten, das Zerlegen von Lehrstoffen in kleinste Schritte, die in der Regel dem Lerntyp des Pädagogen entsprechen, können als Beispiele angeführt werden. Das Erfahrungswissen um unterschiedliche Lerntypen wird heute vor allem durch neurologische Erkenntnisse untermauert. Nach Vester (1999, 37ff) ist der größte Teil des menschlichen Gehirns bis zur Geburt ausgebildet, die restlichen Zellen und ihre festen Verknüpfungen entstehen in der kurzen Periode der ersten Wochen und Monate nach der Geburt. Ein Teil der festen Verknüpfungen der Neuronen ist genetisch festgelegt, ein Teil verknüpft sich je nach vorhandener Umwelt und der aus dieser Umwelt wahrgenommenen Einflüsse unterschiedlich von Säugling zu Säugling und mit noch deutlicherer Ausprägung von Kultur zu Kultur, die Leistungen des Gehirns sind »Ergebnis interner selbstorganisierender Prozesse oder der Interaktion des Organismus mit der Umwelt«. (Roth 1997, 193) Mit diesen in der Biologie unbestrittenen und mit heutigen Forschungsmethoden belegbaren Erkenntnissen muss eine für die Entwicklung von Unterricht und Lernen entscheidende Annahme verabschiedet werden: die Annahme, dass die Verarbeitungsprozesse menschlicher Gehirne gleich ablaufen, gleich strukturiert sind. Diese unterschiedlichen Grundmuster entfalten ihre Bedeutung vor allem in der Kommunikation mit der Außenwelt, d. h. in der Wechselwirkung mit anderen Grundmustern. »Lernerfolg und gute Schulleistungen liegen also nicht nur in der absoluten Intelligenz des Einzelnen (der Fähigkeit zu behalten, zu kombinieren, Zusammenhänge zu erkennen), sondern oft an der relativen Übereinstimmung zweier Muster, an der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Resonanz. Ein Kind lernt immer von einem ›Partner‹, sei es vom Lehrer, vom Schulbuch, von Mitschülern. Und es lernt dann gut, wenn es in diesem Partner sich selbst wiedererkennt, das heißt, wenn sein eigenes Assoziationsmuster mit dem des Partners in Einklang steht.« (Vester 1999, 49) Nicht nur naturwissenschaftliche Forschungen stellen die Annahme in Frage, dass alle Menschen auf dieselbe Art lernen. Auch kognitionswissenschaftliche Studien lassen vermuten, dass es viele Wege gibt, auf denen man Wissen erlangen und repräsentieren kann. »Wir müssen diese individuellen Unterschiede in unserer Pädagogik ebenso wie in unseren Beurteilungen berücksichtigen.« (Gardner 1996, 28) Individuelle Lernstile, Lernwege und Lerntypen verlangen sowohl im Zugang zu einem Thema wie auch in Phasen der Erarbeitung und des Übens unterschiedliche, vielfältige Möglichkeiten, die in geschlossenen Lernsituationen unmöglich anzubieten sind. Genau so wenig ist jedoch der Umkehrschluss zulässig: Offene Lernformen alleine sind noch kein Garant dafür, dass diesen unterschiedlichen Lernstilen und Lerngrundmustern entsprochen wird. Ob dies geschieht, hängt viel mehr von der Aufbereitung der Lernumgebung und der Haltung (Offenheit) der LehrerInnen ab, ob unterschiedliche Zugänge zu einem Thema angeboten oder zugelassen werden. So muss das selbstständige Erarbeiten eines Themas - von BefürworterInnen offenen Lernens manchmal fast als Dogma formuliert - nicht für alle SchülerInnen der adäquateste Lernweg sein, für manche kann dies auch der Weg über das
Erklären sein.
Der Begriff der Ganzheitlichkeit - wie er in der pädagogischen Literatur zum schülerorientierten Unterricht zu finden ist - wird meist im Sinne von Pestalozzis Formel des Lernens »mit Kopf, Herz und Hand« als Gegenpol zum »verkopften Lernen« verwendet, als ganzheitliche Beteiligung der Schülerpersönlichkeit. Nicht vorwiegend als »trocken« empfundener Lehrstoff soll mechanisch eingeübt und memoriert werden. Neben dem Intellekt sollen Gefühle ebenso wie auch die handwerklichen, gestalterischen und sozialen Fähigkeiten verstärkt angesprochen und angeregt werden. (Vgl. Petri 1993, 13) Feuser spricht vom »ganzheitlichen Verständnis vom Menschen (als Einheit von Biologischem, Psychischem und Sozialem)«. (Feuser 1993, 57)
Zur Frage, wie Affekt und Intellekt zusammenhängen, hat der Schweizer Psychiater und Systemtheoretiker Luc Ciompi in seinem Buch »Affektlogik« (1998) umfassende Überlegungen publiziert, die auf einer fundierten Zusammenschau verschiedenster theoretischer Konzepte aus der Kognitionspsychologie, der tiefenpsychologischen Affekttheorie und der Neurobiologie beruhen. Fühlen und Denken oder aber auch Emotion und Kognition, Affekt und Logik wurden in der Forschung weitgehend getrennt untersucht. Ähnlich wie Varela/Maturana sieht er im phylo- und ontogenetisch jüngeren »Denksystem« (dem kognitiven System) und dem älteren »Fühlsystem« (dem affektiven System) zwei Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen, in eine Balance gebracht bzw. in Balance gehalten werden müssen. (Ciompi 1998, 81) »Affektives und kognitives Erleben muß in der Tat als etwas untrennbar Verbundenes, aber in bestimmter Hinsicht Wesensverschiedenes betrachtet werden.« (Ciompi 1998, 81) »Denken heißt spalten, Fühlen heißt vereinigen, vereinfacht gesagt. Erst beides zusammen ist das Ganze.« (Ciompi 1988, 265) Für das schulische Lernen bedeutet dies, dass das subjektive Erleben, die »Eigenwahrheiten« der SchülerInnen, in weitaus stärkerem Maße Lernprozesse beeinflussen als dies von den (Fach)-Didaktikern zur Kenntnis genommen oder gar mitberücksichtigt wird. Das Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen der Gefühlswelt der SchülerInnen, das Ausblenden ihres subjektiven Erlebens, wie es in der Schule gang und gäbe ist, ist sicherlich mit ein Grund für die Krise der Schule, vor allem in der Sekundarstufe, die von PraktikerInnen immer wieder wahrgenommen und beschrieben wird. Ich bin davon überzeugt, dass ein nicht geringer Teil von sog. Verhaltens- und Lernschwierigkeiten eng damit verbunden ist und dass allein schon die Wahrnehmung und der Versuch des Verstehens der subjektiven Gefühlswelt von Jugendlichen eine spürbare Veränderung bewirken könnte.[14]
Wird vom Begriff der Ganzheitlichkeit in der Integrationspädagogik als didaktischer Notwendigkeit, als Muss gesprochen, muss obige Begriffsbestimmung um einen zusätzlichen Aspekt ergänzt werden. Die alltagssprachliche Auslegung der Ganzheitlichkeit als »Lernen mit allen Sinnen«, auch unter Einbeziehung der Gefühlswelt, wäre zu kurz gegriffen. Ganzheitliches Lernen bedeutet mehr als die Dominanz der Augen und Ohren um haptische, olfaktorische oder auch gustatorische Wahrnehmung zu erweitern und dabei von »vielkanaligem« oder »multisensorischen« Lernen zu sprechen. Gemeint ist auch, dass die Strukturierung der Umwelt entwicklungspsychologisch auf unterschiedlichen Aneignungsstufen stattfindet:
-
der sinnlich-aufnehmenden Entwicklungsebene
-
der handelnd-personal-aktionalen Entwicklungsebene
-
der darstellend-bildlich-symbolischen Entwicklungsebene
-
der begrifflich-abstrakten Entwicklungsebene. (Vgl. Lehrplan der Sonderschule für Schwerstbehinderte 1996, 267)
Traditionelles schulisches Lernen bezieht meist nur die beiden letztgenannten Ebenen in den Unterricht mit ein, in der Sekundarstufe oft nur noch die begrifflich-abstrakte, der Schwerpunkt liegt auf sprachlichen und logisch-quantitativen Vermittlungsformen. (Gardner 1996, 26) Ganzheitlichkeit im Sinne der Integrationspädagogik bedeutet, Unterrichtsinhalte so aufzubereiten, dass nach Möglichkeit und Notwendigkeit - abhängig von der Art und Schwere der Behinderungen - Erfahrungen zum selben Unterrichtsthema auch auf der sinnlich-aufnehmenden und der handelnden Ebene gemacht werden können. Eingelöst werden diese Ansprüche - zumindest in der Theorie - vom Handlungslernen. Bei Georg Feuser findet man diese Gedanken unter dem Titel des Lernens »an gemeinsamen Themen, Vorhaben, Gegenständen«. (Feuser 1993, 58)
Leider wird mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit häufig völlig vage, ja nebulos umgegangen. In einer scharfen und sehr pointierten Polemik gegen das »Lernen mit allen Sinnen« legt Schirlbauer (1996, 105) die Gefahren bloß, die die unreflektierte Verwendung dieses Terminus beinhaltet, der ja fast immer als Gegenentwurf - und nicht als Ergänzung - zum Lernen mit dem Intellekt, zum Denken, zur »Kopflastigkeit« eingeführt wird. »Das Schlamassel dieser Welt ist dadurch bedingt, daß wir zuwenig denken und die meisten von uns überhaupt nicht. (...) Immer noch geben (...) im menschlich-allzumenschlichen Zusammenhang die archaisch-vitalen Anteile unserer dreifaltigen Ganzheit den Ton an.« (Schirlbauer, 110) Auch wenn ich Schirlbauers - meiner Meinung nach abwertende - Haltung zum Diskurs des Lernens mit allen Sinnen nicht teilen kann und will, so kann ich den ›Angriff‹ doch als notwendige Aufforderung verstehen, sich ernsthaft theoretisch zu fundieren und die Kritik an Schule und Unterricht besser zu argumentieren als mit einem verklärten, romantisierenden Blick auf Kinder und Kindheit, der Kinder auch nicht respektiert, sondernfür eigene Zwecke instrumentalisiert.
Hartmut von Hentig äußert sich ähnlich, wenn er sich gegen die einseitige Kritik der »verkopften Didaktik« stellt: »Auf Hentig berufe sich nicht, wer Kindern der Eingangsstufe die Laute, die sie längst sprechen, beim Lernen der Buchstaben noch einmal ästhetisch verschleiert und verniedlicht: sie bunt malen und tanzen, krabbeln und kribbeln, hupfen und rupfen, schnalzen und walzen läßt. Die Buchstaben sind die Entdeckung der Abstraktion. Diese soll jetzt an den Zeichen in ihrer eindeutigsten Form erkannt, geübt, beherrscht werden. Sinnlichkeit entfalte man bitte an Sinnlichem!« (von Hentig 1993, 177) Ich teile diese kritische Einschätzung voll und ganz. In Klassen kann man immer wieder beobachten, dass Kindern nicht selten ›kindische‹ Materialien mit dem Hinweis auf ein Lernen mit allen Sinnen angeboten werden, in der Volksschule Materialien, die Kindergartenniveau entsprechen und von Montessori für das Kinderhaus entwickelt wurden, in der Hauptschule Lernspiele, deren Anspruchsniveau Kinder und jugendliche LernerInnen nicht wirklich ernst nimmt, sondern mehr aussagt über das Selbstverständnis der PädagogInnen und deren Modelle von Lernen. Auch lernpsychologische Methoden wie Brain-gym oder Edu-Kinästhetik, um nur ein Beispiel zu nennen, bedienen sich des Begriffs der Ganzheitlichkeit, meinen damit eine Aktivierung beider Gehirnhälften und reduzieren Ganzheitlichkeit auf einfache Biologismen.[15]
Auf einen weiteren Aspekt der Ganzheit verweist Peterssen: »Nicht nur die Lernenden (Subjekte des Lernprozesses), auch die Sache (Objekt) soll Lernenden in ihrer originären Ganzheit entgegentreten, zwar durchaus an einzelnen Erscheinungen und Vorgängen erfaßt werden, nicht aber in der durch Wissenschaften und ihnen korrespondierenden Fächern vorgenommenen Aufteilung.« (Peterssen 1997, 124) Diese Zerstückelung geht zurück auf das Cartesianische Weltbild der Aufklärung, bedeutet in ihrer Wirkmacht die Segmentierung von Weltwahrnehmung, bedeutet ein Entkoppeln von Welt und zerteilt eine Welt, die im kindlichen und jugendlichen Wahrnehmen anders angelegt ist, nämlich synthetisierend. Ich sehe die Kunst des Lernens und Arbeitens mit LernerInnen darin, diese Synthetisierung in den Vordergrund zu stellen und Wahrnehmungen und Äußerungen von Jugendlichen - die oft als »nicht zur Sache gehörend« kritisiert und in der Folge segregiert werden, möglich werden zu lassen.
Ganzheitlichkeit in diesem umfassenden Sinne meint also mehrere Aspekte: das Zulassen und Reflektieren von subjektivem Erleben, das Lernen auf unterschiedlichsten Aneignungsniveaus wie auch das synthetisierende Lernen mit Überwindung der starren Fächerung. Lernen mit allen Sinnen, das sich dem vorherrschend visuell-akustisch dargebotenen Lehrstoff mit Malen, Schneiden, Basteln, Legen und Bewegen nähert, hätte mit diesem Begriff von Ganzheitlichkeit nur wenig gemein.
Handlungslernen bzw. handlungsorientiertes Lernen ist ein weiterer Begriff, der derzeit hoch im Kurs steht. Peterssen schreibt dazu in seinem Methoden-Lexikon: »Allerdings fehlen den Empfehlungen in der Regel alle vorhergehenden pädagogischen Reflexionen und Rechtfertigungen sowie die fundierte Entwicklung von Handlungskonzepten.« (Peterssen 1997, 124)
Die Bedeutung des Handlungslernens wurde von sämtlichen Reformpädagogen aus der Beobachtung und Erfahrung der Praxis erkannt und theoretisch unterschiedlich begründet. Auf solchen Beobachtungen basiert die psychologische und erkenntnistheoretische Auffassung vom Handeln als Ursprung des Denkens, als dessen Hauptvertreter Piaget bei uns bekannt ist (vgl. Piaget 1975), das jedoch mit großer Übereinstimmung in den Forschungsarbeiten verschiedenster Entwicklungspsychologen wiederzufinden ist, z. B. bei den sowjetischen Forschern Wygotsky, Galperin und Leontjew. (Vgl. Strassmeier 1997, Papadopoulos 1999) Die Erkenntnis, dass kognitive Strukturen auf der Basis von Eigenaktivität über Assimilations- und Akkomodationsprozesse entwickelt werden, ist ein großes Verdienst Piagets. Wenn das begriffliche Denken aus dem Handeln hervorgeht, muss es Aufgabe des Unterrichts sein, diesem genetischen Prinzip immer wieder Rechnung zu tragen.
Obwohl Piagets Theorie schon zu meiner Zeit in der Lehrerausbildung Mitte der 1970er Jahre bei uns Studierenden damals als Symbolwissen abgefragt wurde, scheinen die für das schulisch-tradierte Lernen revolutionären Aussagen kaum Wirkung gezeitigt zu haben. Nicht nur, aber gerade in Integrationsklassen - für Kinder mit Behinderung - ist diese Lernform essentiell. Die materielle Handlung als Fundament der Vorstellung und der Begriffsbildung oder als Fundament für das Verstehen von Operationen und Vorgängen aus der Welt der Biologie oder Physik wird meiner Meinung nach viel zu früh aus der Schule verbannt, findet teilweise nicht einmal in der Grundschule statt.
Hans Aebli ist einer jener Pädagogen, der sich mit dem Handlungslernen ausführlich beschäftigt hat und es in seiner Publikation »Zwölf Grundformen des Lehrens« sehr genau definiert, fundiert und daraus didaktische Konsequenzen ableitet. Zunächst grenzt er Handlung und Fertigkeit voneinander ab: »Handlungen sind aber mehr als Fertigkeiten: es sind zielgerichtete, in ihrem inneren Aufbau verstandene Vollzüge, die ein faßbares Ergebnis erzeugen.« (Aebli 1994, 182) Eine Fertigkeit wird also erst zur Handlung, wenn ihr innerer Aufbau verstanden wird, in einem Denkprozess. Galperin beschreibt diesen Prozess in einem Modell von fünf Stufen:
-
Materielle Handlung - Umgang mit realen Gegenständen;
-
Materialisierte Handlung - nicht mehr die realen Gegenstände werden zur Bildung einer Handlung herangezogen, sondern Abbildungen;
-
Übergang zur Vorstellung - weder die realen Gegenstände noch Bilder werden als unmittelbare Stütze verwendet, sondern die Sprache im Sinne des handlungsbegleitenden Sprechens;
-
Äußere Sprache - gegenständliches Handeln wird durch Sprache ersetzt;
-
Innere Sprache - eine Handlung ist verinnerlicht und kann innerlich nachvollzogen, verändert, erweitert und auf neue Situationen übertragen werden. (Vgl. Strassmeier 1997, 45ff)
Ziel von Handlungslernen ist es, nicht im pragmatisch-utilitaristischen Sinn zu einem Produkt zu kommen oder eine Fertigkeit einzuüben, sondern die »Fähigkeit, sein eigenes Handeln intellektuell regulieren zu können«. (Peterssen 1997, 124) Anders ausgedrückt: Vor dem Vollzug einer Handlung wird diese geplant, ein Handlungsschema entworfen und anschließend umgesetzt. Diese Fähigkeit führt in der Folge dazu, dass auch Handlungen anderer Menschen gedanklich nachvollzogen und verstanden werden können. Aufgabe einer Pädagogik, die handlungsorientiertes Lernen zu ihrem Prinzip erklärt, ist es, SchülerInnen beim Prozess der Verinnerlichung (Interiorisation) zu unterstützen. Nach Aebli setzt die erste Stufe der Verinnerlichung nach dem Abschluss der realen Handlungen ein. Auf die Handlung wird rückgeblickt (Arbeitsrückschau), sie wird gedanklich noch einmal rekonstruiert. Das konkret vorliegende Werk erinnert im Sinne einer Anschauung nochmals an die Phasen seiner Erarbeitung. Auf eine sprachlich präzise Darstellung wird besonderer Wert gelegt. In einer zweiten Stufe der Verinnerlichung stellt sich der Schüler den Handlungsverlauf nochmals vor, indem er sich nur noch auf eine bildliche Darstellung einer oder mehrerer Phasen des Entstehungsvorganges stützt. In einer dritten Phase soll der Schüler ohne jegliche anschauliche Stütze, also aus der reinen Vorstellung, die Handlung wiedergeben können. (Aebli 1994, 201)
Der Prozess der Verinnerlichung von Handlungen, die Entwicklung von Handlungsvorstellungen oder auch das Verstehen von Operationen oder Vorgängen werden sicherlich weniger durch lehrerzentrierte Formen unterstützt, die sich ja dadurch definieren, dass die Planung vom Lehrer ausgeht. Sie werden durch alle Methoden gefördert, die eben solche Vor-Planungen den Lernenden überlassen bzw. abfordern. Projektlernen, Planspiele, Freiarbeit (die mehr ist als nur Üben) werden in diesem Zusammenhang immer wieder als die idealtypischen Methoden angeführt, wobei auch da jeweils im Einzelnen zu schauen ist, ob eine Reflexion und damit die Unterstützung bei der Interiorisation stattfindet.
Aus dieser kurzen Synopsis geht hervor, dass Handeln alles andere ist als ›umtriebige Geschäftigkeit‹. »Allein die Erhöhung des Aktivitätspegels im Klassenraum ist keine Handlungsorientierung.« (Meyer 2001, 212) Handeln im Sinne von Tun allein ist zu wenig, heißt noch lange nicht, dass dieses Tun dem Aufbau kognitiver Strukturen dient und wenn, dass ein Kind dies ohne Unterstützung in sein Denksystem übertragen könnte, dass es den Transfer von der handelnden auf die symbolisch-begriffliche Ebene ohne Übersetzungshilfe von LehrerInnen vollziehen kann, eine Beobachtung, die wir in Integrationsklassen öfters machen konnten. Das kann auch für die Verwendung von Montessori-Materialien gelten, deren Aufbau einer entwicklungslogischen Struktur folgt und vielfältige Möglichkeiten der Selbstkontrolle beinhaltet. Dieser Aspekt ist besonders bei Kindern mit Lernschwierigkeiten zu beobachten und zu beachten.
Es ist jedenfalls kein handlungsorientiertes Lernen, wenn in freien Lernphasen oder Wochenplanstrukturen mit Puzzles Vokabeln eingeübt werden, wenn Rechenaufgaben statt geschrieben mit Kärtchen zugeordnet werden, wenn ein Rechtschreibthema mittels eines Lauf- oder Dosendiktats geübt wird. Wiederum, um nicht missverstanden zu werden: Ich will diese Übungsformen keineswegs abwerten, sie haben ihre Berechtigung im Sinne von abwechslungsreichem Üben, von lustvollem Üben, als Motivationssteigerung, und sie sind häufig auch weit produktiver als frontale Übungsstunden, in denen der Lehrer zuerst fünf Minuten braucht, um überhaupt beginnen zu können, dann 15 Minuten erklärt und einführt und pausenlos redet, dann Übungsbeispiele gemeinsam erarbeitet, wobei gemeinsam bedeutet, dass immer nur ein Kind aktiv ist, und er daneben mindestens noch einmal gleich viel Zeit dafür aufwendet, die Ordnungsstrukturen oder die Disziplin zu wahren (vgl. Meyer 2001, 212) - den Ansprüchen und Intentionen von Handlungslernen als Grundlage zum Aufbau kognitiver Strukturen und zum Verstehen von Operationen und Zusammenhängen entspricht das jedoch keineswegs. Die Gleichsetzung von Handeln ist gleich mit Händen tätig sein ist eine simple Reduktion.
Howard Gardner relativiert in seinen Überlegungen jedoch die Bedeutung des sensomotorischen Lernens (Lernen über Bewegung und Sinne, Handlungslernen) als allumfassende Grundlage für den Aufbau kognitiver Strukturen. Auch Kinder, deren motorische Systeme in großem Umfang nicht funktionieren und die die Welt der Objekte nicht über TUN erfahren können, bilden Formen des Verständnisses aus, die es ihnen ermöglichen, sich in der Welt der physikalischen Objekte und Theorien zurechtzufinden. (Vgl. Gardner 1996, 73)
Lernen bedeutet heute im Wesentlichen, dass sich Menschen aus dem ungeheuren Wissensvorrat das für sie subjektiv gewünschte, notwendige Wissen aneignen und erweitern. Wissen basiert allerdings nur noch zu einem Teil auf Primärerfahrungen, im schulischen Kontext und vor allem auf der Sekundarstufe fast ausschließlich auf Sekundärerfahrung aus Büchern, Medien, vermittelt über andere Personen, wie z. B. die LehrerInnen. Aus lernpsychologischen Untersuchungen wissen wir, dass das selbständige Gewinnen von Erkenntnissen zu dauerhafterem und besser verfügbarem Wissen führt. Es kann jedoch nicht darum gehen, die SchülerInnen sämtliche Erkenntnisse neu erforschen zu lassen, »(...) sondern sie vorliegende Erkenntnisse nach-vollziehen, nach-entdecken zu lassen, sie einen persönlichen Prozeß der Wissenskonzeption durchlaufen zu lassen«. (Peterssen 1997, 122). »Zeit, Raum und soziale Welt, unsere Lebensformen in unserer Kultur, werden zwar nur angeeignet, indem wir sie - psychologisch betrachtet - konstruktiv verarbeiten, aber hierbei erfinden wir nicht alles neu. Immer mehr Lernzeit wird darauf verwendet, die Erfindungen anderer für uns nach zu entdecken. Das Motto der Rekonstruktion lautet: ›Wir sind die Entdecker unserer Wirklichkeit.‹« (Reich 1999, 84)
Entdeckendes Lernen bedeutet, dass SchülerInnen angeregt werden, sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen, Probleme zu erkennen, eigene Fragen zu formulieren, Hypothesen über Lösungsmöglichkeiten zu bilden, durch spielerisch-exploratives bis hin zu quasi-experimentellem Handeln Antworten zu finden, die wiederum neue Fragen aufwerfen. (Vgl. Aebli 1994, 298) Problemlösungen werden somit nicht vorgegeben, sondern durch SchülerInnen in einem aktiven Auseinandersetzungsprozess mit der Umwelt erfahren. So erfahren sie auch, dass es nicht immer nur eine richtige Lösung oder einen richtigen Lösungsweg gibt, aber auch, dass Fehler ein Mittel sind, weiterzukommen, Hypothesen zu verwerfen, neue zu bilden, andere Lösungswege zu suchen. In diesem Verständnis wäre der Fehler nicht das, was er in der gängigen Schulpraxis ist, nämlich etwas ›Schlimmes‹, ›Schlechtes‹, das mit allem Nachdruck vermieden werden muss und mit schlechten Noten geahndet wird, sondern ein Wegweiser auf der Suche nach Lösungen. Solange jedoch Fehler Grundlage der Bewertung sind, werden Lernsituationen als Kontrollsituationen missbraucht, wodurch eigenständige Wege der Auseinandersetzung, des Suchens und Verwerfens, des Ausprobierens verhindert werden. Fehler sind der Preis jeder Entwicklung - das ist die Umkehrung des Umgangs mit Fehlern, eine völlig andere Fehlerkultur als die in der Schule praktizierte. Mit Titelungen wie »Lob des Fehlers. Übergänge vom Belehren zum Lernen« (Kahl 1997) wird der Perspektivenwechsel verdeutlicht.
Entdeckendes Lernen in diesem Sinne regt vielfältige Lernerfahrungen an, fordert auf zur Eigenaktivität. Besonders SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten, Kinder mit bereits vielen negativen Lernerfahrungen, die problemhaltige Situationen meiden, können in einer solchen Lernorganisation neue Erfahrungen sammeln. Gelingt es, das Problem zu lösen, ›etwas gemeinsam geschafft zu haben‹, führt diese Erfahrung gleichzeitig zur Stärkung der Ich-Identität. (Vgl. Wernig 1996)
Wenn in lehrerzentrierten Unterrichtsstunden, wie das häufig geschieht, ein Lehrstoff vom Lehrer in einzelne Schritte zergliedert wird und so die Kinder zu einem Aha-Erlebnis geführt werden sollen, entspricht das nicht dem entdeckenden Lernen im oben umfassend beschriebenen Sinn. Dennoch wird es häufig als solches bezeichnet.
Im letzten Jahrhundert, vor allem in den letzten Jahrzehnten, ist der Wissensvorrat/Sym-bolvorrat sehr stark angewachsen. Wenn man nicht nur oberflächliches Wissen für eine zeitlich begrenzte Reproduktion (Prüfung) will, muss die Stofffülle, wie sie vor allem über Schulbücher als kaum hinterfragte Norm suggeriert wird, drastisch reduziert werden. Exemplarisches Lernen, Lernen an einem Beispiel verschiebt das Gewicht vom Wissen und der Stofffülle hin zum Lernprozess, zur Rekonstruktion, der idealtypisch von den SchülerInnen später auf andere, ähnliche Lernbereiche übertragen werden könnte.
Diese Vorstellung hat vor allem Auswirkungen auf die Rolle des Lehrers: Er tritt als alleswissender Informator in den Hintergrund. Seine Aufgabe besteht in der Planung darin, Möglichkeiten für das nach-Entdecken anzubieten, während des Unterrichts in der Beratung, Moderation und Unterstützung der Schüler bei der selbständigen Aneignung des Wissens. Die wohl zeitaufwändigere Aufgabe liegt jedoch in der Planung, in der Vorbereitung, in der Organisation der Lernumgebung, sodass Lernende so selbständig wie eben möglich die Lernziele erreichen können.
Viele Lehrer, die ihr Unbehagen mit und an der Schule formulieren, schulische Praxis aus unterschiedlichsten Gründen in Frage stellen und nach neuen Wegen suchen, stoßen in der Regel auf die Reformpädagogen am Beginn des vorigen Jahrhunderts und beziehen sich vielfach auf deren Konzepte. Für meine eigene Praxis war das Kennenlernen der Freinet- und Montessori-Pädagogik sowie der gesamten internationalen Alternativschulbewegung weitaus prägender als sämtliche Angebote im Rahmen meiner formalen Ausbildung als Lehrerin. Erst sehr viel später lernte ich z. B. die Bedeutung von Piagets Kognitionspsychologie schätzen, die ich zwar während meiner Ausbildung brav gelernt hatte, deren Stufen ich der Reihe nach kannte und in eigenen Worten offenbar schlüssig wiedergeben konnte, die ich nach Meinung meiner Professoren damals auch ausgezeichnet beherrschte. Bei aller Kritik an Piagets Konzept aus heutiger Sicht hätte das Verstehen seiner Theorie und die Umsetzung wohl eine andere schulische Wirklichkeit erzeugen müssen als jene, die wir heute vorfinden.
Obwohl ich aus meiner eigenen Lehrtätigkeit die Genialität der Materialien von Montessori zu schätzen weiß, deren große Qualität es nämlich ist, über das Handeln kognitive Strukturen im mathematisch-logisch-analytischen und grammatikalischen Bereich aufzubauen, Verstehensprozesse anzubahnen - ganz im Sinne Piagets, fällt es mir schwer, mich heute auf ihre theoretischen Aussagen zu beziehen, auch wenn sich viele ihrer Gedanken in einer zeitgemäßeren Sprache formuliert, in aktueller theoretischer Literatur finden könnten. Auch die Rückbesinnung auf und die Wiederentdeckung anderer Pädagogen zu Beginn des letzten Jahrhunderts, wie etwa John Dewey (1859 -1952), Hugo Gaudig (1860 - 1923), Helen Parkhurst (1886 - 1973), Celestin Freinet (1896 - 1966) halte ich zwar historisch für hochinteressant - ich schätze vor allem das Menschenbild der Reformpädagogen, das dem der Zeit sehr gegenläufig war, und die darauf aufbauenden pädagogisch/didaktischen Konzeptionen - gleichzeitig halte ich die theoretische Anknüpfung an sie doch auch für fragwürdig: Muss die Pädagogik heute wirklich auf theoretische Konzepte aus der Zeit der Jahrhundertwende zurückgreifen, während sich andere Wissenschaften und technologische Entwicklungen revolutionieren? Sind die Konzepte aus dieser Zeit tatsächlich übertragbar auf heutige Gesellschaftsstrukturen und verändertes Erleben der Kindheit? (Vgl. Postman 1987, Rolff/Zimmermann 1990) Stellt sich eine pädagogische Praxis, die rückwärtsgewandt Gegenwarts- und Zukunftsfragen bewältigen will, nicht selbst ein wenig ins gesellschaftliche Abseits und macht sich damit lächerlich? Hat die Pädagogik im letzten Jahrhundert keine kritischen Denker/Theoretiker hervorgebracht, deren Forschungsergebnisse wert wären, in der Praxis rezipiert zu werden? Und, gibt es keine Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften, die mitbedacht und in pädagogischen Konzepten mitberücksichtigt werden müssten?
So versuche ich im folgenden Abschnitt einige Positionen, die für ein Lernen eintreten, das etwas anderes ist als nur rezeptive Wissensanhäufung, die Lernen als aktiven Dialog mit der Umwelt verstehen, die kognitive Konstrukte als »Resultat der aktiven Erfahrungsinterpretation« (von Glasersfeld 1997, 121ff) sehen, zusammenzufassen und vor allem in Hinblick auf die Schulpraxis zu diskutieren. Ein solches Lernverständnis entspricht nicht nur integrationspädagogischem und reformpädagogischem Denken, sondern einem systemisch-konstruktivistischen Lern- und Entwicklungsverständnis, das Lernen grundsätzlich als die aktive Selbstentwicklung eines Organismus in Auseinandersetzung mit der umgebenden Umwelt versteht. (Vgl. Kösel 1995; Maturana/Varela 1987)
Wie bereits erwähnt, folgt die Auswahl und Zusammenschau dieser Positionen meinen eigenen Suchbewegungen und erhebt keineswegs den Anspruch, umfassend zu sein. Gemeinsam ist diesen Positionen, dass sie überzeugende Argumente für eine Veränderung der schulischen Praxis anbieten, von deren Notwendigkeit ich aus der Perspektive sowohl der Theorie als auch der Praxis überzeugt bin.
Maturana/Varela (1987) definieren und charakterisieren Lebendiges, Lebewesen durch ihre autopoietische Organisation. Lebewesen, ob es sich um einzelne Zellen oder aber um Zellsysteme (z. B. das neuronale System) oder den Menschen an sich handelt, sind dadurch gekennzeichnet, »dass sie sich - buchstäblich - andauernd selbst erzeugen«. (ebd. 50) Daraus abgeleitet wird der Begriff der Autonomie, der besagt, dass Lebewesen autonome Einheiten sind: Autonom sind Systeme dann, wenn sie dazu fähig sind, ihre »eigene Gesetzlichkeit bzw. das ihm Eigene zu spezifizieren«. (ebd. 55) Diese Systeme befinden sich in einem permanenten strukturellen Wandel, »entweder ausgelöst durch aus dem umgebenden Milieu stammende Interaktionen oder als Ergebnis der inneren Dynamik der Einheit«. (ebd. 84) Ganz entscheidend und zentral ist die Erkenntnis, dass die »Struktur des Milieus in den autopoietischen Einheiten Strukturveränderungen nur auslöst, diese also weder determiniert noch instruiert (vorschreibt), was auch umgekehrt für das Milieu gilt. Das Ergebnis wird - solange sich Einheit und Milieu nicht aufgelöst haben - eine Geschichte wechselseitiger Strukturveränderungen sein, also das, was wir strukturelle Koppelung nennen.« (ebd. 85)
Nervenzellen unterscheiden sich von anderen Zellen dadurch, dass sie Verzweigungen (Dendriten und Axome) entwickelt haben, die sich in Relation zur Zellgröße über enorme Abstände erstrecken und damit verschiedenste Zellgruppen miteinander verknüpfen können. »Indem es zwischen den sensorischen und motorischen Flächen ein Netz von neuronalen Zwischenverbindungen spannt, das sehr präzise Interaktionen erlaubt, bildet es das, was wir das Nervensystem nennen.« (ebd. 171) Auch das Nervensystem kann als autopoietisches, autonomes System betrachtet werden, das in diesem Sinne durch »operationale Geschlossenheit« (ebd. 180) charakterisiert ist. Mit anderen Worten: »Das Nervensystem ist ein Netzwerk aktiver Komponenten, in dem jeder Wandel der Aktivitätsrelationen zwischen den Komponenten zu weiterem Wandel zwischen ihnen führt.« (ebd. 180) Das menschliche Gehirn steht demnach in einem andauernden Austauschprozess, man könnte auch sagen Dialog, mit seiner Umwelt, wobei es dabei nicht zwischen Eindrücken (Perturbationen) von außen oder von anderen Systemen innerhalb des Körpers unterscheidet. Das neuronale System reagiert mit Veränderung auf diese einströmenden Impulse, wobei es das Ziel des selbstreferentiellen Systems ist, adäquat im Sinne der Aufrechterhaltung der Balance zwischen Organismus und Milieu zu handeln. Diesen komplexen Sachverhalt fassen Maturana/Varela in einem Kernaphorismus zusammen: »Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun.« (ebd. 32), was soviel bedeutet wie: »Erkennen ist effektive Handlung, das heißt, operationale Effektivität im Existenzbereich des Lebewesens.« (ebd. 35)
Was bedeuten diese Erkenntnisse für das Lernen an sich und die Organisation schulischen Lernens? Nach Maturana/Varela ist Lernen ebenso als »Ausdruck einer Strukturkoppelung zu verstehen, in der die Verträglichkeit zwischen der Arbeitsweise des Organismus und des Milieus aufrechterhalten wird«. (ebd. 188) Wenn das Nervensystem ein operational geschlossenes, autonom und autopoietisches System oder, mit anderen Worten, ein selbstreferentielles System ist, entscheidet das Gehirn im Rahmen der internen Systembedingungen selbst, »welche von außen kommenden Einwirkungen ›angeschlossen‹ werden und welche nicht, dass also jedes Gehirn aufgrund seiner physiologischen Operationsweise vollkommen und im prinzipiellen Sinne autonom ist. Auch Entwicklungen wären dann tatsächlich in einem bisher kaum angenommenen Ausmaß als intern gesteuert zu verstehen (...)«. (Huschke-Rhein 1994, 35) Ein Zellverband wird nicht durch äußere Einflüsse gezwungen, Elemente aus der Umwelt aufzunehmen, sondern umgekehrt: »die eigene Organisation (bzw. Struktur) entscheidet darüber, welche Einflüsse (Elemente; Stoffe) aus der Umwelt aufgenommen werden und welche nicht (welche schädlich oder tödlich sind)«. (Huschke-Rhein 1999, 42)
Lernprozesse können demzufolge weder determiniert noch von außen gesteuert werden, noch minutiös für andere Individuen geplant, sie können nur angeregt, nicht einmal initiiert werden. Dieselbe Information (ein Begriff, den Maturana/Varela ablehnen, weil er die populäre, aber schlichtweg falsche Metapher des Gehirns als Computer mit In- und Outputprozessen transportiert - Maturana/Varela 1987, 185) wird von unterschiedlichen Menschen (neuronalen Systemen) unterschiedlich verarbeitet. Ob ein dargebotener Lehrstoff, ein Lehrervortrag, eine Erklärung überhaupt aufgenommen, wie und auf welche Weise er angeschlossen wird oder eben nicht, welche Systemprozesse ausgelöst werden, ist also von außen nicht beeinflussbar und entzieht sich der Steuerung durch Lehrende. Allein diese Sichtweise müsste bei Lehrenden dazu führen, die tradierte Unterrichtsvorstellung im Sinne einer Wissensvermittlung als falsch und überholt endlich hinter sich zu lassen. Lernen ist Eigenaktivität, Selbststeuerung, bewusste oder unbewusste, arrangierte oder zufällige. Auf diesem Hintergrund ist die nach wie vor übliche Praxis in der Lehrerausbildung, minutiöse Feinziele als Lern- und Erziehungsziele für eine gesamte Kindergruppe zu formulieren, blanker Unsinn, oder eine »Katastrophe der schulischen Praxis« auf der Basis »unbiologischer Lernstrategien von Psychologie und Pädagogik«, wie Vester, auch Biologe, es ausdrückt (Vester 1999, 114). Lernziele können nur von Individuen selbst formuliert und verfolgt werden, sie müssen bedeutungsvoll sein, entweder für die Gegenwart des Lernenden oder mit Anschluss an die Zukunft. Lehrende können bei der Zielfindung beraten und Lernumwelten gestalten, die eigenständige Lernwege ermöglichen. Die Vorstellung allerdings, dass LehrerInnen Wissen oder Kenntnisse vermitteln können, von einem Kopf in den anderen, die Vorstellung einer »Einschleusung von Fremdwissen in ein System« (Krüssel 1999, 97) ist obsolet. LehrerInnen können im Rahmen von lehrerzentrierten Unterrichtseinheiten höchstens Lehrziele formulieren (d.h. sie formulieren für sich, was sie erreichen wollen und nicht, was bei den Schülern als Lernprozess stattfinden soll), diese den SchülerInnen transparent machen, d. h. in einen Dialog zu treten und darauf zu hoffen, dass sie von SchülerInnen als bedeutungsvoll akzeptiert und deshalb, unterschiedlich zwar, aber in irgendeiner Weise ›angeschlossen‹ werden können. Es ist allerdings pädagogische Illusion zu glauben, dass damit alle SchülerInnen einer Gruppe erreicht werden könnten.
Und noch ein Gedanke zur Heil- oder Sonderpädagogik: Auch für Menschen mit schwersten Behinderungen oder Schädigungen gilt, dass ihnen die Fähigkeit zur Selbststeuerung und Eigenaktivität nicht abgesprochen werden kann, denn dies ist eine der konstituierenden Eigenschaften des Lebendigen. Auch den schwerstbehinderten Menschen als kompetenten Experten und als Akteur seiner Entwicklung anzuerkennen, der im Rahmen seiner individuellen Lebensbedingungen adäquat handelt, wäre eine Folgerung aus Maturana/Varela. So einsichtig und selbstverständlich diese Einsichten in Teilen der humanistischen Psychologie und der Sonderpädagogik - vor allem bei den Integrationsbefürwortern sind, so wenig scheinen sie in der Alltagspraxis von (Sonder)Schule und institutioneller Betreuung verankert. Der Betreuer bzw. Lehrer als Experte ist nach meiner Erfahrung noch häufig anzutreffen, besonders wenn es sich um den Bereich der schweren Behinderung handelt.
Strukturelle Koppelung bedeutet aber auch, dass lebende Systeme neben der Autonomie und Selbststeuerung eine zweite, ganz entscheidende Eigenschaft besitzen: Sie sind zum Milieu - zur natürlichen wie sozialen Umwelt - hin offen (dissipativ), in einem ständigen Austauschprozess, dessen Ziel die Verträglichkeit beider Systeme ist. Dieser Austauschprozess, die Koppelung der autonomen Systeme war nach Maturana/Varela entscheidend für die Phylogenese (Maturana/Varela 1987, 85). Dasselbe Prinzip gilt für die individuelle Lebensgeschichte (Ontogenese). »Wenn wir dies wieder auf die Entwicklung eines Kindes beziehen, das eigenaktiv mit der Umwelt im Dialog bzw. Austausch ist, dann ist vielleicht verständlich, dass mögliche Entwicklungen des Kindes nur beschränkt vorhersagbar sind. So vielfältig die Dialoge bzw. die Dialogmöglichkeiten sind, so vielfältig erscheinen die Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist die Grundaussage, die Integration begründet.« (Schönwiese 2000, 66) Lernen in diesem Sinne ist nicht linear vorhersagbar und planbar, nicht berechenbar. Dies gilt sowohl für den Aufbau kognitiver Strukturen wie psychischer Systeme - und, wie Luhmann (1998) ausführt, für soziale Systeme ebenso. Schule, Unterricht, Lehrpersonen und Mitschüler erscheinen unter dieser Perspektive als Rahmenbedingungen
beim Aufbau eines individuellen Wissenssystems. Lehrende bieten Anreizstrukturen, Anregungen, Lernende entfalten ihre eigenen, subjektiven Lernwege. (Vgl. Kösel 1995)
Was in der Biologie als strukturelle Koppelung beschrieben wird, findet seine Entsprechung in der philosophischen Tradition bei Martin Buber, in seinem Kernaphorismus: »Der Mensch wird am Du zum Ich« (Buber 1983, 37), aber auch in der Denktradition der Reformpädagogen, denen gemeinsam ist, dass Lernen an subjektiven Bedeutungszusammenhängen anknüpfen sowie Eigenaktivität und Selbststeuerung zur Bedingung haben muss.
2.3.1.2 Denken - Lernen - Vergessen bei Frederic Vester - Ergebnisse aus der Gehirnforschung[16]
Bedeutend einfacher und für PädagogInnen verständlicher geschrieben und leichter an schulische Praxis anknüpfbar (viabel) ist Frederic Vesters Klassiker »Denken - Lernen - Vergessen« (1999, 26. Auflage), der anhand neuer Erkenntnisse der Gehirnforschung die Biologie von Lernvorgängen, so wie man sie heute versteht, darstellt. Damit verbunden ist ein harsche Kritik an der tradierten Lernorganisation der Schule, der Pädagogik (z. B. der Schulbuchautoren) und der Psychologie, die nur allzu häufig biologische Grundgesetze und neuere Forschungsergebnisse ignorieren, weil sie die biologischen Grundlagen von Denkvorgängen, Speichervorgängen, Erinnerungsprozessen und Gefühlen nicht berücksichtigen.
Es gibt zwar eine Reihe von Divergenzen zwischen Maturana/Varela und Vester, u. a. die starke Gewichtung der Autopoiese im Vergleich zur strukturellen Koppelung. Mein Interesse gilt hier allerdings der Frage, welche Erkenntnisse - aus welchen Wissenschaftsbereichen auch immer - eine andere schulische Praxis begründen. Die Grundparameter bei Maturana/Varela und Vester sind dieselben: Neuronale Systeme entwickeln sich autonom im Dialog, im Austausch mit der natürlichen und sozialen Umwelt, die neuronale Organisation, also die Verknüpfungen »müssen verschieden sein, weil sich auch die ersten Eindrücke von Kind zu Kind unterscheiden«. (Vester 1999, 118) »Die mehr oder weniger modular organisierten kognitiven Leistungen des Gehirns, (...) sind - wenn auch in unterschiedlichem Maße - das Ergebnis interner selbstorganisierender Prozesse oder der Interaktion des Organismus mit der Umwelt.« (Roth 1997, 193) Nach Vester bilden sich in den ersten Wochen im Leben eines Säuglings Grundmuster (Verdrahtungen von Neuronen), wobei die Eingangskanäle wie Sehen, Hören, Fühlen und alle damit zusammenhängenden Empfindungen recht verschieden ausgebildet und gänzlich anders verknüpft sind. Später eintreffende Impulse der Außenwelt werden »entlang dieses Netzes über mehrere Stufen in stofflich gespeicherte kodifizierte Erinnerungen überführt « (Vester 1999, 42), wobei Erinnerungen wie auch bei Maturana/Varela nicht im Sinne von Abbildungen in einer Zelle, sondern als Zusammenspiel vieler über das Gehirn verteilter Neuronen, die sich zu einer Art vernetzter Informationsmuster verknüpfen, vorzustellen sind. (Vester 1999, 72) Erinnerungen sind »überall und nirgends« gespeichert, über die ganze Großhirnrinde verteilt, dazwischen gibt es Kreuz- und Querverbindungen. Alle späteren Impulse werden nicht einfach entweder behalten oder vergessen, sondern verweilen in drei unterschiedlich langen Speicherstufen. Zunächst kreisen die Impulse in Form von elektrischen Strömen und Schwingungen im Gehirn, im Ultrakurzzeitgedächtnis, wo sie nach zehn bis zwanzig Sekunden wieder abklingen, wenn sich die neuen Impulse nicht an bereits bekannten oder ähnlichen Verbindungen aufhängen lassen oder mit Aufmerksamkeit verbunden sind. Solche Informationen gehen sozusagen an uns vorbei wie der Straßenlärm oder Laute einer fremden Sprache. Das Ultrakurzzeitgedächtnis wirkt wie ein Pförtner und entscheidet, welche Impulse aufgenommen und verarbeitet werden - und damit das neuronale System auch in einem andauernden Prozess verändern. »Bei Dingen, die wir selbst intensiv erleben, genügt ja oft eine einmalige Aufnahme zur permanenten Speicherung, das heißt, wir können uns ein Leben lang daran erinnern. Beim Lernen dagegen, wo ein Stoff gewöhnlich nicht erlebt, sondern eben nur gehört oder gelesen wird, ist das freilich schwieriger. Erst wenn mehrere Synapsen aus möglichst vielen Gehirnbereichen gleichzeitig angeregt werden (wobei viel Natrium in die Zelle strömt, das Magnesium aus den Poren springt, und Kalzium in die Zelle fließt), löst dies in der Zelle eine Kaskade von Prozessen aus, die nötig ist, um den elektrischen Schwellenwert dauerhaft zu senken und die spätere Aktivierung dieser synaptischen Verbindung, also das Erinnern, zu erleichtern. Die Erinnerung ebnet sich so gleichsam selbst die Bahnen, entlang derer sie später wieder wachgerufen wird.« (ebd. 83) Sämtliche Impulse werden von Anfang an mit Gefühlen verknüpft, die ja auch eine biologisch/neurologische Grundlage haben. Gefühle sind Wahrnehmungen, die über das Zwischenhirn mit den Hormonreaktionen in unserem Körper zusammenhängen. »Die Art und Tiefe der Einspeicherung und damit die Leichtigkeit des Erinnerns (bzw. die Resistenz gegen das Vergessen) wird ganz wesentlich vom emotionalen Begleitzustand bestimmt (...).« (Roth 1997, 210) Auch diese Hormonreaktionen sind durch das Grundmuster individuell vorgeprägt, ähnlich wie die Anlage der individuellen Assoziationswelt. Diesen Hormonreaktionen misst Vester beim Lernen große Bedeutung zu. Eine unvorstellbare Zahl (fünfhundert Billionen) Synapsen regeln den gesamten Informationsfluss in unserem Gehirn, müssen zusammenspielen, damit Erkennen und Denken und Erinnern möglich sind. Bei Stress, also bei Angst, Schreck, Schmerz wird die normale Funktion der Synapsen gestört, da die bei Stress ausgeschütteten Hormone Adrenalin und Noradrenalin Gegenspieler bestimmter Transmittersubstanzen sind, die die Impulse über die Synapsen weiterleiten. Sobald der Gehalt dieser Substanzen im neuronalen System ansteigt, werden viele Impulse nicht mehr weitergeleitet - die biologische Erklärung für Denkblockaden, die mehr sind als nur die Einbildung von Kindern oder Eltern. (Vgl. Vester 1999, 98) Weder hilfreiches Nachfragen noch unsensibles Insistieren auf einer Reaktion helfen, diese Blockaden aufzulösen. Neben kurzfristigen Denkblockaden werden auf dieselbe Art und Weise ganz spezifische Dauerblockaden erzeugt, die entweder mit einem bestimmten Thema oder Fach verknüpft sind oder sogar auf das schulische Lernen an sich gerichtet sind - was insbesondere beiKindern mit sog. Lernschwächen zu beachten ist.
Als weiteren wichtigen Faktor für das Aufnehmen und Abrufen führt Vester die Sekundärinformation oder, anders bezeichnet, die Begleitinformationen an. Damit sind Assoziationen gemeint, die beim Lernen nicht intendiert wurden, aber als mitschwingende Wahrnehmung mitgespeichert werden. Wir alle kennen solche Begleitinformationen - den Lehrer mit der nassen Aussprache, das Kichern der Freundinnen, die Angst vor dem Angesprochen-Werden. Die Wirkung von Sekundärassoziationen - nicht ausschließlich im schulischen Kontext - ist viel zu wenig bewusst. Oft kann über eine Sekundärassoziation der gesamte Erinnerungsvorgang abgerufen werden. Mentale Lernstrategien, wie etwa NLP (Neurolinguistisches Programmieren), bedienen sich bewusst dieser Sekundärassoziationen. (Vgl. Bachmann 1999)
Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Organisation schulischen Lernens?
Vester selbst formuliert 13 Regeln zur Aufbereitung von Lernstoff aus der Lernbiologie, die ich hier nur auszugsweise wiedergebe.
-
Nach Vester gibt es nicht zwei oder drei verschiedene Lerntypen, wie das in der pädagogischen Ratgeberliteratur häufig zu lesen steht, sondern eine Vielzahl individueller Lerntypen, die sich aus der Wechselwirkung von unterschiedlichen Grundmustern, der Umgebung, der Lernbiographie, der individuellen Assoziationen, Gefühle und Gewohnheiten und sehr unterschiedlichen hormonellen Reaktionen und Stoffwechselfunktionen ergeben. Ein wirksames Schulsystem müsste so organisiert werden, dass Schüler zum einen ihre eigenen Lernmuster erkennen, um ihre Lernprozesse individuell steuern zu können, zum anderen, dass die Entfaltung dieser unterschiedlichen Lerntypen innerhalb einer Lernorganisation überhaupt möglich ist - was wiederum nur in offenen Unterrichtskonzepten zu verwirklichen ist. ->Individualität
-
Statt nur mit den Begriffen von Dingen zu arbeiten, also auf der verbalen Ebene - so wie es die Schule und im Besonderen die Sekundarstufe auch unter Berufung auf Piaget tut - »sollten wir auch mit den Dingen selbst arbeiten, mit ihren Wechselwirkungen, mit ihrer Beziehung zur Umwelt. Und sofort würden auch die Begriffe sich im Gehirn nicht nur spärlich, sondern vielfach verankern können. Sie würden den visuellen, den haptischen, den gefühlsmäßigen und den auditiven Kanal in gleicher Weise nutzen und dadurch viel stärkere Assoziationsmöglichkeiten bieten als bei einem realitätsfremden Eintrichtern«. (Vester 1999, 126) Je mehr Eingangskanäle angesprochen und Wahrnehmungsfelder aktiviert werden, desto eher kann neue Information aufgenommen, angeschlossen werden. ->Unterschiedliche Zugänge zu einem Thema.
-
Dass Lernen Spaß machen sollte, Humor und Lachen Lernprozesse positiv unterstützen, hat eine biologische Grundlage in der Hormonlage, die für ein reibungsloses Funktionieren der Synapsen notwendig ist. Diese banale Aussage ist leider weit davon entfernt, Wirklichkeit an Schulen zu sein. Strenge LehrerInnen, Ruhe und Disziplin gelten noch immer häufig als Synonym für guten Unterricht. Stresshormone stören die Funktionsweise der Synapsen und führen in der Schule dazu, dass notwendige Schaltungen für das Denken oder auch Erinnern nicht verfügbar sind. Die alltägliche Praxis der Leistungsfeststellung an Schulen mit Schularbeiten, Prüfungen, Abfragen usw. ist demnach alles andere als eine erinnerungsförderliche Vorgangsweise. ->Positive Hormonlage, Vermeidung von Stress, angenehmes Lernklima.
-
Lernen muss für das Individuum bedeutungsvoll sein, sonst werden Impulse (Perturbationen) vom Ultrakurzzeitgedächtnis in seiner »Pförtnerfunktion « abgewiesen. »Dem Lernenden müssen zu jedem Zeitpunkt Wert und Bedeutung eines Lernstoffs persönlich einsichtig sein.« (ebd. 189) Lernstoff, dessen Nutzen weder aus seiner Beziehung zur Wirklichkeit für den Lernenden einsehbar ist noch mit vorhergehenden Lerninhalten verknüpft wird, wird im Gedächtnis, wenn überhaupt, unzureichend verankert. Zudem ist er wertlos, da er isoliert gespeichert und für weitere Gedankenverbindungen nicht verfügbar ist. ->Bedeutungsvolles Lernen.
-
Neues kann nur gelernt werden, indem es mit Bestehendem, Bekanntem verknüpft und vernetzt verankert wird. Bei der Gestaltung von Lernsituationen ist auf vielfältige Verknüpfungen zu achten: Verknüpfung mit der Realität, mit realen Erlebnissen; Verknüpfung mit größeren Zusammenhängen; Verknüpfung mit Bekanntem - »Skelett vor Detail«. Solche Information wird sich eher auf vielen Ebenen im Gehirn verankern können und ein empfangsbereites Netz für später angebotene Details bieten können. Vielfältige Verknüpfungen - Zusammenhänge herstellen, fächerverbindende Formen des Lernens.
-
Die biologischen Prozesse des Speicherns und Erinnerns müssen bewusst bei Lernprozessen eingesetzt werden. Je vielfältiger ein Lehrstoff mit anderen Assoziationen verknüpft ist, desto weniger muss ein Stoff ›gepaukt‹ werden und umso besser ist er aus dem Langzeit-Gedächtnis abrufbar. Intensive Erlebnisse schaffen von sich aus starke Verknüpfungen. Nicht alle Lehrstoffe lassen sich jedoch mit intensiven Erfahrungen verbinden. In diesem Fall ist es notwendig, Information wiederholt aufzunehmen und mit vorhandenen Gedächtnisinhalten zu assoziieren. Dadurch werden »Vorstellungen und Bilder (...) geweckt, die die vielen Wahrnehmungskanäle eines echten Erlebnisses teilweise ersetzen und eine Einkanal-Information wenigstens innerlich zu einer Mehrkanal- Information machen«. (ebd. 192) ->Regelmäßige Wiederholung, vielfältigesmehrkanaliges Üben.
Konstruktivistische Überlegungen zum Lernen werden durch mehr oder weniger radikal formulierte Aussagen der konstruktivistisch orientierten Erkenntnistheorie beeinflusst. Diese Positionen basieren zusammenfassend auf dem Gedanken, dass Lernen und Verstehen als konstruktive Operationen verstanden werden müssen, die jeder Mensch selbständig auf der Grundlage seines spezifischen Erfahrungshorizonts vollzieht. (Vgl. Wolff 1997, 107) Eine objektiv erfassbare Wirklichkeit, die unabhängig vom wahrnehmenden Menschen (Beobachter) geschaffen wird, gibt es nach deren Vertretern nicht. Die Wirklichkeit wird immer vom Menschen geschaffen (konstruiert) und existiert deshalb nur subjektiv in seinem Gehirn. Damit wird die Subjekt-Objekt-Trennung, die lange Zeit die wissenschaftliche Tradition des abendländischen Denkens bestimmt hat und im Alltagsdiskurs noch immer auf Schritt und Tritt zu finden ist, grundsätzlich angezweifelt. Allerdings sind diese Gedanken keineswegs neu.[17] Immer wieder gab es in der Philosophiegeschichte Philosophen, die Schwierigkeiten mit der Annahme »objektiver Erkenntnis« hatten: schon bei den antiken Griechen die Skeptiker, vor allem aber in der Aufklärung Berkeley in England, Vico in Italien und Kant in Deutschland. Auch die feministische Wissenschaftstradition hat sich ausführlich mit patriarchalen Wirklichkeits- und Denkkonstruktionen in Verbindung mit Definitionsmacht beschäftigt. Mit der Theorie aus der Evolutionsbiologie von Maturana/Varela und Erkenntnissen aus der neueren Hirnforschung werden diese Ideen biologisch fundiert. Brügelmann (1999, 171) fasst diese naturwissenschaftlich begründeten Positionen treffend so zusammen:
»Gehirne sind geschlossene Systeme. Gegenstände und Ereignisse der Umwelt haben keine objektive Bedeutung. Sie lösen zwar Aktivitäten im Gehirn aus. Diese unterscheiden sich aber von Organismus zu Organismus. ›Reize‹ der Umwelt werden also vom Gehirn in einer je besonderen Weise interpretiert. D. h. das Gehirn weist seinen Erfahrungen Bedeutung intern zu. (Demnach sieht/hört/fühlt das Gehirn, nicht das Sinnesorgan, Anm. d. V. in Anlehnung an Roth 1994). Die Biene ›sieht‹ eine Rose anders als eine Kuh oder ein Mensch. Ein Dichter wiederum hat eine andere Vorstellung von einer Rose als ein Botaniker oder ein Florist. Unsere gängige Vorstellung ist: Das Gehirn nimmt die Umwelt über die Sinne ›wahr‹ (d. h. unsere Vorstellungen ›spiegeln die Wirklichkeit wider‹). Dagegen steht die biologische These: Die Umwelt reizt das Gehirn durch unspezifische Impulse zur Eigenaktivität. Wahrnehmung transportiert Energie, aber nicht Information. Bedeutung entsteht also erst im Gehirn.« (Brügelmann 1999, 179)
Sehr viel gemäßigter, dennoch in derselben Tradition, formuliert Piaget seine kognitive Psychologie: Er identifiziert bei geistigen Prozessen zwei Aspekte: die der Assimilation und Akkomodation. Unter Assimilation versteht er die Veränderung des Bildes von der Welt, um sie den eigenen Denkmustern anzupassen. Akkomodation wird verstanden als gegenläufiger Prozess. Die eigenen Denkmuster werden verändert, um sie mit der Welt bzw. den Erfahrungen in Einklang zu bringen. Auch Aebli verortet seine Forschungsergebnisse in der Tradition des Konstruktivismus, geht aber davon aus, dass Strukturierungsprozesse nicht nur als Folge spontaner Aktivität des Kindes entstehen, sondern durch Lernprozesse von seiner sozialen Umwelt, insbesondere der Familie, aber auch der Schule ausgelöst werden können. (Vgl. Aebli 1994, 391)
Gemeinsam ist beiden Positionen, dass es sich beim Lernen um einen aktiven Konstruktionsprozess handelt, den der Lernende weitgehend unabhängig und eigenständig auf der Basis bereits gemachter Erfahrungen durchführen muss. Diese Vorstellungen - ob gemäßigt oder radikal - passen nicht zu gängigen Vorstellungen und vor allem zur Praxis von Schule und Unterricht. Hier wird »Lehren« und »Lernen« üblicherweise als Transport von Information aus einem Kopf in den anderen verstanden - eine Vorstellung, die weder mit den erkenntnistheoretischen Positionen Piagets, Aeblis oder gar der radikalen Konstruktivisten noch mit den Befunden der Neurobiologie vereinbar ist.
Die allgemeinen Annahmen und Überlegungen der Konstruktivisten fasst Wolff (1997) wie folgt zusammen:
-
«Es kann nur das verstanden und gelernt werden, was sich mit bereits vorhandenem Wissen verbinden lässt.
-
Die eingesetzten Konstruktionsprozesse sind individuell verschieden; deshalb sind auch die Ergebnisse von Lernprozessen nicht identisch.
-
Wissen ist immer ›subjektives‹ Wissen, das sich selbst für Lernende, die im gleichen sozialen Kontext lernen, beträchtlich unterscheiden kann. Auch deshalb sind die Ergebnisse von Lernprozessen individuell verschieden.
-
Neues Wissen impliziert die Umstrukturierung bereits vorhandenen Wissens. Der soziale Kontext, die soziale Interaktion sind beim Lernen von ausschlaggebender Bedeutung.
-
Weil die Konstruktion von neuem Wissen an bereits vorhandenes Wissen angebunden ist, müssen Lernprozesse in reiche und authentische Lernumgebungen eingebettet werden. Dadurch wird am besten gewährleistet, dass der einzelne Lernende Wissen vorfindet, das er mit dem eigenen Wissen verbinden kann.
-
Von besonderer Bedeutung ist das Prinzip der Selbstorganisation. Der Mensch als in sich geschlossenes System organisiert damit für sich die Welt.
-
Selbstorganisation verbindet sich mit Eigenverantwortlichkeit. Der Mensch ist für das eigene Lernen verantwortlich, weil er damit sein Überleben im System sichert.« (Wolff 1997, 107)
Was aber heißt das für Schule und Unterricht? Frage um Frage reiht sich auf:
-
Wenn Lernen in diesem Ausmaß individuell ist, ist Unterricht im Sinne der zielgerichteten Vermittlung von Wissen und Erfahrung überhaupt möglich?
-
Ist Unterricht in einer Klasse mit 20 Individuen dann Fiktion oder hohle Konvention, in der völlig anderes geschieht, nur nicht Lernen? - (Ein Ansatz, der ideologiekritischen Denkweisen nicht ganz fremd ist.)
-
Warum, wenn die je eigene Welt im Kopf so unterschiedlich ist, haben dann viele LehrerInnen das Gefühl, dass viele Kinder doch lernen, was im Unterricht vermittelt wird? Viele lernen z. B. Englisch in einem recht brauchbaren Ausmaß, zugegeben, andere nicht.
-
Wenn Projektunterricht als theoretisch/methodische Konzeption diesen Vorstellungen am nächsten kommt, sollte dann der gesamte Unterricht als Lernen an Projekten organisiert werden? Würde das dann aber wiederum nicht der Annahme der Konstruktivisten widersprechen, die auf Offenheit, Unterschiedlichkeit und Diversität aufbauen?
-
Können Kultur-»Techniken« - mit der Betonung auf Technik und damit »tools« oder aber auch der Erwerb einer Fremdsprache z. B. ohne sinnvolles, lustvolles und abwechslungsreiches Üben - aber immerhin Üben - erworben werden, das einer Überwindung, einer Anstrengung oder vielleicht auch einer Vorgabe von außen bedarf?
-
Sind meine Erfahrungen als Lehrerin und auch als Lernende selbst nichts weiter als meine subjektiven Konstruktionen von Wirklichkeit, wenn ich meine, dass »fremdbestimmtes«, »gelenktes« Üben auch und manchmal notwendiger Teil von Unterricht ist - und so eingebettet werden kann, dass Kinder und Jugendliche keinen Schaden daran nehmen?
-
Ist es nur mein verklärter Lehrerinnenblick, der mich sehen lässt, dass viele Kinderaugenpaare gespannt und ohne zu schwätzen/stören, ohne Drohung nicht nur einer, sondern vielen Geschichten aufmerksam folgten? Oder Freude hatten an fremdbestimmtem Singen und Musizieren?
Der Frage nach der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit von Unterricht auf der Basis konstruktivistischer Denkansätze geht auch Hans Brügelmann - ein von mir hochgeschätzter Didaktiker - nach. (1999, 179 ff) Eine Erklärung für die Tatsache, dass sich Kinder in einer Gesellschaft/Gemeinschaft in ähnlicher Richtung entwickeln, sieht er in ihrer gemeinsamen Geschichte: »zunächst als Gattung Mensch, dann als Mitglied einer Kultur, als TeilnehmerInnen an einer gemeinsamen Aktivität. Damit zunehmend ähneln sich auch die Filter, mit deren Hilfe sie Wahrnehmung konstruieren.« (Brügelmann 1999, 181) Gehirne als geschlossene Systeme sind zwar autonom gegenüber ihrer Umwelt, aber sie haben eine gemeinsame Evolution hinter sich. Biologisch gleiche Gehirne entwickeln sich unter ähnlichen (Über-)Lebensbedingungen eher gleichartig, die durch die Kulturgeschichte ähnlichen Erfahrungen schlagen sich in ähnlichen Welt«bildern« nieder - so seine Ausführungen, wobei er die Einschränkungen »eher« und »ähnlich« ausdrücklich hervorhebt. Konsensuelle Wirklichkeitskonstruktionen werden vor allem durch soziale Systeme und mittels Sprache hergestellt und im Subjekt internalisiert, was Berger/Luckmann schon in den 1960er Jahren in ihrem Buch »The Social Construction of Reality« beschrieben haben.
Wie schon mehrfach in diesem Kapitel ausgeführt: Es gibt keine Entwicklung und kein Lernen, das nicht zum einen selbst organisiert und aktiv angeeignet wäre, das aber nicht in dialogischer, interaktiver und kommunikativer Weise, also sozial vermittelt wäre. (Vgl. auch Feuser 1995, 104) Dennoch sind die Spielräume (Driftmöglichkeiten) der menschlichen Gehirne auch innerhalb dieser gemeinsamen Bedingungen sehr groß und vielfältig. Dafür gibt es eine Vielzahl von Belegen. Zu den spannendsten gehören aus meiner Sicht Untersuchungen über Bedeutungen, die Kinder mit sprachlichen Begriffen verbinden.[18] Eine ähnliche Überlegung findet man bei Vester, biologisch argumentiert.
Daraus ergibt sich für ihn - und ich kann meine eigene Position in diesen Gedanken gut wiederfinden - dass Unterricht also doch möglich ist, wenn wir ihn nicht missverstehen als »Transport von stabiler Information«, wenn wir Lernen nicht als »passives Komplement zur Lehre« (Brügelmann 1999, 182) auffassen, wenn wir verstehen, dass Lernen ein eigenaktiver Vorgang ist, der nicht linear geplant werden kann. Je angemessener die Lernbedingungen arrangiert sind, desto wahrscheinlicher wird nach seiner Auffassung der Erfolg, dass zielgerichtete Vermittlung von Inhalten möglich wird, die jedoch nicht zu den exakt gleichen Lernergebnissen führen müssen und können. Angemessen heißt für ihn:
-
Bemühen um den Zugang zur Biografie und Lebenswelt der Lernenden;
-
Bezugnahme auf ihre Besonderheiten in der inhaltlichen Gestaltung von Aufgaben, Aktivitäten und Arbeitsmitteln;
-
Der Eigenaktivität genügend Raum geben;
-
Die Selbstorganisationsfähigkeit von Erfahrung berücksichtigen.
Auf der Suche nach Anknüpfungspunkten der neuen/radikalen Konstruktivisten an die Praxis der Schulen und des Unterrichts bin ich wenig fündig geworden. Das Entwickeln didaktischer Ansätze steht am Anfang und wiederholt im Wesentlichen die generellen Postulate. Vermutlich hängt das damit zusammen, dass sich die ersten Konstruktivisten weniger mit dem kontextuellen Aspekt von Lernen und Erziehung, sondern eher mit dem ko-evolutionären, ökologischen Aspekt von Lernen befasst haben, also mit jenen Fragen, die dem Überleben der Menschheit dienen. So präzise die Analyse und Kritik am Traditionellen ist, so brauchbar die Erklärungsmodelle sind, warum Unterricht und schulisches Lernen verändert werden müssen, so wenig werden eigene didaktisch-methodische Modelle aus der Hochschulpraxis vorgestellt und diskutiert noch schulische Beispiele, die für die Praktiker Orientierungshilfe wären.
Einen Ansatz zur Verbindung von Theorie und Praxis entwickelt Kösel in seinem Buch: »Die Modellierung von Lernwelten« (1995). Als einer der wenigen spricht Kösel das Spannungsverhältnis zwischen Schule als System und Lernenden und Lehrenden als Systeme an und relativiert damit den Anspruch an die Praxis, radikal neue Wege zu gehen, Schule und Unterricht grundsätzlich in Frage zu stellen. Er schafft zumindest für mich Orientierungspunkte, die in vielen anderen Beiträgen fehlen. Für ihn ist entscheidend, die Spielräume (Driftmöglichkeiten) mit Berücksichtigung der konstruktivistischen Theorien über den Wissenserwerb auszunützen und zu vergrößern und dabei eben zu berücksichtigen, dass Veränderungsprozesse immer viabel - und zwar für alle am Prozess beteiligten Systeme sein müssen. »‹Lehrende‹, ›Lernende‹ und ›Schule‹ stellen operational geschlossene Systeme dar, die eine jeweils spezifische Systemgeschichte und eine rekursive Systemstruktur haben. Sie weisen zwar in konkreten Situationen viele Driftmöglichkeiten auf, grundsätzlich aber sind sie durch die je eigene Strukturdeterminiertheit gebunden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als im Strom der Evolution des Bewusstseins zu bleiben und darin Wege und Konstruktionen zu versuchen, die anschlussfähig (›viabel‹) und gesellschaftlich akzeptabel sind, und so zu versuchen, diese personalen und sozialen Systeme allmählich umzugestalten.« (Kösel 1999, 105) Veränderungsprozesse werden also nur dann stattfinden können, wenn ein Mindestmaß an Akzeptanz von allen Systempartnern vorhanden ist. Übertragen auf die Bemühungen um inklusiven Unterricht heißt dies, dass gemeinsames Lernen nur dann gelingen kann, wenn man es mit und nicht gegen andere - Eltern von nichtbehinderten Kindern, LehrerInnen - durchsetzen kann, wenn ein Grundkonsens über Chancen und Notwendigkeiten der Veränderung schulischen Lernens hergestellt werden kann.
Kösel formuliert fünf Prinzipien, die bei der Gestaltung von Lernsituationen aus systemisch-konstruktivistischer Sicht zu berücksichtigen sind und die ich im Folgenden als Gliederung übernehme (vgl. Kösel 1999, 107 ff):
Wissenserwerb als aktiver Prozess
Unter aktiver Beteiligung - Eigenaktivität - versteht man die Motivation und das Interesse an einem Prozess oder Gegenstand des Wissenserwerbs. Aktive Beteiligung evoziert aus der biologischen Perspektive neuronale Tätigkeit, die notwendig ist, damit neue Inhalte vom System aufgenommen, mit anderen verknüpft werden und dabei strukturbildend wirken. Eigenaktivität darf jedoch nicht missverstanden werden als ausschließlich eigenständiges Tun, wie das in ›offenen‹ Klassen manchmal scheint, noch pointierter: Tun kann auch mit sehr geringer aktiver Beteiligung im Sinne von Lernen einhergehen. Ohne dem Frontalunterricht das Wort reden zu wollen, aber aktive Beteiligung kann auch heißen, einem Vortrag konzentriert zu folgen, eine Geschichte aufmerksam zu lesen. Neurobiologisch gesehen ist jedes Erkennen Tun, wobei Maturana/Varela mit Tun ›operationale Effektivität‹ (Maturana/Varela 1987, 35) meinen, das heißt Aktivität des neuronalen Systems, die nicht unbedingt als Handlung nach außen sichtbar sein muss. Allerdings gelten die gesamten Einschränkungen aus der Hirnforschung, dass ein Vortrag nur ein einkanaliges Angebot ist und daher nur wenige Wahrnehmungsfelder anspricht und es sicherlich schwierig ist, in einer Klasse, die sich in aller Regel ja nicht freiwillig zu einem Lehrervortrag einfindet, bei allen SchülerInnen auf Interesse zu treffen. Wir alle kennen aus den eigenen Lernbiographien und aus der Praktikerperspektive das Phänomen, in einem Setting organisierten Lernens zu sein, physisch anwesend, jedoch ohne Beteiligung und Aktivität am Lerngegenstand.
Wissenserwerb als selbstgesteuerter Prozess
Wenn Wissenserwerb schon seit langem übereinstimmend nicht als Übertragung von Information gesehen wird, sondern als eigenaktiver Konstruktionsprozess, bedeutet das auch, dass Lernen nicht von außen gesteuert, sondern allenfalls angeregt werden kann. Nachdem Wahrnehmungsverarbeitung und -steuerung zwar ähnlich sind und dennoch mit großen individuellen Spielräumen einhergehen, ist die Fähigkeit zur Selbststeuerung eine wichtige Komponente, die im Arrangement von Lernsituationen zu berücksichtigen ist. Selbststeuerungsprozesse sind prinzipiell Voraussetzung für Lernen, sollten aber gleichzeitig auch als Ziel und Methode von Unterricht betrachtet werden. Ein kleines Kind braucht keinerlei Fremdsteuerung beim Spracherwerb oder beim Erwerb von anspruchsvollen motorischen Fertigkeiten wie dem Gehen; Kulturgüter als Lerninhalte, die stärker aus der Perspektive der Gesellschaft als aus der gegenwärtigen Perspektive des kleinen Kindes oder der Jugendlichen bedeutsam sind, wie z. B. das Üben der In-Sätzchen oder des Einmaleins, werden auch bei der Gestaltung von Lernumgebungen in einem gewissen Grad fremdbestimmt. Seit es die Pädagogik als Wissenschaft gibt, wird diese Frage unter dem Stichwort intrinsische und extrinsische Motivation geführt. Ich teile die Meinung von Kösel (Kösel 1999, 107), dass Selbststeuerung und Fremdsteuerung keine unversöhnlichen Gegensätze sind, dass Selbststeuerung nicht bedingungslos vorausgesetzt werden kann, wie das Montessori-Pädagogen in einem meiner Meinung nach sehr romantisierenden Kinderbild annehmen - allerdings auch, dass selbststeuernde Aktivitäten, die das Lernen von Kindern im Vorschulalter bestimmen, schon häufig bei Schuleintritt nicht nur nicht gefördert, als Anknüpfungspunkte nicht wahrgenommen, sondern nicht mehr zugelassen werden und damit eine notwendige Basis von Lernen zerstört wird.
Im Verhältnis Selbst- und Fremdsteuerung spiegelt sich also das Spannungsfeld von Schule als gesellschaftlicher Institution versus dem individuellen Lernen wider: Die Fremdsteuerung schulischen Lernens basiert ja auf dem ideologischen Konstrukt von Schule als einem Ort, an dem junge Menschen gebildet werden, d. h. mit Wissen (als Erkennen von Zusammenhängen) so ausgestattet werden sollen, dass sie den Erwartungen und Erfordernissen ihrer Gesellschaft oder Kultur gewachsen sind. Alle komplexen Gesellschaften haben pädagogische Einrichtungen geschaffen, seien dies Schulen oder Formen von Lehrlingsverhältnissen (vgl. Gardner 1996, 58), um den Heranwachsenden die notwendigen Kompetenzen zum Überleben in der jeweiligen Kultur zu vermitteln. In dieser Tatsache ist Fremdbestimmung und -steuerung begründet, (in der Sprache der Evolutionsbiologie als strukturelle Koppelung mit dem Milieu). Diese Prämisse scheint unumstritten, auch Konstruktivisten geben zu, »dass es Kulturgüter gibt, dass z. B. Sprache zu erlernen ist, Mathematik nicht überflüssig wird, wissenschaftliche Fächer nicht einfach verschwinden sollen« (Reich 1999, 74), dass Lerninhalte nicht völlig beliebig sind. Allerdings bleibt Reich sehr vage, welche Kulturgüter nicht mehr auszuhandeln und damit folglich als Curriculum einer Schule akzeptierbar wären. Die fundamentale Kritik an der Schule aus verschiedensten Perspektiven richtet sich ja nicht grundsätzlich gegen ihren Auftrag, sondern kreist um die Fragen, welche Kompetenzen die Menschen zur gesellschaftlichen Teilhabe aber auch in einem ko-evolutionären Sinne zum Überleben der Menschheit brauchen, ob Schule in ihrem derzeitigen Selbstverständnis dazu einen Beitrag leistet, bzw. wie eine Schule Lernprozesse anregen müsste, dass sie diesem Ziel näherrückt. Publikationstitel wie etwa »Die Schule neu denken« (von Hentig 1993) oder »Die Schule neu erfinden« (Voß 1999) verweisen deutlich auf diesen Zusammenhang. Fremdsteuerung und Selbststeuerung sind Pole auf einem Kontinuum, wobei es notwendig ist, zum einen eine Balance zwischen beiden herzustellen, die Fremdsteuerung zu reflektieren, Ziele transparent zu machen, sodass Wert und Bedeutung eines Lernstoffs für jeden Lernenden persönlich einsichtig sind - und ihn dann zum anderen dabei zu unterstützen, die notwendigen Lernaktivitäten selbst zu steuern.
Was auf Papier so einfach erscheint, ist es in der Praxis nicht. Während für viele LehrerInnen Selbststeuerung nahezu eine Fremdwort ist, verkehren sich offene Lern-Systeme mit Verweis auf Selbststeuerung und Selbstbestimmung teilweise in ihr Gegenteil: Wenn Kinder nach vier Jahren Grundschule - ohne dass sie als lernschwach oder gar behindert eingestuft worden wären - nahezu als Analphabeten in die Sekundarstufe übertreten, dort dann die Kulturtechnik Lesen und Schreiben meiden, weil ihre Fertigkeit es ihnen nicht erlaubt, altersgemäße Texte zu entschlüsseln, dann meine ich, dass hier in verantwortungsloser Weise mit Begriffen wie Selbst- und Fremdsteuerung umgegangen worden ist. Aus konstruktivistischer Sicht könnte man natürlich sagen, dass für diese Lernenden die Kulturtechniken Lesen und Schreiben nicht bedeutungsvoll genug waren.[19]
Wissenserwerb als sozialer Prozess
Der Aufbau von kognitiven Strukturen und Wissenserwerb ist gleichzeitig immer auch ein sozialer Prozess. Lebendige Systeme sind zwar sich selbst organisierende Einheiten, die sich aber nicht aus sich selbst heraus zu organisieren vermögen, sondern nur im permanenten Austausch mit ihrer Umwelt. Vom Augenblick der Geburt an betritt ein Säugling eine Welt voller Deutungen und Bedeutungen, die auf den Annahmen der Kultur beruhen, in die er zufällig hineingeboren wurde. Jeder Mensch lebt in einer von anderen Menschen bereits vorstrukturierten Welt, soziales und biologisches Milieu sind untrennbar miteinander verbunden. Die ›psychische Geburt‹ (vgl. Mahler 1980), also die Ausbildung des Konstrukts, das wir als Ich oder Selbst bezeichnen, erfolgt nur im Dialog mit Anderen, in komplexen Identifikationsprozessen. (Vgl. Stern 1992; Dornes 1993) Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die »Integrierte Persönlichkeitstheorie« nach Epstein, die Kösel (1997, 79ff) weiterentwickelt hat und die sehr umfassend die Prozesse und Faktoren darstellt, die in Wechselwirkung von Selbst- und Umwelt-Theorie zur Realitäts-Theorie einer Person führen. Menschen werden nicht als Mitglieder einer Gesellschaft geboren, sondern in einem dialektischen Prozess der Internalisierung zu Mitgliedern dieser Gesellschaft. »Evolution ist immer Koevolution, wie jedwede individuelle Entwicklung nur im Sinne der Koontogenese von Systemen verstanden werden kann.« (Feuser 1995, 103) Der Austausch des Menschen mit anderen Menschen wirkt im Sinne dessen, was wir als Ich oder Selbst bezeichnen, strukturbildend. (Vgl. Feuser 1995, 100) Ähnlich der kognitiven Struktur ist auch die Selbst- Theorie eine Konstruktion, ein Bild über sich selbst, das sich aus der Wechselwirkung, dem Dialog mit der Umwelt, mit dem »signifikant Anderen« (Berger/Luckmann 1980, 148) entwickelt. Das Medium dieses Prozesses ist Kommunikation und Interaktion oder auch Dialog - gemeint sind alle kommunikativen Ausdrucksformen -, in welchen explizite und implizite Beziehungsbotschaften transportiert werden, aber auch Grundbotschaften wichtiger Beziehungspersonen, wie »Du bist hier erwünscht« oder »Alles dreht sich nur um dich« oder »Du bist hier lästig«. (Schulz von Thun, 1997, 189) Nach Epstein liefert uns diese Selbst-Theorie ein stabiles Gerüst mit der Funktion, Erfahrungen zu assimilieren und das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Hat sich ein Selbstkonzept einmal verfestigt, dann schafft sich das Individuum eine Erfahrungswelt, in der sein einmal etabliertes Selbstkonzept immer wieder bestätigt wird, wobei es sich der Mechanismen der ›Verzerrung‹ und ›Vermeidung‹ bedient.
Auch wenn das Fundament des Selbstkonzepts in seinen Grundzügen in der frühen Kindheit festgelegt wird, spielt die Schule - und zwar sowohl die individuelle Lehrerpersönlichkeit, aber auch die Schule als System - im Rahmen der sekundären Sozialisation eine bedeutende Rolle. Die Beziehungsbotschaften, vermittelt über alltägliche Schulerfahrungen, wurden schon in den 70er Jahren von Tillmann (1976) als ›heimlicher‹ aber eigentlich wirksamer Lehrplan bezeichnet. Solange z. B. Schule Kinder und Jugendliche als passive Wissensempfänger behandelt und ihnen dadurch Verantwortung verwehrt, solange sie nicht in deren Lernbereitschaft vertraut, handelt sie gegen ihren eigentlichen - offiziellen - gesellschaftlichen Auftrag.
Meiner Meinung nach wird die Bedeutung der sozialen Prozesse in der Schule, vor allem in der Sekundarstufe - auch bedingt durch die Fächerung - noch immer viel zu stark vernachlässigt. Dass die Trennung der Sach- (oder Inhaltsebene) von der Beziehungsebene ein unmögliches Konstrukt ist, kann nicht nur aus der Systemtheorie abgeleitet werden (vgl. Ciompi 1998). Die Kommunikationswissenschaft (Watzlawick 1990, von Thun 1997) aber auch psychologische Zugänge, beispielsweise die themenzentrierte Interaktion (TZI) von Ruth Cohn (1993) belegen eindrucksvoll und vielfältig, dass die Beziehungsebene auch bei Ausblendung wirkt und Lernprozesse auf der Sachebene geradezu torpediert - eine alltägliche Erfahrung von LehrerInnen, die leider viel zu selten reflektiert wird. Die psychischen Belastungen, unter denen viele LehrerInnen leiden, die hohe Burnout-Rate gerade bei LehrerInnen, die Flucht in Zynismus und Sarkasmus - die Aufzählung ließe sich fortsetzen - könnten als Indizien für die subversive Wirkung nicht beachteter Beziehungswirkungen - und zwar nicht ausschließlich auf der sozial-interaktiven Ebene von Lehrer und Schüler - interpretiert werden. Es scheint mir symptomatisch für die Schule von heute zu sein, dass LehrerInnen vielfach nicht einmal die Bedeutung dieses Zusammenhangs erkennen, denn sonst müssten Supervisions-Angebote, wie sie in anderen sozialen Berufen längst zum Standard gehören, angenommen bzw. solche gefordert werden. Für diese, wie mir scheint, ignorante Haltung kann sicher nicht die Lehrerbildung linear-kausal verantwortlich gemacht werden, aber sie trägt dazu bei. Zum einen hat sich die Fachwissenschaft auf ihre immer komplizierter werdenden Inhalte (ein Vergleich mit Mathematik-Schulbüchern aus den 60er Jahren mit heutigen kann das eindeutig belegen) konzentriert und die Beziehungsebene dem inhaltlichen Auftrag geopfert. Zum anderen wird in der Praxisausbildung noch immer eine Unterrichtstradition weitergegeben, die sich weit sicherer auf der Sach- denn auf der Beziehungsebene bewegt. Lehramtsstudierende lernen in ihrer Ausbildung fachwissenschaftlich teilweise auf höchstem Niveau - und bleiben nahezu Analphabeten, was die Fähigkeiten zum Wahrnehmen und Gestalten von Beziehungen, Gruppenprozessen, Kommunikationsvorgängen anlangt.
Der Aspekt des Lernens als sozialer Prozess ist neben allen anderen von weitreichender, geradezu zentraler Bedeutung für die Begründung von inklusivem Unterricht. Georg Feuser hat die Bedeutung aus systemischer Sicht für Menschen mit sog. Behinderungen herausgearbeitet und schlüssig und gut nachvollziehbar belegt. (Vgl. Feuser 1995)[20]
Wissenserwerb als konstruktiver Prozess
Dass Wissenserwerb ein konstruktiver Prozess ist, dass verschiedene Formen des Wissens und Denkens nur dann erworben und genutzt werden können, wenn sie in bestehende kognitive Strukturen eingebaut und vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen des Einzelnen interpretiert werden, habe ich bereits ausgeführt. Noch deutlicher möchte ich den Gedanken herausarbeiten, dass auch das Wissen an sich eine Konstruktion der jeweiligen Kultur, der Zeit, der Beobachterperspektive, z. B. Mann oder Frau, ist. Es gibt kein Wissen als Wahrheit, sondern stets mehrere Konstruktionen ein- und derselben Wirklichkeit - und das gilt auch für gängige Lehrmeinungen einer bestimmten Zeit. Aufgabe einer Schule bzw. Didaktik aus konstruktivistischer Sicht wäre es, »Beobachtervielfalt zu entwickeln« (Reich 1999, 74), d. h. weniger in Kategorien von richtig und falsch zu denken, sondern verschiedene Sichtweisen nicht nur zuzulassen, sondern geradezu zu provozieren - und damit gleichzeitig Toleranz einzuüben - unterschiedliche Lösungswege zu vergleichen, unterschiedliche Lösungen zu akzeptieren, unterschiedliche Bedeutungen zu reflektieren und auszuhandeln. Celestin Freinet hat die Kernidee einer konstruktivistischen Didaktik in diesem bezeichneten Sinne in der Praxis verwirklicht (übrigens weit mehr z. B. als Maria Montessori), indem Lehrer und Schüler gemeinsam Arbeiten - Projekte - aushandeln, planen und realisieren - und eben nicht nur die Symbolvorräte der Moderne wie ein Schwamm aufsaugen.
Für die Gestaltung von Lernumgebungen schlägt Kösel folgende Konsequenzen vor:
-
»Wissenschaftliche Konzepte sollen stets deutlich und anschaulich dargestellt und erklärt werden. (Vgl. hiezu die Kritik Vesters an Mathematikschulbüchern, die Lernen verhindern, Anm. d. V.) Die Lernenden sollen die Möglichkeit haben, in authentischen und komplexen Situationen eigene Erfahrungen zu machen und ihre Konzepte zu erweitern. (...) Entscheidend ist, dass die Lernenden selbst erfahren, dass die neuen konzeptuellen Modelle bestimmte Phänomene besser erklären als die eigenen Überzeugungen.« (Kösel 1999, 108)
Wissenserwerb als situativer Prozess
Wissen und Fertigkeiten werden immer in bestimmten Kontexten erworben. Von Verstehen würde man sprechen, wenn dieses auch in verschiedenen Kontexten angewendet werden könnte - nach dem Motto: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir - eine Wunschvorstellung, der schulische Praxis heute diametral widerspricht. In »Der ungeschulte Kopf« zeigt Howard Gardner (1993) eindrücklich, wie tief die Kluft zwischen schulischem Kontext und der Anwendung ›im Leben‹ ist, wie einfachste physikalische Alltagsphänomene von Physik-Studenten nicht erklärt werden konnten bzw. falsch erklärt wurden, während nicht-geschulte Personen komplizierte physikalische Prinzipien (z. B. die Hebelwirkung) anwenden, ohne die schulische Formel dazu jemals gelernt zu haben. Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen, wir könnten dazu in den eigenen Lernbiographien kramen und fündig werden. Aus konstruktivistischer Sicht sind Abstraktion und Vereinfachung von Umwelten, wie sie im schulischen Kontext häufig praktiziert werden, völlig ungeeignet, um anwendbares Wissen zu vermitteln oder zu erwerben. Die Komplexität und Authentizität der Umwelt muss aufrecht erhalten werden.
Als Anregung für die Praxis - weit weniger radikal als die theoretischen Aussagen - leitet Kösel Folgendes ab:
-
Den Lernenden sollen mehrere Beispiele und Kontexte für Wissensanwendung geboten werden - Prinzip der multiplen Kontexte, was auch Aeblis Durcharbeiten entspricht;
-
Lernende sollen Inhalte unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten - Prinzip der multiplen Perspektiven;
-
Schulisches Lernen soll stärker an nicht schulische Alltagssituationen angebunden werden (›bridging‹);
-
Lernende müssen vermehrt unterstützt werden, zwischen der Symbolebene (mathematisches, physikalisches Symbolsystem, aber auch grammatikalische Strukturen) und der Realität Verbindungen herzustellen. (Vgl. Kösel/Scherer 1999, 109)
Die didaktischen Antworten von Pädagogen, die sich in der konstruktivistischen Denktradition positionieren, sind nicht weit entfernt von den Vorstellungen schülerorientierter Unterrichtskonzepte und werden von Praktikern unterschiedlichster reformpädagogischer Ausrichtungen jedenfalls stärker berücksichtigt als in der Staatsschule. Die Gefahr des schülerorientierten Ansatzes ohne fundierte theoretische Begründung kann jedoch leicht dahingehend missverstanden, sogar missbraucht werden, keine wesentliche, grundlegende Veränderung anzustreben, sondern nur subtilere Formen des ›Traditionellen‹ anzubieten. Darauf verweist Kersten Reich (vgl. Reich 1999, 71), wie auch schon Feuser (»Alter Wein in neuen Schläuchen«): Wie ich schon im ersten Teil dieses Kapitels im Zuge der Profilschärfung einzelner Begriffe herausgearbeitet habe, geht es neben der Didaktik als Handlungstheorie um grundsätzliche Haltungen und Positionen von Pädagogen, nicht um Behübschungen, auch wenn der Weg dorthin in kleinen Schritten erfolgt. Verschiedene Perspektiven in der Wissenskonstruktion zuzulassen, muss sich längerfristig in einem nicht vom Lehrer zu bewertenden, sondern von beiden auszuhandelnden Leistungsbeurteilungssystem niederschlagen, Selbst- und Mitbestimmung können sich nur entwickeln, wenn nicht vor jedem Prozess alle Wege und Ziele klar vorgeschrieben sind, Wahlmöglichkeiten können auf dem Weg zu mehr Autonomie unterstützend wirken - aber auch verschleierte Formen von Gängelung sein. Ich stimme mit Reich völlig überein, dass Schülerorientierung eine Leerformel bleibt, wenn nicht auch das Schüler-Lehrerverhältnis reflektiert und grundlegend neu definiert wird, was sich langfristig in einer veränderten Beurteilungspraxis widerspiegeln müsste.
In den letzten Jahren der wissenschaftlichen Begleittätigkeit - im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Arbeitsintegrationsprojekts - hatte ich öfters die Gelegenheit, im Rahmen von Austauschprogrammen mit KollegInnen aus Dänemark, Schweden und Holland zusammenzutreffen. Immer wieder fiel der Name Howard Gardner, dessen Theorie offensichtlich in den pädagogischen und heilpädagogischen Kreisen diese Länder genauestens rezipiert wurde.
Auf der Suche nach gegenwärtigen Positionen, die eine Veränderung der Organisation des Lernens in Schulen auch aus nicht-inklusiver Sicht begründen, befasste ich mich mit seinen Publikationen - und war zunehmend mehr überrascht und fasziniert von den theoretischen Überlappungen, den Parallelen und von der Ähnlichkeit der Argumentation mit den bisher vorgestellten Positionen, mit denen er die notwendige Veränderung der amerikanischen Regelschuleneinfordert.
Howard Gardner ist Kognitionspsychologe, lehrt an der Harvard University und forscht am Boston Veterans Administration Medical Center. Seine Arbeitsweise ist es, die engen Grenzen der Kognitions- und Entwicklungspsychologie zu erweitern und mit Erkenntnissen und Annahmen anderer Wissenschaftsbereiche zu verbinden - dieselbe Arbeitsweise, die auch schon Ciompi (1998) gewählt hat. »Diese Ausweitung zielt zum einen auf die biologischen und evolutionären Wurzeln der Kognition, zum anderen auf die kulturellen Varianten kognitiver Kompetenzen.« (Gardner 1991, 22) Vor allem die Neurobiologie - weit mehr als die Genforschung - habe in den letzten Jahren Erkenntnisse geliefert, deren Bedeutung die Psychologie nicht nur nicht ignorieren, sondern endlich anerkennen und mit den eigenen Erkenntnissen konfrontieren sollte. Dabei geht es in erster Linie um Fragen der Organisation und Funktionsweise neuronaler Strukturen, die materielle Grundlage von Wahrnehmung, Gedächtnis, Affekten, Lernfähigkeit, Verhalten sind. Diese Strukturen sind zu verstehen als einschränkende Rahmenbedingungen, unter denen sich die menschliche Entwicklung vollzieht. Geistige oder intellektuelle Funktionen sind jedoch weit mehr als Reifungsprozesse und Vorgänge im Gehirn, sie sind in ihrer Genese nur zu verstehen im Eingebettet-Sein in die jeweilige Kultur und deren Symbolsysteme - d. h. im Dialog oder der strukturellen Koppelung mit der Umwelt. »Nach meiner Meinung sollten Exkursionen in die ›Labors‹ der Gehirnforscher und in das ›Feld‹ einer exotischen Kultur zum Studienplan aller gehören, die sich für Kognition und Entwicklung interessieren.« (Gardner 1991, 22)
Während Piaget und seine Nachfolger, aber auch Noam Chomsky von einem stark individuumszentrierten Denkansatz ausgehen, verbindet Gardner diesen mit kultur- und sozialpsychologischen Denkansätzen, die sich in der Tradition um Wygotski reihen und deren bekanntester Vertreter Jerome Bruner ist. Die individuumszentrierten Forscher haben nach Ansicht von Gardner »zwei elementare Faktoren in der Gleichung der kognitiven Entwicklung außer Acht gelassen: einerseits die Bedeutung der Kultur mit ihren Kunstwerken und Erfindungen, andererseits den Einfluss anderer Menschen«. (Gardner 1991, 58)
In Gardners Arbeit finde ich meine Zugänge widergespiegelt, die Arbeit fasziniert und begeistert mich durch die Füllle an Forschungsergebnissen aus der Neurobiologie, der Ethnologie und die Vernetzung mit der Philosophie- und Kunstgeschichte. Gardner fasst diese Erkenntnisse und Hypothesen zusammen und versteht es, in verblüffender Klarheit ein Netzwerk von unterschiedlichsten theoretischen Ausgangspunkten, Widersprüchen und Zusammenhängen vor dem Auge der Leserin entstehen zu lassen.
Auf dieser Basis entwickelt er seine Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen. Damit einhergehend kritisiert er das in den westlichen Zivilisationen vorherrschende Denkkonstrukt, welches Intelligenz auf mathematisch-logische und linguistische Kompetenzen reduziert. »Alle (gemeint sind die verschiedenen Richtungen der Kognitionspsychologie) ignorieren sie die Biologie, keine von ihnen bekommt die höheren Ebenen der Kreativität in den Griff, und alle sind sie blind für die vielen Rollen, die in der menschlichen Gesellschaft wichtig sind.« (ebd. 34)
Trotz dieser Kritik weiß er jeden Ansatz und die großen Verdienste der Kognitionswissenschaft zu würdigen, auch wenn er im Einzelnen andere Positionen bezieht und sein Selbstverständnis im Erweitern der Sichtweisen besteht. Sein Hauptinteresse fokussiert auf den Nachweis der Existenz multipler Intelligenzen, sein »wichtigstes und zugleich ehrgeizigstes Anliegen« (ebd. 23) wäre es jedoch, dass sich seine dargelegte Betrachtungsweise für Politiker wie Praktiker als nützlich erweist und bei der Planung von allem, was mit Lernen und der »Förderung von Menschen« (ebd. 23) zu tun hat, hilfreich wäre.
Gardner führt überzeugende Indizien für die Existenz relativ autonomer intellektueller Kompetenzen beim Menschen an, die er als »menschliche Intelligenzen« bezeichnet. Er beschreibt sieben solcher Kompetenzen, die er in drei großen Gruppen zusammenfasst: (ebd. 252)
Objektbezogene Intelligenzformen - dazu gehören:
-
die räumliche Intelligenz
-
die logisch-mathematische Intelligenz und
-
die körperliche-kinästhetische Intelligenz.
Diese intellektuellen Kompetenzen sind der faktischen Kontrolle durch Strukturen
und Funktionen physikalischer Objekte unterworfen, mit denen die Individuen
in Kontakt kommen.
Objektfreie Intelligenzformen:
-
Linguistische Intelligenz
-
Musikalische Intelligenz
Diese intellektuellen Kompetenzen werden nicht durch die physikalische Welt gestaltet, sondern reflektieren die Strukturen der jeweiligen Sprache oder Musik. Sie hängen eng zusammen mit dem sensorischen Apparat des auditiven und oralen Systems, Teile der jeweiligen Kompetenz können sich jedoch bis zu einem gewissen Grad auch ohne diesen sensorischen Apparat entwickeln.
Personale Intelligenzformen:
-
Intrapersonale Intelligenz
-
Interpersonale Intelligenz
oder anders ausgedrückt, das Wissen über sich selbst und andere. Diese intellektuellen Komponenten wurden von den Kognitionsforschern weitgehend ausgeblendet. Mit intrapersonaler Intelligenz meint Gardner, dass es den Menschen im Zuge der Evolution gelungen sei, Zugang zum eigenen Gefühlsleben zu bekommen, die Palette der Affekte und Emotionen »zu unterscheiden, zu etikettieren, in symbolische Codes zu verschlüsseln und als Hilfsmittel zum Verstehen und Steuern des persönlichen Verhaltens zu benutzen«. (ebd. 219) Die interpersonale Intelligenz wendet sich nach außen, anderen Personen zu. Die Kernkapazität besteht in der Fähigkeit, »Unterscheidungen zwischen anderen Individuen wahrzunehmen und zu treffen: insbesondere zwischen ihren Stimmungen, Temperamenten, Motiven und Absichten«. (ebd. 220) Die Entwicklung der personalen Intelligenzen ist wie keine andere kulturell gebunden und die Gewichtung zwischen inter- und intra-personalen Ausprägungen gesellschaftlich/kulturellen Normen und Konventionen unterworfen. Es ist wichtig festzuhalten, »dass diese ›Glorifizierung des Selbst‹ eine kulturelle Option ist, die zwar in zeitgenössischen westlichen Kreisen wahrgenommen wurde, aber keineswegs einen humanen Imperativ darstellt. Kulturen können als wichtigste Einheit das individuelle Selbst wählen, die Kernfamilie oder eine noch größere Einheit, die Volksgemeinschaft oder Nation«. (ebd. 251) Die Entwicklung des Selbst, das Gefühl einer persönlichen Identität ist die Folge der Evolution des intrapersonalen Wissens, das nur in einem interpretierenden kulturellen und damit interpersonalen Zusammenhang entstehen kann.
Gardner definiert eine Intelligenz als ein Sortiment von Fähigkeiten, »die ihrem Inhaber ermöglichen, echte Probleme oder Schwierigkeiten zu lösen und, wenn nötig, brauchbare Methoden oder Vorrichtungen zu erfinden - und die Fähigkeit, Probleme zu entdecken oder zu schaffen, um die Basis für neues Wissen zu legen«. (ebd. 65)
Jeder dieser Kompetenzen - man könnte sie auch als neuronale Mechanismen beschreiben - ordnet Gardner Kernoperationen zu. Diese versucht er zu identifizieren, ihre neuronalen Substrate zu lokalisieren und zu beweisen oder durch Indizien plausibel zu erklären, dass diese »Kerne« auch tatsächlich voneinander getrennt existieren. Als Beleg stützt er sich vor allem auf Untersuchungen hirnverletzter Menschen, auf experimentalpsychologische Befunde, aber auf auch sog. Wunderkinder und Menschen mit Behinderungen, die teilweise hochentwickelte intellektuelle Kompetenzen in isolierten Bereichen aufweisen. Die Annahme von generellen Hirnstrukturen, wie Piaget vorschlägt, kann viele der von Gardner beschriebenen Phänomene nicht erklären. Weiters stützt er sich auf ontogenetisch identifizierbare Entwicklungen und evolutionsgeschichtliche Hinweise - allerdings mit der Einschränkung, dass genau in diesem Bereich Spekulationen verlockend und Beweise schwierig sind. Ein letztes Kriterium für die Existenz verschiedener Intelligenzen ist ihre Repräsentation in unterschiedlichen kulturellen Symbolsystemen.
Die Akzeptanz der Theorie Gardners hätte weitreichende Konsequenzen im Hinblick auf schulische Integration oder Segregation. Noch immer basieren sonderpädagogische Gutachten, die Kinder in die Kategorie ›behindert‹, ›lernschwach‹ und ›nicht behindert‹ einteilen, im Kern auf Intelligenzmessungen mit Tests, die auf dem von Gardner in Frage gestellten und fundiert kritisierten Intelligenzkonzept beruhen. Hauptkritikpunkt Gardners daran ist die Reduktion intelligenten Verhaltens auf zwei Bereiche, die mathematisch-logisch-analytische und die linguistische Kompetenz bei gleichzeitiger Ausblendung und damit einhergehender Abwertung kreativer Potentiale und der gesellschaftlich immens wichtigen Kompetenzen im personal-sozialen Bereich. Die Verengung des Intelligenzbegriffs führt dazu, große Gruppen von Kindern und Jugendlichen - unabhängig von einer diagnostizierten Behinderung - auszugrenzen, weil sie keine ihren Lernstilen und Intelligenzprofilen adäquaten Lernangebote erhalten, Aufstiegschancen oder aber Selektionsmechanismen, je nach Perspektive, auf genau jenen Fähigkeiten und Fertigkeiten beruhen, die aus diesem verengten Intelligenzkonstrukt abgeleitet werden.
Gardner formuliert in seinem Buch »Abschied vom IQ. Die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen« fundamentale Kritik an der Schule. Seinen Fokus richtet er auf die Tatsache, dass die Regelschule nahezu ausschließlich mathematisch-logische und linguistische Kompetenzen fördere und die individuell sehr unterschiedlichen intellektuellen Profile, die sich aus dem Zusammenwirken der sieben beschriebenen Intelligenzen ergeben, ignoriere. Kinder, deren Intelligenzprofile nicht dem Schulstandard entsprechen, können zu Schulversagern werden, als schlechte Schüler stigmatisierte Kinder wären in Wirklichkeit gar nicht so »dumm« oder »verhaltensgestört«, wenn nicht nur einseitig eine Intelligenz zugelassen und abgeprüft würde.[21] Aber auch viele Begabungen werden dadurch nicht erkannt und auch nicht gefördert.
In seinem nachfolgenden Buch »Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken.« (1993) stellt er das Lernen und die gesellschaftliche Vermittlungsinstitution des Lernens ins Zentrum seiner Betrachtungen.[22] Während alle kleinen Kinder im Vorschulalter mühelos Symbolsysteme wie Sprachen beherrschen lernen und komplexe kindliche Theorien über das Universum (z. B. ist lebendig, was sich bewegt), über den Geist und über die Welt anderer Menschen entwickeln, versagen viele beim Lernen in der Schule. Aber auch scheinbar erfolgreiches Lernen - und das ist die Hauptkritik Gardners - das sich in guten Schulnoten manifestiert, ist kein Garant dafür, dass dieses Wissen zu einem besseren Verstehen der Umwelt, der Kultur, anderer Menschen und dem Erkennen von Zusammenhängen führt. Auf amüsante und höchst aufschlussreiche Art belegt Gardner, wie abgekoppelt schulisch erworbenes Wissen oft ist. Das über Jahre hin erworbene Schulwissen führe bei vielen Menschen eine Art Eigenleben, das scheinbar nichts mit der Realität zu tun habe und nicht auf sie übertragen werden könne. Diese Behauptung belegt er mit einer Reihe von Untersuchungsergebnissen. (Vgl. Gardner 1993, 15ff) Ein Großteil von Physikstudenten des ersten Semesters war nicht sicher, ob zwei oder eine physikalische Kraft auf eine Münze wirken, die jemand in die Luft wirft; einfachste mathematische Gleichungen konnten nicht auf Anhieb richtig in der mathematischen Symbolsprache aufgeschrieben werden, auch wenn Studenten über Ursachen der Jahreszeiten befragt wurden, zeigten sie nicht das Verständnis, das sie aufgrund der Ausbildung eigentlich hätten haben müssen. Sie greifen in der Regel auf kindliche Erklärungsmodelle zurück, die im Denken fest verankert sind, so die These Gardners, und die durch das schulische Lernen in ihrem Kern kaum verändert worden sind. (Ich gebe gerne zu, dass ich mich teilweise auch bei diesen ›kindlichen‹ Lösungsansätzen ertappt habe.)
»Diese Untersuchungsergebnisse dokumentieren, dass selbst gut ausgebildete Schüler, die alle äußeren Anzeichen des Erfolgs aufweisen - wie der eifrige Besuch guter Schulen, gute Noten und Prüfungsergebnisse, Auszeichnungen durch Lehrer -, in der Regel kein entsprechendes Verständnis des Unterrichtsmaterials und der Begriffe zeigen, mit denen sie gearbeitet haben.« (ebd. 15)
Gardner unterscheidet zwischen drei Lerntypen: (ebd. 19f):
-
Intuitiver Lerntyp - oder auch natürlicher, naiver oder universaler Lerntyp: gemeint sind Menschen, hauptsächlich Kinder im Vorschulalter, die ohne besondere Anweisungen komplizierteste Symbolsysteme erlernen.
-
Schulischer Lerntyp: damit bezeichnet er jene Menschen, die sich im Rahmen von schulischen Routinen sicher bewegen, die sich über Imitation mechanisch und oberflächlich sicher in den schulischen Symbolsystemen bewegen, die jedoch Phänomene ähnlich wie Grundschüler erklären, sobald sie die Schule verlassen haben. Sie können z. B. die Hebelwirkung mit Hilfe einer mathematischen Formel fehlerfrei berechnen, es fällt ihnen jedoch nicht ein, dieses Wissen bei der Lösung eines realen Problems anzuwenden.
-
Lernexperten: Das wären jene Menschen, die fähig sind, das angeeignete Wissen zur Lösung realer Probleme anzuwenden und auch auf neue Phänomene zu übertragen.
Die Hauptkritik Gardners an der Schule ist, dass sie die meisten Schüler als schulische Lerntypen entlässt. Nicht Wissen, sondern echtes Verstehen muss das Ziel der Schule sein. Weinert fasst die Position Gardners im Vorwort so zusammen: »Anstelle disziplinorientierter Wissensvermittlung und psychometrischer Leistungsüberprüfung muß es eine Hin- oder Rückwendung zur Welt der Phänomene und Werte, der fundierten Erfahrungen, der tiefgründigen Einsichten, der Arbeit an sinnvollen Projekten, des reziproken Lehrens und Lernens und des explorativen, gleichermaßen spielerischen wie ernsthaften Umgangs mit der sozialen, biologischen, physikalischen und kulturellen Realität geben.« (Weinert,
in Gardner 1993, 7)
Gardner fordert Schulen, die den Schülern Gelegenheit bieten, statt bloßem Faktenwissen eigene Erfahrungen zu machen und Einsichten zu erwerben, statt reproduzierbarem Wissen ein Verständnis von den Dingen, Phänomenen und Zusammenhängen dieser Welt zu gewinnen und statt stupid und mechanisch eingeübter Aufgabenlösungen das Wissen reflexiv zu nutzen und Strategien zu entwickeln, das gelernte Wissen auf neue Situationen zu übertragen. Dazu braucht es jedoch auch elementare Grundfertigkeiten und Routinen, die in der Schule gelernt werden müssen.
Gardner titelt dieses Kapitel mit »Schritte auf dem Weg zum Verstehen« (ebd. 229). Die pädagogischen Antworten, die Modelle und Konzepte, die er vorschlägt, enthalten eine Reihe von Parallelen, die auch im Diskurs um schülerzentrierte Unterrichtsformen zu finden sind.
Zunächst zeigt er auf, dass jeder Lehrstoff bzw. jedes Thema mit mindestens fünf unterschiedlichen Zugängen aufzubereiten ist, um den verschiedenen Intelligenzprofilen gerecht zu werden (ebd. 304ff).
-
Wählt man den erzählerischen Zugang, versucht man einen Begriff durch eine Geschichte oder eine Erzählung, also durch Sprache zu veranschaulichen;
-
Bei einem logisch-quantitativen Zugang nähert man sich einem Begriff über zahlreiche quantitative Vergleiche oder über deduktive Schlüsse;
-
Unter grundsätzlichem Zugang versteht Gardner das Prüfen von philosophischen und terminologischen Aspekten eines Begriffs;
-
Beim ästhetischen Zugang versucht man die SchülerInnen über die Betonung sensorischer Eigenschaften anzusprechen bzw. ihre Aufmerksamkeit zu
-
erregen;
-
Der experimentelle Ansatz ermöglicht den Schülern, mit einem Material unmittelbar zu handeln und dadurch Erfahrungen zu sammeln.
Darüber hinaus beschreibt er Modelle, die an einzelnen Schulen erprobt worden
sind.
Kindermuseum, Lehrlingsverhältnisse und Schülerprojekte
Als mögliches Modell für die Arbeit mit kleinen Kindern im Vorschul- und Grundschulalter beschreibt er ein Projekt, das die traditionelle Lernschule mit einem Kindermuseum verbindet, und offensichtlich haben diese in den USA eine selbstverständliche Tradition. Allerdings scheint mir Gardners Vorstellung ähnlich jener der vorbereiteten Umgebung, die man von Montessori kennt, oder aber auch den Ateliers aus der Freinet-Pädagogik:
»In einem Spectrum-Klassenzimmer sind die Kinder jeden Tag von vielfältigen und interessanten Lehrmaterialien umgeben, die zur Nutzung mehrerer Intelligenzen anregen. (...) So gibt es zum Beispiel eine naturkundliche Ecke, in der verschiedene biologische Arten zur Verfügung stehen, die die Schüler untersuchen und untereinander vergleichen können. Dieser Bereich spricht sowohl die sensorischen Fähigkeiten an als auch den logisch-analytischen Verstand. Es gibt eine Ecke der Geschichtenerzähler, in der Schüler mit Hilfe einer Reihe anregender Requisiten phantasievolle Geschichten erschaffen können und wo sie Gelegenheit haben, ihre eigenen ›storyboards‹ zu entwerfen. (...)« (ebd. 256)
Gardner entwickelte gemeinsam mit LehrerInnen Lehrplanmaterialien in Form themenspezifischer Pakete, die jeweils über mehrere Zugänge zu erschließen sind und dadurch mehrere Intelligenzen ansprechen. Grundschulkinder werden in Verbindung mit diesen Themen, die sie nach Interessen und Geschick auswählen, in die Kulturtechniken eingeführt. Die Beschreibung, wie in die Kulturtechniken eingeführt wird, ähnelt Methoden wie der bei uns bekannten und vielfach verwendeten Methode des »Lesen durch Schreiben« (vgl. Reichen 2001) oder des »Dialogischen Lesens« (vgl. Kasper 1979), bei welchen von Anfang an das Erlernen einzelner Buchstaben kombiniert wird mit dem Lesen und Schreiben von für Kinder bedeutungsvollen Texten.
Für die spätere Kindheit, die in etwa dem Sekundarstufenalter bei uns entsprechen dürfte, beschreibt er als Methoden Lehrlingsverhältnisse und Schülerprojekte. Die Lehrlingsverhältnisse sind im »pod« (vgl. Gardner 1993, 267) organisiert. Darunter sind altersgemischte Gruppen mit einem Lehrer zu verstehen, die ein bestimmtes Fach oder Handwerk über einen längeren Zeitraum hin lernen oder erwerben - sozusagen als Kursangebot. In den Schulen gibt es eine Vielzahl solcher Gruppen, »von Architektur bis zum Gartenbau, vom Kochen bis zum ›Geldverdienen‹« (ebd. 268). Die Gruppen halten engen Kontakt zu außerschulischen Einrichtungen der Gemeinde, vielfach werden die Eltern und deren Ressourcen als Experten genützt. Als einen anderen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Verstehen bezeichnet Gardner Schülerprojekte. Schüler suchen zu umfassenden Themenvorschlägen Inhalte, die sie interessieren und die sie über einen längeren Zeitraum bearbeiten wollen. Dabei werden sie in den verschiedenen Phasen und Aspekten angeleitet und unterstützt, damit die Arbeit im Sinne des Verstehens effizient wird.
Entwicklungsmappen-Kultur statt Ziffernbeurteilung
Auch Gardner sieht die Ziffernbeurteilung als Form der Disziplinierung, die zum Lernen auf dem Weg zum Verstehen kontraproduktiv ist. Eine Weiterentwicklung der auch bei uns diskutierten Portfolios[23] - einer Sammlung von Arbeiten der Schüler - sind die Entwicklungsmappen, die Gardner für die von ihrer Forschungsgruppe begleiteten Modellschulen beschreibt. Nicht allein das Endprodukt eines Lernprozesses ist Inhalt des Portfolios, die Mappe beinhaltet auch Reflexionen der Schüler selbst bezüglich des Lernprozesses, der angestrebten und erreichten oder nicht erreichten Ziele, der Schwierigkeiten, der Lösungsansätze. Die Mappe beinhaltet auch Feedbacks der Lehrer, ist sozusagen eine dialogische Dokumentation des Entwicklungsprozesses eines Schülers.
Trotz seiner fundierten Kritik an der Schule behält Gardner Augenmaß und eine realistische Perspektive auf das Machbare - was meiner persönlichen Haltung sehr entgegenkommt. Er argumentiert nicht für eine völlige Neukonzeption, sondern für eine Erweiterung und Veränderung: »Weder Lehrlingsverhältnisse noch Projekte garantieren für sich allein genommen eine Erziehung zum Verständnis. Lehrlingsverhältnisse können Gelegenheiten sein, nachzuahmen oder die Zeit zu vertrödeln; Projekte können am letzten Tag in Eile zusammengeschustert werden oder in schwerer Arbeit des Schülers oder eines Freundes oder eines Klassenkameraden erstellt werden. Ein Teil des Stoffes muß eingepaukt werden; ein anderer Teil wird leichter durch Lektionen im Klassenzimmer oder durch Lektüre eines Lehrbuchs als durch Nachahmung, museumsartige Einrichtungen oder die Teilnahme am Lehrlingsverhältnis gelernt. Was ich erreichen will, ist nicht die pauschale Abschaffung der gegenwärtigen Bildungsformen, sondern die geschickte und vernünftige Einführung von Lehrlingsverhältnissen und Projekten in Situationen, in denen sich ihre Stärken bezahlt machen können.« (Gardner 1993, 272)
Aus einer gesellschafts- und ideologiekritischen Perspektive betrachtet Hartmut von Hentig, einer der von mir meistgeschätzten Pädagogen der Gegenwart, die derzeitige Schule. Als Leiter der Laborschule und des Oberstufen-Kollegs Bielefeld von 1974 bis 1987 verbindet er wie kein anderer der bisher Genannten Wissenschaft mit Praxis.
Hartmut von Hentigs zentrale Fragestellung ist die nach dem Wesen und dem Zweck von Bildung, verbunden mit einer grundlegenden Kritik an der Schule und der Schulpraxis, die den Bildungsbegriff zwar für sich beansprucht oder sich mit diesem schmückt, seinen humanen Kern im Sinne des Bildungsbegriffs von Humboldt jedoch längst nicht mehr verfolgt.
»Bilden ist sich bilden. Der prägnante Sinn des Wortes Bildung kommt jedenfalls in der reflexiven Form des Verbums am klarsten zum Ausdruck.« (von Hentig 1996, 39) Bildung ist demnach ein Prozess der Gestalt-Werdung, ein Formen und Sich-Formen. Zwei seiner vierzehn Thesen, die das Gerüst seines Essays zum Begriff Bildung ausmachen, lauten:
-
»Der Mensch bildet sich.« (ebd. 39)
-
»Das Leben bildet.« (ebd. 41)
Damit benennt Hentig die beiden grundlegenden Prinzipien des Lernens und der Bildung, die auch in den bisher diskutierten Positionen zentral sind: Bildung als eigenaktiver, sehr individueller Prozess im Dialog mit der Umwelt, mit dem Leben, wie er es nennt.
Bildung ist »die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch-proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere«. (Zusammenfassung der Brockhaus-Enzyklopädie, in Hentig 1996, 40), wobei für Hentig jedes einzelne Wort bedeutsam ist.
»Es geht um Anregung (nicht um Eingriff, mechanische Übertragung, gar Zwang), alle (nicht nur die geistigen) Kräfte sollen sich entfalten (sie sind also schon da, werden nicht ›gemacht‹ oder eingepflanzt), was durch die Aneignung von Welt (also durch die Anverwandlung des Fremden in einem aktiven Vorgang) geschieht - in wechselhafter Ver- und Beschränkung (das heißt erstens: auch die ›Welt‹ bleibt nicht unverändert dabei, zweitens: die Entfaltung ist kein bloßes Vorsichhin-Wuchern, sie fordert Disziplin); die Merkmale sind Harmonie und Proportionierlichkeit (Bildung mildert die Konflikte zwischen unseren sinnlichen und unseren sittlichen, zwischen unseren intellektuellen und unseren spirituellen Ansprüchen, sie fördert keine einseitige Genialität); das Ziel ist die sich selbst bestimmende Individualität - aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie als solche die Menschheit bereichert.« (ebd. 41)
In diesem Bildungsbegriff finden wir bei Hentig zusammengefasst alles, was wir schon bisher zum Thema Lernen gehört haben: Lernen als aktiver, selbstgesteuerter, sozialer, konstruktiver und situativer Prozess (siehe Punkt 2.3.2), Bildung als Brücke oder Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft, Lernen als individuelle, aber auch umfangreicher als in den bisherigen Positionen ausgearbeitete soziale Kategorie. Ein Bildungsbegriff, der nur vom Individuum ausgeht und sich in der Frage manifestiert: Was muss jemand lernen, um in der heutigen Welt zu bestehen? und nicht das Ganze, die Gesellschaft, die Menschheit im Auge behält - Was für Menschen braucht die Welt oder das Land zur Bewältigung der Zukunft? - greift allemal zu kurz (ebd. 30f). Schlüsselqualifikationen sind deshalb für ihn nicht nur Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit und Selbstverantwortung, sondern vor allem auch die »Fähigkeit zur Kritik, zu Einspruch und Widerstand«, zu eben jener »Verantwortung für das Ganze« (ebd. 31), Urteilskraft, Improvisationsgabe, Courage und Toleranz.
Die Denkfigur, dass Bildung so etwas wie die geistige und moralische Führung übernehmen könne, sich gegen die aus der Gesellschaft entwickelnden Bedürfnisse stellen solle, sich gegen utilitäre Vereinnahmung wehren müsse, ist für ihn ebenso einseitig wie jene Denkfigur, die heute meiner Meinung nach überwiegt, nämlich dass Bildung in der Tradition der Aufklärung in erster Linie entlang der tradierten Wissenschaftsordnung Wissen zu vermitteln habe, das ökonomischen Nutzen bringe, Kosten spare, sich in den Dienst einer spezialisierten Berufsausbildung mit möglichst guten individuellen Zukunftschancen stelle. Für Hentig ist Bildung die Spannung oder Brücke zwischen diesen beiden Denkfiguren - »zwischen tradierten Idealen und aktuellem Kompetenzbedarf, zwischen philosophischer Selbstvergewisserung und praktischer Selbsterhaltung der Gesellschaft. (...) Das eine ist ohne das andere sinnlos und unbekömmlich.« (ebd. 58)
Hentig stellt sich gegen die sehr oberflächliche und einseitige Kritik an der Verkopfung der Schule und gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit (ebd. 232). Nicht die Spezialisierung sieht er als Kritikpunkt, sondern ihre Trennung von der allgemeinen Bildung und auch den Zeitpunkt, das Alter der Kinder, ab wann diese Spezialisierung als Form des Lernens in den Schulen zum bestimmenden Strukturierungsprinzip werden soll.
Ausgehend von seinem Bildungsbegriff lässt sich die Kritik am Regelschulwesen unschwer nachvollziehen: Die Überbetonung des Wissens und des gesellschaftlich unmittelbar Verwertbaren, das Fehlen des Blicks auf das Ganze, die philosophische Selbstvergewisserung.
Einige Zitate sollen dies belegen:
-
»Das - von mir gern unterstellte - Bemühen von vielen Schulleuten, den Menschen durch Bildung zum Subjekt seiner Handlungen, zum Herrn über die Verhältnisse zu machen (...) wird freilich durch die vorgängige Unterwerfung unter einen bestimmten gesellschaftlichen Auftrag ausgehebelt, nämlich Ausbildungs-, Erwerbs- und soziale Aufstiegschancen zu verteilen.« (von Hentig 1996, 163)
-
Die moderne Schule » (...) konstituiere ein unentrinnbares und unheimliches, ein entfremdendes und entmündigendes Verhältnis - ›gleich, ob sie reformiert oder antiquiert ist‹«. (Hentig 1993, 9).
-
»Auch heute noch sind unsere Schulen nicht ein Lebens- und Erfahrungsraum, nicht a place for kids to grow up in, nicht die polis, an deren Idealen, Aufgaben und Problemen die jungen Menschen lernen und sich bewähren, sondern Bewahranstalt oder Treibhaus oder Schonraum oder cooling-out institution oder Sortieranstalt oder Startmaschine oder Nachwuchsproduzent oder Sozialstation oder alles auf einmal.« (ebd. 9)
-
»Sie entlässt die jungen Menschen kenntnisreich, aber erfahrungsarm, erwartungsvoll, aber orientierungslos, ungebunden, aber auch unselbständig - und einen erschreckend hohen Anteil unter ihnen ohne jede Beziehung zum Gemeinwesen, entfremdet und feindlich bis zur Barbarei.« (ebd. 10)
Es ist nicht Wissen, das den Schülern mechanisch und »häppchenweise zerstückelt« (ebd. 208) angeboten, das die jungen Menschen zur Bewältigung ihrer Lebensfragen brauchen, sondern Dialog und Auseinandersetzung mit ihren Lebensthemen, es geht um das »Einüben in das Verhalten«, um das Entwickeln von Urteilskraft, Improvisationsgabe, Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verlässlichkeit, Courage und Toleranz. Diese Haltungen sind bedeutend wichtiger für die Bewältigung der unerhörten Probleme, die die derzeitige Gesellschaft den Kindern vermacht - und die die Bildungspolitik regelmäßig in Unterrichtsprinzipien fasst, die in der tradierten Schule zu abfragbarem Wissen generieren: Umwelterziehung, Friedenserziehung, Sexualerziehung, politische Bildung, Gesundheitserziehung und andere mehr.
Auch Hentig zeigt auf, dass elementare Grundsätze, die seit Bestehen der Pädagogik immer wieder von unterschiedlichsten Pädagogen formuliert wurden, bis heute nicht im Regelschulwesen verwirklicht werden. Diese Grundsätze werden nahezu ident von der Neurobiologie (vgl. 2.3.1.2) gefordert:
-
»Verstehen ist für die Aneignung von Erkenntnis wichtiger als Wissen.
-
Lernen wird durch Zwang nicht gefördert.
-
Lernen gelingt besser im Zusammenhang der Dinge.
-
Wo mit Interesse gelernt wird, ist der Zeitverlust (das heißt, der Schüler verweilt länger bei der Sache als geplant) ein Zeitgewinn.
-
Vorbild und Mitmachen bewirken mehr als Belehrung.« (ebd. 208)
Nicht die Wissensvermittlung und die Belehrung kann Aufgabe der Schule von heute sein. Information ist kein Wissen, und Wissen noch keine Bildung. Schule muss Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche sein, d. h. dass Kinder und Jugendliche handelnd Sachen, Menschen und Vorgänge verstehen lernen, sich für Unterschiede interessieren, diese bejahen, das Gemeinsame herausfinden, Regeln vereinbaren und sich daran halten. Die Übersetzung dieser Aussagen in die Praxis kann man in der Laborschule Bielefeld anschauen. Die Fächer sind durch Erfahrungsbereiche ersetzt worden. Für die jüngeren Schüler heißt es: kein fester Stundenplan, Lesen, Schreiben und Rechnen stehen gleichberechtigt neben Tierpflege und Kochen. Ältere Schüler haben freie Fächerwahl, denn mit zunehmendem Alter können Einteilungen von Personen, Gegenständen, Zeiten und Verfahren rationalisiert - und damit bejaht, verstanden oder auch abgelehnt werden. Die Ziffernbeurteilung gibt es an der Laborschule nicht - »Die Benotung lügt und verbiegt und verdirbt, was sie zu erreichen behauptet - Leistung und Gerechtigkeit.« (1993, 203) - Zensuren gibt es erst in den letzten Klassen.
An anderer Stelle beschreibt Hentig das Selbstverständnis der Regelschule wie folgt:
»Unter den drei Verben, mit denen man das Wort Bildung assoziieren kann: etwas haben bzw. wissen, etwas können bzw. tun, etwas sein bzw. sich einer Sache bewusst sein, verwenden wir noch immer die größte Anstrengung auf das erste und fast keine auf das letzte, auf das es in unserer Zeit am meisten ankäme.« (1993, 209)
Fünf Denkfiguren von Schule, die historisch gewachsen sind, stellt er seine Vorstellung von Schule von heute entgegen, nämlich jene der Schule als Lebens und Erfahrungsraum oder, anders ausgedrückt, der Schule als polis. (Vgl. von Hentig 1993, 189)
Historisch gewachsene Denkfiguren von Schule: (ebd. 186f)
-
Die Schule als Einrichtung, in welcher man besondere Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt, die man nicht durch die bloße Teilnahme an der Gesellschaft lernen kann.
-
Die Schule als vom Leben der Erwachsenen »kunstvoll abgetrennter Ort, an dem besondere, für das Aufwachsen der Kinder geeignete Verhältnisse herrschen« (ebd. 186). Die Schule als Schutz- und Schonraum für Kinder, um sie vor schädlichen Einflüssen der Erwachsenen-Welt zu bewahren.
-
Die Schule als Wiege für den neuen Menschen bzw. für die Bewahrung der Zivilisation, die fundamental Konservativen und Revolutionären gemeinsam ist: »die einen fürchten, die Welt könnte mit jeder neuen Generation in die Barbarei zurückfallen, die anderen hoffen auf die neue, noch unverbildete Generation, mit der die ersehnte neue Welt anbrechen kann, die mit den Alten nicht zu haben ist« (ebd. 187).
-
Die Schule als Vorbereitung auf das Leben als Erwachsene, die Kinder beim Hineinwachsen in die Gesellschaft unterstützt, die auf Berufswahl, auf Bürgerpflichten vorbereitet, zum mündigen Staatsbürger erziehen will.
-
Der fünfte Typus ist die »verwaltende, berechtigende, den Erfordernissen der Gesellschaft zuarbeitende und nicht zuletzt den Lehrerstand in Brot und Arbeit haltende Schule; (...)«, deren Aufgabe es unter anderen ist, die Kinder »(...) nach ihrer Begabung (zu) sortieren, ihre Leistungen (zu) messen und auf das aus(zu)richten, was man als den gesellschaftlichen Bedarf erkennt; (...)« (ebd. 187).
Die Schule der Gegenwart und der Zukunft müsste als Lebens- und Erfahrungsraum gestaltet werden, der die Lebensprobleme der Jugendlichen, die sich in ihren Vorstellungen, Fragen, Verstörungen und in ihrem Verhalten zeigen, ernst nimmt. Viele Verhalten von Jugendlichen, die ihnen die Gesellschaft vorwirft, wie Vandalismus, Gleichgültigkeit, die Verbrauchen-und-Wegwerfen-Mentalität sind Spiegel der Erwachsenenwelt. Die Jugendlichen haben spätestens seit Tschernobyl erkannt, dass die Erwachsenen nicht mehr über die Welt verfügen, die sie gemacht haben und auf die sie die jungen Menschen vorbereiten wollen.Wahrheiten gelten über Nacht nicht mehr, der Wissenschaft ist nicht zu trauen, auf die Erwachsenen ist kein Verlass - so der Befund Hentigs (ebd. 190), der mit den Ereignissen um und nach dem 11. September eher erhärtet denn entkräftet wird.
Deshalb meint Hentig, dass wir wieder eine »Erziehung« zur Politik brauchen, wobei er Politik als »gemeinsame bewegliche Regelung gemeinsamer Angelegenheiten« (ebd. 224) definiert. Ein mündiger Bürger als Ziel der Schule, wie er in der Schulgesetzgebung gefordert wird, wird man nicht durch Belehrung, sondern durch Erfahrung, auch Toleranz und Verständnis muss gelebt, nicht als Wissen abgefragt und bewertet werden. All diese Werte müssen nach Hentig in der Schulpolis gelernt und gelebt werden. »Nur wenn wir im kleinen, überschaubaren Gemeinwesen dessen Grundgesetze erlebt und verstanden haben - das Gesetz der res publica, das des logon didonai (der Rechenschaftspflicht), das der Demokratie, das der Pflicht zur Gemeinverständlichkeit in öffentlichen Angelegenheiten, also der Aufklärung, das des Vertrauens, der Verlässlichkeit, der Vernünftigkeit unter den Bürgen und nicht zuletzt das der Freundlichkeit und Solidarität unter den Menschen überhaupt -, werden wir sie in der großen polis wahrnehmen und zuversichtlich befolgen.« (ebd. 191)
In seinem Buch »Die Schule neu denken« formuliert er sechs Thesen zu einer Schule, die seinem Bildungsbegriff entsprechen. Diese Thesen finden sich gleichzeitig auch als pädagogische Leitlinien der Laborschule Bielefeld und werden dort seit Jahren in der Praxis umgesetzt. (Vgl. von Hentig 1993, 215 ff; www.uni-bielefeld 1)
»Das Leben zulassen« - Schule als Lebens- und Erfahrungsraum (von Hentig
1993, 215)
Die Schule, in der Kinder und Jugendliche viele Stunden ihres Lebens verbringen, ist neben den Lebensräumen Familie/Wohnung und Straße/Nachbarschaft ein wichtiger Lebensraum. Hier sollen wichtige Grunderfahrungen ermöglicht werden, die viele von ihnen sonst nicht machen könnten. Leben und Lernen sollen, soweit dies sinnvoll ist, eng aufeinander bezogen sein. Lernen aus Erfahrung ist das primäre Unterrichtsprinzip, nicht Lernen durch Belehrung. Altershomogene Gruppen, Lernen in fixierten Zeitintervallen wie auch das Lernen ausschließlich im Klassenzimmer, auch wenn dies mit Projektunterricht, Montessori-Material oder Freinet-Methoden geschieht, machen aus einer Schule nach Hentig keinen Lebens- und Erfahrungsraum aus.
»Mit Unterschieden leben« (ebd. 219)
Wir leben in einer Gesellschaft, die die Freiheit der Personen schützt, die Meinungsvielfalt bejaht, die verschiedenste Lebensziele und Lebensformen akzeptiert - kurz, in einer pluralistischen Gesellschaft. Dabei soll die Würde des Einzelnen geschützt und geachtet werden. Voraussetzung dafür ist, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit Unterschieden zu leben. Die neue Schule (Laborschule) will die Unterschiede zwischen Kindern bewusst bejahen und als Bereicherung verstehen. Seit Bestehen der Laborschule Bielefeld wurden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen, Inklusion praktiziert. Daraus ergibt sich eine weitgehende Individualisierung des Unterrichts: »Jedes Kind hat seine Aufgabe und sucht den Lehrer auf, wenn es Hilfe braucht, oder der Lehrer geht zu ihm. Zur Verselbständigung wie zum Unterschied-machen und -Bejahen gehört, daß man seine Aufgabe aus einem wohlbedachten Angebot von Aufgaben selber wählt, wenigstens mitbestimmt, wann man was erledigt. Darüber darf der Zusammenhang mit der Gruppe nicht verloren gehen. (...) Die Gruppe bleibt zusammen: eine Gemeinschaft von Individuen, kein
Kollektiv.« (ebd. 221)
»In der Gemeinschaft leben« - die Schule als polis (ebd. 222)
Die Schule ist ein Ort, an dem Zusammenleben tagtäglich stattfindet. Die bekannte Vorstellung Hentigs als der Schule als ›polis‹ formuliert er wie folgt: »Die Schule ist eine polis. Man lernt am Modell dieser Gemeinschaft die Grundbedingungen des friedlichen, gerechten, geregelten und verantworteten Zusammenlebens und alle Schwierigkeiten, die dies bereitet. Gemeinschaft fordert Ordnungen, Selbstdisziplin, Einigung auf die Zwecke und die Grenzen des Zusammenseins. Gemeinschaft bedeutet auch stärker sein, sich geborgen fühlen, Spaß miteinander haben.« (ebd. 222) Die Verhaltensweisen, die von mündigen BürgerInnen erwartet werden, sollen im schulischen Alltag gelernt werden: das friedliche und vernünftige Regeln gemeinsamer Angelegenheiten, das Aushandeln von Vereinbarungen, das Übernehmen von Verantwortung.
»Der ganze Mensch« - ganzheitliches Lernen (ebd. 226)
Ganzheitlich lernen heißt bei Hentig, aus wirklichen Erfahrungen zu lernen - im Gegensatz zu artifiziell hergestellten, im Sinne einer didaktischen Maßnahme. Die Forderung nach Ganzheitlichkeit im Sinne von wirklichen Erfahrungen wird vor allem durch allgemeine gesellschaftliche Tendenzen verstärkt, denen die Schule im Kleinen entgegensteuern kann und muss:
-
»den Verlust von sinnlicher Erfahrung zugunsten von Theorie,
-
den Verlust von Zusammenhang und Sinn zugunsten von Funktionalität,
-
den Verlust von Verantwortung zugunsten von Ressort-Zuständigkeit,
-
den Verlust von Verstehen zugunsten von gespeichertem Wissen,
-
den Verlust von Unmittelbarkeit zugunsten von Ver-Mittlung, also von ›Mediatisierung‹.« (ebd. 227)
Ganzheitlich lernen heißt auch, dass Leben nicht in das Schulleben und das Leben außerhalb der Schule zu gliedern, Schulgegenstände scharf abzugrenzen, sondern das Erleben der Kinder in der Schule wahrzunehmen, Lernorte auch außerhalb der Schule zu suchen, die Schule zu öffnen (= bridging). Und auch das Fehlermachen gehört zu den wirklichen Erfahrungen, diese nicht zu verschleiern und sanktionieren, sondern Fehler als Lernpotential und -chance zu nützen - wie eben im Leben auch.
»Eine Brücke zwischen der kleinen und der großen Welt« (ebd. 228)
Die Schule hat eine Brückenfunktion zwischen dem Leben des kleinen Kindes in der Familie und dem Leben als Erwachsener in der Gesellschaft und ist in sich selbst gestuft, wobei jede Stufung mit der Erweiterung von Lebenshorizont, Lern- und Arbeitsformen einhergeht, die Aufgaben komplexer werden, Verantwortung und Freiheit zunehmen.
»Die Schule bleibt eine Schule« (ebd. 231)
Auch wenn die Schule eine Lebensschule sein soll, bleibt sie dennoch der Ort, an dem junge Menschen wichtige Kenntnisse erwerben, Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen und üben, auf das Leben danach vorbereitet werden. Sie unterstützt Schüler bei der Ausbildung jener Fähigkeiten, die sie für zukünftige Berufsaus- oder Weiterbildungen brauchen, hilft, realistische Einschätzungen zu entwickeln, hilft Jugendlichen bei ihrer Lebensplanung.
»Soft learning« (ebd. 162), aber auch Unterrichtskonzepte, die den Kindern »(...) die Besinnung nehmen mit den pausenlos Spaß machenden, weltrettenden, gemeinschaftsfördernden, phantasieanregenden, kind- oder jugendgemäßen Projekten« (ebd. 217) sind für ihn keine Antworten auf die Schwierigkeiten der Schule, eher Verschleierungen. Lernen ist nicht nur Spaß, Schule heißt auch, sich an vereinbarte Regeln zu halten, Kompromisse einzugehen, sich anzustrengen, heißt nicht nur das zu tun, was man will, sondern verlangt auch Disziplin von Kindern und Jugendlichen - untergeordnet unter die Maxime, die von Hentig 1985 formuliert hat: »Die Menschen stärken, die Sachen klären.« (1985)
Eine Schule, in welcher diese Grundsätze und Vorstellungen umgesetzt werden, müsste eigentlich ein Modell für Inklusion im Kleinen sein. Und so ist es denn auch nur konsequent, dass die Laborschule Bielefeld eine integrative Regelschule ist, eine Schule ohne Aussonderung, die vor allem Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache und Verhalten beschult.[24] (Vgl. Demmer-Dieckmann 2001)
Die von Georg Feuser formulierten Anforderungen an eine »basale Pädagogik« sind in den pädagogischen Leitlinien enthalten und werden seit 25 Jahren in die Praxis umgesetzt. Es gibt keine Selektion nach Leistung und keine Aussonderung, mit Unterschieden leben zu lernen, gemeinsame Regeln auszuhandeln und zu achten und dabei Toleranz einzuüben, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Schule als Polis.
Hartmut von Hentigs Kritik an der Regelschule ist ähnlich radikal und fundamental wie die Georg Feusers. Solange die Regelschule über die Benotung den gesellschaftlichen Auftrag der Zuteilung von Bildungs- und damit Lebenschancen erfüllt, ist ihr Grundprinzip Konkurrenz. Auf dieser Grundlage kann Schule dem pädagogischen Auftrag, nämlich Menschen zu stärken, nicht nachkommen. Das Einüben von Toleranz, die Rücksichtnahme auf Andere, Kooperation, das Verständnis und die Berücksichtigung von Fragen des Gemeinwesens rücken in den Hintergrund, sind höchstens zweitrangig.
Der ›politische‹ Auftrag an die Schule, nämlich über das Leben in der polis im Kleinen mündig zu werden für die Demokratie im Großen, wird durch ›kosmetische‹ Veränderungen der Schulwirklichkeit nicht eingelöst. So ist es nicht überraschend, dass sich Hentig ausgesprochen kritisch gegen alle didaktischen Finessen stellt, die sich »die rationalistische Didaktik der verkopften Schule« (von Hentig 1993, 162) als Hauptfeind ausgesucht hat. Eine Reihe von Methoden aus dem didaktischen Supermarkt, als »soft learning« bezeichnet, verschleiern höchstens den Widerspruch, in welchem sich die Pädagogik seit langem befindet: nämlich sich der Frage zu stellen, ob sie einem pädagogischen Auftrag im Sinne des Bildungsbegriffes folgt, der auch emanzipatorischen Charakter hätte oder aber dem Ruf nach gesellschaftlich-ökonomisch-kurzfristiger Verwertbarkeit mit höchstem individuellen Nutzen für eine kleine Gruppe und der Konservierung gesellschaftlicher Strukturen.
Die in diesem Kapitel vorgestellten, jetztzeitigen (prominenten) Positionen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Erkenntnisperspektiven können alle als überzeugende Argumente/Belege für eine Neudefinition und Veränderung schulischen Lernens herangezogen werden. Sie begründen eine Erweiterung von Unterrichtsformen und -strukturen nicht allein aus der Perspektive von Inklusion - Inklusion wird in den meisten der vorgestellten Positionen gar nicht eigens erwähnt -, sondern allgemein auf der Basis von Erkenntnissen über das Lernen und das Lernen im System der Schule. Lernen wird von allen - wenn auch mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten - als individueller, eigenaktiver und selbstgesteuerter Konstruktionsprozess im Dialog mit der sozialen und dinglichen Umwelt verstanden. Daraus muss abgeleitet werden, dass homogene Gruppen von Lernern ein Artefakt sind und schulisches Lernen, das von dieser Konstruktion ausgeht, den SchülerInnen in ihren individuellen Lernmustern und Zugängen zum Verstehen nicht entsprechen kann. Gemeinsam ist allen vorgestellten Positionen, dass Lernen heute mehr und anderes sein muss als rezeptive Wissensaneignung, denn als Wissensspeicher sind die technischen Medien den menschlichen Gehirnen bereits jetzt überlegen: Ziel ist ein Verstehen von Zusammenhängen, sowohl in der Welt der Objekte als auch in der Welt der Personen, und die Möglichkeit, in diese Zusammenhänge einzugreifen, gesellschaftlich zu partizipieren. Die Staatsschule wird von allen kritisiert, teilweise äußerst vehement, da sie noch immer zum größten Teil mit Vermittlungsformen operiert, die neuen Erkenntnissen von Lernen widersprechen, sogar diametral entgegenstehen. Schulisches Lernen, so die gemeinsame Kritik, wird noch immer missverstanden als Transport von Wissen von einer Person zur andern. Die Pädagogik, vor allem die pädagogische Praxis, negiert hartnäckig mittlerweile unumstrittene Erkenntnisse aus der Neurobiologie. Und auch längst anerkannte und in der Lehrerbildung rezipierte Theorien wie etwa die Piagets, der Lernen seit langem als individuellen Konstruktionsprozess beschreibt, warten noch immer auf eine Umsetzung in der Schule.
Insgesamt geht es in den vorgestellten Positionen jedoch nicht ausschließlich darum, wie Lernen mit größtmöglicher Effizienz erzielt und gesellschaftlich individuell im Sinne bester Berufschancen ökonomisch verwertet werden kann, sondern auch um Fragen des gesellschaftlichen Miteinander und im weiteren Sinne um ko-evolutionäre, ökologische Aspekte von Lernen und Erziehung, um jene Kompetenzen also, die langfristig ein Überleben der Menschheit sichern sollen - um den Begriff der Bildung. Nicht nur ökonomisch verwertbare Schlüsselqualifikationen wie Zeitmanagement, Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit werden gefordert, sondern auch kritische Urteilsfähigkeit, Widerstand, vor allem aber Respekt und Toleranz vor dem Anderen, das Einüben von Demokratie. Diese Haltungen können nicht gelehrt, sondern nur im alltäglichen Umgang miteinander erfahren und reflektiert werden. Die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum (polis) wird der heutigen Schule als Institution zur Wissensvermittlung und zur gesellschaftlichen Chancenzuteilung gegenübergestellt (von Hentig). In einer anderen Terminologie, jedoch mit ähnlichen Zielen, stellt Gardner das Intelligenzkonzept in Frage, das den gesamten Bereich des sozialen Verhaltens und der Kreativität ausblendet zugunsten einer Reduktion intelligenten Verhaltens hauptsächlich auf ökonomisch verwertbare mathematisch-technische und sprachliche Kompetenzen. Dadurch werden ganze Gruppen von Kindern ausgegrenzt, deren Intelligenzprofile nicht jenen der in der Regelschule erwarteten und geförderten entsprechen, Stärken und Ressourcen in den anderen Bereichen zu wenig wahrgenommen, wertgeschätzt und deren Entwicklung nicht unterstützt.
Die reformpädagogischen Konzepte, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entwickelt worden sind, zeigen - wenn auch in sehr unterschiedlicher Ausprägung - in weiten Bereichen große Überlappungen mit den theoretisch formulierten Ansprüchen aus heutiger systemisch-konstruktivistischer Sicht. Didaktische Maßnahmen, die heute unter dem Sammelbegriff schülerzentrierter Unterricht zusammengefasst werden, entsprechen jedoch nicht immer den Ansprüchen der Reformpädagogen und auch nicht den Kriterien, die in den theoretischen Positionen der Gegenwart formuliert werden, deren wichtigste Ziele Selbst- und Mitbestimmung, Eigenverantwortung und Eigenständigkeit auch im Sinne von Emanzipation sind. Gegen eine oberflächliche Verwendung dieser Begriffe im Zusammenhang mit kindorientiertem Unterricht und schülerzentrierter Didaktik argumentieren vor allem von Hentig und Feuser, die darin häufig keine Veränderung, sondern nur eine subtile Verschleierung der ›herrschenden‹ Verhältnisse sehen.
Lernen auf der Basis der in diesem Kapitel vorgestellten Positionen verlangt eine Neudefinition des Lehrer-Schüler-Verhältnisses und der Bewertungs- und Beurteilungskriterien. Schulen, die über das Disziplinierungsmittel Ziffernbeurteilung die gesellschaftliche Selektionsaufgabe nicht in Frage stellen, stellen sich letztlich gegen eine pädagogische Schule, deren Ziel die Stärkung von Menschen und das Verstehen von Zusammenhängen sein könnten, weil Lernprozesse einer andauernden Bewertung ausgesetzt werden. Dies führt dazu, dass eigenständige Suchbewegungen, das Ausprobieren und Verwerfen von Hypothesen und Lösungsversuchen verhindert werden, weil Fehler nicht als Lernchance, sondern als negative Bewertungsgrundlage dienen.
Trotz der theoretisch radikal formulierten Kritik an der schulischen Praxis wird deutlich gemacht, dass eine Veränderung nur in kleinen Schritten, in grundsätzlicher Übereinstimmung mit allen Systempartnern, erreicht werden kann, weil Veränderungen für alle ›viabel‹ (anschlussfähig) sein müssen. Nicht eine völlige Neukonzeption von Schule und Unterricht wird vorgeschlagen, sondern eine Erweiterung und Veränderung - auch wenn die Vision eine andere wäre. Die Spielräume auszunützen und zu vergrößern ist eine realistische Perspektiveauf das Machbare.
Sämtliche der vorgestellten Positionen können zur Begründung von Inklusion
herangezogen werden.
[14] Im personenzentrierten Ansatz der Psychotherapie wird der Kontakt zu einer Person über ihr subjektives
Erleben als ausgesprochen wichtig und wirksam bezeichnet, vgl. Kapitel 4, 4.7.2.1
[15] Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Methoden, die Hentig als ›soft learning‹ bezeichnet, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Mir geht es an dieser Stelle ausschließlich darum, aufzuzeigen, wie unterschiedlich der Begriff der Ganzheitlichkeit verwendet wird.
[16] Vgl. hiezu auch: Roth, G: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a.Main 1997
[17] vgl. zur Einführung in den »radikalen Konstruktivismus«, von Glasersfeld 1987.
[18] Z. B. NZZ-Folie von August 2001, vgl. auch Balhorn/Brügelmann (Hrsg): Bedeutungen erfinden - im Kopf, mit Schrift und miteinander. Lesen und Schreiben als individuelle und soziale Konstruktion von Wirklichkeiten. DGLS-Jahrbuch »Lesen und Schreiben«, Bd. 5, Konstanz 1993
[19] Ich formuliere die Kritik an offenen Formen deshalb, weil ich der Meinung bin, dass aus meiner Sicht ›falsch‹ verstandene Formen von Offenheit Innovation nicht unterstützen, sondern dem traditionellen System in die Hände spielen. Dabei meine ich mit ›falsch‹ nur Formen, die letztlich mit den Vorstellungen von Schule aus unterschiedlichster Perspektive - der Eltern, der übernehmenden Schulen - nicht viabel sind. Aus Sicht eines Individuums lassen sich alle nicht erlernten Kulturgüter - zumindest aus der Zeitperspektive des Jetzt - als nicht bedeutungsvoll begründen.
[20] Siehe dazu 4.7 - Förderung von Jugendlichen mit Behinderung in der Sekundarstufe.
[21] Vgl. Jürg Jegge: Dummheit ist lernbar. Bern 1976
[22] Dieses Buch ist zu verstehen als Antwort auf die aktuelle Diskussion um das öffentliche Schulwesen in den USA. Eine Serie von vergleichenden Studien hatte gezeigt, dass amerikanische Schüler im Vergleich zu ihren Alterskameraden in europäischen Ländern, aber auch in China, Japan und anderen asiatischen Ländern durchschnittlich schlechter abschneiden. Diese Studien führten zur Forderung nach einer generellen Verbesserung des US-amerikanischen Schulsystems (vgl. Vorwort, S. 8).
[23] Siehe Punkt 4.8 dieser Arbeit.
[24] Auskunft von Frau Demmer-Dieckmann, e-mail vom 6. 12. 2001, Universität Bielefeld.
Inhaltsverzeichnis
Die Weiterführung der Integrationsklassen nach der Volksschule stellte sich in Vorarlberg zum ersten Mal im Schuljahr 1994/95 mit zwei[25], im darauffolgenden Schuljahr 95/96[26] mit vier und pendelte sich in den nachfolgenden Jahren zwischen 8 und 10 Klassen pro Jahr ein.
Meine Ausführungen in diesem Kapitel wie auch in Kapitel 4 beziehen sich in erster Linie auf die ersten sechs Hauptschulklassen, die 94/95 und 95/96 mit der Hauptschulintegration begannen und die ich im Folgenden als Pionierklassen bezeichne. Die LehrerInnen dieser Klassen waren jene, welche die Herausforderung von etwas gänzlich Neuem[27] annahmen, die sich auf den Weg machten, mit einem Ziel und einer Vision, ohne den Weg genau zu kennen. Sie suchten nach Möglichkeiten und Formen, Vision und Theorie in die Praxis umzusetzen. Dabei orientierten sie sich an den Erfahrungen der Volksschul-Integrationsklassen und an Schulversuchsmodellen aus anderen Bundesländern.
Aufgrund der geringen Klassenanzahl und meiner Stundenressourcen (halbe Lehrverpflichtung für die wissenschaftliche Begleitung) war es möglich, die Pionierklassen umfassend zu begleiten. Die Zusammenarbeit mit den Teams basierte auf einer Vereinbarung, die folgende Aufgabenstellungen für mich beinhaltete:
-
Unterrichtsbeobachtung, vor allem im Hinblick auf sozial-integrative sowie lern- bzw. leistungsorientierte Aspekte;
-
Mitarbeit bei der Entwicklung der Unterrichtsorganisation;
-
Beratungsgespräche mit den beteiligten LehrerInnen (einzeln und im Team);
-
Unterstützung im sonderpädagogischen Bereich (Beobachtung, Erstellung von Förderplänen);
-
Unterstützung der Teams bei der Elternarbeit - auf Wunsch;
-
Dokumentation des Schulversuchs in Form eines Jahresberichtes (Modellbericht) gemeinsam mit den LehrerInnen der Versuchsklassen;
-
Rückmeldung an den Landesschulinspektor für Sonderpädagogik und Integration, welche Konsequenzen die Erfahrungen in den Klassen in personeller, organisatorischer, struktureller und dienstrechtlicher Hinsicht nach sich ziehen;
-
Weitergabe der Erfahrungen an Hauptschulen in Vorarlberg, die sich im Stadium der Modellentwicklung befinden (auf deren Wunsch);
-
Beratung der Pädagogischen Institutionen hinsichtlich der Wünsche und Notwendigkeiten in der Lehreraus- und -fortbildung, die sich aus der Arbeit in den Schulversuchsklassen ergeben. (Vereinbarung 1994)
In diesem Kapitel werde ich die von den Pionierteams entwickelten Ausgangshypothesen, die organisatorischen Veränderungen und die Rahmenbedingungen beschreiben, die diese als Voraussetzung für integrativen Unterricht in der Sekundarstufe betrachteten. Diese Überlegungen basieren auf der Annahme aller Teams, dass die im Hauptschulsystem immanent angelegten segregativen Strukturen verändert werden müssen, um überhaupt Voraussetzungen für integrativen Unterricht zu schaffen.
Datengrundlage dieses Kapitels sind sechs Modellberichte aus dem Jahr 1995/96, die detailliert Entstehungsgeschichte, Teambildung, Ziele, Rahmenbedingungen, Unterrichtsorganisation, Leistungsentwicklung und eine Gesamteinschätzung der LehrerInnen enthalten sowie Protokolle von Klausuren in den darauffolgenden Jahren 96/97, 97/98 und 98/99, die Prozesse, Zäsuren und damit einhergehende Veränderungen dokumentieren. Die Schulen und Aussagen aus den Modellberichten werden mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet, um ein Minimum an Anonymität zu gewährleisten.
An fünf Schulstandorten wechselten die Kinder aus bestehenden Volksschulintegrationsklassen nahezu geschlossen an die Hauptschulen. Nur an einem Standort konnte kein bestehender Klassenverband übernommen werden, die Klasse entstand aus Kindern vier verschiedener Volksschulklassen, die jeweils zum Sprengel der Hauptschule gehörten.
Bis auf eine Schule setzten sich alle späteren Lehrkörper bzw. Teams sehr früh mit dem Gedanken der sozialen Integration behinderter Kinder auseinander, da sie über die VS-Klassen in ihren Sprengeln Bescheid wussten. Vor allem für eine Schule, die HS Bürs, wurde die Integrationsklasse zu einem Ausgangspunkt für eine umfassende Schulentwicklung mit dem Ziel, eine Schule für alle Kinder zu werden, ohne Formen der äußeren Differenzierung und mit Verwendung und Erprobung alternativer Formen der Leistungsbeurteilung. Auch die anderen Schulen sahen die Integrationsklasse als Chance für Schulentwicklung insgesamt, vor allem in Hinblick auf die Erprobung und Einführung neuer Lehr- und Lernformen.
Gemeinsam war allen Pionier-Teams die positive Grundhaltung sowohl zur schulischen als auch zur gesellschaftlichen Integration. Die in den Volksschulen angebahnten sozialen Prozesse sollten auch in der Hauptschule weitergeführt werden, Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollten auch nach der Volksschule in ihrem regionalen Umfeld, im Dorf oder in der Sprengelschule, bleiben können. Sämtliche LehrerInnen der ersten Teams meldeten sich freiwillig zur Mitarbeit an den Schulversuchen, auch wenn bei einzelnen so etwas wie »moralische Verpflichtung«, »Verantwortung«, »moralischer Druck« (Modellbericht F, S. 3) die Entscheidung bis zu einen gewissen Grad mitbeeinflusste.
Auffallend war, dass die Lehrerinnen dieser Teams zum größten Teil sehr erfahren waren, d. h. mehr als zehn Dienstjahre unterrichteten. Die Teams waren offen und neugierig, sich auf Neues einzulassen.
Als wesentliche Motive zur Mitarbeit am Schulversuch nannten die LehrerInnen neben dem eigentlichen Ziel, der sozialen Integration von Kindern mit Behinderung, den Reiz am Neuen, den Wunsch nach einer humaneren, menschlicheren Schule, die Überzeugung, dass Integration für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sinnvoll sei und die Herausforderung ›Heraus aus der Routine‹.
Alle sechs Teams führten in den Schulversuchsbeschreibungen zwei wesentliche Ziele an:
-
Fortführung der sozial-integrativen Prozesse, die in der Volksschule begonnen wurden und
-
Erprobung ›neuer‹ Lehr- und Lernformen, Öffnung des Unterrichts, Erweiterung des Unterrichts mit sog. schülerzentrierten Lernformen, die individuelles Lernen ermöglichen.
Integrativer Unterricht aus der Perspektive der Praxis heißt, den Unterricht so zu gestalten, dass Kinder mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen, Kinder auf unterschiedlichsten Entwicklungsniveaus sowohl im kognitiven als auch im emotional-sozialen Bereich in einer Gruppe gemeinsam lernen. Es bedeutet für LehrerInnen, die Lernumwelt so zu gestalten, dass alle die sich daraus ergebenden Lernbedürfnisse berücksichtigt werden können, dass alle Kinder Lernmöglichkeiten vorfinden, die ihren Lernvoraussetzungen und Lernniveaus, ihren Interessen und Neigungen entsprechen und gleichzeitig den gesellschaftlichen Auftrag der Regelschulen nicht aus den Augen zu verlieren. Dieser wird auf verschiedenen Ebenen festgeschrieben, in der Schulgesetzgebung (SchOG) als allgemeine Zieldefinition, in den Lehrplänen u. a. als Vorgabe von Inhalten und Lernzielen für die einzelnen Fächer.[28] Daneben wirken wenig präzise definierbare Erwartungen, Erwartungen von Eltern, Stoffvorgaben durch Lehrbücher, der öffentliche Diskurs, Erwartungen weiterführender Schulen, die das Spannungsfeld Unterricht charakterisieren.
Die pädagogische Konzeption der Volksschule beruht u. a. auf dem Klassenlehrerprinzip und dem Prinzip des ›Gesamtunterrichts‹. Dieser Begriff, auch wenn er unpräzise und theoretisch überholt ist (vgl. Drews u.a. 2000, 199), wird in der Praxis noch immer verwendet und meint, dass Lerninhalte nicht in engen Fachgrenzen und Zeitstrukturen angeboten werden sollen und müssen. Die mit diesen Prinzipien verbundenen Rahmenbedingungen bieten in der Volksschule sehr viel Freiraum für verschiedenste Unterrichtskonzeptionen, vor allem aber Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung von Zeitstrukturen. Längerfristiges Arbeiten an einem Thema - unabhängig ob schüler- oder lehrerzentriert - fächerverbindendes, handlungsorientiertes, vernetztes oder auch ganzheitliches Arbeiten verbunden mit Lehrausgängen - sollte selbstverständlich sein und ist an und für sich das konstituierende Element des Grundschulunterrichts. In den Volksschulen Vorarlbergs ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren vieles in Bewegung geraten. Wochenplanarbeit und freie Lernphasen, individualisiertes Lernen - wie ja schon seit 1986 im Lehrplan der Volksschulen gefordert - sind immer häufiger anzutreffen, keineswegs nur in Integrationsklassen. Allerdings hat die Integrationsbewegung diese Tendenz sicherlich verstärkt. Hinzu kommt eine starke Montessori-Bewegung, die nicht zuletzt durch die seit mehreren Jahren möglichen Ausbildungslehrgänge, die von engagierten LehrerInnen initiiert wurden und vom Land Vorarlberg und dem Pädagogischen Institut mitfinanziert werden, entstanden ist. Die starke Rezeption der Montessori- Pädagogik sehe ich als Indikator für die Suche nach befriedigenderen Unterrichtsformen, für die Hinwendung zu einer stärker an den Voraussetzungen und Bedürfnissen der SchülerInnen orientierten Schule.
Im Unterschied zum System der Volksschule ist das Hauptschulsystem durch sehr starre Grenzen charakterisiert: Das Klassenlehrersystem der Volksschule wird durch das Fachlehrersystem abgelöst, was für die Kinder sowohl zeitliche als auch inhaltliche Segmentierung des Schulalltags bedeutet - Lernen im 50-Minuten-Zeittakt. Eine weitere Segmentierung erfolgt durch die Organisation des Unterrichts im Leistungsgruppensystem: Alle SchülerInnen einer Jahrgangsstufe werden in Mathematik, Deutsch und der Lebenden Fremdsprache Englisch zusammengefasst und in drei möglichst homogene Leistungsgruppen eingeteilt. Der Unterricht in diesen Leistungsgruppen umfasst - je nach Schulstufe und autonomen Standortentscheidungen 12 bis 15 Unterrichtsstunden pro Woche - und erfolgt räumlich getrennt. Innerhalb dieser Strukturen ist es nahezu unmöglich, die integralen Elemente eines schülerzentrierten Unterrichts auch nur ansatzweise durchzusetzen.
Der Schulversuch der Integration, der Heterogenität zur Voraussetzung hat, bietet den Lehrerteams die Möglichkeit, die äußere Differenzierung durch Leistungsgruppen und mitunter auch die durch Fächergrenzen vorgegebenen Einschränkungen zu überwinden, bzw. ›weichere‹, fließendere Formen zu entwickeln und auszuprobieren.
Zurück zum Klassenverband
Die Überlegungen, wie integrativer bzw. schülerzentrierter, individualisierender, offener Unterricht im Hauptschulsystem verwirklicht werden könnte, führt bei allen Teams dazu, von einem Klassenverband, einer Klasse, aus zu denken (ähnlich wie in der Volksschule) - ohne permanenten Wechsel von Räumen und Gruppenzusammensetzungen mit SchülerInnen aus Parallelklassen. Innerhalb dieses Klassenverbandes sollen dann unterschiedlichste Formen der Binnendifferenzierung erprobt werden (siehe Kapitel 4). Auf der Ebene des Klassenverbandes, abgekoppelt und unabhängig von Parallelklassen, ist es organisatorisch einfacher, die Zeitstruktur der 50 Min.-Einheiten zu überwinden, was als eine notwendige Voraussetzung für die erweiterten Unterrichtsformen gilt. Eine nicht andauernd wechselnde Gruppe - wie dies das Leistungsgruppensystem der Hauptschule nach sich zieht - soll außerdem positive Auswirkungen auf das soziale Lernen haben sowie die personale Entwicklung der SchülerInnen positiv unterstützen, vor allem durch die Reduktion der Anzahl der Bezugspersonen und auch durch eine ›räumliche Beheimatung‹ in einem Klassenraum. Der ständige Wechsel der Räume als Folge der Leistungsgruppenorganisation entfällt dadurch und macht es den LehrerInnen bedeutend einfacher, Lernumgebungen zu gestalten, vielfältige Materialien bereitzustellen als Voraussetzung zu selbständigem Arbeiten in Anlehnung an die Vorstellung einer vorbereiteten Umgebung oder auch an die Ateliers der Freinet-Pädagogik. Die Organisation des Lernens innerhalb eines Klassenverbandes ohne Formen der äußeren Differenzierung und Zersplitterung ist im Übrigen auch in den anderen Formen der Sekundarstufe, im Gymnasium wie auch in der Allgemeinen Sonderschule, bestimmendes Strukturmerkmal.
Leistungsgruppen ohne äußere Differenzierung
Bis auf einen Schulstandort wird dennoch an der Einteilung der Hauptschulkinder in Leistungsgruppen festgehalten und damit im Wesentlichen auch am Denkkonstrukt von relativ homogenen Lerngruppen - jedoch mit einem ganz entscheidenden Unterschied zum Hauptschulsystem: dem Verzicht auf die äußere Differenzierung in Leistungsgruppen. Die Kinder werden also nicht in ›homogene‹ Gruppen zusammengefasst, die eine bestimmte Anzahl von Stunden die Klasse verlassen und in einer anderen Gruppe lernen, sondern sollen ihrem Niveau entsprechend in wechselnden Gruppenzusammensetzungen und Sozialformen innerhalb des Klassenverbandes lernen. Die Einteilung der Schüler in Leistungsgruppen hat vor allem die Funktion, die Anforderungen an einzelne Kinder zu regulieren, d. h. Schwierigkeitsgrade bei Lernaufgaben zu erhöhen bzw. zu vermindern und eine größere Bandbreite bei der Benotung zu ermöglichen. Solange an der Leistungsbeurteilung durch Ziffern festgehalten wird, bieten Leistungsgruppen die Möglichkeit, drei unterschiedliche Bezugsnormen - so widersprüchlich das ist - zu definieren und damit vor allem leistungsschwächere Kinder nach einer anderen Bezugsnorm zu beurteilen (vgl. Kapitel 4.8). In der Praxis bedeutet dies, dass leistungsschwächere Kinder nicht mit den leistungsstarken Schülern verglichen werden müssen, dadurch die Möglichkeit erhalten, auch gute Noten zu bekommen und nicht ständig mit Misserfolgsrückmeldungen über Noten konfrontiert werden. Auch wenn diese Argumentation theoretisch mehr als nur fragwürdig ist, sollte bei einer Be- und möglichen Abwertung aus theoretischer Perspektive berücksichtigt werden, dass eine bildungspolitische Diskussion über Leistung (und Bildung) insgesamt und Formen der Leistungsfeststellung und -beurteilung schon längst grundsätzlich geführt werden müsste und weder auf die Integrationspädagogik noch auf die Ebene einzelner Teams verlagert bzw. abgeschoben werden soll und darf.[29] (Vgl. von Hentig 1993, Gronemeyer 1996)
Die dargestellte Ausgangskonzeption widerspricht zwar der Theorie eines radikal vom Subjekt ausgehenden Lernens, die auf Kategorisierungen verzichtet, ist jedoch aus meiner Sicht ein ehrlicher Kompromiss zwischen den über den Lehrplan verordneten gesellschaftlichen Ansprüchen, den von LehrerInnen internalisierten und vorgestellten Erwartungen an den Leistungsnachweis nach vier Jahren Hauptschule, dem Bild des ›guten‹ Lehrers und dem Wunsch nach Berücksichtigung der individuellen Lernprozesse und Interessen eines Kindes. Selbstverständlich widerspiegelt sich in dieser Entscheidung auch eine theoretische Verortung der Teams, deren Selbstverständnis von Lernen, Unterricht und Bildung. Je nach Standpunkt kann man diese Konzeption als Reproduktion des segregativen Systems oder auch als Driften zwischen den Ansprüchen verschiedener Systeme (Schüler - Lehrer, Schule - Eltern) interpretieren, das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis wird jedenfalls an dieser Stelle deutlich sichtbar.
Ich halte den Verzicht auf äußere Differenzierung durch Leistungsgruppen und damit verbunden die mögliche Aufhebung der relativ starren Gruppenbildungen für einen wichtigen und keineswegs selbstverständlichen Schritt bei der Überwindung der segregativen Strukturen des Sekundarstufensystems und für eine notwendige Voraussetzungen für gemeinsames Lernen, auch wenn er, gemessen an theoretischen Erkenntnissen und Visionen, nur sehr gering scheinen mag. Nicht das Tempo und die Größe der Schritte ist für mich entscheidend, sondern das Sich-auf-den-Weg-Machen an sich, mit der Theorie als Orientierungshilfe. Die Entscheidung aller Teams zugunsten innerer Differenzierung schafft jedenfalls einen großen Freiraum, mit vielfältigen und je nach Thema unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen zu arbeiten. In offenen Strukturen können SchülerInnen ihre Lernpartner vielfach ohnehin selbst auswählen, in lehrerzentriert organisiertem Unterricht können Gruppen vielfältig zusammengestellt werden. Ob und wie der Freiraum genützt, vergrößert oder verkleinert wird, ob Gruppen flexibel eingeteilt werden oder ob sich wiederum klar definierte ›homogene‹ Gruppen mit der Tendenz zur Zusammenfassung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf entwickeln, hängt von vielen Faktoren ab: dem Selbstverständnis des Teams, den Erfahrungen mit der veränderten Struktur, der Bereitschaft und Möglichkeit der LehrerInnen zur Zusammenarbeit, dem Mut und Wunsch nach Veränderung, den Erwartungen der Eltern, den personellen Ressourcen einer Schule u. a. m. Als organisatorischer Rahmen für eine mögliche Entwicklung in Richtung integrative Pädagogik ist diese Ausgangskonzeption jedenfalls eine gute Voraussetzung.
Kleines Lehrerteam - Klassenlehrerprinzip versus Fachlehrerprinzip
Als notwendige Voraussetzung für das Gelingen integrativen Unterrichts wurde von allen ein möglichst kleines Lehrerteam angenommen. In der Regel unterrichten weit mehr als zehn LehrerInnen in einer Hauptschulklasse.[30] Bei gemeinsamen Lernvorhaben, wie etwa Projektunterricht, sind allein schon neun LehrerInnen über die Leistungsgruppenstruktur zu koordinieren (je drei LehrerInnen in Mathematik, Deutsch und Englisch), zusätzlich LehrerInnen der Realien und der kreativen Fächer. Ausgangshypothese war, dass in kleinen LehrerInnen-Teams Kommunikation untereinander einfacher sei und dass fächerverbindende, fächerübergreifende und projektorientierte Formen des Unterrichts leichter zu koordinieren und in der Praxis umzusetzen seien. Kleine Lehrerteams bedeuten zudem mehr zeitliche Präsenz in der Klasse, was sich sowohl auf die Schüler-Lehrer-Beziehung positiv auswirken sollte, aber auch stundenplantechnisch dazu führt, dass sich die HS-LehrerInnen nicht ständig nach 50 Minuten die Türklinke in die Hand drücken. Nicht nur der Sonderpädagoge sollte die Rolle des Klassenlehrers und Koordinators übernehmen, sondern durch größtmögliche Präsenz in der Klasse sollten sich alle gleichermaßen für die integrativen Prozesse verantwortlich fühlen.
Die Bildung möglichst kleiner Teams gehört meiner Meinung nach wohl zu den wichtigsten organisatorischen Weichenstellungen. In der Praxis der Pionierklassen bestehen die Teams aus drei bis vier HS-LehrerInnen - je einem geprüften Fachlehrer in Deutsch, Mathematik und Englisch mit ihren jeweiligen Zweitfächern - und dem Sonderpädagogen. Dieses Team versucht nun, so viele Fächer bzw. Stunden wie möglich in der Klasse abzudecken. Damit verbunden ist jedoch zumindest teilweise der Verzicht auf ausgebildete FachlehrerInnen, d. h. es erfolgt tendenziell eine Verschiebung vom Fachlehrerprinzip hin zu einer stärkeren Gewichtung des Klassenlehrerprinzips. In mehreren Teams befinden sich zwar LehrerInnen, die bereits Lehramtsprüfungen in Zusatzfächern erworben hatten, weil sie die Segmentierung durch Fachgrenzen auch ohne Integration aufzuweichen versuchten.
Das Fächersystem hat sich in der Moderne, an der Wende vom 18. zum 19. Jh., ausdifferenziert in der Annahme, durch Spezialisierung sei eine höhere Effektivität zu erreichen, was notwendig mit einer gewissen Trennung vom Erziehungssystem einhergegangen ist. (Vgl. Huschke-Rhein 1999, 34) Das Unbehagen und die Kritik an der historisch gewachsenen Gliederung in Fächer ist keineswegs zeitgeistig, sondern hat eine lange Tradition. (Vgl. Hehlmann 1971, 146) Dennoch ist dieses Konzept an den staatlichen Schulen bis heute fest verankert, manifestiert sich in den Lehrplänen und vor allem in der Organisation der Lehrerbildung, welche die Fächerung permanent reproduziert.
Die Verschiebung in Richtung kleines Team (Kernteam) spiegelt die unterschiedliche Gewichtung in der Sicht auf Schule und Lernen: Unterricht, im Sinne von zielgerichtetem Lernen und Erziehung im Sinne von sozial/personaler Entwicklung gelten als gleichrangige Aufgaben. Es geht nicht nur um die Vermittlung und den Erwerb von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen einer Allgemeinbildung, sondern auch um die Bildung der Gesamtpersönlichkeit und die Entwicklung und Entfaltung sozialer, ethischer und kultureller Wertvorstellungen und Handlungsweisen. Während die Fachdidaktik verstärkt auf das Vermitteln von Fachwissen setzt, betont ein kleines Team stärker den Aspekt der Menschenbildung und des sozialen Lernens. In den Schulversuchsbeschreibungen der Pionierteams finden sich diese Überlegungen unter dem Aspekt des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen wieder.
Für integrativen Unterricht sind zunächst die Rahmenbedingungen entscheidend. Eine der wohl wichtigsten Rahmenbedingungen ist die Klassenzusammensetzung: Wie ist das Verhältnis von Kindern mit SPF[31] zu HS-Kindern? Wie ist die Zusammensetzung der Kinder mit SPF - wieviel individuelle Unterstützung brauchen sie, in welchen Bereichen sind sie nicht auf besondere Hilfe angewiesen? Nicht minder bedeutend ist jedoch die Frage der Zusammensetzung der HS-Kinder: Ist die Gruppe tatsächlich heterogen zusammengesetzt, sind auch leistungsstarke Schüler in der Klasse oder aber wird die Klasse als ›Auffangstation‹ für Kinder gesehen, die in irgendeinem Bereich Schwierigkeiten zu erwarten haben? In engem Zusammenhang mit der Klassenzusammensetzung steht die Frage, wieviele Stunden einem Lehrerteam für die innere Differenzierung zur Verfügung gestellt werden. Stehen genügend Stunden zur Verfügung, um den unterschiedlichsten Leistungsniveaus gerecht zu werden?
Für die tägliche Praxis nicht unwichtig ist die Frage nach der Raumsituation. Es ist für jemanden aus der Praxis unschwer vorstellbar, dass der Unterricht mit so unterschiedlichen Leistungsniveaus und auch Lernbedürfnissen nicht ständig in einem 9 x 9 m Raum stattfinden kann. Generell kann man sagen, dass offene Lehr- und Lernformen mehr Raum benötigen als Frontalunterricht: Raum für Bewegung, Raum für die Arbeit in verschiedenen Sozialformen, aber auch Raum für die Präsentation von Arbeitsmaterialien. Auch lehrerzentrierter Unterricht in verschiedenen Gruppen - gesamter Klassenverband, Kleingruppen - wird durch ein günstiges Raumangebot erheblich erleichtert. Raumgestaltung und Raumatmosphäre können und sollen animieren, zum Bleiben auffordern oder auch das Bedürfnis wecken, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen. Was für Räume allgemein gilt, gilt auch für die Klassengestaltung - auch wenn es scheint, als ob dieses Wissen vor den Türen vieler Schulen Halt gemacht hätte.
Selbstgesteuertes Lernen setzt entsprechende Arbeitsmittel voraus. Der Lehrer als allwissendes Lexikon muss ersetzt werden durch andere Medien, seine Aufgabe wäre die des Anregens und Begleitens von Lernprozessen. Stehen den LehrerInnen genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung, diese Arbeitsmittel zu beschaffen oder wird von ihnen erwartet, alles selbst zur Verfügung zu stellen bzw. mit hohem Zeitaufwand herzustellen?
Aus Untersuchungen aus der Volksschule wissen wir, dass die Teamzusammensetzung einen entscheidenden Einfluss auf das Gelingen der Integration hat. (Vgl. Specht 1993) Es kommt dabei jedoch weniger auf äußere Faktoren wie Teamgröße oder -zusammensetzung an, als vielmehr auf ähnliche Vorstellung, was Lernen überhaupt ist, auf ähnliche Ziele, auf Grundhaltungen und die Offenheit, Differenzen anzusprechen und Anders-Sein auch auf der Ebene des Lehrerteams zuzulassen und zu respektieren.
Strukturelle Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für integrativen Unterricht, jedoch kein Qualitätskriterium an sich. Gute Rahmenbedingungen allein führen nicht zwingend zu einer qualitativen Verbesserung von Unterricht, fehlende Rahmenbedingungen jedoch verhindern bzw. hemmen die Umsetzung innovativer Unterrichtskonzepte. Aus diesem Grund werde ich im Folgenden die äußeren Faktoren, die Strukturen, innerhalb derer die Pionierklassen gearbeitet haben, genau beschreiben. Auf dieser Basis können schließlich Vergleiche angestellt werden, ob und vor allem wie sich die Rahmenbedingungen nach der Übernahme der Integrationsklassen ins Regelschulsystem verändert haben.
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Klassenzusammensetzung in den ersten sechs HS-Integrationsklassen. Als ausgesprochen positives Signal der Eltern an die HS-Teams ist zu werten, dass trotz ausgestellter AHS-Reife viele SchülerInnen bzw. deren Eltern die Integrationsklasse an Hauptschulstandorten bevorzugten, sodass große Kerngruppen aus den Volksschulklassen übernommen werden konnten und alle Klassen wirklich als leistungsheterogen zu bezeichnen sind, mit dem gesamten Spektrum an Leistungsbreite: von sog. ›SpitzenschülerInnen‹ bis zu Kindern mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf. Während im Durchschnitt in Vorarlberg etwa 25 % der VolksschülerInnen in ein Gymnasium wechseln[32], waren es bei den Integrationsklassen nur ein bis drei Kinder pro Klasse, das entspricht einem Prozentsatz von 10 bis 15 %. Auch die Zusammensetzung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf war keineswegs homogen: Kinder auf unterschiedlichsten Entwicklungsniveaus besuchten die Integrationsklassen, von solchen mit Teilleistungsschwächen in einem Fach bis hin zu schwer mehrfachbehinderten Kindern. Nur in einer Pionierklasse wurde kein Kind nach dem Lehrplan für schwerstbehinderte Kinder unterrichtet.
|
Schule |
Kinder gesamt |
Kinder mit SPF insgesamt |
ASO-Lehrplan |
S- Lehrplan |
|
A Kirchdorf |
19 |
6 |
4 |
2 |
|
B Egg |
23 |
4 |
1 |
3 |
|
C Bürs |
20 |
5 |
2 |
3 |
|
D Dornbirn |
18 |
4 |
2 |
2 |
|
E Bezau |
21 |
4 |
3 |
1 |
|
F Schwarzach |
22 |
4 |
4 |
0 (2)[a] |
|
123 |
27 |
16 |
11 |
|
|
[a] Die Modellentwicklung erfolgte unter der Annahme, dass auch zwei Kinder mit schweren Behinderungen der Klasse angehören, was jedoch zu Schuljahresbeginn nicht mehr den Fakten entsprach. Trotz des Bemühens aller Beteiligten (Lehrpersonen, Schulbehörde, Direktion) konnte ein Kind nicht mehr zum Schulbesuch motiviert werden und verblieb im häuslichen Unterricht. Für ein anderes Kind bot die Landessonderschule Mäder für körperbehinderte Kinder aus verschiedenen Gründen die wesentlich besseren Rahmenbedingungen, die in der Hauptschule unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich gewesen wären. |
||||
Die Schülerzusammensetzung entsprach im Wesentlichen den Schulversuchsbedingungen in den Volksschulen mit dem Richtwert 16 + 4 (16 VS-Kinder + 4 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf). Durchschnittliche Schülerzahl in den Pionierklassen war 20,5, die der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 4,5. Heute, 7 Jahre danach, erscheinen diese Klassenzusammensetzungen geradezu paradiesisch. 6 Kinder mit SPF dürften der Schnitt sein (vgl. Kapitel 6).
Die Schulversuchsklassen erhielten neben dem Stundenkontingent für eine Hauptschulklasse ein Kontingent an sonderpädagogischen Stunden zugeteilt. Im ersten Jahr der Schulversuche setzte sich dieses wie folgt zusammen: 5,5 Stunden pro Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf und zusätzlich 15 Stunden, im zweiten Jahr reduzierte sich dieses zusätzliche Stundenkontingent auf ca. 10 Stunden. Auf eine Differenzierung nach Behinderungsart bzw. verwendetem Lehrplan wird von Seiten der Schulbehörde mit dem Argument verzichtet, dass keines von beiden sichere Aussagen über Betreuungsintensität bzw. -aufwand zulasse.
Je nach Schulstandort erhielten die Teams zusätzliche Stunden aus dem Hauptschulkontingent für leistungsdifferenzierten Unterricht. Ob den Integrationsteams aus diesem Posten anteilsmäßig Stunden zur Verfügung gestellt werden oder nicht, ist von Anfang an bis heute ein Punkt der Auseinandersetzung geblieben. Stunden für leistungsdifferenzierten Unterricht ergeben sich dadurch, dass in den Hauptschulen pro Hauptfach mehr Leistungsgruppen geführt werden können als Jahrgangsklassen existieren. Zum besseren Verständnis ein Beispiel: In einer Hauptschule mit 3 Parallelklassen werden je Hauptfach vier Leistungsgruppen geführt (jedoch nur drei Niveaus, also Leistungsgruppe 1, 2 und 3). Welche Leistungsgruppe doppelt geführt wird, hängt von der Einstufung der Kinder ab. Wenn nun die Integrationsklasse aus dem System der äußeren Differenzierung zur inneren Differenzierung wechselt, müssen für zwei Klassen trotzdem drei Leistungsgruppen pro Fach geführt werden, d. h. die leistungsdifferenzierten Stunden sind bereits gebunden/verbraucht. Fordern Integrationsteams dennoch Stunden aus diesem Kontingent, müssen sie aus dem frei verfügbaren Stundenkontingent der Hauptschule genommen werden und belasten, wiederum von Standort zu Standort unterschiedlich, das Angebot an Freifächern oder unverbindlichen Übungen. Je nach Standort, Haltung der Teams und der Direktion wurden diese Stunden selbstverständlich zur Verfügung gestellt, an anderen Standorten wanderte keine einzige Stunde zusätzlich aus dem HS-Kontingent in die Integrationsklasse.
Anders stellt sich die Situation für kleinere Hauptschulen dar, die nur zwei Klassen pro Jahrgang führen. Im traditionellen HS-System werden die Kinder aus zwei Klassen in drei Leistungsgruppen eingeteilt. Entscheidet sich jedoch eine Klasse für die innere Differenzierung, kann die andere Klasse mangels Stunden nicht mehr in drei Leistungsgruppen eingeteilt werden. Hier war es nötig (C, F), ein Organisationsmodell zu entwickeln, das nicht nur eine, sondern zwei Klassen umfasste.
Aus dem HS-Stundenkontingent und den zur Verfügung gestellten sonderpädagogischen Stunden und je nach Standort, wie oben ausgeführt, zusätzlichen Stunden aus dem HS-Kontingent konnten die Teams autonom entscheiden, in welchem organisatorischen Rahmen die innere Differenzierung stattfinden sollte, welche Stunden mit zwei Lehrern, welche evtl. nur mit einem Lehrer und welche mit drei Lehrern besetzt werden. Neben den gehaltenen Stunden (Schülerstunden) mussten aus diesem Kontingent die Abschlagsstunden und Koordinationsstunden (das sind Stunden zur Entwicklung des Schulversuchs) zusätzlich abgedeckt werden. Koordinationsstunden wurden in der Praxis als Besprechungs- oder Teamstunden bezeichnet und konnten in Vorarlberg bis zum heurigen Schuljahr 2001/2002 lehrverpflichtungsmindernd geltend gemacht werden, mit anderen Worten, es waren bezahlte Lehrerstunden. Für die Pionierteams war klar, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn das Team den Unterricht laufend koordiniert und sich abspricht - und diese Koordination als zusätzliche Arbeit und nicht als ehrenamtlich idealistisch zu leistende Zusatztätigkeit angesehen wird. Diese Ansicht wird durch die Evaluation der Hamburger Integrationsklassen bestärkt, denn eine von zwei grundsätzlichen Entwicklungsperspektiven bezieht sich auf die gemeinsame Unterrichtsplanung: »Schulinterne Fortbildung mit dem Schwerpunkt gemeinsamer Unterrichtsplanung wird als aussichtsreicher Ansatz (...) gesehen.« (Schley/Köbberling 2000, 186)
|
Standorte |
Gesamtstunden-verbrauch |
Schülerstunden Gehaltene Stunden in der Klasse |
Koordinations-stunden (Teamstunden) |
Abschlagstunden Klassenvorstandschaft |
|
A |
87 |
75 |
8[a] |
4 |
|
B (2. Schulstufe)[b] |
80 |
70 |
4 |
6 |
|
C |
81 |
71 |
4 |
6 |
|
D |
74 |
65 |
5 |
4 |
|
E |
82 |
72 |
4 |
6 |
|
F |
78,5 |
64 + 3 (techn. Schwerpunkt) |
4 |
6 |
|
[a] Die beiden Koordinationsstunden pro LehrerIn des Kernteams reduzierten sich von der 2. Klasse HS an auf eine Stunde, da das Stundenkontingent insgesamt nicht erhöht wurde und diese Stunden deshalb als Schülerstunden für zusätzliche Fächer (Geschichte, Physik/Chemie) gebraucht wurden. [b] Diese Klasse wurde von mir erst ab der 2. Klasse wissenschaftlich begleitet. |
||||
Trotz unterschiedlichster Klassenzusammensetzungen im Hinblick auf die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist der Gesamtstundenverbrauch bei vier Teams relativ ähnlich, Standort D fällt auf. An diesem Standort wurden dem Team aufgrund des Schulmodells der Hauptschule keine zusätzlichen Stunden aus dem Hauptschulkontingent zur Verfügung gestellt. Die LehrerInnen meldeten auch Bedenken hinsichtlich der Differenzierungsmöglichkeiten an. Sie arbeiteten nach eigenen Aussagen an der untersten Grenze der Differenzierungsmöglichkeiten (Modellbericht D, S. 7).
Ein Blick auf die detaillierten Stundenmodelle (3.3) zeigt, wie unterschiedlich diese Stunden eingesetzt werden. Während an einem Standort 12 Stunden mit drei Lehrpersonen besetzt werden, gibt es an einem anderen Standort nur zwei solcher dreifachbesetzter Stunden. Dieser auf den ersten Blick sehr erstaunliche und erklärungsbedürftige Umstand wird erst verständlich, wenn man die Klassenzusammensetzung und vor allem die Anwesenheitsstunden der Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf mitberücksichtigt. Laut Lehrplan unterscheidet sich die Stundenanzahl der Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf erheblich von jener der Hauptschulkinder oder jener Kinder, die nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule unterrichtet werden. Je nach dem Stundenkontingent, das den Teams zur Verfügung steht oder aber auch umgekehrt, je nach Einschätzung der Teams, ob diese Differenz sinnvoll ist oder nicht, dem integrativen Gedanken entspricht oder nicht, unterscheidet sich die Anwesenheitszeit dieser Kinder in der Schule erheblich. Während an einem Standort (A - 87 Stunden) auch die Kinder, die nach dem S-Lehrplan unterrichtet wurden, gleichviel Stunden wie alle anderen SchülerInnen in der Schule lernen, gibt es an anderen Standorten eine Differenz zwischen HS-Kindern und S-Schülern von sechs Stunden, was exakt den Lehrplänen entspricht.
Als wünschenswert wird von allen Teams ein direkt ans Klassenzimmer angegliederter Raum in der Größe von mindestens eines halben Klassenraumes genannt. An vier Schulen sind die räumlichen Verhältnisse nahezu ideal, die Klassen verfügen direkt an die Klasse angrenzende Gruppenräume, die von der Klasse aus erreichbar sind und bis auf einen Standort nur den Pionierklassen zur Verfügung stehen, zwei Klassen können sich mit den gegebenen Bedingungen gut arrangieren, auch wenn sie nicht als optimal bezeichnet werden.
Alle Teams waren mit der Ausstattung mit Arbeitsmitteln sehr zufrieden. Kein Team hatte finanzielle Probleme, die Einrichtung der ersten Integrationsklassen wurde von allen Gemeinden großzügig unterstützt. Diese Unterstützung umfasste sowohl bauliche Maßnahmen wie etwa das Druchbrechen einer Wand zwischen zwei Klassenräumen als auch die Bereitstellung eines Budgets zur Anschaffung von Lehr- und Lernmaterialien bzw. Computern, die in allen Klassen zur Standardeinrichtung gehörten. Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Materialien waren in keinem Fall das Geld, eher das Materialangebot auf dem Markt. Und obwohl sich das Angebot mittlerweile vervielfacht hat, müssen LehrerInnen immer wieder Arbeitsmaterialien selber herstellen oder adaptieren, damit sie den Voraussetzungen der Kinder entsprechen.
Ein kleines Team wird von allen als wichtige organisatorische Maßnahme für die Realisierung von integrativem Unterricht angesehen. Fünf Teams setzten sich folglich aus je drei HauptschullehrerInnen und der Sonderpädagogin zusammen und werden als Kernteam bezeichnet. Diese vier LehrerInnen übernahmen im Wesentlichen bis auf Religion, textiles Werken und evtl.Musikerziehung sämtliche Stunden und waren deshalb sehr viel Zeit in der Klasse anwesend. Unterrichtsblockungen ergaben sich daraus nahezu automatisch auch ohne besondere stundenplantechnische Vorkehrungen, innerhalb dieses Rahmens war es leicht möglich, nach Absprache mit dem Kollegen bestimmte Stunden je nach Thema zusammenzulegen. Damit arbeiteten die ersten Teams mit Voraussetzungen, die in der Evaluation der Hamburger Schulversuche von Köbberling/Schley als eine wichtige Entwicklungsperspektive in Richtung qualitativer Verbesserung identifiziert werden. Die Teams wünschen sich nämlich in der Abwandlung der bestehenden Organisationsstrukturen »größere(r) zeitliche(r) und gestalterische(r) Flexibilität (Rhythmisierung des Schultags, Unterrichtszeiten in Blöcken, geblockte Klassenzeiten, Fachstunden auf möglichst wenig Lehrkräfte verteilt), (...).« (Schley/Köbberling 2000, 186)
|
Lehrer |
Team A |
Team B[a] |
Team C |
Team D |
Team E |
|
L1 |
D, GW, M, Me, LÜK 15 Stunden |
D, BU, PC, GS, Tech, LÜK, R, KV 22 Stunden |
R, M, Tech, KV 13 Stunden |
D, BE, 10 Stunden |
M, BU, BE, LÜK, Tech, KV 18 Stunden |
|
L2 |
D, E, GW, LÜM 15 Stunden |
F, BE LÜM, Tex 12 Stunden |
D, BU, GW, LÜM 16 Stunden |
E, BU, LÜK/M[b] 12 Stunden |
D 8 Stunden |
|
L3 |
E, M, BU, Tech, LÜK 17 Stunden |
M, GW, ME, Tech 10 Stunden |
E, ME, BE 12 Stunden |
M, GW, Tech 11 Stunden |
E, GW, LÜM 13 Stunden |
|
Sonder-pädagoge |
20 Stunden (davon Hauptfachlehrerin in BU; ME) HS Lehrerin + Sonderpädagogin |
26 Stunden, davon R, Tex HS-Lehrerin |
26 Stunden HS-Lehrerin |
26 Stunden Sonderpädagogin |
27 Stunden HS Lehrer |
|
Andere Lehrer |
Rel, BE, Tech, Tex - 8 Stunden |
Tex, Tech 4 Stunden |
R, ME, Tex 6 Stunden |
R, ME, Tex 6 Stunden |
|
|
[a] Diese Angaben beziehen sich auf die 2. Klasse [b] LÜK/LÜM wird koedukativ mit Begleitung der Sonderpädagogin unterrichtet. |
|||||
Das Team F bestand aus 7 Lehrern, die in dieser Zusammensetzung jedoch die Integrationsklasse und die Parallelklasse unterrichteten. Außer Religion, Leibesübungen- Mädchen und textiles Werken deckte dieses Kernteam ähnlich wie in den anderen 5 Modellen sämtliche Stunden aus beiden Klassen ab. Der Integrationsklasse stand ein erfahrener Sonderpädagoge, der gleichzeitig geprüfter Hauptschullehrer war, zur Verfügung.
Nur in drei der sechs Teams übernahm eine geprüfte Sonderpädagogin die Aufgaben der sonderpädagogischen Betreuung, die drei anderen ›Sonderpädagogen‹ (gemeint sind jene LehrerInnen, welche die Begleitung der Integrationskinder übernahmen) sind HauptschullehrerInnen, die sich jedoch freiwillig und gerne dieser Aufgabe stellten. Der Mangel an Sonderpädagogen kennzeichnet seit vielen Jahren die Schullandschaft Vorarlbergs und ist kein Spezifikum der Hauptschulintegration. Er ist meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass in den 1990er Jahren in Vorarlberg keine Ausbildung zum Erwerb des Lehramts für Sonderpädagogik angeboten wurde. Zwei dieser Lehrer äußerten Bedenken hinsichtlich ihrer Qualifikation, die sich weniger im Umgang mit den Kindern als vielmehr als persönlicher Belastungsfaktor zeigte.
»Für mich ist belastend, dass ich einfach zu wenig Vorwissen und keine Erfahrung als Sonderpädagoge habe. Ich mache zwar viele Erfahrungen, aber ich möchte mir noch mehr Grundwissen aneignen.« (Modellbericht E, S. 14)
Zwei der Sonderpädagogen sind gleichzeitig geprüfte Hauptschullehrer, nur eine Sonderpädagogin kam aus dem System der Allgemeinen Sonderschule und kannte das Hauptschulsystem nicht von innen. Die Wechsel, vor allem aber das Tempo in den Hauptschulen erlebt sie als große Umstellung.
Die folgenden Übersichten geben Auskunft, wie die einzelnen Teams ihr Stundenkontingent einsetzen und wieviel Stunden die einzelnen SchülerInnen anwesend sind. Die Spielräume werden auf dem Hintergrund der verschiedenen Stundentafeln der Lehrpläne verständlich. Die Schulpflicht von Kindern mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf (S-Lehrplan) ist je nach Schulstufe bis zu sechs/sieben Stunden niedriger. Für die praktische Umsetzung bedeutet dies, dass Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf weniger Stunden in der Schule anwesend sein dürfen oder müssen - je nach Perspektive, entweder später kommen, früher gehen oder auch Nachmittage frei haben. Ob und wie dieser Spielraum genützt wird, ist nicht nur und leider nicht in erster Linie eine pädagogische Fragestellung und Entscheidung, sondern auch schon bei den Pionierklassen eine der Stundenzuteilung, denn die Anwesenheit von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf erfordert in der Regel immer eine Lehrerdoppelbesetzung, während SchülerInnen, die nach dem ASO-Lehrplan unterrichtet werden, oft ohne besondere Unterstützung mit der Hauptschulgruppe mitlernen können. (Mit der kontinuierlichen Reduktion der Stunden in den darauffolgenden Jahren stellt sich diese Diskussion eigentlich nicht mehr: Die Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf sind nur noch so viele Stunden wie laut Lehrplan vorgesehen anwesend, sonst wären keine Lehrer-Dreifachbesetzungen in den Hauptfächern möglich gewesen.) Ohne im Detail auf die Unterrichtsorganisation einzugehen, soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass alle Klassen eine Mischung aus offenen und gebundenen Lernformen anstreben. An dieser Stelle werde ich nur aufzeigen, welche unterschiedlichen Unterrichtskonzeptionen den dreifachbesetzten Stunden, die in erster Linie der Differenzierung in den sog. Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch gelten, zugrunde gelegt wurden.
|
Schülerstunden (1. Schulstufe) |
Lehrerstunden |
|||||
|
HS-Kinder |
I-Kinder |
davon Freiarbeit |
HL |
SL |
HL zusätzlich |
|
|
Rel |
2 |
2 |
2 |
|||
|
D |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
3 |
|
M |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
3 |
|
F |
5 |
5 |
2 |
5 |
5 |
3 |
|
BU |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
GW |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
ME |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
LÜK/LÜM |
4 |
4 |
4+4 |
4 |
||
|
Tech/Tex |
2 |
2 |
2+2 |
2 |
||
|
BE |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Summe |
31 |
31(30) |
8 |
gehaltene Lehrerstunden 75 |
Dem Lehrerteam an diesem Standort ist nicht einsichtig, warum gerade Kinder mit sog. schweren Behinderung weniger Lernzeit zur Verfügung haben sollten als alle anderen Kinder. Es entspricht ihrem Verständnis von ›Normalisierung‹[33] und auch den Wünschen der Eltern, dass auch Kinder mit erhöhtem SPF dieselben Schulzeiten haben. Ob Kinder überlastet sind, hängt nach dem Verständnis des Teams mehr von der Gestaltung des Unterrichts als von der zeitlichen Anwesenheit in der Schule ab. Einzige Ausnahme war eine Mittagsrandstunde, um die Mittagspause zu verlängern.
Die dreifach besetzten Stunden werden als gebundene Unterrichtsstunden geplant, in denen in erster Linie neue Inhalte erarbeitet werden sollten. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus der Klasse (S-Lehrplan, verschiedene ASO-Lehrplanstufen, das gesamte Leistungsspektrum der Hauptschule bis hin zu sehr hochbegabten Schülern) sollten die Kleingruppen je nach Thema und Bedarf flexibel zusammengesetzt werden. Starre Gruppenzusammensetzungen widersprechen den Vorstellungen von integrativem Unterricht. Auf den wöchentlichen Teamsitzungen werden diese Stunden gemeinsam durchgeplant und entschieden, wie die Kleingruppen zusammengesetzt werden bzw. welche Kinder ohne Unterstützung eines Lehrers arbeiten sollten.
|
Schülerstunden (2. Schulstufe) |
Lehrerstunden |
|||||
|
HS-Kinder |
I-Kinder |
davon Freiarbeit |
HL |
SL |
HL zusätzlich |
|
|
Rel |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
D |
5 |
4 |
2 |
5 |
4 |
1 |
|
M |
4 |
3 |
4 |
3 |
||
|
E |
4 |
3 |
1 |
4 |
3 |
1 |
|
BU |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|
GW |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
ME |
2 |
2 |
2 |
1 |
||
|
LÜK/LÜM |
4 |
4 |
4 + 4 |
3 |
||
|
Tech/Tex |
2 |
2 |
2 + 2 |
2 + 2 |
||
|
BE |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
PC |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
|
GS |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
KV |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Summe |
34 |
28 |
7 |
gehaltene Lehrerstunden 70 |
Alle vier Integrationskinder in dieser Klasse werden nach dem S-Lehrplan unterrichtet. Sie haben - wie im Lehrplan vorgesehen - sechs Stunden weniger Unterricht als die Hauptschulkinder: am Samstagvormittag und an einem Nachmittag. Außerdem hält dieses Team in Mathematik an der äußeren Differenzierung fest. Da für alle vier I-Kinder ein Förderschwerpunkt im lebenspraktisch- funktionalen Bereich für wichtig erachtet wird, arbeiten sie mit der Sonderpädagogin an einem Vormittag drei Stunden im Lernfeld Küche, während die Hauptschulkinder je eine Stunde Deutsch, Englisch und Mathematik haben. Trotz äußerer Differenzierung versuchen sie den Unterricht teilweise in eine integrative Figur einzubetten, indem die Integrationskinder eine Jause für die gesamte Klasse vorbereiten. Diese Organisationsstruktur führt dazu, dass die Integrationskinder während der lehrerzentrierten Hauptfachstunden entweder in äußerer Differenzierung arbeiten oder nicht in der Schule anwesend sind (Samstagvormittag).
Obwohl den einzelnen Teams das Stundenkontingent zur autonomen Gestaltung ihres Modells zur Verfügung gestellt wird, zeigt sich an diesem Standort, dass der Spielraum nicht groß ist. Die notwendige Unterstützung von drei Kindern lässt es nicht zu, einzelne Stunden (z. B. ME oder LÜ) nur mit einer Lehrperson zu besetzen. Dadurch sind viele Stunden bereits gebunden und können nicht zugunsten einer Dreifachbesetzung vom einen Fach in ein anderes verlagert werden, wie dies an anderen Standorten praktiziert wird. Das Team akzeptiert die Rahmenbedingungen als gegeben, sowohl das zugeteilte Stundenkontingent als auch die unterschiedlichen Stundentafeln der Lehrpläne.
|
Integrationsklasse (1. Schulstufe) |
Parallelklasse |
|||||||||
|
Schülerstunden |
Lehrerstunden |
Schülerstunden |
Lehrerstunden |
|||||||
|
HS |
ASO S |
davon FA |
HL |
SL |
HL zusätzlich |
HS |
davon FA |
HS |
HL zusätzlich |
|
|
Rel |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
D |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
|
M |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
|
|
E |
5 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
5 |
|
|
BU |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
||
|
GW |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
||
|
ME |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
LÜK/M |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4+4 |
||||
|
Tech-tex |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2+2 |
|||
|
BE |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
KV/EG |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Summe |
32 |
30 |
12 |
gehaltene Lehrerstunden 71 |
32 |
11 |
Lehrerstunden 54 |
Standort C ist eine Hauptschule, in der pro Jahrgang zwei Klassen parallel geführt werden. Wie bereits ausgeführt, bedeutet die Entscheidung, eine Klasse mit innerer Differenzierung zu führen für die andere, dass nicht mehr drei Leistungsgruppen pro Hauptfach angeboten werden können. Da diese Hauptschule die Integration jedoch als Auftakt zu einer umfassenden Schulentwicklung sieht und sich zwei Jahre lang darauf vorbereitet hat, entwickeln sie ein Modell, das auch die Parallelklasse in die Überlegungen mit einbezieht. Beide Klassen werden in innerer Differenzierung organisiert, die Teams kooperieren in der Vorbereitung eng miteinander, führen jedoch beide Klassen mit je einem Team getrennt. An diesem Standort entsteht das im Sinne integrativer Pädagogik am weitesten entwickelte Modell: Die SchülerInnen werden bis in die 4. Klasse Hauptschule nicht in Leistungsgruppen eingeteilt, die Leistungsbeurteilung durch Ziffernnoten wird durch ein Pensenbuch (Lernzielkatalog) bis in die vierte Klasse ersetzt.
Die mit drei LehrerInnen besetzten Stunden werden konsequenterweise auch nicht als gebundene Stunden, sondern für offene Lernphasen geplant. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die Konzeption des integrativen Unterrichts im Team C: Möglichst viele neue Inhalte sollen nicht mehr lehrerzentriert dargeboten, sondern von den Kindern selbständig - mit unterschiedlichen Hilfestellungen - erarbeitet werden. Gebundene Stunden sollen auf ein Minimum beschränkt werden und dienen in erster Linie der Lernprozessbegleitung und der Präsentation von Ergebnissen.
|
Schülerstunden (1. Schulstufe) |
Lehrerstunden |
|||||
|
HS-Kinder |
I-Kinder |
davon Freiarbeit |
HL |
SL |
HL zusätzlich |
|
|
Rel |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
D |
5 |
4 |
2 |
5 |
4 |
|
|
M |
5 |
4 |
2 |
5 |
4 |
2 |
|
E |
5 |
4 |
2 |
5 |
4 |
2 |
|
BU |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
GW |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|
ME |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
LÜK/LÜM |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Tech/Tex |
2 |
2 |
2 + 2 |
2 |
||
|
BE |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Summe |
31 |
28 |
8 |
gehaltene Lehrerstunden 65 |
Die Hauptschulkinder haben 31, die Integrationskinder 28 Stunden Unterricht. Die Differenz in der Stundenzahl ergibt sich daraus, dass die Kinder mit SPF am Samstagvormittag keine Schule haben. Sämtliche Stunden am Standort D werden zur Begleitung von zwei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf doppelt besetzt, vier Stunden arbeiten drei LehrerInnen in der Klasse gemeinsam. An diesem Standort werden der Integrationsklasse keine Stunden aus dem Hauptschulkontingent zur Verfügung gestellt, sodass der Samstagvormittag zum Einsparen von Stunden notwendig wird. (Leibesübungen wird aus dem selben Grund koedukativ geführt.) Auch an diesem Standort ist es keine Frage der Pädagogik, wie sinnvoll es ist, dass die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Fünf-Tage-Woche haben, die HauptschülerInnen nicht, dass die Kinder mit SPF drei Stunden weniger unterrichtet werden, sondern eine Frage der Stundenressourcen, die sich über die Stundentafeln der Lehrpläne legitimiert. Dieses Team äußert Bedenken, eine Verbesserung kann jedoch während der gesamten Hauptschulzeit nicht erreicht werden, da die Stunden zur Leistungsdifferenzierung durch das autonom entwickelte Hauptschulmodell blockiert sind.
|
Schülerstunden |
Lehrerstunden |
||||
|
HS-Kinder |
I-Kinder |
HL |
SL |
HL zusätzlich |
|
|
Rel |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
D |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
|
M |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
|
E |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
|
BU |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
GW |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
ME |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
LÜK/LÜM |
3 |
3 |
3 + 3 |
2 |
|
|
Tech/Tex |
2 |
2 |
2 + 2 |
2 |
|
|
BE |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
KV |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Summe |
31 |
31 |
gehaltene Lehrerstunden 72 |
Das Team E plant den Unterricht sehr langsam in Richtung freie Lernphasen zu verändern und will sich deshalb bei der Modellentwicklung nicht auf eine bestimmte Anzahl von Freiarbeitsstunden festlegen. Die dreifach besetzten Stunden werden als gebundene Unterrichtsstunden geplant, und zwar im Halbgruppenmodell, welches das Team von der Hauptschule Liefering, Salzburg, übernommen hat (vgl. 4.4). Aufgrund der Schülerzusammensetzung ist es an diesem Standort möglich, einzelne Stunden nur mit einem Lehrer zu besetzen (Musikerziehung, Bildnerische Erziehung), sodass neun Stunden mit einer Dreifachbesetzung geführt werden können. SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf wie auch eine Schülerin mit erhöhtem SPF haben, wie an Standort A und C, gleich viel Stunden Unterricht wie die Hauptschulkinder, ohne dass die Lehrpersonen Überforderung aufgrund von zeitlicher Belastung beobachten.
Standort F ist eine Hauptschule mit technischer Schwerpunktsetzung mit zwei Klassen pro Jahrgang. Aufgrund der bereits dargelegten Schwierigkeiten bei der Organisationsstruktur bei Führung einer Klasse mit innerer Differenzierung strebt auch dieser Standort von Anfang an ein Modell an, das beide Klassen berücksichtigt.
Das Team an diesem Standort setzt sich aus sieben Lehrern zusammen, je zwei geprüften Lehrern in Deutsch, Mathematik, Englisch und dem Sonderpädagogen, der gleichzeitig auch Hauptschullehrer ist. Der grundsätzliche Unterschied zu den bisher vorgestellten Modellen besteht darin, dass diese sieben Lehrer gemeinsam in beiden Klassen unterrichten und nahezu alle Fächer abdecken.
Auch im Hinblick auf die Klassenzusammensetzung unterscheidet sich diese Klasse von allen anderen, da kein Kind mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf diese Klasse besucht. Statt Bildnerische Erziehung oder Musikerziehung oder Leibesübungen mit zwei Lehrern zu besetzen, entscheidet sich das Team, die Stundenressourcen in die Hauptfächer zu verlagern. Auch in Biologie und Geographie wird nur eine der beiden Stunden mit dem Sonderpädagogen besetzt, sodass in Mathematik, Deutsch und Englisch jeweils vier Stunden mit drei Lehrern besetzt werden können.
|
Schülerst. 1a + 1b |
Lehrerstunden |
|||||||
|
Integrationsklasse |
Parallelklasse |
|||||||
|
HS |
ASO |
HL |
HL |
SL zus. |
HL |
HL |
||
|
Rel |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
D |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
|
M |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
|
E |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
|
BU |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|||
|
GW |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|||
|
ME |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
LÜK/M |
3 |
3 |
3+3 |
3+3 |
||||
|
WTC/X |
2 |
2 |
2+2 |
2+2 |
||||
|
BE |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
techn. Gruppe |
||||||||
|
Informatik |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Maschinschr. |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
techn. Werken |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
S (o. tech. ) |
30 |
30 |
gehaltene L-Stunden 64 |
L-Stunden 50 |
||||
|
S (m tech.) |
33 |
30 |
gehaltene L-Stunden 67 |
L-Stunden 53 |
Bis auf ein Team betonen alle die guten materiellen Voraussetzungen, die ihnen im ersten Schuljahr zur Verfügung gestellt wurden. Alle Teams halten an den Grundstrukturen ihrer Modelle fest, verändern sie im Laufe der vier Jahre nur geringfügig.
Veränderungen bei der Zuteilung von Stunden-Ressourcen
Die nahezu optimalen Anfangsbedingungen bei der Stundenzuteilung aus dem sonderpädagogischen Kontingent durch den Landes- bzw. die Bezirksschulinspektoren verschlechtern sich aus Sicht der Teams schon in den kommenden Jahren: Trotz Erhöhung der Schülerstunden durch Fächer wie Geschichte oder Physik/Chemie, die erst auf der zweiten Stufe eingeführt werden, wird das zusätzliche Stundenkontingent zur autonomen Modellentwicklung nicht erhöht. Die Teams erleben es teilweise als Kampf, die zugeteilten Stunden des ersten Jahres zu behalten und Kürzungen zu verhindern. Besonders jene Teams, die auch Kinder mit erhöhtem sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichten, sehen in einer Reduktion der dreifach besetzten Hauptfachstunden eine gravierende Qualitätsminderung und erleben es auch als Geringschätzung der Arbeit, wenn die Dreifachbesetzungen als »Luxus« angesehen werden. Das Dilemma kann nur gelöst werden, indem einzelne Teams auf bis dahin bezahlte Teamkoordinationsstunden teilweise verzichten, da sie diese Stunden zur inneren Differenzierung benötigen. Gleichzeitig betonen jedoch alle, dass die Koordination zwischen den LehrerInnen unbedingte Notwendigkeit ist, wenn man den Unterricht nach den in den Kapiteln zwei und vier vorgeschlagenen Kriterien organisieren und gestalten will. Jene Teams, die sich auf relativ weitgehend offene und fächerübergreifende und -verbindende Strukturen einigen, sind der Meinung, dass der Mehraufwand mit einer Koordinationsstunde ohnehin nur symbolisch abgegolten ist. Andere Teams mit weniger ehrgeizigen Ansprüchen an die Veränderung von Unterricht, die sich langsamer aus dem tradierten System hinausentwickeln wollen, die sich auf kleinere Schritte in Richtung Veränderung verständigt haben, kommen mit deutlich weniger Koordination zurecht.
Veränderungen der Stundenzuteilung durch die Veränderung in der Klassenzusammensetzung
Am Standort E kann am Ende der dritten Klasse Hauptschule der sonderpädagogische Förderbedarf eines Mädchens aufgehoben werden, sie hat sich so positiv entwickelt, dass sie dem Lehrplan der Hauptschule in allen Fächern folgen kann, ein Mädchen zieht weg, ein Schüler kommt dazu. Die Veränderungen führen dazu, dass in der vierten Klasse statt vormals vier Kinder nur mehr drei Kinder mit SPF, davon zwei mit erhöhtem SPF, unterrichtet werden, was eine gravierende Reduktion der Stundenzuteilung aus dem sonderpädagogischen Kontingent nach sich zieht. Das Unterrichtsmodell, bestehend aus Freiarbeit und gebundenen Unterrichtsstunden mit dreifacher Besetzung im Halbgruppenmodell kann durch die Stundenkürzung nicht mehr in der ursprünglichen Form aufrechterhalten werden.
»Das Unterrichtsmodell scheiterte bzw. ist am Stundenkontingent gescheitert.« (L1, Abschlussbericht E, S. 3)
»Heuer habe ich C. und M. (2 Jugendliche mit erhöhtem SPF) zum Teil ohne Begleitung des Sonderpädagogen mitbetreuen müssen. Hier wäre ich um mehr Stunden mehr als nur froh gewesen.« (L2, Abschlussbericht E, S. 3)
Dies ist ein Schulbeispiel für das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma (vgl. Wocken 1996): Positive Entwicklungen werden sanktioniert, indem Ressourcen entzogen werden. Die positive Entwicklung, die zur Auflösung des sonderpädagogischen Förderbedarfs geführt hat, steht vermutlich in einem Zusammenhang zu den optimalen Bedingungen in den drei Jahren zuvor und der Möglichkeit der persönlichen Zuwendung und Unterstützung, die in diesem Setting gegeben war.
Veränderungen im Team
An drei Standorten kommt es aufgrund von Mutterschaftskarenz und der Bestellung einer Lehrerin zur Leiterin der Hauptschule zu gravierenden Veränderungen innerhalb des Kernteams. Auch wird die Vorstellung des Kernteams etwa ab der dritten Klasse gelockert, damit die Realien - vor allem Physik/Chemie - von geprüften Fachlehrern unterrichtet werden können. Die Teamveränderungen führen an zwei Standorten dazu, dass die integrativen Bemühungen sich zusehends auf jene LehrerInnen konzentrieren, die schon von Anfang an der Modellentwicklung mitgearbeitet hatten und die Ideen eines Lernens am gemeinsamen Gegenstand und schülerorientierte Formen der Unterrichtsgestaltung grundsätzlich befürworten. Die Klassenvorstände der beiden Klassen erleben dieses Abgeben von Verantwortung für integrative Prozesse als persönlich sehr belastend.
Veränderungen in der Zusammensetzung der SchülerInnen
Es war der große Wunsch der Pionierteams, dass möglichst viele Kinder aus den Volksschulintegrationsklassen in die Hauptschulen wechseln, weil sie die Heterogenität der SchülerInnengruppe als bedeutenden Faktor für das Gelingen integrativer Prozesse vermuteten. Nur wenige Kinder wechselten damals in die Gymnasium-Unterstufe, die freigewordenen Plätze mussten in den Hauptschulen aufgefüllt werden. An einem Standort werden sämtliche Plätze - entgegen dem Versprechen der Leitung an die Eltern - mit sog. schwierigen, eher lernschwachen, vor allem aber wenig lernmotivierten Kindern besetzt, ein Umstand, den Lehrer wie auch Eltern beklagen und der sicherlich keine positive Außenwirkung erzeugte. Die Gruppenheterogenität wird mit großer Übereinstimmung von allen Teams nach vier Jahren als entscheidender Faktor für die Umsetzung schülerzentrierter Lernformen und das Gelingen integrativer Prozesse angesehen.
Quelle
Claudia Niedermair: Zur Pragmatik der Vision einer Schule für alle. Integrative Unterrichtsgestaltung im Spiegel von Theorie und Alltagspraxis am Beispiel der ersten Hauptschulintegrationsklassen in Vorarlberg. Teil 1-3
Dissertation am Institut für Erziehungswissenschften der Universität Innsbruck, Innsbruck, März 2002.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 22.08.2006
[25] Hauptschule Lustenau Kirchdorf; Hauptschule Egg
[26] Hauptschule Bürs, Hauptschule Dornbirn Markt, Hauptschule Schwarzach, Hauptschule Bezau
[27] gänzlich neu deshalb, weil in fünf der sechs Klassen auch Kinder waren, die nicht nur als lernschwach, sondern auch als Kinder mit sog. schwerer/geistiger Behinderung eingestuft waren
[28] Mit dem Lehrplan 99 wurden diese Vorgaben erstmals verknappt, es werden neben Erweiterungsstoffen verbindliche Kernstoffe angeführt und Bildungsbereiche für fächerverbindenden Unterricht ausgewiesen.
[29] Das Entwickeln und Einbringen solcher gesellschaftlich relevanter Fragestellungen in eine bildungspolitisch öffentliche Diskussion würde ich als wesentliche Aufgabe auch von der Theorie erwarten.
[30] Zur Präzisierung: Nicht ein einzelnes Kind wird von mehr als zehn LehrerInnen unterrichtet, sondern die Kinder einer Klasse.
[31] SPF - Abkürzung für sonderpädagogischen Förderbedarf
[32] Die Zahl ist regional sehr unterschiedlich, abhängig von der Erreichbarkeit einer AHS.
[33] Das Normalisierungsprinzip wurde Anfang der 70er Jahre von Bank Mikkelsen und Bengt Nirje formuliert und gehört zu den Standards der Heilpädagogik.
