sozialgeschichtliche, familiendynamische und alltagsintegrative Aspekte - mit besonderer Berücksichtigung des Vereins der Heilpädagogischen Familien in Tirol
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, am Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Mai 1995
Inhaltsverzeichnis
- Kommentar
- Dank
- 1. Einleitung
- 2. Sozialgeschichtliche Aspekte der Pflegefamilie
- 3. Alltagsorientierte Integration in heilpädagogischen Pflegefamilien
-
4. Die heilpädagogische Pflegefamilie - Ergänzungsfamilie oder Ersatzfamilie?
- 4.1 Forschungsansätze
- 4.2 Das Prinzip der Ersatzfamilie als Ergebnis der individuumzentrierten, entwicklungspsychologischen Sichtweise
- 4.3 Das Prinzip der Ergänzungsfamilie als Ergebnis der systemischen Sichtweise
-
4.4 Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Konzepte
- 4.4.1 Konsequenzen für das Pflegekind - Ausgangslage und Folgerungen für neue Bindungen in der familiären Praxis
- 4.4.2 Aus dem Tagebuch von Klaus über die erste Zeit mit Timo
- 4.4.3 Konsequenzen für die Herkunftsfamilie
- 4.4.4 Konsequenzen für die Pflegefamilie
- 4.4.5 Konsequenzen für die Dynamik der Geschwisterbeziehungen in der Pflegefamilie
- 4.5 Voraussetzungen für die positive Gestaltung einer doppelten Elternschaft
- 4.6 Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis
- 5. Der Verein "Heilpädagogische Familien" in Tirol
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Lebenslauf
- Fußnoten
Die Autorin hat sich in dieser Diplomarbeit, motiviert durch ihre persönliche Erfahrung als "heillpädagogische Pflegefamilie", mit der Problematik der Pflegefamilie als therapeutisches Handlungsfeld auseinandergesetzt. Nach einer Diskussion der Begriffe "Familie", "Behinderung", "Integration" und "Pflegefamilie", wobei Sie vorallem die Unterscheidung zwischen Ergänzungs- und Ersatzfamilie betont, beschreibt sie die Entstehung und Arbeitsweise des Vereins der "Heipädagogischen Familien" in Tirol.
Diese Arbeit gibt einen guten Einblick in die Probleme einer Pflegefamilie und macht auf die schwierige rechtliche Situation der Pflegeeltern aufmerksam. (Angela Woldrich,17. Juni 98)
Für Hilfe und Unterstützung danke ich meinem Betreuer Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, den "Heilpädagogischen Familien", besonders Dr. Herrad Weiler, meinen Studienkolleginnen und Freundinnen, Filo, Sabrina, Gertrud, Tilli, Anita, vor allem Klaus,
und widme diese Arbeit meinen Kindern.
Meine Motivation, dieses Thema zu wählen, liegt in der persönlichen Erfahrung unserer inzwischen 12jährigen Tätigkeit als heilpädagogische Pflegefamilie. Im Frühjahr 1983 lernten wir (mein Mann Klaus und ich) an der Universitätsklinik für Psychiatrie von Innsbruck drei Optimistinnen kennen, die sich ebenso wie wir die Frage stellten, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, beziehungsgestörten, hospitalisierten und behinderten Kindern, die an Herkunftsfamilie oder Institutionen gescheitert waren, ein familiäres Leben mit Beziehungskontinuität bieten zu können.
Dabei begegneten wir Timo: er war damals 10 Jahre alt und hatte während dieser Zeit schon jede Menge negative Erfahrungen für sein Leben gesammelt. Er hatte die verschiedensten Institutionen kennengelernt und bereits einige Beziehungsabbrüche hinter sich. Dadurch war er stark hospitalisiert und schließlich autoaggressiv geworden. Timo sprach von sich nur in der dritten Person und zeigte autistisches Verhalten. Er war - nach mehrjährigen Klinik- und Heimaufenthalten - seit einem halben Jahr stationär an der kinderpsychiatrischen Abteilung aufgenommen. Nun wurde fieberhaft beraten, wie sich seine Zukunft weiterhin gestalten sollte. Da Timos Eltern mit seiner Betreuung überfordert waren und ihn keine kindgerechte Institution mehr aufnehmen wollte, bzw. Timo an ihnen - aufgrund seiner autoaggressiven Problematik - gescheitert war, wurde schon als letzter Ausweg eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung in Erwägung gezogen.
Während der Phase des Kennenlernens (einer Zeitspanne von ca. 4 Monaten) gelang es uns, einen guten emotionalen Zugang zu Timo zu finden. Wir hatten aber trotzdem Bedenken, ob wir uns die Arbeit mit ihm zutrauen konnten. Mit viel Optimismus und dem damals noch sehr kleinen Verein der "Heilpädagogischen Familien" im Rücken begannen wir das Abenteuer. Wir vertrauten darauf, daß es Timo bei konstantem Beziehungsangebot gelingen könnte, sich auf uns einzulassen und ein Stück seines Lebens mit uns zu gehen. Nun suchten wir nur noch eine größere Wohnung, dann zog Timo bei uns ein. Ich erinnere mich noch gut an die Worte, die uns eine dabei maßgeblich entscheidende Persönlichkeit mit auf den Weg gab: "Ist Ihnen schon klar, was Sie da tun? Neben ihm kann man ja nicht einmal eine Brennsuppe kochen!"
Ich beschreibe den Anfang unserer gemeinsamen Geschichte deshalb so ausführlich, da sich durch das Leben mit Timo und aus der Zusammenarbeit mit dem seither immer größer werdenden Verein der "Heilpädagogischen Familien" meine grundlegende Einstellung zu diesem Thema ergibt. Diese Arbeit ist der Versuch einer reflexiven Auseinandersetzung mit Praxis und gleichzeitig die Suche nach angemessenen Theorien, die sich wiederum in der Praxis bewähren müssen. Ich schreibe diese Arbeit aus meiner persönlichen Betroffenheit heraus, sie erhebt somit nicht unbedingt den Anspruch, wissenschaftlich repräsentativ zu sein.
Ausgehend vom Familienverständnis in der Geschichte und davon, welches Familienbild heute als "normal" gilt, stellt sich für mich die Frage, ob sich die gesellschaftliche Auffassung von Pflegefamilien und die Realisierbarkeit der an sie herangetragenen Aufgaben im wesentlichen mit dem Verständnis der Pflegefamilie über sich selbst in Einklang bringen läßt. Dabei werde ich mich hauptsächlich auf das (Berufs-)Verständnis der heilpädagogischen Pflegefamilie beziehen und zeigen, daß sich berufliches Engagement und familiäre Beziehungsarbeit nicht widersprechen müssen.
Die heilpädagogische Pflegefamilie ist m.E. ein wesentliches therapeutisches Handlungsfeld im Netz der Sozialarbeit, in dem sich - im Unterschied zu anderen - die für das Kind so wesentlichen Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit mit fachlicher Professionalität verbinden lassen. Der Arbeitsbereich verschmilzt mit dem Privatbereich: die Arbeit ist so im eigentlichen Sinn Beziehungsarbeit, die alltäglich gelebt werden muß, man kann sich ihr nicht entziehen, sie zieht sich durch alle Lebensbereiche, sie kann nicht so ohne weiteres - ohne massive Auswirkungen auf das Kind - abgegeben werden. Weitgehend vermieden werden so auch einige Nebenwirkungen einer institutionalisierten und professionalisierten Sozialarbeit: z.B. die Fragmentierung der therapeutischen Handlungsfelder, ihre Isolierung von der alltäglichen Lebenswelt, ihre Entfremdung vom wirklichen Zusammenleben, falsch verstandene Professionalität, die letztlich nur auf eine Verwahrung der Kindheit hinausläuft.
Wenn man sich dafür entscheidet, einem behinderten Kind Familie zu sein, muß man sich auch im klaren sein, damit für eine sehr lange Zeit, wenn nicht lebenslang, die Verantwortung für das Wohlergehen dieses Kindes übernommen zu haben.
Läßt man sich auf diese Form der Beziehungsarbeit mit Kindern ein, dann bedeutet dies größte berufliche Verantwortung und zugleich innerstes emotionales Interesse: Hier treffen sich zwei sonst so vorsorglich voneinander getrennte Bereiche, die professionelle und bezahlte Arbeit einerseits und die familiäre und kostenlose Arbeit andererseits. Durch die Solidarität und die Beziehung zum Kind gerät die herkömmliche Trennung von Arbeitsbereich und Privatbereich ins Wanken. Nun ertappt man sich dabei, rechtfertigen zu müssen, warum man für diese familiäre Aufgabe Geld verdient. Ein Sozialarbeiter oder Erzieher, der in einer Institution arbeitet, käme gar nicht auf diesen Gedanken.
Natürlich sind die Voraussetzungen und Bedingungen des Arbeitsvertrages ganz andere. Der an beide "Institutionen" herangetragene gesellschaftliche Auftrag ist jedoch der gleiche: nämlich dem Kind zu seiner Entfaltung und Entwicklung einen geschützten Rahmen zu bieten, damit aus ihm ein selbständiger und beziehungsfähiger Erwachsener werden kann.
Heilpädagogische Pflegefamilie zu sein ist also eine Form der Sozialarbeit, die nicht abgehoben ist vom alltäglichen Zusammenleben. Sie ist eine Arbeitsform, aus der ich nicht nach Dienstschluß wieder in das Privatleben zurückkehren kann. Sie ist sozusagen ein Non-Stop-Unternehmen des Zusammenlebens rund um die Uhr. Sie entgegnet mit dieser "privaten" Form auch der Arbeitsteilung im Sozialbereich und schafft mit dieser Besonderheit die grundlegende Voraussetzung für alltagsintegratives Zusammenleben.
Mit alltagsintegrativem Zusammenleben verstehen wir, daß sich viele Erfahrungen, die in Institutionen meist aufgrund von Therapieplänen erarbeitet werden müssen, in der Familie automatisch durch das Miteinanderleben ergeben. In der Familie besteht auch die Möglichkeit, gewisse Arbeitsschwerpunkte ins Alltagsleben einzubeziehen, ohne daß sich daraus gleich ein Therapieprogramm entwickeln muß. Es ist im kleinen Rahmen eher möglich, flexibel und individuell zu reagieren. Und viele Dinge ergeben einfach mehr Sinn, wenn sie im alltäglichen Miteinander und im ständigen Bezug aufeinander erlernt werden. Jeder ist auf jeden angewiesen, es gibt oft eine gemeinsame Geschichte und, sofern diese erst beginnt, gibt es auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunft.
Diese Perspektiven lassen sich in einem institutionellen Betreuungsverhältnis nicht herstellen, auch wenn es noch so gut organisiert ist. Schon allein die Tatsache, daß ein Kind mit mehreren Betreuungspersonen pro Tag konfrontiert ist und sich immer wieder auf neue Bezugspersonen einlassen muß (sofern ihm das aufgrund bisher durchgemachter Beziehungsabbrüche überhaupt noch möglich ist), erfordert so viel Kraft, daß ein Weiterentwickeln auf der Basis von Sicherheit und Vertrauen schwer möglich sein wird.
Damit diese kleine Einheit der Familie aber nicht überfordert ist und "professionell" arbeiten kann, bedarf sie einer fachlichen Unterstützung von außen. Sie braucht Ansprechpartner, die Kenntnis über die familiäre Situation haben, die mit ihr fachlich kompetente Lösungen erarbeiten und in Konfliktsituationen helfend zur Seite stehen können. Von ihnen wird Loyalität sowie Sensibilität und Rechtskenntnis verlangt. Im Hinblick darauf, wo, wieviel und welche Hilfen Pflegefamilien brauchen, möchte ich das Modell des Vereins der "Heilpädagogischen Familien" in Tirol vorstellen, welches meines Wissens in dieser Art das einzige in Österreich ist.
Im weiteren Verlauf werde ich noch näher auf die rechtlichen Bestimmungen im Pflegefamilienwesen hinweisen und dabei besonders auf das Spannungsfeld Herkunftsfamilie, Pflegekind und Pflegefamilie eingehen. Dabei stellt sich nämlich die Frage, wieweit das in der Gesetzgebung verankerte Prinzip des "Kindeswohls" in der Praxis erfüllt wird, und warum es trotzdem heute noch möglich ist, Kinder in ihrem Fühlen und Denken einfach zu übergehen und dadurch ihr Leben wissentlich zu zerstören. Wenn es nämlich nur um Besitzansprüche und juristische Machtkämpfe zwischen Erwachsenen geht - wofür nicht an letzter Stelle auch gesellschaftliche Rollenbilder mitverantwortlich sind -, bleiben die Rechte und vor allem die Bedürfnisse von Kindern sehr leicht auf der Strecke. An dieser Stelle bleibt für mich die Frage offen, ob es nicht einen Zeitpunkt gibt, an dem Eltern ihre Rechte verwirkt haben.
Wieviele, vor allem auch kleine Kinder, müssen in Heimen leben, weil niemand außer ihren Müttern oder Vätern das "Recht" hat zu entscheiden, was mit ihnen geschieht. Auf sie wird man erst aufmerksam, wenn sich die Folgen von fehlender Geborgenheit z.B. in Verhaltensstörungen niederschlagen. Oft müssen Pflegeeltern die traurige Feststellung machen, daß sie viel mehr erreichen hätten können, wenn sie "ihr" Kind schon früher bekommen hätten. Hier schließt sich der hinlänglich bekannte Teufelskreis: Mit solchen Erfahrungen ins Leben geschickte Kinder werden als Erwachsene wohl kaum in der Lage sein, ihren eigenen Kindern hinreichend Kontinuität und Geborgenheit zu bieten, die diese für ihre positive Lebensbewältigung brauchen würden.
Im Zusammenhang mit den Problemen, die sich aus dem Beziehungsdreieck Pflegekind, Pflegefamilie und Herkunftsfamilie ergeben, werde ich systemische Ansätze und individuumzentrierte bzw. psychoanalytische Ansätze der Sozialarbeit im Pflegekinderwesen vergleichen. In der theoretischen Diskussion der unterschiedlichen Ansätze haben sich diese beiden konträren Auffassungen entwickelt. Als Folge davon kommt es in der Praxis der Vermittlung von Pflegekindern vermehrt zu Unsicherheiten. Gerade hier wäre es wichtig, daß sich beide therapeutischen Richtungen ergänzen, damit individuell flexibel gehandelt werden kann: denn was für das eine Kind richtig ist und seine Entwicklung positiv beeinflußt, muß nicht auch für das andere Kind gelten.
Die Bilder in dieser Arbeit hat Timo im Laufe der Jahre gezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
"Die Familie ist zwar in besonderem Maße von biologischen Faktoren beeinflußt, und sie ist auf Grund dieser naturhaften Bezüge ein relativ stabiles Gebilde, sie begegnet jedoch im Lauf der historischen Entwicklung in einer solchen Formenvielfalt, daß man von einer überzeitlich gleichbleibenden, natürlich vorgegebenen Einheit menschlichen Zusammenlebens keineswegs sprechen kann." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 14)
Die Bedeutung des Wortes Familie im heutigen Sinn hat sich erst im 18. Jahrhundert durchgesetzt. Bis zum Beginn der Neuzeit gab es keine eigene Bezeichnung für die Form des Zusammenlebens von miteinander verwandten Personen - meist Eltern mit ihren noch nicht selbständigen Kindern - wie sie heute üblich ist. Zum besseren Verständnis wird heute üblicherweise die Bezeichnung "Klein-" oder "Kernfamilie" verwendet.
Das französische Wort "famille" ist der Vorläufer von Familie und leitet sich aus dem lateinischen Wort "familia" ab. Das lateinische "familia" läßt sich historisch sehr weit zurückverfolgen und hat gemeinsame indogermanische Wurzeln mit dem oskischen1 Wort "famel". Die Grundbedeutung dieses Wortes umschreibt Haus und erfaßt damit alle in einem Haushalt lebenden Personen mitsamt dem im selben Haushalt lebenden Gesinde. (Mitterauer & Sieder 1984, S. 20f)
Im lateinischen Sprachgebrauch war für das Oberhaupt einer Familie die Bezeichnung "pater familias" üblich. Er war derjenige, dem alle anderen Familienmitglieder, auch die im Haushalt mitlebenden Sklaven2, zu Gehorsam verpflichtet waren und hatte mit einer leiblichen Vaterschaft überhaupt nichts zu tun.
In der germanischen Frühzeit wurde zwischen "fester" und "offener" Sippe unterschieden. Der Begriff der festen Sippe wurde nur für die männliche Linie der Verwandtschaft verwendet, während der offenen Sippe alle Blutsverwandten einer Person angehörten. Die offene Sippe wurde von einem Sippenrat geleitet, dem ein Sippenführer vorstand. Dem Sippenrat kam die Aufgabe zu, das Sippenrecht auszuüben, indem er auch u.a. die Vormundschaft für unmündige Kinder und Witwen zu übernehmen hatte.
In Familienkonstellationen früherer Zeit kamen der übergeordneten Gemeinschaft wesentliche Aufgaben der Lebensgestaltung und Lebensbewältigung zu. Die Abgrenzung zur "Sippe" hin gestaltete sich fließend, jedoch deren Abgrenzung nach außen war sehr stark. Stellt man dazu Vergleiche mit heute an, dann verläuft die Entwicklung gerade gegenteilig. Einem sich immer mehr nivellierenden "Außen" stellt sich eine aus wenigen Mitgliedern bestehende Gruppe entgegen. Vielleicht ist der heutige Trend zum Individualismus durch die Überforderung des einzelnen zu erklären, seine Identität in der nivellierenden Gesamtheit der Menschen finden zu müssen. Weiters läßt sich eventuell auch darin eine Ursache der immer tiefer werdenden und dadurch unauswechselbaren Eltern-Kind-Beziehungen finden. In der Isolation und im Rückzug der Familie sowie in der damit verbundenen Wichtigkeit familialer Identität zeigt sich eine Gegentendenz zur drohenden Nivellierung und Verallgemeinerung der Individualität.
Mehr denn je wird die Familie in ihrer Funktion als auch ihre Aufgaben betreffend hinterfragt. Vielfältige Formen des Zusammenlebens versuchen an ihre Stelle zu treten, haben sich jedoch noch nicht bewährt. Der Wettlauf zwischen der Familie im allgemeinen Verständnis und den Ansprüchen einer unabhängigen und flexiblen Lebensplanung hat seine Spuren in allen Lebensbereichen hinterlassen.
Die Familie im weitesten Sinn ist eine der ursprünglichsten Formen menschlichen Zusammenlebens. Wirtschaftliche und soziale Prozesse haben sie allerdings stets beeinflußt, aber ebenso haben sich umgekehrt übergeordnete Sozialgebilde an ihrem Modell orientiert. Die hierarchische Struktur der "familia" ist auch heute noch in den mitteleuropäischen Gesellschaftssystemen in den verschiedensten Formen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Organisation menschlichen Zusammenlebens anzutreffen.
Die Ursachen, warum es nun zu der verengten Auffassung von Familie im heutigen Sinn gekommen ist, sieht Mitterauer im gesellschaftlichen Wandel des 17. und 18. Jahrhunderts begründet:
-
Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich sowie die damit einhergehende Trennung von Berufs- und Privatsphäre, u.a. bedingt durch die Industrialisierung.
-
Vertiefung der Eltern-Kind-Beziehungen bedingt durch religiöse Einflüsse der Reformation sowie der Gegenreformation und durch das Zeitalter der Aufklärung.
-
Lösung der Dienstboten aus der engen Gemeinschaft der Hausangehörigen. Die Versachlichung ihres Dienstverhältnisses führt zur Lockerung ihrer familialen Integration.
-
Entstehung zahlreicher Haushalte, die nur mehr aus engsten Familienangehörigen bestehen. Dadurch wird der Familienhaushalt zur vorherrschenden Form menschlichen Zusammenlebens. (Mitterauer & Sieder 1984, S. 21)
Die geschichtliche Entwicklung des Pflegekinderwesens läßt sich auf zwei voneinander unabhängige Entstehungszusammenhänge zurückverfolgen:
-
Ein Ausgangspunkt liegt in der Ammenbeziehung. Sie war schon im römischen Altertum vor allem in den herrschenden Gesellschaftsschichten üblich und setzte sich bis ins 20. Jahrhundert fort. Sie verkörperte eine Form der Pflegebeziehung, die sich als Dienstleistung verstand.
-
Der andere und spätere Ausgangspunkt besteht in der christlichen Motivation und der damit einhergehenden Wertigkeit der Nächstenliebe. Diese Richtung war vor allem für die armen Bevölkerungsschichten maßgeblich. Aus ihr läßt sich die Tradition der Fürsorgeerziehung ableiten. (Nienstedt & Westermann 1990, S. 14)
Zunächst waren von der Pflegebeziehung aus christlicher Nächstenliebe nur Findelkinder und Waisenkinder betroffen. Letztere nur dann, wenn sie keine Angehörigen mehr hatten, die sich ihrer annahmen. Vor allem im ländlichen Raum war die Versorgung der Kinder noch weitgehend durch die Großfamilie gewährleistet. Selbst wenn sich eine Familie, bedingt durch Katastrophen und Krankheiten sowie durch die damit einhergehende hohe Sterblichkeitsrate, aufzulösen drohte, war es schon aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, daß auch Witwer und Witwen sich wieder vermählten.
Dadurch ergab sich häufig eine Form des familiären Zusammenlebens, in der Stiefeltern und Stiefgeschwister sehr stark verbreitet waren. Die Blutsverwandtschaft spielte offensichtlich noch keine so wesentliche Rolle, wie ihr heute zukommt und der Zuordnung einzelner Familienmitglieder diente eher der Hausname3 als der Name der Familie im engeren Sinn.
"Hatte ein Witwer oder eine Witwe schon aus der ersten Ehe des verstorbenen Partners Kinder übernommen und kam es dann zu einer neuerlichen Heirat, so konnten Konstellationen entstehen, in denen Kinder weder mit den Eltern noch mit einem Teil der Geschwister tatsächlich verwandt waren. Solche Beispiele zeigen deutlich, daß die Stellung des Sohnes und der Tochter im Haus keineswegs auf Blutsverbindungen beruhen muß. Daß sie trotzdem zur Familie zu rechnen sind, ist evident. Dasselbe gilt für Zieh-, Pflege- und Kostkinder." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 32)
War das Familienverständnis der mitteleuropäischen Völker des Altertums und des frühen Mittelalters noch ein gänzlich anderes als heute, so wandelt sich das moralische Verständnis über die Form des familiären Zusammenlebens vor allem unter kirchlichem Druck. Im fortschreitenden Mittelalter trat eine entscheidende Veränderung vorerst durch den religiös getragenen Wert der Unterscheidung zwischen unehelichen und ehelichen Kindern ein. Da das kirchliche Verständnis von Ehe als unauflösliche Lebensgemeinschaft zunehmend an Bedeutung gewann, wurden uneheliche Kinder moralisch immer mehr geächtet. Dieser Wandel hatte ein dramatisches Ansteigen von Kindesaussetzungen zur Folge. H. Erich Troje führt diese Entwicklung auf Thomas von Aquins (1225-1274) zurück. Er war ein Verfechter der Unauflöslichkeit der Ehe und er begründete diese mit drei moralischen Prinzipien:
-
mit der Dauer der Erziehung,
-
der Sicherung der Vaterschaft und
-
der größten Freundschaft.
Diese Prinzipien dienten in erster Linie dazu, den Vater eines Kindes und dessen "Echtheit" feststellen zu können, um davon die Versorgungs- und Erziehungspflicht ableiten zu können. Weiters hatten sie auch die Aufgabe zu bekräftigen, daß die Frau allein für die "Aufzucht" der Kinder nicht "Sorge tragen" konnte. (Troje 1990, S. 150) Damit waren grundlegende Weichen für die Zuschreibung von "defizitär-stigmatisierenden Eigenschaften" an nichteheliche Kinder gestellt. Wesentliche Anteile dieser Sicht von Ehe und Familie wirken sich noch bis heute, vor allem in Schule, Kirche und Sozialpolitik aus. (Friedlmayer 1992, S. 61)
Mit der Kenntnis über historische Familienformen und dem Bewußtsein, daß es viele Möglichkeiten des Zusammenlebens von einander vertrauten Personen gibt, soll es uns möglich sein, für die Zukunft Offenheit zu bewahren. "So mag etwa das Wissen um die Häufigkeit des Zusammenlebens mit nicht verwandten Personen in Familienkonstellationen der Vergangenheit ein Alternativdenken über Familienformen der Zukunft erleichtern." (Mitterauer & Sieder 1984, S. 37)
Um 400 n. Chr. gab es zwar schon vereinzelt Armenhäuser und Ziehmütter4 für Findelkinder, aber bis 1500 wurde die Familienerziehung der Waisenkinder hauptsächlich in ihrer Sippe geleistet. Aufgrund der beginnenden, vor allem religiös bedingten, strukturellen Veränderung der Familie gab es aber immer mehr Kinder, die auf eine öffentliche Fürsorge, bzw. auf eine Pflegefamilie angewiesen waren. Der Kirche kam nun eine Betreuungs- und Vermittlerrolle zu, die sie weitgehend so löste, daß sie "mildtätigen Gläubigen [...] durch die Übernahme eines solchen Kindes" dazu verhalf, "ein gutes Werk vollbringen und zu ihrer eigenen Läuterung beitragen" zu können. (Friedlmayer 1992, S. 61)
Im 16./17. Jahrhundert kam das soziale Gefüge des Mittelalters durch die geistigen Strömungen der Reformation und des Humanismus sowie durch wirtschaftliche Veränderungen, in Bewegung. "Statt Versorgung wurde die Erziehung, insbesondere zur Arbeit, vorherrschender Fürsorgegedanke: Jetzt lag es nahe, die unversorgten Kinder in Anstalten unterzubringen, um sie auf ihre spätere Eingliederung in den Produktionsprozeß vorzubereiten." (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 9f) Es gab aber damals noch verschiedene Modelle öffentlich geförderter Privatpflege, sodaß auch in der beginnenden Neuzeit die Heimerziehung noch keine Priorität hatte.
Erst Ende des 17. Jahrhunderts gewann die Anstaltspflege, bedingt durch den beginnenden Pietismus5 nach dem 30jährigen Krieg und dem starken Rückgang der Landbevölkerung, an Bedeutung. Die Anstalten wurden sehr unterschiedlich geführt, je nachdem, ob wirtschaftliche, pädagogische oder religiös-ethische Motive zugrunde lagen.
Ende des 18. Jahrhunderts fand sich in den Armenhäusern unvorstellbares Elend. Kinder, Alte und Gebrechliche, Verbrecher und Geisteskranke waren dort unter unwürdigsten Bedingungen untergebracht. Zu dieser Zeit starben in den Anstalten mehr als 25% der Kinder vor dem 5. Lebensjahr, in manchen Industriestädten Englands waren es bis zu 50%. Diese Umstände lösten vermehrte Kritik in der Öffentlichkeit aus und in der Folge daran wurden wieder die Vorzüge der Familienpflege hervorgehoben. Gleichzeitig wurde aber auch versucht, die Anstaltspflege neu und menschenwürdiger zu gestalten.
Dieses Jahrhundert war trotz des Elends auch ein Zeitalter großer Pädagogen. In Deutschland entstanden Einrichtungen der Philanthropen6 und erste, am Kind orientierte Ratschläge zur Erziehung wurden niedergeschrieben. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gilt ebenso als Begründer neuer erzieherischer Wertvorstellungen, die bis heute Auswirkungen zeigen. Die politische, wirtschaftliche sowie soziale Situation in dieser Zeit verhinderte aber den Durchbruch einer kindgerechten Anstaltspflege- und Erziehung.
Im 19. Jahrhundert gewannen die Pflegefamilien in der öffentlichen Ersatzerziehung zunehmend an Bedeutung. "Neben den pädagogischen Überlegungen waren wirtschaftliche Gründe maßgebend: Einmal waren Pflegefamilien billiger als Anstalten, zum anderen war das Pflegekind für die Pflegeeltern eine Erwerbsquelle." (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 10f) Die Eignung der Pflegeeltern wurde jedoch nie überprüft und meist waren die Pflegeeltern aus unteren Gesellschaftsschichten und hätten wohl oft für ihre eigenen Kinder Hilfen gebraucht. Auch Kinderarbeit war zu Ende des 19. Jahrhunderts immer noch weit verbreitet, trotzdem schon vereinzelt Kinderschutzgesetze rechtlich verankert waren.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Kinderarbeit vor allem im ländlichen Bereich noch üblich. Pflegekinder wurden als Kostgeher von einem Kostplatz zum anderen gereicht und mußten für ihre Verpflegung hart arbeiten. Diese Kinder waren dem "Wohlwollen" der Erwachsenen ausgeliefert und ihre Not reichte über den Ersten Weltkrieg hinaus. Es war wirtschaftlich notwendig, landwirtschaftliche Arbeitskräfte zu erziehen, um den Bevölkerungsverlust auszugleichen.
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde zwar nach außen die Ideologie der "Familie als Keimzelle des Volkes" vertreten, doch in der Realität war die Familie nur die Produktionsstätte für Kinder, denn die Erziehung wollte die Partei leisten. Rassische Gesichtspunkte und die Überwindung des Individualismus waren wesentliche Erziehungsziele. (Kumer & Friedlmayer & Braun 1988, S. 17f) Daher sind aufgrund der überparteilichen Kontrolle nur wenige Familien bereit gewesen, Kinder in Pflege zu nehmen.
Die österreichische Regisseurin Karin Brandauer hat in ihrem Film "Sidonie" das Schicksal eines, in einer Pflegefamilie aufwachsenden Zigeunermädchens eindrucksvoll geschildert. Sidonie war nach rassistischen Gesichtspunkten dieser Zeit "wertlos" und daher zur Vernichtung im Konzentrationslager bestimmt.
"Wertlos" in diesem Sinne waren auch behinderte Kinder. Sie wurden sowieso nicht für "würdig" befunden, in Familienpflege erzogen zu werden, wenn sie nicht in der Herkunftsfamilie leben konnten. Sie wurden als "bewahrungsbedürftig" in Anstalten gebracht, und ihr weiteres Schicksal ist hinlänglich bekannt. Behinderte Kinder hatten in vergangenen Zeiten kaum die Chance, ein halbwegs normales Leben zu führen, aber ihre gezielte Vernichtung während der Zeit des Nationalsozialismus war einzigartig in der Geschichte. 200.000 bis 275.000 geschädigte Menschen fielen dem Programm zur "Sonderbehandlung der unheilbar Kranken zum Opfer7." (Jantzen 1974, S. 66)
Während der Wiederaufbauzeit der Nachkriegsjahre kommt es zur Massenerziehung in Kinderheimen mit unausgebildeten Erziehern. Erst langsam besinnt man sich wieder auf die schon vor dem Krieg gewonnenen Erkenntnisse psychologischer Forschungen8 in der Fürsorgeerziehung. In den 60er Jahren setzt, ausgelöst durch die Studentenbewegung, der Trend ein, möglichst Kleinheime mit familiärem Charakter und familienähnliche Wohngruppen zu errichten. Aufgrund neuer Überlegungen in der Deprivationsforschung wird erneut die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien gefordert. (Heitkamp 1989, S. 30)
Bis heute haben sich die Prioritäten der Fürsorgeerziehung immer wieder verändert. Wissenschaftliche Erkenntnisse dieses Jahrhunderts haben uns vor allem über die Psyche des Menschen Aufschluß gebracht. Das Bemühen, zum Wohle des Kindes zu handeln, ist somit zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Auch die von Fürsorgemaßnahmen betroffenen Kinder, sind nicht mehr die Findel- und Waisenkinder von damals. Begriffe wie Wohlstandsverwahrlosung, Scheidungswaisen u.a. haben sich breit gemacht. Betroffene Kinder kommen vielfach aus zerrütteten Familien, die, aus welchen Gründen auch immer, in ihrer Funktion als Eltern versagt haben. Es stimmt nachdenklich, wenn man damit konfrontiert ist, wie vielen Erwachsenen es nicht mehr gelingt, ihre Probleme zu lösen.
Ein wesentlicher Anteil an dieser Entwicklung dürfte in einem gesellschaftlichen Trend unserer Zeit zu suchen sein: in der Auflösung familialer Strukturen durch die Infragestellung der Familie als Ort persönlicher Verwirklichung (Beck 1986).
Besonders von Frauen wird auch heute noch verlangt, daß sie sich voll für ihre Familie und für ihre Kinder einsetzen. Gleichzeitig wird ihnen aber auch diesbezüglich Geringschätzung entgegengebracht und speziell über die Medien vermittelt, daß individuelle Verwirklichung nur im Alleingang möglich ist.
Auch ist es für viele Frauen finanziell notwendig, nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten zu gehen, um sich und ihre Kinder versorgen zu können. Dies trifft nicht nur auf alleinerziehende Mütter zu, sondern auch auf viele, im traditionellen Verständnis "vollständige" Familien.
So haben auch "viele minderbegabte junge Frauen [...] nicht die Möglichkeit, sich ein ausreichendes soziales Netz zu schaffen, um entlastet zu werden. Sie lassen deshalb die Kinder, sobald diese schlafen, allein oder vernachlässigen sie auf anderen Gebieten, bis das Jugendamt eingreift. [...] Das Normensystem ist unverläßlich geworden. War es früher selbstverständlich, daß eine 'ordentliche' Frau von früh bis spät Haushalt und Kinder versorgt, so gilt es heute als genauso selbstverständlich, daß man die eigenen Bedürfnisse befriedigt." (Weiler 1989, S. 61)
Die Schere, in die die Frau von heute gerät, ist das Resultat gesellschaftlicher Rollenzuweisung: einerseits selbstverständliche Familienarbeit und vor allem Hausarbeit leisten zu müssen, die zu nie endender Restarbeit zwischen Industrieproduktion, bezahlten Dienstleistungen und technisch perfektionierter Binnenausstattung verkommen ist, - andererseits nicht auf die gesellschaftliche Bestätigung außerhalb der Familie verzichten zu können, gerade wegen dieser "Dequalifizierung der Hausarbeit" (Beck & Beck-Gernsheim 1990, S. 44) und der "Insularexistenz der Kleinfamilie" (ebd.) als auch wegen der eigenen sozialen Absicherung.
Die Rolle der Frau ist in keinem Fall so eindeutig wie die Rolle, die dem Mann in der Gesellschaft zugewiesen wird. Diese Doppelbelastung und das ungeklärte Rollenverständnis der Frau sind auch Ursache dafür, daß die Familie weitgehend ihre Funktion als Ort der sozialen Integration (vgl. Kap. 3.2.) verloren hat.
Frauenarbeit wird in der Familie nicht als professionelle Arbeit honoriert. Erwerbsarbeit ist sichtbar, während die unbezahlte Frauenarbeit im Verborgenen geschieht und somit nicht nur die heimliche Ressource unserer Gesellschaft ist, sondern auch eine Voraussetzung für das Funktionieren unserer Gesellschaft (Schunter-Klemmann 1992).
Zur Anerkennung der Arbeitsleistung der Frau reicht es allerdings nicht, wenn Politiker - gerade in Zeiten wirtschaftlicher Rezession - auf die mütterzentrierte Lebensform ein Loblied singen, und so Frauen wieder in traditionelle Zuweisungen zurückbinden wollen. Denn so wird den Frauen die bisher recht und schlecht erreichte soziale und wirtschaftliche Absicherung wieder genommen. Befürworter dieses konservativen Trends wissen nämlich, daß "eine wirklich durchgesetzte Arbeitsmarktgesellschaft, die allen Frauen und Männern eine eigenständige und ökonomische Existenzsicherung ermöglicht, [...] die Arbeitslosenzahlen hochschnellen lassen [würde]." (Beck & Beck-Gernsheim 1990, S. 46)
Mit diesen Unsicherheiten als Basis versagt - gerade in Belastungssituationen - die Solidarität der gesellschaftlichen sowie der familiären Gemeinschaft, die Verantwortung für das Krisenmanagement wird der Frau überlassen. So wirft auch die Geburt eines behinderten Kindes in erster Linie die Frage auf, wie die Frau dies in ihr Leben integrieren kann, und nicht, wie die Gesellschaft damit als Aufgabe umgeht - meistens wird darin zu diesem Zeitpunkt gar keine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen. Die Frau wird oft in der Trauerarbeit allein gelassen, die sie bei der Geburt eines behinderten Kindes zu leisten hat und die nicht nur ihr Kind betrifft. Niemand hilft ihr bei der Bewältigung ihrer eigenen, unerfüllten Lebensziele.
Inhaltsverzeichnis
Der Begriff "Behinderung" läßt sich nur in der Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Voraussetzungen und vom Blickwinkel der Betrachtung definieren. "Als Phänomene des sozialen Lebens sind die Behinderungen in soziale Wertsysteme eingebettet, die die Gesellschaft mit einem hohen Grad von Allgemeinverbindlichkeit als Konventionen entwickelt haben. Welche Eigenschaft oder Zuständigkeit als behindernd empfunden wird, ist also abhängig von allgemeinen Wertsetzungen, Erwartungen, Gewohnheiten usw." (Bächtold 1981, S. 23)
Mit der Erkenntnis, daß die Definition von Behinderung nur in der Bezogenheit auf die jeweilige Lebenswelt ihre Gültigkeit hat, entspricht die Sozial- und Integrationspädagogik jener Tendenzwende der Erziehungswissenschaften, die als "Alltagswende" bezeichnet wurde (vgl. dazu Hierdeis & Hug 1992). Diese Wende ist gekennzeichnet durch die Ablehnung übergeordneter Normen und sicherer Klassifikationsgrundlagen, die Abkehr von allgemeinen Theorien und die Rückbesinnung auf die Einzigartigkeit der jeweiligen Lebensform, und stellt die Forderung nach vermehrter Praxisrelevanz für erziehungswissenschaftliche Theorien: um einer Entfremdung der Wissenschaft vorzubeugen, kann nur die Lebenswelt als einzige Basis der Letztbegründung gesehen werden. Die Hinwendung der pädagogischen Forschung zum Alltag zeichnet sich also vor allem dadurch aus, daß sie sich qualitativ am beteiligten Subjekt orientiert und sich nicht von vornherein auf abstrakte universelle Werte beruft.
Die Konsequenz, die sich daraus für das Verständnis von Behinderung ergibt, läßt sich umschreiben mit: weg von distanzierenden Beurteilungen, weg von defektologischen Klassifizierungen und verallgemeinernden Etikettierungen (vgl. Kap. 3.1.1.)
Wie läßt sich die Alltagswende in der Erziehungswissenschaft - neben ihren Konsequenzen für die Theorie und Diagnose von Behinderung - auch auf die Praxis der Sozialpädagogik umsetzen? Läßt sich daraus auch ein Verständnis von Integration gewinnen, im Sinne einer "Alltagsintegration", die als Prozeß verstanden wird, der die alltägliche Lebenswelt einschließt? Belege für ein solches Konzept von Alltagsintegration lassen sich sowohl im Normalisierungsprinzip (vgl. Kap. 3.1.2) als auch in der Forderung nach Selbstbestimmung (vgl. Kap. 3.1.3) finden.
Allgemein läßt sich feststellen, daß das gesellschaftliche Verständnis für behinderte Menschen von sozialer Distanzierung geprägt ist. Das kann sich u.a. auch darin zeigen, daß Personen mit einer negativen Einstellung zu Behinderten den persönlichen Kontakt meiden, auf der unpersönlichen Ebene jedoch die institutionalisierten Hilfestellungen befürworten oder gar finanziell unterstützen (um einem gegebenenfalls doch auftretenden Gewissenskonflikt aus dem Weg zu gehen).
Helmut von Bracken (1979, S. 424) weist dieses gesellschaftliche Distanzverhalten in einer Untersuchung nach, die bestätigt, daß zwei Drittel der von ihm ausgewählten Probanden ein eigenes Kind mit einem geistigbehinderten Kind spielen lassen würden, etwa über ein Drittel ein geistigbehindertes Kind für kürzere Zeit aufnehmen würde und nur 3,5% ein geistigbehindertes Kind adoptieren würden. Ebenso befürworteten zwei Drittel der Befragten eine Unterbringung in Anstalten oder Heimen, möglichst abgeschlossenen und abgelegen. Der Großteil der Bevölkerung war jedoch zu wenig informiert und hielt auch u.a. aus Ängstlichkeit Distanz. Bei Menschen, die ein geistigbehindertes Kind in ihrem Umfeld kannten, war die Einstellung eine andere.
Jürgen Wendeler (1993, S. 49) kritisiert an Untersuchungen, u.a. an jenen von Helmut v. Bracken, die Annahme einer "festgelegten Einstellung der Bevölkerung" und entgegnet, daß gegenwärtig Unsicherheit und Unklarheit im Verhalten der Menschen eher vorherrschen. "Viele Menschen sind zwar guten Willens, und auch die moralischen Appelle haben sie erreicht, aber sie wissen nicht recht, wie sie mit ihren geistig behinderten Mitmenschen umgehen und welche Einstellungen sie ihnen gegenüber einnehmen sollen [...]." Jürgen Wendeler beanstandet vor allem auch Untersuchungen, die durch Festschreibungen und Zuordnungen ein pauschales Urteil abgeben und somit eine "Etikettierung" fördern. So ist es wahrscheinlich, daß durch diese Etikettierung die soziale Isolation behinderter Menschen verstärkt, oder gar erst herbeigeführt wird. "Wer die soziale Integration fördern will, der solle am besten auf solche Etikettierungen ganz und gar verzichten." (ebd., S. 50)
Wir sind in unserer Gesellschaft gewohnt, alles und jedes irgendwo zu- oder einordnen zu können. Dies ist im Zusammenhang mit unserem Bedürfnis zu sehen, in der Suche nach Begründungen und Erklärungen in einem System von "Schubladen" zu denken. Wir orientieren uns an passenden, in unserem Denken bereits vorhandenen Schubladen, in die sich unsere Wahrnehmungen einordnen lassen. Nur zögernd legen wir neue Schubladen an: wir sind dann in unserem Weltverständnis so lange beunruhigt, bis wir eine passende Erklärung bzw. Möglichkeit der Zuordnung unserer Wahrnehmungen gefunden haben. Von diesem "Schubladendenken" sind auch und gerade unsere Mitmenschen betroffen. Denn besonders die soziale Wirklichkeit ist im alltäglichen Zusammenleben diesem Schubladendenken unterworfen, weil ihre Beurteilung viel unsicherer und fließender (also qualitativ) geschieht als die Beurteilung von anderen ökonomischen, quantifizierbaren Tatsachen. Wenn wir erst einmal eine Lade gefunden haben, in die sich etwas einordnen läßt, dann sind wir erleichtert und es ist uns gar nicht mehr so wichtig, ob wir auch die richtige gewählt haben: Hauptsache, wir können sie schließen.
Wir ordnen und werten gleichzeitig und bestimmen die Lösungen, ohne deren Berechtigung bzw. ohne auch die erstellte Ordnung und ihre Auswirkungen anzuzweifeln. Den Anfang setzen wir mit übereilten Diagnosen, das Ende ist oft für den Betroffenen fatal. Besonders geistigbehinderte und psychisch kranke Menschen stehen in diesem Lösungs-, Ordnungs- und Wertesystem an letzter Stelle und dies, obwohl sie am meisten auf eine Lobby angewiesen wären.
Jedenfalls zeigt sich hier, daß das allgemeine Verständnis von Behinderung nicht nur mit medizinisch-defektologischen Erklärungen abzutun ist, sondern auch - und vor allem - eine gesellschaftliche Zuschreibung beinhaltet, die es im Umgang mit "Behinderung" auch als gesellschaftliches Konstrukt erst einmal zu berücksichtigen gilt.
Georg Theunissen (1991) spricht davon, daß die ganzheitliche Orientierung am Menschen und an seinem sozialen Bezugssystem "Ausdruck der ökologischen Wende oder des systemischen Denkens ist, das mittlerweile viele Wissenschaften erfaßt hat." (Theunissen 1991, S. 29) Der wesentliche Unterschied zum medizinisch-defektologischen oder auch kausalen Ursache-Wirkung-Denken besteht darin, "daß nicht mehr ausschließlich oder vorrangig der behinderte Mensch, sondern stets auch das soziale Bezugsfeld, d.h. der behinderte Mensch in seiner Lebenswelt als Adressat oder Gegenstand der Heilpädagogik begriffen wird." (ebd.)
Zur Zeit ist jedoch, aufgrund der wirtschaftlichen Rezession und der "Negativstimmung" in der Gesellschaft, sowie der momentanen Sozialpolitik, eher ein Rückwärtstrend im Verständnis von manchen, schon längst als selbstverständlich betrachteten, Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zu beobachten.
Rechte und Zugeständnisse an behinderte Menschen, sowie Erklärungen und Begründungen für Unterstützungen, werden wieder mehr denn je hinterfragt, wodurch unvermeidlich von neuem, an medizinisch-defektologischem Denken und Begutachten festgehalten wird, oft auch aus der Notwendigkeit heraus, lebenswichtige Unterstützungen durch die öffentliche Hand gewährt zu bekommen. Der Lebensraum oder auch Spielraum für den einzelnen wird wieder enger, und den letzten beißen bekanntlich die Hunde.9
Deshalb ist sowohl die Pädagogik, als eine am Menschen und seiner Lebenswelt orientierte Wissenschaft, als auch jeder einzelne aufgerufen, weiterhin Abstand von abstrakten Normen und Klassifikationen zu nehmen, da es "primär um das geht, was aus einem Menschen seiner Möglichkeit nach werden kann und wiederum erst in zweiter Linie um das, was er im Moment gerade ist." (Feuser, 1992, S. 256)
Im Sinne dieses Prinzips hat der Däne Niels Erik Bank-Mikkelsen Ende der 50er Jahre Normalisierung definiert als "die Annahme geistig behinderter Menschen samt ihrer Behinderung, wobei ihnen dieselben Lebensbedingungen zur Verfügung stehen sollen wie anderen Menschen, einschließlich der zu ihrer bestmöglichen Entwicklung notwendigen Behandlung und Ausbildung." (zitiert nach: Bernard & Hovorka 1992)
Normalisierung bedeutet jedoch nicht nur die Anpassung an bestehende Normen. Jürgen Wendeler (1993) verweist auf die Erweiterung des Normalisierungsgedankens durch Wolfensberger (1972), der die Forderungen des Normalisierungsprinzips, die sich ursprünglich in sehr konkreter Weise vor allem gegen die Zustände in Anstalten gerichtet haben, ergänzt und systematisiert hat. Er unterscheidet sechs verschiedene Wege, die zur Normalisierung führen.
-
Person - Interaktion: Normale Fähigkeiten und Gewohnheiten aufbauen (z.B. Begrüßungsregeln erlernen).
-
Person - Interpretation: Geistigbehinderte Menschen so vorstellen, daß ihre Normalität und nicht der Unterschied zu anderen Menschen hervorgehoben wird (z.B. unbekannte geistigbehinderte Erwachsene in der Sie-Form anreden).
-
Primäre Sozialsysteme - Interaktion: Soziale Systeme wie Schule, Arbeitsplatz, Familie, Nachbarschaft schaffen oder stabilisieren, damit behinderte Menschen normale Gewohnheiten lernen können.
-
Primäre Sozialsysteme - Interpretation: Die primären Sozialsysteme für Menschen mit geistiger Behinderung so gestalten und darstellen, daß sie so normal wie möglich erscheinen (z.B. Wohnmöglichkeiten so gestalten, daß sie nicht wie Kasernen, Krankenhäuser oder Gefängnisse aussehen).
-
Gesellschaftliche Systeme - Aktion: Eine Gesetzgebung schaffen, auf deren Grundlage Sozialsysteme entstehen können, die eine Normalisierung ermöglichen.
-
Gesellschaftliche Systeme - Interpretation: Kulturelle Werte und Einstellungen in der Weise aufbauen und weiterentwickeln, daß Normalisierung theoretisch vorbereitet und begründet wird. (Wolfensberger, zit. in: Wendeler 1993, S. 25)
Der Normalisierungsgedanke allein reicht nicht aus, er muß durch Erfahrungsprinzipien ergänzt werden, um auch den Schutz des geistigbehinderten Menschen durch den Grundsatz "so normal wie möglich" zu gewährleisten. "Auch wer kein Kulturpessimist ist, wird gelegentlich bezweifeln, daß das, was normale Menschen normalerweise tun, immer das Richtige ist, und er wird befürchten, daß es behinderten Menschen nicht unbedingt guttut, wenn sie es ihnen gleichtun wollen." (ebd., S. 26)
"Alle hatten es gut gemeint. Eltern und Fachleute hatten die beste Umwelt gestaltet. Aber sie gaben vor, sie setzten ihre Lebensqualität als Maßstab." (Bruckmüller 1993, S. 71)
Geistig behinderte Menschen sind ein Leben lang mehr oder weniger auf die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen angewiesen. Das heißt, daß sich meist Fremde Gedanken über eine "sinnvolle Lebensgestaltung" machen, sowie zu "sinnvoller Tätigkeit anleiten" wollen. So "behindert" z.B. die Unterbringung in Heimen ein selbstbestimmtes Leben durch die notwendige Unterordnung, da meist unhinterfragbare Regeln vorgegeben sind. Eine andere Form der Fremdbestimmung behinderter Menschen ist die lebenslange Bindung an das Elternhaus.
Vor allem der geistigbehinderte Mensch wird so auch als Erwachsener wie ein Kind behandelt - und die Forderung nach selbstbestimmter Lebensform bleibt auf der Strecke: "Betrachtet man den Einzelnen [...] als jemanden, der ein ewiges Kind bleibt, so bedeutet das, daß man den heiklen Augenblick, in dem man sich mit ihm als einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft auseinandersetzen muß, auf ein unbestimmtes Morgen verschiebt." (Sorrentino 1988, S. 25)
Was beinhaltet aber der ethische Anspruch eines selbstbestimmten Lebens für Behinderte? Dieser Anspruch ist im Sinne "der Ermöglichung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens [...]" zu verstehen und bezieht sich auf Menschen, "die bedroht sind, die Achtung ihrer Menschenwürde zu verlieren und in soziale Isolierung zu geraten." (Speck 1993, S. 80) Trotzdem darf nicht übersehen werden, daß mit der Ermöglichung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens zwar ein abstraktes Grundrecht der Lebensqualität gesichert ist, die konkreten Bedürfnisse des einzelnen jedoch solange nicht berücksichtigt sind, solange der Lebensraum nicht als "individualisiert und als zugehörig erfahren" werden kann. (Brückmüller 1993, S. 75)
Individuelle Lebensqualität und Selbstbestimmung können Geistigbehinderte demnach erst dann erreichen, wenn wir, die wir mit ihnen leben, nicht über ihren Kopf hinweg Entscheidungen treffen, sondern sie möglichst in ihre Lebensgestaltung einbeziehen und sie dabei unterstützen, für sich selbst zu sprechen. "Es ist ein moralisches Gebot, daß sich professionelle Hilfe tunlichst überflüssig zu machen hat, daß sie - sei es als Erziehung, Förderung oder Therapie - sich als Unterstützung für das In-Gang-bringen und Stabilisieren von Eigensteuerungsprozessen zu verstehen hat." (Speck 1993, S. 82)
Da geistigbehinderte Menschen allerdings in der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse auf Mitmenschen als "Vermittler" angewiesen sind, ist es notwendig, aufmerksam zu sein, um auch nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten erfassen und verstehen zu können. In diesem Zusammenhang geben uns Handlungen eindeutigere Informationen als die uns geläufige verbale Auseinandersetzung. "Es sind die individuellen Handlungen der Betroffenen, in denen sich ihr eigenes Verständnis von Lebensqualität, ihre Empfindungen, Meinungen und ihr Lebensverständnis für uns offenbaren. Es liegt also an uns, diesen persönlichen Ausdruck zu erkennen, zu akzeptieren und zur Grundlage unserer Vorgaben zu machen." (Bruckmüller, 1993, S. 70)
Mit den Prinzipien der Normalisierung und Fremdbestimmung entspricht die Integrationspädagogik auch dem Paradigma der Alltagsorientierung in der Erziehungswissenschaft allgemein: eingehen auf individuelle Lebenswelten, ihren Horizont ausloten, ihre verborgenen Möglichkeiten freilegen, kompensierende Lebensbewältigungsstrategien zulassen und diese nicht nur den gegebenen gesellschaftlichen Normen und Etiketten anpassen. So rechtfertigt sich auch der Begriff "Alltagsintegration".
Soziale Integration bedarf - wenn sie ernst gemeint ist - der gesellschaftlichen Veränderung. Damit soziale Integration nicht nur gefordert, sondern auch gelebt werden kann, gilt es, dort mit Integration anzusetzen, wo die systematische Ausgrenzung beginnt: beim behinderten Kind, das oft um den Preis seiner Rehabilitation, sowohl aus der Sichtweise der Leistungsgesellschaft als auch aus verschiedensten sozialen und medizinischen Begründungen - natürlich immer zu seinem vermeintlichen "Wohl" - isoliert und ausgegrenzt wird. Dabei wurde früher, und wird auch heute noch, kaum Rücksicht darauf genommen, daß gewachsene soziale Kontakte unwiderruflich verloren gehen.
Für jedes Kind ist es wichtig, in einer familiären Struktur aufzuwachsen, und besonders behinderte Kinder brauchen - um ihr Leben bewältigen zu lernen - keine starren Strukturen institutioneller Betreuung, sondern ein flexibles und lebenspraktisches Umfeld sowie Bezugspersonen, die offen sind für Veränderungen und bereit sind, sich auf die Möglichkeiten des behinderten Kindes einzulassen.
Es müßte also gerade dort Verantwortung übernommem werden, wo sich der gesellschaftliche Druck am meisten auswirkt: Beim behinderten Kind und seiner Familie und dort vor allem bei den von diesem "Schicksal" betroffenen Frauen, da sich die Haltung der sie umgebenden Lebenswelt unmittelbar auf das Kind und seine Chancen für ein lebenswertes Leben auswirken. Es wird Frauen schon unter normalen Bedingungen schwer gemacht, ihr Leben zu gestalten, wenn sie jedoch in unserer patriarchal-leistungsorientierten Gesellschaftsstruktur einem behinderten Kind das Leben schenken, sind die Verachtung und Hilflosigkeit die ihnen und ihren Kindern entgegengebracht werden, sowie das "Alleingelassensein" so groß, daß sie unmittelbar in eine Lebenskrise geraten müssen. Denn die Schuldzuweisungen durch die Gesellschaft oder durch ihre Familien gehen in erster Linie an die Frauen: ein behindertes Kind zu haben, kommt ihrer gesellschaftlichen Vernichtung gleich.
Dietmut Niedecken (1989) bezeichnet die Schuld, mit der Mütter von geistig behinderten Kinder beladen und alleingelassen werden, als "gesellschaftlichen Mordauftrag". "Die Umwelt lädt die kollektiven Mordphantasien in solchen Inszenierungen auch noch zusätzlich auf ihnen [den Müttern] ab. Es ist der Haß eines ganzen Volkes, der zu unsäglichen Verbrechen geführt hat, den sie jetzt allein tragen sollen, und das können sie nicht. So wachsen die Schuldgefühle (für eine Schuld, die nicht die ihre ist, an der sie aber, wie wir alle, teilhaben) ins Unermeßliche." (Niedecken 1989, S. 55)
Solange sich hier nicht grundlegende gesellschaftliche Veränderungen ergeben, kommt die Forderung nach Integration und Normalisierung nur Lippenbekenntnissen gleich. D.h. nun aber nicht, daß wir uns jetzt in der gesellschaftlichen Anonymität - ohnmächtig und resignierend im Handeln - ergeben können, sondern fordert das Umdenken jedes einzelnen.
Genauso entlasten auch allgemeine Grundsätze über Fremd- und Selbstbestimmung den einzelnen nicht, selbst im Umgang mit behinderten Mitmenschen den richtigen Weg zu finden. "Unter den heute herrschenden Verhältnissen schreiben [zwar] nicht nur wir selbst im Prozeß unserer Persönlichkeitsentwicklung unsere eigene Biographie; sie wird auch immer geschrieben. Dennoch: Wer und wieviel uns die gesellschaftlichen Verhältnisse ins Stammbuch des eigenen Lebens schreiben, bestimmen nur wir und können nur wir bestimmen. Es ist menschlich, einen hohen Grad von Mitbestimmung nicht zu erreichen und es ist menschenmöglich, aber nicht menschlich, Menschen so auszuschließen und zu unterdrücken, daß ihre Selbstbestimmung verhindert oder vernichtet wird." (Feuser 1992, S. 253)
Somit sind gesellschaftliche Veränderungen stets Selbstveränderungen, und gesellschaftliche Verantwortung bedeutet auch Eigenverantwortung, die aber nur wahrgenommen werden kann, wenn behinderte Kinder und Erwachsene zusammen leben lernen. Es geht darum, behinderte Kinder und auch Erwachsene nicht einfach "wegzudenken", indem wir sie irgendwo mit "ihresgleichen" ausgrenzen und rund um die Uhr mit (teuren) therapeutischen Beschäftigungsangeboten versorgen. Es gilt, das behinderte Kind in das normale alltägliche Leben, mit all seinen Vor- und Nachteilen zu integrieren, das Leben gemeinsam zu gestalten und nicht, die Integration per Therapie zu verordnen, weil dies vielleicht der bequemere und einfachere Weg ist, der jedoch nicht selten in einer institutionellen Verwahrung endet.
Es wird auch zum heutigen Zeitpunkt immer mehr gefordert, behinderte Kinder in der Familie aufwachsen zu lassen. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, unter welchen Umständen Eltern ihre behinderten Kinder oft Institutionen überantworten müssen und wie schwer ihnen dieser Schritt meistens auch fällt, d.h. sie haben in unserem gesellschaftlichen System oft gar keine andere Wahl. Also müßte diese Forderung automatisch auch die Forderung nach gesellschaftlicher Hilfe einschließen. "Denn wenn es, wie bekannt, schon anstrengend sein kann, nichtbehinderte Kinder zu versorgen und zu erziehen, so fordert es alle Kräfte, ein behindertes Kind großzuziehen." (Wendeler 1993, S. 29)
Eltern behinderter Kinder werden ständig Ratschläge erteilt: So erfahren sie von den einen, daß sie ihr Kind überfordern oder überbehüten, von den anderen müssen sie sich sagen lassen, daß sie ihr Kind unterfordern, vernachlässigen oder ablehnen. Egal wie sie es machen, irgendwie machen sie es immer falsch. "Tatkräftige" Hilfe und Entlastung wäre folglich oft besser angebracht als "gute" Ratschläge.
Ob der Familie jedoch die Bewältigung des Problems, ein behindertes Kind zu haben gelingt, ist abhängig von mehreren Faktoren, u.a. von der Problemlösungskompetenz der Eltern, von ihrer Lebensphilosophie, von Hilfen durch die soziale Umwelt, von Werthaltungen und nicht zuletzt von finanziellen Mitteln.
Gelingt es der Familie, trotz dieser Belastung ein harmonisches und gesundes Gleichgewicht auch zur sozialen Umwelt herzustellen, dann steht der positiven Persönlichkeitsentwicklung des behinderten Kindes nichts im Wege.
"Die Anpasssung des behinderten Kindes erfolgt im allgemeinen nicht dadurch, daß es - nur mühsamer - die gleichen Ziele erreicht, sondern durch die Kompensation seiner Schwierigkeiten und durch ihre Verarbeitung. Dies kann aber nicht in den nur auf den Behinderten eingestellten Institutionen geschehen. Das Leben im Bereich der normalen sozialen Umwelt stellt die stärkste Motivation zur Anpassung, zur Nachahmung und zur Selbstbeurteilung dar." (Roser 1983, S. 158)
Wenn die Herkunftsfamilie aus bereits erwähnten möglichen Belastungen (vgl. Kap. 4.4.3) diese Bedingungen nicht erfüllen kann, dann soll das behinderte Kind trotzdem die Möglichkeit haben, in einem familiären Rahmenÿ- z.B in einer Pflegefamilie - aufzuwachsen, da Integration nur dort wirklich möglich ist, wo Menschen "selbstverständlich" miteinander den Alltag bewältigen.
Integration ist für uns als heilpädagogische Pflegefamilie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Alltagsrealität zu sehen. Integration ist nicht ein in der Ferne liegendes Ziel, das irgendwann einmal erreicht werden soll, sondern ein Prozeß, der aus dem alltäglichen Zusammenleben in der Familie entsteht - individuell und ohne ausdrücklichen Auftrag. Integration bedeutet: in Beziehung treten zueinander, abhängig sein voneinander, im Sinne der Verantwortung für eine gemeinsame Sache.
Die Familie ist ein flexibles Sozialisationssystem, das schon allein durch die unterschiedliche Zusammensetzung der in ihr lebenden Personen, behinderten Kindern mehr Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, sowie der sozialen Erfahrungen und Mitbestimmung bieten kann, als dies in einem institutionellen Rahmen überhaupt möglich ist.
Einerseits sind die Solidarität und der persönliche Einsatz in einer Familie höher, gleichzeitig werden andererseits aber auch Grenzen des Systems für den einzelnen spürbar und erfahrbar. Das Wir-Gefühl ist stärker und jeder trägt Verantwortung für den anderen. Die heilpädagogische Familie schafft in ihrem kleinen geschützten Rahmen die Voraussetzungen für selbstbe-stimmtes Leben, die so nicht therapeutisch erarbeitet werden müssen, sondern sich mit normalen Alltagssituationen verbinden lassen.
Im System "Familie" spiegeln sich, bedingt durch den ständigen Austausch mit der Umwelt, gesellschaftliche Veränderungen. Aufgrund dieser Vernetztheit ist es auch für behinderte Kinder möglich, Leben als etwas Selbstverständliches zu erleben. Kontakte nach außen wachsen mit, je nach den Bedürfnissen des Kindes. Dadurch wird die Forderung nach Integration auch im Verständnis des Normalisierungsprinzips (vgl. Kap. 3.1.2) zu einer lebbaren Realität.
Im familiären Zusammenleben ergeben sich für ein Kind überschaubare Handlungszusammenhänge, die es, aufgrund ihrer lebenspraktischen Ausrichtung, leichter verstehen lassen, was von ihm gefordert wird und warum es etwas Bestimmtes tun soll. Gleichzeitig lernt auch das behinderte Kind - seinen Möglichkeiten entsprechend - Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, wenn es merkt, daß es damit Einfluß auf die ganze familiäre Gruppe hat und die Gestaltung des Zusammenlebens mitbestimmt. Erst dann ist ein erster Schritt in die Selbständigkeit möglich. Diese Selbständigkeit ist im Vergleich zu gesunden Kindern wesentlich schwieriger zu erreichen, es ist ein lang dauernder Prozeß, der nicht erst nach einer isolierten und verwahrten Kindheit beginnen kann.
Bedingungen des Aufwachsens und Lebens können behinderte, wie auch nichtbehinderte Menschen, in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung hemmen. Zum Erlernen von Autonomie und Handlungskompetenz sind sowohl die "personale" als auch die "soziale Integration" als einander bedingende Voraussetzungen zu sehen. Entwicklung von Identität ist ohne Sozialbezug und Sozialisation nicht denkbar. "So kann sich z.B. die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen, die wir als eine allseitige und harmonische Entfaltung der im Individuum angelegten Möglichkeiten begreifen, nur im sozialen Kontext und im praktischen Handeln äußern." (Theunissen 1991, S. 84)
Begreift man den Weg zum Erwachsenwerden auch für geistigbehinderte Menschen als "Emanzipations-, als Entwicklungs- oder Lernvorgang" der von individuellen und sozialen Gegebenheiten abhängig ist, dann ist dieser Weg "anthropologisch gesehen für alle gleich." (ebd., S. 39) Auch schwer geistigbehinderte Kinder und Erwachsene erreichen Autonomie, immer bezogen auf die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse, sowie die soziale Verbundenheit. Da sie jedoch in ihrer Autonomie und Handlungskompetenz meistens auf die lebensbegleitende Unterstützung und Anregung von außen angewiesen sind, liegt es an unserem Verständnis und Einfühlungsvermögen, wie weit wir lebensbegleitend und partnerschaftlich Autonomie und selbstbestimmtes "Er-Leben" zulassen.
Unser Eindruck, im Umgang mit schwer geistigbehinderten Kindern und Erwachsenen, ist zwar meist der, daß sie sich auf einem frühen kindlichen Entwicklungsniveau befinden, trotzdem ist es jedoch grundsätzlich falsch, ihre Handlungskompetenz und ihre Bedürfnisse mit dem Verhalten und Erleben von nichtbehinderten Kleinkindern zu vergleichen. In der Begegnung mit geistigbehinderten Mitmenschen ist es erst einmal notwendig, ihnen so zu begegnen wie anderen Mitmenschen auch. Bei näherem Kennenlernen gilt es - ebenso wie im Umgang mit nichtbehinderten Menschen - Eigenheiten zu respektieren, individuelle Erfahrungen zu berücksichtigen, die Lebensgeschichte, sowie den momentanen sozialen Kontext, zu beachten.
Soziales Lernen wird sich immer an den Bedingungen orientieren, die mir als Individuum während meines Aufwachsens geboten werden. Wie weit ich als Person respektiert und geachtet werde und Raum für Bestätigung und Anerkennung finde, desto leichter wird es mir - auch als behinderter Mensch - fallen, Erwartungen, die an mich gerichtet sind nachzukommen, auch wenn dies mit viel mehr Mühen verbunden ist als bei nichtbehinderten Menschen. Wenn man diese Bedingungen nicht leichtfertig übergeht, dann zeigt sich gerade auch in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des familiären Aufwachsens und damit als wesentliches Faktum die Kontinuität der Bezugspersonen, - dies auch in weiterer und systemischer Bedeutung.
Soziales Lernen kann auch nur langfristig und über eigene Erfahrung stattfinden und nur unter Bedingungen, die "menschliche Emanzipation" zulassen. "Lebenswelt und individuelle Entwicklung wirken somit in ihrer gegeseitigen Bedingtheit und müssen als Einheit erkannt und berücksichtigt werden." (Theunissen 1991, S. 30)
In der Familie ist es auch möglich, daß jüngere nichtbehinderte Kinder von älteren, auch geistigbehinderten Kindern, durchaus etwas lernen können (So hat Timo seinem Bruder schon vor der Schule das Weben gelernt, worauf dieser sehr stolz ist). Es bleibt also im familiären Kontext mehr Raum für Selbstbestätigung, obwohl das gesellschaftliche Leistungsdenken nicht ausgeblendet ist, wie dies im institutionellen Rahmen öfter der Fall ist.
In der Familie erfährt das geistigbehinderte Kind Zusammenhänge besser, da es Auswirkungen seines Handelns aufgrund des unmittelbaren Erlebens eher begreifen und verstehen kann. Gleichzeitig lernt es im familiären System soziale Regeln auf verschiedenen Ebenen, lernt sich behaupten und unterordnen.
Weiters werden, da individuell, von mehreren Familienangehörigen (vom Baby bis zur Oma, jeder auf seine eigene Art und Weise) gefördert werden kann, kleine Lernschritte kaum übersehen und vieles kann spielerisch in den Alltag eingebunden werden. Wahrscheinlich wird das geistigbehinderte Kind, da es auf vielen Ebenen angesprochen wird, zugleich motiviert, eigene Überlebens- und Kompensierungsstrategien zu finden. (Timo hat auch seine jüngeren Geschwister manchmal aus Gefahrensituationen befreit: wenn sie z.B. als Kleinkinder irgendwo hinaufgekrabbelt sind, hat er sich schützend vor sie gestellt und hat auch dort Verantwortung übernommen, wo wir es ihm von vornherein nicht zugetraut hätten.) So sind behinderte und nichtbehinderte Kinder füreinander eine Bereicherung. Sie gehen miteinander viel unbekümmerter um und sind viel spontaner als Erwachsene. Die vielfältigen (Er-)Lebensmöglichkeiten - und ihr Bezug zum Alltag -, mit denen ein Kind während des Aufwachsens in einer Familie konfrontiert wird, lassen sich in keinem institutionellen Rahmen nachvollziehen.
Gerade deswegen gehört auch sehr viel Mut dazu, mit "dem Behinderten durch Versuch und Irrtum auszuloten, was nun tatsächlich an selbständigem, autonomen Verhalten im Einzelfall möglich ist. Versuch und Irrtum bedeuten aber auch Angst und Besorgnis und sehr viel mehr persönlichen Einsatz und Durchhaltevermögen als Überfürsorge." (Sorrentino 1988, S. 67) Die Gratwanderung zwischen Autonomie und Hilfestellung ist für leibliche Eltern, als auch für Pflegeeltern meist nicht alleine zu bewältigen und bedarf der Unterstützung und Beratung eines fachlich geschulten Teams um Verantwortung gemeinsam tragen zu können.
Miteinander leben lernen gelingt wahrscheinlich, bezogen auf das weitere soziale Bezugssystem, in einer dörflichen Gemeinschaftsstruktur, wo jeder jeden kennt, eher als im städtischen Bereich, da hier alle Kinder noch mehr Bewegungsfreiraum haben. Es ist auch erstaunlich, wieviele Leute Verantwortung übernehmen, wenn sie das behinderte Kind bzw. den späteren Erwachsenen schon länger kennen und um seine Eigenheiten Bescheid wissen. Und je älter ein behindertes Kind wird, desto wichtiger sind gewachsene Kontakte im sozialen Umfeld (zum Kaufmann, zu Nachbarn, zu Bekannten, zu anderen Kindern, u.a.), denn dadurch ist es auch geistigbehinderten Menschen möglich, Selbständigkeit zu leben und doch Hilfe zu erhalten, wenn es nötig ist.
So haben wir z.B. - als Timo vor einem Jahr begann, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen - die Erfahrung gemacht, daß sich die Autobuschauffeure sehr engagiert um Timo gekümmert und ihn auch in ihr Büro zu einer Tasse Kaffee eingeladen haben, wenn er den Bus versäumt hatte; Auch, als ich mich einmal im Lebensmittelgeschäft des Ortes bei der Verkäuferin erkundigte, ob es auch in Ordnung geht, wenn Timo einkaufen kommt, antwortete sie darauf, daß andere Kinder auch einkaufen gehen, und wenn er sich nicht auskennt, würde sie ihm schon weiterhelfen. Es gäbe noch einige Geschichten aus der Praxis zu erzählen, die in ihrer Aussage vor allem eines verdeutlichen: Integration läßt sich in ihrem Anliegen nicht als Forderung, sondern nur als Prozeß begreifen.
Als ständiger Prozeß und nicht als fixe Gegebenheit ist auch die Struktur des familiären Systems zu verstehen. Die Familie ist in ihrem Wirken durch ständige Veränderungen gezwungen, sich immer wieder neu zu organisieren, um ihr Gleichgewicht zu halten. Insofern läßt sich natürliche, lebensnahe Integration als Wechselspiel in der familiären Kommunikation begreifen. Kinder stellen Erwartungen an ihre Eltern, und Eltern stellen Erwartungen an ihre Kinder. Sie erteilen sich gegenseitig Aufträge und setzen sich gleichzeitig gegenseitig Grenzen. Aus diesem ständigen Wechselspiel entsteht eine Form des Zusammenlebens, in der Integration nicht nur gefordert wird, sondern gelebt.
Damit familiäre Integration nicht am Ende der Schulzeit zur Überfürsorge wird, und den behinderten Menschen in seiner Entwicklung stagnieren läßt, ist es nun notwendig, das soziale Bezugssystem zu erweitern und die Kompetenzen zur Alltagsbewältigung zu fördern. Dabei stößt man zum Zeitpunkt der beruflichen Integration speziell bei uns in Österreich auf neue, oft unüberwindbare Hürden. Das Unternehmen "berufliche Integration" kann kaum von einer Familie im Alleingang bewältigt werden. Unterstützung durch professionelle Helfer ist auf mehreren Ebenen notwendig.
Wenn berufliche Integration jedoch trotzdem nicht gelingt, bleibt letztlich der Weg zurück in die "Verwahrung" nicht erspart. Nur dann fragt niemand mehr, wie ein Mensch, der jahrelang gewohnt war individuell und selbstbestimmt zu leben und sich auf seine Weise im Leben zurechtzufinden, mit dieser Tatsache leben kann. "Im Verlauf der Jahre kann man ein fortschreitendes Nachlassen der Bemühungen bei allen sozialen Einrichtungen jenen gegenüber feststellen, bei denen keine Hoffnung auf Besserung besteht und die lediglich der Hilfe und Unterstützung bedürfen. [...] Der Vorgang des Vergessens tritt ein, je älter der Behinderte wird." (Sorrentino 1988, S. 25) Isolation ist oft der angenehmere und bequemere Weg.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Forschungsansätze
- 4.2 Das Prinzip der Ersatzfamilie als Ergebnis der individuumzentrierten, entwicklungspsychologischen Sichtweise
- 4.3 Das Prinzip der Ergänzungsfamilie als Ergebnis der systemischen Sichtweise
-
4.4 Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Konzepte
- 4.4.1 Konsequenzen für das Pflegekind - Ausgangslage und Folgerungen für neue Bindungen in der familiären Praxis
- 4.4.2 Aus dem Tagebuch von Klaus über die erste Zeit mit Timo
- 4.4.3 Konsequenzen für die Herkunftsfamilie
- 4.4.4 Konsequenzen für die Pflegefamilie
- 4.4.5 Konsequenzen für die Dynamik der Geschwisterbeziehungen in der Pflegefamilie
- 4.5 Voraussetzungen für die positive Gestaltung einer doppelten Elternschaft
- 4.6 Zusammenfassung mit Blick auf die Praxis
Wissenschaftliche Forschungen im Pflegefamilienwesen wurden erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts durchgeführt und waren primär auf die Erforschung der Beziehungen zwischen Pflegekindern und Pflegemüttern gerichtet. Die Rolle des Pflegevaters ist bis heute noch unzureichend thematisiert. Unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg wurde zu Beginn der 50er Jahre vor allem auf die psychischen Folgen der Verwahrlosung und die damit verbundenen Störungen im Bindungsverhalten von Heimkindern hingewiesen. Ren‚ Spitz, Sigmund Freud, John Bowlby und andere machten diese Thematik zum Gegenstand der Forschung (Literaturangaben in: Kötter 1994, S. 96).
Bowlbys Forschungsergebnisse zum Bindungsverhalten von Kleinkindern sowie die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie von Freud bilden heute wesentliche Grundlagen der Pflegefamilienforschung, wobei der Sozialisation von Kindern in Pflegefamilien noch wenig Beachtung geschenkt wird. Seit den 80er Jahren hat sich aus der Frage, ob nun Beziehungen des Kindes zu den Herkunftseltern aufrechterhalten werden sollen oder nicht, ein Theorienstreit entwickelt, der sich auch direkt auf die Praxis der Vermittlung von Kindern auswirkte.
-
Auf der einen Seite finden sich die VertreterInnen des individuumzentrierten, psychoanalytischen Konzeptes,
-
auf der anderen die VertreterInnen des systemischen Konzeptes der Familienforschung.
Der Theorienstreit beider Richtungen in bezug auf die Pflegefamilienforschung begründet sich hauptsächlich in der unterschiedlichen Auffassung der Pflegefamilie als Ergänzungs- bzw. Ersatzfamilie. (Kötter, 1994)
Als HauptvertreterInnen des Ersatzfamilienkonzeptes gelten die Kinderpsychoanalytiker Monika Nienstedt und Arnim Westermann, die ihren theoretischen Ansatz vor allem während ihrer langjährigen therapeutischen Tätigkeit mit Pflegekindern, die traumatisierenden Erfahrungen in der Herkunftsfamilie ausgesetzt waren, gewonnen haben.
"Sie gehen davon aus, daß mindestens 50 - 70% der in Dauerpflege aufgenommenen Kinder traumatische Erfahrungen gemacht und das Scheitern der frühen Eltern-Kind-Beziehung erlebt haben. Das bedeutet, daß diese Kinder hinsichtlich des Aufbaus funktionaler Objektbeziehungen eingeschränkt sind und kaum, oder nur über 'Angstbindungen' an ihre Herkunftseltern gebunden sind." (Kötter 1994, S. 72)
Nienstedt und Westermann betonen die Notwendigkeit, daß Kindern, die schon in frühester Kindheit seelische Verletzungen erfahren haben, die Möglichkeit geboten werden muß, neue vertrauensvolle und vor allem sichere Beziehungen aufbauen zu können. Die Grundlage dazu sollen, - mit möglichst klarem und widerspruchsfreiem Beziehungsangebot -, Ersatzeltern, also psychologische Eltern, schaffen. Die neue Beziehung sollte nicht durch Kompetenzstreitigkeiten zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie beeinträchtigt sein, da sonst die Gefahr besteht, "daß das Kind seine Orientierung zwischen zwei Elternpaaren völlig verliert, in einem ständigen Loyalitätskonflikt steckt und bindungslos wird." (ebd., S. 73)
Einem Kind ist es noch nicht möglich, klare Grenzen zwischen sich und seinen Eltern zu ziehen, da es ja von ihnen abhängig ist und sich durch sie erlebt und wahrnimmt sowie seine Identität entwickelt. Die Eltern sind für das Kind vorerst eine ausschließliche Instanz, die erst im Lauf der Entwicklung zunehmend angezweifelt wird - und dies auch nur dann, wenn eine positive und für das Kind befriedigende Basis der Sicherheit vorhanden ist, die ihm selbständiges Agieren erlaubt. Erst aus dieser Sicherheit heraus kann das Kind weitere Entwicklungsschritte wagen. In der Pubertät schließlich wird sich zeigen, ob die Eltern-Kind-Beziehung tragfähig genug war und dem jungen Menschen die Voraussetzungen mitgegeben hat, außerhalb der Familie Beziehungen und Bindungen eingehen zu können, und ob er letztlich selbst fähig sein wird erziehen zu können.
Wenn ein Kind "zweimal" Eltern hat, und die Beziehungen zur Herkunftsfamilie aufrecht bleiben sollen, dann liegt es an Herkunftsfamilie und Pflegefamilie, wie das Kind mit dieser Situation zurechtkommt und in seine Persönlichkeit integrieren kann. Ein Kind will beiden Elternpaaren entsprechen und kann so ständiger Überforderung und Verunsicherung ausgesetzt sein oder es wird sich, wenn es sich nirgends beschützt fühlt und keine klaren Strukturen vorfindet, enttäuscht aus beiden Beziehungen zurückziehen - und nirgendwo "zu Hause" sein. Wenn sich das Kind vor dieser Realität wiederfindet, hat es nur die Möglichkeit, das Beste für sich - im negativen Sinn - daraus zu machen: "Es kann sich von dem jeweils einen Elternpaar das holen, was es von dem jeweils andern nicht bekommt. Es lernt, aus den vorhandenen Schuldgefühlen und Rivalitäten Kapital zu schlagen." (Kötter 1994, S. 93) Mit dem Nachteil allerdings, daß es "in der Doppelelternbeziehung aber auch dem ausweichen [kann], was ein leibliches Kind lernen muß, 'die Eltern in ihrer Doppelrolle als gewährende und verbietende Instanz hinzunehmen' " (ebd.).
Ebenso stehen Nienstedt und Westermann einer Pflegebeziehung auf Zeit mit Vorbehalt gegenüber, weil für sie eine Rückführung in die Herkunftsfamilie - vor allem nach einem geglückten Beziehungsaufbau in der Pflegefamilie - einem erneuten Beziehungsabbruch mit traumatischem Charakter gleichkommen würde. Das Kind fühlt sich von neuem verlassen und verraten, und die Chance, daß es sich wieder auf neue Bindungen einlassen kann, schrumpft auf ein Minimum. Es macht dadurch die negative existentielle Erfahrung, daß es sich letztlich nur auf sich selbst verlassen kann.
Einen weiteren Grund, die Pflegefamilie als Ersatzfamilie zu befürworten, sehen die beiden Kinderpsychoanalytiker darin, daß die Erziehungsfähigkeit vieler Herkunftseltern aufgrund der eigenen, meist auch schon in der Kindheit erlebten traumatischen Erfahrungen stark eingeschränkt ist, und sie daher eher bereit sind, Probleme zu verdrängen als zu bearbeiten. Nienstedt und Westermann treten deshalb für ein relativ geschlossenes System der Pflegefamilie gegenüber der Herkunftsfamilie ein, da sonst die Besuchskontakte zum Pflegekind den Herkunftseltern nur dazu dienen, "ihre Illusion befriedigender Eltern-Kind-Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich damit selbst zu stabilisieren." (ebd., S. 72) Eine Rückführung ohne gezielte therapeutische Arbeit mit den Herkunftseltern ist für sie aus diesen Gründen daher fast immer zum Scheitern verurteilt. Wenn jedoch die Rückkehr des Kindes in seine Herkunftsfamilie von vornherein geplant ist (im Fall daß sie nur kurzzeitig entlastet werden soll), dann ist eine Heimunterbringung der Vermittlung in eine Pflegefamilie vorzuziehen, da das Heim nicht in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie tritt und die Bindungen des Kindes an seine Erzieher eher oberflächlich bleiben werden.
Schematische Darstellung der Ersatzfamilie, entnommen aus Kötter 1994, S. 71
(Grafik nicht verfügbar)
Kötter (1994) führt für Deutschland das Deutsche Jugendinstitut als Hauptvertreter des Ergänzungsfamilienprinzips im Bereich des Pflegefamilienwesens an. In Italien wird, bedingt durch das Wirken wichtiger systemisch orientierter FamilientherapeutInnen, auch im Pflegefamilienbereich verstärkt versucht, präventiv mit Problemfamilien zu arbeiten. Eine Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien wird nur im äußersten Notfall und nur als vorübergehende Lösung angestrebt, mit dem Ziel, das Kind - nach erfolgreich verlaufener therapeutischer Intervention in der Familie - wieder in sie integrieren zu können. Aber auch in Österreich berufen sich Jugendämter und soziale Trägerschaften in ihrer Arbeit immer mehr auf familiensystemische Erkenntnisse, die aber, wie ich vor allem aus der Praxis zu zeigen versuche, nicht in jedem Fall, vor allem nicht im Alleingang, ihre Richtigkeit haben.
In der familiensystemischen Arbeit kommt den Beziehungsstrukturen innerhalb einer Familie die primäre Beachtung zu. Der Gegenstand ihrer Betrachtung ist an erster Stelle das System als Einheit und erst dem nachgeordnet wird das Individuum als Teil des Systems berücksichtigt. Am einzelnen Mitglied (Symptomträger10) lassen sich Fehler innerhalb eines Systems erkennen, die Bearbeitung erfolgt über das System in Form von Interventionen11.
"Es ist von Grund auf falsch, das Kind als Einheit für sich zu betrachten. Vom biologischen, wie vom psychologischen Standpunkt aus gesehen existiert das Kind nur als Teil eines Beziehungssystems." (Cirillo 1990, S. 11)
Bowlbys bindungstheoretische Erkenntnisse bilden für das systemisch orientierte Ergänzungsfamilienprinzip ebenso wie für das individuumzentrierte Ersatzfamilienprinzip wesentliche theoretische Grundlagen. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für das Pflegekind werden jedoch von beiden Richtungsvertretern unterschiedlich interpretiert.
In den ersten beiden Lebensjahren entwickelt sich zwischen Mutter und Kind eine psychologische Bindung, die dem Kind Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wenn diese Bindung für das Kind nicht befriedigend verläuft, kommt es zu seelischen Störungen in der Entwicklung des Kindes. Aus systemischer Sicht ist eine Trennung des Kindes von seiner Bindungsperson, auch wenn die Bindung nicht befriedigenden Charakter aufweist, von traumatischen Erfahrungen begleitet und daher möglichst zu vermeiden.
Ist eine Trennung von der Herkunftsfamilie dennoch erforderlich, dann soll zumindest der Kontakt zu den verlorenen Bezugspersonen aufrechterhalten bleiben, um dem Pflegekind Beziehungsabbrüche zu ersparen, sowie eine reale Möglichkeit der Auseinandersetzung mit seinen leiblichen Eltern und dadurch die Bewältigung seiner Vergangenheit zu ermöglichen. "Da es [das Kind] die Fähigkeit besitzt, mehrere Bindungen gleichzeitig einzugehen, wenn diese klar voneinander abgegrenzt sind, nimmt es dabei keinen Schaden und wird in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt." (Kötter 1994, S. 74)
In bezug auf die Pflegefamilie bedeutet dies, daß sie sich nur als Ergänzung zur Herkunftsfamilie verstehen darf. Das kann im Extremfall für die Pflegefamilie heißen, daß sie sich nicht nur um ein Kind erweitert, sondern auch gleich ein komplexes Subsystem mitsamt dessen Andersartigkeit zu integrieren hat und in der Lage sein muß, ihre eigene Struktur entsprechend anzupassen. Das erfordert von ihr große Flexibilität, Offenheit und Problemlösungskompetenz sowie des öfteren fundierte, psychologische Kenntnisse - über die verschiedenen Formen der Sozial- und Therapiearbeit -, um solch komplexen Auswirkungen gewachsen zu sein.
Für die Seite der Jugendwohlfahrt bedeutet dies: Schon bei der Auswahl der Pflegeeltern den Aspekt zu berücksichtigen, daß sie nicht nur "Eltern für ein Kind sein [müssen], sondern auch Partner für die Herkunftseltern." (ebd., S. 77) Weiters wäre es nötig, für Pflegeeltern vermehrt Supervisionsmöglichkeit anzubieten, Zusammenarbeit mit Fachkräften und Weiterbildung zu ermöglichen sowie Anlaufstellen zur Bewältigung von Krisensituationen zu schaffen. Daraus läßt sich in weiterer Konsequenz die Tatsache ableiten, daß Pflegefamilien, besonders im heilpädagogischen Verständnis, weit über ihren privaten Rahmen hinaus Sozialarbeit leisten und daher im Netzwerk der praktischen Umsetzung von Sozialarbeit auch als kompetente Fachkräfte anzuerkennen sind. (vgl. Kap. 4.5 u. 5.3.5.1)
"Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Beziehungsaufnahme zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern [und Pflegekind] ist die Fähigkeit der Fachkräfte, sowohl die Pflegeeltern als auch die Herkunftseltern dazu anzuhalten, weder die neuen noch die alten Beziehungen des Pflegekindes zerstören zu wollen." (ebd.) Diese Vorgangsweise erfordert von beiden Familien gegenseitige Wertschätzung. Die Voraussetzung für das Gelingen der gegenseitigen Wertschätzung ist schon von der Vermittlungspraxis abhängig, von der Klarheit und Offenheit, mit der SozialarbeiterInnen beiden Familien begegnen, und wesentlich auch von der Neutralität, die sie beiden Familien entgegenbringen.
Weiters ist im Beziehungsdreieck Herkunftsfamilie, Pflegekind und Pflegefamilie auch auf die rechtliche Dimension zu achten, die erhebliches Konfliktpotential in sich bergen kann.
Wieweit sich die theoretischen Ausführungen der beiden Forschungsrichtungen auf die Praxis der Familienarbeit auswirken und wieweit sie die Arbeit der Pflegefamilie beeinflussen, versuche ich in der Gegenüberstellung der beiden Konzepte aufzuzeigen.
Schematische Darstellung der Ergänzungsfamilie, entnommen aus Kötter 1994, S. 76
(Grafik nicht verfügbarf)
Nienstedt und Westermann (1989) vertreten die Auffassung, daß die Pflegefamilie, im Interesse des Kindes, als Ersatzfamilie zu verstehen sei und grenzen sich von den systemisch orientierten Vertretern, die die Pflegefamilie als Ergänzung zur Herkunftsfamilie auffassen, deutlich ab. Sie begründen dies damit, daß hier entwicklungspsychologische Aspekte zu wenig berücksichtigt werden und gestörten Eltern-Kind-Beziehungen - die u.U. Angstbindungen beim Kind auslösen - zu wenig Beachtung geschenkt wird. Weiters sei zu bemerken, daß im Ergänzungsfamilienkonzept die Interessen der Erwachsenen zu sehr im Vordergrund stehen würden.
In der am systemischen Prinzip orientierten Praxis des Pflegefamilienwesens wird das Kind als Persönlichkeit gesehen, die aktiv und gleichberechtigt Beziehungen mitgestaltet. Nienstedt und Westermann sehen aber darin die Gefahr, daß die Abhängigkeit des Kindes von seinen Eltern zu wenig bedacht wird und die aktive Handlungsfähigkeit eines Kindes zu sehr an den Möglichkeiten der Erwachsenen gemessen wird.
Ebenso weisen die Vertreter des Ersatzfamilienprinzips darauf hin, daß Pflegefamilien mit der Aufgabe, die Herkunftsfamilie mitzubetreuen, oft überfordert sind, und es schwierig ist, Pflegefamilien zu finden, die ihre Grenzen nach außen so offen halten können, wie es im Ergänzungsfamilienprinzip gefordert wird, und dabei aber trotzdem die eigene Identität bewahren können.
In beiden Konzepten wird der Problematik, die sich aus den Spannungen innerhalb des Beziehungsdreieckes Pflegefamilie-Pflegekind-Herkunftsfamilie ergeben kann, ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. Insgesamt ist es jedoch sehr schwierig, die beiden Konzepte rein theoretisch gegenüberzustellen, da die Vertreter des Ergänzungsfamilienprinzips den Anteil der Dauerpflegekinder, die traumatische Beziehungserfahrungen gemacht haben, mit 15% der Fälle relativ gering ansehen, während die Vertreter des Ersatzfamilienprinzips den Anteil dieser Kinder mit 50-70% relativ hoch einschätzen. (Kötter, 1994)
"Jahrelanger Mangel an lebenswichtigen Erfahrungen wie Fürsorge und Zuwendung, Anerkennung und Achtung und über allem anderen die kontinuierliche Erfahrung geliebt zu werden, einem anderen Menschen wichtig zu sein, geht an einem Kind ebensowenig spurlos vorüber, wie wenn man jungen Pflanzen Licht, Wasser und nahrhaften Boden entzöge." (Rosenberg & Steiner 1991, S. 61)
Ein Kind kann sich zu Beginn seines Lebens nur über seine Bindungsperson(en) begreifen, es ist völlig abhängig von ihnen. Ob sich diese Personen ihm gegenüber in ihrer Beziehung eindeutig verhalten oder nicht, besonders davon hängt es ab, daß das Kind ihnen mit dem Gefühl des Mißtrauens oder des Vertrauens begegnen kann. Letztlich auch, daß es sich - als Konsequenz daraus - wertvoll und einzigartig erleben kann oder sich als Verursacher der Probleme seiner Eltern begreifen muß und sich dafür schuldig fühlt.
Wenn es nun zu der öffentlichen Entscheidung kommt, ein Kind aus der Herkunftsfamilie herausnehmen zu müssen, dann haben zu diesem Zeitpunkt meist schon viele negative Erfahrungen sein Leben geprägt. Aus der kindlichen Abhängigkeit heraus wird für das Kind - auch wenn die Beziehung zu seinen Eltern von Versagungen geprägt war - der Beziehungsabbruch mit traumatischen Erfahrungen sowie mit einem Identitätsverlust verbunden sein. Möglicherweise hat dieses Kind auch schon mehrere Beziehungsabbrüche erleben müssen und ist dadurch in seiner Sozialisation und in seiner Persönlichkeitsentwicklung gestört. Wenn es mißhandelt oder sexuell mißbraucht worden ist, dann sind die Bezugspersonen zur Lebensbedrohung geworden.
Es wären noch viele ungünstige Voraussetzungen aufzuzählen, die das Aufbauen von neuen Bindungen erschweren. Grundsätzlich gilt: Je früher und je öfter ein Kind solche Erfahrungen gemacht hat desto irreversibler sind sie. "Kein Erwachsener ist - von Alter und Krankheit abgesehen - von einem anderen Menschen so abhängig wie ein Kind von seinen Eltern." (Nienstedt & Westermann 1989, S. 306)
Will man diesen Kindern als Pflegefamilie neue Eltern-Kind-Beziehungen ermöglichen, so erfordert dies Einfühlungsvermögen in das Kind und setzt voraus, daß man sich von ihm ein Stück weit "an die Hand nehmen läßt", damit es Vertrauen fassen kann. "Erst die Erfahrungen, daß ein anderer Mensch auf eigene Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nimmt, schafft die Voraussetzungen dafür, die Wünsche und Bedürfnisse des anderen, die die eigenen einschränken, berücksichtigen zu können." (ebd., S. 59)
Ein Pflegekind muß zu Beginn eines Pflegeverhältnisses mit unterschiedlichen Gefühlen fertig werden, es muß sich auf die neue Situation einstellen und gleichzeitig damit rechnen, in den alten Erfahrungsbereich zurückzukehren. Ob nun ein neuer Beziehungsaufbau gelingt, hängt in erster Linie von den Pflegeeltern ab und gestaltet sich umso schwieriger, je älter ein Kind ist und je mehr Beziehungsabbrüche es schon erlebt hat. Weiters wird die Zusammensetzung der Pflegefamilie, schon vorhandene Geschwister und nicht zuletzt das Verhalten der Herkunftsfamilie zum Scheitern oder Gelingen der neuen Eltern-Kind-Beziehung beitragen.
Nienstedt und Westermann (1989) haben diesen Prozeß der Integration in drei Phasen unterteilt, dem wir uns aus unseren Erfahrungen als heilpädagogische Pflegefamilie voll anschließen möchten.
In der ersten Phase des Beziehungsaufbaus scheint sich das Kind (besonders wenn es noch jung ist) ganz kritiklos an seinen neuen Bezugspersonen orientieren zu können. Es sieht so aus, als ob es mit der neuen Situation zufrieden und erst einmal glücklich ist. Vor allem wenn dieser Phase eine längere Zeit des gegenseitigen Kennenlernens vorausging, kann es das Kind kaum erwarten, endlich auf Dauer zu den neuen Eltern zu kommen. Es will ihnen alles recht machen und zeigt sich von seiner besten Seite.
Ist ein Kind jedoch schon älter, kann es durchaus sein, daß sich die Angst vor der neuen Situation in ambivalenten Gefühlen den Pflegeeltern gegenüber ausdrückt und daß es vor dem endgültigen "Umzug" einen Rückzieher macht. Es kann sein, daß sich das Kind selbst beschwichtigt, indem es z.B. sagt, daß die Pflegeeltern ja doch lieber ein Mädchen möchten als einen Jungen und es ihm im Heim ohnedies ganz gut gefällt. Hier ist es wichtig, daß das Kind Zeit hat, sich mit der neuen Situation anzufreunden. Jedenfalls spricht so ein Verlauf einer Anbahnung eher für die Noch-Beziehungsfähigkeit des Kindes, als wenn es so schnell wie möglich, mit "fliegenden Fahnen", ins neue Lager überwechseln möchte.
Ein Kind versucht, während der ersten Annäherungen Einfluß auf die neue Familie zu gewinnen. Wenn es dabei die Erfahrung machen kann, daß es ein aktiver Mitgestalter der Beziehung ist, dann sind damit schon positive Voraussetzungen für die weitere Beziehungsgestaltung geschaffen. Das Kind macht die Erfahrung, daß jemand Interesse an seinem Leben hat, daß das, was es tut, wichtig ist, und daß es mit seinem Handeln viel bewirken kann. Hier läßt sich auf einen wesentlichen Unterschied hinweisen, der sich zwischen dem Aufwachsen in einer Familie und dem Aufwachsen in einem Heim ergibt. Das familiäre Leben ist für das Kind überschaubarer, die Individualität wird mehr berücksichtigt und wirkt sich daher positiv auf das Selbstvertrauen des Kindes aus. "Heimkindern wird [...] kaum jemals das Gefühl übermittelt, daß sie um ihrer selbst willen gebraucht und geliebt werden, daß sie wichtig und nie mehr wegzudenken sind." (Rosenberg & Steiner 1991, S. 197)
Reflexionen zu den Erfahrungen mit Timo:
Die eigentliche Anpassungsphase verlief auch bei Timo rückblickend betrachtet "klassisch" und dauerte mit wenigen Unterbrechungen ca. 6 Wochen. Wenn man dabei bedenkt, wieviel Energie ein Kind für diese Zeit der Anpassung an die neuen Bezugspersonen aufbringen muß - ein beachtlicher Zeitraum. Als Timo mit zehn Jahren zu uns zog, hatten wir noch keine eigenen Kinder und somit die Möglichkeit, ganz auf seine Bedürfnisse einzugehen und unser Leben weitgehend entsprechend zu gestalten. Daraus ergab sich für Timo ein großer Handlungsspielraum zum Testen und Experimentieren mit seinen neuen Bezugspersonen.
Timo war auch beim Einrichten der neuen Wohnung dabei und machte von seinem "Mitspracherecht" reichlich Gebrauch. Dieser Umstand, daß wir uns quasi in der gleichen Situation befanden wie er, hat wesentlich zur Tragfähigkeit unserer Beziehung beigetragen; das wurde uns jedoch erst später bewußt.
Unsere Auffassung, Timo von Anfang an als aktiven und mitverantwortlichen Partner zu begreifen und einzubinden, ist ein wesentliches Moment des Gelingens der Beziehung gewesen und entspricht - rückblickend betrachtet - der Forderung von Nienstedt & Westermann (1989) an Pflegeeltern: ein positiver Beziehungsaufbau könne nur dann gelingen, wenn die Erwachsenen bereit sind, sich auch vom Kind an die Hand nehmen zu lassen. (vgl. Kap. 4.4.1)
Dieser Abschnitt des Integrationsprozesses wird von Pflegeeltern oft als Rückschritt erlebt. Aufgrund der vorangegangenen Phase der Akzeptanz während der Zeit der Anpassung stellen sie sich zwangsläufig die Frage, was sie falsch gemacht haben. Aber gerade in dieser Zeit liegt "die Chance für eine weitreichende Korrektur gestörter Sozialisation." (Nienstedt & Westermann 1989, S. 67)
Das Kind überträgt in dieser Phase früher gemachte Erfahrungen und damit verbundene Affekte direkt auf die neue Situation, "die neuen Eltern werden perfekt mit den früheren elterlichen Bezugspersonen verwechselt." Übertragungsbeziehungen sind "in gewisser Hinsicht gar keine neuen Beziehungen, sondern Neuauflagen alter affektiver, emotionaler Beziehungen. Der andere gerät in eine Rollenbeziehung, die eigentlich mit ihm selbst nichts zu tun hat." (ebd., S. 68f)
Die eigentliche Chance der Aufarbeitung alter Konflikte liegt für das Pflegekind darin, daß sich die Pflegeeltern als therapeutische Übertragungsobjekte zur Verfügung stellen. Für das Gelingen einer Übertragungsbeziehung muß nicht unbedingt eine elterliche Konstellation gegeben sein, aber im Hinblick auf die vom Kind gemachten familiär-defizitären Erfahrungen bietet sich in der familiären Beziehungsgestaltung für das Kind eher die Möglichkeit, frühere Beziehungserfahrungen korrigieren und aufarbeiten zu können. Wesentlich ist, daß diejenigen Personen, die als Übertragungsobjekte zur Verfügung stehen, dem Kind einen schützenden Rahmen bieten können, Sicherheit vermitteln und vor allem Kontinuität versprechen, indem sie während dieser sensiblen Phase nicht austauschbar sind. Diese Voraussetzungen sind in unserer Gesellschaftsstruktur eher im familiären Zusammenleben zu realisieren.
Die Phase der Übertragungsbeziehung kann für beide Seiten, für Kind und Pflegeeltern, sehr anstrengend sein. Wenn die Vorgeschichte des Kindes bekannt ist, dann lassen sich Bedürfnisse des Kindes besser erkennen sowie gezielte weitere Handlungen darauf abstimmen. Ebenso ist während dieser Zeit eine fachliche Unterstützung der Pflegeeltern (möglichst Fachkräfte, die die familiäre Situation kennen, vgl. Kap.5.3.5) von großer Bedeutung und erleichtern die Arbeit wesentlich. Inwieweit sich die neue Situation für die Entwicklung von Übertragungsbeziehungen eignet, hängt großteils davon ab, "wieweit die gegenwärtige Situation für das Kind eine wirklich beschützende ist." (ebd.)
Die therapeutische Qualität der Pflegeeltern liegt in dieser Zeit darin, sich dem Kind als manipulierbar anzubieten und dennoch genügend Sicherheit und Kontinuität in der Beziehung zu geben, die dem Kind signalisieren, daß es trotzdem hier seinen Platz hat. Weiters kann in dieser Phase die noch vorhandene Distanz zum Kind oft hilfreich sein, um schwierige Situationen bewältigen zu können.
Reflexionen zu den Erfahrungen mit Timo:
Mit Timo erlebten wir recht "aufregende" Übertragungssituationen. Heute noch, wenn wir uns erinnern, sind wir der Überzeugung, daß Timo genau spürte, wie weit wir belastbar waren, und meist erkannte er, wann der Moment gekommen war, wo er uns "weiterhelfen" mußte.
Wie ich in der Einleitung schon anmerkte, schlug sich Timo selbst, als er zu uns kam. Er schlug sich mit dem Handrücken in die Schläfen und zwar zeitweilig mit solcher Wucht, daß die Knochen krachten. Er versuchte, sich selbst zu schützen, indem er seine rechte Hand in einen Epileptikerhelm verwickelte, der zu seinem Schutz angefertigt wurde, den er aber nie aufsetzte. In seiner linken Hand hielt er eine Puppe, in deren Pullover er seine Finger einwickelte. Er trug die Gegenstände immer bei sich, beim Essen, Schlafen, Radfahren, Klogehen. Legte er die Gegenstände ab, mußte man ihn an beiden Händen halten, da er sich ohne diese Hilfen, die er zwischendurch ganz "magisch" beschwor, schutzlos fühlte und sofort wieder auf seinen Kopf eintrommelte.
Je nachdem, in welcher psychischen Verfassung Timo war, konnte er auf ablenkende Angebote unsererseits eingehen oder auch nicht. Viele unserer Versuche lehnte er ab, manche nahm er an und darauf konnten wir weiter aufbauen.
Einmal versuchte ich, da seine Puppe schon sehr schnuddelig und schmutzig war, eine neue zu nähen. Ich bemühte mich, sie seinen Vorstellungen entsprechend anzufertigen, aber Timo lehnte ab, diese Puppe war für ihn unbrauchbar. Ich war enttäuscht und traurig. Timo, der sonst kaum spontane Gefühle zeigte, setzte sich zu mir, umarmte mich und versuchte mich zu trösten! Solche seltenen Begebenheiten bestätigten uns aber Timos Beziehungsfähigkeit und sorgten dafür, daß uns "die Luft" nicht ausging.
Während der Zeit, in der wir Timo als Übertragungsobjekte dienten, wechselten wir uns streckenweise auch beim Schlafen ab, da es passieren konnte, daß sich Timo auch nachts schlug und dann zumindest einer von uns einsatzbereit sein mußte. Es war uns sehr wichtig, daß er sich auf uns verlassen konnte, daß wir da waren, wenn er unsere Hilfe brauchte und wir ihm durch unsere ständige Anwesenheit Sicherheit vermitteln konnten.
Zudem war es für uns - wenn wir die Ursachen von Timos autoaggressivem Verhalten kennenlernen wollten - notwendig, mit ihm durch ständiges Zusammenleben möglichst viele Wege der Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu finden. Wir waren darauf angewiesen, minimale Zeichen von Timo aufzugreifen und zu reagieren, besonders in kritischen Situationen, wenn er in einen Automatismus des Schlagens hineingeriet, waren wir keinesfalls "professionell" überlegen in unserer Reaktion und unserem Handeln, sondern waren mitten ins Geschehen involviert, da es für uns - wie wahrscheinlich für die meisten Menschen - ganz schwer einzuordnen war, daß sich jemand selbst solchen Schaden zufügen konnte.
Es war ungefähr ein Zeitraum von einem halben Jahr, in denen sich Phasen der Autoaggression ablösten mit autistischer Beziehungsverweigerung, die sich wiederum in das Bedürfnis nach Schutz und Nähe verwandeln konnte.
Manche Tage gestalteten sich wie eine Berg- und Talfahrt mit der Achterbahn. Wir waren uns nicht immer sicher, ob wir stark genug wären für dieses Abenteuer. Durch Timo wurden wir mit dem Unterschied von beruflichem und privatem Einsatz konfrontiert sowie mit der Verantwortung, die uns ständig, auch im Bewußtsein unserer Grenzen begleitete. Aber nach diesem halben Jahr ging es kontinuierlich bergauf und Timo "vergaß" beim Spielen im Schwimmbad das erste Mal auf seinen Helm und seine Puppe. Nach weiteren zwei Monaten gehörten seine selbstverletzenden Handlungen der Vergangenheit an und Timo sprach von sich nicht mehr in der dritten Person, sondern verwendete die Ich-Form. Seinen Helm und seine Puppe warf er etwas später ganz entschieden in den Ofen (er saß oft vor dem Ofen und beobachtete fasziniert das flackernde Feuer). Kurzfristig erschrak er über seinen Mut und wurde wieder unsicher, aber durch diese Aktion war der Damm gebrochen.
Timo sah in uns nicht primär die Ersatzeltern, dafür waren wir wahrscheinlich noch zu jung (Klaus war 25, ich war 22, und Timo war 10). Er spricht uns auch heute noch (aus eigener Entscheidung) mit unseren Vornamen an und er versteht sich, im Gegensatz zu den "Kleinen", eher als ein uns gleichgestellter "Partner". Trotzdem, oder vielleicht auch wegen dieser nicht ganz üblichen Form unseres Zusammenlebens mit Timo, ist es uns gelungen, ihm soviel Kontinuität und Sicherheit zu vermitteln, daß er unsere Hilfe auch angenommen hat und dies besonders in der Bewältigung seines autoaggressiven Verhaltens.
Er fühlte sich dann offensichtlich so sicher, daß er seinen Helm und seine Puppe gegen uns - quasi als "Ersatzobjekte" - austauschen konnte. Damit war die Basis des Vertrauens geschaffen und Timo konnte sich weiterentwickeln. Wenn wir heute mit ihm über "damals" sprechen, dann kann er ganz unbefangen über seine "Streiche" lachen und darüber erzählen.
Um die Situation von damals besser verdeutlichen zu können, ist am Ende dieses Kapitels ein Auszug aus dem Tagebuch von Klaus zu lesen.
Das regressive Verhalten macht es dem Kind möglich, sich auf eine frühere Entwicklungsstufe zurück zu begeben, dadurch kann es eine neue Beziehung wie ein kleines Kind aufbauen. Es wagt gewissermaßen einen Neubeginn, indem es sich auf eine Entwicklungsstufe begibt, auf der es Nähe herstellen kann. "Die regressiven Bedürfnisse und Beziehungsformen [dienen] dem Aufbau dichter, naher und persönlicher Beziehungen, die ein gewisses Maß an Exklusivität, Einmaligkeit und Intimität besitzen und dadurch die Beziehung zu einer unverwechselbaren machen." (Nienstedt & Westermann 1989, S. 84)
Regressive Bedürfnisse können sich bei einem Kind z.B. so äußern, daß es auf einmal angibt, nur fünf Jahre alt zu sein, obwohl es in Wirklichkeit schon zehn ist. Es kann wieder einnässen, nach einer Windel verlangen oder auch ständig am Rockzipfel der Mutter hängen. Auch in dieser Phase des Beziehungsaufbaues ist es wichtig, daß man versucht, auf die Wünsche des Kindes einzugehen und das "Klein-Sein-Wollen" respektiert, daß man das Kind notwendige Entwicklungsschritte nachholen läßt, aber trotzdem vermeidet, es nicht seinem Alter gemäß ernst zu nehmen. Denn das Kind kann sich erst abgrenzen und weiterentwickeln, wenn es eine Basis der Sicherheit und des Vertrauens in der Beziehung erreicht hat.
Dabei ist es manchmal nicht leicht, regressive Verhaltensweisen zuzulassen und sie als solche zu verstehen. Positive Aspekte können wir noch ganz gut darin erblicken, wenn ein schon älteres Kind wieder auf den Schoß der Mutter flüchtet und ihre Nähe sucht, aber wer hat noch Verständnis dafür, wenn ein elfjähriger Junge plötzlich wieder einnäßt und Kot schmiert oder auch mit aggressivem Verhalten - als oft einzige Ausdrucksmöglichkeit seiner Gefühle - auf seine Umwelt reagiert?
In der Problematik der Regressionsphase zeigt sich auch deutlich, wie wichtig die familiäre Geschwisterkonstellation ist, damit das Pflegekind überhaupt die Möglichkeit hat, regredieren zu können. Grundsätzlich sollte das Pflegekind jünger sein als die schon in der Familie lebenden Kinder, um zu verhindern, daß mögliche Regressionstendenzen auf die anderen Kinder destabilisierend wirken. Ist das Pflegekind älter, so sollte der Altersunterschied dementsprechend groß sein. Wenn der Altersunterschied zwischen dem Pflegekind und anderen in der Familie lebenden Kindern zu gering ist, wird man von vornherein zwar nicht ausschließen, daß die Integration eines Pflegekindes trotzdem erfolgreich verlaufen kann, aber es ist zu berücksichtigen, daß sich daraus vermehrt Probleme ergeben können. (vgl. Kap.4.4.5)
Reflexionen zu den Erfahrungen mit Timo:
Timo zog in "seiner" Regressionsphase vor, sein Bett naß zu machen, um es sich anschließend schelmisch lachend in unserem Bett bequem zu machen. Oder, er sagte auch manchmal, daß er jetzt wieder zwei Jahre alt sei und dabei sprach er von sich nicht in der Ich-Form, sondern vom "Timo", machte in die Hose und verlangte nach einer Windel. Weiters zeigten sich seine regressiven Verhaltensweisen auch, wenn wir mit Bekannten Kontakt hatten, die selbst kleine Kinder hatten. Timo wollte nicht, daß ich mich anderen Kindern widmete und verlangte z.B. dann auch getragen zu werden. Das ließ sich zeitweise auch machen, da er ja sehr klein und leicht war.
Daß es uns möglich war, defizitäre Erlebnisse aus früheren Bindungserfahrungen mit Timo aufzuarbeiten, zeigte sich, als eineinhalb Jahre später unser eigenes Kind zur Welt kam. Timo war, entgegen vieler Prophezeiungen, überhaupt nicht eifersüchtig auf seinen Bruder. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon soviel Sicherheit gewonnen, daß ihn der kleine Bruder nicht mehr irritierte. Erst als dieser zu laufen begann, und Timo seine Sachen in Sicherheit bringen mußte, sagte er einmal: R. sollte besser doch wieder auf den Boden zurück und statt laufen lieber nur krabbeln.
Timo ist mittlerweile 22 Jahre alt und lebt seit 12 Jahren bei uns. Selbstverletzende Handlungen gehören längst der Vergangenheit an, er hat andere Wege gefunden, sich mitzuteilen und seine Bedürfnisse zu äußern. Seine Integration in unsere Familie (wir haben inzwischen auch zwei eigene Kinder) ist gelungen und er ist nun schon auf dem besten Weg, sich von uns weitgehend unabhängig zu machen. Obwohl er früher auf Veränderungen mit Verunsicherung reagierte, ihm unbekannten Personen entweder signalisierte, daß er mit ihnen gehen wollte, oder sie komplett ablehnte, ist nun seine persönliche Sicherheit und Stabilität beachtenswert. Wir sind zwar immer noch seine primären Ansprechpartner und "Stabilisatoren", wenn es darum geht, "Unsicherheiten" wieder ins Lot zu bringen, aber es gelingt ihm mittlerweile schon, positive und tragfähige Beziehungen auch zu anderen Menschen herzustellen.
26.7.83
Ein gespenstischer Eindruck: die zerfließend hellblauen Augen und die dunkelblau schimmerenden Ringe um diese herum; in einem kleinen Einzelzimmer, im weißen Kliniknachthemd, eingewickelt in die Bettwäsche, in der rechten Hand den Schutzhelm, in der linken die Puppe. Der Blickkontakt ist sofort und intensiv hergestellt, Timo klammert sich gleich an unsere Namen.
27.7.83
Ein Sommerhitzetag. Timo erkennt uns sofort; er nimmt mich mit einem noch freien Finger an der Hand. Wie ich stehe, steigt er auf einen Stuhl und meint, er sei größer. Einmal sei er, sagt er, ein Baby gewesen; er sei jetzt zehn Jahre alt. Er redet immer von sich in der dritten Person: "Der Timo ...". Wie er sich im Spiegel anschreit. Am Gebäudeeingang brüllt er in ein geöffnetes Kellerfenster und sagt dann erleichtert: "So jetzt hat sich der Timo ausgeschrien".
Oft lacht er leise vor sich hin. In der verbalen Kommunikation: er spricht, indem er alles, was die anderen von ihm wollen, an den Timo-in-sich übersetzt. Er wiederholt sogar alte, Jahre zurückliegende, an ihn gerichtete Ermahnungen. Verarbeitet er sie auf diese Weise? Oder ist dies ein Panzer, hinter dem er sich selbst zu verbergen und zu schützen versucht? Oder ist die szenische Aufbereitung dieser Situationen ein wichtiges Moment seiner Selbstwahrnehmung?
Er sagt (fragt?): Der Timo braucht nicht mehr gespritzt zu werden, nicht mehr gestupft zu werden, er schlägt sich nicht mehr, der Klaus hält ihn nicht, der Timo wird größer usw. - wie er den Tonfall nachahmt ("Timo", "Du Timo", "Timo Timo"), ich kann nicht anders, als ihn auch nachzuahmen: Timo, Du Timo.
Oft wendet er sich einfach ab, der andere ist dann nicht mehr für ihn da. Wie er alle Betreuer in seiner Hand hat mit dieser paradoxen Verhaltensfigur, sich sein Wohl dadurch zu sichern, daß er sich Leid zufügt. Das Zusammenleben mit ihm ist also ganz auf den einen Punkt konzentriert: ob Timo sich schlägt oder nicht: er setzt die Maßstäbe. Wie er dann selbst (quasi als der Chefarzt) sagt: "Der Timo ist autoaggressiv."
11.8.83
Claudia ist bei Timo in der Klinik und macht seine Rituale mit: ihm eine Schranke mit den Händen bieten, damit er sich, bei abgelegten Instrumenten (Helm und Puppe), nicht schlägt; ihn ins Bett bringen, dabei sich bemühen, ein Wort zu erhaschen, einen Blick ...
Am Sonntag waren wir in einer Krise: nicht zu beruhigen ist er im Alpenzoo durch die Menschenmenge gerast, brüllend und tobend, wir mußten ihm hinterher laufen: dann auf der Bank im Park hat er geweint.
4.9.83
Wir sehen drei Aspekte seiner Autoaggression. Einmal das automatisierte Schlagen. Gegen dieses kämpft Timo selbst an, auf verschiedene Weise: er trägt z.B. die Schutzinstrumente an seinen Händen (er bindet die Hände an Gegenstände), er klammert sich an Arme und Beine seiner Betreuer, er verlangt nach einer "Sperre". Entweder macht er damit auch die Betreuer zu seinen Objekten oder er füllt ein Vakuum in seiner Persönlichkeit, der Betreuer ist in jedem Fall eine Verlängerung seiner Persönlichkeit: insofern ist er andererseits nicht ganz so autistisch. Die Autoaggression hat eine introvertierte Seite als Bedingung dafür, daß sie automatisch werden kann, und eine fast bewußte, extrovertierte Seite.
Das automatisierte Schlagen ist ein Mechanismus in einem circulus vitiosus - da ist nichts zu machen; das zweite, nach außen gerichtete Schlagen ist sozial orientiert, da gibt es Angriffsflächen, da ist Timo durch entsprechende Reaktionen von seiner Umwelt her beeinflußbar, das ist sein Fenster zur Außenwelt, damit erregt er Aufmerksamkeit, so bekommt er Zuwendung: dies ist das wesentliche Ausdrucksmittel in diesem System. Wie kann Timo dieses Ausdrucksmittel aber aufgeben, wenn er damit gleichzeitig auf die emotionale Zuwendung seiner Betreuer verzichten müßte?
Aber auch dieser - wahrscheinlich ihm selbst als leidvoll bewußten - Strategie will Timo gottseidank durch eine Reihe von Ersatzstrategien entfliehen. Z.B. durch notorische Fragerei, die sinnlos ist für uns (ohne praktischen Bedeutungszusammenhang), wohl aber sinnvoll für ihn (eben als Ersatz für die Autoaggression). Damit tastet er Kommunikationsmöglichkeiten mit seinen Bezugspersonen ab, ohne dabei wirklich zu kommunizieren. Daß diese notorische Fragerei mit der Autoaggression zusammenhängt, zeigt sich daran, daß die Fragen inhaltlich fast nur mit Destruktivität zusammenhängen ("tot", "kaputt", "verräumen"; "Das Auto ist nicht kaputt", "Das Lego müssen wir nicht verräumen").
Zuletzt gibt es noch das spielerische Sichschlagen, mit dem er das automatisierte Sichschlagen spielerisch einzuholen und zu entschärfen versucht: er legt die Hand ganz zaghaft und probeweise an die Schläfe und sagt: "Der Timo schlägt sich nicht mehr".
9.8.83
Heute gab es die Umkehrung der Fragesituation: meine Frage "Ist das Auto kaputt?" beantwortet Timo ärgerlich mit "Na". So sollte auch er die Bedeutung der Fragen ernst nehmen lernen.
Heute ist er ziemlich unruhig. Er schließt sich in sein Zimmer ein und schreit und spricht mit sich selber.
10.9.83
Gestern: Timo sticht sich mit einer Stecknadel mehrmals in die Fingerspitzen und kichert dazu - ein masochistisches Schmerzerleben und eine Menge Fragen, die sich daraus ergeben, z.B.: Ist die Autoaggression auch Mittel zum Zweck der Lusterzeugung?
Heute: Claudia lacht Timo an und er lacht zum ersten Mal zurück, ohne äußerlichen Anlaß.
Timo isoliert sich seit gestern in seinem Zimmer. Auf die Frage, ob er die Tür zu haben wolle, sagt er: Zu!
12.9.83
Timo objektiviert und grenzt ab: plötzlich hält er die Puppe nicht mehr so fest (nicht mehr so in sie verwurstelt), er lacht dazu und bekommt unser Lob: wir zeigen ihm eine Flöte und sagen, er könne nur ohne seine Dinger (Helm und Puppe) spielen. Genauso plötzlich schlüpft er dann aber wieder in die Puppe hinein.
Verkraftet er eine Mahnung nicht, dann beginnt er, im Tonfall der anderen sich selbst zu beschimpfen.
13.9.83
Resümee. Wir freuen uns über Äußerungen seiner Bedürfnisse; wir korrigieren diese Äußerungen, insofern wir sie als Bedürfnisse seiner Persönlichkeit sehen möchten ("Ich will"); denn mit dem Bewußtwerden von Bedürfnissen formt sich eine Persönlichkeit und wird fähig, seine eigenen Bedürfnisse in seiner Umwelt durchzusetzen.
Zweischneidig ist allerdings, daß wir seine Bedürfnisse jetzt eher akzeptieren müssen als ablehnen, damit er überhaupt Bedürfnisse äußern lernt; das könnte dann so laufen, daß er Bedüfnisse nur äußert um den Preis, daß wir sie nicht ablehnen dürfen.
Ein Ziel: Beseitigung der Instrumente und versuchen, andere Wege der Sicherheit zu finden: den im Ansatz vorhandenen Ausweg, sich durch die Beschäftigung mit Objekten vom Schlagen abzuhalten, weiterentwickeln. Das Sichklammern an diese Objekte, seine Schutzinstrumente (Helm und Puppe), bedeutet einerseits, daß eine Tendenz zum Besseren da ist (ohne diese können wir ja nichts machen!), andererseits daß diese Tendenz noch nicht überwiegt. Die Abhängigkeit von Helm & Co ist aber noch stärker als die Neugier, mit der der Flöte zu spielen. Timo sucht noch Hilfe bei diesen Objekten, vielleicht werden sie einmal durch Menschen (durch uns) sersetzt.
15.9.83
Timo sieht mich an und fragt: "Der Timo ist nicht mehr komisch?" Ob man an dieser Frage positive Ansätze erkennen kann?
Ihm ist offenbar bewußt, daß er irgendwie anders ist: er bringt Komisch-sein in einen Wenn-Dann-Zusammenhang mit In-die-Klinik-gehen-müssen.
"Ich": hie und da klappts, mechanisch oder nicht? Er sagt es so inhaltslos; das "Ja" kommt schon kräftiger: damit kann er schon Ziele durchsetzen.
Er steckt den Stecker genau dann in die Steckdose, wenn er staubsaugen will: er verändert eigenständig die Saugleistung.
An dem, was er wiederholt, wenn man ihm etwas erklären will, erkennt man, daß er weitgehend nur in Hauptsätzen denkt. Höchstens aber kennt er den indirekten Fragesatz mit "ob". Die Konjunktion "weil" bleibt hingegen als leere Formel "weil er ..." in der Luft hängen.
16.9.83
Augenblicklich läuft der Staubsauger (sein Lieblingsspielzeug) auf Hochtouren. Zugenommen haben heute die sinnlosen Äußerungen, nicht einmal mehr die sinnlosen Fragen, womit er Kontakt sucht, sondern eher die Monologe ("Du Timo"), womit er sich isoliert. Unsere Ängste.
Timo ist enttäuscht von der neuen Puppe: die alte war so schnuddelig, daß wir ihm eine neue angeboten haben; den gestrigen Nachmittag, Abend und vielleicht auch die vergangene Nacht (er hat wieder blaue Ringe unter den Augen) fieberte er auf die neue Puppe hin (er kann offensichtlich mit Veränderung von Konstanten in seiner Umwelt schlecht umgehen); dann als Claudia die Puppe fertig genäht hatte, akzeptierte er sie nur als Spielzeug unter ferner liefen.
Während ich schreibe, saust er dauernd zu mir herein und will mit der Pfeife zündeln.
28.10.83
Timo schlägt sich manchmal auch nachts im Halbschlaf, wenn er entweder den Helm oder die Puppe verliert. Tagsüber steckt er seine Hände auch in den Hosengürtel, um zusätzliche Sicherheit vor dem Schlagen zu haben. Die Hilfe durch Helm und Puppe läßt nach: neue Gegenstände, die ihm helfen sollen, kommen dazu, Legostücke, Spielzeugautos usw.; Timo beschwört sie, indem er sie an die Stirn führt, sie weg hält, mit ihnen spricht (Du Timo, du To...).
Ich versuche, sein Schlagen von seinem Kopf weg auf eine Schaumstoffmatte an der Wand zu leiten. Nach anfänglichem Zögern erweist sich dies als brauchbare Ablenkung.
Wenn sich Timo nachts unsicher fühlt oder ins Bett gemacht hat, kommt er zu uns ins Bett und fühlt sich dann offensichtlich sehr wohl.
30.10.83
Rückblick auf den Rückfall. Die Ursachen: erstens daß wir Timo überfordert haben, hauptsächlich damit, daß wir seine notorische Fragerei abgeblockt haben. Zweite Überforderung: daß er engagiert - zusammen mit uns, wie bei einem magischen Ritual - seine Puppe verheizt hat und so seine Schutzinstrumente aufgegeben und verloren hat.
Daraus der Rückfall: Timo schlägt sich gegen den Kopf. Was können wir tun? In sehr extremen Situationen müssen wir seine Hände halten, den Automatismus im Schlagen mit allerlei Ablenkungen und Umwegen unterbrechen, im Freien herumlaufen, mit Wasser spielen. In weniger kritischen Situationen versuchen wir, ihn zu verbalen Äußerungen zu bringen, damit er so mit seinen Gefühlen umgehen lernt; oder wir reagieren auf für ihn unerwartete Weise (z.B. lachen). Dazu gehören noch Beschwörungsrituale mit Helm und Puppe: Wenn du dich nicht mehr schlagen willst, dann hilft dir die Puppe. Daß ihm dann die Puppe nicht mehr helfen braucht, ist das versteckte Ziel.
3.11.83
Wir versuchen wieder, seine endlose Fragerei etwas einzuschränken (z.B. beim Essen). Timo umgeht dies jedoch mit allen möglichen Mitteln - z.B. mit der Frage, ob er nicht fragen darf, ob er leise fragen dürfe, ob er brav sei usw. Insgesamt ist Timo wieder offener, nimmt Zärtlichkeiten an.
5.11.83
Wir fahren zu Verwandten mit einem Kleinkind und sind neugierig, wie es Timo dabei geht. Er ist sehr nett mit dem Kind und sagt: "Tut der Timo auf die M. aufpassen?" Als Claudia jedoch den Kinderwagen schiebt, schlägt er sich aufs Kinn. Sie widmet sich wieder ihm allein und trägt ihn ein Stück.
Beim Kuchenessen verlangt Timo partout auch den Kuchen von Claudia, fragend, fordernd: "Mag der Timo noch einen Kuchen, mag er den da!"
6.11.83
Timo schlägt sich mit dem Kinn auf sein Knie. Um sich davor zu schützen, steckt er sich einen weiteren Plastikgegenstand in den Halsausschnitt seines Pullovers. Auf die Frage, warum er sich schlage, ob er sich einfach so schlage, antwortet er: "Nicht einfach so, bei mir bleiben". Und abends: "Der Timo kann die Claudia haben."
9.11.83
Wir ziehen Schlüsse von seinem Verhalten mit seiner Puppe auf seine jüngere Schwester. Die Puppe (Schwester) schützt ihn vor dem Schlagen, andererseits hegt er starke Aggressionen gegen sie. Er schleudert sie mit Schwung in eine Ecke!
12.11.83
Die große Überraschung: Timo saust ohne Helm und Puppe durch die Wohnung, bietet sich für diese Probe an. Gestern hat er bewußt die Hände an die Schläfen gelegt, der Kurzschluß kam zustande, das nächste Eis ist weg. Heute sage ich zu Timo, er soll versuchen, die Hände an die Schläfen und das Kinn langsam an die Knie zu legen und dabei so zu schreien, als ob er sich schlagen würde. Es klappt! Es wird ihm bewußt, daß er Kontrolle über sich hat. Sein Selbstbewußtsein wächst. Nachmittags ist er die ganzen 2 Stunden im Schwimmbad ohne Helm und Puppe, und ohne gehalten zu werden...
Die Herkunftsfamilie (oder das, was von ihr übrig ist) wird, wenn sie ihr Kind an Pflegeeltern verliert, mit eigenen Gefühlen der Ohnmacht, Wut, Trauer und Resignation konfrontiert. Gleichzeitig ist sie jedoch auch von gesellschaftlicher Seite dem Vorwurf ausgesetzt, in ihrer Aufgabe als "gute Eltern" für ihr Kind versagt zu haben. An erster Stelle treffen diese Vorwürfe die Mutter. Wenn sie ihr Kind in ein Heim gibt, dann kann sie eher damit leben, als wenn das Kind in eine Pflegefamilie kommt. Denn die Pflegefamilie wird im Gegensatz zum Heim als unmittelbare Konkurrenz erlebt, und durch sie wird die Herkunftsfamilie dauernd an ihr Scheitern als "gute Eltern" für ihr Kind erinnert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Herkunftsfamilie dieses Ereignis verarbeiten kann. Es kann sein, daß sie sich vollkommen von ihrem Kind zurückzieht, es kann auch sein, daß sie an der Hoffnung festhält, das Kind wieder zurück zu bekommen. Stefano Cirillo (1990) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß jede Familie ein sensibles Gebilde ist, in das man nicht zu massiv eingreifen soll, da die Herkunftsfamilie versuchen könnte, die entstandene Lücke mit einem neuen Kind zu schließen und daß so letztlich keinem gedient sei.
Wenn eine Fremdunterbringung unumgänglich ist, brauchen auch die Eltern eine therapeutische Unterstützung. Dies findet jedoch in der Praxis der Sozialarbeit kaum statt, da weder die finanziellen Mittel dazu reichen, noch genügend Fachleute zur Verfügung stehen, die diese Arbeit leisten können. Wenn aber Pflegefamilie und Herkunftsfamilie, wie es im systemisch orientierten Ergänzungsfamilienprinzip gefordert wird, eine gemeinsame Zukunft in der Betreuung des Kindes gestalten sollen, dann muß gleichzeitig mit der Herkunftsfamilie gearbeitet werden. Herkunftseltern müssen Trauerarbeit leisten können, um sich vom Kind zu lösen. Erst dadurch können sie eine neue Beziehungsebene zum Kind finden und ihm klare Strukturen vermitteln.
Eindeutige, für das Kind durchschaubare Informationen von der Seite der Herkunftsfamilie können dem Kind das "Okay" geben, (Wiemann 1991; vgl. auch Kap.4.3. u. 4.5), damit es sich ohne Schuldgefühle und ohne zwischen zwei verschiedenen Elternpaaren aufgerieben zu werden, an die Pflegeeltern binden kann.
Sind Herkunftseltern zur Zusammenarbeit nicht bereit oder nicht in der Lage und hat das Kind schwere seelische Verletzungen erfahren, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn es nicht durch ständige Besuchskontakte mit der Herkunftsfamilie konfrontiert wird, da sonst die Belastungen zu groß sind und das Kind in seiner Entwicklung scheitern kann, da es nicht weiß, wohin es gehört. Hier ist der Auffassung der Vertreter des Ersatzfamilienprinzips (Nienstedt & Westermann 1989) eher zuzustimmen. Sie sind der Meinung, daß die Aufarbeitung der Geschichte des Kindes auch - und vor allem weniger belastend für das Kind - in der Pflegefamilie erfolgen kann, wenn die Herkunftsfamilie im Gespräch thematisiert wird. Sie rechtfertigen diese Vorgangsweise damit, daß sich Eltern von mißhandelten und vernachlässigten Kindern "als höchst unbefriedigend, rücksichtslos und egozentrisch erwiesen haben" und das mißhandelte Kind "u.U. in außerordentlichem Maße an die Eltern gebunden ist", indem es die Schuld bei sich selber sucht und sich für das Verhalten der Eltern verantwortlich fühlt (weil ich so böse bin, haben sie mich geschlagen).
Jürg Willi (1975, 1985) umschreibt diese gegenseitig unbefriedigende Abhängigkeit von Eltern und Kind mit dem Begriff der "Kollusion". Das vernachlässigte Kind übernimmt ungerechtfertigter Weise Schuld und Verantwortung und bleibt so an die Eltern gebunden, während die Eltern an der Beziehung zum Kind festhalten, indem sie ihre Schuld verleugnen. (ebd., S. 206) "Ich bin so schuldig, weil du so unschuldig bist, sagt das Kind. Ich bin so unschuldig, weil du so schuldig bist, sagt die Mutter bzw. der Vater. Aus dieser Kollusion heraus wird an unbefriedigenden Beziehungen wechselseitig festgehalten, auch wenn alternative Beziehungen Befriedigung versprechen." (ebd., S. 207)
Reflexionen zu Timos Eltern:
Timo ist das fünfte von sechs Kindern. Sein ältester Bruder ist schwerstbehindert und lebt in Mils. Seine Eltern bewirtschaften einen kleinen Nebenerwerbsbauernhof, sein Vater arbeitet bei der ÖBB. Beide Eltern leiden unter Depressionen, die auch - vor allem beim Vater - mit stationären Aufenthalten verbunden sind. Laut den Schilderungen der Mutter hat sie Timo sehr lange getragen als Ausgleich für die Schwangerschaft, in der sie sehr depressiv war. Als sie erneut schwanger war konnte sie sich nicht mehr so intensiv um Timo kümmern. Timo war zu dieser Zeit schon schwer rachitisch und mußte in die Klinik. Seine Mutter gibt an, daß er immer schon sehr launisch und schwierig gewesen sei und im Kindergarten schon autoaggressiv war. Seine Eltern besuchten ihn kaum auf der Klinik. Timo sah, am Fenster stehend, wie sie an ihm vorübergingen, um jemand anderen zu besuchen. Während verschiedener Aufenthalte in institutionellen Einrichtungen kam Timo für kurze Zeit wieder nach Hause, jedoch erfolglos. Die Eltern waren mit ihm überfordert und wollten ihn nicht mehr.
So war die Situation, als wir als Pflegeeltern dazukamen. Aufgrund des schwierigen psychischen Zustandes von Timo trafen wir uns mit den Eltern vorerst ohne Timo. Später besuchten wir uns ein paar Mal gegenseitig, zuerst mit unserer Sozialarbeiterin, später ohne sie, jedoch nur auf unsere Initiative hin. Timo machte deutlich, daß er seine Eltern gerne besuchen möchte, aber er versicherte sich immer wieder, ob wir auch am Abend wieder nach Hause fahren würden. Im Lauf der Jahre wurden die Kontakte immer seltener, Timos Eltern zeigten von sich aus wenig Interesse. Aus Gesprächen mit ihnen erfuhren wir, daß sie Angst davor haben, Timo eines Tages zurücknehmen zu müssen. Jetzt schicken wir ihnen manchmal Fotos von Timo.
Rivalitäten zwischen Timos Eltern und uns gab es wahrscheinlich deshalb keine, weil sie "abgebende" Eltern waren. Wir versuchten, so gut wir konnten, ihre Situation zu verstehen. Auch aus der Tatsache, daß uns Timo beim Vornamen nennt, leiteten die Eltern ab, daß wir ihnen keine Kompetenzen streitig machen wollten. Vielleicht sind sie auch erleichtert, daß es Timo gut geht und sie eine Sorge bzw. Belastung weniger haben. Vielleicht hätte Timo auch in seiner Ursprungsfamilie bleiben können, wenn sie rechtzeitig betreut und unterstützt worden wäre.
"Wenn Pflegeeltern sich als 'Eltern auf Zeit' verstünden, so müßten sie sich davor hüten, das Kind zu lieben, es an sich zu binden, es glücklich zu machen. Aber: 'Gebremste Zuwendung der Pflegeeltern würde bedeuten, das Kind an den gedeckten Tisch zu setzen und es dort verhungern zu lassen.'" (R. Lempp, zit. in: Rosenberg & Steiner 1991, S. 212)
Pflegeeltern werden sich, wenn sie ein Pflegekind bei sich aufnehmen aus emotionalen Gründen wahrscheinlich eher als Ersatzeltern begreifen denn als Ergänzungsfamilie. Es sei denn, der explizite Arbeitsauftrag ist von vornherein ein anderer, und die das Kind vermittelnde Stelle bringt ihre anderen Anliegen klar zum Ausdruck. Wenn geplant ist, das Kind wieder in seine Herkunftsfamilie zu integrieren, dann sollte diese Perspektive auch für die Pflegeeltern geklärt sein, weil davon schließlich auch das gesamte familiäre Zusammenleben betroffen ist.
Die Beziehungsgestaltung zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie ist u.a. abhängig von der Form und der Häufigkeit der Kontakte. Es gibt die Möglichkeit,
-
die Herkunftsfamilie aus dem Pflegeverhältnis auszuschließen;
-
die Herkunftsfamilie gedanklich zu integrieren und in der Pflegefamilie zu thematisieren ohne den direkten Kontakt zwischen beiden Familien;
-
oder die Möglichkeit der Zusammenarbeit beider Familien und zwar so, daß Kontakte zwischen Pflegekind und Herkunftseltern möglich sind. (Kötter 1994, S. 81)
Aus der zuletzt angeführten Form der Beziehungsgestaltung ergeben sich dabei die weitreichendsten Auswirkungen für die Pflegefamilie. Wenn die Zusammenarbeit zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie in gegenseitiger Wertschätzung funktioniert, dann wird für das Kind die Möglichkeit geschaffen, sich mit der Realität der doppelten Elternschaft auseinandersetzen zu können und diese Tatsache evtl. in seine Persönlichkeit integrieren zu können. Damit ist aber noch lange nicht sichergestellt, daß dann das Kind keinen Konflikten mit der Herkunftsfamilie ausgesetzt sein wird. Im Gegenteil: die Tatsache an sich, daß es zweimal Eltern hat, ist schwierig genug. "Das Kind, das an zwei Orten zuhause ist, hat immer wieder den Sprung von einem Wertesystem ins andere zu schaffen, je verschiedener die soziokulturellen Milieus, desto größer die Sprünge." (Hofmann & Hofmann 1990, S. 79)
An der heilpädagogischen Pflegefamilie liegt es nun, das Kind zu unterstützen und Verständnis aufzubringen sowohl für die Lage des Kindes, als auch für die Situation der Herkunftsfamilie. Der dauernde Einfluß der Herkunftsfamilie betrifft aber nicht nur das Pflegekind und die Pflegeeltern als Personen, sondern wirkt in seiner Dynamik auf das gesamte pflegefamiliale System.
Besonders wenn Kinder nur für eine kurze Zeit in eine Pflegefamilie aufgenommen werden sollen, wird oft zu wenig berücksichtigt, daß die Pflegefamilie ja ebenfalls ein System ist, daß sich ggf. neu organisieren muß, um im Gleichgewicht zu bleiben. Auf eine gewisse Beständigkeit muß auch eine heilpädagogische Pflegefamilie bauen können, da willkürliche Veränderungen von außen das System empfindlich stören, besonders dann, wenn auch Geschwister vorhanden sind. Sie leiden unter einer allzu großen Fluktuation und können es nicht so ohne weiteres verstehen, warum ihre Geschwister auf einmal nicht mehr da sind.
Der dauernde Kontakt mit der Herkunftsfamilie kann für die Pflegefamilie auch zu einer großen Belastung werden, insbesondere dann, wenn die Herkunftsfamilie zu sehr in das pflegefamiliale System hereinwirkt und wenn dadurch die Grenzen der Pflegefamilie diffus werden und ihre Stabilität auf dem Spiel steht. Um sich wieder stabilisieren zu können, bleibt der Pflegefamilie in dieser Situation oft nur der Ausweg, das Pflegekind wieder auszuschließen. Es kommt zum Pflegeabbruch, der vielleicht vermeidbar gewesen wäre. "Eine zu große oder erzwungene Offenheit der Grenzen einer Familie [birgt] die Gefahr einer Gegenreaktion in sich [...], die Tendenz, ihre Grenzen gegenüber dem Eindringling zu schließen, um die familiale Stabilität wiederherzustellen und einen Identitätsverlust zu vermeiden." (Kötter 1994, S. 86)
Auf jeden Fall erfordert die Einbeziehung der Herkunftsfamilie von der heilpädagogischen Pflegefamilie ein hohes Maß an Konfliktbewältigungspotential, Toleranz, Offenheit, therapeutische Distanz und die Bereitschaft zur ständigen Reflexion ihrer Beziehungsarbeit.
Während unserer Tätigkeit als heilpädagogische Pflegefamilie haben wir wiederholt die Erfahrung gemacht, daß den pflegefamilialen Geschwisterbeziehungen eine bedeutende Rolle im Integrationsprozeß eines Pflegekindes zukommt. Diese Dimension wird in der einschlägigen Literatur meist vernachlässigt oder überhaupt nicht erwähnt.
Obwohl die Eltern-Kind-Beziehung der Geschwisterbeziehung vorgeordnet ist, können die Geschwisterkonstellation sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Kinder einen Einfluß auf das Gelingen oder Mißlingen der Integration eines Kindes haben, der nicht unterschätzt werden darf und in der Vermittlung von Pflegekindern berücksichtigt werden muß.
Faktoren, die dabei beachtet werden sollten sind:
-
das Alter der Geschwister
-
die Problematik des Pflegekindes
-
das Altersverhältnis der Kinder zueinander
Kinder beeinflussen sich in ihrer Entwicklung gegenseitig, und zwar negativ oder positiv. Wenn man z.B. ein Kind mit Verhaltensproblematik und Beziehungslosigkeit zu kleineren Geschwistern gibt, können dadurch Probleme entstehen, die bei einer umgekehrten Situation wahrscheinlich keine Rolle spielen. Wenn das Pflegekind und das bereits in der Familie lebende Kind gleich alt bzw. auf derselben Entwicklungsstufe sind, können Konkurrenzbeziehungen zu den Pflegeeltern und Rivalitäten untereinander ihre weitere Entwicklung erschweren, vor allem, wenn die Kinder schon älter sind. Sind die Kinder noch sehr klein, wird eine gute Beziehung eher gelingen, weil die Kinder bereits miteinander aufwachsen.
Bei der Integration von behinderten Kindern in eine Pflegefamilie ist weiter zu berücksichtigen, daß die Geschwister durch die Behinderung des Pflegekindes nicht zu sehr an den Rand gedrängt werden dürfen. D.h. daß sie nicht - was bei leiblichen behinderten Kindern oft geschieht - unter der Verantwortung für das behinderte Kind leiden sollen und aufgrund der Überbeanspruchung der Eltern durch das behinderte Kind in ihrer Bedürfnisbefriedigung zu kurz kommen sollten. Denn, wenn den gesunden Kindern nicht von vornherein zu viel Verantwortung übertragen wird, dann wächst die Solidarität zwischen den Geschwistern von selbst, sie übernehmen von sich aus mehr Verantwortung und Integration ergibt sich im ganz normalen alltäglichen Zusammenleben ohne explizite Forderung.
Wenn man den beziehungsdynamischen Wechselwirkungen unter Geschwistern Beachtung schenkt, dann zeigt sich auch, daß es ungünstig ist, mehrere Kinder mit der gleichen Problematik in eine Pflegefamilie aufzunehmen.
Auch der Forderung, daß Geschwister möglichst zusammen vermittelt werden sollen, kann in der praktischen Arbeit nicht immer nachgekommen werden, da Kinder mit sozialer Deprivation erhöhten Nachholbedarf an intensiven und positiven Beziehungserfahrungen haben, sodaß eine Familie mit dieser Aufgabe bei zwei Kindern leicht überfordert sein kann, bzw. es dadurch auch geschehen kann, daß sich die Geschwister, aufgrund ihrer negativen Erfahrungen gegenseitig in der Entwicklung neuer Beziehungen behindern. (Nienstedt & Westermann, 1989)
"Das Kind bedarf der Unterstützung in seiner Identitätssuche und wir sollen verhindern helfen, daß es aus allseitiger Loyalität zur Windfahne wird oder aus Trotz in die Opposition gegen alle und alles geht. [...] Damit sei aber klar einem Wertepluralismus das Wort geredet, im Gegensatz zur Wertneutralität, die sich nach unserer Erfahrung eher Fachleute leisten können, die nach einer mehr oder weniger kurzen Intervention das System wieder verlassen können." (Hofmann & Hofmann 1990, S. 79)
Wenn Pflegeeltern und Herkunftseltern eine gemeinsame Elternschaft gestalten wollen, die sich für das Kind positiv und nicht belastend auswirken soll, dann ist dies nur bei klarer Rollenverteilung möglich, da das Kind sonst in Loyalitätskonflikte zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern verwickelt wird. Für die gesunde Persönlichkeitsentwicklung braucht jedes Kind Eindeutigkeit und Sicherheit in der Zugehörigkeit und weiters muß für das Kind deutlich sein, wer seine primären Bezugspersonen sind. Ob diese die leiblichen Eltern oder die psychologischen Eltern sind, ist für das Kind nicht wichtig. Für ein kleines Kind sind automatisch jene Menschen die Eltern, die es versorgen und seine Bedürfnisse befriedigen. "Wenn diese Beziehungen hinreichend befriedigend sind, dann ist das Kind in der Tat in der Lage, auch zusätzliche, differenzierte, aber qualitativ andersartige Beziehungen zu weiteren Betreuungspersonen zu entwickeln, die jedoch für die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung des Kindes nicht den gleichen bestimmenden Einfluß haben, wie die 'Hauptbindungsfigur': die psychologische Mutter, der psychologische Vater." (Nienstedt & Westermann 1989, S. 238)
Irmela Wiemann, eine Vertreterin des Ergänzungsfamilienprinzips, sieht in der Gestaltung doppelter Elternschaft dann eine Chance, wenn kein Buhlen um das Kind stattfindet, die Rollen beider Teile von vornherein klar sind und kein Rivalitätsverhältnis zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie die Situation beeinträchtigt. "Es sind die Ausnahmen, daß abgebende Eltern so destruktiv und gefährlich sind, daß anonyme Vermittlung und ein langjähriger Kontaktabbruch notwendig sind. Zuständige Jugendämter sollten darum ringen, daß auch chaotische, obdachlose, alkoholabhängige oder mißbrauchende Eltern ihrem Kind auf ihre Weise das Okay geben, in der neuen Umgebung Wurzeln zu schlagen." (Wiemann 1991, S. 41)
Aber gerade an diesem Punkt scheint das Problem der Gestaltung von doppelter Elternschaft eine Widersprüchlichkeit in sich zu tragen: denn viele Ursprungseltern sind aufgrund ihrer negativen Erfahrungen während ihrer eigenen Erziehungsgeschichte gar nicht in der Lage, ihrem Kind die notwendige Eindeutigkeit und Klarheit zu signalisieren. Wenn sie dies könnten, dann wären sie ohnedies beziehungsfähig und könnten ihr Kind wahrscheinlich selbst versorgen. Wenn Eltern ihrem Kind das "Okay" vermitteln können, dann ist diesem Schritt bereits ein Prozeß der Trauerarbeit vorausgegangen, der das Loslassen überhaupt möglich macht. Das heißt weiter, daß auf jeden Fall mit den Herkunftseltern therapeutisch gearbeitet werden muß, um die geforderte Qualität der Zusammenarbeit zu erreichen. Da dies aber aus sozial-organisatorischen sowie finanziellen Gründen im Bereich der Jugendwohlfahrt selten der Fall ist, liegt es meist im Aufgabenbereich der Pflegeeltern, Konflikte, die aus dem nicht eindeutigen Verhalten der Herkunftseltern gegenüber ihrem Kind entstehen, aufzufangen, zu balancieren und mit dem Kind zu bearbeiten: Hier ist therapeutische Kompetenz der Pflegeeltern verlangt, da oft jahrelange mühevolle Beziehungsarbeit mit den Herkunftseltern nötig ist.
Dieses Ziel ist oft nicht leicht zu realisieren, wenn Pflegekinder auf Besuchskontakte bei der Herkunftsfamilie mit psychosomatischen Beschwerden und verstärkten Verhaltensauffälligkeiten reagieren, und in der Pflegefamilie rein gefühlsmäßig die Frage auftaucht, warum ein Kind, wenn es sich mit all seinen ihm zur Verfügung stehenden Ausdrucksmitteln gegen die belastende Situation wehrt und sichtlich überfordert ist, sich trotzdem mit der Herkunftsfamilie auseinandersetzen muß. Das Kind müßte in der Lage sein, Beziehungen in ihrer Wichtigkeit zu reihen, es müßte eine Entscheidungskompetenz mitbringen, die Erwachsene oft nicht haben. Auch auf die Abhängigkeit des Kindes von seinen Eltern ist an dieser Stelle wieder hinzuweisen. (vgl. Kap. 4.2) Vom Kind wird folglich etwas verlangt, was es in seinem bisherigen Leben noch nicht gelernt hat, da es ihm seine Eltern nicht vermitteln konnten. Wer hat in diesem Spiel von vornherein die besseren Karten und wem nützt es letztlich?
Hilft es dem Kind zur besseren Bewältigung seines Lebens, wenn es ständig mit seiner biographischen Wirklichkeit konfrontiert ist oder nimmt es ihm nicht auch die Chance, sich als ein "ganz normales" Kind zu begreifen? Wird das Kind zum Therapeuten seiner Eltern und übernimmt es die Funktion, in ihnen die Illusion befriedigender Eltern-Kind-Beziehung aufrechtzuerhalten um den Preis der eigenen Gefährdung?
"Auch Kinder dürfen psychisch nicht mißhandelt werden. (Erwachsene) Ehepartner dürfen sich scheiden lassen, Kindern wird das Recht verweigert, sich von ihren leiblichen Eltern scheiden zu lassen, auch wenn sie physisch oder psychisch mißhandelt werden." (Schreiner 1991, S. 39)
Es wird in der täglichen Praxis der Sozialarbeit weiterhin schwierig sein, den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht zu werden, aber es sollte in der Diskussion und bei anfallenden Entscheidungen nicht auf das betroffene Kind vergessen werden. Das gesetzlich verankerte Kindeswohl sollte in der Praxis nicht so ausgelegt werden, daß in ihm nur der Wille und die Interessen der Erwachsenen verkörpert sind.
Denn oft ist es so, daß das Kind, wenn die Herkunftseltern auf Besuchskontakte bestehen, seine "Realität" bewältigen lernen muß. Wenn jedoch die Eltern keinen Kontakt zum Kind wollen, dann muß sich das Kind auch damit abfinden. Ob es auf die eine oder andere Form überfordert sein kann, bleibt in beiden Fällen meist die sekundäre Frage: eine doppelte Elternschaft kann für das eine Kind förderlich sein, für das andere dazu beitragen, im Leben zu scheitern.
Im Interesse des Kindes wäre es wohl besser, wenn sich die Vertreter des Ergänzungsfamilienprinzips als auch jene des Ersatzfamilienprinzips in der Sozialarbeit mit Kindern in sinnvoller Weise ergänzen würden. Eine einfühlsame, dem Kind entsprechende Entscheidung beruht auf der Berücksichtigung vieler Faktoren und verlangt Mut zu wohlüberlegter Intervention im richtigen Augenblick. Auch oder gerade Entscheidungen in rechtlichen Belangen sollten ebenso von möglichst verschiedenen Fachkräften gemeinsam getragen werden (auch den Pflegeeltern soll Kompetenz in der Beurteilung der für das Kind förderlichen Maßnahmen zugesprochen werden) und - nicht zuletzt - nicht nur von Juristen gefällt werden, die unter Umständen, da sie meistens die Lebensumstände des Kindes nicht kennen, einseitige Entscheidungen treffen, die fatale Folgen für das weitere Leben eines Kindes haben können.
Bezogen auf die unterschiedlichen Erkenntnisse in der Erforschung des Pflegekinderwesens ist die Pflegefamilie aus systemisch orientierter Sicht als Ergänzungsfamilie zur Herkunftsfamilie zu sehen, aus individuumzentrierter psychoanalytischer Sicht hingegen als Ersatzfamilie der Herkunftsfamilie.
Aus diesem ungeklärten Theorienstreit ergeben sich in der Folge Unsicherheiten für die Praxis des Pflegekinderwesens, die sich sowohl auf die Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien, als auch auf die Zusammenarbeit mit der Pflegefamilie sowie auf die Beziehungsarbeit mit der Herkunftsfamilie auswirken.
Die Vertreter des Prinzips der Ergänzungsfamilie rechtfertigen ihre theoretischen Auffassungen:
-
mit dem Recht des Kindes auf seine Identität, was erfordert, daß es sich real, mittels Besuchskontakten mit seiner Herkunftsfamilie auseinandersetzen kann,
-
mit der dem Individuum übergeordneten Rolle des Systems als Einheit;
-
mit der Fähigkeit des Kindes, mehrere Bindungen gleichzeitig haben zu können.
-
Daraus läßt sich die Notwendigkeit der therapeutischen Arbeit mit der Herkunftsfamilie ableiten.
Die Vertreter des Prinzips der Ersatzfamilie auf der anderen Seite rechtfertigen ihre theoretischen Auffassungen:
-
mit dem Recht des Kindes (besonders bei traumatischen Beziehungserfahrungen) auf Sicherheit und Neuaufbau von Bindungen;
-
aus diesem Grund und wegen der eingeschränkten Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie ist eine Rückführung nicht anzustreben;
-
Besuchskontakte belasten das Kind unnötig und dienen nur der Illusion von aufrechten Eltern-Kind-Beziehungen bei den Herkunftseltern.
Gemeinsam ist den beiden Prinzipien die Forderung nach der Eindeutigkeit von Beziehungen als Grundvoraussetzung für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Als Konsequenz, die sich aus beiden theoretischen Prinzipien ableiten läßt, wäre festzuhalten, daß in der Praxis im Interesse des Kindes eine gemeinsame ergänzende und integrative Vorgangsweise gewählt werden sollte.
Von Jugendämtern sollte eine soweit als möglich vorausschauende Vermittlungstätigkeit im Pflegekinderwesen angestrebt werden. Das würde bedeuten konkret abzuklären, in welcher Funktion eine Pflegefamilie ein Kind aufnehmen soll: als vorübergehende Ergänzungsfamilie mit Blick auf eine eventuelle Rückkehr des Kindes in seine Herkunftsfamilie oder als Ersatzfamilie im Sinne einer langfristigen familiären Integration.
Weiters ist es wichtig, daß Jugendwohlfahrtseinrichtungen ihre Vorstellungen über die Form der pflegefamilialen Hilfe den Pflegefamilien zu Beginn einer Pflegebeziehung mitteilen und aktiv mit den Pflegeeltern im Verlauf des Pflegeverhältnisses zusammenarbeiten. Damit die Integration eines Kindes in die Pflegefamilie gut gelingt, sollte die Pflegefamilie bei Bedarf auf eine professionelle Unterstützung zählen können, sowie Supervision in Anspruch nehmen können. Ebenso ist bei dieser komplexen Aufgabenstellung, mit der die Pflegeeltern konfrontiert sind, ein entsprechendes Angebot an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen nicht mehr wegzudenken.
Von einer Pflegefamilie wird vermehrt eine gewisse fachliche Qualifikation verlangt, je mehr Aufgaben sie zu bewältigen hat. Sie soll nicht nur für die Erziehung eines Kindes geeignet sein, sondern auch gleichzeitig als beratender und unterstützender Partner für die Herkunftsfamilie fungieren können. Dazu muß sie eine grundsätzliche Bereitschaft für Problemlösungen und Reflexionsarbeit mitbringen, sowie flexibel und offen sein, was ihre familialen Grenzen betrifft. Gleichzeitig sollte diese Offenheit und Flexibilität aber nicht so weit gehen, daß die Grenzen diffus werden, denn die familiäre Identität aller in der Familie lebenden Mitglieder darf dadurch - besonders auch im Interesse des Pflegekindes - nicht gefährdet sein.
Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf allen Ebenen im Sinne einer sozialen Vernetzung, sowie die Anerkennung der Qualifikation und beruflichen Kompetenz von Pflegefamilien.
Inhaltsverzeichnis
"Die Qualität der Beziehungen, in die das behinderte Kind eingebunden ist (und in denen es interagiert) ist es, die seine Entwicklung und die Effizienz der Rehabilitationsarbeit bestimmt. Das ausgeklügeltste pädagogische und rehabilitative Programm ist dazu verurteilt, fehlzuschlagen, wenn es in ein System dysfunktionaler Beziehungen eingebettet ist. Es ist dies eine weitere Bestätigung dafür, daß die wesentlichen Aspekte der Wissenschaft, die den Menschen betreffen, auf der Grundlage der Qualität ihrer Beziehungen basieren." (Mara Selvini-Palazzoli in: Sorrentino 1988, S. 14)
Der Verein "Heilpädagogische Familien" wurde 1982 von Dr. Emese Szab¢ (Psychiaterin), Dr. Herrad Weiler (Psychologin) und Adelheid Elvin-Aull (Sozialarbeiterin) - drei engagierten Mitarbeiterinnen der kinderpsychiatrischen Abteilung der Klinik Innsbruck - gegründet. Der Initiative lag die Idee zugrunde, daß es doch möglich sein müßte, Familien zu finden, die Kinder, die offenbar "niemand mehr haben wollte", bei sich aufnehmen können, damit auch sie in einem familiären Rahmen aufwachsen können.
Vorerst wurden Frauen und Männer angesprochen, die in Sozialberufen tätig waren, und z.B. wegen eigener Kinder zu Hause blieben, aber ihre beruflichen Qualifikationen in der Familie nutzen wollten. Später interessierten sich auch Pflegeeltern mit anderen beruflichen Voraussetzungen, sie konnten spezielle, von MitarbeiterInnen des Vereins, angebotene Ausbildungskurse besuchen.
Um den Aspekt der Berufstätigkeit hervorzuheben, mußte eine Möglichkeit der Anstellung mit Sozialversicherung für den therapeutischen Sonderaufwand gefunden werden. Die arbeitsrechtlichen Bedingungen ließen sich dadurch erfüllen, daß sich der Verein im Sinn einer Trägerschaft als Arbeitgeber zur Verfügung stellte.
Da sich die Gründungsmitglieder aus den sich sonst meist voneinander abgrenzenden Fachbereichen der Medizin, Psychologie und der praktischen Sozialarbeit zusammensetzten, war von Anfang an ein quasi "multiprofessionelles" Arbeiten möglich. Gerade in diesem Arbeitsfeld bewährt sich das ergänzende Zusammenarbeiten der verschiedenen Fachbereiche.
Im Februar 1983 übersiedelte das erste Kind aus der Klinik zu seinen neuen Eltern.
Im September 1983 wurden vom Amt der Tiroler Landesregierung der Verein als Rehabilitationseinrichtung und die Familien als heilpädagogische Pflegefamilien anerkannt.
Ein halbes Jahr später nahm auch die Familienberatungsstelle ihre Arbeit auf. Sie unterstützt Pflege- und Adoptivfamilien beratend in Krisensituationen sowie Herkunftsfamilien im Ablösungsprozeß von ihren Kindern und vermittelt in der Zusammenarbeit zwischen Herkunftsfamilien und heilpädagogischen Pflegefamilien. Als sich zeigte, daß bei frühzeitiger Unterstützung von Kindern in ihren Herkunftsfamilien eine Fremdunterbringung manchmal vermieden werden konnte, wurde ab 1984 auch der Schwerpunkt der ambulanten Familienbetreuung ausgebaut.
Seit ihrem 13jährigen Bestehen haben sich die "Heilpädagogischen Familien" aufgrund des erhöhten Bedarfs an Hilfestellungen beachtlich vergrößert. Dieser Umstand machte - wenn die anfänglichen Grundsätze aufrechterhalten werden wollten - eine Neuorganisation des Vereins notwendig. Es war nun nicht mehr der kleine, für jeden überschaubare "Familienbetrieb", sondern nun mußten klare Kompetenzverteilungen und arbeitseffiziente Richtlinien erarbeitet werden: zum einen, damit nicht einzelne MitarbeiterInnen zur Gänze überlastet sind, zum anderen, um qualitatives, autonomes und eigenverantwortliches Handeln weiterhin gewährleisten zu können.
1992/93 haben sich mehrere MitarbeiterInnen des Vereins mit einem Organisationsberater zusammengefunden, um ein verändertes, den neuen Anforderungen entsprechendes, Konzept zu erarbeiten. Das in diesem Organisationsentwicklungsprozeß entstandene Arbeitspapier, sowie meine eigenen Aufzeichnungen dienen im wesentlichen als Grundlage für die folgenden Ausführungen.
Heute werden 244 Kinder von 144 MitarbeiterInnen betreut. Davon leben 43 Pflegekinder in 38 heilpädagogischen Pflegefamilien. (Stand April 1995)
Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, "etwas anderen Kindern" (H. Weiler) möglichst günstige Voraussetzungen für ein lebenswertes und selbstbestimmtes Leben mitzugeben. Daraus läßt sich das Grundprinzip des Vereins ableiten:
"Das Kind steht im Mittelpunkt des Bemühens."
Das heißt, es wird versucht, die individuellen Gegebenheiten jedes Kindes so gut wie möglich zu berücksichtigen, Handlungen und Aufgaben in seinem Interesse zu setzen und alle, das Kind sonst noch betreffende Aktivitäten, wie Therapie, Freizeitgestaltung und schulische Bildung, diesem Grundprinzip entsprechend zu gestalten. Weiters soll das Leben des Kindes in erster Linie von seinen Interessen bestimmt sein und nicht von fiktiven Vorstellungen der Erwachsenen.
-
"Wir unterstützen behinderte und/oder verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, ihnen möglichst günstige Voraussetzungen für ihre Persönlichkeitsentfaltung und Lebensbewältigung zu schaffen.
-
Dabei ist unser wichtigstes Anliegen, diesen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, in Familien aufzuwachsen. Zu diesem Zweck bieten wir Beratung und ambulante Unterstützung für Familien an.
-
Wenn diese Form der Unterstützung nicht ausreicht und die Familie über keine Ressourcen mehr verfügt, bieten wir die Möglichkeit einer heilpädagogischen Pflege an.
-
Wir wollen helfen, neue Formen und Möglichkeiten des Zusammenlebens von behinderten und nichtbehinderten Menschen zur Bewältigung des Alltags zu entwickeln.
-
Unsere Arbeit soll gesellschaftspolitische Auswirkungen zum Wohl benachteiligter Menschen haben." (Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung 1994, S. 10)
Grundsätzlich gilt im Interesse des Kindes die "Familie als Bezugssystem für die Arbeit". Das heißt, daß die vom Verein angebotenen Hilfestellungen um das Kind herum aufgebaut werden. Damit die Familie dem Kind einen geschützten Rahmen des Aufwachsens bieten kann, werden alle anderen stützenden sowie therapeutischen Strukturen unter Berücksichtigung des familiären Zusammenlebens angeboten. Dabei kommt der multiprofessionellen Zusammensetzung der MitarbeiterInnen im Verein eine besondere Bedeutung zu.
Werte:
-
"Wir gehen auf die Bedürfnisse der Kinder, Eltern, MitarbeiterInnen und aller anderen Partner möglichst individuell ein.
-
Wir respektieren die Eigenverantwortung der Kinder, Eltern, MitarbeiterInnen und aller anderen Partner.
-
Durch unsere Arbeit wollen wir Freiräume für Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen schaffen.
-
In der Begegnung mit Kindern, Eltern, MitarbeiterInnen und anderen Partnern wollen wir Selbsterfahrung möglich machen.
-
Wir bemühen uns um möglichst gute Kommunikation mit Kindern, Eltern, MitarbeiterInnen und allen anderen Partnern."
Grundsätze:
-
"Durch den bedürfnisorientierten Einsatz der MitarbeiterInnen entsprechend ihrer Qualifikation und Kapazität schaffen wir ein vielfältiges Betreuungsangebot für Kinder, Jugendliche und Familien.
-
Wir fühlen uns einer emanzipatorischen, entwicklungsorientierten Arbeitshaltung verpflichtet.
-
Die Transparenz im Verein muß für jedes Mitglied und für alle MitarbeiterInnen gegeben sein.
-
Im Rahmen unseres Evaluationssystems reflektieren und prüfen wir periodisch die Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse des Vereins.
-
Wirksame, bewußtseinsbildende Öffentlichkeitsarbeit in bezug auf die Bedürfnisse der Familien ist uns ein wichtiges Anliegen." (ebd., S. 11)
Die Werte und Grundsätze der "Heilpädagogischen Familien" wurden im gemeinsamen Organisationsentwicklungsprozeß von Mitgliedern des Vereins aus allen Arbeitsbereichen sowie mit der Unterstützung eines Beraters für Organisationsentwicklung erarbeitet.
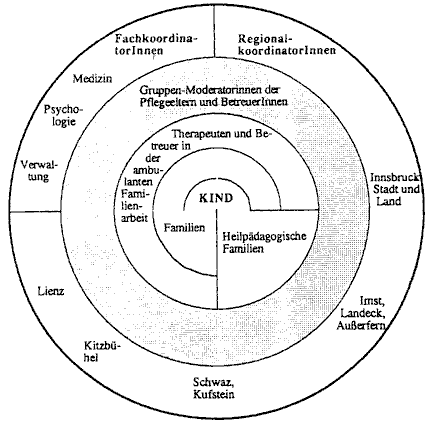
Schematische Darstellung der Vereinstätigkeit (entnommen aus dem Projektbericht der Organisationsentwicklung, Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung 1994)
Die organisatorische Struktur des Vereins "Heilpädagogische Familien" ist an seine geographische Verteilung gebunden:
-
Regionalkoordination Innsbruck Stadt u. Land, mit zentraler Stelle der Verwaltung und Fachkoordination,
-
Regionalkoordination Imst, Landeck, Außerfern,
-
Regionalkoordination Schwaz, Kufstein,
-
Regionalkoordination Kitzbühel,
-
Regionalkoordination Lienz (derzeit noch in Planung).
Der Verein "Heilpädagogische Familien" ist ein Trägerverein, dessen organisatorische Aufgabenstellung sich unmittelbar aus seinen Tätigkeitsbereichen ergibt:
-
den Bereich der heilpädagogischen Pflegefamilien,
-
den Bereich der ambulanten Familienarbeit,
-
den Bereich der Beratung, des Leitungsteams u.a. MitarbeiterInnen, die nicht der 1. u. 2. Gruppe angehören.
Die Mitglieder des Trägervereins setzen sich aus jeweils drei gewählten Vertrauensleuten dieser Gruppen zusammen, die als Mitglieder in den Trägerverein delegiert werden. Die delegierten Personen dürfen in keinem Anstellungsverhältnis zum Verein stehen, ihre Neuwahl erfolgt alle zwei Jahre.
Diese neun delegierten Mitglieder haben nun die Aufgabe, drei Vorstandsmitglieder zu wählen.
Der Trägerverein hat die Aufgabe einer Ethikkommission, die Aufgabe der Kontrolle und nimmt Revisionsanstöße wahr, verfügt jedoch über keine "Weisungsbefugnis" und tritt nach Bedarf, mindestens jedoch 3x im Jahr zusammen zusammen.
Das Leitungsteam setzt sich zusammen aus den FachkoordinatorInnen für
-
Medizin
-
Psychologie
-
Verwaltung
sowie aus den RegionalkoordinatorInnen der Außenstellen.
Das Leitungsteam hat alle fachlichen, finanziellen, organisatorischen, administrativen und personellen Aufgaben wahrzunehmen sowie deren Koordination untereinander zu sichern. Es achtet darauf, daß die MitarbeiterInnen des Vereins Voraussetzungen vorfinden, die ein freies und selbständiges Arbeiten ermöglichen. Die KoordinatorInnen tragen für ihren Bereich Eigenverantwortung, bereichsübergeordnete Entscheidungen werden im Leitungsteam besprochen und entschieden. Personelle Entscheidungen werden möglichst im gemeinsamen Konsens getroffen, sonst mit einfacher Mehrheit.
Ein weiteres Anliegen des Vereins ist, für alle MitarbeiterInnen transparent zu sein, das setzt geeignete Kommunikationsstrukturen voraus, die auf allen Arbeitsebenen gegeben sein müssen. Damit dieser Anspruch bei so vielen MitarbeiterInnen auch eingelöst werden kann, ist es notwendig, daß viele Zusammenkünfte auf unentgeltlicher und idealistischer Basis erfolgen.
Das Leitungsteam organisiert und führt Aus- und Weiterbildungen in den verschiedenen Fachbereichen durch und unterstützt heilpädagogische Pflegeeltern, TherapeutInnen und FamilienbetreuerInnen mit fachlicher Beratung, hilft bei der Konzepterstellung und nimmt, wenn nötig, gutachterliche Aufgaben wahr.
Weitere Aufgabengebiete, die das Leitungsteam betreffen sind: für die ausreichende Finanzierung der Vereinstätigkeit zu sorgen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, die Vernetzung mit anderen sozialen Einrichtungen anzustreben sowie Arbeitsergebnisse wissenschaftlich auszuwerten und festzuhalten.
Es wird unterschieden zwischen FachkoordinatorInnen und regionalen KoordinatorInnen. Die FachkoordinatorInnen sind im besonderen für die fachlich qualifizierte Beratung, die Organisation und Durchführung fachlicher Weiterbildung der MitarbeiterInnen sowie für die Mithilfe bei der Konzepterstellung verantwortlich. Die regionalen KoordinatorInnen sind verantwortlich für die Organisation und Koordination der an sie herangetragenen Aufgaben in ihrem Arbeitsbereich: u.a. Ausarbeitung regionaler Konzepte, Unterstützung der heilpädagogischen Pflegefamilien in ihrem geographischen Bereich, Suche nach neuen MitarbeiterInnen, Verwaltungsarbeiten, Kontakte zu anderen sozialen Einrichtungen.
Die Arbeitsbereiche der Fach- und RegionalkoordinatorInnen überschneiden sich teilweise sowohl in den Arbeitsaufgaben, als auch personell und zwar so, daß manchmal beide Aufgabenbereiche in einer Person wahrgenommen werden.
Bei weitgehend freier und eigenverantwortlicher Handlungskompetenz sind sie dem Leitungsteam unterstellt und haben sich mit diesem in bezug auf fachliche Konzepte, finanzielle, organisatorische und rechtliche Fragen abzusprechen.
Sie haben aber auch die Aufgabe wahrzunehmen, das Leitungsteam auf Probleme aufmerksam zu machen, anstehende Fragen zu thematisieren, das Leitungsteam in bezug auf die finanzielle Gebahrung sowie auf die Umsetzung des Leitbildes zu kontrollieren.
Die ModeratorInnen haben die Aufgabe, heilpädagogische Pflegeeltern und ambulante FamilienbetreuerInnen in ihrer Arbeit mit den Kindern zu unterstützen. Dies geschieht in Form von regelmäßig (mindestens einmal im Monat) stattfindenden MitarbeiterInnen-Runden, die sie vorbereiten, leiten und deren Ergebnisse auswerten.
Die ModeratorInnen müssen eigenverantwortlich und situationsgerecht handeln, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, tragen Sorge dafür, daß schriftliche Aufzeichnungen über die Kinder geführt werden, erheben Vorschläge und Bedürfnisse der MitarbeiterInnen und leiten diese an die KoordinatorInnen weiter. Sie informieren und beraten die KoordinatorInnen sowie das Leitungsteam bei der Erstellung von Therapiekonzepten.
ModeratorInnen besprechen mit den Familien oder Betreuern den Einsatz von Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen u.a. und geben die Wünsche an die KoordinatorInnen weiter. Da die heilpädagogischen Familien wegen der Kinder nicht sehr mobil sind, sind die ModeratorInnen die hauptsächlichen Ansprechpartner für sie. Sie nehmen in diesem Zusammenhang auch viele organisatorische Aufgaben wahr, die die Familien entlasten (sie erinnern an Termine, organisieren Familienhelfer, Therapeuten, bieten "Schützenhilfe" z.B. bei Schulproblemen...).
Wichtig ist vor allem in Krisensituationen, daß die ModeratorInnen auch privat jederzeit erreichbar sind. Sie kennen alle Kinder, der von ihnen geleiteten Elternrunden und unterstützen und beraten die Familien - wenn dies gewünscht wird - auch außerhalb der MitarbeiterInnenrunden.
Ambulante FamilienbetreuerInnen haben den Auftrag, Kinder in ihren Herkunftsfamilien zu unterstützen, sodaß sie weiterhin in ihrer Familie aufwachsen können. Die Zeit, die sie in den Familien verbringen ist je nach Bedarf unterschiedlich, ebenso ist die Form der Betreuung in jeder Familie eine andere.
Sie vermitteln, organisieren und stützen, um das System der Familie aufrecht zu erhalten. Sie arbeiten anhand eines Therapiekonzeptes, das ständig in bezug auf das Therapieziel überprüft wird und beziehen sich in ihrer Arbeit auf familiensystemische Erkenntnisse.
Ambulante FamilienbetreuerInnen nehmen, so wie heilpädagogische Pflegefamilien, an regelmäßigen Supervisionsrunden und Teambesprechungen teil und verpflichten sich, Fortbildung wahrzunehmen. Weiters informieren sie ModeratorInnen und KoordinatorInnen über ihre tägliche Arbeit und beraten sich diesbezüglich mit den von ihnen betreuten Familien. Sie sind mitverantwortlich für das Wohlergehen des Kindes in seiner Familie und versuchen die Eltern entsprechend zu beraten. Sie müssen vor allem in Krisensituationen eigenverantwortlich handeln und abschätzen können, ob für das Kind in seiner Familie noch ausreichend positive Voraussetzungen für seine Weiterentwicklung gegeben sind.
Die heilpädagogischen Pflegefamilien befinden sich in einer Doppelrolle. Sie sind einerseits die nächsten Bezugspersonen für das Kind und wissen, da sie quasi rund um die Uhr im "Dienst ihres Kindes" stehen, am besten, was für das Kind richtig und wichtig ist, andererseits ist ein Elternteil (manchmal auch beide), für einen bestimmten Zeitabschnitt, im Verein als heilpädagogische BetreuerIn angestellt, die aufgrund der Anstellung dem Dienstrecht im Hinblick auf "Anweisung und Kontrolle" unterliegt.
Heilpädagogische Pflegefamilien nehmen die Aufgabe und somit die Verantwortung auf sich, ein meist behindertes Kind ein weites Stück seines Lebens zu begleiten, dem von ihnen betreuten Kind familiäre Geborgenheit zu vermitteln und ihm zu größtmöglicher Selbständigkeit zu verhelfen. Auch sie arbeiten nach einem Therapiekonzept und verpflichten sich, so wie die ambulanten Familienbetreuer, systemisch zu arbeiten und den Kontakt zur Herkunftsfamilie aufrecht zu erhalten.
Sie informieren und besprechen in den Elternrunden mit ihren ModeratorInnen die Entwicklung des Kindes, das Zusammenleben in der Familie, bearbeiten mit ihnen anfallende Probleme und tragen mit ihrer praktischen Arbeit zu theoretischen Erkenntnissen bei. Weiters leisten sie Aufklärungs- und dadurch Integrationsarbeit in ihrem gesellschaftlichen Umfeld.
-
Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit: Die Pflegeeltern müssen zum Kind eine lang andauernde tragfähige Beziehung aufbauen können, damit seine Integration in die Familie gelingen kann. Weiters müssen sie offen sein für Beratung und Zusammenarbeit mit Fachkräften und nicht nur im Vertrauen auf die von ihnen vermittelte familiäre Geborgenheit agieren.
-
Stabile Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur Reflexion und Selbsterfahrung: Pflegeeltern müssen sich im klaren sein darüber, daß das Aufwachsen des behinderten Kindes vor allem wegen der oft vorausgegangenen "behindernden" Lebensumstände nicht problemlos verlaufen wird. Sie müssen zu einer empathischen Grundhaltung fähig sein, beim Ausbleiben schneller Fortschritte Enttäuschungen in Kauf nehmen können, auf ein "Übertherapieren" verzichten und sich auch an kleinen alltäglichen Fortschritten freuen können.
-
Wertschätzung für andere Menschen empfinden: Fernab unseres kategorisierenden Leistungsdenkens müssen die Pflegeeltern Neugier und Offenheit für andere Personen ohne negativ wertende Grundhaltung empfinden können. Dies gilt besonders auch für die Zusammenarbeit mit den Herkunftsfamilien.
-
Bereitschaft zur Reflexion eigener Erfahrungen: Da gerade zu Beginn eines Pflegeverhältnisses die familiäre Belastung nicht zu unterschätzen ist, ist es notwendig, eigene Erfahrungen reflektieren und in Supervisionsgruppen gemeinsam thematisieren und bearbeiten zu können.
-
Flexible, spontane Persönlichkeit: Pflegeeltern sollten sensibel genug sein, auf Zeichen, die das Kind setzt, reagieren zu können, um es dabei in seinem Sinne spontan und individuell in seiner Entwicklung fördern und unterstützen zu können.
-
Guter Realitätsbezug: Pflegeeltern sollten ein Kind nicht aus übertriebenen sozial-ethischen Gründen bei sich aufnehmen. Eine fundiertere und belastbarere Voraussetzung ergibt sich aus einer kindzentrierten und psychologischen Betrachtungsweise, die gleichwertig neben der inneren Anteilnahme und der liebenden Fürsorge der annehmenden Eltern stehen muß. (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 92)
Ohne in Frage zu stellen, daß das Aufwachsen eines Kindes in seiner Herkunftsfamilie so lange als möglich zu unterstützen ist, möchte ich einige Vorteile der heilpädagogischen Pflegefamilien anführen. Sie sollten auch nicht im Sinn einer Konkurrenz mit anderen institutionellen Möglichkeiten gesehen werden, sondern als eine gangbare Alternative unter anderen. Die Entscheidung, welche Möglichkeit für welches Kind die beste ist, bleibt weiterhin von vielen Faktoren abhängig, die in der Gesamtheit weitestgehend zu berücksichtigen sind.
-
Heilpädagogische Pflegefamilien eignen sich für Kinder mit den verschiedensten Problemen, da sie speziell bzw. den Bedürfnissen der zu vermittelnden Kinder entsprechend ausgesucht werden können.
-
Da sie als institutionelle Einheit sehr klein und überschaubar sind, können sie auch flexibel auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, spontan handeln und auf Veränderungen sofort angemessen reagieren.
-
Heilpädagogische Pflegefamilien sind nicht an zentrale Voraussetzungen gebunden, sie können ihre Arbeit "überall" ausführen und kommen daher integrativen Forderungen entgegen.
-
Sie sind sehr "ökologische Institutionen", da sie sich nach erfüllter Aufgabe wieder auflösen. (Hofmann & Hofmann 1990, S. 91)
-
Das alltägliche Zusammenleben wird von mehreren verschiedenen Persönlichkeiten gemeinsam gestaltet, dadurch ergibt sich eine Vielfalt des Erlebens und Zusammenlebens, mit einem direkten Bezug zur Realität.
-
Da die heilpädagogische Pflegefamilie in ihrer Struktur "begreifbar" ist, ergibt sich für das Kind unmittelbar ein "Er-Leben" nicht ohne Sinnzusammenhang. Das Kind lernt dadurch, Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst sowie für die anderen Familienmitglieder.
-
"Behinderungen, die nicht in der eigenen Familie entstanden sind, können wertfrei und ohne moralische Schuldfrage gesehen und erlebt werden. Es ist daher ausreichend, wenn die Pflegeeltern das Erlebnis der Behinderung ihres Pflegekindes in ihrer Familie als nicht wesentlich belastend für die bisherigen Familienstrukturen ansehen." (Masur & Tiesler & Schiel 1982, S. 92)
-
Durch die unterschiedliche Zusammensetzung und den verschiedensten Aufgaben der Familienmitglieder ergibt sich mehr Raum für Bestätigung, als Grundlage für Selbstbewußtsein und Selbständigkeit.
-
Die heilpädagogische Pflegefamilie muß aufgrund ihrer Autonomie nicht "institutionsangepaßt" agieren, sondern kann "menschenangepaßt" arbeiten.
In der einschlägigen Literatur werden verschiedenste Motivationen, warum Pflegefamilien Kinder aufnehmen, angeführt. Im folgenden möchte ich auf einige Motive näher eingehen, von denen wir als Pflegefamilie nur den wenigsten zustimmen können.
Nach einer Aufstellung des Jugendamtes des Kantons Zürich werden z.B. die folgenden Motive angeführt (zitiert in Zenz & Weiler & Fischer 1990, S. 12):
-
Soziales Engagement
-
Suchen nach einer sinnvollen Aufgabe, wenn die eigenen Kinder außer Haus gehen
-
Kinderlosigkeit
-
Spielkameraden für bereits vorhandene Kinder
-
"Unausgefüllte Frauen"
-
Frauen, die gerne Babies betreuen bzw. Schwierigkeiten mit älteren Kindern haben
-
Hoffnung auf positive erzieherische Auswirkungen auf die eigenen Kinder
-
Pflegekind soll eigenes verstorbenes Kind ersetzen
Jürgen Blandow (1972) erklärt die Motivation von Pflegefamilien, ein Pflegekind anzunehmen, vor allem mit verschiedenen, diesem Entschluß vorangegangenen, Deprivationserfahrungen der Pflegemutter.
Er unterscheidet dabei zwischen:
-
der kulturellen Deprivation: die Pflegemutter konnte der verinnerlichten kulturellen Forderung, "Mutter" zu sein im Verständnis des traditionellen Rollenkonzeptes, bisher nicht entsprechen, - mit der Übernahme des Pflegekindes versucht sie, dieser Rollenerwartung entgegenzukommen;
-
der familiären Deprivation: hier soll mit dem Pflegekind familiäre Stabilisierung erreicht werden, oder auch für das eigene Kind ein Spielkamerad gesucht werden;
-
der persönlichen Deprivation bei eigenen unglücklichen Kindheitserlebnissen, bei einer vermeintlichen Schuld am Tod eines Kindes oder anderen unbewußten traumatischen Erfahrungen - hier soll die Annahme eines Pflegekindes zu persönlicher Stabilität beitragen;
-
die wirtschaftliche Deprivation, wonach mit der Annahme eines Pflegekindes das eigene wirtschaftliche Interesse befriedigt werden soll oder das Pflegekind als Arbeitskraft eingesetzt wird.
Nach Jürgen Blandow haben alle Pflegemütter gemeinsam, daß sie aus irgendeinem Grund am Fehlen eines Kindes leiden. Mit der Aufnahme eines Pflegekindes wird die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach einem Kind und der tatsächlichen Kinderlosigkeit überwunden und die Deprivation aufgehoben.
Aus unserer Erfahrung können wir nur sagen, daß manche der angeführten Gründe vielleicht ihre Berechtigung haben, viele andere aber auch nicht berücksichtigt wurden, und keiner dieser Gründe für sich isoliert besteht und nicht einseitig behauptet werden soll. In diesem Sinne schreiben auch Masur, Tiesler und Schiel (1982, S. 98):
"Diese Bemühungen um die Absicherung nicht nur des zukünftigen Wohls des Pflegekindes, sondern auch um die spätere Feststellung der Richtigkeit der eigenen Entscheidung des vermittelnden Sozialarbeiters/Sozialpädagogen, sind sicher notwendig. Bis zu einer gewissen Grenze sind sie auch berechtigt und als strukturelle Entscheidungshilfen anzusehen. Sie sind aber keinesfalls dazu angetan, um vor Beurteilungsfehlern, Fehlinterpretationen, affektiven Haltungen und schlicht ungerechten Beurteilungen zu schützen; und sie sind ebenso wenig dazu geeignet, die Eignung der sich bewerbenden Pflege- und Adoptiveltern zu bestimmen."
Verschiedenste Motivationen sind zulässig, ein eigenes Kind zu bekommen, bei der Annahme eines Pflegekindes werden jedoch von vornherein traumatische, helfersyndromatische, religiöse oder finanzielle Motive bzw. "Deprivationen" angelastet.
Ist aber das Interesse und die Freude an der Entwicklung eines Kindes nicht "Motiv" genug?
Hat diese "Arbeit" in der gesellschaftlichen Auffassung von Beruf und Arbeit nicht ebenso ihre Berechtigung wie jede andere Tätigkeit auch? Welche Motive sind im allgemeinen für eine positiv besetzte Berufsausübung ausschlaggebend? Warum schließt z.B. Entlohnung als Motiv, das ja vorwiegend auch als Grund für die Berufsausübung angegeben wird, nicht von vornherein eine Eignung aus?
Ist mit einer Stunde Sozialarbeit in einer institutionellen Sozialeinrichtung - nur weil sie außerhalb der Familie erbracht wird - mehr Garantie für eine gute Arbeitsleistung gegeben als mit der Sozialarbeit innerhalb der Familie?
Im Rahmen der ambulanten Familienarbeit wurde auch die Initiative für ein Tagesmütterprojekt gesetzt. Die in Frage kommenden heilpädagogischen Tagesmütter werden in Fortbildungskursen ausgebildet, sie übernehmen die Betreuung von Kindern tagsüber, um so Familien oder auch alleinerziehende Mütter zu entlasten. Mit dieser Form der Betreuung kann auch eine drohende Fremdunterbringung verhindert werden.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des Vereins liegt in der Betreuung von HIV-betroffenen Müttern und Kindern. Hier gilt es, individuell angepaßte Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren, die den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen, von stundenweise angebotener Hilfe bis zu Dauerpflegeplätzen.
Im Entstehen begriffen ist die Unterstützung von behinderten Jugendlichen bei der Suche nach einem integrierten Arbeitsplatz.
Nachdem einige der im Verein betreuten Kinder bereits erwachsen sind, stellt sich die Frage, wie die begonnene Integrationsarbeit auch nach der Schulzeit weitergeführt werden kann. Geistigbehinderte Menschen finden in der Regel keinen Arbeitsplatz in der freien Marktwirtschaft. Die momentane wirtschaftliche Lage erschwert dies noch mehr, ebenso "behindern" - obwohl von ihrer Intention her richtig - arbeitsrechtliche Sicherungen (z.B. der Kündigungsschutz für behinderte ArbeitnehmerInnen) ein längeres Beschäftigungsverhältnis. Arbeitgeber stellen behinderte Menschen zwar gerade noch für eine Probezeit oder Schnupperlehre ein, sie machen aber von vornherein klar, daß sie nicht in der Lage sind, einen Dauerarbeitsplatz zu bieten. So bleibt letztlich doch wieder nur der eingeschränkte Beschäftigungsraum einer Werkstatt für Behinderte.
Da in Österreich die Integration am Arbeitsplatz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch in den "Kinderschuhen" steckt, sind MitarbeiterInnen des Vereins auf der Suche nach entsprechenden Modellen außerhalb Österreichs. Dabei sind sie auf das Projekt der Hamburger Arbeitsassistenz gestoßen, das über eine Elterninitiative gegründet wurde und sich an dem in den USA schon erfolgreich arbeitenden Modell des "Supported Employment" ("Unterstützte Beschäftigung") orientiert. Die Hamburger Arbeitsassistenz kann mit ihrem Modell trotz wirtschaftlicher Rezession auf gute Erfolge verweisen - deshalb möchte ich ihr Konzept, mit dem seit 1992 erfolgreich gearbeitet wird, kurz vorstellen.
Die Hamburger Arbeitsassistenz hat sich zum Ziel gesetzt, geistigbehinderte Personen bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz zu unterstützen und sie im Arbeitsprozeß zu begleiten.
-
Bewerbungsverfahren: Mit Personen, die sich bei der Hamburger Arbeitsassistenz vorstellen, wird in Gesprächen ein individuelles Fähigkeits- und Interessenprofil erarbeitet, ebenso werden auch von Bezugspersonen Informationen eingeholt.
-
Auswahl eines geeigneten Arbeitsplatzes: Mit Betrieben, die Stelleninserate aufgegeben haben, wird telefonisch Kontakt aufgenommen und die grundsätzliche Bereitschaft, einen behinderten Menschen anzustellen, abgeklärt. Anschließend werden persönliche Gespräche über die Möglichkeit und Grenzen des Arbeitseinsatzes geführt, dann folgt die Besichtigung. Hier ist es notwendig, betriebswirtschaftliche als auch soziale Gesichtspunkte sowohl von der Unternehmerseite als auch vom Bewerber zu berücksichtigen und zu klären. Arbeitsplätze werden vor allem im Dienstleistungsbereich (Altenheime, Tankstellen, Verpackungsindustrie, Gastronomie u.a.) gefunden sowie in Branchen, die normalerweise durch eine hohe Fluktuation gekennzeichnet sind und wo der Arbeitgeber an einer zuverlässigen Arbeitskraft interessiert ist. Dabei sind Klein- und Mittelbetriebe eher bereit, behinderte Personen einzustellen.
-
Vorbereitung der Arbeitsaufnahme: Es kommt vor, daß Arbeitsplätze auch neu geschaffen werden, indem einfachere Tätigkeiten, die zuerst auf mehrere Arbeitnehmer verteilt waren, zu einem neuen Arbeitsplatz umgestaltet werden. Meist werden jedoch im Rahmen des Integrationsprozesses Fähigkeiten aktiviert, die sowohl von den Begleitern als auch vom Betrieb unterschätzt worden sind, was zur Folge hat, daß der Eigenverantwortungsbereich meist erweitert wird.
-
Die Arbeitsbegleitung oder das "Job Coaching": Dies ist das Kernstück des Konzeptes und bezieht sich auf die Begleitung und Betreuung des behinderten Menschen am Arbeitsplatz. Vom Konzept her ist die Arbeitsplatzbegleitung zeitlich unbegrenzt angelegt, Dauer und Intensität wird individuell bemessen, dabei wird jedoch auf weitgehende Selbständigkeit im betrieblichen Umfeld wert gelegt. Wesentliche Elemente des Job-trainings sind: Fahrtraining (selbständiges Erreichen und Verlassen des Arbeitsplatzes), räumliche Orientierung im Betrieb, zeitliche Orientierung (pünktlicher Arbeitsantritt, Einhalten der Pausen, Arbeitsende), Training der konkreten Arbeitstätigkeit, Erlernen sozialer Kompetenzen, Vermittlung von Kommunikationsfähigkeiten bei den nichtbehinderten ArbeitskollegInnen.
-
Der Job Coacher oder Arbeitsbegleiter: Der Arbeitsbegleiter arbeitet vor Arbeitsantritt einige Tage im ausgewählten Betrieb, um die Arbeit selbst kennenzulernen und um mit den MitarbeiterInnen Kontakt aufzunehmen und sie auf das neue Beschäftigungsverhältnis vorzubereiten. Die Aufgaben des Job Coachers sind auf die Bedürfnisse der behinderten Person abgestimmt, von der einfachen Anwesenheit und Arbeitseinführung, bis hin zur Struktur vermittelnden Erstellung eines Tages- und Wochenplans.
Es zeigte sich, daß mit länger andauernder Beschäftigung die Intensität der Betreuung aufgehoben werden konnte, es jedoch weiterhin notwendig ist, aktiven Kontakt zur Arbeitsstelle zu halten, um aufkommende Probleme frühzeitig erkennen und ihnen begegnen zu können, da Arbeitgeber und KollegInnen sowie der behinderte Arbeitnehmer bei Problemen nicht immer von sich aus Initiative zu deren Lösung ergreifen.
Weiters ist zu bemerken, daß zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Person länger als drei Monate in einem anderen Arbeitsverhältnis stand und alle Personen öffentlich unterstützt wurden. Dies bedeutet längerfristig, daß die Vermittlung über die Arbeitsassistenz (alle behinderten Arbeitnehmer stehen in einem normalen Arbeitsverhältnis) beträchtliche Kosteneinsparungen zur Folge hat. (Daten aus dem 2. Zwischenbericht der Hamburger Arbeitsassistenz 1993)
Die Auftraggeber des Vereins "Heilpädagogische Familien" sind: die Rehabilitationsabteilung des Landes Tirol (Va) und die Jugendwohlfahrtseinrichtungen der Bezirkshauptmannschaften des Landes. Es bestehen jedoch auch Verträge mit den Jugendwohlfahrtseinrichtungen anderer österreichischer Bundesländer (bei Pflegekindern). Die Beratungsstelle wird über das Bundesministerium für Jugend und Familie finanziert. Weitere finanzielle Ressourcen ergeben sich aus Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen Spenden, Sponsoren.
Die Abrechnungen mit dem Verein erfolgen in unterschiedlichsten Formen, mittels Stunden- oder Tagessatz sowie auch monatlich.
Der Verein in der Funktion des Arbeitgebers bietet aufgrund der vielfältigen Arbeitsaufgaben unterschiedliche Entlohnungsmodelle an.
Vereinsinterne Entlohnung der Pflegeeltern: (Die Einstufung ist abhängig vom Behinderungsgrad und vom erhöhten Sonderaufwand des Kindes)
-
Stufe 1: Bei der Betreuung von Kindern, die voraussichtlich völlig rehabilitiert werden können, bekommen die Pflegeeltern eine erhöhte Aufwandsentschädigung auf Werkvertragsbasis.
-
Stufe 2: Bei der Betreuung von Kindern mit mittelschwerer Behinderung werden die Pflegeeltern im Ausmaß von 20 Wochenstunden für den erhöhten heilpädagogischen Sonderaufwand angestellt.
-
Stufe 3: Bei der Betreuung von Kindern mit schwerer und schwerster Behinderung erfolgt eine Anstellung der Pflegeeltern im Ausmaß von 40 Wochenstunden für den erhöhten heilpädagogischen Sonderaufwand.
Zusätzlich zum heilpädagogischen Sonderaufwand bekommen alle Pflegeeltern Pflegegeld für den Unterhalt des Kindes, dazu wird bei heilpädagogischen Pflegekindern auch die erhöhte Familienbeihilfe gewährt.
Vereinsinterne Entlohnung der ambulanten FamilienbetreuerInnen: (Die Entlohnung ist bei allen MitarbeiterInnen gleich, jedoch ist die Dauer des Arbeitseinsatzes abhängig von der beruflichen Qualifikation).
-
Stufe 1: Betreuer ohne Abschluß in einem psychosozialen Beruf arbeiten 1 3/4 Stunden in der Familie.
-
Stufe 2: Betreuer mit dem Abschluß einer FS oder BHS im psychosozialen Bereich arbeiten für die gleiche Bezahlung 1 1/2 Stunden in der Familie.
-
Stufe 3: Betreuer mit dem Diplom einer AK oder eines Studiums im psychosozialen Bereich arbeiten 1 1/4 Stunden in der zu betreuenden Familie.
-
Stufe 4: Betreuer aus dem Ausbildungsbereich der Stufe 3 mit Psychotherapeutenqualifikation arbeiten für die gleiche Entlohnung 1 Stunde in der Familie.
Zusätzlich zu diesen Leistungen erfolgt die Fahrtkostenrückvergütung. Dadurch kommt der von der öffentlichen Hand bezahlte Stundensatz ausschließlich dem Kind zugute.
Anmerkung am Rande: Die gesamte Buchhaltung und Kostenverrechnung wurde bis vor kurzem von einem Pflegevater geleistet, wobei viele ehrenamtliche Stunden angefallen sind.
Das österreichische Recht kennt neben der leiblichen Elternschaft und der Wahlelternschaft die Pflegeelternschaft, wobei sich der Begriff Pflegeeltern auch auf einzelne Personen beziehen kann. "Die dabei entstehenden Rechtsverhältnisse zwischen dem Kind und den Pflegeeltern einerseits sowie zu den Trägern der Jugendwohlfahrt andererseits sind durch das Zivilrecht und das Jugendwohlfahrtsrecht geregelt." (Mazal 1994, S. 15)
§ 186 ABGB nennt Pflegeeltern jene Personen, die ihre Rechte unmittelbar von Erziehungsberechtigten oder Jugendwohlfahrtsträgern übertragen bekommen. Der _ 186a beinhaltet die Regelung der Obsorge. Die Obsorge kann auch Pflegeeltern übertragen werden, und zwar dann, wenn die Beziehung zwischen ihnen und dem Pflegekind, jener zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommt, wenn sie zum Wohl des Kindes ist und das Pflegeverhältnis auf Dauer beabsichtigt ist.
§ 17 JWG sind Pflegekinder Minderjährige, die von anderen Personen als von bis zum dritten Grad Verwandten oder Verschwägerten, von Wahleltern oder vom Vormund gepflegt und erzogen werden. (Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 1990)
Pflegeeltern brauchen, wenn sie ein Kind bei sich aufnehmen wollen, eine Pflegebewilligung, die von der Jugendwohlfahrtsbehörde bei Erfüllung verschiedener festgelegter Kriterien ausgestellt wird und rechtlich als Bescheid gilt.
Pflegeeltern können ein Kind tagsüber betreuen (meistens aufgrund einer Ermächtigung der Erziehungsberechtigten und ohne Zustimmung des Jugendwohlfahrtsträgers im Sinn einer abgeleiteten Pflege durch Tagesmütter) oder auch zur Gänze, (dann sind sie Personen, denen auch die Erziehung des Kindes übertragen ist). Pflegeeltern dürfen nicht in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Kind stehen und haben wie leibliche Eltern die Pflicht, nach
§ 146 ABGB, das körperliche Wohl und die Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht und Erziehung besonders die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf zu wahren.
Die Rechte der Eltern bleiben im Fall einer Ermächtigung der Pflegeeltern ihrerseits (bzw. des Jugendwohlfahrtsträgers) unverändert und die Tätigkeit der Pflegeeltern tritt zur Berechtigung der Erziehungsberechtigten hinzu. Wenn die Pflege jedoch auf einer gerichtlichen Übertragung beruht, dann wird die eigenständige Position der Pflegeeltern begründet. Im Extremfall (wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist) kann das Gericht den leiblichen Eltern die Rechte zur Gänze entziehen, wobei hier immer der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs gilt. (Mazal 1994, S. 17f)
In der Rechtsstellung von Pflegepersonen sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die vom Gesetzgeber unterschiedlich beachtet und definiert werden. Zum einen sind es Aspekte der familien- und jugendwohlfahrtsrechtlichen Seite - sie beziehen sich direkt auf das Wohl des Kindes -, die in ihren Bestimmungen und Bedingungen sehr klar und deutlich ausgeführt sind, zum anderen ist es die persönliche Rechtsstellung der Pflegeeltern - sie bezieht sich nicht unmittelbar auf das Kind - die keine Regelung erfährt und daher von Pflegeeltern als mangelhaft empfunden wird.
Pflegeelternvereinigungen beklagen meist die fehlende soziale Absicherung und auch die Ungleichbehandlung von Pflegeeltern gegenüber institutioneller Pflege.
"Während Erziehungspersonen, die im Rahmen der institutionellen Pflege als Arbeitnehmer beschäftigt sind und damit nicht nur entsprechend bezahlt werden, sondern auch in den Anwendungsbereich der arbeits- und sozialrechtlichen Schutzgesetzgebung fallen, werde dieselbe Tätigkeit bei Unterbringung in einer Pflegefamilie nicht nur nicht abgegolten, sondern hätten die Pflegepersonen auch keinerlei soziale und arbeitsrechtliche Absicherung." (Mazal 1994, S. 26)
Es stellt sich die Frage, ob die Tätigkeit der Pflegeeltern in den privatrechtlichen oder in den öffentlich-rechtlichen Bereich fällt, ob ihre Arbeitsleistung dienstrechtlich (und somit in irgendeiner Form entlohnt werden soll) oder familienrechtlich (also unentgeltlich) betrachtet werden soll. Daraus ergibt sich die Diskussion, ob Pflegeeltern überhaupt - und wenn ja, in welcher Form - entlohnt, entschädigt oder sozialversichert werden können. Weiters werden in diesem Zusammenhang noch Bedenken angeführt, daß mit einer möglichen Entlohnung der Pflegeeltern der familienähnliche Charakter verloren gehen würde, da "Pflegeeltern eben nicht Arbeitnehmer sind, sondern auch aus ihrem Selbstverständnis heraus mit natürlichen Eltern zu vergleichen sind." (Mazal 1994, S. 58)
Daß sich beide Voraussetzungen nicht von vornherein widersprechen, sondern sich auch sinnvoll ergänzen können und die "Qualität" der Arbeitsleistung sowohl vom familienrechtlichen als auch vom dienstrechtlichen Standpunkt aus nicht leiden muß, zeigt sich an der schon 13jährigen Arbeitsweise des Vereins "Heilpädagogische Familien" in Tirol.
Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung, Verein "Heilpädagogische Familien" (Hg.): Projektbericht der Organisationsentwicklung. Innsbruck 1994.
Bächtold Andreas: Behinderte Jugendliche: Soziale Isolierung oder Partizipation? Bern & Stuttgart (Haupt) 1981.
Beck Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne: Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1986.
Beck Ulrich & Beck-Gernsheim Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1990
Bernard Jeff & Hovorka Hans: Behinderung ein gesellschaftliches Phänomen. Befunde, Strukturen, Probleme. Wien (Passagen) 1992.
Bieglmann Daniela: Kinder die übrig sind. Zur Geschichte und Gegenwart der Fürsorgeerziehung unter besonderer Berücksichtigung der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Kinderheimen mit Beispielen aus dem Kinderheim Pechegarten in Innsbruck. Innsbruck (Dipl.-Arb.) 1992.
Bösen Werner: Zwischen Entfremdung und Heimkehr. Das Konfliktfeld von Heim-, Pflege- und Adoptivkindern. Frankfurt/M. (Fischer) 1992.
Bracken von Helmut: "Soziologische und sozialpsychologische Aspekte." In: Bach Heinz (Hg.): Pädagogik der Geistigbehinderten. Berlin (Marhold) 1979, S. 421-443.
Bruckmüller Maria: "Unerwartete Lebensqualität im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung." In: Österr. Gesellschaft f. Heilpädagogik (Hg.): Lebensqualität und Heilpädagogik. Höbersdorf/Wien (Kaiser) 1993, S. 70-77.
Cirillo Stefano: Sind wir denn Rabeneltern? Familie in der Krise. Salzburg (Pusset) 1990.
Deppe-Wolfinger Helga (Hg.): Behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft. Weinheim, Basel (Beltz) 1983.
Elvin Peter: Das Jugendwohlfahrtsreferat der Bezirksverwaltungsbehörde. Hilfe für Kinder, Eltern und Familien. Innsbruck (Amt der Tiroler Landesregierung Abt. Vb) 1994.
Elvin Peter: Rechtsinformation für Pflegeeltern. Innsbruck (Amt der Tiroler Landesregierung Abt. Vb) 1994.
Fetka-Einsiedler Gerhard & Förster Gerfried (Hg.): Diskriminiert? Zur Situation der Behinderten in unserer Gesellschaft. Graz (Leykam) 1994.
Feuser Georg: "Die Lebenssituation geistig behinderter Menschen." In: Meister-Steiner Birgit & Schönwiese Volker & Wieser Ilsedore: Blinder Fleck und rosarote Brille. Thaur (Österr. Kulturverlag) 1989.
Feuser Georg: "Ein Abschluß als Anfang!" In: Stein Anne-Dore: Lebensqualität statt Qualitätskontrolle menschlichen Lebens. Berlin (Spieß) 1992.
Forster Rudolf & Schönwiese Volker (Hg.): Behindertenalltag. Wie man behindert wird. Wien, München (Jugend & Volk) 1982.
Friedlmayer Stefanie: "Arbeit mit Pflege- und Adoptivfamilien. Betrachtungen aus zwei unterschiedlichen Positionen zur Arbeit mit nicht leiblichen Eltern." In: Systeme Jg. 6, Heft 1/92, S. 59-66.
Hagmann Thomas & Simmen Ren‚ (Hg.): Systemisches Denken und die Heilpädagogik. Luzern (Edition SZH/SPC) 1990.
Hamburger Arbeitsassistenz (Hg.): Zweiter Zwischenbericht über die berufliche Integration von Menschen mit geistiger Behinderung. Hamburg 1993.
Heitkamp Herman: Heime und Pflegefamilien - konkurrierende Erziehungshilfen? Frankfurt/M. 1989.
Hierdeis Helmwart & Hug Theo: Pädagogische Alltagstheorien und erziehungswissenschaftliche Theorien. Ein Studienbuch zur Einführung. Bad Heilbrunn (Klinkhardt) 1992.
Hofmann Paul & Terry: "Gelebte Heilpädagogik in der Großfamilie." In: Hagmann Thomas & Simmen Ren‚ (Hg.) Systemisches Denken und die Heilpädagogik. Luzern (Edition SZH/SPC) 1990, S. 71-91.
Hubeny Christine: Pflegekinderfamilien in Tirol. Ihre psychologische Situation aus systemischer Sicht. Innsbruck (Dipl.-Arb.) 1994.
Jantzen Wolfgang: Sozialisation und Behinderung. Studien zu sozialwissenschaftlichen Grundfragen der Behindertenpädagogik. Gießen (Focus-Verlag) 1974.
Kessler Judith: Gemeinsam leben lernen. Behinderte und nichtbehinderte Kinder im integrierten Kindergarten. Wien (Jugend & Volk) 1986.
Kötter Sabine: Besuchskontakte in Pflegefamilien. Das Beziehungsdreieck "Pflegeeltern - Pflegekind - Herkunftseltern." Regensburg (Roderer) 1994.
Kumer Annemarie & Friedlmayer Stefanie & Braun Eveline: Zwischen Abbruch und Neubeginn. Eine Studie zur Demographie, Familiendynamik und Eingewöhnung von Pflegekindern. Wien (Deuticke) 1988.
Marschalek Nikola: Heimerziehung und Pflegeelternschaft als Gegenstand pädagogischer Analyse. Wien (Dipl.-Arb.) 1992.
Masur Rainer & Tiesler Johannes A. & Schiel Wittich: Eingliederung behinderter Kinder in Pflegefamilien. Das soziale, klinisch-psychologische Konzept. München, Basel (Reinhardt) 1982.
MazalWolfgang: Der Schutz von Pflegeeltern. Arbeits- und sozialrechtliche Fragen. Wien (Orac) 1994.
Mitterauer Michael & Sieder Reinhard: Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie. 3. Aufl. München (Beck) 1984.
Niedecken Dietmut: Namenlos.Geistig Behinderte verstehen. München (Piper) 1989.
Nienstedt Monika & Westermann Arnim: Pflegekinder. Psychologische Beiträge zur Sozialisation von Kindern in Ersatzfamilien. 2. Aufl. Münster (Votum) 1990.
Rosenberg Holger & Steiner Marianne: Paragraphenkinder. Erfahrungen mit Pflege- und Adoptivkindern. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1991.
Schaber Gerald: Inwieweit wird das Tiroler Rehabilitationsgesetz den Ansprüchen und Bedürfnissen der geistig behinderten Menschen und ihren Angehörigen gerecht? Innsbruck (Dipl.-Arb.) 1991.
Schönwiese Volker: "Thesen zu Integration und Therapie." In: Meister-Steiner Birgit & Schönwiese Volker & Wieser Ilsedore: Blinder Fleck und rosarote Brille. Thaur (Österr. Kulturverlag) 1989.
Schreiner Haro (Hg.): Pflegekind - Leihkind? Eltern berichten - Fachleute beraten. Stuttgart (Quell Verlag) 1991.
Schunter-Kleemann Susanne (Hg.): Herrenhaus Europa. Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat. Berlin (Verlag Rainer Bohn) 1992.
Seifert Monika: Geschwistern in Familien mit geistig behinderten Kindern. Eine praxisbezogene Studie. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 1989.
Sierck Udo: Das Risiko nichtbehinderte Eltern zu bekommen. Kritik aus der Sicht eines Behinderten. 2. Aufl. München u.a. (AG SPAK Publ. u.a.) 1992.
Sorrentino Anna Maria: Behinderung und Rehabilitation. Ein systemischer Ansatz. Dortmund (Verlag Modernes Lernen) 1988.
Speck Otto: "Geschichte" [geistiger Behinderung]. In: Bach Heinz (Hg.): Pädagogik der Geistigbehinderten. Berlin (Marhold) 1979, S. 57-71.
Speck Otto: "Lebensqualität als ethische Orientierung für die heilpädagogische Arbeit". In: Österr. Gesellschaft f. Heilpädagogik (Hg.): Lebensqualität und Heilpädagogik. Höbersdorf/Wien (Kaiser) 1993, S. 78-85.
Stein Anne-Dore (Hg.): Lebensqualität statt Qualitätskontrolle menschlichen Lebens. Berlin (Spieß) 1992.
Stimmer Franz (Hg.): Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit. München & Wien (Oldenbourg) o.J.
TAFIE (Hg.): Pädagogik und Therapie ohne Aussonderung. Innsbruck (TAFIE) 1990.
Theunissen Georg: Heilpädagogik im Umbruch. Über Bildung, Erziehung und Therapie bei geistiger Behinderung. Freiburg/Br. (Lambertus) 1991.
Troje Hans Erich: "Sehr zum Wohle des Pflegekindes." In: Familiendynamik, Jg. 15, 1990, S. 150-155.
Wendeler Jürgen: Geistige Behinderung. Pädagogische und psychologische Aufgaben. Weinheim, Basel (Beltz) 1993.
Wiemann Irmela: Pflege- und Adoptivkinder. Familienbeispiele, Informationen, Konfliktlösungen. Hamburg (Reinbek) 1991.
Willi Jürg: Die Zweierbeziehung. Reinbek b. Hamburg (Rowohlt) 1975.
Willi Jürg: Ko-evolution. Die Kunst gemeinsamen Wachsens. Reinbek b. Hamburg (Rowohlt) 1985.
Zenz Gabi & Weiler Herrad & Fischer H.: Unser Kind ist anders. Möglichkeiten der Bewältigung von Behinderung in unserer Gesellschaft. 6 Bde., Innsbruck (Projekt des FWF) 1993.
Claudia Niedermair, geboren in Vöcklabruck am 6. 2. 1961. Eltern: Horst und Roswitha Keppel.
Schulausbildung: Volksschule und Hauptschule in Vöcklamarkt; Fachschule für Sozialberufe in Salzburg; Bundesinstitut für Sozialpädagogik und Erzieherausbildung in Baden, Abschluß Juni 1980.
1980 lernte ich auch meinen Mann Klaus kennen. Nach einem Jahr als Erzieherin an der HBLA für Frauenberufe in Linz wechselte ich meinen Wohnsitz nach Innsbruck, wo ich eine Wohngemeinschaft für sozial auffällige Mädchen leitete.
Seit 1983 betreue ich - in Zusammenarbeit mit dem Verein "Heilpädagogische Familien" - ein geistigbehindertes Kind in unserer Familie. 1984 wurde unser Sohn Ren‚ geboren, 1988 unsere Tochter Nora.
Im Wintersemester 90/91 begann ich das Studium der Erziehungswissenschaften und des Psychotherapeutischen Propädeutikums im Fächerbündel.
Seit 1992 Mitarbeit in der Arbeitsgruppe für Organisationsentwicklung und Ausbildung zur Gruppenmoderatorin im Verein "Heilpädagogische Familien".
-
"Osker, altitalischer Volksstamm in Kampanien, nah verwandt den Samniten, mit dieser zur oskisch-umbrischen Sprachgruppe gehörend, in den Römern aufgegangen." (Brockhaus, 2 Bde, 1962)
-
Kinder waren in ihrer gesellschaftlichen Stellung den Sklaven gleichgesetzt.
-
Es ist z.B. in einigen Tiroler Orten durchaus heute noch üblich, Personen mit dem Hausnamen und nicht mit dem Familiennamen anzusprechen.
-
Diese Ziehmütter wurden teilweise von Waisenhäusern entlohnt und versorgten Kinder im allgemeinen bis zum 7. Lebensjahr. Sobald sie fähig waren, für sich selbst zu "sorgen", wurden sie in den Bettelstand entlassen.
-
Der Pietismus war eine evangelische religiöse Bewegung zur Erneuerung des frommen Lebens in der Kirche.
-
Die Philanthropen (Menschenfreunde) haben ihren Ausgangspunkt in Dessau. Sie forderten eine natürliche Erziehung mit Einbeziehung von Kopf, Herz und Hand. J. Gottlieb Salzmann (1744-1811) war einer der ersten Pädagogen, der die Erzieher aufforderte, Fehler und Untugenden seiner Zöglinge erst einmal bei sich selbst zu suchen.
-
Zahlen lt. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses (S. 245).
-
Charlotte Bühler führte in Zusammenarbeit mit der Wiener Schule der Kinderpsychologie erste systematische Untersuchungen über psychische Auswirkungen bei Anstaltsunterbringungen durch. Sie zeigte Mißstände des Pflegeprinzipes auf und erbrachte einen eindeutigen Nachweis der Schäden und Entwicklungsrückstände bei Heimkindern.
-
Einige Konsequenzen daraus: Präventive Sozialarbeit ist immer weniger finanzierbar; Sozialtherapeutische Arbeit ohne medizinisch-diagnostische Begründung ist fast unmöglich; dadurch nimmt die pseudowissenschaftliche Klassifizierung und Etikettierung von Menschen zu; was wiederum zu vermehrter Desintegration - nicht nur von Randgruppen - führt.
-
Als Symptomträger wird in der Familientherapie jene Person bezeichnet, die auffällig wird und von der Familie als krank stigmatisiert wird. Am Symptomträger läßt sich die Instabilität des Systems erkennen, sie wirkt sich unmittelbar auf ihn aus.
-
Die (familien-)therapeutische Intervention ist als Vorgang zu verstehen, in dem der Therapeut versucht, der Familie möglichst viele Wege der Problemlösung aufzuzeigen. Er will sie damit zur aktiven Veränderung ihrer Situation anregen und dazu bewegen, ihre Probleme selbst zu lösen.
Quelle:
Claudia Niedermair: Die heilpädagogische Pflegefamilie als therapeutisches Handlungsfeld
sozialgeschichtliche, familiendynamische und alltagsintegrative Aspekte - mit besonderer Berücksichtigung des Vereins der Heilpädagogischen Familien in Tirol
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, eingereicht bei Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, am Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Mai 1995
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 19.05.2008
