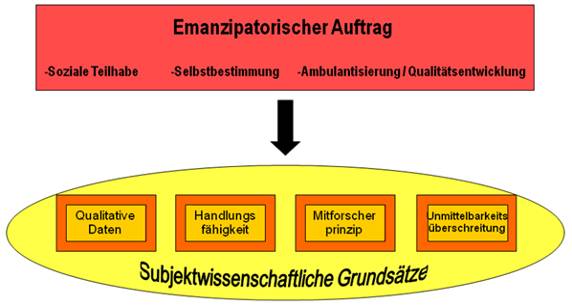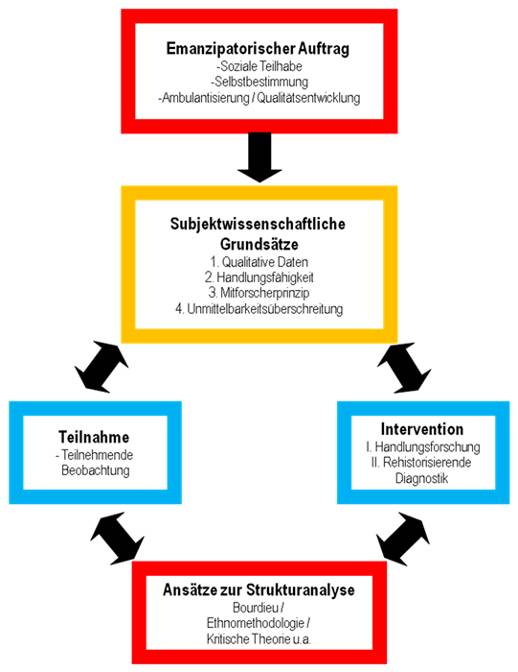"Qualitätsentwicklung als teilnehmender und intervenierender Forschungsprozess in der Behindertenhilfe
Eine empirische Handlungsforschung im sozialen Prozess der Ambulantisierung einer stationären Wohneinrichtung in Hamburg"
Der Fakultät I (Bildungs-, Kultur- und Sozialwissenschaften) der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades Doktor der Philosophie - Dr. phil. - vorgelegte Dissertation; eingereicht am 18.08.2009; Erster Gutachter Erster Gutachter: Prof. Dr. Kurt Bader, Leuphana Universität Lüneburg; Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Rainer Hoehne, Leuphana Universität Lüneburg; Dritter Gutachter:Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg
Inhaltsverzeichnis
- Teil A: Einleitung
- Teil B: Gegenstandsbereich dieser Forschungsarbeit
- Teil C: Teilnehmendes und intervenierendes Forschungskonzept
- Teil D: Empirie
- Teil E: Abschließende Betrachtung
- Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ursprung dieser Dissertation und der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Begleitung einer stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe auf dem Weg zur Ambulantisierung war mein Wunsch, innerhalb des Themenbereichs Qualitätsentwicklung in der Behindertenhilfe zu promovieren. Diese Absicht traf sich mit dem Interesse der XXX-Vereinigung Hamburg[1], ihren diesbezüglichen Entwicklungsprozess von Prof. Dr. Kurt Bader an der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich begleiten zu lassen. Erste Vorgespräche zu diesem Vorhaben haben im April 2006 stattgefunden. Zur Forschungsgruppe gehörten anfangs Kurt Bader als Professor und Forschungsleiter, Markus Lauenroth als Diplomand und ich. Im April 2007 ist der Student Birger Rietz hinzugekommen, im Sommer 2007 Prof. Dr. Rainer Hoehne, ehemaliger Professor an der Fachhochschule Lüneburg am Fachbereich Sozialwesen.
Ich verwende in dieser Dissertationsarbeit die Ich-Form, wenn ich über die eigene persönliche Praxis berichte, subjektive Reflexionen darlege oder Bewertungen abgebe. Damit will ich meine eigene Subjektposition verdeutlichen, anstatt meine eigenen wissenschaftlichen Leistungen, Lücken und subjektiven Schlüsse hinter anonymen Umschreibungen zu verbergen. Die Wir-Form verwende ich an einigen Stellen, um darauf hinzuweisen, dass an dem entsprechenden Projekt, Ergebnis oder Handlung die Forschungsgruppe als Ganze beteiligt war. Im folgenden Kapitel stelle ich kurz die Aufgabenstellungen und Bedingungen dar, unter denen diese Forschung stattgefunden hat.
Die grundlegende Aufgabenstellung des Auftraggebers war von Beginn an, eine "wissenschaftliche Begleitung" des geplanten Ambulantisierungsprozesses (s. Teil B, Kap. 2.4) der Wohneinrichtung X-Straße[2] mit 20 Wohnplätzen im Hamburger Stadtteil X durchzuführen. Als konkrete Aufgaben nannte der Einrichtungsleiter im Mai 2006 die längerfristigen Projekte einer Evaluation der Bewohnerzufriedenheit (s. Teil D, Kap. 1.2) sowie die Entwicklung und Implementierung eines neuen Systems zur "Individuellen Hilfeplanung" (Teil D, Kap. 1.1). Während Markus Lauenroth die Aufgabe der Hilfeplanung im Rahmen seiner Diplomarbeit übernahm, konzentrierte ich mich auf das Thema Evaluation. Nach ersten Besuchen in der Einrichtung machte unsere Forschungsgruppe noch im Sommer 2006 dem Einrichtungsleiter den Vorschlag, mit einem Videoprojekt (Teil D, Kap. 1.3) in die Materie der Evaluation einzusteigen.
Der Auftrag einer wissenschaftlichen Begleitung entsprang nach eigenen Angaben der Intention des Leiters und war nur mit einem kleinen Teil des Betreuungsteams abgestimmt worden. Die meisten Mitarbeiter hatten anfangs wenig Interesse an unserer wissenschaftlichen Tätigkeit. Die Motive des Leiters an unserer Mitarbeit waren folgende:
-
Die Hamburger Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) hatte den Einrichtungen der Behindertenhilfe, die stationäre Wohnplätze in "Ambulant betreute Wohngemeinschaften" transformieren wollten, die Auflage erteilt, diesen Prozess im Hinblick auf die Zufriedenheit der Bewohner zu evaluieren.
-
Die Einrichtungsleitung wollte wissenschaftlich untersuchen lassen, ob der Ambulantisierung ihrer Einrichtung ein "Modell-Charakter" zukommt. Dies besonders im Hinblick auf die Frage, ob es gelingt, auch Menschen mit sehr großem Hilfebedarf, herausforderndem Verhalten und/oder Autismus gemeinsam und gleichzeitig mit allen anderen Bewohnern in eine ambulante Wohn- und Betreuungsform zu überführen. Der Leiter vertrat bei unseren ersten beiden Besprechungen die Ansicht, dass das Besondere bei seinem Projekt darin bestehe, dass alle Bewohner zum gleichen Zeitpunkt den Wechsel vom Heim ins ambulante Wohnverhältnis vollziehen und dabei niemand im stationären Bereich zurückgelassen werde.
-
Das Interesse des Leiters ging auch dahin, die Einrichtung mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Begleitung gegenüber der Behörde und auf dem Markt besser positionieren zu können.
-
Unsere wissenschaftliche Begleitung sollte darüber hinaus zur fachlichen Absicherung bei der Planung und Durchführung der Ambulantisierung beitragen.
-
Die wissenschaftliche Begleitung sollte eine Art fachliche Kontrollfunktion darstellen und eine Transparenz nach außen ermöglichen.
Was unser Auftraggeber genauer unter einer "wissenschaftlichen Begleitung" verstand, wie sie ausgeführt und umgesetzt werden sollte, blieb zunächst offen. In der Frage der Methodologie hielt sich der Einrichtungsleiter weitgehend zurück. Er machte jedoch seine Abneigung gegenüber quantitativen Ansätzen deutlich. Die methodische Offenheit, die uns der Auftraggeber zu Beginn unserer Arbeit eingeräumt hatte, füllten wir in unserer Forschungsgruppe dann mit konkreten Inhalten und eigenen Interpretationen.
Den Auftrag einer "wissenschaftliche Begleitung" haben wir in unserer Forschungsgruppe schon gleich zu Beginn als einen Auftrag zur "subjektwissenschaftlich begründeten Qualitätsentwicklung" interpretiert. Hintergrund dafür waren unsere aktuellen Erfahrungen mit dem Thema Qualitätsmanagement, das zu jener Zeit in der fachlichen Öffentlichkeit eine Hochkonjunktur erlebt hatte. Prof. Dr. Kurt Bader hatte schon vor unserem Zusammentreffen mit dem Auftraggeber sein Interesse an einer Forschung zum Thema Qualitätsentwicklung geäußert. Ich hatte in der Einrichtung, in der ich mein Anerkennungspraktikum absolvierte, damals einige unangenehme Erfahrungen mit dem Thema gemacht und Interesse gefunden, das Thema Qualitätsmanagement und -entwicklung soziologisch zu untersuchen. Als "unangenehm" war mir vor allem aufgefallen, dass die dort angewandten Instrumente des Qualitätsmanagements wenig zur Verbesserung der pädagogischen Qualität taugten, sondern sich auf inhaltsarme Formalien beschränkten, die zusätzliche Arbeit erforderlich machten und von oben herab verordnet worden waren.
Auf diesem subjektiven Hintergrund formulierten wir den "eigentlichen" Auftrag einer "wissenschaftlichen Begleitung" in ein alternatives Programm zur Qualitätsentwicklung um. Rückblickend kann ich feststellen, dass uns erst rund anderthalb Jahre später dieser Widerspruch bewusst geworden ist, als das Verhältnis zwischen unserer Forschungsgruppe und der Einrichtung in eine Krise geraten war. Dennoch haben wir unser Verständnis einer wissenschaftlichen Begleitung als einen Auftrag zur Qualitätsentwicklung schon bei unseren Vorbesprechungen und in unseren anfänglichen Forschungsentwürfen dem Einrichtungsleiter und den Mitarbeitern mitgeteilt. Dieser hat unserem Verständnis des Auftrages ausdrücklich zugestimmt und somit akzeptiert. Eine "subjektwissenschaftlich begründete Qualitätsentwicklung" ist gemäß unserer schriftlichen Vereinbarungen schließlich zum Gegenstand unserer wissenschaftlichen Tätigkeit geworden. Somit konnten wir zu Beginn unserer Arbeit mit dem Leiter einen Konsens über den Inhalt unseres Auftrages herstellen. Dass es dann ein Jahr später zu immer größeren Konflikten kam, lag nach meiner Auffassung auch daran, dass beide Seiten von Anfang an von unterschiedlichen Interessen ausgegangen sind und der Einrichtungsleiter die Tragweite unseres Ansatzes nicht ausreichend einschätzen konnte.
Ich selber habe für meinen Teil der Forschung und dieser Arbeit das Programm einer "subjektwissenschaftlich begründeten Qualitätsentwicklung" modifiziert und in eine "Qualitätsentwicklung als teilnehmender und intervenierender Forschungsprozess" umgewandelt (s. Teil C), weil der subjektwissenschaftliche Ansatz nach der Kritischen Psychologie für mich nicht den primären Stellenwert hatte. Vielmehr waren in meiner Forschungspraxis Teilnahme und eigene Intervention die bestimmenden Momente, bei denen ich mich von Grundsätzen der Kritischen Theorie habe leiten lassen und eine emanzipatorische Zielrichtung verfolgt habe. (s. Teil C, Kap. 1.1) Der subjektwissenschaftliche Ansatz blieb dennoch mit meinem eigenen kompatibel, so dass ich mich immer wieder auf ihn bezogen und genutzt habe. (s. Teil C, Kap. 1.2)
Unser bzw. mein Ansatz unterscheidet sich von den herkömmlichen und zumeist quantitativ ausgerichteten Ansätzen zur Qualitätsentwicklung u.a. darin, dass weniger vom Außenstandpunkt aus beobachtet, gefragt, notiert und analysiert wird, sondern auch aktiv ins Forschungsfeld eingegriffen wird - mit der Zielsetzung, die Lebensqualität der beteiligten Subjekte, vor allem der Bewohner, zu verbessern. "Eine solche Forschung ist prozesshaft und dynamisch, mischt sich ein, bietet konkrete Unterstützungen und versteht sich als Teil der Veränderungsprozesse" (Bader 2006, S.1). Sie ist zugleich dialogisch: Die Forschungsgruppe reflektiert ihre Beobachtungen und Analysen möglichst eng mit allen Angehörigen des Forschungsfeldes, regt Veränderungen an, bietet Unterstützung sowie eigene Projekte an und benennt auch ihre offene Kritik schon während der laufenden Forschung.
Vor allem im Rahmen meiner Evaluation (Teil D) hatten wir uns immer tiefer in eine aktive und konfliktreiche Teilnahme hineinmanövriert. Unser gemeinsamer Ansatz zur Intervention, bei dem Prozesse auch unsererseits initiiert und gefördert werden sollten, interpretierte ich Anfang des Jahres 2007 immer mehr als einen Auftrag zur Stärkung des Empowerments der Bewohner. Dies führte zu Konflikten mit den Mitarbeitern und später auch mit der Leitung. Im Kontext der Handlungsforschung (Teil C, Kap. 2.2) versuchte ich Bewohner zu ermutigen, autonomer auch gegen Vorgaben der Betreuer zu handeln, Interessen gegenüber der Institution durchzusetzen und sich gegen überflüssige Einschränkungen zu wehren. Parallel dazu teilte ich dem Team regelmäßig meine Beobachtungen und meine Interpretationen von erlebten Situationen mit. Damit verfolgte ich das Ziel, dem Team Strukturen aufzuzeigen, die einer erfolgreichen Ambulantisierung nach meiner Einschätzung im Wege standen. Da die Leitung sich das sehr hohe Ziel gesetzt hatte, eine Ambulantisierung mit "Modellcharakter" realisieren zu wollen, fühlte ich mich unter Druck, durch frühzeitige Hinweise und Kritik die Einrichtung zu diesem Ziel hindrängen zu müssen. Das war meine Wahrnehmung im ersten Jahr unserer Arbeit, womit ich die Vorgaben der Leitung, wie sich später herausstellen sollte, ernster genommen hatte als diese selbst und unsere Zusammenarbeit mit der Einrichtung nahe an den Rand des Scheiterns gebracht hatte (s. Teil E, Kap.1).
Die Arbeit an der wissenschaftlichen Begleitung haben wir innerhalb unserer Forschungsgruppe wie folgt aufgeteilt:
Forschungsleiter Kurt Bader hatte die Aufgabe, den gesamten Prozess zu leiten, zu koordinieren und gegenüber der Einrichtung zu vertreten. Markus Lauenroth entwickelte eine neue Methode zur Individuellen Hilfeplanung. Er nahm anfangs zweimal im Monat an den Teamsitzungen teil und besuchte die Einrichtung für Einzelberatungen. Birger Rietz hat im Februar 2008 den Auftrag zur Beobachtung der Interaktionsprozesse innerhalb einer Wohngruppe der Einrichtung übernommen und besuchte diese einmal wöchentlich. Prof. Hoehne besuchte gelegentlich die Dienstbespechungen in der Einrichtung und nahm an den Beratungen der Forschungsgruppe teil. Ich übernahm schwerpunktmäßig die Evaluation und besuchte in der Regel einmal pro Woche die Wohnstätte.
In den ersten vier Monaten unserer wissenschaftlichen Begleitung habe ich hauptberuflich noch als sozialpädagogischer Anerkennungspraktikant in der ambulanten Behindertenhilfe in Lübeck gearbeitet. Dadurch waren zunächst meine Möglichkeiten, die Einrichtung zu besuchen, erheblich eingeschränkt. Erschwerend kam von Anfang an die periphere Lage der Einrichtung hinzu. Für eine Hin- und Rückfahrt zwischen Lübeck und der Wohnstätte benötigte ich rund 4,5 Stunden. Aus diesen Gründen besuchte ich anfangs nur alle zwei bis drei Wochen das Wohnheim.
Ein- bis zweimal im Monat traf sich unsere Forschungsgruppe an der Uni Lüneburg zur Diskussion und weiteren Planung unserer Arbeit. Die Vorbereitungsphase der ersten vier Monate wurde von der XXX-Vereinigung bereits mit einem kleinen Honorar vergütet.
Zur Finanzierung unserer wissenschaftlichen Begleitung hatte der Auftraggeber anfangs in Aussicht gestellt, über seinen Fundraiser die Mittel für eine tariflich bezahlte befristete Stelle plus Honorare und Sachmittel einzuwerben. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen einigten wir uns auf eine direkte Bezahlung unserer Tätigkeit durch den Auftraggeber. Ein Teil unserer Leistungen wurden mit monatlichen Pauschalen abgegolten, andere mit Einzelvergütungen. Für meine Leistungen hatten wir ebenfalls ein monatliches Pauschalhonorar vereinbart, für das keine Stunden- oder sonstige Einzelnachweise erforderlich waren. Damit konnte ich zumindest insofern eine relative "Freiheit der Wissenschaft" sicherstellen, da ich nicht jede Handlung dokumentieren oder einzeln beantragen musste. Da sich wissenschaftliches Arbeiten nach meinem Verständnis kaum in den Grenzen der kapitalistischen Zeitmessung, der Wareneinheit Arbeitsstunde, ernsthaft praktizieren lässt, verstand ich diese Regelung als einen offenen Möglichkeitsraum. Denn Gedanken können nur im freien Zeitfeld fließen und sich zu wertvollen Erkenntnissen entwickeln. In der Praxis bedeutete dies, dass ich je nach Entwicklung und Bedarf mitunter fast "rund um die Uhr" mit der wissenschaftlichen Begleitung beschäftigt war und ebenso auch mal zwei Wochen lang eine "kreative Pause" einlegen konnte. Dennoch war die Höhe des Honorars, ohne an dieser Stelle eine Zahl nennen zu wollen, gerade ausreichend, um auf einem mittelmäßigen "Studentenniveau" leben zu können.
Ein Abhängigkeitsverhältnis ergab sich aus dem Vertragsverhältnis heraus dennoch, weil die Einrichtung, in der wir forschten, auch zugleich Auftraggeber war und unsere Honorare zahlte. Hinzu kam, dass wir unseren Vertrag nur mündlich abgeschlossen hatten. Diese Bedingungen hatten für mich die Bedeutung, von einem gewissen Konsens mit dem Heimleiter abhängig zu sein. Zumindest erschien mir ein größerer Konflikt als ökonomische Bedrohung. Unser Honorarvertrag war schließlich jederzeit kündbar, über die näheren Modalitäten hatten wir keine schriftliche Vereinbarung getroffen, was unserem Vertragspartner wiederum eine gewisse Willkür hätte ermöglichen können. Trotz einiger größerer Konflikte kam es aber letztendlich doch zu keinem Vertragsbruch und auch zu keiner Drohung damit. Diese vertragliche Konstellation empfand ich dennoch als eine Dauerbelastung, weil wir stets auch aus ökonomischen Gründen einen gewissen Opportunismus beibehalten mussten, obwohl einige Entwicklungen in der Einrichtung sehr konträr zu unseren Grundsätzen der Behindertenpädagogik verliefen. Dennoch haben wir Konflikte nie gescheut, wie ich in Teil E, Kapitel 1 ausführlich darlegen werde.
-
Evaluation der Bewohnerzufriedenheit: Teil B, Kap. 4/ Teil D, Kap.2.5 u. 3.5
-
Beurteilung der Frage: Kommt der untersuchten Einrichtung im Rahmen der Ambulantisierung Modellcharakter zu? Dies besonders im Hinblick auf den Aspekt, ob es gelingt, auch Menschen mit sehr großem Hilfebedarf, herausforderndem Verhalten und/oder Autismus gemeinsam und gleichzeitig mit allen anderen Bewohnern in eine ambulante Wohn- und Betreuungsform zu überführen: Teil E, Kap. 2.1 u.2.2
-
Unsere Forschungsgruppe hat einen Beitrag zur fachlichen Absicherung der Planung und Durchführung des Ambulantisierungsprozesses zu leisten: Teil E, Kap. 2.3
-
Mit unserer wissenschaftlichen Begleitung tragen wir zu einer Verbesserung der Transparenz der Einrichtung nach außen bei: Teil E, Kap. 2.3
-
Wir versuchen einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität der Einrichtung zu leisten. Dies geschieht mit qualitativen Methoden, subjektwissenschaftlicher Ausrichtung und im Hinblick auf die Steigerung der sozialen Teilhabe der Bewohner, der Öffnung neuer Möglichkeitsräume und der Erweiterung von Selbstbestimmung sowie Entwicklungschancen: Teil E, Kap. 2.4
-
Ist es möglich, auf Grundlage meines Forschungskonzeptes (s. Teil C) und seiner Methoden eine Weiterentwicklung der Einrichtung im Sinne ambulanter Strukturen zu unterstützen? Wie ist die Gegenstandsadäquatheit dieses Forschungskonzeptes zu beurteilen? Teil E, Kap.1.4/ 2. u. 3.
Am Ende dieser Arbeit versuche ich auf dem Hintergrund meiner empirischen Untersuchung, diese Fragen abschließend und knapp zu beantworten sowie eine Resümee zu den Aufgabenstellungen zu formulieren.
Inhaltsverzeichnis
Der Gegenstandsbereich dieser Forschungsarbeit fokussiert sich auf das soziale Feld einer Wohn-einrichtung für geistig behinderte Menschen, die sich in einem Transformationsprozess von einem stationären zu einem ambulanten Status befindet und in dem wir (die Forschungsgruppe) an der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität mitwirken und diese zugleich evaluieren. In diesem Feld bzw. in diesem Prozess sind somit die Begriffe "geistige Behinderung", "Ambulantisierung", "Qualitätsentwicklung" und "Evaluation" von zentraler Bedeutung. Diese vier Elemente zusammen konstituieren den Gegenstandsbereich meiner Forschung. Eine begriffliche Klärung dieser Grundelemente ist an dieser Stelle notwendig.
Der Begriff "geistige Behinderung" ist die gesellschaftlich konstruierte Kategorie, nach welcher die betreuten Menschen in der von mir untersuchten Einrichtung ihre pädagogische Hilfe erhalten. Er ist zugleich der zentrale Begriff, nach welchem sie gesellschaftlich ausgegrenzt, stigmatisiert und an besondere Orte der Arbeit und des Wohnens verwiesen werden. Für diese Arbeit fällt dem Begriff deswegen eine zentrale Rolle zu, weil er die normative Grundlage ist, auf welcher sich die betreffenden Menschen an jenem Ort befanden, an dem ich geforscht habe. Er konstituiert das Forschungsfeld und verweist dabei über die Grenzen der Einrichtung hinaus. "Geistige Behinderung" ist ein politischer Begriff von globaler Bedeutung und wird auf internationaler Ebene von der WHO definiert. Den Behinderungsbegriff der WHO stelle ich somit in Kapitel 1.1 voran. Von dieser globalen Ebene leite ich in Kapitel 1.2 auf die nationale Ebene über und erörtere die Bestimmungen im deutschen Sozialrecht, nach denen die betreffenden Menschen jener Kategorie zugeordnet werden, aber auch notwendige Hilfen beanspruchen können. Die Institution des Rechts verweist an dieser Stelle immer wieder auf die Definitionsmacht der Medizin. In Kapitel 1.3 erläutere ich somit die medizinische Sichtweise(n) und kehre auf dieser Grundlage in Kapitel 1.4 auf die gesellschaftliche Ebene der geistigen Behinderung zurück, in welcher dann der medizinische (biologische) Aspekt aufgehoben ist. In diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Gesellschaft versuche ich abschließend in Kapitel. 1.5 eine eigene begriffliche Lösung anzubieten.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in ihrer 1980 veröffentlichten "International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps" (ICIDH) Behinderung als soziale Folge einer körperlichen oder psychischen Schädigung definiert. Das damalige Krankheitsfolgenkonzept gliederte sich in die drei Kategorien: Schädigung, Beeinträchtigung und Behinderung.
"Schädigung: Jeder Verlust oder jede Anomalie einer psychologischen, physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion.
Beeinträchtigung: Jede (auf eine Schädigung zurückgehende) Einschränkung der Fähigkeit oder die Unfähigkeit, eine Tätigkeit so und im Rahmen dessen auszuüben, was für einen Menschen als normal gilt.
Behinderung: Eine auf eine Schädigung oder Beeinträchtigung zurückgehende Benachteiligung, die einen bestimmten Menschen teilweise oder ganz daran hindert, eine Rolle auszufüllen, die für ihn nach Alter und Geschlecht und sozio-kulturellen Faktoren normal wäre." (BMA 1983, zit.n.Cloerkes 2003, S.93)
In dieser begrifflichen Konstruktion ist die Schädigung eine rein medizinische Kategorie, während Beeinträchtigung und Behinderung durch die Bezugnahme auf gesellschaftliche Normalität zusätzlich eine soziologische Dimension erhalten. "Mit dem Bezug auf das Rollenkonzept ist außerdem die Bedeutung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen in den Blick geraten" (Waldschmidt 2003, S.94), konstatiert Anne Waldschmidt. Die Medizin habe ihre traditionelle Definitionsmacht teilweise an die Sozialwissenschaft abgetreten. Behinderung erscheint in der ICIDH als das Ergebnis eines Verhältnisses zwischen den körperlichen bzw. psychischen Eigenschaften eines Individuums und den gesellschaftlich üblichen Rollenanforderungen.
Der WHO wurde von Verbänden der Betroffenen wegen ihres Behinderungsbegriffes in der ICIDH seinerzeit dennoch eine Defizitorientierung vorgeworfen. "Unterstellt wird, dass die Beeinträchtigung umstandslos auf die körperliche Schädigung zurückzuführen ist und auch die Behinderung als soziale Benachteiligung ursächlich aus einer Beeinträchtigung bzw. Schädigung resultiert." (ebd.) Ein umgekehrter Entwicklungsprozess, der bei einer sozialen Benachteiligung, z.B. Hospitalisierung, beginnt und zu medizinischen Folgeschädigungen führt, sei nach dem Modell der ICIDH nicht denkbar.
Die WHO hat dann in den 1990er Jahren ihr Konzept überarbeitet und 2001 die "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF) verabschiedet. Auf den negativ besetzten Begriff "Handicap" wurde darin verzichtet. Behinderung wird in der ICF als "der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen" (DIMDI 2004, S.4) definiert.
"Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren - ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und - -strukturen),
sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivität),
sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder - strukturen oder der Aktivität erwartet wird (Konzept der Partizipation an Lebensbereichen)." (ebd.)
In der deutschen Übersetzung ist der englische Begriff "Participation" mit "Partizipation" übersetzt worden, weil das Wort "Teilhabe" im Schweizer Deutsch eine engere Bedeutung hat. In Deutschland wird der Begriff jedoch allgemein als "soziale Teilhabe" rezipiert. Die ICF unterscheidet neun Bereiche der Teilhabe: 1. Lernen und Wissensanwendung; 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen; 3. Kommunikation; 4. Mobilität; 5. Selbstversorgung; 6. häusliches Leben; 7. soziale Beziehungen; 8. "bedeutende Lebensbereiche" und 9. soziales und staatsbürgerliches Leben. (vgl. ebd., S.20) Mit der Aufgliederung dieser weit umfassenden Lebensbereiche wird deutlich, dass die WHO in ihrer ICF ihr normatives Rollenkonzept revidiert hat und Behinderung als eine Beeinträchtigung der subjektiven Entfaltungsmöglichkeiten "in allen Lebensbereichen" versteht.
Die WHO versucht in der ICF Behinderung aus systemtheoretischer Sicht zu begreifen, "als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren einerseits und den externen Faktoren, welche die Umstände repräsentieren, unter denen Individuen leben, andererseits." (ebd., S.22) Die Autoren des ICF-Papiers bezeichnen dies als ein "bio-psycho-soziales Modell" (ebd., S.5) der Behinderung. Explizit werden also neben den Beeinträchtigungen der Körperfunktionen einschließlich der geistigen auch Umweltfaktoren benannt: "Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Leben gestalten. Diese Faktoren liegen außerhalb des Individuums und können seine Leistung als Mitglied der Gesellschaft, seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben bzw. Handlungen oder seine Körperfunktionen und -strukturen positiv oder negativ beeinflussen." (ebd., S.21f.) Hierzu zählen unter anderem die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes, die Gestaltung des Wohnumfeldes, das Verkehrswesen, Gesetze, Vorschriften, ethische Einstellungen in der Gesellschaft und Weltanschauungen.
Wenn Behinderung als eine Beeinträchtigung der menschlichen Funktionsfähigkeit verstanden wird, so folgern die ICF-Autoren, kann die materielle und soziale Umwelt je nach ihrer konkreten Beschaffenheit diese Funktionsfähigkeit fördern oder auch einschränken: "Die Gesellschaft kann die Leistung eines Menschen beeinträchtigen, weil sie entweder Barrieren schafft (z.B. unzugängliche Gebäude) oder keine Förderfaktoren bereitstellt (z.B. Unverfügbarkeit von Hilfsmitteln)". (ebd.,S.22) Auch personenbezogene Faktoren leisten danach ihren Beitrag zur Beeinträchtigung oder Förderung der menschlichen Funktionsfähigkeit. Damit meint die WHO u.a. Geschlecht, Alter, Lebensstil, Fitness, persönliche Bewältigungsmuster, Bildung und Erziehung. Behinderung ist danach ein Resultat aus dem Zusammenspiel dieser drei Komponenten. "Damit kann die Behinderung anders als im Krankheitsfolgenkonzept nicht mehr als persönliche Eigenschaft verstanden werden. Es handelt sich bei der Behinderung um ein soziales Verhältnis zwischen behindertem Menschen und Umwelt." (Welti 2006, §2 Rz 19)
Wie ich in Kapitel 1.4 weiter ausführen werde, wird auch in der systemtheoretisch fundierten ICF der Dualismus zwischen den individuellen Funktionen und dem gesellschaftlichen Umfeld nicht aufgehoben. Die körperlichen einschließlich mentalen Funktionen erscheinen auch hier als von der Person mitgebracht und treten dann im zweiten Schritt ins Verhältnis zur Gesellschaft, wobei folglich als dritter Schritt eine Behinderung durch das ungünstige Zusammenwirken zwischen Individuum und Gesellschaft entstehen kann. Die individuellen körperlichen oder geistigen Funktionseinschränkungen selber werden aber in ihrer gesellschaftlichen Vermitteltheit nicht begriffen.
Der Gesetzgeber des deutschen Sozialrechts hat die inhaltliche Neubestimmung des Behinderungsbegriffes der WHO ansatzweise übernommen. Das Sozialgesetzbuch Neun (SGB IX) trägt den Titel "Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen". Damit wurde zumindest das Teilhabekonzept der ICF normativ verankert. Der Begriff Behinderung wird in § 2 Abs.1 SGB IX sowie in § 53 Abs.1 SGB XII folgendermaßen definiert:
"Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist."
In der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungshilfe-Verordnung) werden in den §§ 1-3 die Kategorien körperlich wesentlich behinderte Menschen, geistig wesentlich behinderte Menschen und seelisch wesentlich behinderte Menschen näher bestimmt. Geistig wesentlich behinderte Menschen sind nach § 2 EinglHVO Personen, "die infolge einer Schwäche ihrer geistigen Kräfte in erheblichem Umfang in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt sind".
Schon im ersten Satz des § 2 SGB IX fällt auf, dass entgegen der Überschrift des Paragraphen nicht der Begriff der "Behinderung" definiert wird, sondern der behinderte Mensch: "Menschen sind behindert, wenn..." Sie sind es, wenn im Resultat eines unbestimmten Prozesses, welcher nur die Behinderung sein kann, der aber durch eine bekannte Ursache initiiert wird, "ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeinträchtigt ist". Eine nähere Bestimmung des Prozesses der Behinderung, wie und durch wen oder was, außer dem behinderten Menschen selber, seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt wird, spart der Gesetzestext aus. Das Teilhabekriterium in der ICF holt der Gesetzgeber damit zwar ein, er fällt aber genau hinter das zurück, was in der ICF im Gegensatz zur ICIDH als Paradigmenwechsel wesentlich ist, nämlich die Überwindung des kausalen Krankheitsfolgenmodells zugunsten des systemtheoretischen bio-psycho-sozialen Modells der Behinderung. Im § 2 Abs.1 SGB IX hält der Gesetzgeber nämlich am tradierten Krankheitsfolgenmodell fest: behindert sind geistig behinderte Menschen, wenn als Ursache ihre geistigen Fähigkeiten wahrscheinlich länger als sechs Monate vom alterstypischen Zustand abweichen und sie nur aus diesem Grunde in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt sind. Der Grund der Beeinträchtigung liegt also im Individuum selber. Diese monokausale Konstruktion wird dann in der EinglHVO durch die Verknüpfung "infolge" noch verstärkt: Die geistigen Schwächen einer Person erscheinen als einzige Ursache für die sozialen Einschränkungen.
"Der teilweise soziologische Charakter des rechtlichen Behinderungsbegriffs ist freilich nicht viel mehr als eine rhetorische Übung" (Felkendorff 2003, S.32), bemerkt Kai Felkendorff. Durch das Merkmal der gesellschaftlichen Teilhabebeeintächtigung wird dem Gesetzestext nach zwar soziologische Kompetenz bei der Feststellung einer Behinderung eingefordert, in der Praxis aber erfolgt die rechtliche Anerkennung des Behindertenstatus rein aus dem medizinischen Blick. Eine Behinderung wird gem. § 69 Abs.1 SGB IX auf Antrag von den "für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden" durch eine Zuordnung zu einem "Grad der Behinderung" (GdB) festgestellt. Diese Grade sollen dem Gesetz zufolge das ausgleichswürdige Problem einer sozialen Benachteiligung quantifizieren: "Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt." (§ 69 Abs.1 Satz 4 SGB IX) Dieser dem Gegenstand nach (soziale Teilhabe) an die Disziplinen der Soziologie oder auch Sozialpädagogik gerichtete gesetzliche Auftrag hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) als oberste Exekutivbehörde kurioserweise einzig und allein dem Berufsstand der Ärzte zugewiesen. Diese müssen sich zwar im Bereich der Sozialmedizin qualifiziert haben, um als Gutachter in den Versorgungsämtern tätig werden zu dürfen, ihre Begutachtungen über die Grade der Behinderungen sollen aber aus "rein ärztlichen Beurteilungen" (BMAS 2008, S.3) erfolgen, wie es in den 2008 vom BMAS neu veröffentlichten "Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit" (AHP) heißt.
In diesen Anhaltspunkten werden keineswegs, wie es das Gesetz vermuten lässt, Kriterien zur Beurteilung der sozialen Teilhabe genannt, sondern rein körperliche und geistige Funktionseigenschaften des Antragstellers zur Messung vorgeschrieben. Für den Bereich der geistigen Behinderung ist beispielsweise die Kategorie "Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörungen (z.B. Aphasie, Apraxie, Agnosie)" (ebd., S.42) ein typisches Untersuchungsfeld. Untersucht wird der gegenwärtige Ist-Zustand des Schweregrades der individuellen Schädigung bzw. Beeinträchtigung, nicht aber der Grad der sozialen Teilhabe. So sieht die AHP bei den "Hirnschäden mit kognitiven Leistungsstörungen" einen GdB zwischen 30 und 40 vor, wenn der Arzt einen leichten Grad feststellt. Ein "mittelgradig (er)" Hirnschaden, "z.B. Aphasie mit deutlicher bis sehr ausgeprägter Kommunikationsstörung" (a.a.O.) wird mit einem GdB zwischen 50 und 80 bewertet. Und ein Patient mit einem schweren Hirnschaden, "z.B. globale Aphasie" erhält einen GdB zwischen 90 und 100.
Im "Handkommentar zum Sozialgesetzbuch IX" kritisiert Felix Welti: "Die AHP scheinen in ihrer Konzeption mit dem Behinderungsbegriff in § 2 Abs.1 und in der ICF nur schwer vereinbar, weil sie die Interaktion zwischen behinderten Menschen und Kontextfaktoren nicht hinreichend berück- sichtigen." (Welti 2006, § 2 Rz 42) Als problematisch wertet Welti, dass die durch das BMAS "sanktionierte und geförderte Verwaltungspraxis mit dem Wortlaut von § 2 Abs.1 und § 69 Abs.1 Satz 3 nicht übereinstimmen." (a.a.O.) Dort werde gefordert, mit dem GdB die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe festzustellen. So habe das Sozialgericht Düsseldorf im Februar 2002 "die Rechtsverbindlichkeit der AHP abgelehnt" (Rz 41 unter Verweis auf Az. S 31 SB 282/01). In dem Urteil wird festgestellt, dass es den AHP "an demokratischer Legitimation, Transparenz und wissenschaftlicher Grundlage fehle." (a.a.O.) Obwohl das Bundessozialgericht bereits 1993 (Urteil vom 23.6.1993, 9/9a RVS 1/91) und das Bundesverfassungsgericht 1995 (Beschluss vom 6.3.1995, 1 BvR 60/95) die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die AHP angemahnt haben, hat der Gesetzgeber erst Ende 2007 eine Ermächtigungsgrundlage für eine vom BMAS zu erlassende Rechtsverordnung geschaffen.
Eine deutliche Diskrepanz zu dem Behinderungsbegriff der ICF zeigt sich auch im Grundgesetz (GG). In Art. 3 AbS.3 heißt es: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Dieser Ansatz fällt sogar noch hinter das Teilhabekonzept zurück, das in § 2 SGB IX kodifiziert worden ist. Denn die Behinderung wird im GG als das private Eigentum oder die ganz persönliche Eigenschaft einer Person gefasst. Wegen dieses Besitzes oder dieser Eigenschaft darf keine sekundäre Benachteiligung seitens der Gesellschaft erfolgen. "Nur an die Behinderung anknüpfende Benachteiligungen sind nach der Neureglung (des Art.3 GG/d.Verf.) verboten", argumentierte das Bundesverfassungsgericht 1997 (BverfG v. 8.10.1997 - 1 BvR 9/97). Der Begriff der Behinderung findet auch in dem Urteil der obersten Verfassungsrichter eine verdinglichte Wendung:
"Doch bezeichnet Behinderung nicht nur ein bloßes Anderssein, das sich für den Betroffenen häufig erst im Zusammenwirken mit entsprechenden Einstellungen und Vorurteilen im gesellschaftlichen Umfeld nachteilig auswirkt, bei einer Veränderung dieser Einstellungen die Nachteilswirkung aber auch wieder verlieren kann. Behinderung ist vielmehr eine Eigenschaft, die die Lebensführung für den Betroffenen im Verhältnis zum Nichtbehinderten unabhängig von einem solchen Auffassungswandel grundsätzlich schwieriger macht." (a.a.O.)
Behinderung an sich kann demnach ohne Benachteiligung existieren und damit ohne das Mitwirken der Gesellschaft. Wie ich in Kapitel 1.4.2 näher ausführen werde, fehlt den Verfassungsrichtern eine Kenntnis über den Begriff der strukturellen Gewalt. Nach Johan Galtung liegt Gewalt dann vor, "wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung". (Galtung 1975, S.92) Dies bedarf somit nicht erst einer aktiven und willkürlichen Diskriminierung, sondern es reicht, wenn Menschen in ihrer ganz besonderen Art und Weise zu denken und zu handeln nicht die notwendigen und gesellschaftlich möglichen Mittel und Hilfen erhalten, die sie zu ihrer individuellen Art der Entwicklung benötigen. Behinderung ist danach keineswegs eine "Eigenschaft" des Individuums, sondern ein strukturell oder gar offen gewaltförmiges Verhalten der Gesellschaft gegenüber dem betreffenden Menschen, worauf in der Folge das Individuum besondere Kompensationsmuster entwickelt, die üblicherweise als abweichendes Verhalten gedeutet und zum Anlass für weitere Ausgrenzungen genommen werden.
Für den klinischen Anwendungsbereich der Psychologie und Medizin hat die WHO neben der ICF noch ein begrifflich einfacheres und leichter zu handhabendes Klassifikationssystem herausgebracht: Die "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (ICD-10, zit. n. DIMDI 2006). Die Zahl 10 steht für die zehnte Überarbeitung des Katalogs. Während die ICF eher als theoretischer Überbau fungiert und besonders in den sozialwissenschaftlich orientierten Disziplinen rezipiert wird, müssen die Kassenärzte ihre Abrechnungen nach den Verschlüsselungen der ICD-10 vornehmen. Diese Krankheits- und Störungscodes bilden eine internationale Sprache. Patienten, die sich mit der Diagnose F 71 an irgendeinen Arzt in der Welt wenden, dürfen davon ausgehen, dass dieser die "mittelgradige Intelligenzminderung (...) inkl.: mittelgradige geistige Behinderung" (DIMDI 2006) entschlüsseln kann. Gemeint ist der IQ-Bereich von 39-49. F70 bedeutet "leichte Intelligenzminderung...inkl. "Debilität", F73: "Schwerste Intelligenzminderung. IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt." (a.a.O.) Die in der ICF berücksichtigte Interdependenz mit sozialen Systemen spielt hier keine Rolle, sondern nur die "soziale Anpassung" des Patienten an die soziale Umwelt.
Die Begriffe "geistige Behinderung", "Intelligenzminderung" und "mentale Retardation" gehen ineinander über. Zwischen Behinderung im Sinne der sozialen Teilhabe und geistig-biologischer Funktionsstörung wird nicht unterschieden. Vielmehr ist die geistige Behinderung eine Eigenschaft der Person, die "anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt" wird (DIMDI 2006, F70-F79). Dabei interessiert stets nur der momentane Zustand. "Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen." (a.a.O.) An größere Entwicklungschancen glaubt die WHO kaum: "Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern." (a.a.O.)
Diese "defizitorientierte Sichtweise", die die "Abweichung vom sogenannten Normalen" (Sarimski 2008, S.92) misst, wird in der psychologischen Diagnostik seit einigen Jahren kritisiert. Alternativ dazu sind bereits "strukturorientierte diagnostische Verfahren" (a.a.O.) entwickelt worden, die nicht einen "Vergleich der individuellen Leistung mit den Leistungen einer Referenzgruppe" anstreben, sondern "das individuell erreichte Niveau bei der Aneignung einer bestimmten Kompetenz zu bestimmen" versuchen. (a.a.O.) Solche Verfahren gehen laut Sarimski über die bloße Statusdiagnostik hinaus und zielen auf die Bestimmung der "Zone der nächsten Entwicklung"[3].Der klientenzentrierte Diagnoseansatz, nach dem die Behinderung isoliert in der einzelnen Person gesucht wird, steht seit den 1990er in Konkurrenz zu interaktionsorientierten Ansätzen. "Seit etwa 20 Jahren wird die entwicklungspsychologische internationale Literatur von einem bio-psychosozialen Entwicklungsmodell geprägt, in dem Entwicklungsprozesse verstanden werden als Ergebnis von dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Eigeninitiativen, Reifungs- und Aneignungsprozessen des Kindes und der Qualität der sozialen Angebote, die es in seiner Lernumwelt erhält." (Sarimski 2008, S.93)
Auch in der Medizin häufen sich die Zweifel über das rein biologische Betrachtungsmodell geistiger Behinderung. So konstatiert der Psychiater Manfred Koniarczyk "geistige Behinderung ist keine Krankheit, ihre Ursachen, ihre Schwere und ihr Erscheinungsbild sind vielfältig." (Koniarczyk 2006, S.40) Nach seiner Statistik sind bei 25 bis 30 Prozent aller Klienten die Ursachen unbekannt. Der Kinderneurologe Dieter Karch bezifferte die Fälle geistiger Behinderung mit unbekannter Ursache sogar mit 49,3 Prozent. (Karch 2002, S.5) Das biologisch-kausale Modell der Ätiologie und Pathogenese verliert an Überzeugungskraft "Vielfach wirken genetische Faktoren mit exogenen Einflüssen zusammen und führen in einem komplexen 'multifaktoriellen' Geschehen zu Entwicklungsstörungen." (Neuhäuser 2008, S.81)
Der Pädiater Gerhard Neuhäuser weist auf äquifinale und multifinale Strukturen hin: "Eine ausgeprägte Strukturveränderung des Gehirns kann ohne Folgen für die Funktion bleiben, zum Beispiel werden große porenzephale Zysten, nach umschriebener Durchblutungsstörung vor der Geburt entstandene, mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, oft weitgehend oder vollständig kompensiert. Andererseits sind bei manchen Menschen mit schweren geistigen Behinderungen trotz Anwendung aller heute verfügbaren diagnostischen Methoden keine fassbaren Befunde nachzuweisen", räumt Neuhäuser ein, nicht ohne Hoffnung auf Verbesserung der naturwissenschaftlichen Diagnostik: "...wohl weil die Veränderungen im ultrastrukturellen bzw. molekularen Bereich zu suchen sind, die unseren Methoden der Visualisierung (noch) nicht zugänglich sind." (Neuhäuser 2008, S.79) Überwiegend sucht die Medizin nach neuronalen, chromosomalen und genetischen Aberrationen. So weist Neuhäuser darauf hin, dass beim Fragilen-X-Syndrom ein Fehlen des FMR1-Gens verantwortlich sei, das bei der Entstehung von Synapsen und der synaptischen Signalübertragung eine große Rolle spiele. Bei der Trisomie 21, die schon 1959 aufgeklärt werden konnte, sei aber noch immer weitgehend unklar, "wie die gestörten Gene ihre Wirkung entfalten". (Neuhäuser 2008, S.80)
Wie ich in Kapitel 1.1 ausgeführt habe, betrachtet die WHO in ihrer ICF das Problem der Behinderung als Verhältnis zwischen dem behinderten Individuum und seiner Umwelt. Die Behinderung ist keineswegs das Defizit einer Person, sondern das nachteilige Zusammentreffen zwischen einem Menschen, dessen "mentale Funktionen" nicht denen eines "gesunden Menschen" entsprechen, und den Bedingungen seiner natürlichen und sozialen Umwelt einschließlich seiner persönlichen (psychischen) Problembewältigungsressourcen. Weiterhin bleibt nach diesem Ansatz der Dualismus von Mensch und Umwelt bzw. Natur und Gesellschaft bestehen. Wenn auch die Behinderung als Ganzes nun nicht mehr dem Individuum zugeschrieben wird, so gelten aber die mentalen Funktionen weiterhin als Eigenschaften der Person. Die Trennung zwischen Individuum und Gesellschaft ist durch die Vergesellschaftung der Behinderung nur einen Schritt zurück verlegt worden. Im Gegenzug sind die "mentalen Funktionen" privatisiert worden. Auf Grundlage der Marx'schen Theorie der Gesellschaft erscheint dieser Dualismus zweifelhaft.
"Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis - einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis -, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird." (Marx 1981a, S.44)
Der Zeugungsakt, die Schwangerschaft und die Erziehung des Kindes sind gesellschaftliche Arbeit. Sie finden immer intersubjektiv innerhalb einer gesellschaftlichen Formation statt. Da der Mensch zugleich auch ein natürliches Wesen ist, ist seine Natur eine gesellschaftliche oder gesellschaftlich geschaffene Natur. Eine begriffliche Trennung beider Sphären, wie sie in der ICF, dem deutschen Recht und in der Medizin vorgenommen wird, bleibt hinter dieser Erkenntnis zurück. Die Frage, die sich vielmehr stellt, ist die: Wie und warum werden "mentale Funktionen" bei bestimmten Menschen im Prozess ihrer gesellschaftlichen Produktion gegenüber anderen Menschen, die als gesund gelten, beeinträchtigt?
Die Kulturhistorische Schule, die in der Sowjetunion vor allem in den 1920er und 1930er Jahren entwickelt worden ist, hat sich aus heutiger Sicht vor allem dadurch verdient gemacht, dass sie die klientenzentrierte psychologische und medizinische Sichtweise von Behinderung überwinden konnte, indem sie die Entwicklungsprozesse des Gehirns im Verhältnis zum Feld der sozialen Interaktion des Individuums untersuchte. Sie stellt den bis heute grundlegenden Versuch dar, das interaktive Wechselverhältnis zwischen biologischer und sozialer Ebene der Behinderung zu verstehen. In Westdeutschland ist die Kulturhistorische Schule erst seit den 1970er Jahren populär geworden, vor allem durch Wolfgang Jantzen und Georg Feuser, und hat bis heute einen relevanten Stellenwert im Studienfach der Behindertenpädagogik.
Der sowjetische Neuropsychologe und Mitbegründer der Kulturhistorischen Schule, Alexander Lurija, ist in seinen Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass die "höheren psychischen Funktionen" (alle bewussten Tätigkeiten wie Wahrnehmen, Denken, Erinnern u.a.) sich nicht in einzelnen kortikalen Zonen lokalisieren lassen, sondern sich "vielmehr in Systemen gemeinsam arbeitender Bereiche organisieren". (Lurija 1998, S.26) Diese gemeinsam arbeitenden Bereiche des Gehirns werden nach Lurija durch äußere Hilfsmittel miteinander verknüpft, durch Werkzeuge, Symbole, Sprache. Die funktionellen Verbindungen kortikaler Zonen und damit die Organisation des Gehirns ist somit zwar ein natürlicher Prozess, indem die Neuronen bestimmte biologische Verbindungen herstellen, er ist aber wesentlich auch ein sozialer Prozess, indem die Richtung der Verknüpfungen durch gesellschaftliche Teilhabe, durch Interaktion und Kooperation, bestimmt wird. "Ändert sich die äußere Lebenssituation (z.B. durch den Erwerb der Lesefähigkeit oder der Schrift), werden Denkprozesse qualitativ und sehr schnell verändert." (Weber, Eric 2004, S.47) Die "Entwicklungslinien höherer psychischer Funktionen" verlaufen nach Lev Vygotskij von außen nach innen.
"Jede höhere psychische Funktion erscheint im Prozess der kindlichen Entwicklung zwei Mal; einmal als Funktion des kollektiven Verhaltens, der Organisation der Zusammenarbeit des Kindes mit seiner sozialen Umwelt und dann als individuelle Funktion des Verhaltens, als inneres Vermögen der Tätigkeit psychischer Prozesse im engen und genauen Sinne des Wortes." (Vygotskij 2001a, S.119 f.)
So führt Vygotskij die Entwicklung des individuellen Denkens auf die äußere soziale Tätigkeit des Streitens zurück. Das Denken ist dann die "Übertragung einer Streitsituation ins Innere, ist eine Beratung mit sich selbst." (Vygotskij 2003, S.329) Ebenso ist "jeder Willensprozess in seinem Ursprung ein sozialer, ein kollektiver, ein interpsychischer Prozess", schreibt Vygotskij: "Zuerst ist es so, dass einer befiehlt, der andere ausführt. Später gibt der Mensch sich selbst einen Befehl und führt ihn selbst aus." (a.a.O.) Vygotskijs Konzept zur Diagnostik der geistigen Entwicklung ist dementsprechend nicht auf bereits erreichte Kompetenzen begrenzt, sondern vor allem auf das Zukünftige und Mögliche gerichtet. Dies ist "die Zone der nächsten Entwicklung" (Vygotskij 1987, S.80), jene Fähigkeiten, die noch nicht ausgereift sind, sich aber im Reifungsprozess befinden:
"Was das Kind heute in Zusammenarbeit und unter Anleitung vollbringt, wird es morgen selbständig ausführen können. Und das bedeutet: Indem wir die Möglichkeiten eines Kindes in der Zusammenarbeit ermitteln, bestimmen wir das Gebiet der reifenden geistigen Funktionen, die im allernächsten Entwicklungsstadium sicherlich Früchte tragen und folglich zum realen geistigen Entwicklungsniveau des Kindes werden." (ebd., S.83)
Entsprechend gilt die geistige Entwicklung des Menschen in der Kulturhistorischen Schule vor allem als eine soziale Entwicklung. Lurija hat bei seinen Zwillingsforschungen festgestellt, dass mit zunehmender Entwicklung die biologischen Faktoren an Einfluss verlieren, während die sozialen Faktoren an Bedeutung gewinnen. (Lurija 1993, S.95) Dennoch konstatiert Vygotskij eine biologische Basis der Behinderung. Er spricht von "primären Besonderheiten, die den Kern der geistigen Behinderung bilden" (Vygotskij 2001a, S.124) und bezeichnet diese als Symptome, "die unmittelbar aus der biologischen Unzulänglichkeit des Kindes resultieren und die seiner Rückständigkeit zu Grunde liegen." (a.a.O.)
Diese elementaren "Unzulänglichkeiten", die Vygotskij dem biologischen Bereich zuordnet, sind nach seiner Auffassung für die Pädagogik kaum zugänglich. Sie sind auch nicht die letztendlich entscheidenden Faktoren für die Genese einer geistigen Behinderung. Denn alle Funktionen des Intellekts seien niemals gleichermaßen beeinträchtigt. "Die relative Unabhängigkeit der Funktionen unter den Bedingungen ihrer Einheit führt dazu, dass die Entwicklung einer Funktion von der anderen kompensiert wird und sich auf die andere auswirkt." (Vygotskij 2001a, S.122) Die Organisation des Gehirns ist nach Auffassung der Kulturhistorischen Schule dynamisch. "Unzulänglichkeiten" in einem Bereich können durch Stärken in anderen Bereichen und entsprechende funktionelle Neuverknüpfungen ausgeglichen werden. Die "dynamische Lokalisation bedeutet in dieser Auffassung, dass die sozial bedingte (extrazerebrale) Organisation der höheren psychischen Prozesse über kulturelles Lernen deren Realisierung im Gehirn selbst (intrazerebral) determiniert." (Jantzen, 2003, S.3)
Die Aufgabe der Pädagogik ist es nach Vygotskij, auch bei Menschen mit bestimmten intellektuellen Beeinträchtigungen die Entwicklung der höheren psychischen Funktionen zu fördern, denn diese sind sozialer Natur. Die Komplikationen, die einer biologischen Unzugänglichkeit in zweiter, dritter oder höherer Stufe folgen, lassen sich durch pädagogische Förderung beeinflussen. Und nur von den höheren Funktionen ausgehend lassen sich indirekt auch die elementaren Unzulänglichkeiten überwinden. Beispielsweise werde in der Montessori-Pädagogik die Leistung des Geruchssinns als primäre biologische Funktion durch das Training der höheren Funktionen von Aufmerksamkeit und Analyse gesteigert. Durch die "Auflösung der sekundären Komplikationen" verändere sich "das gesamte klinische Bild der geistigen Behinderung in einem solchen Ausmaß, dass die moderne Klinik es zurückweisen würde, hier von geistiger Behinderung zu sprechen, falls der Prozess der erzieherischen Arbeit bis zu seinem logischen Ende durchgeführt würde." (Vygotskij 2001a, S.127)
Vygotskij versteht geistige Behinderung stets als eine soziale Behinderung: "Die Unterentwicklung der höheren Funktionen hängt von der kulturellen Unterentwicklung des geistig behinderten Kindes ab, von der Tatsache, dass es aus seiner kulturellen Umgebung, aus dem Stoffwechsel mit der Umwelt herausfällt. Wegen seiner Mängel bekam es nicht hinreichend den Einfluss der Umwelt zu spüren." (ebd., S.126) Das Theorem der (sozio-kulturellen) Isolation als Ursprung der geistigen Behinderung hat Jantzen mit dem Theorem der (strukturellen) Gewalt verbunden und weiterentwickelt.
Vygotskijs Ausführungen lassen sich als ein dreistufiges Modell der geistigen Behinderung zusammenfassen. Er geht zunächst von einem biologischen Defekt aus, der pädagogisch am wenigsten zu beeinflussen ist. Die höheren psychischen Funktionen, also die intellektuellen Fähigkeiten, sind durch die Kooperation in der Gemeinschaft beeinflussbar. Sie können zu kompensatorischen Funk-tionen gegenüber dem primären Defekt führen. Geschieht dies aber nicht oder nicht ausreichend, "so kommt es unter Bedingungen sozialer Isolation zu tertiären Neubildungen pathologischer Art." (Jantzen 2001a, S.235)
Den Begriff der Isolation definiert Jantzen als eine "auf die Tätigkeit des Subjekts einwirkende Größe", die "auf Wahrnehmungsebene als sensorische Deprivation, Überstimulierung oder widersprüchliche Information" zu verstehen ist. (Jantzen 1992, S.283) Die Folge ist eine Wahrnehmungstäuschung. Diese Wahrnehmungstäuschung entsteht aber nicht nur im engeren Sinne einer Isolation, wie der eines Gefängnisaufenthaltes, sondern allgemeiner, durch eine Isolation des Individuums vom kulturgeschichtlichen Erbe der Gesellschaft - wenn ihm Bindung und Dialog, der Zugang zur Sprache, Bildung und den alltagspraktischen Techniken vorenthalten werden. Als Folge dieser Isolation entwickelt der betroffene Mensch tertiäre Neubildungen, also pathologische Verhaltensmuster wie rhythmische Bewegungen oder Bewegungsstürme. Dies sind dann die typischen Auffälligkeiten, die in den stationären Wohneinrichtungen häufig zu Tage treten. Sie sind aber keineswegs eine direkte Folge eines biologischen Defekts, keine naturhaften Erscheinungen, sondern gesellschaftlich geschaffene Behinderungssymptome.
Der Defekt auf biologischer Ebene verändert nach Jantzen die Beziehungen des Individuums zu den Menschen und zur Welt radikal. Es ist dann die Aufgabe der sozialen Umgebung, individuell passende Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe anzubieten, geschieht das nicht, entsteht eine Situation der Isolation.
Die biologische Ebene einer Behinderung versteht Jantzen also keineswegs als eine "Basiserklärung". Vielmehr versucht Jantzen auch den biologischen Bereich, der an einer geistigen Behinderung beteiligt ist, durch soziale Feldeinwirkungen zu erklären. Er beruft sich dabei u.a. auf die Neurowissenschaftler Trevarthen und Aitken. Diese gehen davon aus, dass bei der Entwicklung von Stammhirnfunktionen beim Embryo zwischen der fünften und achten Woche ein "intrinsisches Motiv-System (IMF)" entsteht, welches sich später mit einem emotionalen Ausdruckssystem (EMS) der Mund- und Gesichtsmotorik verbindet. (Jantzen 2002, S.4) Das IMF enthält bereits eine Differenzierung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Es zielt auf den intersubjektiven emotionalen Austausch. "Das Bedürfnis nach intersubjektiver Übermittlung von Gefühlen wie Freude, Neugier, Angst wird vielmehr als der primäre, soziale Entwicklungsorganisator des Gehirnwachstums wie des damit zusammenhängenden kognitiven Lernzuwachses angesehen - und zwar nicht erst postnatal durch äußere Stimulierung angeregt, sondern 'innate', im Zusammenhang mit vokalen und propriozeptiven Stimuli der Mutter", ergänzt Ulrike Lüdtke (2006, S.6).
Diese embryonalen Prozesse wirken sich laut Jantzen auf die Entwicklung der höheren Hirnsysteme aus und "realisieren die Raum-Zeit-Koordination der psychischen Prozesse innerhalb des Körperselbst nach Maßgabe und Integration der räumlich-zeitlichen Organisation des Körpers" (Jantzen 2002, S.4). Sie beeinflussen somit weitere zerebrale Entwicklungen oder auch Fehlentwicklungen in der pränatalen Phase. Diese sind nicht länger rein biologische Entwicklungen, sondern sozial-interaktive Entwicklungen. Das entstehende Gehirn im Embryo ist nach diesem Modell von Anfang an bereits ein soziales Organ, welches durch eine Störung der Interaktion zwischen Mutter und Embryo geschädigt werden kann.
"Geistige Behinderung ist für uns immer das Resultat vielfältiger Transaktionen innerhalb derer sich das 'behindert werden' (Isolation, strukturelle ebenso wie direkte Gewalt) in einem spezifischen natürlichen und sozialen Kontext zunehmend als 'behindert sein' auskristallisiert." (Jantzen 2001b,S.2)
Isolation und Gewalt stehen in einem Wechselverhältnis. Misslingender Austausch mit der sozialen Umwelt, der primären Bezugsperson, postnatal und pränatal, führen zur emotionalen Unterversorgung und zu einem Vorenthalten von Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne der strukturellen Gewalt. Andererseits begünstigen Bedingungen der Isolation das Einwirken von Gewalt und erhöhen die Verwundbarkeit durch Gewalt.
Jantzen konstatiert in Anlehnung an verschiedene Verhaltensstudien große Übereinstimmungen in den pathologischen Verhaltensmustern von traumatisierten Opfern schwerer Gewalt und geistig behinderten Menschen. (Vgl. Jantzen 2001c, S.4 ff.) Schon bei Neugeborenen träten posttraumatische Stress Syndrome auf, die auf eine Gemeinsamkeit mit Gewaltopfern hindeuten. Diese Stresserfahrungen führt Jantzen auf "misslingendes oder fehlendes 'attachement', verstanden als gestörter feldabhängiger Austausch, als misslingender Dialog" zurück und verweist auf die mangelnde Vermittlung der Übergänge zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen durch die beteiligte Bezugsperson. Erfahrungen dieser Art führen laut Jantzen zu einer "Überaktivierung des Frontalbereichs der rechten Großhirn-Hemisphäre" (Jantzen 2002, S.5). Daraus folgten Umbildungen im Gehirn sowie Schädigungen des Hippocampus, der Basalganglien und möglicherweise des Kleinhirns sowie des Gyrus cinguli. Die Folgen seien Störungen des biografischen Gedächtnisses und der raum-zeitlichen Koordination. Störungen im Hippocampus und im Kleinhirn lägen gemeinsam bei Syndromen vor, die sonst höchst unterschiedlich seien, z.B. beim Down-Syndrom, Fragilen-X-Syndrom und Rett-Syndrom. Jantzen bezweifelt, dass diese auffälligen Gemeinsamkeiten rein biologisch zu erklären seien und sieht als mögliche Ursache "Stress in der Pränatalperiode". (Jantzen 2001c, S.6)
Auch nach der Geburt ist nach Jantzen das Gehirn auf ein dialogisches Handlungs- und Kommunikationsmodell ausgerichtet. Das "dialogische Prinzip" (Buber 1997) wird aber verletzt durch die feindliche Einstellung der sozialen Umwelt. "Bewusste und unbewusste Tötungswünsche sind erste emotionale Reaktionen des sozial vermittelten Schreckens" (Jantzen 2002, S.3). Behinderte Kinder werden zur Belastung für die Eltern, Nachbarn und Verwandte distanzieren sich von den Familien (ebd., S.11). "Transaktionen zwischen geistig behinderten Kindern und ihren Bezugs- personen sind im Vergleich zu nicht behinderten Kindern weit häufiger gestört." (ebd., S.10) Jantzen sieht dies als strukturelle Gewalt, die zugleich zur Ausgrenzung und Isolation führt und umgekehrt. Das gestörte Verhältnis zwischen Erziehungspersonen und Kind begünstige eine gewaltförmige Erziehung, bei der höhere Risiken für Vernachlässigungen, Missbrauch und Misshandlungen aufträten. Aber auch unterhalb der Schwelle zur offenen Gewalt sei die Erziehung durch "intrusive Verkehrsformen" (a.a.O.) geprägt. Die Sprache werde simplifiziert, das Verhalten der Kinder häufiger kontrolliert und korrigiert. In ihrem Tempo der Kommunikation stellten sich die Eltern aber nicht auf die Erfordernisse des Kindes ein. Sie "stellen die zweite Frage, bevor das Kind die erste beantwortet hat". (Jantzen 2001c, S.12) Das menschliche Bedürfnis nach Dialog und Kooperation wird negiert, die geistige Entwicklung behindert und emotionale Störungen begünstigt. "'Stupide' zu sein bedeutet, mit Gram vertäubt zu sein." (Jantzen 2001c, S.2) Geistig behinderte Menschen sind in einem höheren Maße verwundbar und zugleich der Gefahr einer größeren Gewalteinwirkung ausgeliefert.
Geistige Behinderung ist bei Jantzen eine gesellschaftliche Institution. "Institutionen selbst sind sozialwissenschaftlich als hinter unserem Rücken entstehende, gesellschaftliche Regelsysteme der Zuweisung von Individuen an soziale Orte und in soziale Felder zu begreifen." (Jantzen 2005, S.155) Diese Institution und diese sozialen Felder konstruieren durch ihre diagnostischen und therapeutischen Zugangsweisen "selbsterfüllende Vorhersagen" und damit geistige Behinderung. (Vgl. Jantzen 2002, S.5) "Gewalt ist der verborgene Kern von geistiger Behinderung" (ebd. S.1)
Nach dem bisher erfolgten heuristischen Aufbau des Begriffs der geistigen Behinderung in Anlehnung an die Kulturhistorische Schule und Jantzen ist nach meiner Schlussfolgerung der Begriff nur auf soziale Felder anwendbar. Es gibt soziale Felder der geistigen Behinderung. Denn geistige Behinderung entsteht immer nur relational im Zusammenwirken zweier oder mehrerer Individuen, sowie der Mensch ohnehin nur innerhalb gesellschaftlicher Verhältnis entstehen und sich entwickeln kann. Soziale Felder der geistigen Behinderung können Eltern-Kind-Konstellationen sein, in denen prozesshaft geistige Einschränkungen und soziale Teilhabebeeinträchtigungen produziert werden. Zu den sozialen Feldern der geistigen Behinderung gehören ebenso Nachbarschaftsbeziehungen, Schulen, der Arbeitsmarkt, das soziale Hilfesystem und die gesellschaftliche Gesamtheit mit ihren kontrollierenden, bewertenden und sanktionierenden Instanzen überhaupt. In diesen Feldern konstituieren und reproduzieren sich Isolation, Gewalt, Stigmatisierung und selbsterfüllende Vorhersagen, so dass mögliche Prozesse der geistigen Entwicklung behindert werden.
Die Herstellung geistiger Behinderung erfolgt in diesen sozialen Feldern stets über eine regelgeleitete Zuordnung von Menschen aufgrund äußerlich wahrnehmbarer Verhaltensweisen und Körpermerkmalen in Kategorien sozialer Statusgruppen. So werden Menschen aufgrund besonderer Leistungen in die Statusgruppe der Hochbegabten eingeordnet, andere als Faulenzer tituliert, wenn sie normativ erwünschte Leistungen nicht erbringen, obwohl ihnen die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten dafür unterstellt werden. Andere Menschen gelten als Fremde oder als Krüppel aufgrund ihrer Hautfarbe oder fehlender Gliedmaße, als "Idioten" oder "Debile", wenn sie intellektuell nicht in der Lage sind, kleinere Einkäufe zu erledigen oder als einfach eingestufte Rechenaufgaben zu lösen. Gesellschaftliche Normen, an denen geistige Kompetenzen gemessen werden, entstehen im herrschaftsförmigen Prozess gesellschaftlicher Entwicklung. Soziale Gruppen, die aufgrund ihrer Machtmittel in der Lage sind, Normen zu definieren und wirksam durchzusetzen, bestimmen die Zone der Normalität und die Grenzen, hinter denen Behinderung und Ausschluss beginnen. Das gilt für die IQ-Werte ebenso wie für die Zensuren und Leistungsanforderungen in der Schule oder die Zuordnung in eine Hilfebedarfsgruppe.
In dieser Gesellschaft, so Jantzen, "entsteht im Alltagsbewusstsein (als Basis von Ausgrenzungsvorgängen) ein verdinglichter Begriff von Normalität als gesellschaftlicher Funktionsfähigkeit". (Jantzen 1992, S.260) Der Begriff der Verdinglichung meint in der marxistischen Theorie-Tradition die verzerrte Widerspiegelung gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse als naturwüchsig gegebene Tatsachen im Bewusstsein der Menschen. Ein verdinglichter Begriff von Normalität fasst somit das gewohnt Übliche nicht als ein historisches und veränderbares Resultat menschlicher Produktion und Reproduktion, sondern als ein unveränderlich und selbstverständlich gegebenes Ding, das aufgrund seiner Faktizität normative Kraft erlangt. Auf der Folie dieser Normalität werde das konkrete Individuum beurteilt, konstatiert Jantzen weiter. Als normbildende Grundlage für diese Folie nennt er die Funktionstüchtigkeit innerhalb der "klassenbedingten herrschenden Arbeits- und Verwertungszusammenhänge". (a.a.O.) Behinderung ist somit:
-
aus Sicht der kapitalistischen Produktion "Arbeitskraft minderer Güte",
-
"Aus Sicht der Zirkulationssphäre (...) ist Behinderung reduzierte Geschäftsfähigkeit. Der ‚Behinderte' ist nicht in der Lage, seine Arbeitskraft selbstständig und in üblicher Weise zu Markte zu tragen."
-
Aus Sicht der Konsumsphäre "fallen Behinderte aus der Norm der sozialen Konsumfähigkeit. Sie stören die öffentliche Sitte und Ordnung, wenn sie als Obdachlose oder Alkoholiker in Parks sitzen, als spastisch gelähmte Menschen ein Lokal aufsuchen, oder in Urlaub fahren wollen usw. Behinderung ist unter diesem Aspekt reduzierte soziale Konsumfähigkeit."
-
"Aus Sicht der Distributionsverhältnisse, die das kapitalistische System vermittelt über den Staat aufrecht-erhalten, ist Behinderung reduzierte Ausbeutungsbereitschaft."
-
Aus Sicht der Warenästhetik ist Behinderung "reduziertes Gebrauchswertversprechen."
-
"Aus Sicht der antagonistischen Gegensätze zwischen den Klassen einer Klassengesellschaft ist Behinderung in besonderer Weise Anormalität und Minderwertigkeit, weil sie die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die herrschende Klasse stört."
-
"Als gesellschaftliche Form des Umgangs mit den Betroffenen entwickelt sich der gesellschaftliche Ausschluss, der nicht nur Behinderte trifft, aber diese in besonderer Form und Schwere." (ebd., S.41f.)
Die Praxen der sozialen Konstruktion geistiger Behinderung sind nach Feuser auch "Knoten unserer Identitätsbildung" (Feuser 1996, S.4) Sie setzen uns zu anderen Menschen in Distanz. Die geistige Behinderung erscheint als verdinglichte Eigenschaft der jeweils anderen Person. Umgekehrt schreiben wir uns eine "innewohnende Eigenschaft" der Normalität zu, wodurch wir uns grundlegend von den geistig behinderten Menschen unterscheiden können. Jene Menschen, die gesellschaftlich und sozialrechtlich bereits den Institutionen der geistigen Behinderung zugewiesen worden sind, klassifizieren sich selber in der Regel aber nicht als geistig behindert. Das hindert sie aber nicht daran, wie Feuser und auch ich beobachten konnten, wiederum andere Menschen als "verrückt", "dumm" oder als "Idioten" zu bezeichnen, wenn sie bei jenen bestimmte Merkmale wahrnehmen, durch welche eine Abgrenzung möglich wird. So erklärte mir der Bewohner U. in der Einrichtung, sein Mitbewohner B. gehöre eigentlich in die "Irrenanstalt", weil er gelegentlich Tassen auf den Boden werfe. U., der selber in einer Einrichtung der stationären Behindertenhilfe wohnt, grenzt sich über dieses Verhaltensmuster von seinem Mitbewohner ab. Es erscheint ihm unverständlich, irre, als Grund für eine Ausgrenzung und Zuweisung des Bewohners B. an einen anderen sozialen Ort der Behinderung.
Das beschriebene Verhaltenssymptom alleine ist in diesem Beispiel offensichtlich nicht der einzige und entscheidende Faktor zur Konstruktion einer geistigen Behinderung. Neben der Zerstörung der Tassen kommt als wesentlicher Umstand hinzu, dass dies in einem Feld der sozialen Kontrolle, also halb öffentlich in der Einrichtung geschieht. Es kommt auch hinzu, dass der Bewohner B. über keine eigenen Tassen verfügt und somit nur die Möglichkeit hat, die Tassen der Einrichtung zu zerstören, womit er zwangsläufig die Norm der Achtung fremden Eigentums verletzen muss, wenn er Aggressionen an Tassen ausagieren will.
Der Tatbestand einer geistigen Behinderung oder einer Psychopathologie ist somit immer feldabhängig. Das jeweilige Feld muss mit dicht am Handlungsradius der Person haftenden sozialen Normen ausgestattet sein und über Instanzen der sozialen Kontrolle verfügen. Ob eine Person in die Zone der geistigen Behinderung gerät oder nicht, hängt wesentlich von ihren Ressourcen ab, die ihr vor dem Begehen der fraglichen Handlung von der Gesellschaft zugeteilt worden sind. Je größer die persönliche, geschützte Privatsphäre ist, desto größer sind die Chancen, seine Handlungen dem Zugriff der sozialen Kontrolle zu entziehen. Materieller Besitz steigert die Möglichkeiten zu handeln, auch "verrückt" zu handeln, Geld zu verbrennen oder Porzellan zu zertrümmern, ohne das Eigentum und die Grenzen anderer Menschen zu verletzen. Je geringer die gesellschaftlich legitimierten Handlungsmöglichkeiten eines Menschen sind, desto größer ist seine Gefahr, der Zone der geistigen Behinderung oder des Wahnsinns anheim zu fallen.
Feuser weist bei dem Prozess der Zuordnung eines Menschen in den Bereich der geistigen Behinderung auf das Moment der Verständnislosigkeit ihm gegenüber hin. "Das Verständnis des anderen gelingt nur mittels der Projektion unserer Verstehensgrenzen auf ihn, d.h. wir erkennen unsere Grenzen des Verstehens als Begrenztheit derer, die es zu verstehen gilt. In der Folge kommt es zur Wahrnehmung unserer Begrenztheit als Grenzen des anderen." (Feuser 1996, S.6) Begründet durch die Annahme über diese nun für seine Person wesensmäßig gehaltenen Begrenztheit des anderen führen wir diesen dann gesonderten sozialen Orten der Unvernunft zu, die seiner Begrenztheit zu entsprechen scheinen: Sonderschulen, Behindertenwerkstätten und -heimen. "Das garantiert, dass der andere trotz Förderung so bleibt, wie ich ihn mir nur denken kann." (a.a.O.) Am Ende werden die Normalität und alle, die sich ihr selbst zuordnen, bestätigt, indem der notwendige Gegenpol, die geistige Behinderung, die Idiotie, der Wahnsinn, gesellschaftlich stets aufs Neue reproduziert wird.
Obwohl Feuser die Existenz geistig behinderter Menschen negiert, räumt er ein, dass die Bezeichnung etwas benennt, was es in der sozialen Realität dennoch gibt. "Es gibt Menschen, die WIR aufgrund UNSERER Wahrnehmung ihrer menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem WIR sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, den WIR als 'geistigbehindert' bezeichnen." (Feuser 1996, S.4) Damit verweist Feuser auf das Dilemma der Begrifflichkeit: Geistig behinderte Menschen gibt es nicht an sich. Jene so bezeichneten Menschen klassifizieren sich selber in der Regel nicht als geistig behindert. Die "geistige Behinderung" einer Person ist eine Fremd- zuschreibung vom urteilenden Außenstandpunkt aus. Dennoch verweist der Begriff der geistigen Behinderung auch auf eine Realität, in der Menschen tatsächlich behindert werden. Er verweist auf die Existenz "von Zuschreibung und Ausgrenzung" (ebd. S.5) sowie auf die "Verwahrlosung der Heil- und Sonderpädagogik". (a.a.O.)
Ein rein sprachlicher Versuch zur Auflösung des Problems der geistigen Behinderung erscheint mir wenig hilfreich. Solange Menschen in unserer Gesellschaft durch (strukturelle sowie offene) Gewalt, Isolation, Stigmatisierung und Zuweisung in ihrer geistigen Entwicklung behindert werden, ist es die Pflicht der Sozialpädagogik und der Sozialwissenschaften, dies auch so zu benennen. Die Ideologie des Political Correctness (PC) führt meiner Auffassung nach eher zu Euphemismen und Verschleierungen. Die sprachliche Negation benachteiligter sozialer Gruppen beruhigt vielmehr das schlechte Gewissen der sich als "normal" klassifizierenden Mehrheit und legitimiert das Handeln der gesellschaftlich herrschenden Gruppen. Auch die von der "Lebenshilfe" initiierte Bezeichnung "Menschen mit geistiger Behinderung" ändert an der gesellschaftlichen Realität nichts. Sie ist nicht nur reine Sprachkosmetik, sondern verdinglicht die Behinderung zudem. Die Behinderung erscheint plötzlich als ein Ding, das zum Eigentum oder zum Anhängsel eines Menschen geworden ist. Die soziale Tätigkeit des Behinderns hingegen wird unterschlagen. Im Ausdruck "geistig behinderte Menschen" hingegen wird deutlich, dass es sich um Menschen handelt, die (vor allem) im geistigen Bereich behindert werden. Die Bezeichnung "geistig behinderte Menschen" halte ich aus diesem Grunde aufrecht, obgleich auch sie nicht frei von Widersprüchen und Unstimmigkeiten ist.
Geistig behinderte Menschen bilden keine homogene Gruppe. Ein Mensch mit Down-Syndrom unterscheidet sich in seinen Verhaltensweisen, Kompetenzen und Unterstützungsbedürfnissen meist ganz wesentlich von einem autistisch behinderten Menschen. Bewohner, die sprechen, leben ganz wesentlich anders als jene, die nur einzelne Laute artikulieren können. Die rechtlich und institutionell konstruierte Homogenität jener Gruppe basiert auf Unkenntnis und Wunschdenken. Sie ist eine Fiktion. Eine fachlich begründete Alternative zum Begriff der geistigen Behinderung wäre seine Auflösung zugunsten empirisch ansatzweise fundierter Homogenitätsgruppenkategorien bezüglich konkreter Hilfebedarfe. Beispielsweise ließen sich Menschen, die (noch) nicht mit Zahlen operieren können und somit Hilfe beim Umgang mit Geld benötigen, als eine Gruppe zusammenfassen. Eine andere Gruppe könnten Menschen sein, denen es schwer fällt, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Mit diesem Modus könnten Gruppen bezeichnet werden, die auch lebenspraktisch über subjektiv wahrnehmbare Gemeinsamkeiten verfügen.
Durch eine solche begriffliche Umstrukturierung würde die Isolierung der betroffenen Menschen in ihren sozialen Feldern der geistigen Behinderung überwunden werden. Denn die konkreten Probleme, um die es geht, finden sich oft auch in anderen sozialen Gruppen. Sie könnten als allgemein menschliche Probleme wahrgenommen werden, von denen mehr oder minder jeder betroffen sein kann. Auch gut gebildete Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigen nicht selten Hilfe beim Umgang mit Geld, ebenso beim Aufbau sozialer Kontakte. Konkrete Hilfebedarfe dieser Art finden sich auch in der "normalen Mitte" unserer Gesellschaft wieder. Sie zeigen sich oft nur anonym in den Überschuldungsstatistiken, dem Boom der Internetforen und den Umsatzzahlen der lebenspraktischen Ratgeberliteratur.
Eine solche begriffliche Transformation der geistigen Behinderung macht aber nur dann Sinn, wenn sie mit einer institutionellen und rechtlichen verbunden wird. Die Wissenschaft würde ihren Gegen- stand verfehlen, wenn sie von der Realität abstrahiert und nicht das analysiert, was faktisch an tradierten und sozial wirksamen Konstruktionen in der Gesellschaft stattfindet.
Das Sozialrecht unterscheidet zwischen körperlich, geistig und seelisch behinderten Menschen. Damit sind die Kategorien rechtlich vorgegeben, nach denen die Zuordnung erfolgt. Dass diese strikte Einteilung längst nicht mehr dem Stand der Wissenschaft entspricht, hat der Gesetzgeber übersehen. Wie ich bereits ausgeführt habe, ist bei einer geistigen Behinderung nicht nur "der Geist" betroffen. Sie hat in der Regel auch eine körperliche (genetische, neurologische, chromosomale) Komponente. "Es liegen bei diesen Menschen in der Regel umfassende Störungen bzw. Mehrfach- behinderungen vor. So etwa Störungen der körperlichen Entwicklung, des affektiven und emotionalen Erlebens, der Steuerung des Antriebs und der Aufmerksamkeit, der kognitiven Kompetenz, der psychosexuellen Entwicklung usw., d.h. der Persönlichkeitsreifung insgesamt." (Koniarczyk 2006, S.1) Körper und Geist lassen sich nach Auffassung des Neurologen Manfred Koniarczyk nicht gänzlich voneinander trennen.
Das, was in meinem Gegenstandsbereich unter dem Wort "geistig" verstanden wird, sind die kognitiven und intellektuellen Funktionen eines Menschen. Soweit diese organisch von der Funktionalität des Gehirns abhängen und im Gehirn stattfinden, kann geistige Behinderung ebenso als eine Körperbehinderung bezeichnet werden. Da die intrazerebrale Tätigkeit des Gehirns aber zugleich auf dynamische Weise von der extrazerebralen Interaktion abhängt und das Individuum jeweils seine ganz eigenen, individuellen neuronalen Verknüpfungen herstellt, gewinnt dieser Bereich der Behinderung einen Rest an Unerklärbarem, etwas "Geistiges" im spirituellen Sinne des Wortes. Er markiert eine Grenze der positiven Naturwissenschaften und verweist die betroffenen Menschen zugleich ins Feld des Mysteriösen.
Eine ebenso mysteriöse Konnotation wie diese, hat auch die Kategorie der seelischen Behinderung. Die Seele ist ein übernatürlicher Gegenstand. Menschen mit irrationalen Ängsten, Depressionen oder Kontaktstörungen leiden emotional. Sie können psychologische Hilfen erhalten und gelten medizinisch als psychisch gestört oder krank. Der Gesetzgeber unterscheidet mit zwei übernatürlichen Begriffen das Gefühlsleben vom kognitiven bzw. intellektuellen Leben, dabei gehört zur Psychologie nicht nur der Bereich der Emotionen, sondern auch der der Kognitionen. Auch Intelligenztests werden von Psychologen durchgeführt. Die gesetzliche Trennung zwischen Denken und Fühlen erscheint antiquiert. Bereits Vygotskij hat auf die dialektische Einheit von Emotion und Kognition hingewiesen. "Die vergleichende Untersuchung schwachsinniger und normaler Kinder zeigt, dass es lohnenswert ist, die Unterschiede zwischen ihnen nicht in erster Linie nur in den Eigenschaften des Intellekts selbst oder des Affektes selbst zu sehen, sondern in den zweifachen Beziehungen, die zwischen diesen Sphären des seelischen Lebens und ihren Entwicklungslinien bestehen, die die Beziehung zwischen den affektiven und intellektuellen Prozessen schaffen." (Vygotskij 2001b, S.162) Umgekehrt leiden auch "seelisch behinderte" Menschen unter kognitiven Störungen, wenn die Gefühle ihre Wahrnehmung verzerren, Erinnerungen blockiert werden oder positive Lebenschancen im Grau der Depression untergehen.
Wissenschaftlich lässt sich die rechtliche Dreigliederung des Behinderungsbegriffes nicht aufrecht erhalten. Seine Auflösung zugunsten einer Behinderungskategorie, die alle Bereiche zusammenfasst, würde sich jedoch soziologisch auf äußerst dünnem Eis bewegen, da die Homogenität dieser fiktiven Gesamtgruppe noch weitaus geringer ist, als die der geistig behinderten Menschen. Ein solcher Begriff macht soziologisch fast keinen Sinn. Rechtlich würde er nicht viel verändern, da behinderten Menschen, gleich welcher der drei Kategorien, unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Eingliederungshilfe zusteht. (Vgl. § 53 AbS.1 SGB XII)
Weder der Begriff "geistig behindert", noch der Begriff "Menschen mit geistiger Behinderung" treffen den Gegenstand seiner inneren Struktur nach adäquat. Stigmatisierend und somit wiederum behindernd wirken sie beide. Eine Feindifferenzierung in empirisch konkrete Hilfebedarfsgruppen vermeidet Stigmatisierung weitestgehend und wäre begrifflich die zutreffendste Lösung. Sie geht aber an dem vorbei, was die Gesellschaft durch ihre tradierten Konstruktionen geschaffen hat und weiterhin aufrechterhält. Die geistige Behinderung ist faktisch eine gesellschaftliche Institution. Sie schafft Fakten und verweist Menschen, die zuvor äußerst unterschiedlich waren, an gleiche Orte der Ausgrenzung. Sie fasst Menschen in Wohngruppen, in Werkstätten und Heimen zusammen, unterstellt sie den gleichen Regeln und Bedingungen. So schmiedet die Gesellschaft das zusammen, was nicht zusammengehört, und erfüllt sich damit ihre eigene Fiktion von "den geistig behinderten Menschen". Vielmehr als die biologischen Defekte, die es dort gibt, ist für meine Arbeit jene sozial wirksame Fiktion der Gegenstand, den es zu erforschen und aufzuheben gilt. Die geistige Behinderung kann nicht aufgehoben werden ohne die geistig behinderten Menschen und umgekehrt. Sie in "Kunden" oder "Nutzer" umzubenennen, würde die Welt nur anders interpretieren, statt sie zu verändern. Ich verwende den Begriff der "geistig behinderten Menschen" folglich nicht abwertend, sondern in kämpferischer Absicht, ähnlich dem Begriff des Proletariats, der bei Marx positiv besetzt war. Gleichwohl ist mir bewusst, dass ich Gefahr laufe, damit den beschriebenen Stigmatisierungs- und Ausgrenzungskreislauf selber zu bedienen und mich sprachlich an der Behinderung zu beteiligen. Aus der Unmöglichkeit einer richtigen Begriffsfindung gibt es kein Entrinnen, solange die gesellschaftliche Realität in ihrer menschlichen Unmöglichkeit fortbesteht. Es gibt keinen richtigen Begriff im falschen![4]
Dem Thema Ambulantisierung kommt in dieser Dissertationsarbeit eine zentrale Rolle zu, weil meine Qualitätsentwicklung im Rahmen der Umwandlung einer stationären Einrichtung in ein ambulantes Wohn- und Betreuungsangebot stattfand. Die grundsätzliche Zielsetzung der Einrichtung war durch den Begriff der Ambulantisierung bereits vorgegeben, als ich mit meiner wissenschaftlichen Begleitung begonnen habe. An diesem Ziel musste ich meine Evaluation ausrichten. Die Qualität der Einrichtung sollte sich an dem Ziel der Herstellung ambulanter Wohn- und Betreuungsstrukturen messen lassen. Doch was heißt genauer "ambulant"? Mit dieser Frage musste sich unsere Forschungsgruppe zunehmend beschäftigen, je länger wir den Prozess beobachten konnten. Immer wieder haben wir die Frage diskutiert, ob es sich in unserem Falle um eine tatsächliche Ambulantisierung handelt oder eher um eine "Scheinambulantisierung" oder um eine Teilambulantisierung. Um dies klären zu können, war ein Blick auf die in der Fachliteratur, den Gesetzen und in den Richtlinien der Sozialhilfeträger vorfindbaren Ausführungen notwendig. Der Begriff steht in einem historischen Kontext.
Um den Begriff der Ambulantisierung in seinem historischen Kontext besser begreifen zu können, werde ich die Geschichte der sozialen Ausgrenzung und Isolation bis hin zur Vernichtung behinderter Menschen im faschistischen Deutschland darstellen, um anschließend die Strukturen der "totalen Institution" nach 1945 vorzustellen. Erst auf diesem Hintergrund gewinnt der Begriff der Ambulantisierung seinen Sinn und lässt sich operativ auf das konkrete Projekt dieser Arbeit anwenden.
Franca Ongaro Basaglia hat in ihrem Essay "Ausschluss/Integration" Anfang der 1980er Jahre die Dialektik dieser beiden Begriffe geschichtsphilosophisch herausgearbeitet. "Die erste Bedeutung des Begriffs 'Integration' als des offensichtlichen Gegenteils von 'Ausschluss' bezeichnet also tatsächlich die Integrität dessen, der den anderen ausschließt, indem er ihn auslöscht." (Ongaro Basaglia 1985, S.75) Derjenige, der die Macht hat, den anderen physisch oder auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, auszugrenzen, ihn in den Narrenturm zu sperren oder ihm in eine Zwangsjacke zu stecken, integriert sich durch diesen Akt mittels des Ausgeschlossenen mit sich selbst. "Wer ausschließt (tötet), der bleibt integer, unversehrt; er bleibt lebendig, indem (und weil) er dem anderen den Tod zufügt." (ebd., S.74) Beide, Ausgeschlossener und Ausschließender, sind voneinander abhängig. Der von der Teilhabe und Macht ausgeschlossene "Diener" braucht den "Herrn", um zu überleben. Der Herr braucht den von der Macht ausgeschlossenen Diener zur "Anerkennung seiner eigenen Macht." (ebd., S.76) Nur durch diese Anerkennung bleibt er Herr und sich dessen bewusst. Dieses feindselige Verhältnis der Menschen untereinander verfolgt Ongaro Basaglia zurück bis Adam und Eva: Der Herr schloss beide aus dem Paradiese aus. Der Allmächtige bleibt integer durch den Akt der Vertreibung.
"Dieses symbolische Schema der Ausgliederung des anderen um des eigenen Überlebens willen und der individuellen Integritätsbehauptung durch Erniedrigung des anderen (Gott, der seine Hoheit bekräftigt, indem er die Gesetzesbrecher aus dem Garten Eden verjagt; Kain, der Abel tötet, weil dieser die Gunst des Gottes genießt) bildet das Leitmotiv der Menschheitsgeschichte. Es entwickelt und wandelt sich mit der Fähigkeit des Menschen, die Natur und sich selbst zu beherrschen" (ebd. S.73)
Damit knüpft die italienische Psychiaterin unverkennbar an Horkheimer/Adornos "Dialektik der Aufklärung" an. Als Leitmotiv der bisherigen Menschheitsgeschichte erscheint darin die Herrschaft: die Herrschaft über Mensch und Natur als berechenbare und verwertbare Objekte. Dazu gehört die Beherrschung der inneren Natur genauso wie der äußeren. "Was dem Maß von Berechenbarkeit und Nützlichkeit sich nicht fügen will, gilt der Aufklärung für verdächtig." (Horkheimer/Adorno 1981, S.9) Anders als Ongaro Basaglia beginnt das Elend von Beherrschung und Ausgrenzung bei Horkheimer und Adorno mit der Gestalt des Odysseus in Homers Odyssee. Es fällt in eins mit der Geburt der Aufklärung, welche nicht erst im 18. Jahrhundert beginnt, sondern mit der "Entzauberung der Welt" (ebd. S.7), mit der Auflösung der Mythen durch Vernunft und Wissen, mit der List der instrumentellen Vernunft über die Gewalt der Naturkräfte und Gottheiten. "Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann." (ebd., S.12)
Odysseus als Prototyp der Aufklärung herrscht und grenzt aus, was seiner Herrschaft im Wege steht. Er lässt sich auf seinem Schiff festbinden und verschließt seiner Mannschaft die Ohren mit Wachs, um die Naturgottheiten zu überlisten. Nur dadurch übersteht Odysseus den Gesang der Sirenen und bleibt unversehrt (integer). Er setzt seine kalkulierende Vernunft dem Mythos und den Naturgewalten entgegen. Er opfert den Impuls seiner inneren Natur, grenzt ihn aus, und wird zum souveränen Subjekt seiner selbst. "Das identisch beharrende Selbst, das in der Überwindung des Opfers entspringt, ist unmittelbar doch wieder ein hartes, steinern festgehaltenes Opferritual, das der Mensch, indem er dem Naturzusammenhang sein Bewusstsein entgegensetzt, sich selber zelebriert." (ebd., S.50f.) Opferritual und Beherrschung, Selbsterhaltung und Ausgrenzung all dessen, was der instrumentellen Vernunft sich entzieht, bilden im Fortgang der Aufklärung, eine destruktiv voranschreitende Formation, die bis zu den Vernichtungslagern führt. Auf dem Wege dieses eisernen Fortschritts spaltet die Gesellschaft all jene ab, die nicht mithalten können oder wollen, die ihre innere Natur nicht rational beherrschen und so an das längst Überwundene erinnern. "Was als Fremdes abstößt, ist allzu vertraut" (ebd. S.163), konstatieren Horkheimer und Adorno in Bezug auf Freud. "Es ist die ansteckende Gestik der von Zivilisation unterdrückten Unmittelbarkeit." (a.a.O.) Die personifizierte Unvernunft: die nach Ongaro Basaglia als Naturobjekt entmenschlicht wird!
Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts konstruiert die frühkapitalistische Gesellschaft eine "neuartige Kategorie der Ausgrenzung" (Ongaro Basaglia 1985, S.87) und schafft besondere Institutionen, "in denen die neu Stigmatisierten isoliert und verwahrt werden". (a.a.O) Die Ausgrenzung erfolgt zwischen Vernunft und Unvernunft, Anpassung und Widerspenstigkeit. "Die Abnormalität wird abgeschafft, indem man sie klassifiziert, aussondert und an einem eigens dafür bestimmten Ort 'beherbergt', wo es der Norm entspricht, abnormal zu sein." (ebd., S.89) Der Ausschluss der Narren aus der Öffentlichkeit und ihre Integration in die Anstalten integriert zugleich die Gemeinschaft der Funktionierenden mit sich selber als eine Gemeinschaft der Vernunft. "Sobald diese 'Anwesenheit' beseitigt ist, weil man ihr das Recht eingeräumt oder die Pflicht auferlegt hat, sich auf einem entlegenen Schauplatz zu bekunden, ist ihr die Anstößigkeit genommen - das Bankett kann weitergehen, die Fröhlichkeit der Tafelrunde bleibt unvergällt." (ebd., S.90)
Die Narren und Wahnsinnigen werden als störendes Gesinde vom Bankett ausgeschlossen, aber nicht nur weil die Herrschaften ihren Kaviar nicht teilen wollen, sondern auch, weil die Ausgeschlossenen, metaphorisch gesprochen, mit Messern und Gabeln nicht umgehen können. Messer und Gabeln sind nämlich nicht von Narren und Wahnsinnigen erfunden worden, sondern von integeren Subjekten vom Typ eines Odysseus. Nicht, dass geistig behinderte Menschen den Umgang mit Besteck nicht erlernen könnten, gemeint ist vielmehr ein Aspekt des Ausschlusses, den ich bei Ongaro Basaglia an dieser Stelle vermisse: Es ist der des dinglich geronnen Ausschlusses. Die aufgeklärte Elite der Gesellschaft sperrt nicht nur aus, sondern sie plant auch und entscheidet, konstruiert technische Dinge und Systeme, schreibt Gesetze und Verordnungen, ohne die Ausge- schlossenen und künftig Auszuschließenden zu fragen, geschweige denn sie daran zu beteiligen. Irgendwann bedurfte es keines bösen Willens mehr, gewisse Menschen zu ihrem eigenen Wohl hinter hohen Mauern zu verschließen, bevor sie auf freien Füßen im Großstadtverkehr unter die Räder kommen. Der Ausschluss konstituiert sich strukturell und indirekt, hinter dem Rücken der Handelnden, die ihrerseits implizit ausschließend für sich und gegen andere handeln.
Die Vernunft existiert nicht nur im Denken, sondern materialisiert sich in all den technischen Geräten und bürokratischen Regeln, die schnell zur Gefahr werden können, sofern man nicht pausenlos "am Ball" bleibt. Es bedarf längst keiner direkten Vertreibung mehr, um die Zurückgebliebenen in die Obhut der Anstalt zu jagen. Die meisten Insassen kommen freiwillig. Die Welt, wie sie ist, hat das Nötige bereits besorgt, um ein Leben in Freiheit unerträglich werden zu lassen. Der Ausschluss/Einschluss erscheint als alternativloses Gebot der Menschlichkeit. Das soziale Verhältnis verschwindet hinter der Unmittelbarkeit der Erscheinung. Der Akt des Ausschlusses verlagert sich nämlich im Fortgang der Aufklärung immer weiter nach hinten. Er beginnt da, wo über die Bedingungen der alltäglichen Lebensführung entschieden wird, wo Bedingungen gestaltet und als Sachzwänge mystifiziert werden. "In diesem Universum liefert die Technologie auch die große Rationalisierung der Unfreiheit des Menschen und beweist die 'technische' Unmöglichkeit, autonom zu sein, sein Leben selber zu bestimmen" (Marcuse 1982, S.173), schreibt Marcuse in "Der eindimensionale Mensch": "Die befreiende Technologie - die Instrumentalisierung der Dinge - verkehrt sich in eine Fessel der Befreiung, sie wird zur Instrumentalisierung des Menschen." (ebd., S.174)
Die gesellschaftliche Herrschaft schraubt die Anforderungen, um teilhaben zu können, kontinuierlich höher. Der Einschluss in die Sonderzone der Unvernunft wird zur Erlösung, den sich betroffene Eltern von geistig behinderten Kindern sehnlichst wünschen, statt ihn zu fürchten (s. Kap. 2.2.3). Das ist die andere Seite der Dialektik von Ausschluss und Integration. Wenn das Leben in scheinbarer Freiheit zum totalen Ausschluss sich verkehrt, erscheint der Einschluss als Rettung, als Integration in die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. An diesen Aspekt knüpft Georg Feuser an, indem er die Befreiung aus den Anstalten auch als Gefahr sieht, dass die gesamte Normalität zur Anstalt wird und Isolation darin aufrecht erhalten bleibt. (s. Kap. 2.2.2)
Die Diskriminierung, Aussonderung und Ermordung behinderter Menschen ist in der bisherigen Geschichte keineswegs parallel zum Fortschreiten der Aufklärung verlaufen. Es gibt keine aufsteigend negative Linie des Ausschlusses, die bis zum Holocaust in der Nazi-Zeit führt. Vielmehr finden sich in der Geschichte wechselnde Formen des Ausschlusses, Epochen der Brutalität und Epochen der größeren Brutalität ebenso wie Perioden humanitärer Reformen. Dennoch zeigt sich mit dem Fortschritt der Vernunft eine Verfeinerung des Ausschlusses, eine weitergehende Differenzierung und Erfassung der Unvernunft.
Der Ausschluss behinderter Menschen lässt sich bis zum ägyptischen Reich zurück verfolgen. Dort wurden sie als Aussätzige stigmatisiert, aber auch ins Berufsleben eingegliedert. "Der Hinkende wird zum Torhüter gemacht, der Kurzsichtige zum Viehfütterer." (Barsch 2008, s.p.) "Narren" dienten den Pharaonen und deren Hofstaat zur Belustigung. In Sparta und Athen, beides Staaten mit hoch entwickelter Vernunft und Aufklärung, wurden Kinder mit Missbildungen gleich nach der Geburt ermordet. Der Ausschluss durch die direkte Tötung setzte sich dann auch im Römischen Reich fort. Diejenigen, die ihren Häschern entkommen konnten, durften aber mitunter als Sklaven, Bettler oder Narren ihr Dasein fristen. Auf den Narrenmärkten waren behinderte Menschen sogar begehrte Handelsobjekte.
Soweit die Geschichte der Behinderung über viele Jahrhunderte hinweg eine Geschichte des Terrors und der Vernichtung war, entwickelte sich mit der monotheistischen Religion eine humanitäre Gegentendenz. Die jüdische Gesellschaft in der Zeit vor Christus hat zwar die Behinderten von der Teilhabe am religiösen und kulturellen Leben ausgeschlossen, ihnen durch soziale Fürsorge aber ein Überleben ermöglicht. Die Bettelgaben wohlhabender Juden dienten ihnen dazu, im Himmel die Gunst Gottes zu erwerben und auf Erden ihr Prestige zu steigern.
Eine revolutionäre Umwertung und Aufwertung des Behinderten wurde aber erst im Christentum erreicht. "Der Geist des Herrn ist über mir. Er salbte mich dazu, den Armen frohe Botschaft kundzutun; er sandte mich (zu heilen, die zerknirschten Herzens sind) Gefangenen Erlösung, Blinden das Augenlicht zu verkünden, Niedergebrochene in die Freiheit zu entlassen..." (Lukas 4,18)
Auch wenn Jesus keine irdische Revolution entfachen wollte, seine geistige Haltung den kranken, behinderten und benachteiligten Menschen gegenüber steht im radikalen Gegensatz zur Geschichte des Ausschlusses und Vernichtung. Kirchengründer Augustinus (354-430) forderte behinderten Menschen gegenüber tätige Nächstenliebe. "Karitativität sichert dem Spender umgekehrt ebenfalls einen Platz im Paradies." (Strasser 2006, S.4) Im Kontext der dialektischen Aufklärung zeigt sich in dieser frühchristlichen Norm deutlich der Doppelcharakter: das Gebot zur praktischen Nächstenliebe enthält die Idee der Gleichheit aller Menschen, wie sie in unserem Grundgesetz formal seit 1949 gilt. Sie ist ein riesiger humanistischer Fortschritt gegenüber der Ausmerze "unwerten Lebens", wie es im Jargon der Nazis heißt. Zugleich aber wird die gute Tat nicht des armen Menschen wegen alleine vollbracht, sondern sie enthält zugleich einen Tauschwert, den besseren Platz im Himmelreich. Christliche Nächstenliebe ist Menschlichkeit und Eigennutz zugleich. Sie ist eine ideelle Form des Warentausches. Die gute Tat gründet auf Kalkulation, sie ist rational und berechnend, zugleich aber dem Mythos verhaftet. Mythos und Aufklärung gehen Hand in Hand. Mit Hilfe der Vernunft versucht der frühe Christ die Allmacht Gottes zu manipulieren. Die Opfergabe besänftigt das Gesetz. Sie ist ein Tausch, ebenso wie der heutige Warentausch nicht nur rationaler Akt ist, sondern zugleich Ritus des Glaubens an seine Allmacht. Im karitativen Subjekt-Objekt-Verhältnis erscheint zwar der Hilfebedürftige als nützliches Objekt, er wird aber zugleich in den Rang des Menschen, als gleichrangiges Kind Gottes, erhoben, während er in anderen Gesellschaften als bloß unnütze Last liquidiert worden war. Von daher ist das Christentum der Ursprung für das, was heute als emanzipatorische Behindertenpolitik und -pädagogik praktiziert wird. Der Gedanke, dass die Letzten die Ersten sein werden, und jeder Mensch von Gott gleichermaßen geliebt wird, ist die zivilisatorische Mission des Christentums und letztendlich auch die Voraussetzung für die Grundorientierung dieser Forschung, auch wenn ich mich eher an der Lehre von Marx und der Kritischen Theorie orientiere - was aber in Gesellschaften säkularisierter Herrschaft kein echter Widerspruch ist.
Wie allgemein bekannt ist, fristete das Christentum der Nächstenliebe nur ein kurzes Dasein und existiert bis heute nur in Nischen fort. Das kirchenchristliche Mittelalter war vor dem Rückfall in die Barbarei keineswegs gefeit. Einerseits boten Klöster den Behinderten Betreuung und Pflege, andererseits aber wurden sie "in die Wüste geschickt". "Es geschah oft, dass die Irren ein Wanderleben führten. Häufig wurden sie aus der Stadt gejagt und ihrem Schicksal überlassen", schreibt Andrea Riedmann (2003, S.8). "Doch in der Mehrzahl der europäischen Städte im Mittelalter gab es eigene Gebäude, die für die Einschließung der Irren bestimmt waren. In Deutschland waren es die zahllosen Narrentürme, in Frankreich wurden sie teilweise in den Hospitälern aufgenommen und gepflegt." (a.a.O.) In Deutschland erfolgte der Ausschluss oft durch die Deportation mit Narrenschiffen. "Meist gingen die Irren auf der Reise in größeren Städten 'verloren', und ihre Herkunftsorte wurden damit von ihnen gesäubert." (a.a.O.) Im Kontext der Hexenprozesse wurden auch geistig behinderte Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Behinderte Menschen aus wohlhabenden Familien wurden hingegen gepflegt und erhielten sogar individuelle Förderung durch einen Hauslehrer. Die primär sichtbare Behinderung war nicht das entscheidende Moment für die Lebenslage des betreffenden Menschen, sondern mindestens ebenso sehr seine Klassenzugehörigkeit.
Mit der Reformation verliert die Nächstenliebe ihren transzendentalen Sinn. "Nach der protestantischen Ethik konnte die Befreiung von Sünde nicht mehr durch milde Gaben erreicht werden, sondern nur noch durch ein strenges, arbeitsames, gottgefälliges Leben." (Frehe 2004, S 2) Max Weber erkennt in der "protestantischen Ethik" das Prinzip einer innerweltlichen Askese. "Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne." (Weber 1984, S.67) Nach Weber schließt die "protestantische Ethik" das christliche Gebot der Nächstenliebe mit der Einordnung in die gesellschaftliche Arbeitsteilung kurz. Berufsethik wird als Nächstenliebe verklärt, da durch die Arbeit am zugewiesenen Platz dem Nächsten gedient werde. Luthers Ethik entmystifiziert Gottes Gebot durch die rationale Anpassung ans weltliche Gesetz, damit mystifiziert er zugleich die weltliche Ordnung als göttliche. Das Leistungsprinzip und der Besitz werden heiliggesprochen. "Da er (Luther, d.Verf.) auf das irrationale Prinzip, die Gnade, konsequent sich verließ und es verschmähte, das rechte Verhalten aus Vernunft zu deduzieren, blieb ihm gesellschaftlich nichts übrig, als den Staat und die Verwaltung, die bestehende Obrigkeit zu vergotten." (Horkheimer 1985a, S.190) Entsprechend hart trifft Luthers Urteil all jene, die sich der Obrigkeit nicht fügen, besonders die aufständischen Bauern. "Luther bezeichnet Schwachsinnige und anderweitig behinderte Kinder als 'massa carnis' (seelenlose Masse, Fleisch), als 'Wechselbälger' (vom Teufel untergeschobene Ersatzkinder) oder Besessene und empfahl dem Fürsten von Anhalt in einem Fall, das Kind zu ersäufen." (Strasser 2006, S.4)
Mit dem Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, der zunehmenden Rationalisierung des wirtschaftlichen Handelns, der Entzauberung der Welt und der Steigerung der Produktivkräfte verschärft sich die feindliche Haltung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber behinderten Menschen. "Die Entstehung der ersten flächendeckenden Anstalten gründet auf der Bewegung der Aufklärung, die im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts die soziale Landschaft Europas grundlegend verändert." (Riedmann 2003, S.9) Je mehr das kalkulierende Denken an Bedeutung gewinnt, desto verdächtiger wird alles Unvernünftige. "In dieser Arbeits- und Vernunftswelt war für Bettler, Arbeitslose, Vagabunden, Dirnen, Alkoholiker, Verrückte, Idioten und Sonderlinge kein Platz und man ließ diese Menschen hinter Schloss und Riegel verschwinden." (a.a.O.) Hamburg hatte als erste deutsche Stadt schon 1620 ein Zuchthaus für Wahnsinnige errichtet. In den neu entstandenen Anstalten galt Arbeitspflicht. Die Müßiggänger und Irren sollten in ihrem Verhalten korrigiert und zu verwertbaren Arbeitskräften umerzogen werden.
Im 19.Jahrhundert wurden eine Vielzahl von vor allem protestantischen und katholischen Anstalten gegründet, z.B. 1849 die "Pflegeanstalt für Schwachsinnige" in Rieth, 1863 die Alsterdorfer Anstalten bei Hamburg, 1872, die "Anstalt für Epilepsie" in Bethel. In dieser Zeit setzte sich der medizinische Blick auf das Phänomen der geistigen Behinderung durch. "Idiotie wurde als unheilbare Gehirn- bzw. Nervenkrankheit diagnostiziert und man begann, die Idioten- bzw. Irrenanstalten als Krankenhäuser zu gestalten und unter irrenärztlicher Leitung zu stellen." (Riedmann 2003, S.12). Diese Anstalten wurden meist fern ab der Öffentlichkeit außerhalb der Stadt errichtet. Mit dem medizinischen Zugriff wurden laut Riedmann die Pfleger zu bloßen Wärtern degradiert, ihre pädagogische Funktion war nicht mehr erwünscht.
Mit dem Beginn des sozialstaatlichen Versicherungswesens Ende des 19. Jahrhunderts nimmt der Staat zunehmend Differenzierungen vor. Die soziale Gruppe der Hilfebedürftigen zerfällt in einzelne rechtliche Kategorien. "Mit diesen unterschiedlichen Gesetzen und den Institutionen, die sich zu ihrer Durchführung entwickeln, entsteht ein umfassendes Netz von diagnostischen Eingriffen in den Lebenszusammenhang der Bevölkerung", konstatiert Wolfgang Jantzen. Erst in diesem Konstruktionsgeflecht von Zusammenhängen "entstehen die Voraussetzungen, unter denen eine wissenschaftliche und sozialpolitische Systematisierung der Tatbestände 'Behinderung' und 'psychische Krankheit' möglich wird." (Jantzen 1992, S.55) Die diagnostische Aussonderung ergreift Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr Menschen, die mit den Anforderungen an Disziplin und abstrakter Vernunftsleistung nicht mithalten können.
"Die Ausbreitung der Hilfsschulen als zahlenmäßig bedeutendster Form des Sonderschulwesens erfolgt rapide: 1900 umfassen sie ca. 8.000 Kinder in 90 Städten, 1920 ca. 43.000 Kinder in 320 Städten. Im Bereich der höheren Schulen treten Lern- und Verhaltensprobleme in der Zeit vor und um 1900 unter dem Gesichtspunkt der 'Überbürdung', heute würde man von 'Schulstress' sprechen, sowie der 'nervösen' oder 'psychopathischen' Konstitution auf." (ebd., S.55)
Die zunehmende Technifizierung und Technokratisierung des gesellschaftlichen Lebens führt zu höchst differenzierten Kategorien der Pathologisierung und Ausgrenzung. Hinter dieser rationalen Nüchternheit diagnostischer Begriffe steht aber immer noch oder immer mehr der Mythos des naturhaft Bösen. Psychische Auffälligkeiten und Behinderung werden auf naturhafte individuelle Eigenschaften zurückgeführt. "Psychopathie ist jede Form der Abweichung von der gesellschaftlichen Normalität: sie wird als Minderwertigkeit, zunehmend als konstitutionell-biologische Minderwertigkeit begriffen, die im psychischen und sozialen Prozess ihren Ausdruck findet. Psychiatrische Lehre und Sozialdarwinismus verknüpfen sich hier aufs Engste." (ebd., S.58 f.)
Die biologistische Ideologie von Behinderung, nach der die Beeinträchtigung die kausale Folge eines genetischen oder organischen Defektes ist, verbündete sich in Deutschland mit der rassistischen Ideologie schon lange vor der Machtergreifung der Nazis. "Es wurde befürchtet, dass die unkontrollierte Fortpflanzung geistig kranker Menschen mit ihrem minderwertigen Erbgut zum Verfall des ganzen Volkes führen könnte" (Riedmann 2003, S.12), umschreibt Riedmann den völkischen Wahn. Behinderte und psychische kranke Menschen ebenso wie Juden, "Zigeuner", Angehörige slawischer Völker, Homosexuelle u.a. soziale Minderheiten wurden mit dem Durchbruch des "autoritäre(n) Charakters" (Fromm 1987, S.123) als Massenphänomen zur Projektionsfläche von irrationaler Angst, Hass und sadistischen Strebungen in Deutschland vor, während und auch noch lange nach der Nazi-Herrschaft. Dieser autoritätsfixierte Charakter, der nach den Analysen der Frankfurter Schule auf der Basis gesellschaftlicher Ohnmacht breiter Massen in der spätkapitalistischen Gesellschaft nach Ende des 1. Weltkrieges zum vorherrschenden Soziali- sationstypus geworden war, verehrt tendenziell alles, was mächtig erscheint, bis hin zum blinden Gehorsam und der Opferung seines eigenen Lebens im Dienste der Macht. Hinter der stählernen Fassade sind die Gefühle jedoch ambivalent. "Alles, was an Feindseligkeit und Aggression vorhanden ist und was dem Stärkeren gegenüber nicht zum Ausdruck kommt, findet sein Objekt im Schwächeren. Muss man den Hass gegen den Stärkeren verdrängen, so kann man doch die Grausamkeit gegen den Schwächeren genießen." (Fromm 1987, S.117)
Der autoritäre Charaktertyp spiegelt in seinem falschen Bewusstsein die reale Fremdbestimmung seines Lebens durch reale Mächte als ein Ausgeliefertsein an mystische oder verhexte Kräfte wider, wie beispielsweise das Weltjudentum, die bedrohlichen Gene behinderter Menschen, das Schicksal Gottes, böse Geister oder ganz einfach Schmutz und unsichtbare Bakterien. Den zwanghaften Reinheitswahn, die Angst vor unsichtbaren Bedrohungen konnten die Nazis für ihre Zwecke erfolg- reich einbinden und immer wieder neue Feindbilder anbieten, mit denen letztlich alles "unwerte Leben" ausgerottet werden sollte. "Der Wert des Menschen als Kern der Bevölkerungspolitik wurde restlos vom kapitalistischen Arbeits- und Verwertungsprozess her bestimmt." (Jantzen 1992, S.68) Jantzen weist daraufhin, dass selbst in Schulbüchern die "Kosten" für behinderte Menschen vorge-rechnet worden sind, um diese als "Schädlinge" des Volkes zur Vernichtung freigeben zu können.
Die Ausrottung behinderter Menschen begann schon 1933 mit dem "Gesetz zur Verhütung erb- kranken Nachwuchses". Nach diesem Gesetz haben die Nazis bis 1945 zwischen 350.000 und 400.000 Menschen zwangssterilisiert. (Den Begriff Nazi verwende ich nicht nur für eingetragene Parteimitglieder, sondern für alle, die an den Verbrechen mitgewirkt haben.) 1939 erließ Adolf Hitler den sogenannten Euthansiebefehl.
"Mit ihm begann die erste systematische Vernichtung von Menschen im Dritten Reich. Verschleiert wurde die Aktion durch den von Hitler in seinem Ermächtigungsschreiben verwendeten Begriff 'Gnadentod'. Als 'lebensunwert' galten nach seiner Definition vor allem missgebildete Kinder und an Geistes- und Erbkrankheiten oder Syphilis leidende Erwachsene." (Arbeitskreis Shoa.de e.V. 2007, s.p.)
Das Vernichtungsprogramm wurde als "Aktion T 4" benannt und bezog sich auf die Organisationszentrale des Massenmordes, die Zentrale der Reichskanzlei in der Berliner Tiergartenstraße 4. Die Auswahl und Erfassung der Opfer, die dann in sechs Tötungsanstalten deportiert worden sind, nahm die "Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten" vor. "Bis 1941 fielen der 'Aktion T4' mindestens 120.000 Menschen durch Vergasung, Erschießung und tödliche Injektionen zum Opfer." (a.a.O.) Nach 1941 bis Kriegsende wurden in den psychiatrischen Anstalten weitere hunderttausend Menschen durch Hunger, überdosierte Medikamente und durch Nichtbehandlung von Krankheiten getötet. (vgl. Hähner 1997, S.25)
Mit der planmäßigen Ermordung der selektierten Menschengruppen kommt das Projekt der Aufklärung zu sich selbst. Die "Dialektik der Aufklärung" haben Horkheimer und Adorno am Ende des 2.Weltkrieges im amerikanischen Exil geschrieben. In jener Phase des "totalen Krieges" und der Massenvernichtung sahen die Autoren die entfesselte Vernunft in Aktion, die sich weder von religiösen Tabus noch von humanistischer Philosophie hat beirren lassen. "Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils." (Horkheimer/Adorno 1981, S.7) Hier schließt sich historisch der Kreis: Während zu Beginn der Aufklärung im antiken Griechenland behinderte Kinder einzeln auf noch primitive Weise ermordet worden waren, geschieht dies im nationalsozialistischen Deutschland mit technischer Perfektion in fabrikartigen Vernichtungslagern. Vollendete Vernunft und mystische Rassenideologie gehen bruchlos ineinander über.
Das Ende der Nazi-Herrschaft führte für die behinderten Menschen keineswegs zur Befreiung. "Die aktive Mittäterschaft der Anstalten an den Euthanasieprogrammen wurde verleugnet, tabuisiert und in einen Mantel des Schweigens gehüllt." (Riedmann 2003, S.12) Das Prinzip des Ausschlusses der behinderten und psychisch kranken Menschen aus der Gesellschaft und ihr Einschluss hinter Mauern blieb bestehen. "Man war sich lediglich sicher, dass diese nun nicht mehr wie bei den Nazis ermordet wurden." (Nathow 1981, s.p.) Sie wurden stattdessen in Anstalten und in "Oligophrenen- abteilungen" psychiatrischer Krankenhäuser verwahrt. "Viele geistig und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche wurden nach dem Krieg mit der Diagnose ‚Pflegefall' in diese Einrichtungen eingewiesen und dort nicht selten an die Gestelle ihrer Betten gefesselt. Behinderung und Anstalts- unterbringung waren Synonyme, andere Formen des Umgangs mit Menschen mit einer Behinderung schienen nicht denkbar." (Hähner 1997, S.26)
Ernst Klee beschreibt das Leben in einer Behindertenanstalt wie folgt:
"Behindertenheime sind wie Gefängnisse. Die Heimleitung regelt die Bedürfnisse genauso rigoros wie die Gefängnisleitung, sie bestimmt, was für den Bewohner gut oder schlecht ist, förderlich oder schädlich. Im Heim sind die Zimmer nur von außen abzuschließen und nicht selten auch von außen einzusehen - bei der Gefängniszelle ist das nicht anders, nur dass hier dicke Riegel und Schlösser einen Fluchtversuch verhindern. Behinderte flüchten nicht. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Das ist der Unterschied: Im Heim geschieht die Entmündigung im Namen der Pflegebedürftigkeit, im Gefängnis wird sie mit der Gefährlichkeit und Sozialschädlichkeit der Eingesperrten legitimiert.
Heimordnungen und Gefängnisordnungen unterscheiden sich graduell. Aber auch im Behindertenheim wird der Tagesablauf von der Heimleitung und nicht von den Bewohnern bestimmt. Aufstehzeiten, Essenszeiten (in der Regel wird zu völlig anormalen Zeiten gegessen), Besuchsregelungen, Schlafenszeiten setzt die Anstaltsleitung fest und wie im Knast ist Sexualität verboten. Das alles geschieht natürlich nur zum Besten der Schützlinge, denn sie müssen geschont werden. Wer Pflege braucht, wird rechtlos. Und obgleich Behinderte, die im Heim leben müssen, sich gegen kein Gesetz vergangen haben, durch kein Gericht verurteilt wurden, werden ihre Rechte auf Entfaltung der Persönlichkeit resolut eingeengt." (Klee 1980, Teil I, Kap.7)
Der Journalist Ernst Klee hat in den 70er Jahren zahlreiche Anstalten besucht, darüber berichtet und damit wesentlich zur Politisierung dieser unmenschlichen Zustände beigetragen:
"Etwa zwei Wochen bevor ich dieses Kapitel schrieb, im Juni 1979, besuchte ich eine 'Heilerziehungs-, Heil- und Pflegeanstalt' für etwa 1300 meist geistig Behinderte. Bei meinem Besuch kam ich in einen Gruppenraum. Da standen neun Betten, dicht gedrängt. Ein Junge lag in einem Bett, das viel zu klein für ihn war. Die jungen Mitarbeiterinnen bedauerten dies, aber ein richtiges, großes Bett passe nicht mehr ins Zimmer. Im Raum stand eine Badewanne, über die man eine Holzplatte gelegt hatte. So war die Badewanne zugleich der Tisch." (Klee 1980, Teil III, Kap. 2)
Wie aus Klees und anderen Berichten hervorgeht, herrschten die post-faschistischen Bedingungen dieser und ähnlicher Art im großen Umfang noch bis tief in die 1980er Jahre. Jantzen konzentrierte sich in den 1990er Jahren in seiner Forschung auf das Evangelische Hospital Lilienthal bei Bremen. In dem von ihm mitverfassten "Lilienthaler Memorandum" konstatieren er und seine Mitautoren 1993: "Mit vollem Recht sprechen mittlerweile Eltern, Betreuer, Mitarbeiter und Fachöffentlichkeit unter Bezug auf W. Wolfensbergers Analyse 'Der neue Genozid an den Benachteiligten, Alten und Behinderten' davon, dass hier das 'Totmachen' von Behinderten bereits begonnen hat." (Jantzen u.a.,1999a) Dieses "Totmachen" erfolgte weder mit Schusswaffen noch mit Giftgas, sondern primär als psycho-soziale Vernichtung durch Depersonalisierung, systematische Entwürdigung und Unterversorgung. Dass Menschen unter solchen Bedingungen inmitten der reichen Bundesrepublik Deutschland leben mussten, prangerte Rainer Nathow auf dem Gesundheitstag 1981 in Hamburg an: "Ihr Elend wurde dem Blick der Öffentlichkeit konsequent entzogen." (Nathow 1981, s.p.) Die Anstalten befanden sich weiterhin außerhalb der Städte. Dabei waren in den Fachkreisen der Soziologie die Lebensumstände in den Anstalten bereits in den 1960/70er Jahren ins Blickfeld geraten.
Der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman hatte Mitte der 1950er Jahre eine qualitative Feldstudie im St. Elizabeths Hospital in Washington D.C. durchgeführt und dabei die Grund-strukturen der "totalen Institution" erforscht:
"Das zentrale Merkmal totaler Institutionen besteht darin, dass die Schranken, die normalerweise diese drei Lebensbereiche (Schlaf, Freizeit, Arbeit, d.A.) voneinander trennen, aufgehoben sind: 1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und dergleichen Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant (...) und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben. 4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen." (Goffman 1973, S.17)
Goffman beschreibt in seinem Buch, wie die Persönlichkeit des Insassen systematisch gebrochen wird, mit dem Ziel, "den Neuankömmling zu einem Objekt zu formen, das in die Verwaltungsmaschinerie der Anstalt eingefüttert und reibungslos durch Routinemaßnahmen gehandhabt werden kann." (ebd., S.27) Unter diesen Umständen kann dann nur noch von einem "Unterleben" in der Anstalt gesprochen werden.
In Deutschland haben Christa und Thomas Fengler eine vergleichbare Studie 1984 unter dem Titel "Alltag in der Anstalt" (Fengler 1984) veröffentlicht. In der untersuchten niedersächsischen Psychiatrie fanden sich im Wesentlichen die Grundstrukturen, die Goffman in Washington entdeckt hatte, wieder. Die Pflegekräfte nahmen in Fenglers Klinik vor allem die Funktion von Wärtern ein. Priorität kamen den Aspekten der Sicherheit, dem Abarbeiten von Schichten und der Einpassung der Insassen in die Ordnung der Institution zu. Vor allem die Pflegekräfte versuchten, sich mit allen Mitteln gegen die pädagogische Förderung der Patienten zu wehren. Reformorientierte Ärzte und Psychologen hatten gegenüber dem Pflegepersonal kaum eine Chance, Veränderungen durchzusetzen. Der Alltag in der Anstalt wird als ein Alltag des Wegsperrens, der Gewalt und der Depersonalisierung beschrieben.
Wie die Psychiatrie-Enquête des Deutschen Bundestages 1975 einräumte, gab es zu jener Zeit noch keine genauen Zahlen über die soziale Gruppe der behinderten Menschen. Die Expertenkommission schätzte in ihrem Bericht, dass rund 360.000 Einwohner geistig behindert waren und etwa ein Zehntel davon, also rd. 36.000, "schwerst- und mehrfachbehindert" seien und "im allgemeinen der stationären Dauerunterbringung" bedürften. (BT-DrS.7/4200, S.14) Dem Bericht zufolge befanden sich rd. 17.500 geistig behinderte Menschen in psychiatrischen Krankenhäusern. Die Sachverständigen-Kommission stellte auch fest, dass 93 der untersuchten Heime und Anstalten jeweils mit über 100 Betten ausgestattet waren. Die Einrichtungen befanden sich häufig in für die Insassen ungünstigen Lagen, die Bausubstanz war veraltet, verschlissen, das Personal schlecht qualifiziert, ambulante Hilfen fehlten gänzlich. Als "erfreulich" wertete die Kommission den "starke(n) Anstieg bei der Errichtung neuer Werkstätten für Behinderte in den letzten Jahren". (a.a.O). Aber selbst dieser Bereich konnte bei weitem nicht den Bedarf decken. Von den damals 61.000 für notwendig erachteten Werkstattplätzen waren 1973 erst 17758 fertig eingerichtet worden.
Schon lange vor der Psychiatrie-Enquête hatte die 1958 von Eltern und Fachleuten in Marburg gegründete "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V." eine "Förderung ohne Heimaufenthalt und Trennung von der Familie" (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2008, S.10) angestrebt. "Hauptaufgabe war die Reform der Behindertenpädagogik sowie die Schaffung von Heilpädagogischen Kindergärten, Tageseinrichtungen und Beschützenden Werkstätten." (ebd., S.11) Die Hauptzielgruppe der "Lebenshilfe" waren anfangs behinderte Kinder, dies deshalb, weil nach dem Genozid im Dritten Reich kaum noch geistig behinderte Erwachsene am Leben waren und es in der 1950er Jahren "praktisch keine schulische Erziehung für behinderte Kinder" (ebd. S.18) gab. Seit 1995 heißt die Organisation "Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V." Zu ihren großen Erfolgen zählt die Einrichtung von 510 privaten Tagesbildungsstätten schon bis Ende der 1960er Jahre. Später baute der Verein ein Netz von Werkstätten und Wohneinrichtungen auf.
Mit ihren Modellprojekten gelang es der "Lebenshilfe", das Verwahr- und Wegsperrprinzip der Nachkriegszeit langsam zu begrenzen. Es rückten allmählich Ansätze zur Förderung geistig behinderter Menschen ins Blickfeld. So wurde bis Ende der 1960er Jahre bundesweit die Schulpflicht auch für geistig behinderte Kinder eingeführt und in den 1970er Jahren die Frühförderung etabliert. Mit dem Schwerbehindertengesetz von 1974 erhielten die Werkstätten für behinderte Menschen erstmals einen sozialrechtlichen Status, gleichwohl sich in den Anstalten kaum etwas verändert hatte.
Der Bericht der Psychiatrie-Enquête 1975 war der wesentliche Anstoß für eine langjährige politische Diskussion über die Wohn- und Lebensbedingungen auch geistig behinderter Menschen. Aus dieser heraus entwickelten sich nach und nach zaghafte Reformansätze. Schließlich hatte die Kommission in ihrem Bericht eine Reihe von "Empfehlungen zur Neuordnung der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter" (BT-DrS.7/4200, S.16) gegeben, u.a.:
Die Versorgung von psychisch kranken Patienten und geistig behinderten Menschen sollte institutionell getrennt, die Behinderten aus den psychiatrischen Abteilungen ausgegliedert werden. Behinderteneinrichtungen sollten eine "beschützende Wohnsituation mit angemessenem Freiheitsraum" (ebd. S.17) bieten, außerdem eine heilpädagogische, sozialtherapeutische und rehabilitative Versorgung. Durch ambulante und komplementäre Angebote sollten die stationären Aufenthalte verringert werden. Die Versorgung sollte im näheren Lebensumfeld der Klienten angeboten werden, damit diese ihr soziales Umfeld aufrechterhalten können.
Die 1970er Jahre waren ohnehin durch den Aufbruch der 68er Bewegung und die Reformpolitik von Willy Brandt geprägt. In jener Zeit versuchte die deutsche Gesellschaft in Ansätzen, sich vom "autoritären Charakter" zu verabschieden und "mehr Demokratie zu wagen" (Willy Brandt). Die Bildungseinrichtungen wurden auch für Angehörige unterer sozialer Schichten durchlässig. Soziale Ungleichheit und obsolet gewordene Autoritätsstrukturen gerieten unter verschärften Legitimationszwang. Im gesellschaftlichen Alltag blühte der Protest von Bürgerinitiativen, Basis- gruppen an den Hochschulen, den Projekten alternativer Wirtschafts- und Lebensmodelle und der weitgehenden Auflösung familiär-patriarchaler Autorität. Gilles Deleuze bezeichnet diese Entwicklung als "Krise der Institutionen" (Deleuze 1990, s.p.). Er bezieht sich auf die Epoche der Postmoderne, in denen die "Einschließungsmilieus" erodierten. "Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus, Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie. Die Familie ist ein 'Heim', es ist in der Krise wie jedes andere Heim, ob schulisch, beruflich oder sonst wie." (a.a.O.) An die Stelle der Einschließungsmilieus traten laut Deleuze äußerlich offenere kontroll- gesellschaftliche Milieus. "In der Krise des Krankenhauses als geschlossenem Milieu konnten zum Beispiel Sektorisierung, Tageskliniken oder häusliche Krankenpflege zunächst neue Freiheiten markieren, wurden dann aber Bestandteil neuer Kontrollmechanismen, die den härtesten Einschließungen in nichts nachstehen." (a.a.O.) Deleuze betont in seinem Essay "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" immer wieder die Ersetzung stationärer Regimes durch ambulante Regimes: Ersatz-Strafen statt Gefängnis, elektronische Halsbänder, die permanente Weiterbildung löst tendenziell die Schule ab. "In der Disziplinargesellschaft hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik), während man in der Kontrollgesellschaft nie mit irgendetwas fertig wird." (a.a.O.) Im ambulant betreuten Wohnen folgt dem Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt der Antrag auf Eingliederungshilfe, nach der Bewilligung des ersten folgt der Zwang zum Antrag auf Verlängerung, zur Mithilfe, zur Prüfung im Gesundheitsamt, der Druck, seine Schulden zu regulieren ist erst der Anfang zur Entschuldung mit vielen Hürden und täglichen Prüfungen, die das soziale Leben dem vereinzelten Menschen auferlegt und dabei seine Flexibilität und Eigenmotivation permanent auf die Probe stellt.
In den postmodernen gesellschaftlichen Kontext passten die gefängnisartig organisierten Behindertenanstalten genauso wenig wie die Fabrikhallen mit Stechuhr, Werkssirene und Fließband. Bekannter Weise wurden letztere nach und nach in sogenannte Billiglohnländer verlagert, während in den postmodernen Metropolen das Design, Marketing, Controlling, die Kommunikation und das Public Relation als neue Leitsektoren wirtschaftlichen Handelns aufgebläht wurden. In diesen Sphären der Arbeit war eine andere Mentalität gefragt als noch in der fordistischen Fabrikgesellschaft. Statt Pünktlichkeit, Sauberkeit und Gehorsam verlangte die obere postfordistische Sphäre der Dienstleistung von ihren Aspiranten in hohem Maße Flexibilität, Eigenmotivation, Kreativität und kommunikative Schaumschlägerei. Zeitgeist- Magazine beschworen in den 1980er Jahren das Lifestyle des neuen Sozialcharakters: Der Young Urban Professional, der auf seinem Laptop im Intercity seine Werbeskizzen entwirft, bis tief in der Nacht kreativ bleibt, Motivations-Workshops besucht, sich permanent coachen lässt. In diesem neuen Getriebe gab es keinen Anfang und kein Ende.
Die antiautoritäre Revolte, zu der zumindest in Norditalien auch die Auflösung der Anstalten gehört hatte, war alles andere als revolutionär, sondern nur der Wegbereiter für den neuen, adäquaten Lebensstil des postfordistischen Kapitalismus. "Oft allerdings ist das Lebensgefühl revolutionär, doch die Verhältnisse sind es keineswegs. Damals, Ende der 60er Jahre, waren sie nicht nur ausbruchssicher, dicht wie Manhattan Island in Carpenters Riesengefängnisfilm, sondern sie glichen abhärtendem Beton", konstatiert Wolfgang Pohrt: (1997, S.18) "Eine solche Konstellation entsteht, wenn die Realität sich schneller geändert hat als das Bewusstsein der Menschen. Die Leute kämpfen dann, getrieben von zwiespältigen Gefühlen, gegen die eigenen, lästig gewordenen Denk- und Lebensformen an, während sie eine Welt aus den Angeln zu heben meinen." (a.a.O.)
Zu den neuen Denk- und Lebensformen zählten Toleranz, Weltoffenheit, Pluralität, Spontaneität, Postkonventionalität und das independent Styling. Das produktive Ambiente der alternativen Wegbereiter ebenso wie das der "kreativen" Ökonomie musste mit etwas Elend ausgeschmückt sein. Ein paar Dealer und Junkies im Hamburger Schanzenviertel gepaart mit "Roter Flora" und gelegentlicher Randale wirkten wie Magneten auf die Werbe- und Medienbranche in den 1990er Jahren. Gegenüber dem örtlichen Apple-Laden liegt das Atelier der "Schlumper", wo geistig behinderte Künstler arbeiten. So bereichern die Außenseiter ihr neues Umfeld, sorgen für Vielfalt und garantieren ein gewisses Multikulti-Feeling, in dem die Angehörigen der "kreativen" Ökonomie sich selber ihre Toleranz und Offenheit beweisen können. Das ist die Produktivkraft geistig behinderter und psychisch kranker Menschen im Postfordismus. Hinter den Mauern der Anstalten läge sie brach. Die ambulante Betreuung findet außerhalb der Anstalten statt. Die Pädagogen arbeiten nicht mehr nach dem Kommando der Anstaltsregeln, sondern flexibel und kreativ nach ihrem eigenen Rhythmus und selbstverantwortlich an den Zielen der dezentral ausgehandelten Hilfepläne. Ambulante Betreuung ist postfordistische Sozialpädagogik, sie passt zur Struktur der kreativen Ökonomie. Sie beinhaltet Freiheit und Kontrolle zugleich, während die fremdbestimmte Disziplin in den Hintergrund tritt.
Horkheimer und Adorno haben die humane Seite der Aufklärung keineswegs unterschlagen: "Wir hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere petitio principii -, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist." (Horkheimer/Adorno 1981, S.3). Etwas menschlicher geworden sind die Lebensbedingungen für die meisten geistig behinderten Menschen in der Zeit nach der Psychiatrie-Enquête schon, aber dennoch ist die stationäre Unterbringung keineswegs verschwunden, sondern hat in ihrer Quantität gewaltig zugenommen (s. Kap. 2.2.3). In den 1980er Jahren wurden "offene Hilfen" errichtet. "Dahinter verbergen sich alle die mobil-ambulanten Angebote und Hilfen, die von Menschen mit Behinderung oder Familien mit einem behinderten Familienmitglied in Anspruch genommen werden können." (Hähner 1997, S.32) 1994 gab es aber erst rund 300 solcher Dienste im gesamten Bundesgebiet. Die Entwicklung zur Öffnung der "totalen Institutionen" verlief insgesamt äußerst gemächlich. 1981 konstatierte Rainer Nathow noch: "Nach wie vor werden die Schwächsten dieser Gesellschaft in staatlichen, kirchlichen und privaten Anstalten und Heimen untergebracht und somit vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen." (Nathow 1981, s.p.). Geistig behinderte Insassen der Psychiatrien seien zwar dort entlassen worden, aber zugleich in neue Heime und Anstalten überführt worden.
Die Ausgliederung der sogenannten Fehlplazierten aus den Kliniken empörte in den 1990er Jahren die kritische Fachöffentlichkeit:
"Tatsache ist, dass vielerorts nur eine Umhospitalisierung stattfand (und heute noch stattfindet), indem mit Blick auf die traditionelle Behindertenversorgung in der BRD neue Heime und pflegeorientierte Langzeiteinrichtungen als Ort zum Leben für bislang psychiatrisch oder fehlplaziert untergebrachte behinderte Menschen geschaffen wurden (und werden). Das aber ist ein Etikettenschwindel!" (Theunissen 1998, S.9)
Im Rheinland beispielsweise wurden Anfang der 1980er Jahre auf den Geländen der Landeskrankenhäuser selbständige Behindertenbereiche geschaffen. "Der Durchbruch zu einer realen Alternative in der Betreuung geistig Behinderter gelang jedoch nicht. (...) Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 1987 in Bonn ein neu gebautes Wohnheim für geistig Behinderte mit 120 Plätzen bezogen werden soll, so wird deutlich, dass man noch 1987 das Gegenteil einer in normale Lebensbedingungen integrierten Betreuung beabsichtigt." (Niehoff/Pickel 1987, S.78) In Hessen wurden "Heilpädagogische Einrichtungen" (HPE) geschaffen, denen weiterhin "der allumfassende Versorgungsgedanke" (Günther 1995, S.190) anhaftete. "Sie (die HPE, d.Verf.) sorgt für regionale Wohn-, Beschäftigungs- und Freizeitangebote, als ob es außerhalb der Anstaltsmauern keine Infrastruktur gäbe, die von den Betreuten unmittelbar genutzt werden kann! Hier befinden wir uns an einem Knackpunkt der Entwicklungen. Solange nämlich sämtliche Aufgaben innerhalb der Betreuungssituation geregelt werden, tut sich in der Gemeinde/ dem Kreis und bei den freien Trägern nur so viel, wie der LWV (Landeswohlfahrtsverband, d.Verf.) finanziert. Die gewünschte Kommunalisierung kann so nicht erreicht werden." (ebd., S.190f.)
Gleichwohl wurden viele Anstalten humaner. Es entstanden dezentrale Untergliederungen, Wohngruppen innerhalb der Einrichtung und immer wieder konnten Insassen das Anstaltsgelände verlassen und in Außenwohngruppen umziehen. Die großen Schlafsäle und Wachsäle wichen kleineren und etwas privateren Zimmern, das autoritäre Regime geriet zumindest zunehmend in Misskredit und wich zur Jahrtausendwende hin allmählich der neoliberalen "Kundenorientierung". Ohnehin waren die größten Fortschritte im Bereich der sprachlichen Reformen zu verzeichnen: Statt Betreuung kam der Begriff "Assistenz" in Mode, der Klient wurde mal "Kunde", mal "Nutzer" genannt und der geistig behinderte Mensch als "Mensch mit Behinderung" interpretiert. (s. Kap. 1.5) Ob die sprachliche Kreativität im realen Leben der betroffenen Menschen viel verändert hat, wäre ein spannendes Thema für eine andere Forschung.
Eine echte Alternative zur Heimunterbringung ist in Deutschland erst 1992, 17 Jahre nach der Psychiatrie-Enquête, geschaffen worden. Die Stadt Hamburg hat damals als bundesweit erster Sozialhilfeträger das Modell der "Pädagogischen Betreuung im eigenen Wohnraum" (PBW) eingeführt. Es ist dem Grunde nach identisch mit dem, was in Schleswig-Holstein "Ambulant betreutes Wohnen" (AWG) genannt wird und in anderen Bundesländern wieder andere Namen trägt. Adressaten dieser neuen Hilfeform waren nicht nur Klienten, die vormals stationär betreut worden waren, sondern auch diejenigen, die bereits eine eigene Wohnung bewohnten, um sie in ihrer Lebensführung zu stabilisieren und möglichen Heimaufenthalten vorzubeugen. "Schließlich umfasste der 'eigene Wohnraum' auch Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die noch in ihrer Familie lebten. 'PBW sollte hier entweder den Ablösungsprozess aus dem Elternhaus unterstützen oder aber die 'Situation der Familie, in der ein Behinderter / eine Behinderte lebt, qualifiziert stabilisieren' <Fachliche Weisung der BAGS, Hamburg SR 24/86 10.2.1>." (Weber J. 2002, S.64)
Wie ich in Kapitel 2.2.3 weiter ausführen werde, ist die Anzahl der geistig behinderten Klienten, die ambulant betreut werden, in den vergangenen Jahren stark gestiegen, gleichzeitig aber auch die der Insassen in den stationäre Einrichtungen. Revolte, Psychiatrie-Enquête, Postfordismus/Postmoderne und die von Deleuze konstatierte "Krise der Institutionen" haben zwar zu einer gewissen Auflösung der "totalen Institution" geführt, neue integrationsfördernde, klientenorientierte und ambulante Wohn- und Betreuungsformen ermöglicht, aber dennoch wurde der Ausschluss aus der Gesellschaft und der Einschluss in Sondereinrichtungen aufrecht erhalten, wenn nicht sogar verstärkt. Wie im Allgemeinen, so sind auch im Besonderen die Lebensbedingungen und Lebensstile der behinderten Menschen in der Epoche der Postmodernen pluralisiert worden. Verschiedene Stufen und Formen des Ausschlusses und der Eingliederungen stehen nebeneinander.
Den soziahilferechtlichen Grundsatz "ambulant vor stationär" hat der Gesetzgeber 1984 ins damalige Bundessozialhilfegesetz (BSHG) aufgenommen: "Die erforderliche Hilfe ist soweit wie möglich außerhalb von Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen zu gewähren" (§ 3a BSHG). Diesen Grundsatz hat der Gesetzgeber dann mit seiner Reform des Sozialhilferechts in das seit 2005 gültige SGB XII übernommen. In § 13 AbS.1 SGB XII lautet die entsprechende Bestimmung: "Vorrang haben ambulante Leitungen vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen." Dieser Primat der ambulanten Leistungen wurde allerdings bereits 1996 durch einen Mehrkostenvorbehalt eingeschränkt. "Der Vorrang der ambulanten Leistungen gilt nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist." (§13, Abs.1 SGB XII)
Mit dieser Einschränkung werden die unbestimmten Rechtsbegriffe der Unverhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit und Eignung eingeführt, an die die Umsetzung der Bestimmung geknüpft ist. Sie räumen den Sozialhilfeträgern ein Verwaltungsermessen ein. Sollte im Einzelfall eine ambulante Hilfe mit "unverhältnismäßigen Mehrkosten" verbunden sein, so kann der Sozialhilfeträger diese aber erst dann ablehnen, wenn eine mögliche stationäre Hilfe für den Antragsteller auch geeignet und zumutbar ist. Was dies bedeutet, geht aus § 13 im SGB XII nicht weiter hervor.
Als hilfreich zur näheren Bestimmung des sozialhilferechtlichen Ambulantisierungsauftrages erweist sich das in 2001 verabschiedete und in Kraft getretene SGB IX. Sein Ziel ist nach Angaben der damaligen Bundesregierung, "die vollständige Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft zu verwirklichen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn behinderte Menschen dabei unterstützt werden, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten, und wenn Hindernisse, die ihren Teilhabechancen im Wege stehen, beseitigt werden." (BT-DrS.15/4575, S.2)
So werden in §19 Abs.2 SGB XII nicht der Kostenvergleich, sondern Wirksamkeit und persönliche Umstände als Kriterien für die Entscheidung zwischen stationären und ambulanten Hilfen genannt: "Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit erreichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form und gegebenenfalls unter Einbeziehung familienentlastender und - unterstützender Dienste erbracht." Nach §4 SGB IX werden "Leistungen zur Teilhabe" gewährleistet, die eine "möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung" ermöglichen. "Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre Selbstbestimmung" (§ 9 AbS.3 SGB IX).
Mit den Strukturen einer "totalen Institution" (s. Kap. 2.1.3) sind diese Zielsetzungen unvereinbar. Sie bedeuten vielmehr die Stärkung des Individuums gegenüber dem Regelwerk der betreuenden Institution: mehr Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, soviel Selbstbestimmung und Selbständigkeit wie möglich. Wird dies mit den "Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nicht- behinderten Menschen" (§ 58 Ziff.1 SGB XII) in Verbindung gesetzt, so wird deutlich, dass die Zielsetzungen des SGB IX mit den Strukturen des klassischen Behindertenheims oder -anstalt nicht verwirklicht werden können. Der Vorrang "ambulant vor stationär" wird mit dem Anspruch auf Selbst- bestimmung bekräftigt. Unter dieser Prämisse erscheinen die Voraussetzungen für die Anwendung des Mehrkostenvorbehalts als relativ hoch: Denn es reicht nicht aus, dass eventuell eine ambulante Hilfe zu teuer ist, zusätzlich muss nämlich die stationäre Hilfe auf Grundlage des Selbst- bestimmungsanspruchs auch zumutbar und geeignet sein. Dies geht meines Erachtens nur, wenn die stationäre Einrichtung bereits weitgehend ambulante Merkmale nachweisen kann.
So stellt sich jetzt die Frage, was genauer eine ambulante im Unterschied zu einer stationären Einrichtung ist. Etymologisch betrachtet, stammt der Begriff "ambulare" aus dem Latein und bedeutet spazieren gehen, promenieren, umhergehen. Der Begriff "Station" leitet sich aus dem lateinischen Wort statio ab und hat zum Inhalt: Stellung, Posten, Standort, Wache. Beide Begriffe stellen nicht zwingend einen Gegensatz dar, denn auch innerhalb einer (Polizei-) Wache oder einer Heeres- stellung kann das Personal umherlaufen. Der Krankenhausarzt geht bei seiner Visite von Zimmer zu Zimmer, obwohl er seine Patienten stationär behandelt.
Die WHO hat den englischen Begriff "Ambulatory care" wie folgt definiert: "All types of health services provided to patients who are not confined to an institutional bed as inpatients during the time services are rendered." (WHO 2008, s.p.) Danach ist eine ambulante Versorgung jene, bei der der Hilfeempfänger nicht an ein Bett der Einrichtung gebunden ist. Im übertragenen Sinne bedeutet dies, wenn der Patient nicht an einen institutionellen Aufenthaltsort gebunden ist.
Im Sozialhilfegesetz definiert der Gesetzgeber den Begriff der stationären Einrichtung kurz und knapp: "Stationäre Einrichtungen sind Einrichtungen, in denen Leistungsberechtigte leben und die erforderlichen Hilfen erhalten" (§13 Abs.1 SGB XII). Unter dem Kriterium, in der Einrichtung zu leben, ist nach dem Kommentar von Krahmer im Rechtskontext zu verstehen, dass die Leistungsbe-rechtigten ihren "Lebensmittelpunkt" in der Einrichtung haben (Vgl. Krahmer 2005, S.131, Rz 4). Der Hilfebegriff umfasst nach dem SGB XII die "Hilfen zum Lebensunterhalt" (3. Kapitel), "Hilfen zur Gesundheit" (5. Kapitel), "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" (6. Kapitel), "Hilfe zur Pflege" (7. Kapitel), "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" (8. Kapitel) sowie "Hilfen in anderen Lebenslagen" (9. Kapitel). Das Heimgesetz zählt auch die hauswirtschaftliche Versorgung, Pflegeleistungen, Versorgung mit notwendigen Medikamenten und Schutz vor Infektionen zu den Hilfebereichen eines Heims (vgl. §11 Abs.1 HeimG). Stationäre Einrichtungen sind im Sinne der beiden Gesetze folglich solche Einrichtungen, in denen sich der Lebensmittelpunkt der Bewohner befindet, in denen sie mit Wohnraum, Essen, Pflege, Medikamenten, pädagogischer Förderung und Haushaltshilfe rundum versorgt werden, in denen sämtliche Dienst- und Sachleistungen aus einer Hand erfolgen.
Was in Abgrenzung dazu aber der Begriff "ambulant" bedeutet, lässt der Gesetzgeber offen. Aus der Definition des Begriffs "stationär" lässt sich jedoch folgendes Grundmerkmal für den Begriff "ambulant" ableiten: Einrichtungen gelten als ambulant, wenn die Leistungsberechtigten darin nur einen Teil ihrer erforderlichen Hilfen erhalten bzw. wenn der Ort der Hilfeerbringung nicht identisch ist mit dem Lebensmittelpunkt der Berechtigten. Das Heimgesetz grenzt beide Einrichtungstypen ganz ähnlich ab. Als Heim gelten danach Einrichtungen, "wenn die Mieter vertraglich verpflichtet werden, Verpflegungen und weitergehende Betreuungsleistungen von bestimmten Anbietern anzunehmen" (§1 Abs.2 HeimG).
Nach dem Kommentar zum SGB XII von Krahmer, der sich im Wesentlichen auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BverwG, 24.Feb.1994, 5 C 24.92) bezieht, kommt es bei der Bestimmung einer vollstationären Einrichtung "auf eine Vollunterbringung mit Betreuung tagsüber und nachts an" (Krahmer 2005, S.132 Rz 4). Auch die Einzelwohnung mit "mobiler Betreuung" gehört dazu, wenn sie der "Rechts- und Organisationssphäre des Trägers so zugeordnet ist, dass man sie als 'Teil eines Einrichtungsganzen' ansehen muss." (a.a.O.) Dies insbesondere, "wenn der Träger von der Aufnahme bis zur Entlassung im Rahmen des fachlich begründeten Hilfekonzeptes auch die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung des Hilfeempfängers übernimmt." (a.a.O.) Als ein weiteres Merkmal nennt Krahmer das Vorhandensein von Gemeinschaftseinrichtungen.
Der Übersicht halber fasse ich zunächst die bisher genannten Merkmale einer stationären Einrichtung in Stichpunkten zusammen:
-
Die Einrichtung ist Lebensmittelpunkt des Klienten.
-
Der Klient erhält dort alle Hilfen aus einer Hand.
-
Er wird dort unter vertraglicher Einheit mit Wohnraum, Verpflegung sowie Pflege u.a. Service versorgt.
-
Vollunterbringung mit Tag- und Nachtbetreuung
-
Der Wohnraum des Klienten gehört in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und ist Teil eines Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernimmt von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
-
Existenz von Gemeinschaftseinrichtungen
Insofern diese Merkmale eine Einrichtung als stationär auszeichnen, sind es zugleich Merkmale, die einer ambulanten Einrichtung widersprechen. Liegen dennoch ein, zwei oder gar mehrere dieser stationären Merkmale vor, so bedeutet dies für mich, dass jene ambulante Einrichtung mit einem entsprechend großen stationären Charakter behaftet ist. Im Einzelfall gilt es, differenziert abzuwägen, ob der ambulante Status noch gerechtfertigt ist.
An dieser Stelle meiner Ableitung kann ich festhalten, dass der Gesetzgeber mit dem Begriff der "stationären Einrichtung" sinngemäß eine allumfassende Institution meint. Unter ambulanter Hilfe versteht er hingegen einen Modus der Hilfeerbringung, der die Geschlossenheit der helfenden Institution öffnet, in dem Lebensbereiche institutionelle Abgrenzungen erfahren und es ein lebenspraktisches Innerhalb und Außerhalb der Einrichtung gibt: Einige Hilfen werden von der Einrichtung direkt erbracht, andere erhalten die Bewohner beispielsweise von einem Pflegedienst, von "Essen auf Rädern" oder als direkte Geldleistungen vom Sozialamt. Ambulantisierung, verstanden als ein Prozess des Abbaus institutioneller Omnipräsenz, bedeutet somit eine Dezentralisierung des sozialen Hilfesystems unter der Prämisse der Förderung individueller Selbständigkeit und Selbstbestimmung.
Um eine für die Operationalisierung notwendige weitere Begriffsbestimmung hat sich die "Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe" (BAGüS) bemüht. Deren Ausführungen sind deswegen von besonderem Interesse, weil es sich um den Zusammenschluss der zuständigen Behörden handelt, die die gesetzlichen Bestimmungen umsetzen müssen. In ihrer Broschüre "Wohnformen und Teilhabeleistungen für behinderte Menschen" (BAGüS 2006a) steht im Mittelpunkt ihrer Definition das Merkmal der "Rund-um-Versorgung": "Ambulant betreutes Wohnen unterscheidet sich von der stationären Versorgung dadurch, dass nun nicht mehr die 'Rund-um-Versorgung' durch einen Träger im Vordergrund steht, sondern - vereinfacht dargestellt - das Wohnen mit den notwendigen individuellen Hilfen" (ebd., S.13). Die überörtlichen Sozialhilfeträger halten sich an dieser Stelle vorsichtig zurück, indem sie die Rund-um-Versorgung nicht ausschließen, sondern nur relativieren. Sie bleibt danach weiterhin möglich, tritt aus ihrem Vorder- grund zurück und lässt dem Individualisierungsprinzip Vorrang. Mit dieser offenen Bestimmung intendiert die BAGüS einen Entwicklungsprozess, der weg von der allumfassenden Präsenz der Institution hin zu mehr Individualität und Autonomie führen soll. Ein gewisser Heimcharakter kann trotz Ambulantisierung erhalten bleiben - er wird aber flüssiger: "Hinsichtlich der Auswahl der jeweiligen Wohnform sowie auch im Hinblick auf die Auswahl der jeweiligen Mitbewohner bestehen (im Rahmen der rechtlichen Vorgaben) verbesserte Wahl- und Kontrollmöglichkeiten für den Einzelnen" (ebd., S.14). Die Wahl- und Kontrollmöglichkeiten sind also nur besser, aber längst nicht so vollständig wie bei einem nichtbehinderten Mieter. Die Institution kann im Hintergrund bestehen bleiben. Sie verliert aber ihre Allmacht. So muss der Mietvertrag über den Wohnraum unabhängig vom Bezug der Betreuungs- und Unterstützungsleistungen bestehen. Klienten, die den päda- gogischen Leistungsanbieter wechseln wollen, sollen "nicht gleichzeitig auch noch ihre Wohnung wechseln müssen - und umgekehrt" (ebd., S.14). Die Kombination von Miet- und Betreuungsvertrag darf aber faktisch erhalten bleiben.
Zwischen stationär und ambulant sind nach den Ausführungen der BAGüS die Grenzen fließend: "Ambulantisierung kann in der Praxis bedeuten, dass eine bisherige stationär versorgte Wohngruppe in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft 'umgewandelt' wird" (ebd., S.13), heißt es in der Broschüre weiter. Nach den Ausführungen von Krahmer ebenso wie nach einer Definition des Bundesverwaltungsgerichts muss bei dieser Form der Ambulantisierung darauf geachtet werden, dass sich die Wohnung dann nicht mehr in der "Rechts- und Organisationssphäre des Einrichtungsträgers" befindet. (BverwG, Urteil v. 24.Feb.1994, 5 C 24.92) Was unter einer Umwandlung zu verstehen ist, definiert die BAGüS nicht. Ein bloßer Etikettentausch innerhalb einer "totalen Institution" kann allerdings nicht gemeint sein, sofern man den folgenden Abschnitt berücksichtigt. Dort wird ambulant als Merkmal interner Alltagsstrukturen definiert: "Institutionell vorgegebene feste Strukturen (z.B. gemeinschaftliche Essenseinnahme, feste Essenszeiten, Tage der offenen Tür) entfallen" (a.a.O.).
Aber auch die stationären Einrichtungen sollen im pädagogischen Sinne ambulantisiert werden, fordert die BAGüS, indem sie die Aufgaben der Wohnheime wie folgt ausführt: "Nicht der Bewohner muss sich der Struktur der Institution anpassen, sondern die Einrichtung; das Wohnheim muss das individuelle Betreuungsangebot an den Bedürfnissen des Betreuten ausrichten" (ebd., S.27). Zwar soll im Wohnheim weiterhin die Gesamtversorgung angeboten werden, explizit die Bereiche Förderung, Betreuung und Pflege, dennoch halten die überörtlichen Sozialhilfeträger den "sog. Hotelservice" für eine "Überversorgung" und für veraltet:
"Der betreute behinderte Mensch erhält durch einen solchen umfassenden Service nicht die Möglichkeit, die alltägliche Lebensführung und -versorgung zu lernen oder er verlernt diese Fähigkeiten und bleibt dadurch abhängig von einer Vollversorgung. Dies entspricht nicht den Zielen der Eingliederungshilfe und schränkt das Selbstbestimmungsrecht massiv ein" (ebd., S.27).
An dieser Stelle erscheint eine Differenzierung zwischen "Rund-um-Versorgung" und "sog. Hotelservice"notwendig zu werden. Beide Begriffe erwecken ähnliche Assoziationen und könnten unmittelbar als Synonyme verstanden werden. Wäre dies der Fall, so würde eine Abgrenzung zwischen Heim und ambulanter Hilfe ihren Sinn verlieren. Einerseits konstatiert die BAGüS, dass die Rund-um-Versorgung in der ambulanten Hilfe in den Hintergrund tritt, während sie im Heim erhalten bleibt - andererseits verlangt sie, dass auch innerhalb des Heims auf den "sog. Hotelservice" verzichtet wird. Zwischen beiden Service-Typen scheint es also einen Unterschied zu geben: Die Rund-um-Versorgung grenzt die BAGüS als Gegensatz von den individuellen Hilfen ab. Folglich gewinnt dieser Begriff die Bedeutung einer personenunspezifischen, gesamtgruppenbezogenen Versorgung in allen Bereichen der Bedürfnisse, unabhängig davon, ob der einzelne Bewohner dieses komplette Versorgungsprogramm nötig hat oder nicht. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass die Institution zentral für alle Bewohner die Lebensmittel einkauft oder zu einem festen Tag im Monat einen Friseur ins Heim bestellt, obwohl einige Bewohner selber in der Lage sind, ihre Lebensmittel zu besorgen oder andere selbständig den Friseur in seinem Salon aufsuchen können.
Unter dem "sog. Hotelservice", der sich davon unterscheidet, muss hingegen eine Form und ein Ausmaß an Fürsorge verstanden werden, bei dem der Bewohner wie in einem Hotel lebt, d.h., das Personal übernimmt (fast) sämtliche Aufgaben, die im Haushalt anfallen. Die Bewohner erhalten erst gar keine Möglichkeit, sich selbständig beispielsweise Kaffee zu kochen, den Tisch zu decken, Geschirr zu spülen, ihre Bettwäsche zu wechseln usw.. Sie werden stattdessen in weitgehender Passivität gehalten. So verstanden, bedeutet der "sog. Hotelservice" eine ergänzende Steigerung der Rund-um-Versorgung. Während also im Heim der "sog. Hotelservice" verschwinden soll und die Rund-um-Versorgung bestehen bleiben darf, muss letzterer in der ambulanten Hilfe zumindest deutlich abgebaut werden.
Nach dem gegenwärtigen Verständnis der BAGüS ist das Wohnheim längst keine "totale Institution" mehr, sondern eine Fördereinrichtung mit offenem Ausgang. Die Ambulantisierung als pädagogischer und konzeptioneller Prozess wird als Qualitätsmerkmal eines Wohnheims den Anbietern abverlangt: "Obwohl Plätze in Wohnheimen in der Regel als Dauerwohnplätze konzipiert wurden, ist die Betreuung und Förderung behinderter Menschen der Aufgabe der Eingliederungshilfe entsprechend darauf auszurichten, dass diese in die Lage versetzt werden, in eine offene Wohnform zu wechseln" (ebd., S.28).
Das aus § 13 SGB XII von mir abgeleitete Dezentralisierungsmerkmal ambulanter Einrichtungen überträgt die BAGüS ansatzweise auch auf das Wohnheim. Sie erwartet eine Untergliederung des Heims in einzelne Wohngruppen mit eigenen Küchen, Wohnzimmern, Eingangstüren, Klingeln und Namensschildern an den Briefkästen. "Jede Wohngruppe sollte über Einzel- und Doppelzimmer verfügen" (a.a.O.). Mit diesen Gestaltungsmerkmalen entstehen Grenzen zwischen Innen- und Außenbereichen bereits innerhalb des Wohnheims. Die Wohngruppe kann eine kollektive Privatsphäre in Abgrenzung zur Gesamtheit der Institution herausbilden, jeder einzelne verfügt über ein eigenes Zimmer bzw. gemeinsam mit einem Partner. Durch die Klingeln und die Namensschilder wird das Individuum deutlicher sichtbar, es tritt aus der amorphen Masse der Bewohnerschaft als eine eigenständige Person hervor. Der Sozialraum der Institution wird durch die genannten Merkmale untergliedert und dezentralisiert. Eine solche Entwicklung markiert den Abschied von der "totalen Institution". Heime dieser Art unterscheiden sich bereits deutlich von den dargestellten Beispielen der klassischen Heime. Ich nenne sie somit "reformierte Heime".
Gehörte zum klassischen Wohnheim oder der Anstalt einst die abgeschottete Lage, die Ghettoisierung der Insassen weit ab von der Öffentlichkeit, so lassen sich auch die Ansprüche der BAGüS an die Lageder heutigen Heime als ambulant charakterisieren, im Sinne der sozialen Integration: Wohnheime sollten "grundsätzlich" in einer Umgebung errichtet werden, in der es Läden, Ärzte, Freizeitangebote und eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gibt. "Die Größe der Wohnheime oder von Teileinrichtungen ist so zu bemessen, dass sie den Anforderungen der Integration in die Gemeinschaft entsprechen, also nicht zu einer Ghettobildung führen, gleichwohl wirtschaftlich betrieben werden können" (ebd., S.29). Als Größe wird eine Bewohnerzahl zwischen 24 und 40 vorgeschlagen. Zum Vergleich: Der "Bundesverband Lebenshilfe e.V." beurteilt "Einrichtungen mit mehr als 24 Plätzen als zu groß" (Hoffmann 1998, S.115) Die einzelnen Wohngruppen sollten nach Ansicht der BAGüS nicht mehr als 12 Plätze umfassen und "so gestaltet werden, dass sie dem Wohnen außerhalb von Einrichtungen so weit wie möglich entsprechen" (BAGüS 2006, S. 29.).
Mit diesen umfangreichen Bestimmungen der BAGüS zu stationären und ambulanten Einrichtungen erscheint eine genaue Abgrenzung schwierig zu werden, da viele Merkmale einer ambulanten Wohn- und Betreuungsform auch für stationäre Einrichtungen gelten sollen. Umgekehrt dürfen auch durchaus stationäre Merkmale in ambulante Einrichtungen übernommen werden. Für beide Formen gilt gemeinsam die Tendenz zu mehr Autonomie der Bewohner, mehr Privatsphäre, Individualität, Dezentralität des Lebensumfeldes, Eingliederung ins soziale Umfeld und weniger Service, stattdessen mehr Förderung zur Selbständigkeit. Von daher interpretiere ich die Ausführungen der überörtlichen Sozialhilfeträger zur Gestaltung des gesamten Wohnbereichs in der Behindertenhilfe als einen übergeordneten Ambulantisierungsauftrag an die Träger. Das Ambulantisierungsparadigma gilt sowohl für stationäre als auch für die ambulante Behindertenhilfe. Deutlich davon ausgenommen werden allerdings die Pflegeheime im Sinne des §71 AbS.2 SGB XI. In Heimen dieser Art steht die Pflege im Vordergrund (vgl. ebd., S.28).
Im Spannungsfeld zwischen stationär und ambulant können nun drei Kategorien von Einrichtungen unterschieden werden:
Die "stationäre Einrichtung des alten Typs":
Sie zeichnet sich aus durch eine
-
formelle und faktische Kopplung zwischen Miet- und Betreuungsleistung//Versorgung.
-
Alle Hilfen werden unter einem Dach, unter dem auch der Klient seinen Lebensmittelpunkt hat, erbracht.
-
Primat der Rund-um-Versorgung und Hotelservice
-
Dauerhafter oder gar lebenslänglicher Verbleib der Bewohner
-
Unterordnung der Bewohner unter das Regelwerk der Institution
-
Größe und örtliche Lage begünstigen eine Ghettoisierung der Bewohner.
-
Mangelnde Infrastruktur im Wohnumfeld
-
Der Lebensalltag ist auf die Gesamtheit der Einrichtung bezogen, es fehlen kleinere Substrukturen, die Abgrenzung ermöglichen.
-
Nachrangigkeit der Förderung von Selbstbestimmung und Selbständigkeit
-
Vollunterbringung mit Tag- und Nachtbetreuung
-
Wohnraum des Klienten gehört in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und ist Teil eines Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernimmt von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
-
Existenz von Gemeinschaftseinrichtungen
Das "reformierte Heim" weist folgende Merkmale auf:
-
Formelle und faktische Kopplung zwischen Miet- und Betreuungsleistung / Versorgung
-
Alle Hilfen werden unter einem Dach, unter dem auch der Klient seinen Lebensmittelpunkt hat, erbracht.
-
Bedarfsgerechte u. individuelle Hilfen statt Hotelservice
-
Rund-um-Versorgung bleibt im Vordergrund
-
Bewohnerorientierte Lebenspraxis
-
Grundorientierung auf Förderung und Auszug /Eingliederung
-
Dezentralisierung des Lebensumfeldes
-
Unterteilung in weitgehend autonome Wohngruppen
-
Stärkung der Privatsphäre (Türen, Klingel, Namensschilder)
-
Teilhabe am sozialen Leben / Verbindung zur Nachbarschaft
-
Größtmögliche Selbstbestimmung der Bewohner
-
Größe des Heims bis 40 Bewohner / Lebenshilfe: 24 Plätze
-
Gute Infrastruktur im Wohnumfeld (Läden, Ärzte, Kneipen, Bus/Bahn)
-
Pflege darf keinen dominierenden Stellenwert einnehmen.
-
Wohnraum des Klienten gehört in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und ist Teil eines Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernimmt von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
-
Existenz von Gemeinschaftseinrichtungen
-
Vollunterbringung mit Tag- und Nachtbetreuung
Die ambulante Betreuung wird durch folgende Merkmale charakterisiert:
-
Unabhängigkeit zwischen Mietvertrag und Betreuungsleistungen/Versorgung
-
Wohnraum des Klienten gehört nicht in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und ist nicht Teil eines Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernimmt nicht von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
-
Keine Gemeinschaftseinrichtungen
-
Keine Vollunterbringung mit Tag- und Nachtbetreuung
-
Nicht alle Hilfen erfolgen aus einer Hand oder unter einem Dach, unter dem auch der Klient wohnt.
-
Die Wohnformen können sein: alleine, paarweise oder in einer Wohngemeinschaft.
-
Der Klient kann nach Ansicht der BAGüS auch unter dem Dach der Institution wohnen, dort aber in einer abgetrennten Einheit.
-
Abbau der Rund-um-Versorgung
-
Individuell ausgerichtete Hilfen
-
Keine institutionell vorgegebenen festen Strukturen
-
Größere Mitbestimmung bei der Wahl von Wohnform und Mitbewohnern.
-
Förderung der autonomen Lebenspraxis
-
Soziale Teilhabe / Förderung der Integration
-
Die Anforderungen bezüglich Lage und Größe, die an das reformierte Heim gestellt werden, sollen nach meinem Verständnis nicht unterschritten werden.
-
Pflege darf keinen dominierenden Stellenwert einnehmen.
In rechtlicher Hinsicht unterscheidet das ambulante Betreuungsverhältnis sich im Wesentlichen darin von einem reformierten Heim, dass der Wohnraum der Klienten sowohl vertraglich formal als auch rechtlich und organisatorisch vom Zuständigkeitsbereich der betreuenden Einrichtung getrennt ist. Die von der BAGüS vorgeschlagene Umwandlung ehemals stationär betreuter Wohngruppen in ambulant betreute Wohngemeinschaften erscheint deshalb als problematisch, weil auch nach einer Umwandlung in ein Mietverhältnis, der betreffende Wohnraum als Eigentum weiterhin in der Rechts- und Organisationssphäre des Trägers verbleibt. Hier müsste schon der Wohnraum verkauft werden und von den Bewohnern selbst oder einem Dritten verwaltet werden, damit den rechtlichen Anforderungen entsprochen werden kann.
Vor allem die Umwandlungsvariante der Ambulantisierung führt zur Unschärfe in der begrifflichen Abgrenzung: Die BAGüS setzt voraus, dass jene Wohngruppen bereits vor der Umwandlung existiert haben und dass diese zuvor stationär versorgt worden sind. Ob nach dieser Vorgabe alle Wohngruppen eines Heims "umgewandelt" werden können und dann als ambulant gelten oder dies nur für einzelne Wohngruppen in Abgrenzung zum Gesamtheim, bleibt unklar.
Für solche umgewandelten, ehemals stationären Wohngruppen (eines reformierten Heims) gelten laut BAGüS als Unterscheidung von Wohngruppen eines (reformierten) Heims nur die beiden Kriterien: Entkopplung von Miet- und Betreuungsvertrag sowie die unvollständige und offene Hilfeerbringung sowie Zuständigkeit der Einrichtung für den Klienten, was auch dem geforderten Abbau der Rund-um-Versorgung weitgehend entspricht. In allen anderen relevanten Bereichen werden schließlich dem Inhalt nach nahezu die gleichen ambulanten Merkmale erwartet sowohl für das reformierte Heim als auch für das ambulant betreute Wohnen. In dieser Zone der begrifflichen Unschärfe konstituiert sich nach meiner Lesart ein vierter Einrichtungstyp: das "ambulante Heim". Bei diesem werden ehemals stationär versorgte Wohngruppen oder Außenwohngruppen eines reformierten Heims formell in ambulant betreute Wohngemeinschaften umgewandelt. Miet- und Betreuungsvertrag sind getrennte Dokumente. Jeder Bewohner erhält sein eigenes Sozialeinkommen. Dennoch ist der Wohnraum des Klienten keineswegs unabhängig vom Einrichtungsträger:
Das ambulante Heim zeichnet sich dadurch aus,
-
dass der Wohnraum der Klienten zum Eigentumsbestand der Einrichtung gehört und
-
in praktisch relevantem Maße in das System der Einrichtung einbezogen wird.
-
Dies kann durch die Existenz von Diensträumen innerhalb der Wohneinheiten geschehen, aber auch dadurch,
-
dass sich die Wohneinheiten innerhalb eines Einrichtungsgebäudes oder -komplexes befinden oder
-
dass die betreuten Wohneinheiten gemeinsam mit den Diensträumen der Betreuer in einer baulichen Einheit untergebracht werden.
-
Als abgeschwächte Form reicht aus, dass der Wohnraum der Klienten von der Einrichtung angemietet worden ist und an die Bewohner untervermietet wird. Auch dann gehört der Wohnraum in die Rechts- und Organisationssphäre der Einrichtung. ("Ambulantes Heim light")
Besonders wenn weiterhin eine Vielzahl von Klienten unter einem Dach wohnt, unter dem auch die Einrichtung ihre Diensträume hat, bleibt nach meiner Auffassung der Heimcharakter auch mit ambulantem Etikett bestehen. Denn die Gruppe der behinderten Menschen bleibt weiterhin in einer Sonderzone, in einem Haus wohnen, das ausschließlich dieser Personengruppe zugeordnet wird. Dadurch wird weiterhin eine Grenze zwischen "Normalbürgern" und "den Behinderten" gezogen, wodurch Eingliederung erschwert und alte Stigmatisierungen bekräftigt werden können.
Umgekehrt finden sich innerhalb des stationären Rahmens zahlreicher Einrichtungen auch weitgehend selbständige und unabhängige Außenwohngruppen, die nur rechtlich und vertraglich zum Heim gehören, in der alltäglichen Lebensführung und der Betreuungsstruktur aber in einem ambulanten Verhältnis zur Institution stehen. Hier erscheint mir der rein formelle Status als redundant. Entscheidend ist vielmehr das strukturelle Verhältnis in der alltäglichen Lebensführung zwischen Bewohner und Institution.
"Wir sind in der Entwicklung der Angebotsstrukturen für behinderte Menschen an einem Punkt angelangt, wo die Unterscheidung zwischen ambulant und stationär, zwischen Heim und Nicht-Heim verschwimmt", sagt Wolfgang Urban (2006, S.2). "Betreutes Wohnen als vordergründig rein ambulantes Angebot findet dabei oft unter dem verlängerten Dach der Einrichtung statt." (a.a.O.) Die von den Sozialhilfeträgern geforderte Verselbständigung der Bewohner verkomme dabei zu "einem formellen Akt". (ebd., S.4) Für die politisch bewusst eingeräumte Unschärfe bei der Unterscheidung zwischen stationär und ambulant dürfte nicht zuletzt das Kostendämpfungsinteresse der Sozialhilfeträger ausschlaggebend sein. Schließlich erwartet die BAGüS durch den Prozess der Ambulantisierung eingestandener Maßen einen positiven Effekt für die Ausgabenbelastung ihrer Mitglieder (vgl. BAGüS 2006a, S.13). Je geringer die unterscheidungsrelevanten Anforderungen für die Eingruppierung einer Einrichtung in die Kategorie ambulant sind, desto mehr Einrichtungen können einen ambulanten Status erhalten und entsprechend günstiger finanziert werden. Vor allem mit der Umwandlungsmöglichkeit ehemals stationär betreuter Wohngruppen innerhalb einer Einrichtung scheinen Tür und Tor für einen Etikettenschwindel geöffnet zu sein.
Mit dieser Aufweichung durch die BAGüS wird fast eine Dehnung des Ambulanzbegriffes bis zu einer Art Orwell'schen Bedeutungsumkehrung denkbar: Mal abgesehen von den sozial- raumbezogenen Aspekten ließe sich jedes Gefängnis als ambulante Resozialisierungseinrichtung bezeichnen. Man müsste die Zellen nur an die Insassen zwangsvermieten und den Häftlingen formal die Freiheit einräumen, sich ihre Wärter auf dem Arbeitsmarkt selbst auszusuchen.
Dennoch bleibt im Interesse des Selbstbestimmungsrechts der Bewohner unterm Strich meiner bisherigen Betrachtungen der Ambulantisierungsauftrag bestehen: Mit dem Begriff Ambulantisierung verbindet die BAGüS einen Prozess, den sie allen Einrichtungen der Behindertenhilfe verordnet, den stationären ebenso wie den ambulanten jeglicher Art. Dieser Prozess zielt auf eine Reindividualisierung der Bewohner und auf Reautonomisierung ihrer Lebenspraxis. Das Verständnis des Begriffs ambulant als ein Prozess der Ambulantisierung hat im Unterschied zum Dualismus ambulant- stationär den Vorteil, dass ich mich bei meiner Evaluation nicht auf die Alternative Ja oder Nein beschränken muss, sondern differenziert sowohl die ambulanten als auch die stationären Anteile der Einrichtungen gegeneinanderstellen kann. Je nachdem, wie weit der Prozess der Ambulantisierung fortgeschritten ist, kann ich entscheiden, ob es sich eher um eine stationäre oder überwiegend um eine ambulante Einrichtung handelt. Urban schlägt vor, zwischen "einrichtungs- gebundener" und "einrichtungsunabhängiger Wohnform" (Urban 2006: 3) zu unterscheiden. Das bedeutet, ich muss die Abhängigkeit des Bereichs Wohnen vom Herrschaftsbereich der Einrichtung evaluieren, um die Güte einer Ambulantisierung beurteilen zu können. Bezüglich der alltäglichen Lebensführung bietet Andrea Riedmann folgende Definition an, die sich zur Beurteilung einer Ambulantisierung als Leitidee eignet:
"Im Unterschied zu stationär will ambulant verdeutlichen, dass die Menschen nicht an eine Institution gebunden sind. (...) Eigenverantwortlich leben behinderte Menschen in ambulanten Wohnformen, weil sie nicht mehr davon abhängig sind, die notwendigen Hilfeleistungen irgendwie, irgendwann und von irgendwem zu bekommen. Stattdessen organisieren sie als ExpertInnen für ihr eigenes Leben ihren Hilfebedarf gemäß ihrer individuellen Bedürfnisse, indem sie die Dienstleistungen von persönlichen AssistentInnen in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass bei ambulanten Wohnformen die behinderten Menschen nicht rund um die Uhr einen Assistenten oder eine Assistentin um sich haben, sondern die Assistenz gemäß ihrem persönlichen Bedarf zur Verfügung steht." (Riedmann 2003, S.30f.)
Anstelle des eher verwaltungstechnisch geprägten Begriffspaares ambulant - stationär wird an dieser Stelle eine nähere Betrachtung des soziologisch-pädagogischen Inhaltes der Ambulantisierung notwendig. Ich beziehe mich dabei auf die Tradition der Aufklärung sowie den Wert der Selbstbestimmung und Autonomie, der nur durch soziale Kooperation und Anerkennung verwirklicht werden kann.
"Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten; alle Heteronomie der Willkür gründet dagegen nicht allein gar keine Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des Willens entgegen" (Kant 1982, S.144).
Immanuel Kant hat Ende des 18.Jahrhunderts die Autonomie des Willens als Wesensmerkmal des menschlichen Individuums erkannt und damit zumindest im deutschsprachigen Raum ideengeschichtlich die ethische Begründung der späteren Grundrechte des Menschen geliefert, die bis heute im Grundgesetz ihre Gültigkeit haben. Wesentlich bei Kant war der Gegensatz zwischen Autonomie und Heteronomie. Der Mensch solle sich frei von heteronomen Regeln machen und sich sein eigenes Gesetz autonom aus seiner Vernunft geben. "Was kann denn wohl die Freiheit des Willens sonst sein, als Autonomie, die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein?" (ebd., S.81) Dieses Gesetz sollte dann jedoch so beschaffen sein, dass dessen Maxime verallgemeinerbar ist und kein anderer Mensch nur als Mittel für den unmittelbar eigenen Zweck instrumentalisiert werde, sondern jeder Mensch stets "Zweck an sich selbst" (ebd., S. 59) bleibt.
Kants hohe Zielsetzung ist in der gesellschaftlichen Realität wohl bislang nirgendwo auch nur annähernd eingelöst worden. Ansatzweise findet sich eine Entsprechung darin, dass der erwachsene Mensch in unserer Gesellschaft, soweit der heteronom wirkende Markt es zulässt und nicht unabhängig von der sozialen Herkunft, sich frei einen Beruf wählen kann, sich selber eine Wohnung nach seinen finanziellen Möglichkeiten sucht, diese nach eigenem Geschmack und Geld einrichtet, über seine Essgewohnheiten autonom entscheidet und Besuche empfängt oder hinauskomplimentiert, wie es ihm beliebt. Er kann auch darüber entscheiden, morgens zur Arbeit zu gehen oder es sein zu lassen, sich krank zu melden oder zu kündigen, wenn er Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen bereit ist. Ob und wie er morgens duscht, bleibt seine Angelegenheit ebenso wie die Sauberkeit seiner Wohnung und der Stil seiner Kleidung. Dies unterscheidet den "aufgeklärten Menschen" vom unmündigen Menschen, der sich von äußeren Zwängen, der Tradition, dem Mainstream, den Nachbarn oder den Angehörigen in seiner Lebenspraxis leiten lässt.
Zu diesen unmündigen Menschen gehören zweifelsfrei auch jene, die über lange Zeit in Anstalten und Heimen gelebt haben, in denen "die Freiheit des Willens" keinen Raum hatte, sich zu entfalten, wo ein stummer Wille bestenfalls überleben konnte, nicht aber die Autonomie zur eigenen Gesetzgebung. Diese Unmündigkeit ist jedoch keine "selbstverschuldete Unmündigkeit" (Kant 1984, S.9), sondern eine fremdverschuldete. Während Kant unter dem Begriff Aufklärung "der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" (a.a.O.) versteht, möchte ich den Begriff Ambulantisierung auf der inhaltlich pädagogischen Ebene als "Ausgang des entmündigten Menschen aus seiner fremdverschuldeten Unmündigkeit" definieren!
Mir geht es an dieser Stelle nicht darum, einzelne Maßnahmen, Handlungsanweisungen oder Checklisten aufzuzählen, die für einen solchen Prozess notwendig oder hilfreich sind, sondern vielmehr eine Grundhaltung zu begründen, aus welcher sich konkrete Veränderungen in Richtung Reautonomisierung im Besonderen ableiten lassen.
Betrachtet man den "Alltag in der Anstalt" (Fengler 1984) wie er dem Ansatz nach auch in den Heimen und selbst in einigen "ambulanten Heimen" unserer Zeit noch stattfindet, so stelle ich fest, dass eine Autonomie des Subjekts seitens der Bewohner kaum Chancen zur Entfaltung hat. Das fängt an mit der Wohnung. Im Gegensatz zu fast allen nichtbehinderten Mietern, leben geistig behinderte Menschen mehrheitlich in Wohnungen, die sie sich nicht selber ausgesucht haben. Entweder ist es das Heim, in das sie von ihren Eltern gebracht worden sind oder es ist eine von der Institution verwaltete Mietwohnung. Darin leben sie entweder alleine oder mit anderen Menschen zusammen, die die Einrichtung vorab zusammengestellt hat. Auch wenn es Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Mitbewohner für den einzelnen gibt, so beschränken sie sich immer auf ein Spektrum aus der sozialen Gruppe der geistig behinderten Menschen unter Vorauswahl der Einrichtung.
Dieses entfremdete Verhältnis des behinderten Individuums zu seiner Welt setzt sich dann je nach Konzept der Einrichtung auch in den Alltagspraxen fort: Bei den Möglichkeiten, sein Geld zu verwalten, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, zu essen, sein Zimmer zu gestalten, sich zu waschen, zu kleiden, zu reisen und andere Menschen zu treffen. Jeder Versuch, den eigenen Willen zu reali- sieren, läuft im Extremfall ins Leere. Die Folgen sind Rückzug, Resignation, Antriebslosigkeit und Verlust sprachlicher Kompetenzen. Denn das Subjekt, das stets ins Leere läuft, stumpft ab. Es braucht für die Verwirklichung seiner Autonomie ein Gegenüber, einen "freundlichen Begleiter" (Jantzen 2001b, S.5.). Nur mit diesem gelingt es, sich selbst als autonomes Wesen erfahren zu können.
Die Autonomie als Wert an sich in der Tradition der Aufklärung ist stets nur denkbar im Miteinander, im Austausch, der Kommunikation mit anderen Menschen. Hegel nennt dies Selbstbewusstsein, zu dem zwei Seiten gehören, das eine Ich und das andere Ich. "Jedes ist dem Anderen die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem Anderen unmittelbares für sich seiende Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend" (Hegel 1973, S.147) Erst in diesem sozialen Austausch, der Selbstbewusstsein möglich macht, werden geistige Entwicklung und Handlungsfähigkeit hervorgebracht. "Das Bewusstsein hat erst in dem Selbstbewusstsein, als dem Begriff des Geistes, seinen Wendungspunkt, auf dem es aus dem farbigen Scheine des sinnlichen Diesseits und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet" (ebd., S.145).
Wird dem behinderten Menschen dieses Selbstbewusstsein verwehrt, so bleibt er geistig in "der leeren Nacht" gefangen und unfrei. Selbstbewusstsein als Bedingung für Autonomie und umgekehrt kann nur durch Anerkennung gelingen. "Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, d.h., wenn dein Lieben als Lieben nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch deine Lebensäußerungen als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück." (Marx 1990, S.567) Jantzen schließt aus der zitierten Marx-Stelle: "Ohne ein soziales Feld der Anerkennung, im Hegel'schen Sinne des Begriffs, ist weder eine Anerkennung in der Liebe, in der Ehre noch im Absoluten möglich." (Jantzen 2001d, S.7) Daraus leitet er ab: "Also ist es erste Aufgabe der Pädagogik, dieses Feld praktisch zu realisieren und theoretisch darauf zu insistieren." (a.a.O) Dörner formuliert diesen Grundsatz für die Behindertenpädagogik noch konkreter:
"Weil alle Sorgebedürftigen in vielfältiger Weise gezwungen sind, immer wieder Hilfe anzunehmen, ist ihr Grundbedürfnis, Bedeutung für Andere zu haben, noch vitaler als für andere Menschen; gerade weil sie immer wieder nehmen müssen, bedarf ihr Bedürfnis, auch geben zu können, kompensatorisch geradezu einseitiger Aufmerksamkeit von uns Sozialprofis." (Dörner 2003, s.p.)
Dörner hebt die Sphäre der Arbeit als Möglichkeitsraum hervor, um Anerkennung zu erlangen, und schlägt vor: "Wenn man statt in eine fremdverwaltete Tagesstätte in eine Zuverdienstfirma angstfrei nur in dem Maße seines Bedürfnisses gehen kann, können auch Menschen ohne Isolierungsgefahr in der Kommune wohnen und leben, denen man dies in keiner Weise zugetraut hätte." (a.a.O.) Mit dem Begriff der Ambulantisierung verbindet Dörner die Integration ins soziale Umfeld, das Öffnen der Grenzen zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten mittels sozial anerkannter Tätigkeit:
"Wenn ich eine neue Wohngruppe entlassener Heimbewohner organisiere, habe ich als Erstes auf etwas zu achten, was unserer bisherigen Institutionalisierung meist vergessen wird: Ich habe ein kleines, noch so unbedeutendes, vielleicht nur symbolisches Tätigkeitsfeld für die Neu-Bürger zu finden, durch das öffentlich sichtbar wird, dass sie etwas für die Alt-Bürger, ihre neuen Nachbarn tun." (a.a.O.)
Dörner bietet damit eine Antwort auf das Problem an, das Georg Feuser als Kehrseite der bislang üblichen Ambulantisierung erkannt hat: "Das Ende der Verwahrung hinter sichtbaren Mauern der Institutionen ist eben nicht automatisch das Ende der Verwahrung der Betroffenen." (Feuser 1995, S.267) Denn die Ausgrenzung der behinderten Menschen bleibt außerhalb des Heims fortbestehen.
"Einsamkeit im Sinne des Verlustes der Einbindung in die soziale Gemeinschaft und Ohnmacht im Sinne der Unmöglichkeit, die Einbindung trotz aller Anstrengungen zu erreichen, weil sie strafend entzogen und vorenthalten bleibt, sind nicht einfach durch das Bild vom Einschluss in die Anstalt ohne die Möglichkeit des Entrinnens zu definieren, noch dadurch aufzuheben, dass man Löcher in Mauern sprengt, ihre Tore öffnet oder sie abträgt und es dabei bewenden lässt." (a.a.O.)
Solange die Gesellschaft ihr grundlegend diskriminierendes Verhältnis gegenüber behinderten Menschen nicht verändert, wird vielmehr "die Anstalt zur Normalität und die scheinbare Normalität zur Anstalt". (ebd.,S.265) Sichtbare Ausgrenzung wird durch subtile ersetzt. Der Sonderstatus bleibt erhalten. Auch Feuser sieht die Sphäre der Arbeit als ein Feld an, durch das eine bessere soziale Teilhabe erreicht werden kann und fordert "die Aufnahme des Rechts auf Arbeit - ohne Ansehen von Person und Geschlecht - in das Grundgesetz". (ebd., S.281)
Wie ich in Kapitel 2.2.1 ausgeführt habe, hat der sozialintegrative Aspekt der Ambulantisierung bereits im Sozialrecht und auch in den Vorgaben der BAGüS Berücksichtigung gefunden und wird erkannt. In der Praxis aber sind gerade diese Bestandteile der Ambulantisierung gegenüber den formalen am wenigsten überprüfbar und werden von den Profis nach meiner Erfahrung nicht selten als "zusätzliche" und im Zweifelsfall als "verzichtbare" Leistungen entwertet. "Das tun wir gern, wenn wir Zeit haben." (Fengler 1984, S.181)
Zum ambulanten Handeln gehört gemäß Dörner eine pädagogische Grundausrichtung, die auf die Organisation von sozialen Möglichkeitsräumen gerichtet ist:
"Eigentlich hatten wir doch schon gelernt, dass der fachlich richtige Umgang mit chronisch Kranken und Behin-derten in der Begleitung seiner Beziehungen bestehe (bis dahin, dass man mehr Zeit mit Angehörigen, Freun-den, Nachbarn, Arbeitgebern als mit dem Behinderten selbst verbringt) und natürlich auch in der Beschaffung bedeutungsvoller Tätigkeits- und Wohnmöglichkeiten und dass Professionalität gerade nicht im direkten und frontalen Herumfummeln an Individuen bestehe, weil dies nämlich eine Verwechslung von Menschen mit Sachen wäre. Und die einzig denkbare Alternative zur Institutions- ist natürlich nicht die Person-, sondern die Gemeinde- oder Raum-Zentrierung mit der Verantwortung für gute Beziehungen zwischen Bürgern mit und ohne Behinderungen, ein Lastenausgleichsprogramm für ein definiertes Territorium." (Dörner 2004, S.39)
Damit schlägt Dörner einen Bogen von der Ambulantisierung zur Gemeinwesenarbeit. Der Gegen-stand der sozialpädagogischen Arbeit ist darin nicht länger primär das einzelne Individuum, sondern der soziale Raum, in dem das Individuum agiert. Diese soziale Gemeinschaft gilt es in der Gemein-wesenarbeit dabei zu unterstützen, sich als eine Gemeinschaft zu stärken, selbst zu organisieren und gegenüber den höheren Instanzen der sozialen Herrschaft zu emanzipieren.
Dieses Territorium, das Dörner anspricht, kann sich nach meiner Auffassung anfangs auch innerhalb des Heims oder der Wohngruppe befinden. Verzichtet man auf einen "sog. Hotelservice" und überlässt den Bewohnern schrittweise die Möglichkeit, arbeitsteilig füreinander zu sorgen, so gewinnt jeder von ihnen eine neue Bedeutung für die anderen und Anerkennung. Auch die Profis dürfen nach meiner Auffassung durchaus mal ihre Betreuten um Hilfe bitten, soweit dies nicht in Ausbeutung ihrer Abhängigkeit umschlägt. Die Erfahrung gefragt und als Kompetenzträger anerkannt zu werden, kann für viele langjährige Heiminsassen eine ganz neue und hilfreiche Erfahrung sein. Aus meiner teilnehmenden Beobachtung konnte ich erleben, wie sehr sich ein Bewohner freute, als ich ihn darum bat, mir beim Reparieren meines Fahrrades zu helfen. Er gab sich große Mühe und erwies sich bei seiner Hilfe als äußerst lernfähig sowie handwerklich geschickt.
Voraussetzung für eine solche Grundhaltung ist die Anerkennung des geistig behinderten Menschen als gleichwertiges "vernünftiges Wesen" im Sinne von Kant. Seine Symptome, auch wenn sie auf andere Menschen herausfordernd wirken, dürfen nicht länger als Ausdruck der Unvernunft verstanden werden, sondern als Ausdruck der Vernunft unter den besonderen biologischen, psychischen und sozialen Bedingungen, unter denen jener Mensch aufgewachsen ist und unter denen er aktuell lebt. (s. Teil C, Kap. 2.3.2 )
Das, was ich den inhaltlichen Aspekten der Ambulantisierung zuordne, im Gegensatz zu den rein äußerlichen und formalen Aspekten, trifft weitgehend auch das, was Erik Weber als "De-Institutionalisieren" und Georg Theunissen als "Enthospitalisierung" bezeichnen. Es geht im Grunde genommen darum, die Macht der Institution zurück zu drängen und dem betreuten Individuum mehr Handlungsräume zur freien Entfaltung sowie sozialer Integration zu ermöglichen.
Für den Prozess der Enthospitalisierung hält Theunissen u.a. folgende Veränderungen für wichtig:
-
"Abbau zentraler Verwaltungs- u. Versorgungsstrukturen"
-
"Abschaffung klinisch geprägter Organisationseinheiten und Kontrollinstanzen"
-
"Sicherung von Grundbedürfnissen nach Kommunikation, Achtung und Vertrauen"
-
"Sicherung des Privatbereichs und der Intimsphäre"
-
"Freisetzung und Unterstützung von Eigenaktivität und eines Sich-Selbst-Sein-Dürfens"
-
"Unterstützung der Entwicklung eines individuellen und kollektiven Selbsthilfe-Verhaltens" (Theunissen 1998, S.83f.)
Weber hat ergänzend u.a. folgende notwendige Veränderungen hervorgehoben:
-
"Sich Zeit lassen" Im Sinne, dass der Prozess konzeptionell gut vorbereitet werden muss und eine umfangreiche Weiterbildung für das Personal notwendig ist.
-
"Abbau von Gewaltverhältnissen"
-
Die Wahl-und Entscheidungsfähigkeit der Bewohner fördern.
-
"Um-Schreiben von Kranken- in Lebensgeschichten"
-
Rehistorisierende Diagnostik (Weber J. 2004, S.168, s.auch Teil C, Kap. 2.3)
Dörner konstatiert als "kategorischen Imperativ" für jeden Ambulantisierungsprozess: "Handle in deinem Verantwortungsbereich so, dass du mit dem Einsatz all deiner Ressourcen stets beim jeweils Letzten beginnst, bei dem es sich am wenigsten lohnt." (Dörner 2003, s.p.) Damit soll nicht nur das kapitalistische Prinzip der Ressourcenallokation umgekehrt werden, sondern auch erreicht werden, dass nicht "die Letzten als irrationaler Rest übrigbleiben". (a.a.O.)
Basaglia versteht Deinstitutionalisierung als "Zerstörung des Autoritätsprinzips" (Basaglia 1973, S.143). Die Befreiung des Insassen aus den "Institutionen der Gewalt" muss mit einer subjektiven Selbstbefreiung einhergehen: "Für die Rehabilitation des in unseren Anstalten dahinvegetierenden institutionalisierten Kranken ist es also vor allem nötig, dass wir uns bemühen - bevor wir einen neuen, freundlichen und menschenwürdigen Rahmen für ihn schaffen, den er gewiss auch braucht -, in ihm ein Gefühl der Auflehnung gegen die Macht zu wecken, die ihn bis dahin determiniert und institutionalisiert hat." (ebd., S.142)
Da "die Macht" nicht nur in Form offener Gewalt ausgeübt wird, sondern heute vielmehr "mit Samthandschuhen" (Jantzen 1998, S.1) in Erscheinung tritt, sollte an dieser Stelle auch eine Auflehnung gegen all jene Unterdrückungsmechanismen angestrebt werden, die Jantzen unter dem Begriff Paternalismus zusammenfasst:
-
"Der Anspruch, die wirklichen Interessen der Benachteiligten besser verstehen zu können, als diese selbst;
-
der Anspruch moralischer Überlegenheit gegenüber der Gruppe der Benachteiligten und die damit verbundenen beanspruchte letzte Entscheidungsgewalt über deren wirkliche Interessen;
-
die emotionale Bekundung der Wohltäterschaft;
-
die Nachahmung von Eltern-Kind-Beziehungen;
-
die Kriminalisierung der Benachteiligten bei Durchbrechen der von den Überlegenen vorgegebenen Grenzen (...);
-
-die Überprüfung der Würdigkeit, Leistungen oder Zuwendung zu erhalten;
-
-die sentimentale Selbstdefinition der vorgeblichen Wohltäterinnen, wobei Sentimentalität schnell in Terror umzuschlagen vermag, sobald sich ihr Objekt nicht als dankbar erweist." (Jantzen 1998, S.6)
Jantzen fordert stattdessen einen "radikale (n) Verzicht auf Stellvertretung und Bevormundung zugunsten der Perspektive, etwas gemeinsam mit Behinderten zu tun" (a.a.O.). Dies sollte im Hinblick auf meinen Begriff der Ambulantisierung als Grundorientierung für die alltägliche Betreuung gelten.
Obwohl der sozialrechtliche Ambulantisierungsauftrag bereits 1984 normative Gültigkeit erlangt hat, wird er durch die Verwaltungspraxis der Sozialhilfeträger genau in sein Gegenteil verkehrt: Noch immer gilt faktisch der Grundsatz: stationär vor ambulant! Rund 77 Prozent der behinderten Men-schen im Sinne des § 53 Abs.1 SGB XII wurden noch im Jahr 2005 mit stationärer Eingliederungshilfe versorgt. Nach Angaben der BAGüS waren dies 191.100 Menschen, während nur 57.100 ambulant betreut worden sind. (Vgl. BAGüS 2006b, S.10) Die Zahl der stationär untergebrachten Klienten ist danach von 164.700 im Jahr 2000 innerhalb von fünf Jahren um rund 16 Prozent gestiegen. Die Zahl der ambulant betreuten Hilfeberechtigten stieg zwar um knapp 30 Prozent im gleichen Zeitraum, allerdings auf sehr bescheidenem Grundniveau. Seit 1991 an, als in der Fachwelt die Fragwürdigkeit der Heimunterbringung schon längst bekannt war, bis 2005 hat sich die Anzahl der Heimplätze sogar fast verdoppelt. (Vgl. Rohrmann 2005, S.1) Finanzpolitisch sieht das Verhältnis zwischen stationär und ambulant noch weitaus dramatischer aus: Nach den Zahlen der Bundesregierung wurden im Jahr 2003 noch 7,7 Mrd. Euro für die Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen ohne Werkstätten ausgegeben. In die Hilfen außerhalb von Einrichtungen flossen nur 750 Millionen Euro. Rund 90 Prozent der Eingliederungsgelder wurden demnach für stationäre Maßnahmen ausgegeben, nur zehn Prozent für ambulante. (BT-DrS.15/4575, S.146)
Sowohl die Zahl der Heimbewohner als auch die der ambulant betreuten Klienten steigt von Jahr zu Jahr. Die Bundesregierung führt dies vor allem auf den Trend zurück, "dass der Anteil behinderter Menschen im fortgeschrittenen Alter, die Eingliederungshilfe in Einrichtungen in Anspruch nehmen müssen, von Jahr zu Jahr größer wird, weil die inzwischen betagten und hochbetagten Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihre behinderten Kinder weiterhin zu Hause adäquat zu versorgen und zu betreuen." (ebd., S.147) Außerdem würden auch behinderte Menschen durch eine bessere medizinische Versorgung und verbesserte Lebensbedingungen älter werden als in früheren Zeiten, so dass sie dem Hilfesystem länger erhalten blieben, konstatiert die Bundesregierung. Auch das frühere Verlassen des Elternhauses trage zur Bedarfssteigerung bei. Aus meinen empirischen Beobachtungen sowohl innerhalb des Forschungsfeldes als auch in anderen Einrichtungen konnte ich zudem feststellen, dass die Eltern behinderter Kinder aufgrund ihrer beruflichen Belastung kaum in der Lage waren, diese in ihrer eigenen Wohnung zu betreuen. In sehr vielen Fällen gingen die Ehen zu Bruch, so dass ein alleinerziehender Elternteil ohnehin überfordert war. Auch das Verhältnis zwischen Eltern und dem behinderten (erwachsenen) Kind war meist sehr problematisch: entweder von einer paternalistischen Überfürsorge geprägt oder durch Konflikte bis hin zum Kontaktabbruch. So sind Auszug und ambulante oder stationäre Betreuung für beide Seiten meist die erträglicheren Varianten. Auch im Verhältnis der behinderten Menschen zu ihren Herkunftsfamilien spiegelt sich die allgemein gesellschaftliche Tendenz zur Erosion stabiler sozialer Beziehungsgefüge wider
Dennoch steht der Trend zur Expansion der Heimbetreuung im krassen Gegensatz zu dem, was in der pädagogischen Fachliteratur, auf Tagungen und in den Hörsälen seit nunmehr drei Jahrzehnten diskutiert wird. Dass dies so ist, dazu gehören mindestens drei an der Entscheidung beteiligte Partner: Der behinderte Mensch und Angehörige, die Einrichtungen sowie die Sozialhilfeträger.
Die Klienten selber werden in der Regel von ihren Eltern und Angehörigen in stationäre Einrichtungen überführt, meist kurz nach Erlangung der Volljährigkeit. Bei den Eltern und Angehörigen "steht vielfach die Verlässlichkeit und Sicherheit der Betreuung im Vordergrund ihrer Überlegungen." (Metzler/Rauscher 2004, S.52) haben Heidrun Metzler und Christine Rauscher bei einer Studie in Baden-Württemberg ermittelt. Entsprechend fänden sich bei 73 Prozent der befragten Anbieter Wartelisten, auf denen bis zu 100 Personen verzeichnet seien. Das große Interesse der Familienangehörigen von geistig behinderten Menschen an stationären Plätzen erklärt sich nicht zuletzt auch damit, dass die ambulante Betreuung in regelmäßigen Abständen neu beantragt und neu bemessen wird. In Hamburg beispielsweise ist die "Pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum" (PBW) nur noch für eine Dauer von zwei Jahren vorgesehen. Danach wird die abgeschwächte Betreuungsform der Wohnassistenz angeboten. Wie viele Stunden bewilligt werden, entscheidet die zuständige Behörde von Antrag zu Antrag neu. Auf diese Weise bietet die ambulante Form wenig Perspektive auf eine dauerhaft ausreichende und berechenbare Betreuung des erwachsenen behinderten Kindes. Die Gefahr für die Eltern, dann doch irgendwann wieder in die Verantwortung zu kommen oder gar ihr Kind wieder in der eigenen Wohnung aufnehmen zu müssen, wird vor allem bei älteren Vätern und Müttern zu einem kaum zumutbaren Risiko. Da die Heimplätze meist noch immer als lebenslängliche Aufenthaltsorte verstanden werden, bieten sie eine Art soziale Entsorgungsfunktion für die Eltern auf Dauer und sind entsprechend begehrt.
Die Einrichtungsträger dürften an der stationären Unterbringung am meisten von allen Beteiligten profitieren. Stationäre Plätze werden mit Tagessätzen vergütet. Einzelne Leistungsstunden für einzelne Klienten müssen nicht nachgewiesen werden und sind auch kaum nachprüfbar. Das Heim ist noch immer eine Blackbox, nach außen abgeschottet und kaum transparent. In der ambulanten Hilfe hingegen muss die Einrichtung für jeden Klienten den Namen und die berufliche Qualifikation des Betreuers dem Sozialamt mitteilen. Jede einzelne Stunde, die abgerechnet wird, muss der Klient mit seiner Unterschrift bestätigen. Sofern ein Termin ausfällt, macht sich dies im Umsatz des Trägers bemerkbar. Die Tagessätze hingegen werden für jeden Tag des Aufenthalts eines Bewohners im Heim gezahlt, unabhängig davon, ob ein Betreuer ausfällt, es eine Vertretung gibt oder nicht, auch unabhängig davon, ob eine Stelle vakant ist oder doppelt besetzt wird. Die Einnahmen fließen pauschal - unabhängig von der Leistung.
Ein weiterer Vorteil für die Träger ist bei der stationären Hilfe die wirtschaftliche Verwertungs-möglichkeit ihrer Immobilien. Viele von Ihnen sitzen auf Besitztümern, die einen ganzen Stadtteil füllen. Würden plötzliche alle Klienten in Wohnungen umziehen, die anderen Eigentümern gehören, und nur noch ambulant betreut werden, würde dies zu einem Immobilien-Crash in der Freien Wohl-fahrtspflege führen. Belegte Heimplätze aber werden zum Teil doppelt finanziert. Metzler/Rauscher weisen daraufhin, dass der Neubau von Heimen im Gegensatz zu Investitionen im ambulanten Bereich bezuschusst wird. Auf diese Weise zahlt die öffentliche Hand erstens einen Teil der Baukosten, ohne aber als Gegenwert Eigentumsanteile zu erwerben, und zweitens nach der Belegung über die Tagessätze die vollen Nutzungsgebühren. Die Kosten werden subventioniert, während die Einnahmen im vollen Umfang privatisiert werden. Jeder Heimplatz bringt nur laufende Einnahmen ein, wenn er belegt ist, konstatiert Schwarte: "Es entspricht dieser Logik, dass jeder Wohnheimträger an einer möglichst stabilen und hohen Auslastung interessiert sein muss." (Schwarte 2007, S.7) Hinzu komme die Zweckbindung durch öffentliche Zuwendungsgeber, wodurch die Immobilien nicht einfach verkauft oder anderweitig bewirtschaftet werden dürften. Auch das Personal könne nicht ohne weiteres aus der stationären Arbeit in den ambulanten Dienst überführt werden.
Die Sozialhilfeträger zahlen finanziell den Preis für die großen Annehmlichkeiten der Einrichtungsträger. Sie müssten das größte Interesse daran haben, den sozialrechtlichen Grundsatz "ambulant vor stationär" umzusetzen. Denn die Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfe "ist die umfangreichste Position unter den Hilfearten der Sozialhilfe". (BT-DrS.15/4575, S.147) Sowohl die Bundesregierung als auch die überörtlichen Sozialhilfeträger betonen immer wieder ihre Bemühungen, diese Kosten zu dämpfen, dennoch steigt die Zahl der teuren Heimplätze von Jahr zu Jahr. Ein Grund dafür dürfte die unterschiedliche Zuständigkeit sein. Nach § 97 AbS.2 SGB XII wird die sachliche Zuständigkeit der überörtlichen Sozialhilfeträger nach Landesrecht geregelt. Sehr eindrucksvoll hat das Bayerische Sozialministerium diese kontraproduktive Zuständigkeit dargestellt:
"Für die stationäre Unterbringung (somit für die laufenden Kosten) sind nach der gegenwärtigen Rechtslage die Bezirke als überörtliche Sozialhilfeträger zuständig und kostentragungspflichtig. Für die ambulanten Hilfen sind dies die Landkreise und kreisfreien Gemeinden als örtliche Sozialhilfeträger. Das bedeutet: bei einem im Ein-zelfall möglichen Wechsel von einer stationären Einrichtung zum Wohnen in einer Wohngemeinschaft oder im betreuten Einzelwohnen erfolgt auch ein Wechsel des Kostenträgers. Örtliche Sozialhilfeträger werden aber kein gesteigertes Interesse haben, durch den verstärkten Ausbau ambulanter Wohnformen die Voraus-setzungen dafür zu schaffen, dass eine Reihe bisher stationär vom Bezirk versorgter Menschen in die eigene örtliche Zuständigkeit überführt wird." (Bayerisches Staatsministerium 2007, s.p.)
Nach einer Gesetzesänderung sind seit Anfang 2008 in Bayern nun grundsätzlich die sieben Bezirke des Landes für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zuständig. Damit soll nach den Vor-stellungen des Sozialministeriums der "Ausbau des ambulanten Bereichs" (Bayerisches Staatsministerium 2008, s.p.) gestärkt werden.
Ein anderer Grund könnte darin liegen, dass die großen Wohlfahrtsverbände seit Jahrzehnten korporatistisch mit der Politik zusammenarbeiten. Hier haben sich gute Kontakte und erprobte Beziehungen eingespielt. Erfahrungsgemäß ist der Draht zur zuständigen Behördenleitung kurz. Man nimmt Rücksicht aufeinander und respektiert gegenseitig seine Interessen. Schließlich verfügen auch die Sozialkonzerne über Verhandlungsgeschick, Arbeitsplätze und ökonomische Power. Sie können zwar nicht mit Standortverlagerungen in Billiglohnländer drohen, allerdings Gehör finden ihre Interessen immer wieder in der Öffentlichkeit. Das sind freie Interpretationen. Am Beispiel des aktuellen Ambulantisierungsprogramms in Hamburg zeigte sich zumindest, dass das immobilienwirtschaftliche Interesse der Träger nicht zu kurz kam.
In Hamburg haben sich im März 2005 der Sozialhilfeträger, die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, Verbände der Träger privater Einrichtungen und die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (LAG) auf einen Konsens zur weiteren Ambulantisierung geeinigt, nachdem die ambulanten Betreuungsangebote für erwachsene geistig und mehrfach behinderte Menschen der Pädagogischen Betreuung im eigenen Wohnraum (PBW) und die Wohnassistenz (WA) bereits eingeführt worden waren. Das neue Programm zielte auf die Einrichtung Ambulant betreuter Wohngemeinschaften (AWG) als einer zusätzlichen Form der ambulanten Hilfe.
Mit dem neuen Angebot der AWG versuchte die Stadt Hamburg nicht nur den sozialrechtlichen Ambulantisierungsauftrag einzulösen, sondern nach eigenen Angaben auch die Kosten zu reduzieren. Während ein Platz der mittleren Bedarfsgruppe 3 in einer stationären Wohngruppe nach Angaben der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) pro Tag € 108,00 kostete, lagen die Ausgaben für einen AWG-Platz zwischen € 50,00 und € 72,00. Eine Stunde PBW wurde mit € 36,00 vergütet und eine Stunde WA mit € 29,50 (Vgl. BSG 2007, S.3ff.).
Im Jahr 2006 überwog in Hamburg nach wie vor mit deutlichem Abstand die stationäre Betreuung von geistig und mehrfach behinderten Menschen gegenüber der ambulanten Betreuung. Die zahlenmäßige Verteilung auf die verschiedenen Hilfeformen sah folgendermaßen aus:
Quelle: BSF 2007, S. 53-55
|
Betreuungs- /Wohnform |
Anzahl der betreuten Personen in 2006 in Hamburg |
|
Stationäre Wohngruppen |
3.600 davon rd. 2.500 innerhalb der Stadt |
|
PBW |
800 |
|
WA |
580 |
|
AWG |
83 |
|
Hilfe f. Fam.m. behind. Kindern |
190 |
|
Heipäd. Maßnahmen/ Frühförderung |
200 |
Fast genau zwei Drittel aller Leistungsberechtigten lebten in Heimen, nur ein Drittel im eigenen Wohnraum. Der stationäre Bereich war somit doppelt so groß wie der ambulante.
Mit dem neuen Ambulantisierungsprogramm wollte die BSG bis Ende 2008 insgesamt 770 Heim-plätze abbauen. Das wäre fast ein Drittel aller innerhalb des Stadtgebiets befindlichen stationären Plätze. Die höhere Zahl von 3.600 stationär betreuten Personen ergab sich aus der örtlichen Zu-ständigkeit gem. § 93 Abs.2 SGB XII. Danach bleibt Hamburg für die Finanzierung der stationären Betreuung zuständig, wenn der Bewohner zum Zeitpunkt der Aufnahme oder in den vergangenen zwei Monaten davor seinen Hauptwohnsitz in Hamburg hatte.
Als Gründe für die nur schleppend vorangekommene Umsetzung des sozialrechtlichen Ambulanti-sierungsauftrages nannte eine leitende Mitarbeiterin der BSG im Gespräch mit mir, der Sprung von einer stationären Wohnform in die PBW sei für viele Klienten zu groß. Viele Betreute seien wieder zurück in ein Heim gegangen, weil sie die plötzlichen Autonomieanforderungen nicht hätten bewälti-gen können. Außerdem gebe es auf dem Hamburger Wohnungsmarkt große Schwierigkeiten, für geistig behinderte Menschen eine Wohnung zu finden. "Bisher gab es zum Heim keine Alternativen", argumentiert die Pädagogin. "Aber viele Bewohner sind im Heim falsch aufgehoben." Deshalb wolle ihre Behörde mit dem Modell der AWG ein Zwischen- bzw. Übergangsangebot schaffen, das von den Betroffenen auf freiwilliger Basis genutzt werden könne. Bewohner, deren Plätze ambulantisiert werden, behalten das Recht, wieder in den stationären Rahmen zurück kehren zu können.
Der zentrale Ansatz des Hamburger Programms zielte auf die Umwandlung von bisher stationären Wohngruppen in ambulante. "Dafür sind oft auch bauliche Veränderungen nötig. Die Wohnung einer großen Wohngruppe wird zum Beispiel in zwei kleinere Wohnungen für Wohngemeinschaften aufge-teilt" (BSG 2007., S.37) Das heißt, innerhalb der Heime werden einzelne Wohneinheiten zumindest formal vom Gesamtbetrieb abgetrennt und als "ambulant" bezeichnet. Dafür genügt eine Trennung zwischen Miet- und Betreuungsvertrag sowie eine Trennung zwischen Diensträumen und Wohn-räumen. Die Büros dürfen sich nicht innerhalb der vermieteten Wohnungen der Klienten befinden.
Als weitere Möglichkeit nennt die Behörde die Umwandlung von bereits bestehenden Außenwohn-gruppen einer stationären Einrichtung, die bislang unter Maßgabe des Heimrechts betreut worden sind, strukturell aber eher in einem ambulanten Verhältnis zur betreuenden Institution standen. "Auch ist es möglich, dass Menschen mit Behinderung dabei geholfen wird, aus der stationären Unterkunft auszuziehen" (a.a.O.) und alleine, zu zweit oder in einer WG zu wohnen.
Als wesentliche Vorteile für die Bewohner gegenüber der stationären Form erwartete die BSG folgende Veränderungen:
-
Der Bewohner kann seine Wohnung nach eigenen Vorstellungen einrichten.
-
Er kann Besuch in seiner eigenen Wohnung empfangen,
-
die Tür hinter sich abschließen,
-
den Tagesablauf selbst bestimmen,
-
weitgehend selbst über Einkauf und Küche bestimmen und
-
Unterstützung nach individuellem Bedarf erhalten. (Vgl. BSG 2007, S.38)
Die BSG-Mitarbeiterin formulierte noch weitere Ansprüche an die AWG-Projekte:
-
In den AWG darf es keine Nachtwachen geben.
-
Wenn ein ganzes Haus aus ambulant betreuten Wohngemeinschaften besteht, sollten die Diensträume der betreuenden Einrichtung nicht im gleichen Gebäude untergebracht werden.
-
Sofern ein Umzug stattfindet, sollen dieser und die formelle Ambulantisierung zeitlich unmittelbar aufeinander folgen.
-
Es sollen soziale Stützpunkte im Umfeld der AWG eingerichtet werden, von wo aus die Bewohner Hilfen anfordern können.
-
Eine sozialraumorientierte Öffnung und Integration soll entwickelt werden.
-
Die Mobilität der Bewohner muss gefördert werden.
-
Ein U-oder S-Bahnanschluss "sollte schon um die Ecke sein".
Da viele Bewohner neben der Eingliederungshilfe auch Pflegeleistungen erhielten, sah die BSG eine weitere Veränderung auf die Bewohner und die Einrichtungen im Zuge einer Ambulantisierung zu-kommen: Bewohner ab der Pflegestufe 1 erhalten im stationären Rahmen die pflegerischen Leistungen innerhalb des Heims. Gemäß §11 Abs.1 Ziff.3 HeimG gehört dies zu den Aufgaben der stationären Einrichtung und wird von der Pflegeversicherung gem. §43a SGB XI mit bis zu € 256 pro Monat finanziert. Nach der Umwandlung einer Wohngruppe in eine AWG handelt es sich im Sinne des Heimgesetzes nicht mehr um eine stationäre Einrichtung, womit die Finanzierung nach §43a SGB XI entfällt. Vielmehr leben die pflegebedürftigen Bewohner dann formal in ihrem eigenen Wohnraum. Sollen sie auch darin gepflegt werden, so muss entweder ein ambulanter Pflegedienst bzw. eine Privatperson mit Versorgungsvertrag gem. §77 Abs.1 SGB XI in Anspruch genommen werden oder der Pflegebedürftige beschafft sich selbst im privaten Bereich seine notwendige Pflegehilfe und erhält dafür von der Pflegekasse eine Pflegegeld gem. § 37 Abs.1 SGB XI. Dies beträgt für die Pflegestufe I € 205 monatlich, für Pflegestufe II € 410 und bei Pflegestufe III € 665 pro Monat.
Sollte die Pflege weiterhin durch die betreuende Institution erbracht werden, wie vor der Ambulantisierung, so wäre dies nur dann finanzierbar, wenn der Betreuungsanbieter zusätzlich mit der Pflegekasse einen Versorgungsvertrag (§72 SGB XI) abschließt. Dann wäre die pädagogisch betreuende Einrichtung zugleich ein ambulanter Pflegedienst. Um dafür eine Zulassung zu erhalten, muss der ambulante Pflegedienst "unter ständiger Verantwortung einer Pflegefachkraft" (§71 Abs.1 SGB XI) arbeiten. Werden überwiegend behinderte Menschen gepflegt, so reicht es, wenn der Verantwortungsträger eine Heilerzieherausbildung absolviert und in den vergangenen fünf Jahren zwei Jahre praktische Berufserfahrung nachweisen kann. Trägt hingegen ein Sozialpädagoge die Verantwortung für die Einrichtung, so ist eine Zulassung als ambulanter Pflegedienst nicht vorgesehen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Pflegeberechtigten mit ihrem ausgezahlten Pflegegeld einzelne Betreuer direkt für zusätzliche Pflegeleistungen bezahlen, diese also neben ihrer Angestelltenarbeit zusätzlich privat ihre Klienten pflegen. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass die Pflegeberechtigten ihr Pflegegeld an die Betreuungseinrichtung zahlen, womit diese wie bisher im stationären Rahmen aus einer Hand auch den Pflegebereich übernehmen kann. Damit würde zwar nicht gegen das Gesetz verstoßen werden, aber dennoch würde es unterlaufen werden, zumal die betreuende Einrichtung in diesem Falle gewerbsmäßig und regelmäßig als ambulanter Pflegedienst tätig sein werde, ohne aber über einen entsprechenden Versorgungsvertrag mit der Pflegeversicherung zu verfügen.
Schwerpunktmäßig zielte die neue Ambulantisierung in Hamburg auf das Modell, das ich in Kap. 2.2.1 als "ambulantes Heim" bezeichnet habe. Die Ambulantisierung sollte im Wesentlichen unter dem Dach der Einrichtungen stattfinden: Entweder bleiben die Wohngruppen sogar im Gebäude des alten Heims oder sie befinden sich in Außenwohneinheiten, die ebenfalls unter der rechtlichen Zuständigkeit der Einrichtung stehen. Außer der formellen Trennung zwischen Miet- und Betreuungsvertrag musste sich nicht viel verändern.
In einer amtlichen "Checkliste für geplante Umwandlungen von stationären Wohngruppen in ambulant betreute Wohngemeinschaften in Hamburg" vom April 2006, die an die Einrichtungen verteilt worden ist, ging es ausschließlich um die rein formalen Anforderungen, die beachtet werden sollten. Pädagogische Aspekte blieben darin ausgespart. Was die BSG in ihrer Broschüre unter der Überschrift "Betreuung in den eigenen vier Wänden" ausführt, kommt dann sehr nah an das heran, was eher als eine Rund-um-Versorgung bezeichnet werden kann: "Das Fachpersonal hilft dann bei Bedarf morgens beim Aufstehen, Waschen und Frühstück machen und ist schwerpunktmäßig wieder da, wenn die Menschen mit Behinderung von der Arbeit in einer Werkstatt oder aus einer Einrichtung der Tagesförderung nach Hause kommen" (BSG 2007, S.36). Selbst an den Wochenenden sollen die Bewohner "nach dem individuellen Bedarf" eine helfende Präsenz der Betreuer genießen.
Obwohl die Behörde einräumte, dass sich die Zielgruppe der Klienten gar keine "Rund-um-Versorgung" mehr wünsche, hat sie ihnen dennoch eine fürsorgliche Belagerung verordnet. Wenn die BSG unter einer ambulanten Hilfe versteht, dass die Klienten in ihrem eigenen Wohnraum leben, wirkt eine Betreuung von früh bis spät wie eine "Kolonialisierung der Lebenswelt"[5]. (Habermas 1985, S.522). Ob der Klient in diesen Fällen dann wirklich noch "Herr im eigenen Haus" ist oder vielmehr die Betreuer dort die Regie übernehmen, sollte überprüft werden. Setzt man die Tagespauschale pro AWG-Platz in Höhe zwischen 50 und 72 Euro ins Verhältnis zur Fachleistungsstunde im PBW, so bedeutet dies, dass jeder AWG-Bewohner täglich eine Finanzierung von rund 1,5 bis 2 Betreuungsstunden erhält, davon 80 Prozent als direkte Betreuungszeit. Wohnen in einer AWG beispielsweise sechs Klienten, so hieße das, dass in diesem "Privatwohnraum" täglich 7,2 bis 9,6 Betreuungsstunden abgeleistet werden. Hinzu kommen dann noch evtl. die von der Pflegeversicherung finanzierten Pflegezeiten. Bei Träger B[6] befanden sich nach eigenen Angaben noch im Jahr 2007 zumindest in einigen AWG Diensträume des Personals. Die Institution hat dort also zumindest symbolisch ihre "Kolonialflagge" gehisst. Durch solche Kombinationen wird nach meiner Ansicht der Privatcharakter des eigenen Wohnraums zusätzlich stark in Frage gestellt.
In Kap. 2.2.1 hatte ich u.a. folgende drei Kriterien für die sozialrechtliche Einordnung einer Einrichtung in die Kategorie "stationär" herausgearbeitet:
-
Der Wohnraum des Klienten gehört in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und ist Teil eines Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernimmt von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
-
Existenz von Gemeinschaftseinrichtungen
Diese drei Merkmale werden bei dem vorliegenden Konzept der BSG für die Hamburger Ambulantisierungsprojekte keineswegs ausgeschlossen. Gerade bei der möglichen hohen Betreuungsdichte und wenn zusätzlich die Einrichtung entweder Dienstzimmer innerhalb der Wohnungen ihrer Klienten hat oder sich die Wohnungen innerhalb des Heimkomplexes befinden, erscheint es sehr naheliegend, dass der Träger faktisch zumindest bei einigen Bewohnern die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung übernimmt. Wohnungen dieser Art gehören zweifelsfrei in den Rechts- und Organisationsbereich des Trägers. Selbst wenn die Klienten-Wohnungen vermietet worden sind, so bleibt der Träger Eigentümer und verwaltet diese Wohnungen. Die Reduktion auf die heimrechtliche Bestimmung, der Trennung zwischen Miet- und Betreuungsvertrag, ist nach meiner Auffassung eine unzureichende Abgrenzung zwischen den Kategorien ambulant und stationär. Sie muss ergänzt werden durch eine faktische Trennung zwischen Wohnraumverfügung jeglicher Art und Betreuungsleistung, durch eine strikte Entflechtung von Immobilienbesitz und pädagogischer Dienstleistung. Zudem muss die direkte Betreuungspräsenz vor Ort auf ein Maß reduziert werden, das ein eigenverantwortliches und frei bestimmtes Leben im Alltag der Bewohner ermöglicht. Gleichwohl muss gewährleistet werden, dass jeder behinderte Mensch zu jeder Zeit die für ihn individuell notwendige und gewünschte Unterstützung erhält.
Als ein Euphemismus muss schließlich das Rückkehrrecht der "ambulantisierten" Klienten in die stationären Verhältnisse verstanden werden: Bewohner, deren stationäre Wohnplätze in ambulante umgewandelt werden, ziehen schließlich nicht aus dem Heim aus, vielmehr wird ihnen ihr Zimmer unter den Füßen weg ambulantisiert. Wollen sie dann "zurück", so muss entweder die gesamte Wohngruppe (AWG) ihr Rechtsverhältnis gegenüber dem Anbieter rückumwandeln oder, sofern es einzelne Bewohner sind, müssen diese ausziehen und sich neue Heimplätze suchen.
Während die rein rechtliche Trennung des Vertragsverhältnisses zwischen Bewohner und Einrichtung der Heimaufsicht nachgewiesen werden muss, entziehen sich die Veränderungen im lebensweltlichen Bereich der Betroffenen weitgehend der Kenntnis von Behörden und Öffentlichkeit. Die an der Ambulantisierung beteiligten Gruppen haben sich zwar auf eine Evaluation der "Nutzerzufriedenheit" verständigt (s. Teil D, Kap. 1.2), da diese als eine rein quantitative Befragung konzipiert worden ist, sind wohl kaum Aufschlüsse über die tatsächlichen Entwicklungen zu erwarten. Die LAG formulierte im September 2006 deswegen einige Fragen bezüglich der Auswirkungen auf die betroffenen Bewohner:
"Wie kann erreicht werden, dass sich in den 'Umwandlungsprojekten' die Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Privatheit der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner tatsächlich erweitert, dass es sich also bei der Umwandlung nicht lediglich um einen 'Türschildwechsel' handelt? Wie können Nutzerinnen und Nutzer bestimmen, mit wem sie zusammen wohnen? Inwieweit haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihr Recht auf freie Wahl der Dienstleister umzusetzen?" (LAG Hamburg 2006, s.p.)
Die Fragen erscheinen berechtigt, zumal langzeithospitalisierte Menschen oft nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse selbstbewusst und wirksam gegenüber der Institution zu vertreten. Eine rein forma-le Zustimmung muss noch lange nicht dem inneren Wunsch des Betroffenen entsprechen. Dieser Aspekt fehlt in den Vorgaben der BSG gänzlich. Und ob die Bewohner auch faktisch eine realistische Chance haben, ihren Betreuungsanbieter unabhängig von ihrem Mietverhältnis frei zu wählen, davon scheint die BSG nicht hundertprozentig überzeugt zu sein. Schließlich hat ihre Behörde eine zusätz-liche Hürde dafür aufgestellt: Nicht jeder einzelne Bewohner kann seinen pädagogischen Dienst frei wählen, sondern nur die gesamte Wohngemeinschaft. Faktisch dürfte nach meiner Einschätzung weiterhin eine Verknüpfung zwischen Wohnraumversorgung und Betreuung bestehen bleiben.
Insgesamt werte ich das neue Ambulantisierungsprogramm überwiegend als einen Etiketten-schwindel. Es zielt zu wenig auf den faktischen Auszug der Bewohner aus den Heimen. Was mir fehlt, ist der wirkliche Abbau der Heimplätze, die Schließung von Heimen statt deren "Umwandlung" bzw. Umbenennung.
Die XXX-Vereinigung Hamburg hat bezüglich ihrer stationären Wohneinrichtung in X bereits 1999 erste Überlegungen in Richtung Ambulantisierung angestellt. "Hintergrund war zum einen die zunehmende Baufälligkeit des alten Gebäudes, die eine Kernsanierung notwendig werden ließ. Ein Umzug in das eigene Nachbargebäude erschien daher als nahe liegend." (Lauenroth 2007, S.43) Inwieweit es anfangs auch um den strukturellen Aspekt einer Ambulantisierung ging, war nicht mehr rekonstruierbar. Deutlich wurde jedoch in verschiedenen Gesprächen, dass eine Sanierung des alten Hauses Kosten in Höhe mehrerer hunderttausend Euro verursacht hätte. Die Nutzung des Nebengebäudes erschien unter wirtschaftlichen Aspekten attraktiver. Zwar wurde dafür ein Umbau mit Kosten in Höhe von rd. 400.000 Euro notwendig, doch die Hälfte davon konnte durch eine Spende der "Aktion Mensch" erbracht werden. Desweiteren bot das umgebaute Nachbarhaus Platz für 23 Bewohner, während das alte Gebäude nur über 16 Wohnplätze verfügte. Auf diese Weise konnte eine Ambulantisierung auch eine Erweiterung der Wohnplätze ermöglichen.
Ende Oktober 2003 entwickelte das Team erste Konzeptentwürfe für eine Neuorganisation der Arbeitsstrukturen. Im Protokoll dieser Teamtage (XXX-Vereinigung Hamburg 2003) wurden u.a. folgende Ziele genannt, die in Richtung einer Ambulantisierung zeigen:
-
"Selbständigkeit der Bewohner fördern; eigenständiges Leben führen."
-
"Förderung von individuellen Fähigkeiten."
-
"Förderung der Entscheidungsfähigkeit der Bewohner."
-
"Mehr eingehen auf einzelne Bewohner; nicht nur Gruppenaktivitäten."
-
"Kontakte nach außen für Bewohner und Mitarbeiter nutzen."
-
"Begleitung - nichts abnehmen."
-
"Maximale Selbstbestimmung"
Das Team kritisierte bei dieser Veranstaltung auch deutlich die institutionellen Grenzen der Einrich-tung. Angeprangert wurde die Stadtrandlage des Hauses "mit wenig kulturellem Angebot". In der näheren Umgebung gebe es kaum eine Möglichkeit einzukaufen. Die Anbindung ans Netz der öffentlichen Verkehrsmittel sei "eingeschränkt" und die "gehobene Wohnumgebung" biete kaum Möglichkeiten für eine bessere Integration der Bewohner.
Auf der pädagogischen Ebene begründete der Auftraggeber seine Entscheidung für einen Umzug und eine Ambulantisierung u.a. damit, dass das alte Wohngebäude "typische Heimstrukturen auf-weist" und somit dort "keine konsequente Wohngruppenarbeit zu leisten ist." (W.A. 2008, S.8, anonymisierte Verfasserin) Es gab dort eine Zentralküche, ein zentrales Lebensmittellager, zwei zentrale Aufenthaltsräume und einen zentralen Dienstplan für die Betreuer. Die Privatsphäre der Bewohner beschränkte sich auf das eigene Zimmer. Es gab aber keine von der Gesamtstruktur abgetrennten Wohneinheiten. "Die Wahl zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit beschränkt sich somit auf die Wahl zwischen zwei Extremen: dem eigenen Zimmer und den Gemeinschaftsräumen." (Lauenroth 2007, S.43)
Der erste nach außen hin sichtbare Schritt zur Ambulantisierung wurde in den Jahren zwischen 2003 und 2005 deutlich. Eine Mitarbeiterin widmete sich der Aufgabe, für zwei Bewohner, die das Renten-alter erreicht hatten, eine passende Wohnform zu schaffen. Denn diese beiden Männer waren nun auch tagsüber zu Hause, benötigten weiterhin punktuelle Unterstützung im Alltag, aber keinen heim-typischen Service. In dieser Zeit wurde das Nebengebäude, in dem zuvor Jugendliche untergebracht waren, frei. Darin wurde dann die erste abgetrennte Wohneinheit eingerichtet. Ins Nebengebäude zogen außer den beiden Rentnern auch zwei jüngere Bewohner um, die bereits weitgehend selb-ständig leben konnten. Die zweite abgeschlossene Wohneinheit entstand innerhalb des alten Gebäudes. Dort wurde eine Einheit mit zwei Zimmern und einer Küche abgetrennt. Darin wohnten dann zwei weitere Bewohner. Auf diese Weise hatte die Institution den zentralen, geschlossenen Charakter des Heims bereits lange vor dem Beginn der geplanten Ambulantisierung in Teilen aufgelöst, relativ selbständige Bewohner aus der zentralistischen Raumstruktur entlassen und ihnen damit größere Autonomieräume und mehr Privatsphäre ermöglicht.
Anfang des Jahres 2006 schrieb der Einrichtungsleiter ein "Entwicklungskonzept X-Straße". Darin skizzierte er grob die Ziele und Schritte zur weiteren Ambulantisierung. Bis 2007 sollten im Nebengebäude "abgeschlossene Wohnungen für je drei bis vier Menschen entstehen." (XXX-Vereinigung Hamburg 2006, S.10) Darüber hinaus sollten innerhalb des Stadtteils zusätzlich neue Wohngemeinschaften gegründet werden, "die sich nicht auf dem Gelände befinden" (a.a.O), aber ambulant von den Mitarbeitern der Vereinigung betreut werden. Im Verlauf der Ambulantisierung sollten "Instrumente zur Dokumentation und Evaluation" entwickelt und eingeführt werden. Bei der individuellen Hilfeplanung sollten Bewohner, deren Angehörige und gesetzliche Betreuer einbezogen werden. Die Hilfeplanung sollte sich an den Stärken der Bewohner orientieren. Als methodisches Instrument plante der Einrichtungsleiter die Einführung von Gruppentagen. "Aktivitäten werden gemeinsam abgestimmt, geplant und durchgeführt. Es kann sich hier um eine gemeinsame Putzaktion handeln oder auch um die Organisation eines Festes innerhalb der Wohngemeinschaft." (ebd., S.12) Nach außen hin, so die Planung des Einrichtungsleiters, "wird auch beabsichtigt, Menschen mit Unterstützungsbedarf mehr in die Strukturen des Sozialraums zu integrieren." (ebd., S.13) Das Entwicklungskonzept blieb insgesamt jedoch sehr allgemein. Es wurden darin zwar einige Ziele genannt, methodische Operationalisierungen sucht der Leser aber vergeblich.
In den Teamsitzungen und in persönlichen Gesprächen konnte ich noch weitere Vorgaben der Leitung für die geplante Ambulantisierung erfahren: So sollte künftig die zentrale Dienstplanung aufgelöst werden. Die Bezugsbetreuer jeder Wohngruppe sollten ihre Arbeit autonom organisieren. An Stelle der zentralen Versorgung mit Lebensmitteln sollten die Betreuer eine dezentrale Versorgung innerhalb ihrer Wohngruppen entwickeln. Der vorherrschende Hotelservice sollte abgebaut werden. Stattdessen sollten die Hilfen individuell und zielgerichteter erfolgen.
Die von Markus Lauenroth entwickelte Methode zur Hilfeplanung sollte als verbindlicher Arbeitsauftrag an alle Bezugsbetreuer bis Ende Februar 2007 erstmals angewandt werden. Später nahm der Einrichtungsleiter diese Anordnung zurück und erklärte, die Anwendung der IHP solle freiwillig erfolgen. Auf eine Kontrolle werde verzichtet. Im Zusammenhang mit der neuen IHP sollte eine passende Methode zur Dokumentation entwickelt und eingeführt werden. Aktivitäten außerhalb des Hauses sollten gefördert und begleitet werden. Anstatt die Defizite der Bewohner ins Zentrum der Betrachtung zu rücken, sollte sich die Betreuung an den Ressourcen orientieren. Die Bewohner sollten darauf vorbereitet werden, noch besser mit Geld umzugehen. Eine Sozialpädagogin im Berufspraktikum wurde beauftragt, die Möglichkeiten zur sozialräumlichen Vernetzung zu erkunden und den Bewohnern die Nutzung dieser Möglichkeiten anzubieten.
Von Anfang 2007 bis etwa Mai 2007 fanden in unregelmäßigen Abständen Kleingruppen statt. Darin haben die Betreuer die Arbeitsstrukturen und Hilfebedarfe für ihre künftigen Wohngruppen geplant. Unter anderem wurden folgende Themen diskutiert:
-
Zusammensetzung der Wohngruppen: wer will mit wem zusammen wohnen? Wer passt zu wem?
-
Welcher Bewohner hat welche Hilfen nötig? Auf welche gegenwärtigen Hilfen kann verzichtet werden und welche Hilfen werden in der neuen Wohnform notwendig?
-
Verwaltung der Haushalte / Umgang mit Geld / Einkaufen / Kochen / Umgang mit Lebensmitteln
-
Welcher Bewohner benötigt welche Einrichtungsgegenstände? Wer organisiert Auswahl und Beschaffung?
-
Einrichtung der Küchen und Gemeinschaftsräume, Fußboden- und Wandgestaltung.
Insgesamt hatten sich vier Kleingruppen gebildet. Eine davon hatte sich bis Ende der Kleingruppen-phase kein einziges Mal getroffen. In den anderen Kleingruppen wurde eine kontinuierliche Arbeit erschwert, weil die Mitarbeiter nur unregelmäßig anwesend waren.
Der anfängliche Plan für den Ambulantisierungsprozesses sah folgenden Ablauf vor: Ende 2006/ Anfang 2007 ziehen die Bewohner in das Nebengebäude um. Zunächst bleibt der rechtliche Heim-status erhalten. Die Struktur der Betreuung wird gemäß den oben genannten Zielen vor und nach dem Umzug umorganisiert. Ein Bewohner zieht in eine andere Wohneinrichtung der Vereinigung um und wird dort ambulant betreut. Sechs Monate nach dem Umzug erfolgt bei allen Bewohnern gleichzeitig die rechtlich-formale Ambulantisierung, bei welcher die Heimverträge durch getrennte Miet- und Betreuungsverträge ersetzt werden. Sechs Monate nach diesem Schritt legt die Forschungsgruppe ihren Abschlussbericht zur Evaluation vor.
Das besondere Ambulantisierungskonzept des Auftraggebers fand sich in seiner Gesamtheit nirgendwo schriftlich fixiert. Es existierten nur Fragmente wie Protokolle, das "Entwicklungskonzept X-Straße" und mündliche Äußerungen. Das soweit rekonstruierte Konzept war mit den "harten" behördlichen Vorgaben der Stadt Hamburg kompatibel. Eine Trennung zwischen Miet- und Betreuungsverträgen war vorgesehen. Bezüglich der "weichen" Vorgaben zeigten sich jedoch einige Widersprüche: So sollten bis zur Schaffung neuer externer Wohngruppen alle Bewohner unter einem Dach wohnen, unter dem sich auch der Arbeitsraum der Betreuer befinden sollte. Die abseitige Wohnlage sollte erhalten bleiben.
In sozialrechtlicher Hinsicht fällt vor allem auf, dass bereits die Planung vorsah, alle Wohnräume weiterhin in der Rechts- und Organisationssphäre der Institution zu halten: Die "ambulante" Wohn-anlage sollte komplett vom Träger verwaltet werden. Der Träger sollte weiterhin die Gesamtverantwortung für die alltägliche Lebensführung zumindest bei einigen Bewohnern übernehmen. Eine Trennung zwischen Wohnraumvermietung und Betreuung erschien somit als rein formal. Faktisch sollten beide Rechtsbeziehungen als komplementäre Einheit eingegangen werden. Hausintern war dem Konzept zufolge allerdings eine deutliche Dezentralisierung vorgesehen, nach der die Bewohner ein höheres Maß an Autonomie sollten genießen können. Die alten Heimstrukturen sollten wesentlich gelockert werden, die Hilfeleistungen individualisiert und auf Hilfe zur Selbstbestimmung und Selbständigkeit umgestellt werden. Eine Vernetzung mit den Angeboten außerhalb des Hauses wurde zumindest angestrebt. Insofern sah das Konzept bereits deutliche "ambulante" Wesensmerkmale vor, war aber dennoch "stationär" geprägt. Als einen entscheidenden Schritt zur ambulanten Struktur sah ich vor allem die geplante Einrichtung von externen Wohn-gruppen an. Bezüglich der räumlichen Dezentralisierung war aber zunächst sogar ein Rückschritt geplant. Denn vor dem Gesamtumzug war bereits durch den Umzug von vier Bewohnern ins Neben-haus eine räumliche und lebensweltliche Freigabe erreicht worden, die mit dem Gesamtumzug ins Nebengebäude wieder zurück genommen werden sollte. Nach meiner Auffassung war der Ansatz zur schrittweisen Auslagerung einzelner Bewohner in relativ autonome Wohnräume der geeignetere Weg für eine Ambulantisierung, zumal dadurch der typisch stationäre Charakter "alle unter einem Dach" bereits in einem ersten Schritt überwunden worden war.
Mit der Aufgabenstellung einer teilnehmenden und intervenierenden Qualitätsentwicklung[7] habe ich, wenn auch in kritischer Distanz, an den Qualitätsdiskurs in der Sozialen Arbeit angeknüpft. Seit der Reform des § 93 BSHG im Jahre 1994 werden auch an die Träger der Eingliederungshilfe neue Anforderungen zur Überprüfung der Qualität gestellt. Im SGB XII, das Anfang 2005 das BSHG für den Leistungsbereich der Eingliederungshilfe abgelöst hat, wird vorgeschrieben: "Die Träger der Sozialhilfe vereinbaren mit dem Träger der Einrichtung Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie für den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeit- und Qualitätsprüfungen." (§76 Abs.3 SGB XII)
Die Einführung dieser neuen Qualitätsanforderungen an die Einrichtungsträger war 1994 im Rahmen des Zweiten Föderalen Konsolidierungsgesetzes in Kraft getreten. Mit diesem "Sparpaket" sollten explizit "Kürzungen bei der Sozialhilfe" erzielt werden. (BT-DrS.12/5510) Wie aus dem Gesetzestext deutlich hervorgeht, steht hier der Begriff der Qualität in enger Verbindung zum Imperativ der Wirtschaftlichkeit, also der Sparsamkeit. Diese Verbindung wird umso deutlicher im Kontext des politisch inszenierten Trägerwettbewerbs. Im Leistungsbereich der Sozialhilfe erstatten die Kostenträger seit 1994 nicht mehr sämtliche anfallende Kosten auf Grundlage von Vereinbarungen über Personal-schlüssel und Sachkosten etc. auch rückwirkend (Selbstkostendeckungsprinzip), sondern verein-baren mit den Einrichtungsträgern vorab bestimmte Tages- und Stundensätze (prospektive Entgelte). Seit 1996 stehen im Eingliederungsbereich die Träger der freien Wohlfahrtspflege zudem in direkter Konkurrenz zu privat-gewerblichen Anbietern. "Je nach Ausschreibungsvariante konkur-rieren die Anbieter (...) entweder um den Preis oder um den Preis verbunden mit einer 'fachlichen Leistungsdimension'" (Galiläer 2005, S.111) Die Instrumente zur Qualitätsentwicklung, -sicherung u. -management gewinnen in diesem veränderten Wirtschaftsrahmen eine ähnliche Bedeutung wie bei privaten Unternehmen im Dienstleistungssektor. "Der Sozialmarkt ist ein staatlich geschaffener als Mittel zur Kostenreduktion. Die Anbieter versuchen sich in der Konkurrenz, u. a. durch Qualitäts-sicherungsverfahren, die zu Werbeverfahren benutzt werden, zu bewähren." (Lauenroth 2007, S.10)
Auf diesem sozialpolitischen Hintergrund wundert es nicht, dass die Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit bislang weniger an fachlichen Überlegungen oder Bedürfnissen der Klienten ausgerichtet ist, sondern vielmehr aus betriebswirtschaftlicher Perspektive geführt wird. (Vgl. Lauenroth 2007, S.19) Dementsprechend haben sich in Deutschland die beiden betriebswirtschaftlich orientierten Modelle der DIN EN ISO 9000 bis 9004 und das der European Foundation of Quality Management (EFQM) durchgesetzt.
Die ISO 9000ff. wurde von der International Organization for Standardization (ISO) entwickelt und vom Deutschen Institut für Normung (DIN) sowie dem Europäischen Komitee für Normung (EN) übernommen. Sie bezog sich ursprünglich auf den industriellen Fertigungsbereich, den sie mit ihren 20 Normelementen vollständig zu erfassen beansprucht. In der Norm 9004 wird versucht, diese Anforderungen auf den Dienstleistungsbereich zu übertragen. Inhalt der Normenreihe ist nicht die Qualität des Produktes, sondern der Prozessablauf. Einrichtungen, die ihr Qualitätsmanagement nach der ISO 9000ff. ausrichten, erstellen ein Qualitätshandbuch, das sich an den organisatorischen Kategorien der Norm orientiert. Für jedes Prozesselement wie beispielsweise Verantwortung der Leitung, Endprüfung, Designlenkung oder Beschaffung müssen standardisierte Abläufe beschrieben werden. Diese aus der Wirtschaft übernommenen Kategorien müssen zuvor allerdings begrifflich in das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit übertragen werden. Als Ergebnis regelt das Qualitäts-handbuch sehr detailliert die Verfahrensabläufe auf rein formaler Ebene. In einer Einrichtung der ambulanten Behindertenhilfe, in der ich gearbeitet habe, gab es im QM-Buch genaue Anweisungen z. B. zur Benutzung des Dienstwagens, zum Notieren von Telefongesprächen, aber auch standardisierte Anweisungen zur Bearbeitung von Nutzer-Anfragen, zur Dokumentation und zur Hilfeplanung. Das System der ISO 9000ff. schreibt an sich nur vor, für welche Bereiche der Arbeit eine standardisierte Prozessbeschreibung erstellt wird, nicht aber wie der Prozess ablaufen soll. Bei der Qualitätsprüfung geht es dann darum, festzustellen, ob diese Prozessanweisungen auch in der Praxis umgesetzt werden. Dies wird durch Überprüfung der Dokumentationen und durch Audits (Verhöre) der Mitarbeiter erreicht.
Merchel sieht bei diesem QM-System die Tendenz zu einer "bürokratischen Erstarrung". "Es besteht die Gefahr, dass die Qualitätsdebatte auf die Frage des Einhaltens von Standards konzentriert wird und nur schwer zur Reflexion der Standards und des angemessenen Umgangs mit den Standards vordringt." (Merchel 2004, S.70) Die notwendige Flexibilität beim sozialpädagogischen Handeln wird möglicherweise eingeschränkt und es entsteht für die Mitarbeiter ein relativ hoher Aufwand beim Beachten von Checklisten und dem Ausfüllen von Dokumentationsbögen. Was die betreffende ISO-Reihe nicht vorgebe, sind Kriterien zur fachlichen Qualität der Arbeit. Ob also die Stärkung der Autonomie der Klienten erreicht werden soll oder deren zunehmende Entmündigung: darüber macht das System keine Aussagen, sondern nur darüber, dass der Prozess, wie auch immer er inhaltlich aussehen mag, standardisiert und überprüft werden muss.
Qualität nach der ISO 9000ff. besagt also nichts über die qualitative Beschaffenheit des Produktes und der Arbeit. Für die Soziale Arbeit erscheint sie als wenig hilfreich, denn erstens erfordert sie ein hohes Ausmaß an bürokratischer Belastung, sie ist mit hohen Kosten verbunden und muss, um pädagogisch eine gewisse Sinnhaftigkeit entfalten zu können, ohnehin noch mit fachlichen Inhalten gefüllt werden. Große Einrichtungen nutzen aber häufig das ISO-System deswegen, weil sie oftmals im Werkstattbereich mit Industrieunternehmen kooperieren und somit mit der industriellen Normung kompatibel sein müssen. Der Einfachheit halber, so meine Erfahrung, bleibt es dann für den gesamten Träger bei einem QM-System und einer zentralen Fachstelle für Qualitätsmanagement.
Im Unterschied zur ISO 9000ff. bietet das EFQM-Modell seinen Anwendern ansatzweise auch in-haltliche Orientierung bei der Qualitätsprüfung und -entwicklung. "Es werden neun Kriterienbündel zugrunde gelegt, nach denen eine umfassende, regelmäßige und systematische Bewertung der Tätigkeit und Ergebnisse einer Organisation erfolgen soll." (Merchel 2004, S.71) Diese neun Kriterien werden unterteilt in "qualitätsfördernde Gestaltungsfaktoren" und "Ergebnisse der Qualitätsaktivitäten". Zu den Kriterien des ersten Bereichs gehören Führung, Politik und Strategie, Mitarbeiterführung, Ressourcen und Partnerschaften sowie Prozesse. Zum zweiten Bereich zählen Mitarbeiter-bezogene Ergebnisse (Zufriedenheit, Einstellung der Mitarbeiter zum Unternehmen), kunden-bezogene Ergebnisse, Wirkung des Unternehmens in der Gesellschaft und Leistungsergebnisse (finanzielle und nichtfinanzielle Ergebnisse). (Vgl. ebd., 71f.)
Diese noch sehr allgemeinen Kriterien werden durch Unterkriterien näher konkretisiert, z.B.: "Füh-rungskräfte fördern den Verbesserungsprozess und die Mitwirkung daran, indem sie geeignete Res-sourcen zur Verfügung stellen und Unterstützung gewähren." (ebd., S.72) Welche Ergebnisse und Beobachtungen als Indikatoren für die Bewertung der Unterkriterien herangezogen werden sollen, bleibt dann allerdings offen, also beispielsweise: woran wird die Eignung der Ressourcen sowie Güte und Umfang der Unterstützung gemessen? Zur Prüfung des Qualitätsstandes einer Organisation werden die einzelnen Kriterien und Unterkriterien bewertet. Anhand dieser Bewertung sollen dann ein Verbesserungsprozess eingeleitet werden und die Ergebnisse fortlaufend evaluiert werden. Merchel weist darauf hin, dass auch dieses System auf die Soziale Arbeit nur mit entsprechender Übersetzung bzw. Konkretisierung der Kriterien übertragbar ist. "Allerdings muss man sich bewusst sein, dass jede Konkretisierung und jede einrichtungsspezifische Ausformung der Kriterien zwar die spezifische Situation der einzelnen Einrichtung immer besser erfassen kann und daher die Identifikation der Mitarbeiter mit den so konkretisierten Kriterien erhöht, dass aber dadurch die Vergleichbarkeit mit anderen Institutionen sukzessive eingeschränkt wird." (ebd., S.75)
Im Resultat erweist sich auch das EFQM als ein formales Modell, das wenig konkrete Inhalte für die qualitative Beurteilung einer sozialpädagogischen Einrichtung bietet. Für die "Kunden", Klienten und Finanzierungsträger können Qualitätsberichte nach dem EFQM-Modell ebenso wie nach der ISO 9000ff. kaum Anhaltspunkte für einen Preis-Leistungsvergleich auf dem Sozialmarkt bieten und ebenso wenig etwas über die Verbesserung der Lebensqualität der Klienten aussagen.
Für die Soziale Arbeit als brauchbarer erweisen sich inhaltlich-fachliche Qualitätsentwicklungssysteme. Für den Bereich der Behindertenhilfe hat die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. das LEWO II entwickeln lassen: "Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung - Ein Instrument für fachliches Qualitätsmanagement" (Schwarte/Oberste-Ufer 2001) Im Unterschied zur ISO 9000ff. und EFQM bietet LEWO II einen weit umfassenden Katalog von Kriterien, mit denen die Güte einer Wohneinrichtung bewertet werden kann. So werden die Bewohner etwa danach befragt, in welchem Umfang sie ihre Privaträume gestalten können (Vgl. ebd., S.185), inwieweit Zeitpunkt und Dauer von Alltagshandlungen von den Klienten selbst bestimmt werden können (Vgl. ebd.: 242), ebenso gibt das Handbuch Empfehlungen für die Lage und Aus-stattung der Wohnheime, für den Datenschutz und die Auswahlkriterien von neuen Mitarbeitern. LEWO II umfasst 523 Seiten und liest sich wie die Gebrauchsanweisung für den Betrieb eines perfekten Heims, auch die Methoden zur Evaluation der Qualitätskriterien werden benannt. Dabei wird nicht nur auf standardisierte Fragebögen gesetzt, sondern auch auf "qualitative Verfahren" (ebd., S.63), auf offene Gespräche, biografische Rekonstruktionen und Teilnehmende Beobachtung.
Das Konzept LEWO II kommt jedoch nicht ohne quantifizierende und realabstrahierende Verfahren aus. Die qualitativen Indikatoren werden jeweils mit einer vierstufigen Skala von 0 bis 3 bewertet: 0 bedeutet "trifft nicht zu" und 3 bedeutet "trifft zu". Die Autoren stellen selber fest, dass die gleiche Ziffer für verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutungen haben kann, und degradieren ihre Skalierung im gleichen Schritt zu einem Hilfsmittel der Reflexion und Begründung: "Insofern ist nicht die Bewertung der Indikatoren mit einer Ziffer, sondern die individuelle Begründung der Einschätzungen und das gemeinsame Erarbeiten von möglichen Problemursachen und Wirkungen sowie von Ansätzen zur Verbesserung der Arbeit der zentrale Arbeitsschritt zur Qualitätsprüfung und -entwicklung in einem wohnbezogenen Dienst." (ebd., S.87) Die Sinnhaftigkeit der Skalierung erscheint somit noch zweifelhafter: Soll damit eine scheinbare wissenschaftliche Exaktheit konstruiert werden, in dem Sinne, dass erst, wenn man genaue Zahlen hat, man unangreifbare Fakten präsentieren kann? Bei genauerem Hinsehen bleibt die inhaltliche Aussage einer Bewertung mit 1,2, oder 3 allerdings sehr arm. Welcher konkrete Wunsch oder welche konkrete Kritik will der Klient mit der Nennung einer Ziffer zum Ausdruck bringen? Was kann daraus folgen?
Als problematisch erscheint es auch, vorab festgelegte Indikatoren auf alle Einrichtungen von außen her übertragen zu wollen. Hier besteht die Gefahr, von den realen Bedingungen, den Besonderheiten der Einrichtung und der Bewohner zu abstrahieren. Diese Gefahr sehen auch die LEWO II-Autoren und schlagen vor, nicht jeden Indikator einzeln, sondern die Indikatoren im Zusammenhang zu betrachten. Einzelne Indikatoren könnten symbolisch verstanden werden: Wenn beispielsweise ein Bewohner für seinen Privatraum über keinen eigenen Schlüssel verfügt, was ein entsprechender Indikator verlangt, so sei zu fragen, inwieweit die Privatsphäre anders gesichert werden könne. (vgl. ebd., S.88) "Ich frage mich allerdings, ob es nicht ein unnötiger Umweg ist, zunächst die Qualitätskriterien zu operationalisieren, um anschließend den umgekehrten Weg der Entschlüsselung der Indikatoren zu gehen, um letztlich die Kriterien auf den 'Einzelfall' hin erneut zu operationalisieren." (Lauenroth 2007, S.30)
In meinem Ansatz zur Qualitätsentwicklung habe ich vielmehr versucht, von der konkreten Einrichtung auszugehen, sie in ihrer Widersprüchlichkeit konkret zu analysieren und dialogisch eine qualitative Weiterentwicklung zu fördern. Dennoch halte ich die in LEWO II empirisch abgeleiteten Kriterien und Indikatoren für nützlich. Sie können dazu dienen, über den eigenen "Tellerrand" der Einrichtung, ihre eingeschliffenen Selbstverständlichkeiten und Traditionen hinaus zu blicken und diese zu hinterfragen. Sofern man sich nur auf das Feld einer Einrichtung beschränkt, besteht nämlich die Gefahr, das Vorgefundene zu verabsolutieren und sich vom eingeschränkten Stand-punkt der Subjekte ebenfalls einschränken zu lassen. Die Kriterien und Indikatoren in LEWO II bieten einen wertvollen Vergleich zu dem, was in anderen Einrichtungen möglich ist. Sie schärfen die Sensibilität für Einzelheiten, die dem unbedarften Betrachter und den Beteiligten in der Einrichtung leicht entgehen können.
Grundsätzlich stimme ich mit LEWO II darin überein, dass unter dem Begriff "Qualität" die konkrete Beschaffenheit von Lebensbedingungen der Bewohner zu verstehen sein sollte, und nicht die Standardisierung beliebiger Prozessabläufe. Qualität bedeutet auch Nützlichkeit und Zweckdienlichkeit der eingesetzten pädagogischen Mittel zur Verbesserung der Lebensqualität der Klienten.
In meiner Evaluation sowie in der Individuellen Hilfeplanung (s. Teil D) meines Kollegen Markus Lauenroth wurde versucht, die Kriterien und Indikatoren primär induktiv aus dem konkreten sozialen Feld der Forschung heraus abzuleiten und sie in ihrer dialektischen Vermitteltheit zu verstehen. Es geht also nicht darum, einzelne Segmente des Lebens in der Einrichtung künstlich aus ihrer Gesamtheit herauszulösen, zu parzellieren, sondern sie in ihrer Verbindung und Wechselwirkung zu betrachten.
Wenn in dem vorliegenden Projekt einer Qualitätsentwicklung zwar grundsätzlich Kriterien und Indikatoren von innen heraus, von den Bedürfnissen der Bewohner und aus den realen Widersprüchen der beteiligten Subjekte entwickelt worden sind, so heißt das aber nicht, dass es frei von gewissen Außenkriterien war. Wie ich in Teil A ausgeführt habe, hat zum einen die Einrichtungsleitung bereits mit ihren anfänglichen Fragestellungen Kriterien vorgegeben, nach denen sie selber die Qualität ihrer Einrichtung bewertet haben mochte. Zum anderen fand der Prozess zur Qualitätsentwicklung im politischen Rahmen eines landesweiten Ambulantisierungsprogramms (s. Teil B, Kap.2.3) statt. Den Abschlussbericht zur Evaluation sollte der Träger der zuständigen Behörde vorlegen. Von daher musste die Qualität der Einrichtung, also ihre Beschaffenheit, immer auch daran gemessen werden, inwieweit sie den Implikationen, die der Begriff "ambulant" mit sich bringt, entsprach. Das übergeordnete Ziel dieser Qualitätsentwicklung lautete stets: Die anfangs stationäre Einrichtung soll sich in ihrer Beschaffenheit im Laufe des Prozesses in eine ambulante Wohn- und Betreuungsform umwandeln. Zu fragen war: Inwieweit entsprechen die konkreten Qualitäten der Einrichtung am Ende des wissenschaftlich begleiteten Prozesses den begrifflich abgeleiteten "ambulanten" Inhalten?
Der Schwerpunkt dieser teilnehmenden und intervenierenden Qualitätsentwicklung lag auf dem Aspekt der Entwicklung. Es ging darum, Qualitäten durch direkte Teilnahme am Geschehen in der Einrichtung zu erfahren und sie darüber hinaus weiter zu entwickeln, anstatt bestehende Qualitäten festzuschreiben und zu sichern. Von daher war mein Ansatz wie der der Forschungsgruppe insgesamt ein praktischer. Schwerpunkte waren Intervention, Begleitung und Beratung der Akteure im Handlungsfeld. Dazu gehörten eine Individuelle Hilfeplanung und eine Evaluation der Bewohnerzufriedenheit. Diese hatten stets prozesshaften Charakter. Zu ihnen gehörten Konflikte, Diskussionen und intervenierende Projekte (s. Teil D, Kap. 2 u.3), die mitunter auch gegen den Widerstand der Einrichtung durchgeführt worden sind, um qualitative Entwicklungen anstoßen zu können.
Gegenstand meiner Evaluation ist die Zufriedenheit der Bewohner. Sie sollte vor Beginn und nach Abschluss der Ambulantisierung durchgeführt und der Hamburger Sozialbehörde vorgelegt werden. Mit dieser Überprüfung wollte die Stadt ein Feedback durch die von ihrer politischen Maßnahme betroffenen Bürger einholen, sich ihrer Zustimmung rückversichern und ihr politisches Handeln legitimieren. Verfahren dieser Art sind im politischen und wirtschaftlichen Alltag keine Seltenheit.
Für die Zufriedenheit ihrer Kunden interessieren sich die Unternehmen besonders in der Medienbranche. Kaum ein Internetanbieter verzichtet auf die Befragung, hat man eine Ware bestellt, Freizeitangebote recherchiert oder einfach nur einen Zeitungsartikel gelesen. Auf das Probeabo einer Zeitung folgt stets der Evaluationsfragebogen. Er ist fester Bestandteil des Marketings und meist mit einem neuen Vertragsangebot verbunden. Das Unternehmen zeigt Interesse an den Wünschen seiner Kundschaft, obwohl in der Hotline nur die Musikschleife erreichbar ist, verklausulierte Vertragsbedingungen zur Knebel und private Kundendaten wie auf dem Basar gehandelt werden.
Die Kundenzufriedenheit zu evaluieren, ist Marketing, sie zu manipulieren ebenso. Die öffentlichen Verwaltungen sind seit den 1990er Jahren ideologisch dem Modell der Privatunternehmen gefolgt und haben Ortsämter zu "Dienstleistungscenter" umbenannt, aus Antragstellern wurden "Kunden" beim "Job-Center". Die Meinung der Studenten wird am Ende des Semesters mit Evaluationsbögen erfragt, gleichwohl diesen neuen "Kunden" bei der Einführung von Studiengebühren kein Wort der Mitsprache eingeräumt worden ist. Evaluiert wird vor allem dort und auf solche Weise, wo und wie die Ergebnisse ohnehin entweder positiv ausfallen oder irrelevant bleiben.
Damit meine ich nicht, dass die Zufriedenheit eines Kunden gänzlich belanglos sei. Er bezahlt schließlich die Ware bzw. Dienstleistung mit seinem Geld. Fragwürdig wird die Kategorie aber zumindest im pädagogischen Bereich: Was nützt mir ein Dozent, der eine zufriedenstellend leichte Kost verabreicht, wenig Mitarbeit abverlangt und am Ende ohnehin gute Noten verteilt? Er mag gut gefüllte Seminare bieten, aber in meiner wissenschaftlichen Entwicklung hilft er mir nicht viel weiter. Die Frage nach der Zufriedenheit wirkt an dieser Stelle fehlplaziert, weil sie zu sehr an der Oberfläche haften bleibt.
Bei Hegel gilt die Zufriedenheit als ein "praktisches Gefühl":
"Das praktische Gefühl enthält das Sollen, seine Selbstbestimmung als an sich seiend, bezogen auf eine seiende Einzelheit, die nur in Angemessenheit zu jener als gültig sei. Da beiden in dieser Unmittelbarkeit noch objektive Bestimmung fehlt, so ist diese Beziehung des Bedürfnisses auf das Dasein das ganz subjektive und oberflächliche Gefühl des Angenehmen oder Unangenehmen. Vergnügen, Freude, Schmerz usf., Scham, Reue, Zufriedenheit usw. sind teils nur Modifikationen des formellen praktischen Gefühls überhaupt, teils aber durch ihren Inhalt, der die Bestimmtheit des Sollens ausmacht, verschieden." (Hegel 1990, S.382)
Das Gefühl der Zufriedenheit ist unmittelbar und oberflächlich: "Die Form des Gefühls ist, dass es zwar eine bestimmte Affektion, aber diese Bestimmtheit einfach ist. Darum hat ein Gefühl, wenn sein Inhalt doch der gediegenste und wahrste ist, die Form zufälliger Partikularität, außerdem dass der Inhalt ebensowohl der dürftigste und unwahrste sein kann." (Hegel 1981, S.247) Im Unterschied zur Zufriedenheit findet sich in der "Phänomenologie des Geistes" der Begriff der Bildung. Dieser weist über die unmittelbare Zufriedenheit hinaus und eignet sich für das Feld der Behindertenhilfe insofern, als er auf Freiheit, Selbstbewusstsein und Entwicklung zielt. Bei Hegel bedeutet Bildung zugleich Arbeit am Gegenstand und Kampf zwischen Herr und Knecht. "Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder sie bildet." (Hegel 1973, S.153) Gehemmte Begierde beeinträchtigt unmittelbar das Gefühl der Zufriedenheit, führt aber zu einem gegenständlichen Resultat, in welchem sich das Bewusstsein wiedererkennen kann. "Das arbeitende Bewusstsein kommt also hierdurch zur Anschauung des selbständigen Seins als seiner selbst." (ebd., S.154) Durch die Arbeit, also erst durch die vermittelte Zufriedenheit, entwickelt sich die reife Persönlichkeit. Der Knecht eignet sich in diesem Prozess die Fähigkeiten an, die zum Leben notwendig sind und entmachtet damit seinen Herrn. Schließlich kommt es in Hegels Herr-Knecht-Dialektik zum Kampf um Leben und Tod. Der Knecht riskiert sein Leben, um seiner Freiheit willen und gewinnt bei glücklichem Ausgang sein "selbständiges Selbstbewusstsein". Die dramatische Darstellung Hegels, die erstmals 1807 veröffentlicht worden ist, lässt sich keineswegs wörtlich auf die Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen Anfang des 21. Jahrhunderts übertragen. Sein Begriff der Bildung erscheint dennoch als kompatibel zu meinem Begriff der Ambulantisierung, in dessen Kontext die Zufriedenheit evaluiert werden soll. (Vgl. Kap. 2.1.1 u. 2.2.2). Er untermauert zugleich meinen in Teil C, Kapitel 1.1 begründeten emanzipatorischen Auftrag meines Forschungskonzeptes.
Eine Evaluation von Zufriedenheit auf diesem Hintergrund muss über das unmittelbare Gefühl hinausgehen. Sie muss stets die Aspekte der Entwicklung, der Freiheit, der Teilhabeerweiterung berücksichtigen. Zufriedenheit will ich somit nicht (nur) als punktuelles emotionales Verhalten zu bestimmten, einzelnen Bedingungen erfassen, sondern als Prozess der Auseinandersetzung mit der sozialen und natürlichen Umwelt, als Entwicklung von Möglichkeiten, als Bildungsprozess, wie ich sie exemplarisch mit meinen intervenierenden Projekten versucht habe. (s. Teil D, Kap. 2.1/3.3)
Die Zufriedenheit muss darüber hinaus im konkret sozialen und biografischen Kontext betrachtet werden. Die Zufriedenheit bezüglich einer konkreten Situation hängt ganz wesentlich von den persönlichen Vergleichsmöglichkeiten ab. Personen, die fast ihr gesamtes Leben lang nur in Sonder-anstalten für behinderte Menschen gelebt haben, fehlt der Vergleich zu einem Leben in der eigenen Wohnung. Zufriedenheit ist somit immer gesellschaftlich vermittelt. Die Gesellschaft weist Kraft ihrer Institutionen den Individuen selektiv unterschiedliche Lebens- und Vergleichsmöglichkeiten zu. Die Institution der "geistigen Behinderung" ist eine solche, die Menschen an gewisse Orte verweist und von anderen ausschließt. Wem Vergleichsmöglichkeiten vorenthalten werden, der kann das Bestehende leicht als ein Zufriedenstellendes bestätigen. Zufriedenheitsmessungen laufen damit Gefahr, ausgrenzende Strukturen ideologisch zu legitimieren, die Ausgegrenzten selber als Fürsprecher ihrer eigenen sozialen Lage zu instrumentalisieren. Unzufriedenheit ist der Vorbote zur Veränderung, wo er auftritt, verliert Ausgrenzung ihren Anschein der Unabdingbarkeit.
In meiner Evaluation der Zufriedenheit habe ich statt einer quantitativen Messung versucht, mich qualitativ und narrativ der Substanz der Zufriedenheit zu nähern. Es sollte nicht darum gehen, Antworten zu zählen und gegenüber zu stellen, sondern konkretes Erleben im Spiegel der betreffenden Individuen und im Kontext der sozialen Bedingungen als Entwicklung zu verstehen. Dabei sollten Möglichkeiten und Widersprüche sichtbar gemacht werden. Meine Evaluation war weniger eine Befragung, obwohl auch solche Elemente dazu gehörten, sondern vielmehr eine teilnehmende und intervenierende Forschung. Dem Bericht einzelner Szenen schrieb ich mehr Bedeutung zu als der Erfassung aller Bewertungen sämtlicher Bewohner, denn das Allgemeine spiegelt sich mehr oder minder exemplarisch im Besonderen wider und wird darin anschaulich und konkret, sofern es die allgemeinen Strukturen reflektiert.
Ziel meiner Evaluation sollte letztlich die Weiterentwicklung der Einrichtung in Richtung einer Ambulantisierung sein, zu der eine Erweiterung der Autonomie und Teilhabe jedes Klienten dazu gehören. Der Evaluationsprozess selbst sollte Auseinandersetzung bedeuten und ein Bildungsprozess sein. Er sollte stets über das unmittelbare und gediegene Ist-Gefühl hinausgehen, was ich z.B. in meinem Koch-Projekt praktische ausgeführt habe. (s. Teil D, Kap. 3.3)
Trotz dieser Vermittlungsbemühungen war es kaum möglich, umhin zu kommen, auch unmittelbare oder direkte Zufriedenheitsbewertungen erfassen zu müssen. Diese unmittelbare Zufriedenheit, bei-spielsweise mit den Einkaufsmöglichkeiten oder dem Schutz vor Gewalt, halte ich für ein legitimes Bedürfnis, das auch in seiner Unmittelbarkeit berechtigt ist. Unmittelbare Zufriedenheit muss nicht falsch sein, aber sie alleine reicht nicht aus, um dem Auftrag der Eingliederungshilfe gerecht werden zu können, nämlich den Klienten dabei zu helfen, schrittweise unabhängiger von fremder Hilfe zu werden und am Leben der Gemeinschaft teilhaben zu können. Um die unvermittelten Zufriedenheiten, die immer wieder kommuniziert worden sind, qualitativ differenzieren zu können, habe ich behelfsweise die Kategorien "erfüllte Zufriedenheit", "resignative Zufriedenheit" und "produktive Unzufriedenheit" eingeführt: Der Begriff der "resignativen Zufriedenheit" verallgemeinert das Gefühl, das entsteht, wenn sich das Individuum in schlecht bestehende Verhältnisse eingewöhnt hat, ohne Hoffnung auf deren Veränderbarkeit. Erfüllte Zufriedenheit hingegen bringt zum Ausdruck, dass das, was sein soll, auch ist. Unzufriedenheit kann ebenso abstrakt und allgemein sein, unbegriffen und ziellos, sie kann aber auch gezielt auf konkrete Bedingungen gerichtet sein und/oder produktiv, indem sie Veränderungen vorantreibt (produktive Unzufriedenheit).
Diese Unterkategorien habe ich nur behelfsweise eingeführt, weil sich in der weiteren Praxis bald herausgestellt hatte, dass es nicht immer leicht war, die einzelnen Äußerungen treffsicher zuzuordnen. In meiner Auswertung kommen Zuordnungen dieser Art nur selten vor. Stattdessen habe ich mit diesen Behelfskategorien operative Arbeitshypothesen gebildet und daran weiter evaluiert bzw. ich habe die konkreten Äußerungen in den Kontext ihrer sozialen Situation hinein versetzt, so dass die Qualität der jeweiligen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit konkret verständlich werden konnte. Zufriedenheitsausdrücke sind immer situativ an den Kontext gebunden. Sie sind in konkreten Szenen erfahrbar. Erst im Begreifen einer gesamten Szene können Ausdrücke bezüglich der Zufriedenheit verständlich gedeutet werden. Unscharf bleibt dies dennoch, weil die Deutungsmuster der Bewohner, mit denen sie konkrete Situationen wahrnehmen, interpretieren und daraus Handlungen ableiten, mir nur bedingt zugänglich waren.
Aufgrund dieser erkenntnistheoretischen Prämissen verzichte ich darauf, für alle Bewohner übergreifende oder durchschnittliche Zufriedenheitheitswerte zu messen. Nicht alle Bewohner haben sich zu allen Themen geäußert. Mir kam es vielmehr auf konkrete Beispiele an, in denen sich einzelne Bewohner über gewisse Lebensbereiche mitteilen konnten. Konkrete Äußerungen einzelner Personen können durchaus mehr Auskunft über Bedingungen in der Einrichtung geben und auf Möglichkeiten zu deren Veränderung hinweisen als exakt berechnete Durchschnittswerte. Bei einigen Themen, die ich ausführe, kann ich Übereinstimmungen von mehreren Bewohnern mit Zahlen benennen. In anderen Bereichen halte ich mich zurück und beschreibe meine aus zahlreichen Einzelbeobachtungen verallgemeinerten Einschätzungen. Hier fließt notwendig mein eigener subjektiver Faktor verstärkt mit ein.
Ihre Zufriedenheit und Unzufriedenheit haben die Bewohner nur teilweise sprachlich ausgedrückt. Die meisten Bewohner aber äußerten ihre Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit durch Handlungen, Gestik und Mimik. Als Unzufriedenheitsausdrücke habe ich beispielsweise Handlungen gedeutet wie diese: Ein Bewohner wirft Tassen vom Tisch auf den Boden; eine andere Bewohnerin schlägt sich mit beiden Fäusten gegen den Kopf; stereotypes Auf- und Abgehen in einem Raum; eine tief zum Boden gesenkte Körperhaltung; unverständliches Schreien und Jammern; Zittern; Weinen...
Vor allem in den Auswertungen meiner intervenierenden Projekte in Teil D habe ich einzelne Szenen dargestellt und analysiert. Damit versuche ich erfahrbare Zufriedenheit und auch Unzufriedenheit in ihrer konkreten Bestimmtheit verständig zu machen, um somit Ansätze zur praktischen Veränderung sichtbar werden zu lassen.
[3] Der Begriff "Zone der nächsten Entwicklung" ist von Lew Vygotskij geprägt worden und wird im Abschnitt über den Behinderungsbegriff in der kulturhistorischen Schule ausgeführt. Siehe Kap. 1.4.1
[4] Ich beziehe mich auf Adorno und übertrage sein Diktum "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" (Adorno 1985, S. 42) auf das Problem der Begriffsfindung in diesem Bereich.
[5] In Anlehnung an Jürgen Habermas. Dieser trennt zwischen System (Staat u. Markt) und Lebenswelt. Eine Kolonialisierung der Lebenswelt sieht Habermas da, wo das System durch seine Steuerungsmedien Macht und Geld den lebensweltlichen Bereich seiner Handlungslogik unterwirft.
[6] Anonymisierte Bezeichnung
[7] Meine teilnehmende und intervenierende Qualitätsentwicklung folgt meinem entsprechenden Forschungskonzept, das ich in Teil C ausgeführt habe.
Inhaltsverzeichnis
Mein teilnehmendes und intervenierendes Forschungskonzept soll dem Grundsatz der "Gegen-standsadäquatheit" (Holzkamp 1985, S. 520ff.) entsprechen. Dieser findet sich sinngemäß auch in der Kritischen Theorie: "Die Sache muss in der Methode ihrem Gewicht nach zur Geltung kommen, sonst ist die geschliffenste Methode schlecht." (Adorno 1979a, S.557) Forschungskonzept und Forschungsgegenstand stehen in einem wechselseitigen Verhältnis. Sie sind zwar getrennt, aber keineswegs unabhängig, ebenso wie Subjekt und Objekt. "Die Trennung von Subjekt und Objekt ist real und Schein. Wahr, weil sie im Bereich der Erkenntnis der realen Trennung, der Gespaltenheit des menschlichen Zustands, einem zwangvoll Gewordenen Ausdruck verleiht; unwahr, weil die gewordene Trennung nicht hypostasiert, nicht zur Invarianten verzaubert werden darf." (Adorno 1984, S. 75)
Statt diese Trennung zu hypostasieren, habe ich eine Vermittlung beider Pole versucht. Ich habe darauf verzichtet, vorab bestimmte Methoden auszuwählen und diese dann programmatisch umzusetzen. Vielmehr habe ich aus den Aufgabenstellungen und der Beschaffenheit des Gegenstandsbereiches heraus induktiv Methoden und Ansätze gesucht, mit denen ich brauchbare und dem Gegenstand entsprechende Lösungen für möglich hielt. Grundsätzlich war mein methodisches Handeln im Forschungsalltag überwiegend durch Teilnahme und Intervention gekennzeichnet und weit weniger theoriegeleitet, als es in dieser schriftlichen Form den Anschein erwecken mag. Meist reflektierte ich erst in der Retrospektive die methodologische Systematik meines Handelns und nutzte verschiedene sozialwissenschaftliche Theorien, um meine Daten im Nachhinein aus unterschiedlichen Richtungen zu betrachten. Auch dieses Kapitel habe ich aus der Retrospektive geschrieben, als letzten Teil dieser Arbeit. Die Systematik meiner Ansätze und Methoden ist also nicht Ausgangspunkt meiner Forschung gewesen, sondern vielmehr ihr Endpunkt, eine nachträgliche Rekonstruktion dessen, wessen ich mich praktisch bedient habe.
Diese Herangehensweise führte zwar zu einem gewissen Eklektizismus, der aber vom Standpunkt meiner eigenen Subjektivität heraus authentisch erscheint, weil er meine wissenschaftliche Sozialisation in einer Zeit am "Ende der großen Entwürfe"[8]. widerspiegelt, die vom postmodernen Denken nicht unwesentlich bereichert worden ist. Gegenstandsadäquatheit bedeutet schließlich auch Adäquatheit der Ansätze und Methoden in Bezug auf den Forscher selber. Er ist Subjekt und Objekt zugleich, weshalb wer sich selber, seine theoretischen Bezüge sowie seine Praxis fortlaufend zu reflektieren hat.
Meine sozialwissenschaftliche Grundorientierung habe ich mir im Wesentlichen während meines Soziologie-Studiums an der Universität Frankfurt/Main angeeignet. Dies war Anfang bis Mitte der 1980er Jahre. In jener Zeit standen in meinem Fachbereich die Theorien von Marx, Hegel, Adorno und Horkheimer weit oben auf der Agenda. Die Lehren der großen Denker gerieten durch den zunehmenden Einfluss der postmodernen Ansätze aber ins Wanken. Zugleich war in den politisch aktiven Studentenkreisen vor allem die Praxis gefragt. Der wohl beliebteste Satz von Marx war die 11. Feuerbachthese: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern." (Marx 1981b, S.30) Die Ansätze der Handlungsforschung wirkten auf diesem Hintergrund hoffnungsvoll, weil sie aus dem "akademischen Elfenbeinturm" herausführten und die Welt im kleinen Rahmen tatsächlich zu verändern suchten. Mein zweites Studium, das der Sozial-pädagogik, habe ich bereits auf diesem Hintergrund begonnen. Als ich zwischen 2002 und 2005 in Hamburg und Lüneburg studierte, lagen bereits 15 Jahre Berufspraxis als Journalist hinter mir. Das Bemühen um praktische Veränderungen war bei mir bereits internalisiert. So wollte ich als Sozial-pädagoge im kleinen Rahmen dazu beitragen, mit wissenschaftlichen Methoden im Background die Welt etwas besser zu gestalten - also eine Art "Handlungsforschung" zu betreiben. Während meines sozialpädagogischen Berufspraktikums in der ambulanten Behindertenhilfe entdeckte ich die "rehistorisierende Diagnostik" als hilfreichen Ansatz zur Intervention in behindernde soziale Lebensverhältnisse. Diesen Ansatz habe ich in dieser Forschung weiterverfolgt (s .Kap. 2.3).
Als übergeordnete Klammer in der Zusammenarbeit unserer Forschungsgruppe galt die Kritische Psychologie und deren subjektwissenschaftlicher Empirie-Ansatz. Diese Grundlegung ging vor allem auf unseren Leiter Kurt Bader zurück, der bei Klaus Holzkamp gearbeitet hat und in dieser Theorie-Tradition verwurzelt ist. Ich selber habe mich erst mit Beginn unserer Forschung mit der Kritischen Psychologie auseinandergesetzt und festgestellt, dass sie mir mit meinen bisherigen Modellen und Theorien wissenschaftlichen Arbeitens nur in Teilbereichen kompatibel erschien. Näheres führe ich in den folgenden Kapiteln sowie in Teil E, Kapitel 3.2 aus. Doch grundlegende Prinzipien konnte ich in mein teilnehmendes und intervenierendes Forschungskonzept integrieren.
Den Gegenstand meiner Forschung fasse ich als ein konkretes soziales Feld der geistigen Behinderung, das sich in einem Transformationsprozess von einem stationären zu einem ambulanten Status befindet, in dem ich in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe an der Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität mitwirke und diese zugleich evaluiere: also die dynamische Einheit von geistiger Behinderung, Ambulantisierung und Qualitätsentwicklung inklusive Evaluation (s. Teil B). Dieser Gegenstand ist keineswegs ein "wertfreies" Objekt zur "neutralen" Erkenntnisgewinnung, sondern ein sozialer Gegenstand, der von seiner Sache her zumindest auf den Ausschnitt einer "Konzeption von richtiger Gesellschaft" (Adorno 1979a, S.561) zielt, wie ich ihn Teil B, Kapitel 2 für den Bereich der Ambulantisierung abgeleitet habe. Auch der gesellschaftliche Begriff der Behinderung verweist auf ein Sollen, das ich mit den Begriffen Autonomie, Teilhabe, Handlungs-fähigkeit umschreibe und das ansatzweise in den sozialpolitischen und pädagogischen Programmen zur Ambulantisierung zum Ausdruck kommt.
"Die Sache, der Gegenstand gesellschaftlicher Erkenntnis, ist so wenig ein Sollensfreies, bloß Daseinendes - dazu wird sie erst durch die Schnitte der Abstraktion -, wie die Werte jenseits an einem Ideenhimmel anzunageln sind. Das Urteil über eine Sache, das gewiss der subjektiven Spontaneität bedarf, wird immer zugleich von der Sache vorgezeichnet (...)." (a.a.O., S. 560f.)
Gleichwohl muss sich der Forscher sein Urteil keineswegs von der Sache vorzeichnen lassen. Er kann "die Sache" auch im Sinne der "instrumentellen Vernunft" (Horkheimer 1985b) als Mittel für herrschaftskonforme Zwecke verwerten, ohne ihr dialektisches Verhältnis zum "Ganzen, das in ihr steckt" (Adorno 1979a, S.561), zu erfassen. Der Begriff der Behinderung führt nicht zwangsläufig zum Auftrag einer sozialen Teilhabe und zum Ziel der Autonomie, sondern kann ebenso als eine Rechengröße für Belegungszahlen und Umsätze instrumentalisiert werden. Der Forscher als handlungsfähiges Subjekt trifft stets eine Entscheidung, die gesellschaftliche Konsequenzen hat. Darauf hat Horkheimer 1937 hingewiesen und grundlegend zwischen traditioneller und kritischer Theorie unterschieden:
"Eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbständigkeit die Gestaltung der Praxis, der sie dient und angehört, bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung von Denken und Handeln bescheidet, hat auf die Humanität schon verzichtet. Selbst zu bestimmen, was sie leisten, wozu sie dienen soll, und zwar nicht nur in einzelnen Stücken, sondern in ihrer Totalität, ist das auszeichnende Merkmal der denkerischen Tätigkeit." (Horkheimer 1984a, S.56)
Eine Forschung, die sich selbst dem Auftrag zur Teilhabe und Integration ausgegrenzter Menschen verpflichtet, die, verallgemeinert formuliert, auf "die Emanzipation des Menschen aus versklavenden Verhältnissen" (Horkheimer 1984b, S. 58) zielt, bezieht sich auf das gesamte Feld der Forschung in seiner "Totalität". Das bedeutet, dass sie letztendlich immer über die unmittelbaren Grenzen hinaus-weist und Gesellschaft als Ganzes im Blick hat.
"Theorie im traditionellen, von Descartes begründeten Sinn, wie sie im Betrieb der Fachwissenschaften überall lebendig ist, organisiert die Erfahrung auf Grund von Fragestellungen, die sich mit der Reproduktion des Lebens innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft ergeben. Die Systeme der Disziplinen enthalten die Kenntnisse in einer Form, die sie unter den gegebenen Umständen für möglichst viele Anlässe verwertbar macht. Die soziale Genesis der Probleme, die realen Situationen, in denen die Wissenschaft gebraucht, die Zwecke, zu denen sie angewandt wird, gelten ihr selbst als äußerlich. - Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dagegen die Menschen als die Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand." (ebd., S.57)
Hier wird zugleich die Verbindung der Kritischen Theorie zum subjektwissenschaftlichen Ansatz deutlich. Beide erheben den Anspruch, ihren eigenen subjektiven Standpunkt, ihre Funktion für und Eingebundenheit in die Reproduktion der bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu durchdringen. Die Verortung des eigenen Subjektstandpunktes im komplexen Geflecht der Herrschaftsbeziehungen muss Voraussetzung einer jeglichen subjektwissenschaftlichen bzw. kritischen Forschung sein und im Laufe des Forschungsprozesses immer wieder neu reflektiert werden.
Für meine Forschungspraxis bedeutete dies zunächst, das Projekt der Ambulantisierung in seiner gesamtgesellschaftlichen Totalität zu erfassen (s. Teil B, Kap. 2). Es bedeutete auch, immer wieder die Frage nach der Funktion meiner (unserer) wissenschaftlichen Begleitung für die betroffenen Menschen neu zu diskutieren. Insofern ich als Forscher über die bloße Bereitstellung instrumentellen Wissens hinausgehen wollte, blieben Konflikte und Auseinandersetzungen mit dem Auftraggeber nicht aus (s. Teil E, Kap. 1) Meine Forschungspraxis war insofern immer politisch, als sie auf ambu-lante Veränderung und Erweiterung der Teilhabe der Klienten zielte. Sie orientierte sich damit an Horkheimers Begriff der Kritischen Theorie, der "das Glück aller Individuen zum Ziel hat" (Horkheimer 1984b, S.60) Dieser erforderte eine hohe Bereitschaft, sich einer reibungslosen Unterordnung unter die Vorgaben des Auftraggebers zu verweigern, ihn zu hinterfragen und selber Subjekt des Prozesses zu bleiben.
Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl leiteten aus Horkheimers Kritischer Theorie die Notwendig-keit einer "Guerilla-Mentalität" und einer "revolutionärer Existenz" (Dutschke/Krahl 1988, S.139) ab, als Chiffren für die prinzipielle Möglichkeit auch des einzelnen Menschen, selber Zentrum seiner Entscheidung und Intentionalität zu sein und von dort heraus der Geschichte in jedem Augenblick einen neuen Richtungsimpuls geben zu können. Diese "Guerilla-Mentalität" sollte nicht nur innerhalb dieser Forschung gelten, sondern für die Arbeit im System der Behindertenhilfe insgesamt. Denn dort geht es um die Überwindung von sozialer Benachteiligung. Es ist ein politischer Kampf, der sich im Besonderen des "privaten" Alltags in jeder Wohngruppe reproduziert. Besonders Prozesse zur Ambulantisierung sehe ich aufs Engste verbunden mit einem emanzipatorischen Auftrag.
Der Prozess der Ambulantisierung verweist auf die Veränderbarkeit von Verhalten und Verhältnissen, auf die Öffnung neuer Möglichkeitsräume in jeder Sequenz des täglichen Lebens. Dieser Prozess oder diese "Sache", um an Adorno anzuknüpfen, kommt in der Subjektwissenschaft deutlich "zur Geltung". Sie untermauert zudem meinen qualitativen Forschungsansatz und bietet Modelle für den intersubjektiven Diskurs sowie die Selbstreflexion als Forscher.
Als kompatibel zur Subjektwissenschaft haben sich Methoden aus der Handlungsforschung (s. Kap. 2.2) erwiesen. Mit ihnen wirkt der Forscher praktisch in das Geschehen ein und versucht, den erwünschten Prozess anzustoßen bzw. zu fördern. Dies gehört ganz wesentlich zur Qualitätsentwicklung und zur Evaluation, wie ich sie verstehe, dazu und deckt sich mit meiner von Marx übernommenen Maxime: Es kömmt drauf an, die Welt zu verändern!
Meine empirische Forschungstätigkeit fand innerhalb eines relativ klar umgrenzten Feldes statt. Bei all meinen Bemühungen zur Veränderung war die Gewinnung von Informationen über das Wohnen und Arbeiten in der Einrichtung unumgänglich. Die Methode der offenen Teilnehmenden Beobachtung (s. Kap. 2.1) erschloss sich daraus fast zwangsläufig aus der Beschaffenheit des Gegenstandes im Besonderen, der sich sinnlich-konkret kaum anders als durch direkte Beobachtung und Teilnahme erfassen ließ.
Zu diesem Feld der Handlung und Forschung gehörten Individuen, die im Kontext ihres sozialen Lebens geistiger Behinderung ausgesetzt waren. Diese Individuen verfügten über eine behinderte Biografie, die es auch auf der individuellen Ebene zu rekonstruieren und zu verstehen galt. Als adäquaten Ansatz habe ich mich für die rehistorisierende Diagnostik von Wolfgang Jantzen entschieden, weil dieser sowohl die medizinische, psychologische als auch die soziale Dimension der Behinderung umfasst und zudem auf Veränderung, Weiterentwicklung und Emanzipation ausgerichtet ist. Es ist ein Ansatz zur Intervention, da mit ihm Betreuungsroutinen aufgebrochen, neu reflektiert und im günstigsten Falle verändert werden können. (s. Kap. 2.3)
Wie aus meiner Begriffsanalyse hervorgeht, ist "geistige Behinderung" ganz essentiell an Verhältnisse sozialer Herrschaft geknüpft (s. Teil B, Kap. 1). Die Analyse der konkret relevanten Herrschaftsstrukturen im Forschungsfeld wurde aufgrund dieser Eigenschaft des Gegenstandes notwendig. In meinen Ansätzen zur Strukturanalyse (Kap. 3) beziehe mich dabei vor allem auf die Kritische Theorie, die Ethnomethodologie und auf die Feldtheorie von Bourdieu.
Um den in Kapitel 1.1 begründeten emanzipatorischen Auftrag meiner Forschung umzusetzen, habe ich aus dem subjektwissenschaftlichen Ansatz vor allem folgende Prinzipien übernommen und angewandt:
-
Qualitative Daten
-
Handlungsfähigkeit
-
Mitforscherprinzip
-
Unmittelbarkeitsüberschreitung
Der subjektwissenschaftliche Ansatz ist im Rahmen der Kritischen Psychologie wesentlich von Klaus Holzkamp entwickelt worden. Die Kritische Psychologie hat Holzkamp als Kritik an der bürgerlichen Psychologie, besonders der behavioristisch geprägten Experimentalpsychologie entwickelt, die er auch als "Variablenpsychologie" bezeichnet. Darin werden einzelne Variablen experimentell getrennt und der Einfluss einer willkürlich als unabhängig gesetzten Variablen auf das Verhalten des Probanden, die abhängige Variable, getestet. Der Mensch in der künstlichen Rolle der Versuchs-person legt darin gerade das ab, was ihn als spezifisch menschlich ausmacht, nämlich seine Subjektivität, die Fähigkeit selbst Zentrum seiner Intentionalität zu sein. Im Versuchslabor hat der Proband nur auf vorgegebene Bedingungen zu reagieren. Die Ebene der Begründung von Handeln entfällt. Nach Holzkamp wird dabei gerade die Gegenstandsadäquatheit verfehlt, "weil sie halt nur Menschen unter Bedingungen untersuchen, aber nicht dieses Moment der Verfügung von Menschen über ihre Lebensbedingungen." (Holzkamp 1983, S.18) Die Bedingungen werden durch den Versuchs-leiter kontrolliert. Die Handlungssituation im Experiment ist eine kontrollierte Situation, weshalb Holzkamp dieses Forschungskonzept auch als "Kontrollwissenschaft" bezeichnet. "Es geht ja eigentlich immer darum, wie sind Menschen durch Bedingungen kontrollierbar, aber niemals darum, wie können Menschen ihre Lebensbedingungen kontrollieren." (a.a.O.) Kontrollwissenschaftler kontrollieren Bedingungen und damit menschliches Verhalten vom Außenstandpunkt aus. Der Erforschte ist das Objekt. Der subjektwissenschaftliche Ansatz hingegen versucht, das asymetrische Verhältnis der Macht im Feld der Forschung zu überwinden, zumindest offen zu legen und zugunsten eines kooperativen Mitforscherverhältnisses zu ersetzen. In diesem soll intersubjektiv die Unmittelbarkeit der jeweiligen Weltbezüge überschritten werden, um gemeinsam die Möglich-keitsräume der Handlungsfähigkeit, der Verfügung über die sozialen Bedingungen zu erweitern.
Der subjektwissenschaftliche Ansatz unterscheidet sich von den in Teil B, Kapitel 3 beschriebenen Ansätzen der Qualitätsentwicklung auch darin, dass er sich jeweils auf die besondere und einzelne Einrichtung bezieht und nicht (primär) darauf ausgerichtet ist, globalisierend für alle oder für eine Vielzahl von Einrichtungen eine Kompaktlösung zu entwickeln. Qualitätsentwicklung nach subjekt-wissenschaftlicher Methodologie ist vor allem aktualempirisch an konkreten, realen Fragen und Problemstellungen im sozialen Feld ihres Wirkens orientiert, "an dessen theoretischer Durch-dringung und praktischer Lösung die Betroffenen interessiert sind." (Reimer 2008, S.196)
Forschung und Qualitätsentwicklung gehen bei diesem Ansatz ineinander über. Da auch die subjekt-wissenschaftliche Forschung immer auf praktische Veränderung im Sinne einer Erweiterung der Handlungsfähigkeit und Verbesserung der Lebensqualität zielt, ist sie dem Grunde nach Qualitätsentwicklung. Auch in dieser Art von Forschung wird mit Daten gearbeitet. Es sind zumeist qualitative Daten, obwohl auch quantitative Daten nicht zu vernachlässigen sind, soweit sie etwas über die Lebensqualität der Betroffenen aussagen, z.B. die Größe der Wohnräume oder die Entfernung zur nächsten U-Bahnstation. Nicht von Interesse sind beispielsweise Durchschnittswerte von "Zufriedenheit", weil sie von der konkreten Individualität abstrahieren.
"Im Grunde ist ja im Häufigkeitsansatz jeder eine Ausnahme, es gibt eigentlich nichts weiter als Aus-nahmen, auch derjenige, der zufällig auf der zentralen Tendenz liegt, ist eine Ausnahme, weil er ein Zufall ist (...). Der Mensch ist in der bürgerlichen Methodik eine permanente Ausnahme." (Holzkamp 1983, S.19) Konkrete Daten unterliegen im subjektwissenschaftlichen Forschungsprozess allerdings "keinerlei methodisch induzierten Restriktionen" (Markard 2000, s.p.). Darin überschneidet sich die Subjektwissenschaft mit anderen offenen Konzepten der Sozialforschung, der Handlungsforschung, der Teilnehmenden Beobachtung u.a. Als Daten können beispielsweise Beobachtungen in den For-schungsprozess eingebracht werden, Dokumente, Gesprächsinhalte, Handlungsprotokolle, Stimmungsbeschreibungen und im Grunde genommen alles, was in Bezug auf die Aufgaben- bzw. Fragestellung in einem Sinnzusammenhang steht oder der Möglichkeit nach stehen könnte.
Wie in Teil B, Kapitel 2 dargelegt, tendiert Ambulantisierung im weitesten Sinne des Begriffs auf eine Loslösung der betroffenen Menschen aus ihrer Unmündigkeit. Sie soll Isolation überwinden, soziale Teilhabe ermöglichen und die individuelle wie kollektive Handlungsfähigkeit erweitern.
Holzkamp rekonstruiert in der Entwicklung zur gesellschaftlich vermittelten Produktion der lebens-notwendigen Güter eine Loslösung des Individuums aus der direkten Involviertheit in den Produktionsprozess. Ab einer gewissen Stufe der sozialen Arbeitsteilung wird der einzelne Mensch aus dem unmittelbaren Zwang, seine Mittel zum Leben selber zu produzieren, befreit und nimmt statt dessen an der gesamtgesellschaftlich vermittelten Produktion teil. Die Reproduktion des gesamten Systems verselbständigt sich gegenüber dem einzelnen. Der einzelne wird (zumindest im Sozialstaat) auch dann mit am Leben erhalten, wenn er sich nicht selber an der gesamt-gesellschaftlichen Produktionstätigkeit beteiligt. Die objektiven Handlungsnotwendigkeiten werden damit subjektiv zu Handlungsmöglichkeiten.
"Also dieser Begriff der Möglichkeit ist bei uns ganz zentral, d.h. ich kann mich an der gesellschaftlichen Reproduktion beteiligen, ich muß aber nicht (...). D.h., also, dieses Moment der Möglichkeitsbeziehung zur gesellschaftlichen Realität enthält auch eine neue Form von Subjektivität, indem ich mich nämlich selber als Ursprung meiner Handlungen abgehoben vom gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhang erleben kann." (Holzkamp 1983, S.12)
Damit der gesamte gesellschaftliche Produktionsprozess funktioniert, sind dem Individuum zugleich auch Handlungsbeschränkungen auferlegt. Das Subjekt kann innerhalb bestimmter Bedingungen über sein Handeln verfügen. Die Strukturen der Produktion erscheinen jedoch als Bedingungen, die die Handlungsmöglichkeiten behindern. Dieses doppelte Verhältnis von Möglichkeit und Behinderung kennzeichnet bei Holzkamp die Beziehung des Individuums zur Gesellschaft. Dementsprechend zeigt er eine doppelte Möglichkeitsbeziehung im Verhaltensmodus auf: restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. "Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist jeweils die Realisierung der Möglichkeiten zur Verfügung über die gesellschaftlichen Lebensbedingungen; und der restriktive Aspekt, der ist also stets dieses Moment des Sich-Einrichtens in der Abhängigkeit, des Versuchs also, in den bestehenden Verhältnissen unter Arrangement mit den Herrschenden jeweils seine Existenz zu reproduzieren." (ebd., S.13)
Die Kategorie der Handlungsfähigkeit ist innerhalb des subjektwissenschaftlichen Ansatzes zentral, weil sie das spezifisch Menschliche zum Ausdruck bringt. In Anlehnung an die Marx'sche Theorie geht es darum, dass der Mensch selber seine eigene Geschichte macht, dass er Subjekt seines Daseins ist, nicht durch Triebe determiniert ist und auch nicht durch unmittelbare Reize und Reflexe gesteuert wird, sondern mit Vernunft ausgestattet ist, mit welcher er Bedingungen erkennen und Handlungen planen kann. Nach Holzkamp gibt es immer Alternativen, solange der Mensch lebt. Das macht seine Theorie für mich "sympathisch". An dieser Stelle öffnet sich in seinem Werk das geschlossene System der kategorialen Analysen, die strengen dialektischen Notwendigkeiten, nach denen die Welt bis dahin verlief, drängen dort zur Freiheit, jenem Möglichkeitsraum, um den es in meiner Forschung ganz wesentlich ging.
Die Orientierung an der Kategorie der Handlungsfähigkeit halte ich für eine Bedingung in der ambulanten Betreuung von geistig behinderten Menschen. Denn ohne sie wird das Leben stationär, es stagniert. Der Begriff der Handlungsfähigkeit verweist auf die Veränderbarkeit, gibt Hoffnung und den betroffenen Menschen neues Selbstbewusstsein, Vertrauen, ihr Leben, wenn auch nur in Nuancen, selber bestimmen zu können. Er entspricht zugleich meiner eigenen subjektiven Haltung und ist für mich und meine Forschung passend.
Bei meinen evaluierenden Dialogen und intervenierenden Projekten habe ich durchweg versucht, die Restriktionen der Handlungsfähigkeit im Detail Schritt für Schritt zurück zu drängen. Bedingungen habe ich gemeinsam mit den Bewohnern hinterfragt, neue Alternativen angeboten und ausprobiert, ihnen Erfahrungen ermöglicht, über neue Bereiche ihres Lebens verfügen zu können. Nicht nur auf der individuellen Ebene gehört das Paradigma der Handlungsfähigkeit zum Modell der ambulanten Arbeit. Der Prozess der Ambulantisierung auf der institutionellen und der politischen Ebene ist ein Prozess der Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten. Dem Gegensatz restriktive - verallgemeinerte Handlungsfähigkeit als Handlungsmodi entspricht das Gegensatzpaar stationär - ambulant. Im stationären Rahmen passen sich Bewohner und Betreuer restriktiv den gegebenen Bedingungen an. Im Laufe der Ambulantisierung gewinnen sie eine gewisse Verfügung über jene Bedingungen und gestalten diese vermehrt selbst.
Die Arbeit an dieser Grenzlinie zwischen restriktivem und verallgemeinertem Handlungsmodus prägte immer wieder auch die Auseinandersetzungen im Forschungsprozess, wenn es darum ging, die Grenzen des stationären Rahmens zu überschreiten. Sie war eine grundlegende Methode zur Qualitätsentwicklung. Der subjektwissenschaftliche Ansatz versucht, diese Verfügungserweiterung in der Kooperation mit den direkt betroffenen Menschen zu erreichen.
Der subjektwissenschaftliche Ansatz verfolgt grundsätzlich das Mitforscherprinzip aller im Handlungsfeld beteiligten Personen. Das bedeutet auch, dass die Methoden zur Qualitätsentwicklung von innen heraus erarbeitet und nicht von "Experten" vorgegeben werden.
Holzkamp hat an sein Konzept der subjektwissenschaftlichen Forschung hohe Voraussetzungen geknüpft. Zwischen den Forschungsprofis und den Forschungsteilnehmern müssen "gemeinsame Interessen" bestehen. "Wir können keine Forschung realisieren, wenn die Betroffenen nicht voll begriffen haben, um was es für sie geht und mit dieser Forschung selber den Anspruch verbinden, ein Stück Lebensmöglichkeiten für sich zu schaffen." (Holzkamp 1983, S.21) Das Mitforscherprinzip ist keineswegs Holzkamps eigene Schöpfung. Er hat dies bereits in der Forschungspraxis der Gestaltpsychologie und der "Würzburger Schule" erkannt, wo die Forscher gegenseitig und mit vollem Wissen über die Ziele, Methoden und Theorien der Forschung die Rolle der "Versuchspersonen" übernommen haben. (vgl. Holzkamp 1985, S.544) Das Subjekt-Subjekt-Verhältnis zwischen den Beteiligten sei erst mit der "funktionalistisch-behavioristischen Wende" (a.a.O.) in der Psychologie suspendiert und durch ein asymetrisches Subjekt-Objekt-Verhältnis ersetzt worden. Obwohl mit diesem Modell die wissenschaftliche Objektivität einer Forschung erhöht werden sollte, sei aber "die Spezifik des Gegenstandes" (a.a.O.) verloren gegangen, konstatiert Holzkamp.
Als Spezifik des Gegenstandes versteht Holzkamp die menschliche Handlungsfähigkeit und Befindlichkeit in deren gesamtgesellschaftlicher Vermitteltheit. Um diese zu erfassen, müsse die "Intersubjektivität der Beziehung zwischen Forscher und Betroffenen unreduziert" (Holzkamp 1985, S. 540) erhalten bleiben, weil sonst der "Bedeutungsbezug und die 'Begründetheit' menschlicher Handlungen als Vermittlungsinstanz zu den objektiven gesellschaftlichen Lebensbedingungen eliminiert werden bzw. in der 'black box' zwischen fremd gesetzten Bedingungen und dadurch 'bedingten' Aktivitäten verschwindet." (Holzkamp 1985, S.540f.) Genau darauf kommt es in der Subjektwissenschaft an, auf das Verhältnis zwischen sozialen Bedingungen und deren Bedeutungen für das Subjekt, auf das Verhalten des Subjekts als aktive und begründete Tätigkeit. Darin liegt die Schnittmenge zwischen Forscher und Erforschtem, beide sind gleichermaßen Menschen. Dies begründet einen möglichen gemeinsamen Verständigungsrahmen. "Indem das menschliche Bewusstsein als >Verhalten-Zu< immer >erste Person< ist, erzwingt der Gegenstand hier seine Behandlung vom Standpunkt der betroffenen Subjekte." (ebd., S.305) Da beide Beteiligte eine allgemeine menschliche Erfahrungsbasis teilen, sind ihre Standorte prinzipiell austauschbar. Eine Reduktion des Erforschten zum Objekt einer Forschung würde hingegen genau jene spezifisch menschliche Dimension, das aktive "Verhalten-Zu", ausblenden. "Gegenstand der Forschung ist nicht das Subjekt, sondern die Welt, wie das Subjekt sie - empfindend, denkend, handelnd - erfährt. Aus diesem Grunde sind subjektwissenschaftliche Aussagen keine Aussagen über Menschen, schon gar keine zu Klassifikation von Menschen (z.B. als konzentrationsschwach, s.o.), sondern Aussagen über erfahrene und ggf. verallgemeinerbare - Handlungsmöglichkeiten und - Behinderungen." (Markard 2000, s.p.)
Im subjektwissenschaftlichen Ansatz geht es darum, die konkreten Bedingungen, deren subjektive Bedeutung für die Beteiligten und ihre Handlungsgründe zu diskutieren, gemeinsam zu relativieren und neue Gestaltungsalternativen zu erarbeiten. "Die wesentliche Differenz zur traditionellen Psychologie (...) liegt darin, dass subjektwissenschaftliche Aussagen im Medium des Begründungsdiskurses prinzipiell dialogischen Charakter haben: Es geht hier im intersubjektiven bzw. metasubjektiven Rahmen zentral um die sprachliche Verständigung zwischen den Beteiligten" (Holzkamp 1996, S.98) Subjektwissenschaftliche Qualitätsentwicklung erfolgt somit wesentlich dialogisch in Bezug auf Bedingungen und Bedeutungen. Bedingungen sind u.a. materielle Ressourcen, vorgegebene Strukturen, betriebliche Hierarchien, Arbeitsanweisungen, Gesetze, Verordnungen und behördliche Entscheidungen. Diese Bedingungen beeinflussen das Handeln und die Qualität der Einrichtung, aber: "Gesellschaftliche Bedingungen determinieren menschliches Handeln nicht, sondern sie sind als 'Bedeutungen' zu fassen, die für die Menschen Handlungsmöglichkeiten repräsentieren, zu denen sie sich verhalten können und müssen." (Markard 2000, s.p.) Bedingungen sind keinesfalls eindeutig, sie werden akzentuiert und damit tätig-konstruktiv wahrgenommen. Daraus ergeben sich Prämissen. Diese sind "sozusagen der subjektiv begründete Weltbezug" (a.a.O.) des Individuums. "Theoretische Aussagen über Handlungen fassen wir dementsprechend als Aussagen über Prämissen-Gründe-Zusammenhänge." (a.a.O.) Wesentlich ist dabei die Begründung. Denn menschliches Handeln ist immer subjektiv begründet. Diese Eigenschaft kennzeichnet den Menschen als Subjekt, wobei "begründet" keineswegs mit "rational" oder "bewusst" zu verwechseln ist. Die Begründung ist schließlich nicht unabhängig von den Bedingungen, so dass auch nach außen hin unverständliche oder irrational erscheinende Handlungen durchaus sinnhaft begründet sind, sofern man beispielsweise die biologischen Besonderheiten einer Person und deren Lebensgeschichte berücksichtigt (Syndromanalyse/ rehistorisierende Diagnostik).
Menschliches Handeln bewegt sich somit im Feld von Möglichkeiten, das zwischen objektiver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung liegt. Es ist somit veränderbar, gestaltungsfähig und verhandelbar. Die subjektwissenschaftliche Methodik widmet sich von daher ganz wesentlich der "Bedingungs-Bedeutungs-Begründungs-Analyse" (a.a.O.) Dabei geht es darum, im intersubjektiven Diskurs die Unmittelbarkeit der Erfahrung zu überschreiten, die Vielfalt an Bedeutungen von Bedingungen und die daraus entstehenden Handlungsalternativen zu rekonstruieren.
"Dabei erkenne ich aber gleichzeitig, dass diese Lebensbedingungen in historischer Größenordnung von Menschen produziert und veränderbar sind, so dass ich in Assoziation mit anderen im Rahmen des jeweils objektiv historisch Möglichen selbst an der Verfügung über die allgemeinen/individuellen Lebensbedingungen teilhaben kann, womit die Unterworfenheit unter die objektiven Lebensbedingungen zwar durch die Subjekte nicht aufhebbar ist, aber in Erweiterung ihrer Lebensmöglichkeiten immer weiter zurückgedrängt werden kann." (Holzkamp 1985, S.538f.)
Mit einer dialogischen Analyse von objektiven Bedingungen, Bedeutungen, Gründen und Prämissen habe ich versucht, den Prozess der Qualitätsentwicklung zu fördern. Handlungsmuster wurden reflektiert, auf ihre Prämissen hin hinterfragt, die vorgefundenen Bedingungen in ihrer Potenzialität aufgeschlüsselt und Möglichkeiten der Veränderbarkeit diskutiert. Dabei kam es häufig zu Konflikten. "Dass die jeweiligen Subjekte nicht beforscht werden, sondern auf der Seite der Forscher stehen, bedeutet nicht, dass die professionell Forschenden sich inhaltlich auf die Seite dieser jeweiligen Mitforschenden schlügen." (Markard 2000,s.p.) Dies ergibt sich nach Markard schon alleine daraus, dass beide Gruppen unterschiedliche Erfahrungen und verschiedene handlungspraktische Weltbezüge mitbringen. "Hier sind inhaltliche Kontroversen kaum zu vermeiden, jedenfalls dann nicht mehr, wenn praktische Forschung praktische Änderungen ins Auge fasst." (a.a.O.)
Das dargestellte Mitforscherprinzip war bei meiner Forschung nur bedingt zu realisieren. Anfangs bestand fast einzig seitens der Leitung ein übereinstimmendes Interesse mit der Forschungsgruppe an der Forschung. Seitens der Mitarbeiter wurde uns überwiegend mit Desinteresse und Skepsis begegnet. Streng genommen, hätte nach dem Grundsatz der Subjektwissenschaft diese Forschung von vornherein nicht beginnen dürfen, weil nicht alle Beteiligten ein Interesse an ihr hatten. Dennoch kann dies kein hinreichender Grund sein, um auf eine Forschung gänzlich zu verzichten. Zu fragen ist vielmehr nach den Gründen für das Desinteresse der anderen ebenso wie nach unseren bzw. meinen eigenen Gründen für die Forschung. Dies habe ich in den Teilen A und E reflektiert. Wenn auch sehr begrenzt, so gelang es dennoch phasenweise mit einzelnen Bewohnern wie Betreuern gemeinsam zu forschen und das Mitforscherprinzip umzusetzen.
Die Instrumente zur Qualitätsentwicklung hat die Forschungsgruppe als eigene Instrumente der Betroffenen zu entwickeln versucht. Bewohner, Betreuer und die Leitung haben wir von Anfang an in den Entwicklungsdiskurs als Partner versucht einzubeziehen. Eine Gleichwertigkeit zwischen den Partnern war jedoch real nicht gegeben, da die Forschungsgruppe wirtschaftlich von der Leitung abhängig war. Dennoch haben wir versucht, von unten partnerschaftlich mit den Bewohnern und den Betreuern ihr subjektives "Verhalten-Zur" Institution zu reflektieren, mit dem Ziel, in einem Arbeitsbündnis objektive Bedingungen verändern und die subjektive Verfügung über die eigene Arbeits- sowie Lebenspraxis erweitern zu können. Wesentlich an diesem Aspekt subjektwissenschaftlicher Herangehensweise erscheint mir der Ansatz, eine Qualitätsentwicklung so zu entwickeln, dass vor allem die Schwächsten aller Beteiligten neue Wege finden, um selbstbestimmt eigene Qualitätsansprüche zu artikulieren und wirksam durchsetzen zu können.
"Gesellschaft ist dem Individuum nie in ihrer Totalität, sondern nur in ihren dem Individuum zugewandten Ausschnitten gegeben. Entsprechend sind einzelne Sachverhalte in ihrer Bedeutung nicht mehr allein aus sich selber heraus zu begreifen, sondern nur aus ihren Bezügen im Gesamt der arbeitsteiligen Reproduktion." (Markard 2000, s.p.) Anders ausgedrückt, verweist der subjekt-wissenschaftliche Ansatz auf den Widerspruch zwischen Wesen und Erscheinung. Diesen Widerspruch versucht sie diskurspragmatisch aufzulösen. Die unmittelbare Erscheinung eines Sachverhalts ist immer subjektiv und einseitig. Das dahinter liegende Wesentliche wird nicht als objektive Wahrheit an sich gefasst, sondern als diskursive Wahrheit, die in der Verständigung der beteiligten Subjekte Evidenz erhält.
"Da menschliches Handeln immer mit subjektiv guten Gründen geschieht, muss der Verständigungsrahmen als zentrales Moment die jeweiligen Begründungen und ihnen zugrunde liegenden subjektiven Bedeutungen und Vorannahmen zum Thema haben. Dabei sind gerade die Aspekte von Interesse, die nicht offensichtlich sind und Momente, in denen man sich selber auf die Schliche kommt. (...). Um zu betonen, dass dieser Verständigungsprozess über Begründungen aus Subjektsicht erfolgt, sprechen wir mit Holzkamp von 'Selbstverständigung'. Da es nicht um ein einzelnes Individuum geht, sondern es gerade um die Dezentrierung verschiedener Subjektperspektiven geht, die immer auch in weiteren sozialen Bezügen stehen, ist der Prozess als 'soziale Selbstverständigung' zu bestimmen (Lauenroth 2008, S.14)."
Der Prozess der Unmittelbarkeitsüberschreitung findet nach dem subjektwissenschaftlichen Ansatz im Rahmen des Mitforscherprinzips statt. Die praktischen Schwierigkeiten, die diesem während der Forschung entgegenstanden, werde ich näher in Teil E, Kap. 1 ausführen. Darüber hinaus halte ich folgende Zweifel an diesem Paradigma für angebracht:
Die "soziale Selbstverständigung" setzt voraus, dass diejenigen Subjekte, um die es geht, auch bereit dazu sind, selbstkritisch die "guten Gründe" ihres Handelns offen zu legen. Diese Voraussetzung schätze ich als unrealistisch ein. In den sozialen Feldern, in denen es um die Absicherung von Machtbeziehungen geht, ist auch die Sprache verherrschaftlicht. Gerade um solche Diskurse "erfolgreich" im Sinne des Machterhalts überstehen zu können, lassen sich Führungskräfte in Rhetorik schulen. Damit soll verhindert werden, dass die tieferen Begründungen ihres Handelns offen gelegt werden müssen und ihre Verhandlungspartner leichter "über den Tisch" gezogen werden können. Für die jeweils Mächtigeren gibt es kaum "gute Gründe", sich den jeweils Schwächeren gegenüber zu offenbaren.
Das gleiche Problem betrifft auch den Diskurs zwischen gleichrangigen Partnern. Sie setzt eine Ethik sprachlicher Offenlegung voraus, die faktisch in unserer Gesellschaft nicht vorausgesetzt werden kann. Ich halte sie noch nicht einmal für wünschenswert. Soziale Selbstverständigung kann durchaus in soziale Selbstzerfleischung umschlagen. Der ständige Zwang, seine tiefsten Handlungsgrün-de lückenlos dem oder den anderen mitteilen zu müssen, bedeutet zugleich eine Entgrenzung der Ich-Grenzen, die Auflösung von bürgerlicher Individualität innerhalb bürgerlicher Verhältnisse, und damit eine Auslieferung des einzelnen ans Kollektiv. Das durchschaute und durchleuchtete Individuum untersteht der Kontrolle. Vor allem innerhalb betrieblicher Herrschaftsverhältnisse käme eine restlose Selbstoffenbarung im kollektiven Rahmen einer Selbstdemontage gleich.
Als Methode zur diskursiven Wahrheitsfindung ist soziale Selbstverständigung nicht frei von symbolischer Gewalt. Was als "Dezentrierung verschiedener Subjektperspektiven" im Gewand der "Verständigung" daherkommt, kann von anderen als lästiger Begründungszwang erlebt werden. Die Aufforderung, bitte seine Gründe offen zu legen, stellt den anderen in seinem Handeln in Frage, verunsichert ihn und rückt denjenigen auf die sichere Seite, der fragt. So kann soziale Selbst-verständigung zu einer Art Verhör werden. Sie demonstriert die sprachliche Macht derjenigen, die mit ihr ausgestattet worden sind. Sie drängt dem anderen sprachlich einen ethischen Zwang auf, der selber sprachlich und intersubjektiv nicht legitimiert worden ist. Damit nimmt der Subjektforscher einen kontrollierenden Außenstandpunkt ein. Er verfügt über die Regeln seiner subjektiven Diskursethik und stellt diese Kraft seiner intellektuellen Überlegenheit als universelle Regeln dar.
Als zweifelhaft erscheint mir auch, inwieweit durch eine intersubjektive Dezentrierung der Sichtweisen die Unmittelbarkeit tatsächlich überschritten werden kann. Nicht nur dem einzelnen Individuum ist die Totalität der Gesellschaft begrenzt über einen ihm zugewandten Ausschnitt gegeben, sondern auch der subjektwissenschaftlich arbeitenden Verständigungsgruppe. Die diskursive Übereinkunft über Wahrheit bleibt subjektiv, auch wenn sie in einer Gruppe reflexiv stattfindet. Sie verbürgt keine Überschreitung des gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhangs. Eine Dezentrierung der Sichtweisen im Rahmen einer sozialen Selbstverständigung kann bestenfalls individuelle Blockaden lockern, dem einzelnen helfen, seine zentrierte Sichtweise zu relativieren, "über den Tellerrand" zu blicken, sich selber seiner gedank-lichen Konstruktionsleistungen bewusst zu werden. Als Weg zur höheren Wahrheit, zur objektiven Vernunft, bleibt hier Skepsis angebracht.
Aus diesen Gründen habe ich auf das Element der sozialen Selbstverständigung verzichtet. Dennoch habe ich mich mit anderen im Forschungsfeld beteiligen Subjekten über Bedingungen und deren subjektive Bedeutungen ausgetauscht, die subjektiven Standpunkte, Perspektiven diskutiert und versucht, in einzelnen Situationen die unmittelbaren Wahrnehmungen zu überschreiten. Was ich nicht gemacht habe, ist, Betreuer und Bewohner zur Offenlegung ihrer Handlungsgründe zu drängen. Dies auch deshalb nicht, weil ich bei Fragen nach dem Warum, nach Gründen für das Handeln, meist sehr schnell das Gefühl bekam, mein Gegenüber zu einer Rechtfertigung zu nötigen.
Ein kooperatives Mitforscherverhältnis zwischen den hauptamtlichen Forschern und den "Beforsch-ten" bedeutet keineswegs, dass die Forschungstätigkeit in einem herrschaftsfreien Feld stattfindet. Holzkamp insistiert auf die "Anwendung der ihr eigenen kritisch-historischen Methode" (Holzkamp 1972, S.122) auf sich selbst, auf die permanente Selbstreflexivität subjektwissenschaftlicher For-schung. "Dies schließt die Notwendigkeit ein, das jeweils eigene Denken und Handeln auf ihre reale Eingebundenheit in die bestehenden Machtverhältnisse hin zu überprüfen." (Osterkamp 2008, S.9) Denn jedes Handeln ist, so Osterkamp, "in umfassendere Handlungszusammenhänge eingebun-den", die "den eigenen Erfahrungshorizont prinzipiell überschreiten." (ebd., 15) Auch ein subjektwis-senschaftlich ausgerichtetes Forschungsprojekt findet innerhalb der kapitalistischen Produktionsver-hältnisse statt und wird von ihnen durchdrungen. Die Subjektwissenschaft ist somit grundsätzlich in die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse eingebunden und keineswegs davor gefeit, deren Zwe-cke zu erfüllen. Dies gerade dann, wenn eine subjektwissenschaftliche Forschung in ökonomischer Abhängigkeit von einem Auftraggeber stattfindet und Gefahr läuft, in eine "kontrollierte Wissenschaft" umzuschlagen. (s. Teil E, Kap. 1) Diese Herrschaftsverhältnisse gilt es immer wieder neu zu reflektieren und sich ihnen zu verweigern, weshalb ich eingangs als obersten Grundsatz für meine Forschungstätigkeit Horkheimers Auftrag an eine Kritische Theorie der Gesellschaft vorgestellt habe.
Die bis hierhin abgeleiteten und dargelegten Grundsätze habe ich in meinem Forschungsprozeß vor allem mit teilnehmenden und intervenierenden Methoden operationalisiert. Sie ermöglichten mir eine ausreichende Fülle qualitativer Daten sowie einen Bezug zum Forschungsfeld als teilnehmendes und selber handelndes Subjekt. Insbesondere bediente ich mich der Teilnehmenden Beobachtung (2.1), intervenierenden Methoden auf Grundlage der Handlungsforschung (2.2) sowie der rehistori-sierenden Diagnostik. (2.3), um die übergeordneten Ziele der Ambulantisierung sowie der Teilhabe-verbesserung und Emanzipation der behinderten Menschen im Forschungsfeld zu fördern.
Das Wesentliche meiner Forschungstätigkeit bestand darin, ein bis zweimal pro Woche die Einrichtung zu besuchen und dort in erster Linie zu erkunden, "was los war". D.h. Informationen zu sammeln über die Abläufe im Alltag, über die Bedürfnisse der Bewohner und Mitarbeiter, Entwicklungen zu beobachten, Handlungsszenen zu betrachten, zu fragen und zu diskutieren. Diesen Prozess habe ich nicht vorab geplant, sondern meist auf mich zukommen lassen, also das aufgenommen, was die Akteure in der Einrichtung an mich herangetragen haben. Daran habe ich angeknüpft, Fragen gestellt, Angebote unterbreitet, in den Unterlagen recherchiert und ausgewertet. Dieses induktive Vorgehen entspricht der Methode der offenen Teilnehmenden Beobachtung.
"Mit teilnehmender Beobachtung will der Forscher eine größtmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er/sie will die Innenperspektive der Alltagssituation erschließen." (Mayring 2002, S.81) Zur Innenperspektive gehören der subjektiv gemeinte Sinn von Handlungen, deren Regeln und die Erscheinungsformen der feldspezifischen Wirklichkeit. Das Erschließen dieser Kategorien verstehe ich als einen gegenseitigen Lernprozess.
"Das heißt, dass beide, sowohl der Forscher als auch der, von dem man etwas im Gespräch erfah-ren will, Lernende sind, denn auch der Forscher bringt sich selbst ein und erzählt von sich." (Girtler 2001, S.56) Girtler vertritt die Methode des gegenseitigen Fragens und Erzählens: "Es entspricht der Bescheidenheit des wahren Forschers, dass er von seinem Gesprächspartner sich leiten lässt, denn er ist ein Lernender." (ebd., S.150) Fragen und Erzählungen (statt Antworten) sollen dabei fließend ineinander verwoben werden. Dies kommt dem subjektwissenschaftlichen Mitforscherprinzip sehr nahe. Der Forschungspartner soll innerhalb seiner Lebenswelt verstanden werden können, statt ihn künstlich in eine "Be"-fragung oder in ein Labor zu versetzen. "Ich vertrete im Sinne der ‚qualitativen' Soziologie die Meinung, dass erst, wenn der Befragte sich selbst emotional engagiert und das für seine Alltagswelt auch Bedeutung hat, interne Gültigkeit zu erhoffen ist." (ebd., S.57)
Ein Eintauchen in die Lebenswelt der Forschungspartner oder Akteure hält Girtler der Wissenschaft-lichkeit nicht für abträglich, sondern förderlich. Ein "going native" ermöglicht es, "die Alltagswelt der betreffenden Menschen in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen." (ebd., S.78) Erst durch die Teilnahme an der sozialen Welt, die erforscht werden soll, besteht die Chance, deren Regeln zu erfassen. Dafür ist ein echtes "Miterleben" erforderlich. Girtler versucht durch seine aktive und unstrukturierte Teilnahme, den Subjektstandpunkt seiner Mitforschenden zu übernehmen, um so auch Zugang zu deren Wahrnehmung und Deutungsmuster zu erhalten. Erst im Kontext dieser lebensweltlichen Sinnstrukturen können Handlungen und Aussagen in ihrer gesamten Bedeutungsfülle verstanden werden.
Girtler unterscheidet zwischen der teilnehmend-strukturierten Beobachtung und der teilnehmend-unstrukturierten Beobachtung. Während in der teilnehmend-strukturierten Beobachtung diese nach Maßgabe einer gewissen Vorplanung und Standardisierung verläuft, ist die teilnehmend-unstrukturierte Beobachtung frei. Es gibt darin keinen systematischen Erhebungsplan, sondern die Strukturierung ergibt sich erst schrittweise während der Beobachtung selbst. Als viel wichtiger sieht Girtler die Annäherung ans Forschungsfeld, die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zu den Akteuren, die Auswahl der Informanten, die Beibehaltung der eigenen Authentizität und die Vorsicht, durch Hilfsmittel wie Aufzeichnungsgeräte oder Notizen Vertrauen und Kommunikationsfluss nicht zu stören.
Diese methodischen Prinzipien der offenen, authentischen und dialogischen Begegnung habe ich in meiner Forschung dahingehend operationalisiert, dass ich den Bewohnern in den ersten Monaten so gut wie keine zielgerichteten Fragen hinsichtlich meiner Evaluation gestellt habe. Ich habe die Ansprachen der Bewohner mit Interesse aufgenommen und versucht, deren Themen zu erfassen und darauf einzugehen. Andere Bewohner habe ich nur kurz begrüßt, mit anderen bin ich spazieren gegangen, habe mit ihnen gemeinsam Abendbrot gegessen oder ihnen beim Ankleiden geholfen. In der Einrichtung habe ich mich anfangs mit der Teilnahme weitgehend zurückgehalten und zunächst nur das Geschehen beobachtet, versucht Zusammenhänge zu verstehen und mich erst allmählich beteiligt. Zu den Betreuern war das Verhältnis stets sehr widersprüchlich.
Einige Mitarbeiter begegneten mir mit scharfer Ablehnung, die ich respektierte, zu anderen entwickelten sich fast freundschaftliche Kontakte, dies dadurch, indem durch den authentischen Stil meiner Kommunikation gemeinsame Interessen und Ansichten deutlich geworden waren. Mit drei Mitarbeitern traf ich mich auch im privaten Rahmen. In diesem, nach traditionellem Verständnis "unprofessionellen" Setting konnten gemeinsame Perspektiven entwickelt sowie Widersprüche gegenseitig besser verstanden und akzeptiert werden. Ich ließ mich auf die Vorschläge der Betreuer stets ein, wenn sie mich baten, eine Unternehmung mit ihren Klienten zu begleiten, Dokumente zu prüfen oder pädagogische Analysen auszuarbeiten.
Meine Beobachtungen schrieb ich stets nach meinen Besuchen in Protokolle nieder. Darin notierte ich nicht nur die subjektiven Wahrnehmungen, wie sie mir Stunden später in Erinnerung waren, sondern formulierte jeweils auch Hypothesen, in denen ich aus den aktuellen Beobachtungen Strukturen zu rekonstruieren versuchte. Diese Hypothesen verglich ich dann gemeinsam mit den Kollegen meiner Forschungsgruppe fortlaufend mit den folgenden Beobachtungen und Hypothesen, um so am Ende ein Bild über die Feldstrukturen, so gut sie mir zugänglich waren, zu entwickeln. Anfangs schickte ich meine Beobachtungsprotokolle per Email auch an die Betreuer. Dies führte allerdings rasch zu Konflikten, die ich in Teil E erörtern werde. Später versuchte ich einerseits in persönlichen Dialogen und andererseits bei den Dienstbesprechungen, meine Hypothesen zu diskutieren. Dies führte dazu, dass vieles unausgesprochen bleiben musste, weil dafür zu wenig Zeit vorhanden war. Von meinem methodischen Zugang zum Forschungsfeld über die Methode der Teilnehmenden Beobachtung unterscheide ich meine intervenierenden Projekte nach dem Ansatz der Handlungs-forschung sowie der rehistorisierenden Diagnostik, bei denen ich über die Teilnahme und Beobach-tung deutlich hinausgegangen bin und selber akzentsetzende eigene Prozesse initiiert habe.
Der in Kapitel 1.1 begründete emanzipatorische Auftrag dieser Forschung sowie der von der 11. Feuerbachthese (Marx) abgeleitete Primat der Praxis stehen in einem engen Passungsverhältnis zum gesetzlichen Auftrag der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen[9]. Er zielt auf Veränderung, Intervention und erfordert Forschungsmethoden, die über das bloße Beobachten und Auswerten von Daten hinausweisen. Die Forschung als integraler Bestandteil gesellschaftlicher Praxis muss vielmehr selber die Grenzen des Bestehenden überschreiten, gesellschaftlich intervenieren und nach Lösungswegen suchen, die den übergeordneten Zielen dienen können.
"Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten als eine Forschung im Dienste sozialer Unternehmungen oder sozialer Technik kennzeichnen. Sie ist eine Art Tat-Forschung ('action research'), eine vergleichende Forschung der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns und eine zu sozialem Handeln führende Forschung." (Lewin 1968, S.280)
Ursprünglich entwickelt worden ist die "action research" in den 1940er und 1950er Jahren in den USA. Ihre Aufgabe bestand wesentlich darin, innovative Projekte und Veränderungen im staatlichen Sektor, der Wirtschaft und dem Wohlfahrtswesen mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu implementieren und zu evaluieren.
"Zwar wird im action-research-Ansatz die Trennung von Theorie und Praxis aufgehoben - allerdings im Interesse einer Aufrechterhaltung der politischen und ökonomischen Verhältnisse. Die Untersuchten werden zwar teilweise in den Forschungsprozeß mit einbezogen, aber nicht vornehmlich in ihrem eigenen Interesse, sondern nur soweit eine Einbeziehung im Rahmen der vorgegebenen Fragestellung funktional ist." (Schneider 1980, S.15)
In den 1970ern entstanden in der BRD erste Handlungsforschungsprojekte in den Bereichen der Schulpädagogik, Sozialpädagogik und Hochschuldidaktik. Sie verfolgten im Unterschied zu den US-amerikanischen Vorläufern überwiegend gesellschaftskritische Zielsetzungen in Richtung auf Demokratisierung, Emanzipation und Bewusstseinsveränderung. Handlungsforschung sollte die Wissenschaft aus dem Dienst der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse lösen und sie auf die Seite der gesellschaftlich Benachteiligten stellen. Historisch schließt die deutschsprachige Handlungsforschung an die Umbruchphase an den Universitäten Ende der 1960er Jahre an und rekurriert auf die Kritik an den traditionell-empirischen wissenschaftstheoretischen Positionen der Kritischen Theorie und der Kritischen Psychologie. (Vgl. Block/Unger/Wright 2007, S. 13)
Seit Ende der 1980er Jahre ist in der deutschsprachigen Forschung der Ansatz der Action Research weitgehend verschwunden. Die Publikationen zuvor bezogen sich vor allem auf das Forschungsfeld der Schule und Hochschule. Ulrike Scheiders "Sozialwissenschaftliche Methodenkrise und Handlungsforschung - Methodische Grundlagen der Kritischen Psychologie 2" (Schneider 1980) ist einer der wenigen feldübergreifenden Entwürfe einer Handlungsforschung, der auf den Erfahrungen eines Jahrzehnts basiert. In neuerer Zeit hat sich die Forschungsgruppe Public Health am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) mit dem Ansatz der Handlungsforschung auseinandergesetzt. (Vgl. Block/Unger/Wright 2007)
Die WZB-Autoren verweisen auf drei grundlegende Prinzipien der Handlungsforschung, die mit meinem bisher ausgeführten Forschungskonzept übereinstimmen: "1) Teilnahme der Forscher/innen an sozialen Prozessen, 2) Arbeit mit Gruppen in ihren bestehenden sozialen Bezügen und 3) Einbezug der Untersuchungsteilnehmer in die Forschungstätigkeit." (ebd., S. 14)
In Übereinstimmung mit dem subjektwissenschaftlichen Mitforscherprinzip vollzieht sich Handlungsforschung in direkter Kommunikation von Forschern und Beforschten. Beide Gruppen lernen voneinander. (Vgl. Schneider 1980, S.23) Sie ist ein Versuch, die Wissenschaft aus ihrem "Elfenbeinturm" heraus zu führen und Theorie mit verändernder Praxis direkt zu verbinden. Durch Elemente der Handlungsforschung können die subjektwissenschaftlichen Diskurse zur sozialen Selbstverständigung mit der Dimension des praktischen Handelns ergänzt werden. Auch die Forschungsprofis handeln, idealerweise als gleichberechtigte Partner mit den eigentlichen Akteuren im Forschungsfeld. Das Subjekt-Subjekt-Verhältnis beider Seiten wird so zu einem theoretisch-praktisch vermittelten Kooperationsverhältnis. Damit schwindet nicht nur das Theorie-Monopol der Forschungsprofis, sondern auch das Praxis-Monopol der Akteure. Beide arbeiten direkt im Feld der Forschung und im besten Falle analysieren beide Seiten gemeinsam ihr Handeln.
Diese Vermengung von Forschung und Praxis steht selbstredend im Widerspruch zum positivistischen Paradigma einer objektiven und wertfreien Wissenschaft. Der Handlungsforscher kann mit seiner Herangehensweise keineswegs objektiv soziale Zusammenhänge untersuchen, wie sie an sich gegeben sein mögen. Das ist auch nicht das Ziel der Handlungsforschung. Ziel ist es nicht, eine Objektwelt an sich zu erforschen und die Ergebnisse wertfrei den gesellschaftlich herrschenden Instanzen anheim zu stellen, sondern eine sich verändernde Welt forschend zu gestalten - im Sinne der erweiterten Handlungsfähigkeit. Das Objektivitätskriterium selber erweist sich vielmehr als dogmatisch gesetzt, als künstliche Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit, wie sie im Prozess der kapitalistischen Industrialisierung entwickelt worden ist. Es setzt voraus, dass der Gegenstand an sich oberstes Erkenntnisziel der Wissenschaft ist, nicht aber dessen Veränderung. Der Forscher nimmt in diesem traditionell empirischen Setting eine kontemplative Haltung ein wie der Bürger gegenüber dem Marktgeschehen, das er mit naturwissenschaftlich abgeleiteten Methoden berechnet.
"Die kritische Klärung der Kontemplation bemüht sich immer energischer in der Richtung, aus ihrem eigenen Verhalten alle subjektiv-irrationellen Momente, alles Anthropomorphe restlos auszumerzen; das Subjekt der Erkenntnis immer energischer von dem >Menschen< abzulösen und es in ein reines - rein formelles - Subjekt zu verwandeln." (Lukács 1983, S.235) Erkenntnis reduziert sich auf die Erkenntnis von Notwendigkeiten, auf Gesetzmäßigkeiten, deren Berechnung und Voraussagbarkeit - nicht aber auf die gewollte und bewusste Machbarkeit der menschlichen Geschichte durch den Menschen selber. Handlungsforschung ist somit emanzipatorisch, da sie die kontemplative Stellung verlässt und dem Forscher selber seine Subjekthaftigkeit zurück gibt. Der Kern einer Handlungsforschung liegt im Prozess der Veränderung, in der Praxisanalyse und der fortlaufenden Selbstreflexion eigener Interventionen.
"Dabei geht Handlungsforschung davon aus, dass ein tieferer Einblick in diese Phänomene erst dann möglich ist, wenn der Forscher in das Praxisfeld einbezogen ist. Die Arbeit des Forschers in der Praxis zielt also nicht nur auf die Entwicklung von Veränderungsstrategien, sondern ist auch damit begründet, bessere oder tiefergehende Erkenntnisse über den Gegenstand der Untersuchung und Veränderung zu erlangen." (Schneider 1980, S.40)
Viele Zusammenhänge im sozialen Feld werden nach meiner Erfahrung erst dann offenbar, wenn der Forscher nicht mehr in einer passiven Position verharrt, sondern die Selbstverständlichkeiten des Alltagshandelns intervenierend aufbricht. Dies führte zu Konflikten und Diskussionen. So können Selbstverständlichkeiten in einem erweiterten Rahmen von Möglichkeiten reflektiert werden. Sie werden subjektiv verfügbar und lassen sich eventuell verändern. Vor allem im Hinblick auf das Ziel einer Evaluation der Bewohnerzufriedenheit müssen unausgeschöpfte Möglichkeiten, Wünsche und Entwicklungspotenziale erkannt werden, die noch nicht unmittelbar sichtbar sind. Hier muss der For-scher selber praktische Angebote (evaluierende bzw. intervenierende Projekte) unterbreiten, um das Latente und zugleich Mögliche erfahrbar zu machen. Ein bloß kontemplatives Erfassen der unmit-telbaren Zufriedenheit würde dessen Ist-Zustand verdinglichen, aber keine Qualität weiterentwickeln.
Als oberstes Gütekriterium der Handlungsforschung nennt Schneider die praktische Relevanz: "Die Analyse der im Feld wirkenden Bedingungen muß die Entwicklung und Realisierung von Handlungsstrategien ermöglichen. Die Handlungen müssen einen Beitrag zur Erreichung des Gesamtziels des Projekts liefern." (ebd., S.206) Die Bestimmung des Ziels wird zur Voraussetzung einer Validitätsbeurteilung. Schneider unterscheidet zwischen dem Modus der Zielbestimmung in der Evaluationsforschung und dem in der Handlungsforschung. Während in der Evaluationsforschung die Ziele häufig vorab vom Auftraggeber vorgegeben werden, "werden Ziele von Handlungsforschung erst im Forschungsprozeß selbst, gemeinsam mit den Betroffenen (Erforschten) entwickelt." (ders: 198) Bei diesem Projekt handelte es sich um eine Mischform dieser beiden. Einerseits war es eine Evaluationsforschung mit dem Ziel, am Ende die ambulanten Qualitäten der Einrichtung sowie die Zufriedenheit der Bewohner auszuwerten. Diese Ziele waren vom Auftraggeber vorgegeben worden. Andererseits waren diese Ziele inhaltlich wenig präzise und wurden fortlaufend während des Forschungsprozesses konkretisiert. Dennoch stand das Globalziel der Ambulantisierung über dem gesamten Projekt. Dies bildete den gemeinsamen Nenner zwischen allen beteiligten Gruppen. Meine eigenen Handlungsbeiträge als Forscher bezogen sich stets unterstützend auf das gemeinsame Ziel.
Die konkreten Methoden zur Handlungsforschung leitete ich aus den jeweils vorangegangen Beobachtungen und Strukturhypothesen ab. Konkrete Schritte zur Intervention waren immer tentativer Art wie die Strukturhypothesen selber. Sie mussten sich in der Praxis als passend erweisen, also praktisch verifiziert werden. Meine auf Veränderung zielenden Interventionen waren einerseits Vorschläge an das Team bzw. die Leitung, andererseits waren sie direkte Angebote an die Bewohner. Vor allem die direkten Angebote an die Bewohner haben sich als effektiv in Bezug auf das Ziel der Ambulantisierung erwiesen, weil ich damit in einigen Fällen neue Möglichkeiten zur autonomeren Lebensführung erfahrbar machen konnte. Der Ansatz zur Handlungsforschung kommt im empirischen Teil vor allem in den intervenierenden Projekten zum Ausdruck. (s. Teil D, 2.1, 3,3) Vor allem, wenn sich meine Interventionen auf eine oder nur wenige Personen bezogen haben, wurde es umso notwendiger, die betreffenden Bewohner in ihrer jeweils gesamten Persönlichkeit verstehen zu können. Dies führt zum Ansatz der rehistorisierenden Diagnostik.
Die rehistorisierenden Diagnostik hat Wolfgang Jantzen bereits im Rahmen seines Hauptwerkes "Allgemeine Behindertenpädagogik" (Jantzen 1990, S.194 ff.) in ihren Grundzügen skizziert. Ich habe sie für mein Forschungsfeld für geeignet gehalten, vor allem deswegen, weil Jantzen seinen intervenierenden Ansatz überwiegend im Rahmen seiner Forschung in der stationären Wohn-einrichtung der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal bei Bremen entwickelt hat. Die Großeinrichtung Lilienthal mit anfangs 300 Bewohnern wurde nach einer langen organisatorischen Krise ab 1994 deinstitutionalisiert. Jantzen begleitete teilnehmend und intervenierend diesen Prozess mit Studenten von der Universität Bremen über mehrere Jahre hinweg. In jener Zeit hatte in der Behin-dertenhilfe bereits der Diskurs über Qualitätsmanagement begonnen, so dass Jantzen seine unterstützende Tätigkeit in der Einrichtung auch als "Qualitätssicherung" bezeichnet. Doch anstelle von standardisierten Verfahren setzte Jantzen auf Methoden der Feldforschung und vor allem auf Fachberatungen. Er arbeitete in verschiedenen Betreuungsschichtdiensten selber mit, führte 92 Beratungen zu 69 Bewohnern durch, verlegte Vorlesungen von der Universität in die Einrichtung und bot verschiedene Fortbildungen an. (Vgl. Jantzen 2000, s.p.) Mit seinem Ansatz der rehistorisierenden Diagnostik hat Jantzen in den Entwicklungsprozess der Einrichtung interveniert, grundlegende Neubetrachtungen von einzelnen Bewohnern angeregt und neue Wege sichtbar werden lassen.
Im Zentrum der "Qualitätssicherung" stand bei Jantzen die personenorientierte Beratung zu und mit einzelnen Klienten. Dies deshalb, weil Ursprünge und Dynamik von geistiger Behinderung auch in den Augen vieler professioneller Betreuer als naturhafte Eigenschaften oder unabänderliche Schicksale gesehen wurden. "Je schwerer die Behinderung, desto seltener eine angemessene Diagnostik und umso häufiger eine den behinderten Menschen unangemessene pädagogische und therapeutische Situation." (Jantzen 1999b, s.p.) Die in der dortigen Einrichtung vorgefundenen Ent-wicklungsberichte enthielten kaum erklärende Informationen über die Bewohner, sondern beschränkten sich eher auf Beschreibungen, berichtet Jantzen. Mit seiner Methode der rehistorisierenden Diagnostik versuchte er die konkrete Behinderung des konkreten Menschen biografisch als dynamischen Prozess seiner Entwicklung zu begreifen, sich vom "Fall"-Denken zu verabschieden und eine "Rekonstruktion der Subjektivität" (Jantzen 1990, S.194) zu beginnen. Jantzen bezieht sich dabei auf Franco Basaglia, der seinen rehistorisierenden Ansatz wie folgt begründet:
"Wenn der Kranke tatsächlich die einzige Realität ist, mit der wir uns zu befassen haben, so müssen wir uns allerdings mit beiden Gesichtern dieser Realität auseinandersetzen: 1. mit der Tatsache, dass wir einen kranken Menschen vor uns haben, der psycho-pathologische Probleme aufwirft (die dialektisch und nicht ideologisch zu verstehen sind), und 2. mit der Tatsache, dass wir einen Ausgeschlossenen, einen gesellschaftlich Geächteten vor uns haben. Eine Gemeinschaft, die sich als therapeutisch versteht, muss diese doppelte Realität berücksichtigen - die Krankheit und die gesellschaftliche Ächtung - , um schrittweise die Persönlichkeit des Kranken wiederherstellen zu können, und zwar so, wie sie wahrscheinlich war, bevor die Gesellschaft mit ihren zahlreichen Etappen der Ausschließung einerseits und die von dieser Gesellschaft erfundene Irrenanstalt mit ihrer negativen Gewalt andererseits auf ihn einwirkten." (Basaglia 1973, S.151).
Die rehistorisierende Diagnostik untergliedert Jantzen in drei Schritte, die in Anlehnung an Marx "vom Abstrakten zum Konkreten aufsteigen" (Marx 2005, S.35):
Erster Schritt der rehistorisierenden Diagnostik ist das "Aufsteigen im Abstrakten". Hier wird der Versuch unternommen, hinter den Symptomen ein Syndrom zu entschlüsseln. Jantzen nennt diesen Schritt in Anlehnung an Alexander Romanowitsch Lurija "Syndromanalyse". Sie "dient der Gewinnung einer verständigen Abstraktion, von dem aus das Wesen der begreifenden Prozesse erschlossen werden kann". (Jantzen 2005, S.17). Als zweiten Schritt folgt das "Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten" (a.a.O.). Hierzu wird die Persönlichkeitsentwicklung vor dem Beginn der Behinderung betrachtet, das Syndrom in den Lebenskontext des Klienten zurückversetzt, in welchem es eintrat. Auf diese Weise gewinnt die "verständige Abstraktion" eine konkrete und einmalige Dimension. Der dritte Schritt, "das Aufsteigen im Konkreten" (Jantzen 2005: S.18), zielt auf die Rekonstruktion der Geschichte der Persönlichkeit unter der Bedingung des jeweiligen Syndroms. Jantzen nennt diesen Schritt auch "Romantische Wissenschaft" (Lurija 1993) und bezieht sich damit wiederum auf Lurija. Das Aufsteigen im Konkreten zielt auf das Verstehen eines Menschen, wozu die affektive Beteiligung, die Dimension der "ästhetischen Erkenntnis" gehört. Hier wird das Drama des Lebens nacherzählt und nachempfunden.
Formal orientiert sich Jantzen bei seinem Aufbau der Methode streng an dem dreistufigen dialektischen Modell nach Marx. In den weiteren Ausführungen der einzelnen Analyseschritte und in den Klienten-Beispielen gehen dann die zweite und dritte Stufe, Aufsteigen zum und Aufsteigen im Konkreten, weitgehend ineinander über. Auf klare Abgrenzungen dieser beiden Erkenntnisschritte verzichtet Jantzen, so dass ich diese beiden methodischen Schritte zu einem Kapitel zusammenfasse.
Die Syndromanalyse hat Lurija als methodische Grundlage seiner neuropsychologischen Forschungen und Therapie entwickelt.
"Wenn die Untersuchungsergebnisse brauchbar sein und die Beobachtungen der lokalen Hirnpathologie zu gültigen Schlussfolgerungen hinsichtlich des Aufbaus psychischer Prozesse wie auch hinsichtlich der Lokalisation im Kortex führen sollen, muss der Bestimmung einzelner Symptome die Beschreibung umfassender Symptomkomplexe oder, allgemein ausgedrückt, die Syndromanalyse folgen, die sich auf Verhaltensveränderungen infolge lokaler Hirnverletzungen bezieht." (Lurija 1998, S.34)
Lurija geht davon aus, dass die psychischen Tätigkeiten eines Menschen durch ein komplexes System gemeinsam arbeitender Hirnregionen ermöglicht werden. "Das bedeutet, dass das System als Ganzes durch eine Verletzung in irgendeiner dieser Regionen gestört werden kann und dass es je nach der Lokalisation der Verletzung unterschiedlich gestört wird." (a.a.O.) Um das Syndrom bestimmen zu können, müssen die Symptome miteinander in Verbindung gesetzt werden. "Der Grundgedanke ist es, hinter zahlreichen Symptomen ein Syndrom zu identifizieren, das, bezogen auf die Situation des Patienten, als verständige Abstraktion betrachtet werden kann," (Jantzen 2005, S.19) schreibt Jantzen. Dafür nutzt er empirische Verfahren zur Symptomerfassung, neurologische Untersuchungen und psychologische Tests. Bei seinen Beratungen in Lilienthal stütze sich Jantzen vor allem auf die Informationen in den Bewohnerakten: Ärztliche Diagnosen, Schulzeugnisse, Entwicklungsberichte und Tagesnotizen. Zusätzlich wurden Informationen durch Gespräche mit Angehörigen und Betreuern herangezogen - und schließlich die direkten Informationen, die der Klient selber dem Berater mitteilte. Anhand dieser Daten strebt Jantzen eine "optimale Gruppierung der Symptome im Sinne von Faktoren" (Jantzen 1990, S.188) wie in der Faktoren- oder der Clusteranalyse an.
"Im Rahmen der Syndromanalyse müssen also zahlreiche Einzeldaten daraufhin bewertet werden, welches der theoretisch wahrscheinlichste Zusammenhang ist, in dem sie zu begreifen sind. Man muss daher über Hypothesen von A(1) - A(n) verfügen, um einen Satz Symptome B (1) - B(n) einem verborgenen Syndrom aus der Reihe C (1) - C (n) so zuordnen zu können, dass das Hervorbringen der Symptome mit hoher Wahrscheinlichkeit durch dieses Syndrom, diesen Primärfaktor, diese Grundstörung erklärt werden kann." (Jantzen 2005, S.20)
Der Widerspruch gegenüber seinem in Teil B, Kap. 1.4 dargelegten soziologisch-konstruktivistischen Paradigma ist nicht zu übersehen, wenn Jantzen nun Symptome kausal in Beziehung zu einem Primärfaktor setzt und durch ein Syndrom zu erklären versucht.
Auch Jantzen selber bemerkt diese Ungereimtheiten, so dass er sich zugleich von "der klassischen psychiatrischen oder neurologischen Nosologie" distanziert. "Der Unterschied liegt ersichtlich in der Qualität der Abstraktion". (a.a.O.) Gegenüber der klassischen Diagnostik will Jantzen nicht bloßes "Beschreibungswissen" oder "reduktionistisches Erklärungswissen" zu Tage fördern, sondern "Erklärungswissen darüber, wie der sinnhafte und systemhafte Aufbau psychischer Strukturen in spezifischer Weise durch das Auftreten eines Defekts gestört wird." (a.a.O) Der kausale Begründungsansatz bleibt zwar damit erhalten, doch knapp 100 Seiten weiter im gleichen Buch greift Jantzen zum Begriff "kausaler Strukturen", um den Anschein eines biologistischen Deter-minismus zu entkräften. Wenn zunächst also das durch empirische Methoden entschlüsselte Syndrom als Ursache für die Symptome betrachtet wird, relativiert Jantzen dann die Stellung des Syndroms mit einer multifinalen und äquifinalen Betrachtungsweise: "Höchst unterschiedliche Ursachen können also zum gleichen Effekt führen. Aber auch die gleiche Ursache kann zu unter-schiedlichen Effekten führen." (Jantzen 2005, S.83) Zwischen biotischem Defekt und lebenspraktischem Verhalten sieht Jantzen "unendlich komplexe(n) Möglichkeitsräume der Vermittlung und Selbstorganisation". (ebd., S.145) Die Syndromanalyse verweist Jantzen somit in ihre Grenzen der biotischen Ebene, neben der es noch eine psychische und eine soziale gibt:
"Sie (Syndromanalyse) macht uns deutlich, welche spezifische Auswirkung ein Syndrom auf das Verhältnis zu den Menschen und zur Welt hat, wie z.B. Blindheit, Gehörlosigkeit, Autismus, Down-Syndrom usw. Sie vermag jedoch nicht aus sich heraus die Genesis intellektuellen Zurückbleibens im Sinne sekundärer Folgen und die Herausbildung von ‚Primitivreaktionen' im Sinne tertiärer Folgen zu erklären." (Jantzen 2005, S.121)
Das Syndrom, beispielsweise wie Trisomie 21 oder Blindheit, setzt Jantzen als Kern der Retardation. Dabei müssen Syndrome nicht immer biotischer Art sein. Auch traumatische Erlebnisse, äußere Gewalt oder soziale Verhältnisse können ein Syndrom bilden. Jantzen geht es darum, einen Kern bestimmen zu können, um welchen herum sich durch zahlreiche weitere Einflüsse vermittelt sekundäre und tertiäre Folgen entwickeln. Zur Syndromanalyse gehört also ein differenziertes Wissen über Struktur und Auswirkungen des Syndroms. Am Beispiel der Trisomie 21 zeigt Jantzen auf, wie die typische Langsamkeit der Menschen, die ein Down-Syndrom aufweisen, als eine folgerichtige Kompensationsleitung für die, durch die genetische Besonderheit verursachte Minderung der Dopaminsynthese rekonstruiert werden kann. Das Verhalten eines geistig behinderten Menschen wird auf diese Weise erklärbar. Jantzen erklärt das Symptom als eine Kompensationsleistung des betroffenen Menschen. Diese Kompensationsleistung, die oftmals als verrückt, unnormal oder dumm, bewertet wird, erfährt durch ihre Rückführung auf das Syndrom eine verständige Erklärung. Das Syndrom wird zum Schlüssel, um eine konkrete Geschichte individuellen Lebens verstehen zu können. Die Syndromanalyse bildet den ersten Schritt zur Rehistorisierung. Wie vieles in Jantzens Ausführungen zur rehistorisierenden Diagnostik bleiben auch hier die Abgrenzungen unscharf: Wo endet die Syndromanalyse und wo beginnt der Prozess des biografischen Verstehens, die "Romantische Wissenschaft"?
In praktischer Hinsicht dürfte sich die Abgrenzung beider Schritte voneinander als weniger relevant erweisen, da eine perfekte rehistorisierende Diagnostik, wie sie Jantzen in seinen Berichten vorführt, im Bereich meiner Anwendung ohnehin kaum möglich war. Wie bereits dargelegt, tendieren Jantzens Ausführungen überwiegend dahin, die Syndromanalyse auf den Schritt der biologischen Entschlüsselung eines Syndroms sowie die Explikation dessen direkter Auswirkungen bis hin zu den primären Kompensationen zu begrenzen. Statt biotischer Syndrome können auch psychische oder soziale Syndrome an diese Stelle gesetzt werden.
Während Jantzen die primären Kompensationen deutlich benennt, äußert er sich zu den sekundären und tertiären Kompensationen zurückhaltend. Die primären Kompensationen, die ich dem Schritt der Syndromanalyse zuordne, werden laut Jantzen "recht dicht am Defekt entwickelt. Entsprechend werden wir Handstereotypien, Autoaggressionen, Weinen und Schreien bei Rett-Syndrom eher als primäre Folgen beurteilen." (Jantzen 2005, S.53) Jantzens Einschränkung durch das Wort "eher" verweist bereits auf eine Unschärfe. Anstatt von sekundären und tertiären Kompensationen, spricht Jantzen nur von sekundären und tertiären Folgen oder Komplikationen. Das Kompensationsmodell gibt er, ohne es zu begründen, für die höheren psychischen Entwicklungsstufen auf. Als "sekundäre Komplikation" gilt zumindest die "geistige Unterentwicklung" infolge sozialer Isolation und Gewalt. Als "tertiäre Folgen" bezeichnet Jantzen die "Primitivreaktionen". Zu ihnen gehören z.B. "rhythmische Bewegungen, Bewegungsstürme, Negativismus und Suggestibilität aber auch fehlende Engagiertheit." (Jantzen 2005, S.120)
Den Schritt der Syndromanalyse bezeichnet Jantzen auch als den Schritt des Erklärens, der also über die bloße empirische Beschreibung von Symptomen hinausgeht. Er führt zu einem "Erklärungswissen", welches als Grundlage für den zweiten Schritt, den Akt des Verstehens, Voraussetzung ist. In seinen "Methodologischen Bemerkungen zur Differenz von Syndromanalyse und Rehistorisierung" (Jantzen 2005, S.115ff.) relativiert Jantzen diesen grundlegenden Stellenwert der Syndromanalyse, die er in diesem Text als rein "neuropsychologische Syndromanalyse" versteht. Er bietet stattdessen drei alternative Zugangsmöglichkeiten für das notwendige Erklärungswissen an: Entwicklungspsychologie und -psychopathologie, Soziologie und/oder eine "Theorie des inneren sinnhaften und systemhaften Zusammenhangs psychischer Prozesse". (Jantzen 2005, S.122) Jeder dieser wissenschaftlichen Ansätze "kann unter bestimmten Umständen durch eine je andere ergänzt oder substituiert werden." (a.a.O.) Die neuropsychologische Syndromanalyse hält Jantzen "für eine nicht redundante Bedingung, keineswegs aber für eine hinreichende und nicht immer für eine notwendige Bedingung." (Jantzen 2005: 117f.)
Jantzens zweite und dritte dialektische Stufe der Rehistorisierung gehen ineinander über. Er hat zwar programmtisch eine dreistufig dialektische Methode entworfen, doch da er kein dialektisch gegliedertes Gesamtwerk vollendet hat, gewinnen die einzelnen Schritte und Aspekte seines Ansatzes keine geschlossene und überschaubare Form. In seinem Werk finden sich verstreute Äußerungen, Ansätze, die er beginnt, dann wieder abbricht und in anderen Texten Ergänzungen hinzufügt. So streut Jantzen ein textliches Puzzle aus, das es zusammen zu setzen gilt. Umso mehr ist hierbei die subjektive Konstruktionsleistung des Lesers gefragt, der selber Zuordnungen einzelner Aussagen herstellen und Begriffe kreativ interpretieren muss.
Nachdem ich den Bereich der Entschlüsselung biotischer Syndrome der Stufe der Syndromanalyse zugeordnet habe, treten im Bereich des Verstehens die psychischen und sozialen Faktoren der Behinderung in den Mittelpunkt. Den Übergang stellt Jantzen mit einer gesellschaftlichen Vermittlung des Verhältnisses zwischen Defekt und "primärer Folge" her. Dieses "dynamische Verhältnis (...) wirkt immer in einer sozialen Situation". (Jantzen 2005, S.120) Der betroffene Mensch wird auf dieser analytischen Stufe wieder in seiner konkreten Gesellschaftlichkeit gefasst. Die soziale Situation, in welcher ein durch Syndrom und dessen primäre Kompensation belasteter Mensch hineintritt, "ist eine Situation geistiger Behinderung." (a.a.O.) Hier beginnt analytisch der Zugriff gesellschaftlicher Herrschaft, welcher tatsächlich bereits von Anfang an, wahrscheinlich von der ersten Zellteilung an existent ist.[10]. Jantzen stellt an dieser Stufe seiner Theorie die Gewalt in den Mittelpunkt der Behinderung, während der Defekt zurücktritt:
"Erfahrene Gewalt wird in dieser Sicht zum Schlüssel jeglicher biografischer Rekonstruktion, nicht nur jene Gewalt, die wir selbst wahrnehmen, sondern auch jene, die dadurch auf Individuen ausgeübt wird, dass Umwelten sich weiterhin ‚normal' zu ihnen verhalten, obgleich ihre soziale Entwicklungssituation sich tiefgreifend geändert hat (...) diese veränderte Situation - und keineswegs der Defekt - bildet den Nucleus der Retardation." (Jantzen 2005, S.163)
Um beim Beispiel der Trisomie 21 zu bleiben, gehört nun der Schritt von der primären Kompen-sation, der Langsamkeit, zur sekundären und tertiären Kompensation in den Bereich des rehistorisie-renden Verstehens. Als tendenziell allgemeines Kompensationsmuster stellt Jantzen hierzu folgen-des vor: Aufgrund ihrer Langsamkeit können Kinder mit Trisomie 21 in Lernsituationen nur relativ wenige Korrekturmechanismen aufbauen. Von daher neigen sie zum Modus der Risikovermeidung. "Ihr Anspruchsniveau reguliert sich tiefer ein." (Jantzen 2005, S.72) In Relation zu den gesellschaftlich vorgegebenen Normen des Lernens geraten solche Kinder und Erwachsene ins soziale Abseits. Als soziale Kompensationshandlung erkennt Jantzen die auffallende Freundlichkeit jener Menschen, die ich als tertiäre Kompensation bezeichne. "Wenn sie (Menschen mit Trisomie 21/ d.Verf.) darin bestärkt werden, (dass) andere sie lustig finden usw. und sie niemand im Leistungsbereich ernst nimmt, so bauen sie ersichtlich eine soziale Kompensation auf, in welcher es ihnen im Allgemeinen gelingt, eine positive Befindlichkeit ihrer Umgebung zu produzieren." (Jantzen 2005, S.73)
An diesem Beispiel wird deutlich, wie sehr bei der Konstruktion der sekundären und tertiären Folgen oder Kompensationen im Unterschied zu den primären die Gesellschaft ihren entscheidend bestimmenden Anteil trägt. Jene aufgezeigte Risikovermeidung und Freundlichkeit sind Resultate einer subjektiven Auseinandersetzung mit der auf Leistung, Tempo und Auslese ausgerichteten gesellschaftlichen Umwelt unter der besonderen Bedingung der Trisomie 21. Solange die Gesellschaft auf die genetische Besonderheit jener Menschen keine Rücksicht nimmt, geraten sie auf die Seite der Verlierer und werden als "Behinderte" in Sondereinrichtungen abgeschoben, in denen sie dann weitere Symptome durch die Einwirkungen institutioneller Gewalt und Isolation hervorbringen. Peter Rödler formuliert diesen qualitativen Umschlag so: "Die evtl. vorhandenen organischen Funktionsbeeinträchtigungen eines Menschen werden von diesen Effekten (des Ausschlusses/d. Verf.) so sehr überformt, dass deren Bedeutung im Leben eines Menschen jenseits dieser Effekte nicht mehr erkennbar ist." (Rödler 2002, S.223)
Die Geschichte der Behinderung eines Menschen ist auf der analytischen Stufe des Verstehens vor allem eine gesellschaftliche Geschichte, in der das Drama des Lebens rekonstruiert wird. Jantzen nennt die rehistorisierende Diagnostik somit auch eine "Diagnose der relationalen Beziehungen in jenem Handlungsfeld".(Jantzen 2005, S.157) Rehistorisierende Diagnostik wird hier zu einer Soziologie der Behinderung, zur Gesellschaftskritik im Konkreten, in der Etikettierungen ideologisch entschlüsselt werden und dem behinderten Menschen wieder die Anerkennung seiner Vernunftfähigkeit zurück gegeben wird. Seine Handlungen werden im Akt des Verstehens als durch Vernunft geleitet erkennbar.
"Durch diese Transformation wird die uns vorher fremde Geschichte durch den Modus der ‚Entschlüsselung' zu einer besonderen Geschichte von Menschen, die auch die unsere hätte sein können. Was vorher als Natur oder mir fremdes Schicksal erschien, erscheint nun als Ausdruck eines Dramas des Lebens. Und in dieser Hinsicht lässt uns der Erkenntnisakt nicht unberührt. Er stiftet eine ästhetische Dimension des Berührtseins durch ein Schicksal von Meinesgleichen, das unter Umständen hätte auch das meinige sein können. Und die Frage taucht auf, hätte ich es unter vergleichbaren Umständen besser oder schlechter gemacht? Das Feld der Macht wird also durch den ästhetischen Erkenntnisakt gesprengt, Anerkennung wird möglich, wo vorher Ausgrenzung herrschte." (Jantzen 2005, S.108)
Als Schlüssel zur Rehistorisierung sieht Jantzen den Verzicht auf Gewalt. Im Gegensatz zur Behandlungstechnologie, in der die Pädagogen über den Klienten hinweg beraten und ihn zum Objekt der Bevormundung degradieren, nimmt bei der rehistorisierenden Diagnostik der Klient persönlich an der Besprechung teil. Selbst wenn der Klient nicht spricht oder kognitiv dem Gespräch nicht folgen kann, ist dies zumindest ein symbolischer Akt der Teilhabe, durch den seine Position im Feld der Macht verschoben wird. Jantzen versteht dies als Anerkennung der persönlichen Würde des Klienten. Diese ist wichtiger als die Reparatur eines tatsächlichen oder phantasierten Defekts. Der Klient wird in diesem Prozess zum Mitforscher. Jantzen bezieht sich an dieser Stelle auf das subjektwissenschaftliche Paradigma Holzkamps. (Vgl. Holzkamp 1983) Die Hypothesen, die Jantzen aus den Akten und sonstigen Informationsquellen bildet, müssen am Ende durch den Klient selber verifiziert werden, um als gültig angenommen werden zu können.
In den Beispielen, die Jantzen in seinen Berichten aufführt, scheinen sich die Verifikationen weitgehend auf die Syndromanalyse zu beziehen. Meist sind es kurze Szenen, die Jantzen berichtet. Sie zeugen davon, dass er die verschlüsselten Ausdrucksgestalten der Bewohner situativ richtig versteht und einen kurzen Dialog herstellen kann: Mit einer Bewohnerin, die in der Einrichtung als schwer aggressiv gilt, unterhält sich Jantzen über die kurzen Haare. Sie streicheln sich gegenseitig den Kopf. Die Bewohnerin sagt "Hund" und Jantzen versteht dies als einen Vergleich seiner Frisur mit dem Fell eines Hundes. Die Bewohnerin fühlt sich verstanden. Der von den Betreuern befürchtete Aggressionsausbruch bleibt aus. Jantzen sieht seine These, wonach bei der Frau eine fehlende Orientierung zur Ursache von Aggressionen wird, bestätigt. Durch seine dialogische Absicherung konnte Jantzen in diesem Fall eine Orientierung anbieten. Meist bleibt es bei Episoden dieser Art. Jantzen tippt auf Schultern und Händen von nichtsprechenden Klienten und baut Dialoge auf, so dass die Betreuer staunen. Plötzlich werden aus renitenten Bewohnern aufmerksame Zuhörer, überraschende Verhaltensänderungen stellen sich sogar ein. Nur, wie es nachher weitergeht, wird nicht berichtet. Bezüglich eines Autisten weiß Jantzen, dass seine Empfehlung, ihn so oft zu baden, wie er es wünscht, dazu geführt hat, dass das Team bald erschöpft war und der Bewohner entspannter werden konnte.
Jantzens Ansatz ist ressourcenorientiert. Er sucht im Prozess des Verstehens nach den Stärken, die unter den übermächtigen Etiketten der Defekte in den Alltagsroutinen übersehen werden. Durch dieses Vorgehen erscheint der Bewohner in einem ganz anderen Licht als in der verdinglichten Betrachtung der anstaltstypischen Wahrnehmung. Um diese erstarrte Sichtweise der Betreuer zu verflüssigen, stellt Jantzen deren Erfahrungen in den Mittelpunkt der Fachberatung.
Seine Erkenntnisse aus dem Studium der Bewohnerakten hält er im ersten Teil seiner Fachberatung zurück, um "die Klugheit der MitarbeiterInnen als solche zu Geltung zu bringen" (Jantzen 2000, s.p.), diese zur Theorieentwicklung zu nutzen und die Selbstreflexion im Team zu fördern. Erst im zweiten Teil seiner Beratung greift Jantzen auf das Aktenmaterial zurück. Gemeinsam mit den Betreuern versucht er darin eine Geschichte der Person zu erarbeiten. Dabei geht es kaum um praktische Aspekte, was pädagogisch geschehen soll, sondern um die Frage, wie die Person geworden ist, wie sie ist. Dennoch werden in dieser Diskussion auch praktische Ziele und Methoden erarbeitet, wenn die Mitarbeiter selber solche benennen oder wenn im Dialog mit dem Bewohner konstruktive Ansätze entstehen. Den genaueren Ablauf der Fachberatung beschreibt Jantzen nicht. Auch zu den praktischen Konsequenzen bleiben seine Ausführungen sehr zurückhaltend. Zumindest verweist er aber auf die hemmenden Strukturen der Einrichtung:
"Trotzdem ist der Alltag der Einrichtung so beschaffen, dass die reflexive Distanz der Fachberatung schnell zerrinnt, insbesondere in der zeitlich dichten Situation des Gruppenalltags, wenn häufig negative Gegenübertragungen gegenüber BewohnerInnen, insbesondere verbunden mit Empathieentzug auftreten, die ihrerseits erneut zu Schuldgefühlen führen. Hier hilft auf Dauer nur ‚training on the job', was mir unter den gegeben Bedingungen zu realisieren nicht möglich war." (a.a.O.)
Zumindest jene Betreuer, die regelmäßig Jantzens Vorlesungen besucht haben, konnten die Erkenntnis gewinnen, "dass auch schwerstbehinderte Menschen über eine Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten verfügen." (a.a.O.) Nach dem Bericht eines Kommilitonen aus Jantzens Forschungsgruppe haben nur sehr wenige Betreuer an den Lehrveranstaltungen teilgenommen. Beim Übergang zur praktischen Veränderung wird deutlich eine Schwäche in Jantzens Ansatz sichtbar, auf die ich auf Grundlage meiner eigenen Anwendung der rehistorisierenden Diagnostik in Teil D, Kapitel 2.3 u. 2.4 zurückkomme.
Die gesamtgesellschaftlichen und politischen Strukturen der Ausgrenzung geistig behinderter Menschen durchziehen die Gesellschaft bis zu den einzelnen Individuen. Die Teilhabemöglichkeiten eines einzelnen hängen von seinen geistigen, körperlichen Fähigkeiten sowie ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen ab. Auch innerhalb der sozial konstruierten Gruppe geistig behinderter Menschen konnte ich Ausgrenzungen, Diskriminierungen und Machtkämpfe beobachten. Bourdieu hat mit seinem Modell des "sozialen Feldes" diesen allgemeinen Sachverhalt auf einen anschaulichen Begriff gebracht. Mit ihm konnte ich für die Reflexion meiner praktischen Erfahrungen im Forschungsfeld eine Art innere Landkarte über die Zusammenhänge zwischen den beteiligten Subjekten zeichnen. Das Modell des Feldes hatte ich als kognitives Muster immer "im Hinterkopf". "Der synchronischen Wahrnehmung stellen sich Felder als Räume dar, die ihre Struktur durch Positionen (oder Stellen) bekommen, deren Eigenschaften wiederum von ihrer Position in diesen Räumen abhängen und unabhängig von den (partiellen durch sie bedingten) Merkmalen ihrer Inhaber untersucht werden können." (Bourdieu 1993, S.107) Diese Positionen müssen erfasst werden, wie in meinem Falle beispielsweise die Positionen der Heimleitung, der Betreuer und der Bewohner. Solche Positionen und ihre Beziehungen zueinander verändern sich durch soziale Praxen. "Die Struktur des Feldes gibt den Stand der Machtverhältnisse zwischen den am Kampf beteiligten Akteure oder Institutionen wieder bzw. wenn man will, den Stand der Verteilung des spezifischen Kapitals, das im Verlauf früherer Kämpfe akkumuliert wurde und den Verlauf späterer Kämpfe bestimmt." (ebd.: 108)
Für die Erstellung einer "Landkarte" des Feldes muss zunächst das spezifische Kapital identifiziert werden, also das, was innerhalb dieses Feldes einen Wert hat. Sodann muss die Verteilung dieses Kapitals, die Struktur des Feldes, analysiert werden. Wie verteilt sich die Macht innerhalb des Feldes und nach welchen Spielregeln wird der Kampf um sie ausgetragen? Dies ist auch für die diskursive Analyse von Bedingungen, Handlungsgründen und dem Versuch einer Unmittelbarkeitsüber-schreitung (s. Kap. 1.2) nicht unerheblich. Weiß man beispielsweise, dass zwei Mitarbeiter sich konkurrierend um eine bestimmte Position beworben hatten, der eine davon die Stelle bekommen hat und der andere nicht, so erscheinen inhaltliche Konflikte über pädagogische Fragen zwischen den Kontrahenten in einer zusätzlichen Bedeutungsdimension, die im unmittelbaren Diskurs über subjektive Begründungen verborgen bleiben kann - mitunter sogar umgekehrt: subjektiv fachliche Begründungen werden für den Kampf um die Macht instrumentalisiert, entwickeln eine diskursive Eigendynamik und dienen als Ideologie, als Schleier über die realen Kämpfe, die besonders in Institutionen der sozialen Hilfe gern tabuisiert werden. Unmittelbarkeitsüberschreitung bedeutet hier, das Spiel der Macht zu durchschauen, dies und auch die Risiken dieses Spiels für die Bewohner der Einrichtung zur Diskussion zu stellen.
Diese Machtkämpfe beziehen sich nicht immer und überall primär auf die Verteilung von Geld und Gütern (ökonomisches Kapital), sondern je nach Spezifik des Feldes auch auf andere Ressourcen, z.B. auf Ruhm, Anerkennung (symbolisches Kapital), Kontrolle, ideologische Führung, soziale Kontakte, Bündnisse, Einfluss usw. Bourdieu hat im Wesentlichen vier Kapitalsorten unterschieden:
Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital und symbolisches Kapital. Ich halte diese Differenzierung soziologisch für sinnvoll, weil, wie Bourdieu erkannt hat, die Verteilung des rein ökonomischen Kapitals nicht ausschließlich die Reproduktion der sozialen Hierarchien zu erklären vermag. Der Reichtum an ökonomischem Kapital ermöglicht zwar grundlegend den Zugang zu einer besseren Berufsausbildung und damit zur Karriere und Vermehrung des materiellen Besitzes, ist aber letztendlich dafür keine hinreichende Bedingung. Zur wirtschaftlichen Karriere gehören funktionale soziale Beziehungen, ein Repertoire von opportunen Verhaltensmustern, die erwünschte Bildung und ein entsprechendes Ansehen. Ausgangspunkt für diese Ressourcen kann der geldwerte Besitz sein, aber auch umgekehrt können erfolgreiche Bildungsabschlüsse, die richtigen "Connections" und das passende Auftreten zum materiellen Wohlstand beitragen. Im politischen Feld finden sich häufig Beispiele, wie Menschen aus einfachen sozialen Verhältnissen auch ökonomisch sehr erfolgreich wurden, z.B. Josef Fischer und Gerhard Schröder. Die Kapitalsorten sind nach Bourdieu konvertierbar. (Vgl. Bourdieu 2005, S.70ff.) In jedem sozialen Feld sind die Kapitalsorten anders gewichtet. Im Feld meiner Forschung zählt zwar wie in jedem kapitalistischen Unternehmen das ökonomische Kapital, da aber die Gehälter in der Behindertenarbeit ohnehin, anders als in der Finanzbranche, engen Grenzen unterliegen, lassen sich häufig Kämpfe primär um andere Kapitalsorten beobachten, v.a. um symbolisches und soziales Kapital. Rechthaberei, Kontrolle, Einfluss, Geltung spielten häufig eine bedeutende Rolle in den Auseinandersetzungen.
Der Kampf um das feldspezifische Kapital wird mit regeladäquaten Strategien ausgetragen. Diese Strategien sind zum Teil subjektiv bewusst kalkulierte Strategien, wie sie beispielsweise in Kommunikations- und Führungsseminaren vermittelt werden, meist sind es aber hinter dem Rücken ihrer Subjekte sich stumm vollziehende Strategien, wie sie Bourdieu beschreibt, als "ein unbewusstes Verhältnis zwischen einem Habitus und einem Feld. Die Strategien, die ich meine, sind Handlungen, die sich objektiv auf Ziele richten, die nicht unbedingt auch die subjektiv angestrebten Ziele sein müssen." (Bourdieu 1993, S.113) Der Habitus ist seinem Träger nur teilweise bewusst, er ist verinnerlicht und bestimmt das Verhältnis des Individuums zu seinem Feld ganz wesentlich. "Der Habitus als ein System von - implizit oder explizit durch Lernen erworbenen - Dispositionen, funktionierend als ein System von Generierungsschemata, generiert Strategien, die den objektiven Interessen ihrer Urheber entsprechen können, ohne ausdrücklich auf diesen Zweck ausgerichtet zu sein." (a.a.O.) Bourdieu verweist damit auf routinierte Handlungsmuster, auf Selbstverständlichkeiten des subjektiven Verhaltens, die einer bewussten Begründungsarbeit im Alltag entgehen und trotzdem soziale Wirklichkeiten schaffen. Da, wo der Habitus eines Akteurs nahtlos zu den Anforderungen des jeweiligen Feldes passt, wo sich der Teilnehmer keine bewusste zusätzliche Mühe geben muss, um die spezifische Kapitalsorte zu akkumulieren, passen die subjektiven Strategien des Akteurs und die Strategien des Feldes zueinander.
Reibungen, Kämpfe und Konflikte entstehen nicht nur, wenn Kontrahenten um den zu verteilenden Profit konkurrieren. Sie entstehen auch, wenn das, was im Feld selbstverständlich als wertvoll gilt, durch das Handeln bestimmter Akteure gefährdet wird. In diesem Fall wird die stillschweigende Übereinkunft gebrochen. Da diese ebenfalls zu einem großen Teil in routinierte Deutungsmuster und Handlungsroutinen eingeschliffen ist, treten ihre Inhalte oftmals erst dann bewusst in Erscheinung, wenn die Harmonie durchbrochen wird. Störende Interventionen im Forschungsfeld können somit aufklärend wirken, zur Überschreitung der unmittelbaren Selbstverständlichkeit beitragen und Reflexionen anregen.
Subjektive Deutungsmuster und kollektive Handlungsstrategien stehen in einem widersprüchlichen Wechselverhältnis. Sie müssen nicht übereinstimmen. Im Wohnheim konnte ich folgendes Beispiel beobachten: Bei einem Bewohner, der an Durchblutungsstörungen in den Füßen litt, wurden regelmäßig von Betreuern die Füße eingecremt. Diese Maßnahme führte zwar zu keiner Heilung, aber zu einer Stabilisierung. Da diese Hilfeleistung Arbeitszeit in Anspruch nahm, fehlte sie für die Anleitung aktivierender Angebote. In der Folge entstanden auch bei anderen Bewohnern Symptome, die sich der Möglichkeit nach auf einen Mangel an Bewegung zurückführen ließen. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die symptomatische Behandlung einen noch größeren Zeitaufwand erforderte, wodurch aktivierende Angebote zunehmend in die Ferne rückten. Die subjektiv "gut gemeinte" Maßnahme des Eincremens kann unmittelbar durchaus zu dem gewünschten positiven Effekt führen, im Ensemble des gesellschaftlichen Zusammenwirkens der einzelnen Akteure kann sie aber hinter deren Rücken ihren objektiven Sinn verändern und kontraproduktiv werden.
Dieser Reflexionsansatz knüpft an die Unmittelbarkeitsüberschreitung in der Subjektwissenschaft an: "Gesellschaft ist dem Individuum nie in ihrer Totalität, sondern nur in ihren dem Individuum zugewandten Ausschnitten gegeben. Entsprechend sind einzelne Sachverhalte in ihrer Bedeutung nicht mehr allein aus sich selber heraus zu begreifen, sondern nur aus ihren Bezügen im Gesamt der arbeitsteiligen Reproduktion." (Markard 2000, s.p.) Eine kritische Analyse hat dahin zu wirken, die unmittelbare Verhaftetheit der Individuen in der Erscheinungsform der gesellschaftlichen Zusammenhänge gedanklich lösen und "auf ihren konkreten Wirklichkeitsbezug hin zu durchdringen". (Forschungsgruppe Lebensführung 2003, S.10) Dies geschieht dialogisch, wobei der professionelle Forscher nach meiner Auffassung aufgrund seiner relativen Nichtinvolviertheit in die jeweilige Unmittelbarkeit im Vorteil ist, den falschen Schein, den die sozialen Verhältnisse von sich geben, eher zu durchdringen als die unmittelbar in diesen Schein involvierten Subjekte. Adorno nennt diesen Erkenntnisprozess Ideologiekritik. "Als objektiv notwendiges und zugleich falsches Bewusstsein, als Verschränkung des Wahren und Unwahren, die sich von der vollen Wahrheit ebenso scheidet wie von der bloßen Lüge, gehört Ideologie, wenn nicht bloß der modernen, so jedenfalls einer entfalteten städtischen Marktwirtschaft an." (Adorno 1979b, S.465) Die Ideologie ist ein "Schleier, der notwendig zwischen der Gesellschaft und deren Einsicht in ihr eigenes Wesen liegt" (Adorno 1979b, S.472) und erfüllt die Funktion einer Rechtfertigung von undurchsichtigen und vermittelten Machtverhältnissen. Ideologiekritik ist dann die "Konfrontation der Ideologie mit ihrer eigenen Wahrheit", sofern die Ideologie "ein rationales Element enthält, an dem die Kritik sich abarbeiten kann." (a.a.O.)
Zurück zu meinem Beispiel: "Der rationale" Kern, den ich darin identifizieren kann, ist, dass das Eincremen durchblutungsgestörter Füße ein hilfreiches Mittel zur Linderung der Beschwerden sein kann. Das ist zugleich der wahre Anteil jener Ideologie. Der unwahre Anteil aber ist, dass die kollektiv vermittelten Folgen genau zum gegenteiligen Effekt führen können. In diesem Beispiel verschränkt sich Wahres mit Unwahrem und bildet eine Ideologie, die zugleich wie ein Schleier zwischen den Akteuren und deren Einsicht in das Wesen ihres gemeinsamen sozialen Handelns wirkt. Vom Standpunkt des einzelnen Subjekts aus erscheinen die Folgen des kollektiven Handelns als Bedingungen. Hier beginnt bereits der Prozess der Entfremdung, indem das Resultat des eigenen Handelns als ein fremder Gegenstand dem einzelnen gegenübertritt, zu dem er sich verhalten muss. Im Modus der restriktiven Handlungsmöglichkeit bleibt es bei einem reaktiven Verhalten zu den sozialen Bedingungen.
Die Aufgabe als teilnehmender und intervenierender Forscher besteht darin, vom Außenstandpunkt aus den objektiven Sinn von Handlungsstrategien zu dechiffrieren - dies nicht als "objektive Erkenntnis", als Wahrheitsurteil, sondern im Sinne des Aufzeigens eines anderen Zusammenhangs, der vom unmittelbaren Praxisstandpunkt aus hinter dem Schleier verborgen liegt. Eine solche ideologiekritische Intervention kann auch durch praktische Aktionen eingeleitet werden, z.B. durch das Anstiften der betroffenen Bewohner, sich selber einzucremen oder sie zum Sport zu begleiten. Mitunter hat bei meiner Arbeit erst das provokative Verstören zu Begründungsdiskursen und zu Veränderungen der Handlungsmuster geführt.
"Das zentrale und problematischste Kennzeichen der als selbstverständlich hingenommenen Alltagswelt ist eben die Tatsache, dass sie als selbstverständlich hingenommen wird." (M. Nathanson, Introduction, 1967, zit. nach Fengler 1984, S.79) Nach dem Ansatz der Ethnomethodologie haben Christa und Thomas Fengler eine niedersächsische Psychiatrie untersucht. (Vgl. Fengler 1984) Auch bei ihnen ging es darum, die verborgenen Strukturen des Handelns zu entschlüsseln. Sie legten den Schwerpunkt auf die kommunikative Hervorbringung der sozialen Verhältnisse.
"Im Gegensatz also zur alltagsweltlichen Einstellung (die auch der traditionelle Soziologe nicht verlässt), in der die soziale Welt uns von außen als faktische gegenübertritt, entsteht für die Ethnomethodologie soziale Wirklichkeit erst in den praktischen Erklärungen der Mitglieder, in denen diese sich über den geordneten, regelmäßigen, vertrauten und faktischen Charakter ihrer Handlungen und ihrer Umwelt verständigen."
(Fengler 1984, S.83)
Die als objektiv gegeben erscheinenden Bedingungen bzw. Verhältnisse sind sowohl Voraussetzung als auch Ergebnis des kollektiven Handelns:
"So-ist-es-hier-nun-mal heißt, dass die Dinge im Krankenhaus in einer bestimmten Weise laufen und auch laufen müssen, unabhängig von den Absichten und Interessen der einzelnen beteiligten Akteure. Indem die Mitglieder unablässig auf dieses so-ist-es-hier-nun-mal verweisen, erkennen sie und demonstrieren sie sich gegenseitig den objektiven Charakter der Merkmale ihrer sozialen Umwelt, die gleichzeitig als Maßstab für die Rationalität und Adäquanz ihrer Beschreibungen dient. Diese wesensmäßige 'Reflexivität', die darin besteht, dass eine Äußerung oder eine Handlung ihren Sinn durch den Kontext bekommt, den sie im Moment ihres Erscheinens erst schafft, diese Reflexivität, die für den alltagsweltlichen Handelnden 'uninteressant' bleibt, ist jedoch für die Gesellschaftsmitglieder, die Ethnomethodologie betreiben, ein unentdecktes Land, wo Überraschungen und Abenteuer auf sie warten." (ebd., S.84f.)
Dieses "So-Ist-Es-Hier-Nun-Mal" findet sich stets im Plural. Es gibt endlos viele jener "So-Ist-Es-Hier-Nun-Mal" in den verschiedensten Handlungsbereichen. Sie beschreiben die Regeln, nach denen die Akteure handeln und wie die Akteure eine konkrete Situation einer Regel zuordnen. Diese Konstruktionsleistungen vollziehen sich (auch) sprachlich:
"Die Mitglieder erklären sich selbst und einander die aktuellen Ereignisse und Handlungen in ihrem Setting, indem sie die einzelnen Handlungen und Situationen als Beispielfälle (Dokumente) eines zugrundeliegenden Musters erkennen und sich gegenseitig erkennbar machen. (...). Die Mitglieder beziehen sich - in welch verkürzter Form auch immer - auf Regeln oder regelähnliche Konstrukte (Normen, Haltungen usw.) und verstehen und organisieren so die Welt, in der sie leben." (Fengler 1984, S.218)
Für den Forscher stellt sich dabei die Aufgabe, diese Erklärungen, Zuordnungen und Konstruktionen der Akteure zu verstehen und miteinander in Verbindung zu setzen. Dieses Vorgehen entspricht soweit auch dem subjektwissenschaftlichen Ansatz, als auch nach der Ethnomethodologie die Rekonstruktion der Regeln vom Standpunkt des Subjekts aus geleistet wird. Der Akteur untersteht keinen vom Forscher gesetzten Bedingungen, auf die er reagieren muss, sondern verfügt selber über die Bedingungen seines Handelns, was hier als "Hervorbringung von Regeln" bezeichnet wird. Der Forscher beobachtet dieses Hervorbringen und bringt die in den Narrationen der Akteure meist latent enthaltenen Aussagen über die Regeln auf den Punkt. Er schält quasi die situationsbezogene Verpackung von der zugrundeliegenden Regel ab und reformuliert diese in verallgemeinerbarer Form.
Die Rekonstruktion solcher alltagspraktischer Regeln halte ich für notwendig, um diese von den kodifizierten Regeln, die in Arbeitspapieren, Hilfeplänen oder Konzepten stehen, unterscheiden zu können. Beide stehen erfahrungsgemäß nicht zwingend in einem kongruenten Verhältnis zueinander. So stellt sich anschließend die Herausforderung, diese Widersprüche den Akteuren gegenüber offenzulegen und alternative Handlungsmöglichkeiten auszuloten. Problematisch bei meiner Forschung wurden die Konflikte, die dabei entstanden. (s. Teil E, Kap.1) Als Forscher, der von außen kommt und in die alltagspraktischen Regeln nicht involviert war, leistete ich mir die luxuriöse Rolle, all das zu hinterfragen, was den unmittelbaren Akteuren als notwendig erschien. Dies wirkte oftmals provozierend und "besserwisserisch", so dass ich mich zunehmend mit Äußerungen dieser Art zurückhielt. Die Ansätze dieses Kapitels nutzte ich dann vor allem zur eigenen Reflexion meiner Beobachtungen und zur Diskussion in der Forschungsgruppe.
[8] "Das postmoderne Denken ist von der Einsicht getragen, dass in Totalitätskonzepten und -modellen Partikulares zum Absoluten, zum Ganzen stilisiert wird, dieses Ganze sich aber nicht unter die Herrschaft totalitärer Diskurse bringen lässt. Die Postmoderne beginnt für Welsch da, wo das Ganze aufhört, wo Vielfalt bejaht, begrüßt und nicht bedauert wird." (Fischer 1992, S. 15, in: Fischer/Retzer/Schweitzer: "Das Ende der großen Entwürfe". Frankfurt/M., 1992)
[9] "Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen (...), um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." (§1 SGB IX)
[10] Was bei Jantzen mitunter als ein zeitliches Nacheinander erscheint, ist nach meiner Lesart oft nur ein gedankliches Nacheinander und Nebeneinander, je nachdem, welchen Aspekt er referiert.
Inhaltsverzeichnis
Der empirische Teil umfasst die Darstellung und Auswertung der Qualitätsentwicklung im Rahmen der "wissenschaftlichen Begleitung". Das Feld der Qualitätsentwicklung hat die Forschungsgruppe auf die Bereiche der Individuellen Hilfeplanung (IHP) und der Evaluation begrenzt, weil der Auftrag seitens der Einrichtung im Wesentlichen nur diese beiden Aufgabenbereiche umfasste. Die Ansätze zur IHP und die Evaluation reichten jedoch weit über das Verfassen von Berichten hinaus und griffen intervenierend in die reale pädagogische Praxis ein. Sie zielten auf die Unterstützung eines Prozesses in Richtung der vorgegebenen Ziele einer Ambulantisierung. Qualität bedeutete stets Lebensqualität der beteiligten Subjekte, vor allem der Bewohner. Qualitätsentwicklung zielte folglich auf die Entwicklung von Möglichkeiten zur freien menschlichen Entfaltung und sozialer Teilhabe. Die IHP sollte die Hilfen bei der Entwicklung dieser Möglichkeiten unterstützen, die Evaluation die konkreten Bedürfnisse und real existierenden Möglichkeiten erfassen, gegenüberstellen und neue Wege eröffnen.
Vor allem die Evaluation hatte den Charakter einer permanenten Entwicklungsbegleitung. Zu ihr gehörten eine Teilnehmende Beobachtung, fortlaufende Dialoge mit Leitung, Betreuern und Bewohnern sowie Methoden aus der Handlungsforschung und Ansätze zur rehistorisierenden Diagnostik.
Den Teil D meiner Arbeit gliedere ich historisch analog zum realen Forschungsverlauf. Das Kapitel 1 betrifft die Anfangsphase von Mitte des Jahres 2006 bis Ende 2006, in der wir, die Forschungsgruppe, vor allem unsere Konzepte entwickelt und das Forschungsfeld erkundet haben. In Kapitel 2 werte ich meine teilnehmenden sowie intervenierenden Forschungsprojekte (Januar - September 2007) aus und schließe es mit dem Zwischenbericht zur Evaluation. In Kapitel 3 stelle ich die Auswertung meiner Forschung aus der Phase zwischen Februar und Dezember 2008 dar, überprüfe die Umsetzung des IHP-Konzeptes und schließe mit einer an Entwicklungsthemen orientierten Endauswertung. Ich habe danach meine Mitarbeit in der Forschungsgruppe beendet und mich auf den Abschluss meiner Dissertationsarbeit konzentriert. Dies vor allem deshalb, weil ich für mich als handlungsfähiges Subjekt einen selbstbestimmten Endpunkt dieses Forschungsprozesses setzen wollte, anstatt mich immer wieder auf neue Verlängerungswünsche des Auftraggebers einzulassen, während die Einrichtung ihren Ambulantisierungsprozess immer weiter in die zeitliche Länge dehnte. Meine Kollegen blieben bis Mitte 2009 dem Auftraggeber verbunden.
Ich stelle im Folgenden zunächst Markus Lauenroths Konzept einer Individuellen Hilfeplanung (IHP) in seinen Grundzügen vor und orientiere mich dabei eng an seinen Ausführungen, wie er sie in seiner Diplomarbeit "Subjektwissenschaftlich begründete Qualitätsentwicklung am Beispiel der Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Individuellen Hilfeplanung in einer Einrichtung für behinderte Menschen" (Lauenroth 2007) dargelegt hat. Das IHP-Konzept basiert überwiegend auf der Theorie der Kritischen Psychologie und dem subjektwissenschaftlichen Forschungsansatz. (s. Teil C, Kap.1.2) Es unterscheidet sich von meinem Forschungskonzept deutlich, v.a. insofern Lauenroth keinen Bezug zur Kritischen Theorie nimmt. Dennoch erscheinen mir unsere beiden unter-schiedlichen Ansätze im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes als kompatibel. Die theoretische und methodische Vielfalt betrachte ich gemäß des postmodernen Denkens (vgl. Fischer 1992, S.15) als eine Bereicherung. Zudem basieren sowohl die Kritische Psychologie als auch die Kritische Theorie ganz wesentlich auf der Marx'schen Theorie und deren emanzipatorischem Ansatz. Auch in meinem Forschungskonzept habe ich bedeutende Grundsätze und Theoreme aus der Kritischen Psychologie mit aufgenommen. In Kapitel 1.2 erläutere ich mein Konzept zur Evalua-tion auf Grundlage meiner theoretischen Prämissen, die ich in Teil B, Kapitel 4 begründet habe. An-schließend stelle ich die ersten Ergebnisse meiner Teilnehmenden Beobachtung in Kapitel 1.3 vor.
Hilfeplanung ist durch das Verhältnis mindestens zweier Positionen und damit verbundener Perspektiven gekennzeichnet: die des Sozialpädagogen und die des Klienten. Die Klienten sind mit ihren Versuchen zur Lösung ihrer Probleme nicht zu ausreichendem Erfolg gekommen oder Dritte haben auf ihre Hilfebedürftigkeit hingewiesen; Hilfeplanung ist dabei eine Unterstützung bei der Lebensführung, die mehr oder weniger erwünscht wird. "Hilfe" setzt immer ein soziales Verhältnis voraus, in dem die Helfenden über Ressourcen verfügen, von denen die auf Hilfe angewiesenen ausgeschlossen sind. Die Situation der Hilfebedürftigkeit ist zugleich eine Situation der Nicht-Teilhabe. Das Ziel von Individueller Hilfeplanung muss daher immer Teilhabeentwicklung sein.
Damit Hilfe geplant werden kann, muss sich über die Problematik und die möglichen Wege zur Verbesserung der Situation verständigt werden, ebenso gilt es während und nach der Umsetzung von bestimmten Vorhaben diese auf ihre Sinnhaftigkeit zu reflektieren. Der Prozess der IHP ist von den gleichen Widersprüchen geprägt wie die Soziale Arbeit insgesamt: Allen voran die Einheit von Repression und Reproduktion, Hilfe und Kontrolle. Umso notwendiger ist es, diese Widersprüche als Behinderungen der personalen und damit immer auch kollektiven Handlungsfähigkeit zu thematisieren und die Hilfeplanung zu evaluieren, denn sie kann zur Bevormundung umschlagen. Diese gilt es nach Möglichkeit zu verhindern, indem Individuelle Hilfeplanung als ein möglichst dialogischer Prozess gestaltet wird und Machtverhältnisse sowie verschiedene Positionen benannt werden.
Die Entwicklung einer defizitorientierten Förderplanung, in der von "Professionellen" bestimmt wird, was zu verändern ist, zur bedürfnisorientierten Individuellen Hilfeplanung in der Behindertenhilfe, in der die Betroffenen als Subjekte ernst genommen werden sollen, stellt einen erheblichen Fortschritt dar (Schädler 2002, S.171ff). Jedoch bleiben bestehende Ansätze zur IHP in der Behindertenhilfe hinter diesem Anspruch zurück. Eine Analyse bestehender IHP-Ansätze und Konzeptionen[11]5 ließ folgende Leerstellen und Problematiken erkennbar werden, die hier lediglich aufgezählt werden können und sich selbstverständlich nicht in allen Konzepten finden lassen:
-
Orientierung an Defiziten anstatt an Bedürfnissen und darauf bezogenen Bedarfen,
-
fehlende Prozessorientierung,
-
getrennte Betrachtung verschiedener Lebensbereiche, wobei deren Zusammenhang unberücksichtigt bleibt,
-
Vermischung und damit unkenntlich werden der unterschiedlichen Subjektstandpunkte,
-
keine Darlegung der jeweiligen Zusammenhangsannahmen, die die Ziele und Maßnahmen begründen könnten,
-
damit Reduktion der Hilfeplanung auf unmittelbare Zusammenhänge.
Vor diesem Hintergrund und der Annahme, dass IHP-Konzepte immer auch für den jeweiligen Dienst oder die jeweilige Einrichtungen und ihr Klientel spezifiziert werden muss, hat Lauenroth für den Auftraggeber ein eigenes Konzept entwickelt.
Grundsätzlich praktiziert jeder Mensch fortlaufend "Hilfeplanung" bei der Bewältigung seiner alltäglichen Lebensführung (Vgl. Holzkamp 1996, Bader 2002): Es gehört zur alltäglichen Praxis, die Lebensbedingungen emotional-kognitiv zu bewerten, je nach Situation und Problematik sich mit anderen Individuen zu verständigen, Annahmen über Zusammenhänge zu konstruieren, Perspektiven zu entwickeln und nächste Handlungsschritte zu planen, umzusetzen und auszuwerten. Lebensführung zielt in der Regel immer auf die Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität.
Subjektwissenschaft (vgl. Holzkamp 1997, S.17ff.) zielt auf die intersubjektive Entwicklung von Theorie, auf deren Grundlage die Praxis emanzipatorisch umstrukturiert werden kann. Wesentlich dabei ist die Analyse und Überwindung unmittelbarkeitsverhafteter Begründungsmuster und damit verbundener restriktiver Handlungsfähigkeit. Im Kern geht es darum, die sozial-materiellen Lebensbedingungen in ihrer jeweiligen Bedeutung als Behinderung und/oder Möglichkeit von Teilhabe herauszuarbeiten, um Erkenntnisse für eine veränderte Praxis zu entwickeln (Begründungsanalyse). Die Auswahl der zu bearbeitenden Themen und daraus abzuleitenden Ziele muss von den subjektiven Wünschen und Problemen der Beteiligten ausgehen. Diese Themen sollten in ihrer generativen Dimension herausgearbeitet werden (generative Themen).
Im Alltagsbewusstsein erscheinen die Probleme meist nur in ihrer unmittelbaren Gestalt und nur unmittelbar als veränderlich. Ausgeblendet werden die gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhänge. Zu einer solchen Unmittelbarkeitsverhaftetheit gehört auch ein statisches Denken, das die Prozesshaftigkeit von Problemen ausblendet. Die Fakten erscheinen als unveränderbar, ihre Potenzialität bleibt verborgen (Vgl. Holzkamp 1985, S.386ff). Diese eingeschränkte Weltsicht resultiert daraus, dass zunächst jedem Subjekt die Welt vom jeweiligen Standort aus gegeben ist. Holzkamp spricht in diesem Zusammenhang von einer zentrierten, standortgebundenen Perspektive. (Vgl. Holzkamp, 1996, S.87ff) Diese ist unmittelbarkeitsverhaftet, insofern die standortgebundene Sicht auf die Welt absolut gesetzt wird und somit auf der bloßen Erscheinungsebene verharrt.
Durch eine Herausarbeitung der unterschiedlichen Sichtweisen kann deutlich werden, dass die Welt unterschiedliche Bedeutungen für die verschiedenen Subjekte hat. Diese unterschiedlichen Sichtweisen lassen sich wiederum selbst zum Gegenstand von reflexiven Diskursen nehmen.
Holzkamp spricht hier von einer Dezentrierung und der Konstruktion eines Metastandpunktes, dessen wesentliches Merkmal ist, dass die Lebensbedingungen als gemeinsamer Gegenstand der verschiedenen Subjektsichten thematisiert werden.
Eine besonders bedeutsame Form von Unmittelbarkeitsverhaftetheit ist personalisierendes Denken: "Personalisierung bedeutet allgemein, von den Lebensumständen der Menschen derart zu abstrahieren, dass gesellschaftliche Beschränkungen in subjektive Beschränktheit uminterpretiert werden" (Vgl. Fahl/Markard 1993, S.8); Eine häufige Form sind dabei Vereigenschaftungen. Damit ist das "Anheften" von Bewertungen an eine Person gemeint, der diese als Wesensmerkmal zugeschrieben wird. Ausgeblendet werden damit die Vermittlungszusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Anforderungen/Bedingungen und den jeweils subjektiven Bedeutungen.
Wesentliche Aufgabe für die IHP ist nach einem subjektwissenschaftlich begründeten Handlungsansatz somit, die Lebensverhältnisse als veränderbar zu begreifen. Da die aktuellen Lebensmöglichkeiten Auswirkungen auf die jeweiligen Bedürfnisse haben, ist auch zu fragen, wie das bisherige Handlungsfeld erweitert werden kann, um die Entwicklung neuer Bedürfnisse zu ermöglichen. Über die Dezentrierung der Sichtweisen können, ebenso wie durch die Überwindung personalisierenden Denkens, die Lebensbedingungen und sozialen Verhältnisse in ihrer Problematik und Veränderbarkeit begriffen werden. Als theoretischen Hintergrund, um dies in der Hilfeplanung zu leisten, empfiehlt Lauenroth die Figur der Bedingungs-Begründungsanalyse, deren Vorgehen und Begrifflichkeiten im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Die "Begründungsanalyse" ist eine Kurzform und meint immer die Auseinandersetzung mit Bedingungen, deren gesellschaftlichen und subjektiven Bedeutungen, Handlungsprämissen und Handlungsgründen (Vgl. Holzkamp 1985, Kap.9). Die Bedingungen lassen sich unter verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel Zeit, Ort, beteiligte Personen und ihr je verschiedenes Verhältnis zueinander und zu den Bedingungen, beschreiben. Im Prozess der Sozialen Selbstverständigung bewegt sich der Blick dabei von einer unmittelbaren, zentrierten Beschreibung hin zu komplexeren Bedingungs- Bedeutungszusammenhängen und einer dezentrierten Betrachtung.
Die Bedingungen und Bedeutungen sind auf das in ihnen liegende jeweilige Verhältnis von Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten und deren Einschränkungen hin zu analysieren. Dadurch, dass die jeweiligen handlungsleitenden Vorannahmen (Prämissen) immer subjektive Akzentuierungen und Ausgliederungen aus den gesamten Bedeutungskonstellationen darstellen, wird erkennbar, dass sie sich bei aller Unterschiedlichkeit dennoch auf gemeinsame Lebensbedingungen beziehen.
Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen den Lebensbedingungen, ihrer jeweils subjektiven Bedeutung und den (vermuteten) Handlungsgründen lässt kurzschlüssige Begründungsmuster und Handlungsalternativen erkennbar werden. Es geht insgesamt darum, eine "Lösungstheorie" für das Ausgangsproblem zu schaffen, die anschließend praktisch erprobt und evaluiert werden kann.
Praktisch bedeutet dies, dass unterschiedliche Interpretationen und Erklärungen der Ausgangsproblematik diskutiert werden. Einzelnen Interpretationen wird dabei oft Widerstand entgegengesetzt, dies gilt ebenso für die Betreuer wie für die Klienten und weitere an der IHP Beteiligten. Diese Widerstände können selber wiederum zum Gegenstand von Verständigungsprozessen gemacht werden. Dennoch wird es oft nicht möglich sein, eine gemeinsame Interpretation des Problems und eine Lösungstheorie zu entwickeln. Manchmal werden aus den unterschiedlichen Perspektiven auch verschiedene Dinge als problematisch oder wünschenswert beurteilt. Die verschiedenen Sichtweisen bleiben dann nebeneinander bestehen und es müssen Kompromisse gesucht oder Konflikte ausgetragen werden.
Ein wichtiger Hintergrund für die Bezugnahme auf den Begriff der "generativen Themen" ist die häufig getrennte Betrachtung verschiedener Lebensbereiche, wie sie fast immer in IHP-Konzepten zu finden ist. Aufgrund dieser Parzellierung geraten leicht die Zusammenhänge aus dem Blick und es kommt zu einer unmittelbaren "Behandlung" verschiedener Symptome. Mit der Suche nach Entwicklungsthemen (generative Themen) versucht Lauenroth einen Zusammenhang der verschiedenen Lebensbereiche herzustellen.
Ausgangspunkt dafür war die Beobachtung, dass bei Versuchen, ein Gesamtbild einer Person in der Hilfeplanung zu vermitteln, meist verkürzte und oberflächliche Betrachtungen entstanden waren. Wenn jedoch einzelne Aspekte intensiver analysiert wurden, konnten übergreifende Zusammenhänge erkannt werden. Daraus schloss Lauenroth, dass die Konzentration auf einige wenige besonders bedeutsame Themen oder Situationen eine tiefere Analyse ermöglicht als eine möglichst umfassende und parzellierte Auflistung einzelner Problembereiche.
Mit dem Begriff der generativen Themen knüpfte mein Kollege an Paulo Freire an. Freire bestimmt diese als subjektiv sinnvolle Themen, die Hoffnungen, Motive und Ziele der jeweiligen Menschen in einer bestimmten Situation beinhalten und somit auch stetigem Wandel unterzogen sind : "Ich habe diese Themen "generativ" benannt, weil sie (was immer sie auch enthalten und welche Aktion auch immer sie hervorrufen mögen) die Möglichkeit enthalten, in viele mögliche Themen weiter entfaltet zu werden, die ihrerseits nach der Durchführung neuer Aufgaben verlangen" (Freire 1973, S. 84).
Damit verweist der Begriff auf die Subjektsicht der Klienten und auf eine Entwicklungsperspektive. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Begriff der generativen Themen für die IHP-Konzeption nutzbar machen: Die generativen Themen können aus aktuellen Problemen und Interessen der Beteiligten herausgearbeitet werden. Die Herausarbeitung der Themen ist zwingend mit der Teilhabe der Klienten verbunden und hat daher dialogischen Charakter:
"Diese Themen begreifen und verstehen, heißt sowohl den Menschen verstehen, der sie verkörpert, wie auch die Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen. Aber eben, weil es nicht möglich ist, diese Themen abgesehen vom Menschen zu verstehen, ist es notwendig, dass auch die betreffenden Menschen sie verstehen. Thematische Untersuchung wird so zu einem gemeinsamen Bemühen, die Wirklichkeit ebenso wie sich selbst wahrzunehmen [...]" (Freire 1973, S.89).
Die subjektiven Bewertungen, aus denen die Themen ableitbar sind, können in gemeinsamen Alltagshandlungen, Gesprächen usw. erfasst werden. Oftmals werden eigene Bedürfnisse anderen zugeschrieben und somit die tatsächlichen Zusammenhänge verzerrt. Es ist daher zu differenzieren, um wessen Probleme und Wünsche es sich handelt: diejenigen des Klienten oder diejenigen des Betreuers.
Die Probleme, Konflikte, Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten - und damit auch deren generative Themen - sind in konkreten Situationen zu finden, in denen es ein Bedürfnis nach Veränderung gibt oder in denen dieses Bedürfnis als Möglichkeit enthalten ist. Es handelt sich also um Grenzsituationen, die unerprobte Teilhabemöglichkeiten enthalten, welche herausgearbeitet werden können. Es kann ergänzend sinnvoll sein, subjektiv positiv bewertete Situationen zu thematisieren (Ressourcenorientierung): Warum entstehen hier keine Probleme, was kann daraus für andere Situationen gelernt werden, wo gibt es hier Entwicklungsmöglichkeiten, inwieweit sind diese Situationen durch Teilhabemöglichkeiten oder Anpassung gekennzeichnet?
Grundsätzlich gilt, dass das Aufgreifen und Vertiefen einiger Themen nicht dazu führen sollte, sich für neue Themen zu verschließen. Der Prozess der Hilfeplanung darf nicht zu einer Festschreibung auf diese Themen führen, sondern sollte offen bleiben für Entwicklungen.
Als Arbeitsinstrument zur schriftlichen Dokumentation der Hilfeplanung hat Lauenroth im Dezember 2006 ein IHP-Formular angeboten. Im Unterschied zu den meisten anderen IHP-Vorlagen begrenzte sich dieses auf eine leicht überschaubare Anzahl von Kategorien. Bedeutsamer waren Dialoge und die Reflexionen, aus denen der Planungsprozess entspringen sollte. Dennoch hielt es Lauenroth für sinnvoll, regelmäßig bzw. bei Bedarf die Hilfeplanung auch schriftlich abzufassen. Das Schreiben kann den Reflexionsprozess unterstützen, als Erinnerungsstütze dienen und macht die Inhalte auch für andere Personen transparent. Das IHP-Formular erfasste folgende Eingangsdaten:
-
Name und Geburtsdatum des Klienten
-
Datum der Erstellung und Datum der Überprüfung
-
Namen der gesetzlichen und pädagogischen Betreuer
-
Namen der am Gespräch teilnehmenden Personen
Im inhaltlichen Teil wurde gefragt:
-
Was waren Schwerpunkte der Unterstützungstätigkeit seit ...?
-
Was sind aktuelle Themen?
-
Themen, die der Bewohner selber benennt:
-
Themen, die vermutlich den Bewohner interessieren und als Möglichkeit angeboten werden sollten:
-
Themen, die Mitarbeiter oder andere für wichtig befinden:
-
Vertiefung eines Themas: Hier sollen die Zusammenhänge zwischen einzelnen Themen reflektiert und generative Themen analysiert werden.
-
Konkrete Vorhaben (Für jedes Vorhaben eine neue Seite und einen neuen Gliederungspunkt)
-
Anmerkungen zur Umsetzung
-
Weitere Anmerkungen
Ergänzend dazu bot Lauenroth einen Mitteilungsbogen an, in dem Betreuer Informationen über besondere Beobachtungen bei Bewohnern dem jeweiligen Bezugsbetreuer mitteilen konnten. Diese Vorlagen sollten dazu dienen, nicht nur aktuelle Themen zu benennen und auszuführen, sondern in den Rubriken Anmerkungen fortzuschreiben, die Entwicklungen und Veränderungen zu dokumentieren und somit eine prozesshafte Hilfeplanung zu verschriftlichen.
Die Anwendung dieses IHP-Konzeptes mit bzw. für die Bewohner hat Lauenroth in einigen Fällen begleitet. Einzelne Betreuer haben ihn gebeten, gemeinsam mit ihnen und ihren Klienten die Hilfeplanung zu besprechen. Darüber hinaus hat unsere Forschungsgruppe dem Team das Konzept erläutert und immer wieder auf Kritik und Anregungen reagiert. So haben wir auch innerhalb der Forschungsgruppe das IHP-Konzept und seine Umsetzung fortlaufend reflektiert und weiterentwickelt. Im April 2008 hat Lauenroth ergänzende IHP-Bögen dem Team vorgelegt, um den Diskussions- und Reflexionsprozess differenzierter darstellen und grafisch veranschaulichen zu können. Diese führe ich hier nicht weiter aus, weil während meiner Beobachtungszeit dieses Angebot in der Einrichtung kaum eine Anwendung gefunden hat.
Die Evaluation zielte dem Auftrag gemäß darauf ab, Anhaltspunkte für die Zufriedenheit der Bewohner zu gewinnen. Es sollten Aussagen getroffen werden, ob und inwiefern sich das subjektive Wohlbefinden durch die Ambulantisierung verändert. Als Ergebnis der Evaluation waren nach Vorgaben der "AG Ambulantisierung" (Arbeitsgruppe der Träger, Verbände und Sozialbehörde der Stadt Hamburg) in einer Erst- und Folgeerhebung Aussagen zur Zufriedenheit in den folgenden Bereichen zu machen: Wohnraum/ Wohnsituation (räumliches Umfeld), soziale Kontakte (soziales Umfeld), finanzielle Situation, Schutz und Sicherheit, ausreichende Hilfen und Unterstützung - Zufriedenheit mit der Einrichtung, Zusammenleben und Regeln. Auf dieser Grundlage sollte eine zusammenfassende allgemeine Einschätzung abgegeben werden. Auf die Vorgabe eines standardisierten Fragebogens wurde verzichtet.
Eine Abweichung von den Vorgaben besteht in diesem Konzept in Bezug auf die Erst- und Folgeerhebung: Im Gegensatz zur rechtlich-administrativen Ebene lässt sich eine Ambulantisierung auf der fachlichen Ebene der Betreuung nicht auf einen Stichtag fokussieren. Die Ambulantisierung beginnt vielmehr bereits lange vor einem Umzug mit inhaltlichen Vorbereitungen und strukturellen Umgestaltungen. Auch nach dem Umzug stellen sich die ambulanten Strukturen erst allmählich ein. Daher gibt es hier kein exaktes Vorher/Nachher, sondern vielmehr einen zu evaluierenden Prozess. Dennoch kann ich retrospektiv Aussagen in Bezug auf verschiedene Zeitpunkte und Phasen des Ambulantisierungsprozesses treffen und so den behördlichen Anforderungen entsprechen.
Mein methodisches Vorgehen orientierte sich vor allem an dem in Teil C ausgearbeiteten Forschungskonzept sowie an den in Teil B, Kapitel 4 dargestellten Grundüberlegungen zur Evaluation von Zufriedenheit. Ausgewertet habe ich meine Evaluationsergebnisse, indem ich meine Projekte qualitativ und narrativ zusammengefasst und davon Ansätze zur Weiterentwicklung abgeleitet habe. Darüber hinaus habe ich in meinen Evaluationsberichten Themen der Zufriedenheit und Unzufriedenheit, die ich in der Kommunikation mit den Bewohnern wahrnehmen konnte, zu Kategorien gebündelt und analysiert. Dabei habe ich jeweils die Bedürfnisse der Bewohner mit den Möglichkeiten der Einrichtung ins Verhältnis gesetzt und Vorschläge zur Verbesserung der Zufriedenheit erarbeitet.
Die übliche Methode zur Evaluationen der Klientenzufriedenheit sind Fragebögen oder vorstrukturierte Gespräche. Von Verfahren dieser Art nahm ich Abstand, da sie Gefahr laufen, inhaltsarme Datensammlungen zu produzieren, die keine brauchbaren Erkenntnisse über die Qualität einer Einrichtung oder Hilfeform in Hinblick auf die Entwicklung der subjektiven Zufriedenheit liefern können: Vorstrukturierte und vor allem standardisierte Befragungsmethoden basieren auf von außen gesetzten Vorannahmen und liefern so lediglich Aussagen darüber, was die Auftraggeber der Evaluation für bedeutsam halten. Die subjektiven Weltsichten, Relevanzstrukturen und Erfahrungen der betroffenen Menschen werden so bereits durch die Fragestellung verfehlt und damit auch der Gegenstand Zufriedenheit. [12]
Vorstrukturiere Befragungsmethoden parzellieren zudem meist die einzelnen Lebensbereiche voneinander und beschränken sich auf kurze Ad-hoc-Bewertungen. Zusammenhänge zwischen verschiedenen Lebensbereichen sowie Widersprüche und Entwicklungen in deren Bewertung kommen dabei kaum zum Vorschein. Auf Grundlage einer derart reduzierten Datenlage lassen sich nur schwerlich Aussagen über die konkreten Bedeutungen von (Un-)Zufriedenheitsäußerungen und ihrer subjektiven Begründetheit in den Lebensbedingungen treffen. Zudem konzentrieren sich Evaluationen meist auf die sprachliche Ausdrucksebene und vernachlässigen non-verbale Äußerungsformen sowie (gemeinsame) Handlungsvollzüge.
Entsprechend dieser Ausführungen zur Erfassung des Gegenstandes (Validität) als zentrales Anliegen konnten die anzuwendenden Instrumente und Methoden nicht vorab abschließend definiert werden, sondern sind vielmehr schrittweise im Prozess der Begleitforschung mit den beteiligten Menschen entwickelt worden.
Um zu differenzierten Aussagen über die Klientenzufriedenheit zu kommen, galt es, Ausdrucksformen jeder Art als subjektive Bewertungen von Lebensbedingungen wahrzunehmen. Diese Äußerungen mussten in ihrer Prozesshaftigkeit und ihrer Entwicklungsperspektive im Zusammenhang mit der jeweiligen Lebenssituation und -geschichte betrachtet werden, um die konkrete Bedeutung dieser (Un-)Zufriedenheiten in Bezug auf zu entwickelnde Vorhaben einschätzen zu können.
Meine Evaluation basierte auf angestrebten dialogischen Subjekt-Subjekt-Beziehungen, in welcher sich die Bewertungen der Bewohner und Forscher prozesshaft entwickeln sollten. Evaluierende Dialoge sind offene Dialoge. Sie umfassen kein festgelegtes Repertoire von Methoden und Einzelschritten. Diese ergeben sich vielmehr aus der Interaktion mit den beteiligten Subjekten und den Erfahrungen im Feld der Forschung.
Zu beachten war dabei auch die subjektive Motivation der Bewohner zur Teilnahme an einer Evaluation. Warum sollten sich die Bewohner die Mühe machen, auf die vorgegebenen Fragen eines Interviewers zu antworten? Sinn macht dies nach meiner Annahme nur dann, wenn die Bewohner einen Zweck darin erkennen können, eine Möglichkeit, ihre Lebenssituation zu verändern. Die Evaluation konnte von daher kein der Praxis nachgelagerter Prozess sein, sondern musste im Wesentlichen selber praktisch sein: Eine praktische Evaluation in der Lebenswelt der Subjekte, welche auf Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit zielt. Evaluierende Dialoge finden daher oftmals inHandlungszusammenhängen statt und sind nicht auf die verbale Ebene beschränkt.
Bei den evaluierenden Dialogen bemühte ich mich, "die symbolische Gewalt, die in Interviewbeziehungen zur Ausübung kommen kann" (Bourdieu 1997, S.395), so weit wie möglich zu reduzieren. Ich vermied es dementsprechend, den Bewohnern Themen aufzudrängen, sondern machte Angebote und unterstützte die Dialogpartner dabei, sich auszudrücken. So konnte diese Art von Interview einem wechselseitigen Erkenntnisprozess dienen. Es hilft nicht nur dem Forscher, zu Daten zu gelangen, sondern ebenso dem Befragten, sich im Prozess des Erzählens wiederzuerkennen und zu reflektieren, also lebenspraktisch neue Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen. Ähnlichkeiten zeigen sich bezüglich der Methode des konsekutiven Interviews: "Im konsekutiven Interview greift der Interviewer die thematischen Vorgaben des Befragten auf - er folgt dem roten Faden des Gesprächspartners. Durch eine offen formulierte Anfangsfrage wird das Interview eingeleitet, der Befragte soll zu einer Erzählung motiviert werden." (Kammann 2005, S.15) Das Modell der evaluierenden Dialoge fügt sich zudem deutlich in die Methode der offenen Teilnehmenden Beobachtung (s. Teil C, Kap. 2.1) ein. In den dabei entstehenden dialogischen Handlungen (die selbstverständlich auch Sprache umfassen können) sollten sich die subjektiven Bewertungen in ihrem Zusammenhang zu den Lebensbedingungen erfassen und konkrete Vorhaben zur Teilhabeerweiterung und Verbesserung von Lebensqualität entwickeln lassen (Handlungsorientierung).
Mit dem Begriff der evaluierenden Dialoge bezeichne ich ein grundlegendes praktisches Arbeitsprinzip, das auf Dialog, partnerschaftliche Subjekt-Subjekt-Beziehungen ausgerichtet ist und nach Informationen sucht, die für die Evaluation relevant sein können. Evaluierende Dialoge sind somit eine für meine Evaluation umfassende Kategorie. Sie fanden während meiner Teilnehmenden Beobachtung als auch bei meinen intervenierenden Projekten statt. Auch gezielte Befragungen können als Ergänzung dazugehören, um offene Fragen klären zu können.
Informationen über die Wünsche und Ziele der Bewohner finden sich bereits in der Individuellen Hilfeplanung (IHP). Im Zentrum dieses subjektwissenschaftlich begründeten IHP-Konzepts steht die dialogische Analyse der sozialen, materiellen und kulturellen Lebensbedingungen in ihrer jeweiligen Bedeutung als Behinderung und/oder Möglichkeit von Teilhabe. Ausgangspunkt sind dabei die subjektiven Wünsche und Probleme der Klienten, die in der Tiefe ihrer generativen Struktur erfasst werden sollen. Ziel der individuellen Hilfe ist die Verbesserung der Lebensqualität durch Erweiterung der Handlungsfähigkeit (Teilhabeentwicklung).
Die Themen der Individuellen Hilfeplanung ergeben sich sowohl aus Dialogen in Form von offiziellen Hilfeplangesprächen als auch "nebenbei" in der Praxis alltäglicher Betreuungsarbeit und besonderer Angebote - wie auch die Themen der Evaluation. Die IHP als kontinuierliche Entwicklungsspirale (Reflexion, Planung und Umsetzung) sollte fortlaufend dokumentiert und regelmäßig in IHP-Berichten ausgewertet werden. Die Evaluation konnte daher an die Individuelle Hilfeplanung anknüpfen und zu ihrer Weiterentwicklung in Hinblick auf die Partizipation der Bewohner beitragen.
Mit der Evaluation habe ich im Juni 2006 begonnen. Zunächst habe ich nach der Methode der offenen Teilnehmenden Beobachtung (Teil C, Kap. 2.1) die Räumlichkeiten erkundet, den Tages-ablauf begleitet sowie Kontakte mit Bewohnern und Betreuern aufgenommen. Ziel dieser Phase war es, eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit den beteiligten Personen herzustellen und erste Vor-stellungen über den Forschungsgegenstand zu gewinnen, um darauf gründend, meine näheren Methoden entwickeln zu können. Ich ließ das Geschehen in der Einrichtung auf mich wirken, nahm Dialoge auf, wo sie sich anboten, ohne aber künstliche Interviewsituationen herzustellen. Mehr und mehr beteiligte ich mich dann als aktiver Gast an den Handlungsvollzügen im Alltag. So z.B. aß ich beim Abendbrot mit, half Bewohnern beim Aufräumen ihrer Zimmer und begleitete sie zu Freizeit-veranstaltungen. Darüber hinaus habe ich in dieser ersten Phase textliche Quellen recherchiert, Mitarbeiter, Angehörige sowie die Leitung nach grundlegenden Daten sowie der Geschichte der Ein-richtung befragt. Auch diese Erkenntniswege rechne ich der Methode der Teilnehmenden Beobachtung zu. Die aktuellen Beobachtungen müssen schließlich in ihrem historischen Kontext und einem organisatorisch Rahmen eingeordnet werden können, um sie verstehen zu können.
Ein wesentliches Resultat während der ersten Phase der Evaluation war, dass ich auf der rein verbalen Ebene einen nur unzureichenden Zugang zu den meisten Bewohnern finden konnte. Die Bewohner äußerten ihre Wünsche und Gefühle vor allem nonverbal und im direkten Handeln. Ich entwickelte daher im Herbst 2006 in Absprache mit dem Leiter ein Video-Projekt. An diesem Projekt haben sich drei Bewohner sehr aktiv beteiligt. Wir haben gemeinsam die Räume der Einrichtung, die Umgebung und Szenen des Alltags gefilmt. Im Rahmen dieses Projektes konnte ich bei einigen Bewohnern das Interesse an größerer Mobilität und an künstlerischer Betätigung wahrnehmen. Daraus entwickelte ich dann in der zweiten Phase der Evaluation als Folgeprojekt eine regelmäßige Begleitung von Bewohnern zu einer offenen Malgruppe. (s. Kap. 2.1) Parallel zu meiner Teilnehmenden Beobachtung recherchierte ich schon in der Anfangsphase nach Dokumenten, die über die Geschichte, Struktur und die Bewohner der Einrichtung weitere Auskünfte geben konnten.
Die XXX-Vereinigung Hamburg ist im Jahre 18XX gegründet worden und hat ihre Arbeit mit der Errichtung eines Kinderheims begonnen. 1930 hat die Vereinigung ihren Sitz in die X-Straße im Stadtteil X verlegt. Auf dem rund fünf Hektar großen Anwesen befinden sich zwei Wohnhäuser: eine alte Villa und ein neueres Nebengebäude mit drei Etagen. X ist ein sehr grüner und ruhiger Stadtteil mit Villen, großen Grundstücken und wohlhabenden Einwohnern.
Der Tätigkeitsschwerpunkt der XXX-Vereinigung Hamburg liegt bis heute im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 1984 stieg der Träger in den Bereich der Betreuung von geistig behinderten Menschen ein und eröffnete in seinem Hauptgebäude (X-Straße) eine stationäre Wohneinrichtung für diese Zielgruppe. Die Verwaltung der Vereinigung und die Klienten residierten bis 1994 gemeinsam unter einem Dach. Im Nebengebäude waren bis Mitte der 1990er Jahre Kinder und Jugendliche untergebracht. Danach war das Nebengebäude bis 2003 an einen anderen Träger der Kinder- und Jugendhilfe vermietet worden. Auf diese Weise, so eine ehemalige Betreuerin, hätten die Bewohner auch regelmäßigen Kontakt zu Menschen aus anderen sozialen Milieus gehabt.
Die ehemalige Mitarbeiterin beschreibt das Leben im Heim der 1990er Jahre als sehr lebendig. Die Bewohner hätten viele Außenaktivitäten unternommen, das Personal sei sehr zufrieden und hoch motiviert gewesen. Durch einen Wechsel der Heimleitung sei die Einrichtung dann Ende der 1990er Jahre in eine Krise geraten. Fast alle pädagogischen Mitarbeiter hätten innerhalb kurzer Zeit das Haus verlassen. Die gesamte Vereinigung sei damals unter Mitwirkung eines Unternehmensberaters umstrukturiert worden. Für mehrere Jahre sei dann die Leitung der Wohneinrichtung X-Straße unstetig besetzt gewesen, die Unzufriedenheit der Mitarbeiter habe noch weiter zugenommen.
Der Alltag im Heim wird in der Schrift "Entwicklungskonzept X-Straße" als ein "friedliches Inseldasein" beschrieben. "Der hohe Regelungsgrad des Alltags, die Beständigkeit der Gruppenzusammensetzung und die Isolierung vom übrigen Geschehen im Stadtteil sorgten einerseits für ein hohes Maß an Sicherheit und boten andererseits wenig Anreize zu Konflikten, Auseinandersetzungen und letztlich auch Entwicklung." (XXX-Vereinigung Hamburg 2006, S.5) Es war ein typisches Behindertenheim jener Zeit.
Erst 2003 begann in diesem Heim ein erster Aufbruch in Richtung einer Ambulantisierung. Die Mitarbeiter kritisierten bei einer Teamtagung die abseitige Lage der Einrichtung und sprachen sich für eine klientenorientierte Reform der Betreuung aus. Das Projekt einer Ambulantisierung wurde dann aber erst in den Jahren 2005/06 konkreter geplant. Unsere wissenschaftliche Begleitung begann im Juni 2006, der Umzug aller Bewohner ins Nebengebäude erfolgte Ende Dezember 2007. Anfang 2008 geriet die Einrichtung in eine schwere Personalkrise. Zwei von 11 festangestellten Pädagogen fielen wegen Krankheit über mehrere Monate aus, hinzu kam eine Häufung weiterer Krankheitsausfälle, Kündigungen und eine Zunahme von Aushilfskräften bis hin zum Einsatz von Vertretungen über eine Zeitarbeitsfirma. Über viele Wochen hinweg mussten 100 bis 200 reguläre Arbeitsstunden ausfallen bzw. durch Aushilfen ersetzt werden. Der Prozess zur Ambulantisierung wurde dann im Monat April 2008 auf Eis gelegt. Nicht selten beschränkten sich die Leistungen der Einrichtung auf das notwendige Mindestmaß für die Bewohner, pädagogische Angebote fielen weitgehend aus, Eltern und Angehörige von Klienten beschwerten sich über die schlechte Betreuungsqualität.
Als ich mit meiner Evaluation begann, lebten 20 Bewohner in der Einrichtung: vier Frauen und 16 Männer im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Bis Ende des Jahres 2008 waren davon drei Bewohner ausgezogen. Zwei davon haben zu einer anderen Einrichtung gewechselt, der andere ist in eine andere Wohnstätte innerhalb der XXX-Vereinigung umgezogen. Drei männliche Bewohner und eine Bewohnerin sind neu in die stationäre Einrichtung X-Straße eingezogen, so dass sich die Gesamtzahl der Bewohner nach dem Umzug ins umgebaute Nachbarhaus auf 22 erhöht hatte. Die bei den Bewohnern diagnostizierten Syndrome waren vor allem Trisomie 21, Lernbehinderung, frühkindliche Hirnschädigungen und autistische Störungen. Von den anfangs 20 Bewohnern arbeiteten zwölf in Werkstätten für behinderte Menschen, drei besuchten eine Tagesförderung und fünf Bewohner waren ohne eine externe Beschäftigung.
Der Kontakt der Forschungsgruppe zu den Bewohnern war sehr unterschiedlich. Markus Lauenroth war zu Beginn der Hilfeplanung öfter in der Einrichtung und hat mit einzelnen Bewohnern und Betreuern Hilfeplangespräche geführt. Kurt Bader besuchte die Einrichtungen meist nur anlässlich dienstlicher Besprechungen. Ich habe in der Regel die Einrichtung ein- bis zweimal wöchentlich besucht und mit allen Bewohnern Kontakt aufgenommen, jedoch in unterschiedlicher Intensität. Etwa ein Drittel der Bewohner sah ich nur sehr selten. Zu ihnen gestaltete sich der Kontakt schwierig, weil es wenig gemeinsame Themen gab, sprachliche Barrieren oder: ich traf die Bewohner nur selten an. Mit anderen Bewohnern führte ich regelmäßig Gespräche. Mit etwa einem anderen Drittel der Bewohner konnte ich ein intensives Verhältnis entwickeln. Ich habe den Bewohnern, soweit es mir möglich erschien, meine besondere Rolle in der Einrichtung zu erklären versucht. Da dies aber bei vielen jenseits des erworbenen Abstraktionsvermögens zu liegen schien, betrachteten mich viele Bewohner als einen Betreuer, der gelegentlich mitarbeitet.
Das Personal der Einrichtung bestand im Wesentlichen aus Mitarbeitern, die im pädagogischen Be-reich tätig waren, einem Hausmeister und zwei Reinigungskräften. Die pädagogisch eingesetzten Mitarbeiter waren von ihrer Ausbildung her Dipl. Sozialpädagogen, Heilerzieher, Erzieher, eine Krankenschwester, eine Altenpflegerin, eine Sozialwissenschaftlerin sowie ein Dipl. Ethnologe. Der Leiter verfügte über keine anerkannte Qualifikation im pädagogischen Bereich. Anfang des Jahres 2008 ist eine Sozialpädagogin als Koordinatorin für die Einrichtung eingesetzt worden, die im Juni 2008 die Leitungsfunktion übernommen hat.
Die Zahl der angestellten pädagogischen Mitarbeiter schwankte zwischen 10 und 13 mit hoher Fluktuation. Bis auf zwei von ihnen arbeiteten alle in Teilzeit. Ein großer Teil der Arbeit wurde durch Honorarkräfte und bis zu zwei FSJ-Kräfte erbracht. Die Krankheitsausfälle waren in der Regel auffallend groß. Bei meinen Beobachtungen verging kaum eine Woche, in der nicht ein oder zwei hauptamtliche Betreuer wegen Krankheit ausfielen.
Als dritte Gruppe der Beteiligten waren die gesetzlichen Betreuer relevant. Das waren bei allen Bewohnern Eltern oder Angehörige. Der Kontakt zwischen Bewohnern und deren Angehörigen war von unterschiedlicher Intensität. Einige Bewohner besuchten wöchentlich oder alle 14 Tage ihre Eltern. Einige Angehörige kamen öfter in die Einrichtung, die meisten jedoch selten. Eine langjährige Mitarbeiterin beklagte, dass sich die meisten Angehörigen kaum für das Innenleben der Einrichtung interessierten. Der Kontakt beschränke sich in aller Regel darauf, ihre betreuten Angehörigen abzuholen und wieder zurück zu bringen.
Nach meinen Beobachtungen war das Verhältnis zwischen Angehörigen und Einrichtungsleitung sehr unterschiedlich. Während einige Angehörige sich sehr zufrieden mit der Einrichtung und ihrer Leitung äußerten, konnte ich bei anderen Angehörigen große Unzufriedenheit hinsichtlich der Zuverlässigkeit und der Betreuungsqualität wahrnehmen. Es kam immer wieder zu Konflikten. Bei einem Angehörigenabend konnte ich erleben, wie es zu einem offenen Streit kam. Inhalt der Auseinandersetzungen war die Sorge einzelner Angehöriger um die Sicherheit der Bewohner. Sie fürchteten, dass durch eine Ambulantisierung zu große Freiräume und Kontrolllücken entstehen, so dass den Betreuten etwas zustoßen könnte. Auseinandersetzungen konnte ich auch zwischen Angehörigen und Betreuern beobachten, dies vor allem im Zusammenhang mit pädagogischen Schritten, die zu mehr Freiheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Bewohner führen sollten. Einige Angehörige versuchten bei diesen Anlässen Druck auf die Einrichtung auszuüben, um Schritte zur weitergehenden Selbstbestimmung der betreffenden Bewohner zu verhindern. In diesen Konflikten konnten dann meist Kompromisse erzielt werden. Kritisiert wurde auch ein Mangel an Transparenz der Einrichtung nach außen. Als positiv hervorgehoben wurden von anderen Angehörigen die im Vergleich zu anderen Einrichtungen relativ großen Freiräume der Bewohner sowie die einfühlsame und tolerante Haltung des Personals.
Über ein umfassendes und schriftlich fixiertes Konzept verfügte die Einrichtung nicht. Ein "Entwicklungskonzept X-Straße" lag in kopierter Fassung seit März 2006 vor, aber ohne Impressum, Einband und Datum. "Lediglich soll es als erste Grundlage der weiteren Konzeptentwicklung im Team dienen", hieß es darin auf Seite 4. Eine weitere schriftlich nachvollziehbare Konzeptentwicklung wurde mir danach nicht mehr bekannt. Auch Angehörige von Bewohnern bemängelten das Fehlen eines nach außen hin transparenten Konzeptes. Das "Entwicklungskonzept X-Straße" hat nach meinen Beobachtungen im Alltagshandeln der Einrichtung kaum eine Relevanz gehabt. Es war vielmehr ein Entwurf der Leitung.
Dennoch wurden im "Entwicklungskonzept X-Straße" einige Grundsätze, Ziele und Methoden benannt, die zunächst einmal vorgestellt werden müssen, um die schriftlich fixierten eigenen An-sprüche der Leitung an die eigene Einrichtung sowie deren Selbstverständnis erfassen zu können.
Als ein nicht unwesentliches Ziel der Einrichtung erschien dem Papier zufolge der dauerhafte Aufenthalt der Bewohner in der Wohneinrichtung. Dies deshalb, weil dieses Bestreben fünf Mal auf insgesamt 16 Seiten des Dokuments ausgeführt wurde. Es nahm einen hohen Stellenwert ein und wurde wie folgt paraphrasiert:
"Es wurde und wird ein auf Dauer angelegtes Wohnangebot vorgehalten." (XXX-Vereinigung Hamburg 2006, S.4) "Die X-Straße ist zu ihrem Zuhause geworden, das sie nicht mehr verlassen möchten." (ebd., S.9) Bereits im folgenden Absatz war zu lesen: "In enger Zusammenarbeit mit den Betreuern wird erreicht werden, dass auch diese Menschen ihr Zuhause in der X-Straße nicht verlassen müssen, um stationär in anderen Einrichtungen betreut zu werden." (a.a.O) "Die Zimmer sind ausreichend groß, um auch eine pflegeintensive Begleitung zu ermöglichen. Dies bietet die Gewähr, dass die Bewohner auch bei erhöhter Pflegebedürftigkeit im Alter ihr Zuhause nicht verlassen müssen." (ebd., S.10) "Darüber hinaus werden die Wohngruppen für diese Menschen unabhängig von ihrem Alter und etwaiger Pflegebedürftigkeit ein Zuhause auf Lebenszeit sein, wenn sie dies wünschen." (ebd., S.14) In Verbindung mit dem Ziel eines dauerhaften Aufenthaltes wurde zweimal die Pflege der Bewohner als Aufgabe und Ziel genannt, obwohl die Einrichtung kein Pflegeheim war und auch nicht werden wollte.
Die mit den Zitaten belegte perspektivische Ausrichtung auf den dauerhaften Aufenthalt, das Altwerden und die Pflege der Bewohner erklärte sich nicht zuletzt aus dem Interesse einiger Eltern, für ihre erwachsenen behinderten Kinder eine dauerhafte Unterbringung sichern zu wollen. Auch ökonomische Gründe dürften eine Rolle gespielt haben. Ich konnte schließlich beobachten, dass freie Wohnplätze nur sehr zögerlich wieder belegt werden konnten. Historisch betrachtet, gewann diese Ausrichtung auch deshalb eine gewisse Sinnhaftigkeit, weil zur Zeit der Entstehung der Einrichtung noch keine ambulanten Betreuungsalternativen zur Verfügung standen. Die Perspektive auf einen Auszug in eine eigene Wohnung oder eine ambulant betreute Wohngemeinschaft fehlte zu jener Zeit. 22 Jahre später, als das "Entwicklungskonzept X-Straße" geschrieben wurde und ambulante Betreuungsalternativen außerhalb der Einrichtung zur Verfügung standen, war eine solche Perspektive in der Einrichtung kaum ein Thema: die Bewohner lebten bereits seit vielen Jahren dort und hatten sich an das Leben innerhalb der Einrichtung gewöhnt, die gesetzlichen Betreuer zeigten kaum Interesse an einem Auszug ihrer Betreuten und die meisten Mitarbeiter konnten sich kaum vorstellen, dass ihre Bewohner jemals in einer eigenen Mietwohnung leben können.
Die grundsätzliche Zielvorgabe eines dauerhaften Verbleibs der Bewohner im Heim stand selbstredend im Widerspruch zu den Zielen der Eingliederungshilfe (s. Teil B, Kap. 2.2.1), nach denen der behinderte Mensch dazu befähigt werden soll, möglichst weitgehend von professioneller Hilfe unabhängig zu werden. Gleichwohl verfolgte die Einrichtung das Ziel einer Ambulantisierung in Form einer Umstrukturierung des Hauses in sechs abgetrennte Wohngruppen unter einem Dach (Teil B, Kap. 2.4). Geplant wurden im Entwicklungskonzept auch "die Entstehung neuer Wohngemeinschaften, die sich nicht auf dem Gelände befinden." (ebd.,S.10) Was in dem Papier jedoch gänzlich fehlte, war eine Ausrichtung auf eine abschließende Entlassung der Bewohner aus den Strukturen des Trägers, das Loslassen in die Freiheit.
Darüber hinaus wurden im "Entwicklungskonzept X-Straße" noch folgende Ziele benannt:
-
Die Lebensqualität der Bewohner soll verbessert werden.
-
Die Bewohner werden "aktiv gefordert", mehr Eigenverantwortung für sich zu übernehmen.
-
Solidarität und "eine demokratische Kultur"
-
Die Gestaltung von Kommunikationsprozessen für alle Beteiligten
-
Eine stärkere Orientierung der Betreuung an den Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten der Individuen.
-
Transparenz nach innen und außen
Für diese Ziele wurden in dem Papier folgende Methoden angestrebt:
-
Eine Zusammenarbeit mit Therapeuten.
-
Kooperation mit den gesetzlichen Betreuern, Eltern, Angehörigen und anderen Partnern außerhalb der Einrichtung.
-
Individuelle Hilfeplanung: Diese wird im Dialog mit Angehörigen und gesetzlichen Betreuern entwickelt und orientiert sich an den Stärken der Bewohner, nicht an den Defiziten.
-
System der Bezugsbetreuung
-
Evaluation
-
Dokumentation
-
Gruppentage
-
Sozialraumorientierung und Vernetzung im Stadtteil
-
Förderung von Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrichtung
-
Einzelbetreuung
-
Tag- und Nachtassistenz
Diese Ziele und Methoden wurden nur sehr schemenhaft ausgeführt. Eine praxistaugliche Operatio-nalisierung auf Grundlage der bestehenden Möglichkeiten und Strukturen der Einrichtung erschloss sich daraus kaum.
Die Einrichtung befand sich, wie bereits anfangs erwähnt, in einer ruhigen und wohlhabenden Stadtrandlage. Dies bedeutete, dass die direkte Umgebung des Hauses durch stattliche Wohnhäuser mit großen Grundstücken geprägt war. Auf den Straßen waren nur sehr selten Menschen zu sehen. In erreichbarer Fußnähe befanden sich weder Einkaufsmöglichkeiten, noch Cafés oder Freizeitangebote. Die U-Bahnstation X ließ sich bei durchschnittlichem Schritttempo in ca. 15 bis 20 Minuten erreichen. Die meisten Bewohner benötigten wegen diverser körperlicher Einschränkungen jedoch rund 30 Minuten.
Räumlich gliederte sich die Einrichtung zu Beginn meiner Evaluation wie folgt: Im Hauptgebäude wohnten 16 Bewohner auf drei Etagen verteilt. Zwei davon bewohnten ein Doppelzimmer, die anderen verfügten über Einzelzimmer. Vier Bewohner wohnten im Nebengebäude. Im Hauptgebäude befanden sich im Erdgeschoss ein Flur und ein großes Gemeinschaftszimmer. Daneben lag das Büro der Betreuer. Im Keller befanden sich die Vorratskammer mit Lebensmitteln, der Wäscheraum und ein PC-Raum für das Personal. Im ersten Obergeschoss waren zwei Küchen zur gemeinsamen Nutzung eingerichtet. Die strukturelle Anordnung war zentral auf die Gesamtheit der Einrichtung ausgerichtet. Nur die vier Wohnplätze im Nebengebäude befanden sich in gewisser Distanz zum Gesamtgeschehen.
Die wöchentliche Dienstbesprechung dauerte etwa vier Stunden. An ihr nahmen nur die hauptamtlichen Betreuer sowie die FSJler und die Berufspraktikanten teil. In der Regel fand einmal im Monat eine Supervision statt, entweder eine Teamsupervision oder eine Fallsupervision, wobei die Teamsupervision von einer trägerinternen Pädagogin geleitet wurde. Die Honorarkräfte trafen sich in Abständen von ein bis zwei Monaten zu einer separaten Besprechung mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter. An Supervisionen nahmen sie nicht teil.
Der Einsatz der hauptamtlichen ebenso wie der Honorar-Betreuer erfolgte überwiegend im Schichtdienst. Zwischen 6 und 9 Uhr hatte der mit einer Person besetzte Frühdienst die Aufgabe, die Bewohner bis zur Abfahrt zur Werkstatt zu unterstützen. Zwischen 9 und 14 Uhr übernahm die "pädagogische Hauswirtschaftskraft" die Betreuung der anwesenden Bewohner. Ihre Aufgabe bestand primär darin, mit den Klienten gemeinsam das Mittagessen zu zubereiten. Etwa parallel dazu wurden zwei Bewohner werktags für vier bzw. sechs Stunden zusätzlich einzeln betreut. Der Spätdienst begann für zwei bis drei Betreuer um 14 sowie 15 Uhr und endete zwischen 19 und 22 Uhr. In den Nachtstunden befand sich eine Bereitschaftskraft im Hause. Die Arbeit im Schichtdienst orientierte sich auf die Funktionseinheit des gesamten Heims. Die individuellen Hilfen für einzelne Bewohner waren der Gesamtstruktur untergeordnet. Die Aufgaben, die in den jeweiligen Schichten erledigt werden sollten, wurden in Tagesplänen stichwortartig von den Betreuern der vorhergehenden Schichten notiert. Überwiegend aber orientierte sich die Schichtarbeit an eingeschliffenen, meist medizinisch begründeten Routinen sowie an den Notwendigkeiten, die sich unmittelbar und reaktiv aus dem situativen Verhalten der Bewohner ableiten ließen.
Das Bezugsbetreuersystem bedeutete, dass die meisten der hauptamtlichen Betreuer für zwei oder drei Bewohner individuell zuständig waren.
Der zeitliche Umfang für die individuelle Betreuung war jedoch nicht geregelt und von Person zu Person sehr unterschiedlich. In diesen "freien Stunden", die in keinem Dienstplan erfasst und in keinem System dokumentiert worden waren, entwickelten die Pädagogen ihre Hilfepläne, erledigten den Schriftverkehr mit Behörden, organisierten Arzttermine und andere externe Kontakte für ihre Klienten. Aber auch direkte Angebote wie kleinere Ausflüge, das Lernen von alltagspraktischen Fertigkeiten und persönliche Gespräche fanden mitunter in den "freien Stunden" statt. Zwei Honorarkräfte boten regelmäßig wöchentlich eine Schwimm- und eine Turngruppe an.
In meiner ersten Beobachtungsphase von Juni bis Dezember 2006 habe ich insgesamt 19 Mal die Einrichtung besucht und meine Beobachtungen protokolliert. In dieser Zeit habe ich vor allem passiv das Geschehen in der Einrichtung beobachtet und Gespräche mit Bewohnern und Betreuern geführt, um eine erste Orientierung über die Abläufe, Zusammenhänge und Handlungsmuster im sozialen Feld der Forschung zu gewinnen. Erst allmählich habe ich mich an einigen Handlungsprozessen in der Einrichtung selber beteiligt. Meine Protokolle habe ich regelmäßig in unserem Forschungsteam diskutiert und im Frühjahr 2007 zusammenfassend ausgewertet. Es handelt sich im Folgenden um einen Versuch, meine ersten Wahrnehmungen aus der Zeit zwischen Juni und Dezember 2006 zu systematisieren und zu Hypothesen über die Handlungsstruktur in der stationären Einrichtung vor dem Beginn der Ambulantisierung zu verdichten.
Entsprechend meiner Beobachtungen unterteilte ich zunächst die beobachteten Arbeitsprozesse in zwei Kategorien: Erstens in direkte Hilfeprozesse und zweitens in indirekte Hilfeprozesse. Zu den direkten Hilfeprozessen zählten alle Tätigkeiten, die in einem direkten Bezug zu den Bewohnern standen. Dazu gehörten unter anderem das morgendliche Wecken, die Unterstützung bei der Nahrungszubereitung, die Vergabe von Medikamenten, Hilfe bei der Körperpflege und ähnliches. Als indirekte Hilfeprozesse bezeichnete ich jene Arbeitseinheiten, die im Hintergrund stattfanden. Zu ihnen gehörten vor allem die formalisierten Kommunikationsprozesse wie Dienstbesprechungen (DB), Supervision, Hilfeplanung und Dokumentation.
Die Arbeit der hauptamtlichen Betreuer im Bereich der direkten Hilfeprozesse nahm nach den vorliegenden Beobachtungen fast die gesamte Arbeitszeit ein. Außer einer wöchentlichen Dienstbesprechung, die drei bis vier Stunden dauerte und mitunter durch eine Supervision ersetzt worden war, konnte ich keine weiteren regelmäßigen indirekten Hilfeprozesse beobachten. Im ersten Beobachtungszeitraum fand darüber hinaus noch ein Teamtag statt, an dem die reguläre Dienstbesprechung den gesamten Arbeitstag umfasste. Über Fortbildungen und andere kommunikative Hintergrundveranstaltungen konnte ich in diesem Zeitraum nichts erfahren.
Die direkten Hilfeprozesse, also die Arbeit unmittelbar an und mit den Klienten, erschienen mir nach meinen Beobachtungen in der ersten Phase durch eine hohe Arbeitsdichte und enge Regulierung strukturiert zu sein. Wenn Betreuer wegen Krankheit ausfielen, reagierten ihre Kollegen und auch die Bewohner sehr besorgt. Es wurde dann befürchtet, dass die gesamte Tagesorganisation zusammenbrechen könne. Die Betreuer fühlten sich dann einem verstärkten Druck ausgesetzt. Es war auch zu beobachten, dass Krankheitsausfälle weitere Krankheitsausfälle nach sich zogen, was einige betroffene Pädagogen mit dem erhöhten Stress bei der Arbeit zu erklären versuchten.
Inhaltlich konnte ich beobachten, dass in den direkten Hilfeprozessen dem Modus der stellvertretenden Ausführung gegenüber dem Modus der anleitenden und beratenden Hilfe ein deutliches Übergewicht zukam. Die näheren Strukturierungsprinzipien jener stellvertretenden Hilfeprozesse konnte ich nach meinen ersten Beobachtungen noch nicht ausreichend aufklären. Viele Beobachtungen legten die Hypothese nahe, dass sich die Regelhaftigkeit des Arbeitsablaufes nach scheinbar gegebenen Hilfebedarfen richtete. Wenn Bewohner morgens nicht von alleine aufstanden, wurde daraus die Notwendigkeit eines Weckdienstes abgeleitet. Wenn andere Bewohner sich nicht alleine die Brote belegen konnten, übernahm ein Betreuer dann regelmäßig das Belegen der Brote für bestimmte Bewohner. Die auf diese Weise vorgefundenen Bedarfe wurden dann als gegebene Eckpfeiler zur Arbeitsstrukturierung interpretiert und erhielten einen Muss-Status im Schichtdienst. Kamen neue Bedarfe von Bewohnern hinzu, dann verdichteten sich die Arbeitsabläufe noch weiter, weil die alten Bedarfe weiterhin bestehen blieben.
Bedarfe sind mit Handlungsaufforderungen ausgestattete Sinneinheiten, die im sozialen Feld sich nur kommunikativ vermittelt durch Ausdrucksgestalten konstituieren. Es gehören also mindestens zwei Personen zur Konstruktion eines Bedarfs: das Individuum, das ein Bedürfnis äußert und jenes Individuum, dass diese Äußerung wahrnimmt, einen Aufforderungsaspekt dabei erkennt und von dem Bedürfnis einen operationalisierbaren Befriedigungsmodus ableitet. Der Schwerpunkt liegt bei der Bedarfskonstruktion des Botschaftsempfängers, dem Helfer. Er muss nämlich nicht nur das symbolisch vermittelte Bedürfnis dechiffrieren, sondern zusätzlich eine Handlungsaufforderung davon ableiten, sofern sich diese nicht evident aus der Botschaft des Bedürftigen ergibt, und der Helfer muss zusätzlich einen operationalisierbaren Modus finden, wie er helfen will.
Der Ablauf der stellvertretenden Hilfen folgte einerseits den direkten Bedürfnisäußerungen der Bewohner, andererseits der Dienstplanung. Wenn also einige Bewohner zu Bett gebracht werden mussten, weil sie sich nicht alleine umziehen konnten, dann wurde diese Arbeitssequenz deshalb zwischen 18:30 Uhr und 20 bzw. 21 Uhr vollzogen, weil um 21 Uhr der Tagesdienst endete. Der Dienstplan bestimmte auf diese Weise den Tagesablauf vieler Bewohner zu einem erheblichen Teil. Die Vergabe von Medikamenten erfolgte zeitlich nach der ärztlichen Verordnung und unterteilte immer wieder andere Arbeitssequenzen, weil zu einer bestimmten Uhrzeit der eine Bewohner eine Tablette nehmen und dem anderen der Blutzuckerspiegel gemessen werden musste. Auf diese Weise wurde der Arbeitsalltag der Betreuer multipolar engmaschig strukturiert.
Er ließ wenig Raum für Experimente und Sonderwünsche. So musste auch ich anfangs bei meiner teilnehmenden Beobachtung zur Kenntnis nehmen, dass meine situativen Fragen während der Arbeit von den Betreuern als störend empfunden wurden. Eine Mitarbeiterin argumentierte, sie sei dann "nicht mehr ganz Ohr bei den Bewohnern" und werde abgelenkt. Die Arbeit schien also, zumindest in der Wahrnehmung der Betreuerin, derart verdichtet zu sein und einen so intensiven Grad an permanenter Konzentration zu erfordern, dass jeder Abzug von Aufmerksamkeit vermieden werden musste. Auch wenn die Hilfeleistungen weitgehend stellvertretend für die Bewohner ausgeführt wurden, so waren dabei Aspekte einer pädagogischen Förderung möglich. Diese sind mir jedoch weitgehend verborgen geblieben, weil ich von dem Ausmaß der stellvertretenden Hilfen derart überrascht war, sodass ich meine Aufmerksamkeit mitunter zu sehr auf diesen Anteil fokussiert habe.
Ganz im Gegensatz dazu konnte ich bei den indirekten Hilfeprozessen ein eher zufälliges Strukturierungsprinzip erkennen. Bei der Dokumentation "gibt es viel, aber wenig Einheitliches", erklärte eine Mitarbeiterin. Die Einträge wurden per Handschrift vorgenommen. Für drei Bewohner gab es Betreuungstagebücher, für die anderen nicht. Es gab einen Tagesplan und einen Wochenplan. Regelmäßige Eintragungen über die Entwicklung aller Bewohner konnte ich nicht vorfinden. Die Teilnahme an kommunikativen Dienstveranstaltungen schien sehr locker gehandhabt zu werden. Bei einer Supervision waren nur vier Betreuer anwesend. Bei zwei vereinbarten Hilfeplangesprächen hatte der zuständige Bezugsbetreuer trotz seiner Zusage dann plötzlich keine Zeit, eine Kollegin, die den betreffenden Bewohner nur am Rande mit betreute, sprang kurzfristig ein. Angebote zur individuellen Förderung wurden nach Aussagen einer langjährigen Mitarbeiterin immer wieder mal begonnen, "versandeten" dann aber regelmäßig wieder. Über die organisatorische Entwicklung des Ambulantisierungsprozesses wussten die meisten Betreuer kaum Bescheid. Die Honorarkräfte, die einen erheblichen Teil der gesamten Arbeit abdeckten, nahmen an den DB nicht teil. Auch der von ihnen explizit geäußerte Wunsch, mehr darin eingebunden zu werden, zeigte keine Wirkung. Nach meinen ersten Wahrnehmungen erschienen mir die kommunikativen Prozesse wenig organisiert und unverbindlich zu verlaufen.
Für mich bedeutete diese ungeordnete Struktur der Kommunikationsprozesse ein erhebliches Problem, überhaupt den aktuellen Stand der Planungen und der organisatorischen Strukturen der Einrichtung überblicken zu können. Die Betreuer verhielten sich lange Zeit mir gegenüber sehr distanziert. Ich stocherte lange Zeit im Nebel und fand keinen Einstieg ins Forschungsfeld. Das lag meinerseits auch mit daran, dass ich vor allem in der ersten Phase nur relativ selten in der Einrichtung war. Selbst die Dienstbesprechungen konnte ich nicht regelmäßig besuchen, so dass ich auch aufgrund meiner Abwesenheit nur mühsam ein Vertrauensverhältnis mit den Betreuern entwickeln konnte. Als ein Hindernis erwies sich auch mein besonderer Forschungsansatz: Einige Betreuer erwarteten von mir ein klar strukturiertes Programm, was ich nicht bieten konnte und wollte. Meine offene und unstrukturierte Methode konnte ich kaum verständlich vermitteln.
Einige Betreuer empfanden meine Forschung bedrohlich, weil ich bei meiner teilnehmenden Beobachtung "alles" beobachtete, ständig Fragen stellte, vieles wissen wollte, ohne dass ich ausreichend erklären konnte, wozu dieses Wissen dienen sollte. Zudem war die Forschungsgruppe von der Leitung bestellt worden, was das Misstrauen noch verstärkte, da das Verhältnis zwischen einigen Mitarbeitern und der Leitung nicht völlig konfliktfrei war. Nicht selten war bei den Mitarbeitern der Eindruck entstanden, dass ich mit meinen vielen Fragen vieles hinterfragen und somit deren Kompetenz anzweifeln wollte. Mehr Zurückhaltung und Vorsicht ebenso wie mehr Offenheit und Reflexion meinerseits hätten besonders in der ersten Phase eventuell zu mehr Aufgeschlossenheit und Kooperationsbereitschaft seitens der Mitarbeiter führen können.
Die beiden unmittelbar gegensätzlich erscheinenden Strukturierungsprinzipien bei einerseits den direkten und andererseits den indirekten Hilfeprozessen standen mittelbar in einem komplementären Entsprechungsverhältnis. Die lockere und chaotische Struktur bei der Organisation der Kommunika-tionsabläufe konnte Ausdruck einer geringen Wertschätzung jener Arbeitsbereiche sein, für die insti-tutionell relativ wenig Arbeitszeit zur Verfügung gestellt wurde. Die enge Strukturierung der direkten Hilfen brachte zum Ausdruck, dass jenen ein Höchstmaß an Bedeutung zugeschrieben wurde.
Meine Hypothese lässt sich hier weiter zuspitzen zu der Annahme, dass sich aus den ersten Beobachtungen bereits das Muster einer innerhalb der Einrichtung dominierenden Sinnstruktur der Arbeit rekonstruieren lässt: Als wertvolle und wichtige Arbeitseinheiten wurden all jene Bereiche verstanden, bei denen (1.) unmittelbar sinnlich erfahrbare Ergebnisse erzielt wurden (wecken, füttern, waschen), die (2.) durch eine physisch-materielle Notwendigkeitsdimension als unverzichtbar erschienen und, die (3.) im Wesentlichen durch den Einsatz körperlicher Arbeit vollzogen werden konnten. Rein kommunikative und reflexive Arbeitsbereiche hingegen wurden als zusätzliche Belastung gewertet, auf die tendenziell verzichtet werden konnte. Ihre Bedeutung für das Gelingen des gesamten Funktionsprozesses der Einrichtung wurde als nachrangig eingeschätzt. Aus dieser Sinnstruktur schließe ich auf einen zugrunde liegenden "proletarischen Arbeitsethos". Ich nenne ihn proletarisch, weil in ihm die gesellschaftliche Entfremdung zwischen körperlicher und geistig-kommunikativer Arbeit im subjektiven Bewusstsein reproduziert und einseitig auf dem Pol der körperlichen Arbeit gewichtet wird. Zugespitzt bedeutet dies: Für den Malocher in der Werkhalle oder auf dem Baugerüst ist "wirkliche Arbeit" nur die schweißtreibende körperliche Arbeit. Um lange zu reden und zu diskutieren, ist die Zeit zu kostbar. Dieses proletarische Arbeitsethos scheint durch die berufliche Sozialisation des Personals begünstigt worden zu sein. Denn nur eine Mitarbeiterin verfügte am Ende meiner ersten Beobachtungsphase über ein abgeschlossenes Studium und befand sich während der Beobachtungsperiode in ihrem sozialpädagogischen Anerkennungsjahr.
Die Phase II meiner Evaluation begann im Januar 2007 und endete im September 2007. In dieser Phase stand meine intervenierende Praxis in Form einer Begleitung von Bewohnern zu einer offenen Malgruppe im Vordergrund. (Kap. 2.1) Zusätzlich habe ich weiterhin die Einrichtung etwa einmal wöchentlich besucht und das Alltagsgeschehen teilnehmend beobachtet. Darüber hinaus habe ich in dieser Phase mit sechs Bewohnern versucht, den Ansatz zur rehistorisierenden Diagnostik (s. Teil C, Kap.2.3) umzusetzen. Zwei Beispiele davon stelle ich in Kapitel 2.2 vor. Abschließend hat unsere Forschungsgruppe auf Grundlage meiner Evaluation der Einrichtung einen Zwischenbericht vorgelegt, den ich in Kapitel 2.5 darstelle.
Meine Idee, mit Bewohnern die Malgruppe der "Schlumper" im Hamburger Schanzenviertel zu besuchen, ist während der Dreharbeiten unseres Videos entstanden. Bei mehreren Gesprächen hatte ich erfahren, dass sich zumindest einige Bewohner sehr für Ausflüge und Reisen, für Erfahrungen und Erlebnisse außerhalb der Einrichtung und außerhalb des Stadtteils interessierten. Dieses Interesse griff ich zunächst auf, indem ich eine Bahnfahrt nach Lüneburg zum offenen Atelier an der Universität, am Fachbereich Sozialwesen, anbot. An diesem Ausflug, den ich mit der Kamera begleitete, nahmen zwei Bewohner teil.
Da die Fahrt nach Lüneburg zeitlich sich als sehr aufwendig erwiesen hatte, bot ich dann freitags eine Begleitung zu der offenen Malgruppe des Werkstattateliers der "Schlumper" an. "Die Schlumper" sind eine Künstlergruppe behinderter Menschen, die als Teil der WfbH zum Träger der Evangelischen Stiftung Alsterdorf gehört. Mit den Besuchen bei den "Schlumpern" wollte ich wesentlich zwei Entwicklungsbereiche fördern: Erstens ging es mir darum, die Mobilität der Bewohner sowie deren soziale Kontakte nach außen zu stärken, zweitens wollte ich durch die Teilnahme an einer Malgruppe neue Möglichkeiten zur kreativen Betätigung anbieten.
Beides sind meinem Konzept zufolge evaluierende Dialoge, bei denen die Bewohner durch das Erleben neuer Möglichkeiten ihre Interessen zum Ausdruck bringen und den Horizont für eine Bewertung ihrer aktuellen Lebenssituation erweitern können. Mit dem Angebot wollte ich neue Möglichkeitsräume aufzeigen, die über das Bestehende in der Einrichtung hinausweisen und somit auch Unzufriedenheit stiften, damit Impulse von unten zur Weiterentwicklung der Betreuungsqualität freigesetzt werden. Die Herausforderungen im Bereich der Mobilität bestanden darin, dass sich die Einrichtung am nördlichen Ende der Stadt, befand. Aufgrund dieser Lage waren Fahrten außerhalb bislang mit dem hauseigenen Bus bewältigt worden. So wurden die Bewohner zum Schwimmen, zur Turnhalle oder zum Kegeln gefahren. Dieses fand stets unter Betreuung statt. Für eigenständige Ausflüge und Teilhabe an Angeboten in der Stadt erwies sich für die meisten Bewohner die abseitige Lage der Einrichtung als eine zu große Hürde. Nach meiner Auffassung wäre ein Umzug in einen zentral gelegenen Stadtteil im Rahmen der Ambulantisierung angebracht gewesen. Dies hatte ich bereits zu Beginn meiner Evaluation der Leitung mitgeteilt. Da aber der Träger an dem Standort festhielt, sah ich es als Notwendigkeit an, das örtliche Defizit mit pädagogischen Mitteln zu kompensieren. In den weiteren Schritten sollte darauf hingewirkt werden, dass die Bewohner immer selbständiger und Schritt für Schritt unabhängiger von einer Begleitung werden, bis sie möglichst autonom mit der U-Bahn zu Zielen in anderen Stadtteilen fahren können.
Mit der Teilnahme an der Malgruppe wollte ich darüber hinaus den Bewohnern eine Möglichkeit zum Ausprobieren und Lernen neuer kreativer Tätigkeiten anbieten. Hintergrund dafür war meine Beobachtung, nach der es in der Einrichtung selber wenig Anregung und Möglichkeiten für die Bewohner gab, sich zu betätigen. Hinzu kam, dass viele Bewohner sich sprachlich nicht oder nur sehr schwer verständlich ausdrücken konnten. Die Kunst erschien mir als ein alternatives Medium, sich darzustellen und mitzuteilen. In dem gesamten Veranstaltungsrahmen wurden zudem Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Einrichtung möglich. Es entstanden weitere ungeplante Erfahrungen vor, nach und während des Malens, die die kognitive Weiterentwicklung, Selbständigkeit und gesellschaftliche Integration der Bewohner fördern konnten.
Zur Implementierung des Projekts nahm ich mir vor, die pädagogische Begleitung der Bewohner zunächst selbst durchzuführen. Durch eine regelmäßige Fahrt zu der Malgruppe sollte in der Einrichtung nach und nach die Sinnhaftigkeit dieses Angebots erkannt und die Betreuer zum Umdenken bewegt werden, zum Umdenken dahin, dass Ausflüge, gesellschaftliche Teilhabe und neue Betätigungsmöglichkeiten außerhalb des Hauses einen noch höheren Stellenwert verdient haben. Die Förderung der Mobilität sollte stärker in den Vordergrund rücken, so dass andere Routinen der stellvertretenden Hilfe langsam an Bedeutung verlieren und die Bewohner mehr Selbständigkeit entwickeln können.
Mein Ziel bestand von Anfang an auch darin, die Begleitung nach einer gewissen Startphase an die Einrichtung zu übergeben, in der Hoffnung, dass die teilnehmenden Bewohner von sich aus darauf drängen werden, das Projekt am Leben zu erhalten und möglichst noch zu erweitern. Das meinerseits erwünschte Empowerment der Bewohner sollte die von der Leitung anvisierte Umstrukturierung der Einrichtung in eine ambulante von unten herauf beschleunigen und die Interessen der Bewohner gegen die Betreuungsroutinen des Alltags stärken.
Als regelmäßige Teilnehmer konnte ich die Bewohner R., P. und Jg. gewinnen. Außer den drei "Stammgästen" nahmen im Laufe der sechsmonatigen Projektphase noch andere Bewohner teil, die aber nur einige Male mitkamen und aus ungeklärten Gründen kein weiteres Interesse zeigten. Ich beschränke mich hier auf die Darstellung meiner Erfahrungen mit den regelmäßigen Teilnehmern.
Jg. besuchte seit Anfang Januar 2007 die Schlumper. Beim ersten Besuch habe ich ihn im Wohnheim abgeholt. Schon bei seinem zweiten Besuch ist Jg. nach Feierabend in seiner Werkstatt alleine zur Malgruppe mit der U-Bahn gefahren. Jg. konnte sich mühelos im System des öffentlichen Nahverkehrs zurechtfinden. Auf diese Weise wurde sehr schnell deutlich, dass Jg. eine pädagogische Begleitung auf dem Weg nicht benötigte. Dies stellte für ihn nach eigenen Angaben eine neue Erfahrung dar, zumal er vorher alleine noch keine Fahrten in die City unternommen hatte. Jgs sozialer Lebensradius begrenzte sich weitgehend auf die Werkstatt und die Wohnstätte. Freunde außerhalb des Behindertenmilieus hatte er nicht.
Bei unseren gemeinsamen Fahrten mit der U-Bahn zeigte sich Jg. sehr interessiert am bunten Leben in der Stadt. Viele der urbanen Selbstverständlichkeiten erschienen ihm neu und noch unbekannt. Jg. ein großes Bedürfnis nach Informationen über das gesellschaftliche Leben außerhalb der Einrichtungen. Er reagierte eher ängstlich und zurückhaltend, wenn ihn der Bewohner P. fragte, ob er Lust habe, mit ihm gemeinsam selbständig einen Ausflug zum Hafen oder zur Alster zu unternehmen.
Bei den "Schlumpern" im Atelier konzentrierte sich Jg. sehr auf das Malen. Er malte bei jedem Besuch ein oder zwei Bilder. Auf mich wirkte seine Arbeitsweise sehr zielstrebig und eifrig. So konnte ich auch beobachten, wie seine Bilder von Woche zu Woche nach meiner Empfindung "besser" wurden. Die Formen wurden komplizierter, die Strukturen vielfältiger, es kamen immer wieder neue Motive hinzu. Das Malen erwies sich somit als ein echtes Interesse von Jg., bei dem er seine Fähigkeiten durch eigene Motivation erweitern und neue Lernerfahrungen machen konnte.
Als zentrales Problem nannte Jg. mehrfach seine Wohnsituation. Jg. wohnte bereits im Nebengebäude der Einrichtung und sollte Anfang 2007 eine eigene Mietwohnung beim gleichen Träger beziehen, wo er dann ambulant betreut werden sollte. Stattdessen aber musste Jg. im Februar 2007 wieder zurück ins Hauptgebäude umziehen und mit einem anderen Klienten eine Wohnung teilen. Grund für diese Rückentwicklung war eine Verzögerung der Bauarbeiten. Jörgs Unmut teilte ich umgehend dem Einrichtungsleiter mit und drängte darauf, dafür zu sorgen, dass der Bewohner nun rasch in die von ihm gewünschte Wohnform überwechseln kann. Der Leiter versprach, dass Jg. Anfang Juni umziehen könne. Dennoch verzögerte sich der Umzug bis Ende Juli.
Bei unseren Gesprächen über seine Wohnsituation äußerte sich Jg. ambivalent. Einerseits sagte er, dass ihm der Rückumzug ins alte Hauptgebäude missfalle und er sehr unzufrieden sei, andererseits äußerte er aber auch Verständnis dafür. Bei seiner Bewertung der Wohnsituation und dem Verhalten der Einrichtung ihm gegenüber fiel es ihm schwer, eine eigene subjektive Position eindeutig und kämpferisch zu beziehen bzw. zu verbalisieren. Ich erklärte ihm, dass er ein Recht darauf habe, "sauer zu sein" und er sich bei der Leitung durchaus beschweren dürfe.
Bei R. konnte ich im Laufe des Projekts deutliche Lernprozesse im Bereich der sozialen Kompetenz beobachten. Bei ihren ersten Besuchen bei den "Schlumpern" zeigte R. noch deutlich dissoziale Verhaltensweisen. Sie klaute einem Kollegen eine Zigarette, schrie so lange und so laut, bis sich andere beschwerten und hörte aber trotzdem nicht damit auf. Sie drückte mir ihre Jacke in die Hand, damit ich sie für sie aufhänge, ebenso reichte sie mir ihr Papier, ließ ihre Tassen und Flaschen stehen und kümmerte sich um niemanden. Sehr schnell aber übernahm R. immer mehr Verantwortung für ihre Sachen. Sie sammelte leere Tassen ein und trug sie in die Küche. Ihr Papier entsorgte sie selbständig im Papierkorb und verhielt sich zunehmend ruhiger. In der U-Bahn sprach R. fremde Leute an und setzte sich regelmäßig auf eine von den anderen Teilnehmern weit entfernte Sitzbank. Möglicherweise konnte dies Ausdruck für ihren Wunsch nach mehr Unabhängigkeit sein. Sie kaufte regelmäßig die "Bravo" am Kiosk und bezahlte, obwohl sie den Geldwert nicht verbal benennen konnte.
In den letzten Wochen meiner Begleitung orientierte sich R. zunehmend nach außen. Sie spazierte auf dem Vorplatz, besuchte selbständig die Läden, die sich ringsum befanden, bummelte, betrachtete die Auslagen, kaufte sich mal eine Bratwurst, mal ein Eis. Ich hielt mich bei diesen Aktivitäten bewusst zurück und ließ sie alleine gewähren, um ihr ein selbständiges Erkunden des urbanen Raums zu ermöglichen. R. konnte sich gut orientieren, dies aber verbal nicht mitteilen. So entstand bei vielen Betreuern der Eindruck, R. sei besonders begleitungsbedürftig und könne sich verirren.
Dies hat sie mehrfach widerlegt. Als ich einmal mit P. gemeinsam den Kiosk an der U-Bahn besuchte, kam R. selbständig nach. Sie überquerte alleine eine dicht befahrene Straße, obwohl sie verbal die Bedeutung der Ampelfarben nicht benennen konnte. Mit P. gemeinsam fuhr sie zweimal ohne pädagogische Begleitung zu den "Schlumpern". In der U-Bahn erkannte R. häufig die Stationen wieder und konnte sich orientieren. Sie achtete auf die Ansagen und verstand sie. Nach außen hin machte die Klientin jedoch den unmittelbaren Eindruck, sie sei der Gegenwart weit abgewandt.
Rs. verbale Themen drehten sich vor allem um Filme wie Harry Potter und Shrek. Aus ihren kurzen Sätzen, die meist nur aus zwei oder drei Wörtern bestanden, entwickelten sich aber keine Geschichten. Mein Eindruck war, dass R. möglicherweise die Diskrepanz zwischen virtueller Filmwelt und realer Welt nicht so recht unterscheiden konnte. Aufgrund ihrer sprachlichen Schwierigkeiten konnte R. ihre Wahrnehmungen aus den Filmen nicht mit anderen Menschen diskursiv verarbeiten. Unmittelbare Eindrücke blieben möglicherweise präsent und konnten nicht eingeordnet werden. Ebenso können die Andeutungen über die Filmfiguren Versuche gewesen sein, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Es waren ihre Themen, andere fielen ihr zu selten ein.
Als chronisches Thema erwies sich in Rs. Akten immer wieder ihre Esssucht. R. esse alles, was ihr zwischen die Finger komme, wurde regelmäßig berichtet. Bei unseren Fahrten konnte ich diese Diagnose nicht bestätigen. Das Essen war nur beim ersten Besuch ein Thema für sie. Danach sprach sie dies nie wieder an. Meine früher geäußerte Vermutung, dass ihr übermäßiges Essen eine Kompensation für erlebte Langeweile und Leere sein könne, könnte damit durch die Klientin selber verifiziert worden sein. Vielleicht lag es auch mit daran, dass ich selber R. nie auf ihr Essverhalten angesprochen und das Thema somit aus dem kognitiven Raum ferngehalten habe. Zumindest zeigte sich, dass Rs. Essverhalten unter anderen Bedingungen anders war als innerhalb des Wohnheims.
Einen verstärkten Förderungsbedarf sah ich bezüglich Rs. kommunikativem Verhalten. Sie orientierte sich hauptsächlich an mir oder anderen Betreuern. Mit anderen Klienten nahm sie nur selten Kontakt auf und ignorierte deren Ansprache meistens. Ich habe R. immer wieder aufgefordert, statt sich an mich zu wenden, andere Klienten anzusprechen, wenn sie Gesprächsbedarf hatte oder eine Hilfe benötigte. Damit versuchte ich, ihre starre Orientierung an Betreuungspersonen etwas aufzulösen. Dies gelang nur ansatzweise.
Ein weiteres zentrales Problem war die Verkehrsunsicherheit. R. schaffte es zwar faktisch, unverletzt die Straße zu überqueren. Da sie aber verbal die Bedeutung der Ampelfarben nicht benennen konnte, blieb eine nicht zu verantwortende Unsicherheit, sie alleine gehen zu lassen. Dieses Problem stellte eine ganz wesentliche Einschränkung für Rs. Selbständigkeit und Teilhabe am Leben der Gesellschaft dar. Für hilfreich erachtete ich es, R. die nötigen Verkehrsregeln näher zu bringen.
Meine Erfahrungen mit R. sind im Wesentlichen bereits während des Projektes in die neue Individuelle Hilfeplanung mit eingeflossen. So hat die Bezugsbetreuerin die Teilnahme an der Malgruppe als ein Interesse der Bewohnerin aufgenommen, weitere Ausflüge geplant und das Thema Verkehrssicherheit in die schriftliche Hilfeplanung einbezogen.
Erhat während meiner Begleitung am Malen kein Interesse gezeigt. Für ihn hatte das Projekt andere Bedeutungen: Er fuhr liebend gern mit der U-Bahn, flirtete, nahm Kontakt zu anderen Menschen auf und genoss das Ambiente im Atelier.
P. freute sich riesig, wenn er mit der U-Bahn fuhr, besonders mit der "Quietsche-Bahn". Damit meinte er die alten Züge, die in den Kurven besonders viel Lärm verursachten. P. konnte sich bereits nach wenigen Fahrten die Abfolge der U-Bahnstationen merken. Er wusste bereits nach drei Wo-chen, wo wir in welche Bahn umsteigen mussten. So gelang es ihm auch zweimal, ohne pädagogi-sche Begleitung alleine mit R. bis zu den "Schlumpern" zu fahren. Bei seiner ersten Fahrt alleine stieg er allerdings in einen falschen Zug. Daraufhin fragte er andere Fahrgäste nach dem Weg, so dass er schließlich dennoch selbständig und ohne meine Hilfe den Weg fand. In den letzten Wochen des Projekts fuhr P. direkt nach der Werkstatt gemeinsam mit Jg. zur Malgruppe. P. hatte gelernt, sich im Verkehrsnetz des HVV zu orientieren, obwohl er nicht lesen konnte. Dennoch bestand hier eine erhebliche Behinderung: P. trug eine Metallplatte im Kopf. Dies wurde in der Einrichtung von einigen Betreuern als besonderes Risiko verstanden: Wenn P. stolpern oder im Gedränge geschubst werden sollte, bestünde die Gefahr, dass er fallen und sich tödlich verletzen könnte. Deshalb, so die Meinung, müsse P. begleitet werden. Die Meinungen gingen innerhalb des Teams jedoch auseinan-der, so dass schließlich ein Kompromiss gefunden wurde: P. durfte zunächst nur auf dem Rückweg eine Teilstrecke ohne meine Begleitung fahren. Erst nach langen Diskussionen kam es gegen Ende meiner Begleitung dazu, dass P. auch ohne pädagogische Aufsicht mit der U-Bahn fahren durfte.
P. beobachtete während der Fahrten aufmerksam das Umfeld und entdeckte neue Interessen. Wenn wir am Hafen entlang fuhren, äußerte er wieder den Wunsch, eine Bootsfahrt unternehmen zu wollen. Fand gerade ein Jahrmarkt statt, mochte er dort einen Besuch abstatten. P., so folgerte ich daraus, wollte die Stadt besser kennen lernen. Bislang waren Ausflüge seitens der Einrichtung mit dem hauseigenen Bus erfolgt. P. hatte das Bedürfnis, solche Ausflüge stattdessen lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unternehmen.
Bei der Durchsetzung seiner Wünsche unterstütze ich P., indem ich ihn ermutigte, seine Betreuer aufzufordern, mit ihm beispielsweise zum Flohmarkt zu fahren. P. hatte damit Erfolg. Solche Erfahrungen schätzte ich als hilfreich für ihn ein, um zu lernen, seine eigenen Interessen besser vertreten zu können. Im Verhältnis zu seiner Mutter zeigte sich P. sehr hörig. Er befolgte ihre Anordnungen, ohne diese zu hinterfragen. Ähnliche Züge zeigte P. dann auch, wenn es um alltagspraktische Entscheidungen ging. P. fiel es stets schwer, sich zu entscheiden. So benötigte er beispielsweise eine halbe Stunde, um sich durchzuringen, einen Kaffee zu bestellen.
Im kommunikativen Bereich hat sich P. sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig verhalten. Er unterhielt sich intensiv mit Jg. und sprach andere Menschen in der Malgruppe an. Besonderes Interesse zeigte P. an einer jungen Teilnehmerin der Malgruppe. Zunächst hatte P. sein Interesse an ihr mir gegenüber mitgeteilt. Ich ermutigte ihn daraufhin, sie anzusprechen. Dabei zeigte er sich sehr schüchtern. Er bat mich, ihn dabei zu begleiten. Erst nach einigen Versuchen nahm P. Kontakt zu der Teilnehmerin auf. Ich konnte beobachten, wie P. nach und nach seine Hemmungen ablegte und vermehrt selbständig Kontakt aufnahm. Eine Zunahme an Selbständigkeit fiel mir auch bezüglich seiner Hilfebedürftigkeit auf. Während mich P. anfangs sehr häufig um irgendeine Hilfe bat, wurde dies im Laufe der Zeit deutlich seltener. Er orientierte sich mehr und mehr an anderen Klienten und reduzierte seine Betreuerfixierung während der Projektphase.
Große Probleme wurden beim Kaufen sichtbar. P. fiel es sehr schwer, mit Geld umzugehen. Er kannte den Wert der Einheiten nicht und konnte nur ansatzweise rechnen. Oft kapitulierte P. beim Versuch, sich etwas zu erwerben und kehrte unverrichteter Dinge wieder zurück. P. neigte vor allem bei solchen Frustrationserfahrungen schnell dazu, sich zurück zu ziehen und zu resignieren.
Resümierend stellte ich fest, dass P. durch seine Teilnahme an der Malgruppe erhebliche Fortschritte erzielen konnte. Seine Selbständigkeit im Bereich der Mobilität konnte er erheblich steigern. Seitens der Einrichtung war dafür bereits ein Fahrtraining durchgeführt worden. P. konnte neue Menschen kennen lernen, Flirtversuche unternehmen, lernen, seine Interessen besser durch zu setzen, den Kontakt mit anderen Klienten zu intensivieren, seine Fixierung auf Betreuer abzubauen und seine anfangs sehr große Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Deutlich wurde, dass P. großes Interesse daran hatte, möglichst selbständig mit der U-Bahn zu fahren und viel in der Stadt zu erleben.
In der Hilfeplanung wurde das Thema Selbstbewusstsein vertieft. Die Sinnhaftigkeit, dass P. lernt, souveräne Entscheidungen zu treffen und sich gegenüber anderen Personen abzugrenzen, hat der Bezugsbetreuer ausgeführt. Auch der Umgang mit Geld wurde als Aufgabe in den IHP eingetragen. Andere Erfahrungen bezüglich P. aus dem Projekt konnte ich immer wieder mit dem zuständigen Betreuer diskutieren.
In der Anfangsphase habe ich die Bewohner in ihrem Wohnheim abgeholt und zu den "Schlumpern" durchgängig begleitet. Im Atelier habe ich die Teilnehmer zunächst in die örtlichen Gegebenheiten und in die Regeln der Malveranstaltung eingeführt. Ich saß die meiste Zeit über bei meinen Klienten am Tisch und habe mit ihnen Dialoge entwickelt, weniger über das Thema Kunst, sondern mehr über das, was ihre Anliegen waren. Hierbei habe ich meine Methode der evaluierenden Dialoge praktisch umgesetzt, so dass ich während dieser Zeit eine Menge Informationen über die Interessen, Bedürfnisse und Probleme der Teilnehmer erfahren konnte. Diese Gespräche waren keineswegs einseitige Interviews, sondern waren wechselseitig strukturiert. Ich nahm nicht nur Informationen entgegen, sondern gab den Klienten auch Tipps, machte ihnen Vorschläge, ermutigte sie und erzählte auch über mich.
Da es von Anfang an mein Ziel war, die Bewohner dabei zu fördern, möglichst selbständig mit der U-Bahn fahren zu können, erklärte ich ihnen sehr genau den Weg. Bereits im Februar 2007 versuchte ich ein erstes Lernziel zu erreichen. Anstatt die Bewohner aus X abzuholen, traf ich mich mit ihnen an der U-Bahn in Barmbek. Dies gelang bereits beim ersten Versuch. In der Woche darauf ging ich einen Schritt weiter und verabredete mich mit P. und R. an der Zielhaltestelle. Meine Klienten hatten somit die Aufgabe, zweimal umzusteigen. Diesmal geschah ein Missgeschick. Die Klienten kamen zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt an. Sie hatten sich verfahren, dann andere Fahrgäste nach dem Weg gefragt und ihn schließlich verspätet gefunden. Ich wertete dies als einen großen Erfolg. Die Klienten hatten damit bewiesen, dass sie selbständig in der Lage waren, sich Orientierung zu verschaffen. In der darauf folgenden Woche versuchten wir die gleiche Strecke erneut ohne meine Begleitung: diesmal erfolgreich ohne eine Panne.
In der Einrichtung hatten diese für die Teilnehmer und mich positiven Erfahrungen dennoch große Besorgnis ausgelöst, so dass danach die Betreuer selber die Begleitung auf dem Hinweg übernahmen. Nur Jg. fuhr weiterhin selbständig zu den "Schlumpern". Auf dem Rückweg begrenzte ich meine Begleitung auf den Abschnitt bis Hauptbahnhof. Dort begleitete ich die Teilnehmer bis zur anderen U-Bahn. P. rief dann mit meinem Handy in der Einrichtung an und teilte die Ankunftszeit in X mit, so dass die Klienten dort mit dem Bus abgeholt werden konnten.
Nachdem ein Betreuer aus der Einrichtung die Begleitung der Bewohner auf dem Hinweg übernommen hatte, stieß ich dann hinzu und übernahm in der Folgezeit die Betreuung im Atelier. Zu Beginn dieser neuen Arbeitsteilung kam ich pünktlich zu einem vereinbarten Zeitpunkt. Langsam aber verschob ich meine Ankunft weiter nach hinten, damit sich die Klienten eine zunehmend längere Zeit alleine ohne Betreuung bei den "Schlumpern" aufhalten konnten. Zum Ende meines Projekts hin richtete ich es dann so ein, dass meine Teilnehmer rund zwei Stunden alleine sein konnten. Dies hatte den Grund, ihnen einen neuen Freiraum zu ermöglichen, die Erfahrung machen zu können, auch ohne Betreuer auszukommen und sich unbeaufsichtigt bewegen zu können.
Das gleiche Prinzip verfolgte ich auch während meiner Anwesenheit. Ich mischte mich nur selten beim Malen ein, sondern hielt mich zunehmend zurück, setzte mich woanders hin und unterhielt mich mit anderen Menschen. So erreichte ich zumindest, dass sich P. immer mehr mit Jg. unterhielt und auch andere Maler kennen lernte. R. verhielt sich trotz oder vielleicht gerade wegen der Distanz zur Betreuung zunehmend ruhiger und ausgeglichener. Aktiver war ich bei der Unterstützung von Ps. Flirtversuchen, weil ich hier einen deutlichen Hilfebedarf sah. Zudem sah ich in einer Förderung seiner Flirtkompetenz auch die Möglichkeit, dass er neue Ziele in seinem Leben finden und sich damit selbständiger entwickeln konnte als bislang.
In Bezug zur Wohneinrichtung konnte ich folgende Entwicklungen beobachten: Die Zusammenarbeit mit den Betreuern in der Einrichtung war zu Beginn meines Projektes eher punktuell. Die diensthabenden Pädagogen bereiteten die Teilnehmer auf die Abfahrt vor. Mit dem Team hatte ich anfangs abgesprochen, dass uns jemand mit dem Bus zur U-Bahn fährt. Das gelang aber nicht immer. Einige Male mussten wir dennoch zu Fuß zur Haltestelle gehen, weil nach Auskunft von Betreuern gerade keine Zeit war. Später, als die Bewohner von einem Betreuer bis zu den "Schlumpern" begleitet worden sind und ich dort hinzukam, fiel die Fahrt einige Male aus, weil in der Einrichtung keine Kapazitäten frei waren. Später erfuhr ich von einer Betreuerin, dass zumindest ein Ausfall nicht an der Personalknappheit gescheitert war, sondern deshalb, weil die Betreuerin zu große Angst hatte, die Bewohner zu den "Schlumpern" fahren zu lassen.
Mein Projekt führte lange Zeit ein Schattendasein in der Einrichtung. Ich organisierte die Fahrten und bot meine Betreuungsleistung an. Für die Einrichtung selber war dies zunächst ein zusätzliches externes Angebot, das auf die Alltagsroutinen wenig Einfluss hatte. Sofern der Tagesablauf nicht weiter gestört wurde, konnte ich mit der Unterstützung des Teams rechnen. Fiel ein Betreuer aus, so hatten andere Arbeiten Vorrang. Einige Betreuer beäugten das Projekt lange Zeit misstrauisch. Eine Betreuerin berichtete, dass ich mit meinen Fahrten zusätzlichen Arbeitsdruck auf das Team geschaffen hätte. Die Arbeit im Schichtdienst sei ohnehin schon sehr verdichtet und zusätzliche Leistungen wie lange Fahrten in die Stadt nicht zu bewältigen gewesen.
Das Interesse im Team nahm dann plötzlich zu, nachdem die Teilnehmer zweimal alleine zu den "Schlumpern" gefahren waren. Nun traten die Bedenken in den Vordergrund: R. war nicht verkehrssicher. Ihre Mutter und gesetzliche Betreuerin mochte nicht, dass R. alleine U-Bahn fuhr. Auch Ps. Mutter wehrte sich dagegen. Im Team wurde das Thema intensiv diskutiert. Die Meinungen der Betreuer gingen weit auseinander: Einige sprachen sich zunächst strikt gegen das Fahren mit der U-Bahn aus, andere plädierten dafür, Risiken einzugehen und dafür mehr Selbständigkeit zu ermöglichen. Die lange und intensive Diskussion zeigte, dass der Sicherheitsaspekt in der Ein-richtung einen sehr hohen Stellenwert einnahm. Der Leiter unterstützte in den Diskussionen weitgehend meine Haltung und warnte davor, nach allen erdenklichen Risiken zu suchen, bis gar nichts mehr ginge. Sehr deutlich war geworden, dass die Mütter der beiden Bewohner einen großen Einfluss auf die Einrichtung ausübten. Da die Einrichtung auch vom Wohlwollen der gesetzlichen Betreuer, welche meist die Eltern waren, abhängig war, beeinflusste deren Sichtweise durchaus die Praxis in der Einrichtung. Gemeinsam mit dem Leiter kamen wir zu der Feststellung, dass die gesetzlichen Betreuer keineswegs gewisse Fahrten, U-Bahnnutzungen oder ähnliches im Alltag verbieten durften. Wir waren uns alle darüber einig, dass R. nicht ohne pädagogische Begleitung eine Straße überqueren sollte. Bezüglich P. sahen nach einiger Zeit auch die anfangs eher ängstlich eingestellten Betreuer ein, dass ihm das Fahren mit der U-Bahn große Freude ermöglichte und deshalb gefördert werden sollte. Im Laufe der Zeit wurden dann in der Einrichtung neue Kapazitäten frei, mit denen das Projekt intensiver unterstützt werden konnte.
P. gelang es darüber hinaus, durch seine intensiven Interessensbekundungen weitere Aktivitäten einzuleiten. Er forderte eine Begleitung zum Flohmarkt so oft, bis irgendwann eine Betreuerin dafür eingeteilt worden war. Damit wurden in der Einrichtung nun neue Interessen deutlich. Schließlich machte sich P. selbständig und fuhr entgegen dem Rat seiner Betreuer direkt von der Werkstatt aus zu den "Schlumpern". In der Einrichtung wurde dies irgendwann als Fortschritt erkannt und toleriert.
Als weitere Folge dieser Erfahrungen hat ein Betreuer den Bewohner-Stammtisch in einem zu Fuß erreichbaren Lokal wieder reanimiert. Er war zuvor mit dem Weggang einer Betreuerin zum Erliegen gekommen. Im Team wurde auch die Institution des Busses zunehmend in Frage gestellt. Erkannt wurde, dass dieser einen separierenden Charakter hatte. Dem Fahren mit der U-Bahn wurde stattdessen ein höherer Wert zugemessen.
Dass mein Projekt zeitlich befristet sein sollte, hatte ich von Anfang an im Team mitgeteilt. Im Juni 2007 setzte ich den Termin auf Ende des Monats. Bis dahin sollte die Einrichtung eine eigene Lösung gefunden haben, das Projekt weiter zu führen. Meine Empfehlung war immer, eine hauptamtliche Fachkraft zu beauftragen, weil es dabei um pädagogisch anspruchsvolle Ziele ging. Ersatzweise könnten Honorarkräfte zur Ergänzung im Basisdienst[13] herangezogen werden. Die Einrichtung entschied sich jedoch umgekehrt. Für die Fortführung des Projekts wurde eine Honorarkraft eingesetzt. Hierdurch sah ich die Gefahr, dass dieses und andere Projekte dieser Art als Zusatzaufgaben abgewertet werden könnten: Die hauptamtlichen Betreuer orientieren sich auf den Basisdienst, während Projekte, die darüber hinaus führen, als zusätzlich und somit auch verzichtbar erscheinen.
Abschließenden Empfehlungen an die Einrichtung: Aufgrund der sechsmonatigen Erfahrungen bei der Durchführung des Projektes hat unsere Forschungsgruppe der Einrichtung im Hinblick auf ihre geplante Ambulantisierung folgende Empfehlungen angeboten:
Für die Bewohnerin R. könnte es hilfreich sein, weitere Kenntnisse über die grundlegenden Verkehrsregeln für Fußgänger zu erwerben. Da Rs. Bewegungsfreiraum durch ihre Unsicherheit im Straßenverkehr sehr eingeschränkt war, wäre dies ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu mehr Selbständigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Dieses Anliegen betraf auch andere Bewohner. Die Begleitung der Bewohner auf der Fahrt zu den "Schlumpern" und zurück sollte schrittweise reduziert werden.
Der Einfluss der Eltern auf die Bewohner und auf die Arbeit in der Einrichtung sollte reduziert werden. Sinnvoll könnte es sein, die betreffenden Bewohner dazu zu ermutigen, ihre gesetzlichen Betreuer zu wechseln. Die Einrichtung ihrerseits verfügte gegenüber den gesetzlichen Betreuern auch durchaus über Möglichkeiten, Druck auszuüben.
Die Nutzung des hauseigenen Busses sollte reduziert, Fahrten mit der U-Bahn gefördert werden.
Es wäre weiter in Erfahrung zu bringen, für welche Aktivitäten sich die anderen Bewohner, die ich mit meinem Projekt nicht erreichen konnte, interessierten.
Die Betreuung der Bewohner bei Außenaktivitäten sollte durch hauptamtliche pädagogische Fachkräfte erfolgen. Honorarkräfte sollten stattdessen eher in den Basisdienst eingesetzt werden.
Abschließend wertete ich mein Projekt als erfolgreich: Es war gelungen, neue Impulse in die Einrichtung zu bringen. Das Bedürfnis einiger Bewohner nach neuen Außenaktivitäten war erkannt worden und konnte als neues Angebot von der Einrichtung übernommen werden. Die Aktivitäten haben zudem zu großen Diskussionen und Reflexionen im Team geführt, durch die alte Sichtweisen und Praxen hinterfragt worden sind. Auf Seiten den Bewohner ist es gelungen, ihre soziale Teilhabe und Selbstbestimmung zu stärken. Mein methodisches Handeln hat sich konkret hierbei als gegenstandsadäquat im Hinblick auf den übergeordneten emanzipatorischen Auftrag meiner Forschung erwiesen.
Den Ansatz der rehistorisierenden Diagnostik habe ich bei und mit insgesamt sechs Bewohnern durchgeführt. Anstatt alle diese Entwicklungsgeschichten verkürzt hier darzustellen, habe ich mich entschieden, die Ergebnisse von zwei Bewohnern mit sehr unterschiedlichen Biografien und sehr unterschiedlichem Verlauf der rehistorisierenden Diagnostik exemplarisch für die vorgefundene Vielfalt vorzustellen. In Kapitel. 2.3 weise ich dann auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Anwendung dieses Ansatzes hin und versuche in Kapitel 2.4 niederschwellige Alternativen anzubieten. Meine folgenden Rekonstruktionen der Lebensgeschichten fasse ich in Präsenz ab, weil dadurch das Drama der Behinderung deutlicher zum Tragen kommt.
H. R., geboren 1953, lebt seit 1985 in der stationären Wohneinrichtung. Die vorhandenen Unterlagen in der Einrichtung erscheinen relativ zur Dauer seines Aufenthaltes als spärlich. Es finden sich nur zwei Entwicklungsberichte und ein paar kurze Notizen mit Hilfeplancharakter, kein IHP, keine ärztlichen Diagnosen, kein Arbeitsbericht aus der Werkstatt, keine Schulzeugnisse oder Elternberichte.
Die Anamnese ist ohne Datum und ohne Name eines Verfassers. Als medizinische Diagnosen werden darin ein Down-Syndrom und Schuppenflechte genannt. Als Kern einer geistigen Behinderung berichtet der Betreuer über das Fehlen einer "individuellen Förderung" seitens der Mutter. Die Ärzte hätten Hs. Mutter mitgeteilt, ihr Sohn sei "schwachsinnig" und werde dies auch bleiben. Die biografische Weiterentwicklung bleibt von da an unscharf. H. ist irgendwann in eine Wohngruppe an der Elbchaussee eingezogen und hat nach seinem Sonderschulbesuch angefangen, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten. 1985 mit seinem Einzug in die jetzige Einrichtung wechselte er auch seinen Werkstattplatz und arbeitet seitdem bei den Winterhuder Werkstätten. Festgehalten wird in dem Dokument, dass sich H. bei Arztbesuchen "ausgewiesen renitent" verhalte. Er leide unter chronischer Schuppenflechte, die bereits seit Jahren erfolglos behandelt werde. Als "weitere Problemzone" wird die Fußpflege genannt, die nur gegen Hs. "äußersten Widerwillen" durchsetzbar sei. Außerdem leide der Klient an Krampfaderbildung. Typische Aspekte geistiger Behinderung werden nur ihrem Ursprung nach angerissen, Hilfen zur Förderung der Autonomie und der sozialen Eingliederung fehlen darin gänzlich. Die Frage, weshalb H. den Aufenthalt in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für geistig behinderte Menschen wählte, bleibt offen. Welches Ziel sollte mit dem Aufenthalt erreicht werden? Die benannten Syndrome und Krankheiten begründen alleine noch keine stationäre Betreuung.
Eine "allgemeine Zielvereinbarung" zwischen der Einrichtung und dem Bewohner wird im September 2004, 19 Jahre nach dem Einzug, getroffen. Auch in diesem Dokument dominiert der medizinische Blick. Der zuständige Betreuer erwartet bei H. "Abbauerscheinungen" wegen seines "fortgeschrittenen Alters" und "seiner Diagnose". Bei der Gesundheitsfürsorge zeige sich H. "gänzlich uneinsichtig, ja renitent", heißt es im Text, besonders bei der Fußpflege. "Es ist unsere Absicht, diese auch gegen seinen erklärten Willen durchzuführen..." Wenn man mit H. darüber spräche, äußere er sich nur "einsilbig". Es sei unklar, "ob seine Behinderung allein ursächlich dafür ist, dass er sich so beschränkt darstellt. Ziel unserer Arbeit mit Herrn R. ist es, ihn hier noch genauer einschätzen zu lernen." Hier fällt auf, dass plötzlich von einer Behinderung gesprochen wird, die bislang nur durch eine fehlende Förderung in der Kindheit als verursacht eingeführt worden war. Welche funktionellen Bereiche beeinträchtigt sind, wurde bislang nicht ausgeführt. Worin besteht Hs. Behinderung?
Die Vermutung liegt nahe, dass das Down-Syndrom als "die Behinderung" gedeutet wird. Das Down-Syndrom alleine wäre aber nur eine biologische Ausgangsbasis für eine konkrete Behinderung, die sich nur im Zusammenwirken mit den psychischen und sozialen Bedingungen entwickelt und an sich nur einen relativ abstrakten Aussagewert besitzt. Die "allgemeine Zielvereinbarung" enthält nur zwei Ziele: erstens sollen Hs. lebenspraktische Fähigkeiten "so weit als möglich aufrecht" erhalten werden und zweitens will der Betreuer seinen Klienten noch genauer einschätzen lernen. Was bedeutet dies? Gibt es keine progressiven Ziele mehr? Sind alle Ziele bereits erreicht worden, und welche? Was ist der Auftrag, Sinn und Zweck eines weiteren Aufenthaltes in der Einrichtung? Geht es tatsächlich jetzt nur noch darum, die Fußpflege durchzuführen?
Als Widerspruch erscheint einerseits die Feststellung, dass H. in den letzten Jahren ein "hohes Maß an Autonomie" erworben habe, dennoch bestand der Betreuer darauf, auch entgegen dem Willen des Klienten seine Füße zu pflegen. Hier geraten Autonomie und Fußpflege in einen Widerspruch. Zu fragen wäre, welche subjektive Bedeutung die Fußpflege für H. hat, welche für den Betreuer, unter welchen Bedingungen sie stattfindet, welche soziale Symbolik haftet an ihr? Zu fragen bleibt auch: Was will der Klient mit seinem Symptom, hier das "renitente Verhalten" gegen die Fußpflege, erreichen? Zu Fragen ist aber auch, was will die Einrichtung mit ihrer Maßnahme erreichen?
Über die Zeit zwischen Ende Mai 1997 und Ende Februar 2000 hat die Einrichtung einen Entwicklungsbericht geschrieben. Den Schwerpunkt bildet hier bereits der "körperliche Bereich". Die Schuppenflechte wird an erster Stelle genannt. H. konnte dem Bericht zufolge damals noch die Salbe "mit Unterstützung selbständig" auftragen. Rein medizinisch erscheint aber kaum Hoffnung: Die Schuppenflechte wandert von einer Stelle der Haut zur nächsten.
Die Salbe scheint kaum eine heilende Wirkung zu entfalten, wird aber dennoch weiterhin verwendet. Hs. "mangelnde Zuverlässigkeit" wird als ein verursachender Faktor des anhaltenden Krankheits-bildes aufgeführt. Der Bewohner leide zudem an Hypotonie, seine Ernährungsweise sei ungesund, da er sich am liebsten von Joghurt, Weißbrot und Nutella ernähre, Obst und Gemüse aber meide. Erklärt wird dies mit dem lückenhaften Gebiss des Bewohners, der seine Prothese aber nicht trage. Wegen der Bildung von Varizen wird eine Operation empfohlen. Problematisch erscheint dies wegen der großen Angst des Klienten. Als weiteres Ziel soll H. "noch mehr für die Eigenverantwortung" seiner Gesundheit sensibilisiert werden. Im "lebenspraktischen Bereich" werden H. große Kompetenzen attestiert: Er fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kauft selbständig für seine Wohn-gruppe ein, kann das Geld abrechnen und holt sich sein Taschengeld bei der Bank ab. Auf das Waschen der Wäsche und die Zimmerreinigung hat H. wenig Lust und erhält deswegen größere Unterstützung. Er zeigt sich schnell erschöpft. Ziel ist es, Alterserscheinungen entgegen zu wirken. H. kann "im kognitiven Bereich" einzelne Wörter schreiben und lesen. Sein Zahlen- und Zeitverständnis sei aber eingeschränkt. Er könne komplexere Probleme lösen, soweit er ein subjektives Interesse daran habe. Bei Anforderungen von außen falle ihm das schwerer und er zeige sich schnell überfordert.
Im "sozialen Bereich" ist H. sehr beschäftigt: Er geht am Wochenende zum Fußball, besucht einen Club der Kirchengemeinde Othmarschen, trifft sich mit Arbeitskollegen und Familienangehörigen. Mit seiner Freundin aus der Einrichtung unternimmt H. sehr viel. Als Problem erscheint dem Betreuer Hs. mangelnde Zuverlässigkeit bei Absprachen. Der weitere Aufenthalt im Heim wird damit begründet, dass ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Kontinuität in Hs. Beziehungen notwendig sei. Aus sozialpädagogischer Sicht bleibt es ein Rätsel, weshalb die zuständige Fachbehörde den Antrag auf Verlängerung der stationären Maßnahme bewilligt hat. H. erscheint nach den Ausführungen im Entwicklungsbericht 2000 als typischer Klient einer ambulanten Betreuung. Seine lebenspraktischen Fähigkeiten, seine sozialen und kognitiven Kompetenzen reichten unzweifelhaft dafür aus, um selbständig in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft oder gemeinsam mit seiner Freundin leben zu können. Die Leistungen in der stationären Einrichtung beschränkten sich auf die Unterstützung beim Eincremen der Haut, dem Wäschewaschen und der Zimmerpflege. Diese Hilfen könnten ebenso ambulant erbracht werden.
Aus den folgenden drei Jahren finden sich in der Akte keine Aufzeichnungen. Erst Ende 2004 wird ein neuer Entwicklungsbericht archiviert, der sich auf den Zeitraum zwischen 30.06.03 und 31.12.04 bezieht. Die Schuppenflechte ist weiterhin das zentrale Thema. In den inzwischen vergangenen vier Jahren des stationären Aufenthaltes konnten weder die stationären Bedingungen noch die Salbe eine Linderung bewirken. Jetzt kommt Tinea pedis (Fußpilz) hinzu. Die Zehennägel sind trotz der Verlängerung der Maßnahme verwachsen und werden inzwischen "gegen den energischen Wider-stand" des Klienten geschnitten. Neue Medikamente gegen Fußpilz führen zu Schwindelanfällen.
Den Betreuern fällt auf, dass H. nur in Ausnahmefällen an den "festgelegten Tagen" badet oder duscht. Stattdessen verbringt H. Stunden mit dem Rasieren. Seine Ernährung beschränkt sich weiterhin auf Joghurt und Toastbrot. H. baue ab, wird berichtet. Nach und nach verliere er seine Fähigkeiten, die ihm vier Jahre zuvor noch bestätigt worden waren. Die Verlängerung der stationären Maßnahme scheint sich im Nachhinein zu bestätigen.
So hat H. inzwischen die Lust am Einkaufen verloren. Sein Geld holt er längst nicht mehr selber bei der Bank. Hs. Entwicklung geht rückwärts. Der Betreuungsbedarf steigt. Die Mitarbeiter haben bereits die Zimmerreinigung und die Wäschepflege ganz in ihre Zuständigkeit übernommen. Selbst die Mobilität erscheint problematisch geworden zu sein, nachdem H. gemeinsam mit seiner Freundin in einer Bushaltestelle übernachtet hat. Auch im sozialen Bereich kennt die Entwicklung nur noch eine Richtung: "Kontakte zu Personen außerhalb der Einrichtung unterhält er mittlerweile keine mehr", heißt es im Bericht. Der Kirchenclub verabschiedet H. feierlich, zum Fußball will H. nur noch in Begleitung eines Betreuers fahren. Nach Auskunft des derzeitigen Bezugsbetreuers wurde dies eine Zeit lang gewährleistet, verlief dann aber im Sande. Die Beziehung zu seiner Partnerin besteht zwar weiterhin, aber H. hat sich längst von der Außenwelt zurückgezogen.
Im Sommer 2007 erleidet H. einen epileptischen Anfall. Er kommt ins Krankenhaus. H. wirkt auf die Betreuer zunehmend verwirrt. Er ist kaum noch kommunikationsfähig, sitzt verstört in der Ecke, beim Essen hat er Schwierigkeiten, den Teller zu finden. Nachdem H. sich draußen verirrt hatte, wird das Gartentor abgeschlossen, damit er nicht mehr weglaufen kann. Über einen Hausschlüssel verfügt H. noch, nutzt ihn aber nicht. H. erhält das Medikament Ergenyl gegen Epilepsie. Dieses kann als Nebenwirkungen auch zur geistigen Verwirrung und zu Halluzinationen führen. Jetzt wird eine richterliche Unterbringung angestrebt, obwohl H. schon bald als Mieter ambulant in seiner eigenen Wohngemeinschaft innerhalb der Einrichtung betreut werden soll.
Zusammenfassende Entwicklungshypothese: Bei H. liegt den Berichten und den äußeren körperlichen Anzeichen zufolge ein Down-Syndrom vor. Dies ist als die genetische Bedingung zu verstehen, durch welche er von Geburt an in ein erschwertes Verhältnis zu seiner sozialen Umwelt gesetzt und wodurch das Lernen zumindest erschwert worden ist. Durch die Trisomie 21 wird der für die Beschleunigung von geistigen und körperlichen Aktivitäten notwendige Botenstoff Dopamin in seiner Synthese beeinträchtigt. Ferner wird auch die Synthese der Neurotransmitter Acetylcholin, der an der Regulation motivationaler Aufmerksamkeit beteiligt ist, und Noradrenalin, der für die Stress-vermeidung im Sinne der Körperaktivierung zuständig ist, reduziert. (Vgl. Jantzen 2005, S.73f.) Im Resultat entsteht so etwas wie eine chronische Langsamkeit. Kinder mit Down-Syndrom benötigen deshalb eine individuell auf ihr Tempo abgestimmte Förderung. Konfrontiert man diese aber mit dem gesellschaftlich üblichen Tempo, so werden sie überfordert und in ihrer Entwicklung gehemmt. Hs. Langsamkeit wird in den Berichten immer wieder benannt, wenn davon die Rede ist, dass er sich schnell überfordert fühle und erschöpft sei.
Diese schnelle Erschöpfung ist Folge von fehlgeschlagenen Versuchen, sich dem Tempo der sozialen Umwelt anzupassen. Die bereits Ende der 90er Jahre von Betreuern vermuteten bzw. erwarteten Alterserscheinungen beziehen sich wahrscheinlich auf die für die Trisomie 21 typische Langsamkeit und frühzeitige Erschöpfung. Im Bereich der Wahrnehmung findet sich bei Menschen mit Trisomie 21 eine reduzierte Neuronendichte in den Feldern der Großhirnrinde, die für die optischen, akustischen und die Bereiche der Körperselbstwahrnehmung zuständig sind. Dies könnte im Ansatz zumindest erklären, weshalb H. seine gesundheitlichen Aspekte anders wahrnimmt als die Betreuer, begründet aber keineswegs eine kausale biologistische Determination. Denn Lernschritte hängen immer von der sozialen Kooperation und Kommunikation ab.
Der soziale Kern von Hs. geistiger Behinderung indes dürfte in der unzureichenden individuellen Förderung im frühkindlichen Alter liegen. Von Ärzten wurde bereits damals die Prognose gestellt, H. sei "schwachsinnig" und werde es auch bleiben. Ob H. heute an Demenz erkrankt ist, lässt sich ohne neurologische Untersuchung nicht entscheiden. Nach Jantzen erkrankt ein Drittel der Menschen mit Trisomie 21 an Demenz. Es bestehe eine "größere Verwundbarkeit der Gehirns für das Alzheimer-Syndrom". (Jantzen 2005, S.61) Im ZNS fänden sich bei der Trisomie 21 ähnliche zellulare Veränderungen wie bei Alzheimer. Darin sieht Jantzen eine mögliche Erklärung dafür, dass verschiedene Autoren einen Rückgang der kognitiven Fähigkeiten ab dem 30. Lebensjahr ausgemacht haben. Die durchschnittliche Lebenserwartung indes ist im vergangenen Jahrhundert erheblich gestiegen. Bereits 1970 lag sie bei 55 Jahren.
Zu beachten ist bei all diesen medizinischen Untersuchungen, dass sie stets an Menschen vorgenommen worden sind, die unter historisch konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen gelebt haben. Das zeigt die Entwicklung der Lebenserwartung deutlich. Mit dem Down-Syndrom gehen fast immer eine Reihe von sozialen Ausschlüssen und Benachteiligungen einher. Diese eingeschränkten Möglichkeiten begünstigen ihrerseits geistige Degenerationserscheinungen - mit oder ohne Down-Syndrom. Vor allem die Statistiken vor 1970 oder noch bis vor 10 Jahren bezogen sich überwiegend auf Menschen, die in Großanstalten gelebt haben. Die Trisomie 21 lässt sich empirisch kaum isoliert untersuchen, da sie fast immer in Kombination mit sozialer Benachteiligung auftritt. Diese sozialen Benachteiligungen auf ein Minimum zurück zu drängen, ist dann gerade die Aufgabe der pädagogischen Behindertenhilfe.
Über Hs. Fähigkeiten, Hilfebedarfe und Probleme erfahren wir erst ab 1997 etwas. Zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits 12 Jahre in der stationären Wohneinrichtung. Die Akte ist lückenhaft geführt worden. Es scheint so, als hätte zur Jahrtausendwende hin niemand mehr in der Einrichtung gewusst, warum und mit welcher Zielsetzung H. 1985 eingezogen ist.
Hs. Aufenthalt in der Einrichtung wurde im Jahr 2000 schon gar nicht mehr in Frage gestellt, sondern galt als selbstverständlich. Dabei ist das Ziel der Eingliederungshilfe nicht ein lebenslanger Verbleib im stationären Bereich, sondern die Hilfe zur Rückkehr in die Gesellschaft. Dieses Missverständnis ist nicht nur bei der Einrichtung, sondern auch bei dem damals zuständigen Sachbearbeiter in der Sozialbehörde anzutreffen. Auf Grundlage des Entwicklungsberichtes gab es im Jahr 2000 kaum Anlass, den stationären Aufenthalt zu verlängern. H. war Ende der 1990er Jahre in seinen persönlichen Fähigkeiten so weit entwickelt, dass er keine Betreuung rund um die Uhr mehr benötigte.
Mit der Tatsache alleine, dass sich H. an keine Absprachen hält, lässt sich kein dauerhafter Aufenthalt in einer stationären Einrichtung begründen. Zum Zeitpunkt des Entwicklungsberichtes 2000 setzte der im stationären Bereich nicht unübliche Looping-Effekt ein: H. musste weiter im Heim bleiben, um Kontinuität zu wahren. Hs. entwickelte Unabhängigkeit, die dazu geführt hatte, dass er verlässliche Absprachen mit den Betreuern und die Regeln der Einrichtung längst nicht mehr benötigte, wurde als Argument gegen ihn verwendet. Betrachtet man die Argumentation subjektwissenschaftlich, so fällt auf, dass Hs. mangelnde Verlässlichkeit als Problem von den Betreuern genannt wird, nicht von H. Der Mangel an Verlässlichkeit und die Überschreitung von Regeln waren die Probleme der Betreuer damals, nicht die des Klienten. Die darin deutlich werdende institutionszentrierte Sicht verhinderte es, subjektorientiert den umgekehrten Weg zu beschreiten, nämlich die Regeln nach den Bedürfnissen des Bewohners auszuloten. Die Perspektive auf einen Auszug aus der Einrichtung war bereits aus dem Blick geraten.
Umso fragwürdiger wird das damalige Beharren der Einrichtung auf einen weiteren Verbleib Hs. dadurch, dass im Entwicklungsbericht so gut wie nichts an pädagogischen Zielen und Hilfen genannt wird. H. wird als Patient mit chronischer Psoriasis beschrieben. Nach der Entscheidung seitens der Einrichtung und der Sozialbehörde im Jahr 2000 baut H. dann tatsächlich in seiner Entwicklung ab. Was dann genauer vonstattengeht, wird in der Akte nicht dokumentiert. Es fehlen Entwicklungs-berichte und Hilfepläne. Hier muss nun die Spekulation einsetzen: Klar erscheint den Dokumenten zufolge, dass H. um das Jahr 2000 "reif" dafür war, auszuziehen. Diese Chance und möglicherweise Hs. persönliche Hoffnung auf ein Leben nach der Einrichtung zerschlug sich dann. Folgerichtig zeigt H. im Anschluss daran Kapitulationserscheinungen. Er schließt nach und nach mit der Welt ab und zieht sich zurück: Er wird zunehmend pflegebedürftig. In der Einrichtung wird die Ursache für diese Entwicklung in der Person des Bewohners gesucht: sie liegt in seiner Natur begründet, nicht aber in den sozialen Lebensbedingungen. Auszuschließen sind biologische Abbauprozesse keineswegs. Dennoch stehen auch biologische Prozesse in Wechselwirkung mit sozialen Prozessen.
Rehistorisierende Betreuungskonferenz: An ihr nehmenH., sein Bezugsbetreuer O., seine Tagesbetreuerin P. und ich teil. H. erhält inzwischen an den Vormittagen zwischen 9 und 13 Uhr eine persönliche Betreuung. Zu Beginn unsere Besprechung lege ich meine bisherige Aktenauswertung den beiden Betreuern vor. O. fällt ein Fehler in der Anamnese auf. Nach Os. Informationen hat sich Hs. Mutter sehr um eine individuelle Förderung bemüht. Die niedergeschriebene Feststellung, dass H. keine bedarfsgerechte Förderung erhalten habe, sei falsch. Meine Strategie besteht nun darin, die beiden Pädagogen nicht mit meinen vorläufigen Ergebnissen und Hypothesen zu beeinflussen, sondern ihr eigenes Wissen zur Sprache zu bringen.
Nach Os. Auffassung kann man zurzeit nicht sagen, was Hs. aktueller Wille sei. Er halte sich oft und lange in seinem Zimmer auf, sei sehr passiv und in seiner Wahrnehmung sowie Orientierung sehr beeinträchtigt. Eine neurologische Diagnostik sei nicht durchführbar, weil sich H. dagegen wehre. Wir kommen dann auf Hs. bisheriges Kernthema zu sprechen: die Schuppenflechte. Nach Os. Deutung drückt diese Krankheit eine Abgrenzung nach außen hin aus. O. rekonstruiert Hs. Verhältnis zu seiner Familie. Dort habe er immer im Mittelpunkt gestanden und sei umsorgt worden. Davon habe sich H. abgrenzen wollen und sich schließlich zurückgezogen. Ich schiebe die Deutung ein, dass Hs. Schuppenflechte auch ein Ausdruck seines Freiheitsdrangs sein könne. Darauf antwortet H. plötzlich mit "Ja" und lacht. H. scheint unserem Gespräch zumindest zeitweise folgen zu können, auch wenn er die meiste Zeit über einen abwesenden Eindruck macht.
Ich verweise nun auf den Wendepunkt in Hs. Heimkarriere hin, die Zeit ab dem Jahr 2000. O. versteht die damalige Lage so, dass es für H. kaum einen Unterschied gemacht hätte, wenn er in einer eigenen Wohnung gelebt hätte, zumal H. in dieser Zeit fast nur noch zum Schlafen im Haus gewesen sei. Als Begründung für die Verlängerung des Heimaufenthalts nennt O. seine Erfahrungen mit einer Bewohnerin, die ebenfalls an Trisomie 21 gelitten hatte und ins Nebengebäude umgezogen war. Diese Frau sei kurze Zeit nach ihrem Umzug krank geworden. O. hat diese Erfahrung auf H. übertragen. Er rekonstruiert die damalige Situation von H. dahingehend, dass H. innerhalb des Hauses alle Freiheiten gehabt habe. Er sei nicht eingeschränkt worden. Ein Auszug wäre somit nicht unbedingt mit einem Zugewinn an Freiheiten verbunden gewesen.
O. arbeitet seit 1999 in der Einrichtung. Die dramatische Wende von H. ordnet er in die Jahre 2002 bis 2004 ein. In dieser Zeit seien drei neue Bewohner eingezogen. Dies habe für H. zu einem "Bruch" geführt. H. hört aufmerksam zu und scheint Os. These durch seine rege Gesprächs-beteiligung zu bestätigen. H. ist schwer zu verstehen, mischt sich aber in die Diskussion mit ein. O. führt aus, dass H. damals oft in seiner Tür gestanden und das veränderte Umfeld beobachtet habe. H. sagt "Ja". H. und auch die anderen Bewohner seien seit dem Einzug der drei neuen Mitbewohner immer öfter zu Hause geblieben. Es habe ein Rückzug eingesetzt. Durch die Neuen sei das Haus unsicher geworden. Die neuen Bewohner hätten damals vieles zerstört, so dass die alten Bewohner ihr persönliches Lebensumfeld nicht mehr aus den Augen lassen wollten. Wie ich O. verstehe, sei ab diesem Zeitpunkt auch vieles an Teilhabemöglichkeiten in der Einrichtung verloren gegangen. O. nennt die Treppenhausreinigung, die seitdem professionell erbracht wird. H. habe sich mehr im Gemeinschaftsraum aufgehalten. Ich frage H., ob er sich den neuen Bewohnern damit angeschlossen habe. H. antwortet: "Ich doch nicht."
Zurück zur aktuellen Situation: Hs. Mutter hat als gesetzliche Betreuerin beim Amtsgericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt, um eine richterliche Unterbringung erwirken zu können. Ich gebe zu bedenken, dass nach der Ambulantisierung eine richterliche Unterbringung der ambulanten Struktur entgegen steht. O. erklärt, dass Hs. Mutter nach seinem epileptischen Anfall bereit gewesen sei, ihren Sohn wieder bei sich zu Hause zu betreuen. Er sei auch ein paar Tage dort gewesen. Die Mutter habe dann eingesehen, dass dies ihre Kräfte übersteige. Sie habe zu O. gesagt, sie könne sich auch vorstellen, gemeinsam mit H. auf einen Turm zu steigen und runter zu springen. O. erkennt die symbiotische Bindung der Mutter zu H. Da das zentrale Thema wohl Hs. Bedürfnis nach mehr Freiheit ist, überlegen wir uns folgende Vorhaben:
-
O. schlägt vor, dass H. morgens nicht mehr geweckt wird. Es ist seine Freiheit, solange schlafen zu können, wie er will.
-
H. soll während der Vormittagsbetreuung die Möglichkeit erhalten, wieder allein auf die Straße zu gehen. Die Betreuerin soll ihn aus der Distanz beobachten.
-
H. soll wieder zu einem Fußballspiel begleitet werden.
-
Gemeinsam mit den Bewohnern G. und K. eine Seniorengruppe besuchen
Rehistorisierende Ergebnisse: In unserem Gespräch ist übereinstimmend deutlich geworden, dass Hs. lebensgeschichtliche Wende in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts eingesetzt hat. In dieser Zeit hat sich H. von einem anfangs sehr selbstständigen Menschen zu einem "Pflegefall" entwickelt. Anders, als ich aufgrund der Aktenlage zunächst vermutet hatte, war der primäre Auslöser auf der sozialen Ebene weniger die Verlängerung der stationären Maßnahme im Jahr 2000, sondern der Einzug drei neuer Bewohner zwischen 2002 und 2004. Von daher war eine erste Hypothese nicht falsch, aber noch zu abstrakt: Die Verlängerung des Heimaufenthaltes wirkte sich vor allem deswegen einschränkend für H. aus, weil danach durch den Einzug neuer Bewohner das unmittelbare soziale Lebensumfeld radikal verändert wurde.
Den Einzug der drei neuen Bewohner muss H. als dramatischen Einschnitt in seine bis dahin als sichere Basis empfundene Wohnsphäre erlebt haben. Die drei neuen Bewohner neigten anfangs häufig zu Aggressionsausbrüchen, zerstörten Gegenstände und sorgten für große Unruhe im Haus. Die Betreuer reagierten sehr verunsichert. Es gab lange Zeit große Widerstände in der Belegschaft gegen die Neuaufnahmen. Das Team scheint damals überfordert gewesen zu sein. Die Leitung reagierte mit restriktiven Maßnahmen: Die zuvor von den Bewohnern selbst durchgeführte Treppen-hausreinigung wurde an professionelle Kräfte übergeben, die Lebensmittelversorgung zentralisiert. Aus der Sicht einiger Betreuer fand in dieser Zeit eine Reinstitutionalisierung der Einrichtung statt. Zur Sicherheit einer neuen Bewohnerin musste die Haustür abgeschlossen werden. H. konzentrierte sich in dieser Phase auf das Wohnheim. Er beobachtete das Umfeld seines Zimmers und bewachte seine Privatsphäre.
Wie aus den Berichten einiger Betreuer deutlich wird, banden die neuen Bewohner die meisten Betreuungskapazitäten, so dass die weniger hilfebedürftigen Bewohner leichter "vergessen" wurden. Der Zusammenbruch von Hs. sicherer Lebensbasis führte in der Folge schließlich dazu, dass er sein Explorationsverhalten einschränkte. Diese Reaktion wird oft bei Kleinkindern beobachtet, bei denen der sichere Rückhalt seitens der Eltern abhanden gekommen ist. H. zeigte diese neue Verunsicherung dadurch, indem er "sein Heim" nicht mehr aus den Augen ließ. Seine zunehmende Pflegebedürftigkeit passte zu dem hohen Hilfebedarf der neuen Bewohner. Bei meinen Beobachtungen konnte ich erfahren, dass das jeweilige Maß an persönlicher Zuwendung oft mit dem jeweiligen Hilfebedarf korrelierte. Einige Bewohner neigten dazu, mit Hilflosigkeit um die Zuwendung zu konkurrieren.
Seitens der Einrichtung schien diese soziale Dynamik in jener Zeit kaum verstanden zu werden - was auch innerhalb der Situation schwierig ist. In dieser konfliktreichen sozialen Phase richtete sich der Blick der Betreuer umso mehr auf die medizinische, biologische Seite von H. (wahrscheinlich auch der anderen Bewohner). Diese Reaktion ist verständlich in Zeiten der Unsicherheit, wo alles Soziale ins Wanken gerät, aber die Natur als feste Konstante erscheint.
Was im Gespräch auch zu erfahren war, ist ein Aspekt von Hs. Beziehung zur Mutter. Erschreckend empfand ich die berichtete Drohung der Mutter, evtl. gemeinsam mit H. von einem Turm springen zu wollen. Die Ernsthaftigkeit jener Drohung kann ich nicht beurteilen. Über das, was sich in dieser hochdramatischen Mutter-Kind-Beziehung ereignet haben mag, konnte ich nur wenig erfahren. Ich fühlte mich dennoch an dieser Stelle des Gesprächs zutiefst berührt und konnte ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich H. wohl in seiner Situation fühlen könnte.
R. wurde 1962 geboren. Ihre Mutter berichtet in einem Brief an die Einrichtung, dass Rs. Hände und Füße nach der Geburt blau verfärbt gewesen seien. Sie sei an Gelbsucht erkrankt und sehr unruhig gewesen. "Die Kinderärztin sagte uns, R. wäre anormal." Mit zweieinhalb Jahren konnte R. gehen, aber noch nicht sprechen. Sie besuchte einen Kindergarten für Behinderte, dann eine Sonderschule und kam mit 18 Jahren in ein Kinderheim. Seit ihrer Kindheit werden R. "dämpfende Medikamente" verabreicht. Sie leidet zudem an Übergewicht und an einer Herzschwäche. Letzteres führt dazu, dass sie diverse Medikamente zur Herz- und Kreislaufstabilisierung einnehmen muss.
1985, im Alter von 23 Jahren, zieht R. in ihre jetzige stationäre Wohneinrichtung ein. Aus den ersten Jahren ihres Aufenthaltes sind keine Unterlagen aufzufinden. Die älteste Aufzeichnung stammt aus dem Jahre 1992. Es ist ein Folgebericht an das Landesamt für Rehabilitation. Darin wird berichtet, dass R. in ihr Zimmer uriniere und Gefallen an ihren eigenen Gerüchen finde. Beim Essen verhalte sich R. "unsauber", ihr mangele es an "angemessenen Verhaltensweisen", wohingegen sie in Restaurants "durchaus sauber essen kann". Zu Küchendiensten kann R. dem Bericht zufolge "kaum herangezogen werden", weil sie ihre Arbeiten nicht selbständig erledigen könne.
Im Laufe des Jahres 1991 seien die neurologischen Medikamente abgesetzt worden, heißt es in dem Bericht. Daraufhin habe sie große Fortschritte in ihrer sprachlichen Entwicklung gemacht, komplette Sätze gesprochen und verstärkt ihren Willen geäußert.
Im Abstand von je zwei Wochen besucht R. ihre Eltern. Oftmals wolle sie aber bereits nach einem Tag wieder zurück ins Heim fahren. Dieses "nachlassende Interesse an den Eltern" wird im Bericht als Ursache dafür verstanden, dass R. nun nicht mehr alleine duschen und die Toilette besuchen kann. Sie benötige nun eine "ständige Aufsicht" dabei. R. lege Wert auf einen geregelten Tagesablauf. "Wird dieser gestört, reagiert sie mit lautem Schreien, körperlichen Drohgebärden und unruhigem Umherlaufen".
Im Folgebericht von 1996 wird konstatiert, dass R. seit Anfang 1993 wieder "beruhigende Medikamente" erhält. Der Grund: R. "verfiel in bestimmten Situationen regelmäßig in starke Erregungszustände." Sie schrie "aus vollen Kräften, fuchtelte mit den Armen." Trotz der neuen Medikamente habe R. sprachliche Fortschritte erzielt. Sie lerne immer wieder neue Wörter. Beim Toilettenbesuch sowie bei der Körperpflege benötigt R. weiterhin eine "Aufsicht". In der Zwischenzeit hat R. jedoch gelernt, "einfache Aufgaben im Küchendienst" auszuführen. Die Nahrungsaufnahme sei ein ganz wichtiges Thema für R. Sie esse alles, was herumsteht, und zwar schnell und hastig. "Wird sie daran gehindert, reagiert sie aggressiv." Bei ihrer Mutter zu Hause wird R. mit Süßigkeiten verwöhnt. Die Mutter greife oft störend in die Betreuung ein, indem sie Rs. Zimmer aufräume und für R. das Essen zerkleinere.
Auch im Entwicklungsbericht aus dem Jahr 2000 steht weiterhin "der Umgang mit Nahrung im Vordergrund." Ziel ist "eine Veränderung der zwanghaften Essgewohnheiten." R. soll nun wieder lernen, "dass sie sich Essen nehmen darf, um dem heimlichen Essen die Notwendigkeit zu nehmen." Ihr Übergewicht ist zu dem Zeitpunkt bereits soweit fortgeschritten, dass sich R. nicht mehr ihre Schuhe binden kann und sich immer weniger bewegt. Im Bereich der Sprache wird R. eine Erweiterung ihres Wortschatzes diagnostiziert. Erstmals fällt auf, dass sie über eine passive Sprachkompetenz verfügt und Informationen aus Gesprächen anderer gewinnen kann. Ihre Konzentrationsfähigkeit sei aber sehr gering.
R. zeigt noch immer "extreme Erregungszustände", besonders wenn sie morgens einige Minuten warten muss, bevor sie duschen darf. "Will man ihrem Schreien Einhalt gebieten, setzt sie seit kurzer Zeit auch ihre Körperkraft ein, um ihr Ziel zu erreichen." Dieses Verhalten wird als "zwanghafte Natur" interpretiert und habe zur Folge, dass R. immer weniger im Haus integriert sei. Wegen der Ablehnung seitens der Mitbewohner suche R. vermehrt Körperkontakt mit den Betreuern.
In den Jahren 2001 und 2002 nimmt R. an einem Förderangebot im Bereich Musik, Bewegung und Tanz teil. Die Kursleiterin berichtet, dass R. Lieder mit einer Rassel begleiten könne. R. erzähle viel von ihren Erlebnissen. Ihr gelinge es "im Ansatz" abzuwarten, bis sie an der Reihe sei und könne anderen aufmerksam zuhören. Außerdem mache sie beim Tanzen mit Phantasie mit.
Im ersten Individuellen Hilfeplan vom 30.09.2002 wird festgehalten, dass R. nicht in der Lage war, auf die Fragen während des Hilfeplangesprächs zu antworten. Die Schwerpunkte wurden dann rein aus Betreuersicht entwickelt. Gegenüber den vorangegangen Aufzeichnungen finden sich hierin kaum Veränderungen. Weiterhin wird Wert auf eine bessere Ernährung gelegt. Rs. Aktivitäten zur Körperpflege sollen von ihr nun verstärkt selbständig ausgeführt werden. Sie soll nun freien Zugang zu ihrem Kleiderschrank erhalten, sich mehr bewegen und Angebote zur individuellen Freizeitgestaltung erhalten. Zwei Jahre später im IHP vom 30.11.2004 heißt es einleitend, die Inhalte hätten sich zwischenzeitlich "nur geringfügig verändert." Es sei deutlich geworden, dass eine "regelmäßige Kontrolle der unterstützenden Maßnahmen" stattfinden müsse. Rs."Gefühlsausbrüche" hätten sich aber deutlich verringert. Die sprachliche Entwicklung habe durch eine therapeutische Maßnahme in der Werkstatt deutliche Fortschritte gezeigt. R. nimmt weiterhin freudig an allen Freizeitangeboten teil. Erstmals wird nun vermerkt, dass sich R. unaufgefordert bis zu dreimal am Tag dusche. Diese neue Selbständigkeit führe aber zu dem Problem, dass sie einen "unverhältnismäßig hohen Wäschebedarf" produziere. Abschließend beklagt die Betreuerin, dass es zwischen den Mitarbeitern zu wenig Austausch und Koordination bei der Umsetzung der Ziele gegeben habe. Der Anspruch im IHP kollidiere mit der Realität im Arbeitsalltag.
Im Entwicklungsbericht vom Mai 2003 wird das Thema Ernährung genauer reflektiert. Darin heißt es, bereits seit zwei Jahren werden Vorrats- und Kühlschränke nicht mehr abgeschlossen. R. esse aber dennoch nicht weniger, jedoch "immer häufiger in Ruhe". Sie könne abwarten, bis alle am Tisch sitzen. Quantitative Grenzen müssten ihr beim Essen immer noch aufgezeigt werden. R. befindet sich nun in neurologischer Behandlung. Die beruhigenden Medikamente seien in den vergangenen drei Jahren erheblich reduziert worden mit dem Effekt, dass R. nun wacher wirke und ihre "lautstarken Gefühlsäußerungen" reduziert habe. Innerhalb der Bewohnerschaft sei R. nun besser integriert.
Den Zeitpunkt des Duschens darf R. morgens nun selber bestimmen. "Sie wartet das Erscheinen des Frühdienstes ab und duscht dann mit Unterstützung. (...) Das Aussuchen der entsprechenden Bekleidung erfolgt immer selbständiger." Im Bereich der Mobilität sei nun ein "ausgiebiges Training" zur Verkehrssicherheit notwendig, wird weiter geplant. "Hier bestehen aber noch große Bedenken von Seiten der Mutter." Ihre Sprachkompetenz hat R. im Rahmen einer Sprachtherapie in der WfbM "deutlich verbessert". Kognitiv fehle ihr eine zeitliche Orientierung, so dass sie mehrere Aufgaben hintereinander nicht ausführen könne. In der "allgemeinen Zielvereinbarung" vom August 2004 steht: "Eine Sprachtherapie innerhalb der WfbM hat im letzten Jahr kleine Fortschritte gezeigt."
Im Hilfeplan von Anfang 2005 ist erstmals von einem geplanten Umzug ins Nebengebäude die Rede, der Ende 2005 stattfinden sollte. Darauf sollte R. vorbereitet werden. Ansonsten haben sich die Inhalte erneut "nur geringfügig verändert". Allerdings hat sich zwischen R. und ihren Mitbewohnern inzwischen ein "freundschaftliches Verhalten" entwickelt. R. zeige große Bereitschaft, "Alternativen in der Ernährung anzunehmen". Weiterhin soll ihre Sprachkompetenz gefördert werden. Ihr solle das Gefühl gegeben werden, "dass genug Essen vorhanden ist und sie essen darf (ggf. Obst und Gemüse)." Darüber hinaus wird geplant, dass R. lernen soll, gesunde Lebensmittel für sich einzukaufen. Dazu sollen Lebensmittel grafisch auf einem Einkaufszettel abgebildet werden. Im Vorratsraum soll sie dann allmählich lernen, ihre fettarme Margarine zu erkennen. Für die Hilfe beim Duschen wird ein detailliertes Handlungsprogramm zur Durchführung erstellt.
Die zuständige Bezugsbetreuerin reflektiert in einer undatierten Notiz mit der Überschrift "Neurocil-Absetzen" die Wirkungen des Medikaments auf Rs. Persönlichkeit. Sie stellt fest, dass die Klientin seit ca. 20 Jahren "einen großen Teil des Tages zu gedopt" verbringe und somit nicht oder nur kaum in der Lage sei, Selbsterfahrungs- und Lernprozesse durchzumachen. Aufgrund dieser Behandlung sei kaum noch zu unterscheiden, was "Teil ihrer geistigen Behinderung" sei und was durch Neurocil verursacht bzw. an Entwicklungen verhindert worden sei. Rs. extrem wechselnde Zustände zwischen geistiger Abwesenheit und heftiger Erregung erkennt die Betreuerin als Folge des Medikaments. Das Team habe Anfang 2001 ein Neuroleptika-Seminar besucht. "Es galt für uns abzuwägen und zu überlegen, ob es einen legitimen Grund gibt, R. Erfahrungen - auch mit sich selbst - vorzuenthalten und auch, ob wir eine u.U. lautere R. ertragen und tragen können." Im August 2004 erhält R. abends noch 7 Tropfen Neurocil.
Das in den Akten vorhandene einzige neurologische Gutachten ist vom 26.Januar 2005 datiert, obwohl berichtet wurde, dass sich R. bereits spätestens seit 2003 in einer entsprechenden Behandlung befand. Der untersuchende Arzt berichtet, dass er R. in ihrer Einrichtung besucht und sich ansonsten auf die Aktenlage gestützt habe. Ihm fällt zunächst auf, dass R. eine "ausreichend gepflegt auftretende, kleingewachsene, peradipöse" Patientin sei. Sie habe ihn geduzt und nur "sehr einsilbig" gesprochen. Mit Rs. Äußerungen weiß der Gutachter nichts anzufangen. Dennoch kommt er zu dem Befund: "Die Gedächtnisfunktionen, die Konzentration, Aufmerksamkeit und die Auffassung waren im Rahmen der Intelligenzminderung eingeschränkt bzw. reduziert." Es handele sich um eine "deutliche Debilität, für die als Ursache ein hypoxischer Hirnschaden infolge Blutgruppenunverträglichkeit bekannt ist."
Im Jahre 2006 erfolgt ein Wechsel der Bezugsbetreuerin. In diesem Jahr hat Markus Lauenroth sein neues Konzept für die Hilfeplanung erarbeitet, das um die Jahreswende zu 2007 auch für R. angewandt wird. Darin wird nun berichtet, dass R. in letzter Zeit tatsächlich mit Hilfe von Bildtafeln ihre Lebensmittel selbst eingekauft hat und für ihre Wohngruppe dafür zuständig war, regelmäßig den Kühlschrank aufzufüllen. Beim Thema Essen gesteht die neue Betreuerin ihre Ratlosigkeit offen ein. "R. wurde bisher häufig gesagt, wann sie genug gegessen hat. Vielleicht ist das der Grund, warum sie jede Gelegenheit nutzt, heimlich quasi selbstbestimmt zu essen. Mir fehlt bisher noch der Mut, sie einfach essen zu lassen, soviel sie will, da ich Angst hätte, dass sie noch mehr zunehmen würde... Ich bin an dieser Stelle jedoch ziemlich ratlos."
Der Bereich Freizeit gerät nun in den Mittelpunkt der Betrachtung, worin festgestellt wird, dass R. bereits an drei bis vier Tagen in der Woche an Veranstaltungen teilnimmt. "Sie möchte möglichst viel erleben." Künftig soll R. verstärkt selbst über ihre Freizeitgestaltung bestimmen können und nicht nur Angebote anderer annehmen. Einmal im Monat will die Betreuerin nun Ausflüge mit ihr unternehmen und ihr dabei die Verkehrsregeln näher bringen. Bislang habe R. nur unter Begleitung das Haus verlassen dürfen. Darüber hinaus soll nun der Umzug ins Nebengebäude, der nun im August 2007 stattfinden soll, vorbereitet werden. Erstmals wird in diesem Hilfeplan auch Rs. mögliches Interesse an Sexualität erwähnt. Denn R. beschäftigt sich ausgiebig mit männlichen Filmfiguren wie Ron, Shrek und Harry Potter. Auch stehen jetzt Interessen wie Fußball, Sport und Musik im Vordergrund der Reflexionen. Das Neurocil war zum Zeitpunkt meiner Besuche bereits abgesetzt worden.
Nach meiner Aktenauswertung fand ein gemeinsames Gespräch mit R., ihrer Bezugsbetreuerin und mir statt. Dies dauerte etwa eine Stunde. In diesem Gespräch versuchte die Betreuerin vor allem Rs. Wünsche für den Umzug ins Nebengebäude abzuklären. Dabei wurde die Anschaffung einer Reihe von Einrichtungsgegenständen beschlossen. R. äußerte selbst umfangreiche Wünsche. Für eine Diskussion über die Ergebnisse meiner Aktenauswertung blieb dabei wenig Zeit. R. äußerte deutliche Wünsche bezüglich ihrer Freizeitgestaltung. So forderte sie einen Besuch beim FC St. Pauli, weitere Kinobesuche, eine Reise nach Dänemark und den Kauf von Bilderbüchern und Videos.
Wir kamen gemeinsam zu dem Ergebnis, dass R. nun eine Förderung der Verkehrssicherheit angeboten werden müsse. Die Betreuerin plante zugleich eine Fahrt nach Lüneburg mit ihrer Klientin. Übergreifend war uns deutlich geworden, dass R. ein großes Interesse an Erlebnissen, an Unterhaltung, Kultur und Unternehmungen hat. Deutlich geworden war auch, dass uns R. außer über ganz konkrete Einzelinteressen hinaus nichts über ihre allgemeineren Lebensziele mitteilen konnte. Abstrakte Gedankengänge, die über konkrete sinnliche Gegenstände hinausgehen, konnten wir gemeinsam nicht entwickeln.
Im Gespräch haben wir das Thema Syndromanalyse ausgeklammert. Es erscheint ohnehin schwierig, ein grundlegendes Syndrom als Ausgangsbasis eines behinderten Lebens bei R. identifizieren zu können. Die Diagnose einer hypoxalen Hirnschädigung ist zu unbestimmt. Bekannt ist allgemein, dass durch eine Hypoxie Nekrosen entstehen und somit ganze Neuronengruppen verschwinden. In welchen Regionen bei R. Nekrosen entstanden sind, geht aus keiner Diagnose hervor. Wahrscheinlich ist, dass R. aufgrund des Neuronenverlustes nach ihrer Geburt kognitive Defekte erlitten hat. In der Folgezeit, so berichtete mir ihre Mutter, wurde R. vor den Nachbarn versteckt, weil sich die Eltern wegen ihr schämten. Rs. Leben spielte sich fortan nur noch in Sonderzonen ab. Vom Erbe unserer Kultur wurde sie isoliert (Vgl. Jantzen 1976, S.24) und stattdessen einer verregelten Welt der Sonderanstalten zugeführt.
Eine solche Biografie ist eine abweichende Biografie, übliche Lebenserfahrungen, Lernmöglichkeiten und Freiheiten fallen aus. Das Gehirn organisiert sich entsprechend seiner behinderten sozialen Umgebung, weitreichende Reflexionsfähigkeiten werden im Dialog mit den Betreuern nicht angeboten. Rs. intellektuell-sprachliche Leistungen bleiben auf vergleichsweise niederem Niveau. Welcher Anteil daran der anfänglichen Hypoxie zufällt und welcher der sozialen Isolation, lässt sich nach über 40 Jahren Behinderung kaum noch differenzieren. Im Sinne Jantzens lässt sich bei R. deutlich das Schließen eines Regelkreises rekonstruieren: Eine geschädigte biologische Struktur mit erhöhter Verletzbarkeit trifft auf eine feindselige soziale Umwelt, die umso verletzender auf sie einwirkt. Durch das Ausbleiben eines "freundlichen Begleiters", durch den primäre Defekte auf sekundärer und tertiärer Ebene kompensiert werden könnten, entwickelt sich eine bio-psycho-soziale Lebensstruktur der Behinderung (Vgl. Teil B, Kap. 1.4.2). Trotz dieser weitgehenden Einschränkungen der intellektuellen Entwicklungsmöglichkeiten hat R. bei unseren evaluierenden Projekten große Fähigkeiten, Neues zu erlernen, bewiesen. Bei R. findet Vygotskijs Theorem, wonach die niederen Funktionen am besten über den Umweg über die jeweils höheren psychischen Funktion entwickelt werden können, seine Bestätigung (vgl. Vygotskij 2001a, S. 131): R. zeigt ihre größte Lernfähigkeit, wenn der konkret-operationale Lernschritt in ein übergreifendes Handlungsziel eingebettet ist. Das Detail erlernt R. nur auf dem erkennbaren Wege zum Ziel. Wenn R. zur Malgruppe fahren will, kennt sie schon nach drei Begleitungen den Weg.
Da R. durchweg ein großes Interesse an Ausflügen und Erlebnissen äußert, erscheint das Vorhaben, Rs. Verkehrssicherheit zu fördern, als passend. Denn mit einer verbesserten Verkehrssicherheit könnten sich für R. ganz neue Möglichkeiten der sozialen Teilhabe eröffnen, die ihr Freude bereiten würden. Die pädagogische Kunst besteht dann allerdings darin, die Techniken des Verkehrsverhaltens vom höheren Ziel aus zu vermitteln.
Meine Ausgangsbedingungen für die Anwendung der rehistorisierenden Diagnostik in der Wohneinrichtung waren durch zwei wesentliche Einschränkungen geprägt: Erstens waren die Akten der Bewohner nur sehr unvollständig auffindbar. In der Einrichtung gab es keine systematische Dokumentation. Die Unterlagen der Bewohner wurden verstreut an verschiedenen Orten aufbewahrt. Differenzierte Diagnosen gab es kaum. Sie umfassten meist nicht mehr als drei Sätze und begnügten sich mit der Nennung bekannter Syndrombegriffe. Bei Klienten mit hirnorganischen Schädigungen wurden diese durchweg nie spezifiziert.
Das zweite grundsätzliche Problem war die Organisation der Arbeitszeit in der Einrichtung. Die Betreuer hatten für Hintergrundgespräche dieser Art nur selten Zeit. Ihr Dienstplan sah im Wesentlichen die Durchführung der Basisdienste im Schichtbetrieb vor. Hintergrundgespräche wie diese konnten dann am ehesten vormittags eingeschoben werden, wenn die meisten Bewohner in der Werkstatt arbeiteten. So kam es, dass die Bewohner bei solchen Gesprächen oft gar nicht dabei sein konnten. Insgesamt habe ich bei und mit sechs Bewohnern Ansätze einer rehistorisierenden Diagnostik durchgeführt. Bei drei Bewohnern kam nach meiner Aktenauswertung, die ich schriftlich verfasst und den zuständigen Bezugsbetreuern übermittelt habe, kein Gespräch zustande.
Bei einem Bewohner konnten nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem Klienten und seiner Bezugsbetreuerin ein paar wesentliche Erkenntnisse gewonnen und für die Hilfeplanung operationalisiert werden. Nur bei einem Bewohner fand eine größere Betreuungskonferenz, aber erst sechs Monate nach unserer Aktenauswertung statt, bei der neben einer Reihe beteiligter Pädagogen auch Angehörige des Klienten und dieser selbst beteiligt waren. Bei einer Bewohnerin fand im Anschluss an die Auswertung der biografischen Unterlagen ein gemeinsames Gespräch mit ihr, dem Bezugsbetreuer und mir im Rahmen eines Spazierganges statt.
Insgesamt ist mir aufgefallen, dass nur wenige Betreuer ein Interesse an der rehistorisierenden Diagnostik zeigten. Mein Konzept hatte ich allen Mitarbeitern per Email zugesandt. An einem Workshop oder einer ausführlichen Diskussionen darüber bestand in der Einrichtung kein Interesse. In den Fällen, in denen rehistorisierende Beratungen mit dem Klienten und seinem Bezugsbetreuer zustande gekommen waren, musste ich nachher feststellen, dass die erarbeiteten Schritte für die künftige Betreuungsarbeit kaum oder gar nicht umgesetzt worden sind. Dies lag nach meiner Beobachtung vor allem daran, dass die alltägliche Arbeit mit den Bewohnern überwiegend von anderen Mitarbeitern als dem beteiligten Bezugsbetreuer geleistet wurde, diese aber nichts oder kaum etwas von den Ergebnissen der Rehistorisierung erfahren haben, obwohl sie schriftlich in der Einrichtung vorlagen. Zusammenfassend kann ich festhalten, dass meine diesbezüglichen Versuche kaum eine verändernde Auswirkung auf die reale Praxis zeitigen konnten. Für mein Forschungsinteresse konnte ich durchaus "theoretisch" wertvolle Erkenntnisse erzielen. Deren Umsetzung zur Verbesserung der Betreuungsqualität scheiterte nach meiner Auffassung aber an der vorgegebenen Arbeitsorganisation, die eine ausreichende Orientierung auf das Individuum kaum ermöglichte, sondern primär auf den Tagesablauf der Gesamtgruppe ausgerichtet war.
Ausgehend von diesen Erfahrungen stelle ich fest, dass die von Jantzen angebotene Verfahrensweise sich zumindest für dieses Anwendungsfeld als unzureichend erweist. Das von Jantzen beab-sichtigte Ziel, den Klienten im Feld der Macht ein Stück weit mehr vom Pol der Ohnmacht hin zum Pol der Macht zu verhelfen, seine Emanzipation zu unterstützen und ihn wieder ansatzweise zum Subjekt seines eigenen Lebens werden zu lassen, ist mir kaum gelungen. Dies, obwohl ich bei meinen Versuchen zu aufschlussreichen Erkenntnissen und auch hilfreich erscheinenden pädagogischen Ansätzen gelangen konnte. Die soziale Wirklichkeit in der Einrichtung stand einer praktischen Umsetzung jedoch entgegen. Der materialistische Ansatz, welcher der rehistori-sierenden Diagnostik zugrunde liegt, verpflichtet mich allerdings auf gerade diesen Aspekt, auf die praktische Relevanz im wirklichen Leben der Menschen. An diesem Kriterium müssen sich die Ergebnisse meiner Theorie messen lassen, wie dies bereits Marx in seinen Thesen über Feuerbach konstatierte: "Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit i.e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen." (Marx 1981b, S.27) Es kommt darauf an, die Welt der Klienten gemeinsam mit ihnen zu verändern, sie aber nicht nur anders zu interpretieren.
Rehistorisierende Diagnostik fand bei mir innerhalb des sozialen Feldes der Institution statt, in der die Klienten leben und ihre Behinderungen täglich aufs Neue reproduzieren. Die Institution selber ist Teil des Systems Behinderung, selbst wenn sie das Ziel verfolgen sollte, Behinderungen zu überwinden. Behinderung selber aber ist immer ein sozialer Begriff, der auf das Verhältnis zwischen behindertem Individuum und behindernder Gesellschaft verweist. Aus diesem Grund muss eine rehistorisierende Diagnostik auch immer die an der Behinderung beteiligten sozialen Felder mit einbeziehen und auch den Anbieter jener Methoden selber. Eine Verengung der Rehistorisierung auf den Fokus des Klienten blendet genau jene Bedingungen aus, die der Realisierung einer rehistorisierenden Diagnostik im Wege stehen und führt zur Kapitulation vor den verfestigten Strukturen der Behinderung. Genau jene gilt es aber zu durchbrechen. Gedanke und Wirklichkeit müssen sich wechselseitig durchdringen, verwirklichen und aufheben, wie es Marx in seiner "Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie" erkannt hat: "Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie." (Marx 1981c, S.26) Auch die Theorie der rehistorisierenden Diagnostik kann nicht verwirklicht werden ohne die Aufhebung der Behinderung und die Behinderung nicht aufgehoben werden ohne die Verwirklichung der rehistorisierenden Diagnostik.
Wie Jantzen dazu bereits passend angedeutet hat, ist die rehistorisierende Diagnostik "eine Diagnose der relationalen Beziehungen in jenem Handlungsfeld (...), in dem wir uns selbst als Subjekt und Objekt befinden." (Jantzen 2005, S.157) Darauf aufbauend muss eine rehistorisierende Diagnostik zunächst in der abstrakt fassbaren sozialen Gegenwart des Klienten beginnen, in seine individuell-soziale Geschichte aufsteigen und von dieser Grundlage aus die historisch gewordene konkrete soziale Lebenssituation des Klienten verstehen. Der Schwerpunkt liegt an dieser Stelle bei der ersten Stufe, der sozialen Gegenwart des Klienten. Diese ist Voraussetzung dafür, um die weiteren beiden Stufen überhaupt erreichen zu können. Grundvoraussetzung für eine rehistorisierende Diagnostik ist also zunächst immer eine Analyse der sozialen Strukturen, in denen der jeweilige Klient lebt. Die Fragen, zu denen zunächst zumindest erste Arbeitshypothesen aufgrund von Beobachtungen, Gesprächen und Auswertung von Dokumenten gebildet werden müssen, sind folgende:
-
Wer im aktuellen Handlungsfeld hat möglicherweise ein Interesse an einer rehistorisierende Diagnostik und welches?
-
Was sind die wirklichen grundlegenden Ziele der Einrichtung, in der der Klient lebt? Diese können durchaus ganz andere sein, als die, die in den offiziellen Präsentationen der Institution benannt werden.
-
Wer im sozialen Feld des aktuellen Handelns hat welches Interesse bezüglich des Klienten und wie sind die sozialen Kräfteverhältnisse verteilt?
-
Welches Interesse hat der Anbieter der rehistorisierende Diagnostik selber an dieser? Welche realen Möglichkeiten, welche Realisierungsmittel stehen ihm zur Verfügung?
-
Gibt es mögliche Verbündete im sozialen Feld?
Einrichtungen, in denen von vornherein Möglichkeiten zur Durchführung und Umsetzung der rehistorisierende Diagnostik angeboten werden, in denen dafür Zeit zur Verfügung steht und die Bereitschaft zu Veränderungen zeigen, dürften ohnehin zu den Ausnahmen gehören. Relevant werden meine Fragestellungen vor allem dort, wo zunächst Widerstände gegen eine rehistorisierende Diagnostik, gegen Veränderungen erkennbar werden, wo Vorbehalte und Ängste bezüglich einer größeren Selbstbestimmung der Bewohner geäußert werden.
Anstatt mit der rehistorisierenden Diagnostik einzelner Klienten zu beginnen, muss dort eine Rehistorisierung der Institution selber vorangestellt werden, um gemeinsam mit einer möglichst großen Vielzahl an Beteiligten (Betreuer, Bewohner, Angehörige, Leitung...) zu verstehen, wie die Einrichtung zu dem geworden ist, wie sie gegenwärtig ist. Wie ist sie geworden, welche Strukturen bestimmen das aktuelle Leben und welche Kräfte wirken in welche Richtung möglicher Veränderungen? Daraus ergibt sich die Frage für jeden selber, welche Möglichkeiten habe ich, um verändernd zu handeln? Welche Möglichkeiten hat der Berater, Forscher oder wissenschaftliche Begleiter selber? Er muss sich darüber klar werden, mit welchem Interesse er seine Arbeit begonnen hat. Will er verändernd einwirken, so muss er sich ggf. die Frage stellen, ob dies nur innerhalb der Einrichtung möglich ist oder ob dies ein gesamtpolitisches Problem betrifft, das auch in Zusammenarbeit mit Verbänden, Parteien und der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte.
Diese Fragen werden nicht nur dann relevant, wenn es um die rehistorisierende Diagnostik geht, sondern um das Problem der Lebens- und Betreuungsqualität überhaupt. Ich habe mich für die rehistorisierende Diagnostik als einen Stützpfeiler zur Qualitätsentwicklung entschieden, aber auch das von Lauenroth entwickelte Konzept zur Hilfeplanung, meine Evaluation und Beratungen zur Ambulantisierung gehören zum Angebot meiner Qualitätsentwicklung dazu. Dies alles sind letztendlich Versuche, Behinderungen abzubauen, neue Möglichkeitsräume und Entwicklungsfelder zu öffnen. Behindertenpädagogik ist insofern immer politische Praxis, da sie in das Kräfteverhältnis von Ausschluss und Teilhabe stets eingreift, es entweder stabilisiert oder verändert. Die behindernden Kräfte, die historisch geworden in einer Einrichtung wirken, stehen schließlich nicht isoliert auf der Insel einer Institution. Die Institution selber erfüllt einen politischen Auftrag in einem politisch-administrativen Rahmen. Was in der einzelnen Einrichtung geschieht, ist immer zugleich ein Spiegel der allgemein-politischen Lebensbedingungen der geistig behinderten Minderheit in einer Gesellschaft. Rehistorisierende Diagnostik kommt letztlich nicht umhin, die Geschichte der Behinderung im Allgemeinen zu rekonstruieren und die konkreten Strukturen der sozialen Ausgrenzung gesamtgesellschaftlich zu analysieren und zu kritisieren.
"Ich betrachte die Geschichte der Behinderung und der Behindertenpädagogik als Teil einer Geschichte von Klassenkämpfen" (Jantzen 1992, S.46), konstatiert Jantzen ganz in diesem Sinne. Bevor er mit seiner rehistorisierenden Diagnostik in der Einrichtung Lilienthal bei Bremen beginnen konnte, hatte Jantzen bereits eine politische Vorarbeit geleistet. Er hatte die Angehörigen der Insassen in ihrem Kampf für bessere Lebensbedingungen in der Anstalt unterstützt und seinen Protest in die Öffentlichkeit getragen, bis sich endlich die Evangelische Kirche als Träger der Einrichtung gezwungen sah, die Anstaltsleitung abzusetzen und den Weg für Reformen frei zu machen. Auch dies ist nach meiner Auffassung Bestandteil einer rehistorisierenden Diagnostik: sie ist immer ein politischer Akt im "Klassenkampf"[14].
Wie ich bereits ausgeführt habe, sind die Voraussetzungen für eine rehistorisierende Diagnostik oftmals nur sehr eingeschränkt gegeben, dies nicht nur in der Einrichtung meiner Forschung, sondern auch in vielen anderen. In praktischer Hinsicht halte ich aufgrund meiner Erfahrungen auch alternative, niederschwellige Methoden für ausreichend, um dem Klienten neue und passende Verhaltensalternativen, mehr Teilhabemöglichkeiten und Selbstbestimmung ermöglichen zu können. Eine ausführliche rehistorisiende Diagnostik, wie sie Jantzen entwickelt hat, ist von ihrer Möglichkeit zur Verständnistiefe her zwar keineswegs verzichtbar, dennoch habe ich erfahren, dass ich mich auch mit einfacheren Ansätzen zufrieden geben musste, die allerdings durchaus zu ähnlichen pädagogischen Erfolgen führen konnten.
Für besonders wichtig erachte ich das Passungsverhältnis zwischen Methode und Milieu. Mit letzterem meine ich die geistigen und lebenspraktischen Strukturen, Deutungsmuster und Traditionen in der jeweiligen Einrichtung. Eine Methode kann nämlich nur dann wirksam werden, sofern sie von den Menschen angenommen wird. Deshalb können minimale Schritte oftmals wirkungsvoller sein als anspruchsvolle Ansätze. Voraussetzung ist aber stets eine teilnehmende Beobachtung und eine Analyse der Strukturen, um die Zusammenhänge im Alltag der Einrichtung von innen heraus verstehen zu können.
Möglichkeitsräume eröffnen: Die praktischen Resultate meiner rehistorisierenden Versuche mündeten vor allem in das Ergebnis, dem betreffenden Bewohner neue Bereiche zu öffnen, Verregelungen zu entregeln und neue Handlungs- sowie Erfahrungsräume anzubieten. Eine tiefgehende rehistorisierende Betrachtung wäre mitunter nicht notwendig gewesen, um zu dem gleichen Resultat zu gelangen.
Neue Entwicklungsprozesse können erfahrungsgemäß ermöglicht werden, wenn die Restriktionen, so fürsorglich sie auch gemeint sein können, die einen Klienten in seinem Alltagsleben umgeben, einzeln auf den Prüfstand gestellt und selektiv geöffnet werden. In dieser wie in vielen anderen Wohneinrichtungen gehörten tradierte Restriktionen zum Alltag. Diese zahlreichen behütenden Einschränkungen behindern geistige Entwicklungen und begünstigen die erworbene Hilflosigkeit. Die Praktiker vor Ort sind oftmals schwer davon zu überzeugen, dass weniger tätige Hilfe durchaus mehr pädagogische Hilfe bedeuten kann. Die Sorge, dass etwas passieren oder etwas misslingen könne, überwiegt meist den Mut zur Entwicklung.
Solche angstbesetzten Regelwerke können am ehesten gelockert werden, indem die Leitung Dienstzeiten kürzt, weniger Personal für den Basisdienst, aber mehr für die individuelle Betreuung einteilt, den Mitarbeitern neue Aufgaben stellt, die mehr Verantwortung, Herausforderung und Befriedigung versprechen als die Erfüllung alter Routinen. Dies bedeutet noch lange nicht Personalabbau, wohl aber eine qualitative Überprüfung des Personaleinsatzes.
Durch eine Verlagerung der Betreuungsaufgaben und eine planmäßige Verknappung der Arbeitszeiten für Routinearbeiten ist es durchaus möglich, seitens der Leitung den Klienten neue Möglichkeitsräume zu öffnen. Effektiver ist dies jedoch, wenn auch die Betreuer davon überzeugt werden können und dahinter stehen. Wenn beispielsweise der Basisdienst nur noch einfach statt doppelt besetzt wird, so konnte ich in einer anderen Einrichtung erleben, erledigen Bewohner einen Besuch beim Zahnarzt oder bei der Meldebehörde plötzlich selbständig, wo zuvor stets eine Begleitung notwendig erschienen war. Ein Bewohner schneidet einer Bewohnerin die Pizza, was sonst ein Betreuer stellvertretend ausgeführt hätte.
In diesem Zusammenhang halte ich die "pädagogische Lücke" für eines der wertvollsten Instrumente in der Behindertenarbeit. Sie besagt, dass der Betreuer durch seine partielle Abwesenheit latente Fähigkeiten erfahrbar machen und aktivieren kann. Durch die Abwesenheit erhalten die Klienten oftmals erst die Möglichkeit, Situationen, die bislang nur mit fremder Hilfe bewältigt worden sind, selbständig zu bewältigen. Diese Erlebnisse stärken das Selbstwertgefühl, ermöglichen die Erfahrung von neuen Fähigkeiten und fördern die geistige sowie motorische Entwicklung der Klienten.
Individuelle Betreuung und Dialoge: Jantzens Konzept der rehistorisierenden Diagnostik ist im Kontext einer Großeinrichtung entstanden, wo im Wesentlichen die Verwaltung des Gesamtablaufs im Vordergrund der betreuerischen Arbeit stand. Das einzelne Individuum findet in Einrichtungen dieser Art kaum Gehör. Die rehistorisierende Diagnostik konnte hierzu einen notwendigen Gegenimpuls ins Feld führen: das ausführliche Studium der einzelnen, konkreten Biografien.
Regelmäßige individuelle Betreuungseinheiten können unter Umständen ebenso hilfreich sein, auch wenn Jantzens Methoden nicht umfassend zur Anwendung kommen. Sofern ein fester Bezugsbetreuer sich regelmäßig Zeit nimmt, um mit seinem Klienten zu sprechen, gemeinsam zu handeln und zu erleben, kann die Komplexität der betreffenden Persönlichkeit wie ein Bilderbuch erfahrbar werden. Symptome werden besser in ihrem Kontext verständlich und erhalten subjektiven Sinn. Daraus können neue Angebote und Freiräume abgeleitet und neue Entwicklungen gefördert werden. In der Einrichtung konnte ich dies bei dem Bewohner J. beobachten: Die intensive persönliche Betreuung durch den Pädagogen V. führte bereits nach einem Jahr dazu, dass der Klient trotz reduzierter Medikation deutlich seltener aggressiv wurde. Ihm gelang es, sich besser mit anderen Menschen nonverbal zu verständigen und sich außerhalb der Einrichtung selbstsicher zu bewegen. Bei anderen Klienten, bei denen keine oder nur sehr wenig individuelle Betreuung stattfand, konnte ich kaum neue Entwicklungsschritte beobachten.
Zu fragen ist auf diesem Hintergrund, ob das volle Konzept der rehistorisierenden Diagnostik vielmehr historisch in die präambulante Zeit gehört und durch den Ausbau ambulanter Strukturen und Methoden möglicherweise an praktischer Bedeutung verliert, gleichwohl ich den theoretischen Erkenntnisreichtum, der sich dadurch erschließen lässt, sehr hoch einschätze. Oder anders: Wenn die Bewohner umfangreich individuell betreut werden, könnte eventuell der Aufwand einer rehistorisierenden Diagnostik überflüssig werden, um dennoch zu den gleichen praktischen Veränderungen zu gelangen.
Im Folgenden fasse ich den Zwischenbericht zur Evaluation zusammen, der am 30.09.2007 dem Auftraggeber überreicht worden ist. Grundlage sind die Ergebnisse meiner Teilnehmenden Beobachtung sowie Erfahrungen aus meinen intervenierenden Projekten. Als wesentliche Bereiche, die von den Bewohnern thematisiert worden sind, habe ich folgende zu sinnvollen Einheiten zusammengefasst:
-
Ambulantisierung
-
Selbstbestimmung
-
Mobilität und Lage der Einrichtung
-
Kommunikation
-
Beschäftigung im Haus
-
Gesundheit
-
Geld
-
Persönliche Betreuung
Diese Bereiche überschneiden sich weitgehend mit denen der "AG Ambulantisierung" (Arbeitsgruppe der Träger, Verbände und Sozialbehörde der Stadt Hamburg). Einige Aspekte der vorgegebenen Kategorien (s. Kap.1.2) gerieten bei meinen Schwerpunkten aus dem Blick. Wegen dieser Differenzen habe ich im Anschluss an meine Auswertungsbereiche die Vorgaben der "AG Ambulantisierung" zusätzlich bearbeitet. Sie stellen zugleich eine Ergänzung meiner Kategorien dar. Die beiden Kategorien "Ambulantisierung" und "Selbstbestimmung" habe ich vorangestellt, weil ihnen ein übergeordneter Stellenwert zukommt und sie in den nachfolgenden Bereichen stets mit enthalten sind.
a) Ambulantisierung: Die Ambulantisierung gliederte sich in vier Phasen: Erstens, die Vorbereitung. In ihr wurden die Betreuungspraxen innerhalb der stationären Einrichtung kritisch reflektiert und langsam nach ambulanten Mustern hin verändert. Die zweite Phase sollte der Umzug ins Nebengebäude sein. Die dritte Phase: rechtliche Umwandlung der stationären Wohnplätze in ambulant betreute Wohngemeinschaften. Dies sollte sechs Monate nach dem Umzug geschehen. Als vierte Phase betrachtete ich die inhaltliche Weiterentwicklung der Betreuungspraxis im Rahmen der veränderten institutionellen Bedingungen.
Die Vorbereitungen zur Ambulantisierung habe ich seit Mitte 2006 begleitet. Bis September 2007 haben in der Einrichtung drei Team-Tage stattgefunden. Darüber hinaus hatten sich in der ersten Jahreshälfte 2007 mehrere Kleingruppen aus dem Team gebildet, die in unregelmäßigen Treffen die Hilfeplanungen auf die Herausforderungen der Ambulantisierung hin weiterentwickelt haben. Im Team war die Haltung gegenüber der geplanten Ambulantisierung ambivalent: Grundsätzlich wurde das Vorhaben begrüßt, dennoch gab es eine Reihe kritischer Stimmen, die eine höhere Arbeitsbelastung und den Verlust von Stellen befürchteten. Auch waren einige Betreuer der Auffassung, dass viele Bewohner für eine Ambulantisierung noch nicht weit genug entwickelt seien.
Bei meinen evaluierenden Dialogen mit den Bewohnern war deutlich geworden, dass sie sich im Vorfeld sehr für die Ambulantisierung interessierten. Sie brachten mir ihre Neugierde und auch Ungeduld zum Ausdruck. Die meisten Bewohner freuten sich auf den Umzug. Eine Bewohnerin zumindest äußerte Bedenken. Sie mochte gern ihre alte Wohnform weiter behalten, hat dann aber schließlich den Umzug akzeptiert.
Die Einrichtung hatte die Bewohner schon seit langem in die Vorbereitungen der Umgestaltung mit einbezogen. Bei der Verteilung der künftigen Wohnungen bzw. Zimmer konnten die Bewohner mitbestimmen. Die Bewohner hatten darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, ihre künftigen Wohnungen zu besichtigen. Auch bei der Gestaltung der Räume konnten die Bewohner ihre Wünsche einbringen. In persönlichen Gesprächen haben Bewohner gemeinsam mit den Pädagogen alle notwendigen Vorbereitungen besprochen und geplant. Durch die vorgezogene Ambulantisierung bezüglich eines Bewohners, der bereits Ende Juli 2007 in ein ambulant betreutes Wohnverhältnis gewechselt ist, haben viele Bewohner eine erfahrbare Vorstellung dafür entwickeln können, was der Begriff Ambulantisierung bedeuten könnte. Diese Erfahrung hat den Druck der Bewohner auf die Einrichtung nach meiner Wahrnehmung erhöht, die Planungen schneller umzusetzen.
Inhaltlich waren die Bewohner mit der geplanten Umgestaltung zufrieden. Nach meiner Auffassung verfügte die Einrichtung durchaus über noch weiteres Potenzial, mit dem diese Zufriedenheit künftig gesteigert werden könnte. So bot sich an, die Auswahl der Wohnkonstellationen zu erweitern. Neben Wohngemeinschaften wären auch Einzel- und Zweierwohnungen denkbar gewesen, die sich allerdings keineswegs alle im gleichen Gebäude hätten befinden müssen. Die Entwicklung von dezentralen, kleineren Außenwohngruppen in der näheren Umgebung habe ich als eine Möglichkeit zur Diversifizierung der Wohnformen und zur Förderung von Selbständigkeit sowie sozialer Integration der Bewohner empfohlen.
b) Selbstbestimmung: Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung hatte sich bei den meisten Bewohnern als ein zentrales Anliegen erwiesen. Dies war bei meiner Analyse der vorhandenen Dokumente offenbar geworden. Damit konnte ich mehrfach rekonstruieren, wie Bewohner unter eingeschränkten Handlungsbedingungen zu verstärkten Symptomen und herausforderndem Verhalten tendierten. Wurden dann später jenen Bewohnern erweiterte Handlungsmöglichkeiten eingeräumt, so ließen diese Symptome nach. Drei Bewohner haben mir im direkten Gespräch ihr Bedürfnis nach größeren Handlungsfreiheiten im Alltag mitgeteilt. Ihre Wünsche diskutierten wir gemeinsam mit den zuständigen Bezugsbetreuern, worauf die individuelle Hilfeplanung dementsprechend modifiziert werden konnte. Bei zwei dieser Klienten konnte ich schon kurze Zeit nach der Umsetzung dieser veränderten Hilfepläne deutliche Entwicklungserfolge beobachten. Der dritte Bewohner, der ohnehin bereits sehr autonom lebte, äußerte sich auf meine Nachfrage hin als sehr zufrieden.
Bei einem dieser Bewohner ging es darum, dass die Betreuer ihn nur mit großer Mühe dazu motivieren konnten, regelmäßig sein Zimmer zu reinigen und aufzuräumen. Aus anderen Beobachtungen war deutlich geworden, dass der Klient, soweit man ihn autonom handeln lies, sich sehr konstruktiv und zielgerichtet verhielt. Nach der neuen Hilfeplanung zogen sich die Betreuer dann aus der direkten Anleitung und Kontrolle des Zimmers zurück. Daraufhin gelang es dem Bewohner, aus eigener Motivation sein Zimmer sauber und überschaubar zu halten. Ein anderer Bewohner hatte sich beschwert, weil sich eine Betreuerin mehr, als ihm lieb war, in die zeitliche Planung seiner außerhäuslichen Aktivitäten eingemischt hatte. Diese Kritik teilte ich dem Team mit. Beim nächsten Gespräch mit diesem Bewohner erfuhr ich, dass diese Einmischungen eingestellt worden waren.
Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung wurde auch bei meiner Begleitung von Bewohnern zur offenen Malgruppe der "Schlumper" deutlich. Die dadurch angebotenen zusätzlichen Autonomieräume führten dazu, dass die beteiligten Bewohner ihre sozialen und kognitiven Kompetenzen erweitern konnten. Eine Bewohnerin, die nicht sprechen konnte, brachte ihren Wunsch nach Selbstbestimmung durch ihre ausgelassene Freude zum Ausdruck, wenn sie beim begleiteten Spaziergang einige hundert Meter weit ohne Aufsicht gehen konnte. Bei direkten Aufforderungen, die mit Zeitdruck verbunden waren, reagierte sie mit Verweigerung. Sobald sich der Betreuer auf eine zurückhaltende bzw. indirekte Anleitung zurückzog, war die Bewohnerin wieder bereit zu kooperieren.
Das Thema Selbstbestimmung wurde in den aktuellen Hilfeplänen fast durchweg als Anliegen der Bewohner reflektiert. Es bezog sich auf äußerst verschiedene Handlungsfelder. Bei einigen Bewohnern stand eine Erweiterung der Autonomie in der alltäglichen Lebensführung im Vordergrund, so z.B. bei der Körperpflege, der Kleidungsauswahl, dem An- und Ausziehen - bei anderen Bewohnern ging es um die Mobilität, Haushaltsführung, Geld und Konsum.
Auf Seiten der Einrichtung konnte ich aufgrund von Gesprächen mit Betreuern seit einigen Jahren eine deutliche Orientierung zur verstärkten Förderung der Selbstbestimmung feststellen. Bei einer langjährigen Bewohnerin, die zuvor als "besonders schwierig" galt, wurde das Medikament Neurocil abgesetzt. In der Folge konnte sich die Klientin in ihren lebenspraktischen Fähigkeiten soweit entwickeln, dass sie zumindest im Sommer 2007 zu den "fittesten" Bewohnern zählte. Noch deutlicher wurde die auf Selbstbestimmung orientierte Betreuung am Beispiel einer Bewohnerin, die seit 2003 in der Einrichtung lebte und an sehr einschränkender geistiger Behinderung litt. In der Einrichtung, in der diese junge Frau zuvor untergebracht war, wurde sie mit Psychopharmaka ruhiggestellt, nachts in ihr Zimmer eingeschlossen und auch tagsüber in ihrem Bewegungsradius deutlich eingeschränkt. Nach dem Umzug in die neue Einrichtung erlangte die Klientin ganz neue Freiheiten. Die Medikamente wurden abgesetzt und der nächtliche Einschluss aufgehoben. Die Bewohnerin konnte sich innerhalb des Grundstückes frei bewegen.
Beispielhaft gelang bei einem an Epilepsie leidenden Bewohner, die Einnahme der Medikamente ganz in seine eigene Zuständigkeit zu übertragen. Schritte dieser Art stärkten das Selbstwertgefühl und die Zufriedenheit der betreffenden Bewohner deutlich. Bei den wöchentlichen Gruppentagen einzelner Bewohnergruppen wurden Organisation und Ausführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten geübt.
Aus meiner Sicht fanden in der Einrichtung Veränderungen statt, die auf eine Reautonomisierung der Lebenspraxis der Bewohner gerichtet waren. Verbesserungspotenziale hierzu wurden von einzelnen Betreuern genannt: So plädierten einige Pädagogen dafür, den Bewohnern mehr zu zutrauen, ihnen noch mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten entgegen zu bringen und dafür gegebenenfalls mehr Risiken zu wagen. Gelegentlich wurde ein noch zu großer und versorgender "Service" in hauswirtschaftlichen Angelegenheiten beklagt, der reduziert werden könnte. Diesbezüglich fanden immer wieder Diskussionen im Team statt.
c) Mobilität und Lage der Einrichtung: Als ein generatives Thema haben sich "Mobilität und Lage der Einrichtung" erwiesen. Bewohner, die sich verbal differenziert mitteilen konnten, äußerten ihr Bedürfnis nach Einkaufsmöglichkeiten in zu Fuß erreichbarer Nähe. Auch das Interesse an Fahrten mit der U-Bahn wurde häufig genannt. Viele Bewohner interessierten sich für die "Welt draußen". Sie berichteten von Freizeitfahrten und baten um weitere Ausflüge. Bewohner, die nicht sprechen konnten, äußerten sich in der Regel durch ihr nonverbales Verhalten zufrieden, wenn sie Möglichkeiten zur Mobilität nutzen konnten. Umgekehrt führten mangelnde Bewegungsmöglichkeiten häufig zu Unzufriedenheitsbekundungen.
Die Einrichtung befand sich in einem reinen Wohngebiet, das durch Villen mit großen Grundstücken geprägt war. Die nächste U-Bahnstation war ca. 1,5 km von der Einrichtung entfernt. Die U-Bahn fuhr im Rhythmus von 20 Minuten in Richtung Innenstadt, wobei die Fahrzeit bis zum Hauptbahnhof 36 Minuten betrug. Die Einrichtung bot einen Fahrdienst zwischen der Wohneinrichtung und der U-Bahn X an, um einigen Bewohnern den Fußweg ersparen zu können. Die U-Bahnstation X war weder mit einer Rolltreppe noch mit einem Fahrstuhl ausgestattet, so dass gehbehinderte Menschen erhebliche Schwierigkeiten hatten. Für größere Einkäufe wurden in der Regel Supermärkte in anderen Stadtteilen besucht. Diese befanden sich einige Kilometer von der Einrichtung entfernt, weshalb die Bewohner von Mitarbeitern gefahren werden mussten. In den Sommermonaten bestand die Möglichkeit, direkt an der U-Bahn ein Eiscafé zu besuchen. Sechs Bewohner benötigten wegen verschiedenen Einschränkungen auch für diese Strecke eine Begleitung.
Für den Personentransport verfügte die Einrichtung über einen Kleinbus, mit denen die Bewohner regelmäßig auch zu außerhäuslichen Veranstaltungen gefahren wurden. Einige Bewohner zeigten deutliches Interesse daran, sich unabhängig vom hauseigenen Fahrdienst bewegen zu können und bevorzugten die Fahrt mit der U-Bahn. Ich verstand dies als Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und Integration ins gesellschaftliche Leben. Einige Bewohner fuhren bereits seit langem selbständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine Bewohnerin besaß ein Dreirad und bewältigte damit gelegentlich einige Wege. Ein weiterer Bewohner fuhr regelmäßig mit seinem Fahrrad. Andere Bewohner tätigten bereits selbständig kleinere Einkäufe zu Fuß. Die Fähigkeiten und Möglichkeiten im Bereich der Mobilität waren individuell höchst unterschiedlich.
Bewohner, die an der Nutzung urbaner Strukturen wenig bis kein Interesse zeigten, hatten die Möglichkeit, sich in der Naturlandschaft in der näheren Umgebung des Hauses zu bewegen. Das große Grundstück um das Haus herum bot zudem viel Bewegungsfreiraum für die Bewohner. Die Ruhe in der näheren Wohnumgebung wurde außerdem von einigen Bewohnern ausdrücklich als positiv bewertet.
Um die selbstbestimmte Mobilität zu unterstützen, Zufriedenheit zu evaluieren und "produktive Unzufriedenheit" zu fördern, habe ich sechs Monate lang mit Bewohnern die offene Malgruppe der "Schlumper" besucht. Als Ergebnis konnte ich eine deutliche Steigerung der selbständigen Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln bei zwei Teilnehmern feststellen. (s. Kap. 2.1) Unzufriedenheit bezüglich der Mobilität wurde bei meinem Projekt insofern deutlich, als zumindest ein Teilnehmer häufig Forderungen nach weiteren Ausflügen und Begleitungen in die Stadt stellte. Diese hat er gegenüber seinen Betreuern kundgetan und zum Teil auch durchsetzen können. Das Thema Mobilität konnte durch mein Projekt im Diskurs der Einrichtung einen höheren Stellenwert erlangen als zuvor, nicht zuletzt durch den entstandenen Druck einiger Bewohner.
Als kurzfristige Handlungsmöglichkeit schlug ich vor, auch verkehrsunsicheren Bewohnern neue Angebote zur Verkehrssicherheit zu unterbreiten. Bewohnern, die weiterhin verkehrsunsicher bleiben, sollte aus meiner Sicht eine flexible und bedarfsentsprechende Begleitung angeboten werden. Eine Aufgabe der Einrichtung hätte es darüber hinaus sein können, gemeinsam mit anderen Organisationen der Behindertenhilfe auf den HVV einzuwirken, damit dieser die Haltestelle X behindertengerecht umgestaltet.
d) Kommunikation: Dem Bereich "Kommunikation" rechnete ich eine hohe Bedeutung zu, da die meisten Bewohner in der Einrichtung nicht bzw. nur sehr eingeschränkt sprechen konnten. Drei Bewohner sprachen überhaupt nicht. Eine Bewohnerin sprach nur vereinzelte Worte, eine weitere Bewohnerin redete nur mit einer Betreuerin sowie mit ihrer Mutter, gegenüber anderen Menschen verständigte sie sich schriftlich. Weitere sechs Bewohner konnten sich verbal nur sehr schwer verständlich mitteilen. An kommunikativen Behinderungen litten somit rund zwei Drittel der Bewohner. Sie sprachen nur selten miteinander. Oft saßen mehrere Bewohner über längere Zeit hinweg sprachlos zusammen in einem Raum. Es kam aber gelegentlich zur nonverbalen Kontaktaufnahme.
Zwei Bewohner des Hauses lebten in einer Partnerschaft zusammen Der dominierende Eindruck, den ich gewinnen konnte, war der, dass viele Bewohner nach meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung einiger Betreuer wenig miteinander kommunizierten. Soweit betraf diese Beobachtung noch nicht direkt die Zufriedenheit der Bewohner, sondern meine Wahrnehmung als Beobachter. Da es aber keine Nichtkommunikation gibt, erschien mir das auffallend häufige Schweigen als ein Ausdruck, den ich nicht in eine mögliche Zufriedenheitsskala einordnen mochte, sondern vielmehr als Fragestellung formulierte: Bedeutet das Schweigen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Wenn es Zufriedenheit bedeuten sollte, stellt sich die weitere Frage, ob es eine resignative Zufriedenheit oder eine erfüllte Zufriedenheit war.
Als auffallend erwies sich bei meinen Beobachtungen ebenso, dass die meisten Bewohner eine rege Kommunikation mit den Betreuern pflegten. Ihr kommunikatives Verhalten erschien überwiegend auf Betreuer und andere nichtbehinderte Menschen konzentriert zu sein. Dennoch lebten die Bewohner in erster Linie eng mit anderen behinderten Menschen zusammen. Bei von mir begleiteten Besuchen von kulturellen Veranstaltungen wurde regelmäßig deutlich, dass viele der teilnehmenden Bewohner den Kontakt zu fremden Menschen suchten. In der Einrichtung wohnten aber nur behinderte Menschen. Ihre sozialen Kontakte zu Menschen außerhalb der Einrichtung beschränkten sich bei den meisten auf die Eltern und weitere Angehörige. Besuche von Kollegen aus der Werkstatt waren mir bei den Bewohnern im privaten Bereich nicht aufgefallen.
Einschränkend muss erwähnt werden, dass ein Bewohner der Einrichtung öfter in der Disco Frauen von außerhalb kennenlernte. Diese Beziehungen waren nie von längerer Dauer, wurden aber von der Einrichtung unterstützt. Bewohner, die sprechen konnten, bewerteten die geringen Kontakte zu Menschen von außerhalb vorsichtig als einen Mangel, wobei aber "hindurch zu hören" war, dass sie sich etwas anderes nur schwer vorstellen konnten. Im Lebensfeld der sozialen Außenkontakte schienen den Bewohnern ausreichende Vergleichsmöglichkeiten zu fehlen. Die Einrichtung hatte hierzu bereits einige Bewohner dabei beraten, einen Verein zu suchen, was in einem Fall auch erfolgreich war. Die Einrichtung bot darüber hinaus zahlreiche Begleitungen zu Veranstaltungen außerhalb des Hauses an. Als weitere Handlungsperspektive regte ich an, Methoden der Unter-stützten Kommunikation verstärkt anzubieten und entsprechende Fortbildungen zu ermöglichen.
Kommunikation und Tätigkeit:Das Thema "Kommunikation" steht in einem gewissen Wechselverhältnis zum folgenden Lebensbereich, der "Beschäftigung im Haus". Tätigkeit und Sprache bedingen sich gegenseitig. Wer miteinander arbeitet, muss auch miteinander kommunizieren. Gemeinsame Handlungsvollzüge stiften gemeinsames Erleben. Sie schaffen so etwas wie eine tätige Vergesellschaftung der Individuen, die sich im gemeinsamen Tun als gemeinsame Subjekte erfahren können. Die kooperative Tätigkeit für das gemeinsame Handlungsziel bildet das "gemeinsame Dritte", das Verbindende, über das sich die Beteiligten aufeinander beziehen können.
Tätigkeit und Beschäftigung sollten somit nicht nur im Wechselverhältnis zwischen Betreuern und einzelnen Bewohnern individuell organisiert werden, sondern in möglichst autonomer Kooperation zwischen mehreren Bewohnern. Als mögliche Entwicklungsperspektive sah ich dazu eine Übergabe umfassender Handlungseinheiten an "die Bewohner". Dies hätte als Beispiel das Kaffeekochen für die Gruppe am Nachmittag sein können, die Reinigung des Treppenhauses oder die Vorbereitung eines gemeinsamen Frühstückes. Als entscheidend sah ich es an, dass die Bewohner die Gelegenheit erhalten und auch die Notwendigkeit dafür erkennen können, eine aktive und autonome Kooperation für gemeinsame Ziele herzustellen. Ein solcher Handlungsmodus liegt quer zu allen anderen Lebensbereichen und könnte weitere Entwicklungen grundlegender Art fördern - somit auch die erfüllte Zufriedenheit der Bewohner.
e) Beschäftigung im Haus: Das Thema "Beschäftigungsmöglichkeiten im Haus" hatte eine gewisse Bedeutung, wenn die Bewohner nach Feierabend oder am Wochenende zu Hause waren, bei anderen, die nicht arbeiteten, auch an den Vormittagen. Umso wichtiger erschienen mir dann entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Hauses. Diese haben allerdings einen widersprüchlichen Charakter. Die grundsätzliche Frage, die oft diskutiert wurde, war: Muss die Einrichtung für eine möglichst umfassende Beschäftigung der Bewohner sorgen oder soll sie sich vielmehr zurücknehmen und den Bewohnern ermöglichen, sich eigenverantwortlich zu beschäftigen? Zwischen diesen Gegenpolen bewegte sich in der Praxis das Angebot im Hause.
Bei den meisten Bewohnern konnte ich bezüglich der Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Hauses keine Unzufriedenheitsäußerungen wahrnehmen. Bei einigen wenigen allerdings wurde Unzufriedenheit in manchen Situationen deutlich. Ein Bewohner hatte die Aufgabe, die Badezimmer morgens zu reinigen, übernommen. Da er diesen Dienst innerhalb einer Stunde erfüllen konnte, wünschte er sich weitere Aufgaben. Ein anderer Bewohner reinigte das Treppenhaus, allerdings unregelmäßig, so dass weiterhin eine professionelle Reinigungskraft hierfür eingesetzt wurde. Ein anderer Bewohner saß in seiner Freizeit häufig im Gemeinschaftszimmer und beobachtete das menschliche Treiben um sich herum. Mitunter aber ging dieser Klient nervös auf und ab. Er nahm interessiert jede Handlungsmöglichkeit an, die man ihm anbot, und schien ein größeres Bedürfnis nach solchen Möglichkeiten zu haben. Eine andere Klientin spielte gern mit technischen Geräten. Da diese dabei aber häufig zu Bruch gingen, fehlten ihr genau solche Gegenstände.
Die Einrichtung bot seit einigen Monaten für die häuslichen Bewohner am Vormittag einen pädagogischen Hauswirtschaftsdienst an, mit dem die Anwesenden die Möglichkeit erhielten, sich zu beteiligen. Die Teilnahme war unterschiedlich. Bei einem Bewohner, der zuvor sehr häufig seine Langeweile zum Ausdruck gebracht hatte, hat das pädagogische Hauswirtschaftsangebot zu einer deutlichen Steigerung seiner Zufriedenheit geführt. Ein anderer Bewohner reinigte regelmäßig Büroräume des Trägers.
Seit Anfang 2007 bot eine Betreuerin montags nachmittags die Möglichkeit zur künstlerischen Betätigung an. Sie unterstützte die Bewohner beim Malen und Gestalten von Materialien. Das Interesse der Bewohner an dieser Veranstaltung erwies sich meistens als sehr groß. Mit dem Angebot entdeckten auch Bewohner, die nicht sprechen konnten, ein neues Medium, sich anderen Menschen mitzuteilen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Nach den Beobachtungen der Betreuerin war an jenen Nachmittagen die Zufriedenheit der Bewohner deutlich größer als sonst.
Nach meiner Einschätzung sollte die noch immer wahrnehmbaren Unzufriedenheitsbekundungen als produktive Impulse genutzt werden, um die Angebote zu erweitern, Kunstangebote an weiteren Tagen bereit zu stellen und weitere hauswirtschaftliche Tätigkeiten in die Zuständigkeit von interessierten Bewohnern zu übertragen. Mit diesem Schritt könnten zugleich die sozialen Bezüge der Bewohner untereinander und deren Kommunikation gefördert werden.
f) Gesundheit: Das gesundheitliche Wohlbefinden wirkt sich in der Regel direkt auf die Zufriedenheit eines Menschen aus. Rund drei Viertel der Bewohner hat im Berichtszeitraum medizinische Hilfen erhalten. Bei den Krankheitsarten fielen vor allem Hauterkrankungen, Stoffwechselkrankheiten sowie Herz- und Kreislaufstörungen auf.
In meinen evaluierenden Dialogen wurde das Thema Gesundheit und gesundheitliche Hilfen nur von wenigen Bewohnern angesprochen. Ein Bewohner, der an Epilepsie litt, hat auf eigenen Wunsch die Einnahme seiner Medikamente in seine eigene Verantwortung übernommen. Ein anderer Bewohner sprach öfter über sein Ventil im Kopf und darüber, dass er aufpassen müsse, nicht auf den Kopf zu fallen. Ein weiterer klagte häufig über Schmerzen im Bauch. Bei den meisten Bewohnern, auch jenen, die medizinische Hilfen erhielten, konnte ich keine Äußerungen bezüglich dieses Themenbereichs feststellen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass ich diesen Bereich zu wenig offensiv erfasst habe, eine andere, dass die Bewohner trotz ihrer Krankheiten nicht klagten und zufrieden waren. Von Betreuern wurde hin und wieder das Deutungsmuster kommuniziert, wonach einige Bewohner zu wenig bewusst ihre eigenen körperlichen Prozesse wahrnehmen, relativ schmerzunempfindlich sind und gesundheitliche Zusammenhänge nicht erkennen. Gesundheitliche Unzufriedenheit äußere sich dann vor allem durch körperliche Symptome.
Seitens der Einrichtung wurde für die Verbesserung der gesundheitlichen Zufriedenheit ihrer Bewohner ein umfangreiches Hilfeprogramm angeboten. Blutdruck sowie Zuckerwerte wurden regelmäßig und zuverlässig gemessen und die Daten dokumentiert. Ebenso regelmäßig und zuverlässig übernahmen die Betreuer das Eincremen lädierter Hautstellen bei den Bewohnern und begleiteten sie zu Arztbesuchen. Auch bei der Ernährung bot die Einrichtung individuell abgestimmte Hilfestellungen an. All diese Hilfen erfolgten nach Auskunft von Betreuern in enger Absprache mit Ärzten und gesetzlichen Betreuern.
Trotz dieser umfangreichen Hilfeangebote sahen einige Betreuer weitere Entwicklungsmöglichkeiten: Ein Betreuer äußerte die Idee, das Eincremen der pilzbefallenen Füße eines Bewohners könne der Klient bei entsprechender Anleitung selbständig ausführen. Die Empfehlung eines Arztes, dass mehr Bewegung die Durchblutung der Füße fördern und damit die Abwehrkräfte stärken könnte, wurde im Team diskutiert. Eine Betreuerin äußerte die Befürchtung, dass Anzeichen möglicher Krankheitssymptome möglicherweise übersensibel registriert würden. Weitere Handlungsmöglichkeiten sah ich im Zusammenhang mit der geplanten Ambulantisierung und den Bemühungen zur Förderung der Selbstbestimmung darin, den Bewohnern individuell nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen schrittweise weitere Handlungssequenzen zur gesundheitlichen Fürsorge in die eigene Zuständigkeit zu übergeben und ihnen dabei die nötige Beratung und Anleitung anzubieten. Darüber hinaus könnten in Kooperation mit den zuständigen Ärzten sowie den gesetzlichen Betreuern sicherlich einige verzichtbare Medikamentierungen, Messungen und Kontrollen reduziert werden.
g) Geld: Beim Thema "Geld" ging es um den Umgang mit Geld. Die Höhe des persönlichen Einkommens war gesetzlich geregelt und lag außerhalb der Zuständigkeit der Einrichtung. Die Bewohner haben das Thema Geld regelmäßig angesprochen oder angedeutet, wenn ich mit ihnen unterwegs war. Die Anlässe waren der Kauf von Zeitschriften, Getränken und Speisen. Ich konnte bei diesen evaluierenden Dialogen insgesamt nur sieben Bewohner erreichen. Bei anderen erschien der Gegenstand Geld wegen seiner Abstraktheit noch kein Thema zu sein. Andere Bewohner berichteten, dass sie bereits seit längerer Zeit weitgehend selbständig und ohne nennenswerte Probleme mit ihrem Geld umgehen konnten. Einige verfügten autonom über eine EC-Karte.
Bei meinen Außenbegleitungen baten mich die Teilnehmer häufig, ihnen beim Bezahlen und beim Rechnen zu helfen. Dennoch gelang es ihnen meist selbständig, kleinere Waren zu kaufen. Die Bezahlung bewältigten die Klienten, indem sie dem Verkäufer probeweise Geldscheine oder Münzen reichten, bis dieser zufrieden mit der Summe war und ggf. einen Betrag zurückgab.
Unzufriedenheit äußerten einige Bewohner in der direkten Kaufsituation. Sie zeigten sich nervös und unsicher, wenn sie gegenüber dem Verkäufer und anderen Kunden ihre Schwächen beim Umgang mit Geld offenbaren mussten. Darüber hinaus fiel mir auf, dass viele Bewohner einen eher eingeschränkten Überblick über ihre Finanzlage hatten. Angesichts der bevorstehenden Ambulantisierung musste ich darauf hinweisen, dass das Thema "Umgang mit Geld" künftig eine noch höhere Bedeutung erlangen würde. Dies deshalb, weil dann die Bewohner ihren eigenen Haushalt führen sollten.
Die Einrichtung bot zu diesem Thema den Bewohnern individuell differenzierte Hilfen an. Diese betrafen vor allem die Verwaltung des Taschengeldes. Je nach ihrer Kompetenzentwicklung bewahrten einige Bewohner ihr Geld in ihrem eigenen Zimmer auf, anderen wurde eine Aufbewahrung im Büro angeboten. Die Betreuer planten die Einteilung des Geldes regelmäßig mit den einzelnen Bewohnern, um so deren eigene Kompetenzen und Unabhängigkeit zu fördern. Bei einigen Bewohnern waren bereits keine Hilfestellungen mehr erforderlich. Bei mindestens drei Bewohnern erschienen nach Einschätzung der Betreuer auch in absehbarer Zukunft sehr umfangreiche Hilfen beim Umgang mit Geld erforderlich zu bleiben.
h) Persönliche Betreuung: Die persönliche Betreuung der Bewohner gehört zu den Kernaufgaben der Eingliederungshilfe. Grundlage einer jeden pädagogischen Hilfe ist ein intensives und vertrauensvolles Verhältnis zwischen Betreuer und Klient. Die meisten Bewohner in der Einrichtung äußerten ihre Bedürfnisse nach Hilfe und Zuwendung durch die Betreuer. Dies wurde alleine schon dadurch deutlich, dass die Bewohner in großer Häufigkeit auf die anwesenden Betreuer mit Fragen und Bitten zukamen. Das kommunikative Verhalten vieler Bewohner erschien mir weitgehend eindimensional auf die Pädagogen ausgerichtet zu sein.
Diesen Erwartungen kam die Einrichtung nach den Äußerungen der Bewohner sehr gut entgegen. Die meisten Bewohner, die sprechen konnten, bewerteten ihre persönliche Betreuung als sehr gut. Nur einer aus dieser Gruppe äußerte mehrfach, dass er sich häufigere Begleitungen bei auswärtigen Unternehmungen wünsche, als dies machbar erschien. Mit seinen Forderungen konnte er bereits Erfolge erzielen. Die Einrichtung bot personell eine umfangreiche Tagesbegleitung an. Nachmittags ab 15 Uhr befanden sich regelmäßig mindestens drei Betreuer im Dienst. Hinzu kamen zusätzliche Freizeitangebote wie Sport oder Schwimmen, die von Honorarkräften angeleitet wurden. Durch diese hohe Betreuungsdichte wurde gewährleistet, dass Klienten in plötzlichen Krisensituationen sofort einen Ansprechpartner zur Seite hatten. Ein Bewohner mit autistischen Symptomen und sehr hohem Hilfebedarf erhielt darüber hinaus täglich für sechs Stunden eine Eins-Zu-Eins-Betreuung, die als Tagesförderstättenplatz finanziert wurde. Außer den regulären Basisdiensten bot die Einrichtung auch individuelle Betreuungszeiten an, in denen der jeweilige Bezugsbetreuer sich Zeit für seine eigenen Klienten nahm. Die Anzahl dieser persönlichen Betreuungsstunden war von Klient zu Klient individuell unterschiedlich. Auch auf Seiten der Betreuer bestanden Gestaltungsfreiräume, so dass sich verallgemeinerbare Zahlen oder Quoten nicht benennen ließen.
Resümierend konnte ich für den Bereich persönliche Betreuung feststellen, dass die Zufriedenheit der Bewohner mit den Angeboten der Einrichtung groß war. Auf gelegentliche Unzufriedenheiten reagierte die Einrichtung flexibel mit bedarfsgerechten Veränderungen. Als eine künftige Entwicklungsmöglichkeit sah ich eine weitere Umschichtung von Betreuungsstunden aus dem gruppenbezogenen Basisdienst (Schichtdienst) in die individuelle Betreuung. Darüber hinaus empfahl ich, die Anleitung von sportlichen und kulturellen Zusatzangeboten auch durch hauptamtliche Bezugsbetreuer auszuführen. Die Trennung zwischen Basisdienst und Zusatzangeboten sollte überwunden werden, weil sich die Bedürfnisse in beiden Bereichen wechselseitig bedingten.
Kategorien der AG Ambulantisierung: Zu den sieben Kategorien der Arbeitsgemeinschaft Ambulantisierung habe ich folgende Ergebnisse im Zwischenbericht vorgelegt:
-
Wohnraum /Wohnsituation: Alle Bewohner verfügten über ein eigenes Zimmer. Nur zwei von ihnen wohnten auf eigenen Wunsch gemeinsam in einem Zimmer. Bezüglich der Wohnräume konnte ich keine Unzufriedenheit wahrnehmen. Nur ein Bewohner, der im Juli umgezogen war, beschwerte sich, weil sein Umzug um rund sechs Monate verschoben worden war. Er musste in der Zwischenzeit innerhalb der alten Einrichtung wegen Umbauarbeiten sein Zimmer wechseln, was ihm missfiel. Von vielen Bewohnern wurden die großzügigen Gemeinschaftsräume im alten Gebäude gut angenommen und als Aufenthaltsorte genutzt. Dies deutete auf eine große Zufriedenheit mit diesem räumlichen Angebot hin. Nach meiner Wahrnehmung hätten weitergehende Angebote zur Betätigung innerhalb der Gemeinschaftsräume dem Ziel der Zufriedenheit dienlich sein können, so z.B. Objekte zum Anfassen, zum Spielen und zum Betrachten - mehr sinnliche Reize und ästhetische Vielfalt.
-
Soziale Kontakte (soziales Umfeld): Diese Kategorie deckt sich wesentlich mit den Themen "Mobilität und Lage der Einrichtung" sowie "Kommunikation"
-
Finanzielle Situation: Entspricht meiner Kategorie "Geld"
-
Schutz und Sicherheit: Das Thema "Schutz und Sicherheit" haben die Bewohner bislang nur in Bezug auf ihre Mobilität angesprochen. Einige Bewohner äußerten bei gemeinsamen Fahrten in andere Stadtteile große Ängste. Sie fühlten sich in fremder Umgebung unsicher. Ich verstand dies als eine Unzufriedenheit, die auf den Bedarf nach einer Förderung von Mobilität und Selbstvertrauen hindeutet. Diese Aufforderungen wurden in der Einrichtung durch zusätzliche Angebote aufgegriffen. Schutz und Sicherheit im direkten Wohnumfeld konnte ich nicht als Thema der Bewohner erkennen. Dies lag nach meinem Verständnis mit daran, dass X ein sehr ruhiger Stadtteil war. Es wurde nie über Überfälle oder Belästigungen berichtet. Ein weiterer Aspekt der Sicherheit betraf die soziale Perspektive der Bewohner. Hierzu bot die Einrichtung die Voraussetzungen für eine volle Zufriedenheit der Bewohner, indem sie ihrem Konzept nach grundsätzlich eine dauerhafte Wohnstätte anbot. Viele Bewohner lebten bereits seit vielen Jahren in der Einrichtung und konnten sich auf die Sicherheit ihrer Unterkunft verlassen.
-
Ausreichende Hilfen und Unterstützung /Zufriedenheit mit dem Dienstleister: Entspricht meiner Kategorie "persönliche Betreuung"
-
Zusammenleben und Regeln: Diese Kategorie habe ich zum größten Teil bereits mit meinen Ausführungen zur "Selbstbestimmung" und "Kommunikation" beantwortet. Darüber hinaus konnte ich erfahren, dass die kollektiven Regeln im Alltag der Einrichtung im Wesentlichen von den Betreuern und der Leitung bestimmt wurden. Die Bewohner partizipierten einerseits durch ihre Vertretung im Heimbeirat, anderseits durch ihr unmittelbares Verhalten, das bestehende Regeln teilweise bestätigte, teilweise aber auch durchbrach und somit verändernd wirkte. Bezüglich der Ambulantisierung empfahl ich, dass die Bewohner innerhalb ihrer Wohngemeinschaften möglichst von Anfang an die Regeln ihres Zusammenlebens autonom mit nur beratender Unterstützung durch die Betreuer selbst aushandeln und bestimmen können. Als Risiko sah ich hierfür die Ungleichzeitigkeit zwischen Umzug und rechtlicher Ambulantisierung. Da in den ersten sechs Monaten nach dem Umzug weiterhin der heimrechtliche Status gelten sollte, war nach meiner Auffassung darauf zu achten, dass in dieser Zeit seitens der Institution keine veränderungsresistenten Regeln eingeführt wurden, die dann in das ambulante Wohnen hineinreichen und echte Selbstbestimmung verhindern.
-
Allgemeine Einschätzung: Meine allgemeine Einschätzung der Zufriedenheit der Bewohner war, dass die Bewohner mit den Bedingungen, Möglichkeiten und Angeboten der Einrichtung sowie mit dem Träger zufrieden waren. Dies bedeutete aber nicht eine resignative Zufriedenheit, sondern überwiegend eine erfüllte Zufriedenheit. Gezielte Unzufriedenheiten, wie ich sie ausgewertet habe, hielt ich für die Weiterentwicklung der Einrichtung für notwendig. Ich sah sie als positive Zeichen dafür, dass die Bewohner aktiv am Leben der Einrichtung mitwirkten, ihre Interessen äußern und Einfluss nehmen konnten.
Abschließend hat unsere Forschungsgruppe der Einrichtungen folgende Vorschläge angeboten:
-
Die laufende Umorientierung der Betreuung von der Gruppe auf das Individuum sollte fortgeführt werden.
-
Der geplante Umzug ins Nebengebäude sowie die weiteren Schritte zur Ambulantisierung sollten ohne weitere Verzögerungen realisiert werden.
-
In der Zwischenzeit zwischen Umzug und rechtlich-formaler Ambulantisierung sollte auf die Schaffung von Regeln und Bedingungen verzichtet werden, die dann später ein selbstbestimmtes Wohnen beeinträchtigen könnten. Die Bewohnerzufriedenheit könnte sicherlich gesteigert werden, wenn dann alle Mieter souverän über ihren Wohnraum verfügen können.
-
Der Übergang zu anderen, noch offeneren Wohnmöglichkeiten sollte grundsätzlich stärker gefördert werden. Darüber hinaus könnte die Vielfalt der angebotenen Wohnformen durch die Schaffung von dezentralen Außenwohngruppen, Einzel- und Zweipersonenwohnungen erhöht werden.
-
Bezüglich der Mobilität sollten die Bemühungen zur Förderung der Verkehrssicherheit verstärkt, weitere und flexible Begleitungen bedarfsgerecht angeboten sowie die interessierten Bewohner schrittweise zu einer selbstständigen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hin befähigt werden.
-
Zur Förderung der Kommunikation wäre zu prüfen, inwieweit Methoden der Unterstützten Kommunikation hilfreich sein könnten, ggf. wären entsprechende Weiterbildungen für die Betreuer anzubieten.
-
Weitere hauswirtschaftliche Aufgabenbereiche im Hause sollten an die Bewohner übertragen werden. Dafür wäre eine Reduktion der versorgenden hauswirtschaftlichen Dienstleistungsangebote hilfreich. Die freiwerdenden Kapazitäten könnten in pädagogisch fördernde Hilfen umgeschichtet werden.
-
Eine Erweiterung der kreativen Angebote im Hause könnte dazu beitragen, Kommunikation und Zufriedenheit noch weiter zu fördern.
-
Im gesundheitlichen Bereich wäre zu überprüfen, inwieweit einige Medikamentierungen und Pflegemaßnahmen in Absprache mit Ärzten und gesetzlichen Betreuern reduziert werden könnten. Grundsätzlich wäre es erstrebenswert, die Gesundheitsfürsorge durch entsprechende Anleitungen verstärkt in die Zuständigkeit der Bewohner zu überführen.
-
Als weitere Entwicklungsperspektive grundsätzlicher Art könnten umfassendere Handlungs-bereiche in die autonome Zuständigkeit von Bewohnergruppen übergeben werden, um dadurch Kooperation und soziale Bezüge der Klienten untereinander zu fördern.
Die Phase III der Evaluation begann nach einem Konflikt zwischen der Einrichtungsleitung und der Forschungsgruppe sowie einer anschließenden Besinnungspause (s. Teil E, Kap.1.3) im Februar 2008. Der Umzug ins Nebengebäude war bereits im Dezember 2007 erfolgt. Meine Teilnehmenden Beobachtungen und intervenierenden Aktivitäten habe ich dann Dezember 2008 beendet. Der Abschluss dieser Phase bedeutet keineswegs, dass der Ambulantisierungsprozess in der Einrichtung zu jenem Zeitpunkt abgeschlossen war. Die weiteren Entwicklungen werden allerdings in dieser Arbeit nicht mehr berücksichtigt. Meine Beendigung der Evaluation zu jenem Zeitpunkt begründe ich vor allem damit, dass die Leitung den Termin für eine rechtlich-formale Ambulantisierung in mehreren Aufschüben bereits um zwei Jahre verschoben hatte und auch Ende 2008 noch immer keine Umsetzung für mich konkret sichtbar geworden war. Als Abschluss betrachte ich somit den unabgeschlossenen Prozess, wie er sich mir empirisch aktuell zu jenem Zeitpunkt darbot.
Methodisch habe ich mich weiterhin an dem in Teil D, Kapitel. 1.2 dargestellten Konzept orientiert. Meine Evaluation bis Ende 2008 bezog sich vor allem auf meine Teilnehmende Beobachtung durch regelmäßige Besuche in der Einrichtung. Dabei habe ich nun verstärkt Wert auf gezielte evaluierende Dialoge mit einzelnen Personen gelegt, weil zuvor durch offene und unstrukturierte Beobachtungen zahlreiche Fragen entstanden waren, die ich im gezielten Dialog näher klären wollte. Darüber hinaus wurde diese Phase der Evaluation ganz wesentlich durch mein intervenierendes Projekt "autonomes Kochen" (s. Kap. 3.3) geprägt. Meine Bemühungen zur rehistorisierenden Diagnostik habe ich aus den in Teil D, Kapitel 2.3 genannten Gründen nicht weiterverfolgt. Dennoch habe ich bei meinen Besuchen in der Einrichtung intensiv Tagesberichte und Individuelle Hilfepläne ausgewertet. Meine Informationen aus diesen Dokumenten habe ich dann in Gesprächen mit Mitarbeitern thematisiert und überprüft. Insgesamt erhielten meine evaluierenden Dialoge in dieser Phase mehr Struktur als am Anfang meiner Evaluation, so dass ich häufiger mit gezielten Fragen auf meine Gesprächspartner zuging. Dies deshalb, weil die zuvor noch offenere Form für mein Empfinden zu vieles offen gelassen hatte.
Wie bereits bei der Evaluation für den Zwischenbericht habe ich die Kategorien bezüglich der Zufriedenheit induktiv aus den Äußerungen der Betroffenen abgeleitet. Zugleich habe ich die alten Kategorien bzw. Themen aus dem Zwischenbericht im Auge behalten und Entwicklungen in diesen Bereichen beobachtet. Dieser Teil der Evaluation stellt keinen Abschlussbericht der gesamten Forschungsgruppe dar. Es handelt sich vielmehr um meinen eigenen Abschlussbericht, wohingegen meine Kollegen aus der Forschungsgruppe ihre wissenschaftliche Begleitung und Evaluation auf Wunsch des Auftraggebers zunächst für weitere sechs Monate verlängert haben, da bis Ende 2008 noch keine formale Ambulantisierung durchgeführt worden war.
Den Forschungsbereich Teilnehmende Beobachtung in der dritten Phase untergliedere ich der Übersicht halber in drei Unterkategorien. Im forschungspraktischen Alltag ließen sich diese drei Differenzierungen nicht wirklich aufrechterhalten, da zur Teilnahme und Beobachtung des Alltagsgeschehens auch immer wieder persönliche Dialoge mit Mitarbeitern bzw. Bewohnen gehörten und umgekehrt. In den Dialogen mit Mitarbeitern konnte ich zudem Informationen über Bewohner gewinnen, ebenso wie mir die Bewohner über die Arbeit der Betreuer berichteten. Folgende Untergliederung soll somit lediglich einer besseren Übersicht dienen:
-
Evaluierende Dialoge mit Bewohnern
-
Evaluierende Dialoge mit Mitarbeitern
-
Teilnehmende Beobachtung im Alltag
Im Rahmen meiner evaluierenden Dialoge mit den Bewohnern habe ich auch rund die Hälfte aller Klienten persönlich in ihren eigenen Zimmern besucht und mit ihnen offene und unstrukturierte Interviews geführt. Dies deshalb, weil einige Bewohner kognitiv und sprachlich dazu in der Lage waren, um meine Evaluation auch mit direkten Fragen ergänzen zu können und weil ich mit meinen evaluierenden bzw. intervenierenden Projekten längst nicht alle Bewohner habe erreichen können.
Im Unterschied zu meinen evaluierenden Dialogen für den Zwischenbericht ist mir bei dieser Befragung das Thema Auszug als ein bedeutendes Thema aufgefallen. Es wurde von vier Bewohnern direkt angesprochen und darüber hinaus von zwei Angehörigen zweier weiterer Bewohner. Nach dem Umzug auf dem Gelände der Einrichtung ins Nebengebäude ist hingegen das Thema Ambulantisierung in den Hintergrund getreten. Die Wünsche nach räumlicher Veränderung zielten nun nach draußen. Von drei Bewohnern, die seit Anfang 2007 neu eingezogen waren, wurde das Ziel, nach einer gewissen Zeit in einer eigenen Wohnung zu leben, von Anfang an direkt benannt. Ein anderer Bewohner hegte bereits seit längerem den Wunsch auszuziehen. Dieser Wunsch war bislang weder von den Betreuern noch von der Leitung richtig ernst genommen worden. Erst Mitte 2008 hat sich dies verändert, so dass die Einrichtung in der zweiten Jahreshälfte mit ihm gemeinsam nach alternativen Wohnmöglichkeiten suchte. Bei einem Bewohner war die Mutter eine Zeit lang skeptisch, ob ihr Sohn aufgrund seiner erhöhten Pflegebedürftigkeit weiterhin die ausreichenden Hilfen erhalten kann und erwog einen Umzug in ein Pflegeheim. Ein anderer Bewohner ist auf Druck seiner Mutter in eine andere Einrichtung umgezogen.
Als neues Thema sind zudem Lärm und Unruhe deutlich geworden. Bei meinen Gesprächen wurde häufig eine Unzufriedenheit wegen des Lärms der Nachbarn im Haus beklagt. Unzufriedenheit ist auch bezüglich der individuellen Angebote geäußert worden. Besonders in der ersten Jahreshälfte 2008 bemängelten einige Bewohner den Ausfall von Gruppentagen und persönlichen Gesprächen. In jener Zeit gab es in der Einrichtung personelle Engpässe.
Fast durchweg zufrieden äußerten sich die Bewohner mit der Ästhetik ihrer neuen Wohnräume. Die neuen Zimmer fanden fast alle attraktiver gestaltet und ausgestattet als die früheren. Trotz der Klagen wegen des Lärms der Mitbewohner lobten die meisten befragten Bewohner die Ruhe in der unmittelbaren Wohnumgebung.
Als positiv haben einige Bewohner auch die größeren Rückzugsmöglichkeiten gegenüber früher bewertet. Sie genossen es, sich von der Gesamtgruppe zu distanzieren und sich in ihren kleineren Wohngruppen aufhalten zu können. Bei zwei befragten Bewohnern ist im Vergleich zur ersten Befragung deutlich geworden, dass sie nach dem Umzug einen intensiveren Kontakt zu anderen Bewohnern pflegten und sich öfter gegenseitig besuchten. Die Mobilität, der Kontakt zur Außenwelt, ist nach den Berichten der Bewohner verbessert worden. Die Bewohner unternahmen wesentlich häufiger als früher auch selbständig Fahrten in andere Stadtteile, gingen alleine einkaufen oder besuchten, wie in einem Fall, auch selbständig den Arzt, was vor einem Jahr noch nicht denkbar war. Aufgrund der Berichte konnte ich nun eine deutliche Öffnung nach außen feststellen. Im Bereich der selbständigen Lebensführung insgesamt gab es zahlreiche Beispiele, bei denen Bewohner autonomer handeln konnten als vor dem Umzug.
Deutlich geworden ist in den Gesprächen aber auch ein noch nicht ausreichend erfüllter Wunsch nach persönlicher Betreuung. Ein Bewohner beklagte ganz offen seine Einsamkeit und fühlte sich von den Mitarbeitern tendenziell vernachlässigt. Ein anderer Bewohner wünschte sich eine intensivere Unterstützung beim Aufräumen seines Zimmers. Ein weiterer erwartete eine stärkere Hilfe auf seinem Weg "selbständiger leben zu können". Auch der Wunsch nach mehr Ausflügen und Unternehmungen wurde in den Gesprächen genannt.
Die evaluierenden Dialoge mit Mitarbeitern habe ich in zwei Teilen durchgeführt. Erstens habe ich während meiner Teilnehmenden Beobachtung zahlreiche Gespräche mit den Mitarbeitern zu verschiedenen Themen geführt, ohne diese förmlich als "Befragungen" zu deklarieren. Zweitens habe ich mit drei Mitarbeitern gezielte Interviews geführt. Wesentliche Themen der Gespräche waren:
-
Arbeitszufriedenheit
-
Organisation und Struktur der Arbeit
-
Pädagogische Ziele und Methoden
a). Arbeitszufriedenheit: Bei der Zufriedenheit mit der Arbeit hat sich für mich ein sehr differenziertes Bild ergeben. Sehr zufrieden waren die meisten Mitarbeiter mit den Möglichkeiten, im Verhältnis zur Leitung relativ selbstbestimmt und mit nur wenig Bürokratie arbeiten zu können. Es gebe wenig direkte Vorschriften "von oben", dafür aber relativ problemlose Unterstützung bei eigenen Initiativen. Als entlastend empfanden die Betreuer, dass nach dem Umzug der Basisdienst weitgehend in zwei Sektoren aufgeteilt worden war: Ein Dienst für die relativ betreuungsintensive Wohngruppe unten rechts und ein Dienst für die fünf anderen Wohngruppen des Hauses.
Als weniger zufriedenstellend nahmen die befragten Betreuer folgende Bereiche wahr: Den Basisdienst erlebten viele Betreuer als überfordernd, weil zu viele Bewohner gleichzeitig Erwartungen an die einzelnen Pädagogen herantrügen und dadurch eine zielorientierte und konzentrierte Arbeit kaum möglich sei. Auch in den Zeiten für individuelle bzw. Kleingruppenarbeit sei ein konzentriertes Arbeiten an den jeweiligen Zielen kaum möglich, weil auch dann häufig Anforderungen von anderen Bewohnern oder Kollegen zusätzlich an den einzelnen Mitarbeiter herangetragen würden. Wenn "etwas passiert", müsse man seine personenzentrierte Arbeit unterbrechen und irgendwo anders einspringen, wurde berichtet. Kritisiert wurde auch, dass wegen der Arbeit im Basisdienst zu wenig Zeit für die einzelnen Klienten bliebe.
Als besonderer Stressfaktor wurde die hohe Arbeitsbelastung gewertet, die immer dann entstehe, wenn Mitarbeiter wegen Krankheit ausfielen. Dies sei häufig der Fall und führe nicht selten zu einer Art Kettenreaktion, bei der dann wegen des erhöhten Stresses auch andere Mitarbeiter anfälliger für Krankheiten oder Erschöpfung würden.
Bemängelt wurde auch der Umstand, dass die Betreuer im Basisdienst zu wenig über die Bedürfnisse, Ziele und Hilfepläne der einzelnen Bewohner wüssten, obwohl sie für alle Bewohner zuständig seien und praktisch die alltäglichen Hilfen erbringen müssten. Hierzu wurde der Wunsch nach mehr Transparenz geäußert. Gewünscht haben sich Mitarbeiter auch die Möglichkeit, mehr Ausflüge mit den Bewohnern unternehmen zu können.
b). Organisation und Struktur der Arbeit: Ein Thema meinerseits waren die Regeln, nach denen die Mitarbeiter ihre Arbeit organisierten und strukturierten. Dies hielt ich u.a. deshalb für interessant, weil die Zufriedenheit / Unzufriedenheit der Bewohner zu einem erheblichen Teil auch davon abhing, was und wie die Betreuer arbeiteten: welche Hilfen genießen welche Priorität, welche kommen zu kurz und welche Angebote werden eventuell übermäßig ausgeführt? Die Allokation der Hilfen hängt wiederum von den individuellen und kollektiven Sinnstrukturen ab, nach welchen die Arbeitsabläufe organisiert werden.
Um diese subjektive Strukturierung der Arbeit zu erfragen, bediente ich mich offener Fragen, die je nach Person und Situation variierten. Häufig fragte ich Mitarbeiter: "Wenn Du zum Dienst kommst, woher weißt Du, was Du tun musst?" Eine andere Frage war: "Welche möglichen Tätigkeiten sind wichtig und welche unwichtiger und warum?". Oder: "Was ist denn Dein übergeordnetes Ziel Deiner Arbeit, wohin soll sie führen?" Fragen dieser Art ergaben sich jeweils im Dialog. Die Antworten dazu fielen sehr unterschiedlich aus. Auch das Interesse an solchen war sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Zusammenfassend ergibt sich aus den Gesprächen für mich folgendes Bild: Übereinstimmend wurde von den Mitarbeitern als (ein) wesentlicher Strukturierungsfaktor das spontane und unvorhersehbare Verhalten der Bewohner genannt. Eine Antwort lautete: "Es passiert jeden Tag etwas Neues. Man muss total spontan drauf sein. Es gibt Tage, wo (Bewohner) S. gut drauf ist, und Tage, wo er schlecht drauf ist." Eine andere Fachkraft sagte: "Ich kann meine Arbeit nie planen. Man muss alles machen, was gerade anfällt." Wenn alle Bewohner "gut drauf sind" und niemand durch Lärm oder Hilfeanforderungen auf sich aufmerksam machte, wurde diese im Bereich des Basisdienstes als Indiz dafür gedeutet, dass "jetzt nichts zu tun ist."
Diese und die bereits zum Thema der Arbeitszufriedenheit/Stress genannten Antworten deuten darauf hin, dass die Betreuer zu einem Großteil als "die Getriebenen" agierten. Sie räumten den spontanen Ereignissen, auf die sie ein reaktives Handeln für notwendig hielten, hohe Priorität ein. Demgegenüber traten eigene Angebotskonzepte in den Hintergrund. Die Frage, die sich daraus ergab, war die nach dem "roten Faden". Gab es einen und wenn ja, wer bestimmte dessen Verlauf?
Die Antworten der Mitarbeiter zum Thema "roter Faden" begrenzten sich vor allem auf die Orientierung am Tagesplan. Der Tagesplan übernahm zumindest für den Basisdienst die Funktion eines "roten Fadens". Darin fand sich eine Reihe von Aufgaben, die von anderen Mitarbeitern Tage zuvor für den jeweiligen Dienst notiert worden waren. Dieser Tagesplan wurde dann "Punkt für Punkt abgearbeitet", wie es eine Betreuerin formulierte. Ein anderer ergänzte: "Es gibt gewisse Eckpunkte, die wissen alle." Diese wurden meist auch nicht in den Tagesplan aufgenommen. An die neuen Mitarbeiter wurden die Eckpunkte bei der Einarbeitung durch dienstältere Kollegen überliefert, ebenso die Bedeutung und die Interpretation der stichwortartigen Aufträge im Tagesplan. Als ein weiteres bedeutendes Gerüst der Arbeitsorganisation wurde die Medikamentenvergabe genannt, "weil man weiß, wo man sein muss - das andere ist flexibel."
Die sich daraus ergebende Arbeitsstruktur wurde von den Mitarbeitern ambivalent wahrgenommen: Sie erlebten sie einerseits als entfremdet und langweilig, andererseits schätzen sie aber die Orientierungsfunktion, die sie bot. Das "Abarbeiten" des Tages- und Medikamentenplanes entlastete vor uferlosen Ansprüchen und grenzte die jeweils eigene Verantwortung ein. Zugleich aber führte genau dies zu einer systematischen Unterforderung vieler Mitarbeiter: Dieses "im Haus hin und her wetzen" wurde von einigen Betreuern als monoton empfunden. Beklagt wurde, dass eigene kreative Angebote dadurch auf der Strecke blieben.
In diesem Spannungsfeld zwischen flexibler Reaktionsbereitschaft und monotonem Abarbeiten von Routinen neigten einige Betreuer dazu, auf einen subjektiven Handlungsplan zu verzichten oder ihn weitgehend zu reduzieren. Eine Betreuerin brachte dies deutlich so zum Ausdruck: "Du kannst nur da sein und sagen, du bist heute hier." Ihr Ziel war es ganz einfach, "für die Bewohner da zu sein."
Der "rote Faden" entstand den Darstellungen der Mitarbeiter zufolge hinter ihrem Rücken. Keiner der Mitarbeiter äußerte die Auffassung, dass er selber seinen Arbeitsablauf bestimme. Hinter dem Rücken der Akteure wurde der Handlungsablauf vielmehr durch allgemein bekannte Eckpunkte, also alltagspraktische Selbstverständlichkeiten, durch Notizen im Tagesplan, dem Medikamentenplan und dem spontanen Verhalten der Bewohner bestimmt. Diese unmittelbare Erscheinung verdeckte allerdings die Tatsache, dass alle diese Eckpunkte ihrerseits durch Entscheidungen der Mitarbeiter selber zustande kamen und täglich aufs Neue reproduziert wurden. Die Regeln im sozialen Feld werden von den beteiligten Akteuren selber permanent durch kommunikatives Handeln hervorge-bracht. Dieser aktive Schöpfungsakt ist jedoch oft den Betroffenen selbst nicht bewusst, so dass ihnen diese Regeln als "selbstverständlich" und von außen vorgegeben erscheinen. (s. Teil C, Kap.3)
c) Pädagogische Ziele und Methoden: Die pädagogischen Ziele der Mitarbeiter lagen in der Spannbreite zwischen "den Bewohnern ein sicheres Zuhause bieten" und der "Befähigung, dass er später mal selbständig leben kann". Sie bezogen sich jeweils auf einzelne Bewohner und waren entsprechend deren Fähigkeiten und Interessen verschieden. Übergeordnet war deutlich geworden, dass alle befragten Mitarbeiter daran interessiert waren, die Bewohner zu mehr Selbstbestimmung und Selbständigkeit zu fördern. Wurde dieses Ziel dann auf einzelne Bewohner konkretisiert, so überwog häufig die Skepsis darüber, "ob der dazu jemals in der Lage ist?" Die Zielsetzung schwankte beständig zwischen Hoffnung und Zweifel. Gegenüber einigen Bewohnern mit sehr hohem Hilfebedarf war die Hoffnung auf weitere Fortschritte bereits weitgehend verschwunden. Mitunter wurde der Wunsch geäußert, den Zustand zu erhalten. Diese ambivalente Spannbreite an Zielen entsprach ihrerseits der Pluralität der Bewohner. Auch in der eigenen Zielsetzung schienen sich die Mitarbeiter an die "Vorgaben" der Bewohner anzuschmiegen und demgegenüber eigene Ziele und Utopien zurück zu stellen. Dass aber zugleich auch der jeweilige "Zustand der Bewohner" mit ein Resultat der pädagogischen Praxis und keineswegs ein naturwüchsiges Faktum war, blieb meist unreflektiert.
Bezüglich der Methodik unterschieden sich die Aussagen der Mitarbeiter erheblich. Zwei Mitarbeiter berichteten von lernzielorientierten Projekten, die sie mit ihren Bezugsklienten durchgeführt haben. Dazu gehörte der Versuch, einem Bewohner die Fähigkeit des Schreibens zu vermitteln, einem anderen Bewohner wurde ein Fahrtraining für die U-Bahn angeboten und ein anderer Betreuer hat erfolgreich einen Bewohner dabei unterstützt, sich sicherer in fremder Umgebung zu verhalten. Im Unterschied dazu standen Methoden, die darauf abzielten, "einfach nur da zu sein", oder "auf-zupassen, damit nichts passiert", "damit Bewohnerin R. nicht zu viel isst" und ähnliches. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Polen wurden oft Äußerungen laut, nach denen das methodische Handeln auf eine schrittweise Übergabe von Handlungen an die Bewohner zielte. Einige Betreuer achteten darauf, die Bewohner immer wieder zu neuen Handlungen anzuleiten und zu ermutigen. Ein Betreuer betonte, dass er viel Mühe darauf verwende, die Stimmungen seiner Klienten genau wahrzunehmen und adäquat zu reagieren. Drei Betreuer legten großen Wert darauf, den Bewohnern ein Maximum an Freiheit zu gewähren und von überflüssigen Maßregelungen abzusehen.
Welche praktische Bedeutung diese verschiedenen methodischen Ansätze in der Praxis hatten, konnte in den Gesprächen nicht ausreichend geklärt werden. Die Explikation dieser methodischen Konzepte und Praxen stand zunächst im Widerspruch zu der oben ermittelten Struktur, nach der die Betreuer überwiegend reaktiv an den unmittelbaren Bedürfnissen der Bewohner bzw. den Routinen orientiert arbeiteten. Dieser Widerspruch erklärt sich dadurch, dass beide Arbeitskonzepte nebeneinander existierten. Es gab eine an den Tagesplänen, Selbstverständlichkeiten und den spontanen Ereignissen orientierte Arbeitsstruktur und eine individuelle, methodisch geleitete Arbeitsstruktur. Im Alltag konkurrierten beide Strukturen miteinander. Meist überwog die Dominanz der Routinen - individuelle Angebote und besondere methodische Ansätze gerieten in den Hintergrund. Die Gewichtung beider Arbeitsprinzipien differierte zudem deutlich zwischen den einzelnen Mitarbeitern.
Aufgefallen ist mir dabei, dass Mitarbeiter, die sich vermehrt um ein gezieltes methodisches Handeln bemühten, eine erhöhte Anfälligkeit für psychische Belastungen zeigten. Der doppelte Druck, sowohl den Regeln des Alltags, den Erwartungen der Kollegen, als auch den eigenen methodischen Zielen genügen zu wollen, führte zu Stress und Überforderung. Deutlich wurde auch, dass die jüngeren Mitarbeiter eher zum Arbeitsprinzip der Routineerfüllung neigten und sich als zufrieden äußerten, "wenn der Dienst flutscht". Bei zwei befragten neuen Mitarbeitern wurde diese Haltung im Gespräch deutlich, indem sie besonderen Wert auf die Einhaltung der überlieferten Regeln und den reibungs-losen Ablauf legten. Eine Mitarbeiterin sagte offen, dass die Arbeit für sie einfach nur ein Job sei, mit dem sie keine weiteren Ansprüche verbinde. Zwei ältere Fachkräfte hingegen verließen die Einrichtung mit der Begründung u.a., dass sie "keine Lust mehr auf die stationäre Arbeit" hatten bzw., weil sie sich in ihren eigenen methodischen Ansätzen zu sehr durch die "Zwänge des Alltags" eingeschränkt fühlten.
In der Zusammenschau dieser drei Themen lässt sich eine Arbeitsstruktur rekonstruieren, die zwischen den Polen Stress/Überforderung und eigener inhaltlicher Leere sowie zwischen hohen eigenen methodischen Anforderungen und der erdrückenden Dominanz der Alltagsregeln täglich neu ausgehandelt werden musste. Diese doppelte Balance ist in Einrichtungen und Diensten der sozialen Arbeit nicht unüblich. Festzustellen ist auch, dass es eine Pluralität sowohl hinsichtlich der Arbeitsprinzipien als auch hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit gab. Der von mir erhoffte Ruck nach dem Umzug in Richtung zu mehr individuell orientierter Arbeit und Bedeutungsabnahme des Basis-dienstes hat nur graduell stattgefunden. Die Orientierung des einzelnen Mitarbeiters auf die Zustän-digkeit "für alles" blieb weitgehend erhalten. Als Verbesserung bezeichneten die Mitarbeiter eine Auf-teilung des Basisdienstes in den Bereich der Wohngruppe unten rechts und den Rest des Hauses. In der Praxis aber vermischten sich auch diese Zuständigkeiten, zumal wenn Personal ausfiel.
Grundsätzlich fällt auf, dass die aus Sicht der Mitarbeiter geäußerte Orientierung an den Bedürfnissen der Bewohner oft in ihrer Unmittelbarkeit verharrte. Erst bei weiteren Nachfragen konnte deutlich werden, dass der Orientierung an den Bedürfnissen des jeweils anderen eine eigene subjektive Selektion von Bedürfnissen vorausging - denn jeder Klient hatte zahlreiche Bedürfnisse. Welche davon als wesentlich gewertet wurden, hing immer von der Akzentuierung des Betrachters ab. Auch die Umsetzung dieser Bedürfnisse in praktische Hilfeangebote ergibt sich nicht kausal aus dem wahrgenommenen Bedürfnis, sondern folgt der subjektiven Deutung des Helfers. Wahrgenommene "Sachzwänge" und selbstverständliche Regeln, "was sein muss", erweisen sich so bei einer intersubjektiven Unmittelbarkeitsüberschreitung als relativ und durchaus veränderbar. So wurde beispielsweise der Tagesplan von Mitarbeitern für Mitarbeiter erstellt. Für diejenigen, die die Aufgaben ausführten, erschienen diese als "festes Gerüst" oder als drückende Last. Zugleich aber schrieben auch diese Mitarbeiter Tagespläne für die Kollegen der folgenden Schicht. Sowohl stressige Belastungen als auch entlastende Regeln wurden von den Mitarbeitern selber aktiv hervorgebracht und erschienen ihnen zugleich als unverfügbare fremde Bestimmungen, als eine entfremdete Welt, die sie sich jedoch selber geschaffen hatten. Angesichts der Größe des Heims erschien es mir nicht leicht, kollektiv diese unmittelbarkeitsverhaftete Handlungsstruktur bewusst und subjektiv verfügbar zu machen. Sinnvoll erschien mir eine Dezentralisierung der Organisation - eine Aufteilung in Etagen, so dass in kleineren Zuständigkeitsgruppen die Ziele und Notwendigkeiten des täglichen Handelns bewusst reflektiert und operationalisiert werden könnten.
Nach dem Umzug wohnten 22 Klienten in sechs abgetrennten Wohngemeinschaften über drei Etagen verteilt. Jede dieser Wohneinheiten verfügte über eine Küche, Flur und Badezimmer. Das Arbeitszimmer des Personals war ca. zehn Quadratmeter groß und befand sich im Erdgeschoss. Es war etwa nur noch ein Drittel so groß wie das alte Mitarbeiterzimmer im Hauptgebäude, so dass sich darin mehr als zwei Betreuer gleichzeitig kaum aufhalten konnten. Als Besprechungsräume für kleinere Zusammenkünfte wurden deshalb in der Regel die Küchen in den Wohngruppen genutzt. Im Sommer 2008 hat eine Dipl. Sozialpädagogin die Leitung des Hauses übernommen.
Das Wohnheim mit allen Bewohnern wurde weiterhin zentral unter einer geschlossenen Organisationsstruktur verwaltet. Die Arbeit der Betreuer erfolgte weiterhin überwiegend im Schichtdienst (Basisdienst). Der Basisdienst war jeweils für das gesamte Haus zuständig, wobei eine Wohneinheit davon relativ ausgenommen wurde, für die an den Nachmittagen ein eigener Pädagoge zuständig war.
Wie bereits aus den Mitarbeiterbefragungen deutlich geworden ist, orientierte sich die Arbeit im Basisdienst wesentlich an den Tagesplänen, am Medikationsplan sowie an alltagspraktischen Selbstverständlichkeiten. Die Arbeit wies einerseits einen hohen Routinegrad auf, andererseits war sie im starken Maße flexibel, insofern die Betreuer jederzeit auf spontane Ereignisse seitens der Bewohner reagierten. Die Arbeit an den Zielen im IHP der einzelnen Bewohner wurde innerhalb des Basisdienstes kaum realisiert, da die Betreuer nach eigenen Angaben die IHP der meisten Bewohner nicht kannten. Zielorientierte Pädagogik fand fast nur in den persönlichen Stunden statt, die nur in einem geringen Maße realisiert wurden. Genaue Zahlen konnte ich nicht ermitteln. Sie schwankten zwischen den einzelnen Klienten und den einzelnen Betreuern stark. Einige Klienten haben über Monate hinweg keine persönlichen Betreuungsstunden erhalten, bei anderen lagen sie bei einer oder zwei Stunden pro Woche. Transparente Regeln dazu waren nicht rekonstruierbar. Die verfügbaren Betreuungsstunden wurden überwiegend zentral über den Basispool gestreut und wiesen eine geringe Zielorientierung auf. Betreuer selber umschrieben ihre Arbeit nicht selten als ein "Abarbeiten" von Tagesplanpunkten. Über den Umweg der Dienstbesprechungen und gewisse Einträge in den Tagesplan gelangen auch einzelne IHP-Ziele in die Praxis des Basisdienstes.
Der Arbeitsstruktur nach wies die Wohneinrichtung stark ausgeprägte Züge einer stationären Einrichtung auf. Die zentrale Organisation wurde zum Beispiel deutlich, wenn Mitarbeiter ihren Dienst mit der Aufgabe begannen, "die Wäsche zu machen". Dann ging der jeweilige Betreuer von Wohnung zu Wohnung und sah nach, ob die Wäschekörbe voll waren, ob Wäsche aufgehängt werden musste usw. Das Gleiche galt für das Abendbrot, wenn der Mitarbeiter im Basisdienst in einer Wohngruppe nach der anderen den Tisch deckte bzw. die Bewohner dabei unterstützte. Zentral ausgerichtet wurden auch die Medikamente gestellt und verteilt. Das gesamte Team beriet über einzelne Fragen bezüglich einzelner Bewohner. Dies wurde deutlich, als es um die Frage ging, ob der Bewohner D. eine gesetzliche Betreuung erhalten sollte. Das Thema wurde in einer Dienstbesprechung diskutiert. Fast einstimmig plädierte das Team für die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung, obwohl Ds. Bezugsbetreuer dagegen war. In diesem Punkt zeigte sich, dass die Institution den Fähigkeiten ihrer Bewohner mitunter weit hinterher hinkte. Denn der Bewohner selber war bereits so selbständig, dass er sich selber beim Gericht über eine Betreuung informieren ließ und auf das "Angebot" des Teams verzichtete.
Die zentrale Organisationsstruktur war allerdings keineswegs homogen. Einzelne Wohngruppen genossen höhere Autonomie als andere. Eine Wohngruppe konnte sich im Bereich der Nahrungszubereitung weitgehend selbständig versorgen und wurde aus dem Gesamtplan weitgehend herausgehalten. Zwei andere Wohngruppen zeigten eine sehr hohe und dichte Präsenz von Betreuern auf. Eine Wohngruppe erschien sehr leblos: Deren Küche wurde so gut wie nie benutzt. Die Bewohner hielten sich isoliert in ihren Zimmern auf.
In zwei Gruppen ist deutlich geworden, dass dort jeweils ein jüngerer Bewohner mit relativ hohen lebenspraktischen Kompetenzen und hoher Selbständigkeit mit Klienten mit sehr hohem Hilfebedarf zusammen wohnte. So fühlte sich D. von zwei Mitbewohnern stark beeinträchtigt. D. klagte über den häufigen Lärm, die häufig verwüstete Küche und darüber, dass ein Mitbewohner manchmal nachts versuche, in sein Zimmer einzudringen. D., der beabsichtigte, in absehbarer Zeit in eine eigene Wohnung umzuziehen, wurde nach meinen Beobachtungen durch die dichte Präsenz von Betreuern in seiner Wohnung weit über seinen Bedarf hinaus mit betreut und in seiner autonomen Entfaltung durch die Dominanz der Betreuer und zweier anderer Bewohner beeinträchtigt. D. reagierte mit Abschottung in seinem Zimmer.
Ähnlich verhielt es sich bei B. Auch er schottete sich weitgehend in seinem Zimmer ab, weil er sich vor H. fürchtet und ihn lieber mied. Auch zu einer Mitbewohnerin hatte er kaum Kontakt und kaum Gemeinsamkeiten. Wegen der hohen Pflegebedürftigkeit Hs. stand B. jedoch automatisch unter permanenter indirekter Mitbetreuung. Flur, Küche und Badezimmer wurden von H. und seinen Betreuern eingenommen, was oft mit viel Lärm verbunden war. Eine freie Entfaltung innerhalb der Wohnung erschien für B. nur schwer möglich zu sein.
Ein besonders hohes Maß an Betreuung für besonders hilfebedürftige Bewohner erscheint mir als angemessen und berechtigt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die pädagogische Orientierung vorwiegend an den Problemen ansetzte, mit dem Ziel, Ruhe zu bewahren ("Aufpassen, damit nichts passiert"). Dafür wurden die entwicklungsfähigen Stärken der "fitteren" Bewohner leicht übersehen, so dass nicht auszuschließen war, dass jene in der Einrichtung irgendwann "versanden", zumal sie von anderen Mitbewohnern kaum fördernde Anregungen zu erwarten hatten. Hier könnten eine verstärkte Orientierung an der Individuellen Hilfeplanung und ein gezielter klientenorientierter Personaleinsatz einen Ausgleich ermöglichen.
In zwei Wohnungen konnte ich ansatzweise eine "funktionierende" Gemeinschaft beobachten, die sich gegenseitig half und gemeinsam etwas unternahm. Die Betreuungsintensität war dort geringer. Die Bewohner kommunizierten miteinander und schienen gemeinsame Interessen zu teilen. Zwei andere Wohnungen hingegen zeigten demgegenüber eher Züge einer "ambulanten Iso-Haft" auf. Dort lebten die Bewohner weitgehend kontaktarm und isoliert nebeneinander her. Ohne die Moderation von Betreuern schien kaum etwas zu funktionieren.
Auch wenn die Zusammensetzung der Wohngruppen teilweise als problematisch erschien, zeigte sie doch eine gewisse Vielfalt an Konstellationen. Jede Wohngruppe wies intern andere Strukturen auf als die andere. Auf diese Weise wurde die Homogenität der äußeren Organisationsstruktur intern gebrochen, so dass auch hier die Bewohner in ihrer Pluralität und subjektiven Lebenspraxis der zentralen Gesamtorganisation einen Schritt voraus waren. Erst durch den Umzug und die Aufteilung in Wohngruppen konnten sich diese Subkulturen abgrenzen und relativ eigene Lebenswelten gegenüber dem Gesamtheim konstituieren. Insofern war ein deutlicher Schritt zur Erosion der stationären Totalität zu verzeichnen. Der bereits erreichten Pluralität der Wohngruppenbinnenwelten entsprechend empfahl ich der Leitung eine entsprechende Dezentralisierung in der Organisation: eine Aufteilung des Teams auf Wohngruppen oder Etagen, ebenso etwas Mut zur pädagogischen Lücke: kürzere Basisdienste, dafür verbindliche Einzelbetreuungen.
Als problematisch zeigte sich die sehr heterogene Mischung der Bewohner. Der Ansatz der Leitung, alle Bewohner, auch die mit größtem Hilfebedarf, mit in die ambulante Form zu nehmen, kann dann leicht zu einem Bumerang gegen die Ambulantisierung insgesamt werden. Denn der hohe Betreuungs- und Pflegeaufwand der Bewohner mit sehr hohem Hilfebedarf erforderte eine Allokation der Arbeit in die zeitliche Fläche bis hin zur Nachtpräsenz. Die "schwierigen Bewohner" banden darüber hinaus fast alle Kräfte, weit mehr als ihnen individuell zustand. Auf diese Weise gingen den stillen Bewohnern und auch den weiterentwickelten Klienten Kapazitäten verloren. Die zeitliche Breite der Betreuerpräsenz sowie die Orientierung an den Schwächsten und den damit verbundenen akuten Ereignissen leisteten einer stationären Struktur deutlichen Vorschub: "Es muss immer jemand da sein, wenn etwas passiert." Diese Orientierung von der Einsatzzentrale aus bindet große Kräfte, beeinträchtigt aber einen gezielten personen- und entwicklungsorientierten Einsatz.
Als Alternative wäre eine Sektoralisierung denkbar, nach der entsprechend den Hilfebedürfnissen nach unterschiedlichen Konzepten gearbeitet wird: Eine flächenmäßig breit gestreute Betreuung für Bewohner, die diese benötigen, aber räumlich sowie organisatorisch klar getrennt davon eine ambulante individuelle Betreuung für andere Bewohner, die bereits relativ selbständig leben können und ganz andere Angebote benötigen. Beide Gruppen müssten dabei keineswegs voneinander isoliert, aber soweit abgegrenzt werden, dass die breite Betreuungspräsenz für die einen nicht zu einer übermäßigen Belagerung der anderen ausufert.
In der Zeit zwischen Juli und Oktober 2008 habe ich die Einrichtung zehn Mal zwecks Gründung einer Kochgemeinschaft besucht. Ziel dieses, an der Methodologie der Handlungsforschung (s. Teil C, Kap. 2.2) orientierten Projektes war, die Bewohner anzuleiten, weitgehend selbständig ihr Mittagessen zuzubereiten. Die Idee dazu kam sozusagen von außen und stand im Kontext des Begriffs der Ambulantisierung (s. Teil B, Kap. 2.2). Ein ambulantes Wohn- und Betreuungsverhältnis zeichnet sich in Abgrenzung zu einem stationären ganz wesentlich durch seine Dezentralität aus. Ambulant betreute Wohngruppen bilden kleine Einheiten, die sich weitgehend abgegrenzt von den anderen Wohngruppen des Anbieters bewirtschaften und versorgen können - mit mehr oder weniger profes-sioneller Hilfe. Da die Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten in dieser Einrichtung eine wesentliche Tätigkeit darstellte, bei der die Bewohner regelmäßig in Verbindung zueinander traten, bei der sich Gruppenzugehörigkeit und -grenzen manifestierten, maß ich diesem Handlungsbereich eine große Bedeutsamkeit für die Beurteilung des ambulanten bzw. stationären Charakters der Einrichtung zu.
Struktur des Kochens im alten Haus: Vor dem Umzug, im alten Haus, fand täglich in der Mittagszeit ein gemeinsames Essen mit allen anwesenden Bewohnern in der zentralen Küche des Heims statt. Die Zutaten für das Essen wurden zentral für das gesamte Haus eingekauft und aus der Heimkasse finanziert. Für die Zubereitung war eine Betreuerin zuständig, die den Auftrag hatte, eine "pädagogische Hauswirtschaft" anzubieten. Ihr Auftrag sah vor, dass sie die Bewohner bei den regelmäßigen Arbeiten im Haushalt anleitet und diese mit ihnen gemeinsam durchführt. Nach meinen Beobachtungen führte die Betreuerin die Zubereitung des Mittagessens weitgehend stellvertretend aus. Sie beteiligte allerdings zumeist zwei bis drei Bewohner daran. Die mitwirkenden Bewohner übernahmen Aufgaben wie Kartoffeln schälen oder Karotten schneiden. Die Tätigkeitsbereiche am Herd lagen weitgehend im Handlungsmonopol der Betreuerin.
Struktur des Kochens nach dem Umzug: Das umgebaute Nebengebäude verfügte über keine Zentralküche, stattdessen war es mit sechs dezentralen Küchen ausgestattet worden, die sich jeweils in einer Wohneinheit befanden. Im Widerspruch dazu stand die finanzielle Steuerung: Die Lebensmittel wurden weiterhin überwiegend mit den Mitteln der zentralen Heimkasse finanziert. Ein Bewohner versorgte sich selbst und zahlte einen monatlichen Essensbeitrag. Die anderen Bewohner verfügten über ein kleines persönliches Lebensmittelbudget, das aber nur für "kleine Naschereien" nebenher reichte. Die Zutaten für das tägliche Mittagessen wurden auch nach dem Umzug zentral beschafft und gelagert. Die Wünsche der Bewohner wurden bei der Speiseauswahl meist berücksichtigt.
Auch nach dem Umzug bot die Einrichtung weiterhin täglich ein Mittagessen für alle anwesenden Bewohner an. Da es nach der räumlichen Struktur keine zentrale Küche mehr gab, fand das Mittagessen nun abwechselnd in einer der sechs dezentralen Wohnungsküchen statt. Obwohl dies jeweils die Küche einer besonderen Wohngruppe war, wurde ihr für den jeweiligen Tag während der Mittagszeit die Funktion einer Zentralküche zugewiesen. Die Bewohner der jeweiligen Wohngruppe hatten dabei ein Mitspracherecht, so dass eine Wohngruppe die Übernahme der Zenralküchenfunktion in ihrem Wohnraum verhinderte.
Die Institution der Zentralküche war aus der alten stationären Struktur übernommen worden, allerdings in Gestalt einer zentralen Wanderküche: Sie erfüllte die Funktion der zentralen Versorgung aller anwesenden Bewohner und wechselt täglich ihren Ort. Nach Vorgaben der Leitung sollte ein Betreuer "gemeinsam mit den Bewohnern" das Essen zubereiten. Die wesentliche Funktion dieses Arbeitsprozesses bestand in der Versorgung der anwesenden Bewohner. Dieser sollte innerhalb der Mittelschicht, bis 14 Uhr, abgeschlossen werden.
Meist fiel die Aufgabe des Kochens dem Mitarbeiter zu, der den stark pflegebedürftigen Bewohner H. vormittags individuell betreuen musste (H.-Dienst). Nach meinen Beobachtungen führte der zuständige Betreuer die Zubereitung des Mittagessens weitgehend alleine durch. Einige Bewohner schauten dabei zu, hin und wieder erhielten sie Gelegenheit für eine Handreichung. Als Begründung für die weitgehend stellvertretende Form der Hilfe argumentierten befragte Betreuer wie folgt:
-
"Das wird so gemacht. Die Bewohner helfen höchstens mal beim Schnibbeln." Warum das so ist, konnte die Betreuerin nicht erklären.
-
"Meistens kocht ja der H.-Dienst. Und der hat echt keine Zeit, auch noch groß den Bewohnern was zu erklären und aufzupassen."
-
"Das Essen muss um halb Eins oder ein Uhr fertig sein. Das dauert sonst zu lang."
Darüber hinaus äußerten Betreuer auch große Skepsis darüber, ob die Bewohner überhaupt in der Lage seien, selbständig-(er) zu kochen. In den Gesprächen wurde deutlich, dass von den meisten Betreuern die Sinnhaftigkeit einer verstärkten Übernahme des Kochprozesses durch die Bewohner kaum geteilt wurde. Das wesentliche Argument für die stellvertretende Essenszubereitung war der Zeitdruck. Dieses Argument erschien mir den Beobachtungen zufolge als evident, zumindest wenn der "H.-Dienst" für das Kochen zuständig war. Die Argumente, die auf die selbstverständliche Regelhaftigkeit des Kochmodus verwiesen ("Das wird so gemacht."), deuteten darauf hin, dass die Arbeitsanweisungen seitens der Leitung möglicherweise zu unklar geblieben waren. Es gab keine eindeutige Prozessbeschreibung. Es fehlte zudem eine besonders für die pädagogische Anleitung des Mittagstisches zugewiesene Fachkraft. Das Kochen wurde vielmehr als Nebenbeschäftigung unter andere Aufgabenbereiche subsumiert. Auch die Auswahl des Personals dürfte sich stabilisierend für die stationäre Struktur des Kochens auswirkt haben, da auch (fast) alle neu eingestellten Betreuer aus dem stationären Bereich kamen.
Konzeption des Kochprojektes: Grund für mein Projekt war der Widerspruch zwischen anstehender Ambulantisierung und stationärer Versorgungsstruktur sowie der Widerspruch zwischen der dezentralen räumlichen Struktur und der zentralen Nutzung der Küchen. Durch die Existenz einer neuen Form der Zentralküche wurden wesentliche Strukturmerkmale einer stationären Wohneinrichtung aufrecht erhalten:
-
Der Wohnraum der Klienten, hier die Küche, fiel in den Organisationsbereich der Gesamteinrichtung. Die Küchen wurden partiell zu institutionell organisierten Gemeinschaftsräumen.
-
Es fand weiterhin eine Rund-um-Versorgung mit hotelartigem Charakter statt.
-
Die Bewohner wurden im Bereich des Mittagessens bedingt unter die Regeln der Einrichtung subsumiert. Bedingt insofern, als die Teilnahme am Mittagessen freiwillig erfolgte.
-
Die Förderung von Selbständigkeit und Selbstbestimmung war gegenüber dem Versorgungsaspekt nachrangig.
Mein Ansatz zielte auf folgende Ergebnisse: Die anwesenden Bewohner sollten gefördert werden, unabhängiger von der Hilfe der Betreuer ihr Mittagessen zu kochen. Dies sollte weiterhin in der jetzigen Form der zentralen Wanderküche geschehen, weil die mittags anwesenden Bewohner in keiner gemeinsamen Wohngruppe lebten, sondern übers Haus verteilt wohnten. Ich wollte mit "den Stärksten" beginnen. Die einzelnen Bewohner, die bereits über große hauswirtschaftliche Fähigkeiten verfügten, wollte ich ermutigen, schrittweise die Organisationsverantwortung für den Ablauf des Kochens zu übernehmen. Damit sollten die Pädagogen von den hauswirtschaftlichen Nebentätigkeiten entlastet werden, um über mehr Arbeitszeit für pädagogische Aufgaben verfügen zu können.
Durch eine größere Zurückhaltung der Betreuer könnten ein neuer Bereich des Alltagslebens und der künftig "eigentlich private" Wohnraum deutlicher von der Sphäre der Institution abgegrenzt werden. Als Fernziel sollte es möglich werden, dass die Bewohner dezentral innerhalb ihrer Wohngruppen kochen und die Betreuer nur auf Anfrage einen Rat geben oder eine praktische Hilfe leisten. Die mittags anwesenden Bewohner organisieren ihr Mittagessen selbst und laden sich entsprechend gegenseitig in ihre Küchen ein.
Durch den Zugewinn neuer Fähigkeiten und das zunehmende Selbstbewusstsein sollten die Bewohner die tradierte Institution der zentral versorgenden Küche verstören, das System aus dem Gleichgewicht bringen und Umdenken sowie Veränderungen in der Organisation anstoßen. Durch die erwünschten Irritationen und Auseinandersetzungen sollten Reflexionsprozesse in Gang gesetzt werden. Diese Ziele wollte ich mit folgenden Schritten operationalisieren:
-
Übernahme des Kochdienstes an bestimmten Tagen bzw. an einem Wochentag
-
Dabei weitest mögliche Zurückhaltung. Ich biete den Bewohnern einen offenen Möglichkeitsraum an und beschränke mich auf die unverzichtbaren Anleitungen.
-
Toleranz gegenüber Fehlern genießt hohen Stellenwert.
-
Das Essen muss nicht pünktlich fertig sein. Entscheidend sind der eigene Rhythmus der Bewohner und deren Tempo. Die Bewohner dürfen durch professionellen Druck nicht ausgegrenzt werden.
-
Bei jedem Kochtermin übernimmt "der stärkste Koch" die Gesamtverantwortung und leitet seine "Mitarbeiter" an. Ich leite den "Chefkoch" beim Anleiten an.
-
Ich berichte regelmäßig im Team über meine Erfahrungen und diskutiere mit den Betreuern über die verschiedenen Sichtweisen.
Verlauf des Projekts: Meinen Vorschlag für das Projekt habe ich im Februar 2008 im Team vorgestellt. Das Team begrüßte das Projekt, weil es eine Entlastung durch meine praktische Mitarbeit erwartet hatte. Der damalige Leiter der Einrichtung bat mich jedoch, mein Projekt vorerst zu verschieben. Ich zog mein Vorhaben zunächst zurück. Erst im Juni 2008 machte ich einen erneuten Anlauf. Die Leitung bat mich um ein kurzes schriftliches Konzept. Bis Mitte Juli war das Thema in der Einrichtung wieder weitgehend untergegangen.
Anstatt noch länger auf eine Zustimmung seitens der Einrichtung zu warten, versuchte ich durch eine kalkulierte Regelverletzung die Stagnation zu durchbrechen. Ich sprach mit einem dem Projekt wohlgesonnenem Betreuer und einem Bewohner einen ersten Versuch ab. Die Leitung informierte ich zwar darüber, setzte mich aber über die Vorgaben des Teams hinweg, das Projekt erst noch ausführlicher zu diskutieren.
Bei meinem ersten Termin an einem Dienstagabend nahmen sieben Bewohner aus verschiedenen Wohneinheiten des Hauses teil. Von ihnen beteiligten sich drei aktiv an der Zubereitung eines Salates. Sie stellten bei ihrer Arbeit hohe Kenntnisse und Fertigkeiten bei den Detailausführungen unter Beweis. Unterstützung benötigten sie für die Überleitungen zu den jeweils nächsten Handlungsschritten. Nach dem gemeinsamen Essen beteiligten sich drei Bewohner beim Abräumen des Tisches und der Reinigung der Küche. Die anderen Teilnehmer hielten sich bei den abschließenden Tätigkeiten sehr zurück und verschwanden rasch.
Als nächsten Kochtag wählte ich einen Mittwoch. Für diesen Termin verzichtete ich darauf, vorab Team und Leitung zu fragen, sondern kündigte mein Vorhaben direkt an. Ich leitete an zwei aufeinander folgenden Mittwochen das Kochen an. Dabei beteiligten sich zwischen vier und sechs Bewohner. Wie konzeptionell geplant, hielt ich mich bei diesen beiden Veranstaltungen weitgehend zurück. Anstatt selber mit den Verrichtungen zu beginnen, erklärte ich den Bewohnern, wie beispielsweise eine Spinatpackung geöffnet werden kann usw. Dabei gewährte ich bewusst viel Zeit und zeigte den Klienten die erforderlichen Handgriffe so oft, bis sie diese selbständig ausführen konnten. Die Kenntnisse der Bewohner waren sehr unterschiedlich entwickelt. Während einige Bewohner sehr komplexe Handlungsaufforderungen ohne Hilfestellung selbständig ausführen konnten, benötigten andere intensive Anleitungen bei einfachen Handlungen. Zwei Bewohner konnte ich dafür gewinnen, phasenweise die Leitung für den Ablauf zu übernehmen.
Anleitungen meinerseits erwiesen sich als notwendig bei den Übergängen von einer Handlungsphase zur nächsten. Es musste jemand das Signal geben, dass z.B. jetzt Wasser erhitzt werden oder dass erst Öl in die Pfanne gegossen werden musste und dann erst die Würstchen rein gelegt werden. Als mehrere Töpfe und Pfannen auf dem Herd standen, musste ich die Köche immer wieder daran erinnern, dass in allen Gefäßen gerührt bzw. etwas gewendet werden musste. Auch die Frage, wann das Essen gar ist, bedarf meiner Antwort, ebenso wie die Frage nach der Dosierung der Gewürze. Die einfacheren Arbeiten wie Schälen, Schneiden, den Tisch decken usw. konnten die Bewohner problemlos ausführen.
Mit unserem Mittagessen mussten wir insgesamt zehn Bewohner und die anwesenden Betreuer versorgen. Deutlich konnte ich wahrnehmen, dass nur wenige Bewohner ein Interesse daran äußerten, beim Kochen mitzuwirken. Ein Bewohner vertrat konsequent die Ansicht, dass es keinen Grund gebe, selber für sein eigenes Essen etwas zu tun. Andere Bewohner, die sich weniger differenziert mitteilen konnten, gaben zu verstehen, dass sie eine eigene Mitarbeit nicht für erforderlich hielten, weil ja ohnehin jemand für sie kochen werde. Auch das Aufräumen und Reinigen nach dem Essen erschien selbst für die Aktiven als eine neue Erfahrung. Deutlich geworden ist mir, dass die Bewohner überwiegend noch von der Selbstverständlichkeit ausgingen, dass das Mittagessen ohne eigenes Zutun zustande kommt. Den Mittwochstermin gab ich nach zwei Wochen auf und wählte den Samstag, um einen anderen zeitlichen Rahmen testen zu können.
An den Samstagen nahmen zum Teil andere Bewohner teil. Die beiden Bewohner, die ich als besonders qualifiziert eingeschätzt hatte, fielen aus. Die Teilnehmerzahl schwankte zwischen zwei und fünf Bewohnern. Die anderen Bewohner fühlten sich zu müde oder hatten keine Lust. Deutlich wurde mir, dass ich die Sinnhaftigkeit, selber zu kochen, den Klienten nicht ausreichend vermitteln konnte. Ich versuchte zwar zu verdeutlichen, dass der Erwerb eigenständiger Kochkompetenz eine nicht unbedeutende Voraussetzung für einen späteren Auszug in eine eigene Wohnung sein oder zumindest zu mehr Unabhängigkeit führen kann, doch damit gelang es mir nicht zu überzeugen. Ich konnte auch wahrnehmen, dass die teilnehmenden Bewohner von Woche zu Woche weniger in der Lage oder bereit waren, am gesamten Prozess teilzunehmen. Es kam immer häufiger vor, dass Teilnehmer plötzlich aufstanden und weggingen.
Als eine besondere Schwierigkeit nahm ich subjektiv die Mitarbeit einiger Betreuer wahr. Anders als mittwochs waren nämlich an den Samstagen hauptamtliche Betreuer im Dienst. Diese sahen sich, obwohl ich mein Projekt mehrfach angekündigt und vorgestellt hatte, auch während meiner Anwesenheit für das Kochen zuständig. So entwickelte sich ein Konkurrenzkampf zwischen den Betreuern und mir. Am ersten Samstag hat eine Pädagogin parallel zu meinem Mittagstisch ein zweites Mittagessen in einer anderen Wohngruppe gekocht, weil sie befürchtet hatte, dass unser vegetarisches Essen nicht ausreichend sättigen würde. Mit dieser Konkurrenzküche entstand nicht nur ein Wettbewerb um die Qualität der Speise, sondern auch um den Preis: Während ich von den Bewohnern, die am Essen teilnehmen wollten, als Bedingung eine Beteiligung an der Zubereitung verlangt hatte, bot die Betreuerin die Mittagsspeise bedingungslos an. Damit war mein Versuch unterlaufen worden.
Ein weiteres Konfliktthema war der zeitliche Rahmen. Während ich mir grundsätzlich Zeit ließ und dem Tempo der Bewohner Vorrang einräumte, wurde seitens der Mitarbeiter mehr Wert auf die pünktliche Fertigstellung des Essens gelegt. Als weiteren Streitpunkt erwies sich die Fehlertoleranz. Während ich konzeptionell Pannen als pädagogische Methode mit einkalkuliert hatte, war den Betreuern sehr daran gelegen, dass der Kochvorgang korrekt ausgeführt wurde. So kam es, dass sich eine Betreuerin bei unserer Zubereitung intensiv einmischte und mich sowie die Bewohner fortlaufend zu korrigieren versuchte. Die kreative Lernsituation war durch diesen Konflikt gestört worden, worauf ich mit einem Abbruch des Projektes drohte.
Bei meinem letzten Termin hatte eine Betreuerin bereits mit dem Kochen begonnen, bevor ich in der Einrichtung eintraf. Sie begründete dies damit, dass sie nichts von meinem Kommen gewusst hätte. Die Pädagogin führte die Zubereitung komplett stellvertretend aus, obwohl einige Bewohner am Tisch saßen, die üblicherweise mitgewirkt hatten. Auf meine Frage, warum sie die Bewohner nicht mit einbezog, antwortete die Betreuerin, sie habe nicht gewusst, wen sie hätte fragen sollen. Da es an jenem Tag um das Aufkochen von tiefgekühltem Spinat ging, also um nicht viel mehr, als um das Öffnen der Packungen, betrachtete ich mein Projekt mit dieser Erfahrung als gescheitert und verließ das Haus.
Abschließend fasse ich meine Erfahrungen mit dem Projekt "autonomes Kochen" wie folgt zusammen:
-
Zahlreiche Bewohner der Einrichtung hatten bereits große technische Kompetenzen bei der Zubereitung von Speisen erworben. Ein hoher Unterstützungsbedarf bestand bei der Koordination der Abläufe.
-
Die Bewohner zeigten deutlich soziale Kompetenzen bei der Kooperation. Sie konnten sich ansatzweise über die Arbeit auseinandersetzen und sich hin und wieder auch gegenseitig abstimmen.
-
Ich habe bei sechs Bewohnern festgestellt, dass sie ein relativ großes Interesse am eigenständigen oder zumindest am aktiven Mitwirken beim Kochen hatten. Eine Wohngruppe war bereits in der Lage, sich selber zu kochen.
-
Die meisten Bewohner hielten an dem Deutungsmuster fest, dass das Mittagessen als selbstverständliche Serviceleistung für sie zubereitet wird. Grund dafür war nach meiner Einschätzung die langjährige Gewöhnung an den typischen "Hotelservice" im Wohnheim und der Mangel an Erfahrungen.
-
Durch das selbstverständliche und bedingungslose Angebot des stellvertretenden Kochens hatten vermutlich auch neue Bewohner das stationäre Deutungsmuster übernommen, so dass der Sinn, selbständig zu kochen, schwer vermittelbar erschien.
-
Erschwert wurde der Versuch, die Bewohner zum eigenen Kochen anzuleiten, dadurch, dass der Zubereitung des Mittagessens die Funktion einer Vollversorgung für das gesamte Haus zukam. Dies schränkte die Fehlertoleranz ein und beeinträchtigte die Experimentierfreiheiten der aktiven Bewohner.
-
Darüber hinaus legten einige Betreuer großen Wert auf die korrekte Ausführung des Kochvorgangs, was dazu führte, dass durch häufige Korrekturen der Handlungsfluss der Beteiligten übermäßig behindert wurde.
-
Auch der Anspruch auf eine pünktliche Fertigstellung des Essens schränkte das Feld des autonomen Lernens ein. Durch den Zeitdruck wurde das subjektive und zumeist reduzierte Handlungstempo der Bewohner übersprungen, so dass Lernschritte erschwert wurden.
-
Eine dezentrale Umstrukturierung des Mittagstisches im Rahmen der einzelnen Wohnungen erschien mir bis zum Ende meines Projektes schwer vorstellbar, weil erstens nur in drei Wohngruppen Bewohner lebten, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügten, zweitens die meisten von ihnen kaum Interesse daran hatten und weil drittens das Haushaltsgeld zentral für das gesamte Heim verwaltet wurde, so dass die einzelnen Wohngruppen nicht über das nötige Budget verfügten.
-
Mein subjektiver und auch durchaus umstrittener Eindruck sollte nicht verschwiegen werden, dass nämlich einige Betreuer offenbar mit großer Freude und Engagement die Tätigkeit des Kochens gern selber ausführten. Eine allzu große Beteiligung oder gar Übernahme durch die Bewohner, so meine These, hätte die Arbeitszufriedenheit jener Pädagogen beeinträchtigen können.
-
Die Unklarheiten bei den Mitarbeitern über das Kochprojekt, ob und wann ich komme, waren besonders deutlich bei meinem letzten Termin geworden. Aber auch andere Mitarbeiter äußerten Informationslücken, obwohl das Projekt im Team mehrfach vorgestellt und mit der Leitung abgesprochen worden war. Festzustellen ist zumindest, dass der Kommunikationsfluss zwischen mir und der Einrichtung sowie innerhalb der Einrichtung lückenhaft war.
Der Tätigkeitsbereich Kochen machte deutlich, dass die Einrichtung auch nach dem Umzug und der Neuaufteilung der Räumlichkeiten durch grundlegende stationäre Strukturen geprägt war. Einerseits war das Streben nach neuen, ambulanten bzw. dezentralen Formen nicht zu übersehen. Andererseits zeigte sich aber gerade beim Kochen, dass die beteiligten Subjekte, die Basis, noch sehr an der stationären Lebenswelt festhielt und mit dieser auch zufrieden war. Die meisten Bewohner waren deutlich zufriedener, wenn sie das fertige Essen serviert bekamen. Auch die Betreuer waren mit der Aufgabe des stellvertretenden Kochens keineswegs unzufrieden. Ihre Zufriedenheit nahm allerdings deutlich ab, wenn Bewohner allzu "unprofessionell" am Herd "herumfummelten", den Zeitplan sabotierten oder gar noch das Essen versalzten. Im Sinne der zumindest unmittelbaren Zufriedenheit hielt ich es für empfehlenswert, die stationäre Kochstruktur weiter zu erhalten. Fragwürdig war dies jedoch im Hinblick auf den übergeordneten Auftrag der Eingliederunghilfe, die Klienten dabei zu unterstützen, ihr Leben unabhängiger von fremder Hilfe führen zu können.
Meine Vorannahme, dass die Bewohner zu einem großen Teil Interesse an den neuen Freiheiten, die das autonome(re) Kochen mit sich bringen könnte, hatten, ist mit dem Projekt falsifiziert worden. Ich habe mich auf Konflikte eingelassen, ohne mich auf eine Basis innerhalb der Einrichtung berufen zu können. Die Hoffnung auf eine Verselbständigung des Prozesses, dass die Bewohner meine Initiative aufgreifen, hat sich als Fehlannahme erwiesen. Ich habe offenbar meine eigenen subjektiven Ansprüche an eine autonome Lebensführung zu wenig reflektiert auf die Bewohner projiziert. Auch die Bedürfnisse der bzw. einiger Betreuer habe ich zu wenig berücksichtigt.
Entwicklungsprozesse zur größeren Autonomie müssen ausgehandelt werden. Dazu gehören Geben und Nehmen, wobei das Austauschverhältnis durch die Verteilung der Machtverhältnisse im Feld bestimmt wird. In diesem Projekt habe ich kaum über feldspezifisches Kapital verfügt. Feldspezifisches Kapital hätte sein können Anerkennung, Arbeitserleichterung oder Kontrollressourcen. Keines dieser Kapitalsorten konnte ich in die Waagschale werfen - im Gegenteil: mein Konzept hätte zu höheren Arbeitsanforderungen geführt, das Risiko mit sich gebracht, dass erwartete Arbeitsergebnisse (pünktliches Essen für alle) nicht erreicht worden wären und dadurch ein Verlust an Anerkennung eingetreten wäre. Auch die Kontrolle über die sozialen Räume, Herd und Küche, wäre auf Seiten der Betreuer gemindert worden. Um solche Verschiebungen innerhalb von Machtbeziehungen durchsetzen zu können, hätte ich die Unterstützung der Bewohner benötigt oder eine Kapitalsorte zum Tausch anbieten müssen, über die ich nicht verfügte.
Auch gegenüber den Bewohnern hatte ich wenig zur Kompensation meiner Leistungsanforderungen zu bieten. Die Kapitalsorte Autonomie stand bei vielen Bewohnern nicht hoch im Kurs. Dazu konnte ich sie nur allzu sehr vermittelt anbieten, über den Umweg der Perspektive, irgendwann einmal wie "normale Menschen" in einer eigenen Wohnung leben zu können. Dieser Umweg war nicht zu verdeutlichen, zumal ich die subjektiven Deutungsmuster der Bewohner bezüglich zukünftiger Lebensperspektiven nicht kannte. Ein Diskurs darüber ist mir nicht ausreichend gelungen. Dies dürfte daran liegen, dass ich die subjektiv wahrgenommene und konstruierte Stellung der Bewohner zur Welt nicht nachvollziehen konnte. Es war bis zum Schluss immer noch ein Kontakt zu einer anderen Kultur, zu einer Lebenswelt, die mir fremd geblieben war, die ich sprachlich nicht erfassen konnte, weil dazu die Worte fehlten, und die ich immer nur im Medium der konkreten Handlung erahnen konnte.
Markus Lauenroth hat sein IHP-Konzept (s. Kap. 1.1) im Dezember 2006 den Mitarbeitern und der Leitung der Einrichtung vorgestellt. Der Leiter beauftragte seine Mitarbeiter, bis Ende Februar 2007 mit allen Klienten das neue System erstmals umzusetzen. Dies geschah dann mit Verzögerung. Ende Juni waren von rund zwei Dritteln aller Bewohner die neuen IHP erstellt worden. Erst im Oktober 2007 waren für alle Bewohner neue Hilfepläne erarbeitet worden.
Die Dokumentation der Umsetzung von IHP-Themen und der weiteren Entwicklungen fristete noch ein Jahr länger ein Schattendasein. Eine systematische Dokumentation der pädagogischen Hilfen existierte in der Einrichtung nicht. Einzelne Betreuer hatten stattdessen für ihre Bezugsklienten eigene Tagebücher geführt und darin Beobachtungen, Ereignisse und Angebote mitunter sehr ausführlich beschrieben. Für andere Bewohner existierten Checklisten mit Aufgaben, die in regelmäßigen Abständen erfüllt werden mussten und dort abgezeichnet worden waren.
Lauenroth und ich haben in der Einrichtung immer wieder nach der Anwendung des IHP-Konzeptes nachgefragt. Der Leiter erklärte, dass er den Mitarbeitern "keinen Druck" machen wolle und ihnen Zeit für die Umsetzung gewähre. Einzelne Betreuer baten Lauenroth um weitere Beratungen bei der Arbeit mit dem neuen IHP. Einige Mitarbeiter haben sehr umfangreiche und tief gehende IHP entwickelt, bei vielen drängte sich mir jedoch der Eindruck auf, dass das Dokument eher als Pflichtaufgabe ausgefüllt worden war. Eine Differenzierung der Subjektsichtweisen fehlte bei einigen IHP. Zu vermissen war oft auch die Differenzierung zwischen Themen und Vorhaben sowie zwischen einzelnen Themen und "generativen Themen". Häufig waren Formulierungen wie "A. soll lernen, sein Zimmer zu reinigen" zu finden. Bedingungs- und Begründungsanalysen fielen meist sehr knapp aus.
Grundsätzlich hatten die Mitarbeiter im direkten Gespräch das neue IHP-Konzept begrüßt. Ihre Vorbehalte richteten sich dennoch gegen die Anforderung, "so viel schreiben" zu müssen. Vielen Betreuern waren die offenen Felder für freie Gedanken als zu unübersichtlich erschienen. Sie vermissten klare Einzelfragen, scharf umrissene Felder, Kategorien mit knappen Sätzen und überschaubare Aufgaben. Die Widerstände, Lauenroths Konzept anzuwenden, wurden oft damit begründet, dass man dabei so viel schreiben müsse und dafür zu wenig Arbeitszeit vorhanden sei.
Mit seinem Konzept hatte Lauenroth vom Außenstandpunkt aus die Absicht verfolgt, die Hilfeplanung vom Subjektstandpunkt der direkt beteiligten Personen aus zu gestalten (was bereits ein Widerspruch in sich war), die Lebenslage des einzelnen Klienten als dialektische Gesamtheit mit vielen sich wechselseitig bedingenden Facetten zu verstehen und dahinter ein oder ein paar wenige Grundthemen als zentral zu erkennen. Dies entspricht durchaus den Ansätzen der Kritischen Psychologie und der rehistorisierenden Diagnostik, steht aber im Widerspruch zur Arbeitsstruktur in der Einrichtung. Das verweist auf die Unterschiedlichkeit der Perspektiven beider Seiten: Wir (die Forschungsgruppe) als "Wissenschaftler" sahen die Klienten aus der Perspektive der "besten" Theorien, die Praktiker vor Ort organisierten ihre Arbeit im Koordinatenfeld zahlreicher Detailanforderungen, die innerhalb von vorgegebenen Daten zu Raum und Zeit erledigt werden mussten. Gegenüber dieser "Welt der Sachzwänge", die in Wirklichkeit immer soziale Zwänge sind, genoss die Forschungsgruppe eine relative Unabhängigkeit und konnte aus der geruhsamen Distanz heraus ihre Konzepte entwickeln.
Während Lauenroth also sein subjektwissenschaftlich begründetes IHP-Konzept entwickelte, wurde in der alltäglichen Praxis der Einrichtung bereits längst ein funktionierendes Hilfeplankonzept angewandt, das den Anforderungen der praktischen Koordinaten entsprach. Nur dies sahen weder Lauenroth noch ich als Hilfeplanung an, sondern als "unprofessionelle lose Blättersammlung" mit "handwerklichen Notizen". Hauptkritikpunkt daran war, dass es in der Blättersammlung keine auf gleicher Grundlage beruhende Bedingungs-Begründungsanalyse gab.
Auch wenn der neue IHP nach knapp einem Jahr endlich mit allen Bewohnern theoretisch angewandt worden war, so stand er praktisch in Ordnern abgeheftet nur im Keller. Lauenroths IHP hatte damit das gleiche Schicksal eingeholt, das auch vielen anderen Konzepten in der Praxis widerfährt: Die Bögen werden als Pflichtübung ausgefüllt, danach "kräht kein Hahn mehr danach". Die Praxis ist nämlich ohnehin eine ganz andere.
Die tatsächliche Hilfeplanung für die alltägliche Praxis hingegen wurde in schriftlicher Form mit dem Instrument des Tages- bzw. Wochenplans entwickelt. Dies war eine Sammlung loser Blätter, die zusammengeheftet auf dem Schreibtisch im Mitarbeiterzimmer lag. In diese Blätter waren ganz bestimmte Aufgaben eingetragen worden, die im Laufe einer bestimmten Schicht abgearbeitet werden mussten. Hier einige Beispiele:
Montag: Herr S. kommt um 16 Uhr zu B. / A. und K. kommen.
J.: Grille entsorgen / reinigen?
Dienstag: B. soll zum Arzt begleitet werden, vorher ist Blut abzunehmen. /"R. auch"?
B. soll nachher zur Tagesförderung.
Mit K. wird gekocht.
A. und K. müssen zur KG gefahren werden.
Für J. wird ein Antibiotikum aus der Apotheke geliefert.
G. hat mit seinem Stock nach Bewohner geschlagen. Er wurde ihm dann abgenommen. Es soll darauf geachtet werden, dass er fragen muss und er ihn erst am Donnerstag wieder erhält.
Mittwoch: G. muss zum Zahnarzt.
A. holt R. von WfbM ab und unternimmt etwas mit ihr. Es ist nicht sicher, ob sie mit zum Sport kommt.
Bitte S. Tablettenvorrat prüfen.
Dieses Modell entspricht nicht in Ansätzen dem Konzept einer subjektwissenschaftlich begründeten Hilfeplanung. Es erwies sich dennoch als funktional aus der Perspektive der Betreuer. Der Grund dafür war einfach: Die Pädagogen in der Einrichtung haben im Schichtdienst gearbeitet und waren jeweils für alle Bewohner des gesamten Hauses zuständig. In dieser Position stellte sich ihnen die Herausforderung, eine Vielzahl von einzelnen Pflichtaufgaben termingerecht abzuarbeiten.
Dies gelang unter Zuhilfenahme eines stichwortartigen Tagesplanes. Da musste der eine Bewohner zum Arzt gebracht werden, einem anderen wurden Medikamente geliefert ... Das waren die Aufgaben aus dem wirklichen Leben. Hinzukam eine Unmenge weiterer Aufgaben, die schon längst nicht mehr notiert wurden, weil sie jeder kannte, und andere, die spontan aus der Situation entstanden.
Bei einer entsprechenden Verdichtung von Aufgaben, die innerhalb eines Dienstes erledigt werden müssen, entsteht Stress. Dieser Stress wurde in der Einrichtung regelmäßig durch die Kommuni-kation zwischen Bewohnern und Betreuern gesteigert. Eine Sozialpädagogin erklärte, die Arbeit sei besonders deshalb so anstrengend, weil sie die Bewohner sprachlich so schlecht verstehen könne. Sie müsse bei jedem Satz nachfragen, interpretieren und hoch konzentriert zuhören. Oft kämen zwei oder drei Bewohner gleichzeitig auf sie zu und redeten auf sie ein. "So geht das den ganzen Tag", berichtete sie. Nach der Arbeit sei sie regelmäßig "total geschafft" gewesen, obwohl sie an inhaltlichen IHP-Zielen kaum hätte arbeiten können. Eine Heilpädagogin ergänzte, dass sie immer froh sei, "wenn der Dienst flutscht". Wer häufig solche anstrengenden Dienste überstehen muss, freut sich über jeden Tag, an dem "mal nichts weiter zu tun ist", an dem also kein Bewohner Stühle durch die Küche wirft oder seinen Kopf gegen ein Fenster schlägt. Es wäre anmaßend meinerseits, diese wohlverdiente Ruhe, die ich nicht selten beobachten konnte, als Notwendigkeit zu interpretieren, den IHP in die Hand zu nehmen und mit der Bewohnerin R. beispielsweise die Straßenverkehrsordnung einzuüben. Außer den Schichtdiensten gab es kaum geregelte Zeiten, in denen die Betreuer individuell mit ihren Klienten arbeiten konnten. Es gab sie, aber ich konnte trotz vielfacher Nachfragen keine konsistente Antwort erhalten, nach welchen Regeln, diese berechnet wurden. Selbst in diesen individuellen Zeiten gelang es den Pädagogen nicht, sich auf ihre Klienten zu konzentrieren. Wenn es irgendwo im Hause laut wurde, mussten sie einspringen.
Ich ziehe aus dieser Struktur deutlich den Schluss, dass eine individuell ausgerichtete Hilfeplanung der strukturellen Organisation der Arbeit widersprach. Im Mittelpunkt der Arbeit stand der Tagesab-lauf für das gesamte Haus, nicht aber die Entwicklung des einzelnen Bewohners. Um eine Individu-elle Hilfeplanung und -praxis umsetzen zu können, ist meiner Ansicht nach zunächst eine Dezentra-lisierung der Einrichtungsstruktur notwendig - eine Auflösung des Gesamtheims zugunsten kleinerer Einheiten mit erhöhtem Individualbezug. Trotz dieser zentralen Struktur gelang es einigen wenigen Betreuern, konzentriert am IHP zu arbeiten, wesentliche Vorhaben zu realisieren, abschließend zu reflektieren und zu dokumentieren. Dies waren jene Betreuer, denen es gelungen war, durch persönliche Strategien sich vermehrt aus den Basisdiensten zurück zu ziehen, sich gegenüber dem Heimbetrieb abzugrenzen und sich statt dessen vermehrt auf ihre Bezugsbewohner zu konzen-trieren. Da diese Arbeitsteilung keinen transparenten Regeln folgte, hing dies offenbar von der jeweils persönlichen Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der Leitung und den anderen Kollegen ab.
Nachdem ich im Sommer 2008 den dargelegten strukturellen Widerspruch zwischen IHP und Tagesplanung erkannt und dem Team mitgeteilt hatte, habe ich den Vorschlag unterbreitet, beide Strukturen gemeinsam mit den Betreuern miteinander zu verknüpfen. Dieses Angebot war nicht erwünscht. Meine Idee war, aus den IHP die für den bestehenden Tagesablauf passenden Ziele heraus zu filtern und diese als neue Aufgaben in die Tagespläne einzupassen. Dabei wäre es erforderlich gewesen, alte Tagesplanungspunkte auf ihre Dringlichkeit hin zu überprüfen und möglichst einige davon zu streichen. Das heißt, um sich den Zielen des IHP annähern zu können, hielt ich es für notwendig, die Tätigkeitsschwerpunkte erneut abzuwägen und anders zu gewichten, so dass beispielsweise die Aufgabe "Verkehrserziehung" für R. den gleichen Stellenwert hätte erhalten können wie das Waschen der Wäsche.
Als Selbstkritik aus dieser Erfahrung ziehe ich den Schluss, dass es nicht ausreicht, wenn der Gedanke zur Wirklichkeit drängt. Es muss auch die Wirklichkeit zum Gedanken drängen. Zuvörderst erscheint es mir somit notwendig, die Struktur der empirischen Arbeit in ihrer Sinnhaftigkeit zu ver-stehen, um daraus dialogisch anknüpfend neue Ziele und Schwerpunkte anzusteuern. Das neue Hilfeplansystem war mit seiner Ausrichtung auf das Individuum die einfache Negation des alten Sys-tems. Es stand dem konträr entgegen. Erst die Negation der Negation könnte gemäß der Dialektik das Alte aufheben, ohne dass es verloren geht. Diese zweite Stufe der Negation wäre hier nur dialo-gisch in Kooperation mit den Mitarbeitern möglich und müsste gewährleisten, dass die Versorgung der gesamten Bewohnerschaft erhalten bleibt, aber gleichzeitig an den pädagogischen Zielen des Individuums verbindlich gearbeitet wird. Eine vorausgehende arbeitssoziologische Strukturanalyse halte ich künftig für die Entwicklung neuer IHP-Konzepte für notwendig, um den "Subjektstandpunkt" der Praktiker erfassen zu können, zu dem schließlich eine Hilfeplanung passen muss.
Meine Ergebnisse aus meiner Teilnehmenden Beobachtung und intervenierender Praxis habe ich zunächst mit den Ergebnissen aus dem Zwischenbericht (s. Kap. 2.5) abgeglichen und in Verbindung gesetzt, um somit eine Entwicklung nachzeichnen zu können (s. Kap. 3.5.1). Darüber hinaus habe ich dann die neuen Themen zusammengefasst, die mir nach dem Umzug als bedeutsam aufgefallen sind (s. Kap. 3.5.2).
a) Ambulantisierung: Das Thema Ambulantisierung hatten die Bewohner in den Dialogen vor dem Zwischenbericht als Interesse am Umzug in eine neue Wohnung kommuniziert. Den rechtlich-formalen Aspekt allerdings konnte ich in den Äußerungen nicht erkennen. Nach dem Umzug spielte dieses Thema in dieser Form keine Rolle mehr. Nur ein Bewohner äußerte sich besorgt darüber, dass die alte Villa abgerissen werden könne. Er machte den Vorschlag, in den Räumen ein Café und eine Galerie für Ausstellungen einzurichten. Die neuen Wohnungen haben die Klienten durchweg als eine Verbesserung gegenüber den alten gewertet. Ihnen gefiel vor allem die Raumästhetik und die Ausstattung.
Als Nachteil haben zahlreiche Bewohner einen erhöhten Lärm aus den Nachbarwohnungen beklagt. Das neue Wohngebäude war auch nach Einschätzung von Mitarbeitern deutlich hellhöriger als die alte Villa. Hinzu kam, dass durch eine Reduzierung der Gemeinschaftsflächen die Bewohnerdichte höher geworden war. Formal-rechtlich unterlag die Einrichtung noch Anfang des Jahres 2009 dem Heimgesetz, obwohl die Leitung nach bereits mehreren Verzögerungen eine formale Ambulantisierung zum Jahreswechsel angekündigt hatte. Dementsprechend hatten viele Bewohner noch kein ausgeprägtes Bewusstsein für den Schutz ihrer privaten Wohnsphäre entwickelt. Auf die Klingel an der Wohnungstür wurde oft nicht reagiert, sondern darauf vertraut, dass die Betreuer mit ihrem Generalschlüssel die Tür öffneten. In einer Wohnung, so konnte ich beobachten, reagierten aber einzelne Bewohner entschieden abweisend auf das unaufgeforderte Eindringen Dritter, so dass sich dort bereits ein gewisser Schutz der Privatsphäre entwickelt hatte. Nach meiner Auffassung wären in diesem Bereich weitere Entwicklungen möglich, indem die Einrichtung gezielt darauf hinwirkt, die Wohnungen als Privatbereich der Bewohner zu respektieren.
Soweit das Wohnen einen wesentlichen Bestandteil der Ambulantisierung darstellt, ist in dieser Rubrik auch zu erwähnen, dass ein Bewohner schon seit drei Jahren den Wunsch geäußert hatte auszuziehen. Die Einrichtung verfolgte aber stets das Ziel, S. solle sich an das Leben in der Einrichtung gewöhnen. Erst seit dem Sommer 2008 wurde der Auszugswunsch des Bewohners ernst genommen. Die Leitung zeigte dem Klienten sogar andere Wohnmöglichkeiten. Mit dieser Entwicklung wurde die Einrichtung nun dem ambulanten Anspruch auf eine freie Wahl des Wohnortes mehr gerecht als zuvor.
Als problematisch erschien es mir, dass eine Bewohnerin unter einer richterlichen Unterbringung stand. Die Tür zu ihrer Wohnung war mit einer Alarmsicherung verschlossen. Die Bewohnerin konnte sich nur noch innerhalb dieser Wohneinheit und eines eingezäunten Gartens frei bewegen. Vor dem Umzug umfasste ihr Bewegungsraum das gesamte Haus. Für diese Bewohnerin hat sich mit dem Umzug eine deutliche Einschränkung ergeben. Zu thematisieren wäre die Frage, ob eine geschlossene Unterbringung kompatibel mit dem Vorhaben einer Ambulantisierung sein kann.
b) Selbstbestimmung:: Im Zwischenbericht hatte ich hierzu den Bereich der Zimmerreinigung thematisiert. In diesem Bereich konnte ich nach dem Umzug beobachten, dass sehr unterschiedliche Praktiken realisiert wurden. Einige Bewohner reinigten weitgehend selbstbestimmt und autonom ihren Wohnbereich, bei anderen Bewohnern wurde dieser durch die professionelle Haushaltshilfe gepflegt. Es wurden sehr unterschiedliche Ordnungszustände der Zimmer toleriert. Eine einheitliche Linie war nicht zu erkennen, so dass in diesem Bereich individuell diversifiziert verfahren wurde. Die Küchen, Badezimmer und Flure wurden bei allen Bewohnern zentral und stellvertretend gereinigt, so dass für diesen Bereich die Möglichkeiten einer erweiterten Selbstbestimmung und Selbstverantwortung noch nicht völlig ausgeschöpft zu sein schien.
Im Bereich der Essensversorgung habe ich beobachtet, dass in einer Wohnung der Kühlschrank mit den Vorräten abgeschlossen war und nur von den Betreuern geöffnet werden konnte. Dies wurde damit begründet, dass zwei der Bewohner ansonsten zu viel essen würden, zumal eine Bewohnerin ohnehin an starkem Übergewicht leide. Bei der Auswahl der Zimmer und der Mitbewohner sind nach meinen Informationen die Wünsche der Bewohner zum Teil berücksichtigt und umgesetzt worden, zum Teil aber wurde eine von der Leitung kalkulierte Mischung nach Hilfebedarfsgruppen eingeführt. Ein Bewohner kritisierte ganz offen, dass ihm beim Einzug nur eine Möglichkeit angeboten worden sei, obwohl auch in anderen Wohneinheiten Zimmer frei gewesen seien. Andere Bewohner äußerten sich sehr zufrieden darüber, dass sie ihr Zimmer nach Wahl erhalten konnten.
Durch eine verstärkte Beteiligung der Bewohner beim Einkaufen ist in diesem Bereich eine deutlich höhere Selbstbestimmung zu beobachten gewesen. Die Bewohner konnten ihre Wünsche für die Mahlzeiten häufig durchsetzen. Sie gingen mitunter selbständig einkaufen oder begleiteten die Fahrten zum Supermarkt. Eine größere Autonomie konnte auch durch eine Teildezentralisierung des Haushaltsbudgets für einzelne Wohngruppen und für einzelne Bewohner erreicht werden.
Als einen großen Erfolg sehe ich das selbstverantwortliche Handeln eines Bewohners an, der gegen das Ansinnen von Leitung und Team die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung abgelehnt und sich aus freien Stücken selbständig bei einem Gericht hat beraten lassen. Den Verfahrensweg, solche lebenspraktisch weitreichenden Entscheidungen zentral für einzelne Bewohner zu treffen, halte ich indes für "typisch stationär". Die Auseinandersetzung im Falle des betreffenden Bewohners und die Unterstützung seitens seines Bezugsbetreuers sah ich jedoch als ein Zeichen dafür, dass die alten stationären Strukturen langsam erodierten und sich immer wieder Lücken für neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung öffneten.
Die Kategorie der Selbstbestimmung betrifft auch alle weiteren Kategorien dieser Auswertung und liegt als ein wesentliches Qualitätskriterium quer zu allen Lebensbereichen.
c) Mobilität und Lage der Einrichtung: Die im Zwischenbericht bereits als verbesserungsfähig eingeschätzte Lage der Einrichtung hat sich nach dem Umzug nicht verändert. Die Mobilität der Bewohner hat sich nach meinen Beobachtungen jedoch deutlich gesteigert. Dies ist daran deutlich geworden, dass einige Bewohner verstärkt außerhalb der Einrichtung selbständig ihre Angelegenheiten erledigt haben, bei denen es mir noch ein Jahr zuvor undenkbar erschienen war. Durch den umfangreichen Personalwechsel nach dem Umzug war nach Ansicht von Betreuern eine neue "Lockerheit" eingekehrt, so dass überholte Ängste bezüglich der Mobilität überwunden werden konnten. Die Bewohner äußerten sich über ihre neuen Freiheiten sehr zufrieden.
Auch meine Interventionen zur Verbesserung der Mobilität zeigten nach Ansicht eines Pädagogen hier gewisse Nachwirkungen. Es sei selbstverständlicher geworden, die Bewohner mal alleine auf den Weg zu schicken. Auch sei es bei einigen Bewohnern als Ziel erkannt und umgesetzt worden, sie bei der selbstständigen Bewältigung von Wegen gezielt zu fördern.
d) Kommunikation: Im Zwischenbericht hatte ich konstatiert, dass die Kommunikationslinie überwiegend zwischen Bewohnern und Betreuern verlief, die Klienten untereinander aber wenig miteinander kommunizierten. Dieses Bild hat sich nach dem Umzug differenziert. Wie bereits dargestellt, haben sich sehr kommunikative Subkulturen entwickelt. (s. Kap. 3.2.3) Im gleichen Zuge haben sich aber auch Felder des Schweigens ausgeprägt, in denen die Bewohner einer WG stumm neben sich her lebten. Durch die Dezentralisierung in abgetrennte Wohneinheiten hat sich die direkte Zentrierung der Klienten auf die Betreuer entzerrt. Das Leben der Bewohner fand nun verstärkt innerhalb der Wohngruppen statt und nicht mehr im gemeinsamen Aufenthaltsraum. Zumindest in den Feldern des Schweigens bedeutete dies nicht unbedingt einen Zugewinn an Autonomie, sondern eher Isolation innerhalb der eigenen Wohnung.
Bei vier Bewohnern, die nicht sprechen konnten, waren auch nach dem Umzug keine Versuche seitens der Einrichtung zu beobachten, Methoden der Unterstützten Kommunikation anzubieten. Auch wir bzw. ich habe/n) nichts in dieser Hinsicht unternommen. Nach meiner Ansicht wäre dies eine typische Aufgabe für die zuständigen Betreuer gewesen. Es war zwar ein neuer Mitarbeiter eingestellt worden, der über eine diesbezügliche Qualifikation verfügte, doch konnte dieser wegen seiner Auslastung im Basisdienst keine Hilfen aus diesem Bereich anbieten. Ein nicht-sprechender Bewohner hat jedoch mit Hilfe präkonventionalisierter Zeichen seine Ausdrucksmöglichkeiten soweit präzisieren können, dass er auch für Außenstehende gut verständlich wirkte.
e) Beschäftigung im Haus: Die Beschäftigung der Bewohner im Haus fand nach dem Umzug überwiegend innerhalb der jeweiligen Wohneinheiten statt. Meist geschah dies alleine im eigenen Zimmer. Die gemeinsamen Beschäftigungsmöglichkeiten waren gegenüber der Situation vor dem Umzug weniger geworden, da das neue Haus über keine gemeinsamen Aufenthaltsräume verfügte. Im Gegenzug haben Bewohner berichtet, dass sie sich häufiger gegenseitig besuchten und dies als eine neue Zufriedenheit erlebten. Das Projekt eines Kunstangebotes im Hause ist nach dem Ausscheiden einer Betreuerin Anfang des Jahres 2008 beendet worden. Zwei Bewohner wurden an einzelnen Tagen von einer Honorarkraft bei gezielten Tätigkeiten im Haus angeleitet. Sie arbeiteten im Garten, reinigten das Treppenhaus und entsorgten Müll. Ein Bewohner hat die Möglichkeit erhalten, Schlagzeug zu spielen. Bei meinen Beobachtungen nahm ich aber häufig den Eindruck einer gewissen Leere, die wenig Anregung bot, wahr.
f) Gesundheit: Den Bereich der Gesundheit habe ich nach dem Umzug eher vernachlässigt. Bei einem Bewohner war ein sehr hoher Pflegebedarf entstanden, der mit hohem Personaleinsatz in der Einrichtung geleistet werden konnte. Mitarbeiter haben hierzu Fortbildungen besucht. Der Pflegeprozess wurde ausführlich dokumentiert.
g) Geld: Der Umgang mit Geld wurde weiterhin durch individuelle Beratung der Bewohner, durch gemeinsames Einteilen des Budgets und Aufbewahrung von Taschengeld im Büro unterstützt. Durch die vermehrten Möglichkeiten, einzukaufen oder sich beim Einkaufen zu beteiligen, haben die Bewohner zusätzliche Möglichkeiten erhalten, mit Geld umzugehen.
h) Persönliche Betreuung: Die persönliche Betreuung war ein Thema, das in der Einrichtung häufig diskutiert worden ist. Als Problem hatte sich nach dem Umzug immer wieder erwiesen, dass die Stunden für die individuelle Betreuung zu knapp bemessen waren. (s. Kap. 3.2.1/3.2.3). In meinen Gesprächen äußerte sich ein Teil der Bewohner zufrieden mit der persönlichen Betreuung, ein anderer Teil unzufrieden. Ein Bewohner beklagte seine Einsamkeit. Besonders im ersten Halbjahr 2008 konnte ich große Unzufriedenheit vernehmen, weil einige Betreuer ausgefallen waren. Auch Eltern beschwerten sich bei der Leitung darüber, dass Gruppentage und persönliche Förderangebote häufig auf der Strecke geblieben waren.
Nach meiner Auffassung könnte eine Umstrukturierung in kleinere Organisationseinheiten zu einer Veränderung führen. Auch eine Umgewichtung zugunsten der persönlichen Betreuung könnte machbar sein, sofern dies im Willen der Leitung bzw. der Mitarbeiter läge. Als nachteilig habe ich es wahrgenommen, dass die neuen Mitarbeiter über die Begleitung im Basisdienst eingearbeitet worden sind. Dadurch war von vornherein die Orientierung auf die zentrale Arbeitsstruktur gestärkt worden. Meine Empfehlung zielte darauf, die neuen Mitarbeiter am Anfang mit den einzelnen Bewohnern bekannt zu machen und über die individuelle Orientierung einzuarbeiten - den zentralen Dienst hingegen nur als sekundären Bereich einzuführen. Damit wäre ein Paradigmenwechsel denkbar gewesen. Mit meinem Vorschlag konnte ich die Leitung nicht überzeugen.
a) Gewalt: Gewaltförmige Konflikte waren bereits am Anfang meiner Evaluation immer wieder ein Thema in der Einrichtung. Ich habe sie anfangs wenig wahrgenommen. Erst in 2008 bin ich verstärkt darauf aufmerksam geworden. Gewalttätige Vorfälle wurden mir von drei Bewohnern berichtet. Ein Bewohner, der in 2008 einige Male damit aufgefallen war, hat sich nach dem Umzug wieder stabilisiert. Ein anderer Bewohner war in den vergangenen Jahren häufig mit aggressiven Ausbrüchen bekannt geworden. Auch um ihn war es in 2008 relativ ruhig geworden. Sein Bezugsbetreuer führte dies vor allem auf die intensive Begleitung im Alltag und den gelungenen Aufbau eines stabilen Vertrauensverhältnisses zurück.
Akut waren nach dem Umzug die Vorfälle mit einem Bewohner, der schon seit längerem den Wunsch geäußert hatte, auszuziehen. Über ihn ist mir bekannt geworden, dass er zumindest eine Betreuerin geschlagen, einer Bewohnerin die Brille zerstört, sie beim nächsten Angriff zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten hat. Er soll darüber hinaus einem Mitbewohner einen Kochtopf auf den Kopf geschlagen und einen weiteren Bewohner angegriffen haben. Der Auszugswunsch des Klienten war lange Zeit seitens der Einrichtung übergangen worden. Erst in 2008 waren ihm alternative Wohnmöglichkeiten vorgestellt worden.
Die Unzufriedenheit des Bewohners konnte ich seinen Mitteilungen zufolge nur sehr allgemein erfassen. Er wünschte sich, mit einer Frau zusammen zu leben. Die Betreuer fand er "doof", bis auf einige wenige. Der Klient machte auf mich subjektiv häufig einen sehr gelangweilten und frustrierten Eindruck. Sein Bezugsbetreuer war zu einem Gespräch mit mir nicht bereit. Mein Vorschlag, mit allen Beteiligten eine Betreuungskonferenz durchzuführen, wurde abgelehnt. Angehörige des Bewohners kritisierten, dass häufig Personal und somit auch persönliche Betreuungsangebote ausgefallen seien. Das Wohnumfeld sei zu wenig anregend für ihn. Er verfüge zudem über keine Beschäftigung in einer Werkstatt. Früher habe er Theater gespielt, dies dann später aufgegeben. In 2008 habe der Bewohner wieder Interesse an einer solchen Tätigkeit geäußert. Es gelinge der Einrichtung aber nicht, ihn zu den entsprechenden Orten zu begleiten. Die Angehörigen der verletzten Bewohner haben sehr beunruhigt reagiert und die Leitung zum Handeln aufgefordert. Eine Bewohnerin, die mindestens zweimal innerhalb kurzer Zeit angegriffen worden war, ist in eine andere Wohngruppe des Hauses umgezogen. Zum Problem der Gewalt hatte sich die Einrichtung längere Zeit von einem auf diesen Bereich spezialisierten Erziehungswissenschaftler beraten lassen.
Welche pädagogischen Versuche die Einrichtung speziell zur Bearbeitung des gewaltförmigen Verhaltens des genannten Bewohners unternommen hat, ist mir weitgehend verborgen geblieben. Mein "gefühlter Eindruck" war, dass hier Ratlosigkeit eine gewisse Rolle spielte und im Übrigen auf einen Auszug des Klienten gehofft wurde. Nach meiner begrenzten Informationslage wäre ein umfassenderes Angebot an individueller Betreuung durchaus denkbar gewesen, vor allem ein verstärktes Bemühen, dem Bewohner eine sinnstiftende Beschäftigung zu vermitteln.
b) Privateigentum: Mit der Aufteilung des Heims in kleinere Wohneinheiten hat die Kategorie des Privateigentums eine größere Relevanz erhalten. Möbel und Raumausstattungen gehörten seitdem vermehrt in den Privatbesitz der Wohngruppen bzw. der einzelnen Bewohner. Auch die Lebensmittel sind zum Teil den einzelnen Wohngruppen zugeteilt. Mit diesen neuen Besitzverhältnissen sind nach dem Umzug neue Unklarheiten bei allen Beteiligten entstanden.
Die meisten Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, haben sich über den Verlust von Lebens-mitteln beklagt. Sie vermuteten, dass ihnen Sachen aus dem Kühlschrank gestohlen worden waren. Fehlte ihnen dann etwas, gingen sie ihrerseits in andere Küchen und besorgten sich das ent-sprechende Gut. Mir hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass im Hause ständig "so hin und her gestohlen" wurde. Auch bei einigen Betreuern erschienen mir die Grenzen unklar. Ich konnte beobachten, dass die fehlenden Getränke eines Bewohners durch die Aneignung der Getränke eines anderen Bewohners kompensiert worden sind, "weil es jetzt anders gar nicht geht", argu-mentierte ein Mitarbeiter. Auch die Beteiligung am Essen der Bewohner seitens der Mitarbeiter erschien mir als eine Grauzone. Unklar war, inwieweit dies korrekt bezahlt wurde. Auch das Malzbier zwischendurch oder das eine oder andere Häppchen aus der Küche der Klienten, was sich einzelne Mitarbeiter genehmigt haben, erschien mir diskussionswürdig. Begünstigt wurde die unklare und lockere Handhabung des Privateigentums auch durch die mangelhafte Ausstattung der Küchen. Bei meinen Kochterminen konnte ich immer wieder feststellen, dass Gewürze und Geschirr fehlten. Auch ich habe dann in anderen Wohngruppen entsprechende Gegenstände ausgeliehen und am Ende nicht mehr gewusst, wo welches Ding hingehörte.
c) Sexualität und Partnerschaft: Die Themen Sexualität und Partnerschaft sind im Bereich der deutschen Behindertenhilfe bis heute mehr oder minder mit Tabus belegt. Sie werden nicht mehr offen negiert, aber stillschweigend dethematisiert - so als gäbe es dies nicht. In der Einrichtung sind mir die Bereiche Sexualität und Partnerschaft nach dem Umzug verstärkt aufgefallen. Im Hause selbst lebten ein homosexuelles und ein heterosexuelles Paar schon seit längerer Zeit. Beide Partnerschaften wurden von der Einrichtung akzeptiert und respektiert. Das homosexuelle Paar lebte mit zwei weiteren Klienten in einer WG. Das heterosexuelle Paar wohnte in getrennten Wohnungen und hatte sich sehr voneinander distanziert, seitdem der Mann verstärkt pflegebedürftig geworden war.
Ein neuer, jüngerer Bewohner und eine junge Bewohnerin, die in 2008 eingezogen sind, hatten Partner außerhalb der Einrichtung. Als deutlichen Schritt zur Öffnung nach außen sehe ich es an, dass die externen Partner in den Zimmern der Bewohner übernachten durften. Dies war anfangs im Team zwar umstritten, wurde aber bald zur Gewohnheit, so dass in diesem Bereich eine neue Privatheit und "Normalität" entwickelt werden konnte.
Das Interesse an Partnerschaft und Sexualität wurde auch von anderen Bewohnern geäußert. Ein Bewohner sehnte sich bereits seit langer Zeit nach einer Partnerin. Er hatte in der Vergangenheit häufiger Frauen kennen gelernt, aber ohne nachhaltige Erfolge. Dieser Bewohner äußerte sich sehr unzufrieden über seine Situation. Im Umgang mit Sexualität deutete sich nach Ansicht von Betreuern bei ihm ein pädagogischer Bedarf an. Dieser war seit längerer Zeit bekannt. Nach meinen Beobachtungen fehlte hierfür aber ein passendes Angebot. Auch andere Bewohner zeigten immer wieder Interesse an partnerschaftlichen Erfahrungen. Dies wurde oft nicht verbal und direkt geäußert, sondern vermittelt: Eine Bewohnerin schwärmte sehr häufig von Filmstars und zeigte mir Fotos von erotisch dargestellten Frauen. Eine andere Bewohnerin, so wurde mir berichtet, "baggere" in der Behindertendisco immer wieder junge Männer an, aber erfolglos.
.
Die Einrichtung ist keineswegs dafür zuständig, in allen Bereichen des Lebens glückliche Umstände zu bescheren. Gerade der Bereich der Liebe gehört in individualisierten Gesellschaften zur Privatsphäre, in der "jeder seines eigenen Glückes Schmied" ist. Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit: Auch in individualisierten Gesellschaften der privatisierten Partnerwahl hält die Gesellschaft kollektive Strukturen der Paarung bereit. Medial kommuniziert und konventionalisiert werden nonverbale Gesten, Flirtsprüche, Bekleidungsstile, subkulturelle Symbole, kulturindustriell reproduzierte Idealtypen, mit denen die Komplexität der (scheinbaren) Möglichkeiten überschaubarer wird. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft eine Vielzahl von Feldern der Paarung an: Diskotheken, Single-Partys, Internet, Arbeitsplatz oder Heiratsagenturen.
Der Zugang zu all diesen Feldern erfordert feldspezifisches Kapital: Geld, kommunikative Kompetenz, den jeweils subkulturell erwünschten Habitus, kulturelles Wissen über die Regeln des Feldes, die kulturindustriellen Symbole und Gesten. Zum Begriff der geistigen Behinderung gehört grundlegend die Isolation des betreffenden Individuums vom Zugang zum kulturhistorischen Erbe (s. Teil B, Kap. 1.4.2), somit auch vom Zugang zum symbolischen Kapital, das in den Feldern der Paarung erwartet wird. Aufgabe der Behindertenhilfe ist es grundsätzlich, die gesellschaftlichen Benachteiligungen der Hilfeberechtigten so weit wie möglich auszugleichen. Für den Bereich von Sexualität und Partnerschaft könnte dies bedeuten, die kulturelle Isolation zu überwinden, aber auch innerhalb des Behindertenmilieus soziale Paarungsfelder zu organisieren. Letztere existieren bereits in Form der Sonderzonen für Arbeit und Wohnen. Es gibt speziell für behinderte Menschen organisierte Disco-Abende und Partnervermittlungen. Was bislang in unserer Gesellschaft zu kurz kommt, sind Angebote zur sexuellen Aufklärung, therapeutische Gesprächsangebote und vor allem der Zugang zur "Normalgesellschaft".
Für Menschen mit besonderen Einschränkungen müssen besondere Angebote geschaffen werden. In der Einrichtung hatte unsere Forschungsgruppe einst vorgeschlagen, einen Tantra-Abend zu veranstalten. Diesen Vorschlag haben wir aber nicht hartnäckig verfolgt, so dass er nach einem Betreuerwechsel wieder in Vergessenheit geraten war. Als eine Möglichkeit für einige Bewohner sah ich auch Besuche in einem seriösen Bordell. Auf jeden Fall aber erschienen mir gezielte persönliche Gesprächsangebote zu diesem Themenkomplex bei vielen Bewohnern als sinnvoll. Auch wäre es denkbar gewesen, Kontakte zu Klienten anderer Träger im Bezirk zu organisieren, Partys zu veranstalten und eine Vernetzung im Freizeitbereich anzusteuern.
[11] Analysiert wurden folgende Konzepte und Artikel zu Individueller Hilfeplanung: 1. Eine Expertise zur Individuellen Hilfeplanung (Beck/Lübbe, 2002, 11f, 18f); 2. die Materialsammlung "Die Individuelle Hilfeplanung" (BHH, 2004, besonders Kap.1, Kap.10); 3. der Integrierte Behandlungs- und Rehabilitationsplan (Aktion-Psychisch-Kranke, 2005; Gromann, 2002); 4. Case Management (Adler 1998); 5. Individuelle Hilfeplanung mit dem Konzept LEWO (Schwarte/ Oberste-Ufer, 2001, 114ff.); 6. Individuelle Hilfeplanung Rheinland-Pfalz (MASFG, 2005). (Vgl. Lauenroth 2007, S. 65ff.)
[12] Müller-Kohlenberg/Kammann weisen darauf hin, dass ein solches Vorgehen zu "durch die Methode induzierten Ergebnissen" führt (Die NutzerInnenperspektive in der Evaluationsforschung. In: ebd.: Qualität von Humandienstleitungen, Opladen 2000, S.102). Müller-Kohlenberger weist des Weiteren darauf hin, dass die "Kluft zwischen dem, was Forscher als selbstverständlich oder interessant betrachten und der vielleicht fremden Welt von Behinderten oder Marginalisierten (...) mit standardisierten Verfahren kaum überwunden werden" kann (Müller-Kohlenberg, Jenseits der Neutralität, S.375. In: Beckmann et al (Hrsg.), Qualität in der Sozialen Arbeit, Wiesbaden 2004.
[13] Der Basisdienst ist die gruppenbezogene Präsenz von Betreuern in der Einrichtung. Er erfolgt im Schichtdienst und orientiert sich an den Regeln des allgemeinen Tagesablaufs.
[14] Den Begriff Klassenkampf verwende ich an dieser Stelle nicht wörtlich im Marx'schen Sinne, sondern als Anspielung auf Jantzens These. Gemeint ist hier vielmehr ein politischer und sozialpädagogisch fachlicher Kampf um Humanität, Freiheit und pädagogische Reformen.
Inhaltsverzeichnis
Die wissenschaftliche Begleitung durch die Forschungsgruppe hat sich fast die gesamte Zeit über als sehr konfliktreich erwiesen. Im Folgenden versuche ich, begrenzt nach den Möglichkeiten meiner eigenen Sicht eines an den Konflikten wesentlich beteiligten Akteurs, die Genese der Auseinander-setzungen zu rehistorisieren. Ich verwende hier häufig die Wir-Form, weil ich hier auch über Prozesse berichte, an denen die gesamte Forschungsgruppe beteiligt war.
Als schwierig habe ich anfangs lange Zeit die Unklarheiten empfunden, die mit unserem Auftrag einer wissenschaftlichen Begleitung verbunden waren. Unklar war für mich lange Zeit, was die Leitung genau von uns erwartete. Ebenso unklar blieb mir lange der Inhalt der geplanten Ambu-lantisierung. Ich hatte schwerpunktmäßig die Aufgabe der Evaluation übernommen. Angenehm war für mich, dass uns die Leitung konzeptionell weitgehend freie Hand gelassen hatte. So konnten wir Konzepte entwickeln, die unseren Vorstellungen entsprachen. Als irritierend habe ich zugleich eine gewisse Beliebigkeit seitens der Leitung empfunden. Auch wenn ich dies nicht mit Zitaten belegen kann, so machte sich bei mir bald der Eindruck breit, dass die Leitung an unserer Arbeit nicht ernsthaft interessiert war und wir eher eine Alibifunktion erfüllen sollten. Mit diesem rein subjektiven Eindruck stand ich innerhalb der Forschungsgruppe alleine. Mir wurde vorgeworfen, ich sei zu miss-trauisch. Da mögen meine Kollegen recht gehabt haben. Mein Misstrauen begründete sich mit meinen biografisch vorausgegangenen Erfahrungen mit Einrichtungsleitungen, bei denen ich immer wieder feststellen musste, dass es letztlich primär um wirtschaftliche Interessen ging, weniger um fachliche Inhalte. Besonders misstrauisch hatte mich von Anfang an der rhetorische Stil des Leiters gestimmt. Diesen habe ich als ausgeprägt monologisch, verwirrend und trickreich wahrgenommen.
Auf diese Weise war nicht nur mir, sondern auch meinen Forschungskollegen eine Zeit lang unklar geblieben, wie die Ambulantisierung ausgestaltet werden sollte. Wir fragten uns, wohin die Bewohner denn umziehen sollten. Die Leitung hatte zwar alles erklärt, aber wir konnten es nicht verstehen. Ich hielt es lange Zeit für ein Missverständnis, dass die räumliche Ambulantisierung nur ein Umzug ins Nebenhaus bedeuten und alle Bewohner weiterhin unter einem Dach wohnen sollten. Ein solches Modell war mir völlig fremd und alleine die Erwägung, dies als eine Ambulantisierung verstehen zu können, war mir so sehr abwegig erschienen, dass ich sie in meinen Gedanken sofort verworfen hatte. Hier hatte ich meine Erfahrungen aus meiner vorherigen Arbeit in der ambulanten Behindertenhilfe direkt auf das neue Projekt übertragen und konnte es nicht fassen. Wie dehnbar aber der Begriff der Ambulantisierung tatsächlich ist, erfuhr ich erst später.
Mit diesen Eindrücken hatte sich bei mir schon bald zu Beginn der Arbeit eine sehr skeptische Haltung vor allem gegenüber der Leitung eingestellt. Eine gewisse Grundenttäuschung, dass es nach meiner unmittelbaren Beurteilung nur eine "Pseudo-Ambulantisierung" werden sollte, beeinflusste meine Herangehensweise negativ. Mit dieser vorschnellen Deutung habe ich den Subjektstandpunkt der Gegenseite in Frage gestellt und mir eine detektivische Haltung, die mir in meinem früheren Beruf als Journalist sehr hilfreich war, wieder zugelegt.
Als problematisch hat sich auch die erste Annäherung an die Einrichtung erwiesen. Ich habe seit Juni 2006 das Heim besucht, vor allem um einleitende Erkundungen über die beteiligten Personen, deren Handeln, Denken und die Strukturen des Alltags durchzuführen. Ich empfand es als schwierig, einen Überblick zu gewinnen, weil ich lange Zeit keine Gelegenheit finden konnte, das gesamte Team sehen zu können. Auch die Abläufe blieben lange mir verborgen. Ich konnte jeweils nur kleine Ausschnitte wahrnehmen. Viele Mitarbeiter traten mir anfangs sehr reserviert gegenüber. Sie beschwerten sich bei der Leitung über mich, weil sie sich durch meine situativen Fragen gestört fühlten. Überhaupt gewann ich den Eindruck, durch meine Anwesenheit die Betreuer bei ihrer Arbeit zu stören. Das wiederum störte mich, weil ich von der Leitung den Auftrag erhalten hatte, zu evaluieren. Wie sollte das anders gehen, als durch eine direkte Präsenz im Alltag und ohne situationsbezogene Fragen?
Als Alternative zu den situativen Fragen während der Arbeit wurden mir die Vorschläge gemacht, während der direkten Beobachtung Fragen zu notieren und diese am Ende meines Besuchs den Betreuern zu stellen und/oder meine Fragen auf der Dienstbesprechung zu stellen. Beide Vorschläge hatten sich aus meiner Sicht bald als wenig praktikabel erwiesen, weil zum einen am Ende meiner Besuche zu wenig Zeit war, um Fragen zu klären, zum anderen, weil in den Dienstbesprechungen dann oft gerade die Betreuer nicht anwesend waren, die ich fragen wollte und außerdem auch dort nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stand. Vermutlich ist in diesem Prozess mein anfängliches Misstrauen auf ein Gegenmisstrauen gestoßen, so dass das misstrauische Verhältnis verstärkt worden ist.
Abgesehen von meinem vorauseilenden Misstrauen und detektivischem Eifer, mehr über die Hintergründe und Zusammenhänge wissen zu wollen, konnte ich später erfahren, dass wir mit unserer wissenschaftlichen Begleitung und insbesondere ich mit meiner Evaluation auch "zwischen die Fronten" geraten waren. Denn zwischen der Leitung und einem Teil der Mitarbeiter war das Verhältnis angespannt und ebenfalls durch Misstrauen beeinträchtigt. Es gab eine Reihe Konflikte. Das Vorhaben der Ambulantisierung zumindest war einseitig von der Leitung initiiert worden und bei vielen Mitarbeitern auf große Skepsis gestoßen. Sie befürchteten nämlich Stellenabbau und höhere Arbeitsbelastung. Auch die wissenschaftliche Begleitung hatte die Leitung ohne Rückendeckung ihrer Belegschaft bestellt. Wie mir später zwei Betreuer mitteilten, wurden wir, besonders ich, von einigen Mitarbeitern als "Agenten des Chefs" angesehen. Da wir von ihm den Auftrag hatten, wurde angenommen, dass wir im Sinne der Leitung Informationen sammelten und kontrollierten. Hier bestätigte sich das, was Monika Sieverding als eine Instrumentalisierung der Forscher bezeichnet: "Interne Machtkämpfe werden an die ForscherInnen delegiert. Die ForscherInnen werden zur Koalition gegen ... aufgefordert" (Sieverding 1980, S.130)
Als nächsten Schritt werden in einem Projekt der Handlungsforschung die Forscher bekämpft, konstatiert Sieverding. Auch dazu kam es bei uns gleich in den ersten Monaten. Als wir bei unserem ersten Besuch einer Dienstbesprechung über meine ersten Eindrücke berichteten, kam es zum offenen Streit. Dazu muss zunächst kurz der Hintergrund dargestellt werden: Mir war nach einigen Besuchen deutlich geworden, dass zahlreiche Bewohner nicht sprachen. Ich fragte Mitarbeiter nach den Gründen und bekam zu hören, dass einige jener sprachlosen Bewohner früher einmal bzw. auch noch gegenwärtig sprechen konnten, aber dennoch stumm blieben. Ich fragte dann auch, ob die Einrichtung schon mal beispielsweise Hilfsmittel wie BLISS-Zeichen angeboten habe. Darauf antwortete eine Betreuerin, dies sei schon mal versucht worden und wieder "versandet". Mein Eindruck nach diesem Besuch war, dass die Einrichtung nicht alle Möglichkeiten ausschöpfte, um die Bewohner bei der Entwicklung ihrer sprachlichen Kompetenzen zu fördern. Mir drängte sich sogar der Eindruck auf, dass ein langes Wohnen in der Einrichtung dazu führen könne, die Sprache zu verlieren.
In jener Dienstbesprechung fasste Bader diesen Eindruck provokativ mit dem Satz zusammen: "Wir haben den Eindruck gewonnen, die Einrichtung macht stumm." Dieser Satz schlug bei der Leitung wie eine Bombe ein. Obwohl wir die These differenziert begründeten, hatten wir mit einem Schlag die versammelte Runde gegen uns aufgebracht. Die Leitung argumentierte, dass die sprachlichen Einschränkungen einiger Bewohner nichts mit der Einrichtung zu hätten. "Ihr habt ja keine Ahnung. Ihr kennt die Zusammenhänge nicht..." Das Team war empört. Der Leiter erklärte uns, dass diese Beobachtung unzweifelhaft falsch sein müsse und dies nicht zum Auftrag unserer wissenschaftlichen Begleitung gehöre. Wir wurden öffentlich abqualifiziert und zur Rede gestellt. Mit diesem Eklat hatte der Leiter die Gelegenheit erhalten, sich demonstrativ mit seinen Mitarbeitern zu solidarisieren. Für unser Verhältnis zu den Mitarbeitern hatte dies den Vorteil, dass wir nicht länger als "die Agenten der Leitung" angesehen wurden. Resultat dieses Zwischenfalls war, dass einerseits wir mit dem Thema Sprachkompetenz "in Deckung" gingen, um den Konflikt nicht zu verschärfen. Offenbar war dies ein Tabu in der Einrichtung, dachte ich. Andererseits hatte der Vorfall zur Folge, dass nach und nach einzelne Mitarbeiter den Kontakt zu mir suchten, um mir über die "Vergehen" der Leitung zu berichten. Auf diese Weise gelang mir, über einzelne Betreuer meinen Zugang zur Einrichtung zu verbessern.
Das Problem der Kommunikation zwischen der Einrichtung und der Forschungsgruppe konnte auch nach diesem Streit nicht zufriedenstellend gelöst werden und hat sich bis zum Abschluss meiner Mitarbeit hingezogen. In unserer Forschungsgruppe war die meiste Zeit über "das Gefühl" erhalten geblieben, dass wir sehr außen vor standen. Wir hatten oft den Eindruck, nur sehr spät zu erfahren, was in der Einrichtung geschah. Auf mich wirkte dieser Umstand frustrierend. Unter dem Auftrag einer wissenschaftlichen Begleitung hatte ich erwartet, dass die Leitung eine Art Beratung von außen wünscht, uns vor wesentlichen Entscheidungen nach unserer Einschätzung fragt, dass die Einrichtung eine enge Zusammenarbeit, Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung sucht. Dem war aber nach meiner subjektiv involvierten Wahrnehmung nicht so, sondern umgekehrt: Bei mir kam der Wunsch an, "lasst uns bloß zufrieden". Die Fragen, wo stehen wir, wie machen wir weiter und wie kommen wir besser in Kontakt mit der Einrichtung, wurden zum Dauerthema in der Forschungsgruppe.
Wie kommen wir besser in Kontakt? Wir hatten den Anspruch, mit den betroffenen Menschen gemeinsam zu forschen. Mit zahlreichen Bewohnern war dies relativ reibungslos gelungen. Die Kommunikation mit Leitung und Belegschaft war schwierig. Meine Beobachtungen vor Ort protokollierte ich nach meinen Besuchen und notierte abschließend meine Gedanken über mögliche Zusammenhänge. Diese diskutierten wir regelmäßig in der Forschungsgruppe. Die Diskussion aber mit den Mitarbeitern und der Leitung kam kaum in Gang. Ansatzweise konnten wir bei den Dienstbespechungen Fragen stellen. Meist aber sprach der Leiter. Auf meine kritischen Anmerkungen reagierte er nicht selten schroff: Seine abweisenden Argumente waren häufig jene: 'Das stimmt überhaupt nicht'; 'Ihr wisst das alles gar nicht'; 'Das brauchen wir nicht': 'Kritik bringt uns nicht weiter'; 'Das kennen wir doch schon längst'. Zahlreiche Mitarbeiter reagierten ebenfalls wenig erfreut. Sie warfen uns vor: 'Das ist graue Theorie. Ihr habt von der Praxis keine Ahnung'; 'Ihr kennt die Zusammenhänge nicht'; 'Dafür haben wir keine Zeit'; 'Das liegt an der Behinderung des Bewohners, aber nicht an uns'.
Mit einigen Betreuern gelang uns dennoch, ein intensives Arbeitsverhältnis herzustellen. Ein Heilpädagoge war von Anfang an von unseren "provokativen Fragen" begeistert, weil damit eingeschliffene Routinen hinterfragt werden konnten. Der Mitarbeiter stand jenen Arbeitsroutinen, die auf den geordneten Tagesablauf zielten, sehr kritisch gegenüber und wünschte Veränderungen. Gemeinsam mit ihm gelang es mir, einige Fragen zu klären und Hypothesen zu diskutieren. Bei einem anderen Betreuer stellte sich irgendwann heraus, dass wir beide gleiche Sportinteressen teilten und politisch ähnliche Ansichten vertraten. Auch mit ihm konnte ich eine intensive und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung aufbauen. Eine neue Kollegin, die Anfang 2007 in der Einrichtung zu arbeiten begann, hatte ich bereits an der Fachhochschule als Kommilitonin kennen gelernt. Sie nahm meine Thesen, Anregungen und Fragen meist als eine Bereicherung auf, so dass ich auch mit ihr, soweit Zeit vorhanden war, gemeinsam forschen konnte. Eine weitere Betreuerin, die uns anfangs wegen unserer "Theorielastigkeit" sehr skeptisch gegenüber gestanden hatte, kam dann auf uns zu, nachdem wir gemeinsam mit ihr ein Hilfeplangespräch bezüglich eines Bewohners durchgeführt hatten. Bei diesem Gespräch hatte sie den Eindruck gewonnen, dass wir gewisse unhinterfragte Deutungsmuster auf den Prüfstand stellten und ihr damit hilfreiche Anregungen für neue Ansätze anbieten konnten. Auch mit dieser Pädagogin entstand ein vertrauensvolles Verhältnis in der Folgezeit.
Eine weitere Möglichkeit zum engeren Austausch mit den Betreuern hatte sich in Arbeitsgruppen ergeben, die im ersten Halbjahr 2007 in unregelmäßigen Abständen stattgefunden haben. In den Arbeitsgruppen haben die Mitarbeiter über die künftige Umgestaltung ihrer Arbeit im Zuge der anstehenden Ambulantisierung beraten. An diesen Treffen nahm ich regelmäßig teil. Dabei war es gelungen, öfter einzelne Aspekte der Betreuung im Detail ausführlich zu diskutieren. Die Mitarbeiter zeigten sich in diesem Setting sehr kooperativ und meinen Beiträgen gegenüber interessiert. Insgesamt nahm ich diese Gruppen als ein weitgehend gelungenes Arbeitsforum wahr. Einschränkend muss ich erwähnen, dass die Kontinuität der Arbeit durch eine unregelmäßige Teilnahme seitens der Betreuer beeinträchtigt war. Die Diskussionen wiederholten sich oft, weil einzelne Mitarbeiter nicht anwesend waren. Dennoch erwiesen sich die Kleingruppen als eine der wenigen Situationen, in denen mir ein enger Kontakt mit dem Team gelungen war.
Ein intensives Arbeitsverhältnis bestand zwischen Mitte 2006 bis Ende 2007 auch mit einer Sozial-pädagogin, die in der Einrichtung ihr Anerkennungsjahr absolvierte. Sie war von der Leitung beauftragt worden, in der Forschungsgruppe als Vertreterin der Einrichtung mit zu arbeiten. Die Kollegin informierte uns über Veränderungen, über ihre eigenen Arbeitserfahrungen, über die Stim-mung in der Belegschaft. Mit ihr konnten wir auch widersprüchliche Standpunkte diskutieren und einen Informationsfluss zur Einrichtung aufbauen. Dies alles hatte jedoch Grenzen. Eine nicht unbe-deutende Grenze bestand darin, dass der Informationsfluss oft an der Schaltstelle der Vertreterin ins Stocken geriet. Die Sozialpädagogin hatte ihrerseits oft keine Gelegenheit, das, was sie mit uns diskutiert hatte, entweder dem Team oder der Leitung weiterzugeben. Die Vertretungsfunktion konnte nach meiner Wahrnehmung nur unbefriedigend erfüllt werden, so dass es eher eine selektive Zusammenarbeit mit dieser einzelnen Kollegin war. Das lange Zeit intensive Verhältnis mit der Sozialpädagogin wurde dann eingetrübt, als wir den Zwischenbericht zur Evaluation erstellten. Da wir kein Zeugnis vom urteilenden Außenstandpunkt aus schreiben, sondern die Einrichtung dialogisch daran beteiligen wollten, haben wir der Vertreterin unsere Entwürfe vorher gezeigt, mit der Bitte um Anmerkungen und Ergänzungen. Dies sollte aber vertraulich ohne Beteiligung der Leitung geschehen, weil wir unsere Kritik nicht vorab zensieren lassen wollten. Trotzdem teilte mir die Vertreterin am Ende mit, dass sie unsere Entwürfe ihrem Chef weitergeleitet hatte. Dies führte bei mir zu einem Vertrauensbruch.
Neben diesen Kanälen der direkten Kommunikation nutzten wir das Medium der Emails, um unsere Erfahrungen und Reflexionen dem Team mitzuteilen. Grund dafür war die knappe Zeit der Mitarbeiter für direkte Gespräche mit uns. Wir hatten innerhalb unserer Forschungsgruppe schon gleich zu Beginn per Email kommuniziert. Um die Beteuer langsam in die Diskussionen mit einzubeziehen, nahm ich ab Ende 2006 einzelne Mitarbeiter, zu denen ein gutes Verhältnis bestand, in unseren Emailverteiler auf und sendete ihnen meine Protokolle. Selektiv kam langsam ein Dialog über das Internet zustande. Im Wesentlichen war es ein Pädagoge, der sich mit uns auseinandersetzte. Unsere Emails gelangten dann über diesen Weg zunehmend auch an andere Betreuer, sie wurden in die Umlaufmappe abgeheftet. Somit erreichten meine Beobachtungsprotokolle und die Kommentare meiner Kollegen dazu ab Anfang 2007 nahezu das gesamte Team. Dieser Kommunikationskanal blieb jedoch, abgesehen von den Rückmeldungen eines Betreuers, weitgehend eine Einbahnstraße und löste oft Verärgerung im Team aus. Als Grund für die häufigen Verärgerungen sehe ich den auf die Mitarbeiter provokativ wirkenden Stil meiner Protokolle an.
Provokativ war mein Protokollstil deswegen, weil ich aus meinen jeweiligen Beobachtungen versucht hatte, Hypothesen über grundlegende Zusammenhänge abzuleiten. Dabei nahm ich reflexiv den Außenstandpunkt ein und betrachtete das Geschehen aus einer distanzierten Perspektive, bei der ich die innerhalb der Einrichtung geltenden Regeln und Deutungsmuster, sofern sie mir überhaupt bekannt waren, methodisch ausblendete und sie in den Kontext eines erweiterten Wahrheitsraumes versetzte, um so die institutionsspezifischen Konstitutionsbedingungen von Deutungsmustern erkennbar werden zu lassen .Die Legitimation dieses Vorgehens begründete sich für mich durch den Auftrag einer wissenschaftlichen Begleitung, was für mich als Soziologe bedeutete, alltagsweltliche Selbstverständlichkeiten analytisch zu zerlegen, sie von Grund auf zu hinterfragen, um sie anschließend rational so modifizieren zu können, damit sie dem Zweck der sozialen Handlungseinheit (der Einrichtung) zielgerichtet besser entsprechen. Der Zweck der Einrichtung und des aktuellen Handelns bestand perspektivisch in der Ambulantisierung und der sozialen Eingliederung der Bewohner. Auf dieser Folie der ambulanten Zielsetzung rekonstruierte ich die beobachteten Handlungssequenzen und glich das Bestehende mit dem Sein-Sollenden ab, um im Konkreten zu verdeutlichen, wo sich die alten stationären Strukturen manifestierten. Dies betrachtete ich ruhigen Gewissens als meinen Auftrag und war sehr verwundert, als dieser mir zum Vorwurf gemacht wurde. Einige Mitarbeiter konnten für meine provokativen Dekonstruktionsansätze wenig Verständnis aufbringen. Sie fühlten sich in ihrer Leistung abgewertet und beleidigt. Einige beschwerten sich bei der Leitung darüber und erhielten von dort Unterstützung.
In einer Dienstbesprechung wurde im Mai 2007 folgendes Ereignis diskutiert: Die Bewohnerin E. hatte eines Nachts ihr Bett auseinander gebaut und darunter den Boden gereinigt. Am Morgen war sie dabei, es wieder zusammen zu bauen. Dann kam ein Betreuer und unterbrach E. dabei. Im Team wurde dieses Ereignis als Problem diskutiert. Die Frage war, "was hat das zu bedeuten?" Solche Vorkommnisse wurden bei E. immer als Hinweise für eine psychische Problemlage bzw. für eine mentale Instabilität gedeutet. Mitunter wurde auch die Interpretation vertreten, dass es sich um eine zweckrationale Handlung gehandelt haben könnte: Die Bewohnerin wollte sauber machen.
Den Diskurs über das Ereignis deutete ich in meinem Email-Protokoll so:
"Das Problem, was sich bei E. und ihrem Bett zeigt, ist, dass die zugrunde liegende Handlung nur unter der Bedingung der Überwachung zu einem Problem werden konnte. Erst durch die aktenkundige Registrierung des Vorfalls konnte der Umbau des Bettes als pathologisch relevanter Tatbestand überhaupt erfasst werden. Die Tatsache, dass E. in der Nacht ihr Bett abgebaut hat, wäre unter normalen Umständen für niemanden in der Welt zu einem Thema geworden. Es konnte nur deswegen zum Thema und somit zum Anzeichen einer psychischen Irregularität werden, indem 1. morgens ein Betreuer ins Zimmer tritt und 2. dieser Aktennotizen über nach seiner Ansicht besondere Vorkommnisse macht. Erst diese außergewöhnlichen Rahmenbedingungen lassen eine ansonsten banale Handlung zu einem Problem werden."
Mit dieser, aus der soziologischen Vogelperspektive entwickelten Sichtweise setzte ich methodisch bewusst das interne Deutungsmuster außer Kraft, um den institutionellen Rahmen, die aktive, aber offenbar unbewusste Konstruktionsleistung der Mitarbeiter offen zu legen. Mir ging es darum, die Mechanismen der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zu verdeutlichen: Sofern bei einem Menschen abweichendes Verhalten erwartet wird und andere sich darum bemühen es zu registrieren, bleibt es meist auch nicht aus, fündig zu werden. Das stationäre Setting schafft sich seine eigene Notwendigkeit durch die Aufdeckung entsprechender "Vorfälle" und rechtfertigt damit seinen Fortbestand. Meine Kritik zielte auf eine Bedingungsreflexion, auf eine Differenzierung der problematischen Handlung "an sich" und der Wahrnehmung jener Handlung durch andere. Was wollte die Bewohnerin mit dieser Handlung erreichen? Was wollte sie kompensieren und warum in der Nacht? Konnte es sein, dass die Nacht ein Freiraum bedeutete, weil am Tage zu viele Betreuer anwesend waren? War die Handlung eventuell als eine Stärke zu sehen: E. kann sogar ihr Bett demontieren?Sofern jedoch umgekehrt "das Problem" einseitig in der psychischen Struktur des Klienten verortet wird, zeigt sich keine Notwendigkeit für die Einrichtung zur Veränderung. Das Problem liegt dann in "ihrer Behinderung" begründet, wird verdinglicht und die ambulante Zielrichtung (mehr Selbstbestimmung und weniger Kontrolle) schwindet aus dem Blick.
Durch diese Email war Ende Mai 2007 das Verhältnis zwischen uns und der Einrichtung in eine Krise geraten. Die Leitung war sehr empört und fasste meinen Text als eine Beleidigung auf. Auch zahlreiche Mitarbeiter reagierten verärgert. Auf diesen Konflikt hin beschloss unsere Forschungsgruppe, keine Emails mehr an die Mitarbeiter zu senden und Kritik im direkten Gespräch zu diskutieren. Problematische Beobachtungen sollten erst einmal intern diskutiert und anschließend mit den betreffenden Betreuern oder auf der Teamsitzung direkt besprochen werden. Grund für diese Zurückhaltung war, dass durch unsere (vor allem meine) direkten Rückmeldungen per Email eine dialogische Auseinandersetzung nicht stattfinden konnte. Durch meinen schriftlichen Weg der Kritik hatte ich vielmehr Konfrontationen geschaffen, indem ich den Mitarbeitern meine Sichtweise konträr zu ihrer "vorgeknallt" hatte. Diese "vorgeknallten" Hypothesen kamen dort als "objektive" Feststellungen an. Das wirkte anklagend und entwertete die Arbeit der Betreuer. Deren Arbeitsstil und Weltbild wurden auf einen Schlag durch die "Instanz der Wissenschaft" für nichtig erklärt.
Nur wenige Betreuer haben meine Kritiken als bereichernd empfunden und sie dazu genutzt, ihre Praxis zu reflektieren und zu verändern. Erst später ist mir durch andere Erfahrungen bewusst geworden, dass mein Protest, der in meinen Emails enthalten war, emotional sehr stark besetzt war. Ich fühlte mich mit den Bewohnern solidarisch verbunden und versuchte nach zu fühlen, wie es sein mag, wenn ich nun an deren Stelle dort wohnen würde. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich noch nicht einmal nachts mein Bett auseinander bauen dürfte?. An dieser Stelle muss ich Vygotskijs Theorem der dialektischen Einheit von Kognition und Emotion auf mich selber anwenden: Das Erleben, oder besser: mein Erleben, besteht aus der Einheit von Emotion und Kognition in der jeweiligen Situation. "Das Denken kann Sklave der Leidenschaften, ihr Diener oder aber ihr Herr sein." (Vygotskij 2001a, S.162) Es kommt auf das Verhältnis beider zueinander an, welches sich dynamisch entwickelt und verändern kann. Den "Vorfall" mit E. erlebte ich unter der emotionalen Dominanz der Empörung, wodurch meine kognitive Wahrnehmung auf den Aspekt der Überwachung gelenkt worden war. Diesen Aspekt halte ich nach wie vor für bedeutend und wichtig. Den anderen Aspekt aber, jenen der Fürsorge, den wohl die Betreuer mehrheitlich erkannten, wurde durch meine besondere emotionale Besetzung der Wahrnehmung in den Hintergrund gedrängt.
Die Konfrontationen basierten nicht nur auf fachlichen Differenzen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene. Für meine Kontrahenten und mich waren Szenen wie jene mit E. emotional jeweils genau umgekehrt besetzt. Das Denken war auf beiden Seiten zum Sklaven der Leidenschaften geworden. Die emotionalen Wertungen der kognitiven Inhalte basieren auf ganz individuell eigenen synaptischen Verbindungen, die sich aus den biografischen Erfahrungen des Subjekts ergeben. Sie sind rehistorisierbar, verstehbar und vernünftig im Kontext der jeweils gesellschaftlich vermittelten Stellung des Individuums zur Welt. Diese gesellschaftlich vermittelte Stellung des Individuums zur Welt ist allgemein und besonders zugleich. Allgemein, insofern wir alle innerhalb gleicher übergeordneter sozialer Strukturen leben, besonders, insofern jeder von uns aus einer anderen Position heraus sich auf diese gemeinsamen Strukturen bezieht. Die Wahrnehmung eines Geschehens wird jeweils aus der individuell besonderen Position und Biografie heraus kognitiv eingeordnet und emotional besetzt. Szenen wie die mit E. können so ganz unterschiedliche Bedeutungen erhalten. Nützlich ist dabei eine diskursive Verständigung, bei der genau jene vorausgehenden Positionen, Zuordnungen und emotional-kognitiven Verknüpfungen entschlüsselt werden können. Dies kann nicht per Email gelingen und auch nicht bei den Dienstbesprechungen. Notwendig wäre ein ganz anderer Diskursrahmen gewesen, der vielmehr Zeit, Konzentration und Vertrauen ermöglicht hätte. Meinerseits hätte ein etwas leidenschaftsärmeres Denken, das die Möglichkeiten und Grenzen "nüchtern" und pragmatisch abwägt, zu jener Zeit hilfreich sein können.
Nach dem Konflikt um den "Vorfall" mit E. begann ich mit der Vorbereitung des Zwischenberichtes zur Evaluation. Dabei war mir aufgefallen, dass die Einrichtung noch über kein nach meiner Auffassung systematisches Aufnahmeverfahren verfügte. Nach meinen Recherchen zogen neue Bewohner ein, wobei die betreffenden Bezugsbetreuer von der Leitung keine geordneten Informationen die Hintergründe des Klienten erhielten. Im Kontext des Auftrages zur Qualitäts-entwicklung sah ich es als Teil meines bzw. unserer Aufgabe an, ein entsprechendes Konzept anzubieten. Im August 2007 entwickelte ich gemeinsam mit Markus Lauenroth einen Leitfaden für das, was wir für die Aufnahme neuer Bewohner für erforderlich hielten. Darin wurde nach den vorhandenen psychologischen und medizinischen Diagnosen gefragt, nach dem Auftrag des Klienten an die Einrichtung, nach dem Hilfeverlauf in anderen Einrichtungen usw. Wir schickten dieses Konzept mit bester Absicht an die Leitung. Doch anstatt eines Dankes erhielten wir eine "schallende Ohrfeige". Die Leitung sah unseren Service als Anmaßung an und argumentierte, dies gebe es doch schon längst, es werde bloß nicht schriftlich festgehalten. "Kümmert Euch um Eure Aufgaben und mischt Euch nicht in Sachen ein, die nicht dazu gehören."
Der nächste Konflikt ließ dann nicht lange auf sich warten. Er ereignete sich im Oktober 2007. Der Bewohner J. hatte zwei Betreuer geschlagen. Sein Bezugsbetreuer hatte den Vorfall ausführlich protokolliert. Im Team herrschte größte Aufregung. Der Problemträger stand fest: es war J.. Man erwog sogar ihn zu einem Psychiater zu führen. Für mich erschien dieser Ansatz als zu einfach. Mich wunderte es vielmehr, dass die Bewohner so selten gewalttätig wurden, zumal ich mir deren Leben als äußerst langweilig und perspektivlos vorstellte, sofern ich mich in sie hinein zu versetzen versucht hatte. Anstatt mich auf den Problemträger "zu stürzen", betrachtete ich diskursanalytisch die Narration des Vorfalls. Denn dieser Aspekt war im Team niemandem eingefallen. Meine Vorannahme dabei war die, dass der Vorfall als solcher zwar bedauernswert ist, er aber unter den Bedingungen und im Rahmen der Einrichtung stattfand. Aus diesem Grunde wäre es unredlich, die Tat isoliert dem "Täter" zuzuschreiben, sondern das gesamte System, in welchem der Bewohner lebte und eine Zeit lang sozialisiert worden war, war Bestandteil der kritischen Episode und mit verantwortlich. In meiner Protokollanalyse distanzierte ich mich somit bewusst von der Perspektive des Protokollanten und rekonstruierte stattdessen die Narrationslogik. Dabei ging ich von der Annahme aus, dass das Schreiben eines Protokolls nicht nur die Wiedergabe eines Ereignisses ist, sondern zugleich immer eine subjektive Auswahl von Elementen des Geschehens und eine Konstruktion von Zusammenhängen, Abläufen sowie Gewichtungen einzelner Elemente darstellt. Der Erzähler erzählt immer seine eigene Geschichte und ist dabei gestaltendes Subjekt der Erzählung. Im Prozess der Erzählung werden dann die Geschehnisse geordnet und mit einem Sinn unterlegt, der eine Lösung begründen kann.
Dieses Protokoll hatte ich nicht an das Team adressiert, sondern nur an die Forschungsgruppe gesendet, wozu auch die Vertreterin der Einrichtung gehörte. Diese heftete das Protokoll anschließend im Umlaufordner ab, so dass es dem gesamten Team und der Leitung zugänglich wurde. Die Leitung reagierte wütend, der Protokollant ebenfalls. Dieser brach sogar den Kontakt zu mir ab und kündigte an, nicht mehr mit mir sprechen zu wollen.
Mein grundlegender Fehler bei diesem Eklat bestand darin, dass ich das Protokoll der Vertreterin gesendet hatte, obwohl ich bereits wusste, dass sie vertrauliche Informationen unter der Hand an die Leitung weiterleitete. Dies hatte ich im Rahmen des Zwischenberichtes erfahren. Den Inhalt des Protokolls halte ich weiterhin für berechtigt und für eine wertvolle Betrachtungsweise. Der Ton aber macht die Musik: Klar ist, dass mein zugespitzter und provokativer Stil des Textes nicht die am Vorfall unmittelbar beteiligten Personen hätte erreichen dürfen. Diese sind verständlicherweise persönlich davon betroffen und verletzlich. Der Vorfall, die Schläge des Klienten, waren ein zutiefst emotional besetztes Erlebnis. Meine äußerst distanzierte Interpretation hätte selbstverständlich innerhalb des Rahmens der engeren Forschungsgruppe bleiben müssen. Im nächsten Schritt aber wäre ein Gespräch mit dem betreffenden Betreuer notwendig gewesen, um die unterschiedlichen Wahrnehmungen auszutauschen, die verschiedenen Standpunkte offen zu legen und Hypothesen über das Geschehen zu diskutieren.
Nicht genug des Ärgers, kam es bereits Ende November zum nächsten Konflikt. Bei einem Besuch in der Einrichtung hatte ich beobachtet, wie eine Betreuerin den stark pflegebedürftigen Bewohner H. schubste, weil er nicht im erwünschten Tempo ins Haus hinein gehen wollte. Ich war empört, schrieb ein Protokoll und sendete dies auch dem zuständigen Bezugsbetreuer, weil dieser für die Koordination sowie Ziele und Methoden der Betreuung verantwortlich war. Vorausgegangen war eine Woche zuvor eine rehistorisierende Beratung im Beisein des Bewohners (s. Teil D, Kap. 2.2.1), des Bezugsbetreuers sowie der betreffenden Honorarkraft. In diesem Gespräch waren wir u.a. zu dem Ergebnis gelangt, dass der Bewohner ein Maximum an möglichen Freiheiten benötigte, dass neue Entfaltungsräume gesucht und man ihm möglichst seinen eigenen Handlungsrhythmus belassen sollte. Gerade deswegen hatte ich es für erforderlich gehalten, dem Bezugsbetreuer den Vorfall mit zu teilen. Da es dabei um Gewalt ging, sah sich dieser genötigt, mein Protokoll der Leitung weiterzuleiten.
In der folgenden Dienstbesprechung eskalierte der Konflikt. Leitung und Team stellten sich fast geschlossen hinter die Betreuerin. Mir wurde vorgeworfen, die Mitarbeiter zu bespitzeln, zu denunzieren und vorschnell zu verurteilen. Der Leiter verordnete der Forschungsgruppe eine Besinnungspause für drei Monate. In dieser Zeit sollten wir die Einrichtung nicht betreten. Die betreffende Honorarkraft wurde in eine Festanstellung übernommen. Nach wie vor beurteile ich die Mitteilung meiner kritischen Beobachtung an den Bezugsbetreuer als richtig. Falsch war auf jeden Fall meine Form: erstens das Medium Email und zweitens die indirekte Art. Ich hätte fairerweise die betreffende Betreuerin an Ort und Stelle auf ihr Verhalten ansprechen müssen.
Als wir im Februar wieder mit unserer Arbeit vor Ort begannen, näherten wir uns zunächst vorsichtig der Einrichtung an. Wir waren darauf bedacht, Konflikte zu vermeiden. Der Kontakt zum Leiter reduzierte sich auf ein Minimum. Die direkte Leitung des Hauses übernahm eine Sozialpädagogin, die im Mai 2007 in der Einrichtung zu arbeiten begonnen hatte. Mit ihr erschien uns ein Auskommen besser zu gelingen, zumal sie ein offenes Interesse an unserer Arbeit zeigte und mit uns in dialogische und ausgewogene Diskussionen trat. In der Belegschaft gab es größere Wechsel. Es kamen zunächst zahlreiche Vertretungskräfte hinzu, weil nach dem Umzug ins Nebengebäude viele Betreuer krank geworden waren. Im Laufe des Jahres 2008 waren fünf neue Mitarbeiter eingestellt worden - fast die Hälfte der Belegschaft wurde ausgetauscht.
Mein Verhältnis zu den Mitarbeitern entwickelte sich nach der Besinnungspause vorsichtig bis distanziert. Mit zwei Betreuern blieb ein engeres und vertrauliches Verhältnis erhalten. Einer davon fiel jedoch wegen Krankheit für mehrere Monate aus. Einige Betreuer mieden weiterhin den Kontakt zu mir. Zu dem "Protokollanten" des gewalttätigen Vorfalls entspannte sich das Verhältnis allerdings deutlich, so dass wir wieder miteinander ins Gespräch kamen. Auch mit der Betreuerin, die ich beim Schubsen beobachtet hatte, pendelte sich das Verhältnis wieder ein. Der einzig größere Konflikt entstand dann im Zuge meines Projektes "autonomes Kochen" (s. Teil D, Kap. 3.3), den ich hier nicht wiederholt darstellen möchte.
Eine weitaus gelungene Kooperation ergab sich mit einem Betreuer, der meinen Ansätzen sehr positiv gegenüberstand. Mit ihm zusammen begleitete ich seinen Klienten zu den Eltern, führte längere Hintergrundgespräche und konnte auch wahrnehmen, wie der Pädagoge Anregungen meinerseits aufgriff und umsetzte. In Bezug zu seinem Klienten hatte der Betreuer auf meine Empfehlung hin einen für behinderte Menschen spezialisierten Neurologen konsultiert, einen anderen Bewohner gezielt beim Aufräumen seines Zimmers unterstützt und diesen auf meine Initiative hin zu sich privat nach Hause eingeladen, um ihm eine andere Wohnformen zu zeigen.
Nicht ganz reibungslos, aber mit Erfolgen verlief auch die Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin. Die Sozialpädagogin reagierte nicht selten auf unsere Fragen gereizt und sah sich in einem "Rechtfertigungsdruck", wie sie selber sagte. Unsere Fragen müssen offenbar prüfend auf sie gewirkt haben, zumal wir immer wieder wahrgenommene Schwachstellen angesprochen haben. Eine dieser Schwachstellen betraf eine Bewohnerin mit besonders hohem Betreuungsbedarf, die wegen Verkehrsunsicherheit unter einer richterlichen Unterbringung stand. Diese junge Frau musste sich im neuen Haus nun überwiegend innerhalb der Grenzen ihrer Wohngruppe bewegen und durfte diese selbständig nicht verlassen. Ihr Bewegungsradius war gegenüber früher somit wesentlich reduziert. Dies kritisierten wir gegenüber der Leiterin. Trotz leichter Verstimmung folgte bereits bald auf unsere Intervention hin eine Abhilfe: Der umliegende Garten wurde ein Jahr früher als ursprünglich geplant eingezäunt, so dass sich die Bewohnerin seitdem auch frei im Garten aufhalten konnte.
Birger Rietz aus unserer Forschungsgruppe übernahm seit März 2008 einen regulären Schichtdienst innerhalb einer Wohngruppe. Deklariert worden war diese Mitarbeit als eine zusätzliche Beobachtung einzelner Bewohner zwecks weiterer Hilfeplanung. In der Praxis blieb dem Kollegen dann aber kaum Zeit, etwas gezielt zu beobachten, weil er meist stellvertretend für die eigentlichen Betreuer die Basisaufgaben erfüllen musste. Durch diese unterstützende Arbeit im Basisbereich gelang es dem Kollegen, ein besonders enges Verhältnis zu den Mitarbeitern herzustellen. Er kam rasch in den Genuss deren Vertrauens und wurde eifrig umworben.
Überhaupt konnten wir einige Male wahrnehmen, dass Leitung und auch Team die Erwartung an uns herantrugen, uns auch "nützlich" zu machen: dass wir auch praktisch in der alltäglichen Arbeit einen Gewinn erbringen sollten - vor allem, wenn das Personal knapp war. Von Erfahrungen dieser Art berichtet auch Sieverding: "Es werden einrichtungsbezogene Aktivitäten an sie (die Forscher, d.Verf.) übertragen; sie sollen eigenständige Aufgaben in der Versorgung übernehmen; sie werden in das Team integriert und als gleichwertiges Mitglied behandelt..." (Sieverding 1980, S.129) Die zitierte Forscherin erkannte hinter diesen Strategien "einen subtilen Mechanismus, durch den die Identifikation der ForscherInnen mit der Einrichtung vergrößert wird. Je mehr ich mich mit einer Institution identifiziere, desto schwerer fällt es mir, auch die negativen Aspekte wahrzunehmen und zu untersuchen." (a.a.O.) In unserem Forschungsfeld dürfte vor allem der krankheitsbedingte Personalmangel ein wesentliches Motiv dafür gewesen sein, die Forscher verstärkt integrieren zu wollen. Denn in jener Phase wurden wir verstärkt um aktive Mithilfe im Basisbereich angefragt.
Der Bewohner H., der Anfang des Jahres 2008 zunehmend mehr an Pflege bedurfte, sorgte für noch mehr Bedarf an Arbeitskraft. Der Klient sollte vormittags eins zu eins betreut werden. Dafür fehlte Personal. So trat die Leitung an mich mit dem Auftrag heran, H. für die nächsten drei Monate an drei Tagen pro Woche zu "beobachten", um dadurch seine konkreten Bedürfnisse sowie mögliche Hilfen ermitteln zu können. Der Auftrag war mit dem Vokabular meines Forschungsansatzes formuliert worden und passte zeitlich genau in jene personelle Lücke. In unserem Forschungsteam vermuteten wir die Gefahr einer Instrumentalisierung als "Lückenbüßer". Dennoch saßen wir zunächst in einer "Falle": Unter Berufung auf den Ansatz der Handlungsforschung hatten wir schließlich eine aktive Teilnahme an dem Geschehen in der Einrichtung angekündigt und wollten teilnehmend evaluieren. Dieses Versprechen wirkte gewiss etwas schwammig auf die Akteure in der Einrichtung. Die methodische Offenheit, die eine gewisse Schwammigkeit begünstigen mag, kann dann mitunter als Grenzenlosigkeit erscheinen und Begehren dieser Art die Tür öffnen. Bezüglich des Bewohners H. einigten wir uns dann auf eine sechswöchige Einzelbetreuung an nur einem Tag pro Woche. Auf diese Weise konnte ich die notwendigen Beobachtungen und Dialoge für die Weiterentwicklung der Hilfe durchführen und dem Begehren der Leitung zugleich entgegenkommen, ohne aber die eigenen Aufgaben der Einrichtung stellvertretend zu erfüllen.
Anfragen dieser Art halte ich im Rahmen meines wissenschaftlichen Konzeptes grundsätzlich nicht für falsch. Zu meinem Konzept von Forschung gehörte ganz wesentlich die praktische Arbeit mit den Klienten. Dennoch scheint es mir nicht ausreichend gelungen zu sein, dies von der Funktion der "Lückenbüßerei" abzugrenzen. Meine praktische Arbeit mit den Klienten stand nämlich primär unter der Zielsetzung, deren Bedürfnisse sowie Zufriedenheit zu erfahren und sie dabei zu unterstützen, ihre Interessen besser realisieren zu können. Es ging mir (und der Forschungsgruppe) aber nicht darum, uns "überhaupt mal nützlich zu machen". Diese Kritik richte ich an mich selbst sowie an die Forschungsgruppe. Wir hatten es nämlich versäumt, von Anfang an auf klare Abgrenzungen zu drängen und unser Konzept ausreichend zu verdeutlichen. Das lag auch daran, dass wir selber nicht immer ein Konzept hatten. Wir haben es erst fortlaufend im Prozess entwickelt. Die Unklarheiten der Mitforschenden in der Einrichtung somit sind keine anderen als unsere eigenen Unklarheiten gewesen.
Resümierend erkenne ich im Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen Einrichtung und Forschungsgruppe folgende strukturierende Grundwidersprüche:
-
Das asymetrische Interesse an der wissenschaftlichen Begleitung: Während die Mitglieder der Forschungsgruppe lange Zeit mit großer Motivation den Entwicklungsprozess in der Einrichtung wissenschaftlich begleiteten und sich engagierten, kann ich aus subjektiver Sicht feststellen, dass das Interesse diesbezüglich auf Seiten der Einrichtung relativ gering war. Für die Forschungsgruppe, insbesondere für mich, war die wissenschaftliche Begleitung "der Hauptjob" in jener Zeit. Für die Akteure in der Einrichtung war dies zumeist eine Nebenbeschäftigung oder gar eine lästige Zusatzaufgabe.
-
Das Projekt der Ambulantisierung war in der Einrichtung nach meiner Wahrnehmung von Anfang an nur halbherzig verfolgt worden. Dafür sprechen die langen Verzögerungen, die sparsamen Vorbereitungen, die geringe Konzeptarbeit sowie die Tatsache, dass bis April 2009 noch immer keine amtliche Ambulantisierung durchgeführt worden war. Seitens der Forschungsgruppe hingegen bestand größtes Interesse an einer ambulanten Umgestaltung der Einrichtung.
-
Unsere anfängliche Methode der raschen Rückmeldung unserer (v.a. meiner) Beobachtungen und Hypothesen an die Mitarbeiter hat sich als kontraproduktiver Konflikt-motor erwiesen. Zum einen hatte ich anfangs tatsächlich zu wenige Informationen, um bedeutende Zusammenhänge angemessen verstehen zu können, so dass meine Mitteilungen per Email oftmals vorschnell, zu wenig fundiert und zu sehr besserwisserisch auf die Betreuer wirken mussten. Zum anderen verunsicherten wir uns durch unseren selbstverschuldeten Druck zur sofortigen Rückmeldung unserer Wahrnehmungen sowie der Erwartung einer Gegenreaktion zu sehr selber. Wir orientierten uns zu stark auf das Feed-back der Gegenseite, anstatt selbstbewusster unseren eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen. Jeden Widerspruch seitens eines Mitarbeiters nahmen wir zum Anlass, an uns selber zu zweifeln. Damit verwischten wir unsere Konturen und verunsicherten unsere "Mitforscher". In dieser unsicheren und selber verunsicherten Position boten wir uns geradezu an, den Frust aus dem Arbeitsalltag auf uns zu übertragen.
-
Unser offener und wenig vorstrukturierter Forschungsansatz hat bei einigen Mitarbeitern Be-fremden ausgelöst. Sie vermissten "objektive Daten", Statistiken und klar umrissene Frage-bögen. Mit unserem Ansatz enttäuschten wir deren Rollenerwartung an uns. Wir begaben uns damit zugleich in die bohemehafte Position, "über solchen Dingen drüber zu stehen" und damit auch über der profanen Praxis des Arbeitsalltages, in welchem sich die Betreuer befanden. Einerseits wurde unsere Arbeit nicht immer ganz ernst genommen, andererseits wurden wir als arrogant eingeschätzt. Selbstkritisch ist hier zu fragen, ob unser Ansatz aus dem "Elfenbeinturm der Universität" mit der harten Realität der "Werktätigen" mental überhaupt kompatibel sein kann, ohne zu provozieren. Denn wir konfrontierten die Mitarbeiter mit einem "Reich der Freiheit" (zumindest im Denken), während diese in einem "Reich der Notwendigkeit" tagtäglich arbeiten mussten.
-
Unser besonderer Forschungsansatz implizierte auch folgendes Grundproblem: Zu jeder meiner Beobachtungen ließen sich prinzipiell falsifizierende Gegenbelege anführen. Wenn ich beispielsweise beobachte, dass sich Bewohner B. überwiegend in sein Zimmer zurück-zog, dann entsprach dies keineswegs einer "objektiv gesicherten" Wahrheit, sondern basierte einzig auf meinen selektiven Beobachtungen und Befragungen. In diesem Falle widersprach mir ein Mitarbeiter erbost und warf mir vor, dies frei erfunden zu haben. Denn jedes Mal, wenn er den Bewohner B. angetroffen hatte, befand er sich in der Küche, aber nicht in seinem Zimmer. Der Mitarbeiter warf mir deswegen vor, seine Beobachtungen nicht berücksichtigt zu haben: "Das kommt in Deinem Bericht gar nicht vor." Widersprüche dieser Art erfolgten zu vielen meiner Beobachtungen, weshalb viele Mitarbeiter und die Leitung mir mangelnde "Objektivität" vorwarfen. Um dieser erwarteten "Objektivität" einvernehmlich entsprechen zu können, hätte ich zu jeder Beobachtung sämtliche Mitarbeiter befragen müssen. Dies wurde mitunter sogar von mir explizit erwartet. Auf diese Weise hätten sich zu allen Beobachtungen entsprechende Gegenbeispiele finden lassen, so dass am Ende keine fassbaren Aussagen mehr hätten getroffen werden können: Bewohner B. zieht sich nach meinen Beobachtungen in seinem Zimmer zurück, nach Beobachtungen des Mitarbeiters A. zieht er sich nicht zurück und nach Ansicht von Mitarbeiter B. gelegentlich. Auf diese Weise hätte ich die Wahrnehmungen aller Mitarbeiter differenziert zur Geltung bringen können, doch wozu? Eine Evaluation dieser Art wäre zum Spiegel der Kommunikation einer Dienst-besprechung geworden, in denen der Widerspruch einen hohen Stellenwert hatte und "alles zerredet" wurde, wie es der Leiter einst auf den Punkt brachte. Selbst, wenn ich die Position sämtlicher Mitarbeiter zu Protokoll gebracht hätte, wären auch diese Informationen nur ein Ausschnitt der gesamten Realität geblieben. Um die erwartete Evidenzstufe erreichen zu können, wäre eine Rund-um-die-Uhr-Videoüberwachung aller Bewohner mit anschließender Vollauswertung nötig gewesen.
-
Das beschriebene Konfliktmuster verweist auf eine Absurdität in der Konstellation: Üblicher-weise verfügen Wissenschaftler über Wissen, das ihren Auftraggebern noch fehlt. In diesem Falle verhielt es sich anders: Der Auftraggeber verhielt sich so, als hätte er bereits vor meinem Forschungsbeginn sämtliches Wissen, das ich für meine Evaluation benötigte, in seiner Institution akkumuliert. Zu meiner Aufgabe wurde es dann, in der Einrichtung jene Informationen schrittweise einzuholen, sie in eine neue, methodisch geleitete Struktur zu bringen und wieder dem Auftraggeber zurück zu spiegeln. Auf diese Weise befand ich mich in einer permanenten Prüfungssituation. Irgendein Mitglied der Einrichtung konnte mir bei jeder Aussage einen Fehler nachweisen, weil ich den gesamten Tagesablauf eines jeden Bewohners nicht lückenlos kennen konnte und längst nicht über alle Informationen verfügte, die es potenziell gab. Es gab immer Lücken und Ereignisse, mit denen meine Aussagen widerlegt oder zumindest in Frage gestellt werden konnten. Als "richtig" galten meine Aus-sagen nur dann, wenn sie auf den Konsens aller Beteiligten trafen. Auf diese Weise war meiner Tätigkeit von vornherein ein Großteil ihrer Sinnhaftigkeit entzogen worden. Es ging nicht darum, dass der Auftraggeber etwas Neues vom Wissenschaftler wissen wollte, sondern darum, zu prüfen, ob der Wissenschaftler das weiß, was der Auftraggeber schon längst wusste. Die Evaluation der Einrichtung war in Wirklichkeit vielmehr eine Evaluation der Forschungsgruppe, ein Versuch, sie abzuprüfen, ob sie über ausreichendes und richtiges Wissen verfügte. Der Maßstab dafür war stets das Wissen der Mitarbeiter und der Leitung.
Die beschriebenen Probleme und Konflikte sehe ich keineswegs als kausal durch unser Verhalten ausgelöst und auch nicht als ein Spezifikum dieser Einrichtung an. Vielmehr gehören sie zum typischen Habitus im betreffenden Arbeitsfeld dazu. Fast ausnahmslos konnte ich auch bei anderen Trägern, bei denen ich gearbeitet habe, erfahren, dass in den stationären und halbambulanten Wohneinrichtungen die Neigung zum Verzögern von Entwicklungen und Veränderungen fester Bestandteil des Mitarbeiterverhaltens war. Begründet wurde dies meist mit dem Deutungsmuster, die behinderten Menschen benötigten alle feste Routinen, viel Sicherheit und vertrügen nur schlecht Veränderungen in ihrem Alltagsleben. Dieser Mythos bildet heute noch immer den Kern einer Ideologie bezüglich der Behinderung. Er besagt, dass geistig behinderte Menschen kaum flexibel, ebenso wenig lernfähig seien und kaum Interesse an Entwicklung hätten.
Zum Habitus in der Branche gehörte auch häufig die starke Neigung zum negativen Denken[15]. Neue Ideen, Vorschläge jeglicher Art werden zuerst auf ihre möglichen negativen Auswirkungen hin abgescannt. Über Erfolge und Fortschritte hingegen wird kaum gesprochen. Die durch das eigene negative Denken generierte Unzufriedenheit wird häufig auf andere Personen übertragen, auf einzelne Bewohner, den Chef, die Angehörigen oder die Forscher. Die Teams brauchen einen Sündenbock. Das stationäre Arbeitsmodell begünstigt das stationäre Denken, ein zielloses Drehen im eigenen Kreis der Frustration. Die erfahrenen Konflikte bei dieser Forschungstätigkeit halte ich somit für nicht untypisch in dem betreffenden Arbeitsfeld.
Bereits lange bevor wir mit unserer wissenschaftlichen Begleitung begonnen hatten, waren in der Einrichtung über viele Jahre hinweg zermürbende Konflikte ausgetragen worden. Diese hatten lange Zeit zu einer sehr hohen personellen Fluktuation und häufigem Wechsel in der Leitung geführt. Das Team war noch immer "zerrissen" und zerstritten, als wir mit unserer Arbeit begannen, wie damals der Leiter konstatierte. Konflikte und die leidenschaftliche Streitkultur waren bereits ohne unser Mitwirken entstanden. Wir betraten dann als neue Mitstreiter zusätzlich den Ring, so dass ich heute zu der Einschätzung neige, dass es fast egal gewesen wäre, wie wir uns verhalten hätten und wer das Feld betreten hätte. Konflikte zwischen der Einrichtung und den wissenschaftlichen Begleitern wären so oder so nicht zu vermeiden gewesen.
Mit unserer Arbeit einer wissenschaftlichen Begleitung, v.a. einer Evaluation, übernahmen wir genau das Rollenverhalten, das zu diesem bereits eingeschliffenen Muster passte: Per Auftrag begannen wir zu kritisieren (wie die anderen Streitakteure auch) und boten damit eine willkommene Angriffsfläche. Anstatt diese objektive Funktion im System zu reflektieren, übertrugen wir sogar noch das vorgefundene Muster auf den internen Diskurs innerhalb der Forschungsgruppe und suchten "die Schuld" an den Konflikten bei uns selber. Dies führte zu einer gewissen Betriebsblindheit oder "Unmittelbarkeitsverhaftetheit", zu einer Vereigenschaftung in erster Person. Das Modell des Schuldigen erscheint unmittelbar nämlich immer in personifizierter Form. Unmittelbarkeits-überschreitend wäre es gewesen, es zu entpersonalisieren und als objektive, überpersonelle Funktion zu dechiffrieren. Eine klare Abgrenzung von den Problemen und Kommunikationsmustern in der Einrichtung wäre notwendig gewesen, statt sie zu übernehmen.
Ich selber muss mir allerdings anlasten, mit meiner Aufgabe der Evaluation genau dieses "stationäre" Denkmuster bedient zu haben, nämlich zu evaluieren, nach Defiziten zu suchen, negativ zu denken, zu kritisieren, zu meckern. Aus heutiger Sicht würde ich eine solche Aufgabe nicht noch einmal übernehmen. Die Evaluation ist nämlich weniger dazu geeignet, Probleme zu lösen, sondern vielmehr Teil des Problems. Sie gehört einer Kultur der Rechthaberei an, des Belehrens und Besserwissens - genau jener Kultur, die in der gesellschaftlichen Institution der geistigen Behinderung Entwicklungen verhindert oder zumindest stark verzögert. Gleichwohl kann ich gewisse emanzipatorische Fortschritte durch meine Evaluation nicht in Abrede stellen. Diese stellten sich aber weniger beim "Evaluieren" (im engeren Sinne des Bewertens von Bestehendem) von stationären Handlungsmustern ein, sondern bei konstruktiven Veränderungen, durch vorwärts gerichtete Interventionen wie dem "Schlumperprojekt" oder Beratungen bei der Hilfeplanung.
Schlussfolgernd für mögliche weitere Forschungsprojekte komme ich zu dem Resultat, dass bei einer wissenschaftlichen Begleitung die Forschungsgruppe mindestens folgende Grundsätze beachten sollte:
-
Zurückhaltung bei vorschnellen "Rückmeldungen" von Wahrnehmungen, Kritik und Hypothesen. Erst sorgfältig beobachten und analysieren, bevor Ergebnisse mitgeteilt werden.
-
Sprache und Stil der Mitteilungen entemotionalisieren und möglichst "sachlich" gestalten.
-
Mit dem Auftraggeber klare Bedingungen schriftlich und verbindlich vereinbaren. Dazu gehören Vereinbarungen zum Forschungsansatz und Methoden, ein verbindlicher zeitlicher Rahmen und zeitliche Struktur der Begleitung, klar formulierte Erwartungen an die Mitwirkung seitens der Einrichtung und eine verbindliche Offenlegung der Interessen, Pläne und Konzepte des Auftraggebers sowie der eigenen.
-
Abgrenzung: Der Mangel an Fähigkeit oder Bereitschaft zur Abgrenzung sehe ich als größten Fehler bei unserer Forschungsarbeit an. Wichtig ist, nicht "jeden Schuh anzuziehen", der einem angeboten wird, seine eigenen Interessen und Probleme von denen anderer klar zu unterscheiden, Übertragungen rechtzeitig erkennen.
Abschließend fasse ich in kurzer Form zusammen, inwiefern meine in Teil A, Kapitel 5 formulierten Aufgaben- bzw. Fragestellungen an die Forschung gelöst werden konnten.
Die Ergebnisse der Aufgabe zur Evaluation der Bewohnerzufriedenheit habe ich bereits ausführlich in Teil D, Kapitel 2.5 u. 3.5 dargelegt, so dass ich an dieser Stelle nicht erneut darauf eingehe. Der wesentlichen Aufgabenstellung seitens des Auftraggebers, ob der Einrichtung im Rahmen der Ambulantisierung ein Modellcharakter zukommt, muss die Klärung der Frage, ob und wie weit eine Ambulantisierung in der Einrichtung bis zum Abschluss meiner Beobachtungen stattgefunden hat, vorangestellt werden. Ein Modellcharakter für die Ambulantisierung auf Landes- oder Bundesebene kann der Einrichtung nur dann zufallen, wenn sie selber überwiegend ambulante Strukturmerkmale aufweist.
Bei der Beurteilung dieser Frage beziehe ich mich auf meine Ausarbeitungen in Teil B, Kapitel 2 zum Vergleich zwischen ambulant und stationär. Nach den dort genannten Kriterien handelt es sich bei der untersuchten Einrichtung eindeutig um eine stationäre Wohneinrichtung für geistig behinderte Menschen, wobei ich offenlasse, ob sie mehr zur Kategorie des "alten Typs" oder mehr zur Kategorie des "reformierten Heims" passt. Von den 13 in Teil B, Kapitel 2.2.1 genannten Kriterien einer "stationären Einrichtung des alten Typs" trafen zum Abschluss meiner Evaluation (Ende Dezember 2008) zehn Kriterien zu. Diese waren:
-
Es bestand eine Kopplung zwischen Miet- und Betreuungsverhältnis in Form von Heimverträgen fort. Eine Entkopplung war noch nicht abzusehen.
-
Alle Hilfen wurden unter einem Dach, unter dem auch die Klienten ihren Lebensmittelpunkt hatten, erbracht.
-
Es galt bei Abschluss meiner Beobachtungen weiterhin der Primat der Rund-um-Versorgung mit weitgehendem Hotelservice.
-
Die Leistung war bei den meisten Bewohnern auf Dauer oder gar auf lebenslang angelegt.
-
Die Größe und örtliche Lage der Einrichtung begünstigten eine Ghettoisierung.
-
Das Wohnumfeld war durch mangelnde Infrastruktur gekennzeichnet.
-
Die Förderung von Selbstbestimmung und Selbständigkeit waren gegenüber anderen Zielen im praktischen Alltag nachrangig. Dies wurde insbesondere durch die knappe Bemessung von individuellen Betreuungszeiten deutlich.
-
Es bestand eine Vollunterbringung mit Tag- und Nachtpräsenz des Personals.
-
Der Wohnraum der Klienten gehörte zum Rechts- und Organisationsbereich des Trägers und war Teil des Einrichtungsganzen.
-
Der Träger übernahm von Anfang bis Ende des Aufenthalts die Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung der Bewohner.
Nicht zutreffend waren folgende Kriterien:
-
Der Lebensalltag ist auf die Gesamtheit der Einrichtung bezogen. Durch den Umzug ins Nebengebäude sind erstens die Gemeinschaftsräume entfallen und zweitens sind kleinere Wohngruppen entstanden, die sich voneinander abgrenzten.
-
Gemäß den Erwartungen, die die Stadt Hamburg an die neuen AWG stellte, ist festzustellen, dass sich die neuen Diensträume in der Einrichtung außerhalb der vermieteten Wohnungen befanden, also deutlich davon abgetrennt waren, gleichwohl sie innerhalb des gleichen Gebäudes lagen.
Beim Vergleich der Einrichtung mit den Kriterien eines "reformierten Heims" ist festzustellen, dass die Größe, weniger als 40 bzw. 24 Bewohner (Lebenshilfe), und die erreichte Stärkung der Privatsphäre dafür sprechen, die untersuchte Einrichtung als "reformiertes Heim" zu bezeichnen. Wesentliche andere Kriterien wie die Einbindung der Bewohner ins sozialräumliche Umfeld sowie eine primär individuell ausgerichtete Hilfe, die auf Förderung und späteren Auszug der Bewohner zielt, fehlten jedoch weitgehend, obwohl bei zwei bis drei neuen Bewohnern diese Orientierung ansatzweise erfolgte.
Es sollte auch nicht verschwiegen werden, dass nach dem Umzug in einigen Handlungsbereichen eine gewisse Deinstitutionalisierung stattgefunden hat. Wesentliche Veränderungen in dieser Richtung waren u.a.:
-
Einige Bewohner erlangten eine verbesserte Mobilität nach außen.
-
Es haben sich bei drei Bewohnern Beziehungspartner/innen von außerhalb gefunden, die auch in der Einrichtung übernachteten. Dies bedeutet eine verstärkte Öffnung nach außen und eine gewisse Angleichung der Alltagskultur an die die der Mehrheitsgesellschaft.
-
Durch die Unterteilung in kleine Wohngruppen ist das Gesamtgeschehen im Alltag vermehrt aus dem Blick der Betreuer geraten. Es sind neue Nischen der Privatsphäre entstanden, in denen sich unterschiedliche Lebensstile besser entfalten konnten.
-
Bei der Versorgung mit Lebensmitteln haben die einzelnen Bewohner mehr Möglichkeiten erhalten, selber etwas einzukaufen, sich in kleineren Einheiten zu versorgen und mit zu bestimmen.
Erwähnt sei an dieser Stelle auch, dass nach dem Abschluss meiner Teilnahme im Forschungsfeld ein wesentlicher Ambulantisierungsschritt stattgefunden hat: Im Frühjahr 2009 ist eine Gruppe von drei Bewohnern in eine externe Wohnung im gleichen Stadtteil umgezogen und wurde von der Einrichtung weiterhin betreut. Damit wurde zumindest das stationäre Merkmal "alle unter einem Dach" aufgebrochen.
Zusammenfassend bleibt jedoch festzustellen, dass das anfängliche Vorhaben der Leitung, die gesamte Wohneinrichtung zu ambulantisieren, nicht erreicht worden ist.
Die Frage, ob der Einrichtung im Hinblick auf eine Ambulantisierung bis Jahresanfang 2009 ein gewisser Modellcharakter zukam, ist klar zu verneinen, da die Einrichtung bis dahin rechtlich einen stationären Status hatte. Die Mischung von Bewohnern mit sehr umfangreichem Hilfebedarf und jenen mit eher geringem unter einem Dach stellt keine Besonderheit dar, sondern ist auch bei anderen Trägern häufig vorzufinden. Zudem halte ich die Mischung von Klienten mit sehr unterschiedlichen Hilfebedürfnissen an sich noch für wenig aussagekräftig. Die Frage nach der Güte einer Einrichtung kann vielmehr erst daran gemessen werden, wie es ihr gelingt, den Menschen mit ihren unterschiedlichsten Stärken und Problemen einzeln gerecht zu werden, sie angemessen differenziert zu betreuen. Gerade diese Binnendifferenzierung war bei Abschluss meiner Beobachtungen erst rudimentär ausgeprägt. Die Organisation umfasste noch das gesamte Haus. Obwohl auch Bewohner mit autistischen Symptomen und herausforderndem Verhalten mit ins neue Gebäude umziehen konnten, war längst nicht nachweisbar, dass auch diese dort individuell angemessene Bedingungen vorfinden konnten. Mindestens für eine Bewohnerin war der Umzug mit einer deutlichen Einschränkung ihres Bewegungsradiuses verbunden.
Unsere wissenschaftliche Begleitung hat die Transparenz der Einrichtung gesteigert. Das Haus hat sich unserem Zugang geöffnet, uns umfangreiche Informationen zugänglich gemacht und den Zwischenbericht unserer Evaluation der zuständigen Behörde und der LAG vorgelegt. Er kann zudem von jedem Interessenten auf Anfrage gelesen werden. Damit hat sich die Einrichtung im großen Maße nach außen hin geöffnet und eine deutliche Erweiterung ihrer Transparenz erzielen können.
Die Aufgabe zur fachlichen Absicherung der Planung und Durchführung des Ambulantisierungsprozesses konnten wir nur ansatzweise erfüllen. Dies vor allem auch deshalb, weil es bis zum Ende meiner Mitarbeit zumindest zu keiner förmlichen Ambulantisierung gekommen war. Dennoch haben wir die Einrichtung in dieser Hinsicht unterstützt: Ich habe eine rund 40 Seiten umfassende Studie zum Thema Ambulantisierung (vgl. Teil B, Kap. 2) für die Einrichtung erarbeitet, einen Workshop zu diesem Thema veranstaltet sowie zahlreiche Einzel- und Kleingruppengespräche durchgeführt.
Mit unseren wissenschaftlich fundierten Informationen zum Ambulantisierungsprozess haben wir den Auftraggeber stets über die fachlichen Anforderungen informiert, beobachtete Entwicklungen in der Einrichtung analysiert und eine permanente fachliche Beratung angeboten. Dass bis Anfang 2009 der Auftraggeber hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben war, lag nicht nur an der unzureichenden Unterstützung seitens der Forschungsgruppe - gleichwohl auch diese hätte besser sein können.
Unsere selbst gestellte Aufgabe zur Qualitätsentwicklung haben wir im Wesentlichen mit den beiden Projekten Individuelle Hilfeplanung und Evaluation erfüllt. Wie in Teil D, Kapitel 3.4 ausgeführt, hat das von Markus Lauenroth entwickelte Konzept zur Individuellen Hilfeplanung bis zum Abschluss meiner Beobachtungen weitaus weniger Bedeutung für die Betreuungspraxis erfahren, als von uns erhofft worden war. Dennoch ist es uns damit gelungen, zumindest einen Anstoß für einen anderen Ansatz der Hilfeplanung zu geben. Einzelne Betreuer haben versucht, dieses Konzept umzusetzen.
Meine Berichte zur Evaluation sind in der Einrichtung, der Zwischenbericht auch außerhalb der Einrichtung gelesen worden und auf intensive Resonanz gestoßen. Die Kritik daran überwog zwar deutlich, doch zeigte dies, dass meine Evaluation zur Kenntnis genommen worden ist und zumindest bei einigen Betreuern zur Anregung neuer Betreuungspraxen führen konnte. Im Nachhinein konnte ich erfahren, dass der Vorschlag im Zwischenbericht zur Einrichtung von dezentralen Außenwohngruppen (vgl. Teil D, Kap. 2.5) im Frühjahr 2009 aufgegriffen wurde und eine Gruppe von drei Bewohnern in eine externe Wohnung im gleichen Stadtteil umgezogen ist.
Deutliche Erfolge zur Qualitätsentwicklung konnte ich im Bereich der Mobilität der Bewohner fördern. Mein Insistieren auf eine Verstärkung der individuellen Betreuung war in einigen Fällen zumindest zeitweise erfolgreich, ebenso wie die Stärkung der Selbstbestimmung der Bewohner im alltäglichen Leben.
Positive Wirkungen konnte ich vor allem im Gespräch mit einzelnen Mitarbeitern erfahren, wenn diese meine Anregungen als Bereicherung werteten und sie dazu nutzten, Betreuungsmethoden zu reflektieren und zu verändern. Somit sehe ich den größten Erfolg meiner Versuche zur Qualitätsentwicklung in den häufig eher latenten Prozessen des Umdenkens einiger Betreuer in Richtung ambulant geprägter Strukturen.
Angesichts einer Dauer von rund zweieinhalb Jahren meiner teilnehmenden und intervenierenden Forschung, sind bis Ende des Jahres 2008 die Ergebnisse relativ bescheiden ausgefallen. Als Wissenschaftler stelle ich mir zum Abschluss meiner Arbeit die Frage nach der Gegenstandsadäquatheit meines Ansatzes und der Effektivität meiner Methoden. Damit knüpfe ich an die in Teil A, Kapitel 5 gestellte Frage Nr. 5 an: Ist es möglich, auf Grundlage dieses Forschungskonzeptes und seiner Methoden eine Weiterentwicklung der Einrichtung im Sinne ambulanter Strukturen zu unterstützen? Wie ist die Gegenstandsadäquatheit meines Forschungskonzeptes zu beurteilen?
Den ersten Teil jener Fragestellung habe ich bereits ausführlich in Teil D anhand zahlreicher Beispiele differenziert beantwortet, in Teil E, Kapitel 2.1 kurz zusammengefasst und in Kapitel 1 die mit diesem Konzept und seinen Methoden entstandenen Konflikte und Reibungsverluste offengelegt. In Kapitel 1.4 habe ich daraus Schlussfolgerungen zu einer Verbesserung des Forschungskonzeptes abgeleitet. In den folgenden Unterkapiteln beurteile ich in kurzer Form abschließend und zusammenfassend die einzelnen Elemente meines Konzeptes, die ich theoretisch in Teil C vorgestellt habe und gehe zunächst ausführlicher der Frage nach der Gegenstandsadäquatheit des emanzipatorischen Auftrages nach.
Der grundlegend emanzipatorische Auftrag meines Forschungskonzeptes im Allgemeinen spiegelt sich im Besonderen des Gegenstandes, in seiner Zielsetzung zur Ambulantisierung, wie ich sie ausführlich in Teil B, Kapitel 2 abgeleitet habe, wider. Sie beinhaltet auch die Aufhebung von Behinderung als soziale Struktur von Gewalt und Isolation (s. Teil B, Kap. 1.4). Inwieweit dies gelungen ist, habe ich im Besonderen bereits in meinen Berichten im Teil D sowie in den Kapiteln 2.1 bis 2.4 des Teils E ausgeführt. An dieser Stelle sollte die Betrachtung, angereichert von der empirischen Fülle des Besonderen, wieder zum Allgemeinen zurückführen.
Dass es nicht gelungen ist, eine stationäre Einrichtung mit langer Tradition, festgefahrenen Routinen und Weltbildern sowie erheblichen internen Konflikten in eine ambulante Wohn- und Betreuungsstätte umzuwandeln, muss noch lange nicht als ein Scheitern des emanzipatorischen Grundsatzes gewertet werden. Die Kräfte, die an den stationären Strukturen festhielten, waren stärker. Zu fragen ist vielmehr, ob der emanzipatorische Grundsatz als sozialwissenschaftliches Paradigma adäquat war oder ob die Kategorie der Emanzipation den Gegenstand verfehlte.
In meinem empirischen Teil habe ich anhand zahlreicher Beispiele im Besonderen hinreichend nachweisen können, dass der Gegenstand der geistigen Behinderung ein sozialer Gegenstand ist, wie ich ihn in Teil B, Kapitel 1.4 bereits v.a. unter Bezug auf die Kulturhistorische Schule sowie Jantzen und Feuser auf der begrifflichen Ebene bestimmt habe. Deutlich geworden ist, dass die betroffenen Menschen in weitgehender Abhängigkeit vom Handeln der Institution, ihrer Angehörigen und gesetzlichen Betreuer lebten, dass zahlreiche Betreuungsroutinen ihre geistige Entwicklung und Selbstbestimmung behinderten, dass der soziale Lebenskontext der Bewohner im Besonderen ein herrschaftsförmig strukturiertes Feld war wie die kapitalistische Gesellschaft im Allgemeinen. Eine Forschung zum Gegenstandsbereich der geistigen Behinderung im Grenzbereich zwischen stationär und ambulant ist somit dem Grunde nach eine soziologische Forschung, die der Sozialpädagogik dient. "Kritische Soziologie ist, wenn ihre Begriffe wahr sein sollen, der eigenen Idee nach notwendig Kritik der Gesellschaft" (Adorno 1979a, S. 557)
Der konkrete Gegenstand in den Grenzen der untersuchten Einrichtung weist über diese hinaus und ist verallgemeinerbar. Die untersuchte Einrichtung ist Bestandteil und Resultat der deutschen Behindertenpolitik, der gesellschaftlich allgemeinen Ausgrenzung von Menschen, die wir als geistig behindert bezeichnen. Die untersuchte Einrichtung ist ein konkretes Beispiel der konkreten Ausgestaltung gesamtgesellschaftlicher struktureller Gewalt und Isolation, die sich gegen jene Menschengruppe richtet. Den beteiligten Akteuren im Feld müssen jene behindernden Mechanismen ihres Handelns keineswegs bewusst sein. Sie vollziehen sich stumm hinter ihrem Rücken und erscheinen im verzerrten Spiegel der unmittelbaren Wahrnehmung als unabdingbar. Auch das Moment der Ideologie als gesellschaftlich notwendigem falschen Schein, den die gesellschaftlichen Verhältnisse von sich geben, konnte ich im Besonderen meines Forschungsfeldes aufspüren. Der aus der Kritischen Theorie übernommene emanzipatorische Auftrag, den ich meiner Forschung vorangestellt habe, ist somit gegenstandsadäquat, da der zugrunde liegende Gegenstand ein Besonderes des Allgemeinen der gesamtgesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse ist. "Denn Erkenntnis lebt von der Beziehung auf das, was sie nicht selber ist, auf ihr Anderes." (a.a.O.) Auf ein Anderes jenseits von Herrschaft und Behinderung!
Der gesellschaftliche und politische Charakter des Gegenstandes zeigt sich insbesondere im Begriff der Ambulantisierung, der in ein entsprechendes Programm der Hamburgischen Sozialbehörde mündete, das politisch verabschiedet worden ist. Die Lebensverhältnisse der geistig behinderten Menschen sind ganz wesentlich von politischen Entscheidungen abhängig. "Ich betrachte die Geschichte der Behinderung und der Behindertenpädagogik als Teil einer Geschichte von Klassenkämpfen" (Jantzen 1992, S.46) Am Beispiel der untersuchten Einrichtung zeigte sich, dass die besondere "Klasse" der behinderten Menschen[16] kaum über Machtmittel verfügt. In Hamburg lebten zwei Drittel der Hilfeberechtigten in stationären Einrichtungen (s. Teil B, Kap. 2..3.1). Das neue Ambulantisierungsprogramm wurde überwiegend in Form von Umwandlungen stationärer in "ambulante" Wohngruppen vollzogen. Die Hartnäckigkeit alter stationärer Strukturen erwies sich auch bei anderen Trägern, wie ich aus eigener Anschauung und auch Mitarbeit erfahren konnte, als sehr beständig. Proteste gab es jedoch kaum. Die geistig behinderten Menschen evaluierten ihre Lebensverhältnisse mit überwältigender Mehrheit als zufriedenstellend, wie auf einer Fachtagung der Sozialbehörde am 04.12.2008 in Hamburg zu erfahren war.
Der emanzipatorische Anspruch, der auf konsequente Ambulantisierung zielt, ist aktueller denn je, gerade deshalb, weil die stationären Lebensverhältnisse gesellschaftlich keine Empörung mehr entfachen können. Mein emanzipatorischer Forschungsgrundsatz verweist somit auch intervenierend über das besondere Feld der untersuchten Einrichtung hinaus. Anstatt die intervenierenden Projekte auf das eng umgrenzte Feld zu reduzieren, wären politische Interventionen angemessen gewesen. Die Halbherzigkeit der Hamburger Sozialbehörde bei ihrer "Ambulantisierung" öffentlich anzuprangern, Verbündete in den Parteien zu suchen, mit Medien zusammen zu arbeiten und Aufklärungsarbeit bei den Angehörigen der behinderten Menschen zu leisten, wären angemessene und notendige Schritte gewesen. Sie nachzuholen, werde ich mich nach Abgabe dieser Arbeit bemühen.
Den von Horkheimer postulierten Selbstbestimmungsanspruch kritischer Wissenschaft[17] habe ich insofern erfüllt, als ich meine wissenschaftliche Begleitung zu einem selber bestimmten Zeitpunkt beendet habe, als ich den emanzipatorischen Gehalt eines Weitermachens nicht mehr sehen konnte. Ich habe mich somit der Erwartung des Auftraggebers, am Ende einen "vorzeigbaren" und positiven Bericht abzugeben, der meiner Erkenntnis zum Zeitpunkt meiner Beendigung wider-sprochen hätte, verweigert. Innerhalb der Einrichtung haben meine Interventionen und Diskussionen zu einigen "emanzipatorischen" Erfolgen geführt, die ich bereits dargestellt habe. Darüber hinaus war für mich nicht zu übersehen, dass mein Handeln zu einer gewissen Unruhe geführt hat, dass die Verhältnisse in der Einrichtung hinterfragt worden sind und der Gedanke an "das Andere" zumindest aufschien. Selbstkritisch muss ich mir eingestehen, dass ich mit meiner Evaluation dennoch das halbherzige Ambulantisierungsprogramm der Stadt Hamburg und das der Einrichtung mit unterstützt habe. Ich habe eine Funktion ausgeführt, die zum System der Behinderung dazu gehört. Die Evaluation legitimiert seinen Fortbestand. Ob meine systemverändernde oder meine systemstabilisierende Funktion größer war, mag ich nicht zu beurteilen.
Für den Bereich der subjektwissenschaftlichen Grundsätze stellt sich mir abschließend ein differenziertes Bild dar: Meinen Grundsatz, überwiegend mit qualitativen Daten zu arbeiten, sehe ich bestätigt, da er zu qualitativen Aussagen führen konnte und das Forschungsfeld ohnehin so überschaubar war, dass statistische Verteilungen wenig Sinn gemacht hätten. Qualitative Daten und Aussagen haben sich allerdings im Diskurs mit den Mitarbeitern als sehr strittig erwiesen. Ihnen fehlten oft die "harten Beweise". Die Umkehrung, Antworten auf standardisierte Fragen abzuzählen, hätte hingegen zu einem hohen Verlust inhaltlicher Informationen geführt, so dass ich meinem Vorgehen gegenüber jenem weiterhin den Vorzug gebe. Dies nicht zuletzt auch deswegen, weil auch statistische Daten nicht ohne die subjektive und somit strittige Grundlage vorausgehender Entscheidungen, Zuordnungen und Interpretationen zustande kommen können.
Das Prinzip der Handlungsfähigkeit bzw. deren Erweiterung verweist auf den Ansatz der Hand-lungsforschung sowie auf die übergeordnete Zielsetzung der Autonomie und ist an dieser Stelle als angemessen zu bewerten. Als abschließend nicht-adäquat muss ich das Mitforscherprinzip beurteilen. Wie in Kapitel C, Kapitel 1.2.3 beschrieben, traf dies wenig mit den Erwartungen der Mitarbeiter überein. Die Umsetzung dieses Prinzips ist mir nur mit Einzelpersonen gelungen. Es war vor allem ein Prinzip, das wir als Forschungsgruppe von außen an die Subjekte im Forschungsfeld herangetragen haben, es entsprach unserem anfänglichen Interesse. Oftmals führten gerade die Versuche, es umzusetzen, zu den größten Konflikten. Meine Bemühungen, möglichst direkt meine Informationen an die Mitarbeiter zurück zu melden, um wiederum eine Rückmeldung aus dem Kreis der Akteure zu erhalten, heizte die Konfliktspirale erst richtig an.
Gleichwohl halte ich eine dialogische Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Gegenüber im Forschungsfeld für erstrebenswert, weil dies Voraussetzung für eine intersubjektive Überprüfung von Erkenntnissen sowie zu deren praktischer Umsetzung ist. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Dialoge ins "Zerreden" übergleiten und Kritik zum Selbstzweck wird. Die Kunst zur angemessenen Abgrenzung, zur Balance zwischen Kooperation und der Übernahme unpassender Rollen, gilt es nach Abschluss dieser Arbeit für mich zu verbessern.
Dies führt direkt zum Grundsatz der Unmittelbarkeitsüberschreitung über: Ideologiekritisch ist es mir oft gelungen, latente Zusammenhänge im Handlungssystem des Forschungsfeldes zu durchschauen, Wesentliches hinter den Erscheinungen zu entdecken. Auf uns selber angewandt, sind wir innerhalb der Forschungsgruppe jedoch oft hinter unserem eigenen Anspruch zurück-geblieben (Kap. 1.4). Wir haben uns allzu oft innerhalb der Forschungsgruppe selber als Ursache für die erfahrenen Konflikte gesehen, uns selber "den Schuh angezogen", der in Wirklichkeit von anderen vor uns "geschustert" worden war, anstatt uns selber in unserer Bedeutung zu relativieren. Dies grenzte mitunter an Selbstüberschätzung, nämlich an der Vorstellung, für vieles verantwortlich zu sein, was in der Einrichtung misslang, ohne dabei das Zutun anderer Akteure ausreichend zu reflektieren. So wurde der Begriff der Kritik oft auf Selbstkritik reduziert. Notwendig wäre gewesen, selber über die unmittelbare Involviertheit weiter hinaus treten zu können, vielleicht eine Supervision in Anspruch zu nehmen und vor allem, mehr Distanz zur Einrichtung herzustellen.
Für den Bereich der Datengewinnung beurteile ich mein methodisches Vorgehen auf Grundlage der Teilnehmenden Beobachtung als relativ erfolgreich. Meine sehr um-fangreichen Informationen über Fakten und Strukturen im Forschungsfeld sprechen dafür, dass genau dieser Ansatz angemessen und passend für dieses Feld der Forschung war. Hätte ich mich auf standardisierte oder auch offene Befragungen von außen reduziert, so wären mir zahlreiche Informationen der unmittelbaren Anschauung verborgen geblieben. Zwischen dem, was Akteure berichten, dem Text über ... und dem Geschehen selbst, bestehen nämlich stets erhebliche Differenzen.
Meinen intervenierenden Ansatz zur Handlungsforschung beurteile ich ebenfalls als adäquat. Er hat dazu geführt, vorgefundene Grenzen zu überschreiten, neue Möglichkeitsräume zu öffnen und somit Entwicklungen, wenn auch bescheiden, anzustoßen und zu fördern. In Teil D habe ich den relativen Erfolg meiner diesbezüglichen Methoden anhand einzelner Beispiele ausreichend belegt. Zugleich hat dieser Ansatz auch die in Teil E berichteten Konflikte begünstigt.
Als weniger passend muss ich den Ansatz zur rehistorisierenden Diagnostik beurteilen. Mein theoretisches Bemühen um ihn übertrifft bei Weitem die praktischen Erfolge. Hier muss ich eingestehen, dass dieser Ansatz zwar zu mir persönlich passte, aber weniger zum Forschungsgegenstand. Das von Jantzen entwickelte Konzept hat sich als zu umfangreich, theoretisch zu anspruchsvoll erwiesen, um von den betreffenden Akteuren wirklich angenommen werden zu können. Zudem lagen meist die diagnostischen Voraussetzungen nicht vor, die wünschenswert gewesen wären. (Teil D, Kap. 2.3 u. 2.4). Niederschwellige Alternativen können oftmals zu ähnlichen Erfolgen führen und sind in der Praxis einfacher anwendbarer.
Meine angewandten Ansätze zur Strukturanalyse (s. Teil C, Kap.3) haben sich für mich als sehr hilfreich erwiesen. Mit ihnen gelang es mir, immer wieder einen Blick auf die Strukturen des "Ganzen", über die Unmittelbarkeit innerhalb der teilnehmenden Aktivitäten hinaus zu werfen, einzelne Beobachtungen aus verschiedenen Perspektiven betrachten und das Verborgene hinter den manifesten Erscheinungen aufspüren zu können. Sie waren notwendig, um mich selber, unsere Forschungsgruppe, die Einrichtung und das Zusammenwirken dieser versuchsweise von oben, aus einer gedanklichen Distanz zu betrachten, inneren Abstand zu finden und das konkrete Feld der Forschung besser in den Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Strukturen einzuordnen. Meine theoretischen Rückbezüge zur Strukturanalyse dienten so einer heuristischen Globalkartierung, als Kompass, um inmitten kleiner Baustellen die Gesamtrichtung finden zu können. Für mich erwiesen sich diese soziologischen Ansätze als kompatibel und adäquat zu meinen wissenschaftlichen Denkmustern. Sie waren es somit auch für das Gesamtprojekt, das ich ohne diese kaum hätte durchführen können.
[15] Negatives Denken verwende ich hier nicht im Sinne der dialektischen Negation, sondern als Bezeichnung für frustriertes Meckern, für einen Ausdruck von Lustlosigkeit oder der destruktiven Wichtigtuerei .
[16] Die Gruppe der behinderten Menschen könnte man durchaus auch als eine besondere soziale Klasse bezeichnen, sofern sie in ihrem Arbeitsprozess in den Werkstätten ganz besonderen Bedingungen unterworfen sind und trotz Vollzeitbeschäftigung noch nicht einmal ein Entgelt in Höhe des sozialhilferechtlichen Regelsatz erzielen können.
[17] "Eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbständigkeit die Gestaltung der Praxis, der sie dient und angehört, bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung von Denken und Handeln bescheidet, hat auf die Humanität schon verzichtet. Selbst zu bestimmen, was sie leisten, wozu sie dienen soll, und zwar nicht nur in einzelnen Stücken, sondern in ihrer Totalität, ist das auszeichnende Merkmal der denkerischen Tätigkeit." (Horkheimer 1984a, S.56) Siehe auch Teil C, Kap. 1.1
ADORNO, Theodor W. (1979a): Zur Logik der Sozialwissenschaften. In: ADORNO, Theodor W.: Soziologische Schriften I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 547 - 565.
ADORNO, Theodor W. (1979b): Beitrag zur Ideologienlehre. In: ADORNO, Theodor W.: Soziologische Schriften I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 457 - 477.
ADORNO, Theodor W. (1984): Zu Subjekt und Objekt. In: ADORNO, Theodor W.: Philosophie und Gesellschaft - Fünf Essays. Stuttgart.: Reclam, S. 74 - 93
ADORNO, Theodor W. (1985): Minima Moralia. Frankfurt/M.: Suhrkamp
ARBEITSKREIS SHOA.DE E.V. (2007): Euthanasie. URL: http://www.shoa.de/euthanasie.htm (Stand: 14.02.08).
BADER, Kurt (2002): Alltägliche Lebensführung und Handlungsfähigkeit. In: STIFTUNG MITARBEIT (Hrsg.): AlltagsTräume. Frankfurt/M.: Verlag Stiftung MITARBEIT, S. 11 - 61.
BADER, Kurt (2006): Entwurf für eine wissenschaftliche Begleitung der geplanten Umstrukturierung der XXX-Vereinigung Hamburg unter dem Titel "Subjektwissenschaftlich begründete Qualitätsentwicklung" (SUQU). Lüneburg. (Unveröffentlichtes Diskussionspapier, 16.05.2006).
BADER, Kurt (2008): Mehr Teilnahme als Beobachtung? Lüneburg. (Unveröffentlichtes Manuskript).
BAGÜS (BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER üBERöRTLICHEN SOZIALHILFETRäGER) (Hrsg.) (2006a): Wohnformen und Teilhabeleistungen für behinderte Menschen. Münster. Eigenpublikation der BAGüS von Dezember 2006.
BAGüS (BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER üBERöRTLICHEN SOZIALHILFETRäGER) (Hrsg.) (2006b): Entwicklung der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe. Münster. URL: http://www.beb-ev.de/files/pdf/2007/sonstige/2007-01-29FallzahlpapierBAGueS.pdf(Stand: 30.04.2008).
BARSCH, Sebastian (Hrsg.) (2008): Heilpädagogik - Geschichte. URL: http://www.sonderpaedagoge.de/geschichte/index.htm (Stand: 14.02.08).
BASAGLIA, Franco (1973): Institutionen der Gewalt. In: BASAGLIA, Franco (Hrsg.): Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Ein Experiment der psychiatrischen Klinik in Görz. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 122 - 161.
BASAGLIA, Franco (Hrsg.) (1980): Befriedungsverbrechen - Über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt.
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FüR ARBEIT, SOZIALORDNUNG, FAMILIEN UND FRAUEN (Hrsg.)(2007): Bayerische Behindertenpolitik. München. URL: http://www.stmas.bayern.de/behinderte/politik/wohnen.htm (Stand: 27.04.2007).
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FüR ARBEIT, SOZIALORDNUNG, FAMILIEN UND FRAUEN (Hrsg.) (2008): Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Pressemitteilung 001.08 vom 01.01.2008. München.
BLOCK, Martina/ VON UNGER, Hella/WRIGHT, Michael T. (2007): Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum - Zur Geschichte und Aktualität eines kontroversen Ansatzes aus Public Health Sicht. Berlin: Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Public Health am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WBZ)
BMAS (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES)(2008): Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX). Berlin: BMAS.
BOURDIEU, Pierre (1993a): Über einige Eigenschaften von Feldern. In: BOURDIEU, Pierre: Soziologische Fragen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 107 - 114.
BOURDIEU, Pierre (1997): Das Elend der Welt. Konstanz: UTB.
BOURDIEU, Pierre (2005): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA.
BSG (BEHöRDE FüR SOZIALES, FAMILIE, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, HAMBURG)(BSG) (Hrsg.) (2007): Die Entwicklung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Hamburg. Hamburg: Eigenpublikation der Freien und Hansestadt Hamburg von August 2007.
BUBER, Martin (1997): Das dialogische Prinzip. Gerlingen: Lambert Schneider im Bleicher Verlag.
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FüR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG (2008): 50 Jahre Lebenshilfe: Aufbruch - Entwicklung - Zukunft; 1958 - 2008. Konzept und Text: Berthold Budde. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung.
CLOERKES, Günther (Hrsg.) (2003): Wie man behindert wird. Heidelberg: Universitätsverlag Winter
DELEUZE, Gilles (1990): Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. In: L'autre journal, Nr. 1 (Mai 1990), Deutsche Übersetzung: URL: http://www.nadir.org/nadir/archiv/netzkritik/postskriptum.html (Stand: 10.03.2008).
DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.) (1975): Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn. (Drucksache 7/4200).
DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.) (1993): Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms. Bonn. (Drucksache 12/5510).
DEUTSCHER BUNDESTAG (Hrsg.) (2005): Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe. Berlin. (Drucksache 15/4575).
DIMDI (DEUTSCHES INSTITUT FüR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION)(Hrsg.) (2004): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Köln. URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm (Stand: Oktober 2004).
DIMDI (DEUTSCHES INSTITUT FüR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION)(Hrsg.) (2006): Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.10. Revision. Köln. URL: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2006/fr-icd.htm (Stand: 20.07.2009)
DöRNER, Klaus (2003): Auf dem Weg zur heimlosen Gesellschaft. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/imp27-03-doerner-gesellschaft.html (Stand: 03.11.2005).
DöRNER, Klaus (2004): Das Handeln psychosozialer Profis. In: Soziale Psychiatrie, 3 (2004), S. 37 - 42.
DUTSCHKE, Rudi; KRAHL, Hans-Jürgen (1987): Organisationsreferat. In: LINKE LISTE Universität Frankfurt/Main (Hrsg.): Die Mythen knacken. Materialien wider ein Tabu. Frankfurt/M.: Eigenverlag, S. 137 - 139.
FAHL, Renke; MARKARD, Morus (1993): Das Projekt "Analyse psychologischer Praxis" oder: Der Versuch der Verbindung von Praxisforschung und Psychologiekritik. In: Forum Kritische Psychologie, 32 (1993), S. 4 - 36.
FELKENDORFF, Kai (2003): Ausweitung der Behinderungszone: Neue Behinderungsbegriffe und ihre Folgen. In: CLOERKES, Günther (Hrsg.): Wie man behindert wird. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 25 - 52.
FENGLER, Christa; FENGLER, Thomas (1984): Alltag in der Anstalt. Rehburg-Loccum: Psychiatrie-Verlag.
FEUSER, Georg (1995): Die Lebenssituation geistig behinderter Menschen. In: VEREIN ZUR FöRDERUNG DER INTEGRATION BEHINDERTER e.V. (fib e.V.) (Hrsg.): Leben auf eigene Gefahr. München: Sozialpolitischer Verlag, S. 258 - 286
FEUSER, Georg (1996): "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration. Innsbruck. URL:http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-geistigbehinderte.html (Stand 17.06.2008).
FISCHER, Hans Rudi (1992): Zum Ende der großen Entwürfe. In: FISCHER, H. R.; Retzer, A.; Schweitzer, J. (Hrsg.): Das Ende der großen Entwürfe. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 9 - 34.
FISCHER, H. R.; RETZER, A.; SCHWEITZER, J. (Hrsg.) (1992): Das Ende der großen Entwürfe. Frankfurt/M.: Suhrkamp
FORSCHUNGSGRUPPE LEBENSFüHRUNG (2003): Zum Verhältnis von Selbsterkenntnis, Weltwissen und Handlungsfähigkeit in der Subjektwissenschaft. In: Forum Kritische Psychologie, 47 (2003), S. 4 - 38.
FREHE, Horst (2004): Zur historischen Entwicklung der Diskriminierung Behinderter. Bremen. URL: www.forsea.de/projekte/2004_marsch/zur_historischen_entwicklung_der_diskriminierung_behinderter.pdf (Stand: 22.02.2008).
FREIRE, Paulo (1973): Pädagogik der Unterdrückten. Reinbek: Rowohlt
FROMM, Erich (1987): Sozialpsychologischer Teil. In: HORKHEIMER, Max/FROMM, Erich/MARCUSE, Herbert u.a. (Hrsg.): Studien über Autorität und Familie: Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung. Lüneburg: Dietrich zu Klampen Verlag, S. 77 - 135.
GALILÄER, Lutz (2005): Pädagogische Qualität - Perspektiven der Qualitätsdiskurse über Schule, Soziale Arbeit und Erwachsenenbildung. Weinheim/München: Juventa Verlag.
GALTUNG, Johan (1975): Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek: Rowohlt.
GIRTLER, Roland (2001): Methoden der Feldforschung. Wien, Köln, Weimar: Böhlau
GOFFMAN, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt/M.: Suhrkamp
GüNTHER, Peter (1995): Wohnformen geistig behinderter Menschen in der Diskussion. In: VEREIN ZUR FöRDERUNG DER INTEGRATION BEHINDERTER e.V. (fib e.V.) (Hrsg.): Leben auf eigene Gefahr. München: Sozialpolitischer Verlag, S. 188 - 195.
HABERMAS, Jürgen (1985): Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
HäHNER, Ulrich (1997): Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung. Fragmente zur geschichtlichen Entwicklung der Arbeit mit "geistig behinderten Menschen" seit 1945. In: BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FüR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 25 - 51.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1973): Phänomenologie des Geistes. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1981): Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Bd. III. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1990): Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss (1830). Hamburg: Meiner.
HOFFMANN, Claudia (1998): Enthospitalisierung oder Umhospitalisierung? Am Beispiel der Neuen Länder. In: THEUNISSEN, Georg (Hrsg.): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Bad Heilbrunn: Klinkhardt , S. 109 - 153.
HOLZKAMP, Klaus (1972): Kritische Psychologie. Frankfurt/M.: Fischer.
HOLZKAMP, Klaus (1983): Der Mensch als Subjekt wissenschaftlicher Methodik. URL:http://www.kripsy.de/texte/kh1983a.pdf (Stand: 07.05.2009).
HOLZKAMP, Klaus (1985): Grundlegung der Psychologie. Frankfurt/M.; New York: Campus.
HOLZKAMP, Klaus (1996): Manuskripte zum Arbeitsprojekt "Lebensführung". In: Forum Kritische Psychologie, 36 (1996), S. 7 - 110.
HOLZKAMP, Klaus (1997): Schriften I, Normierung, Ausgrenzung, Widerstand. Hamburg; Berlin: Argument-Verlag.
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor (1981): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M.: Fischer.
HORKHEIMER, Max (1984a): Traditionelle und kritische Theorie. In: HORKHEIMER, Max: Traditionelle und kritische Theorie - Vier Aufsätze. Frankfurt/M.: Fischer, S. 12 - 56.
HORKHEIMER, Max (1984b): Nachtrag. In: HORKHEIMER, Max: Traditionelle und kritische Theorie - Vier Aufsätze. Frankfurt/M.: Fischer, S. 57 - 64.
HORKHEIMER, Max (1985a): Religion und Philosophie. In: HORKHEIMER, Max: Gesammelte Schriften. Bd. 7. Frankfurt/M.: Fischer, S.187 - 196
HORKHEIMER, Max (1985b): Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Frankfurt/M.: Fischer
JANTZEN, Wolfgang (1976): Materialistische Erkenntnistheorie, Behindertenpädagogik und Didaktik. Vortrag auf der 12. Arbeitstagung der Dozenten für Sonderpädagogik in Reutlingen 1975. In: Demokratische Erziehung, 1 (1976), S. 15 - 29.
JANTZEN, Wolfgang (1990): Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 2. Weinheim; Basel: Beltz.
JANTZEN, Wolfgang (1992): Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 1. Weinheim; Basel: Beltz.
JANTZEN, Wolfgang (1997): Deinstitutionalisierung. In: Geistige Behinderung, 36. Jg. (1997), H. 4, S. 358 - 372.
JANTZEN, Wolfgang (1998): Unterdrückung mit Samthandschuhen - Über paternalistische Gewaltausübung (in) der Behindertenpädagogik.
URL: http://www.uni-koblenz.de/~proedler/res/landau.pdf (Stand: 19.04.2009).
JANTZEN, Wolfgang u.a. (Hrsg.) (1999a): Lilienthaler Memorandum.
URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/jantzen-de-institut2.html (Stand: 14.10.2008).
JANTZEN, Wolfgang (1999b): Qualitätssicherung in einer Großeinrichtung. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/jantzen-de-institut7.html (Stand: 10.01.2006). (Link aktualisiert durch bidok, 10.12.2009)
JANTZEN, Wolfgang (2000): Deinstitutionalisierung in einer Großeinrichtung - Methoden und Methodologie im Prozess der wissenschaftlichen Begleitung. In: Behindertenpädagogik, 4 (2000), S. 338 - 351.
JANTZEN, Wolfgang (2001a): Vygotskij und das Problem der elementaren Einheit. In: JANTZEN, Wolfgang: Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, S. 221 - 243.
JANTZEN, Wolfgang (2001b): Gewalt und behinderte Subjektivität.
URL: www.staff.uni-marburg.de/~rohrmann/Gewalt/Gewalt-Kassel.htm (Stand: 11.10.2006).
JANTZEN, Wolfgang (2001c): Aspekte struktureller Gewalt im Leben geistig behinderter Menschen - Versuch, dem Schweigen eine Stimme zu geben.
URL: http://www.staff.uni-marburg.de/~rohrmann/Gewalt/GWLT-BLN.html (Stand: 18.05.2008).
JANTZEN, Wolfgang (2001d): Jeder Mensch kann lernen! Gedanken zum 60. Geburtstag von Christel Manske. In: JANTZEN, Wolfgang (2001): Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, S. 7 - 13.
JANTZEN, Wolfgang (2002): Gewalt ist der verborgene Kern von geistiger Behinderung. URL: http://www.basaglia.de/Artikel/Olten%202002.htm (Stand: 07.10.2006).
JANTZEN, Wolfgang (2003): Neuronaler Darwinismus - Zur inneren Struktur der neurowissenschaftlichen Theorie von Gerald Edelmann. URL: http://www.basaglia.de/Artikel/Edelman.pdf (Stand: 06.05.2009).
JANTZEN, Wolfgang (2005): "Es kommt darauf an, sich zu verändern..." - Zur Methodologie und Praxis rehistorisierender Diagnostik und Intervention. Gießen: Psychosozial-Verlag.
KAMMANN, Cornelia (2005): Projektbericht - Ermittlung der Kundenzufriedenheit von Menschen mit Behinderung im Kontext Dienstleistungen zur beruflichen Rehabilitation. Das Personalentwicklungsinstrument QED aus der Sicht der Werkstattbeschäftigten als Reha-Kunden. Hamburg: URL. http://www.alsterarbeit.de/cont/Projektbericht.pdfhttp://www.alsterarbeit.de/cont/Projektbericht.pdf(Stand: 06.05.2009).
KANT, Immanuel (1982): Kritik der praktischen Vernunft - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Frankfurt/M: Suhrkamp.
KANT, Immanuel (1984): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: BAHR, Ehrhard (Hrsg.): "Was ist Aufklärung?". Stuttgart: Reclam, S. 8 - 17.
KARCH, Dieter (2002): Ursachen der mentalen Retardierung. URL: http://www.kize.de/5-downloads/publikation33.pdf (Stand: 24.04.2009).
KEUPP, Heiner (2002): Identitätskonstruktionen - Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt.
KLEE, Ernst (1980): Behindert - Über die Enteignung von Körper und Bewusstsein. Frankfurt/M. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/klee-behindert.html (Stand: 09.03.2008).
KONIARCZK, Manfred (2006): Geistige Behinderung ist keine Krankheit. In: Der Neurologe & Psychiater, Jg. 2006, H. 4, S. 40 - 44.
KRAHMER, Utz (2005): In: ARMBROST, Christian; BERLIT, Uwe; MüNDER, Johannes (2005): Sozialgesetzbuch XII, Sozialhilfe. Lehr- und Praxiskommentar. 7. Auflage. Baden-Baden: Nomos
LAG (Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen Hamburg) (2006): Ambulantisierung der Behindertenhilfe in Hamburg - einige kritische Fragen. Thesenpapier vom 25.09.2006
LAUENROTH, Markus (2007): Subjektwissenschaftlich begründete Qualitätsentwicklung. Diplomarbeit, Leuphana Universität, Lüneburg.
LAUENROTH, Markus (2008): Erläuterungen zum IHP, Lüneburg: unveröffentlichtes Manuskript
LEWIN, Kurt (1968): Die Lösung sozialer Konflikte. Bad Nauheim: Christian-Verlag.
LUKáCS, Georg (1983): Geschichte und Klassenbewusstsein. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand.
LURIJA, Alexander R. (1993): Romantische Wissenschaft. Forschungen im Grenzbereich von Seele und Gehirn. Reinbek: Rowohlt
LURIJA, Alexander R. (1998): Das Gehirn in Aktion. Reinbek: Rowohlt.
LÜDTKE, Ulrike M.(2006): Emotion und Sprache: Neurowissenschaftliche und linguistische Relationen. Berlin. URL: http://www.reha.hu-berlin.de/sprach/sonstiges/SHA_Emotion.pdf (Stand: 06.05.2009).
MARCUSE, Herbert (1982): Der eindimensionale Mensch. Neuwied: Luchterhand.
MARKARD, Morus (2000): Was ist Kritische Psychologie? URL: http://www.kritische-psychologie.de/wasist.html (Stand: 24.07.2009)
MARX, Karl (1981a): Die deutsche Ideologie. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich: Texte zur Kritik der Philosophie. Frankfurt/M.: Sendler, S. 31 - 90.
MARX, Karl (1981b): Thesen über Feuerbach. In: In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich: Texte zur Kritik der Philosophie. Frankfurt/M.: Sendler, S. 27 - 30.
MARX, Karl (1981c): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich: Texte zur Kritik der Philosophie. Frankfurt/M.: Sendler, S. 13 - 26.
MARX, Karl (1990): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: Marx Engels Werke. Bd. 40. Berlin: Karl Dietz Verlag, S. 465 - 588
MARX, Karl (2005): Einleitung zu den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx Engels Werke. Bd. 42. Berlin: Karl Dietz Verlag, S. 15 - 45
MERCHEL, Joachim (2004): Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Weinheim/München: Juventa Verlag.
METZLER, Heidrun/ RAUSCHER, Christine (2004): Wohnen inklusiv. Wohn- und Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung in Zukunft. Projektbericht. Stuttgart: Diakonisches Werk Württemberg
MüLLER-KOHLENBERG, Hildegard (2004): Jenseits der Neutralität. In: BECKMANN, Christof; OTTO, Hans-Uwe; SCHRöDTER, Mark (Hrsg.): Qualität in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften, S. 369 - 378.
MüLLER-KOHLENBERG, Hildegard; KAMMANN,Cornelia (2000): Die NutzerInnenperspektive in der Evaluationsforschung. In: MüLLER-KOHLENBERG,Hildegard; KAMMANN, Cornelia (Hrsg.): Qualität von Humandienstleitungen. Opladen: Leske u. Budrich, S. 99 - 120.
NATHOW, Rainer (1981): Die Entsorgung findet in den Anstalten statt. Hamburg.
URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/mabuse_nathow-entsorgung.html (Stand: 04.04.2008).
NEUHÄUSER, Gerhard (2008): 50 Jahre medizinische Betreuung für Menschen mit geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung, 47. Jg. (2008), H. 1, S. 78 - 89.
NIEHOFF,Ulrich; PICKEL,Harald(1987): Situation geistig Behinderter in psychiatrischen Einrichtungen. In: Geistige Behinderung, 2 (1987), S.75 - 86.
ONGARO BASAGLIA, Franca (1985): Gesundheit. Krankheit. Das Elend der Medizin. Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag.
OSTERKAMP, Ute (2008): Soziale Selbstverständigung als subjektwissenschaftliches Erkenntnisinteresse. In: Forum Kritische Psychologie, 52 (2008), S. 9 - 28.
POHRT, Wolfgang (1997): Brothers in Crime. Berlin: Tiamat.
REIMER, Katrin (2008): Wie Methoden die Verhältnisse zum Tanzen bringen können... Eine Einführung in die Kritische Psychologie als eingreifende Forschungstätigkeit. In: FREIKAMP, Ulrike u.a. (Hrsg.): Kritik mit Methode? Forschungsmethoden und Gesellschaftskritik. Berlin: Karl Dietz Verlag, S. 195 - 214
RIEDMANN, Andrea (2003): Menschsein... heißt wohnen. Innsbruck. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/riedmann-wohnen-dipl.html (Stand: 30.05.2008).
RöDLER, Peter (2002): Rehistorisierung als Konstruktion. In: FEUSER, Georg; BERGER, Ernst (Hrsg.): Erkennen und Handeln. Berlin: Pro Business, S. 221 - 244.
ROHRMANN, Eckhard (2005): Ambulant oder stationär - Unterstützung behinderter Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe. Kassel. URL: http://www.forsea.de/aktuelles/Ambulant%20oder%20stationaer.pdf (Stand: 15.05.2009).
SARIMSKI, Klaus (2008).50 Jahre psychologische Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. In: Geistige Behinderung, 47. Jg. (2008), H. 1, S. 90 - 100.
SCHäDLER, Johannes (2002): Individuelle Hilfeplanung - Schlüssel zur Modernisierung der Behindertenhilfe. In: GREVE, Heinrich (Hrsg.): Hilfeplanung und Controlling in der Heilpädagogik. Freiburg/Breisgau: Lambertus, S. 171 - 192.
SCHNEIDER, Ulrike (1980): Sozialwissenschaftliche Methodenkrise und Handlungsforschung - Methodische Grundlagen der Kritischen Psychologie 2. Frankfurt/M.: Campus-Verlag.
SCHWARTE, Norbert (2007): Wohnstätten in der Krise - Den Umbruch gestalten. Konversionsprozesse in den Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Probleme und Lösungsansätze. URL:http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/ueber_uns/Mitgliederinformationen/downloads_Mitgliederinformationen/2.--Prof.Dr.-Schwarte.pdf (Stand: 19.04.2009).
SCHWARTE, Norbert; OBERSTE-UFER, Ralf (2001): LEWO II. Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Instrument für fachliches Qualitätsmanagement. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
SIEVERDING, Monika (1989): Konfliktfelder einer wissenschaftlichen Begleitung vor Ort - am Beispiel sozialpsychiatrischer Modellprojekte. In: BEERLAGE, Irmtraud; FEHRE, Eva-Maria (Hrsg.): Praxisforschung zwischen Intuition und Institution. Tübingen: DGVT, S. 127 - 135.
STRASSER, Urs (2006): Menschenbild und Heilpädagogik. Ideologie, Verirrung und Orientierungshilfe im 21. Jahrhundert. URL: http://www.ksh-sgai.ch/Aktuelles/Menschenbild_Urs_Strasser.pdf (Stand: 04.06.2009).
THEUNISSEN, Georg (1998): Empowerment und Enthospitalisierung. In: THEUNISSEN, Georg (Hrsg.): Enthospitalisierung - ein Etikettenschwindel? Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 62 - 93.
URBAN, Wolfgang (2006): Wer braucht ein Heim? URL: http://www.lvr.de/soziales/service/veranstaltungen/veranstaltungsreihe/vortragurban.pdf (Stand: 04.06.2009).
VYGOTSKIJ, Lev Semjenovic (1987): Das Problem der Altersstufen. In: VYGOTSKIJ, Lev Semjenovic: Ausgewählte Werke. Bd. 2. Köln, S. 53 - 90.
VYGOTSKIJ, Lev Semjenovic (2001a): Zur Frage kompensatorischer Prozesse in der Entwicklung des geistig behinderten Kindes. In: JANTZEN, Wolfgang (Hrsg.): Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, S. 109 - 134.
VYGOTSKIJ, Lev Semjenovic (2001b): Das Problem des geistigen Zurückbleibens. In: JANTZEN, Wolfgang (Hrsg.): Jeder Mensch kann lernen - Perspektiven einer kulturhistorischen (Behinderten-) Pädagogik. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand,
S. 135 - 163.
VYGOTSKIJ, Lev Semjenovic (2003): Die psychischen Systeme. In: LOMPSCHER, Joachim (Hrsg.): Lew Vygotskij - Ausgewählte Schriften. Bd. 1. Berlin: Lehmanns Media-LOB.de, S. 319 - 352.
WALDSCHMIDT, Anne (2003): Ist Behinderung normal? Behinderung als flexibelnormalistisches Dispositiv. In: CLOERKES, Günther (Hrsg.): Wie man behindert wird. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 83 - 101.
WEBER, Erik (2004): De-Institutionalisieren: Konzeptionen, Umsetzungsmöglichkeiten und Perspektiven zwischen fachwissenschaftlichem Anspruch und institutioneller Wirklichkeit. Dissertation. Universität. Köln.
WEBER, Joachim (2002): Auf dem Weg zur gesteuerten Gesellschaft. Die Entwicklung der ambulanten Behindertenhilfe in Hamburg (Teil 1). In: Standpunkt: Sozial, 3 (2002), S. 62 - 68.
WEBER, Max (1984): Die protestantische Ethik I. Tübingen: GTB Siebenstern.
WELTI, Felix (2006): In:WELTI, Felix; LACHWITZ, Klaus; SCHELLHORN, Walter (Hrsg.): Handkommentar zum Sozialgesetzbuch IX (HK-SGB IX). Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. 2. Auflage. Neuwied: Luchterhand.
W.A. (2008): Praktikumsbericht Leuphana-Universität Lüneburg, Fachbereich Sozialwesen, Lüneburg. (Unveröffentlichtes Manuskript).
WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO) (Hrsg.) (2008): European Observatory on Health Systems and Policies. URL: http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?phrase=A (Stand: 01.02.2008).
XXX-VEREINIGUNG HAMBURG (2003): Teamtage 2003. Hamburg: Unveröffentlichtes Protokoll)
XXX-VEREINIGUNG HAMBURG (2006): Entwicklungskonzept X-Straße. Hamburg. (Unveröffentlichtes Papier).
Quelle:
Rainer Kreuzer: "Qualitätsentwicklung als teilnehmender und intervenierender Forschungsprozess in der Behindertenhilfe. Eine empirische Handlungsforschung im sozialen Prozess der Ambulantisierung einer stationären Wohneinrichtung in Hamburg"
Der Fakultät I (Bildungs-, Kultur- und Sozialwissenschaften) der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades Doktor der Philosophie - Dr. phil. - vorgelegte Dissertation; eingereicht am 18.08.2009; Erster Gutachter Erster Gutachter: Prof. Dr. Kurt Bader, Leuphana Universität Lüneburg; Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Rainer Hoehne, Leuphana Universität Lüneburg; Dritter Gutachter:Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Universität Flensburg
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 19.05.2010