Menschen mit Lernschwierigkeiten an die Uni? Über die Mitarbeit von ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien
Diplomarbeit, Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosohie (Mag. Phil.) Studienkennzahl lt. Studienblatt: A297 Studienrichtiung laut Studienblatt: Diplomstudium Pädagogik Betreuer: Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer; Wien, im April 2012
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- 1. Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - In Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik"
- 2. Definitionen und Grundlagen
- 3. Bisheriger Stand der Literatur zu Inklusiver Forschung
- 4. Zielsetzung der Diplomarbeit
- 5. Forschungsfrage
- 6. Forschungssetting
- 7. Forschungsdesign
- 8. Qualitative Sozialforschung
- 9. Teilnehmende Beobachtung
- 10. Das Problemzentrierte Interview
- 11. Forschungsmethode: Grounded Theory
- 12. Umsetzung des Inklusiven Ansatzes in der Diplomarbeit
- 13. Vorstellung der am Seminar mitarbeitenden ExpertInnen
-
14 . Individuelle Rolle und Rollenverständnis von Menschen mit Lernschwierigkeiten
- 14.1. Dimension 1: Rolle und Rollenverständnis vor Seminarbeginn
- 14.2. Dimension 2: Diskursives Ausverhandeln und Annehmen von neuen Rollen und Verantwortlichkeiten im Laufe des Forschungsprozesses
- 14.3. Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen
- 14.4. Dimension 4: Durch die Teilnahme resultierende Veränderung und Erweiterung von Rollen und Kompetenzen
- 15. Empowerment
- 16. Empowerment - behindernde Aspekte und Kritik am Setting
- 17. Resümee
- Literaturverzeichnis
- Lebenslauf
Folgenden Personen sei mein herzlicher Dank ausgedrückt:
Denjenigen Menschen mit Lernschwierigkeiten, die als ExpertInnen in eigener Sache am Inklusiven Seminar an der Universität Wien mitarbeiteten. Ich würde euch alle hier gerne namentlich nennen, doch leider würde das die von euch gewünschet Anonymisierung ad absurdum führen.
Mag. Tobias Buchner und Mag. Oliver Koenig, denn sie ermöglichten die Mitarbeit am Projekt und standen auch abseits davon mit Rat und Tat zur Seite. Auch Markus Eichinger darf hierbei nicht vergessen werden. Danke für Alles!
Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer, der mich geduldig und mit wertvollen Hilfestellungen betreut hat.
An privater Unterstützung seien die Personen genannt, die mir beim Korrekturlesen und Formatieren halfen. Weiters meine Freundinnen und Freunde, die mich während der langen Zeit begleiteten, die diese Diplomarbeit letztlich in Anspruch nahm. Ich werde euch alle nicht namentlich erwähnen und vertraue darauf, dass ihr euch angesprochen fühlt. Dies gilt im Besonderen für jenen Herren, der keinesfalls namentlich erwähnt werden möchte. Rita steht mir in einer unendlich wertvollen Freundschaft ohne Wenn und Aber zur Seite. Danke dir ganz speziell!
Meiner Familie, besonders Christine, Ulrike, Wilfried und Michl, muss ebenfalls gedankt werden. Leider fehlt einer, der das Ende meines Studiums nicht mehr miterleben darf. Ihm möchte ich diese Arbeit widmen.
Im Wintersemester 2007/08 besuchte ich selbst die Lehrveranstaltung, die Inhalt dieser Diplomarbeit sein wird - damals noch unter dem Titel "Partizipative Forschungsmethoden mit Menschen mit Lernschwierigkeiten". Dieser Forschungszugang weckte nicht nur mein wissenschaftliches Interesse, konnte ich in diesem Zusammenhang doch an einem ersten kleinen Forschungsprojekt mitarbeiten. Durch die neuen Perspektiven, die sich daraus ergaben, veränderte sich auch meine berufliche Sicht der Dinge als Betreuerin für Menschen mit Lernschwierigkeiten im Bereich des vollbetreuten Wohnens und in einer Freizeiteinrichtung. Recht schnell entwickelte sich eine tiefergehende Beschäftigung mit Inklusiver Forschung, das durch das Angebot, meine Diplomarbeit im Rahmen einer Mitarbeit am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Forschung" im Wintersemester 2008/09 sowie im Sommersemester 2009 als semesterübergreifende Lehrveranstaltung zu verfassen, bestätigt wurde.
Diese Diplomarbeit widmet sich Empowerment-Prozessen, die sich durch die Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien, konkret dem Institut für Bildungswissenschaft, ergeben können. Dieses Seminar ist der Tradition Inklusiver Forschung zuzuordnen und zielt darauf ab, im Rahmen forschungsgeleiteter universitärer Lehre Studierenden diesen Forschungszugang näher zu bringen - auch durch die unmittelbare Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Durch die sehr intensive Zusammenarbeit mit neun Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache lernte ich diese auch abseits des Forschungsinteresses kennen und durfte an freudvollen ebenso wie an tragischen und problematischen Momenten teilhaben. Dafür sei an dieser Stelle explizit diesen neun Personen gedankt. Aber auch Mag. Koenig und Mag. Buchner bin ich zu Dank verpflichtet, denn sie gaben mir nicht nur die Möglichkeit, diesen Forschungszugang kennen zu lernen und damit zu arbeiten, sondern haben mir auch abseits vom Inklusiven Seminar Türen geöffnet, die damit in Zusammenhang stehen. So durfte ich etwa bei insgesamt drei Tagungen Vorträge mit vorbereiten und teilweise auch halten und es wurden entsprechende Publikationen, auch unter meiner Beteiligung, veröffentlicht.
Nach diesen einleitenden Worten kann nun auf die Inhalte der vorliegenden Diplomarbeit eingegangen werden. Vorab soll jedoch kurz beschrieben werden, wie diese Arbeit aufgebaut ist und was den Leser oder die Leserin in weiterer Folge erwarten wird.
Inhaltlich ist der vorliegende Text in drei Kapitel gegliedert:
Im ersten Teil werden theoretische Grundbegriffe geklärt und Definitionen erarbeitet, die notwendig sind, um ein tiefergreifendes Verständnis für die durchgeführte Forschung zu erlangen.
Es folgt Durchführung der Forschung, wobei Grundlagen wie etwa die Forschungsmethode in theoretischer Form ausgeführt und mit konkreten Beispielen aus dem Forschungsprozess belegt werden.
Im Dritten und letzten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse als Ergebnisse dargestellt. Hier sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Fülle der gesammelten Daten eine Beschränkung erfolgen musste. Der Fokus liegt hier auf Empowerment-Prozessen der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, wenngleich auch bei Studierenden sicher spannende Aspekte in Bezug auf die dem empirischen Teil zu Grunde liegende Fragestellung gefunden werden könnten.
Im abschließenden Resümee werden die gewonnenen Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Fragestellungen und Bearbeitungsmöglichkeiten vorgenommen.
Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" mit der Studienplan-Nummer 5.7.4/5 wurde im Wintersemester 2008/09 sowie im Sommersemester 2009 als semesterübergreifende Lehrveranstaltung von Mag. Oliver Koenig und Mag. Tobias Buchner gemeinsam mit einer Gruppe von neun Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache - wie dieser Begriff zu verstehen ist, soll etwas weiter hinten geklärt werden (vgl. Abschnitt 2.4. - der ExpertInnen-Begriff) - am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Wien veranstaltet. In diesem Rahmen habe ich, die Autorin dieser Diplomarbeit, ebenso wie Markus Eichinger, die Möglichkeit bekommen, zu einer selsbt gewählten Fragestellung eine Diplomarbeit zu verfassen und den Rahmen des Seminars als Datenerhebungsquelle zu nutzen.
Dieses Seminar hatte es sich zum Ziel gesetzt, Studierenden das Konzept der Inklusiven Forschung näher zu bringen. Worum es sich dabei genau handelt, soll an dieser Stelle nicht geklärt werden, konkrete Ausführungen finden sich in Abschnitt 2.2.4. - Inklusive Forschung. Dabei war die Grundidee, dies nicht nur auf theoretischer Ebene umzusetzen, sondern im Rahmen dieses Seminares an Inklusiven Forschungsprojekten zu arbeiten.
Hintergrund dessen ist, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in vielerlei Hinsicht ausgeschlossen werden, vor allem dann, wenn es um Universität und Wissenschaft geht:
-
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den Orten, an denen über sie gelehrt und geforscht wird, ausgeschlossen.
-
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von den fachlichen und politischen Diskursen, die ÜBER sie geführt werden, ausgeschlossen.
-
Menschen mit Lernschwierigkeiten sind von dem Wissen über die (methodischen) Möglichkeiten der Durchführung eigener Forschung ausgeschlossen. (Koenig et al. 2010, S. 181, Hervorhebungen im Original)
Um einen kleinen Beitrag zur Veränderung in diesen Belangen herbeizuführen, wurde das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" ins Leben gerufen. Es wurde erstmals im Wintersemester 2007/08 veranstaltet, diesmal als einsemestrige Lehrveranstaltung, ebenso wie im Sommersemester 2008. Der dritte und letzte Durchlauf als zweisemestrige Lehrveranstaltung im Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009 entspricht dem Zeitraum der Datenerhebung.
Die Konzeptionierung des Seminares geschah durch Mag. Koenig und Mag. Buchner, gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die dazu beitragen wollten, die oben angesprochenen Missstände zu verändern. Dies sollte so von statten gehen:
-
als inklusive Lehrveranstaltung: Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen gemeinsam mit Studierenden an jenem Ort, an dem bisher lediglich über sie geforscht und über ihre Lebenswelten berichtet wurde, selbst aktiv teilhaben und in die Diskurse und methodischen Praktiken der Inklusiven Forschung eingeführt werden.
-
Als inklusiv gestaltete Lehre: Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten als Unterrichtende im Vordergrund stehen und die Möglichkeit bekommen, sich gleichsam mit den über sie geführten Diskursen in angemessener Weise auseinanderzusetzen. Dieser Perspektivenwechsel soll zudem einen Reflexionsprozess bei den Studierenden ermöglichen und so auch zu einer Steigerung der Qualität der Lehre beitragen.
-
Als forschungsgeleitete Lehre: Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit inklusiver Forschung und der gemeinsamen Aneignung forschungsmethodischer Grundfertigkeiten sollen die erlangten Erkenntnisse unmittelbar in die Forschungspraxis umgesetzt werden, wobei die beteiligten ExpertInnen dabei sukzessive neue Rollen und Verantwortlichkeiten übernehmen. Die zu beforschenden Themen wurden dabei von den ExpertInnen selbst eingebracht. (Koenig et al. 2010, S. 182, Hervorhebungen im Original)
In der konkreten Umsetzung bedeutete dies, dass jede der neun am Seminar beteiligten Personen mit Lernschwierigkeiten eine Gruppe von mindestens zwei bis maximal vier Studierenden zur Seite gestellt bekam, um in weiterer Folge über die Dauer von zwei Semestern an einem Forschungsthema inklusiv zu arbeiten, welches die Person mit Lernschwierigkeiten zuvor ausgewählt hatte. In den Seminareinheiten gab es immer wieder theoretische Inputs und Informationen zu methodischen Herangehensweisen, ebenso wie konkrete Hilfestellungen zu den jeweiligen Schritten im Forschungsprozess. Nach den Seminareinheiten fand für die mitarbeitenden Personen mit Lernschwierigkeiten eine Nachbesprechungsrunde statt, um den jeweiligen Status Quo zu erheben, gemeinsam zu reflektieren und zu komplizierte Informationen nochmals erklären zu können. Diese wurde von Mag. Koenig und Mag. Buchner geleitet, die sich auch den inhaltlichen Nachfragen annahmen.
Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" wurde 2008 mit dem Anerkennungspreis der Bank Austria für innovative Lehre an österreichischen Hochschulen ausgezeichnet.
Nachdem nun die Rahmenbedingungen der Themenstellung und Datenerhebung für diese Diplomarbeit dargestellt wurden, kann dazu übergegangen werden, die theoretischen Grundlagen und verwendeten Begriffe zu klären.
Inhaltsverzeichnis
Im Folgenden sollen jene Begriffe aufgearbeitet werden, die für das weiterführende Verständnis der Diplomarbeit von Bedeutung sind: "Menschen mit Lernschwierigkeiten" (Abschnitt 2.1.), "Der Forschungshintergrund - Inklusive Forschung und verwandte Forschungsmethodologien" (Abschnitt 2.2.), "Empowerment" (Abschnitt 2.3.), "Der ExpertInnen-Begriff" (Abschnitt 2.4.) sowie "Rolle und Rollenverständnis" (Abschnitt 2.5.).
Ich[1] verwende im Laufe der Diplomarbeit konsequent und fortlaufend den Begriff "Menschen mit Lernschwierigkeiten". Wenn an manchen Stellen andere Bezeichnungen verwendet werden, so stammen diese aus Zitaten oder aus Bezügen zu diesen Zitaten. Was dieser Begriff meint und woher er stammt, soll im Folgenden erläutert werden.
"Menschen mit Lernschwierigkeiten" ist der selbstgewählte Begriff der People First-Bewegung[2] (vgl. Abschnitt 2.1.2. - Exkurs: Die Selbstvertretetungs-Bewegung und People First) und meint all jene Personen, die bisher als "Menschen mit einer geistigen Behinderung", "Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung" und ähnlich bezeichnet wurden. Ich möchte an dieser Stelle für eine erste Abklärung dieses Begriffes die Namensgeber selbst zu Wort kommen lassen, wenn sie schreiben:
"Ein Ziel von People First ist es, den diskriminierenden Begriff ‚geistige Behinderung' abzuschaffen. Der Begriff ‚geistige Behinderung' wertet uns ab und viele Personen trauen uns dadurch immer noch viel zu wenig zu. Denn wer hat das Recht, den Geist eines Menschen zu beurteilen? Nach was wird der Geist bemessen? Wer legt dafür die Messlatte an? Und wer kann das überhaupt? Wir von People First benutzen den Begriff ‚Menschen mit Lernschwierigkeiten'. Dieser Begriff soll aussagen, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, die Ziele zu erreichen, die wir erreichen möchten. Denn häufig werden uns zu wenige Möglichkeiten geboten, um geeignete Lösungen für uns und unser Leben zu finden." (Göthling und Schirbort 2011, S. 61)
Der Begriff "Menschen mit Lernschwierigkeiten" stammt aus dem englischsprachigen Raum, v.a. aus den USA, und wurde in den 1980er-Jahren erstmals als "people with learning difficulties" oder "people with learning disabilities" eingeführt (vgl. Theunissen und Plaute 2002). Die deutsche Übersetzung "Menschen mit Lernschwierigkeiten" ist mittlerweile im wissenschaftlichen Bereich oftmals, wenngleich nicht durchgehend und konsequent in Verwendung.
Beart (2005) geht davon aus, dass es oftmals Personen aus Selbstvertretungsgruppen sind, die sich selbst als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" bezeichnen. Dies sei wissenschaftlich aber schwer nachzuweisen. In einer eigenen Studie hat sie acht Personen interviewt, die sich selbst als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" bezeichnen und sich einer Selbstvertretungsgruppe angeschlossen haben. Alle diese TeilnehmerInnen haben sich mit der Gruppe, bestehend ausschließlich aus Menschen mit Lernschwierigkeiten, identifiziert, die Hälfte davon hat dieses Label jedoch nicht als hervorstechend empfunden und alle TeilnehmerInnen hatten Probleme damit, die Bedeutung dieses Labels zu definieren. Ein Grund dafür ist laut Beart die unterschiedliche und oftmals sehr komplexe Terminologie, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet wird. Dies führt zu Verwirrungen bei den betroffenen Personen, da Dienstleistungen und andere von offizieller Seite gestellte Gegebenheiten eine völlig andere, dennoch aber nicht einheitliche Terminologie verwenden. Beart schlägt offene und ehrliche Diskussionen mit SelbstvertreterInnen seitens sämtlicher ProfessionalistInnen vor, um dem entgegenzuwirken und sämtliche verwendete Bezeichnungen, die nicht von betroffenen Personen selbst verwendet werden, zu hinterfragen (vgl. Beart 2005).
Dan Goodley (1998), der selbst den Begriff "People with Learning Difficulties" verwendet, argumentiert, dass bei Menschen mit Behinderung von einer Schädigung ausgegangen wird, die letztlich zu einer Behinderung führt. Die Behinderung selbst geht demzufolge gleichsam vom Individuum aus. Goodley bezeichnet dies als "Individual Model of Disability" (Goodley 1998, S. 440). Diese Menschen sind von ihrer Umwelt sowie von medizinischer und professioneller Expertise und deren Dominanz abhängig. Auf diese Weise entsteht eine Kultur der Abhängigkeit und Nicht-Akzeptanz.
Anstatt eines "individuellen Modells von Behinderung" verweist Goodley auf das "Soziale Modell von Behinderung" (vgl. Abschnitt 2.2.1. - Das Soziale Modell von Behinderung), das besagt, dass obwohl eine Person eine Schädigung ("impairment") aufweist, dies noch lange keinen Hinweis darauf geben kann, ob dieselbe Person in der Gesellschaft als behindert gilt oder nicht. Der Fokus in diesem Modell liegt auf der Gesellschaft, nicht auf dem Individuum, denn es ist die Gesellschaft, die Menschen exkludiert, diskriminiert und stigmatisiert. "Menschen mit Lernschwierigkeiten" brechen aus der ihnen zugeschriebenen sozialen Rolle aus und brechen Regeln, bekämpfen dominante Vormachtsstellungen und bedrohen die Grundfeste der Vorstellung von Behinderung durch die Gesellschaft. Dies geschieht nicht zuletzt durch den Zusammenschluss in Selbstvertretungsorganisationen und People First-Gruppen (vgl. Goodley 1998, S. 440f.). Aus diesem Blickwinkel heraus ist auch die Begriffsfindung - weg von "Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung" und hin zu "Menschen mit Lernschwierigkeiten" - nicht unbedeutsam, denn in dieser Begrifflichkeit steckt eine Bewegung, die ihre eigenen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Ziele definiert.
Lernschwierigkeiten ist aber auch ein Begriff, der sehr leicht missverstanden werden kann. So können damit z.B. auch Personen mit emotionalen und Verhaltensstörungen sowie mit speziellen Lernstörungen gemeint sein (vgl. Biewer 2009, S. 60). Im Kontext dieser Diplomarbeit wird - der Definition von People First folgend - unter "Menschen mit Lernschwierigkeiten" jedoch jene Personengruppe gemeint, die bisher als "geistig behindert" oder ähnlich bezeichnet wurde. Dennoch soll in weiterer Folge auch kurz darauf eingegangen werden, welche Bezeichnungen und Definitionen für dieselbe Personengruppe gebräuchlich sind, ohne auf diese kritisch einzugehen.
In diesem Abschnitt wird die Auffassung von Behinderung nach der OECD, verschiedene medizinische Zugänge zum Behinderungsbegriff, namentlich ICD-10 und DSM IV, sowie eine Möglichkeit eines soziologischen Zuganges zu diesem Themenkomplex dargestellt. Den Abschluss dieser Ausführungen bildet der Zugang zum Behinderungsbegriff in der ICF.
Sämtliche dieser Ausführungen erfolgen unkommentiert, sollen aber dennoch angeführt werden, um ein umfassenderes Bild von Behinderungsbegriffen abseits des Terminus "Menschen mit Lernschwierigkeiten" zu erlangen.
Die OECD findet nicht eine Definition für Behinderung, sondern greift auf drei Kategorien zurück, die voneinander zu unterscheiden sind:
Kategorie A (Behinderungen, "disabilities"): Behinderungen oder Schädigungen, die primär organisch verursacht sind, insbesondere Defekte im sensorischen, motorischen und neurologischen Bereich. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht aufgrund dieser Behinderungen.
Kategorie B (Lernschwierigkeiten, "learning difficulties"): Emotionale Störungen, Verhaltensstörungen oder spezielle Lernstörungen. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf entsteht aus den Interaktionen zwischen der betreffenden Person und dem erzieherischen Umfeld.
Kategorie C (Benachteiligungen, "disadvantages"): Benachteiligungen entstehen aus sozio-ökonomischen, kulturellen und/oder sprachlichen Gegebenheiten. Der Erziehungs- und Bildungsbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit, Benachteiligungen aufgrund der genannten Faktoren zu kompensieren.
(vgl. Biewer 2009, S. 60)
Weiters müssen in diesem Zusammenhang auch die Definitionen nach ICD 10 und DSM IV genannt werden, die als gängigstes Diagnose-Manual herangezogen werden.
Der ICD 10-Code[3] geht von der Bezeichnung "Intelligenzminderung" aus und beschreibt diese so:
"Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.
Der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Meßmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzminderung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen."
F70 - leichte Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 50-69 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 9 bis unter 12 Jahren). Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Leichte geistige Behinderung.
F71 - mittelgradige Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 35-49 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren). Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten können aber ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit. Mittelgradige geistige Behinderung.
F72 - schwere Intelligenzminderung: IQ-Bereich von 20-34 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 3 bis unter 6 Jahren). Andauernde Unterstützung ist notwendig. Schwere geistige Behinderung.
F73 - schwerste Intelligenzminderung: IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt. Schwerste geistige Behinderung.
Dieser Definition sehr ähnlich, wenngleich mit unterschiedlicher Akzentuierung, ist die Beschreibung im DSM IV.
Das Manual DSM IV[4] verwendet die Bezeichnung "Mental Retardation" und beschreibt diese folgendermaßen (aus dem Englischen eigenständig übersetzt):
A: Signifikant unterdurchschnittliche intellektuelle Leistung: IQ unter 70 nach einem individuell gehandhabten IQ-Test
B: Gleichzeitige Defizite oder Schädigungen in der aktuellen adaptiven Funktionsfähigkeit (v.a. in Bezug auf die erwarteten Standards dem Alter oder der kulturellen Gruppierung entsprechend) in zumindest zwei der folgenden Bereiche: Kommunikation, Selbstversorgung, zu Hause leben, soziale und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Nutzung von Einrichtungen des Gemeinwesens, Selbst-Ausrichtung, zweckmäßige schulische/akademische Fähigkeiten, Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sicherheit.
C: Erstmaliges Auftreten/Erkennen vor dem 18. Geburtstag.
Der DSM IV-Code unterscheidet verschiedene Grade in Bezug auf intellektuelle Schädigung:
Code 317: leichte geistige Behinderung: IQ etwa 50-55
Code 318.0: mittlere geistige Behinderung: IQ von 35-40 bis 50-55
Code 318.1: schwere geistige Behinderung: IQ 20-25 bis 35-40
Code 318.2: schwerste geistige Behinderung: IQ unter 20-25
Felkendorff (2003) beschreibt die Thematik rund um die Begriffsfindung aus soziologischer Sicht und geht davon aus, dass Personen, die als "behinderte Menschen", "Menschen mit Behinderung", "Menschen mit einer Beeinträchtigung" oder "Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf" klassifiziert werden, keineswegs identisch sind sowie auch ein und derselbe Begriff von verschiedenen Instanzen völlig unterschiedlich definiert werden kann. Übereinstimmung bei den AnwenderInnen der genannten Begriffe bestünde nur in Hinblick auf zwei Tatsachen:
Zum einen markieren alle genannten Begriffe Gruppen von Personen als Opfer dessen, was die Soziologie als "soziales Problem" bezeichnet.
Zum anderen ist die Erforschung der Lebens-, Lern- und Entwicklungsbedingungen der so bezeichneten Menschen auch dann ein legitimes Anliegen der Forschung, wenn im Hinblick auf die Bezeichnung des zu erforschenden sozialen Problems alle oder fast alle der in Verwendung befindlichen Begriffe und/oder deren Definitionen umstritten sind (vgl. Felkendorff 2003, S. 25).
All diese Definitionen und Bezeichnungen meinen dieselbe Personengruppe, die die People First-Bewegung als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" tituliert. Nachdem von der Selbstvertretungsbewegung sowie auch von People First nunmehr schon mehrfach die Rede war, wird in weiterer Folge in einem kleinen Exkurs darauf eingegangen, was darunter zu verstehen ist, da letztlich auch die im empirischen Teil genannten und beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten zum größten Teil aus Selbstvertretungs-Organisationen stammen.
Die ICF, die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, wurde von der WHO herausgegeben und knüpft am bio-psycho-sozialen Modell an (vgl. WHO 2005). Es sollen dabei nicht nur Behinderungen und Krankheitsfolgephänomene dargestellt werden, sondern die ICF möchte auch Komponenten von Gesundheit erfassen (vgl. Biewer 2009).
"Der Begriff der Funktionsfähigkeit eines Menschen umfasst alle Aspekte der funktionalen Gesundheit.
Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren -
-
ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen),
-
sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),
-
sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen).
Der Behinderungsbegriff der ICF ist der Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen." (WHO 2005, S. 4)
Die ICF versucht, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten. Aus diesem Grund werden Klassifikationen in folgendem Rahmen betrachtet:
"Als Klassifikation gruppiert die ICF systematisch unterschiedliche Domänen für einen Menschen mit einem bestimmten Gesundheitsproblem (z.B. was ein Mensch mit einer Krankheit oder einer Gesundheitsstörung tatsächlich tut oder tun kann). Funktionsfähigkeit ist ein Oberbegriff, der alle Körperfunktionen und Aktivitäten sowie Partizipation [Teilhabe] umfasst; entsprechend dient Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]. Die ICF listet darüber hinaus Umweltfaktoren auf, die mit den genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen. Auf diese Weise wird es dem Benutzer ermöglicht, nützliche Profile der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit eines Menschen für unterschiedliche Domänen darzustellen."(vgl. a.a.O., S. 9)
Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder Verletzungen, werden dabei nach dem ICD-10-Code angegeben (vgl. a.a.O.).
Die ICF bildet somit ein umfangreiches Instrument der Beschreibung von Behinderung, deckt dabei aber vor allem den Bereich der Medizin ab und ist in der Pädagogik nur bedingt umsetzbar (vgl. Biewer 2009).
"Self-advocacy" - Selbstvertretung - meint das Sprechen für sich selbst und das selbstständige Vertreten der eigenen Ansprüche. Ihre Anfänge liegen in Freizeitclubs in Schweden, wo Betroffene die Gestaltung ihrer Freizeitaktivitäten selbst in die Hand nahmen (vgl. Biewer 2009, S. 145). Inzwischen gibt es weltweit Zusammenschlüsse von Menschen mit Lernschwierigkeiten, in denen Betroffene ihre eigene Situation, ihre Rechte, Bedürfnisse, Wünsche und Probleme diskutieren sowie gegenseitige Unterstützung finden, sich gemeinsam für ihre eigenen Angelegenheiten, insbesondere für gesellschaftliche Zugehörigkeit, einzusetzen (vgl. Theunissen 2009, S. 109).
Von Skandinavien ausgehend erstreckte sich die Idee der Selbstvertretung zunächst über Großbritannien und dann weiter in die USA und Kanada. Es erfolgten Zusammenschlüsse in Gruppen und Gruppierungen, die gemeinschaftlich Tagungen veranstalteten. Die ersten Tagungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten fanden 1968 in Schweden und 1972 in England statt. 1973 wurde eine solche Tagung auch in Kanada und kurz darauf in den USA organisiert, mit der Besonderheit, dass letztere von Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst vorbereitet und durchgeführt wurde. Die Tagung 1973 in Otton Crest, Oregon, ist die Geburtsstunde der People First-Bewegung. Die Namensgebung erfolgte aus der Aussage einer Teilnehmerin:
"We are tired of being seen first as handicapped or retarded or disabled. We want to be seen as people first." (vgl. und zit. nach Göthling und Schirbort 2011, S. 58)
People First kann als Bewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet werden (vgl. a.a.O., S. 57). Dabei werden neben sozialen und gesellschaftlichen auch politische Ziele verfolgt. Die zweite nordamerikanische People First-Konferenz von 1991 definiert Self-Advocacy wie folgt:
"Self-Advocacy handelt von unabhängigen Gruppen behinderter Menschen, die sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen, indem sie einander helfen, ihr Leben zu führen und gegen Diskriminierung kämpfen. Uns wird gezeigt, wie man Entscheidungen, die unser Leben betreffen, fällt, damit wir unabhängiger sein können. Man informiert uns über unsere Rechte, aber während wir unsere Rechte kennen lernen, lernen wir auch etwas über unsere Pflichten. Die Art und Weise, in der wir lernen, für uns selbst zu sprechen, ist die gegenseitige Unterstützung und gegenseitige Hilfe beim Erwerb von Selbstvertrauen, auszusprechen, an was wir glauben." (Dybward 1996, zit. nach Theunissen 2009, S. 109)
Im deutschsprachigen Raum fand diese Idee erst sehr spät Anklang. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe veranstaltete erst 1994 eine Tagung zum Thema "Selbstbestimmung", an der auch Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv beteiligt waren (vgl. Biewer 2009, S. 146).
Das Netzwerk People First Deutschland e.V. nennt vier grundlegende politische Ziele:
-
Leichte Sprache/Easy to read als Beitrag zur Barrierefreiheit
-
Abschaffung des Begriffs "geistige Behinderung", Verwendung der Bezeichnung "Menschen mit Lernschwierigkeiten"
-
Bekanntmachung und Umsetzung des Persönlichen Budgets
-
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. Göthling und Schirbort 2011, S. 60ff.)
In Österreich ist die People First und SelbstvertreterInnen-Bewegung eher überschaubar und ein wenig unstrukturiert, deswegen können an dieser Stelle nur einige wenige Beispiele angeführt werden:
-
Vienna People First-Gruppe in Wien (gegründet 2001)[5]
-
"Netzwerk Selbstvertretung" (gegründet 2008)[6]
-
People First Vorarlberg (keine Angabe eines Gründungsjahres, aktiv in Bludenz und Dornbirn)[7]
-
Interessensvertretung "Selbstbestimmt Leben"[8]
-
Selbstvertretungsgruppe der Lebenshilfe Wien[9] (seit 1999)
Nach dieser kurzen Einführung in Selbstvertretung und People First wird in einem weiteren Abschnitt ersichtlich gemacht, worum es sich bei Inklusiver Forschung handelt.
Bevor näher darauf eingegangen wird, worum es sich bei Inklusiver Forschung genau handelt und welche Zusammenhänge zu anderen Forschungsmethodologien bestehen, erfolgt an dieser Stelle eine knappe Definition von Inklusiver Forschung, um einen ersten Einblick zu gewinnen:
Walmsley und Johnson (2003) beschreiben Inklusive Forschung als das Einbeziehen von Menschen mit Lernschwierigkeiten in den gesamten Forschungsprozess, von der Auswahl der Forschungsfrage bis hin zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Sie sind nicht länger Objekt, sondern Subjekt in der Produktion von Forschung. Sie nehmen eine aktive Rolle ein, in der sie auch unmittelbar zu ForscherInnen werden, indem sie sämtliche Schritte des Forschungsprozesses aktiv mitbestimmen und mitgestalten.
"(...) We define inclusive research as research which includes or involves people with learning disabilities as more than just subjects of research. They are actors, people whose views are directly represented in the published findings in their own words but - and this is important - they are also researchers playing an active role as instigators, interviewers, data analysts or authors." (Walmsley und Johnson 2003, S. 61f.)
Dieses Modell der Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten hat sich aus Strömungen heraus entwickelt, die nicht nur den Behinderungsbegriff, sondern auch den Zugang zu Forschung und Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst haben. Vor einer eingehenen Klärung des Begriffes "Inklusive Forschung" sollen diese Strömungen und Forschungsmethodologien kurz dargestellt werden, um zu einem tiefergehenden Verständnis zu gelangen. Vorneweg ist es jedoch wesentlich, das all diesen Forschungsmethodologien zugrunde liegende Verständnis von Behinderung aufzuzeigen: Das "Soziale Modell von Behinderung". Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um eine der Inklusiven Forschung verwandten Forschungsmethodologie handelt, sondern viel eher um eine grundsätzliche Haltung.
Mike Oliver (1994) zeichnet in seinem Artikel "Capitalism, Disability and Ideology: A Materialist Critique of the Normalization Principle" ein Abbild des Behinderungsbegriffes aus historischer Perspektive, um in weiterer Folge ein neues Modell des Behinderungsbegriffes aufzuspannen - das "Soziale Modell von Behinderung".
Oliver geht davon aus, dass die Unterdrückung, der Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind, in den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Kapitalismus gründet:
"Hence the oppression that disabled people face is rooted in the economic and social structures of capitalism. And this oppression is structured by racism, sexism, homophobia, ageism and disablism which is endemic to all capitalist societies and cannot be explained away as a universal cognitive process." (Oliver 1994, S. 6)
In einem kapitalistischen System werden Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer eingeschränkten Arbeitsleistung verurteilt - sie haben keinen oder wenig "Wert". Dies gilt vor allem während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit den schweren körperlichen Anforderungen, die an ArbeiterInnen in Fabriken gestellt wurden. Gleichzeitig erfuhren die Naturwissenschaften eine Blütezeit, in diesem Zusammenhang vor allem die Medizin. Behinderungen wurden aus medizinischer Sicht erklärt und eine Heilung der Schädigung mit medizinischen Methoden angestrebt, um in weiterer Folge einen gesellschaftlichen "Wert" - also eine möglichst stabile und umfassende Arbeitsleistung - zu erreichen (vgl. Oliver 1994 und Stalker et al. 1999). Behinderung wird aus dieser Sicht gesehen als "an individual problem requiring medical treatment" (Oliver 1994, S. 7) - ein individuelles Problem, das medizinische Behandlung benötigt. Diese Sichtweise dominiert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
Demgegenüber steht das "Soziale Modell von Behinderung". Hier wird davon ausgegangen, dass Barrieren innerhalb der Gesellschaft viel eher als die individuelle Schädigung einer Person als Ursprung von Behinderung zu sehen sind. Im Sozialen Modell von Behinderung wird unterschieden zwischen "Schädigung" und "Beeinträchtigung".
"Schädigung" meint in diesem Zusammenhang das Fehlen eines Körperteils oder eines Teiles davon, den Defekt eines Körperteiles, Organismus oder Mechanismus des Körpers.
"Beeinträchtigung" im Gegensatz dazu ist die Benachteiligung oder Einschränkung einer Aktivität, verursacht durch die gegenwärtige Gesellschaft, die keine oder wenig Verantwortung für Menschen mit Schädigung übernimmt und sie so aus sozialen Aktivitäten ausschließt.
Somit liegt das Problem nicht in der individuellen Schädigung einer Person, wie zuvor im medizinischen Modell von Behinderung angenommen, sondern in der Gesellschaft, die eine Schädigung erst zur Beeinträchtigung macht (vgl. Stalker et al. 1999, S. 9).
Das Soziale Modell von Behinderung hat einen neuen Weg innerhalb der Sozialwissenschaften eröffnet - die Disability Studies, zu denen auch Inklusive Forschung gezählt werden muss. Eine Definition dieser könnte - dem Sozialen Modell von Behinderung anschließend - wie folgt aussehen:
"Disability is broadly understood as the mainstream exclusion of people with sensory, physical or cognitive impairments. Disability Studies aims to interrogate - and change - elements of the disabling world, including the political, economic, social, cultural, interpersonal, relational and discursive. It is therefore an inherently interdisciplinary paradigm." (Goodley und Van Hoove 2005, S. 15)
Die beiden Autoren weisen somit bereits auf Themenfelder hin, die auch in den der Inklusiven Forschung verwandten Methodologien sowie der Inklusiven Forschung selbst wesentliche Aspekte darstellen: Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, zwischenmenschliche, in Beziehung stehende und logisch folgernde.Aus dem Sozialen Modell von Behinderung hat sich somit ein eigener Zweig der Wissensproduktion entwickelt: Die Disability Studies, in deren Tradition auch Inklusive Forschung anzusiedeln ist.
Nachdem nun auf die Grundlage Inklusiver Forschung und aller verwandter Forschungsmethodologien eingegangen wurde, sollen letztere in weiterer Folge dargestellt werden. Diese Ausführungen werden sehr kurz gehalten, da die genannten Methodologien zwar einen wesentlichen Einfluss auf Inklusive Forschung nehmen, das Hauptaugenmerk jedoch dennoch auf letztere gelegt werden muss.
Am Anfang der Ausführungen steht die Handlungsforschung.
Die Handlungsforschung, auch bekannt als Aktionsforschung, hat ihren Ursprung in den 1970er-Jahren, vor allem innerhalb der Sozialforschung des deutschsprachigen Raumes. Man wollte sich von empirisch-analytischen sowie quantitativ-naturwissenschaftlichen Methoden der Wissenschaftspraxis abgrenzen.
Die Handlungsforschung hat zum Ziel, Theorie und Praxis enger miteinander zu verknüpfen, vor allem, indem man das Wissen und die Erfahrung von betroffenen Personen in die Forschung einbringt. Personen, die bisher "Forschungsobjekte" darstellten, sollten zu "Subjekten der Forschung" werden, indem sie an konkreten Forschungsprojekten mitarbeiteten (vgl. Flieger 2003).
Das essentielle Element der Handlungsforschung ist die Kommunikative Validierung, bei der der Dialog mit den erforschten Personen wesentlich zum Forschungsprozess beiträgt und somit wissenschaftliche Erkenntnis und praktische Konsequenzen aufeinander bezogen sind (vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006).
"Kommunikative Validierungsverfahren haben dort ihren Sinn und ihre unaufhebbare Notwendigkeit, wo die theoretischen Interpretationen von Aussagen, insbesondere Selbstdarstellungen, die Funktion haben, eine mit den Erforschten gemeinsame Praxis vorzubereiten und zu strukturieren, für die die Richtigkeit der Interpretationen insofern bedeutsam ist, als sich die Beteiligten über die objektiven Bedingungen des Untersuchungsfeldes und die darin enthaltenen Veränderungsmöglichkeiten zu verständigen haben." (a.a.O., S. 15)
Die Handlungsforschung wurde massiv kritisiert, hat sich im Endeffekt jedoch auch der Entwicklung qualitativer Forschungsmethoden zugewandt, die mittlerweile anerkannt und etabliert sind (vgl. Flieger 2003).
"Von der Aktionsforschung blieb der Anspruch übrig, dass Forschung an die Interpretationsmuster und Sinnstrukturen der "Beforschten" anzuknüpfen habe." (Moser 1995, zit. nach Flieger 2003)
In einem weiteren Schritt erfolgt die Darstellung einer weiteren, der Inklusiven Forschung nahe stehenden Forschungsmethodologie. Es ist dies PAR ("Participatory Action Research").
Participative Action Research - kurz PAR genannt - stammt aus dem US-amerikanischen Raum und könnte kurz wie folgt definiert werden:
"PAR refers to a process whereby the researchers and constituents together identify the problem to be investigated and collaborate throughout the entire data gathering, dissemination, and utilization process." (Markey, Santelli und Turnbull, ohne Jahresangabe, S. 20)
Beforschte Personen nehmen also aktiv am gesamten Forschungsprozess teil. Dabei sind zwei wesentliche Faktoren zu beachten:
-
(Forschungs-)Probleme müssen gemeinsam identifiziert und gelöst werden.
-
Es ist sicherzustellen, dass die Lösungen dieser Probleme nicht nur nützlich sind, sondern von den beforschten Personen auch verwendet werden können. (vgl. a.a.O.).
Weiters muss angefügt werden, dass PAR das Ziel verfolgt, soziale Veränderungen herbeizuführen, indem Personen aus einer unterdrückten Gemeinschaft oder Gruppe aktiv an Forschung teilnehmen (vgl. Garcia-Iriartre et al. 2008). Dem folgend ist PAR eindeutig in die Tradition Inklusiver Forschung einzureihen.
Flieger (2003) weist ausdrücklich darauf hin, dass PAR nicht als spezielle sozialwissenschaftliche Methode verstanden werden kann, sondern vielmehr als grundsätzliche Haltung bzw. als Forschungsansatz.
Hier erreichen wir einen Anknüpfungspunkt, der von Inklusiver Forschung nur noch sehr schwer zu trennen ist. Widmen wir uns also dem Hauptbestandteil der vorliegenden Diplomarbeit: Der Inklusiven Forschung.
Inklusive Forschung kann "als Ausdruck einer Bewegung innerhalb der Sozialwissenschaften gesehen werden, welche sich von einem essentialistischen und paternalistischen Wissenschaftsverständnis abwendet und stattdessen für unterdrückte Personen(gruppen) Partei ergreift und darauf abzielt, durch Forschung auf soziale Missstände hinzuweisen und politische Veränderungen herbeizuführen. Ein wesentliches Anliegen ist es dabei, Unterdrückten durch die Verwendung qualitativer, kreativer Methoden eine Stimme ("voice") zu verleihen." (Koenig und Buchner 2011/1, S. 3)
Bevor nun jedoch näher darauf eingegangen wird, welche Inhalte und Ziele Inklusive Forschung genau verfolgt und was dabei zu beachten ist, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Inklusive Forschung als Sammelbegriff zu verstehen ist für unterschiedliche Formen der Einbeziehung von Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Forschung (vgl. Koenig et al. 2010). Dabei sind vor allem die emanzipatorische und die partizipatorische Forschung gemeint.
"Inclusive Research is a term used to refer a range of research approaches that have traditionally been termed participatory or emancipatory, broadly speaking research in which people with learning difficulties are involved as more than just research subjects or respondents." (Walmsley 2001, zit. nach Koenig et al. 2010, S. 179)
Sofern in dieser Arbeit also die Rede von emanzipatorischer oder partizipatorischer Forschung ist, stammen diese Ausdrücke aus den verwendeten Zitaten und sind im Begriff "Inklusive Forschung" mit eingeschlossen. Dennoch sind diese beiden Forschungsmethodologien nicht gleichzusetzen.
Es folgt nun eine kurze schematische Darstellung (Abbildung 1) der wesentlichsten Unterschiede zwischen Partizipatorischer und Emanzipatorischer Forschung aus einem Beitrag von Koenig et al. (2010), um einen kleinen Einblick in das zu bekommen, was Walmsley (2001) in oben angeführtem Zitat als "Inklusive Forschung" zusammenfasst:
|
Partizipatorische Forschung |
Emanzipatorische Forschung |
|
|
Methodologie |
Primär phänomenologisch (Erforschung der Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen), zumeist qualitative Methoden |
Forschung als politisches Handeln, sowohl qualitative als auch quantitative Methoden |
|
Ideentheoretische Ausrichtung |
Nicht vorgegeben, zumeist verortet innerhalb des Normalisierungsdiskurses oder des Sozialen Modells von Behinderung, Beförderung positiver Bilder von Menschen mit Behinderung |
Klare Übernahme des Sozialen Modells von Behinderung, Forschung wird nur durchgeführt, wenn es einen praktischen Nutzen für Menschen mit Behinderung hat |
|
Kontrolle |
ForscherInnen arbeiten partnerschaftlich mit Menschen mit Behinderung v.a. in der Phase der Datenaufnahme |
Menschen mit Behinderung haben Kontrolle über alle Aspekte des Forschungsprojekts - von der Formulierung der Forschungsfrage bis zur Dissemination |
|
Rolle der ForscherIn |
Die Expertise eines/einer Experten/Expertin, wird gegenseitig geteilt, manchmal auch eine beratende bzw. unterstützende Funktion |
Die Expertise von nicht-behinderten ForscherInnen wird zur Verfügung gestellt |
|
Themen |
Themen, die für Menschen mit Behinderung relevant sind |
Erforschung und Identifizierung geeigneter Handlungsstrategien für Veränderungsprozesse |
|
Rechenschaftspflicht |
Gegenüber Fördergebern und der Akademia |
Gegenüber Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen |
Ein wesentlicher Beitrag zur Darstellung Inklusiver Forschung findet sich bei Walmsley und Johnson (2003), die in "Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present and Futures" die Grundlagen Inklusiver Forschung anführen. Sie definieren Inklusive Forschung so:
"We will define it as research in which people with learning disabilities are active participants, not only as subjects but also as initiators, doers, writers and disseminators of research." (Walmsley und Johnson 2003, S. 9)
Zu dieser Definition formulieren die beiden Autorinnen eine Reihe von Kriterien, die vorliegen müssen, um von Inklusiver Forschung sprechen zu können (an dieser Stelle wird die Übersetzung von Koenig et al. 2011 verwendet):
-
Die Forschungsfragen, Themen oder Problemstellungen müssen für Menschen mit Lernschwierigkeiten von Bedeutung sein.
-
Inklusive Forschung sollte dabei die Interessen von Menschen mit Lernschwierigkeiten vertreten und diese vorantreiben.
-
Die Forschung muss kooperativ sein und Menschen mit Lernschwierigkeiten Gelegenheit geben, am Forschungsprozess selbst als ForscherInnen mitzuwirken.
-
Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten über den Forschungsprozess ein gewisses Ausmaß an Kontrolle ausüben.
-
Die Forschungsfrage, der Prozess und die Ergebnisse müssen für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich sein. (Walmsley und Johnson 2003, S. 64 sowie Koenig et al. 2011, S. 147f.)
Petra Flieger (2003) nennt zusätzlich zu diesen Kriterien unterschiedliche Dimensionen der Partizipation, die das Ausmaß der Teilnahme an Inklusiver Forschung wesentlich beeinflussen:
-
Teilnahme, die den Inhalt der Forschung betrifft (Information, Interpretation, Analyse und Kommentieren der Ergebnisse, Planung und Umsetzung von Veränderungen)
-
Teilnahme, die den Forschungsprozess selbst betrifft (Unterstützung beim Prozess der Datengewinnung und -interpretation, Mitgestaltung des Forschungsprozesses als ForscherInnen bzw. Co-ForscherInnen)
-
Teilnahme, die den Inhalt, den Forschungsprozess oder beides betrifft (Information über den Forschungsprozess und seine Konsequenzen) (vgl. Flieger 2003)
Dies alles erscheint aus Sicht Inklusiver ForscherInnen notwendig, weil bisherige Forschung über Menschen mit Behinderung in Frage gestellt wurde. Traditionelle Forschung über Menschen mit Behinderung missachtet deren Erfahrungen, ist möglicherweise für die betroffenen Personen selbst gar nicht von Nutzen und hat keinen positiven Einfluss auf ihr materielles Wohlergehen und ihre Lebensqualität (vgl. Northway 2000). Anders formuliert hieße das:
"Sonderpädagogische Forschung ist im deutschsprachigen Raum immer noch durchgängig Forschung über Menschen mit Behinderungen statt mit Menschen mit Behinderung." (Buchner und Koenig 2008, S. 32, Hervorhebungen im Original)
Inklusive Forschung stellt den Versuch dar, das an traditioneller Forschung kritisch Betrachtete zu verändern. Die AkteurInnen der Selbstvertretungsbewegung tragen nicht zuletzt einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung (vgl. Johnson 2009).
Wesentlich an Inklusiver Forschung ist, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv an Forschung teilnehmen - und sich somit die Rolle von WissenschafterInnen, die ebenfalls Inklusiv forschen wollen, verändert. Mehr dazu findet sich im Abschnitt 2.5. - "Rolle und Rollenverständnis". Wie und in welcher Form sich Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Forschungsprozess einbringen, ist bestimmendes Element Inklusiver Forschung - auch wenn das bedeutet, dass ForscherInnen und WissenschafterInnen, so sie inklusiv forschen möchten, ihre eigene Rolle im Forschungsprozess überdenken müssen.
"How power in research is exercised ist central to the principles thus inclusive research demands a different approach from those who are traditionally referred to as researchers. Within this framework, research is no longer the exclusive province of the ‚expert'. Rather expertise and skills are shared collaboratively and each party to the research brings a range of skills, expertise and lived experience to the work." (Johnson 2009, S. 252)
Diese Art zu forschen ist nicht unumstritten. Aus diesem Grund folgt anschließend ein Abschnitt zum Thema "Kritik an Inklusiver Forschung".
Inklusive Forschung stellt einen relativ neuen Zugang zu Forschung im Bereich Menschen mit Lernschwierigkeiten dar. Nicht zuletzt deshalb sind im wissenschaftlichen Diskurs Stimmen vorhanden, die diesen Ansatz kritisieren.
Hier werden nun die wesentlichsten Argumente aus der Literatur genannt. Was die Kritik am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" als Inklusives Forschungsprojekt betrifft, so findet sich dafür eigens Raum, wenn die ausgewerteten Daten besprochen werden sollen (vgl. Abschnitt 16. - Empowerment-behindernde Aspekte und Kritik am Setting).
Danieli und Woodhams (2005) nennen einige Argumente innerhalb einer kritischen Betrachtung Inklusiver Forschung. Zum einen stellen sie das verstärkt im Vordergrund stehende politische Moment, das Inklusiver Forschung innewohnt, in Frage. Wenn die unterschiedlichsten Wege, die Unterdrückung einzuschlagen vermag, durch Forschung ans Tageslicht gebracht werden sollen, sind diese Wege nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch im Forschungsprozess selbst aufzuspüren.
"In other words, it requires an examination of both the material and the social relations of knowledge production." (Danieli und Woodhams 2005, S. 284)
Weiters nennen die beiden Autorinnen das Argument, dass Inklusive Forschung insofern als selektiv bezeichnet werden könnte, als sie vom Sozialen Modell von Behinderung ausgeht. Wenn aber, so die beiden Verfasserinnen weiter, Personen, die an der Forschung beteiligt sind, wie zum Beispiel Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst, dieses Modell gar nicht vertreten, weil sie es etwa nicht kennen (für sich selbst und andere betroffene Personen also von einem medizinisch orientierten Behinderungsbegriff ausgehen), dann bestünde der Verdacht, dass eben jene Ergebnisse beiseite gelassen werden könnten, weil sie ja die eigene Forschungsgrundlage in Frage stellten (vgl. Danieli und Woodhams 2005).
Außerdem ist die Frage der Macht für Danieli und Woodhams (2005) insofern offen, als niemals ganz ausgeschlossen werden könne, dass alle beteiligten Personen an Inklusiven Forschungsprojekten gleichermaßen mit Macht ausgestattet seien. Dies gelte zum Beispiel auch für Interviewpersonen mit Lernschwierigkeiten, wenn sie von forschenden Menschen mit Lernschwierigkeiten befragt würden:
"Effectively what we have in this scenario is the researcher, whether consciously or not, exercising power over the research subject, and potentially generating data which support their own arguments, i.e. socially desirable responses, rather than accurately representing the views of their research subjects." (Danieli und Woodhams 2005, S. 288)
Und nicht zuletzt kritisieren die beiden Autorinnen, dass Inklusive Forschung sich als "alleinige Wahrheit" verstehen wolle und andere Forschungsansätze nicht gelten lasse (vgl. a.a.O.). Inklusive Forschung stellt sich demnach über andere Zugänge zu Forschung und wertet diese ab.
Monika Wagner Willi (2011) hingegen betont, dass eine Gemeinsamkeit zwischen ForscherInnen und Forschungssubjekten fälschlicherweise auf der Grundlage eines Labels (in unserem Falle "Menschen mit Lernschwierigkeiten") vorausgesetzt würde - zum Beispiel in Referenzgruppen oder in der Interviewsituation, wie bereits bei Danieli und Woodhams genannt.
Abgesehen davon würden in eben diesen Situationen als Vergleichshorizont oftmals die Erfahrungswerte der interviewenden Person mit Lernschwierigkeiten herangezogen, was die Antworten und somit auch die Ergebnisse verfälschen könnte (vgl. Wagner-Willi 2011).
Sie schließt ihre Ausführungen mit folgendem Satz:
"Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass ich den Einbezug von Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Forschungspraxis grundsätzlich für möglich halte, jedoch nicht als eine Voraussetzung für eine dem Gegenstand angemessene Forschung sehe." (Wagner-Willi 2001, S. 44)
Weiters wurde immer wieder die Tatsache kritisiert, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten mit dem System Universität bzw. Wissenschaft nur bedingt etwas anfangen könnten, da sie diese Systeme - aufgrund der Tatsache, dass sie davon bisher immer ausgeschlossen waren - nicht kennen.
"The relationship between the academy and the disability movement is a problematic one." (Goodley und Moore 2000, S. 861)
Die beiden Autoren zielen mit dieser Aussage auch darauf ab, was Danieli und Woodhams (2005) an der politischen Stoßrichtung kritisierten: dass es nämlich nicht immer ganz einfach ist, politischen Aktivismus mit akademischer Forschung zu verbinden, vor allem dann nicht, wenn man die direkt betroffenen Personen auch in wissenschaftlichem Sinne mit ins Boot holen möchte.
Andererseits stellen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in Forschung eingebunden werden, auch ganz andere Hindernisse in den Weg. Diese Barrieren sind formaler Natur: Menschen mit Lernschwierigkeiten haben weder akademische Ausbildung noch Titel oder Matura und sind somit nicht berechtigt, in universitärem Rahmen zu arbeiten und dort aktiv zu partizipieren.
"Das eigene Karrierestreben und somit ‚bestehen Können' in einem derartigen System ist von der Erfüllung definierter akademischer Output-Kriterien abhängig. Erst durch die Akkumulation akademischer Titel, Publikationen und wissenschaftlicher Vorträge erhält der/die ForscherIn die formelle Legitimation, sein/ihr Handeln entsprechend durchzuführen und über einen längeren Zeitraum fortzusetzen." (Koenig und Buchner 2011/2, S. 269)
Ich als Autorin dieser Diplomarbeit erkenne an, dass Inklusive Forschung nicht vollkommen ist und Fehlerquellen immer wieder aufgespürt werden können und müssen. Dennoch hoffe ich, mit dieser Arbeit einen Beitrag zu leisten, sich mit Inklusiver Forschung auch kritisch auseinanderzusetzen, wenngleich ich meine eigene Arbeit völlig in Frage stellen müsste, könnte ich mich mit diesem Ansatz nicht identifizieren.
Widmen wir uns nun einem weiteren großen Thema im Rahmen dieser Diplomarbeit: Empowerment. Im Folgenden wird ausführlich dargestellt werden, was unter diesem Begriff zu verstehen ist und wie er in weiterer Folge operationalisiert werden wird.
Das Empowerment-Konzept ist in der vorliegenden Diplomarbeit ein sehr wesentliches Element, da die Auswertung der gewonnenen Daten sich an diesem Konzept maßgeblich orientiert. Bevor darauf eingegangen kann, wie und in welchem Zusammenhang es für die vorliegende Arbeit zu verstehen ist, ist ein kurzer Exkurs in die Geschichte dieses Konzeptes und des Begriffes "Empowerment" angebracht, um die Hintergründe besser verständlich zu machen.
Geschichtlich betrachtet gründet der Begriff "Empowerment" in der Sozialgeschichte der USA des 19. Jahrhunderts, obwohl der Begriff erst in der Bürgerrechtsbewegung der afro-amerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten in den 1960er-Jahren eingeführt wurde (vgl. Biewer 2009, S. 147). Hier wurde in selbstorganisierten und kollektiven Aktionen gegen Diskriminierung, gesellschaftliche Benachteiligung und Segregation gekämpft mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit und politischer Teilhabe. Als wesentliche Vertreter dieser Bestrebungen sind Malcolm X und Martin Luther King zu nennen. Ebenso angeführt werden muss in diesem Zusammenhang die lateinamerikanische Befreiungstheologie, wesentlich mitbestimmt von Paolo Freire (1921-1997), einem brasilianischen Pädagogen und Sozialreformer (vgl. Theunissen 2009, S. 31f.). Theunissen erkennt in beiden Entwicklungslinien die Gemeinsamkeit in der Grundüberzeugung, dass sozial benachteiligte und marginalisierte Personen einer Gesellschaft ihre Lebensumstände selbst verbessern können, indem sie sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden und sich selbst Fähigkeiten aneignen (vgl. a.a.O., S. 32). Somit stammt das Empowerment-Konzept also aus Zusammenschlüssen ethischer Minderheiten, die begonnen haben, für ihre eigenen Rechte zu kämpfen, woraus sich in weiterer Folge eine politische Macht entwickelt hat.
In Anlehnung an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und die Befreiungstheologie Paolo Freires haben sich viele unterschiedliche Entwicklungslinien zum Thema Empowerment gebildet, die alle auf dasselbe Grundmuster der "aktiven Gestaltung von Veränderungen durch ‚betroffene Menschen' als zentrales Thema" (Schlummer 2011, S. 33) zurückgreifen. Genannt werden kann hier laut Schlummer (vgl. a.a.O., S. 32) z.B.:
Empowerment
-
in der sozialen Arbeit
-
für Menschen mit geistiger Behinderung
-
in der Erwachsenenbildung
-
in der Psychiatrie
-
Empowerment und Gewaltfreiheit für Frauen im Gaza-Streifen
-
in der digitalen Stadtverwaltung
-
in der Kommunikation und Führung
-
als wichtiges Managementkonzept
-
in der Unternehmensführung und -entwicklung
Theunissen und Plaute (2002, S. 15) erweitern die sozialen Bewegungen, die das Empowerment-Konzept für sich nutzbar machen, um folgende Bereiche:
-
Frauenbewegung
-
Ökologiebewegung
-
Friedensbewegung
-
Behindertenbewegung
-
Kommunitarismusbewegung
-
Gesundheitsbewegung
-
Selbsthilfe- und Selbstvertretungsgruppen
-
Selbstbildungs- und Selbstermächtigungskampagnen
-
Lokal-politische BürgerInneninitiativen
-
Nachbarschafts- und Stadtteilprojekte
-
Gemeinwesenbezogene Aktionen
Weiters weisen Theunissen und Plaute (a.a.O.) darauf hin, dass alle diese Bewegungen, Initiativen und Projekte zur "Entmachtung, Entlegitimierung und Entgrenzung staatlicher Politik" beigetragen haben.
Betrachtet man denjenigen Teil des Empowerment-Konzeptes, der für Menschen mit Lernschwierigkeiten und somit für die vorliegende Diplomarbeit wesentlich ist, so lässt sich aus historischer Perspektive feststellen, dass einen wesentlichen Faktor in der Einbringung des Empowerment-Konzeptes in jenen Bereich die sogenannte "Krüppelbewegung", also ein politischer Zusammenschluss von Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, darstellt. Die "Krüppelbewegung" kämpfte in den 1980er-Jahren gegen Diskriminierung, Benachteiligung, Unterbringung und Fremdbestimmung in Pflegeheimen, Behindertenanstalten und Psychiatrien (vgl. Theunissen 2002, S. 4). Auch die Selbstvertretungsbewegung sowie People First (vgl. Abschnitt 2.1.2.) trugen wesentlich zur Implementierung des Empowerment-Konzeptes in den Bereich von Menschen mit Lernschwierigkeiten bei, indem sie aus eigener Kraft Zusammenschlüsse bildeten und sich ihrer Stärken bewusst wurden.
Nachdem nun in sehr verkürzter Form über die Hintergründe des Begriffes "Empowerment" berichtet wurde, ist es an der Zeit, den Begriff selbst genauer zu betrachten und den Versuch einer Definition für die vorliegende Diplomarbeit zu wagen.
Der Begriff "Empowerment" könnte wörtlich übersetzt werden als "Selbst-Bemächtigung", "Selbst-Ermächtigung" oder "Selbst-Befähigung" (vgl. Theunissen 2009; Biewer 2009). Hinter diesem Begriff verbirgt sich jedoch viel mehr als die bloße Übersetzung eines Wortes.
Der Empowerment-Begriff sagt aus, dass "vorhandene Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position (z.B. soziokulturell Benachteiligte; ethnische Minderheiten; allein erziehende Frauen; Menschen mit einer psychischen Krankheit oder Behinderung; Familien mit behinderten Angehörigen)" (Theunissen 2009, S. 27, Hervorhebung im Original) betont werden sollen, um in weiterer Folge "ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und sich für ihre Interessen ein[zu]setzen" (Biewer 2009, S. 147). Das Ziel liegt in der Kontrolle über die eigenen Lebensumstände (vgl. a.a.O.). Dem muss hinzugefügt werden, dass dem Empowerment-Konzept auch eine massive politische Komponente innewohnt, denn:
"Empowerment war von Anfang an mit politischen Zielsetzungen verbunden und wurde zunehmend zur Bezeichnung eines Prozesses, in dem benachteiligte und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich für ihre Interessen einsetzen."
(Biewer 2009, S. 147)
Es geht hier also vor allem um eine politische Stoßrichtung, um das Eintreten für die eigenen Interessen und darum, die eigenen Lebensumstände selbst kontrollieren zu können. Stärken werden von der betroffenen Personengruppe - in diesem Fall von Menschen mit Lernschwierigkeiten - erkannt und daraus Netzwerke und Zusammenschlüsse gebildet, aufgrund derer nicht nur das Individuum, sondern ein Kollektiv über neue Handlungsspielräume verfügt.
Bevor nun jedoch weiter in das Empowerment-Konzept eingegangen werden soll, sei darauf hingewiesen, dass "als Kerngedanke die Grundidee einer humanistischen Sichtweise zu konstatieren [ist], in der der Mensch mit der Fähigkeit der Selbstregulierung ausgestattet ist und Behinderung als Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses angesehen wird" (Schlummer 2011, S. 32). Näheres zu den Hintergründen wurde bereits in Abschnitt 2.2.1. (Das Soziale Modell von Behinderung) ausgeführt.
Nachdem nun grob umrissen wurde, worum es sich beim Empowerment-Konzept handelt, soll nun herausgearbeitet werden, welche Aspekte davon für die vorliegende Diplomarbeit, genauer gesagt für den empirischen Teil (vgl. Abschnitt 15 - Empowerment) wesentlich sind. Zu diesem Zweck wird eine Art Raster herausgearbeitet, anhand dessen in weiterer Folge die durch das vorliegende Forschungsprojekt gewonnenen Daten bearbeitet werden können - im Folgenden benannt als "Arbeitsraster Empowerment".
In diesem Abschnitt wird geklärt, welche Aspekte des Empowerment-Konzeptes, das im vorangegangenen Abschnitt definiert wurde, für die Bearbeitung des vorhandenen Datenmaterials im empirischen Teil dieser Diplomarbeit eine tragende Rolle spielen. Zu diesem Zweck werden Georg Theunissen und Dorothy Atkinson herangezogen, die beide einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion um Empowerment-Prozesse bei Menschen mit Lernschwierigkeiten leisten. Es wird versucht, aus den Schriften dieser beiden AutorInnen herauszufiltern, welche Ebenen von Empowerment sich finden lassen können, um sie in weiterer Folge in der Auswertung der gewonnenen Daten nutzbar zu machen.
Ein erster Ansatz zum Bearbeiten von Empowerment-Prozessen bei Menschen mit Lernschwierigkeiten findet sich bei Theunissen (2009, S. 27 ff.). Er erfasst - Herriger (2006) folgend - vier zentrale begriffliche Zugänge zu Empowerment:
-
Empowerment als Selbstverfügungskräfte, vorhandene Stärken oder individuelle Ressourcen zur individuellen Bewältigung von Problemlagen, Krisen, Konflikten oder Belastungen im Alltag aus eigener Kraft. Grundannahme hierbei ist das unbedingte Vertrauen in die eigenen Stärken von gesellschaftlich marginalisierten Personen und das Erkennen der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten.
-
Empowerment als politisch ausgerichtete Macht und Durchsetzungskraft durch die Emanzipation von Personengruppen aus einer relativen Ohnmacht hin zu politischer Einflussnahme. Ziel sind hierbei politische Bewusstwerdungsprozesse sowie politische Aktionen und Erfahrungen von bisher durch mangelnden Zugang zu sozio-kulturellen Ressourcen sowie gesellschaftlichen Institutionen (z.B. Bildungseinrichtungen) benachteiligten Gruppen.
-
Empowerment im reflexiven Sinne als Prozess, in dem gesellschaftliche Randgruppen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Sie werden sich dabei ihrer eigenen Würde und Fähigkeiten bewusst, eignen sich selbst Wissen und Handlungskompetenz an, entwickeln eigene Kräfte und nutzen soziale Ressourcen. Ziel ist die selbstbestimmte, eigenverantwortliche Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens.
-
Empowerment im transitiven Sinne durch das Entwickeln von Vertrauen in die eigenen Ressourcen, die Fähigkeit, eigene Angelegenheiten selbstständig zu regeln und sich gegenüber anderen zu behaupten. Dabei ist wesentlich, dass das nur die betroffene Person für sich selbst vollziehen kann, es kann z.B. nicht eine Betreuungsperson eine Person mit Lernschwierigkeiten "empowern", sondern lediglich Empowerment-Prozesse "anstiften" (etwa durch die Bereitstellung von Information oder die Erschließung und Mobilisierung von Ressourcen). Empowerment ist hier als professionelle Praxis gemeint, die bereit sein muss, "die traditionelle hierarchisch-paternalistische Ebene professioneller Arbeit aufzugeben und sich auf Prozesse des Aushandelns und Verhandelns, des gemeinsamen Suchen und Entdeckens einzulassen" (Lenz 2002, S. 16, zit. nach Theunissen 2009, S. 29).
Diese vier Zugänge sind nicht voneinander trennbar und scheinen einander auf den ersten Blick zu ähneln. Aus diesem Grund werden die wesentlichen Unterschiede dieser vier Ebenen noch einmal heraugearbeitet, um ein klareres Verständnis zu bekommen:
Ebene 1 ("Empowerment als Selbstverfügungskräfte") zielt darauf ab, dass die vorhandenen Stärken der betroffenen Personen bereits erkannt wurden und darauf auch vertraut wird - es wurden also bereits Erfahrungen gemacht, die wesentlich dazu beitragen, Empowerment-Prozesse in Gang zu setzen. "Vorhandene Stärken ermöglichen es dem Einzelnen Belastungssituationen selbst zu bewältigen" (Biewer 2009, S. 148).
Ebene 2 ("Empowerment als politisch ausgerichtete Kraft") spricht vor allem Zusammenschlüsse von betroffenen Personen an. Durch die Erfahrungen, die als Gruppe gemacht werden, kann das eigene Potential erkannt werden und in weiterer Folge politische Macht bzw. Einflussnahme ermöglicht werden. "Gruppen treten ein für den Abbau von Benachteiligung und Vorurteilen" (a.a.O.).
Ebene 3 ("Empowerment im reflexiven Sinne") beschreibt einen Prozess, bei dem die Bewusstwerdung der eigenen Fähigkeiten wie auch der eigenen Würde noch nicht abgeschlossen ist. Zuerst müssen die eigenen Fähigkeiten erkannt werden, um diese dann auch einsetzen und verteidigen zu können. "Behinderte Menschen werden sich ihrer Kompetenzen bewusst und nehmen ihre Angelegenheiten selbst in die Hand" (a.a.O.).
In Ebene 4 werden ProfessionalistInnen angesprochen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten dazu anregen sollen, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, ohne sie dazu zu zwingen. Empowerment kann nur durch das Individuum selbst erreicht werden, es kann nicht von außen aufoktroyiert werden. "Menschen werden angeregt, verschüttete Stärken zu nutzen und zu entwickeln" (a.a.O.).
Diese vier Zugänge werden im empirischen Teil (vgl. Abschnitt 15 - Empowerment) zum Tragen kommen, wenn das vorhandene Datenmaterial anhand dieser vier Ebenen analysiert wird. Notwendigerweise muss jedoch auch Dorothy Atkinson besprochen werden, die einen sehr wesentlichen Überschneidungspunkt von Empowerment und Inklusiver Forschung anspricht. Näheres dazu findet sich im nächsten Abschnitt.
Einen weiteren sehr wesentlichen Aspekt bringt Dorothy Atkinson ein. Sie arbeitet und argumentiert aus der Perspektive der Inklusiven Forschung, die auch dieser Diplomarbeit zu Grunde liegt (vgl. Abschnitt 2.2.4. - "Inklusive Forschung").
Davon ausgehend bearbeitet Dorothy Atkinson die Lebensgeschichten von Menschen mit Lernschwierigkeiten (sie nennt dies "Oral and Life History Research", vgl. Atkinson 2004; Atkinson und Walmsley 1999) und erkennt darin einen empowerment-fördernden Aspekt, indem "people can come to own and control the stories of their lives" (Atkinson 2004, S. 691). Autobiographien beinhalten das größte Potential für die Darstellung der eigenen Person (vgl. Atkinson und Walmsley 1999).
Atkinson benutzt narrative Methoden, um Menschen mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit zu bieten, ihr Leben wiederzuerzählen. Dieser Prozess wirkt empowerment-fördernd, indem sie die befragten Personen als "expert witnesses" (Atkinson 2004, S. 692), also als professionelle ZeugInnen, in Bezug auf ihr eigenes Leben ansieht und nicht als Datenquellen für ForscherInnen. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten könnte dies besonders bedeutsam sein, denn:
"[Some] People with learning difficulties, because of their segregated lives, have none of the usual ‚stock of stories' - from family, friends and community - nor the everyday documents, photographs and memorabilia of family life, from which to draw in order to make sense of their lives." (a.a.O.)
Dies mache, so Atkinson, Life History Research umso bedeutender und in weiterer Folge auch empowernder. "Lost voices" (Atkinson und Walmsley 1999, S. 203) kommen zu Wort und somit zu Bedeutung. Der Begriff "verlorene Stimmen" soll das Schweigen von Menschen mit Lernschwierigkeiten über Jahrzehnte hinweg ausdrücken, als man annahm, dass diese Personen nicht für sich selbst sprechen können (vgl. Atkinson und Walmsley 1999).
Weiters kann dadurch nicht nur die Geschichte einzelner Personen erzählt werden, sondern - fasst man alle diese einzelnen Geschichten zusammen - auch die Geschichte von Menschen mit Lernschwierigkeiten (einer Epoche) allgemein.
Atkinson hatte im "Past Time Project" (Atkinson 2004, S. 693ff.) ursprünglich geplant, eine Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten über die Dauer von sechs Wochen zu ihren Lebensgeschichten zu befragen. Daraus wurden letztlich zwei volle Jahre, denn die Gruppe wurde zu einem Selbstläufer, indem sich die beteiligten Personen selbstständig zusammenschlossen und erkannten, dass sie alle ähnliche Geschichten zu erzählen hatten. Atkinson selbst war dazu gezwungen, ihre Rolle als Forscherin hintanzustellen und wurde zur Schreiberin der Gruppe. Ihre Geschichten auch in schriftlicher, publizierter Form vorliegen zu haben war für die TeilnehmerInnen der Gruppe äußerst wichtig. Auf diese Weise wurde öffentlich sichtbar, was jede einzelne Person der Gruppe im Laufe ihres Lebens erlebt hatte. Durch das Zusammenfassen mehrerer Geschichten wurden nicht nur Überschneidungen in den Geschichten einzelner TeilnehmerInnen ersichtlich, sondern ihre Lebensgeschichten konnten auch in einen größeren historischen Kontext gestellt werden.
Atkinson konstatiert drei verschiedene Ebenen von Empowerment, die durch das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte sichtbar gemacht werden können (vgl. Atkinson 2004, S. 698ff.):
-
Individuelles Empowerment durch das Erzählen der eigenen Lebensgeschichte als lebendige Person, nicht als Falldarstellung. Menschen streben danach, ihrem Leben Bedeutung zu verleihen. Im Erzählen ihrer eigenen Geschichte gewinnen Menschen mit Lernschwierigkeiten eine neue Perspektive, auch dadurch, dass es möglich ist, durch die (Wieder-)Erinnerung an negative Erfahrungen dieselben besser zu verstehen und Rückschlüsse daraus zu ziehen. So wird der Sinn der eigenen Identität (erneut) reflektiert, woraus sich ein empowernder Prozess ergibt.
-
Kollektives Empowerment meint den Einfluss von Oral und Life History Research auf einem sozialen Level. Die teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten nehmen im Zuge des Forschungsprozesses eine tragende Rolle als ForscherInnen ein, was bereits das Einsetzen von Empowermentprozessen nach sich ziehen kann. Wesentlich ist aber auch der empowerment-fördernde Faktor des Erkennens von sozialer und politischer Unterdrückung bei sich selbst wie auch bei anderen TeilnehmerInnen der Gruppe durch den Austausch von Informationen und das gegenseitige Erzählen der eigenen Geschichte. Lebensgeschichten werden zu historischen Dokumenten, die aus der Sicht von "InsiderInnen" ein umfassendes Bild der Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten zeichnen. Gerade auch negativen Erfahrungen wie zum Beispiel dem hospitalisierten Leben kommt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Bedeutung zu, wenn eine Art "kollektiver Schmerz" in der Erinnerung aufkommt. (Er-)Fasst man mehrere individuelle Lebensgeschichten zusammen, können diese eine tragfähigere Basis bilden als eine einzelne Geschichte, indem sie allgemeine Themen einer Periode zu einem bestimmten Thema aufzeigen. Der Prozess des Erzählens der individuellen Geschichte selbst ist empowernd, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, auch ("Fighting back against authority", a.a.O, S. 699).
-
Praktiziertes Empowerment: Oral und Life history Research kann sowohl die Forschungspraxis (durch das Anregen Inklusiver Forschung) als auch die Praxis im Gesundheits- und Sozialwesen (durch das Animieren von ProfessionalistInnen wie SozialarbeiterInnen, Pflegepersonal, TherapeutInnen und PädagogInnen), Menschen mit Lernschwierigkeiten ihre Lebensgeschichten erzählen zu lassen, beeinflussen. Diese ProfessionalistInnen haben insofern besonders gute Möglichkeiten, Life History Research umzusetzen, als sie in unmittelbarer Beziehung zu Menschen mit Lernschwierigkeiten stehen und eventuell sogar am ehesten Zugang zu Dokumenten und familiären Quellen schaffen können. Hier könnte der Zugang zu Life History Research nicht über Forschung an sich, sondern etwa über das Erstellen eines "Lebensbuches" erfolgen, das dieselben Nachforschungen und Denkprozesse der erzählenden Person erfordert wie im wissenschaftlichen Kontext.
Bei allen diesen Ebenen ist zu beachten, dass immer kritisch reflektiert werden muss, wer die Lebensgeschichten erfasst und niedergeschrieben hat, da siedadurch natürlich gefiltert werden. Dabei sind drei Leitfragen wesentlich:
-
Wer hat das Erzählen der Lebensgeschichte initiiert und warum?
-
Wer hat sie niedergeschrieben und wie ist das vor sich gegangen?
-
Wer ist in Besitz der niedergeschriebenen Lebensgeschichte? (vgl. Atkinson und Walmsley, 1999)
In Zusammenhang mit der vorliegenden Diplomarbeit muss gesagt werden, dass es sich beim vorliegenden Datenmaterial nicht um die vollständigen Lebensgeschichten von Menschen mit Lernschwierigkeiten handelt. Die Ausführungen von Dorothy Atkinson sind dafür aber insofern bedeutend, als bei einer intensiven Zusammenarbeit mit dieser Zielgruppe über eine Dauer von knapp eineinhalb Jahren deren Lebensgeschichten selbstverständlich von Bedeutung sind. Dies schlägt sich bereits bei der Auswahl der Themen der jeweiligen Forschungsprojekte nieder und spielt in jedem einzelnen Schritt des Forschungsprozesses eine wesentliche Rolle.
Am Ende dieses Abschnitts ist festzuhalten, dass bei Georg Theunissen vier und bei Dorothy Atkinson drei Ebenen von Empowerment gefunden werden konnten, die bei der Auswertung des Datenmaterials eine tragende Rolle spielen werden.
Fahren wir - nachdem der Zugang zu und das Verständnis von Empowerment nun geklärt wurde - also fort mit der Klärung der wesentlichsten Begriffe, die im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit verwendet werden. Es folgt als nächstes die Klärung des Begriffes Experte/Expertin.
In dem beschriebenen Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" wurde für die mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten der Begriff "Experte" bzw. "Expertin" gewählt. Gemeint wurde und ist damit, dass wir, als ebenfalls am Seminar mitarbeitende Personen, und die betreffenden Personen sich selbst als "ExpertInnen in eigener Sache" verstehen, indem sie sich in Themenfelder einbringen, die zuvor ausschließlich Fachleuten - in diesem speziellen Fall wissenschaftlichem Personal bzw. Studierenden - zugedacht waren (vgl. Kulig, Schirbort und Schubert 2011, S. 9). Aber auch die People First-Bewegung (vgl. Abschnitt 2.1.2. - Exkurs: Die Selbstvertretungs-Bewegung und People First) verwendet die Bezeichnung "ExpertInnen in eigener Sache" und begründet dies damit, dass
"Menschen mit Lernschwierigkeiten als Experten in eigener Sache in allen Angelegenheiten selbst bestimmen und mitbestimmen, denn sie haben durch ihre eigene Lebensgeschichte die nötige Erfahrung." (Göthling und Schirbort 2011, S. 59)
Dies soll aussagen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, solange es um ihre Belange geht, auch volles Teilhabe- und Mitbestimmungsrecht haben sollten. Nimmt man dieses Recht ernst, so sind sie als diejenigen Personen anzusehen, die über die nötige Expertise verfügen, um Problemstellungen zum Thema Behinderung identifizieren zu können. Dies macht sie - unabhängig von ihrer Bildung, ihrer Lebenssituation oder in diesem Fall auch ohne die ansonsten unabdingbare akademische Ausbildung - zu "ExpertInnen in eigener Sache". Dies betrifft sowohl die tatsächliche Mitarbeit an Forschungsprojekten wie auch den Aspekt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, sofern es um Themenstellungen geht, die ihre Lebens- und Erfahrungswelt betreffen, selbst befragt werden können und müssen anstatt Nachforschungen bei deren Angehörigen, SachwalterInnen, LehrerInnen oder BetreuerInnen anzustellen (vgl. Buchner, Koenig und Schaefers 2011, S. 2).
"Of all forms of research in which people with learning disabilities have been major participants, the autobiography probably holds the greatest potential for full and equal partnership since the person who tells is unambiguously the ‚expert', the ultimate insider." (Walmsley und Johnson 2003, S. 149)
Solange Menschen mit Lernschwierigkeiten in Forschung einbezogen werden, sind sie - so Walmsley und Johnson - die "ultimativen InsiderInnen", ExpertInnen in eigener Sache, bedingt durch ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigene Lebensgeschichte.
Johnson (2009) geht sogar so weit zu schreiben, dass dieser ExpertInnen-Begriff auf sämtliche an der Forschung beteiligten Personen im Sinne eines kollaborativen Teilens von Wissen zutreffen könnte, denn:
Rather expertise and skills are shared collaboratively and each party to the research brings a range of skills, expertise and lived experience to the work." (Johnson 2009, S. 252)
Dass dieser Begriff - gerade auch im wissenschaftlichen Diskurs - widersprüchlich verstanden werden kann, liegt auf der Hand. Unterschiedlichste Definitionen des Begriffes "Experte/Expertin" sind bekannt und ausformuliert. In Zusammenhang mit dieser Diplomarbeit wird der Begriff jedoch in jenem eben ausgeführten Sinne verwendet.
Daran anschließend soll nun kurz aufgezeigt werden, welche Rollen und welches Rollenverständnis sich ergeben, wenn inklusiv geforscht werden möchte.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst darauf eingegangen, was ganz allgemein unter "Rolle" verstanden werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann aufgrund der Komplexitiät des Themas nur am Rande darauf eingegangen werden, wie die Rolle von Menschen mit Lernschwierigkeiten dargestellt werden kann. Erst in weiterer Folge wird aufgezeigt, welche Rollen und welches Rollenverständnis bei Inklusiver Forschung vorliegt.
Zur allgemeinen Auffassung von Rollen ist zu sagen, dass es sich beim menschlichen Verhalten um Rollenverhalten handelt, "d.h. es ist ausgerichtet an der Summe der Erwartungen anderer" (Cloerkes 2007, S. 164). Verhält man sich nicht rollenkonform, etwa als StudierendeR, LehrerIn, Lehrveranstaltungs-LeiterIn, VerkehrsteilnehmerIn, PatientIn etc. müsste man im schlimmsten Fall mit Konsequenzen rechnen (vgl. a.a.O.).
"Voraussetzung für die Übernahme von sozialen Rollen ist die Sozialisation zu einem handlungsfähigen Mitglied der Gesellschaft. Dieser Prozess ist lebenslang und durchaus nicht nur als einseitige Anpassung zu verstehen. Dauerhaftes abweichendes Verhalten führt in der Regel zu Sozialisation in die Rolle eines Devianten; das Verhalten wird damit wieder rollenkonform." (Cloerkes 2007, S. 164)
Menschen mit Lernschwierigkeiten könnten in diese - wie Cloerkes sie nennt - Rolle des/der Devianten fallen. Darum lohnt es sich, auch in diese Richtung kurz den Blick zu richten.
Cloerkes (2007) führt in seinem Werk "Soziologie der Behinderten" unter anderem den strukturellen Ansatz der Rolle von Menschen mit Behinderung nach Haber und Smith an. Diese treffen fünf Grundaussagen dazu:
-
"Die Behindertenrolle ist Ausdruck einer Anpassung des Betroffenen an Rollenerwartungen, die seinem Zustand ‚behindert' angemessen sind. Die Rolle des Behinderten ist vordefiniert, wird durch Sozialisation vermittelt, legt seine Teilhabe am Leben der Gesellschaft fest und hat Einfluss auf sein Selbstkonzept.
-
Die Behindertenrolle hat positive Funktionen. Sie ist funktional für den Behinderten und den Nichtbehinderten, weil sie Klarheit über die gegenseitigen Rollenerwartungen schafft. Sie schützt den Behinderten vor Überforderung und ‚normalisiert' damit sein Verhältnis zu anderen Menschen. Sie ‚legalisiert' die Abweichung des Behinderten im Gegensatz zu der von anderen Devianten.
-
Die Behindertenrolle unterscheidet sich von der Krankenrolle vor allem dadurch, dass beim Behinderten eine generelle Umdefinition der Person mit Zuweisung einer neuen Rolle und einer neuen Identität erfolgt.
-
Die Feststellung, Zuteilung und Legitimation der Behindertenrolle ‚normalisiert' die Stellung des Behinderten in der Gesellschaft. Er wird nicht zum ‚illegitimen' Devianten mit Bestrafung und Ausschluss, sofern er sich nicht in halsstarriger Weise dem Verlangen der Kontrollinstanzen nach Konformität widersetzt. Ein niedrigeres Lebensniveau und geringere soziale Teilhabechancen sind ein angemessener Preis für die ‚Normalisierung'
-
Im ‚Normalisierungsprozess' (nicht zu verwechseln mit dem ‚Normalisierungsprinzip'!) wird ‚unnormales' Aussehen und Verhalten als für Behinderte ‚normal' umdefiniert. Dies geschieht in erster Linie in den Kontrollinstanzen bzw. Einrichtungen für Behinderte. Sie können Behindertenrollen gewähren oder verweigern."(Haber und Smith 1971, zit. nach Cloerkes 2007, S. 167f., Hervorhebungen im Original)
Dieser Ansatz ist nicht unproblematisch, wobei alleine die Ausdrucksweise ("Die Behinderten") schon zeigt, dass es sich dabei um einen älteren Beitrag handelt. Dennoch eignen sich diese Ausführungen insofern gut, als sie einige Aspekte aufwerfen, die Inklusive Forschung zu verändern sucht (z.B. die Vordefinition der gesellschaftlichen Rolle von Menschen mit Behinderung, niedrigeres Lebensniveau und geringe soziale Teilhabechancen, uneingeschränkte Macht von Einrichtungen der Behindertenhilfe).
Inklusive Forschung zielt - nicht zuletzt dadurch, dass Personen, die zuvor vom System Wissenschaft und Forschung ausgeschlossen waren - darauf ab, Rollen nicht nur zu verändern, sondern völlig neu zu verteilen. Dies geschieht prozesshaft, denn alle Beteiligten müssen sich zuerst daran gewöhnen. Vor allem die Rolle des/der nicht-behinderten ForscherIn in Inklusiven Forschungsprozessen ist bisher gut und von mehreren AutorInnen durchleuchtet worden (vgl. Redmond 2005, Walmsley 2004, Walmsley und Johnson 2003). Diese spielen generell eine besondere Rolle, denn sie sind mit zusätzlichen Expertisen ausgestattet, die die beteiligten Experten und ExpertInnen mit Lernschwierigkeiten nicht haben können. Die Kunst ist, diese Expertisen mit einem hohen Maß an Sensibilität zu nutzen:
"She has to be someone who can explain research questions and issues clearly, who can summarize the literature in a way that people with little formal education can comprehend, network, conduct group work, record, teach, facilitate, negotiate and advocate. She also needs exceptional sensivity to power relationsships and to be prepared to hold back on her ideas in order that people with learning disabilities can express theirs." (Walmsley und Johnson 2003, S. 159f.)
Dies könnte somit also auch bedeuten, dass die Rollen der beteiligten ExpertInnen mit Lernschwierigkeiten maßgeblich von der Rolle des nicht-behinderten Forschers oder der nicht-behinderten Forscherin abhängen - und so kann eine äußerst gefährliche Dynamik entstehen, die nur durch Sensibilität (von Seiten des nicht-behinderten Forschers/der nicht-behinderten Forscherin) aufzulösen ist. Hier findet sich eine sehr wesentliche Unterscheidung zu Forschung von AkademikerInnen mit AkademikerInnen.
"In particular, the power and responsibility I had with regard to my co-researchers was significantly different to that which academics encounter when co-researching with other academics." (Redmond 2005, S. 82)
Beart, Hardy und Buchan (2005) konstatieren in einer Literaturanalyse in Bezug auf Rolle und Identität von Menschen mit Lernschwierigkeiten, dass die Vorstellung, die nicht-behinderte ForscherInnen vom Label "Behinderung" haben, nur durch den Diskurs mit den betroffenen Personen selbst im Sinne einer wissenschaftlichen Suche nach Wahrheiten aufgelöst werden kann, indem man denjenigen Personen, die mit dieser Identität Tag für Tag leben, sorgfältig zuhört (vgl. Beart, Hardy und Buchan 2005).
In diesem Sinne können die Rollen, die im Zuge eines Inklusiven Forschungsprozesses eingenommen werden, im Vorhinein nicht festgesetzt werden, denn solange es sich um individuelle Personen handelt, die daran beteiligt sind, kann es kein Schema geben, das zu dieser Thematik angewandt werden kann. Worauf es ankommt, sind Flexibilität und Sensibilität aller Personen, allen voran der nicht-behinderten ForscherInnen. Nur die unmittelbar am Projekt beteiligten Personen können die Rollen, die sie im Zuge des Forschungsprozesses einnehmen, ausverhandeln (vgl. Walmsley 2004).
Rolle und Rollenverständnis, aber auch Rollenumkehr (z.B. Ein Experte/eine Expertin mit Lernschwierigkeiten ist "Chef/Chefin" über eine Gruppe Studierender) werden einen wesentlichen Teil der Auswertung der Daten im empirischen Teil dieser Diplomarbeit einnehmen (vgl. Abschnitt 14.3.v- Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen). Wir bewegen uns hier auf äußerst heiklem Terrain, das leicht zu Verletzungen und Kränkungen führen kann, weswegen - wie bereits oben beschrieben - es nur schwer möglich ist, genau definierte Rollen bereits im Vorhinein festzulegen. Sie müssen prozesshaft ausverhandelt werden und verlangen ein hartes Stück Arbeit wie auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen.
Bevor nun jedoch endgültig zum empirischen Teil dieser Arbeit übergegangen werden kann, muss der bisherige Stand der Literatur zu Inklusiver Forschung dargestellt werden, ebenso wie die Zielsetzung der Diplomarbeit.
[1] Im Anschluss an eine konstruktivistische Sichtweise (vgl. Charmaz 2008 und 2011), bei der Wissen immer als von Menschen unter bestimmten sozialen Bedingungen konstruiertes Wissen verstanden wird, verwende ich in dieser Diplomarbeit durchgehend eine selbstbezügliche Sichtweise (vgl. Koenig und Buchner 2011/2). Die Konstruktivistische Sichtweise wird in Abschnitt 11 (Grounded Theory) näher erläutert.
[2] Vgl. z.B.: www.people1.de oder www.peoplefirst.org
[3] Quelle: http://www.psychotherapie.de/psychodiagnostik/icd-10/f70-f79.html, Stand: 2011-12-11
[4] Quelle: http://www.psychtreatment.com/mental_health_diagnosis_mental_retardation.htm, Stand: 2011-12-11
[5] Quelle: www.viennapeoplefirst-gaw.at, Stand: 2011-12-11
[6] Quelle: www.bizeps.or.at/news.php?nr=9030, Stand: 2011-12-11
[7] Quelle: tupalo.com/de/rd/4yyohm, Stand: 2011-12-11
[8] Quelle: www.selbstbestimmt-leben.net/index.php?content=startseite, www.slioe.at, Stand: 2011-12-11
[9] Quelle: www.dielebenshilfe.at/index.php?id=21, Stand: 2011-12-11
Literatur zum Thema "Inklusive Forschung" ist im deutschsprachigen Raum bisher eher selten zu finden. Der englischsprachige Raum - allen voran Großbritannien und Irland - bietet diesbezüglich bedeutend mehr, wenngleich in gebundener (Buch-)Form auch nur eher knapp. Nachdem diese Methodologie eine noch sehr junge ist, finden sich die meisten schriftlichen Belege zum Thema Inklusive Forschung somit in Artikelform.
Grundlagenliteratur zu diesem Thema in englischer Sprache bilden v.a. Walmsley und Johnson (2003), die in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnt wurden. Sie stellen in "Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present and Futures" nicht nur die Grundlagen Inklusiver Forschung in sämtlichen Schritten des Forschungsprozesses dar, sondern stellen auch ein konkretes Regelwerk auf, nach dem sich definieren lässt, wann und in welcher Form es sich um Inklusive Forschung handelt. Die wichtigsten Grundregeln wurden im Abschnitt 2.2.4. - "Inklusive Forschung" - bereits dargestellt.
Einführende Worte in Inklusive Forschung in deutscher Sprache findet, wenn auch sehr knapp, Petra Flieger (2003). Sie wurde im Zuge dieser Arbeit ebenfalls bereits mehrfach erwähnt. Auch sie gibt, wie Walmsley und Johnson (2003) an, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um von Inklusiver Forschung sprechen zu können. Diese sollen hier noch einmal kurz erwähnt werden:
-
Teilnehmende Personen müssen im Besitz von Informationen sein, die für die Fragestellung relevant sind.
-
Das Thema soll für die teilnehmenden Personen bedeutungsvoll und sinnvoll sein, vor allem auch, weil ein großer Zeitaufwand mit der Teilnahme an Inklusiver Forschung verbunden ist.
-
Verschiedene Sichtweisen sollen repräsentiert werden.
-
Der zur Verfügung stehende Raum für Mitgestaltung sollte gewährleistet sein (zeitlich, finanziell, Interesse, Rolle der beteiligten Personen). (vgl. Flieger 2003)
Sämtliche weiterführende Literatur zum Thema Inklusive Forschung geht von diesen (also jenen von Walmsley und Johnson wie auch von Flieger) oder ähnlichen Grundregeln von anderen AutorInnen aus. Diese Diplomarbeit orientiert sich weitgehend an Walmsley und Johnson (2003) und deren Definition von Inklusiver Forschung.
Inklusive Forschungsprojekte und deren theoretischer Überbau werden vordergründig in wissenschaftlichen Fachzeitschriften abgedruckt. Im englischsprachigen Raum sind solche Artikel weit häufiger anzutreffen als in deutscher Sprache. Beispielhaft genannt seien hier - abgesehen von den ohnehin bereits erwähnten Artikeln im Zuge dieser Arbeit - z.B. Gilbert (2004), Walmsley (2001), Iacono (2006), Freedman (2001), Lennox, Taylor, Conde et al. (2005), Cameron und Murphy (2006).
Nachdem bisher bereits einige Artikel und die dazugehörigen AutorInnen zu Wort gekommen sind, möchte ich an dieser Stelle nur noch auf einige wenige AutorInnen exemplarisch eingehen:
Aus der englischsprachigen Zeitschriftenliteratur bedeutsam für diese Arbeit ist die bereits in Abschnitt 2.3.3.2. ("Empowerment bei Dorothy Atkinson") erwähnte D. Atkinson, die einerseits betont, dass Inklusive Forschung einen hoch ausgeprägten sozialen Charakter hat und sogar so weit geht, Inklusive Forschung mit Sozialarbeit in Verbindung zu bringen (vgl. Atkinson 2005). Andererseits beschreibt sie auch, inwiefern Inklusive Forschung mit Empowerment-Prozessen in Zusammenhang steht (vgl. Atkinson 2004).
Val Williams (1999) geht auf den Aspekt des gemeinsamen Forschens ein und klärt zu diesem Zweck auch ab, was es bedeutet, mit dem Label "Lernschwierigkeit" konfrontiert zu sein und gleichzeitig zu forschen. Welche Rolle der nicht-behinderte Forscher/die nicht-behinderte Forscherin dabei innehat und was Forschung in diesem Zusammenhang überhaupt sein kann findet sich ebenfalls in ihren Ausführungen. In einem weiteren Artikel beschreibt Val Williams gemeinsam mit Ken Simons und dem Swindon People First Research Team anhand eines konkreten Beispieles Inklusiver Forschung sehr genau die Rolle der nicht-behinderten ForscherInnen (vgl. Williams, Simons et al. 2005).
Die deutschsprachige Literatur zu Inklusiver Forschung ist leider nicht ganz so reichhaltig wie die englischsprachige. Dabei finden sich einige Berichte über Inklusive Forschung, leider aber nur sehr wenige zu konkret umgesetzten Inklusiven Forschungsprojekten. Ausnahmen bilden zum Beispiel Flieger und Schönwiese (2007), Buchner und Westermann (2007), Carraro und Hintringer (2010) sowie Postek (2010). In Österreich hat sich entlang der Achse Wien-Innsbruck jedoch eine kleine Gruppe von WissenschftlerInnen zu diesem Thema gebildet, zu der auch eben genannte AutorInnen zählen:
Petra Flieger und Volker Schönwiese arbeiten zum Thema Inklusive Forschung in Innsbruck und haben dazu einige Forschungsprojekte durchgeführt. Petra Flieger wurde bereits mehrfach genannt, gemeinsam mit ihrem Partner Volker Schönwiese hat sie aber auch das Inklusive Forschungsprojekt "Bildnis eines behinderten Mannes" (vgl. Flieger und Schönwiese 2007) durchgeführt sowie im Jahr 2010 die Jahrestagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen, ebenfalls gemeinsam mit Volker Schönwiese, zum Thema "Menschenrechte - Integration - Inklusion" veranstaltet. Zu dieser Tagung haben die beiden auch einen Tagungsband herausgegeben, in dem sich einige Beispiele zu Inklusiver Forschung finden, darunter auch eine Publikation zum Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" von Markus Eichinger und mir selbst (vgl. Eichinger und Kremsner 2011).
In Wien stellt das Institut für Bildungswissenschaften ein eigenes kleines ForscherInnen-Team, das sich mit Inklusiver Forschung beschäftigt. Gottfried Biewer, Helga Fasching und Oliver Koenig zum Beispiel befassen sich mit der "Teilhabe von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung an Bildung, Arbeit und Forschung" (vgl. Biewer, Fasching und Koenig 2009).
Tobias Buchner, Oliver Koenig sowie Saskia Schuppener (2011) haben gemeinsam einen Artikel zum Thema "Gemeinsames Forschen mit Menschen mit intellektueller Behinderung" herausgegeben und gehen dabei auf die Geschichte, den gegenwärtigen Stand der Dinge in Bezug auf Inklusive Forschung sowie auf Möglichkeiten derselben, vor allem auch in Hinblick auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, ein.
Tobias Buchner und Oliver Koenig haben unter Mitarbeit einiger SelbstvertreterInnen aus Wien und Innsbruck weiters den Eröffnungsvortrag bei bereits genannter Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen in Innsbruck gehalten und diesen auch gemeinschaftlich in Artikelform präsentiert (vgl. Koenig, Buchner et al. 2011).
Das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik", welches den Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit bildet, stellt insofern einen Meilenstein Inklusiver Forschung in Österreich dar, als Inklusive Forschung in universitärem Rahmen zumindest im deutschsprachigen Raum in dieser Form noch nicht angeboten wurde. Erste Ergebnisse von Untersuchungen zu diesem Seminar wurden von Koenig, Buchner, Kremsner und Eichinger (2010) sowie von Eichinger und Kremsner (2011) publiziert.
Ausgehend von diesen Quellen kann festgestellt werden, dass im deutschsprachigen Raum ein massiver Nachholbedarf an Arbeiten zu Inklusiver Forschung besteht. Die Fragestellung dieser Diplomarbeit kann und soll nur einen kleinen Beitrag leisten, diese Forschungsmethodologie weiter zu legitimieren. An dieser Stelle möchte ich abermals ein Zitat einbringen, das bereits angeführt wurde. Da ich mich dieser Sichtweise jedoch voll und ganz anschließen möchte, wird es hier nun nochmals angeführt:
"Sonderpädagogische Forschung ist im deutschsprachigen Raum immer noch durchgängig Forschung über Menschen mit Behinderungen statt mit Menschen mit Behinderung" (Buchner und Koenig 2008, S. 32, Hervorhebungen im Original)
Aus diesem Status Quo der Literatur ergibt sich die Zielsetzung dieser Diplomarbeit, wie im Folgenden erläutert wird.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Empowerment-Prozesse, die im Zuge Inklusiver Forschung stattfinden können, darzustellen. Dazu wurde das Beispiel des Seminars "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" als formeller Rahmen gewählt, wobei sowohl das Setting des Seminares (Räumlichkeiten, universitärer Rahmen, Barrieren in Bezug auf das Gebäude wie auch dem wissenschaftlichen Rahmen etc.) als auch die beteiligten AkteurInnen - Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, Studierende, Lehrveranstaltungsleiter und TutorInnen - eine wesentliche Rolle spielen.
Nachdem eben genanntes Seminar im Wintersemester 2007/2008 sowie im Sommersemester 2008 bereits angeboten wurde, ist für den Zeitraum der Datenerhebung (Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009 als semesterübergreifende Lehrveranstaltung) ein wesentliches Moment, dass manche der ExpertInnen von Beginn an, andere erst nachträglich zur Gruppe der Inklusiven ForscherInnen hinzugestoßen sind. Dieses Faktum wiederum begründet die Annahme, dass Empowerment-Prozesse in diesem Rahmen tatsächlich stattfinden können, da bei jenen Menschen mit Lernschwierigkeiten, die von Beginn an mitarbeiteten, deutliche Veränderungen erkannt werden konnten und diese auch immer wieder von den betreffenden Personen selbst angesprochen wurden. Aber auch allgemeine, außerhalb des Seminares stattfindende Empowerment-Prozesse sollen dokumentiert werden, sofern diese stattgefunden haben (vgl. Koenig et al. 2010).
An dieser Stelle kann nun also übergegangen werden von theoretischen Überlegungen hin zum Eintauchen in die konkrete Umsetzung der Forschung. Dabei wird dargestellt, wie und in welcher Form der empirische Teil dieser Arbeit konzipiert wurde. Den Beginn macht die Ausformulierung und Begründung der Forschungsfrage, gefolgt von Forschungssetting und Forschungsdesign. Danach wird kurz auf Qualitative Sozialforschung eingegangen, bevor Teilnehmende Beobachtung und das Problemzentrierte Interview vorgestellt werden. Daran anschließend folgt die Darstellung der angewandten Methode der Grounded Theory. Abschließend wird auch der Umsetzung des Inklusiven Ansatzes im Rahmen dieser Arbeit Raum gegeben, bevor die am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache vorgestellt werden können.
Ausgehend von den theoretischen Überlegungen und dem Status Quo, der bezüglich Inklusiver Forschung im deutschsprachigen Raum konstatiert wurde (vgl. Abschnitt 3. - Bisheriger Stand der Literatur zu Inklusiver Forschung), ergibt sich insofern eine Forschungslücke, als Inklusive Forschung im universitären Rahmen bisher in Österreich, Deutschland und der Schweiz noch nicht angeboten wurde. Nachdem ich das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" über zwei Semester samt Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit begleiten durfte, liegt dem empirischen Teil dieser Arbeit folgende Fragestellung zu Grunde:
Inwiefern leistet die Teilnahme von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Rahmen forschungsgeleiteter universitärer Lehre in der Tradition Inklusiver Forschung einen Beitrag, Empowerment-Prozesse in Gang zu setzen?
Diese Forschungsfrage bezieht sich auf Empowerment-Prozesse, die im Rahmen einer Teilnahme und aktiven Mitarbeit an einem Seminar dieser Art für die betroffenen Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache erwartet werden. Ob und wie diese Empowerment-Prozesse tatsächlich stattfinden, ist Ziel der Forschungsfrage und somit dieser Diplomarbeit.
Zusätzlich zur eigentlichen Forschungsfrage sind folgende Leitfragen von Bedeutung:
-
Wie haben sich die teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten vor Beginn der Mitarbeit am Seminar selbst wahrgenommen?
-
Was verändert sich durch die Teilnahme am Seminar? Welche Veränderungen sind von außen sichtbar, welche werden selbst genannt und reflektiert?
-
Inwieweit verändern sich Rollen im Laufe des Forschungsprozesses innerhalb der aktiv am Seminar beteiligten Personen?
-
Inwiefern spielt die Teilnahme am Inklusiven Seminar auch nach Abschluss desselben eine Rolle im Leben der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten?
Die Forschungsfrage sowie die Leitfragen werden anhand des vorliegenden Datenmaterials bearbeitet, wobei auch der "Arbeitsraster Empowerment", der in Abschnitt 2.3.3. ausgeführt wurde, zum Einsatz kommt.
Das Forschungssetting, das im Folgenden dargestellt wird, wurde bereits kurz umrissen. Es folgen nun etwas konkretere Ausführungen.
Das Setting des empirischen Teiles dieser Diplomarbeit entspricht der sich über zwei Semester erstreckenden Lehrveranstaltung mit dem Titel "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" am Institut für Bildungswissenschaften an der Universität Wien. Menschen mit Lernschwierigkeiten agieren in diesem Seminarkonzept als ExpertInnen in eigener Sache, die zu selbstständig gewählten Themenkomplexen gemeinsam mit Studierenden Forschungsprojekte durchführen. Den theoretischen Rahmen dazu bietet die angebotene Lehrveranstaltung.
Die mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten wurden weitestgehend in sämtliche Forschungsschritte einbezogen und arbeiteten - nachdem einige von ihnen bereits über mehrere Semester Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln konnten - auch eigenständig an der Umsetzung der jeweiligen Forschungsvorhaben mit. Am Ende des Seminars wurde ein Forschungsbericht jeder Gruppe im Rahmen einer Seminararbeit verfasst, der einer möglichst breiten Öffentlichkeit, vor allem aber auch anderen Menschen mit Lernschwierigkeiten, zugänglich gemacht werden sollte, da das Ziel jeglicher Inklusiver Forschung darin besteht, Themen zu behandeln, die für betroffene Personen von Bedeutung sind (vgl. Walmsley und Johnson 2003 sowie Flieger 2003).
Im Zeitraum der Datenerhebung arbeiteten neun Menschen mit Lernschwierigkeiten in Kleingruppen zu mindestens zwei und maximal vier Studierenden an den bereits zuvor von den ExpertInnen gewählten Themenkomplexen.
Für dieses besondere Setting ist eine intensive Vor- und Nachbereitungszeit unumgänglich. In den Sommermonaten vor Seminarbeginn wurde gemeinsam mit den ExpertInnen in eigener Sache ein Plan für die kommenden beiden Semester erstellt und inhaltliche Schwerpunkte festgesetzt. Da die Studierenden wie auch einige der teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten erst in die konkrete Umsetzung von (Inklusiven) Forschungsprojekten eingeführt werden mussten, wurde auch viel Wert auf theoretische Inputs zu Forschung, deren Umsetzung und deren Methoden gelegt. Manche dieser Inputs konnten durch diejenigen beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten übernommen werden, die bereits Erfahrung mit dem Arbeiten an Inklusiven Forschungsprojekten gewonnen hatten (z.B. die Gewinnung von InterviewpartnerInnen sowie Interviewführung).
Nach den wöchentlichen, jeweils eineinhalb Stunden dauernden Seminareinheiten fand jeweils eine Nachbesprechung zwischen Mag. Koenig und Mag. Buchner als Lehrveranstaltungsleitern sowie den beteiligten ExpertInnen in eigener Sache und den beiden DiplomandInnen Markus Eichinger und Gertraud Kremsner statt. Diese dienten einerseits der Reflexion, andererseits auch der inhaltlichen Nachbesprechung. Zusätzlich dazu wurden - sofern gewünscht - weitere Termine vereinbart, wenn besonders intensiver Nachbesprechungsbedarf bestand.
Eine Besonderheit während des Zeitraumes der Datenerhebung stellt sicher auch die Teilnahme einiger der ExpertInnen sowie den Lehrveranstaltungsleitern und den beiden DiplomandInnen an der Jahrestagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen in Frankfurt am Main dar, wohin wir vom Seminar als Ausgangspunkt aus gemeinsam fuhren und dort auch einen Vortrag zum Thema "Inklusive Forschung und Empowerment" hielten. Dies stellt in Zusammenhang mit der Beschreibung des Forschungssettings ebenfalls einen wichtigen Aspekt dar.
Widmen wir uns nun dem Forschungsdesign, das allen weiteren Ausführungen in diesem Kapitel - zumindest in Bezug auf das konkret umgesetzte Forschungsvorhaben - zu Grunde liegt.
Die vorliegende empirische Arbeit ist als qualitative Forschung angelegt, bei der neun Personen mit Lernschwierigkeiten über einen Zeitraum von ca. eineinhalb Jahren samt Vor- und Nachbereitungszeit begleitet wurden. Die konkrete Teilnahme und Mitarbeit am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" selbst nahm davon zwei Semester, also neun Monate, in Anspruch. Über diesen Zeitraum hinweg wurden Daten auf unterschiedliche Weise zusammengetragen. Die Phase der Datenerhebung ist insofern abgeschlossen, als die besprochene Lehrveranstaltung bereits beendet ist.
Der Fokus der Beobachtungen und Interviews liegt im Besonderen auf zwei Herren, die im genannten Zeitraum der Datenerhebung neu als Experten in eigener Sache in das Inklusive Seminar eingestiegen sind. Dies ist insofern besonders bedeutsam, als sich bereits knapp zwei Jahre zuvor eine Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten gebildet hatte, die bereits Erfahrungen mit Inklusiver Forschungsarbeit und der neuen Rolle als Co-LehrveranstaltungsleiterInnen sammeln konnte. Dies fehlte den beiden "Neueinsteigern" komplett. Sie orientierten sich maßgeblich an den bereits erfahreneren KollegInnen, was sich auch eindeutig in den gewonnenen Daten widerspiegelt. Zudem liegen aber auch Interviews mit anderen am Seminar beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache vor, die ebenso ausgewertet werden sollen.
Die Daten selbst wurden aus Interviews, Beobachtungen und Forschungstagebüchern - meinem eigenen und denen der teilnehmenden Studierenden, sofern sie diese zur Verfügung stellen wollten - gewonnen.
Die Interviews fanden unabhängig vom Seminar statt, Beobachtungen wurden während des Seminars und bei Nachbesprechungen niedergeschrieben.
Die Forschungstagebücher der Studierenden sind zu vollkommen unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden und die Form derselben konnte völlig frei gewählt werden. Diese Forschungstagebücher wurden freiwillig zur Verfügung gestellt, sie liegen somit nicht von allen beteiligten Studierenden vor. Dass dieselben im Rahmen einer Diplomarbeit Verwendung finden, war den beteiligten Studierenden bekannt. An dieser Stelle sei ein herzliches Dankeschön für die Bereitstellung der Forschungstagebücher ausgesprochen.
Mein eigenes Forschungstagebuch enthält Skizzen aus den Seminareinheiten, den Nachbesprechungen, Gedanken, die mich zwischendurch beschäftigten, vor allem aber auch Ideen und Fragen aus Diskussionen mit Studierenden, den beteiligten ExpertInnen in eigener Sache und den beiden Lehrveranstaltungsleitern.
Weiters vorhanden sind Protokolle der Nachbesprechungen, verfasst von Markus Eichinger, der diese dem gesamten Lehrveranstaltungsteam zur Verfügung stellte, wie auch zwei Gedächtnisprotokolle zu einem besonderen Vorfall.
An konkreten Daten sind vorhanden:
-
Mein eigenes Forschungstagebuch, geführt während des Seminares, während der Nachbesprechungen, während sonstiger Besprechungen (auch telefonisch), bei Interviewterminen, bei Tagungen und wenn allgemein offene Fragen aufgetreten sind
-
Protokolle aus den Nachbesprechungen mit den ExpertInnen (niedergeschrieben nach beinahe jeder Seminareinheit von Markus Eichinger)
-
Forschungstagebücher bzw. Auszüge aus Forschungstagebüchern von 22 teilnehmenden Studierenden
-
Ein Gespräch mit einer Forschungsgruppe ohne Beteiligung des/der zuständigen ExpertIn nach einer akuten Krise innerhalb der Forschungsgruppe, festgehalten im eigenen Forschungstagebuch
-
Sechs Interviews mit ExpertInnen
-
Reflexionen derjenigen ExpertInnen, die an der Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen im Februar 2009 in Frankfurt am Main teilnahmen (schriftlich festgehalten von begleitenden Studierenden)
Die gewonnenen Daten werden in weiterer Folge anhand der Grounded Theory (vgl. Abschnitt 11 - Forschungsmethode: Grounded Theory) bearbeitet und ausgewertet.
Bevor wir nun jedoch konkret in die Materie der Forschung einsteigen, sollen noch einmal kurz einige grundlegende Hintergründe geklärt werden, die den gesamten Forschungsprozess wesentlich beeinflussen. Dabei werden Bezüge zur konkreten Umsetzung des Forschungsvorhabens hergestellt.
Es folgt eine kurze Darstellung von qualitativer Sozialforschung, ein Abschnitt zum Thema teilnehmende Beobachtung sowie ein weiterer zum Problemzentrierten Interview. Danach soll die Grounded Theory und deren Vorgehensweise erläutert werden.
Dieser Abschnitt zur Qualitativen Sozialforschung soll in knapper Form die wesentlichsten Merkmale eben jener darstellen. Auf eine weiterführende Diskussion kann aus Platzgründen leider nicht eingegangen werden.
Qualitative Sozialforschung versteht sich als Kontrapunkt zu quantitativer Forschung, wenngleich diese Diskussion im Rahmen dieser Diplomarbeit zu weit führen würde. Mayring (2002) findet dazu folgende einleitende Worte:
"Das rein quantitative Denken ist brüchig geworden; ein Denken, das sich den Menschen und Dingen annähert, indem es sie testet und vermisst, mit ihnen experimentiert und ihre statistische Repräsentanz überprüft, ohne vorher den Gegenstand verstanden zu haben, seine Qualität erfasst zu haben." (Mayring 2002, S. 9)
Eine Definition Qualitativer Sozialforschung ist nur sehr schwer möglich, da "es eine verbindliche oder einheitliche Methodologie qualitativer Sozialforschung" (Lamnek 2005, S. 27) nicht gibt. Dennoch können Grundsätze festgemacht werden, die sämtlichen Ansätzen Qualitativer Sozialforschung innewohnen:
-
Subjektbezogenheit der Forschung
-
Deskription der Forschungssubjekte
-
Interpretation der Forschungssubjekte
-
Untersuchung in der natürlichen, alltäglichen Umgebung der Forschungssubjekte
-
Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring 2002)
Daran anschließend und in Abgrenzung zu quantitativen Methoden haben sich verschiedene Prinzipien herauskristallisiert, die mittlerweile als "Programmatik qualitativer Sozialforschung" (Lamnek 2005, S. 20) verstanden werden können und unbedingt zu nennen sind, sofern man den Versuch einer Beschreibung Qualitativer Sozialforschung wagt. Diese Prinzipien sind:
-
Offenheit: Dies meint, dass vorab keine Hypothesenbildung vor sich gehen soll, da Hypothesen nicht geprüft, sondern generiert werden sollen. Im Untersuchungsprozess selbst sollte der Forscher/die Forscherin so offen wie möglich gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen sein, die dann in die Formulierung der Hypothesen einfließen können.
-
Forschung als Kommunikation bedeutet, dass das gegenseitige Aushandeln der Wirklichkeitsdefinitionen zwischen ForscherIn und Erforschtem/Erforschter in den Mittelpunkt des Interesses rückt und die Kommunikationssituation versucht, sich möglichst weit an die kommunikativen Regeln des alltagsweltlichen Handelns anzunähern.
-
Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand ist notwendig, um die wissenschaftliche Erfassung des Entstehungszusammenhanges sozialer Phänomene zu gewährleisten. Als prozesshaft wird der Akt des Forschens selbst betrachtet, in dem die Kommunikation zwischen ForscherIn und InformantIn vorausgesetzt wird. Die Involviertheit des Forschers/der Forscherin ist konstitutiver Bestandteil des Forschungsprozesses und somit auch des Ergebnisses dieses Prozesses.
-
Reflexivität von Gegenstand und Analyse verlangt eine reflektierte Einstellung des/der ForscherIn wie auch die Anpassungsfähigkeit seines/ihres Untersuchungsinstrumentariums. Außerdem ist die Beziehung zwischen dem/der Erforschten und dem/der ForscherIn selbst kommunikativ und reflexiv.
-
Explikation soll die Nachvollziehbarkeit der Interpretation und somit die Intersubjektivität des Forschungsergebnisses absichern.
-
Flexibilität als Anpassungsfähigkeit an den Untersuchungsgegenstand, wodurch man sich nicht auf eine standardisierte Technik beschränken kann. (vgl. Lamnek 2005)
Die Umsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes entspricht weitestgehend diesen Prinzipien:
Das Prinzip der Offenheit wurde insofern eingehalten, als vorab keine Hypothesen aufgestellt wurden und die Forschungsfrage selbst erst formuliert wurde, als die Phase der Datenerhebung bereits weitgehend abgeschlossen war.
Was das Prinzip der Kommunikation betrifft, so kann gesagt werden, dass ohne Kommunikation in diesem Forschungsvorhaben quasi nichts funktioniert hätte, da viele Fragen offen waren, die nur mit den am Seminar mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache geklärt werden konnten. Abgesehen davon stellte die Anforderung, die Kommunikation an die Lebenswelt der betroffenen Personen anzugleichen, einen Anspruch dar, dem Folge zu leisten äußerst schwierig war - ich hatte große Probleme damit, meine Ausführungen und Kommentare in leicht verständlicher Sprache zu formulieren und musste oftmals das Gesagte mehrfach wiederholen, um am Ende verstanden zu werden. Vor allem in Bezug auf wissenschaftliche Erklärungen und Prinzipien war das nicht immer leicht.
Dem Prozesscharakter der Forschung wurde insofern Folge geleistet, als der Zeitraum der Datenerhebung knapp eineinhalb Jahre umfasste und erst am Ende begonnen wurde, die konkret gesammelten Daten im Rahmen einer Fragestellung zu bearbeiten, wenngleich Ideen hierfür auch währenddessen immer wieder auftauchten, die dann in letzter Folge in die vorliegende Fragestellung eingearbeitet wurden. Dass ich als Diplomandin und Forscherin in das Geschehen eingebunden war, kann nicht abgestritten werden, zumal es sich dabei auch um eine der verwendeten Methoden handelt (vgl. Abschnitt 9 - Teilnehmende Beobachtung).
In Bezug auf Reflexivität von Gegenstand und Analyse kann gesagt werden, dass die vorliegende Forschung sich insofern immer wieder neu auf den Gegenstand bezogen hat, als im Zeitraum der Datenerhebung immer wieder Probleme aufgetaucht sind, die es zu lösen galt und die nicht vorhersehbar waren. Dies hat den Fokus der Untersuchungen immer wieder verändert.
Betreffend der Explikation des Umgangs mit den erhobenen Daten verweise ich auf den Abschnitt 11 - Forschungsmethode: Grounded Theory, der die konkrete Vorgehensweise beschreiben und abklären soll.
Der Flexibilität des Forschungsvorhabens wurde insofern Rechnung getragen, als die Wahl der Methoden erst gefallen ist, nachdem die Daten gesichtet und bevor die Forschungsfrage formuliert wurde und nicht umgekehrt.
Wenn man nun also davon ausgeht, dass die vorliegende Forschung dieser Diplomarbeit als Qualitative Sozialforschung angelegt ist, kommt man nicht umhin, eine nähere Betrachtung der Vorgehensweise vorzunehmen. Ein wesentliches Merkmal der bearbeiteten Fragestellung ist die Erhebung der Daten als teilnehmende Beobachtung, weshalb diese im Folgenden dargestellt wird.
"Kennzeichnend für die teilnehmende Beobachtung ist die persönliche Teilnahme des Sozialforschers bzw. der Sozialforscherin an der Praxis derjenigen, über deren Handeln er bzw. sie Daten erzeugen möchten. Dabei ist die Annahme leitend, dass durch die Teilnahme an face-to-face-Interaktionen bzw. die unmittelbare Erfahrung von Situationen Aspekte des Handelns und Denkens beobachtbar werden, die in Gesprächen und Dokumenten - gleich welcher Art - über diese Interaktionen bzw. Situationen nicht in dieser Weise zugänglich wären. Werden dabei Daten - z.B. in Form von nachträglich erstellten Beobachtungsprotokollen oder Feldnotizen - gewonnen, kann man von teilnehmender Beobachtung als einer eigenständigen Methodologie der qualitativen Sozialforschung sprechen." (Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006, S. 151).
Mayring (2002) betont, dass die teilnehmende Beobachtung eine Standardmethode der Feldforschung ist und stellt fest, dass der/die BeobachterIn nicht passiv-registrierend außerhalb seines Gegenstandsbereiches steht, sondern vielmehr selbst teilnimmt an der sozialen Situation, in die der Gegenstand eingebettet ist und dabei in persönlicher Beziehung mit den zu beobachtenden Personen steht. Der/die ForscherIn sammelt Daten, indem er/sie an deren natürlicher Lebenssituation partizipiert (vgl. Mayring 2002).
"Mit teilnehmender Beobachtung will der Forscher eine größtmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er/sie will die Innenperspektive der Alltagssituation erschließen. Dabei wird höchstens halb-standardisiert vorgegangen." (Mayring 2002, S. 81)
Im vorliegenden Forschungsprojekt im Rahmen dieser Diplomarbeit zum Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" haben wir es eindeutig mit teilnehmender Beobachtung nach den Definitionen von Bohnsack, Marotzki und Meuser (2006) sowie nach Mayring (2002) zu tun. Der Beschluss, Daten durch teilnehmende Beobachtung zu sammeln, erfolgte bereits vor dem ersten Zusammentreffen mit den mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, denn zu diesem Zeitpunkt war einzig und allein klar, dass Daten gesammelt werden sollen, wodurch festgelegt werden musste, auf welche Art dies geschehen soll. Alles weitere - also was mit den gewonnenen Daten geschehen soll und welche Richtung damit eingeschlagen werden wird in Bezug auf die Fragestellung - hat sich erst nach und nach im Zuge des bereits begonnenen Datensammelns herauskristallisiert.
Durch teilnehmende Beobachtung konnte ich also sowohl am Seminar selbst als auch bei den anschließend stattfindenden Nachbesprechungen Daten sammeln. Diese Beobachtungen wurden in weiterer Folge im Rahmen eines Forschungstagebuches niedergeschrieben, was wiederum zur Auswertung herangezogen werden kann. Dabei war die persönliche Nähe zu den teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten äußerst eng - so eng, dass manchmal eher ihre persönliche Lebensgeschichte und -situation in den Fokus rückte als das Interesse an der konkreten Umsetzung Inklusiver Forschung. Doch auch das trägt wesentlich dazu bei, Empowerment-Prozesse bei genannter Personengruppe aufzuspüren und sichtbar zu machen.
Lamnek (2005) weist darauf hin, dass bestimmte Kriterien zu erfüllen sind, um teilnehmende Beobachtung im wissenschaftlichen Sinne von Alltagsbeobachtungen unterscheiden zu können und die gewonnenen Daten somit auf eine solide wissenschaftliche Basis zu stellen. Teilnehmende Beobachtung ist demnach immer ein interaktiver Prozess (ebenso wie Interaktionen im Alltag), jedoch im Unterschied zu Alltagsbeobachtungen mit konkreter Zielsetzung und systematischer Durchführung und Planung (vgl. Lamnek 2005). Dabei können sich folgende Problemstellungen ergeben:
-
Beobachtung als Fähigkeit, die im Sinne qualitativer Sozialforschung nicht etwas methodisch in besonderer Weise zu Fassendes, sondern vielmehr eine Fertigkeit oder Fähigkeit bezeichnet, die sich zur Alltagsbeobachtung ebenso eignet. Betreffend des konkret vorliegenden Forschungsvorhabens hieße dies, dass keine besonderen Vorkehrungen und Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die eine Beobachtung im wissenschaftlichen Sinne bedingen müsste, sondern am Geschehen ohne weiteres Zutun teilgenommen wurde.
-
Die Aufzeichnung von Informationen gestaltet sich oftmals als schwierig, da durch das Aufzeichnen selbst bereits selektiert wird. Dies könnte die Zuverlässigkeit und somit die Gültigkeit der gewonnenen Daten möglicherweise gefährden. In Bezug auf die konkret vorliegenden Daten zur Diplomarbeit ist zu sagen, dass zwar unterschiedlichste Datenquellen vorliegen, dass jedoch jene, die meine eigenen Beobachtungen betreffen, schon allein dadurch als selektiert zu bezeichnen sind, als es in einem Raum mit ca. 40 anwesenden Personen unmöglich ist, sämtliche Interaktionen erfassen zu können.
-
Die Auswertung der Daten zeigt sich, bedenkt man eben genannte Schwierigkeit bei der Aufzeichnung, als mindestens ebenso schwierig, da es sich nur schwer um sachliche Feststellungen des Vorgefundenen, sondern vielmehr um die Wiedergabe von Gefühlen, Wertungen, Vorurteilen und Projektionen des Beobachters/der Beobachterin handelt. Es wird versucht, diesen Umstand in der vorliegenden Diplomarbeit zu umgehen, indem auch andere Datenquellen verwendet werden, um so ein vollständigeres Bild zeichnen zu können. (vgl. Lamnek 2005)
Nachdem wir es bei der vorliegenden Diplomarbeit jedoch nicht nur mit Protokollen aus teilnehmender Beobachtung zu tun haben, sondern außerdem noch weitere Quellen zur Verfügung stehen, muss auch darauf näher eingegangen werden. Widmen wir uns nun dem Problemzentrierten Interview.
Inhaltsverzeichnis
Wie bei den vorgenommenen Interviews mit den aktiv am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache konkret vorgegangen wurde, ist Inhalt dieses Abschnitts.
Als "Problemzentriertes Interview" beschreibt Mayring (2002) folgendes:
"Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden." (Mayring 2002, S. 67)
Im konkret vorliegenden Fall handelt es sich hier um die grobe Problemstellung der Inhalte des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" sowie in weiterer Folge den Themen, die sich durch die aktive Teilnahme von Menschen mit Lernschwierigkeiten an einem universitären Seminar eröffnen. Dabei ist wesentlich, dass das wissenschaftliche Konzept nachträglich anhand der Inhalte des/der Interviews modifiziert wird (vgl. Lamnek 2005) - das heißt, dass eine konkrete Fragestellung nicht vorhanden ist, sondern lediglich Leitfragen zu einem bestimmten Thema, aus deren Antworten man in weiterer Folge Hypothesen generieren kann.
Als Leitfragen beim Führen der Interviews wurden folgende Fragen herangezogen, bei welchen anzumerken ist, dass ich, die Autorin, mit allen beteiligten Personen per Du war, weswegen das auch an dieser Stelle so belassen wird:
Vor Beginn des Seminares:
-
Was denkst du, wird dich erwarten, wenn du Experte/Expertin an der Uni bist? Worauf freust du dich? Was bereitet dir Sorgen?
Während des laufenden Seminares:
-
Wie geht es dir mit der Mitarbeit am Seminar? Wo gibt es Probleme? Was läuft gut?
-
Was hat sich in deinem Leben durch die Mitarbeit am Seminar verändert?
-
Wie geht es dir mit den Studierenden?
-
Wie geht es dir mit den anderen beteiligten ExpertInnen?
-
Wie geht es dir mit den Lehrveranstaltungsleitern?
-
Wie geht es dir mit den beiden DiplomandInnen?
-
Wie geht es dir mit all den verwendeten Fachbegriffen?
-
Benötigst du weitere Hilfestellungen und wenn, wo?
-
Was sagen deine FreundInnen/KollegInnen/Verwandten/BetreuerInnen dazu, dass du jetzt als Co-LehrveranstaltungsleiterIn an der Uni bist?
-
Gibt es berufliche Veränderungen, die sich durch die Teilnahme am Seminar ergeben haben?
-
Gibt es private Veränderungen, die sich durch die Teilnahme am Seminar ergeben haben?
Diese Fragen wurden lediglich als Leitfaden verwendet, zumeist war es nicht notwendig, sie alle herunterzuspulen. Dabei ist zu bedenken, dass die befragten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache ohnehin großen Redebedarf hatten in Bezug auf ihre aktive Mitarbeit an genanntem Seminar und dass es somit nur bedingt notwendig war, überhaupt Fragen zu stellen.
Letztere Aussage entspricht auch einem der Grundgedanken, die Mayring (2002) in Bezug auf das Problemzentrierte Interview aufstellt. Sie werden im Folgenden dargestellt, wobei die kursiv gesetzten Abschnitte den Originaltext von Mayring wiedergeben.
-
Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren. In Bezug auf die konkret geführten Interviews ist hier anzumerken, dass sprachliche Barrieren eine wesentliche Problemstellung beim Führen der Interviews wie auch in Gesprächen mit den ExpertInnen allgemein darstellten. Näheres dazu findet sich im Abschnitt 10.1. - Qualitative Interviews mit Menschen mit Lernschwierigkeiten.
-
Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewtem entstehen. Dieser Forderung wurde hinsichtlich der vorliegenden Interviews insofern Folge geleistet, als zu Beginn lediglich Interviews mit jenen beiden Experten geführt wurden, die neu ins Seminar eingestiegen sind und denen ich als Diplomandin zur Seite gestellt wurde, um als Ansprechperson bei Fragen und Problemstellungen dienen zu können. So hat sich sehr bald eine Vertrauenssituation ergeben. Alle weiteren Interviews wurden während des laufenden Seminares geführt, also zu Zeitpunkten, als ich sämtlichen weiteren Personen schon hinreichend bekannt war.
-
Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird. Das angesprochene gesellschaftliche Problem ist Inhalt des gesamten Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - In Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik", in dem Inklusive Forschung als Versuch angesehen wird, gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu forschen anstatt über sie. Fragestellungen, die sich daraus ergeben, sind Inhalt dieser Diplomarbeit.
-
Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren. Wie bereits etwas weiter oben beschrieben, war es oftmals gar nicht notwendig, allzu viele konkrete Fragen im Zuge der Interviews zu stellen, da durch das besondere Setting ohnehin großer Redebedarf seitens der interviewten ExpertInnen in eigener Sache bestand. (Mayring 2002, S. 69)
Es folgt nun ein kleiner Exkurs in die Interviewführung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, die einige sehr spezielle Anforderungen stellt. Dies soll im Folgenden kurz dargestellt werden.
Beim Interviewen von Menschen mit Lernschwierigkeiten sind viele Aspekte zu berücksichtigen, die bei Interviews mit nicht-behinderten Personen nicht oder in anderer Form zum Tragen kommen. An dieser Stelle soll nicht auf alle diese Aspekte eingegangen werden, sondern nur auf jene, die für die konkret bearbeitete Fragestellung von Bedeutung sind (so wird hier zum Beispiel nicht erläutert, wie man Menschen mit Lernschwierigkeiten als InterviewpartnerInnen gewinnen kann, denn der Kontakt zu den entsprechenden Personen hat durch die gemeinsame Mitarbeit am Seminar bereits bestanden).
Vorab muss jedoch festgehalten werden, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten als InterviewpartnerInnen lange Zeit nicht in Frage kamen, da man annahm, dass Daten, die aus solcherlei Interviews gewonnen würden, als fragwürdig einzustufen seien, "weil dieser Personenkreis sowohl abstrakte Zusammenhänge nur eingeschränkt verstehen könne als auch nur ein begrenztes Repertoire an Antworten beherrsche" (Hagen 2007). Inklusive Forschung fordert jedoch die Einbeziehung der betroffenen Personen, was auch in diesem Text bereits dargestellt wurde (vgl. Abschnitt 2.2.4. - Inklusive Forschung). Aus diesem Grund ist es unumgänglich, in einem Forschungsvorhaben wie dem vorliegenden die betroffenen Personen selbst zu befragen. Dennoch ist dies kein leichtes Vorhaben, denn es müssen einige Aspekte berücksichtigt werden.
Beginnend beim Aspekt der Kommunikation mit Menschen mit Lernschwierigkeiten sind folgende Parameter einzuhalten:
-
Die interviewende Person benötigt ein hohes Maß an Sensibilität, Spontaneität und Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gesprächsführung, von der strikten Abarbeitung eines Interviewleitfadens ist abzusehen.
-
Es empfiehlt sich ein offenes Interviewkonzept - mit genügend Platz und Flexibilität für eventuell im Zuge des Gesprächs auftauchende, nicht im Leitfaden enthaltene Bereiche und Aspekte.
-
Die Atmosphäre während des Interviews sollte von Vertrauen und Entspanntheit geprägt sein, wobei auf die Anonymisierung der Daten hingewiesen werden muss. Hilfreich kann es auch sein, mit Small Talk, wie etwa dem Wetter, als Gesprächseinstieg zu beginnen.
-
Die Länge der Interviews sollte der Konzentrationsfähigkeit der ProbandInnen entsprechen, wobei zu beachten ist, dass dies von Person zu Person höchst unterschiedlich sein kann.
-
Die Interviews sollten in einer verständlichen, nachvollziehbaren Sprache geführt werden, was nicht gleich zu setzen ist mit einer übersimplen Sprachverwendung. Fremdwörter und Schachtelsätze sollten vermieden werden und - wenn nötig - muss die Frage unter Verwendung anderer Wörter wiederholt werden. (vgl. Buchner 2009, Hervorhebungen im Original)
Zusätzlich zu diesen Aspekten nennt Hagen (2007) weitere Grundregeln zum Führen von Interviews mit Menschen mit Lernschwierigkeiten:
-
Man benötigt geeignete InterviewerInnen. Pädagogische Kräfte vor Ort (also in den Einrichtungen, in denen die zu befragenden Menschen mit Lernschwierigkeiten wohnen) sind dazu nicht geeignet, denn sie sind MitproduzentInnen der zu untersuchenden Wirklichkeit.
-
Man muss Kenntnisüber die Lebenswelt der zu befragenden Personen besitzen, um daraus ein differenziertes Vorverständnis für ihre lebensweltlichen Bedingungen zu gewinnen. So kann auch der Sprachgebrauch angepasst werden.
-
Bereits vor Beginn des Interviews muss eine Vertrauensbasis hergestellt werden sowie ausführlich der Sinn und Zweck der Befragung verdeutlicht werden. Menschen mit Lernschwierigkeiten dürfen nicht im Glauben gelassen werden, es handle sich hierbei um einen Test.
-
Interviews sollten in der alltäglichen Umgebung der zu interviewenden Person stattfinden, allerdings in einem separaten Raum, um der möglichen Überwachung des Interviews durch dritte Personen auszuweichen.
-
Hilfsmittel der unterstützten Kommunikation können eingesetzt werden, um die sprachlichen Barrieren zu minimieren.
(vgl. Hagen 2007, Hervorhebungen im Original)
Betreffend der vorliegenden Interviews ist zu sagen, dass nicht alle dieser Regeln eingehalten wurden, weil dies von den Interviewpersonen anders eingefordert wurde. Hierbei ist jedoch wesentlich, dass alle interviewten Menschen mit Lernschwierigkeiten als AkteurInnen im Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" im Zuge der Mitarbeit an diesem Seminar selbst Interviews mit Menschen mit Lernschwierigkeiten führten und somit ein gewisses Maß an Professionalität in der Interviewsituation bereits erreicht hatten.
Über die Lebenswelt der interviewten Personen wurde ich regelmäßig und ausreichend in Kenntnis gesetzt, da ich im Rahmen des Seminares und der Nachbesprechungen wöchentlich mit den betreffenden Personen zusammen arbeitete und mit diesen auch abseits davon in regelmäßigem Kontakt stand.
Sämtliche Interviews wurden in unterschiedlichen Kaffeehäusern Wiens geführt, weil dies von den betroffenen Personen so eingefordert wurde.
Die Länge der Interviews variiert - das kürzeste Interview dauerte rund 30, das längste rund 90 Minuten.
Bezüglich der verwendeten Sprache ist zu sagen, dass ich mir nicht immer leicht getan habe, eine einfache, klar verständliche Sprache zu benutzen. Dabei hatte ich jedoch den Vorteil, größtenteils SelbstvertreterInnen zu interviewen, die es bereits gewohnt waren, darauf hinzuweisen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten.
Hilfsmittel wurden während der Interviews keine verwendet.
Abgesehen von teilnehmender Beobachtung und Interviews kamen auch noch die Forschungstagebücher der Studierenden als Datenquellen zum Einsatz. Wie, wann und warum diese entstanden sind, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis, weswegen ich darauf aus theoretischer Sicht nicht weiter eingehen kann.
Zudem fand auch ein Gespräch mit einer Gruppe Studierender ohne Beteiligung des entsprechenden Experten statt. Ich verzichte an dieser Stelle jedoch auf einen Exkurs zum Thema "Gruppendiskussion", da dieses Gespräch keinen wissenschaftlichen Ansprüchen zu diesem Themenkomplex standhalten könnte, sondern vielmehr Erzählungen der Studierenden anlässlich einer Krise des betreffenden Experten beinhaltet. Dieses Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet und trotzdem als Quelle verwendet - in Form von Notizen, die ich zu diesem Gespräch in meinem eigenen Forschungstagebuch festgehalten habe.
Wesentlich beim Interviewen von Menschen mit Lernschwierigkeiten sind ethische Richtlinien, die nicht zuletzt aus wissenschaftlichen Gründen unbedingt eingehalten werden müssen. Welche das sind, ist Inhalt des folgenden Abschnitts.
"Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sollten von der Teilnahme an einem Forschungsprojekt profitieren und keinerlei Nachteile davontragen. Dieses ethische Primat gilt für den gesamten Forschungsprozess und ist in allen Kontexten einer Untersuchung zu beachten und einzuhalten." (Buchner 2009, S. 516, Hervorhebungen im Original)
Ethisch verantwortungsvolle Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten beinhaltet einige Grundregeln, ohne die einzuhalten man sich auf gefährliches Terrain begibt. Dazu gehört:
-
Informiertes Einverständnis/Informed Consent, worauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird.
-
Eine respektvolle Beziehung zwischen InterviewerIn und ProbandIn in der konkreten Interviewsituation, wobei vor allem Charakter und Dauer dieser Beziehung offen gelegt werden müssen, um nicht das Bild eines "falschen Freundes" oder einer "falschen Freundin" zu vermitteln.
-
Anonymisierung der Daten, um Nachteile für die interviewten bzw. an der Forschung teilnehmenden Personen zu vermeiden und/oder wenn die besprochenen Themen zu intim oder privat sind.
-
Abklärung des Besitzrechtes der Daten - Wem gehören diese und wer hat Zugriff darauf, wenn das Forschungsprojekt abgeschlossen ist? (vgl. Buchner 2009, Hervorhebungen im Original)
Diese Grundregeln beziehen sich vordergründig auf Interviews mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dass diese auch im Kontext Inklusiver Forschung gelten müssen, sollte selbstverständlich sein. Dennoch kommen im Kontext Inklusiver Forschung bedeutend mehr ethische Fragestellungen ans Tageslicht.
Eine dieser Fragestellungen betrifft die Bezahlung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die als ExpertInnen in eigener Sache an Inklusiven Forschungsprojekten teilnehmen. Diese sollte den üblichen Honoraren von wissenschaftlichen MitarbeiterInnen entsprechen, ist doch der Zeitaufwand nicht gerade gering. In der Praxis ist dies aber nur sehr schwer umsetzbar, da zumeist zu wenig Geld vorhanden ist und schon gar nicht gewährleistet werden kann, dass der Arbeitsplatz für Menschen mit Lernschwierigkeiten dauerhaft gesichert werden kann (vgl. Walmsley und Johnson 2003).
Was das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" betrifft, so muss gesagt werden, dass die beteiligten ExpertInnen nicht offiziell bezahlt wurden. Mag. Buchner und Mag. Koenig teilten ihr volles Lehrentgelt auf alle ExpertInnen in eigener Sache auf, sodass pro Semester rund 200€ ausbezahlt werden konnten. Sie wurden auch nicht im Vorlesungsverzeichnis der Uni Wien als Co-LehrveranstaltungsleiterInnen ausgewiesen. Hier handelt es sich zwar insofern um eine spezielle Situation, als dieses Seminar in universitärem Rahmen abgehalten wurde und die beteiligten Personen die akademischen Anforderungen an LehrveranstaltungsleiterInnen nicht erfüllten, dennoch ist es leider übliche Praxis, dass an Inklusiver Forschung mitarbeitende Menschen mit Lernschwierigkeiten finanziell nicht oder nur marginal entgolten werden.
Ebenso angesprochen wird bei Walmsley und Johnson (2003) die Frage, wie TeilnehmerInnen an Inklusiven Forschungsprojekten gefunden werden. Wenn das Interesse, eine Fragestellung wissenschaftlich zu beantworten, von zum Beispiel einer Selbstvertretungsgruppe ausgeht, wäre dies der Idealfall. Wenn dies nicht der Fall ist, muss bei der Gewinnung von aktiv an Forschungsprojekten mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten massiv auf die Einhaltung ethischer Kriterien geachtet werden. Im konkret vorliegenden Fall der Arbeit an dieser Diplomarbeit hat die Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache bereits bestanden, bevor sich das Interesse meiner Diplomarbeit auf diese Gruppe gerichtet hat. Die meisten der ExpertInnen waren bereits zuvor SelbstvertreterInnen, die durch den Kontakt mit Mag. Koenig und Mag. Buchner gemeinsam beschlossen haben, Inklusive Forschung an der Universität zu implementieren.
Zwei der im Zeitraum der Datenerhebung mitarbeitenden Experten sind neu dazugekommen. Sie haben vom Inklusiven Seminar an der Universität Wien gehört und sich selbstständig durch Kontakte zu den ExpertInnen bei den LehrveranstaltungsleiterInnen gemeldet. Insofern muss in diesem Zusammenhang auf diesen Aspekt nicht weiter eingegangen werden.
Ausbeutung stellt ebenso einen wesentlichen Aspekt dar, den es zu bedenken gilt, wenn man ethisch korrekt forschen möchte. Durch die Unverhältnismäßigkeiten an Macht, die sich ergeben können, wenn Menschen mir Lernschwierigkeiten in wissenschaftlichem Sinne forschen und/oder einbezogen werden möchten - sei es als InterviewpartnerInnen oder als aktive MitarbeiterInnen bei Forschungsprojekten - und dabei von ForscherInnen abhängig sind, die ihnen dieses Feld zugänglich machen sollen oder können, besteht diese Gefahr sehr schnell. Ausbeutung liegt dann vor, wenn die eigenen Interessen und Pläne der AkademikerInnen, also der nicht-behinderten ForscherInnen, über jene der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten gestellt werden (vgl. Swain, Heyman und Gillman 1998). Dies gilt für die Situation eines Interviews mit einer Person mit Lernschwierigkeiten ebenso wie für die aktive Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache an Inklusiven Forschungsprojekten.
Den wesentlichsten Aspekt ethischer Kriterien in Bezug auf Inklusive Forschung stellt - neben der Tatsache, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten keinen Nachteil erleiden dürfen und von der Teilnahme am Forschungsprozess profitieren sollten - das Informierte Einverständnis ("Informend Consent") dar, welches aufgrund seiner Wichtigkeit in einem eigenen Abschnitt behandelt wird.
Informed Consent - Informiertes Einverständnis - bildet die Basis jeder Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Inklusive Forschung handelt.
Informed Consent beschreibt das nicht hinterfragbare Recht von an Forschung teilnehmenden Personen, eine freiwillige Entscheidung zu treffen, ob teilgenommen werden will oder nicht. Um diese Entscheidung treffen zu können, müssen Informationen vorliegen, die beschreiben, was das Forschungsvorhaben beinhaltet und was es nach sich zieht. Erst dann kann entschieden werden, ob man damit einverstanden ist oder nicht (vgl. Swain, Heyman und Gillman 1998).
Folgende fünf Kriterien sind maßgeblich mit dem Terminus "Informed Consent" verbunden:
-
Auskunftspflicht
-
Verständnis
-
Freiwilligkeit
-
Kompetenz
-
Einwilligung
(vgl. Milton 2000)
Was hier nach einer Formalität klingt, kann in der Realität oftmals zu Umsetzungsproblemen führen, vor allem dann, wenn die Zielgruppe aus Menschen mit Lernschwierigkeiten besteht (vgl. Walmsley und Johnson, 2003). Tatsächlich geht dieses ethische Kriterium viel weiter.
Buchner (2009) beschreibt die Vorgehensweise beim Informierten Einverständnis sehr genau:
Ein erstes Einverständnis muss bereits vor Beginn der Datensammlung eingeholt werden, wobei vorangehend ein oder mehrere Gespräche stattgefunden haben müssen, bei denen in einfacher, klar verständlicher Sprache alle notwendigen Informationen bereitgestellt wurden - und zwar in vertraulicher, ungestörter Atmosphäre. Zur Entscheidungsfindung muss ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden, vor allem, wenn es sich dabei um Menschen mit Lernschwierigkeiten handelt.
Wichtig ist auch, dass die teilnehmenden Personen verstehen, dass sie zu jedem Zeitpunkt die Teilnahme an der Forschung abbrechen können, wenn sie das wollen. Es reicht jedoch nicht, dieses Einverständnis lediglich vor Beginn der Forschung einzuholen. Vielmehr muss es immer wieder im Laufe des Forschungsprozesses, vor allem in kritischen Phasen der Mitarbeit sowie auch nach Abschluss der Auswertung der Daten, neu eingeholt werden. Somit handelt es sich bei Informed Consent um einen Prozess, der sich über die gesamte Dauer eines Forschungsvorhabens erstreckt (vgl. Buchner 2009).
Bezüglich der in dieser Diplomarbeit genannten Personen haben wir es mit unterschiedlichen Formen des Informed Consent zu tun:
Von den Studierenden wurde keine schriftliche informierte Einverständniserklärung eingeholt, da sie - wenn überhaupt, da der Fokus ja auf den mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten liegt - anonymisiert genannt werden. Sie haben ihre Forschungstagebücher freiwillig zur Verfügung gestellt, und zwar in einer Form, die sie als angemessen empfunden haben. Seitens der Lehrveranstaltungsleiter wurden diesbezüglich keine Vorgaben gemacht. Außerdem wurde bereits in der ersten Seminareinheit geklärt, dass zwei Diplomarbeiten im Rahmen dieses Seminares verfasst werden würden. Somit wurde den Studierenden die Möglichkeit geboten, die Teilnahme abzubrechen.
Die am Seminar aktiv beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, die bereits von Beginn an teilgenommen haben und zum Zeitraum der Datenerhebung bereits den dritten Seminardurchlauf mitgestalteten, haben dem Verfassen zweier Diplomarbeiten durch Markus Eichinger und meiner Person bereits in der Vorbereitungszeit zum Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" zugestimmt. Dies geschah einerseits aus Stolz auf ihre Arbeit und Freude darüber, dass dem auch ein weitergehendes wissenschaftliches Interesse entgegengebracht wird. Andererseits waren Markus Eichinger und ich den beteiligten AkteurInnen bereits bekannt als Tutor (Markus Eichinger) bzw. als Studierende (Gertraud Kremsner), die das Seminar bereits zwei Semester zuvor absolviert hatte.
Diejenigen Experten, die neu ins Seminar hinzukamen, waren von Beginn an über das Vorhaben, zwei Diplomarbeiten verfassen zu wollen, informiert. Sie wurden von Anfang an von mir intensiv betreut, um ihnen den Einstieg in das wissenschaftliche, Inklusive Arbeiten zu erleichtern. Während dieser Gespräche habe ich auch mit ihnen abgeklärt, was es bedeutet, selbst zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Arbeit zu werden bzw. auch, worauf sie selbst achten müssen, wenn sie im Zuge ihrer Forschungsprozesse Personen interviewen werden. Dem haben sie zugestimmt.
Im Laufe der Phase der Datenerhebung, also während des Wintersemesters 2008/09 sowie dem Sommersemester 2009, habe ich mehrfach Interviews geführt. Vor jedem Interview holte ich mir abermals im Sinne des Informed Consent das Einverständnis dafür bei den betroffenen Personen ein. Im Sommersemester 2009 stellte ich meine bisherigen Erkenntnisse im Rahmen des Seminars "Partizipative Forschungsmethoden - mit Menschen mit Lernschwierigkeiten" vor allen SeminarteilnehmerInnen zur Diskussion, sodass auch die bis dahin stattgefundenen Forschungsschritte den betroffenen Personen zugänglich gemacht wurden.
Eine große Barriere im Sinne des Informed Consent stellt die Veröffentlichung der Ergebnisse dar. Die von mir gefundenen Ergebnisse können - zumindest, was ihren offiziellen Auftrag, nämlich das Verfassen einer Diplomarbeit, betrifft - nicht in einer Form veröffentlicht werden, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten, allen voran jene, die selbst Anteil an dieser Diplomarbeit haben, zugänglich ist. Diese Problematik ist im Rahmen des Verfassens einer Diplomarbeit jedoch nicht zu lösen. Die Ergebnisse müssten gesondert in leichter Sprache veröffentlicht werden.
Wie alle verwendeten Quellen - Interviews, Forschungstagebücher der Studierenden sowie mir selbst, außerdem Protokolle aus den Nachbesprechungen - ausgewertet wurden und wie damit umgegangen wurde, wird im folgenden Abschnitt erläutert.
Die Grounded Theory zählt zu den qualitativen Forschungsmethodologien mit dem Endzweck der Theoriebildung auf Basis empirischer Daten. Ihre Verfahren wurden entwickelt, um die Bedeutung menschlicher Erfahrung zu entdecken und die größeren sozialen Strukturen aufzudecken, in denen Bedeutung konstruiert und rekonstruiert wird (vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006).
"Die Grounded Theory gründet auf der Prämisse, dass das Leben komplex ist und es zur Verantwortung der Forschenden gehört, so viel als möglich von dieser Komplexität zu erfassen. Dies zumal die empirischen Daten nicht unmittelbar Auskunft über ihre Bedeutung geben." (a.a.O., S. 70)
Weiters geben die genannten Autoren an, dass Arbeiten nach der Grounded Theory ein Prozess mit zweierlei Charakter ist:
-
Als interaktiver Prozess - als Interaktion des Forschers/der Forscherin mit dem Datenmaterial, um allmählich zu einer theoretischen Sensibilität für das Datenmaterial zu gelangen, um eine Kenntnis dessen zu erlangen, was signifikant ist und
-
Als kreativer Prozess - als Fähigkeit desForschers/der Forscherin, Datenmaterial zu benennen oder ihm konzeptuelle Etiketten zu geben, um dann die entstehenden Konzepte in innovative und plausible Erklärungen lebendiger Erfahrung zu integrieren (vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006)
Die Grounded Theory wurde begründet von Barney Glaser und Anselm Strauss, die eine Methodologie zur Entdeckung von Theorien aus in der Sozialforschung systematisch gewonnenen und analysierten Daten entwickeln wollten (vgl. Glaser und Strauss 2005). In Bezug auf die vorliegende Diplomarbeit ist anzumerken, dass nicht nur die Ausführungen von Glaser und Strauss eine wesentliche Rolle spielen werden, sondern auch die Weiterführungen von Kathy Charmaz (2006), die die Grounded Theory um einige Aspekte bereichert.
Laut Strauss und Corbin (1994) ist die Grounded Theory mittlerweile von der Methodologie auch zur allgemeinen Methode geworden. Sie definieren dies anhand zweier Hauptmerkmale. Sie ist
-
für Untersuchungen in unterschiedlichen Gegenstandsbereichen und Disziplinen anwendbar, und sie bietet
-
eine Möglichkeit über Daten nachzudenken und sie auf eine Weise zu konzeptualisieren, die die Entwicklung neuer analytischer Verfahren erlaubt.
(Corbin und Glaser 1994, zit. nach Charmaz 2011)
Allgemeine Methode meint hierbei, dass die Strategien, die angewendet werden können, zur Diskussion gestellt werden - die Grounded Theory umfasst nämlich eine Gruppe von Methoden, weshalb nicht von einer einheitlichen Methode gesprochen werden kann (vgl. a.a.O.).
Bevor dargestellt wird, wie in der Grounded Theory vorgegangen werden soll, sei kurz angemerkt, warum diese für die vorliegende Diplomarbeit als Methodologie gewählt wurde: weil sie es nämlich möglich macht, eine Vielzahl unterschiedlichster qualitativer Daten zum Zwecke der Theoriegenerierung heranzuziehen (vgl. Glaser und Strauss 2005). Die erhobenen Daten Forschungstagebuch, Interview, teilnehmende Beobachtung und Protokolle sind allesamt als legitime Quellen im Rahmen der Grounded Theory angeführt (vgl. Bohnsack, Marotzki und Meuser 2006). Abgesehen davon wird sie als offene und explorative Methodologie beschrieben:
"Eher als zur Vorauswahl von Variablen und zur Hypothesenprüfung dient sie dazu zu entdecken, welche Variablen relevant sind und in welchem Bezug sie zu Phänomenen stehen" (a.a.O., S. 71)
Ausgangspunkt der Grounded Theory ist die komparative Analyse als Spiegeln von Tatsachen mit augenscheinlich Vergleichbarem, um eine Tatsache als solche zu verifizieren. Bestimmend ist die Frage, ob eine vermeintlich entdeckte Tatsache tatsächlich als solche verifiziert werden kann oder nicht. Dazu braucht es die komparative Analyse. Im Falle der vorliegenden Diplomarbeit werden vermeintliche Tatsachen intern - also innerhalb einer Studie - gespiegelt (vgl. Glaser und Strauss 2006). Die komparative Analyse ist sowohl bei der Entwicklung der Hypothesen als auch bei der vorläufigen Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit und Plausibilität zentrales Moment (vgl. Lamnek 2005).
Bei einer internen Spiegelung wie der der vorliegenden Diplomarbeit werden die gefundenen Tatsachen - etwa das Auffinden möglicher beginnender oder bereits in Gang gesetzter Empowerment-Prozesse - eines einzelnen Experten oder einer einzelnen Expertin an den anderen teilnehmenden Personen, vordergründig natürlich allen anderen ExpertInnen, gespiegelt. So wird überprüft, ob es sich dabei um ein einzelnes Phänomen handelt oder ob dies auch bei anderen beteiligten Personen auftritt. Ist dies der Fall, kann damit begonnen werden, erste Kategorien zu bilden (vgl. a.a.O.). Glaser und Strauss (2005) betonen zwar, dass es besser wäre, Vergleichsgruppen in möglichst großer Vielfalt zu haben, dies scheint für das umgesetzte Forschungsvorhaben und seiner Einzigartigkeit im deutschsprachigen Raum jedoch unmöglich. Außerdem schreiben die beiden Begründer der Grounded Theory auch:
"Da exakte Belege für die Generierung von Theorie nicht so entscheidend sind, kommt es auch nicht unbedingt auf die Art der Belege oder die Anzahl der Fälle an." (Glaser und Strauss 2005, S. 39)
Bevor eine Theorie jedoch generiert werden kann, muss eindringlich darauf hingewiesen werden, dass es wesentliches Element der Grounded Theory ist, Daten gleichzeitig zu sammeln und zu analysieren. Glaser und Strauss (2005) nennen dies "Theoretisches Sampling":
"Theoretisches Sampling meint den auf die Generierung von Theorie zielenden Prozess der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächste erhoben werden sollen und wo sie zu finden sind. Dieser Prozess der Datenerhebung wird durch die im Entstehen begriffene - materiale oder formale - Theorie kontrolliert." (Glaser und Strauss 2005, S. 53, Hervorhebung im Original)
Der Forscher/die Forscherin muss somit theoretisch sensibel an das Forschungsvorhaben herangehen und diese theoretische Sensibilität den gesamten Forschungsprozess hindurch bewahren, um eine aus den Daten hervorgehende Theorie konzeptualisieren und formulieren zu können. In diesem Sinne wird dann auch die Relevanz der Daten abgesichert, indem die Kriterien dafür, was überhaupt erhoben werden soll, aus der entstehenden Theorie selbst abgeleitet werden (vgl. Glaser uns Strauss 2005).
Illustriert werden kann diese Aussage am Beispiel der vorliegenden Diplomarbeit damit, dass zu Beginn des Seminares meinerseits alles aufgezeichnet wurde, was mir im Laufe der ersten Seminareinheiten aufgefallen ist. Bald stellte sich aber zum Beispiel heraus, dass manche Studierende Probleme mit der Rollenumkehr hatten, dass also eine Person mit Lernschwierigkeiten quasi ihr Vorgesetzter oder ihre Vorgesetzte im Rahmen des jeweiligen Forschungsprojektes war. Also richtete ich meinen Fokus intensiver auf diese Problemstellung. Im Sinne der komparativen Analyse stellte ich auch Beobachtungen an, wie es in den anderen Forschungsgruppen diesbezüglich aussah und ob ich dort ähnliche Tatsachen finden konnte. Daraus hat sich in letzter Folge eine Leitfrage zur eigentlichen Fragestellung gebildet, die zur Theoriegenerierung beitragen soll. Dies stellt nur ein Beispiel dar, wie nach Grounded Theory vorgegangen werden kann. Weitere Belege dafür finden sich im dritten Kapitel, wenn die Auswertung der erhobenen Daten dargelegt wird.
Einen weiteren sehr wesentlichen Aspekt zur Generierung von Theorien nach Grounded Theory bringt Kathy Charmaz (2006) ein, denn sie bezieht sich darauf, dass der/die ForscherIn vom Forschungsprozess nicht trennbar ist.
"Grounded Theory serves as a way to learn about the world we study and a method for developing theories to understand them. In the classic grounded theory works, Glaser and Strauss talk about discovering theory as emerging from data separate from the scientific observer. Unlike their position, I assume that neither data nor theories are discovered. Rather, we are part of the world we study and the data we collect. We construct our grounded theories through our past and present involvements and interactions with people, perspectives and research practices." (Charmaz 2006, S. 10, Hervorhebungen im Original)
Der Forscher/die Forscherin ist also immer Teil des Forschungsprozesses, indem er/sie durch seine/ihre frühere und gegenwärtige Beteiligung und Interaktion mit Menschen, Blickwinkeln und Forschungspraktiken Theorien selbst konstruiert.
Die Forschung am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" hat sehr am Leben der dargestellten Personen teilgenommen. Eine Abgrenzung meinerseits zugunsten eines objektiven Forschungsinteresses wäre in dieser Form nicht möglich gewesen. Zudem ist es nicht zu leugnen, dass sich die Rahmenbedingungen der Forschung, nämlich das angesprochene Seminar, auch durch meine aktive Mitarbeit verändert haben und somit auch meine Person nicht aus dem Blickwinkel eines wissenschaftlichen Forschungsinteresses genommen werden kann.
Abgesehen davon betont Charmaz noch einmal, dass es nicht ausreicht, nur eine Datenquelle - etwa Interviews - heranzuziehen:
"Unsere Methoden der Datenerhebung ergeben sich aus der Forschungsfrage. Entsprechend kann eine einzige Datenerhebungs- oder Analysestrategie nicht ausreichen." (Charmaz 2011, S. 188)
Charmaz (2006) benennt ihre Weiterentwicklung der Grounded Theory als "Konstruktivistische Grounded Theory". Sie plädiert dabei dafür, den Forschungsprozess offen und flexibel zu halten und nicht einem starren System zu folgen. Dies ermöglicht es unter anderem - Glaser (2001) folgend - das Verfahren des "Zeile-für-Zeile-Kodierens" zugunsten eines "Ereignis-für-Ereignis-Kodierens" (Charmaz 2011, S. 190) zu verwerfen, was in der vorliegenden Diplomarbeit so umgesetzt wurde. Was die konkrete Vorgehensweise nach Konstruktivistischer Grounded Theory betrifft, so beschreibt Charmaz (2011) diese so:
Wenn beim Forschen etwas Überraschendes entdeckt wird, werden
-
alle denkbaren theoretischen Ideen in Betracht gezogen, die hierfür verantwortlich sein könnten,
-
kehren Forschende ins Feld zurück und sammeln weitere Daten, um diese Ideen zu überprüfen und wählen dann
-
die plausibelste theoretische Interpretation.
(Charmaz 2001, S. 191)
Dies entspricht exakt dem Vorgehen, das ich bei der Auswertung der Daten zu meiner Diplomarbeit angewandt habe.
Weiters weist Charmaz (2011) darauf hin, dass das Vorgehen nach Konstruktivistischer Grounded Theory nicht unbedingt zur Folge haben muss, dass Theorien möglichst allgemein gültig aufgespannt werden müssen. Anstelle dessen ist wesentlich, dass sich Forschende so weit wie möglich in die empirische Welt hineinbegeben, wie sie können. Dadurch sind sie dazu gezwungen, anzuerkennen, dass Analysen aus konstruktivistischer Sicht unvollständig und kontingent sind, denn ein abstraktes Verständnis ergibt noch keine objektiven Verallgemeinerungen (vgl. Charmaz 2011).
Ich sehe an dieser Stelle davon ab, weitere Belege für meine konkrete Vorgehensweise anzuführen, denn diese finden sich ohnehin im dritten Kapitel. Bevor es jedoch soweit ist, die konkret gefundenen Ergebnisse darzustellen, sei ein kurzer Abschnitt zur Umsetzung des Inklusiven Ansatzes in der Diplomarbeit erlaubt.
Bei der vorliegenenden Diplomarbeit handelt es sich nicht um ein konkret umgesetztes Inklusives Forschungsprojekt, sondern vielmehr um die Darstellung eines Seminares, das verschiedene kleinere Inklusive Forschungsprojekte mit den entsprechenden Ergebnissen begleitet. Inklusive Forschung ist somit zwar einer der Hauptinhalte dieser Diplomarbeit, dennoch kann nicht behauptet werden, dass ich in diesem Rahmen selbst inklusiv gearbeitet hätte, denn Menschen mit Lernschwierigkeiten waren zwar als Interview- und zu beobachtende Personen beteiligt, jedoch nicht in sämtliche Schritte des Forschungsprozesses einbezogen. Dies beginnt bei der Fragestellung, die ich alleine gefunden habe, und endet bei der Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse, die ebenso ausschließlich von mir unternommen wurde.
In diesem Sinne handelt es sich bei der hier vorliegenden Diplomarbeit also vielmehr um eine Analyse des Funktionierens Inklusiver Forschungsprojekte im universitären Rahmen, wobei sämtliche Erfolge und Probleme, die sich im Zuge dessen ergeben haben, betrachtet werden sollen.
Die Verfassung dieser Diplomarbeit erfolgte unter höchster Transparenz und Zustimmung der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, ist jedoch - entgegen den Regeln, die Walmsley und Johnson (2003) oder Flieger (2003) für Inklusive Forschung einfordern - "abermals als Produkt traditionell zu wertender Forschungsproduktion zu betrachten" (zit. und vgl. Koenig et al. 2010, S. 183).
Dennoch kann diese Diplomarbeit insofern als der Inklusiven Forschung zugehörig bezeichnet werden, als sie zur weiterführenden Professionalisierung der bislang geleisteten Inklusiven Arbeit betrachtet werden kann (vgl. a.a.O.). Diese "weiterführende Professionalisierung" meint und gilt vor allem für den deutschsprachigen Raum, besonders für Österreich.
Kritisiert werden kann an dieser Diplomarbeit dennoch, wie bereits in Abschnitt 10.3. - Exkurs: Informiertes Einverständnis/Informed Consent angeschnitten, dass, obwohl sich diese Arbeit mit Inklusiver Forschung auseinandersetzt und sich ihr verpflichtet fühlt, die Veröffentlichung der Ergebnisse dennoch nicht in einer Form geschehen kann, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich ist. Vor allem, aber nicht nur, für die konkret besprochenen ExpertInnen in eigener Sache ist dieser Umstand sehr schade. Um dies zu umgehen, bleibt als einzige Möglichkeit, eine eigene Publikation mit denselben Inhalten in leichter Sprache herauszugeben. Im Rahmen einer Diplomarbeit ist es leider nicht möglich, die Sprache so zu wählen, dass sie auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich ist.
Nun ist es an der Zeit, die besprochenen AkteurInnen - also jene Menschen mit Lernschwierigkeiten, die aktiv als ExpertInnen in eigener Sache am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Intergrativen Pädagogik" teilgenommen haben - vorzustellen, um ein besseres Verständnis von dem zu bekommen, was im dritten Kapitel an Ergebnisse dargestellt werden wird.
In Absprache mit den genannten Personen werden im Sinne der Anonymisierung ihre Namen nicht genannt. Um jedoch die Lesbarkeit freundlicher zu gestalten, wird anstelle von Buchstaben- oder Zahlenkombinationen darauf zurückgegriffen, ein frei erfundenes Pseudonym zu verwenden. Nachdem ich, die Autorin dieser Diplomarbeit, mit allen beteiligten ExpertInnen in eigener Sache per Du war, habe ich ausschließlich Vornamen zu diesem Zweck gewählt.
RUDI: Rudi ist zum zweiten Mal beim Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - In Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" dabei. Er pendelt von Niederösterreich nach Wien und arbeitet mit drei Studentinnen am Thema "Diskriminierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten am allgemeinen Arbeitsmarkt", da er selbst bereits Erfahrungen mit diesem Thema machen musste. Rudi ist mit seinen Studierenden wie auch allen anderen am Seminar beteiligten Personen per Du.
JOHANNES: Johannes ist ein etwas älterer Herr, der mit seinem elektrischen Rollstuhl immer wieder auf Probleme und Barrieren stößt. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass er als Thema für sein Forschungsprojekt "Barrieren in öffentlichen Einrichtungen" gewählt hat, das er mit drei Studentinnen und einem Studenten bearbeitet. Johannes ist von Anfang an am Seminarprojekt beteiligt und hat auch als Selbstvertreter bereits Erfahrung. Auch er bietet allen am Seminar beteiligten Personen uneingeschränkt das Du-Wort an.
ANDREA: Eine im Bereich der Selbstvertretung äußerst erfahrene Dame ist Andrea. Auch sie ist auf ihren elektrischen Rollstuhl angewiesen und hat dadurch viel Erfahrung mit Abhängigkeiten von anderen, fremden Personen. Dies ist auch der Grund, weswegen sie sich für das Forschungsthema "Leben mit Assistenz" entschieden hat. Andrea arbeitet mit drei Studentinnen zusammen. Sie ist ebenfalls seit Beginn des Inklusiven Seminares mit dabei und hat schon einige Erfahrung in der Arbeit mit StudentInnen und Inklusiver Forschung sammeln können. Andrea möchte nicht, dass die Studierenden sie mit "Du" ansprechen.
MARTINA: Martina ist zum zweiten Mal am Inklusiven Seminar beteiligt und hat es im Zeitraum der Datenerhebung, also ihrem zweiten Seminardurchgang, alles andere als leicht mit ihrer Gruppe gehabt. Sie arbeitet mit vier StudentInnen zusammen. Martina bearbeitet das Thema "Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihr Umgang mit Krisen".
THOMAS: Thomas arbeitet mit drei StudentInnen und einem Studenten zum Thema "Möglichkeiten der integrativen Freizeitgestaltung". Dieses Thema liegt Thomas insofern besonders am Herzen, als er selbst einige Zeit lang Obmann eines Vereines für integrative Freizeitgestaltung war. Thomas stößt, ebenso wie Johannes und Andrea, mit seinem elektrischen Rollstuhl nicht nur innerhalb des Neuen Institutsgebäudes auf massive bauliche Barrieren. Leider hatte Thomas zu Beginn des Seminares einen mehrwöchigen Kuraufenthalt, weswegen er erst verspätet in sein eigenes Forschungsprojekt einsteigen konnte. Die nötigen Informationen hat er jedoch bereitgestellt. Auch er ist bereits von Beginn an Teil des Inklusiven ForscherInnenteams.
FRITZ: Fritz beschäftigt sich mit drei Studierenden mit dem Thema "Homosexualität und Menschen mit Lernschwierigkeiten". Auch er ist seit Beginn Teil des Inklusiven Seminares und hat schon einiges an Erfahrung in Bezug auf Inklusives Forschen, auch in theoretischer Hinsicht, gewinnen können. Fritz ist ebenfalls ein erfahrener Selbstvertreter.
SEBASTIAN: Sebastian ist einer jener Experten, der neu in das Inklusive Seminar eingestiegen ist. Er arbeitet mit drei Studentinnen und einem Studenten zum Thema "Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten", weil ihm dieses Thema besonders am Herzen liegt. Sebastian hat keine Erfahrungen mit Selbstvertretungsorganisationen oder People First.
KARL: Karl ist ein leidenschaftlicher und erfahrener Selbstvertreter mit dem Spezialgebiet "Leichter Lesen", zu dem er auch regelmäßig Vorträge und Workshops anbietet. Sein Forschungsthema im Inklusiven Seminar ist "Partnerschaften von Menschen mit Lernschwierigkeiten in Wohneinrichtungen", weil er auch selbst schon leidvolle Erfahrungen zu dieser Thematik machen musste. An Karl's Seite stehen drei Studentinnen und ein Student, wobei anzumerken ist, dass es in der Gruppe nicht immer harmonisch war. Auch Karl ist Teilnehmer der ersten Stunde am Inklusiven Seminar.
KURT: Auch Kurt ist im Wintersemester 2008/09 und im Sommersemester 2009 erstmalig mit Inklusiver Forschung konfrontiert und hat ebenso wie sein Kollege Sebastian keine Erfahrung mit Selbstvertretung oder People First. Er hat das Thema "Erfahrungen von IntegrationsschülerInnen" gewählt, das er mit zwei Studentinnen berabeitet.
Ebenso als am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" beteiligte Personen erwähnt werden müssen selbstverständlich die Studierenden, die aus Anonymitätsgründen ebenfalls nicht namentlich genannt werden sollen. Sofern Zitate von ihnen verwendet werden, sind diese als Studentin 1, Student 2 etc. ausgewiesen. Insgesamt haben im Wintersemester 2008/09 sowie im Sommersemester 2009 31 Studierende die Lehrveranstaltung besucht.
Die Lehrveranstaltungsleiter Mag. Oliver Koenig und Mag. Tobias Buchner werden nicht anonymisiert, genauso wenig wie die beiden DiplomandInnen Markus Eichinger und Gertraud Kremsner. Dennoch sind diese vier ebenso als AkteurInnen im beschriebenen Seminar zu nennen.
Mit diesen Informationen und Bezug nehmend auf die bisher ausgearbeiteten theoretischen Inputs ist es nun an der Zeit, die Ergebnisse der durchgeführten Forschung zu betrachten. Sie sind - wie bereits eingehend in Abschnitt 11 (Forschungsmethode: Grounded Theory) ausgeführt, nach Vorgaben der Grounded Theory entstanden. Außerdem spielt der in Abschnitt 2.3.3. erarbeitete "Arbeitsraster Empowerment" an dieser Stelle eine wesentliche Rolle, liegt doch das Hauptaugenmerk der gestellten Forschungsfrage darauf, inwiefern durch die Teilnahme von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Rahmen forschungsgeleiteter universitärer Lehre in der Tradition Inklusiver Forschung Empowerment-Prozesse in Gang gesetzt werden können.
Es sei noch kurz darauf hingewiesen, dass, sofern Zitate aus den Interviews selbst verwendet werden, diese in der ursprünglichen Form der Transkription belassen und somit im jeweiligen Dialekt wiedergegeben werden. Dies soll dazu beitragen, den Sinngehalt der Aussagen nicht zu verfälschen. Sofern Worte benutzt werden, die schwer oder nicht verständlich sind, erfolgt die Übersetzung unmittelbar und in Klammer hinter dem entsprechenden Wort.
Dieser letzte Teil der vorliegenden Diplomarbeit stellt Ergebnisse aus den Bereichen "Individuelle Rolle und Rollenverständnis von Menschen mit Lernschwierigkeiten" dar, beschreibt daran anschließend Empowerment-Prozesse, die stattgefunden haben und schließt mit Ausführungen zu Empowerment-behindernden Aspekten und Kritik am Setting ab.
Weiterführende Gedanken sowie eine Zusammenfassung des Erarbeiteten finden sich im Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- 14.1. Dimension 1: Rolle und Rollenverständnis vor Seminarbeginn
- 14.2. Dimension 2: Diskursives Ausverhandeln und Annehmen von neuen Rollen und Verantwortlichkeiten im Laufe des Forschungsprozesses
- 14.3. Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen
- 14.4. Dimension 4: Durch die Teilnahme resultierende Veränderung und Erweiterung von Rollen und Kompetenzen
In diesem Abschnitt soll nicht erneut darauf eingegangen werden, was unter Rolle verstanden werden kann und wie dieser Begriff hier verwendet wird. Das wurde bereits ausführlich in Abschnitt 2.2. (Rolle und Rollenverständnis) dargelegt. Dennoch sollen die Rollen, die im Rahmen des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfelder der Heil- und Integrativen Pädagogik" ausverhandelt und eingenommen wurden, dargestellt werden. Dabei soll nicht nur auf die Rolle der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache, sondern auch auf diejenige der beteiligten Studierenden wie auch der Lehrveranstaltungsleiter sowie der beiden DiplomandInnen eingegangen werden.
Die Darstellung der eingenommenen Rollen erscheint insofern als wichtig, als ohne die Klärung derselben nicht hinreichend geklärt werden kann, welche Empowerment-Prozesse sich im Zuge der Mitarbeit an Inklusiven Forschungsprojekten ergeben haben. Außerdem bedingt das Ausverhandeln und Einnehmen neuer Rollen bereits einen Schritt hin zu Empowerment-Prozessen.
Ein Teil der hier dargestellten Ergebnisse wurde - unter anderem mit meiner Beteiligung - bereits publiziert (vgl. Koenig et al. 2010), weswegen ich mich darauf besonders beziehen werde.
In Bezug auf Rolle und Rollenverständnis wurden vier Dimensionen aufgefunden, die sich durch die Teilnahme und Mitarbeit am Inklusiven Seminar entwickelt haben und auf die in weiterer Folge näher eingegangen werden sollen (vgl. a.a.O.).
Diese vier Dimensionen sind:
-
Dimension 1: Rollenverständnis vor Beginn Inklusiver Forschung
-
Dimension 2: Diskursives Ausverhandeln und Annehmen von neuen Rollen und Verantwortlichkeiten im Laufe des Forschungsprozesses
-
Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichekeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen
-
Dimension 4: Durch die Teilnahme resultierende Veränderung und Erweiterung von Rollen und Kompetenzen
Die Namen der eben genannten Dimensionen entsprechen den folgenden Unterabschnitten - es wird auf jede einzelne dieser Dimensionen somit also näher eingegangen werden. Zuvor jedoch folgt eine schematische Darstellung, wie diese Dimensionen miteinander verknüpft sind (wobei zu beachten ist, dass bei dieser Darstellung noch von "partizipatorischer" anstelle von "Inklusiver" Forschung die Rede ist):
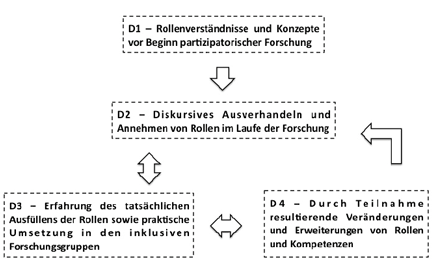
Abbildung 2 - Visualisierung der vier theoretischen Dimensionen (Koenig et al. 2010, S. 184)
Wie diese Dimensionen zu verstehen sind und was genau sie aussagen sollen, soll in weiterer Folge erklärt und mit Beispielen versehen werden.
Die erste Dimension ("Rollenverständnisse und Konzepte vor Beginn partizipatorischer Forschung" in der schematischen Darstellung genannt) beschreibt, wie sich die beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten, noch bevor sie als ExpertInnen in eigener Sache an Inklusiven Forschungsprojekten mitgearbeitet haben, selbst definiert haben und wie sie ihre Rolle in der Gesellschaft vor Seminarbeginn wahrgenommen haben.
Es ist zu beachten, dass die Biographieverläufe der beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten wesentlichen Einfluss darauf nehmen, wie diese Selbstwahrnehmung zustande kommt (Stichwort: "Behinderungskarrieren"). Manche von ihnen weisen hochgradig institutionalisierte Laufbahnen in Einrichtungen der Behinderungseinrichtungen auf, andere hingegen haben ihre Erfahrungen eher in "moderneren" Formen (zum Beispiel Wohngemeinschaften, Beschäftigungstherapien, Werkstätten sowie ambulante Unterstützungssysteme) eben jener gesammelt. (vgl. Koenig et al. 2010).
"Durch diese unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen haben sich unterschiedliche Formen von Rollenverständnissen und Selbstwahrnehmungen entwickelt, die an verschiedenen Stationen der jeweiligen Biographien zu unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit der eigenen Lernschwierigkeit und daraus resultierenden Selbst- und Rollenkonzepten geführt haben. Dabei scheint dem Ausmaß der erhaltenen Unterstützung im Sinne selbstorganisierter und selbstbestimmter Hilfeleistungen eine entscheidende Rolle in der Konstitution eines positiv besetzten Rollenverständnisses zuzukommen. Derartige interne Verarbeitungsprozesse erscheinen zudem zumeist als Resultat gesellschaftlicher Zuschreibungen und Kollektivierungstendenzen, welche die Ausgangspositionen für positive Beeinflussung von Rollenveränderungsprozessen erschwert." (Koenig et al. 2010, S. 184f.)
Es ist schwierig, diese Selbstwahrnehmung für alle am Seminar beteiligten ExpertInnen in eigener Sache aufzuspüren, da sieben der neun beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten bereits vor Beginn der Datenerhebung am Inklusiven Seminar beteiligt waren und deren Definition ihrer eigenen Selbstwahrnehmung und Rolle nur aus Nacherzählungen zu konstruieren ist, wodurch sich das Ergebnis verwäscht. Abgesehen davon haben die meisten von jenen sieben ExpertInnen bereits zuvor an Selbstvertretungsorganisationen teilgenommen, sodass hier bereits eine Verschiebung der Selbstwahrnehmung stattgefunden haben dürfte.
Was die beiden Herren (Sebastian und Kurt) betrifft, die neu zum Inklusiven Seminar hinzugekommen sind, finden sich unverfälschte Aussagen zu deren Rollenverständnis. Dies trifft auch auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Lernschwierigkeit zu. Aus diesem Grund soll nun dargestellt werden, wie sich diese beiden Herren vor Beginn der Mitarbeit am Inklusiven Seminar selbst wahrgenommen haben:
Sebastian tut sich sehr schwer mit der Frage, wie er sich selbst definieren soll oder kann. Er verwendet abwechselnd und gleichzeitig die Begriffe "PatientIn" und "KlientIn", wenn er von Menschen mit Lernschwierigkeiten - auch von sich selbst - spricht. Das Thema "Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten" wählt er, weil er selbst nicht weiß, ob und wenn dann welche Rechte es für diese Zielgruppe überhaupt gibt. Dennoch hat er manchmal Probleme damit, dass viele Menschen ihn aufgrund seiner Behinderung diskriminieren:
"Dass die Gesellschaft si verändert, a bissl wenigstens. Maunche akzeptieren a Menschen, do gibt's sicher Menschen, de wos a Menschen net akzeptieren mit Behinderung und des find i net ok weil es gibt sicher Leit, de wos gaunz normal sein und a behinderte Kinder kriagn oder so." (Sebastian, Interview I, S. 4, Zeile 22-26)
In weiterer Folge weist Sebastian außerdem darauf hin, dass dies ein Umstand ist, der unveränderlich sei und man dagegen nichts machen könne.
Andererseits ist Sebastian der Auffassung, dass er so, wie er ist, vergleichsweise glücklich sein könne, denn es hätte ihn auch - seiner Ansicht nach - viel schlimmer treffen können:
"I sog wenn i söwa (= selber) im Rollstuhl sitzen tät und dann goa nix mehr mochn tät, dann wär i scho verzweifelt, des sog i scho. Net dass i an Zorn auf aundere hob, owa i wa söwa verzweifelt." (Sebastian, Interview I, S. 5, Zeile 17-19)
In Bezug darauf, dass er sich oftmals diskriminiert fühlt, äußert Sebastian, dass er sich in solchen Situationen massiv ärgert und aber gleichzeitig das Gefühl hat, dass es keinen Sinn mache, unmittelbar eine Diskussion zu beginnen. Dennoch möchte er sich dafür einsetzen, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten Rechte haben und findet im Zuge des Interviews auch konkrete Beispiele dafür, welche Rechte vorhanden sind und inwiefern diese nicht oder nicht zielführend berücksichtigt werden (zum Beispiel wird - so Sebastian - mit Sachwalterschaft insofern viel zu leichtfertig umgegangen, als SachwalterInnen quasi uneingeschränkte Macht über die zu vertretenden KlientInnen besitzen, sich trotzdem aber keine Zeit für die einzelnen Personen nehmen, weil sie viel zu viele Menschen mit Lernschwierigkeiten gleichzeitig zu vertreten haben und so etwas, das äußerst individuell gehandhabt werden sollte, unpersönlich wird).
Zunächst scheint es also so, als ob Sebastian nicht so recht wissen würde, was er auf die Frage nach seinem eigenen Rollenbild antworten sollte und er sich über seine Selbstwahrnehmung auch keine allzu großen Gedanken gemacht haben dürfte. Je länger er jedoch darüber spricht und die konkrete Frage vergisst, umso mehr verdeutlicht sich der Verdacht, dass er sehr wohl eine Vorstellung davon hat, wie er sich selbst - auch in Bezug auf seine Lernschwierigkeit - wahrnimmt.
Kurt hingegen bezeichnet sich selbst von Anfang an als "Mensch mit Lernschwierigkeiten" und gibt an, dass er diese Bezeichnung von Johannes, einem anderen Experten im Seminar, wie auch von Mag. Oliver Koenig übernommen habe, die er beide bereits vor Seminarbeginn kennen gelernt hatte. Über Johannes ist er auch auf das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" gestoßen. Seine eigene Lernschwierigkeit erfasst Kurt als etwas, das damit zusammenhängt, dass er seine gesamte Schullaufbahn hindurch nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule unterrichtet werden musste. Dazu passt auch die Wahl seines Forschungsthemas, nämlich "Erfahrungen von IntegrationsschülerInnen".
Was seine Rolle im Zuge des Forschungsthemas betrifft, ist sich Kurt anfangs nicht so ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Ursprünglich hatte er sich Forschung im naturwissenschaftlichen Sinne vorgestellt und wollte den Themenkomplex "Klimawandel" behandeln. Erst nach intensiver Klärung des Begriffs "Inklusive Forschung" und den dort behandelten Themenstellungen greift er auf ein anderes Thema zurück, das er dann aber dennoch selbstständig wählt.
Eine konkrete Vorstellung davon, wie es ihm als zuständigen Leiter über eine Forschungsgruppe gehen könnte, hat Kurt nicht und ist diesbezüglich auch ein bisschen nervös:
"Na owa i tui kan aunderem aunschoffen, der wos des wü (= will), also, des is seine eigene Meinung dazu. Do muass i mi noch denen, noch de richten, wie die Studis (= Studierenden) Zeit hom." (Interview II mit Kurt, Seite 1, Zeile 16-18)
Dass sich irgendjemand für ihn interessieren könnte, liegt außerhalb Kurt's Vorstellungskraft, schon gar nicht, wenn es um Themen geht, die ihn beschäftigen. So hat er keineswegs damit gerechnet, dass sich Personen finden könnten, die mit ihm gemeinsam an dem von ihm gewählten Forschungsthema arbeiten würden. Dass sich dann sogar vier Studentinnen gemeldet haben, hat ihn zum einen ein wenig überfordert und zum anderen äußerst erfreut.
"I hob ma denkt, es interessiert si eh niemand fia mi. Und dann samma, dann woan ma auf amoi viere." (Interview II mir Kurt, S. 7, Zeile 24-25)
Leider sind nach wenigen Seminareinheiten zwei Studierende wieder abgesprungen, weshalb die Enttäuschung bei Kurt enorm war.
Es lässt sich also festhalten, dass bei beiden Herren eine Vorstellung davon besteht, wie sie selbst sich und ihre Lernschwierigkeit sehen - auch wenn dies nicht unmittelbar mit einem oder mehreren Begriffen dafür verknüpft werden kann, wie bei Sebastian. Beispiele dafür lassen sich zur Genüge finden, sofern die Möglichkeit dazu besteht, dem Nachdenken darüber Raum zu lassen. Beide sind in Bezug auf das bevorstehende Seminar nervös und machen sich Sorgen darüber, ob sie von den Studierenden gut angenommen werden und können sich nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn sie eine eigene Forschungsgruppe leiten, denn beide haben bisher nicht die Erfahrung gemacht, als Person mit Lernschwierigkeiten ernst genommen zu werden.
Gehen wir nun dazu über, die zweite Dimension darzustellen, das "Diskursive Ausverhandeln und Annehmen von neuen Rollen und Verantwortlichkeiten im Laufe des Forschungsprozesses".
Bei dieser Dimension ist anzumerken, dass es sich hierbei nicht um den Forschungsprozess handelt, dem die Ausarbeitung dieser Diplomarbeit zugesprochen werden kann, sondern um die jeweiligen Forschungsprozesse der einzelnen Gruppen der ExpertInnen in eigener Sache.
Diese Dimension beschreibt die gegenseitige Begleitung des ExpertInnen-Teams neben Mag. Koenig und Mag. Buchner sowie den beiden DiplomandInnen. Diese AkteurInnen werden gemeinsam auch als "Leitungsteam" bezeichnet (vgl. Koenig et al. 2010).
Das Konzept des Seminars "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" hat sich durch die Neuartigkeit dieser Lehrveranstaltung im Laufe der drei Seminardurchläufe (also im Wintersemester 2007/08 und im Sommersemester 2008 als einsemestrige Lehrveranstaltung sowie im Wintersemester 2008/09 und im Sommersemester 2009 als semesterübergreifendes Seminar) immer wieder nach dem Prinzip "Learning by Doing" (Koenig et al. 2010, S. 185) verändert. Dies trifft auch auf die Rollen zu, die die beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache sowie auch die Lehrveranstaltungs-Leiter Mag. Koenig und Mag. Buchner eingenommen haben.
Vor allem der Faktor "Zeit" ist hier im Besonderen zu nennen:
"Aufgrund unterschiedlicher Vorbereitungs- und Einarbeitungszeit innerhalb der ExpertInnen-Gruppe haben sich zwei ‚Generationen' der ExpertInnen entwickelt, die von ihnen selbst als ‚alte Hasen' und ‚Frischlinge' bezeichnet werden. Diese unterschiedlichen Generationen führen folglich auch zu verschiedenen Rollen innerhalb des Leitungsteams." (Koenig et al. 2010, S. 185)
"Alte Hasen" meint diejenigen ExpertInnen, die von Beginn an das Inklusive Seminar begleiteten und gemeinsam mit Mag. Buchner und Mag. Koenig konzeptionierten. Sie hatten eine lange Vorbereitungszeit zur Verfügung, wodurch ein schrittweises Annehmen und Ausfüllen neuer Rollen (zum Beispiel als ExpertIn, ForscherIn, GruppenleiterIn, Lehrende etc.) ermöglicht wurde.
Als "Frischlinge" werden diejenigen Personen bezeichnet, die in den folgenden Semestern neu zur ExpertInnen-Gruppe hinzugekommen sind. Bei ihnen konnte nicht mehr so viel Zeit aufgewandt werden, um in die neue Rolle eingeführt zu werden. Daraus resultierten unbeabsichtigte Hierarchien innerhalb der ExpertInnen-Gruppe (vgl. a.a.O.).
Sebastian und Kurt bilden im Zeitraum der Datenerhebung die Gruppe der "Frischlinge", weswegen anhand ihrer Aussagen illustriert werden soll, was darunter zu verstehen ist:
Sebastian bevorzugt eher das Seminar selbst als die darauf folgenden Nachbesprechungen, denn in Gegenwart der anderen ExpertInnen fühlt er sich unsicher:
"Najo i hob jo a net so vü Erfahrung wia die Aundan (= Anderen)" (Interview III mit Sebastian, S. 2, Zeile 23)
In der konkreten Arbeit seiner eigenen Forschungsgruppe, also gemeinsam mit den Studierenden, fühle er sich eher nicht unsicher, so Sebastian. Dennoch ist ihm die Rückmeldung in den Nachbesprechungen sehr wichtig, vor allem dann, wenn er das Gefühl hat, etwas gut gemacht zu haben.
Kurt wiederum hat kein Problem damit, in den Nachbesprechungs-Einheiten seine Probleme in Bezug auf das Forschungsprojekt zu äußern und bittet immer wieder die anderen ExpertInnen um Hilfe:
"Fritz und Andrea raten ihm, hart durchzugreifen und seine Rolle klar zu definieren: ‚Du bist der Chef!'" (eigenes Forschungstagebuch, 28.10.08, S. 4)
Wie aus diesen Beispielen bereits deutlich wurde, sind die Nachbesprechungs-Einheiten der zentrale Ort für den Austausch und das Ausverhandeln der eingenommenen Rollen innerhalb des Leitungsteams. Hier werden alle Fragen besprochen, die die konkrete Arbeit der ExpertInnen in eigener Sache in ihren jeweiligen Forschungsteams betreffen und es wird versucht, gemeinschaftlich Lösungen für alle Probleme, die sich stellen, zu finden. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass neue Rollen ausverhandelt und übernommen werden können (vgl. Koenig et al. 2010).
"Hier ist ein beständiges Abnehmen von Unterstützungsbedarf durch die Lehrveranstaltungsleiter zu beobachten. Die ExpertInnengruppe hat sich zu einem eigenständigen, handlungsfähigen Team entwickelt." (Koenig et al. 2010, S. 186)
Dies betrifft sowohl "Frischlinge" als auch "alte Hasen", denn diese unterstützen sich gegenseitig und die Gruppe der "alten Hasen" übernimmt dabei ein Stück weit von sich aus die Verantwortung dafür, dass die neu hinzugekommenen Experten Sebastian und Kurt die notwendige Unterstützung bekommen und sich jederzeit hilfesuchend an sie wenden können.
Im Optimalfall könnte die ExpertInnen-Gruppe die Nachbesprechungen selbstständig, ohne Beisein von Mag. Koenig, Mag. Buchner und den beiden DiplomandInnen führen. Dass eine Tendenz in diese Richtung vorhanden ist, bestätigt Andrea, wenn sie sagt:
"Und ich weiß nicht, ich trau mir, ich würd es mir zutrauen, die, die, wenn's die Zeit zulassen würde, würd ich mich mit anderen Experten, -Innen oder Kolleginnen und Kollegen, wie ich's nenne, einfach den Oliver und den Tobias beiseite schubsen und sagen so, jetzt machen wir, wir das Seminar, ohne die Leitung, und halt schauen, was raus, rauskäm, und mal schauen was rauskäm. Ich find, ich glaube, das wär lustig, es mal rauszubekommen." (Interview IV, Teil 2 mit Andrea, S. 5, Zeilen 7-13)
In diesem Zusammenhang muss natürlich auch diskutiert werden, wie die Zusammenarbeit zu den Lehrveranstaltungs-Leitern Mag. Oliver Koenig und Mag. Tobias Buchner funktioniert hat. Diese Zusammenarbeit steht in engem Verhältnis zu den Rollen, die während des Forschungsprozesses eingenommen worden sind.
Es lässt sich feststellen, dass zu Beginn Inklusiver Forschung das Verhältnis der ExpertInnen in eigener Sache zu den Lehrveranstaltungsleitern von Unsicherheit geprägt ist, wobei im schlimmsten Fall auch eine Tendenz in Richtung Ängstlichkeit erkennbar ist. Dabei ist nicht die Angst vor den Personen selbst gemeint, sondern Angst in Bezug auf Forschung und Wissenschaft und dem damit verbundenen Wissen, das sich die beteiligten ExpertInnen selbst nicht zutrauen.
Andererseits sind die beiden Lehrveranstaltungs-Leiter auch eine große Hilfe und deshalb sehr geschätzt innerhalb der ExpertInnen-Gruppe, da allen Beteiligten zu jeder Zeit klar ist, dass man sich mit Fragestellungen und Problemen - auch privater Natur - an diese beiden Personen wenden kann.
Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Auffassungen äußert sich in den Seminareinheiten zum Beispiel dadurch, dass vereinbart wurde, dass sich die Personen des Leitungsteams vor den Studierenden beim Nachnamen ansprechen, außerhalb dieses Rahmens beim Vornamen. Bis zum Ende des Seminares kam es immer wieder zu Situationen wie diesen:
"Herr, ähm, Herr, na geh, also Tobi und Oli!" (eigenes Forschungstagebuch, 11.11.2008, S. 5)
Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass Mag. Koenig und Mag. Buchner zwar einerseits großer Respekt aufgrund ihres Status' als Teil der Scientific Community seitens der ExpertInnen entgegengebracht wurde, andererseits jedoch handelte es sich bei diesen beiden Herren um Personen, die am Leben der aktiv am Seminar mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache teilnahmen und zu denen ein persönlicher, auch außerhalb Inklusiver Forschung weiter bestehender Kontakt bestand. Dies zu trennen, war nicht nur für die ExpertInnen schwierig, sondern auch für Mag. Koenig und Mag. Buchner.
Im Zuge der Inklusiven Forschungsprojekte der beteiligten ExpertInnen in eigener Sache hat sich das Verhältnis zu den Lehrveranstaltern jedoch verändert. Zwar blieben sie immer noch Personen, die Anteil am Leben der ExpertInnen nahmen, jedoch wurde mehr und mehr zwischen Mag. Koenig und Mag. Buchner als Lehrveranstaltungsleitern im Gegensatz zu diesen beiden als Privatpersonen differenziert.
So wurde es möglich, dass sich auf fachlicher Ebene - also in Bezug auf Inklusive Forschung - Konflikte und Differenzen auftaten, die auf eben dieser Ebene und getrennt vom privaten Bereich in Angriff genommen werden mussten. Vor allem Andrea und Karl, als MitarbeiterInnen am Inklusiven Seminar seit der Geburt der Idee desselben dabei, konnten sich fachlich in teilweise heftigen Diskussionen mit den beiden Lehrveranstaltern auseinandersetzen. Dabei ging es vordergründig um das geplante Forschungsdesign.
"Jo, es, ähm, so, so wie's jetzt, oiso seit ma diesen wie sui i sogn a bissl den Konflikt bei dem Projekt ghobt hom, nehmans as jetzt zur Kenntnis dass i des doch so durchziagn (= druchziehen) möchte, ähm, auch wenn sie meinen, dass des, ähm, net so afoch (= einfach) sein wird. Owa (= aber) des hob i ma eben vurgnumman (= vorgenommen) weil des auch net, also weil's auch für mi wichtig woa." (Interview V mit Karl, S. 3, Zeilen 24-28)
Karl hat sich bei der Konzeptionierung seines Forschungsprojektes gegen die Lehrveranstaltungsleiter durchgesetzt, als es um die Frage ging, welche Personen interviewt werden sollten. Hier kann eindeutig von einer Tendenz in Richtung Emanzipatorische Forschung gesprochen werden, bei der Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht nur die Auftraggeber Inklusiver Forschungsprojekte sind, sondern auch die Kontrolle über alle Aspekte des Forschungsprozesses behalten (vgl. Koenig et al. 2010).
Ähnlich, wenngleich nicht ganz so konfliktbeladen, formuliert Andrea ihr Verhältnis zu Mag. Koenig und Mag. Buchner:
"Ich sage nur, wie ich's machen würd, und, und sie nehmen es an, weil sie, weil sie, sie, sie sagen selber die Experten leiten, sie sagen selber glaub ich dass die Experten die, die, das Seminar leiten. Ich seh sie nur als Unterstützer, also, ja, als Unterstützer und, und, und was mich, einmal war so ein Fall wo, wo, wo ich sie, wo ich sie kritisiert habe in der Nachbesprechung, und sie haben's locker genommen, sie haben's angenommen, das war ein komi, komisches Gefühl, weil, weil ich, weil ich hab immer gelernt, dass ein, dass man einen Lehrer nicht kritisieren darf, und also seh ich sie nicht als Leiter an, eher so als Freunde oder Kollegen." (Interview IV, Teil 1, mit Andrea, S. 3, Zeile 22-31)
Es ist also eindeutig, dass die ExpertInnen in eigener Sache diejenigen sind, die die Forschungsprojekte leiten und dass die Lehrveranstaltungsleiter lediglich als Unterstützer fungieren, die auch kritisiert werden dürfen. Auch dies stellt eindeutig ein Indiz in Richtung Emanzipatorische Forschung dar. Das private, gute Verhältnis zu Mag. Koenig und Mag. Buchner wird dabei nicht in Frage gestellt.
Anhand dieser Beispiele und Erläuterungen wurde nun also verdeutlicht, welche Rollen innerhalb des Leitungteams des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" eingenommen wurden. Was sich bisher nur auf die aktiv am Seminar mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache bezog, kann im Sinne eines Annehmens von neuen Rollen natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit Studierenden übertragen werden. Dies soll im folgenden Abschnitt geschehen.
In dieser Dimension soll die konkrete Zusammenarbeit zwischen den am Inklusiven Seminar mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache mit den Studierenden besprochen werden.
Zur Wiederholung: neun Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache arbeiteten zu einem selbstständig gewählten Thema mit mindestens zwei und maximal vier Studierenden zu jeweils einem Forschungsthema. Daraus ergeben sich neun Forschungsgruppen, bedingt durch die neun mitarbeitenden ExpertInnen, die mit insgesamt 31 Studierenden zusammenarbeiten.
Die Herausforderung, die sich dabei stellt, ist eine Umkehrung der Hierarchien: Studierende sind nicht den Lehrveranstaltungsleitern, sondern den beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache sowie deren Thema und der gemeinsam erarbeiteten Fragestellung verpflichtet. Die Lehrveranstaltungsleiter selbst in Person von Mag. Koenig und Mag. Buchner fungieren eher als eine Art Berater.
Dennoch sind letztere diejenigen Personen, die am Ende der Lehrveranstaltung Noten an die Studierenden vergeben und sich auch an die von der Universität ausgegebenen Vorgaben halten müssen. Die Studierenden selbst nahmen auch eher aus Gründen der Erfüllung des Studienplans am Seminar teil als aus echtem, unbeeinflusstem Interesse. Die Erlangung eines "Scheins" durch Verfassen eines Forschungsberichtes stand für manche Studierende im Mittelpunkt, was die Gruppenleitungsfunktion der ExpertInnen teilweise negativ beeinflusst hat. Dies führte zu Schwierigkeiten und Konflikten, die auszuräumen nicht unbedingt immer einfach war (vgl. Koenig et al. 2010, S. 186).
Abgesehen davon hatten manche der Studierenden zuvor keinen Kontakt zu Menschen mit Lernschwierigkeiten, wodurch ebenfalls Schwierigkeiten aufgetreten sind. Andere wiederum, die durch berufliche Praxis oder absolvierte Praktika bereits Erfahrungen mit dieser Zielgruppe sammeln konnten, hatten nur eingeschränkt Kontakt mit SelbstvertreterInnen, die auf ihre Autonomie besonderen Wert legen. Die Folge dessen war ein Aufeinanderprallen von unterschiedlichsten Zugängen und Rollenbildern, was ebenfalls zu Spannungen geführt hat (vgl. a.a.O., S. 187). Andrea beschreibt dieses Faktum so:
"Komm ich in das, in dieselbe Situation, wo ich denke, akzeptieren sie eine Behinderte als Leiterin, dieser Gedanke schwirrt mir immer wieder im Kopf, aber nur am Anfang des Seminars, dann hört's auf." (Interview IV, Teil 1 mit Andrea, Seite 3, Zeilen 1-3)
Die neu erarbeiteten Rollen im Zuge der Vorbereitung des Seminars und der Nachbesprechungen haben in diesem Sinne nur dann eine Berechtigung, wenn sie in der konkreten Situation im Seminar als TeamleiterIn von einer Gruppe Studierender auch umgesetzt werden können - auch wenn das bedeutet, dass man die neue Rolle gegebenenfalls auch verteidigen muss, was nicht immer allen ExpertInnen gelungen ist. Zu den Studierenden kann folgendes gesagt werden:
"Ebenso müssen die Studierenden wiederum ihre Rollen hinterfragen, ändern oder gegebenenfalls verteidigen, um das Ziel des Seminars - inklusives Arbeiten in allen Stadien der Forschungsprojekte - zu erreichen. In diesem Sinne wird auch unterschiedlich viel Unterstützung von außen (also durch die LehrveranstaltungsleiterInnen) als auch von innen (also durch die betreffenden ExpertInnen und StudentInnen) eingefordert." (Koenig et al. 2010, S. 187)
Ich werde nun versuchen, anhand einiger Beispiele anzuführen, was in Bezug auf die Umkehrung der Hierarchien in den Forschungsgruppen geschehen ist und auf welche konkreten Beispiele sich die soeben ausgeführten Aussagen stützen.
Kurt hat mit seiner Gruppe zu Beginn des Seminars insofern große Probleme, als von den ursprünglich vier Studentinnen letztlich nur zwei übrig blieben, über die Kurt sich beklagt, da sie ihn seiner Meinung nach zu wenig einbeziehen würden und auch das von ihm gewählte Thema zu sehr abändern wollten. Der größte Konflikt in dieser Hinsicht baut sich um die Frage auf, ob SchülerInnen in Integrationsklassen auch im Burgenland befragt werden sollten oder nicht, worauf Kurt besteht. Die Situation wurde dahingehend aufgelöst, dass Kurt's Gruppe bei beinahe jeder Seminareinheit Markus Eichinger oder meine Person zur Seite gestellt wurde, die der Gruppe dabei helfen sollten, Lösungen zu finden, die für alle beteiligten Personen vertretbar wären. Mit dieser Strategie hatte Kurt den Vorteil, Unterstützung beim Ausfüllen seiner neuen Rolle zu bekommen und trotzdem nicht zu sehr in seiner Autonomie eingeschränkt zu werden (denn die Gruppentreffen außerhalb des Seminars musste er alleine bestreiten). Die Studierenden profitierten, indem sie ebenfalls Hilfe in Anspruch nehmen konnten, war dies doch die kleinste Gruppe und den anderen gegenüber dadurch im Nachteil, dass sie zu dritt ebenso viel Arbeit erbringen mussten wie andere Gruppen, die aus fünf Personen bestanden.
Anders stellt sich die Situation von Sebastian dar.
Was Sebastian als zweiten "Frischling" in der ExpertInnen-Gruppe betrifft, so lassen sich völlig andere Entwicklungen vorfinden. Er tut sich sehr schwer damit, seine Rolle als Gruppenleiter auszufüllen und stellt seine eigenen Ansprüche massiv in den Hintergrund. Es besteht außerdem der Verdacht, dass Sebastian mit der neuen Situation an der Universität völlig überfordert sein könnte.
Die konkrete Zusammenarbeit mit den Studierenden in Sebastian's Gruppe funktioniert einwandfrei; es wird versucht, Sebastian bei jedem Forschungsschritt einzubeziehen. Dennoch fällt es auch den Studierenden dieser Gruppe auf, dass Sebastian stellenweise den Anforderungen nicht gewachsen zu sein scheint.
Anfang Dezember eskaliert die Situation dahingehend, dass Sebastian in eine psychische Krise gerät, die sich erstmalig in ein Telefonat mit mir, der Autorin dieser Diplomarbeit, zeigt. Nachdem alle notwendigen Schritte eingeleitet wurden, um die akute Situation zu lösen, wurde - auch gemeinsam mit Sebastian's Forschungsgruppe - beschlossen, dass Sebastian im Seminar so lange pausieren könne, wie er wolle. Ende Jänner kam Sebastian ins Seminar zurück und die Zusammenarbeit mit ihm klappte von da an einwandfrei, vor allem auch dadurch bedingt, dass er zu jeder Zeit die Möglichkeit bekam, selbst zu entscheiden, wo er konkret mitarbeiten wolle und wo nicht. Auch das entspricht den Grundregeln Inklusiver Forschung, die die Studierenden in Sebastian's Gruppe versucht haben, so gut wie möglich umzusetzen - Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen zwar in jeden Schritt des Forschungsprozesses eingebunden werden, sofern sie dies aber überfordert und möglicherweise sogar ihre Gesundheit beeinträchtigt, müssen sie das nicht tun.
Zu betonen ist, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass Sebastian's psychische Krise nicht ausschließlich mit dem Inklusiven Seminar in Zusammenhang zu bringen ist, sondern auch andere Faktoren von außerhalb diesen beeinflussten. Nach seiner Pause steigt Sebastian so wieder ein:
"Sebastian ist wieder da. Er entschuldigt sich vor Beginn des Seminars für den Stress rund um Weihnachten, allerdings sei er dennoch am überlegen, ob er nach Ende des Studienjahres aufhört - er wisse es noch nicht so recht. Das laufende Jahr will er auf jeden Fall schaffen. Außerdem möchte er sich dringend zum Plaudern treffen." (eigenes Forschungstagebuch, 20.2.2009, S. 13)
Letztlich veränderte sich Sebastian's Zugang zu seiner neuen Rolle als Leiter einer Forschungsgruppe dahingehend, dass er immer wieder betonte, dass er unbedingt am Inklusiven Seminar weiterarbeiten wolle, sofern dieses wieder angeboten werden würde. Dieser Wandel zum positiven Annehmen seiner neuen Rolle wurde nicht zuletzt von den Studierenden seiner Forschungsgruppe beeinflusst, die mit viel Einfühlungsvermögen und Verständnis versucht haben, Sebastian so gut wie möglich in Inklusive Forschung einzubinden.
Rund um Sebastian's psychische Krise fand ein Gespräch mit den Studierenden seiner Forschungsgruppe statt, um zu besprechen, wie es ihnen mit der Situation ergeht. Dieses Gespräch ist - wie bereits in Abschnitt 10.1. (Exkurs: Qualitative Interviews mit Menschen mit Lernschwierigkeiten) angemerkt - in Form von Notizen in meinem eigenen Forschungstagebuch festgehalten worden und somit in diesen Abschnitt eingeflossen.
Eine Besonderheit in der Zusammenarbeit zwischen Studierenden und der zuständigen Expertin findet sich in der Forschungsgruppe rund um Martina.
Massive Schwierigkeiten in Bezug auf die Zusammenarbeit von Studierenden und der entsprechenden Expertin stellten sich in Martina's Gruppe. Die Prinzipien der Inklusiven Forschung funktionierten hier nur bedingt, denn vor allem eine Studentin hatte große Schwierigkeiten damit, eine Person mit Lernschwierigkeiten als Gruppenleiterin zu akzeptieren.
Wenn in weiterer Folge Zitate aus den Forschungstagebücher der Studierenden verwendet werden, so sehe ich davon ab, fiktive Namen für diese zu verwenden, sondern bezeichne sie als "Studentin 1", "Studentin 2" usw. Dies trifft auch dann zu, wenn von ihnen in direkten Zitaten gesprochen wird - an den entsprechenden Stellen wurden die Namen ausgetauscht.
Der Konflikt mit Studentin 1 ließe sich kurz so darstellen:
"Eine Studentin fühlt sich diskriminiert, weil die ExpertInnen sich als Chefs deklarieren. Statt ‚meine Gruppe' müsste es ‚unsere Gruppe' heißen (‚Ich gehöre niemandem'). Außerdem würde mit zweierlei Maß gemessen - die ExpertInnen dürfen fehlen und zu spät kommen, die Studis (= Studierenden) jedoch nicht. Sie möchte den ExpertInnen auf gleicher Augenhöhe begegnen." (eigenes Forschungstagebuch, 2.12.2008, S. 8)
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Studentin in ihrem eigenen Forschungstagebuch durchgängig Begriffe wie "meine Expertin" oder "meine Gruppe" verwendet.
Im Forschungstagebuch von Studentin 1 finden sich immer wieder eindeutige Hinweise darauf, dass diese Studentin tatsächlich große Probleme mit der hierarchischen Rollenumkehr hat und dass sich der - zunächst nur vermutete - Eindruck somit bestätigen lässt. Dies betrifft nicht nur den Beginn des Seminars, sondern zieht sich über beide das Inklusive Seminar umfassende Semester durch, wenngleich zu Beginn besonders viel zum Thema "Rollenumkehr" im Forschungstagebuch zu finden ist. Dazu einige Beispiele:
"Wieder gibt es Diskussionen, als uns gesagt wird, dass die StudentInnen die AssistentInnen der ExpertInnen und die AssistentInnen (sic!) SeminarleiterInnen sind. Da schließe ich mich an. Auch ich fühle mich an dieser Stelle abgewertet. Ich dachte gleichwertige, gegenseitige Anerkennung. Nicht Toleranz, sondern eben Anerkennung, völlig gleichgestellt. Im Moment bin ich so weit, dass ich mir überlege auszusteigen, nicht weil mich das Thema nicht interessiert, sondern weil ich so behandelt werde. Ich fühle mich diskriminiert." (Forschungstagebuch Studentin 1, 21.10.2008)
"Ich habe das große Problem, dass es hier nicht um gegenseitige Wertschätzung geht, sondern dass die Experten teilweise zu sehr herauskehren, unsere Chefs zu sein. Ich fühle mich deswegen nicht gleichwertig integriert, nicht ich diskriminiere die ExpertInnen, sondern es ist umgekehrt, das ist genauso wenig in Ordnung." (Forschungstagebuch Studentin 1, 30.10.-3.11.2008)
Besonders dann, wenn andere ExpertInnen versuchen, der Gruppe Tipps zu geben, wird besonders deutlich, wie sehr die Thematik der Rollenumkehr hier hervorsticht, denn es steht, so die zitierte Studentin, ihnen nicht zu, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen.
Resultat dessen ist, dass die zuständige Expertin Martina sich weigerte, an Gruppentreffen außerhalb des Seminars teilzunehmen. Erst als ein klärendes Gespräch mit allen beteiligten Personen sowie der Lehrveranstaltungsleiter auf Ansuchen von Martina geführt wurde, entspannte sich die Situation.
In den übrigen Forschungsgruppen konnte eine derart massive Dynamik nicht beobachtet werden und wurden teilweise auch sehr positive Aspekte der Zusammenarbeit mit den ExpertInnen gefunden. Aus diesem Grund sollen auch sie noch einmal kurz dargestellt werden.
Thomas hat mit seiner Forschungsgruppe nach eigenen Angaben keinerlei Probleme, auch in Anbetracht dessen, dass er die ersten Wochen des Inklusiven Seminars aufgrund eines Kuraufenthaltes nicht anwesend sein konnte.
"Lob an seine Gruppe und die Vorbereitungen, die sie gemacht hat, als er nicht da war. Er fühlt sich gut eingebunden und versteht sich mit den Gruppenmitgliedern recht gut." (eigenes Forschungstagebuch, 20.1.2009, S. 14)
Dem ist hinzuzufügen, dass Thomas bereits sein drittes Inklusives Seminar bestreitet und sich in seine neue Rolle als Teamleiter gut eingefunden hat. Es ist also davon auszugehen, dass er Kritik äußern würde, wenn dies notwendig erscheint.
Karl hatte anfangs massive Probleme mit seiner Gruppe, da auch hier zumindest eine Studentin Probleme damit hatte, Karl als Teamleiter anzuerkennen. Dies hat sich jedoch im Laufe der Zusammenarbeit gelegt, vor allem auch dadurch, dass Karl in Bezug auf Inklusive Forschung bereits äußerst kompetent ist.
Rudi gibt an, dass er sich von seinen Studentinnen äußerst gut eingebunden fühlt und meint:
"Sowohl Zusammenarbeit als auch Chemie stimmen bestens." (a.a.O.)
Dem schließen sich auch Johannes und Andrea in Bezug auf ihre Forschungsgruppen an.
Die Gruppe rund um Fritz dürfte ebenso gut funktioniert haben, da diesbezüglich keinerlei Kritik geäußert wurde. Fritz übt lediglich massive Selbstkritik, da er aufgrund seiner häufigen Erkrankungen nicht die volle Leistung erbringen könne, die er von sich selbst erwarte. Fritz gibt an, dass die Gruppe am Anfang zu sehr auf Mag. Koenig und Mag. Buchner konzentriert gewesen sei. Eine Studentin, die Fritz' Kompetenz erst ausfindig machen musste, reagiert darauf mit den Worten:
"Ich wusste nicht, dass der Fritz auf so ziemlich alles eine Antwort hat." (a.a.O., S. 19)
Daraus wird also deutlich, dass die Zusammenarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten als TeamleiterInnen von Inklusiven Forschungsprojekten mit den ihnen zugeteilten Studierenden nicht immer einfach ist und sogar von groben Schwierigkeiten begleitet werden kann, die auszuschalten in diesem Setting nicht möglich ist. Dennoch kann - wie die eben dargestellten Beispiele verdeutlichen - dies auch äußerst gut funktionieren. Eine allgemein gültige Regel dafür lässt sich nicht finden, liegt es doch immer an den konkret beteiligten Personen, ob und wie ein Inklusives Forschungsprojekt umgesetzt wird.
Festzuhalten ist in jedem Fall, dass eine deutliche Tendenz erkennbar ist: Je länger ein Experte oder eine Expertin sich mit Inklusiver Forschung auseinandersetzt, umso eher gelingt es ihm oder ihr, die neue Rolle als TeamleiterIn, LehrveranstaltungsleiterIn, ForscherIn etc. anzunehmen und auszufüllen. Dies gilt auch in Bezug darauf, sich gegen die Widerstände von Studierenden durchzusetzen. Einzelfälle wie in Martina's Gruppe können leider in diesem Rahmen nicht ausgeschalten werden - hier liegt es an der Lehrveranstaltungsleitung, den Schaden möglichst gering zu halten.
Die vierte und letzte Dimension beschreibt Veränderungen und Erweiterungen von Rollen und Kompetenzen, die sich durch die Teilnahme an Inklusiver Forschung ergeben können. Sie soll im Folgenden dargestellt werden.
In dieser Dimension sollen Rollen dargestellt werden, die die am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache auch außerhalb dieses Rahmens einnehmen, die damit aber unmittelbar einhergehen.
"Wir sehen Inklusive Forschung als Chance, gesellschaftliche Zuschreibungen zu hinterfragen, Ausschlussmechanismen aufzubrechen und Menschen, die selten Gehör finden, eine Stimme zu geben. Die ExpertInnen können im Idealfall ihre Rolle in der Gesellschaft neu definieren (...)." (Koenig et al. 2010, S. 187)
Durch die Mitarbeit am Inklusiven Seminar haben sich für viele der daran beteiligten ExpertInnen neue Perspektiven ergeben, für die es notwendig ist, neue Rollen zu definieren. Zwar wird darauf noch näher eingegangen werden, wenn es gilt, die konkret stattgefundenen Empowerment-Prozesse aufzuzeigen, dennoch sei an dieser Stelle kurz aufgelistet, um welche neuen Perspektiven es sich dabei handelt:
-
Erkennen und (teilweises) Ergreifen neuer Perspektiven - vor allem beruflicher Natur
-
Bewusstwerdung und Einsetzen von Kompetenzen innerhalb und außerhalb der Lehrveranstaltung
-
Erweiterung der sozialen Netzwerke
-
Aktive Beteiligung bei Kongressen
-
Leitung von Workshops
-
Erleben von Respekt und Akzeptanz
-
Ko-Moderation bei Persönlicher Zukunftsplanung
(Koenig et al. 2010, S. 188)
Bei der Entwicklung, dem Ausverhandeln und dem Annehmen von neuen Rollen außerhalb des Inklusiven Seminares waren die ExpertInnen in eigener Sache auf sich selbst gestellt, weshalb hierzu keine direkt beobachtbaren Belege existieren, sondern lediglich auf die Aussagen der ExpertInnen selbst zurückgegriffen werden kann. Einzige Ausnahme hierbei bildet die gemeinsame Teilnahme an der Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen im Februar 2009 in Frankfurt am Main, bei der die beteiligten ExpertInnen in direkte Diskussion mit ForscherInnen und AkademikerInnen von anderen Universitäten im deutschsprachigen Raum traten.
Ich werde die Darstellung der neu eingenommenen Rollen außerhalb des Inklusiven Seminares kurz halten, da sich dieser Teil im nächsten Abschnitt wiederholen wird, wenn individuell stattgefundene Empowerment-Prozesse besprochen werden.
Sebastian hat das Gefühl, dass er nun, da er als Experte in eigener Sache tätig ist, dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft sich verändert und nimmt dies für sich als neue Rolle an. Dabei bezieht er sich zunächst darauf, dass er auch bei den am Inklusiven Seminar teilnehmenden Studierenden als Teil der Gesellschaft etwas bewirkt haben könnte:
"Najo wos vielleicht über die, die vielleicht in der Uni oder so, die wos si a Büd (=Bild) gmocht hom fia an der wos hoit mit maunche Sochn net so guat so vielleicht laungsaumer is mit die Gedaunken is oder so, wasst wos i man, der wos oiso a bissl, der wos hoit a bissl länger braucht beim nochdenken und so, do hom, do san vielleicht vüle (= viele) draufkommen, dass si de eigentlich der wos länger braucht zum nochdenken, a bissl Rücksicht nehmen die Leit dann, wasst wos i man, also des Büd (= Bild) hot si zum Positiven, wasst, wasst wos i man, ähm, wia sull i sogn, also die Leit die wos negativ eingstöt (= eingestellt) san die san jetzt mehr, des Gsicht hot si mehr positiv dorgstöt (= dargestellt), de san jetzt mehr, wia sull i des sogn, i kauns net genau definieren, des is schwa zum sogn." (Interview III mit Sebastian, Seite 8, Zeilen 21-30)
Sebastian ist also der Meinung, dass sich aus Sicht der Studierenden das Bild über Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Positiven gewandelt haben könnte. Dem ist hinzuzufügen, dass Sebastian, sofern es sich um positive Entwicklungen handelt, von denen er weiß, dass er daran beteiligt gewesen sein könnte, sehr zur Unsicherheit in seinen Formulierungen neigt. Man könnte behaupten, dass er sich nicht so recht traut, dies auch selbstbewusst auszusprechen.
Karl schlägt in eine ähnliche Kerbe und meint, dass es nur Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst sein könnten, die sich gegen Ungerechtigkeiten, denen sie begegnen, wehren könnten. BetreuerInnen, SachwalterInnen und ähnliche Personen würden ihre eigenen Interessen verfolgen und sich der Problematik von Menschen mit Lernschwierigkeiten nur dann widmen, wenn sie "ein gutes Bauchgefühl" (Interview V mit Karl) hätten. Deswegen setzt Karl dort an, wo Personen, die mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammenarbeiten, ausgebildet werden. Hier kommt den betroffenen Personen selbst eine wesentliche neue Rolle zu:
"Jetzta nur ois Beispü (= Beispiel), wie in Einrichtungen umgegangen wird, jo, und dann kumman hoit die, i sog jo net, dass, dass, dass schlechte Betreuer gibt, in dem Sinne gibt's auch gute Betreuer, jo, owa, owa wie sui i sogn, oiso eben diese Geschichten in diesen Einrichtungen, die hom olle diese altmodische Ausbildung, sog i jetzt amoi, und nicht dieses neue, oiso neu in dem Sinn, ähm, dass es auch anders geht, wie ma hoit mit die Leit umgeht." (Interview V mit Karl, S. 9, Zeile 16-22)
Die Ausbildung von Studierenden der Heil- und Integrativen Pädagogik zielt unter anderem darauf ab, dass diese Personen nach Beendigung des Studiums in Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten werden. Aus diesem Grund, so Karl weiter, sei das Inklusive Seminar eine gute Möglichkeit, etwas an der Sichtweise von zukünftigen BetreuerInnen zu verändern.
Ein weiterer Aspekt, der im Zuge der Mitarbeit am Inklusiven Seminar aufgetaucht ist, bildet das Auftreten der mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache in Einrichtungen der Behindertenhilfe. So gab es zum Beispiel einen Konflikt zwischen Fritz, der mich in meiner Arbeit in einer Freizeiteinrichtung der Behindertenhilfe besucht hat, und den anderen dort anwesenden Gästen mit Lernschwierigkeiten. Fritz hat sich dort sehr damit gebrüstet, jetzt "an der Universität" (eigenes Forschungstagebuch, 28.4.2009, S. 25) zu sein, was die anderen Menschen mit Lernschwierigkeiten als Prahlerei empfunden haben und sich in Folge dessen ein Streit entwickelt hat.
Diese Szene konnte von mir zufällig beobachtet werden, da er dort ja explizit mich besuchen wollte. Ob und wie solche Ereignisse außerhalb des Inklusiven Seminares häufiger stattfanden, kann von meiner Seite aus nicht beurteilt werden, stellt aber dennoch einen spannenden Aspekt dar. Hier wird eine neue Rolle eingenommen, die bei Personen innerhalb derselben Zielgruppe möglicherweise als überheblich eingeschätzt wird.
Weitere Beispiele für das Einnehmen neuer Rollen können zuhauf gefunden werden. Diese sollen jedoch, um Wiederholungen zu vermeiden, im nächsten Abschnitt besprochen werden, da sie unmittelbar mit Empowerment-Prozessen, die sich im Zuge der Teilnahme am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" ergeben haben, zusammenhängen.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Abschnitt soll der "Arbeitsraster Empowerment", wie in den Abschnitten 2.3.3.1. ("Empowerment bei Georg Theunissen") und 2.3.3.2. ("Empowerment bei Dorothy Atkinson") ausgearbeitet, anhand des Datenmaterials zum Tragen kommen.
Vorneweg ist ganz allgemein zu sagen, dass bei allen am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" im Zeitraum der Datenerhebung beteiligten ExpertInnen in eigener Sache Empowerment-Prozesse in Kraft getreten sind. Die Intensität und die Art dieser Prozesse ist jedoch dabei von Person zu Person vollkommen unterschiedlich.
Vorab soll dennoch kurz dargestellt werden, welche wesentlichen Veränderungen ganz allgemein beobachtet werden konnten. Diese Auflistung wurde von Eichinger und Kremsner (2011) bereits publiziert:
-
Wir konnten bei (fast) allen ExpertInnen Empowerment-Prozesse beobachten. Probleme in deren Arbeits- und Wohnbereich wurden erkannt und Veränderungen teilweise herbeigeführt.
-
Durch die Forschungstätigkeit ergaben sich neue soziale Beziehungen, die über das Seminar hinaus erhalten blieben. Kontakte zu anderen WissenschaftlerInnen wurden hergestellt, was zur Beteiligung der ExpertInnen an neuen Projekten führte.
-
Die ExpertInnen konnten bereits ab dem zweiten (Anm.: Seminar-) Durchgang theoretisches Wissen an Studierende weitergeben. Sie übernahmen Inputs im Seminar und halfen Studierenden bei Unklarheiten im Forschungsprozess.
-
Die Seminare wurden jeweils mit öffentlichen Präsentationen unter Beteiligung von JournalistInnen abgeschlossen, alle Gruppen präsentierten ihre (Zwischen-)Ergebnisse. Gemeinsam stellten wir auf drei IntegrationsforscherInnen-Tagungen unser inklusives Projekt vor. (Eichinger und Kremsner 2011, S. 162)
Was die weitere Vorgehensweise betrifft, so ist zu sagen, dass nicht die Empowerment-Prozesse jedes einzelnen Experten und jeder einzelnen Expertin nacheinander durch besprochen werden sollen. Vielmehr wird versucht, die einzelnen Ebenen und Dimensionen, die Georg Theunissen und Dorothy Atkinson ansprechen, mit Beispielen zu belegen, um in Erfahrung zu bringen, welche Dimensionen in diesem Setting von besonderer Bedeutung waren und welche nicht.
Die vier Dimensionen, die Georg Theunissen (2009) in Anschluss an Herriger (2006) erfasst, sollen an dieser Stelle nicht abermals angeführt werden, da dies bereits ausführlich in Abschnitt 2.3.3.1. ("Empowerment bei Georg Theunissen") geschehen ist. Dennoch soll jede dieser vier Ebenen nach und nach abgeklopft werden und anhand des Datenmaterials überprüft werden, welche Ebenen bei den eingetretenen Empowerment-Prozessen zum Tragen kommen.
Diese Ebene zielt auf Empowerment-Prozesse ab, die bereits in Gang gesetzt wurden, indem vorhandene Stärken und Ressourcen bereits erkannt worden sind.
Auf die am Inklusiven Seminar mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache trifft dies vordergründig auf jene Personen zu, die bereits Erfahrung mit Inklusiver Forschung, aber auch mit Selbstvertretung sammeln konnten - kurzum: jene sieben ExpertInnen, die bereits mehrere Semester lang am Inklusiven Seminar mitarbeiteten.
Über Kurt und Sebastian ist zu sagen, dass für diese beiden Herren keine Hinweise im Datenmaterial gefunden werden konnten, die darauf Hinweisen, dass sich ihre individuellen Empowerment-Prozesse in dieser Dimension widerspiegeln.
Weiters zielt diese Ebene vor allem auf das eigenständige Bewältigen von Krisen, Konflikten oder Belastungen im Alltag ab. Dazu konnten viele Belege gefunden werden.
Karl etwa gibt an, dass er während der ersten beiden Seminardurchläufe des Inklusiven Seminars (also im Wintersemester 2007/08 sowie im Sommersemester 2008) sehr wohl Schwierigkeiten damit gehabt hat, seine Rolle als Gruppenleiter vor den StudentInnen durchzusetzen. Dies mache ihm im Zeitraum der Datenerhebung, also im Dritten Seminardurchgang, keine Schwierigkeiten mehr, da er sich in die Rolle eingelebt habe.
Hier ergibt sich zum einen die Problemstellung, dass er einen fachlichen Konflikt mit den beiden Lehrveranstaltungsleitern Mag. Koenig und Mag. Buchner hat, der sich insofern auflöst, als Karl die besseren Argumente findet und sich durchsetzen kann. Er hat also die Erfahrung gemacht, dass es auch in seiner Position möglich ist, mit Personen, die ihm grundsätzlich äußerst wohlwollend gegenüberstehen, einen fachlichen Diskurs auszutragen, bei dem er letztlich Recht bekommt. Karl "traut" sich also, sich durchzusetzen.
Zum anderen findet er sich in seiner Rolle als Leiter eines Forschungsteams zwar gut zurecht, dennoch gibt es auch während des Zeitraumes der Datenerhebung einen Konflikt mit den mit ihm zusammenarbeitenden Studierenden. Dieser wird ausgeräumt, indem Karl aufgrund seiner erworbenen Kompetenzen es schafft, sich als Gruppenleiter durchzusetzen, sodass alle beteiligten Personen letztlich zufrieden mit der Situation sind. Dennoch bleibt bei Karl kurzzeitig ein negativer Beigeschmack zurück, da er sich nur allzu gut an die Zeiten erinnern kann, in denen er nicht ernst genommen wurde. Er erkennt nach wenigen Wochen jedoch, dass dies mit den aktuellen Studierenden seiner Forschungsgruppe nichts zu tun hat und ist somit zur Selbstreflexion fähig.
"Der Krach mit den Studis zu den letzten beiden Terminen dürfte sich gelegt haben. Er ‚war wahrscheinlich doch ziemlich grantig'." (eigenes Forschungstagebuch, 20.1.2009, S. 14)
Die Fähigkeit zur Selbstreflexion kommt auch bei Andrea in besonderer Weise ans Tageslicht: Anfang Dezember 2008 erklärt sie in der Nachbesprechung, dass sie einer massiven Überlastung sehr nahe sei und dass sie deshalb mit den Studierenden nicht so intensiv zusammenarbeiten könnte, wie sie gerne wollte. Bevor sie damit jedoch ans Leitungsteam (Mag. Koenig, Mag. Buchner sowie alle weiteren beteiligten ExpertInnen und die beiden DiplomandInnen) treten konnte, wollte sie dies unbedingt zuerst mit den Studierenden ihres Forschungsteams besprechen, die dies äußerst verständnisvoll aufgenommen haben dürften.
"Ich hatte Probleme mit meinen Studentinnen am Anfang, aber das war nicht deren Schuld, sondern meine, und jetzt komm ich sehr gut klar." (Interview IV, Teil 2 mit Andrea, S. 1, Zeile 28-30)
Andrea hat es also geschafft, ihre Grenzen rechtzeitig zu erkennen und hat ihre Verantwortung als Gruppenleiterin selbstständig wahrgenommen, indem sie zuerst die unmittelbar von ihrer Situation betroffenen Personen informiert hat. Dieses Faktum hat bei den Studierenden nicht nur zu Verständnis, sondern auch zu mehr Respekt Andrea gegenüber geführt (wie mehrfach in den betreffenden Forschungstagebüchern der Studierenden dieser Gruppe angeführt wurde).
Abgesehen davon ist zu sagen, dass die Überforderung, von der Andrea spricht, letztlich insofern als Resultat eines sehr intensiven Empowerment-Prozesses zu werten ist, als Andrea aufgrund massiver Autonomie-Konflikte in ihrer Wohngemeinschaft, auch bedingt durch die Mitarbeit am Inklusiven Seminar, zu jener Zeit damit begonnen hat, sich um eine eigene Wohnung zu kümmern, die nach langem Kampf schließlich auch bezogen werden konnte. Gleichzeitig beendete sie ihre Mitarbeit in einer Behinderten-Werkstätte und organisierte sich ein Praktikum in einer SelbstvertreterInnen-Organisation. Andrea hat sich somit aus dem System der Behindertenhilfe so weit wie möglich aus eigener Kraft und Motivation heraus gelöst, was kurzzeitig zu einer enormen Überbelastung führte.
Weiters ist zu nennen, das auch Rudi sich selbstständig insofern beruflich verändert hat, als er von einer Beschäftigungstherapie an einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt wechseln konnte. Auch er führt dies unter anderem darauf zurück, dass er durch die Mitarbeit am Inklusiven Seminar neue Perspektiven erkennen und ergreifen konnte.
Martina, Thomas und Fritz haben eine Ausbildung an einer pädagogischen Bildungseinrichtung begonnen und arbeiten dort mittlerweile teilweise als Lehrende. Vor allem Fritz hält außerdem immer wieder Vorträge in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Außerdem hat auch Martina ihre Wohnsituation dahingehend verändert, als sie nunmehr nicht mehr in einer vollbetreuten Wohngemeinschaft, sondern in einer eigenen Wohnung lebt.
In dieser Ebene werden vor allem Erfahrungen angesprochen, die als Gruppe gemacht werden, in diesem Fall durch den Zusammenschluss von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien. Inwiefern hier von politischer Macht bzw. Einflussnahme gesprochen werden und inwiefern ein "Abbau von Benachteiligung und Vorurteilen" (Biewer 2009, S. 148) vollzogen werden konnte, wird anhand des vorliegenden Datenmaterials dargestellt.
Gemeinsames Auftreten als Gruppe nach außen fand vor allem bei der gemeinsamen Teilnahme an der Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen im Februar 2009 in Frankfurt am Main statt.
Leider konnten nicht alle am Inklusiven Seminar beteiligten ExpertInnen auch die Tagung besuchen. So ergab sich folgende ExpertInnen-Gruppe, die nach Frankfurt reiste: Johannes, Martina, Thomas, Fritz und Kurt.
Von diesen Personen wurden Reflexionen gemeinsam mit Studierenden des Inklusiven Seminares, die in diesem Rahmen ihr wissenschaftliches Praktikum absolvierten, niedergeschrieben. Dies geschah unter voller Kontrolle der entsprechenden ExpertInnen - die verschriftlichte Version konnte erst mit Zustimmung des Experten oder der Expertin abgegeben werden.
Eine erste politische Stoßrichtung erreicht die - teilweise öffentlich auf der Tagung geführte - Diskussion um die verwendete wissenschaftliche Sprache, die von Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht immer verstanden werden kann. Auf Nachfragen bzw. Verständnisfragen wird teilweise äußerst zuvorkommend, oftmals aber auch widerwillig geantwortet. Dies gilt es aus Sicht der beteiligten ExpertInnen in Zukunft zu verändern.
Kurt bezeichnet es als "diskriminierend", dass er "in den Vorträgen nicht mitkam" (Tagungsreflexion Kurt, 29.3.2009). Als Lösungsversuch schlägt er vor, dass ein und derselbe Vortrag in zweierlei Sprachen gehalten werden solle - einmal als wissenschaftlicher Vortrag und einmal in leichter Sprache. Außerdem sei es für Menschen mit Lernschwierigkeiten viel zu anstrengend, zwei Vorträgen hintereinander ohne Pause zu folgen.
Der Diskussion um wissenschaftliche und leichte Sprache schließt sich auch Thomas an:
"Man müsste versuchen Leichte Sprache in die Tagung einzubauen. Einen Teil wissenschaftlich und eine Teil in Leichter Sprache. Es sollte auch offener für Fragen sein." (Tagungsreflexion Johannes, ohne Datum)
Vor allem Thomas, Johannes, Martina und Fritz forderten in den konkret besuchten Workshops und Vorträgen die Verwendung einer einfachen Sprache immer wieder selbst ein und stellten Nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten. Für diese ExpertInnen war dies jedoch auch bereits die zweite wissenschaftliche Tagung, an der sie teilnahmen. Kurt, der zum ersten Mal eine Tagung besuchte, hatte damit Probleme - er traute es sich noch nicht zu, selbstbewusst für sich aufzutreten.
Thomas diskutiert um Inklusive Forschung und argumentiert folgendermaßen:
"Es wurde Bezug auf die UN-Konvention § 19 genommen, die Forschung sollte im Zuge der UN-Konvention geführt werden und testen und evaluieren inwieweit die Forderungen der UN-Konvention auch umgesetzt werden." (Tagungsreflexion Thomas, 12.3.2009)
Diese Argumentation brachte er auch in den von ihm konkret besuchten Workshops und Vorträgen ein. Immer, wenn ein Forschungsprojekt vorgestellt wurde, trat Thomas auf den Plan und untersuchte es auf Inklusive Aspekte, die er leider oftmals nicht finden konnte und so in Diskussion mit den ZuhörerInnen und ForscherInnen trat. Dabei verwendete er immer wieder die UN-Behindertenrechtskonvention als Argumentationshilfe.
Dieser Umstand wurde im Laufe der Tagung oftmals auch unter den teilnehmenden ForscherInnen und WissenschafterInnen besprochen, von denen manche die Inklusive Forschungsgruppe als störend bzw. als unangebracht empfanden. Aus diesem Grund wurde die Diskussion darum auf Initiative von Mag. Rainer Grubich von der Pädagogischen Hochschule Wien öffentlich gemacht, indem er Fritz, Martina und Thomas zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion am letzten Tagungstag bat.
"Was ich sehr gut fand, ist dass spontan eine Diskussionsrunde zwischen Fritz, Martina und mir bei der Abschlusssitzung am Samstag Vormittag, dem 28.02.09 zustande gekommen ist. Wir hatten die Möglichkeit, uns vor der gesamten wissenschaftlichen Community, die bei der Tagung anwesend war auszutauschen (Idee kam von Rainer Grubich und ist auch von ihm realisiert worden). Bei der Diskussion bzw. danach habe ich mich gut gefühlt. Es war ein tolles und erleichterndes Gefühl diese Möglichkeit zu nutzen. Das Gespräch selbst war auch gut gelungen." (Tagungsreflexion Thomas, 12.3.2009)
Eine Folge des Auftretens von Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache im Rahmen des Inklusiven Seminares an der Universität Wien war, dass die Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen im darauffolgenden Jahr anders angelegt und durchgeführt wurde: Der Vorschlag, Vorträge und Workshops in wissenschaftlicher wie in leichter Sprache anzubieten wurde vollständig umgesetzt. Zudem wurden Menschen mit Lernschwierigkeiten explizit zur Teilnahme an dieser Tagung eingeladen. Und auch Thomas' Vorschlag zur Betrachtung von Forschung im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention fand Anklang, denn selbige bildete das Thema dieser Tagung. Durch den Veranstaltungsort Innsbruck und die OrganisatorInnen Petra Flieger und Volker Schönwiese fanden sich Personen, die Inklusive Aspekte in ihrer täglichen wissenschaftlichen Arbeit umsetzen - dies spiegelte sich auch in der Organisation der Tagung wider.
Abgesehen davon hielten einige der genannten ExpertInnen gemeinsam mit Mag. Koenig und Mag Buchner sowie SelbstvertreterInnen aus Innsbruck, die alle gemeinsam in einem anderen Rahmen zusammenarbeitetet, den Eröffnungsvortrag auf eben jener Tagung. Sie konnten somit an sehr prominenter Stelle auftreten und sich für ihre Belange auch auf einer akademischen Fachtagung einsetzen.
Weiters trat das gesamte ExpertInnen-Team des Inklusiven Seminares im Zuge der Präsentationen der Forschungsergebnisse der einzelnen Gurppen öffentlich auf. Dabei wurden in einem barrierefreien Lokal während des laufenden Betriebes das Inklusive Seminar wie auch die gewonnenen Ergebnisse aus den Forschungsgruppen dargestellt.
Das Auftreten vor einer breiten Öffentlichkeit wie auch vor JournalistInnen stellte ein bedeutendes Moment für alle beteiligten Personen dar, es ergaben sich jedoch dabei keine Hinweise auf politisch ausgerichtetes Empowerment. Doch allein die Tatsache, öffentlich für die eigenen Interessen einzutreten und selbstbewusst zu zeigen, was man geleistet hat, kann sehr wohl als solches gewertet werden. Außerdem wurde dabei auch das Ziel verfolgt, Inklusive Forschung sowie die Ergebnisse aus den Forschungsgruppen für Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu machen und so auch außerhalb der ExpertInnengruppe zu zeigen, dass durch Inklusive Forschung Veränderungen bei selbst betroffenen Personen herbeigeführt werden können.
Treten wir nun über zur dritten Ebene nach Georg Theunissen, dem "Empowerment im reflexiven Sinne".
Empowerment im reflexiven Sinne meint die Bewusstwerdung der eigenen Stärken und Kompetenzen, um diese in weiterer Folge einsetzen und verteidigen zu können. Dies geschieht aus eigener Kraft.
Aus dieser Sicht scheint es besonders spannend, die beiden "Frischlinge" Sebastian und Kurt in den Blick zu nehmen, da sie weder Erfahrungen mit Selbstvertretungsgruppen noch mit Inklusiver Forschung vor Beginn des Seminares mitbrachten.
Was Kurt betrifft, so wurde bereits angesprochen, dass er vor Beginn des Seminares davon ausging, dass sich niemand für ihn interessieren würde. Dasselbe gelte auch für sein Forschungsthema "Erfahrungen von IntegrationsschülerInnen". Dann jedoch meldeten sich vier Studentinnen für seine Gruppe, was ihn mehr als überraschte:
"Jo, i, irgendwos unterm Tisch hot gsogt, die kinnan si a jo interessieren fia mei Thema oder a net, also, auf amoi woan, stengan olle viere vor mir." (Interview II mit Kurt, Seite 7, Zeilen 30-31)
Leider sind zwei dieser Studentinnen wieder abgesprungen, was ihn sehr belastet. Kurt denkt, dass die beiden weder mit ihm als Person noch an seiner Themenwahl arbeiten möchten, er tut sich schwer damit, zu akzeptieren, dass hier auch andere Gründe zum Ausstieg aus dem Seminar vorliegen könnten. Dies beschäftigt ihn bis zum Ende des Seminares, also zwei Semester lang.
Mit den beiden übrig gebliebenen Studentinnen gibt es insofern Probleme, als Kurt darauf besteht, auch im Burgenland Interviews mit IntegrationsschülerInnen zu führen, da er den ländlichen mit dem städtischen Bereich vergleichen möchte. Zu diesem Zweck hat er auch selbstständig Kontakte zu Schulen und SchülerInnen hergestellt - und zwar unmittelbar nach Seminarbeginn im Oktober 2008. Den Studierenden ist das jedoch zuviel Aufwand. Kurt reagiert, indem er meint, er müsse "stur bleiben" (eigenes Forschungstagebuch, 28.10.2008, S. 4), vor allem auch deshalb, weil er die Tendenz erkennt, dass sie sein ursprüngliches Forschungsthema zu sehr abändern wollen.
Hier sind zwei unterschiedliche Formen des reflexiven Empowerments erkennbar:
Zum einen hat Kurt selbstständig und ohne Anleitung von außen Interviewpersonen gefunden, und zwar zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht notwendig war. Er hat somit nicht nur sein Forschungsthema fixiert und abgesichert, sondern auch positives Feedback bekommen, indem er eigenständig Einsatz zeigte und dieser auch von Erfolg gekrönt war.
Andererseits hat er die Erfahrung gemacht, dass er seine neu gewonnene Rolle als Gruppenleiter gleich zu Beginn verteidigen musste. Auch dazu wurde ihm nur bedingt geraten, denn die Diskussion um eine Abänderung des Forschungsthemas und den Stadt-Land-Vergleich geschahen vordergründig in Gruppentreffen außerhalb des Seminares. Kurt hat sich schließlich insofern durchgesetzt, als er um Unterstützung beim Leitungsteam der Lehrveranstaltung bat: Durch Organisation eines Autos sollte es den Studierenden wie auch Kurt erleichtert werden, die gewonnenen InterviewpartnerInnen im Burgenland zu besuchen.
Weiters fordert Kurt immer wieder eigenständig Unterstützung seitens der beiden DiplomandInnen wie auch von Mag. Buchner und Mag. Koenig ein. Diese sollten sich abwechselnd im Seminar zu seiner Gruppe setzen und sich ebenso alleine mit ihm Treffen, da er zu viele Informationen zu verarbeiten habe, die er nicht verstehen könne. Dieser Forderung wurde nachgekommen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Unterstützung von Kurt, sondern auch für Sebastian als zweiten "Neueinsteiger".
So konnte Kurt nicht nur erkennen, dass er in seinen Wünschen, Bedürfnissen und Forderungen ernst genommen wird, sondern auch, dass er mit konstruktiver Kritik aktiv zur Konzeption der Lehrveranstaltung beitragen kann.
Sowohl Kurt als auch Sebastian sind zu Beginn des Seminares äußerst nervös, wenn es darum geht, öffentlich vor allen Studierenden zu sprechen (zum Beispiel beim Vorstellen des eigenen Forschungsthemas wie auch bei Präsentationen der Forschungsgruppen zu ihren Zwischenergebnissen wie Literaturrecherche und Fragestellung). Nachdem sich beide jedoch als ausgesprochen gute Redner herausstellen, gewinnen sie auch hier massiv an Sicherheit und somit auch Selbstbewusstsein, sodass gegen Ende der Lehrveranstaltung dies überhaupt kein Problem mehr darstellt.
Sebastian setzt sich sowohl innerhalb des Seminares als auch in den darauf folgenden Nachbesprechungen sehr dafür ein, dass nicht nur negative, sondern auch positive Kritik geübt wird. Negative Kritik könne man auch wertschätzend, also "mit Respekt" (eigenes Forschungstagebuch, 11.11.2008, S. 5), ausdrücken. Dabei setzt er sich auch gegen die Gruppe der übrigen ExpertInnen in eigener Sache durch, denen er ansonsten zu Beginn eher ängstlich gegenübertritt. Er selbst bringt im Rahmen des Seminares öffentlich ein Beispiel dafür, indem er die Studierenden seiner Forschungsgruppe lautstark lobt:
"I glaub eis werds guide Menschen wenn's fertig seids." (eigenes Forschunsgtagebuch, 18.11.2008, S. 6)
Nach der bereits besprochenen psychischen Krise von Sebastian wurde überlegt, diesem einen zweiten Experten oder eine zweite Expertin in der Gruppe zur Seite zu stellen, um ihm den Druck ein wenig nehmen zu können. Dies wehrte er vehement ab. Stattdessen lobte er die Studierenden in seiner Forschungsgruppe als äußerst hilfreich und betonte, dass er gelernt hätte, nunmehr rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn er das Gefühl hat, überfordert zu sein. Das Zurückkommen ins Seminar war für ihn äußerst wichtig. Es ist erkennbar, dass Sebastian im Inklusiven Seminar etwas erlebt, das er außerhalb nicht finden kann und er selbst nach einer massiven psychischen Krise, die mitunter auch mit der Mitarbeit an der Lehrveranstaltung zusammenhängt, nicht darauf verzichten möchte. Auf diese Situation wurden die Studierenden seiner Gruppe angesprochen. Ihr Statement dazu lautete:
"Er zeigt sehr genau, was ihm wichtig ist. Allerdings stellt er sein eigenes Licht ein wenig unter den Scheffel." (Eigenes Forschungstagebuch, 26.1.2009, S. 16)
Demnach kann Sebastian seine eigenen Vorstellungen und Wünsche artikulieren und bekommt dafür Wertschätzung und Respekt als Rückmeldung, auch wenn er selbst noch nicht ganz in der Lage ist, zu seinen eigenen Stärken und Begabungen zu stehen. Die Studierenden seiner Gruppe sehen das als Grund dafür an, dass Sebastian nach der psychischen Krise wieder ins Seminar zurückgekehrt ist und auch jedwede Unterstützung durch weitere ExpertInnen in seiner Gruppe verweigert.
Es ist also klar erkennbar, dass sich bei Sebastian und Kurt, die erstmalig mit Inklusiver Forschung im Zeitraum der Datenerhebung konfrontiert waren, Empowerment-Prozesse entwickelt haben. Diese können die beiden allerdings nicht eigenständig benennen. Einerseits liegt das daran, dass das Konzept "Empowerment" einmal mehr einen Fachausdruck darstellt, den zu verstehen und zu verwenden den beiden schwer fällt. Zum Anderen sind die stattfindenden Empowerment-Prozesse im Zuge des Inklusiven Seminares erst in den Anfängen, weswegen Kurt und Sebastian ihre Stärken und Begabungen zwar erkannten, das Selbstbewusstsein jedoch noch nicht soweit entwickeln konnten, dazu auch öffentlich zu stehen. Beide hofften eher, dass dies von außen erkannt wird und erwarteten Lob von den Studierenden sowie dem Leitungsteam der Lehrveranstaltung.
Dies leitet unmittelbar über zur vierten und letzten Ebene bei Georg Theunissen, dem "Empowerment im transitiven Sinne".
Diese Ebene deckt sich teilweise mit den zuvor ausgeführten unterschiedlichen Ebenen von Empowerment.
Empowerment im transitiven Sinne meint das Anstoßen und Anregen von Empowerment-Prozessen von außen, ohne diese zu erzwingen. Hier werden vor allem ProfessionalistInnen angesprochen, die Menschen mit Lernschwierigkeiten dabei unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen, ohne ihnen Empowerment-Prozesse aufzudrängen.
Aus dieser Sicht kann die gesamte Konzeption des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" als Empowerment im transitiven Sinne betrachtet werden, wenngleich dies außerhalb der klassischen "professionellen" Zugänge zu Menschen mit Behinderungen - wie etwa bei Einrichtungen der Behindertenhilfe - angesiedelt ist.
"Wie auch unsere eigenen Erfahrungen des Einbezugs von Menschen mit einer intellektuellen Behinderung an der Universität Wien in inklusive Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte gezeigt haben, bringt die Öffnung bislang verschlossener Systeme und Wissensbestände gänzlich neue Möglichkeiten für selbst initiiertes Empowerment von Menschen mit (intellektueller) Behinderung - jenseits rein transitiver (sonder-)pädagogischen Bemühungen - mit sich." (Koenig und Buchner 2011/2, S. 270)
Das Inklusive Seminar wurde nicht mit dem vordergründigen Ziel angeboten, Empowerment-Prozesse von Menschen mit Lernschwierigkeiten anzustoßen. Dennoch trägt ein Setting in dieser Form wesentlich dazu bei, denn allein die Tatsache, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache angesehen werden, bedingt ein Überdenken der eigenen Rolle von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Die Mitarbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Inklusiven Seminar eröffnete den teilnehmenden ExpertInnen völlig neue Perspektiven (wie zum Beispiel berufliche und private Veränderungen, die aus den in Gang gesetzten Empowerment-Prozessen resultierten). Diese Veränderungen haben die beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten jedoch selbst in Angriff genommen und umgesetzt und wurden nicht von Mag. Buchner und Mag. Koenig initiiert. So wurden einige ExpertInnen etwa bei öffentlichen Vorträgen (wie auf der Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen oder den öffentlichen Abschlusspräsentationen der Forschungsprojekte) von außenstehenden Personen angesprochen und um weitere Vorträge und Mitarbeit an anderen Projekten gebeten. Auch die Ausbildung von Martina, Thomas und Fritz an einer pädagogischen Bildungseinrichtung ergab sich auf diesem Wege.
Aber auch kleinere Schritte, die im Sinne des Empowerment-Konzeptes gemacht wurden, lassen sich auf die Konzeption des Inklusiven Seminares zurückführen. Als Beispiel seien hier Kurt und Sebastian genannt, die ihre Stärken und Ressourcen erkennen konnten, wenngleich es ihnen schwer gefallen ist, dazu auch zu stehen.
So gesehen können derartige Prozesse "auch als Ausdrucksformen eines reflexiven Empowerment angesehen werden, wodurch der Zugang zu Wissen in der Lage ist, Grenzen zu verschieben und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern" (Koenig und Buchner 2011/2, S. 270).
Auch auf die Studierenden sei hingewiesen, denn auch ihre Sicht der Dinge in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten hat sich durch die Teilnahme am Inklusiven Seminar verändert. Wenn man bedenkt, dass viele von ihnen in Zukunft und Gegenwart in Einrichtungen der Behindertenhilfe tätig sein werden und sind, so kann das Inklusive Seminar an der Universität Wien auch als Projekt angesehen werden, das nicht nur bei den unmittelbar beteiligten ExpertInnen in eigener Sache Empowerment-Prozesse auslösen kann, sondern auch bei Menschen mit Lernschwierigkeiten außerhalb des universitären Rahmens, sofern bei den Studierenden tatsächlich ein Umdenken stattgefunden hat. Auch dies könnte als Empowerment im transitiven Sinne betrachtet werden.
Es soll nun übergegangen werden auf die Ebenen, die Dorothy Atkinson zu Empowerment aufstellt, da sich hier eine anders geartete Gewichtung finden lässt.
Atkinson betrachtet Empowerment-Prozesse in Zusammenhang mit dem Erzählen der eigenen Lebensgeschichte.
Im Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" sind die Lebensgeschichten der ExpertInnen in eigener Sache nicht im Fokus der Mitarbeit. Dennoch kann die Teilnahme am Seminar wie auch die konkrete Umsetzung von Inklusiven Forschungsprojekten nicht losgelöst von den Lebensgeschichten der betreffenden Personen betrachtet werden. Allein die Auswahl des Forschungsthemas steht eng in Zusammenhang mit der eigenen Lebensgeschichte, da (negative) Erfahrungen in den entsprechenden Gebieten gemacht wurden.
In einer derartig engen Zusammenarbeit lässt es sich nicht vermeiden, dass Informationen, die über die konkrete Bearbeitung eines Forschungsthemas hinausgehen, preisgegeben werden. Private Erzählungen können nur schwer außen vor gelassen werden.
Abgesehen davon können konkrete Situationen im Zuge des Forschungsprojektes Prozesse auslösen, die sehr eng mit der eigenen Lebensgeschichte in Verbindung stehen. Als Beispiel hierfür sei Sebastian's psychische Krise genannt.
Es folgt nun das Eintauchen in die Empowerment-Ebenen, die Dorothy Atkinson (2004) benennt. Bei diesen Abschnitten werde ich mich darauf konzentrieren, Empowerment-Prozesse vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte der betreffenden Personen auszuarbeiten Dies soll Wiederholungen vermeiden und den ursprünglich erfassten Sinn bei Atkinson (2004) wahren. Den Beginn macht dabei die Ebene des Individuellen Empowerments.
In dieser Ebene wird der Sinn des eigenen Lebens und Schaffens reflektiert. Dies hat das Ziel, dem eigenen Leben Bedeutung zu verleihen. Ausgegangen wird hier von einer individuellen Perspektive.
In Bezug auf die Bereitschaft, Informationen aus dem eigenen Leben preiszugeben, liegen beim vorhandenen Datenmaterial vollkommen unterschiedliche Mechanismen und Zugänge vor.
Sebastian erzählt über weite Strecken bei den durchgeführten Interviews aus seinem Privatleben. Oftmals ist es eher schwierig, ihn zur eigentlichen Frage zurück zu führen. Sofern mehrere Personen anwesend sind, also in den Seminareinheiten wie auch den Nachbesprechungen, gibt er sich diesbezüglich eher schüchtern und zurückhaltend. In den Treffen mit seiner Forschungsgruppe außerhalb des Seminarrahmens dürfte er - nach Angaben der Studierenden in dieser Gruppe - jedoch auch eher viel aus seinem Leben erzählen.
Kurt wiederum legt großen Wert auf die Wahrung seiner Privatsphäre. Ihm ist es äußerst wichtig, dass nicht allzu viele Informationen an sämtliche AkteurInnen im Inklusiven Seminar gelangen. Er möchte außerhalb des Seminares auch keinerlei Kontakt zu den betreffenden Personen, sofern dieser nicht inhaltlich mit dem Inklusiven Seminar in Zusammenhang steht.
Kommt man mit ihm jedoch in einer Zweiersituation in Kontakt, erzählt er sehr gerne aus seinem Leben, sowohl seine Kindheit und Jugend wie auch aktuelle Situationen betreffend. Er möchte jedoch nicht, dass dieses Material irgendjemandem zur Verfügung gestellt wird und auch nicht, dass man irgendetwas davon weitererzählt. Anonymität ist ihm äußerst wichtig.
Bei Rudi, Johannes, Andrea, Martina, Thomas, Fritz und Karl stellt sich die Situation etwas anders dar. Sie erzählen mir immer wieder punktuell, was sie gerade beschäftigt, und beziehen sich dabei auch oftmals auf Geschehnisse aus ihrer Vergangenheit. Dennoch ist eine konkretere Kenntnis ihrer Lebensgeschichten Mag. Koenig und Mag. Buchner vorbehalten, die sie allesamt schon aus der Zeit vor dem Inklusiven Seminar kennen und hier eine völlig anders geartete Vertrauensbasis vorhanden ist.
Nun soll jedoch versucht werden, zu erfassen, inwiefern sich individuelles Empowerment auf die Mitarbeit am Inklusiven Seminar an der Universität Wien zurückführen lässt. Dazu werden private Veränderungen außerhalb des universitären Rahmens herangezogen, die sich im Zeitraum der Datenerhebung ergeben haben. Teilweise wurden diese Veränderungen bereits in Abschnitt 15.1.1. (Ebene 1: Empowerment als Selbstverfügungskräfte) dargestellt. Ob und wie diese Veränderungen mit der Mitarbeit am Inklusiven Seminar in Zusammenhang gebracht werden können, bleibt offen, da keinerlei Informationen dazu außerhalb des universitären Rahmens - also zum Beispiel durch Befragung von BetreuerInnen, FreundInnen und Verwandten der beteiligten ExpertInnen - gesammelt wurden. Ausschließlich die Aussagen der am Seminar mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache dienen als Grundlage für die folgenden Ausführungen.
Rudi bekam im Zeitraum der Datenerhebung einen neuen Job am ersten Arbeitsmarkt, den er sich selbst organisiert hatte. Er konnte es nicht länger ertragen, in einer Werkstätte oder Beschäftigungstherapie zu arbeiten, weshalb er auf die Möglichkeit der Arbeitsassistenz zurückgriff. Dies ist nicht ohne massive Anstrengung und grobe Enttäuschungen erfolgt, hat letztlich jedoch zu seiner Zufriedenheit geklappt.
Johannes gibt aus seinem privaten Leben keine Informationen preis - abgesehen von der Tatsache, dass er eine neue Partnerin gefunden hat.
Andrea hatte teilweise mit einer massiven Überforderung - auch im Rahmen des Seminares - zu kämpfen, da sie im Zeitraum der Datenerhebung quasi ihr Leben völlig umstrukturierte. Sie erwirkte den Auszug aus ihrer Wohngemeinschaft und zog in eine eigene Wohnung, die rund um die Uhr betreut wird. Dies wurde nur mit großem Einsatz und viel Diskussionsvermögen möglich. Außerdem kündigte auch sie ihre Beschäftigung in einer Werkstätte der Behindertenhilfe und organisierte sich ein Praktikum in einer Selbstvertretungsorganisation, in der sie letztlich auch angestellt wurde.
Auch Martina zog aus ihrer Wohngemeinschaft aus und in eine eigene, ambulant betreute Wohnung ein. Eine berufliche Veränderung ergab sich insofern, als Martina eine Ausbildung an einer pädagogischen Bildungseinrichtung begann, ebenso wie Thomas und Fritz.
Thomas wohnt nach wie vor in einer Wohngemeinschaft, wenngleich sich berufliche Veränderungen nicht nur durch die neu begonnene Ausbildung, sondern auch durch das Halten von Vorträgen und die Mitarbeit an Ausschüssen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Lernschwierigkeiten ergeben haben. Thomas konnte durch das Knüpfen von Kontakten, bedingt durch die Mitarbeit am Inklusiven Seminar, seine beruflichen Perspektiven verändern.
Ähnliches gilt für Fritz. Auch er hält viele Vorträge und bringt sich ebenso wie Thomas immer wieder bei Ausschüssen ein. Seine Wohnsituation hat sich oftmals verändert. Er lebte zwar immer in einer eigenen Wohnung und wurde dort ambulant betreut, wechselte jedoch oftmals die ihn betreuenden Vereine, was auch mit häufigen Umzügen verbunden war. Dies ist mitunter darauf zurückzuführen, dass Fritz seine Rechte sehr genau kennt und die Einforderung derer auch umsetzen kann, was einerseits zu großer Unzufriedenheit seitens Fritz beiträgt und ihm andererseits laut eigenen Angaben den Ruf eines "schwierigen Klienten" einbringt.
Karl hat leider nichts aus seinem Privatleben bekannt gegeben, weswegen Veränderungen in diesem Bereich hier nicht angeführt werden können.
Kurt und Sebastian, die beiden neu mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache am Inklusiven Seminar, berichten nichts in Bezug auf berufliche oder private Veränderungen von unmittelbar sichtbarem Ausmaß. Dennoch hat sich laut eigenen Angaben ihr Leben dahingehend verändert, als sie nunmehr in der Lage sind, genauer auf das zu achten, was sie können und wollen. Diese Tatsache führte immer wieder zu Konfliktsituationen mit BetreuerInnen und SachwalterInnen, jedoch nie in grobem Ausmaß. Beide schienen zum Ende der Datenerhebung mit ihrer Lebenssituation zufrieden, vor allem auch, weil sie merkten, dass die eingetretenen Veränderungen bei ihren BetreuerInnen und AssistentInnen im Allgemeinen gut angenommen wurden.
Es ist also festzuhalten, dass auf einer individuellen Ebene viele Veränderungen beobachtet und dokumentiert werden konnten, sofern die entsprechenden Menschen mit Lernschwierigkeiten die Dokumentation dessen zuließen. Dabei kann behauptet werden, dass sich umso tiefer gehende Veränderungen ergeben, je länger die betreffenden Personen als ExpertInnen in eigener Sache am Inklusiven Seminar mitarbeiteten.
Erzählungen aus dem Privatleben der ExpertInnen hängen einerseits ab von der Art des Vertrauensverhältnisses, das sich aufgebaut hat. So wird von denjenigen Personen am ehesten aus dem Privatleben berichtet, zu denen man den meisten Kontakt pflegt. Andererseits wiederum ist das Verweigern von Auskünften aus dem privaten Bereich, sofern dies geschehen ist, eindeutig als Erkennen der eigenen Rechte und Möglichkeiten und damit als eine Form von Empowerment anzusehen.
Es folgt nur die Ausarbeitung der Empowerment-Prozesse innerhalb der zweiten von Atkinson (2004) genannten Ebene, dem Kollektiven Empowerment.
Hier wird Empowerment auf einem sozialen Level angesprochen, und zwar durch das Erkennen von sozialer und politischer Unterdrückung von Menschen mit Lernschwierigkeiten selbst wie auch als Gruppe.
Vorab sei hier kurz angeführt, dass Inklusive Forschung sich als einen möglichen Zugang sieht, Menschen mit Lernschwierigkeiten im Sinne einer Einleitung von Empowerment-Prozessen von Nutzen zu sein, und zwar auf einem individuellen wie auch einem kollektiven Level:
Die Prinzipien Inklusiver Forschung "machen auf die Bedeutung von Forschung aufmerksam, welche für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung von Nutzen ist. Sie unterstreichen die Bedeutung von sozialer Veränderung und der Beseitigung von Barrieren, die der vollen Teilhabe im Weg stehen, und vergrößern dadurch das kollektive Bewusstsein von Menschen mit intellektueller Behinderung über die Art und Weise, wie Behinderungen sozial produziert sind." (Koenig und Buchner 2011/2, S. 275)
Das Auftreten der am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" beteiligten ExpertInnen in eigener Sache als Gruppe wurde bereits in Abschnitt 15.1.2. (Ebene 2: Empowerment als politisch ausgerichtete Kraft) erläutert. Eine Wiederholung soll hier vermieden werden. In Bezug auf die Lebensgeschichten der beteiligten Personen tritt jedoch Neues zum Vorschein:
Alle neun am Inklusiven Seminar beteiligten ExpertInnen in eigener Sache standen zwangsläufig durch die Teilnahme an den wöchentlichen Seminareinheiten und den darauf folgenden Nachbesprechungen in engem Kontakt miteinander. Hier wurde nicht nur über die Inhalte sowie den Status Quo der durchzuführenden Forschungsprojekte gesprochen, sondern auch über konkrete private Problemstellungen oder Befindlichkeiten - zumeist in Zusammenhang mit der eigenen Behinderungserfahrung.
Dabei ist zu bemerken, dass wesentliche Hilfestellungen bei privaten Problemlagen vordergründig seitens der teilnehmenden ExpertInnen selbst kamen, denn zumeist hatte irgendein Mitglied der Gruppe bereits früher ähnliche Erfahrungen zu einem Thema gemacht, zu dem eine Lösungsstrategie entwickelt worden ist. Als Themenbereiche genannt seien hier zum Beispiel Erfahrungen mit Sachwalterschaft, Probleme in der konkreten Betreuungssituation sowohl im Wohn- als auch im Arbeitsbereich, Diskriminierungen aufgrund einer öffentlich sichtbaren oder unsichtbaren Beeinträchtigung, Barrieren in baulicher wie in sprachlicher Hinsicht oder aber Selbstzweifel aufgrund von unterschiedlichsten negativen Erfahrungen, die gemacht worden sind.
Zu Beginn des Inklusiven Seminares fällt es Sebastian bereits auf, dass er von den anderen ExpertInnen gute Hilfestellungen im privaten Bereich bekommen kann. Hier traut er sich jedoch noch nicht so recht, dies auch in Anspruch zu nehmen:
"Des san a nur Menschen (lacht). Eigentlich kinnt i's scho frogn, eigentlich wenn i a Problem hob kinnt i's eigentlich frogn, owa i bin schüchtern, i trau mi maunchmoi Leit die wos fremd san net so frogn, weil wenn i a Problem hob oder so hob i (überlegt kurz) wos sie davon hoidn (=halten), des trau i mi net frogn." (Interview III mit Sebastian, Seite 2, Zeilen 9-12)
Die Schüchternheit kann Sebastian sehr bald ablegen. Er bittet nicht nur um Ratschläge bei den anderen ExpertInnen, sondern steht auch selbst zur Verfügung, wenn Unterstützung gebraucht wird. Außerdem versorgt er die gesamte Nachbesprechungsrunde (also Mag. Koenig und Mag. Buchner, die beiden DiplomandInnen sowie alle ExpertInnen in eigener Sache) regelmäßig mit Nahrungsmitteln aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, in dem er arbeitet. So gewinnt er selbst an Sicherheit als Gruppenmitglied und hat eine zusätzliche Möglichkeit gefunden, einen Beitrag zum Wohlergehen der Gruppe zu leisten, was dankbar angenommen wird.
Einen anderen Zugang zum Thema kollektives Empowerment bildet das Faktum, dass Inklusive Forschung konkret an der Lebenswelt von Menschen mit Lernschwierigkeiten ansetzen soll. Dies betrifft nicht nur die Lebenswelt von denjenigen Personen, die an Inklusiven Forschungsprojekten mitarbeiten, sondern hat den allgemeinen Anspruch, die Lebenswelt von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verbessern.
Andrea bringt immer wieder den Grundsatz einiger Selbstvertretungsorganisationen ein, den sie auch selbst vertritt:
"Ich habe einen Vorsatz, und der heißt Nichts ohne uns über uns, und den versuch ich in der Forschung und nein, den, und den leb ich seit, und den Vorsatz leb ich aus in, in jeder Sicht, Sichtweise." (Interview IV, Teil 2 mit Andrea, S. 4, Zeilen 10-12)
"Nichts über uns ohne uns" beschreibt einen Zugang, der allgemeine Gültigkeit besitzt. Hier ist nicht eine einzelne Person, sondern die Gesamtheit einer Gruppe gemeint - in diesem Fall Menschen mit Lernschwierigkeiten. Andrea weitet diesen Zugang auf ihr gesamtes Leben, auch abseits Inklusiver Forschung, aus. Daraus ließe sich ableiten, dass Andrea ganz allgemein das Ziel verfolgt, sich nicht nur für ihre Rechte, sondern für diejenigen von allen Menschen mit Lernschwierigkeiten einzusetzen. Dazu bietet - laut Andrea - Inklusive Forschung die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zu leisten.
Somit hat Inklusive Forschung implizit den Anspruch, Empowerment-Prozesse in Gang zu setzen. Dieser Anspruch betrifft jedoch nicht nur die konkret mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache, sondern lässt sich auf die Gesamtheit aller oder zumindest möglichst vieler Menschen mit Lernschwierigkeiten generalisieren.
Das öffentliche Präsentieren der gewonnenen Ergebnisse aus den einzelnen Forschungsgruppen soll dazu einen Beitrag leisten, denn hier wurde in leicht verständlicher Sprache einem breiten Publikum näher gebracht, was im Inklusiven Seminar erarbeitet wurde. Zu diesen Präsentationen wurden neben JournalistInnen und VertreterInnen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten eingeladen, denen die Ergebnisse in leicht verständlicher Sprache vorgetragen wurden. Im Anschluss an jede Präsentation einer Forschungsgruppe wurde zum Nachfragen angeregt, was vor allem diejenigen BesucherInnen in Anspruch nahmen, die sich selbst zur Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten zählten. Hier wurde nicht nur das Interesse an den konkreten Forschungsergebnissen geweckt, sondern auch an Inklusiver Forschung allgemein entfacht. Zudem tauschten sich viele Personen über ihre konkreten privaten Problemlagen aus und es wurde versucht, Hilfestellungen dahingehend seitens der mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache anzubieten. Man könnte behaupten, dass die Anwesenheit von Studierenden sowie den Lehrveranstaltungsleitern und DiplomandInnen bei den Abschlusspräsentationen beinahe überflüssig war.
Es ist schwierig, die Ebene des kollektiven Empowerments nur in Bezug auf die Gruppe der am Inklusiven Seminar mitarbeitenden ExpertInnen in eigener Sache nachzuvollziehen. Dies liegt vordergründig an der Tatsache, dass die Gruppe als solche bereits vor Beginn der Datenerhebung bestanden hat und nur zwei Personen neu hinzukamen. Somit lässt sich im Nachhinein also nicht feststellen, inwiefern sich das Konzept des kollektiven Empowerments auf die teilnehmenden Personen zu Beginn der Gruppenfindungsphase übertragen lässt.
Andrea wagt den Versuch, sich zu erinnern, was damals passiert ist, und bringt sich selbst als Beispiel dafür:
"Und dann war eine Besprechung, hab ich, hat mir Oliver uns, uns gesagt er wird, er wird ein Seminar machen mit, auf der Uni, wo, wo, wo die, wo ich halt als Expertin eine Gruppe anleiten soll und das, und das einfach zu hören war der, war das absolute Highlight, weil ich hab auch eine Schwester und da, da hab ich mir gedacht, ich hab was, ich hab da was zum sagen, ich bin auf der Uni, ich geh, ich leiste einen Teil und auch meine Umgebung hat mich anders gesehen, ich glaub, ja, anders gesehen, ich, ich, ich war, ich war in einer BT, das ist eine Beschäftigungstherapie, und plötzlich hab ich von, von jedem Lob bekommen, wie gut ich bin, was ich leiste, und das Lob ist, war mir unangenehm, aber auch irgendwie angenehm, ich weiß auch nicht, wie ich mich gefühlt hab." (Interview IV, Teil 1 mit Andrea, S. 4, Zeilen 22-31)
Andrea hat bei der zuvor gestellten Frage versucht, sich zu erinnern, wie es damals der gesamten Gruppe ergangen ist, als alles noch neu war. Sie wollte zunächst eine generelle Euphorie innerhalb der ExpertInnengruppe beschreiben, meinte dann jedoch, dass es besser wäre, nicht für alle zu sprechen, sondern ihr eigenes Empfinden als Beispiel zu bringen. Dennoch ist es leicht vorstellbar, dass sich die lebhafte und freudvolle Erzählung Andreas mehr als zwei Jahre nach der konkreten Situation auch auf andere ExpertInnen in eigener Sache aus dieser Gruppe übertragen lässt. Hier bleibt jedoch eine bloße Vermutung stehen.
Nun folgt der Übertritt in die dritte und letzte Ebene bei Dorothy Atkinson (2004), dem Praktizierten Empowerment.
Diese Ebene spricht ProfessionalistInnen an, die in Beziehung zu Menschen mit Lernschwierigkeiten stehen und somit die Möglichkeit haben, Empowerment-Prozesse bei diesen Personen durch das Erfassen der jeweiligen Lebensgeschichte in Gang zu setzen, ohne sie ihnen aufzuzwingen.
An dieser Stelle kann eine konkrete Aussage diesbezüglich nicht gemacht werden, da die Erfassung einer Lebensgeschichte nicht Ziel und Inhalt des Inklusiven Seminares darstellte. Anstelle dessen soll erläutert werden, ob und wie sich der Zugang von Studierenden in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten als TeamleiterInnen verändert hat. Dazu werden vordergründig die Forschungstagebücher der am Inklusiven Seminar teilnehmenden Studierenden auf den Aspekt der Selbstreflexion hin untersucht.
Es handelt sich hierbei also um eine Art "umgekehrtes Empowerment", indem Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache in der Lage sind, das Bild von Studierenden und somit potentiellen MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu verändern.
Zunächst lässt sich festhalten, dass viele der teilnehmenden Studierenden zu Beginn von Voraussetzungen ausgingen, die einzuhalten nicht möglich war. So wird zum Beispiel mehrfach kritisiert, dass es unmöglich sei, mit ExpertInnen in eigener Sache Termine per E-Mail auszumachen oder generell über diesen Weg Informationen auszutauschen. Recht schnell wurde jedoch auf andere Möglichkeiten zurückgegriffen, da eingesehen wurde, dass dies nicht von Menschen mit Lernschwierigkeiten uneingeschränkt verlangt werden kann. Der private Zugang zu Internet obliegt einer Genehmigung der entsprechenden SachwalterInnen und BetreuerInnen und ist somit mit Barrieren verbunden, die die Studierenden rasch erkennen konnten.
Auf diesen sehr alltagsbezogenenen Ebenen konnte bei den Studierenden eine Einsicht in die Lebenswelt von Menschen mit Lernschwierigkeiten erwirkt werden, was zur Folge hatte, dass die Studierenden sich besser in diese einfühlen konnten. Sie entwickelten ein Gefühl dafür, welche Hürden und Hindernisse sich ergeben, wenn man in einem dauerhaften Abhängigkeitsverhältnis (zum Beispiel zu BetreuerInnen, AssistentInnen, SachwalterInnen und Familienangehörigen) lebt. Teilweise reagierten die Studierenden darauf beinahe geschockt.
Die Problematik der Rollenumkehr seitens der Studierenden wurde bereits in Abschnitt 14.3. (Dimension 3: Erfahrungen des tatsächlichen Ausfüllens dieser Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der praktischen Umsetzung in den Inklusiven Forschungsgruppen) eingehend ausgearbeitet. Dennoch sei an dieser Stelle abermals darauf hingewiesen, dass es für die beteiligten ExpertInnen nicht immer leicht war, ihre Rolle als Teamleiterin durchzusetzen.
Als Beispiel hierfür sei Studentin 5 genannt, die zu Beginn des Inklusiven Seminars eindeutig als "Betreuerin einer Behinderteneinrichtung" bezeichnet werden könnte, die es anfangs nicht schafft, zu akzeptieren, dass es sich beim Inklusiven Seminar nicht um eine konkrete Betreuungssituation handelt. Sie kritisiert etwa, dass während des Seminares Kekse und Limonade zur freien Entnahme bereitstehen und argumentiert, dass dies nicht einer gesunden Ernährung entspräche.
Ihre eigene Rolle innerhalb des Inklusiven Seminares definiert sie gleich zu Beginn der Lehrveranstaltung so:
"Inklusiv? Mir kommt das Seminar eher exklusiv für die ExpertInnen vor. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass es ihnen gut geht. Mir scheint es sekundär, wie es uns mit ihnen geht." (Forschungstagebuch Studentin 5, 21.10.2008, ohne Seitenangabe)
Recht bald verändert sich dieser Zugang jedoch, und Studentin 5 kann in den Prozess des Inklusiven Forschens voll und ganz einsteigen. Immer wieder berichtet sie in ihrem Forschungstagebuch, wie sehr der zuständige Experte ihrer Forschungsgruppe sie positiv überraschen und durch seine Kompetenz überzeugen konnte:
"Er sagt zu uns ‚seine Studenten'. Ich finde das lustig, aber es passt auch für mich. Er ist sehr lustig und ich bewundere auch, wie sehr er motiviert ist, Misstände aufzudecken! Ich bin sehr zufrieden, dass wir ihn als Experten haben." (a.a.O., 12.11.2008)
Dieses Beispiel soll einerseits belegen, mit welchen Problemstellungen in Bezug auf das Durchsetzen der eigenen Rolle die am Inklusiven Seminar beteiligten ExpertInnen konfrontiert sind. Andererseits kann so auch gezeigt werden, welchen Prozess Studierende durchlaufen können, sofern sie es schaffen, sich auf Inklusive Forschung einzulassen. Das Bild von Studentin 5 in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten hat sich eindeutig verändert. Somit ist ein Empowermentprozess auf praktischer Ebene nicht nur bei den beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern auch bei den Studierenden in Kraft getreten. So können tiefergehende Veränderungen letztlich umgesetzt werden.
Eine weitere Studentin, die beruflich mit Kindern mit Lernschwierigkeiten zu tun hat, geht bereits mit der Erwartungshaltung in das Seminar, dass sich ihre Perspektive verändern könnte:
"Der Zugang zu Erwachsenen mit LS (Anm: LS = Lernschwierigkeiten) ist ein anderer, der mich sehr interessiert, vor allem das MITEINANDER finde ich sehr spannend. Ich erhoffe mir, viel Neues zu lernen, so manche Vorurteile abzubauen, und ich hoffe auch vor allem, in der qualitativen Forschung viel zu lernen, denn da bin ich noch nicht so sattelfest." (Forschungstagebuch Studentin 4, Einleitung, S. 1)
Diese Erwartung wurde insofern nicht enttäuscht, als diese Studentin laut eigenen Angaben viele Tipps und bereichernde Informationen für ihre eigene Berufspraxis mitnehmen und umsetzen konnte. Dass sich ihre grundsätzliche Haltung in Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten jedoch tiefgreifend verändert hat, lässt sich auf der Grundlage des Forschungstagebuches jedoch nicht belegen.
Treten Studierende also mit Menschen mit Lernschwierigkeiten im Kontext Inklusiver Forschung näher in Kontakt, ergibt sich die Möglichkeit, den eigenen Zugang zu verändern - sowohl auf studentischer Ebene wie auch aus Sicht der beteiligten ExpertInnen in eigener Sache.
Um wiederum auf den ursprünglichen Sinngehalt bei Atkinson (2004) zurückzukehren, lässt sich in Bezug auf die Lebensgeschichte von Menschen mit Lernschwierigkeiten auf einer praktizierten Empowerment-Ebene folgendes feststellen:
Informationen, die die Lebensgeschichte der beteiligten ExpertInnen betreffen, wurden nur teilweise innerhalb der jeweiligen Forschungsgruppen weitergegeben, da dies nicht von allen beteiligten Personen erwünscht wurde. Zum Teil berichteten die am Inklusiven Seminar mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr viel aus ihrem Leben außerhalb des universitären Rahmens und griffen dabei auch (negative oder traumatische) Erfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend auf. Andere ExpertInnen wiederum wollten die Distanz sowohl zu Studierenden als auch zum Leitungsteam der Lehrveranstaltung wahren und gaben nicht allzu viele Informationen diesbezüglich preis.
Hier wurde nicht nachgehakt, da die Erfassung einer Lebensgeschichte nicht primärer Inhalt der Lehrveranstaltung war, sodass die Entscheidung, was erzählt werden sollte und was nicht, den entsprechenden Personen vorbehalten blieb.
Generell lässt sich jedoch feststellen, dass Studierende eher in der Lage sind, sich in eine Person mit Lernschwierigkeiten hineinzuversetzen, je mehr Informationen sie aus dem Leben dieser Person erhalten. Dabei ist unbedingt und immer auf die Privatsphäre des Experten oder der Expertin zu achten und es ist zu respektieren, wenn dieser oder diese nur bedingt oder keine Informationen preisgeben möchte.
Abschließend kann gesagt werden, dass sich in allen Ebenen von Empowerment, die im Arbeitsraster Empowerment durch die Ausführungen von Georg Theunissen (2009) und Dorothy Atkinson (2004) gefunden wurden, Belege finden lassen konnten, die darauf hinweisen, dass Empowerment-Prozesse tatsächlich stattgefunden haben. Die Dimensionen bei Dorothy Atkinson (2004) mussten jedoch ein wenig abgewandelt werden, da eine Erfassung von Empowerment-Prozessen in Zusammenhang mit dem Erzählen der eigenen Lebensgeschichte in diesem Setting nicht möglich war.
Doch es gibt auch Kritikpunkte, die dem Empowerment von Menschen mit Lernschwierigkeiten entgegenstehen und dieses behindern. Diese sollen im folgenden Abschnitt diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Abschnitt soll erläutert werden, inwiefern eingetretene Empowerment-Prozesse behindert wurden. Dazu ist es auch notwendig, eine Kritik am Setting zu üben.
Dabei sei vorab noch einmal bemerkt, dass das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" insgesamt dreimal abgehalten wurde (im Wintersemester 2007/2008, im Sommersemester 2008 sowie als semesterübergreifende Lehrveranstaltung im Wintersemester 2008/09 und im Sommersemester 2009). Der Zeitraum der Datenerhebung erstreckt sich lediglich über letzteren Zeitraum, wodurch sich einige Kritikpunkte nur schwer im Nachhinein nachvollziehen lassen.
Zunächst soll dargestellt werden, inwiefern sich die unterschiedlichen "Generationen" in der ExpertInnen-Gruppe - bedingt durch Abgänge und Neuzugänge innerhalb dieser Gruppe - auf die Seminarkonzeption und die Empowerment-Prozesse der beteiligten Personen ausgewirkt haben.
Dass Sebastian und Kurt während des Zeitraums der Datenerhebungen die beiden Personen waren, die als einzige neu zur Gruppe der ExpertInnen in eigener Sache am Inklusiven Seminar mitarbeiteten, wurde bereits erwähnt. An dieser Stelle sollen nun die negativen Konsequenzen dargestellt werden, die diese Tatsache nach sich zog.
"Bei den drei Durchläufen des Projekts kam es zu Abgängen und Neuzugängen innerhalb der ExpertInnengruppe. Vor Start des Projektes wurde der Einführung neuer ExpertInnen in inklusive Forschung viel Zeit gewidmet, was während der folgenden Semester in dieser ausführlichen Form nicht mehr möglich war." (Eichinger und Kremsner 2011, S. 163)
Die ExpertInnen-Gruppe selbst benannte im Zuge der Vorbereitung zur Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen 2009 in Frankfurt am Main die Neuzugänge innerhalb der ExpertInnen-Gruppe als "Frischlinge", das Pendant dazu, also jene Personen, die von Beginn an mitarbeiteten, als "Alte Hasen". Aus diesem Grund soll die selbst gewählte Terminologie beibehalten werden.
Da für die "Alten Hasen" bedeutend mehr Zeit verwendet werden konnte, sie in Inklusive Forschung einzuführen und ein Seminarkonzept gemeinsam mit ihnen erarbeitet wurde, ergibt sich hier eine Ungleichheit den "Frischlingen" gegenüber. Dies lässt sich auch in einem hierarchischen Sinne verstehen, da diejenigen Personen, die seit Beginn am Seminar mitarbeiteten, sich für die beiden neu hinzugekommenen Herren ein Stück weit verantwortlich fühlten, was nicht immer erwünscht war.
Sebastian drückt seine Beziehung zu den anderen ExpertInnen in eigener Sache so aus:
"Eigentlich kinnt i mi scho unterhoitn, owa i wass net wos i reden sui, vielleicht is ma des a bissl zhoch, i wass net, i wass net, vielleicht hom de irgendwöche Fachausdrücke, i trau mi net so recht, jetzt wasst as." (Interview III mit Sebastian, Seite 2, Zeile 3-5)
Sebastian traut sich also nicht so recht, mit den anderen ExpertInnen zu sprechen, da diese ihm "zu hoch" seien, er also mit ihnen nicht mithalten könne. Hier ergibt sich ein unterschwelliger Konkurrenzdruck, dem Stand zu halten nicht unbedingt einfach ist. In anderer Stelle im selben Interview drückt er dies noch extremer aus:
"Owa es kummt ma hoit manchmal so vor, dass maunche, denen bin i egal oder so, nur zum oaweitn (= arbeiten) bin i guat, und dass i denk, wia i net ois Mensch akzeptiert, nur ois Oaweitsmaschine (= Arbeitsmaschine) oder so, dass i fia die Oaweit guat gnua (= gut genug) bin, dass i ma denk, des aundere zöht (= zählt) nix oder so." (Interview III mit Sebastian, Seite 4, Zeile 5-9)
Er wirft zu Beginn den anderen am Inklusiven Seminar beteiligten ExpertInnen vor, dass sie ihn als Mensch nicht akzeptieren und ihn als bloße Arbeitsmaschine ansehen. Bald darauf revidiert er dieses strenge Urteil, betont jedoch nach wie vor, dass er sich nicht als gleichwertig fühle und dass ihn dieser Umstand belastet. Dies ist auch der Grund, weshalb Sebastian keinen Kontakt zu den anderen ExpertInnen außerhalb des Inklusiven Seminars und der darauf folgenden Nachbesprechungen wünscht.
Konkrete Hilfestellungen, die sein Forschungsthema oder private Gegebenheiten betreffen, die innerhalb des Seminares angesprochen werden, nimmt er dennoch gerne auf - auch und vor allem dann, wenn sie von anderen ExpertInnen in eigener Sache kommen. Das Verhältnis zu den "Alten Hasen" ist also geprägt von Bewunderung und Ablehnung gleichzeitig.
Am Inklusiven Seminar - auch nach Abschluss desselben - weiter mitarbeiten möchte Sebastian dennoch, denn auch er möchte laut eigenen Angaben in die Rolle des "Alten Hasen" schlüpfen. Leider wurde nach dem Zeitraum der Datenerhebung eben jenes Seminar nicht mehr angeboten, weshalb Sebastian diese Chance nicht ergreifen konnte. Dies führte zu massiver Enttäuschung seinerseits.
Ähnlich ergeht es Kurt. Auch er wünscht keinen Kontakt außerhalb des Seminar- und Nachbesprechungsrahmens, wenngleich er Hilfestellungen diesbezüglich gerne annimmt.
Kurt hat von einigen anderen ExpertInnen die Rückmeldung bekommen, dass er die Teilnahme am Inklusiven Seminar nicht schaffen würde, da er zu wenig anwesend sei. Dies hat ihn sehr gekränkt. Als Problemlösungsstrategie schlägt Kurt vor, dass Mag. Koenig, Mag. Buchner und die beiden DiplomandInnen ihn mehr unterstützen und ihm in regelmäßigen Treffen schwierige Forschungsschritte oder Fachausdrücke besser zu erklären. Auf diese Weise, so Kurt, könne er mit den "Alten Hasen" mithalten.
Es wird also deutlich, dass ein gewisser Konkurrenzdruck innerhalb der ExpertInnen-Gruppe besteht, der sich vor allem auf die beiden neu mitarbeitenden Experten Sebastian und Kurt auswirkt.
Als Nachteil kann das Faktum bezeichnet werden, dass Kurt und Sebastian sich vor allem in den Nachbesprechungen - also in jenen Einheiten, in denen ausschließlich die ExpertInnen in eigener Sache sowie Mag. Koenig, Mag. Buchner und die beiden DiplomandInnen anwesend sind - nicht wohl fühlen. Dies behindert ihre Mitarbeit und Diskussionsbereitschaft in den Nachbesprechungen. Sie sind von der Kompetenz und dem Wissen der "Alten Hasen" ein wenig eingeschüchtert und fühlen sich nicht als gleichwertige ExpertInnen.
Andererseits entwickeln sowohl Sebastian als auch Kurt den Ehrgeiz, mit den bereits seit Beginn des Inklusiven Seminares mitarbeitenden ExpertInnen mithalten zu können. Dies ist als erfreulich anzusehen, zieht jedoch auch die Sorge nach sich, dass die beiden Herren sich selbst massiv überfordern könnten, indem sie viel zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen.
Die Hierarchie innerhalb der ExpertInnen-Gruppe ergibt sich vordergründig durch den Faktor "Zeit". Die "Alten Hasen" hatten die Gelegenheit, sich ihre eigene Rolle innerhalb des Inklusiven Seminares zu erarbeiten und konnten auch schon Erfahrung im Ausfüllen dieser Rollen sammeln. Dies blieb Sebastian und Kurt völlig vorbehalten und konnte auch nicht wettgemacht werden, indem man ihnen besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte und gesonderte Nachbesprechungstermine ermöglichte.
Ein weiterer Aspekt, der aus Sicht der beteiligten Personen am Inklusiven Seminar kritisch betrachtet werden muss, betrifft die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die in das Seminar eingebracht wurden. Darauf soll im folgenden Abschnitt der Blick gerichtet werden.
Sämtliche am Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" beteiligten Personen bringen unterschiedliche Erwartungshaltungen in die Lehrveranstaltung mit, die sich teilweise widersprechen. Es wird nun versucht, die Erwartungshaltungen der beteiligten ExpertInnen in eigener Sache, der Lehrveranstaltungsleiter sowie der Studierenden herauszuarbeiten.
Erwartungshaltungen der ExpertInnen in eigener Sache betreffen vordergründig die eigenen Themen, die zu bearbeiten sind, um in weiterer Folge eine Veränderung herbeizuführen.
"Mir geht's drum die Sachen die i aunfaung, dass do wos verändert wird zum Positiven, und, und, und dass i des durchführ, wo i glaub, dass ma des und des verändern muass oder verbessern kaunn." (Interview V mit Karl, Seite 8, Zeile 16-18)
Eine konkrete Verbesserung der eigenen Lebenssituation bzw. derjenigen von Menschen mit Lernschwierigkeiten allgemein wird durch die Durchführung Inklusiver Forschung erwartet. Diese Veränderung kann und soll auch auf einem politischen Level erreicht werden, so Sebastian:
"Des wa a wichtiger Punkt wo die Experten hoit söwa (= selber) mit die Politiker reden und schaun wie's ausschaut oder so, des tät ma taugn (= gefallen)." (Interview VI mit Sebastian, Seite 3, Zeilen 28-29)
Diese Veränderungen können nur herbeigeführt werden, indem man die betreffenden Personen selbst zu Worte kommen lässt, betont Andrea. Dies sei ein Ziel Inklusiver Forschung und decke sich mit ihren Erfahrungen:
"Die partizipative Forschung hat, hat das in dem Sinne, macht in dem Sinne für mich Sinn, weil man eher auf die Meinung der Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Wert legt als von zum Beispiel von Betreuern oder von Eltern oder von einer anderen dritten Person, man beschäftigt sich rein mit der Person, die es angeht." (Interview IV, Teil 2 mit Andrea, Seiten 3 und 4, Zeilen 31-32 und 1-3)
Als Erwartungshaltung für die beteiligtem Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache kann also festgehalten werden, dass sich diese konkrete Veränderungen durch die Teilnahme an Inklusiver Forschung erwarten, und zwar sowohl auf einer persönlichen als auch auf einer politischen Ebene. Dies kann nur erreicht werden, indem man den betreffenden Personen selbst eine Stimme verleiht.
Leider liegen mit den beiden Lehrveranstaltungsleitern Mag. Koenig und Mag. Buchner keine Interviews vor, sodass als Quelle zur Erarbeitung ihrer Erwartungshaltungen lediglich mein eigenes Forschungstagebuch sowie die Publikationen der beiden Herren herangezogen werden können.
Mag. Koenig und Mag. Buchner sehen sich im Zuge des Inklusiven Seminares eher in der Rolle der Unterstützer denn der Lehrveranstaltungsleiter, da sie den Posten der LeiterInnen an die beteiligten ExpertInnen in eigener Sache abgegeben haben. Sie unterstützen in sämtlichen Schritten des Forschungsprozesses und da, wo die einzelnen Forschungsgruppen Hilfe brauchen, nehmen sich abseits davon jedoch so weit wie möglich aus der Gestaltung der Seminareinheiten heraus.
"Hier ist ein beständiges Abnehmen von Unterstützungsbedarf durch die Lehrveranstaltungsleiter zu beobachten. Die ExpertInnengruppe hat sich zu einem eigenständigen, handlungsfähigen Team entwickelt." (Koenig et al. 2010, S. 186)
Trotzdem haben Mag. Buchner und Mag. Koenig Vorgaben seitens der Universität Wien, die einzuhalten sind: Sie sind diejenigen Personen, die am Ende der Lehrveranstaltungen Noten an die Studierenden vergeben müssen und auch dazu angehalten sind, darauf zu achten, dass ein gewisser Rahmen eingehalten wird. Außerdem sind sie für alle am Seminar beteiligten Personen verantwortlich - also sowohl für die ExpertInnen wie auch die Studierenden - und haben ihnen gegenüber die Verpflichtung, inhaltlich wie menschlich alles nötige zu tun, um den Rahmen eines Seminares zu wahren und niemanden zu überfordern.
Hinzu kommt außerdem die Rolle der Wissenschafter, die Mag. Buchner und Mag. Koenig einnehmen, wenngleich diese im Rahmen des Inklusiven Seminares selbst kaum zum Tragen kommt. Umso deutlicher wird diese jedoch bei der Teilnahme an der Tagung der Integrations- und InklusionsforscherInnen im Februar 2009 in Frankfurt am Main. Kurt findet dazu im Gespräch mit Mag. Koenig folgende Worte:
"Wie du mit den Hochkultivierten geredet hast bin ich eigentlich nie ins Gespräch dazu gestoßen. Weil's irgendwie sehr hoch in anderen Dimensionen gesprochen habt's über die Themen. In den anderen Workshops, nicht im eigenen. Bin da überhaupt nicht mitgekommen, jedes Mal angestanden an der Grenz, nimma mehr gwusst, was das bedeutet." (eigenes Forschungstagebuch, 31.3.2009, S. 23)
Kurt entdeckt hier eine völlig andere Seite der beiden Lehrveranstaltungsleiter, die er noch nicht kannte, und die ihn auch ein wenig überfordert.
Es wird sehr deutlich, dass Mag. Koenig und Mag. Buchner einem ständigen Spannungsfeld ausgesetzt sind, das auszugleichen und zu halten nicht immer einfach ist:
Zum einen wollen sie so viel Verantwortung wie möglich an die beteiligten ExpertInnen in eigener Sache abgeben, ohne diese zu überfordern. Sie sind hier in der Tradition Inklusiver Forschung Menschen mit Lernschwierigkeiten und den Regeln Inklusiver Forschung unterstellt.
Andererseits wiederum sind sie insofern eindeutig als Lehrveranstaltungsleiter zu betrachten, als sie den formalen Rahmen einer Lehrveranstaltung zu wahren haben und so den Vorgaben der Universität Wien Folge leisten müssen.
Und zum Dritten sind sie als Lehrveranstaltungsleitern den Studierenden gegenüber verpflichtet, indem sie Inhalte zu Forschung und Wissensproduktion sowohl methodisch als auch praktisch unterrichten müssen. Dies soll in einer Form geschehen, die den akademischen Anforderungen genügt. Zudem muss in einem Setting dieser Art gewahrt werden, dass die Studierenden nicht benachteiligt werden. Dies wurde seitens der StudentInnen immer wieder angesprochen.
Es folgt nun die Darstellung der Erwartungshaltungen der Studierenden.
Rückmeldungen der Studierenden kamen außerhalb des üblichen Rahmens des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" vordergründig in Form von Forschungstagebüchern und Feedbackrunden der einzelnen Forschungsgruppen. Außerdem wurde am 2. Dezember 2008 eine Seminareinheit ohne die ExpertInnen in eigener Sache abgehalten, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, Nachfragen zu stellen und offene Fragen zu klären.
In dieser Seminareinheit wurde abermals über die Rollen diskutiert, die innerhalb des Inklusiven Seminares eingenommen werden (also zum Beispiel darüber, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Rolle eines Teamleiters oder einer Teamleiterin schlüpfen). Außerdem forderten die Studierenden mehr Möglichkeiten für intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit relevanten Schritten im Forschungsprozess ein - und zwar auch in einer wissenschaftlichen Sprache. Es wurde kritisiert, dass die Verwendung von leichter Sprache zu viel Zeit in Anspruch nehme. Der Faktor Zeit könne effizienter genutzt werden.
In den Feedbackrunden der einzelnen Forschungsgruppen forderten die Studierenden mehr Struktur und klarere Vorgaben in Bezug auf die Anforderungen für schriftliche Texte ein. Zusätzlich wünschten sie sich mehr Raum für Diskussionen, auch ohne die beteiligten ExpertInnen.
Dem ist hinzuzufügen, dass die Studierenden im Sinne der Erfüllung des Studienplanes dazu verpflichtet sind, eine gewissen Anzahl an Seminaren zu absolvieren, was mit einem positiv benoteten "Schein" bestätigt wird. Das Sammeln von Zeugnissen ist wesentlicher Bestandteil jedes Studiums. Insofern bildet das Inklusive Seminar hier keine Ausnahme. Das Festhalten an Strukturen und Vorgaben kann als in diesem Zusammenhang stehend verstanden werden.
Dennoch wird in diesem Rahmen von den Studierenden viel mehr verlangt als die bloße Erfüllung von Aufgaben, um am Ende eine Note zu bekommen. Studierende sollen sich nach Möglichkeit auf einen Prozess einlassen, dessen Strukturen sie zuvor nicht kannten und bei dem die Umsetzung und das Einhalten der Regeln Inklusiver Forschung mindestens ebenso wichtig sind wie die gewonnenen Ergebnisse. Universitätsfremde Personen, also Menschen mit Lernschwierigkeiten, sind plötzlich hierarchisch über den Studierenden angesiedelt, und dennoch gibt es auch noch zwei Lehrveranstaltungsleiter, die am Ende der Lehrveranstaltung Noten vergeben werden. Dieser Umstand gestaltete sich für viele der beteiligten Studierenden als äußerst schwierig und wurde auch immer wieder zur Sprache gebracht.
Im Sinne Inklusiver Forschung ist an dieser Stelle anzumerken, dass in diesem Setting die Rolle des nicht-behinderten Forschers bzw. der nicht-behinderten Forscherin sich völlig anders darstellt, als in der Literatur (zum Beispiel bei Walmsley und Johnson 2003) ausgearbeitet. Studierende können sich in diesem Setting nicht aus eigenem Antrieb dazu entscheiden, Forschung in inklusiver Form durchzuführen. Nicht-behinderte ForscherInnen außerhalb eines Seminarrahmens tun dies sehr wohl und überlegen sich davor sehr genau, worauf sie abzielen und wie sie dabei vorgehen können. Dies beeinflusst auch die Qualität der Forschungsergebnisse und der Zusammenarbeit mit ExpertInnen in eigener Sache. Studierende können aufgrund des Settings die Rolle des nicht-behinderten Forschers bzw. der nicht-behinderten Forscherin nicht kritisch und reflektiert ausfüllen, sondern sind auf Rückmeldungen der ExpertInnen in eigener Sache wie auch der Lehrveranstaltungsleitung angewiesen. Das Ausfüllen dieser Rolle kann somit einerseits als unfreiwillig bezeichnet werden. Andererseits besteht die Gefahr, dass die Ausfüllung der Rollen nur so weit gelingt, als dies für das Erlangen eines positiven Zeugnisses nötig ist. Hier ist jedoch zu bemerken, dass einigen Studierenden das Eintauchen in diese Rolle sehr wohl auch in positiv besetzter Form gelungen ist und somit auch die Zusammenarbeit und die Forschungsergebnisse als durchaus ernst zu nehmend beschrieben werden können.
An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich die Widersprüchlichkeit der Erwartungshaltungen der unterschiedlichen am Inklusiven Seminar beteiligten AkteurInnen. Die Umsetzung Inklusiver Forschung in einem solchen Setting verlangt also ein äußerst hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Ausgewogenheit in Bezug auf Bevorzugung oder Benachteiligung einer der beteiligten Personengruppen. Hier liegt die Verantwortung vordergründig bei Mag. Buchner und Mag. Koenig als Lehrveranstaltungsleitern, die diesen Balanceakt schaffen müssen.
Eine Überleitung zum nächsten Abschnitt erübrigt sich insofern, als sich die Darstellung der unterschiedlichen Erwartungshaltungen der am Inklusiven Seminar beteiligten AkteurInnen bereits zu weiten Teilen mit den Inhalten der folgenden Ausführungen deckt: Der Kritik am universitären Setting.
Zunächst sei an dieser Stelle auf die Barrieren eingegangen, die sich für Menschen mit Lernschwierigkeiten in einem universitären Setting ergeben. Dies betrifft sowohl bauliche wie auch sprachliche Barrieren, die von den beteiligten ExpertInnen in eigener Sache aufgedeckt wurden.
Das gesamte Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" hindurch wurden Fachbegriffe benutzt, die nicht vermieden werden konnten und die von den beteiligten ExpertInnen in eigener Sache teilweise nur schwer verstanden werden konnten - selbst wenn sie bereits Erfahrung mit Inklusiver Forschung gewonnen hatten. Auch die Aussprache derer (wie zum Beispiel bei "Partizipativer Forschung") war nicht unbedingt einfach:
"Des mit dem Wort zapernative Forschung oder des schwierige Wort, i kauns net ganz, noch nicht ganz aussprechen, weil des is immer a Zungenbrecher fia mi." (Interview V mit Karl, Seite 9, Zeilen 9-11)
Da es jedoch auch nötig war, die Studierenden in die theoretischen Hintergründe dieses Zugangs zu Forschung einzuführen, konnte es leider nicht umgangen werden, Fachbegriffe und Englische Ausdrücke (zum Beispiel "Disability Studies") zu vermeiden.
"Die wissenschaftliche Sprache stellt eines der Hauptprobleme für die ExpertInnen dar. Diese sprachliche Barriere führt dazu, dass die Forschungsergebnisse (Seminararbeiten) nicht für alle zugänglich sind." (Eichinger und Kremsner 2011, S. 163)
Bezüglich der sprachlichen Barrieren stellt sich also das Problem, dass wissenschaftliche Sprache teilweise nicht nur das gesamte Inklusive Seminar hindurch, sondern auch beim Verfassen der Seminararbeiten verwendet werden musste. So konnten die schriftlich abgefassten Forschungsergebnisse für Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht zugänglich gemacht werden, was den Regeln Inklusiver Forschung widerspricht. An dieser Stelle reiben sich universitäre Vorgaben mit jenen Inklusiver Forschung.
Da der Arbeitsaufwand für die beteiligten Studierenden ohnehin schon enorm war, wurde davon abgesehen, eine zweite Version der Seminararbeit in einfacher Sprache zu verlangen. Stattdessen griff man auf die Möglichkeit einer öffentlichen Präsentation der Forschungsergebnisse zurück, bei der in einer sprachlich adäquaten Form Menschen mit Lernschwierigkeiten ermöglicht wurde, diese Ergebnisse nachzuvollziehen.
Betreffend baulicher Barrieren ist zu sagen, dass der Veranstaltungsort des Inklusiven Seminares, ein Seminarraum im 6. Stock des NIG ("Neues Institutsgebäude"), keineswegs als barrierefrei bezeichnet werden kann. Dies führte vor allem bei den ExpertInnen in eigener Sache, die auf den elektrischen Rollstuhl angewiesen sind, zu Unmut.
Sie mussten über den Hintereingang das Gebäude betreten, da der Haupteingang mit wenigen Stufen versehen ist und zudem die Türen nicht automatisch öffnen und schließen. In den ersten beiden Seminardurchgängen, die außerhalb des Zeitraums der Datenerhebung liegen, gab es für diese ExpertInnen laut eigenen Angaben keine andere Möglichkeit, als mit Hilfe des Portiers im NIG den Lastenaufzug zu benutzen, denn nur dieser bot ausreichend Platz für einen elektrischen Rollstuhl. Nach dem Entfernen des Pater Noster und dem Einbau eines modernen Liftes statt dessen war dieses Problem behoben.
Der Seminarraum selbst ist zwar für die Abhaltung eines Seminares ohne Beteiligung von RollstuhlfahrerInnen groß genug, im Inklusiven Seminar mussten jedoch 31 Studierende, zwei Lehrveranstaltungsleiter, zwei DiplomandInnen und insgesamt neun ExpertInnen in eigener Sache Platz finden. Unter letzteren befanden sich auch drei Personen, die einen elektrischen Rollstuhl bedienten. Man kann sich also vorstellen, dass das Einnehmen der Plätze zu jeder Seminareinheit einem kleinen Kunststück aufgrund von massivem Platzmangel gleichkam. Bedenkt man mit, dass Personen oftmals auch zu spät kamen oder zwischendurch den Raum kurz verlassen mussten, wird der Eindruck der baulichen Barrieren noch viel bildhafter.
Der universitäre Rahmen macht es außerdem unmöglich, Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache auch offiziell als LehrveranstaltungsleiterInnen - zum Beispiel im Vorlesungsverzeichnis - anzuführen. Dies zieht auch die Folge nach sich, dass eine finanzielle Entschädigung für den doch sehr intensiven Arbeitsaufwand verunmöglicht wird. Die beteiligten ExpertInnen in eigener Sache widmeten sich dem Inklusiven Seminar vollständig und unbezahlt in ihrer Freizeit.
Auf die Rolle der Studierenden im Zuge des Inklusiven Seminares, die an diesem Setting einen wesentlichen Anteil haben, wurde bereits im vorigen Abschnitt eingegangen. Hier sei diese Problemstellung noch einmal kurz wiederholt:
"Nicht alle Studierenden besuchten aus der Motivation, inklusiv zu forschen, das Seminar, was zu Interessenskonflikten führte." (Eichinger und Kremsner 2011, S. 163)
Das Leitungsteam des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik", bestehend aus ExpertInnen in eigener Sache sowie Mag. Koenig und Mag. Buchner, war sich dieser Problemstellungen im Vorfeld teilweise bewusst und beschloss dennoch, ein Seminar in dieser Form in universitärem Rahmen zu veranstalten. Dass Optimierungsmöglichkeiten immer gegeben sind, kann und darf nicht zur Diskussion stehen. Es ist jedoch festzuhalten, dass trotz kritischer Betrachtung dieses Settings die großen Vorteile, die sich ebenfalls daraus ergeben haben, nicht aus dem Blick rücken.
Anhand des vorliegenden Datenmaterials könnten einige weitere Aspekte herausgearbeitet werden, die jedoch nicht in Zusammenhang mit Empowerment-Prozessen stehen und somit den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würden. Es soll nun also abschließend im Resümee versucht werden, die wesntlichsten Inhalte dieser Arbeit noch einmal zusammenzufassen sowie einen Ausblick auf weitere Fragestellungen im Rahmen eines ähnlichen Projektes zu wagen.
Zunächst lässt sich feststellen, dass das Seminar "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" als im deutschsprachigen Raum einzigartig zu verstehen ist. Eine Lehrveranstaltung mit dieser Konzeption wurde zuvor weder in Deutschland noch in Österreich oder der Schweiz durchgeführt.
Betreffend der vorliegenden Fragestellung der Forschung nach Empowerment-Prozessen, die bei den beteiligten Menschen mit Lernschwierigkeiten in diesem Rahmen in Gang gesetzt wurden, kann abschließend festgestellt werden, dass bei sämtlichen beteiligten ExpertInnen in eigener Sache tatsächlich stattfindende Empowerment-Prozesse nachgewiesen werden konnten. Das Ausmaß dieser Prozesse ist dabei von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wobei vor allem dem Faktor Zeit eine wesentliche Rolle zukommt.
Je mehr Zeit zur Verfügung steht, sich mit den neu eingenommenen Rollen als TeamleiterIn, ExpertIn in eigener Sache, Vortragende etc. auseinanderzusetzen, umso eher gelingt es, diese Rollen auch auszufüllen und zu verteidigen. Das Einnehmen von neuen Rollen kann als wesentlicher Beitrag zum Auslösen von Empowerment-Prozessen verstanden werden.
Aber auch Empowerment-Prozesse, die abseits des Einnehmens neuer Rollen stattgefunden haben, wurden dargestellt. Diese betreffen den privaten Bereich ebenso wie den beruflichen. Hier wurden teilweise tiefgreifende und massive Veränderungen beobachtet und dokumentiert.
Die Problemstellungen, die sich in einem Setting wie dem Inklusiven Seminar an der Universität Wien ergeben, wurden kritisch betrachtet und reflektiert. Hier ist anzumerken, dass diese Problemstellungen ebenso einen wesentlichen Beitrag zu Empowerment-Prozessen leisten. Das Erkämpfen und Verteidigen einer neuen Rolle zum Beispiel sichert diese ab und bedingt eine intensive Auseinandersetzung damit. Dass dies jedoch nicht immer leicht ist, steht außer Frage - vor allem dann nicht, wenn es sich dabei um Personen handelt, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte ohnehin dauerhaft mit Bevormundung und Unterschätzung zu kämpfen hatten.
Das Inklusive Seminar wurde nach Abschluss der Datenerhebung an der Universität nicht mehr angeboten. Sollte eine Neuauflage dessen jedoch geplant werden, gilt es, folgende Verbesserungsvorschläge zu berücksichtigen:
Die Rahmenbedingungen müssen dahingehend verändert werden, als Studierende nicht dazu verpflichtet werden können, sich in den Prozess des Inklusiven Forschens vollständig einzulassen. Dies kann nur auf freiwilliger Basis und ohne dem Druck, einen Schein dafür zu bekommen, erfolgen. So kann das Interesse an Inklusiver Forschung in den Vordergrund statt wie bisher in den Hintergrund rücken (vgl. Eichinger und Kremsner 2011).
Ein geeigneter Ort zur Durchführung einer Lehrveranstaltung mit dieser Konzeption muss gefunden werden. Dieser muss barrierefrei erreichbar sein und ausreichend Platz für Gruppenarbeiten bieten, wobei auch RollstuhlfahrerInnen sich darin bequem bewegen können müssen.
Bezüglich der sprachlichen Barrieren muss eine Lösung gefunden werden. Es könnten für die Studierenden zum Beispiel vermehrt Unterlagen in wissenschaftlicher Sprache zur Verfügung gestellt werden. Die Inhalte dieser könnten - vielleicht auch von den Studierenden - in einfacher Sprache vorgetragen werden, sodass auch die ExpertInnen zu den nötigen Informationen kommen könnten.
Eine finanzielle Vergütung für den Zeitaufwand der beteiligten ExpertInnen in eigener Sache muss bereitgestellt werden (vgl. Eichinger und Kremsner 2011).
Das System Universität sollte sich insofern öffnen, als Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache auch offiziell als LehrveranstaltungsleiterInnen in diesem Setting anerkannt werden sollten. Eine Nennung im Vorlesungsverzeichnis etwa könnte angestrebt werden.
Es sollten Zeitfenster zur Reflexion ausschließlich für Studierende eingeplant werden. Die betreffenden ExpertInnen in eigener Sache haben diese Möglichkeit bereits in Form der Nachbesprechungen (vgl. Eichinger und Kremsner 2011).
Um negative Gruppendynamiken zu vermeiden, wäre es ratsam, gleich zu Beginn eines Inklusiven Seminares eine Art Klausur oder Kennenlern-Tage zu veranstalten, wo sich alle beteiligten Personen näher kennen lernen können und die Inhalte eines solchen Seminares mit ausreichend Zeit dargestellt werden würden. Erst danach sollten sich die Forschungsgruppen bilden. So kann die Qualität der Arbeiten verbessert werden und es ergibt sich die Möglichkeit, gar nicht erst in Inklusive Forschung einzusteigen, so dieser Ansatz nicht mitgetragen werden kann.
Weiterführende Forschung auf diesem Gebiet könnte sich mit der Sichtweise der Studierenden in diesem Zusammenhang beschäftigen. Wie nehmen sie eine Inklusive Lehrveranstaltung wahr? Warum gelingt es nicht allen StudentInnen, sich in den Prozess des Inklusiven Forschens einzulassen? Welche Auswirkungen hat die Teilnahme am Inklusiven Seminar auf ihre berufliche Praxis, sofern vorhanden?
Auch die Perspektive der Scientific Community oder auch der Universität, an der ein solches Seminar abgehalten wird, birgt interessante Aspekte, die nachzuverfolgen sich lohnen könnte. So wäre es zum Beispiel äußerst interessant gewesen, die Diskussionen auf den Tagungen der Integrations- und InklusionsforscherInnen, an denen die ExpertInnengruppe des Inklusiven Seminars teilgenommen hatte, festzuhalten und weiterführend zu bearbeiten.
Inklusive Forschung in Hinblick auf die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen könnte ebenso näher betrachtet werden.
Es wurde in der vorliegenden Diplomarbeit versucht, nachzuzeichnen, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten an der Universität als Ort der Produktion und Vermittlung von Wissen teilhaben können und welche Vor- und Nachteile diese Teilhabe mit sich bringen kann.
"Eine veränderte Position innerhalb der Gesellschaft (auch mitbedingt durch ‚an der Uni sein') innezuhaben, vermehrt Respekt und Anerkennung der eigenen Leistung zu erleben, eigenverantwortlich eine Gruppe zu leiten, Forschung durchzuführen - um nur einige Beispiele anzuführen - all dies scheinen Faktoren zu sein, die als ‚selbstermächtigend' im Sinne von Empowerment anzusehen sind und wesentlich dazu beitragen können, individuelle und kollektive Sichtweisen und Zuschreibungen zu verändern und aufzubrechen." (Koenig et al. 2010, S. 188)
Eine Setting wie das des Seminares "Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten - in Forschungsfeldern der Heil- und Integrativen Pädagogik" kann einen wesentlichen Beitrag leisten, diese kollektiven Sichtweisen und Zuschreibungen zu verändern. Außerdem kann eine solche Seminarkonzeption wesentlichen Anteil an Veränderungen nehmen, die sich aufgrund der Mitarbeit am Inklusiven Seminar auf individueller Ebene ergeben.
Ich hoffe, dass es anhand der vorliegenden Diplomarbeit gelungen ist, Inklusive Forschung als Ansatz der Wissensproduktion zu legitimieren, wenngleich Kritikpunkte sich immer finden lassen können. Vor allem aber sollte die Darstellung der tatsächlich stattgefundenen Veränderungen, die sich im Sinne des Empowerments bei den mitarbeitenden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ExpertInnen in eigener Sache aufgetan haben, dazu beitragen, diese Art des Forschens weiterhin zu forcieren.
Atkinson, D. und Walmsley, J. (1999): Using Autobiographical Approaches with People with Learning Difficulties. In: Disability & Society, Vol. 14, No. 2, S. 203-216.
Atkinson, D. (2004): Research and empowerment: involving people with learning difficulties in oral and life history research. In: Disability & Society, Vol. 19, No. 7, S. 691-702.
Atkinson, D. (2005): Research as Social Work: Participatory Research in Learning Disability. In: British Journal of Social Work, Vol. 35, S. 425-434.
Beart, S. (2005): "I won't think of meself as a learning disability. But I have": Social identity and self-advocacy. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 33, S. 128-131.
Beart, S.; Hardy, G. und Buchan, L. (2005): How People with Intellectual Disabilities View Their Social Identity: A Review of the Literature. In: Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Vol. 18., S. 47-56.
Biewer, G. (2009): Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik. Verlag Julius Klinhardt, Bad Heilbrunn.
Biewer, G.; Fasching, H. und Koenig, O. (2009): Teilhabe von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung an Bildung, Arbeit und Forschung. In: SWS-Rundschau 3/2009, S. 391-403.
Bohnsack, R.; Marotzki, W. und Meuser, M. (2006) (Hrsg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. Verlag Barbara Budrich, Opladen und Farmington Hills, 2. Auflage.
Buchner, T. (2009): Das qualitative Interview mit Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung. Ethische, methodologische und praktische Aspekte. In: Biewer, G.; Luciak, M. und Schwinge, M. (Hrsg.): Begegnung und Differenz- Länder - Menschen - Kulturen. Dokumentation der 43. Arbeitstagung der DozentInnen der Sonderpädagogik deutschsprachiger Länder. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn, S. 516-528.
Buchner, T. und Koenig, O. (2008): Methoden und eingenommene Blickwinkel in der sonder- und heilpädagogischen Forschung von 1996 bis 2006. In: Heilpädagogische Forschung, 34, S. 15-34.
Buchner, T.; Koenig, O. und Schäfers, M. (2011): Teilhabeforschung - Partizipative Forschung. In: Teilhabe. Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe. Vol. 1/2011, Jg. 50.
Buchner, T; Koenig, O. und Schuppener, S. (2011): Gemeinsames Forschen mit Menschen mit intellektueller Behinderung. Geschichte, Status Quo und Möglichkeiten im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention. In: Teilhabe 1/2005, S. 4-10.
Buchner, T. und Westermann, G. (2007): Die Lebensgeschichte von Gerhard Westermann. In: Boehlke, E. (Hrsg.): Integrationsgespräche Bd. 5: "Individuelle Biografieforschung als Entwicklungschance für Menschen mit Intelligenzminderung".
Cameron, L. und Murphy, J. (2006): Obtaining consent to participate in research: The issues involved in including people with a range of learning and communication disabilities. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 35, S. 113-120.
Carraro, A. und Hintringer, E. (2010): Prozesse sozialer Interaktion und Prozesse der Erkenntnisgewinnung in der Arbeit einer Referenzgruppe. Diplomarbeit an der Universität Wien.
Charmaz, K.C. (2006): Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage Publications, London, New Delhi, Singapur und Washington DC.
Charmaz, K.C. (2011): Den Standpunkt verändern: Methoden der konstruktivistischen Grounded Theory. In: Mey, G. und Mruck, K. (Hrsg.): Grounded Theory Reader. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 181-205.
Cloerkes, G. (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 3., neu überarbeitete Auflage.
Danieli, A. und Woodhams, C. (2005): Emancipatory Research Methodology and Disability: A Critique. In: International Journal of Social Research Methodology, Vol. 8, No. 4, S. 281-296.
Eichinger, M. und Kremsner, G. (2011): Vier Semester inklusive Forschung in einem Seminar an der Universität Wien: Rück- und Ausblick. In: Flieger, P. und Schönwiese, V. (Hrsg.): Menschenrechte - Integration - Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn, S. 161-165.
Felkendorff, K. (2003): Ausweitung der Behinderungszone: Neuere Behinderungsbegriffe und ihre Folgen. In: Cloerkes, G. (Hrsg.): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, S. 25-52.
Flieger, P. (2003): Partizipative Forschungsmethoden und ihre konkrete Umsetzung. In: Hermes, G. und Köbsell, S. (Hrsg.): Disability Studies in Deutschland - Behinderung neu Denken. Dokumentation der Sommeruni Kassel. Verlag bifos, Kassel, 2003, S. 200-204. Quelle: http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger-partizipativ.html , Stand: 2008-04-07, ohne Seitenangabe.
Flieger, P. und Schönwiese, V. (Hrsg.) (2007): Das Bildnis eines behinderten Mannes. Bildkultur der Behinderung vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Wissenschaftlicher Sammelband, Neu Ulm, S. 19-42. Quelle: http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger-forschungsprojekt.html, Stand: 2011-11-21
Freedman, R.I. (2001): Ethical Challenges in the conduct of research involving persons with mental retardation. In: Mental Retardation, Vol. 39(2), S. 130-141.
Garcia-Iriartre, E.; Kramer, J. C.; Kramer, J. M. und Hammel, J. (2008): ‚Who Did What?': A Participatory Action Research Project to Increase Group Capacity for Advocacy. In: Journal for Applied Research in Intellectual Disabilities, S. 1-13.
Gilbert, T. (2004): Involving people with learning disabilities in research: issues and possibilities. In: Health & Social Care in the Community, Vol. 12(4), S. 298-308.
Göthling, S. und Schirbort, K. (2011): People First - eine Empowermentbewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ein Blick zurück und einer nach vorne. In: Kulig, W.; Schirbort, K. und Schubert, M. (Hrsg.): Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best Practice. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 57-65.
Glaser, B.G. und Strauss, A.L. (2005) Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. Verlag Hans Huber, Bern, 2. korrigierte Auflage.
Goodley, D. (1998): Supporting People with learning difficulties in self-advocacy groups and models of disability. In. Health and Social Care in the Community, Vol. 6, S. 438-446.
Goodley, D. und Van Hoove, G. (Hrsg.) (2005): Another Disability Studies Reader? People with Learning Difficulties and a Disabling World. Garant Verlag, Antwerpen und Appeldom.
Goodley, D. und Moore, M. (2000): Doing Disability Research: activist lives and the academy. In: Disability & Society, Vol. 15(6), S. 861-882.
Göthling, S. und Schirbort, K. (2011): People First - eine Empowermentbewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ein Blick zurück und einer nach vorne. In: Kulig, W., Schirbort, K. und Schubert, M. (Hrsg.): Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, S. 57-65.
Hagen, J. (2007): Und es geht doch! Menschen mit einer geistigen Behinderung als Untersuchungspersonen in qualitativen Forschungszusammenhängen. In: VHN, 76. Jahrgang, S.22-34.
Iacono, T. (2006): Ethical Challenges and complexities of including people with intellectual disability as participants in research. In: Journal of Intellectual & Developmental Disability, Vol. 31(3), S. 173-179.
Johnson, K. (2009): No Longer Researching About Us Without Us: a researcher's reflection on rights and inclusive research in Ireland. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 37, S. 250-256.
Koenig, O. und Buchner, T. (2011/1) Von der Ausgrenzung zur Inklusion: Entwicklung, Stand und Perspektiven des gemeinsamen Forschens. In: DIFGB (Hrsg.): Forschungsfalle Methode? Partizipative Forschung im Diskurs. Eigendruck der DIFGB, Leipzig, S. 2-16.
Koenig, O. und Buchner, T. (2011/2): (Inklusive) Forschung als Empowerment? In: Kulig, W.; Schirbort, K. und Schubert, M. (Hrsg.): Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best Practice. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2011.
Koenig, O.; Buchner, T.; Kremsner, G. und Eichinger, M. (2010): Inklusive Forschung und Empowerment: Wie funktionieren inklusive Forschungsprozesse aus Sicht der beteiligten Akteure am Beispiel einer inklusiven Lehrveranstaltung an der Universität Wien. In: Stein, A.-D.; Krach, S. und Niediek, I. (Hrsg.) Integration und Inklusion auf dem Weg ins Gemeinwesen. Möglichkeitsräume und Perspektiven. Klinhardt Verlag, Bad Heilbrunn, S. 176-190.
Koenig, O. und Buchner, T. unter Mitarbeit von Cay, F.; Hoffmann, F.; Koenig, M.; Orehounig, W.: Pittl, D.; Prucker, S. und Rauchberger, M. (2011): Die Bedeutung von Lebensgeschichten für die UN-Konvention. In: Flieger, P. und Schönwiese, V. (Hrsg.): Menschenrechte, Integration, Inklusion. Aktuelle Perspektiven aus der Forschung. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn, S. 139-152.
Kulig, W.; Schirbort, K. und Schubert, M. (Hrsg.) (2011): Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
Lamnek, S. (2005): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 4., vollständig neu überarbeitete Auflage.
Lennox, N.; Taylor, M.; Conde, T. et al. (2005): Beating the barriers: recruitment of people with intellectual disability to participate in research. In: Journal of Intellectual Disability Research, Vol. 49(4), S. 296-305.
Markey, U.; Santelli, B. und Turnbull, A. P. (ohne Jahresangabe): Participatory Action Research Involving Families from Underserved Communities and Researchers: Respecting Cultural and Linguistic Diversity. In. Council for Exceptional Children, Division for Culturally and Linguistically and Diverse Exceptional Learners: Compendium: Writings on effective practice for culturally and linguistically diverse exceptional learners, Reston, VA, S. 20-32 .
Mayring, P. (2002): Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 5., neu überarbeitete und neu ausgestattete Auflage.
Milton, C.L. (2000): Informed Consent: Process or Outcome? In: Nursing Science Quarterly, Vol. 13, No. 4, S. 291-292.
Northway, R. (2000): Ending Participatory Research? In: Journal of Intellectual Disabilities, Vol. 4/27, ohne Seitenangabe.
Oliver, M. (1994): Capitalism, disability and ideology: a materialist critique of the normalization principle. Paper zur Konferenz "25 Years of Normailization, Social Role Valorization and Social Integration: A Retrospective and Prospective View", University of Ottawa, 10.-13- Mai 1994.
Postek, N. (2010): Politische Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Beispiel der Demokratiewerkstatt in Wien. Diplomarbeit an der Universität Wien.
Redmond, M. (2005): Co-researching with Adults with Learning Disabilities: Roles, Responsibilities and Boundaries. In: Qualitative Social Work, Vol. 4(1), S. 75-86.
Schlummer, W. (2011): Empowerment - Grundlage für erfolgreiche Mitwirkung und Teilhabe. In: Kulig, W., Schirbort, K. und Schubert, M. (Hrsg.): Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, S. 31-46.
Stalker, K.; Baron, S.; Riddell, S. und Wilkinson, H. (1999): Models of disability: the relationship between theory and practice in non-statutory organizations. In: Critical Social Policy, Vol. 19(1), S. 5-29.
Swain, J.; Heyman, B. und Gillman, M. (1998): Public Research, Private Concerns: ethical issues in the use of open-ended interviews with people who have learning difficulties. In: Disability & Society, Vol. 13, No. 1, S. 21-36
Theunissen, G. (2009): Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit. 2. Auflage, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau.
Theunissen, G. (2002): Inclusion - Partizipation - Empowerment. Leitbegriffe für eine Praxis des Miteinanders. Vortrag basierend auf dem Artikel "Inclusion, Partizipation und Empowerment - Behindertenarbeit im Zeichen einer Umorientierung", erschienen in: Soziale Arbeit 10, 2002, modifiziert und erweitert. Quelle: www.w.assista.org/files/georg_theunissen.pdf , Stand: 2012-01-20.
Theunissen, G. und Plaute, W. (2002): Handbuch Empowerment und Heilpädagogik. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau.
Wagner-Willi, M. (2001): Standortgegebundenheit und Fremdverstehen - wissenssoziologische Perspektive auf die Forschung zu Erfahrungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten. In: DIFGB (Hrsg.): Forschungsfalle Methode? Partizipative Forschung im Diskurs. Eigendruck der DIFGB, Leipzig, S. 37-45.
Walmsley, J. und Johnson, K. (2003): Inclusive Research with People with Learning Disabilities. Past, Present and Futures. Jessica Kingsley Publishers, London und Philadelphia.
Walmsley, J. (2001): Normalisation, Emancipatory Research and Inclusive Research in Learning Disability. In: Disability & Society, Vol. 16(2), S. 187-205.
Walmsley, J. (2004): Inclusive learning disability research: the (nondisabled) researchers role. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 32, S. 65-71.
WHO (2005): ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Genf.
Williams, V. (1999): Researching Together. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 27, S. 48-51.
Williams, V.; Simons, K. und Swindon People First Research Team (2005): More researching together: the role of nondisabled researchers in working with People First members. In: British Journal of Learning Disabilities, Vol. 33, S. 6-14.
Persönliches:
Gertraud Kremsner
Geboren am 5. Dezember 1983 in Oberwart/Burgenland
Ausbildung:
-
Volksschule in Unterschützen/Burgenland
-
Unterstufe am Evangelischen Realgymnasium mit Schwerpunkt Musik in Oberschützen/Burgenland
-
Oberstufe am Evangelischen Realgymnasium in Oberschützen/Burgenland im 5-jährigen Zweig für Studierende der Musik
-
Matura ebenda 2003 mit ausgezeichnetem Erfolg
-
Ab Herbst 2003 Studium der Pädagogik an der Universität Wien mit den Schwerpunkten Heil- und Integrative Pädagogik sowie Psychoanaytische Pädagogik
-
Im Wintersemester 2004/05 vom Studium aufgrund eines Aufenthaltes in Südamerika zum Zwecke eines Voluntariats beurlaubt
-
Voraussichtliches Studienende 2012
Zusätzliche Ausbildungen:
-
Unterstützung bei der Basisversorgung (UBV 100) an der SOB Wien
-
Lehrgang Unterstütze Kommunikation beim biv-Integrativ Wien
-
Berufliches:
-
Diverse Praktika in Einrichtungen der Behindertenhilfe
-
2004-2009 freie Dienstnehmerin in unterschiedlichen Einrichtungen eines Vereines für die Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten
-
Im Wintersemester 2005/06 Voluntariat in einer Einrichtung zur Betreuung von Straßen- und Marktkindern in Quito/Ecuador
-
2006-2009 Leitung von Urlaubsaktionen ebenda
-
Seit 2009 Anstellung in einer Wohngemeinschaft
Wissenschaftliche Praxis:
-
Seit WiSe 2008 Forschungsprojekt zum Thema "Inklusive Forschung und Empowerment" im Rahmen der Diplomarbeit. Damit einhergehend Mitarbeit am Seminar "Partizipative Forschungsmethoden - mit Menschen mit Lernschwierigkeiten", geleitet von Mag. Oliver Koenig und Mag. Tobias Buchner. Diplomarbeit über diese Thematik mit voraussichtlichem Abschluss 2012
-
24.-27.2.2010 Vortrag bei der Jahrestagung der Integrations- und InklusionsforscherInnentagung in Innsbruck zum Thema "Vier Semester Inklusive Forschung an der Uni Wien", Publikation zum Vortrag im Tagungsband.
-
25. bis 28.2.2009 Vortrag bei der Jahrestagung der Integrations- und InklusionsforscherInnentagung in Frankfurt/Main zum Thema "Inklusive Forschung und Empowerment" gemeinsam mit dem "Netzwerk Inklusive Forschung", Publikation zum Vortrag im Tagungsband.
Quelle:
Gertraud Kremsner: "Menschen mit Lernschwierigkeiten an die Uni? Über die Mitarbeit von ExpertInnen in eigener Sache an einem Seminar an der Universität Wien"
Diplomarbeit, Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosohie (Mag. Phil.) Studienkennzahl lt. Studienblatt: A297 Studienrichtiung laut Studienblatt: Diplomstudium Pädagogik Betreuer: Univ. Prof. Dr. Gottfried Biewer; Wien, im April 2012
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 24.09.2012
