Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und ihre mögliche Auswirkung auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe
Diplomarbeit an der Hamburger Fern-Hochschule HFH; Pflegemanagement. Erstprüfer: M.S.M. Stefan Kornherr, Zweitprüferin: Dr.rer.pol. Barbara Birkner
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
- 3 Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland
- 4 Auswirkungen auf vollstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe
- 5 Perspektiven für das Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der Gesetze und Rechtsordnungen
Abbildungsverzeichnis
- Abs.
-
Absatz
- A. d. V.
-
Anmerkung der Verfasserin
- AGG
-
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Art.
-
Artikel
- ASKM
-
Arbeits- und Sozialministerkonferenz
- BAGFW
-
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
- BAGWfbM
-
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V.
- BayBGG
-
Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz
- BeB
-
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V.
- bes.
-
besonders
- BGBl.
-
Bundesgesetzblatt
- BGG
-
Gesetz zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung
- BMAS
-
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
- BMFSFJ
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
- BRK
-
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)
- bzw.
-
beziehungsweise
- d. h.
-
das heißt
- ebd.
-
ebenda
- et al.
-
und andere
- etc.
-
und so weiter
- FLS
-
Fachleistungsstunde
- ff.
-
folgende
- GmbH
-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- HBG
-
Hilfebedarfsgruppe
- ICF
-
International Classification of Functioning, Disability and Health der Weltgesundheitsorganisation
- Kap.
-
Kapitel
- KEG
-
Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich
- NAP
-
Nationaler Aktionsplan der Bundesrepublik Deutschland
- OBA
-
Offene Behindertenarbeit
- PfleWoqG
-
Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung
- SGB
-
Sozialgesetzbuch
- STMAS
-
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
- u. a.
-
unter anderem
- UN
-
Vereinte Nationen
- UNTC
-
United Nation Treaty Collection
- u. U.
-
unter Umständen
- vgl.
-
vergleiche
- z. B.
-
zum Beispiel
- z. T.
-
zum Teil
Inhaltsverzeichnis
Die Eingliederungshilfe in Deutschland befindet sich seit einiger Zeit in einem grundlegenden Perspektivenwandel. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Deutschland die im Dezember 2006 in New York verabschiedete Behindertenrechtskonvention (im folgenden BRK) im März 2007 ratifiziert und im März 2009 in geltendes Recht umgesetzt hat, in dem das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen als Gesetz verabschiedet wurde. Dieses sichert jedem behinderten Menschen ein Leben in voller sozialer Teilhabe zu, das in inklusiven Gesellschaftsstrukturen barrierefrei und selbstbestimmt gelebt werden kann. Der Artikel 19 des Gesetzes zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gesellschaft“ erkennt explizit an, „...dass a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;…“ (BRK 2008: 1433). Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe sind in diesem Sinne besondere Wohnformen, in denen Menschen mit Behinderungen meist in Gruppenstrukturen zusammen leben, die sie sich weder in der Zusammensetzung noch als Tatsache selbst ausgesucht haben. Zusätzlich trat im Jahre 2005 das neu gestaltete Sozialgesetzbuch XII in Kraft, das im Paragraph 13 eindeutig den Vorrang von ambulanten vor stationären Leistungen festlegt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe Veränderungen zu kommen werden. Diese werden allerdings in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sein, da die Eingliederungshilfe von den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern finanziert wird und somit jedes Bundesland einen eigenen Gestaltungsspielraum besitzt.
Zur Umsetzung der BRK stellte die Bundesregierung im Juni 2011 einen nationalen Aktionsplan (im folgenden NAP) vor, der unter anderem einen Maßnahmenkatalog mit mehr als 200 Einzelmaßnahmen enthält, die in verschiedene Handlungsfelder gegliedert sind. Deutlich wird hervorgehoben, dass es wünschenswert ist, dass zusätzlich jedes Bundesland einen eigenen Aktionsplan erarbeitet. Der momentane Stand ist diesbezüglich sehr unterschiedlich, beispielsweise hat das Bundesland Rheinland-Pfalz bereits 2010 einen fertigen Aktionsplan vorgelegt, wohingegen Bayern erst in diesem Jahr einen beschlossen und veröffentlicht hat.
Ein weiterer erschwerender Faktor für eine langfristige Planung in und von stationären Einrichtungen ist die ungenügende und unsichere Datenlage. Um Leistungen und Angebote zu erweitern, braucht eine Einrichtung verlässliche Daten darüber, wie viele Menschen mit welchem Grad an Unterstützungsbedarf mittel- und langfristig Leistungen in Anspruch nehmen wollen, welche mehr und welche weniger nachgefragt werden und ob diese weiterhin zuverlässig von den Trägern der Sozialhilfe, in der Regel Kommunen und Bezirke, finanziert werden, da diese aufgrund der steigenden Kosten der Eingliederungshilfe ihrerseits Kostensenkungen und Einsparungen von den Einrichtungen fordern.
Ziel dieser Diplomarbeit soll es also sein, einen Überblick zu geben, wie sich der aktuelle Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und im Speziellen in Bayern darstellt, um daraus mögliche managerielle und finanzielle Auswirkungen für stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe abzuleiten. Zusätzlich werden noch die möglichen Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur untersucht. Daraus folgend sollen Handlungsempfehlungen für das zukünftige Pflegemanagement erarbeitet werden, die die strategische Planung mittel- und langfristig unterstützen könnten.
Im zweiten Teil der Arbeit wird ein allgemeiner Überblick zur Behindertenrechtskonvention gegeben, die geschichtliche Entstehung und die Ziele näher beleuchtet und der aktuelle Stand der Ratifizierung weltweit dargestellt. Danach wird die Autorin im dritten Teil detaillierter die Umsetzung der BRK in finanzielle und gesetzliche Grundlagen in Deutschland und als ein ausgewähltes Bundesland in Bayern beschreiben. Zusätzlich werden diese bisher unternommenen Maßnahmen aus Sicht der Wohlfahrtsverbände diskutiert.
Im vierten Teil werden dann nach Darstellung der Versorgungsstrukturen und der derzeitigen Finanzierung von vollstationären Einrichtungen mögliche Auswirkungen in managerieller und finanzieller Hinsicht und in Hinsicht auf die Bewohnerstruktur in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe untersucht. Abschließend werden dabei bereits Anforderungen an das zukünftige Management dargestellt.
Der fünfte Teil beschäftigt sich danach ausführlich mit Überlegungen und Perspektiven für das Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen. Darin fließen konzeptionelle Überlegungen genauso ein, wie dafür notwendige Strukturvoraussetzungen und mögliche zukünftige Finanzierungsformen.
Abschließend werden daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet und ein Ausblick in die zukünftige Entwicklung der Eingliederungshilfe und damit der in ihr verhafteten Organisationen und Einrichtungen unter dem Einfluss der UN-Behindertenrechtskonvention und des Art. 19 gewagt.
Inhaltsverzeichnis
Betrachtet man sich die oft leidvolle und sehr wechselhafte Geschichte behinderter Menschen, bleibt eines zusammenfassend festzustellen. Entscheidungen darüber, ob lebenswert oder nicht, wertgeschätzt oder nicht, erhaltenswert oder nicht haben immer die sie umgebenden Gesellschaften getroffen. Beispielsweise wurden in Ägypten (3000 v. Chr.) Blinde unter besonderen Schutz gestellt und andererseits durften Missgeburten von der Mutter erstickt werden (vgl. Eitle 2003: 16). Im Mittelalter hingegen werden auch vor dem Hintergrund einer christlichen Haltung „Mindersinnige Blinde und Gebrechliche in Klöster“ aufgenommen (ebd.: 17). Gleichzeitig werden aber im Zuge der Hexenverfolgung auch Behinderte verfolgt, da besonders geistig behinderte Menschen als „besessen“ galten. Der „Tiefpunkt“ an Wertschätzung gegenüber behinderten Menschen war sicherlich 1920 erreicht, als Karl Binding und Alfred Hoche ihr Buch „Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens“ veröffentlichen konnten und auch auf dieser Grundlage im Dritten Reich problemlos eugenische Maßnahmen umgesetzt werden konnten (vgl. ebd.: 24). Behinderte Menschen waren also immer abhängig vom jeweilig vorherrschenden Wertesystem und das fast bis ans Ende des 20. Jahrhunderts. Erst seit 1994 z. B. gibt es in Deutschland den „…veränderten Art. 3, Abs. 3 unseres Grundgesetzes, der eine Benachteiligung behinderter Menschen verbietet.“ (ebd.: 29).
Seit einigen Jahren allerdings vollzieht sich ein Paradigmenwechsel, vom Bild eines Menschen der in keiner Weise für sich sorgen und über sich entscheiden kann hin zu Menschen, die selbstbestimmt ein so selbständig wie mögliches Leben führen könnten, wenn die Gesellschaft sie nicht daran hindern würde. Dies zeigt auch eine der entscheidenden Formulierungen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen: „Behinderung resultiert aus der Beziehung zwischen Personen mit Beeinträchtigungen und den in Grundhaltungen und Umweltfaktoren bestehenden Barrieren, derart dass die vollständige und wirksame Beteiligung der Betroffenen auf Grundlage der Gleichheit mit anderen hindert.“ (Bielefeldt 2009: 8).
Für die Erarbeitung einer Konvention für behinderte Menschen gab es bereits mehrere Anläufe, besonders während der UN-Dekade der Behinderten von 1983-1992 (Bruns 2010: 10). Zwar galten die international anerkannten allgemeinen Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 auch genauso für behinderte Menschen, allerdings war man sich im Ad-hoc-Ausschuss darüber einig, dass - auch auf Grund der Tatsache, dass sie bisher kaum ausdrücklich benannt wurden - die spezifischen Bedürfnisse behinderter Menschen zu wenig Berücksichtigung finden. Zudem gehören behinderte Menschen „…weltweit gesehen zu den am meisten gefährdeten Gruppen, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten geht.“ (ebd.: 10). Daher soll die BRK unter anderem auch dazu dienen „…bereits bestehende .. menschenrechtliche .. Standards unter dem besonderen Blickwinkel der Menschen mit Behinderungen zu präzisieren und zu ergänzen.“ (Bielefeldt 2009: 13).
Im Dezember 2001 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen somit ein Ad-hoc-Ausschuss eingesetzt um „…ein umfassendes internationales Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderung zu erarbeiten.“ (Bruns 2010: 10). Innerhalb von 4 Jahren gelang es einen Textvorschlag zu erstellen, der schlussendlich am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York angenommen und verabschiedet wurde. Gleichzeitig wurde das dazugehörige Fakultativprotokoll verabschiedet. Erstmals wurde dabei eine Konvention auf den Weg gebracht, an der sehr viele Personen der Zivilgesellschaft und vor allem auch die Betroffenen selber und ihre Verbände in einem bis dahin unbekannten Ausmaß mitgewirkt haben.
Nachdem Deutschland als einer der ersten Staaten im Jahr 2007 die BRK unterzeichnet hatte, wurde im Jahr 2008 ein Zustimmungsgesetz erarbeitet, welches am 01.01.2009 in Kraft trat. Im Februar 2009 wurde daraufhin die Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Nach 30 Tagen der Hinterlegung ist endgültig das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ sowieso das Fakultativprotokoll in Deutschland in Kraft getreten und damit verbindliches Recht geworden.
Kritisch wird dabei diskutiert, dass die Bundesregierung trotz der Einwände von vielen Behindertenverbänden das englische Wort „inclusion“ mit dem deutschen Wort Integration übersetzt und in das Gesetz mit aufgenommen hat, z. B. wird im Artikel 24 der Originalfassung „…an inclusive education system at all levels…“ (BGBl. 2008: 1436) gefordert, wohingegen der deutsche Wortlaut von einem integrativen Bildungssystem auf allen Ebenen spricht (vgl. ebd.: 1436). Gleiches gilt für das englische Wort „participation“, z. B. in Artikel 3 Absatz c „Full and effective participation…„ (ebd.: 1424). Dieses wird hier mit Teilhabe und Teilnahme übersetzt. „Bei dieser Übersetzung gehen jedoch wesentliche Aspekte, die die Konvention mit dem Begriff „Partizipation“ verbindet, etwa der Aspekt der Mitbestimmung, verloren“ (Hirschberg 2010: 2). Daher fordert unter anderem Dr. Marianne Hirschberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoring-Stelle zur UN - Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte, den Begriff „Partizipation“ wieder in die Diskussion aufzunehmen (ebd.: 2). Ein drittes Beispiel für die nicht ganz stimmige Übersetzung betrifft das Wort „independence“, welches beispielsweise aus Sicht der Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V., hätte mit „Selbstbestimmung“ übersetzt werden müssen. Der Titel des Artikels 19, auf den sich diese Diplomarbeit noch ausführlicher beziehen wird, lautet im Original „Living independently and being included in the community“ (BGBl. 2008: 1433). Im Gesetz der Bundesregierung wurde dies übersetzt mit „Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ (ebd.: S.1433), gefordert in der Schattenübersetzung wird aber „Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ (vgl. Informationsschrift der Stadt Bamberg 2009: 15 der Schattenübersetzung).
Allerdings ist abschließend dazu zu sagen, dass - auch wenn Unstimmigkeiten bezüglich des deutsches Gesetzes bestehen - dieses völkerrechtlich keine Verbindlichkeit besitzt, sondern nur die englische Originalfassung und die genehmigten Übersetzungen in Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Dies bestimmt der Artikel 50 „Verbindliche Wortlaute“ (BGBl. 2008: 1452). „Das Völkerrecht gehorcht jedoch hinsichtlich der Geltung im nationalen Recht einer Besonderheit: Soweit einzelne Vorschriften hinreichend konkret gefasst sind gelten sie unmittelbar und sind sogenannte selbstvollziehende Normen (self-executing-rights), während andere Vorschriften in eine nationale Rechtsvorschrift transformiert werden müssen.“ (BeB 2010: 7).
Die UN-Behindertenrechtskonvention besteht aus einer Präambel (die allerdings rechtlich keinerlei Verbindlichkeit besitzt) und insgesamt 50 Artikeln. In den Artikeln 1-9 werden eher allgemeine Bestimmungen festgelegt, z. B. Ziel, Zweck, Prinzipien und Adressaten der Konvention. Danach geht es in den Artikeln 10-30 speziell um die einzelnen Menschenrechte, wie z. B. das Recht auf Leben (Art. 10), das Recht auf Zugang zur Justiz (Art. 13) oder das Recht auf unabhängige Lebensführung (Art. 19). Abschließend handelt es sich in den Artikeln 31-50 um Schlussbestimmungen zur Durchführung (Art. 33), zum Berichtswesen (Art. 35 und 36) oder Regelungen zum Unterzeichnen, Inkrafttreten oder Kündigen (Art. 42, 45, 48).
„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“ (BGBl. 2008: 1423)
Damit wird eines der stärksten und wichtigsten Anliegen der Konvention bereits im ersten Artikel angesprochen. Die Herausbildung eines Bewusstseins von Menschenwürde, einerseits bei den Betroffenen selbst und andererseits in der Gesellschaft als Ganzes ist eines der zentralen Anliegen der BRK, da sich von diesem Bewusstsein alle weiteren Zielsetzungen ableiten. „Der Begriff der Menschenwürde ist für den Menschenrechtsansatz von fundamentaler Bedeutung. … Von der Würde ist nicht nur ungleich häufiger als in anderen Menschenrechtsdokumenten die Rede … . Hinzu kommt, dass die Würde - sehr viel direkter als in anderen Menschenrechtskonventionen - auch als Gegenstand notwendiger Bewusstseinsbildung angesprochen wird“ ( Bielefeldt 2009: 5). Folgerichtig werden die Staaten durch die Konvention verpflichtet, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung zu ergreifen und zum Beispiel wirksame Kampagnen für die breite Öffentlichkeit einzuleiten und dauerhaft durchzuführen oder die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck des Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen (vgl. BGBl. 2008: 1427f.). Diese Forderung nach Bewusstseinsbildung auch der behinderten Menschen zieht sich weiter wie ein roter Faden durch die Konvention und wird z. B. auch im Artikel 24 Bildung ganz deutlich, in dem ein integratives, bzw. in der englischen Originalfassung ein „inklusives“ Bildungssystem für alle gefordert wird. Mit diesem soll ein lebenslanges Lernen ohne Diskriminierung und auf der Grundlage von Chancengleichheit mit dem Ziel das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen, ermöglicht werden (vgl. ebd.: 1436).
Folgerichtig ist die zweite große Zielsetzung der BRK Inklusion. „Die Inklusion behinderter Menschen, d. h. die Einbeziehung und Berücksichtigung ihrer Rechte und Bedürfnisse von Anfang an, sowie die Verwirklichung der Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist das Ziel der Konvention“ (im Vorwort der Informationsschrift der Stadt Bamberg zur UN-Konvention). Dies ist an sich kein neuer Gedanke, allerdings ist „…die starke Akzentsetzung auf soziale Inklusion, die ausdrücklich vom Postulat individueller Autonomie her gedacht und von dorther von vornherein als eine freiheitliche Inklusion definiert wird…“ eine neue Sichtweise, welche die Perspektiven in der Gesellschaft im Sinne eines wirklichen Paradigmenwechsels weg vom Fürsorgegedanken hin zu Teilhabe und Selbstbestimmung verändern können (Bielefeldt 2009: 16). Es geht darum, dass behinderte Menschen selbst bestimmen können und dürfen, es soll nicht mehr für sie, sondern mit ihnen gedacht werden. Notwendig hierfür ist das dritte große Anliegen der BRK - Barrierefreiheit. Dabei ist mit Barrierefreiheit ausdrücklich nicht nur die Erreichbarkeit öffentlicher Räume gemeint, sondern diese meint alle Hindernisse, die es behinderten Menschen erschweren, so selbständig wie nur irgend möglich zu leben. Diese Hindernisse sollen erfasst und systematisch entfernt werden. Beispiele für die angestrebte Barrierefreiheit sind: Gebärdendolmetscher in öffentlichen Institutionen oder Ämtern, Wahlschablonen für Blinde oder Internetauftritte immer auch in leichter Sprache. Dabei soll die Barrierefreiheit grundsätzlich präventiv gedacht werden, Andreas Bethke vom Bundeskompetenzzentrum fordert in diesem Zusammenhang, dass bei öffentlichen Vergaben Barrierefreiheit immer zur Anforderung erhoben werden sollte (vgl. Heß 2011: 6).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nicht Ziel der Konvention ist, spezielle Rechte für behinderte Menschen zu schaffen. „Sie konkretisiert vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Lebenslagen behinderter Menschen die universalen Menschenrechte und präzisiert die mit diesen universalen Rechten korrespondierenden staatlichen Verpflichtungen“ (Aichele 2008: 4). Dabei füllt, als zusätzlicher Aspekt, das Verbot von Diskriminierung aufgrund von Behinderung, eine wichtige Rolle aus. Dieses Verbot „…erstreckt sich ausdrücklich auf die bürgerlichen, kulturellen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen sowie alle sonstigen Lebensbereiche“ (ebd.: 5).
Insgesamt geht es in der Konvention also darum, die universalen Menschenrechte auch für behinderte Menschen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebenslagen und in Verbindung mit einem absoluten Diskriminierungsverbot einzufordern. „Demnach gehören die Menschenrechte und das Diskriminierungsverbot untrennbar zusammen. Die Konvention entwickelt die Verzahnung dieser beiden Bereiche zum Schutz von Menschen mit Behinderungen weiter“ (ebd.: 5).
Zur Überwachung und Überprüfung der Umsetzung der BRK in den einzelnen Ländern ist jeder Staat verpflichtet, zwei Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen einen Bericht vorzulegen, einen sogenannten Staatenbericht, und danach alle vier Jahre einen Folgebericht. Deutschland hat den ersten Staatenbericht im August 2011 im Bundeskabinett beschlossen.
Erforderlich für das Inkrafttreten des Übereinkommens war die Unterzeichnung, der Beitritt oder die Ratifizierung von mindestens 20 Staaten. „Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.“ (BGBl. 2008: 1450). Dies geschah am 03.05.2008 „Entry into force: 3 May 2008, in accordance with article 45 (1).“ (vgl. UNTC, Chapter IV, 15). Bis zum heutigen Tage haben 155 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet und 130 haben es ratifiziert (vgl. ebd.). Ratifikation bedeutet, dass in diesen Staaten der völkerrechtliche Vertrag auch als Gesetz in Kraft getreten und damit auch nationales Recht ist. Das dazugehörige Fakultativprotokoll wurde bisher von 91 Staaten unterzeichnet und von 76 ratifiziert (vgl. UNTC, Chapter IV, 15. a). Wenn ein Staat das Fakultativprotokoll annimmt „…bekommen Personen oder Personengruppen das Recht, sich in Einzelfällen an den „Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ zu wenden“ (Aichele 2008: 7). Dieser Ausschuss prüft die Eingabe auf Zulässigkeit - dafür müssen vorher alle innerstaatlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden - danach prüft er, ob ein Verstoß gegen die Konvention vorliegt und sollte dem - nach Ansicht des Ausschusses - so sein, spricht er eine Empfehlung an den betreffenden Vertragsstaat aus. Eine verbindliche Entscheidung allerdings trifft er nicht (vgl. ebd.: 7).
Deutschland hat auf Empfehlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte beides, die Konvention und das dazugehörige Fakultativprotokoll unterzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Wie bereits weiter oben ausgeführt ist das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ im März 2008 als Gesetz in Deutschland in Kraft getreten. Daraus ergab und ergibt sich weiterer Handlungsbedarf. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt, am 01.07.2001, wurde das Sozialgesetzbuch zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, SGB IX, verabschiedet, welches das Schwerbehindertenrecht und das Rehabilitationsrecht (vorher getrennt) miteinander verbunden hat. Ergänzt wird dieses Gesetz seit April 2004 durch das „Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen“. Schon die Erarbeitung des SGB IX deutete auf den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik hin. Vorrangige Ziele dieses neuen Gesetzbuches sind nämlich bereits Teilhabe und Selbstbestimmung. So wird zum Beispiel im § 9 Absatz 1 deutlich hervorgehoben, dass den Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen werden soll. „Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen“ (§ 9 Abs. 1 SGB IX). Kritisch ist in diesem Zusammenhang die Formulierung berechtigte Wünsche zu sehen. Die Feststellung der Berechtigung treffen nämlich wiederum die Leistungsträger. Im § 17 SGB IX wird erstmalig das Persönliche Budget eingeführt, das Leistungsberechtigten die Möglichkeit eröffnet, statt Sachleistungen Geldleistungen zu erhalten und sich damit Leistungen selber „einzukaufen“. „Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“ (§17 Abs. 2 SGB IX). Auch mit dieser Möglichkeit möchte der Gesetzgeber die Selbstbestimmung behinderter Menschen weiter stärken. Das SGB IX ist allerdings kein Leistungsgesetz, sondern bildet vielmehr einen gesetzlichen Rahmen.
Für die konkreten Leistungen behinderter Menschen ist die Eingliederungshilfe verantwortlich. Diese ist gesetzlich der Sozialhilfe zugeordnet, somit dem Sozialgesetzbuch XII. Dort werden im Kapitel 6 die Leistungsberechtigten, die Aufgaben und die Leistungen der Eingliederungshilfe konkretisiert. Die Verankerung der Eingliederungshilfe in die Sozialhilfe wird seit einiger Zeit von vielen Behindertenverbänden abgelehnt und auch in der Politik kontrovers diskutiert, nur sind die Gründe dafür verschiedene. Die Behindertenverbände lehnen dies ab, da somit immer noch nicht von wirklicher Selbstbestimmung die Rede sein kann, sondern weiterhin die Leistungsberechtigten im Fürsorgeprinzip verharren müssen und außerdem von der jeweiligen Kassenlage ihrer zuständigen örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger abhängig sind. (vgl. BAGWfbM 2012) Sie fordern eine bundeseinheitliche Gleichbehandlung aller behinderten Menschen in Deutschland auch in finanzieller Hinsicht. Dafür soll die Eingliederungshilfe ein eigenständiges Gesetz werden mit einheitlichen Instrumenten zur Bedarfsermittlung und finanziert durch eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Kosten.
Die Politik (auf der Ebene der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger) fordert ihrerseits eine dringende Reform vor allem aus Kostengründen. Die finanzielle Situation der Sozialhilfeträger lässt eine Umgestaltung der Eingliederungshilfe nur mit Beteiligung des Bundes zu.
Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet das Gesetz zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung (BGG) vom 27. April 2002. Auch dieses Gesetz hat zum Ziel „…die Benachteiligung behinderter Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben und in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen….“ (§1 BGG). Auf der Grundlage des Behindertengleichstellungsgesetzes haben alle 16 Bundesländer zusätzlich eigene Gleichstellungsgesetze erarbeitet und verabschiedet. Ein für behinderte Menschen bedeutender Artikel im BGG ist der §4 Barrierefreiheit. Dieser verpflichtet unter anderem zu barrierefreiem Bauen. Bezogen auf den Artikel 19 BRK wird dies in Zukunft die Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen erhöhen, da dieses Gesetz auch für zivile Neubauten gilt.
Die nächste gesetzliche Grundlage, die an dieser Stelle erwähnt werden muss, ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Es trat am 18. August 2006 in Deutschland in Kraft. „Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (§1 AGG). Es behandelt dabei Diskriminierungsverbote vor allem im Arbeitsrecht und im Zivilrechtsverkehr. Somit können unter anderem auch behinderte Menschen z. B. bei der Vergabe des Arbeitsplatzes oder auf der Suche nach einer Wohnung nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden.
Eine letzte Grundlage zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland hat die Bundesregierung mit dem 2011 veröffentlichten Nationalen Aktionsplan geschaffen. Dieser hat allerdings keinen Gesetzescharakter und somit keine rechtliche Verbindlichkeit. „Der Aktionsplan ist ein Maßnahmenpaket und ein Motor für Veränderung - aber kein Gesetzespaket. Es geht darum, bestehende Lücken zwischen Gesetzeslage und Praxis zu schließen“ (vgl. BMAS 2011: 12). Vielmehr ist es ein Katalog, der unterteilt in 12 Handlungsfelder über 200 konkrete Einzelmaßnahmen enthält. Dabei bezieht sich vor allem das Handlungsfeld 3.7 Bauen und Wohnen auf den Artikel 19 der BRK und hebt die Wichtigkeit der „Schaffung und Förderung geeigneten Wohnraums für behinderte Menschen“ hervor (ebd.: 70). Explizit spricht die Bundesregierung hier Träger von Wohnangeboten an, ihr ambulantes bzw. alternatives Wohnangebot für geistig behinderte Menschen zu erweitern um auch diesen wirkliche Wahlmöglichkeiten im Bereich Wohnen zu eröffnen (vgl. ebd.: 73).
Während die Umsetzung der BRK in gesetzliche Grundlagen bereits vorangeschritten ist, hat sich im Bereich der Finanzierung seit 1961 nichts Wesentliches verändert. Die Regelungen dafür wurden1961 im ersten Bundessozialhilfegesetz verankert. Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beliefen sich nach der Sozialhilfestatistik von destatis.de im Jahr 2010 auf 12,5 Milliarden Euro (vgl. Duschek 2012: 11). Die Eingliederungshilfe ist gesetzlich, wie weiter oben ausgeführt, der Sozialhilfe zugeordnet. Die Zuständigkeit liegt also bei den örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern, das heißt, dass diese auch für die Finanzierung zuständig sind. Die Sozialhilfe, und somit auch die Eingliederungshilfe, fungiert dabei als Zweitsicherung nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass sie dann tätig wird, wenn kein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. Diese können beispielsweise sein: die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung oder die gesetzliche Rentenversicherung. Das vorrangige Ziel der Eingliederungshilfe ist, Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen Eingliederung in das Arbeitsleben zu ermöglichen und sie soweit als möglich von Pflege unabhängig zu machen. Dafür steht ein umfangreicher Leistungskatalog zur Verfügung, der die verschiedensten Maßnahmen umfasst. Diese sind sehr allgemein gefasst und nicht abschließend festgelegt, damit sie neuesten wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden können (vgl. Wansing 2005: 119). Das neueste und bisher letzte Gesetz zur Reform der Eingliederungshilfe, trat im Zuge der Sozialhilfereform bereits im Januar 2005 in Kraft. Allerdings ist durch die Umsetzung der UN-Konvention auch ein „Inklusionsanspruch“ entstanden. Unter anderem auch aus diesem Grund, steigen die Kosten für die Eingliederungshilfe jährlich an, in nur vier Jahren bis 2007 um 9 Prozent. (vgl. BAGFW 2010: 139). Dies bedeutet für die örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger jährlich steigende Ausgaben. Hinlänglich bekannt ist, dass die Städte und Kommunen in Deutschland hoch verschuldet und überbelastet sind. Da die Eingliederungshilfe der Sozialhilfe zugeordnet ist, die sich aus den Steuern der Städte und Kommunen finanziert, wird seit einigen Jahren von diesen gefordert, konkrete Finanzierungsregelungen für „Inklusion“ zu schaffen. „Die Verschuldung der Kommunen, …, hat sich im Zeitraum von 2000 bis 2008 um 18 Prozent erhöht auf 106,2 Milliarden Euro“ (BAGFW 2010: 139). Aktuell tritt auch aus diesem Grund wieder die Diskussion um ein Bundesleistungsgesetz in den Vordergrund. Damit soll einerseits eine bundeseinheitliche Regelung in der Eingliederungshilfe erreicht werden (somit wären die Leistungen nicht von der Kassenlage der Sozialhilfeträger abhängig) und andererseits soll dadurch ein Teil der Kosten vom Bund übernommen werden um die Kreise und Kommunen zu entlasten. Des Weiteren würde damit endlich der Forderung nach einem einheitlichen Bedarfsfeststellungsverfahren Rechnung getragen. Im Mai 2012 hat das Bundesland Bayern einen Erschließungsantrag zur Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes im Bundesrat eingebracht. Im Juni 2012 wurde im Rahmen der Verhandlungen zum Europäischen Fiskalpakt von der Bundesregierung die Zusage an die Bundesländer gegeben, in der nächsten Legislaturperiode, ab 2013, ein eigenständiges Bundesleistungsgesetz zu verabschieden und sich finanziell an den Kosten für die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu beteiligen (vgl. BAGWfbM 2012).
Die Reaktionen der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf die sozialen, ökonomischen und politischen Entwicklungen die sich durch die Umsetzung der BRK in Deutschland ergeben sind vielfältig und haben unterschiedliche Tendenzen (vgl. Wansing 2005: 160). Auf der einen Seite versuchen diese naturgemäß ihre alten Strukturen aufrecht zu erhalten, um ihre bestehenden Angebote zu sichern und auszubauen (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite traten und treten die Wohlfahrtsverbände schon immer als die Fürsprecher behinderter Menschen auf und können sich natürlich vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungen nicht den aktuellen Veränderungen in der Behindertenpolitik entziehen. Daher ist ihnen auch ein Bemühen, sich den aktuellen Anforderungen zu stellen, nicht abzusprechen. Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege arbeiten zusammen unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (im folgenden BAGFW). Zu ihnen gehören der Deutsche Caritasverband, das Diakonische Werk, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden und das Deutsche Rote Kreuz. Dabei ist „Ziel aller Aktivitäten … die Verbesserung von Lebenslagen“ [benachteiligter Bevölkerungsgruppen] (BAGFW o. J.). In diesem Sinne bemüht sich die BAGFW auch um eine vollständige Umsetzung der BRK in Deutschland und wirkt aktiv an den Reformbemühungen der Eingliederungshilfe mit. Zentrale Forderungen des BAGFW sind dabei u. a.:
-
Das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe. Das nach dem Fürsorgeprinzip gestaltete System erscheint aufgrund des Paradigmenwechsels der mit der BRK begonnen hat, nicht mehr zeitgemäß.
-
Die Weiterentwicklung des Behindertenbegriffs im Sinne eines ICF - basierten Ansatzes unter Berücksichtigung des in der BRK beschriebenen Grundverständnisses eines dynamischen Behindertenbegriffs (vgl. Kohlisch 2009a: 2).
-
Die Aufrechterhaltung des Wunsch- und Wahlrechtes ebenso wie die Aufrechterhaltung des Bedarfsdeckungs- und Individualisierungsprinzips, gegebenenfalls lebenslang ohne Zugangsgrenzen zu den Leistungen der Teilhabe (vgl. ebd.).
-
Eine bundesweit einheitliche Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung mit Hilfe eines standardisierten Assessmentverfahrens. Dabei sollte die Bedarfsfeststellung möglichst getrennt werden von der Teilhabeplanung und von unabhängiger Seite, nicht den Leistungsträgern, stattfinden (vgl. ebd.: 3).
Der Hauptkritikpunkt den u. a. die Verbände an der bisher geleisteten Arbeit der Bundesregierung, hier speziell der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (im folgendem ASKM), vorbringen, ist der, das allen Umgestaltungsbemühungen und allen Reformbeteuerungen zum Trotz der Kostenfaktor immer voran gestellt wird. Die Umgestaltung der Eingliederungshilfe soll immer unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität stattfinden (vgl. Zinke 2011). Das Wunsch- und Wahlrecht bleibt weiterhin in dem Punkt eingeschränkt, dass der Leistungsträger Wünsche des Leistungsempfängers ablehnen kann, sofern dadurch ein Mehraufwand entsteht (vgl. § 5 Abs. 2 SGB VIII). Aus Sicht der Verbände sind damit die Hilfeempfänger weiterhin auf „Almosen“ der Sozialhilfeträger angewiesen. Auch aus diesem Grund unterstützen sie die Forderung nach einem Bundesleistungsgesetz und somit der finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten verbunden mit der Hoffnung, dass dann das ungeteilte Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung nicht von der jeweiligen Kassenlage des Sozialhilfeträgers abhängig ist. Diese Befürchtung hegen die Verbände außerdem aufgrund der Gesetzesinitiative zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich, die vom Bundesland Bayern 2004 in den Bundesrat eingebracht wurde. Dieses enthält unter anderem die Forderung nach der „Beseitigung der Verpflichtung zu Erfüllung von Wünschen (Wahlrecht bei der Auswahl von Leistungsanbietern), wenn diese mit Mehrkosten verbunden ist“ (KEG 2004: 2).
Ein letzter Kritikpunkt den die Verbände massiv an der ASKM üben, ist die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Dass dieser einer Neudefinition bedarf, ist auch für die Wohlfahrtsverbände unstrittig, allerdings ist die Zielsetzung, die damit verbunden ist, aus ihrer Sicht indiskutabel. „Dass die Arbeits- und Sozialminister über eine Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs eine Entlastung für den nachrangigen Leistungsträger (Sozialhilfe) erhoffen, ist kaum verwunderlich“ (Der Paritätische Berlin 2012). Hierbei ist besonders die Abgrenzung zur Eingliederungshilfe problematisch. Die BAFGW fordert daher, dass eine „integrierte Erbringung von Leistungen der Pflege .. für Menschen mit Behinderungen, die einen pflegerischen Bedarf haben, auch bei unterschiedlicher leistungsrechtlicher Zuständigkeit sicherzustellen und der Vorrang der Zielstellungen der Eingliederungshilfe umzusetzen [ist]“ (Kohlisch 2009: 1). Nach eigener Aussage beobachten die Verbände eine zunehmende Praxis der Kostenträger, eine Unterscheidung hinsichtlich dessen, was bei einem Menschen im Vordergrund steht, vorzunehmen, entweder „die Teilhabe“ oder „die Pflege“ und entsprechend der Zuordnung werden vermehrt Menschen in „Pflegeeinrichtungen“ verwiesen. Diese Zuordnung lehnen die Verbände kategorisch ab und führen dazu weiter aus: „Das Recht auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (und auf Eingliederungshilfe) ist weder von Art und Schwere der Behinderung, noch vom Lebensalter oder vom Umfang des Pflegebedarfs abhängig. Pflege dient auch dazu, Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus steht eine solche Sichtweise im Widerspruch zu dem in der UN Konvention und in der ICF beschriebenen dynamischen Behinderungsbegriff“ (ebd.: 2f.).
Trotz ihrer intensiven Arbeit für die vollständige Umsetzung der BRK in Deutschland stehen letztendlich auch die Wohlfahrtsverbände selbst in der Kritik, wegen ihrer vorherrschenden Monopolstellung, der mangelnden Konsumentensouveränität und der schwachen Stellung der Leistungsempfänger (vgl. Wansing 2005: 161). Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie „…ihre exklusiven politischen Einflusskanäle für die Sicherung ihrer Bestandsvoraussetzungen und Handlungschancen nutzen“ (Olk 2005: 1913). Damit behindern bzw. mindestens bremsen die Verbände den „wohlfahrtspluralistischen Diskurs“ (Wansing 2005: 161). Zudem werden ihre Strukturen als ineffizient und intransparent wahrgenommen. In Zeiten sich verknappender Ressourcen wird daher auch eine Vergleichbarkeit der Leistungen gefordert, die über eine verstärkte Transparenz und die Verpflichtung zur Leistungsbeschreibung erfolgen soll (vgl. ebd.: 162). Ebenso erhofft man sich von der Umstellung auf prospektive Entgelte die Abschaffung unwirtschaftlicher Leistungserstellung (vgl. ebd.).
Es bleibt aber festzuhalten, dass „trotz der vielfältigen Kritik an der freien Wohlfahrtspflege und des massiven Modernisierungsdrucks .. die Bedeutung ihrer Leistungen auch für Menschen mit Behinderung nach wie vor gewaltig und nicht zu unterschätzen [ist].“ (ebd.: 163).
Am 12.März 2013 hat die bayerische Staatsregierung den von Sozialministerin Christine Haderthauer vorgelegten Aktionsplan beschlossen. An der Erarbeitung dieses Plans haben alle Ministerien und über 140 Verbände und Organisationen von Menschen mit Behinderungen mitgewirkt (vgl. Haderthauer 2013). Der Aktionsplan setzt verschiedene Schwerpunkte in der bayerischen Behindertenpolitik. Dabei sind unter anderem zu nennen:
-
„Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Belange von Menschen mit Behinderung und die Achtung ihrer Rechte, ihrer Würde und ihrer Fähigkeiten, z.B. durch Schulungen der Mitarbeiter in der Verwaltung sowie durch eine geplante Öffentlichkeitskampagne.
-
Inklusive Bildung auf allen Ebenen, begonnen in der frühesten Kindheit.
-
Die Teilhabe am Arbeitsleben. Hierzu enthält der Aktionsplan ein ganzes Bündel an Maßnahmen wie beispielsweise das Programm „Berufsorientierung Individuell“, das Schülerinnen und Schüler beim Übergang von allgemeinbildenden Schulen in das Arbeitsleben unterstützt.
-
Die Beseitigung doppelter Diskriminierung von Mädchen und Frauen mit Behinderung, etwa durch Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und –intervention. Ein wichtiger Ansatz ist hier die Förderung von Frauenbeauftragten in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
-
Maßnahmen zur Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.
-
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung sowie volle Kostenübernahme der Eingliederungshilfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe durch den Bund“ (vgl. ebd.).
Der Aktionsplan umfasst 101 Seiten und gliedert sich in 4 Kapitel. Im 3. Kapitel werden die verschiedenen Handlungsfelder konkretisiert und im Anschluss daran werden ihnen die entsprechenden Ziele und Maßnahmen zugeordnet. Ein eigenes Kapitel widmet die Staatsregierung nochmals ihrer Forderung nach einem Bundesleistungsgesetz und damit auch der vollen finanziellen Kostenübernahme der Eingliederungshilfe durch den Bund (vgl. STMAS 2013: 71). Dabei beruft sich Bayern auf die Unterstützung vieler Bundesländer und verschiedener Verbände, insbesondere des Vereins für öffentliche und private Fürsorge (ebd.: 72).
Weitere Punkte, in denen die UN-Konvention in Bayern bereits umgesetzt wurde, sind unter anderem:
-
das bayerische Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG), das in enger Anlehnung an das Bundesgleichstellungsgesetz am 1. August 2003 in Kraft getreten ist und seit dem 31.Juli 2008 unbefristet gilt. Es ergänzt außerdem das BGG in verschiedenen Lebensbereichen und verpflichtet alle Bezirke, Landkreise und kreisfreie Gemeinden einen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu bestellen.
-
Die Aufnahme des Benachteiligungsverbots für behinderte Menschen in die bayerische Verfassung 1998.
-
Die Verabschiedung des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) am 8.Juli 2008. Mit diesem Gesetz wird erstmals ausdrücklich die Lebensqualität (Art. 1, Abs. 1: Satz 2 PfleWoqG) und die Wohnqualität (ebd.: Satz 3) in den Blickpunkt genommen „…und damit letztlich als ordnungsrechtliche Definition der Ergebnisqualität vorgegeben“ (Burmeister et al. 2009: 4).
-
Im Oktober 2009 beschloss das Bayerische Sozialministerium zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Bezirken eine „Richtlinie zur Förderung von ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit körperlicher und / oder geistiger Behinderung sowie sinnesgeschädigten und chronisch kranken Menschen (Förderrichtlinie Regionale „Offene Behindertenarbeit“) (vgl. Bayrische Staatsregierung 2009). Diese trat am 1.1.2010 in Kraft und soll einheitliche Standards in den regionalen OBA- Diensten sichern. Zusätzlich wird diese aber derzeit noch unter Berücksichtigung der BRK überarbeitet (vgl. STMAS 2013: 44).
-
Die Erarbeitung von Eckpunkten zur Umsetzung dezentraler Wohnstrukturen für Menschen mit körperlicher Behinderung, Sinnesbehinderung und/oder geistiger Behinderung unter dem Aspekt der Inklusion im Dezember 2010. Diese sollen für Träger von Einrichtungen eine Orientierungshilfe darstellen, um dezentrale und ambulante Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen aufzubauen (vgl. STMAS 2013: 44). Gleichzeitig geben sie Einrichtungen Hilfe dabei, wie innerhalb dieser inklusives Wohnen und Leben organisiert werden kann, bzw. welche Möglichkeiten es geben kann, freigewordenen Gebäuden und Flächen umzuwandeln und weiterhin zu nutzen ( vgl. STMAS 2010: 12ff.).
-
Die Novelle des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen vom 13.07.2011. Nach dieser ist inklusiver Unterricht Aufgabe aller Schulen und nur noch die Eltern von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf entscheiden darüber, welche Schule ihr Kind besucht. Das vorher erforderliche Kriterium der „aktiven Teilnahme“ entfällt und auch die Schwere der Beeinträchtigung steht nicht mehr im Vordergrund. Allerdings ist die freie Schulwahl dahingehend eingegrenzt, dass auch das Kindeswohl der Mitschüler nicht gefährdet werden darf und der Schulaufwandsträger die Aufnahme ablehnen darf, wenn die erhebliche Mehraufwendungen entstehen würden (vgl. Deutscher Städtetag 2011: 9).
Inhaltsverzeichnis
In Deutschland lebten im Jahr 2009 nach den Ergebnissen des Mikrozensus ca. 9,6 Millionen amtlich anerkannte behinderte Menschen (vgl. Pfaff 2012: 1). Davon gilt der größte Teil als „schwerbehindert“, das heißt der Grad der Behinderung ist 50% oder mehr. Demgegenüber steht die Anzahl der Leistungsempfänger der Eingliederungshilfe. Daten darüber kann man dem Bericht „Ergebnisse der Sozialstatistik 2010“ entnehmen, der online von destatis.de veröffentlicht wird. Demnach erhielten 2010 ca. 770.000 Menschen Leistungen aus der Eingliederungshilfe, davon rund 57% ausschließlich innerhalb von Einrichtungen (vgl. Duschek 2012: 250). Die ersten diesbezüglich veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2001 weisen noch eine Zahl von 555.000 Leistungsempfängern aus (Haustein 2003: 247). Somit ist die Zahl der Empfänger von Leistungen aus der Eingliederungshilfe in nur 9 Jahren um ca. 38,7 % gestiegen.
Im Jahr 2006 wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (im folgenden BMFSFJ) der erste Bericht über die Situation von Bewohnern und Bewohnerinnen in Heimen veröffentlicht. Dieser enthält unter anderem auch einige Strukturdaten zur stationären Behindertenhilfe. Demnach gab es 2003 ca. 5100 Einrichtungen mit insgesamt rund 179.000 Plätzen (vgl. BMFSFJ 2006: Kap. 7.5). Dabei reichte auch schon damals die Angebotsstruktur von Wohnstätten (Einrichtungen ohne Tagesstruktur) über betreute Wohngemeinschaften bis hin zu ambulant betreutem Wohnen unter dem Dach großer stationärer Einrichtungen. Dabei geht das BMFSFJ aber davon aus, dass das größte Angebot an Plätzen in Wohnheimen mit Tagesstruktur besteht (vgl. ebd.: Kap.7.5). Der überwiegende Teil der Leistungsempfänger ist dabei die Gruppe der geistig und geistig-mehrfachbehinderten Menschen mit 65% (vgl. ebd.: Kap. 7.5). Insgesamt beliefen sich zu diesem Zeitpunkt die Bruttoausgaben für die Eingliederungshilfe auf 11,5 Milliarden Euro (vgl. ebd.: Kap. 7.4), im Jahr 2010 wie bereits weiter oben angeführt schon auf 12,5 Milliarden Netto (vgl. Duschek 2012: 11).
Eine weitere Quelle zur Darstellung der derzeitigen Versorgungsstruktur bietet die Gesamtstatistik der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege ( im folgenden BAGFW ). Diese Statistik setzt sich zusammen aus Daten aller Wohlfahrtsverbände Deutschlands und schlüsselt sich unter anderem nach Einrichtungszahlen gesamt und nach Arbeitsbereichen und Arten unterschieden auf, genauso wie nach Plätzen oder auch Beschäftigten in diesen Bereichen. Der BAGFW zufolge gab es im Jahr 2008 in Deutschland insgesamt 5978 stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen mit insgesamt 181188 Plätzen/Betten ( vgl. BAGFW 2009: 33). In der ersten veröffentlichen Gesamtstatistik wurde die Zahl der stationären Einrichtungen noch mit 3756 und insgesamt 133146 Plätzen angegeben (vgl. BAGFW 2000). Anhand der dargestellten Daten kann man eine deutliche Zunahme der Zahl stationärer Einrichtungen innerhalb relativ kurzer Zeit erkennen, obwohl bereits seit 2005 der Grundsatz „ambulant vor stationär“ im SGB XII fest verankert wurde.
Abbildung 1. Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger von Eingliederungshilfe gesamt und in Einrichtungen mit linearen Trendlinien

Zusammengefasst bleibt also festzuhalten, dass über die Hälfte der behinderten Menschen mit Unterstützungsbedarf in stationären Wohneinrichtungen mit zwar unterschiedlicher Angebotsstruktur, aber dennoch im „Heim“ wohnt. In der allgemeinen Tendenz wird außerdem davon ausgegangen, dass sich zukünftig die Anzahl der stationär betreuten Menschen weiterhin erhöhen wird. Als Ursachen hierzu werden verschiedene Gründe gesehen, z. B. mehr Zu- als Abgänge, eine höhere Lebenserwartung auch bei Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aufgrund besserer Gesundheitsvorsorge, Ernährung und Hygiene, ein früheres Eintrittsalter und der insgesamte Anstieg „schwerbehinderter“ Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts (vgl. Wunder 2009: 36).
Um die möglichen Auswirkungen des Artikels 19 der UN-Behindertenrechtskonvention auf vollstationäre Einrichtungen untersuchen zu können, wird im nächsten Abschnitt die derzeitige Finanzierung dieser Einrichtungen dargestellt.
Der größte Teil der in Deutschland existierenden stationären Behinderteneinrichtungen befindet sich in freier Trägerschaft unter dem Dach einer der großen Wohlfahrtsverbände. Zu diesen zählen z. B. das Diakonische Werk, der Deutsche Caritasverband oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Organisatorisch sind sie oft dem Non-Profit Sektor als gemeinnützige GmbHs zugeordnet. Damit sind sie ganz oder teilweise von Steuerzahlungen befreit (vgl. Arnold, Maelicke 2009: 218). Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe finanzieren sich aktuell noch größtenteils durch ein pauschales Vergütungssystem (Regelfinanzierung). Dieses „…geht zurück auf die bis 1994 im Sozialhilferecht gültige Finanzierungslogik des ,Selbstkostendeckungsprinzips‘, wonach die jährlichen Gesamtkosten für die anerkannten Plätze einer Einrichtung auf die Kosten für eine stationäre Maßnahme (,Heimplatz‘) und diese auf Tagesentgelte (,Pflegesätze‘) umgerechnet und dann vom Kostenträger erstattet werden“. (Schädler et al. 2008: 68). Seit Mitte der 1990 Jahre wurden durch den Gesetzgeber Regelungen geschaffen, die eine Umstellung auf Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen ermöglichen sollten, mit dem vorrangigen Ziel die Ausgaben in der Behindertenhilfe zu begrenzen (vgl. ebd.: 68). Danach schließt jede Einrichtung mit den zuständigen Kostenträgern, dies sind die örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger je nach Zuständigkeit, ein prospektives (dies bedeutet für einen bestimmten zukünftigen Vereinbarungszeitraum, nachträgliche Verluste werden nicht mehr ausgeglichen) Leistungsentgelt ab. Berechnet wird dieses Entgelt nach Pauschalen. Diese werden unterschieden in: Grundpauschale (Unterkunft und Verpflegung,), Maßnahmenpauschale (daraus ergibt sich unter anderem die Personalausstattung) und die Investitionspauschale (Miete, Anlagen, Ausstattung etc.) (vgl. Kohlhoff 2002: 76). Leistungsentgelte werden nur mit Einrichtungen verhandelt, die vorher mit den zuständigen Sozialhilfeträgern eine Leistungs-, eine Vergütungs- und eine Prüfvereinbarung geschlossen haben (vgl. ebd.: 77). Innerhalb der Berechnung der Maßnahmenpauschale ist nach Gruppen für Hilfeempfänger mit vergleichbarem Hilfebedarf zu unterscheiden und zu kalkulieren (vgl. ebd.: 78). Zur Feststellung des Hilfebedarfs gibt es keine deutschlandweite einheitliche Regelung, aber es haben sich verschiedene Messverfahren etabliert. Ein sehr bekanntes Beispiel ist das sogenannte „Metzler-Verfahren“, das die Leistungsempfänger je nach Hilfebedarf in 5 verschiedene Hilfebedarfsgruppen (im folgenden HBG) einwertet. Die Eingruppierung erfolgt nach verschiedenen Aktivitätsbereichen für den Lebensbereich Wohnen/Alltägliche Lebensführung und den dazugehörigen Aktivitätsprofilen je nach Unterstützungsbedarf. Um die derzeitige Finanzierung anschaulicher darzustellen ein Beispiel:
Eine Einrichtung bekommt als Grundpauschale einen monatlichen Betrag von 1.000,00 €, einen Investitionsbetrag von 500,00 € und als Maßnahmenpauschale für einen Klienten der Hilfebedarfsgruppe 2 monatlich 3.500,00 € bzw. für einen Klienten der Hilfebedarfsgruppe 4 monatlich 6.000,00 €. Dies ergibt für die Einrichtung für den Bewohner in Hilfebedarfsgruppe 2 einen monatlichen Gesamtbetrag von 5.000,00 € und für den Bewohner der Hilfebedarfsgruppe 4 einen monatlichen Gesamtbetrag von 7.500,00 €. Übersichtlicher lässt sich dies in einer Tabelle darstellen:
|
Klient 1 – HBG 2 |
Klient 2 – HBG 4 |
|
|---|---|---|
|
Grundpauschale |
1.000 € |
1.000 € |
|
Investitionspauschale |
500 € |
500 € |
|
Maßnahmepauschale |
3.500 € |
6.000 € |
|
Gesamtbetrag: |
5.000 € |
7.500 € |
(eigene Darstellung)
Des Weiteren sind mit den Kostenträgern für die einzelnen Hilfebedarfsgruppen Personalschlüssel zu vereinbaren. Somit ergibt sich dann aus der Maßnahmenpauschale aller Hilfeempfänger die Gesamtausstattung an Personal innerhalb einer Einrichtung. Insgesamt sollte damit für die Vergütungshöhe und den Leistungsanspruch der Leistungsberechtigten der individuelle Hilfebedarf entscheidend sein und über die Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven von Einrichtungen ein Qualitäts- und Preiswettbewerb erreicht werden (vgl. Schädler et al. 2008: 69). Allerdings muss festgestellt werden, dass weder das Ziel der Ausgabenbegrenzung noch das Ziel des Wettbewerbs bisher erreicht wurden. Schoepffer schreibt dazu: „Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Selbstkostendeckungsprinzip nach der Rechtslage aufgegeben worden ist, lebt es praktisch in unterschiedlich ausgeprägter Weise fort. … Nach Beobachtung des Autors sind es insbesondere die Leistungserbringer der freien Wohlfahrtspflege, die als Verfechter des Selbstkostendeckungsprinzips auftreten. Je nach tatsächlicher Stärke im Wettbewerb bzw. Einfluss auf die Entscheidungsträger bei den Sozialleistungsträgern ist die Fortgeltung … mehr oder weniger stark ausgeprägt“ (Schoepffer 2010: 165f). Der Autor erkennt aber auch gegenläufige Tendenzen und zwar in der Rechtsfigur des „externen Vergleichs“ (vgl. ebd.: 165). „Sind Einrichtungen vorhanden, die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer Träger“ (§75 Abs. 2 Satz 3 SGB XII). „Vergütungen dürfen nur bis zu der Höhe übernommen werden, wie sie der Träger der Sozialhilfe am Ort der Unterbringung oder in seiner nächsten Umgebung für vergleichbare Leistungen … mit anderen Einrichtungen trägt“ (ebd. Abs. 4 Satz 3). Dies würde bei konsequenter Umsetzung verbunden mit der Verpflichtung zur Gleichbehandlung eine Finanzierung nach dem Prinzip „gleiches Geld für gleiche Leistung“ bedeuten (vgl. Schoepffer 2010: 165). Diese beiden Prinzipien der Finanzierung stationärer Einrichtungen, das Selbstkostendeckungsprinzip und das Prinzip des externen Vergleich gegenüberstellend hält Schoepffer am Ende seines Beitrages fest: „Bei Anwendung des Selbstkostendeckungsprinzips ist die Frage der günstigen Finanzierung nachrangig gegenüber der Frage, welche Finanzierung vom Kostenträger akzeptiert wird. Nur in dem Maße, in dem das Selbstkostendeckungsprinzip durch das Prinzip des externen Vergleichs überlagert wird, ist die Frage der Finanzierung für die wirtschaftliche Situation eines Einrichtungsträgers von Bedeutung“ (ebd.: 166).
Das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe muss seine Angebote vorrangig an eine mögliche zukünftige Bewohnerstruktur anpassen und zusätzlich neue innovative Angebote aufbauen. Dazu sollen an dieser Stelle Überlegungen zu den Auswirkungen des Art. 19 BRK auf die Bewohnerstruktur von Einrichtungen angestellt werden.
Verfolgt man konsequent den Gedanken des Art. 19 BRK haben zukünftig alle Leistungsberechtigten über diesen einen Rechtsanspruch darauf, ihren Wohnort und ihre Wohnform frei zu wählen. Für einen Teil der behinderten Menschen, vorrangig zuerst einmal den Teil mit geringem Hilfebedarf, trifft es zu, dass sie eine solche Entscheidung treffen werden und es ist anzunehmen, dass ein Teil der Befragten sich für eine selbständige Wohnform außerhalb einer Einrichtung/Gruppe entscheiden werden. In einer Untersuchung von Häussler-Sczepan gaben beispielsweise ein Fünftel der befragten Bewohner an, auf Dauer nicht im Heim leben zu wollen und ein weiteres Drittel, sich bereits Gedanken über einen Wechsel gemacht zu haben bzw. schon konkrete Umzugsabsichten zu haben (vgl. Metzler, Wacker 1998: 79). Es wird allgemein in der Fachliteratur davon ausgegangen, dass dann in den Einrichtungen diejenigen Bewohner verbleiben, die aufgrund des zu hohen Unterstützungsbedarfs, sei es körperlicher, geistiger oder psychischer Natur (z. B. Menschen mit selbstgefährdendem Verhalten), entweder diese Entscheidung gar nicht treffen können und keine Angehörigen haben, die sich an ihrer statt für sie einsetzen oder bei denen der Wunsch nach einer selbstbestimmten Lebensführung aufgrund zu hoher Kosten vom Sozialhilfeträger abgelehnt wird. Es werden bereits jetzt folgende Entwicklungen bzw. Tendenzen beobachtet:
-
„…zunehmende Tendenz zur Errichtung von Schwerstbehindertenheimen…“ (Seifert et al. 2001: 365).
-
„Da schwerbehinderte Menschen auf eine dichte personelle Besetzung bzw. mehr Fachleistungsstunden, nicht unerhebliche Unterstützungsleistungen, Pflege und Therapiemaßnahmen angewiesen sind und da ein individualisiertes Hilfsangebot mit multiprofessioneller ambulanter Unterstützung in gemeinwesenintegrierten [!] Wohnformen gängigen Auffassungen zufolge keinesfalls billiger würde, verbleiben sie aufgrund ihres hohen Unterstützungsbedarfs als Restgruppe in den Institutionen“ (Dalferth 2006: 124).
-
„Die Zunahme von Schwerbehindertengruppen geht mit einer dramatischen Verschlechterung der Lebensqualität in den Institutionen einher: … Die Mitarbeiter haben für den Einzelnen weniger Zeit aufgrund der dominierenden Pflegeleistungen, sie werden durch Kriseninterventionen überfordert und sind verstärkt von Burn-out bedroht. Eine erhöhte Personalfluktuation verschärft zudem die Lebenssituation der Bewohner“ (ebd.).
-
„Im Zuge des Ausbaus der .. Behindertenhilfe und als Ausfluß [!] des gegliederten subsidiären Systems der Hilfen hat sich den Trägern die Möglichkeit eröffnet, mit ihren Angeboten unabhängig von regionalen Bedarfen eine Klientel ihrer Wahl zu versorgen. Es besteht die begründete Vermutung, daß [!] sich deswegen „Problemgruppen“ herauskristallisieren, deren Betreuungsbedarf sowohl die Möglichkeiten des familiären Systems als auch der ambulanten öffentlichen Maßnahmen überschreitet“ (Häußler et al. 1996: 83).
-
„Die in mehreren Bundesländern gem. §93 BSHG bereits vorgenommene Einteilung behinderter Menschen in Hilfebedarfsgruppen wird dieser Entwicklung Vorschub leisten. Es besteht die Gefahr, dass ein Zusammenleben von schwer behinderten Bewohnern mit Menschen mit geringerem Hilfebedarf künftig die Ausnahme bildet“ (Seifert et al.2001: 366).
-
Eine letzte, sehr wahrscheinliche Auswirkung auf die Bewohnerstruktur stationärer Einrichtungen die hier dargestellt werden soll, betrifft das Durchschnittsalter der Bewohner. Es ist hinlänglich bekannt, dass genauso wie bei nicht behinderten Menschen die Lebenserwartung von Menschen mit Unterstützungsbedarfen steigt (vgl. Wunder 2009: 36). Laut bayerischem Aktionsplan sollen unter anderem für ältere behinderte Menschen „entsprechende … stationäre Wohnangebote der Behindertenhilfe .. auf- und ausgebaut werden“ (STMAS 2013: 86). Aus den beschriebenen Gründen wird daher davon ausgegangen, dass sich das Durchschnittsalter der Bewohner auch in den Einrichtungen massiv erhöhen wird. Verbunden damit ist eine größere Belastung des Personals zu befürchten, da zusätzlich zu den bereits bestehenden Behinderungen Komplikationen durch altersbedingte Erkrankungen zu erwarten sind.
Zusammenfassend sind daher aus Sicht der Autorin folgende Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur zu erwarten: es werden vermutlich die Bewohner mit hohem und sehr hohem Unterstützungsbedarf in den stationären Einrichtungen verbleiben, und dabei besonders diejenigen, deren kognitive Fähigkeiten nicht ausreichen, um sich für sich selbst einsetzen zu können. Des Weiteren diejenigen, die aufgrund psychischer Einschränkungen zu sehr herausforderndem Verhalten tendieren (hierbei bes. selbst- und fremdgefährdendes Verhalten) und Autisten. Schlussendlich noch diejenigen Bewohner, die zusätzlich zu ihrer Behinderung altersbedingte Einschränkungen oder Erkrankungen aufweisen. Häußler et al. charakterisieren diese Entwicklung als eine zunehmende Polarisierung zwischen „schwer und mehrfach Behinderten“ sowie „geistig Behinderten“ für die die Unterstützungssysteme nicht (mehr) ausreichen auf der einen Seite, und diejenigen auf der anderen Seite, die unter Ausnutzung alle bestehenden Hilfeleistungen in der Familie oder in einer eigenen Wohnung leben können (vgl. Häußler et al. 1996: 83f). Für stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe kann also davon ausgegangen werden, dass sie sich auf einen Wandel in der Bewohnerstruktur hin zu „schwierigerem“ Klientel einstellen werden müssen, um ihr weiteres konzeptionelles Handeln darauf ausrichten zu können.
Ein zweiter wichtiger Faktor, an dem das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen sein Handeln ausrichten wird ist die Frage der finanziellen Ausstattung der jeweiligen Einrichtung. Sehr viel mehr als bisher müssen sich Einrichtungen überhaupt mit dem Funktionsbereich Finanzwirtschaft innerhalb ihrer Organisation auseinandersetzen, da sie sich auf gravierende Veränderungen einstellen müssen (vgl. Pracht, Wolke 2009: 521). Mögliche Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung sollen an dieser Stelle ableitend aus den Überlegungen zu den Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur dargestellt werden. Wie oben ausgeführt kann zu diesem Zeitpunkt angenommen werden, dass in den Einrichtungen diejenigen Bewohner verbleiben werden, die einen hohen bis sehr hohen Unterstützungsbedarf aufweisen. Dies würde in der logischen Konsequenz bedeuten, dass die Einrichtungen bei gleichbleibender Bewohneranzahl (ausgehend davon, dass bei Auszug eines Bewohners mit wenig Unterstützungsbedarf ein Bewohner mit hohem Unterstützungsbedarf einzieht oder sich die Platzzahl im gesamten verringert) finanziell besser ausgestattet sein werden. Als Beispiel sei an dieser Stelle der Beginn der Verringerung der Heimplätze in Norwegen erwähnt. Anfänglich wurden dabei nur die Bewohner mit geringerem Hilfebedarf ausgegliedert, woraufhin die Heimkosten pro Bewohner stetig stiegen, da in den Einrichtungen nur noch das bereits oben beschriebene Klientel zurückblieb (vgl. Kornherr 2008: 58). Andererseits erwarten die Sozialhilfeträger von den Einrichtungen, Kosten zu senken und Einsparungen vorzunehmen, daher kann davon ausgegangen werden, dass diese bei einer solchen Entwicklung schon aufgrund der eigenen leeren Kassen nicht tatenlos zuschauen werden. Inzwischen gehen einige Kostenträger sogar soweit, Druck auf Einrichtungen auszuüben, sich ganz oder teilweise in Pflegeeinrichtungen umzuwandeln (vgl. Wansing 2005: 119). Damit würden diese in das System der Pflegeversicherungen übergehen und auch darüber finanziert werden, d.h. sie würden einen Versorgungsvertrag nach §72 SGB XI abschließen (müssen), der z. B. Leistungen der Eingliederungshilfe aus den Pflegeleistungen ausschließt. Der Hilfebedarf der Bewohner würde sich dann über die 3 Pflegestufen, wie sie im System der Altenhilfe üblich sind, eingruppieren und es werden nur Leistungen nach § 43 SGB XI erbracht. Der Pflegesatz beträgt derzeit in der höchsten Stufe 1550,00€ monatlich, nur bei besonderen sogenannten „Härtefällen“ kann sich dieser nochmals auf 1918,00€ monatlich erhöhen. Natürlich kann nur durch diese Zahlungen keine gleichbleibende adäquate 24h-Betreuung geleistet werden, der Tagessatz einer Einrichtung der Eingliederungshilfe liegt zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel höher als der einer Einrichtung, die einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen abgeschlossen hat. Die Differenz müsste nach dem System der Pflegeversicherung, der Bewohner oder seine Angehörigen zahlen, sollte dies nicht möglich oder zumutbar sein - wovon in den meisten Fällen ausgegangen werden kann - ist wiederum der Sozialhilfeträger zuständig. Für die Einrichtungen würde dies aber in jedem Fall eine wesentlich schlechtere finanzielle Ausstattung bedeuten, da sie ihre Leistungsvereinbarungen mit den zuständigen Pflegekassen abschließen müssten. Wie weiter oben ausgeführt, ist aber in Deutschland auch die Diskussion um ein Bundesleistungsgesetz und das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe noch nicht beendet, bzw. wird sie von einigen Bundesländern weiter voran getrieben. Sollte dieser grundlegende Systemwechsel in der Einordnung und Finanzierung der Eingliederungshilfe tatsächlich stattfinden, werden sich die möglichen finanziellen Auswirkungen aus Sicht der Autorin eventuell ganz anders darstellen, es würde allerdings an dieser Stelle zu weit führen und wäre rein spekulativ, diese weiter zu beschreiben.
Abschließend bleibt aber festzuhalten, dass sich soziale Einrichtungen in Zukunft stärker als bisher mit ihrer Finanzierungs- und Investitionspolitik auseinandersetzen müssen um den Veränderungen, die durch die BRK und den Art. 19 in dieser (wenn er konsequent umgesetzt wird) auf die Einrichtungen zukommen, begegnen zu können.
Das zukünftige Pflegemanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe wird seinem Handeln eine wesentlich bedarfswirtschaftlichere Orientierung geben müssen mit deutlich ausgeprägteren erwerbswirtschaftlicheren Denk- und Verhaltensweisen als bisher (vgl. Pracht/Wolke 2009: 521). Bisher stellte das Finanzmanagement in Einrichtungen eine eher rudimentär entwickelte Managementfunktion dar. Einerseits wegen früherer, sehr gering vorhandener Handlungsspielräume, und andererseits wegen der Vorrangigkeit von Sachzielen (vgl. ebd.: 522). Aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen und der Forderungen nach Kosteneinsparungen wird sich das zukünftige Management verstärkt mit den Finanzierungsströmen innerhalb der Organisation auseinandersetzen müssen um u. a. Einsparpotenziale aufdecken zu können. Zusätzlich wird sich das Management verstärkt um neue Einnahmequellen bemühen und die „Verzahnung von professionellen Leistungen und Gemeinwohlaktivitäten“ vorantreiben müssen (vgl. Menninger 2010: 146). „Wird ein strategisches, wertorientiertes Management in diese Richtung verfolgt, kann die Wettbewerbsfähigkeit gesichert, und damit die Finanzierungsbedingungen erfüllt werden“ (ebd.: 147).
Des Weiteren wird sich auch aus Sicht der Autorin eine Organisation intensiver mit einer mittel- und langfristigen Planung auseinandersetzen, als es bisher oft der Fall war. „Die Diskussion um das neue Verständnis von Behinderung und das neue Selbstbewusstsein der Betroffenen und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Wohnangebote…“ zwingt Organisationen und Einrichtungen dazu, sich mit ihren Wohnangeboten auseinanderzusetzen und auch neue innovative Angebote zu entwickeln und aufzubauen (Wunder 2009: 38). Es ist konzeptionell und für das weitere managerielle Handeln ein Unterschied ob sich die Einrichtung dafür entscheidet, das Angebot auf das zu erwartende Klientel mit hohem Unterstützungsbedarf ausrichtet oder ob dieselbe Einrichtung sich dafür entscheidet, ihr Angebot an stationären Plätzen für dieses Klientel abzubauen und dafür ihr inklusives Angebot an Wohnplätzen erweitert (bzw. anfängt ein solches aufzubauen). Das Management einer Einrichtung kann sich auch dafür entscheiden, beide Richtungen zu verfolgen. Bisher stand im Managementhandeln sozialer Einrichtungen eine strategisch langfristige Auseinandersetzung mit entsprechenden Konzeptionen selten im Vordergrund, da in der Regel das Bewohnerklientel innerhalb einer Einrichtung bunt gemischt in Altersgruppen und Hilfebedarfsgruppen und in allererster Linie relativ konstant war und sich oft nur die Frage nach einer Platzerweiterung stellte. Dies galt genauso auch für die sogenannten Spezialeinrichtungen, bei denen ein bestimmtes Behinderungsmerkmal zwar zwingend vorhanden sein musste, aber ansonsten jegliche zusätzliche Behinderung oder ein zusätzlicher Hilfebedarf kein Hinderungsgrund für eine Aufnahme darstellte. Bei den strategischen Planungen sollte im Hinblick auf die Umsetzung der BRK der Inklusionsgedanke weit im Vordergrund stehen und alle Entscheidungen, die zu treffen sind, genau vor diesem Hintergrund diskutiert und getroffen werden. Auch von den stationären Einrichtungen wird zu Recht inklusives Denken gefordert. Daher wird vom Management in diesem Bereich vor allem erwartet, dass „… der weiteren Ausweitung von stationären Angeboten mit ihren bekannten Folgen der mangelnden Teilhabemöglichkeiten entgegen gewirkt .. [wird und] zum anderen .. Integration und Community Care vorangetrieben und für bisher stationär versorgte Menschen mit Behinderung ein Leben mitten in der Gesellschaft in individualisierten Wohnformen ermöglicht .. [wird]“ (Wunder 2009: 38).
Eine weitere Anforderung an das strategische Management führt Menninger aus, in dem er fordert, dass gemeinnützige Organisationen eine Binnendifferenzierung ihrer Organisationsziele und -strukturen vornehmen sollen (vgl. Menninger 2010: 145). Er begründet dies unter anderem damit, dass Einrichtungen darüber professioneller und somit wettbewerbsfähiger sind, dadurch Erträge selbst erwirtschaften können und damit Innovationen der Leistungsangebote selbst anstoßen können (vgl. ebd.). Zusätzlich soll ein hohes Leistungs- und Qualitätsniveau erreicht werden, „da .. es inzwischen ausreichend empirische Belege [gibt], dass Einrichtungen mit hohen Leistungs- und Qualitätsstandards wirtschaftlich erfolgreich sind“ (ebd.). Dies bedeutet als eine weitere Anforderung an das Management somit ein verstärktes Auseinandersetzen mit den eigenen vorhandenen Qualitätsstandards und dem Aufbau eines hochwertigen Qualitätsmanagementsystems. Gründe dafür sind u. a. der massive Kostenanstieg auch im Sozialsektor, so dass Einrichtungen verstärkt ihr Handeln gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen (Leistungsempfänger, Öffentlichkeit, eigene Mitarbeiter) rechtfertigen müssen (vgl. Arnold et al. 2009: 459). Gerade auch der Bereich des Personalmanagements gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der bevorstehende Fachkräftemangel im Bereich der Pflege und die erwarteten Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur führen dazu, dass Einrichtungen verstärkte Bemühungen unternehmen müssen, um auf der einen Seite ihr Personal zu binden und auf der anderen Seite neues zu beschaffen. Für beide Bereiche ist „die Entwicklung, Implementierung und Kontrolle von Qualitätsstandards“ unerlässlich (ebd.: 460). Sie führen dazu, dass die Mitarbeiter ihre Leistungen transparent darstellen und glaubhaft nachweisen können. Dies kann gleichzeitig die Motivation der Mitarbeiter erhöhen und einem „Burn-out“ vorbeugen (vgl. ebd.). Dies ist auch vor dem Hintergrund der vermutlich verbleibenden Klientel entscheidend. Für diese Bewohner wird zusätzlich zu einem erhöhten Anteil an Pflegefachkräften auch deutlich mehr medizinisch ausgebildetes Fachpersonal notwendig sein, da die Behandlungspflege verstärkt zunehmen wird. Da tendenziell auch der Anteil der psychisch schwierigeren Bewohner steigt, muss das zukünftige Personal diesbezüglich unterstützt und geschult werden. Supervisorische, therapeutische und psychologische Unterstützung sollten daher mehr als bisher angeboten werden. Fortbildungen für das vorhandene Personal, eventuell auch Weiterbildungen zu speziellen zukünftigen „Problematiken“ sind anzubieten, da sonst die Gefahr der Überforderung des Personals schnell steigt.
Ableitend von den dargestellten möglichen Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur, die finanziellen Ressourcen und das Management sollen im nächsten Kapitel Perspektiven für das zukünftige Entwicklungs- und Veränderungsmanagement stationärer Einrichtungen der Behindertenhilfe erarbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
Wie bereits beschrieben ist es also notwendig, dass stationäre Einrichtungen ihre Angebote erweitern und verändern um damit den beschriebenen Auswirkungen entgegen zu treten. Dazu ist es hilfreich, sich die derzeit üblichen Wohnformen nochmals genauer anzuschauen. Unterschieden wird grundsätzlich in stationäres und ambulantes Wohnen. Das stationäre Wohnen wird differenziert in:
-
Pflegeheim (Angebot für intensiv pflegebedürftige Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf ohne Tagesstruktur außerhalb der Gruppe),
-
Wohnpflegeheim, heute eher bezeichnet als Wohnen mit Tagesstruktur (Angebot für Menschen hohem Unterstützungsbedarf, die angepasst an ihre persönlichen Möglichkeiten in einer Tagesstruktur außerhalb ihrer Gruppe betreut werden, meist in sogenannten Förderstätten),
-
Wohnheim, heute eher bezeichnet als Wohnen (Angebot für behinderte Menschen, die in der Lage sind, einer Tätigkeit in einer Werkstatt oder sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt nachzugehen).
Angeschlossen an Einrichtungen sind z. T. noch Außenwohngruppen und der Bereich Betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen unterscheidet sich dabei noch einmal vom ambulant betreuten Wohnen wie folgt: „ Nur in letzterem übernimmt die Person mit Behinderung die Gesamtverantwortung für die Lebensführung selbst“ (Hanslmeier-Prockl 2009: S. 30). Bei betreutem Wohnen hingegen bleibt der behinderte Erwachsene in der Regel unter dem Dach der Einrichtung und ist z. B. auch nicht selbst Mieter der entsprechenden Wohneinheit. Die Bezeichnung Wohneinheit wird hier in der weiteren Arbeit beibehalten, da sie die verschiedensten Wohnarten (Wohnung, Appartement, Zimmer, etc.) umfasst. Die beiden letzten und durchaus sehr selbstbestimmten Arten des Wohnens bleiben allerdings noch immer überwiegend den Menschen mit geringem bis sehr geringem Unterstützungs- und Hilfebedarf vorbehalten, da adäquate Angebote fehlen.
Das entsprechende Wissen im Umgang und in der Arbeit mit behinderten Menschen, die langjährigen praktischen Erfahrungen und die personellen Ressourcen bieten stationären Einrichtungen die besten Voraussetzungen, flexibel auf die anstehenden Veränderungen zu reagieren und neue Angebote zu schaffen. Dabei ist grundsätzlich eine bedarfsorientierte strategische Ausrichtung der Einrichtung entscheidend. Aus Sicht der Autorin wäre es für Einrichtungen empfehlenswert, inklusives Wohnen jeder Wohnform anzubieten, sprich: das stationäre Wohnen beizubehalten, jedoch umzustrukturieren und ein differenziertes ambulantes Wohnangebot auf- und auszubauen. Entsprechend der BRK hat erst dann der behinderte Mensch (auch eben der, der sich bereits in einer Einrichtung befindet) die vollständige Wahlfreiheit sich auszusuchen „…wo und mit wem [er] .. leben …„ möchte (Art. 19 BRK). Dies hätte aus Sicht der Autorin mehrere Vorteile:
-
Bewohner können verschiedene Wohnformen ausprobieren, also eine ihren Bedürfnissen angepasste Option innerhalb der Einrichtung finden und weiterhin zum Klientel dieser gehören. Dies zielt vor allem auf das Bewohnerklientel, welches sich für ein ambulantes Wohnsetting entscheiden würde und somit sonst der Einrichtung sozusagen „verloren“ gehen würde. Der Wechsel vom stationären in einen ambulanten Bereich wäre sehr niederschwellig (vgl. Schablon 2009: 63).
-
Je breiter gefächert das Angebot an Wohnformen sein wird umso mehr Bewohner werden sich zukünftig für die entsprechende Einrichtung entscheiden, da ihnen auch „ihre“ gewünschte Wohnform angeboten wird.
-
Der Weg zurück in das stationäre Angebot, sofern dies gewünscht wird, wäre einfacher, eine Art „Absicherung“, die es einigen Bewohnern vermutlich erleichtern würde, auch eine andere Wohnform auszuprobieren. Viele Bewohner leben seit Jahrzehnten in einer stationären Wohnform und haben schlichtweg Angst davor, die Sicherheit gebenden Gruppenstrukturen zu verlassen. Schablon nennt diese Gruppenstrukturen „ individueller gewachsener Sozialraum“ und weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Ressourcen erhalten bleiben müssen, da es schwierig ist, alte abgebrochene Kontakte wirklich zu ersetzen (ebd.: 66).
-
Da für viele behinderte Menschen eine gewisse Konstanz in der Betreuung wie erwähnt Sicherheit bedeutet, könnte die Möglichkeit, dass zumindest die sie betreuenden Fachdienste die gleichen bleiben, sie noch mehr ermutigen, den Schritt in eine größere Selbständigkeit zu wagen, da „bewährte Grundleistungen [die] Sicherheit [bieten], auf Standards benötigter Unterstützung vertrauen zu können, …“ (Schäfers et al. 2009: 153).
-
Für behinderte Menschen, besonders im Bereich der „schweren Behinderungen“, besteht eine große Gefahr der sozialen Isolation, da es gerade für sie schwierig ist, Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. „Der Anteil der isolierten Menschen scheint mit zunehmendem Grad von Hilfebedarf zu steigen,… (Häußler et al. 1996: 294). Über die vielen Jahre der Institutionalisierung haben sich aber auch die familiären Netzwerke entweder verkleinert oder sind praktisch kaum noch vorhanden, „weil sich Familien, die unter hohen Belastungen stehen, abkapseln und ganz auf sich zurückziehen“ (ebd.). Dieser Gefahr wird durch die Beibehaltung eines Teils des Netzwerkes, das den Bewohnern seit u. U. Jahrzehnten bekannt ist, entgegen getreten.
-
Da es vor dem Hintergrund des erwähnten bevorstehenden bzw. zum Teil schon vorhandenen Fachkräftemangels von großer Bedeutung sein wird, Mitarbeiter zu gewinnen und an die Organisation zu binden, wird es für eine Einrichtung von Vorteil sein, ein breites Aufgabenfeld anbieten zu können und somit Fachpersonal zu gewinnen. Zusätzlich kann durch die Option von internen Arbeitsplatzwechseln den Mitarbeitern auch ein inhaltlicher Wechsel ihrer Tätigkeit angeboten werden, eine weitere Möglichkeit „gutes“ Personal an sich zu binden.
-
Die Mitarbeiter wären motivierter, Bewohnern bei entsprechenden Übergängen zu assistieren, wenn dies nicht langfristig einen Verlust des eigenen Arbeitsplatzes bedeuten könnte.
Am Beginn des Aufbaus eines Angebots bzw. der Veränderung des bestehenden gilt es für eine Einrichtung zuerst den Bedarf zu eruieren. Dabei müssen im Bereich von behinderten Menschen mit größeren kognitiven Defiziten die Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer mit einbezogen werden. Eine Bedarfserhebung kann in der eigenen Einrichtung gemacht werden, eine weitere Möglichkeit bietet die Statistik der zuständigen Kostenträger. Eine dritte Möglichkeit ist die Erhebung des zukünftigen Bedarfs in integrativen Bildungseinrichtungen oder in den derzeit noch in der Mehrzahl vorhandenen speziellen Schuleinrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Als besondere Schwierigkeit gilt dabei vor allem, die tatsächlichen Wünsche Menschen mit großen kognitiven Defiziten herauszufiltern und zu berücksichtigen. Daher ist vor allem Personal gefragt, dass versucht objektiv und aufgeschlossen neuen Angeboten gegenüberzustehen und sich darauf einlässt auch „ihren“ oft langjährig in der eigenen Gruppe wohnenden Bewohnern eine neue Art des Wohnen und der Betreuung zuzutrauen ohne vorrangig den eigenen Arbeitsplatz im Blick zu haben. An dieser Stelle ist es aus Sicht der Autorin sehr empfehlenswert, einen Prozessbegleiter zu installieren, eine Idee aus dem Community Care Ansatz, die z. B. in der Behindertenhilfe des ‚Rauen Hauses‘ im Großraum Hamburg bereits umgesetzt wird. „Jeder der Bewohner hat einen von der Alltagsbegleitung unabhängigen Prozessbegleiter zur Seite, der die lebensweltlichen Vorstellungen des Menschen mit Behinderung herausfindet und zur Grundlage der Hilfeplanung und Evaluation macht“ (Schablon 2009: 63). Außerdem erfolgen die Hilfeplanungen mit dem Bewohner und (sofern vorhanden) seinen Angehörigen. Als eine weitere Möglichkeit der Bedarfserhebung möchte die Autorin an dieser Stelle auf bereits vorhandene Studien zu diesem Thema hinweisen. Beispielhaft sei hier eine Studie erwähnt, die in den Jahren 2002/2003 stattfand. Sie befasste sich detailliert mit den Wohnwünschen junger erwachsener Menschen mit Behinderungen und wurde als Kundenbefragung im Rahmen des Projekts -Weiterentwicklung von Wohnformen von Menschen mit Behinderungen- von der Diakonie Württemberg und der Caritas Rottenburg-Stuttgart in Auftrag gegeben. Als Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass der Wunsch nach ambulant betreutem Wohnen bereits an zweiter Stelle der Wohnwünsche liegt. Auch die Stellen 3 - 5 werden besetzt von Wohnformen außerhalb einer Einrichtung wie in der nachfolgenden Abbildung erkennbar (vgl. Rauscher 2005: 154)
Abbildung 2. Wohnwünsche von Menschen mit Behinderungen
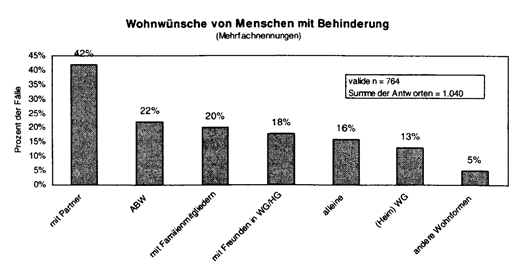
Von 764 Befragten wurden 1.040 Antworten erhalten (Mehrfachnennungen waren möglich), die sich folgendermaßen aufteilten:
42%: mit Partner;
22%: ABW;
20%: mit Familienmitgliedern;
18%: mit Freunden in WG/ HG;
16%: alleine;
13%: (Heim) WG;
5%: andere Wohnformen
Es lässt sich aus der Abbildung aber auch ableiten, dass bei immerhin 13% der Befragten der Wunsch nach einer stationären Wohnform vorherrscht. Diese Ergebnisse und Überlegungen zusammengenommen, lassen für die Autorin den Schluss zu, dass es für stationäre Einrichtungen in der Zukunft empfehlenswert ist, ihr stationäres Angebot zwar beizubehalten aber Plätze abzubauen und dafür in einem Leistungs- und Angebotsmix ihren ambulanten Bereich mit vielen verschiedenen Wohnformen zu erweitern, hier also Plätze aufzubauen. Das Management muss sich also auf den Weg machen und neue Konzepte erarbeiten, die sich immer auch an den Ansprüchen der BRK messen lassen müssen und ausschließlich dem Leitbild der Inklusion folgen. Daher gilt es, Voraussetzungen zu schaffen, die eine vollständige Umsetzung des Art. 19 BRK ermöglichen und dabei aber trotzdem die eigene Organisation und deren Wirtschaftlichkeit und ihr qualitativ hochwertiges professionelles Handeln im Auge behalten.
Nachdem eine Organisation also den Bedarf eruiert und sich strategisch (und wichtig hier: anhand der ermittelten Nachfrage!) festgelegt hat, welche Leistungen sie zukünftig anbieten möchte, sollen in der nächsten Phase die gesammelten Informationen genutzt werden um daraus ein Konzept zu erarbeiten und die Angebotsstruktur zu differenzieren. Dabei müssen folgende Bereiche als Strukturqualitätsmerkmale beachtet werden: die sächliche Ausstattung, die personelle Ausstattung und Personalentwicklung, konzeptionelle Grundlagen und das Qualitätsmanagement. Am Beginn steht also die Erarbeitung eines Konzepts. Hilfreich kann in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Analyse bereits vorhandener Studien zum Thema: „Warum werden Menschen mit hohem Hilfebedarf von ihren Angehörigen überhaupt Institutionen überlassen?“ sein, um vor allem auch die Probleme der pflegenden Angehörigen zu kennen und auf diese schon vorher mit einem Hilfeangebot reagieren zu können. Im Bereich der behinderten Erwachsenen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf lebt der überwiegende Teil (der nicht in einer Institution wohnt) bei der Kernfamilie. Interessant ist dabei also die Frage, warum diese sogenannten „Pflegeverhältnisse“ abgebrochen werden, um beim zukünftigen Angebot auch darauf spezieller eingehen zu können. Beispielsweise ist einer der häufigeren Gründe, weswegen Angehörige von behinderten erwachsenen Menschen diese in eine Einrichtung geben, die Betreuung am Tag während der eigenen Arbeitszeit. „Neben sich ändernden Sozialbeziehungen, …, ist hier vor allem die Erwerbsorientierung der Frauen, die traditionell Versorgungs- und Pflegeleistungen erbringen, hervorzuheben. … Insgesamt muß [!] man also davon ausgehen, daß [!] innerfamiliäre Ressourcen zunehmend knapper werden. Dies tangiert … auch die notwendigen Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen“ (Häußler et al. 1996: S.80). Daraus ableitend kann es eine Überlegung einer Einrichtung sein eine Tagesstruktur anzubieten, die das Familiensystem stundenweise entlastet. Ein weiteres Problem scheint für pflegende Angehörige die Versorgung in der Nacht darzustellen: „Hier könnte ein wichtiger Faktor für eine Überlastung des familiären Hilfesystems gesehen werden und ein ernstzunehmender Grund, ein Hilfe- und Pflegeverhältnis nicht mehr aufrechtzuerhalten“ (Wahl, Wetzler 1998: S. 242). Inhaltlich betrifft dieses Problem natürlich genauso auch allein lebende Menschen mit Hilfebedarf. Die dargestellten Probleme sind beispielhaft und nur zwei von vielen anderen, die vom Management mitbedacht werden müssen, wenn dieses beginnt ein ambulantes Angebot auf- und auszubauen. Zu Beginn gilt es vor allem geeignete Wohneinheiten zu finden, die barrierefrei sind und immer auch dem Inklusionsgedanken Rechnung tragen, im Sinne von in der Gemeinde, im Stadtviertel angebunden mit einer guten Infrastruktur. Dies wird in Zeiten von immer knapper werdendem sozialem - und damit bezahlbarem - Wohnraum vor allem in den Städten sicherlich eines der größeren Probleme darstellen. Ist geeigneter Wohnraum gefunden, ist es zwingend erforderlich, dass dieser für den entsprechenden Personenkreis angemessen ausgestattet wird, so dass er bei Bedarf auch von Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf genutzt werden kann (vgl. Theunissen 2006: 126). Verschiedene ambulante Wohnformen erfordern unter Umständen neue Arbeitszeitmodelle. In einer Studie von Wahl, Wetzler zeigt sich als ein großer Kritikpunkt von pflegenden Angehörigen, das die Angebote ambulanter Dienste bisher „…als nicht genügend flexibel und in „Problemzeiten“ … [als] nicht ausreichend verfügbar…“ empfunden werden (Wahl, Wetzler 1998: 247). Eine Organisation sollte sich daher darauf vorbereiten, Flexibilität bei der zeitlichen Betreuung anbieten zu können. Ein Mitarbeiter, der als Assistent bei einem Bewohner angestellt ist, der in seiner eigenen Wohneinheit lebt, wird sich nicht an starre Dienstpläne halten können und braucht daher ein flexibleres Arbeitszeitmodell, wohingegen ein Mitarbeiter der in einer ambulanten betreuten Wohngruppe arbeitet schon eher festere Dienstzeiten benötigt um den „laufenden Betrieb“ zu gewährleisten und die Grundversorgung zu sichern. Vorstellbar wäre ein Modell, welches im Masurenhof (eine Einrichtung für psychisch kranke und behinderte Menschen in Tiefenthal) gemeinsam mit Mitarbeitern und Betriebsrat entwickelt wurde. Nach diesem Modell haben die Mitarbeiter feste Dienstzeiten und können aber nebenher über 15% ihrer Soll-Arbeitszeit frei verfügen, um punkt- und passgenaue Hilfen erbringen zu können (vgl. Helfrich 2010: 237).
Ein weiterer Schwerpunkt ist, wie in der Studie „Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen Lebensführung in Privathaushalten“ dargestellt, in vielen Fällen die Betreuung in der Nacht. Es müssen daher Regelungen gefunden werden, die eine bedarfsorientierte Hilfe ermöglichen, aber auf der anderen Seite nicht in einem Überangebot münden. Zu überlegen wäre hier vielleicht eine Art „Nachtwache auf Rädern“, ähnlich wie „Essen auf Rädern“, die eine festgelegte Route von einem Stützpunkt in der Einrichtung zu vereinbarten Zeiten abfährt und ansonsten für Notfälle per Rufbereitschaft erreichbar ist. Ein weiterer Hauptaufgabenbereich für das Management ist es, vorab den Kostenträgern eine Leistungsvereinbarung vorzulegen und abzuklären, welche der neuen Leistungsangebote bis zu welcher Höhe über diese finanziert werden. Da bisher noch immer das Gebot der Kostenneutralität über dem Gebot „ambulant vor stationär“ steht, ist aus Sicht der Autorin nicht anzunehmen, dass gerade für den Bereich der „schwer geistig und mehrfach behinderten“ Menschen eine uneingeschränkte Kostenzusage für jede Wohnform ausschließlich nach dem Hilfebedarf und den Wünschen des Leistungsempfängers erfolgt, vor allem wenn die Betreuung bereits jetzt zu einem bekannten (pauschalen) Satz erfolgt und der dann Notwendige höher sein würde. Schon aufgrund der Finanzkraftklausel des § 33 SGB I der für alle Bücher des SGB gilt - und damit auch für den Bereich der Eingliederungshilfe - kann sich ein Kostenträger jederzeit darauf berufen, dass die entstehenden Kosten nicht vertretbar sind und die eigene Leistungsfähigkeit überschreiten würden. Zusätzlich schränkt auch der § 5 SGB VIII das Wunsch- und Wahlrecht Leistungsberechtigter noch weiter ein, in dem verankert ist, dass den Wünschen nur dann entsprochen wird, sofern diese nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind (vgl. §5 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Daher darf vermutet werden, dass es auch bei der Finanzierung über das trägerübergreifende Persönliche Budget vorläufig dabei bleiben wird, dass die ambulante Betreuung nur bis zu einem bestimmten Hilfebedarf aus den dann eigenen Mitteln des Budgetnehmers finanziert werden kann. Abzuklären bleibt an dieser Stelle, ob über das eigene soziale Netzwerk, ehrenamtlich Tätige oder familiäre Ressourcen der restliche Hilfebedarf abgedeckt werden kann. Für das neu entstehende ambulante Angebot hat eine Einrichtung weiterhin für eine „sorgfältige Auswahl und berufsbegleitende Qualifizierung des Personals“ Sorge zu tragen (Theunissen 2006: 126). Mitarbeiter von Einrichtungen, insbesondere langjährige Gruppenmitarbeiter, haben oft (noch) nicht gelernt, mit Teilhabe und Selbstbestimmung umzugehen. In der Regel sind auch sie noch im „Fürsorgeprinzip“ verhaftet und tendieren dazu, „Nutzerinnen und Nutzer [eher] an das Hilfesystem zu binden und eigene Kompetenzen und Ressourcen nicht zu stärken, sondern zu schwächen“ (Wansing 2005: 171). Aber der Inklusionsgedanke erfordert gerade auch von den Professionellen ein vollständiges Umdenken in Richtung Partizipation und Teilhabe. Zeitgleich müssen aber auch die Bewohner geschult und beraten werden. Dies gilt gleichermaßen für diejenigen, die aus dem stationären in das ambulante Setting umziehen möchten, wie für Interessenten und somit eventuell zukünftige Bewohner. Daher ist eine „Schaffung von Beratungsdiensten zur Unterstützung behinderter Menschen bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform“ auch im Rahmen einer Institution angeraten (Theunissen 2006: 126). Aus Sicht der Autorin sollte dieser Dienst eng verzahnt mit dem empfohlenen Prozessbegleiter arbeiten, um zu gewährleisten, dass die Wunsch- und Wahlmöglichkeiten des Leistungsempfängers volle Berücksichtigung finden. Das Partizipationsgefühl behinderter Menschen kann auch darüber gestärkt werden, dass sie sich z. B. ihre Gruppenzugehörigkeit selber aussuchen können, d. h. wenn sie erleben, dass sie auch innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen wählen, mitbestimmen und mitwirken können (vgl. Wansing 2005:171). Außerdem müssen die Bewohner, vor allem diejenigen, die ihre Wohnsituation ändern möchten, bei allen Antragstellungen unterstützt werden. Wünschenswert ist darüber hinaus, dass über die Beratung und Prozessbegleitung die Anbahnung sozialer Kontakte unterstützt wird, z. B. durch Organisation von Freizeitaktivitäten in der Gemeinde um von vornherein der oben beschriebenen Isolation entgegen zu wirken (vgl. Theunissen 2006: 126) . Theunissen benennt in seinen Rahmenbedingungen und Standards für zeitgemäßes Wohnen noch weitere strukturelle Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigungen gemeindeintegriertes inklusives Wohnen zu ermöglichen. Beispielhaft sollen hier noch diejenigen Voraussetzungen erwähnt werden, die Einrichtungen mit bedenken sollten, wenn es um künftige Angebote und die Umwandlung in inklusive Einrichtungen geht:
-
Konzeption von Wohngruppen mit bis zu fünf Bewohnern
-
Nutzung der Ressourcen der Großeinrichtungen durch die Transformation in ein regionales Koordinations-, Beratungs-, Unterstützungs- und Kompetenzzentrum
-
Professionalisierung der Unterstützung durch Teilhabepläne und Kompetenzsteigerung bei den Mitarbeitern
-
Systematische Evaluation der Bewohnerzufriedenheit (ebd.)“.
Gerade auch der zuletzt genannte Punkt muss bei der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement mitbedacht werden: die kontinuierliche Kundenbefragung.
Bei der Erarbeitung des Konzepts gilt es aber auch, sich zu überlegen, wie auch das stationäre Angebot inklusiver gestaltet werden kann. Wie weiter oben ausgeführt, muss auch hier von Anfang an „neu“ gedacht werden, das bedeutet: Bewohner dürfen sich beispielsweise selbst aussuchen, mit wem sie zusammen leben wollen. Unter Umständen bedeutet dies, dass auch bestehende Gruppen neu zusammengesetzt werden. Dies ergibt sich auch schon aus einer anderen Anforderung an inklusives stationäres Wohnen und zwar der Verkleinerung der Wohngruppen auf bis zu maximal 5 Bewohner, die ausschließlich in Einzelzimmern leben (vgl. ebd.). Inklusion geht aber nicht nur in eine Richtung, Inklusion kann auch bedeuten, nicht behinderte Menschen in die Einrichtung zu holen. Im Zusammenspiel mit der Verkleinerung der Wohngruppen muss überlegt werden, wie der frei gewordene Raum genutzt werden kann. So kann es eine Möglichkeit sein, diesen nach sicherlich notwendigen Umbaumaßnahmen, als inklusiven sozialen Wohnraum zu vermieten, ähnlich der Idee des Mehrgenerationen - Wohnens. Dies eröffnet unter Umständen auch ehrenamtliche Ressourcen. In anderen Räumen könnten Treffpunkte eingerichtet werden, die die Begegnung zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen weiter erleichtern, Beispiele hier wären Cafés, Bibliotheken oder Schwimmbäder. Über solche Treffpunkte kann gerade den behinderten Menschen, die wegen ihres hohen bis sehr hohen Unterstützungsbedarfs - wie oben beschrieben - vermutlich in den Einrichtungen verbleiben werden, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme erleichtert werden und ihnen die Chance eröffnet werden, ein soziales Netzwerk aufzubauen. Dabei darf natürlich die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung nicht außer Acht gelassen werden und es muss überlegt werden, wie eine Einrichtung mit diesen Strukturen finanziert werden kann. Es bleibt Aufgabe des Managements eine Einrichtung betriebsfähig zu halten. Eine Idee dafür bietet das Modell „Ortsgebundene Sozialfonds zur Finanzierung der Lebensräume für Jung und Alt“ (Wasel 2010: 152). Bei diesem sind an 25 Standorten in Deutschland und Österreich Wohnanlagen mit 18 - 85 barrierefreien, rollstuhlgerechten Wohneinheiten entstanden, die zum überwiegenden Teil an Privateigentümer verkauft wurden. Die übrigen Wohnungen sind vermietet oder befinden sich in der Betreuung der Altenhilfe der Stiftung Liebenau. In diesen Anlagen wird über ein Service - Zentrum kostenlose Beratung und Vermittlung von Dienstleistungen als Gemeinwesenarbeit angeboten. Diese Gemeinwesenarbeit wird finanziert über einen ortsgebundenen Sozialfond. In diesen fließen „…die Verkaufserlöse der Wohnungen, Mitteleinlagen der Gemeinde und Spenden…“ mit ein (ebd.: 154). Es ist vertraglich festgelegt, dass der Zinsertrag aus diesem Sozialfond ausschließlich den Bewohnern der entsprechenden Anlage zugutekommt. Es ist insgesamt eine Idee zur Finanzierung, die sich in Zukunft in Teilaspekten auf stationäre Einrichtungen übertragen lassen könnte, vor allem sicherlich bei den bestehenden Großeinrichtungen, die in der heutigen Zeit bereits ähnlich wie eine Dorfgemeinschaft organisiert sind, aber doch vom ,normalen‘ Leben recht abgesondert bleiben. Ausgehend davon, dass ein Teil der dort lebenden Bewohner in ein ambulantes Wohnangebot umziehen möchte, könnte sich eine Einrichtung überlegen, leer gewordenen Wohnraum so umzubauen, dass er als Wohnung verkauft oder vermietet werden kann, auch mit der Zukunftsperspektive, dass im Alter bei Notwendigkeit von Unterstützung, die Möglichkeit besteht, diese vor Ort zu leisten. Ein Bewohner kann also in den eigenen vier Wänden bleiben. Der Verkaufserlös sollte wie vorgestellt in Ortsgebundene Sozialfonds angelegt werden. Die über den Zinsertrag zur Verfügung stehenden Mittel können dann auch für Angebote wie Krabbelgruppen, Bewohner-Cafés, Gymnastik-Gruppen oder Mittagstische genutzt werden (vgl. ebd.: 153). Mit dieser Art Angebot gelingt es sicher auch junge Familien in eine Einrichtung zu holen, also Inklusion andersherum, ein Weg den stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe gehen können um die Bewohnern, die aus den verschiedensten Gründen in den Einrichtungen verbleiben werden, am Inklusionsgedanke teilhaben zu lassen.
Das trägerübergreifende Persönliche Budget wurde am 1. Januar 2008 gesetzlich verpflichtend eingeführt und soll auf Antrag des Leistungsempfängers Sachleistungen mit individuell bemessenen Geldleistungen ersetzen. Im Kern geht es darum, über das Auszahlen des Budgets direkt an den Leistungsempfänger die Selbstbestimmung und Teilhabe soweit zu stärken, dass der Budgetnehmer sich seine Hilfen selbst „einkaufen“ kann. Diese können so individueller, passgenauer und effizienter von den Leistungsanbietern erbracht werden als dies im pauschalen Vergütungssystem der Fall ist (vgl. Schädler et al. 2008: 81). Außerdem soll „…bei einer entsprechend großen Anzahl von Budgetnehmer/innen als ,Nachfrager‘ … der Druck auf Anbieter erhöht werden, im Wettbewerb über Preis und Qualität der Angebote möglichst kostengünstig zu arbeiten“ (ebd.). Zudem soll der Grundsatz „ambulant vor stationär“ weiter in seiner Umsetzung gestärkt werden.
Abbildung 3. Leistungsbeziehungen mit einem Persönlichen Budget
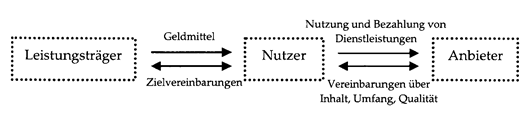
Der Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget ist im §17 SGB IX verankert, wobei die Grundvoraussetzung ein prinzipieller Anspruch auf Teilhabeleistungen nach § 5 SGB IX darstellt. Zusätzlich muss ein Antrag gestellt werden, „…durch den Leistungsberechtigte ihren Wunsch auf Geldleistungen in Form eines Persönlichen Budgets konkretisieren“ (Schäfers et al. 2009: 27). Dabei sollen Persönliche Budgets im Einzelfall jeweils als Komplexleistung von einem oder mehreren Leistungsträgern als Gesamtbudgets ausgezahlt werden. Leistungsträger eines Persönlichen Budgets können u.a. die gesetzliche Krankenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit, die gesetzliche Unfallversicherung, die soziale Pflegeversicherung oder die Sozialhilfe sein, die Nachrangigkeit der Sozialhilfeträger bleibt jedoch unberührt (vgl. ebd.: 28). In einer Modellphase in den Jahren 2001 bis 2007 wurde die Einführung des Persönlichen Budgets in verschiedenen Modellprojekten wissenschaftlich begleitet und überprüft. Konkretisiert wurde danach, wie die Leistungsträger Leistungen koordinieren und ausführen und welche Leistungen überhaupt budgetfähig sind (vgl. ebd.). Allerdings war die Festlegung nach der Art der Leistungen missverständlich und wurde nochmals geändert, sodass nun prinzipiell alle Leistungen zur Teilhabe budgetfähig sind. Außerdem können Leistungen der Kranken- und Pflegekassen, der Unfallversicherung (bei Pflegebedürftigkeit) und der Sozialhilfe (bei Hilfen zur Pflege) als Persönliche Budgets erbracht werden, wenn sich diese auf alltägliche, wiederkehrende Bedarfe beziehen (vgl. ebd.). Kritisch in diesem Zusammenhang ist aber der Satz 4 des Absatzes 3 § 17 SGB IX zu sehen, der bestimmt, dass die Höhe des Persönlichen Budgets nicht den Betrag überschreiten darf, der bisher für den Leistungsempfänger bewilligt wurde. Dies in Verbindung mit dem bereits weiter oben erwähnten §5 SGB VIII wird dazu führen, dass behinderte Menschen, deren Hilfebedarf bei ambulanter Betreuung die Kosten der jetzt stationären überschreitet, vom Persönlichen Budget ausgeschlossen bleiben. Daher verwundert es auch nicht, dass die Befürchtung vor allem auf Seiten von (möglichen) Budgetnehmern groß ist „…die Budgetverordnung sei in erster Linie ein „Einspargesetz“…“ (Kornherr 2008: 61). Weitere Kritikpunkte, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen sind die lange Verfahrensdauer nach Antragsstellung, die nichttransparente Bedarfsfeststellung und -bewilligung und die enge Zweckbindung (vgl. Schädler et al. 2008: 84). Schlussendlich ist auch noch zu klären, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten und „geistiger Behinderung“ am Persönlichen Budget teilhaben können, da ihnen dies nicht ohne intensive Beratung und Unterstützung gelingen wird. Wer allerdings diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen zu erbringen und eben auch zu finanzieren hat, steht noch zur Debatte (vgl. ebd.). Nichtsdestotrotz kann das Persönliche Budget für einen Teil der Adressaten eine Möglichkeit sein in Zukunft ihre Hilfen selber „einzukaufen“, zu organisieren und darüber ein sehr viel selbstbestimmteres Leben zu führen. Beispielhaft sollen hier zwei Modellprojekte dargestellt werden, die das Persönliche Budget einmal im stationären und einmal im ambulant betreuten Sektor mit unterstützender Einrichtung erprobt haben um danach Schlüsse zu ziehen ob und wie diese Finanzierungsform auch in zukünftigen Einrichtungen umsetzbar ist.
Ersteres Projekt fand in einem Wohnheim für geistig und körperlich behinderte Menschen in Bielefeld statt, welches mit seinen 24 Plätzen zum Träger der Bodelschwinghschen Anstalten Bethel gehört. Der Modellversuch PerLe ist eingebettet in ein breit angelegtes Forschungsprogramm, „…das sich systematisch mit den Chancen personenbezogener Unterstützung auseinandersetzt und insbesondere die Möglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung auslotet, ihre Unterstützungsleistungen individueller zuzuschneiden und bezogen auf die benötigten Leistungserbringer mehr zu steuern“ (Schäfers et al 2009: 39). Der Versuch fand außerdem auch in Kooperation mit dem beteiligtem Leistungsträger Landschaftsverband Westfalen-Lippe statt. Das Projekt startete im August 2003, nach 2 Jahren wurden die bis dahin gemachten Erfahrungen reflektiert, die Rahmenbedingungen verändert und angepasst und endete im September 2006. Zunächst musste die Ausgestaltung der neuen „Vertragsbeziehungen“ überlegt werden, da eine Einrichtung trotzdem natürlich auch das Heimgesetz und die rechtlichen Rahmenbedingungen der stationären Eingliederungshilfe zu beachten hat. Dazu wurden Kooperationsverträge mit den Leistungsträgern und Zusatzverträge mit den Bewohnern (bzw. deren gesetzlichen Betreuern A. d. V.) abgeschlossen (vgl. ebd.: 41). Außerdem musste sich der Leistungsanbieter mit seinem Pauschalpaket Wohnen auseinandersetzen um daraus einzelne wählbare Leistungsmodule herauszufiltern und kalkulieren zu können (vgl. ebd.). Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Projekt von Seiten des Anbieters war eine gewisse Planungs- und Finanzierungssicherheit, die das Wohnheim betriebsfähig bleiben ließ und eine bestimmte Versorgungsqualität gewährleistete (vgl. ebd.: 49). In der Ausgestaltung wurde vereinbart, dass ein Teil der Leistungen, die die Versorgungsqualität der Bewohner bei der Grundversorgung gewährleisten sollten, weiterhin vom Wohnheimträger als Sachleistung erbracht werden. Als Geldleistung in Form des Persönlichen Budgets wurden hingegen Leistungen wie Teilnahme an kulturellen oder Bildungsangeboten, Freizeit und Erholung, Mobilität oder Aufrechterhaltung und Förderung sozialer Kontakte flexibilisiert und konnten von den Bewohnern nach Bedarf intern (beim Wohnheimpersonal) oder extern (bei Dienstleistern oder privaten Unterstützern) „eingekauft“ werden. Der jeweilige konkrete Betrag, der den Budgetnehmern zur Verfügung stand errechnete sich aus der individuellen Hilfebedarfsgruppe. In der abschließenden Bewertung des Projektes durch die Forschungsgruppe wurde insgesamt eine hohe Akzeptanz des Persönlichen Budgets festgestellt. Die Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer beurteilten ihre Erfahrungen und die Veränderungen, die durch die veränderten Leistungsbeziehungen stattgefunden haben fast durchweg positiv. Während die Forscher am Anfang eine sehr zögerliche Inanspruchnahme verzeichneten, stellten sie nach immer längerer Laufzeit vor allem in der 2. Modellphase einen Anstieg der „eingekauften“ Leistungen fest. Vor allem im Bereich der Freizeitaktivitäten außerhalb des Wohnheims erlebten die Bewohner einen deutlichen Zuwachs, zudem konnten die Budgetnehmer und Budgetnehmerinnen sehr viel selbstbestimmter und zeitlich flexibler ihre Aktivitäten planen (vgl. ebd.: 95f.). Nach anfänglicher Skepsis des Wohnheimpersonals und vor allem auch der Angst um den eigenen Arbeitsplatz wandelte sich auch die Haltung der Betreuer dem Persönlichen Budget gegenüber (vgl. ebd.: 111). Die Möglichkeit, dass externe Anbieter Unterstützung und Leistungen durchführen können, für die das Personal kaum Zeit hat, wirkt entlastend und erweitert aus Sicht des Personals die Angebotspalette für die Bewohner (vgl. ebd.:103). Außerdem wurde es als sehr positiv empfunden, dass aufgrund der transparenten Leistungsplanung und -dokumentation überzogene Ansprüche von Budgetnehmern oder Angehörigen zurückgewiesen werden konnten und dafür im Gegenzug verstärkt der Personenkreis berücksichtigt wurde, der selten Unterstützung einfordert oder einfordern kann (vgl. ebd.: 102). Für beide Seiten, Budgetnehmer und Betreuer gab es aber auch Kritikpunkte. Für die Bewohner stellte sich vor allem die unbefriedigende Informationslage am Beginn des Projekts als Problem dar. Sie hätten sich eine längere Vorlaufzeit und damit verbundene Schulungen zum Umgang mit dem Persönlichen Budget gewünscht, damit ein großer Teil der Unsicherheiten schon vorher hätte beseitigt werden können (vgl. ebd.: 100). Aus Sicht des Personals ist die häufige Unvereinbarkeit mit dem Rahmendienstplan bzw. das Auftreten unvorhergesehener Ereignisse ein zentrales Problem bei der Umsetzung des Persönliches Budgets (vgl. ebd.: 104). Zudem wurden der bürokratische Aufwand und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung mit der Grundversorgung bemängelt. Als Befürchtung wurde zudem die möglicherweise entstehende Konkurrenz unter den Mitarbeitern geäußert. Zusammenfassend bleibt aber festzuhalten, dass auf beiden Seiten und auch aus Sicht der Einrichtung die Einführung des Persönlichen Budgets für einen Teil der Leistungen als positiv und als Weiterentwicklung für alle Beteiligten erlebt wurde. Im Zuge des Umbaus einer stationären Einrichtung kann daher aus Sicht der Autorin der Schluss gezogen werden, dass es durchaus möglich ist mit der Finanzierungsform des Persönlichen Budgets einen Teil der Leistungen einer Einrichtung zu finanzieren. Dafür muss allerdings vorher genau überlegt werden, welche Leistungen darüber kalkuliert und angeboten werden können. Es wird schon auf Grund der Fürsorgepflicht, der Verantwortung für die Grundversorgung und der gesundheitlichen Sorge sowie der weiterhin notwendigen Beachtung gesetzlicher Vorschriften und des Heimgesetzes nicht möglich sein, einen vollstationären Betrieb nur über das Persönliche Budget zu finanzieren. Aber es ist in jedem Fall ein Weg, den Bewohnern mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu eröffnen und Leistungen individueller und passgenauer anzubieten. Im Zuge der Umwandlung der Eingliederungshilfe und des Paradigmenwechsels hin zu mehr Partizipation sind auch stationäre Einrichtungen gefordert, sich Gedanken zu machen in welcher Form sie inklusiver werden. Leistungen nicht mehr pauschal für alle gleich anzubieten, sondern die Bewohnern selbst wählen zu lassen, welche sie sich „einkaufen“ möchten und vor allem auch bei und mit wem, ist ein Schritt in diese Richtung. Damit eröffnet man auch den Bewohnern eine neue Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und ihr soziales Netzwerk sozusagen „extern“ auszubauen. Geht man aber wie beschrieben davon aus, dass die Menschen in den Einrichtungen bleiben, die einen sehr hohen Hilfebedarf aufweisen, muss überlegt werden, wie diese bei der Verwendung eines Persönlichen Budgets unterstützt werden können, wer dieses wie verwaltet und wer stellvertretend - wenn notwendig - die Wünsche der Budgetnehmer herausfiltert. Es erscheint der Autorin nicht geeignet, dass dies wie im Projekt PerLe die Mitarbeiter übernehmen, da dadurch erstens eine Mischrolle bei den Mitarbeitern entsteht und zweitens die Gefahr bestünde, dass Leistungen langfristig dem Diktat der „Machbarkeit“ im Dienstplan unterliegen. Zu überlegen wäre an dieser Stelle, entweder den Angehörigen bzw. den gesetzlichen Betreuern diese Aufgabe zu übergeben oder - aus Sicht der Autorin am sinnvollsten - eine neutrale Stelle damit zu beauftragen. Es wäre zu erwägen, dem bereits weiter oben beschriebenen Prozessbegleiter diese Aufgabe zu übertragen, dies bietet auf der einen Seite den Vorteil der Neutralität und damit Objektivität und auf der anderen Seite wird der bürokratische Aufwand der Verwaltung der Persönlichen Budgets nicht auf das Personal übertragen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den entwickelten Leistungsmix des obigen Projekts „…kein radikaler Umbau bestehender Leistungssysteme vollzogen [wurde]…“, es aber gelungen ist, einen Mix aus Sicherheit gebenden Standards und individuellen Leistungsoptionen zu entwickeln (ebd.: 153). Der Umbau bestehender Systeme muss langsam und behutsam vollzogen werden, damit die Bewohner Zeit haben zu lernen, mit den Neuerungen umzugehen und in ihre Rolle als Kunde zu wachsen. Dafür bietet das Persönliche Budget im stationären Kontext als Leistungsmix mit standardisierten Sachleistungen der Grundversorgung einen guten Anreiz.
Auch im zweiten Projekt, dem Wohnprojekt der Lebenshilfe Bad Segeberg und Umgebung, kommt der Projektleiter zu dem Schluss, dass das Persönliche Budget eine Möglichkeit bietet ein „…bedarfsgerechtes Betreuungsarrangement zu schaffen, welches sich in seiner Ausgestaltung nicht mehr an der bisherigen Unterscheidung in stationäre und ambulante Angebote oder an standardisierten Einrichtungstypen orientiert“ (Kretzschmar 2011: 5). Das Wohnprojekt befindet sich im Ort Wahlstedt in zwei übereinanderliegenden 4-Zimmer-Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus mit 5 Mietparteien und bietet Platz für 4 behinderte Menschen. Diese habe sich vor Einzug ihre Zimmer und ihre Mitbewohner selbst ausgesucht. Das Wohnprojekt ist eingebettet in das Fachkonzept „ambulantes Wohntraining“, welches die Lebenshilfe Bad Segeberg entwickelt hat um jungen behinderten Menschen den Übergang vom Elternhaus in das ambulante Wohnen zu erleichtern (vgl. ebd.: 1). Die Finanzierung über das Persönliche Budget ist in diesem Projekt wie folgt aufgegliedert. Zunächst einmal sind die Bewohner alle selbständige Mieter ihrer Wohnungen bzw. Zimmer. Zu diesem Zweck haben sie bzw. ihre gesetzlichen Vertreter mit dem Vermieter Verträge abgeschlossen, die unabhängig von den Betreuungsverträgen sind. Dadurch gelten diese Wohngemeinschaften als „…selbstverantwortlich geführte ambulant betreute Wohngemeinschaften…“ die auch nicht der Prüfung durch die Heimaufsicht unterliegen (vgl. ebd.: 3). Folgt man dem Leitgedanken Inklusion und dem Art. 19 BRK so kann festgehalten werden, die Bewohner leben da, wo andere auch leben, wie und mit wem sie wollen. Trotzdem sind sie durch die Angebundenheit über die Betreuungsverträge an die Lebenshilfe Bad Segeberg abgesichert, sodass sie alle notwendige Unterstützung bekommen. Das Wohnen ist von den Unterstützungsleistungen getrennt und wird finanziert über die Leistungen der Grundsicherung. Die Unterstützung wird über ein Persönliches Budget finanziert, welches individuell über den Hilfebedarf kalkuliert wurde. Allerdings ist es dadurch eng angelehnt an die Leistungen, die in der Wohngemeinschaft erbracht werden (vgl. ebd.: 3). Es setzt sich aus folgenden Einzelkomponenten zusammen:
-
„Ambulante, personenzentrierte Betreuung und Förderung durch eine pädagogische Fachkraft
-
Gruppenleistung (hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Pflege, Betreuung, Nachtbereitschaft)
-
Freizeitpauschale
-
Budgetassistenz“ (ebd.).
Assistenz und hauswirtschaftliche Unterstützung werden durchgeführt von „Nicht-Fachkräften“, nur die personenzentrierte Betreuung wird durch eine pädagogische Fachkraft erbracht. Der jeweilige Fachkraft-Anteil und die gesamte personelle Ausstattung werden errechnet aus dem individuellen Unterstützungsbedarf und einer Pauschale für die Gruppenleistung, die bei allen gleich ist. In der Gesamtbewertung des Projekts kommt der Projektleiter zu dem Ergebnis, dass diese Art Wohnform und des Betreuungsarrangements eine grundsätzlich individuellere Leistungserbringung ermöglicht als bisher im Kontext des stationären Wohnens. Die Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und vor allem Selbstbestimmung werden darüber gefördert, dass die Unterstützungsleistungen frei gewählt werden und ebnen den Leistungsberechtigten den Weg, sich als Kunde zu fühlen und entsprechend in diese Rolle zu wachsen. Zeitgleich verändert sich auch das Rollenverständnis der Unterstützenden Dienste hin zu Assistenten (vgl. ebd.: 5). Über die Finanzierung als Persönliches Budget können die „Auftraggeber“ daher „…direkt Einfluss auf die Erbringung der Unterstützungsleistung nehmen“ (ebd.). Trotzdem überwiegen insgesamt die Kritikpunkte und Schwierigkeiten. Diese betreffen allerdings weniger das Grundkonzept an sich als vielmehr die umgebenden Faktoren, hier vor allem die derzeit gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Als schwierig stellte sich u.a. heraus, dass das Wohnen unabhängig von der Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen - vor allem der Gruppenleistung - ist. Dies hatte zur Folge, dass bei Wegfall der Gruppenleistung von einem Bewohner, die Gesamtkostenanteile bei den anderen Bewohnern stiegen und von den Kostenträgern aufgefangen werden mussten. Da dies aber nicht immer zeitnah geschah, konnten die Unterstützenden Dienste dies nicht auffangen, in diesen Fällen mussten dann die Leistungsberechtigten selber oder ihre gesetzlichen Vertreter die Deckungslücken schließen (vgl. ebd.:6). Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass einerseits das Risiko von Kostensteigerungen einseitig bei den Kostenträgern liegt und andererseits bei Nichtübernahme der Kostensteigerungen im negativsten Fall die anderen Bewohner ausziehen müssten und somit die Wohngemeinschaft aufgelöst werden muss (vgl. ebd.: 4). Weiterhin wird bemängelt, dass „…die Standards der Betreuung im Grunde einseitig vom Kostenträger geregelt [sind] und nur unter Anstrengungen von Seiten der Leistungsberechtigten und der Leistungserbringer überprüft werden können“ (ebd.: 6). Nur unter dem Aspekt von Inklusion jedoch ist das Wohnprojekt als erfolgreiche Möglichkeit inklusiven Wohnens zu betrachten. Zu dem gleichen Schluss kommt hier auch die Autorin. Es ist in jedem Fall notwendig, die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und - wie im vorliegenden Projekt geschehen - die Verträge so anzupassen, dass das finanzielle Risiko von Kostensteigerungen minimiert wird und nicht einseitig bei den Kostenträgern liegt. Wenn diese Voraussetzung allerdings erfüllt ist, trägt diese Wohnform mit ihrer Finanzierung über das Persönliche Budget dem Inklusionsgedanken Rechnung und erfüllt die Anforderungen des Art. 19 BRK. Für derzeitige stationäre Einrichtungen, die ihr ambulantes Wohnangebot ausbauen möchten, kann dieses Projekt durchaus beispielhaft sein und dem Management einen möglichen Weg zeigen. Dabei bietet auch hier das Angeschlossen Sein an eine größere unterstützende Einrichtung die schon im ersten Projekt erwähnte Sicherheit, dass bewährte Standards eingehalten werden können.
Die Finanzierungsform des Persönlichen Budgets ist eine gesetzlich verankerte Möglichkeit für Leistungsberechtigte, statt Sach- Geldleistungen zu beantragen und sich damit individuell gewünschte Leistungen selber „einzukaufen“. Darüber soll für behinderte Menschen ein Größtmaß an Selbstbestimmung und Teilhabe erreicht werden. „Das persönliche Budget ist, …, ein Instrument marktwirtschaftlicher Steuerung, insofern es dem Kunden finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt und ihn nicht zur Abnahmen komplex erbrachter Sachleistungen verpflichtet“ (Kornherr 2008: 80). Beide hier beschriebenen Projekte zeigen, dass sich auch im stationären Kontext bzw. im angeschlossen Bereich an eine Einrichtung aber ambulant ein Umdenken des Managements lohnen kann, nicht mehr alle Leistungen über standardisierte Vollversorgung anzubieten und im Zuge der BRK ist es letztlich auch nicht mehr zeitgemäß. Allerdings haben beide Projekte auch die Schwierigkeiten aufgezeigt, die damit verbunden sind. Solange sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht ändern und für Einrichtungen eine Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften zu beachten sind, die der Verwendung von Persönlichen Budgets im Weg stehen und erhöhte finanzielle Risiken bedeuten, werden stationäre Einrichtungen davon absehen, ausschließlich mit dieser Finanzierungsform zu arbeiten. Dabei kommt als ein weiterer entscheidender Aspekt hinzu, dass die Höhe des Budgets auf die derzeitig verursachten Kosten eines Leistungsnehmers „gedeckelt“ ist, sodass Menschen mit hohem bis sehr hohem Hilfebedarf bei individueller Berechnung nicht daran partizipieren werden. Da aber bei derzeitiger Ausgangslage vermutlich genau diese Menschen in den Einrichtungen verbleiben würden, ist davon auszugehen, dass von deren Seite die Inanspruchnahme dieser Finanzierungsform weiterhin gering bleiben wird. Geht man also von dieser Gesamtsituation in der Zukunft aus besteht aus Sicht der Autorin (in rein finanzieller Hinsicht) kein Handlungsbedarf bei Institutionen und Einrichtungen, da die Nachfrage sich nicht oder nur gering erhöhen wird. Dies zeigen auch bundesweite Forschungsergebnisse, die in verschiedenen Modellregionen vor Einführung des Persönlichen Budgets stattfanden. „Bei den bewilligten Budgets handelt es sich zum ganz überwiegenden Teil um ambulante Eingliederungshilfen im häuslichen Bereich …“ (Schädler et al. 2008: 83). Zudem ist bis heute auch noch nicht geklärt, wie besonders Menschen mit großen kognitiven Beeinträchtigungen bei der Verwendung eines Persönlichen Budgets unterstützt werden sollen, wer diese Unterstützung leistet und vor allem wer sie bezahlt (vgl. ebd.: 84). Nichtsdestotrotz ist es überlegenswert, zumindest einzelne Leistungen über Persönliche Budgets zu finanzieren, da es aus institutioneller Sicht Vorteile in der Organisation und Bereitstellung bieten kann, wenn diese extern eingekauft werden. Das aus der Sicht der BRK und unter Inklusions-Gesichtspunkten ein solches Umdenken in die Richtung individuellerer Angebotsformen stattfinden muss, steht außer Frage und ist mit den Zielsetzungen des Persönlichen Budgets grundsätzlich vereinbar. Für unterstützend ambulante Angebote ist das Persönliche Budget ein geeignetes Instrument der Finanzierung und es ist davon auszugehen, dass sich in diesem Umfeld auch die Nachfrage nach Angeboten, die sich darüber finanzieren und damit arbeiten erhöhen wird, da darüber eine sehr viel selbstbestimmtere Lebensführung möglich ist. Daher ist es empfehlenswert, dass sich das Management beim Aufbau inklusiver Wohnangebote detailliert mit den einzelnen Leistungskomponenten ihres Angebots auseinandersetzt, diese einzeln kalkuliert und die Finanzierung über das Persönliche Budget vereinbart.
Für den Begriff der Fachleistungsstunde existiert keine bundeseinheitliche Definition und Regelung. Als Instrument wird sie größtenteils im Bereich der Jugendhilfe über die Hilfen zur Erziehung genutzt. Brinkmann definiert die Fachleistungsstunde als „… ein flexibel einsetzbares Leistungsentgelt, das in ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeleistungen sowie intermediären Netzwerkleistungen des „Sozial- und Gesundheitssektors“ zur Kostenberechnung herangezogen werden kann“ (Brinkmann 2010: 170). In der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen jedoch wird dieses Entgelt bisher nur für die personenbezogene Unterstützung beim ambulant betreuten Wohnen eingesetzt. Daher kann sich die Autorin im Rahmen dieser Arbeit vorrangig nur damit befassen, wie die Fachleistungsstunde als Instrument für zukünftige ambulante Wohnangebote inklusiver Einrichtungen genutzt werden kann.
Die Fachleistungsstunde (im folgendem FLS) setzt sich in der Regel zusammen aus „…allen laufenden, betriebsnotwendigen Aufwendungen (Personal- und Sachkosten, Investitionskosten und kalkulatorische Kosten/Bereitschaftskosten, Anteil an den Gemeinschaftskosten) …, die mit Inanspruchnahme derselben pro Betreuungsstunde verbunden sind (Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers)“ (ebd.). Beispielhaft wird an dieser Stelle eine vereinfachte Formel zur Berechnung einer FLS dargestellt:
Jahrespersonal- und Sachkosten ./. Netto-Jahresarbeitszeit Fachkraft = Stundensatz
Die Netto-Jahresarbeitszeit ergibt sich aus der Bruttoarbeitszeit abzüglich Urlaubs-, Krankheits-, Fortbildungs- und Feiertagen (durchschnittlich) und fach- und fallspezifischen Aktivitäten (vgl. ebd. 171f.). Im Gegensatz zum Persönlichen Budget ist die Fachleistungsstunde ein Instrument, welches auf Anbieterseite zur Kostenberechnung verschiedenster Hilfeangebote genutzt werden kann. Der kalkulierte Kostensatz wird dann zwischen Leistungsträgern und -erbringern verhandelt. Die Fachleistungsstunde kann bei der Finanzierung über ein Persönliches Budget oder bei der Finanzierung über Hilfebedarfsgruppen genutzt werden. Als Voraussetzung muss in einem Hilfeplanverfahren ein Leistungsstundenbudget für den Leistungsempfänger festgelegt werden. Dies bezieht sich allerdings nur auf die Fachkraftstunden, nicht auf den gesamten Hilfebedarf. Daher werden bei dieser Finanzierungsform weitere kalkulatorische Differenzierungen innerhalb der Stundensätze notwendig um gerade im Bereich der ambulanten Betreuung von Menschen mit hohem Hilfebedarf den erforderlichen Personalmix zu gewährleisten. Die Unterscheidung „…nach dem Grad der erforderlichen Fachlichkeit…“ ist an dieser Stelle unerlässlich, um die Kosten zu reduzieren und auch Menschen mit höherem Hilfebedarf ambulant betreutes Wohnen zu ermöglichen (Schädler et al. 2008: 75).
Die Finanzierung über Fachleistungsstunden wurde im Rahmen der „…Begleitforschung zur befristeten Zuständigkeitsverlagerung im Bereich der Hilfen zum selbständigen Wohnen für Menschen mit Behinderungen auf die Ebene der Landschaftsverbände als überörtliche Sozialhilfeträger in Nordrhein-Westfalen…“ von 2003 - 2008 neben anderen Finanzierungsformen mit untersucht (ebd.: 7). In Nordrhein-Westfalen wurden für das Ambulant Betreute Wohnen Fachleistungsstunden eingeführt und wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse und Auswertungen erfolgten größtenteils aus Sicht von Planungsverantwortlichen, Landschaftsverbänden und Trägern. Ausführlich wurden dabei die Schwierigkeiten in der Umsetzung dargestellt. Eine detailliertere Auswertung aus Sicht der behinderten Menschen erfolgte an der Stelle leider nicht und kann daher an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Im Wesentlichen handelte es sich bei diesem Projekt darum, die Finanzierungssystematik FLS umzusetzen. Nach erheblichen Schwierigkeiten seitens der Anbieter bei der Umstellung aufgrund der Ausweitung der administrativen Aufgaben, kamen die Forscher zu einem zweigeteilten Ergebnis. Auf der einen Seite befinden sie grundsätzlich die Einführung der stundenbezogenen Finanzierung in technischer Hinsicht als gelungen (vgl. ebd.: 74). Allerdings stellen sie auf der anderen Seite fest, dass jedoch auch Fragen grundsätzlicher Natur aufgeworfen wurden „…die sich auf das Finanzierungsinstrument Fachleistungsstunde und dessen Implikationen für die Umsetzung des Ziels ,ambulant vor stationär‘ beziehen“ (ebd.). Gemeint sind damit vor allem die Umsetzungsschwierigkeiten bei Menschen mit hohem bis sehr hohem Unterstützungsbedarf. Wie schon weiter oben erwähnt, ist für diesen Personenkreis eine weitere Differenzierung der Stundensätze unbedingt erforderlich, da sich im Projekt herausgestellt hat, dass schon ab einem Hilfebedarf ab acht Stunden pro Woche die stationäre Unterbringung die kostengünstigere ist (vgl. ebd.: 75). Dies ist besonders unter dem Aspekt des Mehrkostenvorbehalts kritisch zu sehen, da schon bei vergleichsweise geringem Unterstützungsbedarf die Heimunterbringung Priorität sein wird, eine Regelung, die natürlich jeglichen Inklusionszielen und allen Grundgedanken der BRK und speziell des Artikel 19 BRK entgegen steht (vgl. ebd.). Weitere Aspekte die als problematisch formuliert wurden sind folgende:
-
eingeschränkte Flexibilität durch ein starr festgelegtes Verhältnis von unmittelbaren Betreuungsleistungen und sonstigen Leistungen (vgl. ebd.:73).
-
Der Umgang mit der Quittierungspflicht, besonders wenn die Betreuungsleistungen von Seiten der Leistungsempfänger abgelehnt wurden. Daraus ergeben sich für die Leistungsanbieter konkrete Einnahmeausfälle (vgl. ebd.).
-
Verbunden mit dem vorherigem Punkt scheinen große Träger daher im Vorteil, da sie mit ihrem Personaleinsatz flexibler auf Veränderungen reagieren können, insbesondere wenn noch stationäre Hilfen angekoppelt sind (vgl. ebd.).
-
Ein deutlich gestiegener Verwaltungsaufwand durch Einzelfallabrechnung (vgl. ebd.).
-
Problematische Anreizstrukturen aufgrund pauschalisierter Sach- und Fahrtkosten. Es wird befürchtet, dass daher vorrangig Nutzer betreut werden, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Es besteht aus Sicht der Forscher damit sogar der Anreiz, stationäre Einrichtungen lediglich formal umzuwidmen (vgl. ebd.).
-
Abschließend wurde auch die Vergütungshöhe kritisiert (vgl. ebd.).
Die Forscher kristallisierten aber auch die Erfolgsfaktoren einer positiveren Umstellung für die Anbieter heraus. Wichtig waren dabei insbesondere der ansteigende Ausbau ambulanter Angebote, eine veränderte Personalstruktur mit einem kleineren Anteil von Fachkräften, eine Verdichtung der Arbeitsaufgaben und eine Absenkung der durchschnittlichen Höhe der Mitarbeitervergütung (vgl. ebd.: 74). Bezieht man diese Ergebnisse nun auf stationäre Einrichtungen und ihr zukünftiges Angebot an ambulanten Wohnformen, scheint eine Finanzierungssystematik über Fachleistungsstunden für den ambulanten Bereich durchaus empfehlenswert. Allerdings wird es nach den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen nur bis zu einem bestimmten Hilfebedarf überhaupt möglich sein, diese Systematik anzuwenden, ohne das Risiko einzugehen, die Nutzer eventuell wieder im Heim unterbringen „zu müssen“. Für eine inklusive Einrichtung ist die Abrechnung über FLS unter den derzeit gültigen Regelungen daher nur bei Wohnangeboten möglich und lohnenswert, die von Menschen mit geringem bis sehr geringem Unterstützungsbedarf in Anspruch genommen werden. Verbindet die Einrichtung allerdings die Abrechnung über FLS damit, dass diese Bewohner Budgetnehmer sind, kann darüber ein sehr personenbezogenes individuelles Unterstützungsarrangement entstehen, das auch von Seiten der Einrichtung absolut transparent dargestellt werden kann. Außerdem müsste schon im Hilfeplanverfahren genauer differenziert und definiert werden, welche Fachkraft-Unterstützung überhaupt notwendig und von Seiten des Hilfeempfängers gewollt ist, dies würde eine sehr viel präzisere und individuellere Leistungsbemessung bedeuten. Geht man von einem Mix in der zukünftigen Bewohnerstruktur aus, bei dem diejenigen mit dem geringerem Unterstützungsbedarf in ambulanten Angeboten der Einrichtung leben und diejenigen mit einem hohen bis sehr hohen Unterstützungsbedarf im stationären Angebot verbleiben, ist die FLS ein Instrument, das vom Management genutzt werden kann, um Bewohnern bis zu einem bestimmten Hilfebedarf ein inklusiveres Wohnen zu erleichtern. Ab einem gewissen Grad des Unterstützungsbedarfs jedoch wird es unter der derzeitigen Rechtslage unmöglich sein, Fachleistungsstunden als Finanzierungsinstrument einzusetzen.
Daher zieht die Autorin das Fazit, dass die Fachleistungsstunde ein Instrument ist, welches für den ambulanten Bereich einer Einrichtung zur Kalkulation der Kosten dienen kann und für Menschen mit einem geringem Unterstützungsbedarf dazu beitragen kann, im Rahmen eines Persönlichen Budgets, selbstbestimmter und transparenter ihre Leistungen einzukaufen. Für die erwartete Bewohnerklientel des stationären Bereichs wird die FLS kaum eine Relevanz besitzen, da an dieser Stelle der derzeit gültige Mehrkostenvorbehalt einsetzt. Das dies absolut kritisch zu sehen ist und in keiner Weise mit den Zielen der BRK und vor allem des Art. 19 vereinbar ist, steht außer Frage, ist aber derzeit gültige Rechtslage. Die eigentliche Systematik stundenbezogener Leistungseinheiten kann allerdings vom Management durchaus genutzt werden, Ressourcen und Potenziale auch innerhalb des stationären Kontext aufzuzeigen und auch da die Leistung individueller im Hilfeplanverfahren bemessen zu können und somit personenbezogener zu gestalten. Zu diesem Schluss kommt letztlich auch die Forschungsgruppe, in dem sie anmerkt, dass durch die neuen Anforderungen an das Hilfeplanverfahren, diese sich „…stärker auf die einzelne Person einlassen [müssen] und präziser die Inhalte erforderlicher Leistungen klären [müssen]“ (ebd.: 75).
Die Finanzierung über Hilfebedarfsgruppen ist, wie bereits unter Punkt 4.2 beschrieben, die derzeit übliche. Da auch die Systematik bereits an dieser Stelle detailliert dargestellt wurde, wird auf eine nochmalige Beschreibung verzichtet. Der Hilfebedarf soll üblicherweise in einem Gesamtplanverfahren festgestellt werden, welches in einer individuellen Hilfeplanung mündet. Derzeit gibt es allerdings dazu bundesweit verschiedene Verfahren, die sich z. B. darin unterscheiden, welche Wege genutzt werden (Verwaltung, vermittelnde Stellen etc.) oder welche Rollen und Kompetenzen die Fachdienste dabei besitzen (vgl. Schädler et al. 2008: 25). Über die Eingruppierung eines Leistungsempfängers in eine Hilfebedarfsgruppe soll eine individuellere Leistungsbemessung entsprechend des Hilfebedarfs erfolgen. Innerhalb der einzelnen Hilfebedarfsgruppen jedoch werden die Leistungen einer stationären Einrichtung weiterhin pauschal standardisiert angeboten und der Leistungsempfänger hat keinerlei Steuerungsmöglichkeiten. Bleibt es zukünftig bei dieser Finanzierungssystematik, gilt es also für das Management zu überlegen, wie inklusive Angebote bedarfsgerechter und personenzentrierter finanziert werden können.
An dieser Stelle kann die Überlegung angestellt werden, ob mehr Selbstbestimmung und Teilhabe darüber erreicht werden kann, dass auch innerhalb einer Hilfebedarfsgruppe Leistungen individuell bemessen und differenziert werden. Das meint, dass eine Einrichtung für den stationären Kontext überlegen kann, welcher Bewohner welchen Unterstützungsbedarf innerhalb einer HBG hat. Es gibt beispielsweise Bewohner deren Pflegebedarf höher als ihr Bedarf bei der Freizeitassistenz ist oder anders herum, beide Bewohner sind aber in der gleichen HBG. Dafür ist es aber wie schon erwähnt erforderlich, dass das Management das Leistungsangebot weiter ausdifferenziert und kalkuliert. Aus Sicht der Autorin erscheint dies auch aus einem anderen Grund durchaus empfehlenswert, danach könnten auch die Mitarbeiter spezieller anhand ihrer Qualifikationen eingesetzt werden. Darüber würden die Bewohner gezielter in ihren individuell notwendigen Bereichen unterstützt. Davon ausgehend, dass zukünftige Einrichtungen aufgefordert sein werden vor allem im stationären Kontext Kosten einzusparen, kann dies außerdem eine Möglichkeit sein finanzielle Ressourcen zu eröffnen. Grundpflegetätigkeiten können gezielter von Pflegehelfern übernommen und Freizeitassistenz über angelernte Kräfte organisiert werden. Dadurch würde das Fachkraftpotenzial frei werden und würde gezielter und effektiver für Fachkrafttätigkeiten zur Verfügung stehen. Als Instrument zur Differenzierung eignet sich dabei die Systematik der stundenbezogenen Leistungseinheiten. Es ermöglicht eine Unterscheidung in Fachkraft- oder Assistenzkraftstunden und darüber einen exakteren Ressourceneinsatz.
Wie die Finanzierung über HBGs im ambulanten Sektor stattfinden kann, zeigt ein Beispiel der SELAM-Lebenshilfe in Oldenburg. In einer Wohngemeinschaft mit 2 Bewohnern werden durch die Ambulante Assistenz auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf betreut. Dabei wird „der Bedarf an Eingliederungshilfe .. über eine Hilfeplanung festgestellt“ und „die Pflegeleistungen [..] über das Gutachten des medizinischen Dienstes der Pflegeversicherung ermittelt“ (Lebenshilfe 2012: 19). Daraus ergibt sich für die Leistungsempfänger ein Gesamtstundenpaket, welches auch eine „Rund-um-die-Uhr-Assistenz“ ermöglichen kann (vgl. ebd.). Das Prinzip der Sachleistungen bleibt allerdings in diesem Projekt unberührt, das bedeutet der Leistungsempfänger hat innerhalb des pauschalisierten Leistungsangebots weiterhin keine Steuerungsmöglichkeiten. Der Art. 19 BRK ist hierbei insofern zwar umgesetzt, dass die behinderten Menschen wählen können, wo und zu Teilen auch mit wem sie wohnen, dem Leitgedanken von Inklusion entspricht die Finanzierung ansonsten aber nicht. „Die schwache Position von Menschen mit Behinderung im traditionellen Beziehungsdreieck zwischen Leistungsträgern, -anbietern und Leistungsempfängern bleibt … unverändert“ (Wansing 2005: 177).
Als Fazit bleibt der Autorin festzuhalten, dass die Finanzierung über Hilfebedarfsgruppen für Einrichtungen die Sicherheit bietet, Leistungsentgelte und Kostenzusagen prospektiv mit den Leistungsträgern zu vereinbaren und damit eine finanzielle Planungssicherheit zu haben. Als Instrument für zukünftiges inklusives Wohnen, bei dem Bewohner selbstbestimmt ihre Leistungen und ihre Unterstützungen steuern können, eignet es sich in der derzeitigen Form allerdings in keiner Weise. Gitschmann nennt die Beziehungen die sich in dieser Leistungsform ergeben „…klassische Fürsorgebeziehung[en]…“ und leitet fast zwangsläufig ab, dass somit die gesamte Leistungsgenerierung bei dieser Finanzierungsform kritisch zu sehen ist, da „… sie den behindertenpolitischen Ansprüchen der Personenzentrierung, Autonomie und Selbstbestimmung eher zuwiderläuft…“ (Gitschmann 2009: 35). Aus Sicht der Autorin kann daher die Partizipation von Bewohnern innerhalb dieser Finanzierungssystematik nur erhöht werden, wenn Einrichtungen Elemente aus dem Persönlichen Budget oder der Fachleistungsstunde anwenden. Es bleibt allerdings fraglich, ob Einrichtungen dies ohne Handlungsdruck umsetzen werden, da dies zweifellos mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden wäre.
Aus den vorangegangenen Überlegungen sollen nun Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die es Einrichtungen ermöglichen, inklusiv zu arbeiten ohne die finanzielle und managerielle Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Dabei sollte die Kunden- und Dienstleistungsorientierung zukünftig mehr im Vordergrund stehen, als dies bisher der Fall war. Einrichtungen der Behindertenhilfe sind angehalten, ihr Angebot an Leistungen inklusiver zu gestalten, da der Paradigmenwandel in der Eingliederungshilfe vor allem auch im Bewusstsein der Nutzer weiter voran schreitet. Am Beginn der Organisationsentwicklung steht daher die Überarbeitung der Konzeption einer sozialen Institution. Eine Einrichtungskonzeption hat hierbei die Funktion eines „… Instrument[s] zur Steuerung und Entwicklung von Organisationen der Behindertenhilfe“ (Schübel, Muth 2009: 10). Sie haben eine richtungweisende und rahmensetzende Funktion und geben Führungskräften genauso wie Mitarbeitern Entscheidungs- und Interpretationshilfen für den beruflichen Alltag ebenso wie für strategische Entscheidungen in der Planung von Organisationen (vgl. ebd.: 12). Innerhalb dieser stellt eine Einrichtung ihre Ziele nach innen und außen dar und „… liefert Ziele für die Qualitätsentwicklung .., indem sich aus diesen Leistungsbeschreibungen, Qualitätsstandards und Erfolgskriterien im Hinblick auf den Auftrag .. und die dafür gebotenen Leistungen entwickeln lassen“ (ebd.). Daraus leitet sich bereits der nächste Schritt ab, der Aufbau eines Qualitätsmanagement, das sich konsequent an der Ergebnisqualität orientiert und dafür auch kontinuierlich den Bedarf der Nutzer erhebt. „Den Nutzer … ernst zu nehmen, bedeutet, ihn konsequent am gesamten Prozess von der Planung bis zur Beurteilung der Leistungen zu beteiligen“ (Wansing 2005: 168). Dabei ist das Management gehalten, dies nicht als einen abgeschlossenen Prozess zu betrachten, der nur einmal gemacht werden muss. Vielmehr können sich die Wohnwünsche bei behinderten Menschen ebenso ändern wie bei nicht behinderten Menschen. Für den Aufbau eines Qualitätsmanagement spricht aus Sicht von Einrichtungen „…gerade in Übergangssituationen…“ noch einer zweiter wichtiger Punkt (Kornherr 2008: 79). „Das Interesse von Kostenträgern nach einem Nachweis von Effektivität wird bei Etablierung von neuen Betreuungsformen und erweiterten Handlungsfeldern, wenn dies auf der Grundlage einer verbesserten finanziellen Ausstattung … geschehen soll, sehr hoch sein“ (ebd.). Somit bekommt das Qualitätsmanagement nach Kornherr eine „…legitimierende Funktion für Einrichtungen“ (ebd.).
Eine weitere Handlungsempfehlung bezieht sich auf den Bereich der Gestaltung der Wohnangebote. Dalferth fordert dabei unter anderem den „Ausbau eines differenzierten Wohnangebotes…„ und empfiehlt als zeitgemäße Wohnformen „… gemeinwesenintegrierte [!], kleine Wohnhäuser und Wohnungen“ (Dalferth 2006: 126). Somit ist das Management stationärer Einrichtungen aufgefordert, sich zu überlegen, welche Teile abgespalten werden können und ob einzelne Gruppen oder Bewohner in neue Wohnformen umziehen können. Dies ergibt sich auch aus dem Bayerischen Aktionsplan, der explizit die Organisation individueller, wohnortnaher Wohnform von großen stationären Wohnheimen einfordert (vgl. STMAS 2013: 88). Dabei darf aus Sicht der Autorin aber nicht aus den Augen verloren werden, dass Inklusion nicht damit vollzogen ist, die räumlichen Gegebenheiten zu verändern. Um die Nutzer, und damit die Kunden einer Einrichtung zu binden, ist es notwendig auch das Leistungsangebot individueller und personenzentrierter zu gestalten. „Standardisierte Konzepte wohlfahrtstaatlicher Fürsorge verlieren im Kontext der Vielfalt individueller Präferenzen und Lebensstile an Plausibilität …“ (Wansing 2005: 169). Daher ist es zusätzlich zu ausdifferenzierten Wohnformen erforderlich, einzelne Leistungskomponenten zu identifizieren, zu definieren und zu kalkulieren. Eine vollversorgende Großeinrichtung mit der gängigen Gruppenstruktur und pauschalen Leistungsangeboten, die für alle Bewohner gleich sind, entspricht nicht mehr dem aktuellen Grundverständnis von Behinderung und Teilhabe. Vielmehr geht der Trend schon jetzt in die Richtung kleiner, gemeindeintegrierter, an verschiedensten Behinderungsgraden ausgerichteter Wohnangebote. Dies zeigen auch Statistiken, die den Anstieg der Leistungsempfänger in der stationären Behindertenhilfe sehr viel geringer beziffern als den Anstieg im Bereich des ambulanten Wohnens (vgl. Schädler et al.: 97).
Natürlich dürfen bei allen Inklusionsbemühungen seitens einer Einrichtung für den ambulanten Bereich nicht diejenigen Bewohner vergessen werden, die vermutlich im stationären Angebot verbleiben werden. Daher sollte zusätzlich auch überlegt werden, wie man diesen Bereich inklusiver gestaltet und sich dabei am Bedarf der behinderten Menschen ausrichtet. Mit Bedarf ist hier nicht wie derzeit üblich der Hilfebedarf gemeint, sondern die Wünsche und Bedürfnisse der Leistungsempfänger.
Auch im Bereich der Strukturvoraussetzungen ergeben sich Handlungsempfehlungen an das Management von Einrichtungen. Diese Empfehlungen beginnen bereits bei der Größe und der Zusammensetzung von Gruppen. „Gruppengrößen über sechs Personen und homogene Gruppenstrukturen sind den Bedürfnissen von Menschen mit schwerer Behinderung nicht angemessen.“ (ebd). Sofern möglich sollte bei der Zusammensetzung der Gruppe sowohl auf Heterogenität geachtet werden als auch die Bedürfnisse der Bewohner mitbedacht bzw. wenn möglich mit ihnen oder dem Heimbeirat besprochen werden (vgl. ebd.).
Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld ist die Personalgewinnung, -bindung und vor allem -entwicklung. Eine gute Personalbindung kann über eine hohe Arbeitszufriedenheit erreicht werden. Dazu sind vom Management angemessene Arbeitsbedingungen herzustellen, beispielhaft seien hier die Punkte „Individualisierung der Arbeit“ oder „Stärkung der Motivation über Anreizsysteme“ genannt (vgl. ebd: 357). Bei dem zu erwartenden, schwierigerem Klientel ist eine Weiterentwicklung und Qualifizierung des Personals über ein kontinuierliches Fort- und Weiterbildungsangebot unbedingt anzuraten, da die Anforderungen an das Personal durch umfassendere Pflegeaufgaben und Bewohner mit stark herausforderndem Verhalten absehbar steigen werden. Zusätzlich sollten neue Arbeitszeitmodelle entwickelt werden, die flexiblere Dienstzeiten ermöglichen und damit eher dem Assistenzgedanken Rechnung tragen, als dies starre Dienstpläne bisher tun. Zu überlegen sind dabei Modelle, die einen Teil der Dienstzeit zur zeitlich freien Verfügung stellen, wie in Punkt 5.1 bereits skizziert wurde. Eine weitere Idee, die in einigen Wohneinrichtungen bereits erprobt wird, ist eine stärkere Beachtung einer „… bewohnerbezogene[n] Dienstplangestaltung …“ (ebd.: 358).
Andere Handlungsempfehlungen ergeben sich aus den Kunden der Einrichtungen selbst. Um Bewohnern, die nach einem jahrelangen Sozialisationsprozess, in dem für und nicht mit ihnen entschieden wurde, überhaupt die Möglichkeit zu inklusivem Leben zu eröffnen, müssen auch diese in den verschiedensten Kompetenzen geschult werden. Dafür sind Einrichtungen verpflichtet, auch den Bewohnern konsequent Schulungen anzubieten, „ … und dies möglichst durch gleichermaßen Betroffene“ (Häußler et al. 1996: 56). Die Kompetenzen, die dabei im Vordergrund stehen sollten, sind erforderlich um behinderte Menschen zu befähigen „Auftraggeber“ zu werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Finanz-, Personal-, Anleitungs-, Raum- und Sozialkompetenz (vgl. ebd.).
Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Zukunft auf Einrichtungen zukommen wird, ist die Problematik, wie wohnen und leben für alternde behinderte Menschen aussehen soll. Gerade in diesem Bereich kommen grundsätzlich neue Anforderungen hinzu, da wie bereits schon beschrieben, erstens der Pflegeaufwand vermutlich noch steigen wird und zweitens neue Formen der Tagesbetreuung entwickelt werden müssen. Die Bewohner benötigen neben einer „…entsprechende[n] Bewohner-Betreuer-Relation“ vor allem „…aktivierende und tagesstrukturierende Angebote…“ (Wunder 2009: 49). Hier sind spezielle Fort- und Weiterbildungen, Beratungen und Supervisionen sowie fachliche Unterstützung bei Kriseninterventionen für Mitarbeiter unbedingt anzuraten (vgl. ebd.). Das Management sollte sich also auch schon jetzt mit „…Konzepten [aus] der allgemeinen Altersforschung..“ auseinandersetzen, um diesen Herausforderungen begegnen zu können (ebd.: 47). Schlussendlich sind Einrichtungen der Behindertenhilfe folgerichtig aufgefordert, sich intensiv mit Hospizkonzepten auseinanderzusetzen und diese zu implementieren (vgl. STMAS 2013: 87).
Der Bereich Finanzierung ist weiteres Handlungsfeld des Managements. Da allerdings bisher - wie dargestellt - noch nicht abzusehen ist, in welche Richtung sich die Finanzierung der Eingliederungshilfe und somit auch der Einrichtungen entwickeln wird, ist es schwierig, allgemeingültige Handlungsempfehlungen abzuleiten. Unstrittig erscheint aber, dass Einrichtungen sich um neue Finanzierungsquellen bemühen werden müssen, um ihr Angebot in adäquater Weise inklusiver gestalten zu können. Als Idee wurden hierzu schon die Ortsgebundenen Sozialfonds skizziert, die im stationären Bereich zusätzlich Inklusion „in die Einrichtung“ ermöglichen können.
Managementhandeln in der Zukunft wird sich auch und gerade in stationären Einrichtungen daran messen lassen müssen, wie viel Selbstbestimmung und Partizipation den Bewohnern ermöglicht wird und ob auch die Bedürfnisse der Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf unter diesem Aspekt mitbedacht wurden. Die dargestellten Handlungsempfehlungen können für Einrichtungen Möglichkeiten aufzeigen, neue Wege zu beschreiten. Ob und welche davon umsetzbar sind, kann allerdings nur die jeweilige Institution entscheiden, da natürlich auch immer verschiedene Voraussetzungen „vor Ort“ vorhanden und zu beachten sind.
Das Entwicklungs- und Veränderungsmanagement von Einrichtungen wird sich in der Zukunft vielfältigen Herausforderungen stellen müssen, um einerseits im Sinne des Paradigmenwandels in der Behindertenhilfe ihren Nutzern einen Weg in Richtung Selbstbestimmung und Teilhabe zu eröffnen und andererseits die Verantwortung in wirtschaftlicher Hinsicht der eigenen Institution gegenüber wahrzunehmen. Dazu wurden in den voranstehenden Punkten Perspektiven in konzeptioneller, struktureller und finanzieller Hinsicht aufgezeigt und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Aus Sicht der Autorin kann danach das Fazit gezogen werden, dass es gerade im stationären Bereich verschiedene Möglichkeiten und Handlungsfelder gibt, diesen inklusiver zu gestalten. In der vertiefenden Bearbeitung konnte aufgezeigt werden, dass es bereits einige innovative Projekte gibt, die neue Wohnangebote erarbeitet haben und versuchen diese modellhaft umzusetzen. Insgesamt steht die Umsetzung von inklusiven Wohnlandschaften in Deutschland allerdings noch am Beginn. Es zeichnen sich für die Autorin mehrere Gründe ab, warum die Entwicklung diesbezüglich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, z. B. Norwegen oder Großbritannien, eher als langsam bis schleppend zu bezeichnen ist. Einer der Hauptgründe dafür bleibt die Finanzierung der Eingliederung. Diese Problematik zeigt sich bereits durch die Einbettung dieser in das System der Sozialhilfe. Unabhängig davon, dass dies mit einem selbstbestimmten, teilhabenden Bild des behinderten Menschen nicht mehr vereinbar ist, bedeutet es eben auch, dass Bezirke und Kommunen die finanzielle Last zu tragen haben. „Angesichts der anhaltenden Krise der öffentlichen Finanzen gewinnt das Kosten-Nutzen-Denken zunehmend Gewicht“ (Seifert 2005: 184). Die Diskussion um ein eigenes Leistungsgesetz und ein Bundesteilhabegeld sind in vollem Gange und man darf gespannt sein, ob die Reform der Eingliederungshilfe wie von der derzeitigen Bundesregierung zugesagt in der nächsten Legislaturperiode stattfindet. Bisher bleibt bei der Auseinandersetzung mit dem Thema allerdings eher der Eindruck übrig, dass Ambulantisierung und Inklusion immer solange befürwortet werden, solange sie nicht mehr kosten (vgl. Hanslmeier-Prockl 2009: 45). Dafür sprechen auch der gesetzlich verankerte Mehrkostenvorbehalt, der Gesetzesvorschlag zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich, der die Wunsch- und Wahlrechte der Leistungsempfänger bei Mehrkosten einschränken möchte oder auch die seit Jahren gedeckelten Kostensätze. „Die durchaus richtungsweisenden Ansätze in der Behindertenpolitik werden sich auf die tatsächlichen Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen nur dann positiv auswirken, wenn sie begleitet werden von einem grundlegenden Kurswechsel in der Sozialpolitik“ (Rohrmann 2005: 271). Solange sich also im Bereich der Finanzierung der Eingliederungshilfe keine Lösung abzeichnet, wird man davon ausgehen müssen, dass Einrichtungen bei neuen Wegen und Wohnprojekten weiterhin behindert werden. Auch die Ausgestaltung der einzelnen Leistungsformen innerhalb der Eingliederungshilfe muss dabei zwangsläufig noch einmal überarbeitet werden. Dau et al. kritisieren beispielsweise zu Recht, dass Persönliche Budgets als Leistungsform nur dann geeignet sind, „…als behinderte Menschen sie mit einem Mindestmaß an Eigenverantwortung selbst verwalten oder verwalten lassen können,…“ (Dau et al. 2011: 131). Solcherart gestaltete Gesetze und Vorschriften bergen damit die von vielen Experten befürchtete Gefahr, dass „…der sich vollziehende Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik allein einer sozial und finanziell gut abgesicherten Behindertenelite zugute [kommt], nicht aber der Gesamtheit aller hier lebenden Menschen mit entsprechenden Bedarfen“ (Rohrmann 2005: 271).
Auf der anderen Seite stehen allerdings die Einrichtungen selbst und ihre Träger, oft große Wohlfahrtsverbände, in der Kritik. Der behinderte Mensch, der auf pflegerische oder lebenspraktische Hilfe angewiesen ist und diese nur in stationären Einrichtungen finden kann, da kein alternatives Angebot vorhanden ist, hat somit auch keine Möglichkeit sein Wunsch- und Wahlrecht überhaupt auszuüben (vgl. Theunissen 2006: 86). In mehreren Studien und Modellprojekten konnte bereits nachgewiesen werden, dass auch innerhalb der bestehenden Finanzierungssystematik inklusivere Möglichkeiten zum Wohnen und Leben eröffnet werden können. Ideen können die verschiedensten Wohnbeispiele der Lebenshilfe in ihrer Broschüre „Wohnen heute“ geben. Bei Inanspruchnahme ambulanter Dienste können beispielsweise zusätzlich zu den Leistungen der Eingliederungshilfe die Leistungen der Pflegeversicherung in voller Höhe genutzt werden. Darüber besteht dann sogar die Möglichkeit einer ‚Rund-um-die-Uhr‘-Assistenz (vgl. Seifert et al. 2001: 369). Trotzdem erweckt es für die Autorin den Anschein, dass viele Einrichtungen (und die in ihnen arbeitenden Führungskräfte und Mitarbeiter) im alten Hilfesystem und in vom Fürsorgesystem geprägten Denk- und Verhaltensweisen verharren und darüber auch behinderte Menschen in Heimen „festhalten“, die in Wirklichkeit mit weniger Betreuung in ihrer eigenen Wohnung leben könnten (vgl. Dörner 2006: 98). Auch die großen Wohlfahrtsverbände tendieren oft dazu, als Fürsprecher für behinderte Menschen aufzutreten und dabei allzu oft nur das eigene „Besitzstandsdenken“ im Kopf zu haben. Auf Grund langjähriger Erfahrungen in der Arbeit mit behinderten Menschen kann Einrichtungen und Verbänden durchaus eine exponierte Rolle und ein Expertentum zugestanden werden, daher sind aber auch genau diese in der Pflicht, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Selbstbestimmung, Partizipation und Teilhabe auch im Bereich des Wohnens kann eben nur erreicht werden, wenn ein Angebot das Wahrnehmen des Wahlrechtes überhaupt erst ermöglicht.
Als schwierig hat sich während der Bearbeitung des Themas die unterschiedliche Datenlage herausgestellt. Erschwert wird diese zusätzlich dadurch, dass die Sozialhilfeträger genauso wie die Verbände ihre Zahlen und Statistiken auf meist regionaler Ebene erheben, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sodass eine Vergleichbarkeit kaum gegeben ist. Genauso stellen sich für die Autorin auch die Fortschritte in der Umsetzung dar. Dies liegt z. T. auch daran, dass die einzelnen Bundesländer sehr unterschiedliche Voraussetzungen in Gesetzen, Aktionsplänen, Vorschriften und Richtlinien geschaffen haben und außerdem die finanzielle Ausstattung der Sozialhilfeträger sehr unterschiedlich ist. Daher ist es auch nicht immer möglich die Umsetzung eines erfolgreichen Projektes in einem Bundesland 1:1 in ein anderes zu übertragen. Als Ideenanregungen eignen sie sich aber durchaus.
Die Qualität der Literaturquellen, die sich inhaltlich mit dem Thema UN-Konvention, Selbstbestimmung, Teilhabe, Wohnen etc. befassen, ist bei Abschluss dieser Arbeit ebenfalls als sehr unterschiedlich zu bezeichnen. Besonders fällt dabei auf, dass Literatur, die sich objektiv und sachlich mit dem Thema „stationär“ befasst, kaum vorhanden ist. In vielen Quellen werden stationäre Einrichtungen einfach vorverurteilt. Aus Sicht der Autorin wird dabei allzu oft vergessen, dass deren Entstehen von der Gesellschaft durchaus gewünscht und diese mit der Lösung der Institutionalisierung ein Jahrhundert lang zufrieden war (vgl. Dörner 2006: 97). Hinzu kommt, dass selbst in der vertiefenden Bearbeitung bei der Autorin nicht der Eindruck entstanden ist, dass eine vollständige Auflösung aller Heime weder von Seiten der Politik noch von Seiten der Bürger und schon gar nicht von Seiten der Mitarbeiter und Träger der Einrichtungen überhaupt gewollt ist. Es erscheint im Moment eher so, als würde Inklusion speziell im ambulanten Bereich vor allem deswegen vorangetrieben, um Kosten einzusparen. Eine weitere kritische, aber sachlich geführte, Auseinandersetzung mit der Wohnform „stationär“ (unter objektiven Gesichtspunkten) ist daher unbedingt erforderlich, da es auch in der Zukunft höchstwahrscheinlich Menschen geben wird, für die diese Unterbringung die passendere oder auch gewünschte Lösung sein könnte. Dalferth berichtete schon 1997 von Studien in den USA, Großbritannien und Norwegen, deren Ergebnisse belegten, dass sich die Lebensumstände für einen Teil übergesiedelter Bewohner in ambulante Wohnformen in der Gemeinde dramatisch verschlechtert hatten (vgl. Dalferth 1997: 346). Zusätzlich wird es vermutlich auch weiterhin Bewohner geben, deren herausforderndes Verhalten das Gemeinwohl anderer Menschen beeinträchtigen könnte, ebenso wie diejenigen Bewohner, die aufgrund mangelnder Möglichkeiten der Kontaktaufnahme eher in die soziale Isolation rutschen würden. Aus Sicht der Autorin wäre es wünschenswert, wenn wissenschaftliche Untersuchungen auch für diejenigen Bewohnern in den Einrichtungen ausgeweitet werden würden, um den Inklusionsgedanken dort weiter auszubauen, wo sich die meisten Menschen mit den verschiedensten Graden an Unterstützungs- und Hilfebedarfen zur Zeit befinden, bis endgültige Regelungen - politisch und finanziell - gefunden wurden.
Bezogen auf das Thema dieser Arbeit bleibt für die Autorin folgendes Fazit zu ziehen: Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland schreitet in gesetzlicher Hinsicht relativ zügig voran, nur die Umsetzung auf finanzieller und vielfach auch konzeptioneller Ebene steckt noch in den Kinderschuhen. Hinzu kommt auch, dass Einrichtungen und Verbände erst allmählich ihre Haltungen in der Arbeit mit und für den behinderten Menschen ändern. Dies hat letztlich zur Folge, dass sich bisher für die meisten Menschen mit hohem bis sehr hohen Hilfebedarf im Grunde wenig verbessert hat, obwohl bereits jetzt Instrumente zur Verfügung stehen, die innovative Wege ermöglichen. Hier ist das Management gefordert und hat - wie aufgezeigt - schon heute umsetzbare Möglichkeiten, diese Entwicklung zu unterstützen und voran zu treiben.
„Managementhandeln in der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung wird sich in Zukunft daran zu messen haben, inwieweit aus dieser Perspektive der Menschenrechtsorientierung ein allgemeiner Beitrag zur Verbesserung des gesellschaftlichen Zusammenlebens erreicht werden kann. … Managementhandeln … in diesem Sinne ist deshalb immer auch ein Beitrag zu einer positiven Zukunftsgestaltung der gesamten Gesellschaft“ (Wunder 2009: 50).
Um beurteilen zu können, wie sich die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe auswirken wird, waren eine Reihe von Faktoren in deren Umfeld zu beachten. Ausnahmslos alle möglichen beeinflussenden Faktoren darzustellen würde den Umfang dieser Arbeit sprengen, somit wurde sich darauf beschränkt, die wichtigsten herauszuarbeiten und darzustellen. In der abschließenden Betrachtung kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich aus heutiger Sicht bei konsequenter Umsetzung des Art. 19 BRK und unter Beachtung der momentanen Rechtslage die Auswirkungen auf Einrichtungen eher negativ darstellen. „Vor dem Hintergrund, dass insbesondere bei Leistungsträgern immer wieder globale Vergleiche der durchschnittlichen Fallkosten zwischen dem sich in der bundesweiten Praxis in der Regel auf Menschen mit geringerem Hilfebedarf beziehenden ambulanten Bereich und den stationären Hilfen, die auch Personen mit höherem Unterstützungsbedarf in Anspruch nehmen, vorgenommen werden, ist anzunehmen, dass ambulante Hilfearrangements aus fiskalischen Gründen im Großen und Ganzen nur dem auch schon jetzt auf diese Weise betreuten Personenkreis zugutekommen sollen“ (Schädler et al.: 218). Es werden also vermutlich „Restgruppen“ von Menschen mit hohem bis sehr hohem Hilfebedarf im stationären Bereich verbleiben und es steht zu befürchten, dass immer mehr Einrichtungen in das System der Pflegeversicherung gedrängt werden, da der Kostenanstieg, der sich sonst ergeben würde, für die Sozialhilfeträger nicht mehr finanzierbar wäre. Tendenzen für diese Entwicklung sind bereits heute vorhanden (vgl. Theunissen 2006: 66).
Es gibt aber auch positive Entwicklungen zu beobachten. Hoffnung macht einerseits die Diskussion um die Ausgliederung der Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe und andererseits die immer weiter voranschreitende Stärkung der Rechte und des Bewusstseins der behinderten Menschen selbst. Schon unter den derzeit vorherrschenden Bedingungen können Einrichtungen neue Möglichkeiten für Wohnformen entwickeln und in den gegebenen Strukturen mittels Konzeptionsänderungen für die Bewohner inklusivere Angebote erarbeiten. Modellprojekte diesbezüglich gibt es bereits bundesweit. Hier ist das heutige Management gefordert, Visionen zu entwerfen und diese in mittel- und langfristige Strategien umzusetzen. Mit Geldleistungen allein ist es auch in der Zukunft nicht getan, daher müssen die Angebote differenzierter und individueller werden, als dies bisher der Fall ist. Nehmen Einrichtungen diese Herausforderungen an, kann ihnen die Entwicklung zu „inklusiven Einrichtungen“ gelingen. Dafür braucht es als zweiten Partner jedoch eben auch die Politik. Es ist unerlässlich, dass die Reform der Eingliederungshilfe auch finanziell umgesetzt wird, da dies nicht zuletzt auch Planungssicherheit für die Einrichtungen bedeutet. Während der Erstellung dieser Arbeit drängte sich der Autorin immer wieder das Bild vom Kaninchen und der Schlange auf. Einrichtungen sitzen wie ein Kaninchen hypnotisiert vor der großen Schlange Politik und wissen nicht in welche Richtung sich diese bewegen wird. Da ihnen dies nicht bekannt ist, wissen sie selbst auch nicht, in welche Richtung sie springen sollen. Also was tun sie? Gar nichts.
Dies ist sicherlich eine etwas überspitzte Darstellung der Situation und mag natürlich nicht auf alle Einrichtungen zutreffen, aber vielfach verhält sich das Management von Einrichtungen so oder ähnlich, statt sich vorzuwagen und bildlich gesprochen anzugreifen mit neuen Ideen und Wegen. Beide Seiten müssen sich aufeinander zu bewegen, anstatt auf ihren Positionen zu verharren. Es sind bereits einige Lösungsansätze erarbeitet und erprobt worden und diese geben Hoffnung und machen Mut, dass die Auswirkungen in der Zukunft ausschließlich im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sein werden, denn letztlich geht es eben eigentlich darum, dass „…Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben…“ (BRK 2008: 1433).
Aichele, V. (2008): Die UN - Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativprotokoll. Ein Beitrag zur Ratifikationsdebatte. Berlin: Dt. Institut für Menschenrechte.
Arnold, U., Maelicke, B. (Hrsg.) (2009): Lehrbuch der Sozialwirtschaft. 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos.
Bayerische Staatsregierung (2009): Richtlinie zur Förderung von ambulanten Diensten zur Sicherung der Teilhabe von Menschen mit körperlicher und / oder geistiger Behinderung sowie sinnesgeschädigten und chronisch kranken Menschen (Förderrichtlinie Regionale „Offene Behindertenarbeit“). Online im Internet: https://www.verkuendung-bayern.de/allmbl/jahrgang:2009/heftnummer:12/seite:352/doc:2 [Stand: 31.05.2013].
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (2010): Eckpunkte zur Umsetzung dezentraler Wohnstrukturen für Menschen mit körperlicher Behinderung, Sinnesbehinderung und/ oder geistiger Behinderung unter dem Aspekt der Inklusion. Stand 22.Dezember 2010. Online im Internet: http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/behinderung/101222_eckpunkte_zur_dezentralisierug.pdf [Stand: 31.05.2013].
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen(2013): Schwerpunkte der bayerischen Politik für Menschen mit Behinderung im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention. Aktionsplan. Online im Internet: http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/behinderung/aktionsplan.pdf [Stand: 31.05.2013].
Bielefeldt, H. (2009): Zum Innovationspotenzial der UN – Behindertenrechtskonvention. 3. akt. u. erw. Aufl., Berlin: Dt. Institut für Menschenrechte.
Brinkmann, V. (2010): Sozialwirtschaft. Grundlagen-Modelle-Finanzierung. 1. Aufl., Wiesbaden: Gabler.
Bruns, G. (2010): UN - Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Text und Erläuterung. Hamburg: Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (2000): 5.Behindertenhilfe. Online im Internet: http://www.bagfw.de/index.php?id=513&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=244&cHash=af55976110 [Stand 31.05.2013].
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (2009): Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege. Gesamtstatistik 2008. Stand 1.1.2008. Online im Internet: http://www.bagfw.de/uploads/media/GS_BAGFW_091221_web_01.pdf [Stand 31.05.2013].
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege „o. J.“: Satzungsgemäße Aufgaben. Online im Internet: http://www.bagfw.de/wir-ueber-uns/aufgaben [Stand: 31.05.2013].
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (2012): Konsequent denken: Bundesleistungsgesetz für Eingliederungshilfe. 26.06.2012. Online im Internet: http://www.bagwfbm.de/article/1798 [Stand: 31.05.2013].
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011): Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft. Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Online im Internet: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a740-nationaler-aktionsplan-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 31.05.2013].
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006): Erster Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend über die Situation der Heime und die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Stand 15.08.2006. Online im Internet: http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/heimbericht/7-Stationaere-einrichtungen-der-behindertenhilfe/7-5-strukturdaten-der-stationaeren-behindertenhilfe.html [Stand: 31.05.2013].
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (2010): Selbstbestimmte Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft. Ein Positionspapier des Bundesverbands evangelische Behindertenhilfe e.V. zu Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention. 31.08.2010. Online im Internet: http://www.beb-ev.de/files/pdf/stellungnahmen/2010-08_positionspapier_art_19_brk.pdf [Stand: 31.05.2013].
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hrsg.) (2012): Wohnen heute. Beispiele für selbstbestimmtes Leben. Menschen mit geistiger Behinderung berichten, wie sie wohnen. 3. Aufl., Berlin: Lebenshilfe.
Burmeister, J., Gaßner, M. Th., König, S., Müller, Ch. (2009): Bayerisches Pflege- und Wohnqualitätsgesetz. Kommentar. München: C.H. Beck.
Dalferth, M. (1997): Zurück in die Institutionen? Probleme der gemeindenahen Betreuung geistig behinderter Menschen in den USA, in Norwegen und Großbritannien. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hrsg.) (1997): Geistige Behinderung 4/97. Marburg: Lebenshilfe: 344-357.
Dalferth, M. (2006): Leben in „Parallelgesellschaften“? Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung zwischen den Idealen der neuen Leitideen und Entsolidarisierungsprozessen. In: Theunissen, G.; Schirbort, K. (2006): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen - Soziale Netze - Unterstützungsangebote. Stuttgart: Kohlhammer: 116-128.
Dau, D. H.; Düwell, F. J.; Joussen, J. (Hrsg.) (2011): Sozialgesetzbuch IX. Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Lehr- und Praxiskommentar. 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos.
Der Paritätische Berlin (2012): Beschlüsse der ASKM zu PTV und neuem Pflegebedürftigkeitsbegriff. Online im Internet: http://www.paritaet-alsopfleg.de/index.php/pflegerische-versorgung/319-arbeitshilfen/1126-beschluesse-der-asmk-zu-ptv-und-neuem-pflegebeduerftigkeitsbegriff [Stand: 31.05.2013].
Deutscher Städtetag (2011): Inklusion in der Bildung. Ein Sachstandsbericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Elementar-und Schulbereich in Deutschland (Stand 2011). Online im Internet: http://www.lwl.org/lja-download/pdfschulen/Staedtetag_Inklusion_in_Schule_und_Bildung_Sachstandsbericht.pdf [Stand: 31.05.2013].
Dörner, K. (2006): Leben in der „Normalität“ – ein Risiko? In: Theunissen, G.; Schirbort, K. (2006): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen - Soziale Netze - Unterstützungsangebote. Stuttgart: Kohlhammer: 97-102.
Duschek, K.-J. (2012): Ergebnisse der Sozialhilfestatistik 2010. Online im Internet: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/ErgebnisseSozialhilfe2010_032012.pdf [Stand: 31.05.2013].
Eilte, W. (2003): Basiswissen Heilpädagogik. 1. Aufl., Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
Gitschmann, P. (2009): Menschen mit Behinderungen. Studienbrief 2: Organisation und Finanzierung. Studienbrief der Hamburger Fern-Hochschule.
Haderthauer, Ch. (2013): Umsetzung der UN-Konvention in Bayern. Online im Internet:: http://www.stmas.bayern.de/behinderung/unkonvention/bayern.php [Stand 31.05.2013].
Hanslmeier-Prockl, G. (2009): Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. Empirische Studie zu Bedingungen der Teilhabe im Ambulant betreuten Wohnen in Bayern. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Haustein, Th. (2003): Ergebnisse der Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik 2001. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003): Wirtschaft und Statistik 3/2003. Online im Internet: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Monatsausgaben/WistaMaerz03.pdf?__blob=publicationFile [Stand 31.05.2013].
Häußler, M.; Wacker, E.; Wetzler, R. (1996): Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten Haushalten. Bericht zu einer bundesweiten Untersuchung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“. Bd. 65, Schriftenreihe des Bundesministerium für Gesundheit. Baden-Baden: Nomos.
Häussler-Sczepan (1998): Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen Lebensführung in Einrichtungen. Integrierter Gesamtbericht zur gleichnamigen Untersuchung. 1. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer.
Helfrich, A. (2010): Privat-gewerblich und sozial - wie geht das? Das Konzept eines privaten Trägers im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen. In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrsg.) (2010): Sozialwirtschaft - mehr als Wirtschaft? Steuerung - Finanzierung - Vernetzung. Bericht über den 6. Kongress der Sozialwirtschaft vom 14. und 15. Mai 2009 in Magdeburg. Bd. 27, Edition Sozialwirtschaft. Baden-Baden: Nomos: 233-244.
Heß, A. (2011): UN - Behindertenrechtskonvention: Deutschland auf dem Weg zur barrierefreien Gesellschaft?!. -Veranstaltungsbericht- Tagung Dienstag 25. Oktober 2011 Kleisthaus, Berlin. Berlin: Dt. Institut für Menschenrechte u. BKB Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit e.V.
Hirschberg, M. (2010): Partizipation - Ein Querschnittsanliegen der UN – Behindertenrechtskonvention. In: Positionen, o. Jg./3: 1 - 4.
Kohlhoff, L. (2002): Finanzierung sozialer Einrichtungen und Dienste. 1. Aufl., Augsburg: ZIEL.
Kohlisch, G. (2009): BAGFW-Stellungnahme zur vorläufigen Orientierungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) zur Abgrenzung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu anderen sozialen Leistungen (Stand: 25.11.2008). Online im Internet: http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpublication/BAGFW-Stellungnahme_Eingliederungshilfe_der_BAG%C3%BCS.pdf [Stand: 31.05.2013].
Kohlisch, G. (2009a): Grundlagenpapier der BAGFW zur Weiterentwicklung von Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB XII und SGB IX. Online im Internet: http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpublication/BAGFW_Grundlagenpapier.pdf [Stand: 31.05.2013].
Kornherr, S. (2008): Inklusion als Utopie der Offenen Behindertenarbeit. Wandel von Integration zu Inklusion als Aufgabe des Sozialmanagements. Norderstedt: Books on Demand.
Kretzschmar, J. (2011): Wohnprojekt der Lebenshilfe Bad Segeberg und Umgebung in Wahlstedt: Online im Internet: http://www.alle-inklusive.de/wp-content/uploads/2011/07/Wohnprojekt-Wahlstedt-Kurzdarstellung.pdf [Stand: 31.05.2013].
Menninger, O. 2010: Finanzkraft durch Werteorientierung stärken. In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrsg.) (2010): Sozialwirtschaft - mehr als Wirtschaft? Steuerung - Finanzierung - Vernetzung. Bericht über den 6. Kongress der Sozialwirtschaft vom 14. und 15. Mai 2009 in Magdeburg. Bd. 27, Edition Sozialwirtschaft. Baden-Baden: Nomos:143-148.
Metzler, H.; Wacker, E. (1998): Behinderte Menschen. In: Häussler-Sczepan (1998): Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen Lebensführung in Einrichtungen. Integrierter Gesamtbericht zur gleichnamigen Untersuchung. 1. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer: 77-98.
Metzler, H.; Meyer, Th.; Rauscher, Ch.; Schäfers, M.; Wansing, G. (2007): Begleitung und Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Persönlicher Budgets. Abschlussbericht. Bonn: Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Olk, Th. (2005): Träger der sozialen Arbeit. In: Otto, H.-U.; Thiersch, H. (Hrsg.) (2005): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik. 3. Aufl., Basel: Ernst-Reinhardt: 1910-1926.
Pfaff, H. (2012): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnisse des Mikrozensus 2009. Online im Internet: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/Lebenslagenbehinderte032012.pdf [Stand 31.05.2013].
Pracht, A.; Wolke, R. (2009): Finanzierung und Finanzmanagement. In: Arnold, U., Maelicke, B. (Hrsg.) (2009): Lehrbuch der Sozialwirtschaft. 3. Aufl., Baden-Baden: Nomos:497-524.
Rauscher, Ch. (2005): „Ein eigenes Leben in der Gemeinde führen“ – Wohn- und Lebenswünsche von Menschen mit Behinderung. In: Wacker, E.; Bosse, I.; Dittrich, T.; Niehoff, U.; Schäfers, M.; Wansing, G.; Zalfen, B. (Hrsg.) (2005): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe: 145-158.
Rohrmann, E. (2005): Zu Behinderungen des Rechts auf Teilhabe in der Sozialpolitik. In: Wacker, E.; Bosse, I.; Dittrich, T.; Niehoff, U.; Schäfers, M.; Wansing, G.; Zalfen, B. (Hrsg.) (2005): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe: 261-272.
Schablon, K.-U. (2009): Community Care: Professionell unterstützte Gemeinweseneinbindung erwachsener geistig behinderter Menschen. Analyse, Definition und theoretische Verortung struktureller und handlungsbezogener Determinanten. Diss. Hamburg 2008. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Schädler, J.; Rohrmann, A.; Schwarte, N. (Hrsg.) (2008): Selbständiges Wohnen behinderter Menschen - Individuelle Hilfen aus einer Hand. Abschlussbericht. Siegen: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.
Schäfers, M.; Wacker, E.; Wansing, G. (2009): Persönliches Budget im Wohnheim. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schoepffer, W. 2010: Finanzierung sozialwirtschaftlicher Unternehmen der Wohlfahrtspflege. In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2010): Sozialwirtschaft - mehr als Wirtschaft? Steuerung - Finanzierung - Vernetzung. Bericht über den 6. Kongress der Sozialwirtschaft vom 14. und 15. Mai 2009 in Magdeburg. Bd. 27, Edition Sozialwirtschaft. Baden-Baden: Nomos: 165-166.
Schübel, U. F., Muth, M. (2009): Menschen mit Behinderungen. Studienbrief 3: Konzeptionsentwicklung, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit. Studienbrief der Hamburger Fern-Hochschule.
Seifert, M. (2005): Teilhabe von Menschen mit schwerer Behinderung im Bereich des Wohnens – eine kritische Bestandsaufnahme. In: Wacker, E.; Bosse, I.; Dittrich, T.; Niehoff, U.; Schäfers, M.; Wansing, G.; Zalfen, B. (Hrsg.) (2005): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg: Lebenshilfe: 173-184.
Seifert, M.; Fornefeld, B.; Koenig, P. (2001): Zielperspektive Lebensqualität. Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim. Bielefeld: Bethel.
Stadt Bamberg „o. J. [ca. 2009]“: Informationen zur UN - Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Bamberg: „o. A.“.
Theunissen, G.; Schirbort, K. (2006): Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen - Soziale Netze - Unterstützungsangebote. Stuttgart: Kohlhammer.
United Nations Treaty Collection, Chapter IV, 15 (2006): 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Online im Internet: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en [Stand: 18.05.2013].
United Nations Treaty Collection, Chapter IV, 15. a (2006): 15.a Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Online im Internet: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=en [Stand: 18.05.2013].
Wahl, H.-W., Wetzler, R. (1998): Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen Lebensführung in Privathaushalten. Integrierter Gesamtbericht zum gleichnamigen Forschungsverbundprojekt. Bd. 111.1, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Wansing, G. (2005): Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Wasel, W. (2010): Sozial gewidmetes Kapital: Finanzierungsquellen, Finanzierungsinstrumente. In: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrsg.) (2010): Sozialwirtschaft - mehr als Wirtschaft? Steuerung - Finanzierung - Vernetzung. Bericht über den 6. Kongress der Sozialwirtschaft vom 14. und 15. Mai 2009 in Magdeburg. Bd. 27, Edition Sozialwirtschaft. Baden-Baden: Nomos: 149-156.
Wunder, M. (2009): Menschen mit Behinderungen. Studienbrief 4: Herausforderungen und Perspektiven. Studienbrief der Hamburger Fern-Hochschule.
Zinke, C. (2011): SGB IIX Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. Online im Internet: http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/artikel/news/sgb-xii-weiterentwicklung-der-eingliederungshilfe/ [Stand: 31.05.2013].
AGG (2006): Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung v. 14.8.2006, BGBl. 2006 I, S. 1897.
BGG (2002): Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze v. 27.4.2002, BGBl. 2002 I, S. 1467.
BRK (2008): Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen v. 21.12.2008, BGBl. 2008 II, S. 1419.
KEG (2004): Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich vom 17.09.2004. Online im Internet: http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2004/0712_2D04.pdf [Stand 31.05.2013].
PfleWoqG (2008): Gesetz zur Regelung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz – PfleWoqG) v. 8.7.2008, GVBl., S. 346.
SGB VIII (1990): Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe – Artikel 1 des Gesetzes v. 26.06.1990, BGBl. I, S. 1163.
SGB IX (2001): Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen v. 19.6.2001, BGBl. I, S.1046.
SGB XII (2003): Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII) Sozialhilfe – Artikel 1 des Gesetzes v. 27.12.2003, BGBl. I, S.3022.
Quelle
Anja König: Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland und ihre mögliche Auswirkung auf stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe. Diplomarbeit an der Hamburger Fern-Hochschule HFH; Pflegemanagement; Eingereicht 2013
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 08.07.2014
