Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck; eingereicht bei Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese, am Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Juli 2003
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Frühförderung und Familienbegleitung
-
3 Annäherungen an die Lebenswirklichkeit der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 ‚Sonderfamilie', ‚Behinderte Familie' oder ‚Gehinderte Familie'? - Zur Situation der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind in der Gesellschaft
- 3.3 Familie in der Krise: Wie die Diagnose Behinderung das Leben einer Familie verändert
- 3.4 Entwicklung unter erschwerten Bedingungen: Das Leben des von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in seiner Familie
- 3.5 Das Leben mit einem Kind mit Behinderung: Der Prozess der Auseinandersetzung in der Familie
-
4. Möglichkeiten und Grenzen einer Familienbegleitung in der Frühförderung
- 4.1 Der Empowerment-Ansatz und seine Bedeutung für die Familienbegleitung
- 4.2 Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern an Frühförderung und Familienbegleitung
- 4.3 Die Position der Frühförderin in der Beziehung zu den Eltern
- 4.4 Konflikte, Spannungen und Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin
- 4.5 Zusammenfassende Überlegungen zur Familienbegleitung
- 5 Zur Forschungsmethode
- 6. Praxisteil
- 7 Bibliographie
- LEBENSLAUF
Meine Entscheidung für das Thema "Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin" gründet auf der langen Erfahrungsgeschichte meiner Arbeit mit von Behinderung bedrohten und betroffenen Kindern.
Wenn ich die Stationen meiner Berufsgeschichte betrachte, fällt mir auf, dass ich mich erst langsam an die Zusammenarbeit mit den Eltern angenähert habe. Als Kindergärtnerin in einem Heim für schwer und mehrfach behinderte Menschen betreute ich zunächst Kinder, die von ihren Eltern bereits kurz nach der Geburt ins Heim gebracht wurden, und die keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hatten. In dieser Zeit habe ich mich ausschließlich mit der Situation der Kinder auseinandergesetzt und mit meiner eigenen Situation als relativ unerfahrene, junge Kindergärtnerin, die plötzlich vor der Aufgabe stand, Pflegeaufgaben und basalste Förderangebote zu übernehmen. Die Dringlichkeit dieser Aufgaben half mir zwar, mit der für mich anfangs sehr schwierigen Situation zurechtzukommen. Es blieb mir dadurch aber kaum Zeit, mich wirklich mit dem Leid der Situation der Kinder und den Gefühlen auseinanderzusetzen, die die Kinder in mir auslösten. Das Helfen und Tätigwerden standen im Vordergrund, und die einzige Frage, die mich bewusst beschäftigte, war die, wie Eltern es verantworten können, ihr Kind einfach wegzugeben.
Während meiner Arbeit in einem Integrationskindergarten empfand ich es als sehr wohltuend, nicht mehr mit der Isolation einer Sondereinrichtung konfrontiert zu sein. In zahlreichen Elterngesprächen bekam ich allmählich ein wenig Einblick in die Situation der Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder. Der Kindergartenbetrieb folgt jedoch eigenen Regeln, und die Konfrontation der Kindergärtnerin mit der Lebenswelt der Eltern findet innerhalb dieses Rahmens statt. Der Alltag mit dem Kind wird in den Elterngesprächen zwar spürbar, bleibt aber doch in weiter Ferne. Die Rolle der Kindergärtnerin ist sowohl für sie selber, als auch für die Eltern klar definiert.
In meiner Arbeit als Frühförderin war ich hingegen von Anfang an mit den Schwierigkeiten der Situation der Eltern konfrontiert, während ich gleichzeitig erst meine eigene Rolle im familiären Feld, meine Aufgaben, meine Zuständigkeiten und meine Arbeitsbedingungen für mich selber klären und mich dann auch mit der Familie darüber verständigen musste.
Nach etwa einem halben Jahr meiner Arbeit in der Frühförderung stand der Sommer an und mit ihm eine Pause in der begleitenden Fallsupervision, die zum Anlass für eine Bestandsaufnahme der Befindlichkeit aller teilnehmenden Frühförderinnen genommen wurde. Im Nachdenken darüber, wie es mir mit und in der Frühförderung erging, entdeckte ich, dass ich mit der Entwicklung aller Kinder und mit meiner Förderarbeit sehr zufrieden war, dass mir die Situation der Eltern aber oft den Atem nahm. Mir fiel ein, wie oft ich mich fragte, wie die Eltern das überhaupt schaffen, mit ihrem Kind und seinen Bedürfnissen und mit ihrer veränderten Stellung in der Gesellschaft zurechtzukommen. Mir fiel ein, wie oft mir das Herz schwer war, wenn ich eine Familie verließ, wie oft mich besonders die Lage der Mütter bedrückte.
Als der Supervisor mir die Frage stellte, was für mich gut daran wäre, an die Situation der Eltern zu denken, wurde mir schlagartig klar, dass ich hier meine eigenen Fragen auf die Eltern projizierte. Die eigentlichen Fragen hätten lauten müssen: Wie schaffe ich das, mit dem Leid zurechtzukommen, mit dem ich in dieser Arbeit konfrontiert werde? Was löst die Behinderung des Kindes wirklich in mir aus und wie gehe ich damit um? Wie würde es mir selber ergehen, wenn ich mit der Behinderung meines eigenen Kindes leben müsste?
Mit dieser Diplomarbeit möchte ich die Gelegenheit nützen und mir nach jahrelanger Praxiserfahrung die Chance eröffnen, mich mit diesen Fragen anhand theoretischer Konzepte und anhand meiner eigenen Erfahrungen als Frühförderin zu beschäftigen und damit auch etwas nachzuholen, was vielleicht ganz an den Anfang meiner Tätigkeit gehört hätte. Ich denke aber, dass es für den Bereich der Behindertenarbeit und gerade für den Bereich der Arbeit mit behinderten Kindern charakteristisch ist, dass das Handeln im Vordergrund steht und damit manchmal auch auftauchende Gefühle abgewehrt werden.
In meinen Ausführungen werde ich bewusst ganz an den Anfang zurückgehen und mich zunächst mit der Familie eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in der Gesellschaft auseinandersetzen, bevor ich mich an die Alltagswirklichkeit und das Leben der einzelnen Familienmitglieder annähern werde.
Voranstellen werde ich den Betrachtungen zur Situation der Familie und des Kindes einige Überlegungen zur Frühförderung und Familienbegleitung, in denen ich wichtige Begriffe klären und die Entwicklungsgeschichte und den Hintergrund von "früher Förderung" und Elternarbeit erläutern werde.
Neben dem Erleben der einzelnen Familienmitglieder geht es mir aber auch um die gesellschaftlichen Phantasmen, die sich um Behinderung ranken, und die sowohl die Reaktionen der sozialen Umwelt als auch das Verhalten der Eltern und das Verhalten der Frühförderin bestimmen.
Ich werde in meiner Arbeit den Blick auf die Eltern und vor allem auf die Mütter lenken und ihre Situation genauer beleuchten, um letztendlich verstehen zu können, auf welche Partner die Frühförderin trifft, wenn sie den Eltern in der Frühförderung begegnet. Es geht mir darum, zu ergründen, welche Vorgeschichte diese Begegnung zwischen Eltern und Frühförderin hat, welche Erfahrungen und Erlebnisse ihr vorangegangen sind, welche Einstellungen und Erwartungen auf beiden Seiten zum Tragen kommen.
Gerade als eher kindzentriert arbeitende Frühförderin möchte ich meinen Fokus bewusst auf die Eltern als Partner in der Frühförderung legen, deren Lebenswirklichkeit ich in meinem Bemühen, bessere Lebens- und Entwicklungsbedingungen für das Kind zu schaffen, manchmal zu wenig wahrgenommen habe. Auch wenn bereits viel über die Situation der Eltern geschrieben wurde, halte ich das Verstehen und Einfühlen in die Lage der Eltern und des Kindes dennoch für die grundlegendste Voraussetzung für das Gelingen einer Familienbegleitung in der Frühförderung.
Niemand wird gerne mit Behinderung konfrontiert, weil sie an die Begrenzungen erinnert, die das Leben in sich trägt und vor denen wir alle nicht sicher sind. Die Tendenz, diese Angst vor der Behinderung nicht spüren zu wollen und damit der Behinderung ablehnend gegenüberzustehen, tragen wir alle als Gesellschaft und Individuum in uns.
In meiner Arbeit interessiert mich daher auch, welches die Abwehrtendenzen der Frühförderin sind, die ein weiteres Einfühlen bei ihr verhindern und sie veranlassen, in der Förderung des Kindes sehr aktiv zu werden, um damit der Behinderung entgegenzuwirken.
Eine genaue Analyse zweier Beispiele aus meiner eigenen Arbeit, die jeweils mit einer Beendigung der Zusammenarbeit mit der Familie endeten, soll zeigen, wo Gefahrenmomente für die Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin liegen und die Spannungsfelder der Arbeit in der Frühförderung verdeutlichen.
In diese Arbeit werden an passenden Stellen weitere kurze Ausschnitte und Blitzlichter aus meinen Erfahrungen als Frühförderin einfließen. Diese Praxisbeispiele sind im Text durch eine kursive Schreibweise gekennzeichnet.
Da aus meinem Erleben heraus das Feld der Frühförderung immer noch eine Domäne der Frauen und Mütter darstellt, werde ich mir die Freiheit erlauben, dieser Lebenswirklichkeit Rechnung zu tragen, indem ich die Ausdrucksform "Frühförderin" auch stellvertretend für die Mehrzahl aller in der Frühförderung arbeitenden Fachpersonen verwenden werde. Ich bitte alle männlichen Frühförderer, sich trotzdem angesprochen zu fühlen.
Inhaltsverzeichnis
Einen ersten Hinweis auf seine Bedeutung bietet wohl der Begriff selber durch seine Zusammensetzung aus den beiden Wortteilen "früh" und "Förderung". Ein solcher Rückschluss könnte sich jedoch auch als trügerisch erweisen, wenn man die Entwicklung der Frühförderung durch die inzwischen etwa 50 Jahre ihres Bestehens verfolgt und den Begriff aus der heute gebräuchlichen Sicht definieren möchte.
Frühförderung beinhaltet aus einem gegenwärtigen Verständnis heraus drei Ebenen, die Steinebach (1992) in seiner Definition von Frühförderung meiner Meinung nach sehr deutlich hervorhebt.
"Frühförderung ist ein Angebot für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder, besonders in den ersten drei Lebensjahren, aber auch darüber hinaus bis zur Einschulung" (Steinebach 1992, S 42). Diese Definition schließt sowohl Kinder mit der Diagnose einer Behinderung als auch Kinder mit Entwicklungsstörungen, Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen, Kinder mit Verhaltensproblemen oder Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit ein.
"Frühförderung ist ein Angebot für die Eltern dieser Kinder. Eltern, die unsicher sind, ob die Entwicklung ihres Kindes altersentsprechend verläuft. Eltern, die in der Erziehung ihrer Kinder ratlos sind, die wissen möchten, wie sie ihr Kind fördern können. Eltern, die lernen möchten, die Besonderheiten des Kindes und die Entwicklungschancen der Familie neu zu sehen" (ebd. S 43).
Frühförderung schließt also auch den familiären Kontext des Kindes in ihre Überlegungen und Interventionen mit ein, betont die Bedeutung der Familie als konkrete Lebenswelt und Entwicklungsraum des Kindes und richtet ihr Angebot auch direkt an die Familie im Sinne von Beratung und Begleitung.
"Frühförderung ist ein Angebot für das weitere soziale Umfeld, für die Geschwisterkinder und damit für die Familie als Ganzes, für die Erzieherinnen in den Krabbelgruppen oder in den Kindergärten, die sich um eine Integration dieser Kinder in die Gruppen bemühen" (ebd. S 43).
Hier deutet Steinebach schon an, dass Frühförderung letztlich neben der autonomen Entwicklung des Kindes, der Familie und ihrer Mitglieder auch die Integration der Familie in ihre soziale Umwelt und den Aufbau von stützenden sozialen Netzwerken anstrebt.
Pretis sieht die Wirkung der Frühförderung dementsprechend in drei Bereichen angesiedelt: in der Entwicklungsförderung, in der Elternunterstützung und in der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Lebenssituation von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. (vgl. Pretis 2000, S 113)
Die theoretischen Wurzeln der Frühförderung ortet Pretis in den sozialpädiatrischen Postulaten der Früherfassung, Früherkennung und Frühbehandlung von Kindern mit Gesundheitsrisiken, also in einem ursprünglichen Bemühen um Prävention im medizinisch-therapeutischen Feld. (vgl. ebd. S 117)
Anfangs standen die Begriffe "Frühförderung", "Früherziehung", "Frühtherapie", "Entwicklungsrehabilitation", "Frühe Hilfen" oder "heilpädagogische Früherziehung" noch konkurrierend nebeneinander.
"Im Lauf der Zeit hat sich in den deutschsprachigen Ländern außerhalb der Schweiz der Begriff der ‚Frühförderung' oder ‚interdisziplinären Frühförderung' verbreitet; er wird als Oberbegriff für die Gesamtaufgabe der Diagnostik, Therapie/Förderung, Elternberatung und Vernetzungsarbeit gesehen, und ist aus seinem engeren pädagogischen Kontext gelöst, so dass er auch in medizinisch akzentuierten Kontexten verwendet wird" (Thurmair/Naggl 2000, S 14 mit Bezug auf Neuhäuser 1982, Schlack 1989).
Frühförderung ist demnach ein Begriff, der das pädagogische und das medizinische Feld einschließt. Er hat aber durchaus auch schwierige Konnotationen: etwa die Betonung der Frühzeitigkeit und die Festlegung auf den Begriff der Förderung, die ein wirkungsvolles Eingreifen in Entwicklungsprozesse von außen suggeriert und so ein eher funktionalistisches Bild von der Arbeit in der Frühförderung erscheinen lässt.
Der Begriff "Frühförderung" vermittelt den Eindruck des Machbaren, des Technokratischen, des Beförderns und Irgendwo-Hinbringens, er lässt an Förderziele, Förderpläne und Förderprogramme denken, die von der Frühförderin an das Kind herangetragen und möglicherweise auch von den Eltern durchgeführt werden. Im Begriff der Frühförderung scheinen der Wunsch des Kindes und seine Eigentätigkeit nicht explizit auf - und das mag in der Öffentlichkeit, aber auch bei den Eltern, die sich auf der Suche nach einem passenden Angebot für ihr Kind befinden, oft falsche Vorstellungen über das Geschehen in der aktuellen Frühförderung wecken.
Es kommt aber nicht von ungefähr, dass sich der Begriff "Frühförderung" als im Sprachgebrauch verbindlich durchgesetzt hat. Am Beginn der Entwicklung der Frühförderung standen tatsächlich die Frühzeitigkeit und die Quantität der Fördermaßnahmen im Vordergrund der Bemühungen. Und auch wenn die Frühförderpraxis und die weiterführenden theoretischen Überlegungen inzwischen einen Wandel im Verständnis von Frühförderung bewirkt haben, so haften der Frühförderung diese beiden Aspekte doch bis heute noch an und klingen immer wieder durch. So etwa auch bei Pretis, wenn er in Ermangelung einer einheitliche Definition von Frühförderung im deutschsprachigen Raum einen gemeinsamen Grundkonsens des Begriffes formuliert, der besteht im "präventiven Aspekt zur Vermeidung primärer und sekundärer langfristiger Beeinträchtigung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder durch möglichst frühzeitige pädagogische Betreuung in oder mit der Familie und im interdisziplinären Austausch" (Pretis 2000, S 116).
Entsprechend den weiter oben erwähnten Ebenen der Wirksamkeit von Frühförderung erscheint es mir sinnvoll, ihre Ziele und Aufgaben ebenfalls nach diesen drei Bereichen zu unterscheiden. Dabei beziehe ich mich auf die Ausführungen von Thurmair und Naggl (2000, S 21ff).
Auf der kindbezogenen Ebene geht es in der Frühförderung um die Entfaltung der Kompetenzen des Kindes, um die Entwicklung seines Selbsterlebens und Selbstwertgefühls und um die Integration des Kindes in seine es umgebende Lebenswelt.
Auf der Eltern-Ebene geht es einerseits um die fachliche Beratung und gegebenenfalls Anleitung der Eltern, die auf die Stärkung und Erweiterung ihrer Kompetenzen abzielt und ihnen neben Informationen über den Entwicklungstand und die Bedürfnisse des Kindes auch Kontakte zu anderen Fachleuten und ebenfalls betroffenen Eltern vermitteln soll. Diese fachliche entwicklungsbezogene Beratung ist Aufgabe jeder Mitarbeiter in der Frühförderung und gehört zu ihrem Auftrag.
Auf der anderen Seite kann es auch um die Auseinandersetzung der Eltern mit ihrer Situation gehen und darum, sie dabei zu unterstützen. Dafür ist es wichtig, dass die Frühförderin respektiert, wie sich die Eltern verhalten, dass sie keine normativen Anforderungen an die Eltern bezüglich der Annahme ihres Kindes stellt und dass sie ihre individuellen Entwicklungsprozesse achtet, zu denen auch gehört, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch nicht.
Dazu haben sich in der Frühförderung mittlerweile zwei Angebote entwickelt:
Auf der einen Seite die Begleitung und Unterstützung der Familie, die ein offenes Ohr der Frühförderin für die Anliegen, Sorgen und Nöte der Eltern und ein langfristiges, kontinuierliches Arbeiten in bzw. mit der Familie voraussetzt.
Auf der anderen Seite hat sich aber auch psychotherapeutisch orientierte Beratung für Eltern in der Frühförderung als zusätzliches, fakultatives Angebot etabliert. Diese Form der Beratung stellt einen eigenen Arbeitsschwerpunkt für Mitarbeiterinnen mit besonderen Qualifikationen dar und hat es zum Ziel, den Eltern Hilfe zu geben bei der Umorientierung in ihrer je individuellen Situation, bei der Anpassung an die Belastungen und bei der Weiterentwicklung ihrer Beziehung- und Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihr Kind.
Auf der gesellschaftlichen Ebene hat Frühförderung die Aufgabe und das Ziel, am Aufbau regionaler und erreichbarer Hilfen für die Familien mitzuarbeiten und Bedingungen zu schaffen bzw. zu fördern, die eine Integration der Familie in ihre Lebensumwelt ermöglichen.
Die Arbeitsprinzipien der Frühförderung lassen sich unter den vier Gesichtspunkten der Ganzheitlichkeit, Familienorientierung, Interdisziplinarität und Vernetzung zusammenfassen. (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S 25ff)
Ganzheitlichkeit bedeutet in der Frühförderung das Bestreben, die Angebote der Diagnostik, Therapie und Förderung im umfassenden Kontext der kindlichen Gesamtentwicklung und Lebenswelt zu sehen, andererseits aber auch die Zusammenfassung verschiedener Förderaspekte in einem Konzept, das dem Kind von einer Person angeboten wird.
Familienorientierung "benennt das Anliegen der Frühförderung, die Therapie und Förderung der Kinder in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten" (ebd. S 27).
"Familienorientierung beinhaltet, dass die Verantwortung der Eltern in der Fürsorge für das Kind und in seiner Erziehung wahrgenommen und geachtet wird; dass die Anliegen der Eltern und die Anliegen der Frühförderung am Anfang und auch immer wieder im Verlauf der Frühförderung aufeinander abgestimmt werden; dass die Entwicklung des Kindes auch aus seinem familiären Kontext heraus verstanden, und Förderung und Therapie wiederum auf diesen bezogen werden" (ebd. S 27).
Dahinter steht die konzeptionelle Überlegung, dass die Lebenswelt des Kindes und seine persönlichen Entwicklungskräfte den Verlauf seiner Entwicklung bestimmen und die Überzeugung, dass die Wirksamkeit der Frühförderung von den Verständigungsprozessen mit den Eltern abhängt.
Interdisziplinarität fordert die Zusammenarbeit aller an einer Frühförderstelle beschäftigten Professionen. Die in der Frühförderung anfänglich geltende Meinung, das Kind brauche für jeden Problembereich einen eigenen Spezialisten, ist inzwischen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise gewichen.
"Interdisziplinäre Frühförderung beinhaltet, daß Fachkräfte des medizinischen, pädagogischen, psychologischen und des sozialen Bereichs fall- bzw. institutionsbezogen zusammenarbeiten" (Bölling-Bechinger 1998, S 39).
Dazu ist die Organisation von interdisziplinären Zusammenkünften nötig: in Teamgesprächen, interdisziplinärem Fachaustausch, fallbezogenen Absprachen, gegenseitigen Hospitationen, kollegialer Beratung oder fachlicher Beratung durch Kolleginnen anderer Professionen.
Letztendlich hängt die Qualität der Interdisziplinarität aber von der Beziehungsbereitschaft und -fähigkeit der Fachleute ab.
Vernetzung schließlich "meint die Aufgabe, die Einbettung von Frühförderung in umgebende Systeme wahrzunehmen, und die eigenen fachlichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen" (Thurmair/Naggl 2000, S 30).
Dazu gehört die Beachtung der informellen (Nachbarn, Freunde, soziale Kontakte,...) und der formellen (Institutionen, Behörden, Dienstleister,...) familiären Netzwerke, die Beachtung der regionalen Struktur von Angeboten für die Familien und die Weiterentwicklung regionaler Angebote und gesellschaftlicher Ressourcen im Hinblick auf die Verbesserung der Situation für betroffene Familien. Vernetzung bezieht sich auch auf das Ziel, "den Familien die professionellen Unterstützungssysteme zugänglich und transparent zu machen [...] und ihnen auch zu helfen, ihre Interessen zu artikulieren" (ebd. S 31).
Prinzipiell wird Frühförderung in ambulanter und in mobiler Form angeboten. Nachdem sich Frühförderung aus zunächst vereinzelten Initiativen von Sonderpädagogen entwickelt hat, die über Land zu den Familien hinfuhren, ist Frühförderung heute zumeist in sogenannten Frühförderstellen organisiert. Am Stellenwert der mobilen Hausbesuche hat sich aber vor allem in ländlichen Gebieten nichts verändert.
"Frühförderung ist ein gemeinde- und familiennahes Angebot, das von Frühförderstellen gemacht wird. Frühförderstellen sind konzipiert als offene Anlaufstellen für Familien, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen. Sie sind regionale Einrichtungen die für die Familien gut erreichbar sind, und die ihre Angebote auch in mobiler Form (Hausbesuch) machen. Sie haben einen fachlichen und organisatorischen Hintergrund, der ihnen ein bedarfsgerechtes Handeln ermöglicht" (ebd. S 13).
Mit diesem fachlichen und organisatorischen Hintergrund ist die jeweilige Institution gemeint, die Frühförderstellen installiert und ein Konzept für die Arbeit sowie materielle und fachliche Ressourcen zur Verfügung stellt.
Der Ablauf des Arbeitsprozesses in der Frühförderung lässt sich ganz grob einteilen in die Eingangs- oder Aufnahmephase, die Zeit der Förderung und die Abschlussphase.
Die Eingangsphase stellt den Kontakt mit der jeweiligen Familie her und schafft für Familie und Frühförderin eine Grundlage für die gemeinsame Arbeit. In Informations-, Anamnese- und Erstgesprächen werden die Situation und die Wünsche der Familie erhoben, ein gegenseitiges Kennenlernen findet statt, und die Familie erhält einen Einblick in die Arbeitsweisen und -vorgänge in der Frühförderung. Je nach Institution findet der Diagnoseprozess direkt an der Frühförderstelle statt, oder es werden ärztliche, psychologische oder therapeutische Gutachten von anderen Stellen eingeholt.
"Die Eingangsphase schließt ab mit einem Arbeitsbündnis zwischen Frühförderstelle und Eltern, das Vereinbarungen enthält über die inhaltlichen Schwerpunkte und den formellen Rahmen von Therapie und Förderung, über die damit von der Frühförderstelle betraute(n) Person(en), und über die Einbeziehung der Eltern in die Therapie/Förderung" (ebd. S 37).
Während der Zeit der Förderung wird das Kind entsprechend der vereinbarten Schwerpunkte unterstützt, werden die Eltern dazu fachlich beraten und begleitet und findet ein regelmäßiges Bilanzieren über den Verlauf der Förderung und eine Planung der weiteren Schritte mit den Eltern statt. Bei besonderen Anliegen oder Fragen der Eltern wird im Förderprozess innegehalten, und es finden dazu eigene Gespräche statt. Eine wiederholte Erneuerung und Fortentwicklung des Arbeitsbündnisses mit den Eltern und eine regelmäßige Rückversicherung, wie die Förderung mit den Wahrnehmungen und Anliegen der Eltern zusammenpasst, wird als wichtiger Teil des Frühförderprozesses angesehen.
In der Phase des Abschlusses bzw. der Beendigung der Frühförderung ist es wichtig, "die vorgesehene oder sich abzeichnende Änderung rechtzeitig anzukündigen und mit den Eltern zu besprechen und vorzubereiten; über die Zeit der Förderung insgesamt Bilanz zu ziehen und die Förderung abzurunden; voneinander Abschied zu nehmen" (ebd. S 38).
Der Abschluss beinhaltet ebenso die Gestaltung des Übergangs des Kindes in eine andere Einrichtung, die Übergabe eines schriftlichen Berichtes und der schriftlichen Unterlagen an die Eltern.
Je nach Frühförderstelle werden die verschiedenen Abschnitte der Zusammenarbeit mit der Familie entsprechend dem zugrundeliegenden Konzept unter Umständen anders gehandhabt und gestaltet. Die Ausführungen von Thurmair und Naggl zu diesem Thema beinhalten aber einige sehr verbindliche und konzeptübergreifende Aspekte und erscheinen mir geeignet, einen ersten Einblick in den Frühförderprozess und die Aufgaben der Frühförderin zu geben.
Wichtig ist vielleicht noch festzuhalten, dass die Angebote in der Frühförderung grundsätzlich an die Bedürfnisse der jeweiligen Familie angepasst werden.
"Nicht alle Eltern werden zum gleichen Zeitpunkt der Förderung mit dem gleichen Angebot konfrontiert. Häufig wird erst im Verlauf der Förderung erkannt, ob und in welcher Form eine intensivere Elternbeteiligung sinnvoll und notwendig ist. Oft bestimmen die Eltern selbst, wann, zu welchem Thema und in welcher Form sie selbst beraterische Maßnahmen in Anspruch nehmen möchten" (Steinebach 1995, S 19).
Allgemein könnte man von einer hohen Individualisierung des Angebotes in der Frühförderung sprechen.
Die Vorstellungen von Frühförderung, die wissenschaftlichen Grundlagen und das konkrete Vorgehen in der Frühförderung haben sich seit ihren Anfängen vor etwa fünfzig Jahren stark gewandelt und verändert. Dabei hat sich ein flächendeckendes Angebot von ambulanter und mobiler Frühförderung in Deutschland etwa ab den Siebziger Jahren, in Österreich erst ab Mitte der Achtziger Jahre entwickelt. (vgl. Weiß 2000, S 176; Steinebach 1992, S 50)
Im Folgenden beziehe ich mich vor allem auf die Darstellungen Steinebachs von der Entwicklung der Frühförderung durch die Jahrzehnte, da sie mir im Hinblick auf alle weiteren Überlegungen zu einer Familienbegleitung in der Frühförderung wichtig erscheinen. (vgl. Steinebach 1992, S 50ff)
In den Fünfziger Jahren vollzog sich ein erster Wandel von den Reifungskonzepten hin zu lerntheoretischen Überlegungen. Behinderung wurde noch eher als unabänderliches Schicksal angesehen, die betroffenen Kinder hauptsächlich in Sondereinrichtungen untergebracht, und somit eher versteckt und vergessen. Durch den Einsatz betroffener Eltern und einzelner institutioneller Verbände konnte sich daran schließlich langsam etwas ändern. Man entdeckte die sensiblen Phasen in der kindlichen Entwicklung, die durch eine besondere Aufnahmefähigkeit gekennzeichnet schienen und fand erste Belege dafür, dass sich soziale Faktoren auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Allmählich kam es zur Wende vom Reifungskonzept zum lerntheoretischen Konzept, und so wurde Entwicklung Anfang der Sechziger Jahre als das Ergebnis von Lernen durch spezifische Erfahrungen angesehen.
"Die Ergebnisse führten zu der Annahme, daß durch zahllose nach Gesetzen ablaufende Aktions-Reaktions-Ketten einzelne Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und komplexe Fertigkeiten erlernt werden" (ebd. S 53).
Es entspannen sich heftige Diskussionen um das Verhältnis zwischen Anlage und Lernen.
In den Sechziger Jahren wurde es als vordergründig angesehen, altersentsprechende Fähigkeiten und Reaktionen einzuüben, wobei die Lerntheorie die Begründung bot für intensive Förderung und für den Einsatz von verhaltenstherapeutischen Techniken.
In der Folge kam es zu einer zweiten Wende vom Verhalten hin zum Handeln, vom passiv reagierenden hin zum aktiv handelnden Kind. Es wurde mehr Augenmerk auf die internen Prozesse beim Lernen gerichtet, auf Aufmerksamkeit, Interesse, Motivation, kognitive Kompetenzen und auf die Interpretation und die Bedeutung von Verhalten. Man erkannte, dass die Entwicklung eines Menschen auch von ihm selber stark mitbeeinflusst wird. Das Handlungskonzept ließ erstmals eine Vernetzung zwischen elterlicher und kindlicher Entwicklung zu, weil es die Entwicklung des Menschen über die gesamte Lebensspanne umfasste.
Die Aufgaben der Frühförderung waren es nun, die Kompetenzen des Kindes in der Wahrnehmung seiner Umwelt zu erhöhen und die Vermittlung von kompensatorischen Fähigkeiten anzustreben. Dabei wurde nun auch der Eigenbeitrag und die Eigenverantwortung des Menschen betont.
In den Siebziger Jahren vollzog sich eine weitere Wende von den kindzentrierten Konzepten hin zu umweltbezogenen Betrachtungen. Eine anregende und unterstützende Umwelt wurde als notwendig für das Eintreten von Therapieerfolgen angesehen. Die positive Bedeutung einer "normalen Umwelt" wurde betont, und somit der Grundstein gelegt für Normalisierungs- und Integrationsgedanken. "Umwelt wurde mehr und mehr zu einem aktuellen Begriff, mit dem ein ganzes Wertsystem verbunden wird" (ebd. S 58).
In den Achtziger Jahren fand nun die Veränderung hin zu einer familienbezogenen Frühförderung statt. Die Rolle des Vaters für die Entwicklung des Kindes wurde verstärkt beachtet, und in der Folge wurden alle Familienmitglieder vermehrt in die Angebote miteinbezogen. "Probleme des einzelnen Familienmitgliedes wurden nun als Ausdruck von Problemen der Familie als Ganzes gesehen" (ebd. S 59).
In der Folge zogen Familiensystemtheorien, Familienentwicklungstheorien, Familienstresstheorien und systemische Ansätze der Familientherapie in die Praxis der Frühförderung ein.
"Familienbezogene Frühförderung sieht die Bedeutung des Entwicklungsproblems für die Familie [...], berücksichtigt die Rollen der Familienmitglieder und die Regeln in der Familie" (ebd. S 59).
Steinebach siedelt Anfang der Neunziger Jahre den Wandel von der Familienbezogenheit hin zur systemischen Frühförderung an. Das Konzept der "Autopoiese" (Maturana/Varela 1987) wird zu einem zentralen Konzept der Systemtheorien, und es findet eine Bewegung statt: weg vom "adaptiv-selbstoptimierenden" System, das die Wechselbeziehung zur Umwelt und damit auch die Umweltveränderung betont, hin zum "selbstreferentiellen" System, das die Bedeutung von Selbstherstellungsprozessen in den Vordergrund rückt.
Der Kommunikation gilt das Hauptaugenmerk in systemtheoretischen Ansätzen, wobei es um eine Analyse gegenwärtiger Kommunikationsmuster und Beziehungen geht und weniger um die Familiengeschichte oder die historisch kulturellen Bedingungen familiärer Probleme.
"Schritt für Schritt und Wende für Wende wird die angenommene Komplexität der Entwicklungsprobleme größer. Frühförderung richtet sich in ihren Konzepten und Methoden aus auf viele Faktoren im Kind, in der familiären und außerfamiliären Umwelt des Kindes, in seiner Vergangenheit, seinen momentanen Rollen und in seiner weiteren Entwicklung, die die ganze Lebensspanne umfaßt. Der Fördernde muß sich immer wieder fragen, wo und wie er diese Komplexität eingrenzt" (ebd. S 62).
In diesen Ausführungen wird deutlich, auf welchem theoretischen Hintergrund sich die Frühförderung entwickelt hat. War man anfangs noch von eher linearen Wirkungsweisen von Eingriffen in die kindliche Entwicklung überzeugt, so entdeckte man im Lauf der Zeit immer mehr Zusammenhänge und Faktoren, die das Geschehen in der Frühförderung tatsächlich zu einem immer komplexeren Prozess werden ließen. Es zeichnet sich darin schon ab, wie es zur Entstehung einer Familienorientierung in der Frühförderung kam, auch wenn sie vorerst eher der Optimierung der kindlichen Entwicklungsförderung dienen sollte. Meiner Meinung war die Zeit ab Anfang der Neunziger Jahre jene Zeit, in der versucht wurde, die theoretischen Überlegungen zu einer Familienbezogenheit und Familienorientierung in die Praxis umzusetzen. Der Begriff "Frühförderung" wird heute oft ergänzt mit dem Begriff der "Familienbegleitung", was deutlich macht, auf welche Weise man die Arbeit mit den Eltern heute verstehen möchte: nicht so sehr als Intervention oder Einflussnahme von außen, sondern als Angebot an die Eltern, gemeinsam mit ihnen den oft beschwerlichen Weg mit ihrem Kind zu gehen.
Im Folgenden möchte ich mich gerne mehr mit den konkreten Auswirkungen der theoretischen Veränderungen in der Frühförderung beschäftigen und vor allem den Wandel im Verständnis der Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern herausarbeiten.
Im Stadium des Aufbaus der Frühförderung herrschte ein großer Förderungsoptimismus unter den Fachleuten. Der Slogan "je früher, desto besser" betonte die Überzeugung, dass sehr frühzeitig einsetzende Hilfen und konsequente Förderprogramme eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung des Kindes wirksam beeinflussen, wenn nicht sogar gänzlich aufheben könnten. Dahinter standen wissenschaftliche Annahmen über die Plastizität des frühkindlichen Gehirns und über die Effektivität von Therapie- und Fördermaßnahmen für die Kompensation organischer Schädigungen.
"Je früher und je ausgedehnter und intensiver an das Kind Förderangebote herangetragen werden, um so nachhaltiger können sie auf seine Entwicklung Einfluß nehmen" (Weiß 1993, S 23) - so lautete die vorherrschende Überzeugung.
Frühförderung selber spielte dabei eine große Rolle, weil sie den Eltern die Hoffnung vermittelte, "daß ihrem Kind dadurch bessere Chancen der individuellen Entwicklung und gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet werden" (ebd. S 22).
"Die pädagogisch-psychologische Frühförderung des Kindes gründete auf der Hoffnung, dem Optimismus, daß Behinderung, je früher sie erkannt wird, gemildert oder gar beseitigt werden kann" (Bölling-Bechinger 1998, S 28).
Diese optimistischen Vorstellungen von der Effektivität früher Fördermaßnahmen mussten inzwischen vor allem für den Bereich der Schädigung zurückgenommen werden. Auch die überhöhten und undifferenzierten Vorstellungen von der Plastizität des kindlichen Gehirns mussten zugunsten einer realistischeren Einschätzung revidiert werden.
Die Folge aber waren Übungsprogramme nach lerntheoretischen Prinzipien und die Entstehung eines Modells von Elternarbeit, in dem die Eltern als Laien angesehen und von den "Professionellen" in der Durchführung von Förderprogrammen angeleitet wurden. In einem weiteren Schritt wurden die Eltern schließlich zu Co-Therapeuten, die die therapeutischen Übungen zu Hause fortzusetzen hatten, um die Wirksamkeit der Förderung noch zu verstärken. "Die Begründung für Elternarbeit liegt dabei primär darin, auf die Eltern einzuwirken, daß sie sich an der fachlich bestimmten Förderung beteiligen und deren Kontinuität und Intensität gewährleisten" (Weiß 1989, S 23).
Weiß spricht in diesem Zusammenhang von einem technokratisch- funktionalistischen Modell der Frühförderung, wobei sich "technokratisch" auf die ausgeklügelten Behandlungstechniken und "funktionalistisch" auf die Förderfunktion der Eltern bezieht. Dieser Ansatz hat bis in die frühen Achtziger Jahre hinein überwogen. (vgl. Weiß 1993, S 23)
Ein Umdenken fand vor allem deswegen statt, weil die Eltern zunehmend ihre Unzufriedenheit äußerten und bei Kindern wie auch Eltern Widerstände und Verweigerungsreaktionen auftraten. Die Rolle der Eltern als Co-Therapeuten hatte oft gravierende Auswirkungen auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung zur Folge und belastete die Interaktionen zwischen Eltern und Kindern stark.
Im "Brief einer Mutter" (Speck/Warnke 1983, S 21 ff) zeigen sich die Schwierigkeiten, die Eltern mit der Institution Frühförderung haben können. Der meist wöchentliche Besuch einer Frühförderin erinnert die Eltern ebenso wie deren Ratschläge kontinuierlich daran, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Es ist für die Eltern dann nicht leicht, ihr Kind einfach nur als Kind zu sehen und nicht als förderungswürdiges Objekt, zu dem es durch starre Übungsmaßnahmen degradiert werden kann.
Für Eltern ist es meist ein ganz wichtiges Ziel in der Frühförderung, dass sich ihr Kind wohlfühlt, dass das Kind ebenso wie sie selber geachtet und respektiert wird und man ihre Ängste, Nöte und Bedürfnisse ernst nimmt. Eltern wollen ein glückliches Kind, das Freude und Spaß empfindet - ebenso wie sie auf der anderen Seite aber auch wollen, dass ihr Kind Fortschritte macht. Die Frage ist, ob dies auch Kriterien der Frühförderung waren bzw. sind: das Glück, die Freude, der Lebenswille und das Selbst des Kindes.
Die Mutter beschreibt in ihrem Brief von den Schwierigkeiten, die das Co-Therapeuten-Modell mit sich bringt, weil es die Eltern in Rollenkonflikte drängt. Sie können nicht mehr einfach intuitiv nach ihren Elterngefühlen handeln - es fällt ihnen aber auch schwer, in die Therapeutenrolle zu schlüpfen und von ihrem Kind Dinge zu verlangen, auf deren Einhaltung sie als Mutter oder Vater sicher niemals in dieser Konsequenz bestehen würden. So geraten sie in einen ständigen Widerstreit mit sich selber und verunsichern mit ihrer ambivalenten Haltung auch das Kind. Für Spontaneität und die Äußerung von Gefühlen in der Eltern-Kind-Beziehung stellt dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Frühförderin ein großes Hindernis dar. Es ist inzwischen in der Frühförderung als Arbeitsprinzip nicht mehr gebräuchlich - trotzdem kommen die Eltern aber immer wieder in die Situation, von einem Arzt, einem Therapeuten oder der Frühförderin mit der Wiederholung von bestimmten Übungen beauftragt zu werden.
In diesem Brief bemängelt es die Mutter noch sehr, dass die Familie, besonders auch die Geschwister, nicht in die Frühförderung miteinbezogen werden, dass zu wenig auf den individuellen Hintergrund der Familie und auf ihre soziale Umwelt geachtet wird. In diesem Punkt unterscheidet sich die heutige Frühförderung mit ihrem Schwerpunkt Familienbegleitung wesentlich von den Prinzipien in den Anfängen.
Die Mutter im erwähnten Brief beklagt außerdem, dass die Frühförderung hauptsächlich mit der Motivation arbeitet, den Defekt zu beseitigen, retten zu wollen, was noch zu retten ist und dabei ihren Blick auf das richtet, was noch fehlt. Als Mutter würde sie sich wünschen, von der Frühförderung eine positive Motivation vermittelt zu bekommen - etwa das Ziel der individuellen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Seit den Achtziger Jahren kam es tatsächlich zur Entwicklung von alternativen Förderkonzepten, die auch die Kompetenzen der Kinder und Eltern berücksichtigen.
Einerseits sind das Ansätze, "die das oftmals erschwerte Interaktionsgeschehen zwischen Eltern und behinderten Kindern zu entlasten, zu differenzieren und zu erweitern sowie die subjektiven Bedürfnisse und Dimensionen des Erlebens der Interaktionspartner zu berücksichtigen suchen" (Weiß 1993, S 24). Andererseits sind es Ansätze, die die Eigentätigkeit, die Selbstgestaltung und die Kompetenz des Kindes in einem stärkeren Alltagsbezug fokussieren.
Parallel dazu kam es zur Entwicklung eines "Kooperationsmodells" (Speck 1983; Weiß 1989) in der Elternarbeit mit dem Ziel einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern als Eltern, was ebenfalls einschließt, sie in ihrer erzieherischen Primärverantwortlichkeit und in ihrer Kompetenz zu achten und wertzuschätzen. Daneben zeichnete sich eine weitere Entwicklung ab: die Tendenz, die Mutter-Kind-Zentrierung in der Frühförderung auszuweiten auf die Gesamtsituation der Familie in ihrer konkreten Lebenswelt. "Lebensweltbezug", "Gemeindenähe" und "Netzwerksicherung" bezeichnet Weiß in diesem Zusammenhang als Schlagworte der neuen Sichtweise. (vgl. Weiß 1993, S 24)
Bölling-Bechinger (1998) setzt den Paradigmenwechsel in der Frühförderung mit der Erkenntnis der Begrenztheit der Therapie- und Fördermaßnahmen an. Ihrer Meinung nach trafen sich Eltern und Fachleute bei ihren Förderbemühungen in ihrem unbewussten Wunsch, die Behinderung nicht wahrhaben zu wollen und schoben sich letztendlich gegenseitig die Schuld für die ausbleibenden Entwicklungsfortschritte des Kindes zu. Es kam zu Interaktionsstörungen zwischen Kind und Eltern, zwischen Kind und Frühförderin und zwischen Eltern und Frühförderin. "Erst der Dialog mit den Eltern über die eigene Begrenztheit eröffnete neue Perspektiven und forderte zum Paradigmenwechsel in der pädagogisch-psychologischen Frühförderung heraus" (Bölling-Bechinger 1998, S 28).
Was Bölling-Bechinger hier beschreibt, ist meiner Meinung nach nicht nur ein Geschehen aus längst vergangenen Tagen, sondern es ist das, was sich immer wieder und auch heute noch einstellt, wenn Eltern und Frühförderin sich in ihrem Förderaktivismus gegenseitig verstärken und an irgendeinem Punkt schließlich doch auf Grenzen stoßen.
Das "partnerschaftliche Kooperationsmodell" (Speck 1983; Weiß 1989) hat erst in den folgenden Jahren bis heute zu einer allmählichen Veränderung in den Konzepten der Frühförderung und damit auch in der Haltung und im Handeln der Frühförderinnen geführt. Als das Partnerschaftsmodell formuliert wurde, war es meiner Meinung nach noch stark von der funktionalistischen Sicht der Elternarbeit und von einem doch spürbaren Machtgefälle zwischen Fachleuten und Eltern bestimmt. Durch eine Kooperation mit den Eltern sollten letztlich doch nur wieder die Förderbemühungen optimiert werden, und der Kooperationsgedanke war noch stark davon bestimmt, dass sich die Eltern auf das einlassen sollten, was die Fachleute für sie als wichtig erachteten.
In den Neunziger Jahren gab es einige Bestrebungen, von diesem theoretischen Haltungsmodell der Kooperation zu einem Handlungsmodell zu kommen, die Partnerschaft und ihre Voraussetzungen bei der Frühförderin und bei den Eltern konkret zu formulieren und in Handlungsvorschläge zu übersetzen. (vgl. Pretis 1998)
Das Miteinbeziehen der Eltern in die Frühförderarbeit ist mittlerweile ein konstitutiver Teil der meisten Frühförderkonzepte. Funktionalistische Ansätze bestehen jedoch weiter fort und kommen je nach Frühförderkonzept mehr oder weniger stark zum Ausdruck - wie etwa auch im folgenden Zitat: "Die Einbindung der Eltern als primäre Sozialisationsinstanz stellt eine unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit früher Förderprozesse behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder dar" (Pretis 1998, S 11).
Eine Alternative zum funktionalistischen Ansatz stellt für mich das Bemühen dar, die Situation eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes, seiner Geschwister und seiner Eltern in ihrem sozialen Umfeld und ihre je individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und dabei nicht die optimale Förderung des Kindes, sondern die autonome Entwicklung und das Wohlbefinden aller Familienmitglieder im Blick zu haben.
"Trotz zahlreicher Studien zur Situation von Familien behinderter Kinder [bestehen] bei Fachleuten dazu immer noch gravierende ungeklärte Fragen, Wissenslücken und zum Teil sicher Unrichtigkeiten und Vorurteile" (Weiß 1989, S 16). Auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist, glaube ich dennoch, dass diese Aussage noch immer Gültigkeit hat - wobei es mir bei der Wahrnehmung der Situation der Familie nicht so sehr um äußerliche Merkmale, sondern um ein gefühlsmäßiges Einlassen auf die Sorgen und Nöte der Betroffenen geht. Der Blick einer Frühförderin auf die individuelle Situation einer Familie kann durchaus auch durch die starren Interpretationsfolien fachlichen Wissens verstellt werden.
Aus diesem Grund räume ich der Situation der Familie eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes in meinen weiteren Ausführungen auch einen sehr wichtigen Platz ein und beginne die Beantwortung der Frage nach einer adäquaten Familienbegleitung mit grundlegenden Überlegungen zu den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder.
In vielen Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen der Frühförderung hat Weiß den Eindruck gewonnen, dass es diesen "mit wachsendem Erfahrungshintergrund eher möglich wird, sich zunehmend vom ‚Gebot optimaler Förderung' zu lösen" (Weiß 1993, S 32) - sich quasi davon zu emanzipieren und sich mehr auf die unmittelbare Kommunikation und ein Verständigungshandeln mit Eltern und Kind einzulassen. Mitarbeiterinnen in der Frühförderung können demnach im Laufe ihrer eigenen Tätigkeit ihren individuellen "Verständniswandel" von Frühförderung durchlaufen.
Im Weiteren - vor allem in den Gedächtnisprotokollen meiner eigenen Arbeit in der Frühförderung - wird vielleicht auch mein persönlicher Auseinandersetzungsprozess mit dem Wechsel der Perspektive in der Frühförderung spürbar und erlebbar werden. Um es dem Leser zu ermöglichen, diese Gedächtnisprotokolle in einen größeren Kontext und in seine Rahmenbedingungen einzuordnen, möchte ich vorher aber noch kurz auf die derzeitige Situation der Frühförderung in Österreich eingehen.
Im Folgenden beziehe ich mich auf einen aus dem Jahr 2000 stammenden Beitrag von Pretis (2000, S 113ff).
Die "österreichische Situation" der Frühförderung ist demnach geprägt von einer großen Heterogenität der Organisationsformen, Inhalte und Durchführungsrichtlinien. Es existieren je nach Träger bzw. Bundesland unterschiedliche heilpädagogische Konzepte, Zuweisungsmodi, Qualifikationen und berufliche Zugänge zur Frühförderung, und es gibt keine eindeutig definierten Qualitätskriterien von Frühförderung. Für Pretis spiegelt diese Situation auch ein fehlendes übergeordnetes sozialpolitisches Interesse wider. (vgl. Pretis 2000, S 114)
Aufgrund des fehlenden Datenmaterials zur Inanspruchnahme der Frühförderung bzw. der Versorgung mit Frühförderung im Bundesgebiet stellt Pretis Schätzungen darüber an und beziffert die Zahl der in Österreich arbeitenden Frühförderinnen mit etwa 250-300, die Zahl der von ihnen betreuten Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren mit 3000-4000. Die Inanspruchnahme der Frühförderung für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder durch ihre Eltern liegt gesamteuropäisch gesehen bei etwa 40 Prozent, was in Österreich nicht anders sein dürfte. Dass dieser Wert so niedrig ist, hat nach Pretis einerseits mit der Angst der Eltern vor der befürchteten Stigmatisierung durch den Zuweisungsmodus, mit der nicht flächendeckenden Versorgung in den ländlichen Gebieten, aber auch mit der fehlenden Bewusstseinsbildung der zuweisenden Experten zu tun.
Diese Annahmen bestätigen sich in Aussagen von Eltern, die meinen, sie hätten nichts von der Möglichkeit der Frühförderung gewusst und seien nie darauf aufmerksam gemacht worden, so dass es oft erst die Kindergärtnerin ist, die den Eltern Informationen darüber zukommen lässt.
Frühförderung ist in Österreich Teil der präventiven Maßnahmen zur Erziehung und Förderung des Kindes. Der Zugang hängt jedoch nicht nur von der Motivation der Eltern oder vom Expertenwissen der Fachleute ab, "sondern auch von der Organisation und Erreichbarkeit geeigneter Fördermaßnahmen vor Ort bzw. vom Informationsfluss und der Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Effizienz früher Maßnahmen" (ebd. S 116).
Das durchschnittliche Erfassungsalter in der Frühförderung lag nach Pretis 1995 bei 3,2 Jahren, was prekär erscheint, wenn man bedenkt, dass Frühförderung sich auf Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren bezieht.
Die Tatsache, dass es momentan keine einheitlichen Rahmenbedingungen und Kriterien für die Durchführung von Frühförderung gibt, bewirkt auf der einen Seite, dass jede Organisation ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit betreibt und ihre eigenen Konzepte und Kriterien erstellt, andererseits aber auch, dass betroffene Familien und Menschen dadurch wiederum vereinzelt werden und kein gesamtgesellschaftliches Interesse an der Schaffung von verbesserten Bedingungen für ihre Situation erleben.
Frühförderung basiert in Österreich auf der gesetzlichen Grundlage des Bundesbehindertengesetzes vom 1.7.1990, das Behinderung gesetzlich definiert. Die Behindertenhilfe und die Rehabilitation ist aber Aufgabe der Bundesländer und liegt somit in deren Zuständigkeit. Die Durchführung von Frühförderung ist demnach länderspezifisch sehr heterogen.
"Organisiert ist Frühförderung in Österreich über ungefähr 88 Frühförderstellen, die regional sehr unterschiedliche Strukturen bzw. Trägervereine aufweisen" (ebd. S 120).
Die Zuweisungsmodi sind sehr unterschiedlich: In machen Bundesländern ist Frühförderung nur dann möglich, wenn eine eindeutige Diagnose vorliegt und ein langwieriges verwaltungstechnisches Verfahren durchlaufen wird, in anderen gestaltet sich der Zugang niederschwellig und recht unbürokratisch.
Es existieren sowohl ambulante als auch mobile Formen der Frühförderung, es wird nach kindzentrierten, eher funktionsspezifischen oder interaktionistischen Ansätzen gearbeitet, wobei die theoretische Grundlage der Frühförderung oft mehr von den Grundberufen der Frühförderinnen (Kindergärtnerin, Sonderkindergärtnerin, Interdisziplinäre Frühförderin, Pädagogin, Psychologin, Therapeutin, Sozialarbeiterin, Behindertenfachbetreuerin etc.) abzuhängen scheint als von einem gemeinsamen Ansatz.
Hauptberufliche Frühförderinnen betreuen ca. 10-12 Kinder wöchentlich, nehmen oft weite Fahrstrecken und eine hohe physische wie auch psychische Belastung auf sich und müssen über große Flexibilität verfügen.
"Organisatorisch bedeutet dies, dass FrühförderInnen einmal wöchentlich 90 Minuten Fördereinheiten in den Familien durchführen, und zwar durch
-
theoriegeleitete kindzentrierte Entwicklungsförderung (Angebot von geeignetem Spielmaterial, Förderung der Kommunikationsbereitschaft, stufenweisen Spielaufbau unter Berücksichtigung der kindlichen Denkvorgänge, Motivationen und sozialen Einstellung)
-
Unterstützung der Eltern (Elterngespräche, Information, Begleitung der Eltern im Coping mit der Behinderung, Erziehungsberatung u.a.)
-
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Informationstreffen und Koordination therapeutischer Interventionen mit anderen Fachleuten).
Die Förderarbeit in der Familie wird durch obligate Vor- und Nachbereitungen und Supervision begleitet" (ebd. S 122).
Frühförderung wird in Tirol vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Sozial- und Behindertenhilfe, auf der Basis vorliegender ärztlicher und entwicklungspsychologischer Gutachten meist für ein Jahr genehmigt und endet mit dem Eintritt des Kindes in einen Integrationskindergarten oder in die Schule.
"Die Arbeit der FrühförderInnen wird im Wohnbereich der Familien geleistet, wobei den ExpertInnen der schützende Rahmen einer Institution fehlt und sie somit einerseits über hohe persönliche und fachliche Ressourcen in den jeweiligen - teils krisenhaften - Situationen verfügen müssen. Durch das Hineingehen in das Familiensystem wird das ganzheitliche Erfassen von Problemsituationen erforderlich. Dieses partnerschaftliche Verständnis der Arbeit erfordert Dialogbereitschaft und die Fähigkeit zur Führung von helfenden Gesprächen, aber auch das Erkennen eigener Grenzen und die Fähigkeit, im interdisziplinären Team (behandelnde Fachärzte, Therapeuten, Psychologen u.a.) Unterstützung zu organisieren.
Gleichzeitig scheinen die FrühförderInnen unterschiedlichen Rollenerwartungen (gute Fee, Retterin, Spieltante, Klagemauer, Eindringling, Therapeutin, Fachfrau) ausgesetzt zu sein, die es in einem permanenten Selbstreflexionsprozess zu thematisieren gilt. Der Umgang mit jungen Säuglingen, mit besonders schweren Behinderungsformen, mit Trauer und Leid, mit Problemfamilien u.a. erfordert eine intensive Vorbereitung und die Kenntnis angemessener Vorgangsweisen" (ebd. S 123).
In allen weiteren Überlegungen zur Familienbegleitung in der Frühförderung beziehe ich mich ausschließlich auf die mobile Frühförderung in Form von Hausbesuchen, da meine eigenen Erfahrungen aus diesem Bereich stammen.
Inhaltsverzeichnis
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 ‚Sonderfamilie', ‚Behinderte Familie' oder ‚Gehinderte Familie'? - Zur Situation der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind in der Gesellschaft
- 3.3 Familie in der Krise: Wie die Diagnose Behinderung das Leben einer Familie verändert
- 3.4 Entwicklung unter erschwerten Bedingungen: Das Leben des von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes in seiner Familie
- 3.5 Das Leben mit einem Kind mit Behinderung: Der Prozess der Auseinandersetzung in der Familie
In diesem Kapitel möchte ich mich mit der Situation beschäftigen, in der sich eine Familie befindet, deren Kind sich nicht erwartungsgemäß entwickelt oder bereits die Diagnose einer Entwicklungsauffälligkeit oder Behinderung erhalten hat. Zu diesem Thema existieren zahlreiche Publikationen und es mag so aussehen, als wäre bereits so viel über die Situation der Eltern behinderter Kinder bekannt, dass man diesen Teil der Arbeitsbeziehung zwischen Frühförderin, Kind und Familie getrost vernachlässigen könnte. So behandelt etwa Thurmair dieses Thema in seinem Buch "Praxis der Frühförderung" auf lediglich drei Seiten, während es in anderen Praxisbüchern zur Frühförderung als eigenständiges Thema gänzlich fehlt. (vgl. Thurmair/Naggl 2000, S 112-114; Leyendecker/Horstmann 2002)
Ich persönlich bin der Auffassung, dass sich Spannungsfelder in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Frühförderin nur dann wirklich verstehen lassen, wenn man sich die Situation, in der Eltern beim Eintritt in den Prozess der Frühförderung stehen, ganz deutlich vor Augen führt und sie nicht nur betrachtet, sondern sich auch in sie hineinzufühlen versucht. Es geht mir um die Wahrnehmung der Lebenswelt der Eltern und der Kinder als Partner der Frühförderin in ihrem Arbeitsprozess und um die daraus resultierenden Folgerungen für die Gestaltung einer familienbegleitenden Frühförderung. "Das Verstehen der Eltern, der Kinder und deren Kompetenzen sind die Grundlage für eine Frühförderarbeit, die alle beteiligten Menschen einbezieht. Dabei kommt der Analyse der Lebensgeschichte des Kindes in Verschränkung mit den jeweiligen Bedingungen, unter denen das Kind und die Familie leben, besondere Bedeutung zu" (Ziemen in Theunissen/Plaute 1995, S 87).
"Die richtige Unterstützung der Eltern setzt ein ganzheitliches Verständnis ihrer Situation voraus" (Hinze 1993, S 211).
Ich möchte den Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen persönlicher, sozialer und ökonomischer Art genauer nachgehen, mit denen sich Eltern konfrontiert sehen, wenn ihr Kind von der Diagnose "Behinderung" bedroht oder bereits betroffen ist.
Der Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung oder Entwicklungsstörung des Kindes begleitet und beeinflusst den Prozess der Frühförderung maßgeblich, so wie umgekehrt auch der Frühförderprozess auf den Verarbeitungsprozess der Eltern einwirken kann. Nur wenn ich als Frühförderin einschätzen kann, wie dieser Prozess der Auseinandersetzung die Eltern beschäftigt, kann ich ihr Verhalten, ihre Anliegen und ihre Äußerungen wirklich verstehen und adäquat darauf eingehen.
In meiner Arbeit möchte ich mich vorwiegend mit den Bedingungen und Voraussetzungen beschäftigen, die auf Seiten der Eltern und auf Seiten der Frühförderin auf die gemeinsame Zusammenarbeit einwirken und sie mitbestimmen können.
Auf der Seite der Eltern sehe ich Bedingungen und Voraussetzungen vor allem in ihrer krisenhaften Situation und der damit verbundenen Aufgabe, mit der Behinderung ihres Kindes umgehen zu lernen, die Behinderung in das Leben und Wertesystem der Familie zu integrieren und damit auch dem Kind Raum für seine Entwicklung zu geben.
Die Art des Umgangs mit der Behinderung des Kindes in der Familie bestimmt wesentlich die Vorstellungen der Eltern von den Möglichkeiten der Frühförderung, ihre Anforderungen und Erwartungen an die Förderung des Kindes, ihre Teilnahme am Förderprozess und die Art der Interaktion mit der Frühförderin. Je nachdem, welche Rolle die Behinderung des Kindes in der Familie spielt, erhält auch die Frühförderin eine bestimmte Rolle, Aufgabe oder Funktion von der Familie zugewiesen - und es ist für die Frühförderin wichtig, diese zu erkennen und darüber zu reflektieren, um sich schließlich unabhängig davon positionieren zu können.
Neben der Art und Weise, wie sich die Eltern mit der Behinderung des Kindes auseinandersetzen, spielt es für den Frühförderprozess eine gleichermaßen wichtige Rolle, wie es der Frühförderin gelingt, sich dem Thema der Behinderung zu nähern. Der damit verbundene notwendige Trauerprozess auch auf der Seite der Frühförderin stellt eine wichtige Voraussetzung für die Auflösung ihrer eigenen Angst-Abwehrtendenzen und in der Folge für ihre pädagogische Handlungsfähigkeit dar. (vgl. Schönwiese 1994, S 6)
Um die oft prekäre Situation der Eltern behinderter Kinder und die daraus resultierenden Aufgaben einer Familienbegleitung in der Frühförderung verstehen zu können, werde ich mich in diesem Teil meiner Ausführungen auch bemühen, die Interaktion zwischen Eltern und Kind in ihrem frühen Stadium aus psychoanalytischer Sicht darzustellen. Gerade neuere psychoanalytische Theorien erscheinen mir hier besonders geeignet, um die schwierigen Ausgangsbedingungen für eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion im Falle einer Behinderung des Kindes aufzuzeigen. Ich werde auch die Wechselbeziehung zwischen elterlichen Erwartungen an das Kind und tatsächlicher kindlicher Entwicklung und in der Folge die Formation der Behinderung in einem soziokulturellen Kontext in die Überlegungen miteinzubeziehen. Die genauere Beleuchtung der frühen Eltern-Kind-Interaktion erscheint mir in diesem Zusammenhang wichtig, da die Frühförderin eine bestimmte, oft bereits verfestigte Form der Interaktion zwischen Eltern und behindertem Kind vorfindet und sie durch ihre Arbeit dazu beitragen kann, eine "entgleisende Interaktion" (Niedecken 1998, S 89) wieder in eine für Eltern und Kind befriedigende Bahn zu lenken. Da in den letzten Jahren mit dem zur Förderung des behinderten Kindes hinzugekommenen Schwerpunktes der Familienbegleitung in der Frühförderung sich der Blick der Frühförderinnen immer mehr auch auf die Interaktion zwischen Mutter bzw. Eltern und Kind gerichtet hat, sehe ich es auch als notwendig an, sich als Frühförderin mit den Grundlagen dieser frühen Begegnungen zwischen primären Bezugspersonen und dem Kind auseinanderzusetzen.
Die Frühförderin ist auch jene Person, die neben dem Vater oft schon sehr früh zur Mutter-Kind-Dyade hinzustößt und mit der Art ihrer Angebote und Interventionen darauf Einfluss nehmen kann. Dieses Hinzukommen zur meist noch symbiotischen Beziehung zwischen Mutter und Kind und die Herstellung einer Dreieckskonstellation in der Frühfördereinheit bringt auch die Gefahr von entstehenden Spannungen und Rivalitäten mit sich (vgl. Weiß 1989, S 12).
Solche Entstehungspunkte von Spannungen und Missverständnissen im Förderprozess möchte ich in meiner Arbeit aufdecken und näher beleuchten, weshalb es mir sehr wichtig erscheint, den Weg näher zu beschreiben, der Eltern zur Frühförderung führt und der die Vorgeschichte eines zustande kommenden Arbeitsverhältnisses darstellt.
Dabei möchte ich mich an dem Grundsatz von Fröhlich & Göppel (1992) orientieren, der im Titel ihres Buches sichtbar wird: "Sehen - Einfühlen - Verstehen". Das bedeutet auch, dass es mir vor allem um eine umfassende Darstellung der emotionalen und sozialen Situation geht, in der sich Eltern und Kind im Falle einer Entwicklungsstörung oder Behinderung befinden.
Die Frage lautet demnach: Wer sind sie, die Eltern als Partner der Frühförderin im Förderprozess, welche Ängste und Hoffnungen bestimmen ihr Handeln und Denken, welche Erwartungen tragen sie an die Frühförderin heran, welche Erfahrungen mit Fachleuten und verschiedenen Formen der Hilfe haben sie bereits gemacht, was haben sie alles erduldet und ausgestanden bzw. welche Auseinandersetzungsprozesse der Eltern begleiten die Arbeit in der Frühförderung?
Wenn Eltern als Partner in der Frühförderung angesehen werden, bedeutet das für mich auch, sie in ihrer spezifischen Situation anzuerkennen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu kennen und miteinzubeziehen, ihnen echtes Verständnis und Mitgefühl entgegenzubringen.
Den Wünschen und Bedürfnissen der Eltern, die sich aus ihrer Position und Situation ergeben, möchte ich im Folgenden ebenso nachgehen wie ersten Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen einer Familienbegleitung in der Frühförderung.
Und ich hoffe, dass ich damit dem Wunsch näher komme, den eine Arbeitsgruppe von betroffenen Eltern für das Symposium "Familienorientierte Frühförderung" 1991 in Tübingen formulierte: dass es "gelingen möge, in der Zusammenarbeit miteinander und in der Planung dafür ein Stück weit ‚vom Anderen her zu denken'" (Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 62).
Die Familie ist der Ort, an dem ein Kind erste und grundlegende Erfahrungen mit seiner räumlichen und personalen Umwelt sammelt, wodurch seine Persönlichkeit tiefgreifend geformt und geprägt wird. Die Art der Einbindung des Kindes in seine Familie und der Rahmen, den die Familie für die Handlungen des Kindes absteckt, sind entscheidend für die Möglichkeiten seiner Persönlichkeitsentfaltung und seiner Mitgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Familie. Die Familie als Lebenswelt des Kindes hat demnach eine entscheidende Bedeutung für seine Entwicklung.
Aus soziologischer Sicht ist die Familie "ein Verband von Individuen, der durch Zusammenleben charakterisiert ist ebenso wie durch die Übernahme von Reproduktions- und Sozialisationsfunktionen und durch ein Kooperations- und Solidaritätsverhältnis, das die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander ausdrückt" (Bourdieu 1998, zitiert in Ziemen 2002, S 149). Ziemen nimmt weiteren Bezug darauf und betrachtet die innere Zusammensetzung der Familie näher: "Die Familie ist durch die Persönlichkeit der Eltern, die Beziehung zwischen Eltern - Kind bzw. Kind - Kind geprägt und gekennzeichnet. Jede ‚Familie' wird zum einen bestimmt durch ihre innere Struktur, wie die Anzahl der Mitglieder, die Zusammensetzung, die Persönlichkeit der Mitglieder, deren Beziehungen und Interaktionen untereinander und zum anderen durch die spezifische Art und Weise, auf die Anforderungen, die gesellschaftlichen Normen, Werte, Regeln zu ‚antworten'" (Ziemen 2002, S 150).
Hier klingt bereits das gesellschaftliche Verhältnis an, in dem jede Familie steht. Aus systemischer Sicht handelt es sich bei der Familie demnach um ein System, das in Wechselbeziehung steht zu dem größeren System der Gesellschaft, in die es eingebettet ist. Andererseits stellt jedes Familienmitglied für sich wiederum ein eigenständiges System dar, das in Entwicklung begriffen ist und in wechselseitiger Abhängigkeit von seiner physischen und sozialen Umwelt steht. Alles, was für die Familie Bedeutung hat, hat auch Bedeutung für das einzelne Mitglied; was das einzelne Familienmitglied betrifft, kann für die ganze Familie Bedeutung erlangen und sie beeinflussen - wie etwa auch die Behinderung eines Familienmitgliedes. (vgl. Kriegl 1993, S 10f)
Jetter bezeichnet die Familie als Schnittstelle zwischen der Sicht der "Ganzheitlichkeit des Individuums" und dem "Sozialen Ganzen" von Gemeinde, Staat, Gesellschaftsform und Weltgemeinschaft (Jetter in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 7), sieht sie als Produzenten und Lieferanten von dem Staate zugute kommenden eigenverantwortlichen Bürgern an und stellt fest, dass die Familie im Laufe der Zeit immer mehr staatliche Funktionen übernommen hat.
Die Erwartungen von staatlicher Seite an die Erziehung und Sozialisation der Kinder innerhalb der Familie sind sehr hoch - vor allem, nachdem diese Aufgaben nicht mehr von einer Großfamilie, sondern von der heute gängigen Form der sogenannten Kleinfamilie geleistet werden müssen, und das in einer Zeit der schwindenden Traditionen, pluralistischen Wertesysteme, zunehmenden Flexibilisierung, Individualisierung und der steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Individuen.
Speck (2001) stellt fest, dass sich die Lebenswelt für Kinder und Eltern im letzten Jahrhundert grundlegend geändert hat, wobei diese Veränderungen hauptsächlich die Werte-Orientierungen, die familiären Strukturen und die Erziehung betreffen. Er ortet eine generelle Abnahme der Quantität und Qualität der Kontakte zwischen Eltern und Kindern, eine Zunahme von alleinerziehenden Elternteilen und von neu zusammengesetzten Familienformen, die man mit dem Begriff "Patchworkfamilie" umschreiben kann. Daneben beobachtet er ein "Verschwinden der Väter", das er gerade für Familien mit behinderten Kindern folgenschwer einschätzt (Speck 2001, S 147). In unserer Gesellschaft hochstehende Werte wie Individualismus und Selbstverwirklichung haben nach Speck zur Folge, dass sich die Bedeutung der Kinder für die Eltern maßgeblich verändert hat. Es zeige sich ein weniger familienorientierter Elterntyp, der für seine Kinder nicht auf eine bestimmte Lebensgestaltung verzichten wolle. Das Streben nach Wohlstand bestimme häufig stark das Handeln der Eltern und nehme ihre Energie so in Anspruch, dass oft nur mehr wenig Zeit für das Kind übrigbleibe. Gleichzeitig sieht Speck ein Ansteigen der Anforderungen an das ideale, perfekte, leistungsfähige Kind und einen damit verbundenen Leistungsdruck, der vor allem leistungsschwache Kinder benachteiligt und ihre Chancen auf eine erfolgreiche Lebensführung gefährdet. Neben einer generellen Unsicherheit der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder stellt Speck vor allem Schwächen der Eltern in der ethischen und moralischen Erziehung fest. "In einer normativ pluralen Umwelt ist eine Werteorientierung erschwert" (ebd. S 149). Auch wenn man Speck vorwerfen kann, dass er in seinen Ausführungen zur Frühförderung mit den Eltern (vgl. Speck 1983) sehr normative Ansichten zu Elternschaft und ihren Aufgaben vertritt, muss ich ihm aus meiner Sicht an dieser Stelle Recht geben. Da es kaum mehr tradierte, vorgegebene Erziehungsformen gibt, muss jedes Elternpaar für sich einen eigenen Weg finden, um die Aufgaben der Familie hinsichtlich der Sozialisation und der Vermittlung von Werten und Normen, von lebenspraktischen Fähigkeiten, von Interaktions- und Kommunikationsformen und Regeln der Gesellschaft erfüllen zu können.
Wenn demnach die Bedingungen für eine dem Kind gerecht werdende und es auf die Ansprüche der heutigen Lebenswelt vorbereitende Erziehung schon für "normale" Familien so schwierig und vielschichtig sind, um wie viel schwieriger gestaltet sich diese Aufgabe dann erst für Eltern eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes?
Ein behindertes Kind zu bekommen ist ein Umstand, den kaum jemand bewusst in seine Lebensplanung mit einbezieht. Ein behindertes Kind zu bekommen, ist anormal, generell unerwünscht und entspricht nicht den Vorstellungen der sozialen Umwelt und der Gesellschaft.
"In unserer Gesellschaft, in der die Mittelschichtfamilie den Leistungsnormen und der horizontalen Mobilität mit der Forderung zur ständigen Anpassung an andere Bedingungen genügen muß, ist sie darauf angewiesen, daß jedes Mitglied leistungsfähig ist. Durch die Behinderung des Kindes wird die Familie in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt" (Horstmann 1990, S 14). Das Kind und damit auch seine Familie entsprechen nicht der Norm, es werden ihnen Vorurteile und negative Einstellungen entgegengebracht und sie laufen Gefahr, zu Außenseitern der Gesellschaft zu werden. Die Sozialbeziehungen leiden, und es fehlen der Familie damit oft die notwendige Unterstützung und das Verständnis der Umwelt, die gerade deswegen so nötig wären, weil die Eltern auf die Erziehung eines Kindes mit Behinderung noch viel weniger vorbereitet sind als Eltern generell. (vgl. Hinze, 1993, S 10 ff)
Kriegl sieht durch die Behinderung des Kindes eine Vielzahl von Problemen und Schwierigkeiten auf eine relativ isolierte Kleinfamilie zukommen: Die einzelnen Familienmitglieder sind aufgrund der fehlenden Ausweichmöglichkeiten hohen Belastungen ausgesetzt, durch die Verinstitutionalisierung von sozialen Hilfen kann die Familie von der öffentlichen Hilfe abhängig werden, es kann zu einer Verstärkung der traditionellen Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau mit vermehrter Bindung der Frau an den innerfamiliären Bereich kommen, die Familie ist weniger flexibel und mobil als von der Gesellschaft erwartet, und die Erreichung heutiger Ziele wie Selbstverwirklichung und Emanzipation muss meist zurückgestellt werden. (vgl. Kriegl 1993, S 12/13)
Behringer sieht in der heutigen Gesellschaft eine Tendenz, jeden einzelnen selber für sein Glück und damit auch für seine Gesundheit verantwortlich zu machen und zitiert in diesem Zusammenhang Kaufmann (1984) mit dem Begriff der "verantworteten Elternschaft" (Behringer 2001, S 160).
Die Verantwortung für eine umfassende Förderung des Kindes und die Bereitstellung von optimalen Entwicklungsbedingungen liegt demnach bei den Eltern, die gerade, wenn es sich bei ihrem Kind um ein Kind mit Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit handelt, in ein Spannungsfeld von großen gesellschaftlichen Erwartungen und spürbarem Leistungsdruck kommen. Dieses Spannungsfeld ist neben Versagensängsten und Schuldgefühlen gegenüber dem Kind und der Gesellschaft auch geprägt von der Hoffnung auf Normalisierung ihres Kindes und ihrer Lebenssituation durch Therapie und Förderung.
Fortschritte der Medizin und Technik und unzählige therapeutische Angebote lassen das Gefühl entstehen, dass Behinderung und Entwicklungsdefizite heilbar sind, wenn man nur genug für eine Besserung unternimmt. Das "Gelingen des Produktes Kind" wird so zur persönlichen Aufgabe der Eltern, die sich über jede Möglichkeit der medizinischen, therapeutischen und institutionalisierten Hilfe genau informieren müssen, um die für das Kind und die Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt passende Entscheidung treffen zu können. (vgl. ebd. S 161)
Diese Aufgabe der Informationssuche beginnt für die Eltern durch die gängige Handhabung der Methoden der Pränataldiagnostik zu einem immer früheren Zeitpunkt. Angesichts des heute üblichen vorgeburtlichen "Screenings" können Eltern in die prekäre Situation kommen, über den Wert oder Unwert des Lebens ihres ungeborenen Kindes entscheiden zu müssen, während von der Gesellschaft her der Auftrag kommt, nur leistungsfähige, für die Gesellschaft auch produktive Kinder zur Welt zu bringen. Behringer zitiert an dieser Stelle den Philosophen Martin Sass, der risikoreiche Fortpflanzungsentscheidungen als "unverantwortlich der Gesellschaft gegenüber [bezeichnet, C. K.-S.], die einen so schwer Benachteiligten in die Solidargemeinschaft aufnimmt" ( Sass in Behringer 2001, S 161).
Durch die Pränataldiagnostik ist man scheinbar dem Schicksal nicht mehr ausgeliefert - man muss es nicht mehr annehmen, man kann sich auch verweigern. Angesichts des großen Unsicherheitsfaktors pränataldiagnostischer Maßnahmen möchte ich diese Annahme an dieser Stelle aber sehr in Frage stellen. Für Danielowski (in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 24-38) kann das Ergebnis vorgeburtlicher Untersuchung Eltern in unlösbare Konflikte stürzen. Es wird eine gesellschaftliche Entscheidung - nämlich die, behindertes Leben als unwert anzusehen und zu eliminieren - auf die Eltern und die Mutter im Besonderen abgeschoben. Welch große Schuld dabei mittransportiert wird, ist kaum vorstellbar. In einem von Eltern behinderter Kinder für ein Frühfördersymposium formulierten Thesenpapier kommt diese bitter empfundene Schuldzuweisung in einem sarkastischen Statement zum Ausdruck: "Kinder sind heute ein Luxusartikel und ein individuelles Risiko, für das jeder selbst verantwortlich ist. Eltern behinderter Kinder haben diese Situation mutwillig herbeigeführt und müssen die Konsequenzen daraus auch alleine bewältigen" (Behringer 2001, S 162).
Danielowski sieht in der Pränataldiagnostik eine Verstärkung der phobischen Angst vor der Behinderung in der Gesellschaft. Behinderung wird zur Bedrohung, die Schwangerschaft an sich gerät vom "Guter-Hoffnung-Sein" zum Gesundheitsrisiko.
"Sie [die Behinderung, C.K.-S.] durchkreuzt die eigenen Pläne - und zwar deswegen, weil alle unsere Pläne ausnahmslos auf Gesundheit und Unversehrtheit aufbauen; diese Lebensqualität ist bedroht" (Danielowski in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 30). Behinderung wird so zum rein biologischen Phänomen, die soziale Dimension der Formation von Behinderung wird ausgeklammert. Der Defekt bestimmt die Sicht von Behinderung als mit allen Mitteln zu vermeidende Katastrophe - im Gegensatz zu einer Sicht von Behinderung als mögliche Variante genetischer Vielfalt.
"Die angstbesetzte Fixierung auf Gesundheit und Unversehrtheit erschwert Menschen mit Behinderung die Selbstakzeptanz; sie verursacht Risse in der persönlichen Identität; und sie erschwert Eltern den sowieso schmerzlichen Prozess der Annahme ihres behinderten Kindes. Die Stigmatisierung hindert uns alle daran, den positiven Sinn, die Gestaltungsmöglichkeiten, die Würde eines Lebens mit Behinderung zu erschließen" (ebd. S 31). Danielowski spricht sich gegen eine Infragestellung des Lebensrechtes behinderter Menschen aus und fordert eine Stärkung der vorhandenen sozialen Netze und der praktischen Solidarität. Er sieht in der Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung eine große Chance, gegenseitige Grenzen, Stärken und die Würde des jeweils anderen wahrzunehmen. Die Akzeptanz der natürlichen Grenzen des Lebens hält er für unersetzbar, und er sieht in der Auseinandersetzung mit dem, was uns Angst macht (Behinderung, Tod, Krankheit, Alter) einen Weg zur Neuordnung unserer Grundwerte.
Eine ähnliche Meinung vertritt Jonas, wenn sie von der Notwendigkeit der sozialen Trauer spricht, die zur Folge habe, "Menschen mit Behinderung real wahrzunehmen und ihre Unterschiedlichkeit anzuerkennen und dies ins gesellschaftliche Bewußtsein zu integrieren" (Jonas 1992, S 104).
Zu den oben erwähnten Begriffen der Unversehrtheit und Gesundheit möchte ich gerne noch festhalten, dass wir uns als Menschen zwar auf sie hin orientieren können, sie aber weder planbar noch machbar sind. Das gehört zur Eigenart menschlichen Lebens, dass wir es eben nicht völlig in der Hand haben, dass Ereignisse unvorhergesehener Art immer und jederzeit unser Leben durchkreuzen können, dass das Leben Begrenzungen - Behinderungen im weitesten Sinn - bereithält und wir uns ihnen nicht entziehen können, auch wenn wir das vielleicht gerne glauben möchten.
Liegt gerade darin die große Angst der Menschen vor der offensichtlichen Behinderung eines anderen Menschen? Weil durch sie etwas sichtbar wird, was wir lieber verdrängen möchten? Dieser Frage werde ich nun im Folgenden nachgehen und dabei mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig erscheinende Autoren, darunter vor allem Dietmut Niedecken, miteinbeziehen. Dazu wird es zunächst nötig sein, sich dem Begriff der "Behinderung" aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern.
Eine der bekanntesten Definitionen von Behinderung stellt wohl die Einteilung der WHO in "Impairment" (Schädigung), "Disability" (Behinderung) und "Handicap" (Benachteiligung) dar. Dabei sind mit "Schädigung" die organische, medizinisch feststellbare Abweichung, mit "Behinderung" die Bedeutung dieser Schädigung für den jeweiligen Menschen und mit "Benachteiligung" die sozialen Folgen der Schädigung und Behinderung gemeint (vgl. Cloerkes 1997). Diese Definition impliziert zwar schon die Auffassung, dass eine Behinderung sich erst über ihre soziale Bedeutung formiert, aber die Darstellung vermittelt einen vermeintlich linearen Ablauf dieser Entwicklung. Tatsächlich aber wirkt schon bei der Feststellung einer organischen Schädigung die gesellschaftliche Auffassung von dem, was nicht der Norm entspricht, mit ein. Behinderung hat demnach von Anfang an eine soziale Dimension, die dafür verantwortlich ist, wie sie sich schlussendlich zeigt. Elbert spricht in diesem Zusammenhang von der "Formierung" von Behinderung bzw. von "Formierungsprozessen" (vgl. Elbert 1982).
"Die Konstitution von Behinderung ist nicht durch alltägliche Wahrnehmungen, nicht durch eine medizinische Defektologie erklärbar, sondern kann als Folge von Einigungsprozessen, an denen eine größere Anzahl von Personen und Institutionen aufgrund eines historisch entstandenen Wissens beteiligt sind, verstanden werden. Es ist ein Akt einer Verständigung, was wir unter Behinderung verstehen" (Schönwiese 1995, S 1).
Behinderung wird heute systemisch im weitesten Sinn verstanden, was meint, dass sie sich innerhalb der vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen dem Individuum und seinem engeren und weiteren Kontext, also zwischen dem behinderten Kind und seiner Lebenswelt, erst zu dem entwickelt, als was sie später erscheint. (vgl. ebd. S 5)
"Be-Hinderung ist letztlich nur Ausdruck dessen, was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen und durch vorurteilsbelastete Vorenthaltungen an Inhalten und sozialen Bezügen nicht lernen durfte und Ausdruck unserer Art und Weise, mit ihm umzugehen" (Feuser 1994, S 4).
Behinderung hat immer etwas mit "Behindert-Werden", mit Hinderung und Hindernisssen und damit zu tun, wie wir als Gesellschaft sie bewerten und mit ihr umgehen. Eine Schwäche wird erst dann zur Behinderung, wenn ein Gegenüber sie dem betroffenen Menschen mit seiner Reaktion auf ihn kontinuierlich vermittelt, wenn die Schwäche immer wieder zum Grund für Abwertung und Ablehnung in der sozialen Umwelt wird und der Betroffene keine adäquate Unterstützung erhält, die ihm einerseits Autonomie und Handlungsfähigkeit, andererseits aber auch Selbstachtung und die Integration seiner Schwächen in seine Gesamtpersönlichkeit und nicht zuletzt eine vollwertige Einbindung in die soziale Gemeinschaft ermöglicht.
Wie sich die Formierung einer Behinderung vollziehen kann, möchte ich gerne am Beispiel der geistigen Behinderung genauer verfolgen. Das hat seinen Grund auch darin, dass in der Frühförderung allgemein ein Anstieg der Zahl der zu betreuenden Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten feststellbar ist und ich der Meinung bin, dass es hier Gemeinsamkeiten und Parallelitäten zur Formierung der geistig behinderten Entwicklung gibt.
Nach Johannes Elbert wird die geistige Behinderung wie alle Behinderungen, Störungen, Defekte usw. als ein von der Norm abweichender Zustand diagnostiziert. Was als Norm gilt, wird von verschiedenen Fachdisziplinen und ihren Experten festgelegt, ebenso die Liste der Verhaltensweisen, die demnach als abweichend gelten.
Einerseits nimmt man so als "Normaler" Distanz davon, andererseits werden behinderte Menschen in der Folge von rehabilitierenden Institutionen vereinnahmt mit der Intention, sie dem Normalzustand anzugleichen.
Geistige Behinderung wird vor allem als Intelligenzmangel, als Mangelzustand überhaupt angesehen, was angesichts der großen Bedeutung von Intelligenz in unserer Gesellschaft fatale Auswirkungen hat. Die Suche nach den Ursachen konzentriert sich dabei auf das Individuum und endet meist bei der Feststellung eines nicht behebbaren hirnorganischen Defekts. Dadurch wird der betroffene Mensch leicht als rein organisches Wesen betrachtet, was ihn zum Objekt der Wissenschaft macht und ihn in den Machtbereich der "wissenden" Experten bringt. Dabei gäbe es viele andere Wege der Annäherung an das Phänomen, etwa indem man hinter den Symptomen nach psychischen Ursachen, nach einer behindernden Geschichte des Menschen sucht.
"Die geschaffene soziale Wirklichkeit, die Erscheinungsform ‚Geistige Behinderung' wird als natürlich, als ‚Behinderung an und für sich' begriffen und erlebt" (Elbert 1982, S 74). Elbert sieht das Problem an der gängigen Sichtweise der geistigen Behinderung darin, dass sie als naturgegeben, als Wesen des betroffenen Menschen und nicht als Prozess des Zusammenwirkens von biologischen, personalen und sozialen, gesellschaftlichen Faktoren gesehen wird.
Wichtig wäre für Elbert vor allem die Frage, warum und wozu ein Mensch sich geistig behindert verhält. Das würde unterstellen, dass das Verhalten des Kindes eine Bedeutung, einen Sinn hat und dass "nur das Kind den Sinn und die Funktion seines Verhaltens zusammen mit einem Anderen entschlüsseln könnte" (ebd. S 74). Eine solche Sichtweise setzt aber eine große Bereitschaft voraus, sich auf das Kind einzulassen und sich ganz in es einzufühlen, was sowohl für Eltern als auch für Betreuungspersonen bedeutet, sich mit ihren eigenen Ängsten und Abgrenzungsmechanismen zu konfrontieren und auseinander zu setzen.
Wie so eine Auseinandersetzung auf der Expertenseite aussehen kann, hat Dietmut Niedecken in ihrem Buch "Namenlos" (1998) beeindruckend gezeigt. Am Beginn ihrer Darstellungen beschreibt Niedecken, wie sie in manchen ihrer eigenen Gedanken zu geistig behinderten Menschen bei genauerem Hinsehen Tötungswünsche erkennen konnte, etwa als sie sich für einen geistig behinderten Menschen wünschte, dass er doch ins Paradies heimgehen könnte. Wenn ich meine anfänglichen Erfahrungen mit schwer und mehrfach behinderten Menschen in einem großen Heim nachträglich betrachte, fällt auch mir auf, wie sehr ich es damals - und zum Teil auch heute noch - als Erlösung angesehen habe, wenn ein "solches" Kind sterben konnte. Wie schnell ist man dabei, dann davon zu sprechen, was dem Kind - und vor allem auch seinen engsten Bezugspersonen - erspart geblieben ist, dass es ihm so ja viel besser ergangen sei. Es ist schmerzlich, anerkennen zu müssen, dass hinter solch frommen Wünschen wirklich Todeswünsche stehen und dass sie eigentlich in uns allen mehr oder weniger unbewusst da sind.
Diese Erkenntnis und die Beschreibung ihrer fatalen Auswirkungen verdanken wir Niedecken. Ich möchte ihre Theorien insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für ein besseres Verständnis für die in der Frühförderung ablaufenden Prozesse und die Interaktionen zwischen Frühförderin, Eltern und Kind immer wieder in meine Ausführungen einfließen lassen und auch eigene Überlegungen und Beispiele aus meiner Arbeit einfügen, wo sie mir sinnvoll erscheinen.
Eine der zentralen Auffassungen Niedeckens ist wohl die des "Geistigbehindertseins" als Institution. Nach Niedecken setzt sich diese "Institution Geistigbehindertsein" in der institutionellen Gegenübertragung auf all die Gefühle durch, die behinderte Menschen in uns - in der Gesellschaft - auslösen, vor allem in der Reaktion auf die Tötungsphantasien, die massiv abgewehrt werden müssen, damit sie im Unbewussten verborgen bleiben.
Das, was uns geistig behinderte Menschen in ihrem So-Sein vor Augen führen, macht uns große Angst: ihre Abhängigkeit, ihr ohnmächtiges Ausgeliefertsein, ihr Angewiesensein auf Hilfe und ganz besonders ihr "Existieren außerhalb aller Normen" und die damit verbundene fehlende Leistungsfähigkeit im Sinne wirtschaftlicher Kriterien. Ihr oft "kindliches Verhalten" und die darin enthaltene Triebhaftigkeit erinnert uns nach Niedecken sehr an alle Regungen und Wünsche, die wir seit unsere Kindheit abzuwehren gelernt haben. Behinderte Menschen wecken in uns die Sehnsucht danach ebenso wie die große Angst davor, dass wir diese hart erarbeitete Kontrolle verlieren könnten. Also bringen wir uns schnell auf Distanz, betonen die "Andersartigkeit" dieser Menschen und halten sie uns so vom Leib.
"Mit der Abgrenzung einher geht der Versuch, die geistig Behinderten unserem genormten Dasein anzupassen, damit sie uns nicht mehr als Verkörperung des von uns Ersehnten und Unterdrückten einen Spiegel vorhalten und unsere Selbstbeherrschung in Frage stellen" (Niedecken 1998, S 25).
Eine Frau erlebt im ersten Erkennen das Gebären eines behinderten Kindes zumeist als Schuld. Sie sieht es als ihr eigenes Versagen an, kein leistungsfähiges Geschöpf geboren zu haben. Sie erlebt sich als wertlos und nicht fähig, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen; etwas, das doch ganz selbstverständlich von ihr erwartet wird. Das Kind ist nun aber da und seine Existenz zeugt von der Schuld, dem Versagen der Mutter. Aus dieser Sicht kann man verstehen, warum Eltern manchmal auch bewusst "den Impuls haben, ihr Kind zu töten" (ebd. S 22). Dieses Phantasma bestimmt sehr zentral unsere Haltung zu geistig behinderten Menschen: "..es ist die Zuweisung, Abschiebung der ungeheuerlichen Kollektivschuld, des unsäglichen Versagens unseres aufgeklärten Bewußtseins, an einzelne" (ebd. S 22). Demnach empfindet die einzelne Mutter stellvertretend für uns, die Gesellschaft, den Tötungswunsch dem Kind gegenüber. "So gründet also die Institution ‚Geistigbehindertsein' auf der Abschiebung kollektiver Tötungstendenzen auf einzelne" (ebd. S 22).
An dieser Stelle möchte ich gerne Volker Fröhlich zitieren, der in Niedeckens Auffassung des Tötungswunsches als gesellschaftliches Phänomen wiederum eine Abwehrreaktion, quasi ein Abschieben des eigenen Tötungswunsches auf die Anonymität der Gesellschaft zu erkennen glaubt. Für Volker Fröhlich scheint dieses Phantasma des "Tötungsauftrages" "weniger gesellschaftlich verfestigt als vielmehr jeweils individuellen Ursprungs zu sein und vor allem durch eine archaische Angst vor der Bedrohung der eigenen Unversehrtheit bestimmt" (Fröhlich V. 1994, S 173). Obwohl ich der Meinung Niedeckens bin und durchaus ein gesellschaftliches Phantasma vermute, finde ich diese Sichtweise interessant, weil ich glaube, dass die Abwehr dieser Ängste wirklich so stark sein kann, dass die Gefahr besteht, dass Kreisprozesse des gegenseitigen Abwehrens der Angst vor der Behinderung zwischen Individuum und Gesellschaft entstehen können: Indem ich das Phantasma als gesellschaftliches erkläre, bin ich schon wieder in Gefahr, meine eigene Teilhabe daran aus den Augen zu verlieren, und indem ich es als individuelles Phantasma bezeichne, vergesse ich auf seinen mächtigen gesellschaftlichen Aspekt.
Die Abwehr aller negativen, destruktiven Gefühle, die wir angesichts einer Behinderung empfinden, bedingt den gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Kindern und zeigt sich in den medizinischen und therapeutischen Maßnahmen, die im Rahmen der institutionellen Förderung und Erziehung des Kindes ergriffen werden. Ziel der meisten dieser Maßnahmen ist es ja, das behinderte Kind in eine Normalität einzugliedern, die wir selber für erstrebenswert halten. Der Zwang für das Kind, sich daran anzupassen ist sehr groß, denn es spürt instinktiv, welche Gefahr ihm sonst droht. Diese Gefahr sieht Niedecken für das behinderte Kind im Abgeschoben- und Totgeschwiegenwerden. Sie meint, dass behinderte Kinder angesichts unserer zumindest in der Phantasie ausgelebten Tötungswünsche oft ein sehr angepasstes, fröhliches, freundliches, höfliches, geradezu entschuldigendes Verhalten an den Tag legen.
Als die drei Faktoren, die die "Institution Geistigbehindertsein" konstituieren, sieht Niedecken an: die Diagnose, die gesellschaftlichen Phantasmen vom Geistigbehindertsein und die institutionalisierten Techniken der Rehabilitation und Integration.
Durch die Diagnose werden für Niedecken die fortbestehenden gesellschaftlichen Mordtendenzen unbewusst gemacht und auf die Eltern abgeschoben. Gesellschaftliche Phantasmen wiederum sind die Einstellungen zum Geistigbehindertsein, die über die Mutter - als Teil der Gesellschaft - auf das Kind übertragen werden. Was Mannoni als die "mütterlichen Phantasmen" (vgl. Mannoni 1972, S 14) bezeichnet, sind für Niedecken "gesellschaftliche Phantasmen" (vgl. Niedecken 1998, S 22). Durch die Diagnose und die jeweiligen Phantasmen bezüglich der Behinderung nehmen wir demnach das betreffende Kind auf eine ganz bestimmte Weise wahr, wir machen uns ein Bild von ihm. Die Behandlungstechniken, die wir im Anschluss daran ersinnen, passen wiederum in jenes vorgefertigte Bild, festigen und bestätigen es.
Auch Elbert sieht in Diagnose und Prognose Schlüsselstellen für die Formation von geistiger Behinderung. Die Diagnose wird "unter Ausschluß der Öffentlichkeit von einem Experten durchgeführt.[...]Der Experte kennt Krankheitsbilder, denen bestimmte Symptomkombinationen entsprechen. Diese versucht er mit geschultem Blick in dem Objekt wiederzufinden. Die Diagnose ist zu vergleichen mit einem Puzzlespiel, wo passende ‚Symptomteilchen' für die Bestätigung der Hypothese, die durch den Mangel an sozialer Anpassung provoziert wurde, gesucht werden" (Elbert 1982, S 63).
Die anschließende Prognose vermittelt nach außen, was der Betroffene aufgrund der festgestellten Diagnose nicht können wird. So gerät die Diagnose zum Knotenpunkt, der über die weitere Zukunft des Betroffenen entscheidet. Sie durchdringt von nun an alle Lebensbereiche des Kindes: Familie, Therapie und Förderung, Kindergarten, Schule und Kontakte zu Freunden. Die Diagnose kann bei den Eltern zu einer erzieherischen Hilf- und Ratlosigkeit und zu einer defektorientierten Sichtweise und Erziehungshaltung führen, die von Resignation, Pessimismus, Vorurteilen und Ängsten geprägt ist. Das Kind wird oder bleibt ihnen fremd und sie brauchen die Hilfe von Fachleuten, die mit speziellen Methoden, Programmen und Maßnahmen die entstandene Distanz zum Kind zu überbrücken versuchen. Viele solcher Programme orientieren sich an der Leitlinie einer lebenslangen Schutz- und Pflegebedürftigkeit des Kindes und einer damit verbundenen lebenslangen Verantwortung der Eltern. Durch diese Grundannahme können betroffene Eltern, vor allem Mütter, noch weiter in Bedrängnis und unter Druck kommen: durch die Annahme einer permanenten, lebenslang überdauernden Verantwortung für ein Kind, dem abgesprochen wird, jemals erwachsen zu werden. (vgl. ebd. S 63 ff)
Elbert sieht bereits in der Diagnostizierung und Vermittlung einer dazu passenden Prognose Umstände, die das Kind behindern.
Der als behindert diagnostizierte Mensch "wird zum Objekt bestimmter (Wieder)herstellungsmechanismen. Eine positive Veränderung wird nur durch gezielte Eingriffe von außen für möglich gehalten" (ebd. S 65).
Maud Mannoni beschäftigt sich in ihrem aus dem Jahr 1972 stammenden Buch mit den Erkenntnissen aus ihrer eigenen Arbeit mit "zurückgebliebenen", "debilen" oder auch "pseudodebilen" Kindern. Ihr Anliegen war es, das Augenmerk auf die Bedeutung, den Sinn zu richten, den eine Behinderung für das Kind selber und für seine Eltern bekommt. Mannonis Ansicht erscheint mir an dieser Stelle der systemtheoretischen Sichtweise nahe zu kommen, den Patienten als Symptomträger in einem System anzusehen und danach zu fragen, welche Störung im System vorliegt, für die die Symptome des Einzelnen Ausdruck sein können.
Sie spricht dabei von der Mutter und ihrem "zurückgebliebenen" Kind. Das Wort "zurückgeblieben" empfinde ich in diesem Zusammenhang als sehr bezeichnend, da ich glaube, dass ein Kind wirklich "zurückbleiben", aus dem Blickfeld geraten, alleingelassen werden kann: in den Erwartungen, die man an es stellt, aber auch in der Ausbildung seiner eigenen Persönlichkeit, in der Entfaltung seines Selbst. Es bleibt nicht nur hinter den Normen einer durchschnittlichen Entwicklung zurück, sondern auch als eigenständiges Wesen, da ihm Autonomie mit dem Verweis auf die organische Schädigung und der damit unweigerlich verbundenen Annahme der geistigen Behinderung von vorneherein abgesprochen wird. Mannoni hingegen fragt ganz bewusst nach dem verschütteten, "zurückgebliebenen" Wunsch des Kindes.
Bei schwer zurückgebliebenen Kindern und Kindern mit einer offensichtlichen organischen oder genetischen Schädigung wird die Diagnose meist sehr früh, oft bereits unmittelbar nach der Geburt gestellt. Sie werden vielfach von vornherein als unheilbar erklärt, den Eltern wird wenig Hoffnung auf eine Besserung gemacht und manchmal ist die Folge dieser Prognostizierung eine Anstalts- oder Heimunterbringung des Kindes.
Noch während meiner Arbeit in einem großen Heim für schwer und mehrfach behinderte Menschen habe ich es innerhalb eines Jahres zweimal erlebt, dass Eltern ihr Kind wenige Wochen nach der Geburt der Institution übergeben haben, weil sie durch die Aussagen der Ärzte an der Klinik dermaßen verunsichert waren, dass sie sich niemals zugetraut hätten, das Kind mit nach Hause zu nehmen und selber zu versorgen und zu erziehen.
Es gibt aber oft auch die Situation, dass Eltern schon sehr früh ahnen, dass die Entwicklung des Kindes nicht der Norm entsprechend verläuft und sie spüren, dass "mit ihrem Kind etwas nicht stimmt". In diesem Fall folgt nicht selten eine lange Zeit, in der sich die Eltern auf die Suche nach einer Diagnose machen und viele verschiedene Ärzte aufsuchen, um endlich Gewissheit zu erlangen. Die Erwartung an den Arzt besteht darin, dass dieser ihnen entweder sagen soll, was nicht in Ordnung ist und auch gleich ein "Mittel dagegen verschreiben" oder ihnen versichern soll, dass sie sich unnötige Sorgen machen und dem Kind nichts fehle. Mannoni selber entschied sich dafür "nicht zu wissen", wenn Eltern sie mit der Frage nach einer Diagnose konsultiert haben, weil sie der Auffassung war, dass "es immer zu früh [ist; C.K.-S.], ein Leben abzuschreiben" (Mannoni 1972, S 29).
Sie spricht in diesem Zusammenhang auch schon vom "Etikett Debilität", das vom Arzt zugeschrieben wird. Indem sie ihre eigenen Erfahrungen darstellt, schaut sie hinter dieses Etikett, "das zum Ausgangspunkt für die Ausbildung einer Familienangst wurde" (ebd. S 30). "Ich will gerade nicht durch mein Sagen den Patienten zu einem entsprechenden Handeln veranlassen" (ebd. S 31). Das impliziert für mich schon die Annahme, dass man durch das "Sagen" bzw. das Zuschreiben von bestimmten Eigenschaften das Kind erst recht dazu bringt, sich diesen Erwartungen entsprechend zu verhalten und sich in die angenommene Richtung zu entwickeln.
Mannoni glaubt, dass die "Tragödie" eines Kindes "beginnt, wenn die Erwachsenen nicht mehr an es glauben." (ebd. S 107).
"Wie viele Diagnosen sind so als Todesurteil verstanden worden und haben die Beziehung zwischen Eltern und Kind für immer in einem Verhältnis von Überprotektion erstarren lassen, das Schuldbewußtsein erzeugt und die schlimmsten Folgen hat" (ebd. S 107).
Für Mannoni ist es sehr bedeutsam, dass die Eltern die Möglichkeit haben, über ihre Gefühle angesichts der Diagnose zu sprechen, dass sie vom Arzt Hoffnung und Perspektiven vermittelt bekommen und dass sie Menschlichkeit in solchen Gesprächen erfahren können. "Mehr als alles andere brauchen diese Eltern Fürsorge und seelischen Halt" (ebd. S 178).
Die Phantasmen, also Vorstellungen der Eltern von ihrem Kind, können durch die therapeutischen Maßnahmen, die sie ergreifen und durch die Institutionen, die sie dabei in Anspruch nehmen, weiter gefestigt und verstärkt werden, vor allem wenn das Kind dabei hauptsächlich als Pflegeobjekt und nicht als Wesen mit eigenen Intentionen und Wünschen gesehen wird. Mannoni meint, dass die Form der heilpädagogischen Erziehung bzw. Förderung eine Bedeutung in den Phantasien des Kindes einnimmt, "entsprechend der Rolle, die dasselbe Kind in den Phantasmen seiner Eltern hat" (ebd. S 43). Sie spricht hier also im Gegensatz zu Niedecken von den mütterlichen Phantasmen und macht es sich zur Aufgabe, "die unterschiedlichen phantasmatischen Reaktionen der Mutter in ihrer Gesamtheit zu begreifen (ebd. S 14). Hinter dem Verhalten der Eltern und Erzieher dem Kind gegenüber wähnt Mannoni die große Angst "vor dem Abgrund der Triebe, den das Kind darstellt" (ebd. S 44). Ich denke, dass die Kinder diese Angst spüren können und in der Folge noch starrere Verhaltensweisen zeigen. Sie bleiben sozusagen eingesperrt im Käfig der Ängste ihrer Bezugspersonen. "Wenn die Erwachsenen nichts von dem Kind erwarten, wird es seine eigenen Wünsche aufdecken" (ebd. S 44).
Die Umgebung eines Kindes ist nach der Diagnosestellung meist fest davon überzeugt, dass das Kind tatsächlich zurückgeblieben ist und behandelt es auch dementsprechend. Es bekommt so eine bestimmte Rolle zugewiesen - es wird festgelegt auf seine Behinderung.
"Sie haben keine Möglichkeit, ihren eigenen Mangel zu hinterfragen, weil dieser Mangel als ‚Realität' von der Umgebung hingenommen wird" (ebd. S 45). Die Kinder werden als Folge des Mangels eher dazu gebracht, nicht zu leiden oder zu trauern, sondern Automatismen zu lernen, ihre Lücken zu füllen.
Niedecken begründet dies mit der weitverbreiteten Überzeugung, dass "solche Kinder" nur über Konditionierung lernen können bzw. ihnen diese Form des Lernens aufgrund ihrer Zurückgebliebenheit entspricht.
Geistige Behinderung ist für Niedecken das "Produkt eines spezifischen Sozialisationsvorganges zwischen einem Kind mit spezifisch beeinträchtigten körperlichen Voraussetzungen und einer dazu in spezifisch pathogener Weise sich verhaltenden Umwelt" (Niedecken 1998, S 28). Niedecken meint, dass kein Säugling geistig behindert geboren wird, sondern dass sich seine Entwicklung wie die jedes Kindes in der Auseinandersetzung zwischen seinen eigenen Möglichkeiten und Grenzen und seiner Mutter bzw. seiner Umwelt vollzieht.
Mannoni lässt aber auch anklingen, welcher Weg aus dieser dramatischen Situation hinaus führen könnte: "Akzeptiert man seine (des Kindes; C. K.-S.) intellektuellen Grenzen oder seine körperliche Misere, so ist die Möglichkeit des Aufschwungs seiner Kreativität oder eines rettenden Aufstandes nicht ausgeschlossen. Innerhalb der Geschichte, die zu dem persönlichen Drama führte, bedeutet ‚das Leben wählen' immer den ‚Kampf aufnehmen'" (Mannoni 1972, S 187/188). Aus ihren Worten spricht Hoffnung und Mut, wenn man liest, dass sie und ihre Mitarbeiter aus ihrer Arbeit mit zurückgebliebenen Kindern den Schluss gezogen haben, "daß ein Mensch alles zu gewinnen hat, wenn er nicht von einem Mitglied der Gesellschaft unwiderruflich verurteilt wird" (ebd. S 188) - andererseits lässt diese Erkenntnis auch die große Macht der diagnostizierenden Instanz erkennen.
Alle drei Autoren betonen hier die Formierung, die Entwicklung der Behinderung von der eventuell bestehenden Schwäche über die Annahme eines vom Phantasma der Diagnose bestimmten Symptomkataloges und die daraus resultierende Behinderung des Entwicklungsraumes und des Selbstsein-Dürfens des betroffenen Kindes bis hin zur Erfüllung der durch Diagnose und Prognose festgelegten Kriterien in der Erscheinung der Behinderung. Was mich persönlich an den Darstellungen von Mannoni, Niedecken und Elbert so betroffen macht, ist die Vorstellung, selber als Mitglied der Gesellschaft, insbesondere aber als Mitarbeiterin einer Frühförderinstitution, unbewusst auch oft zu genau dieser Konstitution von Behinderung beizutragen.
Dazu kommt noch ein Aspekt, den verschiedene Autoren im Zusammenhang mit der Situation der Familien mit behinderten Kindern erwähnen: dass auch die Eltern selber ja in einer von den Vorstellungen und Phantasmen der Gesellschaft bestimmten Meinung und Haltung zu behinderten Menschen aufgewachsen sind und sich diese Erfahrungen nicht einfach auflösen, nur weil man selber mit der Behinderung des eigenen Kindes konfrontiert wird. So stehen Eltern und Fachpersonen demnach vor derselben Aufgabe, bei der sie sich im Idealfall gegenseitig Stütze sein könnten: vor der Aufgabe, dieses ihnen anvertraute Kind als das eigenständige Wesen mit eigenständigen und bedeutungsvollen Lebens- und Persönlichkeitsäußerungen anzunehmen, das es von Beginn an ist und das es noch werden wird.
Eltern eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes erleben die Einstellung der Umwelt zu ihrem Kind in den konkreten Erfahrungen, die sie in ihrem näheren sozialen Umkreis machen. Die Reaktionen des sozialen Umfeldes wiederum können Einfluss nehmen auf ihren eigenen Umgang mit dem betroffenen Kind. Oft findet sich eine hilfreiche unterstützende Nachbarschaft, aber es gibt auch Fälle, in denen sehr ablehnend auf das Kind und damit auf die gesamte Familie reagiert wird. (vgl. Kriegl 1993, S 54 ff).
Führt man sich die tiefliegenden Ängste jedes einzelnen Menschen vor Behinderung an und für sich nochmals vor Augen, so verwundert es nicht, dass Familien behinderter oder entwicklungsverzögerter Kinder oftmals massiven Reaktionen von Seiten ihrer sozialen Umwelt ausgesetzt sind. Häufig erleben betroffene Familien den Rückzug, das Schweigen, die Distanz ihrer Umwelt, so als wollten die Menschen sagen: damit wollen wir nichts zu tun haben - seht selber, wie ihr damit fertig werdet.
Dazu muss bemerkt werden, dass sich betroffene Eltern gerade in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung meist auch von sich aus vor ihrer sozialen Umgebung zurückziehen. Darin würde ich eine Art Selbstschutz sehen, der für die Familie auch nötig ist, um sich selber mit der veränderten Situation auseinandersetzen zu können, bevor sie dann auch noch mit den Reaktionen anderer Menschen konfrontiert ist.
"Der Rückzug [der Familie, C. K.-S.] in die familiäre Isolation wird zu einem Versuch, in einer Atmosphäre der Intimität und Geborgenheit die mangelnde Toleranz und Hilfsbereitschaft der Umwelt zu kompensieren" (ebd. S 56).
Statt echter, tatkräftiger Unterstützung erfährt die betroffene Familie häufig Mitleid in ihrer sozialen Umgebung. Sofern dieses Mitleid nicht echt empfundenes Mitgefühl darstellt, bewirkt es ebenfalls Distanz und aktiviert nach Kriegl nur wieder die Trauer in der Familie über den erlittenen Verlust. "Mitleid zu empfinden ist aber auch ein Zeichen der tiefen inneren Erleichterung, daß dieses ‚entsetzliche Unglück' anderen zugestoßen ist und nicht der eigenen Familie" (ebd. S 56).
Eine weitere häufig zu beobachtende Reaktion der Umwelt ist die der offen gezeigten Ablehnung und Abwertung der Familie mit einem behinderten Kind.
Wenn schon die Mutter eines "normalen" Kindes ständig dem Urteil der Umwelt ausgesetzt ist, um wie viel schwieriger muss es erst für die Mutter eines behinderten Kindes sein, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und eventuelle negative Reaktionen auszuhalten. Sie erleiden die Ablehnung, die man ihnen entgegenbringt um des Kindes willen, haben dafür aber wiederum kein anderes Gegenüber als das Kind selber.
Ich hatte beschlossen, mit Michael in den Supermarkt zu gehen, um gemeinsam die Lebensmittel einzukaufen, die wir zum Kochen des Mittagessens benötigen würden. Michael liebte es, technische Vorgänge genauestens unter die Lupe zu nehmen, und so gelang es mir kaum, ihn dazu zu bewegen, sich von der automatisch öffnenden und schließenden Tür in den Innenraum des Geschäftes zu begeben. Anschließend mussten wir alle Dinge im Regal nacheinander betrachten und Michael räumte sie schneller aus, als ich sie wieder einräumen konnte. Als ich eben noch eine Packung zurückstellte, hatte Michael schon die Obstabteilung erreicht und in eine Orange gebissen, die er angewidert wieder zurücklegte. Tomaten und Salat waren auf dem Boden gelandet und ich konnte ihn eben noch davon abhalten, mit dem Finger ein Loch in den Joghurtbecher zu drücken, den er sich bereits geangelt hatte. In ähnlicher Weise setzte sich unser erster Supermarktbesuch fort und ich schaffte es kaum, die benötigten Lebensmittel zu besorgen, während ich ihn im Auge behalten und auf seine Erkundungsbedürfnisse eingehen wollte. Während ich zahlte, hatte Michael wieder die Eingangstür in Beschlag genommen und blockierte durch seine Bewegungen den Zutritt für einige ältere Damen, die sich daraufhin nach der dazugehörenden Mutter umsahen, mich erblickten und mir gute Ratschläge erteilten, wie ich auf mein Kind besser Acht geben sollte. Im Vorbeigehen murmelten sie auch noch etwas von schlechter Erziehung und schüttelten demonstrativ den Kopf. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken und hätte fast laut ausgerufen, dass das ja gar nicht mein Kind ist. Und diese Tatsache ermöglichte es mir ja noch, mich von dem Geschehen emotional zu distanzieren, in dem Wissen, dass es wirklich nicht mein Kind war, das da so viel Anstoß erregte. Wie muss es aber für eine Mutter sein, die sich nicht so einfach aus ihrer Pein und Scham retten kann, wenn sie sich ständiger Beurteilung ausgesetzt fühlt?
Niedecken spricht von der "latent schuldzuweisenden Umwelt" (vgl. Niedecken 1998, S 49f), der sich Eltern behinderter Kinder gegenüber sehen und die ihnen auch in Fachkräften und Betreuerinnen und deren Ansprüchen an die Erziehungsfähigkeit der Eltern immer wieder begegnet.Gerade Eltern von Kindern mit der Diagnose "Down-Syndrom" beschreiben sehr häufig die Blicke der Umwelt, denen sie mit ihrem Kind ausgesetzt sind und die keineswegs immer wohlwollend gemeint sind, sondern eher Erschrecken und Ablehnung transportieren. Dieses "Komisch-Angesehen-Werden" gehört schon fast zum Alltag dieser Familien.
Davids Mutter berichtete mir einmal davon, wie sehr es sie in der Anfangszeit betroffen gemacht hatte, wenn während der Zeit im Wartezimmer des Kinderarztes ein anderes Kind auf ihren Sohn zeigte und laut rief: "Mama, was hat denn der?". Schlimm fand sie aber eigentlich nicht die Frage des Kindes, sondern die Reaktion der anderen Mutter, die die Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger ihres Kindes beschämt wegnahm und "psst!" machte. Darüber redet man also nicht, hier wendet man sich lieber schnell ab, um nur ja nicht in Kontakt zu kommen. Davids Mutter empfand vor allem die so entstehende Isolation als belastend. Sie gab aber bereitwillig zu, dass sie früher wahrscheinlich nicht anders reagiert hätte, als sie durch ihren Sohn noch nicht selber mit der Behinderung konfrontiert war.
Ein besonders schlimmes Ereignis, in dem der Hass der Gesellschaft gegenüber der Behinderung deutlich zu spüren ist, und das die subtile Art darstellt, mit der diese ablehnenden Gefühle der Mutter vermittelt werden, war für mich das vorbereitende Gespräch zu Davids Volksschulintegration. Es waren alle Eltern und zuständigen Betreuungspersonen der zu integrierenden Kinder, aber auch Kindergärtnerinnen, Lehrer, Sonderschullehrer und Vertreter der Kindergarten- und Schulbehörde des Landes bei dem Gespräch anwesend. Während bei den Kindern mit leichtem Entwicklungsrückstand die Frage der Schulintegration recht schnell besprochen war, wurden Davids Mutter große Steine in den Weg gelegt. Der Volksschuldirektor erzählte ihr von einem Kind aus seiner Nachbarschaft, das so erfolgreich die Sonderschule besuchen würde, und der Sonderschuldirektor pries die Vorteile seiner spezialisierten Schule. Die Vertreterin des Landes aber fragte Davids Mutter allen Ernstes, ob sie es verantworten möchte, wenn David bei einer Ansage in seiner zukünftigen Volksschulklasse die anderen Kinder durch sein auffälliges Verhalten so störe, dass diese eine schlechtere Note bekommen würden. Man wollte Davids Mutter hier wirklich schon im Voraus die Schuld an der Befürchtung eines gestörten Lernerfolgs der übrigen Kinder einreden.
Aber nicht nur die Eltern erleben solche Ablehnung, sondern auch das Kind spürt, "wie all seine Mitmenschen nur immer an ihm sein ‚Anderssein' sehen, ablehnen oder nicht wahrhaben wollen" (Niedecken 1998, S 117).
Kerstin Ziemen spricht in Anlehnung an Goffman (1975) vom Stigma, das nicht nur das Kind, sondern mit ihm auch seine Eltern und seine Familie trifft. "Mit der Vermutung der Behinderung des Kindes ist zugleich die Vermutung des Stigmas verbunden" (Ziemen 2002, S 169). Nach Ziemen wird die Schuld für die Behinderung des Kindes bzw. für die Umstände, die dazu geführt haben, stets bei den Eltern gesucht. Auch Kriegl erwähnt, dass vor allem bei von Geburt an bestehenden Behinderungen des Kindes in der sozialen Umgebung die Meinung vorherrscht, dass die Eltern in irgendeiner Weise selber daran schuld seien, etwa durch einen ungünstigen Lebenswandel oder durch Vererbung. (vgl. Kriegl 1993, S 52ff)
"Das Stigma der Eltern wird über die diagnostizierte oder angenommene Behinderung des Kindes manifest" (Ziemen 2002, S 180). Ziemen ortet im Umgang mit Familien eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes zahlreiche "soziale Regelverstöße", durch die die Familie diskreditiert werde. Solche "soziale Regelverletzungen" (Ziemen 2003, S 30) stellen für sie Kränkungen der Eltern im medizinisch- psychologischen Feld, in der Öffentlichkeit und in der eigenen Familie dar. Es passieren Schuldzuweisungen an die Eltern, die sich wiederum rechtfertigen müssen. In Anlehnung an Niedecken spricht Ziemen von der "Institution Geistigbehindertsein" und ihrer sozialen Bedeutung für das Leben der Familie eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes. "Andererseits sind es die Eltern, die von der ‚Institution Geistigbehindertsein' betroffen sind, die soziale Regelverletzungen erleben und institutionelle Gegenübertragungen auf ihr Kind (welches sie bedingungslos lieben wollten) wahrnehmen" (Ziemen 2002, S 179/180).
In diesem Zusammenhang erscheint meine eingangs gestellte Frage danach, ob es sich bei der Familie eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes um eine "Sonderfamilie" handelt oder nicht, relativ bedeutungslos. Denn auch wenn sich die Familie selber nicht als behindert empfindet - ihre Situation in der Gesellschaft ist eine behinderte, stellt eine von archaischen Ängsten und den damit verbundenen Reaktionen aber auch von mangelnder Solidarität und Unterstützung geprägte Behinderung dar.
Es ist gerade in der Literatur der Achtziger Jahre häufig vom Begriff "Sonderfamilie" (Balzer & Rolli 1975 in Hensle 1988, S 236) die Rede, wenn von Familien mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind gesprochen wird. Die Situation der Familie wird als eine ganz besondere angesehen, das Kind als ein Kind mit besonderen Bedürfnissen, das ganz besondere Behandlung braucht.
Warum liegt die Betonung auf dem Wort "besonders"? Müssen wir als Gesellschaft die betroffene Familie zum Sonderfall erklären, um möglichst viel Distanz zu ihr zu bekommen, damit das, was der Familie und dem Kind zugestoßen ist, möglichst wenig mit uns und unserem Leben zu tun hat?
Ich bin trotz allem davon überzeugt, dass es eine große Chance für das Leben einer Familie und aller sie umgebenden Personen sein kann, mit einem Kind mit Behinderung zu leben. Die vorgefertigten Meinungen und Einstellungen verlieren an Kontur, die vorgefasste Lebensplanung bricht vorerst einem Kartenhaus gleich zusammen; aber wenn die Krise überwunden ist, wird man auch frei, die Maßstäbe anders anzulegen, die eigene Wertehierarchie zu reformieren, das Leben aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und zu erkennen, dass es noch andere Aspekte als Leistung, Konformität, Erfolg und Sicherheit hat.
Ich finde, dass es gut tut, zu sehen und anzuerkennen, dass nicht alles im Leben planbar und machbar ist, dass es die Vollkommenheit nicht gibt und dass vielleicht gerade in der Unvollkommenheit des Lebens sein Reiz und seine Bedeutung liegen können.
Es wird wahrscheinlich jeder Mensch in seinem Leben an Punkte stoßen, wo er mit seinen eigenen Grenzen und mit Behinderungen, die das Leben bereit hält, konfrontiert wird. Er wird sich in dieser Situation von seinen bisherigen Wünschen und Vorstellungen verabschieden müssen, weil er einsehen muss, dass seine Bemühungen umsonst waren, er auf einem falschen Weg war oder das lang ersehnte Ziel momentan nicht erreichbar ist. Die "Ent-Täuschung" an diesem Punkt schmerzt zwar lange Zeit sehr, aber der Blick kann wieder frei werden - und es tun sich oft neue ungeahnte Möglichkeiten auf.
In diesem Sinne ist jeder Mensch in seinem Leben mit Behinderung konfrontiert. Es könnte gerade für den Abbau der gegenüber behinderten Menschen und ihren Familien bestehenden Angst-Abwehrmechanismen in der Gesellschaft und bei jedem einzelnen hilfreich sein, die Normalität von Behinderung in diesem weit gefassten Sinn zu betonen. Damit verliert Behinderung etwas von dem Dunklen, Bedrohlichen, Grauenhaften und man holt ein Schicksal, das man nicht kennt und das einem Angst macht, von der Betonung des Fremden ins Bekannte, in die Normalität. Ein Stück weit könnte es so möglich sein, der Angst zu begegnen, sie nicht weiter abzuwehren und damit auch dem von Behinderung betroffenen Menschen und seiner Familie näher zu kommen und offen zu werden für seine und ihre eigentlichen Bedürfnisse.
Handelt es sich bei der Familie eines von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kindes also um eine "behinderte Familie", eine "Sonderfamilie" ?
Ich möchte diese Frage gerne von Betroffenen selber beantworten lassen und beziehe mich dabei auf die Erfahrungen aus Elternselbsthilfegruppen, die Behringer (2001) zusammengefasst hat. "Zum einen empfinden sie [die Eltern, C.K-S] sich selbst als behindert, sie sind in ihrer Bewegungsfreiheit stärker eingeschränkt, fühlen sich stärker an zu Hause gebunden und sind stärker neugierigen bzw. mitleidigen Blicken ausgesetzt. [...]
Gleichwohl erleben sie sich in ihrer Umwelt nicht als normale Eltern, obwohl sie viele Kriterien moderner Elternschaft erfüllen, nicht aber das ‚Ideal des perfekten Kindes'" (Behringer 2001, S 163). Auf der anderen Seite würden Eltern sich selber, auch wenn sie ein behindertes Kind haben, noch lange nicht als "behindert" bezeichnen.
Niedecken bezieht sich in ihren Darstellungen auf den Stand der Frühförderung Ende der Achtziger Jahre und zitiert darin vor allem Speck und Thurmair aus dem Buch "Frühförderung mit den Eltern" (1983). In den Ausführungen dieses Werkes wird Frühförderung als Maßnahme zur Erreichung des Ziels gesehen, das Kind möglichst gut in das staatliche Leben einzugliedern. Der Blick ist vor allem auf die Schule und die dort geforderten Kompetenzen gerichtet - ausgehend von einer Norm, an die das Kind durch möglichst gute Förderung angepasst werden soll. Diese Auffassung von Frühförderung degradiert "Eltern und Frühförderer zu Agenten des Staates" (Niedecken 1998, S 160).
Niedecken kritisiert, dass den Eltern unter dem Deckmantel "Das ist das Beste für ihr Kind!" viele Maßnahmen, Förderprogramme und Anweisungen aufgezwungen und sie in der Folge von der Frühförderung abhängig werden.
Wichtige Prinzipien der Frühförderung waren damals die Messung des Kindes an den Standards der "normalen" Entwicklung und das Ersinnen von Maßnahmen, um das Kind diesen Standards anzupassen. Aber auch heute noch sind diese sogenannten "Entwicklungsgitter" im Einsatz, in denen man in Tabellen die Leistungen des Kindes in bestimmten Bereichen ankreuzt und sie mit dem dazugehörenden Entwicklungsalter vergleicht.
Eigenständigkeit, Autonomie und Selbstwerdung des Kindes waren noch keine großen Themen und die Freude am gemeinsamen Spiel nur ein Nebeneffekt, der eintreten konnte. Auch die Begleitung der Familie stand nicht im Vordergrund - Frühförderung war sehr isoliert auf das Kind mit Behinderung bezogen, die Sicht der Behinderung eher eindimensional und die Förderung selber eher defektorientiert.
Eines der wichtigsten Ziele der Förderung wäre für Niedecken die psychische Selbständigkeit des Kindes. Es solle lernen, sich zu entscheiden und auch "nein" sagen zu dürfen.
Wenn ein Kind mit offensichtlicher Behinderung im Sinne einer körperlicher Schädigung zur Welt kommt, wird die Frühförderung meist schon sehr früh, im ersten halben Lebensjahr des Kindes, auf den Plan gerufen. Die Empfehlung dazu kommt oft von den behandelnden Ärzten im Krankenhaus. In dieser Zeit sind die Eltern noch sehr getroffen vom Urteil der Diagnose und in ihrem Selbstvertrauen erschüttert. Niedecken spricht davon, dass "besonders durch die mobilisierten Tötungsphantasien Schuldgefühle hervorgerufen [werden C. K.-S.] und dadurch ein Wiedergutmachungsbedürfnis" (Niedecken 1998, S 164). Wenn Ärzte in dieser Phase sagen: "Nehmen Sie doch Frühförderung in Anspruch - Sie tun damit das Beste für ihr Kind!", dann wirkt das, wie Niedecken meint, wie ein Absolutionsangebot: "Wir Fachleute sprechen Euch Eurer Sünden (Eurer Tötungsphantasien) ledig, wenn ..." (ebd. S 164). Damit kommen die Eltern in eine Abhängigkeit von Instanzen wie Ärzten, Therapeuten und anderen Fachleuten bis letztlich hin zum Staat und zur Gesellschaft.
Ich denke, dass es für die Entstehung von Schuldgefühlen auch schon reicht, wenn Eltern ihr Kind am Beginn ablehnen oder ihm (noch) keine Liebe entgegenbringen können. Ich weiß nicht, ob die Ablehnung bzw. der Schock, die Enttäuschung immer so weit geht, dass man davon sprechen kann, das Kind tot zu wünschen. Der Wunsch, es wäre einfach gar nicht mehr da, einfach nicht geboren worden, kommt aber wohl letztendlich dem Töten gleich.
Niedecken bezieht sich auf Thurmair in "Frühförderung mit den Eltern" (Speck 1983), wenn sie die Haltung der Frühförderung den Eltern gegenüber kritisiert. Liest man jedoch denselben Thurmair in seinem Buch "Praxis der Frühförderung" aus dem Jahre 2000, spürt man doch deutlich, dass der Stellenwert der Familienbegleitung sich in den letzten 20 Jahren stark verändert hat. In "Frühförderung mit den Eltern" spricht Thurmair noch dezidiert davon, dass die Wünsche der Eltern in der Frühförderung wenig berücksichtigt werden können, dass es geradezu die Aufgabe der Frühförderung ist, die Eltern zu ihren Zwecken einzusetzen und ihrer Hilflosigkeit wenn möglich konkrete Programme entgegenzusetzen. Es liest sich fast so, als wären die Eltern lästige Störfaktoren, die es zu umgehen gilt.
"So ist das Angebot das einer fixierten Abwehr von Schuld und Depression - und die Tötungsphantasien werden im Unbewußten fixiert, so daß sie als Motor dienen können, der die Eltern gegen die eigene Kritikfähigkeit zum willfährigen Instrument der Frühförderung macht" (Niedecken 1998, S 166). Niedecken sieht das eigentliche Problem darin, dass die Eltern mit den sie quälenden Gefühlen und ihren Tötungsphantasien, die weitgehend unbewusst geworden sind, alleine gelassen werden. An die Stelle der notwendigen bewussten Auseinandersetzung mit den ablehnenden Gefühlen dem Kind gegenüber tritt die Aufgabe, das Kind zu fördern, Übungen durchzuführen, Anweisungen und Ratschläge zu befolgen.
Einfache spielerische Interaktionen mit dem Kind, die spontansten Begegnungen in der Eltern-Kind-Beziehung, kommen unter die Räder des "Auftrages Förderung", weil sie nicht mehr impulsiv, offen für die Gefühle des jeweils anderen geschehen, sondern in der Bewusstheit, dass da jetzt etwas passieren muss, was gut ist für die Entwicklung des Kindes. Die Eltern stehen unter dem Druck, Erfolg haben, etwas bewirken zu müssen.
"Die Freude am Spiel mit dem Kind wird dann ersetzt durch die Erleichterung und Freude, wenn ‚es klappt', wenn das Kind annähernd normgerecht leistet" (ebd. S 166).
Mannoni etwa spricht von der Vielzahl der heilpädagogischen Erziehungs- und Förderungsmaßnahmen als von "pädagogischer Wiederanpassung" (Mannoni 1972, S 156).
Hier stellt sich die Frage der Anpassung an welche Norm und die Frage danach, wer diese Norm aufstellt.
Niedecken spricht in diesem Zusammenhang von dem Leistungsdruck, den die Frühförderung den Eltern auferlegt. Ich als Frühförderin hatte aber oft das Gefühl, gegen den Leistungsdruck ankämpfen zu müssen, der von den Eltern ausging. Das Spiel mit dem Kind erschien ihnen manchmal zu wenig fördernd, ja geradezu belanglos.
So berichtete mir die Mutter von Christophs Kontrolluntersuchung beim zuständigen Psychologen, dass dieser sie gefragt hätte, was denn die Frühförderin so alles mache. Die Mutter erwiderte ihm, dass ich mit dem Kind hauptsächlich "Kasperle spielen" würde, womit sie ihre Geringschätzung deutlich zum Ausdruck brachte. Gemeint hat sie damit die Rollenspiele, die ich zur Förderung der Sprachfähigkeit und Kreativität des Kindes, aber auch zu seiner Freude, hin und wieder anregte. Die Mutter forderte dann, sozusagen mit der Unterstützung des Psychologen, von mir ein, dass ich "etwas Richtiges" mit dem Kind tun solle - womit sie Arbeitsblätter zur Schulvorbereitung meinte.
Es ist möglich, dass Eltern den von der Gesellschaft ausgehenden Druck zur Normalisierung ihres Kindes bereits sehr gut internalisiert haben, wenn sie auf die Frühförderin treffen.
Niedecken bietet noch eine andere Sichtweise dieses Problems an, wenn sie beschreibt, wie etwa auch Vorgesetzte oder Arbeitskollegen misstrauisch auf eine neue Form des Umgangs mit behinderten Menschen reagieren können. Aus dem gängigen Schema der institutionalisierten Behandlungstechniken auszubrechen, bedeutet für Niedecken, die Wünsche des Kindes zu achten, seine Autonomie und Eigenständigkeit zu fördern, ihm Entscheidungen zuzutrauen und es zur Selbständigkeit hinführen. Damit fallen aber auch gängige Abwehrformen im Muster von Erzieher-Kind-Beziehungen weg und man ist als Pädagogin mit den eigenen Gegenübertragungsgefühlen und Ängsten konfrontiert: mit der Angst vor extremer Hilflosigkeit, vor Versagen, vor Überschwemmt-Werden oder vor dem Ausgestoßen-Werden.
Ich frage mich, ob es auch Eltern so ergeht, die sich ein genaues Punkteprogramm zur Förderung ihres Kindes von der Frühförderin erwarten und dann beobachten, dass die Frühförderin dem Kind sehr viel Freiraum und Mitgestaltungsmöglichkeit bietet. Entsteht dabei in den Eltern die Angst vor dem gesellschaftlichen Ausgestoßen-Werden, wenn das Kind nicht funktioniert, wenn es sich nicht eingliedern lässt in die gängigen Normen? Werden sie dadurch wieder mit den tiefen Ängsten rund um die Behinderung an und für sich konfrontiert? Bekomme ich als Frühförderin deswegen spürbaren Druck von den Eltern, das Kind "richtig" zu fördern?
Es kommt vor, dass Eltern Hoffnungen und Erwartungen in die Frühförderung setzen, die sie niemals erfüllen kann. Das "Wiedergutmachen" ist meiner Meinung nach nicht nur etwas, das Frühförderung scheinbar verspricht, sondern auch etwas, das als Wunsch von den Eltern an sie herangetragen wird. Dazu stellt sich mir die Frage, ob die gegenseitigen Erwartungshaltungen nicht schon beim Erstgespräch zwischen Eltern und Frühförderin grundgelegt werden. Ich frage mich, wie Frühförderinnen ihre Tätigkeit beim Erstgespräch vermitteln und wie sie der Angst und Verzweiflung der Eltern, die durchaus schon in diesem ersten Gespräch spürbar werden, begegnen. Es ist möglich, dass man als Frühförderin von Anfang an zumindest Andeutungen in die Richtung macht, schon etwas tun, etwas verändern, etwas bewirken bzw. Rezepte für die Bewältigung der schwierigen Situation bereitstellen zu können.
Mannoni nimmt auf diese Situation Bezug und spricht sich dafür aus, dass die Therapeutin den Eltern gerade zu Beginn keine Ratschläge erteilen sollte, "auch wenn aufgrund ständiger Bitten der Eltern um Rat die Versuchung groß sein dürfte" (Mannoni 1972, S 155).
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Hilfsbedürftigkeit der Eltern gerade in so einem ersten Gespräch sehr stark zum Vorschein kommt und man als Frühförderin in die Situation gerät, viele Hilfsangebote zu machen. Dahinter steht nach meinem Verständnis, dass die Konfrontation mit den Gefühlen der Eltern, mit ihrer Hoffnungslosigkeit und ihrem Schmerz nicht so einfach auszuhalten ist. Vielleicht ist man deswegen so schnell geneigt, Lösungen anzubieten, auch wenn man zunächst noch gar nicht so recht sieht, wie so eine Lösung aussehen könnte. In diesem Sinne wäre die darauffolgende Förderung tatsächlich als Abwehr der nicht so leicht auszuhaltenden Gegenübertragungsgefühle zu sehen, und der Leistungsdruck, der in Frühförderprozessen so leicht entsteht, als etwas, das sich gegenseitig immer wieder bedingt.
Leistungsdruck entsteht aber auch im Spannungsfeld der Frühförderung zu ihren indirekten "Auftraggebern", also zu den diagnostizierenden Ärzten, Psychologen und Therapeuten, die Frühförderung "verschreiben" und denen die Frühförderung durch den Nachweis von geschehenen Veränderungen und Entwicklungen bei nachfolgenden Kontrolluntersuchungen verpflichtet bleibt. Frühförderinnen begleiten Eltern in vielen Fällen zu diesen Kontrolluntersuchungen und haben dem Arzt dann Rede und Antwort über den Verlauf ihrer Tätigkeit zu stehen.
Wie oft habe ich bei solchen Gelegenheiten das Kind beobachtet in der bangen Hoffnung, dass es auch vor dem Arzt das zeigt, was ihm zu Hause schon gelingt - so als wäre es mein Produkt, das von einer Fachjury bewertet werden soll. Und manchmal kam ich mir vor wie bei Gericht, wenn der Arzt von seinen Notizen aufschaute und mich fragte, was ich in diesem oder jenem Entwicklungsbereich bereits unternommen hätte. Es war eine Notwendigkeit, den Erfolg meiner Arbeit darzulegen vor dem Arzt, der unter Umständen darüber entschied, ob der Antrag auf Verlängerung der Frühförderung bei dem jeweiligen Kind von der zuständigen Landesbehörde genehmigt werden sollte oder nicht und damit auch darüber, ob ich meine Arbeit fortsetzen konnte oder nicht.
Somit sehe ich die Frühförderin im Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen der Eltern, den Ansprüchen der Institution, der Diagnose-Instanz, der Gesellschaft und schließlich den Bedürfnissen des Kindes stehen. Da sich die Ansprüche der jeweiligen Interaktionspartner oft grundlegend voneinander unterscheiden, erscheint mir die Position der Frühförderin - ebenso wie die Situation der Eltern und die des Kindes - keine leicht zu bewältigende zu sein.
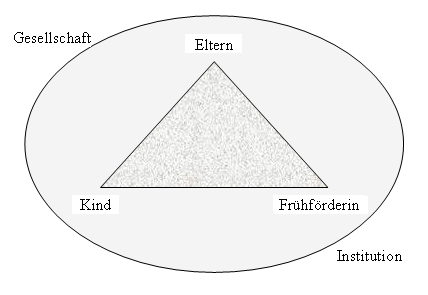
Abb. 1: Frühförderung im Spannungsfeld
An dieser Stelle möchte ich gerne meine eigenen Überlegungen und die Ausführungen Niedeckens ergänzen durch die Darstellung des Spannungsverhältnisses von Beratung und Kontext im Beitrag von Dietmar Chur im Werk "Beratung" (Nestmann 1997, S 39-69).
Wenn Chur hier von Beratung im Allgemeinen spricht, sehe ich Frühförderung ebenfalls als ein zunehmend in die Richtung von Beratung gehendes Angebot an Familien mit entwicklungsverzögerten oder behinderten Kindern. So wie viele Beratungsstellen hat auch Frühförderung einen meist individuellen institutionellen Hintergrund, der wiederum in einem größeren gesellschaftlichen Kontext steht.
Chur sieht in unserer heutigen Lebenswelt durch die geringe Orientierung an allgemeingültigen oder tradierten Konzepten und durch die Pluralität möglicher biographischer Entwürfe ein verstärktes Bedürfnis nach individuellem Halt und damit nach Beratung bei den Menschen. Dabei liegt für ihn in der Betonung der Individualisierung zwar die Chance auf Freiraum für den Einzelnen, aber auch die Gefahr von vereinzelnden Verlusterfahrungen durch den Umstand, dass jede Person auf sich selber zurückgeworfen ist.
Auch Familien mit behinderten Kindern werden zunächst auf ihre eigenen Ressourcen verwiesen, und es wird die gesellschaftliche Erwartung an sie gestellt, alleine mit der Situation fertig werden zu müssen.
Die zentrale Herausforderung im Aufgabenbereich von Beratung sieht Chur folgendermaßen: "Die plurale und individualisierte Gesellschaft fordert von ihren Mitgliedern ein orientiertes Alltagshandeln innerhalb einer als sinnvoll erlebten und gelebten Biographie" (Chur 1997, S 41).
Beratung sieht er als eine in sozialwissenschaftlichen Theorien und daraus abgeleiteten Methoden gründende professionelle Unterstützung bei der Orientierung, der Entscheidung und beim Handeln angesichts der Anforderungen der alltäglichen Lebenswelt. Er bezieht sich dabei auf konkretes Handeln mit einer präventiv-entwicklungsfördernden Akzentsetzung auf die Herausbildung von Identität im Lebensvollzug. Das zentrale Ziel ist für ihn die Erschließung und Stärkung von Kompetenzen, die auf dem Zugang zu persönlichen und sozialen Ressourcen gründen. Beratung wird so zur kompetenzfördernden Unterstützung des Alltagshandelns, Beratungshandeln wird verstanden "im Kontext der Verhältnisse, auf die es sich bezieht" (Thiersch 1991, S 25 zitiert in Chur 1997, S 42).
Für eine konkrete Beratungssituation würde das bedeuten, die Person in ihrem Alltagshandeln zu unterstützen durch die Förderung ihrer Kompetenzen und die Erschließung ihrer persönlichen und sozialen Ressourcen. Daneben ginge es um die Analyse von bedeutsamen positiven und belastenden Einflüssen in der dynamischen Beziehung der Person zu ihrer Umwelt und damit um die Wirkung von Kontextfaktoren.
Für eine wirksame Beratung ist es nach Chur aber auch notwendig, den institutionellen Hintergrund der Beratenden selber einer Analyse zu unterziehen und einer Beeinflussung zugänglich zu machen.
Der gesellschaftliche Kontext bildet schließlich den übergreifenden Rahmen von Beratung. Die Gesellschaft fordert vom Ratsuchenden Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit in einer pluralen, individualisierten Gesellschaft - der Beratende muss demnach die Funktionsfähigkeit und die gesellschaftliche Integration seiner Klienten fördern.
Beratung findet meist in einem institutionellen Rahmen statt, in den die Berater-Klient-Interaktion eingebunden ist. Die Interessen der Institution und die dahinterstehen gesellschaftlichen Interessen decken sich nicht immer mit den Interessen der Klienten. Der Berater kann also in einen Interessenskonflikt, in ein Spannungsfeld geraten.
Während von der Gesellschaft - vom institutionellen Trägerkontext - her der Auftrag an den Berater kommt: "Sorge dafür, daß die Klienten ihre gesellschaftliche Funktionen erfüllen!", ergeht vom sozialen und institutionellen Alltagskontext des Klienten her der Auftrag an ihn selber: "Erfülle deine gesellschaftlichen Funktionen!". Gleichzeitig stellt der Klient an den Berater die Forderung: "Entlaste mich!".
Über eine öffentliche oder freie Trägerinstanz ist Beratung also angebunden an das Gefüge der gesellschaftlichen Institutionen und steht in einem normativen Rahmen, der angibt, was unter einer gelungenen Integration und Funktionsfähigkeit der Klienten zu verstehen ist.
Vorstellungen über das Zusammenleben in Familie und Partnerschaft, Erziehungsvorstellungen, Vorstellungen von wünschenswerter Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vorstellungen über Integration und Aussonderung bilden institutionell verankerte Leitlinien und damit die Grundlage für die Beratungsarbeit.
Für den Berater gibt es nach Chur unterschiedliche Möglichkeiten, mit seiner Position im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und den Bedürfnissen des Klienten umzugehen:
-
Die Koalition mit der Institution bedeute für den Berater die Identifikation mit den gesellschaftlichen Anforderungen und bewirke im Beratungshandeln direktive Interventionen, Kontrolle und Anpassung.
-
Die Koalition mit dem Klienten bringe den Berater dazu, sich gegen die Gesellschaft auf die Seite des Ratsuchenden zu stellen und dessen Werte- und Bezugssystem zu übernehmen. Im Beratungshandeln überwiege dann Solidarität, Verständnis und stützendes Vorgehen. Im Verhältnis des Beraters zu seiner Institution könne es zu Konflikten kommen.
-
Der Berater könne aber auch zum Medium der Konfliktregelung werden, indem er keine Position beziehe und sich für den Kompromiss engagiere.
-
Der Berater nehme die Position des neutralen, neugierigen Außenstehenden ein, der zu einer Lösung anrege, aber keine direktive Funktion übernehme und nach beiden Seiten Veränderungen initiiere. (vgl. Chur 1997, S 61)
Chur sieht nur in der letzten Position den Freiraum für eine Aktivität zur Veränderung, während alle übrigen Positionen den Berater in seiner Funktion einschränken.
Ich denke, dass diese Überlegungen auch für die Frühförderin und die Frühförderung als zwischen dem gesellschaftlichen Auftrag zur Eingliederung des Kindes in die Gemeinschaft und den tatsächlichen Anliegen der Familie und des Kindes stehende Institution bedeutsam sein könnten. Es benötigt von der Frühförderin eine bewusste Reflexion über die unterschiedlichen Anforderungen, die an sie gestellt werden und eine entschiedene Positionierung in ihrer Haltung diesen Ansprüchen gegenüber, um nicht in dem Versuch, alle Anforderungen zu erfüllen, zwischen den Fronten zerrieben zu werden.
Ein Beispiel hierfür ist vielleicht der Spagat, den man als Frühförderin jedes Mal zu bewältigen hat, wenn es um die Integration eines Kindes in eine Schule geht, die diesem Wunsch nicht sehr aufgeschlossen gegenüber steht. Während die Familie alle Hoffnung in das Verhandlungsgeschick der Frühförderin und in ihre Unterstützung setzt, glaubt auch die Schule manchmal, in der Frühförderin eine Verbündete zu haben, die den Eltern erklären kann, dass sich Integration nicht umsetzen lässt, ebenso wie die Schulbehörde ihr die bestehenden gängigen Vorgangsweisen und gesetzlichen Rahmenbedingungen erläutert und von ihr erwartet, dass sie diese den Eltern nahe bringt.
Die Frühförderin ist in einer schwierigen Lage, weil sie einerseits die Bedürfnissee des Kindes wahren und ihnen auch innerhalb der Familie Gehör verschaffen soll, andererseits aber auch Teil einer Institution ist, die der Öffentlichkeit und damit den gesellschaftlichen Ansprüchen verpflichtet ist.
Auch Mannoni hat sich mit dem Problem des institutionellen Hintergrundes von Beratung beschäftigt. Am Beispiel der Konsultation des Arztes sieht sie diesen "nicht nur dem Verlangen der Eltern konfrontiert, sondern auch dem Urteil der Gesellschaft. Oft unterliegt er einem pädagogischen Bezugsrahmen und erfüllt eine gesellschaftlich bestimmte Rolle in einem Wiederanpassungsunternehmen - auch wenn er sich dagegen wehrt" (Mannoni 1972, S 155). Ihrer Ansicht nach verleitet eine bereits bestehende Organisation dazu, hauptsächlich Lösungen zur gesellschaftlichen und schulischen Wiederanpassung anzustreben, um damit sowohl den Erwartungen der Eltern als auch den Ansprüchen der Gesellschaft zu genügen.
"Der Berater ist selbst von den inneren Bedingtheiten eines Beratungsdienstes geformt und unterliegt der Versuchung, die die Bandbreite angebotener Reedukationsmethoden ausübt" (ebd. S 155).
Mannoni legt die Vermutung nahe, dass Institutionen mit der Zeit gängige Umgangsformen und Fördermaßnahmen in ihrem Angebot vereinen, die eine bestimmte Haltung und Einstellung zum behinderten Menschen ausdrücken.
Diesen Ausführungen zufolge kann man davon ausgehen, dass die in der Institution gängige Sichtweise und Vorgangsweise nachhaltig das Vorgehen des einzelnen Mitarbeiters beeinflussen. Es stellt sich zudem die Frage, ob solch unbewusst wirkende "Institutionsgesetze" den Blick der Frühförderin auf die tatsächliche Situation und Bedürfnislage der betroffenen Familie und auf das Kind als Person verstellen.
Niedecken fragt in diesem Zusammenhang, ob wir uns, auch wenn wir es gar nicht bewusst beabsichtigen, in unserem Tun nicht viel mehr mit der Gesellschaft und ihren Normen identifizieren, als wir uns mit dem Kind solidarisieren.
Für mich würden diese Erkenntnisse einerseits bedeuten, dass sich jede einzelne Frühförderin diesen wirksam werdenden institutionellen und letztlich gesellschaftlichen Einflüssen gegenüber verhalten muss. Dazu gehört auch, sich selber als Teil der Gesellschaft und der in ihr wirkenden Phantasmen wahrzunehmen. Andererseits würde es aber auch für die Institutionen bedeuten, ihre Konzepte nach gesellschaftlich geforderten und übernommenen Wiederanpassungsmechanismen zu durchforsten und daraus Konsequenzen für die weitere Arbeit abzuleiten.
Wenn ich mich hier hauptsächlich auf psychoanalytische Theorien beschränke, so ist mir durchaus bewusst, dass mit manchen dieser Theorien auch die Gefahr der Überbetonung der frühen Entwicklungsphase des Kindes und der daraus abgeleiteten Schuldzuweisung an die Mütter verbunden ist.
"Mehr als jede andere Entwicklungsperiode wurde die frühe Kindheit unter dem Einfluss wechselnder Theorien, deterministischer Denkweisen und einseitig-linearer Ursache-Wirkungsmodelle mit schweren Hypotheken belastet. Vorschnelle Generalisierung von Konzepten der Psychobiologie (z.B. Prägung, mütterliche Deprivation) und Zuschreibung adultomorpher und pathomorpher Metaphern der psychoanalytischen Theorien ( z.B. primärer Autismus, frühkindliche Symbiose, Spaltung, infantile Grandiosität, halluzinatorische Wunscherfüllung) haben die frühe Kindheit befrachtet und ihr eine empirisch bisher nicht belegte Schicksalhaftigkeit zugeschrieben" (Papousek M. in Koch-Kneidl/ Wiesse 2000, S 70/71). Die negativen Folgen sieht Papousek vor allem in den Schuldzuweisungen an die Mutter und in der Verunsicherung junger Eltern, deren Ängste geweckt werden, in der Erziehung ihres Kindes etwas grundlegend falsch zu machen. Auch Monika Jonas ist der Ansicht, dass die Theorie der frühen Mutter-Kind-Beziehung durch Psychoanalytiker wie Spitz oder Winnicott den Müttern ein hohes Maß an Verantwortung und somit auch Schuld zuweist. (vgl. Jonas 1990, S 50f)
Wenn ich mich hier trotzdem auf psychoanalytische Konzepte beziehe, so deshalb, weil es mir um das Nachvollziehen der Emotionen bei Eltern und Kind geht und um ein tieferes Verständnis der Entstehung von bestimmten Erziehungshaltungen und Verhaltensweisen, mit denen die Frühförderin in der Familie des Kindes mit Behinderung konfrontiert wird.
Für dieses Einfühlen und Verstehen halte ich die im Folgenden behandelten Theorien für sehr wichtig.
Schon bevor das Kind geboren ist, sind bei den Eltern Träume und Vorstellungen davon da, wie es mit dem Kind sein wird. Mütter und Väter haben zu diesem Zeitpunkt schon eine ideale Beziehungsphantasie zu ihrem Kind entwickelt und auch von sich selber eine Vorstellung als "gute Mutter" oder "guter Vater". Dabei spielen die Sehnsüchte und erlebten Verletzungen aus der eigenen Kindheit eine große Rolle. (vgl. Jonas 1990, S 60)
"Auf das Kind werden ideale Wünsche und Vorstellungen projiziert. Die Kinder ‚sollen es einmal besser haben', sie sollen über bestimmte emotionale, soziale und kognitive Qualitäten verfügen" (ebd. S 60)
Dass die Eltern neben Idealvorstellungen aber auch Ängste und Befürchtungen in Bezug auf das Kind hegen, zeigt allein schon die Tatsache, wie erleichtert beide sind, nachdem der Arzt nach der Geburt verkündet, dass mit dem Kind alles in Ordnung sei. (vgl. Kriegl 1993, S 19)
Das geborene Kind ist in diesem Sinne zunächst immer eine "Ent-Täuschung", ein Aufheben der Täuschung, die man sich selber geschaffen hat. Nach einer langen Zeit des Wartens ist das Kind nun endlich "ein Wesen aus Fleisch; es ist da, aber von ihr [der Mutter, C.K.-S.] getrennt, während sie doch unbewusst von einer Art Verschmelzung geträumt hat" (Mannoni 1972, S 68). Die Mutter versucht, den vorher geträumten Traum von ihrem Kind zu erhalten und überdeckt das lebendige Kind mit ihren Phantasievorstellungen. Es entsteht eine Scheinbeziehung, die sich (noch) nicht auf das reale Kind bezieht. "Von Anfang an täuscht sich die Mutter in ihrem Kind" (ebd. S 68). Eigene Wünsche - ich würde sie Sehnsüchte nennen - verlagern sich auf das Kind.
Die Mutter möchte etwas, das ihr verloren gegangen ist, durch das Kind wiedergewinnen. "Das Kind ist dazu bestimmt, den Mangel am Sein der Mutter auszugleichen, es ist dazu bestimmt, für sie zu leben und nicht für sich selbst" (ebd. S 68). Dabei ist der Mutter nicht bewusst, was sie sich vom Kind erhofft und wünscht, ebenso wenig wie es dem Kind bewusst ist, dass es eine bestimmte Rolle spielen soll.
Nach Mannoni soll durch die Geburt eines Kindes für die Mutter etwas in Erfüllung gehen, was sie sich wünscht. Das Kind soll wiedergutmachen, was in ihrer eigenen Kindheit gefehlt hat, oder es soll mit ihm eine Wiederholung der eigenen Kindheit möglich sein. Das "erträumte Kind soll das wiedergutmachen, was in der Geschichte der Mutter gefehlt hat, es soll das fortführen, worauf sie verzichten mußte." (ebd. S 23 )
In der mütterlichen Wahrnehmung überlagert sich demnach ein imaginäres Kind (Wunschkind) dem realen Kind. "Erst die wachsende Erfahrung mit dem sich zunehmend eigenständig entwickelnden Kind, das Erleben der Differenz von wirklichem und phantasmatischem Kind, ermöglicht der Mutter ein allmähliches Aufgeben ihrer Projektionen" (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 10).
Gerspach (ebd. S 3ff) weist darauf hin, dass Freud vor allem die Wichtigkeit der Phantasien betont hat, die ein Kind in Bezug auf seine Eltern hat. Jedoch sind gerade auch die Phantasien, die Eltern im Hinblick auf ihre Kinder haben von großer Bedeutung, um familiäre Beziehungsformen verstehen zu können.
Gerspach bezieht sich auf Spangenberg, wenn er die Mutter-Kind-Beziehung als eine "weitgehend unbewusste ‚interaction phantasmatique'" (ebd. S 8) bezeichnet und meint, dass dabei die inneren Vorstellungen und Phantasien des einen das Verhalten des anderen zu beeinflussen suchen und umgekehrt.
In der Entwicklung des Säuglings besteht von Anfang an die uneingeschränkte Abhängigkeit von der Versorgung durch seine Umwelt. Es entsteht die Mutter-Kind-Dyade, in der die Mutter sich ganz auf die Bedürfnisse ihres Kindes einstellt und das Kind sich als Teil der Mutter bzw. als ganz mit ihr verbunden erlebt. Durch die symbiotische Beziehung mit dem eigenen Kind wird die Erinnerung an die eigene Mutter-Kind-Beziehung wieder angeregt. Die Mutter "versucht, über die Identifikation mit dem Kind die eigene symbiotische Mutter-Kind-Beziehung wieder zu erleben bzw. die Korrektur dieser Beziehung" (Jonas 1990, S 61).
Das bedeutet nach Gerspach aber auch, dass sich das Kind auf die reale Mutter ebenso einlassen muss, wie auf die bei ihr bestehenden Gefühle und Phantasien.
"Die Mutter hat schon in ihr ‚imaginäres Kind' investiert, bevor es geboren wurde." (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung, 2000, S 7)
Gerspach bezieht sich in seinen Darstellungen auf die ödipale Inszenierung rund um die Zeugung und Geburt eines Kindes. Wenn das kleine Mädchen in die ödipale Phase eingetreten ist, wünscht es sich vom Vater ein Kind, während sich der kleine Junge von der Mutter einen Sohn wünscht.
Im Erwachsenenalter bestehen diese Wünsche umgewandelt in: "ein Kind machen = zur Geburt bringen (für den Mann ) wie: selbst ein Kind gebären (für die Frau)". (vgl. Freud, 1910h, S 76, in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung, 2000, S 9)
Gerspach geht davon aus, dass sich rund um Zeugung und Geburt inzestuöse Phantasien ranken. Um das Kind als sichtbar gewordene Sexualität von Frau und Mann spinnen sich inzestuöse und damit verbotene Phantasien. "Die Frau schlief mit ihrem imaginierten Vater, der Mann mit seiner imaginierten Mutter. Erst die allmählich wachsende reale Begegnung mit dem sich zunehmend autonom entwickelnden Kind führt zum Zurücktreten dieser Urphantasien." (ebd. S 10)
Durch die Geburt ihres eigenen Kindes löst sich die Frau aus psychoanalytischer Sicht von dem ödipalen Wunsch, ein Kind vom Vater zu bekommen und wird so zur eigenständigen, vollwertigen Frau. Jonas sieht diese Annahme kritisch und hinterfragt die gesellschaftlich festgelegte Stellung der Frau. "Sie [die Mütter, C.K.-S.] geben eine eigenständige Identität als Frau auf und werden nun in der Einheit mit dem Kind als Mutter definiert. Das entspricht dem gesellschaftlich vermittelten Bild, daß Frauen erst über Kinder vollständig werden" (Jonas 1990, S 60).
Jonas spricht davon, dass das Kind in unserer Gesellschaft die Machtdomäne der Frau und aus sozioökonomischer Sicht ihr "Produkt" darstellt. "In einer produktionsorientierten Gesellschaft wird die ‚Qualität' der Mutter daran gemessen, ob dieses ‚Produkt' gelungen ist" (ebd. S 63).
Die Geburt eines Kindes stellt demnach ein komplexes psycho-physisches und soziales Geschehen für die Frau dar.
Kommt ein Kind mit einem offensichtlichen Makel, einer Schädigung zur Welt, so ist das zunächst ein Schock für die Eltern. Vor allem bei der Mutter werden frühere Traumata und Versagungen reaktiviert und "auch endgültig verhindert, daß die Mutter auf symbolischer Ebene endlich ihr Kastrationsproblem überwindet. Sie kann sich ja nur zur Frau entwickeln, wenn sie auf den Fetisch Kind verzichtet, der nichts anderes ist als das imaginäre Kind der Ödipusverbindung." (Mannoni 1972, S 23)
Angesichts eines behinderten Kindes aber entwickelt sich eher die Vorstellung von einer Bestrafung für ihre Phantasien und Wünsche.
"Die Beziehung zum behinderten Kind stellt sich hauptsächlich als eine (lustlos) über Versorgung organisierte dar, so, als gelte es, die Erinnerung an den Zeugungsakt ungeschehen zu machen." (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 10)
Die Mutter kann sich nicht aus der Ödipussituation lösen - im Gegenteil: diese verwirklicht sich oft darin, dass der eigene Mann sich eher zurückzieht, wohingegen die Frau in der Beziehung zu ihrem eigenen Vater die Unterstützung und Kraft findet, das Kind aufziehen zu können. (vgl. Mannoni 1972, S 23)
Nach Mannoni sorgt die Mutter für das Kind, indem sie sich dabei mit ihrem eigenen Vater identifiziert. In den wenigen Fällen, wo es der Vater ist, der für das Kind sorgt, identifiziert dieser sich mit seiner eigenen Mutter.
Zwei Aspekte spielen für die Beziehung der Mutter zu ihrem behinderten Kind eine große Rolle: "Zum einen spiegelt es nicht ihre hoffnungsvollen Phantasien, die nur qua dieser Idealisierung aufgehoben werden können. Zum anderen wird die Existenz der Behinderung als Bestrafung für die verbotenen Inzestwünsche phantasiert." (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 13)
Somit fügt Gerspach den Ausführungen von Mannoni zu den mütterlichen Phantasien den Aspekt der Phantasien rund um das ödipale Drama hinzu und meint, dass die Schuldgefühle der Eltern auch aus den inzestuösen Urphantasien entstehen können, die sich um die Geburt eines Kindes ranken und die sich angesichts des behinderten Kindes nicht auflösen, sondern unbewusst weiterwirken.
Gerspach glaubt, dass viele Eltern behinderter Kinder die Behinderung ihres Kindes als göttliche Strafe ansehen. Er sieht auch die oftmals passierende "Dämonisierung" behinderter Kinder und die bei anderen Menschen auftretende Angst vor "Ansteckung" in diesem Zusammenhang im Ödipuskomplex begründet, den jeder von uns in sich trägt und der dazu führt, dass wir unsere eigene Angst vor den Inzestphantasien auf andere, vornehmlich auf Behinderte, projizieren.
"Wir alle versuchen womöglich, unsere unbewussten, ödipalen Regungen diesen Kindern, aber auch ihren Eltern und ihrem ‚schändlichen Tun' unterzuschieben" (ebd. S 15).
So geraten die Eltern eines behinderten Kindes unter großen seelischen Druck und es verwundert nicht, wenn sie Hilfe bei Fachleuten suchen, von denen sie gleich einem Orakel Weissagungen bezüglich der Zukunft ihres Kindes erwarten und gleichzeitig Schuldentlastung, indem sie die Verantwortung für ihr Kind ein Stück weit in deren Hände legen.
Die Mütter selber suchen die Schuld und Ursache für die Behinderung des Kindes oft im Schwangerschafts- und Geburtsverlauf. Schwangerschaft ist heute von einem Ideal von harmonischer Mutterschaft und von einer hohen Verantwortung der Mutter für eine konfliktfreie Schwangerschaft geprägt. Vor allem in der zweiten Schwangerschaftsphase mit den Bewegungen des Kindes nimmt die Mutter ihr Kind als eigenständiges Wesen wahr und richtet ihre Sensibilität auf dieses von ihr getrennte Individuum. Aber auch Ängste, dass das Kind nicht so sein könnte, wie sie es erhofft, beschäftigen die Mutter. Wenn sie in ihrer Umgebung nicht über ihre Ängste sprechen kann und ihre Idealvorstellungen von Mutterschaft sehr groß sind, kann das zu einem inneren Konflikt führen. Im Nachhinein geben sich die Mütter dann für die Behinderung des Kindes die Schuld und begründen dies mit solchen Ängsten und Spannungen - fühlen sich vielleicht sogar dafür bestraft. Schuldgefühle können also auch entstehen aus den Phantasien und Vorstellungen, aus den Befürchtungen, die man unbewusst gehegt hat und die man nun bestätigt sieht in der Behinderung des Kindes. (vgl. Jonas 1990, S 62ff)
Mannoni stellt wie die meisten Autoren eine große narzisstische Kränkung bei der Mutter fest, wenn ein Kind mit einer Schädigung geboren wird - es fällt der Mutter schwer, sich mit ihm zu identifizieren. Trotzdem aber empfindet sie sich stark mit dem Kind verbunden, und sie spürt jede Kränkung des Kindes wie eine eigene.
"Weil sie das Leben gibt, ist die Mutter gegenüber jedem Schaden an dem von ihr geborenen Kind so empfindlich, daß sie sich versucht fühlt, selbst zu entscheiden, ob das Wesen, das ihre eigene menschliche Zukunft gefährdet, leben soll" (Mannoni 1972, S 19).
Tötungsphantasien, Mordgedanken dem Kind gegenüber entstehen und begleiten von da an, wenn auch zumeist unbewusst, die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Sie müssen geleugnet werden, denn wenn sie bewusst werden, steht auch das Leben der Mutter, die sich ja als Einheit mit dem Kind empfindet, auf dem Spiel. Abwehrformen dieser Todeswünsche sieht Mannoni in "sublimer Liebe" oder "krankhafter Gleichgültigkeit" dem Kind gegenüber. (ebd. S 20)
Gleichzeitig bleiben aber die schon vorhandenen Imaginationen zum erwünschten Kind bestehen und die reale Erfahrung mit ihrem Kind wird für die Mutter so zum schmerzhaften Anerkennen dessen, was wirklich ist. Dazu kommt noch der gesellschaftlich bestehende hohe Anspruch an die eigene Mütterlichkeit, der es der Mutter fast unmöglich macht, um den Verlust des imaginären Kindes zu trauern. Der Verlust bleibt also bestehen und kann nicht verabschiedet und somit integriert werden.
Kind und Mutter bilden meist eine totale Einheit, eine symbiotische Verbindung. Diese wird durch die Auffassung von der völligen Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit des behinderten Kindes noch verstärkt und macht es dem Kind schwer, sich später aktiv und auch aggressiv von der Mutter zu lösen. Es kann leicht geschehen, dass das Kind in einen starren, undynamischen und auch von vielen Ängsten geprägten Zustand verfällt, der nicht ohne Wirkung auf die eng mit ihm verbundene Mutter bleibt, die nun ihrerseits in einen ebenso starren Zustand gerät, weil sie dem Kind entsprechend leben muss. So formen sich die beiden gegenseitig. Mannoni sieht das Kind dann oft nur mehr als das Pflegeobjekt, das sich in der allumfassenden Mutter-Kind-Beziehung nicht als Subjekt erleben kann und von der Mutter auch nicht als ganzes Wesen gesehen wird.
Die Behinderung des Kindes kann bei den Eltern das eigene Kindheitstrauma neu beleben, selber zumindest in Teilen abgelehnt worden zu sein. Dies rührt wahrscheinlich an einen großen Schmerz, der abgewehrt und verdrängt werden muss.
Beim Kind können die Phantasien der Mutter eine große Beeinträchtigung seines Selbstbildes bewirken, gerade weil im Zusammenhang mit dem Auftreten einer Behinderung des Kindes viele Kränkungen bei den Eltern entstehen, die sie wiederum an das Kind weitergeben, wodurch sich auf beiden Seiten eine große Anfälligkeit für Kränkungen ausbilden kann.
"Durch die enge und anhaltend von ambivalenten Gefühlen gespeiste Beziehung kommt es zu einer Vermischung der Phantasien des Kindes über seine von ihm selbst wahrgenommene (defekte) Körperlichkeit und der projektiven Phantasien der Mutter über die Schädigung. Diese Interferenz erschwert dem Kind eine Differenzierung von Selbst und Objekt und behindert die Entwicklung seiner Eigeninitiative" (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 11).
Dabei ist die Tatsache wesentlich, dass das Kind die Phantasien der Mutter als seinen eigenen übergeordnet erlebt. Das Kind stellt sich auf den Platz ein, den es im mütterlichen Phantasma zugewiesen bekommt.
"Im Fall der mentalen Debilität wird die fehlende Intelligenz der Mutter dermaßen zu schaffen machen, daß sie den Mangel des Kindes anderen gegenüber immer als objektiv gegeben darstellen wird" (Mannoni 1972, S 69).
Diese Einstellung vermittelt sie auch dem Kind und deutet seine Äußerungen in Richtung der organischen Schädigung, so dass dem Kind die Möglichkeit genommen wird, sich anders zu entwickeln.
Ebenso wenig wie die Mutter den Teil des Kindes annehmen kann, der defekt ist, kann das Kind diesen Teil als zu ihm gehörig integrieren. Die Wut des Kindes auf seine Unvollständigkeit und auf die Mutter, die es so geboren hat, darf meist keinen Ausdruck finden, da ihm aggressives Verhalten nicht zugestanden wird. Die nicht gelebte Wut beim Kind - aber auch bei den Eltern - verhindert laut Mannoni, dass das Kind mit seiner Behinderung angenommen werden kann.
Das "Kind kann von sich selbst nicht das Bild eines einheitlichen Körpers haben; seine Stückhaftigkeit, die es in seine Zeichnungen überträgt, ist Ausdruck seiner Unfähigkeit, Subjekt zu sein [...]" (Mannoni 1972, S 26, Fußnote).
Die normalerweise in der Ödipalphase der kindlichen Entwicklung von den Eltern ausgehende Zurückweisung der erotischen Wünsche des Kindes, während es jedoch gleichzeitig ihre Zuwendung erlebt, muss das behinderte Kind auf einer viel grundsätzlicheren Ebene erfahren: Es fühlt sich abgewiesen aufgrund seiner Unvollständigkeit, wegen seiner Mängel.
Für die Mutter kann die enge Beziehung zum Kind zuweilen aber auch bedrohlich sein, vor allem, wenn sie das Kind in seiner Abhängigkeit von ihr als sehr fordernd erlebt.
"Auf dieses bösartige Tier, zu dem das Kind zeitweilig wird, reagiert die Mutter mit der Dressur, die die Angst vor dem nicht mehr zu erkennenden Menschen verbirgt" (ebd. S 26).
An dieser Stelle fallen mir die archaischen Ängste ein, die Niedecken für die Begegnung mit behinderten Menschen in der Gesellschaft beschreibt. Die Angst vor dem Triebhaften, Unkontrollierten, das uns behinderte Menschen in ihrem impulsiven Verhalten manchmal demonstrieren. Auch die Angst der Mütter, ein Monster geboren zu haben, gehört zu diesem Formenkreis.
Die Angst ist in der Beziehung zwischen Mutter und Kind sehr bestimmend und beeinflusst das Verhalten beider ganz entscheidend. Die Mütter können nicht ohne weiteres über ihre Phantasien sprechen, weil sie zu bedrohlich sind, andererseits aber ist "das Kind [..] immer in diese Phantasiewelt der Mutter einbezogen" (ebd. S 27) und damit auch in ihre Ängste.
Das Kind spürt demnach auch die Todesphantasien der Mutter und reagiert auf diese, indem es sich tot stellt, unscheinbar macht, ruhig ist und sich anpasst, um nicht Gefahr zu laufen, umgebracht zu werden. (vgl. Niedecken 1998, S 20)
In der großen Nähe zur Mutter nimmt das Kind aber die ambivalenten Gefühle auf, die sie ihm entgegenbringt. Es spürt die Enttäuschung, die Ablehnung und die Ängste, auch die Schuldgefühle und Aggressionen, die, weil nicht offen ausgedrückt, aber nebulös bleiben und damit ungleich bedrohlicher wirken müssen.
Die Ambivalenz dem Kind gegenüber zeigt sich oft in widersprüchlichen Erwartungen, die an das Kind gestellt werden. Einerseits soll es das unselbständige Pflegeobjekt bleiben, während es andererseits der Forderung nach altersgerechten Leistungen nachkommen soll.
Gerspach hält es für wichtig im Hinblick auf eine Entlastung von Schuldgefühlen bei den
betroffenen Eltern, dass sie ihren Phantasien rund um das Kind nachspüren können. Auch Mannoni und Niedecken halten es für wesentlich, dass betroffene Eltern den Raum zugestanden bekommen, um sich mit ihren ablehnenden, ambivalenten oder aggressiven Gefühlen dem Kind gegenüber auseinandersetzen zu können.
Um besser verständlich zu machen, wie schwierig dieses Anliegen für die Eltern wahrscheinlich umsetzbar ist, möchte ich ein Erlebnis anführen, das mich kürzlich sehr bewegt hat.
Bei der Geburtstagsfeier einer Freundin sind einige junge Mütter anwesend, die sich für diesen Abend für kurze Zeit von ihren Familien "frei genommen" haben. Eine dieser Mütter erzählt gerade von ihren Kindern im Alter von einem und vier Jahren, worauf eine andere sie fragt, ob die Kinder nicht manchmal sehr anstrengend seien. Sie antwortet: "Ja, doch, manchmal wünscht man sich schon, man könnte die Kinder zum Mond schicken - ohne Rückfahrkarte!" Sie sagt es lachend - es ist als Spaß gemeint - und richtet ihren Blick auf eine Mutter neben ihr, die ebenfalls wissend nickt.
Dieser Mutter ist etwas möglich, was der Mutter eines Kindes mit Behinderung niemals möglich wäre. So etwas kann man nur sagen, wenn man sich der Beziehung zum eigenen Kind ganz sicher ist und man keine reale Angst haben muss, dass das Kind wirklich nicht mehr da sein könnte. Und es gibt noch eine weitere Dimension: Was ich hier gut verstehen und als Scherz nehmen kann, würde mich bei der Mutter eines behinderten Kindes zutiefst erschrecken und betroffen machen. Ich denke, dass ich der Mutter eines behinderten Kindes einen solch scherzhaften Ausspruch nicht so leicht zugestehen könnte, und ich vermute darin meine Angst davor, dass mir dadurch eigene Tötungsphantasien vor Augen geführt werden könnten. Wenn die Mutter eines behinderten Kindes ihre Tötungsphantasien laut ausspricht, konfrontiert sie damit auch die sie umgebende soziale Umwelt mit ihren archaischen Ängsten, ihren eigenen verdrängten Mordphantasien.
Niedecken ist der Meinung, dass die Schuldgefühle der Eltern nicht ursächlich darauf zurückzuführen sind, dass sie sich schuldig daran wähnen, dass ihr Kind sich nicht normgerecht entwickelt, sondern dass sie Schuldgefühle eigentlich aus den geheimen Tötungsphantasien erwachsen. Abwertende Erlebnisse in der Umwelt verstärken unbewusst die eigenen Tötungswünsche der Mutter, die sie dann noch mehr verdrängen, abwehren muss. Die Mütter allein sollen den Hass der ganzen Gesellschaft tragen, was sie aber nicht können. "So erwachsen die Schuldgefühle ( für eine Schuld, die nicht die ihre ist, an der sie aber, wie wir alle teilhaben) ins Unermeßliche" (Niedecken 1998, S 55).
Niedecken spricht hier immer nur von der Mutter als derjenigen, die die meiste Zeit mit dem Kind verbringt und auch am häufigsten gemeinsam mit dem Kind den Reaktionen der Umwelt ausgesetzt ist, ich denke aber doch, dass auch die Väter von den hier beschriebenen Gefühlen in ähnlicher Weise betroffen sind.
Für Niedecken wäre es ganz entscheidend, wenn Eltern behinderter Kinder die Möglichkeit bekommen würden, sich mit ihren eigenen Mordimpulsen und dem gesellschaftlichen Anteil daran auseinandersetzen zu können.
Es wäre zwar gut, wenn die Mutter eines behinderten Kindes sich bewusst mit den Tötungswünschen ihrem Kind gegenüber auseinandersetzen könnte, aber wie soll sie das tun, wenn sie keine Unterstützung von ihrer sozialen Umgebung erhält, wenn von außen direkte oder indirekte Anspielungen auf den Unwert des Lebens ihres Kindes kommen, wenn sie von außen und innerlich mit Schuldgefühlen konfrontiert ist? In Niedecken schreibt eine Mutter von der "unheimlichen Versuchung" (Niedecken 1998, S 94), die angesichts bewusst gemachter Tötungsphantasien die Mutter befallen kann. Mütter behinderter Kinder können ihre ambivalenten Gefühle nicht ausdrücken, sie müssen sie unterdrücken, damit sie nicht in "Versuchung" kommen. Vor allem wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dass das Kind sterben könnte, wenn es nicht richtig gepflegt wird, ist der Spielraum für die Mutter sehr gering.
Dieses Beispiel zeigt vielleicht auch, dass professionelle Helfer, die es sich zum Ziel gesetzt haben, betroffenen Eltern diesen Spielraum für das Bewusstwerden ihrer Phantasien in einfühlsamen Gesprächen zu ermöglichen, auch bereit sein müssen, diese Gefühle gemeinsam mit ihnen auszuhalten und sich auch mit ihren eigenen Phantasien rund um die Behinderung auseinander zu setzen.
Ich würde sagen, dass die "Ent-Täuschung" vom phantasierten Kind jede Mutter durch die Geburt des realen Kindes erlebt. Aber im Gegensatz zur Mutter eines mit Behinderung zur Welt gekommenen Kindes bleibt einer anderen Mutter genügend Zeit, um durch das Zusammenleben mit ihrem Kind langsam ihre Vorstellungen abzubauen und sich mit dem zu identifizieren, was wirklich ist. Der Übergang vom Wunschkind zum realen Kind geschieht allmählich, fließend und lässt ihr genügend Raum für Phantasien, die sie in vielen Variationen durchspielen kann. Sie kommt ganz selbstverständlich dazu, zu sagen: So ist es und es ist gut so, wie es ist.
Dagegen wird die Mutter des behinderten Kindes mit einem Schlag all ihrer Träume und Hoffnungen beraubt, und sie steht vor der Aufgabe anzuerkennen, wie es ist, lange bevor sie sagen kann: Es ist in Ordnung ( und noch lange nicht: es ist gut ) so, wie es ist, es darf so sein.
Im Normalfall ist es die wachsende Autonomie des Kindes, die dazu führt, dass das Kind nicht länger der Träger des mütterlichen Phantasmas bleibt. Nun wird dem behinderten Kind eine solche Autonomie von vornherein gar nicht zugestanden, was es gezwungenermaßen in den mütterlichen Phantasien verhaftet sein lässt.
Die Phantasien, Vorstellungen und Gefühle, die bei den Eltern bezüglich ihres Kindes da sind, bedingen den Raum, in dem sich das Kind letztendlich entwickeln kann.
Was allen psychoanalytisch orientierten Arbeiten zu diesem Thema gemeinsam ist, ist die Auffassung, dass es besonders wichtig ist für das Gelingen einer Eltern-Kind-Beziehung unter solch erschwerten Bedingungen, dass diese Phantasien der Eltern im Dialog ausgedrückt werden können. Im Dialog mit Menschen der sozialen Umgebung, mit Fachleuten, aber auch im Dialog mit dem Kind selber.
Gerade hier sehen die Autoren der Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung (Funk 2000) einen Handlungsauftrag in der Frühförderung.
"Wenn diese Prozesse in der Frühförderung gespürt, verstehend aufgenommen und wirksam werden können, erreichen die Förderhandlungen die Entwicklungsdimension, die nach dem heutigen Stand der Forschung persönliche Strukturen und Fähigkeiten des Kindes im Dialog mit seiner Familie und den Spielkameraden entfalten und wachsen lassen." (Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung, 2000, S VII )
Im Verhalten der beiden Elternteile nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung sieht Mannoni große Unterschiede. "Gerade die Mutter wird gegen die Untätigkeit und Gleichgültigkeit der Gesellschaft einen langen Kampf führen, in dem es um die Gesundheit ihres von der Gesellschaft verstoßenen Kindes geht" (Mannoni 1972, S 19). Diese aktive Zuwendung zum Kind sieht sie in krassem Gegensatz "zum Vater, der niedergeschlagen, resigniert, blind ist oder nicht begreift" (ebd. S 19). Während sich der Vater also eher aus seiner Rolle als Vater und Mann zurückzieht, geht die Mutter oftmals ganz in der Sorge um das Kind auf.
Tatsächlich kann man als Frühförderin in den meisten Familien beobachten, dass es die Mutter ist, die sich um immer neue Therapieangebote für das Kind bemüht oder die den Kampf aufnimmt mit gesellschaftlichen Instanzen, die ihr etwa eine Integration des Kindes verwehren wollen. Mannoni meint: "weil das Kind dank ihr nicht mehr ein totaler Krüppel ist, möchte sie etwas daraus machen, es ausbilden lassen" (ebd. S 21).
Ich werde nie vergessen, wie ich mit David und seiner Mutter auf dem Weg zum zuständigen Schulamt für Integration war und sie mit ihm die Begrüßung des Schulamtsleiters einübte. David wiederholte immer wieder brav die höfliche Anrede und den Namen des Schulamtsleiters. Wenig später begrüßte David ihn dann tatsächlich ganz persönlich und ohne Stocken, was seiner Mutter viel Anerkennung einbrachte, und es folgte eine sehr positiv verlaufende Unterhaltung bezüglich Davids Integration. Die Mutter hatte der Behörde sozusagen ein sehr zivilisiertes, den Umgangsformen angepasstes und perfekt trainiertes Kind vorgeführt und war damit auch mit großem Entgegenkommen belohnt worden. Noch viele Frühfördereinheiten danach tauchte der Name des Beamten immer wieder in Davids Erzählungen auf.
Die Mutter ist dem Kind notwendigerweise zugewandt, gleichzeitig aber verstrickt in Schuldgefühle und erfüllt von Phantasien das Kind und die Behinderung betreffend, wie etwa von der Vorstellung vom unbeherrschten, triebhaften Wesen, das ihr in ihrem Kind begegnet. Gerspach sieht darin die Projektion der Vorstellung vom eigenen Inzest und vermutet dadurch eine gewisse Entlastung von Schuldgefühlen bei der Mutter. Er sieht die oft übermäßige Zuwendung zum Kind als Versuch der Wiedergutmachung und wähnt in den Schuldgefühlen den Grund für die Hemmung von Aggressionen dem Kind gegenüber. (vgl. Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 10)
Die Situation der Mütter ist dabei eine prekäre: einerseits sind sie sehr einsam, werden oft von ihrer sozialen Umgebung allein gelassen und fühlen sich wegen ihres Kindes als Mensch nicht anerkannt; andererseits werden sie genauestens beobachtet und müssen ihre Gefühle verstecken, um ihr Gesicht zu wahren. Gerade am Anfang geschieht es häufig, dass die Mutter mit der Sorge für ihr behindertes Kind, die voraussichtlich eine lebenslange Aufgabe zu sein scheint, alleine gelassen wird.
"Das Fehlen des Dialogs und die totale Einsamkeit zu zweit sind verantwortlich für die Angst und die Depression dieser Mütter, die in den Augen der Welt ihr Schicksal so tapfer tragen" (Mannoni 1972, S 23, Fußnote).
Jede Mutter wird diese Situation auf die ihr eigene Weise lösen, wobei sie auf ihre bisherigen Erfahrungen, ihre Biographie zurückgreifen wird. Die präödipalen Funktionen der Mutter, die Versorgung und Kontrolle entsprechen und sich im Halten, Tragen und Versorgen des Kindes ausdrücken, werden auf besondere Weise herausgefordert.
"Die einerseits notwendige Übernahme von Ich-Funktionen und die Bereitschaft, in einem erweiterten Maß als üblich als mütterliches oder väterliches Hilfs-Ich dem Kind zur Verfügung zu stehen, gerät auf der einen Seite in die Gefahr, ‚überkompensiert' zu werden und die Kinder als ewige Babys zu behandeln und ihnen damit jegliche Form von Autonomie zu rauben" (Fröhlich 1994, S 154). Andererseits besteht die Gefahr, dass "durch die Kränkung des mütterlichen Narzißmus, über die Tatsache ein behindertes Kind geboren zu haben, die notwendige emotionale Unterstützung für das Kind ganz oder teilweise unmöglich wird" (Fröhlich 1994, S 154).
"Die Wahrscheinlichkeit, daß sich das behinderte Kind mit einer Objektwelt auseinander zu setzen hat, die auf seine Bedürfnisse entweder mit emotionaler Unterversorgung oder schuldvoller Überkompensation reagiert, liegt besonders hoch" (Fröhlich 1994, S 154).
Für den Vater ist es sehr schwer, in die enge Mutter-Kind-Beziehung einzutreten.
"Wir haben festgestellt: Das kranke Kind wird sehr selten in eine Dreierbeziehung einbezogen" (Mannoni 1972, S 24).
Mannoni begründet die oftmals beobachtbare Distanz des Vaters mit seiner aus psychoanalytischer Sicht bestehenden Rolle als Hüter des Gesetzes:
"Als Garant des Gesetzes kann der Vater jedenfalls nur fassungslos auf ein Kind reagieren, das von Anfang an außerhalb aller Normen leben wird" (ebd. S 25).
Was hier klingt, als würde Mannoni von der Unabdingbarkeit der Schwächen des Kindes ausgehen, widerlegt sie sehr deutlich in den Beispielen ihrer gelungenen Therapien mit schwer zurückgebliebenen Kindern. Ich denke, dass sie hier Bezug nimmt auf die ersten Gedanken und Annahmen der Eltern, wenn sie erfahren, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt.
Allgemein treten für Mannoni die Väter eher in den Hintergrund, was sie damit begründet, dass ein Mann durch die Geburt seines behinderten Kindes niemals auf dieselbe Weise betroffen sein kann wie die Mutter und die Bedeutung dieser Situation nicht derart intuitiv erfassen kann wie sie. Mutter und Kind bilden eine Einheit, in der die Mutter auch jede Kränkung des Kindes wie eine eigene erfahren muss. Trotzdem würde ich aber nicht unbedingt derselben Meinung sein, was die Betroffenheit anbelangt. Ich denke, dass Väter durch ihre Sozialisation als Männer nur eine andere Art der Bewältigung gelernt haben und auch zeigen, und es ihnen ihre Stellung als "Familienerhalter" eher ermöglicht, aus schwierigen Situationen nach außen zu flüchten.
Meiner Meinung nach bedingt die Geburt eines behinderten Kindes gerade in den ersten Jahren oftmals eine traditionelle Rollenverteilung im Zusammenleben seiner Eltern. Man nimmt allgemein an, dass ein Kind mit Schwierigkeiten, ein Kind mit besonderen Bedürfnissen mehr Pflege und Zuwendung benötigt, was augenscheinlich besser erfüllen zu können immer noch der Frau zugesprochen wird.
Gerspach spricht davon, dass der Vater sich innerlich entzieht "oder er entwickelt gar die Vorstellung, nicht der leibliche Erzeuger und also nicht am Inzest beteiligt zu sein" (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 14).
Jedenfalls entspricht diesen Überlegungen ein in der Frühförderung beobachtbarer realer Rückzug des Vaters vom Kind.
Ich möchte dieses Kapitel gerne mit der Schilderung eines Vaters einleiten, die sehr genau beschreibt, in welcher Situation sich Eltern befinden, wenn sie mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert werden. Alfried Längle ist selber Arzt, Psychologe und Psychotherapeut und veröffentlichte diese Schilderung im Tagungsbericht "Behinderung als menschliches Phänomen" der Gesellschaft für Existenzanalyse und Logotherapie (1996).
"Da wir vor einigen Jahren selbst ein behindertes Kind bekommen haben, kann ich über diese Situation aus eigener Erfahrung und unmittelbarer Betroffenheit sprechen. Unser Sohn Armin ist geistig behindert. Er hat ein Down-Syndrom. Wir wissen nicht, warum gerade wir ein mongoloides Kind bekommen haben. Wir wissen nicht, ob uns ein Unrecht widerfahren ist oder ob dies eine Strafe sein soll oder eine Auszeichnung, die wir nicht verstehen. Eigentlich haben uns diese Fragen nicht beschäftigt.
Wir haben seine Behinderung als großen Schmerz empfunden. Und der hat uns sehr beschäftigt. Ich selbst empfand eine Erschütterung wie bei einem KO-Schlag: Für einen Augenblick glaubte ich, jetzt sei alles aus. Es war, als ob die Welt zerbrechen würde und ich ins Nichts stürzen würde. Für einen Augenblick hatte alles in mir gestockt - für einen Augenblick war ich fassungslos. Und wie betäubt und doch in einem überklaren Bewußtsein sagte ich dem Kollegen, der mich mit kurzen Worten aufgeklärt hatte, und sagte es eigentlich zu mir selbst: "Es ist, wie es ist". Ich spürte, wie mir dieser Gedanke Halt gab und Entlastung brachte. "Es ist so!" - Das heißt auch, ich brauche nichts zu verändern, kann nichts ändern. Das Kind ist da, es ist schon da, mit der Behinderung, und ich bin trotzdem noch. Es ist da, und es ist möglich, daß es da sein kann! Die Welt hält es tatsächlich aus.
"Es ist so!" Meinetwegen, ich habe es nicht gemacht, nicht so geplant. Es kann das Kind meinetwegen auf der Welt sein, ich kann es zulassen, kann es lassen. Es ist, wie es ist. Ich hätte ihm und uns ein anderes Leben gewünscht, mein Gott! Wir werden sehen, was zu tun ist, was wir können, was wir nicht können, was wir mit ihm machen. Das muß nicht heute schon entschieden werden.
So dachte es in mir, so empfand ich - sah ich, und es war ein besonderes, ungewöhnliches Sehen, als ich dieses "Es ist, wie es ist" sagte. Es war ein Blick in die Tiefe der Existenz, die sich mir in diesem Abgrund für einen Augenblick aufgetan hatte. Der Schrecken war aufgefangen, ich war wieder ruhig, konnte die Situation vorläufig annehmen - aber konnte ich den Sohn annehmen? Ich hatte mich wieder gefaßt, ich wußte nun, ich würde mir zu helfen wissen und weiterleben können - aber ich hatte von jetzt ab einen behinderten Sohn. - Was wird aus ihm, wie wird es uns miteinander gehen?
In der nächsten Stunde untersuchte der Professor den Kleinen in meinem Beisein. Wie in einer Vorlesung über das Down-Syndrom zählte er mir die Defekte auf, immer den Satz wiederholend: "Wie es typisch für das Syndrom ist, wie Sie ja wissen, Herr Kollege." In mir brannte der Schmerz und die Trauer für das Kind. Im kalten und gefühllosen Ton des Arztes klang ein Vorwurf an. Sein "Wie Sie ja wissen" klang wie: "Sie hätten es ja wissen müssen, Herr Kollege". Mir sagte es : "Wie kann Ihnen so etwas passieren? Ihnen als Arzt? Das ist doch heute nicht mehr nötig, es ist geradezu fahrlässig, ein Kind mit Down-Syndrom in die Welt zu setzen. Da gibt es doch die pränatale Diagnostik. So ein Kunstfehler dürfte einem Arzt heute nicht mehr passieren!"
In mir aber brannte der Schmerz für das Kind und für uns, und der Vorwurf hätte mich ungemein schuldig fühlen lassen, wenn wir diese Frage nicht vorher für uns beantwortet hätten. So erlebte ich das erste "Nein", die erste Ablehnung, die dem Kleinen und mir entgegenkam. Aber ich spürte, wie sich mir im Innersten die Frage an den Arzt auftat, was er eigentlich vom Leben verstehe?
In den nächsten Tagen beschäftigte mich vor allem die Frage, worin der Schmerz nun eigentlich bestehe? Was tat so weh, noch immer so weh, jetzt, nachdem ich den Schrecken überstanden hatte und die Situation mit einem behinderten Kind angenommen hatte? - Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf, wie es wohl sein wird mit ihm, wenn er in den Kindergarten kommt, in die Schule, wenn wir alt sind. Alle möglichen Szenarien tauchten auf und taten weh. Aber der größte Schmerz, fand ich dann nach Tagen heraus, der größte Schmerz war die Angst, daß ich ihn vielleicht nicht lieben könnte. Daß die Behinderung meine Liebe behindern könnte. Daß ich immer nur die Behinderung und nicht ihn als Person sehen könnte. Es war die Angst, vielleicht das eigene Kind nicht lieben zu können. Ich spürte: Die Behinderung kann ich nicht lieben.
Als ich das erkannt hatte, versuchte ich, ihn zu sehen, ihn, der er ist. Die Behinderung wurde mir nebensächlich. Ich wollte sehen, was er kann, was er will, was er tut, was er erlebt. Ich wollte ihn nicht mehr im Vergleich mit anderen sehen, wo ich dann nur noch die Defizite sah. Durch das Betrachten der allgemeinen Strukturen ("er müte doch - er könnte doch") verliert die Beziehung ihren personalen Charakter und das Verhalten wird "gemein". Ich wollte ihn in seiner Ganzheit, in seiner Welt und in seiner Art sehen.
(Längle in Tagungsbericht der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse 1996, S 56/57)
Dieser Bericht zeigt meiner Meinung nach sehr wichtige Elemente der Situation der Eltern nach der Diagnosemitteilung. Längle spricht von einem KO-Schlag, er fühlte sich wie betäubt, für einen Augenblick schien die Welt stillzustehen. Von diesem Schock, der Lähmung nach der Mitteilung der Diagnose sprechen auch anderen Eltern in ihren Erfahrungsberichten ( vgl. Hinze 1993, S 117f; Kriegl 1993, S 20ff; Miller 1997; Fröhlich A. 1993; Lambeck 1992; Ziemen 2002).
Jonas sieht in der Betonung des Verlustes des idealen Kindes eine Reduzierung der Problematik, mit einem Kind mit Behinderung zu leben. Die große Erschütterung bezieht sich nicht nur auf den Verlust des idealen, erträumten Kindes, sondern auch auf den Verlust der eigenen Lebensplanung, der persönlichen Lebenswünsche der Eltern - Jonas spricht von einem doppelten Verlust. (vgl. Jonas 1990, S 40ff)
Aus dieser Sicht kann man auch den großen Schmerz besser verstehen, den Längle in seinem Bericht zum Ausdruck bringt.
Die Diagnose hat aber nicht nur Auswirkungen auf die emotionale, sondern auch auf die faktische Situation der Eltern. Die Geburt eines Kindes mit Behinderung führt immer zu einer umfassenden Veränderung der Lebensumstände der Eltern und der Familie. Meist trifft die Behinderung des Kindes die Eltern völlig unerwartet und unvorbereitet. "Ihre Vorstellungen vom Leben mit Behinderten sind sozialisationsbedingt von negativ stereotypen Vorstellungen geprägt" (Lambeck 1992, S 11). Lambeck bezeichnet die Geburt eines behinderten Kindes als nicht-normatives, d.h. als unerwartet eingetretenes und deshalb vorerst unkontrollierbar erscheinendes Lebensereignis, das für die Eltern bedeutet, ihre bisherige Lebensführung und ihre bisherigen Lebensziele neu zu überdenken. (vgl. ebd. S 11ff)
Wie Längle es beschreibt, beschäftigen sich die Eltern schon in dieser ersten Phase damit, wie sich ihr Leben mit dem behinderten Kind nun verändern wird. Sie fragen sich, was jetzt wohl alles auf sie zukommt. Nicht nur die Behinderung des Kindes, sondern auch der bange Blick in die ungewisse Zukunft lässt bei den Eltern große Ängste und große Niedergeschlagenheit aufkommen. Dazu kommt noch die durch die Diagnose vermittelte Überzeugung, als Eltern nicht den besonderen Bedürfnissen dieses Kindes gerecht werden zu können. Die Eltern werden in ihrer erzieherischen Kompetenz, in ihrer elterlichen Identität durch die Diagnose und die Art ihrer Mitteilung sehr stark verunsichert.
Was Längle in seinem Bericht sehr eindrucksvoll ausführt, gilt für die Mehrheit der betroffenen Eltern: die Diagnosemitteilung bleibt ihnen in sehr negativer Weise in Erinnerung. Das hat einerseits natürlich mit dem Schock zu tun, den die Diagnose bei den Eltern auslöst, andererseits aber mit der oft wenig einfühlsamen Art, in der sie den Eltern vom Arzt überbracht wird. Das Verschweigen der Diagnose, das Ausweichen, Hinauszögern, Beschwichtigen, Beruhigen bis hin zu völlig nüchterner, unvollständiger Information sind nur einige Beispiele für den Umgang mit den Eltern in dieser für sie so schwierigen Situation. Nicht selten wird einem Elternteil die Diagnose allein mitgeteilt. Dieser hat dann die Aufgabe, sie dem jeweils anderen zu überbringen. Kriegl beschreibt den Arzt dabei als reinen Funktionsträger, der den Eltern oft keinerlei Halt bietet. (vgl. Kriegl 1993, S 20f)
Die Gründe für die oft eher unbefriedigende Diagnosemitteilung sieht sie auf ärztlicher Seite in Zeitmangel, Unkenntnis, mangelnder Fähigkeit, ein solches Gespräch zu führen, und in uneingestandenen Ängsten wie etwa der Angst, eine schlechte Botschaft überbringen zu müssen oder Angst vor den direkten Gefühlsäußerungen der Eltern und der Angst davor, kein Allheilmittel anbieten zu können.
"Anstatt die Wärme, Nähe und Verbundenheit mit dem Kind genießen zu können, sind die Eltern jetzt plötzlich einer Vielzahl von Ängsten, Sorgen und Streßfaktoren ausgesetzt" (ebd. S 21).
Susanne Lambeck definiert in ihren Ausführungen zur Diagnosemitteilung das Ziel einer angemessenen ärztlichen Intervention, das aus ihrer Sicht darin bestehen sollte, "den Eltern ein Höchstmaß an Kontrolle und überschaubaren Perspektiven zu geben, die ihnen eine konstruktive Bewältigung dieses Lebensereignisses erlauben bzw. erleichtern" (ebd. S 16)
Mit der Diagnose wird den Eltern aber meist Hoffnungslosigkeit, Perspektiven- und Zukunftslosigkeit vermittelt durch eine düstere, jedoch auch vage und ungenaue Prognose.
Manchmal ist das Überleben des Kindes noch nicht sicher und die Eltern sollen über lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden. Sie müssen im Extremfall darum kämpfen, dass die Ärzte ihr Kind retten und nicht einfach sterben lassen. Eltern erleben aber auch beim Pflegepersonal einen oft eher rauen, nicht liebevollen Umgang mit dem Kind - und in der Art, wie über die Behinderung gesprochen wird, erfahren sie zudem viel Abwertung. (vgl. Lambeck 1992)
Ziemen bemerkt dazu, dass Eltern auf der Basis der Art und Weise der Diagnosemitteilung Veränderungen in ihrem sozialen Kontext erfahren müssen, die sie als "soziale Regelverletzungen" bezeichnet. "Die sozialen Regelverletzungen und nicht vordergründig das behinderte Kind werden zum belastenden Faktor für die gesamte Familie" (Ziemen 2002, S 174). Dabei versteht sie unter "sozialen Regeln" alle den zwischenmenschlichen Umgang bestimmenden Grundsätze wie etwa gegenseitige Achtung, Respekt, Bereitschaft zum Dialog und zur Unterstützung. Ziemen ortet im Umgang mit Eltern behinderter Kinder rund um die Diagnoseeröffnung zahlreiche Kränkungen und Verletzungen durch solche sozialen Regelverstöße.
"Kränkungen und Verletzungen führen letztlich zum Bruch von persönlichem Sinn. Negative Emotionen oder das Maß der emotionalen Nichterfülltheit der Tätigkeit können Indizien dafür sein, dass Sinn verloren gegangen ist. Was damit verloren gehen kann, ist ein bestimmter im Habitus gespeicherter Sinn, der im bisherigen Leben als sinnhafte Grundlage und Orientierung gegolten hat. Sinn als bloßer Sinn geht damit nicht gänzlich verloren, sondern sucht sich eine neue bislang unbekannte Grundlage bzw. eine andere Bedeutung" (Ziemen 2003, S 31). Meiner Meinung nach spricht Ziemen hier die für die Eltern nun bestehende Notwendigkeit an, ihre Lebensführung neu zu organisieren, sich allmählich mit dem Unausweichlichen zu konfrontieren, sich langsam von unerfüllbaren Hoffnungen zu verabschieden, die Verantwortung für das eigene Leben und das des Kindes in die Hand zu nehmen und den Sinn in ihrem Leben wieder neu zu definieren. Diese Aufgabe kann durch die permanente Erfahrung sozialer Regelverstöße natürlich sehr erschwert werden.
Ziemen sieht die Eltern durch die Behinderung des Kindes in verschiedenen Feldern herausgefordert: im medizinischen, im pädagogisch-psychologischen, im therapeutischen, ökonomischen und sozialen Feld. Dabei spricht sie von der großen Gefahr, dass die Eltern in diesen unterschiedlichen Feldern sehr leicht an den "Pol der Ohn-Macht" gedrängt werden, während die Fachleute, die sogenannten "Wissenden", am "Pol der Macht" stehen.
Rund um die Diagnosemitteilung sind die Eltern hauptsächlich mit dem medizinischen Feld und mit der dort herrschenden Macht des Arztes konfrontiert. Ziemen sieht den Arzt in einer herausragenden Machtstellung, da seine Diagnosestellung ausschlaggebend ist für die Inanspruchnahme entsprechender Institutionen oder Hilfen. Die Eltern sind dabei vor allem durch ihr (noch) fehlendes Wissen zunächst völlig abhängig von den Experten und somit in der Position der Ohnmacht. Sie müssen die Kompetenzen in den verschiedenen Feldern erst erwerben, um "kämpfen" zu können. (vgl. Ziemen 2002, S 199)
"Bewegen sich Eltern, zwangsläufig hervorgerufen durch die Existenz des behinderten Kindes, in den medizinischen, pädagogischen Feldern, müssen sie zumeist den Platz am Pol der Ohn-Macht einnehmen und sind auf das Anerkennen und Wertschätzen der ‚Professionellen' und zugleich auf deren Gunst angewiesen. So entsteht ein einseitiges Abhängigkeits- und Machtverhältnis" (ebd. S 199).
Ziemen berücksichtigte in ihren Interviews mit den Eltern behinderter Kinder vor allem das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, also den gesellschaftlichen und sozialen Anteil an der Situation der Eltern. "So sind in unterschiedlichen Feldern Veränderungen der sozialen Situation der Eltern nachzuweisen, wobei diese mit mangelnder Anerkennung oder Wertschätzung [...] einhergehen" (ebd. S 199).
Was für Ziemen die Lage der Eltern und ihrer Kinder und die weitere Entwicklung ihres Lebens maßgeblich beeinflusst, sind die zahlreichen Widersprüche, in denen Familien behinderter Kinder leben müssen.
Einen grundlegenden Widerspruch sieht Ziemen "zwischen der Tatsache als Eltern sein Kind bedingungslos zu lieben (das erwartet die Gesellschaft) und andererseits der Wahrnehmung, dass genau dieses Kind nicht den ‚normativen' Kriterien der Gesellschaft entspricht" (ebd. S 169). Dies ist also der Widerspruch zwischen dem Wunsch, das Kind lieben zu können und andererseits aber der realen Erfahrung der Ablehnung, wie es auch Längle beschreibt, wenn er von seinem Ringen darum berichtet, seinen Sohn lieben zu können. Längle spricht von seinem Bemühen, durch die Behinderung hindurch seinen Sohn als Person, als fähiges Individuum mit eigenen Wünschen wahrnehmen zu können. Diesem Bemühen entspricht der Widerspruch zwischen den herkömmlichen gesellschaftlich vermittelten Wertvorstellungen über insbesondere die geistige Behinderung und dem individuellen Erleben des eigenen geliebten Kindes. Dieser Widerspruch wird nach Ziemen noch dadurch verschleiert, dass Eltern das Problem der Behinderung alleine auf sich nehmen und die Lösung in ihrem eigenen Zurechtkommen damit sehen.
Einen Grundwiderspruch sieht Ziemen aber zwischen dem Wert und der Abwertung der Eltern "in dem Maße, wie sich die Eltern einerseits als wert und würdig erleben, die Elternrolle uneingeschränkt ein- und wahrnehmen zu können, andererseits jedoch Abwertung sich selbst und dem Kind gegenüber erfahren" (Ziemen 2003, S 31). Sie meint, dass die gesellschaftlichen Tötungswünsche in den Vorstelllungen und Haltungen der die Familie umgebenden sozialen Welt präsent sind und Eltern diese Angriffe nicht nur auf ihr Kind, sondern auch auf sich selber bezogen erleben.
In meinen Augen spielt vielleicht gerade deshalb die Ambivalenz zwischen Wert und Abwertung auch im Frühförderprozess eine so große Rolle. Ich denke, dass die Eltern durch die zahlreich erfahrenen Kränkungen sehr verletzbar gemacht werden und sie in Konfliktsituationen ihre selber erlebte Abwertung zumeist unbewusst an die Frühförderin weitergeben und diese wiederum Gefahr läuft, die Eltern abzuwerten, wodurch leicht ein Kreislauf der gegenseitigen Kränkungen und damit der Entwertung entstehen kann.
Im Laufe der weiteren Entwicklung des Kindes nehmen die Eltern einen Widerspruch als besonders schmerzlich und andererseits doch hoffnungsverheißend wahr: den Widerspruch zwischen der Diagnose und Prognose und der Realität, der tatsächlichen Entwicklung des Kindes. Die zumeist sehr negativ und defektorientiert formulierte Diagnose und die düstere Prognose steht oft in krassem Gegensatz zur tatsächliche Entwicklung des Kindes. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, wie wenig sich eine Entwicklung schon bei einem nicht behinderten Kind vorhersagen lässt. Die für die Eltern aber anfangs feststehend scheinende Diagnose wird so in Anlehnung an Niedecken und Elbert zur Schlüsselstelle der Formation der Behinderung, da sie die Beziehung zwischen Eltern und Kind schlagartig wenn nicht gar zerstört, so zumindest verändert, ich möchte sagen: behindert.
Ziemen unterscheidet wie die meisten Autoren (vgl. etwa Hinze 1993) drei Zeitpunkte der Diagnosestellung: "vor der Geburt, kurz nach der Geburt und erst allmählich, nach einem langen Weg der Vermutungen, Hoffnungen und Ängste" (Ziemen 2002, S 164).
Wird die Diagnose noch vor der Geburt des Kindes gestellt, bewirkt sie eine Verschiebung der Eltern in Richtung "Pol der Ohn-Macht". In dieser Phase bekommen die Eltern meist mit der Diagnose auch das Angebot mitgeliefert, das Kind zu töten, nicht zur Welt zu bringen. Der am "Pol der Macht" angesiedelte Arzt beeinflusst die Entscheidung der Eltern, die mühevoll die Kraft aufbringen müssen, um gegen diese Macht nein und ja zum Kind sagen zu können. Nicht selten werden Eltern wegen ihrer Entscheidung für das Kind noch weiter abgewertet.
Wie schwierig sich eine solche Situation für Eltern darstellt und welch enorme Kräfte sie mobilisieren müssen, um sie durchzustehen, kann ich nur erahnen. Spürbar wird dies vielleicht am Beispiel eines Elternpaares, das ich im Laufe meiner Arbeit kennenlernen durfte.
Als mir die Mutter am Beginn unserer Zusammenarbeit meinen zukünftigen Arbeitsplatz, das Wohnzimmer, zeigte, fielen mir sofort die wunderschönen Bilder auf, die das ganze Zimmer schmückten. Bei genauerem Hinsehen entpuppten sich diese Bilder als aus tausenden Puzzleteilchen mühevoll zusammengesetzte Kunstwerke. Ich fragte die Mutter danach, wer diese sicherlich sehr zeitaufwändige Arbeit vollbracht hatte. Da erzählte sie mir von den schwierigen letzten Schwangerschaftsmonaten, als ihr Mann und sie schon von der Behinderung ihres Kindes wussten und in denen diese Bilder in gemeinsamer Arbeit entstanden waren. Diese Puzzles scheinen mir fast sinnbildlich zu sein für die tatsächlich puzzleartigen Aufgaben, die auf eine Familie mit der Behinderung ihres Kindes zukommen: ein mühevolles allmähliches Zuständigwerden für die eigenen Belange und die des Kindes, ein Erwerben von vielen Kompetenzen, die die Familie schlussendlich befähigen, selbstbestimmt ihren eigenen Weg zu gehen.
Auch bei der Mitteilung der Diagnose kurz nach der Geburt werden die Eltern durch die Vorgänge im Krankenhaus und durch die Erfahrungen mit Ärzten sehr leicht an den "Pol der Ohn-Macht" gedrängt. Das geschieht durch eine ungenaue, diffuse, unklare Diagnose und Prognose, durch Trennung von Kind und Mutter und durch das Alleinegelassen-Werden der Eltern in dieser unsicheren, instabilen Situation. Oft kommt es zu nur vermuteten Diagnosen aufgrund undefinierter "Komplikationen" oder zu unterschiedlichen Diagnosen von unterschiedlichen Ärzten, wobei die ursprüngliche Diagnose wieder revidiert werden muss. Dabei ist mit dem Aussprechen der Diagnose die Entwicklung des Kindes schon von vorneherein behindert: durch die Verunsicherung der Eltern in ihrer Beziehung zum Kind, durch die Verunsicherung der elterlichen Kompetenz und der elterlichen Zuversicht, für dieses ihr Kind eigenverantwortlich zuständig sein zu können und durch die ausgesprochene Diagnose, die die Vorstellungen der Eltern von nun an bestimmt und somit auch ihre Erwartungen an die Entwicklung und die Persönlichkeit des Kindes.
Wird die endgültige Diagnose erst nach einer langen Zeit der Ahnungen und Befürchtungen der Eltern gestellt, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmen könnte, so geschieht die Verschiebung der Eltern hin zum "Pol der Ohn-Macht" in einem langsamen Prozess. Das Bild vom geliebten "normalen" Kind, die Hoffnung auf ein Leben mit ihm nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen bricht allmählich zusammen. Am Anfang steht eine Vermutung, eine Ahnung der Eltern, dazwischen gibt es immer wieder aufkeimende Hoffnung durch die vielen Vertröstungen von ärztlicher Seite her. Die Vermutungen der Eltern, die auf der genauen Beobachtung ihres Kindes beruhen, werden oft nicht ernst genommen und bagatellisiert. Die Zeit der Unsicherheit, der Ängste und Hoffnungen dauert damit an und verstärkt die große Verunsicherung der Eltern ihrem Kind gegenüber.
Ziemen sieht eine große Diskrepanz zwischen der Zeit, in der die Eltern ein gesundes Kind haben, das sich normal entwickelt und der Zeit, in der die Eltern eine Regression in der Entwicklung wahrnehmen oder sie Kenntnis erhalten von der Behinderung oder Störung ihres Kindes. Dazwischen liegt meist noch eine geraume Zeitspanne eigener Befürchtungen oder erster Hinweise auf eine Behinderung, die von außen, in vielen Fällen von der Kindergärtnerin oder der hinzugezogenen Beratungskindergärtnerin stammen. Die Beobachtung des Kindes verändert sich in dieser Zeit, der Blick auf das Kind ist ein anderer. Die Eltern schauen plötzlich genau auf Besonderheiten, Abweichungen, Defekte und schließlich schauen sie durch die Folie der angenommenen Behinderung, Auffälligkeit oder Störung. Wenn man in diese Überlegungen mit einbezieht, dass das Kind diese Veränderungen wahrnimmt und die Ängste der Eltern intuitiv erfassen kann, muss man von einem wechselseitigen Prozess ausgehen, innerhalb dessen sich die Behinderung erst formiert. Auch wenn in diesem Fall schon eine Beziehung der Eltern zu ihrem Kind besteht, so denke ich dennoch, dass diese Beziehung ebenso wie nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung zutiefst verunsichert und erschüttert werden kann. Die Gefühle der Eltern, ihre emotionale, psychosoziale und faktische Situation ist der Situation der Eltern nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung sehr ähnlich. Auch wenn man annehmen könnte, dass diese Eltern ja länger Zeit gehabt haben, sich mit der Behinderung ihres Kindes allmählich zu konfrontieren, glaube ich, dass es für sie ebenso einen Schlag, eine unerwartete Wendung der Bedingungen ihres Lebens darstellt und sie ebenso erst vor der Aufgabe stehen, mit diesen Veränderungen zurechtkommen zu müssen.
Die faktischen Veränderungen im Leben der Familie mit behindertem Kind möchte ich gerne mit den Worten Günther Emleins beschreiben, der Behinderung als Lebenslage definiert:
Behinderte Kinder brauchen mehr Pflege und Betreuung. Es ist also rein praktisch mehr zu tun, die faktische Belastung der Eltern im Alltag ist größer, ihre Anerkennung aber meist geringer. Die Fördermaßnahmen, Therapien, Elternnachmittage oder -abende, Arztbesuche etc. brauchen viel Energie und Zeit. Es bleibt den Eltern und der gesamten Familie weniger Zeit für Freizeitaktivitäten, für sich selber, für Hobbys oder Freunde. Das Helfernetz, das die Familie mit der Zeit umgibt, wird zu einem Teil des Familienlebens.
"Privatheit und familiäre Selbstregulation können durch solche Umstände schnell unterlaufen werden. Nichtbetroffene können die Wirkungen eines Helfernetzes auf betroffene Familien kaum abschätzen" (Emlein in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 107).
Die Familie hat einen Sonderstatus in der sozialen Umwelt. Es besteht viel Erklärungsbedarf, und die Familie ist den unterschiedlichen Reaktionen der Umgebung ausgesetzt, auch Kommentaren, Ratschlägen Abwertung und Ablehnung. Die Familie mit behindertem Kind ist mit Wertungen konfrontiert, die von der Gesellschaft auf sie zukommen und die ihre Familienwirklichkeit als "Unnormalität" bezeichnen. Insgesamt sieht Emlein bei den Familien behinderter Kinder einen großen Wunsch nach faktischer Entlastung, etwa nach familienentlastenden Diensten oder Beratung über rechtliche Belange. (vgl. ebd. S 107)
Um abschließend noch einmal Bezug zu nehmen zum Eingangstext von Alfried Längle, möchte ich gerne noch festhalten, dass er durch seine Ausbildung als Arzt, Psychologe und Psychotherapeut bereits im Besitz sehr vieler von den meisten Eltern erst zu erwerbender Kompetenzen war, als er mit der Behinderung seines Sohnes konfrontiert wurde. Trotz aller dieser Befähigungen traf ihn diese Mitteilung aber im Grunde ebenso unvorbereitet wie andere Eltern. Das heißt für mich, dass der Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen praktischer und theoretischer Art in den erwähnten Handlungsfeldern für die Eltern zwar notwendig und hilfreich für die Durchsetzung ihrer eigenen Anliegen auch im Hinblick auf das Kind ist, dass diese Kompetenzen aber nicht den schmerzlichen Prozess der emotionalen Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes und den eigenen widersprüchlichen, ambivalenten Gefühlen ersetzen können. Ich denke, es ist vielmehr so, dass die faktische Mehrbelastung durch die Suche nach geeigneten Hilfen und Förderungsmöglichkeiten für das Kind und die Familie über einen langen Zeitraum begleitet wird von den schmerzlichen Gefühlen, die mit dem Erkennen der veränderten Lebensbedingungen, mit dem Anerkennen des Schicksalsschlages und mit der Trauer um den Verlust des erträumten Kindes und der erträumten Lebensführung verbunden sind. Diese Trauer wird in manchen Phasen stärker zum Ausdruck kommen und in anderen Phasen nicht vordergründig spürbar sein, sie kann aber durch unterschiedliche Ereignisse immer wieder reaktiviert werden. Diese Ereignisse können in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frühförderung des Kindes stehen oder die Frühförderung zumindest betreffen: Rückschläge in der Entwicklung des Kindes, lange Strecken von gleichbleibendem Entwicklungsstand, erfolglos bleibende Therapieversuche, aber auch soziale Erlebnisse, die mit großer Ablehnung einhergehen, Schwierigkeiten, die bei der Integration des Kindes in den Kindergarten oder beim Schuleintritt auftauchen. Es kann aber auch eine Bemerkung oder Anforderung sein, die von der Frühförderin her kommt, die an den Schmerz der Eltern rührt und bei ihnen Reaktionen auslöst, die der Frühförderin nicht sofort verständlich sind. Deshalb glaube ich, dass es für die Frühförderin wichtig ist, sich bewusst zu sein, wie einschneidend sich Erfahrungen in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung bei den Eltern einprägen und ihr Verhalten leiten, aber auch anzuerkennen, dass der Prozess der psychischen Auseinandersetzung in manchen Fällen ein lebenslang begleitender sein kann. Das bedeutet für mich auch, die eigenen Idealvorstellungen von der Verarbeitung der Behinderung durch die Eltern, die bewussten und unbewussten Ansprüche an ihre Liebes- und Erziehungsfähigkeit zurückzustellen und die ambivalente Gefühlslage der Eltern nicht als pathologisch, sondern als ihrer Situation angemessen wahrzunehmen und ihnen dies auch so zu vermitteln.
Die Mitteilung einer Diagnose und die sich daraus ergebende Prognose stellt auch nach Niedecken im ersten Moment eine große Kränkung, ein Trauma für die Eltern dar. Ihre Hoffnungen und Wünsche werden zunächst einmal radikal zerstört und die spontane Mütterlichkeit (Väterlichkeit) sehr verunsichert.
Die Diagnose ruft Ängste, Vorstellungen und Phantasien in den Eltern wach. Sie sind beide mit ihren Gefühlen beschäftigt und kämpfen einen verzweifelten Kampf. Das Kind selber hat seine Geburt und nicht selten Krankenhausaufenthalte oder sogar schon Operationen hinter sich und würde Sicherheit, Halt und Geborgenheit von den Eltern brauchen, um seine eigenen Ängste bewältigen zu können. Die Eltern aber benötigen ihre Kraft, um selber mit der Situation fertig zu werden. Es zeichnet sich durch diese Überlegungen schon ab, dass die Entwicklungsbedingungen für ein Kind mit Behinderung gerade am Beginn sehr erschwert sind. Die Eltern schauen mit einem anderen, ängstlich das Diagnostizierte und Prognostizierte erwartenden Blick auf das Kind und deuten jede Regung in Richtung der Behinderung. Jede Normabweichung bestätigt in ihren Augen das, was der Arzt ihnen erklärt hat. Eine Äußerung des Kindes wird schnell als Verhaltensauffälligkeit angesehen und nicht mehr als subjektiver Ausdruck eines eigenständigen Wesens, dem man sinnvolles, intentionales Handeln oft schon von vornherein abspricht. Die fatale Folge ist, dass das Kind in seinem Ausdruck von den Eltern nicht verstanden wird. Es wird nicht "gehört" und somit auch nicht "erhört" und seine Entwicklung "zum symbiotischen, sprachlichen Ausdruck ist erschwert oder blockiert" (Niedecken 1998, S 39).
Die Überzeugungen - Phantasmen - der Eltern von der Behinderung verstellen ihnen den Blick auf die ganz individuellen Leistungen und Entwicklungen des Kindes. Jeder Zweifel an der Diagnose würde ja Ängste, Hoffnungen und Trauer wiederbeleben, die sie schon in der Anfangszeit so schmerzlich erlebt haben. Dagegen bildet sich nach Niedecken eine Abwehrhaltung, die darin besteht, auch positive Entwicklungen wieder nur als typisches Symptom der Behinderung anzusehen, so wie man etwa deutliche Intelligenzleistungen des Kindes als "Raffinesse" geistig behinderter Kinder abwerten kann.
Im entwicklungspsychologischen Gutachten eines Kindes, das neu in die Frühförderung aufgenommen werden sollte, stand unter anderem zu lesen, dass es "zu sehr eigene Interessen" verfolge. Die Eltern sahen es nun als wichtigen Punkt der Förderung an, diesen "Fehler" beim Kind zu beheben. Ich habe mich damals oft gefragt, was denn so schlimm daran ist, wenn ein Kind eigene Interessen zeigt und die Motivation und Willenskraft, diese auch umzusetzen. Vielleicht ist Eigenständigkeit nur dann nicht wünschenswert, wenn sie nicht unseren Vorstellungen von "sinnvollen" Leistungen entspricht. Und wie anders müsste ein Förderkonzept aussehen, wenn man die "eigenen Interessen" des Kindes nach dem Sinn befragen müsste, den sie für das Kind selber haben. Es würde heißen, sich auf das ureigenste Wesen, die persönlichen Erfahrungen und die Bedürfnisse des Kindes uneingeschränkt einzulassen, seinen Weg mit ihm zu gehen und nicht es auf den von uns als richtig erkannten zu führen.
Neben diesen Gefahren bietet die Diagnose aber auch Vorteile. Sie gibt den Eltern Stabilität und Orientierung in einer Phase der Verunsicherung und macht sie wieder handlungsfähig. Das, was vorher nicht greifbar war, das Befürchtete, die Ahnung, hat nun einen Namen, wird fassbar und man kann sich darauf einstellen, damit umgehen. In der Zeit vor einer Diagnosestellung fühlen sich die Eltern oft wie Versager und haben Angst, etwas falsch gemacht zu haben, "schuld" zu sein an der Auffälligkeit ihres Kindes. Die Diagnose, die objektive Feststellung einer Schädigung, eines Defekts entlastet die Eltern vordergründig von diesen Schuldgefühlen. Eine Empfindlichkeit gegenüber diesen Schuldgefühlen bzw. gegenüber allem, was sie wieder aktivieren könnte, bleibt aber oft bestehen.
Der Arzt bekommt in diesem Prozess der Diagnosestellung eine wichtige Funktion und Stellung für die Eltern. Er ist derjenige, der das "Urteil" spricht, der entweder alle Hoffnungen zerstören oder die Eltern beruhigen kann. Wenn Eltern jedoch etwas ahnen oder befürchten, gehen sie oft einen langen Weg von Arzt zu Arzt, bis ihre Vermutungen bestätigt werden. Die Mutter konsultiert die Ärzte immer wieder von neuem und sucht bei ihnen Unterstützung. Mannoni meint, dass sie dabei weniger Rat für das Kind als vielmehr für sich selber sucht. "Insgeheim wünscht sie, dass ihre Frage nie eine Antwort erhält, damit sie sie immer wieder stellen kann. Denn sie braucht Kraft um weiterzumachen, und genau das ist ihre Forderung. Sie braucht einen Zeugen, einen Zeugen, der fühlt, daß sie - hinter der Fassade der Gelassenheit - am Ende ist. Einen Zeugen, der im Notfall weiß, daß sie zum Töten bereit ist" ( Mannoni 1972, S 20).
Ich kann dieses "Nicht-wirklich-wissen-Wollen" mancher Eltern auch aus der Frühförderung bestätigen, wenn Eltern z.B. sehr großes Interesse am Verlauf der Entwicklung des Kindes bezeugen und dann aber nicht zuhören, wenn ich versuche, ihnen Details näher zu erklären. Es gibt auch Eltern, die die Frühförderin unter großen Druck setzen, indem sie von ihr verlangen, eine bestimmt Behinderung betreffend immer auf dem neuesten Stand des Wissens zu sein, und dann aber verneinend abwinken, wenn die Frühförderin sich tatsächlich gut informiert hat und den Eltern dieses Wissen nahe bringen will.
Nach etlichen Arztbesuchen steht dann vielleicht endlich eine Diagnose im Befund, aber die Eltern sind trotzdem zu wenig informiert - die Diagnose wurde ihnen nur bruchstückhaft mitgeteilt, Fremdwörter im Befund nicht erklärt. Ziemen vermutet hier sogar eine Täuschung der Eltern und somit eine weitere Art sozialer Regelverletzung. (vgl. Ziemen 2002, S 164ff)
Diese Aufgabe des Erklärens des Befundes fällt nicht selten erst der Frühförderin zu. Hier haben viele Eltern zum ersten Mal den Mut, genauer nachzufragen, was aus ihrer Position am "Pol der Ohn-Macht" auch leicht zu verstehen ist.
Aber auch nach einer Diagnosestellung möchten die Eltern diese immer wieder von neuem bestätigt wissen. Niedecken beschreibt ähnlich wie Mannoni, dass sie in vielen Elterngesprächen das Gefühl hatte, von den Eltern zur Bestätigung der ursprünglich gestellten Diagnose gedrängt zu werden. Gerade wenn die Diagnose nur sehr allgemein formuliert ist oder nebulös bleibt, wie etwa bei der Diagnose einer Wahrnehmungsstörung, habe ich dieses Bedürfnis bei vielen Eltern in der Frühförderung ähnlich erlebt.
Eine Mutter, bei deren Kind eine pränatale Encephalopathie und in der Folge eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung festgestellt wurde, äußerte im Erstgespräch den Verdacht, dass es sich doch auch um Autismus handeln könnte. Später erzählte sie in vielen Einheiten von einem ihr bekannten autistischen Jugendlichen und wollte von mir immer wieder bestätigt wissen, ob es sich nicht doch auch bei ihrem Kind um diese Störung handeln könnte. Es schien mir fast so, als wollte sie lieber die Diagnose "Autismus" hören, denn mit ihr hätte sie etwas anfangen können, da hätte sie ungefähr gewusst, was auf sie zukommt und womit sie zu rechnen hat. Auch anderen Menschen gegenüber wäre es für sie leichter gewesen, die schwere aber allgemein eher bekannte Störung "Autismus" statt der unklaren Wahrnehmungsverarbeitungsstörung zu nennen.
Das Verhalten ihres Kindes in der Öffentlichkeit ließ die umgebenden Menschen eher auf die mangelnde Erziehungsfähigkeit der Mutter schließen, als auf eine organische Störung. Damit kam sie immer wieder in die Lage, sich nicht rechtfertigen zu können - eine klare Diagnose, die an organischen Schäden festzumachen ist, hätte es ihr erleichtert, mit der Kritik der Umgebung fertig zu werden.
In diesem Beispiel zeigt sich deutlich, dass die Diagnose bei dieser Mutter keinerlei Entlastung von Schuldgefühlen erreichen konnte.
Ich denke, dass auch die Frühförderin potentiell Schuldgefühle in den Eltern wecken kann, vor allem, wenn sie etwas an der Entwicklung des Kindes anders interpretiert als im Sinne der Diagnose und Prognose. Es gibt auch Situationen, in denen die bloße Anwesenheit der Frühförderin den Eltern immer wieder vor Augen führt, was sie lieber nicht wahrhaben möchten: dass ihr Kind anders ist und erschwerte Entwicklungsbedingungen hat. Niedecken spricht von der Abhängigkeit von der Umwelt "als absolutionserteilender oder -verweigernder Instanz" (Niedecken 1998, S 53), in die Eltern geraten können.
Ebenso wie Mannoni sieht auch Niedecken die Gefahr der Spaltung im Zusammenhang mit der Diagnosestellung. Oft gibt es einen Arzt, der für die böse, verurteilende Instanz steht und einen anderen Arzt oder eine Therapeutin, der/die die gute, hilfreiche, schuldentlastende Instanz verkörpert.
So berichtete mir eine Beratungskindergärtnerin einmal, dass sie es für den schwierigsten Teil ihrer Aufgabe hält, den Eltern sagen zu müssen, dass ihr Kind in der Kindergruppe auffällt und es abgeklärt werden sollte, wo die Probleme des Kindes liegen. Sie fand es sehr belastend, auch in späteren Gesprächen immer die Rolle derjenigen zu haben, die den Eltern als Erste mitgeteilt hat, dass etwas nicht in Ordnung ist und damit die verurteilende Instanz zu verkörpern.
In einer anderen Familie blieb die psychologische Untersuchung des Kindes für die Eltern ein so einschneidendes Erlebnis, dass es in der Frühförderung immer wieder zur Sprache kam. Jedes Mal aufs Neue berichteten die Eltern von der Überforderung des Kindes in der Untersuchungssituation, in der der Psychologe in einer für das Kind unverständlichen Sprache gesprochen hätte, von der unmöglich langen Dauer und der zu strengen Beurteilung. Damit wehrten sie die aufgekommenen schmerzlichen Gefühle um das Wissen von der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Kindes bzw. auch ihre Schuldgefühle ab, wenn ich auch auf der anderen Seite davon überzeugt bin, dass es sicherlich zu diskutieren wäre, inwieweit die Untersuchungssituation den Kindern wirklich entgegenkommt.
In einer anderen Familie entwickelte die Mutter eine beinahe schon paranoide Einstellung ihrer personalen Umwelt gegenüber. Sie fühlte sich überall von beurteilenden Blicken verfolgt und mied schließlich mit ihrem Kind die Gesellschaft anderer Menschen mit dem Hinweis auf deren schlechte Eigenschaften. Hier würde ich von einer Spaltung sprechen, die die gesamte Umwelt zur negativen Instanz machte, während nur ausgesuchte Fachleute von der Mutter akzeptiert wurden.
Hier zeigt sich deutlich, dass die Frühförderin als Teil einer rehabilitierenden Institution von den Eltern zunächst mit denselben großen Hoffnungen und Erwartungen konfrontiert wird wie jede neue Therapieform, jeder neue Arzt, jeder neue Helfer. Gerade in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung ist es vielen Eltern noch lange nicht möglich, ihre veränderte Situation mit einem Kind mit Behinderung anzunehmen. Sie hoffen auf irgendeine Methode, die zur Heilung führt oder auf irgendeinen Menschen, der ihnen Heilung versprechen kann. So lange wie irgendwie möglich hoffen sie auf eine Veränderung, auf ein Wunder - eine Reaktion, die sehr gut nachzuvollziehen, sehr menschlich ist. Und auf der einen Seite ist es ja auch wichtig, dass die Eltern nicht von vornherein aufgeben und ihr Kind "zurückbleiben" lassen. Es ist wichtig, dass sie Entscheidungen treffen hinsichtlich des Lebens, das sie mit dem Kind führen möchten und hinsichtlich der Hilfen, die sie für sich und ihr Kind dazu in Anspruch nehmen wollen. Wichtig wäre nur, dass diese Entscheidungen wirklich im Hinblick auf das Wohl des Kindes und nicht aus einer Abwehrhaltung der Eltern gegenüber der Behinderung heraus getroffen werden. Hier ist es vielleicht immer wieder die Aufgabe der Frühförderin, die Bedürfnisse des Kindes ebenso wie seine Reaktionen auf momentane Entwicklungsanregungen oder Therapieformen wahrzunehmen und diese in der gemeinsamen Beobachtung des Kindes den Eltern zu vermitteln.
Um den Eltern eine Art von Frühförderung nahe zu bringen, die sich sehr stark an den Bedürfnissen des Kindes, an seiner Autonomieentwicklung und an seinen Wünschen orientiert, ist es für die Frühförderin wichtig zu wissen, dass sie mit dieser Art der Förderung vielleicht die Erwartungen der Eltern an eine Förderung enttäuschen muss. Dann sollte die Frühförderin nicht gegen die Einstellung der Eltern ankämpfen, in der verzweifelten Hoffnung, dass diese die Situation endlich "annehmen" können, sondern bereit sein, sich den Ängsten und Befürchtungen der Eltern zu stellen und offen mit ihnen über ihre Ansprüche an die Frühförderung und über die vielleicht dahinterliegenden Ängste zu sprechen.
Das Bild vom Kind in seiner frühen Entwicklung - vom Säugling - hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Ergebnisse der empirischen Säuglingsforschung maßgeblich verändert. Traditionelle tiefenpsychologische Erkenntnisse zur frühen Kindheit orientierten sich nach Ziemen oftmals nicht am kindlichen Verhalten, sondern wurden eher durch die Analyse Erwachsener gewonnen. Der Säugling wurde als passives, asoziales, seinen Trieben völlig ausgeliefertes und undifferenziert wahrnehmendes Wesen betrachtet - als wildes Tier, das gezähmt werden müsse. (vgl. Ziemen in Theunissen/Plaute 1997, S 75f; Köhler in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 51f).
Durch die Ergebnisse der empirischen Säuglingsforschung und deren Einbeziehung in neuere psychoanalytische Konzepte zur frühkindlichen Entwicklung (z.B. Stern) kam es zur "Entdeckung des aktiven Säuglings" (Gstach 1996, S 117).
"Eine Vielzahl von Beobachtungen an Säuglingen hat belegt, daß der Säugling von Beginn an ein aktiver kompetenter Partner ist" (Ziemen in Theunissen/Plaute 1997, S 77).
Man geht demnach heute nicht mehr so sehr von einer beim Säugling anfangs bestehenden primär-narzisstischen Welt aus und von einer symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung im Sinne einer völligen Abhängigkeit vom jeweils anderen, sondern von einem Säugling, der von Anfang an aktiv am Interaktionsgeschehen mit seinen primären Bezugspersonen beteiligt ist und nach Wechselseitigkeit strebt.
"Es ist an der Zeit, die Wechselseitigkeit der Beziehungen ernst zu nehmen und der aktiven Rolle des Säuglings ebenso wie der Rolle des Vaters, der Geschwister und des sozialen Beziehungsnetzes gerecht zu werden" (Papousek in Koch-Kneidl/Wiesse 2000, S 71).
"Symbiose" möchte Ziemen im Zusammenhang mit der Mutter-Kind-Beziehung in Anlehnung an Dornes und Göppel eher als "Ausdruck der feinen Abgestimmtheit, der großen wechselseitigen emotionalen Bedeutsamkeit und der empathischen Verschränkung zwischen Mutter und Kind" verstehen (Ziemen in Theunissen/Plaute 1997, S 78).
Eva Hedervary-Heller sieht die "dyadische Interaktion" zwischen Mutter und Kind als Prototyp sozialer Interaktion an. "Auf der einen Seite steht die Mutter, die mit ihrer reifen, strukturierten Eigenpersönlichkeit als Repräsentant der Umwelt steht, auf der anderen Seite das Kind, dessen Individualität sich erst stufenweise entwickelt und festigt" (Hedervary-Heller in Koch-Kneidl/Wiesse 2000, S 11). Mit der Betonung der aktiven Rolle des Säuglings wird auch die Qualität der Wechselbeziehung hervorgehoben, die man daran erkennt, "wie genau das Verhalten der beiden zeitlich aufeinander abgestimmt ist und wie genau ihre Verhaltensweisen sich aufeinander beziehen. [...] Die Bezugsperson muss die Signale des Kindes richtig erkennen, richtig zuordnen, und sie muss in der Lage sein, angemessen - den augenblicklichen Zustand und das Entwicklungsniveau des Kindes berücksichtigend - zu antworten" (ebd. S 12).
"Interaktionen" bedeuten nach Hedervary-Heller "eine Wechselbeziehung zwischen aufeinander reagierenden Partnern (dyadisch, triadisch oder in sozialen Gruppen)" (ebd. S 13). Interaktionen können über verschiedene Informationskanäle laufen und auf der verbalen, der nonverbalen, der mimischen oder gestischen Ebene oder auf der Ebene der Körperhaltung stattfinden. Dabei kann man zwischen einphasigen Interaktionen unterscheiden, bei denen die Handlung von A nach B verläuft, zwischen zweiphasigen Interaktionen, bei denen die Handlung von A nach B und von B nach A verläuft und zwischen mehrphasigen Interaktionen, bei denen sich die Handlungen zwischen A und B mehrfach wiederholen. (vgl. ebd. S 13f)
"Bereits sehr junge Säuglinge verfügen über eine Vielfalt von Verhaltensweisen, die es ihnen ermöglichen, eine Interaktion selbst zu initiieren oder sich aus der Interaktion zurückzuziehen" (ebd. S 15).
Das Kind lernt allmählich, mit seinen Handlungen etwas in der Welt bewirken zu können.
"Schon das Neugeborene ist fähig und motiviert, die soziale und dingliche Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen, seine Wahrnehmungen zu integrieren, zu speichern, sich mit der Umwelt vertraut zu machen, Regeln zu entdecken und sein Verhalten darauf abzustimmen, bald darauf auch Erwartungen und Hypothesen aufzubauen, zu überprüfen und zu korrigieren. Eine zentrale Bedeutung in seiner frühen Erfahrungswelt hat all das, was es auf Seiten der Umwelt durch eigenes Tun bewirken kann" (Papousek in Koch-Kneidl/Wiesse 2000, S 73).
Kinder vor dem Spracherwerb nehmen direkter und globaler wahr als Erwachsene. Es ist dies ein ganzheitliches Erleben, in dem Kognition, Handlung und Wahrnehmung noch keine getrennten Kategorien sind. "Diese differenzieren sich offenbar erst allmählich und im Zusammenhang mit dem Spracherwerb heraus" (Köhler in Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 53).
Affekte sind das wichtigste Kommunikationsmittel des Säuglings. Von diesen Affekten erlebt der Säugling ein "propriozeptives Feedback von seiner mimischen Muskulatur" (ebd. S 53), was bedeutet, dass sich dem Säugling Affekte sensomotorisch einprägen.
Waltraud Hackenberg nimmt in diesem Zusammenhang Bezug auf Stern und beschreibt drei Aspekte, die er für besonders bedeutsam für die Entwicklung des Kindes hält:
Der erste Aspekt ist die elterliche Affektspiegelung, die es dem Säugling ermöglicht, über den Spiegel des menschlichen Gesichtes ein basales Identitätsgefühl zu entwickeln. Die Eltern spiegeln dem Kind seine Affekte durch eine intuitiv etwas übertriebene Ausdrucksform, durch die die Affekte für das Kind klar unterscheidbar werden. "Indem Säuglinge also erkennen können, wie ihre affektiven Signale von den Eltern aufgenommen und rückgespiegelt werden, gewinnen sie erste Vorstellungen von sich selbst" (Hackenberg 2003, S 6).
Die beiden anderen Aspekte sind die gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung und die Affektabstimmung zwischen Eltern und Kind, die beide etwa im letzten Viertel des ersten Lebensjahres große Bedeutung erlangen - zu einer Zeit, in der das Kind nach Stern zur Intersubjektivität gelangt. Das bedeutet, dass das Kind beginnt, seine inneren Zustände (Wünsche, Bedürfnisse) mitzuteilen und auch bei seinem Gegenüber innere Zustände zu erwarten. "Es wird nicht mehr nur mit Affekten kommuniziert, sondern auch über Affekte" (ebd. S 7).
Stern "geht davon aus, dass für Interaktionsepisoden Erwartungen und präverbale Repräsentationen entwickelt werden, die er als ‚generalisierte Interaktionsrepräsentationen' (Representations of Interactions that have been Generalized), kurz RIG's, bezeichnet" (Hedervary-Heller in Koch-Kneidl/Wiesse 2000, S 22). Die einzelnen RIG's repräsentieren jeweils einen spezifischen Interaktionstyp und bilden die Bausteine der von Bowlby beschriebenen Arbeitsmodelle. "Bowlby (1973) beschreibt innere Arbeitsmodelle als individuelle und unbewusste mentale Repräsentationen des Selbst, der anderen und der Welt" (ebd. S 21). Diese Arbeitsmodelle helfen dem Menschen dabei, "aktuelle Ereignisse wahrzunehmen, künftige vorherzusehen und Pläne zu konstruieren" (ebd. S 21). Arbeitsmodelle beim Kind dienen der Speicherung von Vorstellungen über die Verfügbarkeit, also über die Zugänglichkeit und Reaktionsbereitschaft der Bezugsperson und der Lieferung von Informationen über das eigene Selbstbild. Es zeigt sich eine enge Verbindung von Objekt- und Selbstrepräsentation im Arbeitsmodell. Je nachdem, wie das Kind seine "primäre Bindungsperson" innerlich repräsentiert, wird die Art seiner Selbstrepräsentation beeinflusst (überwiegend positiv oder überwiegend negativ).
(vgl. ebd. S 21f).
Papousek beschreibt den menschlichen Säugling als sehr abhängig von seiner Umwelt, was die Erfüllung seiner biologischen und emotionalen Grundbedürfnisse und seinen Schutz betrifft, sieht ihn aber von Anfang an fähig zur "Wahrnehmung und integrativen Bearbeitung seiner Umwelterfahrungen" und als Person mit kommunikativen Kompetenzen.
In Verhaltensbeobachtungen und Analysen der frühen Kommunikation zwischen Mutter und Kind konnte Papousek intuitive elterliche Kompetenzen entdecken, die die selbstregulatorischen Kräfte beim Kind hinsichtlich seiner affektiven Erregungssteuerung, seiner gezielten Aufmerksamkeit, seiner Schlaf-Wach-Regulation und einer reibungslosen Nahrungsaufnahme unterstützen und die integrative und kommunikative Entwicklung des Kindes fördern.
"Es sind Verhaltensmuster, die ohne bewusste Kontrolle ausgeübt und gesteuert werden; sie sind nicht auf die biologische Mutter beschränkt, sondern sind ebenso bei Vätern und Nichteltern, und, trotz kultureller Unterschiede in Traditionen und Erziehungsvorstellungen, universell angelegt; sie gehören zur Kategorie der intuitiven Verhaltensformen, mit denen Eltern - typischerweise mit einer kurzen Latenz von 200-600 Millisekunden - kontingent auf kindliche Signale antworten. Sie sind auf die Grenzen und Kompetenzen des Säuglings abgestimmt, und sie werden durch Aussehen und Signale des Kindes ausgelöst und gesteuert, die über seine Aufnahme- und Interaktionsbereitschaft informieren" (Papousek in Koch-Kneidl/Wiesse 2000, S 74).
Zu diesen intuitiven elterlichen Kompetenzen gehören verschiedenste Beruhigungsformen beim Schreien des Kindes, aber auch schon im Vorfeld von Schreien und Unbehagen ein "facettenreiches Repertoire von an- und aufregenden und entspannenden Stimulationsformen" (ebd. S 75). Dabei orientieren sich die Eltern an den Rückkoppelungssignalen des Kindes: an der Atmung, den Lauten, dem Lachen, der Händchensprache, dem Körpertonus und der Haltung. Bei neuen, aufregenden Erfahrungen orientiert sich das Kind an der Reaktion des Erwachsenen, sucht "dabei mit Auge und Ohr nach Signalen in Mimik und Stimme der vertrauten Bezugsperson, die ihm helfen, die neue Erfahrung einzuordnen" (ebd. S 75). Papousek nennt dies auch die "soziale Rückversicherung". Das Kind lernt das elterliche Gesicht kennen und erfährt, dass es mit seinem eigenen Blickverhalten etwas bewirken kann, es speichert Zusammenhänge, bildet Erwartungen dazu aus und versucht, Wiederholungen zu erreichen.
"Das elterliche Kommunikationsverhalten kompensiert die anfängliche Unreife und unterstützt die postnatalen Regulations- und Anpassungsprozesse des Säuglings" (ebd. S 77). Dabei wirken Rückkoppelungssignale des Säuglings als "Belohnung und Bestärkung des elterlichen Selbstwertgefühles und der intuitiven Verhaltensbereitschaften" und es entsteht ein Kreislauf "positiver Gegenseitigkeit" (ebd. S 77). Für Papousek beinhaltet dieses Zusammenspiel von kindlicher Selbstregulation und intuitiver elterlicher Kompetenz protektive Kräfte. Sie sieht die vorsprachliche Kommunikation als "Puffersystem, das anfängliche Anpassungsprobleme auf Seiten des Kindes wie auch auf Seiten der Eltern bis zu einem gewissen Grad auffangen und bewältigen kann" (ebd. S 77).
Belastungs- und Risikofaktoren können die frühe wechselseitige Anpassung von Kind und Eltern stören. Wenn Mütter und Väter etwa häufig nicht in der Lage sind, ihr schreiendes Baby zu beruhigen, erleben sie sich ohnmächtig und versagend, ihr Selbstwertgefühl als Eltern erlebt eine Kränkung und es können resignative, depressive Gefühle auftreten. Ein "schwieriges" Verhalten des Kindes bedeutet bei der Mutter aber auch, sich von der Vorstellung verabschieden zu müssen, eine perfekte Mutter zu sein. Die emotionale Reaktion der Eltern auf ein sich nicht beruhigen lassendes Baby kann in schwer kontrollierbare, ohnmächtige Wut mit aggressiven Phantasien oder Fluchtphantasien, in Selbstvorwürfe, in die Angst, das Kind nicht genug zu lieben oder die Befürchtung, vom Kind abgelehnt zu werden, münden. Dabei können die intuitiven elterlichen Kompetenzen blockiert werden. Die Eltern vermeiden dann die Kommunikation mit dem Kind auch in aufnahmebereiten Wachphasen und das Kind erhält nicht mehr ausreichende Anregung und Unterstützung. So kann das Eltern-Kind-System nach Papousek vorübergehend oder langfristig entgleisen und eine "negative Gegenseitigkeit" (ebd. S 81) entstehen.
Für die Beratung und Therapie in solchen Fällen schlägt Papousek eine Weichenstellung für die entgleisende Kommunikation zwischen Eltern und Kind vor, die durch psychophysische Entlastung der Eltern die blockierte intuitive elterliche Kompetenz wieder freisetzen und den Weg ebnen kann für entspannte Formen der Kommunikation. Sie sieht Lösungen in der Kommunikationsanleitung, in einer zeitlich limitierten Gesprächspsychotherapie für die Eltern und in Physio- oder Ergotherapie für das Kind, wenn die Probleme auch daraus resultieren, dass die selbstregulatorischen Fähigkeiten des Kindes noch zu wenig ausgereift sind. Beratungsangebote sollten Hilfen zur Strukturierung des Tagesablaufes, zu Einschlafroutinen, Schlafgewohnheiten, Bettzeit-Interaktionen, zur Nahrungsaufnahme und zu gemeinsamen Handlungen enthalten.
Ich denke, dass diese Vorschläge auch für die Frühförderung Bedeutung haben, da es bei Kindern mit Behinderung und ihren Eltern eine große Gefahr gibt, dass es zu entgleisenden Interaktionen, zu gegenseitigen Missverständnissen und Kommunikationsschwierigkeiten kommen kann - einerseits resultierend aus den Schwierigkeiten des Kindes und seinen eventuell eingeschränkten Fähigkeiten zur Bedürfnismitteilung, andererseits aber auch aus der Verunsicherung der Eltern und ihrer belasteten emotionalen Lage heraus, die es ihnen erschwert, adäquat auf die mitgeteilten Bedürfnisse des Kindes einzugehen.
Kerstin Ziemen gibt in ihren Ausführungen zu bedenken, dass die Kontaktangebote, die in den ersten Lebenswochen als Antworten des Kindes interpretiert werden können, vor allem das Saugen, das Blicken, das Kopfwenden und die Bewegungen der Arme und Beine sind. Sie fragt sich, wie die Situation aussieht, wenn ein Kind behindert geboren wird. Dann ist es in seinen Möglichkeiten, auf diese Weise Kontakt aufzunehmen und Antwort zu geben, womöglich erheblich eingeschränkt - oder die Eltern sind nicht in der Lage, die Äußerungen des Kindes, die vielleicht nicht den üblichen Erwartungen entsprechen, richtig zu deuten.
"Bedeutsame oder lebenswichtige Reize und Situationen sind vom ersten Lebenstag an nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern vor allem auch sozialer Kontakt und Kommunikation. Fallen sozial interpretierbare Signale des Säuglings aus, z.B. durch Abwenden des Blickes, Versteifen des Körpers..., so können Dialoge entgleisen und Fehlentwicklungen entstehen. [...] Ist der Dialog mit dem Kind erschwert, weil z.B. das Lächeln ausbleibt oder es den Kopf abwendet, so wird dieses Verhalten oft als eine Kommunikationsverweigerung des Kindes aufgefaßt. Doch solch eine Deutung verstärkt von Seiten der Bezugspersonen den Prozeß der gestörten Interaktion und verhindert eine Interpretation des Verhaltes als aktive Suche des Kindes nach Dialogmöglichkeiten. Auch hier kommt somit der Interaktion mit der Mutter als zunächst engster Bezugsperson oder anderen an der frühen Entwicklung beteiligten Personen (z.B. der Pädagogin in der Frühförderung) grundlegende Bedeutung zu" (Ziemen in Theunissen/Plaute 1997, S 84).
Hierin sehe ich wichtige Hinweise für die Art einer Familienbegleitung in der Frühförderung und für ihre Aufgaben: in der Begleitung der Eltern beim Wahrnehmen und Deuten der Äußerungen ihres Kindes und in der Anbahnung von für beide Seiten positiven Interaktionserfahrungen.
Susanne Lambeck sieht eine mögliche Kompensation bei sich entwickelnden Interaktionsstörungen zwischen dem Kind und seinen primären Bezugspersonen vor allem in der Stärkung des Selbstwertgefühles der Eltern, in ihrer Ermunterung, sich in entspannter, ruhiger Atmosphäre offen auf die Initiativen des Kindes und auf das einzulassen, was sie in einer Wechselbeziehung gemeinsam erleben. (vgl. Lambeck 1992)
Frühförderung sehe ich hier als den Rahmen für gemeinsame Erlebnisse von Eltern und Kind an, der zu einer entspannten Atmosphäre, zur Ermutigung der Eltern und zur gemeinsamen Reflexion des Ablaufes von Interaktionen zwischen Eltern und Kind beitragen kann. Durch ihre Angebote kann Frühförderung neue Erfahrungen der Eltern mit ihrem Kind ermöglichen und die Eltern in ihrem Wunsch bestärken, ihr Kind in seiner Entwicklung zu begleiten.
Im Folgenden möchte ich gerne auf die Erkenntnisse Dietmut Niedeckens zur Entwicklung des Kindes eingehen, da sie aus meiner Sicht eine besondere Relevanz für das Verständnis der erschwerten Entwicklung des Kindes mit Behinderung haben.
Am Beginn seines Lebens bildet das Kind eine Einheit von Körper und Seele, was auch heißt, dass sich alle Geschehnisse in beiden Bereichen auswirken. Schon ein gesunder Säugling ist in dieser ersten Zeit durch große Verletzlichkeit und Abhängigkeit von der Umwelt geprägt. Bei einem zusätzlichen organischen Defekt ist diese Sensibilität ungleich größer und in diesem Fall sind auch die Bezugspersonen empfindlicher und verletzbarer - die Bedingungen also wesentlich erschwert.
Die Wahrnehmung des Kindes ist zunächst auf die inneren Vorgänge in seinem Körper gerichtet, auf das Empfinden von Wärme, Hunger oder Lageveränderungen. Erst später konzentriert sie sich auf die äußeren Sinne wie Hören, Sehen oder Tasten. In dieser ersten Zeit ist der Säugling darauf ausgerichtet, einen Zustand von Homöostase, von ausgeglichenem Wohlbefinden zu erreichen. Dabei reagiert er sehr sensitiv auf Stimmungsschwankungen oder etwaige Veränderungen in der Atmosphäre, die ihn umgibt.
Die Mutter wird vom Kind anfangs nicht als eigenständiges, von ihm getrenntes Wesen wahrgenommen, sondern es erlebt sich als Einheit mit ihr. Sie muss fähig sein, die Bedürfnisse, die das Kind mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln äußert, richtig zu erkennen und zu erfüllen, was von ihr ein ganz spezielles Einfühlungsvermögen erfordert. Niedecken nennt diese Fähigkeit zur Einfühlung die "mimetische Kompetenz". "In ihrem mimetischen Verhalten übernimmt die Mutter für das Kind Spiegelfunktion: indem sie einfühlend auf den Bedarf eingeht, den das Kind mit seinem Schreien ihr signalisiert, mimt, spiegelt sie ihm sein körperliches Erleben und verleiht seinem Schreien Bedeutung" (Niedecken 1998, S 64). Das Kind erkennt mit der Zeit im Tonfall der Stimme der Mutter seine eigenen Gefühle wieder und findet sich verstanden. In den Reaktionen der Mutter auf seine Äußerungen kann sich das Kind mit der Zeit selber erkennen als "Subjekt mit Wünschen, Vorlieben, Abneigungen" (ebd. S 65).
Die Mutter interpretiert dabei aber und legt die Äußerungen des Kindes auf etwas fest, das wieder mit ihr selber zu tun hat, mit dem, was sie selber an Gefühlen zulassen kann. Die Mutter ist individuell und kulturell darin begrenzt, die Affekte ihres Kindes wahrzunehmen. Manches interpretiert sie nicht richtig, was beim Kind zu einer Frustration seiner Bedürfnisse führt. Solange sich das Kind jedoch insgesamt verstanden fühlt und sich die Frustrationen in einem erträglichen Rahmen halten, sind diese sogar wichtig, damit das Kind nach und nach auch seine eigenen Grenzen und die seines Liebesobjektes kennenlernen kann. Das Kind "lernt, daß sein Schreien in der Welt etwas bewirkt, daß es ein Selbst und eine Umwelt gibt, die miteinander kommunizieren" (ebd. S 65).
Mit der Zeit nimmt das Kind Personen und Gegenstände, also die Welt der Objekte, wahr und entwickelt zu ihnen unterschiedliche Formen der Interaktion. Es bilden sich beim Kind Erinnerungsspuren, in denen es Vorstellungen "von der befriedigenden Person als auch von den eigenen Körperempfindungen im Zusammenhang mit der Befriedigung [speichert C.K.-S.], die es später erinnern kann" (ebd. S 65). Mit diesen Vorstellungen überbrückt das Kind allmählich die Wartezeiten bis zur Bedürfniserfüllung.
In die symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind treten nun langsam Gegenstände und sogenannte Übergangsobjekte - beispielweise auch nicht-mütterliche Personen - ein, mit denen das Kind spielt. Das Kind erlebt nun nicht mehr nur Allmacht, wenn seine Bedürfnisse von der Mutter erfüllt werden oder Ohnmacht, wenn ihm etwas versagt bleibt, sondern es gewinnt Handlungsspielraum, in dem es den Umgang mit der Umwelt erprobt. Diese Öffnung der Zweier- zur Dreierbeziehung ist mit vielen Konflikten verbunden. "Durch gelegentliches Beißen in die Brust, durch Haareziehen, später durch Hauen versucht das Kind, den Bannkreis der symbiotischen Macht der Mutter zu durchbrechen." "Sie muß angemessen auf diese Aggression reagieren können, nicht schuldbewußt zurückschrecken, aber auch nicht die Loslösungsversuche sanktionieren" (ebd. S 67).
Dazu fällt mir ein, dass es neue Dimensionen eröffnen könnte, solch aggressives Verhalten bei Kindern mit Behinderung als Ausdruck von Autonomiebestrebungen zu sehen anstatt wie meist üblich als Verhaltensauffälligkeit. Gerade das Werfen mit Gegenständen, das für Kinder mit der Diagnose "Down-Syndrom" im sogenannten "Trotzalter" als typisches Symptom der Behinderung angesehen wird, könnte hier eine ganz andere Art des Umgangs mit dem Kind ermöglichen.
Wichtig ist für Niedecken, dass die Mutter einen Weg findet, nicht nur die Aggressionen des Kindes anzunehmen, sondern auch ihre eigenen Aggressionen zuzulassen und mit ihnen umzugehen, so dass sie ein Vorbild für das Kind sein kann. Die Aggression als legitimes Gefühl soll in der Beziehung der beiden Raum finden und beantwortet werden können, damit das Kind lernt, dass es selber und die Mutter zwei getrennte Personen sind, die sich aber aufeinander beziehen in ihren "Wünschen, Affekten, in Zeichen, Gesten und Worten" (ebd. S 68).
Jetzt tritt für Niedecken auch der Vater in Erscheinung. Er lebt dem Kind eine Form des Umgangs mit der Mutter vor, indem er sich ihr gegenüber eigenständig verhält. Das Kind kann sich mit dem Vater identifizieren und sich unter seinem Schutz von der Mutter entfernen, um sich ihr dann erneut zu nähern, nun aber als eigenständiges Individuum.
"Diese Phase der Loslösung und Individuation wird von geistig Behinderten nur unzureichend oder gar nicht bewältigt, wozu [...] die weitverbreitete Tendenz der Väter beiträgt, ihr geistig behindertes Kind der Mutter zu überlassen, sie mit dieser Aufgabe alleine zu lassen" (ebd. S 68). Der Eintritt des Dritten in die Mutter-Kind-Beziehung ist etwas ganz Wesentliches, das den Grundstein legt für eigenständiges Lernen.
" ‚Dritte' sind ja auch Symbole, Worte, Lieder, sogar Gedanken und Phantasien. Solche Symbole stehen für Personen und Interaktionen. Sie machen es dem Kind möglich, sich eine Person oder ein Gefühl vorzustellen, unabhängig von seiner Präsenz. Daraus kann sich dann selbständiges Denken und eine realistische, auch kritische Wahrnehmung von sich selbst und von der Umwelt entwickeln" (ebd. S 68).
Für Mannoni läuft das behinderte Kind von Anfang seines Lebens an Gefahr, von der Mutter und seinen engsten Bezugspersonen vordergründig als Pflegeobjekt angesehen zu werden und sich damit in der allumfassenden Mutter-Kind-Beziehung nicht als Subjekt erleben zu können. Das Kind bleibt oft jahrelang in einem stark abhängigen Verhältnis zu seiner Mutter, später aber auch zu weiteren meist weiblichen Erziehungspersonen. Häufig handelt es sich bei der Betreuerin wieder um "eine Frau, die ausschließlich für es da ist und Forderungen stellt, sich anzupassen und voran zu kommen" (Mannoni 1972, S 11).
Im Normalfall kommt der Vater als Dritter zur Mutter-Kind-Beziehung hinzu und ermöglicht es dem Kind, sich angesichts der Kastrationsdrohung aus der engen Bindung zur Mutter zu lösen und in die "Ordnung der Kultur" einzutreten.
Der Rückzug des Vaters vom behinderten Kind bewirkt, dass seine Botschaft, die "Kastrationsdrohung", nicht zum Kind gelangt und es in "einer bestimmten phantasmatischen Beziehung" zur Mutter und damit ein Objekt bleibt. Es kann nicht zum Subjekt werden. Es ist wichtig, dass der Vater zur Mutter-Kind-Dyade hinzukommt, damit es dem Kind ermöglicht wird, all dem eine Bedeutung zuzumessen, was über die ursprüngliche Beziehung zur Mutter hinausgeht und sich selber und seine Umwelt zu bezeichnen. "Die dritte Bestimmung nennt Lacan das ‚Symbolische' [...] Sie setzt eine Ordnung (eine Ordnung des Gesetzes, der Kultur, der Sprache)" (ebd. S 90).
Da dieser Übergang von der Zweier- zur Dreier-Beziehung gerade beim behinderten Kind oft nicht auf diese natürliche Weise geschieht, haben die Kinder Schwierigkeiten, Objekte zu besetzen, was sich vor allem bei Raum- und Zeitbegriffen und in der Mathematik zeigt.
Es fehlt ihnen eine bestimmte Dimension des Symbolischen, so dass die Zahlen als solche nicht begriffen werden können.
Dabei fällt mir Julian ein: ein in den ersten Jahren seiner Entwicklung schwer misshandeltes und vernachlässigtes Kind, das im Alter von fünf Jahren nun in einer Pflegefamilie untergebracht wurde. Der erste psychologische Entwicklungstest und auch die Beobachtungen der Pflegeeltern ergaben eine besondere Schwierigkeit bei Julian, sich Namen von Menschen zu merken und Zahlenbegriffe zu verstehen. Im engen Kontakt zu seinem Pflegevater, der ersten männlichen Bezugsperson, auf die er sich verlassen konnte und die ihm Halt gab, verschwanden diese Probleme innerhalb eines Jahres sehr rasch.
Das bedeutet demnach, dass die Entwicklung eines behinderten Kindes oft auch noch dadurch erschwert wird, dass der Vater seine Aufgabe nicht wahrnimmt, dem Kind den Weg aus der engen Beziehung zur Mutter zu eröffnen, es nicht dabei begleitet, sich die Welt zu erschließen.
In diesem Sinn würde ich auch die Frühförderung und die Frühförderin selber als Dritte ansehen, die zur Mutter-Kind-Beziehung hinzukommen. Im Idealfall spielt sich die Frühfördereinheit ja in einer Dreiersituation zwischen Mutter, Kind und Frühförderin ab, die zusätzlich Spielmaterial, aber auch Lieder, Reime und Symbole mit- und in die Interaktion einbringt.
Simon war knapp drei Jahre alt, als meine Arbeit als Frühförderin in seiner Familie begann. Meine Vorgängerin hatte die Mutter von Anfang an in die Einheiten miteinbezogen, was ich auch beibehielt. Das gesamte Spielgeschehen teilte sich in dieser Situation gleichmäßig zwischen der Mutter mit ihrem Kind, dem Kind mit mir und zwischen der Mutter und mir auf. Das sah dann in etwa so aus, dass ich eine Handpuppe mitbrachte, die das Kind begrüßte, mit ihm sprach und ein Bewegungslied mit ihm sang, zu dem das Kind tanzte und Gesten ausführte. Simon nahm mir dann die Puppe ab, versuchte selber hineinzuschlüpfen. Dabei entdeckte er die Kleidung der Puppe und begann, sie aus- und anzuziehen. Seine Mutter gesellte sich zu ihm, erklärte ihm, wie die Kleidungsstücke heißen und erzählte mir, wie Simon zur Zeit darauf bestand, sich selber anzukleiden. Das erinnerte Simon an seine eigenen Kleidungsstücke und er holte seine eigene Mütze und den Schal, die er nun der Puppe anzog. Ich unterstütze ihn so weit, dass er dies selber tun konnte. Die nun fertig gekleidete Puppe wanderte in die Hände der Mutter, die nun das Kinderlied "Ringa-Ringa-Reiha" anstimmte, das Simon schon gut kannte und wir alle tanzten mit. In meiner Kiste fand Simon dann noch ein Tülltuch, das er auf die Puppe legte. Ich zeigte ihm, wie das Tuch schweben konnte und auf dem Kopf der Puppe landete. Dann fragte ich : "Wo ist die Puppe?" und zog mit einem Ruck das Tuch von ihrem Gesicht. Simon lachte und probierte diese Spiel gleich bei seiner Mutter aus, die bereitwillig mitspielte und es dann umdrehte, indem sie das Tuch auf Simons Kopf schweben ließ. Dieser wiederum kam zu mir und wiederholte es mit mir noch einmal.
Auf diese und ähnliche Weise war es dem Kind möglich, in einer harmonischen Dreiersituation verschiedene Gegenstände zu erproben und Erfahrungen zu machen. Es konnte sich von der Mutter wegbewegen und sich wieder in ihren Schutz begeben, sobald ihm das nötig erschien. Meine Aufgabe sah ich hier im Anbieten von Spiel- und Handlungsmöglichkeiten und in der Begleitung der Mutter in ihrem Anliegen, die Entwicklung des Kindes in einem sehr freien Rahmen zu gewährleisten. Bei Simons Mutter handelte es sich aber auch um eine Mutter, der es besonders gut gelang, sich kreativ und ohne Förderdruck in Simons Spiele einzubringen, ohne ihm damit seinen eigenen Spielraum zu nehmen.
Spielraum hält Niedecken für sehr wesentlich für die Entwicklung des Kindes. Damit sich das Kind diesen Spielraum in den ersten beiden Lebensjahren erobern kann, muss aber auch seine Mutter selber Spielraum besitzen, sowohl in materieller Hinsicht, als auch, was soziale Freiheit, Zeit und äußere Unterstützung betrifft. "Spielraum kann fehlen, er kann zerstört, besetzt, unterminiert sein" (Niedecken 1998, S 69).
Fehlenden Spielraum sieht Niedecken vor allem in Familien gegeben, die in einem Mangelmilieu leben und in denen die Gefahr der emotionalen Vernachlässigung des Kindes sehr groß ist. In solchen Familien bleiben die Kinder viel mit sich allein, in einer Leere und müssen oft zu lange auf die Erfüllung ihrer Bedürfnisse warten, als dass sich Vorfreude darauf einstellen könnte. Das Erleben von befriedigenden Interaktionsformen stellt nach Niedecken aber eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung des Urvertrauens des Kindes dar und für seine Fähigkeit, sich in der Welt zu orientieren und in ihr zu lernen. Die Mangelsituation prägt sich beim Kind ein, es bilden sich "destruktive somatische Erinnerungsspuren", welche die Entwicklung des Kindes behindern und sein Vertrauen minimieren. Niedecken sieht in später auftretenden Symptomhandlungen des Kindes wie Anklammern, Werfen mit Gegenständen oder Kopfschlagen eine Reinszenierung der erlebten Nicht-Erfüllung von Bedürfnissen. Das Kind kann sich den Übergangsraum von der Symbiose mit der Mutter hin zum eigenen, autonomen, selbständigen Handeln nicht erobern und bleibt in seiner Lernfähigkeit auf der Stufe der Konditionierung. Der Übergangsraum wird normalerweise erfüllt "mit wohltuenden Erinnerungen, mit einem schützenden Polster aus Interaktionsformen, aus Vorstellungen und Phantasien" (ebd. S 73).
Der so wesentliche Spielraum kann aber auch durch Ereignisse zerstört oder unterminiert werden, die die Mutter-Kind-Beziehung derart verunsichern, dass die Mutter an ihrer eigenen Kompetenz zweifelt und in ihr Angst und Schuldgefühle entstehen. Das kann etwa geschehen, wenn der Arzt bei einer Untersuchung des Kindes einen Rückstand in einem bestimmten Bereich feststellt, wenn bei den Eltern selber Sorge darüber besteht, ob sich ihr Kind wohl normal entwickelt oder wenn eine Krankheit des Kindes die Angst bei den Eltern weckt, es könnten Folgeschäden entstanden sein.
In diesen Fällen wird der Spielraum der Mutter besetzt von Phantasien und Vorstellungen, über das, was sein könnte. Sie ist nicht mehr frei, ihrem Kind Eigenraum zu geben, weil sie nicht mehr darauf vertraut, dass sich ihr Kind auch ohne Einwirkung von außen gut entwickelt. Es verändert sich etwas in der Beziehung zum Kind. "Die Mutter liebt das Kind jetzt nicht weniger als vorher, sie widmet sich ihm nicht seltener oder häufiger - aber ihre Zuwendung und ihr Vertrauen sind unterminiert, und das spürt das Kind: Die Angst und Schuldphantasien seiner Mutter nehmen ihm den Raum zum Spielen und Sich-Entfalten" (ebd. S 83).
Das freie Spielen des Kindes wird dem Kind normalerweise vor allem dann ermöglicht, wenn die Mutter zwar anwesend, aber doch bei sich allein ist, z.B. etwas erledigt, während das Kind daneben spielt. Dies ist so nicht mehr möglich, und es besteht die Gefahr der Überbehütung des Kindes. In diesem Sinne möchte ich Niedecken auch widersprechen, wenn sie weiter oben meint, dass sich die Mutter dem Kind jetzt nicht häufiger widmet.
Die Mutter schaut also mit ängstlichem Blick auf das Kind und es herrscht bei ihr nicht die Freude über die Handlungen des Kindes vor, sondern der Zweifel, die Unruhe, das drohende Schuldgefühl, etwas verabsäumt oder falsch gemacht zu haben. Niedecken betont, dass die Phantasien der Mutter nicht mehr frei und spielerisch sind, sondern von Angst besetzt. Dass sich dies atmosphärisch und auch direkt dem Kind gegenüber äußert, lässt sich leicht erahnen und damit auch der Einfluss, den die Befürchtungen auf das tatsächliche Verhalten und die Entwicklung des Kindes haben können.
Das eben Geschilderte gilt in meinen Augen für beide Situationen: für die Phase, in der Eltern etwas befürchten, was aber noch nicht durch eine diagnoseerteilende Instanz bestätigt ist, aber auch für die Zeit nach der Diagnosestellung, wenn die Diagnose selber die Phantasien der Eltern beherrscht. In beiden Fällen ist der Spielraum beschnitten.
Nach Niedecken muss eine Mutter auf ihre eigenen Erfahrungen aus der frühkindlichen Erlebniswelt zurückgreifen, um sich in ihr Kind einfühlen zu können. Ein erschütterndes Ereignis, das die Mutter-Kind-Beziehung trifft, bewirkt nun, dass die Mutter eine "namenlose" Angst befällt, mit ihrem Kind könnte etwas ganz anders, grauenvoll, fremd sein und sie hat das Gefühl, ihren eigenen Empfindungen nicht mehr trauen zu können. Sie verlässt sich nicht mehr auf ihre eigenen mimetischen Kompetenzen, sondern sucht Halt in dem, was von außen über Diagnosen, Prognosen, Behandlungsvorschläge und Handlungsanweisungen an sie herangetragen wird. Ihre eigenen so bedrohlichen Phantasien werden unbewusst - als Abwehr dienen ihr die gesellschaftlichen Phantasmen, d.h. unbewusst wirksame gesellschaftliche Einstellungen.
Das Phantasma kann z.B. lauten: Wenn ich alles tue, was man mir sagt, dann behalte ich die Kontrolle über das Leben meines Kindes. So bindet also das Phantasma die erschreckenden Gefühle, die das Kind in ihr auslöst. Niedecken spricht von der "phantasmatischen Entgleisung der Mutter-Kind-Beziehung" (ebd. S 89), wenn gesellschaftliche Phantasmen die Oberhand gewinnen und der Spielraum fehlt.
In einer entgleisenden Mutter-Kind-Interaktion verlässt sich die Mutter nicht mehr auf ihre eigene Wahrnehmungsfähigkeit und versucht nicht mehr, intuitiv die Bedeutung dessen zu erfassen, was das Kind mitteilen will. Sie bleibt im Rahmen des Phantasmas fixiert, d.h. sie deutet die Äußerungen des Kindes dem Phantasma entsprechend. Dahinter sieht Niedecken die Angst der Mutter, dass sie auch ihre mittlerweile unbewussten Gefühle wie Angst, Wut oder Hass auf das Kind übertragen und ihm damit vielleicht schaden könnte, wenn sie sich ganz auf das Kind und ihre eigenen Gefühle einlässt. Das Phantasma dient somit auch der Kontrolle. "Mit dem Phantasma sieht alles so aus, als müsse es so sein, selbstverständlich, ohne Bedeutung, reine Natur, Schicksal, unabänderlich und unhinterfragbar" (ebd. S 102). Die Mutter fragt nicht mehr nach dem individuellen Sinn einer Äußerung ihres Kindes. Indem sie sagt: "So ist es eben mit meinem Kind", ist jede Einfühlung schon verhindert.
"Die Dimension des Sinnes ist ausgeschlossen, unbewußt, verdrängt aus Angst vor den Tötungsphantasien" (ebd. S 101).
Als ich David im Rahmen eines Eltern-Kind-Nachmittags kennen lernte, war er gerade dabei, mit großer Wucht auf eine Trommel einzuschlagen, die das nicht aushielt und kaputt ging. Die Mutter nahm dieses zerstörerische Verhalten mit dem Hinweis auf seine Behinderung sehr gelassen zur Kenntnis und prophezeite mir für meine zukünftige Arbeit mit David, dass auch ich es nicht schaffen werde, ihm dieses aggressive Verhalten "abzugewöhnen". Was wäre wohl passiert, wenn sie sein Verhalten nach dem Sinn befragt hätte, den es für David vielleicht gehabt hat? Wäre dann auch ihre eigene Wut aufgebrochen im Zusammenhang mit ihrer schwierigen Situation als mittlerweile in Scheidung lebende Alleinerzieherin?
Was tatsächlich geschah, war, dass nachdem am Beginn der Frühförderung die Integration Davids in die Volksschule gewährleistet werden konnte, die Mutter wieder Spielraum in ihrem Umgang mit David erhielt. Da diese die Mutter sehr belastende Frage nicht mehr alles beherrschend im Raum stand und sie dazu brachte, großen Druck auf Davids Leistungsfähigkeit auszuüben, konnte sie ihm wieder mehr Freiraum gewähren, was im Laufe der Zeit dazu führte, dass sein aggressives Verhalten verschwand, ohne dass dazu eigene Maßnahmen ergriffen werden mussten.
Beide - Mutter und Kind - bleiben Gefangene des Phantasmas: Die Mutter bleibt mit dem, was sie vom Kind versteht, im abgesteckten Feld dessen, was das Phantasma vorgibt, und das Kind gleicht sich an das Phantasma an, um die Sicherheit der Mutter zu gewährleisten.
"Es verhält sich so, wie die Mutter fürchtet, zugleich aber als versichernde Bestätigung braucht: typisch behindert" (ebd. S 102).
Beim Kind können Abwehrfiguren entstehen, "genau das nicht zu können, worauf der Eltern angstvolle Erwartung sich besonders richtet" (ebd. S 103). Es bekommt nicht vermittelt, was es als Grundlage für seine Entwicklung brauchen würde: das Vertrauen seiner Umwelt in seine Entwicklung und das vertrauensvolle Angenommensein als Person, so wie es ist. Nach Niedecken macht sich das Kind dem gleich, was seine Eltern von ihm phantasieren, spiegelt ihnen damit ihre Angst und verstärkt sie noch - ein Teufelskreis entsteht.
Auch die Frühförderin kann in diesen Kreislauf der fortwährenden Diagnosebestätigung einbezogen werden und darin eine wichtige Rolle spielen. Die Mutter fragt die Frühförderin, was dieses oder jenes Verhalten des Kindes zu bedeuten hat, die Frühförderin antwortet im Sinne der Diagnose, die ihr ja auch Halt gibt in dem, was sie für die Arbeit mit dem Kind plant und in den Schwerpunkten, die sie dabei setzt. Beide bestätigen sich also immer wieder die Diagnose, auch oder gerade wenn im Befund nur "Verdacht auf ..." zu lesen ist. Die Befunde von Ärzten und Therapeuten können so zur Handlungsanleitung für die Frühförderung werden.
Nach einer mehrwöchigen Beobachtungsphase stand die Aufgabe für mich an, für Sabine eine Zielplanung zu erstellen, die ich im Anschluss daran mit den Eltern besprechen wollte. Während ich meine Beobachtungen sammelte, hatte ich neben mir den Befund des Psychologen liegen, auf den ich immer wieder einen Blick warf, um mich zu vergewissern, dass ich mit meinen Schwerpunkten nicht ganz "daneben" lag. Nach dem Gespräch mit den Eltern fiel mir dann in der Reflexion auf, dass ich mich mit meinen Erkenntnissen ganz an die Sichtweise des psychologischen Befundes angepasst hatte. Ich denke, dass dies eine häufig auftretende Schwierigkeit darstellt: das Verhalten des Kindes unabhängig von bereits bekannten Diagnosen neu zu beurteilen.
Gleichzeitig ist es aber auch schwierig für die Frühförderin, ein Verhalten des Kindes als aus seiner individuellen Situation verständliches Anmelden eines Bedürfnisses zu deuten, wenn die Eltern nicht bereit sind, eine solch neue Sichtweise anzunehmen. Wenn die Deutung der Frühförderin die Schuldängste der Mutter aktiviert, die sie wiederum abwehren muss, kommt sie in Gefahr, rasch abgewertet und nicht ernst genommen zu werden.
Niedecken beschreibt in Beispielen aus ihrer eigenen Arbeit, dass es in Institutionen oftmals schwierig ist, nach dem Sinn einer Veränderung oder eines Ereignisses in der Entwicklung eines geistig behinderten Menschen zu fragen, da die "Einfühlungsverweigerung" und die "selektive Blindheit" die "Institution Geistigbehindertsein" ja gerade konstituieren. (vgl. ebd. S 29ff)
In einer Kindergartengruppe wurde den Kindern die Aufgabe gestellt, ein Bild zum Thema "Meine Familie und ich" zu zeichnen. Bei einem Gespräch mit der Kindergärtnerin zeigte mir diese die Zeichnung von Christoph, den ich im Rahmen der Frühförderung betreute. Die Kindergärtnerin wollte mir damit Christophs Rückstand in seiner geistigen Entwicklung belegen und war ganz verzweifelt angesichts der in ihren Augen völlig falschen Darstellung von Christophs Familie. Christoph lebte nach der Scheidung seiner Eltern mit seiner Mutter bei den Großeltern. Seine Mutter hatte eine recht große Verwandtschaft und einen Lebensgefährten, zu dem Christoph ebenso Kontakt hatte wie zu seinem Vater. Aus seiner Sicht gehörten demnach viele Menschen zu seiner Familie, die er auch alle in dem Haus gezeichnet hatte, in dem sich die Kindergärtnerin die isolierte Darstellung Christophs mit seiner Mutter erwartet hatte. Als ich versuchte der Kindergärtnerin zu vermitteln, dass für Christoph von seiner Lebenserfahrung her die Abgrenzung seiner Kernfamilie von der übrigen Familie gar nicht so einfach möglich war, und er vielleicht auch die Trennung seiner Eltern noch gar nicht so richtig verarbeitet hatte, war sie sehr erstaunt, aber auch sehr skeptisch gegenüber dieser Sicht Christophs als Kind mit momentan nicht so klar geordneten Familienverhältnissen und nicht als geistig behindertem Kind. Es war geradezu vermessen von mir, etwas ganz Sinnrichtiges und nicht den Defekt hinter dem zu vermuten, was Christoph gezeichnet hatte.
Niedecken schreibt vom "mimetischen Tabu", vom Tabu, sich nicht einfach einfühlen zu dürfen, wo man nichts verstehen darf, um die bestehende Ordnung nicht zu gefährden.
Tatsächlich ist es sehr schwierig, eine neue Sichtweise einzubringen, vor allem, wenn bereits mehrere medizinische oder therapeutische Gutachten und Befunde zur Behinderung des Kindes vorliegen. Hier bestätigt sich die Gefahr der Stigmatisierung in der Art und Weise, wie ein erst einmal aufgedrücktes Etikett wie die Feststellung einer Behinderung, Verhaltensauffälligkeit oder Entwicklungsverzögerung immer weitere Kreise zieht, immer mehr untermauert wird und einen Prozess von zusätzlichen Etikettierungen nach sich zieht, in dem kaum mehr die Chance besteht, dass das betroffene Kind anders als über das Etikett definiert wird.
Wie das Phantasma einer Diagnose wirken kann, möchte ich in Anlehnung an Niedecken gerne am Beispiel des "Down-Syndroms" näher erläutern, da diese Diagnose eine klassische Indikation für Frühförderung darstellt. Viele Kinder mit dieser genetischen Auffälligkeit werden bereits ab einem Alter von wenigen Wochen oder Monaten im Rahmen der Frühförderung betreut.
In vielen Fällen wird den Eltern zusammen mit der Diagnose auch gleich das gesellschaftliche Phantasma bezüglich des Down-Syndroms vermittelt. Es seien zwar geistig schwer behinderte, nur eingeschränkt lernfähige, aber doch vom Wesen her sehr liebe, fröhliche, freundliche und vor allem musikalische Kinder. Niedecken bezeichnet dieses Phantasma auch mit "dumm-angepaßt, wehr- und hilflos, aber süß" (ebd. S 118).
Auch die anzunehmenden Schwierigkeiten, die dieses Kind haben wird, werden den Eltern mit der Diagnose mitgeteilt. Als ein Beispiel möchte ich hier nur die Saug- und Schluckprobleme nennen, die aufgrund der meist großen Zunge und der schlaffen Gesichtsmuskulatur als bereits vorprogrammiert angenommen werden.
Als man Simons Mutter zwei Tage nach der Geburt schließlich über die "Diagnose Down-Syndrom" informierte, die bei ihrem Kind festgestellt wurde, nahm man ihr auch gleich die Hoffnung, das Kind stillen zu können, weil "diese Kinder große Probleme im mundmotorischen Bereich haben". Simons Mutter ist vielleicht eine der wenigen Mütter, die sich durch diese Prognose nicht davon abhalten ließen, ihr Kind wie jedes andere auch zu behandeln. Sie erzählte mir, dass es zwar nicht ganz einfach war, dass es aber innerhalb einiger Wochen gut möglich war, ihr Kind zu stillen, was sie auch für das nächste halbe Jahr beibehielt. Simon ist das einzige mir bekannte Kind mit Down-Syndrom, das keinerlei Schwierigkeiten im mundmotorischen Bereich hatte. Der "normale" Umgang seiner Mutter scheint sich sehr positiv auf seine Entwicklung und auf die Beziehung zwischen den beiden ausgewirkt zu haben.
Ich denke, dass es für ein Kind mit Behinderung weder gut ist, wenn die Behinderung geleugnet wird, noch wenn das Kind auf die Behinderung festgelegt wird. Weder im einen noch im anderen Fall kann das Kind ein angemessen positives Bild von sich selber entwickeln. Es gibt nichts, worauf es stolz sein könnte, es kann nicht aus fester Überzeugung sagen: So bin ich und es ist gut so, wie ich bin.
"Schlimm ist besonders, daß Eltern ein "mongoloides" Kind nicht narzißtisch besetzen, nicht auf es stolz sein können" (ebd. S 118). Das gelingt manchmal erst später, wenn sie das gut geförderte Kind, das nun doch einige Leistungen erbringen kann, anerkennen. Mit der Anerkennung ist aber dann eher die gute Anpassungsleistung als das Selbst des Kindes gemeint.
Im Extremfall passen sich die Kinder an die Tötungsphantasien der Umwelt an, indem sie "sich tot stellen", ganz unauffällig und möglichst unsichtbar werden. "Der gebrochene originäre Lebenswille hat sich zurückgezogen in die Todesangst, die hinter der freundlichen Angepaßtheit oft allzu deutlich hervorschimmert" (ebd. S 124).
Auch als Frühförderin mit einer Ausbildung, die noch sehr dem Phantasma "Down-Syndrom" verhaftet war, ist man in Gefahr, das Kind durch die Schablone dessen zu sehen, was man als für diese Behinderung geltende typische Symptomatik annimmt. Niedecken beschreibt den Gedanken hinter den vielen Förderzielen, die sich aus der Diagnose ergeben, folgendermaßen: "Wenn ich es ihr nicht zeige, von selbst wird sie es nicht lernen!" (ebd. S 119). Sie meint, dass Kinder sich gerade dann in der Fördersituation verweigern, wenn sie spüren, dass etwas von ihnen erwartet wird, was man ihnen gleichzeitig gar nicht zutraut. Indem das Kind seine Reaktion auf das Spielangebot verweigert, enthält es mir als der Fördernden "die Bestätigung meiner fördernden Allmacht" vor. "Recht hat sie; aber mit ihrer Gegenwehr beschämt sie mich, und deswegen wird es mir schwer, ihre Weigerung als Leistung zu achten. Wie viel leichter wäre es doch, mit dem Phantasma mir zu sagen, daß sie ‚es nicht kann, denn sie ist eben behindert', und damit mein Versagen in ihr zu verachten" (ebd. S 122).
In der letzten Frühfördereinheit hatte ich mit David im Wohnzimmer einen Weg aus Balancierhalbkugeln gelegt, auf die er steigen sollte, ohne dazwischen den Boden zu berühren. Das Spiel hatte seinen Ehrgeiz geweckt, und er bewältigte den schwierigen Weg wieder und wieder mit großer Begeisterung. Heute hatte ich mir nun Variationen dieses Spiels vorgenommen, um seine Umschalt- und Reaktionsfähigkeit zu fördern. Wir legten also den Parcours auf, und ich ließ Davids jüngeren Bruder vorzeigen, wie man im Slalom um die Halbkugeln laufen kann. David sah zwar zu, stieg dann aber wie beim letzten Mal auf die Halbkugeln drauf. Er ließ sich auch von meinen wiederholten Anweisungen nicht davon abbringen, so zu gehen, wie er das beim vorigen Mal getan hatte und war erst erbost und dann sehr verzweifelt, als ich immer noch auf der neuen Variante bestand. Inzwischen war ich davon überzeugt, dass David sich aufgrund seiner Behinderung nicht auf die neue Situation einstellen konnte und "solche Kinder" eben viele Wiederholungen brauchen. In diesem Moment rief David tränenüberströmt aus: "I schon brav!" - und mir wurde schlagartig bewusst, dass er meine Übungsanweisung als Bestrafung angesehen haben musste. Ich hatte hier ganz fatal den simplen Wunsch eines Kindes nach Wiederholung einer Tätigkeit verkannt, die ihm einfach großen Spaß machte. Sehr beschämt musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ich David unterstellt hatte, dass er nicht fähig war, mehr als eine Art der Anwendung eines Materials zu erlernen. Ich hatte ihm beschränkte geistige Lernfähigkeit zugeschrieben, während er sich nicht anders verhalten hatte als jedes andere Kind, das auf einem dringenden Wunsch beharrt. Mit seinem Ruf "I schon brav" hatte er mich aber auch auf seine große Anpassungsbereitschaft hingewiesen, die er ja sonst wirklich immer an den Tag legte.
Förderziele innerhalb einer gemeinsam mit den Eltern zu erstellenden Zielplanung sind ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in der Frühförderung, die zur Legitimation der Tätigkeit der Frühförderin den Eltern, aber auch der Institution und letztendlich der Gesellschaft gegenüber dienen.
Es kommt aber darauf an, wie Förderziele formuliert werden - und es ist durchaus möglich, gerade die Entfaltung der Autonomie des Kindes als zentrales Ziel anzunehmen und damit dem "Wunsch" des Kindes als Individuum mit ganz eigenen Bedürfnissen Raum zu geben. Spielraum ist vielleicht ein ganz wesentlicher Hinweis für die Arbeit der Frühförderin. Einerseits geht es darum, der Mutter bzw. den Eltern Spielraum für das Aussprechen ihrer Ängste, Sorgen, Belastungen und ambivalenten Gefühle zu geben, dann aber auch wieder um das Eröffnen von Spielraum für ihre eigenen Wünsche und Lebenspläne. In der Beziehung zu ihrem Kind geht es um das Aktivieren von positiver Motivation für das Zusammensein mit ihm in dem Sinn, die Eltern für die vom Kind geäußerten Bedürfnisse zu sensibilisieren und ihnen eine neue Sicht des Kindes als Person mit individuellen Fähigkeiten und dem Wunsch sowohl nach Eigenständigkeit wie auch nach Bindung nahe zu bringen - vielleicht eine Sicht des Kindes außerhalb des von der Diagnose vermittelten Phantasmas. Dies könnte dazu führen, dass letztendlich auch das Kind wieder mehr Spielraum für die Entfaltung seiner Eigenaktivität und seiner Eigenpersönlichkeit bekommt und sein Verhalten den Eltern wiederum Mut und Kraft gibt, einen individuellen Weg zu suchen, um mit der Behinderung des Kindes, mit den begleitenden Fachkräften aus dem therapeutischen und medizinischen Feld und mit den Menschen der sozialen Umgebung in einer für die Familie förderlichen Weise umgehen zu können. Diese Überlegungen würden für die Frühförderin bedeuten, den Spielraum aller Familienmitglieder im Blick zu haben und ihre Maßnahmen darauf abzustimmen, diesen zu vergrößern bzw. zu eröffnen.
Wie aus dem Vorangegangenen schon ersichtlich wurde, hat die Diagnose der Behinderung Auswirkungen auf den Umgang der Eltern mit ihrem Kind und damit auf ihre erzieherische Haltung. Allgemein könnte man sagen, dass die schwierige emotionale und faktische Situation der Eltern, ihre relative soziale Isolation in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung und ihre oft ohnmächtige Position gegenüber Fachleuten die Ausbildung von Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismen begünstigt, die sich in erzieherischen Fehlhaltungen dem Kind gegenüber ausdrücken können. "Abwehrreaktionen der Eltern gegen die Tatsache der Behinderung des Kindes können sich, verbunden mit gesellschaftlichen Ablehnungshaltungen, zu erzieherischen Fehleinstellungen verdichten" (Kriegl 1993, S 39). Diese Fehlhaltungen können nach Kriegl von der völligen Realitätsverleugnung, in der die Eltern in Passivität und der unrealistischen Hoffnung verharren, alles werde wieder gut, über die übersteigerte, hektische Aktivität bis hin zur feindseligen Verbitterung gegenüber der Umwelt und zur extremen Zuwendung zum Kind reichen. Es kann passieren, dass die Eltern ihre unreflektierte ambivalente Haltung dem Kind gegenüber in nonverbalen Reaktionen und einer Mischung aus Aggression und Verzärtelung zum Ausdruck bringen. Das Kind fühlt dann die drohende Wut dahinter und reagiert mit gehemmter Entwicklung. Die verleugnete elterliche Frustration und Depression kann tiefgreifend verwirrend auf das Kind wirken. (vgl. Kriegl 1993, S 39ff)
In der Erziehung des Kindes kann die Abwehr der Schuldgefühle und Ängste der Eltern der Behinderung gegenüber zum Ausdruck kommen. Es kann sein, dass alle Bemühungen der Eltern in die Richtung gehen, der Behinderung entgegenzuwirken und alles zu unternehmen, was eine Verbesserung oder Veränderung, wenn nicht gar eine Heilung, verspricht. In diesem Fall kann auf die Bedürfnisse des Kindes keine Rücksicht genommen werden, und es besteht die Gefahr der Vereinnahmung und Überforderung des Kindes durch unzählige therapeutische und medizinische Maßnahmen. Hier ist es auch wahrscheinlich, dass die Eltern die Rolle der Co-Therapeuten übernehmen und zu Experten werden, was die Hintergründe und das Wissen rund um die Behinderung betrifft. Es hilft den Eltern oft sehr, wenn sie das Gefühl haben, etwas tun zu können, aktiv der Behinderung und damit dem Schicksal begegnen zu können. Der Aktivismus gibt zumindest vordergründig das Gefühl, die Situation kontrollieren zu können und ihr nicht so hilflos ausgeliefert zu sein.
Christoph Steinebach konnte in seiner Befragung der Mütter von Kindern mit Teilleistungsstörungen feststellen, dass das Gefühl der Kontrollierbarkeit belastender Ereignisse ein wichtiges Motiv für das Verhalten der Mütter darstellt. Mütter reagieren nach Steinebach auf konflikthafte Situationen oder Entwicklungsschwierigkeiten des Kindes meist mit größerer Nähe, was sich positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann. Die Entwicklungskontrolle nimmt in Konfliktsituationen demnach zu. (vgl. Steinebach 1995, S 124 f).
Hinter der vermehrten Aktivität und Sorge für das Kind kann aber auch das unbewusste Motiv stehen, die ambivalenten Gefühle dem Kind gegenüber nur ja nicht zum Ausdruck kommen zu lassen. Gerade in der ersten Zeit nach der Diagnosestellung dient die Abwehr den Eltern als eine Art Selbstschutz und stellt oft den Versuch dar, dem erlittenen Verlust auszuweichen, ihn zu leugnen. Es kommt eine Sehnsucht nach dem Ungeschehen-machen-Wollen zum Ausdruck. Die Verdrängung kann sich äußern in sehr gesteigerter Aktivität, die Monika Jonas in Anlehnung an Verena Kast die "Flucht in die Geschäftigkeit" oder in Anlehnung an Milani-Comparetti den "Förderungsaktivismus" nennt. Nach Milani-Comparetti unterstützen Fachleute die Abwehr der Eltern oft, indem die Maßnahmen, die sie ergreifen, eigentlich der Bewältigung ihrer eigenen Angst dienen und nicht unbedingt dem Kind. (vgl. Jonas 1990, S 100)
"Es ist die Frage zu stellen, ob die ‚Geschäftigkeit wider den Verlust' nicht auch ein Problem der Medizin, der Therapie, der Heilpädagogik und deren Institutionen und letztlich der handelnden Personen ist" (ebd. S 103)
Die Mütter können also in ihrer Abwehr noch zusätzlich verstärkt werden durch das Handeln der Fachleute. Nachdem das Handeln in der Rehabilitation meist im Vordergrund steht, haben die Mütter meist wenig Raum, um ihre Emotionen ausdrücken zu können.
Aktivismus als Abwehrform zu sehen, würde für mich im Hinblick auf die helfenden Berufe auch heißen, die Grenzen der eigenen Tätigkeit und damit die eigene Hilflosigkeit anzuerkennen, sie auszuhalten und dazu zu stehen - auch gegenüber einer verzweifelt nach Veränderung strebenden Familie.
Aus dieser unbestimmten Hoffnung heraus, das Kind doch noch heilen zu können, akzeptieren die Eltern die Fremdbestimmung durch die Fachleute. Das Aufgeben dieser Hoffnung und die schrittweise Wahrnehmung des Kindes in seinem Sosein kann aber oft Jahre dauern, wenn die Eltern überhaupt je an diesen Punkt gelangen.
"Eine weitere Hoffnung beruht darauf, durch den therapeutischen Einsatz für ihr Kind ein Gefühl für sich als gute Mutter zu bekommen und über das Handeln die positiv besetzten Beziehungsphantasien wiederherzustellen. Dies ist trügerisch, da die Mütter nicht mit eigener Kompetenz handeln, sondern an fremdbestimmter Kompetenz partizipieren" (ebd. S 101). Therapieanweisungen können die Beziehung zwischen Mutter und Kind erschweren und die Abwehr noch verstärken. Da sie Hoffnung auf Heilung wecken und den Eltern das Gefühl geben, endlich etwas tun zu können, werden sie oft gerne angenommen. "Die Mütter schwanken zwischen der Hoffnung, der Verlust sei reversibel und der Furcht, die Katastrophe könne hereinbrechen" (ebd. S 103).
Für die Mütter besteht nach Jonas aber noch ein weiteres Motiv, sich sehr für die Entwicklung ihres Kindes einzusetzen: Die positive Entwicklung des Kindes gilt ihnen als persönlicher Erfolg, während ihnen die fehlende Entwicklung des Kindes als Misserfolg angelastet wird, was ihre Identität als Mutter zusätzlich beeinträchtigt.
Jonas sieht im Aufgehen der Eltern in der Beziehung zu ihrem Kind auch verdrängte Todeswünsche, abgewehrte Aggressionen und geleugneten Hass und Wut auf das Kind mit seiner Behinderung, seiner Andersartigkeit. Die Idealisierung der Beziehung zum Kind dient dann der Abwehr destruktiver Gefühle. "Die Wut und Aggression der Mutter richten sich dann gegen Außenstehende: Partner, TherapeutInnen oder die, die diese symbiotische Einheit in Frage stellen" (ebd. S 112).
Dabei sind Wut und Aggression für Jonas wichtige Elemente, die zum Trauerprozess gehören und ausgedrückt werden sollten, was aber gerade Frauen aufgrund ihrer spezifischen Sozialisation oft sehr schwer fällt. "Die bedeutende Funktion von Wut und Haß liegt darin, entschiedenes Handeln und Entscheidungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Trennung und zum Loslassen zu aktivieren" (ebd. S 112). Nicht erlaubte Aggression kann zur Depression führen, zu Hilflosigkeit und Abhängigkeit von therapeutischen Maßnahmen und zum Teil massiven medizinischen Eingriffen oder zu passivem Widerstand, der darin besteht, keine Initiative zu ergreifen und damit wiederum Schuldgefühle auslöst.
Die Wut kann personalisiert und gegen die Therapeutinnen gerichtet werden, mit dem Vorwurf, sie hätten nicht genügend für ihr Kind getan. "Sie werden entwertet, um das eigene Gefühl des Unwertes abzuwehren" (ebd. S 113). Jonas gibt dabei aber zu bedenken, dass Kritik an Therapeutinnen auch durchaus realen Hintergrund haben und berechtigt sein kann. "Wut und Aggression gegen Außenstehende kann die hilfreiche Funktion haben, den Aufbau der mütterlichen Identität, die durch die Fremdbestimmung verloren ging, einzuleiten, so daß die Mütter sich selbst als kompetent für ihr Kind begreifen" (ebd. S 113). Eingestandene Wut kann demnach dazu führen, einen Weg aus der Hilflosigkeit, Passivität und Opferrolle heraus zu finden und kann der Übergang zu entschiedenem, selbstbestimmtem Handeln sein.
Was Jonas hier noch anspricht und was ein grundlegendes Problem für die Entwicklung des Kindes darstellt, ist die Frage der Loslösung und Trennung, die ihm von seinen Eltern zugestanden bzw. ermöglicht wird. Gerade durch eine enge Beziehung, die die Eltern zum Kind aufrechterhalten, durch die große Sorge, die vielen Unternehmungen und die große Kontrolle wird es dem Kind sehr erschwert, Äußerungen in Richtung vermehrter Autonomie zu zeigen. Wenn die Fürsorge für die Eltern die Funktion hat, widersprüchliche Gefühle abzuwehren, dann ist es ihnen kaum möglich, dem Kind in diesem Wunsch entgegenzukommen, ohne mit den verdrängten Gefühlen in Berührung zu kommen und ohne über das Verständnis ihrer Elternidentität reflektieren zu müssen. Dabei ist nach Miller das Abnabeln ein Prozess, der sich bereits von Geburt an in winzigen Schritten vollzieht. "Jeder Wachstumsschub ist ein Schritt in Richtung Selbständigkeit und Ablösung" (Miller 1997, S 90). Sie betont dabei die Aufgabe der Eltern, die ihrer Meinung nach darin besteht, den Ablösungsprozess beim Kind anzustoßen, auszulösen. Ich glaube hingegen, dass auch jedes Kind mit Behinderung in irgendeiner Form Autonomiebestrebungen zeigt und dass es vor allem darum geht, diese zu erkennen.
"Voraussetzung für eine erfolgreiche Loslösung und Errichtung eines inneren Selbstbildes, für Erlangen von Autonomie und Empathie, ist die ‚Erlaubnis' und Unterstützung der Mutter, ohne die das Kind in der symbiotischen dualen Beziehung gefangen bleibt und in seinem Autonomiebestreben auf eine ichbezogene Agitation zurückgeworfen wird" (Elbert 1982, S 77/78).
Elbert hat in seinen Ausführungen spezifische Merkmale beschrieben, die die Sozialisation des geistig behinderten Kindes bestimmen können. (vgl. ebd. S 79ff)
Überbehütendes Verhalten der Eltern kann aus der Projektion einer innerlich ablehnenden Haltung auf eine drohende äußere Gefahr entstehen, vor der das Kind behütet werden muss. Aus der Angst heraus, die eigenen negativen Gefühle könnten sich auf das Kind übertragen, will sich die Mutter selber beweisen, dass sie eine gute Mutter ist, indem sie möglichst viel tut. Der Kampf gegen die unbewusste eigene Aggression wird so nach außen verlegt in den Kampf um das "Wohl" des Kindes. Überbehütendes Verhalten wird gerade der Mutter aber oft auch von außen aufgedrängt, indem Fachleute immer wieder darauf beharren, dass das Kind lebenslangen Schutz und Hilfe benötigen wird. Die Folgen für das Kind bestehen darin, dass es durch die übergroße Aktivität der Eltern darin unterstützt wird, sich nicht mehr mit der Welt auseinander zu setzen. Es wird ihm der Raum zur Eigeninitiative genommen, und Autonomie ist für das Kind nur mehr als sozial unerwünschtes, abweichendes Verhalten möglich. Das Kind bleibt im Wunsch nach Trennung und gleichzeitig in der großen Angst davor gefangen und kann sich selber nicht als handlungsfähig erleben. Es fehlen ihm die nötigen Frustrationserlebnisse, durch die es das Getrenntsein von der Mutter erproben kann und aushalten lernt.
Die Gefahr einer lebenslangen Mutter-Kind-Dyade besteht, aus der sich weder die Mutter noch das Kind lösen können. Durch den Rückzug oder das Fehlen des Vaters kann die duale Beziehung zwischen Mutter und Kind sehr gefestigt werden. Zusätzlich wird die Mutter auch durch die gesellschaftlichen Vorstellungen von einer aufopfernden, pflegenden Mutter in eine häusliche Isolation gezwungen, die für das Kind weitreichende Folgen hat. Auf der Seite des Kindes entstehen der Mutter gegenüber zahlreiche ambivalente Gefühle. Neben der Zuwendung verstärken sich Hass- und Wutgefühle, wenn es sich nicht lösen kann bzw. darf. Zornausbrüche oder andere aggressive Verhaltensweisen können dafür ein Zeichen sein.
Außerdem können gehäufte Double-Bind-Situationen das Kind entwerten, weil es auf paradoxe, widersprüchliche Mitteilungen und Anforderungen nicht adäquat reagieren kann. Es bleibt immer etwas nicht erfüllt, auch wenn es alles richtig macht, und damit kann es letztendlich nur scheitern. Zum Double-Bind kommt es, weil "der Mutter die Projektion ihrer negativen Gefühle nicht immer gelingt, sondern ihre ambivalenten Gefühle dem Kind gegenüber oft durchscheinen. [...] Indem das Kind das Paradoxon nicht lösen kann, wird es ‚entwertet', d.h. es wird ihm mitgeteilt, daß es nicht existiert bzw. seine Existenz bedeutungslos ist" (ebd. S 81). Es bildet sich ein negativer Kreislauf, in dem Mutter und Kind auf ihre jeweiligen Äußerungen paradox reagieren und gegenseitiges Verständnis nicht entstehen kann. "Das Kind verliert den Glauben an seine Handlungsfähigkeit, und sein Vertrauen in sich und seine Mutter, sein rudimentäres Selbstbild wird verunsichert" (ebd. S 82).
Aufgrund einer erschütternden Prognose senken die Eltern oft ihre Erwartungshaltungen und Anforderungen an das Kind. Das kann zu einer Unterforderung des Kindes führen - es werden ihm Lebensraum und Lernerfahrungen vorenthalten. Die Eltern reagieren anders auf das Kind, sie verstärken es früher oder insgesamt weniger, verbieten ihm entweder mehr oder weniger. Die emotionale Welt des Kindes verändert sich, und es besteht die Gefahr der Entwertung, "wenn durch die Diagnose sich die Perspektive und die Erwartungen der Eltern verändern und die Grenzen verrückt werden, eine adäquate Rückmeldung auf sein Verhalten ausbleibt" (ebd. S 83).
Insgesamt geben Diagnose und Prognose der Familie neben all der zerstörenden Wirkung aber doch eine scheinbare Stabilität. Man weiß, was einen erwartet, womit man rechnen, sich abfinden muss und was man tun soll. Ein von der Diagnose und Prognose abweichendes Verhalten des Kindes gefährdet diese mühsam wiedererlangte Stabilität. Die Reaktion darauf sieht dann oft so aus, dass jenes der Diagnose nicht entsprechende Verhalten als abweichend erkannt und unterbunden wird. "Daher ist autonomes Handeln eines ‚Geistigbehinderten' per Definitionem nur im illegalem Raum möglich" (ebd. S 83).
Was diese Ausführungen sehr deutlich machen, ist die Tatsache, dass ein von Behinderung bedrohtes oder betroffenes Kind in seiner Entwicklung durch die Reaktionen seiner wichtigsten Bezugspersonen noch zusätzlich behindert werden kann. Es zeigt sich, wie schwierig es für Eltern ist, angesichts der Behinderung des Kindes und den Ängsten, die dadurch in ihnen wachgerufen werden, ihre elterlichen Kompetenzen zu wahren und sich auf ihre intuitiven Fähigkeiten als Eltern zu verlassen. Ob es nun der von außen kommende Druck ist, der die Eltern veranlasst, schnell Gegenmaßnahmen zu ergreifen, oder ob man darin innerpsychische Abwehrmechanismen erkennen will - es bedeutet für das Kind jedenfalls, dass es sich anpassen muss, und es bleiben ihm so wichtige Erfahrungsräume und damit Entwicklungsmöglichkeiten verwehrt.
Wenn nun die Entwicklung des Kindes von so vielen Seiten her erschwert ist, so bedeutet das für die Frühförderung aus meiner Sicht, vom prinzipiellen Entwicklungspotential des Kindes überzeugt zu sein und ihm möglichst viele Möglichkeiten wieder zu erschließen. Dieser Weg kann aber nur über die Eltern führen bzw. gemeinsam mit ihnen verwirklicht werden.
Für die Entwicklung des Kindes ist es entscheidend, inwieweit die Eltern in der Lage sind, die Signale des Kindes zu verstehen und ihre Kommunikationsmöglichkeiten mit ihm zu erweitern. Frühförderung könnte hier den Eltern Hilfe anbieten im Verstehen der Äußerungen des Kindes in ihrer Bedeutung, so dass die Eltern sie nicht als Ablehnung oder einfach nur als Verhaltensauffälligkeit wahrnehmen. Diese Gefahr besteht sicherlich auch für die Frühförderin: dass sie das Verhalten eines Kindes als Symptom der Behinderung und nicht als Mitteilung seines eigenen Wunsches deutet. Dabei ist das Kind selber wahrscheinlich der beste Ausgangspunkt für Überlegungen zu seiner Förderung. In der Orientierung am Kind und an seinen Bedürfnissen finden sich alle Anhaltspunkte für seine Entwicklungsbegleitung. Das Kind zeigt mit seinen Reaktionen auf ein Angebot den Weg auf, den es gemeinsam zu gehen gilt. Sich von den Äußerungen des Kindes im Dialog mit ihm leiten zu lassen, bedeutet auch, Wege abseits der Diagnose und Prognose einzuschlagen und mit den Erwartungen und Anforderungen an das Kind nicht im Rahmen dessen zu bleiben, was es laut Prognose können oder nicht können wird, sondern in der direkten Beobachtung und Interaktion mit dem Kind konkrete Ziele zu entwickeln. Dabei sollten die Stärkung des Selbstwertgefühles und der Autonomie des Kindes, die Entfaltung seiner individuellen Stärken und seine Integration die zentralen Ziele bilden.
"Wenn man jedoch von einem Entwicklungsmodell ausgeht, nach dem jeder Organismus die Tendenz hat, aus der aktiven Auseinandersetzung mit Erfahrungen Strukturen zu bilden, die sich auseinanderentwickeln und eine gewisse Tendenz zur Selbstkorrektur haben, [...] dann wäre eine Hilfe für die Eltern und Frühförderer, sich an Anzeichen am Kind für solche fortschreitenden Entwicklungstendenzen zu orientieren" (Rauh 1983, S 143, zitiert in Lambeck 1992, S 54).
Für die konkrete Entwicklungsförderung des Kindes schlägt Lambeck vor, sich nicht an übergeordneten psychologischen Begriffen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit oder Konzentration zu orientieren. "So ist es nicht möglich, mit behinderten Kindern die Aufmerksamkeit oder die Konzentration zu üben, da diese Begriffe nicht isoliert betrachtet werden können. Sie sind hilfreiche Konzepte, um Verhalten zu beschreiben und zu analysieren, aber sie haben keine direkte Entsprechung als Disposition beim Kind. Geübt und angeregt werden können nur Handlungserfahrungen" (Lambeck 1992, S 53). So spielt etwa bei motorischen Übungen nicht der motorische Handlungsinhalt die wichtigste Rolle. Vielmehr geht es darin um das Kind als handelnde Person, die etwas bewirken kann, was der Interaktionspartner freudig aufnimmt. Die positive Verstärkung durch den Interaktionspartner löst beim Kind Freude über die Bewegung aus, und es wird dazu motiviert, die Handlung weiterzuführen, zu variieren und in anderen Situationen einzusetzen. Es geht also um die Anregung der Eigenaktivität des Kindes und um den Transfer von Lernprozessen in Alltagsbereiche, wodurch die Selbstbestimmtheit des Kindes eine Erweiterung erfahren kann. Lambeck spricht sich auch dagegen aus, Entwicklungsaufgaben als Programmschritte in einem Förderprogramm zu verwenden, da ein Durchschnitt im Grunde nichts über die individuelle Entwicklung eines Kindes aussagt.
Lambeck sieht die Aufgaben der Frühförderung je nach Adressat verschieden: im Erwerb optimaler Handlungsfähigkeit für das Kind, in der Erhöhung und Stärkung der Elternkompetenzen und in der Integration von Kindern und Eltern in die Gesellschaft.
Sie bezieht aber auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Frühförderinnen in ihre Überlegungen mit ein. "Aus der abstrakten Formulierung der Förderziele leitet sich jedoch nicht unmittelbar eine konkrete Interventionsmaßnahme ab. Die konkrete Interventionsmaßnahme ist abhängig vom theoretischen Hintergrund des jeweiligen Therapeuten, der die seiner Theorie und seinem Menschenbild zugeordneten Methoden einsetzt" (ebd. S 54). Die Frühförderin soll also verschiedene theoretische Konzepte prüfen, hinterfragen, ihre Möglichkeiten und Grenzen sehen und sie nach Bedarf miteinander kombinieren, um Lernbedingungen für das Kind zu schaffen, die eine unnötige Einschränkung seiner Lernfähigkeit vermeiden.
"Entwicklungsberatung kann hier heißen, den Eltern zu helfen, die Kommunikationsmöglichkeiten ihres Kindes besser zu verstehen" (ebd. S 55).
Auf der anderen Seite geht es ihr auch um die Einbeziehung der Eltern in die Überlegungen der Frühförderin. "Ein weiterer Aspekt von Entwicklungsberatung besteht darin, mit den Eltern, die die wichtigsten Bezugs- und Betreuungspersonen für das Neugeborene oder Kleinkind sind, ihre Vorstellungen von Entwicklung und Erziehung des Kindes zu besprechen" (ebd. S 56). Das würde für die Frühförderin bedeuten, sich laufend mit den Eltern darüber zu verständigen, welche Prozesse in der Arbeit mit dem Kind und in seiner Entwicklung gerade im Vordergrund stehen und wie sie diese selber im Alltag und in ihrer Beziehung zum Kind einschätzen. Die eigenen Ziele und Vorstellungen der Eltern sollten gemeinsam mit ihnen reflektiert werden.
Das bedeutet auch, sich auf die Haltung der Eltern zur Behinderung des Kindes einzulassen und gegebenenfalls die dahinterliegenden Gefühle der Eltern anzufragen, gerade auch, wenn der Förderdruck in der Frühförderung überhand zu nehmen droht.
Hackenberg betont die Bedeutung der Beziehung in der Frühförderung und sieht die Aufgabe der professionellen HelferInnen deshalb in der Beziehungsförderung. "Auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung zur Frühförderin erhalten die Eltern Hilfen dabei, ihr Kind differenziert wahrzunehmen, seine Signale und Reaktionen zu beobachten und verschiedene Angebote auszuprobieren. Zugleich erhalten sie Raum dafür, ihre belastenden Erfahrungen und Gefühle auszudrücken und zu reflektieren" (Hackenberg 2003, S 6).
Es geht in der Frühförderung also hauptsächlich um den Dialog: um den Dialog mit dem Kind, um den Dialog zwischen Kind und Eltern und um den Dialog zwischen Eltern und Frühförderin - letztendlich geht es um die gegenseitigen Interaktionen in diesen verschiedenen Handlungsfeldern der Frühförderung.
Dabei sollte es sich um einen Dialog gleichberechtigter Partner handeln, in dem jeder Interaktionspartner seine Beiträge und Vorschläge einbringen kann, in dem jeder Interaktionspartner an der Aktion und Handlung beteilig ist und in dem sich jeder Interaktionspartner als beachtet, wertgeschätzt und gleichrangig erleben kann. Dabei stellt aber nicht nur die Aktion, sondern auch das Nicht-Mitgeteilte einen Beitrag zur Interaktion dar - ebenso wie Ruhephasen zur Entwicklung gehören. (vgl. Lüpke in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 73ff)
Lüpke hält es für sehr wichtig, dem Kind das Experimentieren zu ermöglichen, damit es das mit sich Identische in einem risikofreien, geschützten Raum finden kann. Er sieht im Erproben eine ständig stattfindende Entwicklung und damit die Komposition von Identität.
In Anlehnung an Veldman (1991) beschreibt er ein Konzept der Entwicklungsbegleitung, in dem der Entwicklungsbegleiter im wörtlichen und übertragenen Sinn die "gute Hand" darstellt: "Sie nimmt nichts, fordert nichts, sucht nicht sich selbst, sie ist bestätigend, beschützend, zärtlich, einhüllend, [...] Indem sie bewahrt, Werden und Sein einfach zulässt, erweckt sie in ihrer affektiven Bestätigung zum Leben" (Veldman 1991, S 411, zitiert von Lüpke in Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 76).
Die Konsequenzen dieser Haltung sieht Veldman in drei Qualitäten des Therapeuten: in der Präsenz, in der Transparenz und in der Vorsichtigkeit, Behutsamkeit.
Ich denke, dass diese Haltung für die Frühförderin eine Orientierung vor allem für das Arbeiten mit dem Kind darstellen, dass sie aber auch die Arbeit mit den Eltern und die Einflussnahme auf die Interaktion zwischen Eltern und Kind leiten könnte. Eine der wichtigsten Aufgaben der Frühförderung besteht wohl im Da-Sein für die Familie, in ihrer Anwesenheit in einer oft schwierigen Situation, in der die Eltern sonst wohl manchmal alleingelassen wären. Trotzdem aber muss die Frühförderin gerade wegen ihrer räumlichen Nähe zur Familie, gerade wegen ihres Eindringens in die Intimsphäre der Familie mit großer Behutsamkeit und Vorsichtigkeit die Bedürfnisse der Mitglieder aufnehmen und die Intentionen ihrer Arbeit transparent und damit gut verständlich machen.
Mit der Art und Weise der Förderung des Kindes kann die Frühförderung viel zur Umsetzung von gesellschaftlichen Anforderungen beitragen, vor allem, wenn sie durch die Zugehörigkeit zu einer Institution unter dem Einfluss des dort vertretenen Menschenbildes steht und mit den Bedingungen konfrontiert wird, die von der übergeordneten geldgebenden Instanz festgelegt werden. Gerade in den letzten Jahren wurde der Druck auf die einzelne Frühförderin spürbar größer, wenn es darum ging, genaue Ziele für die Förderung festzulegen und Erfolgsnachweise zu erbringen, um die weitere Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen zu gewährleisten. Dabei zählt es leider wenig, wenn es der Frühförderin gelungen ist, eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind herzustellen, in der es diesem möglich wird, eigenständig zu handeln, seine Wünsche auszudrücken und sich in die Interaktion eigeninitiativ einzubringen. Der Erwerb alltagspraktischer, schulorientierter Fähigkeiten und von Verhaltenweisen, die der normalen Entwicklung entsprechen, hat hier zumindest nach außen hin größere Bedeutung. Ich denke, dass auch Eltern diesen Anspruch zu spüren bekommen und ihn auf ihre Erwartungen an die Arbeit der Frühförderin übertragen.
Die Orientierung an der Gesamtpersönlichkeit des Kindes und auch an seine emotionalen und sozialen Fähigkeiten hat natürlich oft den Beigeschmack der unspezifischen "Ganzheitlichkeit" und damit den Anschein des Ungeplanten, Chaotischen, Nicht-Fassbaren.
Dagegen können aber viel Struktur und genau geplante Übungsanweisungen in der Frühförderung neben dem durchaus berechtigten Anspruch nach Sicherheit und Orientierung für das Kind manchmal auch den eigenen Bedürfnissen der Frühförderin nach Halt, wenn nicht sogar der Angstabwehr dienen. Hinter einer genau geplanten Übungsstunde kann man sich genauso gut verstecken wie hinter einem riesigen Materialangebot, das dem Kind dann nicht mehr Entscheidungsfreiheit gibt, sondern es überfordert.
Wenn die Frühförderin Schwierigkeiten damit hat, die Offenheit einer Fördersituation auszuhalten, dann sollte sie sich die Frage danach stellen, was sie daran nicht gut aushalten kann. Hat sie zu wenig Vertrauen in die Eigentätigkeit des Kindes? Nimmt sie das Kind wirklich als autonomen Interaktionspartner wahr und kann sie seine Äußerungen wirklich beachten und aufnehmen? Hat sie Angst davor, den Gefühlen zu begegnen, die sich unwillkürlich einstellen, wenn sie sich ganz auf das Kind einlässt? Hat sie Angst davor, dass das Triebhafte, Unkontrollierte im Kind überhand nimmt und es nichts Sinnvolles im Sinne ihrer Schemata tut?
Authentizität ist meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, den die Frühförderin fähig sein muss, in die Interaktion mit dem Kind und seinen Eltern einzubringen. Sie sollte die in ihr entstehenden Gefühle dem Kind und seinen Eltern gegenüber auch ausdrücken können, ohne sie damit zurückzuweisen oder zu verletzen.
Das Kind mit Behinderung fordert die Anerkennung seiner Eigenart auf fundamentale Weise heraus: Es stellt die Eltern und die Frühförderin vor die Aufgabe, sich ganz auf es einzulassen, es nach seiner Persönlichkeit und nach dem Sinn seiner Äußerungen zu befragen.
Die Auseinandersetzung mit der Behinderung des Kindes und deren Verarbeitung ist nach Hinze ein Prozess, der im zeitlichen Verlauf stattfindet und von bestimmten objektiven Ereignissen und Bedingungen abhängt. Es ist ein Prozess ständiger Veränderungen des Erlebens und Verhaltens, der entwicklungsorientiert ist. Für viele betroffenen Familien ist die Auseinandersetzung mit der Behinderung stressreich, belastend und schwer zu bewältigen. Dabei wird die Art und Weise der Auseinandersetzung und Verarbeitung maßgeblich von der Art und Weise mitbestimmt, wie die Eltern die Behinderung wahrnehmen und erleben. Der Verarbeitungsprozess hat sowohl einen intrapsychischen als auch einen interpersonellen Bezug. Er findet in der Person der Eltern ebenso statt wie in deren Beziehungen zum sozialen Umfeld. Somit hat der Verarbeitungsprozess auch eine gesellschaftliche Dimension, da gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen, die durch die geschlechtsspezifischen sozialen Rollen der Väter und Mütter zum Tragen kommen, die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Behinderung in entscheidender Weise mitbestimmen. (vgl. Hinze 1993, S 167)
Hinze wendet sich gegen eine pathologische Anschauung des elterlichen Verhaltens. "Stets versuchen sie [die Eltern, C.K.-S.] damit, sich seelisch zu schützen, die emotionale Belastung zu lindern, mit ihrer Trauer und Enttäuschung fertig zu werden und ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren oder wieder herzustellen" (ebd. S 15). Andererseits spricht er davon, dass Vermeidungsreaktionen bei Eltern behinderter Kinder auch einen gesellschaftlichen Hintergrund haben können. "Das entwicklungsgestörte Kind entspricht nicht der Norm. Es entspricht nicht nur nicht den Erwartungen der Eltern, sondern auch den gesellschaftlichen Erwartungen nicht. Das Ausweichen vor den Problemen dürfte deshalb auch von dem Motiv bestimmt sein, daß nicht sein kann, was nicht sein darf" (ebd. S 103). Er ist der Meinung, dass der Prozess der Verarbeitung ein lebenslanger Prozess sein kann, was mit der heute gängigen gesellschaftlichen Einstellung kollidiert, wonach jeder einzelne Krisen alleine und schnell bewältigen muss. Für Trauer scheint heute oft keine Zeit mehr zu sein, und trauernde Menschen können dadurch unter Druck geraten.
"Es muß davon ausgegangen werden, daß zwischen den Erwartungen der sozialen Umgebung an die Fähigkeit der Eltern, mit der Behinderung fertig zu werden und der von den Eltern selbst erlebten Situation eine große Diskrepanz zu bestehen scheint. Außenstehende schienen häufig unrealistische Vorstellungen davon zu haben, wie schnell die Eltern mit ihrem Los fertig werden können bzw. sollen" (ebd. S 144).
Hier kommt auch die Rolle der Fachleute ins Spiel. In der Art und Weise, wie sie das Kind in seiner Eigenart annehmen, wie sie mit der Behinderung umgehen und welche Einstellung sie den Eltern damit vermitteln, können sie Einfluss auf den Verarbeitungsprozess der Eltern nehmen, sie unterstützen oder zusätzlich unter Druck setzen. Es geschieht meiner Meinung nach sehr häufig, dass Probleme mit den Eltern auf deren ungenügende "Annahme" oder Verarbeitung der Behinderung geschoben werden, ohne dass die dahinter anklingende Not der Eltern ernst genommen wird.
Hinze untersuchte in einer Befragung von Elternpaaren mit behinderten Kindern die verschiedenen Reaktionsformen und teilte sie in sechs Dimensionen ein, die grundlegend unterschiedlichen Formen der Auseinandersetzung und Bewältigung entsprechen. Er unterscheidet dabei zwischen der Belastung durch die Behinderung, dem Meiden der Konfrontation mit der Behinderung, dem Glauben an die Veränderbarkeit der Behinderung, der Herausforderung durch die Behinderung, der Suche nach Kontakt und Unterstützung und der Bejahung der Behinderung.
In der Verdachtszeit bis zur endgültigen Diagnosestellung sieht Hinze ein Überwiegen der Vermeidungsreaktionen. Die Eltern entwickeln aber auch ein starkes Problembewusstsein, das vor allem auf die Mütter emotional sehr belastend wirkt. Es sind in dieser Zeit hauptsächlich die Mütter, die sich der Probleme des Kindes immer mehr bewusst werden, die sich auf die Suche nach Ärzten und Therapeuten begeben, Informationen einholen und dabei stark zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwanken.
"Insbesondere Mütter brachten zum Ausdruck, ständig unter dem Druck gestanden zu haben, das Richtige für ihr Kind zu tun. Zu diesem Druck hätte häufig auch eine entsprechende Erwartungshaltung der therapeutischen Fachkräfte beigetragen" (ebd. S 101). Die Möglichkeiten des Vaters, sich mit den Problemen der Kinder praktisch auseinander zu setzen, sieht Hinze beschränkt durch ihre Berufstätigkeit, ihre mangelnde Beteiligung am Kontakt mit Fachleuten und durch ein "erzieherisches Gewohnheitsrecht" der Mütter. Hinze sieht darin auch den Umstand begründet, dass sich die Mütter in dieser Zeit hoffnungsvoller äußerten als die Väter, die die Situation eher distanziert betrachteten. "Aufgrund ihrer faktischen Situation waren die Mütter wahrscheinlich besser in der Lage, nicht nur die Probleme des Kindes, sondern auch seine Fortschritte wahrzunehmen" (ebd. S 110).
So erleben Mütter auch die Diagnosemitteilung und den vorläufigen Verlust der Hoffung als besonders schmerzvoll und reagieren sehr emotional, wohingegen die Väter sich in dieser Situation eher rational verhalten und versuchen, ihrer Rolle als Beschützer der Familie und als Stütze für die Partnerin gerecht zu werden.
Im Nachhinein sahen die von Hinze befragten Eltern mit der endgültigen Diagnose aber auch ihre Bereitschaft steigen, die Tatsache der Behinderung zu bejahen. Für die Folgezeit sieht Hinze den Aspekt des Herausgefordertseins durch die Behinderung langsam in den Vordergrund treten und beobachtet eine Abnahme der Vermeidungsreaktionen. Während die Mütter nun vermehrt kognitiv getönte Reaktionsformen zeigen, scheint diese Phase es den Vätern erst zu erlauben, emotional zu reagieren. Ihre Ängste beziehen sich hauptsächlich darauf, dass das Kind keine Fortschritte machen und die Familie aufgrund der Behinderung des Kindes sozial ausgeschlossen werden könnte. Beide Eltern fühlen sich in gleichem Maß innerlich aktiviert und aufgerufen, sich für ihr Kind zu engagieren und mit der Behinderung fertig zu werden. Dabei zeigen sich für Hinze aber Unterschiede in der Verarbeitung von Müttern und Vätern. "Durch ihr starkes praktisches Engagement bei seiner [ des Kindes, C.K.-S.] fachlichen Betreuung dürften vor allem Mütter gelernt haben, positive Veränderungen wahrzunehmen. [...] Besser als Väter hatten es Mütter gelernt, das Kind selbst zum Maßstab seiner Entwicklung zu machen" (ebd. S 135). Trotzdem aber können emotionale Reaktionen und Trauer immer wieder von neuem aktiviert werden.
"Allein durch die Anwesenheit des behinderten Kindes dürften sie immer wieder an den Verlust des Wunschkindes und an die Endgültigkeit der Behinderung erinnert worden sein und dies als sehr schmerzhaft empfunden haben" (ebd. S 129).
In diesem Sinne würde ich sagen, dass auch die alleinige Anwesenheit der Frühförderin bzw. ihr regelmäßiges Erscheinen Woche für Woche den Eltern die Behinderung ihres Kindes immer wieder vor Augen führen und sie mit ihrem Auseinandersetzungsprozess konfrontieren kann.
"Depressive Gefühle werden häufig in bestimmten Situationen wachgerufen, in denen die Eltern mit der Behinderung massiv konfrontiert werden. Mehrere Väter und Mütter meinten, stark betroffen gewesen zu sein, wenn sie normale Kinder beim Spielen beobachtet hätten und ihnen bewußt geworden sei, daß ihr Kind nie richtig würde mitspielen können" (ebd. S 129). Väter und Mütter fühlen sich durch ein behindertes Kind hauptsächlich seelisch gefordert. "Ein dauerhaft behindertes Kind zu haben, bedeutet eine permanente emotionale Belastung" (ebd. S 130). Mütter erleben im Gegensatz zu Vätern in der Folgezeit oft eine Normalisierung der Beziehung zu ihrem Kind. Die Annahme des Kindes so, wie es ist, bringt ihnen emotionale Erleichterung, und durch die oftmals geringer werdende faktische Belastung durch Pflegeaufgaben verringert sich auch die empfundene Belastung. Mit der Zeit erleben die Mütter ihr Kind und dementsprechend auch ihr Familienleben wieder als zunehmend normal, und diese zunehmende Gewöhnung an die Situation und die Behinderung des Kindes bewirkt emotionale Entlastung. "Die Ergebnisse zeigen, daß die Neigung auf Seiten der Väter, sich von der Behinderung zu distanzieren, vor allem darauf ausgerichtet war, negative soziale Folgen zu vermeiden" (ebd. S 134).
Insgesamt aber sind die Eltern zum Teil auch sehr zufrieden mit der Pflege- und Betreuungsarbeit, die sie bereits geleistet haben und beschäftigen sich wieder mehr mit ihren eigenen Interessen, die sie lange Zeit zurückgestellt haben. Die Mehrzahl der Eltern in Hinzes Studie gab an, die Tatsache bejaht zu haben, Eltern eines behinderten Kindes zu sein. Sie äußerten sich aber dahingehend, dass sie noch nicht damit fertig geworden seien und hegten Zweifel daran, ob sie überhaupt je damit fertig werden könnten. "Die Bejahung der Behinderung bedeutet keine ‚stabile Endposition', bedeutet nicht den Abschluß des Verarbeitungsprozesses, bedeutet nicht das Ende der emotionalen Belastungen. Abwehrtendenzen ebenso wie Hoffnungen werden immer wieder wirksam und lassen an der Behinderung zweifeln" (ebd. S 139). In diesem Sinne verstehe ich auch die Aussage mancher Eltern, die sagen, dass sie zwar ihr Kind angenommen haben, aber die Behinderung niemals akzeptieren können.
Hinze stellt eine Erfolgsorientierung in der Coping-Forschung fest und hinterfragt kritisch die bestehende Auffassung, nach der jeder Mensch fähig sein muss, eine Krise über kurz oder lang zu überwinden. "Die Erwartung geht dahin, die jeweilige Krise nicht ernst zu nehmen und möglichst rasch mit ihr fertig zu werden" (ebd. S 150).
Viele Phasen-Modelle zur Verarbeitung einer Krise nehmen einen idealen Endzustand an, den es zu erreichen gilt: etwa ‚Akzeptanz', ‚Anpassung' oder ‚Bewältigung'. Dabei herrscht selten die Meinung vor, dass sich Eltern behinderter Kinder gut mit den veränderten Bedingungen arrangieren können. Oft richtet sich der Blick vermehrt auf die pathologische Seite. Bezeichnet wird der angenommene Endzustand der Verarbeitung dann als Anpassungsleistung, als emotionale oder gelungene Anpassung. Ich finde es sehr interessant, dass in diesem Zusammenhang so häufig von Anpassung als Erfolg des Verarbeitungsprozesses gesprochen wird. Die Frage ist, woran sich die Eltern anpassen müssen. Vielleicht an die gesellschaftliche Erwartung, möglichst schnell, selbständig und ohne viel Aufsehen zu erregen, mit ihrer veränderten Situation aber auch den herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen und Umgangsweisen zurecht zu kommen. So gesehen kommt es der gesellschaftlichen Haltung sehr entgegen, wenn sich die Eltern gut anpassen: Es muss dann nichts verändert werden bzw. ist es die Familie, die sich verändern muss und nicht die Gesellschaft.
"Die Krise als Schicksal anzunehmen, neue Wertmaßstäbe zu entwickeln oder die Krise sogar als Glück erleben zu können, werden als Ausdruck einer vollzogenen Sinngebung angesehen" (ebd. S 151). Auch wenn Eltern behinderter Kinder vielleicht irgendwann dazu kommen, ihre Situation in dieser Weise wahrzunehmen, wäre es für Fachleute fatal, von diesem idealen Fall auszugehen. Viel wahrscheinlicher ist es, daß die Familie über lange Zeit der Behinderung des Kindes ambivalent gegenübersteht bzw. die verschiedenen Phasen im Verarbeitungsprozeß sich überschneiden, ineinander übergehen oder immer wieder auftauchen.
Welche Reaktionsformen für welche Menschen zu welcher Zeit und unter welchen Umständen die richtigen sind, kann ganz unterschiedlich sein. "Zudem ist zu fragen, im Hinblick worauf Verarbeitungsprozesse denn eigentlich effizient sein sollen, und das ist letztendlich eine Wertfrage" (ebd. S 153).
Hinze sieht es aber als hilfreich an, wenn Eltern die Krise als Herausforderung, als Chance sehen können. Weitere krisenverarbeitungsfördernde Bedingungen sieht er in der inner- und außerfamiliären Unterstützung, in der emotionalen Unterstützung des Ehepartners und in der Anerkennung, dem Verständnis, der Anteilnahme und der praktischen Hilfe von Angehörigen, Freunden, aber auch Fachleuten. Er betont damit wie auch andere Autoren (Ziemen 2002, Jonas 1990, Miller 1997, Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, Weiß 2001 etc.) die Bedeutung eines sozialen Stützsystems. Dies könnte ein weiterer wichtiger Hinweis für eine Familienbegleitung in der Frühförderung sein. Es könnte die Aufgabe der Frühförderin sein, den Eltern Kontakte zu anderen betroffenen Familien oder zu Elternselbsthilfegruppen zu ermöglichen und mit ihnen gemeinsam ihre sozialen Kontakte zu reflektieren.
Insgesamt wendet sich Hinze gegen eine Auffassung des Verarbeitungsprozesses in aufeinanderfolgenden, regelmäßigen Phasen. Er nimmt vielmehr an, dass solche Phasen individuell, nebeneinander oder gleichzeitig, in unterschiedlicher Dauer oder gar nicht auftreten. Eine sogenannte Endphase wird von vielen Menschen niemals in der Form erreicht, wie sie Phasenmodelle annehmen. "Die Vorstellung einer interindividuell generalisierbaren, einheitlichen und geregelten Abfolge von Phasen ist nach Meinung von Kritikern empirisch nicht beweiskräftig" (Hinze 1993, S 173). Hinze entwickelte aus dieser Annahme heraus ein integratives Modell des Auseinandersetzungs- und Verarbeitungsprozesses.
Die Auseinandersetzung mit einer Lebenskrise, einem kritischen Lebensereignis oder einer emotionalen Stress-Belastung ist nach Hinze ein prozessuales und auf Wechselwirkungen gründendes Geschehen, das von Kognitionen und Emotionen bestimmt wird, die wechselseitig aufeinander wirken. Der Prozess hat einen innerseelischen Aspekt ebenso wie einen interpersonellen und damit sozialen Bezug und ist darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden der Personen sowie ihre soziale Lebenssituation zu bewahren bzw. wiederherzustellen. (vgl. ebd. S 204ff)
Phasenmodelle können also immer nur zur Orientierung dienen, wenn man sich auch bewusst ist, dass es den regelmäßigen Ablauf der Phasen nicht gibt und sich der individuelle Prozess der Auseinandersetzung letztlich aus verschiedenen Elementen der innerhalb der Phasenmodelle beschriebenen Reaktionsformen zusammensetzt.
In diesem Sinn verstehe ich auch die Ausführungen von Jonas (1990) zum Trauerprozess und möchte sie anführen, weil es mir doch wichtig erscheint, in Bezug auf die Situation der Eltern behinderter Kinder von einem Trauerprozess zu sprechen. Jonas geht jedoch auch von einer parallel zum Trauerprozess stattfindenden Autonomieentwicklung vor allem der Mütter aus. Diese Sicht entspricht der Annahme, dass man erst etwas loslassen muss, bevor man auf etwas Neues zugehen kann bzw. sich einem etwas Neues auftut.
Wenn Jonas sich hier aus einer feministisch psychoanalytisch orientierten Perspektive hauptsächlich mit den Mütter auseinandersetzt, so glaube ich doch, dass ihre Erkenntnisse auf die Familie des behinderten Kindes ausgeweitet werden können.
Jonas begründet den Trauerprozess mit dem Verlust der Mütter, den ich für das Verständnis des tiefen Schmerzes für wichtig halte, mit dem gerade Frühförderinnen durch die meist enge Beziehung zur Mutter des Kindes mit Behinderung oft in Berührung kommen. Jonas siedelt diesen Verlust auf drei unterschiedlichen Ebenen an.
Auf der Ebene des identitätszentrierten Verlustes muss sich die Mutter mit ihrem Verlust an autonomer Identität als Frau durch die bevorstehende Mutterschaft, mit dem Verlust an mütterlicher Identität durch die Behinderung ihres Kindes und der damit oft verbundenen Fremdbestimmung durch Fachleute auseinandersetzen. (vgl. Jonas 1990, S 93)
Der kindzentrierte Verlust bezieht sich auf den Verlust des idealen, unbeschädigten Kindes, den Verlust der idealen Beziehungsphantasien und den damit verbundenen Verlust des Gefühles des Ganzseins. (vgl. ebd. S 95)
Auf einer dritten Ebene geht es um den sozialzentrierten Verlust, der den Verlust an autonomer Lebensplanung und an sozialer Integration umfasst. (vgl. ebd. S 98)
Jonas beschreibt in Anlehnung an Verena Kast vier Phasen des Trauerprozesses, die sie aber nicht linear, sondern als sich überschneidend und ineinanderwirkend verstehen möchte. In diesen Phasen geht es um die Auseinandersetzung mit den oben beschriebenen Verlusten:
1. Phase der Nicht-Wahrnehmung und Suche
2. Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen
3. Phase des Suchens, Findens und Sich-Trennens
4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs (vgl. ebd. S 93/94)
In der ersten Phase der Nicht-Wahrnehmung und der Suche kann der Verlust noch nicht wahrgenommen werden - er soll mit allen Mitteln aufgehalten oder rückgängig gemacht werden. "Die Abwehr dient dem Selbstschutz, da die Wahrnehmung des kind-, identitäts- und sozialzentrierten Verlustes nicht ertragen wird" (ebd. S 100). Die Suche bezieht sich in dieser Phase auf die oft sehr lang andauernde Suche nach dem unbeschädigten Kind auf der kindzentrierten Ebene und nach der unbeschädigten mütterlichen Identität auf der identitätszentrierten Ebene. Diese Suche kann eine Beeinträchtigung der Partnerbeziehung und der sozialen Kontakte zur Folge haben und unter Umständen zu großer psychischer und physischer Erschöpfung bei der Mutter führen.
Vergleichbar wäre diese Phase auch mit jener Phase der äußeren Suche, die Nancy Miller beschreibt. (vgl. Miller 1997, S 58 ff)
Der zweiten Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen geht meist das erfolglose Ende der anstrengenden Suche und die Aufgabe der Hoffnung auf eine Heilung voraus. Die Wahrnehmung des Verlustes kann langsam zugelassen werden, und damit brechen die unterschiedlichen Emotionen von Schmerz, über Wut und Angst bis hin zu großer Niedergeschlagenheit und Schuldgefühlen auf. Neben dem kindzentrierten Verlust kommt jetzt auch der identitätszentrierte Verlust mehr ins Bewusstsein der Mutter, was sich in gemindertem Selbstwertgefühl und geminderter Selbstachtung bemerkbar macht.
In dieser Phase kann es auch zu Therapieabbrüchen kommen. "Die Therapieabbrüche haben auch die Funktion, sich der sozialen Kontrolle zu entziehen und den chaotischen Emotionen freien Lauf zu lassen" (Jonas 1990, S 109).
Damit die Emotionen aber aufbrechen können, braucht es Raum und Personen im sozialen Netzwerk, die die Betroffenen auffangen können.
Jonas betont hier die wichtige Bedeutung von Wut und Aggression, die neben ihrer kathartischen Funktion auch den Übergang zum entschiedenen, selbstbestimmten Handeln darstellen und damit auch die Autonomieentwicklung begünstigen können. "Schuldgefühle können abgewehrte Aggressionen sein [...], aber Aggressionen auch abgewehrte Schuldgefühle" (ebd. S 108).
Als Mensch zu leben heißt immer, in irgendeiner Form schuldig zu werden oder etwas schuldig zu bleiben, da wir nicht immer unser Ideal von etwas leben können und nicht alles unter Kontrolle haben, alles bedenken können. Konflikte und Entscheidungen gehören zu unserem Leben. Wir müssen immer etwas abwägen, um das Sinnvollste in der jeweiligen Situation zu finden - und manchmal gibt es auch keine wirkliche Lösung, sondern nur eine Entscheidung für das geringere Übel. Wichtig ist es, einen angemessenen Umgang mit dieser Tatsache zu finden. Ambivalenzgefühle sind also normal, können aber Angst und Schuldgefühle auslösen.
Dies ist meiner Meinung nach etwas ganz Entscheidendes für die Arbeit der Frühförderin: der Mutter zu vermitteln, wie normal in ihrer Situation ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber sind, sie dabei zu unterstützen, ihre Gefühle zuzulassen und nicht weiter abzuwehren.
Große Schuldgefühle der Mütter können aus dem Konflikt erwachsen, eigene Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse des Kindes abwägen zu müssen. Es wäre für die Mütter wichtig, zu erkennen und anzuerkennen, dass ihre Möglichkeiten und Kräfte Grenzen haben und dass sie es aushalten lernen, abwägen zu müssen, sich selbst oder dem Kind etwas schuldig zu bleiben. "Die Schuldgefühle bezüglich der Begrenztheit der Bemühungen um das Kind treffen die Mütter im Kern ihrer Persönlichkeit" (ebd. S 115).
Schuldgefühle können also nicht vermieden werden, sondern es geht darum, einen Umgang mit ihnen zu finden.
In der dritten Phase des Suchens, Findens und Sich-Trennens ist die Suche nun gekoppelt mit einer bewussten Wahrnehmung des Verlustes. Das bedeutet, dass sie nun zielgerichtet stattfindet und ergänzt wird durch das Finden und Sich-Trennen, wobei immer wieder Phasen der chaotischen Emotionen ausgelöst werden können. Es handelt sich um eine Phase starker innerpsychischer Aktivität, in der der Verlust wahrgenommen werden kann, was ein Loslassen ermöglicht. All das, was ein Kind stellvertretend für seine Mutter in der Zukunft hätte verändern sollen, muss die Mutter nun wieder in ihre eigene Verantwortung und ihre eigene Person zurücknehmen. "Die eigene Zukunft gilt es zu planen und in die eigene Kompetenz zu nehmen" (ebd. S 120).
Jonas sieht hier auch die Aufgabe der Mutter angesiedelt, sich aktiv und bewusst vom Kind zu lösen, da dies dem Kind aus eigener Kraft oft nicht möglich ist. Hier ist es aber auch Aufgabe der Frühförderin, der Mutter dabei zu helfen, die Äußerungen ihres Kindes in Richtung Wunsch nach Autonomie und Ablösung zu deuten. Diese Konfliktregelung zwischen der Ablösung vom Kind und der Angewiesenheit des Kindes kann für die Mütter sehr schwierig oder fast unmöglich sein, vor allem dann, wenn der soziale Druck sehr groß ist oder sie keine Ressourcen für eine eigene autonome Entwicklung hat. Verantwortung für das Kind abzugeben, kann für die Mutter bedeuten, eine "schlechte" Mutter zu sein. Die Ablösung vom Kind kann bei der Mutter eine Leere auslösen, die sie auf sich selbst zurückwirft und auf die Frage, was sie nun mit ihrem Leben anfangen, was sie selber unabhängig vom Kind tun möchte. Dazu braucht die Mutter emotionale und soziale Ressourcen, sozusagen ein soziales Stütz-Netzwerk, zu dem unter anderem auch die Frühförderin gehören kann. Für die Mütter werden stabile soziale Kontakte und Entlastung nun wichtiger als die Förderung des Kindes.
Für das Erreichen einer autonomen Lebensführung ist es oft nötig, dass sich die Mutter von der tradierten Mutterrolle lösen kann. "Der Ambivalenzkonflikt zwischen Angewiesenheit des Kindes und autonomer Lebensführung bedeutet auf der Ebene der Identität den Konflikt zwischen der Identität als Mutter und der Identität als Frau" (ebd. S 122).
Aber auch wenn dieser Prozess äußerlich oft ruhig und nachdenklich wirkt, ist er für die Mütter trotzdem von heftigen Emotionen begleitet: von Schmerz, Wut, Verzweiflung, Depression, aber auch von Loslassen und entschiedenem Handeln. (vgl. ebd. S 123)
Der Übergang zur Autonomieentwicklung bei der Mutter hat also bereits in der dritten Phase begonnen, kommt aber nun in der vierten Phase des veränderten Selbst- und Weltbezuges stärker zum Ausdruck. So wie jeder Trauernde verändert sich auch die Mutter in ihrem Trauerprozess, an dessen Ende nicht unbedingt die Annahme und Bejahung der Behinderung stehen muss. Wichtiger erscheint Jonas, dass die Realität des Verlustes wahrgenommen werden kann, und die Mütter wieder Freude am Leben empfinden, Beziehungen zu anderen Menschen eingehen und sich in der neuen Situation und der neuen Rolle als Mutter eines Kindes mit Behinderung zurechtfinden. Ob dies alles oder nur ein Punkt davon erreicht werden kann, ist unklar, denn die Erfahrung des Verlustes ist komplex und es bleibt fraglich, ob es einen dauerhaften Abschluss des Trauerprozesses überhaupt gibt. Aus diesem Grund spricht Jonas auch von der zirkulierenden Trauer. Eine Reaktivierung der Trauer ist demnach jederzeit möglich, auch wenn das Gleichgewicht bereits wiederhergesellt ist, und kann letztlich eine Chance für die weitere Entwicklung sein. "Die zirkulierende Trauer ist die Möglichkeit zur lebensgeschichtlichen Veränderung" (ebd. S 129).
Dessen sollte sich auch die Frühförderin stets bewusst sein: Sie kann nicht davon ausgehen, dass die Eltern schon am Ende ihres Auseinandersetzungsprozesses angelangt sind und muss damit rechnen, dass immer wieder Phasen auftauchen werden, in denen vermehrt Emotionen zu Tage treten und in denen die Eltern wieder mehr mit ihren Verlusten hadern bzw. sich mehr mit ihrer veränderten Situation auseinandersetzen.
Nachdem ich mich im Vorhergehenden schwerpunktmäßig mit dem Erleben und der Situation der Mutter auseinandergesetzt habe, möchte ich im Folgenden näher auf die spezifische Situation des Vaters eingehen.
Väter blieben sowohl in der traditionellen Familienforschung als auch in der Behindertenpädagogik lange Zeit unbeachtet. Meist wurden Aussagen der Mütter auf die gesamte Familie übertragen.
Väter sind jedoch durch die Behinderung ihres Kindes genauso betroffen wie die Mütter - durch ihre Rolle zeigen sie diese Betroffenheit aber anders. Kurt Kallenbach führte eine Untersuchung zur Situation von Vätern schwerstbehinderter Kinder durch. Er bestätigt in diesen Ausführungen meine weiter oben angeführte Vermutung, dass die Rollenverteilung in Familien mit behinderten Kindern eher verstärkt wird. (vgl. Kallenbach 1997)
Kallenbach stellt eine große Belastung der Väter durch den finanziellen Mehraufwand fest. Der Vater ist in seiner Rolle als Erwerbstätiger und Familienerhalter den Anforderungen der Arbeitswelt mehr ausgesetzt und entwickelt große Angst vor sozialer Diskriminierung. (vgl. auch Hinze 1993, S 134)
Durch ihre außerhäusliche Tätigkeit geraten viele Väter in eine Distanz zur Familie und zum Kind mit Behinderung, weil sie dadurch von vielen Pflege- oder Fördermaßnahmen ausgeschlossen bleiben und ihnen damit wichtige Erfahrungen für die Auseinandersetzung mit der Behinderung fehlen.
Beide Eltern setzen sich zwar für die Familie ein; durch die unterschiedliche Akzentuierung haben aber beide kaum Berührungspunkte zueinander. (vgl. Kallenbach 1997, S 28)
Der Vater kann bei wichtigen Terminen oft nicht anwesend sein. Väter übernehmen zwar im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten Pflegeaufgaben, bleiben aber von wesentlichen Bereichen der Kinderbetreuung ausgeschlossen. Sie haben weniger Kontakt zu Fachleuten und somit auch weniger Zugang zu Hilfsangeboten. Ihr vermehrtes außerhäusliches Engagement verstärkt zudem Vermeidungstendenzen, wenngleich die Väter in ihrer Interaktion eher auf die Familie, besonders auf ihre Partnerin ausgerichtet sind. "Viele Männer wehren sich, ihre Probleme mit Außenstehenden zu besprechen" (ebd. S 29).
Dabei ist es aber mehr die Mutter, die das Gespräch mit dem Vater sucht, während der Vater problembezogene Gespräche vor allem am Beginn eher vermeidet.
Vätern fällt es sehr schwer, mit ihren Kindern in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie schämen sich oft für ihr Kind, und es ist ihnen peinlich, mit ihm gemeinsam gesehen zu werden. Dabei haben sie auch weniger Übung darin, während Mütter dieser Situation viel häufiger ausgesetzt sind und mit der Zeit auch lernen, damit umzugehen.
Wenn sich die Eltern mit ihrem Kind beschäftigen, so liegt bei der Mutter die Aufmerksamkeit mehr im pflegerischen und fördernden, beim Vater hingegen mehr im spielerischen Bereich. Väter haben oft sehr wenig Übung darin, ihr Kind gezielt zu beobachten und brauchen nach Kallenbach spezielle Anleitung darin, die Entwicklungschancen ihres Kindes zu erkennen. "Es scheint so, daß Väter einer besonderen Anleitung und Ermutigung zur Interaktion bedürfen" (ebd. S 28). Dabei befassen sich Fachleute aber weniger mit den Vätern. Aus meiner eigenen Erfahrung in der Frühförderung heraus würde ich sagen, dass zwar grundsätzlich verstärkt darauf geachtet wird, Väter in der Frühförderung mit einzubeziehen, dass dieser Anforderung aufgrund bisheriger Erfahrungen der Frühförderin aber meist Resignation entgegengebracht wird. Die Frage ist, ob sich Väter überhaupt mehr Einbindung seitens der professionellen Helfer wünschen. Vielleicht ist es ein sich gegenseitig bedingender Kreislauf, der hier leicht entsteht und nur schwer durchbrochen werden kann. Ein Kreislauf, in dem sich der Vater aus Frühfördermaßnahmen ausgeschlossen erlebt und sich deshalb eher distanziert, und in dem die Frühförderin das Verhalten des Vaters als Desinteresse wahrnimmt und ihn deshalb weniger einbindet.
Kallenbach fordert für eine Väterberatung die Anerkennung der besonderen Rolle des Vaters in der Familie und seine vermehrte Beachtung in der professionellen Arbeit. Der Konflikt, in dem der Vater steht, sollte berücksichtigt werden: der Konflikt zwischen seiner Rolle als berufstätiger Ernährer und der ihm zur Verfügung stehenden Zeit für die Übernahme von Aufgaben in der Familie. Durch ihre eindeutige Rollenfestlegung, die sich aus der besonderen Situation ergibt, ist für die Väter ein Wandel hin zu den "neuen Vätern" oft nicht möglich. "Sie gehören eher zu den traditionellen Vätern, müssen aber in Teilbereichen wie die so oft benannten ‚neuen' Väter handeln" (ebd. S 67).
So fordert Kallenbach für die Berater, dass sie auch über Kenntnisse aus dem Arbeitsleben und dem Sozialrecht verfügen sollten, um mit den Väter Möglichkeiten zu finden, wie sie mehr Zeit in der Familie verbringen können. Sehr wichtig findet Kallenbach auch die regelmäßige Information der Väter über die Therapie und Entwicklung des Kindes, was auch einem Anliegen in der Frühförderung entspricht. Der professionelle Helfer sollte nach Möglichkeiten suchen, den Vater in seine Arbeit einzubinden und ihm ebenso wie der Mutter die Möglichkeit zur Teilnahme an den Aktivitäten mit dem Kind und zum gemeinsamen Gespräch zu geben. In der Frühförderung etwa hat sich das Anbieten von Gesprächsterminen am Abend sehr bewährt.
"Der Vater läßt sich gut in die professionelle Arbeit einbinden, wenn er in seinen Kompetenzen gestärkt wird und diese als einen Beitrag für die Familie und letztlich für sein Kind einsetzen kann" (ebd. S 69).
Für Fachleute finde ich es wichtig zu sehen, dass nicht nur die Mütter durch ihre soziale Rollenzuschreibung behindert werden, sondern auch die Väter, wenn von ihnen erwartet wird, dass sie stark sind, ihre Gefühle im Griff haben und alleine mit Problemen zurechtkommen können. "Fachleute verfestigen oft unversehens diese Rollenverteilung, weil sie vorzugsweise mit den Müttern zusammenarbeiten und die oft nötige besondere Einladung an die Väter vergessen oder als zu schwierig empfinden" (Schlack in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 23).
Diese besondere Einladung wird so lange nötig sein, bis der Vater sich als gleichberechtigtes Mitglied in der Beziehungskonstellation zwischen Frühförderin, Kind und Eltern erlebt und seine Rolle als wichtiger Interaktionspartner seines Kindes einnehmen kann.
Die Situation der Geschwister behinderter Kinder ist ein Thema, das sowohl in der Literatur als auch in der Praxis oft zu wenig beachtet wird, was wohl in manchen Fällen auch der Realität der Geschwisterkinder in der Familie entspricht. Gerade in der Anfangszeit kann es passieren, dass die Eltern die Bedürfnisse der übrigen Kinder nicht mehr in gewohntem Maß wahrnehmen können, da sie sich vermehrt um das Kind mit Behinderung sorgen. Die Geschwister müssen dann zurückstehen, und es werden nicht selten hohe Anforderungen an sie gestellt, was ihr eigenes Verhalten, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Mithilfe bei der Betreuung des behinderten Kindes betrifft. Die Geschwister fühlen sich häufig zurückgesetzt, werden durch die an sie gestellten Anforderungen überfordert, und man verlangt von ihnen noch zusätzlich Rücksichtnahme und Verständnis.
Die Geschwister leiden meist unter den indirekten Auswirkungen der Behinderung, die vor allem aus den Einstellungen, Belastungen und Reaktionsformen der Eltern resultieren. In einer belasteten, hoffnungslosen oder überprotektiven Haltung bzw. Situation sind die Eltern meist nicht in der Lage, den Geschwistern ausreichende Sicherheit, Vertrauen in die Zukunft, Liebe und Zuwendung zu vermitteln. Eine depressive oder ambivalente Gefühlslage der Eltern kann demnach auch die Geschwister sehr verunsichern. (vgl. Horstmann 1990, S 14f)
Kriegl spricht davon, dass die Annahme des behinderten Kindes bei den Geschwistern abhängig ist von der Art und Weise, wie die Eltern selber mit der Behinderung umgehen und dies ihren Kindern vermitteln. Sie ist der Ansicht, dass die Geschwister sich häufig mit der Haltung und Rolle der Eltern identifizieren. Die Belastung für die Geschwister kann dabei sehr hoch sein, vor allem dann, wenn sie viel Verantwortung übernehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und versuchen, den Erwartungen ihrer Eltern hinsichtlich ihrer eigenen Entwicklung zu entsprechen. Ich denke, dass es nicht selten geschieht, dass die Geschwister sozusagen zum Ausgleich für die Behinderung ihres Geschwisterkindes außergewöhnliche Leistungen erbringen, um so die Eltern in gewissem Sinn wieder auszusöhnen.
"Zu frühe und zu hohe diesbezügliche Erwartungen und Forderungen geben den Kindern zu wenig Möglichkeiten, ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen, auf dessen Basis eine Entwicklung von echter Toleranz und Einfühlungsvermögen erst möglich ist. Den gesunden Kindern muß auch die Gelegenheit geboten werden, ihre ‚egoistischen' Tendenzen befriedigen zu können, um nicht einen zu frühen Verzicht von ihnen zu verlangen" (Kriegl 1993, S 33).
Die Reaktionen der Geschwister auf ein Kind mit Behinderung hat Miller (1997, S 169 ff) sehr klar zusammengefasst. Sie ortet einerseits Wut oder Eifersucht auf das Kind mit Behinderung, weil es die Eltern so sehr in Anspruch nimmt, andererseits aber auch Sorgen und Ängste, selber eine Behinderung zu bekommen, die Behinderung an eigene Kinder weiterzuvererben oder sich später um das behinderte Geschwister kümmern zu müssen. Daneben kann auch die Angst auftauchen, Schuld an der Behinderung des Geschwisters zu haben. Zusätzliche Schuldgefühle können aus der Wut und Angst erwachsen, die sie sich unter Umständen selber nicht zugestehen. Auch Geschwister durchleben demnach eine Art der inneren Suche, beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themen und Fragen und müssen die Situation erst verarbeiten. Miller glaubt, dass manche Geschwisterkinder sich in diesem Prozess zu sehr angepassten, leistungsorientierten Menschen entwickeln, die das Gefühl haben, nur geliebt zu werden, wenn sie perfekt sind. Andere wiederum werden zu Betreuern, Pflegern ihrer behinderten Geschwister und fühlen sich sehr früh mitverantwortlich. (vgl. Miller 1997, S 169ff)
Schlack sieht auch positive Aspekte am gemeinsamen Aufwachsen mit einem Kind mit Behinderung und bezieht sich dabei auf zwei Studien von Hackenberg. "Die Geschwisterkinder tendieren zu mehr emotionaler Ansprechbarkeit, mehr Selbstkritik, mehr sozialem Engagement" (Schlack in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 23).
Er hält es für wichtig für die Geschwisterkinder, dass sie sich von den Eltern wahrgenommen fühlen, und dass sie auch negative oder ambivalente Gefühle dem behinderten Kind gegenüber zulassen und äußern dürfen. Wenn sie in die Betreuung und Förderung des behinderten Kindes mit einbezogen werden, dann soll dies nicht dem Stress- oder Druckabbau der Eltern dienen, sondern die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Aufgabe der Familie sein. Er hält auch die Präsenz des Vaters für wichtig, vor allem dann, wenn die Mutter stark belastet ist. (vgl. ebd. S 23)
Auch Miller betont die Wichtigkeit einer guten, offenen Gesprächsatmosphäre in der Familie, die es den Kindern ermöglicht, ihre Sorgen oder Bedürfnisse auszudrücken und Fragen zu stellen.
In der Frühförderung ergeben sich oftmals Gelegenheiten, nicht behinderte Geschwister in die Interaktion mit dem behinderten Kind mit einzubeziehen und ihnen dabei zu vermitteln, dass sie ihrem Geschwister auch etwas zutrauen können, ihm die Zeit geben können, etwas selbständig zu tun und seine Fortschritte wahrzunehmen. Manchmal kann es nötig sein, Geschwister in ihrer Überfürsorge für das Kind mit Behinderung ein wenig zu bremsen und ihnen damit auch Leistungsdruck zu nehmen. Gleichzeitig könnte eine Beobachtung der gemeinsamen Interaktionssituation der Geschwister auch für die Eltern Anstöße geben, die Situation ihrer übrigen Kinder wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Hier kann es auch die Aufgabe der Frühförderin sein, die Eltern auf die Bedürfnisse der Geschwisterkinder aufmerksam zu machen.
An dieser Stelle und damit am Übergang zu einer genaueren Beleuchtung der Beziehungen zwischen Fachleuten und Eltern behinderter Kinder möchte ich mich gerne mit den Ausführungen Kerstin Ziemens näher auseinandersetzen, da sie einen anderen Blick auf die Situation der Eltern ermöglichen und sich daraus meiner Meinung nach sehr wichtige Folgerungen für die pädagogische Arbeit in der Frühförderung ergeben.
Wenn ich weiter oben schon die von Ziemen georteten Widersprüche in der emotionalen und sozialen Situation der Eltern angeführt habe, so geht es jetzt um die Darstellung möglicher Lösungen für diese Widersprüche, die Ziemen darin sieht, die Kompetenzen der Eltern in verschiedenen Bereichen zu kennen und damit auch anzuerkennen. "Der Begriff der ‚Kompetenz' ist nicht nur mit ‚Fähigkeit' oder ‚Vermögen' gleichzusetzen, sondern ebenso ein Akt des Kennens und Anerkennens" (Ziemen 2003, S 32).
Kompetenzen der Eltern hat Ziemen in drei Bereichen näher beschrieben: im emotionalen, im kognitiven und im sozialen Bereich. Dabei bezieht sie sich auf die Ergebnisse ihrer Interviews mit den Eltern behinderter Kinder.
Als emotionale Kompetenzen der Eltern behinderter Kinder bezeichnet Ziemen die Reflexion ihrer Wünsche, Hoffnungen und Emotionen und die Reflexion von emotional besetzten Ereignissen, also die Selbstreflexion der Eltern. "Das emotionale Sich-Selbst zur Situation in Beziehung zu setzen kennzeichnet die Reflexion" (Ziemen 2002, S 213). Über die Reflexion ihrer Wünsche und Hoffnungen kann man auch erkennen, was Eltern wichtig ist. "So ist zusammenfassend zu konstatieren, dass die Wünsche und Hoffnungen der Eltern gerichtet sind:
-
auf die Entwicklung bzw. ‚Gesundheit', ‚Heilung' des Kindes
-
gegen die Isolation /Benachteiligung des Kindes
-
auf die Unterstützung im medizinischen Feld
-
auf die Unterstützung vom bürokratischen/administrativen/öffentlichen Feld" (ebd. S 221).
In den Interviewgesprächen fand eine Selbstreflexion der Eltern statt, die ihre Kompetenzen sichtbar machte, wenn sie etwa über Veränderungen in der Wahrnehmung der Behinderung, über Veränderungen ihrer eigenen Situation, über den Wertewandel und Veränderungen im eigenen Selbst, im Selbstwertgefühl und im Selbstbewusstsein berichteten.
Im kognitiven Bereich sieht Ziemen sowohl diagnostische Kompetenzen als auch pädagogische Kompetenzen der Eltern. Dabei verfügen die Eltern zunächst bereits über ein "kulturelles Kapital", über ihr eigenes in der Sozialisation erworbenes Wissen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, zu dem dann noch spezifische Kompetenzen hinzukommen, die die Eltern in der Betreuung ihres Kindes oder in ihrer Auseinandersetzung mit der Behinderung erwerben. Sowohl ihr kulturelles Kapital als auch ihre zusätzlich erworbenen Kompetenzen werden meist nicht genügend anerkannt. "Insofern kommt es von Seiten der Eltern bzw. der ‚Professionellen' zu unterschiedlichen Anforderungen an das Kind, zu gegenseitigen Unterstellungen und Verzerrungen, die die kooperativen Beziehungen belasten müssen" (ebd. S 236).
Die diagnostischen Kompetenzen der Eltern siedelt Ziemen vor allem in der Beobachtung des Kindes an: in der Beobachtung seines Verhalten und eventueller Verhaltensänderungen, in der Rekonstruktion seiner Entwicklung, im Wahrnehmen von Entwicklungsbedingungen, in der Beobachtung des aktuellen Entwicklungsstandes, in der Beobachtung der Beziehung des Kindes zu verschiedenen Personen und in der Wahrnehmung seiner Bedürfnisse, Interessen und Motive.
Die pädagogischen Kompetenzen der Eltern beziehen sich dagegen auf die Erprobung verschiedener Begegnungsmöglichkeiten mit dem Kind, auf seine Orientierung im Tagesablauf, auf Anregungen zum Spiel, die Kommunikation mit dem Kind, die Beachtung von Spannung und Entspannung innerhalb von Tätigkeiten, auf das Wahrnehmen von Bezugspersonen des Kindes, die Reflexion der Beziehungen zwischen Eltern bzw. Kind und Fachleuten und das Favorisieren oder Ablehnen bestimmter Methoden und Verfahren.
"Im Gegensatz zur Anerkennung der Kompetenzen werden Eltern aus verschiedenen ‚professionellen Feldern' heraus, auch aus dem pädagogischen Feld, zumeist als ‚inkompetent', ‚weniger kompetent' etc. betrachtet. [...] Pädagogen schließen aus Beobachtungen von Verhaltensweisen/Handlungen der Kinder kausal auf bestimmte Kompetenzen bzw. Inkompetenzen der Eltern, ohne weitere Zusammenhänge zu beachten" (ebd. S 244).
Ziemen sieht in solchen Unterstellungen, solchem "Schubladendenken", Gründe dafür, dass auch im pädagogischen Feld Eltern nahe an den Pol der Ohn-Macht rücken können. Viele Eltern entwickeln deshalb auch eine eher kritische Haltung gegenüber "Professionellen".
"Eltern kennen die Spielbedürfnisse ihrer Kinder sehr genau, beschreiben die Handlungsmöglichkeiten des Kindes und die sozialen Fähigkeiten im Spiel, aber auch die Kompensationsleistungen und die daraus erwachsenden Schwierigkeiten für die Bezugspersonen" (ebd. S 246).
"Eltern geben Anregungen, unterstützen und schaffen Bedingungen, die die Entwicklung des Kindes beeinflussen können" (Ziemen 2003, S 34).
Im Bereich ihrer sozialen Kompetenzen reflektieren die Eltern über die Beziehungen innerhalb der Familie ebenso wie über die Unterstützung, die sie erfahren.
Im familiären System bezieht sich die Reflexion der Eltern auf Beziehungen und Verhältnisse zwischen den Familienmitgliedern, auf die Wahrnehmung der differenzierten Mutter- bzw. Vaterrolle innerhalb der Familie und auf Beziehungskonflikte. Hier kommt auch die Organisationskompetenz der Eltern zum Ausdruck: Sie handhaben die Verteilung von Aufgaben innerhalb der Familie, die zeitliche Organisation, die Sicherung von freier Zeit und zeigen spezifische Problemlösungskompetenzen. Neben der innerfamiliären Unterstützung, die vor allem auch der emotionalen Stabilisierung der Familienmitglieder dient, nutzen die Eltern aber auch Unterstützungsangebote von außen, die hauptsächlich der Betreuung des Kindes und der Unterstützung der Organisation des Familienlebens zu gute kommen. "Die Reflexion der Unterstützungsangebote, die Suche nach Unterstützung und das Annehmen dieser kann als ‚soziale Kompetenz' anerkannt werden" (Ziemen 2002, S 269).
Die Unterstützung, die Eltern erfahren bzw. in Anspruch nehmen, ist im Laufe der Entwicklung des Kindes oder des Zusammenlebens in der Familie Veränderungen unterworfen. "Auf die Situation von Familien bezogen bedeutet dieses, dass an den entsprechenden ‚Übergängen', die z.B. die Geburt des Kindes, der Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule darstellen können, jeweils neu über das Leben bzw. Zusammenleben mit dem Kind reflektiert wird. [...] Damit verändern sich zumeist auch die Angebote der Unterstützung, zum einen durch den Wechsel der Rolle des Kindes und andererseits durch die Veränderungen des Lebensbereiches" (ebd. S 263).
Aus den elterlichen Reflexionen über die Unterstützung durch die "Professionellen" leitet Ziemen einige Erkenntnisse zur Unterstützung und Beratung der Eltern behinderte Kinder ab, die ich für sehr relevant halte.
"Unterstützend wirkten die Angebote dann, wenn Befindlichkeiten von Eltern und Kind in gleichem Maße in die Beratung/Unterstützung aufgenommen wurden" (ebd. 265). Ärzte, Psychologen und Therapeuten werden vor allem dann als unterstützend wahrgenommen, wenn sie Informationen zur Betreuung und Förderung des Kindes weitergeben können und über Erfahrung mit behinderten Kindern verfügen. Positiv erlebt wird im medizinischen Feld, wenn die Eltern die Möglichkeit erhalten, über ihre Situation zu sprechen. Unterstützend von Pädagogen wird erlebt, wenn diese die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Eltern aufnehmen. "Die Anerkennung und das Angenommensein von ‚Professionellen' wirkt auf die Familie stabilisierend" (ebd. S 266).
Wichtig sind aber auch Kontakte der Eltern zu anderen Betroffenen, z.B. in Selbsthilfegruppen, da die Unterstützung von den ‚Professionellen' nicht immer hinreichend gewährleistet wird.
"Das ‚soziale Kapital', d.h. das Netz an Beziehungen, verändert sich zumeist mit dem Dasein eines behinderten Kindes in der Familie grundlegend. Unterstützung im Kontext von Selbsthilfegruppen, Elterngesprächskreisen, individuellen Eltern-Eltern-Beratungen usw. werden neben der innerfamiliären Unterstützung favorisiert. Die Kommunikation mit ‚Gleich- oder Ähnlichbetroffenen' und das Wahrnehmen unterschiedlicher familiärer Problematiken führt dazu, in konkurrenzarmen Feldern über die eigene Situation zu reflektieren" (ebd. S 270).
Hier bekräftigt Ziemen nochmals, was ich inzwischen als wichtigen Hinweis für die Arbeit in der Frühförderung ansehe: Das Anregen und Unterstützen von Kontakten zwischen den betroffenen Familien kann in den Aufgabenbereich der Frühförderstelle bzw. der einzelnen Frühförderin fallen.
Wenn Ziemen am Beginn ihrer Ausführungen im Zusammenhang mit dem Eintreten der Diagnose vom Bruch von sozialem und persönlichem Sinn und in der Folge von der Suche nach Sinn spricht, so ist sie der Auffassung, dass die Lösung der Widersprüche, von denen die Situation der Familie mit einem von Behinderung bedrohten bzw. betroffenen Kind bestimmt wird, gleichzeitig als Versuch gelten muss, ‚persönlichen Sinn' wiederzuerlangen. (vgl. ebd. S 271).
"In diesem Prozess sind sie [die Eltern; C.K.-S.] auf die Anerkennung von Kompetenzen angewiesen, um persönlichen Sinn wiederzuerlangen, um sich selbst zu stabilisieren und unter Umständen die sozialen Verletzungen zu verarbeiten" (ebd. S 271).
Ziemen konnte dazu in den von ihr durchgeführten Interviews drei Strategien erkennen, auf die Eltern bei der Bewältigung ihrer Situation zurückgreifen.
Die Erhaltungsstrategie hat zur Folge, dass die Eltern sich mit der neuen Situation arrangieren und die im bisherigen Familienleben bevorzugten Strategien erhalten bleiben. Die eigene Position der Familie am Pol der Ohn-Macht wird nicht weiter in Frage gestellt, wobei die Unterstützung innerhalb der Familie bevorzugt wird.
Strategien der Häresie haben hingegen grundsätzliche Veränderungen im familiären Zusammenleben zur Folge. Es kann sein, dass sich die Eltern der bestehenden Ordnung widersetzen, gegen die Auffassungen von Fachleuten kämpfen und sich in ihrem gesamten Lebensablauf am behinderten oder von Behinderung bedrohten Kind orientieren.
Am häufigsten anzutreffen sind wahrscheinlich Mischformen mit Anteilen aus den beiden Strategien. Neben der Neuorientierung vom Kind aus besteht dabei gleichzeitig das Bestreben, die bewährten Positionen zu erhalten.
Alle drei Formen sind aber jeweils nur Tendenzen, die anzeigen können, wie die Familie ihr Leben momentan und im Hinblick auf die Zukunft gestaltet. (vgl. ebd. S 272ff)
Für die Frühförderin kann es auf jeden Fall wichtig sein, zu erkennen, welchen Weg die Familie gerade einschlägt und sie entsprechend dabei zu unterstützen.
Mit diesem Blick auf die Kompetenzen der Eltern möchte ich gerne überleiten zu einer näheren Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen einer Familienbegleitung in der Frühförderung und einer genaueren Beleuchtung der Beziehung zwischen den Eltern und der Frühförderin, wobei ich mein Hauptaugenmerk auf die Schwierigkeiten, Spannungen und Konflikte lege, die sich innerhalb des Frühförderprozesses zwischen Eltern und Frühförderin ergeben können.
Ein erster Schritt hierzu ist für mich - ausgehend von der Wahrnehmung und Anerkennung der vielfältigen elterlichen Kompetenzen - der Bedeutung eines Stärkenmodells für die Familienbegleitung in der Frühförderung nachzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 4.1 Der Empowerment-Ansatz und seine Bedeutung für die Familienbegleitung
- 4.2 Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern an Frühförderung und Familienbegleitung
- 4.3 Die Position der Frühförderin in der Beziehung zu den Eltern
- 4.4 Konflikte, Spannungen und Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin
- 4.5 Zusammenfassende Überlegungen zur Familienbegleitung
Lange Zeit hindurch war es üblich - und es kommt auch heute noch vor - Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder "vorrangig im Lichte von Problemen, Hilfebedürftigkeit, Ohnmacht, Mängeln, Schwächen oder Inkompetenz wahrzunehmen" (Theunissen/Garlipp 1999, S 54).
"In der einschlägigen Fachliteratur finden sich viele Äußerungen, in denen Eltern eine generelle Rat- und Hilflosigkeit speziell in Bezug auf die Sozialisation und Erziehung ihrer behinderten Kinder unterstellt wird. [...] Hingegen werden positive Entwicklungen in den Familien ‚aufgrund der Erfahrung mit Behinderung' kaum weiterverfolgt" (Weiß 1992, S 161).
Diese einseitige Sicht führte und führt in logischer Konsequenz zu einer eher defizitorientierten Praxis. Demgegenüber steht ein Kooperationskonzept, das Unterstützung und Hilfe auf den Stärken und Kompetenzen der Betroffenen aufbaut und durch eine Stärkenorientierung gekennzeichnet ist.
Die Auffassung eines solchen Ansatzes ist es, dass kontinuierliches Wachstum bei einem Menschen vor allem durch das Erkennen, Anerkennen und Entwickeln seiner Stärken entsteht.
Diese Stärkenorientierung findet sich im Konzept des "Empowerment" wieder. Der Begriff "Empowerment" kommt ursprünglich aus dem angloamerikanischen Sprachraum und steht für einen Prozess der "Selbst-Ermächtigung" bzw. der "Selbst-Bemächtigung", innerhalb dem Betroffene "ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewußt werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nützen" (Theunissen/Garlipp 1999, S 54).
Menschen werden in diesem Konzept nicht einseitig als bloße Empfänger von Hilfeleistungen gesehen. Es wird ihnen im Gegenteil zugestanden, für sich selber Sorge tragen zu können, und es stellt ein wesentliches Ziel von Empowerment dar, die betroffenen Menschen (wieder) dazu zu befähigen. Dahinter steht ein Entwicklungsverständnis, das die Entwicklung eines Menschen wesenhaft an seine Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit gebunden sieht. (vgl. Theunissen/Plaute 1995, S 11f)
Im Empowerment-Konzept werden Menschen in marginalen Positionen Ressourcen, Stärken und Kompetenzen zugeschrieben, eigene Betroffenheiten zu meistern, eigene Problemlösungswege und tragfähige Lebensziele zu entwerfen und zu realisieren.
Ein solches Stärkenmodell geht von drei Annahmen aus:
-
Jede Person besitzt eine innere Kraft, die auch als Lebenskraft, Selbstheilungskraft oder Lebensenergie bezeichnet werden könnte.
-
Diese Kraft beinhaltet Ressourcen, die personale und soziale Veränderungen anleiten kann.
-
Menschen greifen auf diese ihre Stärken zurück, wenn ihre positiven Fähigkeiten unterstützt werden. (vgl. Theunissen/Garlipp 1999, S 55)
Diese Sichtweise lässt sich in der Frühförderung sowohl auf die Entwicklung des Kindes als auch auf die Entwicklung der Eltern umlegen.
Weiß hat zusammengefasst, was sich durch oder in Empowerment-Prozessen entwickeln kann: Es entwickelt sich "ein positives und aktives Gefühl, des ‚In-der-Welt-Seins'" (Weiß 1992, S 164).
"Es entstehen Wissen und Können, die zu einem kritischen und analytischen Verständnis der sozialen und politischen Umwelt führen. [...] Es entwickeln sich Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen, um in sozialer und politischer Aktion persönliche und gemeinschaftliche Ziele zu erreichen" (ebd. S 164).
Weiß spricht hier an, dass Empowerment auf einer individuellen, persönlichen Ebene stattfinden, aber auch auf einer kollektiven, sozialpolitischen Ebene aufgrund aktiver Solidarität Veränderungen bewirken kann.
Wie lauten nun die Kritikpunkte, die einer solchen Auffassung entgegengebracht werden?
Theunissen und Garlipp haben sie zusammengefasst und dazu Stellung genommen. (vgl. Theunissen/Garlipp 1999, S 56)
Es besteht die Gefahr, dass Empowerment zum Schlagwort, zum reinen Lippenbekenntnis verkommt. Gerade weil Empowerment offene, nicht vorhersehbare oder berechenbare Entwicklungen in Gang setzt, die oft neben Überraschungen und Fortschritten auch Umwege und vorübergehende Rückschritte mit sich bringen, kann dies Ängste und Unsicherheiten vor allem bei den Helfern auslösen und damit die Gefahr des Umschlagens in alte Denk- und Handlungsmuster beinhalten.
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass Empowerment der Vorwurf gemacht wird, es würde real existierende Probleme oder Schwächen bagatellisieren oder gar ausblenden.
Theunissen und Garlipp setzen dem entgegen, dass Probleme und Schwächen gerade deshalb angemessen beachtet werden, weil es um eine Umorientierung geht, die die Perspektiven und Rechte Betroffener ernst nimmt und zum Ausgangspunkt für Überlegungen für die Praxis macht. Man versucht an dem anzuknüpfen, was der Betroffene kann. "Überdies versetzt die Konzentration auf Defizite oder Probleme die helfenden Berufe in eine Position der Macht und Überlegenheit, die es für die Betroffenen schwer macht, überhaupt Lebenskraft zu finden und für ein Mehr an Lebenszufriedenheit zu nutzen" (ebd. S 56).
Ich persönlich finde, dass Empowerment vor allem dazu beitragen kann, die Situation der Betroffenen, also auch die Probleme und Schwächen, in einem anderen Licht zu sehen. Wenn von der Ohnmacht der Eltern die Rede ist, so macht es einen erheblichen Unterschied, ob ich diese Ohnmacht als Schwäche und Problem der Eltern ansehe, oder ob ich in der Betrachtungsweise von Ziemen die Eltern in einer Position der Ohmacht sehe, in die sie durch die widersprüchlichen Umstände ihrer Situation geraten sind. Das hieße in logischer Konsequenz: nicht die "ohnmächtigen, hilflosen" Eltern bevormunden oder mit "fürsorglicher Belagerung" (Weiß 1989, S 11) heimzusuchen, sondern sie dabei zu unterstützen, ihre Anliegen zu formulieren und sie auch zu realisieren.
Ein weiterer Vorwurf an Empowerment lautet, es würde keine Aufarbeitung von psychischen Problemen geschehen (Auseinandersetzung mit Ängsten, Schuld, Trauer,..), die Klienten würden damit alleine gelassen und erhielten keine angemessene psychosoziale Unterstützung.
Nach Theunissen und Garlipp hat gerade der Kompetenzdialog, das Gespräch über individuelle Kompetenzen, erfolgreiche Bewältigungsstrategien, positive Erfahrungen und Zukunftsperspektiven psychisch-kompensatorischen Charakter. Die Kompetenzfokussierung wendet sich bewusst gegen die Pathologisierung, Normierung und Therapeutisierung des Lebens der betroffenen Menschen. Theunissen und Garlipp halten gerade das Bewusstmachen einer Überlebenden-Rolle bei den Betroffenen für geeignet, neue Lebenskräfte freizusetzen. Das, was die Betroffenen in ihrem Kampf um die Bewältigung von Problemen lernen, kann ihnen für ihr weiteres Leben hilfreich sein. (vgl. Theunissen/Garlipp 1999, S 56)
Gerade in den letzten Jahren wurde immer wieder von Autoren (Theunissen/Garlipp 1999, S 61; Speck 2001, S 150ff; Steiner 2002, S 131ff) die Bedeutung von sogenannten "Resilienzfaktoren", also von Schutzfaktoren und Widerstandskräften des einzelnen Menschen für seine Bewältigungskompetenz hervorgehoben. Diese Erkenntnis bringt für die Arbeit der "Professionellen" mit sich, gerade auf die Entwicklung und Erhaltung solcher Resilienzfaktoren großes Augenmerk zu legen.
Theunissen und Garlipp haben diese individuellen und sozialen Schutzfaktoren zusammengefasst und zählen dazu:
-
körperliche Gesundheit und Widerstandkraft
-
Glauben an und Vertrauen in die eigenen Problemlösefähigkeiten
-
finanzielle und materielle Absicherung
-
soziale Ressourcen
-
Lebenszuversicht (gesunden Optimismus und Realismus)
-
positives Selbstbild und Selbstwert
-
Bereitschaft, schwierige Situationen als Herausforderung anzusehen
-
flexible Anpassung an Umbrüche und einschneidende Veränderungen im Leben
(vgl. Theunissen/Garlipp 1999, S 61)
Steiner bezieht sich in ihren Darstellungen mehr auf die kindliche Entwicklung und nennt in Anlehnung an Lösel und Bender (1990) folgende schützende Faktoren:
-
eine stabile emotionale Beziehung zu einer primären Erziehungsperson
-
ein emotional positives, unterstützendes und strukturgebendes Erziehungsklima
-
Rollenvorbilder für den Umgang mit belastenden Situationen
-
soziale Unterstützung durch Personen innerhalb der Familie
-
Temperamentsmerkmale wie Flexibilität und Soziabilität
-
kognitive Kompetenzen
-
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstkonzept
-
ein aktives und nicht nur reaktives, eher vermeidendes Bewältigungsverhalten
-
Erfahrungen der Sinnhaftigkeit und Struktur der eigenen Entwicklung
(vgl. Steiner 2002, S 131)
In diesen Darstellungen zeichnet sich deutlich ab, worauf auch in der Frühförderung des Kindes und in der Begleitung der Familie Wert gelegt werden sollte:
Auf die Unterstützung der Eltern beim Aufbau einer tragfähigen Beziehung zum Kind, die es ihnen ermöglicht, einerseits "sichere Basis" (Bowlby) für das Kind zu sein und ihm schützende Strukturen vorzugeben, andererseits aber dem Kind Aktivität zu gewähren und ihm eigenes Handeln zuzutrauen. Die Voraussetzung dafür könnte allerdings sein, die Eltern in ihren positiven Haltungen und in ihren bisher bereits gezeigten Bewältigungskompetenzen zu bestärken, gemeinsam mit ihnen nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen und gemeinsam mit ihnen Ressourcen materieller und sozialer Art zu erschließen, sodass sie überhaupt frei werden, ihrem Kind offen und aufmerksam zu begegnen.
Ein solches Vorgehen im Sinne von Empowerment bedeutet für den Helfer allerdings auch, eine veränderte Rolle einzunehmen.
Wenn Betroffene als Experten in eigner Sache angesehen und entsprechend ernst genommen werden wollen, bedeutet das für die Fachleute, dass sie die Aufgabe haben, Prozesse anzuregen und konsultativ und kooperativ zu unterstützen. Dies erfordert vom Helfer, Vertrauen in die individuellen Ressourcen und Fähigkeiten der Betroffenen zu setzen. Eine solche Sicht des Klienten als kompetente Person in einer schwierigen Lebenslage nimmt ihn ernst und bringt ihm Wertschätzung entgegen. Von der Fachperson wird dabei verlangt, sich authentisch, ressourcen- und autonomiefördernd auf den Dialog mit dem Betroffenen einzulassen.
Ich denke, dass dies auch entlastend für die Fachperson sein kann: sich der Stärken des Gegenübers bewusst zu sein, darauf zu vertrauen, dass es die Situation meistern kann, und es seinen eigenen Weg gehen zu lassen, ohne das Gefühl zu haben, "alles" für es tun zu müssen.
Die Aufgabe des Helfers ist es demnach, "die Bedingungen in der sozialen Umwelt bereitzustellen und zu pflegen, die Empowermentprozesse von Individuen, in Gruppen und sozialen Strukturen ermöglichen"
(Bobzien/Stark 1991, S 174 in Theunissen/Garlipp 1999, S 13).
Weiß spricht in seinen Überlegungen zum Empowerment-Ansatz als handlungsorientierendes Modell in der Frühförderung davon, dass Empowerment davon ausgeht, "daß Phänomene gesellschaftlicher Wirklichkeit, als Bedingungen und Ziele sozialen Handelns, häufig antinomischer Natur sind und daher divergente Sichtweisen und Lösungsansätze erfordern" (Weiß 1992, S 166).
Antinomie sieht er dabei in Anlehnung an Rappaport als den Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann.
Gerade in der Frühförderung haben wir es meiner Meinung nach mit einer Vielzahl von Spannungsverhältnissen und Widersprüchen zu tun.
Gertraud Finger etwa hat die Situation der Familie eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes im generellen Spannungsfeld zwischen Besonderheit und Normalität beschrieben, wobei beide Pole etwas von der Wirklichkeit der Familien beinhalten. Sie differenziert dieses Spannungsfeld weiters in mehrere Teilbereiche, die sie ebenfalls als Widersprüche beschreibt. (vgl. Finger/Steinebach 1992, S 79ff)
Für eine begleitende Frühförderung sieht Finger dabei mehrere Fragestellungen als handlungsleitend an:
-
Wie kann eine Familie ihre Besonderheiten anerkennen, ohne zur Sonderfamilie zu werden?
-
Welche Entlastung braucht die Familie?
-
Welche Schutzfaktoren hat die Familie?
-
Welche Kräfte kann sie noch entwickeln, um mit der Situation umzugehen?
Im Spannungsfeld zwischen Verunsicherung und Gelassenheit nennt Finger einige Schutzfaktoren, die Eltern helfen können, die Verunsicherung zu überwinden und sich gelassener dem realen Kind zuzuwenden: Wissen und Information über die Störung, Entwickeln von Alltagsroutinen, gegenseitiges Kennenlernen zwischen Eltern und Kind, Überwinden der eigenen Vorurteile und Entlastung im Tagesablauf. Hier hätte Frühförderung also den Auftrag, die Eltern fachlich zu beraten, die Eltern beim Aufbau von Alltagsroutinen und Alltagsstrukturen zu begleiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Eltern ein Kennenlernen des Kindes in einer spannungsfreien Atmosphäre zu ermöglichen und mit ihnen nach Entlastungsmöglichkeiten im Alltag zu suchen.
Im Spannungsfeld zwischen Fremdbestimmtheit und Selbstbestimmung sieht Finger zwar einerseits die Unterstützung der Fachleute als hilfreich an, fordert aber eine Verhaltens- und Einstellungsänderung vom Therapeuten bzw. der Frühförderin. Für besonders wichtig hält sie die Kooperation der Dienste, um die Familie nicht mit Hilfsangeboten zu überschwemmen, und eine partnerschaftliche Abstimmung mit den Eltern auf der Basis der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme des Angebotes auf der Elternseite. Im Sinne von Empowerment hält sie es für notwendig, dass die Fachleute wahrnehmen und in Erfahrung bringen, welche Wege der Bewältigung die Familie bisher gefunden hat und gemeinsam mit den Eltern überlegen, wie diese Wege weiter ausgebaut werden können. Dies bedeutet auch einen Abschied von der Helferrolle, die leicht in einen Teufelskreis führen kann, innerhalb dessen der Helfer der Meinung ist, den Klienten stützen zu müssen, weil er so schwach ist, und der Klient schwach bleiben muss, weil der Helfer ihn dauernd stützt. In einem Verständnis von Empowerment sind die Helfer "keine Experten mehr, die allein die richtige Lösung kennen und die Eltern auf den richtigen Weg bringen. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die Familien zu befähigen, sich selbst Hilfe zu holen und Bedingungen zu suchen, unter denen familiäre Schutzfaktoren die Wirkung von Risikofaktoren verringern" (Finger/Steinebach 1992, S 85).
Im Spannungsfeld zwischen gegenseitiger Abhängigkeit und Eigenständigkeit der Eltern und des Kindes ist es für die Eltern schwierig, ihrem behinderten oder von Behinderung bedrohten Kind Autonomie zuzutrauen und seine Loslösung zu unterstützen, vor allem dann, wenn ihnen selber keine anderen Rollen mehr offen stehen, oder sie es unter dem Druck der Verantwortung nicht wagen, andere Lebensmöglichkeiten zu entwickeln. Dies betrifft vor allem die Hauptbezugsperson des Kindes, in der Regel die Mutter.
"Ein Kind mit geringer sozialer Kompetenz, das sich nicht selbständig löst, eine Umgebung, die von der Mutter erwartet, ganz für ihr Kind da zu sein, Mütter, die in der Versorgung des Kindes eine neue, sie bestätigende Lebensaufgabe gefunden haben, alles dies trägt dazu bei, die gegenseitige Abhängigkeit von Mutter und Kind zu verstärken" (ebd. S 86/87).
Beide - Mutter und Kind - geraten in Gefahr, dass ihr Wunsch nach Autonomie nicht genügend beachtet wird.
Wege, die dazu führen könnten, dass einerseits die Mutter nicht auf ihre Eigenständigkeit vergisst und andererseits den Wunsch nach Autonomie bei ihrem Kind wahrnimmt, sind für Finger die Aufteilung der Aufgaben innerhalb der Familie, d.h. die Entlastung der Mutter auf einer praktischen und damit gleichzeitig auch emotionalen Ebene, und die Förderung der Selbstbestimmung der Mutter, die darin bestehen kann, eigene Bereiche und Lebensmöglichkeiten für die Mutter zu erschließen und sie dabei zu unterstützen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und durchzusetzen. Andererseits braucht die Loslösung vom Kind auch Vorbereitung, wobei die Frühförderung vielleicht ein Ort ist, an dem die Trennung sozusagen "geübt" und in einem geschützten Rahmen erfahren werden kann.
Im Spannungsfeld zwischen sozialer Isolierung und sozialer Unterstützung geht es vor allem darum, den Eltern, die zunächst einmal eher auf Distanz zu ihrer sozialen Umwelt gehen, soziale Netzwerke wieder zu erschließen. Dazu zählen das Netzwerk von Freunden und Verwandten, das eher praktische Hilfe und Verständnis entgegenbringt, das Netzwerk von Fachleuten, das fachliche Beratung und Begleitung zur Verfügung stellt und das Netzwerk von Gleichbetroffenen, das neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch auch die Entwicklung von Eigeninitiative und den Aufbau einer neuen sozialen Identität unterstützen und Solidarität erfahrbar machen kann.
Im Spannungsfeld zwischen Belastung und Entlastung kann es geschehen, dass die Eltern sich so sehr nach den Bedürfnissen ihres Kindes ausrichten, dass sie in der Folge unter einem großen Druck stehen, der sie wiederum Reaktionen entwickeln lässt, die sie zusätzlich belasten. So kann ein schwer zu unterbrechender Teufelskreis entstehen.
"Je mehr die Eltern von ihrem Kind erhoffen und je weniger sie von ihm wissen, umso enttäuschter, schuldbewusster und unsicherer reagieren sie auf sein Verhalten. Je schwankender sie sind, desto weniger fühlt das Kind sich akzeptiert und verstanden, um so unsicherer wird es in seinem Verhalten, und um so weniger kann es die Erwartungen der Eltern erfüllen" (ebd. S 96).
Die Frühförderung kann der Gefahr unterliegen, "daß sie die Seite der Hoffnung im ambivalenten Erleben der Eltern verkörpert, sich damit aber von der Seite ihrer Not entfernt" (ebd. S 97, mit Bezug auf Weiß 1991, S 211).
Die Eltern brauchen gerade in der Frühförderin ein Gegenüber, das ihre ohnmächtige Trauer aushalten kann und nicht vor ihr davonläuft oder kapituliert.
"Begleitung bedeutet nicht, Hilfe bereitzustellen, nicht Befreiung von der Last, nicht einmal sie zu teilen, sondern anzuerkennen, daß sie da ist und anzuerkennen, daß es schwer ist. Begleitung bedeutet auch, die unter der Belastung entstehenden negativen Gefühle zu sehen und auszuhalten. Indem Eltern erfahren, daß ihre Gefühle keine Ablehnung und keine Angst erzeugen, können sie es wagen, diese Gefühle anzusehen und auszusprechen. Sie brauchen dann nicht mehr verdrängt zu werden und kommen auch nicht mehr unkontrolliert im Verhalten dem Kind gegenüber zum Ausdruck" (ebd. S 98).
Dies ist meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt für einen möglichen Ausstieg aus dem Förder- und Erfolgsdruck auf Seiten der Frühförderin: sich bewusst zu machen, dass man momentan vielleicht gerade nicht mehr tun kann, als da zu sein und gemeinsam mit den Eltern die aufkommenden Gefühle auszuhalten.
Begleitung ist für Finger in diesem Sinn ein "Mitgehen der Fachleute auf dem Weg, den die Eltern zu gehen haben, es ist aber kein Hinführen zu einem vorher festgelegten Ziel" (ebd. S 98).
Ähnlich sieht dies auch Weiß, wenn er sagt: "Begleiten heißt ja auch, den Weg mitzugehen, den der andere geht, und nicht ihn auf unseren Weg herüberzuziehen" (Fritsche/Thurner/Weiß 1993, S 66).
"Der Weg, den die Eltern zu gehen haben, liegt in ihrer ‚Ver-Antwortung', er ist ihre Antwort auf ihr Kind. [...] Vielleicht enthält diese Antwort ein ‚Ja' zu dem Kind und zugleich ein ‚Nein' zu seiner Behinderung. Eine solche ambivalente Einstellung entspricht der nicht aufzuhebenden Widersprüchlichkeit, in der die Eltern leben" (Finger/Steinebach 1992, S 98).
Weiß sieht vor allem hier eine große Chance im Empowerment-Ansatz, weil er uns die Möglichkeit gibt, "soziale Prozesse dadurch besser zu verstehen, daß wir sie von mehr als einer Seite betrachten. [..] Gelänge es der Fachperson, die subjektive Wirklichkeit der Eltern in der Divergenz zu den Bedürfnissen des Kindes in ihr Denken zu integrieren, könnte dies die Beziehung zu ihnen entlasten" (Weiß 1992, S 160).
Er hält dabei das Gespräch zwischen Eltern und Fachleuten für die beste Möglichkeit, um einen gemeinsamen Such- und Abklärungsprozess in Gang zu bringen, innerhalb dem Problemlösungsstrategien entwickelt und in ihren Auswirkungen durchgespielt werden können. Der Empowerment-Ansatz ist "immer auch ein Lernfeld für Fachleute sowie [für; C.K.-S.] eine professionelle Haltung" (ebd.S 164).
Ziemen nennt drei Aufgaben von Empowerment in der Frühförderung:
"Empowerment muß auf das Kind im frühen Lebensalter, dessen Entwicklung und die frühe Förderung bezogen sein.
Empowerment muß die Rolle der Eltern in der Frühförderung thematisieren.
Empowerment muß die Stellung und Arbeitsweise der Mitarbeiter der Institutionen der Frühförderung reflektieren" (Ziemen in Theunissen/Plaute 1995, S 72).
Für Ziemen bedeutet dies in weiterer Folge, dass Empowerment aus der Identität und Autonomie aller an der Frühförderung Beteiligten bestimmt wird.
Frühförderung soll vor allem dazu beitragen, entwicklungsanregende Bedingungen für das Kind im familiären Alltag zu schaffen und die Eltern dabei unterstützen, die Handlungen und Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und die von ihm verwendeten Ausdrucksmöglichkeiten zu verstehen. "Wenn Eltern wahrnehmen, daß z.B. die Frühförderin ihr Kind annehmen, akzeptieren kann oder das Verhalten des Kindes und seine Handlungen anders interpretiert, können sie wieder lernen, ihre eigenen Kompetenzbereiche in der Interaktion mit dem Kind zu erkennen und zu nutzen" (ebd. S 86). Familienbegleitung sollte demnach eine gemeinsame Suche nach Lösungen zur Bewältigung der durch die Behinderung des Kindes bzw. seine drohende Behinderung ausgelösten Krisen und Belastungen der Familie sein. "Die Mitarbeiter der Frühförderung sind demnach in erster Linie einfühlsame Berater" (ebd. S 87).
Dabei sollte neben den Bedürfnissen und der Lebenswelt der Eltern aber auch die Gefühlslage der Frühförderin bzw. ihre Beziehung zum Kind Beachtung finden. Es ist wichtig, dass die Frühförderin sich den Eltern authentisch mitteilt, sodass diese eine andere Perspektive erfahren und ihr Verhältnis zum Kind möglicherweise relativieren können.
"Erst wenn beide Seiten in der Lage sind, auf dieser Vertrauensbasis auch Gefühle auszutauschen, wird es möglich sein, wirklich gemeinsame Entscheidungen für das Kind und mit dem Kind zu treffen" (ebd. S 87).
Ziemen sieht im Verstehen der Eltern, des Kindes und ihrer Kompetenzen die Grundlage für eine Frühförderarbeit, die alle beteiligten Menschen mit einbezieht und durch die gemeinsamen Überlegungen zu einem gegenseitigen Wissens- und Kompetenzaustausch gelangt. Dies stellt die Frühförderin vor die Aufgabe, das Kind und seine Eltern in ihrem So-Sein zu akzeptieren und sich auf ihre Lebens- und Erfahrungswelt einzulassen.
Im Frühförderprozess ergibt sich somit eine Triade zwischen Eltern, Kind und Frühförderin. "Jeder einzelne bringt Kompetenzen in den Prozeß ein, die sich auf sich selbst (Ich-Kompetenz), auf Objekte/Dinge der Umgebung (Sachkompetenz) und auf das Miteinander mit anderen Menschen (Sozialkompetenz) beziehen" (ebd. S 88).
In den Überschneidungen dieser Bereiche schließlich begegnen sich die Menschen. Die einzelnen Systeme sind selbsterhaltend, aber mit den anderen vernetzt. "Und nur das ‚Gehaltenwerden' durch das eigene System und durch die mit diesem vernetzten Systeme, bildet für jeden einzelnen (d.h. nicht nur für das Kind) die Voraussetzung, um zu mehr Autonomie gelangen zu können" (ebd. S 88).
Ziemen spricht hier an, dass der Frühförderprozess ein Geschehen ist, in dem sich alle Beteiligten verändern können und in dem Weiterentwicklung nicht allein auf das Kind beschränkt bleibt. Die Voraussetzung dazu ist wohl der Aufbau einer tragfähigen vertrauensvollen Beziehung zwischen Frühförderin, Eltern und Kind und eine Sichtweise von Frühförderung, die nicht auf die Optimierung der normgerechten Entwicklung des Kindes abzielt, sondern die Autonomie aller Beteiligten fördert.
In der Denkweise von Empowerment gehört dazu auch, die Bedürfnisse und Wünsche der zu Begleitenden aufzunehmen - und wer könnte diese besser zur Sprache bringen als die Eltern selber?
Aus diesem Grunde möchte ich im Folgenden gerne den Erwartungen und Wünschen der Eltern an die Frühförderung und an eine partnerschaftliche Kooperation nachgehen.
Hier möchte ich einige Studien erwähnen, in denen die Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder nach ihren Wünschen und Erwartungen hinsichtlich einer Frühförderung befragt bzw. ihre Zufriedenheit mit der Frühförderung erhoben wurden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Eltern der Frühförderung gegenüberstehen.
Voranstellen werde ich eine Studie von Theunissen, Plaute und Westling zu den Wünschen von Eltern entwicklungsverzögerter oder behinderter Kinder in Deutschland und Österreich (Theunissen/Plaute/Westling 1997), die in der Tradition des Empowerment-Konzeptes nach der Situation, den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen fragt. Die Autoren beziehen sich in ihren Darstellungen auch auf die Ergebnisse ähnlicher Studien aus dem englisch- und deutschsprachigen Raum.
Solche Studien haben etwa ergeben, dass sich die Förderwünsche der Eltern bei Kindern im Alter zwischen null und zwei Jahren sehr auf die motorischen Fähigkeiten, bei Kindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren sehr auf die kommunikativen und hygienischen Fertigkeiten und bei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren mehr auf kommunikative und lebenspraktische Fertigkeiten beziehen.
Eltern mittelschwer behinderter Kinder wünschen sich stärker funktionale Fertigkeiten, etwa für das öffentliche Leben oder den Haushalt, und schulische Fähigkeiten, während sich Eltern schwerstbehinderter Kinder eher auf Freundschaft und soziale Fertigkeiten konzentrieren. (vgl. Theunissen/Plaute/Westling 1997, S 3)
Verschiedenste Studien befassten sich mit der Zufriedenheit der Eltern mit heilpädagogischen Angeboten und kamen zu folgenden Ergebnissen:
Eltern behinderter Kinder wünschen sich vor allem Beteiligung am Erziehungs- und Förderprozess ihres Kindes, und zwar in höherem Maß als Eltern nicht behinderter Kinder. Leider konnten diese Ergebnisse bei Eltern, die einer Minderheit angehören oder von Armut betroffen sind, nicht gefunden werden.
Eltern behinderter Kinder wünschen sich Kontakt zu den Betreuungspersonen des Kindes, Beteiligung am Planungsprozess und mehr Informationen über wichtige Trends in der Heilpädagogik.
Sie wünschen sich mehr Information über ihre rechtliche Situation und über geeignete Institutionen für ihre Kinder.
"Eltern von behinderten Vorschulkindern haben zwar ihre Zufriedenheit mit den vorhandenen Angeboten ausgedrückt, äußerten allerdings den Wunsch nach besserer Koordination der Angebote und besserer Information über diese Angebote. Darüber hinaus wurde die mobile Frühförderung höher bewertet als ambulante Frühförderdienste" (Able-Boone et al. 1992 in Theunissen/Plaute/Westling 1997, S 4).
"Im Zusammenhang mit den familienorientierten Diensten wünschten sich Eltern vor allem eine verstärkte Kooperation und mehr Information über die Entwicklung und die Fortschritte des Kindes und waren an Familienberatung weniger interessiert" (Mahoney et al. 1990 in Theunissen/Plaute/Westling 1997, S 4).
Durchwegs eher unzufrieden äußerten sich die Eltern gegenüber den Angeboten der öffentlichen Hand (finanzielle, psychologische und medizinische Dienstleistungen). Hier bestand ein großes Bedürfnis der Eltern nach mehr Angebot, mehr Information über diese Angebote und eine bessere Organisation und Koordination der Angebote. (vgl. Biklen 1988 und Knoll 1989 in Theunissen/Plaute/Westling 1997, S 4)
Die Studie von Theunissen, Plaute und Westling ergab für Österreich, dass zwar ein "(leidlich) funktionierendes System traditioneller Behindertenhilfe" (ebd. S 5) existiert, dass neue Wege aber offenbar schwer einzuschlagen sind, und die Institutionen neue pädagogische Konzepte nicht oder nur spärlich aufnehmen.
Eltern würden sich hier mehr emotionale Begleitung für sich selber, assistierende Formen der Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten und ein flächendeckendes Angebot von integrativen Kindergärten und Schulen wünschen. (vgl. ebd. S 6)
Die Autoren der Studie sprechen in diesem Zusammenhang eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen Eltern und Fachleuten im Sinne von Empowerment an. "Eltern brauchen keine Bevormundung durch (sogenannte) Fachleute, sondern bestenfalls psychosoziale Beratung (Konsultation) sowie motivationale und soziale Unterstützung bei Durchsetzung ihrer legitimen Interessen und Perspektiven" (ebd. S 7).
Die Studie ergab für die Wünsche der Eltern bezüglich der Förderung ihres Kindes ein Ansteigen des Wunsches nach Fertigkeiten im Haushalt und in der Öffentlichkeit, in Bezug auf eine Arbeitsmöglichkeit und nach kreativen Fertigkeiten mit zunehmendem Alter der Kinder. Gleich wichtig hingegen bleiben für die Eltern der Wunsch nach Fertigkeiten für die Freizeit, nach sozialen, kommunikativen und motorischen Fertigkeiten.
Zusätzlich wurden die Eltern nach ihrer Zufriedenheit mit der bisherigen Vermittlung der gewünschten Fertigkeiten beim Kind gefragt. Hier zeigten sich die Eltern am wenigsten zufrieden mit der Vermittlung von beruflichen und schulischen Fertigkeiten. (vgl. ebd. S 12)
Die hier geäußerte Unzufriedenheit entspricht meiner Meinung nach wohl auch der Enttäuschung der Eltern über die nicht erreichten Ziele und Hoffnungen in dieser Hinsicht.
Die Studie stellte weiters einen hohen Wunsch der Eltern nach der Betreuung ihrer Kinder in integrativen Einrichtungen fest, vor allem dann, wenn sie die Gelegenheit hatten, solche Einrichtungen kennen zu lernen.
Im Zusammenhang mit der Frage, ob sich die Eltern eine Teilnahme an wichtigen Planungsschritten für das Kind wünschen, schätzten die Eltern das Gespräch mit den Therapeuten, den allgemeinen Informationsaustausch über das Kind und über pädagogische Inhalte als besondern wichtig ein.
Auf die Frage hin, welche Art von Information sich die Eltern wünschen würden, nannten diese am häufigsten: Information über den Entwicklungsverlauf des Kindes, über Möglichkeiten der Verhaltensänderung, über Lerneigenschaften und Lernmöglichkeiten, über medizinische Grundlagen, über Organisationen für behinderte Menschen, über Kontaktmöglichkeiten zu anderen Eltern, über das Spielverhalten des Kindes, über die Rechte des Kindes und über Unterstützungen für die Betreuung und Förderung des Kindes zu Hause.
Die Informationsvermittlung sollte nach Meinung der Eltern vor allem in schriftlicher Form (z.B. Literatur), durch Hausbesuche von Fachleuten und durch persönliche Beratungsgespräche geschehen.
Die Wünsche der Eltern nach besonderen unterstützenden Diensten beziehen sich hauptsächlich auf die Koordination der Angebote, auf geeignete Hilfsmittel, auf den Kontakt zu anderen Eltern, aber auch auf Eltern- und Familienberatung und die Möglichkeit einer Kurzzeitunterbringung des Kindes.
Eine Zusammenfassung der Studie hebt vor allem den Wunsch der Eltern nach mehr Information heraus, verbunden mit der Feststellung, dass eine derzeit noch ungenügende Informationssituation ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Eltern noch nicht genügend einbezogen, informiert und ernst genommen werden. (vgl. ebd. S 19)
"Ansätze, die Beratung als Konsultation begreifen, die auf Kooperation angelegt sind und Eltern als ‚Experten in eigener Sache' annehmen, sind eher dazu angetan, verkrustete Vorbehalte oder Ängste zu durchbrechen und eine Offenheit gegenüber neuen Formen der Zusammenarbeit (z.B. Elterngruppen; Familienberatung und -besuche) zu befördern (vgl. Weiß 1989; Theunissen/Garlipp 1996 b). Dadurch kann zugleich auch dem ausgeprägten Wunsch nach Informationen einer Förderung zu Hause am besten entsprochen werden" (ebd. S 19).
Die Autoren der Studie sehen für die Zukunft die Notwendigkeit eines Wandels in der Rolle der Fachleute. "Es werden zukünftig keine dominierenden und tonangebenden Experten gefragt sein, sondern Menschen, die Fachwissen zur Verfügung stellen und damit ein Stück beitragen, daß behinderte Menschen und deren Angehörige ein selbstbestimmteres Leben führen können" (ebd. S 20).
"Behinderte Menschen und Eltern wollen in ihren Bedürfnissen und mit ihren Problemen ernst genommen werden. Dazu gehört, daß sie jene Informationen bekommen, die sie brauchen, um ihr Leben in die eigenen Hände nehmen zu können und daß sie in jenen Bereichen professionelle Unterstützung bekommen, in denen sie selbst es wünschen" (ebd. S 21).
In der Schweiz führte Gisela Chatelanat (2002) eine Studie über die Beziehungen von Eltern mit Fachpersonen aus dem medizinischen, therapeutischen und erzieherischen Bereich durch. Es ging ihr hauptsächlich um die Frage, wie Eltern professionelle Milieus erfahren.
Den Frühförderinnen kommt hier in den Augen Chatelanats eine Schlüsselposition zu.
"Sie können die Familien informieren, ihnen Wege ebnen, sie bei der Geltendmachung ihrer Rechte unterstützen, damit sie die für sie am besten geeignete Form der Kommunikation und Hilfestellung finden und in Anspruch nehmen können" (Chatelanat 2002, S 114).
Da die Partnerschaft mit den Eltern heute als anzustrebendes Ideal propagiert wird, hat es zumindest den Anschein, als sei ein dahingehender Wandel vielerorts schon vollzogen.
"Der Übergang zu neuen, gleichberechtigten Beziehungen zwischen Eltern und Fachpersonen erfordert unserer Meinung nach umfassende Veränderungen in den Einstellungen und Handlungen der Fachpersonen, es sei denn, man tauscht nur Worte aus, ohne Inhalte zu verändern! Eine echte Partnerschaft zwischen Familien und Professionellen hat weitreichende Konsequenzen auf die Erwartungen, Pflichten und Rechte der betroffenen Systeme und Individuen" (ebd. S 114).
Als Kriterien für eine Partnerschaft nennt Chatelanat das Verfolgen gemeinsamer Ziele, die gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen, das gemeinsame Definieren der Rollen, das Teilen der Verantwortung, den Aufbau beiderseitigen Vertrauens und von Loyalität, den Austausch von Informationen und das Belassen der Entscheidungskompetenz bei den Eltern.
Für die Studie wurden 23 Fragebögen und 10 Gespräche mit Eltern behinderter Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren ausgewertet. Die Resultate weisen darauf hin, "dass die meisten Eltern solche partnerschaftlichen Formen des Umgangs miteinander bzw. solche Spielregeln begrüßen würden" (ebd. S 116).
Die Eltern wollen nicht nur informiert werden, sondern auch aktiv teilnehmen und entscheiden.
"Die Eltern wünschen sich [...], dass ihr spezifisches Wissen um ihr Kind und ihre eigenen Handlungskompetenzen von den Fachpersonen als bedeutsam anerkannt und geachtet werden, und dass die Fachleute anerkennen, dass ihnen als Eltern als Erste die Erziehungsverantwortung für ihr Kind zukommt" (ebd. S 116).
Die Studie bestätigt zudem den Eindruck, "dass die meisten Eltern aktiv, kritisch und selbstbestimmt sind" (ebd. S 116).
Für die meisten Fachleute ist Vertrauen die Basis für die Begleitung der Eltern. Eine häufig gebrauchte Redewendung ist in dieser Beziehung das "Herstellen eines Vertrauensverhältnisses". Die Eltern aus Chatelanats Studie aber meinen dazu: "Nicht aus dem Vertrauen erwächst die Zusammenarbeit, sondern ‚zusammen arbeiten' entwickelt Vertrauen" (ebd. S 117).
Frühförderung als pädagogisches Angebot wurde von den Eltern im Gegensatz zu den medizinisch-therapeutischen Diensten sehr positiv bewertet und als unterstützend beschrieben, wenngleich es auch eher abgekoppelt von den übrigen Fördereinrichtungen und von institutionellen Bindungen wahrgenommen und weniger in Zusammenhang mit Profession gebracht wird.
Eine solch positive Bewertung von Frühförderung durch die Eltern liegt etwa im regelmäßigen Austausch begründet, der Vertrauen und Teamgeist zwischen Eltern und Fachpersonen aufbaut, oder in der Weitergabe von schriftlichen Berichten an die Eltern.
"Früherzieher und Eltern beobachten gemeinsam das Kind, entwickeln gemeinsame Ziele und tauschen regelmäßig Erfahrungen über Verhaltenweisen, Schwierigkeiten und Fortschritte des Kindes aus. [...] Fachpersonen in der Früherziehung beraten, aber Eltern treffen die Entscheidungen" (ebd. S 118).
Wenn Frühförderung hier offensichtlich eine partnerschaftliche Kooperation schon großteils in die Praxis umgesetzt hat, so zeigen sich jedoch andere Besonderheiten wie etwa die mangelnde Wahrnehmung der Professionalität der Frühförderin.
"Die befragten Eltern erinnern sich hauptsächlich an die ‚Dame, die Spielzeug mitbrachte' [...]. Häufig wurden die ‚Menschlichkeit' und aufrichtige Zuneigung dieser Dame zum Kind erwähnt und die guten persönlichen Beziehungen, die sie mit allen Familienmitgliedern hatte. Aber es besteht dennoch ein blasses Bild von ihrem professionellen Profil und ihren spezifischen Kompetenzen. Die Früherzieherin erscheint den Eltern [...] so als ob sie aus eigener Initiative ‚ins Haus geschneit' wäre" (ebd. S 119).
Es hat hier fast den Anschein, als brächte das Anstreben eines partnerschaftlichen Verhältnisses zu den Eltern die Gefahr des Verlustes der eigenen Professionalität für die Frühförderin mit sich.
Weiß bemerkt in diesem Zusammenhang, dass ein Begleiten der Familie für die Frühförderin auch bedeutet, "die Spannung zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung des anderen auszuhalten" (Weiß 1993, S 66).
Es geht demnach um eine Balance zwischen den Ansprüchen der Frühförderin an ihre eigene fachliche Tätigkeit aus ihrem Selbstverständnis heraus und zwischen ihrem Eingehen auf die Wünsche und Erwartungen der Eltern.
Frühförderinnen und Eltern schätzen sich in Bezug auf ihre Rollendefinition und Zuständigkeiten aber überhaupt sehr unterschiedlich ein, wie auch eine Studie von Pretis aus dem Jahr 1997 zeigt: Frühförderinnen sehen sich mit dem Fokus auf Professionalität, auf Begleitung und Beratung, während Eltern viel stärker den kindzentrierten Förderaspekt erleben. (vgl. Pretis 1999, S 153)
Jaehne, Malzan und Neuhäuser (1995) werteten 104 Fragebögen und 58 Interviews mit Eltern behinderter Kinder aus, um einen Eindruck von der Effizienz und der Bewertung vorangegangener Maßnahmen in der Frühförderung zu erhalten.
Fast alle befragten Eltern brachten zum Ausdruck, dass sie im Rahmen der Frühförderung eine positive Entwicklung des Kindes beobachtet hatten, besonders im Spielverhalten, in der Konzentration, in der Motorik und im Sozialverhalten.
(vgl. Jaehne/Malzan/Neuhäuser 1995, S 15)
Die befragten Eltern betonten zudem, "wie wichtig Beratung bei und neben den angebotenen Fördermaßnahmen sei" (ebd. S 15).
Dabei beklagten viele Eltern gleichzeitig einen mangelnden Informationsaustausch mit Fachleuten aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich.
"Von den Eltern als besonders hilfreich empfunden wurde die Möglichkeit, Mitarbeiter der Frühförderstelle auf alle generellen und speziellen Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kindes ansprechen zu können. Dadurch sei die Bewältigung der gegebenen Situation erleichtert worden. Aus Sicht der Eltern steht bei allen Frühfördermaßnahmen die Entwicklung des Kindes zwar im Vordergrund. Diese schließt jedoch die Unterstützung der gesamten Familie ausdrücklich ein, wird immer wieder betont" (ebd. S 16).
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Frühförderung eine kontinuierliche Hilfe für betroffene Eltern und Familien anbieten muss, wobei sie eine Familienorientierung als besonders wichtig für den Erfolg der Frühförderung ansehen.
"Aufgrund der engen Beziehung zwischen Familienstruktur und Kindesentwicklung, besonders bei ‚Risikokindern' [...], ist es notwendig, psychosoziale Bedingungen zu berücksichtigen, die direkt und indirekt Einfluß auf das Kind haben" (ebd. S 16).
Hier sehen die Autoren auch ein sich veränderndes Bild im Bereich der Frühförderung.
"Zunehmend sind Kinder mit Verhaltens- und Lernproblemen im Vorschulalter zu betreuen" (ebd. S 16).
Diese Feststellung entspricht auch meiner eigenen Wahrnehmung von der Zusammensetzung der Diagnosen der betreuten Kinder in der Frühförderung.
Evaluationsforschung hat in der Frühförderung eine noch eher junge Tradition und wird erst in den letzten zehn Jahren - verbunden mit der zunehmenden Notwendigkeit, die Effizienz der Maßnahmen zu dokumentieren, um finanzielle Fördermittel zu erhalten - verstärkt ins Auge gefasst.
In Europa gibt es mittlerweile die Gruppe "Eurlyaid" (Europäisches Netzwerk in der Frühförderung), die in den Jahren 1996/1997 eine Skala zur Messung der Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung konzipiert hat.
Die Messung der Elternzufriedenheit hat unter anderem das Ziel, "die Teilnahme der Eltern zu (ver)stärken, das Empowerment der Eltern zu fördern und die Dienste zu verbessern" (Lanners 2002, S 123).
In der betreffenden Studie von Lanners wurden Eltern aus verschiedenen Ländern Europas befragt und hatten folgende Bereiche der Frühförderung zu bewerten: Förderung des Kindes, Berichte über das Kind, Integration des Kindes, Begleitung der Geschwister, Kinder- und Elterngruppen, Begleitung der Eltern, Informationen über andere Dienstleistungen, Rechte der Eltern, Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern, Arbeitsmodell und Zugänglichkeit und Flexibilität des Dienstes.
Die Zufriedenheit der Eltern erwies sich je nach Bereich als unterschiedlich.
"Als Stärken ergeben sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Förderung des Kindes und die Begleitung der Eltern. Schwachpunkte sind zu finden in den Bereichen der Eltern- und Kindgruppen, der Informationen der Eltern über ihre Rechte und der Maßnahmen für die Integration der Kinder" (ebd. S 126).
94,2 % der Eltern gaben an, dass sie der Fachkompetenz der Frühförderinnen vertrauen. Lanners stellt zudem anhand der vorhandenen Daten fest, dass "die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung hoch ist" (ebd. S 128).
Einen ähnlichen Zufriedenheitswert ermittelte auch Pretis in einer bislang noch unveröffentlichten Studie aus dem Bundesland Steiermark. (vgl. Pretis 2003)
In anonymen Telefoninterviews wurden Eltern befragt, deren Kinder durchschnittlich 4,4 Jahre alt waren und jeweils etwa zwei Jahre Frühförderung in Anspruch genommen hatten.
Etwa 72 % dieser Kinder hatten vor Beginn der Frühförderung noch keine Therapie oder Förderung erhalten, was für Pretis ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass die Frühförderung eine Art Screening-Stelle darstellt.
Der Wunsch, dass es dem Kind gut geht, stellt in 90% der Fälle das wichtigste Ziel der Eltern in der Frühförderung dar. Auf die Frage, was ihrer Meinung nach in der Frühförderung passiert, antworteten etwa 30% mit Spielen und 15% mit motorischen Übungen. Nur 4% der Eltern sagten, dass in der Frühförderung Arbeit passiert.
Das Spiel als Hauptmethode in der Frühförderung wird also von den Eltern kaum als ernst zu nehmende Arbeit wahrgenommen.
Etwa 67% der Eltern gaben an, keinen erkennbaren Plan in der Frühförderung zu sehen.
Dementsprechend messen die Eltern auch die Qualität der Frühförderung an den Effekten, die sich beim Kind zeigen.
Auf die Frage, was passiert, wenn die Eltern und die Frühförderin nicht einer Meinung sind, gaben 71% der Eltern an, dass so etwas nicht vorkommt. Weitere 18% gaben an, dass in so einem Fall über das gesprochen wird, was vorgefallen ist.
Pretis schließt aus diesen Angaben, dass das partnerschaftliche Modell in der Frühförderung bereits umgesetzt zu sein scheint. Dabei muss man meiner Meinung nach aber auch bedenken, dass die Eltern am Telefon gefragt wurden, ob sie an der Umfrage teilnehmen wollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass unzufriedene Eltern hier ihre Teilnahme verweigert haben und somit gar nicht aufscheinen. Inwieweit sich Eltern am Telefon über ihre Probleme mit der Frühförderin oder ihre Unzufriedenheit überhaupt äußern können, möchte ich ebenfalls in Frage stellen.
Diese Annahme betrifft auch den Wert der Zufriedenheit, den 94,8% der Eltern mit "sehr zufrieden" und weitere 4,3% mit "zufrieden" angeben.
Sehr aufschlussreich finde ich allerdings die Begründungen der Eltern für ihre Zufriedenheit. Am häufigsten genannt wurde von den Eltern: "weil die Frühförderin so gut mit dem Kind umgeht", "weil die Frühförderin nett ist" und "weil die Frühförderin gut mit der Mutter auskommt". Hier schient also hauptsächlich die "Nettigkeit" der Frühförderin ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Eltern gewesen zu sein.
Andererseits könnte man aber auch sagen, dass der Hauptfaktor der Wirkung der Frühförderung die Beziehungsgestaltung ist: also nicht unbedingt das, was die Frühförderin tut, sondern ihre Fähigkeit, eine gute Arbeitsbasis mit dem Kind und den Eltern aufzubauen.
Effekte bzw. Veränderungen durch die Frühförderung werden von den Eltern vor allem beim Kind wahrgenommen.
57% der Eltern verneinten die Frage, ob sich durch die Frühförderung auch etwas in der Familie verändert hat; 90% der Eltern sahen auch keinerlei Veränderungen in Bezug auf die Umwelt. Hier ließe sich allerdings wiederum die Gegenfrage stellen, ob man solche Veränderungen überhaupt über ein Telefoninterview ermitteln kann und ob es dazu nicht ausführlicherer Interviews und einer qualitativen Auswertung bedarf.
57% der Eltern könnten sich auch ambulante Formen der Frühförderung vorstellen; 60% der Eltern würden auch eine Frühförderung ihres Kindes zusammen mit anderen Kindern begrüßen; 90% der Eltern empfinden die derzeitige Form der Frühförderung in wöchentlichen Abständen und in der Dauer von 90 Minuten als angemessen.
Einen großen Wunsch der Eltern konnte Pretis allerdings feststellen: den Wunsch nach früherer Information über die Möglichkeit der Frühförderung. Dieser Wunsch entspricht wohl einerseits der Forderung nach breiter angelegter Öffentlichkeitsarbeit durch die Institutionen und andererseits nach einer Bewusstseinsänderung bei den zuweisenden Berufsgruppen hinsichtlich der Möglichkeiten von Frühförderung.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie von Pretis scheint mir zu sein, dass der eigentlich in der Frühförderung wirkende Faktor der ist, wie es der Frühförderin gelingt, den Eltern beim Aufbau einer Beziehung zum Kind zu helfen. Erst eine intakte und anregende Beziehung der Eltern zum Kind bewirkt gute Erfolge im Sinne einer positiven Entwicklung des Kindes und der Familie.
Zusammenfassend zeigen diese Studien, dass es ein deutliches Anliegen der Eltern ist, begleitend zur Förderung des Kindes von der Frühförderin beraten und informiert zu werden. Eltern wollen am Planungsprozess und an den Entscheidungen für ihr Kind maßgeblich beteiligt sein. Als von den Eltern hier gewünschte Form wird eine partnerschaftlichen Kooperation genannt, die von der Frühförderin eine eher assistierende Rolle verlangt.
Die fehlende Wahrnehmung von den Arbeitsweisen der Frühförderung bei den Eltern hat vielleicht damit zu tun, dass es in der Frühförderung noch wenige klare, handlungsanleitende Konzepte gibt. Jede Frühförderin schlägt einen eher individuellen Weg für ihr Arbeit ein, was für die Familie von großem Vorteil ist, da die Frühförderin sich flexibel auf ihre Bedürfnisse einstellen kann.
Um die Frühförderin als Fachfrau mehr ins Bewusstsein der Eltern zu rücken, wäre es hingegen notwendig, den Eltern die eigenen Herangehensweisen und Arbeitsmethoden transparent zu machen.
In diesem Zusammenhang möchte ich gerne Silvia Turinsky (Leiterin der Frühförderung der Wiener Sozialdienste) zitieren, die im Rahmen ihres Vortrages bei einem Frühfördersymposium 2003 in Innsbruck bemerkte: "Die Eltern dürfen wissen, was wir uns denken!"
Dass für die Eltern bei der Inanspruchnahme von Frühförderung ihr Kind und seine Entwicklung im Vordergrund stehen, dass sich ihre Ziele auf eine Verbesserung der Chancen für ihr Kind beziehen, ist nur zu verständlich, vor allem, wenn man bedenkt, mit welch großen Hoffnungen sie in die Frühförderung kommen und welche Hoffnungen allein der Name "Frühförderung" in ihnen wecken muss.
Für eine Begleitung der Familie könnte es ein wichtiger Hinweis sein, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn es um Gespräche mit den Eltern geht. Um nicht der Gefahr zu unterliegen, sich in den komplexen Aufgaben einer Frühförderung und Familienbegleitung zu verstricken und zu einem "Mädchen für alles" zu werden, ist eine Begrenzung in den Aufgaben der Frühförderin notwendig. Eine solche Begrenzung könnte es sein, sich daran zu orientieren, ob es bei den Maßnahmen und behandelten Themen noch um das Thema "Behinderung" und im weitesten Sinn um das Kind geht.
Eine solche Sichtweise könnte neben einer Entlastung für die Frühförderin auch den Anliegen der Eltern entgegenkommen, ohne dass die Frühförderin dabei zur "Erfüllungsgehilfin" der Eltern bei der "Heilung" ihres Kindes wird.
Damit bin ich in meinen Ausführungen bei der Rolle und Position der Frühförderin im pädagogischen Dreieck der Frühförderung (Eltern - Kind - Frühförderin) angelangt. Die Position der Frühförderin, ihre Erwartungen, Ansprüche, Gefühle und Voraussetzungen möchte ich im Folgenden gerne näher betrachten und in die Überlegungen zu einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern einfügen.
Wenn die Eltern schon mit unterschiedlichsten Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen in die Frühförderung kommen und diese in die Beziehung zur Frühförderin einbringen, so stellt sich mir die Frage, mit welchen Voraussetzungen und Hintergründen die Frühförderin in die Beziehung zu den Eltern eintritt.
Wie weiter oben schon einmal erwähnt, kommen die Frühförderinnen meist aus unterschiedlichen Grundberufen und somit auch aus unterschiedlichen Fachrichtungen (Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, etc.). Diese Ausbildungen haben Einfluss auf ihre Einstellungen und Haltungen in der Begegnung mit dem Kind und seinen Eltern, und beeinflussen zudem ihre Sichtweisen von den Problemen, auf die sie möglicherweise treffen.
Jede Frühförderin wird ihre Vorstellung von der kindlichen Entwicklung und ein bestimmtes Menschenbild in ihre Tätigkeit mit einbringen. Entsprechend diesen Vorstellungen wird sie entweder mehr Struktur vorgeben und Eltern und Kind anleiten, oder sich eher als Begleiterin sehen und in offene Beziehungssituationen eintreten.
So wie die Eltern Verhaltens- und Gefühlsmuster aus vorangegangenen Beziehungen in die Arbeitsbeziehung mit der Frühförderin einbringen, so wird auch die Frühförderin von ihren Vorerfahrungen beeinflusst, was sie vielleicht sehr optimistisch macht oder andererseits sehr vorsichtig sein lässt.
Jede Frühförderin hat ihre eigene Überzeugung von der Wirksamkeit ihres Tuns und damit ein bestimmtes Selbstverständnis von ihrer Rolle im Frühförderprozess, das sie den Eltern gegenüber auch vermitteln bzw. geltend machen wird.
Sie kommt in die Beziehung mit den einzelnen Familienmitgliedern mit ihren persönlichen und fachlichen Überzeugungen und Vorstellungen von dem, wie eine Familie sein sollte, wie Elternschaft aussehen und wie man mit Behinderung umgehen könnte. Je nachdem, wie stark ihre Idealvorstellungen von Familie oder Elternschaft ausgeprägt sind, wird sie diese auf ihre Gegenüber übertragen. Wahrscheinlich hat gerade ein Frühförderin, die unter den Schwächen ihrer eigenen Eltern sehr gelitten hat und ein dementsprechend verletztes inneres Kind in sich trägt, besonders hohe Ansprüche an die Eltern, mit denen sie es in der Frühförderung zu tun hat.
Ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und ein gehemmter Umgang mit Aggression bei der Frühförderin kann ebenso bewirken, dass sie bestimmte Probleme der Familie nicht wahrnimmt, den Ausdruck negativer Gefühle vor allem bei der Mutter nicht aushalten kann, und die Familie mit Ansprüchen an Anpassung und Annahme unter Druck setzt.
Die Persönlichkeit der Frühförderin hat demnach eine große Bedeutung für die Gestaltung der Beziehungen in der Frühförderung.
Eine Frühförderin, die sich gut abgrenzen, die ihre Bedürfnisse gut vertreten kann und die es aus ihrem Selbstverständnis her gewohnt ist, zu führen, zu leiten und zu helfen, wird eher darum bemüht sein müssen, den Eltern und dem Kind etwas zuzutrauen und sich selber zurückzunehmen.
Eine Frühförderin, die Schwierigkeiten damit hat, der Familie gegenüber ihre eigenen Bedürfnisse und Minimalanforderungen für ihre Arbeit zu vertreten, wird vielleicht eher zurückhaltend, behutsam aber auch sehr vorsichtig im Umgang mit den Eltern agieren und damit in Gefahr kommen, ihr Profil zu verlieren und für die Eltern in der Folge zu wenig Halt darzustellen.
Eine Frühförderin, die sehr auf die Bedürfnisse des Kindes achtet, kann sich unter Umständen so weit mit dem Kind identifizieren, dass sie den Eltern gegenüber sehr fordernd auftritt bzw. deren Perspektiven vernachlässigt.
Eine Frühförderin, die sich sehr engagiert auf das Kind einlässt und sich hauptsächlich darauf konzentriert, in eine Interaktion mit ihm zu kommen, kann in ein Rivalitätsverhältnis mit der Mutter und damit in schwerwiegende Konflikte mit ihr geraten.
Eine Frühförderin, die ihre Grenzen nicht gut wahrt, kann sich auf eine Weise in die Probleme der Familie verstricken, die deren Probleme zu ihren eigenen werden lässt.
Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie sehr die Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin von allgemein menschlichen Beziehungsschwierigkeiten belastet sein kann, wenn die Frühförderin nicht darauf achtet, ihr eigenes Verhalten, ihre Beweggründe und Erfahrungen zu reflektieren.
An die Frühförderin stellt dies hohe Ansprüche an ihre Selbstreflexionsfähigkeit und die Bereitschaft, den eigenen Verhaltensmustern im Rahmen von Selbsterfahrungsprozessen nachzugehen.
Dies betrifft auch ihren eigenen Auseinandersetzungsprozess mit dem Thema der Behinderung. Die Beziehung zu den Eltern des Kindes wird auch davon bestimmt sein, wie die Frühförderin mit dem Leid und der Trauer umgehen kann, die mit der Behinderung des Kindes verbunden sind, oder wie sie auf die Ängsten der Eltern reagiert, die mit einer Entwicklungsauffälligkeit des Kindes aufbrechen können.
Je nachdem, wie sicher sie sich ihrer eigenen Gefühle in dieser Beziehung bereits ist, wird sie einen inneren Raum besitzen und aufmachen können, der es ihr ermöglicht, sich emotional auf die Situation der Eltern einzulassen - oder eben nicht.
Sehr wichtig finde ich persönlich, dass die Frühförderin ihre eigene Motivation kennt, die hinter ihrem Antrieb steht, in der Frühförderung arbeiten zu wollen.
"Leider fehlt bis heute eine ähnlich ausführliche Analyse der Helfer-Motivation im Bereich der Behindertenhilfe" (Weiß 1989, S 11).
Auch wenn ich Weiß hier Recht geben möchte, finde ich doch, dass eine allgemeine Analyse verschiedenster Motivationen des Helfens die Auseinandersetzung der Frühförderin mit ihren eigenen Beweggründen nicht ersetzen könnte.
Ich bin der Meinung, dass in ähnlicher Weise wie bei den betroffenen Eltern auch bei der Frühförderin Formen der Abwehr und des Leugnens der Behinderung auftreten können.
Eine häufige Reaktionsform stellt dabei wohl der sogenannte "pädagogische Aktivismus" dar, den die Frühförderin zur eigenen Angst-Abwehr entwickelt, und innerhalb dessen sie sich mit den ebenfalls in diese Richtung gehenden Bemühungen der Eltern treffen kann.
Als Reaktionsformen bei der Frühförderin sehen ich persönlich zum Beispiel an:
-
Das Ankämpfen gegen die Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit: Dieser Kampf kann sich im eben erwähnten Aktivismus, in großem Engagement und Bemühen äußern. Die Frühförderin arbeitet dann nach ausgeklügelten Techniken, ersinnt viele Angebote und bringt viel Material an das Kind heran. Sie trifft sich vielleicht mit der Mutter in ihrem Leistungsdruck, stellt selber noch Leistungsanforderungen an die Mutter und gibt somit ihren eigenen empfunden Druck an die Eltern weiter. So kann ein Kreislauf gegenseitigen Drucks entstehen, innerhalb dessen das Kind von beiden Seiten her großen Anforderungen ausgesetzt ist.
-
Eine eher depressive Haltung: Die Frühförderin zieht sich eher von den Ansprüchen und Erwartungen der Eltern zurück, fühlt sich hilflos und ohnmächtig. Sie nimmt dieses Gefühl aber auf sich und erlebt so große Selbstentwertung. Hier könnte man aber auch Reaktionen einordnen, die eine Führförderin dazu bringen, sich so weit auf die Familie einzulassen, dass sie nicht mehr unterscheiden kann zwischen ihren eigenen Empfindungen und denen der Familie und es passiert, dass sie sozusagen mit den Eltern im Leid versinkt. "Ein Sich-Einlassen in die Alltagswirklichkeit einer Familie mit ihren konkreten Erschwernissen und Begrenzungen auf der Grundlage mitmenschlich-solidarischen Helfens kann dazu führen, daß sich der Frühbetreuer mit den Verständnis- und Handlungsmustern dieser Familie voll identifiziert und deren Belange in gleichsam voraussetzungsloser Weise zu seinen Anliegen macht. Damit aber verliert er die reflexive Distanz, die erforderlich wäre, um die Alltagsverstehen und -handeln inhärente Ambivalenz und Widersprüchlichkeit wahrzunehmen und in der Zusammenarbeit zu thematisieren" (Weiß 1989, S 47).
-
Distanz einnehmen, Flüchten: Hier würde ich eine Frühförderin sehen, die eine sehr neutrale, sachliche Haltung einnimmt, nach ganz klaren Strukturen und Regeln vorgeht, sich innerlich von den Gefühlen distanziert, die von der Familie auf sie zukommen oder in ihr selber ausgelöst werden. Ein Berg von Materialien, die dem Kind dargeboten werden, kann ebenso ein Zeichen von Engagement sein wie auch von Abschottung gegenüber dem, was vom Kind her spürbar werden könnte. Flüchten kann aber auch heißen, Äußerungen der Mutter übergehen, nicht weiter verfolgen, in einer sehr sachlichen Sprache zu verharren oder bestimmten Gesprächsthemen auszuweichen.
Es ist wichtig für die Frühförderin, sich der Grenzen bewusst zu sein, an die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit immer wieder stoßen wird. Statt gegen diese Grenzen anzukämpfen und das Erleben der Begrenztheit einer eigenen Unfähigkeit zuzuschreiben, ist es unerlässlich für die Frühförderin, sich diese Grenzen einzugestehen, sie anzuerkennen und anzunehmen. Ähnlich drückt es auch eine Mutter für ihre eigene Situation aus, wenn sie meint: "Ich muß mir eingestehen, daß ich nicht mehr tun kann. So leid es mir für mein Kind tut" (Beuys 1984, S 74 zitiert in Weiß 1989, S 34). Für die Frühförderin müsste man vielleicht noch den Zusatz anfügen: "so Leid es mir auch für die Eltern und die Familie tut".
Die Frühförderin muss sich fragen, inwieweit sie ein funktionales Verständnis von ihrer Arbeit und von Behinderung hat, ob sie der Vorstellung unterliegt, die Behinderung reduzieren zu können, "ohne sich genügend mit Sinnfragen eines Lebens mit Behinderung auseinander zu setzen (im Rahmen dessen, wie dies einem Außenstehenden möglich ist)" (ebd. S 34).
"Auf diesem Hintergrund stellt sich die Aufgabe, die Grenzen der eigenen Wirkungsmöglichkeiten anzuerkennen, nicht nur für die Eltern, sondern in analoger Weise auch für die Fachleute immer wieder von neuem" (ebd. S 35).
Wie eine Frühförderin in einer bestimmten Situation reagiert, wird aber neben ihren Persönlichkeitsmerkmalen auch von ihrer momentanen Verfassung, vom gerade aktuellen Thema und den Anforderungen abhängen, die von der Familie her auf sie zukommen.
Um solchen Coping-Strategien der Frühförderin auf die Spur zu kommen, in der Folge einem Agieren der Frühförderin vorzubeugen und sie letztendlich dazu zu befähigen, sich authentisch in die Interaktion mit den Eltern einzulassen, spielen neben ihrer persönlichen Bereitschaft auch die Ressourcen eine große Rolle, die ihr von Seiten der Institution zur Verfügung gestellt werden.
Gerade eine mobil arbeitende Frühförderin ist in vielen Bereichen auf sich allein gestellt und muss mit auftauchenden Fragen und Schwierigkeiten zunächst einmal allein fertig werden, bevor sie - üblicherweise einmal in der Woche - die Möglichkeit hat, die Unterstützung ihrer Teamkolleginnen in Anspruch zu nehmen.
Die Rahmenbedingungen, die eine Frühförderin braucht, sind neben einem Rahmenkonzept der Institution, das ihre Aufgaben und Arbeitsweise strukturiert, die Möglichkeit von Supervision und zusätzlicher Intervision in einem interdisziplinären Team. Zusätzlich dazu wären für die Frühförderin auch Fortbildungsangebote hilfreich, die ihr ein Erleben eigener Gefühlsmuster in selbsterfahrerischer Weise möglich machen.
Ein Sich-Einlassen auf die Belastungen der Familie während man gleichzeitig eine fachlich-reflexive Distanz wahren sollte, ist ein schwieriges Unterfangen, dem sich die Frühförderin täglich aufs Neue stellen muss. Divergierende Sichtweisen und Spannungskonstellationen in der Zusammenarbeit mit den Eltern sind dabei beinahe vorprogrammiert und erfordern in weiterer Folge eine konstruktive Auseinandersetzung, um Ambivalenzen im Verstehen und Handeln aufzudecken und aufzulösen.
"Diese Spannungsmomente auszuhalten, sie bewußt zum Gegenstand der eigenen reflexiven Verarbeitung und Kontrolle, aber auch der beiderseitig unter Umständen viel psychische Energie abfordernden Interaktion und Kommunikation zu machen, dazu bedarf es einer institutionell gesicherten, wissenschaftlich fundierten Professionalität" (ebd. S 48 mit Bezug auf Thiersch 1986).
Solchen Spannungsmomenten werde ich im Folgenden nachgehen und versuchen, Lösungsansätze anzubieten. Es scheint eine Eigenart von Frühförderung zu sein, sich so sehr auf die Seite der Hoffnung und des Erfolges zu begeben, dass Schwierigkeiten oder Grenzen - auch in der Familienbegleitung - selten zur Sprache kommen und kaum thematisiert werden. Es ist für eine Frühförderin meist nicht leicht, eigene Hilflosigkeit oder Probleme vor sich selber einzugestehen. Eine Darstellung ihrer Probleme im Team der Kolleginnen fällt in der Folge noch schwerer. Weiß nennt als mögliche Grenzen für die Teamarbeit etwa "Autoritätsprobleme sowie Konkurrenz- und Leistungsängste; tradierte zum Berufsbild sozialer ‚Helfer' gehörige Vorstellungen, keine Kontakt- und Beziehungsstörungen haben zu dürfen; Angst vor Kritik und Harmonisierungstendenzen" (ebd. S 58).
Hier werde ich ganz bewusst einen anderen Weg gehen und den Blick auf die schwierigen Seiten und die spannungsreichen Momente der Frühförderung richten.
Hackenberg (2003) macht in ihren Überlegungen zum Thema Beziehung in der Frühförderung auf die Bedeutung des Erkennens und Reflektierens der teilweise unbewussten Beziehungsdynamik zwischen Eltern und Frühförderin aufmerksam. Dabei betont sie die Wichtigkeit der Erkenntnis von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen aus der Psychoanalyse. (vgl. Hackenberg 2003, S 6f)
"Wiederholungszwang und Reinszenierung: In der Psychoanalyse sind dies mittlerweile gängige Begriffe, die ein Phänomen beschreiben, das keineswegs nur für geistig Behinderte gilt. All die unbewußten Konflikte und Traumata aus unserer Kindheit provozieren wir, wenn sie durch irgend etwas aktualisiert werden, in unserer Umwelt immer wieder neu, wir reinszenieren sie. Wir übertragen unbewußte Gefühle und Sehnsüchte auf andere, und diese reagieren in der Regel ebenfalls unbewußt mit Gegenübertragung, die einen Kompromiß darstellt zwischen dem der angebotenen Szene entsprechenden Verhalten und je eigenen Verhaltensmöglichkeiten, auf welche nun wir selbst wiederum mit Gegenübertragung reagieren. Die Alternative zu diesem oft leidvollen Wiederholen wäre ein Ebenenwechsel: der gemeinsame Versuch der Interaktionspartner/innen, sich über die in solchen Inszenierungen auf Umwegen befriedigten Triebwünsche zu verständigen und daraus handelnd Alternativen zu entwickeln. Gemeinsam muß der Versuch sein, denn allein aus der Zwangsläufigkeit solcher Inszenierungen auszusteigen wird umso schwerer, je "normaler" das Immergleiche ist" (Niedecken 1998, S 27).
Für die Frühförderin ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass die Eltern mit Erfahrungen von Enttäuschung und Schmerz, zugleich aber auch mit der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Situation in die Frühförderung kommen. "Dies löst Erwartungen und Ängste aus, die an Erfahrungen in der Lebensgeschichte anknüpfen.[...] In dieser Situation emotionalen Aufgewühltseins und in der asymmetrischen Beziehungskonstellation zwischen Frühförderin und Elternteil werden emotionale Reaktionsbereitschaften und Verknüpfungen mit bedeutsamen Vorerfahrungen geweckt. Diese führen zur Übertragung von - meist unbewussten - Wünschen, Ängsten etc. auf die Frühförderin" (Hackenberg 2003, S 7).
Auch bei der Frühförderin werden durch bestimmte Aspekte der Persönlichkeit der Eltern oder der Familienkonstellation, die sie vorfindet, eigene Erfahrungen und Erlebnisse wieder wachgerufen, was ihr nicht immer bewusst ist.
Die Zusammenarbeit zwischen Frühförderin, Eltern und Kind wird von diesen Übertragungs- und Gegenübertragungsphantasien aber maßgeblich beeinflusst.
So kann die Frühförderin etwa auch auf das Kind mit bestimmten Assoziationen reagieren.
Sie identifiziert sich vielleicht mit der kindlichen Angepasstheit oder mit dem kindlichen Widerstand oder sie ist enttäuscht über die Grenzen, die ihr das Kind setzt. Sie versucht vielleicht, über die Beziehung zum Kind und über die besondere Fürsorge, die sie ihm angedeihen lässt, Verletzungen ihres eigenen inneren Kindes zu mildern. In so einem Fall ist die Frühförderin in der Interaktion mit dem Kind selber bedürftig - sie braucht die Zuneigung und Entgegnung des Kindes für sich selber. In der Folge kann sie leicht in eine Rivalität mit der Mutter kommen, die intuitiv spürt, dass die Beziehung der Frühförderin zum Kind eine besondere Qualität hat.
"Im Beziehungsdreieck Eltern-Kind-Frühförderin verkompliziert sich das System unbewusster Erwartungen, da Eltern und Frühförderin und auch das ältere Kleinkind jeweils eigene Erfahrungen mit Dreierbeziehungen in diese Situation übertragen. Das kann zu Rivalität, Ängsten vor Ausgeschlossenwerden oder Machtkämpfen führen" (ebd. S 7).
Was es braucht, um mit dieser Beziehungsdynamik umgehen zu können, ist eine differenzierte Analyse des Einzelfalls in der Supervision.
"Für die professionellen Helfer beinhaltet die Arbeit in diesem Beziehungsfeld die Aufgabe, eigene Übertragungstendenzen zu reflektieren und sich mit der eigenen Lebensgeschichte auseinander zu setzen. Dies stärkt die Fähigkeit, das Kind und seine Eltern relativ offen wahrzunehmen und ihnen genügend Raum für ihre Problematik zur Verfügung zu stellen" (ebd. S 8).
Im Folgenden möchte ich gerne auf einige Themen eingehen, die in der Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern immer wieder zu Schwierigkeiten und Spannungen führen können.
Eines der wohl schwierigsten Themen für die Frühförderin ist meiner Meinung nach der Erwartungsdruck, dem sie beinahe überall begegnet, mit dem sie umgehen und den sie aushalten können muss.
Die Erwartungen der Eltern an die Frühförderin äußern sich zunächst meist in der Anforderung, ihr Kind in seiner Entwicklung weiterzubringen und sie bei den Fördermaßnamen zu unterstützen. Die Eltern erhoffen sich, dass die Frühförderin etwas erreichen kann, was sie bisher nicht geschafft haben und wofür sie sich aber verantwortlich fühlen.
Für die Frühförderin eröffnet sich damit ein Spannungsfeld zwischen Förderung und Gewährenlassen, zwischen Verändern und So-Sein-Lassen, und es stellt sich ihr die Frage nach der "optimalen Förderung", nach dem "Besten" für das Kind.
In unserer Zeit und in unserer Gesellschaft lastet ein hoher Verantwortungsdruck für die möglichst gute Entwicklung des Kindes auf den Eltern, verbunden mit dem Machbarkeitsglauben und dem Ideal perfekter Elternschaft, die "alles" für das Kind unternimmt. "Optimale Förderung" wird so zum Gebot für die Eltern, vor allem für die Mutter.
"Der gesellschaftlich vermittelte Verblendungszusammenhang der ‚Machbarkeit' kindlicher Entwicklung drückt sich in der oft verzweifelten Suche nach not-wendigen Therapien aus. Da diese allerdings häufig nicht den erhofften Erfolg bringen, enden sie nicht selten in Ohnmachtserfahrungen" (Weiß 1993, S 26).
Eltern und Frühförderin können sich darin noch verstärken, ohne es bewusst zu wollen.
"Eltern übertragen ihre Ängste und Bedürfnisse nach wirksamer Beeinflussung der kindlichen Entwicklung auf Professionelle. Diese, ihrerseits nicht frei von ähnlichen Ängsten und Bedürfnissen, identifizieren sich mit der Not der Eltern" (ebd. S 26).
Frühförderinnen können so leicht zu den "Erfüllungsgehilfinnen" der Eltern im Kampf gegen die Behinderung werden, und es kann ein Kreislauf von Förderdruck und Ohnmachtserfahrungen entstehen, wenn solche Identifikationsprozesse und Koalitionsbildungen zwischen Eltern und Frühförderin nicht bewusst werden und zur Sprache kommen. Für die Eltern ist es besonders schwer, aus diesem Förderdruck auszusteigen, da für sie eine Drohung immer im Raum hängt:
"Abklärungen nicht zu veranlassen, Therapien nicht durchzuführen, erscheint belegt von der Drohung, für das Kind nicht das Beste getan, ihm vielleicht sogar Schaden zugefügt zu haben" (ebd. S 27).
Den Eltern geht es also vordergründig um die Förderung ihres Kindes. Ihre eigene Situation ist jedoch von Beginn an in der Frühförderung präsent und für die Frühförderin spürbar - wie etwa in den Anforderungen, die an sie gestellt werden.
"Auch wenn Frühförderung in ihrer Eingangsphase - beispielweise im Erstgespräch, in der Anamnese - das Befinden und die emotionale Situation der Eltern bewusst aufnimmt und sich dafür interessiert, ist für die Eltern die Frage, wie es ihnen geht, vielfach noch unlösbar verbunden mit der Frage, wie es ihrem Kind geht, und sie können deshalb sehr darauf bestehen: ‚Es geht nicht um mich, es geht um mein Kind!'" (Thurmair/Naggl 2000, S 112).
Im Folgenden werde ich mich auf die Ausführungen von Thurmair und Naggl (2000, S 112ff) beziehen und dabei meine eigenen Erfahrungen und Gedanken einfließen lassen.
Frühförderung versucht, auf die Erwartungen der Eltern einzugehen und sie in ihrem Förderdruck zu entlasten, indem die Frühförderin ein Stück weit Verantwortung für die weitere Entwicklung des Kindes mit übernimmt und ihr fachliches Wissen einbringt. Die Frühförderin nimmt die Hoffnungen der Eltern auf, setzt sie womöglich in einem Förderplan um und geht so ein Stück weit mit den Eltern mit.
Es kann sein, dass sich die Wahrnehmung der Eltern im Frühförderprozess verändert und sie ihr Kind im Laufe der Begleitung durch die Frühförderin besser in seinen Fähigkeiten und Schwächen sehen können und seine Fortschritte bemerken. Damit kann gleichzeitig ein allmählich realistischeres Bild von der Behinderung oder den Schwächen des Kindes, aber auch von seinen Fähigkeiten, entstehen. Die wöchentliche Frühfördereinheit kann so immer wieder ein Anstoß für die Eltern sein, sich mit der Behinderung bzw. Entwicklungsauffälligkeit des Kindes auseinander zu setzen.
"Gerade im Miterleben der Förderung, wenn eine andere Person mit ihrem Kind spielt oder lernt, wollen Eltern oft für sich die Realität des Erlebens der Behinderung an einer anderen Person überprüfen und Resonanz für ihr Erleben finden" (Thurmair/Naggl 2000, S 113).
Es liegt demnach eine große Chance in der Anwesenheit der Eltern während der Tätigkeit der Frühförderin. Ein innerer Prozess der Annäherung an das Kind kann dadurch angeregt und letztendlich die Interaktion zwischen Kind und Eltern in neue Bahnen gelenkt werden.
Andererseits kann diese Auseinandersetzung bei den Eltern auch heftige Gefühle auslösen, die sie unter Umständen "stellvertretend" mit der Frühförderin austragen, "auf dem Feld der Förderung, als Kampf um mehr, oder um richtige Therapie" (ebd. S 114/115); wobei es für mich wichtig ist, berechtigte Kritik der Eltern ernst zu nehmen und nicht auf ihre ungenügende Annahme des Kindes zu schieben.
Thurmair und Naggl sind der Meinung, dass Störungen im Förderprozess entstehen, wenn das Thema der Behinderung unausgesprochen oder ausgesprochen auftaucht.
"Störungen im Förderprozess können ganz verschiedene Formen annehmen: Häufig ist Druck ein Signal für einen sich anbahnenden Konflikt um das Thema der Behinderung. Die Frühförderin bemerkt, wie sie selbst immer mehr unter Druck gerät, oder sie bemerkt, wie die Eltern unter Leistungsdruck stehen. Ja, es kann die Situation entstehen, dass beide Seiten sich wechselseitig unter Druck gesetzt fühlen" (ebd. S 115).
Als Sabines Schuleintritt näher rückte, vereinbarte ich das den Eltern versprochene Gespräch mit dem zukünftigen Lehrer. Während dieses Gespräches geschah etwas, das mir in meiner Arbeit öfter passiert ist. Angesichts der Fragen des Lehrers zu Sabines Entwicklungsstand und zu meiner Arbeit veränderte sich mein Blickwinkel. Ich sah Sabine plötzlich nicht mehr mit den Augen der Entwicklungsbegleiterin, die viele Fortschritte bei ihr wahrnahm und sich über die Anzeichen einer Entwicklung hin zu mehr Selbständigkeit und Autonomie freute, sondern ich sah sie mit den Augen der schulischen Norm, von der sie tatsächlich noch weit entfernt war. Der Kontakt mit dem Lehrer konfrontierte mich plötzlich wieder mit den gesellschaftlichen Maßstäben, die während meiner Arbeit im doch eingegrenzten Feld der Familie an Bedeutung verloren hatten. Aus dieser Sicht kamen in mir jetzt doch Zweifel auf, ob Sabine den Schuleintritt schaffen würde, ohne dabei als "Integrationskind" von einem Stützlehrer begleitet zu werden. Der Lehrer sagte ganz klar, dass er nicht die Zeit haben werde, sich eingehend um Sabines Förderung zu bemühen. Er fragte, ob ich nicht dahingehend auf die Eltern einwirken könne, dass sie sich für Sabine nach einer zusätzlichen außerschulischen Förderung umsahen. Plötzlich mit der schulischen Wirklichkeit konfrontiert, erschien auch mir das wichtig, und so ging ich zurück in die Familie, wo ich mich gezwungen sah, meine Aussagen über die positive Entwicklung von Sabine dahingehend zu revidieren, dass die Schule an sie wohl doch Anforderungen stellen könnte, bei denen sie noch Unterstützung braucht. Nachdem ich das vergangene Jahr mit den Eltern daraufhin gearbeitet hatte, Sabine auf die Schule vorzubereiten, musste ich mir und den Eltern eingestehen, dass das Ziel der normgerechten Schulreife nicht in Reichweite lag.
In dieser Situation gab ich meinen eigenen empfundenen Druck von Seite der Schule an die Eltern weiter, indem ich ihnen eine Weiterführung der Fördermaßnahmen auch begleitend zur Schule nahe legte. Ich spürte wie dieser Anspruch die Atmosphäre zwischen uns veränderte, und die Eltern wieder unter Druck kamen, mehr für ihr Kind zu tun. Es gelang mir später zwar, diesen Druck abzuschwächen und die Entscheidung über weiter Fördermaßnahmen beruhigt in die Hände der Eltern zu legen, aber in der ersten Zeit nach dem Gespräch mit dem Lehrer war dieses altbekannte Gefühl von: "Da muss ich jetzt unbedingt sofort etwas tun - da muss jetzt etwas geschehen!" wieder sehr stark in Erscheinung getreten und hatte einen Kreislauf von gegenseitigem Druck in Gang gebracht - nicht zuletzt auch deshalb, weil die Fragen des Lehrers für mich auch die ebenso bekannte Frage danach, ob ich wohl genug für Sabines Förderung unternommen hatte, in den Raum stellten.
Gerade Stagnationen im Förderprozess oder nicht erreichte Förderziele, Rückschritte in der Entwicklung oder der nahende Schuleintritt des Kindes können Anlass für Spannungen zwischen Frühförderin und Eltern sein und die Eltern offen oder verdeckt an der Kompetenz der Frühförderin zweifeln lassen.
Spannungen können aber auch in der Fördersituation selber entstehen, wenn etwa die Mutter mit Argusaugen über den Handlungen der Frühförderin wacht, wenn sie das Kind zurechtweist und es unter Druck setzt, "richtig" mitzumachen, oder wenn die Mutter pausenlos redet und damit die Aktivität des Kindes stört. Die Frühförderin kann Spannungen beispielweise daran bemerken, dass sie sich wünscht, die Mutter wäre nicht anwesend.
Die Ursache von Konflikten liegt häufig in Differenzen über das richtige Bild vom Kind. Es kann sein, dass die Einschätzungen von Frühförderin und Eltern dabei weit auseinandergehen. Entweder sehen die Eltern das Kind zu positiv und empfinden alles nicht so schlimm, oder sie sind sehr leistungsorientiert, während die Frühförderin in ihren Angeboten bei einem niedrigeren Entwicklungsniveau ansetzt.
"Störungen sind oft auch an Äußerlichkeiten zu erkennen: Unpünktlichkeit, vergessene Termine, vergessene Absprachen, häufige Absagen aus guten und weniger guten Gründen; die Mutter hat während der Stunde etwas unaufschiebbar Wichtiges zu tun; das Kind wird statt von der Mutter von der Oma, Tante, ... begleitet" (ebd. S 116).
Wenn man als Frühförderin ein ungutes Gefühl hat, ist das meistens ein Hinwies auf eine kritische Entwicklung zwischen Frühförderin und Eltern. Es ist dann notwendig, einen Blick auf die Hintergründe zu werfen und die eigene Wahrnehmung den Eltern gegenüber anzusprechen, um zu klären, was passiert ist.
Es kann sein, dass sich die Hoffnungen der Eltern nicht erfüllt haben und sie sich an einem solchen Punkt nicht mehr im Gleichklang mit der Arbeitsweise der Frühförderin bewegen.
"Doch das, was die Eltern sich von der Frühförderin, der Frühförderung generell erhoffen, kann sie nicht erfüllen" (ebd. S 117).
An diesem Punkt kann sich die Resignation und die Enttäuschung der Eltern bemerkbar machen und ihr Auseinandersetzungsprozess für die Frühförderin offensichtlich und erlebbar werden.
"Sobald der Therapeut die Anwesenheit der Mutter als Störung empfindet, ist er im Grunde diesen Spannungen, die das Leiden der Eltern ausdrücken, begegnet. Er ist mit einem gefühlsmäßigen Ausdruck ihrer Not konfrontiert" (Spörri 1985, S 63 in Thurmair/Naggl 2000, S 118).
Wie die Frühförderin auf solche Spannungen reagiert, hängt davon ab, wie es ihr gelingt, den Hintergrund für die Schwierigkeiten zu erkennen und in die Kommunikation oder Interaktion mit den Eltern einzubringen.
Wenn sie die gespannte Atmosphäre und ihre Gefühle und Gedanken dazu nicht anspricht, kann es sein, dass sie noch mehr Kraft und Aktivität aufwendet, um das Kind "gut" zu fördern. Es kann sein, dass sie die Mutter aus dem Geschehen mit dem Kind ausschließt. Es kann sein, dass sie in ihren Aussagen zur kindlichen Entwicklung beschönigt und verharmlost, um die Eltern nicht mit ihrem Schmerz zu konfrontieren. Es kann sein, dass sie die Ansprüche der Eltern abwehrt, indem sie den Eltern vorwirft, die Tatsache der Behinderung des Kindes noch nicht angenommen zu haben.
Ein Ausstieg aus dem Förderdruck ist erst möglich, wenn die Frühförderin die Störung ernst nehmen und als Signal für die Not der Eltern auffassen kann.
In einem ersten Schritt geht es dann darum, die eigene Position im Verhältnis zu den Eltern zu klären. Die Frühförderin muss sich eingestehen, dass sie die Erwartungen der Eltern an dieser Stelle nicht erfüllen kann, dass ihre Bemühungen Grenzen haben und sie auch manchmal hilflos ist. Dies ist besonders schwierig, "denn nicht zuletzt das Machbarkeitsversprechen der Frühförderung und die Helfermotivation der Personen, die in ihr arbeiten, stehen dem entgegen" (ebd. S 122).
Die Frühförderin muss den Eltern gegenüber ansprechen, dass ihr Können Grenzen hat, auch wenn dies das Angebot inkludiert, sich woanders hinzuwenden. Mit dem Eingeständnis ihrer eigenen Hilflosigkeit setzt sich die Frühförderin aber auch der Enttäuschung und den womöglich bei den Eltern auftauchenden Gefühlen von Trauer und Wut aus. Sie muss den Schmerz der Eltern in so einem Fall aushalten können.
"So entstehen negative Gefühle in unserem Beruf häufig dann, wenn wir ein falsches Verständnis von unseren Aufgaben und Möglichkeiten haben, uns unter Leistungsdruck setzen und glauben, Entwicklungsförderung wie in einer Reparaturwerkstatt betreiben zu können. Erst wenn wir unsere Grenzen anerkennen, unser Nicht-Antworten-Können eingestehen und aushalten, uns zurücknehmen und dadurch unserem Gegenüber Raum lassen, sich zu äußern, kann Entwicklung geschehen" (Finger/Steinebach 1992, S 38).
Das Aushalten und Mittragen der Gefühle der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil der Begleitung, eine schwierige, wenn nicht sogar unmögliche Aufgabe.
"Begleiten bedeutet, die Eltern nicht allein zu lassen, ihre Gefühle respektvoll zu akzeptieren, und mit ihnen mitzufühlen. Begleiten bedarf einer Haltung, wie wir sie aus dem psychotherapeutisch orientierten Gespräch kennen: eigene und fremde Gefühle wahrnehmen, akzeptieren und Empathie zeigen, aber keine ‚Hilfsangebote' machen" (Thurmair/Naggl 2000, S 123).
Das Konfrontiertwerden mit all den schmerzlichen Gefühlen rund um die Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit löst beim Helfer oft Gefühle von Schmerz, Wut und Schuld aus. Häufig entwickelt der Helfer dagegen auch Schutzmechanismen, die für die Eltern in der Weise spürbar werden, dass sie sich mit ihren eigenen Empfindungen alleine gelassen fühlen.
Um sich mit der ganzen Realität ihrer Arbeitssituation auseinandersetzen zu können und um mit ihrer Angst und Hilflosigkeit nicht alleingelassen zu werden, braucht die Frühförderin stützende Strukturen innerhalb der Einrichtung, in der sie arbeitet: klare Richtlinien und Rahmenbedingungen, theoretischen Leitlinien, das Angebot der fallbezogenen Supervision und ein Team, das ihr Vertrauen besitzt und den Austausch mit Kolleginnen ermöglicht.
Die Frühförderin muss wissen, dass sich die Eltern in einer schwierigen Situation befinden, die sie auch durch noch so viel Einsatz nicht wieder gut machen kann, und dass sie den Eltern ihre Gefühle nicht abnehmen oder für sie lösen kann. Sie darf hier weder dem überzogenen Förderbedürfnis einfach nachgeben, wenn es fachlich nicht vertretbar ist, noch darf sie versuchen, die Eltern pseudoberaterisch von ihren Gefühlen zu befreien. Begleiten heißt manchmal auch einfach: da sein.
Die Frühförderin muss zwischen den Zeilen des von den Eltern Gesagten lesen bzw. auch ihre nonverbalen Ausdrucksweisen wahrnehmen können. Sie braucht die Fähigkeit, hinter das zu schauen, was sich abspielt oder sich in den Interaktionen zeigt.
Sie braucht einerseits fachliches Wissen über die kindliche Entwicklung, über Förderungsmöglichkeiten und Therapien, Beratung, Psychotherapie etc, um entscheiden zu können, was hilfreich ist, und Entlastung in dem Wissen, sich an kompetente Kolleginnen wenden zu können. Andererseits muss sie sich aber auch selber sagen können, dass sie gute Arbeit leistet, oder das hin und wieder von ihren Kolleginnen oder in der Supervision hören.
"Die Infragestellung der Kompetenz der Frühförderin seitens der Eltern, der sie mit dem Eingeständnis, dass sie die Erwartungen der Eltern nicht erfüllen kann, geradezu die Tür geöffnet hat, kann leicht auch eigene Zweifel wecken, ob man wirklich fachlich gut genug ist, ob man nicht doch noch die Zusatzausbildung in XY... hätte erwerben sollen" (ebd. S 125).
Der Zweifel der Eltern an der eigenen fachlichen Kompetenz kann die Frühförderin gerade dann persönlich kränken, wenn sie sich sehr bemüht und engagiert hat. Fühlt sich die Frühförderin dadurch aber persönlich angegriffen, hat sie vielleicht vorher schon eine Grenze überschritten bzw. ist über ihre Grenzen gegangen. Ein bei der Frühförderin entstandenes Wertlosigkeitsgefühl kann in der Folge einen negativen Grundton in der emotionalen Arbeitshaltung erzeugen.
Ich persönlich glaube, dass es nicht einfach damit getan ist, den Eltern gegenüber seine Hilflosigkeit bzw. Grenzen einzugestehen. Damit ist die Gefahr sehr groß, dass die Eltern die Frühförderung abbrechen, ohne sich mit ihren eigenen Anteilen am Förderdruck auseinandersetzen zu können. Es wäre gut, mit ihnen über ihre Beweggründe zu sprechen, über die aufkommenden Ängste und ihren Schmerz. Die Frühförderin müsste sie in ihrem Wunsch nach mehr Förderung ernst nehmen, sich aber gleichzeitig davon distanzieren und die Eltern mit ihrem eigenen Anspruch konfrontieren.
Die Frühförderin hatte Daniel bereits zwei Jahre hindurch betreut, als der Schuleintritt näher rückte und es sich für sie abzeichnete, dass sich einige der gemeinsam mit der Mutter vorgenommenen Ziele in der Entwicklung des Kindes wohl nicht mehr bis zu diesem Zeitpunkt erreichen lassen würden. Sie versuchte, dies der Mutter gegenüber sehr behutsam anzusprechen, kam aber nicht sehr weit, da die Mutter diesen Bemühungen konsequent auswich. Einige Monate vor Schulbeginn schließlich überraschte die Mutter die Frühförderin damit, dass sie bei einem Kinesiologen gewesen sei, der ihr endlich erklärt habe, welche Ursachen Daniels Entwicklungsrückstand habe und der mit Daniel nun in regelmäßigen Abständen arbeiten wolle. Nach Meinung dieses Fachmanns könne man Daniels Probleme in etwa zehn Sitzungen (also noch vor dem Schuleintritt) lösen. Kurz darauf äußerte die Mutter dann, dass sie die Frühförderung gerne beenden möchte, da sie nun doch schon zwei Jahre andauere und Daniel alles zu viel werden könnte.
Ich erlebte mit, wie schwer es für die Frühförderin war, diesen Entschluss der Mutter hinzunehmen, ohne selber von großen Schuldgefühlen gepeinigt zu werden. Sie haderte mit sich und stellte ihre Arbeit in Frage, wohl wissend, dass sie die Mutter mit ihrer Wahrnehmung von Daniels Entwicklung in ihren Hoffnungen enttäuscht hatte und nun die Konsequenzen tragen musste.
Es ist für die Frühförderin wichtig zu wissen, dass die Eltern in einer anderen Situation stehen und somit oft andere Motivationen haben, andere Bedürfnisse und andere Entscheidungskriterien. Sie muss wissen, dass Spannungen nicht unbedingt auf ihr eigenes Versagen zurückzuführen sind, sondern aus der Situation heraus entstehen können.
Es kann ihr helfen, selber bereits aus dem Förderdruck ausgestiegen zu sein und sich mit der eigenen Hilflosigkeit bekannt gemacht zu haben.
"Die Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Resignation und vielleicht auch Verzweiflung bei den Eltern kann ich besser aushalten, wenn ich vor meinen eigenen nicht flüchten muss, die ja immer mit angesprochen werden" (ebd. S 126)
Dabei spielt die eigenen Einstellung der Frühförderin zur Behinderung eine große Rolle.
"Wenn ablehnende Gefühle gegenüber der Behinderung etwas Verbotenes sind, dann werde ich sie bei mir selber nicht wahrnehmen, dafür aber umso schärfer bei den Eltern" (ebd. S 126).
Für die Frühförderin können die Erwartungen der Eltern bedrohlich sein, weil sie sich ihr gegenüber ja als Anforderungen äußern. Damit sie die Wünsche der Eltern aus dieser Angst heraus nicht abwehren muss und um sich zu entlasten, sollte ihr bewusst sein:
"Die Eltern dürfen etwas von mir wollen, und ich muss es nicht tun, und ich muss mich trotzdem nicht schlecht fühlen. Ich kann zulassen, dass die Eltern enttäuscht von mir sind. Dazu gehört viel Großzügigkeit, statt der Anerkennung für gute Förderung gelegentlich das Gegenteil davon zu akzeptieren" (ebd. S 126).
Die Frühförderin braucht also viel Gelassenheit, Mut, Ausdauer, Geduld und inneren Halt.
Sie muss eine "angreifbare" Persönlichkeit sein. Unter "angreifbar" verstehe ich, dass sie sich von den Eltern anfragen lassen muss, damit sich die Eltern an ihrer Haltung orientieren, aber auch reiben und ausrichten können. Sie muss fähig sein, für die Eltern ein Gegenüber zu sein, das ihnen Mitgefühl, Verständnis und Anerkennung vermittelt, sich gleichzeitig aber auch klar positioniert und trotzdem auf ihre Nöte und Wünsche eingeht.
Dazu muss die Frühförderin aber selber festen Boden unter den Füssen haben, was für mich bedeutet, dass sie in sich selber und in der Struktur, in die sie an der Frühförderstelle eingebettet ist, Halt, Schutz und Raum haben muss. Sie muss sich in sich selber ebenso wie im Team ihrer Kolleginnen aufgehoben und angenommen fühlen und muss sich selber ebenso Anerkennung entgegenbringen können, wie sie Wertschätzung durch die Institution erfahren sollte, um nicht von der Wertschätzung und vom Lob der Familie abhängig zu sein.
Ich denke, dass es fatale Auswirkungen haben kann, wenn die Frühförderin aus der Motivation heraus in der Familie arbeitet, sich gebraucht und geliebt zu fühlen. In so einem Fall kann es sein, dass sie die wahren Bedürfnisse der Familie gar nicht hören, sehen oder spüren kann, weil sie im Grunde ein eigenes Ziel verfolgt, das über dem Wohl der Familie und des Kindes steht.
"Gefühle, die wir wahrnehmen dürfen, aussprechen dürfen, teils erklären können, beeinträchtigen uns nicht in unserer Kommunikation" (Finger/Steinebach 1992, S 39).
Die Frühförderin muss "ambivalenzfähig" sein, d. h. sie muss mit den Widersprüchlichkeiten umgehen können, die die Situation der Familie an sich prägen und die Situation einer in der Familie arbeitenden Frühförderin mit sich bringt.
Der Frühförderberuf wird gemeinhin in Verbindung gebracht mit Nächstenliebe, Zuhören, Helfen und Unterstützen. Immer aber bin ich auch als Frühförderin nicht verständnisvoll und aufnahmebereit, manchmal interpretiere ich etwas falsch bzw. eben auf meiner Folie von Wissen und Erfahrung, und manchmal wehre ich auch Ansprüche oder negative Gefühle ab.
Manchmal kenne ich keinen Weg, weiß keinen Rat und kann nur aushalten, die Verzweiflung mit ansehen und trotzdem da sein. (vgl. ebd. S 38)
"Dies bedeutet für mich, ihre [der Eltern; C. K.-S.] Fragen auszuhalten, ihnen viel Raum zu geben und sie nicht durch eine schnelle Antwort von mir verstummen zu lassen" (ebd. S 38).
Die Rolle der Frühförderin in diesem pädagogischen Dreieck zwischen einem Elternteil, meist der Mutter, und dem Kind, kann je nach ihrer Arbeitsweise oder dem dahinterliegenden pädagogischen Konzept eine jeweils ganz andere sein.
Es kann sein, dass die Frühförderin mit dem Kind arbeitet und die Mutter als beobachtende Teilnehmerin dabei ist. Es kann sein, dass die Frühförderin die Rahmenhandlung vorgibt, die Mutter selber aktiv und gestaltend daran teilnimmt und sich mit der Frühförderin in ihrem Tun mit dem Kind abwechselt. Es kann aber auch sein, dass die Frühförderin nur als beobachtende Teilnehmerin anwesend ist und mit der Mutter im Anschluss an die Fördereinheit ihre Beobachtungen bespricht, dass die Frühförderin also eine supervisorische Haltung einnimmt und Mutter und Kind in deren Aktivitäten begleitet.
Es gibt meiner Meinung nach auch Situationen oder Phasen, wo es gut sein kann, wenn die Frühförderin alleine mit dem Kind arbeitet. Dann müssen aber regelmäßig ausführliche Gespräche mit den Eltern stattfinden, um diesen einen Einblick in das Geschehen während der Frühförderung zu gewähren.
Für die Mutter ist es unter Umständen nicht leicht, ihr Kind jemand anderem zu überlassen bzw. in eine Interaktion zu dritt einzusteigen, besonders dann, wenn ihre Beziehung zum Kind eine sehr symbiotische ist, und es bis jetzt hauptsächlich sie war, die das Kind versorgt hat.
Mannoni hat die Rolle der Therapeutin in der Arbeit mit schwer geistig behinderten Kindern genauer unter die Lupe genommen. Auch wenn nicht alles davon auf die Frühförderung übertragbar ist, möchte ich ihre Beispiele doch anführen, weil zumindest Ähnlichkeiten auch in Frühförderkonstellationen zu finden sind.
Was geschieht also, wenn eine Betreuerin, eine Therapeutin oder eine Frühförderin in die Beziehung zwischen Mutter und Kind eintritt bzw. die Aufgabe übernimmt, beide zu begleiten? Wie mag die Mutter das Eingreifen der Fachperson empfinden?
Mannoni gibt uns Beispiele aus ihrer therapeutischen Erfahrung und beschreibt ihre erlebten Empfindungen. "Von daher wird der weibliche Analytiker unmittelbar in die Netze der Mutter verstrickt sein. Denn die Mutter vertraut ihr Kind allenfalls jemandem an, um sich und uns zu beweisen, daß niemand außer ihr selbst der Situation gewachsen ist" (Mannoni 1972, S 55). Es ist für die Mutter wichtig, an ihre mütterliche Allmacht zu glauben, um mit dem "Schicksalsschlag" fertig zu werden. Diese Überzeugung von Allmacht bringt sie aber auch der "Expertin" entgegen. Mannoni meint: "In der Mutter begegnet der Analytikerin, wie in ihrer eigenen frühen Kindheit, die mütterliche Allmacht" (ebd. S 56).
Für viele Mütter ist es sehr schwierig, ihr Kind einer Therapeutin zu überlassen, ohne dabei selber anwesend zu sein. Lange Zeit waren sie ja die einzig Zuständigen, diejenigen, die ihr Kind am besten kannten, und nun sollen sie darauf vertrauen, dass eine andere - womöglich eine junge Frühförderin, die selber noch keine Kinder hat - plötzlich auch weiß, wie sie mit dem Kind umgehen soll.
"Wenn man dem Kind verbietet, Sachen kaputt zu machen, setzt man sich einem Geheul aus, das nicht nur den Analytiker treffen, sondern vor allem die wartende und horchende Mutter auf den Plan rufen soll" (ebd. S 55).
Annas Mutter erklärte mir zu Beginn der Frühförderung sehr klar, dass sie während der Einheit mit ihrem Kind nicht dabei sein wolle. Sie machte einen sehr überanstrengten, fast überforderten Eindruck und sagte, dass sie die Zeit gerne für sich selber nutzen wolle. Trotzdem aber war sie immer zur Stelle, wenn Annas Laute aus dem Wohnzimmer drangen, in dem wir gemeinsam arbeiteten. Andererseits wusste auch Anna, dass es genügte, wenn sie sich gegen meine Anforderungen lautstark wehrte, um die besorgte Mutter herbeizurufen.
Es gibt unterschiedliche Arten, wie Mütter es die Frühförderin spüren lassen, dass sie sich durch ihre Anwesenheit verunsichert, wenn nicht sogar in ihrer eigenen Kompetenz angegriffen fühlen. "Befaßt man sich mit der Unfähigkeit des Kindes, so rührt man an die Existenznot der Mutter und provoziert Reaktionen, die sich mangels symbolischer Vermittlung offen in der Realität äußern müssen" (ebd. S 59).
Christoph war erst als knapp Fünfjähriger in den Kindergarten aufgenommen worden. Dort fiel der Kindergärtnerin ein großer Entwicklungsrückstand auf, und sie empfahl der Mutter Frühförderung. Diese konnte einfach nicht begreifen, warum mit ihrem Kind jetzt plötzlich etwas nicht mehr stimmen sollte, wo ihr doch selber nie etwas Besonderes aufgefallen war. Immer wieder erzählte sie mir von ihrem Bruder, der sich als Kind ähnlich entwickelt hatte wie jetzt ihr Sohn und aus dem doch auch etwas geworden war. Die Frühfördereinheiten verliefen nach kurzer Zeit jeweils so, dass die Mutter regelmäßig während meiner Anwesenheit im angrenzenden Wohnzimmer auf der Couch einschlief. Irgendwie wirkte sich das auch auf meine persönliche Einschätzung von meiner Arbeit als sehr langweilig und im Grunde völlig unnötig aus.
Für Mannoni spielt die Angst in Behandlungsprozessen eine große Rolle. Es kann schon während einer Therapie des Kindes in der Familie die Angst vor den Konsequenzen einer Veränderung beim Kind entstehen. Auch ein erwünschter Behandlungserfolg kann die Familienmitglieder vor die Frage stellen, wie sie selber ihre Rollen verändern müssen.
"Man vergißt nur zu oft, daß man mit der Behinderung eines Kindes an das rührt, was bereits vor seiner Geburt als pathogener Keim da war. Verändert man die Umweltbeziehung des Patienten, so stößt man unweigerlich mit den Erwachsenen zusammen, die gerade durch ihre eigenen Schwierigkeiten diese Art gestörter Beziehung beim Kind geschaffen haben. Es ist unerläßlich, daß die Erwachsenen die Genesung ihres Kindes akzeptieren lernen, eines Kindes, das mit seiner Krankheit die Wunde der Eltern verdeckt hatte" (ebd. S 81).
Es kann auch die Angst der Mutter sein, die sich in den Symptomen des Kindes zeigt. Die Mutter kann ihr Kind dazu verwenden, ihre eigene Angst oder eigene Probleme nicht eingestehen zu müssen. Andererseits ist es für das Kind oft die einzige Möglichkeit, in Beziehung zu kommen, indem es beim Anderen Angst auslöst.
Die Therapeutin kann diese Angst nicht umgehen, sie muss sich ihr stellen, was bedeutet, dass sie sich von der Angst der Mutter, der Familie, des Kindes treffen und berühren lassen und sich damit auseinandersetzen muss. Mannoni meint, dass sich die Therapeutin mit den Eltern bzw. mit der Art ihrer Beziehungen auseinandersetzen muss, die ihre eigenen Abwehrmechanismen mobilisiert.
"In allen Fällen funktioniert das Kind als phantastisches Objekt, das die Eltern vor der Enthüllung des Kerns ihrer Neurose schützt. Wenn man ihnen den Gegenstand der Beschwerde, das kranke Kind, wegnimmt, rührt man an die Abwehr der Eltern und konfrontiert sie mit dem Unerträglichen [...]" (ebd. S 89).
Die Frühförderin ist zwar in den meisten Fällen keine Psychotherapeutin, aber sie muss das Familiengeschehen in seiner Bedeutung für die Entwicklung des Kindes erfassen können und dabei auch ihre eigene Rolle im Familiensystem erkennen und reflektieren können. Sie muss sehen, beobachten und erkennen, darf aber nicht direktiv verändernd eingreifen, sondern nur beratend begleiten.
In der pädagogischen Dreieckssituation zwischen Frühförderin, Mutter und Kind können sich interaktionelle und kommunikative Schwierigkeiten zwischen allen Beteiligten ergeben bzw. sichtbar werden.
Eine besonders große Gefahr stellt die unter Umständen entstehende Rivalität zwischen der Frühförderin und der Mutter um die Stellung der "besseren" Mutter dar.
"Auf der Basis der strukturellen Bedingungen in dieser Dreiecks-Konstellation tragen vermutlich auch die Lebenssituation der Mutter, biographische Hintergründe und die Art der Mutter-Kind-Beziehung zu einer etwaigen Brisanz bei. Eine Frau mit lebenssituations- und lebensgeschichtlich bedingten Belastungen in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwertgefühl oder mit einem gespannten bis brüchigen Verhältnis zu ihrem Kind dürfte eine intensive und unbefangene Beziehung der Frühbetreuerin zu ihm als bedrohlich für ihr eigenes mütterliches Selbstverständnis empfinden, wenn sie diese als die quasi ‚bessere Mutter' erlebt" ( Weiß 1989, S 57).
Für eine Frühförderin ist es deshalb nach Finger/Steinebach (1992) wichtig, der Mutter auch zu vermitteln, dass die Spielsituation zwischen Kind und Frühförderin eine andere ist als die Situation zwischen Mutter und Kind: durch den fachlichen Hintergrund, das ansprechende Material, die Konzentration der Frühförderin auf das Kind, aber auch durch die zeitliche Begrenzung der Fördereinheit und die fehlende Betroffenheit - die Behinderung des Kindes trifft die Frühförderin ja nicht in ihrem Selbstwertgefühl. Diese Ausnahmesituation ist mit dem täglichen Einsatz der Eltern für ihr Kind keinesfalls zu vergleichen.
"Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, wenn die Eltern uns mit dem Kind beobachten. Jeder von uns hat seine eigene Beziehung zu dem Kind, doch jeder kann den anderen an seiner Beziehung teilhaben lassen. [...] So werden Therapeut und Eltern sich wechselseitig zum Modell, und jeder kann durch das Teilhaben an der Beziehung des anderen zum Kind seine eigene Beziehung verändern und erweitern" (Finger/Steinebach 1992, S 36).
Weiß schlägt vor, dass sich die Frühförderin in ihrer Aktivität mit dem Kind zurückhalten sollte, um einer möglichen Konkurrenzsituation mit der Mutter auszuweichen.
Das hat nicht nur Folgen für die berufliche Identität der Frühförderin, die sich ja durch die Entwicklungsauffälligkeit des Kindes in besonderer Weise zur Aktivität aufgerufen fühlt. Die Frühförderin entspricht damit auch nicht den Erwartungen der Eltern, die sich von ihr gerade konkretes fachliches Handeln wünschen. "Das dürfte es Fachleuten zumindest erschweren, sich in der Fördersituation zurückzuhalten" (Weiß 1989, S 58).
Ich bezweifle, dass es die Lösung der Probleme darstellt, wenn sich die Frühförderin in ihrem persönlichem Engagement dem Kind gegenüber zurücknimmt. Denn andererseits ist es für das Kind und die Entfaltung seiner Eigentätigkeit und Autonomie auch wichtig, dass es eine tragfähige Beziehung zur Frühförderin aufbaut und somit in ihr eine "sichere Basis" im Sinne von Bowlbys Bindungstheorie findet. Gerade wenn die Frühförderin dem Kind eine vorbereitete Umgebung bieten will, innerhalb der es selber Handlungen setzen kann und es in seiner Aktivität "nur" begleiten will, muss das Kind sich seiner Beziehung zu ihr sicher sein.
Ich sehe den wesentlichen Aspekt in dem, was Weiß hier anspricht:
"Es käme darauf an, daß sich der Frühbetreuer der Beweggründe und Implikationen seines Verhältnisses von ‚Nähe und Distanz' in der Beziehung zu Kindern und Erwachsenen, z.B. des Grades seines Angewiesenseins auf Bestätigung von Zuneigung insbesondere durch Kinder, mit denen er arbeitet, stärker bewußt zu werden versucht, und zwar durch Reflexion und Selbsterfahrung, etwa im Rahmen einer fundierten fachlich-persönlichen Begleitung und Supervision" (ebd. S 58).
Die Frühförderin darf also nichts für sich brauchen in der Beziehung zum Kind. Die Erfüllung und Zufriedenheit, die sie aus ihrer Tätigkeit gewinnt, muss demnach etwas sein, das sich im Tun einstellt und nicht etwas, das sie von vornherein anstrebt.
Das Ziel ihrer Arbeit sollte ja die Absicherung und Stabilisierung der Beziehung des Kindes zu seinen Eltern sein und nicht die möglichst gute Beziehung des Kindes zur Frühförderin.
Weiß plädiert in diesem Zusammenhang für eine verstärkte Beachtung von ganzheitlich orientierten, interaktionistischen Entwicklungsansätzen, die es zum Ziel haben, "innerhalb des familiären Alltags und der individuellen Mutter-Kind-Beziehung für beide interessante und relevante Interaktionssituationen ausfindig und der Mutter zugänglich zu machen" (ebd. S 59). Dabei sollte die Tätigkeit der Frühförderin darin bestehen, "sich in das (Spiel)Handeln zwischen Mutter und Kind einzulassen und in vorsichtiger Zurückhaltung durch eigene Impulse diese Interaktion zu stabilisieren und bereichern" (ebd. S 59).
Ein solches Arbeiten ist aber nur möglich, wenn es nicht zu viele Spannungen zwischen Mutter und Frühförderin gibt, wenn ihre Vorstellungen von Förderung nicht zu weit auseinander klaffen und nicht zu große Leistungsorientierungen ein autonomes Handeln des Kindes verunmöglichen. Auch wenn es wichtig ist, den Eltern in ihrem Bedürfnis nach Förderung und Leistung entgegenzukommen, muss die Frühförderin offen legen, wie sie selber arbeitet und warum sie wie vorgeht. Dies setzt wiederum voraus, dass aufkommende Spannungen nicht durch Harmonisierungstendenzen verdeckt werden, sondern dass die Frühförderin sie wahrnimmt und aushält, in einem nächsten Schritt versucht, zu verstehen, was die Spannungen ausmacht, und sie in die Kommunikation mit den Eltern bewusst einbringt.
Die Fördersituation zwischen Mutter, Kind und Frühförderin kann vor allem dann problemträchtig werden, wenn sehr unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse einander gegenüberstehen. Unbearbeitet können diese die Beziehungen stark belasten und die Förderung des Kindes gefährden.
Weiß schlägt für solche Situationen ein sogenanntes "Verständigungshandeln" bzw. "Verständigungsgespräche" vor. (vgl. ebd. S 62ff)
In Verständigungsgesprächen geht es darum, "die jeweiligen Interessen, Bedürfnisse und Gefühle im Zusammenhang mit der Fördersituation herauszufinden" (ebd. S 62).
Es geht also darum, die Erwartungen der Eltern an die Förderung anzusprechen und zu verstehen versuchen. Die Frühförderin muss dazu auf das Ausdrucksverhalten der Eltern im Spiel mit dem Kind oder beim Beobachten in bestimmten Momenten des Betroffenseins immer wieder bemerken, aufgreifen und sie nach ihren momentanen Erlebnissen, Gedanken, Wünschen und Sorgen bezüglich des Kindes, bezüglich der Arbeit der Frühförderin und bezüglich ihrer eigenen Situation befragen.
Dabei ist zu bedenken, dass sich die Rollenverteilung in der Fördersituation mit jeder Mutter anders gestalten wird, dass sich diese von Zeit zu Zeit verändern kann, und es immer wieder gemeinsam besprochen werden muss, wie es gerade sein soll und kann.
"Ziel kann es dabei nicht sein, Erwartungs- und Gefühlsdiskrepanzen immer kompromißartig aufzulösen oder gar harmonistisch zu überdecken, sondern wechselseitig wahrzunehmen, zu verstehen und als Bedingung der Möglichkeit zu begreifen, in der Auseinandersetzung mit jenen des ‚gegenüberstehenden' Kooperationspartners die eigene Sicht- und Handlungsweise weiterzuentwickeln" (ebd. S 63).
Wenn ein solches Verständigungshandeln auf der sprachlichen Ebene (noch) nicht möglich ist, könnte die Frühförderin dies auf der nonverbalen Interaktionsebene versuchen. Verständigungshandeln bedeutet, dass die Frühförderin der Mutter in ihren Bedürfnissen in der Fördersituation in Stück weit entgegenkommt, was die Mutter von ihrem Druck entlasten und bewirken kann, dass sie sich in ihrem Spielhandeln mit dem Kind freier bewegt und auf diese Weise wieder der Frühförderin entgegenkommt.
Ein anfängliches Verständigungshandeln kann unter Umständen erst die Verständigungsgespräche ermöglichen.
"Aufgabe einer guten Teamarbeit könnte dabei sein, Möglichkeiten für ‚Verständigungsgespräche' zu überlegen und unter Umständen im Rollenspiel (Selbst-)Erfahrungen damit zu sammeln" (ebd. S 64).
Was Weiß hier für die Kooperationsgespräche vorschlägt, könnte auch gut sein, um den Umgang mit dem Schmerz und der Trauer der Eltern zu üben und eigene Erfahrungen damit zu sammeln.
Für Weiß zeigt sich, dass "ein schrittweises Zugehen der Fachperson auf die Bedürfnisse der Mutter im Rahmen des ihr Möglichen (nicht im Sinne eines harmonischen Zudeckens von Unterschieden, sondern im Ernstnehmen der anderen Position) es letzterer erleichtert, in größerer Offenheit eigene Vorstellungen und Gefühle wahrzunehmen und in Auseinandersetzung mit jener des Frühbetreuers weiterzuentwickeln" (ebd. S 64).
Mütter schwerstbehinderter Kinder sind durch die anfallenden Pflegeaufgaben oft sehr stark belastet. Hier kann es auch sinnvoll sein, die Zeit der Förderung des Kindes für die Entlastung der Mutter zu nutzen. Wichtig ist es aber, in so einem Fall zu überlegen: "Handelt es sich für die Mutter tatsächlich um eine Entlastung von allgemeinen Pflegeaufgaben? Oder könnte eher das Motiv eines ‚inneren Rückzugs' eine Rolle spielen, d.h. daß sie sich förderspezifischen Belastungen, Spannungs- und Konfliktsituationen zu entziehen versucht, was Gegenstand eines ‚Verständigungsdialoges' sein sollte" (ebd. S 64).
Wenn es so ist, dass die Mutter ihre in der Fördersituation aufkommenden Gefühle nicht gut aushalten kann, sollte vielleicht nach einer anderen Möglichkeit zur Entlastung der Mutter - eventuell durch einen familienentlastenden Dienst - gesucht werden, so dass sie die Möglichkeit bekommt, sich mit Hilfe der Frühförderin für die begrenzte Zeit der Fördereinheit ganz auf das Kind und ihr eigenes Erleben einzulassen. Eine solche Aufgabe setzt aber unbedingt die Begleitung der Mutter und damit die Beratungsfähigkeit der Frühförderin voraus.
Prinzipiell kann es gut sein, scheinbare thematische "Belanglosigkeiten" im Gespräch mit den Eltern ernst zu nehmen, weil sich in solchen Gesprächsimpulsen oft ein dringendes Anliegen der Eltern verbirgt. Inwieweit die Eltern auf die Vorschläge und Überlegungen der Frühförderin eingehen können, hängt vielleicht auch davon ab, inwieweit sie selber sich in ihren Äußerungen ernst genommen fühlen. (vgl. ebd. S 65)
In weiterer Folge bedeutet dies, dass es Zeit geben muss für ungestörte, regelmäßige Gespräche mit den Eltern, was aber nicht heißt, dass spontane Gesprächsimpulse eines Elternteils etwa während dem Spielhandeln mit dem Kind nicht aufgefangen und zugelassen werden sollten.
Für wichtige Gespräche ist es gut, einen Termin außerhalb der Förderzeiten und vielleicht auch außerhalb der Wohnung der Familie anzubieten, sodass es den Eltern möglich ist, sich ungestört und ohne, dass sie sich nebenbei um alltägliche Dinge kümmern müssen, auf die Gesprächsinhalte einzulassen.
Manchmal kann vielleicht auch die Anwesenheit eines "Dritten", etwa einer Psychologin, bei einem Gespräch in einer verfahrenen Situation hilfreich sein.
Prinzipiell fordert die Arbeit in der Familie von der Frühförderin eine phänomenologisch-lebensweltliche Haltung, d.h. sie muss das aufnehmen, was sich in der Interaktion mit dem Kind und den Eltern zeigt und was ihr davon auch emotional zugänglich wird, und sie muss das Geschehen auf dem größeren Hintergrund der Lebensgeschichte und der momentanen Lebenswelt der Familie auffassen und verstehen können.
Eine solche Haltung braucht neben fundiertem Wissen über die Situation und die Lebenswirklichkeit der Familie mit einem von Behinderung bedrohten oder betroffenen Kind auch eine Haltung, die es ihr ermöglicht, sich auf die individuelle Situation der jeweiligen Familie einzulassen, ohne sich in ihren Belangen zu verstricken.
Gemeinsame Reflexionsbemühungen von Eltern und Frühförderin sind dafür unerlässlich.
"Es geht insbesondere darum, jeweils nach einem zurückgelegten Weg in der Zusammenarbeit innezuhalten und sie unter der Fragestellung zu überdenken, inwieweit die praktische Umsetzung vereinbarter und aufeinander abgestimmter Ziele und Vorhaben den jeweiligen Vorstellungen entsprechen konnte, als Versuch, eingeschlagene Richtungen unter Umständen zu modifizieren, sich einschleifender oder bereits verfestigter Kooperationserschwernisse zu verdeutlichen und zu reduzieren, (unterschwellige) Diskrepanzen und Mißverständnisse in den Sicht- und Handlungsweisen durchsichtig zu machen und abzubauen, kurz: die spezifischen Voraussetzungen und Grundlagen der Kooperation immer wieder neu zu bestimmen bzw. zu bestätigen" (ebd. S 246).
Da es vielen Eltern vielleicht nicht von Beginn an so selbstverständlich möglich sein wird, ihre Lage, ihre Anliegen, ihre Fragen, Wünsche, Sorgen und Kritik zu äußern, braucht es dazu immer wieder Ermutigung und die Schaffung von dafür geeigneten Bedingungen von Seiten der Frühförderin.
Eltern wollen die Frühförderin als kompetente, fachlich engagierte Person erleben, aber auch dadurch Vertrauen zu ihr gewinnen, indem sie Wissensdefizite offen legt und versucht, diese zu füllen. Eine tragfähige Beziehung "wird besonders dann einem anzustrebenden, wohl nicht immer voll erreichbaren Gütekriterium gerecht, wenn sie in einer angemessenen Weise das Ansprechen von Konfliktpotentialen erlaubt, ohne daß sie deswegen beeinträchtigt wird" (ebd. S 252).
Voraussetzung dazu ist aber auch, dass beide Seiten einander zuhören, aufeinander eingehen, voneinander lernen wollen, eigene Auffassungen revidieren und einander respektieren können.
Gerade Konzepte, die die Eigentätigkeit des Kindes in den Mittelpunkt stellen und offene Interaktionssituationen zwischen Mutter, Kind und Frühförderin bevorzugen, setzen viel Vertrauen auf allen Seiten voraus. Weil weniger Regeln und äußere Strukturen die Situation bestimmen, brauchen sowohl das Kind als auch die Mutter viel emotionalen Halt von der Frühförderin. Offene Interaktionssituationen geben nicht nur dem Kind viel Raum, sondern eröffnen auch für die Mutter einen Raum, der das Auftauchen von Emotionen ihrer eigenen Situation und dem Kind gegenüber möglich macht. Solche Emotionen können die Mutter erschrecken und in ihr Ängste und Schuldgefühle auslösen. Vielleicht erleben Mütter ihr Kind gerade dann sehr "behindert" in seinen Fähigkeiten, z.B. eingeschränkt in seiner Problemlösungskompetenz, wenn sie es dabei beobachten müssen, wie es selber nach einer Lösung sucht, und die Frühförderin lange Zeit geduldig abwartet und nicht eingreift. Das Erleben der Schwierigkeiten, die ihr Kind hat, unterdrücken sie vielleicht im Alltag oft dadurch, dass sie Dinge für das Kind einfach tun, ohne von ihm Mithilfe zu erwarten. Das Mitansehenmüssen der Bemühungen des Kindes kann dann Schuldgefühle, aber auch sehr viel Schmerz und Trauer auslösen, die die Mütter sonst in ihrem Alltag ganz gut unter Kontrolle haben (müssen).
Sehr strukturierte, klare Übungsabfolgen können im Gegensatz dazu den Müttern Halt in ihren Aktivitäten mit dem Kind bieten und die dadurch beim Kinde eingeübten Fähigkeiten können den Müttern Sicherheit geben und sie im Hinblick auf die Zukunft des Kindes beruhigen. Der Schwerpunkt sehr strukturierter Fördermaßnahmen liegt ja meist auf der Aktivität, einer Aktivität, die Emotionen auch gut zudecken kann.
Damit Eltern eine Vorgangsweise der Frühförderin annehmen können, innerhalb der sich die Frühförderin eher als Unterstützerin und Begleiterin der kindlichen Eigenaktivität sieht, braucht es wahrscheinlich ein behutsames Vorbereiten, ein schrittweises Hinführen der Eltern zu Angeboten, die vom Kind selber unter der Einhaltung einiger Grundregeln bestimmt werden, weg von Angeboten, die Anforderungen von außen an das Kind heranbringen. Gerade wenn sich Eltern noch in der anfänglichen Phase der äußeren Suche nach den besten Fördermöglichkeiten befinden, wird die Frühförderin hier sehr behutsam zwischen den Bedürfnissen der Eltern und ihren eigenen fachlichen Überzeugungen jonglieren müssen.
Da Alexanders Vater im Schichtdienst arbeitete, war es ihm oft möglich, an den Frühfördereinheiten teilzunehmen. Bei einem der ersten Termine hatte ich Bauteile für eine Kugelbahn mitgenommen, da ich gerne beobachten wollte, wie es Alexander gelang, sich eine Vorstellung vom Bau der Kugelbahn zu machen und diese Vorstellungen schließlich ins Tun umzusetzen. Alexanders Vater beobachtete uns dabei, wie wir die verschiedenen Bauteile begutachteten, ordneten und ihre Funktionsweise erprobten. Für mich war es ganz selbstverständlich, dass ich dabei Alexanders Neugier die Führung überließ und ihm Zeit gab, eigene Lösungswege für den Bau zu finden. Die ganze Stunde über probierte Alexander verschiedene Möglichkeiten aus, die Teile ineinander zu stecken und die Bahn so aufzubauen, dass die Kugel von oben nach unten rollen konnte. Dabei musste er immer wieder eine Kugel holen und überprüfen, wie sie rollen würde. An entscheidenden Stellen gab ich Alexander so weit Hilfe, dass ihm seine Motivation erhalten blieb und er letztendlich zu einem Erfolg kommen konnte. Während dieser Zeit merkte ich, wie Alexanders Vater sich sehr zurückhalten musste, um seinem Sohn die Teile nicht aus der Hand zu nehmen und wie schwer es ihm fiel, dabei zuzusehen, wie Alexander einen "falschen" Weg einschlug, um sich später selber wieder zu korrigieren.
Im nachfolgenden Gespräch erzählte mir Alexanders Vater dann, dass ihm erst jetzt aufgefallen sei, wie gemeinsame Spiele zwischen Alexander und ihm eigentlich ablaufen. Sie wären immer schnell fertig, weil der Vater die aktive Rolle übernahm, während Alexander sagte, was der Vater für ihn bauen sollte - ein Konstellation, die die beiden eher auf Distanz brachte und nicht zu einem gemeinsamen Erlebnis führen konnte. Der Vater stellte auch fest, wie schwer es für ihn war, Alexander bei seinen eigenen Versuchen zuzusehen und das Vertrauen aufzubringen, dass er es schon allein schaffen werde. Aus dieser Fördereinheit entstand für Alexanders Vater der Wunsch, in Zukunft eine andere Art des Umgangs mit Alexander auszuprobieren, während für mich die Gelegenheit entstand, ihm mein dahinterliegendes Arbeitskonzept näher zu bringen.
Es gibt aber auch Situationen, in denen die Mutter so sehr unter Druck steht, dass ein Perspektivenwechsel in diese Richtung nicht möglich wird bzw. es der Frühförderin nicht gelingt, die dahinterliegenden Motive anzusprechen.
Andreas Mutter hielt solche Spielsituationen nicht aus, verfiel dann immer in große Hektik und Unruhe und beruhigte sich selber, indem sie nach Beendigung meiner Fördereinheit die Lernspielsammlung der Familie herbeiholte und mir zeigte, was Andrea schon alles konnte. Dabei spielte es für sie keine Rolle, dass Andrea die Antworten auf viele Fragen und Anforderungen dieser Spiele einfach auswendig wusste, aber sich schwer tat, etwa im Rollenspiel Ideen zu entwickeln oder das auszudrücken, was sie wollte. Gespräche mit der Mutter darüber und über den nahenden Schuleintritt wurden auch dadurch vereitelt, dass immer am Ende der Stunde eine Schwester der Mutter zu Besuch kam, die die Mutter in ihrem Wunsch bestärkte, Andrea in die Schule zu schicken und ihr nicht noch ein Jahr länger den Kindergartenbesuch zu ermöglichen, mit dem Hinweis, dass sich die Probleme schon auswachsen würden, wenn Andrea endlich "der Knopf aufgehen würde". In diesem Fall habe ich es nicht geschafft, die Mutter auf den Druck hin anzusprechen, den sie offenbar nicht nur selber empfand, sondern der ihr auch von ihrer näheren sozialen Umwelt auferlegt wurde. Es war mir nicht möglich, die Mutter auf Andreas geistige Behinderung aufmerksam zu machen und ihre Hoffnungen zu dämpfen. Wie sehr Andreas Mutter die Behinderung ihrer Tochter nicht wahrhaben wollte, zeigt vielleicht auch, dass sie zwar mit ihr bei einer ärztlichen und psychologischen Abklärung war, den Befund aber über ein Jahr lang nicht angefordert hatte, bis ich am Beginn meiner Arbeit in der Familie danach fragte.
Es ist vielleicht wichtig anzuerkennen, dass es nicht immer möglich sein wird, mit den Eltern an einen Punkt zu gelangen, an dem sie den Problemen oder der Behinderung ihres Kindes gelassen gegenüberstehen und sich keine unberechtigten Hoffnungen mehr machen. Es ist anzuerkennen, dass die Eltern ihren eigenen Weg der Auseinandersetzung gehen und ihre eigene Zeit dafür brauchen. Für die Frühförderin stellt sich hier nur die Frage danach, wie sie die Eltern dabei am besten begleiten kann, ohne sich gegen ihre Überzeugungen an deren Vorstellungen anzupassen und ohne den Eltern einen Weg aufzudrängen, für den sie noch nicht bereit sind oder der ihnen nicht entspricht.
Hier möchte ich gerne drei Aspekte herausgreifen und noch einmal näher betrachten, die ich persönlich für das Gelingen von Familienbegleitung für wesentlich halte. Es sind dies drei Aspekte, die die Frühförderin und ihre Arbeit betreffen, und die für mich die Voraussetzungen dafür darstellen, dass es zum Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern kommen kann.
Die Bereitschaft der Eltern zu einer partnerschaftlichen Beziehung wird in den meisten Fällen zwar vorhanden sein, kann aber von der Frühförderin nicht vorausgesetzt werden. Vor allem, wenn Eltern schon viele negative Erfahrungen mit Fachleuten gemacht haben oder ihre Situation sehr ablehnen, kann es schon vorkommen, dass die Frühförderin zunächst mit Misstrauen und Skepsis konfrontiert wird.
Schon deshalb ist es wichtig, dass sie selbst von ihrer Haltung her die Eltern von Beginn an als kompetente Partner wahrnimmt und ihnen diese Sichtweise auch vermittelt.
Hiltrud Bölling-Bechinger beschreibt in ihren Überlegungen zu einer die Autonomieentwicklung begünstigenden Frühförderung (1998) eine aus der Klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers übernommene Haltung der Frühförderin in ihrer Arbeit mit den Eltern. Auf diese möchte ich im Folgenden Bezug nehmen.
"Die Beziehung zwischen Eltern bzw. Kindern und Fachleuten ist zu verstehen als eine Beziehung von ‚Person zu Person' (Buber 1983 in Pfeiffer 1991, S 18), von Subjekt zu Subjekt: Die Aussagen der Eltern über ihre Kinder werden dabei z.B. gleichberechtigt mit den Beobachtungen der Fachleute in die Diagnose miteinbezogen. Eltern und Fachleute planen und entscheiden gemeinsam, welche Interventionen augenblicklich erforderlich sind. [...] Die Berater (Psychologe, Pädagoge) bemühen sich, die einen psychotherapeutischen Prozeß fördernden Bedingungen, Selbstkongruenz, aufmerksame Zugewandtheit und einfühlendes Verstehen, gegenüber den Eltern und deren behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern in der pädagogisch-psychologischen Frühförderung zu verwirklichen, um hierdurch die Entwicklung des Interaktionsprozesses zwischen Eltern/Kind und Berater zu beleben" (Bölling-Bechinger 1998, S 63).
Als wesentlichstes Merkmal hebt Bölling-Bechinger dabei die Feinfühligkeit heraus, die ja auch Bowlby in seiner Bindungstheorie als wichtigstes Kriterium einer sicheren Bindung beschreibt. Sie entwickelte in jahrelanger Praxisarbeit ein Konzept für eine "pädagogisch-psychologische Frühförderung" und beobachtete dafür auch die Wirkung einer solchen Haltung der Fachperson auf die Beziehung zu den Eltern.
"Verhielten sich die Fachleute nämlich in der Beziehung selbstkongruent, waren sie Eltern und Kindern aufmerksam zugewandt und bemühten sie sich, Eltern und Kinder einfühlsam zu verstehen, so konnten die Eltern sich sehr viel eher über ihre Probleme und die ihrer Kinder Klärung verschaffen und autonome Entscheidungen treffen" (ebd. S 43).
Anstelle von Ratschlägen tritt so die Unterstützung von Autonomieprozessen bei Eltern und Kind.
Bölling-Bechinger konnte feststellen, dass die Eltern in der Folge eher die Möglichkeit hatten, ihre Bedürfnisse und ihre Betroffenheit angstfrei zu äußern und dass sich die Kinder unbefangener und unverstellter in ihrem Sosein vor den Eltern und Fachleuten zeigen konnten. (vgl. ebd. S 44)
"Sie fühlten sich rascher entlastet und konnten eher eine positive Beziehung zu den Fachleuten aufnehmen" (ebd. S 44).
Eine alleinige Betreuung der Kinder ohne Anleitung und Unterstützung der Eltern reicht nicht aus, weil negative Gefühle der Eltern die Interaktion mit dem Kind stören können. Es braucht dazu aber zunächst eine veränderte Haltung der Fachleute, die es ihnen ermöglicht, so auf die Eltern zuzugehen, dass diese sich auch öffnen können.
Diese Haltung schließt das Bemühen der Frühförderin mit ein, die Äußerungen und Verhaltensweisen von Kind und Eltern in ihrem jeweiligen Kontext zu sehen und zu beschreiben, um sie schließlich in ihrer Bedeutung zu verstehen und zu klären.
Wenn eine Mutter etwa betont, dass ihr Kind sonst ganz anders ist, so muss die Frühförderin nachfragen, wie die Mutter das meint. Es ist ein großer Unterscheid, ob die Mutter damit meint, dass sie erstaunt darüber ist, was ihr Kind alles kann oder ob sie Angst hat, es könnte in den Beobachtungen der Frühförderin schlechter eingestuft werden. Daraus kann sich in weitere Folge auch ein ergiebiges Gespräch über das Verhalten des Kindes im Alltag entwickeln, innerhalb dessen auch die Mutter Raum für die Schilderung ihres eigenen Erlebens erhält.
Wenn Selbstkongruenz, Empathie und emotionale Zugewandtheit die Entwicklung einer positiven Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern begünstigen, so bedeutet das für die Frühförderin auch, zu sagen, wie sie etwas empfindet bzw. zu sagen, wenn etwas für sie nicht in Ordnung ist.
Einerseits bedeutet das, die Eltern gut und offen über die eigene Vorgangsweise, das eigene Konzept und den Sinn der geplanten Aktivitäten aufzuklären und sich ihres Einverständnisses zu vergewissern.
"Im Respekt voreinander können durchaus unterschiedliche Auffassungen stehen bleiben; worauf es jedoch ankommt, hat Ingeborg Bachmann so formuliert: ‚einander Deutlichkeit verleihen'" (Weiß in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 97).
Andererseits heißt das aber ebenfalls, als Frühförderin auch dann noch selbstkongruent zu sein, wenn sich die Eltern der eigenen Arbeit gegenüber kritisch oder dem Kind gegenüber negativ äußern. Auch dann ist es wichtig, dass die Frühförderin den Eltern den Eindruck vermittelt, den ihre Äußerungen auf sie machen oder zu sagen, dass es ihr schwer fällt, das anzunehmen oder auszuhalten. Eine solche Offenheit ermöglicht es den Eltern, ebenfalls zu spüren, was an der Situation schwierig oder schwer auszuhalten ist.
"In diesem Prozeß der Auseinandersetzung der Eltern mit sich selbst, d.h. mit der Behinderung ihres Kindes, wird es einem erfahrenen und mit sich selbst kongruenten Berater eher gelingen, von den Eltern als Begleiter angenommen zu werden" (Bölling-Bechinger 1998, S 57).
Dabei sollte für die Frühförderin ein besseres Verständnis für die Situation der Familie vordergründig und handlungsleitend sein.
"Für Eltern ist es zunächst hilfreich, wenn wir ihnen zuhören, um letztendlich die gesamten sie verletzenden Erfahrungen und ihre Ängste im Zusammenhang mit der Geschichte ihres Kindes verstehen zu können. [...] Eltern wagen nämlich auf dem Weg des Sichverstandenfühlens damit zu beginnen, sich ihrer Verletzungen zu erinnern und diese dann auch zu verbalisieren. So kann schon die Anamnese für Eltern zum Anfang der Bearbeitung ihrer Betroffenheit und ihrer Trauer werden" (ebd. S 57).
Dazu ist vielleicht auch noch zu bemerken, dass Eltern intuitiv erfassen, wie viel sie ihrem Gegenüber zumuten können. Sie spüren, wie viel die Frühförderin aushalten kann, ob sie bereit und fähig ist, damit umzugehen, ob sie genügend inneren Raum besitzt, den sie aufmachen kann. (entnommen aus meiner Mitschrift zum Vortrag von Silvia Turinsky beim Frühfördersymposium in Innsbruck 2003)
Turinsky hält aus diesem Grund die Trauerarbeit der Frühförderin, die Arbeit der Frühförderin an ihrem eigenen inneren Raum, für unerlässlich für die Begleitung der Familie.
Lange Zeit hindurch war die Beratung und Begleitung der Eltern in der Frühförderung von dem Gedanken bestimmt, den Eltern dabei zu helfen, mit den durch die Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit des Kindes entstehenden Anforderungen praktischer und emotionaler Art zurechtzukommen und ihre Situation als Eltern eines behinderten Kindes anzunehmen. Auch heute ist dies oft noch ein Motiv der Fachleute in der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die Annahme und Bejahung des Kindes wird als grundsätzliche Aufgabe der Eltern betrachtet. (vgl. Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung 1997, S 40)
Damit gerät nach Weiß Annahme zur "fremdbestimmten Norm, welche die Autonomie der Eltern in ihren Verarbeitungsprozessen unangemessen einschränkt, weil sie deren Ergebnis von vornherein festlegt" (ebd. S 40)
Dazu ist zunächst aber einmal zu klären, was Annahme eigentlich bedeutet.
Annahme ist bezogen auf die Situation Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder immer auch ein Prozess des Abwägens verschiedener Pole. Es stellt sich für die Eltern die Frage, ob sie ihr Kind in seinem So-Sein einfach annehmen und ihr bisheriges Leben weiterführen, oder ob sie ihren Alltag ganz nach dem Kind und seiner bestmöglichen Förderung ausrichten sollen, die Frage danach, ob sie sich mit der Behinderung abfinden oder eine Veränderung des Zustandes anstreben sollen.
Annahme kann heißen, die Elternschaft für dieses Kind anzuerkennen und die Tatsache anzunehmen, ein geschädigtes, nicht den gängigen Normen der Gesellschaft entsprechendes Kind gezeugt und zur Welt gebracht zu haben.
"Annahme kann ferner beinhalten, die Grenzen der eigenen und fremden Hilfsmöglichkeiten zu akzeptieren" (ebd. S 41).
Es gilt auszuhalten, dass es nicht die perfekte oder die einzig mögliche Lösung gibt, sondern dass die verschiedenen Pole in einem gewissen Rahmen ihre Berechtigung und Notwendigkeit haben und man dazwischen abwägen muss in dem Wissen, nicht allen und allem gerecht werden zu können. Hier wird die Ambivalenzfähigkeit bei Eltern und Frühförderin angesprochen und herausgefordert.
Schwierig wird es dann, wenn Fachleute die emotionale Annahme des Kindes als zu erreichendes Ziel im Auseinandersetzungsprozess der Eltern ansehen, diese Anforderung den Eltern bewusst oder unbewusst vermitteln und sie damit unter Druck setzen. Leicht kann dann aus dem Wunsch, bestmögliche Bedingungen für das Kind schaffen zu wollen, der Anspruch an eine Liebespflicht der Eltern entstehen.
Ich denke, dass jede Frühförderin mit bestimmten Vorstellungen von Elternschaft, von der Annahme der Behinderung und von harmonischem Familienleben an die zu begleitende Familie herantritt, und es ist auch wichtig, dass sie für sich solche Leitlinien hat. Problematisch wird es nur dort, wo sie solche zum Teil auch unbewussten Ansprüche unreflektiert an die Eltern heranbringt.
"Die Bilder, die sich Fachleute vor allem von uns Eltern machen, entsprechen nach unseren Erfahrungen selten der Wirklichkeit, sondern sind mehr nur Projektionen professioneller Vorstellungen oder gar ihrer Wunschbilder" (Elterngruppe in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 60).
Zusätzlich ist man als Fachperson dazu verleitet, "die Probleme der Familie mit einem behinderten Kind als Folge eines unzureichend geglückten Annahmeprozesses zu deuten" (Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 42).
Auf diese Erklärung lassen sich unterschiedlichste Probleme abwälzen: auch Spannungen und Konflikte in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein Insistieren auf der Annahme des Kindes durch die Eltern kann so auch eine Abwehrhaltung der Professionellen darstellen: gegenüber ihrer eigenen Ohnmacht oder Hilflosigkeit und gegenüber negativen Gefühlen die Behinderung betreffend.
Wenn heute die Qualität der Interaktion zwischen Eltern und Kind besonders betont und in den Mittelpunkt gestellt wird, kann es hier genauso geschehen, dass damit neue Anforderungen und Ansprüche auf die Eltern zukommen und sie nach bestimmten Normen - der Norm der guten Mutter, des guten Vaters und der Norm einer idealen Beziehung zum Kind - bewertet werden.
Auch wenn es nahe liegt, die Eltern in ihrem Auseinandersetzungsprozess zu begleiten, muss die Frühförderin anerkennen, dass Coping-Prozesse ein persönliches Geschehen darstellen und ein Einwirken auf die Eltern eine Gratwanderung zwischen Hilfe und unangemessenen Eingriffen und Zumutungen sein kann.
"Es besteht die Gefahr, ohne Absicht Druck auf die Eltern in Richtung einer fremdbestimmten Annahme ihres behinderten Kindes, eine Art ‚Liebespflicht' auszuüben" (ebd. S 43).
Es ist wichtig, den Trauerprozess der Eltern als ein zeitlich offenes Geschehen mit unterschiedlichem Ergebnis anzuerkennen bzw. die Trauer im Sinne von Jonas (1990) als "zirkulierend" zu begreifen.
Für eine in der Frühförderung arbeitende Fachfrau kann es zu einem großen Hindernis in der Zusammenarbeit mit den Eltern werden, wenn sie sich bewusst oder unbewusst von der Anforderung der Annahme und Liebe des Kindes durch die Eltern leiten lässt. Sie kann damit auch selber unter den Druck kommen, der Mutter dabei helfen zu müssen, ihr Kind anzunehmen, was in weitere Folge bedeuten kann, dass sie der Mutter keinen Raum mehr eröffnet, um auch ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber zu äußern. Hier stellt sich zum wiederholten Mal - und darin zeigt sich vielleicht ihre Wichtigkeit - die Frage, inwieweit sie selber solche ambivalenten Gefühle dem Kind gegenüber wahrnimmt bzw. zulässt.
"Inwieweit kann sie sich der eigenen ‚Ich-Bedrohung' im Angesicht des Leidens anderer Menschen stellen und ‚gemeinsam mit den Eltern die Angst vor dem Ungewissen und dem scheinbaren Nichts ertragen'" (Niedecken 1989, S 191, in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 99).
Begleiten bedeutet ja gerade nicht, die eigenen Vorstellungen den Eltern aufzudrängen, sondern sie in ihrem je individuell verlaufenden Prozess der Auseinandersetzung zu unterstützen. Die Eltern auf diesem Weg zu begleiten heißt, mit ihnen ein Stück auf diesem ihrem Weg zu gehen in dem Bewusstsein, dass es eben nur ein kurzes Stück (bezogen auf das weitere Leben des Kindes und der Familie) ist, auch wenn Frühförderung real gesehen oft mehrere Jahre umfasst.
Weiß hat in seinen Überlegungen einige Bedingungen für eine fachliche Beratung und Begleitung der Eltern ohne fremdbestimmte Vorgaben angeführt. (vgl. Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 49ff)
Dazu gehört es zunächst, Annahme nicht als absolutes Ziel der Verarbeitung anzusehen und anzuerkennen, dass Abwehr, Widerstand und Verweigerung Aspekte sind, die zum Trauerprozess gehören und sowohl ihren Sinn als auch ihre Berechtigung haben. Von außen lässt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt kaum sagen, welche Abwehrformen produktiv und welche destruktiv sind.
Annahme ist ein weitläufiger, vielschichtiger Begriff und hat wohl vor allem eine Berechtigung, wenn er verstanden wird als Annahme der eigenen Realität und somit der eigenen Lebensbedingungen. Annahme dessen, was ist, setzt aber voraus, die Wirklichkeit des Lebens zu erkennen und richtet ihren Blick auf die "Vielfalt und Vielschichtigkeit menschlicher Existenz, auf Stärken und Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen, Freudvolles und Schmerzliches, Einsichten und ungelöste Probleme [...]" (ebd. S 50).
Annahme in diesem Sinn bedeutet ein Abwägen der Bedürfnisse jedes einzelnen Familienmitgliedes und ein Abwägen nach dem Kriterium der Veränderbarkeit. Es stellt sich die Frage danach, was ich als Mensch verändern und beeinflussen kann und was nicht, die Frage danach, wo ich gestaltend einwirken und wo ich etwas nur akzeptieren kann.
Diese Fragen stellen sich für Eltern und Frühförderin gleichermaßen.
"Eltern können unsicher sein, wie sie innerhalb ihrer Lebenssituation, ihrer Welt- und Menschensicht, ihres Wertesystems und ihrer Erziehungsvorstellungen für sich und ihr Kind diese Fragen beantworten sollen" (ebd. S 51).
Auf die Frage nach dem eigenen Lebenskonzept und der Weiterentwicklung persönlicher Wertvorstellungen können Eltern "letztlich nur selbst für sich Antworten finden. Dennoch wäre für sie das Gespräch mit Fachpersonen wichtig" (ebd. S 51). Oft kristallieren sich gerade in der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber, im Dialog mit ihm, durch seine Zuwendung und Anteilnahme oder sein Nachfragen wichtige Antworten und Positionen für den betreffenden Menschen heraus.
Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder befinden sich zwangsläufig in einer ambivalenten Gefühlslage: Zuneigung zum Kind, Hoffnung für seine Zukunft und Zuversicht stehen der Enttäuschung, Trauer und Wut, aber auch Schuldgefühlen gegenüber.
Annahme dessen, was ist, kann auch bedeuten, diese ambivalent Haltung, die nun einmal zur Wirklichkeit der Situation Eltern behinderter Kinder gehört, anzuerkennen und sie da sein zu lassen, ohne die "dunkle Seite" der eigenen Gefühle, die eigenen Grenzen, die Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht abspalten zu müssen. Dies gilt meiner Meinung nach für Fachleute ebenso wie für die Eltern selber.
Voraussetzungen dafür sind einerseits das verstehende Einfühlen der Fachleute und andererseits emotionaler Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten für die Eltern. Fremdbestimmter Druck in Form von Liebes- oder Förderpflicht erweist sich hingegen als hinderlich. Für Fachleute bedeutet dies, fremdbestimmte normative Vorgaben nach Möglichkeit zu vermeiden und in ihrer Beratungshaltung ihrem Gegenüber bedingungslose Akzeptanz entgegenzubringen.
Familienbegleitung stellt demnach hohe Anforderungen an die Frühförderin.
"Hierbei sind als persönliche Grundvoraussetzungen psychologische Persönlichkeitsvariablen wie die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden und Vertrauen zu erwecken, Kooperationsfähigkeit, Selbsterkenntnis, die Fähigkeit zur Objektivität und angemessenen Distanz in der Beratungssituation gegenüber den Beteiligten, sowie Fachkenntnisse und berufliche Erfahrungen in der Beratungstätigkeit und eventuell der Anwendung psychotherapeutischer Verfahren zu erwähnen" (Niebergall in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 76).
Bezogen auf das Kind hat Weiß die Anforderungen an die Frühförderin in Anlehnung an Niedecken (1989) in die Richtung formuliert, dass die Frühförderin fähig sein muss, das Symbolische der Ausdrucks- und Kommunikationsweisen des Kindes zu verstehen und in das gemeinsame Handeln mit ihm sowie in das Gespräch mit den Eltern einzubringen, was auch bedeutet, dass die Frühförderin eigene Anteile des Nicht-Verstehens in der Beziehung zum Kind wahrnehmen, begreifen und aushalten muss, ohne sie einseitig dem Phantasma seiner Behinderung zuzuschreiben.
In der Selbstreflexion muss die Frühförderin außerdem ihre fachlichen Vorstellungen von der Familie danach befragen, inwieweit sie von traditionellen Rollenmustern oder Idealvorstellungen geprägt sind, und inwieweit sie Müttern behinderter Kinder überhaupt eine eigenständige Lebensführung unabhängig vom Kind mit Behinderung oder Entwicklungsauffälligkeit zugesteht.
Damit kommt wieder die gesellschaftliche Seite der Einstellungen der Frühförderin zum Vorschein. Gerade die Forderung nach emotionaler Annahme des behinderten Kindes hat tiefe Wurzeln in unsere Gesellschaft und Kultur. Im Gegenzug zur Unfähigkeit der Gesellschaft, Behinderte als Gleichberechtigte anzunehmen, sollen dies die Eltern übernehmen und so auch der sozialen Umgebung eine Auseinandersetzung ersparen.
Annahme kann somit auch zur gesellschaftlichen Forderung nach möglichst guter Anpassung des Kindes und seiner Eltern werden.
"Vorherrschende gesellschaftliche Sichtweisen von Behinderung und damit verbundene Ablehnungs- und Ausgliederungstendenzen können und sollen von Eltern nicht akzeptiert werden" (Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 55).
Kerstin Ziemen konnte in ihren Interviews mit Eltern behinderter Kinder einen großen Wunsch der Eltern nach Kooperation mit den Fachleuten feststellen. Gleichzeitig bemerkt sie aber, dass sich Eltern und Pädagogen in einer sehr unterschiedlichen Position befinden und dass sich aus diesem Gegensatz leicht Probleme ergeben können.
"Unbestritten scheint die Tatsache, dass es zwischen Eltern und Fachleuten kooperative partnerschaftliche Beziehungen geben sollte. Das entspricht vor allem der aktuellen Diskussion innerhalb der Frühförderung. Zugleich ist jedoch diese Zielvorstellung oder Forderung eine Illusion bzw. nur unter Schwierigkeiten zu realisieren" (Ziemen 2002, S 251).
Frühförderin und Eltern unterscheiden sich schon in ihrem Anspruchsniveau in Bezug auf das Kind sehr deutlich: Es besteht ein großer Unterschied darin, Mutter oder Vater zu sein und eine emotionale Bindung zum Kind zu haben, oder Frühförderin zu sein und eine sehr viel weniger emotional getragenere, viel kognitiv gesteuertere Bindung zum Kind zu haben.
Eltern sind auch im pädagogischen Feld gefährdet, an den Pol der Ohn-Macht zu rücken und in ihren spezifischen Kompetenzen und in ihren Anliegen nicht entsprechend anerkannt zu werden. Andererseits benötigen Eltern zusätzlich zu ihrem "kulturellen Kapital" zusätzliche Kompetenzen in ihrem Umgang mit dem Kind und brauchen dafür die Unterstützung der Fachleute.
"Durch entsprechende Beratung und Unterstützung, die Hinweise und Informationen zur Entwicklung des Kindes, zur Behinderung, zur Anregung des Kindes gibt, kann das Zusammenleben mit dem Kind intensiver und bewusster gestaltet werden" (ebd. S 253).
Die Bezeichnung "Anregung" beinhaltet schon, dass ein Impuls von der Frühförderin an die Eltern ergeht, den sie aufgreifen können oder auch nicht. Solche Anregungen können Eltern in verschiedenen Bereichen benötigen: für die Umsetzung von Förderung im täglichen Leben, für die Gestaltung des Spielraumes in der Wohnung oder für den Aufbau einer Tagesstruktur. Grundsätzlich sollten es Anregungen sein, die das Zusammenleben mit dem Kind erleichtern und seine Entwicklung stimulieren, und sie sollten individuell den Bedürfnissen der jeweiligen Familie entsprechen.
"Ideen, Anregungen, Hinweise sind in gemeinsamen Gesprächen zwischen Eltern und Fachleuten u.a. bezüglich Pflege, Entwicklung, Anregung des Kindes in die Beratung und Unterstützung einzubringen" (ebd. S 254).
Nach Ziemen bezieht sich eine kritische Wahrnehmung der Eltern von der pädagogischen oder therapeutischen Arbeit der Fachleute zumeist auf Anforderungen, die an ihr Kind gestellt werden, auf Inkompetenzen, die bei den Professionellen wahrgenommen werden und auf bestimmte Methoden oder Verfahrensweisen, die von ihnen angezweifelt werden.
"Machtkämpfe zeigen sehr deutlich an, dass die Chancen der Betroffenen in den entsprechenden Feldern ungleich verteilt sind und sich Professionelle diese Ungleichheit zunutze machen können, indem sie Druck ausüben und Maßnahmen, Methoden oder Vorgehensweisen durchzusetzen beabsichtigen" (ebd. S 256).
Die Selbstbestimmung der Eltern zu unterstützen und zu wahren, scheint nicht immer so leicht zu sein für Fachleute, die sich stark mit ihrer Helferrolle identifizieren. Helfen kann die Gefahr des Bevormundens des Betroffenen mit sich bringen. Aber auch, wenn man als Außenstehender glaubt, eine Lösung oder den besseren Weg zu wissen, ist zu achten, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg wählen darf. Einerseits sind "Fehler" oder Umwege" ein wichtiger Teil des Erkenntnis- und Weiterentwicklungsprozesses und andererseits muss die von außen als am besten erachtete Lösung für den Betroffene nicht unbedingt geeignet sein.
"Eltern/Familien mit behinderten und nichtbehinderten Kindern bedürfen der Unterstützung (in unterschiedlicher Art und Weise), um das Leben mit dem Kind gestalten und um sich selbst (als Eltern) stabilisieren zu können. Durch die Unterstützung jeglicher Art werden ‚Spielräume" für Kind und Eltern geschaffen. Sowohl Kind als auch Eltern benötigen jeweils ihren spezifischen 'Spielraum' als auch eine gemeinsamen. Das erfordert einen gewissen Freiheitsgrad an Entscheidungen, Handlungen, Verhaltensweisen. Die Unterstützungsangebote von Seiten der ‚Professionellen' haben diese Kontexte, vor allem für Eltern behinderter Kinder, in den Blick zu nehmen" (ebd. S 260).
Was Ziemen hier für die Familienbegleitung fordert, ist praktisch beispielhaft für die momentane Situation in der Frühförderung. Im Hinblick auf die methodische Durchführung partnerschaftlichen Tuns gibt es wenig konkrete Handlungsanweisungen, bis eben auf die Forderung, die gesamte Familie miteinzubeziehen und die Interventionen auf die Bedürfnisse und die Lebenswelt der Familie abzustimmen.
Partnerschaft kann je nach den Bedürfnissen der Familie heißen, sich als Frühförderin im Förderprozess zurückzunehmen oder direktiv konkrete Handlungsanweisungen zu geben.
Dabei stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein gängiges, auf die meisten Situationen umzulegendes Konzept für Partnerschaftlichkeit gibt, da Kooperation ja einschließt, sich am Gegenüber zu orientieren und Vereinbarungen im Dialog miteinander auszuhandeln.
Es ist wichtig, dass sowohl die Eltern als auch die Frühförderin ihre Rahmenbedingungen und Erwartungen artikulieren. Gerade die Erstgesprächssituation ist dafür prädestiniert, dass die Frühförderin einerseits die unabdingbaren Voraussetzungen für ihr Arbeit deutlich definiert und andererseits die Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern aufnimmt. Eine kontraktmäßige Vereinbarung darüber in einem sogenannten "Arbeitsbündnis" kann eine erste Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit bilden.
"Die Gefahr liegt im erlebten Handlungsdruck der FrühförderInnen, sofort mit Förderung und Tun beginnen zu müssen, ohne reflektierte apriori-Annahmen (‚Eh-klar'-Sätze) diskursiv zu überprüfen" (Pretis 1998, S 14).
Pretis hat versucht, das Haltungsmodell der Partnerschaft zwischen Eltern und Frühförderin aus den Achtzigerjahren in ein "Handlungsmodell" umzusetzen. Wesentlichstes Merkmal seiner Ausführungen ist die Forderung nach Transparenz in der Arbeit der Frühförderinnen, sodass es den Eltern möglich ist, die Intentionen und Interventionen der Frühförderin nachzuvollziehen. (vgl. ebd. S 14ff)
Zur Transparenz und Offenlegung gehören für Pretis etwa das Vorstellen des jeweiligen Konzeptes der Frühförderung, die Transparenz in der Vorgangsweise, den Methoden und Verfahren, ein gemeinsames Aushandeln von Förderzielen und Förderplänen, die theoretische Reflexion der Einheiten nach dem Motto: Warum tue ich, was ich tue?, die Verwendung von intersubjektiv nachvollziehbaren Dokumentationsmitteln, die Transparenz der Vor- und Nachbereitung der Fördereinheiten und das Deklarieren der eigenen pädagogischen Einstellung. Pretis betont den Servicecharakter von Frühförderung als soziale Dienstleistung und die Freiwilligkeit der Eltern bei der Inanspruchnahme dieses Dienstes, die es immer wieder zu bedenken gilt. Weiters hält Pretis es für wichtig, mögliche weitere Ressourcen der Eltern zu respektieren.
"Partnerschaftliche Frühförderung muß auch respektieren, daß Eltern über weitere Ressourcen verfügen, über persönliche Themen zu sprechen, ohne daß die FrühförderInnen argumentieren, Eltern seien in ihrem ‚Bejahungsprozeß' noch nicht soweit, über die Behinderung des Kindes bzw. die persönliche Betroffenheit zu sprechen" (ebd. S 15).
Pretis sieht aber auch Grenzen in der Kooperationsfähigkeit, die etwa bei Abbrüchen in der Frühförderung zum Vorschein kommen. Gründe dafür liegen für ihn vor allem in einer von Seiten der Eltern gering erlebten Kompetenz der Frühförderin, in völlig unterschiedlichen Zielsetzungen, in Förderdruck und Kontrolle und in unklaren Rollendefinitionen.
Ein besonderes Problem stellen hier auch sogenannte "Multiproblemfamilien", d.h. Familien aus sozioökonomisch gefährdeten Milieus, dar, in denen für den Helfer die Gefahr der Verstrickung in die Probleme der Familie sehr groß ist. Auf die spezielle Problematik dieser Familien in der Frühförderung näher einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weshalb ich diese besondere Konstellation hier zwar erwähnen, aber nicht näher darauf eingehen möchte.
Letztlich hängt das Gelingen einer Kooperation von der Bereitschaft beider Seiten ab, miteinander in Kontakt zu kommen, im gemeinsamen Dialog die "Marschroute" für den gemeinsamen Weg festzulegen und aufeinander einzugehen.
"Partnerschaftlichkeit kann nur als interaktiver Prozeß verstanden werden, der primär von Seiten der professionellen Helfer ein hohes Maß an erlebter Kompetenz und somit Motivation zur Transparenz und theoretischen Fundierung des eigenen Tuns abverlangt" (Pretis 1998, S 16).
Vielleicht wird der Konsens für die Zusammenarbeit nicht immer eine breite Basis sein - es kann aber auch schon ein "kleiner gemeinsamer Nenner" vorerst ausreichen, um die Arbeit zu beginnen und die Beziehung aufzubauen und zu erweitern. Von der Frühförderin verlangt dies einerseits eine professionelle Haltung, eine Offenheit und Klarheit in ihrer Arbeitslinie und viel Einfallsreichtum, andererseits muss sie aber auch wissen, wo ihre Grenzen sind und anerkennen, dass nicht alles in ihrer Macht steht. Bei aller Professionalität wird sie sich manchmal auch einfach auf ihr Gefühl und ihre "menschliche" Kompetenz verlassen müssen, um den Eltern und dem Kind auf einer gemeinsamen Ebene begegnen zu können.
Inhaltsverzeichnis
Während meiner noch eher kurz währenden Arbeit als Frühförderin traf mich der Abbruch der Frühförderung in einer Familie auf den ersten Blick völlig unvorbereitet und hinterließ bei mir viele Fragen danach, wie es dazu kommen konnte und was ich hätte tun können, um diesen Abbruch zu vermeiden.
Als ich kurz darauf in einer weiteren Familie mit der Mutter des Kindes in Konflikt kam, war ich schon eher fähig damit umzugehen und konnte einen Abbruch verhindern, indem ich der Familie die Fortsetzung der Frühförderung mit einer Kollegin vorschlug. Trotzdem waren für mich auch diesmal die Schwierigkeiten aus nicht eindeutig ersichtlichen Gründen aufgetaucht.
Dazu muss ich vielleicht noch bemerken, dass ich bei meinem Eintritt in die Frühförderung zwar eine bereits langjährige Erfahrung in der Betreuung und Begleitung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeit und Behinderung mitbrachte, jedoch bis zu diesem Zeitpunkt eher wenig direkten Kontakt mit den Eltern gehabt hatte und darauf auch von meiner Ausbildung als Sonderkindergärtnerin her nicht sehr gut vorbereitet war.
In die Zeit meiner Arbeit in der Frühförderung fielen jedoch einerseits meine Ausbildung zur Psychotherapeutin und andererseits Verbesserungen im Rahmenkonzept der Institution, bei der ich arbeitete. Je mehr Orientierungs- und Anhaltspunkte ich für meine Arbeit mit den Eltern dadurch erhielt, umso mehr konnte ich allmählich erkennen, worauf es in der Familienbegleitung ankommt.
Trotz zunehmend guter Erfahrungen und zunehmender Sicherheit im Umgang mit den Familien nahm ich immer wieder Spannungsmomente und Erwartungsdruck in der Interaktion vor allem mit den Müttern wahr und blieben mir die beiden anfänglichen Beendigungen der Zusammenarbeit doch sehr im Gedächtnis. Es entstand der Wunsch in mir, der Entstehungsgeschichte dieser Schwierigkeiten noch einmal intensiv und auf der Grundlage theoretischer Konzepte nachzugehen und neben der Situation jener Familien auch meine eigenen Anteile in der Interaktion mit ihnen genauer zu ergründen.
Während ich mich im bisherigen Verlauf dieser Arbeit eher mit den theoretischen Hintergründen zu Frühförderung und Familienbegleitung, zur Situation von Familien mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und zur Position der Frühförderin beschäftigt habe, möchte ich nun den Aspekt in den Mittelpunkt stellen, der in den bisher schon eingeflochtenen Beispielen aus meiner persönlichen Arbeit in der Frühförderung schon zum Ausdruck kam: meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Familienbegleitung in der Frühförderung auf der Basis meiner Erfahrungen und meiner Selbstreflexion.
Wenn ich mich dabei auf die für mich eher schmerzlichen Erfahrungen der Beendigung von Arbeitsverhältnissen konzentriere, so deswegen, weil ich glaube, dass an einer genaueren Analyse dieser "Fälle" ersichtlich werden kann, an welchen Punkten in der Zusammenarbeit die gemeinsame Basis mit den Eltern gefährdet ist. Daraus werden vielleicht auch der eigene Anteil der Frühförderin, ihre Gegenübertragung und eventuell bei ihr bestehende Angst-Abwehrtendenzen ersichtlich und lassen sich in weiterer Folge vielleicht Rückschlüsse ziehen auf wichtige Voraussetzungen für eine gelingende partnerschaftliche Beziehung zu den Eltern in der Frühförderung.
Als Arbeitsmaterial für mein Forschungsvorhaben dienen mir Gedächtnisprotokolle von Erlebnissen aus meiner Arbeit mit den Familien. Diese Gedächtnisprotokolle entstanden im Nachhinein auf der Grundlage meiner Vor- und Nachbereitungen.
Der Text dieser Arbeitsprotokolle bildet den Ausgangspunkt für meine Überlegungen und Interpretationen, die sich im Rahmen des von mir bisher schon dargelegten theoretischen Hintergrundes, meines Alltagswissens und meines fachlichen, auch psychotherapeutischen Vorverständnisses halten werden.
Im weitesten Sinn ist mein Forschungsvorhaben der qualitativen Sozialforschung zuzuordnen, als qualitative Forschung ja eine Rekonstruktion deutungs- und handlungsgenerierender Tiefenstrukturen darstellt. (vgl. Moser 1995, S 63)
Auf der Suche nach einer geeigneten Methode für die Auswertung meiner von vornherein schon subjektiven Daten stieß ich im Rahmen der qualitativen Methoden sowohl auf die Aktionsforschung, und hier im besonderen auf die Praxisforschung, als auch auf die psychoanalytisch orientierte Sozialforschung, der meine Vorgangsweise zwar nicht genau entspricht, an der ich mich aber orientiert bzw. die ich als vorbildhaftes Modell gewählt habe.
Mein Forschungsvorhaben ist in dem Sinne Praxisforschung, als es aus der Praxis kommt, im direkten Kontakt mit dem Forschungsgegenstand "Frühförderung und Familienbegleitung" entstanden ist und versucht, Theorie mit der Praxis zu verbinden.
Moser (1995) nennt fünf Grundsätze für qualitatives Forschen nach Mayring:
-
Subjektbezogenheit der Forschung
-
Deskription der Forschungssubjekte
-
Interpretation der Forschungssubjekte
-
Forderung nach der Untersuchung der Subjekte in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung statt im Labor
-
Auffassung von der Generalisierbarkeit der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess
(vgl. Moser 1995, S 61)
Praxisforschung geht davon aus, dass man ein vertieftes Verständnis für den Forschungsgegenstand und für die darin "beforschten" Menschen erhält, wenn man sich in dasselbe Umfeld begibt. Es geht ihr um die Bedeutungen, die hinter den beobachtbaren Aktionen oder Interaktionen stehen.
"Forschung [hat, C. K.-S.] an die Interpretationsmuster und Sinnstrukturen der ‚Beforschten' anzuknüpfen" (ebd. S 61).
Das "Ins-Feld-Gehen" des Forschers wird jedoch nicht ganz kritiklos gesehen.
"Nicht untypisch ist das Verdikt von Sommerfeld/Koditek (1954), daß bei der Aktionsforschung die weitgehende Vermischung von Parteinahme und Erkenntnissuche dem Wahrheitspostulat entgegenstehe und sich nachteilig auf die Theorie wie die Praxis auswirke" (ebd. S 58).
Diesen Aspekt habe ich in Bezug auf mein Forschungsvorhaben erwogen, und er war für mich ausschlaggebend dafür, mich auf die Suche nach einer Methode zu begeben, die die Anteile des Forschers und seine Position mit einbezieht und zum Thema macht. Es war mir klar, dass ich, wenn ich versuche, meine eigenen Erfahrungen zu interpretieren, der Gefahr der Spekulation und des Auftretens von "blinden Flecken" erliegen könnte.
"Zudem besteht auch die Gefahr, daß einer naiven Form der Praxisforschung, bei welcher der Forscher zugleich Akteur innerhalb der zu untersuchenden Verhältnisse ist, noch der letzte Rest von Distanz verloren geht" (ebd. S 60).
Mein Forschungsvorhaben ist eines jener, "in denen die Forschenden gleichzeitig auch Teil der untersuchten Praxis sind" (ebd. S 87).
Da ich selber zugleich Subjekt als auch Objekt meines Forschungsvorhabens bin, nehme ich quasi erst im Nachhinein die Rolle der Forscherin ein, um mich selber in meiner Interaktion mit den Eltern in der Frühförderung zum Objekt der Forschung zu machen.
Dazu brauche ich einen methodologischen Rahmen, der mir die Möglichkeit der Selbstreflexion einräumt. Am ehesten geeignet scheint mir dazu eine Anlehnung an die psychoanalytisch orientierte Sozialforschung zu sein. Ich möchte aber festhalten, dass ich mich dabei lediglich an der Psychoanalyse als Tiefenpsychologie, als Methode zur Erfassung von Tiefenstrukturen, und an den in dieser Arbeit bereits dargelegten psychoanalytischen Konzepten orientieren werde.
Um meine eigene Rolle als Frühförderin und damit als Interaktionspartnerin der Eltern analysieren zu können, bietet mir die Terminologie der Psychoanalyse wichtige Anhaltspunkte, wie etwa die Beachtung der Übertragung und Gegenübertragung, die auch im Arbeitsfeld der Frühförderung einen wesentlichen Einfluss auf das Interaktionsgeschehen haben.
Meine derzeitige Situation als "hauptberuflich" Studierende ermöglicht mir Distanz zu dem Arbeitsfeld, das Gegenstand meiner Forschung ist, und räumt mir den Spielraum ein, das Interaktionsgeschehen, das nun doch schon längere Zeit zurückliegt, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen.
Es ist mir sehr wichtig, die Anonymität der Familien zu wahren, von denen ich hier berichte. Aus diesem Grund habe ich alles unternommen, was zu einer Anonymisierung beitragen kann, wie etwa die Änderung aller Namen oder das Einfügen von fiktiven Teilen, wo es die Darstellung nicht wesentlich verändert.
Ich denke, dass meine Vorgangsweise dadurch zu legitimieren ist, dass mein Hauptinteresse dem Verhalten und der Position der Frühförderin gilt und die beschriebenen Familienprozesse nur als Beispiele für die Vielfalt der Begegnungen dienen, mit denen die Frühförderin in ihrer Arbeit konfrontiert wird. Es geht dabei um meine persönlichen Erfahrungen, um meine Sichtweise als Frühförderin, um meinen Standpunkt, von dem aus ich auf möglichst einfühlsame Weise auf die Situation der Familien und das stattgefundene Interaktionsgeschehen blicken möchte.
Im Folgenden werde ich die psychoanalytische Sozialforschung näher charakterisieren, um anschließend festzuhalten, welche Aspekte meiner eigenen Vorgangsweise daraus entlehnt sind.
Ab den Siebziger Jahren kam es zur Entwicklung einiger Konzepte psychoanalytischer Sozialforschung, deren grundlegendste die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse von Lorenzer darstellt.
Die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse untersucht kulturelle Erzeugnisse wie Texte, bildende Kunst oder Architektur. "Gegenstand ist also nicht die direkte Interaktion mit einem leibhaftigen Gegenüber" (Busch 2001, S 22). Die Gemeinsamkeit psychoanalytisch orientierter Verstehensweisen mit anderen Formen des Verstehens liegt dabei im Sinnverstehen, was bedeutet, dass menschlichem Interagieren ein gemeinschaftlich geteilter Sinn unterstellt wird, der sich einem logischen und psychologisch-nacherlebendem Verstehen erschließt. (vgl. ebd. S 23)
Psychologisches Verstehen richtet sich dabei auf die innere Situation im Subjekt, wobei aber auch der gesellschaftliche Bezugsrahmen mitberücksichtigt wird.
"Individuelles Lernen wurzelt stets - über Familie hinaus - in den restriktiven Bedingungen herrschender gesellschaftlicher Strukturen" (ebd. S 25).
Vom Psychoanalytiker aus geschieht Verstehen und auch Interaktion immer über gewisse Vorannahmen: einerseits über das "natürliche" Alltags- und Handlungswissen, das er im Lauf seiner eigenen Geschichte in einer konkreten Gesellschaft und Kultur erwirbt und andererseits über sein spezifisches theoretisches und methodisches Wissen.
"Tiefenhermeneutisches Verstehen gelingt im Verkehr dieser beiden Felder miteinander" (ebd. S 26). Im Forschungsprozess sollen sich dabei aber auch diese theoretischen und praktischen Annahmen als kritikfähig und veränderbar erweisen.
Weil bei der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse das beforschte Gegenüber meist ein feststehender Text oder ein fertiges Kunstwerk ist, unterscheidet sie sich damit deutlich von der im Dialog mit dem Klienten stattfindenden psychoanalytischen Therapiepraxis.
"Ihr Untersuchungsgegenstand ist nicht der Patient, sondern der Text. Gleich ist dagegen der Erkenntnisgegenstand: das Unbewusste" (ebd. S 27).
Die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse geht davon aus, dass ein gesellschaftliches Unbewusstes im Text latent enthalten ist, und versucht, in der Interpretation zu dieser unbewussten Sinnebene vorzudringen. Bei der Interpretation bleibt der Text "fest". Er kann beliebig oft gelesen werden, ist unveränderbar, aber auch nicht erweiterbar. Der Interpret hat also eine gänzlich rezeptive Rolle, und er muss seine Vorannahmen einbringen, um den Text "szenisch" aufzuschließen. (vgl. ebd. S 31)
Die Veränderungspotenz liegt demnach nicht beim Gegenüber, sondern lediglich beim Forscher selber.
Neben einer psychoanalytischen Kompetenz sieht Lorenzer für seine Methode auch die "Auseinandersetzung mit sich selbst" als "unerlässliche Voraussetzung eines interpretierenden Umgangs mit den im Text angebotenen Lebensentwürfen" an. (vgl. ebd. S 35)
"Der Text wird also nicht minuziös und unter Verwendung eines interdisziplinären Fächerkanons sequentiell in seine sinnhaften Bestandteile auseinandergenommen, wie es die objektive Hermeneutik vorschreibt, sondern in - diesbezüglich gröberer Weise - abgesucht, in der Haltung gleichbleibender, schwebender Aufmerksamkeit" (ebd. S 35). Als Gültigkeitskriterium für die Interpretation dient dabei der Konsens einer Interpretationsgruppe, wobei jedem der Teilnehmer derselbe Text als Grundlage dient.
In der Tradition der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse von Lorenzer entwickelten sich verschiedene Methoden psychoanalytisch orientierter Sozialforschung, die sich in direktere Interaktion mit den erforschten Individuen und Gruppen ins soziale Feld begeben.
Diese haben jeweils sehr unterschiedliche Zugänge, was die Behandlung von Interview-Protokollen, Übertragung - Gegenübertragung, das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse und die Verbindung zur therapeutischen Arbeit angeht.
Busch hält dabei jeweils die begleitende Supervision für unerlässlich, denn eine "sozialwissenschaftlich empirische Hermeneutik, die mit der Reproduktion der Szene in der Auswertungssituation rechnet und dies im Ensemble verstehbarer Daten integrieren will, benötigt eine quasi supervisorische Instanz bzw. muss sich selbst als eine solche organisieren" (Lorenzer 1970, S 108 in Busch 2001, S 6).
Heinze (1995) bezieht sich in seinen Darstellungen hauptsächlich auf die Forschungsarbeit von Leithäuser und Volmerg (1987), wenn er meint, dass es in der psychoanalytischen Sozialforschung hauptsächlich darum geht, "aufzudecken, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse in der psychischen Struktur von Individuen manifestieren und sich in psychische Regulationsmechanismen verwandeln oder wie sich umgekehrt psychische Triebimpulse und Wünsche sozialer Situationen und Rollen zunutze machen" (Heinze 1995, S 166).
Der Gegenstand der psychoanalytischen Sozialforschung ist hier also das Spannungsfeld zwischen Individuierung und Vergesellschaftung, wobei die Förderung einer selbstreflexiven und verändernden Praxis das zentrale Anliegen darstellt.
Der Forscher ist dabei nicht ein neutraler Unbeteiligter. Durch seine Anwesenheit im Forschungsfeld werden Übertragungen vom Beforschten an ihn herangetragen, auf die der Forscher wiederum mit Gegenübertragung reagiert.
"Durch methodische Selbstreflexion wird es jedoch möglich, Gegenübertragungen und unbewußte Identifikationen zu erkennen" (ebd. S 170). Die Grundlage psychoanalytischer Sozialforschung liegt für Heinze "in einem Wechselspiel von Distanz und Beteiligung, der Eingebundenheit in Übertragungen und ihrer Auflösungen im Prozeß der Selbsterkenntnis" (ebd. S 170).
Selbsterfahrung und Supervision des Forschers werden in diesem Zusammenhang für die Forschung nutzbar gemacht.
Bei der Interpretation von Texten geht man dabei davon aus, dass ein Text mehrere Sinnebenen beinhaltet: eine propositionale (sachliche), eine metakommunikative (Beziehungs-), eine pragmatische (Handlungs-) und eine intentionale (Absichts-) Ebene.
(vgl. ebd. S 178 in Anlehnung an Leithäuser/Volmerg 1987, Bd. 2, S 230).
Die entsprechenden Sinnerschließungsfragen lauten:
"Worüber wird gesprochen? (propositionaler Gehalt)
Wie wird miteinander gesprochen? (metakommunikativer Gehalt)
Wie wird worüber gesprochen? (pragmatischer Gehalt)
Warum wird wie worüber gesprochen? (intentionaler Gehalt)"
(Leithäuser/Volmerg 1987, S 231f in Heinze 1995, S 179).
Szenisches Verstehen schließt die Frage mit ein: "Wie wird sich über was verständigt?" und geht von der Annahme aus, dass ein Text dramatische Entwürfe, Szenen und Lebensformen repräsentiert.
Leithäuser und Volmerg (1988) unterscheiden bei der Interpretation zwischen der Situation, in der man als Interpret zu dem dokumentierten Material in Beziehung tritt (in meinem Fall der Situation der Frühförderin und nachträglichen Forscherin), der Situation, in dem sich der Erforschte befindet (in meinem Fall der Situation der Eltern und ihres Kindes) und der Situation, über die man spricht (in meinem Fall der im Gedächtnisprotokoll geschilderten Situation). (vgl. Leithäuser/Volmerg 1988, S 46)
Es gilt demnach sowohl die Interpretationssituation als auch die Verständigungssituation und die thematische Situation mitzubedenken und mitzureflektieren. Mit meiner Situation als Forscherin beschäftige ich mich im derzeitigen Teil meiner Arbeit, mit meiner Situation als Frühförderin und mit der Situation der Eltern habe ich mich bereits im Vorhergehenden auseinandergesetzt. Im noch folgenden Teil meiner Arbeit werde ich diese Ebenen bei der Auseinadersetzung mit den geschilderten Themen ebenfalls weiter berücksichtigen.
Eine solche Unterscheidung zwischen verschiedenen Sinn- und Situationsebenen dient nach Leithäuser und Volmerg (1988) dazu, um zu den verborgenen, latenten Sinngehalten vorzudringen, die ein besseres Verständnis der Belastungen ermöglichen, wobei für sie der Aspekt des Erkennens stärker ist als der des Heilens oder Veränderns.
Den Aspekt des Erkennens und Verstehens stellt auch Volker Fröhlich in seiner psychoanalytisch orientierten Forschungsarbeit im Bereich der Lebenswelt körperbehinderter Kinder in den Vordergrund. (vgl. Fröhlich 1992, S 99-116)
Der Leitsatz des Buches, in dem Fröhlichs Forschungsarbeit veröffentlicht wurde, lautet: "Sehen - Einfühlen - Verstehen", und ich möchte ihn zum Leitsatz für die Interpretation meiner eigenen Arbeitsprotokolle machen.
"Nur das Verstehen im unmittelbaren Bezug, sei es nun ein therapeutisches oder pädagogisches, umfaßt die Möglichkeit, daß aus ‚Verstehen' ‚Verständigung' wird" (ebd. S 100).
Für Fröhlich stellt die Psychoanalyse dafür ein Modell des Verstehens zur Verfügung, welches sich im unmittelbaren mitmenschlichen Bezug vollzieht und die Beziehung zwischen Verstehendem und Zu-Verstehendem mitberücksichtigt. Den Ausgangspunkt des Verstehens sieht Fröhlich in Anlehnung an Dilthey dabei im "Nachvollzug fremden Erlebens" (ebd. S 100).
"Wirklichkeitsverzerrungen entstehen nicht zuerst auf der Ebene der theoretischen Bearbeitung des gewonnenen Materials, sie beginnen bereits auf der Ebene der Wahrnehmung der zu untersuchenden Situation. Der Forscher beeinflußt diese, indem er mit dem Kind in Beziehung tritt, er wird zum teilnehmenden Beobachter bzw. zu einem beobachtenden Teilnehmer. Er nimmt selektiv wahr: er wählt aus einer Vielzahl von Handlungssequenzen, die von ihm für bedeutsam gehalten werden aus, die Nachträglichkeit der Aufzeichnungen läßt Lücken entstehen" (ebd. S 103).
Was Fröhlich hier anspricht, gilt sicher auch für meine eigenen Protokolle. Fröhlich geht noch einen Schritt weiter und glaubt bei der Auswahl der Inhalte nicht unbedingt an eine Erkenntnismethode, die immer das Bedeutungsvolle einer Handlung oder Rede erkennt und erinnert, sondern er spricht gerade im Zusammenhang mit dem Thema der Behinderung die Möglichkeit unbewusster Abwehr an, die ein "Vergessen" oder "Vernachlässigen" bewirken kann.
"Solches gefühlsmäßiges Angesprochensein durch die Kinder, dem sich kein Erzieher oder pädagogischer Forscher entziehen kann, wenngleich er sich noch so gefaßt und ‚cool' gibt, bleibt in der Sonderpädagogik mit ihrem stark ausgeprägten Helferwillen vielfach unberücksichtigt" (ebd. S 111).
Ich würde dieses gefühlsmäßige Angesprochensein auch auf den Schmerz und die Ängste der Eltern ausweiten, die der Frühförderin in den Aussagen und Handlungen der Eltern immer wieder begegnen und denen sie ebenso wie der Schädigung des Kindes nicht immer vorbehaltlos gegenübersteht.
"Wahrnehmungsverzerrungen dieser Art zu mindern, war die Aufgabe der psychoanalytischen Supervision. Natürlich kann auch die Supervision Wahrnehmungsverzerrungen nicht völlig ausschließen, doch bot sie uns Gelegenheit, über praktische Schwierigkeiten mit den Kindern sowie über eigene Ängste zu reflektieren und vermochte ‚blinde Flecken' unserer Wahrnehmung aufzudecken" (ebd. S 103).
Meinen eigenen Widerständen oder Abwehr-Tendenzen in dieser Beziehung nachzugehen, war Aufgabe meiner eigenen Selbsterfahrung und Supervision.
Ausgangspunkt für das Verstehen und das Nicht-Verstehen war für Fröhlich sein eigenes gefühlsmäßiges Erleben der Beziehungssituation. Aus diesem gefühlsmäßigen Angesprochensein heraus blickte er schließlich auf weitere Kontexte der Lebens- und Erlebenswelt der Kinder, die seine Gegenüber in der Forschungssituation waren.
Bei der Interpretation und Schilderung meiner Erfahrungen in der Beziehung zu den Eltern werde ich ebenfalls versuchen, mein eigenes gefühlsmäßiges Erleben miteinzubeziehen und von diesem aus auf die weitere Situation der Familie und ihren weiteren Kontext zu blicken.
Mit Bezugnahme auf das eben Geschilderte werde ich meine Forschungsmethode als "Selbstreflexive Forschungsmethode" bezeichnen.
Die beiden Erfahrungsbeispiele, die ich im weiteren vorstellen und interpretieren werde, sind dabei doppelt supervidiert worden: einerseits durch die begleitende Fallsupervision während meiner Arbeit als Frühförderin und andererseits im Rahmen meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin in der existenzanalytischen Lehrsupervision, in die ich sie als "Fälle" eingebracht habe.
Dadurch sind manche Sichtweisen aus der Supervision in meine Darstellungen eingeflossen, ohne dass ich sie mehr genau rekonstruieren kann, während ich sie an anderer Stelle deklarieren werde.
Ich berufe mich dabei auf Leithäuser und Volmerg, die erwähnen, dass auch biographisches Material zum Gegenstand einer psychoanalytischen Sozialforschung werden kann. (vgl. Leithäuser/Volmerg 1988, S 57)
Der Erkenntnisgewinn wird dabei weniger in verallgemeinerbaren Ergebnissen liegen und damit auch nicht unbedingt in einer Umsetzung der Erkenntnisse in eine pädagogische Praxis. Vielmehr geht es mir darum, pädagogisches Beziehungsgeschehen und meine Gedanken dazu darzustellen und zu versuchen, die geschilderten Interaktionssituationen zu verstehen, soweit sie mir selber zugänglich sind.
Inhaltsverzeichnis
Meine Kollegin hatte in der Zeit, in der sich Familie A auf der Warteliste unserer Frühförderstelle befand, regelmäßig Kontakt mit der Familie aufgenommen. Wir beschlossen deshalb, gemeinsam zum ersten Gespräch in die Familie zu gehen. Bei Familie A waren bereits alle Familienmitglieder um den Tisch in der geräumigen Küche versammelt: Vater, Mutter, Martin, sein einjähriger Bruder und seine zehnjährige Schwester. Ich stellte mich vor und holte dann erste Informationen über Martin und seine Familie ein. Martin war zu diesem Zeitpunkt knapp drei Jahre alt. Die Psychologin hatte bei ihm eine Wahrnehmungsverarbeitungsschwäche festgestellt und dringend die Begleitung der Familie empfohlen. Seine Mutter berichtete auch gleich über die Schwierigkeiten zu Hause. Martin wäre sehr unruhig, immer in Bewegung und gefährde sich dabei selber. Früher wäre er oft auf die nahegelegene Bundesstraße zugerannt. Ein Zaun hätte dieses Problem aber zwischenzeitlich gelöst. Trotzdem aber wolle er immer noch weglaufen, und die Mutter müsse ihn ständig im Auge haben. Seinem jüngeren Bruder gegenüber wäre er oft sehr aggressiv. Ein weiteres Problem stellte für die Familie seine verzögerte Sprachentwicklung dar.
Neben der Schilderung dieser Schwierigkeiten stand aber eine Frage im Mittelpunkt des Interesses der Mutter: Wie würde sich Martin weiterentwickeln, welche Prognose hätte der weitere Verlauf seiner Entwicklung mit der Wahrnehmungsstörung, und würde sie jemals ganz verschwinden? Könnte er irgendwann eine normale Schulde besuchen?
Noch bevor ich antworten konnte, zeigte mein Gesicht der Mutter wahrscheinlich, dass ich keine Antworten auf diese Fragen parat hatte, und sie gab sich selber die Antwort: "Das kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen."
Ich habe mich später oft gefragt, ob dies wohl die erste große Enttäuschung war, die sie mit mir erlebte, dass ich ihr nicht garantieren konnte, dass sich alles zum Positiven entwickeln würde.
Martin war bei diesem Gespräch anwesend. Er verkroch sich zunächst auf Papas Schoß und musterte uns Neuankömmlinge von diesem sicheren Ort aus. Bald wechselte er zwischen den Mitgliedern seiner Familie hin und her und bewegte sich rund um den Tisch. Alle meine Versuche, zu ihm Kontakt aufzunehmen, fruchteten nicht. Er beobachtete mich zwar, sprach aber nicht mit mir. Ich beschränkte mich darauf, mit seinem Kuscheltier, einem Plüschkrokodil zu sprechen, was ihm sehr gefiel. Trotz seiner Schüchternheit und Ängstlichkeit blitzte der Schalk in seinen Augen und ich konnte seine Neugier wahrnehmen.
Martins Eltern waren besorgt darüber, dass Martin sich so auf Distanz hielt. Ich versuchte ihnen zu vermitteln, dass es für mich ganz in Ordnung war und dass wir beide wahrscheinlich eine Zeit lang brauchen würden, um uns gegenseitig kennen zu lernen.
Ich glaube, dass ich mich schon bei dieser ersten Begegnung sehr bemüht habe, die Erwartungen der Eltern aufzunehmen und ihnen Hoffnung zu vermitteln. Vor allem die Mutter sah in mir von Anfang an diejenige, die ihnen nun endlich helfen würde und ihnen sagen könnte, was zu tun sei. Ich denke, dass ich auf die große Erwartungshaltung der Mutter sehr angesprungen bin und sofort das Gefühl hatte, da muss man etwas tun, da muss ich nun etwas tun. Von Anfang an habe ich viel Zuversicht vermittelt und eine sehr positive Sicht der Welt, die sich letztlich aber nicht mit der Weltsicht der Mutter deckte, sondern ihrer eigenen sehr widersprach.
In meiner Überzeugung, etwas verändern zu können und auch zu wollen, habe ich dann aber die realen Bedürfnisse und auch die Bedingungen der Familie übersehen. Ich habe meine Sicht der Probleme über die der Familie gestellt und dabei übersehen, dass die Familie nicht bereit und fähig war, den Weg zu gehen, den ich für den richtigen hielt.
Die ersten Wochen der Frühförderung waren davon geprägt, dass ich versuchte, eine vertrauensvolle Beziehung zu Martin aufzubauen. Das war kein leichtes Unterfangen, da Martin sich vor allem zu Beginn kaum aus der schützenden Nähe zu seiner Mutter fortbewegte und mich und meine Spielvorschläge sehr kritisch begutachtete, bevor er sich darauf einließ.
Die Mutter hatte auf Anraten der Ergotherapeutin, bei der Martin in Betreuung war, im Wohnzimmer bereits einen bestimmten Platz für gemeinsame Spiele hergerichtet. Um eine schützende Begrenzung zu erreichen, hatte die Mutter zu beiden Seiten des Teppichs Matratzen gestapelt, die manchmal auch zum Hüpfen und Tragen verwendet werden konnten.
Insgesamt war die Atmosphäre im Haus rein von der Gestaltung der Einrichtung und Materialien her eher kühl. Was mir auffiel war, dass alle Räume, die auch Besuchern zugänglich waren, sehr beeindruckend und imposant gestaltet waren. Alles hatte seinen Platz. Auch die Spielsachen der Kinder waren in ganz bestimmten Schränken untergebracht, jedoch für die Kinder zum Teil nicht erreichbar. Martin war deswegen oft damit beschäftigt, etwas von ganz weit oben herunterzuholen und bewies dabei großen Ideenreichtum. In manchen Stunden war Martin großteils damit beschäftigt, etwas zu holen, was er jetzt unbedingt brauchte, was seine Mutter aber weggeräumt hatte.
Auffallend an Martins Entwicklung war zu Beginn vor allem der sprachliche Rückstand, seine motorische Unruhe und seine geringe Ausdauer. Er war ständig in Bewegung, wollte am liebsten von ganz oben herunterhüpfen und war dementsprechend unfallgefährdet.
Für die Familie waren seine Unruhe, seine Unstetigkeit und die damit verbundene Gefahr einer Verletzung bzw. auch sein unberechenbares Verhalten seinem kleinen Bruder gegenüber die größten Probleme. Dabei muss ich bemerken, dass ich persönlich diese von der Mutter festgestellte Aggression in den gemeinsamen Spielen mit Martin und seinem Bruder nicht beobachten konnte.
In der Nacht wollte Martin nicht alleine bleiben, weshalb er bei seinen Eltern im Schlafzimmer, genauer gesagt im Bett seines Vaters, schlief. Zu diesem Zeitpunkt schlief auch noch der jüngere Bruder mit im Elternschlafzimmer.
Ein weiteres sehr großes Problem war Martins Davonlaufen. Wann immer sich eine Gelegenheit dazu ergab, lief Martin weg.
Immer, wenn die Einheit mit Martin beendet war, und ich mit der Mutter ein Gespräch begonnen hatte, war Martin wie ein Blitz aus der Hintertür in den Garten und von dort aus in das angrenzende Haus seiner Tante zu seinem etwa gleichaltrigen Cousin gelaufen. Auch auf der Straße passierte es nach den Erzählungen der Mutter dauernd, dass Martin sich losriss und einfach davonlief.
Als ich einmal vorschlug, die Mutter solle doch die Außentüren absperren, sodass Martin sie fragen müsste, wenn er zu seinem Cousin wollte, erntete ich einen entrüsteten Blick und die Antwort, sie wolle doch ihr Kind nicht einsperren.
Ich fragte mich oft, warum Martin so vehement versuchte, davonzulaufen, oft ohne bestimmtes Ziel, einfach nur weg.
Was sich hier für mich zeigt, ist eine große Widersprüchlichkeit. Die Mutter betont zwar, ihr Kind nicht einsperren zu wollen und versucht auch, auf seine Wünsche einzugehen. Auf der anderen Seite aber ermöglicht sie ihm wenig Freiraum und Selbständigkeit. Es ist eine große Unsicherheit bei der Mutter in ihrem Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu ihrem Kind zu bemerken (er macht ihr Angst, sie erlebt ihn fremd und gleichzeitig bindet sie ihn stark an sich) und eine ebenso große Unsicherheit, was die Erzeigungsaufgabe des Grenzen-Setzens betrifft. Sie hat Angst davor, ihr Kind unrechtmäßig einzuschränken und gleichzeitig gewährt sie ihm in seinem Selbstsein oft zu wenig Spielraum.
Ihm Spielraum zu verschaffen, war deshalb ein wichtiges Ziel meiner Arbeit in der Frühförderung.
Die ersten Monate waren geprägt von einer raschen und sehr positiven Entwicklung Martins. Seine Aufmerksamkeitsspanne vergrößerte sich um ein Vielfaches, er experimentierte mit unterschiedlichen Materialien und fand dabei immer neue Wege, sie zu verwenden oder daraus etwas zu gestalten. Seine Sprachfähigkeit entwickelte sich am beeindruckendsten, und er funktionierte fast jedes Spiel in ein Rollenspiel um. Dabei sprach er bald in sehr differenzierten Sätzen, sein Wortschatz wuchs enorm, und er konnte in Dialoge gut einsteigen und sie weitergestalten. In diesen Rollenspielen verarbeitete er seine alltäglichen Erlebnisse. Der Vater spielte darin eine besonders wichtige Rolle: Er war derjenige, der - in Martins Spiel - immer arbeitete und das meistens weit weg von seiner Familie. Diesen Umstand konnte ich während den Zeiten, in denen ich in der Familie war, häufig auch in der Realität beobachten.
Was an den Rollenspielen sonst noch auffiel, war, dass es meistens eine Person oder ein Tier (z.B. einen Fuchs) gab, das außerhalb der Familie wohnte und von dort aus immer wieder in das Geschehen eingriff, um schnell wieder zu verschwinden. Sehr oft endeten die Spiele damit, dass jemand starb oder ins Krankenhaus musste.
Im Nachhinein sehe ich in Martins Spiel viel Symbolik: seine Identifikation mit dem Vater, der nicht im Haus (und damit im Bannkreis der Mutter) bleiben musste, seine Sehnsucht nach dem dadurch für ihn fehlenden Vater. Das meist freche und vorwitzige Tier, das die Familie störte, war ebenso eine Identifikationsfigur für ihn - vielleicht stellte es auch ihn selber dar: ihn, der nicht in das Schema der Familie passte bzw. passen wollte. Meist war es die rebellierende Figur, die schließlich sterben musste oder zumindest verletzt wurde. Hier klingt schon seine Angst oder seine Phantasie dazu an, was mit jemandem passiert, der ausbrechen möchte.
Er hatte eine Vorliebe für alles, was fahren konnte: für Autos, den Bus, für Lastwägen und für die Eisenbahn. Sein Lieblingsspiel war lange Zeit hindurch, mit seinem Dreirad mit Anhänger durch das Haus zu fahren.
Sein Verhalten seinem jüngeren Bruder gegenüber war von der unter Geschwister diesen Alters üblichen Eifersucht geprägt, aber die Mutter hatte ständig Angst, er könnte ihm etwas antun, wenn sie die beiden gerade nicht im Auge hatte.
Ich denke, dass die Mutter hier etwas von der Aggression Martins spürte, dass sie sie aber in eine andere Richtung deutete.
In meinen Einheiten war es schwierig, die beiden zum gemeinsamen Spiel anzuregen, was aber auch ihrem Entwicklungsstand noch nicht unbedingt entsprach. So schaffte ich es meistens, dass sich die beiden zwar mit demselben Material, aber auf unterschiedliche Weise beschäftigten. Manchmal aber gelangen auch gemeinsame Spiele ganz gut, wenn es dafür eine geeignete Struktur gab, wie etwa, dass man sich abwechselte oder jeder eine andere Rolle einnahm. Oft war es dann so, dass ich mit Martin arbeitete und die Mutter sich mit dem jüngeren Bruder in unmittelbarer Nähe beschäftigte.
Nach etwa drei Monaten meiner Arbeit in der Familie fragte mich die Mutter eines Tages, ob sie mit mir auch Probleme besprechen könnte. In der Meinung, es handle sich um ein Problem in Bezug auf Martins Entwicklung, bejahte ich. Daraufhin schien die Mutter wie erlöst und sie konfrontierte mich mit den ganzen Schwierigkeiten ihrer Lebenssituation. Die Erzählungen über ihre Eheprobleme, über die Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Familie und der Familie ihres Mannes, über ihre dadurch und durch das auffällige Verhalten ihres Kindes entstandene große Isolation auch im Dorf brachen nur so aus ihr heraus. Sie weinte ununterbrochen und ich konnte zunächst einmal nur zuhören und ihr mein Verständnis entgegenbringen.
Bei einem nächsten Gespräch sagte ich ihr dann aber, dass ich das Gefühl habe, es könne gut für sie sein, sich eine professionelle Gesprächspartnerin, eventuell eine Psychologin oder Psychotherapeutin zu suchen. Ich erklärte ihr, dass sie aktuelle Probleme auf jeden Fall in der Frühförderung ansprechen könne, ich aber befürchte, dass die von ihr geschilderten Probleme den Rahmen der Frühförderung sprengen könnten. Das tat ich aus der Befürchtung heraus, dass allein die Zeit, die ich in der Familie verbrachte, nicht dazu ausreichen würde, um die Probleme der Mutter und die Probleme, die mit dem Kind zu tun hatten, gleichwertig zu behandeln.
Ich machte ihr einige Vorschläge zu Beratungsmöglichkeiten, die sie in Anspruch nehmen könnte und sagte ihr, dass ich sie bei der Suche nach einer geeigneten Gesprächspartnerin jederzeit unterstützen würde. Auf diese Angebot kam sie jedoch nie zurück.
Es kann sein, dass hier eine große Enttäuschung bei der Mutter stattgefunden hat. Die Massivität der von der Mutter geschilderten Schwierigkeiten überforderten mich in diesem Moment auch wirklich, und ich sah in der Frühförderung nicht den geeigneten Rahmen für ihre Bearbeitung, nachdem ich schon von Anfang an in der Familie darum kämpfte, die Zeit der Frühförderung nicht ständig zu überziehen, da mich die Mutter beinahe jedes Mal mit Fragen zur Erziehung und Entwicklung des Kindes konfrontierte, deren Beantwortung immer viel Raum einnahm. Es kann auch der Fall sein, dass in den Fragen der Mutter zur Erziehung ihre eigenes Bedürfnis nach Hilfe zum Ausdruck kam, und ich zwar auf die vordergründigen Fragen, aber nicht auf die dahinterliegende Einsamkeit der Mutter eingestiegen bin.
In Bezug auf Martins expansives Verhalten und seinen Drang, in Bewegung zu sein und weg von der Mutter zu laufen, versuchte ich, sein Bedürfnis nach der Erschließung der Außenwelt und auch seinen Wunsch nach Autonomie zu sehen. In seinem Bestreben, soviel Zeit wie nur möglich mit seinem Cousin zu verbringen glaubte ich seinen Wunsch nach dem Kontakt zu Gleichaltrigen zu erkennen. Diese Sichtweisen versuchte ich der Mutter nahe zu bringen. Sie bestätigte meine Annahmen teilweise, indem sie erzählte, dass es ihn bei Spaziergängen immer sehr zum Spielplatz hinzog, wenn sich dort andere Kinder aufhielten. Das Problem dabei bestand jedoch darin, dass es der Mutter nicht gut möglich war, anderen Menschen, vor allem anderen Eltern mit Kindern, unbefangen zu begegnen. Sie erzählte mir etwa, dass sie einmal und seitdem nie wieder im Eltern-Kind-Zentrum gewesen sei. Dort hätten die Eltern ja doch nur Kaffee getrunken und um die Kinder hätte sich niemand gekümmert. Das widersprach ganz ihrer eigenen Auffassung und ihrem Anspruch, ganz für die Kinder da zu sein. Sie setzte alles daran, ihren Kindern eine möglichst freie Entwicklung nach ihren eigenen Maßstäben zu gewährleisten und beschäftigte sich während der gesamten Zeit des Frühförderprozesses regelmäßig mit Entwicklungskonzepten wie Montessori-Pädagogik, mit den Bausteinen der Entwicklung nach Jean Ayres und den Erkenntnissen von Maurice und Rebecca Wild.
Als mir die Mutter in einem Gespräch, in dem wir gemeinsam überlegten, wie es für Martin möglich sein könnte, andere Kinder kennen zu lernen, von der Kleinkindgruppe erzählte, die zweimal wöchentlich in dem Ort stattfand, glaubte ich, dass sich hier eine gute Gelegenheit bot. Ich konnte mir gut vorstellen, dass es für Kind und Mutter eine positive Erfahrung sein konnte, sich ein wenig voneinander abzulösen. Ich begleitete die Mutter zu einem ersten Gespräch mit den Leiterinnen der Kindergruppe, die sich bereit erklärten, Martin im kommenden Herbst aufzunehmen und sich auch nach speziellen Spielmaterialien oder Änderungen im Raum erkundigten, die sie für Martins Integration vornehmen könnten. Ich schlug vor allem das Einrichten einer Kuschelecke vor, die den Kindern einen eventuellen Rückzug ermöglicht und Spielmaterialien, die das Experimentieren beim Kind anregen. Es wurde vereinbart, dass man sich im Herbst danach orientieren würde, wie lange es Martin schon möglich sei, in einer so großen Kindergruppe zu verweilen, und dass auch ein stundenweiser Besuch der Kleinkindgruppe für ihn möglich sei. Martins Mutter war zwar eher skeptisch und hatte immer noch große Bedenken, während ich selber eher zuversichtlich war und auch bei Martin große Neugier, wenn auch Ängstlichkeit, wahrnahm.
Im Sommer vor dem Eintritt in die Kindergruppe erlebte ich Martin sehr aktiv und experimentierfreudig und es wurden einige Anstrengungen auch von Seiten seines Vater unternommen, um ihm darin entgegenzukommen - etwa in der Errichtung einer großen Sandkiste im Garten, die Martin viel Bewegungsfreiheit bot und in der er sich oft aufhielt. Ich regte bei der Mutter auch an, dass sie mit Martin auf Entdeckungswanderungen in die nähere Umgebung gehen könnte. Das erschien ihr aber viel zu gefährlich und außerdem sagte sie oft, dass auch Martins kleinre Bruder ihre Aufmerksamkeit brauche und sie sich nicht in der Lage sehe, beide Kinder dabei zu beaufsichtigen. Sie konnte sich auch nicht vorstellen, mit Martin ins Schwimmbad zu gehen, wo so viele andere Menschen sind. So blieb Martin im abgesteckten Rahmen seiner Familie - und ich hoffte auf eine Änderung der Situation im Herbst.
Der Besuch der Kleinkindgruppe war für die Mutter von Anfang an ein Spießrutenlauf. Sie musste Martins kleinen Bruder mitnehmen und war dann damit beschäftigt, beide Kinder innerhalb der Kleinkindgruppe zu beaufsichtigen und zu beschäftigen. Sie hatte große Angst davor, dass Martin ohne sie nicht in der Gruppe bleiben würde und dass er dann weinen könnte. Diese Erfahrung hatte sie mit ihm bei den ersten Ergotherapiestunden schon gemacht. Als die Therapeutin damals vorschlug, sie solle doch während der Therapiestunde weggehen und die Zeit für sich nützen, war sie darauf eingegangen und hatte erleben müssen, dass Martin beinahe die ganze Zeit geweint hatte.
Diese Erfahrung war für sie offenbar sehr traumatisch gewesen und ich weiß nicht, wer eigentlich mehr Angst vor der Trennung hatte: sie selber oder das Kind.
In der Gruppe sah es dann so aus, dass Martin die Anwesenheit seiner Mutter dazu nützte, um mit ihr und seinem Bruder zu spielen, statt mit Gleichaltrigen oder mit den Pädagoginnen. Gleichzeitig gefiel der Mutter die Art und Weise des Umgangs mit den Kindern, den sie bei den beiden Kindergärtnerinnen beobachtete, überhaupt nicht. Sie erzählte oft davon, dass mit dem einen oder anderen Kind nicht feinfühlig genug umgegangen werde oder dass sie es als schlimm erlebe, wenn ein Kind dazu angehalten werde, eine Anweisung zu befolgen. In unseren Gesprächen über den Aufenthalt in der Kleinkindgruppe ging es hauptsächlich um die Empfindungen der Mutter und ihre Ängste. Immer, wenn ich nach den Reaktionen von Martin und danach fragte, wie es ihm denn dort gefalle, hielt die Mutter erstaunt inne und gab zu, dass dieser sich dort recht wohl fühle. Und aus diesem Grund ging sie Woche für Woche wieder mit ihm hin und ertrug die für sie sehr unangenehme Situation, dort als einzige Mutter immer anwesend zu sein. Nach ca. drei Monaten schien dies auch für die Kindergärtnerinnen allmählich ein Problem darzustellen, und sie übten Druck in Richtung der Mutter aus, es doch einmal zu versuchen, Martin in ihrer Obhut zu lassen. In einem Gespräch mit mir wollte die Mutter wissen, ob das denn in Ordnung sei, wenn Martin dann weine. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Sonderkindergärtnerin in einem Integrationskindergarten und den vielen dabei erlebten Szenen der ersten Trennungen von Mutter und Kind in der Kindergarteneingangsphase versuchte ich sie zu beruhigen und ihr solche Situationen zu schildern. Ich sagte ihr aber auch, dass es wichtig sei, dass sie den Kindergärtnerinnen vertraue und dass sie sich letztendlich entscheiden müsse, ob sie soviel Vertrauen besitze und ihr Kind in die Obhut der Betreuerinnen geben könne oder eben nicht.
In diesem Augenblick fing sie zu weinen an. Ich war sehr betroffen und erschrocken. Auf meine Frage, ob ich etwas gesagt hatte, was sie verletzt habe, schüttelte sie nur den Kopf. Sie wollte aber auch nicht mehr mit mir sprechen. Mein Angebot, am selben Tag noch einmal wiederzukommen und über die Situation in Ruhe zu sprechen, lehnte sie ebenfalls ab. Da die Zeit meiner Anwesenheit in der Familie bereits abgelaufen war, blieb mir nichts anderes übrig, als sie in dieser aufgelösten Verfassung zurückzulassen.
In der nächsten Einheit kam ich gleich zu Anfang noch einmal auf die Szene zu sprechen und fragte wieder, ob ich sie mit einer meiner Aussagen verletzt habe. Diesmal gab sie zu, dass es für sie sehr schlimm gewesen sei, als ich gesagt hatte, dass sie sich eben anpassen müsse. Ich konnte mich zwar nicht daran erinnern, diese Formulierung verwendet zu haben, aber es spielte keine Rolle mehr, denn sie hatte dieses Wort gehört und seine Bedeutung hatte in ihr offenbar viele schmerzliche Emotionen ausgelöst.
Im anschließenden Gespräch versuchte ich, auf ihren Schmerz einzugehen und gab zu, dass es schon sein könne, dass ich ihr eher vermittelt habe, sich eben den Regeln zu fügen, die in der Kindergruppe herrschen - vielleicht aus meiner eigenen Art heraus, mit Schwierigkeiten umzugehen und weil ich es sehr wichtig fand, dass Martin in Kontakt mit Gleichaltrigen komme. Ich sagte ihr auch, dass ich es sehr positiv finde, wenn sie sich in ihrem eigenen Weg nicht beirren lasse und auf ihr Gefühl vertraue, was das Beste für die Entwicklung ihrer Kinder sei.
Als wäre dieses Gespräch für sie die Erlaubnis gewesen, das "Experiment Kindergruppe" endlich abzubrechen, beschloss sie in den nächsten Wochen tatsächlich, Martin aus der Kindergruppe herauszunehmen.
Die nächste anstehende Entscheidung betraf ein wichtiges Thema: Martins Integration in einen Kindergarten. Die Mutter zweifelte sehr daran, Martin in den Dorfkindergarten zu geben, da ihre ältere Tochter diesen Kindergarten besucht und ihr einige Jahre später erzählt hatte, wie unwohl sie sich im Kindergarten gefühlt habe und wie schlimm diese Zeit für sie gewesen sei. Einen solchen Fehler wollte die Mutter nicht noch einmal begehen. Ich selber hatte von meiner Kollegin gehört, dass die zuständige Kindergärtnerin in der Integrationsgruppe eine pädagogisch sehr kompetente und sehr engagierte Frau war. Außerdem fand ich es persönlich nicht so gut, von vornherein einen weiter weg gelegenen Kindergarten ins Auge zu fassen, der Martin wiederum keine wohnortnahe Integration ermöglichen konnte. Ich versuchte, die Bedenken der Mutter ernst zu nehmen, schlug ihr aber vor, sich den Kindergarten einmal unverbindlich anzusehen, ein Gespräch mit der Kindergärtnerin zu führen und sich dabei gut zu informieren, bevor sie sich für einen anderen Kindergarten entschied.
Martins Mutter und ich bereiteten uns gemeinsam auf dieses Gespräch vor und überlegten uns Fragen, die wichtig sein könnten. Das tatsächliche Gespräch mit der im Falle von Martins Integration zuständigen Kindergärtnerin verlief aus meiner Sicht sehr gut und auch sehr informativ. Die Kindergärtnerin ging sehr auf die Bedenken und auch auf Schilderungen der Mutter von Martins Schwierigkeiten ein. Die Gesprächsatmosphäre änderte sich jedoch, als die Kindergartenleiterin auftauchte und das Gespräch eher in Richtung der formalen Seite der Integration lenkte. Es erschreckte Martins Mutter sehr, ihr Kind in diesem Fall als "Integrationskind" deklarieren zu müssen. Wir verblieben am Ende des Gespräches so, dass Martins Mutter sich überlegen sollte, ob sie Martin in den Dorfkindergarten integrieren wolle oder nicht. Noch blieb genügend Zeit für diese Entscheidung.
Als ich eine Woche später in die Familie kam, war Martins Mutter sehr aufgeregt und verzweifelt. Sie berichtete mir davon, dass die Kindergartenleiterin sie angerufen und ihr mitgeteilt habe, dass im Falle von Martins Integration eine Elternversammlung einberufen werden müsse, in der die übrigen Eltern von dem Vorhaben von Martins Integration unterrichtet werden sollten.
Martins Integration in einen Regelkindergarten war die erste, mit der ich nach meiner langjährigen Tätigkeit in einem Integrationskindergarten wieder konfrontiert war - und dort herrschte ein anderer formaler Ablauf. Ich konnte mich erinnern, dass der Passus der Elternversammlung tatsächlich im Kindergartengesetz enthalten war und versuchte, der Mutter dies nach meinem damaligen Wissen zu erklären, versprach aber, mich zu informieren. Martins Mutter hatte bei der Ergotherapie eine andere Mutter kennen gelernt, die ihr gesagt hatte, dass diese Elternversammlung nicht mehr stattfinden müsse. Ich fragte bei meinen Frühförderkolleginnen nach, von denen mir aber keine genau sagen konnte, wie die Kindergartenintegration momentan gehandhabt werde und versuchte, bei der Kindergarteninspektorin direkt nachzufragen. Ich erreichte telefonisch aber nur einen Juristen der Kindergarten - und Schulabteilung, der mir bestätigte, dass diese Elterversammlung natürlich laut Gesetz abgehalten werden müsse.
Als ich dann - nach einer Woche Urlaub - wieder in die Familie kam, hatte ich mich - nachdem ich nichts anderes in Erfahrung bringen konnte und nachdem ich der Meinung war, dass eine Kindergartenleiterin, die jedes Jahr mit der Integration von Kindern zu tun hat, eigentlich wissen müses, wie diese abläuft - darauf vorbereitet, der Mutter sagen zu müssen, dass ich persönlich zwar diesen Gesetzespassus für diskriminierend halte, dass sie sich aber darauf einstellen müsse, wenn sie Martin in diesen Kindergarten integrieren möchte. Die Mutter hatte mich offenbar schon erwartet und während ich ihr von meinen Erkundigungen erzählte, lächelte sich mich bitter und sehr distanziert an. Sie sagte, sie habe sich inzwischen bei ihrer Egotherapeutin schon informiert und die habe ihr bestätigt, dass die Elternversammlung seit einiger Zeit nicht mehr zum Aufnahmemodus in einen Kindergarten gehört. Ich war sehr im Zwiespalt, weil ich nicht wusste, ob diese Regelung von Kindergarten zu Kindergarten verschieden gehandhabt wurde und weil ich ihr nichts versprechen wollte, was dann nicht der Wahrheit entsprach. Für die Mutter aber hatte sich damit endgültig bestätigt, was sich rund um Martins Integration in die Kleinkindgruppe schon angekündigt hatte: dass meine Ratschlägen nicht immer richtig waren und dass ich nicht über alles Bescheid wusste.
In der darauffolgenden Zeit konnte ich dann wirklich in Erfahrung bringen, dass der Passus der Elternversammlung zwar noch im Gesetz steht, aber in der Praxis nicht mehr so gehandhabt wird. Die Beratungskindergärtnerin, mit der ich sprach, war sehr verärgert darüber, dass die Kindergartenleiterin die Mutter offenbar absichtlich falsch informiert hatte und gab zu, dass es auch bei den Juristen noch Uneinigkeit darüber gab, obwohl diese bereits über die momentane Handhabung informiert waren. Ich erzählte Martins Mutter davon und entschuldigte mich dafür, dass es mir nicht gleich gelungen war, den richtigen Ansprechpartner in dieser Sache zu finden.
Nach diesem Ereignis bemühte ich mich sehr, das Vertrauen der Mutter wiederzugewinnen, indem ich sehr viele Informationen zu alternativen Möglichkeiten für Martins Kindergartenintegration einholte und ihr eine Liste aller in Frage kommenden Kindergärten erstellte, bei denen sie sich dann weiter erkundigen konnte. Martins Mutter aber zog sich sehr zurück, die Atmosphäre während der Frühfördereinheiten war eisig und wenn ich ihr eine Beobachtung zu Martins Entwicklung mitteilte, gab sie mir schnell das Gefühl, dass daran nichts Besonderes sei. Ich spürte, dass sie sich in meiner Anwesenheit sehr unwohl fühlte und mir erging es kaum anders. Sie hörte mir zwar noch zu, hatte sich aber innerlich ganz distanziert. Oft ging sie nun während der Frühfördereinheiten mit Martins jüngerem Bruder spazieren, beauftragte aber ihr ältere Tochter, während meiner Arbeit mit Martin anwesend zu sein, was ich als Kontrolle empfand. Meine Unsicherheit wuchs und ich versuchte, sie durch noch mehr Einsatz wett zu machen.
Bei einem interdisziplinären Gespräch mit Martins Ergotherapeutin spürte ich, wie diese sehr einfühlsam die Situation der Mutter nachvollziehen konnte, was mir schon gar nicht mehr gelang. Sie erzählte mir auch davon, dass sie der Mutter bereits mehrmals nahegelegt hatte, für sich selber eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, wozu sie sich jedoch nicht entschließen konnte.
Als ich der Mutter von dem gemeinsamen Gespräch mit der Ergotherapeutin und unseren gemeinsamen Beobachtungen und Überlegungen zu Martins Entwicklung berichtete, gab sie mir deutlich zu verstehen, dass sie zwar sehr viel von der Ergotherapeutin hielt, nicht aber von mir. Sie meinte, dass sie sich überlegt habe, dass sie die Frühförderung gerne noch vor Martins Kindergarteneintritt beenden würde, weil er ja sowieso schon zur Ergotherapie ginge und dann ja noch zusätzlich den Kindergarten besuchen werde, für den sie sich mittlerweile entschieden hatte.
Ich sagte ihr, dass ich es auch ganz wichtig fände, darauf zu achten, dass Martin durch die Förderangebote nicht überfordert werde, während mir gleichzeitig klar war, dass ihre Entscheidung letztlich nichts mit Martin, sondern mit meinem Versagen in ihren Augen zu tun hatte.
Diese Erkenntnis empfand ich als sehr schmerzlich und ich bat sie deswegen um ein Gespräch, in dem ich meine Vermutung äußern und versuchen wollte, mit ihr doch noch einen gemeinsamen Weg zu finden.
Das Gespräch fand erstmals an der Frühförderstelle statt und bot mir von der Atmosphäre dadurch einen etwas entspannteren Rahmen als bei der Familie zu Hause. Als ich die Mutter - wie schon bei meiner Einladung zu diesem Gespräch - bat, mit mir noch einmal über den Verlauf der Frühförderung zu reflektieren, war sie sehr erstaunt und sagte, sie hätte sich erwartet, "dass ich ihr etwas erzähle".
Mir fällt hier auf, dass unsere bisherigen Gespräche wohl oft so verlaufen waren, dass sie mich fragte und ich daraufhin "erzählt" hatte, d.h. Ratschläge erteilt, Entwicklungsaufgaben im frühen Kindheitsalter näher erklärt oder ihr meine Beobachtungen zu Martins Verhalten nahegebracht hatte.
Ich versuchte, ihr unseren Konflikt aus meiner Sicht noch einmal darzulegen und nachzuvollziehen, wie es dazu gekommen war und was dabei in ihr vorgegangen war. Offensichtlich wuchs sich meine Darstellung aber zu einer Rechtfertigung aus, da die Mutter mir entgegnete: "Und, soll ich dich jetzt bemitleiden?"
Ich spürte, dass sie mir meinen Fehler nicht verzeihen konnte und kam auf die Erwartungen zu sprechen, die sie in Bezug auf die Frühförderung gehegt hatte. Dabei kam deutlich zum Ausdruck, dass sie sich von mir als Frühförderin erwartet hatte, dass ich genau wisse, was zu tun sei und dass ich ihr den Weg vorgeben konnte, den es zu gehen galt. Als ich erklärte, dass ich immer nur Vorschläge machen oder mit ihr gemeinsam verschiedene Möglichkeiten diskutieren und abwägen könne, dass aber letztendlich nur sie als Mutter entscheiden könne, was sie tun möchte, schien ihr dies eine ganz neue Sichtweise zu sein. Ich versuchte ihr am Beispiel von Martins Aufenthalt in der Kleinkindgruppe zu zeigen, dass dieses Unternehmen auch dadurch gescheitert war, dass ich versucht hatte, ihr meinen Weg vorzugeben. Sie reagierte mit ehrlichem Erstaunen auf diese Sicht von Beratung als Begleitung und nicht als Allheilmittel. Ich erinnerte sie aber auch an die vielen Situationen, in denen ich ein weiterführendes Gespräch mit ihr alleine vorgeschlagen hatte, was sie aber immer wieder als unnötig abgelehnt hatte. In diesem Punkt gab sie mir Recht. Mir wurde klar, dass es dieses Gespräch am Anfang gebraucht hätte und es nun viel zu spät kam. Die Enttäuschung der Mutter war viel zu groß, als dass sie sich noch einmal auf mich hätte einlassen können.
Als wir überlegten, wie es nun weitergehen sollte, äußerte die Mutter klar, dass ich zwar noch zu Martin kommen könne, bis er in den Kindergarten eintrete, dass sie aber kein Gespräch mehr mit mir führen wolle. Ich sagte, dass es für mich ganz wesentlich sei, mit ihr über Martins Entwicklung sprechen zu können und es mir unter diesen Umständen nicht mehr möglich sei, die Frühförderung weiterzuführen. Es war für mich sehr schmerzlich, das sagen zu müssen, aber ich spürte, dass ich auch an meine Grenzen gestoßen war. In meiner damaligen emotionalen Verfassung war es mir nicht mehr möglich, den Frühförderprozess im Wissen um die Ablehnung durch Martins Mutter weiterzuführen.
Wir vereinbarten die Beendigung der Frühförderung.
In meiner Schilderung der Ereignisse während der existenzanalytischen Supervision fiel der Gruppe auf, dass die Mutter darin den größten Raum eingenommen hatte, während ich kaum vom Kind erzählt hatte. Das entspricht auch meiner eigenen retrospektiven Wahrnehmung davon, dass es in der Frühförderung selber viel häufiger um die Schwierigkeiten der Mutter gegangen war und sie diejenige war, die Hilfe und Begleitung gebraucht hatte. Dieser Umstand belegt vielleicht aber auch die Notwendigkeit einer Familienbegleitung in der Frühförderung.
Hans Weiß stellt in seinen Überlegungen fest, dass es für die Frühförderin schwierig sein kann, in der Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eltern und denen des Kindes oder anderer Familienmitglieder ein Gleichgewicht zu finden. (vgl. Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 43)
Mir selber fiel während meiner Schilderung des Frühförderprozesses in der Supervision noch einmal sehr stark die Isolation der Mutter auf, die in vielen Bereichen stattfand: in der Familie selber als Zuständige für Erziehungsangelegenheiten, in ihrer Ehe, nachdem ihr Mann sich so viel wie möglich außerhalb des Hauses aufhielt und sie bei vielen Entscheidungen allein ließ, in ihrer Herkunftsfamilie, wo sie viel Kritik erntete und in der sie vergeblich um Anerkennung zu kämpfen schien, in der Familie ihres Mannes, in der sie abgelehnt wurde und als hochnäsig galt, im Dorf, wo sie eigentlich zu niemandem wirklich Kontakt hatte.
Vielleicht war Martin als das auffällige, von der Norm abweichende Kind das äußere Symbol für diesen Mangelzustand, den die Mutter wohl schon seit ihrer eigenen Kindheit erlebt hatte.
Gleichzeitig klang in vielen ihrer Äußerungen über andere Menschen ebenfalls Abwertung und Ablehnung durch, was vielleicht ein Projektion ihrer eigenen erlebten Abwertung und Ablehnung darstellte und letztlich nur ihre große Angst vor zwischenmenschlichen Begegnungen und ihre bisherigen schlechten Erfahrungen zum Ausdruck brachte.
Andreas Fröhlich beschreibt die Möglichkeit der Projektion der unerträglichen Gefühle und Schwäche der Eltern auch auf das Kind: nicht die eigenen inneren Ängste und Schwächen sind dann Ziel der Ausrichtung der Maßnahmen, sondern die äußere Schwäche und die Behinderung des Kindes, deren Behebung mit allen Mitteln angeregt wird. (vgl. Fröhlich 1993)
Ich denke, dass Martins Mutter viele ihrer eigenen Sozialängste auf ihr Kind übertragen hat.
Mit Martin war sie nun berechtigt eine Außenseiterin und umso mehr band sie sich an ihr Kind bzw. ihr Kind an sich und ließ ihre beiden Kleinkinder keinen Augenblick aus den Augen.
Aus dieser Sicht wäre verständlich, warum Martin so beharrlich einen Ausweg, eine Fluchtmöglichkeit aus diesem Käfig gesucht hatte und immer wieder dabei gewesen war, wegzulaufen. Er folgte damit wahrscheinlich auch dem Beispiel seines Vaters. Wenn man der psychoanalytischen Sichtweise folgt, nachdem das Kind durch das Vorbild des Vaters einen autonomen Umgang mit der Mutter erlernt, dann musste dies für Martin bedeuten, dass er sich nur von der Mutter lösen konnte, indem er vor ihr flüchtete. Wie war das dann aber, wenn ihm diese Ausbruchversuche nicht gelangen und er dableiben musste, an die bedürftige Mutter gefesselt? Wären aus dieser Sicht auch seine Schreiphasen und sein wildes, expandierendes Verhalten sowie seine Tendenz, sich selber zu verletzen, besser zu verstehen? Martin war als Kind der Symptomträger in der Familie, in der vielleicht alle gerne geflüchtet oder aggressiv geworden wären - er hat es ausgelebt und musste therapiert werden.
"Einerseits werden frühe Eltern-Kind-Störungen [..] vorrangig im Sinne einer Krise als Reaktion auf die Geburt eines behinderten Kindes interpretiert, wohingegen andererseits psychische Auffälligkeiten des geschädigten Kindes nicht selten als symptomatisch für die Behinderung selbst angesehen werden" (Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 84).
Wie sah es mit der eigenen Wahrnehmung der Mutter aus, wenn bei Martin schon eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung vermutet wurde?
Die Mutter sah ihre personale Umwelt sehr negativ, in manchen ihrer Meinungen klangen fast schon paranoide Züge durch. In ihren Augen erzogen alle übrigen Eltern ihre Kinder schlecht, beaufsichtigten sie zu wenig oder waren zu streng, zu fordernd. Dahinter steckte ihre eigene große Angst, ihre Kinder nicht genügend zu respektieren und sie einzuschränken bzw. sie zu etwas zu zwingen, was sie selber nicht wollten. Außerdem schien mir, dass sie es als unrecht empfand, ihre Kinder sich selber zu überlassen. Das war es auch, was sie am meisten störte beim Gedanken an die Eltern im Eltern-Kind-Zentrum, die sich in ihren Augen nicht genug um ihre Kinder kümmerten.
Alle meine Versuche, Martins Isolation aufzubrechen und Kontakte zu anderen Menschen und vor allem zu Spielkameraden für ihn anzuregen, mussten an der großen Angst der Mutter scheitern. Martins eigene Angst vor anderen Menschen, seine Angst, alleine ohne die Mutter zu bleiben, war im Grunde die Angst der Mutter. In diesem Sinne spielten wahrscheinlich auch die Phantasien der Mutter bezüglich der Integration ihres Kindes in eine Gemeinschaft eine große Rolle. Sie konnte ihn nirgendwo alleine lassen, vertraute niemandem ihr Kind an. Und das war es auch, was sie eigentlich dazu veranlasste, bei jeder Frühförderstunde und in jeder Therapiestunde anwesend zu sein. Sie hätte mir ihr Kind nicht alleine überlassen können. Ihre Erfahrungen mit anderen Menschen müssen für sie sehr traumatisierend gewesen sein und prägten alle ihre Vorstellungen von zwischenmenschlichen Beziehungen auch in der Gegenwart.
"Die Person verfügt über ein internes Erfahrungsmodell (Schneewind 1991), das die ‚subjektiven Repräsentationen, die eine Person von sich, ihrer Umwelt und den Beziehungen zu ihrer Umwelt zu einem bestimmten Zeitpunkt' (Schneewind 1991, S 106) umfaßt" (Steinebach 1995, S 43). Steinebach spricht sich dafür aus, dieses jeweils individuelle interne Erfahrungsmodell der beteiligten Personen in der Frühförderung zu berücksichtigen.
Was ängstigte die Mutter am meisten im Hinblick auf ihr Kind? Einerseits war es die Vorstellung, dass man es zwingen könnte, sich an die Gemeinschaft der übrigen Kinder gegen seinen Willen anzupassen, dass man Martin auch bestrafen könnte dafür, dass er sich nicht fügt. Andererseits hatte sie aber auch Angst, er könnte nicht akzeptiert, sondern abgelehnt werden und keine Freunde finden. Ich denke, dass man auf diese Weise auch ihre eigenen Ängste hätte beschreiben können.
Die existenzanalytische Supervisorin machte mich darauf aufmerksam, dass ich die Probleme der Mutter nicht richtig eingeschätzt hatte, bis ich mit ihr in Konflikt kam. Dieses Verhalten entspricht wahrscheinlich meiner eigenen Sichtweise von der Welt, in der alle zunächst einmal positiv und gut sind.
Hier bestätigt sich meiner Ansicht nach eine Annahme von Hans Weiß. Weiß meint, dass Fachleute und Eltern sich in einer völlig unterschiedlichen Lebenssituation befinden und ihre Lebenswirklichkeit und damit auch ihre Betroffenheit eine völlig andere ist. Dadurch besteht die Gefahr, dass Fachleute die existentiellen Fragen der Eltern eher ausblenden, ihnen aus dem Weg gehen. ( vgl. Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 51)
Mit dem Wort anpassen habe ich in ihr an etwas gerührt, was wahrscheinlich mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihrer momentanen Situation als Mutter eines von Behinderung bedrohten Kindes zu tun hatte. Ich habe damit vielleicht alte Wunden aufgerissen, über die sie aber nicht sprechen und die sie sich nicht genauer ansehen wollte. Die Tränen würden dafür sprechen, dass ich sie an etwas erinnert habe, das für sie sehr schmerzvoll war.
"Die Behinderung des Kindes erinnert unbewusst an das eigene infantile Trauma, sich selbst als Kind (in Teilen) abgelehnt erlebt zu haben. Um also selber der Wiederbelebung der eigenen seelischen Wunden durch früh erlebte Kränkungen zu entgehen, darf die Bearbeitung der Projektionen auf die kindliche Behinderung nicht zugelassen werden." (Gerspach in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 13)
Was bedeutete anpassen für sie? Vielleicht verschwinden, nicht mehr existieren, keine eigene Identität mehr zu haben? Bedeutete entscheiden für sie, dass dadurch viele andere Möglichkeiten verloren gingen?
In Martins Störung zeigten sich noch einmal alle Ängste der Mutter.
Das Zustandekommen seiner Entwicklungsauffälligkeiten war vielleicht auch das Ergebnis eines Zusammenwirkens von neurologischer Störung bzw. organischer Determiniertheit und elterlicher Unsicherheit. Martins Mutter berichtete mir in einem unserer Gespräche von Komplikationen gegen Ende der Schwangerschaft, die sie sehr geängstigt hatten und in ihr die bange Befürchtung zurückließen, dass ihr Kind dabei Schaden genommen haben könnte. Gisela Schleske meint dazu, dass durch unvorhergesehene Komplikationen während der Schwangerschaft das vorgeburtliche Kommunikationssystem zwischen Mutter und Kind gestört und verunsichert und dadurch große Angst hervorgerufen werden kann. Diese Angst kann weiter verunsichernd auf die Mutter-Kind-Beziehung wirken, auch wenn das Kind "gesund" geboren wird. Oft erfolgt dann im ersten oder zweiten Lebensjahr des Kindes tatsächlich die Feststellung einer Entwicklungsauffälligkeit.
"Eine Mutter, die sich als kompetente Mutter für das ungeborene Kind fühlt, nimmt sich später eher auch als kompetente Mutter für das Baby wahr" (Schleske in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 34) - was bedeutet, dass sich eine Mutter, die sich ihrem ungeborenen Kind gegenüber ängstlich und unsicher fühlt, sich auch später nicht als kompetent wahrnimmt.
Vielleicht verhielt Martin sich von Beginn an anders als ihr erstes Kind und vielleicht machte er es seiner Mutter schwer, seine Signale als Säugling richtig zu deuten. Die Unsicherheit der Mutter verstärkte nun die Unsicherheit beim Kind, es entstanden wahrscheinlich viele Missverständnisse. Die Wahrnehmung beim Kind entwickelte sich nicht so verlässlich, weil die Mutter seine Äußerungen häufig nicht richtig spiegeln konnte. (Missverständnisse würde ich auch in der Beziehung zwischen der Mutter und mir sehen: was meine Aufgabe betrifft, die Funktion von Beratung, den Sinn des letzten Gespräches, etc.)
Dieses Zusammenspiel könnte Martins Entwicklungsrückstand erklären.
Wie steht es mit seinem erheblichen Sprachrückstand?
Eine mögliche Erklärung liegt vielleicht in der Mutter-Kind-Dyade, die üblicherweise durch Dritte erweitert wird, wodurch das Kind fähig wird, sich Symbole anzueignen, zu denen letztlich auch die Sprache gehört. Die Mutter tat sich vielleicht überhaupt schwer, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu kommunizieren, ihn zu verstehen. Im Frühförderprozess war sie sehr dankbar für alle Sprachangebote und Vorschläge in diese Richtung. Auffallend war auch die rasante Sprachentwicklung von Beginn der Frühförderung an. Mit den Angeboten bekam Martin die Möglichkeit, sich auszudrücken und auch verstanden zu werden und mit der Dreiersituation in der Frühförderung kam Martin ein wenig aus der engen Mutter-Kind-Beziehung heraus, konnte die Welt entdecken, was ihm vorher durch die enge Bindung an die Mutter und ihre Überbesorgtheit gar nicht möglich war.
War es für die Mutter wichtig, dass Martin das auffällige Kind blieb, womit sie selber ja auch eine besondere, wenn auch isolierte Position einnahm? Bestätigte dieses Kind ihre Wahrnehmung von sich selber, die Rolle, die sie immer schon eingenommen hatte? Mannoni geht davon aus, dass das Kind eine bestimmte Funktion in den Phantasmen der Mutter einnimmt, die wiederum die Ausbildung seiner Identität, seines Bildes von sich selber, beeinflussen.
Auffallend war auch die Spaltung in der Wahrnehmung der Mutter, ihr Schwarz-Weiß-Denken. Sie teilte Personen ein in gute und böse Menschen. Anfangs hat sie mich idealisiert, alles aufgesaugt, was ich gesagt habe, alles umgesetzt, mir alles geglaubt, ich war die Allmächtige, die Rettung bringen kann. Eigentlich hat sie alles umgesetzt, was ich gesagt habe, sie hat es zwar immer kritisch hinterfragt, aber dann auch ausprobiert - bis auf die Struktur im Tagesablauf, deren konsequente Umsetzung ihr große Probleme bereitete. Am erstaunlichsten finde ich es im Nachhinein, dass sie auch meine Versuche mitgemacht hat, Martin und damit auch sie selber bei der Integration in ihren Heimatort zu unterstützen - trotz ihrer großen Ängste.
Hier kommt wieder der Hoffnungsaspekt in der Frühförderung ins Spiel, den ich für sehr wichtig halte für das Verständnis von Abläufen in der Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern und den Weiß meiner Meinung nach sehr treffend beschreibt.
"Die Frühförderung versteht sich als fachliche Hilfe, die zur Entwicklung des Kindes und zum Wohlergehen der gesamten Familie beizutragen sucht. Sie verheißt damit Eltern (und Fachleuten) Hoffnung, nährt den Glauben, gegen Behinderung und ihre Folgen etwas bewirken zu können. Aber sie läuft damit Gefahr, sich von der ‚negativen' Seite im Spannungsfeld ambivalenten Erlebens der Eltern (an dem Fachleute Anteil haben) zu entfernen: von ihrer Not, daß das Kind trotz möglicher Fortschritte behindert bleiben, daß es auf Ablehnung stößt, von ihrer Enttäuschung, existentiellen Verunsicherung, Verzweiflung und Ohnmacht - trotz fördertechnischer Beeinflußbarkeit. Dies ist nicht das Ergebnis bewußten Handelns: im Bemühen, Hoffnung zu konkretisieren, auch aus der Angst, in Ausweg- und Mutlosigkeit, Resignation und Depression hineingerissen zu werden, können Früherzieherinnen/Therapeutinnen vielmehr in Situationen geraten, die für sie nur mehr durch Agieren bewältigbar erscheinen. Dadurch aber bleibt Eltern nur wenig Raum, ‚negative' Aspekte ambivalenten Erlebens, z.B. ihre Wut auf die Behinderung und auf das Kind sowie damit zusammenhängende Schuldgefühle, intersubjektiv und intrapsychisch ‚zur Sprache' zu bringen" ( Weiß in Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. 1991, S 98).
Hier wird auch noch einmal mein eigenes Verhalten deutlich. Als Frühförderin versuchte ich, den Ängsten der Mutter mit Taten, mit konkreten Vorschlägen, mit Handlungen zu begegnen, anstatt mich wirklich auf ihre emotionale Lage einzulassen und Probleme auf dieser Ebene anzusprechen.
Johannes Gstach bringt hier einen Vorschlag ein, wie man mit Anfragen der Eltern umgehen könnte. "Fragen der Eltern, die zunächst recht harmlos klingen, sollten vom Frühförderer in einen größeren Zusammenhang gestellt werden" (Gstach 1996, S 119). Er betont die Wichtigkeit, als Frühförderin den Hintergrund von Fragen sehen zu können, die von den Eltern kommen. "Meist genügt es, das gegenwärtige Problem, mit dem die Eltern den Berater konfrontieren, in den Kontext zu den kindlichen Erlebnissen der Eltern zu stellen" (ebd. S 119). Wenn Gstach von den kindlichen Erlebnissen der Eltern spricht, so bezieht er sich hier auf Fragen der Eltern bezüglich der frühesten Entwicklung des Kindes. Ich würde aber sagen, dass es allgemein wichtig ist, den Kontext zur Geschichte und den Erfahrungen der Eltern zu sehen, um ihre Reaktionsweisen besser verstehen zu können.
Was Elternberatung betrifft, meint Gstach auch, dass es manchen Eltern nicht so leicht möglich sein wird, die Mitteilungen der Frühförderin aufzunehmen. Manche Eltern können diese Hilfe als Unterstützung sehen, andere fühlen sich vielleicht noch zusätzlich zu den Anforderungen, die das Kind mit seinem Verhalten an sie stellt, von den Ratschlägen der Frühförderin verfolgt und unter Druck gesetzt. (vgl. ebd. S 119)
Dabei muss man vielleicht auch die generelle Ambivalenz beachten, die Eltern Förderangeboten entgegenbringen können.
"Die Eltern wünschen sich einerseits Information und Anleitung, erleben die Ratschläge dann aber als Vorwurf und Kränkung" (A. Fröhlich 1993, S 89).
Hilfsangebote können von den Eltern demnach leicht als Überforderung oder als Maßregelung erlebt werden - vor allem dann, wenn sie bei ihrer Umsetzung auf eigene Schwächen stoßen. Martins Mutter tat sich schwer, ihren Kindern Grenzen zu setzen, ihnen eine bestimmte Struktur vorzugeben. Ich denke, dass sie über wenig Halt in sich verfügte und sie deshalb auch Halt in den äußeren Strukturen nicht so leicht finden und ihren Kindern geben konnte. Auf ihre Fragen danach, wie sie denn ihren Alltag für Martin besser strukturieren könne, machte ich ihr jedes Mal viele verschiedene Vorschläge. Beim nächsten Mal berichtete sie dann davon, dass nichts funktioniert habe. Anstatt mit ihr der Frage genauer nachzugehen, was ihr denn Schwierigkeiten bereitet hatte, bezog ich diese Frage ausschließlich auf die Qualität meiner Vorschläge, geriet selber unter Druck und suchte nach besseren Möglichkeiten. Beim nächsten Mal ließ die Mutter dann ihre ältere Tochter danach fragen, was sie denn mit Martin den ganzen Tag so alles tun könnte - und ich kramte wieder in meiner Ideenkiste. So kann sich ganz leicht ein Kreislauf der gegenseitigen Erwartungen und des gegenseitigen Leistungsdruckes aufbauen. Gebraucht hätte es in dieser Situation eher ein Gespräch über die faktische und emotionale Belastung der Mutter, über ihre Überforderung und über Möglichkeiten, die ihr selber wieder Entlastung bringen konnten.
Der Supervisor in der Frühförderung machte mich bei einer Schilderung des Frühförderprozesses einmal darauf aufmerksam, dass ich eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt hatte als die Mutter. Sie hatte die Auffassung: Die Welt ist grundsätzlich schlecht. Ich hingegen wollte sie vom Gegenteil überzeugen: Die Welt ist gut. Das war natürlich in keiner Weise kompatibel und musste letztendlich zur Krise führen.
Die Mutter hat sich immer doppelt abgesichert und so die Ergotherapeutin und mich in gewisser Hinsicht auch gegeneinander ausgespielt. Sie fragte uns jeweils nach denselben Dingen und verglich uns immer wieder miteinander. Dadurch entwickelte ich ein Konkurrenzverhalten, habe mich ständig hinterfragt und mich durch die Bemerkungen der Mutter wie: "Die Ergotherapeutin arbeitet aber ganz anders als du ... nein, nein, nicht schlechter ... aber halt ganz anders", sehr verunsichert bzw. in Frage gestellt gefühlt. Dabei hatte ich persönlich immer den Eindruck, dass sich unsere Arbeitsweisen und Überzeugungen von der kindlichen Entwicklung sehr ähnelten.
Die Mutter hielt mich lange Zeit für die Wissende, die Allwissende bzw. wollte mich gerne so wahrnehmen, weil sie sich von mir Lösungen, eindeutige Ratschläge und Rezepte erhoffte. Unser Abschlussgespräch kam in vielerlei Hinsicht zu spät. Erst angesichts der verfahrenen Situation war es mir möglich, über den Sinn von Beratung und die Rolle einer Beraterin mit ihr offen zu sprechen und auch zuzugeben, dass eine Beraterin nicht von vornherein Lösungen parat hat, sondern eher eine Begleiterin auf dem Weg hin zu einer Entscheidung sein kann. Mit meinem Nicht-Wissen habe ich sie schwer "ent-täuscht", habe sie der Täuschung beraubt, ich sei ihre Rettung. In der Folge hat sie mich von dem Thron gestoßen, der schon immer auf unsicherem Grund stand. Sie musste mich entwerten und fallen lassen, nachdem ich ihren Erwartungen nicht entsprochen hatte.
Einige Zeit vorher hatte bereits die Spaltung stattgefunden: hilfreiche, gute Ergotherapeutin, hilflose, böse Frühförderin. Indem ich mich in meinem Bemühen um Neutralität in ihren Augen auf die Seite der Kindergärtnerinnen und damit auf die Seite der verurteilenden Instanz stellte, habe ich sie im Stich gelassen, habe ich mich gegen sie gewandt, bin ihr in den Rücken gefallen und war plötzlich auf der Seite ihrer Feinde wiederzufinden. Diesen Verrat und Vertrauensbruch konnte sie mir auch nicht mehr verzeihen.
Wir hielten es zum Schluss beide nicht mehr aus, miteinander zu sprechen. Ich erlebte aus meiner Sicht eine kalte, schweigende, ablehnende, vernichtende Atmosphäre, in der ich nicht mehr arbeiten konnte.
In der Frühförderarbeit wäre eine Trennung von Mutter und Kind sinnvoll gewesen. Vielleicht hätte ich in der geschützten Atmosphäre der Frühförderbeziehung die bevorstehende Loslösung des Kindes von der Mutter im Rahmen des Kindergartenbesuches vorbereiten können. Gleichzeitig hätte ich dann auch die auftauchenden Ängste der Mutter mit ihr bearbeiten und besprechen können, sodass wir ganz von selber beim eigentlichen Thema angelangt wären. Auf diese Idee bin ich aber gar nicht gekommen, weil die Bedürftigkeit und das Wissen-Wollen bei der Mutter so im Vordergrund standen. Sie hat mich mit vielen Fragen konfrontiert, und ich bin bereitwillig auf sie eingegangen - ich habe schnell auf ihre Not geantwortet. Es war mir nicht klar, dass ich ihr das, was sie von mir haben oder hören wollte, gar nicht geben konnte.
In der Gegenübertragung habe ich sehr wohl die Angst und die Verzweiflung, die Unsicherheit der Mutter gespürt, habe sie ebenfalls als Angst und als Versagensgefühle wahrgenommen. Reagiert habe ich darauf aber mit Aktivismus. Ich war schnell dabei, Vorschläge für das Handeln der Mutter zu machen, habe oft alle mir bekannten Möglichkeiten aufgezählt, wie die Mutter den Tagesablauf mit dem Kind gestalten könnte. Vielleicht wäre es aber viel mehr darum gegangen, ihr zu signalisieren, dass das wirklich sehr schwer war, den Verhaltensauffälligkeiten des Kindes zu begegnen, damit geduldig umzugehen und die Unruhe und Hektik auszuhalten, die sich oft ergab. Ich hätte viel mehr ansprechen müssen, wie es ihr dabei eigentlich erging, wie sie das aushalten konnte, was genau ihr Probleme bereitete. Und vor allem hätte ich mit ihr gemeinsam nach der Antwort auf die Frage suchen sollen, was Martin mit seinem Verhalten sagen wollte, was er damit ausdrücken wollte. Das Warum seines Verhaltens beschäftigte die Mutter ja sehr. Ich habe aber den Verdacht, dass sie nicht hören wollte, dass ihr Kind dabei war, sich Spielraum und Freiräume zu schaffen, sondern dass sie eigentlich nur die Diagnose der Wahrnehmungsstörung von mir bestätigt haben wollte. Diese Absicht lag wohl hinter ihren Schilderungen von den Schwierigkeiten im Alltag, wenn eine Verkäuferin sich darüber aufregte, dass Martin im Geschäft herumrannte und -hüpfte oder wenn ihre Verwandten wieder einmal bemerkten, dass an Martins Verhalten nur sie alleine mit ihrem "Getue" schuld war. Sie wollte von mir wissen, ob sie immer allen erklären solle, was mit Martin nicht stimme. Ich denke, dass sie sich in solchen Momenten von mir die Bestätigung der im Grunde auch in den Befunden sehr vage formulierten Diagnose der Wahrnehmungsverarbeitungsstörung erhoffte. Damit hätte und habe ich sie ja auch immer wieder von dem Verdacht ihrer eigenen Schuld an Martins Schwierigkeiten losgesprochen.
Ihre eigenen Ängste hätten in der Frühförderung zum Thema werden sollen, nicht Martins Ängste, die wahrscheinlich schnell verschwunden wären, wenn seine Mutter gelernt hätte, mit ihren eigenen Ängsten umzugehen bzw. ihnen zu begegnen.
Ich hätte sie schon früher enttäuschen sollen, das auch ansprechen und klar machen, was ich real tun kann und was nicht, was meine Rolle ist. Aber es stärkt natürlich den eigenen Narzissmus, wenn man um Rat gefragt und bestärkt wird, wenn jemand die Hoffnung und Erwartung in einen setzt, dass man helfen kann. Aber echte Hilfe ist eben die Hilfe zur Selbsthilfe. Am Beispiel von Martins Mutter sieht man deutlich, wie schnell man als Frühförderin in die Gefahr gerät, Rezepte auszuteilen, Konzepte und Regeln zu vermitteln und sich auch selber an Programme zu halten, anstatt das Leid auszuhalten und auch in der Angst und im Schmerz noch dazusein und dabei die eigene Unwissenheit oder Hilflosigkeit zuzulassen. Aber: Ist das überhaupt so leicht möglich, ohne den Abbruch der Frühförderung zu riskieren? Vielleicht dann, wenn man es von Anfang an thematisiert und nicht in die Spirale von Schuld- und Versagensgefühlen gerät, in den Strudel von Gegenübertragungsgefühlen.
Weiß nimmt in seinen Betrachtungen einen für mich sehr wichtigen Gedanken von Schlack mit auf, der meint, dass gerade eine kindzentriert arbeitende Frühförderin, die sehr sensibel die Situation des Kindes wahrnimmt, eher in Gefahr gerät, an die Eltern hohe Anforderungen zu stellen und bestimmten elterlichen Einstellungen oder Verhaltensweisen gegenüber sehr unduldsam zu sein. (vgl. Weiß in Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e.V. 1997, S 44).
Ich denke, dass auch mir dies mit Martins Mutter so geschehen ist: Ich habe hauptsächlich die Not des Kindes gesehen und von der Mutter gefordert, dass sie ihre eigenen Ängste zum Wohl des Kindes einfach aufgibt, was so natürlich nicht möglich war.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals Elbert zitieren. "Voraussetzung für eine erfolgreiche Loslösung und Errichtung eines inneren Selbstbildes, für Erlangen von Autonomie und Empathie, ist die ‚Erlaubnis' und Unterstützung der Mutter, ohne die das Kind in der symbiotischen dualen Beziehung gefangen bleibt und in seinem Autonomiestreben auf eine ichbezogenen Agitation zurückgeworfen wird" (Elbert 1982, S 77/78).
Dieses Beispiel zeigt aber neben dem Stellenwert, der der Symbioselösung innerhalb der Frühförderung zukommt, auch, wo die Grenzen der Frühförderin liegen. So sieht Gstach so eine Grenze, wenn Probleme der Eltern von eigenen verdrängten psychischen Konflikten herrühren. In diesem Fall braucht die Frühförderin psychotherapeutische Kompetenzen, um mit der Situation adäquat umgehen zu können. (vgl. Gstach 1996, S 120)
Weiß stellt fest, dass vor allem bei tiefgreifenden, lebensgeschichtlich begründeten "Wahrnehmungsstörungen der Eltern hinsichtlich der kindlichen und ihrer eigenen Bedürfnisse und bei Irritationen der Eltern durch entwicklungs- oder behinderungsbedingte (Verhaltens-) Auffälligkeiten ihres Kindes" (Weiß 2000, S 189) kontinuierliche Angebote und ein "langer Atem" in der Frühförderung nötig sind.
Dass ich diesen langen Atem im konkreten Fall der Familie A am Ende nicht mehr besessen habe, tut mir im Nachhinein sehr Leid. In der damaligen Situation hatte ich für mich persönlich aber keine andere Handhabe mehr, als die Zusammenarbeit zu beenden. Es zeigt vielleicht auch, wie schwer es für eine Frühförderin sein kann, sich eingestehen zu müssen, dass ein Konflikt in der Frühförderarbeit nicht mehr von ihr gelöst werden kann, dass sie einem Problem hilflos gegenüber steht und dass es in so einem Fall gut wäre, sich diese Schwierigkeit früher einzugestehen, um einen eventuellen Wechsel der Familie zu einer anderen Frühförderin zu ermöglichen.
Dass es in der Frühförderung in erster Linie darum geht, die Familie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, den, der auf den Ressourcen und Möglichkeiten und auf der tatsächlichen Bereitschaft der Familie basiert und nicht auf den Vorstellungen der Frühförderin, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die ich aus der Zusammenarbeit mit Familie A gewinnen konnte.
Anna kam in meine Betreuung, als meine Kollegin beschlossen hatte, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und mir einige der von ihr betreuten Familien zu übergeben. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir die Übergabe in der Familie gemeinsam mit den Eltern vornehmen würden.
Meine Kollegin gestaltete die letzte Einheit mit Anna und ich konnte als Beobachterin daran teilnehmen. Anna war zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt, von ihrem körperlichen Erscheinungsbild her aber sehr zart und klein für ihr Alter. Sie hatte Schienen als Stütze an den Beinen, die sie aber beim Gehen sehr behinderten. Der ärztliche Befund sprach bei Anna sowohl von einer progressiven Muskeldystrophie als auch von einer Mikrocephalie. Erst vor einem Jahr hatte sie das Gehen erlernt und war nun ständig auf den Beinen und in Bewegung. Das Aufstehen vom Boden bzw. das Hinsitzen oder Hinknien konnte sie nicht ohne Hilfe bzw. ohne sich anzuhalten bewältigen. Sie sprach nur wenige Worte, konnte sich damit aber ihrer Familie sehr gut verständlich machen. Ihr Spielverhalten war von Einräum- und Ausräumspielen geprägt, und ein besonderes Problem bestand darin, dass Anna sehr oft Spieldinge und andere Gegenstände durch die Gegend warf. Es war nicht ganz klar, was sie damit bezweckte, aber meine Kollegin sah den Grund darin, dass Anna dann entweder gerade überfordert war oder von sich aus mit einem Spielmaterial nichts mehr anzufangen wusste. Für die Familie stellte dieses Verhalten ein großes Problem dar, da Anna manchmal auch Tassen und Teller ohne Vorwarnung vom Tisch warf.
Die Mutter begrüßte uns eher neutral. Es schien ihr nicht so viel auszumachen, dass die Person der Frühförderin wechseln würde. Sie warf einen Blick auf das mitgebrachte Material und begleitet uns in das sehr beengte Wohnzimmer. Dann bemerkte sie, noch sehr viel zu tun zu haben und verabschiedete sich schnell.
Während der Förderstunde hielt Anna meine Kollegin sehr auf Trab. Sie wechselte schnell von Spielmaterial zu Spielmaterial und brauchte viel Führung, um bei einer Beschäftigung eine Zeit lang bleiben und auch Erfolge erleben zu können. Eine Plastikkiste, die mit Bohnen gefüllt war, bildete den Spielmittelpunkt. Anna konnte sich am Rand der Kiste festhalten und daran aufstehen bzw. niederknien. Einige Gefäße waren am Couchtisch daneben platziert, sodass Anna sich jedes Mal aufrichten und ihren Rumpf drehen musste, um ein neues Gefäß zu holen. Diese Absicht verfolgte meine Kollegin mit dem Spiel: die Kräftigung der stützenden Rumpfmuskulatur. Die Bohnen waren ein geeignetes Material zum Schöpfen, Schütten, Experimentieren, wobei Anna bald anfing, mit den Bohnen und Gefäßen zu werfen. An diesem Punkt blieb meine Kollegin ganz nahe bei Anna und zeigte ihr immer wieder andere Verwendungsmöglichkeiten für die Löffel, Schaufeln und Schöpfgefäße.
Anna plapperte während der Einheit sehr viel und gebrauchte dabei auch die Worte, die sie schon sprechen konnte. Dabei bildete sie schon erste Zweiwort-Sätze: "Tom Balli" (Thomas - ihr älterer Bruder - spielt Fußball) oder "Papa Auto" (Der Vater ist mit dem Auto weggefahren ). Annas erklärtes Lieblingsspielzeug waren Bälle in allen Größen und Farben. Der Flur, die Küche und auch das Wohnzimmer waren am Boden mit Bällen und Luftballons übersät. Sobald die Einheit beendet war, bewegte sich Anna, so schnell ihre Schienen das zuließen, aus dem Wohnzimmer hinaus zu ihren Bällen, die sie fröhlich durch die Gegend warf. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich Anna die Bälle noch nicht so gut selber wieder holen, sodass ihre Mutter ständig damit beschäftigt war, ihr die Bälle wieder zu bringen.
Das anschließende Gespräch war nur kurz und hauptsächlich durch die Verabschiedung meiner Kollegin geprägt. Der Vater und Annas Bruder waren gerade nach Hause gekommen und saßen schon am gedeckten Tisch bei einer Jause. So fand das Gespräch zwar in der Küche, aber eher im Stehen statt, während die Mutter immer wieder kurz wegging, um etwas zu holen, was gebraucht wurde.
Was mir schon nach dieser ersten Begegnung sehr im Gedächtnis geblieben war, waren die spürbare und geäußerte Belastung der Mutter durch die Behinderung ihrer Tochter und die allgemeine Unruhe und Hektik, die die Atmosphäre im Haus beherrschte. Kind wie Mutter kamen kaum zur Ruhe und waren ständig in Bewegung. Die Frage, ob die Mutter an der Frühfördereinheit teilnehmen wollte, stellte sich erst gar nicht. Sie vermittelte mir klar, dass sie diese Stunde dringend brauche, um ihren Tätigkeiten im Haushalt nachzukommen, da sie sonst ja ständig ein Auge auf ihre Tochter haben musste.
An der Austauschbarkeit der Person der Frühförderin merkte ich, dass Frühförderung für sie in erster Linie bedeutete, dass jemand ihr für eine Stunde in der Woche das Kind abnahm und es beaufsichtigte.
Im Förderprozess war ich anfangs ziemlich verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, dass Anna auf meine Angebote nicht einsteigen wollte. Sie war dabei, meine Grenzen auszuprobieren und ich ließ mich dabei oft auf Machtkämpfe mit ihr ein, in denen sie den längeren Atem hatte.
Da mir auffiel, dass Anna mit ihrem Verhalten die gesamte Familie auf Trab hielt und ständig ihre Grenzen ausprobierte, wollte ich gerade in meinen Einheiten sehr auf Struktur und Rahmenbedingungen achten. Für Anna war das etwas Neues, und es war sehr schwierig für mich, auf dem Einhalten meiner Regeln zu bestehen. Eine solche Regel war etwa das Aufräumen benutzter Spieldinge, bevor wir uns einem neuen Material zuwandten. Ich fand es ganz wichtig, dass Anna verschiedenes Material und verschiedene Spielarten zu unterscheiden lernte. Dazu mussten die Spieldinge aber erst einmal voneinander getrennt werden, z.B. in verschiedene Schachteln eingeräumt werden.
Die Familie hatte für Anna in der Küche eine Spielkiste, in der alle möglichen Spieldinge durcheinander gewürfelt waren: Puzzleteile, Autos, Teile einer Ringpyramide, Legosteine, Plastiktierfiguren, zusammensetzbare Ringe usw. Alles, was Anna damit tat, war, diese Kiste auszuleeren und sie zum Teil wieder einzuräumen. Natürlich entsprachen diese Aus- und Einräumspiele zum Teil auch einfach ihrem Entwicklungsstand und hatten auch durchaus ihre Berechtigung, aber es wäre für Anna auch wichtig gewesen, langsam zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden zu können. Ich regte bei der Familie an, die in der Kiste enthaltenen Spiele einzeln herauszunehmen und in verschiedene Behälter zu geben, sodass Anna sie zwar immer noch aus- und einräumen, sie aber auch spezifisch verwenden bzw. ihre unterschiedliche Verwendungsweise kennen lernen konnte.
Diesen Vorschlag wiederholte ich noch einige Male in darauffolgenden Stunden. Die Mutter sagte zwar immer wieder, dass sie das gut finden würde, aber es änderte sich nichts am Zustand der Kiste. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben.
Im Umgang der Familienmitglieder mit Anna war für mich deutlich zu spüren, dass sie in Anna immer noch das bedürftige, hilflose Baby sahen, das Anna ja anfangs auch gewesen war. Sie kam mit einer unnatürlichen Fußstellung zur Welt, weswegen sie bald nach ihrer Geburt operiert wurde und einige Monate im Gipsverband liegen musste. Als ich Anna kennen lernte, zeugte ein Ausschlag auf ihrem Arm noch von einer schweren Krankheit, die sie gerade wieder überstanden hatte. Ihre Krankengeschichte war voll von Berichten über Operationen und Krankheiten. Anna war von Beginn ihres Lebens an das Sorgenkind der Familie gewesen, und ich hatte den Eindruck, dass ihre Eltern und vor allem ihre Mutter jederzeit wieder den Ausbruch einer neuen Krankheit befürchteten. So wurde Anna sozusagen mit Samthandschuhen angefasst und ständig besorgt beobachtet.
"Die einerseits notwendige Übernahme von Ich-Funktionen und die Bereitschaft, in einem erweiterten Maße als üblich als mütterliches oder väterliches Hilfs-Ich dem Kind zur Verfügung zu stehen, gerät auf der anderen Seite in die Gefahr, ‚überkompensiert' zu werden und die Kinder als ewige Babys zu behandeln und ihnen damit jegliche Form von Autonomie zu rauben" ( Fröhlich V. 1994, S 154).
Die Spielkiste in der Küche hatte etwas von einer Spielkiste für Babys - und offensichtlich fiel es der Mutter schwer, Anna als inzwischen Vierjährige auch ihrem Alter entsprechend ernst zu nehmen und ihr ein differenziertes Spielverhalten zuzutrauen.
Eines der häufigsten Themen in den Gesprächen mit der Mutter war Annas Unruhe, ihre große Aktivität, ihr Ständiges In-Bewegung-Sein. Die Mutter ließ öfter anklingen, dass Anna sie dadurch sehr fordere und sie keine ruhige Minute am Tag finde.
Dabei erschien sie mir sehr belastet, aber auch selber ständig in Bewegung, ständig am Sprung zu einer Tätigkeit. In diesen Gesprächen versuchte ich, ihr meine Sicht von Annas Aktivität zu vermitteln. Ich sah in Anna immer das Kind bzw. den jungen Säugling, der einige Monate bewegungsunfähig gewesen war durch mehrer Operationen an seinem Fuß und dem es verwehrt geblieben war, seine Umwelt krabbelnd und rollend zu begreifen. Ich denke, dass ihr dadurch viele sensorische Erfahrungen nicht möglich waren, und sie durch ihr Abgeschirmtsein von der Umwelt, die sie ja hauptsächlich optisch und akustisch wahrnehmen konnte, viel zu wenig Spürinformationen erhalten hatte. Nun - als Vierjährige - war sie ständig unterwegs, um solche Spürinformationen zu erhalten, um sich und ihre Grenzen zu erfahren. Auch das Werfen von Gegenständen konnte ich bei ihr vor allem bei neuen Dingen beobachten, die sie noch nicht einordnen konnte und die sie warf, um eine Resonanz, eine Information über ihre Beschaffenheit zu erhalten.
Doch immer, wenn ich auf Anna als Säugling zu sprechen kam und der Mutter zu erklären versuchte, wie ich mir Annas damalige Situation vorstellte, kam ich damit nicht sehr weit, da Annas Mutter an dieser Stelle schnell das Thema wechselte oder plötzlich etwas Dringendes erledigen musste.
Ich denke im Nachhinein, dass es ihr gar nicht möglich war, meinem Gedankengang zu folgen, weil bei ihr in diesem Moment so viel Schmerz und Leid und wahrscheinlich auch Schuldgefühle aufzubrechen drohten, dass sie an diesem Punkt immer schnell abblockte und das Thema wechselte. Mir hingegen fehlte der Mut, mit ihr bei diesem Schmerz zu bleiben und ihn einfach mit ihr auszuhalten, mit ihr nochmals die damalige Situation anzuschauen und mit ihr zu sehen: Ja, das war damals so, so schlimm und so schwierig war es für uns alle. Das wäre die Voraussetzung dafür gewesen, dass Annas Mutter auf Annas Entwicklung hätte blicken können, ohne Angst und ohne sich dafür schuldig zu fühlen.
So aber bewegten wir uns nur immer wieder vor und zurück. Annas Mutter klagte über ihre Belastung und wollte von mir Lösungsvorschläge. Ich versuchte, ihr Vorschläge zu machen und zählte ihr mein ganzes Repertoire an Möglichkeiten auf, von Massagen über Körperspiele, Badespiele, Entspannungsübungen bis hin zur Gestaltung eines abendlichen Rituals rund um das Zu-Bett-Gehen. Wenn wir dann beim nächsten Mal darüber sprachen, sagte sie mir, momentan gehe es ganz gut, nur um einige Stunden später wieder darüber zu klagen, dass sie keine Ruhe fänden und Anna nicht schlafe. Dabei vermittelte sie mir ganz deutlich, dass meine Vorschläge nicht helfen würden und ich bemühte mich, noch bessere Ratschläge zu geben, die dann aber auch nicht halfen, bis ich immer kleinlauter wurde und das Thema eine Zeit lang vermied, bevor ich einen neuen Anlauf nahm.
Im Nachhinein erscheint mir die Situation wie ein ständiges Gegen-die-Wand-Laufen, ein ständiges Kämpfen gegen die Familie, wo es doch eigentlich ein Miteinander hätte sein sollen.
Ich stellte mich ganz auf die Seite des Kindes und wollte von der Mutter, dass sie die Situation ihres Kindes verstehen kann. Ich wollte bessere Entwicklungsbedingungen für Anna erreichen, indem ich der Mutter Vorschläge machte. Ich wollte Annas Entwicklung voranbringen, indem ich meine Einheiten sehr strukturierte und ihr Fähigkeiten im Umgang mit Spielmaterial vermittelte. Ich war ganz auf Förderung und Veränderung, auf Ziele und damit auf Leistung eingestellt, auf Aktivität und Tun und nicht auf Fühlen und Aushalten, dass die Situation nun gerade schwierig war, dass sich in der Entwicklung des Kindes nun gerade nicht viel tat, dass in der Familie Verzweiflung darüber da war.
Das war es ja letztendlich, was die Mutter mit ihren vielen Forderungen nach Ratschlägen zum Ausdruck brachte: dass sie sich nicht mehr zu helfen wusste und verzweifelt darüber war, wie Anna sich verhielt.
Ich "übersah" den momentanen Stand der Familie, konnte ihn nicht wirklich sehen: den sehr belasteten Zustand der Mutter, das Leid der Familie an der langsamen Entwicklung ihres Kindes und ihre Zukunftsängste.
Der Appell der Mutter: "Ich bin so belastet, ich kann nicht mehr" kam bei mir sofort an als: "Tu etwas dagegen, mach, dass es besser wird!" und erzeugte bei mir großen Druck. Ich kam in die Situation, mich hilflos und damit schuldig zu fühlen, weil ich letztendlich keine schnelle Lösung anbieten konnte. Wenn ich mir bewusst gemacht hätte, dass das gar nicht möglich gewesen wäre und dass es eigentlich darum gegangen wäre, aus diesem Druck auszusteigen, hätte ich vielleicht einfach versuchen können, mit der Mutter die schwierige Situation und die schmerzlichen Gefühle anzusehen und auszuhalten. Ich glaube, dass es gut gewesen wäre, meine eigene Hilflosigkeit einzugestehen und der Mutter auch zu vermitteln, dass ich keine Wunder wirken kann, und dass ich als Frühförderin manchmal auch nicht mehr tun kann, als etwas zu versuchen oder mit ihr gemeinsam auszuhalten, wie schwierig die Situation momentan für sie ist.
Aus dem Annehmen der momentanen Situation und auch aus dem Annehmen der leidvollen Anfangszeit am Beginn von Annas Leben hätte sich vielleicht bei der Mutter das Verständnis für Anna entwickeln können, das mir immer ein Anliegen war. Vielleicht hätte das bei der Mutter die Gelassenheit bewirkt, die sich auch positiv auf Annas Unruhe hätte auswirken können.
So aber blieb unser Arbeitsverhältnis gespannt, und es entstand oft eine Art Patt-Stellung zwischen uns, bzw. es tauchten Störungen im Förderprozess auf, wie ich sie weiter oben schon theoretisch beschrieben habe.
Das Gespräch am Ende der Fördereinheit gestaltete sich bei Familie E sehr ergiebig. Frau E kam ins Erzählen und berichtete von verschiedenen Erlebnissen mit David. Es war eine große Nähe und viel Vertrauen entstanden, die ich in diesem Gespräch als sehr positiv erlebte. Ein Blick auf die Uhr sagte mir zwar, dass es Zeit gewesen wäre, mich jetzt zu verabschieden, aber ich brachte es nicht fertig, Frau E darauf hinzuweisen. Also wartete ich eine Pause im Gespräch ab, um zu sagen, dass ich leider weiter müsse.
Da ich abschätzen konnte, dass ich bei Familie B nun etwa eine Viertelstunde zu spät kommen würde, rief ich Frau B an, um ihr meine Verspätung anzukündigen. Sie klang verärgert und sagte mir, dass ihr das dann zu spät wäre und sie nicht mehr möchte, dass ich heute kam.
In den nächsten Wochen bemühte ich mich dann um besonders große Pünktlichkeit. Um Punkt halb vier stand ich vor der Haustür der Familie B und läute. Frau B öffnete mir und sagte, dass sie jetzt keine Zeit mehr habe und in die Stadt fahren wolle. Ich sagte, dass wir aber diesen Termin vereinbart hätten. Sie entgegnete mir, dass wir eine Stunde früher vereinbart hätten und zeigte mir sogar den Kalender, wo sie das eingetragen hatte. Ich war mir zwar ganz sicher, dass sie sich den Termin falsch notiert hatte, musste ihre Entscheidung aber akzeptieren.
In der nächsten Stunde sprach ich das Thema Pünktlichkeit und Terminvereinbarung an. Ich sagte ihr, dass mir aufgefallen war, dass es für sie schwierig ist, Terminverschiebungen oder Verspätungen zu akzeptieren. Ich bot ihr deshalb einen Termin für die Frühfördereinheit an einem anderen Tag an, an dem ich eher garantieren konnte, dass es keine Verspätungen geben würde.
Was ich aber eigentlich hätte ansprechen müssen, war ihre Zufriedenheit mit der Frühförderung an und für sich. Es wäre Zeit gewesen für eine Bestandsaufnahme, einen Rückblick und einen Ausblick im Förderprozess.
Ich denke aber, dass meine Angst davor, was ich dann zu hören bekommen hätte, zu groß war. Ich spürte ihre Kritik ganz deutlich, vermied es aber, sie direkt anzusprechen. Sie kam aber an einer anderen Stelle, dem Thema Terminvereinbarung, zum Ausdruck. Ich bin auf dieser Ebene geblieben, anstatt auf das wirkliche Problem zu sprechen zu kommen.
An diesem Beispiel lassen sich meiner Meinung nach gut die verschiedenen Situationsebenen erkennen. Die Mutter und ich sprachen zwar über meine Verspätung und ein Missverständnis bei der Einhaltung der Termine. Die von der Mutter darüber geäußerte Unzufriedenheit brachte aber ihre Unzufriedenheit auf einer ganz anderen Ebene zum Ausdruck: ihre Verzweiflung, was die Behinderung ihrer Tochter und die geringen Fortschritte in ihrer Entwicklung betraf. Es war ihr zwar möglich, mein "Versagen" im Bereich Pünktlichkeit anzusprechen, nicht aber mein "Versagen" bei der Förderung ihrer Tochter. Dass ich in meiner Reaktion auf der von der Mutter gewählten Ebene geblieben bin, hatte mit Schuldgefühlen auf meiner Seite zu tun. Ich fühlte mich im Umgang mit Anna oft sehr hilflos und herausgefordert. Dies einzugestehen fiel mir schon im Rahmen meiner Reflexionen schwer. Umso mehr war es mir nicht möglich, dies in Gegenwart der Mutter anzusprechen und ihren von mir erwarteten Unmut darüber auszuhalten.
Dass wir das Problem nicht beim Schopf gepackt hatten, zeigt vielleicht auch die weitere Entwicklung unserer Beziehung, innerhalb der nun weitere Störungen auftraten.
In dieser Phase der Frühförderung kam es häufig vor, dass Annas Mutter zum Termin meiner Frühfördereinheit Besuch aus ihrer Verwandtschaft eingeladen hatte. Wenn ich das Haus betrat, saßen die Erwachsenen um den Kaffeetisch, während die Kinder im Haus herumtobten. Ich musste Anna dann entweder aus der Kindergruppe herausnehmen und mit ihr in das kleine Wohnzimmer gehen, oder ich gestaltete meine Einheit so, dass auch noch Annas Cousinen oder Cousins teilnehmen konnten. Während ich mit Anna im Wohnzimmer arbeitete, drang ständig die Geräuschkulisse des gemütlichen Familienbeisammenseins zu uns herein. Anna empfand es dann als Strafe, mit mir arbeiten zu müssen und konnte sich auf meine Angebote nicht einlassen. Ich fühlte mich wie die Babysitterin, die die Kinder beaufsichtigte, damit die Erwachsenen in Ruhe reden konnten. Auch nach der Förderstunde war mir die ganze Situation sehr unangenehm, da ich vor der versammelten Verwandtschaft nicht gut über das, was in der Förderung passiert war, sprechen konnte. Andererseits wurde ich immer eingeladen, mich doch dazuzusetzen und mich am Gespräch zu beteiligen.
Für diese Situation wäre es gut gewesen, wenn ich mir für die Zeit meines Hausbesuches Ruhe auserbeten und die Mutter darauf hingewiesen hätte, was die Situation für eine Ablenkung für Anna und mich bedeutete, und dass ich nach meiner Einheit die Möglichkeit haben möchte, in Ruhe mit ihr zu sprechen. Ich hätte aber auch ansprechen müssen, was diese Situation für ein Signal an mich aussendet, wie sei bei mir ankommt. Ich hätte die Gelegenheit wahrnehmen müssen, um mit ihr darüber zu sprechen, welchen Stellenwert die Frühförderung bzw. meine Hausbesuche für sie haben. Es wäre Zeit für eine Standortbestimmung in der Förderung und in der Familienarbeit gewesen.
Aus meiner Sicht der Wahrnehmungsproblematik von Anna hatte ich beschlossen, ihr viele Spürerfahrungen zu bieten und sie verschiedenes Material am Körper spüren zu lassen. Gleichzeitig erlebte ich unsere Fördersituation als sehr verbissen, weshalb ich den Spaß am Tun an die oberste Stelle setzte.
Im Zuge dieses Bemühens nahm ich vor allem Naturmaterial mit und gab es in große Schachteln bzw. Behälter, sodass Anna in die Kiste steigen und sich im Naturmaterial bewegen konnte. Da Anna sehr kränklich war, legte ihre Mutter großen Wert auf warme Kleidung. Anna trug immer mehrere Schichten Strumpfhosen und Socken, was ihr zusätzlich wenig Möglichkeit zum Spüren bot. Für das Bewegen in der Bohnenkiste zog ich Anna ihre Hausschuhe und zwei Paar Socken aus und ließ sie nur mit einer Wollstrumpfhose bekleidet in die Kiste steigen. Anfangs verunsicherte Anna das neue Material. Es war für sie auch gar nicht so leicht, in der Bohnenkiste umherzugehen, da die Bohnen keinen gleichmäßigen Untergrund boten. Sie konnte sich jedoch gut am Rand der Kiste festhalten und probte so erste Schritte. Anfangs war sie ganz still und lauschte dem Geräusch, das ihre Bewegungen in der Bohnenmenge verursachten. Vorsichtig löste sie den Griff um den Rand der Kiste und ließ sich langsam auf den Bohnen nieder. Ich versuchte sie dazu anzuregen, die Bohnen in die Hand zu nehmen, durch die Finger gleiten zu lassen, auf ihre Beine rieseln zu lassen. Dazu sangen wir das Lied "Es regnet" und ließen die Bohnen wie Regentropfen auf Annas Beine rieseln. Anna zeigte zunächst nur wenig Regung, nur ein gespanntes, waches Lächeln. Es dauerte eine Weile, bis sie selber tiefer in die Bohnen eintauchte und selber im Bohnenbad tätig wurde. Um ihr Spielvorschläge zu machen, legte ich einige Behälter und eine Schaufel in die Kiste und zeigte ihr, wie man damit Bohnen einfüllen kann. Als wir eine Plastikflasche mit Bohnen gefüllt hatten, wobei auch Anna kräftig mitgeholfen hatte, ließ ich den gesamten Inhalt der Flasche auf ihre Oberschenkel rieseln. Das muss von der Menge der Bohnen her ein Reiz gewesen sein, den sie ganz gut spüren konnte. Sie brach unvermittelt in ein Juchzen aus und wollte dieses Spiel noch sehr oft wiederholen. Als sie davon genug hatte, begann sie, die Bohnen in der Kiste herumzuwerfen. Ich stoppte sie erst, als sie Bohnen auch über den Rand der Kiste auf den Boden des Wohnzimmers warf. Auf der Suche nach einer neuen Spielmöglichkeit bedeckte ich Annas Beine ganz mit Bohnen und sang dazu das Lied "Annas Beine sind verschwunden". Anna musste sich dann befreien, indem sie die Beine anzog bzw. sie aus dem Bohnenhügel herauszog. Diese Bewegung ihrer Beine löste am Boden der Kiste Geräusche von rollenden Bohnen aus. Das Geräusch brachte Anna dazu, sich in der Kiste vor- und zurückzubewegen und mit den Beinen hin- und herzurutschen. Dabei muss sich auch ein intensives Spürerlebnis eingestellt haben, denn Anna fing an zu lachen, aus vollem Hals, aus ihrem Bauch heraus. Ein so befreites Lachen hatte ich bei Anna während meiner Einheiten noch nie erlebt. Ich unterstützte sie dabei, im Bohnenbad große Bewegungen auszuführen, indem ich ihr Halt bot und sie auch selber ein paar Mal hin- und herschob. Während dieser Momente erlebte ich Anna als ganz anderes Kind. Es ging nicht mehr darum, dass ich etwas von ihr wollte und sie ausprobierte, wie ich auf ihr Verhalten reagierte, sondern es war ein gemeinsames, wechselseitiges Spiel entstanden, an dem wir beide großen Spaß hatten und das ihr neue Erfahrungsmöglichkeiten eröffnete, wobei sie gleichzeitig Bewegung und Gleichgewicht übte. Annas Lachen hatte aber noch einen weiteren Effekt. Es brachte Annas Mutter dazu, ihre Haushaltstätigkeiten zu unterbrechen und erstaunt im Rahmen der Wohnzimmertür stehen zu bleiben und ihre Tochter zu beobachten. Ich merkte zwar, dass es ihr nicht so recht war, Anna nur so "leicht bekleidet" zu sehen, aber es war auch für sie ein neuer Aspekt, den sie bei ihrer Tochter beobachten konnte: dass Anna so lange und ausdauernd bei einer Tätigkeit, einem Material bleiben konnte und so glücklich dabei war.
Ich wagte einen weiteren Vorstoß, indem ich Annas Mutter fragte, ob sie etwas dagegen hätte, Anna die Strumpfhose auszuziehen, damit sie die Bohnen wirklich auf der Haut spüren konnte. Diese Frage erschreckte sie sehr und sie wies meinen Vorschlag weit von sich. Das wäre viel zu kalt für Anna. (Obwohl die Wohnung immer überheizt war und es auch zu diesem Zeitpunkt sehr warm im Raum war.)
Wir beendeten die Einheit mit einem Bewegungslied, das Anna im Bohnenbad umzusetzen versuchte, indem sie in den Bohnen herumwatete, zu hüpfen versuchte, sich darin drehte, klatschte und tanzte.
Im anschließenden Gespräch erklärte ich der Mutter, dass ich mit den Spürerlebnissen Anna die Gelegenheit bieten wollte, Erfahrungen zu machen, die ihr als Säugling aufgrund ihrer komplizierten Krankengeschichte verwehrt geblieben waren. Ich wollte ihre Wahrnehmungsfähigkeit anregen und ihr echte Spürmöglichkeiten bieten, sodass sie sich nicht immer Reize in überschießenden Bewegungen oder im Herumwerfen suchen musste.
Über die nächsten zwei Monate setzte ich meine Arbeit auf diese Weise fort. Ich variierte das Material und die Art des Behälters. Einmal bauten wir aus großen Legosteinen ein Haus, das wir dann mit kleinen Bällen füllten. Anna konnte dann auf den Bällen liegen und sich darin bewegen. Gleichzeitig ging es mir um das Zusammensetzen der Legosteine und um das Sortieren der Bausteine in unterschiedliche Farben. Ein anderes Mal war der Behälter ein Therapiekreisel, in den wir Sand- und andere Tastsäcke warfen und in den Anna dann klettern konnte, während ich den Kreisel festhielt und sie dann langsam bewegte, drehte und schaukelte.
Meine Beziehung zu Anna veränderte sich durch diese Art der Förderung ganz entscheidend. Sie hatte viel Freude an den Aktivitäten und Angeboten und ließ sich auf meine Vorschläge ein, während ich umgekehrt das Gefühl hatte, dass ich so auf ihre Bedürfnisse eingehen konnte und sie ernst nahm in dem, was sie in der Welt tun wollte, nämlich Erfahrungen sammeln, entdecken, ausprobieren.
Ich hatte auch das Gefühl, dass sich meine Beziehung zu Annas Mutter ein wenig verändert hatte. Das zeigte sich vor allem in Äußerlichkeiten. Sie hatte nun öfter einen Kuchen gebacken, wenn ich kam und suchte von sich aus das Gespräch mit mir.
Aber immer wieder war das Material, das ich für die Förderung verwendete, ähnlich und als ich eines Tages nach Beendigung der Fördereinheit gerade meine Bohnenkiste aus dem Wohnzimmer räumte, sagte Annas Mutter ganz beiläufig: "Nein, jetzt muss die Tante aber wieder einmal etwas anderes mitbringen!" Dabei blickte sie zu Anna, so als wollte sie deren Einverständnis für diese Aussage einholen oder so, als wäre es eine abgesprochene Sache zwischen ihnen beiden.
Dieser Satz traf mich wie ein Schlag. Nachdem die Kritik auf diese indirekte, für mich sehr abwertende Weise ausgesprochen wurde, fühlte ich mich wie die Spieltante, deren Qualität an der Attraktivität der Spieldinge gemessen wird.
Ich war unfähig darauf zu antworten, raffte kleinlaut meine Sachen zusammen und wäre am liebsten aus dem Haus geflüchtet.
In der Folge bemühte ich mich tatsächlich, wieder interessantere Dinge mitzunehmen, die auch einen eindeutigen Fördercharakter besaßen.
In dieser Situation wiederholte sich das, was die Beziehung zwischen Annas Mutter und mir charakterisierte: Annas Mutter konnte Kritik und Unzufriedenheit nur indirekt äußern, was ich als wenig wertschätzend erlebte, wohingegen ich es nicht schaffte, ihre Kritik auch als Ausdruck ihrer eigenen Not wahrzunehmen und sie darin ernst zu nehmen.
Der Satz: "Nein, jetzt muss die Tante aber wieder einmal etwas anderes mitbringen!" hätte im Grunde auch heißen können: "Da geht ja gar nichts vorwärts!". Thurmair und Naggl schlagen in diesem Fall vor, genau zu unterscheiden, auf welcher Ebene sich eine solche Aussage bewegt:
"- Redet die Mutter über mich und meine Arbeit?
- Über sich und wie es ihr geht mit ihrem Kind?
- Über ihr Kind und das, was ihr Kind braucht?
- Über mich?
- Über sich?
- Übers Kind?" (Thurmair/Naggl 2000, S 127).
Was die eben geschilderte Szene deutlich zum Ausdruck bringt, ist die sehr symbiotische Bindung zwischen Mutter und Tochter. Ängstlich wachte die Mutter über jedem meiner Versuche, Anna mehr "Freiraum" zu geben.
Dabei wird deutlich, dass Annas Mutter und ich eine völlig andere Wahrnehmung von Anna hatten. Während mir das Miterleben von Annas früher Kindheit und damit das Miterleben ihrer Krankheiten und Operationen fehlte, konnte die Mutter kein anderes Bild von Anna mehr aufbauen. Während Anna für sie das hilflose, kränkliche, schutzbedürftige Kind war, das vor allen Gefahren bewahrt werden musste, lernte ich Anna als kleine, aber sehr lebendige und eigenwillige Persönlichkeit kennen, die über viel Widerstandskraft, Spontaneität und Eigensinn verfügte. In meinen Augen hielt Anna ihre Familie und vor allem ihre Mutter ständig in Bewegung. Ich hatte das Gefühl, dass Anna sehr viel mehr alleine hätte tun können, als ihre Mutter zuließ. Indem ich von ihr einforderte, Dinge selber zu tun oder ihrem Spiel auch Grenzen setzte, provozierte ich natürlich sehr ihre Gegenwehr, die wiederum ihre besorgte Mutter auf den Plan rief. Anna erwartete in der Fördersituation von mir dieselbe Behandlung, die sie von ihrer Mutter erhielt, und kämpfte mit mir ebenfalls wie mit ihrer Mutter um mehr Autonomie.
Wie schwer es der Mutter fiel, Anna mehr Freiraum, aber eben Freiraum in guten Grenzen, zu ermöglichen, zeigt vielleicht ihre Reaktion auf meine Bitte, Anna Hautkontakt mit dem Naturmaterial zu ermöglichen, die sie sehr strikt ablehnte.
Dahinter standen bei ihr wahrscheinlich die Erinnerungen an den kleinen, sehr zarten und schwachen Säugling, der Anna einmal war. Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Mutter die Sorge, die man um das Leben seines Kindes empfunden hat, nicht mehr so schnell vergisst und einen die ängstlichen Gefühle immer wieder einholen können. Andererseits könnte sich hier auch etwas zeigen, was Elbert mit der Erziehungsfehlhaltung der Überbehütung umschreibt und was auch Mannoni und Niedecken im Rahmen der Tötungswünsche einem Kind mit Behinderung gegenüber erwähnen. Es kann gut sein, dass es der Mutter sehr schwer fiel, dieses körperlich deformierte Kind nach seiner Geburt anzunehmen. Auch wenn ihr eventuelle Tötungsphantasien unbewusst geblieben sind, kann es doch sein, dass das überbehütende Verhalten der Mutter solche Wünsche möglichst unsichtbar machen sollte.
Es kann sein, dass die Mutter damit ihre Schuldgefühle aufgrund ihrer ablehnenden Gefühle dem Kind gegenüber zu beruhigen versuchte. Der Kampf gegen die unbewusste eigene Aggression wird dann nach außen verlegt in den Kampf um das "Wohl" des Kindes. "Die Wahrscheinlichkeit, daß sich das behinderte Kind mit einer Objektwelt auseinander zu setzen hat, die auf sein Bedürfnisse entweder mit emotionaler Unterversorgung oder schuldvoller Überkompensation reagiert, liegt besonders hoch" (Fröhlich V. 1994, S 154).
In diesem Fall könnten Annas Unruhe und ständiges In-Bewegung-Sein auch eine Form der Gegenwehr gegen die von ihr gespürten ablehnenden Gefühle der Mutter gewesen sein.
Denn wie sollte es einem Kind möglich sein, sich gelassen und ruhig zu verhalten, wenn es um seine Existenz fürchten muss. Dazu möchte ich einen Gedanken von Lüpke erwähnen, der im Zusammenhang mit motorisch-funktionalen Therapiekonzepten die Frage danach stellt, warum diese Konzepte weitgehend das Feld von Diagnostik und Rehabilitation dominieren. Er sieht darin eine Abwehr archaischer Ängste, die einer Gedankenlogik folgt, die lautet: Bewegung = Lebendigkeit; Bewegungslosigkeit = Tod. Lüpke interpretiert eine Fixierung auf Bewegung als manische Abwehr gegen die Todesangst. (vgl. Lüpke in Funk/Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung 2000, S 77)
Jetter (1995) bietet eine andere Sichtweise der Rastlosigkeit im Verhalten von Mutter und Kind an.
"Alle in ihrer Entwicklung gefährdeten Kinder haben Probleme damit, die Spielräume in ihrem Lebensalltag zu nutzen, weil die Ordnung ihres Familienlebens labilisiert oder - in manchen Familien nahezu ausweglos - erstarrt ist. Die Kompetenzen des Kindes sind dadurch nicht aufgehoben in der umfassenderen Geordnetheit der Zirkularität der Familienheimat, sondern sie isolieren sich in fixierten ‚Autorhythmen' bzw. ‚Mutter-Kind-Stereotypien' oder in verallgemeinerter Rast- und Orientierungslosigkeit - oder von alledem etwas" (Jetter 1995, S 56).
Elbert betont in seinen Ausführungen, dass eine überbehütende Mutter ihrem Kind kaum Raum für Eigeninitiative ermöglicht, und Autonomie für das Kind nur mehr als sozial unerwünschtes, abweichendes Verhalten möglich wird. (vgl. Elbert 1982, S 79)
Auch der Wunsch von Annas Mutter nach mehr Förderung entpuppt sich in diesem Zusammenhang als klassische Angst-Abwehr. Aktivität und Förderung scheinen für die Mutter eine wichtige Bedeutung gehabt zu haben. Aktivität gibt ja meist das Gefühl, etwas tun zu können und kann so Ängste vermindern. Solange noch Hoffnung besteht, dass sich am Zustand des Kindes etwas verändert, muss man sich noch nicht unbedingt mit der Unabänderlichkeit der Tatsache der Behinderung des Kindes auseinandersetzen.
Hierbei habe ich mich als "Erfüllungsgehilfin" der Mutter erwiesen, weil auch meine Handlungsmotivation darin bestand, Anna weiterzubringen, von Anna etwas zu verlangen, sie herauszufordern, sie möglichst gut und intensiv zu fördern. Es war auch mir nicht gut möglich, Annas Schwierigkeiten - gerade in körperlicher Hinsicht - wahrzunehmen, ohne dass der Drang in mir entstand, etwas "dagegen" tun zu müssen.
Vielleicht wäre es manchmal gut gewesen, mich neben Anna zu setzen, ihre Unruhe auszuhalten und ihr zu vermitteln, dass ich jetzt sehr verzweifelt sei und nicht mehr weiter wisse, dass ich aber ihren Gefühlzustand wahrnehme.
So aber fand ein Kampf auf mehreren Ebenen statt: ein Kampf um Termine, ein Kampf um Arbeitsbedingungen, ein Kampf um Förderziele, ein Kampf zwischen der Mutter und Anna, ein Kampf zwischen der Mutter und mir, ein Kampf zwischen Anna und mir, ein Kampf gegen die Behinderung.
Die Szene des Kampfes hat sich später auch noch weiter fortgesetzt im Kampf um eine Weiterführung der Frühförderung.
Auch wenn die Mutter zeitweise einen anderen Weg der Förderung akzeptieren konnte und auch Verbesserungen in den Beziehungen stattfanden, überwog dann doch wieder der Förderaktivismus. Diese Rückkehr in ein altes Verhaltensmuster bildet oft einen Teil des gesamten Veränderungsprozesses und ist ein Zeichen für den Wiederholungszwang, dem die Aufarbeitung schmerzlicher oder bedrohlicher Gefühle auch unterliegt.
Es kann sich hier auch ein Widerstand der Mutter gegen die drohende Loslösung ihres Kindes und die damit drohende Symbioselösung zeigen. Wenn ihre Überfürsorge auch den Zweck hatte, negative Gefühle dem Kind gegenüber zu verdecken, stellte die zunehmende Selbständigkeit des Kindes ja auch real eine Gefahr für die Mutter dar bzw. bedrohte die Autonomie ihrer Tochter ihre Abwehrstrategie und brachte die Möglichkeit des Aufbrechens und Sichtbarwerdens der ambivalenten Gefühlslage mit sich.
Gebraucht hätte es in dieser Situation meine Festigkeit in Sachen Förderung, mein klares Bekenntnis zu den Zielen, die mir in der Entwicklungsförderung wichtig erschienen. Ich hätte die Mutter darauf hin ansprechen müssen, ob sie mit meiner Förderung unzufrieden ist, welches Problem sie damit hat und was meine Art der Förderung in ihr auslöst. Ich hätte sie auf ihre Ängste und Befürchtungen und auf ihre eigenen Erwartungen hin ansprechen müssen, ohne meine Position sofort zu verlassen, nachdem Kritik von ihrer Seite her angeklungen war. Im Nachhinein kann ich mir gut vorstellen, dass es sie geängstigt hat, dass nach außen hin so wenig "weiter ging" in der Förderung. Vielleicht stellte es auch eine Kränkung für sie dar, dass man mit ihrem inzwischen fast fünfjährigem Kind "nur" mit Bohnen spielen konnte. Es war die Zeit kurz vor Annas fünftem Geburtstag, und es kann gut sein, dass die Mutter den Entwicklungsstand ihres Kindes als sehr schmerzlich empfand und das große Zukunftsängste in ihr auslöste.
Ich nutzte den Anlass zwar zu einem Gespräch über den weiteren Verlauf der Förderung, holte dabei aber hauptsächlich die Vorschläge und Wünsche der Familie ein, ohne nochmals darzulegen, warum ich die Förderung auf meine Weise gestaltete. Es kann auch sein, dass meine Ziele für die Familie zu vage waren und sie den Sinn dahinter trotz meiner Erklärungen nicht sehen konnten. Von der Familie kam einerseits ja auch der große Wunsch, dass Anna Spaß an der Förderung haben solle. Sie wäre so musikalisch, ob ich das nicht mehr berücksichtigen könne, ob ich nicht Instrumente mitbringen könne. Ich nahm eine Ambivalenz wahr zwischen dem Wunsch, Anna solle Freude haben und dem Wunsch, Anna solle etwas lernen. Denn Anna liebte Musik und ich baute diesen Aspekt immer wieder in Liedern und Tänzen ein, aber sie ging mit Instrumenten wie mit anderem Material um, indem sie es warf.
Grundsätzlich wäre ja ein Miteinander in der Planung der Förderung anzustreben und es sollte ja auch ein gemeinsames Entscheiden über Förderziele sein. Trotzdem habe ich als Frühförderin auch eine professionelle Pflicht, die Eltern über notwendige Maßnahmen zu informieren. In diesem Sinn hätte das Gespräch eigentlich ein Kompromiss, eine gemeinsame Übereinkunft sein sollen, in dem ich meine Ziele darlege und den weiteren Verlauf der Förderung nach meiner Vorstellung beschreibe, gleichzeitig aber die Vorschläge und Wünsche der Eltern berücksichtige und miteinbeziehe.
Indem ich es den Eltern ganz übergab, wie die Förderung in Zukunft aussehen soll, habe ich meine Professionalität nicht gewahrt und den Eltern wahrscheinlich sogar den Eindruck vermittelt, dass es um meine Fachlichkeit nicht so gut bestellt ist. Sie hätten Sicherheit und Orientierung durch meinen Standpunkt gebraucht. Indem ich davon eher abgegangen bin, habe ich sie auch verunsichert.
Auf der anderen Seite war mein Interesse für ihre Wünsche nicht ganz ehrlich, weil ich mich sehr über die Art der Kritik geärgert hatte und wütend darüber war, dass die Eltern nicht erkennen konnten, was sich alles positiv entwickelt hatte. Ich denke, ich übergab ihnen die Verantwortung ein Stück weit mit dem Gedanken: "Da, macht ihr nur, wenn ihr meint, ihr wisst es besser, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt!"
Ich war gekränkt und reagierte mit Rückzug, weil ich die Kritik ganz auf mich bezog, anstatt den zwischen uns gefallenen Satz der Mutter zurückzugeben und sie danach zu fragen, wie es in ihr aussah, was sie dazu bewogen hatte, an diesem Punkt der Entwicklung wieder auf mehr Leistung zu pochen.
Die Mutter ernst zu nehmen hätte auch bedeutet, sie in der Not ernst zu nehmen, die sie veranlasst hat, Kritik zu üben. Es hätte für sie vielleicht eine Chance bedeutet, sich mit ihren widersprüchlichen Gefühlen ihrem Kind gegenüber auseinandersetzen zu können. Es wäre gut gewesen, die Themen Leistungsdruck und Erwartungen anzusprechen und aus dem Leistungsdruck auszusteigen, anstatt ihn noch zu fördern, indem ich mich einfach den Forderungen der Eltern untergeordnet habe.
Nachdem Annas Mutter mir von Annas Vorliebe für das Kasperltheater berichtet hatte, das im Kindergarten regelmäßig stattfand, beschloss ich, in den Fördereinheiten vermehrt Handspielpuppen einzubauen. Anna liebte den frech aussehenden Raben, der mich nun meist "begleitete" und sich am gemeinsamen Spiel mit ihr "beteiligte". Für den Raben holte sie Bausteine, ordnete sie nach ihren Farben und baute für ihn ein Haus. Mit dem Raben betrachtete sie Bilderbücher und suchte aus verschiedenen Kärtchen das heraus, was der Rabe sich wünschte, oder benannte die Abbildung, die der Rabe nicht kannte. Für den Raben "kochte" sie und mit ihm zusammen turnte sie.
Es war mir schon früher aufgefallen, dass eine Dreier-Situation mit Anna viel entspannter ablief als eine dyadische Konstellation. Anna liebte ihren Bruder Thomas, der ebenfalls ein sehr lebendiges, aktives Kind war und sich viel draußen beim Fußballspiel mit seinen Freunden aufhielt. Annas Vorliebe für Ballspiele entstammte vielleicht ihrer Sehnsucht, mit ihm gemeinsam Fußball zu spielen, die sie auch immer wieder äußerte. Als Anna später wesentlich sicherer auf ihren Beinen unterwegs war, klagte die Mutter oft, dass Anna immer nur zu den Buben wolle. Vielleicht war die Freiheit ihres Bruders, die vor allem darin zum Ausdruck kam, dass er sich sehr oft zum Spiel mit seinen Freunden verabredete, und oft auch dann nach draußen lief, wenn seine Mutter von ihm verlangte, Hausaufgaben zu machen, das, was Anna faszinierte und anzog. Thomas konnte sich den Ansprüchen der Mutter entziehen, was Anna in dieser Form nicht möglich war.
Wann immer Annas Bruder an unseren Fördereinheiten teilgenommen hatte, waren diese sehr lustig verlaufen. Thomas konnte sehr liebevoll, aber auch natürlich mit seiner Schwester umgehen und variierte meine Spielangebote in seiner Interaktion mit Anna sehr phantasievoll. Bei ihm hatte ich nicht das Gefühl, dass er übervorsichtig mit ihr war, was ihm allerdings oft die Rüge seiner Mutter einbrachte. Sie sah es auch gar nicht gerne, wenn Thomas mit uns gemeinsam spielte. Ich hatte den Eindruck, dass die Mutter befürchtete, die Förderung für Anna könnte dann zu kurz kommen. Thomas war überhaupt einem sehr großen Leistungsdruck von seinen Eltern her ausgesetzt. Beinahe jedes Mal, wenn ich in der Familie war, gab es eine Auseinandersetzung zwischen Thomas und seiner Mutter, was die Hausaufgaben oder sein Lernverhalten betraf. Dieser Anspruch der Mutter zeigt vielleicht auch, dass es ihr nicht leicht gefallen ist, Annas Entwicklungsrückstand anzunehmen bzw. dass Thomas sozusagen als Entschädigung für die Behinderung seiner Schwester besonders gute Leistungen erbringen sollte.
Die Situation mit der Handpuppe war nun auch eine triadische. Während Anna von mir nicht gerne Anforderungen akzeptierte, ging sie auf den Raben, mit dem sie sich außerdem sehr gut identifizieren konnte, bereitwillig ein. Wenn ich über die Figur des Raben mit ihr kommunizierte, konnte sie ganz offen auf meine Vorschläge eingehen. Ich hatte das Gefühl, als würde sie den Raben als gleichwertigen Interaktionspartner akzeptieren, während sie mir gegenüber oft viel kontroverses Verhalten zeigte und auszuprobieren schien, wie weit meine Geduld reichte. Es scheint mir im Nachhinein so, als hätte Anna mit mir wieder eine dyadische Beziehungsform hergestellt, die stark an ihre Beziehung zur Mutter erinnerte.
Köllerer (in Trost/Walthes 1991, S 101-111) stellt in seinen Ausführungen zu "Intersubjektivität, Phantasmen und Realität" fest, dass seiner Ansicht nach und aus seinen Erfahrungen in der Frühförderung in Familien mit behinderten Kindern als eines der zentralsten Symptome häufig eine pathologische Bindung zwischen Mutter und Kind zu finden ist. Köllerer sieht es in der Folge für die Arbeit in der Frühförderung als wichtig an, aus der dyadischen Kommunikationsstruktur, die zur Lebenswelt von Mutter und Kind gehört, in eine triadische Beziehungsstruktur (Gespräche zwischen drei Erwachsenen) zu gelangen. Er sieht im triadischen Setting (Mutter-Vater-Frühförderin oder Frühförderin-Mitarbeiterin der Frühförderstelle-Mutter) einen Schutz der Frühförderin vor dem, was er den "Sog der Dyade" (ebd. S 105) nennt, der von der Mutter eines Kindes mit Behinderung ausgeht. Der "Sog der Dyade" äußert sich in dem Gefühl, das die Frühförderin der Mutter gegenüber empfindet: im Gefühl, so schnell als möglich helfen zu müssen. Mit großer Förderaktivität reagiert die Frühförderin also auf die Übertragung der Mutter, innerhalb der die Frühförderin zur Retterin, zur Erfüllungsgehilfin der Mutter im Kampf gegen die Behinderung wird.
Dabei möchte ich aber noch einmal den gesellschaftlichen Hintergrund betonen, auf dem die ablehnenden Gefühle der Mutter und ihre Abwehr dagegen beruhen. Erst die gesellschaftlichen Phantasmen von Behinderung lassen die Behinderung des eigenen Kindes für die Mutter zum unerträglichen Schicksal werden, und es sind unser aller Ängste, die in den Reaktionen der Mütter sichtbar werden und mit denen wir sie allein lassen.
"Phantasmen sollen hier verstanden werden als die schöpferische Aktivität des Individuums, das Dinge und Inhalte seiner Lebenswelt mit Vorstellungen und Empfindungen belegt, so daß eine einmalige gedankliche Binnenwelt entsteht" (ebd. S 108).
Frühförderinnen entwickeln verschiedene Bewältigungsformen, um auf die Begegnung mit der Beschädigung eines Kindes zu reagieren: Sie nehmen oft die Rolle der Helferin oder die der besseren Mutter ein und handeln nach dem Phantasma der Omnipotenz, das ihnen ermöglicht, daran zu glauben, etwas wieder heil oder ganz machen zu können.
In der professionellen Arbeit hält Köllerer es für sehr wichtig, darin nicht ständig wieder dyadische, symbiotische Beziehungen zu bilden, die unter Umständen konkurrierend nebeneinander stehen, sondern bewusst eine Triangulierung anzustreben (in Gesprächen mit Mutter und Vater; in der Teambesprechung, in der Arbeit mit dem Kind, in der Zusammenarbeit mit Fachleuten).
Köllerer schlägt für die Arbeit in der Fördersituation ein Setting vor, in dem die Frühförderin Mutter und Kind mit einbezieht, und Frühförderin und Mutter gemeinsam entscheiden, welchen Platz sie darin jeweils einnehmen wollen und können.
"Vom entwicklungsdynamischen Standpunkt aus ist dies die erste Voraussetzung für eine frühe Triangulierung, die nur dann gelingt, wenn Mutter und Therapeutin sich gegenseitig stehen lassen können. Das Kind muß also innerhalb dieser Dreieckssituation die Möglichkeit loyaler Teilbeziehungen sowohl zur Mutter wie auch zur Therapeutin haben. Diese Konstellation ist an die prinzipielle Übereinkunft zwischen Mutter und Therapeutin gebunden, daß jeder zum anderen eine Beziehung aufnehmen darf, in die der dritte nur auf indirekte Weise einbezogen ist. Fehlt diese Voraussetzung, so zerfällt das Dreieck in zwei miteinander konkurrierende Dyaden. Es kommt zwangsläufig zum Verrat für die Mutter und zum Solidaritätskonflikt für das Kind, das sich nicht sicher ist, ob es die Therapeutin genauso lieben darf wie seine Mutter. Der Abbruch der Therapie steht im Raum" (ebd. S 105/106). Köllerer hält Elterngespräche für unerlässlich, in denen ausdrücklich nach dem Erleben der Mutter während der Einheiten gefragt wird. Eine Verbalisierung des Erlebens der Mutter ist demnach fundamental.
Ziel solcher Gespräche ist für Köllerer, dass die Mutter sich wieder als autonome Person, als "Einperson" im Gegensatz zur "Zweiperson" mit dem Kind erleben kann. Die Entwicklungsdynamik führt dabei von der Dyade und der konkurrierenden Dyade über loyale Teilbeziehungen und eine frühe Triangulierung schließlich zur vollständigen Triade und letztlich zur wiedergewonnenen Autonomie der Mutter.
Dass ich mich in der Beziehung zu Anna mit der Mutter in einer konkurrierenden Dyade befand, zeigt vielleicht auch folgende Begebenheit:
Eines Tages hatte ich die Mutter dazu überreden können, mit Anna im Garten spielen zu dürfen. Dieser war in Hanglage angelegt und fiel etwas schräg ab, weshalb man darauf achten musste, dass Anna nicht das Gleichgewicht verlor. Anna liebte es, sich draußen aufzuhalten, und ich veranstaltete gemeinsam mit ihr und einem zufällig dazugestoßenen Nachbarkind ein Wettschießen mit dem Ball, dem beide Kinder ausgelassen hinterherliefen, um ihn wieder einzufangen. Mitten in dem Toben fiel mein Blick auf das einige Meter höhergelegene Küchenfenster, von dem aus uns die Mutter beobachtete. Von meinem Empfinden her war dieses Zuschauen aber nicht ein Teilhaben am Tun ihrer Tochter, sondern die ängstliche Kontrolle über meine Kompetenz.
Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, nach dem Erleben der Mutter in dieser Situation zu fragen. Hatte sie sich gefreut, dass Anna so viel Spaß am gemeinsamen Spiel mit dem Nachbarjungen hatte? Hatte sie den Eindruck, dass unser Spiel gar nichts mit Förderung zu tun hatte? Verglich sie das Verhalten ihrer "behinderten" Tochter mit dem des "normalen" Jungen? Hatte sie Angst um Annas Gesundheit, als sie sie so den Hügel hinunterrennen sah? Ich kann diese Fragen im Grunde nicht beantworten, weil ich Annas Mutter nicht danach gefragt habe, wie sie die Situation wirklich erlebt hat.
Der Sommer rückte näher und Annas Sprache entwickelte sich zu dieser Zeit sehr gut. Anna vergrößerte ihren Wortschatz zunehmend, und eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war es, seitenstarke Kataloge gemeinsam mit ihrer Mutter durchzublättern und einzelne Abbildungen zu benennen. Das geschah in einem solchen Tempo, dass ich es fast nicht aushielt, dabei zuzusehen. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass Anna dabei auch etwas wirklich aufnehmen konnte, aber es war ihr eigenes Tempo, das sie auch bestimmte. Es entstand in mir die Frage, wie die Mutter das aushielt. Ich schilderte ihr meine Wahrnehmung und sprach ihr Anerkennung für ihre Geduld aus, worauf sie aber nur die Achseln zuckte. Annas Spracherwerb war für die Mutter sehr wichtig, und sie war auch bereit, dafür viel Zeit zu investieren. Ich hatte den Eindruck, dass Mutter und Tochter dabei nicht wirklich in Beziehung kamen. Es war im Grunde ein sehr funktionaler Ablauf, der beendet war, wenn die letzte Katalogseite zugeschlagen war, und der oft am Tag wiederholt wurde.
Frühere Versuche meinerseits, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter anzuregen, waren regelmäßig gescheitert, obwohl der Wunsch danach meist von der Mutter gekommen war.
Einmal wünschte sich die Mutter von mir, dass ich mit Anna Entspannungsübungen oder Massagen machen sollte, damit sie mehr zur Ruhe käme. Ich bat sie daraufhin, bei einer solchen Einheit anwesend zu sein, da ich die Mutter gerne dazu angeregt hätte, Anna zu massieren und mit ihr so eine neue Beziehungserfahrung zu machen. Das Vorhaben scheiterte daran, dass es mir nicht gelang, mit Mutter und Tochter eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Als ich kam, hatte die Mutter gerade eine Kassette mit Bewegungsliedern eingelegt, und Anna tanzte dazu ausgelassen. Daraufhin wirkten meine Kassette mit Meeresrauschen und Entspannungsmusik, die Duftlampe und die Massageabsichten fast absurd. Ich versuchte es zwar, scheiterte aber gleich darauf daran, dass Anna gar nicht ruhig bleiben wollte und die Mutter nach wenigen Minuten verschwand.
Ähnlich erging es mir mit dem Wunsch der Mutter nach logopädischen und mundmotorischen Übungen, nachdem die von uns aufgesuchte Physiotherapeutin befunden hatte, dass Anna im motorischen Bereich keine Therapie mehr benötigte, aber vielleicht noch Anregungen im mundmotorischen Bereich.
Die Mutter und ich saßen dann mit Anna am Tisch vor dem mitgebrachten Spiegel und Materialien wie Federn, Strohhalmen und Watte. Anna wollte aber weder sitzen, noch etwas über den Tisch blasen und entfloh angesichts ihrer fordernden Mutter und einer verzweifelt um die Gunst der Mutter bemühten Frühförderin zu ihren Bällen.
Aus meiner heutigen Sicht kann ich Anna ihre Flucht nicht verdenken. Damals war ich sehr verzweifelt - ich zweifelte im wahrsten Sinn des Wortes an meiner Förderkompetenz und gab der Mutter im Stillen Recht: Ich versagte bei Anna wirklich kläglich. Diese Schuldgefühle waren es auch, die mich davon abhielten, der Mutter gegenüber meine Hilflosigkeit auch anzusprechen.
Während für mich die einzige Art der Förderung für Anna in offenen Spielsituationen lag, innerhalb derer sie selber die Führung übernehmen konnte, erwartete sich die Mutter von mir funktionale Förderung, die bestimmte Fähigkeiten trainierte. Nachdem es mir nicht gelang, im Rahmen meiner Anwesenheit in der Familie diesen Widerspruch zu thematisieren, und nachdem es auch am Anfang kein Verständigungsgespräch über meine Arbeitsweise und über die Erwartungen der Familie gegeben hatte, wurden die Gegensätze immer größer.
Etwa einen Monat vor meinem Urlaubsantritt im Sommer hatte ich der Familie meine Urlaubsabsichten bekannt gegeben. Diesmal hatte ich mich dazu entschieden, mir einen Monat frei zu nehmen, auch weil die Erfahrung gezeigt hatte, dass viele Familien im Sommer gerne eine Zeit lang "förderfrei" hatten, um gemeinsame Unternehmungen oder einen Familienurlaub zu planen.
Als ich mich dann in der letzten Einheit vor meinem Urlaubsantritt von der Familie verabschiedete, fragte der Vater mich, ob denn während dieser Zeit keine Vertretung für mich kommen könne. Seine Bemerkung irritierte mich und gab mir das Gefühl, dass es für die Familie nicht in Ordnung war, dass ich so lange Zeit wegbleiben würde. In diesem Moment erschien mir die Frage eine Zumutung, und ich ärgerte mich darüber, dass die Familie mir keinen Urlaub zugestehen wollte, auch wenn ich nach außen hin ruhig auf die Frage antwortete und dem Vater erklärte, dass dies leider nicht möglich sei.
Ich vereinbarte mit der Familie, mich in der Woche nach meinem Urlaubsende wieder zu melden, um den ersten Termin danach nochmals zu bestätigen.
Als ich nach fünf Wochen wieder in der Familie anrief, um mich für den ersten Termin anzukündigen und nachzufragen, wie es der Familie ergangen sei, entgegnete mir die Mutter, sie könne für die nächsten zwei Monate überhaupt keinen Termin mit mir ausmachen, da sie selber sich entschlossen habe, einen Fahrkurs zu besuchen. Ich versuchte, ihr zu vermitteln, dass ich das Vorhaben toll fand und auch verstand, dass damit eine Menge Belastungen auf sie zukommen würden, dass ich es aber nicht gut fände, eine so lange Zeit verstreichen zu lassen. Die Mutter sagte, dass es für sie keine andere Möglichkeit gäbe und ging auf keinen meiner Vorschläge ein. Ich sagte ihr auch, dass sich in meiner Planung einiges ändern würde und ich ihr für eine so lange Zeit nicht garantieren könne, dass dann noch ein Nachmittagstermin für Anna frei wäre. Die Mutter versicherte, es wäre kein Problem für sie, wenn ich dann Vormittags kommen würde und sie Anna für diese Zeit aus dem Kindergarten abholen müsse.
Ich akzeptierte zunächst eine Pause von einem Monat und versprach, mich dann noch einmal zu melden, um zu sehen, ob es nicht doch möglich wäre, die Frühförderung fortzusetzen.
Was war passiert?
In der Situation selber empfand ich zunächst einmal nur Ärger. Einerseits wollte ich die Mutter respektieren und auch ihren Wunsch nach einer "Pause", andererseits hatte ich das Gefühl, dass der Fahrkurs nicht der wahre Grund für ihren Wunsch war.
Erst in der Fallsupervision und später noch einmal in der existenzanalytischen Lehrsupervision konnte ich die Situation mit den Augen anderer auch von einer anderen Seite sehen. Die erste Mitteilung meiner Urlaubsabsichten war von der Familie wohl nicht wirklich aufgenommen worden, weshalb sie meine Ankündigung eine Woche vorher eher unvorbereitet traf und Ärger bei ihnen auslöste. Die Familie fühlte sich gekränkt dadurch, dass ich sie im Stich ließ, dass ich einfach so gehen konnte und mich damit der Belastungen nicht aussetzen musste, denen sie sich nicht entziehen konnte.
Jonas (1990) thematisiert diesen Gegensatz zwischen "Arbeit" und "Liebe" in der Frühfördersituation. Die Arbeit der Frühförderin ist eine arbeitrechtlich geregelte, bezahlte Arbeit - die Fortsetzung der Förderung durch die Mutter bzw. ihre Pflegeaufgaben stellen eine unbezahlte Arbeit dar, die unter die Kategorie "Liebe" fällt. (vgl. Jonas 1990, S 138)
Die Eltern waren entrüstet, dass ich einfach für so lange Zeit auf Urlaub gehen konnte, und haben meine Ankündigung als große Kränkung empfunden.
Der von ihnen ausgehende Wunsch nach einer "Pause" im Herbst war wohl eine Reaktion auf diese erlebte Kränkung, die mir vermitteln sollte, dass sie meine Hilfe nicht wirklich brauchten.
Gerade ihre empfundene Kränkung durch meine Urlaubsankündigung zeigt aber - für mich selber im Nachhinein sehr erstaunlich -, dass die Frühförderung ihnen offensichtlich wirklich fehlte und eine Lücke hinterließ, die sie nicht so gerne hinnehmen wollten. In der damaligen Situation empfand ich selber aber ebenfalls eine Kränkung. Sonst hätte ich ihre Sorge aufnehmen und mit ihnen gemeinsam überlegen können, wie sie die betreuungsfreie Zeit überbrücken könnten. Es hätte sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, einen familienentlastenden Dienst hinzuzuziehen, wenn ich den Appell des Vaters richtig verstanden hätte.
Das zeigt aber auch, was ein Kreislauf von gegenseitiger Entwertung in der Beziehung zwischen Frühförderin und Eltern bewirken kann.
Jonas (1990) beschreibt diesen Kreislauf in ihren Ausführungen genauer. Demnach geschieht es oft, dass Therapeuten von Eltern abgewertet werden, wenn die erhoffte Heilung des Kindes ausbleibt. Durch die Entwertung der Personen, die es nicht schaffen, das Kind zu heilen und damit auch die Identität der Mutter wiederherzustellen, müssen die Mütter ihr eigenes Gefühl von Selbstentwertung nicht so sehr spüren.
"Die abgewehrte Selbstentwertung durch die Entwertung der MitarbeiterInnen der Frühberatung und Frühförderung kann die Interaktion nachhaltig beeinflussen, wenn von Seiten der Professionellen dieser Mechanismus nicht verstanden und thematisiert wird, sondern eine Verstrickung in das Geschehen stattfindet" (Jonas 1990, S 105).
Jonas sieht die Gefahr des Abbruchs in der Frühförderung vor allem dann, wenn die Frühförderin die emotionale Not hinter den Hoffnungen, Ansprüchen und Aktivitäten der Mutter nicht erkennt. Eigene bei der Frühförderin entstehende Gefühle des Unwertes, der Resignation, der Depression etc. können Gegenübertragungsgefühle sein, die es behutsam anzusprechen gilt. Aber auch dann kann es noch sein, dass die Mutter die Förderung abbricht. (vgl. ebd. S 105f)
Ich denke, dass Jonas hier gut beschreibt, was sich in der Beziehung zwischen der betreffenden Familie und mir ereignet hat. Ich frage mich aber, ob diese Sichtweise nicht schon wieder eine Abwehr darstellt: die Abwehr der Frühförderin gegen die Entwertung durch die Mutter, indem sie diese Abwertung als Abwehr bei der Mutter wahrnimmt. Die Gefahr scheint groß zu sein, dass Frühförderin und Mutter in eine gegenseitige Entwertungsspirale geraten angesichts der Behinderung des Kindes und der von beiden empfundenen Ohnmacht.
Das Problem der Entwertung der Frühförderin kann aber auch auf den Erfahrungen der Eltern beruhen, innerhalb denen sie selber bereits viel Entwertung und Abwertung erlebt haben, die sie nun ihrerseits an die Frühförderin weitergeben.
Wie versprochen nahm ich in regelmäßigen Abständen telefonischen Kontakt mit der Familie auf, um zu erfahren, wann sie beabsichtigte, die Frühförderung fortzusetzen, nur um einmal davon zu hören, dass die Mutter schwer krank war und ein anderes Mal davon, dass die Fahrprüfung verschoben werden musste. Dieses im wahrsten Sinn des Wortes "Hin und Her" setzte sich über etwa zwei Monate fort, bis der Fahrkurs offenbar abgeschlossen war und die Frühförderung wieder beginnen konnte. Ich bestand auf einem klärenden Gespräch, bevor wir einen neuen Arbeitsbeginn in der Familie vereinbarten.
Dieses Gespräch mit der Mutter fand bei ihr zu Hause statt, und sie empfing mich freundlich. In dem Gespräch ging es mir darum, die Ziele für eine weitere Zusammenarbeit abzustecken. Von der Mutter kam zunächst der Wunsch, ich solle mit Anna Dinge unternehmen, die ihr Spaß machten. Anna hätte nämlich öfter geäußert, dass sie nicht mehr mit mir spielen wolle.
Die Mutter berichtete mir von einem Gespräch, das sie mit der Beratungskindergärtnerin im Kindergarten geführt hätte, und diese hätte Unternehmungen für Anna vorgeschlagen wie etwa das Malen mit Fingerfarben auf einem großen Stück Papier. Ich erinnerte die Mutter nicht daran, dass ich das mit Anna schon versucht hatte, sondern nahm diesen Vorschlag auf und erklärte ihr auch, dass meine vorhergehenden Bemühungen in dieselbe Richtung gegangen waren und ebenfalls das Ziel verfolgt hatten, Anna Körpererfahrungen zu vermitteln.
Daraufhin kam von Annas Mutter der Wunsch, ich solle Anna mehr fordern und mit ihr "richtige" Spiele machen, Spiele für vier- bis fünfjährige Kinder, die ihrem Alter entsprachen. Ich antwortete, dass ich immer wieder versuchen würde, die Anforderungen an Anna zu steigern, dass ich aber durch die lange Pause in der Frühförderung Annas momentanen Entwicklungsstand nicht beurteilen könne. Daraufhin beeilte sich die Mutter, mir zu versichern, dass Anna sich in den letzten drei Monaten sehr gut entwickelt habe und jetzt viel mehr könne.
Neben solchen Gedanken zur Planung der Frühförderung ging es in dem Gespräch auch um den erfolgreich abgeschlossenen Fahrkurs der Mutter. Sie berichtete mir voller Freude und Stolz davon, und ich freute mich sehr für sie, dass sie diesen Schritt in Richtung Unabhängigkeit geschafft hatte.
Wir vereinbarten am Schluss des Gespräches den ersten Frühfördertermin und einigten uns darauf, dass ich Fingerfarben und große Packpapierbögen mitbringen würde.
Was ich in diesem Gespräch verabsäumt habe anzusprechen, und worum es eigentlich gegangen wäre, war der rund um meinen Urlaub entstandene Konflikt. Es wäre sehr wichtig gewesen, die entstandene Kränkung bei der Familie anzusprechen und die Ebene zu thematisieren, auf der die Schwierigkeiten zwischen der Mutter und mir nun ausgetragen wurden: die Ebene der Terminvereinbarungen. Es wäre nötig gewesen, Frühförderung an und für sich zum Thema zu machen und die Art von Hilfe, die die Eltern sich wünschten oder brauchten.
Stattdessen bin ich im Gespräch schnell wieder auf die Handlungsebene gegangen, auf der wir uns über Förderziele unterhielten. Es war mir in diesem Moment nicht bewusst, dass eigentlich jede Grundlage, jeder Konsens fehlte, um eine weitere Förderung zu planen.
Gezeigt hat sich auf dieser Ebene aber etwas, was wohl die Gefühlslage von Annas Mutter ebenso charakterisierte wie ihre Handlungen: ihre Ambivalenz in der Einstellung zu ihrem im Kind. Einerseits wollte sie von mir eine Art der Förderung, die Anna Spaß machte und ihr den Freiraum für eigene Erfahrungen bot, und andererseits empfand sie es als sehr schmerzlich, dass ich ihrem Kind keine Spiele bot, die seinem Lebensalter entsprachen. Es muss hier derselbe Schmerz zum Vorschein gekommen sein, der sich schon rund um die von mir intensivierte Phase der Spiele mit Naturmaterial bei der Mutter gezeigt hatte. Sie empfand es als Kränkung, dass ich bei ihrem Kind "Babyspiele" anregte.
In dieser Ambivalenz zeigte sich der Wunsch danach, Anna wie jedes andere Kind auch zu behandeln und andererseits der Wunsch nach erfolgreicher Förderung. Annas Mutter befand sich hier wie alle Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder in dem Zwiespalt, ihr Kind annehmen zu wollen, so wie es ist, und ihm andererseits bessere Chancen für sein und ihr Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen und möglichst viel dafür zu unternehmen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals auf die von Ziemen (2002, S 199ff) formulierten Widersprüche im Leben und Erleben der Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder hinweisen.
"Ambivalenz erfordert integrierende Ich-Kräfte, um die Spannungen auszuhalten und die verschiedenen Empfindungen zu tolerieren. Sie wird dort problematisch, wo sie nicht mehr ertragen wird und deshalb aufgespalten werden muß. Es wird dann versucht, nur eine Seite der Ambivalenz zu leben und die andere aus dem Bewußtsein und in die Umwelt zu projizieren" (Jonas 1990, S 68). In so einem Fall hält die Mutter es nicht aus, ihrem Kind gegenüber auch negative Gedanken oder Gefühle zu hegen.
"Diese Form der Spaltung kann in der Frühförderung dadurch wiederbelebt und verstärkt werden, daß die Fachkräfte der Frühförderung z.B. ohne die Mütter mit dem Kind spielen. Damit wird der Abspaltung der ambivalenten Gefühle der Mütter Vorschub geleistet: Die Fachkräfte werden zu ‚guten Müttern', die offen und herzlich auf das Kind zugehen, mit ihm liebevoll spielen und es kompetent fördern. Um diese Spaltung nicht zu begünstigen, ist es nach Spörri-Schönle notwendig, in der Frühförderung die Ambivalenz der Mütter auszuhalten und den Müttern zu vermitteln, daß ihre innere Situation dem Leben mit ihrem behinderten Kind angemessen ist" (ebd. S 69).
Der an bestimmten Stellen immer wieder auftauchende Schmerz der Mutter spricht in meinen Augen auch für das Modell der "zirkulierenden Trauer" (ebd. S 129ff), das besagt, dass die Trauer bei den Eltern durch bestimmte auftretende Ereignisse oder Faktoren immer wieder von Neuem aufbrechen kann.
Da in der Art, wie sie ihre Wünsche äußerte, sehr viel Abwertung mir gegenüber spürbar war, fiel es mir aber schwer, darauf angemessen einzugehen, und ich blieb lieber auf der Handlungsebene, als die Gefühlsebene anzusprechen. Ich wollte mich rechtfertigen und mich beweisen, indem ich meine Bemühungen verstärkte, den Erwartungen der Muter gerecht zu werden.
Was in dem Gespräch eindeutig fehlte, waren meine Selbstkongruenz und meine Authentizität. Ich äußerte ebenso wenig, was ihre Aussagen und ihr Verhalten bei mir bewirkten, wie ich auch nicht wirklich danach fragte, wie die Mutter die Situation erlebte.
Dieses Nicht-Benennen des realen Konfliktes und das Nicht-Eingehen auf das wirkliche Thema unseres Konfliktes bewirkte letztendlich auch das Weiterbestehen der Schwierigkeiten.
Am vereinbarten Tag der ersten Frühfördereinheit nach der langen Pause hatte ich schon alles hergerichtet, als ein Anruf der Mutter kam, um mir mitzuteilen, dass Anna erkrankt wäre. Auch der Termin in der folgenden Woche wurde von der Mutter aus diesem Grund abgesagt.
Inzwischen hatte ich weitere Kinder in meine Betreuung aufgenommen und nur mehr einen Vormittagstermin frei, was ich Annas Mutter mitteilte, woraufhin sie meinte, das sei in Ordnung.
Am Tag dieses ersten vereinbarten Vormittagtermins erklärte sie mir dann aber, dass sie Anna wegen der Turnstunde im Kindergarten nicht früher abholen könne und dass sie mit diesem Termin überhaupt nicht einverstanden sei.
Zu diesem Zeitpunkt war ich vollkommen ratlos, auch weil die Mutter meine inzwischen öfter gestellte Frage, ob sie denn überhaupt noch Frühförderung in Anspruch nehmen wolle, immer bejahte, dann aber praktisch jeden vereinbarten Termin platzen ließ.
Die erste Frage des Supervisors in der Fallsupervision ging dahin, warum ich mich auf ein solches "Spiel" mit der Mutter und auf die Frühförderpause überhaupt eingelassen hatte. Ich denke, ich wollte bis zum Schluss nicht wahrhaben, dass die Zusammenarbeit mit der Familie nicht mehr möglich war, dass es in der Beziehung zu den Eltern zu einem Bruch gekommen war, den ich auch durch noch so großes Bemühen und Eingehen auf die Wünsche der Mutter nicht mehr kitten konnte. Ich wollte mir mein Scheitern in dieser Familie nicht eingestehen und kämpfte weiter um die Anerkennung durch die Familie bzw. um eine weitere Chance, doch noch beweisen zu können, dass ich kompetent war. Den Motor für mein weiteres Bemühen bildeten wahrscheinlich die Schuldgefühle, die ich empfand, weil ich die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt und die Beziehung zu Anna sich nicht immer konfliktfrei gestaltet hatte. Erst durch die Supervision konnte ich erkennen, dass die Zusammenarbeit mit der betreffenden Familie schon längst beendet war. Alles, was mir jetzt noch blieb, war, dies der Familie gegenüber anzusprechen und mit den Eltern zu überlegen, wie es jetzt weitergehen solle.
Ich vereinbarte einen weiteren Gesprächstermin mit der Mutter, wobei ich schon ankündigte, dass ich mit ihr überlegen wolle, wie es mit der Frühförderung weitergehen solle. Sie reagierte wiederum sehr freundlich und entgegenkommend.
Als ich zum vereinbarten Termin bei der Familie erschien, war auch Anna anwesend. Sie begrüßte mich freudestrahlend, nahm meine Hand und wollte mit mir spielen. Ihre Reaktion verblüffte mich, weil sie überhaupt nicht zu dem Bild passte, das mir die Mutter inzwischen vermittelt und das meine Schuldgefühle noch verstärkt hatte. Auch wenn ich persönlich die Arbeit mit Anna immer als sehr herausfordernd erlebt hatte, hatte Anna offenbar doch gute Erinnerungen daran, was mich sehr erleichterte.
Annas Bruder war ebenfalls anwesend und wollte wissen, warum ich gekommen war. Ich sagte ihm, dass seine Mutter und ich wichtige Dinge zu besprechen hätten, worauf er neugierig im Türrahmen stehen blieb. Annas Mutter bat mich hingegen, mich schon zu setzen und sagte, sie würde gleich kommen. Sie wirkte sehr beschäftigt und lief zwischen Küche, Bad und Wohnzimmer hin und her, brachte Anna etwas zu trinken, holte Kleidung für Anna, um sie noch schnell umzuziehen und befahl ihrem Sohn sehr ärgerlich, das Haus zu verlassen. Kaum hatte sie sich neben mich hingesetzt, fiel ihr schon wieder etwas ein, was sie noch erledigen musste.
Auf diese Weise verging fast eine halbe Stunde, bis ich endlich mit ihr sprechen konnte. Ich hatte kaum gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass in unserer Zusammenarbeit ein Konflikt aufgetreten wäre, den wir offenbar nicht mehr lösen können, als mich die Mutter unterbrach und hastig sagte: "Nein, nein, wir können jetzt aber schon normal miteinander reden". Ich sagte ihr, dass ich von mir aus unser Arbeitsverhältnis gerne beenden möchte und erwähnte die Möglichkeit, dass eine andere Kollegin der Frühförderstelle die weitere Betreuung von Anna übernehmen könnte. Die Mutter wollte zwar nichts von Schwierigkeiten in unserer Beziehung wissen, nahm aber das Angebot der Fortsetzung der Frühförderung durch eine andere Frühförderin bereitwillig an. Erstaunlicherweise ergab sich im Anschluss daran noch ein sehr gutes Gespräch mit der Mutter, in dem wir den Verlauf von Annas Entwicklung in der Frühförderung Revue passieren ließen und in dem von der Mutter zum ersten Mal so etwas wie Wertschätzung für meine Bemühungen spürbar wurde. Ich konnte mich nun in einer entspannten Atmosphäre sowohl von Anna als auch von ihrer Mutter verabschieden und ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg wünschen.
Es war eine spannende Erfahrung für mich zu erleben, dass die Reaktion, die ich in der Interaktion mit der Mutter immer befürchtet hatte, nicht eingetreten war. Ich glaube, ich hatte immer Angst vor ihrer Kritik, ihrer Unzufriedenheit und ihren Schuldzuweisungen. Dass es ihr zum Schluss möglich war, unsere Zusammenarbeit doch auch positiv zu sehen, zeigte mir, dass es in unseren Konflikten weniger um ihre Unzufriedenheit mit meiner Arbeitsweise ging, als um die mit ihrer Situation als Mutter eines körperlich und geistig schwer behinderten Kindes zusammenhängenden Schwierigkeiten und ihre dadurch entstandenen Belastungen. Insgesamt haben mein eigener Anspruch an den Erfolg meiner Tätigkeit, meine Abwehr gegen jegliche Kritik und meine Verstrickung in die Gefühlssituation der Mutter es verhindert, dass ich frei war, um auf die Sorgen und Nöte einzugehen, die wirklich hinter ihren Appellen standen.
Die Geschäftigkeit der Mutter vor unserem letzten Gespräch zeigt deutlich, wie unangenehm ihr selber die ganze Situation war. Große Aktivität scheint aber auch die Art ihres Umgangs mit den Belastungen gewesen zu sein. Es war für sie nur schwer möglich, Ruhe auszuhalten, so als könnten in der Ruhe all die schmerzlichen Gefühle auftauchen, die sie so konsequent unterdrückte.
Irgendwie haben wir uns wohl beide vor einem offenen Gespräch gefürchtet. Ihre Aussage: "Nein, nein, wir können jetzt aber schon normal miteinander reden", ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie nicht genauer auf das eingehen wollte, was vielleicht hinter unseren Beziehungsschwierigkeiten steckte. So, wie sie in Gesprächen mit mir immer auswich oder abblockte, wollte sie auch hier eine Grenze ziehen. "Normal reden" hieß für sie wahrscheinlich, dass wir nicht tiefer gehen sollten. Der Appell kam bei mir aber auch so an, dass sie nicht mit mir in einen offenen Konflikt kommen wollte.
Im letzten Gespräch bestätigte sich auch etwas, was ich vorher schon vermutet hatte: dass meine geringe Standfestigkeit in den Gesprächen zuvor die Familie eher verunsichert hatte.
"Für die Gestaltung der Arbeitsbeziehung kommt es [...] darauf an, den eigenen fachlichen Standpunkt klar zu haben, ihn aber auch als hilfreich erfahrbar zu machen. Dies bedingt, ihn mit den Eltern abzustimmen, und ihn auch an der jeweiligen Situation orientiert zu verhandeln" (Weiß 2000, S 221).
Jetzt, da ich klar gesagt hatte, dass ich die Zusammenarbeit beenden wollte, konnte die Mutter besser mit mir umgehen. Vielleicht hätte sie auch besser damit umgehen können, wenn ich im Bereich von Annas Förderung ebenso viel Sicherheit an den Tag gelegt hätte.
Letztendlich war es sehr schwierig für mich, mit der bei Annas Mutter so spürbaren Ambivalenz umzugehen, diese ambivalente Gefühlslage der Mutter als ihrer Situation entsprechend wahrzunehmen und gelassen damit umzugehen. Gerade in ihrer ambivalenten Haltung und damit eigenen Unsicherheit hätte sie meine Festigkeit sehr gebraucht.
Andererseits gibt es vielleicht auch Konstellationen in der Frühförderung, bei denen ein Wechsel in der Person der betreuenden Frühförderin angebracht ist und für alle beteiligten Personen eine Entlastung bringen kann.
Dass die Schwierigkeiten in der Frühförderung in dieser Familie gerade im letzten Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt so eskaliert sind, kommt aber wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Ich denke, dass angesichts der allmählich näher rückenden Konfrontation der Familie mit der Norm der Schulreife Annas Behinderung noch einmal in aller Konsequenz für die Eltern wahrnehmbar wurde. Ich habe den Eindruck, dass damit auch der Wunsch nach einer günstigen Beeinflussung der Behinderung wieder sehr stark geweckt wurde. Auf der anderen Seite erhofften die Eltern sich vielleicht ein Wunder und wollten am liebsten gar nichts mehr mit der Frühförderung zu tun haben, vor allem dann nicht, wenn die Frühförderung den Hoffnungen nicht gerecht werden konnte, die sie anfangs vielleicht einmal verheißen hatte.
Es ist sehr wichtig, dass sich die Frühförderin bereits mit den Grenzen ihrer eigenen Kompetenz und ihres Könnens vertraut gemacht hat, und dass sie nicht von sich selber erwartet, alle Probleme der Familie lösen bzw. für alles zuständig sein zu können. Dies zeigen die eben geschilderten Beispiele deutlich.
Der Aspekt des Begleitens beinhaltet ja gerade, dass es sich dabei um ein Mit-Gehen auf dem Weg der Eltern, der Familie, des Kindes handelt. Mit-Gehen kann heißen, den Weg der Eltern zu achten und an ihrer Seite zu stehen, dabei aber den Weg des Kindes nicht aus den Augen zu verlieren. Mit-Gehen kann heißen mitzufühlen, mitzuerleben, mitzuempfinden, in welcher Situation sich die einzelnen Familienmitglieder befinden. Mit-Gehen kann heißen, die Appelle aufzunehmen, die anklingen oder nur zwischen den Zeilen wahrnehmbar sind. Mit-Gehen kann heißen, die Meinung des anderen und seine Beweggründe zu kennen und zu respektieren, was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht anders positionieren kann. Mit-Gehen heißt vor allem zu verstehen, was im anderen gerade geschieht, worunter er leidet, was ihn beschäftigt, ängstigt oder schmerzt. Mit-Gehen kann heißen, etwas anzusprechen, etwas anzuregen, auf etwas aufmerksam zu machen. Mit-Gehen kann ich auch im Gefühl und in den Gedanken des anderen. Mit-Gehen heißt ein Stück Verantwortung mittragen, ohne dem anderen Entscheidungen abzunehmen oder ihn zu bevormunden.
Auf das Erleben der Eltern zu achten, es anzusprechen, nachzufragen und es auszuhalten, ist vielleicht einer der wichtigsten Hinweise für die Arbeit in der Frühförderung.
Dabei gilt es aber auch, das eigene Erleben im Blick zu haben und zu erkennen, wie man als Frühförderin auf die Behinderung des Kindes und auf die Ansprüche der Eltern reagiert.
Wie wichtig dafür Ressourcen sind, die der Frühförderin von der Arbeitgeberseite zur Verfügung gestellt werden sollten, zeigen die beiden Beispiele ebenso. Gerade durch die Arbeit in der Familie verschwimmen die Grenzen leicht, was es der Frühförderin schwer macht, ihren angemessenen Platz zu finden und zu halten.
Ich denke, dass es gut sein kann, sowohl mobiles als auch ambulantes Arbeiten in der Frühförderung anzubieten und in jedem einzelnen Fall genau abzuwägen und zu bedenken, welche Form den Bedürfnissen und der Konstellation der Familie mehr entspricht.
"‚Förderungsbegleitende Elternarbeit' setzt - so meinen wir, und das ist unsere Erfahrung - ambulantes Arbeiten voraus: Die Überwältigung durch die familiäre Atmosphäre, diese Reizvielfalt und der letztlich nicht definierbare Arbeitsplatz stellen Bedingungen dar, die für das konzentrierte Arbeiten auch an außergewöhnlichen inneren Schauplätzen ungeeignet sind" (Weiß/Baumann 1989, S 61).
Wenn eine mobile Arbeitsform gewählt wird, sollte meiner Meinung nach zumindest die Möglichkeit bestehen, wichtige Gespräche an einen Ort außerhalb der Familie zu verlegen, etwa an die Frühförderstelle.
Ein klares Arbeitskonzept und ein klarer theoretischer Rahmen erleichtern die Arbeit von Beginn an sehr, weil die Eltern dann wissen, womit sie rechnen können. In diesem Sinne sind auch regelmäßige Verständigungsgespräche und ein regelmäßiges Überprüfen des Arbeitsbündnisses unerlässlich dafür, sich im Einverständnis mit den Eltern zu bewegen.
Die Frühförderin "muss Klarheit schaffen, was sie wann und wo tun wird, und was sie dabei von den Eltern braucht. Gleichzeitig wird sie dabei deutlich machen, dass sie auf die Gegebenheiten der Familie Rücksicht nimmt und ihre Autorität als Eltern respektiert. Das erfordert viel Selbstsicherheit, Taktgefühl und Flexibilität" (Thurmair/Naggl 2000, S 221).
Wenn Schwierigkeiten, Spannungen oder Konflikte in der Beziehung zu den Eltern entstehen und spürbar werden, ist es hilfreich zu erkennen, auf welcher Ebene die Unzufriedenheit oder der Konflikt besteht und im Weiteren auf dieser Ebene anzusetzen.
Eine psychoanalytische Sichtweise kann hier in der Frühförderung ein spezifisches Verstehen bestimmter Probleme und Situationen, ein Erkennen und Reflektieren der teilweise unbewussten Beziehungsdynamik und eine veränderte Sichtweise bei der Frühförderin bewirken, die sich wiederum auf ihr Handeln und die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen auswirken kann.
Für die Frühförderin ist es wichtig, das bei sich zu entwickeln, was möglich ist und zu wissen, wer darüber hinausgehend zuständig sein kann. Die "eigene berufliche Mitte" (Weiß 2000, S 222) zu kennen und auch zu halten, zu wissen, wo die eigene Kompetenz trägt und wo sie Grenzen überschreitet, das eigene Selbstverständnis zu halten aber gegebenenfalls auch zu reflektieren, dies alles sind Aufgaben der Frühförderin.
Ob die Frühförderin mehr kindorientiert oder mehr elternorientiert arbeitet, hängt von ihrer Ausbildung, ihren Überzeugungen und ihren Kompetenzen ab, letztlich aber auch von der Unterstützung und vom theoretischen Konzept der dahinterstehenden Institution.
Um zu einer selbstkongruenten und einfühlenden Haltung der Familie gegenüber zu gelangen, ist es aber ebenso notwendig, dass sich die Frühförderin mit dem Thema der Behinderung selber bereits auseinandergesetzt hat, ihre eigenen Einstellungen und Gefühle dazu kennt und auch den unbewussten Anteilen nachgegangen ist.
In jedem Konflikt mit der Familie werden auch eigene Anteile der Frühförderin sichtbar. Diesen sollte sie in Selbsterfahrung und Supervision nachspüren können.
"Gerade weil Frühbehandlung so erfolgreich ist, muss stets darauf hingewiesen werden, dass Therapie nicht allmächtig ist. Es ist auch nicht alles wegtherapierbar. Statt pädagogischem Aktionismus ist bei mancher Grenzerfahrung eher eine Trauerarbeit angebracht. Es geht um ein behutsames Heranführen an das Eingestehen von Grenzen. Es gilt auch, Abschied von Idealen zu nehmen, Lebenskonzepte umzuschreiben.
Eine Frühbehandlung, die - zumindest als Phantasie - spätere Begrenzungen nicht thematisiert, kann eine pädagogische Hochstapelei fördern. [...] Die Verleugnung bzw. Überkompensation der Defizite verschlingt dann alle Kraft, vor allem die, die gebraucht würde, um die anderen, die positiven, vielleicht versteckten Talente hervorzubringen" (Oelsner in Leyendecker/Horstmann 2002, S 197).
In diesem Sinne sollte der Satz "Werde, der du bist" (Kierkegaard in Bölling-Bechinger 1998, S 181) Leitspruch einer Familienbegleitung in der Frühförderung sein, die eine sichere Bindung und eine Autonomieentwicklung beim Kind ebenso wie das Wiedergewinnen des Vertrauens in die eigene Erziehungsfähigkeit und das Wiederentdecken eigener Lebensziele bei den Eltern zum Ziel hat.
Frühförderung ist aber auch ein Feld, das von Widersprüchen und Ambivalenzen geprägt ist, die durch die archaischen Ängste und die gesellschaftlichen Phantasmen gegenüber "Behinderung" aufrecht erhalten und immer wieder spürbar werden. Zu wissen, dass solche Widersprüche nicht einfach gelöst werden können, und dass es im Grunde darum geht, sie zu erkennen, zu thematisieren, auszuhalten und mit ihnen umzugehen, ist eine Voraussetzung für das Gelingen der Arbeit der Frühförderin.
Das Ziel einer Frühförderung und Familienbegleitung kann demnach kein von vorneherein für alle Familien festlegbarer harmonischer Endzustand sein, sondern jeweils nur etwas, das sich im Begleiten der Familie einstellen wird.
Der Weg ist das Ziel.
Baumann, Sybille & Weiß, Hans (1989): "Förderungsbegleitende Elternarbeit" und familiäre Lebenswelt: Eine Nicht-Beziehung? In: Frühförderung interdisziplinär, 8. Jg., S 49-63. München Basel, Ernst Reinhardt
Behringer, Luise (2001): Zur Situation von Familien. In: Frühförderung interdisziplinär, 20. Jg., S 157-165. München Basel, Ernst Reinhardt
Bölling-Bechinger, Hiltrud (1998): Frühförderung und Autonomieentwicklung. Heidelberg, Edition Schindele
Busch, Hans Joachim (2001): Die Anwendung der psychoanalytischen Sozialforschung. Teil I: Psychoanalytisch orientierte Sozialforschung als Interpretation kultureller Objektivationen - Die Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. Teil II: Wege direkter psychoanalytisch orientierter Sozialforschung und psychoanalytisch orientierte Ansätze des Verstehens fremder Kulturen. In: Psychoanalyse. Texte zur Sozialforschung, 5. Jg., S 21-39 und 203-233.
Chatelanat, Gisela (2002): Was wollen Eltern - und was kann Frühförderung? In: Frühförderung interdisziplinär, 21. Jg., S 113-120. München Basel, Ernst Reinhardt
Chur, Dietmar (1997): Beratung und Kontext. Überlegungen zu einem handlungsleitenden Modell. In: Nestmann, Frank (Hrsg.): Beratung. Bausteine für eine interdisziplinäre Wissenschaft und Praxis, S 39-69. Tübingen, dgvt-Verlag
Cloerkes, Günther (1997): Soziologie der Behinderten. Heidelberg, Winter Verlag
Elbert, Johannes (1982): Geistige Behinderung - Formierungsprozesse und Akte der Gegenwehr. In: Kasztantowicz, Ulrich (Hrsg.): Wege aus der Isolation - Konzepte und Analysen der Integration Behinderter in Dänemark, Norwegen, Italien und Frankreich, S 56-105. Rheistätten, Schindele Verlag
Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e. V. (EKFuL) (1997): Beratung und Begleitung für Eltern mit einem behinderten oder von Behinderung bedrohten Kind. Eigendruck
Feuser, Georg (1994): Selbstorganisation und Koevolution. (Lehrveranstaltungsunterlagen) Aus: Feuser, Georg: Vom Weltbild zum Menschenbild. Aspekte eines neuen Verständnisses von Behinderung und einer Ethik wider die "Neue Euthanasie". In: H.-P. Merz & E. Frei (Hrsg.): Behinderung - verhindertes Menschenbild? S 93-174. Luzern, Edition SZH
Finger, Gertraud & Steinebach, Christoph (Hrsg.) (1992): Frühförderung zwischen passionierter Praxis und hilfloser Theorie. Freiburg im Breisgau, Lambertus
Fritsche, Anne; Thurner, Isolde; Weiß, Hans (1993): Boden unter den Füßen kriegen. Schritte eines Autonomieprozesses in der Frühförderung. In: Frühförderung Interdisziplinär, 12. Jg., S 65-72. München Basel, Ernst Reinhardt
Fröhlich, Andreas (1993): Die Mütter schwerstbehinderter Kinder. Heidelberg, Edition Schindele
Fröhlich, Volker (1992): Probleme verstehender Kinderforschung, dargestellt an einem Projekt mit körperbehinderten Kindern. In: Fröhlich, Volker & Göppel, Rolf (Hrsg.): Sehen - Einfühlen - Verstehen. Psychoanalytisch orientierte Zugänge zu pädagogischen Handlungsfeldern, S 99-116. Würzburg, Königshausen und Neumann
Fröhlich, Volker (1994): Psychoanalyse und Behindertenpädagogik. Würzburg, Verlag Königshausen & Neumann
Funk, Hiltrud/ Werkstattgruppe familienorientierte Frühförderung (Hrsg.) (2000): Das behinderte Kind und seine Eltern. Psychoanalytische Perspektiven der Frühförderung. Heidelberg, Asanger Verlag
Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (Hrsg.) (1996): Behinderung als menschliches Phänomen. Tagungsbericht der GLE. Eigendruck
Gstach, Johannes (1996): Die innere Welt der Eltern und die Lebenswelt des Säuglings. Die heilpädagogische Frühförderung im Grenzbereich zwischen Psychotherapie und Beratung. Ein Blick in den angelsächsischen Raum. In: Frühförderung interdisziplinär, 15. Jg., S 116-123. München Basel, Ernst-Reinhardt
Hackenberg, Waltraud (2003): Beziehung in der Frühförderung. Konsequenzen für die Ausbildung. In: Frühförderung interdisziplinär, 22. Jg., S 3-11. München Basel, Ernst Reinhardt
Heinze, Thomas (1995): Qualitative Sozialforschung. Erfahrungen, Probleme und Perspektiven. Opladen, Westdeutscher Verlag
Hinze, Dieter (1993): Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich. Heidelberg, Edition Schindele
Horstmann, Tordis (1990): Das chronisch kranke und behinderte Kind und seine Familie. In: Frühförderung interdisziplinär, 9. Jg., S 12-18. München Basel, Ernst Reinhardt
Jaehne, Michael; Malzan, Susanne; Neuhäuser, Gerhard (1995): Frühförderung aus Sicht der Eltern und kindliche Entwicklung. In: Frühförderung interdisziplinär, 14. Jg., S 11-17. München Basel, Ernst Reinhardt
Jetter, Karlheinz (1995): Familienalltag und Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär, 14. Jg., S 49-58. München Basel, Ernst Reinhardt
Jonas, Monika (1990): Trauer und Autonomie bei Müttern schwerstbehinderter Kinder. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag
Kallenbach, Kurt (1997): Väter schwerstbehinderter Kinder. Wien, Jugend & Volk
Klitzing, Kai von (Hrsg.) (1998): Psychotherapie in der frühen Kindheit. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht
Koch-Kneidl, Lisa & Wiesse, Jörg (Hrsg.) (2000): Frühkindliche Interaktion und Psychoanalyse. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht
Kriegl, Huberta (1993): "Behinderte" Familien?. Wien, Jugend und Volk
Lambeck, Susanne (1992): Diagnoseeröffnung bei Eltern behinderter Kinder. Göttingen, Verlag für angewandte Psychologie
Lanners, Romain (2002): Die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär, 21. Jg., S 212-129. München Basel, Ernst Reinhardt
Leithäuser, Thomas & Volmerg, Birgit (1988): Psychoanalyse und Sozialforschung: eine Einführung am Beispiel einer Sozialpsychologie der Arbeit. Opladen, Westdeutscher Verlag
Leyendecker, Christoph & Horstmann, Tordis (Hrsg.) (2002): Große Pläne für kleine Leute. Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär. Band 6. München Basel, Ernst Reinhardt
Lüpke, Hans von (Hrsg.) (1997): Entwicklung im Netzwerk. Pfaffenweiler, Centaurus
Mannoni, Maud (1972): Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter. Olten und Freiburg im Breisgau, Walter-Verlag
Miller, Nancy (1997): Mein Kind ist fast ganz normal. Stuttgart, Georg Thieme Verlag
Moser, Heinz (1995): Grundlagen der Praxisforschung. Freiburg im Breisgau, Lambertus
Niedecken, Dietmut (1998): Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. Berlin, Luchterhand
Plaute, Wolfgang; Theunissen, Georg; Westling, David (1997): Welche Wünsche haben Eltern von entwicklungsverzögerten oder behinderten Kindern in Deutschland und in Österreich? - eine Vergleichsstudie. (Kopie ohne weitere Angaben)
Pretis, Manfred (1998): Das Konzept der "Partnerschaftlichkeit" in der Frühförderung. Vom Haltungs- zum Handlungsmodell. In: Frühförderung interdisziplinär, 17. Jg., S 11-17. München Basel, Ernst Reinhardt
Pretis, Manfred (1999): Krisenintervention in der Interdisziplinären Frühförderung und Familienbegleitung. In: Frühförderung interdisziplinär, 18. Jg., S 145-155. München Basel, Ernst Reinhardt
Pretis, Manfred (2000): Frühförderung als Entwicklungschance. In: Hovorka, Hans & Sigot, Marion (Hrsg.): Integration(spädagogik) am Prüfstand. Menschen mit Behinderung außerhalb von Schule, S 113-127. Innsbruck, Studienverlag
Pretis, Manfred (2003): Bisher noch unveröffentlichte Studie zur Zufriedenheit der Eltern in der Frühförderung in der Steiermark auf der Grundlage anonymer Telefoninterviews. (Eigene Mitschrift vom Frühfördersymposium in Innsbruck im Mai 2003)
Schönwiese, Volker (1994): Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Eltern im Spannungsfeld von Selbstorganisation und professioneller Hilfen. Eröffnungsreferat zur Tagung des European-Integration-Network (EIN) im HELIOS-Programm der Europäischen Kommission, Reutlingen, 20-25.9.1994. (Lehrveranstaltungsunterlagen)
Schönwiese, Volker (1995): Behinderung - Rehabilitation - Integration . Referat beim Symposium "Rehabilitation - Integration . 20 Jahre Kinderneurologie am Rosenhügel. Wien, 5.5.1995. (Lehrveranstaltungsunterlagen)
Speck, Otto & Warnke, Andreas (Hrsg.) (1983): Frühförderung mit den Eltern. München, Ernst Reinhardt
Speck, Otto (2001): Kinder- und Elternprobleme in einer risikoreichen Lebenswelt. In: Frühförderung interdisziplinär, 20. Jg., S 145-156. München Basel, Ernst Reinhardt
Steinebach, Christoph (1995): Familienentwicklung in der Frühförderung. Die Sicht der Mütter. Freiburg im Breisgau, Lambertus
Steiner, Simone (2002): Das Resilienzparadigma. In: Frühförderung interdisziplinär, 21. Jg., S 130-139. München Basel, Ernst Reinhardt
Theunissen, Georg & Garlipp, Birgit (1999): Kompetente Eltern - Vergessen in der Professionalität der Behindertenarbeit? In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 4/5, 22. Jg., S 53-66. Graz, REHA Druck
Theunissen, Georg & Plaute, Wolfgang (1995): Empowerment und Heilpädagogik. Freiburg im Breisgau, Lambertus
Thurmair, Martin & Naggl, Monika (2000): Praxis der Frühförderung. München Basel, Ernst Reinhardt
Trost, Rainer & Walthes, Renate (Hrsg.) (1991): Frühe Hilfen für entwicklungsgefährdete Kinder. Wege und Möglichkeiten der Frühförderung aus interdisziplinärer Sicht. Frankfurt New York, Campus Verlag
Turinski, Silvia (2003): Frühförderung und Familienbegleitung im ersten Lebensjahr. (Mitschrift ihres Vortrages beim Frühfördersymposium in Innsbruck im Mai 2003)
Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. (Hrsg.) (1991): Familienorientierte Frühförderung. Dokumentation des 6. Symposiums Frühförderung in Hannover. München Basel, Ernst Reinhardt
Weiß, Hans (1989): Familie und Frühförderung. Analysen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit Eltern entwicklungsgefährdeter Kinder. München, Ernst Reinhardt
Weiß, Hans (1992): Annäherungen an den Empowerment-Ansatz als handlungsorientierendes Modell in der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär, 11. Jg., S 157-169. München Basel, Ernst Reinhardt
Weiß, Hans (1993): Kontinuität und Wandel in der Frühförderung. Zu Erfahrungen und Perspektiven früher Hilfen. In: Frühförderung interdisziplinär, 12. Jg., S 21-36. München Basel, Ernst Reinhardt
Weiß, Hans (Hrsg.) (2000): Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen. Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär. Band 7. München Basel, Ernst Reinhardt
Ziemen, Kerstin (2002): Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder. Butzbach-Griedel, AFRA Verlag
Ziemen, Kerstin (2003): Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder. In: Frühförderung interdisziplinär, 22. Jg., S 28-37. München Basel, Ernst Reinhardt
|
Name: |
Cornelia Köll-Senn |
|
geboren am: |
28.06.1973 in Zams als erstes von vier Kindern meiner Eltern Walter und Herta Senn |
|
Familienstand: |
verheiratet seit 28.8.1998 |
|
Ausbildung: |
|
|
1979-1983 |
Volksschule in Tobadill |
|
1983-1987 |
Hauptschule Vorderes Stanzertal in Pians |
|
1987-1992 |
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Zams |
|
1992-1994 |
Lehrgang für Sonderkindergartenpädagogik an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Innsbruck, Falkstraße |
|
seit 1994 |
berufsbegleitendes Studium der Erziehungswissenschaften |
|
1998 |
Abschluss des Propädeutikums |
|
1998-2003 |
Fachspezifikum in Logotherapie und Existenzanalyse |
|
seit Jänner 2003 |
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision |
|
Berufslaufbahn: |
|
|
1992-1994 |
Kindergärtnerin in einem Heim für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen |
|
1994-2000 |
Sonderkindergärtnerin in einem Integrationskindergarten |
|
seit 2000 |
Frühförderin |
Quelle
Cornelia Köll-Senn: Gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Familienbegleitung in der Frühförderung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zwischen Eltern und Frühförderin.
Diplomarbeit an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, Juli 2003.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 29.04.2009
