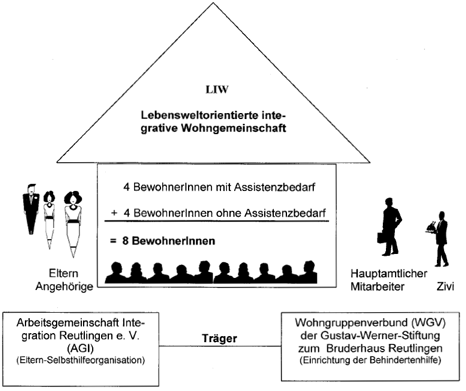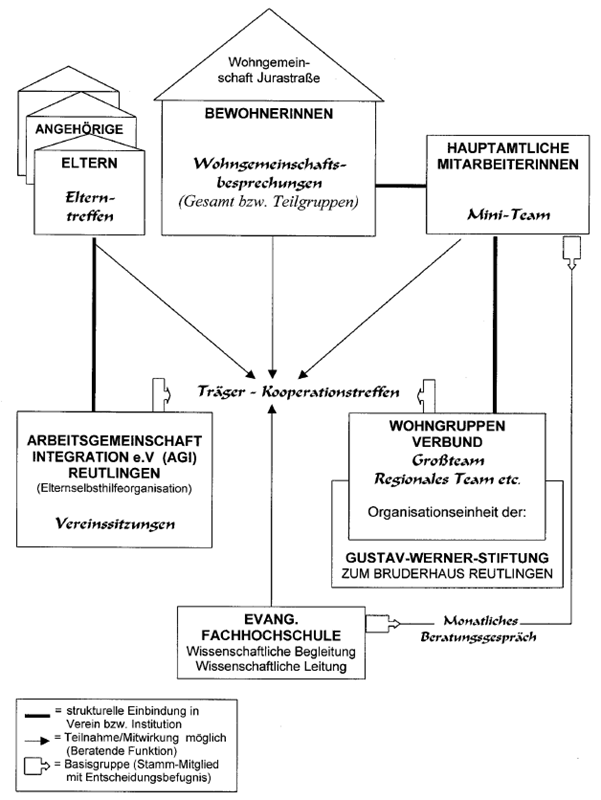Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft
Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg: Diakonie-Ver. 2001. ISBN 3-930061-74-0.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
- Vorwort der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. (AGI)
- Vorwort der Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus, Reutlingen
- „Ein ››LOS« alle“ – Einleitung
-
1 Zusammenleben von Frauen und Männern mit und ohne
Assistenzbedarf in der lebensweltorientierten, integrativen
Wohngemeinschaft (LIW)
- 1.1. Praxisverortung der LIW
-
1.2 Zur Forschungskonzeption
- 1.2.1 Gesellschaftliche Ausdifferenzierung, Individualisierung und die Gleichzeitigkeit von Exklusion und Inklusion
- 1.2.2 Das binäre Ordnungssystem: Normalität und Behinderung
- 1.2.3 Positionen und Perspektiven
- 1.2.4 Mit-Leben in der Gemeinschaft und Solidarität
- 1.2.5 Lebensqualität und Selbstbestimmung
- 1.2.6 „Gut und Billig“ - Das wirtschaftliche Qualitätsprofil als Übertragungsphänomen in der Behindertenhilfe
- 1.3 „Lieber lebendig als normal“ Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen
- TEIL A: ORT UND RAUM
- 2 Räumliche Bedingungen und assistenzgerechtes bzw. barrierefreies Wohnen
-
3 Standort der Wohngemeinschaft
- 3.1 Lebensweltorientierung - kurze Distanzen zu den bisherigen Bezugssystemen
- 3.2 Infrastruktur
- 3.3 Kulturelle und soziale Ortsidentität
- 3.4 Akzeptanz in der Nachbarschaft
- 3.5 Gemeinwesen
- 3.6 Exkurs: Möglichkeiten und Grenzen der Verantwortungsübernahme
- 3.7 Flexibel im Standort und in der Ausstattung
- TEIL B BEWOHNERINNEN
- 4 Zusammensetzung der WG
- Teil C ORGANISATIONS- UND ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN IN DER LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft
- 5 Organisationsstrukturen in der Wohngemeinschaft
- 6. Professionelle Begleitung/Institutionelle Ressourcen
-
7 Elterngruppe – Elternmitarbeit
- 7.1 Konzeptionelle Basis für Elternmitarbeit
-
7. 2 Elterngruppe
- 7. 2.1 „Förderung“ eines Elternaustauschs innerhalb einer LlW - Möglichkeiten zur Verarbeitung/Bewältigung einer neuen Lebenssituation
- 7. 2. 2 Elternkontakte bzw. Elternselbsthilfe - Entscheidungshilfen Eltern bei der Suche nach Wohnmöglichkeiten der Töchter/Söhne
- 7.2.3 Elternverantwortung und Sicherheitsrisiko
- 7.3 Elternmitarbeit
- 8 Trägerkooperation zwischen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe
- Teil D Assistenz, Teilhabe und Selbstbestimmung
- 9 Assistenz - Bedarf, Zeiten und Ressourcen
- 10 Teilhabe - Beteiligung und Alltagsgestaltung
-
11 Selbstbestimmung
- 11.1 Zwischen Kompetenz und Überforderung
- 11.2 „Normalität“ als Anspruch
- 11.3 Selbstbestimmung der Assistenzwahl
- 11.4 Durchsetzungsvermögen, Bewältigungsstrategien, Aushandiungsprozesse - eigene Perspektiven
- 11.5 Uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht
- 11.6 Selbständigkeit im Alltag und Wege zur Selbstbestimmung
- 11.7 Die Macht der Gewohnheit
- 11.8 Bedürfnisentdeckung als Grundlage für Selbstbestimmung
- 11.9 Freiheitsmomente im Alltag und strukturelle Grenzen der Selbstbestimmung
- 11.10 Alltagsgestaltung und Förderung im Kontext von Selbstbestimmung im Wohnbereich
- TEIL E „...VOR ALLEM...“ bis „ZUM ÜBRIGEN...“
- 12 Vor dem Einzug in die LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft... Planungsüberlegungen - Entscheidungswege - Finanzierung - Vereinbarungen /Verträge
- 13 „...und im übrigen...“ - Ein Aus-Blick
- Anhang
- Literatur
Abbildungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Gesellschaftliche lndividualisierungsprozesse sind Personen mit Beeinträchtigungen mit erheblichen Risiken verbunden, sie eröffnen aber auch neue Optionen und Gestaltungsmöglichkeiten, wie die „Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft“ zeigt.
Sie ermöglicht hoffnungsvolle Schritte zur selbstverständlichen Teilhabe am Leben in der Gemeinde und leistet damit einen Beitrag zur „Inklusion“ in aIItägliche(n) Lebenszusammenhängen.
Das neue Paradigma „Community Care“, in dessen Kontext wir auch das Wohnprojekt sehen, zeigt auch hier Perspektiven auf dem Weg zur Inklusion auf. „Community Care bedeutet, daß Menschen mit einer Behinderung in der örtlichen Gesellschaft (= Gemeinde, d. V.) leben, wohnen und arbeiten und sich erholen und dabei auch von der örtlichen Gesellschaft unterstützt werden“[1] Der neue Handlungsansatz geht von der Stärkung der Position der „Betroffenen“ aus und „konzentriert sich auf die kollektive Einwirkung der Nutzer auf ihre Hilfsdienste“ und die Einflußnahme „auf die politischen Rahmenbedingungen Planungen im Gemeinwesen“. Statt zentralisierter Formen institutioneller Unterstützung erfordert Community Care „die Gestaltung der Versorgung mit allen notwendigen Diensten im Gemeinwesen“ und den „Aufbau von lokaler unterstützender bzw. sorgender Gemeinschaft“.[2]
Inklusion und Community Care bündeln zentrale Forderungen der Selbsthilfebewegung und Kategorien der Sozialen Arbeit. In Kooperation mit den Elternorganisationen und (Sonder-) Einrichtungen versucht die Evang. Fachhochschule Reutlingen- Ludwigsburg seit Jahren, in einer Reihe von Projekten diesen Anspruch vor allem im Bereich beruflicher Integration von Frauen und Männern mit einer sog. geistigen Behinderung umzusetzen.
Ausgangspunkt war in den 90er Jahren das als Beschäftigungsinitiative konzipierte „Modellprojekt Berufsbegleitender Dienst Frauen und Männer mit schweren Beeinträchtigungen[3] mit einer Reihe von Nachfolgeprojekten zur Qualifizierung und beruflichen Bildung[4].
In dieser Kontinuität steht auch das Wohnprojekt, das von der Arbeitsgemeinschaft Integration und der Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus Reutlingen getragen wird.
Wie der Bericht zeigt, werden in diesem Projekt die von den Hamburger Kolleginnen unter Community Care definierten Ansätze im Rahmen des möglichen konsequent umgesetzt. Selbstbestimmung wird nicht nur postuliert, sondern es wird versucht, sie im Alltag zu leben. Mitbewohnerlnnen übernehmen Verantwortung im Zusammenleben im Sinne einer „lokal unterstützenden Gemeinschaft“ und erfahren dabei viel Freude und persönliche Befriedigung. (Organisierte) Eltern schaffen, in Kooperation mit einer Großeinrichtung, die bereit ist, sich zu öffnen, eine neue inklusive Facette in der gemeindeorientierten Angebotsstruktur und versuchen damit auch auf die politischen Rahmenbedingungen im Gemeinwesen und auf Landesebene Einfluß zu nehmen.
Der vorliegende Bericht dokumentiert und reflektiert in Ausschnitten die komplexen Erfahrungen in der lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft (LIW) Jurastraße in Reutlingen - Betzingen. Die wissenschaftliche Begleitung hatte den Auftrag, das Projekt zu begleiten und den Stand der Erfahrungen nach drei Jahren aus der Sicht der unterschiedlich Beteiligten auszuwerten und auf dieser Basis Rahmenbedingungen weitere Wohnprojekte zu definieren.
Aus der Sicht der Beteiligten werden das Zusammenleben von Frauen und Männern mit und ohne Unterstützungsbedarf, Formen der Assistenz, der Teilhabe und Selbstbestimmung im WG - Alltag und die Organisations- und Entscheidungsstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der Elternbeteiligung beschrieben. insgesamt stellt der Bericht aus unserer Sicht eine Fundgrube von Formen und (mehr oder weniger) gelungenen Möglichkeiten der Alltagsbewältigung dar, die den fast unerschöpflichen Reichtum aber auch die Konfliktkonstellationen des „Lebens in Widersprüchen“ in und um diese Wohnform herum widerspiegeln. Da diese Erfahrungen in unterschiedlichen theoretischen Bezugsrahmen reflektiert werden, lassen sich daraus auch weiterführende fachliche und sozialpolitische Perspektiven ableiten.
Im Vordergrund der theoretischen Bezüge steht die Diskussion um „Normalität und Behinderung“ und der Anspruch auf Inklusion und Selbstbestimmung. Dabei geht Jo Jerg neue Wege, indem er die Konzepte von „Ambivalenz“ (Baumann) und „die positionsbedingte Perspektive“ (Bourdieu) in den fachlich-wissenschaftlichen Diskurs um die Lebenssituation von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihren Assistenzbedarf einführt. Er kommt dabei zu überraschenden Perspektiven, die unser eigenes Verständnis von „Behinderung“ erweitern und neue Dimensionen das Zusammenleben in der WG eröffnen kann.
Insgesamt versucht er durchgängig, praktische Erfahrungen nicht nur solidarisch zu beschreiben und (in lnterviewform) zu dokumentieren, sondern sie in allen Bereichen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu reflektieren.
Die sehr beschränkten finanziellen Ressourcen machten eine Beschränkung der Fragestellungen und ein möglichst wenig aufwendiges Untersuchungssetting notwendig. die Bestandsaufnahme und die Erarbeitung weiterführender Perspektiven am Ende der Projektphase wurde daher eine „Rekonstruktionsmethode“ gewählt, bei der unterschiedliche Gesprächsgruppen ihre Erfahrungen auswerteten. Dies ermöglichte eine aktive Teilhabe aller Beteiligten am Forschungsprozeß. Der Gesprächsleitfaden ließ genügend Raum, sodaß alle die Möglichkeiten hatten, ihre Erfahrungen und Vorstellungen über das Zusammenleben in einer WG einzubringen. Durch die Sensibilität und den engen Kontakt des Berichterstatters mit den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen ist es gelungen, in den Gesprächen eine große Offenheit herzustellen, aber dabei auch die Privatsphäre der einzelnen Bewohnerinnen und der Gruppe zu wahren. Auch die Gespräche mit den Trägern zeichneten sich trotz zum Teil unterschiedlicher Positionen durch ein hohes Maß an Zufriedenheit über das gemeinsam Erreichte und ein konstruktives Bemühen aus, die konzeptionellen Positionen zu überprüfen und im Hinblick auf ein neues Projekt weiterzuentwickeln.
Eine offene Frage, mit denen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen in der Wohngruppe in unterschiedlichen Situationen durchgängig konfrontiert waren, war die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit in der Wohngemeinschaft. Eltern und Einrichtung hatten das Interesse, die positiven Erfahrungen publik zu machen. Die Bewohnerinnen, vor allem die ohne Behinderung, bestanden zurecht eher auf ihrer Privatsphäre. lm Alltag ergaben sich dann selbstbestimmte Regelungen, die z.B. die Teilnahme an Diskussionen oder Presseauftritte betrafen. Die Beteiligung erfolgte immer auf strikt freiwilliger Basis. Dies war auch die Begleitforschung oberstes Prinzip.
Die Offenheit kann allerdings auch die Träger Schwierigkeiten bringen, wenn die strukturellen Unzulänglichkeiten des Alltagsbetriebs durch die Berichterstattung nach draußen dringen, z. B. wenn es um die Frage der Betreuung während des Wochenendes geht, Hier gibt es unterschiedliche Positionen, die normalerweise eher unter Ausschluß der Öffentlichkeit ausgehandelt würden. Den Risiken der Veröffentlichung steht allerdings auch das Selbstbewußtsein der Beteiligten und die Erfahrungen von vier Jahren Zusammenarbeit gegenüber, die zeigen, daß die WG - Situation und die Trägerkonstellation immer wieder kreative Konfliktlösungsmöglichkeiten aktiviert.
Vieles aus dem Alltag der Wohngemeinschaft und der Zusammenarbeit auf Trägerebene wurde von Jo Jerg in diesem Bericht sensibel, verantwortungsvoll und kompetent erfaßt und facettenreich dokumentiert. Vieles bliebe zu berichten, von überraschenden Entwicklungen Einzelner und in der Gruppe, auch über die ersten Erfahrungen in der neuen WG (s. Vorwort AGl), die wieder ganz anders und doch in der Struktur sehr ähnlich sind. in beiden WGs sind aber vor allem die Bewohnerinnen die Protagonistlnnen des Alltags. Wir freuen uns, daß dies auch im vorliegenden Bericht zum Ausdruck kommt.
Wir bedanken uns auch im Namen des Rektors der Evang. Fachhochschule Reutlingen~Ludwigsburg bei allen Beteiligten, besonders
-
bei den Hauptpersonen der WG Jurastraße, den Bewohnerinnen und Rainer Prause, dem hauptamtlichen Mitarbeiter,
-
bei den Müttern der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz,
-
bei der Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus Reutlingen (GWS) die Bereitschaft, neue Wege zu gehen,
-
bei dem Leiter des Wohngruppenverbunds der GWS, Herrn Helmut Sikeler,
-
bei der Stiftung Bildung und Behíndertenförderung GmbH, Stuttgart,
-
bei der Südwest - AG evangelischer Fachhochschulen und der Gustav-Werneiß Stiftung die finanzielle Unterstützung des Projekts,
-
bei Jo Jerg sein Engagement und die kollegiale Form der Zusammenarbeit in und außerhalb der Fachhochschule.
Juli 2001
Prof. Dr. Werner Schumann
Prof. Dr. Peter Seiberth
[1] Esther Bollag, Community Care, in Orientierung 1/ 2000
[2] Vgl, Michael Tüllmann, Community Care - ein neues Paradigma der Behindertenhilfe in Hamburg? in www.rauheshaus.de
[3] vgl. Gertrud Meuth, Beratungskonzept zur beruflichen Integration, Reutlingen 1996
[4] 4 vgl. Susanne v. Daniels u.a., Wo's lang geht!, Reutlingen 2000
Inhaltsverzeichnis
Die Konzeption der Wohngemeinschaft wurde von der Arbeitsgemeinschaft Integration in einem langen Diskussionsprozeß mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen im Stadtgebiet entwickelt. Die Umsetzung erfolgte dann in der gemeinsamen Trägerschaft mit der Gustav-Werner-Stiftung, einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Die Stiftung verfügt im Wohngruppenverbund über langjährige Erfahrungen im Bereich gemeindeorientierten Wohnens und plant, den Community Care Ansatz in den nächsten Jahren konsequent umzusetzen.
In den intensiven Kooperationsprozeß brachten die Eltern ihre Vorstellungen von Integration / Inklusion und einem partnerschaftlichen Zusammenleben ein. Die Vertreter des Wohngruppenverbundes stellten ihr fachliches know how zur Verfügung und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur Strukturierung des Alltags und der Assistenzleistungen. Der Bericht dokumentiert, daß dieser Prozeß auch mit all seinen Schwierigkeiten, die sich aus unterschiedlichen inhaltlichen Positionen und Erfahrungshintergründen ergaben, alle sehr fruchtbar war. Bemerkenswert, wie es auch in problematischen Situationen immer wieder gelang, konstruktive und wegweisende Problemlösungen zu finden.
In der WG Jurastraße leben inzwischen seit mehr als vier Jahren 8 Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf zusammen, die von einem hauptamtlichen Mitarbeiter und zusätzlichen Kräften begleitet werden. Diese sind beim Wohngruppenverbund beschäftigt, der auch die Dienst- und Fachaufsicht übernimmt und die (finanziellen) Rahmenbedingungen verantwortlich zeichnet.
Das Ziel der AGI, in der Folge weitere Wohngemeinschaften zu etablieren, wurde im Mai 2001 realisiert: Eine weitere LIW konnte im Reutlinger Stadtteil Sondelfingen eröffnet werden.
die Eltern, die sich seit 2 Jahrzehnten in der AGI zusammen mit engagierten Fachleuten die Inklusion ihrer Kinder in allen Lebensbereichen eingesetzt haben, ist die Eröffnung dieser zwei Wohngemeinschaften ein mehr als bemerkenswertes Ergebnis: Zum ersten Mal in der Biographie ihrer Kinder ist es gelungen, sich den Vorstellungen von Lebensqualität in hohem Maße anzunähern.
In der Vergangenheit hat die AGI versucht, alle gesellschaftlichen und politischen Spielräume zu nutzen, um in verschiedenen Projekten (im Kindergarten, im Freizeitbereich usw.) integrative Strukturen zu schaffen. Mit den LlW's ist ein hoher Grad an Selbstbestimmung und Autonomie gewährleistet. Wie wir bisher beobachten, machen die Menschen mit Assistenzbedarf (erwartet schnell) eine sehr positive persönliche Entwicklung.
lm Umsetzungsprozeß einer neuen Wohnform bleiben Konflikte nicht aus; auch tauchen immer wieder neue Fragen auf, die in ihrer Beantwortung Konsens voraussetzen. Bisher konnte in der gemeinsamen Trägerschaft in sehr konstruktiver Weise von allen Beteiligten damit umgegangen werden.
mich als Mutter einer jungen Frau „mit“ ist ganz pragmatisch das Allerwichtigste es geht uns allen gut in und mit den WGs! Auch wenn wir uns noch nicht entspannt zurücklehnen können, so erleben wirr die LlWs doch als großen Erfolg und als ganz wichtigen Schritt in Richtung Inklusion und Community Care.
Da möchte ich im Namen der Eltern allen danken, die sich unsere Kinder mit langem Atem, persönlichem Mut und in einem Jahre dauernden Prozeß der kritischen Reflexion engagiert haben:
-
den Mitstreiterlnnen aus der AGI - den Mitarbeitern der Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
-
der Gustav-Werner-Stiftung
-
den Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen der LlWs
-
und ganz besonders unseren Töchtern und Söhnen, die uns auf dem mühevollen Weg von der Segregation zur Inklusion die Richtung gewiesen und die Kraft zum Durchhalten gegeben haben.
lm Juli 2001
Helga Platen (Vorstandsmitglied der AGI)
Wir freuen uns sehr, daß der Forschungsbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum gemeinsamen Wohnprojekt der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. und der Gustav Werner Stiftung vorliegt. Die lebensweltorientierte, integrative Wohngemeinschaft (LIW) bringt, das ist den differenziert erhobenen Äußerungen und Stellungnahmen der Frauen und Männer, die hier zusammen wohnen und ihren All- tag gemeinsam gestalten, ein hohes Maß an Lebensqualität. Diese Lebensform trägt ganz wesentlich dazu bei, daß sich die Lebensbedingungen Personen mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen verbessert haben. Was unter mehr Lebensqualität von den Frauen und Männer der Wohngemeinschaft erlebt wird, läßt sich erahnen, wenn man nur ein paar Überschriften des Kapitels "Lieber lebendig als normal" dieses Berichts überfliegt:
-
Ein eigenes Zimmer als Rückzugsort und Sicherheit in Bezug auf lntimität
-
Selbstbestimmung in angenehmer Atmosphäre
-
Assistenz in privater Wohnatmosphäre
-
Vielfalt und Verschiedenheit oder
-
Küche - Arbeitsplatz und Kommunikationsraum
In der gemeinsamen Konzeptionierung und Trägerschaft der lebensweltorientierten, integrativen Wohngemeinschaft haben sich die Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V, und die Gustav Werner Stiftung kennengelernt, verständigt, ergänzt, von einander gelernt und profitiert; sie haben die jeweils eigenen Interessen wahrgenommen und verstehen gelernt und verständlicherweise auch um Positionen gerungen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, die Lebensbedingungen Personen mit Behinderung zu verbessern. Die beiden Kooperationspartner haben diesen neuen Weg gemeinsam betreten, das dazu erforderliche Gepäck gemeinsam geschultert und Unwegbarkeiten geebnet.
Die vielfältigen Erfahrungen in den vergangenen vier Jahren und die jetzt vorliegende systematische Dokumentation und umfassende Evaluation der LIW sind neben dem genannten Punkt, nämlich der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Assistenzbedarf, die Gustav Werner Stiftung von außerordentlich großer Bedeutung. Sie stellen einen Meilenstein im Prozeß ihrer konzeptionellen Umprofilierung u.a. von der institutions- zur Subjektorientierung und von der Zentralisierung zur Dezentralisierung und zur Regionalisierung dar.
Leitbilder, Gesetze und Paradigma der Behindertenhilfe haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verändert. Ein Paradigmenwechsel wäre nicht denk- bar ohne die wertvollen Impulse sozialer Bewegungen wie der Selbsthilfebewegung von Menschen mit und ohne Behinderung, die sich Integration und Selbstbestimmung und community care, im Sinne eines Menschen mit Behinderung sorgenden Gemeinwesens, als Voraussetzung zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, unermüdlich einsetzen.
Die Gustav Werner Stiftung gestaltet den Wechsel im Selbstverständnis der Hilfen und Angebote Menschen mit Behinderung aktiv mit. Auf dem Weg zu einem sozialraumbezogenen Dienstleister, der im Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern dieser Dienste steht, haben die exemplarischen Erfahrungen mit der LlW eine heraus ragende und wegweisende Rolle. Wir sind im Veränderungs- und Durchsetzungsprozeß neuer Wohnangebote nicht nur auf alle beteiligten engagierten und risikofreudigen Pioniere und Pionierinnen angewiesen, sondern auch an der hier veröffentlichten Evaluation, weil wir der Meinung sind, daß Interessierte von unseren Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren können sollen, weil wir uns mit diesem innovativen Ansatz im Fachdiskurs plazieren wollen und weil wir auf der Basis der hier systematisch reflektierten Modellerfahrungen Angebote und Hilfen zur Alltagsbewältigung weiterentwickeln wollen.
Die Gustav Werner Stiftung betrachtet die Einschätzungen und Erfahrungen der beteiligten Personen zu LIW und diesen Forschungsbericht auch ganz besonders unter sozialpolitischen Gesichtspunkten hier in der Behindertenhilfepolitík in Baden- Württemberg, die de facto noch stark von institutionellen Ansätzen der Sozialplanung und Förderpolitik geprägt ist.
Das gemeinsame Wohnprojekt LIW ist die Gustav Werner Stiftung eine Herausforderung, die sie gerne angenommen hat, in einer Phase der baden-württembergischen Behindertenpolitik, die von Widersprüchlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung geprägt ist - so konstatiert der überörtliche Kostenträger neben der erwähnten lnstitutionsorientierung ein Überangebot an stationären Plätzen und verweist auf Regionalbedarfe und -versorgung, ohne daß es tatsächlich in allen Landkreisen eine regionale Sozialplanung in der Behindertenhilfe gibt. Als Folge fordert der überörtliche Kostenträger den Ausbau und Umbau in ambulante und offene Angebote, finanziert diese Bereiche jedoch nicht ausreichend und sichert sie nicht durch Rahmenverträge ab. Auch in den Umbau der Angebote muss von der Sozialpolitik investiert werden, um längerfristig wirkende Veränderungen tätigen zu können. Es braucht gerade auch in einer Umbauphase alle Beteiligten - potentielle Nutzer und Nutzerinnen, Kostenträger, Anbieter und das Gemeinwesen - Verläßlichkeit und Planungssicherheit. Die Gustav Werner Stiftung ist deshalb - wie andere Träger im übrigen auch - schon seit Jahren gefordert, die Brücken und Wege in diesen Doppelbotschaften selbst zu definieren, zu erproben und zu reflektieren und dies, bildlich gesprochen, in einer "Sandwichrolle", eingeklemmt zwischen Selbsthilfebewegung und Sozialpolitik bzw. Kostenträger.
Wir wünschen uns, daß dieser Forschungsbericht mit seinen vielfältigen Perspektiven, mit Neugier und Interesse gelesen wird, daß er Lust macht auf Nachahmung und daß er dazu beiträgt, verläßliche Wohnmöglichkeiten als Alternative zu bestehenden Angeboten zu etablieren, damit Wahlmöglichkeiten Frauen und Männer mit Assistenzbedarf eröffnet werden können.
Reutlingen, im Juli 2001
Gisela Marina Netzeband
Vorstand Jugend- und Behindertenhilfe Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus
Die Losung „Ein ››LOS« alle”[5] symbolisiert in Form eines kurzen Slogans in treffender Weise und in einer offenen Deutung die Situation einer „Lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft“ Menschen mit und ohne Assistenz- bedarf (im folgenden kurz LIW): Erstens: Alle Beteiligten ziehen ein Los, d.h. jede Person - ob als Bewohnerin mit oder ohne Assistenzbedarf oder als Begleitperson oder als Eltern - entsteht eine Chance. Zweitens symbolisiert ein Los immer einen neuen Beginn bzw. Start. Und drittens beinhaltet ein Los ein Wagnis mit offenem Ausgang im Sinne von damit zusammenhängenden Losungen, wie z, B. „Neues Spiel, neues Glück" oder „Wer wagt, gewinnt“. Damit ist auch eine Band- breite angesprochen, die sowohl eine Verbindung zu einem schweren Los mitenthält, als auch ein ganz besonderes Glück, das sich unvorhergesehen einstellen kann. Unabhängig davon ist außerdem in der WG tatsächlich „viel los“ - eben auch in einer mehrfachen Bedeutung. Die „Wohngemeinschaft Jurastraße“[6] war und ist ein Wagnis, ein Versuch mit offenem Ausgang - ein Versuch, der inzwischen vier Jahre gelebt wurde/wird.
In der Regel dienen Titel von Arbeiten dazu, eine Hauptbotschaft oder Erkennungszeichen oder ein Programm zu kennzeichnen. „Leben in Widersprüchen“ kennzeichnet den Alltag der LIW. Dabei werden gesellschaftliche Widersprüche, Widersprüche zwischen Ehrenamt und Professionalität, zwischen privat und öffentlich, zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit usw. sichtbar. Diese Realität der widersprüchlichen Welten wahrzunehmen und sich darin bewegen zu lernen, ohne den Blick nach vorne zu verlieren, ist ein zentraler Anspruch der LIW und der Träger.
In den folgenden Kapiteln werden auf dem Hintergrund der unterschiedlichen Positionen der Beteiligten ihre Sichtweisen dargestellt und reflektiert - auch mit der Erkenntnis, daß noch viele Entwicklungsprozesse im Wohngemeinschaftsalltag auf den Weg zu bringen sind.
Die zentralen Themen, die den Rahmen, das Gebäude und den Inhalt der LlW charakterisieren, sind nach räumlichen, zusammensetzungsrelevanten, strukturellen, organisatorischen und mitbestimmungsbezogenen Gesichtspunkten in einzelne Kapitel unterteilt worden. Der Blick und Weg richtet sich von den äußeren Gegebenheiten hin zu den inneren Strukturen. Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge gelesen werden, da sich kein fort- setzend vertiefender Aufbau aus dem Thema zwingend ergibt. Zwar bietet z. B. eine barrierefreie räumliche Ausstattung gute Bedingungen eine selbständige Lebensbewältigung, aber eine gute zwischenmenschliche Atmosphäre ist nicht zwangsläufig an räumliche Voraussetzungen gekoppelt. Zwischen den einzelnen Kapiteln bestehen gegenseitige Bedingungszusammenhänge, aber jedes Kapitel hat eine gleichwertige und eigenständige Stellung.
Auf einige Besonderheiten hinsichtlich der Schreibweise und Abkürzungen möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Auf dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen wurden alle Namen geändert. Textpassagen der lnterviewpartnerlnnen sind nur im Hinblick auf die Lesbarkeit um abgebrochene Teilsätze, die keine inhaltlichen Veränderungen mit sich brachten, gekürzt worden.
In unseren Arbeitszusammenhängen haben wir uns darauf geeinigt, daß wir die Bewohnerinnen mit sogenannten Behinderungen sprachlich unter der Bezeichnung „Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf“ (Kurzausführung: Bewohnerinnen m.A.) erfassen. Sogenannte nichtbehinderte Bewohnerinnen werden als „Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf“ (Kurzausführung: Bewohnerinnen o.A.) bezeichnet. Mit dieser Ordnung, Einteilung bzw. Sprache sind wir nicht ganz glücklich, aber die Orientierung am Assistenzbedarf bezieht sich auf die wertfreie Situationsdefinition, daß eine Assistenz bzw. Unterstützung mehr oder weniger je nach Person gewährleistet werden muß, um ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben in Würde etc. zu führen. Die Unterscheidung zwischen „mit“ und „ohne“ Assistenz- bedarf ist und bleibt unbefriedigend, weil es Menschen ohne Assistenzbedarf nicht gibt. Dieses Paradoxon - ohne die Unterstützung von anderen sind wir nicht und die gleichzeitige Kennzeichnung von Personengruppen mit diesem Etikett hat et- was Spitzfindiges. Deshalb ist diese Unterscheidung „mit“ und „ohne“ Assistenz- bedarf mit einer Portion Ironie gewählt und zu tragen; immer mit dem Wink, die herrschende Ordnungssystematik von Normalität versus Behinderung zu reflektieren und zu hinterfragen, warum wir die Unterscheidung benötigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1. Praxisverortung der LIW
-
1.2 Zur Forschungskonzeption
- 1.2.1 Gesellschaftliche Ausdifferenzierung, Individualisierung und die Gleichzeitigkeit von Exklusion und Inklusion
- 1.2.2 Das binäre Ordnungssystem: Normalität und Behinderung
- 1.2.3 Positionen und Perspektiven
- 1.2.4 Mit-Leben in der Gemeinschaft und Solidarität
- 1.2.5 Lebensqualität und Selbstbestimmung
- 1.2.6 „Gut und Billig“ - Das wirtschaftliche Qualitätsprofil als Übertragungsphänomen in der Behindertenhilfe
- 1.3 „Lieber lebendig als normal“ Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIWlebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen
In diesem Kapitel werden grundlegende Bezüge der LIW dargestellt und ein erster Einblick in die Bewertung der LIW gegeben. Zunächst werden die Zielsetzung, das Selbstverständnis und die Verortung der LIW kurz erläutert. Anschließend werden auf die relevanten Theorien Bezug genommen. Weitere forschungsrelevante Überlegungen, wie z.B. Methodenauswahl, Durchführung der Untersuchung, sind im Anhang zu finden[7]. Zum Schluß des Kapitels werden Aussagen von Beteiligten vorgestellt, die die Besonderheit und somit den Charakter der LIW nachzeichnen.
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ (Wolfgang Goethe)[8]
In unserer Gesellschaft gibt es unterschiedliche Gruppen, die marginalisiert wer- den und keine Anerkennung erfahren. Dieses Zitat von Goethe kann auch zwei- hundert Jahre später ohne Abstriche auf die Situation von Menschen mit Assistenzbedarf übertragen werden. Es drückt in seiner sprachlichen Genauigkeit die Machtverhältnisse aus, die zwischen diesen beiden Begriffen Toleranz und Anerkennung liegen. Tagtäglich bekommen Menschen mit Assistenzbedarf zu spüren, daß sie geduldet werden und den Status minderwertiger Bürgerinnen haben. In bezug auf das Wohnen von Menschen mit Assistenzbedarf sollen hier die Ziele und Grundhaltungen angesprochen werden, die die LIW auf dem Weg zur Anerkennung beitragen kann.
Was heißt wohnen? „Wohnen bedeutet nicht nur Versorgung, Unterkunft und Verpflegung, sondern Geborgenheit und Eigenständigkeit, Privatheit und Gemeinschaft, die Möglichkeit des Rückzugs und Offenheit nach außen." (Kräling 1995 121). Darin eingeschlossen sind auch Möglichkeiten, den eigenen Lebensstil zu pflegen, selbst zu entscheiden, wie ordentlich das eigene Zimmer aufgeräumt ist, an welchen Aktivitäten mann/frau teilnehmen möchte etc. - unabhängig von den notwendigen gemeinsamen Prozessen der Gestaltung des Miteinanderlebens. Ausgangspunkt und Anspruch der Wohngemeinschaft ist deshalb, daß Menschen - unabhängig von ihrem Assistenzbedarf - die Möglichkeit haben, eine eigenständige Lebensführung in „normalen“ Lebensbezügen zu entwickeln. Dazu gehört auch, daß sie in bezug auf das Wohnen, wie alle anderen Menschen, von zu Hause oder aus Institutionen ausziehen können. Die Ablösung von den Eltern ist jedes „Kind“ ein wichtiger Prozeß im biographischen Verlauf und kann in bezug auf die Selbständigkeit und Autonomie einen erheblichen Beitrag leisten.
Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Konzept vorgestellt werden, das die bisherigen Angebote der Behindertenhilfe erweitern könnte. Das Konzept versteht sich als eine Ergänzung und Alternative zu stationären bzw. ambulanten Wohnformen. Gleichzeitig bietet es ebenso Menschen ohne Assistenzbedarf eine Alternative zu den gängigen Wohnformen und kann Eltern von Söhnen/Töchtern mit Assistenzbedarf bei der Suche nach normalisierten Wohnformen in ihrer Ablösungs- phase entlasten. Mit anderen Worten: Die strukturelle Einbindung der LIW in die Behindertenhilfe würde Menschen mit Assistenzbedarf eine größere Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus ermöglicht sie die Bildung neuer Rahmenbedingungen Nichtaussonderung bzw. gemeinsame Lebensformen von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf und fördert den Entwicklungsprozeß der Teilhabe.
Auf dem Hintergrund und den Erfahrungen der 40jährigen Arbeit der Integrations- bewegung zur Verwirklichung des Normalisierungsprinzips unter der prägenden Formel „Ein Leben so normal wie möglich“ (Thimm 1994) ist die LIW gebettet. Aus der Perspektive der Alltagsbegleitung und -bewältigung wird versucht, den proklamierten Paradigmawechsel in der Beziehungsgestaltung - „Vom Betreuer zum Begleiter" (vgl. Hähner: 1997) - zu verwirklichen. Eine weitgehend „entpädagogisierte“, partnerschaftliche und lebensweltorientierte Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf soll die gleichberechtigte Teilhabe in der Gemeinschaft und das Recht auf Selbstbestimmung fördern sowie die „Deinstitutionalisierung“ (Jantzen 1999) des Lebens von Menschen mit Assistenzbedarf vorantreiben.
Das Vorhaben, Standards und Rahmenbedingungen einer LIW festzulegen, weckt die Erwartung, klare Aussagen zu den Bedingungen machen zu können. Das all- tägliche Zusammenleben in der LIW ist vielfältig, widersprüchlich und von konkreten Personen abhängig, die dort wohnen oder eine Begleitfunktion übernehmen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, inwiefern die Standards bzw. Methoden und Verfahren, die sich auf dem Hintergrund der Reutlinger Situation als positiv bewährt haben, auf andere Situationen übertragbar sind. Dies betrifft die sozial-strukturellen Gegebenheiten, die sozialräumlichen Voraussetzungen und die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft, die sehr stark durch die individuellen Persönlichkeiten und die daraus folgende Gruppendynamik geprägt sind. Wie jemand sein Zuhause erlebt, ist auch eine Frage der subjektiven Befindlichkeit (vgl. Keul 1998 :44).
Weiterhin - und das ist ein gewichtiger Aspekt - stellt sich die Frage nach den implizierten Leitideen, die hinter einem Konzept und den Begriffen wie Selbstbestimmung, eigene Lebensführung etc. stehen. Hier kann es in erster Linie nur darum gehen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen Diskurs über Positionen und Perspektiven zulassen. In der Praxis werden diese Leitideen mit dem „Geist“, der in der Wohngemeinschaft weht, greifbar. Konkret sichtbar wird dies am Umgang mit Fragen wie z. B.: Welches Selbstbestimmungsrecht haben Menschen mit Assistenzbedarf in bezug auf Partnerschaft und Sexualität? Welchen Respekt erhält das Wahlrecht bei Assistenzleistungen? Wie werden Forderungen von Menschen mit Assistenzbedarf nach Gleichstellung angenommen?
Zielvorstellungen der einzelnen Bewohnerinnen und Beteiligten (z. B. Eltern) liegen hier zum Teil weit auseinander, und die Frage nach dem Wohlbefinden läßt sich nicht nur auf eine Gruppe beschränken, Wenn z, B. Eltern nicht loslassen können und von ihren „Kindern“ erwarten, daß sie am Wochenende nach Hause kommen, damit sie nicht die ganze Zeit alleine sind, wirkt sich dies auf die Wohngemeinschaft und das Zusammenleben aus. Umgekehrt ist es andere Eltern schwierig, Forderungen nach einer Wochenendassistenz zu steilen, wenn sie sehen, daß die Ressourcen von einzelnen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf innerhalb der Wohngemeinschaft überschritten werden. Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sind hier noch weit davon entfernt, sich unabhängig von den umgebenden Interessen frei entscheiden zu können.
Qualitätsbeurteilungen sind daher nur verständlich auf dem Hintergrund der Positionen und damit verbundenen Perspektiven der Beteiligten. Trotz all dieser unter- schiedlichen Bedingungszusammenhänge lassen sich aus den Erfahrungen gewisse Fragestellungen, Standardvorgaben etc. ableiten, die weitere Wohngemeinschaften hilfreich sein können.
Qualität zu beschreiben, festzulegen und zu Standards zu erheben, erfordert eine Vorgehensweise, die immer wieder im Blick behält, daß komplexe Zusammen- hänge reduziert und dieser vorläufige Versuch des Erfassens und Verstehens von Zeit zu Zeit kritisch betrachtet werden müssen. Damit der Gefahr einer zu starken Marktorientierung (sprich ökonomische Gesichtspunkte und Kostenmentaiität) begegnet wird, ist es eine Voraussetzung, über grundlegende Zielvorstellungen, was sich die Gesellschaft und somit auch eine Stadt etc. leisten kann, einen Konsens herzustellen, Dabei sind die Bewohnerinnen miteinzubeziehen.
Ein Blick auf die Wohnwelten von Menschen mit Assistenzbedarf verdeutlicht, daß in den letzten Jahren durch neue Wohnformen - ambulantes Wohnen, Einzel- und Paarwohnen u.a. - das Angebot vielfältiger und bunter geworden ist. Je nach Bundesland sind die Angebote unterschiedlich differenziert. Dabei ist es auch kein Geheimnis, daß in Baden-Württemberg die Uhren in bezug auf Integration und Inklusion etwas langsamer laufen, so daß hier noch ein großer Nachholbedarf besteht.
Vor dem Hintergrund der Einschätzung, daß in den bisherigen Einrichtungen der Behindertenhilfe die selbständige Lebensführung „mehr als notwendig beschränkt“ wird (vgl. HäussIer-Scezpan 1998: 148) und deshalb ein Teil der Betroffenen als auch deren Eltern eine andere Lebensperspektive anstreben, bedarf es Lebens- formen, die den Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen entgegenkommen. Dieser Fakt zeigt sich in der Forderung nach vielfältigen Wohnmöglichkeiten Menschen mit Assistenzbedarf, damit deren individuellen Bedürfnisse und Wünsche durch eine adäquate Auswahl und Differenzierung der Wohnangebote gewährleistet sind (vgl. Metzler 1997). Einen anderen Ausdruck dieser prekären Situation spiegelt der Fehlbedarf von ca. 50 000 gemeindeintegrierten Wohnplätzen (Kräling 1995 124) wider. Mit anderen Zahlen: ca. 60% der erwachsenen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wohnen in ihren Herkunftsfamilien (Thimm 1996: 333).
Warum leben Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung mit Eintritt in das Erwachsenenalter bzw. im Erwachsenenstatus überwiegend bei den Eltern? Der Auszug aus der Familie ist oft ein letzter Ausweg und in bezug auf die bisherigen Entscheidungen besonders schwerwiegend, weil die Perspektive Heim mit „bedrohlichen und düsteren Lebensbedingungen“ (Metzler 1997: 452) verbunden wird.
Es ist davon auszugehen, daß der gesellschaftliche Individualisierungsprozeß auch dazu führt, daß heute und in der Zukunft immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf nach Wohnformen suchen, in denen sie ihre Vorstellungen verwirklichen können.
lm folgenden Kapitel wird der Kontext der Forschung in Teilen vorgestellt. Dabei stehen die theoretischen Bezüge als Hintergrund der Untersuchung und Unterbau des Forschungsblicks im Vordergrund.
Die wissenschaftliche Begleitung bestand über den Projektzeltraum (1997 - 2000) aus zwei zentralen Arbeitsfeldern: Auf der einen Seite die wissenschaftlichen Erhebungen, wovon die zweite Phase hier dargestellt und ausgewertet wird; auf der anderen Seite das Beratungsangebot an die Mitarbeiter[9] (regelmäßige monatliche Sitzungen) und die Mitarbeit in dem Koordinationstreffen der Träger, die zu einem wesentlichen Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitung wurden. Neben Besuche in der Wohngemeinschaft, die nicht zu Forschungszwecken anberaumt waren, bekam ich durch die jahrelange Praxisbegleitung einen tieferen Einblick in den Alltag der LIW. Diese Erfahrungen werden hier nicht explizit ausgewertet und dar- gestellt, aber fließen doch - an der einen oder anderen Stelle - in Bericht ein.
Der Rahmen der zweiten Erhebung, einschließlich aller Beratungs- und Begleitaufgaben, war auf 300 Arbeitsstunden (Werkvertrag) beschränkt. Der Erhebungszeitraum der Interviews lag zwischen Oktober 1999 und Juni 2000.
Ziel der Untersuchung
Die bisherigen Erfahrungen der Beteiligten[10] wurden nun in einer zweiten Erhebung im Hinblick auf eine Rahmenkonzeption eine integrative, lebensweltorientierte Wohngemeinschaft gebündelt. Dabei ging es:
-
um die Formulierung und Diskussion von Rahmenbedingungen;
-
um die Darstellung von Prozessen bzw. unterschiedlichen Positionen / Perspektiven, die mit der Implementierung verbunden waren;
-
um die Weiterentwicklung von Prozessen innerhalb der WG und Lösungsstrategien konkrete Problemlagen.
Die Untersuchung sollte zur Absicherung des Wohnprojekte beitragen und den Weg vom Projekt zum Regelangebot in der Gemeinde vorantreiben.
Die vorliegende Arbeit ist nicht als ein Konzept zu verstehen, das unmittelbar in die Praxis übertragen werden kann, sondern ist eine Sammlung von Erfahrungen, die in der existierenden Wohngemeinschaft gemacht wurden. Die Auswertung besteht in der Reflexion von fördernden und hemmenden Bedingungen, Faktoren und Strukturen, die weitere Projekte produktiv genutzt werden können.
Die Definition von Rahmenbedingungen, wie z. B. die Garantie eines Einzelzimmers alle Bewohnerinnen, ist dabei unverzichtbar. Ansonsten ist es ein Anliegen, Normierungen, die generell verbindlich sein sollen, zu vermeiden. Es wird hier nicht ein Produkt entwickelt, das an jedem Ort in gleicher Ausführung umgesetzt werden soll. Dies erscheint im wirtschaftlichen Sektor als eine Form der Wiedererkennung und Vertrautheit einen Sinn zu geben (vgl. Supermarktketten, Fastfood-Stuben, Heimwerkermärkte etc., die an allen Orten in-ı gleichen Baustil und derselben inneren Anordnung ausgestattet sind). lm Bereich von integrativen Iebensweltorientíerten Wohngemeinschaften sollten die Gestaltungsmöglichkeiten so groß wie möglich sein, um den individuellen Bedürfnissen und sozialräumlichen Bedingungen gerecht zu werden. Ein Leitgedanke ist, daß sich die Bewohnerinnen in der LIW mit ihren spezifischen Wohn- und Lebensvorstellungen Wiedererkennen.
Fragestellung
Das Interesse der zweiten Erhebungsphase läßt sich mit folgender zentralen Fragestellung formulieren: Welche Standards, Rahmenbedingungen ermöglichen Qualität und sind aus der Erfahrung der Beteiligten des Wohnprojekte „Jurastraße” eine Implementierung als Regelangebot Wohnen der Behindertenhilfe notwendig bzw. wünschenswert?
Theoretische Bezüge
Die theoretischen Überlegungen basieren auf dem Grundgedanken, daß Menschen ohne die Unterstützung anderer nicht (über)leben können. Menschen mit Assistenzbedarf sind Mitmenschen, die bei der Lebensbewältigung in unterschiedlichen Bereichen „mehr“ Assistenz benötigen, Dieses „mehr“ an Unterstützung ist im normalen Alltag von Familien, in Regeleinrichtungen etc. zu gewährleisten. Diese Sicht stützt sich auf das Grundrecht (GG, Artikel 1): „Die Würde des Menschen ist unantastbar", Ein würdevolles Leben ist verbunden mit der Teilhabe an dem gemeinschaftlichen Leben in der Gemeinde. Von dieser Vision einer „inklusiven”[11] Gesellschaft sind wir noch weit entfernt, aber die derzeitigen Diskussionen und praktischen Versuche, die sich unter der Überschrift „community care“ (vgl. Bollaq 2000 u.a.) finden, sind Schritte in Richtung Inklusion. Die LIW versteht sich als ein Segment, das den Weg zu einer teilhabenden Gesellschaft, die Selbstbestimmung und individuelle Freiheiten ermöglicht, mit aufzubauen versucht- immer aber auch mit dem Wissen und Ringen, daß Inklusion ein Prozeß des Auf und Ab und nur in engmaschigen Netzwerken zu entwickeln ist. Bauman schärft diesen Blick, indem er das Soziale bzw. das Zwischen-den-Menschen noch stärker hervorhebt: „Individuelle Freiheit kann nur das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung sein (kann nur kollektiv gesichert und garantiert werden)“ (Bauman 2000 :15). Dieser Begriff der gemeinsamen Anstrengung verdeutlicht, daß es sich hier um einen langwierigen Aushandlungsprozeß handelt, der immer wieder Ausgrenzungen produziert und somit eine widersprüchliche Entwicklung nicht ausschließen kann. Inklusion bedeutet auch, daß jeder Mensch einen Beitrag zur Gemeinschaft liefert, auch wenn er/sie nicht unsere gewohnten Kommunikationsformen beherrscht.
Wo stehen wir heute? Mit den folgenden theoretischen Anknüpfungsflächen sollen die widersprüchlichen Bedingungen aufgezeigt werden, die Inklusion in unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Zusammenhängen kennzeichnend sind. Dabei handelt es sich bei der folgenden Darstellung nicht um ein geschlossenes Theoriesystem, sondern um Theoriebezüge, die dieser Arbeit zugrunde liegen.
In einem rasanten Tempo verändern die gesellschaftlichen Entwicklungen nach- haltig die sozialen Systeme bis hinein in die intimsten Bereiche (vgl. Sennett 1998). Während die funktional differenzierte Gesellschaft immer weiter fortschreitet und die einhergehende Individualisierung Optionen den einzelnen in Aussicht stellt, werden die Chancen vielfältiger, aber ebenso die Unsicherheiten und Risiken den einzelnen größer. Dieser Umbruch kann individuell sehr unter- schiedlich erfahren werden, so daß das Begriffspaar der Modernisierungsgewinner und Modernisierungsverlierer (Kern/Schumann 1985 :320ff) ein passendes Bild der Neuordnungen kennzeichnet, wobei es nicht ohne weiteres zu erkennen ist, wer gewinnt und wer verliert bzw. wer sich morgen auf der einen oder anderen Seite befindet. Menschen mit Assistenzbedarf gehören tendenziell zu der Gruppe der Modernisierungsverlierer, auch wenn - jenseits der gesellschaftlichen Entwicklungen - viele dieser Menschen abseits in Anstalten „lebensversichert“ noch ohne große Veränderungen das „alte“ Leben leben. Sie zählen deshalb zu den Verlierern, weil letztendlich in unserer Welt vor allem die Leistung zählt und sich deshalb z. B. die Teilhabe auf dem 1. Arbeitsmarkt noch schwieriger in der Umsetzung gestaltet. Parallel zu dieser Selektion am Arbeitsmarkt gibt es aber auch eine gegenläufige Entwicklung: Die Bestrebungen, Menschen mit Assistenzbedarf stärker in die alltäglichen Lebensbezüge miteinzubeziehen, wie sie z. B. mit dem Konzept des „community care" vorangetrieben werden, wecken neue Hoffnungen im Hinblick auf Teilhabe und Integration von Menschen mit Assistenzbedarf in den verschiedenen Lebensbereichen.
Während Widersprüche und Ambivalenzen in der Tat zunehmen und die Menschen ihre Entscheidungen immer neu austarieren müssen und dabei häufiger nicht (mehr) wissen, welcher Weg die besten Möglichkeiten eröffnet, bleibt oft verborgen, daß die Unsicherheiten und Ungewißheiten gesellschaftlich produziert werden, aber individuell bzw. privat bewältigt werden müssen (vgl. Bauman 1992: 239). Auch in Bereichen der Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf zeigt sich, daß Widersprüche und Ambivalenzen vermehrt entstehen können. Inklusion in der LIW ist eine schöne und menschliche Welt, wie die Bewohnerinnen in den Gesprächen bezeugen können. Gleichzeitig ist nicht zu verkennen, daß sie immer Grenzen, Entscheidungsdilemmata, etc. aufzeigt und zwar alle Bewohnerinnen. Diesen Widersprüchen und Ambivalenzen nicht zu entfliehen, sondern sie anzunehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ohne sie dabei auflösen zu können und zu wollen, ist eine wesentliche Herausforderung und ein Ziel der Inklusion. In der LlW zu leben, bietet die Chance, sich diesen Widersprüchen zu stellen, setzt aber voraus, daß andere Menschen außerhalb der LlW mitarbeiten, um befriedigende Rahmenbedingungen herstellen zu können. Inklusion klingt einleuchtend, politisch korrekt, moralisch überzeugend, aber nicht leicht kompatibel mit unseren Lebenswelten und den dominanten gesellschaftlichen Strukturen. Was macht Inklusion so schwierig? Zunächst kann ein Blick auf die gesellschaftliche Ordnung der Differenz von „normal“ und „behindert“ einen Hinweis auf Konstruktionselemente von geteilten Welten geben.
Betrachten wir die Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf, so kann uns diese Realität - also die Tatsache, wie eine Gesellschaft eine sogenannte Behinderung oder mit anderen Worten ein Anderssein (bzw. das Fremde) konstruiert und in ihre Gemeinschaft einordnet - Aufschluß über zentrale Wesenszüge und Merkmale dieser Gesellschaft geben. Alltäglich wird das Begriffspaar „normal“ und „behindert“ aufs neue bestätigt und hergestellt, so daß uns diese Kultur der konstruierten Gegensätzlichkeit selbstverständlich - als eine natürliche Unterscheidung - erscheint. Jede Sondereinrichtung ist ein Zeichen dieser alltäglichen Konstruktion der Unterscheidung. Jede Person und deren Angehörige, die davon betroffen sind, können bezeugen, wieviel Kraft, Mut und Durchhaltevermögen von nöten ist, um gegen dieses Ordnungssystem von „normal“ oder „behindert“ anzukämpfen (vgl. Saal 1996, Hüwe,... 2000, u.a.). Aus dieser - an strukturellen Gegebenheiten orientierten - Sichtweise ist Behinderung ein von außen aufgedrücktes Etikett. Sie präsentiert sich als eine Ordnungsmacht, die z. B. viele Eltern mit dem Zwang verbunden ist, ihr Kind in Sondereinrichtungen abzugeben.
Gleichzeitig kann aber jeder einzelne Mensch in der täglichen Begegnung und Interaktion mit Menschen mit Assistenzbedarf eine grundlegende Differenz von „normal“ und „behindert“ herstellen oder in ihr den anderen als einen gleichwertigen Mitmenschen anerkennen und somit selbst im beschränkten Rahmen bzw. Raum die Konstruktion von Behinderung vornehmen oder bewußt vermeiden. Ohne Zweifel brauchen Menschen Unterscheidungsmerkmale, um die Welt ordnen zu können. Es fragt sich nur: wo werden sie benötigt? In unserem Zusammenhang stellen sich u.a. folgende Fragen: Warum werden Menschen mit Assistenzbedarf in unserer Gesellschaft in eine besondere Gruppe eingeordnet, und weshalb sind sie besondere Orte vorbehalten?
Der gesellschaftliche und soziale Hintergrund die lnklusion-Exklusion-Opposition kann mit den Konzepten von Ambivalenz (Bauman 1992) und positionsbedingten Perspektiven (Bourdieu 1997) beschrieben werden. Sie dienen als Folie, auf denen die (institutionellen) Konzepte und Rahmenbedingungen einer LIW entwickelt werden können.
Wir gehen davon aus: Wenn wir die Menschen mit Assistenzbedarf in unsere alltäglichen Lebenswelten gleichgestellt miteinbeziehen und dadurch die herrschen- den Ordnungssysteme und die institutionelle Logik durchbrechen, können wir erfahren, daß die konstruierte Differenz zwischen Normalität und Behinderung sehr brüchig wird. Diese Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit herrschender Ordnungsbilder kann mit dem Konzept der Ambivalenz von Zygmunt Bauman erfaßt werden. Baumans Analysen zur Ambivalenz bieten eine Basis die Differenz zwischen Normalität und Behinderung. Normalität enthält die Norm, die das Meßbare, Bestimmbare und Berechenbare verkörpert. Während alles andere, was aus der Norm fällt und nicht in eine Ordnungssystematik einverleibt bzw, eingeteilt werden kann, in der Folge unbestimmbar bleibt. Mit dem Begriff des Fremden versucht Bauman, die Personen zu erfassen, die nicht in die Beziehungsstruktur der Freunde und Feinde, die beide der Bestimmung unterliegen, einzuordnen sind. Der Fremde entzieht sich durch sein Anderssein den Ordnungsvorstellungen. Er ist ein schwieriger Zeitgenosse, der Raum und Zeit in Besitz nimmt, vielleicht immer bleibt und durch sein Anderssein die bisherigen Ordnungen in Frage stellen könnte. Fremde sind auch daran zu erkennen, daß sie in der Öffentlichkeit Gegenstand von Diskussionen über Grenzen von Verantwortung werden. Sie bieten auch immer wieder bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen einen willkommenen Anlaß, gegen die Unübersichtlichkeit und Unbestimmbarkeit - die sie anscheinend mitbringen - zu kämpfen, um eine ordentliche, sichere und überschau- bare Welt zu schaffen (vgl. Bauman 1992 :78ff).
Hierbei sind fundamentale Bewegungen und Denktraditionen aktuell sehr gefragt, weil sie gegen die zunehmende gesellschaftliche Ausdifferenzierung mit ihren lndividualisierungsprozessen eine übersichtliche und widerspruchslose Gesellschaft und Zukunft versprechen. Während sich die bisherigen Strukturen immer mehr auflösen, entsteht im gleichen Zeitraum kein „Ersatz“ von neuen stabilen Strukturen, so daß manche Gesellschaftsgruppen ein Zustand des bodenlosen Schreitens eintritt, der mit dem Wunsch nach klaren Ordnungen einhergeht. Ob- wohl durch die Globalisierung alle Räume erschlossen werden und vieles, was früher als fremd galt, heute räumlich sehr nahe ist, aber uns trotzdem fremd bleibt, nimmt die Ambivalenz und die Nicht-Bestimmbarkeit zu (vgl. Bauman 1992 230). lm Bereich der Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf spiegeln sich diese widersprüchlichen und gegenläufigen Tendenzen wider: Neben integrativen Alltagssituationen, die in den letzten Jahrzehnten Möglichkeiten der Teilhabe und der gegenseitigen Anerkennung zeigen, nimmt bei Menschen mit Assistenzbedarf und ihren Angehörigen gleichzeitig die Angst vor Über- griffen zu, Sowohl Einschränkungen und Bedrohung, z. B. durch die Übergriffe der Bio-Ethik-Konvention, als auch konkrete Übergriffe auf der Straße, z. B. von rechtsorientierten Gruppen auf Menschen mit Assistenzbedarf, sind in der historischen Kontinuität einer verachtenden und entwertenden Haltung gegenüber dem Anderssein zu verstehen. Die brutalste Umsetzung in die Praxis erlebten die Menschen im Nationalsozialismus. Die derzeitige neue Qualität der Entwertung von Menschen mit Assistenzbedarf in der Forschung oder auf der Straße stellt die Frage, inwieweit die Politik und das Recht in der Lage sind, dem falsch verstandenen postmodernen Prinzip „alles ist möglich“ Grenzen zu setzen und Verantwortung die einzelnen Bürgerinnen zu übernehmen. Auf der individuellen Ebene erfordert diese Verantwortungsübernahme die viel zitierte Zivilcourage von Bürgerlnnen.
Am Umgang mit Fremden - und Menschen mit Assistenzbedarf werden als solche immer wieder klassifiziert und behandelt - wird deutlich, welche ethischen Prinzipien strukturell und zwischenmenschlich einer Gesellschaft zugrunde liegen. Des- halb sind Vorstellungen darüber, wie Menschen mit Assistenzbedarf leben wollen bzw. leben dürfen, zunächst Fragen, die mit ethischen Haltungen einer Gesellschaft und deren Mitgliedern zusammenhängen, Offen sein die Konfrontation der Lebenswelten von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf enthält die Option, das Fremde vertrauter werden zu lassen.
Was bedeuten die bisherigen Ausführungen für eine LIW? In der LIW wird ein Teil des Fremden mit dem Eigenen konfrontiert. Dieser Prozeß findet in jeder Begegnung statt. lm Unterschied aber zu den tagtäglichen lnteraktionspraktiken wird in der LIW die Trennung zwischen dem Vertrauen und Fremden räumlich bzw. strukturell durchbrochen. Hier entsteht Raum und Zeit neue Begegnungen, die neue Konstruktionen der Unterscheidung zur Verfügung stehen. Ob diese Chancen genutzt werden können, hängt außer von den gesellschaftlich dominanten Konstruktionsbildern von „Normalität und Behinderung“ auch davon ab, weiche individuellen Sichtweisen auf dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen gemacht wurden. im folgenden Abschnitt sollen dazu grundlegende An- nahmen dargelegt werden.
Jeder Mensch entwickelt auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner persönlichen Geschichte in einem konkreten geschichtlichen Zeitraum, an einem oder mehreren konkreten Orten, in einem bestimmten Milieu, je nach Geschlecht etc., seine Lebensvorstellungen und seine Sicht auf die Welt - auch auf die Lebenswelten von Menschen mit Assistenzbedarf. Beziehen wir diese Thematik der vielfältigen Weitsicht auf die LIW, so ist dieser Ort eine Bühne, auf der die einzelnen Personen mit grundlegend verschiedenen bzw. zum Teil ähnlichen Geschichten den Raum betreten, den Raum ordnen und einnehmen und das Mit-, Neben- Übereinander etc. gestalten. Wie z. B. die einzelnen Bewohnerinnen die Wohngemeinschaft erleben, wie sie sich dort einbringen, den Alltag und dessen Probleme bewältigen, ist individuell sehr verschieden. Auch verschieden zwischen den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, deren Handeln und Verhalten auch sehr stark geprägt ist durch den gesellschaftlichen Status und das Milieu, denen die Eltern zugehören. Gleichzeitig haben die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf im Gegensatz zu den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf gemeinsame Erfahrungen, wie z.B. die lebenslangen Marginalisierungs- und Stigmatisierungserfahrungen oder den gemeinsamen WTB-Alltag, die sie von dem Alltag der Mitbewohne- rinnen ohne Assistenzbedarf abheben.
Bourdieu, der diese positionsbedingte Perspektive mit ihren Handlungs- und Bewältigungsstrategien detailliert französische Bürgerinnen beschreibt (Bourdieu 1997 :17ff), zeigt auf, daß wir dieses „Erbe“ unserer tagtäglichen Praxis, das im Laufe der Zeit in unseren Körper und in unser Denken eingeschrieben wird/ist, nicht ohne weiteres ablegen können, auch wenn wir z. B. unsere bisherige gesellschaftliche Gruppe durch Statusaufstieg verlassen. Die Wurzeln und die erlernten Bewältigungsmuster sind trotz vielschichtiger gesellschaftlicher Veränderungen tragende Säulen unseres Handelns und nicht so leicht abzulegen. Deshalb sind Veränderungen an der Oberfläche auf tiefergehende Wandlungsprozesse zu untersuchen. lm Alltag der LIW heißt dies zu fragen, welche Veränderungen ergeben sich aus dem Miteinander-leben, und wo bleiben bisherige Unterscheidungen wirksam?
Dieses Konstrukt von Kontinuität und Veränderung im Kontext von Position und Perspektive läßt sich ebenso auf die institutionellen Prozesse übertragen. Bei der Entstehung von neuen Konzepten spielt Bourdieu die Frage nach der Verschränkung von Kontinuität und Veränderung immer eine evidente Rolle. Mit an- deren Worten: was ändert sich grundlegend bei sichtbaren Veränderungen? Ein Beispiel Veränderung in den letzten zwei Jahrzehnten ist im institutionellen Kontext der Behindertenhilfe die Dezentralisierung von Großinstitutionen. Viele Menschen mit Assistenzbedarf konnten den Wechsel von einer Großeinrichtung auf der grünen Wiese zu einem Wohnen in kleineren Einheiten im Gemeinwesen miterleben. Einerseits eröffneten sich hierdurch Bewohnerinnen neue Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Gleichzeitig blieb grundlegend als determinierende Größe der institutionelle Charakter erhalten und das Leben der Bewohnerinnen durch die institution bestimmt. Mit anderen Worten: das frühere Großformat der Einrichtung kann sich im Kleinformat der Wohngruppe widerspiegeln und infolge- dessen Selbstbestimmungssituationen begrenzen. Jantzen u.a. fordert deshalb in bezug auf Regionalisierung bzw. Dezentralisierung von Einrichtungen konsequenteıweise die De-lnstitutionalisierung der Hilfesysteme (vgl. Jantzen 1999). Der Blick auf die Beziehung zwischen Kontinuität und Veränderung legt Spannungsfelder von Widersprüchen offen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der positionsbezogenen Perspektive liegt in der Erkenntnis, daß jede Position auch ein positionsbedingtes Elend hervorbringt. Lei- den können in jeder gesellschaftlichen Gruppen entstehen, Leiden kann auf verschiedenen Niveaus stattfinden. In Situationen, in denen eine Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf entstehen, ist immer wieder zu beobachten, daß Menschen, die einen hohen gesellschaftlichen Status und Wohlstand präsentieren, Menschen mit Assistenzbedarf manchmal um deren direkte und offene Kommunikationsfähigkeiten beneiden. Diese Erfahrung kann dazu führen, daß Menschen ohne Assistenzbedarf ihr falsch verstandenes Mitleid bemerken. Gerade in bezug auf Menschen mit Assistenzbedarf ist das Mitleid („Die Armen“ usw.) - als Form einer Distanz und Unterscheidung zum Gegenüber - groß und steht der Gleichberechtigung und Anerkennung im Wege.
Bourdieus Blick auf die Lebenswelten von Menschen macht unseren Kontext zwei wesentliche Dinge deutlich: zum einen wird die Widersprüchlichkeit von Perspektiven (sowohl in einer Person als auch zwischen Personen) als Realität toleriert, und wir sind aufgefordert, die jeweilige Perspektive mit ihren Widersprüchen im Kontext von gesellschaftlichem Status und Anerkennung der Person verstehen zu lernen, Zum zweiten betont Bourdieu, daß bei der Betrachtung des gesellschaftlichen Wandels wie auch bei individuellen Prozessen zwei grundlegende Dimensionen zu betrachten sind: die Veränderungen und die Kontinuitäten mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Aus diesen beiden Entwicklungslinien können sich auch widersprüchliche Eıwartungshaltungen den einzelnen ergeben, die Raum zur Bearbeitung benötigen.
Betrachten wir diese Prämissen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit, so stellt sich die Frage, in welchen Konzepten und Ansätzen sich eine Begegnung, Konfrontation, Annäherung und Anerkennung zwischen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf erleben lassen. Normalisierung, De-lnstitutionalisierung, Gemeinwesenorientierung, community care u.a. sind konzeptionelle Dimensionen, die auf die vorherrschenden strukturellen Unterscheidungen hinweisen und die eine teilhabende Position einfordern. Dabei geht es um Fragen, wie wir das Miteinander- leben in den gesellschaftlichen und privaten Räumen gestalten wollen. Betrachtet wird dieses Miteinander auf dem Hintergrund der Vorstellung, daß unser Sein, unser Da-sein - so wie es Levinas formuliert -immer als ein Mitsein zu begreifen ist, bei dem es darauf ankommt, welche Verantwortung der einzelne im Mitsein übernimmt (vgl. Baumann 2000 : 203).
Gehen wir davon aus, daß Menschen mit Assistenzbedarf in unserer Mitte leben sollen, damit die Lebensqualität alle Menschen verbessert und somit das Fremde im Alltag auch als bereichernd erlebt werden kann und auch jede Person mit ihrer Weitsicht eingebunden wird, so können Konzepte hilfreich sein, die eine Lebenswelt- und Gemeinwesenorientierung forcieren bzw. praktizieren. Lebenswelt- und Gemeinwesenorientierung sind Standpunkte von Praxisansätzen, die vermittelnd und verbindend zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft die bisherigen Ressourcen der Betroffenen anerkennen und einbinden wollen.
im Zuge der Globalisierung sind sie auch eine Gegenströmung, die gemeinschaftliche Bezüge, Traditionen und Kontinuitätslinien aufrechterhalten bzw. neu her- stellen. Von daher bieten Ansätze, die heute unter „community care“ in dem Bereich der Behindertenhilfe Einzug halten und Lebenswelt- und Gemeinwesenarbeitsaspekte einschließen, die Chance, neben der Inklusion, auch wichtige Beiträge zu der Suche nach neuen Gemeinschaften zu leisten. Aufgrund der auflösenden Familien- und Nachbarschaftsstrukturen sind Menschen mit Assistenzbedarf und deren Angehörige - wie viele andere Gruppen auch, z. B. Alleinstehende Paare mit Kindern - heutzutage dazu noch viel stärker auf andere angewiesen. Es stellt sich die Frage, inwieweit unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen eine Bereitschaft im Gemeinwesen vorhanden ist, in Nachbarschaft mit Menschen mit Unterstützungsbedarf zu leben. Welche Chancen haben heutzutage lokale Gemeinschaften? Diese Fragen spielen deshalb eine Rolle, weil in der LIW plötzlich die sogenannten „Bürgerinnen“ als Mitbewohnerlnnen möglicherweise als Nachbarlnnen eine größere Bedeutung erreichen.
In der latenten Angst unter den Eltern, Bewohnerinnen und institutionellen Vertreterlnnen, ob sich überhaupt Menschen finden lassen, die bereit sind, sich auf dieses Zusammenleben einzulassen, spiegelt sich die Unsicherheit in einer durch Flexibilisierung, lndividualisierung geprägten und am Dax-Wert orientierten Gesellschaft. Die damit zusammenhängende Frage nach der solidarischen Gemeinschaft ist eine Themenstellung, die auch in bezug auf die Einstellung/Haltung gegenüber Menschen mit Assistenzbedarf relevant wird und die LlW in ihrem Kern trifft. Generell lassen sich zwei gegenläufige Tendenzen beobachten:
Auf der einen Seite stoßen die Bemühungen um Integration von Menschen mit Assistenzbedarf in der Gesellschaft auf größere Toleranz. Klauß belegt dies anhand der Haltung der Bevölkerung gegenüber der Heimverwahrung. Wesentlich mehr Menschen sehen heute das „klassische Heim“ nicht mehr als den wünschenswerten Lebensort Menschen mit Assistenzbedarf (Vgl. Klauß 1996). Ein Indiz die „Suche nach der Gemeinschaft“ spiegelt sich in lokalen Initiativen wie z.B. Zeitbörsen, neuen Nachbarschaftsselbsthilfegruppen, in denen Menschen bereit sind -trotz oder gerade aufgrund der veränderten Lebensbedingungen - neue Lebensinhalte auf lokalen Ebenen zu kämpfen, wider. Sie sind nach Bauman eine Gegenreaktion auf Globalisierungstendenzen. Bauman spricht deshalb von der „Glokalisierung“ (Bauman 1996 :658), um diese gegenläufige Tendenzen zwischen Globalisierung und Lokalisierung einzufangen.
Auf der anderen Seite erleben wir ständig neue Entwicklungen, die die Solidarität der Gemeinschaft und das soziale Netz in Frage stellen. Mit steigender Tendenz werden die Risiken auf den einzelnen übertragen und die bisher gemeinsam getragenen Risikofonds abgebaut (z. B. Rente). Die Beschränkung von Assistenz auf den Bereich der Pflege ist ein Versuch, umfassende Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf zu beschränken.
Inzwischen setzen sich in anderen Bereichen, wie z. B. in der Kfz-Versicherung, Entwicklungen durch, die eine immer stärkere Ausgrenzung von Risikogruppen beinhalten und mit Sorge zu betrachten sind. Während bisher Rabatte nach unfallfreien Jahren gewährt wurden, bieten Versicherungen heute Personen ab 30 Jahren billigere Grundtarife an mit der Vorgabe, daß keine Person unter 30 Jahren mit dem Auto fahren darf. Dieser Vorgang bedeutet, daß sich Bürgerinnen der Risikogruppe der Neuanfänger (lt. Unfallstatistik) entledigen und die Lasten und Risiken auf diese Gruppe (Versicherte unter 30 Jahren) abwälzen, ohne Rücksicht darauf, daß sich auch in dieser Altersgruppe umsichtige Fahrerlnnen befinden. Die Grundhaltung dieser Sichtweise liegt in dem Bestreben, sich die besten Bedingungen auszuhandeln, ohne den Blick darauf zu richten, welche Konsequenzen daraus andere entstehen.
Dieser „Turbo-Kapitalismus“ (Luttwak 1999), der nur auf Profitmaximierung aus- gelegt ist und den Verlust des Sozialen in der Marktwirtschaft in Kauf nimmt, wirft bei eingehender Betrachtung die Frage auf, wie sich diese Handlungsmaximen der Wirtschaft auf die privaten Beziehungs- und Lebensmuster auswirken. Richard Sennett zeigt auf, wie die Flexibilisierung im wirtschaftlichen Sektor doch auf bedenkliche Weise in die privaten Lebenswelten einkehrt. Sennett legt nahe, daß diese neuen flexiblen Strukturen nicht ohne Spuren an den menschlichen Beziehungen vorbeiziehen, sondern den menschlichen Charakter verändern und somit die sozialen (Wechsel)Wirkungen verdeutlichen. Gerade in bezug auf das Thema der sozialen Verantwortung der Elterngeneration fehlt es an alltäglichen Erfahrungen, die die jüngere Generation überzeugend und glaubwürdig erscheinen (vgl. Sennett 1998 :30). Von daher bietet die LlW eine Chance eines Gegenentwurfs zum mainstream unseres Wertesystems. Sie spricht deshalb auch junge Leute an. Gegenentwürfe, die die Profitorientierung ausbremsen, müssen sich aber an Kriterien messen lassen, die den glaubhaften Nachweis einer gerechten Bemühung um ein humanes Leben erbringen und sich in den Arbeitsprozessen widerspiegeln. Zwei Einbindungen und Verschränkungen sind die Frage der Inklusion im weiteren besonders relevant, Einerseits die Einbindung des Individuums in der Einrichtung und andererseits die Verortung der Einrichtung innerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse.
Wenn wir nochmals zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren und davon ausgehen, daß sich eine Gesellschaft, im Sinne von Gegenseitigkeit dadurch auszeichnet, wie sie Marginalisierungsprozesse bearbeitet und welche Teilhabemöglichkeiten sie bereithält, kann mit dem Begriff und Konzept der Lebensqualität die Verschränkung zwischen individuellen Bedürfnissen und sozialen bzw. institutionellen Strukturen hergestellt werden. Lebensqualität ist ein Zustand, den jede Person zunächst sich selbst definiert und der sehr unterschiedlich gefüllt sein kann. Dabei darf nicht übersehen werden, daß Lebensqualität keine individuelle sondern eine soziale Kategorie ist: Denn wir erfahren die Qualitäten des Lebens im Kontext des Sozialen, in der Anerkennung unserer Person, unserer Fähigkeiten und in der Möglichkeit, Leben mitzugestalten etc. (vgl. Beck 1999 :37). Der Begriff der Lebensqualität ist deshalb nicht nur subjektiv zu deuten, sondern kann an der Bedürfnisbefriedigung von Personen, an den persönlichen Hilfen sowie an der Teilhabe im Gemeinwesen u.a. „gemessen“ werden.
Lebensqualität ist sehr eng mit der Frage verbunden: Welchen Einfluß haben Personen auf ihr eigenes Leben? Hierzu kann mit dem Begriff der Selbstbestimmung ein wichtiger Teil von Lebensqualität erfaßt werden: „Selbstbestimmt leben heißt, KONTROLLE ÜBER DAS EIGENE LEBEN zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren“ (Frehe zitiert nach Schönwiese 1994 18).
Selbstbestimmt leben - was heißt das konkret im Alltag von Menschen mit Assistenzbedarf? Aus welcher Perspektive wird der Begriff Selbstbestimmung gefüllt? Sind die Bilder in den Köpfen sogenannter Nichtbehinderter überhaupt an den Vorstellungen von Menschen mit Assistenzbedarf orientiert? Die Gefahr, den Menschen mit Assistenzbedarf etwas überzustülpen (vgl. Bäumler 14), ist im Hilfesystem eingeschrieben und bedarf einer ständigen Wachsamkeit, damit in den alltäglichen Bewältigungssituationen, wie z. B. Zimmer aufräumen oder nicht, die Betroffenen (mit)entscheiden können, wie ordentlich das Zimmer aufgeräumt ist. Die Form der Assistenzhilfe erfordert bei einer Zielsetzung, die die Kontrolle über das eigene Leben ernst nimmt, eine neue Beziehungsgrundlage zwischen Betroffenen und Professionellen. Die Ermächtigung der Individuen (vgl. Lash 1996 :200), die z.B. im Empowermentansatz (vgl. Theunissen 1995 :11ff) auch Menschen mit Assistenzbedarf ihren Ausdruck findet und die bisher beschriebene Individualisierung mit ihren Chancen und Risiken umschreibt, muß alle Beteiligten mitbedacht werden. Menschen mit Assistenzbedarf fordert Hahn soziale Situationen, in denen in Mini-Entscheidungsschritten der Weg zur mehr Autonomie eröffnet wird (vgl. Hahn 1994 :81ff). Selbstbestimmt leben ist eine Maxime, die auch Menschen, die in ihrem bisherigen Leben über Entfaltungsspielräume verfügten, große Anstrengungen erfordert und oft mißlingt. Menschen mit Assistenzbedarf kann selbstbestimmt leben eine völlig neue Erfahrung sein, die die Gegenerfahrung der „erlernten Hilflosigkeit" (Seligmann 1979) überwinden muß. Selbstbestimmt leben ist deshalb als ein langfristiges Ziel zu begreifen. Genauso kann spiegelbildlich bei Assistenzleistenden z. B. das sogenannte Helfersyndrom als Ausdruck nicht vorhandener Autonomie den Abhängigkeitsprozeß festigen.
Während die Diskurse in der Behindertenhilfe den Dienstleistungscharakter der Hilfe als Basis eine mögliche Erneuerung der Beziehungsqualität sehen können (vgl. Wacker 1998 :86ff), ergibt sich in einer integrativen lebensweltorientierten Wohngemeinschaft noch eine weitere Diskussion aufgrund der egalitären Vorstellungen der Mitbewohnerlnnen. Obwohl sich auch hier im Alltag Ungleichverhältnisse entwickeln, erleben die Bewohnerinnen diese sehr unterschiedlich. Rollenverteilungen geraten leicht in herkömmliche Bahnen von Betreuerlnnen und Betreuten. Eine wichtige Aufgabe scheint darin zu liegen, Dimensionen von Prozeßqualitäten konsequent einzuführen, wie z. B. Entscheidungskompetenzen an der Basis, die zur Auflösung von Herrschaftsverhältnissen hilfreich sein können. (Gemeint ist damit nicht, den objektiv größeren Assistenzbedarf eliminieren zu wollen.)
Die Konzeptqualitätsdimension der Selbstbestimmung zeigt sich auf der Ebene der Prozeßqualität in Formen der Mitsprache, Wahlfreiheit, Tagesstrukturierung usw.; z. B. gibt es festgelegte Essenszeiten oder bedürfnisorientierte Möglichkeiten, am Essen teilzunehmen oder auch einmal die Möglichkeit, selbst etwas ein- zunehmen (Seibstversorgung?) Ein anderer wichtiger Aspekt im Tagesgeschehen betrifft die Ausgangszeiten oder zu-Bett-Geh-Zeiten. Können hier individuelle Lösungen praktiziert werden, oder richten sich die Möglichkeiten nach dem „Dienstplan“? All diese Fragen, die in der täglichen Routine Formen der Selbstbestimmung ermöglichen, müssen auf ihre Umsetzung hin überprüft werden. Dabei ist die Mitarbeiterperspektive als parallele Struktur zu begreifen, die sehr stark die 15 Wohnqualität und die Selbstbestimmungsmöglichkeiten beeinflußt. in der Regel haben die Mitarbeiterinnen Rahmenbedingungen, in die zu wenig Zeit die Be-troffenen einkalkuliert und zu wenig Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen enthalten sind oder einen schlechten lnformationsfluß und wenig Transparenz innerhalb der Einrichtung die Arbeitsbedingungen widerspiegeln (siehe Häussler-Sczepan 1998 157).
In der LiW besteht ein Bedarf an kommunikativen und diskursorientierten Gesprächssituationen, die bei prozeßorientierten Entscheidungsstrukturen Fähigkeiten der Bewohnerinnen fördern können, um Widersprüche, die oft strukturell erzeugt werden, zu thematisieren und zu bearbeiten.
In den letzten Jahren standen im Bereich Wohnen viele fachliche Diskussionen unter dem Zeichen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Verstehen wir Organisationen und Institutionen als Bindeglied zwischen einerseits gesellschaftlichen Entwicklungen mit ihren gesetzlichen Rahmenbedingungen und andererseits individuellen Lebenssituationen, so stellt sich die Frage, wie z. B. Organisationen der Behindertenhilfe auf diese beiden Partnerlnnen - auf der einen Seite die Finanzgeber, auf der anderen Seite die Betroffenen - eingehen bzw. sich an innovativen Entwicklungen beteiligen und sich in der gegenwärtigen „Hilfe“- Landschaft verorten.
Immer mehr Menschen mit Assistenzbedarf und ihre Angehörigen suchen nach Wohnmöglichkeiten in der Gemeinde. Diese Erwartungsveränderungen von Betroffenen und deren Angehörigen sind, wie zuvor ausgeführt, u.a. Folgen der Individualisierungsprozesse, denen Menschen mit Assistenzbedarf auch unterworfen sind. Die herkömmlichen Angebote der Behindertenhilfe können auch beim größten Bemühen der Einrichtung und deren Mitarbeiterinnen um eine „gute“ Arbeit nicht verhindern, daß Ausgrenzung und persönliche Entwertung, Etikettierungsprozesse und Diskriminierung (vgl. u.a. Treeß 1995) Erfahrungsdimensionen sind, denen sich heute immer mehr Eltern und Betroffene nicht mehr selbstverständlich und ergebend aussetzen möchten.
Diese Kritik an den institutionellen Strukturen führt auch zu veränderten Sichtweisen und zum Paradigmawechsel innerhalb Institutionen. in der Fachliteratur stehen seit Jahren Themen zur Lebensweitorientierung und Teilhabe von Menschen mit sog. Behinderung zur Diskussion. Begriffe und Konzepte, wie z. B. De- lnstitutionalisierung, Empowerment, community care etc., zeigen an, daß auch von seiten der Fachdisziplin und Profession der Weg der Begleitung, Betreuung und Unterstützung in die Gemeinde führt. Dadurch kommen Einrichtungen eher unter Druck, die über die Regionalisierung, Dezentralisierung hinaus nicht zu einem neuen Verständnis professioneller Assistenz etc. gelangen. Den neuen Entwicklungen können sie nicht mehr ohne Widerstände aus dem Wege gehen.
Die Kritik an der herkömmlichen Behindertenhilfe (vgl. Theunissen 1995 u.a.) basiert auf der Erkenntnis, daß Aussonderung (auch mit dem Ziel der speziellen Förderung) den Fakt der Konstruktion von Normalität und Behinderung vollzieht und die Gleichstellung und Würde von Menschen mit Assistenzbedarf und deren Entwicklungsmöglichkeiten wenig glaubhaft herstellen kann. Deshalb zeigt sich die inhaltliche und qualitätsbezogene Entwicklung von Einrichtungen vor allem „in der Beachtung von Privatheit, Würde, Unabhängigkeit, Wahlfreiheit, Rechtssicherheit und Selbstverwirklichung“ (Häussler 1998 :25).
lm Zuge der Debatte um die Kostendeckelung bekam die inhaltliche Auseinandersetzung über Qualitäten einer professionellen Arbeit im Bereich der Behindertenhilfe einen zusätzlichen Schub. Die Prüfkriterien der Wirtschaftlichkeit von sozialen Einrichtungen legen ein besonderes Augenmerk auf die teure „Fremd“-Plazierung von Betroffenen.
Bei Betrachtungen der Debatte um die Einführung von Maßnahmen, die die Leistungen der sozialen Arbeit bemessen sollen, spielt eine entscheidende Rolle, wer die Definitionen von Qualität vornimmt (vgl. Heiner 1998: 68). In den Bereichen der Sozialen Arbeit sind Qualitätsdefinitionen eng mit Fragen der Wertvorstellungen verbunden. Aus diesem Grund sind Dimensionen der Prozeßqualität von besonderer Wichtigkeit hier konkret die Beteiligung der Bewohnerinnen an den Zielformulierungen. Aushandlungsprozesse zwischen den Beteiligten über ihre Erwartungen und Vorstellungen sind notwendig, um Qualität entstehen zu lassen. Partizipation ist eine Qualitätsdimension, die allzu gerne peripher behandelt wird (vgl. Heiner 1998 :67). Die Auswirkungen sind oft fatal. In vielen Einrichtungen wird z. B. die Festlegung und Transparenz der Konzeptqualität vernachlässigt. Dadurch entstehen in der Praxis häufig Konflikte, weil kein Konsens über Ziele, keine einheitlichen Richtlinien der Arbeit etc. vorhanden sind (vgl. Heiner 1996a :31). Darüber hinaus bedarf es auch schon im Vorfeld der Einbeziehung der politisch Verantwortlichen auf der kommunalen Ebene, die in Vertretung darüber mit zu entscheiden haben, was sich eine Gemeinde an Lebensqualität Menschen mit Assistenzbedarf leisten will (vgl, Heiner 1996a: 28).
Aus vielen Gründen ist die historisch entstandene Vergleichbarkeit von Wirtschaftsbetrieben und sozialen Einrichtungen unangemessen und der Transfer von Qualitätsmerkmalen der Industrie auf den sozialen Bereich nicht direkt übertrag- bar, Betroffene sind nicht Kunden und auch nicht nur Konsumenten - sie müssen sich einbringen. Außer, daß ihnen ein Wahlrecht zugestanden wird, hinkt der Vergleich mit der allgemeinen Kundensituation. Noch zusätzlich komplizierter wird das einfache Anbieter-Kunden-Verhältnis dadurch, daß im Beziehungsgeflecht der sozialen Arbeit verschiedene Kunden auftauchen, so daß der Begriff eher verwirrend und verzerrend ist. Neben den Betroffenen ist der Träger gleichzeitig auch Kunde im Verhältnis zu den Geldgebem.
Ganz hilfreich erscheint es, die Qualitätsdiskussion mit Brücklings Begriff „Hegemonie managerialen Denkens“ (Brückling 2000: 131) zu erfassen. Hierbei wird sichtbar, daß die Bedeutung des Quality Managements als „kalkulierter Fortschritt“ und Erfolgsversprechen bis in den persönlichen Lebensbereich in Form des Selbstmanagements hinein heutzutage zum Markenzeichen bzw. zum Maßstab wird (ebd. :132ff). Damit verbunden ist die Vorstellung, daß auch in sozialen Einrichtungen die Mitarbeiterinnen als Arbeitnehmerinnen viel stärker noch mit marktwirtschaftlichen und kundenfreundlichen Haltungen vertraut werden müssen. Ausdruck dieser Entwicklung ist die Fluktuation von Begriffen wie Flexibilität oder Effizienz in der sozialen Arbeit. Einerseits zeigt sich dabei ein wichtiges Bemühen um Transparenz, Entwicklung, Innovation oder Bedürfnisorientierung. Andererseits bleibt bei vielen Qualitätsmessungen offen, welchen Sinn sie haben, weil sie z. B. in erster Linie dazu dienen nachzuweisen, daß regelmäßig geprüft wird (vgl. Heiner 1996: 26).
Inklusion ist auf dem Hintergrund der gegebenen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse immer ein Suchen und ein Bewegen im Prozeß, in dem die Beteiligungsformen, die gegebenen Strukturen und Konzepte reflektiert und not- wendige politische Konsequenzen eingefordert werden müssen.
Als Abschluß des einführenden Teiles und gleichzeitig als Einstieg in die Sichtweisen der Bewohnerinnen uncl Beteiligten soll der folgende Abschnitt einen Einblick in die Welt der LIW geben und die „Besonderheiten“ der Wohngemeinschaft, die als Eckpunkte dieser Lebensform die Tragweite des gemeinsamen Wohnens von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf andeuten, aufzeigen.
1.3 „Lieber lebendig als normal“[12] Ein-Blick in die „Besonderheiten“ der LIW oder ein gemeinsames Leben in bzw. mit Widersprüchen
Als Einstieg in das Thema „Lebensweltorientierte, integrative Wohngemeinschaft“ (kurz: LIW) möchte ich einen etwas unüblichen Weg beschreiten und zunächst Auszüge aus den Gesprächen, die den Gesamtkontext der Wohngemeinschaft in treffender Weise kommentieren, in den Mittelpunkt stellen. Es ist eine kleine Auswahl von Aussagen, die das Besondere der Wohngemeinschaft charakterisieren und so einen Einblick in das Leben der Wohngemeinschaft vermitteln. Dabei geht es weniger darum, die Vorzüge der LIW zu präsentieren, sondern eher zu dokumentieren, daß der Alltag in der LIW eigentlich viele Züge einer ganz normalen Wohngemeinschaft trägt und z. T. durch etwas anders gelagerte Widersprüche gekennzeichnet ist.
Beginnen möchte ich mit einer längeren Passage aus dem Müttergespräch, in der neben den Perspektiven der Mütter die Wahrnehmungen ihres Umfeldes stehen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, daß die Verantwortung die Lebensform von erwachsenen Menschen mit Assistenzbedarf in der Regel immer noch in den Händen der Eltern liegt. Die Bewertungen des Umfelds und die gesellschaftlichen Normen hinsichtlich der Vorstellungen über das Leben von Menschen mit Assistenzbedarf prägen in großem Maße die Haltungen der Eltern in bezug auf ein unabhängiges Leben ihrer Söhne/Töchter.
S: Gut, daß sie (andere Mutter) manches gesagt haben (in bezug auf Veränderungswünsche an die Wohngemeinschaft),... was nach besser sein könnte oder noch toller, so als Grundsatz muß ich sagen, drüber über all dem steht, da/J' ich das ganz toll finde, daß ich's ganz prima finde, wie's ist. Da sind einige Punkte, die könnten vielleicht auch noch traumhaft besser sein, aber wenn man das mit anderen Sachen vergleicht, dann ist das wirklich jetzt schon traum- ha/t. Deshalb soll man nicht stehenbleiben, aber es ist traumhaft, wenn man's vergleicht.
R: Dann kann ich das immer wieder nicht verstehen, wenn wir Bekannte treffen ~ und es war jetzt vor drei Wochen beim Spazierengehen sonntags - und dann die ersten Worte waren: ach du armes Kind.
P: Das würde ich zu einem Kind sagen, das immer noch bei der Mutter ist.
R: Ja, du armes Kind, und dann hat die Birgit gesagt, warum bin ich ein armes Kind. Und dann sagte der Vater; der hat aber auch ein behindertes Kinal ja du bist ja in einem Heim. Und dann habe ich gesagt, die Birgit war noch nicht in einem Heim und wird auch nicht in ein Heim kommen, weil die Birgit ist in einer Wohngruppe, ja, das ist ja wohl das gleiche - dann habe ich gesagt, noch lange nicht. Und dann sagte der Vater, mein Michael kommt ein- mal nie fiırl, und dann habe ich so gemacht (sie faltet die Hände vor der Brust zum Gebet) und habe gesagt, beten Sie jeden Abend zu Gott, daß Sie die Worte wahr machen können, denn Sie wissen ja nicht, was Ihnen morgen geschieht. Ich sage, es heißt so oft, es ist am Abend anders als daß es am Morgen war P: Wie man so denken kann! Wo kommt denn das Kind hin, wenn die Eltern mal gestorben sind ?
R: Ja, du armes Kind, ehe sie überhaupt Gruß Gott gesagt hatten, du habe ich gesagt, warum denn
S: Das finde ich auch schlimm, so von jetzt auf nachher
I: Wie reagiert denn das Umfeld das sie haben, auf die Situation, daß die Tochter oder der Sohn in die Wohngemeinschaft gezogen ist?
P: Sehr positiv alle rundum, sehr positiv. Jeder sagt, jetzt ist einfach die Zeit da, die Familienphase ist abgeschlossen und auch, wenn ich ein behindertes Kind habe, es muß raus, natürlich war die Phase ja sowieso schon länger; und irgendwo sage ich mir - vielleicht ist es ein bißchen egoistisch gedacht -, aber irgendwo habe ich ja nachher auch nicht mehr die Kraft oder die Nerven. Und wenn man jetzt so ein bißchen so Abstand hat, das ist schön, dieses Miteinander und auch David. Dem stinkt’s doch auch, wenn ich ihm dauernd dies oder das sage - wie bei uns früher auch, wenn die Mutter was sagte, nur halt alles ein bißchen früher. Ich finde das ganz normal, nur kommt alles ein bißchen später bei behinderten Menschen. Die brauchen das genauso. Es ist schön, wenn sie sich ablösen, und sie werden selbständigen Ich habe ja auch vieles vorher dem David abgenommen, weil 's mir eben auch zu lange dauerte, wenn er sagte, mach' ich mal, mach' ich ınal, wenn ich irgendwelche Dinge forderte. Ich finde, das ist ganz gesund so. Deshalb sage ich immer, was Sie grade sagten, andere sagen immer, armes Kind, du bist ja wirklich ein armes Kind, wenn du es nicht sein darfst, wenn du nicht so raus kannst. (Mütter :28-29)
Obwohl die Wohngemeinschaft schon vier Jahre existiert und dabei unterschiedliche Phasen durchlebt hat, bleibt bei den Müttern das Gefühl eines erfüllten Traumes in bezug auf die Wohngemeinschaft erhalten. Schon in den ersten Gesprächen haben die Mütter diesen Aspekt des Traumhaften immer wieder betont (vgl. Jerg 1998), und auch heute noch ist diese Dimension in den Gesprächen präsent, obwohl noch vieles in dem gemeinsamen Wohnen aus ihrer Sicht verbesserungswürdig erscheint.
Die Reaktionen aus dem persönlichen Umfeld auf den Auszug der Söhne/Töchter sind sehr unterschiedlich. Die Rückmeldungen sind überwiegend positiv. Bei den Müttern selbst bleibt trotzdem noch ein Rest von einem nicht selbstverständlichen Vorgang zurück, der in der Aussage „vielleicht ist es ein bißchen egoistisch gedacht“ zum Ausdruck kommt. Daß selbst unter Eltern im Bekanntenkreis, die die Situation aus eigener Erfahrung und Betroffenheit kennen, so starke Widerstände kommen und Abweıtungen erfolgen, zeigt, wie angstbesetzt der Auszug aus der Familie erlebt werden kann. Diese Haltung (der Bekannten auf dem Sonntagspaziergang) stößt bei den Eltern der Wohngemeinschaft auf Unverständnis, weil sie inzwischen erfahren haben, zum Teil auch erfahren mußten, wie wichtig es ihre Töchter/Söhne ist, ein relativ unabhängiges Leben vom Elternhaus zu führen, um eine selbständige Lebensführung entwickeln zu können. Die Konstruktion zweier Lebenswelten - zu Hause ist es doch am besten, im Heim oder anderswo sind die Lebensbedingungen die Töchter/Söhne schlechter - ist vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Menschen mit Assistenzbedarf verständlich. Dadurch wer- den die Nöte von Eltern sichtbar. Gleichzeitig verdecken sie die Abhängigkeitsverhältnisse und z. T. schwierigen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und idealisieren eine Lebensform, die schlicht und einfach wenig Raum die Entwicklung eines eigenen Lebens der Töchter/Söhne zur Verfügung stellt. Auf Dauer kann das zu Hause wohnen sowieso nicht aufrechterhalten werden, weil Eltern aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Krankheit, Tod) irgendwann nicht mehr die Sorge die Kinder tragen können.
Die Wohnortsnähe zu den Eltern ist einige Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf eine wichtige Voraussetzung den Einzug in die LIW. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß viele Eltern und ihre Töchter/Söhne den Zeitpunkt der Wohnortstrennung so weit wie möglich hinausschieben - oft auch bis zu dem Augenblick, an dem ein Zusammenwohnen aus gesundheitlichen Gründen der Eltern eine abrupte Trennung erfordert (vgl. voriger Abschnitt). Eine Bewohnerin, die selbst in dem Dilemma zwischen dem alten und neuen Lebensort zerrissen ist, beschreibt die Situation, rückblickend auf ein Jahr Wohnen in der LlW, folgendermaßen:
B: Und als ich eingezogen bin, da habe ich mich auch ganz schwer getan, weil ich dreißig Jahre bei meiner Mutti zu Hause gewohnt habe. Es ist sehr schwierig gewesen, von Anfang an.
I: Was hat dir geholfen, sich hier zurechtzufinden?
B: Meine große Schwester, die hat mir viel Geduld gezeigt und auch gesagt, Birgit, wir versuchen das auch. Und ich weiß, sie hat mir auch beigebracht, daß ich mich langsam daran gewöhne.
I: Was hat dir hier in der WG geholfen?
B: Da hat der Kurt, der Gesamtleiter, mir geholfen. Er hat gemeint, ieh pack das schon. Er kannte mich schon ein wenig: Wir waren anfangs ıifiers im Garten und haben uns darüber unterhalten, wa ich gemerkt habe, ich habe Angst. Aber allmählich wird es ein bißchen besser, und so habe ich mich daran gewöhnt. (Bewohnerinnen m.A. :4)
Diesen Gesprächsauszug habe ich deshalb ausgewählt, weil die Bewohnerin von sich aus gefragt hatte, ob es die Leserinnen interessiert, wie sie den Einzug in die Wohngemeinschaft erlebt hatte.
Der Wechsel in die WG ist mit Trennungsängsten verbunden. Dieses Beispiel zeigt - und dies könnte anhand anderer Beispiele mit ähnlichen Situationen verdeutlicht werden -, daß es innerhalb des Familiensystems Mitglieder geben muß, die hinter dem Verselbständigungsprozeß der Bewohnerinnen mit Unterstützungsbedarf stehen, den Ablösungsprozeß begleiten und als Vermittlungspersonen Verantwortung übernehmen. Aus der Sicht der Bewohnerin stehen hier zwei Weiten gegenüber, die sich nicht so ohne weiteres vereinbaren lassen. Die enge Bindung an die Mutter, die jetzt während der Woche alleine wohnen muß, ist die Birgit (Bewohnerin m.A.) nicht so einfach wegzustecken und wirkt in den Wohngemeinschaftsalltag hinein. Die geäußerte Angst von Birgit bezieht sich weniger auf die Bewältigung des Alltags in der Wohngemeinschaft. Hier kann sie die Anforderungen und Herausforderungen leichter meistern. Die Angst konzentriert sich viel stärker auf die Anforderung, die Trennung der Welten mit ihren Unvereinbarkeiten aushalten zu können. Die Unterstützung der Schwester als auch die des Mitarbeiters hilft ihr, die schwierige Ablösungsthematik zu bewältigen.
An dieser Situation soll bewußt gemacht werden, daß die Selbständigkeit bei einigen Bewohnerinnen weniger eine Frage der Kompetenz bezüglich kognitiven oder körperlichen Fähigkeiten ist, sondern in einem weitaus größeren Maße eine Frage der Beziehungsabhängigkeit zum Elternhaus darstellt. Festgefahrene Beziehungsstrukturen, die durch jahrzehntelange gegenseitige Abhängigkeit entstanden sind, sind nicht ohne weiteres aufzulösen. Diese Beziehungsabhängigkeit ist eine gegenseitige und bedarf deshalb einer intensiven Betreuung beider Beziehungsparteien sowie einer individuellen Gestaltung des Ablösungsprozesses.
Auf Dauer könnte ein Regelangebot der LlW dazu führen, daß Menschen mit Assistenzbedarf früher aus dem Elternhaus ausziehen können bzw. dürfen und dadurch der Schritt in ein selbstgestaltetes und selbstverantwortliches Wohnen möglicherweise leichter zu bewältigen ist.
Eine wichtige Erfahrung in der LIW ist, daß Widersprüche permanent auftauchen und auch von den Bewohnerinnen wahrgenommen werden, aber wenig ins Blickfeld von Außenstehenden geraten. Auf den ersten Blick übt das gemeinsame Zusammenleben auf Besucherinnen etc. eine Faszination aus, die sich aus dem, was die Bewohnerinnen und Mitarbeiter selbst mit der Menschlichkeit, Toleranz etc. beschreiben, speist.
Von Anfang an war immer wieder zu beobachten, daß eine einseitige positive Darstellung und Bilanzierung der LIW bei den direkt Beteiligten Widerstände hervorruft. Umgekehrt werden bei einem Blick hinter die Kulissen und bei der Diskussion von Grenzen der Wohngemeinschaft von den Bewohnerinnen die positiven Seiten wieder hervorgehoben. Die folgende Passage aus dem Gespräch mit den Mitarbeitern macht sichtbar, daß die LIW als eine Welt, die dem mainstream der Leistungsgesellschaft nicht folgt und dadurch Faszination und Begeisterung erntet, gleichzeitig Anteile des Versagens bzw. Scheiterns hervorbringt. Dieses Leid - oder mit Bourdieus treffendem Begriff zu reden - dieses „positionsbedingte Elend“ darf nicht unter den Tisch gekehrt und nicht auf den Bereich des Privaten beschränkt werden.
A: Ja, das hat auch - ich denke wieder; so die Außenwirkung ist halt toll. Da sieht man einfach, also schon mal, das ist kein Heim, wo jetzt was weiß ich wie viele da gemeinsam versorgt werden und wo in der Pampa das niemand mitkriegt, sondern mitten in der Stadt, Menschen mit und ohne Behinderung, im Gemeinwesen zum Teil integriert, man geht gemeinsam einkaufen, man ißt gemeinsam, man lebt zusammen, das hört sich schon mal absolut gigantisch gut an, Aber wenn man's dann genauer anguckt, dann sieht man einfach, überall sind Grenzen, weil es sonst auch die Menschen ohne Behinderung nicht tragbar wäre, dort zu wohnen. Und ich muß die auch bewundern, das muß ich echt sagen, das ist schon toll, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt ein Jahr so leben mal.
K: Es hat ja auch etwas verdammt Positives in der WG, diese Menschlichkeit, dieses Chaos und diese Menschlichkeit, das ist das, was die WG auch so trägt. Die Leute, die dort wohnen, die sind chaotisch ohne Ende, sind aber wahnsinnig menschlich drauf, und das ist das, was du heutzutage in unserer perfekten Welt oft nicht mehr findest, und das macht auch die WG aus, Und dann ist es auch mich okay als Hauptamtlicher, da hinzukommen und dieses Chaos ein wenig zu pflügen, das Chaos ein wenig zu organisieren und zu richten, Trotzdem bleibt da noch genügend Chaos übrig. (Mitarbeiter :51)
Ein wesentlicher Unterschied zu Lebenswelten, in denen Menschen mit Assistenzbedarf als Gruppe betreut werden, liegt darin, daß ein gemeinsames Wohnen von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf strukturell und interaktiv bzw. kommunikativ andere Prozesse in Gang setzen kann. Was hier mit „Mensch|ichkeit“ bezeichnet und ausgezeichnet wird, entfaltet sich in den folgenden Aspekten, die diesen umfassenden Begriff an konkreten Beispielen begreifbarer bzw. faßbarer machen möchten.
Privates Wohnen ist verbunden mit Selbstgestaltungsmöglichkeiten des Alltags. Die LlW bietet hier durch die Anwesenheit von Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf eine Garantie des Privaten, die auch von der Institution respektiert wird. lm Unterschied zu einer Wohngemeinschaft ohne Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf besteht in der LIW die Notwendigkeit, bisherige Grenzen zu überwinden. In einer Diskussion über die weniger angenehmen Seiten in der Wohngemeinschaft und im Zusammenleben wurde von den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf u. a. auch erwähnt, daß die Konfrontation mit anderen Bewältigungsformen und Empfindlichkeiten eine Barriere darstellt, mit der jede/r einzelne umzugehen lernen muß.
F: Wir haben die Möglichkeit hier; die Regeln stellen wir zum großen Teil selber auf mit Hilfe von Dr... (Mitarbeiter), weißt du, also das machen wir schon so, wie wir das wollen.
H: Wir können alle heimkommen, wann wir wollen. F: Ja, das wäre zum Beispiel etwas nein, also ich denke, das ist eher etwas Positives, wenn da jetzt niemandem was einfällt, das wäre halt das Gelabere, ständig könntest du dich über irgend etwas beschweren, das ist schon klar: Ich könnte mich beschweren, daß die Clara…
E: sabbert daß die dann überall ihren Rotz dann abläßt oder so, schon beim Essen, das ist echt schon irgendwo sehr wenn sie immer alles so anlatscht da, die Wurst äh und zack - beim Gsälz überlege ich mir's zweimal, gucke ich erst, ist's astrein oder
I: Ja, da muß man schon Grenzen überschreiten, nicht wahr.
E: Am Anfang, wenn ich die Zuckerdose da aufgemacht habe hingestellt und neuen Zucker geholt. Aber das weißt du halt irgendwie, wenn du hier einziehst, daß es halt keine normale WG ist, sondern halt irgendwie ein Projekt ist und daß man das halt irgendwie in Kauf neh-men muß. (Bewohnerinnen o.A. :30)
Zunächst antworten die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf auf die Frage hin- sichtlich des Besonderen in der Wohngemeinschaft mit „alles“. Bei der weiteren Konkretisierung der Frage kommen Beispiele, die die Stimmung in der Wohngemeinschaft sie charakterisieren. die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf liegt der besondere Reiz der Wohngemeinschaft in der Atmosphäre und Gemeinschaft, die sie wie alle anderen auch als ein Lebenselixier einnehmen. Gerade auch Menschen mit Assistenzbedarf gelingt es, Atmosphäre und Wohlbefinden in der Wohngemeinschaft herzustellen. Die Entscheidungsfreiheit in bezug auf ihre Freizeitgestaltung, die Bettgehzeiten sind neue Räume, die allen, die von zu Hause ausziehen, ein selbständigeres Leben ermöglichen.
I: Was gefällt dir hier gut?
B: Die Atmosphäre hier, die Menschen.
I: Kannst du das ein bißchen beschreiben?
B: Wenn die Andrea abends oder morgens aufsteht und lacht uns an zum Beispiel und die Clara da reinfliegt und macht auch ein' Scheiß, manchmal und der Kurt auch.
I: Wie ist es mit den anderen, die hier wohnen?
B: Die finde ich auch gut.
B: Wir können abends manchmal ausgehen.Ins Kino, ins Nepomuk Kaffeehäusle-Ausgehabende und viele andere Möglichkeiten.
I: Ist es dir wichtig, selbst was unternehmen zu können, entscheiden zu können? B: ./rı, alleine ausgehen mit dem Freund. (Bewohnerlmıen m.A. :4)
Die Bedeutung der Selbstbestimmung die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf muß vor dem Hintergrund des gemeinsamen Lebens, also in Zusammenhängen, in denen andere relativ unabhängig von ihren Eltern mitleben, betrachtet werden. Jede Form der gutgemeinten „Einmischung“ von Eltern in das Wohngemeinschaftsleben läßt sich in der LIW nicht so einfach praktizieren. Hier werden die Eltern mit ihren Vorstellungen - sei es die Gestaltung von Räumen zu bestimmten jahreszeitlichen Anlässen etc. oder bei ihren Besuchen in der Wohngemeinschaft - herausgefordert, ein neues Verhältnis zu ihren „Kindern“ zu entwickeln. Die Präsenz von Personen, die unabhängig von ihren Eltern dort wohnen, führt dazu, daß die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sehen lernen, wie es sein kann, sich ohne die Eltern zu bewegen. Gleichzeitig gibt ihnen dieser gemeinsame Alltag den Rahmen, die Wohngemeinschaft zu einem elternunabhängigen Terrain zu definieren.
lm Unterschied zu Institutionen, in denen Arbeit und privates Leben in der Regel klar getrennt sind, läßt sich in der LIW die Assistenz nicht eindeutig in Arbeit und Freizeit aufteilen. Dies gilt zumindest das Wohnen in der Jurastraße. Hier ist der Alltag nicht völlig durchstrukturiert, obwohl bestimmte Aufgaben, wie z. B. Abendassistenz oder Zuständigkeiten im voraus abgesprochen werden. Häufig sind die anderen Mitbewohnerlnnen auch im Wohnzimmer, so daß Bewohnerinnen, die rein organisatorisch im Plan Assistenzbegleitung eingetragen sind, sowie auch diejenigen, die einfach da sind, die Grenzen zwischen Assistenz und Freizeit nicht ziehen (können), weil sich beides mischt. Diese Exklusivität, die in der LlW praktikabel und besonders geschätzt wird, liegt in der Möglichkeit, aus- schließlich zeiteffektive Begleitung zu umgehen. Hier ist auch jemand da, der nicht „Dienst“ hat oder „auf der Arbeit ist“, sondern Alltagssituationen teilt, ohne einen Arbeitsauftrag. Während in der Behindertenhilfe die zeiteffizienten Leistungsberechnungen Assistenz und Pflege schon zu absurden, menschenunwürdigen Kalkulationen und Praktiken führen, stellt die LIW eine mit Annehmlichkeiten versehene Assistenz bereit, Die Notwendigkeit einer Doppelassistenz beim Aufstehen und Frühstücken, die aufgrund der häufigen epileptischen Anfälle einer Bewohnerin außer Frage steht und in der LIW nicht durch Sachzwänge übergangen werden muß, hat nicht nur die Bewältigung der Assistenz Vorteile. Sie führt auch dazu, daß Assistenzleistungen nicht nur als Arbeit, sondern auch als ein angenehmes Arbeiten, das den Arbeitscharakter verlieren kann, wahrgenommen wird.
I: Ich glaube, so lange hätte ich's auch nicht ausgehalten, wenn's wirklich Arbeitscharakter gehabt hätte. Das hat man ja am Anfang probiert, alleine, oder daß man das auf jeden Fall macht. aber die Dienste zu zweit, auf jeden Fall.
M: Ja, und das haben wir ja auch selber gesagt, wir machen den sechs-Uhr-Dienst zu zweit, weil das was ganz anderes ist, wenn du das zu zweit machst, dann ist's zehnmal netter einfach, dann ist es nicht so Arbeit.
L: wenn die Andrea dann mal ins Bett gemacht hat, und ich habe mit dir Frühdienst gehabt, das war halb so schlimm. also nicht mal. M: Ja, das ist wirklich ganz anders einfach, und dann freust du dich, daß du es geschafft hast, um sechs Uhr aufzustehen und bis um sieben Uhr bist du fertig mit allem, dann ist der Tag noch vor dir, ja, ich finde, da kannst du alles viel relativer sehen. (ehem. Bewohnerlnnen o.A. :66/67)
lm folgenden Textbeispiel wird aus der Sicht der derzeitigen Bewohnerinnen die Vermischung von Assistenz und Wohnen, von gemeinsamen Bezügen, die nicht nur unter dem Aspekt der Assistenz stehen und die vorangestellte Perspektive der ehemaligen Bewohnerlnnen unterstreichen, nochmals betont, Die Gemeinschaft, die hier als besonderes Merkmal der Wohngemeinschaft bezeichnet wird, weist darauf hin, daß in einer individualisierten Welt, in der wir uns zurechtfinden müssen, der Wert der Gemeinschaft, der Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit in der LlW realisierbar sein kann.
I: wenn ihr nochmal überlegt, was findet ihr das Besondere an hier, oder was gefällt euch besonders daran, hier zu wohnen, was macht das Wohnen interessant?
E: Die Gemeinschaft auf jeden Fall. Das sind nicht bloß Dienstzeiten, sondern daß man auch gern so hier ist oder auch untereinander etwas unternimmt so und man einen schönen Garten hat, so im Sommer.
F: Einfach, das mit den Leuten stimmt, und man reut sich aufeinander und übereinander; und das ist ganz arg toll.
E: Daß man auch einen Zusammenhalt hat, daß keiner da gegen den anderen sich aufspielt, daß man zusammenhält untereinander.
F: Das ist ein Glücksfall auch in einer WG. (BewohnerInnen o.A. 114)
Einen wesentlichen Beitrag zur privaten Atmosphäre in der Jurastraße bzw. zum wenig sichtbaren institutionellen Kontext trägt die ungewöhnliche Trägerkonstellation von einer großen Einrichtung und einer Elternselbsthilfeorganisation bei, die aus ihren unterschiedlichen Perspektiven die professionellen Aufgaben und die institutionellen Routinen immer wieder hinterfragen. Das Ziel, so wenig wie möglich in die Gestaltung des Alltags der Bewohnerinnen einzugreifen und Professionalität anzubieten in den Bereichen, in denen sie erforderlich ist, gibt den Bewohnerlnnen auch die Möglichkeit, eigene Wohnstrukturen zu entwickeln.
K: Das ist ja auch etwas Besonderes in der WG, daß es von Anfang an geheißen hat, so wenig wie möglich Fachlichkeit da reinzustecken, sondern die große Überschrift in der Jurastraße besteht darin, gemeinsam leben, daß es einem gut geht, daß man lachen kann, daß es einem Freude macht, dort zu leben. Und so wenig wie möglich sozialpädagogische Organisation und Pläne und Struktur und piepapo, sondern da mit reingehen und leben und so im Hintergrund versuchen, den Alltag mit zu organisieren oder so zu strukturieren. (Mitarbeiter 116)
Die nicht vorhandenen institutionellen Strukturen mögen ~ aus der berufsbezogenen Perspektive - einer notwendigen intensiveren Pflege und Förderung entgegenstehen und auf diesem Terrain das Perfekte vermissen lassen. Diesem institutionellen Vorteil steht ein Sich-zu-Hause-fühlen gegenüber.
M: Aber, ich finde, die (Eltern) sollten gehen und sich dann aber wirklich zurückhalten und einfach das Vertrauen haben, daß die Leute wirklich das machen wollen, denn ich glaube, der Wille und der Wunsch war von uns allen da, daß wir's richtig machen und daß wir gemacht haben, was wir konnten und manchmal - aber weißt du, was dann gefehlt hat zum Perfekten, das ist dann vielleicht das, was so eine Institution ausmacht, was hall einfach menschlich war: Grade vom Pflegerischen her ist eben eine Institution besser; aber ich denke, die Andrea wäre nicht so glücklich, obwohl sie manchmal öfters ein Bad brauchen könnte. (ehem. Bewohnerinnen o.A. :66)
Die Gestaltung des gemeinsamen Wohnens ist von den jeweiligen Personen, die Zusammenleben, abhängig. Jede neue WG wird andere Möglichkeiten bereitstellen, je nach den Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewohnerinnen. im Unterschied eines lebensweltotientierten Wohnkonzepts, in dem ausschließlich Menschen mit Assistenzbedarf wohnen, besteht in der LlW die Chance, daß durch den offenen Personenkreis sowohl in bezug auf die Bewohnerinnen mit als auch ohne Assistenzbedarf, eine größere Vielfalt an Aneignungs- und Bewältigungsformen gelebt wird. Dadurch entsteht die Bewohnerinnen ein "Lernfeld", das sozusagen durch die täglichen Begegnungen allen Beteiligten neue Sichtweisen und Bewältigungsmöglichkeiten erschließen läßt.
V: Ja gut, natürlich, aber versucht ihr auch, wirklich so ein Konzept von Alltagsorientierung, Alltagsbewältigung aufzubauen? Die Frage wäre dann allenfalls inwiefern bietet die Jurastraße einfach vielleicht doch ein bißchen mehr Möglichkeiten als eure Wohngruppe? Ich denke, in vielen Punkten unterscheidet sie sich nicht. Was die andere Dimension halt ist, ist daß das Gefälle, die Unterschiedlichkeit oder die Verschiedenheiten halt im Grunde großer sind, die auf der einen Seite dann auch Probleme, aber unter Umständen halt auch wieder andere Lernmöglichkeiten schaffen können.
U: …daß die Lernmöglichkeiten natürlich immer abhängen von den Menschen, die dort auch leben, das ist klar.
S: Ich denke, die ganze Situation ist einfach anders.
U: Vom Ansatz her ist das natürlich schon auch in eine Wohngruppe umgesetzt worden.
V: Also eigentlich, wenn ich das jetzt in der Jurastraße sehe, dann denke ich schon, da haben wir's ja so definiert, daß wir dort Menschen wohnen haben wollen, die keine Behinderung haben und andere Leute, die Behinderungen haben, das haben wir ja so definiert im voraus. In der Nelkenstraße (herkömmliche Wohngruppe im Stadtteil), um das Beispiel aufzugreifen, wohnen Leute mit Behinderung, aber mit unterschiedlicher Behinderung durchaus, da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, und jeder bringt seine Möglichkeiten ein. ...es wohnt jetzt niemand dort, der praktisch keine Behinderung hat, aber vom Grundsatz können alle voneinander lernen, der eine macht's so, der andere so, es können alle voneinander lernen. Wenn man jetzt sagt, man kann nur im Grunde genommen von den Menschen ohne Behinderungen lernen, dann stimmt das nicht.
I: Das ist ja die Frage jetzt.
V: Von dem Grundsatz her kann ich ja nicht ausgehen mit den Leuten zusammen das lernen können, was dort möglich ist, Es ist nicht bloß möglich zu lernen, was in der Jura- straße möglich ist, sicher, weil dort auch ganz andere Leute wohnen, aber in der Nelken- straße ist auch was möglich zu lernen.
T; Aber ich glaube holt, wenn ich jetzt wieder vergleiche mit der Hanna, das ist halt mein Vergleich, das sind zehn schwerstbehinderte Frauen, sehr auffällige Frauen, und da ist die Situation derartig bestimmt von diesen zehn sehr schwierigen Frauen, daß ich also wirklich, wenn ich einen Hut hätte, dann würde ich ihn ziehen vor den Mitarbeitern, weil die auch die Menschen in ihrer Individualität unheimlich toll behandeln, das muß ich sagen aber mich wirkt das unheimlich anstrengend, wenn die Situation total dominiert ist von diesen Behinderungen. (Träger: 33)
Die LlW ist eine Gegenwelt, die ein Kontrastprogramm zu den bisherigen sicheren, vorhersehbaren und gewohnten Strukturen mit sich bringt. Darin sich zu bewegen ist einerseits anstrengend, weil das Chaotische, das alle auch mit der Wohngemeinschaft verbinden, weniger Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet, Andererseits besteht das Besondere an der Wohngemeinschaft gerade in Begriffen wie Menschlichkeit, Offenheit, Toleranz, die mit den Zügen des Chaotischen in Verbindung gebracht werden. Verstehen wir wie Bauman Chaos als einen Zustand, der die Lebensverhältnisse in Opposition zur Ordnung widerspiegelt (Bauman 1992 :17) und die Bewohnerinnen davor bewahrt, alles in geordneten Bahnen zu denken und lenken, so kann diese Lebendigkeit, die die Bewohnerinnen, Mitarbeiter und Eltern so schätzen, als Ausdruck dieser Offenheit gedeutet werden.
I: Machen wir mal eine Abschlußrunde. Was ist das Besondere an der Jurastraße...?
K: Die Menschlichkeit, das Miteinander und die Menschlichkeit würde ich in den Vordergrund stellen.
I: Wie zeigt sich die Menschlichkeit? Kannst du das näher beschreiben?...
K: Daß sie offen sind, alle sind trotzdem sehr offen alle neuen oder fremden Leute, die kommen, die uns besuchen oder die sie besuchen. Es ist eine große Toleranz da und eine große Offenheit, die Leute auch mit reinzunehmen und auch das WG-Leben zu zeigen egal wie chaotisch oder dreckig es ist, in Anführungsstrichen.
J: Da ist's immer dreckig.
K: meine Begriffe auch nicht und auch immer wieder verblüfft mich die WG, wenn's manchmal ganz schlecht aussieht, daß sie alle schlecht drauf sind, oder daß es irgendwie, ja, daß sie schlecht drauf sind und daß es irgendwie so irgendwo den Berg runtergeht. Dann kann ich am nächsten Tag kommen, und die Leute strahlen wieder; sind gut drauf und lachen viel. Also weißt du, die holen sich dann auch wieder irgendwie raus, das haben sie schon drauf Manchmal wenn's ganz arg trist ist oder wenn auch ganz arg viele Schwierigkeiten da sind, kann's am nächsten lag schon wieder ganz anders sein. Und bei allen Schwierigkeiten dieses Zusammenlebens finde ich's trotzdem immer noch spannend, diese WG mit dieser Art von Chaoten, einfach auch immer in bezug auf die Behinderung auch trotzdem ist's mich immer spannend, dort hinzugehen, und ich geh' auch trotzdem noch gern hin.
A: Es ist hall total vielschichtig, also grade, du hast ja vorhin schon gesagt, daß sie so offen sind, daß Besuch kommen kann. Es hat so unterschiedliche Persönlichkeiten, da ist so viel Leben drin, das finde ich schon ungewöhnlich. Da pulsiert ständig was, da kommen die einzelnen dann mit ihren Eindrücken, die sie haben, die kommen dann ins Wohnzimmer; und dann kommen da Besucher und so, das ist so vielschichtig, so interessant.
I: Das sind doch aber auch bloß acht Leute, ich meine, was ist da das Besondere
A: Es ist halt einfach, es sind halt einfach ein Haufen Leute, egal, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder nicht, und dann kommt ja auch Besuch, und dann kommen auch Angehörige, klar, aber hauptsächlich auch Besuch und zwar auch grade, weil sie auch vom Alter her so auseinander sind und auch so unterschiedliche Berufsfelder drinstecken oder nicht drinstecken und im Werden sind und so, Das finde ich schon heiß, das ist sehr ab- wechslungsreich. (Mitarbeiter 169-70)
Chaos hat einen negativen Touch, obwohl darin Bewegung Raum erhält und es nicht durch starre Strukturen gekennzeichnet ist. Vor allem - und das scheint mir wichtig zu sein die Bewertung der LIW - hält das Chaos einen Raum vor, in dem Widerspruch, Unvereinbarkeiten, Ambivalenz etc. nicht beseitigt werden (vgl. Bauman ebd.: 19).
Die Vielfalt und Heterogenität der Bewohnerlnnengruppe stellten sich als ein Spannungsfeld dar. Sie bieten Chancen, sich selbst zu erleben mit der Herausforderung, das bisherige Leben ein Stück weit hinter sich zu lassen. Die Persönlichkeit jeder einzelnen Bewohnerin kann in den Vordergrund treten und dadurch die bisherige Erfahrung von Zuschreibungen durcheinanderwirbeln. Als Folge können Unsicherheiten und Ängste auftreten. Wohin es dabei geht, bleibt offen.
Y: gerade die Unterschiedlichkeit ist das Besondere, die unterschiedlichen Lebensstile, Lebensweisen, ...da liegt irgendwas Besonderes in der Luft, das ist irgendwie spannend Und ich denke, gerade auch da liegt auch die Chance die Leute mit Behinderung, weil da wirst du nicht in eine Schablone gedrückt, da bist du du, du kannst es auch sein.
K: Und dann finde ich, daß es da irgendwie ganz arg viel hapert, weil da die Menschen mit Behinderungen doch dermaßen aus Strukturen rauskommen. Wenn du das im Alltag siehst, da knallen einfach jedes Mal Welten aufeinander. ...ich denke, das stimmt so, daß das ei- gentlich eine Chance die Leute mit Behinderung darstellen könnte oder sollte, aber meistens ist das eine ganz große Angst und eine Unsicherheit, die sich jetzt bei der Birgit zum Beispiel absolut zeigt, absolut. Und ich weiß nicht, wie 's mit dem David eigentlich ist.. (Mitarbeiter: 71)
Das bisherige Ordnungsschema Behinderung und Normalität bricht in der LIW auf, weil auch zu sehen ist, daß die sogenannten nichtbehinderten Bewohnerinnen ihre „Päckchen“ im Alltag zu tragen haben und einige Dinge auch nicht so gut geregelt bekommen, zum Teil auch ganz massive Probleme haben, die in Relation zu dem Unterstützungsbedarf von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf nicht ohne Weiteres „harmloser“ daherkommen. Während bei dem folgenden Gesprächsauszug die Arbeitszuverlässigkeit der Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf hervorgehoben wird, von der sich die Bewohne- rinnen ohne Assistenzbedarf eine Scheibe abschneiden könnten, entstehen im gemeinsamen Wohnen noch weitaus mehr Felder, in denen die Unterscheidung nach Assistenzbedarf verschwimmt.
K: ...Zum Beispiel gehen unsere Leute oder die Leute in der WG gehen alle jeden Tag zur Arbeit. Höchstens denen geht's wirklich mal schlecht, daß sie Magenweh haben oder daß sie wie bei jedem anderen auch. Ich kenne das von den anderen Gruppen, daß die da alles mögliche erfinden und boxen und treiben, daß sie ja nicht in die WFB raus müssen. Unsere Leute sind dermaßen diszipliniert in der Hinsicht, die stehen jeden Tag auf und gehen ins Geschäft Da muß ich sagen, da dreht sich der Stiefel um, daß ich manchmal denke, da möchte ich mal mehr mit den anderen ein bißchen drüber schwätzen, was da eigentlich los ist.
I: Bei den Menschen ohne Assistenzbedarf.
K: Was ich da schon mitgekriegt habe, ob das der Oskar war, die Lisa oder jetzt auch die Eva oder der Felix sozusagen, die gucken auch, wie sie irgendwie ab und zu mal ein bißchen was schleifen lassen, aber die anderen vier sind dermaßen diszipliniert, was das betrıfft, man steht morgens auf und geht zur Arbeit. Wenn ich dann höre, wenn sie (andere Mitarbeiterinnen) von den anderen Gruppen berichtet, das ist dort so konträr, das gibt's bei mir nicht oder bei uns nicht, sondern die plagen sich sogar noch hin, wenn sie krank sind teilweise. (Mitarbeiter :52)
Es steht außer Frage, daß die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf mehr Unterstützung benötigen aufgrund ihrer besonderen Lebenslage. Wird der Blick aber nicht auf den besonderen Assistenzbedarf fokussiert, sondern werden die Bewältigungsmustern im Ganzen betrachtet, so gibt es in der LIW Situationen, in denen mann/frau sich fragt: Wer braucht da eigentlich wen? Die gängige Vorstellung, daß Menschen mit Assistenzbedarf in „normalen“ Lebensbezügen wesentlich mehr Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen, ist nur eine Seite der Medaille und ein typisches Einbahnstraßen-Denken. Menschen ohne Assistenzbedarf können im gemeinsamen Alltag auch viel dazulernen, sich ganz neue Sichtweisen über das eigene Leben erschließen und insbesondere von der direkten Reaktion, der Offenheit und Emotionalität der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf vieles abholen, was ihnen die eigene Bewältigung des Alltags hilfreich sein kann. Zum Schluß dieses Kapitels steht ein Gesprächsauszug, in dem mich zusammenfassend die bisherigen Aspekte, die die LIW charakterisieren, treffend mit dem Begriff des „Lebendigen“ auf den Punkt gebracht werden.
Aus der Retrospektive der ehemaligen Bewohnerinnen wird das Lebendige der Wohngemeinschaft und ihre Bewohnerinnen zum zentralen Begriff. Immer wieder die Eigeninitiative und Fähigkeit zu entwickeln, schwierige Situationen zu beleben, spiegelt dieses Pulsieren wider und verkörpert die Energien, die in dieser Wohn- form entstehen können.
I: Gibt's noch was irgendwas, was ihr noch sagen wollt, was ihr noch loswerden wollt zu dem Thema?
O: Ich bereue es immer noch nicht, daß ich da gewohnt habe.
M: Nein, auf keinen Fall,
0: Es war eigentlich schon eine Super-Zeit eigentlich.
M: Ja natürlich. Und ich finde, so muß das sein, es war immer nie langweilig es war wirklich immer so kurzweilig, das war wirklich immer so. Es war auch immer voller Überraschungen, wenn's auch manchmal keine so netten waren, aber irgendwie, es war sehr lebendig. Ich finde da das Wort lebendig, das ist mich das Wort, das die Jurastraße paßt. Und ich finde, die Leute sind lebendig gewesen Da gehört halt wirklich beides dazu und ich finde halt grade jetzt nochmal in bezug auf die Eltern, weil ich finde, denen ihre Rolle ist wirklich nicht einfach, weil die sind eigentlich ja bloß von außen und gucken rein, und die möchten gern mitschwätzen, aber wir wollen das eigentlich nicht so. Und ich finde, was wir von unseren Eltern, eigentlich haben wir schon so das Wohlwollende, ich denke, also ich finde, das hab' ich immer schon gespürt, daß sie's wirklich mit uns wohl wollen und sie meinen's gut, und ich glaube, wenn sie sich das erhalten können oder wenn die Eltern das haben und kein Mißtrauen, ich finde, das stärkt dann irgendwie schon. Und wenn man weiß, wie das gewürdigt wird und das ist eigentlich auch von der Frau S. und von das ist schon immer wieder signalisiert worden. Und ich finde, also das finde ich toll, wenn die Eltern das können, wenn sie das wirklich sagen können und gleichzeitig ohne den Anspruch dann, ohne Anspruch das äußern zu können, daß sie nichts rückerwarten, daß wir ihnen auch was geben, sondern eigentlich - mir war's am liebsten, sie haben bloß gegeben und nichts wollen, weil ich war in der Situation, wo ich da gewohnt habe, war die Gebende, nicht bloß, aber ja, aber es war schon viel, was man gegeben hat und wenn man den Eltern auch noch hat geben müssen (ehem. BewohnerInnen o.A. :64/65).
Diese Form des Lebendigen läßt sich wahrscheinlich nur entwickeln, weil von außen - hier im Textauszug am Beispiel der Position und Situation der Eltern aufgezeigt - nicht ständig Ansprüche eingefordert werden. Das Gefühl und Vertrauen, daß alle Beteiligten der Idee und Praxis der LIW positiv gegenüberstehen und keine lnteressengruppe aufgrund der strukturellen Bedingungen grundsätzlich eine Oppositionsrolle einnehmen muß, sondern alle eine Teilhabe und Mitgestaltung möglich ist und somit jede einzelne auch zum Gelingen der lnklusionsumsetzung beitragen kann, bieten eine Basis, auf der das Lebendige sich übertragen läßt. Die Folge ist, daß diese Lebendigkeit in den Räumen der Wohngemeinschaft spürbar ist, auch wenn sie zum Teil „dicke“ Konflikte, besonders anstrengende Bewältigungsmuster, chaotische Zustände auch Verzweiflung und Unzufriedenheit her- vorbringt. Aber bisher scheint immer das Moment des Lebendigen durch bzw. bildet einen Widerhaken, der die Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten zurück- drängt und den Schein des Glanzes, des Lichtes nicht verblassen läßt.
Die ehemaligen Bewohnerinnen sind erst vor kurzem aus der Wohngemeinschaft ausgezogen. Sie sind dem Alltag der Jurastraße „entronnen“ und blicken mit einer Distanz zurück. Rückblickend können Situationen verklärt bzw. idealisiert oder klarer erkannt werden. Da sie alle vor allem wegen beruflicher Veränderungen aus der Wohngemeinschaft ausgezogen sind und heute immer noch regen Kontakt zu der Wohngemeinschaft haben, sind keine „offenen Rechnungen“ zu begleichen. Wenn aus dem Gespräch mit den ehemaligen Bewohnerinnen ein vorsichtiges Fazit gezogen werden kann, dann war zu beobachten, daß sie die Positionen der anderen Beteiligten aus der Distanz facettenreicher sehen.
Im Gegensatz zu anderen institutionellen Angeboten zeigt das integrative, lebensweltorientierte Wohnprojekt, in dem Menschen mit und ohne Assistenzbedarf zusammenwohnen, daß sich das Verhältnis von Selbstbestimmung und Abhängigkeit in einer anderen Weise herstellt. Die Aussagen von den Bewohnerinnen, Mitarbeitern, Eltern und Trägern bestätigen, daß die Eingebundenheit der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf in die Wohngemeinschaft den institutionellen Charakter verhindern und die Privatsphäre des Wohnens garantieren. Schon allein die Tatsache, daß ein Besuch in der Wohngemeinschaft von seiten der Leitung (Träger) erfragt wird (im Gegensatz zur Ankündigung), zeigt die Akzeptanz der Privatsphäre.
Der Zugriff auf die Bewohnerinnen bleibt somit weitgehend verwehrt. Die Position und der Status der Bewohnerinnen tendieren eher zu Bedingungen, wie sie in privaten Lebensformen üblich sind. ln diesem Zusammenhang lassen sich auch Veränderungen hinsichtlich der institutionellen Abhängigkeit wahrnehmen: in dieser Wohnform haben die Bewohnerinnen eine Machtposition, die ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft von seiten der Institution voraussetzt. Die Vermittlungsarbeit des hauptamtlichen Mitarbeiters wird deshalb zu einer zentralen Aufgabenstellung.
Kritische Einschätzungen zu dem gemeindenahen Wohnen (vgl. z. B. Dalferth 1997) geben Anlaß zum Nachdenken. Es bleibt z. B. zu bedenken, daß diese Wohnform nicht allen möglichen Adressatinnen entspricht (vgl. Kapitel „Riskante Freiheiten“), so wie auch viele andere Bürger nie in eine Wohngemeinschaft ziehen oder darin nicht zurecht kommen (würden).
Bis jetzt äußern sich die Bewohnerinnen, trotz aller auftretenden Schwierigkeiten und vorhandenen Veränderungswünsche, positiv über die Möglichkeiten, die sich ihnen durch diese Wohnform erschlossen haben.
Dabei müssen Bewältigungsschwierigkeiten, die sich in der Wohngemeinschaft ergeben, vor dem jeweiligen konkreten Hintergrund bzw. im speziellen Kontext betrachtet werden: Nehmen wir z. B. die Ablösungsschwierigkeiten von Eltern und ihren Söhnen/Töchtern. Die Attraktivität des Wohnangebots liegt darin, daß vorhandene Ängste hinsichtlich der Ablösung individuell bearbeitet werden können. einige Bewohnerinnen sind mit dem Einzug in die Wohngemeinschaft Probleme entstanden, die sie bisher nicht hatten: Einerseits der Anspruch, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, an einem eigenen Ort zu leben und andererseits gleichzeitig die Beziehungen zu den Eltern neu zu gestalten. Diese Herausforderung anzunehmen und im Alltag damit leben zu können, ist nicht einfach. Aber wenn sie heute noch bei ihren Eltern leben würden, wäre das Wohnthema in den Beziehungen zwischen den Eltern und Töchtern/Söhnen - vielleicht sogar unausgesprochen - virulent, aber praktisch aufgeschoben.
Positive Effekte innerhalb der LIW sind nur zu erreichen, wenn die Rahmenbedingungen in einer lebensweltorientierten integrativen Wohngemeinschaft alle Beteiligten annehmbar sind (vgl. Jerg 1999). Was darunter zu verstehen ist, wird in den folgenden Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven versucht, zusammenzutragen und zu bündeln.
Als erstes wird der Blick auf den äußeren Rahmen der LIW gerichtet. lm nächsten Kapitel werden deshalb Aspekte zu den (sozial)räumlichen Rahmenbedingungen erläutert.
[7] In der Regel befinden sich die konzeptionellen und forschungsrelevanten Aspekte im ersten Tell einer Darstellung. Aufgrund des Interesses, die konkreten Ergebnisse relativ zügig auszubreiten, sind Teile der Forschungskonzeption in den Anhang am Ende der Arbeit gestellt worden. Mit dieser Platzierung sind keine Wertungen beabsichtigt.
[8] Marlin Klingst in DIE ZEIT Nr. 43, 55. Jg., 19.10.00, S.1
[9] Ausschließlich bei den Mitarbeitern wird die männliche Sprachform verwendet, weil in der LlW nur Männer die Aufgaben von hauptamtlichen Mitarbeitern übernehmen (Ausnahme im professionellen Team sind ab und zu Praktikantlnnen) und die reale Wohngemeinschaft die weibliche Form als gemeinsame Geschlechtsbezeichnung befremdlich wirkt.
[10] Aufgabe und Inhalt der ersten Erhebungsphase war es, die Projekterfahrungen der Beteiligten und den Prozeßverlaut der ersten acht Monate zu reflektieren und zu dokumentieren. Die Rekonstruktion des Projektverlaufs orientierte sich an möglichen Wegen und vorhandenen Barrieren im Wohnprojekt. Der Schwerpunkt lag auf der Suche nach positiven Erfahrungen und Schwierigkeiten, die sich durch den gemeinsamen Wohnalltag von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf ergaben. Dazu wurden Gruppengespräche mit den Bewohnerinnen, Mitarbeitern und Eltern durch- geführt. Die Ergebnisse wurden in einem Bericht zusammengefaßt, der 1998 veröffentlicht wurde. Der Bericht ist über die Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, Ringelbachstraße 221, 72762 Reutlingen, Fax: 07121/241429 DM 8. - einschließlich Porto zu erhalten.
[11] wobei exklusiv als ausschließendes und absonderndes Moment durchaus vornehmer und reiz- voller klingt als inklusiv, aber eben nicht, wenn es sich um Sondereinrichtungen und Besonderung handelt.
[12] Nach der gleichnamigen Ausstellung von Kassandra Ruhm
Inhaltsverzeichnis
Jede Wohnungssuche ist mit der Frage verbunden: welches Objekt bietet die zukünftigen Bewohnerinnen ein Ambiente, das deren Bedürfnissen und Vorstellungen entsprechen könnte? Die Erfahrungen der derzeitigen Bewohnerinnen und Beteiligten zeigen, daß eine LIW räumliche Bedingungen und geeignete bauliche Voraussetzungen zur Verrichtung täglicher Arbeiten bzw. Abläufe wesentlich zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensbewältigung beitragen können. Zur Entwicklung eines Wohlbefindens der Bewohnerinnen und zur Bewältigung des gemeinsamen Alltags haben sich aus den Gesprächen folgende räumliche Bedingungen eine Wohngemeinschaft mit ca. acht Personen (je vier Personen mit und ohne Assistenzbedarf) als erforderlich herauskristallisiert:
-
Einzelzimmer alle Bewohnerinnen als Standard zur individuellen Gestaltung eines eigenen Lebensraumes und zur Gewährung eines privaten Rückzugsortes.
-
Eine geräumige Küche bzw. Wohnküche, die zum einen die assistenzgerechte und funktionale Verrichtung alltäglicher Küchenarbeiten ermöglicht und zum an- deren kommunikative Begegnungen erlaubt.
-
Ein großes Wohnzimmer, das ein gemütliches Zusammensitzen der Bewohnerlnnen einschließlich der Gäste genügend Platz bietet.
-
Mindestens zwei Toiletten (bei mehreren Stockwerken auf jeder Etage eine).
-
Zwei Bäder zur entspannten Bewältigung der Körperpflege in Stoßzeiten.
-
Ein kleines Zimmer als Büro den hauptamtlichen Mitarbeiter und andere Mitarbeiterlnnen.
-
Eine Waschküche, die ausreichend Platz zum Trocknen der Wäsche gewährt.
-
Ein Kellerraum, in dem die Vorräte gelagert werden können.
-
Ein Garten mit Sitzplatz, Wäschetrockenplatz und Blumen- und Gemüsebeeten.
-
Eine Telefonanlage über alle Stockwerke und Außensprechanlage.
Über diesen Rahmen hinaus gab es noch eine ganze Reihe weiterer Wünsche, die sich die Alltagsgestaltung in der Wohngemeinschaft positiv auswirken können, u. a.:
-
Ein zusätzliches Zimmer, das als Rückzugsraum kleinere Gruppen, Gäste oder z. B. als Übernachtungsmöglichkeit Praktikantlnnen dienen könnte.
-
Ein Kellerraum, der als Werk- und Bastelraum genutzt werden könnte.
-
Idealerweise würde aus Sicht von einzelnen Personen der Träger in den einzelnen Zimmern eine Naßzelle oder zumindest ein Waschbecken den Standard optimieren.
-
Sauna im Keller und Swimmingpool im Garten waren in den Gesprächen mit den Bewohnerinnen auf der Wunschliste, um die Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten vor Ort zu erweitern.
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die wesentlichen Standards, die aus Sicht der Beteiligten ein gemeinsames Wohnen zu berücksichtigen sind. im Mittelpunkt standen dabei das Einzelzimmer und die gemeinschaftlich genutzten Räume (Küche, Bad, Wohnzimmer) sowie der Garten.
Einzelzimmer sind die meisten Gesprächspartnerinnen schlicht und einfach eine Voraussetzung den Einzug in eine Wohnung. Schließlich würde keine Bewohnerin ohne Assistenzbedarf auf die Idee kommen, freiwillig in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, in der nicht ein eigenes Zimmer zur Verfügung stände. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen wider, Das Thema Einzelzimmer taucht ausschließlich im Kontext von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf auf.
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung leben in Deutschland bis heute überwiegend in Mehrbettzimmern. Nur ein Drittel dieses Personenkreises verfügt über ein eigenes Zimmer. Nur ein Drittel der Bewohnerinnen, die in Mehrbett- zimmern wohnen, kann Einfluß auf die Auswahl von Mitbewohnerinnen nehmen (vgl. Häussler-Sczepan 1998 :152 ff).
Selbstgestaltung, Rückzug, Abgrenzung, Freiheit, lntimität, Sexualität etc. sind Dimensionen, die unter Bedingungen eines Mehrbettzimmers nur schwer umzusetzen sind. in der ersten Erhebungsphase (vgl. Jerg 1998) als auch u. a. in Häussler-Sczepan (1998 :153) wird der Wunsch nach einem eigenen, selbstgestalteten Zimmmer von den Bewohnerinnen hervorgehoben. Das eigene Zimmer bietet die Ausgangsvoraussetzung, um das Zusammensein mit anderen selbst bestimmen zu können. Ohne diese strukturelle Voraussetzung gibt es keine Freiwilligkeit des Zugehens auf andere. Ein Mehrbettzimmer bedeutet Wohnen in einer Zwangsgemeinschaft, die eine ständige Rücksichtnahme erfordert und nur stundenweise einen eigenen Rückzugsraum ermöglicht.
Einzelzimmer als Rückzugsraum. Das eigene Zimmer bietet z. B. die Möglichkeit, sich nach der Arbeit erst einmal zurückzuziehen und zu sich selbst zu kommen. die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ist dies - im Gegensatz zu den anderen Mitbewohnerinnen - keine Selbstverständlichkeit. Ein Teil der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf war es vor dem Einzug in die Wohngemeinschaft gewohnt gewesen, ständig in öffentlichen Räumen zu leben bzw. immer unter anderen zu verweilen. Neben der Anerkennung der Persönlichkeit, die mit dem eigenen Zimmer zum Aus- druck kommt, lernen sie darüber hinaus, diese neue Möglichkeit in der LIW zu genießen. in den Gesprächen benennen sie diese Rückzugsmöglichkeit als eine wert- volle Qualität. Auch die Bewohnerin, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigt, erlebt den Freiraum, auch einmal alleine in ihrem Zimmer zu sein, als einen wichtigen Aspekt der Selbstbestimmung. Es gibt ihr die Gelegenheit, unabhängig von an- deren auch die Situation des „-sich-alleine-seins" herstellen zu können. Aus den Gesprächen mit den Vertreterinnen der Träger, den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sowie den Müttern möchte ich hier einige Aspekte anführen, um die Bedeutung des Einzelzimmers sichtbar zu machen.
Die Frage eines Einzelzimmers besteht im besonderen Maße im Kontext der Menschen mit Assistenzbedarf
Unter den Vertreterinnen der Träger kam es zu einer ausführlichen Diskussion über die Notwendigkeit eines Einzelzimmers als Standard eine LIW.
T: Also ich denke, daß es in einer WG wichtig ist, Rückzugsmögliehkeiten zu haben, einen privaten Bereich zu haben.
U: Es ist ja schon interessant, daß bei Bewohnerinnen ohne Behinderung keiner auf die Idee kommen würde, daß jetzt zwei, selbst wenn sie eng liiert sind, in ein Einzelzimmer zu stecken, weil das im Prinzip also nicht aushaltbar ist auf Dauer und seltsamerweise - und ich denke schon, daß das von der Heimtradition her kommt, wo man eher mit Mühe und so in den letzten Jahren die Einheiten langsam auf ein verträgliches Maß verkleinert hat, aber letztendlich im Prinzip davon ausgegangen ist, daß also auch ein Zweibettzimmer im Vergleich zu früheren Jahren doch noch eine akzeptable Lösung ist. Aber ich denke, von der Tendenz her geht das doch in allen Bereichen gleich, daß jeder auf Dauer ein Einzelzimmer hat.
V: Wobei ich denke, das gehört einfach zum heutigen Lebensstil. Es kann sein das ist in zwanzig Jahren ganz anders, daß plötzlich alle sagen, es ist toll, in einem großen Schlafsaal zu schlafen, und ich brauche die Qualität nicht mehr und die Intimität, das kann man alles vergessen. Es ist toll, alles miteinander in einem großen Raum - kann ja sein, das kommt einmal wieder; aber unser heutiges Lebensgefühl ist einfach, in einem eigenen Zimmer zu sein und einen eigenen intimen Raum zu haben, und ich denke, genau das ist das, was wir auch erwarten müssen, was wir bereitstellen müssen ein menschliches Miteinander.
S: …also wenn ich jetzt an Menschen mit Behinderungen denke, zum Beispiel Helenes Gruppe, wo zehn unterschiedlich sehr schwer behinderte Frauen beieinander wohnen, und jede hat Auffälligkeiten auf ihre Art, da ist das einfach - also ich finde es schon schlimm, daß die Doppelzimmer haben, weil die stören sich brutal zum Teil.
V: Ein Beispiel: Ein Bewohner im (Wohngruppe - betreutes Wohnen des Trägers A) ist bereundet mit einer Frau, die in der (stationäre Wohngruppe Träger B) wohnt, und er möchte sich auch treffen mal mit der Frau. Jetzt ist die Frau natürlich auch noch behindert und sitzt im Rollstuhl, Da wo er wohnt jetzt im Moment, ist das Haus nicht rollstuhlzugänglich, das heißt, die Frau kann mit ihrem Rollstuhl reinfahren, dann hat der noch sein Zimmer im ersten Stock Also muß man sie noch eine Treppe hochhieven und so weiten Das funktioniert alles nicht so einfach, das kann man machen, wenn Leute da sind, die helfen hochtragen und so weiter, aber man braucht immer einen riesigen Unterstützungsapparat dazu. Und in der (stationäre Wohngruppe Träger B) wäre es im Grunde genommen rollstuhlgerecht, aber dort geht's nicht - und wenn er dort einmal im Monat übernachtet, das haben sie so vereinbart, dann muß die andere Mitbewohnerin, die muß im Grunde genommen so lange ausziehen in ein anderes Zimmer, also die wird ausquartiert in dieser Nacht. Ich finde das ja schon gut, daß die Kollegen von der (stationäre Wohngruppe Träger B) so weit sind, daß sie sagen, sie müssen ja auch allein sein können, so dass Intimität möglich ist. Aber die Situation ist ungeheuer schwierig, da kann man nicht einfach sagen, ich hab' Lust, mit meiner Freundin zusammenzusein, sondern das muß man langfristig vorher planen - eigentlich ein Unding. Das wurde sich von uns heute keiner mehr gefallen lassen, so was Und das sind Dinge, wo ich denke, diese Einzelzimmer haben einen ganz hohen Stellenwert, nicht jeden in gleicher Weise, aber die Voraussetzungen jeden, im Grunde genommen nach seinem Wunsch Besucher empfangen zu können, nach seinem Wunsch ein Zimmer, einen Raum auch einrichten zu können, mal seinen eigenen Geschmack leben zu können, möglicherweise zu rauchen oder auch nicht zu rauchen und so weiter All diese Dinge, die kann man nur; wenn man niemand anderen dadurch stört. Das sind die Gründe, warum man ein Einzelzimmer braucht.
T: Bei .schwerer Behinderung dann die Pflege, die dann da stattfindet, das will man ja auch nicht unter den Augen von anderen machen, die grade jetzt lieber vespern oder so, (Träger 22-5)
Ausgangspunkt der Diskussion war die Frage: warum müssen wir heute noch das Einzelzimmer Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf begründen? Die historisch- gesellschaftliche Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten den Lebensstil und den Wohnstandard eines eigenen Zimmers hervorgebracht, aber Menschen mit Assistenzbedarf noch keine gleichgestellte Realität geschaffen. Die würdevolle Pflege oder das Zugeständnis eines sexuellen Lebens Menschen mit Assistenzbedarf u.a. sind in unserer heutigen Zeit ohne einen eigenen Rückzugsort nicht zu gewährleisten.
Ein eigenes Zimmer als Rückzugsort und Sicherheit in bezug auf Intimität
Unter den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf entstand unter dem Thema Veränderungswünsche eine kontroverse Diskussion über die Intimitätssicherheit inner- halb der Wohngemeinschaft. Ausgangspunkt der Diskussion war der Wunsch einer Bewohnerin, vielleicht später einmal mit ihrem Freund in eine eigene Wohnung ziehen zu können. In der Wohngemeinschaft stört sie, daß ihr eigenes Zimmer noch teilweise einen öffentlichen Charakter besitzt:
C: Nicht reingucken.
B: Wer guckt da rein? David? Andrea?
C: Ja.
B: Darf sie nicht reingucken, was du machst, aber ich bitte dich, Clara!
C: Nicht immer. Alleine im Zimmer, zuschließen.
B: Schließt du zu das Zimmer?
C: Ralf (Freund) Ralf schließt immer zu.
I: Ralf schließt dein Zimmer immer zu, wieso?
C: Ja. I: Damit niemand rein kommt.
C: Ja. 1: Und das magst du nicht?
B: Das willst du nicht, Clara?
C: Nein.
B: Ich find das kein Problem.
I: Wäre das in einer eigenen Wohnung anders?
C: Ja. I: Meinst du, dort könntest du dich zurückziehen mit deinem Freund, ohne daß jemand stören könnte ?
C: Ja.
B: Bei uns guckt keine Sau nach! Alle lachen
B: Ich bitte dich, Clara! I: Erlebst du das anders, Brigitte?
B: Ja, ja. I: Kannst du mit dem David im Zimmer sein, ohne daß jemand kommt?
B: Nein, da schließ ich zu, und da ist niemand drin.
I: Da schließt du zu?
B: Natürlich schließ ich zu, da kommt niemand rein.
I: Und wieso schließt du zu?
B: Weil ich mal mit ihm alleine sein will.
C: Ja. I: Sonst würde jemand anklopfen oder reinkommen?
B: Dann kommt jemand rein. Aber wenn ich zuschließe, passiert nichts.
C: Neugier. (Bewohnerlnnen m.A.: 7)
Dieser Gesprächsauszug macht deutlich, daß Freundschaft und Intimität das Einzelzimmer voraussetzen. Darüber hinaus braucht es dazu noch die Schlüsselgewalt über das eigene Zimmer. Die Tatsache, daß die Bewohnerinnen ihr Zimmer von innen abschließen, könnte ein Hinweis auf das Bedürfnis nach Sicherheit sein, ungestört in einer bisher ungewohnten Situation zu sein. Obwohl es in der Wohngemeinschaft selbstverständlich ist, daß bei verschlossenen Türen angeklopft wird, äußern sich die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf offen hinsichtlich ihrer Strategien. Sie stehen dazu, daß sie ihr intimes Leben keine Störungen in Kauf nehmen möchten. Ein Thema, das in vielen WGs einen Teil der Bewohnerinnen unausgesprochen unter den Tisch fällt, weil die Erwartungen einer offen gelebten Sexualität rational vertreten werden, in der konkreten Situation auch mit Schamgefühlen und Ängsten verbunden sind. Hinter verschlossenen Türen die Intimität zu leben, wird zwar von den zwei Bewohnerinnen unterschiedlich bewertet, aber beide Frauen bringen deutlich zum Ausdruck, daß sie ein Bedürfnis nach Rückzug ins „eigene Reich“ haben und die Wahrung der lntimität wünschen.
Ein eigenes Zimmer als neuer Erfahrungsraum
Aus der Perspektive einer Mutter gibt es auch angstbesetzte Aspekte, die mit dem Einzelzimmer, als Konfrontation mit dem Alleine-sein, verbunden sein können. Sie erzählt von den anfänglichen Schwierigkeiten ihrer Tochter, die neue Situation in der Wohngemeinschaft positiv zu besetzen:
R: und da hat Birgit erst auch drunter gelitten. Die halte die erste Zeit, wie sie in der Jurastraße war; auch Angst, ihre Zimmertür aufgelassen, weil sie war das auch gewöhnt, zusammen schlafen. Wenn man denkt, wo mein Mann verstarb, da kam sie zu mir ins Schlafzimmer und seitdem haben wir zusammen geschlafen. Dann hatte sie auch Angst, erstens durch das, daß das so eine andere Umgebung war, und dann hieß es, alleine schlafen. (Mütter :1 1)
Ganz allgemein spielt bei den Funktionsräumen, zu denen auch die Küche zählt, die Raumgröße eine entscheidende Rolle. Eine Mutter hat dies ganz treffend formuliert:
S: Und das ist ja nun ganz was anderes, wenn du Platz hast, und ich glaube, daß man dann auch lieber jemanden mit beteiligt. (Mütter :11)
Küche als Arbeitsplatz: Alltäglich sich wiederholende Tätigkeiten, wie z. B. Frühstückstisch oder Abendtisch herrichten, erfordern eine Küchenausstattung, die allen Bewohnerinnen die Erreichbarkeit des Geschirrs ermöglicht. Die unbefriedigende Ausstattung der Küche in der Jurastraße zeigt, daß Bewohnerinnen, die in ihrem Stehvermögen unsicher sind, die Teller, Tassen oder Schüsseln, die im Hängeschrank weit oben untergebracht sind, nicht selbständig erreichen können. im Alltag bedeutet dies, daß hier die baulichen Voraussetzungen tagtäglich Assistenzleistungen erfordern, die durch Umbauten vermieden werden könnten. Mit anderen Worten: Es sind zusätzliche Assistenzleistungen erforderlich, die nicht notwendig wären.
Bei den täglichen Vorbereitungen das Essen ist es erforderlich, daß sich ein Teil der Arbeitsflächen in einer rollstuhlgerechten Höhe befindet. Bewohnerinnen, die im Stehen nicht sicher arbeiten können, bietet ansonsten die Küche zu wenig Gelegenheiten mitzuuarbeiten, weil alle Tätigkeiten in der Küche ein zusätzlicher Aufwand erbracht werden muß. Aus praktischen Gründen - so die Erfahrungen in der Jurastraße - wird deshalb der teilhabende Aspekt öfter vernachlässigt. Eine selbstverständliche Beteiligung kann auf Dauer somit nicht ermöglicht werden.
Wohnküche - Küche als Kommunikationsraum. Die Küchengröße ist über eine arbeitsplatzgerechte Ausstattung hinaus unter kommunikativen Aspekten von Bedeutung. ist die Küche nur als Arbeitsplatz ausgelegt, so können in der Regel nur wenige Personen gleichzeitig in der Küche verweilen. Wie aus vielen Alltagserfahrungen in Familien und Wohngemeinschaften bekannt ist, hat die Küche eine magische Anziehungskraft und bildet den zentralen Kommunikationsraum. Der Idealvorstellung entspricht deshalb eine Wohnküche, in der neben den Vorbereitungen und Nacharbeiten auch der Plausch seinen Platz finden kann. Nicht zu unterschätzen sind dabei die funktionalen Gegebenheiten einer Wohnküche: kurze Wege erleichtern die Mitarbeit gerade auch von Bewohnerinnen, die in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.
Der folgende Gesprächsauszug mit den ehemaligen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf gibt nochmals einen Einblick in die schwierigen räumlichen Bedingungen und deren Auswirkungen auf den Alltag. Diese Situation wurde auch in allen anderen Gesprächsgruppen angesprochen.
L: „also das war ja immer das Ärgernis, daß die Küche das Problem war. Die Küche war zu klein und die war nicht nun daß sie nicht behindertengerecht war sondern sie war auch nichtbehinderte Menschen sehr; sehr schwierig. Also ich bin da drin auch nicht gut klar- gekommen. Ich bin an die Hälfte von den Schränken nicht hingekommen, und dann kannst du nicht zu einem Spastiker sagen, jetzt tust du mal allein was kochen, Das war eine Fehlplanung, und das sollte auf gar keinen Fall noch mal passieren. Da sollten sich die Leute Gedanken drüber machen, bevor sie irgendwelche Pfuscher da ans Werk lassen, die dann den Herd vors Fenster bauen und der Abzug paßt dann irgendwie nicht hin und so, das war ja…
M: Das war ja auch immer schade, wenn man dann gekocht hat, man hat dann eigentlich nicht irgendwo dabeisein können und ein Schwätzle halten, sondern man ist dann gleich im Weg gestanden, und das finde ich ein bißchen schade. Oder die Andrea (Bewohnerin m.A.), wenn da einfach ein gescheiter Tisch dringestanden wäre, dann hätte man der nicht extra so ein Konstrukt zusammenbauen müssen.
L: So einen Baby-Tisch da.
M: Ja, genau, sondern dann hätte sie sich einfach normal an den Tisch hinsetzen können.
L: Oder die Clara (Bewohnerin m.A.) ist auch gerne in der Küche gestanden, wenn da highlife war: grade wenn da zwei Leute schnippeln, und wir mußten die regelmäßig rausschmeißen und sagen, Clara, raus aus der Küche, du stehst bloß im Weg, und so war's halt auch.
M: Also so eine Wohnküche mehr; das hat sowieso was das wäre doch geschickt gewesen, Dann hätte man da schon, was weiß ich, schon nebenbei ein kleines Schwätzle halten können und vielleicht schon was trinken nach dem Schaffen.
L: Oder nach dem Schweizer Modell, da gibt‘s ja die wirkliche Wohnküche, also Wohnzimmer hier, Küche da und in der Mitte vielleicht noch so - manche haben da so eine richtige Theke oder so, wo man dann auch hocken kann. Aber grade bei Großfamilien sehe ich das oft, daß die einen Riesentisch drin haben und das dann ineinander übergcht, daß der Tisch so die Grenze ist zwischen da hinten ist dann Wohnzimmer und da ist dann diese Küche. Das wäre schon toll gewesen. Vor allem täte das auch so Aufräumarbeiten erleichtern, denke ich, wenn man nicht dauernd hin- und herspringen muß mit dem Zeug. (ehem. Bewohnerinnen o.A. :1-2)
Auf dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen in der LIW wird deutlich, daß konzeptionelle Leitideen zur Mitgestaltung und Mitbestimmung im Alltag an Grenzen stoßen. Zu oft kommen die Bewohnerinnen und Mitarbeiter in Situationen, in denen Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf nicht einbezogen werden, weil ihnen der Aufwand zu groß erscheint und die Arbeiten deshalb lieber schnell selbst erledigt werden. Umgekehrt ist es auch oft so, daß sich die Bewohnerinnen nach der Arbeit entspannen wollen und nicht mehr viel Energien haben. Teilhaben heißt dann manchmal auch dabeisein zu können, dabeizusitzen, zuzuhören, die Arbeitsabläufe zu beobachten.
Aufgrund der kleinen Küche in der Jurastraße ist das Wohnzimmer, das zugleich als Eßzimmer dient, der zentrale Aufenthaltsort, Diese Koppelung von Eß- und Wohnzimmer ist aufgrund der Größe des Raumes vor allem ein Platzproblem. Beide Funktionen - sowohl ausreichend Sitzplätze am Eßtisch als auch genügend gemütliche Sitzgelegenheiten e lassen sich in diesem Wohnzimmer nicht unterbringen. Deshalb sollten als Standard eine Wohnküche und ein Wohnzimmer vorhanden sein.
Als Alternative könnte zu dieser Doppelfunktion eines Eß- und Wohzimmers ein zusätzliches kleineres Zimmer ein gemeinschaftliches Zusammensein in Frage kommen:
Y: Was ich mir noch vorstellen kann, einfach mehr Rückzugsnischen, also nicht nur das eigene Zimmer und dann das Wohnzimmer, wo dann alle zusammen sind sondern einfach auch das, wenn mal Freunde kommen oder Bekannte, daß man noch einen anderen Raum hat, wo man irgendwas machen kann (Mitarbeiter :28)
Die räumliche Größe ist auch ausschlaggebend die funktionale Gestaltung des Gemeinschaftsraumes. Hier können neben der Gesprächsmöglichkeit auch andere Kommunikationsformen - wie 2. B. gemeinsam musizieren - zu einem lebendigen Zusammenleben beitragen. Die eigene Gestaltung der Räume ist dabei eine wichtige Voraussetzung, um Atmosphäre, Wohlbefliden und räumliche Identität herzustellen (vgl. Kapitel 10 Teilhabe).
K: Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist der, was mir immer wieder auffällt, das Wohnzimmer: Ich kann mir auch vorstellen, eine große Wohnküche, aber es muß wirklich ein Raum sein, wo man einfach Platz hat, wo zum Beispiel Musikinstrumente stehen Ich merke immer wieder das ist einfach eine Sache, das trägt auch zur Atmosphäre bei und auch die Pflanzen, die da sind oder viele, die kommen von der Arbeit und gehen erst mal ins Wohnzimmer; dann sagt man guten Tag also grade die Kommunikation spielt sich in diesem Raum ab, „aber es muß einen Raum geben, wo wirklich Platz ist, der auch entsprechend den Vorstellungen von den Bewohnern auch eingerichtet ist. (Mitarbeiter 128)
Der sanitäre Bereich in der Jurastraße ist alles andere als assistenzgerecht. Die Ausstattung entspricht einem kleinen durchschnittlichen Bad mit Waschbecken und Badewanne.
Barrierenfreie Körperpflege aus der Perspektive von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf
Der längste Beitrag von Andrea (Bewohnerin m. A.) betraf den Badumbau. Seit langem ist dies ein Gesprächsthema innerhalb der Wohngemeinschaft und ein Verhandlungsthema mit dem Vermieter. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine konkrete Zusage die Umgestaltung gemacht worden. Die Wichtigkeit dieses Anliegens wird durch die Aussage des Mitarbeiters bestätigt, der bei einer Beratungssitzung berichtet, daß Andrea ständig nach der Umgestaltung des Bades fragt. Die Bedeutung eines assistenzgerechten Bads wird im Gespräch mit den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf angesprochen:
I : Worauf mußte man nach eurer Meinung bei einer neuen WG achten?
A: Wir kriegen doch ein neues...
I: Was ein neues?
A: Bad wird herausgerissen, doch!
I: Das Bad wird neu gemacht?
A: Jaaaaaaa.
I: Ist das wichtig?
A: Ja.
I: Wird es dann leichter zum Duschen?
A: Ja.
C: Ich auch.
B; Das ist so, weil die Clara kann nicht reinsteigen, und die Andrea wird auch immer schwerer und kann nicht so.
A: Ja.
B: Da wird jetzt einfach eine Dusche reingesetzt, wo man dann duschen kann.
I: Das ist ja ein wichtiger Punkt, den ihr hier erwähnt.
A: Warum?
I: Daß man darauf achten muß, daß das Bad richtig ausgestattet ist.
A: Ja - (lacht) -ja.
B: Rollstuhlgerecht.
A: Ja, ja.
I: Clara, ist es dich auch wichtig, wegen dem Einsteigen?
C: Einsteigen gefährlich. (BewohnerInnen m.A. 13)
Die Beziehung zum eigenen Körper ist bei den meisten Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf konfliktbehaftet. Die Eigen- und die Fremdwahrnehmung „dritten“ hier sehr stark auseinander und führen zu belastenden Konflikten. Die schwierige Aufgabe - aus Sicht der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf und Mitarbeiter - ein angenehmes und positives Körpergefühl zu erarbeiten, ist eng verbunden mit der Möglichkeit einer lustbetonten und angstfreien Erfahrung im Badezimmer.
I: Habt ihr auch den Eindruck daß diese sanitären Anlagen, wie sie da sind, Barrieren darstellen, um so was wie eben Körperpflege sicher durchführen zu können?
M: Sagen wir mal so: die Clara kann's vorschieben, daß sie sagt halt, oh, sie rutscht aus oder sie ist ausgerutscht, und das stimmt auch, das stimmt auch einfach.
L: Und mit der Andrea ist's auch oft genug blöd gewesen, daß die nicht in die Wanne wollte und dann war es so gefährlich, bis die mal da drin war und dann ist sie dringestanden und hat sich nicht hingehockt. Da mußte man wirklich, da sollte man gucken, daß wenigstens, vielleicht auch so, da gibt's ja so Duschen, wo dann der Boden so weit abschüssig ist und dann kann man das auch leicht reinigen. Das können dann die Leute zum Beispiel auch selber machen. Eine Badewanne putzen ist halt viele Leute auch schwierig. Das wäre schon toll gewesen.
M: Oder ja, daß man auch dann wirklich mit einem Stuhl auch unter die Dusche runter kann, daß die sich hinsetzen kann, und dann wird die einfach duschen.
L: Das war auf der Freizeit so, das habe ich da so gemacht, da gab's halt die Gullis im Boden und so einen Abzieher ür hinterher und einen Plastikstuhl, und da habe ich sie draufgesetzt. Dann ging das sogar allein. Und das war ja - Andrea duschen alleine, das ging nicht normal.
M: Es kommt wahrscheinlich auf die Art von Behinderung, auf den Grad von Behinderung an. Ich denke, den David ist das oben okay, wie's ist, oder die Birgit, aber grade, wenn's Menschen sind mit körperlicher Behinderung, dann mußte die Ausstattung dementsprechend halt sein, daß man nicht erst dann aus Erfahrung irgendwann dann nach drei Jahren, bis es dann bewilligt ist und was weiß ich, das ganze bürokratische Zeug, sondern daß das einfach von Anfang an da ist, daß man sagen kann, okay, das untere Stockwerk wird gleich so ausgerichtet, daß Leute mit Behinderung einziehen können Wenn dann jemand nicht weß wer einzieht, daß das einfach von der Konzeption her so ist. (ehem. Bewohnerinnen o.A.: 10)
In die Badewanne einzusteigen, um zu duschen, heißt eine Barriere zu überwinden, die mit einer Verletzungsgefahr verbunden sein kann. Die Praxis zeigt hier, daß die kleinsten Unfälle dazu führen, daß kein Vertrauen hergestellt werden kann und die Barrieren zusätzliche Erschwemisse darstellen. Darüber hinaus werden die Barrieren als Vorwand benutzt, um sich die konfliktbelastete und schwer zugängliche Bezie- hung zum eigenen Körper fernzuhalten.
Der Hinweis auf die Gegenerfahrung auf einer Freizeit mit assistenzgerechten Bedingungen zeigt, daß die Körperpflege dort weniger problembehaftet besetzt ist. Die Betroffenen können wesentlich mehr selbst bewältigen, d.h. selbständiger und nach ihren Vorstellungen handeln und die Assistenzleistenden müssen schlicht und einfach nur das Notwendige zur Unterstützung erbringen. Auf die konkrete Person bezogen, heißt dies auch, daß in einer barrierenfreien Umgebung eine begleitende Assistenz ausreicht, während in der Wohngemeinschaft zwei Personen zur Unterstützung notwendig sind, um die Barrieren ohne größere Gefahren zu überwinden. Selbstverständlich müssen nicht alle sanitären Funktionsräume barrierenfrei umgebaut werden, sondern es reicht, wenn ein erreichbares Bad entsprechend ausgestattet ist.
Alltägliche Barrieren wahrnehmen und beseitigen kann auch die Konstruktion von Behinderung vermeiden
Barrieren fördern Konstruktionsprozesse von Behinderung im Alltag. Dabei besteht die Gefahr, daß sie als ein bestimmendes Moment der Behinderungskonstruktion nicht immer im Blickfeld bleiben und somit reale Situationen von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf nicht erkannt werden. Mitunter kann dies dazu führen, daß Situationen ganz anders gedeutet oder umgedeutet werden, wie dies aus einem Gesprächsauszug mit Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sichtbar wird.
F: die Clara auch, da haben wir ja schon drüber geschwatzt, daß die Clara das ja alles viel schwieriger ist, bis die Clara da ihren Fuß drüberkriegt. Der fällt alles schwer; viel viel schwerer als uns.
H: Und vor allen Dingen eine WG, das wäre sogar ganz arg wichtig, denke ich.
F: Ich sehe jetzt, wenn die Clara sich da hinhockt, bis die dann wieder da raufkommt.
H: …vom Sofa…
F: ja, das ist arg schwer sie, dann sagt man immer, sie sei faul oder so, ich habe oft auch den Eindruck, aber ich glaube, ihr fällt einfach alles tausendmal schwerer als uns, die ist halt von ihrer Spastik her so…
X: Oder was mir auch grade spontan einfällt, wenn man zum Beispiel zur Andrea sagt, sie soll sich doch an Aktivitäten mitbeteiligen, zum Beispiel wenn's bloß staubsaugen ist da vorne im Flur, da hat sie ja zum Teil auch Spaß dran, und ich denke, so eine große Action ist das gar nicht, das dann auch zu verwirklichen, dann zum Beispiel solche Hebeleisten an die Wände ran- zumachen zum Beispiel, daß sie sich mit einem Arm festhalten kann. (Bewohnerinnen o.A. 26)
Als ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität sehen die Beteiligten den großen Garten. Gerade in den wärmeren Monaten dient er als zusätzlicher Raum, der Gelegenheit zur Erholung, Entspannung und Gestaltung bietet und auch Distanzmöglichkeiten zuläßt. Dabei wird der Nutzen des Gartens sehr unterschiedlich eingeschätzt. Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sehen vor allem spielerische und bewegungs- anregende Funktionen:
B: Was ich mir so wünsche, das ist so ein Spielplatz nur uns alle.
I: Was soll drauf sein?
B: Eine Schaukel, Rasen, eine Wippe, ein Sandkasten, Gras zum Fußballspielen.
I: Wieso ein Spielplatz euch alleine?
B: Weil die Andrea mag gern im Sandkasten spielen und ich auch, und schaukeln tu ich auch und Wippen auch. (BewohnerInnen m.A.: 1)
Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf nutzen den Garten entweder als Gestaltungsraum zum Anpflanzen oder zum Relaxen. sie trägt er viel dazu bei, daß das gemeinsame Wohnen entspannt verläuft.
I: ...was macht das Wohnen interessant?
E: Die Gemeinschaft auf jeden Fall, das sind nicht bloß Dienstzeiten, sondern daß man auch gern sa hier ist oder auch untereinander etwas unternimmt so und man einen schönen Garten hat, so im Sommer. (Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf :14)
Mit einer barrierenfreien Ausstattung steht und fällt in hohem Maße der Gestaltungsraum selbständiges und selbstbestimmtes Wohnen. Hier sollten im Vorfeld keine Kosten gescheut werden. Die Erfahrungen in der Jurastraße zeigen. daß zwar auch unter schlechteren bzw. nicht-assistenzgerechten Bedingungen ein gemeinsames Wohnen möglich ist, dies aber mit Reibungsverlusten und schwierigen alltäglichen Bewältigungssituationen verbunden ist, die vermeidbar wären.
Eine lebensweltorientierte Wohngemeinschaft trifft in der Regel bei der Anmietung bzw. beim Kauf auf eine nicht ausreichend barrierenfreie Ausstattung. Aus diesem Grund sind bei der Einrichtung und Umgestaltung der Wohnräume vielfältige Kompetenzen gefordert. Daher ist es ratsam, die Betroffenen und Eltern in diesen Prozeß miteinzubeziehen. Bei der derzeitigen Suche nach einem neuen Zuhause eine weitere Wohngemeinschaft sind die Mütter eine wertvolle Hilfe. Bei der Auswahl von Wohnungen bzw. Häusern gilt es, auf viele Kleinigkeiten zu achten, die wir hier nicht im einzelnen auflisten können. (Als Beispiele seien hier erwähnt: Türschwellen und Unebenheiten bei den Bodenflächen müssen vermieden werden, und bei kleinen Toiletten müssen die Türen nach außen zu öffnen sein, damit man z.B. mit einem Rollstuhl hineinfahren kann bzw. in einer Notsituation die Tür von außen öffnen kann.)
Es soll aber nicht der Eindruck erweckt werden, daß mit einer assistenzgerechten Ausstattung alle Probleme aus der Welt geschafft sind. Gerade im Bereich der Körperpflege zeigt sich im Alltag bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ein massiver Widerstand gegen das Fremdbestimmt-sein. Die gesellschaftliche Abwertung des Körpers bzw. die jahrelange Erfahrung der Fremdbestimmung (des Körpers) läßt darauf schließen, daß hier in kleinen Schritten eine positive Körperbeziehung „erarbeitet“ werden muß.
Weiterhin zeigen einzelne Beiträge in den Gesprächen, daß die räumlichen Bedingungen den Alltag mit diktieren und deshalb als wichtige Dimensionen der Konzept- und Strukturqualität auch ernst genommen werden sollen. Sie dürfen in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt, aber auch nicht absolut gesetzt werden, weil entscheidende Einflüsse auf das Wohlbefinden oder die Qualität des gemeinsamen Lebens stärker durch die Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Bewohnerinnen zum Ausdruck kommen (vgl. Kapitel Teilhabe und Selbstbestimmung).
W: Ja, das sind einfach diese räumlichen Strukturen, aber das wichtigste ist trotzdem die von- Mensch-zu-Mensch-Beziehung absolut. Du kannst dir das schönste Bio-Haus hinstellen mit allem möglichen, was du dir nur vorstellen kannst, aber das braucht der einzelne gar nicht, weil jeder hat eine andere Vorstellung von seinem Wohlbefinden, von seinem Wohlfühlen Trotzdem kann das auch ein Schuß in den Ofen sein, es muß' nicht dazu beitragen, daß sich dann jemand wohlfühlt, wenn man die Räumlichkeiten schafit. Wenn man da die Zeit schafft, um jemandem zuzuhören oder daß er sich oder sie sich einbringen kann, wie sie ist. Und trotzdem kann es sein, das Heimweh zu den Eltern, zu der Mutter; zu der Zeit, die man jetzt rückwirkend erlebt hat oder gelebt hat, diesen Sicherheitsrahmen, diesen Schutz, was die Kleinfamílie geboten hat, kann sein, daß das im Endeffekt trotzdem nicht ausreicht, um sich tatsächlich in einer WG wohlzufühlen, weil 's da so chaotisch ist.
K: Es kann natürlich auch Konflikte geben zwischen den Bewohnern untereinander, obwohl du jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter kommst, Du hast eine gute Beziehung zu jedem einzelnen, und du schafifrl das, eine Beziehung, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit jedem einzelnen, und trotzdem kann's sein, und das erleben wir ja auch grade, daß es Konflikte untereinander gibt, und die Konflikte können so groß sein, daß jemand auszieht, ganz klar. Aber es ist am Anfang nicht so, und mit der Zeit hat sich da etwas entwickelt, hat sich etwas verschoben. Die Dynamik, die kann man einfach nicht vorhersehen, und damit muß man immer wieder rechnen. (Mitarbeiter 128)
Der Rahmen, der hier aufgezeigt wurde, stellt den Aspekt der räumlichen Bedingungen in das Gesamtbild eines Wohngemeinschaftslebens. Sich-zu-Hause-fühlen ist an räumliche Bedingungen geknüpft. Aber sie sind nicht so entscheidend wie die menschliche Gestaltung des Zusammenlebens.
Normalität ist, daß jeder wieder ausziehen kann, wenn es ihm nicht gefällt. Hier besteht ein gravierender Unterschied zu Institutionen. Ungeachtet dieser Differenz bleibt dabei die zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung als Indikator und treibende Kraft eine gemeinsame Perspektive, Die Relativierung der Indikatoren ein Wohlbefinden in einer LIW macht deutlich, daß Raum und Zeit zwar gegeben sein können und trotzdem sich der eine oder andere in dieser Wohnform nicht oder auf Dauer nicht wohlfühlen wird.
In den Wohnbereich hinein wirken die gesellschaftspolitischen Bedingungen und Einstellungen, die hier nicht verhandelt werden, aber doch entscheidend auf das Wohlbefinden von Menschen Einfluß nehmen, z. B, welche Wohnformen akzeptiert, gefördert oder eben auch erschwert werden.
Zu dem äußeren Rahmen gehört neben der räumlichen Ausstattung der Standort der Wohngemeinschaft. Welche Kriterien den Standort relevant sind, wird im folgen- den Kapitel verhandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 3.1 Lebensweltorientierung - kurze Distanzen zu den bisherigen Bezugssystemen
- 3.2 Infrastruktur
- 3.3 Kulturelle und soziale Ortsidentität
- 3.4 Akzeptanz in der Nachbarschaft
- 3.5 Gemeinwesen
- 3.6 Exkurs: Möglichkeiten und Grenzen der Verantwortungsübernahme
- 3.7 Flexibel im Standort und in der Ausstattung
Die Auswahl der Wohnung bzw. des Hauses und somit auch die Frage des Standorts ist zunächst eine Frage des Wohnungsmarktes. in der Regel bieten die in Frage kommenden Objekte immer gewisse Nachteile, die in Kauf genommen werden müssen und im voraus nicht in den Planungsprozeß aufgenommen werden können. Es ist trotzdem ratsam, klare Vorstellungen über die Mindeststandards in einer Planungsgruppe, die mit Vertreterinnen der Träger, Eltern und voraussichtlichen Bewohnerinnen besetzt sein sollte, festzulegen. Aufgrund dieser Schwierigkeiten sind deshalb gemeinsame Besichtigungstermine notwendig, an denen vor Ort die Tauglichkeit eines Objektes aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen werden kann. Bei der Suche nach einem geeigneten Haus bzw. einer geräumigen Wohnung sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
Lebensweltorientierung einer LlW meint hinsichtlich des Standortes, daß die bisherigen Lebensbezüge und Beziehungen aufrechterhalten bleiben können. Gerade Menschen mit Assistenzbedarf, die in einem weitaus größeren Maß von anderen Personen abhängig und mit dem Einzug in die Wohngemeinschaft immer noch in der Mehrzahl auf die bisherigen Beziehungen angewiesen sind, hat die räumliche Nähe einen hohen Stellenwert.
So sehen die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die Nähe zum Elternhaus und ihrem bisherigen Lebensumfeld positiv. Ohne diese räumliche Nähe wären die meisten von ihnen nicht in die Wohngemeinschaft eingezogen, weil sie die Möglichkeit, die bisherigen Beziehungen aufrechtzuerhalten, eine Sicherheit da bietet, die völlig neue Situation positiv zu erleben. Jedoch ist eine gewisse räumliche Distanz zum Elternhaus einzelne Bewohnerinnen auch eine Hilfe, nicht in Entscheidungsschwierigkeiten zu kommen. Der Reiz des Gewohnten und die gegenseitigen Erwartungen könnten beim Wohnen in unmittelbarer Nähe der Eltern ständige Besuche zur Folge haben und somit die Distanz zu einer notwendigen Ablösung erschweren. Räumliche Distanz erleichtert den täglichen Weg in die Wohngemeinschaft. Die kurzen Distanzen - Wohnen in der gleichen Stadt, aber in verschiedenen Stadtteilen - ermöglichen auch kurzfristige Treffen z. B. nach der Arbeit im Cafe, Kurzbesuche am Wochenende oder auch eine schnelle Unterstützung in schwierigen Situationen.
I: Und wie ist es euch, daß eure Eltern so nah wohnen? Ist dies euch wichtig?
C: Ich nicht.
I: Deine Eltern wohnen relativ weit weg.
C: Meine Tante.
I: Deine Tante wohnt in der Nähe?
C: Ja.
B: Da war mal eine Frage von meiner Mama aus, das weiß ich schon so. Wenn man so dicht wie möglich wohnt, in der WG in ... (Städtenamen), direkt neben meiner Multi, das find ich nicht okay.
I: Findest du nicht okay.
B: Nein! (sehr bestimmt)
I: Warum?
B: Weil das ist so, dann geh ich öfters zu meiner Mutti als in die WG, wegen dem bin ich weiter weggegangen.
I: Das heißt. dich ist es ganz gut, daß die Entfernung nicht ganz nah ist? Wie ist es euch David und Andrea, eure Eltern wohnen relativ nahe?
D: Haja mich ist es gut, da sind es nur fiinf Minuten, dann sind die hier.
B: Bei Andrea ist es so, kann auch mal sein, wenn da was passiert, der Kurt (Mitarbeiter) ist manchmal nicht so schnell, manchmal auch schnell, manchmal sind auch andere da, aber wenn irgendwas ist wegen den Medis (Medikamenten), kann man schnell rüberfahren. Das find ich sie gut.
D: Andrea hat eine Apothekekiste. (BewohnerInnen mit Assistenzbedarf: 9)
Aus Sicht der Mütter ist die Aufrechterhaltung und Mitgestaltung der Beziehungen auch nach dem Auszug ihrer Töchter/Söhne von besonderer Bedeutung (vgl. Jerg 1998 :19). Ihre bisherigen Erfahrungen waren geprägt von gesellschaftlichen Bedin- gungen, die ihren Söhnen/Töchtern einen Weg zu einem eigenständigen Leben im normalen Lebensumfeld nicht ermöglicht haben. Der bisher dominierende und angst- besetzte Gedanke, die Töchter/Söhne in eine stationäre Einrichtung abzugeben, gegebenenfalls an einem anderen Ort, ist mit dem Einzug in die wohnortsnahe LIW zu- nächst vom Tisch. In manchen stationären Einrichtungen besteht z. B. in den ersten Wochen Besuchsverbot. Solche Vorschriften und Eingewöhnungspraktiken entbehren aus Sicht der Eltern jeglicher Normalität eines Wohnortwechsels. Die Unterbringung in eine Einrichtung bietet in der Regel keinen normalen Übergang, sondern vollzieht sich in der Vorstellung der Mütter in einem Bruch zu ihrer bisherigen Lebensbegleitung und entzieht sich eigenen Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die wohn- ortsnahe LIW ermöglicht weiterhin die Begleitung der Söhne/Töchter in die Selbständigkeit (vgl. ebd.: 27).
Letztendlich sind die Mütter damit auch Gedanken und Gefühle verbunden, daß z. B. mit dem Eintritt in eine stationäre Einrichtung der Traum eines normalen Lebens der „Kinder“ begraben werden müßte. Mit dem bevorstehenden Weg der Aussonderung, den die Eltern aus ihrer Sicht aktiv mitverantworten müssen, würden sie selbst in ihrer Haltung wieder einmal mehr gebrochen. Der Kampf gegen die gesellschaftliche Abwertung ihrer „Kinder“ wäre verloren oder mit anderen Worten: von einer gesellschaftlichen Anerkennung eine gleichwertige Stellung der eigenen Söhne/ Töchter müßte Abschied genommen werden. In der LlW sehen sie, wie ihre Töchter/Söhne im Alltag in das gesellschaftliche Leben eingebunden sind und an ihm teil- nehmen können (vgl. Jerg 1998 :23f).
Eine lebensweltorientierte Ausrichtung setzt voraus, daß bei der Aufnahme in die Wohngemeinschaft die Wohnortsnähe berücksichtigt wird. Dieses Prinzip läßt sich nicht bzw. sollte nicht durchgängig aufrechterhalten werden, weil zum einen Interessentlnnen aus Einrichtungen anfragen, die keinen Ortsbezug haben und zum anderen auch dem Personenkreis, der einen Ortswechsel vollziehen möchte, die Möglichkeit der Aufnahme nicht verschlossen werden soll.
Viele Menschen leben heute in sozialräumlichen Strukturen, in sogenannten „Schlafstätten“, die keine alltäglichen Begegnungen in gemeinschaftlichen Bezügen zulassen bzw. kaum eine Infrastruktur aufweisen. Ein überschaubares Wohnumfeld mit einer entsprechenden Infrastruktur und mit Gelegenheiten zu Kontakten lm Gemeinwesen bietet einen positiven Rahmen Inklusionsprozesse. Dies ist wichtig, weil die täglichen Anforderungen es meist nicht ermöglichen. sich nach getaner Arbeit und über die WG hinaus noch mit großem Aufwand zu engagieren. Müssen Angebote außerhalb des Wohnviertels in Anspruch genommen werden, ist die räumliche Distanz auch immer ein zusätzliches Hindernis.
Im Alltag der Wohngemeinschaft zeigt sich, daß eine Beteiligung und ein hohes Maß an einer selbständigen Lebensführung alle Bewohnerinnen durch gute infrastrukturelle Bedingungen im Stadtteil erreicht werden. Dazu gehören v.a.: Anbindung an den öffentlichen Busverkehr, Lebensmittelgeschäfte wie Bäcker, Metzger, kleiner Supermarkt, Banken, Ärzte und Fachärzte.
Eine städtische Umgebung bietet den Vorteil der Mobilität und der Vielfalt an Lebensstilen; auf dem Land besteht die Möglichkeit der Nähe zur Natur und zu Tieren. Beide Elemente werden zwar in den Gesprächen angesprochen, sind aber an einem Ort in der Regel nicht zu vereinbaren. Die folgenden Dimensionen könnten deshalb die nähere Auswahl relevant sein.
Bei der Auswahl des Wohnvierteis sind Überlegungen anzustellen, die sich mit dem sozialen Status der Bewohnerinnen und dem des sozialen Umfelds auseinandersetzen, in einer vergleichenden Untersuchung (vgl. Heiner/Meiners 1994) von unterschiedlichen Wohngebieten mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommen die Autorinnen zu dem Ergebnis, daß sich die Bewohnerinnen der Wohngemeinschaften ein ausschlaggebender Faktor das Wohlbefinden im Stadtteil über das Zugehörigkeitsgefühl bezüglich Status und Lebensstil herstellt.[13] Die Bewohnerinnen der Wohngemeinschaften möchten sich im Stadtteil und in der Nachbarschaft nicht deplatziert fühlen, sondern den Stadtteil erleben als eine Umgebung, in der Menschen wie sie leben. Daraus folgt, daß neben der „funktionalen Integration“ (Versorgungseinrichtungen des Stadtteils) auch die „soziale Integration“ bzw. soziale Identität berücksichtigt werden sollte (Vgl. ebd.).
Obwohl die LIW durch ihre Vielfalt in der Bewohnerinnenstruktur und durch den häufigen Besuch von Freunden und Bekannten selbst einen Ort zur Begegnung darstellt, sind die kleinen regelmäßigen Begegnungen im Stadtteil, wie z. B. die freundliche Begrüßung auf der Straße, das kurze Gespräch im Laden, der Plausch beim Milch holen auf dem naheliegenden Bauernhof etc. das Wohlbefinden und das Gefühl der Zugehörigkeit bedeutsam.
Die unmittelbare Nachbarschaft spielt das alltägliche Leben der Wohngemeinschaft eine tragende Rolle. Die Wohngemeinschaft Jurastraße ist „unbenachbart“, d. h. es gibt keine unmittelbar angrenzenden Nachbarn. Dies hat auf der einen Seite Vorteile, weil keine soziale Kontrolle stattfindet und die Bewegungsfreiheit keine zusätzlichen Konfliktpotentiale aufkommen läßt. Auf der anderen Seite fehlen aber gleichzeitig alltägliche Begegnungsmöglichkeiten und Beziehungen, die im alltäglichen Geschehen das vorhandene Inselleben an den Rändern ausfransen könnten.
K: „Auch die Nachbarschaft, die wurde ich mir einfach - wenn ich einfach utopisch bleiben darf-, würde ich mir so ür die WG wünschen, in einer menschlicheren Umgebung zu wohnen. Das heißt einfach, daß mehr Nachbarn da wären, mit denen man gut auskommen könnte und die dann einfach auch so, sagen wir mal dieses Insel-Dasein, das dach die Jurasiraße hat, ein bißchen aufheben würden. Wir sind da draußen brutal isoliert, ganz arg also da täte ich mir eher so wünschen, daß so eine Art Nachbarschaftshilfe auch da wäre. Zum Beispiel grade in letzter Zeit ist es öfters vorgekommen, daß irgendwas dazwischengekommen ist und daß man um halb fünf Uhr nicht da sein kann und Gott sei Dank ist grade der Felix wieder zurück und viel daheim. Dann ist der geschwind noch einen Dienst übernehmen gegangen oder so ein bißchen, bis du dann selber kommst, Und wenn dann so was da wäre, eine tolle Nachbarschaft, daß man die Nachbarin anrufen könnte, die Hausfrau ist, etc. und sagen, könnte die Andrea nicht geschwind eine halbe Stunde zu Ihnen rüberkommen, wir kommen gleich, weißt du, daß da auch wirklich eine aktive Nachbarschaft gepflegt oder gelebt werden könnte, da ist die Jurastraße, finde ich, total isoliert, ringsherum. Die Pferdekoppel ist ja okay, dann diese zwei Fabriken, diese Strickfabriken Das Häusle steht irgendwie schon nett, aber trotz- dem nicht so, daß ich sagen könnte, es täte mir gefallen ringsherum, Es ist kein Kindergeschrei da oder daß Nachbarskinder rüberkommen würden und mit der Andrea im Sandkasten spie- len, lauter so Zeug hätte ich gerne, also einfach, daß es natürlicher wäre, Wir sind auf einer wahnsinnigen Insel dort. “ (Mitarbeiter :4-5)
Bei dem Gespräch mit den Mitarbeitern wird der Aspekt des insel-Daseins angesprochen, der in der ersten Erhebung als zentrales Thema im Raum stand. Eine Insel bietet einerseits ein Wohlbefinden in den eigenen Räumen, weil niemand aus der Nachbarschaft Einfluß auf das konkrete Leben nimmt, andererseits ergeben sich durch die isolierte Situation wenig Anknüpfungspunkte mit anderen im Alltag, ganz zu schweigen von eventuellen Entlastungen oder Hilfestellungen in sogenannten Notsituationen, die man sich wünschen würde. Die Ambivalenz zur Nachbarschaft bringen die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf am stärksten zum Ausdruck.
F: Nett wäre, was ich mir manchmal denke, das gibts hier nicht jetzt, aber es könnte auch blöd sein natürlich, man könnte auch blöde Nachbarn haben. Ich würde mir manchmal wünschen, daß man ein bißchen drum herum noch Nachbarn hat. Der da drüben, der ist recht nett, aber halt eher so ein Schwabe, Dem gehen wir inzwischen aus dem Weg, der laßt einen nicht mehr weg, wenn du mal anfängst…
G: Da drüben links, da ist doch auch eine WG. Kennst du da die Leute?
F: Kenne ich nicht, nein, sieht nach WG aus, ja,
I: Bekommt man keinen Kontakt, wenn man hier wohnt?
F: Das ist ein bißchen so abgeschnitten schon.
H: Da die Firma und hier vorne und die Garage da drüben.
F: Das wäre vielleicht sogar besser, denke ich manchmal, wenn man das hätte. Weißt du, wegen Integration oder so, das ist ja hier, das stand in der einen Zeitung, dieser Artikel, das Haus ist eine Insel, ich denke, wir sind schon eine Insel hier (Bewohnerlnnen o.A. :14)
Den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf fehlt ein engerer nachbarschaftlicher Kontakt. Zwanglose nachbarschaftliche Kurzgespräche ~ so die Aussage in Bewohnerlnnengesprächsgruppen - ergeben sich manchmal durch den Garten oder durch den Sitzplatz vor dem Haus. Besonders Kinder würden sich die Bewohne- rinnen mit Assistenzbedarf in ihrer Umgebung wünschen:
I: Gibt es sonst noch was, was ihr euch wünschen würdet?
B: Au ja. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, hier in der Nähe einen Kindergarten, damit wir ein paar Kinder um mich herum hätten. Denn die Andrea spielt so gerne mit Kindern, ich ab und zu auch.
I: Ihr hättet in der Nachbarschaft gerne Kinder? Fehlt das euch hier?
Alle: Ja.
B: Wir haben so wenig Kontakt mit den Nachbarn hier.
I: Gibt es hier so wenig Nachbarn? Habt ihr Kontakt zu welchen?
E. Ja, ich weiß nicht, manchmal ja, weil in der Nähe vom Bauern da oben, sind ein paar Kinder. (BewohnerInnen m.A.: 4)
Aus der Perspektive der Mütter, die den Blick und das Bild der älteren Generation einnehmen, werden die möglichen Konfliktpotentiale in der Nachbarschaft thematisiert. In einer längeren Diskussion geht es um das äußere Erscheinungsbild, das durch abgemeldete Autos vor dem Haus und sonstige wohngemeinschaftstypische Außenraumnutzung Anlaß zu Streitigkeiten in der Nachbarschaft geben könnte:
S: Und dann ja nicht nur ein Idyll, Kleinbürgeridyll, wo alles so schön ist, das habe ich mir jetzt auch ganz klargemacht in bezug auf die neue WG, die entstehen soll, wo das vielleicht mit einer Familie zusammen ist, die vielleicht bestimmte Vorstellungen mit Garten und wie alles so schön sein soll und so, und das halte ich nicht gut. Inzwischen finde ich sehr gut, daß der Oskar seine alten Autos da stehen hat, das habe ich mir alles erst im Nachhinein überlegt. Das sind alles Gesprächsanlasse, Aufregungen. Da kann man vorbeilaufen und sagen: meine Güte, wie sieht's denn da schon wieder aus, die müßten doch eigentlich ihr Zeug wegmachen. Und wenn jemand nur die Vorstellung hat, alles in Ordnung, alles grad, alles richtig dann ist es eine Katastrophe, weil die Leute mit Behinderung, die brauchen Gespräche, Gesprächsanläße, auch was die Nichtbehinderten quasi, wo die mit ihnen reden können, und das gibt manchmal weniger; mehr oder weniger und da muss es überall sollen Sachen sein, wo man drüber reden kann. Ich finde auch, daß es weg muß, aber es darf ja kein Kleinbürgermilieu sein, wo das überhaupt nicht, wo so was nicht möglich ist, Ich finde, das ist unheimlich lebendig, daß es das gibt, das ist wichtig. (Mütter 12)
Die Mütter sind sich einig, daß der Vorplatz nicht zu einem Aufbewahrungsplatz alte Autos verkommen soll und besser als Sitzplatz genutzt werden kann. Darüber sich innerhalb der WG zu verständigen, wird als lebendiger Prozeß bewertet. Dies ist aber nur unbelastet möglich, wenn dadurch nicht die nachbarschaftliche Verträglichkeit tangiert wird. Deshalb sollte sorgfältig überprüft werden: Welche Akzeptanz erhält eine Wohngemeinschaft im Wohnviertel? Gibt es Widerstände aus der Nachbarschaft gegen den Einzug einer Wohngemeinschaft? Der Wunsch nach nachbarschaftlicher Nähe - so wie ihn die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und die Mitarbeiter formulieren, die mit Lebendigkeit und Akzeptanz gepaart ist und somit auch die Form einer Distanz und eines Respekts wahrt, scheint als ideale Bedingung. Der Blick auf die größere Raumeinheit, auf den Stadtteil und das Gemeinwesen zeigt noch einmal an anderen Gesichtspunkten, wie sich die Spannbreite zwischen innen- und Außenleben darstellt.
Ziel einer LIW ist es, die Möglichkeiten und Funktionen des Gemeinwesens zu nutzen (vgl. v. Lüpke 1994 2104). Das heißt, die Ressourcen, die im Stadtteil verfügbar sind, sollen mit einbezogen werden. In der Regel wird aus dem professionellen Blickwinkel neben dem Dienstleistungssektor an Vereine, Initiativen, kirchliche Organisationen usw. gedacht- an eine lebendige Gemeinschaft, die über die faktisch räumliche Zuordnung mit ihren „kleinen“ täglichen Begegnungen die Eingebundenheit in gemeinschaftliche Bezüge im Stadtteil herstellen kann. Solche Ankerpunkte im Stadtteil können aus dem professionellen Verständnis neue Chancen der Teil- habe bieten und die Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Assistenz- bedarf normalisieren. Die Teilnahme an gemeinschaftstiftenden Angeboten kann dazu führen, daß die Akzeptanz und Toleranz innerhalb der Gemein- de/Gesellschaft gefördert und somit auch die immer noch vorhandenen Verwahrungsphantasien abgebaut werden.
Ein zentrales Anliegen der LIW ist die „De-institutionalisierung“ des Wohnens Menschen mit Assistenzbedarf. Dazu sind z. B, die Ideen des in den USA erprobten Konzepts „community care“[14], das eine konsequente Umsetzung des Assistenzgedankens verfolgt und dabei die primären Netzwerke so weit wie möglich einbezieht und stärkt, zukunftsweisend. Aus den bisherigen Erfahrungen der Jurastraße ist davor zu warnen, allzu hohe Erwartungen in die Integration und in die Aktivierung von Ressourcen im Stadtteil zu setzen. Die Gründe sind vielfältig:
Aus der Perspektive der Bewohnerinnen erhält das Gemeinwesen eine andere Bedeutung. Aufgesucht werden vor allem Orte außerhalb des Stadtteils: integratives Cafe und alternative Szene, in denen „Gleichgesinnte“ anzutreffen sind. Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf orientieren sich in bezug auf neue Orte an den Mitbewohnerlnnen und pflegen den Besuch der ihnen schon vor Einzug in die Wohngemeinschaft bekannten integrativ-ausgerichteten Treffpunkte. Verstärkt wird dieser Trend noch durch die starke Binnenorientierung der Wohngemeinschaft. Wie an anderer Stelle schon erwähnt, kommt viel Besuch - überwiegend Freunde/Freundinnen von Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf - in die Wohngemeinschaft, so daß die äußeren Bezüge in den Hintergrund treten.
Die kleinen sozialen Netzwerke im Stadtteil dürfen deshalb nicht überbewertet werden, da sie die jetzige Lebensphase der Bewohnerinnen nicht so maßgeblich sind wie in den jungen und späteren Lebensphasen. Die historische Entwicklung zeigt weiterhin, daß die nachbarschaftlichen Bezüge aufgrund der geforderten Mobilität und Flexibilität immer stärker die Tendenz haben und die Gefahr in sich bergen, sich aufzulösen.
Hamm geht noch einen Schritt weiter und hinterfragt die funktionale Überhöhung bzw. die Allzuständigkeit der Nachbarschaft und des Gemeinwesens: „Gewiß sind nachbarschaftliche Beziehungen eine Basis die Ausbildung von lokaler Identität, symbolischer Ortsbezogenheit und Heimat. Ob sie allerdings - in diesem generellen Sinn - eine tragfähige Grundlage die Organisation sozialer Dienste oder die politische Aktivierung abgeben können, muß bezweifelt werden.“ (Hamm zitiert in Lindmeier 1998 :147)
Ein grundlegender Unterschied der LIW zu anderen Wohngemeinschaften besteht darin, daß die Wohnperspektiven die Bewohnerinnen mit und ohne Assistenz- bedarf tendenziell auseinanderfallen. Während die meisten Bewohnerinnen oh- ne Assistenzbedarf das Wohnen in der LIW zeitlich begrenzt ist, könnte die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die LIW - auch aufgrund von fehlenden Wahlmöglichkeiten ~ mit einer längerfristigen Perspektive verbunden sein und zu einem Ort des Lebens werden. Vor diesem Hintergrund könnte eine gemeindenahe Vernetzung längerfristig auch dauerhafte Beziehungen vor Ort Menschen mit Assistenzbedarf schaffen, die die Sicherheit von kontinuierlichen Beziehungen sorgen würden.
Die Mütter bewerten die Bedürfnisse zwischen den Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf unterschiedlich. ihre Söhne/Töchter könnten Angebote aus dem Gemeinwesen interessant sein und ein Zeichen der Zugehörigkeit vermitteln:
S: Also wenn wir immer noch bei der Traum-WG bleiben Von den Mitbewohnern ist es ja unterschiedlich, ich glaube, daß die nichtbehinderten Mitbewohner nicht so viel Interesse an Nachbarschaft haben vielleicht wie unsere, die auch ein Schwätzle wollen und die das auch gut wäre. Und deshalb fände ich auch, zum Beispiel daß das mit der Kirchengemeinde oder was auch immer da wäre, daß da Kontakte wären, daß die zum Beispiel auch bestimmte - vielleicht an einem Fest, gut, in der Traum- WG wäre, daß die dann anrufen würden und sagen, wer hat Lust, da mitzugehen, daß so feste Kontakte wären
P: Und daß man dann solche Aktivitäten gemeinsam macht, und es wäre sehr schön, wenn sie von der Nachbarschaft eingeladen werden würden und sagen würden, komm/ doch, das wäre wunderbar...
S: Es muß ja nicht jeder hingehen, sondern nur daß der Anruf käme irgendwie…
P: Schon eine Einladung, auch wenn sie nachher nicht wahrgenommen wird, aber aha, die haben an uns gedacht.
S: Und vielleicht dann auch so, es braucht ja dann auch eine Weile, bis das dann so aufgebaut ist, daß einfach das wirklich, daß die einbezogen wären in ihre Vorstellungswelt, und ich glaube nicht, daß die nichtbehinderten Mitbewohner - das war ursprünglich auch ein Gedanke, den ich gedacht habe -, die machen da alles gemeinsam, und das glaube ich, das geht gar nicht, weil die Interessen da wirklich auseinanderklaffen, Es könnte schon sein, daß einer dann mal sagt, ach gut, da gehe ich auch mal mit, aber das ist, glaube ich, eher etwas Besonderes. Aber daß unsere Leute da gefragt würden, das wäre schon schön
P: Ja gut, da muß man sie jetzt halt mal hinbringen und sehen, ob's ihnen Spaß macht S: Fragen nützt da ja gar nichts, hinbringen - das ist ja immer das, daß man erstmal, ein Mal muß man auf jeden F all.
P: Einmal als Pflichtübung.
S: Und jetzt gehst du einfach mal mit, weil du mußt ja sehen, wo du eine Entscheidung treffen möchtest. (Mütter :4-5)
Die Vernetzung in den Stadtteil ist konzeptionell eine originäre Aufgabe des hauptamtlichen Mitarbeiters. Zwei wesentliche Aspekte wirken sich hemmend auf die Einlösung dieser Aufgabenstellung aus. Zunächst bedarf es zeitlicher Ressourcen, um Kontakte im Stadtteil zu knüpfen und mögliche Kooperationspartnerlnnen bzw. Angebote zu akquirieren. In der bisherigen Alltagsstruktur lassen sich da wenig Kapazitäten freischaufeln.
Unabhängig von den zeitlichen Ressourcen sind die Interessen der Bewohnerinnen anders gelagert - offen ausgesprochen, vor allem durch die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf. Die Angebote im Stadtgebiet haben sie überhaupt keinen Anreiz („Tote Hose“, „Nichts los“ - ihre Kommentare zum Stadtteil), und die Kooperation mit anderen Anbietern im Stadtteil widerspricht ihrem Bedürfnis, nicht als öffentliche Anstalt, sondern als Privatpersonen in der WG zu leben.
In den vergangenen vier Jahren hat sich gezeigt, daß es vor allem an Ressourcen fehlt, über den Wohngemeinschaftsalltag hinaus die Teilhabe im Stadtteil und die Einbindung in das Gemeinwesen von professioneller Seite zu entwickeln. Dieser Anspruch ist aber - wie es bisher angeklungen ist - nicht nur eine Frage der Ressourcen bzw. deren Verteilung. in den Gesprächen mit den Bewohnerinnen kommt immer wieder klar zum Ausdruck, daß die private Atmosphäre der Wohngemeinschaft geschützt werden muß und die öffentlichen Kontakte bzw. die Veröffentlichung des Wohnens auf ein Mindestmaß reduziert bleiben soll.
Virulente Fragen, die das gemeinsame Zusammenleben stellt, sind: wieviel Verantwortung den anderen kann ich im Alltag tragen bzw. übernehmen, und auf wieviel Personen/Situationen kann ich mich einlassen?
In der Wohngemeinschaft war zu beobachten, daß das Anliegen der Gemeinwesenorientierung von außen an die Wohngemeinschaftsmitglieder herangetragen wurde. Von seiten der Bewohnerinnen kam nie der Impuls, in dieser Form Beziehungen aufbauen zu wollen. Dabei ging es den Bewohnerinnen nicht um eine generelle Ablehnung einer Gemeinwesenorientierung. Vielmehr stehen Fragen im Raum, die Grenzen aufzeigen in bezug auf das Einlassen-können auf zusätzliches Neues und Fremdes.
Vor dem Hintergrund des Diskurses von Z, Bauman über das Unbehagen in der Postmoderne, das sich mit Fragen der Verantwortung auseinandersetzt, wird m. E. deutlich, daß z. B. die Gedanken von Levinas, die Bauman innerhalb des Diskurses um Moral und Ethik anführt, hier wichtige Einsichten liefern können. Levinas Ausgangsthese, daß Verantwortung bzw. Moral im „Antlitz“ des anderen entsteht oder, wie Buber sagen würde, in der Ich-Du-Beziehung eingelöst werden kann, kann in der WG bestätigt werden. Bauman schreibt:
„In der moralischen Partei der Zwei treffen Ich und der Andere ohne unsere gesellschaftliche Verkleidung aufeinander - entblößt von Status, sozialen Unterschieden, Handikaps, Positionen oder Rollen; hier sind wir weder reich noch arm, vornehm oder gering, mächtig oder machtlos, sondern auf das Wesentliche unseres bloßen gemeinsamen Menschseins reduziert, ” (Bauman 1999 185)
Auch wenn in vielen Alltagssituationen der soziale Status bzw. die Positionen der Bewohnerinnen zum Tragen kommen, gibt es immer wieder Begegnungen, die im Sinne dieser „moralischen Partei der Zwei“ zu begreifen sind. Das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft - das sich aber permanent über die Zweierbeziehung hinaus mit Interessen von Dritten konfrontiert sieht - hat deshalb in bezug auf die Verantwortungsübernahme seine Grenzen. Das tägliche Zusammensein mit der ständigen Herausforderung, auf das Anderssein bzw. das Ähnlichsein jedes einzelnen einzugehen, kostet viel Kraft alle Beteiligten. Die Bewohnerinnen er- leben deshalb die Wohngemeinschaft als Insel, auf der sie sich bis an ihre Grenzen mit Verantwortungsübernahme konfrontiert sehen. Eine Insel auch deshalb, weil andere Menschen sich in dieser Weise überhaupt nicht oder nur punktuell auf diese Gestaltung der Beziehungen einlassen. Das betrifft die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf in gleicher Weise wie auch die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf. Schon allein der Versuch, jedem einzelnen in der Wohngemeinschaft gerecht zu werden, d. h. über die Beziehung zu dem einzelnen hinaus auch die Interessen der gesamten Bewohnerinnen zu berücksichtigen, die im Widerspruch zu den einzelnen Interessen stehen können, ist ein aufreibendes Unterfangen. Deshalb über- steigt eine zusätzliche Gemeinwesenarbeit, eine Auseinandersetzung mit zusätzlichen Fremden, die Kräfte der direkt Beteiligten.
Jedoch wäre eine Unterstützung aus dem Gemeinwesen die Bewohnerinnen hilfreich. Personen, die bereit sind, Bedürfnisse und Wünsche von Bewohnerinnen aufzugreifen und auch konkret die Verantwortung zu übernehmen, werden inzwischen gerne in den Freundeskreis aufgenommen. Ein Beispiel sind Beziehungen von außen, die z, B. durch studienbegleitende Praktika entstehen und die dem Bedürfnis z. B. eines Bewohners, Fußball zu spielen oder gemeinsame Besuche von Fußballspielen entsprechen oder dieser Person den Zugang zu einer bestehenden Fußballgruppe ermöglichen. Was damit aufgezeigt werden soll, ist, daß die Vernetzung, die Gemeinwesenarbeit oder wie immer man diese Form der Verankerung und Erweiterung des Beziehungsgeflechts benennen mag, nicht von außen aufgesetzt und auch nicht einfach von innen heraus zu gestalten ist. Die Kunst scheint darin zu liegen, Personen oder Gruppen zu finden, die die Bedürfnisse und Interessen, die nicht innerhalb der Wohngemeinschaft abzudecken sind, aufgreifen, ohne die Ressourcen der Mitbewohnerlnnen in Anspruch zu nehmen oder Anteil am Wohngemeinschaftsleben einzufordern.
Erfolgreich sind bisher in der Mehrzahl Versuche gewesen, bei denen Personen über Praktika eine eigenständige Beziehung zu einzelnen Bewohnerinnen aufbau- en konnten und eigenverantwortlich selbstbestimmte Aktivitäten der BewohnnerInnen begleiteten.
Mit der Zeit hat sich darüber ein Freundeskreis[15] gebildet, der zwar langsam aber stetig wächst und gleichzeitig die Privatheit der Wohngemeinschaft aufrechterhält. Diese Personen kommen als Privatpersonen zu Besuch, unterstützen die WG, in- dem sie auch einmal einen „Abenddienst“ übernehmen. Sie verkörpern in keiner Weise einen institutionellen Charakter. Darin scheint eine ganz wesentliche Zugangsvoraussetzung zu liegen.
Diese ernüchternden Darstellungen über den Gemeinwesenbezug dürfen nicht als Norm, als festgeschrieben bewertet werden. Auch in der Jurastraße besteht die Einschätzung, daß hier noch viele Wege offen sind und neue Schritte ins Gemein- wesen eine Bereicherung bringen könnten. Die Reflexion der bisherigen Erfahrungen auf der Trägerebene legen weitere Wohngemeinschaften nahe, schon in der Planungsphase die Netzwerke im Gemeinwesen stärker miteinzubeziehen. die Wohngemeinschaftsmitglieder könnte somit der Pool Vernetzungsstrukturen erweitert und - wenn es sich ergibt- auch der Kreis von Freundschaftsbeziehungen ergänzt werden.
Zum Abschluß von Teil A ist noch eine grundsätzliche Überlegung in bezug auf die Anmietung oder den Kauf eines Wohnobjektes vorzustellen. Soweit die gegenwärtigen Entwicklungen abzusehen sind, wird in Zukunft die Bereitstellung von flexiblen Wohnmöglichkeiten ein wichtiges Fundament ein bedürfnisgerechtes Wohnen darstellen. Aus diesem Grund ist es eine Initiative oder Institution wichtig, genau abzuwägen, ob mit einem Kauf oder einer Anmietung die gewünschte Flexibilität gewährleistet werden kann. ln der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, daß vorhandene Immobilien von Institutionen den Bedarf der Angebote festlegen bzw. die Angebotsüberlegungen mitprägen. Gerade beim Wohnen verändern sich die Bedürfnisse der Bewohnerinnen über Jahre, so daß die Anmietung einer Wohnung leichter wieder aufgelöst werden kann.
Ein anderer Weg ist der Neubau von Wohnungen, die als barrierenfreie Einzelwohnungen konzipiert und über einen Gemeinschaftsraum verbunden sind und so auch als Wohngemeinschaft genutzt werden können.
Sie können bei fehlendem Bedarf ohne weiteres wieder an den freien Markt verkauft werden. Ein grundsätzlich flexibles System ergibt sich durch die politische Einmischung auf dem Wohnungsbaumarkt. ln einigen Städten gibt es schon Wohnungsbaugesellschaften, die bei größeren Bauprojekten oder in Neubaugebieten barrierenfreie Wohnungen planen und umsetzen. Somit entstehen in unterschiedlichen Stadtgebieten Wohnungen Menschen mit Assistenzbedarf. Ein möglicher Weg besteht in der Forderung, daß Wohnraum lebensweltorientiertes, inklusives Wohnen in der Gemeinde bereitgestellt wird. Eltern beschäftigen sich oft mit dem Gedanken, gemeinsam mit anderen Eltern ihren Söhnen und Töchtern eine Wohnung zu kaufen, damit diese in Sicherheit in eigenen Räumen leben können. im Kontext einer LIW wäre hierbei transparent und sorgfältig abzuklären, wer die Eigentümerlnnen (Eltern oder Söhne/Töchter) sind und wie in der Wohngemeinschaft der unterschiedliche Status als Mieterin und Vermieterln nicht zu Rollenkonflikten und nachteiligen Auswirkungen fühlt. Diese Offenheit schon in bezug auf die Wohnung scheint mir deshalb angebracht, weil Menschen in ihrem Lebenslauf auch unterschiedliche Wohnformen suchen. Einige Bewohnerinnen haben auch die Vorstellung, vielleicht später alleine oder mit einer Partnerin bzw. einem Partner zusammen wohnen zu wollen.
[13] Der Stadtteil-Vergleich bezieht sich auf lebensweitorientierte Außenwohngruppen Menschen mit psychischen Lebensbewältigungsproblemen.
[14] (vgl. u.a. ausführliche Darstellung in Orientierung 1'2000, www.rauheshaus.de )
[15] Freundeskreis meint hier nicht einen institutionell von außen organisierten Sympathisantenkreis, sondern im Verständnis von Privatbeziehungen ein Umfeld, das von beiden Seiten ein gegenseitiges Interesse an der Aufrechterhaltung und Weitergestaltung der Beziehungen voraussetzt.
Inhaltsverzeichnis
lm folgenden Kapitel sollen entscheidende Kriterien und grundsätzliche Überlegungen zur Zusammensetzung der Bewohnerlnnengruppe beschrieben werden. in der Darstellung werden zunächst einzelne Aspekte - kulturelle Vielfalt und formale Kriterien - beschrieben, die jeweils sich betrachtet im Wohngemeinschaftsalltag Wirkungen hinterlassen und zusammen ein Bild über die konkrete Besetzung er- geben. im Anschluß daran wird eine ausführliche Debatte über den Personenkreis der Wohngemeinschaft geführt. Dabei geht es auch um die Einbeziehung und Offenheit gegenüber Personen, die eine umfassende Assistenz benötigen.
Eine heterogene Zusammensetzung der Wohngemeinschaft kann sich auf unter- schiedliche Aspekte beziehen.
Einigkeit besteht in den Gesprächsgruppen, daß eine Mischung von BewohnerInnen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf notwendig ist. Zum einen sind die Assistenzressourcen überhaupt nicht da ausgelegt, mehrere Bewohnerinnen mit hohem Assistenzbedarf abzudecken; zum anderen bietet die Vielfalt auch die Möglichkeit einer gegenseitigen Unterstützung und ganz neue Erfahrungshorizonte. Letzteres gilt auch die Bewohnerlnnengruppe ohne Assistenzbedarf. Die Vielfalt von Personen aus unterschiedlichen Lebenswelten, die in ganz verschiedenen beruflichen Bereichen tätig sind, wird sehr positiv bewertet. Diese positiven Erfahrungen in bezug auf die heterogene Zusammensetzung von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf decken sich auch mit den Erkenntnissen aus anderen Wohnprojekten (vgl. u.a. Lindmeier 199 :163).
A: Es ist halt einfach, es sind halt einfach ein Haufen Leute, egal, ob sie jetzt eine Behinderung haben oder nicht, und dann kommt ja auch Besuch, und dann kommen auch Angehörige, klar, weil sie auch so in unterschiedlichen Berufsfeldern drinstecken oder nicht drinstecken und im Werden sind und so, das finde ich schon heiß, das ist sehr ab- wechslungsreich. (Mitarbeiter 169)
Bei der Auswahl von Bewohnerinnen ist auf eine geschlechtsgemischte Konstellation sowohl unter den Personen mit als auch ohne Assistenzbedarf zu achten - davon ausgenommen sind Konzeptionen, die eine geschlechtshomogene Gruppenbildung verfolgen.
Die Gründe diesen Standard liegen vor allem in der anzustrebenden Wahlfreiheit Assistenzleistungen. in der Regel suchen die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ihre Assistenz nach Sympathie aus, so daß sich hier eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Zusammensetzungen hinsichtlich des Geschlechts ergibt. in der alltäglichen Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß sich gerade in bezug auf Körperpflege und geschlechtsspezifische Fragestellungen, Kleidereinkauf etc. eine gemischte Besetzung, die auch eine intime Gesprächsatmosphäre von Frau zu Frau bzw. von Mann zu Mann gewähren kann, sehr hilfreich ist. Darüber hinaus ist auch eine Entscheidungsfreiheit von Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf bzw. Mitarbeitern hinsichtlich einer Mitbestimmung bei der Assistenzleistung gewährleistet. An einer Grenzsituation soll aufgezeigt werden, was eine geschlechts- gemischte Gruppe an schwierigen Situationen verhindern kann:
K: Beim Baden früher war's noch anders, glaube ich, daß die Lisa und die Monika (beides Bewohnerinnen o.A.) mit rein durften, wenn sie in der Badewanne war, und dann die beiden Frauen haben dann ihr irgendwie halt erst die Haare gewaschen, wenn sie drin lag, in der Badewanne. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, hat sie mich einmal reingelockt, aber ich bin nicht einmal reingegangen. Da ist dann die Grenze angesagt. Ich meine, ich bin froh, daß ich's nie getan habe, grade bei der Clara, da stehe ich mit einem Haxen im Gefängnis oder sonstwo. Dann hab' ich gesagt, nein, das mache ich nicht, das muß eine Frau machen. (Mitarbeiter :40)
Eine ausführliche und weiterführende Diskussion zum Thema Assistenzwahl ist im Kapitel Selbstbestimmung zu finden.
Die Wohngemeinschaft ist konzipiert junge Menschen. Die Altersspanne liegt bei den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf zwischen 20 und 48 Jahren. Diese Differenz im Lebensalter und in der Lebensphase wird von seiten der Bewohnerinnen als Bereicherung empfunden, auch wenn sich die unterschiedlichen Lebenswelten im Alltag öfter konträr gegenüberstehen. Bedeutend die jüngeren MitbewohnerInnen ist, daß die „alten“ MítbewohnerInnen in ihrer Art jung geblieben sind. Von Vorteil ist aus ihrer Sicht auch, daß diese altersgemischte Zusammensetzung dem eigenen Lebensstil Gestaltungsfreiraum verschafft:
H: Bei uns in der WG ist's ja jetzt grade verschieden. Durch das, daß der Felix da ist und die Monika, die nicht mehr in die Disco gehen, können immer der Oskar; die Lisa oder die Eva (alles Bewohnerinnen o.A.) immer zum Hupfen gehen und verschlafen dann auch den Frühdienst, und alles das passiert dann sozusagen, aber durch das, daß dann diese beiden älteren Personen da sind. Ja, aber das hat mit dem nichts zu tun jetzt, sondern die übernehmen dann diesen Part. Das habe ich schon öfter gemerkt, daß die dann einspringen und sagen, okay, ieh übernehme jetzt deinen Nachtdienst, damit du in die Disco kannst. Wenn jetzt alle vier Discohüpfer wären, dann würde es ganz schön anders aussehen, dann täte es wieder Eifersüchteleien geben, und sie würden sagen, du hast gestern, du hast gestern, jetzt darf mal ich oder so. (Mitarbeiter :23)
Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sind alle um die dreißig Jahre alt. Die etwa ähnliche Altersstruktur ermöglicht einige gemeinsame Berührungspunkte. Über einen anderen Altersvergieich können aus den Gesprächen keine Aussagen gemacht werden.
Als Wunsch kam von den jetzigen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf, daß bei neuen Wohngemeinschaften darauf hingearbeitet werden sollte, daß auch noch jüngere Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf diese Wohnform gewonnen werden.
Im Gespräch mit Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf wurde die Vorstellung geäußert, daß sich in bezug auf das Alter jüngere Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf besser auf die Wohngemeinschaft einlassen können. Die späte Ablösung von zu Hause und die verbundenen prägenden Sozialisationserfahrungen werden als hemmend in bezug auf neue Erfahrungsdimensionen wahrgenommen.
U: Ich finde, die behinderten Leute sollten jünger sein, noch jünger; also unter 20 auf jeden Fall.
I: Und wieso, Ulli?
U: Und zwar, ich denke, dann sind die einfach auch noch ein bißchen lernfähiger oder auch anpassungsfähigen oder was heißt anpassungsfähigen doch, einfach schon lernfähiger oder offener auch noch, eher neue Sachen offen.
G: Stimmt schon, wenn sie zwanzig Jahre von der Mama verhätschelt wurden und alles auf den Tisch gestellt gekriegt haben, dann ist das schon eine Riesenumstellung die. Ich denke, das ist ganz einfach oft so, daß die dann so verhätschelt werden, es muß ja nicht immer sein, aber ich denke, daß das bei vielen so ist. (Bewohnerlnnen o.A. :6)
Bei der Auswahl von Bewohnerinnen wurden bisher nur Einzelpersonen aufgenommen. Paare standen von Bewerbungsseite auch nicht zur Diskussion. Innerhalb der Wohngemeinschaft haben sich schon Zweierbeziehungen entwickelt. Zur Zeit besteht eine Beziehung zwischen zwei Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf. die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf ist die Gestaltung einer Zweierbeziehung mit unterschiedlichen Wohnorten immer ein Grenzakt. Gleichzeitig genießen sie die gleichgestellten Beziehungen untereinander innerhalb der Wohngemeinschaft. Die Existenz einer Zweierbeziehung unter den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf (beide sind inzwischen ausgezogen) hatte wahrscheinlich deshalb keine grundlegende Veränderung in der Wohngemeinschaft hervorgerufen, weil beide sehr unabhängig voneinander die Beziehungen zu den anderen Mitbewohnerlnnen gestalten konnten. Die Zweier-Beziehung unter den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ermöglicht einerseits eine neue Erfahrung von Beziehungsgestaltung, andererseits gibt es immer wieder Phasen, in denen sie den Wohngemeinschaftsalltag durch vorhandene Konflikte überlagert. Auch hier zeigt sich, daß die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu den anderen Mitbewohnerlnnen, die vor allem durch die weibliche Person eingefordert wird, die Realisierung innerhalb der Wohngemeinschaft ermöglicht. Von seiten der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf besteht ein Wunsch nach einer Wohnform, in die die Partnerschaft eingebunden werden kann. Dabei ist den Frauen, die sich dazu geäußert haben bewußt, daß dieses gemeinsame Zusammenwohnen auch seine Schattenseiten hat und sie sich durch ihr Verantwortungsgefühl stark eingebunden fühlen.
C: Ein Mann.
I: Soll der hier wohnen?
B: Wie kommst du denn darauf?
C: Simon.
B: Simon soll hier wohnen, ojeh.
C: Mein Freund
I: Dein Freund, der soll hier wohnen, das hättest du gerne … wo wohnt der jetzt?
C: In der Wohngruppe.
I: Ist es schwierig, wenn der irgendwo anders wohnt?
C: Ja.
B: Ich find es auch schwierig. Der wohnt woanders und sie hier. Da muß sie jedesmal mit dem Bus da hochfahren.
I: Besuchst du ihn ab und zu auch?
B: Wenn es hier in der Nähe eine Wohngruppe geben würde, da könnte sie jedesmal hin.
I: Ist es weit weg?
C: Ja, in der Stadl beim Kino…
I: Würde es dir gefallen, wenn der Simon hier wohnen würde?
C: Ja.
B: Aber in der Nähe halt, nicht direkt hier, oder?
C: Ja.
I: In der Nähe, würde dir das reichen oder im Haus hier?
C: In der Nähe.
B: So wie ich mit meinem Freund David hier miteinander wohne, so ungenau könnte sie sich es auch vorstellen, aber nicht hier im Haus, aber in einer Wohngruppe hier in Betzingen.
I: Wie ist es dich, Birgit, hier mit deinem Freund in der WG zusammenwohnen?
B: Es geht eigentlich. Manchmal ja, manchmal nein.
I: Wann ist es schwierig?
B: Manchmal ist es schwierig, weil wir nicht aneinander gewöhnt sind. Er muß es lernen und ich auch.
A: Warum?
B: Ich fühl mich nirgends anders wohl als in der Jurastraße, und ich habe mich daran gewöhnt, meine Mutti auch, daß hier mein Wohnsitz ist.
I: Wann ist es schwierig?
B: Der Felix, der hier mit uns wohnt, daß er dem David als guter Freund helfen kann, bei der Wäsche und andere Sachen auch, Manchmal ist er dann so stur und will nicht. Aber dann sage ich: David, sonst muß ich mit dir nicht - und dann klappt das alles.
I: Fühlst du dich verantwortlich den David?
B: Ja, wenn ich nicht da wäre, dann würde der David ziemlich rumgucken. Der braucht jemand, das merke ich jetzt auch wieder. Wenn ich sage: David, so geht das nicht, dann klappt das auch. (Bewohnerinnen m.A. 13)
Der Versuch einer der Gesprächsbeteiligten, den Wunsch der anderen Mitbewohnerin nach dem Zusammenwohnen mit dem Freund auf die unmittelbare Nachbarschaft zu begrenzen, zeigt, wie schwierig und vielleicht bedrohlich Beziehungen innerhalb der Wohngemeinschaft werden können. Die Tatsache, daß Paarbeziehungen in Wohngemeinschaften entstehen, ist normal und eine erfreuliche Gegebenheit. Die Frage, ob Paare miteinbezogen werden sollten, muß sorgfältig geprüft werden. Die Erfahrungen in der Jurastraße zeigen, daß es möglich ist, aber auch schwierig sein kann. Entscheidend wird sein, wie unabhängig die Personen ihre Beziehungen zu den anderen gestalten können.
Bisher ohne Erfahrung ist der Einbezug von Müttern bzw. Vätern mit Kindern in der Wohngemeinschaft. Bei den Bewerberinnen im letzten Jahr war eine junge Mutter mit einem halbjährigen Kind in der näheren Auswahl. Jedoch konnte sich die Wohngemeinschaft nicht dazu entschließen, dieses „Wagnis“ einzugehen. Letztendlich lagen die Bedenken vor allem in den zu erwartenden Überschneidungen in den Assistenzzeiten und Betreuungszeiten des Kindes. Die Entscheidung war sehr schwierig, weil sich die Mehrheit der Bewohnerinnen, auch die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, das Zusammenleben mit einem Kind gut vorstellen konnten. Die- se Offenheit diesen Personenkreis wurde u. a. als Wunsch im Gespräch mit den Mitarbeitern geäußert:
H: Ich würde mir auch wünschen, daß auch in der nächsten WG sozusagen so eine Konzeption auch drin vorkommen könnte oder sollte, daß auch eine alleinerziehende Mutter oder ein Vater mit Kind auch einziehen darf Das bringt auch so einen familiären Charakter mit rein - natürlich muß man dann aufpassen, daß die Frau nicht zu viel schafft, nicht so viel zur Verantwortung herangezogen wird, weil wenn du ständig daheim bist, dann wird auch viel abgeladen. Aber das wäre einfach, finde ich, auch noch so ein Punkt, wo ich sagen möchte, ja, noch ein bißchen mehr Familiencharaktar, Kinder, Ich weiß, daß mein Kleiner brutal gerne mit in die WG immer kommt und da/J' auch die Clara, die Andrea und auch die anderen sich freuen darüber, die freuen sich echt. Die Andrea von sich aus erzählt mir immer wieder und sagt, wann kommt denn der Manuel mal wieder, der soll mal wieder kommen, mit ihm spielen und so. (Mitarbeiter 121)
Neben der Vorstellung, daß Kinder das Leben in der WG bereichern könnten, steht als ein weiterer Gesichtspunkt noch das häuslichere Leben, das mit Kindern ver- bunden wird. Diese Häuslichkeit, die auch von Teilen der Bewohnerinnen gewünscht wird, steht die Gegenwelt der „jungen Hüpfer“.
Eine Offenheit auch gegenüber dem Personenkreis ohne Assistenzbedarf - seien es Mütter/Väter mit Kindern, ausländische Mitbürgerinnen etc. ist nur folgerichtig und stärkt die Kultur der Vielfalt und den Prozeß der Gleichheit in der Verschiedenheit. Auf den Punkt gebracht werden diese vielfältige Heterogenität und ihre Auswirkungen von der Praktikantin im Mitarbeiterlnnengespräch:
Y: Gerade die Unterschiedlichkeit ist das Besondere, die unterschiedlichen Lebensstile, Lebensweise. Dann kam ich dazu als Praktikantin, auch aus einer ganz anderen Welt, und da liegt irgendwas Besonderes in der Luft, das ist irgendwie spannend. Und ich denke, grade auch da liegt auch die Chance die Leute mit Behinderung, weil da wirst du nicht in eine Schablone gedrückt, da bist du du, du kannst es auch sein. (Mitarbeiter :71)
Die Größe der Wohngemeinschaft läßt sich nicht auf ein ideal festlegen. In allen Gesprächen kam zum Ausdruck, daß auch andere Gruppengrößen eine gute Basis das Zusammenleben bieten könnten. Am deutlichsten äußerten sich die Bewohnerlnnen mit und ohne Assistenzbedarf. Sie finden ihre Wohngemeinschaft von der Gruppengröße her optimal.
I." Wenn man eine neue WG aufmacht, fragt man sich: wieviel Leute sollen dort wohnen? Ihr wohnt hier zu acht? Vier Personen, die auch Unterstützung brauchen?
B: (unterbricht) Aber nicht so viele.
I: Wie nicht so viele?
B: Daß immer noch mehr hereinkommen, das paßt mir gar nicht.
I: Findest du acht eine Grenze?
B: Ja.
C: Ja.
B: Acht ist okay.
D: Wenn noch mehr reinkommen, müssen wir den Schuppen umbauen.
I: Meinst du eine neue WG sind acht ausreichend?
D: Ja.
B: Ja, acht sind genügend. Hier häuft sich manchmal viel. (BewohnerInnen m.A.: 10)
Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf liegen die Argumente eine Begren- zung vor allem in einem überschaubaren Beziehungssystem. Durch den häufigen Besuch von Freunden und ein sich immer wieder Einstellen auf neue Personen (Praktikantlnnen, Zivildienstleistende etc.) ist ihr Bedarf an Beziehungen gedeckt, so daß acht Personen sie eine Grenze darstellen.
die anderen Gruppen ergeben sich die Grenzwerte auch bei etwa acht Personen, Die Gründe da werden hier aus dem Mitarbeitergespräch aufgezeigt:
J: so bis zu acht Leuten, so wie 's jetzt ist, kann ich mir das schon vorstellen, aber mehr; also da hätte ich kein gutes Gefühl dabei, weil es ist einfach schwierig dann alles unter einen Hut zu bringen. Aber so ist's ja kaum möglich, dann bei der regelmäßigen Besprechung dann alle zusammenzukriegen Ich finde es auch schwierig, dann den Bedürfnissen der einzelnen einfach gerecht zu werden, wenn's noch eine größere Gruppe wäre. Aber das ist jetzt auch wieder aus dem hohlen Bauch, nicht wissenschaftlich fundiert, daß ich sagen könnte, bei sechs wird's besser und bei zehn schlechten Also ich denke, so acht, bis acht okay, aber mehr das wird zu unüberschaubar. (Mitarbeiter: 10)
Vor allem aus den Erfahrungen aus der Jurastraße, in der einige Bewohnerinnen auch abends arbeiten, sprechen organisatorische Gründe, wie z. B. gemeinsame Besprechungstermine zu finden oder Raum jeden einzelnen gewähren zu können, eine Größe, die in der Regel acht Personen nicht überschreiten sollte.
V: Also, wenn man dran denkt man muß, man möchte einmal die Woche eine Hausversammlung machen, um organisatorische Dinge abzusprechen, dann ist .sicherlich eine Obergrenze bei acht drin, weil man sonst die Termine nicht mehr unter einen Hut kriegt. Das sind ganz einfache Dinge das sind Erfahrungswerte, die man halt so macht, aber es könnte natürlich auch sein, bei der entsprechenden Harmonie in dem Haus, daß auch das bei zehn Leuten so funktionieren würde. (Träger 112)
Aus Sicht der Mütter bietet die 8er-Besetzung mit jeweils vier Personen mit und ohne Assistenzbedarf auch Chancen, unter den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln und Freundschaften zu knüpfen.
S: Ich finde auch, daß die Leute untereinander, wie Birgit und David und Clara (drei BewohnerInnen m.A.), daß die Ansprechpartner untereinander haben, die können auch zu zweit und zu dritt mal weggehen. Jetzt wenn's zwei wären, zum Beispiel ein schwerbehinderter Mensch und einer mit weniger Assistenzbedarf dann wäre das lange nicht so interessant die Leute. Und von den nichtbehinderten Mitbewohnern finde ich es auch gut, daß es mehr sind, weil es ist immer mal einer krank, und immer mal möchte einer fort, und immer mal ist sowas, und dann sind immerhin noch drei da, und sehr viel mehr finde ich schwierig, weil das sind jetzt acht Leute, das ist schon ganz schön viel unter einen Hut zu kriegen, und also so finde ich das ideal.
I: Also keine größere WG, sondern so acht.
P: Aber kleiner auch nicht, denn der Bewohner kann ja nicht diese Arbeitszeit abdecken, der würde gar nicht erst einziehen, der würde sagen, so viel Arbeit - nein danke.
S: Dann wären natürlich auch wieder weniger Leute weniger Pflegebedarf aber das fände ich eben auch nicht gut, weil da sich eben auch Grüppchen bilden können, zum Beispiel David und Birgit jetzt, das ist ja toll, daß die zwei was miteinander unternehmen können und die Clara auch, die können auch (Mütter 113)
Aus der Gruppen- und Organisationspsychologie liegen Untersuchungsergebnisse vor, die auch darauf hinweisen, daß bei egalitären Gruppenstrukturen die Grup pengröße von acht Personen nicht überschritten werden sollte (vgl. Schuler 1993 :329 ff, u.a.).
Neben der Größe der Wohngemeinschaft stellt sich auch die Frage nach dem Anteil von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Beide Komponenten werden immer zusammenhängend diskutiert. Hierzu gibt es kontroverse Diskussionen bzw. keine eindeutigen Haltungen. Eine grundsätzliche Überlegung, die auch im Hin- blick auf die Planung der zweiten Wohngemeinschaft im Raum stand, bezieht sich auf das Normlaisierungsparadigma. Vor diesem Hintergrund wäre z. B. eine Besetzung von vier Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf und zwei Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ein Verhältnis, das eine räumliche Zentrierung von Menschen mit Assistenzbedarf stärker vermeiden würde.
Daneben stehen die Erfahrungen in der Jurastraße. Das ausgeglichene Verhältnis von Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf wird insoweit positiv bewertet, als daß die Auswahl und die Interessen von Personen, die sich auch durch die unterschiedlichen Lebenswelten von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf er- geben, beide Gruppen gleiche Voraussetzungen bieten (siehe Gesprächsauszug letzter Abschnitt).
Ein idealtypisches Verfahren zur Auswahl und Größe einer Wohngemeinschaft und Verhältnis von Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf wurde von einem Teilnehmer aus dem Trägergespräch entworfen:
V: Also es gibt mich keine ideale Große. Die Grüße hängt mich im Grunde genommen tatsächlich davon ab, was kriege ich realistischerweise auf dem Markt der Möglichkeiten im dortigen Bereich. Danach würde ich meine Große ein Stück weit ausrichten. Es gibt mich keine ideale Wohngemeinschaftsgröße, weil jede Große, egal, ob ich jetzt mit drei Leuten eine Wohngemeinschaft mache oder mit fünf oder mit zehn, ihre eigene Spezifika entwickeln wird. Also drei Leute, denke ich, das ist klein und schnuckelig, zehn Leute, denke ich, da ist schnell die Tendenz, auch wieder auseinanderzulaufen und praktisch so eher sich zurückzuziehen und Verantwortung auch abzugeben, also solche Tendenzen Also ich würde sagen, es gibt nicht die ideale Große dazu, sondern man mußte ein Stück weit - und das wäre mein Traum, wenn man das so gut machen könnte, man hätte die Bewohner; die Bewohner mit und ohne Behinderung, wurde die zusammenbringen und würde dann sagen, so, jetzt sagt mal, wie ihr's gerne hättet Und man hätte vielleicht sogar eine Auswahl zwei Wohngemeinschaften die Bewohner und, sagen wir mal von acht Menschen mit Behinderungen und zehn Menschen ohne Behinderung, die kommen zusammen - wie würdet ihr‘s euch organisieren, wer wurde gerne mit wem wohnen. (Träger :8-9)
Eine Vorgehensweise, die sich an diesen obengenannten Richtlinien orientieren könnte, würde voraussetzen, daß die Bewohnerinnen von Beginn an mit in die Planungsprozesse einbezogen werden. Konkret würde das heißen, daß sie sich schon mindestens ein Jahr vor Einzug in die Wohngemeinschaft diese Wohnform entscheiden bzw. sich auf diesen Planungsprozeß einlassen müßten. Hier bestehen bei Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf aufgrund deren kurzfristiger Wohnungssuche gewisse Realisierungsbedenken.
Voraussetzung den Einzug in die WG ist, daß die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf eine Arbeitsstelle haben (z. B. WfB). Dadurch ist ein normaler Tagesrhythmus als auch die Trennung von Arbeit und Wohnen gewährleistet. Die anderen Mitbewohnerinnen sollten in der Regel ein Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis haben, das den Umfang einer 75%-Stelle nicht überschreitet und von den Arbeitszeiten her eine Beteiligung an den Assistenzdiensten ermöglicht. in Einzelfällen gab es auch Phasen, in denen Bewohnerinnen im Umfang einer vollen Arbeitsstelle im Arbeitsprozeß standen. Auf Dauer übersteigen Lebensbedingungen mit Vollzeitarbeitssteilen die Belastungsgrenzen der einzelnen Bewohnerin- nen.
Jeder Mensch hat einen Anspruch auf Teilhabe am sozialen und gemeinschaftlichen Leben (vgl. Lüpke 1996: 71).
Der konzeptionelle Anspruch einer LIW beinhaltet eine Offenheit alle Personen, die Interesse an dieser Wohnform haben. lm Unterschied zu anderen Wohnformen, die ein normales Leben im Gemeinwesen anstreben, soll auch Menschen, die eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz benötigen, die LIW offenstehen. Eine Unterscheidung und infolgedessen eine Hierarchisierung von sogenannten Behinderungsformen soll bewußt vermieden werden. Ein Zimmer in der Wohngemeinschaft soll eine Bewohnerin mit hohem Assistenzbedarf ausgewiesen werden. Diese konzeptionelle Zielsetzung hat weitreichende Auswirkungen auf das gemeinsame Zusammenleben und bedarf deshalb einer ausführlichen Diskussion. Es gibt innerhalb und im näheren Umfeld der Wohngemeinschaft immer wieder Diskussionen, wie dieser Anspruch und diese Realität in der Jurastraße im Alltag umgesetzt werden können, Die folgende Darstellung orientiert sich an der Frage: Welche Schlüsse können aus der Teilhabe einer Person mit einer Rund-um-die- Uhr-Assistenz aus den letzten vier Wohngemeinschaftsjahren gezogen werden?
In allen Gesprächen wird immer wieder die Frage aufgeworfen, welche Rolle eine Bewohnerin mit einer Rund-um-die-Uhr-Assistenz im alltäglichen Zusammenleben einnimmt. Aus der Perspektive der ehemaligen Bewohnerinnen möchte ich zunächst die ambivalente Struktur aufzeigen:
L: Also mich war's essentiell eigentlich, also ich finde es super-wichtig, weil es eben auch dazu geführt hat, daß sie die Gruppe verbindet ...und weil ich denke, also die Andrea ist es einfach total gut, da zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen ~ wie würde die in einer wie täte man mit der in einem Wohnheim umgehen, wo eine Gruppe, grade wie bei der Clara, das waren schwerst-mehrfachbehinderte Menschen, die hatten zwei Mitarbeiter und einen Zivi acht, neun Leute. Da täte man die Andrea die ganze Zeit fixieren und irgendwo im Rollstuhl hinsetzen und Helm auf Da täte die, glaube ich, wahrscheinlich ihre Zeiten haben, wo sie dann mal an der Hand oder unter Aufsicht ja, also mich war das oft auch das, womit ich das begründet habe, warum ich das gut finde, weil ich habe oft mit Leuten geredet, die gesagt haben, warum machst du denn sowas oder grade auch die das dann nicht gut fanden. Ich fand's spätestens immer ab da gut, wo ich an die Andrea gedacht habe. Ich find's sowieso gut, aber sie war so ein Hauptgrund da, daß ich da echt auch immer noch dahinterstehe.
M: Und aber dann, daß man dann gucken muß, man weiß, die Andrea ist wichtig oder die Andrea ist das Verbindende und dann aber gucken, daß trotzdem dann die Entlastung da ist. Weil es ist klar; die ziehen besonders viel Energie raus, und daß von mir aus dann grade die Wochenenden, daß ganz klar ist, die sind frei, weil ja, die Frau ...(Mutter) war's nicht oft, die hat nicht so oft gefragt, weil die hat auch ein schlechtes Gewissen. Aber an sich, laut Plan, wie's vorgesehen war; hätte sie ein Recht drauf und das ist ja damals gesagt worden, und das läuft ja unter stationärer Dings, also von dem her stimmt's eigentlich nicht. Aber ich denke, wenn die Andrea auch am Wochenende noch da wäre, ich wußte auch nicht, wie man das dann personell machen mußte. (chem. Bewohnerinnen o.A. :21-22)
Die positive Einschätzung im ersten Abschnitt ist keine Einzelmeinung. Alle BewohnerInnen sowie auch die Mitarbeiter und anderen Beteiligten sind sich darin einig, daß die Andrea eine ganz wichtige Funktion in der Wohngemeinschaft einnimmt. Dabei ist es nicht einfach zu fassen, welche Dimensionen in die durchweg positive Teilhabe einfließen. Ein Anteil liegt in einer nicht näher zu bestimmenden Kommunikationsfähigkeit von Andrea, die zwar sehr wenig reden kann, aber durch ihr Dabeisein positiv besetzte Beziehungen aufbaut. Trotz ihres oft schlechten gesundheitlichen Zustandes gelingt es ihr, die Herzen der anderen zu öffnen. Bei vielen Besuchen konnte ich immer wieder an der Art und Weise, wie über Andrea geredet wird, feststellen, daß sie wirklich geschätzt wird und eine besonders integrative und kommunikative Situation herstellt. Ohne sie wäre die Wohngemeinschaft eine ganz andere. Zu erkennen war dies während eines längeren Krankenhausaufenthalts von Andrea. in dieser Zeit entfielen sehr viele Assistenzdienste, was zum einen als entlastend empfunden wurde, während sich gleichzeitig ein lndividualisierungsprozeß in Gang setzte, der das Gemeinschaftsgefüge immer mehr auflöste. So war ihre Rückkehr mit ambivalenten Gefühlen besetzt (vgl. Jerg 1998: 47).
Ein Aspekt, der die ehemalige Bewohnerin Lisa hier anspricht, betrifft die immer wieder auftauchende Frage nach dem Sinn des Zusammenwohnens. Gerade daß in der Wohngemeinschaft jemand wie die Andrea wohnt, die ansonsten nie in „normalisierten“ Lebenszusammenhängen leben könnte, bestärkt sie in zweifeln- den Situationen und im Gefühl, daß sich ihre Bemühungen lohnen.
Die strukturellen Anforderungen einer Rund-um-die-Uhr-Assistenz sind in ihren Auswirkungen klar zu erkennen. Ohne Zweifel stellt der hohe Assistenzbedarf, der zudem in vielen Situationen eine Doppelassistenz erfordert, ein verbindendes und intensives Zusammenleben auch die anderen Bewohnerinnen her (vgl. Kapitel 1.3). Gleichzeitig wird in den anschließenden Ausführungen von Monika sichtbar, daß die Bewohnerinnen im Alltag mit ihren Ressourcen an Grenzen stoßen. Am Beispiel des „freien“ Wochenendes kommen das Dilemma und die Kehrseite zum Tragen: Der eigene Wunsch nach einem freien Wochenende steht im Widerspruch zu dem Anspruch der Bewohnerinnen auf Wochenendassistenz und belastet auch das Verhältnis zu den Eltern. Eine zentrale Fragestellung ist: Welche Assistenzleistungen können mit den vorhandenen Ressourcen erbracht werden, und welche personellen Ressourcen wären notwendig, um alle Beteiligten ein hohes Maß an Zufriedenheit herstellen zu können? (Nähere Ausführungen dazu im Kapitel Assistenz)
Ich glaube, daß diese Ambivalenz, daß eine Person durch ihre erforderliche Dauerassistenz sowohl den Zusammenhalt fördert, als auch ständig an die Grenzen der Assistenzhilfe stößt, nicht zu „entzweien“ ist. Nehmen wir an, es würden zusätzliche finanzielle Ressourcen eingesetzt, so wäre nicht zu vermeiden, daß dadurch ein Rückzug einzelner Bewohnerinnen den bisherigen Zusammenhalt verändern würde.
Über diesen Kontext hinaus bedarf es aber genauerer Betrachtungen hinsichtlich der Assistenzressourcen, damit nicht ein strukturelles Problem - in Form von fehlenden personellen Ressourcen - auf den Rücken der Bewohnerinnen ausgetragen wird.
Mit einer etwas anderen Färbung wie in dem Textauszug von Bewohnerinnen wird im Gespräch mit den Mitarbeitern die ambivalente Situation beschrieben:
K: …man muß sich wirklich im Klaren sein, wenn man eine zweite WG macht, was man will was Menschen, wer darf dort einziehen oder wer soll dort einziehen. Weil ich merke einfach jetzt auch in der Konstellation, wie wir jetzt sind in der Jurastraße, das ist auch ein zweischneidiges Eisen. Diese ständige Präsenz und auch immer diese gewisse Angst, mit der Andrea zu leben oder wenn's andere Leute wären, die keinen so hohen Assistenzbedarf hätten, wäre es bestimmt einfacher, in dieser WG zu existieren Andererseits würde es eher dann vielleicht so sein wie in einer normaleren WG, daß alles mehr auseinanderläuft. Ich merke jetzt aber auch wieder intensivst durch meine Gespräche mit Zivis, mit Leuten, die da einziehen wollen, weil's grade so pressant ist, daß sie dann immer wieder aufhorchen und nachfragen, und ich muß das bis ins kleinste Detail teilweise erklären, was mit der Andrea ist, weil sie da Angst davor haben, was kommt da auf mich zu, kann ich das leisten, will ich das leisten als Zivi ein Jahr oder als Mensch ohne Behinderung dort einzuziehen, will ich mir das antun sozusagen, diesen hohen Verantwortungsgrad einzugehen, nachts Nachtdienst zu machen? - Was ist dann, wenn's ihr mal wirklich dreckig geht oder auch dieser andere Aufwand. Das hat einfach auch mit dem zu tun, daß wir diese Wochenenddienste nicht hinbringen, daß die Andrea öfter da sein kann, weil uns das Personal fehlt. (Mitarbeiter :6)
Mit der Offenheit Personen, die eine intensive Assistenz benötigen, werden die zukünftigen Mitbewohnerinnen mit einer Situation konfrontiert, die neben einer ganz neuen Erfahrung noch zusätzlich Ängste hervorruft. Die permanente Gefahr einer Notfallsituation im Alltag setzt eine hohe Bereitschaft voraus, sich auf unsichere Situationen einzulassen, die gleichzeitig noch ein hohes Verantwortungsgefühl erfordern. Aus dieser Sicht steht neben der Besonderheit des Verbindenden auch die der Verantwortung. Es bedarf daher intensiver Gespräche und spezifischer Einführungen in die Assistenzleistungen sowie konkreter Ablaufpläne, wie in Notfallsituationen zu handeln ist.
Wie im Gespräch mit den Bewohnerinnen deutlich wird, ist die schwierige Realisierung der Teilhabe auch von Personen mit intensivem Assistenzbedarf die Mitarbeiter mit den beschränkten Ressourcen verbunden, die über die Wochenenddiskussionen ausgetragen werden. Der Anspruch, die Bewohnerinnen, die Rund-um-die-Uhr-Assistenz benötigen, ein Zuhause zu bieten, kommt an Grenzen, wenn z, B. die Ressourcen nicht eine 7-Tage-Woche ausreichen und damit ein rechtlicher Anspruch nicht immer eingelöst wird und das Selbstbestimmungsrecht nicht immer gewährleistet werden kann.
A: Deshalb muß man sich da schon im klaren sein, finde ich besser, sich einfach nochmal wirklich intensiv Gedanken machen, ab man das tatsächlich will, weil von den Eltern kriegen wir unheimlich Druck, daß die sagen, da wird so viel Geld reingebuttert, und ständig sind die Kinder bei uns am Wochenende daheim dann, bloß weil ihr's nicht wollt, bloß weil ihr's stundenmäßig nicht hinbringt etc. (Mitarbeiter :7)
Der Gedanke, daß vielleicht der Verzicht auf eine Person mit intensiver Assistenz die Situation entlasten könnte, ist folgerichtig, weil die vorhandenen Ressourcen anders verteilt werden könnten. Wie sich aber an anderer Stelle zeigen wird, ist die Wochenendassistenz in ihrer Komplexität noch von weiteren Aspekten durchdrungen. (Eine ausführliche und weiterführende Diskussion über das Thema Wochenende findet sich im Abschnitt Assistenzzeiten 9.1 ff.)
Der Druck der Eltern nach Strukturen, die eine ständige Wochenendassistenz ermöglichen, wird inzwischen größer, nachdem in den letzten Jahren ein Teil der Eltern in der Regel an den Wochenenden die Assistenz ihre „Kinder“ übernommen hat. innerhalb der letzten Jahre hat sich hier viel verändert. Zu Beginn der LIW wurde mit den Eltern vereinbart, daß Assistenzleistungen von den Eltern an den Wochenenden geleistet werden. Mit der Zeit verändern sich die Lebenssituationen, so daß mit der Zeit auch andere Ansprüche und Vorstellungen aller Beteiligten immer wieder neu verhandelt werden müssen.
Von einem Teilnehmer im Mitarbeiterinnengespräch wurde die Einschätzung vertreten, daß die Einbindung einer intensiven Assistenz den Rahmen der Wohngemeinschaft sprengt. Ich habe einen Auszug aus der Diskussion hier eingefügt, um auch einer anderen Position Raum zu geben.
J: Wir können nicht einfach sagen, vier Menschen mit Behinderungen und fünf ohne Behinderungen oder so, sondern es kommt ganz auf den Assistenzbedarf beim einzelnen an. Ich seh’s halt an der einen Bewohnerin von dort, in der Jurastraße, weil das kann den Rahmen einfach sprengen. Es kann auch dazu führen, daß halt diese WG in sich einfach nicht auf die Dauer stabil ist, daß die Fluktuation auch sehr hoch ist, weil sie halt da zu sehr belastet wird. Das heißt auch in der Jurastraße momentan Früh- und Spätdienste, und das würde ich, denke ich, bei einer anderen WG versuchen zu vermeiden. Also diese Randzeiten, die unbedingt ein- gehalten werden müssen, punkt sechs Uhr; punkt halb fünf Uhr; die einen im eigenen Leben einfach auch einengen, das würde ich versuchen zu vermeiden, Also das heißt einfach auch, dann eher Menschen nehmen, wo der Assistenzbedarf dann nicht so hoch ist, wo man sagen kann, okay, ich komme heute abend, und dann wird's eine Stunde später Man weiß genau, der Bewohner ist so lange gut versorgt, die Stunde kann der allein sein. Ich finde es schwierig, wenn jemand zum Beispiel auch einen sehr hohen medizinischen Bedarf hat. Ich habe eher den Eindruck, das sprengt dann den Rahmen Also ich würde, wenn's dann um eine neue WG gehen würde, würde ich dann eher Menschen aufnehmen, die auch eine gewisse Zeit vom Tag auch allein sein können, selbständig sein können gewissermaßen.
Y: Aber dann wird's ja eigentlich dem Klientel von den anderen Außenwohngruppen gleichen, also vom Fitheitsgrad Es war ja eigentlich so diese Besonderheit der WG doch, soweit ich mich erinnern kann, daß auch so das Merkmal war hier so, auch schwerer behinderte Menschen aufgenommen werden können, das war ja so eine Wunschvorstellung.
J: mich stand das nie so im Vordergrund. mich war das eher so ein möglichst natürliches, in Anführungszeichen natürliches, Zusammenleben zu ermöglichen, weil diese Wohngruppe. die Außenwohngruppen, die es sonst in der WGV gibt, die haben ja auch diesen Institutscharakter irgendwo. Das sind Wohngruppen, da kommt der Mitarbeiter und geht wieder, aber die wohnen nicht mit Menschen ohne Behinderungen zusammen und unter diesem Integrationsgedanken, daß man sagt, Menschen mit und ohne Behinderungen, die können auch voneinander profitieren und so verstehen wir Integration, deswegen auch die Jurastraße. Aber daß man jetzt eine Frau mit einer Mehrfach- oder einer schweren Behinderung aufnimmt, speziell in so einer Wohnform, mich war das nie so im Vordergrund, ich habe das nicht so empfunden. Es war eher dieser Integrationsgedanke an sich, überhaupt, so daß man ja auch sagt, gut, man macht ja auch eine Wohngruppe in der Stadt, nicht irgendwo draußen da in der grünen Pampa, daß man quasi den Integrationsgedanken noch mehr auf die Spitze getrieben hat in Form von diesem Projekt Jurastraße. Und ich finde die Idee auch super, ich sehe aber auch grade diese Knackpunkte. Wenn's um eine andere WG geht, du würde ich wirklich genau gucken, wie sieht das aus, also grade mit solchen Betreuungszeiten, wie dicht muß das sein, wie konstant muß das immer umgesetzt werden, und da kommt halt die Jurastraße, denke ich, an die Grenzen. (Mitarbeiter :8-10)
Die absolute Zuverlässigkeit in puncto Zeit oder die durchgängige Assistenzbereitschaft schafft im Alltag Realitäten, die das Leben einengen. Die Belastung besteht in der Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit, die z. B. keinen Raum Verspätungen zum „Nachmittagsdienst" zuläßt. Ein absolut zeitfixierter Alltag verhindert ein „natürliches“ Zusammenleben in der Wohngemeinschaft. Auch unter den Mitarbeitern besteht tendenziell die ambivalente Haltung, die von den Bewohnerinnen vermittelt wurde. An einem Textauszug soll dies nochmals verdeutlicht werden:
K: Ich glaube, da kann man auch so zentrale Figuren herausheben: unsere Andrea, die zentrale Figur; die alles bindet, - ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo die Andrea im Krankenhaus war, wo's ihr längere Zeit nicht gut gegangen ist, wie die WG plötzlich eine normale WG geworden ist, also eine normalere, wie alle ihrer Wege gegangen sind und wie nur noch die Hauptamtlichen irgendwie geguckt haben, daß das so läuft und funktioniert. Und die Andrea ist dieses bindende Glied und bringt gleichzeitig diesen - wie soll ich sagen? - dieses Negative auch mit, was wir das letzte Mal geredet haben, daß man pünktlich um halb fünf Uhr das ein muß und strammstehen muß und dieses ganze Ding, daß man doch nicht so locker dort wohnen oder arbeiten kann, die hat die beiden Seiten. (Mitarbeiter: 70)
Im Gesamtkontext der Wohngemeinschaft darf nicht übersehen werden, daß diese Diskussion um die Rund-um-die-Uhr-Assistenz ausschließlich unter dem Ressourcenblick geführt wird. Bei genauerer Betrachtung der Zusammensetzung fällt auf, daß auch andere Personen einen hohen Assistenzbedarf haben und in ganz anderer Weise Grenzen und Konflikte hervorrufen.
K: Ja genau, ich wollte grade noch sagen, ich möchte aber nicht nur; daß das nur auf die Andrea abgewälzt wird, sondern wir haben eine Clara die ähnlich Assistenz braucht. Wir wechseln uns grade ab, der Clara und ich, anfänglich habe ich das gemacht, oder auch du dann teilweise nach, daß jedes Mal am Freitag abend einer von uns zwei, drei Stunden runter- geht und mit der Clara ihr ganzes Zimmer putzt, Bett überzieht, Wäsche wäscht und so weiter und so fort, ein Riesenaufwand da/J' die auch mit ihrer Pflege, Pflege am Körper, Pflege im Zimmer überhaupt zurechtkommt, das ist auch auf die Hauptamtlichen jetzt reduziert worden, weil's einfach ungutes Blut auch gibt, wenn es jemand von der WG macht, und das ist ein großer zeitlicher Au/wand, diese ganze Wäsche, diese ganze Körperpflege in Ordnung zu halten auch. (Mitarbeiter :15)
Die dargestellten Auszüge legen offen, daß die umfassende Anwesenheitspflicht die Wohngemeinschaft an ihre Grenzen bringt. Oberflächlich betrachtet kann der Blick auf die zu erbringenden Assistenzleistungen dazu verleiten, Personen eine Wohngemeinschaft auszuwählen, die wenig Unterstützung brauchen. Aber die- se Rechnung geht nicht ohne Verluste auf, weil z. B. Andrea mit ihrer Rund-um- die-Uhr-Assistenz eine enorme Integrationskraft besitzt und der Wohngemeinschaft einen Lebensgeist einhaucht, der anders nicht ohne weiteres herzustellen ist. Außerdem verstoßen Reglements, die sich ausschließlich am Assistenzumfang orientieren, gegen den Gedanken der Gleichstellung und Enthierarchisierung von Assistenzformen.
Grundsätzlich ist es nicht leicht, aus den Gesprächen Kriterien die Auswahl der Bewohnerinnen festzulegen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Frage nach der Sympathie unter den Bewohnerinnen, Die Sympathiegemeinschaft läßt sich aber nicht an formalen Kriterien ausrichten.
Auf den Kreis der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf bezogen, wird der Aspekt der Sympathie und die Fähigkeit, sich auf die Gruppe einlassen zu können, besonders hervorgehoben:
J: Ich denke mal, das kommt gar nicht so sehr darauf an, was spezielle Behinderungen das jetzt sind, sondern eher; wie sich die Leute irgendwie finden und sich leiden können, daran liegt viel mehr: Und ob die dann bereit sind oder den anderen so sympathisch sind oder den anderen so mögen, daß sie sich darauf auch einlassen können. (Mitarbeiter :6-7)
In ähnlicher Weise formulieren die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die Vorstellungen, auf was sie Wert legen bei der Auswahl von neuen Mitbewohnerinnen.
I: Und von der Auswahl der Bewohnerinnen, was ist euch wichtig ihr wart ja schon dabei bei der Auswahl von Gabi und Hubert, auf was muß man achten, was ist euch bei der Auswahl von neuen BewohnerInnen wichtig? Wie sollen die sein?
C: Nett.
B: Nett, auf alle Fälle.
D: nett und...
C: die sollen helfen.
D: die sollen helfen können.
C: Brief schreiben.
K: die sollen dir mal einen Brief schreiben, weil du es nicht selber kannst?
C: Ja. (BewohnerInnen m.A. :10)
Aus der Sicht der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf ist die Sympathie untereinander ein wichtiger Bestandteil die Kooperation und Verantwortung hinsichtlich der Assistenzleistungen:
O: sich gut verstehen, ich denke, das ist sehr wichtig... Wenn zwei Nichtbehinderte da miteinander irgendwie Trouble haben, weil so etwas ist dann schon schwierig. In der normalen WG ist das dann weniger schwierig
L: Also das muß man dann wirklich sagen, sonst geht's schief glaube ich. Das ist nicht wie bei mir jetzt zum Beispiel wo man sagt, dann geht man der Person aus dem Weg, sondern ich glaube, das ist einfach da nochmal viel wichtiger.
O: Ja, man schafft ja auch irgendwie so im Team zusammen oder auch, was weiß ich, daß man sich auch jede Woche sieh! und miteinander schwätzt und so, das muß schon passen, irgendwas reinzureden.
L: Wenn ich überlege, daß bei der Besprechung jemand dabeigewesen wäre, der mich jede Woche auf die Palme bringt mit seinem Geschwätz, das hätte ich nicht verkraftet. (ehem. BewohnerInnen o.A. :4-5)
Die ehemaligen MitbewohnerInnen haben teilweise andere Wohngemeinschaftserfahrungen und wohnen z. T. auch wieder in Wohngemeinschaften. Sie sehen im Unterschied zu einer sogenannten „normalen“ Wohngemeinschaft das gegenseitige Aufeinanderangewiesensein und die Zusammenarbeit in Bezug auf die Assistenz als Kriterium, das sich nur auf der Basis von Sympathie entfalten läßt. Es bedarf außerdem auch anderer Organisationsstrukturen, wie z. B. eine wöchentliche Besprechung. ln ihr können durch gemeinsame Absprachen, die auf ähnlichen Weltvorstellungen bzw. gegenseitiger Akzeptanz basieren, gelingende Bewältigungsstrategien erprobt werden.
Zudem bestätigen die Erfahrungen in den letzten vier Jahren durchgängig, daß ein Mindestmaß an Gruppenfähigkeit bzw. sozialer Kompetenz weitaus wichtiger das Zusammenleben ist, als eine Ausrichtung nach dem Assistenzbedarf. Bewohnerlnnen mit und ohne Assistenzbedarf, die die Vorteile des gemeinschaftlichen Lebens bewußt ausnutzen, aber keine Verantwortung übernehmen, sind weitaus weniger zu integrieren als Personen, die etwas mehr Assistenz benötigen, aber ihren möglichen Beitrag zu einem gelingenden Alltag leisten (vgl. Jerg 1999 : 168).
Die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft erfordert ein gründliches Abwägen unterschiedlicher Aspekte, weil im Vorfeld die „Chemie“ zwischen den BewohnerInnen nicht zu berechnen ist.
die Basis einer Entscheidung, die den Sympathieaspekt berücksichtigt, können folgende Schlüsse gezogen werden:
-
Zunächst sollte die Auswahl von Personen nicht unter Zeitdruck vorgenommen werden. Sich Zeit geben und lassen den Entscheidungsprozeß, hat sich in den bisherigen Auswahlverfahren als hilfreich erwiesen.
-
Probewohnen als Entscheidungshilfe beide Seiten. Dieses Verfahren ist nicht unumstritten, weil zum einen bei Personen, die sich darauf einlassen, Hoffnungen geweckt werden, die bei einer eventuellen Ablehnung nach dem Probewohnen zu großen Enttäuschungen führen können; zum anderen kann jemand innerhalb des Probewohnens sich von seinen besten Seiten zeigen, weil er/sie unter dem Druck der Bewährungsprobe steht. Gleichzeitig kann aber der erste Eindruck von einem Bewerbungsgespräch über das Probewohnen den einzelnen Beteiligten einen längeren und intensiveren Austausch mit den zukünftigen Bewohnerinnen ermöglichen (vgl. Kapitel 12.2 Aufnahmekriterien).
-
lm Unterschied zu den herkömmlichen Wohngemeinschaften sind die Bewohnerlnnen in einem weitaus größeren Maße aufeinander angewiesen. Deshalb ist darauf zu achten, daß die Bewohnerinnen selbst über die Auswahl der Mitbewohnerlnnen entscheiden (vgl. Kapitel 11 Selbstbestimmung). Dieses Prinzip läßt sich in einer bestehenden Wohngemeinschaft bei Neuzugängen leichter durchsetzen. ln der Gründungsphase ist die Entscheidungsfindung der Zusammensetzung schwieriger zu gestalten. Eine gemeinsame Planungsphase mit Interessierten könnte hier hilfreich sein. Dabei besteht in der Realität die Schwierigkeit, daß Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf in der Regel kurzfristiger einen Umzug planen und deshalb eine längere Vorlaufphase nicht so leicht zu gewinnen sind.
Beim Neuaufbau einer Wohngemeinschaft sollten sich alle Interessierten an der Planung und Entscheidungsfindung beteiligen können.
Einleitung
Autonomie und Institutionshierarchien - Autonomie als Lernmodell
Organisationsstrukturen sind ein Spiegel des Selbstverständnisses einer Einrichtung. Das Anliegen der Träger der LIW war und ist, Teilhabe und Selbstbestimmung der BewohnerInnen zu ermöglichen. Deshalb bestand Übereinstimmung der Träger, eine flache Hierarchie mit einem hohen Maß an Autonomie in den Organisationsstrukturen der Wohngemeinschaft zu verankern. Damit sollen die Gestaltungsfreiheit und der Einfluß der direkt Beteiligten gewährt werden.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der flachen hierarchischen Strukturen liegt in der Transparenz der Trägerarbeit. Als praktische Konsequenz wurde deshalb z. B. das Ko- operationstreffen der Träger alle Bewohnerinnen und Beteiligten geöffnet. Diese Offenheit soll Mitwirkung an der Gestaltung und Weiterentwicklung signalisieren, die direkte Begegnung bzw. den Dialog ermöglichen und die Vernetzung der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Ebenen praktisch fördern.
Grundlegend ein integratives, lebensweltorientiertes Wohnen ist die Vorstellung, daß hier das Zusammenleben von Menschen im Vordergrund steht. Um sich vor Idealisierungen zu schützen, muß immer wieder reflektiert werden, inwieweit sich im Alltag nicht Herrschaftsverhältnisse und Hierarchien etablieren. Dazu kann auf unterschiedlichen Ebenen überprüft werden, ob sich Abhängigkeitsverhältnisse festsetzen, die durch stärkere Beteiligung der Bewohnerinnen entschärft oder durch Unterstützungsmaßnahmen wieder aufgelöst werden können.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Interessengruppen, die von außen ihre Vorstellungen direkt oder indirekt aufdrücken, z. B. die Geldgeber. Sie erwarten, daß dieses Angebot am besten billiger, jedenfalls nicht teurer als die bisherigen stationären Angebote sein soll, auch wenn dadurch eine höhere Lebensqualität erreicht werden könnte bzw. die Selbstbestimmung der Betroffenen bei der Auswahl der Assistenzleistungen stärker zum Tragen kommen würde.
Rahmenbedingungen sollten so gestaltet sein, daß neben den existenzabsichernden Faktoren, also z. B, der Finanzierbarkeit der Wohngemeinschaft, auch die Möglichkeit der gleichberechtigten Mitgestaltung, die Erweiterung von eigenen Handlungs- Kompetenzen bzw. eine selbständige Lebensführung gefördert werden.
Gruppenbildung in der LIW - Positionsbezogene Selbstformierungen
Die Vorstellungen über das gemeinsame Wohnen von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf sind verschieden - verschieden zwischen Trägern, Eltern, Mitarbeitern, Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sowie auch innerhalb dieser Gruppen. Neben den eingerichteten Organisationsformen entwickelten sich unter den Beteiligten auch eigene Gruppenstrukturen, die inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Wohngemeinschaft sind.
Die bisher selbst entstandenen Formierungen orientieren sich an den Positionen der einzelnen Beteiligten. Eltern schließen sich kurz, Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf brauchen eigene Diskussionsrunden. Auch wenn die Einteilung in positionsorientierten Gruppen immer wieder die Differenz zwischen den Gruppen erzeugt und somit auch wieder „Behinderung“ und „Normalität“ konstruiert und praktiziert (werden), bleibt der Weg zu einem offeneren heterogenen Diskurs nur über diese Gruppen zu erreichen (vgl. z. B. Abschnitt Elterntreffen).
Der Wunsch (bzw. das Ziel) nach einem offenen Austausch zwischen den jeweiligen Gruppen (z. B. Eltern und BewohnerInnen ohne Assistenzbedarf) über ihre Vorstellungen und über die gegenseitigen Erwartungen ist in den Begegnungen kein selbstverständlicher Bestandteil. in der Praxis werden zwar unterschiedliche Erwartungen sichtbar, ein offener Diskurs kommt aber selten zustande, weil dies auf dem Hintergrund der bisherigen Lebensgewohnheiten auch nicht eingeübt wurde. Höflichkeit zu bewahren, Harmonie herzustellen, Distanz zu halten, Angst vor Verletzungen bzw. weitere Konfliktfelder nicht verkraften zu können, sind einige Beweggründe, die diesen Umgang prägen.
Aus den bisherigen Erfahrungen läßt sich aufzeigen, daß die positionsorientierten Gruppen dazu beitragen, die Verständigung innerhalb des Projekts positiv in ihrer Entwicklung zu fördern. inzwischen hat sich in den drei Jahren doch einiges bewegt. in den Kooperationsgesprächen z. B. der Träger herrscht eine offene Atmosphäre, in der die unterschiedlichen Positionen thematisiert und unterschiedliche Standpunkte offen aus- getragen und als anregend und konstruktiv erlebt werden.
Die positionsbezogenen Gruppen haben kathartische Wirkungen. Sie ermöglichen einen Austausch, in dem bei der Darstellung der eigenen Sichtweisen zunächst nicht mit negativen Sanktionen zu rechnen ist und entschärfen auch die bestehenden Konfliktfelder. Sie tragen dazu bei, daß Haltungen und Perspektiven der Personen durch die gemeinsame Bearbeitung in der gleichgesinnten Gruppe in den Kontext der Wohngemeinschaft getragen werden, d. h. hier anderen Beteiligten vermittelt werden.
Unter Berücksichtigung der konzeptionellen Vorstellungen von Gleichheit in der Verschiedenheit, Selbstbestimmung bzw. Freiheit und Selbständigkeit etc. stellt sich die Frage, wie diese Ziele am wirkungsvollsten in Organisationsstrukturen eingebunden werden können.
Im Trägergespräch wurde der strukturelle Zusammenhang zwischen Entscheidungskompetenzen und Autonomieverhältnisse innerhalb von Einrichtungen und der Praxis von Selbstermächtigung und Selbstbestimmung der Bewohnerinnen hergestellt:
V: Wenn ich jetzt Strukturen habe, wo Mitarbeiter selber nachfragen müssen und Entscheide einholen müssen von Vorgesetzten, dann sind die natürlich nicht so sehr in der Lage, jetzt selber vor Ort Entscheidungen zu treffen und auch selber im Grunde genommen selbstbestimmt irgendwas zu machen und dann auch genau dies gegenüber den Leuten umzusetzen, denen sie assistieren. Und das, denke ich, ist wieder eine Frage der Struktur; auch der Entscheidungsstruktur ein Stück weit, wie autonom können Mitarbeiter oder wie klar ist im Grunde genommen ihr Auftragsbereich auch formuliert, daß sie in ihrem Aufgabenbereich auch wirklich autonome Entscheidungen treffen können. Und wenn sie das können, dann denke ich, können sie auch genau dies weitergeben in ihrer Assistenz - wenn sie das nicht können, dann können sie´s auch nicht weitergeben, sie würden sich ins eigene Fleisch schneiden dabei - und das sind die Strukturen, die eingebracht sind und möglicherweise verändert sind und die, denke ich, auch die Jurastraße so sind, daß sie sich positiv auswirken. (Träger :29)
Die Konsequenzen einer direkten Beteiligung der Bewohnerinnen lassen sich auf die folgende Formel zusammenfassen: Die Institution muß sich so weit wie möglich aus dem Alltag der Wohngemeinschaft heraushalten und die Regeln des Zusammenlebens den Bewohnerinnen überlassen. Wie an anderer Stelle ausgeführt ist, garantiert dies die Entwicklung und Festigung von privaten Beziehungen und Privatatmosphäre (vgl. Kapitel 10 Teilhabe).
Diese Situation zu gewährleisten, stellt ganz neue Herausforderungen an die Institution, z. B. die bürokratischen Strukturen von den Bewohnerinnen fernzuhalten. Zumindest die Bewohnerinnen beurteilen die Situation als angenehm und positiv, wenn der hauptamtliche Mitarbeiter die institutionellen Strukturen und Themen nicht ständig in den Wohngemeinschaftsalltag hineinträgt, sondern nur die nötigsten Dinge mit den Bewohnerinnen bespricht und ansonsten die Bewohnerinnen mit den institutionellen Themen in Ruhe läßt (vgl, Kapitel 6.2 Hauptamtlicher Mitarbeiter).
Inhaltsverzeichnis
In den folgenden Ausführungen werden in einem ersten Schritt die zentralen Organisations- und Entscheidungsgremien innerhalb der Wohngemeinschaft kurz dargestellt: Hierzu zählen die Wohngemeinschaftsbesprechung und die internen Wohngemeinschaftsbesprechungen. in den weiteren Abschnitten kommen vor allem die Regelwerke die Alltagsorganisation zur Sprache, die, gerade in bezug auf den Grad der Institutionalisierung von Aufgaben, Auskunft über die Möglichkeiten und Schwierigkeiten geben.
Die Entscheidungsinstanz der Wohngemeinschaft bildet die wöchentliche Wohngemeinschaftsbesprechung. Sie ermöglicht die Teilhabe aller Bewohnerinnen an Entscheidungsprozessen und wird von ihnen als Forum genutzt, die eigenen Themen in die Gruppe einzubringen.
Die Gleichstellung der Bewohnerinnen hat auch zur Folge, daß sich Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf z. T. sehr engagiert an den Besprechungen beteiligen und ihre Themen dort einbringen (vgl. auch Kapitel 10.2 Teilhabe).
R: Ich finde auch so ganz toll, daß sie Mittwoch abends ihr Gruppengespräch haben, daß dann die Behinderten das anbringen dürfen, was ihnen nicht gefällt oder was sie gerne hätten und auch dann der Kurt einige Vorschläge macht. Also das finde ich ganz toll, da sind auch alle am Tisch und auch, daß dann die Behinderten das gleiche Mitspracherecht haben wie die Nichtbehinderten, also einwandfrei, ich finde das roll, also das finde ich ganz ganz wichtig. (Mütter :i9)
Wichtig ist, daß die Wohngemeinschaftsbesprechung nicht überlagert wird von organisatorischen Fragestellungen und somit einen Charakter einer Dienstbesprechung er- hält. Zeitweise hat die Organisation der Assistenz die Besprechungen in der Jurastraße ausgefüllt und zur Folge, daß einige Bewohnerinnen die Lust verloren haben, daran teilzunehmen und an ihrer Notwendigkeit zweifelten.
Vor allem die BewohnerInnen mit Assistenzbedarf haben dann das Gefühl, daß sie nicht gebraucht werden, wenn die Besprechung überwiegend von der Organisation der Assistenz in Anspruch genommen wird. Die Auslagerung des Assistenzplans (Listen, in die sich jede Bewohnerin schon zuvor eintragen kann) und die Festlegung von relativ festen Assistenztagen haben viel dazu beigetragen, daß die eigenen Themen der Bewohnerlnnen in der Wohngemeinschaftsbesprechung wieder mehr Raum erhalten.
Seit Bestehen der Wohngemeinschaft gab es immer wieder, entweder zu besonderen Anlässen, wie schwierige Krisen oder auch aufgrund der Abwesenheit von BewohnerInnen mit Assistenzbedarf, interne Wohngemeinschaftsbesprechungen mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter, an denen ausschließlich BewohnerInnen ohne Assistenzbedarf teilnahmen. Dies hatte, wie man im schwäbischen zu sprechen pflegt, ein „G'schmäckle", - einen unangenehmen Beigeschmack. Eigentlich sollten vom Anspruch her alle Themen, die die Wohngemeinschaft betreffen, zusammen mit den Bewohnerlnnen besprochen werden. Die separate und ausgrenzende Gruppenbildung paßte hierzu nicht ins Bild einer integrativen Wohngemeinschaft. Gleichzeitig aber hatten diese Besprechungen auch ganz wichtige Funktionen die Motivation und den Zusammenhalt der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sowie allgemein die Entwicklungen der Wohngemeinschaft.
Während sich Eltem und Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf diesen Austausch unter Gleichpositionierten bei Bedarf holen, haben die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf bis vor kurzem keinen organisierten Austausch unter ihresgleichen. in solchen Formen sind sie nicht geübt und müssen die Artikulation ihrer eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen vorbereitet werden. Hierzu war es notwendig, einen Austausch und eine Gesprächsebene anzubieten. Wie die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf einen Austausch unter sich zu motivieren wären, wurde in dem Beratungsgespräch mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter herausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt. Die Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf waren begeistert über die Vorstellung, daß ihnen genauso wie den anderen ein separater Raum zugestanden wurde. Diese Treffen sind nach Berichten des hauptamtlichen Mitarbeiters ein großer Erfolg, weil z. B. auch BewohnerInnen, die sich in den Besprechungen zurückhalten bzw. z. T. auch heraushalten, sich aktiv in dieser internen Runde einbringen (vgl. Kapitel 10.2 Teilhabe).
Zwei gleichgestellte interne Wohngemeinschaftsbesprechungen vermeiden den Geschmack einer Ungleichbehandlung. Sie können als Foren dazu beitragen, Themen und Befindlichkeiten im kleineren Rahmen anzusprechen, die dann anschließend sicherer in die Gesamtbesprechung hineingetragen werden können. Darüber hinaus stellen sie ein Übungsfeld peer-counceling bereit.
Entscheidungen werden an der Basis gefällt.
Kennzeichen einer echten Mitbestimmung zeigen sich in den Reglements von Entscheidungsprozessen. Am Beispiel des Aufnahmeverfahrens, der Auswahl neuer Bewohnerlnnen soll dies aufgezeigt werden, in der Jurastraße haben zunächst die Bewohnerlnnen und der Mitarbeiter die Entscheidungsfreiheit über die Gestaltung der Anzeige bis hin zur Auswahl der neuen Bewohnerin. Alle Entscheidungen, die im Aus- wahlverfahren getroffen werden, stimmt der Mitarbeiter dann mit der Leitung bzw. den Trägern ab. Mögliche Veränderungswünsche von seiten der Institutionsleitung werden mit den Bewohnerinnen nochmals verhandelt. Diese Entscheidungswege von der Basis benötigen einen größeren Aufwand und nehmen mehr Zeit in Anspruch. Vom Ergebnis und auf Dauer zahlen sie sich voll aus, wie dies die folgenden Aussagen der BewohnerInnen widerspiegeln. Die eigene Entscheidungsfreiheit wird sehr hoch bewertet.
G: Ich denke auch, wenn die jetzt eine neue WG gründen wollen, da würde ich es ziemlich wichtig finden, damit das so läuft wie jetzt bei uns, daß praktisch - da waren Felix und Eva noch da - da haben alle mit entschieden, wer jetzt da neu einzieht, also damit sich die Leute schon im Vorfeld irgendwie kennenlernen, damit die nicht von irgend jemandem zusammengewürfelt werden.. (Bewohnerinnen o.A. :3)
F: ...daß man viel Entscheidungsfreiheit hat, daß wir uns gegenseitig aussuchen können. Also Freiwilligkeit ist was ganz arg Wichtiges. Ich wollte vorhin schon - ich weiß nicht, wie ích's sagen soll -, ich wollte vorhin schon sagen, eine wichtige Voraussetzung ist halt, daß man sich mag, aber so was kannst du ja nicht basteln, und das haben wir jetzt halt glücklicherweise er- wischt so, und das ist natürlich ideal. Es müssen alle auf jeden Fall die Möglichkeit haben, nein, den nehmen wir nicht. Solche Dinge muß man einbauen, daß man auch die Möglichkeit hat, jemanden wieder rauszuschmeißen (BewohnerInnen o.A. :22-23)
In der LIW stehen neben organisatorischen Strukturen, die die Beteiligung und Mitgestaltung in wichtigen Entscheidungen betreffen, die Bewältigung von alltäglichen Arbeiten, die zusammen mit den Bewohnerinnen organisiert werden müssen. Zu diesen Aufgaben gehören z. B, das selbständige Einkaufen, Kochen, Abspülen, Aufräumen, Putzen etc. Hier sind in der LIW keine Standardversorgungsleistungen ein- geplant. Obwohl in vielen Familien auch heute noch die Mütter die Versorgungs- und Dienstleistungen zu Hause zuständig sind und viele Bewohnerinnen mit diesem Erfahrungshintergrund in die WG kommen, orientiert sich die LIW an den Lebenswelten von Wohngemeinschaften, die eine egalitäre Aufgabenverteilung mit dieser Wohnform verknüpfen.
Grundsätzlich stellt sich immer wieder die Frage, wieviel Strukturen vorgegeben bzw. festgelegt werden sollen, um eine relativ reibungslose Alltagsbewältigung gewährleisten zu können. Einen wesentlichen Beitrag zur gelingenden Alltagsbewältigung erfordert eine gute Mischung zwischen Sicherheiten, einen verläßlichen Rahmen und genügend Freiraum, um situationsbezogene Bedürfnisse damit vereinbaren zu können. Teilhabe und Selbstbestimmung setzen immer voraus, daß Regeln flexibel interpretiert und eingesetzt werden. Zu viele Festlegungen sind eher ein Zeichen eines institutionellen Charakters. Die Privatheit der Wohngemeinschaft setzt einen flexiblen Aushandlungsspielraum auf dem Hintergrund grundsätzlicher Vereinbarungen voraus.
G: Was ich noch gedacht habe so, daß bei uns eigentlich alles so ziemlich viel absolut durchstrukturiert ist. Klar, es geht ja nicht ohne, aber wo die (BewohnerIn aus einer anderen integrativen Wohngemeinschaft) da waren, da habe ich gedacht, so im Prinzip ist das ja eigentlich fast gar nichts, was wir haben, bei denen war wirklich sämtlich alles vorgegeben und so. Da ist es geregelt, wer wann die Waschen wäscht, und da hat jeder wir/dich seine feste Arbeiten und seine bestimmten Tage und so. Ich finde es sehr positiv, daß das bei uns nicht so ist, sondern man sich da einfach abspricht dann. (BewohnerInnen o.A. :24)
Strukturen zeigen sich in Verpflichtungen. Gleichzeitig besteht aber von seiten der BewohnerInnen der Wunsch, soviel wie möglich in eigener Verantwortung zu über- nehmen und somit Wahlmöglichkeiten zu haben (vgl. Schulz 1997).
Diesem Wunsch nach Offenheit steht im Alltag der Wohngemeinschaft die Erfahrung entgegen, daß Offenheit und Nicht-Absprachen auch zu Unverbindlichkeit, vor allem im Bereich der Hausarbeiten, führen können. Die fehlende Verantwortungsbereitschaft kann zu nachhaltigen Konflikten führen.
Einen wichtigen Beitrag zu einem gelingenden Alltag leistet eine alle verbindliche Organisation und Bewältigung anfallender Hausarbeiten - sprich allgemein verbindliche Regeln ein akzeptables Zusammenleben.
lm folgenden werden die Schwierigkeiten bei der Umsetzung vor allem an Beispielen von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf thematisiert. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß hier alle Bewohnerinnen, auch die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf, in einem ähnlichen Ausmaß betroffen sind. Vor allem geht es dabei um ein typisches Wohngemeinschaftssyndrom, dem ungleichen Verantwortungsbewußtsein die Zuständigkeiten von Hausarbeiten, das auch geschlechtsbezogene Züge aufweist. Ausschließlich Frauen ohne Assistenzbedarf thematisieren, daß sie sich durch nicht erkennbare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten permanent in ihrem Verantwortungsgefühl die Sauberkeit in gemeinschaftlich genutzten Räumen und auch in den privaten Zimmern der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ertappen. Dies hatte zur Folge, daß sie sich ständig rechtfertigen mußten die in ihren Augen unzumutbaren hygienischen Zustände in der Wohngemeinschaft. Vor allem gegenüber den Müttern, Praktikantinnen und Gästen verdeckt die gemeinsame Verantwortung das Sauberkeitsniveau die Unzuverlässigkeit einzelner Bewohnerinnen, die sich hinter den nicht sichtbaren Verantwortungsbereichen verstecken können und somit auch nicht zur Verantwortung herangezogen werden. Dadurch ist das Wohlbefinden der Bewohnerinnen in der Wohngemeinschaft stark beeinträchtigt gewesen.
Die folgende Diskussion über Organisationsformen von Hausarbeiten spiegelt die Erfahrungen im Wohngemeinschaftsalltag und ihre Rückwirkungen auf verantwortliche Bewohnerinnen wider. Anhand der „Putzuhr“ wird perspektivisch eine Form präsentiert, die eine gleichberechtigte Stellung aller Bewohnerinnen in der Haushaltsorganisation vorsieht und zudem fehlende Verantwortungsübernahme einzelner BewohnerInnen sichtbar macht. einen Großteil der Haushaltsaufgaben kann damit ein Instrument genutzt werden, das ganz automatisch die Zuständigkeiten aufzeigt und nur Vertretungen einen Regelungsbedarf erfordert. Gleichzeitig ist die Anteilnahme der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf mit der erforderlichen Unterstützung an allen zu erledigenden Aufgaben gewährleistet. So werden alle Bewohnerinnen von Anfang an in die Alltagsbewältigung miteinbezogen. Jede Haushaltstätigkeit, z. B. Komposteimer leeren, kann das Gefühl des Beteiligtseins fördern und zur Gleichstellung beitragen.
L: genau, Putzpläne - genau, da würde ich gerne was sagen! Diese Putzpläne, das war eine Katastrophe, und ich bin inzwischen in meiner WG, ich bin zum Fan von Putzuhren geworden. Diese Uhr; das ist ein Kreis, da sind dann die Namen drin, und da sieht dann halt auch immer der Name von der Person drin, die grade verantwortlich ist. Bärbel putzt das Klo, und der und der muß einkaufen, und wenn dann jemand den Kühlschrank aufmacht und der ist leer, dann guckt er auf der Putzuhr nach und dann steht drauf wer schuld ist, daß der leer ist, und das, glaube ich, hätte mir sehr sehr gut getan, wenn ich, wenn die Frau S. in die Wohnung kommt und ich denken muss, Sch..., wie sieht's da aus, sondern daß ich weiß, die Frau S sieht auch, warum ist das Klo dreckig, und das ist nicht dreckig, weil die Lisa keine gute Hausfrau ist, sondern das ist dreckig, weil hier jemand seinen Job nicht macht, und dann steht auch drauf wer seinen Job nicht macht. Ich habe immer gedacht, die Frau kommt da jeden Montag, und das Waschbecken von ihrer Tochter sieht aus wie die Sau, und sie putzt das jeden Montag, und ich will das eigentlich nicht, aber wenn ich das nicht will, dann muß ich's putzen, und das ist nicht meine Aufgabe, und ich hab's dann arg oft gemacht, und ich hab' mich sehr geärgert, und ich bin nicht auf die Idee gekommen, das so zu lösen, daß einfach Verantwortlichkeiten viel klarer erkennbar sind.
M: Meinst du, es war nicht erkennbar durch den Plan, den wir gehabt haben - meinst du, das hätte man noch öffentlicher machen müssen, daß man mehr unter was weiß ich, daß das Prestige ein bißchen gelitten hätte, wenn man 's nicht gemacht hat?
L: Vor allen Dingen gab's Leute, die haben sich nie Einkauf eingetragen, Es gab jemanden, der hat nie Altglas gemacht. Klar, ist das natürlich ein Problem, aber dazu ist ja auch die Assistenz da vom Zivi, vom SozPäd und da gibt's dann auch Leute, die sind dann nicht da bei der Besprechung, grade auch Menschen mit Behinderung, wo man dann auch vielleicht mal froh ist. wenn sie nicht da sind Aber dann fehlen sie beim Einteilen, und übergehen will man ja niemand und so weiter, und eine Putzuhr, die läuft, die hat ihre Richtung, und da kommt jeder dran, und das ist einfach so. Und, ja so eine Pranger-Wirkung wenn ich dann denke an meinen Ärger; dann muß ich jetzt wirklich sagen, es wäre mir manchmal echt recht, daß man auch sieht, wirklich so richtig die Schuld, das ist hier der, der ist der Böse sozusagen.
…
L: Das war bei der Andrea zum Beispiel sowieso bei jeder Aufgabe so. Sie hat ja außer an einem außergewöhnlich guten Tag hat sie mal den Komposteimer wirklich selber rausbringen können, aber ausspülen - da hast du auch helfen müssen. Und da bin ich auch gerne dazu bereit, das ist auch nicht das Thema,... Mich hat bloß angekotzt, daß ich halt, daß ich oft gedacht habe, ich bin die einzige oder jetzt muß ich das schon wieder machen. Klar ist das, ich bin nie die einzige gewesen, aber das Gefühl kommt irgendwann bei bestimmten Leuten. Und wir haben halt am Anfang, da haben wir noch gesagt, Putzplan, so was brauchen wir nicht, das weiß ich noch.
M: Das war ganz am Anfang, ja.
L: Und da haben wir echt alle gedacht, das ist doch spießig und am Schluß, echt, so spießig wies nur geht, wirklich, damit nicht einer einen Hals kriegt, weil das kommt sowieso, weil dann gibt's jemanden, der macht sein Klo dann halt drei Wochen lang nicht, aber wenigstens steht dann da der Name. Und jetzt bei mir ist es halt so, ich habe jetzt heute auch was geputzt, was nicht mein Job war, weil's einfach brutal schmutzig war, aber da kommen keine Eltern und gucken, wie meine Mitbewohner leben und wo ich mir dann überlegen muß, was denken die jetzt über mich, sondern es ist mir egal. Und dann putze ich. weil ich das sauber haben möchte, und dann fühle ich mich hinterher auch nicht so blöd dann wieder wie die Putzfrau, und das wäre, wenn man das umgehen könnte, das wäre natürlich schon, denke ich, gut. (ehem. BewoherInnen o.A. :7-9)
Die Putz- und Hausarbeiten sind ein sehr konfliktbehaftetes Thema. einzelne BewohnerInnen stellen sie auch Grenzerfahrungen dar, die so belastend werden, daß sie mit zu einem ausschlaggebenden Grund den Auszug wurden.
L: Ich hab´s gehaßt, wo du im Keller gewohnt hast und ich so oft bei dir gepennt habe und ich immer da oben aufs Klo mußte. Ich wäre am liebsten manchmal auf Stelzen da rein. Und das haben wir so oft besprochen, daß das alle zwei Tage eigentlich oder zweimal in der Woche…
M: Ja, wir haben sogar jeden Tag, haben wir gesagt, aber das hat nie geklappt.
L: Das hat nie geklappt, und dann sollte man vielleicht echt auch knallhart sein und sagen, die Leute, die's nicht putzen, da wird einfach die Uhr weitergedreht und denen nimmt man fünf Mark ab, wirklich, wirklich wahr.
M: Das ist nämlich auch das Gästeklo gewesen.
L: Und die Yvonne…dann kommt die Praktikantin und kümmert sich um die Andrea. Und wenn sie dann mal aufs Klo muß, die muß sich auch echt ab und zu richtig geekelt haben, weil das war widerlich, also es war nicht mehr schön, weil die Leute oft auch grade sich den Hintern abwischen und dann an den Lichtschalter und so, da hat's oft echt auch…also. Und da solltest du auf jeden Fall auch Sagrotan haben zum Beispiel
O:…das war ja da - am Ende.
L: Ja, also da war ich echt, also ich war so verbittert, und ich fühle mich wirklich so arg befreit jetzt, wo das endlich vorbei ist, und das war mich ganz arg schlimm, und das war mich auch wirklich eigentlich der Anlaß zum Ausziehen, schon bevor mir das klar wurde, daß ich irgendwie wegen der Ausbildung raus muß, das hat mich echt fertig gemacht, und das muß ja eigentlich nicht sein.
M: Jetzt grade das Klo?
L: Überhaupt, das Altglas, das Klo, die Küche…
I: Diese Dienste, diese Verantwortlichkeiten.
L: Ja, und daß ich einfach denke, das kannst du niemandem zumuten, dem Johannes, der da mittwochs nachmittags kommt, der kann da nicht einen Stack höher ins Klo gehen und die Andrea mal geschwind unten lassen. Der muß da drauf der muß und dann habe ich tatsächlich manchmal, wenn ich wußte, morgen ist Mittwoch, dann habe ich das Klo saubergemacht, daß die da ordentlich, daß die während ihrer Arbeitszeit auch mal austreten können - und wer bin ich denn? Und vor allem, wenn man dann halt mal angefangen hat, wenn eine Person angefangen hat, das zu machen, dann denken die anderen auch, die werden nie auf die Idee kommen, daran zu denken, das ist ja auch logisch, das ist ja auch meine eigene Schuld (ehem. BewohnerInnen o.A. :24-25)
Seit Beginn der Wohngemeinschaft wird von verschiedenen Beteiligten immer wieder vorgeschlagen, zur Bewältigung der Hausarbeiten eine Putzfrau/ einen Putzmann unterstützend anzustellen. Aus dem Rückblick der ehemaligen Mitbewohnerlnnen wird die Thematik und Entwicklung aufgerollt und zeigt eine ähnliche Problematik wie das Thema Außenassistenz Pflege (vgl. Kapitel Assistenz).
M: Eine Hilfe im Haushalt, daß einmal in der Woche jemand kommt. also ich hab' mich echt lang dagegen gewehrt - ich kann mich erinnern, daß wir, wo wir am Anfang grad mit dem Felix eine Diskussion gehabt haben, und ich war da vehement dagegen, daß man jemanden holt zum Putzen, aber…ja, wenn der Putzdienst klappt, wenn der Mittwoch geklappt hat, dann war's okay, aber wenn der halt nicht geklappt hat, dann war's nicht so gut.
L: Eigentlich soll´s ja klappen.
M: Ja, eigentlich soll 's klappen. Ich finde, eigentlich finde ich, sollte man schon fähig sein, daß man ein Haus zusammen in Schuß hält, daß das möglich ist.
L: Vor allem ist es ja, die Leute, die das nie lernen, die haben auch immer Probleme, oder sie ziehen irgendwann mit Leuten zusammen, die genauso Schweineigel sind, und das ist ja bei nicht behinderten Menschen das gleiche.
O: Das ist der besondere Kick an der Jurastraße, daß es das da eben nicht gibt, so im Gegensatz zu ~ was weiß ich -, im Heim oder so (ehem. BewohnerInnen o.A. :23)
Ein wichtiges Prinzip ist die Einbeziehung aller Bewohnerinnen in die alltäglichen Arbeitsprozesse (vgl. Putzplan). Dabei hat sich in der WG gezeigt, daß es vom ersten Tag an wichtig ist, jede einzelne Bewohnerin in die Alltagsarbeiten einzubinden. In den euphorischen Anfangszeiten der Wohngemeinschaft haben die BewohnerInnen ohne Assistenzbedarf zu oft Tätigkeiten übernommen, die gemeinsam oder auch selbständig von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf hätten erledigt werden können (Vgl. Jerg 1998; vgl. Kapitel 12 Aufnahmegespräch).
I: Mir wäre es eigentlich wichtig nochmal, was Sie sagen was Sie aus der Elternperspektive als wichtig erachten, wenn man so eine neue WG aufmacht, was Sie gerne weitergeben würden an andere Eltern und…
S: Daß man gleich am Anfang das klar sagt, daß die Leute mit Assistenzbedarf sich echt mit ein- setzen müssen und mithelfen müssen und daß da überhaupt nicht das aufkommen darf von Anfang an, wir sind die, die versorgt werden, und die anderen sind die, die uns versorgen, und das darf vom ersten Tag an nicht sein, das ist dann verkehrt.
P: Ich denke, es ist auch sehr sehr schwierig, es kommen wirklich verschiedene Personen zusammen
S: beim Tischdecken, du nimmst den Teller; ganz klar; daß das gar nicht aufkommt, daß die hinsitzen und sich den Tisch decken lassen, daß das ganz klar ist von Anfang an: wir sind eine gemeinsame WG, wir haben gemeinsame Pflichten, gemeinsame Rechte, und wir sind nicht die, die versorgt werden, überhaupt nicht, wir werden gleich von vorne (Mütter :17)
Aus den Erfahrungen der Jurastraße läßt sich an vielen Beispielen ablesen, wie entscheidend die Konzeption von Organisationshilfen wie „Wochenassistenzpläne“ ist. Diese Hilfen sind auch Ausdruck von Teilhabe und präsentieren das Ernstnehmen aller Bewohnerinnen. Es gab in den Anfangszeiten der Jurastraße sogenannte „Dienstpläne", in denen ausschließlich die Assistenzzeiten der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf aufgelistet wurden. Die Konsequenzen und Veränderungen wurden im ersten Bericht dargestellt (vgl. Jerg 1998 :58) und zeigen, daß das Einbezogen- sein ständig reflektiert werden muß, damit im Detail jede einzelne MitbewohnerIn das Gefühl der Mit-Verantwortlichkeit zugesprochen bekommt und dies sich in den Strukturhilfen wie Wochenplänen Assistenz widerspiegelt.
S: Und auf jeden Fall das Einbezogensein in die Tätigkeiten, das finde ich auch gut, daß wenn gewaschen wird daß jemand dabei ist zum Waschen und daß, wenn gekocht wird jemand dabei ist zum Kochen oder wenn man im Garten schafft, daß da jemand mitgeht.
P: So daß sie's langsam lernen auch, diese Selbständigkeit vor allem. Ich denke, manchmal sind auch die nichtbehinderten Bewohner einfach zu müde abends das verstehe ich auch, dann denken sie, das machen sie schon selbst, und dann ist es erledigt, das verstehe ich auch…
S: Sogar bei der Andrea, finde ich es wichtig, daß die auch beim Putzen und bei allem drum und dran einfach einbezogen wird. Duß wenn die anderen putzen, also egal, ob das jetzt sinnvoll ist, daß sie auch einen Gegenstand hat, den sie putzen muß und wo man dann ihr das gibt und sagt, so, das machst jetzt du sauber und möglichst noch einen Lappen oder irgendwas, das macht sie ja furchtbar gern. Und es ist eben das Einbeziehen.
I: Weil das schafft ja quasi dann auch die Frage, bin ich beteiligt oder nicht.
S: Bin ich mitbeteiligt und kann ich meine Fähigkeiten zeigen oder nicht oder bin ich einbezogen oder nicht.
P: Dann schlafen die Fähigkeiten irgendwann ein, das ist sehr schade, das sind die Erfolgserlebnisse.
S: Und vor allem, bin ich beteiligt, darf ich mitmachen, das ist auch wichtig, (Mütter :21-22)
Aus den bisherigen Erfahrungen der Wohngemeinschaft Jurastraße ist zu schließen, daß der Wunsch nach klaren Strukturen die Aufgabenverteilung im Haushalt von den Bewohnerinnen mit der Zeit selbst aufkam. Dies ist zum einen positiv zu bewerten, weil jede Wohngemeinschaft den Prozeß der eigenen Strukturierung selbst durchlaufen muß. Durch vorgefertigte Pläne, die von außen aufgesetzt werden, können Konflikte nicht verhindert werden. Der Prozeß des Erkennens weitere Regelungen ist eine wichtige Voraussetzung da, daß Ordnungspläne weitgehend auch umgesetzt werden. Die selbstgewählten Strukturen geben Anlaß zur Hoffnung, daß das Chaos und die Schwierigkeiten nicht auf eine übergeordnete Struktur abgewälzt werden können. Einen wichtigen Beitrag können Strukturhilfen von außen geben, wenn sie als Ideen in die Wohngemeinschaft hereingebracht werden, aber deren Einsatz in der Entscheidungskompetenz der Bewohnerinnen liegen.
Inhaltsverzeichnis
Das Konzept der LIW benötigt ein neues professionelles Verständnis, das in den folgenden Abschnitten beschrieben wird. Zunächst werden auf dem Hintergrund der personellen Strukturen die Erwartungen und Anforderungen an den hauptamtlichen Mitarbeiter formuliert. im Anschluß richtet sich der Blick auf die entscheidenden alltagsrelevanten Folgen, die sich aufgrund der Beteiligung von privaten Personen an der Assistenz das Aufgabengebiet des hauptamtlichen Mitarbeiters ergeben.
Alle professionellen bzw. institutionellen Stellen der lebensweltorientierten, integrativen Wohngemeinschaft (LIW) sind beim Wohngruppenverbund (Bereich innerhalb der Gustav-Werner-Stiftung) angesiedelt und in dessen Strukturen eingebunden.
Der Wohngemeinschaft stehen
-
ein hauptamtlicher Mitarbeiter und eine Vertretung Krankheit, Urlaub etc. aus dem Personalpool des Wohngruppenverbundes
-
ein Zivildienstleistender (sofern Bewerber vorhanden sind)
-
ein/e Praktikantin (FH Sozialwesen) (sofern Bewerberinnen vorhanden sind)
zur Verfügung.
Bei Bedarf können die Mitarbeiter sowohl den Leiter des Wohngruppenverbunds als auch die Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft Integration (AGI) mit einbeziehen. Zur Beratung steht auch der Psychologe des Wohngruppenverbundes zur Verfügung.
Die Stelle des hauptamtlichen Mitarbeiters ist eine Vollzeitstelle eine SozialpädagogIn/Heilpädagogln. Ca. 75 - 85% der Arbeitszeit können nach Angaben des hauptamtlichen Mitarbeiters die Aufgaben der Wohngemeinschaft einkalkuliert werden. Ca. 15 - 25% des Stundenkontingents fließen in übergeordnete Organisationsaufgaben und Besprechungstermine[16]
Die Aufgaben des hauptamtlichen Mitarbeiters werden in der Konzeption der Wohngemeinschaft wie folgt umrissen:
„…Der hauptamtliche Mitarbeiter ist verantwortlich und zuständig die Wohngemeinschaft im gesamten. Er hat darauf zu achten, daß alle Bewohnerlnnen in die Meinungs- und Entscheidungsfindung einbezogen werden und fungiert als Anwalt der verschiedenen Interessensgruppen. Er erledigt Verwaltungsangelegenheiten und erstellt Entwicklungsberichte die Kostenträger. Er ist Kontaktperson, Mittler und Vermittler im Verhältnis zur Gustav Werner Stiftung, der Arbeitsgemeinschaft Integration und den Angehörigen der BewohnerInnen mit Assistenzbedarf Als Vertreter des Trägers der Wohngemeinschaft ist er Inhaber des Hausrechts und vertritt die Wohngemeinschaft nach außen.
Er berät und unterstützt die Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf in allen Belangen des /Alltags. Sein pädagogisches Handeln leitet sich ab von dem zentralen Anliegen der Wohngemeinschaft, Selbstbestimmung und ein gleichberechtigtes Miteinander zu verwirklichen und umzusetzen. Die Bewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf leitet er, falls erforderlich, in ihrer „Assistenzfunktion “an. “ (Konzeption der Wohngemeinschaft Jurastraße 14)
Die Stelle des Zivildienstleistenden besteht vorwiegend zur Unterstützung in den Assistenzzeiten. Eine besondere Aufgabe innerhalb der Wohngemeinschaft ist, einen Nachmittag in der Woche den Assistenzdienst eine Bewohnerin zu übernehmen. Außerdem nimmt er als zusätzliche Personalressource an integrativen Freizeiten teil, die diese Bewohnerin besucht. Der Einsatz des Zivildienstleistenden ist innerhalb des Wohngruppenverbundes Hausmeistertätigkeiten in verschiedenen Wohn- gruppen, bei Umzügen oder Renovierungen u. ä. vorgesehen.
Die Praktikantin hat neben den Hospitationen in allen anderen Bereichen des Wohngruppenverbundes zwei zentrale Aufgabengebiete in der Wohngemeinschaft. Zum einen ist sie durch Assistenzdienste in den Alltag der Wohngemeinschaft eingebunden. Als weiteren Schwerpunkt sucht sie zusammen mit einer Bewohnerin mit Assistenzbedarf eine Aktivität aus (z. B. intensive Stadtteilerkundung einmal die Woche, Begleitung zu einem wöchentlichen Sportangebot).
Die folgenden Ausführungen zur Notwendigkeit und Qualität der professionellen Begleitung beziehen sich fast ausschließlich auf den hauptamtlichen Mitarbeiter. Deshalb soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, daß die Einbindung von PraktikantInnen und Zivildienstleistenden über den befristeten Zeitrahmen hinaus sehr positive Wirkungen zeigt: Ein Zivildienstleistender ist nach dem Zivildienst als Bewohner in die Wohngemeinschaft eingezogen. Eine Praktikantin ist bei Assistenzengpässen nach Abschluß des Praktikums immer wieder eingesprungen. Gerade im Hinblick auf die Schaffung eines aktiven Freundeskreises, der aufgrund der Privatsphäre nicht mit fremden Personen besetzt werden kann, hat sich diese Einbindung bewährt (vgl. Kapitel 3.5 Gemeinwesen).
Auch dem hauptamtlichen Mitarbeiter kommt in der LIW eine zentrale Rolle zu. Die heutigen Lebensbedingungen erfordern von den Bewohnerinnen Mobilität, Flexibilität und sonstige individuelle Bewältigungsleistungen. Daher können die Bewohnerinnen den gemeinsamen Alltag in einer LIW nur begrenzte Ressourcen bereitstellen. Außerdem sind gleichzeitig die gesellschaftlichen Voraussetzungen außerhalb der Wohngemeinschaft überhaupt nicht integrativ ausgerichtet, so daß hier jemand benötigt wird, der von außen den Alltag stützt und integrative Prozesse außerhalb der Wohngemeinschaft in Gang setzt.
U: Das ist auch die zentrale Figur; das muß man wirklich sagen, also neben anderen zentralen Figuren natürlich. Aber das haben wir ja gemerkt: in dem Moment, wo der Hauptamtliche fehlt, denke ich, da fehlt im Grunde genommen die Koordinationskraft in diesem Gebilde drin, und dann läuft's auseinander, das haben wir ja gemerkt, wie schnell das passiert, wie schnell plötzlich alles…man hat den Eindruck, man kriegt's nicht mehr zusammen. (Träger 115)
Die Notwendigkeit eines hauptamtlichen Mitarbeiters und die Unterstützung durch einen Zivildienstleistenden bzw. durch eine Praktikantin stehen heute nicht mehr in Frage. Nicht immer war diese Einsicht in diese personelle Unterstützung so eindeutig klar und bewußt. Eine Anekdote aus einem gemeinsamen Seminarbesuch von BewohnerInnen mit und ohne Assistenzbedarf und dem Mitarbeiter an der Fachhoch- schule zeigt den Wandel bzw. die bewußte Wahrnehmung der professionellen Hilfe:
F: Ja, das muß ein guter Diplomat sein. Aber so, genau das, was der Kurt macht, das ist wirklich Klasse. Aber den braucht man, wir haben ihn am Anfang mal brüskiert, da war eine Besprechung (Seminarbesuch) da hat uns dann jemand gefragt, ab das auch ohne Hauptamtlichen gehen würde, und wir sind alle dagehockt und haben überlegt, und der Kurt ist auch dagehockt und ist in den Stuhl reingesunken, und wir haben immer noch überlegt. Da ist halt nicht gleich ein Ja gekommen, so wie's jetzt wäre. Wir haben dann einfach überlegt: wäre es tatsächlich möglich - das war mein Gedanke -, wäre es wirklich möglich ohne ihn, das war mein Gedanke, wie wäre es ohne ihn, und ich hab' dann überlegt und überlegt. Ich habe nicht gesagt, ja, das ist klar das wäre unmöglich, das wäre ganz unmöglich.
E:…und das ganze Zeug, was da auf der Gustav-Werner-Stiftung läuft, also ich hätte du keine Lust, da mit irgend jemandem von denen zu verhandeln und da rumzuschlagen.
H: Und auch die Zeit. (Bewohnerinnen o.A. :19-20)
Die Diplomatie als Fähigkeit, die verschiedenen Parteien mit einzubeziehen und im Spiel zu halten, wird dem hauptamtlichen Mitarbeiter in den Gesprächen allseits zu- geschrieben. Diese Notwendigkeit einer Vermittlungsfunktion nach innen und außen wird immer wieder betont.
Konkret zeigt sich diese Vermittlungsfähigkeit die Bewohnerinnen an der Fähigkeit, sich offen auf ein WG-Leben einlassen zu können. Hier können eigene Wohngemeinschaftserfahrungen des hauptamtlichen Mitarbeiters von Vorteil sein. Eine weitere wesentliche Eigenschaft ist aus der Sicht der Bewohnerinnen die menschliche Kompetenz, die sich darin zeigt, daß er jeden einzelnen in der Wohngemeinschaft mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten annimmt und vertritt. Darüber hin - aus muß er seine Arbeit auch im Sinne einer sozialarbeiterischen Kompetenz verstehen und sich konkret bei der Bewältigung anfallender Arbeiten beteiligen. Gegenüber Interessen von außen, z. B. Institution, WfB und Eltern, kann er die Bedürfnisse der Bewohnerinnen vertreten. Menschen ohne Assistenzbedarf ist auch bewußt, daß eine Person vor Ort sein muß, die z. B. die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Assistenzbedarf im Blick behält, damit die Gefahr möglicher Ungleichheiten, die im gemeinsamen Alltag entstehen können, aufgegriffen und thematisiert wird.
M: Also ich finde das auch immens wichtig, derjenige, der das begleitet oder leitet oder wie immer man da sagt, daß der paßt und ja, und auch grade die Figur, die er sein muß, nach der Institution zu und uns zu, und ich hab' das immer positiv beim Kurt gefunden, daß er so gesagt hat, ja, er steht auf unserer Seite. Und natürlich ist klar, er muß die Rechte von den Menschen mit Behinderung auch wahren, und das wollen wir ja auch, aber trotzdem so der Institution zu und von mir aus den Eltern auch zu, also ja, daß man sich, daß wir nicht aufpassen müssen bei ihm, daß man hat denken müssen, oh je, was hab' ich jetzt wieder gesagt oder so, sondern man hat wirklich einfach sein können, wie man ist, und ich hab' nie das Gefühl gehabt, ich muß mich anders geben wie ich bin, sondern ja, ich finde, der hat wirklich probiert, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und natürlich hat er manchmal vielleicht nicht alles gut gefunden oder ja, also dem seine Rolle finde ich schon nicht einfach. Das diplomatische Geschick...ja…
M: Also ich finde, ihm muß vielleicht auch das WG-Leben einfach nicht fremd sein, der muß einfach wissen, wie das ist und was vorkommen kann, wenn Leute zusammen wohnen und wenn viele Leute zusammen wohnen und ja, muß eine Offenheit in der Gesinnung haben…
M: Und ich denke, ja, die Person sollte einfach auch die Bereitschaft ausstrahlen, einfach auch praktisch mitzuhelfen, denn ich denke, auf das kommt´s einfach manchmal an, also das hab' ich manchmal beim Kurt wirklich toll gefunden, wenn er gekommen ist und den Putzeimer gepackt hat Ich meine, wenn du allein dahockst, dann denkst du auch Sch..., nein, dann putze ich auch nicht, aber wenn er dann kommt, dann denkst du dann auch, aka)/, jetzt machen wir's, und ich hab's auch gut gefunden in der Ausschreibung, das ist nicht SozPäd ausgeschrieben gewesen, sondern das ist. …
L: ...Aber dann auf jeden Fall sehr viel Wert legen auch aufs Praktische und aufs Spontane und aufs Flexible…
O: Was die Monika sagte, ich fand das vorhin ganz richtig, menschlich kompetent, das fand ich super ausgedrückt. (ehem. Bewohnerinnen o.A. :41-42)
Die menschliche Qualität bzw. Kompetenz des Professionellen wird besonders be- tont. Damit kommt zum Ausdruck, daß eine pädagogische Kraft, die sich in ihrer Funktion über die Bewohnerinnen stellt, indem sie als der Wissende auftritt und sich von den Bewohnerinnen als Fachkraft abhebt, wenig Akzeptanz erfahren wird.
Sprachlich etwas anders gefärbt, aber von der inhaltlichen Intension in die gleiche Richtung gehend, sehen die Mütter die Hauptaufgabe des hauptamtlichen Mitarbeiters in der Anwaltsfunktion alle Beteiligten. Als Ansprechpartner hat er die Aufgabe, eine Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen herzustellen und somit eine stabile Struktur im Alltag zu gewähren. Auch schätzen sie die Situation ähnlich wie die anderen Gruppen ein: Ohne den hauptamtlichen Mitarbeiter gerät die Wohngemeinschaft in existenzielle Schwierigkeiten.
S: Und da muß ich sagen, es ist eigentlich das Tolle, daß es einen Hauptamtlichen gibt, das wird ja bei uns immer mal wieder diskutiert, braucht man das überhaupt oder nicht, und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt, das muß ich echt sagen, daß das ganz wichtig ist.
I: was ist der wichtig?
S: eine stabile Struktur wiederum.
P: Wenn das nicht wäre, es würde auseinanderbrechen.
S: Es würde ganz schnell auseinanderbrechen, als Anwalt die Leute mit Behinderung, als Anwalt die Leute ohne Behinderung und als Anwalt die Eltern.
P: Das ist etwas ganz Wichtiges, unbedingt. Wer wäre denn sonst der Ansprechpartner; sonst mußte ja einer der Nichtbehinderten…
S: Sonst würde es einer aus der WG werden, der sich am besten eignet. Das halte ich ganz schlecht, weil 's dann Hierarchien gibt…
R: Richtig, und er guckt ja wirklich nach allem. Er hat die Birgit gefragt nach ihrem Ausweis, dann hab' ich gesagt, nein nein, Ende Mai brauchst du erst eine neue Marke, also er guckt ja wirklich in der Hinsicht nach allem, also da muß ich ihn dann wirklich loben,
S: .Ja, und das sind auch Aufgaben, die die nicht übernehmen können, die Leute, die Mitbewohner; das wird dann einfach zuviel an Aufgaben auch.
R: Oder auch so, wie er das jetzt beim letzten Gespräch im Nepomuk, daß er mit allen zur Krebsvorsorge gegangen ist…
P: Ja, auch die Gedanken, die er sich macht…
R: Sagen wir auch so, daß die Birgit das jetzt eingesehen hat, daß solche Sachen sein müssen, Nein, es war furchtbar wenn die Birgit einen weißen Mantel sah, obwohl ja die Ärzte heute auch kaum mehr einen weißen Mantel anhaben, dann hat die geschrien. Die ging mir zu keinem Arzt, die ging zu keinem Arzt, das wird wieder besser; Mutti, und morgen sieht das wieder anders aus und alles so. Und seit sie in der Jurastraße, der Kurt hat sie bewogen, daß sie zum Frauenarzt geht, was ja bei einem Mädel mit 33 Jahren wirklich wichtig ist. Sie geht alleine zum Zahnarzt, sie geht alleine zu dem Arzt, den sie da haben und so, also das finde ich ja wirklich toll, also in der Hinsicht hat sie sich schon…
R: Und es ist ja nicht bloß so, daß der Hauptamtliche dort in der WG ist, denn auch gibt es Probleme dort in der Werkstatt, dann ist ja der Kurt auch da, er ist ja auch da, und wer will das denn sonst machen? Also in der Hinsicht finde ich das schon wichtig (Mütter 32-34)
Zwei Aspekte, die im Gespräch der Mütter angesprochen werden - die zeitlichen Ressourcen der Bewohnerinnen und die neutrale Position des hauptamtlichen Mitarbeiters - sollen anhand von Aussagen der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf vertieft werden.
Zunächst zu den zeitlichen Ressourcen der Bewohnerinnen. Viele Alltagsaufgaben, wie z. B. der Kontakt zu der Arbeitsstelle der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, die regelmäßige Wahrnehmung von Arztterminen, der Kontakt zu den Eltern, Assistenzleistungen am Nachmittag u. a., können von den Bewohnerinnen zeitlich gar nicht geleistet und kontinuierlich übernommen werden. Darüber hinaus erfordern die organisatorischen Aufgaben, wie z. B, die ganzen Abrechnungsmodalitäten, Verwaltung von Etats, Formalitäten der Institution sowie die Organisation der Assistenzleistungen, ein hohes Maß an Verantwortungsübernahme und Disziplin, die den meisten Bewohnerinnen fremd sind bzw. sie z. T. überfordern würden.
F: …Ich wußte am Anfang gar nicht, daß es das gibt, und ich bin inzwischen heilfroh, daß wir die (Mitarbeiter, Zivi, Praktikantlnnen) haben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
I: Ja, kannst du sagen, warum, also warum das wichtig ist?
F: Weil 's ganz einfach erleichtert, weißt du, so viel Zeit hat man gar nicht, das ist einfach eine zeitliche Geschichte auch, wir schaffen ja alle und das ist, wenn jetzt der Xaver (Zivildienstleistender nicht da wäre, dann mußten wir das untereinander verteilen, einfach von der Zeit her schon. Wann willst du das machen? Und allein mittwochs nachmittags, da ist keine Sau im Haus…herkommen und dann tut die Andrea den Walter plagen und dann sagen, du hackst jetzt da hin, das ist einfach so, das wäre unmöglich. Und dann auch so mal, ich empfinde es jetzt grade schon so, ich muß mal gucken, wie das weitergeht, ich' habe grade keine Beziehung, keine Freundin, aber ich habe mir wirklich schon so Gedanken gemacht, ganz theoretisch, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, was wäre das? Ich hätte gar keine Zeit das Weib, ich wußte nicht wann, mal ein bißchen tagsüber, aber wenn die vielleicht schafft sogar, dann könnten wir uns einmal in der Woche sehen oder so, von daher noch mehr - weißt du, wie ich meine? - rein zeitlich. Und darum ist das alles ganz wichtig, auch mit Zivis, Praktikanten, Praktikantinnen oder was und der Kurt natürlich, der macht das ganze Organisatorische, da bin ich heilfroh, daß ich das nicht machen muß, also den ganzen Papierkram. Und dann zum Arzt gehen (Bewohnerlnnen 0.A. :7-8)
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Neutralität des hauptamtlichen Mitarbeiters. Die strukturelle Einbindung von außen gibt ihm die Chance, zu allen eine Beziehung aufzubauen und Distanz zu wahren. Die ständige Erreichbarkeit (oder auch die Möglichkeit, den Bereitschaftsdienst des Wohngruppenverbundes in Anspruch zu nehmen) bietet den Bewohnerinnen eine Sicherheit und Entlastung brenzlige Situationen, die durch schwere Anfälle einer Bewohnerin in der Wohngemeinschaft, besonders neue Mitbewohnerinnen, bedrohlich sind.
H: Ich finde es halt auch ungemein wichtig, daß der Kurt so eine Art Person ausübt, wo ziemlich neutral ist und wo die Leute mit Unterstützung einen Ansprechpartner haben, genauso wie wir auch und daß die, wie man vorher schon gesagt hat, so diplomatisch zwischen den Seiten da verhandelt und daß zusätzlich auch die Nummer da ist mit dem Handy, und ich denke, daß das auch wichtig ist andere WGs, die aufgebaut werden, daß das so eine Art Sicherheit schafft, falls etwas wäre und man sich da vielleicht eher unsicher wäre, was man da jetzt zu tun und zu lassen hat, jetzt grade im Fall Andrea oder so was zum Beispiel. (Bewohnerinnen o.A. :22)
Das Arbeitsfeld einer LIW stellt Anforderungen an einen hauptamtlichen Mitarbeiter, die Arbeit vor dem Hintergrund zu sehen, daß hier eine Zusammenarbeit mit erwachsenen Personen den Gegenstand der Tätigkeit kennzeichnet, Nicht „pädagogische Interventionen“, sondern die Fähigkeit, den unterschiedlichen Bedürfnissen und lnteressen eine Plattform zu bieten, gemeinsam mit den jeweils Betroffenen eine gelingendere Alltagsbewältigung zu erproben, sind zentrale Aufgabenstellungen (vgl. Kapitel 11 Selbstbestimmung).
Gerade in der LIW gibt es nicht das klassische Verhältnis von Klienten und Professionellen, sondern auch die Existenz von Bewohnerlnnen, die in kein Betreuungsverhältnis eingebunden sind. Dies erfordert ein hohes Maß an Distanz zu klassischen Vorstellungen pädagogischer Betreuungsverhältnisse und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beteiligten.
G: Als Grundteam war das auch so gut, weißt du, wir vier mit dem Kurt, daß das auch eine freundschaftliche Ebene ist, daß er nicht bloß unser Chef da ist, der uns sagt, wo's langgeht und daß der uns eher dann so drückt, sondern eher, der lobt uns auch ganz oft und freut sich, daß er hier ist und daß wir das Gefühl haben, wir werden ernst genommen. (BewohnerInnen o.A. :22)
Bei den BewohnerInnen mit Assistenzbedarf wird sichtbar, daß sie ihre Fragen zur Arbeit, Familie, Freizeit etc. den hauptamtlichen Mitarbeiter, der da da ist, als Bezugsperson wählen. Vor allem in Zeiten, in denen der hauptamtliche Mitarbeiter nicht zur Verfügung steht bzw. vertreten wird, zeigt sich, wie wichtig dieser nicht-mit- wohnende Ansprechpartner ist.
S: … aber auch so eine väterliche Rolle hat, also das hab' ich letzten Montag ganz deutlich gesehen, wie da die Birgit kam, und der Kurt war nicht da. Sie hatte das wohl gewußt, weil das irgendwie durchschien, daß sie das gewußt hat, daß der Kurt nicht da ist, dann hat sie immer gesagt, ich bin ganz verwirrt, ich weiß gar nicht, was los ist, was ist eigentlich da, und das lief immer darauf hinaus, daß der Kurt nicht da ist, und den hat sie total vermißt, weil der sie der Ansprechpartner ist, wo sie dann am Wochenende und so alles loswerden kann, (Träger 113)
Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf bringen in ihren Beispielen die vielfältigen Erwartungen an den hauptamtlichen Mitarbeiter zum Ausdruck. Sie sehen ihn als eine Vertrauensperson, die die eigenen Themen ein offenes Ohr hat, die wichtigen Termine im Alltag im Blick behält, nach außen die Vermittlung übernimmt und alltagspraktische Assistenz auch zur Verfügung steht.
I: was braucht man den Kurt?
B: s Aufstehen.
C: Vier Augen.
I: Unter vier Augen sprechen zu können?
A: Ja.
D: Zum Einkaufen (alle lachen).
C: s Geld.
D: Der Lumpensack.
C: Babyfon.
I: Zum Anrufen.
R: Daß es immer funktioniert und bereit steht und der Nachtdienst geregelt ist.
C: Ja. Arzttermine.
I: Fällt euch noch was ein?
C: Mit den Eltern zusammensitzen. (Bewohnerinnen m. A. :8)
Die unterschiedlichen Lebensbiographien und die bisherigen Lebenswelten von BewohnerInnen mit und ohne Assistenzbedarf haben zur Folge, daß die Erwartungen an die Rolle des hauptamtlichen Mitarbeiters unterschiedlich ausfallen. Die Bewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf legen sich ein partnerschaftliches Miteinander als Ausgangsbasis der Beziehung zum hauptamtlichen Mitarbeiter zugrunde. Die Erwartungen der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf richten sich viel stärker auf die pädagogische Funktion des hauptamtlichen Mitarbeiters. Obwohl beide Gruppen auf unterschiedlicher Ebene Gesprächs- und Assistenzbedarf einfordern, zeigt sich bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, daß sie in einem weitaus stärkeren Maß auf die Kontinuität und damit auf die Sicherheit eines hauptamtlichen Ansprechpartners angewiesen sind. Ein Grund liegt wahrscheinlich darin, daß die veränderten Lebensbedingungen durch den Einzug in die LIW Menschen mit Assistenzbedarf ein weitaus größerer Schritt aus völlig anders organisierten Lebensverhältnissen darstellt (vgl. Kapitel 7).
J: Da ist gleich mich ein Unterschied, weil wenn ich zum Beispiel mich dann mit der Birgit (Bewohnerin m. A.) unterhalte, dann ist mich so ganz klar; die spricht mich immer ganz klar in der Funktion als Mitarbeiter an. Die sagt auch, du bist so wie der Kurt, und dein Job ist doch das und das, und du kennst auch die verschiedenen Leute in der WfB, und da denke ich wieder; ja klar; es ist wichtig, daß ich ihr jetzt zuhöre und ihr auch ein bißchen die Sicherheit gebe, ernstgenommen zu werden. Und bei der Andrea (BewohnerIn m. A.) ist's auch ganz klar definiert, was ich zu tun habe, und das Gespräch läuft auf einer ganz anderen Ebene ab, wie jetzt zum Beispiel mit dem Felix oder mit der Monika (beides BewohnerInnen o. A.). Das ist eine ganz andere Ebene. Genauso jetzt mit dem David (Bewohner m. A.). Da muß ich auch immer wieder gucken, da versuche ich, ihn mit einzubeziehen. Ich versuche nicht, Menschen ohne Behinderungen jetzt in irgendwas mit einzubeziehen, weil ich einfach denke, das können die jetzt, die Eigenverantwortung haben die selber, aber der David hat sie nicht, der hat den Überblick nicht, da muß ich wirklich konkret sagen, mach' jetzt mal das und wie wäre das, wenn du jetzt den Tisch decken würdest. Ich muß da immer so Impulse schaffen, also jetzt im Alltag draußen - ich sehe schon einen großen Unterschied, keine Frage. Und auch da, Menschen mit Behinderungen, da kann es zu jedem einzelnen auch eine unterschiedliche Beziehung geben, das finde ich schon, aber die ist mich schon auf einer ganz anderen Ebene. Ich arbeite eher, denke ich, wirklich bewußter als Pädagoge, als Erzieher, der wirklich bewußt versucht, bestimmte Dinge an die Leute ranzubringen oder mit ihnen zu bearbeiten, das ist mich schon ein großer Unterschied.
I: Wie ist's euch? Wie stellt sich das euch dar?
J: Und ich merke das, die Birgit zum Beispiel, die kriegt das ganz gut auf den Punkt, so wie du's grade gesagt hast, die weiß ganz genau, wer von wo kommt und welche Jobs die haben und so, ganz klar: Und auch die Monika (Bewohnerin o. A.), die kam auch schon her und hat mir van ihren Schwierigkeiten in der WG berichtet und hat gemeint, na ja, du mußt dir das ja auch anhören, du bist ja auch Mitarbeiter Dann hab' ich gesagt: klar; richtig, das ist mein Job, da bin ich auch da. Also so wird das schon wahrgenommen.
Y: Also mir schwebt grade ein Bild vor den Augen…der Kurt ist noch nicht da, und er kommt zur Tür herein - hecht. Also ich denke, die persönliche Präsenz von den Mitarbeitern ist da zum Teil eine große Sicherheit. (Mitarbeiter :31-32)
Begleiten statt betreuen, Dieser Paradigmawechsel, der in einer Veröffentlichung der Lebenshilfe (vgl. Hähner 1997) ausführlich dargestellt wird und der Konzeption zugrunde gelegt wurde, soll in der LIW praktisch umgesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Grundgedanke besteht in der Haltung, so wenig wie möglich Pädagogik und Profession einzubinden. damit darüber nicht der institutionelle Charakter verstärkt wird. Eine Aufgabe, die den hauptamtlichen Mitarbeiter nicht einfach zu realisieren ist, wie die Ausführungen im weiteren zeigen werden, aber dennoch durch gute Ausgangsbedingungen gekennzeichnet ist.
V: Also mir wäre ein Punkt wichtig, jetzt nicht, um das als Ziel zu formulieren, aber das doch halt zu überprüfen. Also grade auf dem Hintergrund der Diskussion, die wir jetzt geführt haben - auch die Eltern haben Erwartungen, und die klar formulierten Erwartungen, die wir damals in der Konzeptionsphase geäußert haben bzw. die damals von euch geäußert wurden, waren keine weitere Pädagogisierung, keine Therapeutisierung des Alltags, damit möglichst normales, in Anführungszeichen, Zusammenleben möglich ist. Und ich denke, jetzt grade noch auf die Person des Hauptamtlichen bezogen, ist das ja so eine der schwierigsten Ausgangspositionen und zwar im Hinblick auf beide Gruppen im Haus. (Träger :19)
Die Voraussetzungen diese Umsetzung sind in einer LIW günstig, weil aufgrund der permanenten Anwesenheit von Bewohnerinnen ohne Betreuungsauftrag kein klassisches Betreuungsverhältnis die Basis der Arbeit darstellt. Die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf nehmen deshalb die Stellung eines Korrektivs ein. Sie präsentieren allzeit den privaten Charakter des Wohnens und zwingen somit den hauptamtlichen Mitarbeiter, alle institutionellen Regelungen zu begründen und auszuhandeln.
T: Aber das haben wir schon, Weichen gestellt, also ich denke, einen Aspekt, da werde ich immer wieder gefragt, aber was eine Ausbildung haben denn dann die Leute (BewohnerInnen), die denken alle, das müssen hochqualifiziert ausgebildete Sozialpädagogen sein, daß wir gesagt haben, nein, ganz bewußt, lieber ganz normale. Das ist zum Beispiel auch so was, was sicher die Selbstbestimmung indirekt reguliert, die haben nämlich nicht den Ansatz, daß die sich ein pädagogisches Konzept zurechtlegen, wie man der Andrea jetzt Bildkarten herstellt zwecks Backens eines Kuchens, sondern da backt man halt. (Träger 239)
Gleichzeitig hat das gemeinsame Zusammenleben zur Folge, daß unter dem Gleichberechtigungsparadigma eine grundsätzliche andere „Behandlung“ der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf nicht ohne Widerstände möglich ist. Diese strukturellen Voraussetzungen geben den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die Möglichkeit, bei Fragen der Ungleichbehandlung, Bevormundung oder Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte auf die gleichen Freiheits- und Entscheidungsrechte hinzuweisen.
K: Das ist ja auch etwas Besonderes in der WG, daß es von Anfang an geheißen hat, so wenig wie möglich Fachlichkeit da reinzustecken, sondern die große Überschrift in der Jurastraße besteht darin, gemeinsam leben, daß es einem gut geht, daß man lachen kann, daß es einem Freude macht, dort zu leben. Und so wenig wie möglich sozialpädagogische Organisation und Pläne und Struktur und piepapo, sondern da mit reingehen und leben und so im Hintergrund versuchen, den Alltag mit zu organisieren oder so zu strukturieren.
J: Aber das Heiße ist ja das, als du kamst, da gab's eine Zeit, da haben die einfach ohne Hauptamtlichen arbeiten müssen, da war das absolute Chaos, da ging's darum, geht die WG den Bach runter. Und alle, habe ich so im Nachhinein dann feststellen müssen, waren eigentlich ganz froh drum, nachdem du das so strukturiert hast. Da war wirklich, da lief 's dann wieder, und da kam überhaupt kein Widerspruch, das ist uns zuviel, das ist uns zu außengesteuert, sonst was, nein, im Gegenteil, das ist das Heiße.
K: Ja, trotzdem muß ich aufpassen, weißt du, das geht auch bloß bis zu einem gewissen Niveau, und weiter darf ich's aber nicht machen, weißt du, daß ich anfange bei den Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf zum Beispiel, Arbeitspläne zu erstellen, oder wie sagt man da, nicht Arbeitspläne…
I: Förderpläne.
K: Ja, Förderpläne auf zwei, drei Jahre hin, mit den anderen (BewohnerInnen o. A.) mache ich's ja auch nicht so.
J: Das ist auch keine Schule! (Mitarbeiter :53)
Die LlW bietet eine Basis bzw. ein Erprobungsfeld das Empowermentprinzip, die Selbstbemächtigung von Menschen mit Assistenzbedarf: soviel Autonomie wie möglich und soviel Begleitung bzw. Hilfe wie nötig. Dabei ergeben sich im Alltag viele Schwierigkeiten bei der Umsetzung, so daß die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit dem hauptamtlichen Mitarbeiter ein hohes Maß an Konfliktmanagement ab- verlangt (vgl. auch Kapitel Assistenz und Selbstbestimmung).
K: Weißt du, ich denke, wie werden da auch manchmal Konflikte ausgehandelt oder miteinander ausgetragen, wenn wir Hauptamtliche nicht da sind Das ist das, was ich denke, was in der WG nicht funktioniert. Zum Beispiel, das war ja ein WG-Punkt letzten Mittwoch, dieser Konflikt Clara, David und Birgit, das haben die WGler untereinander: die täglich miteinander wohnen oder leben, nicht auf die Reihe gekriegt, sondern da brauchen sie einen SozPäd in der WG- Besprechung, der das organisiert, der das anspricht, der praktisch das ordnet und organisiert. Das ist mich ein Armutszeugnis die WG untereinander, wie die miteinander umgehen oder wie die auch miteinander auskommen. Freilich fühle ich mich geehrt, die brauchen mich, aber in dem Moment, muß ich sagen, wäre es mir anders eigentlich lieben Nicht, weil ich die Arbeit nicht machen will, sondern weil ich manchmal wirklich die WG nicht verstehe.
J: Aber es heißt ja, das hast du ja vorher selber gesagt, möglichst wenig Fachlichkeit.
K: Genau, da wird sie aber voll verlangt. Also der Anspruch ist wieder ganz woanders, und auch du geht man, von der Konzeption her; stellenweise einfach abgehoben und das, was ich so tag- täglich mitkriege, ist einfach eine andere Geschichte. (Mitarbeiter: 64)
Diese Diskrepanz bei der Umsetzung vom Empowermentansatz wird im Bereich der Behindertenhilfe thematisiert und ein Weg der kleinen Schritte eingefordert (vgl. Theunissen 1995 :21ff), den die Mitarbeiter der LIW aus ihren Erfahrungen bestätigen.
K: Aber man muß das einfach längerfristig sehen und kurzfristig in kleinen Schritten, so sehe ich das, kurzfristig in ganz kleinen Nuancen kannst du da was leben und etwas organisieren und das halt auf eine ganz lange Perspektive. (Mitarbeiter :52)
Die Aufgaben und Funktionen eines hauptamtlichen Mitarbeiters in einer LIW müssen vor dem Hintergrund der strukturellen Basis betrachtet werden. Die folgenden Aspekte scheinen mir besonders relevant die konkreten Ausführungen zur alltäglichen Arbeit des hauptamtlichen Mitarbeiters.
Die zur Verfügung stehenden Assistenzressourcen sind in der Wohngemeinschaft ein Dauerthema (vgl. Ausführungen im Kapitel Assistenz). Aus Sicht der Mitarbeiter und Praktikantin müßten die vorhandenen Kapazitätsmöglichkeiten kontinuierlich besetzt werden, damit der Assistenzbedarf befriedigend gedeckt werden kann. So- wohl die Zivildienststelle als auch die Praktikantlnnenstelle sind nicht durchgängig zu besetzen, und z. T. ergeben sich bei Neubesetzungen längere Besetzungslücken.
Y: Also ich denke, es sollte dann halt Voraussetzung sein, daß dann professionelle Mitarbeit aufgestockt werden muß, also daß einfach prinzipiell eine Praktikantenstelle mindestens toujours, also permanent in der Jurastraße besetzt wird und die Zivildienststelle.
K: Da sind wir jetzt wieder auf einem anderen Dampfer; wie vorher der Johannes gesagt hat, er wünscht sich's eigentlich eher so ohne diese ganzen Hauptamtlichen, aber wenn man sagt, so eine stärker behinderte Frau soll dort wohnen, dann mußte das von der Institution her noch mehr abgedeckt werden. (Mitarbeiter: 24)
Bei der Berechnung der professionellen und institutionellen Unterstützung bedarf es einer kritischen Betrachtung von effizienten Assistenzberechnungen. immer wieder taucht die Frage auf, wieso die bestehenden Kapazitäten nicht ausreichen, auch auf dem Hintergrund, daß in der Regel die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf tagsüber in der WfB arbeiten. Gemeinsam wohnen läßt sich nicht so einfach einteilen in „Assistenzzeiten“ und „Freie Zeiten“. Auch die von außen kommenden Begleitpersonen zeigt sich die Qualität der Arbeit in der kontinuierlichen Präsenz, im Möglichkeits- raum als Ansprechpartner in Anspruch genommen zu werden. Raum und Zeit zu gewähren sind deshalb qualitative Dimensionen, die ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis sich entwickeln lassen können.
J:Indem man Raum und Zeit gibt. Also ich sehe das grade immer, ich beziehe das immer auf da hat's einfach Vertrauen, Raum und Zeit, die den Menschen gegeben sind, sich zu äußern, zu schwarzen, zuzuhören und ein Vertrauen zu geben.
K: Ja, du brauchst die Zeit einfach. Also man kann nicht einfach herkommen und sagen, so und jetzt sprich dich aus, sondern das muß auch, also wenn die Bewohnerin zum Beispiel das Bedürfnis hat, sich aussprechen zu müssen oder zu wollen, dann muß man einfach dasein, das heißt, regelmäßige Anwesenheit von den anderen, das heißt Hauptverantwortlicher oder auch ein Mensch ohne Behinderung und da auch Zeit haben. (Mitarbeiter:26)
Jede Wohnform in der Behindertenhilfe legt die Berechnung des Assistenz- schlüssels und somit den Umfang einer hauptamtlichen Person den regulär gülti- gen bzw. verhandelten Personalschlüssei zugrunde. Dieses sogenannte Betreuungs- verhältnis bezieht sich in der LIW ausschließlich auf die Bewohnerinnen mit Assi- stenzbedarf. im Alltag zeigt sich aber, daß auch die Bewohnerinnen ohne Assistenz- bedarf fachlich begleitet und beraten werden müssen. Darüber hinaus werden auch die private Situation bzw. die privaten Bewältigungsschwierigkeiten Gegenstand der Beziehungen zwischen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf und hauptamtlichem Mitarbeiter. Aus diesem Grund kann hier nicht einfach von einem „Betreuungs“- verhältnis von vier Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ausgegangen werden, son- dern müssen auch Ressourcen die Begleitung der Bewohnerinnen ohne Assi- stenzbedarf miteinkalkuliert werden.
J: Ja, aber trotzdem, das ist ein altes Thema, also wir haben dann schon drüber gesprochen, daß du ja auch gesagt hast, du hast nicht vier, die du zuständig bist, sondern acht. Ja, wenn's einfach darum ging, die Dienste abzuklären oder warum der eine jetzt mit dem anderen Schwierigkeiten hat im Zusammenleben oder so, also da war dann immer der Hauptverantwortliche da entsprechend dann auch noch als Berater Ich denke schon, also man kann nicht einfach sagen, es gibt vier Menschen, die man zu betreuen hat, sondern das sind nicht; je nachdem auch, Das kommt immer darauf an, auf die persönlichen Verhältnisse, in denen die jetzt momentan leben, das verändert sich ja auch. Und man merkt schon auch, wenn jemand privat besonders belastet ist, weil sich das ja dann auch auf das Zusammenleben auswirkt, und da habe ich schon den Eindruck, daß in solchen Situationen der Hauptverantwortliche sehr gefragt ist und wirklich da auch beratend und anleitend tätig ist, auch bei Menschen ohne Behinderungen, auf jeden Fall, das ist immer Thema.
K: Es kommt halt auch auf die Beziehung an, die du dann hast zu den Menschen ohne Behinderungen, daß sie dann auch Zutrauen haben zu dir, daß sie kommen mit ihren Anliegen, nicht nur WG-mäßig, sondern auch mit ihren privaten Sachen, Aber das kommt drauf an, wie du als Mensch auf sie wirkst, was du ausstrahlst sozusagen, denke ich auch.
J: .la, ich denke, da kommt auch das hinzu, wie man sich selber dann einbringt und sich selbst dann offenbart. (Mitarbeiter 133)
Zu bedenken gilt auch, daß die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf einen nicht unproblematischen Status zugeschrieben bekommen, nämlich einerseits den der Mitbewohnerin, andererseits den der Assistenzleistenden, so daß hier auch auf die jeweils individuelle Lebenssituation eingegangen werden muß. Die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf haben ein Recht darauf, ihre Assistenzleistungen auch eine qualifizierte Begleitung zu emailen. Dies erscheint deshalb erforderlich, weil die Qualität einer LIW maßgeblich von der Kontinuität und dem Wohlbefinden der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf abhängig ist.
K: Also bei den Menschen ohne Behinderung kann ich mir vorstellen, daß es auch ganz arg wichtig ist, daß sie berücksichtigt werden als Individuum mit ihren ganzen persönlichen Aufs und Abs, daß sich nicht nur irgendwelche Menschen sind, die jetzt dort wohnen, die ihre Dienste abzuleisten haben und die einfach da sein müssen. Das ist ja immer diese Gratwanderung, daß sie eigentlich auch Fachkräfte sind und dann trotzdem keine sein dürfen etc. etc., daß es oft den Eltern aus dem Mund rausrutscht, daß sie auch Betreuer sind, obwohl sie keine Betreuer sein wollen, daß man die Menschen dann ohne Behinderung dann auch berücksichtigt in ihrer speziellen Lebenssituation, wo sie grade sind, daß das Sicherheit auch gibt. Guck mal her, der sieht das, die anderen sehen das und die gewähren mir das, daß ich jemand zum Beispiel, daß ich das mit einbringe in der WG-Besprechung, daß ich sage, ich möchte, daß jetzt die und die Person zum Beispiel vierzehn Tage oder drei Wochen oder vier Wochen bei dem Dienstplan nicht berücksichtigt wird, weil ich grade sehe, er oder sie ist jetzt grade ganz arg belastet. Wir versuchen, das jetzt mal ohne diese Person hinzukriegen, daß die Person Luft hat, von der WG her; und sich um andere Sachen kümmern kann, damit sie nachher wieder besser reinkommt, Wenn du das nicht machst oder alles immer nur über einen Kamm scherst, dann ist auch ruckizucki ist es dann dicht. Der sagt, ich kann nicht mehn ich will hier nicht mehr, man sieht ja nicht, wer ich bin und was grade mit mir los ist, dann gehe ich, weil's mich zu arg belastet, (Mitarbeiter 134-35)
Kann auch eine intensive Begleitung der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf gewährt und somit auch die Sorge das Wohlbefinden aller Bewohnerinnen übernommen werden, sind auch den hauptamtlichen Mitarbeiter spürbare Entlastungen in der Verantwortung integrative Situationen zu erwarten. Zwei strukturelle Möglichkeiten der LIW, die hierzu besonders hervorzuheben sind, sollen aufgeführt werden.
Der gemeinsame Alltag von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf, mit seiner Vielfalt von Lebensstilen und Bewältigungsstrategien auf engem Raum, bietet Chancen, den Handlungsspielraum der einen oder anderen Bewohnerin zu erweitern. Auf dem Hintergrund, daß sich Menschen jeglichen Alters unter Gleichgestellten viele Anregungen die eigene Lebensbewältigung holen und institutionalisierte und professionalisierte Beziehungen auch an Grenzen in der Vermittlung von Handlungskompetenzen stoßen, kann die LIW hier ein breites Anregungsmilieu zur Erprobung von Handlungsmöglichkeiten bereitstellen.
J: Ja, grade die Leute mit Behinderungen ist es vielleicht gar nicht schlecht, Da sind jetzt einfach noch vier andere Leute ohne Behinderung, jetzt in Anführungszeichen, die auch unter- schiedliche Lebensstile haben, wo man sich vielleicht dann von dem was abgucken kann und von dem, daß man denkt, der macht das, dann kann ich das vielleicht auch mal machen. Oder der nimmt sich da jetzt das raus, der braucht da seinen Freiraum und ja da wird man ja vielleicht auch nochmal anders angeregt als daheim. (Mitarbeiter :37)
Ein weiterer struktureller Vorteil der LIW liegt darin, daß die Verantwortung eine gelingende Alltagsbewältigung und ein Sich-wohl-fühlen in der Wohngemeinschaft nicht ausschließlich auf den Schultern der hauptamtlichen Mitarbeiter zu tragen ist. Auch wenn an anderer Stelle die Notwendigkeit eines hauptamtlichen Mitarbeiters die Kontinuität der Wohngemeinschaft hervorgehoben wird, bleibt als Besonderheit der LIW, daß der Blick auf den Beitrag jedes einzelnen nicht verlorengeht. Nicht nur in schwierigen und stressigen Situationen hat sich gezeigt, daß Verantwortung auf unterschiedlichen Ebenen von allen Bewohnerinnen übernommen wird.
U: Der Grund ist doch den du bist nicht allein da verantwortlich sozusagen, daß du diese Situation so steuerst, daß akzeptable Bedingungen alle rauskommen. Es sind die wenigsten, also alle, in der Jurastraße sind alle, denke ich, mehr oder weniger im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran beteiligt, und die Verantwortung hat nicht ausschließlich das Personal, sondern die ist in einer anderen Weise verteilt sozusagen. (Träger 134)
In dem Gespräch mit den Mitarbeitern wurde deutlich, daß sie auch anderen Aufgaben nachgehen möchten, aber der stumme Zwang der Verhältnisse sie an die Alltagsbewältigung fesselt.
J: Aber da fällt mir jetzt grade was ein, ein ganz wichtiger Grund mich, wenn's darum geht, ein bißchen rumzuspinnen: ich würde mir wünschen, daß so eine WG ohne Hauptamtlichen funktioniert, daß der Hauptamtliche Öffentlichkeitsarbeit macht, aber diese Assistenzzeit nicht abdecken muß, und das sehe ich halt genau jetzt, das ganze läuft nur noch deswegen, weil der Hauptverantwortliche sehr viel Zeit da reingebuttert hat, seine Kapazität hauptsächlich in Anwesenheit und in Betreuung und ins Assistenzangebot reingebuttert hat, sonst wäre das Ganze schon längst geplatzt.
W: Da würde ich mir für die andere WG wünschen, daß es einen Hauptverantworllichen gibt, der wirklich Öffentlichkeitsarbeit macht und so weiter und das Ganze koordiniert, aber die WG von der Anwesenheit und von der Betreuung her, das möglichst eigenständig macht. ...so habe ich das immer aufgefaßt, daß der Hauptamtliche am Anfang natürlich Anschubsgeschichten dann leisten muß, aber mit der Zeit sich dann herausziehen kann, und das sehe ich einfach nicht, weil das Konstrukt so zu wackelig ist. (Mitarbeiter: 11)
Die Visionen der hauptamtlichen Mitarbeiter entsprechen den Grundgedanken der konzeptionellen Überlegungen. Aus der Außenperspektive wird der Öffentlichkeitsarbeit ein bedeutender Stellenwert zugemessen, weil die Etablierung dieses Angebots ein politisch wichtiges Ziel darstellt. Von innen - aus der Perspektive der Bewohnerinnen - wäre diese Vision kaum akzeptabel. Wie die Gesprächsauszüge zeigen, sehen sie die Qualitäten des hauptamtlichen Mitarbeiters besonders in einer alltagsnahen Begleitung und Unterstützung. Öffentlichkeit in dosiertem Umfang ist die Bewohnerinnen positiv besetzt und eine Anerkennung und Bestätigung ihres Engagements, aber eben ein kleiner Ausschnitt des Alltags, der das private Leben so wenig wie möglich tangieren soll.
Ein Versuch, den Arbeitsbereich in ein Anforderungsprofil zu fassen, kann wie folgt beschrieben werden:
Auf dem Hintergrund der beschriebenen Tätigkeiten erfordert das Stellenprofil einen pädagogisch qualifizierten Mitarbeiter. In Kooperation mit den Bewohnerinnen gilt es, ihre Interessen und Bedürfnisseherauszufinden, Aushandlungsprozesse zwischen den Bewohnerinnen zu begleiten, ohne mit dem pädagogischen Zeigefinger und mit Verantwortung der eigenen Machtposition zu argumentieren. Entsprechend dem Anforderungsprofil benötigt es ebenso eine Person, die eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Positionen und die Reflexivität über Interaktions- und Kommunikationsmustem zulassen kann. Widersprüche lieben lernen bzw. Chaos aushalten können, gehört zu den besonderen Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter mitbringen sollte. Ohne jeglichen Sarkasmus oder Zynismus meint dies, daß ein Interesse und empathisches Gefühl zu unauflöslichen Gegensätzen bei dem hauptamtlichen Mitarbeiter vorhanden sein muß, damit die alltäglichen Situationen und Konflikte nicht nur zu einer Belastung werden. Mit Widersprüchen so gut wie möglich leben zu können, heißt, das Bestmögliche getan zu haben in der Gewißheit, daß die eine oder andere Interessengruppe nicht vollständig befriedigt werden konnte. Auf dieser Basis können die Vermittlungsfunktionen und Konfliktlösungsstrategien auf Dauer zu einer besseren Kommunikation und Interaktion führen.
Ein Mitarbeiter, der den Alltag der Wohngemeinschaft durchstrukturieren und in feste Ablaufpläne ordnen möchte, läuft Gefahr, daran zu verzweifeln bzw. die Lebendigkeit aus dem Alltag zu verdrängen.
[16] Zu den Organisationsaufgaben gehören u.a. Bürodienst/Telefondienst im Wohngruppenverbund (drei Std. pro Woche), Tag- und Nachtbereitschaft den Rufdienst, ein sogenannter Notdienst Bewohnerinnen des Wohngruppenverbunds (einmal in der Woche wochentags von 20 Uhr bis nächsten Morgen 8 Uhr I einmal pro Monat am Wochenende von Freitag 20 Uhr bis Montag 8 Uhr). Organisatorisch ist die Wohngemeinschaft Jurastraße zu einem regionalen Teamverbund mit drei weiteren Wohngruppen zusammengeschlossen (14tägige Teambesprechung). Alle zwei Wochen gibt es das Großteam, an dem sich alle Mitarbeiterinnen des Wohngruppenverbundes treffen. Zu Beginn der Woche gibt es eine Montagsrunde, an der jeweils eine Vertreterin der einzelnen Wohngruppen beteiligt ist, um die Vorkommnisse über das Wochenende zu vermitteln und zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- 7.1 Konzeptionelle Basis für Elternmitarbeit
-
7. 2 Elterngruppe
- 7. 2.1 „Förderung“ eines Elternaustauschs innerhalb einer LlW - Möglichkeiten zur Verarbeitung/Bewältigung einer neuen Lebenssituation
- 7. 2. 2 Elternkontakte bzw. Elternselbsthilfe - Entscheidungshilfen Eltern bei der Suche nach Wohnmöglichkeiten der Töchter/Söhne
- 7.2.3 Elternverantwortung und Sicherheitsrisiko
- 7.3 Elternmitarbeit
Das Konzept der Wohngemeinschaft Jurastraße sah von Anfang an vor, die Eltern in die Strukturen der Wohngemeinschaft mit zu verankern. Vor allem über die Mitträgerschaft der Arbeitsgemeinschaft Integration (kurz: AGI) sollten Eltern auch Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. Sie können dadurch auch an den Kooperationstreffen zwischen den Trägern teilnehmen. in den folgenden Ausführungen werden die Beteiligungsformen und die unterschiedlichen Konsequenzen der Nähe von Eltern zur LIW angeschnitten.
Zwei wesentliche Grundgedanken, die eine aktive Mitarbeit der Eltern begründen, sind:
a) Die individuelle Beziehungs- und Ablösungsgestaltung der Familienmitglieder, die dem Freiheitsgedanken des einzelnen verpflichtet ist und so wenig wie möglich von den institutionellen Rahmenbedingungen bestimmt sein soll, damit die Privatheit des Wohnens gewährleistet bleibt.
b) Die ressourcenorientierte Ausrichtung der Wohngemeinschaft, die die gewachsenen Beziehungen und Netzwerke erhalten und miteinbeziehen soll.
In der Praxis konnten diese Zielvorstellungen weitgehend eingelöst werden. Überlagert werden diese Kriterien von pragmatischen Handlungszwängen, d. h. von fehlen- den Finanz- bzw. Assistenzressourcen. Schon vor der Öffnung der Wohngemeinschaft wurde vereinbart, daß die Verwirklichung der LIW nur möglich ist, wenn Eltern bereit sind, an Wochenenden ihre Söhne und Töchter zu Hause zu betreuen, weil die vorhandenen Assistenzressourcen der Bewohnerinnen und hauptamtlichen Mitarbeiter nicht ausreichen, um alle Bewohnerinnen an jedem Wochenende zu begleiten - zumindest in der Anfangsphase.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern wäre idealerweise unabhängig von der notwendigen Eiternassistenz am Wochenende alle Beteiligten eine bessere Ausgangsbasis. Besser deshalb, weil die Aufgaben und Positionen klarer abgegrenzt wären und die gegenseitige Zusammenarbeit freier gestaltet werden könnte (vgl. ausführliche Diskussion über Wochenendassistenz in Kapitel 9).
Die positiven Entwicklungen der Wohngemeinschaft in den letzten vier Jahren sind auf die besondere Konstruktion zurückzuführen. Die institutionelle Einbindung der Eltern über die AGI führte dazu, daß sie sehr stark in die Entwicklung miteinbezogen werden. Elterntreffen und Elternengagement richten ihren Blick nicht auf die Dienstleistungs- rechte und -ansprüche. Die Mitverantwortung der Eltern auf der Trägerseite führt dazu, daß sie Verantwortung die Wohngemeinschaft mitübernehmen, auch an Macht und Einfluß gewinnen und deshalb keine grundsätzliche Opposition zur Wohngemeinschaft einnehmen.
lm folgenden soll zum einen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und zum anderen die Elternmitarbeit bzw. konkrete Kooperation mit der Wohngemeinschaft beleuchtet werden.
Der Auszug der Töchter/Söhne aus dem Elternhaus stellt sich auch die Eltern als eine völlig neue Situation dar. An die Stelle einer alltäglichen Begleitung der Töchter/Söhne, die in den letzten 30 Jahren mit wenigen Ausnahmen das Leben bestimmte, tritt ein Freiraum mit Leerstellen. Die Umstellung auf ein grundlegend anderes Leben mit der Gleichzeitigkeit, weiterhin stark an den Lebenswelten der Töchter und Söhne teilnehmen zu können, braucht Gelegenheiten, in denen die Distanz und die eigene Lebensgestaltung Raum haben. Der Austausch unter den Eltern über- nimmt hierbei wichtige Funktionen, auch die eines Korrektivs:
I: Zur Elternzusammenarbeit und Elternmitarbeit in der WG, was gäbe es denn da noch zu sagen zu einer neuen WG, also an jemanden, der so etwas aufmachen will?
P: Elternzusammenarbeit, ja, also wir treffen uns ja eigentlich regelmäßig zum Gedankenaus- tausch, und das ist auch sehr schön, finde ich…
S: Das ist auch wichtig, finde ich, weil wir haben doch manchmal halt Sorgen oder Probleme oder irgendwas und wenn man das miteinander bespricht, da hat immer einer eine andere Idee dazu, und das bringt einen auch weiter eigentlich, und man hört wieder; der eine erzählt das
P: …das löst manches Problem eigentlich auch..
S: Ja, da braucht man eigentlich überhaupt nicht dort hingehen, da merkt man, aha, so ist das, so habe ich das noch gar nicht gesehen, und schon hat sich das Problem dann gelöst.
R: Ich muß eigentlich sagen, Frau (Mutter) und Frau (Mutter) haben mir ja sehr geholfen, sehr gehoben. Es ist noch nicht so sehr lange, wo ich sagen muß, ja, die Birgit ist gut untergebracht, und die Birgit muß da bleiben, und die Birgit bleibt da. Ich war ja anfangs so wankelmütig und so und auch so mit dem Dableiben und so, wie die Birgit das erste Mal übers Wochenende in der Jurastraße, also da mußten sie dableiben, da haben sie Großputz gemacht, also da sollte ja jeder dableiben, das war gleich, glaube ich, im ersten Jahr Ich habe gedacht, ich schnappe rüber: ich habe gedacht, ich schnappe rüber, das Wochenende alleine, ohne das Mädel, das war schlimm, es war sehr schlimm, und ich war schon ofi so nahe wieder dran, aber jetzt Ich habe jetzt auch der Frau (Mutter) gesagt, also jetzt rückt es auch an die Eltern ran, auch weil der Hubert sagte, die Birgit kann ihr Bett alleine überziehen, die Birgit kann ihre Wäsche selber machen, und jetzt spüre ich aber immer; daß das weniger wird bei ihr.
P: Und dann machen sie das automatisch, daß sie sagen in der Jurastraße, passen Sie mal auf.
R: Ich werde jetzt wohl ins Krankenhaus gehen müssen, und ob's nun gleich zur Operation kommt, weiß ich nicht,…
P: Aber das sind Momente, wo man Verantwortung abgeben muß, und dann macht mans auch. Vorher habe ich auch lang nur alles an mich gezogen, jetzt bin ich weg davon. (Mütter :26-27)
Ein zentrales Thema für die Mütter wie auch die anderen Beteiligten bezieht sich auf die Verantwortungsabgabe der Mütter. Der Diskussionsauszug macht deutlich, daß aus Sicht der Mütter Zwangssituationen - wie z. B. die eigene Erkrankung - notwendig sind, damit ein Stück Verantwortung abgegeben werden kann. Aus die- sem Umstand läßt sich schließen, wie schwer es den Müttern fällt, loszulassen. Des- halb ist der strukturell verankerte Austausch unter Müttern/Eltern, sofern sie ihn nicht selbst organisieren, eine Hilfe zur Bewältigung der neuen Lebenssituation.
Ein Leben der Söhne und Töchter außerhalb der Familie ist die Eltern mit vielen Unsicherheiten und Ängsten verbunden (Vgl. Abschnitt 1.3.1 und 3.1). Eine Hilfestellung die Entscheidungsfindung der Eltern, ihre Söhne/Töchter in eine LlW ziehen zu lassen, sehen die Mütter im Austausch mit anderen Müttern, die schon Erfahrungen mit integrativen Wohnformen gesammelt haben. Besuche auch - von integrativen Wohngemeinschaften in anderen Städten - haben zur Klärung im Entscheidungsprozeß beigetragen.
I: Also wenn man eine LIW nochmal eröffnet, was würden Sie denen auf den Weg geben, so hinsichtlich, wie sie das gestalten sollen, diese Phase der Ablösung, also mit Bezug auf Kontakt zu den Bewohnern ?
P: Ich denke, das kann man gar nicht so vorgeben, das ergibt sich, so habe ich das immer gesehen. Man kontaktet ja sowieso anfangs intensiver; und das kann man gar nicht so genau vorgeben. Gut, vielleicht wäre es solche Eltern ganz interessant, wenn sie sich mit uns zusammen- setzen und einfach mal Fragen anbringen, daß man sich mal austauscht und hört, was wir Erfahrungen gemacht haben. Denen würde es dann wahrscheinlich leichter fallen, wenn wir von unseren Schwierigkeiten sprechen vom Anfang, die es damals gegeben hat.
S: Vor allen Dingen ist es auch ausgesprochen befruchtend, das alles schon mal gehört zu haben. Ich weiß auch, heute noch ist mir das wie - das Gespräch damals (Besuch einer integrativen Münchner Wohngemeinschaft, das ist mir wie eingeschweißt ins Gehirn, weil ich da das alles gehört habe, was die erzählt haben von der WG und wie's ihnen erging und was sie da Probleme hatten und was auch immer P: Das könnten wir auch schon weitergeben...
R: Ich meine und den Schritt da rein, den muß eben jeder alleine wagen Die einen können gut zureden, wenn sie aber auf solehe stoßen, wie ich sie da kurz erwähnt habe, denen können sies auch mit Engelszungen nicht klarlegen, das muß jeder - und ich kann nur vom Besten sagen Ich meine, es hat bei uns sehr lange gedauert, und es kommen auch nochmal wieder trübe Stunden, aber doch bin ich, kann ich sagen, überm Berg. (Mütter 135-36)
Der Auszug der Töchter/Söhne entlastet die Eltern, entläßt sie aber nicht aus der Elternverantwortung.
U:… wenn sie in der Situation ist, daß ihre Tochter in so eine Wohngemeinschaft zieht, wird das gleich Anforderungen bringen, Daß sie eine gewisse Absicherung will, das ist doch klar, das ist doch verständlich. Sie bleiben Eltern, sie bleiben diejenigen, die ein Stück weit ihren Kindern auch das Gefühl geben, ich bin verantwortlich, letztendlich auch verantwortlich man kann's ein Stück weit delegieren, aber abnehmen tut's einem niemand, und das sind im Grunde genommen diese Realitäten letztendlich dann, und das ist der Wunsch nach gewissen Sicherheiten und so weiter …(Träger 243)
Der Projektstatus, der die Wohngemeinschaft in den ersten zwei Jahren hatte, machte den Müttern sehr zu schaffen, obwohl durch die Mitträgerschaft einer großen Einrichtung eine Wohnplatzsicherheit innerhalb der Institution garantiert wurde. In diesen letzten vier Jahren hat sich hier viel bewegt. Während im ersten Gespräch mit den Müttern (vor 2 1/2 Jahren) die Forderung nach einer Absicherung einen zentralen Stellenwert im Gespräch einnahm, wird heute dieses Thema vielfältiger betrachtet.
S: Da kann man bloß sagen, das, was ich auch noch erhoffen würde, wäre, daß es so abgesichert ist, daß das eine beständige Sache bleibt. Das wäre auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
P: Das weiß ich aber nicht, ob man das so absichern kann. Ich wünsche es mir auch, daß es lange so bestehen bleibt, aber andererseits denke ich auch, es kann auch mal anders sein, aber dann haben unsere Kinder schon den Vorteil: sie kennen das Leben in der Gruppe, auch wenn's nachher zum Beispiel eine normale Wohngruppe wäre. Aber sie kennen die Situation schon mal, und sie würden leichter reinfinden, als wenn man sie dann plötzlich irgendwann da reinstoßt.
R: Vor dem habe ich jetzt eigentlich ein bißchen, Angst kann ich nicht grade sagen, aber ein bißchen Bedenken, wenn unsere jetzt schon mal im Arbeitsbereich sind, dürfen sie dann…
P: ach so R: Sie werden ja nicht jünger.
I: Wenn sie in Rente kommen, meinen Sie?
R: Ja, wenn sie nicht mehr arbeitsfähig sind.
P: Ja, so weit schaue ich gar nicht, muß ich ehrlich sagen Ich denke einfach, jetzt haben sie sich schon mal an diese Wohnform gewöhnt, wenn's vielleicht später auch dann eher behinderte Mitbewohner sind aber ich denke, da würden sie auch gut reinkommen, das glaube ich mal. (Mütter 237)
lm Unterschied zu anderen Wohnangeboten Menschen mit Assistenzbedarf bleibt ein Restrisiko in der LIW von den Eltern mitzutragen. Ungewiß ist und bleibt die Tatsache, daß sich immer wieder Mitbewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf finden lassen müssen. Mütter, deren Töchter/Söhne schon seit vier Jahren in der Wohngemeinschaft wohnen, können z. T. aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Entwicklungen den Unsicherheiten trotz allem auch positive Seiten abgewinnen, Die nicht- planbare Zukunft des Wohnplatzes der Kinder kann somit weniger belastend erlebt werden.
Elternmitarbeit ist eine Voraussetzung das Gelingen der Wohngemeinschaft - zumindest unter den bisherigen strukturellen und konzeptionellen Rahmenbedingungen in der „Wohngemeinschaft Jurastraße“. Ohne eine praktische und konstruktive Mitarbeit der Eltern reichen die Ressourcen der Wohngemeinschaft nicht aus. Einerseits erfordert dies eine Nähe und einen kontinuierlichen Kontakt zu der Wohngemeinschaft. Andererseits muß eine Distanz gewahrt bleiben, damit das Wohngemeinschaftsleben nicht von den Vorstellungen der Eltern zu stark betroffen wird. Dieser nicht auflösbare Widerspruch wird in dem folgenden Gesprächsauszug mit den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf thematisiert:
I: Elternmitarbeit, wie seht ihr das so, also wenn man so überlegt, was gibt man da weiter?
O: Elternmitarbeit? Möglichst minimal, bloß am Wochenende eigentlich.
M: Bis aufs Wochenende, ja.
L: Also ich hätte lieber angeboten, glaube ich, also ich überlege mir grade, daß es mir fast lieber ist, ich kann mich drauf einstellen, ich gehe mal zur Frau ...(Mutter) und entlaste sie ein paar Stunden, als daß ich daheim bin, und auf einmal schneit sie ins Haus, und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das war mir schon nicht so ein Problem wie dir jetzt, Monika, aber schon ab und zu mal Manchmal war ich völlig verkatert, total durch, verquollen und verstrubbelt bin ich dann um vier Uhr nachmittags mal aufgestanden, und dann sind (Eltern) im Haus und haben noch eine Freundin mitgebracht, irgendwie eine Tante aus soundso ist da, und ich laufe da in der Unterhose durch mein Haus und denke aufeinmal so - huch, ach guten Tag und so, Hand geben und so, auf der anderen Seite willst du dich wirklich nur verstecken Das hat aber mit Elternmitarbeit nichts zu tun eigentlich.
I: Das heißt, das war eher nochmal so die Frage, wann kommen die Eltern ins Haus?
O: Ich würde sagen, eigentlich wie Gäste, also ich finde es gut, daß die Eltern einen Schlüssel haben, das ist bestimmt für viele Situationen recht nützlich, wenn sie Gepäck abholen oder sonst irgendwas oder so. Aber eigentlich, wenn ich in der Jurastraße, daß die Leute dann da hingehen und klingeln und dann warten, ob jemand aufmacht - man kann dann schon reingehen, aber eigentlich als Besuch einfach, ja, das finde ich sogar wichtig, auf jeden Fall.
I: Also wie jeder Besuchen der kommt.
O: Sonst wirst du irgendwie, der in einem Haus wohnt, wo die Eltern da bezahlen irgendwie - das ist schwierig zu erklären jetzt, aber Mr Ich denke, die Eltern ist es oft schwierig, unseren Standpunkt zu verstehen oder von mir aus meinen manchmal, daß ich eher manchmal ein bißchen auf Distanz gegangen bin, weil ich glaube, die wollen irgendwie auch dazugehören. Also das Gefühl habe ich manchmal gehabt, die wollen da dazugehören und die wollen
I: So als Mitglieder der Wohngemeinschaft?
M: Ja, die wollen eigentlich mehr da sein als ich eigentlich. Ich wollte sie vielleicht schon, aber ich kann's nicht verkraften, weil ich, wenn dann, was weiß ich, bloß so Smalltalk machen, ja. also für mich war der Montag wirklich oft, da hast du dann halt so Smalltalk gemacht, wenn du im Wohnzimmer gehackt bist. Also das war kein normaler Tag, sondern wenn man da war, dann hat man gewußt, jetzt kommt die Frau (Mutter) und vielleicht die Frau (Mutier) und vielleicht, wenn man Pech hat, auch noch Birgit-Mama, man weiß ja nie - ja, einfach, ich mag die Frau (Mutter) ganz arg gern, ich finde, das ist wirklich eine nette Frau, aber ich will nicht sagen, ich geb' mich vielleicht so zu 80 % so wie ich bin, oder vielleicht 85 %, aber dann sind immer noch 15 % so ein bißchen so Anstand oder was weiß ich, wie man da sagt, oder so die... ja, oder einfach halt
O: Frau (Mutter), also zu der bin ich ein ganz anderer Mensch als sonst.
M: Ja, ich liege da nicht aufs Saflı, wenn ich grade Lust habe, aufs Sofa zu liegen, obwohl ich das Gefühl habe, die Frau (Mutter), die möchte das eigentlich, daß ich mich so fühle, daß ich mich einfach aufs Sofa lege, wenn sie da ist.
L: Die leidet da bestimmt auch drunter, daß sie das Gefühl hat, das ist angespannter oder so, M: Ja, aber ich denke, also mich war einfach der Punkt, ja, das war für mich ein Punkt der Verkraftung der Kontakte, weil das ist eigentlich mein Ideal, daß ich ein offenes Haus habe und' daß Leute kommen, und ich will zu denen allen freundlich sein, ich will mit denen allen schwätzen und, aber ich hab' dann wirklich das Gefühl gehabt, ich kann da niemand mehr ein bißchen näher an mich ranlassen. Ich verkrafte das nicht, daß dann wirklich meine letzte Kraft auch vollends irgendwie weg ist, wenn ich da auch noch zuhöre... (chem. Bewohnerinnen o.A. 145-47)
Das Thema Nähe und Distanz, das vor allem zwischen den Eltern und Bewohnerinnen ohne Assístenzbedarf problematisiert wird, wirft immer wieder die Frage auf, in welcher Art und Weise die Mütter/Eltern mit einbezogen werden und wie das Verhältnis bzw. die Beziehungen zwischen den Gruppen gestaltet werden können. Unterschiedliche Rollenerwartungen, Ängste und Unsicherheiten begleiten und belasten diese Beziehung (vgl. Jerg 1998).
Wie an anderer Stelle schon dargelegt wurde (vgl. Kapitel 3.6 Exkurs), stellt das Zusammenleben hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewußtsein der Bewohnerinnen. Die Grenzen der Verantwortungsübernahme, wie sie im obigen Auszug zur Sprache kommen, lassen in bezug auf die Elternbesuche erkennen, daß hier keine bösen Absichten oder Antisympathien den Ausschlag die Distanz und die Beschränkung der Elternbesuche geben. Der Grund liegt eher in der fehlenden Kraft, den Dialog mit den Eltern, der ein Eingehen und Zugehen beinhaltet, vertiefend zu führen.
Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf artikulieren sich positiv zu den Besuchen der Eltern. Sie grenzen sich bei den Besuchstagen von ihren Eltern ab, so die Äußerungen der Mütter, Mitbewohnerinnen und des Mitarbeiters. Dies zeigt sich darin, daß sie sich von ihren Eltern, wenn sie in die Wohngemeinschaft kommen, um gewisse Aufgaben zu erledigen, fernhalten. in der Regel gehen sie in den Gemeinschaftsraum zu den anderen Wohngemeinschaftsbewohnerinnen und bringen zum Ausdruck, daß sie hier mit den anderen Bewohnerinnen zusammenwohnen. Auch wenn sie sich nach Beschreibungen der anderen Bewohner, Mitarbeiter und Eltern oft bei den Besuchen eher im Kreise der Mitbewohnerlnnen aufhalten, wünschen sie sich die Besuche.
I: Wie ist es für euch, wenn die Eltern hier sind im Haus? Wie geht es euch dabei?
A: ja.
D: Gut.
C: Gut.
I: Kommen die oft?
D: Nee.
B: Ab und zu.
D: Ab und zu mal, nicht so oft.
C: Montags.
B: Nicht nur die Eltern, auch die Geschwister.
D: Da könnt man manchmal einen ganzen Laster brauchen, einen Bus, soviel kommen da (alle lachen).
B: Bei mir sind vier und meine Schwägerin und Schwager.
I: Kommen die hier zu Besuch?
B: Ja.
K: Aber es gefällt euch?
C: Ja. (BewohnerInnen m.A. :9)
Die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf, die Mitarbeiter wie auch Teile der Träger- Vertreterinnen plädieren für eine vereinbarte Besuchsregelung betreffend der Eltern. im Gespräch mit den ehemaligen Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf wird die Notwendigkeit begründet.
I: Also wenn man jetzt sagt, okay, diese Nähe, diese Art von zufällig-auch-in-der-Wohnung-stehen von den Eltern, das ist zuviel. Was könnte man denn anbieten, also was wäre denn eigentlich so aus der Erfahrung her sinnvoll zu sagen, was kann man leisten und anbieten für die Eltern?
L: Ich fand den Montag nicht schlecht, weil mir das nichts ausgemacht hat dann, am Montag wußte ich, die kommen, am Montag ist die Frau (Mutter) da und irgendwann habe ich mich sogar gereut. Dunn habe ich gedacht, Mensch, heute kommt die Frau (Mutter), die hat dann auch immer was mitgebracht…
M: das war ja auch okay, wenn dann alle gekommen sind am Montag, dann war's auch okay, dann war der Montag, und dann war's vorbei. (chem. Bewohnerinnen o.A. :49)
Ungeachtet von Besuchen, die sich aus besonderen Anlässen ergeben, sind generelle Absprachen unerläßlich. Die zeitlichen Vorgaben sollten klar geregelt sein. Die Begrenzung auf einen Wochentag verhindert, daß täglich Eltern auftauchen. So können sich alle auf die Besuche einstellen. In der Wohngemeinschaft Jurastraße ist Montagabend in der Regel der Elternbesuchstag. im einzelnen gestalten sich die Besuche sehr unterschiedlich. Regelmäßig kommen zwei Mütter, während die dritte Mutter unregelmäßig und die vierte gar nie erscheinen (Die Väter kommen sehr selten in die LIW, manchmal am Wochenende.) Der fixe Termin am Wochenanfang er- möglicht es, den Regelungsbedarf mit der Wohngemeinschaft die Woche abzuklären. Diese Praxis hat sich in der Jurastraße bewährt. Die Mütter nutzen den Besuch auch, um das Gespräch mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter zu führen und evtl. Probleme und Schwierigkeiten anzusprechen.
Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf erzeugt Orientierungen, die sich auf die übliche Milieubildung von Wohngemeinschaften beziehen. in der Regel zeichnen sich Wohngemeinschaften mit jungen Erwachsenen dadurch aus, daß die Besuchsquoten des Freundeskreises sehr hoch liegen, aber der generative Kontakt wenig Raum in der Wohngemeinschaft einnimmt. In den vier Jahren der Wohngemeinschaft Jurastraße läßt es sich an einer Hand abzählen, wie oft Eltern von Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf auf Besuch in der Wohngemeinschaft waren. Der Kontakt zu den Eltern, den auch diese Bewohnerinnen pflegen, findet in den Wohnungen der Eltern statt. Auf dem Hintergrund dieser Realitäten ist auch der Besuch der Eltern der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf einzuordnen. Die Eltern können noch so freundlich und aufgeschlossen sein: in den Räumen der Wohngemeinschaft werden sie immer ein Fremdkörper bleiben.
Das Engagement der Mütter wird einerseits sehr positiv aufgenommen. Vor allem ihr Einfühlungsvermögen und ihre Gesten der Anerkennung, wie z. B. die Wahrnehmung der Vorlieben der einzelnen Bewohnerinnen bei Süßigkeiten, werden hervor- gehoben. Andererseits schwappen Aktionen der Mütter immer wieder in Richtung unerwünschte Einmischung. Ein wichtiger Gedanke, der im folgenden Gesprächsauszug entwickelt wird, weist auf die Zusammenarbeit unter den Müttern hin. Wenn sich Mütter untereinander verstehen, können auch bisher ungelöste Probleme wie die Wochenendassistenz vielfältiger und kooperativer gestaltet werden. Die Frage, wie sich die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf die Elternmitarbeit wünschen würden, was sie bisher als sehr angenehm empfunden haben, kam erst nach mehrmaligem Nachfragen auf den Tisch.
L: Das ist halt immer brutal schwierig, weil eigentlich, wenn du jetzt fragst, was würdest du dir wünschen, was die Eltern machen, dann fällt dir eigentlich spontan genau das ein: die waren ja schon sehr vorsichtig und sind ja sehr behutsam, wenn ich mir vorstelle, das Kind hat dreißig Jahre bei mir gelebt, und auf einmal soll ich 's abgeben und so tun, als hätte ich 's vergessen. Klar kommen die und bringen uns dann was zum Nikolaus und bereiten das aber natürlich vor und machen dann herum und hängen irgendwas ab, damit sie ihre Deko auf- hängen können und so, und sofort ist's dann doch wieder komisch. Das ist halt eine Sache, ich glaube, da ist's vor allem wichtig, rechtzeitig drüber sich klarzuwerden, wie's einem dann geht, daß man nicht irgendwann merkt, oh Scheiße, das kotzt mich voll an, und dann ist es schon so weit, daß man nicht mehr normal drüber reden kann oder daß die Frau, wie vor- sichtig hätte man der Frau (Mutter) das sagen müssen, daß sie nicht beleidigt gewesen wäre ?
O: Das hätte man dann durch die Blumen sagen müssen, anders wäre das gar nicht gegangen.
L: Hat man doch versucht, also du bist ja bestimmt nicht zu ihr gegangen und hast gesagt, das kotzt mich an, daß sie immer hier…
I: Man muß doch umgekehrt fragen, okay, wenn jetzt jemand kommt mit einem bestimmten Angebot, wo man das Gefühl hat als Mitbewohnerin, das geht zu weit…
L: Aber der Garten, das geht ja nicht zu weit, finde ich.
M: Das ist so schwierig, die Grenze zu bestimmen, was zu weit geht und was nicht.
I: Ja, aber wie ist nochmal die Frage, anders herum gesehen, ihr habt ja jetzt so zwei, drei Jahre in der WG gewohnt, was ist euch angenehm, was hätten sie übernehmen können?
M: Es war nett, wenn jeden Montag Süßigkeiten da waren.
0: Wollte ich grade auch sagen.
M: Das war wirklich immer nett. Mit der Zeit hat sie herausgefunden, die Eva steht eher auf Salziges, dann hat sie geguckt, daß Süßes und Salziges da ist, also das hab' ich wirklich so ja, also das hat mich immer ganz beeindruckt.
L: Die war auch echt Spitze, ja, das hat sie - und sie kann ja nicht mal die Andrea fragen irgendwie, was hat denen geschmeckt?
O: Ja, eigentlich im Prinzip schon, es ist ja schon wünschenswert, daß sich die Eltern möglichst wenig sehen lassen, finde ich, fand ich.
L: Das ist halt jetzt auch schwer zu sagen, weil ich denke dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde es schön, wenn die Eltern anbieten, wir machen einen Ausflug, wir fahren in die Bärenhöhle, wir nehmen die Clara mit - also grade Davids Eltern sagen, wir nehmen die Clara mii. die Birgit kann auch mitkommen und von euch auch jeder - so was zum Beispiel.
M: Aber würdest du dann mitgehen?
L: Aber täte ich dann mitgehen, genau, das ist immer das Ding.
M: Jetzt, freies Haus!
L: Aber auf der anderen Seite…
O: Ich denke, das war schon, ja…
L: Die machen ja eh' auch was mit ihren Kindern am Wochenende zum Teil, die Frau (Mutter) hat ja auch mal der Clara - das fand ich super; die Frau (Mutter) hat zur Clara gesagt, sie soll einfach am Wochenende kommen, und dann hat die die Clara bei sich übernachten lassen mit der Birgit zusammen, und die haben einen Spaziergang gemacht zusammen, wo dann auch ein bißchen was schiefgelaufen ist …(…)
I: Also wenn die Eltern euch einladen würden, die WG oder einen Teil der WG oder diejenigen, die Zeit haben, zu gemeinsamen Aktivitäten, das wäre mal was anderes wie wenn die da auftauchen in der WG?
L: Da habe ich dann eher das Gefühl, das ist so eine Art, das ist mich vom Gefühl her mehr ein Anspruch, als wenn sie was anbieten. Es ist ja gleich eine ganz andere Ebene, wenn sie dann vor mir stehen, dann denke ich immer: ja, dieses alleine. sie wollen jetzt mit mir reden, ich muß jetzt irgendwie ein Gespräch führen, und anders ist es ein Angebot für mich, das kann ich wahrnehmen oder auch nicht. Welleícht, daß man das einführt, daß man's abwechselnd macht, wenn's wirklich so ist, daß man alle vierzehn Tage aufmachen würde für die Menschen mit Behinderungen in einer anderen WG, daß man sagt, ja ganz klar, ein Wochenende sind wir verantwortlich und das andere Wochenende dann die Eltern, und die können sich ja genauso wie wir zusammentun, wer weiß, wie gut die sich dann auch miteinander verstehen. Das ist denen ja auch wichtig, die kamen ja von alleine auch, die waren ja auch sehr traurig, daß die Frau (Mutter), daß' das nicht klappt. Das wäre ihnen auch sehr wichtig gewesen, und das haben die selber auch gesagt bei der Auswahl von der vierten Mitbewohnerin mit Behinderung, daß da ein Elternteil dabei ist, wenigstens ein Elternteil, das haben die sich gewünscht, daß sie mit denen auch - die haben sich auch getroffen.
M: Ja, ich glaube schon, das ist auch gut.
L: Ja, das ist wichtig, das wollen die. Für uns ist es ja auch wichtig, zusammenzuhocken und zu reden und die wissen ja nicht mal, was passiert. die ist's um so wichtiger: Ja, daß man einflach auch guckt, daß vielleicht die Eltern miteinander können, das ist vielleicht wichtiger als man denkt. (ehem. Bewohnerinnen :52-54)
Darüber hinaus zeichnen sich die Diskussionen unter den Bewohnerinnen über die Elternmitwirkung dadurch aus, daß Grenzen, was die einzelnen an Mitgestaltung möglich halten, unterschiedlich weit gezogen werden. Uneinigkeit besteht z. B, darin: kann eine Mutter in der Gartengestaltung Verantwortung mit übernehmen oder wird dies als Eingriff in die eigene Geschmacksgestaltung begriffen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Zudem haben die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf die gleiche Einschätzung wie die Eltern über die Vorstellung, daß ein gemeinsamer Austausch der Eltern das gemeinsame Zusammenleben der Bewohnerinnen und den Ablösungsprozeß vom Elternhaus förderlich ist.
Ein Ergebnis aus der ersten Erhebungsphase war die Durchführung eines gemein- samen Austauschs zwischen den Eltern und den Bewohnerinnen über ihre jeweiligen gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen. Während eines Konzeptionstages wurde die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Gespräch gegeben. Dieser Aus- tausch fand auf beiden Seiten positiven Anklang und führte zu dem Vorhaben, in regelmäßigen Abständen solche Treffen selbstorganisiert durchzuführen. Danach strich sehr viel Zeit ins Land, bis schließlich der hauptamtliche Mitarbeiter ein gemeinsames Treffen organisierte. Aus diesen Erfahrungen heraus erachte ich es sinnvoll, in Abständen von ca. vier Monaten den Austausch zwischen Eltern und Bewohnerlnnen zu etablieren und den hauptamtlichen Mitarbeiter als Vermittlungsperson, wenn es nötig ist, miteinzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
Die Trägerschaft zwischen sehr unterschiedlichen Organisationen - auf der einen Seite ein Elternverein mit einer Selbsthilfegruppen-Vereinsstruktur und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und andererseits eine große Institution der Behindertenhilfe mit gewachsenen Strukturen - erfordert neue Formen der Zusammenarbeit. Wie diese Zusammenarbeit konkret gestaltet wird, weiche Strukturen und Prozesse hilfreich sind bzw. hinderlich sein können, ist Gegenstand dieses Kapitels.
Gemeinsame Verantwortungsübernahme kann unterschiedlich gestaltet werden: in Form von Fusionen, Kooperationen etc. Fusionen sind heutzutage eine Alltäglichkeit, um die Marktchancen, die Marktanteile und das Überleben zu sichern. innerhalb des Wirtschaftssektors sind Fusionen unumgänglich, und der Einfluß der Entscheidungsträger auf diese Entwicklung scheint aufgrund eines verselbständigten Prozesses nicht aufzuhalten zu sein (vgl. Reutter 1999). inwieweit sich im sozialen Bereich diese Trends zu Fusionen und Beschleunigungsprozessen niederschlagen, ist offen. Kooperationen zeichnen sich vor allem dadurch aus, daß die Eigenständigkeit der beteiligten Träger erhalten bleibt.
Der gemeinsamen Verantwortung der LIW liegt ein Kooperationsverständnis zugrunde. in erster Linie bestand und besteht von beiden Seiten das Interesse, Menschen mit Assistenzbedarf eine dezentrale, lebensweitorientierte und integrative bzw. inklusive Wohnform anzubieten. Die bisherigen Erfahrungen in der LIW haben gezeigt, daß dieses gemeinsames Interesse für die innovativen Entwicklungsprozesse der letzten vier Jahre grundlegend ist.
Einen positiven Effekt bei der Kooperation bzw. Koalition von Trägern ist, daß durch die gemeinsame Verantwortung die Konflikte zwischen verschiedenen Vertreterinnen von Strukturprinzipien (hier: Träger der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe) notwendigerweise ausgetragen werden. Daraus folgen kann eine positive Einschätzung der Zusammenarbeit von Menschen, die unterschiedliche Positionen einnehmen und sich diesen Auseinandersetzungen stellen.
Die Einbindung von Selbsthilfe in die Trägerstruktur - sei es in der Gestalt von Eltern-Initiativen oder lndependent-living-Gruppen - gibt dieser Wohnform einen Über- bau, der ähnlich wie auf der Ebene der Bewohnerinnen kooperative, partizipative und dialogische Strukturen herstellen kann. Vor dem Hintergrund, daß sich in den alltäglichen Beziehungsstrukturen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf begegnen, erscheint es folgerichtig, daß sich auch in übergeordneten (Entscheidungs-)Strukturen durchlässige und gleichberechtigte Formen der Zusammenarbeit widerspiegeln. Voraussetzung dabei ist, daß sich auch auf der Trägerebene Nomalisierungsentwicklungen vollziehen, die den Anspruch der Alleinherrschaft und Alleinzuständigkeit von Institutionen auflösen. Mit anderen Worten: Sie muß „Kontroll- und Definitionsmacht“ (vgl. Beck 1996) abgeben. Gleichzeitig müssen sich die Vertreterinnen der Selbsthilfe auf die gesellschaftspolitisch bedingten bzw. gegebenen Rahmenbedingungen einlas- sen. Zwei wesentliche Chancen beide Kooperationspartnerinnen stecken in dieser Zusammenarbeit: zum einen, daß unterschiedliche Interessen verhandelt werden müssen, zum anderen, daß unterschiedliche Kompetenzen gebündelt werden können.
Die Weiterentwicklung von offenen, lebensweltorientierten Angeboten ist ohne die Einbeziehung der großen Versorgungsinstitutionen in der Behindertenhilfe - zumindest in Reutlingen - nicht zu erreichen. Das Platzkontingent stationäres Wohnen wurde vom Landeswohfahrtsverband gedeckelt, so daß keine zusätzlichen Plätze in neuen Einrichtungen ermöglicht werden. Das hat zur Folge, daß eine Struktureinbindung von Initiativen stattfinden kann, die finanziellen und personellen Ressourcen aber in den Großeinrichtungen verbleiben. Trotz dieses Vorteils die existierenden Institutionen liegt die Chance darin, daß sich Institutionen neuen Konzepten öffnen (müssen), um den Anschluß an die Bedürfnisse und Wünsche von Betroffenen nicht zu verpassen. Gleichzeitig haben sie das berechtigte Interesse, ihre Trägerlnnenrolle zu erhalten, ihr know how zu behalten und auszubauen sowie sich neuen Herausforderungen zu stellen. Selbsthilfeorganisationen mit ehrenamtlichen Mitgliedern besteht dadurch die Möglichkeit, als Kooperationspartnerln mit ihren fachlichen Ressourcen Einfluß zu er- halten, ohne mit verwaltungsorganisatorischen Aufgaben, fachspezifischem know how, finanzielien Risiken etc. belastet und überfordert zu werden.
Eine wichtige Voraussetzung und zu leistende Aufgabe besteht in der strukturellen Einbindung des neuen Projekts in die Angebotspalette der Einrichtung. Konkret erfordert dies eine Akzeptanz und Unterstützung und nicht eine Konkurrenzsituation mit anderen Angeboten innerhalb der Einrichtung. Dies erscheint das Arbeitsklima der Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen eine notwendige Grundlage, obwohl in der Regel in Institutionen mit eher unbeweglichen Strukturen und geringerer Veränderungsbereitschaft Widerstände von seiten anderer Mitarbeiterinnen bisher bestehender Wohngruppen zu erwarten und kaum zu vermeiden sind. Ein zentraler Widerstands- und Abgrenzungs- effekt ist darin zu sehen, daß die LIW durch die Einbeziehung von Bewohnerinnen in die Assistenzleistungen Ängste bei anderen Mitarbeiterinnen hervorruft, die sich in ihrem Professionalitätsverständnis bedroht fühlen. Eine weitere Skepsis spiegelt sich im Gegenargument, das ins Feld geführt wird, wider, daß das Projekt Arbeitsplätze vernichtet. Eine Behauptung, die so nicht aufrechtzuerhalten ist, weil die personellen Ressourcen der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen auf der gleichen Bemessensgrundlage errechnet werden und sich durch die Unterstützung der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf keine drastischen Kürzungen der hauptamtlichen Begleitung ergeben
Die Kooperation bietet eine Basis eine mehrperspektivische Arbeitsweise. Sie kann eine Annäherung gegenseitiger Standpunkte von Selbsthilfe und Institution er- möglichen. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen bietet Chancen neue konstruktive Kompromiß- und Konsensprozesse. Ein gemeinsames Projekt erfordert zwingend gemeinsam getragene Entscheidungen und schafft Anregungen neue Wege in der Praxis.
Die gemeinsame Trägerverantwortung fordert und fördert den Prozeß der gegenseitigen Perspektivenübernahme. Gemeinsame Verantwortung trägt dazu bei, daß die bisherige Arbeitsteilung in ihrer Zweipoligkeit nicht aufrechterhalten wird. Die institutionellen Vertreterinnen standen und stehen z. T. heute aber nicht mehr in dem Maße die Praxis, das pragmatische Handeln, den realistischen Blick. Die Vertreterinnen der initiative bekamen den Part der Theoretikerlnnen und der Utopistlnnen, in manchen Situationen auch die Rolle der Traum-Tänzer, zugeschrieben. Diese aufgezeigten Rollen, Zuschreibungen und Grenzen werden durch das gemeinsame Handeln aufgeweicht.
Kooperation zwischen den Trägern Die Kooperationstreffen zwischen den Trägern sind alle Beteiligten an der LIW offen. Jeder Interessierte kann dort sein Anliegen einbringen oder mitdiskutieren. Diese Transparenz auf der Trägerseite wird von den Bewohnerinnen nicht genutzt. Die Gründe sind vielfältig und individuell verschieden. Meines Erachtens schafft aber diese Offenheit des Koordinationstreffens ein Klima, das eventuellen Bedenken der Bewohnerinnen bezüglich der Undurchsichtigkeit von Entscheidungsstrukturen durch die mögliche Teilnahme Vorschub leistet.
Je nach Ressourcen der Träger sollte ein Konzept so offen sein, daß für beide Seiten ein Aushandlungsspielraum besteht, in den die jeweiligen Kompetenzen und Interessen eingebracht werden können. Das Ergebnis der Vorgespräche sollte mit klaren Absprachen über Verantwortlichkeiten und Kooperationsstrukturen enden und in einem schriftlichen Kooperationsvertrag festgehalten werden. Dabei können strukturelle Hierarchien entstehen, die sich durch formale Klarheit er- geben und in der Regel nicht zu vermeiden sind. Durch die informelle Zusammenarbeit und Solidarität der gemeinsamen Trägerschaft können sie aber weitgehend aus- geschaltet werden. Regelmäßig in kurzen Abständen stattfindende Kooperationstreffen erscheinen dabei notwendig, um wichtige Entscheidungen und Vorgehens- weisen abgleichen zu können. Die Stamm-Gruppe setzt sich aus Vertreterinnen der Träger, dem hauptamtlichen Mitarbeiter, der wissenschaftlichen Begleitung und sonstigen interessierten Beteiligten zusammen.
Eine wesentliche Bedingung zur Verankerung der Wohngemeinschaft in einem institutionellen Kontext ist der Erhalt einer privaten Atmosphäre. Dies ist ein Widerspruch, der letztendlich nicht aufzulösen ist, aber sich durch eine zurückhaltende Politik der Institution und deren Akzeptanz einer autonomen Entscheidungsstruktur in der Alltagsgestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens relativ konstruktiv umsetzen läßt. Die Trägervertreterlnnen sind auf ihrer Ebene ständig herausgefordert, die Logik der Institution kritisch zu hinterfragen und mit ihr, ggf. im Interesse der Bewohnerlnnen oder der Durchsetzung der gemeinsamen Plattform, zu brechen. Gleichzeitig müssen die Träger z. B. die Assistenz gewährleisten und die Verantwortung gegen- über den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf wahrnehmen.
V: aber ich denke, eine WG ist… ein Privatraum, wo man nicht immer meint, man muß von außen Leute reinholen. Es wäre meine Forderung jetzt auch an so eine WG, auch wirklich diese Privatheit der WG auch mit ins Zentrum zu stellen, also die nicht einfach der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wobei ich gleichzeitig natürlich jetzt als Vertreter einer Einrichtung, die natürlich auch Interesse hat, daß auch Öffentlichkeit Zugang kriegt, aber wirklich in ganz begrenztem Maße und nur mit Zustimmung der Personen, die dort auch leben Aber die andere Geschichte ist auch, es mußte eine WG sein, wo natürlich ein Stück weit die Bedürfnisse der Bewohner im Mittelpunkt stehen, also nicht so sehr jetzt meine oder eure Bedürfnisse, sondern eigentlich der Bewohner, die dort direkt leben, die müßten ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen können. … (Träger :6-7)
Inwieweit die institutionellen Zusammenhänge aus dem alltäglichen Wohngemeinschaftsleben herausgehalten werden können, liegt im wesentlichen an der praktizierten Vermittlungsfunktion des hauptamtlichen Mitarbeiters. Über ihn kommt die Institution mit ihren Richtlinien, Vorschriften und Entscheidungen in den Wohngemeinschaftsalltag. Seine Vermittlungskompetenz und Vermittlungsposition werden von allen Beteiligten als entscheidend einen gelingenden Alltag bewertet (vgl. dazu Ausführungen im Kapitel 6.2.2).
V: Ja, die Institution kommt schon auch über diese Hauptamtlichkeit herein, das ist ganz klar. Auch wenn dieser Hauptamtliche also nicht mehr diesen tradierten Auftrag hat, also zu pädagogisieren und zu therapeutisieren, zu erziehen, sondern im Prinzip das ist das Dilemma, mit dem ich auch nicht ganz fertig werde. Von der Tendenz her wollen wir ja mehr so Assistenzangebote, daß dem einzelnen dort, wo er Einschränkungen hat sozusagen, ermöglicht wird, doch daran teilzuhaben. Also da sehe ich wirklich das Dilemma, auch in dieser starken Figur, die in unserem Konzept der Hauptamtliche jetzt einnimmt so. …
U: …dieser Moment Institution - das habe ich eigentlich immer weggetrennt von der Jura-straße, aber de facto ist es natürlich schon da. Also durch diese Person des Hauptamtlichen, durch die Trägerschaft, durch die Rahmenbedingungen, die über den Träger gesichert wer- den, wobei der dann natürlich auch eine entsprechende Bedeutung kriegt, auch im Alltagsverständnis der Bewohnerinnen und Bewohner, also ja, die Gustav-Werner-Stiftung ist sozusagen der Nährboden unserer WG irgendwo; und das beeinflußt, denke ich, das Bewußtsein noch in einer anderen Weise, als wenn man sagen würde, ja, also wir haben eine selbstorganisierte, getragene, finanzierte Einrichtung von gleichberechtigten Leuten, die sich hier zusamtnentun und sich dann zusätzlich die notwendige Assistenz quasi einkaufen.
S: Das muß man aber jetzt nochmal sagen dazu, also ich finde diesen Hauptamtlichen in dem Konstrukt aber auch ganz wichtig, weil so, wie's in Camphill ist, ist das die gemeinsame Arbeit, ist das Leben mit behinderten Menschen, und da ist eben das nicht die gemeinsame Arbeit, und ich finde, das kann sehr schnell auch zu einer Überforderung werden und da - und das ist einfach auch ein mühsames Dasein oft, das ist ofl kein Zuckerschlecken mit Menschen, die eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben, umzugehen auf die Dauer, und ich denke immer, wenn man selber stark ins Berufsleben eingebunden ist, dann muß jemand da- sein, der das auch ein bißchen regelt und auch guckt, daß die Menschen mit Behinderungen zu ihrem Recht kommen und daß die nicht einfach geschwind nebeneinanderrutschen, was leicht in dieser Konstruktion sein kann, wenn da jetzt kein Hauptamtlicher wäre. (Träger :16)
Die Diskussion um eine autarke, selbstorganisierte und finanziell selbständige und unabhängige Selbsthilfeorganisation stellt die Mehrzahl der Beteiligten keine mögliche Basis der LlW dar. In den Planungsüberlegungen der Arbeitsgemeinschaft Integration war zunächst die selbstorganisierte Wohngemeinschaft ein Bestandteil des Konzepts, das sich nicht verwirklichen ließ. lm Nachhinein wird die Kooperation mit dem institutionellen Träger als eine gelungene und zukunftsorientierte Möglichkeit bewertet.
Unter den Bewohnerinnen gab es eine längere Diskussion um die Organisationsform des Projekts. Eine Bewohnerin, die schon längere Zeit in einem Camphill-Dorf gelebt hatte und somit auch andere Erfahrungen im Zusammenleben mit Menschen mit Assistenzbedarf sammeln konnte, hätte sich die Übernahme von Verantwortung in übergeordneten Bereichen vorstellen können. Die Mehrzahl der Bewohnerinnen hat aufgrund ihrer Arbeitsverhältnisse und -perspektiven, überhaupt nicht die Zeitressouroen und das Interesse, um die erforderliche Verantwortung zu übernehmen. Trotzdem sind aus ihrer Sicht die Machtverhältnisse, die sich aufgrund der Verantwortungsverteilung ergeben, als einschränkend zu bewerten.
M: … aber was ich mir grade in der Form manchmal gewünscht hatte, daß ich einfach auch mit bei den AGs dabeisein könnte, AGI oder was weiß ich, was Meetings es da noch alles gibt. Und das hab' ich aber nicht, nein, ich bin da, ich bin angestellt, ich war Angestellte bei der Gustav-Werner-Stiftung, und natürlich wars ein bißchen ein Mischmasch, und der Kurt war als Vermittlungsperson und der wo geguckt hat, daß unsere Belange, ja, daß es nicht bloß dienstlich war, sondern daß es schon auch noch Privatleben und daß das gewahrt ist, unser Bereich. Aber die Jurastraße ist ja schon, vor allem die Gustav- Werner-Stiftung, auch so im Hintergrund halt, und das ist das, wo ich schon immer so ein bißchen meine Schwierigkeiten so gehabt habe und ja, weil - und ich hab' das oft ausblenden können und hab' bloß die Jurastraße gesehen und dann aber, wenn das aber, wenn du dir dann so Extremsituationen vorstellst, dann ist ganz klar, dann ist die Gustav-Werner-Stitung hinten dran, dann sind das nicht wir, die dann Sachen beschließen und das dann in Erwägung ziehen, sondern da haben wir dann nichts mehr zu sagen,
L: Ja, die sagen dir dann, was du machen mußt.
M: Ja, und das ist das, finde ich, was uns vielleicht ein bißchen hindern kann, das so auf längere Perspektive zu machen, außer wenn man sieht, wenn man denkt, okay…
0: Das ist halt aber wieder für die kürzere Perspektive optimaler; du brauchst weniger Verantwortung übernehmen.
L: Manche wollen das ja auch gar nicht. Ich denke, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommen wurde wie der Kurt zum Beispiel, also der neue Mitbewohner; der hätte wahrscheinlich gesagt vielleicht, ich will überhaupt gar nicht in die Finanzgruppe, und ich habe auch überhaupt keine Lust auf Organisationsarbeiten. Ich will einfach nur billig wohnen, und die Idee gefällt mir, weil ~ also zum Beispiel im Nepomuk ist's ja auch so, daß ich dann, ich war ja nur Jobber, ich habe ja nur gejobbt, ich war in keiner Verantwortungsgruppe, aber trotzdem ist's mir da leichter gefallen, auch zu rödeln und über die Schicht zu arbeiten, Überstunden zu machen und in Ausnahmesituationen zu arbeiten, als wenn ich weiß, ich habe einen Chef und der sagt zu mit; das machst du jetzt, und an deinem freien Tag machst du Inventur, Wenn ich aber weiß, das ist eigentlich ein selbstverwalteter Betrieb, und da sind andere Leute, und das ist unseres, dann sage ich: hey, klar, ich komme auch an meinem freien Tag und mache Inventur; das ist ein anderes Gefühl.
I: Wäre das eine Vorstellung, das in Selbstverwaltung zu machen?
0: Ja, aber dann muß es sehr anders laufen, dann muß es ja auf Lohnbasis laufen. Du mußt ja was rauskriegen dann im Endeffekt, wenn du das so machen willst.
L: Ich meine, das ware dann zum Beispiel die autarke WG, wo einfach wirklich die Gelder an die WG kommen, und dann gibt's einen Kassenmeister; der das verwaltet und einteilt und daß man dann vielleicht auch eher das Gefühl hat, das ist unseres, und wir sind die Bestimmen und wenn wir's schlecht machen, dann fallen wir auf die Schnauze, aber uns spuckt auch niemand in die Suppe oder - ich weiß nicht.
M: Ich denke, da muß man sich dann halt schon, ja, auf die anderen auch verlassen können, also da mußt du dann schon wissen, mit wem du das machst.
O: Ja, und dann muß natürlich auch die Zeit von den Leuten dasein. (ehem. Bewohnerlnnen o.A. :33ff.)
Vielfältige Lebenswelten - Trennung von Arbeit und Wohnen
Einen wesentlichen Bestandteil einer gemeinsamen Lebensbasis In der LIW bildet der berufliche Alltag, der außerhalb von der Wohngemeinschaft angesiedelt ist. lm Unterschied zu gemeinsamem Wohnen in Lebensgemeinschaften wie Camphill etc. ist die Trennung von Beruf und Wohnen alle die Basis des Zusammenlebens, Diese Basis bedeutet, daß jede/jeder Bewohnerin ihren/seinen Lebensunterhalt außerhalb der WG verdient und niemand eine besondere Stellung in der WG einnimmt. Diese Gleichstellung der Personen und die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten haben ihre Vor- und Nachteile. ln den Gesprächen kamen die Trägervertreterlnnen zu der Einschätzung, daß diese unterschiedlichen Konzepte nicht so einfach zu vergleichen sind.
S: Und beruflich ist es doch auch so gewesen, hat die Monika dort gearbeitet eben, das war ihre Arbeit, während jetzt hier hat sie eine andere das ist gemeinsam, und das ist ja hier bei allen eigentlich, es sind halt getrennte Bereiche …
V: das Arbeiten von den Menschen mit Behinderung ist dort vor Ort passiert, das war - wir haben ja bei uns so ein bißchen die Vorstellung, Arbeit und Wohnung soll getrennt sein, das hat auch seine Vorteile. Und dort hat man alles zusammengepackt als, sagen wir mal, einheitliches Leben, das darf man nicht auseinandernehmen …
S: Also wenn ich da wohnen wollte, dann war doch ein erklärtes Ziel von uns, daß eben, also angenommen, ich wäre jetzt ein erwachsenwerdender Mensch mit einer Behinderung, daß man sich lösen kann grade aus den familiären Strukturen und beginnen kann, selbständig zu leben, während die da ja offensichtlich familiäre Strukturen haben, auch im Erwachsenenleben Das war ja bei uns grade ein Ziel, warum wir das so haben und auf der anderen Seite aber schon auch das, was wir an der Institution als eingrenzend empfunden haben, über die integrative Wohnform zum Beispiel auch so weit wie möglich eben wegzunehmen. Und darum, klar, ist eine Institution da als Tragen die einen hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt, aber wir wollten ja auch die Trennung von Arbeit und Wohnen. (Träger :14)
Zwei wesentliche Grundpfeiler der LIW sind: zum einen die Herausführung aus familiären Strukturen hin zum selbständigen Wohnen; zum anderen die Orientierung an normalen Lebensbezügen. Mit der LlW assoziieren sind deshalb Entwicklungen, bei denen die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf auch in anderen Lebensbereichen, wie z. B. Arbeit, Erfahrungen in Betrieben und Einrichtungen des ersten Arbeitsmarktes sammeln können. In diesem Bereich wurde exemplarisch mit Andrea ein Praktikumsversuch unternommen. Dabei ist es bisher geblieben.
Mögliche Konsequenzen einer Institutionsanbindung
Aus der historischen Gewordenheit der LlW, die ausgehend von einer Elterninitiative in die Kooperation mit einer Institution mündete, stellt sich die Frage, welche Vor» und Nachteile durch Kooperation entstehen: Sicherheitsrecht: Die Kooperation mit einem anerkannten Träger der Behindertenhilfe bietet eine größere Garantie hinsichtlich der Assistenzleistungen. die Betroffenen und auch insbesondere für die Eltern rmß eine integrative, lebensweltorientierte Wohngemeinschaft eine Perspektive aufzeigen, die eine Absicherung des Projekts ermöglicht und bei einem Scheitern andere Möglichkeiten bereithält. lm Alltag bewährt sich die Institutionsanbindung durch die geregelte Absicherung und Vertretung bei Krankheit oder bei Urlaub des Mitarbeiters, bei der Nichtbelegung von Plätzen. Darüber hinaus stehen bei Bedarf die Beratungsangebote der Einrichtung zur Verfügung.
Fachliche Kompetenz: Die Organisation der LIW benötigt neben den pädagogischen auch reichlich wirtschaftliche, rechtliche und verwaltungsbezogene Kompetenzen, die durch die Institution weitgehend abgedeckt und erfolgreich eingesetzt werden.
Mitfinanzierung von Institutionsdienstleistungen: Wie in jeder größeren Einrichtung halten diese Leistungen vor, die von kleineren, mit autonomen Strukturen ausgestatteten Bereichen nicht genutzt und gebraucht, aber auf die Gesamtheit der Einrichtungen um- gelegt werden. Der finanzielle Spielraum ist deshalb eingegrenzt, und die organisatorische Einbindung des Mitarbeiters in die Strukturen der Einrichtung erfordert Zeitressourcen, die der LIW direkt nicht zur Verfügung stehen.
Lange Entscheidungswege: im Gegensatz zu anderen Wohngruppen des institutionellen Trägers hat die LIW andere Entscheidungsstrukturen und Kontrolle durch die Einbindung der Selbsthilfe. Bei grundsätzlichen Fragestellungen, die mit finanziellen Bei- trägen verbunden sind, müssen die institutionellen Entscheidungsgremien mit einbezogen werden. Auf diesem Wege können Entscheidungen lange liegen.
Kooperation(szwang) als Standard: Wie oben aufgezeigt, ist eine Neugestaltung der Wohnformen notwendig. Sie zwingt die unterschiedlichen Parteien aufgrund von strukturellen Rahmenbedingungen vor Ort zu einer engeren Zusammenarbeit. Sie gelingt nur über eine Kooperation mit vorhandenen Trägerstrukturen, Das hat zur Folge, daß neue Initiativen keine selbst- bzw. eigenständigen Realisierungschancen haben und nur in Aushandlungsverfahren mit bisherigen Trägern ihre Ideen verwirklichen können. Dies erfordert und bedeutet ein Umdenken / Überdenken der traditionellen Angebotsformen. Die bisherige Tradition, daß die interessensgruppen (Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege etc.) jeweils ihre Angebote unabhängig und unkoordinlert anbieten, wird durch den Kooperationszwang unterlaufen. Es bleibt zu betonen, daß sich hier eine Chance bietet; dabei darf aber nicht übersehen werden, daß diejenigen Kooperationspartner, die bisher über Heimplätze verfügen, sich in der Machtposition befinden. Gleichzeitig können sie sich den neuen Entwicklungen auch nicht entziehen, aber die hierarchischen Strukturen aufrechterhalten.
Neue Wohnformen müssen vor Ort in bestehende Einrichtungen integriert werden. Damit verbunden ist die Möglichkeit, daß institutionelle Vorbehalte bearbeitet werden. Auf Dauer ist zu hoffen, daß die Sonderstellung des integrativen Angebots durch die Ankoppelung an bzw. Einbindung in Einrichtungen aufgelöst wird und die LIW in der Vielfalt der Angebote als ein gleichgestellter, integrierter Bestandteil ausgewiesen wird. Gegenüber den von außen auferlegten Kooperationszwang steht die freie Entscheidung der Träger zur Zusammenarbeit und das gemeinsame Interesse, selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Assistenzbedarf in der Gemeinde zu ermöglichen, Aus der gemeinsamen Trägerschaft der LIW hat sich eine grundsätzliche Kooperationsbasis ergeben, die auch über die LIW hinaus zu gemeinsamen Projekten (z. B. im Bereich Arbeit) führte und somit ein Fundament eine ständige Zusammenarbeit ermöglicht.
Zusammenfassend sind zwei wesentliche Gesichtspunkte aus den bisherigen Erfahrungen der Trägerkooperation hervorzuheben:
-
Die Institutionsanbindung bezieht Kompetenzen und Ressourcen mit ein, die die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und deren Eltern eine Zukunftsperspektive in Aussicht stellt, Das gemeinsame Interesse der Träger sowie das Engagement der Beteiligten, diese Wohnform zu etablieren, haben dazu beigetragen, unter schwierigen sozialpolitischen Verhältnissen die Projektidee zu verwirklichen.
-
Inwieweit dieses Wohnangebot dauerhaft etabliert und weiterentwickelt werden kann, hängt auch von dem politischen Willen der zuständigen politischen Gremi- en und verantwortlichen Geldgebern ab (vgl. Kapitel 13,2).
Assistenz, Teilhabe und Selbstbestimmung sind Schlagwörter, die in Konzeptionen der Sozialen Arbeit, besonders auch in der Behindertenhilfe, en vogue sind. Dabei bleibt es oft offen, was im Konkreten mit diesen Begriffen gemeint ist und wie sie gefüllt werden. Die Begriffe stehen hier im Zentrum, weil sie im Alltag der LIW eine tragende Wirkung erreichen können und viele andere Paradigmen (Normalisierung, Empowerment, Inklusion etc.) eine Basis bilden.
Teilhabe begreifen wir als strukturelle Voraussetzung und Rahmenbedingung Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Ohne die Partizipationsmöglichkeit an Planungs- und Entscheidungsprozessen kann der Weg zu einem selbstbestimmten Leben nur schwerlich beschritten werden. Obwohl der Begriff der Teilhabe den Mitgestaltungsgedanken beinhaltet und somit auch der Begriff der Selbstbestimmung darin aufgehen kann, scheint hier eine Differenzierung nach unterschiedlichen Dimensionen hilfreich. Mit dem Begriff der Assistenz sind konzeptionelle Grundeinstellungen verknüpft, die den Menschen mit Assistenzbedarf die Entscheidungsmacht über Auswahl, Form und Umfang der Assistenz zugestehen. Vergegenwärtigen wir uns den Alltag von Menschen mit Assistenzbedarf, so liegen die Besonderheiten in der Notwendigkeit von spezifischen Assistenzleistungen. Iris Beck definiert diese besondere Lebenssituation und Differenz zur „Normalität“ folgendermaßen:
„Gelingendes Alltagsleben ist zunächst nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben, Anforderungen und Erfahrungen und der Belastungen, die das Alltagsleben oder besondere Lebenssituationen mit sich bringen. Der Alltag behinderter Menschen ist in besonderem Maße durch die Aufgabe der dauerhaften Bewältigung zumeist umfänglicher und anhaltender Belastungen gekennzeichnet“.(lris Beck 1998: 273)
Die Bewältigungsversuche sind dabei oft in ein Netz von gegenseitigen Abhängigkeitsstrukturen verwoben, so daß die Selbständigkeit von Menschen mit Assistenzbedarf nur wenig entwickelt wurde. Mit dem Begriff der „erlernten Hilflosigkeit“ (Seligmann 1979) wird diese Realität, die auch im gemeinsamen Wohngemeinschaftsalltag sichtbar wird, treffend erfaßt. Die Ursachen und Gründe diese Form der Lebensgestaltung sind vielfältig, sobald der Blick nicht nur auf die Erziehung innerhalb der Familie sondern auf die Lebensbedingungen von Familien mit Kindern, die Assistenzbedarf benötigen, gerichtet wird.
Teilhabe, Selbstbestimmung und Verantwortungsmöglichkeiten werden in der LIW individuell nach Möglichkeiten und Fähigkeiten austariert. Auf dem Hintergrund der „erlernten Hilflosigkeit“ und dem zu bewältigenden Arbeitstag sind hier individuell ausgerichtete Aufgaben festzulegen. Damit sollen mögliche Überforderungen einzelner Bewohnerlnnen verhindert, aber eine aktive Beteiligung und Teilhabe aufrechterhalten und gefördert werden. Interne Wohngemeinschaftsbesprechungen Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf sind z. B. Versuche, vertrauliche und überschaubare Diskussionsräume zu schaffen und die Bewohnerinnen zu befähigen bzw. zu aktivieren, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
In den Gesprächen hat sich gezeigt, daß der Blick auf Strukturen und Prozesse innerhalb der LlW am ehesten die Möglichkeiten und Schwierigkeiten aufzeigen, die mit diesen konzeptionellen Begriffen verbunden sind. Diese Situation ist des- halb nachvollziehbar, weil Begriffe, wie Assistenz, Teilhabe und Selbstbestimmung, nur relational und kontextuell zu verstehen sind, also jede Person mit anderen Dingen assoziiert und von verschiedenen Einflußfaktoren abhängen wer- den. Die folgenden Ausführungen beschreiben an konkreten Situationen Möglichkeiten und Grenzen von Assistenz, Teilhabe und Selbstbestimmung als ein Patchworkbild, bei dem es noch viele Felder zu beschreiben und zu beschreiten gilt.
Inhaltsverzeichnis
In der Wohngemeinschaft sich zu Hause fühlen, setzt voraus, daß jede/r BewohnerIn selbst darüber bestimmen kann, wann er/sie sich dort aufhält. Diesen Anspruch zu verwirklichen, bedeutet, ausreichend Ressourcen den notwendigen Assistenzbedarf bereitstellen zu können.
Besonders deutlich zeigen sich die Schwierigkeiten an den Wochenendregelungen, die in diesem Kapitel deshalb ausführlich dargestellt werden. Die „Wohngemeinschaft Jurastraße“ konnte diesen Anspruch nur in Ausnahmefällen für alle Bewohnerinnen einlösen, während einzelne Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf dieser Anspruch fast durchgängig gewährleistet werden konnte.
Zunächst werden kurz die spezifischen Assistenzbedingungen innerhalb des institutionellen Rahmens und der konkrete Assistenzbedarf erläutert. im Anschluß werden ausführlich die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Ansprüche diskutiert und im Abschluß die Folgen thematisiert.
Personenbezogener Assistenzbedarf im Kontext des Wohngruppenverbundes
Die konzeptionelle Offenheit Menschen mit hohem Assistenzbedarf erfordert Rahmenbedingungen, die sich vom klassischen Bedarf und der Ausstattung betreuter Wohngruppen grundlegend unterscheiden.
Die vorliegenden Überlegungen sind aus der Perspektive eines Angebundenseins an den Wohngruppenverbund entwickelt worden. Ein Eingebundensein einer integrativen, lebensweltorientierten Wohngemeinschaft in den Kontext einer klassischen stationären Bereichs hätte zum Teil andere Voraussetzungen, wahrscheinlich aber auch andere Konfliktfelder, Eine grundsätzliche Unterscheidung zu anderen Wohngemeinschaften im Bereich des Wohngruppenverbunds liegt im erhöhten Assistenzbedarf von einzelnen Bewohnerlnnen. Konkret heißt dies z. B. in der Jurastraße, daß zum "Frühdienst" zwei Assistenzpersonen notwendig sind oder immer eine Person für die Nachtbereitschaft im Hause sein muß. Dadurch werden ein größeres Assistenzkontingent und eine andere Basis in bezug auf die finanzielle Ausstattung benötigt.
Benötigt wird an Wochentagen eine Assistenzbegleitung beim Aufstehen, Ankleiden und Frühstücken (6.00 - 7.30 Uhr). Nach der Arbeit (WfB) ca. 16.30 bis ca. 21 bzw. 22 Uhr müssen eine durchgehende Assistenz eine Person und weitere Assistenz bei der Vorbereitung des Abendessens und bei sonstigen Haushaltsauf- gaben vorhanden sein. Von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist eine Bewohnerin als Nachtbereitschaft erforderlich.
An Wochenenden bedarf es eigentlich einer durchgängigen Begleitung. Bisher konnten nicht alle Bewohnerinnen am Wochenende in der Wohngemeinschaft bleiben, so daß in der Vergangenheit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine stundenweise Begleitung einer Bewohnerin bzw. inzwischen immer für zwei weitere Bewohnerinnen benötigt wurde. in Ausnahmefällen besteht auch eine durch- gängige Assistenz, wenn die vierte Mitbewohnerin am Wochenende in der Wohngemeinschaft bleibt.
In der Anfangsphase der Wohngemeinschaft wurden die konkreten Zeiten die Assistenzbegleitung jeweils eine Woche jedesmal neu abgesprochen. Mit zunehmender Erfahrung der Bewohnerinnen und Mitarbeiter haben sich im Laufe des ersten Jahres der Wunsch und die Notwendigkeit einer strukturierten Vorgehens- weise entwickelt. inzwischen ist klar geregelt, daß alle Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf jeweils einen Früh-, Mittags- und Abend-„Dienst“ in der Woche übernehmen. Diese Praxis wird von den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf als Idealzustand bezeichnet, weil diese Anforderungen gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten ohne Streß zu bewältigen sind.
Diese Regelung hat aus organisatorischen Gründen den großen Vorteil, daß sich die Bewohnerinnen aufgrund ihrer sonstigen Einbindungen feste Tage herauskristallisieren, an denen sie ihre Assistenzfunktionen übernehmen. Außerdem ist der ganze Zeitaufwand, der bisher nötig war, um die Assistenz zu organisieren, weil dabei auch alle eingebunden werden mußten, jetzt auf ein Minimum reduziert. im Alltag zeigt sich dies als wesentlich effektiver als die bisherigen Lösungen, die doch während der WG-Besprechung viel Zeit und vor allem auch Energie einforderten.
I: Das war dann aber so ein Endprodukt, nicht wahr; einmal morgens, einmal mittags, einmal abends.
M: Ja, das war so der Idealzustand, wenn das geklappt hat…
O:… dann war's total easy eigentlich, das war ein Tag in der Woche und das fand ich dann auch nicht schlimm.
I: Das ist etwas, was ihr als realistisch seht, daß jeder so einen Tag begleitet…
M: Mit verantwortlich, ja, weil man ist ja sowieso da und bringt seinen Beitrag und das kostet dann Kraft, aber das wird halt nicht in Stunden dann abgerechnet. Aber das Verantwortliche, wo man dann wirklich auch mit dem Kopf ganz dabeisein muß und sich verantwortlich erklärt.
L: Da ging auch irgendwann das Dienstplanmachen schneller, weil klar war, es gibt bestimmte Tage, wer macht lieber Montag, ein anderer haßt Montag. Du warst nie montags da oder nicht so arg, und ich fand‘s okay Das war ein guter Tag mich, weil ich da im Nep immer frei hatte zum Beispiel.
I: Von den Strukturen her so eine klare Regelung.
L: Und das macht's einfacher. Und dann könnte man sogar, wenn ich jetzt überlege, man läßt das Putzplanmachen weg, man vereinfacht das Dienstplanmachen: wir haben‘s am Schluß auch, du haben wir ihn oft rumgegeben, und man hat sich eingetragen, daß nicht irgendwie die ganze Bande dahockt und man braucht eine Viertelstunde, Dann könnte man vielleicht auch mal sagen nach dem Essen, Leute, hat irgendjemand was zu sagen? (ehem. Bewohnerinnen o.A. :I2-13)
K: Also den Rahmen, den was ich jetzt grade auch den Leuten erzähle, wie ich mir es vorstelle, das ist schon so, daß ich mir wünsche, einen Frühdienst, einen Abenddienst und einen Spätdienst, also Nachtdienst in der Woche abzuleisten für dieses mietfreie Wohnen. Das ist das, was das Geld und den tatsächlichen Dienst betrifft. Aber es kommen noch andere Sachen dazu, die ich jetzt natürlich nicht jedem einzelnen so direkt auflisten kann, ob das dann tatsächlich auf die Person zutrifft. aber es hängen andere Sachen auch noch. Am Wochenende, wenn du da bist, wenn die Clara da ist, dann ist es ganz arg schwierig, sich ständig abzugrenzen und nicht immer im Dienst zu sein. Dann auch Pflichten zu übernehmen die Andrea, für die Clara, mit Wäsche zu waschen übers Wochenende und unter der Woche, Einkaufsdienste zu übcrnehmen, Verantwortung in verschiedenen Tagesabläufen zu übernehmen, wo dann in diesen Stunden, in diesem Stundenkontingent nicht mit eingerechnet ist.
W: Gut, das sind halt auch Dinge, die halt eine andere WG auch betreffen würden. Man muß halt einfach putzen, man muß einkaufen, solche Geschichten, bloß daß man's sehr wahrscheinlich noch etwas strikter macht, daß man einen Plan festlegen muß, weil einfach auch die Menschen mit Behinderungen ja auch versorgt werden müssen. Die haben einfach nicht so die Möglichkeiten, wenn der Kühlschrank jetzt leer ist, irgendwo was essen zu gehen oder so, sondern es geht einfach um die Versorgung, die muß einfach hundertprozentig sichergestellt sein, deswegen dann auch die Pläne. (Mitarbeiter :l6)
Deutlich wird aus den beiden Passagen, daß diese formale Struktur des Dienstes nur einen Teil des Assistenzumfangs beinhaltet und es weitaus mehr Aufgaben gibt, die eine Assistenz erfordern. Seit geraumer Zeit sind auch weitere Zuständigkeiten die Begleitung von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf festgelegt worden, so daß jede/r Mitbewohnerin ohne Assistenzbedarf als Ansprechperson zur Bewältigung von Alltagsarbeiten eine/n Bewohnerin mit Assistenzbedarf zur Verfügung steht. Diese Auswahl wurde im gegenseitigen Einvernehmen getroffen (vgl. Kapitel 11.3 Assistenzwahl).
Das gemeinsame Wohnen braucht klare Regelungen und Absprachen, wie die Assistenzzeiten abgedeckt werden. Vielleicht viel klarer und verbindlicher deshalb, weil keine bzw. eine geringe räumliche Trennung von Assistenz und zu-Hause-sein die Situation strukturiert. Die Grenzen sind die Bewohnerinnen fließend und nicht immer leicht zu ziehen. Die Balance zwischen Distanz und Nähe zu halten, ist auf engem Raum und vor dem Hintergrund z. T. alltäglicher Begegnung ein zentrales Thema alle Beteiligten. Rückzugsräume in Anspruch zu nehmen und als Recht zugesprochen zu bekommen, z. B. auch ein freies Wochenende zu haben und dadurch nicht in die Ecke von Verweigerung und moralischer Beurteilung gestellt zu werden, entspricht normalisierten Beziehungsverhältnissen. In jeder Beziehung oder Familie sind solche Rückzugsräume auf Dauer notwendig, um die Beziehungen aushalten bzw. gestalten zu können.
Was heißt das? Es gilt, sich bewußt zu machen: wie wäre es, wenn ich in eine solche Wohngemeinschaft einziehen würde? Wo sind meine Grenzen? Ausgehend von der „Kontakthypothese“ (vgl. Cloerkes in Lindmeier 1998: 144), die in der LIW auch die alltäglichen Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung kennzeichnet, spielen die qualitativen Dimensionen der Begegnung, also die Intensität der Begegnung, eine wichtige Rolle. „Freiwilligkeit“, „Freude am Kontakt“, „positive Gefühle“ (vgl. ebd.) sind entscheidend. interessant ist, daß sich Gefühlsbesetzungen von Beziehungen fördernd oder auch belastend entwickeln können. Aus diesem Grund ist einerseits bei der Auswahl von Bewohnerinnen dar- auf zu achten, daß hier die Bewohnerinnen zu entscheiden haben müssen, mit wem sie wohnen möchten bzw. mit wem sie nicht zusammenwohnen wollen. Eine Zwangsverpflichtung ist kontraproduktiv und wirkt gegen das Selbstbestimmungsrecht. Andererseits stellt sich hier die Frage: wie erleben die Bewohnerinnen konkret die Situation von Nähe und Distanz, und welche Rückschlüsse lassen sich daraus auf die Gestaltung des Alltags ziehen?
Am Beispiel der Bedeutung des Wochenendes, das der Inbegriff der „Frei-Zeit“ darstellt und in den Gesprächen auch in dieser Funktion angesprochen wurde, soll der Zusammenhang von Assistenzbedarf und persönlichen Grenzen aufgezeigt werden. im Unterschied zu den Wochentagen, an denen die Arbeitswelt die Nähe und Distanz strukturell schon vorgibt, bleibt am Wochenende diese selbstverständliche Trennung von Raum und Beziehung aus. Hier ist jede/r einzelne Bewohnerin gefordert, die Balance zwischen Nähe und Distanz herzustellen.
Bei der Umsetzung der Konzeption hat sich in der Jurastraße immer wieder das Problem ergeben, daß die vorhandenen Strukturen und die Zusammensetzung der Wohngemeinschaft Grenzen setzen. Eine geregelte Assistenzsicherung alle Bewohnerlnnen am Wochenende konnte bis heute nicht verwirklicht werden. Nur in Not- bzw. Ausnahmesituationen besteht für alle Bewohnerinnen die Möglichkeit, durchgängig am Wochenende in der WG zu wohnen. Mitbewohnerlnnen, die auch über einen längeren Zeitraum am Tage alleine in der WG bleiben und die lebensnotwendigen Aufgaben selbständig verrichten können, sind frei in ihrer Wahl, ob sie nach Hause gehen oder in der Wohngemeinschaft bleiben. Alle Beteiligten sind sich darin einig, daß dieser unbefriedigende Zustand die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf bzw. Mitarbeiter belastend und für die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und deren Eltern einschränkend ist.
Eine Wahlfreiheit für alle soll angestrebt werden, auch wenn einzelne Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf am Wochenende zu den Eltern fahren, Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf ein freies Wochenende in Anspruch nehmen wollen oder Eltern den Wunsch bzw. die Erwartungen und das Recht auf Wochenendassistenz in der Wohngemeinschaft einfordern.
Die Wochenendregelung ist ein Dauerthema in der Wohngemeinschaft. In den letzten vier Jahren war in der Regel eine Bewohnerin mit Assistenzbedarf so gut wie immer in der Wohngemeinschaft, während die anderen Bewohnerinnen in den ersten zwei Jahren und zur Zeit zumindest jede zweite Woche am Wochenende nach Hause gingen bzw. gehen. Die strukturellen Bedingungen lassen offen, wie der Assistenzbedarf und die Assistenzressourcen innerhalb der Wohngemeinschaft sich im Alltag umsetzen lassen. Die Ansprüche werden von seiten der Bewohnerinnen wahrgenommen. Gleichzeitig bringt sie diese Einsicht in andere Positionen in Widerspruch mit den eigenen Möglichkeiten.
L: Also es war jelzt, wenn ich überlege, diese Regel irgendwie Morgendienst, Abenddienst und ein Nachtdienst, das ist in Ordnung und ich habe du - ich hab' halt auch geschichtet - ich habe mein Privatleben gehabt, ich habe mich wirklich ausleben können und hab' gut nebenher noch geschafft, und ich habe am Schluß 100 % geschafft, aber das war auch hart. Aber was halt, was ich gut fände, wenn so Sachen wie Ausnahmesituationen extra bezahlt, also wenn da Assistenz - Bedarf, Zeiten und Ressourcen nochmal irgendwas wäre, daß du, ja Wochenenden zum Beispiel, du hast die ganze Woche in der WG verbracht, und dann heißt‘s auch noch, ahja, jetzt kommen wieder Andrea und David in die WG am Wochenende.
M: Das war natürlich nicht oft aber bei der Andrea war ich oft auch…
L: Das waren immer Dienste, die gingen den ganzen Tag. Und dann mußt du am Samstag auch noch um sechs aufstehen und ihr die Tabletten geben. Das ist eine Arbeit, das ist echt Und wenn ich dann, ich habe oft sonntags die Andrea gehabt, und das ist schon hart, wenn du da Sonntag morgens dann um sechs die Tabletten geben mußt, und dann kannst du dich nicht mal wieder hinlegen, weil um sieben kommt die nächste Fuhre, und dann ist sie eh' wach, und wenn's ihr schlecht geht und du bist alleine, das ist nicht, du wohnst mit jemandem zusammen, sondern das ist echt schaffen, und ich finde, das sollte so auch anerkannt werden auf irgendeine Art und Weise. Und die Frau (Mutter) hat ja auch selber von alleine immer versucht, dann hat sie sich bedankt und war zu Tränen gerührt und so, und dann war's mir immer noch um so peinlicher, daß es mich so angekotzt hat. Und es ist nicht der Frau … (Mutter) ihre Aufgabe, uns dann da noch irgendwie sich da erkenntlich zu zeigen. Und sie war ja auch hin- und hergerissen zwischen eigentlich tut's ihr leid, aber auf der anderen Seite hat sie auch das Recht darauf M' Und die braucht‘s einfach.
L: Das wußten wir auch, das war eine schwierige Sache, und ich denke, wenn jetzt jemals in eine WG so jemand wie die Andrea einziehen würde, wäre das echt schon, da sollte man echt drüber nachdenken. (ehem. Bewohnerlnnen o.A. :11-12)
Im Zusammenhang mit der Frage nach Auszugsgründen entstand eine längere Diskussion unter den ehemaligen Bewohnerinnen über Belastungen, Enthaltsamkeiten und Entsagungen. Der Wunsch nach einem freien Wochenende bzw. nach ungestörten und von Verantwortung entlastenden Zeiträumen war dabei auch ausschlaggebend für den Auszug aus der Wohngemeinschaft.
Hintergrund dieser schwerwiegenden Situationseinschätzung ist die Erfahrung, daß bis vor einem Jahr in der Regel am Wochenende nur eine Bewohnerin mit Assistenzbedarf in der Wohngemeinschaft war, die aber die ganze Zeit auf Kontakt und Ansprechpersonen wartet. Sie ist die einzige Bewohnerin, die nur begrenzt auf ihr familiäres Netzwerk zurückgreifen kann und dadurch nur die W0hngemeinschaft als Beziehungsgefüge hat. Diese Bewohnerin kann zwar relativ selbständig viele Alltagsanforderungen bewältigen, aber die Wochenendstruktur, die keinen geregelten Tagesablauf und keine Beschäftigung mit sich bringt, überfordert sie. Diese Situation haben die ehemaligen Bewohnerinnen sehr belastend empfunden, weil sie einerseits die Einsamkeit von der Bewohnerin wahrnahmen, aber andererseits den Wunsch nach Distanz bzw. sich zu sein, nicht zurückstellen wollten. Das schlechte Gewissen gesellte sich zum selbstverständlichen Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten, Sich frei zu bewegen wird durch das Ausgeliefertsein der Situation beschränkt, besonders in Zeiten, in denen keine anderen Mitbewohnerinnen in der Wohngemeinschaft verweilen. Sich der Verantwortung zu entziehen, gelingt nicht ohne das Gefühl, ein schlechter Mensch zu sein. Auch ein Fluchtversuch, sich im Garten zu verstecken, zeigt die Hilflosigkeit, sich ohne weiteres zu- rückziehen zu können.
Assistenzpläne für das Wochenende können zumindest insofern Abhilfe schaffen, daß die Zuständigkeiten klar geregelt sind, die Verantwortungsübernahme beschränkt bleibt und somit der Rückzug aus dem Wohngemeinschaftsleben frei gewählt werden kann. Weiterhin zeigen die Erfahrungen, daß die Anwesenheit anderer Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf auch entlastende Momente hat, weil die Beziehungen untereinander die Verantwortung verteilen. Eine Unterstützung könnte auch darin liegen, daß eine Assistenz von außen am Wochenende zur Entlastung beitragen könnte.
M: … und was ich dann immer gemerkt habe, was mich wirklich belastet hat, und wie so oft merkt man die Belastung erst, wenn's dann mal weg ist, also das war wirklich, ja die Clara am Wochenende. Weil ich bin jemand, ich bin gern daheim, grade durch das, daß ich einfach viel unterwegs bin, bin ich einfach ja viel daheim, und ich hab' genau gewußt, wenn ich am Wochenende aufisiehe, und ich komme runter in die Küche, die Clara steht da, und ich komme mir wirklich auch ein bißchen - ja, ich will nicht sagen gemein, aber schon ein bißchen, wenn ich dann mein Tablett packe und raufgehe zum frühstücken.
0: Das macht aber einfach schon ein schlechtes Gewissen …
M Ja, dann steht sie da und guckt dich an, guckt dich wirklich traurig an …
L: und du denkst echt, du bist ein schlechter Mensch, weil du das jetzt brauchst.
M: Ja, und manchmal hab' ich's dann gepackt, was weiß ich, mit der Zeitung, aber ich hab' das wirklich gemerkt und grade vor allem, wenn der Kurt das dann hingebracht hat, daß sie mal zur Tante gegangen ist, das war was ganz anderes, und ich finde, das müßte rein, daß das ganz klar ist, entweder jedes zweite Wochenende oder mindestens einmal im Monat ein freies Wochenende, und das war nämlich - was nützt das dann, wenn die Andrea daheim ist, der David ist daheim, also ich hab' oft zum Kurt gesagt, du Kurt, mir ist's wirklich lieber; wenn der David da ist, dann ist die Clara und der David und nicht ich, wenn ich da runterkomme, und ich bin dann das Opfer; und ich bin einfach da, ich hocke da nicht ins Wohnzimmer rein, weil ich weiß genau, dann muß ich herhalten, und das hab' ich wirklich, am Schluß zu hab' ich das wirklich gemerkt, grade wenn der Felix am Wochenende, was wew ich, der schlaf? ja lang oder schafft dann im … (Geschäft). Und wenn die Eva dann am Wochenende weg war; und die schlaft ja auch ewig - ja, also ich hab' mir dann wirklich echt manchmal richtig hilflos und ausgeliefert, richtig ausgeliefert. Und dann hab' ich schon gedacht, nein das will ich eigentlich nicht mehr Ich will wirklich am Sonntagmorgen, ich will einfach ganz normal mein Frühstück machen und das in Ruhe essen, ohne daß ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muß, und gleichzeitig denke ich, ist es aber die Clara wirklich auch hart, wenn am Wochenende niemand nach ihr guckt und natürlich, das ist jetzt einfach im Moment eine Notlösung, weil’s nicht anders geht - wo soll sie hingehen ? Also mir wäre es zehnmal lieber gewesen, ich hätte dann gesagt, okay, ich bin einmal am Wochenende bin ich da für jemanden, und dann aber kann ich einfach dasein, und ich muß mir nicht wegen der Clara ein schlechtes Gewissen machen oder wegen sonst jemand, wcil da sind dann einfach Leute da, die wo nach der Sache gucken. Und weißt du, mir macht's auch dann nichts aus, dazusein, ich finde, das Ausgeliefertsein ist bloß, wenn du als einziger Mensch ohne Behinderung da bist, und die Clara krallt sich dich.
L: Weil niemand da ist, weil einfach sonst niemand da ist.
M: Ja, weil niemand da ist, und das ist schon ganz anders, wenn dann der Felix beim Frühstück mit da war das ist für mich dann wirklich harte Arbeit, so stelle ich mir dann den Dienst in der (Institution) vor, das ist mich dann Arbeit. Und wenn dann nochmal irgendwo anders jemand dasitzt, und man kann einfach ein bißchen was schwätzen, und die Clara gibt hin und wieder ihren Senf dazu, das ist okay.
L: Vor allem hört sie dann mehr zu, wenn zwei Leute schwätzen, dann sitzt sie da und ist eigentlich unterhalten, so ungefähr: Aber wenn die immer alleine ist, die dreht fast hohl ~ ein Geräusch draußen auf der Straße, und die stand am Küchenfenster und hat geguckt, was ist da los, und da kriegst du so zuviel, so schnell.
0: Da mußte man dann halt auch wieder anfangen, irgendwelche Aktivitäten mit der anzufangen, sonst hätte man ja am Wochenende auch mal alleine fortgehen können, aber das geht ja genauso um dein Wochenende.
L: .Ja gut, aber dann habe ich eine klare Aufgabe und muß mich nicht fühlen wie ein Lumpenmensch, wenn ich keinen Bock habe. …
M: Ja, das finde ich dann auch so schade, auch im Sommer; wenn du gern einfach in den Garten gegangen bist…
L: ja, ich habe mich versteckt, ich habe mich immer hinten beim Kompost, da hat sie auch nicht geguckt. Da habe ich mich dann ganz ruhig verhalten und hab' mich echt wirklich manchmal einfach versteckt, daß sie mich nicht findet. Und da ist nie, also am Wochenende war von den Hauptamtlichen, klar; die haben auch Familie, und der Oskar hat auch als Zivi .reine Freizeit gehabt, natürlich, das ist ja auch klar; aber nochmal von wegen am Wochenende vielleicht wirklich dann die Möglichkeit zu haben, jemanden von außen zu holen, wenn's sein muß. (ehem. Bewohnerlnnen :29-31)
lm Unterschied zu anderen „normalen“ Wohngemeinschaften ist das Angewiesensein und Abhängigsein von Mitbewohnerlnnen eine bestimmende Größe. Von daher werden das Wohlbefinden und das Ziel, einen gelingenden Alltag herzustellen, davon abhängen, inwiefern die Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen nicht nur mit und durch Assistenzaufgaben gefüllt werden. Zumindest sollte verhindert werden, daß dieses Gefühl der ständigen Bewältigungsanforderung in den Vordergrund tritt und den Alltag mit seinen lebendigen Seiten überlagert. Hier wird ansonsten der gleiche Effekt erzeugt, der sich in anderen Wohngemeinschaften darin zeigt, daß die Beziehungen nur noch über Aufgabenverteilung, Leistung und Gegenleistung definiert und gelebt werden.
Aus der Perspektive der Mütter werden folgende Aspekte für eine zufriedenstellende Wochenendregelung hervorgehoben.
Ideal wäre eine individuelle Gestaltungsfreiheit der Söhne/Töchter in bezug auf den Aufenthaltsort am Wochenende. Mit der Einschränkung, daß auch die Bedürfnisse der Eltern zum Tragen kommen. Auf diesem Weg wären schon zwei geregelte Wochenenden im Monat traumhaft, an denen alle Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf in der Wohngemeinschaft bleiben können. Dabei ist es den Eltern wichtig, daß kein institutioneller Verpflichtungscharakter für die Söhne/Töchter daraus abgeleitet wird bzw. sie verplant werden, so wie es in vielen Institutionen üblich ist, sondern sie die Wahl dieses Angebots frei und flexibel wahrnehmen können.
Barrieren für die Umsetzung dieser Vorstellungen sehen sie in den strukturellen Bedingungen, d. h. in den nicht ausreichend vorhandenen Assistenzressourcen, die eine Zuverlässigkeit der Wochenendassistenz garantieren. Die Freiräume zur Erholung werden den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf von seiten der Mütter zugestanden.
Aus Müttersicht besteht die Notwendigkeit von Assistenzleistungen am Wochenende in Form von Angeboten, Programmen bzw. Begleitung der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf (abgesehen von der Tatsache, daß eine Bewohnerin auf jeden Fall eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz benötigen würde). Neben dieser Strukturiertheit können Freiräume, die in überschaubaren Zeiträumen selbst gestaltet werden, den Wochenendalltag abwechseln. Diese Mischung ermöglicht feste Ankerpunkte am Wochenende und läßt Raum für die Entwicklung von Verselbständigungsprozessen. Die gemeinsamen Freizeitaktivitäten bieten Chancen, andere Beziehungsqualitäten unter den Wohngemeinschaftsbewohnerlnnen herzustellen.
Dies sind notwendige Voraussetzungen, damit das Wochenende in der Wohngemeinschaft die Söhne/Töchter anregend und sicher zu bewältigen ist. Ohne jegliche Begleitung das Wochenende in der Wohngemeinschaft zu verbringen, ist die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf eine Überforderung. Der Weg der kleinen Schritte in die Selbständigkeit muß sichergestellt sein, So wie die Bewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf sich eine klare Verantwortung und Zuständigkeit an bestimmten Wochenenden als Basis das gemeinsame Wohnen deklarieren, wird von seiten der Mütter diese Begleitung eingefordert.
S: … daß jeder in seiner Schnelligkeit oder Langsamkeit das machen kann, jeder kann quasi selbständig werden, so wie er‘s braucht und so wie es die Eltern brauchen, daß das wirklich in einem Prozeß vor sich gehen kann. Aber wenn der Prozeß dann gar nicht am Ende steht, also nicht mal überhaupt, dann ist das ja auch eigentlich dieser Grundsatz oder diese Vorstellung, die können sie ja gar nicht durchprobieren. …
P: Das ist ja der Traum, daß dann einer da ist, und der muß ja nicht den ganzen Tag Programm machen, aber so zwischendrin so ein paar Punkte, dann sind sie hier ein bißchen für sich.
S: Das ist ja jetzt egal, jetzt träumen wir ja mal, wie wir das eigentlich wollten Also ideal, das heißt im Grunde genommen dann gleich mal wieder, personell gut besetzt, so daß das möglich ist. … Das ist das größte Hindernis, deshalb sage ich das ja, personell so besetzt, daß das echt möglich ist, daß die Leute selber entscheiden können, möchten wir dableiben oder nicht oder daß man, wenn das personell - ja, wir können es uns ja wünschen, das wäre der Traum natürlich, daß sie selber sagen können, wir möchten oder wir möchten nicht, und daß das wirklich so kommt, daß das von innen heraus dann kommen kann, ja, ich bleibe jetzt da.
P: Daß das Angebot da ist, und wenn dann aber einer sagt, nein, dieses Wochenende paßt mir's nicht, dazubleiben, dann bin ich nicht da, dann sind die anderen da, irgendwer ist ja da, aber daß es ganz feste Wochenenden gibt, so zwei Mal im Monat am besten - das wäre ein Traum!
S: Ein Traum wäre das, ja …
P: Aber ich finde auch, sie dürfen da nicht gezwungen werden, dazubleiben, und wenn die dann sagen, nein, ich habe da doch etwas anderes vor dann müssen sie auch gehen können Dann bleiben halt vielleicht nur zwei da, und trotzdem muß das Angebot sein, nicht nur, wenn eine da ist, sondern feste Termine, das wäre mein Wunsch.
R: Weil die Birgit auch gesagt hat, wenn irgend etwas gemacht wird, dann nur spazierengehenı und die Möglichkeiten in Betzingen über die Felder und denn sie sagt, was soll ich in der Jurastraße, wenn ich nur da drinnen sitze, dann komme ich lieber heim, und wir gehen ja viel, also bis so lange, jetzt muß sich ja erst mein Bein wieder bessern, daß ich besser laufen kann. Wir gehen viel spazieren, und sie will raus, und das ist ja auch in der Werkstatt, die sind ja in der Werkstatt zum Arbeiten und nicht zum Spazierengehen. Wenigstens am Wochenende - die müssen ja nicht mit ihnen dann über Stock und Stein gehen, aber spazierengehen.
S: Also ohne Angebot sollten sie nicht dableiben, es mußte dann schon irgendwie was getan werden.
R: Und ich finde, das ist eigentlich gut so, wie der Kurt das angeschnitten hat. Wenn jetzt der Hubert und die Eva und die Gabi, oder wie sie grade so heißen, von dann bis dann der und von dann bis dann den dann hat der immer einen Freiraum, damit er sich auch erholen kann. Weil dann mußte jemand von zwei bis um vier mit denen spazierengehen, dann hat er seine Arbeit getan und dann nachher: von vier bis um fünf oder bis um sechs, wo sie Abendessen, da können sie sich ja auch mal alleine beschäftigen, und dann um sechs tım sie gemeinsam essen, und wenn sie dann noch irgendwie Würfelspiele machen oder Kartenspiele, das macht ja die Birgit auch so gern und wenn's im Sommer ist, dann sitzt man draußen, und wenn sie sich nur Dummheiten erzählen aber sie sind dach dann beschäftigt und nicht bloß in ihrem Zimmer oder im Aufenthaltsraum, das finde ich eigentlich nicht so ideal.
P: Sie brauchen schon immer noch so ein bißchen eine Führung. Ich glaube, sonst schwimmen sie so. Sie möchten was tun und wissen nicht, wo sie anfangen sollen Die brauchen einfach so ein bißchen Führung. (Mütter 7/8)
P: Natürlich, am Wochenende kann man Zusammenwachsen, nicht unter der Woche. Das behaupte ich immer noch: unter der Woche hat man da viel zu wenig Möglichkeiten. (Mütter :9)
Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf befinden sich bei diesen schwierigen Wochenendregelungen in einem Dilemma und in einer schwierigen Position. Zum Teil haben sie damit zu kämpfen, daß die Eltern erwarten, daß sie am Wochenende nach Hause kommen und sie ihren eigenen Weg nicht so leicht finden können. Wenn sie das Wochenende ln der Wohngemeinschaft verbringen, bekommen sie z. T. zu spüren, daß Mitbewohnerinnen ohne Assistenzbedarf ihre eigenen Wege gehen wollen. Das Wechseln zwischen den zwei Lebenswelten ~ hier die Wohngemeinschaft, dort die Herkunftsfamilie - kann ihnen vielleicht helfen, die Distanz zu den jeweiligen Welten zu schaffen oder die Abhängigkeiten von den beiden Systemen zu verdeutlichen. Es kann davon ausgegangen werden, daß sich ihr Entscheidungsfreiraum aufgrund der größeren Abhängigkeit von anderen schon in Grenzen hält und die ungeklärte Situation am Wochenende ihre Abhängigkeit vergrößert. Wie sich die unterschiedlichen Bedürfnisse bzw. Abhängigkeitsverhältnis- se in den Äußerungen der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf spiegelt, soll anhand des folgenden Auszugs aus dem Gespräch untermauert werden.
I: Wie ist es für dich mit dem Wochenende? Wärst Du gerne hier?
B: Ungern.
I: Wieso?
B: Weil ich gerne bei meiner Mutti sein möchte. Aber wir sind auch froh, daß es nur einmal im Monat ist. Das reicht uns, öfters nicht.
I: Kannst du das nicht selbst bestimmen, wo du dein Wochenende verbringst?
B: Ja, sonst darf ich immer nach Hause, aber der Kurt hat sich anders geäußert.
I: Wie ist es bei dir Andrea, möchtest du gerne am Wochenende hier sein?
A: Ja
I: Öfters am Wochenende?
A: Ja.
I: Wieso geht es nicht?
B: Darf ich das sagen? Also sie braucht eine bestimmte Betreuung. Sie kann schon dasein, aber sie braucht eine Betreuung. Wir brauchen keine Betreuung (Andrea jammert bzw. macht Geräusche, die als leider oder so ähnlich zu verstehen sein können), Die Mitwohnenden möchten auch mal ausschlafen, (Bcwolrmcrlııncn m.A. :7)
Im zweiten Gespräch mit den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf wurde die Wochenendregelung nochmals thematisiert, und es kam zur Sprache, daß im ersten Moment alle - außer Andrea, die schon mehrmals in anderen Besuchssituationen den Wunsch geäußert hatte, öfters das Wochenende in der Wohngemeinschaft verbringen zu wollen - mit der Situation zufrieden sind. Sie arrangieren sich mit den Gegebenheiten und fühlen sich in ihrem Selbstbestimmungsrecht wenig ein- geschränkt. Der Gedanke und die freie Entscheidung, vielleicht das Wochenende in der Wohngemeinschaft oder bei den Eltern zu verbringen, sind dann sie ein Thema, wenn sie von außen stark bedrängt werden, das eine oder andere zu tun. Die große Unsicherheit kommt erst im zweiten Anlauf zur Sprache. Die Vorstellung, daß die Eltern sie nicht mehr am Wochenende oder in den Ferien begleiten können oder nicht mehr leben würden, ist für einzelne Bewohnerinnen eine große Sorge. Wo können sie das Wochenende verbringen? Für einen Bewohner ist es selbstverständlich, daß die Wohngemeinschaft dieses Zuhause auch am Wochenende bieten müßte. Eine andere Bewohnerin hat ihre Zweifel und sieht die Wohngemeinschaft noch nicht als ein Zuhause, das auch am Wochenende selbstverständlich sie offensteht.
I: Eine Frage noch zu den Wochenenden, Wie ist es für euch, könnt ihr hier sein, wann ihr wollt?
C: Ja.
I: Könnt ihr das selbst bestimmen?
Alle: Ja.
B: Oder mit absprechen.
I: Und wie ist es in den Ferien, wenn die WG zwei Wochen zu ist, wie ist es euch? Ist es euch schwierig, wenn gesagt wird, ihr müßt nach Hause gehen, weil dies ist ja auch euer Zuhause Wie seht ihr dies?
B: Ja, schon blöd. Aber wenn man ständig hier wäre, wie würde es dann geregelt? Das weiß ich nicht.
I: Ist es für euch schwierig, wenn es heißt: hier ist zu?
B: Ja, das stimmt schon, nach Hause dürfen wir schon gehen. Aber es könnte ja auch mal sein, meine Multi wäre nicht hier und kann nicht mehr. Wo soll ich dann sonst sein, wenn die WG so ist?
I: Das ist eine wichtige Frage, Birgt, das sehe ich auch so. Wenn deine Mutter einfach nicht mehr könnte, und du könntest nicht mehr nach Hause gehen.
B: Was soll ich dann machen? Ich kann ja auch nicht sagen, wenn die WG zwei Wochen zu ist und stehe auf der Straße. Das geht ja bei mir auf alle Fälle nicht.
I: Die Clara ist ja auch öfters am Wochenende hier.
C: Ja, der David auch.
B: Am kommenden Wochenende bin ich bei meinem Vater.
I: Mir war es nochmal wichtig, von euch zu hören, Du, Birgit, hast gesagt, jetzt im Moment ist diese Lösung kein Problem, aber wenn deine Mutter nicht könnte …
E: (unterbricht) Aber wie wird es, ich muß da auf jeden Fall nochmal mit dem Kurt schwätzen. Ich weiß es nicht, wie es dann wird.
I: Und wie ist es für dich, David, daß die WG zwei Wachen zu ist?
D: Gut.
B: Aber wenn deine Eltern nicht mehr können, wo willst dann sein?
D: Ja hier.
B: Darum geht es mir gerade jetzt.
I: Solange die Eltern leben, ist es so okay?
D: Ja.
B: Ja, ja - aber wie lange, das weiß kein Mensch. (Bewohnerlnnen m.A. :11)
Die bisherigen Ausführungen legen nahe. daß eine Sieben-Tage-Assistenz nicht ohne weiteres zu verwirklichen ist. Das ist eines der zentralen Mängel in der bisherigen Umsetzung und eine wichtige Aufgabe, die auf Dauer gelöst werden muß. Das ist zwar allen Beteiligten bewußt, und einige Schritte auf dem Weg sind erreicht, aber eine kontinuierliche Regelung ist noch nicht in Aussicht.
Vor allem die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf bringen deutlich zum Ausdruck, daß ihre Kapazitäten nicht ausreichen, um die durchgehende Assistenz am Wochenende aufzubringen„ Die Verantwortung die Nicht-Einlösung der Sieben- Tage-Assistenz wird den Trägern übertragen, die die Mittel die Assistenz er- halten. Dabei offen und nicht nachvollziehbar bleibt für die Bewohnerinnen die Frage, wieso kein Geld für den zusätzlichen Asslstenzbedarf vorhanden ist. Von seiten des institutionellen Trägers, der die Finanzen verwaltet, ergeben sich die fehlenden Assistenzressourcen durch die Kleinstbesetzung der Wohngemeinschaft. Eine Wohngemeinschaft, in der nur vier Menschen mit Assistenzbedarf wohnen, schafft keine Synergieeffekte wie sie in größeren Einrichtungen möglich sind. Die Kosten der Wohngemeinschaft werden gerade so in etwa mit den vorhandenen Ressourcen gedeckt.
Wie in vielen Einrichtungen der Sozialen Arbeit aber entsteht an der Basis der Ein- druck, daß die vorhandenen Gelder irgendwie von der Institution „geschluckt“ werden.
I: Wie seht ihr die Sieben-Tage-Assistenz?
O: Das ist schon heftig.
L: Ich würde echt gern wissen wollen, daß ich dann einfach nicht verantwortlich bin, und das kann man ja nur leisten, wenn jemand von außen kommt, der bezahlt wird oder daß ich bezahlt werde, wenn ich grade Geld brauchen kann. Ich habe ja auch gerne mit der Andrea was gemacht. Ich war auch mit ihr auf Freizeit jetzt zehn Tage, aber das mache ich doch nicht umsonst, ich bin doch nicht bescheuert. Und das, was mich da halt auch immer ein bißchen gestört hat, ist, daß ich mir überlegt habe, da zahlt ja jemand dafür; daß die Andrea vollstationär untergebracht wird, und dieses ganze Geld kommt aber nicht uns zugute irgendwie, daß jemand sagt, wir stellen euch jemanden zur Verfügung, sondern das wird gefressen von irgendeinem Verwaltungsapparat. Klar du kannst es vielleicht - vielleicht kann man's autark machen, so eine Wohngruppe, ich weiß aber auch nicht, wie sich das dann wirklich, ob das finanzierbar wäre. Aber ich habe das auf dieser Tagung damals in - wo war das? - da oben, da hat man dann gesehen, da wird geschluckt eine immense Summe, einfach für Verwaltung und…
O: mich wundert, daß die Jurastraße so viel dann kostet, daß sich das kaum lohnt oder so …
M: … den Förderplatz … (ehem. Bewohnerinnen :22-23)
Durch die besetzte Praktikantinnenstelle und Zivildienststelle wurde ein weiterer Versuch unternommen, die Assistenzzeiten neu zu strukturieren und effektiver zu gestalten, so daß seit kurzem für alle Bewohnerinnen die Wahlfreiheit an ein bis zwei Wochenenden im Monat besteht, zumindest teilweise in der Wohngemeinschaft zu bleiben.
Auf Dauer müssen Konzeptionselemente von „community care“ (Boilaq 2000 u.a.) oder von „Persönliche Zukunftskonferenzen“ (Boban/Hinz 1999) stärker in die Assistenzgestaltung mit aufgenommen werden, um ein größeres Netz von Unterstützung und Verantwortungsübernahme auch von außenstehenden Personen zu er- reichen. Erste Ansätze ergaben sich durch den Aufbau eines Freundeskreises, dessen Mitglieder schon jetzt ab und zu Assistenzaufgaben übernehmen.
Die Grundlagen den Assistenzbedarf der Bewohnerinnen werden in den Vorgesprächen verhandelt (vgl. Kapitel 12). in welchen Bereichen die einzelnen Bewohnerinnen einen Assistenzbedarf benötigen, erweist sich im Alltag als eine schwierige Frage. Ausgehend von der gleichberechtigten Stellung aller Bewohnerinnen, die eine neue Positionsbestimmung zu dem bisherigen Eltern-Kind-Verhältnis beinhaltet, entstehen im Alltag Leerstellen bzw nicht verplante Zeiträume, die nicht ohne weiteres ausgefüllt werden. Unter den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf besteht die Schwierigkeit, den eigenen Assistenzbedarf zu erkennen und ihn einzufordern. Die neuen Strukturen, die die Wohngemeinschaft bietet, haben nicht mehr den Rahmen, bei dem ständig eine Vorgabe und Kontrolle über den Tagesablauf erfolgt. Das kann dazu führen, daß sich einzelne Bewohnerinnen in ihrer Selbsteinschätzung hinsichtlich ihrer Selbständigkeit täuschen. Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf, die z. T. mit dem Einzug in die Wohngemeinschaft das Elternhaus zum ersten Mai verlassen haben, sehen sich in bezug auf den nötigen Assistenzbedarf großen Herausforderungen ausgesetzt. Die Scheu, jemandem nicht zu nahe treten zu wollen und ihn zu verletzen, spielt bei der Begegnung mit Menschen, die Assistenz benötigen, eine besondere Rolle. Es braucht relativ lange, um als Bewohnerin eine Sicherheit zu gewinnen, in welchen Situationen jemand anderes Unterstützung benötigt. Es ist aber dann noch ein weiter Weg, bis ich als Mitbewohnerin dann konsequent die scheinbare Selbständigkeit des anderen begrenze oder die eigene Unterstützung einfordere. Wie der folgende Gesprächsauszug zeigt, nimmt man die Überforderung einzelner Bewohnerinnen eher in Kauf, während die Konfrontation mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen der Unterstützung stärker mit Ängsten besetzt ist. Hier schließt sich der Kreis zwischen den Bewohnerinnen: Die Überforderung bleibt eher unterbelichtet, mit der Folge, daß sie nicht an- bzw. ausgesprochen wird.
L: … das Ding war glaube ich, daß wir am Anfang davon ausgegangen sind, daß sie sehr viel selbständiger ist, und man hat, glaube ich, viel mehr Angst davor, jemanden unterzubuttern und irgendwie zu übergehen, als daß man Angst davor halt, jemanden zu überfordern. Und das ist vielleicht manchmal ein bißchen schwierig, grade mich. Ich habe noch nie was mit Menschen mit Behinderung gemacht und habe gedacht, die Frau kann alleine duschen, und inzwischen bin ich der festen Überzeugung, die braucht eine Person. Das war ja auch der Plan, daß jemand kommt und sie wirklich pflegt, also mit ihr duscht, weil sie alleine sich ins Bad einschließt und eine halbe Stunde das Wasser laufen laßt, und hinterher hat sie sich die Haare naß gemacht und hat keinen Tropfen Wasser auf ihre Haut gekriegt. Und da hat man einfach eine Scheu, auch zu sagen, die gute Frau kann das nicht, da muß wirklich - obwohl sie's natürlich von der Fähigkeit her könnte, aber die bräuchte da professionelle Hilfe und nicht von mir und nicht von der Monika, sondern eben professionell. Oder jemand ist wirklich so knallhart und sagt, Clara, ich heiße zwar Lisa und hab' keine Ausbildung in keiner Weise, aber ich stelle mich zu dir ins Bad und gucke zu, wie du dich wäschst und auch unter den Armen, undw enn das nicht geht, was ja die Tanja (ehemalige Mitbewohnerin) gemeint hat, daß die das gar nicht kann, daß die nicht über ihre Körpermitte kommt aufgrund ihrer Behinderung, daß man dann sagt, gute Frau, dann mußt du baden und zwar zweimal die Woche, und das hat nie geklappt, die ganze Zeit hat das nicht funktioniert (ehem. Bewohnerinnen o.A. 115-16)
Die Konsequenzen liegen darin, daß mit den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die nötigen Assistenzleistungen klar auszuhandeln sind und die Bereiche, in denen eine Unterstützung notwendig ist, erarbeitet werden müssen. Hier wurde im letzten Jahr durch die Institution ein Evaluationsinstrument (QlBS-Bögen) entwickelt, das zur Zeit erprobt wird und den nötigen Hilfebedarf zusammen mit den betreffenden Bewohnerinnen im Detail ermittelt. Grundlegend bei der Entscheidung die Ausrichtung der Wohngemeinschaft ist der Assistenzbedarf der Bewohnerinnen. Besteht unter den Beteiligten und Entscheidungsträgern Konsens und Interesse, auch Menschen mit hohem Assistenzbedarf in die Wohngemeinschaft aufzunehmen, so drängt sich die Frage auf, wie im Alltag die Assistenzleistungen gewährt werden können. Eine Vernachlässigung dieser Aufgabenstellung kann dazu führen, daß Bewohnerinnen, die keine intensive Pflege und Assistenz benötigen, aber z. B. das gemeinsame Gespräch im Alltag brauchen, nachrangig bedient werden bzw. „nebenherlaufen“ und somit durch die Hintertür neue Hierarchieformen entstehen.
Ein hoher Assistenzbedarf sprengt den Rahmen der Wohngemeinschaft: immer wie- der tauchen in den Gesprächen Überlegungen auf, wie sich die Wohngemeinschaft von den Bewältigungsüberforderungen freischwimmen könnte. Ein Gedanke, der aus anderen Projekten ins Spiel gebracht wird, bezieht sich auf die Möglichkeit, Pflegedienstleistungen nach außen zu übertragen. Dadurch sollen gewisse Assistenzleistungen und Alltagsroutinen aus dem WG-Leben herausgenommen werden, um eine Entlastung herbeizuführen. Da spricht, daß Familien, die in der Bewältigung ihrer Aufgaben an Grenzen kommen, auch auf fremde Unterstützung angewiesen sind. Diese wird aber in den Familien oft erst nach längeren Widerständen und Auseinandersetzungen in Anspruch genommen. Mit einer Außenassistenz ist auch die Abkoppelung von Konfliktthemen aus den WG-Beziehungen verbunden (z. B. bei der Inanspruchnahme eines Wäschedienstes).
J: Andererseits, das hört sich schon einleuchtender an, daß diese pflegerischen Sachen wirklich von einem professionellen Pflegedienst übernommen werden, weil das ist auch in Familien zum Beispiel, wenn da jemand pflegebedürftig ist, eine Riesenbelastung, und dann ist es auch meistens so, daß du eine Schwester kommt oder so, und in einer normalen WG das einzufordern von den anderen Mitbewohnem …
K: genau, auch von der Verantwortung einfach her; die ist ja wahnsinnig, weil bei der Andrea geht's manchmal wirklich um Leben und Tod und was die schanfiir schlimme Anfälle gehabt hat, und immer diesen Druck zu haben: ich darf mir jetzt keinen Schnitzer erlauben, und gleichzeitig wohnt man da aber und soll sich wohlfühlen, und die arbeiten ja alle auch - und auch wenn jemand studiert, dann hat er auch seine Belastung, seine berufliche. Und das finde ieh, also ich denke wirklich, da kommt das Ganze an seine Grenze. Deswegen auch so ein professioneller Dienst, wenn man sagt, ojfen alle, dann muß man das mit einbeziehen, aber da gehts dann gleich wieder ums Geld (Mitarbeiter 215)
Die andere Seite: Die Vergabe nach außen - die nach den Regeln des Wahlrechts der Betroffenen folgen muß - birgt die Gefahr, daß die Beziehungsintensität darunter leiden konnte. Eine institutionelle Versorgungsmentalität, die in vielen Einrichtungen zu beobachten ist, könnte durch die Verlagerung nach außen gefördert und dadurch mögliche Räume eine Kompetenzerweiterung durch die Auslagerung verhindert werden. Unter den Mitarbeitern führen alle Diskussionen, die sich mit der Frage beschäftigen, Assistenzleistungen an andere Dienstleistungsunternehmen abzugeben, zu dem Ergebnis, daß der Preis diese Vorgehensweise zu hoch ist. Die Möglichkeit einer selbständigen Lebensführung wird eingeschränkt, weil die Bewältigung dieser Tätigkeiten zu einer Eigenständigkeit führen kann. Ein weiterer Gesichts- punkt ist die Erinnerung an Institutionen, die viele Tätigkeiten abnehmen, weil sie effektiver und zeitsparender durchgeführt werden können, gleichzeitig aber die Möglichkeiten der Bewohnerinnen beiseite schieben.
K: Ja gut, ich meine Wäsche waschen gehört halt leider Gottes zu unserem Alltag dazu, zu jedem von uns, Aber ich denke wirklich, da kommt so eine WG an die Grenzen, weil so viele Mensehen doch auf relativ engem Raum leben und da gigantische Wäscheberge anstehen, und ich denke, so ein Wäschedienst, das ist auch eine Möglichkeit. Wegen dem Geld ist's naturlich schwierig, aber ich denke, das konnte ich mir vorstellen. Aber man kann dem einzelnen da- durch nicht vermitteln, daß auch zum Alltag Wäsche waschen gehört, das ist ein bißchen so das Problem dabei.
W: Das ist auch wieder so eine Versorgung, eine Versorgung von außen, was man ja an sich auch nicht will.
I: Wie halt die Institution, wie eine große Institution … wenn man sagt, die Wäscherei, die holt das ab und weg ist's.
K: Ja, aber das beißt sich ja in dem, was wir alle gesagt haben, weil wir ja gesagt haben, jede Familie, die überfordert ist mit jemandem, höchstens die Frau, die reißt sich wirklich Tag und Nacht so den Arsch auf, die Hausfrau und putzt das mit oder die Mama, oder wer das ist. Aber es gibt halt dann die Möglichkeit auch, die Wäsche außerhalb zu waschen, und wir müssen wieder von den Institutionen, von unserem eigenen Denken her das vermitteln, Eigenständigkeit, Integration, das heißt, du wirst deine Dreckwäsche auch selber waschen können, darauf müssen wir die Leute hinboxen. (Mitarbeiter :19)
Die Diskussionen um den Einbezug von Außenassistenz erweisen sich in der Praxis als Luftblasen. Zum einen fehlen die finanziellen Mittel, zum anderen führen sorgfältige Überlegungen immer wieder zu dem Ergebnis, daß die Vergabe nach außen mit dem Ziel, die Selbständigkeit zu fördern, kollidieren. Außenassistenz grundlegend abzulehnen, macht keinen Sinn, sofern die Möglichkeiten gegeben sind. Die Schwierigkeit liegt darin abzuwägen, in welchen Situationen die Erleichterung durch eine Außenassistenz den gesamten bzw. auch den individuellen Entwicklungen angemessen ist.
Die Assistenzleistungen, die in einer LIW realisiert werden können, haben auch ihren Preis. Kompetenzerweiterungen können z. B. in bestimmten Bereichen im WG-Alltag zu kurz kommen. Personenbezogene Aufgabenstellungen werden eben nicht in einem Förderplan und täglichem Rhythmus mit genau festgelegten Übungseinheiten durchgeführt. Das sind Grenzen, die auch berücksichtigt werden müssen. Neben dem fachlichen Know-how stehen vor allem der Alltag mit seinen hohen Bewältigungsanforderungen und auch das Ziel, gemeinsam mit den Unterschiedlichkeiten zusammenzuleben, ohne ständig irgendwo die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf hin zu fördern, hier im Wege.
L: Ich glaube auch, daß einiges, also daß wir wirklich wahrscheinlich einen größeren Bedarf an Pflege, … also grade die Clara kam irgendwann mal vom Logopäden und hat Schluck- übungen verschrieben bekommen. Man hat festgestellt, daß ihre Lippenmuskulatur total schwach ist und daß sie immer so mit so Stäben irgendwelche Übungen machen muß. Die hat sie kein einziges Mal gemacht, und dann habe ich natürlich schon auch irgendwo den Anspruch, das sollte jemand mit ihr machen, das könnte jetzt zum Beispiel ich sein, aber die Zeit habe ich nicht. Und dann fühlst du dich immer wie ein .schlechter Mensch, weil du's nicht machst, und wenn du's mit ihr machst, das will sie ja sowieso erst üben, und es ist aber niemand da. Und die Andrea kam aus der Rehaklinik und hat die Bewegungstherapie gehabt und Kunsttherapie und Musiktherapie. Die war hinterher fitter als vorher, und in der WG gibt‘s da niemand, der wirklich mit den Leuten arbeitet, also das ist halt auch immer das, also ich würde sagen, das ist etwas Zweischneidiges, weil sie auf der einen Seite eine Normalität erleben, die sie in keinem Heim kriegen, und auf der anderen Seite ist‘s aber auch, also grade bei der Andrea jetzt weniger, aber grade bei der Clara mit ihren Übungen, ich meine, muß man das machen? Hat man den Anspruch, daß dann wirklich, daß sie dann weniger, daß der Speichel nicht immer so rausläuft? Ich meine, das wäre ja für sie auch toll, weil sie wünscht sich das ja auch, sie sag! ja auch, manchmal hat sie gesagt, sie ist ein armes Mädchen, weil sie keiner anguckt oder irgendwie hat sie ja schon auch ein Gespür da, woran das liegen könnte. (chem. Bewohnerlnnen o.A. :18)
Mit der Lebensweltorientierung verbunden ist die Bewohnerinnen eine zunehmende Offenheit, eine geringere Alltagsstrukturierung und z. T. eine kurzfristigere Planung. Aus der Perspektive der Mitarbeiter wirkt die sozialpädagogische „diffuse Allzuständigkeit“ (Thiersch 1993) in einem weitaus größeren Maße wie in stationären Einrichtungen, in denen der Alltag durchstrukturiert ist. Das fängt z. B. beim Einkauf des alltäglichen Bedarfs an Lebensmitteln an, setzt sich bei der Essenzubereitung und in flexiblen Abendbrotzeiten fort. Diese Offenheit und Flexibilität hat auch ihre Schattenseiten/Schattenzeiten. Manchmal ist in der Wohngemeinschaft auch der Kühlschrank leer, niemand anwesend, der einen versorgt oder genau sagt, was zu machen ist. Diese Leerstellen bzw. Lehrstellen sind die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf zum einen bedrohlich, weil eben bisher das Leben in ständiger Umsorgung plötzlich auseinanderbricht und neue Bewältigungsanforderungen stellt. Zum anderen enthalten sie auch die Chance, Neues zu erproben, wo bisher kein Raum zur Verfügung stand. Bleiben wir bei dem Beispiel der Einsamkeit, so wird sie in der Wohngemeinschaft in einer anderen Weise als bisher zutage treten. im Vergleich zu den anderen Mitbewohnerlnnen, denen andere Möglichkeiten offenstehen, kann auch gleichzeitig die Erfahrung gemacht werden, daß der/die eine oder andere Bewohnerln ohne Assistenzbedarf auch von diesem Thema der Einsamkeit betroffen ist. Diesem Widerspruch tagtäglich ausgesetzt zu sein und auszuhalten, daß die Mitbewohnerinnen aufgrund ihrer sozialen Position andere Bewältigungschancen er- halten, die einem selbst nicht offenstehen und gleichzeitig aber zu sehen, daß auch diese Personen mit ihrem Leben immer wieder an Grenzen kommen, die einem selbst bekannt sind, stellt auch eine besondere Belastung dar. Der Möglichkeitsraum der eigenen Autonomie konfrontiert die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf mit den Wunsch- und Realitätsebenen. Der Umgang damit ist sehr verschieden: Während der/die eine Bewohnerin ihr Leben lebt und sich wenig von den äußeren Einflüssen verunsichern läßt, stellt die ständige Konfrontation mit anderen Lebenswelten einen anderen/eine andere Bewohnerin eine permanente Herausforderung an die eigenen Handlungsmöglichkeiten dar. Die Freisetzung des Einzelnen (Individualisierung), die Pluralisierung der Lebenswelten u.a. mit all den Folgen bricht in der LIW auf, auch für Menschen mit Assistenzbedarf (vgl. u.a. Metzler 1997). Neuman spricht in diesem Zusammenhang von einem unbeschützten Leben (vgl. Neumann 1999 :13).
Besondere Schwierigkeiten der Lebensweltorientierung ergeben sich vor allem im Übergang zu anderen Lebenswelten. Hier darf auch bei dem kritischen Blick auf Wohngemeinschaften nicht übersehen werden, daß andere Lebensbereiche, wie Freizeit außerhalb der Wohnung etc., wenig bereitstellen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben zu können. Inklusion kann nicht nur auf die Wohngemeinschaft begrenzt bleiben, sondern er- fordert einen Ansatz, der sich auf die gesamten Lebensfelder bezieht. Hier ist - wie eingangs beschrieben - noch ein schwieriges Feld zu bearbeiten.
Auf dem Hintergrund der dargestellten Assistenzsituationen sind die folgenden Ausführungen über Möglichkeiten der Teilhabe und Selbstbestimmung zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
Wie in vielen anderen sozialpädagogischen Bereichen besteht ein Bild einer umfassenden und auf die individuellen Bedürfnisse der Personen ausgerichteten Unterstützung, die über die Wohngemeinschaft hinaus in den Sozialraum eingebettet sein sollte und die Teilhabe in der Wohngemeinschaft sowie auch am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.
Diese globale Zielsetzung ist gerechtfertigt, da eine vernetzte Ausrichtung der Wohngemeinschaft den Zusammenhang unterschiedlicher Lebensfelder zurecht als wesentlich für eine gelingende Alltagsbewältigung bereitstellen muß und dazu die unterschiedlichen Ressourcen der Personen und eines Gemeinwesens benötigt. Diese Aufgabenstellung und Zielformulierung wird aber von unterschiedlichen Bedingungsfaktoren begleitet:
-
Die lebensweltorientierte Ausrichtung und Plazierung einer integrativen Wohngemeinschaft erlöst diese nicht automatisch aus einem gesellschaftlichen lnseldasein. Obwohl alltägliche Kontakte möglich sind, benötigt die Vernetzung im Wohngebiet personelle Ressourcen, um eine qualitativ andere Daseinsform, ein gemeindeintegriertes Leben im Stadtteil zu etablieren. Vor allem die Entwicklkung eines Dialogs ist ein anzustrebendes Fernziel, das nicht nur zusätzliche Energien der Wohngemeinschaft erfordert, sondern auch Entlastungen durch ein breiteres Netzwerk zur Folge haben kann. Folgerichtig ist es deshalb, frühzeitig die Infrastruktur des Gemeinwesens miteinzubeziehen (Vgl. Kapitel 3.5ff).
-
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Alltagsbewältigung innerhalb der Wohngemeinschaft. Hier stehen viele Anforderungen, die aufgrund der Geschichte der Personen nicht ohne weiteres in gelingende Prozesse überführt werden können. Zum Beispiel im Bereich der Körperhygiene sind die Aufgabenstellungen so vielfältig und konfliktbeladen, daß hier schon die Wohngemeinschaft mit dem Anspruch der Teilhabe voll ausgelastet ist. Die Folge: Praktisch erweist sich diese Hinwendung und Zuwendung an die Öffentlichkeit bisher als eine Überforderung (vgl. Kapitel 3.5). Sie wird außerdem durch die Effizienzberechnungen im Bereich der Behindertenhilfe konterkariert. Such- und Vernetzungsarbeiten sind keine Leistungskriterien.
-
Grundlegend ist zunächst eine konstruktive Zusammenarbeit mit den primären Netzwerken - in der Regel die Kooperation mit den Eltern - herzustellen. Die bestehenden Lebensweltsysteme (Elternhaus, WfB Wohngemeinschaft, u.a.) müssen hinsichtlich ihrer Bewältigungsformen und Einstellungen erst einmal auf eine solide Basis der gegenseitigen Anerkennung, Akzeptanz und Toleranz gebracht werden. Wohnen ist aus diesen verschiedenen Positionen mit zum Teil sehr gegensätzlichen Vorstellungen und folglich mit verschiedenen pädagogischen Aufgaben verbunden, so daß hier zunächst ein Gegeneinander arbeiten in ein Zusammenarbeiten geführt wird. Ein Beispiel: Bewohnerinnen m. A. und Mitarbeiter berichten in den Gesprächen, daß z. B. Mitarbeiter der WfB, die auch den gleichen institutionellen Träger haben, im Beisein der Bewohner- Innen offen eine abwertende Haltung gegen die LIW in der Werkstatt kundtun und damit sowohl die Bewohnerinnen in eine schwierige Lage bringen als auch das Konzept torpedieren. Gelingt es, eine gemeinsame Basis herzustellen, dann lassen sich gemeinsame Zielvorstellungen entwickeln, die eine weitergehende Perspektive für die Inklusion im Gemeinwesen unterstützen.
Beschränken wir unseren Blick auf die LIW als Wohnort, so kann folgende Sicht- weise der Teilhabe eine Basis geben: Entscheidend für die Teilhabe sind die Assistenz-/Unterstützungstrukturen, die in ihrer Unterschiedlichkeit und nach ihrer lntensität differenziert werden müssen. Nicht der „Schweregrad der Behinderung“ bildet den Maßstab der Unterscheidung, sondern maßgeblich ist, welche konkreten Assistenzformen in den verschiedenen alltäglichen und besonderen Begleitsltuationen nötig sind (vgl. Goll, Jelena 1998 127). Diese Sichtweise ist deshalb wichtig, weil Teilhabe nicht von den Besonderheiten der einzelnen Personen abhängig ist, sondern von den Möglichkeiten, die ein Zuhause bietet.
lm Arbeitsfeld der Behindertenhilfe bedarf es konzeptioneller wie auch praktischer Ansätze, um die Betroffenen als Gleichberechtigte zu akzeptieren. lm Vordergrund steht die Grundhaltung, mit den persönlichen Ressourcen und mit den sozialräumlichen Ressourcen zu arbeiten. In der Praxis bedeutet dies, daß der allgegenwärtige Defizitblick erkannt und bearbeitet werden muß.
Als Einstieg möchte ich ein Erlebnis eines Trägermitglieds darstellen, das zum einen die Normalität der Nicht-Teilhabe an wichtigen Planungsprozessen verdeutlicht, zum anderen die Schwierigkeit von Personen - in diesem Fall einer Mutter - aufzeigt, die sich schon seit Jahren mit Fragen der Integration und Teilhabe auseinandergesetzt haben und Erfahrungen in konkreten Situationen sammeln konnten, in denen sie die Teilhabe ihrer Kinder konsequent einforderten. Neben den Widerständen von institutionellen Strukturen und institutionellem Denken, die bei Eltern, die sich vehement für Teilhabe einsetzen, immer auch die Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Töchter/Söhne hervorrufen, erfordert der Weg der Teil- habe eine ständige Wachsamkeit der Eltern gegenüber den gewohnten fremdbestimmten Prozessen.
T: Doch, ich will nochmal ein Beispiel sagen: Ich war am Wochenende im … (Heim), … und da sehe ich immer die Unterschiede zur Jurastraße und eben zwischen der Zielsetzung, also wir waren eingeladen, um die Werkstatt kennenzulernen. … Dann hab' ich gefragt, die Hanna (ihre Tochter) nimmt doch auch teil, dann sagt der Konrektor, nein nein, die bleibt in der Schule … Dann hab' ich schon mal geschluckt, dann hab' ich gesagt, mir ging's eigentlich auch darum, es dreht sich ja doch um die Hanna, also ich denke, die Leute, die betroffen sind, die sollte man doch vielleicht einbeziehen. - Ach wissen sie, hat er gesagt, das wird auch heute gar nicht entschieden, die ist in der Schule, die ist gut aufgehoben. Also gut. Dann kamen andere Bewohner herein und haben gestrahlt, juhu, Besuch in der Eingangshalle. Manche kennen einen vom Bus und sagen hallo, dann haben die (Mitarbeiter) gebärdet, weiten weitet; Gesprächsrunde, ab ab, nicht stören. Ja, das sind aber erwachsene Menschen gewesen und so gab 's, also immer; laufend solche Bevormundungen von Leuten, die gang und gäbe sind. Das fällt vielen von den Leuten vor allem aus dem schulischen Bereich, die sind glaube ich schlimmer als auf den Gruppen, da gibt's viele, die das merken, aber so dieses Nicht-ernstnehmen und dieses Bevormunden, das finde ich inzwischen so schlimm, und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, eben. …
Ja, und dann haben sie mir noch gesagt, weil ich halt gefragt habe, ob man mit der Hanna so mit Botengängen und so, naja, es wäre halt bei ihnen ein ganz ganz wichtiges Ziel während der ganzen Ausbildung, daß die Leute lernen, stillzusitzen. Und da haben wir uns schon vor über zehn Jahren aufgeregt in der … (Schule für „Geistig Behinderte“), weil Behinderte sitzen immer da wie ausgestopft, das wird denen derartig antrainiert, im Bus und überall, die rühren sich nicht, in der Kirche, im Konzert, jeder darf rumlaufen, bloß die nicht. Und das haben sie mehrmals betont, das wäre also ein ganz wichtiges Erziehungsziel, stillsitzen. Und darum finde ich das so wichtig, daß man hier sagt, okay, natürlich wird sich's im Alltag ergeben, daß man Hilfestellungen, Handreiechungen, Tips und so weiter gibt, aber ich hoffe doch, auf einem anderen Hintergrund als diese Betreuer betreuen. (Träger :20)
Die Bevormundung von Menschen mit Assistenzbedarf paßt treffend zu dem Begriff der Betreuung, der das Treu-sein und Passiv-sein verkörpert. Teilhaben ist ein aktiver Prozeß, der für die Mehrzahl der Bewohnerinnen mit dem Einzug in die Wohngemeinschaft einen ganz neuen Erfahrungsraum darstellt. Dieses ausgewählte Beispiel betrifft eine von vielen Planungs- und Entscheidungsprozessen, in denen die Teilhabe praktiziert werden könnte. Von daher wäre es ein Großprojekt. die einzelnen Situationen von Teilhabemöglichkeiten erfassen zu wollen. in den folgenden Ausführungen beschränke ich mich deshalb auf wesentliche Teilhabe-Strukturen und Gestaltungsmöglichkeiten eines gemeinsamen Zusammenlebens.
Strukturelle Gleichheit und individuelle Verschiedenheit
Teilhabe kann sich in unterschiedlicher Art und Weise in der Wohngemeinschaft herstellen: Zum einen über strukturelle Formen, wie z. B. regelmäßig gemeinsame Wohngemeinschaftsbesprechungen oder strukturell verankerte Vereinbarungen über die gemeinsame Durchführung von Hausarbeiten (Kochen, Putzen, Einkaufen etc.); zum anderen braucht es offene Entscheidungsräume im Alltagsleben und in der Alltagsorganisation, um den individuellen Lebenssituationen der einzelnen Bewohnerlnnen gerecht zu werden.
Verantwortlich mit-eingebunden-sein
Kompetenzen erlernen und erleben die Bewohnerinnen in einer gemeinsamen Alltagsbewältigung, auch die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, wenn sie bei Assistenzleistungen miteinbezogen werden. Ein eindrucksvolles Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung im Wohnprojekt soll hier zur Verdeutlichung skizziert wer- den: im vergangenen Herbst habe ich in der Wohngemeinschaft im Zusammen- hang von Urlaubsengpässen einige Abende die Assistenz in der WG mit übernommen. Dabei kam es zu einer Situation, bei der die Bewohnerin, die zusammen mit mir die Abendassistenz übernommen hatte, noch dringend für zwei Stunden aus dem Haus mußte. Eigentlich war es schon Zeit für Andrea (Bewohnerin m.A.), ins Bett zu gehen, aber wie so oft, wollte sie noch ein bißchen aufbleiben. in der Regel gibt es da nichts einzuwenden. in dieser außergewöhnlichen Situation mußte erst einmal abgeklärt werden, ob Andrea mit meiner Assistenz beim ins- Bett-bringen einverstanden ist. Die Situation erleichtert hatte die Bereitschaft einer weiteren Bewohnerin mit Assistenzbedarf (Clara), die sich einverstanden erklärte, die Zu-Bett-geh-Assistenz mit mir zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen. So konnte die Bewohnerin ihre dringenden Geschäfte erledigen und Andrea noch eine Weile aufbleiben.
Das Zu-Bett-Begleiten erfordert neben der ständigen Aufmerksamkeit vor epileptischen Anfällen ein detailliertes Wissen über praktische Handgriffe, um in hohem Maße ein selbständiges Aus- und Ankleiden etc. zu ermöglichen. Außerdem sind die Vorrichtungen eines Bettgurtes technisch so raffiniert konstruiert und in einer systematischen Reihenfolge durchzuführen, daß diese Leistungen ohne eine Einführung auch beim besten technischen Verständnis nicht zu erbringen sind. Weiterhin sind wichtige Kleinteile an bestimmten Orten aufbewahrt und auch dort wie- der anzubringen, damit nichts verlorengeht. Clara (Bewohnerin m.A.) hatte jeden Schritt verinnerlicht, so daß ich ausschließlich als zweite Assistenz unterstützen mußte.
Zwei wichtige Momente sollen mit diesem Beispiel verdeutlicht werden: zum einen war die Situation der gemeinsamen Assistenz, in der die Clara ihre erlernten Kompetenzen und ihr Wissen einbringen konnte, eine Erfahrung, in der sie gleichberechtigt und, auf die spezifische Situation bezogen, eine anleitende Stellung über- nahm. Für sie war diese Assistenz eine Routineaufgabe, eine Selbstverständlichkeit, die sie mit Engagement und Freude übernahm. Sie konnte zeigen, wie wichtig sie war, und wäre ihr eigenes Standvermögen sicherer, so könnte sie die Andrea öfter alleine für bestimmte Zeit begleiten - was sie immer wieder im Wohngemeinschaftsalltag anbietet. Zum anderen läßt sich an diesem Beispiel aufzeigen, daß Kompetenzerweiterung und Alltagsbewältigung - so banal das klingen mag - an konkreten Aufgaben, die einen Sinn ergeben, erlernt werden können. im Gegensatz zu gestellten oder unter Laborbedingungen hergestellten Lernsituationen verdeutlicht dieses Beispiel wie in einem gemeinsam getragenen und bewältigten All- tag die Trennung von Assistenzleistenden und Assistenznehmenden durchbrochen wird. Diese Teilhabe an Assistenzleistungen von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ist deshalb, soweit sie erbracht werden kann, strukturell mit einzuplanen. Dies beinhaltet auch einen ersten Schritt/Baustein in eine noch weiter auszubauende Konzeption einer von Betroffenen selbst getragenen Assistenz-Selbsthilfe. Als ergänzende und weiterführende Beispiele eines verantwortlichen Mit-eingebunden- seins stehen die Ausführungen zu „demokratischen“ Putzstrukturen (Kapitel 5.4.2) und „Lernprogramme“ im Wohngemeinschaftsalltag (Kapitel 11.10), die hier nicht nochmals ausgeführt werden.
Strukturelle Hilfen auf dem Weg zur Teilhabe
Die WG-Besprechung dient als Forum oder Beirat, in dem die Interessen der Bewohnerlnnen eingebracht und diskutiert werden (sollen). Sie ist das zentrale Mitbestimmungsgremium, in dem alle wichtigen Termine und Absprachen vorgetragen und verhandelt werden. Wöchentlich regelmäßige Wohngemeinschaftsbesprechungen sind die Voraussetzung dafür, daß alle Bewohnerinnen die Gelegenheit haben, ihre Anliegen einzubringen und die der anderen Mitbewohnerlnnen zur Kenntnis zu nehmen. Gegebenenfalls können so konträre Positionen verhandelt werden (vgl. Ausführungen im Kapitel 5.1).
Aus den Erfahrungen in der Jurastraße hat sich gezeigt, daß Belange, die alle betreffen, aber in „Tür- und Angelgesprächen“ bzw. individuell verhandelt werden, die gemeinsame Verantwortung erschweren. Außerdem können individuell ausgehandelte Bewältigungsstrategien die Beziehungen in der WG belasten, weil es da- durch Wissende und Nicht-Wissende gibt oder viele Anfragen, die alle Bewohne- rinnen angehen, irgendwann nur noch an den hauptamtlichen Mitarbeiter gerichtet werden.
Inzwischen sind die Wohngemeinschaftsbesprechungen auch für die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf ein zentraler Ort, an dem sie z. T. ihre Interessen und Wünsche einbringen:
I: Wie ist es mit der Mitbestimmung?
B: Ist okay. Manchmal gibt es auch Meinungsverschiedenheit Aber das gibt es überall mal. Meine Mutti hat auch gesagt, das gibt es überall. Aber ansonsten habe ich damit keine Probleme.
I: Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, was macht ihr dann?
B: Also dann spricht man das an, das wird dann akzeptiert, manchmal halt auch nicht. Dann versuche ich halt das nächste Mal wieder. Dann klappt es. Deshalb haben wir hier auch WG-Besprechung jeden Mittwochabend.
I: Findest Du das gut?
B: Ja, finde ich sehr gut. Was man verändern will, wie es uns geht, was man machen kann. Finde ich kein Problem.
I: Ist das nicht lästig?
B: Überhaupt nicht. Das ist normales WG-Leben hier. (BewohnerInnen m.A. :6)
Zu der gemeinsamen Wohngemeinschaftsbesprechung kommen noch die internen WG-Besprechungen. Bisher kam diese Form der Kleingruppen nur den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf zugute. Diese Treffen, die zwar sehr selten stattfanden, hatten einen Beigeschmack „man kann nicht alles offen reden“ und dokumentierten eine privilegierte Position. Die Mitarbeiter kamen - zumindest nach außen - unter Rechtfertigungsdruck, wobei diese Treffen von dem inhaltlichen und persönlichen Austausch sehr wichtig erschienen und den Prozeß voranbrachten. im Kontext der Auswertung wurde deutlich, daß sowohl die Eltern wie auch die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf diese Treffen sehr wichtig erachten und auch viel über die gemeinsame Position an gegenseitiger Unterstützung geben können. Deshalb wurde den Mitarbeitern im Beratungstreffen vorgeschlagen, diese Kleingruppenform von Gleichgesinnten, Gleichbetroffenen aufgrund der Lebenslage auch den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf anzubieten. in der Umsetzung kam die Rückmeldung, daß die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sehr positiv auf dieses Angebot reagiert haben. Für sie war es eine Erfahrung der Wertschätzung ihrer Person und ein Ernstnehmen als gleichberechtigte Mitbewohnerlnnen. Sie sehen ihr Treffen als einen Rahmen, in dem ihre Probleme und Interessen einen Raum erhalten. Als besonderer Erfolg ist zu verzeichnen, daß ein Bewohner mit Assistenzbedarf in die interne Wohngemeinschaftsbesprechung voll integriert ist. Während er bisher an den Wohngemeinschaftsbesprechungen nur aus der Distanz teilnehmen konnte, indem er immer wieder auftauchte, unter der Tür stand und ständig wieder ging und dann wieder kam, sitzt er die ganze Zeit, wie alle an- deren auch, in der internen Besprechung dabei und engagiert sich sowohl in bezug auf die eigenen Themen und Probleme, wie auch für die der anderen.
Wie findet ihr diese interne gemeinsame Besprechung?
C: Gut.
B: Super.
I: Warum?
D: Zum Probleme lösen.
C: Ja. (BewohnerInnen m.A. 18)
Viele Besucherinnen in der Jurastraße - sei es der Freundeskreis oder das interessierte Fachpublikum - sind erstaunt über die gemütlichen und bis in das letzte Örtchen (WC) persönlich/privat gestalteten Räume, Rein äußerlich ist die Jurastraße von einer anderen Wohngemeinschaft nicht zu unterscheiden: Sie hat eine persönliche und unverwechselbare Note. Diese individuell und gemeinsam eingerichteten Räume sind eine Voraussetzung für ein Sich-zu-hause-fühlen. Otto Speck spricht im Zusammenhang mit der Wohnzufriedenheit von einer „Ortsidentität“, die sich in einem längeren Prozeß herstellt und sich in einem Zugehörigkeitsgefühl äußert (vgl. Speck 1998 225):
„Erst über das Gestalten, also Verändern-können, läuft der Aneignungsprozeß, der ein Haus bzw. eine Wohnung zu einem Zuhause werden läßt. Aneignung ist als ein interaktiver Prozeß zwischen Mensch und Umwelt zu verstehen, bei dem etwas Reales zu etwas Eigenem gemacht wird. “ (Speck 1998 126)
Illustrieren möchte ich dies an den Gestaltungsmöglichkeiten des Wohnzimmers. Von seiten der ehemaligen Bewohnerinnen wurde die Bedeutung des fernsehfrei- en Wohnzimmers hervorgehoben:
O: Ich fand‘s zum Beispiel supergut in der Jurastraße, daß es keinen Gemeinschaftsraum mit Fernsehen gab, das fand ich wirklich super. Gut, ich kenne das oft von so … Heimen und so, da ist es jedes Mal so, der Aufenthaltsraum ist auch so einfach gestaltet, der Fernseher und zackbumm, die Leute kommen rein, Fernsehen an, und dann ist's aus irgendwann, du kennst es ja auch selber …
L: Dann gibt 's auch viel Streit, wer will was sehen und so. …
O: Das war ja dann auch automatisch irgendwie so, daß man dann auch abends halt mal gesungen hat oder so was einfach. Ich denke, das hätte sich nicht entwickelt, wenn ein Fernseher dagestanden hätte.
L: Das finde ich auch toll, also bei uns war das ja eh' so, daß es sehr vielseitig war: der Felix mit seinen Lampen und mit seinen Duftlämpchen, die Monika mit ihrem Klavier, und wenn das nicht von Natur aus so ist, das war halt so einfach - das find ich auch das Schöne an unserer Wohngemeinschaft, daß das von allein so was, und wenn das halt nicht so ist, dann muß man's vielleicht sogar herbeiführen, daß man sagt, stellt euch, wenn's sein muß, ein Keyboard ins Wohnzimmer; vielleicht auch einen Computer. Das war für die Clara eine gute Beschäftigung. Die hat dann angefangen, Solitär zu spielen auf dem Computer; und die Andrea hat immer gern gesungen und fand das immer Klasse, die Anlage, also daß man einfach darauf achtet, daß auch Möglichkeiten da sind, verschiedene, wenn sie nicht schon von alleine gegeben sind. Und was auch Spaß gemacht hat, ganz arg, das habe ich mit dem Felix viel gemacht, war das Zeug gemeinsam einzukaufen, und da hätte man vielleicht auch die Leute mit Behinderung noch mehr integrieren können, daß man sagt, wir gehen mit dem David die Gartenbank kaufen, und er schraubt sie mit uns zusammen, ...Und, ja, wenn man mit den Menschen mit Behinderung gemeinsam das Zeug anschafft, dann kriegen die vielleicht auch viel eher dieses, Das-ist-jetzt-unseres-Gefühl. Also das glaube ich, daß es immer gut ist, gemeinsam einzurichten, und bei uns war's halt so, daß halt eigentlich am Anfang nur die Clara da war und die anderen erst nach Monaten nach und nach gekommen sind, und ich glaube, der Birgit zum Beispiel hat es sehr viel Spaß gemacht, beim Geschirr hätte man ihr wahrscheinlich manchmal auf die Finger klopfen müssen, daß sie nicht das mit dem, was weiß ich - da könnte man mehr gemeinsam machen.
M: Das ist halt immer das schwierige, das in den Alltag zu integrieren, wenn ich mir das jetzt ganz praktisch vorstelle, wenn du einfach so eine Woche anguckst, welcher Tag hätte da gepaßt? (chem. Bewohııerlnnen o.A, :39-40)
Auch wenn bei der Realisierung eines gemeinsamen Gestaltens der Räume in der Jurastraße noch einiges zu verbessern ist und der Hinweis auf einen gemeinsamen Einzugstermin eine bessere Grundlage für eine Mitgestaltung bieten würde, zeigt der Gesprächsauszug dennoch, daß die persönlichen Gegenstände, die die einzelnen in den Wohnbereich einbringen, zu gemeinsamen Aktionen animieren. Der bewußt fernsehfreie Gemeinschaftsraum schafft Begegnungsmöglichkeiten. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch andere Autoren: Speck führt explizit den Fernseher auf, der eine dominierende Rolle im Gemeinschaftsraum erhalten kann und das persönliche Gespräch erschwert und dadurch konkrete Erfahrungen und Begegnungen behindert (vgl. Speck 1998 :28).
In der Jurastraße haben nur Menschen mit Assistenzbedarf Fernseher in ihrem Zimmer. Das hat zur Folge, daß sie auch einmal die Gelegenheit bieten können, andere Mitbewohnerlnnen zu einem Film in ihr Zimmer einzuladen und Fernsehen nicht zu einer Beziehungsgestaltung verkommt.
„Nicht von oben herab“ - Lebendiges Wohnen und demokratische Prinzipien
Mitgestaltung setzt voraus, daß die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt und Entscheidungsprozesse offengehalten werden. Viele kleine Entscheidungen im Alltag dürfen nicht durch Regelwerke oder Vorschriften normiert werden. Dazu gehört auch, daß jedem/jeder Bewohnerin der Freiraum zu gewähren ist, mit seinen/ihren zur Verfügung stehenden habituellen Formen Situationen zu bewältigen. Akzeptanz und Toleranz zu praktizieren, bietet individuelle Möglichkeiten der Situationsbewältigung. Grenzen sind den einzelnen dann zu setzen, wenn sie durch ihre Herangehens- weisen andere damit unberechtigt begrenzen bzw. Machtgefälle aufbauen. Die Wohngemeinschaft braucht jede einzelne Bewohnerin, benötigt die gegenseitige Akzeptanz und egalitäre Strukturen, damit die gegenseitige Verantwortung entwickelt werden kann.
O: Ich find's immer recht schön, es war aber auch ganz natürlich in der Jurastraße, daß alles ein bißchen lockerer war: Ich weiß nicht, wenn's so ganz feste Regeln gibt bei irgendeiner WG ich glaube, das könnte man da nicht bringen, es würde übler sein, wenn man da zu geregelt dann … das vergrault natürlich schon einige Leute …
L: Das hat mich auch gelockt. Also ich weiß noch, was ich erzählt habe, bevor ich eingezogen bin, Da habe ich erzählt, ja, ich ziehe jetzt da ein, und was ich immer toll fand, war, daß ich sagen konnte, ich kann da aktiv mitgestalten, also da sagt mir nicht jemand, das machst du jetzt so und so oder wir machen - klar, für die Eva (Bewohnerin o.A) war‘s wahrscheinlich schon anders, die kam da rein und da war dieses, wir machen da so, und sie hat da einsteigen müssen, aber auf der anderen Seite hat sie ja auch sich eingebracht mit ihrer Art, zum Beispiel grade, wie sie dann Paul (ehem. Bewohner m.A.) entlarvt hat und so, da hätte ich ja gesagt, so machen wir das nicht, aber es war ja super, das war ja Klasse. Und ich täte mir dann auch nie anmaßen, dann der Eva - weil ich bin ja eben keine professionelle Kraft und habe nicht den Anspruch, daß ich jetzt wissen muß, wie's läuft, und das finde ich gut, daß jeder es so machen kann, wie er oder sie denkt, das ist wichtig. Und dann, ja, dieses alte Hasengetue, daß das überhaupt nicht vorhanden ist, das ist wichtig, daß da niemand sagt, ach, ich bin seit zehn Jahren Heilerziehungspfleger und jetzt ziehe ich hier ein Von mir aus kann da ein Heilerziehungspfleger einziehen, aber wenn der mir so gekommen wäre, ich glaube, ich hätte ziemlich .schnell gesagt, ja dann lack mich doch am Arsch, dann macht halt so, wie du denkst, also das würde ich auch weiterhin empfehlen, daß einfach Leute kommen und daß man denen auch sagt, es ist gut, wenn ihr aus dem Bauch heraus arbeitet. (ehem. Bewohnerinnen o.A. :38-39)
Interesse an Planungs- und Entscheidungsprozesse
Viele Aufgaben, die in einem Wohnprojekt zu bewältigen sind, können nicht so einfach in den Alltag der Bewohnerinnen integriert werden oder sind den Bewohnerinnen lästig. Diese Entwicklung zeigt sich auf verschiedenen Ebenen: Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf wollen so wenig wie möglich mit den institutionellen Interessen und Zusammenhängen zu tun haben. Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf haben z.T. noch nicht genügend Kompetenzen entwickelt, um ihre eigene Haltung bei Entscheidungen in der Wohngemeinschaft einzubringen.
Angestrebt werden sollte eine Aufteilung der Arbeiten in Bereiche, in denen eine regelmäßige Abwechslung und verbindliche Übernahme aller gefordert ist bzw. gefördert werden muß. Dabei können ausgewählte Arbeitsbereiche nach Interessen, Kompetenzen und Vorlieben abgesprochen werden. Hierbei erhält die Wahlfreiheit der Assistenz eine wichtige Dimension, z. B. hinsichtlich Körperpflege, Assistenz in intimen Bereichen.
Diskussionen über eine stärkere Beteiligung von Bewohnerinnen an übergeordneten institutionellen Gremien sind zwiespältig. Die Bewohnerinnen sind einerseits froh, daß sie ihre Energien in die Anforderungen des konkreten Alltags stecken können und entlastet werden von den finanziellen, rechtlichen und bürokratischen Angelegenheiten. Gleichzeitig gibt es immer einzelne Bewohnerinnen in der Wohngemeinschaft, die ein Interesse bekunden und sich ein Engagement auf dieser Ebene vorsteilen können. Aus zeitlichen Gründen kam diese Beteiligung nur selten zustande. In einzelnen Situationen, wie z. B. bei der Auswahl eines neuen hauptamtlichen Mitarbeiters, hat sich gezeigt, daß die Teilnahme von Bewohnerinnen beim offiziellen Auswahlverfahren von allen Seiten positiv und konstruktiv für den Entscheidungsprozeß bewertet wurde. Die Chancen für eine größere Beteiligung der Bewohnerinnen an Gremien, wie z. B. das monatliche Koordinationstreffen, wären besser, wenn sich die Sprache und Diskussionsform wesentlich starker an dem Stil der Bewohnerinnen orientieren würde.
Ablösungsprozeß mitgestalten
Die Wohnortsnähe der Eltern zu den Töchtern/Söhnen ermöglicht ihnen Einblicke in die Wohnsituation, bietet ihnen Gestaltungsraum für den Ablösungsprozeß so- wie Unterstützungsmöglichkeiten ihrer erwachsenen Kinder. Die räumliche Nähe zu den Eltern enthält Chancen und Gefahren, die die Mütter auch wahrnehmen. Als wesentliche Aufgabe der Eltern in der neuen Situation betrachten die Mütter die Arbeit an der eigenen neuen Rollenfindung. Dazu gehört, als Gesprächspartnerin für die Söhne/Töchter zur Verfügung zu stehen, die bisherigen Beziehungsmuster zu hinterfragen und Verantwortungsgefühle abgeben zu lernen. Den Auszug von zu Hause beschreiben sie für sich als einen schwierigen Ablösungsprozeß, der sich mit den Perspektiven von anderen Beteiligten (Bewohnerinnen, Mitarbeitern) deckt. Während die Wohngemeinschaft noch mehr Rückzug hinsichtlich der Einmischung der Eltern wünscht, legt die folgende Passage offen, wie viele Prozesse, die jenseits der Wohngemeinschaft stattfinden, bei den Müttern einen Veränderungsprozeß in ihrer Haltung bewirken. Die umfassende Verantwortungsübernahme für ihre Töchter/Söhne wird durch eigene Grenzen (z. B. durch Krankheit) als unbegründet erlebt (vgl. Kapitel Elternmitarbeit). Der Einblick in das Wohngemeinschaftsleben und die mögliche Beteiligung geben ihnen Sicherheit. So sehen sie, daß es ihren Töchtern/Söhnen in der Wohngemeinschaft gut geht.
I: Was würden Sie denn den Eltern noch mitgeben wollen, auf was sie achten sollten, was wichtig ist aus Ihren Erfahrungen?
S: Daß sie ihre Kinder unterstützen und ihnen zutrauen, sich auch zu äußern und zu wehren und ja, daß sie gleichberechtigt sind mit den anderen, daß sie da Unterstützung kriegen von zu Hause. P: Ich denke auch einfach, die Kinder loslassen, das ist ja ein ganz großer Lernprozeß für die Eltern, so habe ich's empfinden, mein Kind überhaupt Ioszulassen, zumal er sowieso nicht dableiben (in der WG) wollte, und ich habe jetzt immer mehr und mehr gelernt, ihn loszulassen, da bin ich ganz glücklich drüber.
P: Ja, jetzt sowieso. Dadurch, daß er am Wochenende immer dort geschlafen hat, weil ich ja so schlecht beieinander war, und da merke ich richtig ich denke gar nicht unter der Wbche groß an David. Ich sage wohl, David, wenn du Lust hast, dann rufst du mich mal an, Kann sein, er rufi die ganze Woche nicht an, dann ist es auch in Ordnung, dann hat er keine Sehn- sucht nach mir oder irgendwie, man kann's auch positiv sehen. Wenn ich denke, wie war's bei mir früher? - Ich habe zu Hause auch nicht angerufen, ich kam dann am Wochenende nach Hause, mit meinem möblierten Zimmer da, und das ist eigentlich in Ordnung so. Und anfangs habe ich mir ja immer Gedanken gemacht, oh, wenn's regnete morgens, jetzt ist die Zeit, daß David zum Bus geht, jetzt wird er doch naß! Jedes Mal, wenn's mir nicht gut geht, dann denke ich, mein Gott, denk' an dich und laß' ihn doch mal, die anderen laufen auch mit offenen Jacken und werden naß.
R: So weit bin ich noch nicht.
P: Das kommt nach, das kommt noch, das garantiere ich Ihnen. Dann denke ich: gut, laß' ihn naß werden - was hat mich das anfangs berührt zu Hause, unbegründet. …
P: Habe ich morgens gedacht, wenn er von der Jurastraße um viertel nach sieben ging, dann dachte ich, ah, es regnet, der macht doch keinen Schirm auf die Birgit hat ja immer den Schirm gleich auf und der David geht dann so …
R: David, der ist naß bis auf die Haut …
P: So merke ich, das habe ich jetzt wirklich gut gelernt, loszulassen. …
S: Ja, das ist bei mir auch so, daß ich durch die Woche, obwohl k der Andrea ja oft nicht gut geht und mir das ein Riesen-Anliegen war und ich gedacht habe, packen die das auch oder packen sie's nicht oder heißt das, daß die Andrea wieder raus muß oder wie auch immer; und ich muß sagen, daß ich in der Woche eigentlich nicht an die Andrea denke und am Anflıng, jeder Anruf der kam, der ist mir von oben bis unten in den Magen gegangen, jetzt kammt's, jetzt ist was passiert, jetzt wird sie jetzt muß ich los. Ich bin innerlich einfach gelassener; das muß ich schon sagen. Ich kannk ja eigentlich denen überlassen. Ja, ich sehe es auch, daß ihr's da gut geht. (Mütter 123-24)
Für eine Teilhabe an der Wohngemeinschaft bietet sich neben klaren Besuchsregelungen, kontinuierlichen Gesprächen mit den Söhnen/Töchtern und dem haupt- amtlichen Mitarbeiter sowie gemeinsamen Treffen mit allen Bewohnerinnen, Eltern und hauptamtlichem Mitarbeiter vor allem ein regelmäßiges Elterntreffen an (ausführliche Darstellung in Kapitel 7.3 Elternmitarbeit).
Inhaltsverzeichnis
- 11.1 Zwischen Kompetenz und Überforderung
- 11.2 „Normalität“ als Anspruch
- 11.3 Selbstbestimmung der Assistenzwahl
- 11.4 Durchsetzungsvermögen, Bewältigungsstrategien, Aushandiungsprozesse - eigene Perspektiven
- 11.5 Uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht
- 11.6 Selbständigkeit im Alltag und Wege zur Selbstbestimmung
- 11.7 Die Macht der Gewohnheit
- 11.8 Bedürfnisentdeckung als Grundlage für Selbstbestimmung
- 11.9 Freiheitsmomente im Alltag und strukturelle Grenzen der Selbstbestimmung
- 11.10 Alltagsgestaltung und Förderung im Kontext von Selbstbestimmung im Wohnbereich
Selbstbestimmung beinhaltet zunächst begrifflich das „Selbst“ bestimmen zu kön- nen. Verstehen wir unter dem Selbst, die Balance zu finden mischen dem Eige- nen, den eigenen Bedürfnissen einerseits und den Anforderungen der anderen bzw. Umwelt andererseits, so wird deutlich, daß Selbstbestimmung immer vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontextes zu definieren und zu erklären ist. lm Bereich der Behindertenhilfe hat die Diskussion um das Selbstbestimmungsrecht eine besondere Bedeutung, weil in der Vergangenheit und z. T. auch noch in der Gegenwart den Menschen mit Assistenzbedarf in vielen Lebensbereichen dieses Recht überhaupt nicht zugestanden wurde. Es ist wahrscheinlich nicht überzogen, daß in unserem Kulturraum die Fremdbestimmung - als Opposition zur Selbstbestimmung -- eine Alltagswirklichkeit darstellt, der nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Eltern in einem großen Maße ausgeliefert sind. Diese Erfahrungen bestätigen sich in vielen Berichten von Betroffenen und Eltern, z. B. bei medizinischen Arztkontakten, bei Entscheidungsträgern des Kindergartens bzw. der Schule. Selbstbestimmung ist eher ein Fremdwort im Lebensweg von Menschen mit Assistenzbedarf. Kennzeichen ist der Kampf gegen die Fremdbestimmung. Eigene Wege, eigene Ausdrucksmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien von Menschen mit Assistenzbedarf erscheinen dabei eher in Verhaltensweisen, wie z. B. Festhalten an gewohnten Strukturen etc.
Ausgangspunkt ist die Haltung und Überzeugung, daß jede Person - so hoch der Assistenzbedarf auch sein mag - die Fähigkeit besitzt, selbst Entscheidungen treffen zu können und deshalb in verschiedenen Bereichen in ihrem Selbstbestimmungsrecht wahrgenommen bzw. ernst genommen werden muß (vgl. Hahn 1994 :81).
Selbstbestimmung setzt voraus, daß die Bewohnerinnen Wahlmöglichkeiten haben. Konkret im Wohnalltag stellt sich die Frage: Welche Regiekompetenzen er- halten Bewohnerlnnen im WG-Alltag? Was dürfen sie selbst entscheiden oder mit- entscheiden, ohne daß darauf Einfluß genommen wird? Entscheidungsmöglichkeiten bietet das Wohnen in Hülle und Fülle. Einige Beispiele: bei der Zimmergestaltung, bei lns-Bett-geh-Zeiten, bei der Kleidungsauswahl, bei Freizeitaktivitäten, bei Außenaktivitäten, bei Besuchen, bei der Essensauswahl, bei der Gestaltung von Geburtstagsfeten usw. Die Bewohnerinnen schätzen diese Partizipations- und Wahlmöglichkeiten und sehen in der LIW einen Raum zur Mit- und Selbstbestimmung.
I: Was gefällt dir gut hier, Clara?
C: Laut Musik hören.
I: Was noch?
C: Geburtstagsfeier.
I: Daß du hier Geburtstagsfeier machen kannst?
B: Hier kann man immer aussuchen, was wir essen mögen. Die Clara sagt zum Beispiel, was sie mag, und dann wird das auch gemacht.
I: Könnt ihr auch während der Woche Vorschläge machen - mitbestimmen?
B: Kann man auch.
C: Ja.
B: Da sitzen wir zusammen, dann fragt man: was wird gekauft, was wird gemacht, geht man zum Essen? Solche Dinge gibt es.
C: Spinatnudeln.
B: Genau, Spinatnudeln, Clara, machst du das mal wieder? Die macht es echt gut.
I: Du kochst das hier, Clara?
B: Sie kocht alleine, andere kochen auch alleine.
I: Wie oft macht ihr das?
B: So wie wir Lust haben.
C: Immer.
B: Nicht immer, ab und zu mal.
C: Am Wochenende immer. (Bcwohnerlnnen m.A. 14)
Die Erfahrungen in der Wohngemeinschaft Jurastraße zeigen, daß Selbstbestimmung als Orientierungsprinzip nur dann als eine reale Grundlage für eine gelingende Alltagsbewältigung dienen kann, wenn der Assistenzbedarf mit den Beteiligten ausgelotet wird. lm alltäglichen Umgang wird sichtbar, daß viele Konflikte auf einen nicht geklärten Assistenzbedarf zurückzuführen sind.
K: Und die Clara braucht auch ihre Strukturen und wird auch in ihrer Selbstbestimmung ganz klar eingegrenzt. Klar, logisch, aber sie kriegt's allein nicht hin, sie hat selber die Struktur nicht, das zu machen. … Genauso sagt sie auch immer am Wochenende, daß' sie sich selber versorgen kann. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist jetzt auch rausgekommen an dem Wochenende, als die drei alleine waren, da hat mir die Birgit ganz klar erzählt, daß die Clara fast nichts kann. Wenn die hier allein in der WG ist, dann boxt sie sich irgendwie durch mit allem möglichen Essen oder Trinken, was halt grade da ist, aber das ist alles andere als irgendwie positiv ernährungstechnisch. Das ist das gleiche, da ist auch, da gehst du auf ihr Wort, daß sie's kann, Du redest mit ihr, und dann sagst du, okay, du kannst das selbständig machen, Du sagst das, ich muß das nicht überprüfen und nach längerer Zeit jetzt, dann glaubst du ihr das, und sie sagts weiterhin und will die Hilfe dann auch irgendwie nicht, oder ich weiß nicht, waruın. Mit der Wäsche und mit dem Zeug ist's genauso. Wenn du da nicht ständig hinterher bist und sie kontrollierst und beaufsichtigst, dann geht gar nichts.
A: Aber sie kann 's, also das meiste kann sie da, sie kann stellenweise bei der Bettwäsche die Bezüge nicht zuknöpfen oder aufknöpfen, aber das meiste kann die allein, das sieht dann wirklich okay aus, aber man muß danach gucken. Es muß klar sein, an welchem Tag, und man muß kontrollieren, muß sehr viel kontrollieren. Aber die kann da schon manches, aber genau mit dem Waschen, ich weiß auch nicht, wie gründlich sie sich dann wäscht. Auf jeden Fall hat sie dann gut gerochen und hat sich auch die Haare gewaschen, es war wirklich dann wesentlich angenehmer. (Mitarbeiter 138)
Verdeckte Bewältigungsstrategien erschweren den Klärungsprozeß und führen zu Kontrollsituationen, die niemand von den Bewohnerinnen gerne ausführen möchte und die verständlicherweise als unangenehm empfunden werden. Die Gefahr, die sich dabei hinterrücks einschleichen kann, besteht darin, daß ein Kompetenzansatz bzw. Ressourcenansatz aus dem Blickfeld gerät und eine Defizitorientierung die Oberhand gewinnt bzw. an die Oberfläche treten kann. Mit anderen Worten: Kontrolle schärft den Defizitblick und wird zum Helfer des Defizitblicks, während die Festlegung eines reellen Assistenzbedarfs die Chance bereit- hält, die Ressourcen ins Blickfeld zu setzen.
Selbstbestimmung in der LIW zu verwirklichen, benötigt in bezug auf Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf viel Raum und Zeit, um in vielen alltäglichen Situationen Mini-Entscheidungen zu ermöglichen bzw. zu fördern. Der Weg zu einer Sensibilisierung für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche ist in vielen für uns selbstverständlichen Bereichen durch die Gewohnheit des Fremdbestimmtsein schwerlich in Gang zu setzen. „Normalität“ als Zielsetzung, die den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die gleichen Entscheidungsräume bereitstellt, setzt einen gegenseitigen Verständigungs- und Verstehensprozeß voraus, der dauernd die eigenen und fremden Bewältigungsmuster hinterfragt. Die folgende Passage weist darauf hin, wie viele Entscheidungen, die wir heute Kinder mittreffen lassen, für die Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf keine Selbstverständlichkeit sind.
A: … das wäre für mich das Normale, so wie ich mich auch ankleide oder so wie ich mit meinen Kindern einkaufen gehe, da gehe ich immer davon aus, so wie ich das für mich in meinem Alltag strukruriere mit meinen Kindern, so möchte ich's eigentlich auch gern mit der Andrea oder mit den Leuten auch machen: ihnen die Wahl geben, was sie anziehen möchten, was ihnen paßt, was ihnen gefällt farblich und nicht wieder fremdbestimmen und sagen, die fünf Hosen, die sind grade im Angebot und die könnten irgendwie vielleicht nach pi-mal-Daumen passen, zack, nimm' sie mit, ist doch egal, wie die morgens in die WjB reinhumpelt, wie das aussieht - das ist doeh ein Unding. (Mitarbeiter :63)
Die Assistenzwahl in der Jurastraße hat sich zunächst ohne große Planung ergeben. Dadurch blieb in der Regel ein situatives Wahlrecht für Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf möglich. Dieses Wahlrecht nehmen Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf auch bewußt wahr, in dem sie klar zu erkennen geben, wen sie für die jeweiligen Assistenzaufgaben dabeihaben möchten. Nicht ausgeschlossen werden können Situationen, in denen aufgrund der situativen Anwesenheit von einzelnen Assistierenden eine Auswahl nicht gewährt werden kann. Insbesondere bei der Bewohnerin mit durchgehendem Assistenzbedaıf bietet der Rahmen nicht immer ein Mitbestimmungsrecht bei der Assistenz. Die vorhandene Vielfalt von Assistenzleistenden läßt in der Regel z. B. bei der täglichen Begleitung zum lns-Bett-gehen auch spontane und situationbezogene Wahlmöglichkeiten zu.
Allgemein bildet die gegenseitige Sympathie die Grundlage für die Assistenzwahl.
O: Ich weiß eigentlich gar nicht, Selbstbestimmung, das war gar nicht groß in der Jurastraße, weil auch irgendwie niemand einem anderen irgendwie Befehle gegeben hat. Ich glaube, du hat man schon drauf geachtet, daß haltjeder - wenn du jetzt auch sagst, Pflegebedarf, daß sich jetzt ein Behinderter seinen Pfleger unter den anderen raussucht oder so …
L: Das ist nie passiert, die Andrea hat sich von mir irgendwann nicht mehr an- und ausziehen lassen, das wollte sie, daß das der Oskar macht. Die Clara hat sich nur vom Felix die Nägel schneiden lassen, also von jemand anders wäre sie nicht auf die Idee gekommen, zum Felix ist sie freiwillig hin und hat gesagt, hier. Der David hat sich nur von der Monika die Haare waschen lassen, bei allen anderen war's … Wutanfall. Das hat sich ergeben, und wir haben auch drüber gesprochen irgendwie, daß man das dann so ein bißchen aufteilt …
O: Man guckt ja selber auch, von wem man ausgewählt wird, das ist ja auch klar: Ich meine, da machst du genauso viel wie der andere. Wenns nicht paßt, dann macht irgendeiner von beiden nicht mehr mit - doch, so war's, in der Jurastraße schon. (ehem, Bewohnerinnen o.A.. :55)
Der Gesprächsauszug vermittelt eine vehemente Vertretung der eigenen Assistenzwahl bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf. Die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sehen aus ihrer Sicht eine gegenseitige Wahlmöglichkeit gegeben. Sie nutzen auch die freie Wahl, so daß sich hier von selbst eine Zuordnung und Unterstützung herausbildet und sich dadurch Assistenzstrukturen ergeben. Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf äußern sich zufrieden über die zustande gekommenen Zuordnungen:
I: Könnt ihr selber die Leute auswählen, die euch helfen sollen?
B: Ja, das ist die Gabi und Evi für die Andrea, wen du hast, weiß ich nicht.
C: Kurt.
B: Und der David hat auch zwei …
I: Ist es für dich okay, daß der Hubert und Felix das mit dir, David, zusammen machen? Sind dies auch die Personen, mit denen du das machen möchtest?
B: Haja, meine Mutter hat gesagt, ich soll meine Wäsche hier waschen, meine Mutter muß zu Hause viele Wäsche waschen, auch für meinen Vater.
I: Für dich ist es okay, daß der Hubert und Felix das mit dir machen oder würdest du dir gerne andere Personen heraussuchen?
B: Nein, der Hubert und der Felix.
I: Und für dich, Clara?
C: Ist auch okay.
I: Und für dich, Andrea?
A: Ja. (BewohnerInnen m.A. :9)
Grenzen entstehen für einzelne Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf in Beziehungsstrukturen, in denen einseitige Erwartungen von anderen Mitbewohnerlnnen mit Assistenzbedarf in den Bereich der lntimität, Freundschaft und Sexualität übergehen. Ein Beispiel:
L: Beim Paul ist's mir schwergefallen. Der Paul ist auf mich abgefahren, und das war mir unangenehm, das war mii' echt unangenehm, und ich habe mich da auch zurückgezogen, und ich habe eigentlich gedacht, ich habe gespürt, ich bin die Person, die eigentlich wenn, dann bin ich die sagt, he, wir leihen jetzt einen Videofilm aus und gucken den jetzt zusammen an, das habe ich auch ein Mal gemacht, aber das war - da hat er sein Zimmer aufgeräumt und hat halt Cola auf den Tisch gestellt und Gläser geholt und alles, super Erfolgserlebnis, aber eigentlich wollte ich's nicht, das war mir unangenehm, das ist dann schon schade. Und das ist ein Männer-Frauen-Ding, glaube ich, das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, daß ich den Paul nicht leiden kann, sondern ich habe einfach, das war mir einfach unangenehm.
I: Hast du das Gefühl gehabt, da ist eine Erwartung da an dich als Frau?
L: Vielleicht, ich glaube, so arg kann man das gar nicht so klar sagen, was da jetzt wirklich war, aber ich habe halt zum Beispiel gemerkt, ich gucke in den Bildschirm, und er starrt mich an, und dann habe ich auch gedacht, mich anzustarren und irgendwie hallo da, Film, aber ich kann ihn ja nicht zwingen, einen Film zu gucken, wenn's ihm jetzt Spaß macht, mich anzugucken. Und das war schon ein bißchen blöd dann habe ich natürlich habe ich das nicht mehr gemacht und habe dann gedacht, Mensch, ja, wir haben auch mal zu zweit mit ihm was angeschaut. Das war dann schon eher okay, aber ich glaube, das hat ihn dann auch nicht mehr … ich weiß nicht. (ehem. Bewohnerlnnen o.A, 155/56)
Unter dem Thema Selbstbestimmung werden von den Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf alltägliche Situationen angesprochen, die einen interessanten Blick auf die Machtverhältnisse und den Umgang mit Anforderungen zwischen den Bewohnerinnen eröffnen.
Aus der Perspektive der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sind die Mitbewohnerinnen mit Assistenzbedarf durch ihre direkte und unmittelbare Art eine Herausforderung. in diesem Interaktions- und Kommunikationsbereich sehen sie für sich einen Beratungs- und Qualifizierungsbedarf. Hierdurch wird die notwendige Begleitung der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf durch den hauptamtlichen Mitarbeiter sichtbar (vgl. Kapitel 6.2.3).
Die Schlagfertigkeit und das Durchsetzungsvermögen der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf hat aber auch „Schlagseiten“. Die Lebenswelt der Wohngemeinschaft unterscheidet sich von dem bisherigen Familienleben durch eine Beziehungsstruktur und -kultur, in denen kein Eltern-Kind-Verhältnis zugrunde liegt. Überlebensstrategien der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf in diesem neuen Wohnumfeld, die sich auch in Verweigerungshaltungen äußern können, erhalten mehr Raum. Auch deshalb, weil die Zuschreibung der Elternrolle von den Mitbewohnerinnen ohne Assistenzbedarf nicht übernommen wird und somit vergangene Abhängigkeitsstrukturen nicht angeboten werden. Hierbei entsteht für die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf auch ein Bild vom harten Alltag, weil die Bewohne- rinnen mit Assistenzbedarf in dieser Art und Weise bisher nicht in die Verantwortung genommen wurden. Eine Versorgungsmentalität, die ihren bisherigen Lebensweg kennzeichnete, wird in der LIW nicht angeboten bzw. versucht abzubauen. Gefordert wird mehr Eigenverantwortlichkeit.
Die Konsequenzen aus diesen offenen Strukturen fordern eine ständige Reflexion und Abstimmung innerhalb der Wohngemeinschaft über den notwendigen individueilen Assistenzbedarf hinaus, um einerseits Überforderungen und andererseits Vermeidungsstrategien zu verhindern. Zuletzt deshalb, weil die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf Durchhaltevermögen und konsequent-sein als Kompetenz entwickeln müssen, um dem Beharrungsvermögen und den Ausweichstrategien von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf entgegentreten zu können. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, daß die meisten neuen Bewohnerinnen ohne Assistenz- bedarf lernen müssen, als Partnerin hinzustehen und nicht aus Mitleid zu betütteln und in dieser Weise sich die eigene Bestätigung zu holen. Deshalb ist intensive Vorbereitung und enge Begleitung durch den hauptamtlichen Mitarbeiter nötig. Freiheit als neue Dimension im Zusammenleben beinhaltet auch Verantwortungsübernahme der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, die in vielen Alltagssituationen von ihnen geleistet wird und erbracht werden kann. Als Ergänzung zu dem folgenden Gesprächsauszug ist anzumerken, daß einige Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf z. B. im Bereich der Medikamenteneinnahme viel zuverlässiger als die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf auf die notwendige pünktliche Verabreichung achten.
Grundsätzlich gilt auch noch zu bedenken, daß die Bewohnerinnen mit Assistenz- bedarf eine Vollzeitstelle in der WfB haben und sich hier die Frage stellt, ob ihnen eine Teilzeitbeschäftigung einen besseren Rahmen für die Bewältigung der Arbeiten im privaten Wohnen geben könnte.
M: Und grade von der Selbstbestimmung, also so ganz spontan würde ich sagen, ich denke, da haben eher wir gucken müssen, daß wir selbstbestimmt waren, Also ich denke, eine Clara, wenn die was will, das kriegt die hin, das kriegt die wirklich hin, die kann das so verfolgen, und wenn sie's nicht will, dann kriegt sie's nicht hin. Die kriegt Sachen hin, das hätte ich nie gedacht. Ich habe ein Jahr lang gebraucht, daß die wirklich eine Küche tiptop hinbringen kann, wirklich, die putzt die, ich hab' bloß geguckt, ich hab' gedacht, wer war jetzt denn da? das hat sie aber das erste Jahr fast nicht gemacht, wirklich, ich weiß noch, ich kann mich an den Tag echt noch erinnern, wo ich gedacht habe, wer war jetzt da, und dann war das die Clara. Und auch eine Andrea kann ziemlich genau sagen, was sie will und was sie nicht will. Beim David finde ich, also der David durch das, daß er sich so rauszieht, - eine Birgit, die kriegt auch hin, was sie will.
L: Die sagt das, ja.
M' Da muß man aufpassen, also die kann dich drücken, da muß ich erst mal schlucken, bevor ich dann zu einer Gegenantwort, also die …
O: … das ist doch mein Essensgeld! Den letzten Toast und Sprudel, das ist doch mein Essensgeld.
M: Ja, ich habe sie drauf aufmerksam gemacht. Sie hat sich nie in den Einkaufsdienst eingetragen gehabt und hat schon, ganz nett natürlich, ich bin ja nett, dann sag' ich, Birgit, jetzt guck' mal, wir wechseln immer, also einkaufen ist einfach das Schwierigste, da muß man zu zweit sein, und das kostet wirklich viel Kraft und so, und die war ja bei mir eingetragen wenn ich eingekauft habe und dann … wo dann das nächste Mal die Runde rumgegangen ist, wo sie sich eingetragen hat, da hat sie sich beim … was weiß ich, wo sie sich eingetragen hat, dann hab' ich gesagt, ja Birgit, hättest du nicht Lust, dich da mit einzutragen, beim Einkaufen Nein, sie hat sich jetzt da eingetragen, und das hat sie letzte Woche gemacht, und das macht sie jetzt weitet; und ich soll sie nicht so blöd anmachen, also so in der Art.
O: Die Clara und die Birgit sind ja auch irgendwann mal draufgekommen, aha, wir nehmen einfach den Plan … und schreiben uns einfach in die besten Jobs rein M: Ja genau, also die wissen schon, wie sie drankommen, und wir haben uns ja eine Zeitlang bloß jede Woche immer eingetragen, und die haben sich dann im voraus schon für fünf sechs Wochen für die Sachen eingetragen, die halt wirklich ganz schnell gehen, und da komme ich mir dann blöd vor, wenn ich dann hinterher kommen muß und Ding …
L: Ja, das ist schon, also man muß vielleicht wirklich eher auf die Nichtbehinderten aufipassen, daß sie noch den Blick dafür behalten…
M: Natürlich ist es wichtig, daß sie lernen, einkaufen zu gehen, auch wenn sie keinen Bock haben, wenn's anstrengend ist, weißt du, das ist ja auch immer das, ja, das ist etwas Anstrengendes. Ich meine, bloß einmal in der Woche ist es vielleicht schon nett, einkaufen zu gehen, aber daß das vielleicht wirklich eine Verantwortung ist und daß man es dann vielleicht auch machen muß, wenn man keine Lust hat, das ist dann - das gehört nämlich auch dazu, so zur Selbstbestimmung, daß man einfach vielleicht mal was macht, wenn man keine Lust hat. Das ist nicht bloß das, daß man jetzt das und das und das lernt, okay, nach und nach und dann hat man's gelernt, dann kann man 's, aber daß man dann auch, daß das dann vielleicht auch heißt, okay, ich muß das jetzt - ich mache das auch nicht so gern, ich muß das auch machen, und ich bin ja bei der Andrea manchmal wirklich streng gewesen und hab' gesagt, Andrea, auch du machst was, auch du kannst was dazu beitragen. Ich weiß, die ist manchmal schon, die hat mich manchmal schon angeguckt, aber das finde ich wirklich, die kann auch ihren Teil beitragen, die Prinzessin da auf der Erbse, von allen hofiert.
L: Ja, das weiß sie auch, das merkt sie schon auch.
M: Und die kann nämlich auch viel, aber Sache ist halt das, von allein macht sie das oft auch nicht, man muß dann schon sagen, Andrea, du hast heute Dienst, du bist mit dem Kochen dran, und jetzt kommst du.
O: Das war auch schon immer schwierig weil sie sind ja auch alle von zu Hause gekommen, da war dann schon Befehlsgewalt, und bei uns ist es ja so, wir wollen zusammen und im Prinzip weiß aber auch schon jeder von denen, daß wir denen nichts zu sagen haben Der David, der sagt ja auch, du hast mir nichts zu sagen, und ich bleibe hier und so, aus basta.
M: Ja, aber wenn man zusammen wohnt, dann gehört das auch dazu, daß der …
0: Ja, aber die sind ja noch in der Rolle von den Eltern.
M: Ja, so die Versorger-Mentalität.
L: Die haben ja auch, also der Ernst hat damals auch gesagt irgendwie, so zuviel Freiheit, daß das gar nicht ja, du kommst da her, und erst mal läuft alles nach dem Motto, jeder macht das, wo er Bock drauf hat, und erst nach einem halben Jahr merkt man, da sind immer die gleichen die Doofen, und dann fängt man an, den Leuten irgendwie vorsichtig mal was zu sagen, und eigentlich mußte man wahrscheinlich wirklich von Anfang an klarmachen und sagen, so wie in den Wohngruppen mit den sogenannten nicht so netten Behinderten, weil da haben wir ja echt also harmlose Fälle, daß man sagt, wenn ihr nicht einkauft dann gibt's nichts zu beißen, und wenn irgendjemand dann von euch Hunger hat, dann bestellen wir den Pizza-Service, und du zahlst die Rechnung. Das machen die in der Wilhelmstraße, wenn da einer seinen Kochdienst nicht macht, dann wird da vielleicht der Pizza-Service gerufen, und dann zahlt der, der nicht kochen wollte, der keinen Bock hatte, der kriegt das abgezogen von seiner Arbeitsprämie. Ich weiß nicht, ob das die Andrea je irgendwie ob die das realisiert, ob die das schnallt, aber ich meine, die täte wahrscheinlich nie meckern. Der David vielleicht auch nicht, der hat ja auch genug Kohle, wer weiß. Aber ich würde den Leuten echt sagen, seid nicht so - man denkt immer, man ist schlecht, wenn man so streng ist oder so unnachgiebig, aber das nervt mich jetzt wirklich auch schon, wenn dann irgendjemand, wenn ich Leute sehe, die noch auf dieses … die armen Behinderten, man tut denen keinen Gefallen und sich selber erst recht nicht. Das ist schön und gut, denn man ist wie ein Babysitter, der wenn dann mal das Kind dann ruhig ist, dem alles kauf), was es haben will, ein Eis und ein Cola und noch irgendwie Süßigkeiten, bloß damit es - und dann, die Mama hat dann den Ärger, weil es das nächste Mal halt sagt, ich mag die Tante Lisa viel lieber als dich, also da ja gut, aber vielleicht ist das auch ganz gut, wenn das die Leute einfach lernen. Mir hat ja auch niemand eine Lehrerin verpaßt und gesagt, Lisa, mach' das so oder mach' das anders, Aber daß drauf geachtet wird daß das nicht ganz so …
M: Die haben das wahrscheinlich einfach auch nicht gelernt, daß die Leute meinen, wenn die Menschen behindert sind, daß man sie nicht in die Verantwortung genommen hat, und das ist natürlich dann vielleicht für manche schon ein bißchen hart, wenn sie dann plötzlich in die Pflicht genommen werden, wenn jemand sagt, du wohnst zusammen mit uns, ich koche jetzt oder der Felix kocht, und dann kannst doch du auch was machen, dann kannst doch du den Tisch decken oder kannst dann sonst was machen. Und das ist noch nicht so lange gewesen, daß man dann wirklich auch grade den David und so weiter, daß man die dann auch in den Dienstplan mit reingeschrieben hat, weil okay, wegen was sollen wir da wuseln und rennen und gucken, und die machen gar nichts selber, da kommt einem das dann mit der Zeit ein bißchen so vor, und die Birgit motzt dann, wenn man zu ihr was sagt, und das hab' ich dann schon nicht schlecht gefunden, wo man dann - am Anfang hat sie gemotzt, und dann aber im Gespräch ist dann schon rausgekommen, man ist dann …
L: … vorher die Frau … (Clara) mir beim Zwiebelschneiden zu und sagt zu mir, ich muß das Brett naß machen, weißt du, da denke ich auch, ja aber hallo. die hat schon mal Zwiebeln geschnitten, und dann tut sie aber so, als wußte sie nicht, wie herum man ein Messer hebt und das ist einfach, ja, da muß man halt wirklich ein bißchen Detektiv spielen auch und gucken, daß man die Leute nicht überfordert. Aber grade die Clara ist ziemlich gut in sich wirklich saublöd stellen und so tun, als hätte sie von Tuten und Blasen keine Ahnung, und beim Paul war's wirklich so, daß der mit einem Messer vor einem Stück Kuchen steht und das noch nie gemacht hat, noch nie, obwohl der ja viel fähiger wäre als die Clara, und der hat das noch nie machen müssen. Und dann muß man da einen Unterschied machen und sagen, die Clara hat zwar mehr Schwierigkeiten, aber sie weiß sehr wohl, wies geht, und sie stellt sich nur doof und der Paul hat wirklich keinen Plan, obwohl er, wenn sich ein Band verwickelt in der Anlage, weiß, in welche Richtung muß er das Rädle drehen, weil seine Mama ihm wirklich alles an den Arsch hingetragen hat. Und das ist halt, da muß man echt ein bißchen wirklich beobachten und vielleicht auch, ja, diese Versuche, daß die Clara zum Beispiel aufeinmal putzen kann, wenn 's ihr langweilig ist, daß sie aufeinmal die Milch aufmachen kann, wenn sie alleine ist oder als sie den Finger gebrochen hatte, da hat sie behauptet, sie kann den Telefonhörer nicht halten, ich muß ihr, wenn sie telefoniert, den Telefonhörer ans Ohr halten, dann hab' ich gedacht, he, jetzt spinnst du aber wohl, und dann bin ich ein Stockwerk höher und hab' dann gehört, wie sie versucht hat, leise heimlich zu telefonieren, dann ging's auf einmal. Also so die Augen offenhalten und ja, wirklich die Leute halt … vielleicht nicht so viel Angst davor haben, den Leuten zuviel zuzumuten, weil wenn sie's nicht hinkriegen …
O: … das ist auch nicht so schlimm.
L: Und die Clara hat oft so getan, als ab sie's nicht hinkriegt, als ob sie jetzt anfangen mußte zu heulen Dann hat man zu ihr gesagt, jetzt nimmst du's nochmal - manno, dann hat sie's hingepfeffert und einen Wutanfall simuliert, und wahrscheinlich war sie auch wirklich stinkesauer, aber nicht, weil sie's nicht kann, sondern weil sie das ankotzt, daß ich das jetzt will, daß sie das macht. I: Jetzt das Thema nochmal, daß man hinschauen muß, was die Leute können, also am Beginn und auch sie gleichzeitig damit konfrontiert, daß ein WG-Leben heißt, ich muß quasi auch da Verantwortung übernehmen
L: Die Clara hat wirklich versucht, von uns sich mehr betütteln zu lassen, um einiges mehr; als sie's nötig hatte. Die hat uns ziemlich lang wirklich verarscht, kann man sagen, wobei man nicht unterstellen kann, daß das wirklich boshaft war; sondern sie ist ja eigentlich ziemlich schlau, sie hat gemerkt, wir machen ihr das alles, Brot kleinschneiden, wie oft, wie lang haben wir der das Brot gestrichen, die Butter aufs* Brot geschmiert, und jetzt schmiert sie sich abends ihr Vesper und tut's in den Kühlschrank für den nächsten Tag. Da denkst du doch auch manchmal, also
M: Und ich glaube, vielleicht ist das, wenn sie in die WG kommen will, einfach ein bißchen mehr Freiheit, oder wenn der feste Rahmen nicht ganz so da ist, weil so einen ganz festen Rahmen gibtfis ja eigentlich nicht, weißt du, daß sie dann, daß sie vielleicht bloß die Freiheit sehen und aber halt was zur Freiheit dazugehört, daß das manchmal vielleicht eine bittere Seite hat, also das, ich glaube, das müssen sie erst lernen. (ehem. Bewohnerinnen o.A. 58-64)
Die Strukturen und Vereinbarungen innerhalb der Wohngemeinschaft müssen für besondere Situationen einen Freiraum bereitstellen, in dem dem persönlichen Selbstbestimmungsrecht ein absolutes Vorrecht eingeräumt wird. Immer wieder tauchen Phasen auf, in denen einzelne Personen aus ganz unterschiedlichen Gründen, die auch nicht direkt mit der Wohngemeinschaft Zusammenhängen können, z. B. Beziehungskonflikte mit dem/der PartnerIn, Probleme auf der Arbeit usw., die Gemeinschaft auffordern, besondere Regelungen für die eigene Situation zuzugestehen. Der hauptamtliche Mitarbeiter sollte die persönlichen Situationen der einzelnen Bewohnerinnen, ob mit oder ohne Assistenzbedarf, im Auge haben, um rechtzeitig auch den einzelnen Personen Möglichkeiten aufzuzeigen, neue Wege zu beschreiten und die Gruppe darauf aufmerksam zu machen, daß sie Verständnis und Zustimmung für besondere Freiräume von einzelnen aufbringt.
K: Ich meine auch, wenn jemand kommt, und es ist offensichtlich, daß es einfach, Schnauze voll, und dann würde ich das schon versuchen. es zu respektieren, daß der jetzt einfach nicht mehr in der Lage ist, mit einem bestimmten Thema sich zu beschäftigen oder so, da würde ich nicht mit aller Gewalt, und du mußt jetzt, weil … oder so. Sondern ich würde auch dem das Recht zugestehen, wirklich sich selber auch mal einen Freiraum zu geben und zu sagen, jetzt grade überhaupt nicht. (Mitarbeiter 250)
Einige Bewohnerinnen sind in ihrem bisherigen Leben in ihrer Selbständigkeit nicht ausreichend gefordert worden. Ein Beispiel hierzu ist die eigene Auswahl der Kleidung, die bisher bei einer Bewohnerin in der Verantwortung der Mutter lag. Sie ruft deshalb ständig ihre Mutter an, um abzuklären, weiche Hose sie z. B. anziehen soll. im Gespräch mit den Mitarbeitern wird hervorgehoben, daß entscheiden lernen in bestimmten Alltagsbereichen Fehlentscheidungen produziert, die aber keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen. Aus Erfahrungen lernen heißt auch, als Mitarbeiter unpassende Entscheidungen von Bewohnerinnen stehen lassen zu können.
K: … learning by doing, das heißt für mich, zu ihr zu sagen, jetzt hockst du vor deine drei Hosen in deinem Zimmer hin und tust sie anbeten oder angucken, und dann ziehst du irgendeine an, und wenn's die Winterhose ist, dann wirst du's merken, wenn du den ganzen Tag schwitzen mußt, daß es die nicht ist, wenn 's heiß ist. Weißt du, wie ich meine? Nicht ihr ständig diese Entscheidung abzunehmen, daß dann ihr Betreuer das übernimmt, sondern daß sie sich mit der Materie auseinandersetzen muß, und wenn sie den ganzen Frühdienst macht, so lernt man das.
… Dieses erfahren, dann die falsche Hose eventuell doch anzuziehen und mit den Winterstiefeln bei dreißig Grad ins Geschäft zu gehen, und dann mußt du mit den Winterstiefeln den ganzen Tag auskommen, und das machst du dann nie mehr.
J: Und vor allem: das ist ja ein Erfahrungsbereich dann für sie, du kann ja nichts mehr passieren, als daß sie mal verschwitzt heimkommt oder so was. Wenn's um Medikamente geht und um solche Sachen, oder wenn 's darum geht, daß man sich verletzen kann, dann - ich denke auch, da geht's darum, die Selbstbestimmung dann so einzuschränken, daß niemand gefährdet ist. Aber ansonsten, in diesem Alltagsgeschäft, da können die so viele Erfahrungen machen, und wenn man vielleicht mal die Erfahrung machen muß, wie ist das in einem Zimmer, das total verdreckt ist und dann den Unterschied kennen, wie ist das Zimmer dann, wenn ich das gemeinsam mit dem Mitarbeiter wieder auf Vordermann gebracht habe und es wieder sauber ist. Aber daß man auch so ein bißchen selber entscheiden kann. wo fühle ich mich denn wohl, was möchte ich denn, aber wenn man die Erfahrung da ständig vorenthalten kriegt, weil die Eltern immer gucken, daß alles klinisch rein ist … (Mitarbeiter 246-47)
Die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf sehen z. T. selbst die Schwierigkeit, daß sie in vielen Entscheidungssituationen noch auf die Hilfe anderer angewiesen sind und hier für sie ein wichtiges Neuland entsteht.
I: Wo könnt ihr Dinge selbst entscheiden, die ihr bisher nicht entscheiden konntet?
B: Das muß ich noch üben (lacht), das kann ich nicht immer.
I: Kannst du ein Beispiel machen, Birgit?
B: Oh je! - Beispiel - bei allem …
I: Bei vielen Sachen? Und warum fällt es dir schwer, selbst zu entscheiden?
B: Manchmal frage ich die Leute, manchmal frage ich überhaupt nicht die Leute, dann mal rag ich meine Mutti, darf ich, darf ich des, darf ich sell, dann fängt die an: hör doch auf. Das fällt mir so schwer. (BewohnerInnen m.A. :8)
Die unterschiedlichen Lebenswelten der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf - hier die Wohngemeinschaft, dort das Elternhaus - mit ihren unterschiedlichen Praktiken, Norm- und Wertvorstellungen lassen sich nicht so einfach verknüpfen. in einigen Bereichen prallen hier unterschiedliche Welten aufeinander. Die jahrelange Versorgung z. B. erschwert den Verselbständigungsprozeß. Die Nähe der Mütter birgt auch die Gefahr, daß sie ständig Verantwortung übernehmen und Einfluß nehmen. Damit werden z. T. Prozesse des Selbständigwerdens und der Raum für Selbstbestimmung beschnitten.
K: Wenn ich zu dem schon gesagt habe, beim Bad oben, er soll jetzt auch ein Waschbecken putzen, dann steht der da wie die Gans vor dem Apfelbutzen, weil das alles die Frau B. immer gemacht hat. Die Leute sind in der Hinsicht ganz ganz weit unten, und ich weiß nicht, wie weit die dazu fähig sind, da schon längerfristig einiges dazuzulernen, aber dann müßte man ganz anders rangehen, dann müßten wirklich die Eltern draußen sein, denn das packen wir einfach nicht, denn die Eltern, die drücken ja massiv rein, das ist so brutal. …
Y: Das ist ganz arg schwer; das aus der Hand zu geben, so das eigene Kind, die Kontrolle, so was herzugeben
K: Die sind halt so überängstlich, das merkt man immer wieder. Mein Gott, die trauen denen so wenig zu, die halten sie für viel kleiner, als sie sind insgesamt auf jeden F all. (Mitarbeiter :48)
Im letzten Jahr haben sich im Koordinationstreffen der Träger, an denen Mütter als Mitglieder der AGI vermehrt kontinuierlich teilnehmen, einige offene Diskussionen ergeben, die sich mit Fragen der Elternbeteiligung befaßt haben. Obwohl dieses Treffen allen offensteht, nehmen die Bewohnerinnen z, T. aus zeitlichen Gründen oder aus der Unsicherheit einer fremden Kultur nicht teil. Die Distanz zum Alltag der Wohngemeinschaft, die die meisten Mitglieder dieses Arbeitskreises haben und das gemeinsame Interesse und Engagement, diese Wohnform weiterzuentwickeln, ermöglichten Diskussionen, in denen völlig konträre Positionen zur Mütter- bzw. Elternbeteiligung offen ausgetragen wurden. Obwohl die Mütter z. B. mit ihren Vorstellungen jahreszeitlich bezogener Aktivitäten zur Gestaltung der Gemeinschaftsräume ziemlich Gegenwind erhielten, blieb am Ende des Gesprächs ihrerseits eine positive Resonanz auf die Widerstände. Die offene Streitkultur führte dazu, daß sie ihre Angebote außerhalb der Wohngemeinschaft durchführten und somit eine direkte Einmischung in die Gestaltung der Wohngemeinschaft vermieden. An dieser Stelle wird auch noch einmal deutlich, daß Diskursforen, die nicht unmittelbar mit den Betroffenen (und über sie) geführt werden, die Chance enthalten, vorhandene Konfliktfelder zu bearbeiten (vgl. auch Kapitel Elterntreffen).
Gewohnte Bewältigungsstrategien und bisherige Ressourcen erlauben den Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf keinen selbstverständlichen Umgang mit Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Während die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf z. T. auch lernen müssen, ihre Bedürfnisse - frei und unabhängig von den vermittelten HeiferInnenbildern - zu äußern und zu vertreten (Vgl. 11.4), ist die Aufgabenstellung bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf noch grundsätzlicher zu verstehen. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die bisherigen Denkstrukturen zu durchbrechen, um Bedürfnisse, die bisher keinen Raum hatten bzw. nicht abgefragt wurden, entdecken zu lernen.
K: Nein, die sind total überfordert, weil sie halt aus einer ganz anderen Struktur kommen. Das haben wir ja vorher so mitgekriegt, also grade mit dem Elternhaus, also das ist ja was die nicht kriegen das ist ja klar, wenn du dann ein Leben lang in so einer Struktur aufwächst und gar nichts anderes kennst und wo's heißt, das machst du, das ist gut für dich, und das machst du nicht, das ist nicht gut für dich, also da kannst du ja gar nicht so denken. (Mitarbeiter :56)
Die Strukturen der Wohngemeinschaft bieten den Bewohnerinnen mit Assistenz- bedarf in kleinen Teilbereichen die Möglichkeit, selbständige Entscheidungen zu treffen - aus Sicht der Mitarbeiter in einem größeren Umfang als das bisher möglich war (siehe nächster Gesprächsauszug). Dies zeigt sich z. B. an der freien Wahl, auch am gemeinsamen Abendessen einmal nicht teilzunehmen, ohne daß die Bewohnerinnen oder Mitarbeiter hier einschränkend einwirken. Neben den biographischen Erfahrungen, die neuen Schritten auch im Wege stehen, liegen die Grenzen der Selbstbestimmung - wie eingangs erwähnt- in den strukturellen Bedingungen von Assistenzmöglichkeiten. Immer wieder treten strukturelle Grenzen an die Stelle von Entscheidungsmöglichkeiten. Besonders eklatant sind hier Ferienzeiten, in denen den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf jegliches Wahlrecht des Wohnens bedauerlicherweise vorenthalten wird.
Y: Und ich denke, da kommt es auch drauf an: wie wird Selbstbestimmung vom einzelnen definiert und angenommen? Also ich denke, daß die Leute mit Behinderungen in der WG schon selbstbestimmter leben wie zu Hause, ja, und das anders erleben oder genau, Arbeit, wo dann wirklich Kontrolle dann einfach im Vordergrund steht und auch der Arbeitsauftrag und das persönliche Erleben. Ich denke, das kann man so pauschal nicht erfassen.
K: Ich denke, so in kleinen Teilbereichen, da können sie selbständig entscheiden.
X: Denn grade auch, wenn wir dann zusammensitzen, da kann jeder entscheiden, mache ich jetzt noch einen Spaziergang oder nicht Ich meine klar, dann steht da aber die Überforderung gegenüber; ich bin's von daheim nicht gewohnt, ich geh' nicht allein weg. Wenn jetzt niemand mit mir geht, dann bleibe ich halt in der WG, und da sind dann wieder die Schranken.
J: Aber es ist klar; es muß sich jeder dran beteiligen, zum Beispiel die Nahrungsmittel ranzuschaffen und zuzubereiten, aber wenn jemand sagt, ich habe jetzt keinen Bock, dann kommt er halt nicht zum Essen dazu und möchte vielleicht später was essen, dann gibt's nichts mehr - gut, aber er hat die Entscheidung. Also so Teilbereiche, da kann man sich wirklich selbständig entscheiden.
K: Dann gibt's halt zum Abendessen nichts mehr, oder die können sich zum Beispiel irgendwas anderes machen oder so, nicht wie in der Familie, entweder ißt du jetzt oder du gehst ohne Essen ins Bett. Der David hat oft keine Lust, abends mit am Tisch zu sitzen und das zu essen, was gekocht wird, manchmal, dann geht er halt lieber und macht sein Müsli, aber da sagt keiner was, du hockst jetzt hierher und ißt das, weißt du so. Was ich halt schade finde ist das, was ich jetzt halt auch wieder merke, wenn ich Urlaubsplanung mache, daß manchmal die Menschen mit Behinderung keine große Entscheidungskraft mehr haben, weil dann die Institution, der Rahmen zu eng ist, daß ich nicht sagen kann, jeder kann machen, was er will, das tut mir selber weh, daß ich dann sagen muß zu gewissen Personen und mit den Eltern schwarzen, ob das nicht geht, daß sie Urlaub machen von der WG und dann halt von daheim aus ins Geschäft gehen, weil wir sonst das Ding nicht geregelt kriegen Und da muß ich dann die Leute mit Behinderung heimschicken, wegschicken, obwohl sie gar nicht wollen und mit denen das auch organisieren, und da ist auch die Selbstbestimmtheit auf dem Nullpunkt, obwohl sie da wohnen. (Mitarbeiter :57-58)
Darüber hinaus ist das Thema Grenzen der Selbstbestimmung ein ambivalentes für die begleitenden Personen. Die Einsicht, die aus den konkreten Erfahrungen gewonnen wurde, daß in bestimmten Situationen den Bewohnerinnen eigene Verantwortung nicht überlassen werden kann, aber gleichzeitig das Hineinversetzen in das Gegenüber deren Verhalten und Haltungen verständlich macht, führt dann zu einem Konflikt, der in der Praxis nicht einfach auf zu lösen ist.
Y: Selbstbestimmung und Helm, das ist ein Thema für mich.
I: Ja, inwiefern ?
Y: Ja, weil sie sich einfach massiv dagegen wehrt, den aufzuziehen Und wenn sie kurz da- vor gekippt ist und so quasi gegen besseres Wissen, eigentlich mußte man ja denken, sie muß das doch eigentlich selber merken, aber ja, immer wieder das gleiche. Und dann einfach für einen selber, man steht ja auch in der Verantwortung, wenn ihr was passiert. Klar, ich verstehe das, daß sie den nicht aufsetzen will, und sie sagt selbst, sie artikuliert das, der stört mich, und das verstehe ich auch. Ich würde den auch nicht gern aufziehen wollen, grade wenn's warm ist oder so, aber wenn dann was passiert, dann ist man halt auch dran, dann wird gefragt, ja warum hat sie den Helm nicht aufgehabt?
J: Also da kommt ja auch massiver Druck von den Eltern, die dann ganz klar sagen, sobald die Frau ein bißchen allein rumgehen möchte, aufjeden Fall den Helm, bei jedem Schritt.
K: Mit den Medikamenten ist es doch genauso. Du bist immer nur darauf angewiesen, ob die Andrea ihre Medikamente einnimmt dir zuliebe, oder ob sie bockt. Also das habe ich schon wieder gemerkt in der Woche, seit ich jetzt vom Urlaub du bin, abends und morgens teilweise massiv Schwierigkeiten gehabt, damit sie ihre Medis nimmt. Das will sie einfach nicht, das sieht sie nicht ein, oder sie will sie einfach nicht mehr schlucken oder so, wo ich total verstehe, das ist ja eine halbe Apotheke, was die jeden Tag schluckt - die macht sich auch einen Spaß draus. Aber trotzdem, du bist in der Verantwortung, du mußt die Medis rechtzeitig geben, das habe ich in der Fortbildung auch gelernt. das ist sehr wichtig wie der Arzt praktisch das auf- geschrieben hat und wie sie eingestellt ist, daß man das einhält, und da sind wir diejenigen, die das managen müssen. (Mitarbeiter 24211)
Wohnen heißt zu Hause sein. In diesem Lebensbereich sind die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Lebensstile etc. am ehesten zu verwirklichen. Zumindest verbinden wir mit dem Wohnen einen Privatbereich, in dem die eigene Gestaltungsmöglichkeit ihren Platz zugesprochen bekommt. lm Gegensatz zu anderen Lebensbereichen, wie z. B. Arbeit, Schule etc., in denen die Unterordnung strukturell geregelt und notwendigerweise akzeptiert werden muß, hoffen wir, zu Hause diesen fremden Einflüssen entrinnen zu können bzw. uns ihnen nicht aussetzen zu müssen. Trotzdem ist auch im privaten Wohnbereich die Selbstbestimmung als Gegensatz zu Fremdbestimmung (zwei Ordnungsbegriffe, die es in einer „Reinform“ nicht geben wird) wie auch anderswo immer abhängig von der Definitionsmacht der anderen. Da sich die LIW durch die Begleitungsaufgaben der hauptamtlichen Mitarbeiter und Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf auch als „Arbeitsfeld“ aus- zeichnet, stellt sich hier die Frage, in welcher Art und Weise in dem privaten Wohnbereich Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Anhand einer längeren Diskussion im Trägergespräch wird, im Zusammenhang von Selbstbestimmung, die Diskrepanz in Interaktionssituationen zwischen Bedürfnisäußerung von einer Person und Bedürfniswahrnehmung der anderen Personen dargestellt. Gesprächsgegenstand ist der Wunsch einer Bewohnerin mit Assistenzbedarf. Kuchen backen zu wollen. Diskutiert wird darüber, wie dieses Bedürfnis zu verstehen ist. Interpretiere ich die Situation als Wunsch, einfach zusammen einen Kuchen zu backen, oder liegt in der Äußerung der Wunsch, einzelne Arbeitsschritte und die Zusammenstellung der Zutaten vermittelt zu bekommen. Kompetenzerwerb ist ein Vorgang, der auf unterschiedliche Art und Weise der Vermittlung entstehen kann, aber sehr stark durch Spaß und Freude sowie eigen- geleitetes Interesse an der Aktivität gebunden ist.
Ein wesentlicher Grundgedanke in der Gestaltung des Alltags besteht darin, gängige Vorstellungen über Förderung und Fördermethoden zu hinterfragen und stärker an den Bewältigungssituationen anzusetzen.
S: Also ich denke, ob jemand was lernen will, das muß er auch zum Teil selber in dem Alter mitbestimmen - also wenn zum Beispiel jetzt die Andrea einen Kuchen backen lernen will, dann ist es okay, wenn sie dann sagt, zeig' mir mal, wie das geht.
U:…nie jemand einen Kuchen backen lernen wollen, es will jemand einen Kuchen backen.
T: Ja, die will einen Kuchen backen, fertig
S: Doch, die will wissen, wie das geht.
T: Nein, überhaupt nicht, die will Kuchen backen, fertig.
S: Die will doch aber wissen, wie das geht.
T: Nein, die Andrea will Kuchen backen, fertig - dann backt die Kuchen, und dann mußt du ihr bei dem Backen, wenn du willst, daß ein Kuchen dabei herauskommt, da mußt du ihr helfen, sonst…weil wenn sie einen Kuchen backen will, dann will sie doch einen Kuchen und sonst nichts.
S: Du hast doch grade gesagt, wenn sie will, daß ein Kuchen herauskommt dabei.
T: Nein, sie will einen Kuchen backen - sie will einen Kuchen backen, der Vorgang Kuchen backen ist ihr wichtig.
S: Das ist natürlich ein Unterschied, ab sie einen Kuchen will, den sie nachher zum Kaffee anbieten kann oder selber essen, oder ob sie bloß matschen will.
T: Die will nicht matschen, die will Kuchen backen, fertig.
V: Der Weg wäre im Grunde genommen ein anderer; der Weg mußte sein: wenn du einen Kuchen backen möchtest, dann ist das toll, aber dann sollte natürlich am Ende auch was rauskommen, daß wir miteinander hinsitzen können und dann einen Kaffee trinken können und Kuchen essen. Dann haben wir alle was davon, das wäre der Weg im Grunde genommen, diese Gemeinschaftlichkeit auch…
S: … daß man das Ziel definiert…
V: … rauskommt und sie hat mehr dann auch für die Gemeinschaft getan und deswegen, denke ich, muß der Kuchen ebenso gebacken sein, daß man ihn hinterher auch essen kann, und deswegen muß auch ein Ei rein und nicht nur Mehl und was weiß ich, Backpulver noch und Zucker muß noch rein und all diese Sachen. Man muß es entsprechend verrühren, in einer entsprechenden Folge und so, das kann man schon, denke ich, dann miteinander auch diskutieren vor Ort, und sie kann trotzdem die Aktivität machen, die sie gern machen möchte.
T: Und wenn sie jetzt aber, wenn ihr das vollkommen wurst ist, ob da ein Kuchen rauskommt oder nicht…
S: Dann mußt du doch auch abwägen, kannst du eigentlich diese Masse an guten Sachen, die da alle sind, kannst du die nachher alle fortschmeißen oder kannst du das nicht.
T: Vom Geld her kostet es nicht mehr als Ton oder Knet oder Modelliermasse…
V: Das sind halt die…zur Erziehung dann halt beitragen, daß man Lebensmittel einfach nicht vergeudet.
U: Ich sehe den entscheidenden Unterschied einfach auch darin, die Andrea will gern einen Kuchen backen, und dann sage ich aber, ich habe keine Lust jetzt oder ich' habe keine Zeit dazu, also da kommt auch nochmal auf eine andere Art eine Gleichberechtigung irgendwo rein, also ich muß nicht dauernd hinterher sein, um mit denen bestimmte Programme zu er- füllen, bestimmte Lernziele zu erreichen…
T: …das kann Schule und Ausbildung…aber es gibt ja viele Erwachsene, die machen Kurse und wollen noch irgendwas lernen, die gehen dann noch…
V: Ich denke, das ist deshalb auch eine falsche Vorstellung, wenn man von Lernprogramm redet. Ich finde, es sind gezielte Aktionen auf bestimmte Vorstellungen hin, auch Dinge, die von den Leuten, die dort wohnen dann auch geäußert werden, wo denke ich Änderungswünsche da sind die eben noch in den Anfängen stecken…und dann rede ich auch von einem Lernprogramm, weil ich dann mir Gedanken mache, in welchen Schritten zeige ich das demjenigen, daß er es auch wirklich weithin nachvollziehen kann, üben kann, so lange üben kann, daß wirklich irgendwann dann auch etwas Selbständiges dabei herauskommt.
U: Gut, das paßt für mich gut rein, wenn der berufsbegleitende Dienst sozusagen jemanden anleitet am Arbeitsplatz, also zum Beispiel jetzt, wie man so eine Geschirrspülmaschine bedient und schnell füllt - dann macht das einen Sinn, Ich habe gewisse Bedenken, wenn man also jetzt sozusagen so ein Programm also in den Alltag, ja als Förderprogramm sozusagen einbaut, weil da halt schon irgendwo nochmal, da wird die Beziehung in einer anderen Weise definiert halt so.
V: Aber ich denke, das Problem ist doch, wenn Menschen mit diesen Einschränkungen in der Wohngemeinschaft leben, dann ist doch das Problem, daß sie im Grunde genommen in der Tat da an der Stelle am leichtesten auch was lernen können, wo sie im Grunde genommen das selber nutzen können und umsetzen können. Da nutzt mir so ein abgehobenes Lernprogramm mit der Spülmaschine irgendwo im anderen Raum gar nichts, sondern es nutzt nur in dem Haus, in dem ich mein eigenes Geschirr spüle, wo ich die Spülmaschine benutzen kann, die mir vor Ort zur Verfügung steht…
V: Du kennst nicht das wohlsortierte Repertoire vom Wasserhahn…wo du einfach die Fähigkeit, einen Wasserhahn aufzumachen, an zehn verschiedenen Hahnen einübst, damit du später tatsächlich, wenn du mal einen hast, das schaffst.
U:…und dann schaffe ich's grade in dem Moment nicht.
V: Da haben wir uns früher arg drüber aufgeregt, über dieses Beispiel, aber das ist schon lange her.
U: Aber genau das wollen wir ja nicht lernen. Also ich denke mir, da sind wir nicht weit aus~ einander: Also es geht wirklich nicht darum, ob wir von einem Lernprogramm reden oder nicht Mein Anliegen wäre schon, daß man deutlich macht, daß man sich Gedanken machen muß, welche Schritte muß ich unternehmen, um jemandem etwas zeigen zu können, daß es auch ankommt, daß ich nicht nur sage, das macht man halt so, und dann kommt nichts an, sondern daß ich das, was ich sagen oder beibringen will, je nach Bedarf auch aufgliedere in kleinste Schritte, daß es ankommt, nämlich das ist das, was wir auch dort machen müssen, sonst kriegen wir Probleme da…(Träger :24ff)
Die Diskussion um die Formen des Lernens kann nicht auf eine bestimmte Herangehensweise beschränkt werden. Einigkeit besteht unter den Trägermitgliedern, daß jede Form zur Kompetenzentwicklung an konkreten Alltagssituationen orientiert sein muß. Der Blick auf die vier vergangenen Jahre in der Wohngemeinschaft läßt erkennen, daß verschiedene Strategien erfolgreich sein können: Alle Bewohnerlnnen mit Assistenzbedarf nehmen an Bildungsveranstaltungen für Erwachsene der VHS (in Kooperation mit der Lebenshilfe) teil, die sie selbst aussuchen: Kochen, Tanzen, Schreiben lernen etc. Sie nutzen hier außerhäusliche Strukturen, um bestimmte Interessen zu lernen und zu vertiefen.
Alltägliche Bewältigungsanforderungen werden durch das gemeinsame Tun auf der Basis einer gleichberechtigten Teilhabe zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Wohnens. Dadurch verlieren sie auch den Charakter einer schulischen bzw. defizitorientierten Beziehungsgestaltung, die auf dem Hintergrund der biographischen Erfahrungen nicht positiv und selbstwertfördend erlebt wurde. Dies schließt nicht aus, daß in einzelnen Situationen spezifische Hilfestellungen, wie z. B. ein (visuelles) Ablaufprogramm für die Bedienung der Waschmaschine, mit den Beteiligten entwickelt und gestaltet werden können. Solche Unterstützungs- und Erinnerungshilfen müssen aber von den Betroffenen selbst gewollt sein, Wie in unterschiedlichen Kapiteln (Vgl. Kapitel 6.2.2 u.a.) sichtbar geworden ist, werden pädagogisch ausgerichtete Förderungshaltungen in der Wohngemeinschaft zurecht kritisch bewertet.
Das Schlußkapitel beherbergt zwei Themen, die ausschließlich unter dem Aspekt des Versuches, aus der Auswahl von Themen, die noch angesprochen werden könnten, sich auf zwei wesentliche Abschnitte zu beschränken. Zum einen werden Überlegungen, die sich im Vorfeld einer LIW-Gründung ergeben, dargestellt (Abschnitt 12). Zum anderen sind im Abschnitt 13 einige weiterführende Gedanken ausgeführt, die sich auf Reflexionsmöglichkeiten in der Praxis beziehen und grundlegenden Fragen zu Perspektiven nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
Neue Wege brauchen Zeit- Zeit, die auch Chancen bietet, mit den unterschiedlichen Beteiligten an einem Tisch gemeinsame Schritte zu entwickeln. Gleichzeitig haben lange Entwicklungszeiten wie bei der Gründung einer LIW (1 - 2 Jahre) eine eigene Dynamik. Darüber hinaus gibt es einige formale Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Das Wesentliche wird hier noch angesprochen.
Unabhängig davon, wer letztendlich in die Wohngemeinschaft einzieht, gilt für alle Bewerberinnen, daß sie ein gut durchstrukturiertes Planungs- und ein transparentes Bewerbungsverfahren durchlaufen sollten. Dies im Sinne der Betroffenen zu gestalten, heißt auch, sie aktiv in diese Prozesse mit einzubeziehen. Diese Praxis wurde in der Jurastraße erprobt und hat sich bewährt. Einige wichtige Verlaufsaspekte werden im folgenden erläutert.
lm Vorfeld der Errichtung einer LIW besteht ein großes Interesse von Menschen mit Assistenzbedarf und/oder deren Eltern an einer integrativen, lebensweltorientierten Wohngemeinschaft. Bis die LIW tatsächlich ihre Türen öffnet, verstreichen dann ein bis zwei Jahre. Einzelnen Betroffenen sind diese Wartezeiten zu lang, anderen ist der Aufwand zu hoch bzw. die Unsicherheit zu groß. Sie steigen während der Planungsphase aus.
Ein Teil des interessierten Personenkreises wird nur durch eine intensive Begleitung bzw. Beratung den Weg in die Wohngemeinschaft einschlagen können. Wesentliche Gründe liegen auch darin, daß sich bei einigen Anfragen entweder die Eltern oder die Betroffenen gegen eine Veränderung der Wohnsituation aussprechen oder unterschwellig diese Haltung zum Ausdruck bringen.
Ein Motiv für Menschen mit Assistenzbedarf, aus dem familiären Kontext auszuziehen, besteht in der Hoffnung, in einer lebensweltorientierten Wohngemeinschaft die eigenen Lebensvorstellungen und Bedürfnisse stärker leben zu können und somit einen größeren Autonomie- und Entscheidungsfreiraum im Sinne von Mitgestaltung und Teilhabe zu erreichen. Junge Menschen, die sich aus eigenem Antrieb für das Wohnprojekt interessieren, haben dabei oftmals die Schwierigkeit, nicht ohne weiteres aus dem Elternhaus ausziehen zu können. Die Eltern möchten die Töchter/Söhne nicht gehen lassen, binden sie an sich und machen ihnen den (unausgesprochenen) Vorwurf, daß sie durch den möglichen Auszug ihre Eltern im Stich lassen bzw. alleine zurücklassen.
Weitaus häufiger tritt die umgekehrte Situation auf, wo Eltern eine Zukunftsperspektive für ihre Töchter/Söhne entwickeln möchten, die außerhalb der Herkunftsfamilie eine Wohnsicherheit für ihre „Kinder“ garantieren. Die Töchter bzw. Söhne streben aber überhaupt keinen Auszug aus dem Elternhaus an und begreifen diese Überlegungen als eine Form der Abschiebung. Das häufigste Motiv der Eltern liegt in der Sorge, daß der eigene Gesundheitszustand bzw. der eigene Tod die Töchter/Söhne in eine schwierige und unfreiwillige Situation manövrieren könnte. Sie haben konkret die Angst, daß ihre Söhne/Töchter vielleicht dann in eine nicht „geeignete“ Einrichtung eingewiesen werden. Aus ihrem Selbstverständnis und Verantwortungsgefühl heraus wollen sie dies nicht dem Zufall überlassen und haben zwar schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine geeignete Wohnform zu suchen, aber dies bisher aufgrund von fehlenden Alternativen hinausgezögert.
Die Folgen sind, daß sich nicht im Konsens geklärte Entscheidungen auf die neue Wohngemeinschaft auswirken. Personen, die eher von den Eltern überredet werden mußten und von sich aus diesen Wechsel nicht vollzogen hätten, können sich schwer auf die neue Wohnform einstellen. Einzelne Bewohnerinnen brauchten fast zwei Jahre, um den neuen Lebensort für sich selbst anzunehmen. Davor wurde z. B. in vielen Konfliktsituationen in der Wohngemeinschaft immer wieder damit gedreht, zurück zu den Eltern zu gehen.
Bewohnerinnen, die von den Eltern emotional nicht losgelassen werden und immer wieder zu hören bekommen, daß der Auszug aus der Familie von seiten der Eltern nur mit Verlusten bewertet wird, sind besonderen Belastungsproben ausgesetzt. Das Hin-und-Hergerissen-sein hindert die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, sich frei und ganz auf die WG einzulassen.
Diese widersprüchlichen Interessen zwischen Eltern und ihren Söhnen/Töchtern lassen sich im Vorfeld nicht immer in gute Kompromisse auflösen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern muß deshalb auch nach dem Einzug in die WG als ein wichtiger Bestandteil und Prozeß bewertet werden. In der Regel lernen diese Bewohnerinnen die Vorzüge der Wohngemeinschaft schätzen. Nur ein Bewohner mußte bisher die Wohngemeinschaft verlassen, weil er und seine Mutter sich überhaupt nicht auf die Wohngemeinschaft mit ihren Regeln einlassen konnten. Vielleicht ist hier die richtige Stelle, um zu betonen, daß eine Wohngemeinschaft nicht für jede Person die geeignete Wohnform darstellt.
Die Kriterien für die Auswahl von Bewohnerinnen (Auswahlverfahren) sind auf der Basis der Konzeption grob festgelegt worden. Neben den individuellen Motiven und Voraussetzungen können Geschlechterparität, Assistenzvielfalt oder -differenzen u.a. Kriterien bilden. Während in bestehenden Wohngemeinschaften die Wohngemeinschaftsmitglieder vorhanden sind, die um einen Konsens ringen müssen, ist die Situation bei einer Neugründung einer LIW schwieriger. Hier liegt die Entscheidungsgewalt bei den Trägern. in dieser Situation müssen die interessierten Bewohnerinnen nach dem Einzug sehen, wie sie sich (zurecht)finden[17].
Wichtig ist deshalb ein transparentes Bewerbungsverfahren mit offenen Kriterien, weil es sich bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und deren Eltern nicht um eine Kurzbewerbung handelt, sondern um einen über einen längeren Zeitraum an- dauernden Prozeß, auf den sich diese Personen einlassen und bei einer eventuellen Ablehnung bei der Auswahl von Mieterlnnen Enttäuschungen nicht zu vermeiden sind.
Gegenstand der Verhandlungen und Schwerpunkt der Einzelbewerbungsgespräche sind die Regelung von Verantwortlichkeiten und die Auseinandersetzung mit den (sozialen) Kompetenzen der Bewerberinnen. Der Hintergrund für diese Sichtweise liegt in der Erfahrung, daß der Assistenzbedarf an Wichtigkeit verliert, vorausgesetzt (soziale) Kompetenzen und Ressourcen werden im Wohngemeinschaftsalltag in den Vordergrund gestellt.
Um den Geist der LIW von Anfang an transparent zu machen, ist es wichtig, daß schon beim Erstkontakt und bei den weiteren Gesprächen den Bewohnerinnen, besonders den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf, Verantwortung zugestanden wird und sie aufgefordert werden, Verantwortung zu übernehmen. Inzwischen schreibt der „Hilfeplan“ die Beteiligung der Betroffenen vor. Trotz allem bleibt das Hilfeplangespräch oft in der Konstruktion des Bedürftigen verhaftet. Dabei soll es in der LIW nicht bleiben. Die Erfahrungen zeigen, daß für ein gelingendes gemeinsames Zusammenleben neben der Verantwortung für sich selbst auch die Verantwortung für andere notwendig ist. Besonders für die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf bietet die Verantwortungsübernahme für andere bzw. für bestimmte Aufgabenstellungen eine Chance, Anerkennung zu erhalten und Selbstwertgefühle zu entwickeln - eine Situation und ein Gefühl, das ihnen nicht so oft zuteil wird, obwohl sich die Bewohne- rinnen mit Assistenzbedarf selbst anbieten und ohne Aufforderung z. B. Verantwortung in Bereichen der Assistenz übernehmen. Diese Anerkennung im Alltag ist aber Voraussetzung für die Herausforderung, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ohne dieses Gefühl des Gebrauchtwerdens besteht wenig Anlaß, die eigenen Verhaltensmuster, wie z. B. gewohnte Versorgungsmentalitäten, zu bearbeiten und einen Gewinn aus der Selbständigkeit einzufahren. Deshalb sollte von Beginn an das Ernstnehmen der Bewohnerinnen als gleichwertige Mitbewohnerlnnen umgesetzt werden.
In den Vorsteilungsgesprächen sollte herausgearbeitet werden, wieviel Assistenz die einzelnen Bewohnerinnen benötigen und welche Aufgaben sie übernehmen können, um einen Beitrag zum gemeinsamen Leben zu „leisten". Hilfestellung für die Abklärung von Kompetenzen können auch die gängigen Erhebungsbögen bieten.
Vorgespräche mit Eltern in der Wohngemeinschaft
Aus der Sicht der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf sind für eine Entscheidungsfindung auch Gespräche mit den Eltern in der Wohngemeinschaft erforderlich, um deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit abzuklären.
I: Wenn jemand eine WG gründen will, auf was soll er achten?
F: Ich würde inzwischen sagen, auch tatsächlich ein Stück weit die Eltern beschnüffeln, wie die so drauf sind, weil das spielt eine ganz ganz große Rolle. Wenn man's mit den Eltern gut kann, das erleichtert das ganz arg alles, daß die mitspielen und das wirklich auch wollen…daß die Eltern das auch wirklich wollen und sie nicht das Gefühl haben, man nimmt ihnen die Kinder weg, und dann mußt du kämpfen und mußt dich rechtfertigen, man kocht zuviel und das ist ich glaube, das muß man auf sich zukommen lassen Wir haben ja am Anfang auf nichts geachtet, na ja. (BewohnerInnen ohne Assistenzbedarf :35)
Probewohnen von Bewerberinnen
Im Bezug auf die Auswahl von Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf stellt sich immer wieder die Frage, welche Formen im Klärungs- und Entscheidungsprozeß hilfreich sein können. Neben den obligatorischen Vorstellungsgesprächen und einem Besuchstag in der Wohngemeinschaft bietet das Probewohnen eine intensivere Kennenlernphase. Das Probewohnen kann in Form einer Probewoche bzw. durch mehrere Probetage gestaltet werden. Aus den bisherigen Erfahrungen trägt das Mit- erleben des Alltags, das Erleben der konkreten Assistenzanforderungen bzw. die Gestaltung der verschiedenen Phasen des Tages sowie der Umgang miteinander für die einzelnen überwiegend zur Klärung bei. Die Diskussion, über den Sinn eines Probewohnens, um eine Entscheidung über die Aufnahme herbeizuführen, fallen in der Beurteilung unterschiedlich aus. Die Bedenken werden folgendermaßen formuliert:
G:…Ich war dann vollkommen begeistert von der Birgit, die saß da, lieb und nett und kann al- les. Man sollte so eine Probezeit vielleicht einführen, daß die erst mal sechs Wochen so mal da sind und dann…
I: Gibt's keine Probezeit, kein Probewohnen?
G: Ich glaube, eine Woche war das, aber das ist ja auch Blödsinn, weil man da nicht viel vom wahren Charakter sieht.
F: Wir haben ja schon geschwätzt…nur eine Woche, aber dann lernst du niemanden kennen…Ich glaube wirklich, man kann da oft gar nicht viel machen, weißt du, die Ausgangssituation, das weißt du, wo wir hier alle eingezogen sind, wir haben uns alle nicht gekannt, wir alle acht - auf was willst du da viel achten ? Du kannst sagen, ja oder nein, und da haben wir geschwitzt, nächtelang„ und wir haben großes Glück gehabt halt, das kann auch total schiefgehen. (Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf :13)
Diese Kritik an dem einwöchigen Probewohnen ist verständlich, weil die spezifische und neue Situation den Raum auch geben kann, sich in einer überschaubaren Zeitspanne von der „besten“ Seite zu präsentieren. Das Probewohnen darf aber in seiner Funktion nicht überbewertet werden. Es kann nur zu einer grundsätzlichen Klärung beitragen. Längere Zeiträume sind den Bewerberinnen nicht zuzumuten, weil je länger die Probephase dauert, eine eventuelle Ablehnung schwieriger wird. Unabhängig von der Dauer der Probephase wird nach dem Einzug in die Wohngemeinschaft jede Person auch andere Seiten offenbaren. Das gilt für alle Bewohnerinnen und ist eine typische Erfahrung von Beziehungs- und Gruppenprozessen.
Große Einrichtungen, wie 2. B. die Lebenshilfe Bremen, bieten Wohntraining in separaten Wohngruppen zur Vorbereitung auf ein gemeinwesenorientiertes Wohnen an[18], um somit den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf intensive Test- und Erprobungsphasen gewähren zu können. Für die LIW sind solche Testphasen nicht praktikabel und hilfreich. Als bedürfnisgerechter Einstieg bleibt eine individuelle Gestaltung und eine behutsame Heranführung an die neue Umgebung, die für einen Teil der Bewohnerinnen wichtig ist. Konkret wird den neuen Bewohnerinnen ein Probewohnen angeboten, bei dem zunächst sie selbst und auch die Mitbewohnerlnnen überprüfen können, inwieweit eine gemeinsame Basis für das Wohnen herzustellen ist. Kommt es zu einem Mietabschluß, kann über den sukzessiven Einzug in die WG von seiten der Bewohnerin und deren Eltern verhandelt werden.
Diese Form ist vor allem für eine bestehende Wohngemeinschaft relevant. Bei der Neugründung einer Wohngemeinschaft ist der Einbezug der Bewohnerinnen in die Planungsphase ein wichtiger Schritt. Leider vergeht bei der Umsetzung einer LIW von der Entscheidung zur Einrichtung bis zum Einzug in die Wohnung mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre. Aus diesem Grund des ungewissen Einzugstermins lassen sich vor allem kaum Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf für die Planungsphase finden. Für Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und deren Eltern kann eine längere Planungsphase eine Chance sein, sich auf die Veränderung einzustellen. Die derzeitige Planung einer zweiten Wohngemeinschaft, die demnächst eröffnet werden soll, bestätigt, daß eine frühzeitige Einbeziehungen von Menschen mit Assistenzbedarf sinnvoll wäre.
Bewohnerlnnensuche
Die Suche nach Mitbewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf ist nach den bisherigen Erfahrungen sehr unterschiedlich gewesen, so daß hier in Kürze die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgeführt werden sollen. Zunächst wurden Initiativen und Szenen, die diesem Thema offen gegenüberstehen, als Ort der Ausschreibung für die Mieterlnnensuche genutzt. Darüber hinaus wurden an unterschiedlichen Treffpunkten, die junge Menschen mit bzw. ohne Assistenz aufsuchen, Handzettel oder Plakate aufgehängt. Sehr spärlich verlief der Zulauf über Artikel in Tageszeitungen, in denen das Projekt vorgestellt und ein Hinweis auf die Suche nach Bewohnerinnen thematisiert wurde. Diese Strategie hat sich im Projekt nicht als erfolgreich gezeigt.
Später hat sich herausgestellt, daß der übliche Weg über eine Anzeige unter der Rubrik Vermietungen sehr vielversprechend verläuft. Diese Spalte lesen in der Regel die meisten Leute, die ein Zimmer suchen. Die große Anzahl der Rückmeldungen zeigte auch, daß sich Personen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen für die WG interessierten. Die Gestaltung der Anzeige, die von den Bewohnerinnen weitgehend selbst formuliert wurde, hat vielleicht auch zu der großen Nachfrage beigetragen.
Gleiche Mietverträge - Argumente für/gegen eine zeitliche Befristung der Mietverträge mit Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf
Ein konfliktbehaftetes Thema in der ersten Erhebungsphase entstand durch die zeitliche Befristung der Mietverträge für Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf. Diese Regelung wurde von einem anderen Wohnprojekt übernommen, weil dort - etwas salopp formuliert - die Erfahrung gemacht wurde, daß ein Wechsel von Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf nach zwei Jahren wieder „frischen Wind“ in die Wohngemeinschaft bringt.
Die darauffolgenden Diskussionen nach dem ersten Jahr der Wohngemeinschaft führten zu dem Ergebnis, daß eine Beschränkung der Mietverträge bzw. eine Überprüfung nach zwei Jahren aus Gleichheitsgründen für alle Bewohnerinnen gelten müßte oder gar nicht in die Mietverträge mit aufgenommen werden sollte. In der Praxis wurde die Vereinbarung außer Kraft gesetzt.
Im Rückblick auf die vergangene Zeit können aus Sicht der ehemaligen Mitbewohnerlnnen der zeitlichen Befristung auch positive Aspekte abgewonnen werden:
L: Und ich muß im Nachhinein sagen, das ist eigentlich, eine gute Zeit, es ist schlecht, das als - du hast ja gesagt, es ist für dich ein Druck, daß es heißt, nach zwei Jahren sollte die Besetzung wechseln…
M: Ja, weil ich denke, das ist für mich keine Voraussetzung eigentlich irgendwo einzuziehen und zu sagen, ja, da bin ich jetzt daheim oder so, weißt du, ich mache da kein Praktikum oder so, sondern ich hab' ja da gelebt - ja, da ziehst du ein
L: Aber ich muß im Nachhinein sagen, daß das schon eine gute Zeit eigentlich war mit uns dreien halt.
…
M: Ich denke, es ist ja schon immer so, man kommt mit der Zeit in eine bestimmte Rolle rein, und die Rollen sind dann fest. Und von dem her denke ich, daß es manchmal gar nicht schlecht ist, wenn's dann einen Wechsel gibt, dann können andere in die Rolle reinwachsen. Ich finde, für die Eva war's am Anfang nicht einfach, weil wir haben schon bestimmte Rollen einfach gehabt und ja, ich glaube, für die Eva war's jetzt eher positiv, daß wir ausgezogen sind Und von dem her denke ich min weiß du, wenn du dann da auch Bestätigung kriegst - ich kann mir vorstellen, die macht jetzt mehr wie vorher.
L: Auf jeden Fall
M: Und sie macht das gern, weißt du, weil jetzt hat sie die Bestätigung und ist diejenige, die jetzt am längsten da ist, und die hat jetzt eine ganz andere Rolle. (ehem. Bewohnerinnen 126)
Für die derzeitigen Bewohnerinnen stellt sich der Sachverhalt etwas anders dar. Sie stehen dem Zweijahresvertrag sehr kritisch gegenüber.
F: Nein, wir wollten das nicht, das ist einfach auch Sch... mit den zwei Jahren…es ist doch Blödsinn, nach zwei Jahren kennt man sich vielleicht erst mal richtig. Solche Beziehungen, die man so aufbaut, zu David zum Beispiel, das hat zum Beispiel für mich zwei Jahre gedauert, bis ich überhaupt mal rnit dem konnte, mit dem Kerl, und dann soll ich wieder ausziehen nach zwei Jahren, das ist doch völlig gaga, also völlig daneben. Und außerdem wohnen wir gerne hier, das ist Blödsinn, das braucht man nicht so beschränken - wenn du das meinst.
I: Ja, ich meine das.
E: Es ist halt die Regelung da, ich meine, das kann man vielleicht so oder so verlängern, wenn man nach zwei Jahren sagt, ich möchte weitermachen, dann darf man auch weitermachen so kompliziert war die Regelung nicht.
F: Das war am Anfang vielleicht auch so aus Sicherheit…Ich glaube, so was haben wir gehabt, aber da hat sich nie jemand drum gekümmert, um eine Probezeit. Da nützt kein Vertrag und gar nichts, wenn man sich nicht verträgt, dann verträgt man sich nicht, und wenn's einem gefüllt, dann gefällt's einem, das ist einfach so. (Bewohnerlnnen ohne Assistenzbedarf :15- 16))
Aus den bisherigen Erfahrungen scheinen folgende Überlegungen für die Gestaltung der Mietverträge bedenkenswert zu sein
-
Der Grundsatz der Gleichheit der Bewohnerinnen sollte sich auch in den formalen Verträgen widerspiegeln. Deshalb sind in den Mietverträgen für die Bewohnerinnen mit und ohne Assistenzbedarf die gleichen Verhandlungspunkte aufzunehmen. Zur Folge hätte dies auf der einen Seite, daß auch bei den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf die real möglichen Assistenzleistungen in den Mietvertrag aufgenommen werden. Auf der anderen Seite würde durch diese Gleichstellung eine Teilung und Konstruktion in Personengruppen, die betreut oder nicht betreut werden müssen, verhindert bzw. zumindest abgeschwächt.
-
Die Dauer der Mietverträge sollte nicht befristet werden, Der Hauptgrund liegt in der Annahme, daß das Zuhause sein nicht zeitlich befristet werden kann und da- durch jeder Bewohnerin die Möglichkeit offengehalten wird, auch für einen unbefristeten Zeitraum in dieser Wohnform zu leben. Eine Absicherung, die mit dem Mietrecht zu vereinbaren wäre, könnte in einer Klausel bestehen, die bei grober Verletzung der Ziele und Vereinbarungen eine Auflösung des Mietverhältnisses zur Folge hätte, Dies gilt sowohl für die Bewohnerinnen mit als auch für die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf. in der Regel werden die Personen, die sich mit dem gemeinsamen Wohnen in irgendeiner Weise nicht arrangieren können von selbst ausziehen. Eine zeitliche Befristung kann in einer unerträglichen Situation keinen Lösungsweg bieten. Sie bietet nur in dem besonders glücklichen (Zu)Fall eine Hilfe, wenn ein schwerwiegender Konflikt genau zum Zeitpunkt der Kündigungsfristzeit auftaucht.
-
Eine gründliche und intensive Abklärung im Vorfeld des Einzugs in die Wohngemeinschaft bietet allen Seiten eine fundierte Entscheidung. Sie kann dazu beitragen, daß Erwartung und Realitäten abgeglichen werden können.
-
Neben den allgemeinen Regelungen eines Mietvertrags müssen die Leistungen und Vergünstigungen beider Parteien klar geregelt werden. In der Wohngemeinschaft Jurastraße sind im Mietvertrag der Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf wöchentlich 15 Assistenzstunden, die zu leisten sind, vereinbart. Als Ausgleich für diese Assistenzleistungen können sie dafür mietfrei (Warmmiete) wohnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnet sich in den Verhandlungen eine adäquatere Lösung ab. in Zukunft soll die Arbeitsassistenz auf der Basis von 630-DM- Beschäftigung abgerechnet und vergütet werden. Der Vorteil dieses Abrechnungsmodus liegt darin, daß für die Assistenzleistungen entsprechend Sozialabgaben und somit auch Rentenbeiträge erbracht werden. Damit ist - wenn auch nicht im erwünschten Maße - ein Ausgleich für die notwendige Teilzeitbeschäftigung der Bewohnerinnen gewährleistet. Als Folge müssen die Bewohnerinnen die Miete wie bei jedem anderen Mietverhältnis bezahlen.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Eröffnung einer integrativen, lebensweitorientierten Wohngemeinschaft sind in den folgenden Sammlungen zu finden: Grundgesetz, BSHG, SGB und im Rahmenvertrag zwischen den Einrichtungsträgern und den jeweiligen Landeswohlfahrtsverbänden.
Die elementarste Grundlage für ein menschenwürdiges Leben oder ein Leben in der Gemeinschaft bildet das Recht auf Teilhabe, im allgemeinen der Artikel 1 GG und im speziellen die Eingliederungshilfe §39 Abs.3 BHSG. Seit 1994 ist durch die Ergänzung im Grundgesetz, die eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderung verbietet (Art.3 GG), der Wert der Gleichheit bzw. Gleichstellung explizit hervorgehoben und unterstrichen worden.
Die Eingliederungshilfen (BSHG 39/40) regeln die Maßnahmen zur Eingliederung von Menschen mit Assistenzbedarf. Sie dienen dazu, daß Menschen nicht nur in ihren elementaren Lebensverrichtungen begleitet und versorgt werden, sondern auch in einem genauso lebensnotwendigen Bereich - in der Teilhabe bzw. Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben ~ eine Unterstützung erfahren (vgl. von Lüpke 1996).
Gesetzliche Grundlage für die Konzeption einer lebensweltorientierten, integrativen Wohngemeinschaft bieten Einrichtungen der Behindertenhilfe nach BSHG §39 ff und in Abgrenzung bzw. in Ergänzung zu Pflegeleistungen die Ausführungen zur Pflege in Behinderteneinrichtungen (gem. §§ 43a und Abs. 4 SGB XI). Seifert stellt in ihrer Gegenüberstellung von Pflegeeinrichtungen und Behinderteneinrichtungen heraus, daß in bezug auf „Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen“ (Seifert 1998 1211) die Unterschiede deutlich werden. Während sich in Pflegeeinrichtungen die Tätigkeiten und Kompetenzen in erster Linie auf den pflegerischen Bereich beschränken, stehen in Einrichtungen der Behindertenhilfe (heilpädagogische Fachlichkeit, Kompetenzerweiterung und Teilhabe in den verschiedenen Lebensbereichen, wie Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit, im Vordergrund (vgl. ausführliche Gegenüberstellung, Seifert ebd.). Dabei sind Personen, die einen hohen Pflegebedarf haben, grundsätzlich nicht von Einrichtungen der Eingliederungshilfen auszuschließen.
Die Liga der Wohlfahrtsverbände (Vertreterinnen der Einrichtungsträger) in den jeweiligen Bundesländern verhandeln mit dem Landeswohlfahrtsverband Rahmenverträge aus, die als Grundlage für die jeweiligen Träger dienen. Bisher ist eine bundeseinheitliche Regelung aufgrund von Widerständen einzelner Verhandlungspartner gescheitert, so daß die Verträge auf Bundesländerebene als Basis herangezogen werden müssen. Die Grundlage dieser Leistungsvereinbarungen zwischen Sozialhilfeträger und Dienstleistungsinstitution bildet der §93 Abs.2 des BSHG. Gegenstand der Vereinbarungen sind drei zentrale Aspekte: Die Leistung, die erbracht wird („Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung“), die Vergütung, die in eine Grundpauschale, Hilfebedarfsgruppe und Investitionspauschale gegliedert ist und der Nachweis, wie die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen geprüft wird.
Die LIW gehört zu den Einrichtungen und Wohnformen, die nach dem BSHG (§100) in den Zuständigkeitsbereich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe fallen. Diese überörtlichen Träger übernehmen im Rahmen der Eingliederungshilfen nach §§39 bis 47 BSHG die Unterbringungskosten (Vgl. Kräling :26). Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben vor, daß zwischen den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf und der Einrichtung ein Vertrag gemäß §4 Heimgesetz abgeschlossen werden muß (vgl. ebd.: 27).
Grundsätzlich wird von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf als Voraussetzung für die „Aufnahme“ in die LIW die Formblätter A und HB (der sogenannte „Metzler Bogen“) benötigt, die vom Gesundheitsamt in Kooperation mit den Beteiligten erstellt werden. Der „Metzler Bogen“ ist in Baden-Württemberg ein Standardbogen, der Art und Umfang des Hilfebedarfs ermittelt und zur Leistungsberechnung herangezogen wird.
Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) - in Funktion als überörtlicher Träger der Sozialhilfe in Baden-Württemberg - hat eine eigene Überprüfungsstelle, die berechtigt ist, die vorgenommene Einstufung des Gesundheitsamts in die Hilfegruppe 1 - 5 zu akzeptieren oder neu beurteilen zu lassen. Wenn die Betroffenen mit der ermittelten Hilfebedarfsgruppe nicht einverstanden sind, gibt es die Möglichkeit des üblichen Widerspruchsverfahrens. Ein Wunsch- und Wahlrecht wird den Betroffenen gewährt (BSHG §3 Abs.2), sofern das erwünschte Angebot nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten gegenüber an- deren gleichwertigen Angeboten verbunden ist.
Grundlage der Finanzierung bilden zwei zentrale Eckpfeiler der LIW: zum einen ist die Lebensweltorientierung mit dem Ziel u.a., die Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf am Gemeindeleben zu schaffen, der inhaltliche Kern des LIW-Konzeptes und entspricht somit den Grundlagen der Eingliederungshilfe. Zum anderen ist die Offenheit der LIW für Bewohnerinnen mit hohem Assistenzbedarf auf eine durchgängige Assistenz angewiesen. Die geforderten Rahmenbedingungen für Assistenz, Pflege und Unterstützung zu Selbständigkeit und Teilhabe können durch/mit vier stationären Plätzen gewährleistet werden, in den ersten vier Jahren hat sich gezeigt, daß der Etat in Höhe von vier Heimplätzen die Personalkosten für eine hauptamtliche Mitarbeiterin, einen Zivildienstleistenden und Praktikantin sowie die sonstigen Betriebskosten knapp abdeckt.
Die angestrebte Verwirklichung gemeindebezogener Angebote im Bereich der Behindertenhilfe bietet die Chance, die bisherigen Betreuungsformen zu überprüfen. Die von seiten der Betroffenen, Eltern und Initiativen geforderte Normalisierung und Selbstbestimmung sind in Theorie und Praxis zentrale Themen. in der Praxis zeigt sich jedoch, daß bisher wenige Projekte umgesetzt werden, die diesen Anforderungen gerecht werden.
Eigentlich befinden wir uns mit dem Projekt auf einer konsensfähigen Zielsetzung mit dem Landeswohlfahrtsverband (Lebensweltorientierung, gemeindenahe Versorgung etc.). Seit Jahren vertritt der LWV diese Richtung nach außen, zuletzt auf der Verbandsversammlung[19], Aber ihre Politik richtet den Blick auf Sparversionen und Kostensenkung. Damit kann eine LIW zunächst nicht dienen. integrative Wohnformen erfordern angemessene finanzielle Ressourcen.
Die Entwicklungen in den letzten Jahren zeigen, daß sich neue Wohnformen in der Behindertenhilfe in der Region Reutlingen ~ wie z. B. die integrative Wohngemeinschaft - nur einrichten und etablieren lassen, wenn gleichzeitig vorhandene stationäre Plätze dafür bereitgestellt werden. So muß in der Regel davon ausgegangen werden, daß bei den sogenannten „leeren“ öffentlichen Kassen keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen für die Einrichtung eines neuen Angebots zur Verfügung gestellt werden (Deckelung der Kosten).
Dabei handelt es sich bei dieser Umwidmung von Plätzen um einen angemessenen Standard lebensweltorientierter Wohngemeinschaften bei gleichzeitigem Abbau klassischer stationärer Heimplatze. Für diese Sichtweise müssen die Geldgeber z. T. noch überzeugt werden, weil dieser Standard der LIW als Privileg wahrgenommen wird. Dies spiegelt sich auch an den widersprüchlichen Interessenskundgebungen des LV\N wider (vgl. Abschnitt 13.2). Er billigt und genehmigt diese Wohnform, aber eine Unterstützung bzw. ein Interesse an einem Ausbau in Richtung (hin zum) Standardangebot bleibt aus. Hierzu fehlt der finanzielle Reiz. Es gibt schon ähnliche Wohnangebote, die auf ambulanter Finanzierungsbasis - also mit geringeren finanziellen Mitteln - auskommen (müssen), und hier liegen der Schwerpunkt und das Hauptinteresse der Wohlfahrtsverbände (Argumentation des LWV gegenüber der AGI).
[17] Ideal wäre ein Bewerbungsverfahren, in dem sich die Bewerberinnen gegenseitig selbst aussuchen konnten. Diese Utopie hatte Realisierungschancen, wenn die Flexibilität der Wohnformen wie auch die Diskussion des eigenständigen Wohnens breiter und früher angelegt würde oder anders formuliert die Träger unabhängig von ihren eigenen Immobilien als Wohnungsberater zur Verfügung stünden.
[18] vgl. Wohnkonzeption Bremen in „Wohnen heißt zu Hause sein". S.33
[19] Siehe Bericht „Mehr Geld für Behinderte" über die Verbandsversammlung des LWV am 20. 2. 2001 in Reutlingen in-ı „Reutlinger General-Anzeiger* (GEA) vom 21. Februar 2001, S. 11.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Kapitel ist angelegt als eine letzte Rundschau. Dazu werden im ersten Abschnitt Möglichkeiten und Grenzen der wissenschaftlichen Begleitung thematisiert. lm Anschluß können einige offene Fragen andiskutiert werden, so daß hier noch einmal die Gelegenheit wahrgenommen wird, einiges anzusprechen, was aus dem Begleitungsprozeß grundlegend - so mit dem Blick aus dem Fenster, nachdem der Zug vorbeigefahren ist- zu sagen ist.
Über die bisher angesprochenen fördernden Strukturen der Teilhabe und Selbstbestimmung und der gesetzlich durchzuführenden Evaluationen (Hilfebedarfsentwicklung etc.) hinaus, geht es in den folgenden Ausführungen um die Erfahrungen von Reflexionsstrukturen, die durch die wissenschaftliche Begleitung gegeben waren.
Interessengegensätze benötigen organisatorische strukturelle Verbindungen
Die formale Gleichberechtigung herzustellen, ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Beziehungsebene. In vielen grundlegenden und alltäglichen Situationen ist innerhalb dieses Bereiches noch häufig ein Umdenken in der LIW notwendig. Ein Konfliktpotential zwischen den unterschiedlichen Interessen der Beteiligten ist akzeptierend anzunehmen. Der Umgang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen der Beteiligten kann als wichtiger Maßstab für die Lebensqualität in der LIW gesehen werden.
Eine gleichberechtigte Kultur der Verschiedenheit bzw. Anerkennung und Toleranz der Differenz liegt in der Fähigkeit, den anderen mit seinen Bewältigungsformen gewähren lassen zu können (vorausgesetzt, die anderen Mitmenschen erfahren den Respekt der Gegenseitigkeit). lm Unterschied zu alltäglichen Beziehungsformen zwischen sogenannten nichtbehinderten Menschen zeigt sich im Zusammenleben mit Menschen mit Assistenzbedarf, daß durch die existierenden Abhängigkeits- bzw. Unterstützungsstrukturen ein Übergehen der Bedürfnisse leichter miteinhergehen kann (vgl. Hahn 1994).
Die unterschiedlichen Interessen innerhalb der LIW werden sich nicht auflösen lassen und sind nicht zusammenzubringen. Verschiedene Perspektiven treffen unmittelbar aufeinander: Perspektiven der professionellen Hilfe, Elternperspektiven und unterschiedliche Bewohnerlnnenperspektiven. Dieses Zusammentreffen ist eingebettet in die vorherrschenden gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse und in institutionelle Rahmenbedingungen. Als Teil dieser Systeme ergeben sich zwischen den Perspektiven Macht- und Hierarchieformen, die immer wieder hinterfragt und neu ausbalanciert werden müssen. Die täglichen Begegnungen - im Spannungsfeld zwischen Normalitätsanpassung und Selbstbestimmung - können durch die Reflexion der Beziehungsgestaltung dazu führen, daß der Respekt des Eigensinns (vgl. Schönwiese 1994) im Blick behalten wird. Wechselseitige Einstellungsveränderungen sind dabei notwendig, um Konsens in wesentlichen Fragestellungen zu erreichen.
Begleitung von außen - Bewertung der wissenschaftlichen Begleitung und Beratung
Die Erhebungen stellten im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung nur einen Teil der Arbeit dar (vgl. Kapitel 1.2). Durch die regelmäßige Teilnahme an den Kooperationstreffen, den monatlichen Beratungsterminen mit den Mitarbeiterinnen sowie durch die Besuche in der Wohngemeinschaft stand für die Bewohnerinnen und Beteiligten die Beratung der Wohngemeinschaft im Vordergrund der Arbeit. In zwei Interviewgesprächen (während der zweiten Erhebung) wurde von den Beteiligten selbst das Thema der wissenschaftlichen Begleitung angesprochen. Ich habe sie deshalb mitaufgenommen, weil ich denke, daß eine Begleitung von außen in vielerlei Hinsicht für die Entwicklung der Wohngemeinschaft positive Wirkungen erzielen kann.
Aus der Elterngruppe kam die Rückmeldung, daß der erste Bericht der wissenschaftlichen Begleitung durch die Funktionsbeschreibungen auch von Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf deren Bedeutung in der Wohngemeinschaft ans Licht brachte und die eigene Position und Sichtweise stärkte.
S: Ja, ich sehe es auch, daß ihr's da gut geht. Und ich sehe, daß das eine gute Situation ist und auch Ihre Arbeit (Bericht) hat mir da auch geholfen, zu lesen, daß die Andrea da doch eine wichtige Funktion hat mit dem Zusammenhalt, daß das alles ziemlich auseinanderlaufen würde ohne die Andrea, Und daß dadurch auch eine Gemeinsamkeit entsteht, das hat mir eigentlich auch gut getan, das so zu lesen, Ich kannte dann auch akzeptieren, daß das nicht so wäre, wenn die Andrea nicht da wäre - und ich muß auch sagen, das ist auch bei uns daheim. Sie hat was Verbindendes; schon rein durch die Anwesenheitspflicht sind auch Leute da, und die unterhalten sich natürlich zwangsläufig auch mit den anderen, Das wäre sonst nicht der Fall. Und das hat mich doch auch sehr beruhigt. (Mütter :25)
lm Gespräch mit den ehemaligen Bewohnerinnen gaben die positiven Erfahrungen in der ersten Erhebungsphase den Anlaß, über Bewältigungshilfen nachzudenken. Die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf artikulierten das Bedürfnis, in regelmäßigen Abständen ihre Erfahrungen zu reflektieren, um die bestehenden Konfliktfelder sicht- bar zu machen, die Realisierung von Zielen zu überprüfen und Veränderungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Regelmäßige Auswertungs- und Reflexionsrunden können dazu beitragen, unter- schiedlichen Perspektiven Raum zu geben. Sie können als prozeßorientierte Evaluationsforschung genutzt werden, um sowohl die konzeptionelle Fortschreibung als auch die praktische Umsetzung weiter voranzutreiben.
L: Und deshalb fand ich's zum Beispiel auch nicht schlecht, das was du damals gemacht hast (Gespräche zur ersten Erhebung), das war ja fast so supervision-mäßig, so ansatzweise und so was sollte eigentlich regelmäßiger passieren, das wäre, vor allem, weil bei uns hat's ja gepaßt - und wenn das aber nicht so ist, dann muß eine Ansprache sein und eine Möglichkeit für die Leute, wo sie sich nicht großartig drum kümmern müssen, sondern wo sie einfach wissen, da kann ich mir… (...)
M: Ja, das ist mir damals auch aufgefallen, wo wir die Gespräche geführt haben, das war eigentlich das erste Mal, daß der Raum dafür da war; einfach mal um zu reflektieren und nachzudenken, weil vorher das war natürlich der Anfang und man hat einfach das nächst liegende machen müssen und man hat bloß immer ein Schrittle vorwärts geguckt und hat das dann gemacht, aber daß dann einfach der Zeitpunkt auch kommt, daß man sich dann hinsetzt und einfach mal rückwärts guckt einmal und überlegt, wie ist es jetzt eigentlich, da fehlt oft halt die Zeit. Das ist einfach so, also Zeit ist ja etwas, was irgendwie ganz knapp immer war
L: Und vor allen Dingen bin ich nie zur Monika hin und habe gesagt, wie siehst du eigentlich das oder was denkst du da drüber und auf einmal, das war echt hochinteressant, ich fand das total gut, mit anderen Leuten, mit dem Oskar habe ich immer abends über die WG geredet, aber wir waren halt zusammen unterwegs. Mit der Monika war ich nicht jeden Abend auf Achse, da wußte ich gar nicht, wie geht's jetzt da lang und da habe ich mir auch echt - das fand ich gut. Und wenn dafür ein Raum da wäre, ich glaube, ja, ich fand´s super damals. (ehem. Bewohnerlnnen o.A. :64)
Die Bewohnerinnen gehen davon aus, daß im Abstand von 4-5 Monaten ein Reflexionsgespräch ausreichen würde. Bei Bedarf sollte die Möglichkeit bestehen, auch kurzfristig einen Termin anzuberaumen.
Die letzten vier Jahre haben gezeigt, daß eine Begleitung von außen sehr offen an- genommen wird. Der monatliche Beratungstermin mit den hauptamtlichen Mitarbeitern, der auf deren Wunsch zustande kam, wurde regelmäßig in Anspruch genommen. Aktuelle Fragen und konzeptionelle Überlegungen standen hier offen zur Diskussion und führten zu neuen Ideen, die auch in der Praxis erprobt und umgesetzt werden konnten.
Dieser Rahmen ist aufgrund der Projektförderung, die dem beratenden Aspekt der wissenschaftlichen Begleitung einen hohen Stellenwert einräumte, möglich gewesen. Alle Beteiligten haben immer wieder betont, daß ein Gesprächsrahmen, der von außen begleitet wird, hilfreich und notwendig ist. Es sollten Möglichkeiten gesucht wer- den, diese Begleitung auch später kontinuierlich anzubieten.
Zusammenfassend können folgende Schwerpunkte und Rahmenbedingungen der Reflexions- und Beratungsgespräche als Bausteine empfohlen werden:
-
Die Erinnerung an gelungene Wege ist ein wesentlicher Bestandteil der Beratungsarbeit. Es zeigt sich immer wieder, daß im Wohngemeinschaftsalltag positive Entwicklungen in den Hintergrund geraten oder durch Schwierigkeiten überlagert werden und so verlorengehen. in vielen Entwicklungsreflexionen kamen positive Veränderungen ans Tageslicht, z. B, welche Kompetenzen einzelne Bewohnerinnen erworben haben, die schon in Vergessenheit geraten bzw. zur Selbstverständlichkeit geworden sind.
-
Die Beratungssituation braucht Raum, um den Bereich des Nicht-Erfüllten frei zu thematisieren, Konflikte zu entdecken und dafür neue Perspektiven zu entwickeln. Hiermit sind heikle Themen angesprochen, wie z. B. die Organisation der Wochenendassistenz, Umgang mit Grenzen etc.
-
Ein wichtiges Thema ist die Aufgabenverteilung und Verantwortungsübernahme in der LIW. Was sind die Aufgabenstellungen für den einzelnen? Weiche Aufgaben werden vernachlässigt? Wo liegen Verschiebungen zwischen Selbsthilfe, Selbstorganisation und Profession? Ein Beispiel zum immer wiederkehrenden Verschiebungsprozeß; irgendwann werden Aufgaben von den Professionellen übernommen, die die Wohngemeinschaft in ihrer Verantwortlichkeit regeln können müßte. Gerade in bezug auf Alltagstätigkeiten wurden zusätzliche Personen, wie Praktikantlnnen, in Verantwortungsbereiche der Bewohnerinnen mithereingezogen.
-
Eine institutionell-unabhängige Position der Beratungsperson ist für offene Reflexionsgespräche erwünscht und erforderlich.
-
Der zeitliche Rahmen für Reflexionsgespräche muß überschaubar und begrenzt bleiben.
Aus den bisherigen Erfahrungen kann jeder initiative/Einrichtung, die eine LIW ein- richten möchte, geraten werden, darauf zu achten, daß in regelmäßigen Abständen alle Beteiligten die Möglichkeit erhalten, Zwischenbilanz zu ziehen. Die Formen hierfür können unterschiedlich sein. Eine Möglichkeit besteht darin, einen gemein- samen Konzeptionstag durchzuführen, an dem alle Beteiligten teilnehmen. Mit einer außenstehende Moderatorin werden virulente und wichtige Fragestellungen, die zu- vor gesammelt werden, verhandelt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch eine Kooperation mit einer ortsnahen Fachhochschule oder Universität fachkompetente Personen in einen Beirat míteinzubinden und gemeinsam Projekte zur Evaluation zu entwickeln.
Sollen mit Evaluationsformen der Qualitätsentwicklung und -sicherung humane Le- bensbedingungen erreicht werden, so wird eine Einbindung von außenstehenden Personen unumgänglich sein, weil sie in ihrer Position (ohne Einbindung in die Strukturen) eine Transparenz der Probleme forcieren und offen gegenüber kritischen Betrachtungen sein können.
QUALitätskontrolle (insbesondere Leistungsbeschreibungen) in der LIW
„Wenn man zu rechnen beginnt, stimmt's nicht mehr“ (ehemalige Bewohnerin)
Die Vorstellung, Qualitätskontrollen in der Wohngemeinschaft durchführen zu können, ist sehr schwierig. Qualitätssicherung in Form von Leistungsbeschreibungen und -kontrollen entspricht nicht dem Grundverständnis und den Grundhaltungen der WG-Bewohnerinnen. Widerstände gegen die Erfassung von Leistungen waren schon in der ersten Erhebungsphase vorhanden. „Arbeitszeiten“ aufzuschreiben, um die tatsächlichen Assistenzleistungen zu erfassen und den Bedarf zu konkretisieren - und dem damals vorherrschenden Gefühl und der vorhandenen Einschätzung, daß zusätzliche Ressourcen notwendig sind, zu belegen, - stieß auf Ablehnung. Neben dem Widerstand, im privaten Bereich überhaupt regelmäßige Evaluationen durchzuführen und darüber hinaus noch irgendwelche Formulare ausfüllen zu müssen, begründen die Bewohnerinnen ihre Ablehnung vor allem auf den nicht-eindeutigen und deshalb schwer zu kategorisierenden Alltag. Die „saubere“ Trennung von „privat“ und „Dienst“ ist schwierig: Bin ich beim Abendessen oder wenn ich nach Hause komme und mich den Mitbewohnerlnnen widme, privat teilnehmend oder übernehme ich da- bei konkrete Assistenzleistungen, obwohl ich nicht im „Dienstplan“ eingetragen bin? Eine Frage, die nicht ohne weiteres zu beantworten ist und bei einem Versuch der Kategorisierung das vorhandene Beziehungsverhältnis unterminiert.
Gleichzeitig erfordert der Alltag - und dies ist auch der Wunsch der Bewohnerinnen - klare Regelungen von „Diensten", damit sie Rückzugsmöglichkeiten wahrnehmen können und sich relativ frei entscheiden können, in welchen Situationen sie ohne Verpflichtung teilhaben. Ein Widerspruch, der nicht leicht zu lösen ist.
Hier werden konkrete Messungen und Vereinbarungen nur unzureichend die situativ entstehenden Grenzen einzelner Bewohnerinnen einfangen können. Aus den vierjährigen Erfahrungen in der Jurastraße ist zweierlei sichtbar geworden:
-
Ein klar definiertes Mindestmaß an Assistenzleistungen muß vereinbart (vgl. Kapitel Assistenzleistungen) und in Leistungseinheiten beschrieben werden.
-
Eine beständige Aufgabe des hauptamtlichen Mitarbeiters ist es, Lebensbedingungen zu schaffen und individuell auszuhandeln, die jeder Bewohnerin auch das Gefühl von Eigenständigkeit und den Raum von Rückzugsmöglichkeiten gewähren.
Für eine Bedarfs- und Leistungsbeschreibung wäre eine quantitative Erhebung über einen überschaubaren Zeitraum hilfreich gewesen, um zusätzliche und konkret nachweisbare Fakten zu haben, die als Argumentationshilfen für die Weiterentwicklung interessant gewesen wären. Während in Institutionen solche Erhebungsmethoden heute notwendig erscheinen und zu einem transparenten Alltagsgeschäft gehören, ist in der LIW ein anderer Kontext wirksam. Die Bewohnerinnen sehen ihre Wohngemeinschaft als einen Privatraum und weniger als einen Arbeitsraum. Wie das Zitat zu Beginn dieses Kapitel andeutet, ist gegen allzuviel formale und bürokratische Vorgänge eine ablehnende Haltung vorhanden. Sobald eine rechnerische Perspektive bei den Bewohnerinnen in den Vordergrund tritt, sind die Atmosphäre, die gemeinschaftlichen Strukturen und die gegenseitigen Freiräume verloren. Deshalb muß der Respekt vor der Privatsphäre gewahrt bleiben, und es müssen Möglichkeiten gesucht werden, durch analysierende und kritische Sequenzen die Weiterentwicklung voranzutreiben, Die zuvor beschriebenen Reflexionsgespräche waren im Kontext der Wohngemeinschaft Jurastraße eine akzeptierte Evaluationsform. In an- deren Wohngemeinschaften können andere Formen angemessen und hilfreich sein.
Zunächst stellt sich am Ende eines Forschungsprozesses die Frage, ob das Ergebnis zufriedenstellend ist. Relativ leicht fällt eine Bewertung im Bereich der Projektberatung. Die konkrete Beratung der Mitarbeiter und die Beteiligung in den Gremien wurde von den Beteiligten immer wieder positiv bewertet. Damit wurde auch in diesem Projekt bestätigt, daß der teilhabende, mitwirkende und einmischende Anteil der Praxisforschung für das Gelingen der Arbeit bedeutend ist. Dieser gemeinsame Prozeß, der Forschung auch an den Entscheidungsprozessen beteiligt und in den Verantwortungsbereich miteinbezieht, ist auch für den Erkenntnis- und Verstehensprozeß der unterschiedlichen Positionen hilfreich - auch wenn gleichzeitig diese Nähe kritische Positionen der Forschung nicht immer erleichtert.
lm Vorfeld der zweiten Erhebungsphase bestand die Hoffnung, daß durch ein klares Durchdeklarieren von Qualitätsmerkmalen die ideale LIW gebastelt werden könnte. Hier hat sich relativ schnell gezeigt, daß dieses Ansinnen nicht zu realisieren ist. Schon im ersten Gespräch mit den Trägern stellte sich heraus, daß die Vorstellung, ein übersichtliches Bausteinesystem der LIW zu kreieren, nicht umzusetzen ist, weil Begriffe wie Selbstbestimmung entweder auf der allgemeinen Definitionsebene zu pauschal bleiben, so daß konkrete Handlungen nicht mehr sichtbar werden oder bei einer konkreten Betrachtungsweise wieder für jede einzelne Situation ganz unter- schiedlich „gehandelt“ wird. lm Nachhinein bleibt ein beruhigendes Gefühl, daß durch diese offene Darstellung und Konzentration auf die Erfahrungen der Beteiligten der Bericht nicht in einem Zehn-Punkte-Programm mündet, sondern hoffentlich die Perspektiven der Beteiligten sichtbar werden.
Die folgenden ausgewählten Aspekte sollen den Hintergrund der LIW in den Vordergrund stellen und damit Entwicklungsfelder und weiterführende Diskussionsprozesse deutlich machen.
Vom Projekt zum Standardangebot
Eine Möglichkeit der Bilanzsichtung besteht darin, ganz nüchtern auf die Zahlen bzw. auf quantitative Größen zu schauen. Hier kann nach vier Jahren positiv verzeichnet werden, daß die LIW, die zunächst als ein Projekt immer den Charakter eines Versuchs hatte, heute ein Bestandteil des Wohnangebots der Einrichtung darstellt. Die Etablierung einer zweiten LIW zum gegenwärtigen Zeitpunkt entläßt die erste LIW auch aus der Rolle eines „Sonderfalls“ und weckt Hoffnungen auf eine solide Basis für einen neuen Bereich im Wohnen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die institutionellen Perspektiven einer Großeinrichtung über den Bereich des Wohngruppenverbunds hinaus für eine inklusive Politik der „Behindertenarbeit“ öffnet. Hier zeichnen sich gegenwärtig nicht nur im Verbund mit institutionellen Trägern Entwicklungsprozesse und eine sich verändernde Institutionspolitik ab, die im Sinne von Betroffenen zukünftig eine bedarfsorientierte Begleitung erhoffen läßt. Hier können ernstgemeinte und an den Interessen der Betroffenen orientierte Kooperationen zwischen Selbsthilfeorganisationen und Institutionen in Zukunft Welten verändern - für einzelne in radikaler Weise.
An dieser Stelle wäre es hilfreich und spannend, einmal an einem konkreten Projekt- vergleich zu untersuchen, an welchen Stellen und Situationen Kooperationsformen von Selbsthilfeorganisationen und Institutionen eine andere Dynamik entwickeln als ausschließlich professionelle Hilfen.
Eine wesentliche Erkenntnis aus den Erfahrungen der LIW ist, daß die Betroffenen und/bzw. die Eltern ihren Bedarf an inklusiven Wohnformen gegenüber Institutionen und der Öffentlichkeit formulieren müssen. Denn eines zeigt sich immer wieder: Ohne einen öffentlich formulierten und nachweisbaren Bedarf gibt es wenig Bewegung in Richtung inklusives Wohnen. Bei einer LIW-Gründung heißt dies: Menschen mit Assistenzbedarf und ihre Eltern müssen konkret die Nachfrage stellen.
Entwicklung einer Anerkennungskultur für Bürgerinnen-Engagement
Die Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und Institution hat, wie die Wohngemeinschaft Jurastraße zeigt, positive Effekte. Grundsätzlich zu hinterfragen ist die Tatsache, daß die Bewohnerinnen und organisierten Eltern für ihr Engagement zu wenig (gesellschaftliche) Anerkennung erhalten.
Ein Beispiel aus der Bewohnerlnnenperspektive: Eine Bewohnerin ohne Assistenz- bedarf wird von seiten ihres Arbeitgebers immer wieder gefragt, ob sie ihr Arbeitsverhältnis von 75% auf 100% aufstocken könnte. Diesen Wunsch weist sie zurück, weil sie auch für die Wohngemeinschaft Energien freihalten möchte. Hier bedarf es Überlegungen von seiten der Leitung, Verwaltung und Politik, wie sich dieses Engagement nachhaltig z.B. in rentenrelevanten Bezügen niederschlagen könnte.
ln ähnlicher Weise betrifft dies auch das Selbsthilfe-Engagement der Mütter, die schon über Jahre hinweg ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. Bei allen Kooperationstreffen und Sitzungen bleibt das Engagement freiwillig und unbezahlt. lm Sinne einer Gleichbehandlung muß hier angefragt werden, ob nicht eine neue Kooperationsbasis angezeigt wäre, damit nicht die einen dienstlich und die anderen privat in der gleichen Besprechung sitzen. Nach den Jahren der gemeinsamen Kooperation könnten hier neue Wege gesucht werden, die ein Überwinden der klassischen Trennung von Ehrenamt und Professionalität verfolgen. Eine Möglichkeit bestände darin, der Kooperationspartnerln eine symbolische Summe für die Mitarbeit und Beratung aus dem Etat zur Verfügung zu stellen.
Diese neuen Formen der Bewertung und Anerkennung von Bürgerlnnenbeteiligung müssen auf (Verbands-)politischer Ebene unterstützt werden. Gerade im Zuge des Abbaus des Sozialen und der Ökonomisierung und Privatisierung des Wohlfahrtstaates (vgl. Rose 2000 172) - Prozesse, die sich nicht einfach aufhalten lassen - benötigen wir neue adäquate, gerechte und menschliche Formen einer Anerkennungskultur. Soziales Engagement soll sich lohnen. Ansonsten werden sich Menschen mit Assistenzbedarf durch die zunehmende Privatisierung der Verantwortung eine Teilhabe nur noch leisten können, wenn sie über Vermögen verfügen.
Die LIW als eine Wohnalternative
Die LIW ist ein Wohnangebot für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf. Obwohl hier kein Ranking von Wohnformen betrieben werden soll, kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß die LIW für ein Wohnen in der Gemeinde/im Stadtteil eine grundlegend andere Basis für Partizipation bietet als totale Institutionen jenseits eines normalen Lebens. Die LIW bietet somit einen Rahmen, der Inklusion erleichtert und Menschen mit Assistenzbedarf die Chance gibt, aus den institutionell-exklusiven Lebenswelten auszusteigen bzw. nicht noch im Lebensbereich des Wohnens in ein weiteres exklusives Leben einzusteigen.
Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Wohnformen, die Anschlußmöglichkeiten an ein stadteilbezogenes Wohnen in der Gemeinde ermöglichen. Eine vergleichbare Alternative z. B. zur LIW bietet etwa das Einzelwohnen in einem barrierefreien Wohnhaus, das über einen gemeinsamen Wohn- und Küchenbereich die Möglichkeit einer Wohngemeinschaft herstellen kann. Dabei liegt die Assistenzorganisation in der Verantwortung des einzelnen bzw. des Unterstützerlnnenkreises. Ein Vorteil dieser Wohnform liegt darin, daß alle Beteiligten, unabhängig von Assistenzleistungen, aufeinander zugehen können, da die Assistenz von außen geleistet wird. Somit sind nicht so leicht Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Bewohnerinnen möglich. Die Schwierigkeit bei diesem Modell liegt vor allem in der Finanzierung - zumindest dann, wenn eine Bewohnerin eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz benötigt.
Auf dem Weg zu „community care“
Der Anspruch auf Inklusion (GG) wird durch die LIW nur fragmentarisch realisiert, aber er wird ernst genommen. Dieser Versuch ist dringend notwendig, trotz aller Widersprüche und Schwierigkeiten, wenn das Ziel einer menschlichen Gesellschaft als erstrebenswert gilt. Es ist ein möglicher Weg, es gibt noch viele andere.
Strukturell läuft die LIW immer Gefahr, eine Insel im Gemeinwesen zu bleiben, zumindest von innen wird die Einbindung in andere unterstützende Strukturen vermißt. Die Signale von Bewohnerinnen, Mitarbeiterinnen und Eltern, die immer wieder die Grenzen und Schwierigkeiten thematisieren, müssen ernst genommen werden. An der Oberfläche ändert sich vieles, auf den ersten Blick kann mann/frau ins Schwärmen kommen. Auch bei der Betrachtung der Entwicklungen von einzelnen Bewohne- rinnen sind viele positive Veränderungen festzustellen. im Vergleich zu traditionellen Einrichtungen gibt es auch grundlegende Unterschiede. Das beginnt mit der räumlichen Gestaltung, Atmosphäre usw. und reicht bis zu flexiblen Bettgehzeiten für Personen, die auf Assistenz angewiesen sind. Trotz allem sind auch in der LIW Parallelen zu traditionellen Wohngemeinschaften zu finden, die - mit Bourdieus Worten - hinter den sichtbaren Veränderungen die verdeckten Kontinuitätslinien wahrnehmen lassen. So wie auch in traditionell betreuten Wohngemeinschaften einige Mitarbeiterinnen ihr möglichstes für ein integratives Leben tun, so bleiben die Bemühungen in der LIW an den gleichen strukturellen Grenzen stehen. Die Teilhabe in anderen gesellschaftlichen Bereichen - z. B. im Arbeitsbereich - kommt nur ganz mühsam vor- an, so daß der erwünschte Schneeballeffekt von Inklusion zunächst ausbleibt und ein langer Atem notwendig ist, um nicht allzu schnell enttäuscht zu werden.
Auch wenn hier noch viele Schritte in die Praxis umgesetzt werden müssen, liegt eine vordringliche Aufgabe in der Auseinandersetzung mit den politischen Vertreterinnen und Bürgerinnen auf der kommunalen Ebene. Es gilt, ihnen nahezubringen, daß Menschen mit Assistenzbedarf als Bürgerinnen ihres Stadtteils zu verstehen sind und für sie auch selbstverständlich Verantwortung mit übernommen wird. Wenn wir als Bürgerinnen in einen Stadtteil ziehen, möchten wir dort privat wohnen. Diesen Privatraum sollten Bürgerinnen mit Assistenzbedarf auch haben und soviel institutionelle Hilfe wie nötig direkt in der Gemeinde erhalten.
„Wir können alles, außer Hochdeutsch“ - Zur „Behinderungspolitik“ im „Ländle“
Natürlich ist der Werbeslogan der baden-württembergischen Landesregierung nicht ernst gemeint- oder? Wie dem auch sei, mit diesem Slogan im Bereich der Integration, Inklusion oder Teilhabe von Menschen mit Assistenzbedarf kann im „Ländle“ kein Werbespot gedreht werden. im Vergleich zu etlichen anderen Bundesländern befinden wir uns in Baden-Württemberg in der Diaspora. Der Bericht und die gesammelten Erfahrungen müssen auf dem Hintergrund der baden-württembergischen Kultur und Sozialpolitik betrachtet werden. Der Erfahrungskontext bleibt in den Kapiteln durchgängig auf die direkten Begegnungen und Kooperationen begrenzt. Die landespolitischen Einwirkungen auf den Alltag bleiben außen vor. Deshalb ist es an dieser Stelle notwendig, diesen Hintergrund anzusprechen. Vielleicht kann die folgende Begebenheit etwas zur Wirksamkeit des landespolitischen Integrationsverständnisses beitragen. Die bisherigen Reaktionen des Kostenträgers auf die Beantragung einer zweiten Wohngemeinschaft können als Kontinuum einer Duldung, et- was schärfer formuliert als eine Blockade betrachtet werden. Während sich in anderen Bundesländern die Kostenträger selbstverständlich über neue Versuche eines gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Assistenzbedarf freuen und ihre Unterstützung geben, wird die LIW allenfalls geduldet und ignoriert. Ohne die Bereitschaft der Gustav-Werner-Stiftung, vier Wohnplätze auszulagern und umzuwandeln, hätte das ursprüngliche Elternprojekt keine realisierbare Finanzierung bekommen. Alle Beteiligten, die sich auf neue Begegnungen einlassen, leiden in irgendeiner Form an diesen Auslegungsrichtlinien der Politik und Verbände. Aus dieser Situation heraus sind zwei wichtige Aspekte zu beachten: Diese Politik der Integrationsverhinderung von oben, die sich über Jahrzehnte in die Strukturen und in das Denken, auch in die Erfahrungen der Widerstandsbemühungen und in ihren Folgen abgelagert hat, eröffnet nur ein begrenztes Potential an Perspektiven. Deshalb ist zu hoffen, daß zukünftig vom Kostenträger akzeptable Rahmenbedingungen gewährt werden und somit die in diesem Bericht beschriebene Konflikte, Widersprüche und alltäglichen Widrigkeiten weniger in Erscheinung treten.
Unter den baden-württembergischen Bedingungen bleibt die politische Strategie der Einmischung und Beteiligung der Selbsthilfe ein wichtiger Veränderungsmotor. Je mehr Menschen und initiativen ein Leben für alle in der Gemeinde verwirklichen, desto stärker kommen Verbände und Politik unter Druck. Hierzu bedarf es eines langen Atems und an Kooperationspartnerlnnen in der Gemeinde, in Institutionen, die für diese Idee mit zu begeistern sind.
Auf dem Hintergrund der Debatte um Qualität, Ökonomie und Marktprinzipien muß klar sein, daß die Minimalversorgung „satt, sauber und trocken" (vgl. Speck 1998) keine Potentiale einer positiven Veränderung für Menschen mit Assistenzbedarf enthält. Die Qualität im Bereich von Inklusion muß erst einmal geschaffen werden, unabhängig von Kosten. Das klingt zwar utopisch und weltfremd, aber in der Regel zeigen sich Möglichkeiten von Einsparungen, Effizienz bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualitätsentwicklung nur in Bereichen, die Qualität besitzen und sie des- halb auch verbessern können (vgl. Bröokling 2000 :136ff).
upside down
„Leben in Widersprüchen“ als ein treffendes Bild für das Leben in einer lebensweltorientierten, integrativen Wohngemeinschaft beschreibt auf den ersten Blick in der heutigen Zeit sehr normale Verhältnisse, Dieses Lebensgefühl können viele für sich in Anspruch nehmen, und das ist auch eine Seite, die aus den Erfahrungen der LIW deutlich wird: Die LIW ist auch eine ganz normale Wohngemeinschaft. Aber die Widersprüche sind z.T. von unterschiedlicher Qualität. Sie konfrontieren alle Bewohnerinnen auf eine andere Weise mit Grenzen. Grenzen von Selbstbestimmung, Grenzen der Leistungsgesellschaft, Grenzen von Denkgebäuden usw. immer wieder entstehen Prozesse, die geprägt sind von Erfahrungen, die herrschende Bilder auf den Kopf stellen.
Ein wesentlicher Aspekt meiner Auswertung der Begleitung ist verbunden mit der Erfahrung, daß sich in einem „lebendigen“ Miteinander zwischen Menschen mit und ohne Assistenzbedarf immer wieder eine Sicht auf unsere verkehrten Welten offenbart. Während sich in manchen Gewohnheiten von Menschen mit Assistenzbedarf bisherige Differenzsichtweisen bestätigen, bleiben bei einer offenen Begegnung im Alltag Gegenerfahrungen nicht aus, die grundlegende Differenzsysteme von „normal“ und „behindert“ in Frage stellen. Obwohl wir von Menschen mit Assistenzbedarf immer noch zu wenig wissen, wie sie umgekehrt in ihren Bildern bei Begegnungen mit den sogenannten nichtbehinderten Menschen neue Sichtweisen und Erschütterungen der bisherigen Denkweisen erfahren, können wir davon ausgehen, daß ihnen solche Erfahrungen nicht erspart bleiben. Ein Beispiel aus der Praxis: im letzten Semester hatte ich im Seminar zu „Selbstbestimmt leben“ einen Referenten eingeladen, der umfassend Assistenz benötigt. Auf die Frage, welche Erfahrungen er durch die Begegnungen mit sogenannten nichtbehinderten und synonym definierten „normalen" Menschen mache, antwortete er: „Der Nichtbehinderte ist behinderter als der Behinderte denkt“ (Hajo Weisschuh 23.1.2001 Reutlingen). Dieses Beispiel macht deutlich, wie stark Begegnungen oder mit anderen Worten Teilhabe und Inklusion Fragen nach der konstruierten Differenz von Normalität und Behinderung aufwerfen. Verkehrte Welten liegen deshalb auch darin, daß dieses Buch auch gut mit Geschichten, die Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf mit ihren Problembewältigungsstrategien und Alltagsschwierigkeiten zeigen, geschrieben werden könnte. Würde es gelingen, das Leben in der LIW aus der Perspektive der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf zu beschreiben, so würde an einigen Alltagssituationen die selbstverständliche Akzeptanz der Normalität deutlich hinterfragt werden. Deshalb scheint mir die Orientierung an der Normalität sehr gefährlich. Zunächst muß man sich immer wieder vergegenwärtigen, daß Normalität Gegenbegriffe wie Behinderung braucht und schafft. Der Versuch, Menschen mit Assistenzbedarf in die Normalität zu „integrieren“, sie also aus der Isolation wieder zurückzuführen in die Welten des Gemeinwesens, birgt immer die Gefahr, sie in die gängigen Lebensbewältigungsmuster bzw. -vorstellungen zu pressen. Ein großer Teil von professioneller Hilfe beschäftigt sich mit der Frage: wie können die Menschen mit Assistenzbedarf gefördert werden, daß sie mitleben können? Noch wenig verbreitet und noch recht anstößig sind Fragen, die Positionen vertauschen und danach fragen, wie Lebenswelten verändert werden müssen, damit Menschen mit Assistenzbedarf teilhaben können. Hier sind noch einige Paradigmawechsel zu vollziehen, damit die Konstruktion von Behinderung in den Köpfen auf die Füße gestellt und beim Gehen erkennbar wird, daß sich auf den Wegen der einzelnen diese Formen der Unterscheidung durch gemeinsame Strecken nicht ergeben.
Adornos Erkenntnis „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ (Adorno 1973) trifft das Lebensgefühl in der LIW ganz gut, weil Illusionen eines harmonischen Lebens dadurch nicht genährt und auch das alltägliche Scheitern nicht nur negativ bewertet und auf sich selbst bezogen, sondern in die schwierigen Ausgangssituationen eingebettet werden.
Eine gewisse Radikalität des Denkens und Handelns ist geboten, um Grenzen zu erkennen. Die Begrenzung der Wahrnehmung zu sprengen, heißt immer, auch über vorhandene Strukturen hinauszugehen und Widerstand gegen die vorherrschende Ordnungslogik zu leisten. Können wir lernen, Menschen mit Assistenzbedarf mit anderen Augen zu sehen oder die Welt aus den Perspektiven von Menschen mit Assistenzbedarf zu betrachten?
Aufgrund der immer stärkeren Auflösung traditioneller Strukturen und der Tendenz, die Risiken in die Verantwortung des Privatbereichs zu verlagern, finden sich immer mehr Menschen am Rand der Gesellschaft und sind von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Inklusion wird deshalb zu einer zentralen Aufgabe der Sozialen Arbeit. Ein besseres Leben für alle beinhaltet auch die Chance für ein besseres Leben jedes einzelnen.
Lohnt es sich, diese Widersprüche „reinzuziehen“, die in der LIW entstehen? Alle Beteiligten werden es bejahen, auch wenn direkt darauf ein „aber“ folgt. lm Sinne einer philosophischen Betrachtungsweise der Welt, wie sie z.B. Laotse beschreibt, beginnt ein Weg von tausend Meilen mit dem ersten Schritt (vgl. Laotse). Auch wenn der Bericht nicht immer eine Leichtigkeit vermittelt und wir noch am Anfang einer Entwicklung stehen, sind sich alle Bewohnerinnen und Beteiligten darin einig, daß sich dieser Weg lohnt und Mut macht.
Inhaltsverzeichnis
Auf dem Hintergrund der theoretischen Verortung (vgl. 1.2) ergibt sich zunächst für die Standortbestimmung der Forschung innerhalb des Gesamtsystems LIW und aus dem Verständnis von Praxisforschung folgender Ausgangspunkt: Die Bewohnerinnen und die anderen beteiligten Personen sind die Expertinnen in bezug auf die Fragen zum Alltag und Leben in der LIW. Die Position der Forschenden besteht darin, die zentralen Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenzutragen, zu vergleichen, zu diskutieren und daraus Impulse für die Praxis zu entwickeln.
Die Erfahrungen der ersten Erhebungsphase haben gezeigt, daß eine qualitative Befragung in Form von Gruppengesprächen, an denen sich alle beteiligen können, zur aktiven Teilhabe am Forschungsprozeß sowie zur Selbstthematisierung genutzt wird. Deshalb wurde die Gruppengesprächsform als bewährte Methode beibehalten. Die Gesprächskonzeption bestand in einem Methodenmix zwischen offenen und strukturierten Anteilen. Diese Vorgehensweise hatte zwei Gründe: Erstens bestand die Notwendigkeit, verschiedene Rahmenbedingungen der LIW in den Gesprächen abzuklopfen, so daß z. B. über räumliche Bedingungen, personelle Besetzung, Mitbestimmung etc. die Vorstellungen der Gesprächsteilnehmerlnnen eingeholt werden mußten und dazu Leitfragen entwickelt wurden. Hier wurden die methodischen Überlegungen des problemzentrierten Interviews (Andreas Witzel 1982) zugrunde gelegt. Zweitens wurden unterschiedliche Möglichkeiten der qualitativen Befragung kombiniert, um mit offenen Fragestellungen bzw. mit Erzählaufforderung, narrative Sequenzen von einzelnen einzufangen, Der Möglichkeitsraum der Gesprächsteilnehmerlnnen liegt zwischen einer narrativen Bereitschaft bzw. Kompetenz und der Fähigkeit, sich über Frage-Antwort-Schema zu vermitteln, was zwischendurch auch kurze eigenstrukturierte Passagen enthalten kann. Aus diesem Grund wurden der Gesprächsleitfaden als Orientierung verwendet und die Gespräche je nach Bedarf mehr oder weniger strukturiert.
Der Gesprächsverlauf war nach vier Leitfragen gegliedert, die auf verschiedenem Niveau die Erfahrungen des Projekts im Blick auf Rahmenbedingungen erfassen sollten.
Den Einstieg ins Thema bildete eine fiktive Frage zur Idealvorstellung einer integrativen, lebensweltorientierten Wohngemeinschaft: Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Wohngemeinschaft nach ihren Vorstellungen entwerfen. Wie würde die Wohngemeinschaft aussehen?
lm weiteren Verlauf sollten die notwendigen und wünschenswerten Bedingungen in bezug auf die Struktur- und Prozeßdimensionen in der LIW beleuchtet (z.B. Raum- bedarf, Standort, Entscheidungsgremien etc.) und im Hinblick auf eine weiterführende Praxis in der WG und weiteren Projekten vertieft und überprüft werden. Eine Möglichkeit herauszufinden, was diese Wohnform auszeichnet und sich von den bisher erlebten Wohnerfahrungen unterscheidet, wurde mit der Frage nach dem Besonderen an der Wohngemeinschaft beabsichtigt.
Ein letzter wichtiger Bestandteil des Gesprächs sollte mit konkreten Empfehlungen für Personen bzw. Initiativen gesammelt werden, die an anderen Orten eine Wohngemeinschaft aufmachen möchten: Was würden Sie anderen Menschen, die eine Wohngemeinschaft neu eröffnen möchten, an Empfehlungen weitergeben? Worauf sollten diese achten?
Gegen die ursprüngliche Absicht, die Bewohnerinnen wieder wie bei der ersten Erhebungsphase nach Geschlechtszugehörigkeit in Gruppen einzuteilen und nicht nach der Kategorie des Assistenzbedarfs, sprachen einige Argumente. Einerseits widerstrebte mir die klassische Einteilung nach „Behinderung“ und „Nichtbehinderung“; andererseits kam es im Gegensatz zu der ersten Erhebungsphase weniger auf die Kommunikations- und Interaktionsprozesse zwischen den Bewohnerinnen an, Die Diskussion kreiste immer wieder um die Frage, ob nun die geschlechtlichen Lebenswelten, die in der Wohngemeinschaft auch sichtbar werden oder die Welten der Assistenzgebenden und Assistenznehmenden als Gruppenbildungskriterien gewählt werden. Der Gedanke, daß sich auch in der LIW eine gewisse Anordnung durch die Assistenzdefinitionen ergibt, die entscheidend die Lebenswelten unterscheiden, gab letztendlich die Orientierung für die Bildung von Gesprächsgruppen. Ausschlaggebend für die Einteilung der Gesprächsgruppen nach Assistenzgebenden und Assistenznehmenden war das Interesse herauszufinden, ob sich in diesen zwei Welten bedeutende Unterschiede herausbilden. Ein weiterer Gesichtspunkt, der sich aus den ersten Erhebungen ergab, lag in dem Gefälle der verbalen Ausdrucksmöglichkeiten. Das Gesprächstempo und die dynamische Entwicklung eines Gespräches mit einer Gruppe, in der die Beteiligten alle mehr Zeit zum Verbalisieren ihrer Gedanken benötigen, bieten auch eine Chance.
Ein Effekt dieser Gesprächsgruppenbildung war besonders in der Gruppe der Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf zu spüren. Dieser Rahmen, „unter sich“ zu sein, ermöglichte einem Bewohner mit Assistenzbedarf, der ansonsten an den Gesprächen nie teilnahm, sich engagiert einzubringen. Ein Rest an Zweifel bleibt bei dieser Vorgehensweise vorhanden: Die Gruppenbildung nach Assistenzbedarf oder „Behinderungskategorien“ trägt auch einen Beitrag zur alltäglichen Konstruktion von „Behinderung“ bei.
Zentrales Anliegen der Erhebung war es, alle Beteiligten miteinzubeziehen. Auswahlkriterien für die Zusammensetzung der Gruppen bildeten positions- und funktionsbedingte Merkmale der Beteiligten. Dabei ergaben sich folgende sechs Gesprächsgruppen:
-
Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf (3 Frauen, 1 Mann);
-
Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf ( 2 Frauen, 2 Männer);
-
Ehemalige Bewohnerinnen ohne Assistenzbedarf (2 Frauen, 1 Mann);
-
Mitarbeiterinnen (hauptamtlicher Mitarbeiter, Stellvertreter des hauptamtlichen Mitarbeiters, teilweise ehemalige Praktikantin, ehemaliger Praktikant und Zivi);
-
Eltern (3 Mütter);
-
Träger (1 Vertreter der Einrichtung, 3 Vertreterinnen der Selbsthilfeorganisation).
Die Gesprächsaufzeichnungen auf Tonträger wurden vollständig transkribiert und in einem ersten Schritt die Themen der Gespräche mit ihren inhaltlichen Kernaussagen herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt wurden die Themen geordnet. Dabei ergaben die Leitfragedimensionen, die sich auf sozialräumliche, personelle und professionelle Unterstützung, Assistenzleistungen, Selbstbestimmung und Teilhabe bezogen, ein Grundraster für die Auswertung. Das Textmaterial enthält noch einige Themenbereiche, die aufgrund von Prioritätensetzungen nicht weiter verfolgt wurden. Vor allem mußten dabei Themen ausgeklammert werden, die im Hinblick auf eine Auswertung auf Beziehungs- und Interaktionsstrukturen einen interessanten Stoff bieten würden (z. B. geschlechtsspezifische Sichtweisen oder hierarchische Prozesse in der LIW). In einem dritten Schritt wurden die Aussagen der einzelnen Gesprächsgruppen verglichen. im Vordergrund stand dabei die Frage: bei welchen Themen ergeben sich Übereinstimmungen, und wo zeichnen sich widersprüchliche Haltungen und Einschätzungen ab?
Aus den Gesprächsaufzeichnungen wurden alle angesprochenen Themen und Kriterien herausgefiltert und als Basis für die Gliederung der einzelnen Kapitel herangezogen.
Die Gespräche dauerten im Durchschnitt etwa 2,5 Stunden (minimal 2 Stunden bis maximal 4 Stunden). Die Mehrzahl der Gespräche wurde im Rahmen eines Treffens durchgeführt, bei den restlichen fanden zwei Termine statt. Die Wahl des Gesprächsortes überließ ich den Gruppen.
Gesprächsverlauf - exemplarische Darstellung von Gesprächserfahrungen
Den meisten Teilnehmerinnen war die Gesprächssituation „interview“ durch die Beteiligung an der ersten Erhebungsphase bekannt. Die durchgängig positive Resonanz der Teilnehmerinnen nach den ersten Gesprächen konnte auch in der zweiten Erhebungsphase verzeichnet werden. Der Verlauf in den einzelnen Gesprächen war unterschiedlich, wobei in allen Gesprächen eine engagierte Teilnahme vorhanden war, im einzelnen möchte ich auf die Gesprächsverläufe nicht eingehen.
Zwei exemplarische Erfahrungen, die mir besonders wichtig erscheinen, sollen hier kurz erläutert werden. Die erste Situationsbeschreibung (Beispiel 1) befaßt sich mit dem Umgang der Interviewten mit der fiktiven Fragestellung nach der Traum- Wohngemeinschaft, die in allen Gesprächsgruppen ähnliche Reaktionen auslöste. Die zweite Situationsbeschreibung (Beispiel 2) betrifft die sprachliche Kommunikation im Gespräch mit den Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf.
Beispiel 1: Die Traum-Wohngemeinschaft
Der Einstieg in die Gespräche wurde über die Vorstellungen einer Traum- Wohngemeinschaft eröffnet. Mit dieser Phantasieebene zu Beginn des Gesprächs sollten Idealvorstellungen festgehalten werden, die frei vom Gesprächsverlauf in den Köpfen „schwirren“.
In allen Gesprächsgruppen rückten bei dieser Frage relativ schnell Alltagsthemen und reale Probleme in den Vordergrund. Versuche meinerseits, die Gruppe wieder auf ideal- und Wunschebenen zu führen, wurden nicht aufgegriffen. Den Gesprächsbeteiligten fiel es offensichtlich schwer, sich auf eine Traumebene zu begeben. Die Gespräche kamen durch meine Interventionen eher ins Stocken, und als Rückmeldung in der Gesprächsreflexion wurde geäußert, daß in vielen Aspekten Traum und Wirklichkeit nicht so weit auseinanderliegen und keine grundsätzlichen Veränderungen notwendig sind.
Ich war zunächst über diese fast durchgängige Herangehensweise in den Gruppen überrascht, weil ich damit gerechnet hatte, daß Bilder über eine integrative Traum- Wohngemeinschaft existieren und im Gespräch genannt werden. Der Hintergrund der Fragestellung lag in der Erfahrung, daß Phantasien bzw. Vorstellungen jenseits der Realität auf einer gefahrlosen Ebene, nämlich ohne Kritik äußern zu müssen oder Realisierungsprobleme zu berücksichtigen etc., Wünsche und eventuelle Verlustseiten thematisieren. Darüber hinaus hätte ein Gesamtbild einer Traum- Wohngemeinschaft die Grenzsteine für die Rahmenbedingungen einer LIW bilden können.
Die Wunsch-WG wurde in den Gesprächen konstruiert aus dem vorhandenen Mangel in der existierenden Wohngemeinschaft. Somit zeigt die Frage nach Utopien und Visionen eine sehr enge Verknüpfung zu den realen Erfahrungen. Der Verlauf in den Gesprächen tendiert immer wieder zu den konkreten Alltagssituationen. Ideen und Phantasien sind nicht abgehoben, sondern an konkreten Problemstellungen angebunden. Was heißt das? ich vermute, daß die Distanz zwischen Traum und Wirklichkeit im Wohngemeinschaftsalltag immer wieder durchbrochen wird und deshalb die Wunschperspektive nicht eingehalten wurde, weil die existierende Wohngemeinschaft selbst schon viel Utopiepotential enthält und im Grunde konkrete Schritte und Veränderungswünsche anstehen, um die Wohnform zu verbessern.
Liegen Realität und Wunsch so nah beieinander? Berücksichtigt man die Schwierigkeiten und Hindernisse im Alltag, so klaffen diese Welten auseinander, Alitäglichkeiten und Beziehungsmuster sind belastend, aber gleichzeitig wird der Realitätsbezug anerkannt. Gleichzeitig erleben die Bewohnerinnen ihre Wohngemeinschaft immer als etwas exklusives, etwas was es sonst nicht oft gibt, das die Zeitung und das Fernsehen interessiert. Und vielleicht wird die Traumperspektive nicht gewählt, weil von außen die Wohngemeinschaft oft als Traum bezeichnet wird, Aus der Sicht der Bewohnerinnen und Mitarbeiter sind solche Idealisierende Vorstellungen fehl am Platz und werden nicht akzeptiert (vgl. Jerg 1998 : 51f).
Setzt man die Schwierigkeiten einer Traum-Wohngemeinschaft in Beziehung zu der Frage des Besonderen an der Wohngemeinschaft, so wird deutlich: hier fallen Begriffe wie Menschlichkeit, Offenheit, Toleranz - Begriffe, die sich nicht so leicht fassen bzw. bestimmen lassen, die vor allem an konkreten Situationen deutlich und verständlich werden. Ein Beispiel: Das Lächeln am Morgen von Andrea wird als etwas Besonderes beschrieben (siehe Kapitel 1). Diese immateriellen Werte einer Gemeinschaft. eben das Lächeln zum Beispiel, das zwischenmenschliche Wärme ausstrahlt, sind das Lebendige, das auch durch einen grauen und tristen Tag hindurch scheint.
Beispiel 2: Sprachbarrieren bei Andrea
Im Vorfeld der Gespräche standen immer wieder Überlegungen im Mittelpunkt, wie die Bewohnerinnen mit Assistenzbedarf adäquat befragt werden können. Dabei ging es um die Frage, ob nicht noch andere nonverbale Methoden (Einsatz z. B, Bilderkarten) als Alternative zu Gesprächen eingeführt werden sollen. Dies geschah vor dem Hintergrund, daß sich Andrea (eine Bewohnerin) kaum verbal äußern kann. Sowohl in vielen kleineren Gesprächsgruppen, die bei Besuchen entstanden, als auch bei öffentlichen Veranstaltungen oder auch einem Konzeptionstag, an dem alle Beteiligten anwesend waren, hat sich gezeigt, daß sich Andrea immer wieder ins Gespräch einschaltete. Ihre typische Standardfrage „Warum?“ oder ihr langgezogenes „Jaaa“, das durch das nach-vorne-Bewegen des Oberkörpers unterstrichen wird und die Aussagen von anderen Beteiligten zeigen, wie sie ohne viel zu reden das Gespräch verfolgt und sinnbezogen ihre Wahrnehmungen widerspiegelt. In alltäglichen Situationen scheinen ihre Warum-Fragen oder ihr „Nein“ als erste Reaktion auf Fragen, das bei wiederholtem Nachfragen in eine Bejahung übergehen kann, ein Impuls zu sein, der nicht gesteuert ist. Wobei die Mitbewohnerlnnen bestätigen, daß ein wiederholtes Nachfragen, ein-sich-Zeit-lassen und ernsthaftes Nachfragen zur Verständigung und Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse und Wünsche führt. Wir haben in unterschiedlichen Zusammensetzungen diskutiert, wieso auf eine Frage an Andrea oft zunächst die Antwort mit Nein erfolgt und kamen zu der Einschätzung, daß sie zunächst widerspricht und abwehrt, um Zeit zu gewinnen. Diese Strategie zwingt auch das Gegenüber zunächst in eine Passivität.
Anhand von zwei konkreten Gesprächsauszügen möchte ich den Bezug zum Gespräch, den Andrea herstellt und dadurch ihre Position darstellt, verdeutlichen:
Beispiel A:
I: Worauf müßte man nach eurer Meinung bei einer neuen WG achten?
B: Ich habe mal eine Frage. Interessieren sich die Leute auch, wie ich hier eingezogen bin? I: Einen Moment, Brigitte, die Andrea möchte etwas sagen.
A: Wir kriegen doch ein neues...
I: Was ein neues?
A: Bad wird herausgerissen, doch!
I: Das Bad wird neu gemacht?
A: Jaaaaaa.
I: Ist das wichtig?
A: Ja.
I: Wird es dann leichter zum Duschen?
A: Ja.
C: Ich auch.
B: Das ist so, weil die Clara kann nicht reinsteigen, und die Andrea wird auch immer schwerer und kann nicht so.
A: Ja.
B: Da wird jetzt einfach eine Dusche reingesetzt, wo man dann duschen kann.
I: Das ist ja wichtiger Punkt, den ihr hier erwähnt.
A: Warum?
I: Daß man darauf achten muß, daß das Bad richtig ausgestattet ist.
A: Ja - (lacht) -ja.
B: Rollstuhlgerecht.
A: Ja, ja.
Der Auszug macht deutlich, daß Andrea für ihre Belange in der WG sehr kompetent eintreten kann. Sie bringt von sich aus den Umbau des Bads ins Spiel, der vor allem für sie einen erheblichen Barriereabbau zur Folge hätte. ihre Warum-Fragen kommen an Stellen, an denen es etwas nachzufragen gilt, während die Bejahungen immer die vorigen Aussagen bestätigen. (Diesen Gesprächsauszug habe ich als besondere Erfahrung mit einbezogen, weil im Umfeld von Andrea viele Personen die Meinung vertreten, mit ihr kann man sich nicht verständigen.)
Auch an dem folgenden Gesprächsausschnitt wird sichtbar, daß sie an für sie wichtigen Stellen nachfragt, die angesprochene Person die Frage versteht und intersubjektiv ein Gespräch zustande kommt. Ihr in-Frage-Stellen fördert eine inhaltliche Auseinandersetzung und macht das Gespräch auch spannend.
Beispiel B:
I: Wie ist es für dich, Brigitte, hier mit deinem Freund in der WG zusammenwohnen?
B: Es geht eigentlich. Manchmal ja, manchmal nein.
I: Wann ist es schwierig?
E.' Manchmal ist es schwierig, weil wir nicht aneinander gewöhnt sind. Er muß es lernen und ich auch.
A: Warum?
B: Ich fühl mich nirgends anders wohl als in der Jurastraße, und ich habe mich daran gewöhnt, meine Mutti auch, daß hier mein Wohnsitz ist.
I: Wann ist es schwierig?
B: Der Felix, der hier mit uns wohnt, daß er dem David als guter Freund helfen kann, bei der Wäsche und andere Sachen auch. Manchmal ist er dann so stur und will nicht. Aber dann sage ich: David sonst muß ich mit dir nicht - und dann klappt das alles.
I: Fühlst du dich verantwortlich für den David?
B: Ja, wenn ich nicht da wäre, dann würde der David ziemlich rumgucken, der braucht jemand, das merke ich jetzt auch wieder. Wenn ich sage, David so geht das nicht, dann klappt das auch.
I: Auf dich hört er?
C: Matthias auf mich.
I: Der hört auch auf dich?
C: Ja.
A: Warum?
I: Das weiß ich auch nicht, warum die Männer auf die Frauen hören, (alle lachen)
B: Normalerweise mußte es auch umgekehrt gehen. Das geht auch umgekehrt bei uns.
C: Beide.
B: Ich auf ihn und er auf mich.
Die Gesprächsauszüge zeigen, daß sich die Bewohnerin trotz der sprachlichen Schwierigkeiten im Rahmen der angewandten Technik einbringen konnte. Die Antwortsequenzen sind kurz, aber bestätigen ihre Kompetenz. Sie kann mitreden und z. T. ihre Interessen darstellen. Ein weitergehendes Gespräch mit zusätzlichen methodischen Hilfen hätte ihre Vorstellungen detaillierter ausführen können. Dazu waren die zeitlichen bzw. finanziellen Mittel am Ende nicht vorhanden.
Adorno, Th. W. 1973: Minima Moralis, Frankfurt a.M
Bäumler, Christian 1995: Innehalten! Weitergehen? In: Zur Orientierung 3/95, S. 2-4
Bauman, Zygmunt 2000: Ethics of individuals. ln: Kron, Th. (Hrsg.): Individualisierung und soziologische Theorie, Opladen 2000, S. 203-217
Bauman, Zygmunt 1999: Unbehagen in der Postmoderne, Hamburg
Bauman, Zygmunt 1996: Glokalisierung oder Was für die einen Globalisierung, ist für andere Lokalisierung. In: DAS ARGUMENT 217, S.653-664
Bauman, Zygmunt 1992: Moderne und Ambivalenz, Hamburg
Beck, Iris 1996: Qualitätsentwicklung im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessenslagen. In: Geistige Behinderung 1/96, S. 3-17
Beck, Iris 1998: Gefährdungen des Wohlbefindens schwer geistig behinderter Men- schen. ln: Fischer U., u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 273-300
Beck, Iris 1999: Der „Kunde“, die Qualität und der „Wettbewerb“: Zum Begriffschaos in der Qualitätsdebatte. In: Jantzen, W., u.a. (Hrsg.): Qualitätssicherung und De-Institutionalisierung, Berlin, 8.35-45
Bollag, Esther 2000: Community Care - Oder: wie viele Profis braucht der Mensch? In: Zur Orientierung 1/2000, S. 8-11 Bourdieu, Pierre 1997: Das Elend der Welt, Konstanz
Bröckling, Ulrich 2000: Totale Mobilmachung. In: ders. u.a.(Hrsg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt, S.131-167
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte e.V. (Hrsg.) 1995 : Wohnen heißt zu Hause sein. Handbuch für die Praxis gemeindenahen Wohnens von Menschen mit geistiger Behinderung, Marburg
Dalferth, Matthias 1997: Zurück in die Institutionen? Probleme der gemeindenahen Betreuung geistig behinderter Menschen in den USA, in Norwegen und Großbritannien. In: Geistige Behinderung 4/97, S. 345-357
Eisenberger, J. I Hahn, M. Th., (Hrsg.) 1999: Das Normalisierungsprinzip - vier Jahrzehnte danach: Veränderungsprozesse stationärer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung, Reutlingen Fischer, Ute u.a. (Hrsg.)1998: Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Reutlingen
Fischer, Ute u.a. (Hrsg.)1996: Urbanes Wohnen für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung, Reutlingen Frevert, Uwe 1998: Selbstbestimmung als Lebensqualität. ln: Zur Orientierung 2/98, S.11-14
Goll, Jelena 1998: Neuere Ansätze zum Verständnis von geistiger Behinderung: Auf der Suche nach alternativen Begriffen und Zugangsweisen. In: Goll H. I Goll J. (Hrsg.): Selbstbestimmt leben und Integration als Lebensziel, Mannersbach, S. 15-31
Hähner, Ulrich u.a. 1997: Vom Betreuer zum Begleiter, Marburg (Hrsg. Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.)
Hahn, Martin Th. 1994: Selbstbestimmung im Leben, auch für Menschen mit geistiger Behinderung. ln: Geistige Behinderung 2/94, S. 81-94
Hahn, Martin Th. 1998: Menschen, die als schwer geistig behindert gelten. ln: Fischer, Ute, u.a. (Hrsg.) 1998, a,a.O., S. 56-73
Häussler-Sczepan, Monika 1998: Möglichkeiten und Grenzen einer selbständigen Lebensführung in Einrichtungen, Stuttgart, Berlin, Köln (Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
Heiner, Maja 1998: Qualitätsmanagement zwischen Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. ln: Metzler H./Wacker, E. Soziale Dienstleistungen. Zur Qualität helfender Beziehungen, Tübingen, S. 65-85
Heiner, Maja 1996a (Hrsg.) Qualitätsentwicklung durch Evaluation, Freiburg
Heiner, Maja 1996: Evaluation zwischen Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. ln: ders. (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation, Freiburg, 3.20-47
Hüwe, Birgit, u.a. 2000: Leben ohne Aussonderung Eltern kämpfen für Kinder mit Behinderungen, Neuwied Jantzen, Wolfgang 1997: Deinstitutionalisierung. In: Geistige Behinderung 4/97, S. 358-372
Jantzen, Wolfgang u.a. (Hrsg.) 1999: Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung, Berlin Jerg, Jo 1999: Perspektiven eines nicht-alltäglichen Zusammenlebens oder „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ (Adorno). ln: Gemeinsam leben 4/99, S. 163-169
Jerg, Jo 1998: „Koi Wunderl“ Erste Erfahrungen in einer integrativen, lebensweltori- entierten Wohngemeinschaft, Reutlingen (zu beziehen über Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg)
Kern, Horst / Schumann, Michael 1985: Das Ende der Arbeitsteilung, München Keul, Alexander, G. 1998: Wohlbefinden. In: Fischer, U., u.a. (Hrsg.): a.a.O. S. 43-56
Klingst, Marlin 2000: Ende einer Lebenslüge? In: DIE ZEIT, Nr.43, 55.Jg. 19.10.00, S.1
Klauß, Theo 1996: ist Integration leichter geworden? Zur Veränderung von Einstellungen für die Realisierung von Leitideen. In: Geistige Behinderung 1/96, 8.56-68
Kräling, Klaus 1995: Wohnen heißt zu Hause sein. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte e.V., a.a,O., S. 21-35
Kräling, Klaus 1999: Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung: Die Rolle von Rahmenbedingungen, Trägern, Immobilien und Beratung, In: Eisenberger, J. u.a. (Hrsg.): a.a.O., S299-326
Lash, Scott 1996: Reflexivität und ihre Doppelungen: Struktur, Ästhetik und Gemeinschaft. In: Beck, U., u.a. (Hrsg.): Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt, 3.195-288
Lindmeier, Christian 1998: Wohlbefinden im nachbarschaftlichen Zusammenleben. In: Fischer, Ute, (Hrsg.): Wohlbefinden und Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Reutlingen
Lüpke, Klaus von 1996: Eingliederungshilfe und persönliche Assistenzdienste. In: Geistige Behinderung 1/96, S. 69-76
Lüpke, Klaus von 1994: Nichts Besonderes, Essen
Luttwak, Edward 1999: Turbokapitalismus - Gewinner und Verlierer der Globalisierung, Hamburg
Meiners, Irmgard / Heiner, Maja 1994: Evaluation der Integration psychisch Kranker im Wohnumfeld. Beobachtungen, Gespräche, Zeichnungen, Spaziergänge. ln: Heiner, M., (Hrsg.): Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit, Freiburg, S146-177
Metzler, Heidrun / Wacker, Elisabeth (Hrsg.) 1998: Soziale Dienstleistungen - Zur Qualität helfender Beziehungen, Tübingen
Metzler, Heidrun 1997: Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. In: neue praxis 5/97, S. 450-455
Neumann, Johannes 1999: 40 Jahre Normalisierungsprinzip - von der Variabilität eines Begriffs. In: Geistige Behinderung 1/99 S.2-20
Rauheshaus.de\Behindertenhilfe\CommunityCare
Rose, Nicolas 2000: Tod des Sozialen? Eine Neubestimmung der Grenzen des Regierens. In: Bröckling, u.a. (Hrsg.), a.a.O., S.72-109
Sack, Rudi 1995: Eine Wohngemeinschaft wie jede andere. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte, a.a.O., Seite 69-75
Saal, Fredi 1996: Warum sollte ich jemand anderes sein wollen? Gütersloh
Schönwiese, Volker 1994: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Eltern im Spannungsfeld von Selbstorganisation und professionellen Hilfen. Vortrag am 20.9.94 auf der Tagung: integration - eine Herausforderung im Gemeinwesen, ReutIingen
Schuler, Heinz (Hrsg.) 1993: Lehrbuch 0rganisationspsychoiogie, Bern
Schulz, Jürgen 1997: Gemeinsames Wohnen von Menschen mit und ohne Behinderung - Wegweisendes Modell oder realitätsferne Traumwelt? (Diplomarbeit an der Evang. Fachhochschule Freiburg)
Seligmann, Martin EP. 1979: Erlernte Hilflosigkeit, München
Seifert, Monika 1998: Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Vergleich. In: Geistige Behinderung 3/98, S.207-213
Seifert, Monika 1999: Qualität und Verantwortung. In: Jantzen, W., u.a. (Hrsg.): a.a.O., 8.217-231
Sennett, Richard 1998: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin
Speck, Otto 1998: Wohnen als Wert für ein menschenwürdiges Dasein. In: Fischer, U., (Hrsg.) 1998, a.a.O., S.19-43
Theunissen, Georg / Plaute Wolfgang 1995: Empowerment und Heilpädagogik, Freiburg
Thiersch, Hans 1993: Strukturierte Offenheit. Zur Methodenfrage einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. In: Rauschenbach, Th., (Hrsg) Der sozialpädagogische Blick. Lebensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit, Weinheim u. München 1993, 8.11-28
Thimm, Walter 1998: Zusammenleben in Nachbarschaften. In: Hahn, Martin Th. u.a. (Hrsg.): Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Gemeinde, Reutlingen, S.330-336
Thimm, Walter 1994: Leben in Nachbarschaften. Hilfen für Menschen mit Behinde- rungen, Freiburg i. B.
Treeß, Helga 1995: Schwer normal und mehrfach behindert. In: Sozial extra 5/95, 8.14
Wacker, Elisabeth 1998: Trautes Heim - Glück allein? Bewohnerorientierung stationärer Behindertenhilfe. In: Metzler, H./Wacker, E., a.a.O., S. 86-107
Witzel, Andreas 1982: Verfahren der qualitativen Sozialforschung, Frankfurt
Quelle
Jo Jerg: Leben in Widersprüchen. Lebensweltorientierte integrative Wohngemeinschaft. Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg: Diakonie-Ver. 2001. ISBN 3-930061-74-0.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 04.05.2016