Eine explorative Studie an nordrhein-westfälischen Universitäten zum Kontakt angehender GrundschullehrerInnen mit Inklusion
Masterarbeit, Ausgegeben am 10. 05. 2011 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für Lehrerbildung, Erstprüfer: Herr Marcel Veber, Zweitprüferin: Frau Prof. Dr. Sara Fürstenau
Inhaltsverzeichnis
"Ah, 'Inklusion', das wunderbare Zauberwort von dem gerade jeder Pädagoge spricht! Für die meisten ist es wohl eher ein Fluch, weil keiner so wirklich dafür ausgebildet wurde."
Diese Worte erhielt ich als Antwort einer befreundeten Lehramtsanwärterin, als ich ihr von dem Vorhaben meiner Masterarbeit berichtete. Das Zitat trifft in komprimierter Form den Kern der Motivation dieser Arbeit: das Verhältnis zwischen der aktuellen Schulentwicklungslinie der Inklusion und der damit häufig empfundenen Überforderung auf Seiten der Lehrerschaft. Dies hängt offenbar nicht zuletzt in vielen Fällen mit ihrer Ausbildung zusammen. Die vorliegende Arbeit möchte daher die derzeitige Vorbereitung der Lehrer auf Inklusion durch die Universitäten in den Blick nehmen und herausstellen, inwiefern die Hochschulen das aktuelle Thema der Inklusion an Grundschullehramtsstudierende herantragen: Lässt sich nach der Darstellung besser verstehen, wieso Inklusion von einigen Lehrern als Fluch aufgefasst wird?
Im Zentrum dieser Masterarbeit steht eine explorative Studie, die der Frage nachgeht, inwiefern angehende Grundschullehrkräfte während ihrer universitären Ausbildung auf Inklusion in der Bildungslandschaft vorbereitet werden. Sie wurde im Sommer dieses Jahres mit Studierenden des Grundschullehramtes in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Der Anlass dieser Studie ist durch die zunehmende Bedeutung des Themas Inklusion im Bildungssystem gegeben, wobei das Ziel angestrebt wird, kontinuierlich alle Kinder in den Regelunterricht zu involvieren. Da sich die Schülerschaft somit immer heterogener entwickelt, ist es umso wichtiger, dass auch angehende Lehrkräfte im Bereich der Inklusion sowie in den damit verbundenen Teilgebieten wie zum Beispiel der Sonder- und Heilpädagogik und der Interkulturellen Pädagogik ausgebildet werden.
Der erste Themenblock dieser Masterarbeit beschäftigt sich zunächst mit den theoretischen Grundlagen zum Thema Inklusion. So soll vorab definiert werden, was unter Inklusion zu verstehen ist und welche verschiedenen Verständnisse es diesbezüglich gibt. Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, welche Entwicklungsschritte es im inklusiven Bereich gegeben hat. Einen wichtigen Anstoß hat das Thema Inklusion durch die UNBehindertenrechtskonvention von 2006 erhalten, in der ein Recht auf inklusive Bildung für jedes Kind beschlossen wurde und die von Deutschland 2009 unterzeichnet wurde. Dabei wird in dieser Arbeit ebenfalls auf den Status quo des Einzugs von Inklusion in die deutsche Schulpraxis Bezug genommen. Je fortschrittlicher das Thema Inklusion in die Schulen eindringt, umso wichtiger erscheint es, dass zukünftige Lehrer bereits während ihrer universitären Bildung sowie bereits im Beruf stehende Lehrer in Weiterbildungsprogrammen das Thema Inklusion behandeln. Im anschlieÿenden Teil der Arbeit wird aufgezeigt, welche Konsequenzen der Einzug von Inklusion in die Schulpraxis für die didaktische Umsetzung von Unterricht hat. Dabei wird der Fokus darauf gelegt, welche Elemente einer inklusiven Didaktik zu berücksichtigen sind und über welche Kompetenzen angehende Lehrer demnach für inklusive Settings verfügen sollten.
Nachdem die inhaltliche Thematik dieser Arbeit erörtert wurde, wird im zweiten theoretischen Teil der Fokus auf das Umfeld gelegt, in der die Studie zum Thema Inklusion durchgeführt wird: die Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen. Als erstes werden dazu einige allgemeine Informationen zur Lehrerbildung gegeben, die die Struktur und den Aufbau betreffen. Dargestellt werden im weiteren Verlauf das aktuelle sowie das neue Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens. Dies ist notwendig, da sich die folgende Studie auf die Lehrerbildung bezieht und so bereits die Rahmenbedingungen dieser Ausbildung theoretisch dargelegt werden. Zudem wird auf diese Weise ersichtlich, inwiefern Aspekte von Inklusion in den Gesetzen verankert sind.
Im zweiten Hauptteil der Arbeit wird die Studie zum Thema Inklusion in der Lehrerbildung vorgestellt. Zunächst wird begründet, welche Relevanz dieser Studie zukommt und welcher Fragestellung sie nachgeht. Anschließend werde ich das Untersuchungsdesign beschreiben, um transparent zu machen, auf welchen methodischen Entscheidungen die Studie basiert, wie die Daten ermittelt wurden und auf welchen Überlegungen die Fragebogengestaltung beruht. Das Vorgehen der Kontaktaufnahme zu den Teilnehmer, der Rücklauf sowie die anschließende Datenaufbereitung stellen weitere Komponenten des Methodenteils dieser Arbeit dar. Zum Abschluss des Kapitels werden schließlich die ausgewerteten Ergebnisse präsentiert und interpretiert.
Im letzten Teil der Arbeit werden die wichtigsten Arbeitsschritte reflektiert und die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert. Nachdem eine Antwort darauf gegeben wird, wie Studierende des Grundschullehramts in Nordrhein-Westfalen auf Inklusion vorbereitet werden, werden anhand eines Ausblicks Vorschläge aufgeworfen, welche Konsequenzen die Ergebnisse dieser Arbeit für die Zukunft haben.
Zur Begrifflichkeit dieser Arbeit seien vorab zwei Hinweise gegeben. In dem folgenden Text wird aus Gründen der Leserfreundlichkeit stets die maskuline Form verwendet, wenn von männlichen und weiblichen Personen die Rede ist (zum Beispiel Schüler statt Schülerinnen und Schüler). Gemeint sind damit jedoch in jedem Fall beide Geschlechter. Des Weiteren werden die Begriffe "behinderte Menschen" oder "Menschen mit Behinderungen" genutzt. In speziellen Fällen wird auf die Bezeichnung "Menschen mit Beeinträchtigungen" zurückgegriffen. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass diese Terminologie kontrovers diskutiert wird. Allerdings soll dieser Wortgebrauch keinerlei Diskriminierung oder Stigmatisierung implizieren. Die drei verschiedenen Ausdrücke beinhalten in dieser Arbeit inhaltlich das selbe und bedeuten (in Anlehnung an die UNBehindertenrechtskonvention) langfristige körperliche, seelische oder geistige Einschränkungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen, die die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindern können [vgl. Bundesgesetzblatt, 2008, . 1, Absatz 1].
Inhaltsverzeichnis
Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Grundlagen zu den relevanten Themen dieser Masterarbeit in zwei Schritten gelegt: Während im ersten theoretischen Abschnitt der Fokus auf Inklusion gelegt wird, beschäftigt sich die Darstellung im zweiten Teil mit der Lehrerbildung. Diese thematische Einführung dient der Verständnissicherung, um darauf aufbauend im praktischen Teil der Arbeit eine Studie zu dem Thema "Inklusion in der Lehrerbildung" vorstellen zu können.
Dieser erste theoretische Teil beschäftigt sich mit allgemeinen Informationen zu Inklusion. Dabei ist dieser Abschnitt in sich dreigeteilt, um eine sukzessive Herangehensweise an das Themenfeld zu ermöglichen. Zunächst wird versucht eine Definitionsgrundlage zu formulieren, um die Bedeutung des Begriffes für den weiteren Verlauf der Arbeit abzustecken. Anschließend wird auf die Entwicklung der Inklusion eingegangen, wobei hier die UNBehindertenrechtskonvention von 2006 im Fokus der Betrachtung liegt. Im letzten Teil dieses Abschnittes wird das Thema Inklusion für den Bereich der Schule konkretisiert.
Zu Beginn soll der zentrale Begriff, der dieser Arbeit zugrunde liegt, definiert werden: Inklusion. In der Überschrift zu diesem Kapitel wurde bewusst die Terminologie "Definitionsversuche" gewählt, da es in der aktuellen Literatur ein breites Spektrum verschiedenweit gefasster Interpretationen und Auffassungen gibt und man zu Recht von einer "babylonischen Sprachverwirrung" [Wocken, 2011, S. 59] sprechen kann. Außerdem gibt es in einschlägigen Lexika oder Wörterbüchern der (allgemeinen) Pädagogik oder Erziehungswissenschaften kaum Einträge zu "Inklusion".[1] Dies liegt vermutlich daran, dass Inklusion zum einen ein relativ neues Thema innerhalb der Pädagogik darstellt und zum anderen Inklusion häufig der Sonder- oder Heilpädagogik zugeschrieben wird. So ist im Glossar der Heilpädagogik unter dem Stichwort "Inclusion" Folgendes zu lesen:
"Inclusion, auch: Inklusion; Dazugehörigkeit; bildungs-, sozialpolitische und pädagogische Leitvorstellung; anerkennt die grundsätzliche Einzigartigkeit und Verschiedenheit aller Menschen sowie ihre Zusammengehörigkeit in allen gesellschaftlichen Institutionen und öffentlichen Lebensbereichen (z.B.: Kindertagesstätte, Schule, Beruf) ohne die Notwendigkeit von Segregation und Sondereinrichtungen; im Unterschied zu Integration keine vorherige Ausgrenzung." [Bloemers u. Wisch, 2004, S. 146f.]
Diese Definition stellt in einer Kurzform dar, dass es bei der Inklusion um eine grundsätzliche Sichtweise geht, die die Einzigartigkeit und Verschiedenheit aller Menschen bei gleichzeitiger Zusammengehörigkeit in allen Lebensbereichen betont. Da alle Menschen verschieden sind, besteht keine Notwendigkeit zur Segregation. Im Folgenden werden nun verschiedene Definitions-Ansätze aufgegriffen, um dabei allgemeingültige Merkmale auszumachen, die das Wesen von Inklusion beschreiben. Die Definition des Heilpädagogik-Glossars kann hierfür als erste Richtlinie gelten, die aber in den weiteren Ausführungen noch differenzierter beleuchtet wird.
Betrachtet man Inklusion etymologisch, so gelangt man zu dem lateinischen Verb "includere", was so viel wie "einschließen" bedeutet. Dieses zunächst negativ konnotierte Wort im Sinne von "eingeschlossen sein" wird im Gebrauch des Wortes Inklusion jedoch in einem sozialen Kontext verstanden: Soziales Eingeschlossen sein hat (im Gegensatz zu Exklusion) eine positive Bedeutung im Sinne von Zugehörigkeit und Teilhabe an Gemeinschaft [vgl. Speck, 2011b, S.60f.].
Integration und Inklusion - ein unbestimmbares Verhältnis?
Die Definition des Heilpädagogik-Glossars für Inklusion beinhaltet in ihrem letzten Satz einen Vergleich zur Integration. Hierin besteht eine in der Literatur häufig aufzufindende Strategie, nämlich eine Definition des Inklusionsbegriffes zu entwickeln, die in Anlehnung an den Integrationsbegriff formuliert wird. Dies hängt damit zusammen, dass "die heutige Inklusionsdebatte auf der in Deutschland seit den 1970er Jahren geführten Integrationsdebatte [fußt]" [Werning, 2010, S. 284]. Integration ist im Gegensatz zu Inklusion ein Thema, das schon seit Anfang der 1970er Jahre im Sinne des gemeinsamen schulischen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung diskutiert wird [vgl. Schnell, 2003, S. 14], weswegen die Bedeutung des neueren Begriffes Inklusion (erst etwa seit dem Jahr 2000 im deutschsprachigen Raum aktuell [vgl. Liesen u. Felder, 2004, S. 3]) oftmals im Sinne einer Abgrenzung zu Integration vorgenommen wird. So beschreibt auch Wocken das inhaltliche Konzept der Inklusion als "Revitalisierung integrationspädagogischer Grundlagen" [Wocken, 2011, S. 57].
In der Fachliteratur besteht jedoch kein Konsens darüber, wie genau das Verhältnis von Integration und Inklusion bestimmt ist. Die Spannbreite vollstreckt sich über ein Verständnis, in dem Inklusion nur eine neue Bezeichnung für Integration ist (so zum Beispiel bei Bielefeldt: "Über die Inklusion - oder wie man herkömmlich sagt: Integration - von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in die Regelschule wird hierzulande seit langem kontrovers diskutiert" [Bielefeldt, 2010, S. 1]), bis zu einer Interpretation, die besagt, dass Inklusion etwas völlig Neuartiges sei, das weit über die bisherige Praxis der Integration hinausreiche. Problematisch hierbei ist wiederum, dass auch der Integrationsbegriff nicht eindeutig zu bestimmen ist und es variierende Wortbedeutungen gibt [vgl. Bielefeldt, 2010, S. 3].
Sander hat in seinem Aufsatz "Konzepte einer inklusiven Pädagogik" verschiedene Interpretationen des Inklusionsbegriffs systhematisiert [vgl. Sander, 2004]. Hierbei hat er die unterschiedlichen Verständnisse von Inklusion mit dem Integrationsbegriff in Verbindung gebracht und innerhalb dieser vergleichenden Definitionsstrategie drei verschiedene Verständnisse des Inklusionsbegriffes klassifiziert.
Als erste Kategorie beschreibt er "Inklusion I: Undifferenzierte Gleichsetzung mit Integration" [Sander, 2004, S. 240]. Nach diesem Verständnis bedeutet Inklusion das gleiche wie Integration, was Sander u. a. darauf zurückführt, dass oftmals die deutsche Übersetzung des englischen Wortes "inclusion" mit Integration übersetzt werde.[2] Wenn das Integrationsverständnis darin besteht, dass Menschen mit Behinderungen integriert werden, beschränken sich all diejenigen, die Inklsuion mit Integration gleichsetzen, also auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen. Innerhalb dieses Konzeptes wird dementsprechend der Begriff Inklusion synonym zu Integration verwendet. Diese Handhabung wird jedoch von bedeutenden Fachleuten kritisiert: Nur weil Inklusion als die moderne Variante von Integration gelte, dürfe nicht lediglich ein "Schilderwechsel" [Wocken, 2011, S. 65] stattfinden, der keine qualitative Veränderung beinhalte, und lediglich aktuelles Interesse provozieren soll [vgl. Hinz, 2002, S. 354].
Im Rahmen des Konzepts "Inklusion II: Von Fehlformen bereinigte Integration" [Sander, 2004, S. 241] sehen die Verfechter dieser Gruppe an der Integration in erster Linie Fehlentwicklungen und Schwächen, wie bspw. die von Feuser so betitelte "Schäferhund-Pädagogik"[3] [zitiert nach Hinz, 2004], die zu vermehrter Aussonderung führt. Aufgrund dieses Verständnisses der fehlerhaften Integration sei es notwendig, sich auf die ursprüngliche Bedeutung der Integration rückzubesinnen. "Um der Versandungsgefahr der Integrationspraxis entgegenzuwirken und einem Missbrauch des Integrationsbegriffs auszuweichen, verwendet eine Reihe von Fachleuten deshalb neuerdings den Begriff Inklusion" [Sander, 2004, S. 241]. Inklusion bedeutet in diesem Sinne die optimierte Integration behinderter Kinder [vgl. Sander, 2004, S. 242].
Als drittes Konzept nennt Sander "Inklusion III: Optimierte und umfassend erweiterte Integration" [Sander, 2004, S. 242], was er als neue Entwicklungsstufe und Erweiterung von Inklusion II beschreibt. Zentral sei nach dieser Auffassung von Inklusion die Akzeptanz der Unterschiede nicht nur im Vergleich zu behinderten Kindern, sondern bezüglich jeglicher Unterschiede aller Kinder. Das Konzept strebt die Akzeptanz der Vielfalt an. Dies sei der Ansatz, den schon Prengel, Preuß-Lausitz und Hinz mit der "Pädagogik der Vielfalt in Gemeinsamkeit" seit 1993 verfolgen [vgl. Hinz, 2002, S. 255].
Diese drei Konzepte inklusiver Pädagogik verzeichnen einen jeweils qualitativen Anstieg mit höheren Ansprüchen an das, was Inklusion bedeutet. Nach Veber gibt das dritte Verständnis die aktuelle Mehrheitsmeinung der wissenschaftlichen Diskussion wieder [vgl.Veber, 2010, S. 57]. Hierbei gilt es jedoch darauf zu achten, dass der Integrationsbegriff nicht zu einer völligen Degradierung geführt wird [vgl. Wocken, 2011, S. 61], da es neben "klassischen" Integrations-Maßnahmen insbesondere im Zuge der Integrationpädagogik auch sehr fortschrittliche Vorstellungen von Integration gab, die sich nicht nur auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen beziehen, sondern weitere Heterogenitätsdimensionen ins Auge fassten [vgl. Hinz, 2004]. In diesem Sinne spricht Schnell davon, dass Inklusion nicht unbedingt die Weiterentwicklung von Integration bedeuten muss, sondern auch eine Rückbesinnung auf den Kern der Integrationspädagogik meinen kann [zitiert nach Wocken, 2011, S. 63]. Dies unterstützen auch Liesen und Felder, da sich für sie Inklusion und die "totale" Integration nicht voneinander unterscheiden, weswegen sie keinen Sinn darin sehen, einem schon vorhandenen Konzept einen neuen Namen zu geben [vgl. Liesen u. Felder, 2004, S. 20-22]. Mit dieser Auffassung argumentieren sie zwar im Sinne des Kozepts II nach Sander, der Unterschied besteht jedoch darin, dass sie weiterhin den ursprünglichen Begriff der Integration anstelle der neuartigen Bezeichnung der Inklusion verwenden wollen.
Bislang kann also festgehalten werden, dass der Versuch, Inklusion in Anlehnung an Integration zu definieren, auch immer davon abhängig ist, welches Verständnis von Integration dabei zugrunde liegt. Dieses kann zum einen progressive Werte mit sich tragen (betrachtet man die Strömungen der Integrationspädagogik), aber auch klassisch die Eingliederung von Kindern mit Behinderung in den Regelunterricht bedeuten. Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll daher folgende Begriffsbestimmung nach Hinz gelten: Eine differenzierte, selektive Integration steht einer totalen, umfassenden Inklusion gegenüber [vgl. Hinz, 2002, S. 354]. Inklusion kann in dem Sinne eine Weiterentwicklung der Integration bedeuten, wenn man vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration ausgeht (was die Eingliederung von Kindern mit Behinderungen bedeutet) und zu einem integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion gelangt [vgl. Hinz, 2004]. Kritisch sei trotzdem angemerkt, dass andere Pädagogen, wie oben erläutert, diese Ansicht nicht teilen und an dem Integrationsbegriff festhalten wollen, da dieser schon das beinhalte, was unter Inklusion zu verstehen sei.
Greift man Hinz' Begriffsbestimmung auf, so liegt der Hauptunterschied zur Integration darin, dass mit Inklusion nicht die Eingliederung einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen in eine Gruppe mit Menschen ohne Behinderungen gemeint ist, "vielmehr liegt die Zielsetzung in einem Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten - darunter auch die Minderheit der Menschen mit Behinderungen." [Hinz, 2002, S. 355]. Diese Überwindung der so genannten "Zwei-Gruppen-Theorie" [Hinz, 2010a], die durch die "Merkmalsorientierung" [Buholzer u. Kummer Wyss, 2010b, S. 83] charakterisiert ist und bei der durch dichotome Vorstellungen jeweils zwei gegensätzliche Kategorien gebildet" werden (behindert - nicht behindert, arm - reich, deutsch - ausländisch, usw.), ist ein wesentliches Moment der Inklusion. Damit ist ausgesagt, dass Inklusion über die Integration von Menschen mit Behinderungen hinausgeht und sämtliche Formen von Heterogenität ins Augen fasst, ohne jedoch aus diesen unterschiedlichsten Heterogenitätsdimensionen neue Gruppen zu bilden [vgl. Hinz, 2009, S. 172f.]. Diese zu nennen ist deswegen nur aus Verständlichkeitsgründen angebracht: Es kann dabei um "unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen, soziale Milieus, Religionen und weltanschauliche Orientierungen, körperliche Bedingungen oder anderes mehr gehen" [Hinz, 2009, S. 171], ohne diese Unterschiede jedoch bewusst herauszustellen. Da sich jeder Mensch von jedem anderen durch bestimmte Unterschiede unterscheidet, spricht man auch von der Vielfalt als Normalzustand oder von der Normalität der Heterogenität [vgl. Hinz, 2002, S. 357]. Dies lässt sich durch den Sachverhalt untermauern, dass eine Person niemals nur in eine Kategorie einzuordnen ist, jeder Mensch also unendlich viele "Variablen" besitzt, die ihn ausmachen: Ein Mensch mit Behinderung ist entweder männlich oder weiblich, kann jeder sozioökonomischen Schicht zugehörig sein, kann verschiedenste Arten von intellektuellen Voraussetzungen mitbringen, hat evtl. einen Migrationshintergrund und so fort. An Stelle der Betrachtung eines Merkmals tritt somit die Wahrnehmung der individuellen Ausprägung verschiedener Merkmale, was durch den Begriff "intersection" ausgedrückt wird [vgl. Buholzer u. Kummer Wyss, 2010b, S. 84].
Die Achtung des Individuums mit all seinen "Variablen" ist zentral für inklusives Denken. In diesem Zusammenhang spricht Prengel von "egalitärer Differenz" [zitiert nach Kron, 2010, 2. Absatz]. Dieser zunächst paradox wirkende Ausdruck betont die Gleichheit im Sinne von Gleichberechtigung ohne Hierarchisierungen bei gleichzeitiger Achtung der individuellen Besonderheiten: "'Egalitäre Differenz' [...] komprimiert den Gedanken, dass in der sozialen Anerkennung die Respektierung der Unterschiede und der Gleichheit untrennbar ist" [Kron, 2010]. Dass im inklusiven Denken keine Gruppen und Kategorien mehr existieren und es lediglich "Vielfalt" gibt, fasst Wocken unter den Begriff der Dekategorisierung zusammen. Hierin sieht er den substantiellen Unterschied zwischen Integration und Inklusion [vgl. Wocken, 2011, S. 79].
Auch wenn demnach Heterogenität die Grundlage der Inklusion darstellt, betont Wocken, dass sich die Teilnehmer der Inklusionsdiskussion noch zu häufig auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen fokussieren:
"Die Protagonisten der Inklusion sind allesamt in behindertenpädagogischen Gefilden beheimatet. Inklusion findet in der allgemeinen Pädagogik schlichtweg nicht statt, sondern scheint bislang ein exklusives Anliegen der Behindertenpädagogik zu sein." [Wocken, 2011, S. 67]
Schumanns Worten: "Während die integrative Pädagogik die Eingliederung der 'aussortierten' Kindern mit Behinderungen anstrebt, erhebt die inklusive Pädagogik den Anspruch, eine Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder zu sein" [Schumann, 2009, S. 52] kann man nur hinzufügen, dass es bislang oft bei einem Anspruch der inklusiven Pädagogik bleibt. Bezüglich der schulischen Inklusion begründet Wocken diesen Sachverhalt allerdings auch damit, dass die Gruppe der Kinder mit Behinderungen im Schulsystem am offensichtlichsten, nämlich räumlich, exkludiert sind [vgl. Wocken, 2011, S. 66].
Neben diesen Aspekten verweist Hinz auf zwei weitere Kritikpunkte an der Integration: Zum einen nennt er die Fixierung auf die administrative Ebene, was bedeutet, dass die Art und der Grad der Schädigung das Ausmaß der Integration bestimmen [vgl. Hinz, 2002, S. 356]. Dies führt dazu, dass die Integrationsbemühungen in Deutschland vorwiegend selektive integrative Angebote blieben, wonach Kinder mit leichteren Behinderungen öfter integriert werden, da diese mit wenigen Stunden sonderpädagogischer Förderung beschult werden können. Für die Inklusion hingegen steht das Einbezogensein des Individuums als vollwertiges Mitglied im Mittelpunkt, wobei keine Fähigkeiten, Qualifkationen oder Beeinträchtigungen darüber entscheiden, ob ein Mensch zur Gemeinschaft gehört. Wocken führt als klassischen Kritikpunkt an der Integration zudem an, dass die Integrationspraxis häufig halbherzig und nur äußerlich integrierend, in Wahrheit jedoch weiterhin stigmatisierend durchgeführt werde [vgl. Wocken, 2011, S. 61].
Zum anderen gibt Hinz die administrative Etikettierung mit entsprechenden individuellen Curricula als negativen Gesichtspunkt der Integration an [vgl. Hinz, 2002, S. 358]. Hierunter versteht Hinz die massive Stigmatisierung, die Kinder mit Behinderung durch das Integrationssystem der Schule erfahren. Dies hängt damit zusammen, dass die Zuweisung des speziellen Förderbedarfs und die damit verbundene finanzielle Bezuschussung nur über die genaue Identifikation der jeweiligen Behinderung erfolgt. Dies ist ein Grund dafür, dass die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den vergangenen Jahren offiziell stetig angestiegen ist [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 22f.]. Dieses Problem wird in der Literatur als "Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma" [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 27] betitelt: Erst wenn das Kind stigmatisiert wird, erhält man die Möglichkeit einer sonderpädagogischen Förderung.
Wocken spricht in diesem Zusammenhang von der "Assimilierungstendenz" [Wocken, 2011, S. 61] der Integration im Unterschied zur Inklusion: Dabei gehe die Integration von einem definierten Normalzustand aus. Das Ziel bestehe dementsprechend darin, alle Menschen so gut wie möglich an diesen Normalzustand anzupassen, während sich die Inklusion an keiner Norm orientiert.
Zusammengefasst beschreibt Hinz die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion folgendermaßen:
"Die Integrationspraxis versucht, aus sonderpädagogischer Warte individuumsbezogen die Einbeziehung ihrer Klientel mit sonderpädagogischem Förderbedarf, je nach individueller Schädigung, mit personenbezogener Ressourcenausstattung, spezieller Förderung und primärer eigener Zuständigkeit voranzubringen, während die Inklusionspraxis mit schulpädagogischem Ausgangspunkt und systemischem Ansatz alle Schüler an einer gemeinsamen Schule für alle teilhaben und individuell wie gemeinsam lernen lassen und dies mit systembezogener Ressourcenausstattung und allen beteiligten Berufsgruppen vorantreiben will" [Hinz, 2002, S. 359f.]
Eine noch genauere Differenzierung zwischen der Praxis der Integration und der Inklusion nimmt Hinz in einer tabellarischen Gegenüberstellung vor [vgl. Hinz, 2002, S. 359], auf die in diesem Zusammenhang jedoch nicht weiter eingegangen wird.
Eine positivere Beschreibung des Verhältnisses von Inklusion zu Integration stellt Klauß heraus [vgl. Klauß, 2009, S. 8f.]. Er verdeutlicht, dass Inklusion Integration erfordere, da das Ganze, das Eingeschlossensein aller Menschen, in der momentanen Situation erst hergestellt werden müsse. Integration ist somit eine notwendige Bedingung dafür, dass der Inklusionsgedanke realisiert werden kann. Wenn Inklusion zur Normalität geworden ist, ist Integration nicht mehr nötig, da bereits alle teilhaben. So könnte man den Ausspruch Krons "Ausgangspunkt: Heterogenität. Weg und Ziel: Inklusion?" [Kron, 2010] folgendermaßen abändern: Ausgangspunkt: Heterogenität. Weg: Integration. Ziel: Inklusion. Ähnlich drücken es Bloemers u. a. aus: "Anders gesagt war die Integration nur ein Teil des Weges zur Inklusion." [Vojtová u. a., 2006, S. 74]. Eberwein erkannte diese Vermittlungsfunktion der Integrationspädagogik bereits vor über 10 Jahren, wobei er sich jedoch erstrangig auf Kinder mit Beeinträchtigungen bezieht:
"Sobald die Ausgrenzung von Kindern mit Beeinträchtigung und damit das herkömmliche Sonderschulwesen überwunden sind, wenn also integrative Erziehung und integrativer Unterricht zum Regelfall geworden sind, bedarf es keiner explizit als Integrationspädagogik bezeichneten Disziplin mehr. Pädagogik ist dann a priori integrative und damit Allgemeine Pädagogik." [Eberwein, 1998, S. 359]
Wenn es so weit gekommen ist, sind demnach die Grundvoraussetzungen für Inklusion erfüllt, da die Barriere der räumlichen Ausgrenzung dann behoben wäre. So gesehen ist unter Integration eher eine Dynamik, eine Aktion zu verstehen, während Inklusion in seiner Formvollendung einen Zustand beschreibt.
Abschließend zu dieser Integrations-Inklusions-Thematik sei auf die versöhnlichen Worte Wockens hingewiesen, der die solidarische Zukunft von Inklusion und Integration hervorhebt und die Zeit der Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander als vorüber betrachtet: "Der Inhalt der Verpackung entscheidet, nicht der Aufkleber." [Wocken, 2011, S. 86]. Was für den Inklusions-Begriff spricht, drückt Klauß folgendermaßen aus: "Inklusion artikuliert die Hoffnung, die Probleme der bisherigen Praxis durch einen neuen Anlauf beheben zu können." [Klauß, 2009, S. 5]
Es lässt sich jedoch auch feststellen, dass es unabhängig von der terminologischen Diskussion zwischen Integration und Inklusion verschiedene Sichtweisen auf Inklusion gibt. Auch diese reichen von einer eng gefassten Auffassung der Integration behinderter Kinder in Regelklassen bis zu grundlegenden Fragen nach dem Umgang mit Verschiedenheit [vgl. Werning, 2010]. Hinz kritisiert erstgenanntes als kursichtiges Inklusionsverständnis und als "Tendenz zur Sonderpädagogisierung inklusiver Pädagogik" [Hinz, 2009, S. 171], da eine Festlegung auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen gegen eine umfassende inklusive Pädagogik spreche. Diese Sichtweise wird jedoch noch häufig durch die Medien vermittelt, was daran liegen mag, dass Inklusion als "neuer Modebegriff [Hinz, 2009, S. 172] verwendet wird. Als Beispiel sei folgender Beginn eines Zeitungsartikels angeführt: "Das heißeste Eisen der NRW-Schulpolitik dürfte in den nächsten Monaten die 'Inklusion', das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen, sein." [WN, 2011].
Ein weit gefasstes Inklusionsverständnis
Ein weites Verständnis von Inklusion vertritt der britische Erziehungswissenschaftler Tony Booth. Für ihn stellt Inklusion ein Konzept mit Prinzipien dar, das ein Ansatz für die Entwicklung von Bildung und Gesellschaft ist [vgl. Booth, 2011, S. 5]. Auch Klauß kommt zu der Erkenntnis, dass Inklusion inzwischen "als eine Art Gesellschaftsentwurf oder -ideal verstanden" [Klauß, 2009, S. 1] werde. In diesem Sinne plädiert Booth dafür, die Pädagogik nicht punktuell zu modifizieren, sondern er sieht in Inklusion "eine Strategie, um Bildung und Erziehung für alle neu zu überdenken und neu zu ordnen." [Booth, 2011, S. 5]. Weiterhin kritisiert Booth die enge Sichtweise auf Inklusion [vgl. Booth, 2011, S. 6f.]: Wo Inklusion lediglich im Rahmen einer "special needs education" gesehen werde, würde pädagogisches Scheitern mit den Defiziten von Kindern erklärt werden und zu vermehrter Ausgrenzung führen. Booth macht deutlich, dass in der inklusiven Pädagogik die Probleme jedoch nicht bei einzelnen Kindern zu sehen sind, sondern die Barrieren das Problematische darstellen, die einem Zusammenleben verschiedenster Individuen im Wege stehen. Inklusive Pädagogik setzt also nicht bei den Individuen an und überlegt, welche Bedingungen gelten müssen, damit sich das Individuum dem bestehenden System anpassen kann, sondern betrachtet die Institutionen und Systeme als Ganzes, die so barrierefrei ausgerichtet sein müssen, dass jeder Mensch von vorne herein hineinpasst und ein Zusammenleben aller Menschen ermöglicht wird. Dies meint Hinz, wenn er von einem systemischen Ansatz der Inklusion gegenüber eines individuumsbezogenen Ansatzes der Integration spricht [vgl. Hinz, 2002, S. 359f.], Klauß nennt dies die "Idee der Normalisierung" [Klauß, 2009, S. 4]. Booth weist ebenfalls auf die Komplexität des Inklusionsbegriffes hin, was eine griffige Definition von Inklusion unmöglich mache [vgl. Booth, 2011, S. 8f.]. Er stellt als Wesen der Inklusion jedoch die Prozesshaftigkeit heraus, in dem die Teilhabe aller Menschen stetig zunimmt und gleichzeitig die Ausgrenzung abnimmt. Zentral für Inklusion ist für ihn "ein Prinzip des gleichen Werts, dass nämlich jedes Leben und jeder Tod von gleichem Wert sind." [Booth, 2011, S. 9]. Booth' prinzipiengeleitete Auffassung von Inklusion begründet, warum seiner Meinung nach zur Umsetzung von Inklusion bestimmte Werte gelebt werden müssen:
"Wenn Inklusion nicht mit Werten verbunden ist, von denen man zutiefst überzeugt ist, dann mag das Streben nach Inklusion nur die Anpassung an eine vorübergehende Mode sein, oder eine offenkundige Befolgung von Anweisungen der nationalen oder lokalen Regierung." [Booth, 2011, S. 9]
Als wesentliche Werte, die für die Umsetzung von Inklusion von Bedeutung sind, nennt Booth dementsprechend Gleichheit, Rechte, Teilhabe, Respekt für Vielfalt, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit, Gewaltfreiheit, Vertrauen, Ehrlichkeit, Mut, Freude, Mitgefühl, Liebe/-Fürsorge, Optimismus, Hoffnung und Schönheit [vgl. Booth, 2011, S. 10].
Diese Sicht auf Inklusion nach Booth kann man als drei Ebenen beschreiben [vgl. Hinz, 2010a]: Die erste Ebene stellt die Teilhabe von Personen dar. Dies bedeutet, dass alle Menschen unabhängig von Voraussetzungen oder Bedingungen die Chance haben sollen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die zweite Ebene geht einen Schritt weiter, da sie die Barrieren im System im Blick hat. Hier wird der Frage nachgegangen, welches Verständnis von Heterogenität vorliegt und ob es dementsprechend Kriterien gibt, die Menschen ausschließen. Die dritte Ebene thematisiert die Umsetzung der oben genannten Werte für Inklusion. Nur wenn alle drei Ebenen zusammen betrachtet werden, hat man einen uneingeschränkten Blick auf Inklusion [vgl. Hinz, 2010b, S. 66]. Dieses Verständnis impliziert außerdem den Prozesscharakter von Inklusion. Hinz benutzt in diesem Zusammenhang für Inklusion die Metapher des "Nordsterns" [Hinz, 2010a]: Ein Prinzip, das es anzustreben gilt und das allen Handlungen übergeordnet ist, wobei fraglich ist, ob der "Nordstern" jemals gänzlich erreicht werden kann.
An diese Darstellung anschließend wird eine kritische Anmerkung Specks wiedergegeben [vgl. Speck, 2011a]. Er warnt davor, dass mit Inklusion Situationen eintreten können, in denen viele Gegebenheiten beschönigt werden und so insbesondere Kinder mit Behinderungen nicht verantwortbare Nachteile erleiden würden. Dies befürchtet er angesichts der zunehmenden Ideologisierung von Inklusion, was zu "ideologischen Verzerrungen" [vgl. Speck, 2011a, S. 84] führen könne. Hier sei Booth' Verständnis von Inklusion erwähnt, das aufgrund der mit Inklusion verbundenen Werte ideologische Tendenzen aufweist. Speck ist sich sehr wohl darüber bewusst, dass eine optimistische Einstellung hilfreich sein kann, gewisse Neuerungen umzusetzen und bezüglich der Inklusion zum Beispiel Stigmatisierungen abzubauen. Ob es jedoch sinnvoll ist, dass in diesem Zuge die Sonder- und Heilpädagogik aufgrund ihrer Defizitorientierung stark abgewertet wurden und sich eine Terminologie herausgebildet hat, die im Sinne eines "positiven Denkens pur" [Speck, 2011a, S. 85] negative Sachverhalte ins Positive zu wandeln suchte (zum Beispiel "schwere Mehrfachbegabung"), stellt Speck in Frage. Dabei macht Speck auf folgende Gefahr aufmerksam: Inklusion könne "eine Ideologie [sein], die in die Zukunft reicht und Wunschbilder als künftige Wirklichkeiten erscheinen lässt, wobei reale Hindernisse entweder vernachlässigt oder ignoriert werden." [Speck, 2011a, S. 86]. Was Speck dem entgegenhält (ohne an der Idee der Inklusion rütteln zu wollen), ist ein rationaler Optimismus und Verantwortlichkeit im Umgang mit der Umsetzung von Inklusion [vgl. Speck, 2011a, S. 90].
Wesentliches der Inklusion
Zum Abschluss dieser unterschiedlichen Darstellungen von Inklusion wird nun versucht, die wesentlichen Merkmale von Inklusion zusammenzustellen, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Dabei bieten die "vier konzeptionellen Eckpfeiler der Inklusion" nach Hinz [vgl. Hinz, 2010a] eine erste Orientierung.
-
Heterogenität und Vielfalt von Menschen werden positiv aufgefasst. Homogene Gruppen zu bilden wird abgelehnt.
-
Es werden alle Dimensionen der Heterogenität betrachtet, sie werden allerdings nicht als einzelne Dimensionen gehandhabt.
-
Inklusion ringt um die Vermeidung gesellschaftlicher Marginalisierung und hat dementsprechend auch eine politische Dimension.
-
Der Abbau von Diskriminierung und Marginalisierung wird angestrebt und die Vision einer inklusiven Gesellschaft vertreten.
Neben diesen Aspekten von Hinz werden nach obiger Ausführung zusammenfassend folgende ergänzende Merkmale genannt:
-
Inklusion schließt sich an wichtige Überlegungen der Integrationspädagogik an.
-
Inklusion strebt eine Dekategorisierung und die Aufhebung der Zwei-Gruppen-Theorie an.
-
Die systemische Sichtweise steht im Vordergrund: Die Frage nach Inklusion wird nicht mehr am Kind, sondern an der Institution festgemacht.
-
Inklusion hat mit der Umsetzung wichtiger Werte wie Teilhabe, Gleichheit, Vertrauen, Mut, Hoffnung u. a. zu tun, muss aber darauf achten, sich nicht ideologisierend zu entwickeln.
Während im vorigen Kapitel allgemeine Merkmale von Inklusion herausgestellt wurden, um eine Grundlage für die Thematik dieser Arbeit zu bilden, werden in diesem Teil der Arbeit wichtige Schnittstellen in der Entwicklung der Inklusion präsentiert. Es wurde bereits herausgearbeitet, dass Inklusion auch eine gesellschaftliche Dimension besitzt. Die folgende Darstellung wird jedoch primär auf die Entwicklung von Inklusion im schulischen Bereich eingehen, da dies für die weitere Arbeit von Bedeutung ist. Es wurde außerdem gezeigt, dass Inklusion sich an wichtige Überlegungen der Integrationspädagogik angeschlossen hat. Auf diese wird im Weiteren nicht mehr explizit eingegangen; stattdessen bezieht sich die folgende Skizzierung auf aktuelle, inklusionsrelevante Aspekte.
Als Überblick sei zunächst ein Stufenmodell über verschiedene Phasen des Umgangs mit Behinderung bzw. Vielfalt angeführt. Dieses wurde von Sander modifiziert und enthält fünf Entwicklungsstufen: Die Stufe der Exklusion, die der Separation, die der Integration, die der Inklusion und die der Vielfalt als Normalfall [vgl. Sander, 2004, S. 243]. Dieses Modell ist zum einen historisch zu verstehen: So bezieht sich die Stufe der Exklusion auf die Zeit, in der behinderte Kinder von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen waren (18. Jahrhundert). Die Stufe der Separation stellt eine höhere Entwicklungsstufe dar, da behinderte Kinder nun Bildungseinrichtungen besuchen können, diese jedoch neben den allgemeinbildenden Schulen stehen. Integration auf der nächsten Stufe ist als weitere Annäherung an die Regelschule zu verstehen, da hier Kinder mit speziellen Förderbedarfen in diese Schulen integriert werden können. Die vierte Stufe der Inklusion stellt Sander als Zustand dar, in dem behinderte Kinder sowie alle anderen Kinder die Allgemeine Schule besuchen und die so entstehende Heterogenität positiv genutzt werde. Sander nennt jedoch noch eine letzte Stufe: Die Stufe der Vielfalt als Normalfall. Da es normal ist, verschieden zu sein, und deswegen auch sämtliches Gruppendenken und separierende Maßnahmen undenkbar sind, ist der Begriff der Inklusion überflüssig geworden, da das damit Gemeinte selbstverständlich geworden ist.
Das deutsche Schulwesen befinde sich allerdings, so Sander, noch weit von der Stufe der Inklusion entfernt und halte sich im Moment zwischen zweiter und dritter Stufe auf [vgl. Sander, 2004, S. 243]. Demnach ist das Modell nicht in erster Linie historisch zu verstehen, sondern als Entwicklungsprozess der Schule auf dem Weg zu einer Schule für alle Kinder, als "orientierendes Richtziel" [Sander, 2004, S.243].
Wocken kritisiert die Auffassung des Modells als zeitliche Abfolge epochaler Phasen, da die Entwicklungsstufen nicht zeitlich linear erfolgten, sondern sich sowohl überschnitten, als auch wiederholt stattfanden und auch heute noch punktuell vorhanden sind bzw. sein können. Er empfiehlt, statt von "Entwicklungsphasen" allgemeiner von "Qualitätsstufen" zu sprechen [vgl. Wocken, 2011, S. 72f.].
Seit wann ist aber in Fachkreisen das Gespräch um die pädagogische Inklusion entfacht? Im deutschsprachigen Raum wird der Inklusionsbegriff seit etwa dem Jahr 2000 diskutiert, während er im englischsprachigen Raum schon 30 Jahre länger existiert [vgl. Hinz, 2009, S. 171]. Dieser zeitliche Unterschied hängt unter anderem damit zusammen, dass der englische Begriff "inclusion" lange Zeit mit "Integration" übersetzt wurde, wie beispielsweise in der Salamanca-Erklärung von 1994 [vgl. UNESCO, 1994]. Diese ist als wichtiger Beitrag für die Entwicklung schulischer Inklusion zu verstehen. Sie hat jedoch lediglich einen empfehlenden und keinen verpflichtenden Charakter bezüglich der Bildungsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen in allgemeinen Schulen. Aus diesem Grund beschränkt sich der folgende Text auf die Darstellung der UN-Behindertenrechtskonvention, die als besonders zukunftsweisender Entwicklungsschritt auf dem Weg der Inklusion zählt, da Inklusion in ihr als Recht erklärt wird. Auf diese wird im Folgenden genauer eingegangen, da sie wesentlich dazu beigetragen hat, dass die heutige Forderung nach Inklusion realistisch geworden ist.
Die UN-Behindertenrechtskonvention - Anspruch und Verpflichtung [4]
Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 lässt sich als "monumentaler Meilenstein" [Wocken, 2011, S. 52] auf dem Weg zu einer inklusiv ausgerichteten Zukunft beschreiben. 145 von 192 UN-Staaten haben dieser Konvention bislang zugestimmt [vgl. Demmer- Dieckmann, 2010, S. 8], in Deutschland ist die Konvention seit März 2009 verbindlich. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2010 einstimmig beschlossen (bei Stimmenthaltung der FDP) diese Konvention umzusetzen [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 5]. Hierdurch wird deutlich, dass sie weltweit einen politischen Willen zur Veränderung ausgelöst hat und dieser auch unter deutschen Politikern vorhanden ist [vgl. Aichele, 2010, S. 11]. Inhaltlich geht es darum, "dass alle Kinder mit Behinderungen ein Recht haben, innerhalb eines allgemeinen, inklusiven, kostenlosen, wohnortnahen und auf Diversität setzenden Bildungssystems aufzuwachsen und dabei die nötige Unterstützung erhalten" [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 9].
Bei den Beschlüssen handelt es sich zwar um die Rechte von Menschen mit Behinderungen, allerdings wäre es falsch, diese als spezielle Rechte für die Gruppe der eingeschränkten Menschen zu betrachten.
"Die Behindertenrechtskonvention versteht sich nicht als eine 'Sonderkonvention', sondern als Bestandteil des allgemeinen Menschenrechtsschutzes, den sie bekräftigt und zugleich präzisiert. Das 'Besondere' an der Konvention ist, wenn man so will, ihre spezifische Perspektive, nämlich der Erfahrungshintergrund von Menschen mit Behinderungen." [Bielefeldt, 2010, S. 1]
Somit stärkt sie uneingeschränkt die universellen Menschenrechte und setzt bei der Gleichberechtigung behinderter Menschen an. "Zentrale Leitziele sind das bedingungslose Verbot jeglicher Formen von Diskriminierung, das unbedingte Recht auf Selbstbestimmung und das uneingeschränkte Recht auf gleiche Teilhabe." [Wocken, 2011, S. 91]
Mit den Forderungen der Konvention geht ein gewandeltes Verständnis von Behinderung einher. Behinderung wird nicht mehr rein defizitorientiert als Mangel oder Krankheit verstanden, sondern als Teil der menschlichen Vielfalt aufgefasst, wobei die Behinderungen in gesellschaftlichen Barrieren gesehen werden [vgl. Aichele, 2010, S. 13f.]. Somit sind alle Menschen gemeint, "die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen [...] Barrieren am vollen und gleichberechtigten Gebrauch ihrer fundamentalen Rechte hindern" [Riedel, 2010, S. 1]. Darum will die Konvention nicht bezwecken, dass in den jetzigen Strukturen Raum gemacht wird für die Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern setzt daran an, die gesellschaftlichen Strukturen im Ganzen zu verändern, sodass die Gesellschaft der Vielfalt aller Menschen gerecht wird [vgl. Aichele, 2010, S.13-15]. Dabei werden folgende Strukturelemente für ein inklusives Bildungssystems nach Tomasevski zugrunde gelegt: Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Akzeptierbarkeit und Anpassungsfähigkeit [zitiert nach Wocken, 2011, S. 92-94].
Während die Begründung von Inklusion in der Salamanca-Erklärung anhand von pädagogischen und lerntheoretischen Empfehlungen erfolgt (wobei auch positive ökonomische Faktoren genannt werden) [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 11f.], wird Inklusion in der Behindertenrechtskonvention aufgrund der bestehenden Menschenrechte gerechtfertigt, was für Deutschland eine neuartige Argumentation darstellt [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 14]. Dieser Rechtsanspruch beschränkt sich nicht nur auf den Bildungsbereich, sondern umfasst Inklusion in allen Lebensbelangen. Dabei nimmt die Bildung jedoch einen hohen Stellenwert ein, da Menschen mit Behinderungen über diese ein Leben in und nicht am Rande der Gesellschaft ermöglicht werde [vgl. Aichele, 2010, S. 17]. Der Bildung ist Artikel 24 der UN-Konvention gewidmet, in dem ein "integratives Bildungssystem auf allen Ebenen" (im Englischen: "inclusive education system at all levels") [vgl. Bundesgesetzblatt, 2008, Artikel 24, Absatz 1] gefordert wird. Somit gehört auch Bildung zu den Menschenrechten, woraus sich nach obiger Darstellung ergibt, dass auch Menschen mit Behinderungen dieses Recht gleichberechtigt zusteht: "[Das allgemeine Menschenrecht auf Bildung] wird zum Rechtsanspruch auf inklusive Bildung." [Bielefeldt, 2010, S. 2]. Hier sieht Wocken einen entscheidenden Unterschied zur Integration: Während sich Integration in sozialen, humanen oder karitativen Motiven begründe, sei Inklusion durch die UN-Behindertenrechtskonvention zu einem verbindlichen Recht geworden [vgl. Wocken, 2011, S. 74]. Klemm und Preuss-Lausitz drücken die Bedeutung dieses Sachverhalts folgendermaßen aus: "Damit kann eine historische Epoche überwunden werden, die davon ausging, es sei für Kindern mit Behinderungen das Beste, in Sondereinrichtungen getrennt von anderen ihrer Altersgruppe zu lernen." [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 12].
Worin bestehen nun diese Rechte im Bereich der Bildung laut der UN-Konvention?
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dieser Frage und bezieht sich dabei auf Artikel 24 der Beschlüsse der Behindertenrechtskonvention von 2006, die die Bundesregierung Deutschland im Bundesgesetzblatt Nr. 35 anerkennt [vgl. Bundesgesetzblatt, 2008].
In Absatz 1c wird appelliert, dass Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft befähigt werden sollen. Daran anschließend werden konkretere Maßnahmen genannt, zu denen sich die Vertragsstaaten verpflichten: Laut Absatz 2a dürfen Menschen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem, also vom obligatorischen Regelschulunterricht, ausgeschlossen werden. Den beeinträchtigten Kindern wird somit das Recht zugesprochen, Regelschulen zu besuchen. Dies bedeutet deswegen jedoch nicht, dass sie es müssen und dementsprechend alle Förderschulen postwendend abzuschauen sind [vgl. Speck, 2011a, S. 82]. Absatz 2b sichert jedoch, dass Kinder mit Behinderungen Zugang zu inklusivem Unterricht haben können müssen. Um das "Ziel der vollständigen Integration [Inklusion]" [Bundesgesetzblatt, 2008, Absatz 2e] erreichen zu können, müssen angemessene Vorkehrungen getroffen werden (2c) und individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in der Regelschule vorliegen (2d und 2e). Unter "angemessenen Vorkehrungen" sind nach Riedel Änderungen gemeint, die keine unzumutbare Belastung darstellen und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt ihre Menschenrechte ausüben können [vgl. Riedel, 2010, S. 2].
Der dritte Absatz beschäftigt sich mit den von den Vertragsstaaten zu errichtenden Maß-nahmen für lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen, um behinderten Menschen eine gleichberechtigte Bildung zu ermöglichen. Angeführt wird hier zunächst qualifiziertes Personal, das bezüglich spezieller Kommunikationsformen wie der Brailleschrift und der Gebärdensprache ausgebildet sein soll. Darüber hinaus besagt Absatz 4, dass insgesamt geeignetes Lehrpersonal eingestellt werden muss und angemessene Mittel, Formate und pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung herangezogen werden müssen. Dies bedeutet, dass eine Notwendigkeit darin besteht, sonderpädagogische Fachkräfte in die Regelschule einzubinden [vgl. Aichele, 2010, S. 17]. Der letzte Absatz dieses Artikels (5) bezieht sich darauf, dass Menschen mit Behinderungen auch in der Erwachsenenbildung nicht diskriminiert werden dürfen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das anerkannte Recht der Konvention in einer individuellen Rechtsposition besteht, die besagt, dass Kinder mit Behinderungen einen diskriminierungsfreien Anspruch auf Zugang zum Regelschulsystem haben, sofern keine unzumutbaren Vorkehrungen betrieben werden müssen [vgl. Riedel, 2010, S. 2]. Die wohnortnahe Schule, in der alle Kinder der Gegend, ob mit oder ohne Behinderung, gemeinsam lernen können, wird demnach in Artikel 24 der Konvention angestrebt [vgl. BAG Gemeinsam leben - gemeinsam lernen e. V. u. a., 2011, S. 3]. Somit kann ein Kind selbstverständlich eine allgemeine Schule besuchen, sodass "der unwürdige Bettelgang der Eltern um einen Integrationsplatz ein Ende hat" [Löhrmann u. a., 2010].
Mit der Anerkennung Deutschlands dieser Konvention sind nun die Bundesländer zur Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung verpflichtet [vgl. Wocken, 2011, S. 91]: Das derzeitige System muss mit allen geeigneten Mitteln und verfügbaren Ressourcen weiterentwickelt werden [vgl. Aichele, 2010, S. 18f.]. Auch wenn dieser Vorgang "als gesamtgesellschaftliches komplexes Vorhaben längerfristig und schrittweise angelegt ist" [Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 2] und das vorliegende Recht noch nicht vollständig anwendbar ist, steht es auch heute schon Kindern mit Behinderungen zu [vgl. Bielefeldt, 2010, S. 4]: Diesen muss ein Platz in einer Regelschule gewährt werden, der Wunsch nach inklusivem Unterricht darf nicht wegen der noch fehlenden Rechtsgrundlage abgewiesen werden [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 16f.]. Eine Ablehnung kann jedoch in solchen Fällen stattfinden, in denen nachweislich begründet werden kann, dass momentan keine "angemessenen Vorkehrungen" (Absatz 2c) zur Verfügung stehen, das beeinträchtigte Kind in die Regelschule einzubinden [vgl. Aichele, 2010, S. 19]. Bielefeldt drückt die bedeutungsvollen Auswirkungen des Rechtsanspruches auf inklusive Bildung folgendermaßen aus:
"Die Behindertenkonvention signalisiert somit einen grundlegenden Perspektivwechsel: An die Stelle pragmatischen Ermessens der Schuladministration tritt der Primat des Menschenrechts auf inklusive Bildung." [Bielefeldt, 2010, S. 3].
Um zu überprüfen, inwiefern die Länder, die die Konvention anerkannt haben, diese bereits umgesetzt haben, werden bestimmte Kommissionen eingesetzt. In Deutschland übernimmt diese Aufgabe des "Monitorings" [Aichele, 2010, S. 22] das Deutsche Institut für Menschenrechte. Außerdem hat die Bundesrepublik bereits im August diesen Jahres einen ersten Bericht vorgelegt, mit welchen Fortschritten und Hindernissen Deutschland bei der Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung zu tun hat [vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011a]. "Die deutschen Bundesländer stehen damit vor der Herausforderung, mit zügigen, zielgerichteten und wirksamen Schritten ein inklusives Bildungssystem aufzubauen und zu unterhalten." [Aichele, 2010, S. 24]
Status Quo der Inklusion in Deutschland und NRW
Da das Bildungssystem in Deutschland von den jeweiligen Regierungen der verschiedenen Bundesländer geregelt wird, ist jedes Land eigenverantwortlich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bildungs-Angelegenheiten zuständig [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 2], auch wenn sich die Bundesregierung auf ganz Deutschland bezogen dafür einsetzt, dass "inklusives Lernen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit wird" [Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011a, S. 50]. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich im Dezember 2010 dazu verpflichtet, die Implikationen der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Dies weist darauf hin, dass das Bildungssystem sich in den nächsten Jahren in "Richtung Inklusion" verändern wird.
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie es um die momentane Situation in der Bildungslandschaft Nordrhein-Westfalens bzgl. Inklusion und Integration steht und welche politischen Bemühungen zur Umsetzung der Bestimmungen der UN-Behindertenrechtskonvention bislang unternommen wurden.
Alle Schulgesetze in der BRD ermöglichen den Gemeinsamen Unterricht, was bedeutet, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen in der allgemeinen Schule unterrichtet werden [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 4]. In welcher Form der Gemeinsame Unterricht allerdings stattfindet, also beispielsweise anhand eines individualisierten Curriculums oder im Sinne der oben bereits erwähnten "Schäferhund-Pädagogik", wird durch diese Aussage nicht deutlich [vgl. Klauß, 2009, S. 4]. Realisiert wird der gemeinsame Unterricht aber noch relativ selten. Dies verdeutlicht die KMK-Statistik von 2006, wonach 84,3 % der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Förderschulen beschult werden [zitiert nach Schumann, 2009, S. 52]. Außerdem lässt sich verzeichnen, dass die Gesamtzahl der integrierten Schülerinnen und Schülern in Deutschland bis zum Jahr 2006 nur langsam angestiegen ist und sie in NRW sogar stagnierte: Hier wurden 2006 lediglich 11 % der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen unterrichtet [vgl. Schumann, 2009, S. 52].
Interessant ist es an dieser Stelle zu überprüfen, ob sich die Zahl der gemeinsame Beschulung in den vergangenen fünf Jahren und speziell seit den Beschlüssen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 2009 erhöht hat. Die aktuelle Problemlage sieht folgendermaßen aus:
Deutschlandweit werden derzeit insgesamt ca. 18 % aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Regelschulformen integrativ beschult [vgl. Beckmann, 2011, S. 3]. Klemm hat in seiner Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, dass von allen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Primarbereich deutschlandweit mehr als ein Drittel, nämlich etwa 34 %, am integrativen Grundschulunterricht teilnehmen. Die Variation zwischen den einzelnen Bundesländern ist jedoch sehr hoch, Nordrhein-Westfalen liegt mit 26 % deutlich unter dem Durchschnittswert [vgl. Klemm, 2010, S. 9]. Optimistisch stimmt jedoch insgesamt, dass Schulen, die sich dem Gemeinsamen Unterricht geöffnet haben, zum Großteil an diesem System festhalten und überzeugt davon sind [vgl. Fleischhauer, 2011, S. 6].
Vergleicht man den Integrations-Anteil von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen mit der Situation von vor einigen Jahren, fällt auf, dass er sich um mehr als die Hälfte erhöht hat: Waren es 2006 in Nordrhein-Westfalen noch 11 %, liegt der Anteil einige Jahre später bei 26%. Dies weist auf eine steigende Tendenz der Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regelschulen hin, was einen Fortschritt in Richtung eines inklusiven Schulsystems darstellt. Diese Quote ist jedoch noch stark ausbaufähig, denn schließlich besuchen noch knapp drei Viertel der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf separate Schulen.
Auch wenn sich diese Ausführung lediglich auf den Gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung bezog, konnte in Studien gezeigt werden, dass auch andere "Gruppen" von Gemeinsamem Unterricht profitieren:
"Durch den Gemeinsamen Unterricht [entwickeln die Schulen] eine größere Akzeptanz auch gegenüber der ethnischen, kulturellen und muttersprachlichen Heterogenität ihrer Schülerschaft [...]. Ihre Bereitschaft, diese Kinder trotz ihrer besonderen Lernbedürfnisse und Lernschwierigkeiten zu unterrichten, ist [...] unbestritten höher." [Merz-Atalik, 2002, S. 372]
Es konnte also herausgestellt werden, dass Inklusion weit davon entfernt ist, eine Selbstverständlichkeit zu sein. Jedoch lässt sich hinsichtlich der heutigen Inklusions-Landschaft mit Klauß' Worten optimistisch feststellen: "Es gibt 'in Nischen' gute Beispiele, Modelle, die auf dem Weg dahin sind, soziale Teilsysteme inklusiv zu gestalten." [Klauß, 2009, S. 9].
Welche Bemühungen bislang in Deutschland und Nordrhein-Westfalen unternommen wurden, die Beschlüsse der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in die Tat umzusetzen, wird im folgenden Abschnitt erläutert.
Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Die Kultusministerkonferenz (im Folgenden "KMK" abgekürzt) macht Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung und insgesamt zu schulischen Entwicklungsprozessen in Deutschland. Somit ist sie auch dafür verantwortlich, einen Diskurs zwischen den einzelnen Bundesländern in Bildungsangelegenheiten zu ermöglichen, was die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert [vgl. Jürgens-Pieper, Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 18]. Diesbezüglich sieht die KMK die bereits im Mai 1994 beschlossenen Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung als Grundlage an, die es weiterzuentwickeln gilt [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 8]. Dort heißt es unter anderem, dass der Wandel von der institutionsbezogenen zur personenbezogenen Sichtweise und die individuelle Förderung in den Fokus zu rücken sind. Außerdem wurde die Zuständigkeit der allgemeinen Schule für sonderpädagogischen Förderbedarf betont, was auch der terminologische Wechsel von "Sonderschulbedürftigkeit" zu "sonderpädagogischem Förderbedarf" ausdrückt. Hiermit soll der gleichberechtigte Zugang zum allgemeinbildenden Schulsystem auch für Kinder mit Behinderungen sichergestellt werden.
Des Weiteren empfiehlt die Konvention in ihrem Diskussionspapier zur Fachtagung in Bremen 2010, dass die Kompetenzen der allgemeinen Schulen im Umgang mit Heterogenität sowie die Einstellungen zur Akzeptanz von Verschiedenheit gestärkt werden müssen [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 8]. Außerdem legt die KMK dar, dass die Weiterentwicklung des Bildungssystems in inklusiver Richtung "auf der Ebene der Lehr- und Lernforschung [...] eine zentrale Herausforderung an die Erziehungswissenschaften und die Lehrerbildung [darstellt]" [Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 8].
Die KMK hat Ende des letzten Jahres eine weitere Empfehlung veröffentlicht, die an die Bildungsministerien der Länder gerichtet ist: "Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen." [Kultusministerkonferenz, 2010b]. Auch hierin wird anknüpfend an die Forderungen der UN-Konvention der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems gefordert, mit dem Ziel der "Erweiterung der Tragfähigkeit der allgemeinbildenden Schule und damit ihre Fähigkeit, mit einer größeren Heterogenität der Kinder und Jugendlichen umzugehen." [Kultusministerkonferenz, 2010b, S. 18]. Kritisiert werden diese Empfehlungen jedoch von den Verbänden behinderter Menschen (zum Beispiel BAG Gemeinsam leben - gemeinsam lernen e. V., dem Deutschen Behindertenrat und dem Sozialverband Deutschland). Zum einen habe die KMK bei der Verfassung ihrer Empfehlungen nicht mit den Verbänden zusammengearbeitet, was gegen die Forderung der Konvention (Artikel 4, Absatz 3) nach Kooperation spreche [vgl. BAG Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen e. V. u. a., 2010, S. 1]. Des Weiteren stellen die Verbände entscheidende inhaltliche Mängel fest. So fehlt ihnen beispielsweise ein klares Bekenntnis zu Inklusion als tragfähige Zukunftsperspektive und sie bemängeln, dass die KMK die Option der Erhaltung von Förderschulen als Ergänzung zu den allgemeinen Schulen in Erwägung ziehe [vgl. BAG Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen e. V. u. a., 2010, S. 2f.]. Auf diese Kritik gehen auch Klemm und Preuss-Lausitz in ihrer Empfehlung für die Umsetzung der UN-Konvention für Nordrhein-Westfalen ein [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 15]. Klemm, der 2010 eine Studie zum Thema "Gemeinsam lernen. Inklusion leben." im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt und darin eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Inklusions-Situation Deutschlands erforscht hat, untermauert die Kritik der Verbände behinderter Menschen durch folgenden Sachverhalt: "Doppelstrukturen mit ihrem Nebeneinander von Inklusion und separierender Förderschule sollte es nur für eine begrenzte Übergangszeit geben." [Klemm, 2010, S. 11]. Dies fordert er auch mit Preuss-Lausitz, was sie unter anderem mit finanziellen Aspekten begründen: "Das Doppelsystem steht daher nicht nur im Widerspruch zur UN-BRK[5], sondern ist zugleich das teuerste und ein inklusionshinderliches System." [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 23]. Bezüglich der Kosten des Aufbaus eines inklusiven Bildungssystems schätzt Aichele die Lage für realistisch ein, in den nächsten Jahren mit den in den Ländern zur Verfügung stehenden Ressourcen ein solches System aufbauen und unterhalten zu können [vgl. Aichele, 2010, S. 21]. Fleischhauer macht darauf aufmerksam, dass sich in den personellen Voraussetzungen ein positives Signal erkennen lässt: So wurde zum Februar 2011 für den Mehrbedarf, den Gemeinsamer Unterricht erfordert, die Zahl der Stellen in NRW von 188 auf insgesamt 483 erhöht und ein weiterer Anstieg auf insgesamt 600 Stellen ist geplant [vgl. Fleischhauer, 2011, S. 6].
Es gibt jedoch auch Beispiele dafür, dass die Politik trotz der UN-Konvention keinen Veränderungsbedarf im Bildungssystem sieht. Dadurch, dass "inclusion" mit "Integration" übersetzt wurde, interpretieren einige Politiker den Sachverhalt so, dass die Realität in Deutschland diesem Prinzip bereits entspräche. So sagt bspw. das Kultusministerium Baden-Württemberg: "Die Konvention macht keine verbindlichen Vorgaben zur Ausgestaltung eines Schulsystems oder zur Schulorganisation", und auch Äußerungen der Bildungsministerin Schavan implizieren eine ähnliche Haltung [zitiert nach Klauß, 2009, S. 6]. In Nordrhein-Westfalen hat sich die aktuelle Regierung der Koalition aus SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN klar für ein inklusives Bildungssystem ausgesprochen. So wird im Antrag "UN- Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen" deutlich darauf hingewiesen, dass ein inklusives sich von einem integrativen Bildungssystem unterscheidet:
"Die integrative Pädagogik strebt die Eingliederung der aussortierten Schülerinnen und Schüler an. Eine inklusive Pädagogik hingegen sortiert erst gar nicht. Inklusion bedeutet, dass Strukturen und Didaktik von vornherein auf die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler und individuelles Fördern und Fordern ausgerichtet sind." [Löhrmann u. a., 2010, S. 1]
In diesem Antrag wird der schrittweise Umbau zu einem inklusiven Schulsystem gefordert, der bereits zum vergangenen Schuljahr beginnen sollte. Deutlich wird ausgedrückt, dass die allgemeine Schule der Regelförderort für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sein soll. Nach Löhrmann ist diese Offensive mit einer notwendigen erheblichen Verbesserung der Rahmenbedingungen verbunden und erfordert eine Fortbildungsoffensive in der Lehrerbildung [vgl. Löhrmann u. a., 2010, S. 2]. Die Bildungsministerin fordert außerdem eine "Kultur des Behaltens". Hierunter versteht sie, dass alle Formen der Aussonderung vermieden und dementsprechend keine Schüler separiert werden sollen, weil jedes Kind so angenommen wird, wie es ist [vgl. Löhrmann, 2010, S. 4f.].
Weitere Forderungen zur Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems und der Umsetzung der UN-Konvention stellen folgende Dokumente dar, auf die jedoch nicht näher eingegangen wird: Klemm und Preuss-Lausitz haben auf Landesebene im Juni diesen Jahres Empfehlungen für Nordrhein-Westfalen zur weiteren Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention geliefert [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011]. Auf der Ebene der Bundesrepublik hat die Bundesregierung kürzlich ihren ersten Staatenbericht zur bisherigen Umsetzung der UN-Konvention vorgelegt [vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011a]. Außerdem wurde im August der Aktionsplan "einfach machen - Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft" der Bundesregierung veröffentlicht [vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011b], der für die nächsten 10 Jahre angelegt ist und die klare Devise "Deutschland will inklusiv werden" [Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011b, S. 7] in Aussicht stellt.
Anhand dieser Vielzahl von Dokumenten wird ersichtlich, dass ein starker Wille dazu besteht, die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen zu verwirklichen. Dies bedeutet, dass Deutschland aller Voraussicht nach in den nächsten Jahrzehnten das Ziel eines inklusiven Bildungssystem erreichen wird. Klemm und Preuss-Lausitz schätzen es als realistisch ein, dass "bis 2020 ein Inklusionsanteil von 85 % erreicht werden [kann]" [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 5]. Ebenso spricht Wocken als mittelfristiges Ziel von einer Agenda 2020, die eine Integrationsquote von 80 % anstrebe [vgl. Wocken, 2011, S. 106]. An dieser Stelle sei jedoch die Anmerkung hinzugefügt, dass (wie im ersten Kapitel erläutert) allein die Eingliederung von Kindern mit Behinderungen in den Regelunterricht nicht automatisch Inklusion bedeutet. Legt man den Fokus zu sehr auf die Gruppe behinderter Menschen, würde ein beachtlicher Teil der inklusiven Pädagogik ungeachtet bleiben, und ihre Verortung mehr in den Bereich der Sonderpädagogik als in den der Allgemeinen Pädagogik fallen [vgl. Hinz, 2009, S. 172]. Hinz schildert diesen Sachverhalt folgendermaßen: "So sehr die UN-Konvention die Diskussion um Inklusion befruchtet, so sehr droht sie Inklusion zu einer Frage der Menschen mit Behinderung und der Sonderpädagogik zu machen." [Hinz, 2010b, S. 64].
Auf diese Gruppe wurde jedoch in diesem Kapitel der Blick gerichtet, weil eine inklusive Schule unmöglich ist, wenn systembedingt nicht einmal alle Kinder gemeinsam eine Schule besuchen können. So stellt die Eingliederung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gewissermaßen eine Voraussetzung dafür dar, dass Inklusion überhaupt erm- öglicht wird. Erst dann macht es Sinn, über die reale Umsetzung von Inklusion zu sprechen. Welche Umstellungen und Veränderungen Inklusion dabei auf der Schulebene erfordert, wird im letzten theoretischen Teilabschnitt dieser Arbeit erläutert.
Inklusion in der Schule lässt sich durch den Slogan der einen "Schule für alle" [vgl. Hinz, 2002, S. 360] kurz, aber prägnant auf den Punkt bringen. Betrachtet man das Deutsche Schulsystem, tritt augenscheinlich die Frage auf, wie sich dieses Konzept der einen Schule mit dem gegliederten Schulwesen Deutschlands vereinbaren lässt [vgl. Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 13f.]. Ein Schulsystem, das Kinder nach der Grundschule in drei Leistungskategorien aufteilt und in dem außerdem schon während der Grundschule ein parallel laufender Sonderschulzweig existiert, kann nur schwerlich mit "einer Schule für alle" übereinstimmen. Da es sich hierbei allerdings um eine Systemfrage handelt, wäre es müßig, an dieser Stelle politisch über die Frage des richtigen Systems zu sinnieren. Auch wenn das durch Selektion geprägte System für sich im Widerspruch zu Inklusion steht, wäre es zu einfach, das Schulsystem als Ausrede für die Unmöglichkeit der Umsetzung von Inklusion zu nutzen und keine Innovationen oder Veränderungsprozesse einzugehen. Dadurch, dass mit der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht auf inklusive Bildung manifestiert wurde, geht es in Bezug auf Inklusion "nicht mehr um die Frage des Ob, sondern [...] ausschließlich um die Frage des Wie" [Hinz, 2010b, S. 63], auch wenn die Rahmenbedingungen nicht unbedingt förderlich sind.
Für die Gestaltung inklusiver Schulen ist eine "kohärente Gesamtstrategie" [Gomolla, 2009, S. 37] erforderlich. Gomolla bezieht sich hierbei auf die Interventionsfelder schulischer Entwicklung nach Rüesch: Schulumfeld, Schulhaus, Schulklasse und Elternhaus, die sich allesamt auf das Lernen des Kindes auswirken [zitiert nach Gomolla, 2009, S. 37]. Nur mit Einflussnahme auf all diese Bereiche und einer entsprechenden "Netzwerkarbeit" [Klauß, 2010, S. 289] kann eine inklusive Schulentwicklung erfolgen. Ebenso betont Werning, dass "inklusive Schulen [...] durch kooperative Strukturen nach innen und außen gekennzeichnet" [Werning, 2010, S. 288] sind. Mit Kooperation, die nach außen stattfindet, sind Vernetzungen gemeint, die das schulische Umfeld mit außerschulischen Einrichtungen, wie der Gemeinde, dem Stadtteil etc. aufbaut [vgl. Werning, 2010, S. 288]. Der Unterricht und weitere innerschulische Prozesse stellen also nur eine Komponente inklusiver Schulen dar.
Im folgenden Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche Besonderheiten inklusive Settings in der Schule aufweisen, welche Veränderungen damit verbunden sind und wie sich dies auf die Rolle des Lehrers auswirkt. Dabei beziehe ich mich ausschließlich auf die inneren Strukturen inklusiver Schulen nach Werning.
Im obigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass die Verwirklichung von Inklusion prozessartig stattfindet und sich nicht von heute auf morgen (beispielsweise nur durch einen Begriffswechsel) vollziehen lässt. Wenn sich eine Schule dazu entschlossen hat, ihr Konzept einer inklusiven Grundhaltung zu unterziehen, fehlen oft Mittel und Wege, wie dies zu verwirklichen ist. Aus dieser Problemlage heraus haben Tony Booth und Mel Ainscow im Jahr 2000 den so genannten "Index for inclusion" entwickelt, der von Andreas Hinz und Ines Boban ins Deutsche übersetzt wurde. Inhaltlich legen Booth und Ainscow dar, "wie Inklusion, eingebunden in eine humanistische Wertehaltung, gesellschaftlich entfaltet werden kann und verbinden diese grundlegenden konzeptionellen Ausführungen mit praktischen und detaillierten Anregungen und Hilfestellungen zur Umsetzung" [Booth u. a., 2006, Vorwort, S. 5]. Dabei erläutern sie sehr konkret (anhand von spezifischen Dimensionen, Bereichen, Indikatoren und Fragen), wie im Verlauf von fünf Phasen und einer inhaltlichen Systematik Inklusion verwirklicht werden kann. Bezogen auf das System Schule bedeutet dies, dass alle Gruppierungen der Schule in diesen Prozess involviert sind [vgl. Hinz, 2009, S. 177]. Hinz drückt die Bedeutung des Index' für Inklusion folgendermaßen aus: "Mit ihm wird das Potenzial deutlich, Inklusion als Entwicklungsprogramm konkret werden zu lassen" [vgl. Hinz, 2010a].
Heterogenität als Grundprinzip einer inklusiven Didaktik
Erhebt man die Forderung einer inklusiven Schule, stellt sich gleichzeitig die Frage, ob es dementsprechend auch eine inklusive Didaktik gibt. Rehle drückt dies radikal aus: "Eine 'inklusive' Didaktik an sich existiert nicht" [Rehle, 2009, S. 128], und auch Platte betont, dass "inklusive Bildungsprozesse [...] keine neuen, keine besonderen Konzeptionen [verlangen]" [Platte, 2010, S. 92]. Dies hänge damit zusammen, dass Inklusion nicht nur pädagogisches Konzept ist, sondern als Leitnorm für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen stehe [vgl. Goddar, 2011]. Jedoch können laut Platte inklusive Momente in konkreten Unterrichtssituationen konkret gelebt werden [vgl. Platte, 2010, S. 92]. Beide Aussagen implizieren: Eine inklusive Didaktik ist kein völlig neuer oder anderer Ansatz als bisherige Didaktik. Platte und Rehle betonen jedoch, dass es speziell für heterogene Gruppen geeignete Grundmuster der Unterrichtsorganisation gibt, die die Verschiedenheit der Kinder als Vorteil nutzen und individuelles wie gemeinsames Lernen ermöglichen [vgl. Rehle, 2009, S. 128]. Hierzu sei es notwendig, die bestehenden Lehr- und Lernmethoden, Curricula und didaktischen Konzepte vor dem Hintergrund einer inklusiven Wertehaltung zu betrachten und unter Umständen zu modifizieren [vgl. Platte, 2010, S. 92].
Deutlich wird also, dass im Rahmen von Inklusion keine völlig neue Didaktik entwickelt werden muss, sondern die Prinzipien guten Unterrichts als Orientierung dienen können. Ein guter Unterricht wirkt sich genauso positiv (wenn nicht positiver) auf eine heterogene Schülergruppe aus, wie auf eine homogene [vgl. Rehle, 2009, S. 128]. Guter Unterricht wird dadurch ausgemacht, dass "alle Schüler/innen einer Lerngruppe optimale Lernergebnisse in einem sozial befriedigenden Lernklima erreichen" [Klemm u. Preuss-Lausitz, 2011, S. 33]. Die Betonung liegt hierbei auf "alle", was den Unterschied zu herkömmlichen Unterrichtssituationen veranschaulicht: In inklusiven Klassen liegt eine noch höhere Heterogenität vor, die jedoch positiv für Lernprozesse genutzt werden kann.
Da Heterogenität in diesem Sinne gewissermaßen die Grundlage jeder "inklusiven Didaktik" bildet, soll im folgenden Teil genauer darauf eingegangen werden, bevor anschließend konkretere Merkmale zur Arbeit in inklusiven Unterrichtssettings gegeben werden.
Was verbirgt sich nun genau hinter dem Begriff der "Heterogenität"? Nach Brügelmann ist Heterogenität eine Zuschreibung von Unterschieden aufgrund von Kriterien, deren Bedeutung von sozialen Normen und persönlichen Werten abhängt [zitiert nach von Saldern, 2010, S. 57].
Hiermit ist ausgesagt, dass es sich dabei immer um soziale Konstruktionen handelt, die von dem Maßstab einer konstruierten Einheitlichkeit (Homogenität) abweichen [vgl. Gomolla, 2009, S. 22]. Die so entstehenden Unterschiede zwischen Schülern einer Klasse kann man zur Beschreibung einer Gruppe heranziehen, sodass diese eine "heterogenen Klasse" genannt wird [vgl. von Saldern, 2010, S. 57]. Gomolla betont, dass in jüngster Zeit zunehmend anerkannt wurde, dass die vielfältige Pluralisierung der Ausgangslagen von Schülerinnen und Schülern eine Erneuerung der Gestaltung schulischer Strukturen und Praktiken erfordere [vgl. Gomolla, 2009, S. 21]. Die Pluralisierung lässt sich durch die Einwanderung anderer Kulturen, pädagogische und politische Forderungen (zum Beispiel nach Inklusion), das Bestreben, auch hochbegabte Kinder angemessen zu fördern und Kinder mit speziellem Förderbedarf zu integrieren, begründen [vgl. Buholzer u. Kummer Wyss, 2010a, S. 6].
Als "Modewort" [Gomolla, 2009, S. 21] habe sich hierbei Heterogenität herauskristallisiert. Während in der Bildungsdiskussion der vergangenen Jahrzehnte stets versucht wurde, homogene Lerngruppen zu konstruieren [vgl. Buholzer u. Kummer Wyss, 2010b, S. 78], ist seit den letzten Jahren ein Bewusstseinswandel zu verzeichnen, der die problemfixierte Sicht auf Heterogenität negiert, "zugunsten eines Verständnisses von Verschiedenheit und Vielfalt als 'normaler' Voraussetzung und Ressource des Unterrichtshandelns" [Gomolla, 2009, S. 21]. Dennoch ist es so, dass auch Unterrichtsstrukturen noch immer nach Normalitätserwartungen der gesellschaftlichen Mehrheit ausgerichtet sind [vgl. Gomolla, 2009, S. 31] und sich Lehrer in ihrem Handeln an einem fiktiven "Mainstreamschüler" [Heyer, 2002, S. 191] orientieren. Hierbei wird die vorhandene "normale" Vielfalt der Schülerinnen und Schüler weitestgehend ignoriert bzw. wird versucht, diese Unterschiede möglichst zu mindern. Ein sinnvoller Umgang mit Heterogenität besteht hingegen darin, dass es keine Normalität als Maßstab gibt, woran man alle anderen messen kann, sondern alle Differenzen ihre eigene Berechtigung haben [vgl. Gomolla, 2009, S. 39]. Um die Heterogenität in Schulen produktiv nutzen zu können, wird mancherorts jahrgangsübergreifender Unterricht durchgeführt, um auch die Alterszusammensetzung der Kinder heterogen zu gestalten [vgl. Stähling, 2009, S. 116-118]. Auf diese Weise kann die nochmals vergrößerte Vielfalt insbesondere durch kooperative Lernformen produktiv genutzt werden.
Wie der Umgang mit Heterogenität in der Unterrichtspraxis erfolgen kann, wird im Folgenden erläutert.
Inklusion in der Unterrichtspraxis
Nach Wocken ist inklusiver Unterricht durch drei Dimensionen geprägt: Die Vielfalt der Kinder, die Vielfalt des Unterrichts und die Vielfalt der Pädagogen. Basierend auf diesen drei Grundlagen stellt Wocken folgende Defnition auf:
"Inklusiver Unterricht bedeutet, dass alle Kinder einer unausgelesenen und ungeteilten Lerngruppe sich allgemeine Bildung nach individuellem Vermögen und nach individuellen Bedürfnissen in vielfältigen Lernprozessen mit gemeinsamen und differentiellen Lernsituationen unter Nutzung förderlicher Ressourcen ohne behindernde Lernbarrieren und ohne diskriminierende und exkludierende Praxen sowie mit entwicklungsorientierter Lernevaluation aneignen können, und zwar mit aktiver Unterstützung von kooperierenden Pädagogen und sozialen Netzwerken." [Wocken, 2011, S. 134]
Dabei müssen zwei Passungen vorliegen: Zum einen die didaktische Passung, was bedeutet, dass für die Lernbedürfnisse des Kindes passende pädagogische Angebote vorhanden sind, und zum anderen die professionelle Passung zwischen Lernbedürfnissen des Kindes und den Kompetenzen der Pädagogen [vgl. Wocken, 2011, S. 113f.].
Wie lässt sich diese didaktische Passung herstellen?
Heyer beschreibt als pädagogische Grundsätze einer integrationsfähigen Grundschule (wobei er Integration so versteht, dass sie Inklusion entspricht) von folgenden pädagogischen Grundsätzen [vgl. Heyer, 2002, S. 193-199]:
-
Integrative Grundhaltung aller Beteiligten
-
Individualisierung des Unterrichts
-
Differenzierende Förderung und Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigungen und speziellen Lernproblemen
-
Gemeinsamkeit in der Vielfalt
-
Lernanregende und Beeinträchtigungen berücksichtigende Gestaltung von Schulraum und Schulgebäude
-
Fehler als Lernchance
-
Zunehmende Eigenverantwortung des Lernenden
-
Differenzierende Bewertung
-
Kooperation in Unterricht und Schulleben
Eine ähnliche Aufstellung nimmt Werning vor, auch wenn er seine "Leitlinien integrativer Arbeit" etwas allgemeiner auf die Schule als auf den Unterricht bezieht und ein Postulat für den Gemeinsamen Unterricht aufstellt [vgl. Werning, 2010, S. 288]. Ohne auf die einzelnen Grundsätze genauer einzugehen, kann insgesamt festgehalten werden, dass Individualisierung und Differenzierung angesprochen werden, um mit ihnen auf die vorliegende Heterogenität einzugehen. Eine Möglichkeit, einen individualisierenden Unterricht zu gestalten, liegt darin, dass die Arbeit innerhalb eines gemeinsamen Curriculums bezüglich eines Themas verschiedene Schwierigkeitsstufen und Zugangsmöglichkeiten eröffnet, sodass jeder nach seinem Niveau arbeiten kann [vgl. Rehle, 2009, S. 128]. Feuser schlägt hierzu die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand vor, was variable Lernziele ermögliche [zitiert nach Seitz, 2005, S. 166]. So wird zugleich binnendifferenziertes und zieldifferentes Lernen ermöglicht [vgl. Heyer, 2002, S. 191].
Das entscheidende Kriterium von Unterricht in heterogenen Gruppen liegt demnach darin, die Anschlussfähigkeit von Schülern zu garantieren und zu fördern, wobei all dies im Bereich des Machbaren für die Lehrperson liegen muss [vgl. Klippert, 2009, S. 122]. Eine geeignete Lernform bietet dabei insbesondere das kooperative Lernen, da auf diese Weise sowohl auf Seiten der Schüler ein fruchtbares Lernen ermöglicht als auch die Lehrkraft in ihren Möglichkeiten entlastet wird. Außerdem wird so neben der Förderung sozialer Kompetenzen auch die Weiterentwicklung individueller kognitiver Strukturen ermöglicht [vgl. Rehle, 2009, S. 129]. Folglich kann festgehalten werden: Kooperatives Lernen "stützt die schwächeren und stärkt die cleveren Schüler" [Klippert, 2009, S. 123]. Von Saldern nennt solche Unterrichtssituationen, die den Austausch zwischen Schülern in den Mittelpunkt stellen, Situationen der Ko-Konstruktion, womit er gleichzeitig die positive Sicht auf Heterogenität ausdrückt:
"Optimal läuft die Ko-Konstruktion nur dann, wenn viele, möglichst unterschiedliche Konstruktionspartner zur Verfügung stehen. Heterogenität - oft als Problem gesehen - ist damit nicht nur Begleiterscheinung, sondern notwendige Voraussetzung gelungener Individualisierung." [von Saldern, 2010, S. 62]
Neben dem kooperativen Lernen nennt Klippert als weitere Lernform das individualisierte Üben und Lernen mit passenden Unterrichtspraktiken und geeignetem Material. Als Beispiele nennt er die freie Arbeit, sowie Werkstatt-, Wochenplan-, Lernzirkel- und Projektarbeit [vgl. Klippert, 2009, S. 123]. Das Ziel bei all diesen Aktivitäten besteht darin, dass die individuellen Lernkompetenzen der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden, um so langfristig ein selbstständiges und reflektiertes Arbeiten sowie Selbstmotivation und Selbststeuerung zu ermöglichen [vgl. Klippert, 2009, S. 124].
Dabei sollte die konstruktivistische Lern-Lehr-Theorie zugrunde liegen [vgl. Buholzer u. Kummer Wyss, 2010b, S. 83], die besagt, dass Lernprozesse am effektivsten sind, wenn das Kind sich das zu Lernende selbstständig aneignet. Rehle spricht außerdem den "entwicklungsorientierten Unterricht" an, wobei die Fragen "Was kann das Kind? Was kann es als nächstes lernen? Was soll es in Bezug auf das Ganze lernen?" beachtet werden müssen [vgl. Rehle, 2009, S. 128f.]. Im Fokus stehen die Förderung der Persönlichkeit und die Leistungsentwicklung, wobei es sich an den individuellen Entwicklungsständen der Kinder zu orientieren gilt.
Konsequenzen für das Lehrerhandeln
Nachdem wesentliche Elemente eines inklusiven Unterrichts aufgezeigt wurden, wird im Folgenden verdeutlicht, welche Auswirkungen dies für die Lehrertätigkeiten hat und wie auf diese Weise die professionelle Passung [vgl. Wocken, 2011, S. 114f.] erzielt werden kann. Schließlich sind es die Lehrer, die als konkrete Akteure jedem Kind die Teilnahme am inklusiven Unterricht ermöglichen können [vgl. Veber u. Stellbrink, 2011, S. 11f.] und die es zum Ziel haben sollten, jedes Kind zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Erwerb von sozialen Kompetenzen und zur Ausschöpfung des individuellen Begabungspotentials zu führen.
Wenn man den Aspekt betrachtet, dass "eine Schule für alle" das Ziel der inklusiven Bildung ist, hat dies zur Folge, dass über kurz oder lang die Zahl der Förderschulen sinken wird. An dieser Stelle tritt die Frage auf, welche Rolle auf die Sonderschullehrer zukommt. Fakt ist jedoch, dass die Zahl der Kinder mit Förderbedarf mehr oder weniger konstant bleiben wird, da sich die Behinderungen für sich nicht mindern werden, sondern die behinderten Kinder lediglich in die Regelschule integriert werden. Aus diesem Grunde wird sich auch das Umfeld der Sonderpädagogen in die Regelschulen verlagern. "Es ist deshalb geradezu absurd, den Begriff der Inklusion zum Vorwand für den Abbau sonderpädagogischer Fachkompetenz zu nehmen." [Aichele, 2010, S. 17]. Es bedarf ihrer speziellen professionellen Kompetenzen, um einen individualisierten Unterricht zu garantieren und gemeinsam mit einer Grundschulpädagogin die Klasse führen zu können, um spezifische Blickwinkel zu ermöglichen [vgl. Hinz, 2002, S. 359]. Aus diesem Grund ist der Einsatz von multiprofessionellen Teams zur Arbeit in einer inklusiven Klasse unerlässlich. Dies fordert von den Lehrkräften Kooperationsbereitschaft und Teamkompetenz als "Dreh- und Angelpunkt der inklusiven Schule" [Klauß, 2010, S. 289]. "Problemlösekompetenzen als ein entscheidendes Moment von schulischer Qualität lassen sich in Teamstrukturen mit einer Kombination verschiedener Perspektiven weitaus besser realisieren als durch einen 'omnipotenten' Inklusionspädagogen." [Hinz, 2002, S. 359]. Entscheidend ist bezüglich der Aufgabenverteilung jedoch, dass alle Lehrkräfte lehren und nicht etwa die Sonderpädagogen zur "Betreuung" der Schüler mit besonderem Förderbedarf abgestellt werden [vgl. Schwager, 2011, S. 96]. Das Ziel des gemeinsamen Unterrichtens im Gemeinsamen Unterricht liegt darin, ein Lernen der Gruppe bei gleichzeitigem individuellem Lernen zu ermöglichen [vgl. Schwager, 2011, S. 95]. Schwager verwendet bezüglich der Aufgaben von Regel und Förderpädagogen in Anlehnung an Murawski folgendes Bild: Es geht darum, "dass die Lehrkraft der Allgemeinen Schule lernt, die Bäume im Wald zu sehen, wohingegen die Sonderschullehrkraft lernt, neben den Bäumen auch den Wald zu sehen." [Schwager, 2011, S. 95]. Beachtet werden muss jedoch, dass sich die Kooperation von Grundschullehrkräften nicht nur auf das Zusammenarbeiten mit Sonderpädagogen bezieht, sondern auch mit anderweitigen "Spezialisten" (Sozialpädagogen, Erzieher, Lehrer für muttersprachlichen Unterricht etc.), Helfern, Kollegen sowie den Eltern zusammengearbeitet werden muss.
Die Bereitschaft zur Teamarbeit ist also ein wesentliches Moment des Lehrers in inklusiven Settings. Heimlich führt weitere notwendige Basiskompetenzen an, die Lehrkräfte zur Arbeit im inklusiven Unterricht erwerben sollten und die sich vorrangig auf ebendiese Zusammenarbeit beziehen. Hierbei handelt es sich um Sachkompetenzen, soziale Kompetenzen, personale Kompetenzen und ökologische Kompetenzen [vgl. Heimlich, 2007, S. 163ff.]. Unter Sachkompetenzen sind in erster Linie das Wissen über individuelle Lern und Entwicklungsprozesse sowie deren Steuerung und Analyse gemeint sowie Kenntnisse im didaktisch-methodischen Bereich, um diese zu initiieren. Unter den sozialen Kompetenzen versteht Heimlich die Bereitschaft, diese Fertigkeiten weiterzuentwickeln und über Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit professionellen Teampartnern zu verfügen, um eine fruchtbare Kooperation zu ermöglichen. Die personalen Kompetenzen betreffen die Lehrperson in ihrem Wesen selbst, da in der Zusammenarbeit mit anderen Pädagogen die Reflexion der eigenen individuellen Ressourcen notwendig sei. Zuletzt gilt es, über ökologische Kompetenzen zu verfügen, was bedeutet, dass beispielsweise die Organisation innerhalb der Schule zwischen den verschiedenen Kooperationspartnern analysiert wird, um eine problemlose Zusammenarbeit zu garantieren.
Welche Umstellungen ergeben sich darüber hinaus in der Unterrichtsgestaltung für die Lehrperson? Wie oben erwähnt, erfordert inklusiver Unterricht individualisierte Unterrichtssituationen. Hierzu ist der Lehrer aufgefordert, offene Unterrichtsformen bereitzustellen [vgl. Carle, 2011, S. 18]. Die Rolle des Lehrers wandelt sich hierbei in dem Sinne, dass Unterrichtsstunden nicht mehr lehrer-fixiert durch Frontalunterricht stattfinden, sondern die Lehrperson vielmehr für die Initiation von Lernarrangements verantwortlich ist, für die Organisation und Vermittlung der Bildung [vgl. Vojtová u. a., 2006, S. 94]. Der Lehrer ist dafür zuständig, die Lernumgebung zu gestalten und Lernprozesse unterstützend zu begleiten [vgl. Grossenbacher, 2010, S. 164]. Der Schüler wird so vom passiven Empfänger zum aktiven Gestalter seines Lernprozesses [vgl. Vojtová u. a., 2006, S. 92]. Bei aller notwendiger Individualisierung sei aber dennoch darauf hingewiesen, dass der Lehrer darauf achten muss, die Balance zwischen individueller Förderung und Unterstützung der Klassengemeinschaft zu bewahren [vgl. Grossenbacher, 2010, S. 164].
Wichtige Fähigkeiten auf Seiten des Lehrers bestehen hierfür vor allem in der Beobachtung und Diagnostik, um auf kognitive Prozesse zu schließen und zu beurteilen, ob der derzeitige Lernprozess sinnvoll ist [vgl. Joller-Graf, 2010, S. 130]. Hierbei sind jedoch weniger die "Platzierungsdiagnostik" und punktgenau erwartete Lernergebnisse von Bedeutung, sondern viel mehr eine Förderdiagnostik, die beschreibt, an welcher Stelle das Kind steht und unter langfristiger Perspektive plant, welche Lernziele das Kind (wodurch, mit wem, von wem etc.) als nächstes erreichen kann [vgl. Klauß, 2010, S. 289]. Hierzu bietet sich die Arbeit mit Förderplänen an [vgl. Erbring, 2005, S. 131].
Ähnlich verhält es sich mit der Leistungsbewertung. Ziffernbewertung kann nicht das Kriterium in heterogenen Klassen sein, da Noten immer einen Vergleich mit anderen implizieren. Da das Gleichschrittlernen jedoch nicht mehr Sinn des Unterrichts ist, sondern vielmehr die individuelle Leistungsentwicklung, bedarf es eines Instruments, das stattdessen die persönlichen Lernfortschritte festhält. Statt der sozialen sollten die individuelle und sachliche Bezugsnorm im Fokus liegen [vgl. Grossenbacher, 2010, S. 164]. Hierzu bietet sich zum Beispiel das Portfolio als Medium der Leistungsübersicht an.
In inklusiven Settings stellen die Akzeptanz der Vielfalt und die gegenseitige Respektierung die wesentliche Grundlage dar. Dabei wird die Einstellung des Lehrers als wesentlicher Faktor für das Realisieren von inklusivem Unterricht gezählt [vgl. Vojtová u. a., 2006, S. 95]. Hierzu ist es wichtig, dass der Lehrer eine gewisse Reflexionskompetenz entwickelt [vgl. Grossenbacher, 2010, S. 164]. Schuppener erklärt in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Mehrperspektivität auf Seiten der Lehrperson für unabdingbar [vgl. Schuppener, 2007, S. 143]. Hierunter versteht sie die Fähigkeit des Lehrers, unabhängig von seiner eigenen Sichtweise Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten, um auf diese Weise seine eigenen Gedanken und Handlungen mit fremden Haltungen und Sichtweisen zu bereichern, was die Voraussetzung dafür bildet, sich in sein Gegenüber hineinversetzen zu können.
Vor diesem Hintergrund besteht eine Hauptaufgabe des Lehrers darin, für ein stark ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl und eine gute Klassenatmosphäre zu sorgen [vgl. Carle, 2011, S. 18]. Außerdem muss der Lehrer darauf achten, dass er (evtl. auch bedingt durch eigene Vorurteile oder Antipathie) kein Kind ausschließt oder vernachlässigt. Dies muss er berücksichtigen, indem er Material, Arbeitsaufträge etc. so gestaltet, dass jedes Kind gewinnbringend daran arbeiten kann [vgl. Carle, 2011, S. 18]. Eine gute Schüler- Lehrer-Beziehung ist zentral für eine positive Zusammenarbeit und für die Lernunterstützung [vgl. Joller-Graf, 2010, S. 130].
Das Ziel der Lehrkraft sollte es sein, dass die Kinder immer weniger Hilfen des Lehrers benötigen und stattdessen die Selbstständigkeit der Schüler ansteigt und diese sich gegenseitig in ihren Lernprozessen unterstützen [vgl. Carle, 2011, S. 18f.]. "Die Schüler sollten ihre eigenen Wege des Lernens und Verstehens entdecken; dies befähigt die Prozesse ihrer Eigenständigkeit." [Vojtová u. a., 2006, S. 93].
Abschließend kann zusammengefasst werden, dass zur Realisierung von Inklusion in der Schule einige Veränderung notwendig sind, auch wenn diese im unterrichtspraktischen Bereich keine völlige Neustrukturierung erfordern. Zentral ist es, dass Lehrkräfte auf den Umgang mit Heterogenität vorbreitet werden und in ihrer Ausbildung Mittel und Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, mit denen sie in inklusiven Settings arbeiten können. Klippert und Von Saldern weisen darauf hin, dass es darauf ankommt, den Lehrern das Gefühl der Überforderung abzunehmen und ihnen Strategien nahezubringen, die sie zum Umgang mit Vielfalt ermutigen, um zu zeigen, dass derartige Konzepte machbar sind [vgl. von Saldern, 2010, S. 61]; [vgl. Klippert, 2009, S. 122]. Allerdings bleibt ebenso festzuhalten: "Unübersehbar gibt es im Bereich der Didaktik inklusiven Unterrichts noch viel Entwicklungsbedarf, vor allem was die methodische Umsetzung angeht."[Klauß, 2010, S. 288].
Bei der Frage der passenden Bezeichnung für das Erlernen des Lehrerberufs gibt es die terminologische Unterscheidung von Lehrerbildung und Lehrerausbildung [vgl. Blömeke, 2009, S. 547]. Blömeke charakterisiert die beiden Begriffe dahingehend, dass sie Lehrerbildung als "ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung" [Blömeke, 2009, S. 547] bezeichnet, wogegen der Begriff Lehrerausbildung die Erlernbarkeit des Lehrerberufes akzentuiere. In dieser Arbeit wird vorrangig der Begriff der Lehrerbildung verwendet. Dies lässt sich damit begründen, dass hier der Fokus auf der universitären Phase der Lehrerbildung liegt, die eher durch Bildung gekennzeichnet ist, als dass sie eine praktisch erlernbare Ausbildung darstellt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ebenso von der Ausbildung von Lehrern gesprochen wird.
Im folgenden Abschnitt wird auf die Lehrerbildung genauer Bezug genommen. Dazu werden zunächst allgemeine Informationen gegeben, bevor das derzeitige Lehrerausbildungsgesetz in NRW erläutert wird. In dem Zusammenhang werden anschließend Kritikpunkte an der momentanen Lehrerausbildung aufgezeigt, woraufhin schließlich überprüft wird, ob das neue, seit dem Wintersemester 2011/ 2012 in Kraft getretene, Lehrerausbildungsgesetz diese Kritikpunkte korrigieren kann.
Die Lehrerbildung in Deutschland betrifft Kinder mit dem Eintritt in die Grundschule. Im Gegensatz zu anderen Ländern findet in Deutschland keine akademische Ausbildung für Lehrkräfte im vorschulischen Bereich statt [vgl. Blömeke, 2009, S. 547f.].
Die Lehrerbildung ist hierzulande in vier Phasen gegliedert [vgl. Veber, 2010, S. 17]: Die erste Phase verbringen die Studierenden an den Universitäten, während die zweite Phase der Ausbildung aus dem Vorbereitungsdienst besteht, der an einer schulformspezifischen Schule absolviert und von wöchentlichen Besuchen im Studienseminar begleitet wird. Die dritte Phase beschreibt die Berufseingangsphase und die vierte die weitere berufliche Qualifikation. Insgesamt orientiert sich die Lehrerbildung an den im Schulsystem vorzufindenden Schulformen: Der Grundschule, der Hauptschule, der Realschule, dem Gymnasium, dem Berufskolleg und der Sonderschule. Somit gibt es für diese Bereiche eigenständige Studiengänge, die zum Teil zusammengefasst werden [vgl. Blömeke, 2009, S. 548].
An dieser Stelle sei wiederum darauf hingewiesen, dass Fragen des Bildungswesens in Deutschland föderalistisch behandelt werden, also jedes Bundesland selbst für die Gestaltung des Bildungswesens verantwortlich ist, was auch die Hochschulbildung einschließt. Aus diesem Grund bezieht sich das folgende Kapitel auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen, da nur dies für die folgende Studie Relevanz hat. Gleiches gilt für die zu betrachtende Schulform: Hierbei liegt der Blick auf der Lehrerbildung für angehende Grundschullehrkräfte.
Das Studium der angehenden Grundschullehrer stellt eine integrierte Lehrerausbildung dar. Dies bedeutet, dass neben fachwissenschaftlichen auch fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten parallel vermittelt werden [vgl. Blö-meke, 2009, S. 549]. Diese drei Facetten kann man als Professionswissen bezeichnen; sie stellen die kognitive Komponente der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen dar. Auf der anderen Seite machen persönliche Überzeugungen, Werthaltungen und motivationale Orientierungen einen weiteren Teil der professionellen Kompetenz aus [vgl. Blömeke, 2009, S. 552f.]. Bayer et al. stellen die beide Komponenten Wissenschaft und (Lehr- )Person in ihrer Trias zur Lehrerbildung als zwei Eckpunkte dar. Als dritten Eckpunkt bezeichnen sie die Praxis, also das Berufsumfeld des Lehrers [vgl. Bayer u. a., 1997, S. 7-10]. Das Zusammenspiel dieser drei Aspekte muss in der Lehrerbildung zu jeder Zeit gegeben sein. Ziel (und gleichzeitig Weg) des Studium ist demzufolge die Professionalisierung von Lehrkräften [vgl. Veber, 2010, S. 16], die auf der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf aktuellen Anforderungen des Berufsfeldes beruht, aber auch die individuellen Voraussetzungen der Studierenden berücksichtigt. Experten sollen im späteren Lehrerberuf unter hohem Handlungsdruck im Klassenzimmer relevante Informationen auswählen, verarbeiten und Entscheidungen zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten treffen können, sodass das angelernte Regelwissen Anwendung findet [vgl. Blömeke, 2009, S. 553].
Unter welcher Bedingung erlerntes Wissen jedoch nur umgesetzt werden kann, macht Blö-meke deutlich: "Damit eine schrittweise Prozeduralisierung von erworbenem deklarativem Wissen gelingt, sind umfangreiche Praxiserfahrungen notwendig." [Blömeke, 2009, S. 553]. Diese Aussage drückt aus, dass ein Lehrer zum Ende seiner Ausbildung noch nicht komplett ausgebildet ist, sondern sich sein Lehrerhandeln mit zunehmender Praxiserfahrung weiterentwickelt.
Schaut man sich das bislang gültige Lehrerausbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen an [vgl. MSW NRW, 2011b], erfährt man Näheres zur Struktur und zum Aufbau der Ausbildungsphasen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Landesministerium im Mai 2009 ein neues Lehrerausbildungsgesetz beschlossen hat, das zu Beginn des aktuellen Semesters (Wintersemester 2010 / 2011) verpflichtend an den nordrhein-westfälischen Universitäten ausgeführt werden muss. Da die derzeitigen Lehramtsstudenten jedoch noch nach dem alten Gesetz studieren, das 2002 verabschiedet wurde und nach dem seit dem Wintersemester 2003 / 2004 studiert wird, wird zunächst auf dieses Gesetz eingegangen.
Nach Abschluss des Studiums erwerben Lehramtsstudierende ihr erstes Staatsexamen. Dies ist noch nicht berufsqualifizierend, stellt aber die Berechtigung für den Vorbereitungsdienst dar. Mit Abschluss des Referendariats erhalten die Lehramtsanwärter ihr zweites Staatsexamen, womit sie in den Beruf einsteigen können. Die universitäre Phase gliedert sich in Grund- und Hauptstudium. Allerdings gibt es in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2005 den Modellversuch "Gestufte Studiengänge in der Lehrerausbildung", in dem das Studium bereits modularisiert und in einer aufeinander aufbauenden Bachelor-Master-Struktur organisiert ist [vgl. Schulministerium NRW, 2011]. Bellenberg betitelt diesen freiwilligen Modellversuch als "erste[...] nordrhein-westfälische Lehrerbildungsreform" [Bellenberg, 2010, S. 16]. An dem Modellversuch nehmen die Universitäten Bielefeld, Bochum, Dortmund, Münster und Wuppertal teil, wobei in Bochum nicht die Möglichkeit eines Grundschulstudiums besteht. In den übrigen vier Universitäten Nordrhein-Westfalens, in denen man das Lehramt für Grundschulen ausüben kann (Paderborn, Siegen, Duisburg / Essen und Köln), wird nach der üblichen Studienstruktur studiert. Inhaltliche Änderungen beinhaltet der Modellversuch jedoch nicht.
Die Regelstudienzeit für Studierende des Grundschullehramts beträgt im Normalfall sieben Semester mit einem Vorbereitungsdienst an einer entsprechenden Schule über 24 Monate [vgl. MSW NRW, 2011b, §7]. Hiermit stellt sich ein Unterschied zu den übrigen Lehrämtern dar, da sich bei diesen die Regelstudienzeit auf neun Semester (bei gleichbleibendem 2-jährigen Vorbereitungsdienst) beläuft [vgl. MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 3]. Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Bundesländern stellt die Regelung dar, dass die Schulformen Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschule zu einem Studiengang zusammengefasst werden und man sich im Laufe des Studiums auf einen Schwerpunkt fixiert [vgl. MSW NRW, 2011b, §5].
Des Weiteren ist festgelegt, dass die Studierenden vier Fächer kombiniert studieren. Hierbei handelt es sich um zwei Hauptfächer, ein didaktisches Grundlagenstudium und das erziehungswissenschaftliche Begleitstudium. Diese Regelung, die eine Mischform aus Wissenschaftlichkeit und Berufsorientierung darstellt, wurde bereits in den frühen siebziger Jahren geprägt, als die Ausbildung der Volksschullehrer in Universitäten verlagert wurde [vgl. Becker, 2001]. Sie besteht also schon seit Beginn der universitären Ausbildung von Grundschulpädagogen.
Eines der beiden Hauptfächer muss Mathematik oder Deutsch sein, das andere Fach ist frei wählbar, sofern es dem Fächerkanon der Grundschule entspricht und im Angebot der jeweiligen Hochschule liegt. Das didaktische Grundlagenstudium wird entweder in Deutsch oder in Mathematik studiert, was davon abhängt, ob Mathematik oder Deutsch ein belegtes Hauptfach bildet: Das jeweils andere Fach bildet das didaktische Grundlagenstudium [vgl. MSW NRW, 2011b, §13]. Die entscheidenden Bereiche, in denen Lehrer Kompetenz erwerben sollen, werden mit Unterricht und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik sowie Evaluation und Diagnostik beschrieben [vgl. MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 6].
Bezüglich der in der Ausbildung involvierten Praxisphasen werden unkonkrete Aussagen getroffen, da über Anzahl oder Dauer der Praktika keine Angaben gemacht werden. Es wird lediglich erwähnt, dass ein gewisser Grundbestand gewährleistet sein müsse [vgl. MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 5] und dass in den Praxisphasen eine Verknüpfung von theoretischen Studien und schulpraktischen Erfahrungen erfolgen soll [vgl. MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 4]. Hierzu gibt es allerdings ein weiteres Dokument, die Rahmenbedingungen der Praxisphasen in den Lehramtsstudiengängen, das die Praxisanteile näher definiert [vgl. MSJK NRW, 2004]. Die Praxisphasen bestehen aus einem vierwöchigen Orientierungspraktikum und aus einem 10-wöchigen Kernpraktikum, das im Gegensatz zum Orientierungspraktikum jedoch auch in mehrere Phasen zerlegt werden sowie während der Semesterferien im Block oder semesterbegleitend absolviert werden kann [vgl. MSJK NRW, 2004, S. 5f.]. Zu jeder Praxisphase muss zudem eine Begleitveranstaltung an der Universität besucht werden.
Interessant sind außerdem folgende zwei Details im Lehrerausbildungsgesetz: In Paragraph sechs "Verwendung der Lehrerinnen und Lehrer" wird der Aufgabenbereich von Sonderpädagogen nicht nur auf Förderschulen reduziert: "Die Befähigung zum Lehramt für Sonderpädagogik berechtigt zur Erteilung von Unterricht in Sonderschulen sowie in anderen Schulformen entsprechend den fachlichen und sonderpädagogischen Anforderungen." [MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 1]. Hiermit wird grundsätzlich der Einsatz von Sonderpädagogen in Regelschulen legitimiert. Eine zweite beachtliche Aussage ist in Paragraph zwei zu finden. Hier heißt es anschließend an die Beschreibung der Kompetenzbereiche: "Dabei ist die Befähigung zum Umgang mit Verschiedenheit besonders zu berücksichtigen." [MSW NRW, 2011b, §2, Absatz 6]. Anhand dieser zwei Beispiele wird deutlich, dass Ansätze bezüglich der Vorbereitung für eine inklusive Bildungslandschaft vorliegen.
Dennoch hat die bisherige Lehrerbildung reichlich Kritik erfahren, auch wenn sie sich laut Terhart in den letzten 10 Jahren einem erkennbaren Wandel unterzogen hat [vgl. Terhart, 2010, S. 11]. Der Diskurs in der Lehrerbildung sei eine "Diskussionsarena, in der sich Dauer-Kritik und Dauer-Hoffnung kontinuierlich wechselseitig anfeuern." [Terhart, 2010, S. 11]. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist der fehlende Praxisbezug des Studiums beziehungsweise ein wenig ausgeglichenes Theorie-Praxis-Verhältnis. Die Ausbildungsstruktur rühre aus der Annahme, "dass theoretisches wissenschaftlich pädagogisches Wissen zunächst erworben, dann in der Praxis eingeübt und mit Abschluss der Ausbildung im alltäglichen Unterricht angewendet wird." [Böing, 2011, S. 61]. Diese Ansicht verkenne allerdings die Tatsache, dass eine vernetzte Bearbeitung von Theorie und Praxis entscheidend sei [vgl. Obolenski, 2001, S. 87]. Hinzukommt die wissenschaftliche Erkenntnis, dass das erworbene Wissen nicht unmittelbar auf das reale Lehrerhandeln übertragbar ist und sich dieses von dem theoretischen Wissen unterscheide [vgl. Böing, 2011, S. 61f.]. Aus diesem Grund sei es besonders wichtig, die persönliche Reflexion von Praxisphasen als wesentlichen Bestandteil von Professionalisierung stärker in die universitäre Ausbildung aufzunehmen, da gerade der wissenschaftlich-systematischen Analyse von praxisorientierter Erfahrung eine große Bedeutung zukomme [vgl. Obolenski, 2001, S. 86f.].
An diese Problematik anknüpfend kritisiert Obolenski das Verhältnis von Schule und Universität: Obwohl gerade in der Lehrerausbildung beide Institutionen kooperieren müssen, konkurrieren sie zu oft, beziehungsweise schenken sie der Gegenseite zu wenig Beachtung [vgl. Obolenski, 2001, S. 83]. Die universitäre Lehrerausbildung müsse jedoch immer die Schulentwicklung berücksichtigen, da sie ihre Studierenden auf das Berufsfeld Schule vorbereitet und sie sich sonst nicht weiterentwickeln kann [vgl. Obolenski, 2001, S. 103]. Nur so würden sich die verschiedenen Orte der Ausbildung gegenseitig befruchten, weil die Studierenden in unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Kontexten mit den gleichen Inhalten in Berührung kommen [vgl. Wernstedt u. John-Ohnesorg, 2010, S. 7].
Des Weiteren werden vermehrt inhaltliche Aspekte der Lehrerbildung kritisiert. So wird das Nebeneinander der einzelnen Fächer als "zersplittertes 'Nebenfachstudium'" [Becker, 2001, S. 6] ebenso bemängelt, wie der Überschuss an vermitteltem Fachwissen gegenüber fachdidaktischer Inhalte [vgl. Terhart, 2010, S. 12]. Wichtig sei zudem die Vermittlung von Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit [vgl. Obolenski, 2001, S. 100f.]. Dies betont auch Erbring: "Erst wenn die Ausbildung sich für den Erwerb von Interaktionskompetenzen zuständig erklärt, wird der Gedanke der Inklusion umsetzbar."[Erbring, 2005, S. 130]. Bezüglich einer inklusions-orientierten Lehrerbildung stellt Klauß des Weiteren heraus, dass in den allgemeinen Lehramtsstudiengängen kaum etwas zu spezifischem Bedarf bei unterschiedlichen Beeinträchtigungen (bezüglich Didaktik, Diagnostik, Hilfsmitteln etc.) gelehrt werde [vgl. Klauß, 2010, S. 292]. In gleiche Richtung ist die Kritik von Meier und Merz-Atalik einzuordnen: Sie fordern eine stärkere interdisziplinäre Koordination, sodass Inhalte der allgemeinen Pädagogik mit Inhalten der Sonderpädagogik, der Integrations-/Inklusionspädagogik, der interkulturelle Erziehung und der Sozialpädagogik verbunden werden [vgl. Meier u. Merz-Atalik, 2005, S. 183].
Bezieht man all diese Kritikpunkte zusammenfassend auf die Eckpunkte der Lehrerbildung nach Bayer, Carle und Wildt, so lässt sich sagen, dass das Zusammenspiel aller drei Eckpunkte, Wissenschaft, Person und Praxis, bislang unzureichend ist. Sowohl die individuelle Lehrerpersönlichkeit wird zu wenig berücksichtigt, als auch die Verbindung von Praxis und Wissenschaft sowie von Praxis und angehender Lehrperson. Hinzukommt, dass das Verhältnis von Student und Wissenschaft zu sehr von unzureichenden Inhalten geprägt ist (nicht aufeinander abgestimmte Inhalte, zu wenig Fachdidaktik, zu wenige interdisziplinäre Angebote).
Punkte, in denen sich die Lehrerbildung in den letzten Jahren bereits verbessert habe, sieht Terhart darin, dass die Universitäten klarere Studienordnungen für Lehramtsstudiengänge aufgebaut haben, sich die Situation der Fachdidaktiken sowie die Absprache zwischen erster und zweiter Studienphase leicht verbessert habe und dass mit den von der KMK verabschiedeten "Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften" von 2004 [vgl. Kultusministerkonferenz, 2004] sowie mit den länderübergreifenden fächerbezogenen Anforderungen von 2008 [vgl. Kultusministerkonferenz, 2008] wichtige Orientierungspunkte für die Lehrerbildung gesetzt wurden [vgl. Terhart, 2010, S. 13f.].
"Inklusive Schulen brauchen eine Reform der Lehramtsstudiengänge."[Klauß, 2010, S. 295]. Mit dieser Forderung weist Klauß darauf hin, welche Bedeutung auch die Lehrerbildung für die Umsetzung einer inklusiven Schulpraxis darstellt. Im obigen Teil der Arbeit wurde außerdem herausgestellt, dass sowohl die Landesregierung Nordrhein-Westfalens als auch die Kultusministerkonferenz eine Umstrukturierung der Lehrerbildung in Hinsicht eines inklusiven Bildungssystems fordern. Wie das neue Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens konzipiert ist und ob es inklusive Aspekte berücksichtigt, wird im Folgenden untersucht.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Reaktion auf die ansteigende Kritik und auf die Innovationsprozesse in der deutschen Bildungslandschaft im Jahr 2009 ein neues Lehrerausbildungsgesetz beschlossen, das spätestens zu Beginn dieses Wintersemesters (2011 / 2012) an allen Universitäten des Landes die rechtliche Grundlage des Lehramtsstudiums bildet [vgl. MSW NRW, 2011a]. Zur inhaltlichen Gestaltung des Gesetztes hat sich die Landesregierung an den Standards für die Bildungswissenschaften der KMK orientiert [vgl. Bellenberg, 2010, S. 16]. Wie dieses Gesetz auf die oben erläuterte Kritik eingeht und insofern Besserungspotential verspricht, soll im Folgenden kurz dargestellt werden.
Eine besondere strukturelle Innovation, die das neue Lehrerausbildungsgesetzt beinhaltet, besteht darin, dass es in Zukunkt auch in Nordrhein-Westfalen einen speziellen Studiengang für Grundschullehrämtler gibt, der getrennt von der Haupt- und Realschulausbildung erfolgt. Des Weiteren wurden Ausbildungsdauer und -aufbau der verschiedenen Lehrämter angeglichen, sodass neuerdings sowohl der Studiengang des Lehramts für Grundschule als auch der des Lehramts für Haupt- und Realschule ebenso wie der Studiengang der Gymnasien und Gesamtschulen, der des Berufskollegs und der der Sonderpädagogik aus einem sechs-semestrigen Bachelor- und einem vier-semesterigen Masterstudium besteht. Interessant ist an dieser Stelle eine inhaltliche Randnotiz: Hieß es im alten Ausbildungsgesetz noch schlicht "Lehramt für Sonderpädagogik" wird dieser Studiengang im neuen Gesetz als "Lehramt für sonderpädagogische Förderung" bezeichnet. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Sonderpädagogik mittlerweile nicht mehr als separates Teilgebiet der Pädagogik gesehen wird, sondern als Bestandteil der Allgemeinen Pädagogik, was in diesem Sinne impliziert, dass die sonderpädagogische Förderung ebenso gut an Regelschulen erfolgen kann.
Mit diesen Regelungen erfolgt die Lehrerausbildung in ganz Nordrhein-Westfalen modularisiert im Bachelor- und Mastersystem. Der so genannte "Master of Education" löst das bisherige 1. Staatsexamen als Abschluss der ersten Phase der Lehrerbildung ab.
Aber auch inhaltlich gibt es einige Neuerungen: Bereits der erste Satz weist darauf hin, dass der Bezug zwischen Schulen und Universitäten stärker ausgebaut werden soll: "Das Land und die Hochschulen gewährleisten eine Lehrerausbildung, die die Bedürfnisse der Schulen berücksichtigt." [MSW NRW, 2011a, §1, Absatz 1]. Neu ist in diesem Sinne auch, dass eine stetige Evaluation der Lehrerausbildung gesetzlich geregelt ist (im Abstand von drei Jahren) und sich die Qualität der Ausbildung an der Schulentwicklung ausrichten soll [vgl. MSW NRW, 2011a, §1, Absatz 1]. Dass an diesem Aspekt der Schulentwicklung im Vergleich zum bisherigen Lehrerausbildungsgesetz im neuen Gesetz angesetzt wird, sieht man, wenn man die zu erzielenden Kompetenzen für angehende Lehrer betrachtet. Diese wurden neben Komeptenzen in den Bereichen Unterricht und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik um die Aspekte Beratung, Kooperation und Schulentwicklung ergänzt [vgl. MSW NRW, 2011a, §2, Absatz 2]. Während im Anschluss daran im bisherigen Lehrerausbildungsgesetzt die Rede davon war, Lehrer besonders im Umgang mit Verschiedenheit zu befähigen [vgl. MSW NRW, 2011b, §1, Absatz 6], hat das neue Lehrerausbildungsgesetz die aktuelle Terminologie aufgenommen. So heißt es hier: "Dabei ist die Befähigung zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern und zum Umgang mit Heterogenität besonders zu berücksichtigen." [MSW NRW, 2011a, .2, Absatz 2].
Bezüglich der Studieninhalte für das Grundschulstudium wurden ebenfalls neue Beschlüsse gefasst. Das etwas starr wirkende Prinzip des Studiums der zwei Hauptfächer, mit denen Fachwissenschaft und -didaktik abgedeckt waren, sowie des fachdidaktische Grundlagenstudiums und des erziehungswissenschaftlichen Begleitstudiums wird mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz etwas aufgelockert. So gibt es neben dem Studium der Bildungswissenschaften (anstelle der Bezeichnung Erziehungswissenschaften) und der Praxisphasen die Lernbereiche "Sprachliche Grundbildung" und "Mathematische Grundbildung" sowie einen weiteren, frei wählbaren Lernbereich, jeweils einschließlich der Fachdidaktik. Die Bildungswissenschaften sind speziell für Grundschullehramtsstudierende konzipiert, da hier der Schwerpunkt auf dem frühen Lernen sowie auf elementar- und förderpädagogischen Schwerpunkten liegt [vgl. MSW NRW, 2011a, .10, Absatz 5]. Hieran wird deutlich, dass das neue Lehrerausbildungsgesetz die pädagogisch-didaktische Komponente der Lehrerbildung stärkt. Interessant ist außerdem der gesetzlich geregelte Zusatz, dass Leistungen in Deutsch für Schüler mit Zuwanderungsgeschichte in allen Lehrämtern erbracht werden müssen [vgl. MSW NRW, 2011a, .10, Absatz 7].
Besonders viel Innovationspotential trägt die Regelung der Praxisphasen, die das "Herzstück" [Bellenberg, 2010, S. 16] des neuen Lehrerausbildungsgesetztes bildet [vgl. MSW NRW, 2011a, §12]. Waren im alten Gesetz nur sehr vage Formulierungen diesbezüglich zu finden, ist hier nun gesetzlich verankert, wie viele Praxisphasen es gibt und wie lange diese andauern: Im Rahmen des Bachelors finden ein 20-tägiges Eignungspraktikum, ein einmonatiges Orientierungspraktikum und ein ebenso lange dauerndes Berufsfeldpraktikum statt, das auch außerschulisch absolviert werden kann. Das Kernelement dieser Lehrerausbildungsreform bildet jedoch das Praxissemester, das im zweiten oder dritten Semester des Master-Studiums belegt wird. Es soll "berufsfeldbezogene Grundlagen" ermöglichen und auf das Referendariat vorbereiten [vgl. MSW NRW, 2011a, .12, Absatz3], welches in Zukunft nicht mehr zwei Jahre, sondern nur noch ein Jahr (beziehungsweise 18 Monate als Übergangszeit bis zum Jahr 2005) andauern wird. Die Theorie-Praxis-Problematik wird durch einen intensiveren Anteil an Praxisphasen verbessert, allerdings weist Böing darauf hin, dass sich dieses Problemfeld nicht allein durch eine Verlängerung der Praxisphasen kompensieren lasse. Vielmehr gehe es bei dieser Problematik um strukturelle Merkmale des Lehrerhandelns, die kontinuierlich in Fortbildungsangeboten thematisiert werden müssen [vgl. Böing, 2011, S. 65].
Ebenso wird hier auf eine notwendige Kooperation zwischen Hochschule, der Praktikumsschule sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung verwiesen. Die Dokumentation und Reflexionsleistung aller Praxisphasen ist ebenso im neuen Lehrerausbildungsgesetz geregelt: Hierzu wird die Anfertigung von Portfolios gefordert [vgl. MSW NRW, 2011a, §12, Absatz 1]. Interessant ist, dass auf eine Verzahnung zwischen Praxisphasen und theoretischen Studienanteilen Wert gelegt wird. So heißt es in Paragraph 11, Absatz 2: "Das Studium umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien, in die Praxisphasen einzubeziehen sind." [MSW NRW, 2011a, §11, Absatz 2].
Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die Landesregierung die Kritikpunkte an der bisherigen Lehrerausbildung Ernst genommen hat, da das neue Lehrerausbildungsgesetz diesbezüglich erkennbares Innovationspotential verspricht. Auch auf die aktuelle Inklusions-Forderung wird im neuen Gesetz eingegangen (Verständnis von Sonderpädagogik, verpflichtende Veranstaltungen in Deutsch als Zweitsprache, Betonung der Relevanz individueller Förderung und Heterogenität, Betonung des Bezugs zur Schulentwicklung und Erwerb von Kompetenzen im Bereich der Kooperation). Mit den Worten Amrheins bleibt festzuhalten:
"Da im Bereich inklusiver Schulentwicklung [...] ein großes Problem im Transfer vom Wissen zum Können existiert, erscheint hier die Einführung des Praxissemesters in Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel im Rahmen des universitären Masterstudiums Theorie und Praxis professionsorientiert miteinander zu verbinden, eine vielversprechende Maßnahme, die umfassenden Kompetenzen anzubahnen, die angehende aber auch bereits erfahrende Lehrkräfte für die Bewältigung der anspruchsvollen Aufgaben in einem inklusiven Schulsystem benötigen."[Amrhein, 2011, S. 135]
Somit kann konstatiert werden, dass das neue Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens ein Reformkonzept im Sinne Beckers darstellt, da es sich einerseits auf gegebene Strukturen bezieht und andererseits aufgrund der oben erläuterten Merkmale zu Veränderungen beitragen kann [vgl. Becker, 2001, S. 4f.]. Wie sich diese Veränderungen allerdings bemerkbar machen, sich die gesetzliche Grundlage also in der praktischen Umsetzung gestalten lässt und sich auf die Lehrerbildung auswirkt, werden erst die nächsten 10 bis 15 Jahre zeigen [vgl. Terhart, 2010, S. 14]. Darauf weist auch Klauß hin, wenn er darauf aufmerksam macht, dass die anstehende Reform der Studiengänge nichts für die nächste Zeit bewirke, "in der sich vermutlich entscheiden wird, in welchem Umfang und wie erfolgreich sich Schulen in Richtung Inklusion entwickeln werden."[Klauß, 2010, S. 294]. Bevor die ersten offiziellen "inklusions-ausgebildeten" Lehrer in die Schulen kommen, wird also noch Zeit vergehen. Erbring stellt jedoch heraus, dass Integration (im Sinne von Inklusion) auch ohne entsprechende Lehrerausbildung möglich sei, wie Praxisbeispiele zeigen. So werde zwar in der Lehrerausbildung der Grundstein gelegt, die Umsetzung hänge jedoch von der Umsetzung in den Schulen ab [vgl. Wernstedt u. John-Ohnesorg, 2010, S. 4]. Mit einer an Inklusion angepassten Ausbildungsstruktur würde die Ausgangslage von Lehrern allerdings verbessert und es könnten viele Probleme und Widerstände behoben werden [vgl. Erbring, 2005, S. 130].
Es bleibt zu wünschen, dass sich mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz die "Dauer- Hoffnung" [Terhart, 2010, S. 11] bestätigen wird, was erfordert, "den jetzt eingeschlagenen Weg konsequent und mit langem Atem zu gehen, in dem die Akteure immer wieder zur Kooperation, Abstimmung und gemeinsamen Zielfindung verpflichtet werden." [Bellenberg, 2010, S. 18].
Das neue Lehrerausbildungsgesetz wird sich also erst in der Zukunft zu bewähren haben. Nichtsdestotrotz finden bereits jetzt Prozesse zur Umgestaltung in Richtung eines inklusiven Schulsystems innerhalb der Schulen statt, die in den nächsten Jahren vermutlich noch vielzähliger und konsequenter durchgeführt werden. Aus diesem Grund interessiert es, wie die Lehramtsstudierenden bereits jetzt auf besagten Wandel in der Bildungslandschaft vorbereitet werden. Dieser Fragestellung geht die Studie im folgenden Teil der Arbeit nach.
[1] Dies gilt exemplarisch für folgende Werke: Roth, L. (Hrsg.): Pädagogik. Handbuch für Studium und Praxis. (2001); Schaub, H.; Zenke, K.-G. (Hrsg.): Wörterbuch Pädagogik. (2007); Mertens, G. u. a. (Hrsg.): Allgemeine Erziehungswissenschaft 1 und 2 (2011); In dem Werk "Tenorth, H.-E.; Tippelt, R. (Hrsg): Beltz Lexikon Pädagogik. (2007)" findet sich eine Definition von Inklusion, die sich jedoch auf eine Erklärung von Luhmann 1997 bezieht und eher unter soziologischen als unter pädagogischen Gesichtspunkten verfasst ist. Das Lexikon "Jordan, S.; Schlüter, M. (Hrsg.): Lexikon Pädagogik. 100 Grundbegriffe. (2010)" verweist unter dem Eintrag "Integrationspädagogik" auf die Verwendung von Inklusion in der neueren Literatur.
[2] So geschehen in wichtigen internationalen Dokumenten über Inklusion, wie zum Beispiel in der Salamanca-Erklärung von 1994 oder in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 [vgl. Wocken, 2011, S. 59].
[3] Hierbei handelt es sich um ein nach außen demonstriertes Bild von Integration, da auch Kinder mit Behinderungen die Klasse besuchen und Sonderpädagogen in der Klasse arbeiten. Diese Arbeit gestaltet sich jedoch so, dass die betreffenden Kinder in der Klasse wiederum separiert und damit stigmatisiert werden, da die zugeteilten Stunden der Sonderpädagogen strikt für die Kinder mit Behinderungen meist in getrennten Räumlichkeiten durchgeführt werden, so dass der "normale" Unterricht nicht verändert werden muss.
[4] Diese Titulierung hat der Kultusministerkonferenz-Präsident, Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle, bei der Fachtagung zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 2010 in Bremen geprägt [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010a].
[5] UN-Behindertenrechtskonvention
Inhaltsverzeichnis
In diesem praktischen Teil der Arbeit wird eine Studie vorgestellt, die im Sommer dieses Jahres unter 369 Studierenden des Grundschullehramtes in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde. Wie im vorangegangenen Theorie-Teil dargelegt wurde, bietet das neue Lehrerausbildungsgesetz Ansatzpunkte für eine Lehrerbildung, in der inklusionspädagogische Inhalte integriert werden sollen. Da sich diese Studienordnung jedoch erst in der Zukunft zu bewähren hat, geht es innerhalb dieser Studie darum, eine Bestandsaufnahme der Situation der derzeitigen Grundschullehramtstudierenden angesichts ihrer universitären Vorbereitung auf Inklusion zu liefern, da auch sie in ihrem späteren Beruf aller Voraussicht nach mit Inklusion konfrontiert werden.
Das Vorgehen für die Darstellung der Studie in diesem Kapitel gestaltet sich folgendermaßen: Zunächst werden einige einleitende Gedanken angebracht, in welchem Betrachtungsrahmen die Studie einzuordnen ist und welche Relevanz ihr zukommt. Anschließend wird auf die nähere Umsetzung der Studie eingegangen, indem notwendige methodische Elemente skizziert werden. Hierbei handelt es sich um das Design der Untersuchung, die Beschreibung des verwendeten Erhebungsinstruments des Online-Fragebogens sowie um die Datenerhebung- und aufbereitung des gewonnenen Datensatzes. Daran anschließend werden die Ergebnisse dargestellt, bevor im letzten Teil dieses Kapitels die Interpretation dieser ermittelten Ergebnisse vorgenommen wird.
Im vorherigen Teil dieser Arbeit wurde bereits deutlich, wie es in der Bildungslandschaft Deutschlands und Nordrhein-Westfalens um die Themen Inklusion und Lehrerbildung steht. Zum einen erhält Inklusion nicht zuletzt aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention immer mehr Einzug in die Schulpraxis und wird zukünftig aller Voraussicht nach schulische Realität werden. Dieser Prozess hat demzufolge auch Auswirkungen auf das Schulleben, die Unterrichtspraxis und folglich auf das Lehrerverhalten.
Zum anderen wurde mit der Darstellung der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie diese derzeit aufgebaut und strukturiert ist und welche Inhalte darin thematisiert werden. Da die Lehrerbildung allerdings auch aufgrund der zunehmenden Forderung nach schulischer Inklusion einiger Kritik ausgesetzt war und ist, wurde daraufhin das neue Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens vorgestellt und herausgearbeitet, dass es (theoretisch) den Ansprüchen einer modernen und aktuellen Lehrerbildung näherkommt.
Um die Relevanz der Lehrerbildung unter dem Aspekt der Inklusion zu verdeutlichen, weist Amrhein darauf hin, dass die Entwicklung einer inklusiven Lehrerbildung zur Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems in der UN-Behindertenrechtskonvention mit eingeschlossen sei [vgl. Amrhein, 2011, S. 133]. Auch die Kultusministerkonferenz fordert, dass angehende Lehrer sowohl in der Ausbildung als auch in Weiterbildungsmaßnahmen auf inklusive Settings vorbereitet werden, da es zukünftig qualifiziert ausgebildeter Lehrkräfte mit vertieftem und wissenschaftlichem Wissen im inklusionspädagogischen Gebiet bedürfe [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010b, S. 22f.].
So ist es von entscheidender Relevanz, dass angehende Lehrkräfte für den Bereich der Inklusion professionalisiert werden, da "die pädagogischen Akteure selbst ein wesentlicher Gelingensfaktor für Schulentwicklungsprozesse sind" [Böing, 2011, S. 59]. Jede theoretische Reform kann erst dann den Anspruch erheben, wirksam zu sein, wenn die Lehrer als die "zentralen Akteure, die Transformationsstellen von der Theorie der Reformkonzepte zu ihrer praktischen Erfüllung" [Werning, 2010, S. 4], diese auch in den Schulen umsetzen. "Das heißt, die Schulrealität, der 'Output' der Schule, wird durch die Qualität der erworbenen pädagogischen und didaktischen Qualifikationen der LehrerInnen mitbestimmt."[Obolenski, 2001, S. 85]. Um einen möglichst hohen "Output" zu erreichen, müssen den Lehrpersonen allerdings auch passende Inhalte und Möglichkeiten innerhalb ihrer Lehrerbildung eröffnet werden. Somit wird die Einsicht gewonnen, dass sich Inklusion und Profession gegenseitig bedingen [vgl. Goddar, 2011]. Um es mit den Worten der "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft" (GEW) zu sagen: "Gute Rahmenbedingungen und gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind Qualitätskriterien für inklusive Bildung." [Demmer u. Schmerr, 2011, S. 17].
Doch wie stellt sich die Situation der Vorbereitung von Lehrkräften auf einen inklusiven Schulalltag derzeit dar?
In diesem Zusammenhang hat die GEW unter 2350 Lehrern aller Schulstufen und -formen im Jahre 2010 eine Online-Umfrage durchgeführt, bei der ihre Mitglieder befragt wurden, was sie über Inklusion denken, welche Vorbehalte sie dagegen hegen und wie ihre Schulen mit Inklusion umgehen. Deutlich wurde in dieser Studie, dass die teilnehmenden Lehrer mehrheitlich inklusive Bildungseinrichtungen befürworten (zu 80 %), sich aber nur etwa 10 % der Teilnehmer adäquat durch entsprechende Rahmenbedingungen und durch Aus- bzw. Fortbildung darauf vorbereitet fühlen [vgl. Demmer u. Schmerr, 2011, S. 16]. So stellt die GEW gute Rahmenbedingungen und gut ausgebildete Lehrer als Qualitätskriterien für inklusive Bildung heraus [vgl. Demmer u. Schmerr, 2011, S. 17].
Während das Urteil über Inklusion von Lehrern also von der GEW bereits in Erfahrung gebracht wurde, steht die Frage, wie sich derzeit Studierende, die in den nächsten Jahren den Schuldienst antreten werden, auf Inklusion vorbereitet fühlen, noch im Raum. Haben die Universitäten Nordrhein-Westfalens den aktuellen Weg der Schulentwicklung registriert und - was von eigentlicher Bedeutung ist - schon jetzt in ihr Programm zur Lehrerbildung aufgenommen?
Dieser Fragestellung geht die folgende Studie nach, die im Juni und Juli dieses Jahres per Online-Fragebogen mit 369 Studierenden des Grundschullehramts nordrhein-westfälischer Universitäten durchgeführt wurde. Einbezogen wurden alle acht Universitäten Nordrhein-Westfalens, die die Möglichkeit eines Grundschullehramts-Studiums anbieten: Bielefeld, Dortmund, Duisburg-Essen, Köln, Münster, Paderborn, Siegen und Wuppertal.
Als Ausgangspunkt dieser Umfrage ist die Studie Franzkowiaks "Integration, Inklusion, Gemeinsamer Unterricht - Themen für die Grundschullehramtsausbildung an Hochschulen in Deutschland? Eine Bestandsaufnahme." zu zählen, die er 2008 durchführte [vgl. Franzkowiak, 2009]. Im Unterschied zur folgenden Studie hat Franzkowiak allerdings den Fokus stärker auf Integration gelegt und betrachtet weniger das weitere Heterogenitätsdimensionen umfassende Thema der Inklusion. Dies wird daran erkenntlich, dass er das Gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern zum Hauptbestandteil seiner Befragung gemacht hat. Somit bezieht sich seine Forschung darauf, inwiefern sonderpädagogische Inhalte in die allgemeine Lehrerbildung eingebunden sind.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Franzkowiak seine erkenntnisleitende Fragestellung "An wie vielen und an welchen deutschen Hochschulen gibt es bereits Lehrangebote zum Gemeinsamen Unterricht für zukünftige LehrerInnen im Primarbereich?" auf ganz Deutschland bezog. Die hier präsentierte Studie beschränkt sich auf die Grundschullehramtsstudierenden Nordrhein-Westfalens. Zudem besteht hierbei die zugrunde liegende Datenbasis aus Studierenden, die einen Online-Fragebogen ausfüllten, während Franzkowiaks Ergebnisse auf dreierlei Quellen basieren: Zum einen befragte sein Forscherteam Hochschullehrende per Online-Fragebogen zum Angebot von Gemeinsamen Unterricht an ihren Hochschulen, zum zweiten wurden intensive Internetrecherchen zu integrativem Lehrangebot betrieben und letztlich wurden ehemalige Studierende des Seminars "Grundschule - Förderschule - Gemeinsamer Unterricht" an der Universität Siegen ebenfalls online zu ihren Erfahrungen befragt.
Dennoch sind Franzkowiaks Ergebnisse auch für diese Arbeit interessant: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umgang mit Veranstaltungen zum Thema "Gemeinsamer Unterricht" an Deutschlands Universitäten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Herausgestellt wurde außerdem, dass fast die Hälfte der deutschen Hochschulen, an denen angehende Grundschullehrkräfte ausgebildet werden, keine speziellen Lernangebote zum Gemeinsamen Unterricht anbieten. Nichtsdestotrotz ist die allgemeine Zustimmung hierzu sehr hoch; befürworten doch etwa neun von zehn Befragten den Einbezug dieser Thematik in der Lehrerbildung. Ein ebenso großer Anteil spricht sich gar für verpflichtende Veranstaltungen diesbezüglich aus. Als Haupt-Konsequenz für die Ausbildung von Grundschullehrern an den Universitäten wurde abschließend eine Beschäftigung aller Studierenden während ihrer universitären Ausbildung mit sonderpädagogischen Inhalten und dem Gemeinsamen Unterricht gefordert, wofür die Hochschulen entsprechende Lehrangebote bereitstellen müssen. Zudem empfehlt Franzkowiak, dass die Studienordnungen überarbeitet und um integrations- bzw. inklusionspädagogische Inhalte ergänzt werden sollten.
Wie sich die Situation im Jahr 2011 an Nordrhein-Westfalens Universitäten darstellt, ob sich auch hinsichtlich der von Franzkowiak geforderten Konsequenzen schon etwas in der Lehrerausbildung geändert hat, soll in folgender Studie gezeigt werden. Zu beachten ist, dass es sich aus oben beschriebenen Gründen keineswegs um eine Folge-Studie handelt, sondern sich meine Untersuchung lediglich thematisch an Franzkowiaks Studie anlehnt. Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass die hier präsentierte Studie dem in Kapitel 2.1 erläuterten Verständnis von Inklusion nachgeht und sich nicht auf Gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne speziellen Förderbedarfen beschränkt.
Die primäre Fragestellung der Arbeit lautet:
Wie werden Studierende des Grundschullehramts in Nordrhein-Westfalen von den Universitäten auf Inklusion vorbereitet?
Um diese Frage beantworten zu können, werden folgende Akzente gesetzt:
-
Wie oft begegneten den Studierenden Veranstaltungen mit inklusionspädagogischen Inhalten?
-
Haben die Studierenden im Studium Mittel kennengelernt und Kompetenzen erlernt, die sie in inklusiven Settings benötigen?
-
Wie groß ist das Wissen der Studierenden über Inklusion und was verstehen sie darunter?
-
Wie gut fühlen sich die Studierenden auf Inklusion vorbereitet und für wie wichtig halten sie eine gute Vorbereitung in diesem Bereich?
Dieser Themenblock widmet sich den Fragen, wie die Studie aufgebaut ist, welchen Methoden sie folgt und wie die Fragestellung operationalisiert werden kann. Das Vorgehen gestaltet sich in dem Sinne, dass zunächst das Untersuchungsdesign der Studie dargelegt wird. Hierbei geht es darum, formale Überlegungen bezüglich der Studie anzustellen: Wie ist die Studie angelegt und mit welchen Mitteln kann die empirische Untersuchung umgesetzt werden?
Anschließend wird auf das Erhebungsinstrument näher eingegangen: Ein Online-Fragebogen bildet die Grundlage dieser Studie. Die hierbei zu berücksichtigenden formalen Kriterien und die inhaltliche Ausgestaltung wird im zweiten Teil dieses Kapitels behandelt. Im Fokus des letzten Teilabschnittes dieses Themenbereiches steht die Datenerhebung und die Datenaufarbeitung. Es wird erläutert, wie die Feldphase der Studie verlaufen ist und wie die Daten im Anschluss daran bereinigt und für die folgende Auswertung präpariert wurden.
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die empirische Fragestellung beantwortet werden soll. Hierzu werden die Erhebungsmethode, die Stichprobe sowie das Erhebungsdesign betrachtet.
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage bietet sich eine (teil-)standardisierte Befragung an, da die Umfrage möglichst viele Teilnehmer erreichen soll und so die Bedingungen für eine statistische Auswertung mit Vergleichsoptionen am besten gesichert werden können [vgl. Scholl, 2009, S. 77]. Dies bedeutet, dass der Fragebogen zum Großteil geschlossene Fragen aufweisen muss, die Antwortvorgaben also bereits vorgegeben sind. Da jedoch nicht alle Fragen geschlossen gestellt werden können, wird von einer teilstandardisierten Befragung gesprochen. Als weiteres Kriterium hierfür gilt eine feste Reihenfolge der Fragen, die zwischen den einzelnen Teilnehmern nicht variieren darf. Nur bei Einhaltung der gleichen Bedingungen für alle Teilnehmer können valide und reliable Daten erzielt und miteinander verglichen werden [vgl. Scholl, 2009, S. 78]. Um das Gütekriterium der Objektivität zu garantieren, muss der Fragebogen also unabhängig vom Erhebungszeitpunkt und vom Teilnehmer stabil und somit standardisiert sein. Die Frageformulierungen müssen des Weiteren reliabel sein, was bedeutet, dass ein Teilnehmer die gleichen Ergebnisse liefern müsste, wenn er ein zweites Mal an der Umfrage teilnehmen würde. Das dritte Gütekriterium, die Validität, wird erreicht, wenn eine "inhaltliche sachlogische Gültigkeit" [Scholl, 2009, S. 25] vorliegt. Dieses Gütekriterium ist dann erfüllt, wenn sich das, was der Autor der Studie erfahren möchte, auch wirklich mit den gestellten Fragen in Erfahrung bringen lässt [vgl. Scholl, 2009, S. 24f.].
Im Fokus des Interesses zur Auswertung der Daten steht die deskriptive Untersuchung: Ein bestimmtes Phänomen soll beschrieben und Tendenzen überblicksartig veranschaulicht werden. Die Studie hat des Weiteren explorativen Charakter, weil es sich um die Erkundung relativ unbekannter Phänomene, dem Vorkommen von inklusiven Inhalten in der Lehrerbildung, handelt. Hinzukommt, dass beispielsweise eine Inhaltsanalyse von Interviews vom organisatorischen Aufwand für die gewünschte hohe Teilnehmerzahl nur schwer realisierbar gewesen wäre.
Bei der folgenden Studie handelt es sich um eine Querschnittstudie, da zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Informationen abgefragt wurden: Die Datenerhebung fand vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2011 statt. In diesem Zusammenhang fällt der Blick bereits auf die Grundgesamtheit: Hierbei handelt es sich um Studierende des Grundschullehramts in Nordrhein-Westfalen. Diese sind an den Universitäten Bielefeld, Dortmund, Duisburg- Essen, Köln, Münster, Paderborn, Siegen und Wuppertal zu verorten. Die Beschränkung auf Studierende des Primarbereichs lässt sich mit Praktikabilitätsgründen und persönlichem Interesse begründenden. Da Inklusion bislang stärker im Primar- als im Sekundarbereich praktiziert wird, ist es zudem relevanter zu betrachten, inwiefern die Lehrerbildung diesen Schulentwicklungsprozess für angehende Grundschullehrer realisiert.
Für ein aussagekräftiges Ergebnis wurde ein Stichprobenumfang von etwa 200 bis 300 Teilnehmer angestrebt, was bedeutete, von jeder Universität im Durchschnitt 30 Studierende zur Teilnahme zu motivieren. Außerdem sollte die Stichprobe an allen Universitäten möglichst gleich viele Teilnehmer aufweisen, um ein ausgeglichenes Gesamtbild zu erhalten. So lässt sich zur Stichprobenkonstruktion sagen, dass sich diese mit dem Ziel einer möglichst regen Teilnahme zufällig ergeben würde. Aus diesem Grund mussten keine Einschränkungen innerhalb der Grundgesamtheit festgelegt werden. Zur speziellen Vorgehensweise des Erreichens der Studierenden siehe Kapitel 3.2.3.
Wie oben bereits erwähnt, fiel die Wahl der Erhebungsmethode auf die Befragung. Somit wurde ein Fragebogen konstruiert, der von allen Studierenden beantwortet werden sollte1. Allerdings stand zur Diskussion, ob dieser Fragebogen per Papier- oder Online-Umfrage ausgefüllt werden sollte[6]. Vorteile der Online-Befragung liegen darin, dass die Befragungssituation im Ganzen kontrollierbar ist, die Teilnehmer durch das System auf Fehler bei der Bearbeitung aufmerksam gemacht werden können und angenommen wird, dass die Teilnehmer einer Online-Umfrage mehr Offenheit entgegen bringen, da der Grad der Anonymität erhöht ist [vgl. Scholl, 2009, S. 57f.]. Gräf weist zudem darauf hin, dass es mittlerweile solch leistungsfähige Software mit komplexen "tools" gibt, die es auch Laien ermöglicht, qualitativ hochwertige Fragebögen zu konstruieren [vgl. Gräf, 2010, S. 11]. Ein möglicher Nachteil wurde darin gesehen, dass die Stichprobe unter Umständen verfälscht werden könnte, da eher Studierende den Fragebogen bearbeiten würden, denen Inklusion zusagt und die sich in diesem Themengebiet auskennen. Diese Selektion hätte vermieden werden können, wenn man Studierenden den Fragebogen in Vorlesungen direkt und in papierform ausgehändigt hätte. Schließlich überwogen die Vorteile der Online-Befragung, nicht zuletzt, da sich die Studierenden in ganz Nordrhein-Westfalen aufhalten und es eine erhebliche logistische und finanzielle Erleichterung für die Durchführungsperson darstellte.
Als Plattform zur Erstellung des Fragebogens wurde das kostenlose Softwarepaket oFB (der OnlineFragebogen) verwendet[7]. Dieses bietet neben verschiedenen ansprechenden Layout-Variationen die Möglichkeit, alle Fragen separat einzugeben und anschließend variabel in der gewünschten Reihenfolge anzuordnen. Außerdem bietet die Plattform die Möglichkeiten, den Pretest über dieses Programm ablaufen zu lassen, den Rücklauf kontrollieren zu können und die Daten direkt in das Auswertungsprogramm zu exportieren. Zur Datenaufbereitung und -bearbeitung wurde die Computer-Software SPSS verwendet.
In einem nächsten Schritt wurde das Augenmerk auf die Konstruktion des für die Online-Befragung benötigten Fragebogens gelegt. Der Gestaltung des Fragebogens kommt entscheidende Bedeutung zu, wobei es Aspekte wie die Art der Fragestellungen, die Vorgabe und Auswahl der Antwortmöglichkeiten sowie die ideale Reihenfolge der Fragen zu berücksichtigen gilt [vgl. Toutenburg u. Heumann, 2008, S. 9]. So hängt die Datenqualität entscheidend davon ab, wie das Erhebungsinstrument konzipiert ist, weswegen der Fragebogen möglichst fehlerfrei konstruiert werden und keine "measurement errors" (Abweichung der wahren von den erhobenen Daten) aufweisen sollte [vgl. Gräf, 2010, S. 35].
Von zentraler Bedeutung bei der Fragebogenkonstruktion ist die Operationalisierung: Die zugrunde liegende Forschungsfrage muss in geeignete Fragebogen-Fragen transformiert werden. Gleiche Transformationsnotwendigkeit besteht für den rückwirkenden Prozess, der die Auswertung betrifft, da die Fragen des Fragebogens nur als Indikatoren für die eigentliche(n) Forschungsfrage(n) zu zählen sind [vgl. Scholl, 2009, S. 144].
Da die Grundlage dieser Studie ein Online-Fragebogen bildet, möchte ich kurz darauf eingehen, welche Besodnerheiten es diesbezüglich zu beachten gilt. Gräf weist darauf hin, dass bedacht werden muss, dass die Umfrage auf Computer-Monitoren bearbeitet wird, die unterschiedliche Formate und Größe haben können [vgl. Gräf, 2010, S.35]. Hinzukommt, dass der Fragebogen komplett für sich sprechen muss, da der Fragebogenersteller nicht anwesend ist, um gegebenenfalls Rückfragen zu beantworten. Dies bedeutet, dass sowohl einleitende Worte als auch ein passender Abschluss in den Fragebogen integriert ein müssen, da die gesamte Kommunikation über den Fragebogen verläuft. Dies gilt auch für die Frageformulierungen: Sie müssen für sich sprechen und durch Instruktionen zur richtigen Beantwortung ergänzt werden [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 35]. Des Weiteren berichtet Nielsen, dass Online-Nutzer Texte im Internet nicht Wort für Wort, sondern eher überblicksartig lesen, weil das Lesen am Bildschirm als anstrengender empfunden wird, weswegen besonders auf eine kurze und präzise Formulierung zu achten ist [zitiert nach Gräf, 2010, S. 36]. Insgesamt erhält der Befragte einen Gesamteindruck des Fragebogens, was dazu beiträgt, wie seriös, qualifiziert und interessant er die Umfrage hält. Dies entscheidet wiederum über seine Teilnahme an der Studie [vgl. Gräf, 2010, S. 36].
Formale Kriterien der Fragebogengestaltung
Zur Fragebogenkonstruktion mussten sowohl inhaltliche Aspekte als auch formale und strukturelle Bedingungen berücksichtigt werden [vgl. Porst, 2008, S. 51]. Zunächst werde ich auf einige äußere Merkmale eingehen und in diesem Zusammenhang mögliche Frage und Antwortformate darlegen, die für den Fragebogen dieser Studie Relevanz haben. Diese werden jedoch nur kurz vorgestellt, da ich im Zuge der inhaltlichen Ausgestaltung des Fragebogens konkreter darauf zurückkommen werde. Orientieren werde ich mich in erster Linie an den Ausführungen Scholls [vgl. Scholl, 2009, S. 147-174].
Bezüglich der Frageformen ist zwischen offenen Fragen und geschlossenen Fragen, bzw. Fragen mit Antwortvorgaben zu entscheiden [vgl. Scholl, 2009, S. 160-163]. Porst nennt zusätzlich die halboffenen Fragen, wobei der geschlossenen Frageform als additive Auswahlmöglichkeit ein Feld hinzugefügt wird, in das der Teilnehmer eine weitere Antwort notieren kann, oft als "Sonstiges" tituliert [vgl. Porst, 2008, S. 55f.]. Alle Formen haben Vor- und Nachteile. Bei einer standardisierten Befragung überwiegen jedoch die geschlossenen Fragen. Trotzdem muss man jede Frage für sich betrachten und abwägen, ob eine offene Fragestellung zum Beispiel aufgrund einer unabsehbaren Bandbreite der Antwortmöglichkeiten zu bevorzugen ist.
Des Weiteren gilt es einige generelle Regeln bezüglich der Frageformulierungen zu beachten [vgl. Scholl, 2009, S. 152-155]. In diesem Sinne orientierte ich mich an folgenden Logiken: Zunächst spricht Scholl die Gesprächslogik an. Hierbei ist es wichtig, dass der Fragebogen der Struktur eines Gesprächs entspricht, also alle Fragen miteinander im Zusammenhang stehen, sich nicht widersprechen und alle Fragen für das Forschungsziel relevant sind. Um einzelne Passagen miteinander zu verbinden, verwendete ich Übergangsformulierungen. Unter der Fragenlogik ist das Gebot der Eindimensionalität zu verstehen. Dies bedeutet, dass eine Frage nur einen bestimmten Aspekt anspricht, weil zwei Sachverhalte in einer Frage angesichts der Antwortmöglichkeiten zu Verwirrungen führen können. Hinzukommt, dass in Fragen auftauchende Fakten zweifelsfrei akurat und unstrittig stimmig sein müssen.
Unter der Antwortlogik versteht Scholl, dass die Antwortkategorien bei geschlossenen Fragen erschöpfend und vollständig zu sein haben. Es sollte nicht passieren, dass ein Teilnehmer keine mögliche Antwortauswahl treffen kann, bzw. eine für ihn wichtige weitere Option im Kopf hat, die von der Frage nicht berücksichtigt wird. Dies bedeutet auch, dass sich die Antwortkategorien bei Einfachnennungen gegenseitig ausschließen müssen, also disjunkt sind. Angesichts dessen achtete ich darauf, auch ausweichende Antwortmöglichkeiten wie "weiß nicht" oder "Sonstiges" anzubieten.
Als nächste einzuhaltende Regel nennt Scholl die Sprachlogik, was bedeutet, dass die Sprache der Fragen dem normalen Sprechen der Teilnehmer ähneln soll. Hierzu gehört, dass die Sprache weder zu elaboriert noch zu alltäglich ist und sie nicht zu aufdringlich, sondern eher zurückhaltend wirken sollte. Insgesamt ist ein neutraler Sprachstil zu bevorzugen. Gleiches gilt für Grammatik und Satzbau, hier ist auf Einfach- und Korrektheit zu achten. An dieser Stelle ist direkt der nächste zu beachtende Aspekt hervorzuheben: Bei der Fragenkonstruktion sind des Weiteren Verständlichkeit und Präzision zu beachten. Hierbei muss sich der Verfasser an das Niveau der Befragten anpassen und vermeiden, dass Fragen aus Verständnisgründen nicht beantwortet werden können. Aus diesem Grund sollte mit Fachbegriffen und Abkürzungen vorsichtig umgegangen werden. Begriffe müssen präzise ausgedrückt werden und kurze Sätze sind zu bevorzugen.
Diese Aspekte habe ich bei der Fragebogenkonstruktion berücksichtigt. Auch wenn es sich bei den Teilnehmern um Studierende und somit Personen handelt, die elaboriertere Sprachformen gewöhnt sind, wählte ich eine Sprache, die nicht zu formell, sondern für jeden Teilnehmer verständlich sein sollte. Die Sätze sind kurz gehalten und doppelte Verneinungen versuchte ich weitgehend zu vermeiden. Wo ich die Gefahr möglicher Missverständnisse sah, fügte ich weitere erläuternde Hinweise hinzu. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass ich als Anrede die persönliche "Du-Form" der "Sie-Form" vorzog, da ich mich auf der gleichen Studierenden-Ebene befinde wie die Teilnehmer und keine künstliche Situation erzeugen wollte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt darin, die Neutralität bei der Erstellung der Fragen zu wahren. Zum einen müssen sie wertneutral sein, was auch bedeutet, keine ideologisch geladenen Begriffe zu verwenden. Zum anderen sollen Suggestivfragen vermieden werden, ebenso wie Antwortmöglichkeiten, die die Teilnehmer unbewusst in eine bestimmte Richtung lenken. Dabei musste ich darauf achten, mein eigenes Inklusionsverständnis nicht unbewusst in die Frage- und Antwortformulierung einschießen zu lassen. Absehen sollte man außerdem von privaten oder unter Umständen bloßstellenden Fragen.
Als letztes Kriterium bezüglich der Fragenformulierung wird auf die Antwortschwierigkeit und den Antwortaufwand hingewiesen. Die Antworten sollten ohne großen Aufwand getroffen werden können, um ein Überspringen der Frage oder gar Abbrechen des Fragebogens zu verhindern.
Die Fragen des Fragebogens werden im Folgenden auch Variablen genannt. Bedingungen einer jeden Variablen liegen darin, dass es mindestens zwei Antwortmöglichkeiten gibt und dass eine Verteilung auf die verschiedenen Antwortoptionen vorliegen muss [vgl. Scholl, 2009, S. 164].
Bei der Bearbeitung der Fragenformulierung sind parallel bereits die Antwortvorgaben, die so genannten Skalen, zu bedenken. Hierzu gilt es ebenso einige wichtige Hinweise zu beachten.
Es gibt drei verschiedene Skalenniveaus, deren Unterscheidung sich durch den Zusammenhang der Antwortvorgaben ergibt: Die Nominalskalierung, die Ordinalskalierung und die Intervall- oder metrische Skalierung [vgl. Scholl, 2009, S. 164f.]. Diese Klassifizierung ist bedeutsam, da sich die verschiedenen Skalentypen unterschiedlich bei der Datenauswertung verhalten. Die Antwortitems bei nominalskalierten Variablen sind nicht hierarchisch zu ordnen, sondern stellen lediglich Unterschiede dar. Ein Beispiel hierfür ist das Geschlecht. Die ordinalskalierte Variable hingegen weist eine Hierarchisierung ihrer Antwortvorgaben auf. Diese lassen sich jedoch nicht metrisch ordnen, da die Abstände zwischen den einzelnen Antwortoptionen nicht zu bestimmen sind. Der Schulabschluss kann hierzu als Beispiel genannt werden. Als drittes Skalenniveau ist die Intervallskalierung zu zählen. Da in diesen Fällen die Abstände zwischen den Antwortmöglichkeiten gleich groß sind, liegen Intervalle vor. Hierzu ist das Alter exemplarisch zu nennen.
Bezüglich der Anzahl der Antwortmöglichkeiten ist zwischen dichotomen und polytomen Antworten zu entscheiden [vgl. Scholl, 2009, S. 165f.]. Erstgenanntes Skalenformat weist nur zwei (sich widersprechende) Antwortmöglichkeiten auf, während letztgenannte mehrere Antwortmöglichkeiten beinhaltet. Polytome Skalen können im Nachhinein noch zu dichotomen zusammengefasst werden. In diesem Zusammenhang sei zusätzlich auf die Differenzierung von Einfach- und Mehrfachnennungen hingewiesen. Unabhängig von dichtotomen und polytomen Skalen kann der Fragebogen-Verfasser entscheiden, ob der Teilnehmer bei einer Frage nur genau eine Antwort auswählen soll oder mehrere Nennungen von ihm gewünscht sind [vgl. Porst, 2008, S. 51]. Im hier vorliegenden Fragebogen werden diese Unterschiede auch visuell hervorgehoben: So werden bei Einfachnennungen runde Auswahlkästchen (Radiobuttons) angezeigt und bei Mehrfachnennungen eckige (Check-Boxes).
Eine besondere Art von Skalen stellen die Ratingskalen dar [vgl. Scholl, 2009, S. 167f.]. Diese kommen oft dann zum Einsatz, wenn auf die Erhebung von Einschätzungen, Präferenzen oder Meinungen abgezielt wird. Hierbei gibt der Teilnehmer den Grad seiner subjektiven Meinung auf einer mehrstufigen Skala von zum Beispiel "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme voll und ganz zu" wieder. Werden mehrere solcher Items hintereinander geschaltet, spricht man auch von Matrixantworten [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 42]. In der Regel wird dem Teilnehmer dabei eine vier- bis elfstufig differenzierte Skala angeboten. Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Stufen ist genau abzuwägen: Je mehr Stufen die Skala hat, umso genauer kann der Teilnehmer seine Antwort ausdrücken. Viele Stufen können aber auch dazu führen, dass der Befragte sich nicht mehr orientieren kann und relativ willkürlich eine Stufe auswählt, sodass die Reliabilität vielstufiger Skalen gering ist. Aus diesem Grund muss das richtige Maß der Anzahl gewählt werden.
Außerdem gilt es zu berücksichtigen, ob man für die Anzahl der Stufen eine gerade oder eine ungerade Zahl wählt. Der Unterschied liegt darin, dass Skalen mit einer ungeraden Anzahl an Stufen eine Mittelkategorie aufweisen, die so gesehen als neutral oder "weiß nicht" interpretiert werden kann. Bei Skalen mit einer geraden Stufenzahl gibt es keine eindeutige Mitte, sodass der Befragte immer zumindest eine eher positive oder negative Tendenz ausdrücken muss. Nachteilig daran ist, dass sich der Befragte mit seiner Meinung unter Umständen in der Skala nicht wiederfindet und er die Frage entweder überspingt oder sich willkürlich für eher positiv oder eher negativ entscheidet. So könnte unter Umständen eine verfälschte Meinung erzeugt werden. Andererseits kann eine Mittelkategorie auch dazu verführen, sich im Sinne einer leichten Ausweichoption relativ unbedacht für die "neutrale Mitte" zu entscheiden. Scholl weist darauf hin, dass die Nachteile beider Varianten klein gehalten werden können, wenn eine Skala mit entweder sechs oder sieben Abstufungen gewählt wird [vgl. Scholl, 2009, S. 168]. Ich entschied mich in meinem Fragebogen in den meisten Einschätzungsfragen für eine sechsstufige Skala. Mir war es wichtig, zumindest eine Tendenz der Teilnehmer zu verzeichnen und die neutrale Mitte als Ausweichoption zu vermeiden. Wenn eine Mittelkategorie für angebracht angesehen wurde, entschied ich mich für eine fünfstufige Skala, da ich nicht auf eine so feine Differenzierung angewiesen bin, wie sie die siebenstufige Skala ermöglicht.
Eine Frage, die ebenso nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die der Verbalisierung der Skalenpunkte. Neben der eindeutigen Formulierung ist ebenso abzuwägen, ob alle Stufen oder nur die Skalenendpunkte benannt werden sollen [vgl. Porst, 2008, S. 77-80]. Eine voll verbalisierte Skala wird vom Teilnehmer gerne gesehen, da er seine Meinung nicht einordnen muss, sondern lediglich die für ihn stimmige Aussage auswählen kann. Die Nachteile bestehen jedoch in erster Linie darin, die passende Bezeichnung für jede Abstufung zu finden sowie hinsichtlich des Skalenniveaus: Endpunktbenannte Skalen können bei der Auswertung als intervallskalierte Skalen behandelt werden, da simuliert wird, dass die Skalenpunkte gleichabständig sind. Dies ermöglicht es beispielsweise, Mittelwerte aus den Daten zu errechnen [vgl. Porst, 2008, S. 73]. Für eine Verbalskalierung ist die Behandlung als metrische Skala nicht möglich, sie bleibt ordnialskaliert. Problematisch an den endpunktbenannten Skalen ist jedoch, dass die Interpretation der unbenannten Stufen auf Seiten der Teilnehmer liegt, was relativ beliebig und unterschiedlich ausfallen kann. Die Entscheidung für den hier verwendeten Fragebogen bezüglich der Skalenverbalisierung ist darauf gefallen, in den meisten Fällen nur die Endpunkte zu benennen. Alle Antwortoptionen wurden nur dann verbalisiert, wenn ich es zur Verständnissicherung für wichtig erachtete.
Des Weiteren ist die Skalenrichtung zu berücksichtigen, wobei es zu unterscheiden gilt, ob der höchste Skalenwert auf der rechten oder auf der linken Seite liegt [vgl. Porst, 2008, S. 86-89]. Da Skalen einen Verlauf signalisieren, sollten sie von links nach rechts ansteigend präsentiert werden, da dies der normalen Lesart entspricht. Daran hat sich auch der vorliegende Fragebogen gehalten.
Die Entscheidung zwischen verschiedenen Skalentypen ist weiterhin von großer Relevanz im Rahmen der Fragebogenkonstruktion. Kuckartz u. a. nennen folgende Online-Antwortformate: Drop-Down-Listen, Radiobuttons, Matrixantworten, Checkboxes und Freitextfelder [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 40-43]. Auch diese Auswahl ist immer in Abhängigkeit zum Inhalt der Fragen zu bestimmen. Generell kann gesagt werden, dass für den Fragebogen Radiobuttons für Einfachantworten, Checkboxen für Mehrfachantworten und Freitextfelder für offene Fragen gewählt wurden. In besonderen Fällen werde ich im folgenden Abschnitt der inhaltlichen Gestaltung des Fragebogens auf die jeweils spezifisch gewählte Skala eingehen.
Inhaltliche Ausgestaltung des Fragebogens
Nachdem die formalen Kriterien zur Fragebogengestaltung betrachtet wurden, richtet sich der Blick in diesem Abschnitt auf die inhaltliche Komponente des Fragebogens. Zentral ist die Frage, wie die zugrunde liegende Fragestellung operationalisiert werden kann.
Dabei stellte ich drei Hauptkategorien auf, die Auskunft darüber geben sollten, wie Studierende während ihrer universitären Ausbildung mit Inklusion konfrontiert werden. An erster Stelle stand der allgemeine Erfahrungsbereich. Diesen Bereich unterteilte ich nochmals: So stellte ich zum einen das Teilgebiet der Erfahrungen im Rahmen der Professionalisierung der Studierenden auf, wozu sowohl universitäre Veranstaltungen als auch Praxisphasen zu zählen sind. Hiermit kann die Fragestellung sehr direkt beantwortet werden. Das andere Teilgebiet erfasst die privaten Erfahrungen der Studierenden, also solche, die sie außerhalb ihres Studiums mit Inklusion bzw. mit Situationen, die für inklusive Settings Relevanz haben, gemacht haben. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Kontakt zu Menschen mit Behinderungen oder zu inklusiven Maßnahmen eine positive Haltung gegenüber Inklusion erzeugt. Bestätigt wird diese Vermutung durch eine Studie von Loreman, Forlin und Sharma, die sie 2007 in Australien, Kanada, Hong-Kong und Singapur durchgeführt haben [vgl. Loreman u. a., 2007].
Im zweiten Bereich sollte das Wissen der Teilnehmer über Inklusion fokussiert werden. Das Wissen kann als indirekter Indikator dafür gelten, wie Studierende auf Inklusion vorbereitet sind, da sie dieses Wissen vermutlich primär in universitären Veranstaltungen erworben haben. Zudem bedarf es eines tief verwurzelten Verständnisses von Inklusion sowie eines methodischen Know-Hows [vgl. Stein, 2011, S. 3], wenn man im späteren Berufsleben mit inklusiven Settings konfrontiert wird.
Ein drittes Feld innerhalb des Fragebogens zielte auf die Einstellungen der Studierenden ab. Auch wenn dieser Aspekt zunächst der eigentlichen Fragestellung fern liegen mag, war es mir wichtig, ihn dennoch in die Befragung zu integrieren. Dies hängt damit zusammen, dass persönliche Einstellungen unser Verhalten mitprägen. Außerdem ist es ebenfalls Aufgabe der Lehrerbildung, den angehenden Lehrpersonen positive Leitideen überzeugend zu vermitteln sowie eine bejahende Einstellung und die Verinnerlichung der Konzepte hervorzurufen [vgl. Wernstedt u. John-Ohnesorg, 2010, S. 4]. Bezogen auf Inklusion heißt dies: Wer von der Idee der Inklusion nichts hält oder dahinter eine unrealistische Utopie sieht, wird wenig Mühe aufbringen, sich bei der Umsetzung von Inklusion zu engagieren bzw. sein Handeln den damit verbundenen Umstellungen anzupassen. So sei es im Zuge einer Veränderung des Schulsystems in Richtung eines inklusiven Systems besonders wichtig, am Umdenken der Lehrpersonen zu arbeiten, da keine Änderungen zu erwarten seien, wenn die Lehrer nicht von der Richtigkeit und Wichtigkeit der Neuerungen überzeugt sind [vgl. Wernstedt u. John-Ohnesorg, 2010, S. 2] und ein "inklusives Denken" [Klauß, 2010, S. 285] an den Tag legen. In diesem Zusammenhang sei auf die Studie "Inklusive Überzeugung und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Heterogenität - Wie denken Studierende des Lehramts für Grundschulen?" von Bärbel Kopp hingewiesen. In dieser wurde unter anderem untersucht, wie die Überzeugung von Inklusion durch entsprechende Seminarmaßnahmen beeinflusst wird [vgl. Kopp, 2009]. Das Ergebnis zeigt eine sehr unterschiedliche Wirkung von Seminarinhalten: Einige Seminarteilnehmer wurden in ihrer anfangs skeptischen Haltung zu einer positiveren Einstellung geführt, andere wiesen jedoch auch eine negativere Denkweise bezüglich Inklusion auf, als dies zu Seminarbeginn der Fall war.
Trotz ihrer indirekten Funktion sind diese beiden Bereiche (Wissen und Einstellungen) jedoch ebenfalls von entscheidender Relevanz: Lehrpersonen müssen in den jeweiligen schulischen Neuerungen sowohl kompetent ausgebildet als auch gewillt dazu sein, an Schulentwicklungsprozessen mitzuwirken [vgl. Böing, 2011, S. 59].
Mit der Behandlung dieser drei Themenkomplexe soll ein umfassender Blick auf die Vorbereitung der Studierenden gegeben werden. Pestalozzi beschreibt ganzheitliche menschliche Bildung anhand des Lernens mit Kopf, Herz und Hand. Diese Betrachtungsweise gilt nicht nur für schulisches Lernen, sondern ist auch auf die Hochschulbildung übertragbar. Dementsprechend sind die Bereiche Wissen (Kopf), Einstellung (Herz) und Erfahrung (Hand) die Aspekte, die ein Lernen ermöglichen, das die ganze Person einschließt. Ähnlich verhält es sich mit der in Kapitel 2.2.1 vorgestellten Trias zur Lehrerbildung nach Bayer et al.. Die Lehrerbildung ist in das Zusammenwirken von Wissenschaft, Praxis und der individuellen Lehrperson eingebettet. So ist der Wissensbereich des Fragebogens dem wissenschaftlichen Eckpunkt zuzuordnen, die Erfahrungen, die Studierende bereits mit Inklusion gemacht haben, der Praxiskomponente und letztlich sind Einstellung und Haltung zur Inklusionsidee bei der Berücksichtigung der individuellen Lehrperson zu verorten. Aus diesen Gründen werden alle Bereiche im Fragebogen berücksichtigt, da sich nur so zeigen wird, wie Lehrpersonen insgesamt auf Inklusion vorbereitet sind. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit jedoch darauf liegt, wie die Universität Studierende vorbreitet, wird sich dies auch in der Auswertung der Ergebnisse niederschlagen: Aus kapazitären und zeit-ökonomischen Gründen wird der Bereich der Einstellungen nur äußerst rudimentär und punktuell betrachtet. Ebenso unbeachtet bleiben die Erfahrungen in Praxisphasen und außeruniversitären Situationen mit dem Thema Inklusion.
Bevor ich die Fragen innerhalb der thematischen Bereiche näher erläutere, werden einige Aspekte bezüglich der soziodemografischen Daten der Teilnehmer genannt. In diesem Rahmen wurden die Variablen Geschlecht, Alter, Muttersprache, Universität, Studiengang, Studienphase und Semesteranzahl abgefragt. Diese Auswahl wahrt zum einen die Anonymität der Teilnehmer, gibt zum anderen aber dennoch Aufschluss über die Verteilung der Stichprobe, wenn man beispielsweise das Geschlecht oder den Universitätsort betrachtet. Zu Beginn dieser Fragen wurde ein zusätzlicher Hinweis gegeben, dass die Daten allein für die Studie von Relevanz sind und nicht mit dem Teilnehmer in Verbindung gebracht werden, um mögliche Bedenken bezüglich der Anonymität (insbesondere in Bezug auf die Hochschule) auszuschalten.
Das Merkmal "Muttersprache" wurde in den Fragebogen integriert, da so möglicherweise Verständnisschwierigkeiten aufseiten der Teilnehmer bzw. undeutliche Antworten bei der Auswertung des Fragebogens enttarnt werden können.
Die Variable der Universität liefert vorrangig Informationen darüber, wie die Stichprobe in NRW verteilt ist. Außerdem kann sie im Laufe der Befragung Orientierung geben, von welchen Universitäten angesichts einer möglichst gleichen Verteilung noch Teilnehmer benötigt werden. Es ist außerdem denkbar, dass zwischen den einzelnen Universitäten Unterschiede bezüglich der Vorbereitung ihrer Studierenden auf Inklusion auszumachen sind, worauf in einer weiteren Untersuchung eingegangen werden könnte. Während alle Fragen in diesem soziodemografischen Einstieg auf der sichtbaren Auswahl beruhten (Antwortformat der Radiobuttons), wurde die Frage nach der Universität als Drop-Down-Auswahl konzipiert. Dies bedeutet, dass zunächst nur eine einzelne Antwortmöglichkeit mit einem nebenstehenden Abwärtspfeil sichtbar ist, sich aber mit einem Klick auf eben diesen Pfeil alle Auswahlen zeigen. Diese Frageform bietet sich an, da die Liste der Auswahlmöglichkeiten relativ lang ist (acht Antwortoptionen).
Die Variablen Alter, Studienphase und Semesterzahl tragen dazu bei, herauszustellen, wie weit die Studierenden sich innerhalb ihres Studiums befinden. Studierende, die bereits länger studieren, haben vermutlich eher Veranstaltungen zu Inklusion besucht, da sie während des Studiums insgesamt mehr Veranstaltungen und Module belegt haben. Andererseits wäre es denkbar, dass Studierende der ersten Semester eher mit Inklusion konfrontiert werden, weil Inklusion ein aktuelles Thema ist und Hochschuldozenten in diesem Sinne gerade Studienanfänger für dieses Thema sensibilisieren wollen. Aus diesem Grund wurde die erste Überlegung, lediglich Studierende der älteren Semester (also zum Beispiel nur des Masters bzw. des Hauptstudiums) zu befragen, wieder verworfen.
Einige Schwierigkeiten bereitete die Frage des Studiengangs. Dies lag daran, dass in Nordrhein-Westfalen die Lehrerbildung für den Primarbereich aufgrund des neuen Lehrerausbildungsgesetzes und den damit verbundenen Modellstudiengängen, die bereits auf Bachelor- und Master-Modus umgestellt haben und an den Universitäten Bielefeld, Dortmund, Münster und Wuppertal durchgeführt werden, momentan nicht an allen Universitäten identisch verläuft und keine einheitliche Titulierung haben. Im Gegensatz dazu wird an den Universitäten Dusiburg-Essen, Köln, Paderborn und Siegen zum Zeitpunkt der Erhebung nach dem "alten" Lehrerausbildungsgesetz studiert, das das Studium in Grund- und Hauptstudium unterteilt. Aus diesem Grund verwendete ich die offizielle übergeordnete Bezeichnung "Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule". Die verschiedenen Antwortmöglichkeiten "Schwerpunkt Grundschule" sowie "Schwerpunkt noch ungewiss" gehen auf diese Problematik ein. Als dritte Antwortoption gab es die Auswahl "Sonstiges", um auf diesem Wege Teilnehmer aussortieren zu können, die nicht zur Grundgesamtheit der Grundschullehramtsstudierenden gehören.
Die Frage der Studienphase wurde ebenso differenziert: Für die Modellstudiengänge gab es die Unterscheidung zwischen Bachelor- und Masterphase, für die nach herkömmlicher Studienordnung Studierenden die Bezeichnung Grund- und Hauptstudium. Auch hier wurde eine halboffene Frage verwendet, da die Studierenden unter "Sonstiges" eintragen konnten, wenn sie sich in einer anderen Phase (zum Beispiel Examensvorbereitung oder in der Wartezeit auf das Referendariat) befänden.
Im folgenden Abschnitt werde ich näher auf den inhaltlichen Themenbereich der Erfahrungen eingehen. In diesem Zusammenhang interessierte es, ob und wie viele Veranstaltungen die Studierenden zum Thema Inklusion besucht haben.
Wie genau sollte also nach dem Vorkommen von Inklusion im Studium gefragt werden? Ich entschied mich zum einen nach Veranstaltungsreihen zu fragen, die "Inklusion" im Ganzen thematisieren. Zum anderen wollte ich in Erfahrung bringen, ob in einzelnen Sitzungen anderer Veranstaltungen Komponenten, die Inklusion ausmachen, sowie Konsequenzen, die für den Umgang mit Inklusion bedeutsam sind, kennengelernt wurden.
Bezüglich der Abfrage nach Inklusion thematisierenden Veranstaltungsreihen wurde nach dem Titel der Veranstaltung gefragt. Durch die Nennung des Titels sollte vermieden werden, dass der Teilnehmer selbst entscheiden muss, ob die Veranstaltung inklusive Inhalte aufwies, da es sich bei dem Titel um eine festgelegte Zuschreibung handelt, die frei von subjektiver Einschätzung ist. Somit wird der Wirkung von unterschiedlichen Inklusions-Definitionen entgegengewirkt. Wenn dieser Titel das Wort "Inklusion" bzw. "inklusiv" (im pädagogischen Sinn) enthält, kann davon ausgegangen werden, dass Inklusion das grundlegende Thema der gesamten Vorlesungsreihe ist. Der Teilnehmer sollte zunächst beantworten, wie viele solcher universitärer Inklusions-Veranstaltungen er besucht hat. Daran anschließend wurden zwei so genannte Filterfragen eingefügt, die nur die Studierenden zu beantworten hatten, die bereits Veranstaltungen besucht haben, die Inklusion im Titel trugen. Zum einen sollten die Studierenden den/die genauen Titel der Veranstaltung(en) nennen, damit ersichtlich wird, in welchem Zusammenhang die Veranstaltung stattfand und um sicherzugehen, dass die Studierenden wahrheitsgemäß geantwortet und die Fragestellung richtig verstanden hatten. Des Weiteren wurde in Form einer halboffenen Frage nach der Art der Veranstaltung gefragt. Die Antwortmöglichkeiten lauteten: Vorlesung, Seminar, Begleitseminar zum Praktikum, Kolloquium, Tutorium sowie "Sonstiges (und zwar...)". Auch die Art der Veranstaltung kann Aufschluss darüber geben, wie die Studierende auf Inklusion vorbereitet werden: Tendenziell kann man davon ausgehen, dass in einer Vorlesung das Wissen eher gelehrt wird, während Seminarthemen kontroverser zur Diskussion stehen und beispielsweise in Praktikumsseminaren der Bezug von Inklusion zur Praxis stärker im Fokus steht.
Um Missverständnissen vorzubeugen, wurde diesem Fragenblock außerdem eine kurze Erklärung vorgeschaltet, was mit "Veranstaltung" und was mit "Sitzung" gemeint ist. So wurde als übergeordneter Begriff für eine Veranstaltungsreihe der Begriff "Veranstaltung" definiert und für eine einzelne Einheit einer solchen Veranstaltung der Begriff "Sitzung". Auch im Rahmen anderer Veranstaltungen, deren Vorlesungs- bzw. Seminartitel nicht den Begriff Inklusion enthalten, kann das Thema Inklusion in einzelnen Sitzungen thematisiert werden. Auch dies sollte in einer Frage berücksichtigt werden. Die Antwortmöglichkeiten zu diesen Fragen ordnete ich in Form von sichtbaren Items an, wobei jeweils nur eine Antwortoption gewählt werden konnte. Da ich davon ausging, dass Veranstaltungen, die Inklusion im Titel tragen, eher seltener von Studierenden besucht wurden, wählte ich als Antwortoptionen keine, eine, zwei, drei und mehr als drei. Für die Frage nach der Behandlung von inklusiven Inhalten in einzelnen Sitzungen einer Veranstaltung wählte ich hingegen aufgrund des vermutlich häufigerem Aufkommens die Auswahlmöglichkeiten keine, 1-2, 3-4, 5-6 und mehr als 6.
Des Weiteren interessierte mich, ob die Studierenden neben inklusiv titulierten Veranstaltungen ebensolche besucht habe, die man als Teilbereiche oder untergeordnete Themen von Inklusion ansehen kann. Speziell betrifft dies die Integrationspädagogik und spezifischer den Gemeinsamen Unterricht sowie die Interkulturelle Pädagogik. Sicherlich hätte hier auch noch nach weiteren Themen wie zum Beispiel der Hochbegabtenförderung gefragt werden können, jedoch stellten sich für mich die beiden genannten Felder als die entscheidensten für Inklusion in der Praxis von Lehrkräften dar. Als Antwortformat wählte ich das selbe wie bei der Frage nach inklusiven Inhalten in einzelnen Veranstaltungen.
Zusätzlich wollte ich in Erfahrung bringen, inwiefern sich Studierende des Grundschullehramts innerhalb ihres Studiums mit Themen aus dem Bereich der Sonderpädagogik beschäftigt haben. Dies geht über den Bereich der Integrationspädagogik hinaus, da hier spezifischer heilpädagogische Themen hineinfallen. Wenn zukünftige Grundschullehrkräfte jedoch auch Kinder mit Behinderungen in ihren Klassen unterrichten, dann ist es eine Überlegung, ob nicht auch Grundschulpädagogen ein Grundwissen an heil- bzw. sonderpädagogischen Inhalten erlangen sollten. Um dies herauszufinden, wurde eine Frage nach sonderpädagogischen Inhalten innerhalb des Studiums gestellt. Da im Fragebogen diesbezüglich lediglich eine Tendenz herausgestellt werden sollte, wurde nicht nach genauen Veranstaltungen gefragt, sondern nach der Häufigkeit. Diese war auf einer horizontalen Auswahl-Skala mit den fünf Auswahloptionen nie, selten, manchmal, oft, sehr oft verankert.
Um Doppelnennungen zu vermeiden, wies ich bei den drei zuletzt vorgestellten Fragen darauf hin, dass Veranstaltungen, die Inklusion im Titel tragen und bereits bei der vor-angegangenen Frage genannt wurden, zu diesen Fragen nicht angegeben werden sollten. Die nächsten Fragen zielten auf die Qualifikation von angehenden Lehrpersonen in inklusiven Unterrichtssituationen ab. Dabei sollte der Blick zum einen auf das Kennenlernen offener Unterrichtsformen abzielen, da dies ein wesentliches Moment von inklusivem Unterricht und Differenzierung ist. Hierzu wurde ein Großteil der in der Literatur angeführten Unterrichtsformen des offenen Unterrichts ausgewählt und aufgelistet: Wochenplanarbeit, Werkstattarbeit, Freiarbeit, Stationsarbeit, das Projektlernen, das Kooperative Lernen, das Entdeckende Lernen und das Forschende Lernen. Aufgabe der Teilnehmer war es, diejenigen Unterrichtsformen auszuwählen, denen sie bereits im Studium (einschließlich Praktika) begegnet sind. Zusätzlich gab es eine Antwortkategorie für Teilnehmer, die keine der angegebenen Lernformen kennengelernt haben. In diesem Sinne handelte es sich um eine Mehrfachantwort. Ein besonderes Augenmerk lag bei dieser Frage auf dem Kooperativen Lernen, da dies ein wesentlicher Gelingensfaktor für erfolgreiche inklusive Unterrichtspraxis ist.
Zum anderen interessierte, inwiefern die Studierenden im Studium pädagogisch-didaktische Mittel erfahren haben, mit denen Inklusion in der Schule umgesetzt werden kann. Hierbei wurden auf Grundlage der in Kapitel 2.1.3 präsentierten Informationen bezüglich unterrichtlicher Konsequenzen folgende schulpraktische Bereiche ausgewählt: Heterogene Klassenkonstellationen, Förderdiagnostik, alternative Formen der Leistungsbewertung, Team- Teaching, Jahrgangsübergreifender Unterricht und Differenzierung. Im Unterschied zur vorherigen Frage wurde jedoch nicht gefragt, ob sie im Studium mit diesen Themen konfrontiert wurden, sondern in welchem Ausmaß: Die Studierenden sollten ihr im Studium erworbenes Wissen in diesen Bereichen einschätzen. Für diese Einschätzung wurde eine endpunktbenannte Referenz-Skala verwendet. Insgesamt wies diese Skala sechs Abstufungen auf, deren erste Stufe "sehr niedrig" und sechste Stufe "sehr hoch" genannt wurde. Auch für diese Aufgabe gilt: Je höher die Studierenden ihr Wissen in den jeweiligen Bereichen einschätzen (was sie vermutlich in universitären Veranstaltungen erworben haben), umso eher sind sie auf die inklusive Schulpraxis vorbereitet.
Bezüglich der universitären Veranstaltungen wurde als letztes gefragt, ob die Studierenden in Zukunft gerne eine Veranstaltung zum Thema Inklusion besuchen würden. Anhand dieser Frage wird deutlich, wie hoch die Studierenden selbst die Relevanz von Inklusion sehen und wie gut oder schlecht sie sich bislang auf Inklusion vorbereitet fühlen. Als Antwortoptionen wurden hier "ja", "nein" und "weiß nicht" angeboten.
Nur kurz eingehen möchte ich auf den Bereich der Praxisphasen in vorliegendem Fragebogen. Hierzu wurden drei Fragen gestellt: Zum einen an wie vielen verschiedenen Schulen der Teilnehmer bereits Praktika absolviert hat, zum anderen wie viele Wochen dies bislang insgesamt waren und zuletzt, ob ein Praktikum schon einmal an einer Förderschule, an einer integrativ arbeitenden Schule oder an einer inklusiven Schule verbracht wurde. Um die Antwortauswahl für alle denkbaren Fälle zu komplettisieren, wurden zusätzlich die Antwortkategorien "Ich habe bislang alle Praktika an Regelschulen absolviert, die nicht integrativ oder inklusiv arbeiten." sowie "Ich habe noch kein Praktikum absolviert." ergänzt. Bei Auswahl einer der beiden letzten Antwortmöglichkeiten konnte keine andere Option gewählt werden. Die ersten drei Antwortvorgaben konnten jedoch durchaus kombiniert genannt werden. Die Antwort gibt Aufschluss über die praktischen Erfahrungen der Studenten mit integrativen, inklusiven oder sonderpädagogischen Einrichtungen.
Auf die Fragen bezüglich der privaten Erfahrungen der Studierenden soll in diesem Kontext nur am Rande eingegangen werden, da sie bei der Auswertung dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden können. Gefragt wurde danach, ob der Teilnehmer vor oder während des Studiums ein Freiwilliges Soziales Jahr, den Zivildienst, einen Job oder ein Ehrenamt ausgeübt hat, bei dem er mit Menschen mit Behinderungen arbeitete. Des Weiteren interessierte, ob dem Familien- oder Bekanntenkreis eine Person mit Behinderung angehört. Eine weitere Frage zielte darauf ab, ob in der eigenen Gemeinde bzw. dem eigenen Stadtbezirk inklusive Angebote vorzufinden sind, während die letzte Frage Angaben zu Erfahrungen mit Integration oder Inklusion in der eigenen Schulzeit verlangte. Relevanz haben diese Fragen deswegen, weil die Einstellungen der Studierenden zu Inklusion durch vorherige praktische Erfahrungen (insbesondere mit behinderten Menschen) beeinflusst werden können.
Der Wissensbereich des Fragebogens begann mit einer Einschätzungsfrage, in der die Teilnehmer ausdrücken sollten, wie gut sie sich mit dem Thema "Inklusion" auskennen. Sie konnten ihren Wissensstand dabei auf einer fünfstufigen Skala markieren, deren Endpunkte und Mittelpunkt benannt sind, die "Zwischenräume" jedoch nicht. Die Beschriftung des negativen Extremums lautete "sehr schlecht", des positiven "sehr gut" und die mittlere Stufe trug die Bezeichnung "mittelmäßig". Für diese Frage wurde eine Mischform der endpunktbenannten und der voll verbalisierten Skala gewählt. Dies lässt sich in erster Linie anhand einer technischen Notwendigkeit erklären: Die vorliegende Auftaktfrage des Wissensbereiches ist zugleich als Filterfrage konzipiert. Da es keinen Sinn macht, Teilnehmer, die sich schlecht im Themengebiet Inklusion auszukennen, weiter über ihr Wissen abzufragen, übersprangen sie einige Wissensfragen. Konkret bedeutete dies, dass alljenigen, die sich schlechter als "mittelmäßig" mit Inklusion auskennen, die vier Folgefragen nicht bearbeiteten. Um dieses Verfahren in der Fragebogen-Software einzubinden, musste der Punkt der Skala, ab dem der Filterbereich gelten sollte, verbalisiert werden, da sonst die notwendige Programmierung nicht möglich gewesen wäre.
Bei dieser ersten Frage fiel es zunächst schwer, eine passende Formulierung zu finden, da die Frage, wie gut sich der Teilnehmer mit Inklusion auskennt, eventuell zu ungenau ist. Zunächst stand daher die Überlegung im Raum, nach der Begriffskenntnis von Inklusion zu fragen. Da diese Frage prinzipiell nur mit ja oder nein zu beantworten ist, sollten als Antwortkategorien die Aussagen "Ich habe noch nie davon gehört.", "Ich habe schon mal davon gehört, aber weiß nicht, was er bedeutet.", "Ich habe schon davon gehört und weiß grob, was er bedeutet.", "Ich kenne mich einigermaßen gut mit Inklusion aus." und "Ich kenne mich sehr gut mit Inklusion aus." angeboten werden. Allerdings war diese Frageform nicht optimal, da einerseits die Fragestellung nicht genau zu den Antwortoptionen passte und andererseits aus diesem Grund nicht sichergestellt werden konnte, ob alle möglichen Antwortmöglichkeiten mit der Auswahl abgedeckt sein würden. So entschied ich mich doch als Einstieg danach zu fragen, wie gut sich die Studierenden mit dem Thema "Inklusion" auskennen.
Folgende vier Fragen betrafen den "Filterbereich":
Zunächst ging es um die Frage, wo die Teilnehmer ihr Wissen über Inklusion erlangt haben. Interessiert hat an dieser Frage, ob sie ihr Inklusions-Wissen vornehmlich im Rahmen ihrer Professionalisierung erworben haben oder aus ihrem privaten Umfeld darauf zurückgreifen. Folgende Antwortoptionen standen bei dieser Mehrfachnennung zur Option: Universitäre Veranstaltungen, Diskussion in den Medien, Gespräche mit Freunden oder Bekannten, Praktika, Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, Fachliteratur. Da auch mit dieser Antwortbreite nicht sichergestellt werden konnte, dass alle möglichen Informationsquellen abgedeckt sind, wurde die Option "Sonstiges, und zwar:" mit der Möglichkeit der offenen Texteingabe gestellt.
Interessiert hat des Weiteren, was die Studierenden unter Inklusion und speziell unter schulischer Inklusion verstehen. Da ich wenig Einfluss auf die Antworten nehmen wollte, um eine möglichst unabhängige Aussage der Studierenden zu erzielen, entschied ich mich für die freie Texteingabe. Um nicht sehr pauschal fragen zu müssen "Was verstehst du unter Inklusion?", entschied ich mich dazu, die Teilnehmer folgenden Satz weiterführen zu lassen: "Eine inklusive Schule...". So konnte ich sicherstellen, dass sich die Aussagen tatsächlich auf Inklusion im schulischen Bereich beziehen und konnte den Teilnehmern zudem mit einer Formulierung den Einstieg erleichtern. Die Größe des Eingabefeldes ermöglichte eine umfangreiche Antwort.
Die anschließende Frage, die ebenfalls auf das Inklusionsverständnis der Studierenden hinauswollte und halboffen gestellt wurde, zielte auf die Differenzierung zwischen Integration und Inklusion ab. Als Antwortmöglichkeiten auf die Frage, ob sie einen Unterschied zwischen beiden Konzepten sähen, standen zur Auswahl "Ja, und zwar ...", "Ich sehe keinen Zusammenhang." und "weiß nicht". Nach der "Ja"-Option war der Teilnehmer wiederum dazu aufgefordert, diesen Zusammenhang zu beschreiben. Mit der Begründung einer offenen Frageform verhält es sich ähnlich, wie bei der Frage zuvor: Den Studierenden sollten keine "fertigen" Antworten präsentiert werden, um ihre wirkliche Meinung zu erfahren. Das Ziel der Frage bestand darin, zu überprüfen, ob die Teilnehmer ihr Inklusionsverständnis auf die Integration von Kindern mit Behinderungen in den Regelunterricht beschränken oder ein weiter gefasstes Inklusionsverständnis aufweisen. Damit lässt sich an Sanders drei "Konzepte einer inklusiven Pädagogik" anknüpfen (siehe Kapitel 2.1.1), wonach es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, Inklusion über Integration zu definieren. Die Antworten der Studierenden können im Nachhinein auf diese Konzepte überprüft werden.
Als abschließende Filterfrage wurde nach der Kenntnis des "Index für Inklusion" gefragt. Diese Frage ist ein Indikator des Wissens über Inklusion, da der "Index für Inklusion" ein sehr entscheidendes Instrument darstellt, Inklusion innerhalb eines Schulentwicklungsprozesses in die Tat umzusetzen. Diesen Index zu kennen ist für Grundschullehramtsstudierende von daher von Relevanz, weil er deutlich macht, wie das theoretische Konzept der Inklusion in der Schule Realität werden kann. Dadurch, dass die Frage mit dichotomen Antwortvorgaben im Sinne von "ja" und "nein" zu beantworten ist, stellt sie (im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Fragen) einen geringen kognitiven Aufwand für die Teilnehmer dar.
Der folgende Fragenkomplex, der als letztes dem Wissensbereich zuzuordnen ist und wieder für alle Teilnehmer zugänglich war, bestand darin, den Wahrheitsgehalt von vier Aussagen zu beurteilen. Dabei gab es pro Aussage die Antwortmöglichkeiten "wahr", "falsch" und "weiß nicht". Das Hauptanliegen dieser Fragestrategie bestand darin, herauszufinden, ob den Teilnehmern die UN-Behindertenrechtskonvention und das darin beschlossene Recht auf inklusive Bildung bekannt ist. Anders als bei der Frage bezüglich des "Index für Inklusion" wollte ich bei dieser bedeutsamen Frage nicht bereits mit der Fragestellung implizieren, dass es eine solche Konvention gibt. Aus diesem Grund bot sich die Wahl der Beurteilung des Wahrheitsgehaltes von Aussagen an. Zwei der vier Aussagen waren korrekt, zwei falsch. Neben der Frage bezüglich der UN-Konvention wurde folgende wahre Aussage hinzugefügt: "Alle Schulgesetze der Bundesländer Deutschlands sehen das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern vor." Dieser Satz entstammt dem Diskussionspapier der Kultusministerkonferenz zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention in Deutschland [vgl. Kultusministerkonferenz, 2010c, S. 4]. Auch diese Aussage macht deutlich, welche Relevanz Gemeinsamer Unterricht in Deutschland hat. Von daher ist interessant, ob die Teilnehmer diese Aussage für wahr halten oder nicht. Die beiden Falschaussagen betreffen das Vorkommen von inklusiven Schulen in Nordrhein-Westfalen sowie eine finanzielle Unterstützung für inklusiv arbeitende Schulen. Dabei musste darauf geachtet werden, dass die Fragen realistisch formuliert werden, auch wenn sie imaginäre Sachverhalte betreffen. Aus diesem Grund wurde beispielsweise der Frage über das Vorkommen inklusiver Schulen der Zusatz "(Stand: Februar 2011)" hinzugefügt.
Im dritten Hauptteil des Fragebogen ging es darum, herauszufinden, welche Einstellung die Studierenden gegenüber Inklusion haben. Da dieser Bereich in der Auswertung dieser Masterarbeit wie oben erläutert jedoch zum Großteil unberücksichtigt bleibt, werde ich nur kurz auf dessen Konstruktion eingehen.
Um Einstellungen in Erfahrung zu bringen, bietet es sich besonders an, die Befragten subjektive Einschätzungen vornehmen zu lassen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung für die Wahl des passenden Frage-Antwort-Formates auf eine Matrix-Skala: Es wurden bestimmte Aussagen verfasst, denen die Teilnehmer auf einer sechsstufigen Skala nach ihrer Meinung zustimmen oder die sie ablehnen konnten. Dabei waren nur die Endpunkte der sechsstufigen Skala benannt und zwar mit den Verankerungen "trifft überhaupt nicht zu" und "trifft voll und ganz zu". Insgesamt verfasste ich 22 Aussagen, zu denen Stellung bezogen werden sollte. Thematisch ging es in erster Linie darum, wie die Studierenden das Konzept der Inklusion bewerten und dementsprechend zu Heterogenität, der Integration von Kindern mit speziellem Förderbedarf und der Umsetzung und den damit verbundenen Maßnahmen von Inklusion stehen. Während ein Teil der Aussagen primär auf die Einstellung zum Konzept der Inklusion abzielte, sollte der andere Bereich Aufschluss darüber geben, wo die Ängste, Befürchtungen und Schwierigkeiten bezüglich Inklusion auf Seiten der Studierenden liegen. Bei diesen Fragen handelt es sich weniger um die Einstellung zu Inklusion als viel mehr um eine Selbsteinschätzung im Zusammenhang mit der zukünftigen Inklusions-Situation.
Dabei zielten einige Fragen darauf ab, wie sich die Studierenden auf Inklusion in der Schulpraxis vorbereitet fühlen. Da diese Fragen wiederum direkt auf die Vorbereitung durch die Universität zurückzuführen sind, werden sie in der Ausarbeitung dieser Arbeit berücksichtigt. Es handelt sich dabei um folgende zwei Aussagen: "Ich fühle mich im Moment nicht ausreichend qualifiziert, um in einer Klasse mit behinderten Kindern zu arbeiten." und "Mir fehlen Mittel und Konzepte, mit denen ich die Lernbedürfnisse jedes Kindes individuell erfüllen kann.". Anhand dieser beider Aussagen kann ermittelt werden, wie kompetent sich die Studierenden in ihrer späteren Lehrerrolle in der inklusiven Praxis einschätzen. Die erstgenannte Frage bezieht sich speziell auf Kinder mit Behinderungen und berücksichtigt dabei nicht die anderen Heterogenitätsdimensionen. Die Integration von Kindern mit Behinderungen stellt jedoch eine sehr einschneidende Umstellung in Richtung einer inklusiven Schullandschaft insbesondere für Grundschulpädagogen dar, weswegen hier explizit darauf eingegangen wird. Die zweite Frage hingegen zielt auf die individuelle Förderung ab. Diese ist im Vergleich zu nicht-inklusiven Schulen keine komplett neue didaktische Maßnahme, gewinnt aber in inklusiven Settings an Bedeutung, da sie gewissermaßen die alles entscheidende Grundlage für schulischen Erfolg aller Kinder bildet.
Zwei weitere Fragen, die zu einem gewissen Teil dem Bereich der Einstellungen zuzuordnen sind, aber zum anderen auch Wissensaspekte betreffen, wurden ebenfalls in den Fragebogen integriert. Die erste Frage zielte auf die Einschätzung der Teilnehmer ab, welche Kompetenzen und Aufgabenfelder sie für angehende Lehrkräfte am wichtigsten erachten. Mit dieser Frage sollte deutlich werden, ob die Teilnehmer die Bedeutung der Veränderung der Kompetenz- und Aufgabenbereiche der Lehrperson im Zusammenhang mit der Veränderung in Richtung eines inklusiven Schulsystems sehen. So wurde eine Vielzahl von Aspekten aufgelistet: Belastbarkeit, Beobachtung, Diagnostik, Einfühlungsvermögen, Fachwissen, Gelassenheit, Gestaltung der Lernumgebung, Humor, Ich-Stärke, Kommunikationsfähigkeit, Medienkompetenz, Methodenkompetenz, Organisation, Toleranz, Transparenz und Unterrichtsvorbereitung. Diese Auswahl wurde zunächst nach eigener Überlegung getroffen und anschließend durch Literaturarbeit ergänzt. Da es neben dieser Auswahl jedoch sicherlich noch weitere Bereiche gibt, die für Lehrer wichtig sind, wurde hierzu ein Feld zur freien Texteingabe zur Verfügung gestellt. Außerdem bot ich die Option des "weiß nicht" an. Da die Teilnehmer sicherlich eine Vielzahl der angegebenen Aufgaben- und Kompetenzbereiche für wichtig halten, begrenzte ich die Auswahl auf vier mögliche Items, um eine Prioritätsbewertung auf Seiten der Befragten zu erreichen.
Bei der zweiten Frage wurden die Studierenden dazu aufgefordert, Stichwörter zu nennen, die sie am stärksten mit Inklusion assoziieren. Vom Antwortformat gleicht diese Frage der zuvor erläuterten Frage, da auch hier eine Mehrfachantwort von maximal vier Antwortoptionen, sowie die weitere freie Texteingabe und die Option "weiß nicht" möglich waren. Folgende Assoziationswörter wurden angeboten: Menschen mit Behinderungen, Heterogenität, Vielfalt, Ausgrenzung, Menschen mit Migrationshintergrund, Eingliederung, Anpassung, Chancengleichheit, Grundhaltung, Gleichmacherei, Randgruppen, Individualität, Chance, Hindernis, Multikulturelle Gesellschaft, Zukunft, Teilhabe und Integration. Diese Frage kann als Ergänzung zu der Fortführung des Satzes "Eine inklusive Schule..." aus dem Wissensbereich gesehen werden, da auch hier deutlich wird, welches Inklusionsverständnis bei den Studierenden verankert ist.
Neben diesen drei Hauptthemenbereichen der Arbeit wurden abschließend noch einige generelle Schlussfragen gestellt. Sie dienten zum einen dazu, einige zusätzliche Informationen in Erfahrung zu bringen und zum anderen, um einen "runden" Abschluss der Umfrage zu sichern.
Hierbei handelte es sich um vier Fragen, wovon zwei auf die generelle Studiums-Situation abzielten: Zum einen wurde nach der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Studium gefragt und zum anderen nach der eigenen Entschlossenheit, den Lehrerberuf ausüben zu wollen. Eine weitere Frage befasste sich mit der zukünftigen Lehrerrolle und zwar erforderte sie eine Einschätzung zu der Wahrscheinlichkeit, später an einer inklusiven Schule zu unterrichten. Diese drei Fragen trugen allesamt das selbe Antwortformat: Eine sechsstufige endpunktbenannte Skala, die sich jedoch in ihrer genauen Bezeichnung (je nach Frageformulierung) unterschieden: Die negativen Extrema lauteten "sehr unzufrieden", "sehr unsicher" bzw. "sehr unwahrscheinlich", die positiven "sehr zufrieden", "sehr sicher" bzw. "sehr wahrscheinlich".
Eine weitere Frage, die als einzige dieser Schlussfragen mit in die hier bearbeitete Auswertung aufgenommen wird, will in Erfahrung bringen, ob die Studierenden ein Pflichtseminar für alle Lehramtsstudierenden zum Thema Inklusion befürworten. Diese Frage lehnt sich an die Studie "'Aus Zwang wurde Interesse'. Eine Studie zur Wirksamkeit von Seminaren zum Gemeinsamen Unterricht in Berlin." von Demmer-Dieckmann an, die sie innerhalb von drei Semestern zwischen 2005 und 2006 an der TU-Berlin durchgeführt hat [vgl. Demmer-Dieckmann, 2007]. In Berlin gibt es seit 1999 eine verpflichtende Veranstaltung für alle Lehramtsanwärter zum Thema Integrationspädagogik. Dieses Angebot ist neben einem Pflichtbereich dieser Thematik in Sachsen-Anhalt einzigartig in Deutschland. Die Teilnehmer der Studie haben allesamt diese Seminare besucht und bewerteten sie rückblickend. Als Ergebnis der Studie konnte gezeigt werden, dass über 90 % der Teilnehmer eine positive Haltung zum Gemeinsamen Unterricht haben und sogar 85 % ein Pflichtseminar zu diesem Thema befürworten. Insgesamt hat sich die Einstellung und Bewertung von Inklusion durch das Seminar verbessert [vgl. Demmer-Dieckmann, 2007, S. 161].
Als abschließende Interaktionsform des Fragebogens wurde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Bewertungen, Meinungen oder Einschätzungen abzugeben. Diese Einladung wurde bewusst offen gestaltet, sodass sich die Teilnehmer nicht eingeengt fühlten, ihre spontanen Eindrücke nach der Bearbeitung des Fragebogens für sich zu behalten. Die genaue Formulierung lautete: "Falls du noch Anmerkungen zur Umfrage hast oder du gerne noch etwas loswerden willst, kannst du das hier tun."
Zusammenstellung des Fragebogens
Im vorangegangenen Teil der Arbeit stand die Mikroplanung im Vordergrund, da die einzelnen Fragen der jeweiligen Themenbereiche im Fokus der Betrachtung lagen. In diesem Teilabschnitt gerät die Makroplanung in den Blick, da die wesentlichen Bausteine des Fragebogens anschließend in eine schlüssige Gesamtreihenfolge gebracht werden müssen [vgl. Paier, 2010, S. 102]. So unterliegt jeder Fragebogenverlauf einer Dramaturgie, um die Teilnehmer zu motivieren, die Umfrage bis zum Ende durchzuführen [vgl. Paier, 2010, S. 103f.]. Es entscheiden meistens schon die ersten Fragen darüber, ob ein Teilnehmer den Fragebogen abbricht oder bis zum Ende beantwortet. Aus diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung, für einen geeigneten Einstieg in den Fragebogen zu sorgen.
Generell gilt, dass die Sukzession des Fragebogens sich so verhält wie jede zielgerichtete Kommunikation und aus diesem Grunde auch die entsprechenden Elemente wie Einleitung und Abschluss, sowie ein thematischer Höhepunkt vorhanden sein sollten [vgl. Porst, 2008, S. 135]. Zu achten ist dabei aber auf Folgendes: So ist sowohl bei der Reihenfolge der Fragen als auch bei der der Antwortmöglichkeiten darauf zu achten, dass die jeweilige Beantwortung der Frage nicht durch den so genannten "Halo-Effekt" beeinflusst wird [vgl. Scholl, 2009, S. 216]. Unter dem Halo-Effekt versteht man die Gegebenheit, dass die vorherigen Fragen noch so im Bewusstsein des Teilnehmers verankert sind, dass die Entscheidung für die Antwort der aktuellen Frage von diesen geprägt ist.
Jeder Online-Fragebogen muss mit einer Titelseite beginnen, die den 'Auftraggeber', den Zweck, die Thematik und den Rahmen der Umfrage beinhaltet. Diese Begrüßung sollte auf eine möglichst motivierende Weise geschehen, damit dem Teilnehmer die Relevanz seiner Teilnahme deutlich wird. So begann der Begrüßungstext meiner Umfrage damit, dass ich meine Freude über die Teilnahme des Befragten ausdrückte und deutlich machte, dass er mit dazu beitragen könne, wichtige Erkenntnisse über die Lehrerbildung zu liefern und langfristig an deren Verbesserung mitzuwirken. Des Weiteren gab ich das Anstreben des Berufs des Grundschullehrers als Bedingung für den Fragebogenteilnehmer an. Anschließend wurde ausgesagt, dass die Studie im Rahmen meiner Masterarbeit stattfindet, die die Abschlussarbeit meines Grundschullehramtsstudiums an der Universität Münster darstellt.
Wichtig war es mir außerdem darauf hinzuweisen, dass auch diejenigen an der Umfrage teilnehmen können, die bislang nichts oder wenig über Inklusion gehört haben, weil ich auf diese Weise vermeiden wollte, dass Studierenden, die diesbezüglich keinen Erfahrungshintergrund haben, die Studie gar nicht erst beginnen würden. Anschließend wurden noch einige technische Anmerkungen gegeben, indem die Bearbeitungszeit sowie Informationen über den Datenschutz geliefert wurden. Bevor die Begrüßung durch ein Dankeswort beendet wurde, wies ich auf die Verwendung der maskulinen Form innerhalb des Fragebogens hin, womit jedoch stets beide Geschlechter gemeint seien. Als Kontaktdaten gab ich auf der Titelseite meinen Namen sowie meine Email-Adresse an, die aber auch auf jeder neuen Fragebogenseite erschienen.
Für die thematische Gestaltung des Fragebogens behielt ich die oben erläuterten Blöcke (Erfahrungen, Wissen, Einstellung etc.) zum Großteil bei. Dies erschien mir logisch, da ein Fragebogen aus thematisch zusammenhängenden und inhaltlich geschlossenen Fragebatterien bestehen sollte [vgl. Paier, 2010, S. 104]. Die Übergänge sollten durch passende Formulierungen eingeleitet werden, in denen bereits angekündigt wird, worauf der folgende Fragenbereich abzielt.
Als Einstiegsteil entschied ich mich dafür, die soziodemografischen Fragen anzubringen, auch wenn in der Literatur dazu geraten wird, diese an den Schluss zu stellen [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 36], [vgl. Scholl, 2009, S. 175]. An gleicher Stelle wird jedoch auch darauf verwiesen, dass mit leichten Einstiegsfragen begonnen werden soll, was meines Erachtens auf die soziodemografischen Fragen zutrifft. Der Hauptgrund für die Voranstellung bestand jedoch darin, dass die Studierenden durch die Frage des Studiengangs nochmals darauf hingewiesen werden sollten, dass die Umfrage nur auf Studierende des Grundschullehramts abzielt und somit Studierende, die beispielsweise das Gymnasiallehramt studieren, den Fragebogen direkt abbrechen und nicht erst zum Ende der Umfrage darauf aufmerksam werden.
Bei der Reihenfolge ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass kognitiv anspruchsvolle und eventuell heikle Fragen in der Mitte der Befragung platziert werden, da sich die Teilnehmer eingangs erst auf den Fragebogen einlassen müssen und zum Ende oft Ermüdungserscheinungen auftreten [vgl. Scholl, 2009, S. 175]. Generell erschien es mir wichtig, die relevanteren Fragen eher am Anfang als am Ende zu stellen, um den Teilnehmern die Thematik vor Augen zu führen und um die größte Aufmerksamkeit zu Beginn zu nutzen. Den für die Befragten anstrengendsten Teil dieses Fragebogens werden vermutlich die zwei Einstellungs-Matrizen darstellen, da jedes Item zunächst genau erfasst werden muss, um sich anschließend dazu zu positionieren. Aus diesem Grund sollte der Einstellungs-Bereich in die Mitte des Fragebogens integriert werden. Als thematische Einstiegsfrage wählte ich die Frage bezüglich der Selbsteinschätzung des Wissens über Inklusion. Diese Frage macht direkt den Themenbezug des Fragebogens deutlich, betrifft die Befragungsperson persönlich und ist technisch einfach sowie von allen Teilnehmern zu beantworten. Hinzukommt, dass sie spannungsvollen Charakter aufweist, da man unter Umständen wissen möchte, wie das Thema Inklusion im weiteren Verlauf des Fragebogens akzentuiert wird.
Insgesamt legte ich mich auf folgende Reihenfolge fest:
-
Soziodemografische Fragen
-
Wissensbereich
-
Erfahrungsbereich, Professionalisierung
-
Einstellungsbereich
-
Lehrerkompetenzen und Stichwörter zu Inklusion assoziieren
-
Erfahrungsbereich, privat
-
Schlussfragen
So wie eine Umfrage mit einer ansprechenden Titelseite beginnen sollte, sollte sie auch mit einem Dankeschön an die Teilnehmer auf einer Schlussseite enden [vgl. Porst, 2008, S. 157]. Zusätzlich gab ich den Hinweis, dass das Browserfenster nun geschlossen werden könne, um deutlich zu machen, dass die Umfrage komplett beendet ist und nicht beispielsweise noch auf ein "Senden-Button" oder ähnliches geklickt werden müsse.
Um die Fragebogenkonstruktion abzurunden, mussten noch einige Überlegungen bezüglich des Layouts angestellt werden.
Da es sich bei dem Fragebogen um eine Online-Befragung handelt und somit die Beantwortung am Monitor stattfindet, stand die Frage im Raum, wie viele Fragen auf einer Bildschirmseite angeordnet werden sollen [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 45]. Hier gibt es die Möglichkeiten, nur jeweils eine Frage auf einer Seite zu platzieren, als auch den gesamten Fragebogen innerhalb einer einzigen Seite zu integrieren. Darüber hinaus können die Fragen auch in kleineren Gruppen pro Bildschirmseite angelegt werden. Ich entschied mich für letztgenannte Variante, da die erste Möglichkeit mit zu viel Unruhe und "Weiterklicken" verbunden und die zweite durch Unübersichtlichkeit und "Weiterscrollen" geprägt ist. In Einzelfällen (zum Beispiel wenn es sich um eine Filterfrage handelte) wurde nur eine Frage auf einer Bildschirmseite platziert, in den meisten Fällen jedoch (je nach Länge der Items) drei bis fünf Fragen. Es galt dabei zwei Kriterien zu beachten: Zum einen mussten die Fragen thematisch einwandfrei zusammenpassen und zum anderen sollte immer in etwa eine Bildschirmseite abgedeckt sein, um zu verhindern, dass die Teilnehmer oft nach unten scrollen müssen. Des Weiteren galt es zu berücksichtigen, dass keine Fragen inklusive zugehöriger Antwortoptionen gesplittet wurden: Eine Frage sollte nicht auf einer Seite begonnen und auf der nächsten Seite weitergeführt werden [vgl. Scholl, 2009, S. 177]. Aufgrund der Tatsache, dass sich somit mehrere Fragen auf einer Bildschirmseite befanden, musste dafür gesorgt werden, dass diese deutlich voneinander abgetrennt und einzeln erkennbar sind. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Fragen fortlaufend durchnummeriert wurden und genügend Freiraum zwischen ihnen bestand. Zur Übersichtlichkeit war es ebenso von Bedeutung, Antworten, die mehreren Optionen beinhalten, visuell zeilenweise voneinander zu unterscheiden. Besonders trifft dies auf die Einschätzungsmatrizen zu, bei denen mehrere Items hintereinander geschaltet sind. Sichergestellt wurde die visuelle Hervorhebung in meinem Fragebogen durch eine hellblaue Untermalung bei jeder zweiten Antwortoption.
Folgende Elemente waren zudem auf jeder Fragebogenseite abgebildet: Oberhalb der Bildschirmseite war links das Logo der Universität Münster platziert, da die Darstellung des Logos der zugehörigen wissenschaftlichen Einrichtung den Teilnehmern Seriösität signalisiert [vgl. Gräf, 2010, S. 130]. Rechts war der Fortschrittsbalken integriert, der die Befragten darüber informierte, wie viel Prozent der Umfrage sie bereits bearbeitet hatten. Unterhalb jeder Bildschirmseite waren meine Kontaktdaten sowie die Namen "Zentrum für Lehrerbildung" und "Universität Münster" zu finden. Dem Weiter-Button auf der rechten Seite am unteren Rand des Fragebogens zum Laden der nächsten Fragebogenseite wurde ein Zurück-Button auf der linken Seite hinzugefügt, um den Teilnehmern zu ermöglichen, nochmals die vorherigen Fragen zu betrachten oder ihre Antwortauswahl zu ändern.
Nachdem der Fragebogen vorläufig fertiggestellt war, wurde er dem Pretest unterzogen. Dieser dient der Verbesserung des Fragebogens, prüft, ob er funktioniert und ob es inhaltliche Mängel gibt. Dabei kann man zwischen dem technischen Pretest und dem eigentlichen, allumfassenden Pretest unter möglichst authentischen Feldbedingungen unterscheiden [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S.47-50]. Im technischen Pretest werden die visuelle Darstellung, ein fehlerloses Funktionieren der eingesetzten Antwortformate, die verschiedenen Filterwege, die Datenübermittlung und der Ex- und Import der Daten aus der Software in das entsprechende Analyseprogramm kontrolliert [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 47f.].
Hinsichtlich des eigentlichen Pretest ist es von besonderer Bedeutung, die beiden Aspekte "Verständlichkeit" und "erschöpfende Antwortmöglichkeiten" im Blick zu haben [vgl. Kuckartz u. a., 2009, S. 49]. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, wie hoch die Aufmerksamkeit der Befragten bei einzelnen Fragen sowie während des gesamten Verlaufs ist, ob es heikle Stellen im Fragebogen gibt und ob manche Fragen Fehler provozieren [vgl. Scholl, 2009, S. 203f.]. Auch bezüglich der Reihenfolge und des oben beschriebenen "Halo-Effektes" eignet sich der Pretest. Letztlich gibt der Pretest auch Aufschluss über die Bearbeitungszeit des Fragebogens.
Den Pretest zu vorliegendem Fragebogen haben zehn Leute durchgeführt. Hierbei handelte es sich um zwei fachfremde Personen, zwei ebenfalls fachfremde Personen, die allerdings Erfahrungen mit Fragebogenkonstruktionen haben, zwei Grundschullehrer, ein Sonderschullehrer, zwei angehende Grundschullehrer und ein Student der Sonderpädagogik. Insgesamt hat der Pretest noch einige Stellen des Fragebogens ausgebessert: An manchen Stellen waren die Frageformulierungen nicht ganz eindeutig oder die Antwortmöglichkeiten nicht ausschöpfend. In technischer Hinsicht stellten sich keine Probleme dar. Die Dauer der Bearbeitung des Fragebogens wurde mir mit 10 bis 15 Minuten zurückgemeldet.
Mit den eingeholten Verbesserungsvorschlägen wurde der Fragebogen nochmals überarbeitet, sodass daraufhin die Feldphase begonnen werden konnte. Über einen Web-Link war der Fragebogen den Teilnehmern zugänglich.
In diesem Abschnitt werden zunächst wichtige Randdaten bezüglich der Feldphase der Studie genannt, bevor auf die Herstellung des Kontaktes zur Stichprobe und den Rücklauf näher eingegangen wird. In einem letzten Schritt wird die Datenaufbereitung erläutert, die die Bereinigung der Daten einschließt. Dies ist notwendig, um anhand eines aufgearbeiteten Datensatzes Ergebnisse entwickeln zu können, die im anschließenden Kapitel präsentiert werden.
Feldphase
Die Feldphase der Studie vollzog sich über einen Monat, vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2011. Dieser Zeitpunkt wurde ins Auge gefasst, weil ein späterer Termin in die Prüfungsphase zu Ende eines jeden Semesters gefallen wäre und die Studierenden dann vermutlich weniger Zeit und Sinn für diese Umfrage gehabt hätten.
Zunächst stand die Überlegung an, wie ich die Stichprobe meiner Studie erreichen sollte. Da ich selbst Studierende der Universität Münster bin, war es weniger ein Problem, Studierende dieser Universität als Probanden für meine Studie zu gewinnen, als von den übrigen sieben Hochschulen. Da ich demnach keinen direkten Kontakt zu den Studierenden haben würde, musste ich auf indirektem Weg an sie gelangen. Aus diesem Grund suchte ich nach passenden "Verteilern", denen ich per Email von meiner Studie schrieb und die ich bat, den Link unter Studierenden des Grundschullehramts zu publizieren. Hierfür fielen Dozierende sowie die Fachschaften in den Blick. Außerdem könnten die Zentren für Lehrerbildung der jeweiligen Universitäten bei der Verbreitung behilflich sein.
Eine Internet-Recherche führte dazu, dass ich die Fachschaften der Grundschulstudierenden aller Universitäten per Email kontaktierte, abgesehen von der Universität Köln, da hier keine spezifische Fachschaft gefunden werden konnte. In Köln gibt es allerdings die Fachschaft Integration/Inklusion, an die ich mich wandte. Ebenso versandt ich Emails an die Zentren für Lehrerbildung, die es an allen der acht relevanten Universitäten gibt. Des Weiteren recherchierte ich nach Dozierenden, die im Grundschulbereich tätig sind und dort eine verantwortungsvolle Position innehaben, da ich mir so eine weit verbreitete Verteilung erhoffte. So sendete ich mein Anschreiben zunächst an etwa zwei bis drei Dozenten (zum Teil auch an Dekanate) pro Universität. An der Universität Münster bat ich lediglich eine Dozentin um die Bekanntmachung des Links. Eine Besonderheit tat sich an der Universität Duisburg/Essen auf, weil mir hier der Kontakt der studentischen Vertreterin im Ausschuss Lehrerbildung vermittelt wurde, die den Link meiner Umfrage verbreiten würde. An der Universität Siegen gibt es die "Gesellschaft zur Förderung der Lehrerbildung an der Universität Siegen", denen ich ebenso mein Anliegen schickte. Neben diesen Kontakten traf ich im Internet auf einige Emailadressen studentischer Hilfskräfte im Primarbereich, denen ich von meiner Studie schrieb und weiterhin sendete ich persönliche Emails an die Mitglieder der Fachschaften, sofern diese ihre Emailadressen im Internet veröffentlicht hatten.
Anhand dieser Kontaktadressen verschickte ich am 15. und 16. Juni 82 Emails, die abgesehen von der Universität Münster auf die sieben weiteren Hochschulen weitgehend gleichverteilt fielen.
In den ersten Tagen der Feldphase versuchte ich auf direktem Weg Kontakt zu Studierenden herzustellen. Da ich an der Universität Münster einige Studierende persönlich kenne, wandt ich mich an sie und bat sie wiederum, den Link der Umfrage an weitere Kommilitonen zu versenden. Hinzukam, dass ich in zwei Seminaren Emailadresse von Probanden sammelte, die sich dazu bereit erklärten, an meiner Studie teilzunehmen. Aber auch von den Universitäten Paderborn, Siegen, Bielefeld und Dortmund waren mir jeweils ein oder zwei Personen bekannt, die dort Grundschullehramt studieren, sodass ich auch diese um die Verbreitung meiner Umfrage bat.
Da die Rückmeldung auf meine Emails relativ gering ausfiel (12 Antworten von Dozenten mit positiver Rückmeldung, dass sie die mail an Studierende oder an weitere Dozenten, die für den Bereich zuständig sind, weitergeleitet haben, 2 positive Rückmeldungen des Zentrums für Bildungsforschung und Lehrerbildung Paderborn und des Zentrum für Lehrerbildung sowie einzelne Rückmeldungen von Studierenden, einer positiven Rückmeldung der Fachschaft Integration/Inklusion aus Köln und einer negativen der Fachschaft Bielefeld), entschied ich mich, weitere Dozenten anzuschreiben. So verfasste ich am 21. Juni nochmals 53 Emails und schickte sie an Lehrende im Primarbereich der Universitäten Siegen, Wuppertal, Bielefeld, Dusiburg/Essen, Köln und Dortmund. Da ich von Studierenden aus Paderborn und Münster bereits verhältnismäßig viele Teilnahmen verzeichnen konnte, verzichtete ich auf weitere Emails an diese Hochschulen. Außerdem wandt ich mich an das InKö-Projekt, das in Köln ansässig ist, und fragte, ob sie eine Idee der weiteren Verteilung sehen würden, da sich aus Köln erst sehr wenige Studierende an der Umfrage beteiligt hatten .
Insgesamt antworteten nach dieser Periode knapp 20 Personen auf meine Emails, von denen der Großteil meine Studie befürwortete und den Link an Studierende weitergegeben hatte. Auch die Projektleiterin von InKö antwortete, dass sie den Link an Kollegen weitergeleitet hätte und fragte, ob sie auf ihrer Homepage oder im nächsten Newsletter auf meine Studie verweisen sollten. Dies lehnte ich jedoch ab, da ich vermeiden wollte, eine spezifische Zielgruppe zu erreichen, die vermutlich deutlich besser über Inklusion informiert ist als der "Durchschnitt". Ich erstellte jedoch einen Aushang, den sie in der Humanwissenschaftlichen Fakultät platzierte. Des Weiteren wurde ich von einer Dozentin der Universität Köln sowie von der Fachschaft für Integration/Inklusion darauf hingewiesen, mich an das Studierenden Service-Center zu wenden. Diese sahen mit meiner Anfrage aber leider ihren Verantwortungsbereich überschritten.
Eine Besonderheit ergab sich dadurch, dass die Studiendekanin der Universität Dortmund meinen Fragebogen durch das Justiziariat prüfen ließ, bevor sie ihn weiterleiten konnte. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass die Angaben bezüglich der Muttersprache und der aktuellen Semesterzahl gestrichen werden müssten, da sonst einzelne Studierende identifizierbar seien. So stellte ich für diesen Fall den Fragebogen erneut zusammen, sodass ich eine zweite Version erhielt, die ohne die zwei zu entfernenden Fragen auskam. Im Endeffekt nahmen über diesen Fragebogen jedoch nur 10 Teilnehmer an der Studie teil. Am 29.6. verfasste ich nochmals 18 Emails an Lehrende des Primarbereichs der Universität Wuppertal, die ich zuvor nicht berücksichtigt hatte. Eine letzte Kontaktierungsphase nahm ich am 2. Juli vor, indem ich 25 ausgewählten Dozierenden eine Wiederholungs- Email geschrieben habe, von denen ich bislang keine Rückmeldung erhalten hatte. Bis zum Abschluss der Studie erhielt ich noch etwa 20 Rückmeldungen, von denen die Hälfte berichtete, dass sie den Link an Studierende weitergeleitet hätte.
Insgesamt wurde etwa ein Viertel meiner knapp 200 Emails beantwortet. Dies ist allerdings nur ein sehr geringer Indikator über die Teilnehmerbereitschaft, da die Adressaten der Emails wie oben beschrieben nur eine Verteilerfunktion einnahmen und nicht eingeschätzt werden kann, wie viele der Studierenden, die den Link erhalten haben, auch wirklich an der Umfrage teilgenommen haben. Hinzukommt, dass weitere Ansprechpartner meine Email eventuell weitergeleitet haben, mir diesbezüglich aber keine Rückmeldung gegeben haben.
Die folgende Tabelle zeigt den Rücklauf der 31-tägigen Feldphase im Überblick, dargestellt wird bereits der bereinigte Datensatz. Ersichtlich wird, dass die Folgetage der Tage, an denen ich Kontakt zu Vermittlungspartnern aufnahm, einen Anstieg an Teilnahmen aufweisen.

Abbildung 3.1: Rücklauf der Daten (Es sei darauf hingewiesen, dass die Tage 28.6.und 1.7. nicht in das Diagramm aufgenommen wurden, da an diesen Tagen niemand den Fragebogen bearbeitet hat.)
Datenaufbereitung
Nachdem die Feldphase abgeschlossen war, mussten die Daten in das Auswertungsprogramm SPSS exportiert und bereinigt werden.
Die online-Plattform oFB, mit der die Umfrage durchgeführt wurde, hat die Aufrufe des Fragebogens kontrolliert und zudem unterschieden, wer nur die erste Seite des Fragebogens betrachtet und wer den kompletten Fragebogen bearbeitet hat. Zudem wurden die Abbruchquoten dokumentiert. So konnte ersichtlich werden, dass knapp 974 Personen die Titelseite des Fragebogens aufgerufen haben[8]. Hier kann natürlich nicht garantiert werden, dass es sich dabei um 974 verschiedene Menschen handelte. Sicherlich haben einige Teilnehmer zunächst betrachtet, worum es bei der Umfrage geht, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt daran teilgenommen haben.
Des Weiteren hat die Software dokumentiert, dass von diesen 974 Personen 644 Studierende den Fragebogen begonnen haben. Dementsprechend haben 330 Personen nur die Titelseite betrachtet. Dies macht ein Verhältnis von etwa zwei Dritteln zu einem Drittel aus. 424 Teilnehmer haben mindestens 55 % der Fragen beantwortet. Die Grenze von 55 % wurde vom System gewählt, vermutlich, da der Wert knapp über der Hälfte liegt. Dies bedeutet, dass 220 Teilnehmer den Fragebogen zunächst begonnen, aber während der Umfrage abgebrochen haben.
Direkt ersichtlich wird ebenso, auf welchen Seiten die Teilnehmer den Fragebogen beendet haben. Der Großteil aller Abbrecher hat nach den ersten vier Fragen abgebrochen, nämlich insgesamt 170 der 220 Abbrecher, was ungefähr drei Viertel der Abbruchquote ausmacht. Dies stellt nach Gräf einen typischen Verlauf bei Online-Umfragen dar: Es ist normal, dass die Abbruchquote speziell nach den ersten Fragen am höchsten ist. Dann fällt sie drastisch und steigt für die restliche Umfrage nur noch langsam, aber kontinuierlich an [vgl. Gräf, 2010, S. 60f.]. Dieses Muster bezieht sich in diesem Fragebogen auf die vier ersten Fragen, da es sich bei der ersten Seite um die Titelseite handelt, die beiden folgenden Seiten die soziodemografischen Daten erheben und auf der vierten Seite der thematische Einstieg beginnt. Allein auf Seite vier sind insgesamt 67 Abbrecher zu verzeichnen und ist damit die Seite mit der höchsten Abbruchquote.
424 Teilnehmer stellte also die oFB-Software als brauchbare Stichprobe dar. Nach Export der Daten musste dieser Datensatz aber nochmals persönlich überprüft werden. Ein Kriterium, das die Software nicht berücksichtigen konnte, bestand in der Frage nach dem Studiengang. Hier galt es zu prüfen, ob Teilnehmer, die kein Grundschullehramt studieren, dennoch an der Umfrage teilgenommen hatten. So wurden insgesamt 30 Teilnehmer aussortiert, die kein Grundschullehramt studierten, davon 14 Gymnasiallehrämtler, 8 Sonderlehr ämtler, 6 Lehrämtler für das Berufskolleg, einer für das Realschullehramt und einer für den Studiengang Pädagogik. Des Weiteren gab es auch in diesem Datensatz noch einige Teilnehmer, die nicht den kompletten Fragebogen bearbeitet hatten. Dementsprechend wurde der Datensatz nochmals um 26 Teilnehmer verringert, die mehr als 15 % des Fragebogens nicht beantwortet hatten. Letztlich entsprach der bereinigte Datensatz einer Stichprobengröße von 369 Teilnehmern.
Mit dem Export der Daten in das Auswertungsprogramm SPSS ging bereits die Kodierung der verschiedenen Merkmale einher. In Einzelfällen musste die Kodierung manuell nachgeholt werden, zum Beispiel wenn ein Teilnehmer keine Angabe gemacht und das Programm dies nicht entsprechend übernommen hatte. Zur Datenvalidierung [vgl. Toutenburg u. Heumann, 2008, S. 15f.] wurden zunächst die Häufigkeitsverteilungen pro Variable geprüft. An welchen Stellen es Besonderheiten gab, wird im Folgenden erläutert.
Bezüglich der Frage zum Studiengang musste in vier Fällen, in denen die Teilnehmer "Sonstiges" markiert und eine andere Bezeichnung für den Grundschullehramts-Studiengang angaben (zum Beispiel "Master of Education, GHRGe, Schwerpunkt Grundschule"), die Codierung der Antwort 1 "Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule, Schwerpunkt Grundschule" übernommen werden, da auch die vier Teilnehmer zu dieser Gruppe gehören. Des Weiteren wurde bei der Variable der aktuellen Studienphase eine Systematisierung der "Sonstiges-Eingabe" vorgenommen. Hierbei gab es 22 Teilnehmer, die entweder das Studium bereits beendet haben (17) oder sich derzeit in der Examensphase befinden (5). Diese Befragten habe ich nicht aus dem Datensatz gelöscht, auch wenn es unter Umständen keine aktuell Studierenden sin. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass ihr Studium noch nicht allzu lange zurückliegt. Eine weitere Ausbesserung musste bezüglich der Semesterangabe vorgenommen werden. Da es sich auch hierbei um eine freie Eingabe handelte, waren die Angaben zum Teil nicht identisch, da für das vierte Semester einige Teilnehmer beispielsweise "4." und andere "4" eingetragen haben. Dies wurde angeglichen.
Schließlich wurde manuell überprüft, ob die Studierenden die Frage der Anzahl der Veranstaltungen, die "inklusiv" oder "Inklusion" im Titel tragen, richtig verstanden und dementsprechend korrekt beantwortet hatten. Dies ließ sich daran überprüfen, dass die Studierenden die Titel dieser Veranstaltungen angeben sollten. So zeigte sich, dass viele Studierende angaben, dass sie eine oder mehrere "inklusive Veranstaltungen" besucht hätten, dies aber nach Überprüfung des angegebenen Titels in knapp 50 (!) Angaben nicht mit diesem übereinstimmte und somit korrigiert wurde. Auf diese Weise wurde die Anzahl der Veranstaltungen der Titelangabe angepasst.
Des Weiteren musste untersucht werden, wie das Antwortverhalten der Teilnehmer bei den (halb-) offenen Fragen ausfiel. Die Fragen, die eine "Sonstiges, und zwar..." - Antwortoption aufwiesen, wurden dahingehend geprüft, ob es hier zu Auffälligkeiten wie zum Beispiel der mehrmaligen Nennung desselben Begriffs von verschiedenen Teilnehmern kam. Da dies nicht der Fall war, wurde die Kategorie "Sonstiges" in allen Fragen beibehalten und es musste keine neue Antwortkategorie erstellt werden.
Die Betrachtung der freien Textantworten bezog sich auf die Frage der Fortführung des Satzes "Eine inklusive Schule..." und auf die Frage bezüglich des Zusammenhangs zwischen Inklusion und Integration. Die Antworten zu diesen Fragen sollten aus Auswertungszwecken systematisiert werden. Dabei war das Vorgehen bei beiden Fragen vom Prinzip her gleich angelegt: Zunächst wurden alle Antworten gelesen und bereits im Rahmen eines ersten Eindrucks überlegt, in welche Richtung die Antworten weisen und ob es Antwortformate gibt, die sich wiederholen. Dementsprechend wurden die ersten Kategorien anhand von prototypischen Beispielsätzen gebildet, denen die verschiedenen Textantworten der Teilnehmer zugeordnet wurden. Im Laufe dieses Zuordnungsprozesses wurden weitere Kategorien gebildet, wenn mehrere Aussagen den gleichen Inhalt aufwiesen. Die restlichen Antworten, die nicht mit den Kategorien übereinstimmten und sich nicht ähnelten, wurden in die Kategorie "Sonstiges" eingeordnet. Für die Satzfortführung "Eine inklusive Schule..." wurden neun und für die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration sechs Klassen konstruiert.
Die Fragen, in denen die sechsstufigen, endpunktbenannten Ratingskalen verwendet wurden, wurden ebenfalls geclustert. Hierbei wurden jeweils zwei Antwortmöglichkeiten zusammengelegt, sodass eine Unterteilung von beispielsweise "(sehr) schlecht", "mittel" und "(sehr) gut" entstand, die jeweils zwei Antwortoptionen präsentieren.
Im folgenden Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Online-Befragung vorgestellt. Hiermit soll im Endeffekt die übergeordnete Fragestellung "Wie werden Studierende des Grundschullehramts in Nordrhein-Westfalen von den Universitäten auf Inklusion vorbereitet?" beantwortet werden. Dabei liegt im Fokus der Betrachtung, ob die Studierenden Inklusion im Studium kennengelernt haben und wenn ja, was sie darüber und dafür gelernt haben. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels (siehe 3.1) wurde bereits erläutert, dass zur Beantwortung dieser Frage vier untergeordnete Fragestellungen entwickelt wurden. Auf diese geht die folgende Darstellung zunächst im Einzelnen ein, um im nächsten Kapitel die Interpretation der Ergebnisse vornehmen zu können.
Zur Darstellung der Ergebnisse sei hinzugefügt, dass Teilnehmer, die zur jeweiligen Frage keine Antwort gegeben haben, nicht in den Tabellen und Abbildungen festgehalten sind. Lediglich in Fällen, in denen mehr als 5 % der Teilnehmer keine Angabe gemacht haben (dies entspricht einer Häufigkeit von mehr als 18 Personen), wird dies in die Tabellen und Diagramme aufgenommen. Die Gesamtzahl der Teilnehmer variiert aus diesem Grund von Frage zu Frage leicht und weist nicht immer die Stichprobengröße von 369 auf.
Bevor auf die thematischen Ergebnisse eingegangen wird, werden kurz einige Informationen über die Stichprobe dargelegt. Hinsichtlich des Geschlechts hat sich die überdurchschnittlich hohe Frauenquote im Grundschullehramtsstudium auch in der Umfrage niedergeschlagen: Von 10 Teilnehmern sind neun weiblich und einer männlich. Die Verteilung auf die acht verschiedenen Universitäten veranschaulicht folgende Tabelle:
Tabelle 3.1: Universitäts-Zugehörigkeit
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Uni Bielefeld |
15 |
4,1 |
|
Uni Dortmund |
110 |
29,8 |
|
Uni Duisburg-Essen |
31 |
8,4 |
|
Uni Köln |
4 |
1,1 |
|
Uni Münster |
42 |
11,4 |
|
Uni Paderborn |
28 |
7,6 |
|
Uni Siegen |
39 |
10,6 |
|
Uni Wuppertal |
16 |
4,3 |
|
nicht beantwortet |
84 |
22,8 |
|
Gesamt |
369 |
100,0 |
Deutlich wird, dass die Verteilung sehr uneinheitlich ist: Während aus Köln nur fünf Teilnehmer zu verzeichnen sind, macht Dortmund mit 110 Befragten das Maximum aus. Unklar ist, wie diese ungleiche Verteilung zu erklären ist, da die Kontaktaufnahme zu Dozenten, Fachschaften etc., die die Verteilerfunktion übernahmen, bei allen Universitäten annähernd gleich verlief. Weiterhin ist auffällig, dass ein Großteil der Teilnehmer keine Angaben zu dieser Frage gemacht hat, nämlich knapp 23 %. Dies könnte man damit erklären, dass Studierende ihre Hochschule nicht in ein schlechtes Licht stellen wollen, wenn ihnen bewusst ist, dass diese wenige Veranstaltungen zu Inklusion anbietet. Andererseits könnte ein technischer Aspekt zur Erklärung herangezogen werden: Bei dieser Frage handelte es sich um die erste Frage auf einer Bildschirmseite, die zudem in einer Drop-Down-Auswahl angeboten wurde. Dadurch wirkte sie unscheinbarer und wurde unter Umständen von einigen Teilnehmern übersehen.
Bezüglich der Studienphase lässt sich sagen, dass sich knapp die Hälfte der Studierenden im Hauptstudium oder in der Masterphase befindet, etwa 45 % im Grundstudium bzw. in der Bachelorphase und ein Anteil von etwa 5 % das Studium bereits abgeschlossen hat. Dementsprechend haben an der Umfrage in etwa gleich viele Studierende des Grund- bzw. Bachelorstudiums wie Studierende des Haupt- bzw. Masterstudiums teilgenommen. Dies zeichnet sich auch in der Angabe des aktuellen Semesters ab: Den größten Anteil der Stichprobe machen die 96 Studierenden im siebten und achten Semester aus, was einen Anteil von über einem Viertel darstellt. Dies ist die Studienzeit des Masterstudiums. Den geringsten Anteil machen die Erst- und Zweitsemestler mit zusammen 14,6 % aus, abgesehen von den Studierenden, die bereits im neunten Semester oder länger studieren (insgesamt 10,8 %). Die Studierenden des dritten bis sechsten Semesters sind in etwa gleich stark vertreten, zwischen 22 und 24 %. Diese Angaben decken sich in etwa mit den Altersangaben, auf die aus diesem Grund nicht weiter eingegangen wird. Insgesamt kann man sagen, dass die Umfrage alle Semester annähernd gleichverteilt erreicht hat, wobei die höheren Semester der Regelstudienzeit tendenziell häufiger erreicht wurden.
Im folgenden Teil werden die Ergebnisse zu den vier Fragestellungen veranschaulicht.
1. Wie oft begegneten den Studierenden Veranstaltungen mit inklusionspädagogischen Inhalten?
Für diese Fragestellungen stand die Frage "Wie viele Veranstaltungen hast du bisher im Rahmen deines Studiums besucht, bei denen "Inklusion" oder "inklusiv" (im pädagogischen Sinn) im Titel genannt wurde?" im Mittelpunkt, da sie direkt Aufschluss über den Besuch von inklusiven Veranstaltungen gibt. Die Ergebnisse hierzu veranschaulicht folgende Tabelle:
Tabelle 3.2: Wie viele Veranstaltungen hast du bisher im Rahmen deines Studiums besucht, bei denen "Inklusion" oder "inklusiv" (im pädagogischen Sinn) im Titel genannt wurde?
|
Häufigkeit |
Prozent |
Kumulierte Prozente |
|
|
keine |
358 |
97,0 |
97,0 |
|
eine |
11 |
3,0 |
100,0 |
|
mehr als eine |
0 |
0,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
369 |
100,0 |
Wie in Kapitel 3.2.3 erläutert, musste diese Frage bezüglich ihrer Antworten korrigiert werden, da die Angabe des Titels bei einer Vielzahl der Antworten eben nicht "inklusiv" oder "Inklusion" enthielt. Somit gaben in den Original-Angaben 39 Personen an, eine Veranstaltung mit "Inklusion" oder "inklusiv" im Titel besucht zu haben, neun gaben zwei an und ein Teilnehmer drei. Nach dieser Korrekturmaßnahme blieben jedoch insgesamt nur 11 Teilnehmer übrig, die bereits eine Veranstaltung mit einem Titel zum Thema "Inklusion" besuchten. Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass 97 % der Studierenden noch keine Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion belegt haben.
Des Weiteren wurde im Fragebogen darauf eingegangen, ob Inklusion zumindest in einzelnen Sitzungen verschiedener Veranstaltungen in anderen Zusammenhängen thematisiert wurde. Außerdem interessierte, ob Veranstaltungen besucht wurden, in denen die Themen Integrationspädagogik bzw. Gemeinsamen Unterricht sowie Interkulturelle Pädagogik in einzelnen Sitzungen behandelt wurden. Diese Fachgebiete gelten als relevant für Inklusion, weil sie wichtige Teilbereiche inklusiver Settings bilden. Die Ergebnisse dieser drei Bereiche veranschaulicht folgendes Diagramm:
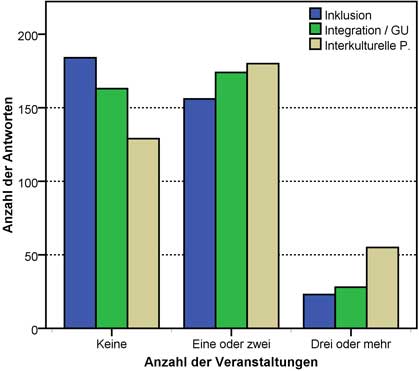
Abbildung 3.2: Besuch von Veranstaltungen, in denen Inklusion, Gemeinsamer Unterricht / Integrationspädagogik oder Interkulturelle Pädagogik mindestens einmal Inhalt einer Sitzung war
Ersichtlich wird, dass die Themen "Integrationspädagogik und Gemeinsamer Unterricht" sowie "Interkulturelle Pädagogik" insgesamt häufiger in einzelnen Sitzungen behandelt wurden als das Thema "Inklusion". Die Hälfte der Teilnehmer gibt an, dass sie dem Thema Inklusion bislang noch nie in einer einzelnen Sitzung begegnet ist, ein Anteil von 44 % sagt dies für Integrationspädagogik und Gemeinsamen Unterricht aus. Ein noch geringerer Anteil, nämlich 35 %, hat in universitären Veranstaltungen nie etwas zu Interkultureller Pädagogik gelernt. Insgesamt fällt auf, dass in allen drei Fällen selten mehr als zwei Veranstaltungen besucht wurden, in denen die entsprechenden Themen in mindestens einer Sitzung integriert waren: Für Inklusion und Integrationspädagogik / Gemeinsamen Unterricht haben weniger als 10 % der Teilnehmer mehr als zwei Veranstaltungen besucht, bei der Interkulturellen Pädagogik sind es etwas mehr, nämlich etwa 15 %.
Zuletzt wurde speziell danach gefragt, wie oft Studierende des Grundschullehramts innerhalb des Studiums Inhalte aus dem Gebiet der Sonderpädagogik gelernt haben. Auch dies ist interessant für die Inklusions-Thematik, da in inklusivem Unterricht Kinder mit Behinderungen integriert sind und Grundschullehrpersonen somit auch im Bereich der Sonderpädagogik gefordert sind. Da sich diese Frage schwer an einzelnen Veranstaltungen festmachen lässt, wurde nach der generellen Häufigkeit gefragt, die sich wie folgt verteilt:
Tabelle 3.3: Wie oft hast du im Rahmen deines Studiums etwas aus dem Gebiet der Sonderpädagogik gelernt?
|
Häufigkeit |
Prozent |
Kumulierte Prozent |
|
|
nie |
142 |
39,7 |
39,7 |
|
selten |
171 |
47,8 |
87,4 |
|
gelegentlich |
40 |
11,2 |
98,6 |
|
oft |
5 |
1,4 |
100,0 |
|
sehr oft |
0 |
0,0 |
100,0 |
|
Gesamt |
358 |
100,0 |
In Tabelle 3.3 wird deutlich, dass knapp die Hälfte der Studierenden (47,8 %) nach eigenen Angaben selten etwas aus dem Gebiet der Sonderpädagogik gelernt hat, was das Maximum darstellt. Ähnliche viele Studierenden (39,7 %) antworteten, dass sie im Studium noch nie sonderpädagogische Themen behandelt haben. Ein Anteil von fast 90 % der Grundschulstudierenden hat demnach selten oder nie etwas zum Themengebiet der Sonderpädagogik gelernt. Sehr oft hat niemand der Teilnehmer sonderpädagogische Inhalte im Studium gelernt und oft lediglich 5 Teilnehmer, die einen Anteil von 1,4 % markieren. "Gelegentlich" gab etwa jeder 10. Teilnehmer als Antwort. Nach der Präsentation der Ergebnisse zum Besuch von Veranstaltungen, die Inhalte der Inklusion thematisierten, bezieht sich die folgende Darstellung darauf, ob die Studierenden während ihrer universitären Ausbildung darauf vorbereitet wurden, in inklusiven Schulen zu unterrichten.
2. Haben die Studierenden im Studium Mittel kennengelernt und Kompetenzen erlernt, die sie in inklusiven Settings benötigen?
Bezüglich dieser Fragestellung wurden die zwei Fragen herangezogen, die darauf abzielen, wie die Studierenden im Studium auf inklusive Settings vorbereitet werden. Dabei handelt es sich darum, welche Lernformen des offenen Unterrichts sie kennengelernt haben (Wochenplan-, Werkstatt-, Frei- oder Stationsarbeit, Projektlernen, Kooperatives, Entdeckendes oder Forschendes Lernen) und wie viel Wissen sie in schulpraktischen Bereichen erwerben konnten, die relevant für inklusiven Unterricht sind, nämlich heterogene Klassenkonstellationen, Förderdiagnostik, alternative Formen der Leistungsbewertung, Team-Teaching, Jahrgangsübergreifender Unterricht und Differenzierung. Hinsichtlich der Lernformen des offenen Unterrichts zeichnet sich folgendes Bild ab:
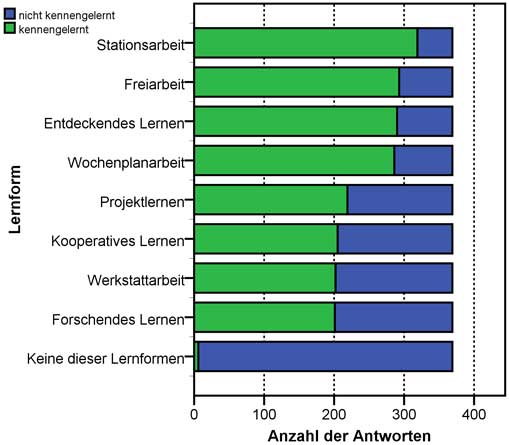
Abbildung 3.3: Welche der angeführten Lernformen des offenen Unterrichts hast du in deinem Studium (einschließlich Praktika) bislang kennengelernt?
Es wird ersichtlich, dass Stationsarbeit die bekannteste Lernform unter den teilnehmenden Studierenden ist: 86,4 % haben diese bereits im Studium oder in Praktika kennengelernt. Die Arbeitsformen Freiarbeit, Entdeckendes Lernen und Wochenplanarbeit sind in etwa vier von fünf Studierenden während ihres Studiums begegnet. Das Projektlernen ist einem Anteil von knapp 60 % bekannt, während nur etwa jeder zweite Studierende dieser Umfrage im Verlauf des Studiums mit dem Kooperativen Lernen, der Werkstattarbeit oder dem Forschenden Lernen konfrontiert wurde.
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Erfahrungen der Studierenden in für Inklusion relevanten schulpraktischen Feldern. Dabei haben sie ihr Wissen in diesen Gebieten selbst eingeschätzt. Während die Studierenden in der Umfrage aus einer sechsstufigen Skala von "sehr niedrig" bis "sehr hoch" wählen konnten, wurden diese Kategorien zur Auswertung zusammengefasst, so dass die Abbildung nur noch drei Kategorien zeigt.
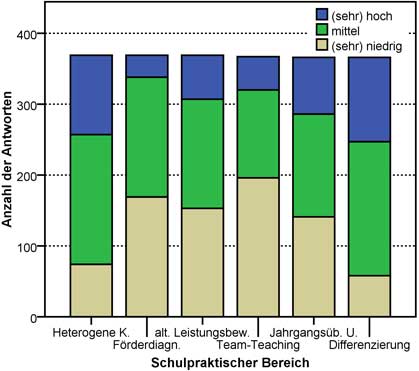
Abbildung 3.4: Einschätzung des Wissens in inklusionsrelevanten schulpraktischen Bereichen
In dem Bereich "Heterogene Klassenkonstellationen" schätzen die Befragten ihr Wissen insgesamt recht gut ein. Lediglich einer von fünf Befragten hat angegeben, dass sein Wissen hinsichtlich heterogener Klassenkonstellationen (sehr) niedrig ist. Die Hälfte aller Teilnehmer schätzt ihr Wissen in diesem Bereich jedoch mittelmäßig ein (49,6 %), fast ein Drittel sieht sein Wissen in diesem Bereich als (sehr) gut an.
Bezüglich der Förderdiagnostik wird deutlich, dass nur 8,4 % ihr Wissen hierzu als hoch oder sehr hoch bezeichnen. Die restlichen 91,6 % verteilen sich zu gleichen Anteilen auf ein (sehr) niedriges und ein mittelmäßiges Wissen bezüglich der Förderdiagnostik.
Die Verteilung der Antworten zur Wissenseinschätzung in dem Bereich der alternativen Formen der Leistungsbewertung ähnelt der des Bereichs der Förderdiagnostik. In diesem Fall schätzt zwar ein doppelt so hoher Anteil (16,8 %) im Vergleich zu dem Bereich der Förderdiagnostik (8,4 %) sein Wissen als (sehr) gut ein, jedoch geben ebenso die meisten Studierenden an, ihr Wissen sei bezüglich alternativer Formen der Leistungsbewertung (sehr) niedrig oder mittelmäßig. Die Ähnlichkeit des Musters wird dadurch deutlich, dass sich die Anteile in den Kategorien "(sehr) niedrig" und "mittel" wie im Bereich Förderdiagnostik mit jeweils etwa 41 % nahezu entsprechen (im Bereich Förderdiagnostik waren es jeweils etwa 45 %).
Die eigene Wissensbeurteilung bezüglich des Team-Teachings weist insgesamt die niedrigste Wissenszuschreibung auf: Über die Hälfte der teilnehmenden Studierenden hat die Antwortoption "sehr niedrig" oder "niedrig" ausgewählt, wobei im Gegensatz dazu lediglich 12,8 % ihr Wissen bezüglich des Team-Teachings als (sehr) hoch bezeichnen. Für ein mittelmäßiges Wissen entschied sich in diesem Fall etwa ein Drittel aller Teilnehmer.
Jahrgangsübergreifender Unterricht ist ein Thema, dem die Mehrzahl der Studierenden mit mittlerem und niedrigem Wissen gegenübersteht. Nur leicht mehr als jeder fünfte Teilnehmer gibt an, ein (sehr) hohes Wissen in diesem Bereich zu besitzen. Knapp 40 % schätzen ihr Wissen mittelmäßig ein und 38,5 % (sehr) niedrig.
Bezüglich der Wissenseinschätzung in dem Bereich der Differenzierung zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie in dem Feld der heterogenen Klassenkonstellationen: Es gibt einen insgesamt recht hohen Anteil, der sein Wissen als mittelmäßig beurteilt und mehr als die Hälfte aller Teilnehmer ausmacht. Nur ein Anteil von gut 15 % gibt an, dass sein Wissen in diesem Gebiet niedrig bzw. sehr niedrig ist, wogegen ein weiteres Drittel angibt, hier ein (sehr) hohes Wissen aufzuweisen.
Nachdem die Ergebnisse der ersten beiden Bereiche bezüglich der universitären Erfahrungen mit Inklusion bereits dargestellt wurden, bezieht sich die folgende Präsentation auf den Wissensbereich der Umfrage, als Indikator dafür, was die Studierenden über Inklusion gelernt haben. Dies manifestiert sich anhand folgender Fragestellung:
3. Wie groß ist das Wissen der Studierenden über Inklusion und was verstehen sie darunter?
Zur Klärung dieser Frage werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung des Wissens über Inklusion, der Wissensquellen und des Wissens über die UN-Behindetenrechtskonvention und über den Index für Inklusion präsentiert. Des Weiteren wird anhand der Aufforderung, den Satz "Eine inklusive Schule..." fortzuführen sowie anhand der Frage des Zusammenhangs zur Integration dargelegt, welches Verständnis die Studierenden von Inklusion haben.
Die erste Frage in diesem Bereich gibt Aufschluss darüber, wie gut sich die Teilnehmer selbsteingeschätzt mit dem Thema Inklusion auskennen, was in folgender Tabelle dargestellt ist:
Tabelle 3.4: Wie gut kennst du dich mit dem Thema "Inklusion" aus?
|
Häufigkeit |
Prozent |
Kumulierte Prozente |
Mittelwert x |
|
|
Sehr schlecht |
119 |
32,2 |
32,2 |
|
|
Schlecht |
97 |
26,3 |
58,5 |
|
|
Mittelmäßig |
118 |
32,0 |
90,5 |
|
|
Gut |
29 |
7,9 |
98,4 |
|
|
Sehr gut |
6 |
1,6 |
100,0 |
|
|
Gesamt |
369 |
100,0 |
2,20 |
Fast gleich viele Studierende geben an, dass sie sehr schlecht oder mittelmäßig über Inklusion im Bilde sind: Fast ein Drittel aller Antworten fällt auf diese beiden Kategorien zusammen. Ein weiteres Viertel der Teilnehmer gibt an, sich schlecht mit Inklusion auszukennen. Fasst man dieses Viertel mit dem Drittel zusammen, dass sich sehr schlecht mit Inklusion auszukennen scheint, sind bereits 58,8 % der Teilnehmer erfasst. Weniger als 10 % schätzen ihr Wissen über Inklusion gut oder sehr gut ein. Diese Tendenz drückt auch der Mittelwert von x = 2,20 aus, der anhand der Kodierung "sehr schlecht = 1" und "sehr gut = 5" ermittelt wurde.[9] Der Durschnittsteilnehmer kennt sich demnach eher schlecht als mittelmäßig mit Inklusion aus.
155 der 369 Teilnehmer kennen sich mittelmäßig oder besser mit Inklusion aus, was bedeutet, dass sie in den Filterbereich des Fragebogens gelangten und zu vier weiteren Wissensitems über Inklusion befragt wurden.
Woher die Studierenden ihr Wissen über Inklusion erlangten, wird in folgender Abbildung ersichtlich. Diese Frage stellte das erste Item des Filterbereichs dar, was begründet, warum die Antwortzahl dieser Frage lediglich bei 155 liegt. Bei der Frage war eine Mehrfachnennung möglich, so dass sich die Prozentzahlen lediglich auf "ausgewählt" oder "nicht ausgewählt" beziehen.
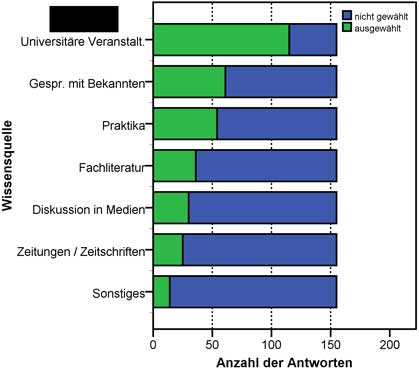
Abbildung 3.5: Wissensquellen der Inklusion
Es wird deutlich, dass etwa drei Viertel der Teilnehmer, die ihr Wissen zwischen mittelmäßig und sehr gut einschätzen, als Wissensquelle "universitäre Veranstaltungen" angaben (74,2 %). Die Antwort, die am zweithäufigsten genannt wurde, wurde nur etwa halb so oft gewählt, nämlich insgesamt von 61 Personen, was einem Anteil von 39,4 % entspricht. Hierbei handelt es sich um Gespräche mit Freunden und Bekannten. An dritter Stelle steht die Antwortkategorie "Praktika", wonach 34,8 % ihr Wissen über Inklusion in ihren Praxisphasen erlangt haben. Die Wissensquellen "Fachliteratur" und "Diskussion in den Medien" wurden jeweils von etwa jedem vierten oder fünften Teilnehmer angegeben, wogegen "Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel" lediglich von einem Anteil von 16,1 % genannt wurde. Des Weiteren gaben 14 Teilnehmer weitere Wissensquellen an, die sich zum Großteil auf ihre Ausbildung bezogen, wie zum Beispiel Referate oder Abschlussarbeiten.
Die nächsten beiden Tabellen verdeutlichen anhand zweier Beispiele, wie groß das Wissen der Teilnehmer bezüglich der Inklusion tatsächlich ist. Zur Überprüfung des Wissens werden die Fragen nach dem Wahrheitsgehalt der UN-Behindertenrechtskonvention und der Kenntnis des Index für Inklusion herangezogen: Die UN-Konvention ist im Großen und Ganzen der Grund dafür, warum Inklusion immer mehr an Relevanz gewinnt und der Index für Inklusion stellt ein Instrument dar, mit dem die Umsetzung einer inklusiven Schule entwickelt werden kann.
Bezüglich der Einschätzung des Wahrheitsgehalts der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen zeichnete sich folgendes Bild ab:
Tabelle 3.5: Beurteilung des Wahrheitsgehaltes folgender Aussage: "Es gibt ein Recht auf inklusive Bildung für alle Menschen. Dieser Beschluss wurde 2006 von den Vereinten Nationen in der Behindertenrechtskonvention verabschiedet. Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Konvention 2009 als verbindlich anerkannt."
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
wahr |
171 |
46,5 |
|
falsch |
16 |
4,3 |
|
weiß nicht |
181 |
49,2 |
|
Gesamt |
368 |
100,0 |
Knapp die Hälfte der Studierenden hält die Aussage für wahr (was die richtige Antwort ist) und knapp die andere Hälfte gibt an, sich diesbezüglich unsicher zu sein. Die restlichen 4,3 % entfallen auf die Teilnehmer, die sagen, dass es dieses Recht auf inklusive Bildung nicht gibt.
Tabelle 3.6: Ist dir der "Index für Inklusion" bekannt?
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Ja |
20 |
13,0 |
|
Nein |
134 |
87,0 |
|
Gesamt |
154 |
100,0 |
Die Kenntnis der Teilnehmer über den Index für Inklusion wird in Tabelle 3.6 veranschaulicht. Hinzugefügt sei an dieser Stelle, dass es sich bei dieser Frage um eine Frage des Filterbereichs handelte, die nur von Befragten beantwortet wurden, die sich mittelmäßig oder besser mit Inklusion auskennen. Daher liegt die Gesamtzahl der Teilnehmer, die diese Frage bearbeitet hat, nur bei 154, eine Person hat diese Frage des Filterbereichs ausgelassen. Deutlich wird, dass 13 % der Studierenden den Index für Inklusion kennen und er dementsprechend 87 % der Befragten unbekannt ist.
Nach diesen drei Fragen, die auf das Wissen der Teilnehmer abzielten, wird im Folgenden auf das Inklusionsverständnis der Studierenden eingegangen.
Wie in Kapitel 3.2.3 geschildert, wurden die freien Textantworten der Teilnehmer in Kategorien zusammengefasst, die mit einem Satz tituliert sind, die mit den darunter eingeordneten Nennungen der Teilnehmer übereinstimmen. Die Tabelle 3.7 zeigt die verschiedenen Antwortkategorien und ist nach der Häufigkeit der Aussagen geordnet.
Tabelle 3.7: Führe den Satz fort: Eine inklusive Schule...
|
Eine inklusive Schule... |
Häufigkeit |
Prozent |
|
... berücksichtigt alle Kinder. |
47 |
32,2 |
|
... integriert Kinder mit Behinderungen. |
38 |
26,0 |
|
... ist gewollte Heterogenität und nutzt die Vielfalt. |
18 |
12,3 |
|
... bedeutet Chance, Zukunft oder Gleichberechtigung. |
13 |
8,9 |
|
... benötigt individuelle Förderung. |
8 |
5,5 |
|
... steht für Akzeptanz. |
6 |
4,1 |
|
... benötigt eine Ausfinanzierung, qualifiziertes Personal oder einen Systemwechsel. |
6 |
4,1 |
|
... ist momentan unrealistisch. |
4 |
2,7 |
|
Sonstiges |
6 |
4,1 |
|
Gesamt |
146 |
100,0 |
Etwa ein Drittel der Teilnehmer, die sich nach eigenen Angaben zumindest mittelmäßig in dem Themengebiet der Inklusion auskennen, sieht in einer inklusiven Schule alle Kinder berücksichtigt. Der zweitgrößte Anteil beschränkt das Wesen einer inklusiven Schule auf die Integration von Kindern mit Behinderungen: Dies sagt etwa jeder vierte Teilnehmer, der sein Wissen über Inklusion einigermaßen gut einschätzt. Diese beiden Nennungen stellen zusammen die Mehrheit aller Aussagen dar (nämlich knapp 58,2 %). Auch die von inklusiven Schulen gewollte Heterogenität und positiv gesehene Vielfalt wurde von 12,3 % der Teilnehmer angegeben. Andere Teilnehmer heben die für sie mit einer inklusiven Schule verbundenen Attribute Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Zukunft hervor (13 Nennungen). Vereinzelte Antworten gab es außerdem dafür, dass eine inklusive Schule individuelle Förderung benötige und für Akzeptanz stehe. Sechs Personen führten den Satz eher auf einer strukturellen als auf einer inhaltlichen Ebene fort: Sie nannten eine Ausfinanzierung, qualifiziertes Personal oder einen Systemwechsel als notwendige Bedingungen für eine inklusive Schule. Die Unmöglichkeit einer inklusiven Schule gaben vier Teilnehmer als Antwort. In diesen Kategorien nicht einzuordnen waren sechs weitere Aussagen der Studierenden.
Diese Frage des Filterbereichs haben 146 Studierende beantwortet, während sie neun Teilnehmer übersprungen haben. Diese im Vergleich zu den anderen Fragen recht hohe Auslassungsquote kann vermutlich darauf zurückgeführt werden, dass es sich um eine (halb-)offene Frage handelte, für deren Beantwortung eine höhere kognitive Anstrengung aufgebracht werden musste.
Die folgenden Tabellen gehen auf die Frage ein, ob die Teilnehmer einen Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration sehen.
Tabelle 3.8: Siehst du einen Zusammenhang zwischen Integration und Inklusion?
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Ja. |
115 |
75,2 |
|
Ich sehe keinen Zusammenhang |
6 |
3,9 |
|
Weiß nicht |
32 |
20,9 |
|
Gesamt |
153 |
100,0 |
Während drei Viertel derjenigen, die sich zumindest durchschnittlich mit Inklusion auskennen, einen Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration sehen, sagen lediglich 3,9 %, dass sie keinen Zusammenhang sehen. Etwa jeder fünfte der inklusions-firmen Teilnehmer ist sich diesbezüglich nicht sicher. Diejenigen Teilnehmer, die diese Frage mit "ja" beantwortet haben, waren dazu aufgefordert, den vorhandenen Zusammenhang mit eigenen Worten zu formulieren. Diesem Appell sind 100 der 115 Teilnehmer, die einen Zusammenhang zwischen Integration und Inklusion sehen, nachgekommen.
Auch die Antworten auf diese Frage wurden wie in Kapitel 3.2.3 erläutert in Kategorien geclustert. Folgende Tabelle zeigt die Antwortverteilung:
Tabelle 3.9: Zusammenhang zwischen Integration und Inklusion
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
Inklusion bedeutet wie Integration die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. |
18 |
18,0 |
|
Bei Integration und Inklusion geht es um Gemeinsamkeit, Toleranz oder Chancengleichheit. |
16 |
16,0 |
|
Integration und Inklusion schöpfen aus der Heterogenität. |
5 |
5,0 |
|
Integration stellt eine Vorstufe zu Inklusion dar, geht aber darüber hinaus. |
32 |
32,0 |
|
Integration separiert Einzelne, während Inklusion in der Verschiedenheit das Ganze sieht. |
12 |
12,0 |
|
Sonstiges |
17 |
17,0 |
|
Gesamt |
100 |
100, |
Die Antworten der Teilnehmer, die den Zusammenhang von Inklusion und Integration niederschrieben, lassen sich zunächst in zwei grobe Klassen teilen: Die obere Hälfte der Tabelle stellt die Aussagen der Teilnehmer dar, die den Zusammenhang von Inklusion und Integration anhand eines Merkmals ausmachen, das sowohl das Wesen der Inklusion, als auch der Integration ausmacht, was gewissermaßen beide kennzeichnet. Anders verhält es sich bei der unteren Tabellenhälfte: Der Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration wird in einer Unterschiedlichkeit gesehen. Dabei wird vermutlich eine Grundähnlichkeit vorausgesetzt, aber den Teilnehmern scheint es wichtig zu sein, die Andersartigkeit zu betonen.
So sagten 18 % der Befragten, dass Integration und Inklusion beide dadurch gekennzeichnet sind, dass Kinder mit Behinderung in den Regelunterricht integriert werden. Fast ebenso viele Teilnehmer gaben an, dass wesentliche Merkmale von Integration sowie von Inklusion in Gemeinsamkeit, Toleranz oder Chancengleichheit bestehen. 5 % stellen die positive Sicht auf Heterogenität für Inklusion als auch für Integration heraus. Bezüglich des Zusammenhangs, der in einem Unterschied gesehen wird, nennt der Großteil der Befragten, nämlich insgesamt ein Drittel aller Teilnehmer, die zu dieser offenen Frage eine Antwort gaben, den Sachverhalt, dass Inklusion auf Integration folge. In diesem Sinne stellt Integration eine Vorstufe der Inklusion dar. Eine häufige Formulierung dabei lautete "...geht aber darüber hinaus". Weitere 12 Teilnehmer wiesen darauf hin, dass Inklusion den Blick auf das Ganze wirft, in dem es normal ist, dass alle verschieden sind, während Integration Einzelne zunächst als separat ansieht, um diese integrieren zu können. Um auf das Inklusions-Verständnis der Teilnehmer schließen zu können, wurde zusätzlich betrachtet, welche vorgegebenen Stichwörter die Studierenden am ehesten mit Inklusion verbinden. Dies zeigt folgende Übersicht, die die Rangfolge der Nennungen beinhaltet. Da jeder Teilnehmer bis zu vier Auswahlen treffen konnte, ist das Diagramm so zu lesen, dass jeweils ein Aspekt von dem angegebenen Anteil von Studierenden ausgewählt wurde.
Tabelle 3.10: Welche Stichwörter assoziierst du am ehesten mit Inklusion?
|
ausgewählt |
nicht ausgewählt |
|
|
Heterogenität |
194 (52,6) |
175 (47,4) |
|
Menschen mit Behinderungen |
175 (47,4) |
194 (52,6) |
|
Chancengleichheit |
148 (40,1) |
221 (59,9) |
|
Vielfalt |
140 (37,9) |
229 (62,1) |
|
Integration |
140 (37,9) |
229 (62,1) |
|
Individualität |
136 (36,9) |
233 (63,1) |
|
Eingliederung |
103 (27,9) |
266 (72,1) |
|
Chance |
97 (26,3) |
272 (73,7) |
|
Teilhabe |
58 (15,7) |
311 (84,3) |
|
Zukunft |
47 (12,7) |
322 (87,3) |
|
Multikulturelle Gesellschaft |
31 (8,4) |
338 (91,6) |
|
Grundhaltung |
21 (5,7) |
348 (94,3) |
|
Menschen mit Migrationshintergrund |
19 (5,1) |
350 (94,9) |
|
Ausgrenzung |
14 (3,8) |
355 (96,2) |
|
Gleichmacherei |
12 (3,3) |
357 (96,7) |
|
Randgruppen |
11 (3,0) |
358 (97,0) |
|
Hindernis |
9 (2,4) |
360 (97,6) |
|
Anpassung |
5 (1,4) |
364 (98,6) |
|
Sonstiges |
6 (1,6) |
363 (98,4) |
Über die Hälfte der Befragten nennt "Heterogenität" als wesentliches Element der Inklusion An zweiter Stelle steht die Assoziation "Menschen mit Behinderungen", was ebenfalls fast jeder zweite Teilnehmer ausgewählt hat (47,3 %). Gut 40 % der Teilnehmer wählten "Chancengleichheit" als wichtiges Moment der Inklusion, ebenfalls knapp 40 % "Vielfalt". An fünfter Stelle mit einer Auswahlquote von 37,8 % steht "Integration", gefolgt von "Individualit ät" mit 37,0 %. Dies sind die sechs Antworten, die über 30 % der Teilnehmer auswählten. Merkmale, die weniger als 5 % der Studierenden als wesentlich für Inklusion empfinden, sind "Ausgrenzung", "Gleichmacherei", "Randgruppen", "Hindernis" und weitere Nennungen.
In einem letzten Schritt wird nach Antworten auf die Frage gesucht, wie die Studierenden sich selbst auf eine nahende inklusive Bildungslandschaft vorbereitet fühlen und wie sie die Relevanz der Inklusionsthematik in Bezug auf ihren späteren Lehrerberuf einschätzen.
Hierzu wurden zum einen zwei Items aus dem Einstellungsbereich betrachtet, die Aufschluss darüber geben, wie sich die Studierenden auf Inklusion vorbereitet fühlen: Einerseits bezüglich der individuellen Förderung und andererseits bezogen auf die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen. Zum anderen werden drei weitere Fragen herangezogen, in denen die Studierenden ausdrücken, wie relevant sich die Inklusionsthematik für sie darstellt.
In folgender Abbildung ist veranschaulicht, inwiefern die Studierenden im Studium Mittel und Konzepte zur individuelle Förderung kennengelernt haben und wie sie sich für die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen qualifiziert fühlen. Zum Verständnis sei hinzugefügt, dass die Assage-Items, zu denen die Studierenden ihre Zustimmung oder Ablehnung angeben sollten, negativ formuliert waren, so dass beispielsweise die Aussage "trifft zu" dafür steht, wenig Mittel und Konzepte zur individuellen Förderung kennengelernt zu haben.
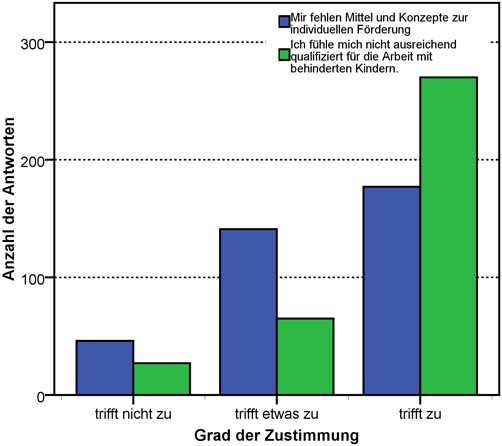
Abbildung 3.6: Persönliche Gefühlslage bezüglich individueller Förderung und der Arbeit mit behinderten Kindern
Dieses Diagramm verdeutlicht die in drei Kategorien zusammengefassten Antworten der Teilnehmer. Ursprünglich standen den Studierenden jeweils sechs Antwortoptionen zur Auswahl, die jedoch zu drei Klassen zusammengefasst wurden.
Es wird ersichtlich, dass knapp die Hälfte der Teilnehmer der Aussage zur individuellen Förderung zugestimmt hat, was bedeutet, dass ihnen zur Umsetzung individueller Förderung eines jeden Kindes Mittel und Konzepte fehlen. Ein Anteil von 12,6 % hingegen widerspricht dieser Aussage, was bedeutet, dass in etwa jeder achte Teilnehmer angibt, über angemessene Mittel und Konzepte zur individuellen Förderung zu verfügen. Für eine mittlere Zustimmung entschied sich der zweitgrößte Anteil, nämlich 141 Studierende, was einen Anteil von 38,7 % ausmacht.
Zieht man das Item der Einschätzung der eigenen Qualifizierung für die Arbeit mit behinderten Kindern hinzu, wird deutlich, dass die Zustimmung hierzu noch größer ist. Drei Viertel der Teilnehmer gibt an, sich nicht ausreichend für die Arbeit mit behinderten Kindern qualifiziert zu fühlen. Lediglich ein Anteil von 7,5 % fühlt sich für die Arbeit in einer Klasse befähigt, in der behinderte Kinder am Unterricht teilnehmen. Die übrigen 18 % haben sich für eine mittlere Antwort entschieden, stimmen also teilweise zu.
Anhand der ebenfalls in drei Kategorien zusammengefassten Tabelle 3.10 kann deutlich gemacht werden, für wie wahrscheinlich die Teilnehmer es halten, später an einer inklusiven Schule zu unterrichten. Die Antworten dazu machen deutlich, wie die Teilnehmer die Relevanz der Inklusionsthematik einschätzen: Werden sie in ihrem späteren Beruf selbst davon betroffen sein oder nicht?
Tabelle 3.11: Für wie wahrscheinlich hältst du es, später an einer inklusiven Schule Lehrer zu werden?
|
Häufigkeit |
Prozent |
Kumulierte Prozent |
Mittelwert x |
|
|
Wahrscheinlich |
125 |
34,1 |
100,0 |
|
|
Vielleicht |
178 |
48,5 |
65,9 |
|
|
Unwahrscheinlich |
64 |
17,4 |
17,4 |
|
|
Gesamt |
367 |
100,0 |
3,85 |
Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer gibt an, dass es weder wahrscheinlich, noch unwahrscheinlich ist, später an einer inklusiven Schule zu arbeiten, was dementsprechend mit "vielleicht" übersetzt werden kann. Ein gutes Drittel der Teilnehmer hält es hingegen für wahrscheinlich, Lehrer an einer inklusiven Schule zu werden. Für unwahrscheinlich schätzen 17,4 % der Teilnehmer ihre eigene spätere Tätigkeit an einer inklusiven Schule ein. Eine Tendez dazu, dass die durchschnittliche Meinung dahin weist, es eher unwahrscheinlich zu halten, später an einer inklusiven Schule zu unterrichten, drückt der Mittelwert von x = 3,85 aus, der anhand von sechs Antwortkategorien ermittelt wurde.
Die letzten beiden zu betrachtenden Fragen zielen darauf ab, wie die Studierenden selbst zu inklusiven Veranstaltungen stehen: Halten sie Veranstaltungen zur Inklusionsthematik für wichtig oder sehen sie sie als überflüssig an?
Tabelle 3.12: Würdest du ein Pflichtseminar für angehende Lehrer befürworten, das sich mit Inklusionspädagogik beschäftigt?
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
ja |
288 |
78,3 |
|
nein |
37 |
10,1 |
|
weiß nicht |
43 |
11,7 |
|
Gesamt |
368 |
100,0 |
Die erste Frage hierzu bezieht sich darauf, ob die Teilnehmer eine Pflichtveranstaltung befürworten würden, die sich mit der Inklusionspädagogik befasst. Dies würde bedeuten, dass jeder Lehramtsstudent ein solches Seminar im Rahmen seines Studiums besuchen müsste. Über drei Viertel der Teilnehmer stimmt sich dafür aus, was insgesamt knapp 300 Studierende ausmacht. Nur jeder zehnte Befragte lehnt ein Pflichtseminar im Inklusionsbereich ab. Weitere 11,7 % sind sich dieser Angelegenheit gegenüber unschlüssig.
Tabelle 3.13: Würdest du in Zukunft gerne eine Veranstaltung zur Inklusionspädagogik besuchen?
|
Häufigkeit |
Prozent |
|
|
ja |
311 |
84,5 |
|
nein |
15 |
4,1 |
|
weiß nicht |
42 |
11,4 |
|
Gesamt |
368 |
100,0 |
Die Antwortverteilung auf die Frage, die in die gleiche Richtung zielt wie die zuvorige und den eigenen Willen gegenüber des zukünftigen Besuches einer Inklusionsveranstaltung in Erfahrung bringen will, ist in Tabelle 3.12 veranschaulicht. Hierbei zeigt sich eine noch deutlichere positive Zustimmung als bei der Frage bezüglich des Pflichtseminars zum Thema Inklusion: Ein Anteil von 84,5 % der Teilnehmer gibt an, dass sie in Zukunft gerne eine Veranstaltung besuchen würden, in der die Inklusionsthematik im Vordergrund steht. Ein Anteil von 4,1 % spricht sich dagegen aus und gut jeder zehnte Befragte ist sich unsicher.
Nachdem in diesem Teil der Arbeit alle relevanten Ergebnisse dargestellt wurden, wird im nächsten Schritt die Interpretation dieser Ergebnisse vorgenommen. Dabei sollen die verschiedenen Antwortverteilungen hinsichtlich der vier untergeordneten Fragestellungen betrachtet werden, um daraus letztendlich Schlüsse bezüglich der Fragestellung "Wie sind Studierende des Grundschullehramtes in Nordrhein-Westfalen auf Inklusion vorbereitet?" ziehen zu können.
Zunächst gehe ich auf die erste untergeordnete Fragestellung ein, die sich auf die Quantität von inklusiven Inhalten in der universitären Ausbildung von Grundschullehramtsstudierenden bezieht.
Die Frage bezüglich der Anzahl von Veranstaltungen, die "Inklusion" oder "inklusiv" im Titel enthalten, gibt am stärksten Aufschluss darüber, wie intensiv die Studierenden mit Inklusion konfrontiert wurden. Bei einem Besuch zu einer gesamten Veranstaltungsreihe zu diesem Thema ist davon auszugehen, dass die Studierenden eine fundierte inklusionspädagogische Grundlage erhalten haben müssten. Wie die Ergebnisdarstellung zeigte, haben jedoch nur 11 Studierende von insgesamt 369 angehenden Grundschullehrpersonen, die an der Studie teilgenommen haben, eine solche inklusionsthematische Veranstaltung besucht. Selbst wenn man diejenigen Studierenden mit einbezieht, die zunächst angaben, schon eine oder mehrere Veranstaltung besucht zu haben, die "Inklusion" oder "inklusiv" im Titel tragen, die Notation des Titels jedoch diese Stichwörter nicht enthielt, bleibt eine Zahl von 322 Teilnehmern erhalten, die definitiv keine Veranstaltungsreihe zu Inklusion absolvierte, was einen Anteil von fast 90 % ausmacht. Woran es liegt, dass bislang so wenige Studierende Veranstaltungen zu Inklusion besuchen, geht nicht direkt aus der Frage hervor. Es kann einerseits am universitären Angebot liegen und andererseits an den Studierenden selbst. Wenn es an der Universität keine oder nur vereinzelte Veranstaltungen zu Inklusion gibt, können die Studierende diese auch nicht oder nur in wenigen Fällen besuchen. In Franzkowiaks Studie "Integration, Inklusion, Gemeinsamer Unterricht" wurde beispielsweise herausgestellt, dass 2008 innerhalb Deutschlands an fast der Hälfte der Universitäten (44 %), an denen die Möglichkeit eines Grundschullehramts-Studiums besteht, keine Veranstaltungen zu diesen Themen angeboten wurden [vgl. Franzkowiak, 2009, S. 8].Andererseits wäre es auch möglich, dass das Angebot vorhanden ist, die Lehramtsstudierende aber die Relevanz dieser Thematik nicht sehen, bereits viele andere Veranstaltungen belegen müssen oder sich für andere Themen mehr interessieren und aus diesen Gründen keine Wahlveranstaltung zu Inklusion wählen. Auf diese Ursachenüberlegung wird die Ergebnisinterpretation im weiteren Verlauf noch zurückkommen.
Des Weiteren ist zu verzeichnen, dass Inklusion öfter punktuell, nämlich in einzelnen Sitzungen von Veranstaltungen thematisiert wurde. Dies trifft jedoch nur auf die Hälfte der Studierenden zu, sodass die andere Hälfte selbst in einzelnen Sitzungen zu anderen Veranstaltungsthemen noch nie das Thema "Inklusion" behandelt hat. Dies bedeutet, dass jeder zweite angehende Grundschullehramtsstudent dieser Studie noch nie etwas in universitären Veranstaltungen über Inklusion gehört hat.
Bezüglich der Themen Gemeinsamer Unterricht und Interkulturelle Pädagogik, die ebenfalls wichtige Komponenten im inklusionspädagogischen Bereich darstellen, sieht die Situation etwas positiver aus. Während die Themen Integrationspädagogik und Gemeinsamer Unterricht nur leicht häufiger von den Studierenden in einzelnen Sitzungen erfahren wurden als Inklusion, ist der Unterschied zwischen Inklusion und Interkultureller Pädagogik deutlicher: Hier ist es nur gut ein Drittel, das das Thema Interkulturelle Pädagogik noch nie in einzelnen Sitzungen behandelt hat, gegenüber der Hälfte für das Thema der Inklusion. Die Mehrheit der Studierenden, nämlich genau die Hälfte, hat ein oder zwei Veranstaltungen besucht, in denen einzelne Sitzungen zu Interkultureller Pädagogik gestaltet wurden. Hinsichtlich dieser drei Themen, dem übergeordneten Thema Inklusion und die beiden inklusionsrelevanten Themen Gemeinsamer Unterricht / Integrationspädagogik und Interkulturelle Pädagogik, lässt sich sagen, dass Interkulturelle Pädagogik den Teilnehmern der Studie am häufigsten in einzelnen Sitzungen begegnet ist, das Thema Inklusion am seltensten. In Bezug auf die Gesamtheit der Stichprobe hat jedoch auch jeder zweite Teilnehmer in universitären Veranstaltungen noch nie das Thema Inklusion behandelt, was für fast ebenso viele Studierende auch auf das Thema der Integrationspädagogik zutrifft. Zieht man zu diesem Aspekt noch die Begegnung von Studierenden mit Inhalten der Sonderpädagogik im Studium hinzu, verstärkt sich die Tendenz: Ein Anteil von fast 90 % der Studierenden gibt an, nie oder selten etwas aus diesem Bereich thematisiert zu haben. Im interkulturellen Bereich haben zwei Drittel der Teilnehmer bereits Erfahrungen in universitären Veranstaltung sammeln können. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Universitäten die Relevanz der Interkulturalität momentan höher einschätzen, als die der Inklusion und der Integration.
Insgesamt gesehen sind die Erfahrungen aller Studierenden in entscheidenden Teilgebieten der Inklusion und in dieser selbst jedoch als relativ gering zu bezeichnen, wenn man in Betracht zieht, dass vermutlich jeder dieser Teilnehmer in Zukunft in einer inklusiven Bildungslandschaft arbeiten wird.
Die zweite Fragestellung zielt darauf ab, inwiefern die Studierenden im Studium Mittel und Kompetenzen erwerben konnten, um in inklusiven Settings arbeiten zu können. Hierbei wurden die Fragen nach verschiedenen kennengelernten Lernformen des offenen Unterrichts sowie nach Erfahrungen in inklusionsrelevanten schulpraktischen Bereichen in Betracht gezogen. Zunächst werde ich auf die verschiedenen Lernformen eingehen.
Die Rangliste macht deutlich, dass Stationsarbeit die Arbeitsform ist, die mit einem Anteil von fast 85 % der Mehrzahl der Studierenden bekannt ist. Selbst die Lernform, die am wenigsten bekannt ist, das Forschende Lernen, ist immerhin noch über der Hälfte der Studierenden bekannt.
Im Theorieteil dieser Arbeit wurde herausgestellt, dass im inklusiven Unterricht das kooperative Lernen einen hohen Stellenwert einnimmt, da so das Lernen untereinander intensiviert und davon profitiert wird (siehe Kapitel 2.1.3. In dieser Studie erreichte das Kooperative Lernen im Vergleich zu anderen Lernformen des offenen Unterrichts jedoch einen der hinteren Plätze, was bedeutet, dass ein Anteil von 44,5 % der Teilnehmer, also fast jeder zweite Grundschullehramtsstudent, diese Lernform nicht in der Universität kennengelernt hat.
Insgesamt gesehen scheinen die angeführten Lernformen jedoch in der Mehrzahl in der universitären Lehre vermittelt zu werden, da sie alle einen "Bekanntheitsgrad" von über 50 % erzielen konnten und lediglich einem Anteil von 1,6 % (was einer Anzahl von sechs Teilnehmern entspricht) jede der angegebenen Lernformen unbekannt ist. Eine Erklärung hierfür könnte darin liegen, dass diese Lernformen unabhängig von Inklusion als fortschrittliche Lernformen eines modernen Unterrichts im Sinne des Konstruktivismus gelten. Dies zeigt zum einen, wie im Theorieteil dargestellt wurde (siehe Kapitel 2.1.3, dass es keine neuartige inklusive Didaktik gibt und geben wird, sondern dass sich viele bereits bekannte didaktische Elemente zusammenfügen müssen. Die hier angeführten Lernformen des offenen Unterrichts sind ein Beispiel dafür, denn sie werden bereits an Schulen angewandt, die nicht als inklusive Schulen gelten. Dennoch ist es wichtig, von deren Vermittlung hinsichtlich einer nahenden inklusiven Schullandschaft nicht abzurücken und bestenfalls das kooperativen Lernen als inklusionsförderliche Lernform zu bestärken. Der zweite Aufgabenbereich dieser Fragestellung betrifft sechs verschiedene schulpraktische Bereiche, die in inklusiven Settings an Bedeutung gewinnen. Es stellte sich heraus, dass die beiden Gebiete "Heterogene Klassenkonstellationen" und "Differenzierung" die zwei Bereiche markieren, in denen die Studierenden ihr Wissen am höchsten einschätzten. Hinsichtlich dieser Aspekte schätzen mehr Teilnehmer ihr Wissen als "hoch oder sehr hoch ein als "(sehr) niedrig". In den anderen vier Bereichen (Förderdiagnostik, alternative Formen der Leistungsbeurteilung, Team-Teaching und Jahrgangsübergreifender Unterricht) beurteilen die Studierenden ihr Wissen deutlich schlechter. Dabei bilden die beiden Bereiche Förderdiagnostik (x = 2,76) und Teamteaching (x = 2,65) die Schlusslichter. Im Fachgebiet der Förderdiagnostik beurteilen nur 8,4 % der Studierenden ihr Wissen als hoch oder sehr hoch, hinsichtlich des Team-Teachings gibt über die Hälfte an, ein (sehr) niedriges Wissen zu haben. In den schulpraktischen Feldern alternative Formen der Leistungsbewertung und jahrgangsübergreifender Unterricht schätzen die Teilnehmer ihr Wissen ebenfalls eher niedrig als hoch ein.
Deutlich wird insgesamt, dass alle der angegebenen Bereiche keine Höchstwerte erzielen. Heterogene Klassenkonstellationen und Differenzierung gehören vermutlich zu den Felder, in denen die Studierenden das größte Wissen besitzen, weil es wiederum allgemeinere Themen sind, als die vier anderen Bereiche und diese somit öfter und in vielfältigeren Zusammenhängen in der Universität thematisiert werden. Team-Teaching stellt insgesamt das Feld dar, dass die niedrigste Wissenszuschreibung der Studierenden erhalten hat. Dies ist angesichts eines sich in Richtung Inklusion entwickelnden Schulsystems bedenklich, da inklusive Schulen und inklusiver Unterricht auf Kooperation und team-work angewiesen sind, da sich sonst die große Vielfalt der Schüler kaum bewerkstelligen lässt, geschweige denn positiv genutzt werden kann. Es zeigt sich hieran somit auch, dass die universitäre Lehre scheinbar noch nicht auf inklusiven Unterricht vorbereitet, da die Komponente des Team-Teachings erst im inklusiven Rahmen und nicht in allgemeineren Zusammenhägen wirklich an Relevanz gewinnt (abgesehen von bereits länger existierendem Gemeinsamen Unterricht, in dem meistens auch gemeinsam unterrichtet wird).
Die dritte Fragestellung will in Erfahrung bringen, wie es um das Wissen der Teilnehmer in inklusionspädagogischen Inhalten steht. Dabei standen zum einen konkret die beiden Fragen bezüglich des Wissens über die UN-Behindertenrechtskonvention und des Index für Inklusion im Raum, zum anderen zielten einige Fragen auf das Inklusionsverständnis der Studierenden ab, da auch dies ein Indikator dafür ist, was der Studierende unter Inklusion versteht und demnach darüber weiß.
Zunächst wurden die Studierenden jedoch dazu aufgefordert, ihr Wissen bezüglich Inklusion selbst zu beurteilen. Hier zeigt sich bereits, dass sie ihr Wissen relativ gering einschätzten: Fast jeder dritte Teilnehmer bewertet sein Wissen im Thema Inklusion mit der am negativ formuliertesten Antwortoption "sehr schlecht". Weitere knapp 100 Studierende geben an, sich zwischen sehr schlecht und mittelmäßig mit Inklusion auszukennen. Diese beiden Zuschreibungen zusammengefasst erfassen demnach bereits einen Anteil von 58,5 %. Der zweitgrößte Anteil bezeichnet sein eigenes Inklusions-Wissen als mittelmäßig, was gleichzeitig bedeutet, dass sich nach eigenen Angaben nicht einmal jeder zehnte Grundschullehramtsstudent besser als mittelmäßig mit Inklusion auskennt.
Diese Sachlage könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass man sich selbst tendenziell eher schlechter einschätzt und unterbewertet, sodass man auch angesichts des eigenen Wissens über Inklusion tiefstapelt. Andererseits kann hier wiederum der Vorteil der Online-Umfrage angebracht werden, da diese anonym ist und daher der Teilnehmer nicht das Gefühl haben muss, dass er in einem schlechten Licht steht, wenn er sich zu gut bewertet. Des Weiteren könnte es sein, dass die Studierenden ihr Wissen für schlechter ausgeben, als es wirklich ist, da sie bewusst auf den Missstand von inklusiven Inhalten in der universitären Lehre aufmerksam machen wollen. Von dieser Eventualität wird jedoch nicht ausgegangen. Wenn es dennoch so wäre, würde es wiederum nur dafür sprechen, dass inklusive Inhalte in der Lehrerbildung vermehrt Einzug erhalten müssen.
Interessant ist weiterhin die Betrachtung der verschiedenen Wissensquellen der Studierenden von Inklusion. Drei Viertel derjenigen, die sich mittelmäßig bis sehr gut mit Inklusion auszukennen scheinen, gibt an, sein Wissen aus universitären Veranstaltungen gewonnen zu haben. Dies ist mit Abstand die häufigste Antwort: Am zweithäufigsten wurden Gespräche mit Freunden und Bekannten genannt, aber nur zu einem Anteil von 39,4 %. Aus Praktika hat ein weiteres Drittel sein Wissen über Inklusion gezogen. Auffällig ist Folgendes: Die Teilnehmer, die nach eigenen Angaben über Wissen im inklusionspädagogischen Bereich verfügen, haben dieses zum Großteil innerhalb ihres Studiums erworben. Hieran wird nochmals die Verantwortung der Universitäten als der Ort der Wissensvermittlung im inklusionspädagogischen Bereich ersichtlich: Wenn sie die Studierenden nicht über Inklusion aufklären, wird der größte Teil der Studierenden nicht mit diesem Thema konfrontiert werden.
Im Folgenden gehe ich auf das Wissen über den Index für Inklusion und über die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen ein. Bei erstgenannter Frage hat sich gezeigt, dass lediglich 20 Personen angegeben haben, den Index für Inklusion zu kennen. Da sich diese Frage innerhalb des Filterbereichs befand, haben nur 154 Teilnehmer dieses Item beantwortet. Da sich die restlichen Teilnehmer jedoch schlecht mit Inklusion auskennen, ist davon auszugehen, dass auch ihnen der Index unbekannt ist. Bezogen auf die gesamte Stichprobe bedeutet dies also, dass lediglich 20 von 369 Teilnehmern ein wichtiges Instrument zur Implementierung von Inklusion in die Schulpraxis kennen. Ein Anteil von fast 95 % kennt den Index demnach nicht.
Die UN-Behindertenrechtskonvention scheint bekannter zu sein als der Index für Inklusion. Dies ist naheliegend, da sie populärer ist, stärker in Medien und Fachliteratur thematisiert wird und den Grund dafür darstellt, warum Inklusion ein immer bedeutenderes Thema im Schulalltag wird. Knapp die Hälfte der Studierenden hat die Aussage bezüglich des von der UN-Konvention festgelegten und von Deutschland ratifizierten Rechts auf inklusive Bildung als wahr markiert. Lediglich ein Anteil von 4,3 % glaubt, dass diese Aussage falsch ist. Jedoch ist sich auch knapp die Hälfte der Teilnehmer unsicher, ob die Aussage die Wahrheit betrifft oder erdacht ist. Hinzugefügt sei an dieser Stelle, dass diese Frage zur Einschätzung des Wahrheitsgehalts nicht ganz mit einer Frage zu vergleichen ist, die direkt auf die Kenntnis eines Sachverhalts abzielt. Bei Einschätzungsfragen zum Wahrheitsgehalt kann man leichter auf "wahr" tippen, was nicht unbedingt heißen muss, dass man sich hinsichtlich der Richtigkeit des Sachverhalts sicher ist: Es ist lediglich eine Einschätzungsfrage, sodass die Aussage auch für wahr gehalten werden kann, ohne den tatsächlichen Wahrheitsgehalt wirklich zu kennen. Vergleicht man diese Frage nämlich mit den drei anderen Fragen, deren Wahrheitsgehalt beurteilt werden musste, so wird ersichtlich, dass das Antwortmuster bei allen vier Items in etwa gleichverteilt ist: Die "weiß nicht" - Antwortoption wurde bei allen vier Fragen am häufigsten ausgewählt (zwischen 34 und 72 %) und insgesamt zeigen die Items ein eher willkürliches Antwortverhalten. Die Aussage bezüglich des Gemeinsamen Unterrichts in allen Bundesländern Deutschlands hält beispielsweise jeweils ein Drittel für wahr, ein weiteres Drittel für falsch und das letzte Drittel ist sich nicht sicher. Deutlich wird hieran also, dass das Wissen über Inklusion eher oberflächlich ist und sich wenig an konkreten Fakten festmachen lässt.
Anhand der beiden offenen Fragen, die darauf abzielten, was die Studierenden unter einer inklusiven Schule verstehen und worin sie einen Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration sehen, lässt sich zeigen, wie sich das Inklusions-Verständnis der Teilnehmer konstituiert.
Betrachtet man die Aussagen der Studierenden über das Wesen einer inklusiven Schule, so wird deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmer (nämlich jeder Dritte), die sich zumindest mittelmäßig mit Inklusion auskennen, die Berücksichtigung aller Kinder in den Fokus einer inklusiven Schule stellt. Weiterhin betont etwa jeder vierte dieser Teilnehmer positive Merkmale einer inklusiven Schule wie gewollte Heterogenität, Nutzung der Vielfalt, Chance, Zukunft, Gleichberechtigung oder Akzeptanz. Ein weiterer Anteil von gut 5 % gibt individuelle Förderung als notwendige Bedingung einer inklusiven Schule an. Fasst man all die bis hierhin genannten Zuschreibungen der Teilnehmer für eine inklusive Schule zusammen, wird ein Anteil von 63 % erreicht. Demnach kann man sagen, dass etwa zwei Drittel der Studierenden der Umfrage, die sich nach eigenen Angaben einigermaßen gut mit Inklusion auskennen, wichtige Merkmale von Inklusion in der Schulpraxis genannt haben.
Ein weiteres Viertel (38 von 146 Personen) charakterisiert eine inklusive Schule dahingehend, als dass sie Kinder mit Behinderungen integriert. Im Vergleich zum vorherigen Inklusionsverständnis wird deutlich, dass diese Gruppe Inklusion anscheinend mit Integration bzw. Gemeinsamem Unterricht gleichsetzt. Bezieht man dieses Verständnis zurück auf Sanders Konzepte inklusiver Pädagogik (siehe Kapitel 2.1.1), so ist dieses Verständnis der Kategorie "Inklusion I: Undifferenzierte Gleichsetzung mit Integration" zuzuordnen. Das eigentliche Wesen der Inklusion hat ein Viertel der Studierenden damit jedoch nicht erfasst. Hinzugefügt sei an dieser Stelle, dass es sich bei diesem Viertel der Teilnehmer bereits um solche handelt, die ihr Wissen über Inklusion zwischen mittel und sehr gut bezeichnen. Zieht man an dieser Stelle die Aussagen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Inklusion und Integration hinzu, weisen 18 % der Nennungen in die selbe Richtung: Dieser Anteil sieht den Zusammenhang zwischen Integration und Inklusion darin, dass innerhalb beider Formen Kinder mit Behinderungen in den Regelunterricht integriert werden.
Unbeachtet bleiben sollen jedoch auch nicht die Teilnehmer, die eine skeptische Haltung bezüglich einer inklusiven Schule ausgedrückt haben. Knapp 7 % halten eine inklusive Schule derzeit für unrealistisch bzw. sind für ihre Realisierung zunächst eine angemessene Finanzierung, qualifiziertes Personal oder ein Systemwechsel notwendig.
Nachdem auf Sanders Konzepte einer inklusiven Didaktik bereits Bezug genommen wurde, lässt sich diese Rückkoppelung auch anhand weiterer Aussagen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Inklusion und Integration anstellen. Ein Anteil von 21 % der Teilnehmer, die diesbezüglich einen Zusammenhang sehen, nennt als positive Attribute, die sowohl auf die Integration als auch auf die Inklusion zutreffen, Gemeinsamkeit, Toleranz, Chancengleichheit oder die positive Sicht auf Heterogenität. Da sie diese Zuschreibungen sowohl für Integration als auch für Inklusion treffen, ist davon auszugehen, dass ihr ursprüngliches Integrationsverständnis bereits dem eines positiven Inklusionsverständnisses gleicht. Aus diesem Grund lassen sich diese Studierenden in Sanders Konzept "Inklusion II: Von Fehlformen bereinigte Integration" einordnen.
Des Weiteren gibt ein Drittel der einen Zusammenhang zwischen Inklusion und Integration sehenden Teilnehmer an, dass Integration eine Vorstufe der Inklusion darstelle. Weitere 12 Studierende gehen inhaltlich näher auf die Unterschiedlichkeit ein und beschreiben sie dahingehend, als dass Integration von einzelnen Personen ausgehe, die zunächst separiert sind, um sie integrieren zu können, während Inklusion in der vorhandenen Verschiedenheit das Ganze sehe. Diese beiden Aussagentypen kann man dem Verständnis "Inklusion III: Optimierte und umfassend erweiterte Integration" zuordnen, was demnach auf 44 % der Studierenden, die sich zumindest mittelmäßig mit Inklusion auskennen, zutrifft. [10]
Unterstützt werden diese verschiedenen Inklusions-Verständnisse der Teilnehmer weiterhin durch die Zuschreibung der Assoziationen zu Inklusion. Über die Hälfte der Studierenden gibt dabei das Stichwort "Heterogenität" an, jedoch ist die am zweithäufigsten genannte Antwort "Menschen mit Behinderungen", was insgesamt ebenfalls fast die Hälfte der Teilnehmer angegeben hat. Die Liste enthielt jedoch auch das Stichwort "Randgruppen", sowie andere Gruppen-Bezeichnungen (die es so gesehen in der Inklusion ja gar nicht geben soll) wie "Menschen mit Migrationshintergrund" und "multikulturelle Gesellschaft". Diese drei Leitwörter wurden jedoch von den Teilnehmern nur sehr selten mit Inklusion assoziiert (zwischen 3 % und 8 %). Dies lässt die Interpretation zu, dass viele Studierende Inklusion in erster Linie auf die Integration von Menschen mit Behinderungen beziehen und andere Gruppen, die gemeinhin als "anders" dargestellt werden und somit tendenziell häufiger exkludiert sind, vernachlässigen.
Zuletzt werde ich auf die Fragestellung Bezug nehmen, die auf die von den Studierenden selbst eingeschätzte Vorbereitung auf Inklusion abzielt und herausstellen möchte, ob die Studierenden die Brisanz und Relevanz der Inklusionsthematik erfasst haben.
Deutlich wurde, dass sich die Studierenden selbst auf eine nahende inklusive Schulpraxis insgesamt recht schlecht vorbereitet fühlen. Dies wurde anhand der beiden Indikatoren "Mittel und Konzepte zur individuellen Förderung" und "Arbeit mit behinderten Kindern im Klassenverbund" herausgestellt. Nur etwa jeder achte Teilnehmer schätzt seine derzeitige Lage so ein, dass ihm Mittel und Konzepte bekannt sind, mit denen er die Lernbedürfnisse eines jeden Kindes individuell erfüllen kann, fast der Hälfte der Studierenden fehlen jedoch nach eigener Angabe solche Mittel und Konzepte. Bezüglich der Arbeit in einer Klasse mit behinderten Kindern fühlen sich nur 7,5 % angemessen qualifiziert. Für eine nicht ausreichende Qualifizierung sprechen sich sogar drei von vier Teilnehmern aus. Diese Erkenntnisse lassen sich mit Ergebnissen der GEW-Studie aus dem Jahr 2010 vergleichen, in denen über 2000 Lehrkräfte zu Inklusion befragt wurden. Bezüglich der Vorbereitung auf Inklusion gab auch hier lediglich ein Anteil von 10 % an, sich adäquat auf Inklusion vorbereitet zu fühlen.
Angesichts dieser Wahrnehmung der schlechten Vorbereitung auf Elemente einer inklusiven Schulpraxis ist es interessant, die Fragen bezüglich der Relevanz von Inklusion in Betracht zu ziehen. Glauben die Studierenden, dass sie zukünftig in einer inklusiven Schule arbeiten werden? Und halten sie es dementsprechend für wichtig, auf inklusionspädagogische Inhalte vorbereitet zu werden?
Die Tatsache, an einer inklusiven Schule Lehrer zu werden, wird von den Studierenden tendenziell daher als wahrscheinlich eingeschätzt: Ein gutes Drittel hält dies für wahrscheinlich, nur halb so viele Studierende halten es für unwahrscheinlich. Deutlich wird aber auch eine recht große Ungewissheit auf Seiten der Studierenden, da etwa die Hälfte ihre Antwort in den mittleren Antwortkategorien einordnete. Dieses Antwortverhalten lässt entweder auf ein "vielleicht, vielleicht aber auch nicht"-Denken schließen, kann aber auch dafür stehen, dass die Studierenden die Wahrscheinlichkeit nur schwer abschätzen können.
Die Mehrheit der Studierenden hält es also eher für wahrscheinlich, im späteren Berufsalltag mit Inklusion konfrontiert zu werden. In diesem Licht erscheint auch das Antwortverhalten auf die beiden Fragen bezüglich einer Pflichtveranstaltung zum Thema Inklusion und zu dem persönlichen Vorhaben in Zukunft eine solche Veranstaltung zu besuchen. Etwa vier von fünf Teilnehmern würden ein Pflichtseminar befürworten. Nur 10 % lehnen ein solches verpflichtendes Seminar ab. Diese Werte ähneln dem Ergebnis aus Franzkowiaks Studie: Befragt wurden ehemalige Teilnehmer des Seminars "Grundschule - Förderschule - Gemeinsamer Unterricht" u. a. dazu, ob sie ein verpflichtendes Seminar zu diesem Thema befürworten würden. 91,5 % der Befragten stimmten für ja, 8,5 % dagegen [vgl. Franzkowiak, 2009, S. 17f.]. Deutlich wird an dieser Stelle, dass unabhängig davon, ob bereits ein Seminar zu integrationspädagogischen Inhalten belegt wurde oder nicht, die hohe Bedeutung einer solchen Veranstaltung von der Mehrheit der Studierenden gesehen wird.
Noch eindeutiger ist die Zustimmung der Studierenden, wenn ihr persönlicher Wille zum Besuch einer inklusionspädagogischen Veranstaltung gefragt ist: 84,5 % wollen in Zukunft gern eine solche Veranstaltung besuchen. Nicht einmal 5 %, 15 Teilnehmer, sprechen sich dagegen aus. Man kann von dieser Frage zwar nicht direkt darauf schließen, dass die Studierenden ihr Vorhaben auch in die Tat umsetzen werden, es zeigt sich aber allemal, dass ihnen bewusst zu sein schein, dass Inklusion ein sehr aktuelles Thema ist, dass in der nächsten Zeit immer mehr Einzug in die Schullandschaft erhalten wird. Aus diesem Grund halten sie das Thema für wichtig und vermutlich auch interessant und möchten inklusionspädagogische Lehrangebote wahrnehmen. Auch dieses Muster aus Franzkowiaks Studie (jedoch vornehmlich hinsichtlich des Gemeinsamen Unterrichts und der Integrationspädagogik) kann bestätigt werden: Die Thematik wird von den Studierenden sowohl für die Lehrerbildung als auch für die spätere Berufspraxis als bedeutend angesehen [vgl. Franzkowiak, 2009, S. 22].
Am Anfang dieses Abschnittes wurden hinsichtlich des Besuchs von universitären Veranstaltungsreihen zum Thema Inklusion verschiedene Erklärungsmuster herangezogen. Die geringe Zahl der Studierenden, die bereits Inklusions-Veranstaltungen besucht hat, ließe sich zum einen damit begründen, dass das universitäre Angebot zum Thema Inklusion nicht vorhanden ist, und zum anderen damit, dass die Studierenden Inklusion für kein bedeutsames Thema halten und deshalb kein Interesse entwickeln, solche Veranstaltungen zu besuchen. Wie zuletzt gezeigt werden konnte, sind sich die Studierenden aber über die Relevanz der Inklusionsthematik sehr wohl bewusst, betrachtet man allein, wie groß der Wunsch der Studierenden ist, in Zukunft eine Inklusionsveranstaltung zu besuchen. Aus diesem Grund kann vermutet werden, dass das universitäre Angebot zu inklusionspädagogischen Veranstaltungen äußerst gering sein muss.
[6] Zur Konstruktion dieses Fragebogens siehe das folgende Kapitel, 3.2.2. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang vorzufinden.
[7] Online erreichbar unter www.soscisurvey.de
[8] Die Zahlenwerte sind zusammengefasst und beziehen sich sowohl auf den regulären Fragebogen als auch auf die Sonderversion für Studierende der TU Dortmund.
[9] Auch wenn dieser Frage keine reine endpunktbenannte Skala zugeordnet war (neben den Endpunkten war zusätzlich die mittlere Option verbalisiert), wird trotzdem zur Verdeutlichung der Mittelwert herangezogen. Da nur die mittlere Kategorie aufgrund der notwendigen Filteroption zusätzlich verbalisiert war, kann die Skala so behandelt werden, als ob die Skalenpunkt im gleichen Abstand zueinander liegen, sodass sie als intervallskaliert interpretiert werden kann.
[10] Angemerkt werden soll an dieser Stelle, dass die Zurodnung der Aussagetypen dieser Frage zu Sanders Konzepte einer inklusiven Pädagogik auf Überlegungen und einer Interpretation der Aussagen beruht. Es kann nicht sichergestellt werden, dass diese Zuordnung für jeden einzelnen Fall treffend ist und allein durch die angegebene Aussage auf das zugrunde liegende Inklusionsverständnis geschlossen werden kann.
Zum Abschluss werden die wesentlichen Arbeitsschritte und Ergebnisse dieser Arbeit kurz zusammengefasst und diskutiert, um daran anschließend in Aussicht zu stellen, welche Konsequenzen sich hieraus für die Zukunft ergeben.
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde aufgezeigt, wie schwer es ist, eine einheitliche Definition für Inklusion aufzustellen. Herausgestellt wurde jedoch, dass das Inklusionsverständnis über das Integrationsverständnis hinausgeht und zwar in dem Sinne, als dass mit Inklusion mehr gemeint ist als die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen. Dies stellt ein Bestandteil der Inklusion dar, grundlegendere Aspekte sind jedoch darin zu sehen, dass die Vielfalt aller Menschen als normal angesehen wird und jeder Mensch in seiner individuellen Persönlichkeit dem Ganzen zugehörig ist, unabhängig davon, was die individuelle Person ausmacht (eine Behinderung, eine Hochbegabung, das Geschlecht, die Haarfarbe, einen Migrationshintergrund etc.).
In der Studie wurde aufgezeigt, dass ein Drittel derjenigen Studierenden, die sich nach eigenen Angaben relativ gut mit Inklusion auskennen, eben jenes Verständnis von Inklusion haben, welches sich auf die Integration von behinderten Kindern in den Regelunterricht beschränkt. Hieran wird erkennbar, wie wichtig es ist, das Thema "Inklusion" in seinem vollständigen Wesen zu vermitteln und nicht "Begriffskosmetik" zu betreiben und den ursprünglichen Begriff der Integration durch den Begriff der Inklusion zu ersetzen. Dies bedeutet auch für die Universitäten, auf eine sachlich korrekte Vermittlung des Inklusionsgedankens zu achten.
Mit der Erläuterung der UN-Behindertenrechtskonvention konnte gezeigt werden, dass inklusive Bildung rechtlich verankert ist. Für Deutschland bedeutet dies, dass sich das Land mit der Ratifizierung dieser Konvention zum Aufbau eines inklusiven Bildungssystems verpflichtet hat. Hierin ist demnach die Konsequenz implementiert, dass ein Bedarf an Lehrern besteht, die sich mit Inklusion auskennen und die inklusive Settings handhaben können, um darin fruchtbare Lernprozesse für alle Kinder zu initiieren. In Nordrhein- Westfalen werden derzeit vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten und Maßnahmen geplant, mit denen Inklusion Einzug in die Bildungslandschaft erhalten kann. Durch die aktuelle Landesregierung und die Ministerin für Schule und Weiterbildung Sylvia Löhrmann hat das Land Nordhrein-Westfalen eine politische Führung erhalten, die sich sehr fortschrittlich um das Thema Inklusion kümmert. So sollen Rahmenbedingungen und auch die Lehreraus- und fortbildung inklusionsförderlich geregelt werden.
Einen Anstieg verzeichnet zudem die Integrationsquote in Nordrhein-Westfalen: Immerhin besucht mittlerweile jedes vierte Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Primarbereich eine Regelschule. Diese Tendenz weist in die Richtung einer Schule für alle, auch wenn diese mit einem Anteil von 75 % nicht integrierten Kindern noch einige Jahre entfernt zu liegen scheint.
An diesen Entwicklungslinien wird deutlich, welch progressiven Anschub die Inklusionsbewegung in den letzten Jahren erhalten hat. Hieran muss sich auf die Leherbildung orientieren. Einen ersten Fortschritt ist durch das neue Lehrerausbildungsgesetz zu verzeichnen, das einige vielversprechende Ansätze für eine inklusive Lehrerbildung aufweist: Eine stärkere Verzahnung von Schulen und Universität und damit verbunden von Wissen und Erfahrungen durch das neue Praxissemester, die Erweiterung der basalen Lehrerkompetenzen um die Bereiche Schulentwicklung und Kooperation, die besondere Akzentuierung des Umgangs mit Heterogenität und der individuellen Förderung sowie die Festlegung auf Leistungsnachweise in Deutsch für Schüler mit Zuwanderungsgeschichte deuten daraufhin, dass die Lehrerbildung Nordrhein-Westfalens sich in Richtung Inklusion verändern wird. Wie sich dies in der Realität darstellen wird, wird allerdings erst die Zukunft zeigen. Konkrete Veranstaltungen oder Pflichtmodule in der Inklusionsthematik sind in diesen Rahmenbedingungen beispielsweise nicht vorgesehen.
Wie sich Unterricht hinsichtlich einer inklusiven Schulpraxis ändern wird, wurde im letzten Teil des theoretischen Kapitels erläutert. Zusammenfassend kann man die wichtigsten Elemente diesbezüglich mit der positiven Nutzung von Heterogenität, notwendiger Differenzierung und individualisierendem Unterricht, dem Einlassen auf Team-Arbeit und Kooperation sowie dem Nutzen von offenen Lernformen, insbesondere des Kooperativen Lernens, beschreiben. Auch die Einstellung des Lehrers bezüglich seiner Haltung zu Verschiedenheit, Akzeptanz eines jeden Kindes und Inklusion im Ganzen sind von wesentlicher Bedeutung für das Gelingen einer inklusiven Unterrichtspraxis. Auf diesen Aspekt wurde in der vorliegenden Masterarbeit nicht näher eingegangen. Der Fragebogen, der der Studie zugrunde liegt, weist aber hinsichtlich der Einstellung angehender Grundschullehrkräfte gegenüber Inklusion ein Themengebiet auf. Zu diesem Thema liegen also bereits Daten vor, die angesichts eines umfassenden Blicks auf die angehende Lehrperson in einem nächsten Schritt zur Auswertung herangezogen werden können. Dies betrifft auch die persönlichen Erfahrungen der Studierenden abseits der Universität mit inklusionsrelevanten Begebenheiten oder Erlebnissen, die sich unter Umständen auf die Einstellung zu Inklusion auswirken können.
Die Studie, die an 369 Grundschullehramtsstudierenden Nordrhein-Westfalens durchgeführt wurde, ist infolgedessen der Frage nachgegangen, wie Studierende des Primarbereichs derzeit durch die Universitäten auf Inklusion vorbereitet werden.
Es hat sich bestätigt, dass Studierende insgesamt betrachtet relativ schlecht auf eine inklusive Bildungslandschaft vorbereitet werden. Hinsichtlich der Veranstaltungen, die die Teilnehmer der Umfrage bereits zu inklusionspädagogischen Inhalten besucht haben, lässt sich sagen, dass es der Seltenheit entspricht, wenn ein Studierender des Grundschullehramts bereits eine Veranstaltungsreihe zu dem übergeordneten Thema Inklusion besucht hat. Etwas häufiger trifft dies darauf zu, wenn Inklusion oder zugehörige Bereiche, wie integrationspädagogische oder interkulturelle Themen, in einzelnen Sitzungen verschiedener Veranstaltungen angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass jeder zweite Studierende dieser Studie in universitären Veranstaltungen noch nie etwas zum Thema Inklusion gelernt hat. Hinsichtlich der Mittel und Kompetenzen, die Grundschullehramtsstudierende im Studium vermittelt werden, stellt sich die Situation etwas positiver dar. Lernformen des offenen Unterrichts sind den Studierenden in der Mehrheit recht bekannt, was damit zusammenhängen mag, dass sie nicht typisch für eine inklusive Didaktik stehen, sondern als Qualitätskriterien eines jeden modernen Unterrichts gelten. Eine gerade für inklusive Settings besonders entscheidende Lernform, die des Kooperativen Lernens, ist unter den Teilnehmern allerdings recht unterrepräsentiert: Mehr als jedem zweiten Studierenden ist das Kooperative Lernen bislang im Studium nicht begegnet. Ähnlich stellen sich die Ergebnisse hinsichtlich spezieller schulpraktischer Bereiche dar: In denjenigen Gebieten, die besonders entscheidend für inklusive Bildungsprozesse sind, weisen viele Teilnehmer ein geringes Wissen auf. Dies betrifft insbesondere den Bereich des Team-Teachings, das für inklusiven Unterricht unabdingbar ist, jedoch schreibt sich mehr als die Hälfte der Teilnehmer diesbezüglich ein geringes Wissen zu. In den allgemeineren Felder Heterogenität und Differenzierung geben die Studierenden an, sich besser auszukennen.
Das Wissen der Teilnehmer über Inklusion wurde ebenfalls in der Studie hinterfragt, da dieses indirekt Aufschluss darüber gibt, wie viel die Studierenden über Inklusion gelernt haben. Dieses Wissen ist auffallend gering: Von zehn Studierenden beschreiben sechs Teilnehmer ihr Wissen als schlecht, drei als mittelmäßig und lediglich einer als gut. Diejenigen, die ihr Wissen als mittelmäßig oder gut einschätzen, haben dieses Wissen jedoch hauptsächlich in der Universität erlernt, was die Verantwortung der Hochschulen hinsichtlich einer inklusions-fundierten Ausbildung bestärkt: Wenn die Hochschulen die Studierenden nicht auf Inklusion vorbereiten, wird ein Großteil der angehende Lehrer bis zum Berufseinstieg bzw. bis zum Referendariat überhaupt nicht mit dem Thema Inklusion konfrontiert werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass das Wissen zum Thema Inklusion bei den Studierenden recht oberflächlich und wenig fundiert zu sein scheint. An diesen Erkenntnissen muss die universitäre Lehre anknüpfen: Es ist nicht nur wichtig, dass überhaupt Veranstaltungen zum Thema Inklusion angeboten werden, von ebenso großer Bedeutung ist es, dass auf Seiten der Studierenden eine fruchtbare Grundlage in inklusionspädagogischen Themen geebnet wird.
Dass diese Forderung von den Studierenden erwünscht und verlangt wird, konnte die Studie des Weiteren belegen. Die überwiegende Mehrheit möchte zukünftig Veranstaltungen zur Inklusionsthematik besuchen und könnte sich sogar vorstellen, dass es hierzu verpflichtende Seminare für alle Lehramtsstudierenden gibt. Den meisten Teilnehmern scheint bewusst zu sein, dass es sich hierbei um einen äußerst aktuellen und relevanten Schulentwicklungsprozess handelt und es notwendig ist, dass sie, als angehende Akteure dieses Systems, auf diese Entwicklung vorbereitet sein wollen. Dass die Studierenden sich momentan schlecht auf Inklusion vorbereitet fühlen, konnte in der Studie ebenso gezeigt werden. In erster Linie betrifft dies die Arbeit mit behinderten Kindern in Unterrichtssituationen, aber ebenfalls das individuelle Eingehen auf die Lernbedürfnisse eines jeden Kindes.
Insgesamt konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass Studierende des Grundschullehramtes in Nordrhein-Westfalen in einem recht geringen Ausmaß auf Inklusion vorbereitet werden. Zu bedenken gilt es jedoch auch, dass viele der Studierenden, die sich an der Umfrage beteiligt haben, noch nicht am Ende ihres Studiums angelangt sind und zukünftig weitere Inhalte zum Thema Inklusion erfahren können. Wenn durch diese Studie Studierende, die sich bislang noch nicht sehr umfassend mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt haben, durch die Umfrage für inklusionspädagogische Inhalte sensibilisiert wurden, ist dies ein schöner Erfolg hinsichtlich ihrer weiteren Ausbildung.
Mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz besteht die Hoffnung, dass sich die Lehrerbildung inklusionsgewandt verändern wird. Jedoch gibt es auch heute schon praktizierte inklusionspädagogische "Inseln" in der Lehrerbildung. An der Universität Münster wird seit drei Semestern das praktikumsbegleitende Seminar ""PinI - Praxisphasen in Inklusion" angeboten [vgl. Veber u. Stellbrink, 2011]. Die Dozierenden dieses Seminars kooperieren mit Schulen der Umgebung, in denen Inklusion bereits praktiziert wird, und vermitteln den Teilnehmern des Seminars auf diese Weise ein Praktikum in einer inklusiven Schule. Dieses Praktikum schließt sich an das im Semester stattfindende Seminar an, in dem den Studierenden eine inklusionspädagogische Wissensbasis bereitet wird und sie die Möglichkeit finden, sich auf ihr Praktikum vorzubereiten. Die Verzahnung sowohl von Hochschule und Schule als auch von Wissensvermittlung und Selbsterfahrung wird in diesem Fall ermöglicht, so dass die Studierenden auf effektivem Wege einen umfassenden Blick auf inklusive Schulpraxis erhalten.
Hinsichtlich der Tatsache, dass sich die bereits im Berufsleben stehenden Lehrer angesichts von Inklusion schlecht vorbereitet fühlen, ist als positives Beispiel der Weiterbildungsmaster Integrative Förderung an der pädagogischen Hochschule Luzern anzubringen [vgl. Achermann u. Grossrieder, 2010]. In diesem zweijährigen Studiengang werden Regelschullehrer für den integrativen Umgang mit Vielfalt qualifiziert. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf sonderpädagogische Bereiche, sondern es werden Deutsch als Zweitsprache sowie die Schwerpunkte Heilpädagogik, Interkulturelle Pädagogik oder Begabungsförderung angeboten.
Vergleichbar mit diesem Weiterbildungsmaster ist das Konzept der Universität Bielefeld, in der kombinierte Studiengänge angeboten werden. Das integrierte sonderpädagogische Bachelor- und Masterstudium in der Erziehungswissenschaft bietet die Möglichkeit, sowohl angehende Grundschul- als auch Sonderpädagogen mit sonderpädagogischen Themen zu konfrontieren [vgl. Universität Bielefeld, 2011]. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass andere relevante Bereiche, die für Inklusion wichtig sind, die beispielsweise im zuvor dargestellten Master für Integrative Förderung thematisiert werden, in der Ausbildung der Studierenden nicht vergessen werden. Auch hier bietet die Studie für eine weitere Arbeit mit den erhobenen Daten die Möglichkeit, einen Vergleich der Universität Bielefeld mit den anderen Universitäten hinsichtlich der Vorbereitung auf Inklusion anzustellen.
Diese drei exemplarischen Möglichkeiten zur Eingliederung von Inklusion in die Lehrerbildung sollten als Ansatzpunkte für eine flächendeckendere Umsetzung angesehen werden. Nur so kann erreicht werden, dass das "Zauberwort Inklusion" seinen Zauber auf die damit konfrontierten Lehrer ausstrahlt und der empfundene "Fluch der Inklusion" auf diese Weise verschwindet.
[Achermann u. Grossrieder 2010] Achermann, B. ; Grossrieder, I.: Stärkung der Inklusionskraft der allgemeinen Schule. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg : Lebenshilfe-Verl., 2010, S. 297-310
[Aichele 2010] Aichele, V.: Das Recht auf inklusive Bildung gemäß Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention: Inhalt und Wirkung. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle: Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg : Lebenshilfe-Verl., 2010, S. 11-25
[Amrhein 2011] Amrhein, B.: Lehrkräfte im Paradox zwischen Integration und Segregation - Konsequenzen für die zukünftige Aus- und Fortbildung von LehrerInnen für Inklusion. In: Ziemen, K. (Hrsg.) ; Langner, A. (Hrsg.) ; Köpfer, A. (Hrsg.) ; Erbring, S. (Hrsg.): Inklusion - Herausforderungen, Chancen und Perspektiven. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2011, S. 125-138
[BAG Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen e. V. u. a. 2010] BAG Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen e. V. ; Deutscher Behindertenrat ; Sozialverband Deutschland: Positionierung der Verbände zum Entwurf der KMK-Empfehlungen "Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Schulen" (Stand 6. August 2010). (2010). http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de/images/stories/StN_Verbnde_zu_KMK-Empfehlungen__2011-3-28.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[BAG Gemeinsam leben - gemeinsam lernen e. V. u. a. 2011] BAG Gemeinsam leben - gemeinsam lernen e. V. ; Deutscher Behindertenrat ; Sozialverband Deutschland: Stellungnahme der Verbände zu den KMK-Empfehlungen 'Inklusiv Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen' vom 3.12.2010. (2011). http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de/images/stories/StN_Verbnde_zu_KMK-Empfehlungen__2011-3-28.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Bayer u. a. 1997] Bayer, M. ; Carle, U. ; Wildt, J.: Editorial. In: Bayer, M. (Hrsg.) ; Carle, U. (Hrsg.) ; Wildt, J. (Hrsg.): Brennpunkt: Lehrerbildung: Strukturwandel und Innovationen im europäischen Kontext. Opladen : Leske + Budrich, 1997, S. 7-16
[Becker 2001] Becker, E.: Lehramtsausbildung - Illusion ohne Ende? (2001). http://www.sowi-onlinejournal.de/lehrerbildung/becker.html , Abruf: 18. Oktober 2011
[Beckmann 2011] Beckmann, U.: Vorwort: Aus unserer Sicht - Inklusion. In: Schule heute 51 (2011), Nr. 3, S. 2_3
[Bellenberg 2010] Bellenberg, G.: Von den Mühen der Ebene - Erste Erfahrungen mit neuen Steuerungsprozessen zur Umsetzung der Lehrerbildungsreform in NRW. In: Wernstedt, R. (Hrsg.) ; John-Ohnesorg, M. (Hrsg.): Der Lehrerberuf im Wandel. Wie Reformprozesse Eingang in den Schulalltag finden können. Berlin : Friedrich Ebert Stiftung, 2010, S. 16-18
[Bielefeldt 2010] Bielefeldt, H.: Menschenrecht auf inklusive Bildung. Der Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention. (2010). http://www.inklusive-schule-bayern.de/upload/files/BRK-inkl.Bildung.doc , Abruf: 18. Oktober 2011
[Böing 2011] Böing, U.: Professionalisierung von Lehrpersonen und Schulentwicklung - eine effektive Wechselbeziehung. In: Ziemen, K. (Hrsg.) ; Langner, A. (Hrsg.) ;Köpfer, A. (Hrsg.) ; Erbring, S. (Hrsg.): Inklusion - Herausforderungen, Chancen und Perspektiven. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2011, S. 59-74
[Blömeke 2009] Blömeke, S.: Lehrerausbildung. In: Andresen, S. (Hrsg.) ; Casale, R. (Hrsg.) ; Gabriel, T. (Hrsg.) ; Horlacher, R. (Hrsg.) ; Larcher Klee, S. (Hrsg.) ; Ölkers, J. (Hrsg.): Handwörterbuch Erziehungswissenschaft. Weinheim und Basel : Beltz, 2009, S. 547-562
[Bloemers u. Wisch 2004] Bloemers, W. ; Wisch, F.-H.: Glossar der Heilpädagogik. Special education glossary. Frankfurt a. M. : Lang, 2004
[Booth 2011] Booth, T.: Wie sollen wir zusammen leben? Inklusion als wertbezogener Rahmen für die pädagogische Praxis. Aus dem Englischen von Sulzer, A. und Wagner, P. Frankfurt a. M. : Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2011
[Booth u. a. 2006] Booth, T. ; Ainscow, M. ; Kingston, D.: Index für Inklusion. (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln. Deutschsprachige Ausgabe Aus dem Englischen von Hermann, T. Frankfurt a. M. : Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2006
[Buholzer u. Kummer Wyss 2010a] Buholzer, A. (Hrsg.) ; Kummer Wyss, A. (Hrsg.): Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zug : Klett, Kallmeyer, 2010
[Buholzer u. KummerWyss 2010b] Buholzer, A. ; Kummer Wyss, A.: Zur Einführung: Reaktionen auf Heterogenität in Schule und Unterricht. In: Buholzer, A. (Hrsg.) ; Kummer Wyss, A. (Hrsg.): Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zug : Klett, Kallmeyer, 2010, S. 78-86
[Bundesgesetzblatt 2008] Bundesgesetzblatt, Jg. 2008 Teil II Nr. 3.: Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf. Version: 2008, Abruf: 18. Oktober 2011
[Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a] Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen. Erster Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland. (2011). http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf%3bjsessionid=3B05548672F0F1F9FD0B8FBBF32CBB82?__blob=publicationFile, Abruf: 18. Oktober 2011
[Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011b] Bundesministerium für Arbeit und Soziales: "einfach machen". Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. (2011). http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/2011_06_15_nap.pdf?__blob=publicationFile, Abruf: 18. Oktober 2011
[Carle 2011] Carle, U.: Vom Anspruch ins Tun wechseln. Was Lehrerinnen und Lehrer in inklusiven Schulen können müssen. In: Erziehung und Wissenschaft 63 (2011), Nr. 2, S. 18-19
[Demmer u. Schmerr 2011] Demmer, M. ; Schmerr, M.: Mehr Zeit, mehr Lehrer, mehr Fortbildung. Die GEW hat ihre Mitglieder befragt. In: Erziehung und Wissenschaft 63 (2011), Nr. 2, S. 16-17
[Demmer-Dieckmann 2007] Demmer-Dieckmann, I.: "Aus Zwang wurde Interesse." Eine Studie zur Wirksamkeit von Seminaren zum Gemeinsamen Unterricht in Berlin. In: Demmer-Dieckmann, I. (Hrsg.) ; Textor, A. (Hrsg.): Integrationsforschung und Bildungspolitik im Dialog. Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2007, S. 153-162
[Demmer-Dieckmann 2010] Demmer-Dieckmann, I.: Die UNBehindertenrechtskonvention und Ergebnisse der Integrationsforschung. In: VBE aktuell 39 (2010), Nr. 9, S. 8-10
[Eberwein 1998] Eberwein, H.: Integrationspädagogik als Element einer allgemeinen Pädagogik und Lehrerausbildung. In: Hildeschmidt, A. (Hrsg.) ; Schnell, I. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim und München: Juventa-Verlag, 1998, S. 345-362
[Erbring 2005] Erbring, S.: Integration/Inklusion braucht die Diskussion um Bildungsstandards - besonders im Bereich der Lehramtsausbildung. In: Geiling, U. (Hrsg.) ; Hinz, A. (Hrsg.): Integrationspädagogik im Diskurs. Auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik? Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2005, S. 129-134
[Fleischhauer 2011] Fleischhauer, R.: Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem. In: Schule heute 51 (2011), Nr. 3, S. 4-6
[Franzkowiak 2009] Franzkowiak, T.: Integration, Inklusion, Gemeinsamer Unterricht - Themen für die Grundschullehramtsausbildung an Hochschulen in Deutschland? Eine Bestandsaufnahme. (2009). http://bidok.uibk.ac.at/library/franzkowiak-integration.html , Abruf: 18. Oktober 2011
[Goddar 2011] Goddar, J.: Profession braucht Inklusion. Tagung Arbeitskreis Inklusion. (2011). http://www.gew.de/Profession_braucht_Inklusion.html , Abruf: 18. Oktober 2011
[Gomolla 2009] Gomolla, M.: Heterogenität, Unterrichtsqualität und Inklusion. In: Fürstenau, S. (Hrsg.) ; Gomolla, M. (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Unterricht. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, S. 21-43
[Gräf 2010] Gräf, L.: Online-Befragung. Eine praktische Einführung für Anfänger. Berlin : LIT, 2010
[Grossenbacher 2010] Grossenbacher, S.: Kompetenz und Professionalität entwickeln. In: Buholzer, A. (Hrsg.) ; Kummer Wyss, A. (Hrsg.): Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zug : Klett, Kallmeyer, 2010, S. 162-168
[Heimlich 2007] Heimlich, U.: Zusammen arbeiten - Qualifikation für integrative Pädagogik. In: Mutzeck, W. (Hrsg.) ; Popp, K. (Hrsg.): Professionalisierung von Sonderpädagogen: Standards, Kompetenzen und Methoden. Weinheim und Basel : Beltz, 2007, S. 158-177
[Heyer 2002] Heyer, P.: Grundschule - Schule für alle Kinder. Grundsätze zur Entwicklungintegrativer Arbeit. In: Eberwein, H. (Hrsg.) ; Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim und Basel : Beltz, 2002, S. 191-200
[Hinz 2002] Hinz, A.: Von der Integration zur Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 53 (2002), Nr. 9, S. 354-361
[Hinz 2004] Hinz, A.: Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? (2004). www.gew-nds.de/sos/Vortrag-hinz.doc , Abruf: 18. Oktober 2011
[Hinz 2009] Hinz, A.: Inklusive Pädagogik in der Schule - veränderter Orientierungsrahmen für die schulische Sonderpädagogik!? Oder doch deren Ende?? In: Zeitschrift für Heilpädagogik 60 (2009), Nr. 5, S. 171-179
[Hinz 2010a] Hinz, A.: Inklusion als Schulentwicklungskonzept. (2010). http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/1009816/publicationFile/AndreasHinzIncklusion.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Hinz 2010b] Hinz, A.: Schlüsselelemente einer inklusiven Pädagogik und einer Schule für Alle. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg :Lebenshilfe-Verlag, 2010, S. 63-75
[Joller-Graf 2010] Joller-Graf, K.: Binnendifferenziert unterrichten. In: Buholzer, A. (Hrsg.) ; Kummer Wyss, A. (Hrsg.): Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zug : Klett, Kallmeyer, 2010, S. 122-137
[Klauß 2009] Klauß, T.: Was meint Inklusion? Zwischen Idee und Realitäten. (2009). http://www.beb-ev.de/files/pdf/2009/dokus/elt09/klauss_vortrag. pdf, Abruf: 18. Oktober 2011
[Klauß 2010] Klauß, T.: Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern für eine Schule für alle. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg :Lebenshilfe-Verlag, 2010, S. 281-296
[Klemm 2010] Klemm, K.: Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland. (2010). http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_32811_32812_2.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Klemm u. Preuss-Lausitz 2011] Klemm, K. ; Preuss-Lausitz, U.: Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen. Empfehlungen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der allgemeinen Schulen. (2011). http://http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Inklusion_Gemeinsames_Lernen/Gutachten__Auf_dem_Weg_zur_Inklusion_/NRW_Inklusionskonzept_2011__-_neue_Version_08_07_11.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Klippert 2009] Klippert, H.: Heterogene Lerngruppen unterrichten. Anregungen für den Schulalltag. In: Pithan, A. (Hrsg.) ; Schweiker, W. (Hrsg.): Evangelische Bildungsverantwortung: Inklusion. Ein Lesebuch. Münster : Comenius Institut, 2009, S. 121-127
[Kopp 2009] Kopp, B.: Inklusive Überzeugung und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Heterogenität - Wie denken Studierende des Lehramts für Grundschulen? In: Empirische Sonderpädagogik 1 (2009), Nr. 1, S. 5-25
[Kron 2010] Kron, M.: Ausgangspunkt: Heterogenität. Weg und Ziel: Inklusion? Reflexionen zur Situation im Elementarbereich. In: Zeitschrift für Inklusion. Online-Magazin. 3 (2010). http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/65/68 , Abruf: 18. Oktober 2011
[Kuckartz u. a. 2009] Kuckartz, U. ; Ebert, T. ; Rädiker, S. ; Stefer, C.: Evaluation online. Internetgestützte Befragung in der Praxis. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009
[Kultusministerkonferenz 2004] Kultusministerkonferenz: Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. (2004). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Kultusministerkonferenz 2008] Kultusministerkonferenz: Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung. (2008). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Kultusministerkonferenz 2010a] Kultusministerkonferenz: Fachtagung zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Bremen. In: VBE aktuell 39 (2010), Nr. 9, S. 18
[Kultusministerkonferenz 2010b] Kultusministerkonferenz: Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen. (2010). http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/AllgBildung/Anhoerungstext-Entwurf-2010-12-03-205-AK.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Kultusministerkonferenz 2010c] Kultusministerkonferenz: Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) in der schulischen Bildung. Diskussionspapier der Kultusministerkonferenz für die Fachtagung der Kultusministerkonferenz am 21./22.06.2010, Bremen. (2010). http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_11_18-Behindertenrechtkonvention.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Löhrmann 2010] Löhrmann, S.: Grußwort im Rahmen des EU-Kongresses: Auf dem Weg zur schulischen Inklusion: Eine Kultur des Behaltens entwickeln und leben! Gehalten am 22. 9. 2010. (2010). http://www.schulministerium.nrw.de/BP/_Rubriken/Initiativen/Inklusion.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Löhrmann u. a. 2010] Löhrmann, S. ; Kraft, H. ; a. u.: Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: UN-Konvention zur Inklusion in der Schule umsetzen. (2010). http://www.eine-schule-fuer-alle.info/downloads/13-62-520/MMD15-26.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Liesen u. Felder 2004] Liesen, C. ; Felder, F.: Bemerkungen zur Inklusionsdebatte. In: Heilpädagogik online 3 (2004), Nr. 3. http://www.heilpaedagogik-online.com/2004/heilpaedagogik_online_0304.pdf
[Loreman u. a. 2007] Loreman, T. ; Forlin, C. ; Sharma, U.: An International Comparison of Pre-service Teacher Attitudes towards Inclusive Education. (2007). http://www.dsq-sds.org/article/view/53/53 , Abruf: 18. Oktober 2011
[Meier u. Merz-Atalik 2005] Meier, J. ; Merz-Atalik, K.: Aus- und Fortbildung für Integration/Inklusion in neuen Strukturen. In: Geiling, U. (Hrsg.) ; Hinz, A. (Hrsg.): Integrationspädagogik im Diskurs. Auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik? Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2005, S. 181-183
[Merz-Atalik 2002] Merz-Atalik, K.: Kinder nichtdeutscher Muttersprache und Herkunft. Belastung oder Bereicherung für den Gemeinsamen Unterricht? In: Eberwein, H. (Hrsg.) ; Knauer, S. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Weinheim und Basel : Beltz, 2002, S. 370-380 [MSJK NRW 2004] MSJK NRW: Ministerium für Schule, Jugend und Kinder Nordrhein-Westfalen: Praxisphasen in den Lehramtsstudiengängen. Rahmenvorgaben. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Lehrerausbildung/Praxisphasen.pdf. Version: 2004, Abruf: 18. Oktober 2011
[MSW NRW 2011a] MSW NRW: Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen: Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz - LABG) vom 12. Mai 2009. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Lehrerausbildung/LABGNeu.pdf. Version: 2011, Abruf: 18. Oktober 2011
[MSW NRW 2011b] MSW NRW: Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen: Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz - LABG) vom 2. Juli 2002. http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Lehrerausbildung/LABGAlt.pdf. Version: 2011, Abruf: 18. Oktober 2011
[Obolenski 2001] Obolenski, A.: Integrationspädagogische Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Grundlagen und Perspektiven für "eine Schule für alle". Bad Heilbrunn : Klinkhardt, 2001 [Paier 2010] Paier, D.: Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung. Wien : facultas. wuv, 2010
[Platte 2010] Platte, A.: Inklusiver Unterricht - Eine didaktische Herausforderung. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg : Lebenshilfe-Verlag, 2010, S. 87-100
[Porst 2008] Porst, R.: Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008
[Rehle 2009] Rehle, C.: Grundlinien einer inklusiven, entwicklungsorientierten Didaktik. In: Pithan, A. (Hrsg.) ; Schweiker, W. (Hrsg.): Evangelische Bildungsverantwortung: Inklusion. Ein Lesebuch. Münster : Comenius Institut, 2009, S. 128-132
[Riedel 2010] Riedel, E.: Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem. (2010). http://www.sovd.de/fileadmin/downloads/pdf/positionspapiere/Kurzfassung_Riedel-Gutachten.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Sander 2004] Sander, A.: Konzepte einer inklusiven Pädagogik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 55 (2004), Nr. 5, S. 240-244
[Schnell 2003] Schnell, I.: Geschichte schulischer Integration. Gemeinsames Lernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderung in der BRD seit 1970. Weinheim und München: Juventa, 2003
[Scholl 2009] Scholl, A.: Die Befragung: Sozialwissenschaftliche Methode und kommunikationswissenschaftliche Anwendung. 2. Weinheim und Basel : UVK-Verl.-Ges., 2009
[Schulministerium NRW 2011] Schulministerium NRW: Gestufte Studiengänge (Bachelor/Master). http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege/Lehramtsstudium/#A_6Version : 2011, Abruf: 18. Oktober 2011
[Schumann 2009] Schumann, B.: Inklusion statt Integration - eine Verpflichtung zum Systemwechsel. Deutsche Verhältnisse auf dem Prüfstand des Völkerrechts. In: Pädagogik 61 (2009), Nr. 2, S. 51-53
[Schuppener 2007] Schuppener, S.: ICH - DU - WIR. Mehrperspektivität in der Inklusion. Voraussetzungen und Möglichkeiten des Lehrerhandelns am Beispiel des Übergangs Schule-Beruf von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. In: Mutzeck, W. (Hrsg.) ; Popp, K. (Hrsg.): Professionalisierung von Sonderpädagogen. Standards, Kompetenzen und Methoden. Weinheim und Basel : Beltz, 2007, S. 141-157
[Schwager 2011] Schwager, M.: Gemeinsames Unterrichten im Gemeinsamen Unterricht. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 62 (2011), Nr. 3, S. 92-98
[Seitz 2005] Seitz, S.: Zeit für inklusiven Sachunterricht. Hohengehren : Schneider, 2005 (Basiswissen Grundschule Bd. 18)
[Speck 2011a] Speck, O.: Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht. Rhetorik und Realität. 2. München und Basel : Ernst Reinhardt Verlag, 2011
[Speck 2011b] Speck, O.: Wage es nach wie vor, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ideologische Implikationen einer Schule für alle. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 62 (2011), Nr. 3, S. 84-91
[Stein 2011] Stein, A.: Inklusion in der Hochschuldidaktik. Oder die Frage: Wie können Studierende darauf vorbereitet werden, in einer ausgrenzenden Gesellschaft inklusive Strukturen zu etablieren? Frankfurt a. M. : Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 2011
[Stähling 2009] Stähling, R.: "Du gehörst zu uns". Inklusive Grundschule. 2. Hohengehren: Schneider, 2009 (Basiswissen Grundschule Bd. 20)
[Terhart 2010] Terhart, E.: Was hat sich in der Lehrerbildung getan? - Ein Rückblick. In: Wernstedt, R. (Hrsg.) ; John-Ohnesorg, M. (Hrsg.): Der Lehrerberuf im Wandel. Wie Reformprozesse Eingang in den Schulalltag finden können. Berlin : Friedrich Ebert Stiftung, 2010, S. 11-15
[Toutenburg u. Heumann 2008] Toutenburg, H. ; Heumann, C.: Deskriptive Statistik. Eine Einführung in Methoden und Anwendungen mit R und SPSS. 6. Berlin und Heidelberg : Springer, 2008
[UNESCO 1994] UNESCO: Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Aus dem Englischen von Flieger, P. (1994). http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html , Abruf: 18. Oktober 2011
[Universität Bielefeld 2011] Universität Bielefeld: Das integrierte sonderpädagogische Bachelor- und Masterstudium im Nebenfach Erziehungswissenschaft. (2011). http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft//ag3/pdf/informationsheft_integrierte_sonderpaedagogik.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[Veber 2010] Veber, M.: Ein Blick zurück nach vorn in der Lehrerbildung. Eine empirische Studie zu Alltagstheorien über Behinderung, Integration-Inklusion und Sonderschule. Münster : ZfL-Verlag, 2010
[Veber u. Stellbrink 2011] Veber, M. ; Stellbrink, M.: Praxisphasen in Inklusion -Professionalisierung an der Schnittstelle von allgemeiner Schulpädagogik und Sonderpädagogik. In: Mitteilungen des Verbandes Sonderpädagogik e. V. 49 (2011), Nr. 1, S.11-18
[Vojtová u. a. 2006] Vojtová, V. ; Bloemers, W. ; Johnstone, D.: Pädagogische Wurzeln der Inklusion. Berlin : Frank & Timme, 2006 (Studium europäischer Inklusion Bd. 10)
[von Saldern 2010] von Saldern, M.: Heterogenität - eine Herausforderung für die Bildung. In: Hinz, A. (Hrsg.) ; Körner, I. (Hrsg.) ; Niehoff, U. (Hrsg.): Auf dem Weg zur Schule für alle. Barrieren überwinden - inklusive Pädagogik entwickeln. Marburg Lebenshilfe-Verlag, 2010, S. 53-62
[Werning 2010] Werning, R.: Inklusion zwischen Innovation und Überforderung. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 61 (2010), Nr. 8, S. 284-291
[Wernstedt u. John-Ohnesorg 2010] Wernstedt, R. (Hrsg.) ; John-Ohnesorg, M. (Hrsg.): Der Lehrerberuf im Wandel. Wie Reformprozesse Eingang in den Schulalltag finden können. Version: 2010. http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/07023.pdf , Abruf: 18. Oktober 2011
[WN 2011] WN: "Inklusion" erfordert einen echten Kraftakt. Gemeinsames Lernen bleibt heißes Eisen. In: Westfälische Nachrichten 206 (2011)
[Wocken 2011] Wocken, H.: Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen - Baupläne - Bausteine. Hamburg : Feldhaus, 2011
Anmerkung der bidok-Redaktion:
Der Fragebogen ist unter http://bidok.uibk.ac.at/download/fromme-anhang.pdf als pdf verfügbar.
Quelle:
Thersa Fromme: Inklusion in der Lehrerbildung: Eine explorative Studie an nordrhein-westfälischen Universitäten zum Kontakt angehender GrundschullehrerInnen mit Inklusion
Masterarbeit, Ausgegeben am 10. 05. 2011 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Zentrum für Lehrerbildung, Erstprüfer: Herr Marcel Veber, Zweitprüferin: Frau Prof. Dr. Sara Fürstenau
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 17.04.2013
