Sprache, Behinderung, Integration
Herausgegeben von: Integration: Österreich
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Geleitwort des Bundesministers
- Vorwort
- Zu diesem Buch
-
Fremddefinition -> Selbstdefinition
- ... an den Rollstuhl gefesselt
- ... an einer Behinderung leiden
- behindert
- Behinderte
- behindertengerecht
- Behinderung
- Disability
- Down Syndrom
- Freak
- gehörlos
- geistig behindert
- Handicap
- Heiminsasse
- Idiot
- Impairment
- invalid
- kleinwüchsige Menschen
- Licht ins Dunkel
- Liliputaner
- Menschen mit Behinderung/en
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen
- Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Mongoloismus Vgl.
- Pflegefall
- taubstumm
- Trisomie 21
- versehrt
- Zwerg Vgl.
-
Fremdbestimmung -> Selbstbestimmung
- Arbeitsassistenz
- Arbeitsbegleiter/in
- Arbeitsmarkt
- Arbeitsplatzassistenz
- Assistenzgenossenschaften
- Beschäftigungstherapie
- Empowerment
- Geschützte Beschäftigung
- Independent Living
- Integrative Betriebe
- Job-Coach Vgl.
- Mentoring
- Peer Counseling
- Persönliche Assistenz
- Selbstbestimmt Leben
- Supported Employment
- Teilgeschützte Beschäftigung
- Unterstützte Beschäftigung
-
Aussonderung-> Integration
- Behindertenmilliarde
- berufliche Integration
- Berufsqualifizierung
- Bildung für Alle
- Clearing
- I-Kinder
- inklusive Erziehung
- Integer
- Integration in der Schule
- Integration in weiterführenden Schulen
- Integrationsklasse
- integrative Volkshochschulkurse
- Integrativer Kindergarten
- Interkulturelles Lernen
- Normalisierungsprinzip
- QSI
- Salamanca Erklärung
- Sonderschulen
- soziale Integration
- Spezial-Sonderschulen
- SPF
- TQL
- Uniability
-
Gesetze -> Gleichstellung
- Artikel 7, B-VG
- Artikel 13, Vertrag von Amsterdam
- Ausgleichtstaxe und Beschäftigungspflicht
- Begünstigte Behinderte
- Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
- Beschäftigungspflicht
- Bundesbehindertengesetz
- Diskriminierungsverbot
- EU-Gleichstellungsrichtlinie
- Gleichheitsgrundsatz
- Gleichstellungsbewegung in Österreich
- Gleichstellungsgesetz in Deutschland
- Gleichstellung in der Schweiz
- Gleichstellung in den USA
- Verwaltungsverfahrensgesetze
-
Isolation -> Kommunikation
- Audiodeskription
- Basale Kommunikation
- Bliss
- Braille-System
- Braillezeichen
- Blindenkurzschrift
- Dialog im Dunkeln
- Easy to Read
- Elektronische Kommunikationsmittel
- Facilitated Communication (FC)
- Fingeralphabet
- Gebärdensprache
- Gebärdensprachdolmetscher/innen
- Gestützte Kommunikation Vgl.
- GUK
- Hörbuch
- Hörfilm
- Kunst
- LÖB
- Lormen
- Medien
- MUDRA
- Picture Exchange Communication System - PECS
- Symbol
- Unterstützte Kommunikation
- Untertitelungen
-
Barrieren -> Accessibility
- Accessibility
- akustische Ampeln
- akustische Anzeigen im Lift
- Barrierefreiheit
- behindertengerechtes Bauen
- Behindertenparkplatz
- Berollbarkeit
- Blindenführhund
- Bodenleitstreifen
- Braillezeile
- Cash Test
- Color Test
- Design für Alle
- Drehkreuz
- eAccessibility
- eEurope
- Euro-Schlüssel
- Fahrtendienst
- Gehhilfen
- Haltegriffe
- Handynet
- Induktive Höranlagen
- Kopfmaus
- Leitsystem
- Lift - Lifter
- optische Signale bei Alarmsystemen
- PKW
- Rampen
- Rollator
- Rollstuhl
- rollstuhlgerecht
- rollstuhlgerechte Duschen
- Rollstuhlradius
- Rutschbrett
- Screenreader
- Sitzkissen
- Spezialtastatur
- Sprachausgabe
- Stiegensteiggeräte
- Usability
- Vergrößerungsprogramme
- WAI
- Wohnungsadaptierung
- Klassifikation -> Komplexität
- Literaturverzeichnis
- Autor/innen und Textnachweis
Das "Buch der Begriffe" ist ein ungewöhnliches Wörterbuch zu Fragen von Behinderung und Integration. Das Nachschlagewerk listet nicht nur eine Reihe von Begriffen und Redewendungen auf, die Menschen mit Behinderungen sprachlich diskriminieren. Es bietet auch Anleitungen für einen nicht - diskriminierenden, respektvollen Sprachgebrauch und erläutet wichtige Fachbegriffe. Entstanden ist das "Buch der Begriffe" in einer Kooperation von Integration: Österreich und dem Integrativen Journalismus-Lehrgang. Gefördert wurde das Projekt vom Bundessozialamt, Landesstelle Salzburg, aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung.
Wir alle wissen, dass Gesagtes und Gemeintes nicht immer identisch sind. Der eine sagt oder schreibt etwas und geht selbstverständlich davon aus, dass der andere, der das hört oder liest, auch so versteht wie es gemeint war. Leider erleben wir zu oft, dass das, was beim Empfänger ankommt nicht das ist, was der Absender wirklich meinte - sei es, dass sich der "Sender" unklar ausgedrückt hat oder beim Empfänger Vorstellungen und Assoziationen mitschwingen, die dem Inhalt gleich einen negativen Beigeschmack verleihen. Und wenn man in diesem Zusammenhang noch das Thema "Behinderung" ins Spiel bringt, wird die Kommunikation oft noch komplizierter. Während die einen sich nichts dabei denken, wenn sie das eine oder andere Wort in den Mund nehmen, sehen die anderen darin bereits einen ersten Schritt zur Diskriminierung.
Umso wichtiger ist es daher, im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen auch auf diesem Gebiet zu sensibilisieren, vor allem jene, die hauptberuflich mit Kommunikation und Berichterstattung in den Medien zu tun haben. Das vorliegende Buch der Begriffe ist ein erster wichtiger Versuch, auch auf diesem Gebiet dem Normalitätsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen. Betroffene schreiben in diesem Buch, das wie ein kleines Lexikon gesehen werden kann, welcher Sprachgebrauch diesem Normalisierungsprinzip entspricht und welcher nicht. Dazu kommen sachliche Erklärungen und Beschreibungen von Spezialbegriffen im Zusammenhang mit "Behinderung".
Ich bin überzeugt, dass dieses Buch ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Jahr für Menschen mit Behinderungen ist.

Mag. Herbert Haupt
Vizekanzler und Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz
Begriffe als Spiegel unserer Gesellschaft.....
Bilder und sprachliche Definitionen von und über Menschen mit Behinderungen, die im Laufe der Geschichte geprägt wurden, beherrschen unser Alltagsgeschehen. Dies betrifft den Bereich der medialen, sprachlichen und schriftlichen Darstellung gleichermaßen. Die Verwendung herkömmlicher Bezeichnungen ist gewohnt, oftmals unüberlegt, kaum reflektiert, jedoch meistens negativ besetzt. Diskriminierende und verfälschte Begriffe werden spontan angewandt, aber über deren Wirkung und Auswirkung für die behinderten Menschen selbst und die daraus resultierende gesellschaftliche Wahrnehmung wird viel zu wenig nachgedacht. So manches ist Gewohnheit, leicht und schnell dahingesagt
Festgefahrene, zum Teil mit unbekanntem Hintergrund besetzte Sprachbilder in eine positive Definition und Wahrnehmung zu verändern, erfordert Lernwillen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Selbstbewusst - selbstbestimmt - selbstverständlich
wollen behinderte Menschen wahr- und ernstgenommen werden. Dies auch weit über 2003, dem Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen, und den derzeit vorherrschenden sprachlichen Definitionen hinaus. Die Idee zum vorliegenden "Buch der Begriffe" gebar eine Gruppe von behinderten und nichtbehnderten Menschen, die sich intensiv und engagiert mit den Auswirkungen des diskriminierenden Sprachgebrauches auseinandersetzte. Dieses Büchlein soll nicht nur als Nachschlagewerk und als Anreiz zu "gedanklichen Blitzlichtern" fungieren, sondern auch Sie als Leserin und Leser herausfordern: Hier vielleicht einmal zum Widerspruch, dort zur Zustimmung, immer aber mit der Option zum Nach- bzw. Weiterdenken. Darüber hinaus soll es uns im alltäglichen Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen unterstützen, so zu kommunizieren, dass es zu weniger Missverständnissen, Enttäuschungen und Verletzungen führt.
Ich wünsche Ihnen als Leserin und Leser, sowie den Journalistinnen und Journalisten dieser Recherchen, dass Sie damit einen unentbehrlichen Ratgeber und Unterstützer im Alltagsleben gefunden, wie geschaffen haben.
Maria Brandl
Vorsitzende Integration: Österreich
ungehindert behindert
Bundesweite Elterninitiative
Wien, im März 2003
Ähnlich einem Lexikon bietet das Buch eine Reihe von Begriffen, deren Bedeutung in kurzen, prägnanten Texten erläutert wird. Im Unterschied zum klassischen Lexikon werden die Begriffe jedoch nicht durchgängig von A-Z aufgelistet, sondern verschiedenen Kapiteln zugeordnet. Diese Einteilung erlaubt es, die Begriffe inhaltlich zu bündeln und im Kontext verschiedener Themenschwerpunkte zu beleuchten. Die Auswahl der Begriffe für das jeweilige Kapitel erfolgte nach redaktionellen Kriterien, sie ist bis zu einem gewissen Grad subjektiv, und nicht allumfassend. Dennoch bietet das "Buch der Begriffe" einen guten Überblick über eine Vielzahl an Bezeichnungen, Sprachbildern und Fachausdrücken zu den Themen Behinderung und Integration. Die Begriffe sind inhaltlich vernetzt, das heißt, es wird auf themenverwandte Begriffe an anderer Stelle verwiesen. Wer von A-Z durch das Buch "surfen" will, findet vorneweg als Navigationshilfe ein alphabetisch geordnetes Stichwortverzeichnis, das die Suche nach einzelnen Begriffen erleichtert.
Abgesehen von der formalen Gestaltung zeichnet sich das Buch durch seine authentischen Inhalte aus. Denn die Mehrheit der Autor/innen weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, als behinderter Mensch in Österreich zu leben. Sie schreiben über "ihre" Welt und sind Expert/innen in eigener Sache. Die einzelnen Beiträge sind dennoch unterschiedlich im Stil und spiegeln unterschiedliche Zugänge wider.
Das bunt gemischte Team, das am Buchprojekt mitgearbeitet hat, kommt vor allem aus den Reihen des Integrativen Journalismus-Lehrgangs (I:JL). Dieses innovative Ausbildungsprojekt zielt sowohl auf die berufliche Qualifizierung im Bereich Journalismus als auch auf die Schaffung neuer medialer Bilder von behinderten Menschen ab. Die Autor/innen verfügen also nicht nur über "First Hand Experience", sondern auch über journalistische Kenntnisse, die sie im Zuge des Integrativen Journalismus-Lehrgangs erworben haben.
Als Lehrgangsleiterin habe ich die Redaktion für das "Buch der Begriffe" übernommen. Ich hoffe, es ist uns damit gelungen, Anstöße zu einem nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch zu geben. Anleitungen zum inhaltlich kompetenten Umgang mit dem Themenfeld "Behinderung" liefern die vielen Fachbegriffe, die vor allem für die nicht-behinderten, nicht selbst betroffenen Leser/innen erklärt werden. Gedacht ist das "Buch der Begriffe" nicht zuletzt auch für Journalist/innen und Interessierte aus der Medien- und Kommunikationsbranche, die sich hier Basiswissen für publizistische Arbeiten abseits der Klischees holen können.
Beate Firlinger, Wien, im März 2003
Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann.
Bertolt Brecht
"Es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das schwachmütige und sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell freizumachen von der peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück, jenes Mitleid, das gar nicht Mit-Leiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Und das andere, das einzig zählt, das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid, das weiß, was es will, und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen bis zum Letzten seiner Kraft und noch über dies Letzte hinaus."
Stefan Zweig, aus "Ungeduld des Herzens", 1939
Inhaltsverzeichnis
- ... an den Rollstuhl gefesselt
- ... an einer Behinderung leiden
- behindert
- Behinderte
- behindertengerecht
- Behinderung
- Disability
- Down Syndrom
- Freak
- gehörlos
- geistig behindert
- Handicap
- Heiminsasse
- Idiot
- Impairment
- invalid
- kleinwüchsige Menschen
- Licht ins Dunkel
- Liliputaner
- Menschen mit Behinderung/en
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen
- Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Mongoloismus Vgl.
- Pflegefall
- taubstumm
- Trisomie 21
- versehrt
- Zwerg Vgl.
Zur Sprache zwischen Diskriminierung und Akzeptanz
"Bist behindert?" ist unter Jugendlichen ein häufig gebrauchtes Schimpfwort. Es wird für jene Teenager gebraucht, die Außenseiter sind und durch den Gruppenzwang nicht in das Gruppenbild passen. Sie tragen die falsche Kleidung, haben andere Ansichten, sind nicht so schlagfertig wie ihre Kameraden. Jugendliche reflektieren oft ihre Ausdruckweise nicht, ihr Verhalten spiegelt aber eine gewisse gesellschaftliche Werthaltung wider, die ihnen von den Erwachsenen vorgelebt wird.
Das Image, das Menschen und Gruppen in der Gesellschaft haben, drückt sich auch in der Sprache aus. Ist das Image negativ, sind meist auch die Bezeichnungen negativ, herabwürdigend und diskriminierend. So werden Migrant/innen häufig als Belastung für den heimischen Arbeitsmarkt gesehen und mit abfälligen Ausdrücken wie "Tschuschen" oder "Krowotn" abgestempelt. Auch behinderte Menschen werden vielfach als wirtschaftliche Belastung empfunden und nur allzu leicht mit dem Etikett "Sozialschmarotzer" bedacht. Das ist aber nicht die einzige Ebene, auf der die Geringschätzung beruht. Für die Leute auf der Straße drängt sich oft das Bild physischer und psychischer Unzulänglichkeiten auf. Sie sind vom scheinbaren Elend peinlich berührt und wissen sich oft nur durch Wegschauen zu helfen. Das, was gemeinhin unter "Mitleid" verstanden wird, ist nicht Mitleiden im Sinne von "einfühlen" und die Situation eines Menschen verstehen. Es ist vielmehr ein Ausdruck peinlicher Berührtheit, des Wegschauens und der Hilflosigkeit gegenüber einer für die Nichtbehinderten "schrecklichen" Tatsache der Behinderung.
Diese Unfähigkeit mit einer Situation umzugehen manifestiert sich im Sprachgebrauch. So finden sich zahlreiche Redewendungen, die scheinbares Leid implizieren. Beispiele dafür sind: "an Behinderung leiden", "einen Schicksalsschlag erleiden", "sein Leben fristen müssen", "hilfsbedürftig" oder "an den Rollstuhl gefesselt sein".
Die Mobilität, die Flexibilität oder auch scheinbare Banalitäten, wie aufstehen und sich frei bewegen können, sind für die Gesellschaft so selbstverständlich, dass die Fortbewegung im Rollstuhl als tragisch, unmöglich oder als Fessel im Alltag empfunden wird. So wie diese Fesseln in Hinblick auf den Rollstuhl gesehen werden, hat wohl jeder Begriff einen gesellschaftlichen Hintergrund. Ändert sich dieser, ändert sich auch die Sprache. Ausgehend von der Bürgerrechtsbewegung in den USA haben auch behinderte Menschen in den letzten Jahren zu einem neuen Selbstverständnis gefunden, weg von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Diese neue Haltung drückt sich auch in einer Summe neuer Begriffe aus, die das Positive in den Vordergrund rücken. Gegen diskriminierende Begriffe wehren sich heute immer mehr behinderte Menschen.
Im nachfolgenden Kapitel versuchen wir, das Dickicht an Bezeichnungen und Ausdrücken zum weiten Thema "Behinderung" ein wenig zu lichten.
Marlies Neumüller und Kornelia Götzinger
Diese Redewendung ist nach wie vor sehr beliebt, vor allem auch in Medienberichten. Rollstuhlfahrer/innen empfinden sie aber als unangebracht, da sie nicht "gefesselt" sind. Im Gegenteil: Der Rollstuhl bedeutet Mobilität. Hinter dem Wort "Fessel" verbergen sich Assoziationen zu "Gefängnis" oder "schreckliches Schicksal", die Ängste und Projektionen bei nichtbehinderten Menschen auslösen. Durch das Sprachbild werden Menschen nicht nur auf ihre Behinderung reduziert, auch eine Einschränkung der geistigen Mobilität schwingt bisweilen mit. Stattdessen kann einfach gesagt werden: Personen "benutzen einen Rollstuhl" oder "sind auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen".
Viele Menschen mit Behinderungen sind mit dieser Formulierung nicht glücklich, weil sie einerseits Armut und Leid suggeriert und dadurch -> Mitleid (S. 122 im Buch) hervorruft, andererseits "leiden" die wenigsten behinderten Menschen tatsächlich an ihrer Behinderung. Meist macht ihnen die Umwelt das Leben schwer. Schon alleine aufgrund der Objektivität sollte diese Phrase vermieden werden, da nur behinderte Personen selbst wissen, ob sie tatsächlich an ihrer Behinderung "leiden" oder nicht. Besser ist es neutral festzustellen, dass jemand "eine Behinderung hat" oder "mit einer Behinderung lebt".
Es gibt eine große Zahl von Behinderungen, die alle so verschieden sind, dass man sie unmöglich in einen Topf werfen kann (z.B. körperliche, psychische, geistige Behinderungen, Sinnesbeeinträchtigungen, u. a.). Das Adjektiv "behindert" beschreibt eine bestimmte Eigenart eines Menschen und wirkt, wenn es hauptwörtlich gebraucht wird, undifferenziert.
"Ich bin in erster Linie Mensch und erst viel später behindert." Diesem Satz werden vermutlich alle Personen, die behindert sind, zustimmen. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit häufig von "den Behinderten" gesprochen. Viele behinderte Menschen empfinden diese Verallgemeinerung zumindest als "unschön" und diskriminierend, weil sie nicht in erster Linie über ihre körperliche Eigenart definiert werden wollen. Sie sind Menschen, die einen Namen haben, ihre individuelle Geschichte und ihre eigenen Lebensumstände. Werden behinderte Menschen auf das Schlagwort "die Behinderten" reduziert, bleiben negative Einstellungen in den Köpfen der Menschen verankert. Die undifferenzierte Wortwahl kann leicht verbessert werden. Behinderte Personen empfinden es jedenfalls angenehmer als "behinderter Mensch" oder "Mensch mit Behinderung" bezeichnet zu werden, oder einfach als "behinderte Frau", "behinderter Mann", "behindertes Kind", "behinderte Journalistin" usw.
Der Begriff "behindertengerecht" bezieht sich zwar auf alle Behinderungsgruppen, ist aber vorwiegend im Baubereich zu finden. Besser ist es jedoch von -> Barrierefreiheit (S. 98 im Buch) zu sprechen. Denn die Zugänglichkeit von Gebäuden, die Benutzbarkeit von Liften, Verkehrsmitteln, Arztpraxen oder Geschäften, also die uneingeschränkte Teilhabe am sozialen Leben, ist nicht nur für Rollstuhlfahrer/innen, sondern für alle Menschen relevant.
Eine allgemein gültige Definition von Behinderung gibt es nicht. Die meisten Behinderungsbegriffe unterscheiden nach Ursache, Art und Folgewirkung der Behinderung. Als Grundlage für die internationale Diskussion über eine einheitliche Behinderungsdefinition diente lange Zeit die im Jahr 1976 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Internationale Klassifizierung von Schädigungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen (ICIDH). Diese WHO-Klassifikation unterscheidet zwischen den drei Begriffen: "Impairment" ("Schädigung") "Disability" ("Beeinträchtigung") und "Handicap" ("Behinderung"). In der deutschen Fachliteratur werden die Begriffe unterschiedlich, teilweise auch widersprüchlich übersetzt. Von Behindertenorganisationen wurde kritisiert, dass diese WHO-Definition aus einem herkömmlichen Verständnis von "Gesundheit und Krankheit" entstanden ist. (Vgl. BECHTOLD, 1998). Deshalb wurde die ICIDH-Klassifikation überarbeitet und die -> ICF (S. 121 im Buch) vorgelegt. Im Mittelpunkt der ICF ("International Classification of Functioning, Disability and Health") steht die Frage, wie Menschen mit ihrer Behinderung leben (können).
bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 "Beeinträchtigung". Der Begriff beinhaltet eine Vielzahl von Funktionseinschränkungen, die aus einer körperlichen oder geistigen Behinderung, einer Sinnesbehinderung, einem Krankheitszustand oder einer psychischen Krankheit resultieren können. Disability erfasst im Gegensatz zum Begriff -> Impairment (S. 27 im Buch) auch die individuellen Konsequenzen einer Schädigung in Bezug auf bestimmte Aktivitäten bzw. Tätigkeiten. Der Verlust des kleinen Fingers würde für die meisten Menschen keinen Nachteil im Alltag bedeuten, für einen Pianisten jedoch, der seinen Lebensunterhalt mit den Händen verdient, entstünde dadurch eine -> Behinderung (S. 23 im Buch) im engeren Sinn. Vgl. -> Handicap (S. 26 im Buch)
Der englische Arzt John Langdon Down verglich 1866 Menschen mit Down Syndrom mit Mongolen. Er beschrieb das Gesicht als platt, die Augen als schrägstehend und das Haar schütterer als bei echten Mongolen. Durch diese Beschreibung prägte er den Begriff Mongolismus, der bis in die 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts gebräuchlich war. Down glaubte gemäß Darwins Theorien, dass das später nach ihm benannte Syndrom eine Rückverwandlung in einen "primitiven Rassetypen" darstelle. Der Begriff Mongolismus ist deshalb diskriminierend, und auch aus medizinischer Sicht nicht haltbar. Das Down Syndrom hat nichts mit den Bewohnern der Mongolei zu tun. Es ist eine Behinderungsart, die auf das Erbgut der Eltern zurückgeführt und in der Medizin auch als -> Trisomie 21 (S. 31 im Buch) bezeichnet wird.
kommt aus dem Englischen und bedeutet in der Grundübersetzung "abnorme Gestalt" oder "Monstrum" (lat.: "Ungetüm"). Dementsprechend wurden Tiere oder Menschen mit sichtbaren Behinderungen im englischen Sprachraum als "Freaks" bezeichnet. In so genannten "Freak Shows" stellten behinderte Menschen ihre körperlichen Eigenarten zur Schau. Verbreitet waren sie vor allem in Amerika und England im 18. und 19. Jahrhundert. Auf Conny Island in den USA, dem einstigen Mekka der Shows, existiert heute noch eine permanente Freak-Show. Als Bezeichnung für behinderte Menschen wurde das Wort "Freak" bis in die 1980-er Jahre im deutschen Sprachraum abwertend verwendet. In den vergangenen Jahren machte der Ausdruck aber in der Behindertenszene einen Bedeutungswandel durch und wurde vor allem von behinderten Künstler/innen satirisch oder selbstironisch aufgegriffen. In Bezug auf Behinderung ist Freak also nicht wie im allgemeinen Sprachgebrauch ein Ausdruck für Fanatiker ("EDV-Freak"), sondern lehnt sich im (selbst)ironischen Sinn an die Grundbedeutung an.
löst als Begriff zunehmend den unrichtigen Ausdruck -> "taubstumm" (S. 31 im Buch) ab. Denn gehörlose Menschen sind keineswegs stumm, sie können sprechen und verstehen sich als Angehörige einer Sprachminderheit. Vgl. -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch)
Mit der bewusst provokativen These "geistig behindert wird niemand geboren ..." beschreibt die Hamburger Psychotherapeutin Dietmut Niedecken den Weg des "geistig behindert Werdens" als das Ergebnis eines vielfältig wirksamen kollektiven Verdrängungs-, Ausgrenzungs- und Projektionsprozesses (Vgl. NIEDECKEN, 1989). Sind Informationen so kompliziert verfasst, dass -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch) den Sinn der Aussage nicht mehr verstehen können, werden sie - die normalerweise den Alltag ohne Probleme schaffen - durch diese "Barrieren" behindert. Vgl. -> geistige Behinderung (S. 119 im Buch)
bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 -> Behinderung (S. 23 im Buch). Der Begriff bezieht sich auf die sozialen Benachteiligungen, die Menschen infolge einer Schädigung (-> Impairment, S. 27 im Buch) oder einer Beeinträchtigung (-> Disability, S. 24 im Buch) in ihren körperlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten erfahren. Ursprünglich kommt das Wort von einem Lotteriespiel, in dem die eingesetzten Güter oder Geld in einen Hut oder Kappe gegeben wurden: "money was held in a hand in a cap". Das Wort wurde früher auch beim Pferderennen verwendet, bei dem ein überlegenes Pferd ein vom Schiedsrichter bestimmtes Gewicht (genannt handicap) tragen musste. Im übertragenen Sinn wurde es später für eine Behinderung/Benachteiligung jeder Art verwendet.
bedeutet eigentlich "Einsitzer" in einer Institution wie dem Gefängnis, wird aber leider noch immer auch für Bewohner/innen von Heimen und Internaten gebraucht. Besser ist es von "Heimbewohner/innen" zu sprechen.
kommt ursprünglich aus dem Griechischen (idios). Es bedeutet "eigen, privat, eigentümlich" und wurde wertneutral gebraucht. Im 16. Jahrhundert wurde der Begriff in der deutschen Sprache heimisch, zunächst ebenfalls ohne negative Wertung. Erst durch die englische Rechtssprechung, die den Begriff auf eigenartige, oft geistig behinderte Personen (so genannte "Irre") anwendete, erhielt er sein negatives Image. Als Idiotie wurde eine schwere Form der -> geistigen Behinderung (S. 119 im Buch) bezeichnet. In der Medizin wurde der Begriff lange unkritisch benutzt. Mittlerweile wird das als diskriminierend bewertet. Heute werden häufig -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch) (früher "geistig Behinderte") mit dem Schimpfwort "Idiot" abgewertet. Seit einigen Jahren versuchen die Betroffenen dieses negative Image abzuschütteln. Menschen mit Lernschwierigkeiten sehen sich nicht mehr als "geistig behindert", sondern als Personen, denen es durch gesellschaftliche Vorurteile schwer gemacht wird, ihre Fähigkeiten zu nutzen.
bedeutet nach der WHO-Klassifizierung von 1976 "Schädigung". Der Begriff bezeichnet Mängel oder Normabweichungen der anatomischen, psychischen oder physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers. Vgl. -> Behinderung (S. 23 im Buch)
bedeutet im ursprünglichen Sinn die Verneinung (in-) des lateinischen Wortes "validus": Stark, kräftig, gesund. Die Bezeichnung "die Invaliden" ist so wie die -> Versehrten (S. 31 im Buch) ein veralteter Ausdruck für behinderte Menschen. Das Wort kommt heute noch in diversen Bezeichnungen wie "Zivilinvalidenverband", "Invalidenpension" oder "Invalidität" vor.
gibt es überall auf der Welt, sie sind keine eigene "Rasse". Der so genannte Kleinwuchs kann verschiedene Ursachen haben. Falsch ist, dass Menschen mit geringer Körpergröße weniger intelligent oder "ewige Kinder" sind. In der Medizin wurde lange Zeit von "Zwergwuchs" gesprochen, kleinwüchsige Menschen wurden demzufolge klischeehaft als "Zwerge" oder -> Liliputaner (S. 28 im Buch) bezeichnet. Wer über kleinwüchsige Menschen schreibt, sollte diese Ausdrücke nicht verwenden.
wurde vor 30 Jahren als Spendenaktion vom Landesstudio Niederösterreich (Initiator: Kurt Bergmann) zur Weihnachtszeit ins Leben gerufen, um behinderte Kinder zu unterstützen. Mittlerweile hat sich die Aktion auf ganz Österreich ausgeweitet und 2001/02 wurden mehr als 11 Millionen € gespendet. Die Aktion Licht ins Dunkel wird vom ORF und vielen anderen Medien beworben. Aufgrund des großen Erfolges fließt ein Teil der Spendengelder auch an andere Gruppen (von Armut betroffene Familien, Nachbar in Not, Hochwassergeschädigte). Das Gros der Einnahmen geht aber an behinderte Menschen. So gut diese Aktion für Unbeteiligte erscheinen mag - für behinderte Menschen ist sie zweischneidig. Denn Licht ins Dunkel wirbt, um Spenden zu lukrieren, häufig mit klischeehaften Bildern vom armen behinderten Menschen, der unser aller -> Mitleid (S. 122 im Buch) verdient. Aufgrund der enormen Medienpräsenz werden diese Klischees im großen Stil weiter transportiert und sind oft das Einzige, was über behinderte Menschen in den Medien gezeigt wird. Ausgeblendet bleibt dabei die Realität. Menschen mit Behinderungen, die arbeiten, werden so gut wie nicht gezeigt. Die Kritik an der Spendenaktion impliziert nicht, dass behinderte Menschen finanzielle Hilfe an sich ablehnen. Dort, wo öffentliche Mittel fehlen, werden Spendengelder gebraucht. Kampagnen, die auf Mitleid setzen, erschweren jedoch eine umfassende Integration, wie sie behinderte Menschen fordern. Auch deshalb, weil sich - anstatt behinderte Menschen zu beschäftigen - spendende Firmen durch Licht ins Dunkel werbewirksam von ihrer sozialen Verantwortung freikaufen.
Menschen, die überdurchschnittlich klein sind, werden im Volksmund oft "Liliputaner" genannt. Liliputaner sind Fabelwesen aus der Erzählung "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift und sie gibt es genau so wenig wie die sieben Zwerge. Es ist eigentlich verständlich, dass -> kleinwüchsige Menschen (S. 27 im Buch) nicht mit diesen Märchenfiguren verglichen werden wollen. Trotzdem werden sie im Alltag oft noch so genannt.
Die Frage, ob "Menschen mit Behinderung" (Einzahl) oder "Menschen mit Behinderungen" (Mehrzahl) sprachlich korrekt ist, sorgt bisweilen für Verwirrung. Dazu gibt es keine prinzipiellen Regeln. Die Ausdrucksweise hängt vom Kontext ab. Eine Person, die behindert ist, hat eine Behinderung (z.B. Querschnittlähmung oder Gehörlosigkeit) oder auch Behinderungen (z.B. Diabetes gekoppelt mit Blindheit). Handelt es sich um mehrere Personen oder allgemein um die gesellschaftliche Gruppe der Menschen, die behindert sind, ist meist die Verwendung der Mehrzahl (Behinderungen) sinnvoll. Denn es gibt nicht eine, sondern viele Formen von Behinderungen.
In letzter Zeit hat die Formulierung "Mensch mit besonderen Bedürfnissen" in den Sprachgebrauch Einzug gehalten, etwa in Gesetzestexten (z.B. niederösterreichisches Sozialhilfegesetz) oder in den Medien. Behinderte Menschen werden damit in der Öffentlichkeit augenscheinlich als Personengruppe mit "besonderen", mit "speziellen" Bedürfnissen gezeigt. Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass diese Formulierung nicht alleine auf behinderte Menschen zutrifft, sondern auch auf obdachlose, arbeitslose, drogenkranke oder alte Menschen. Auch Kinder, Migrant/innen, Verbrechensopfer oder Vegetarier sind Personengruppen, die besondere Bedürfnisse haben. Eigentlich hat "jeder" Mensch besondere Bedürfnisse.
Menschen, die den allgemein gültigen intellektuellen -> Normen (S. 123 im Buch) nicht entsprechen, werden von der Gesellschaft vielfach als -> geistig behindert (S. 25 im Buch) angesehen. Viele Betroffene bezeichnen sich in letzter Zeit als "Menschen mit Lernschwierigkeiten" oder als "Menschen mit Lernschwächen". Diese Begriffe sollen darauf hinweisen, dass diese Menschen "bloß" Schwierigkeiten beim Lernen und Aneignen von Wissen haben. Zusätzlich erschweren es Vorurteile und Barrieren, z. B. komplizierte Texte, die oft schon für Otto Normalverbraucher kaum zu verstehen sind, diesen Menschen, ihre intellektuellen Fähigkeiten zu nutzen. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben Gefühle, Gedanken und Wünsche - so wie andere Menschen auch. Dieser Grundsatz der "eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche" liegt der People First-Bewegung zu Grunde, die für ein -> selbstbestimmtes Leben (S. 42 im Buch) für Menschen mit Lernschwierigkeiten kämpft. Die Organisation wurde von Menschen mit Lernschwierigkeiten 1974 in Oregon/USA gegründet. Mittlerweile gibt es weltweit "People First-Gruppen", seit dem Jahr 2000 auch in Österreich. Vgl. -> Easy to Read (S. 80 im Buch) www.winexperts.net
Wenn jemand Pflege braucht, wird er schnell zum "Fall", meistens zu einem "Fall fürs Pflegeheim". Meine Mutter ist ein "Pflegefall". Der Begriff zerlegt sich auf der Zunge von selbst, in Pflege - Fall. Kann heißen: Ein Fall fürs Pflegeheim oder Mutter hat einen hohen Bedarf an Pflege. Zum Fall ist sie geworden. Zum Casus, wie die Mediziner heute noch manchmal sagen. Die Frage, wie schwierig man es den anderen macht, als Pflegefall, beschäftigt viele und alle sagen: Ein Pflegefall möchte ich niemals sein. Wer schon? Aber warum die Mutter zum Pflegefall machen, sie damit ihrer Person berauben? Die Abwertung vermag die psychosoziale Belastung nur kurzfristig zu lindern. Beim schweren medizinischen Not-"Fall" geht es um Leben und Überleben, da sind vorerst Name und Adresse nicht wichtig. Beim "Pflegefall" geht es um Leben. Person hat Vorname und Nachname und ist Mutter oder Vater oder Kind. Der subjektiven Sicht des Betroffenen wird man besser gerecht, wenn man von einer "pflegebedürftigen Person" spricht.
wird von den gehörlosen Menschen als diskriminierend empfunden, da der Ausdruck suggeriert, dass gehörlose Menschen stumm sind. Das ist falsch. Gehörlose Menschen können sehr wohl sprechen, aber nicht hören, was sie sprechen. Daher ist die Lautsprache bei dieser Personengruppe eingeschränkt nutzbar. Taub ist eine Zustandsbeschreibung für Gefühllosigkeit im eigentlichen und im übertragenen Sinn. So ist etwa von "tauben Fingern" oder "etwas stößt auf taube Ohren" die Rede. Das Wort "taubstumm" wird aber immer noch verwendet. Richtiger ist es von Gehörlosigkeit zu sprechen. Behindertenverbände plädieren daher auch für eine Umbenennung der Taubstummengasse im
4. Wiener Gemeindebezirk, benannt nach dem k.k. Taubstummeninstitut, das sich von 1803 bis 1913 hier befand. Vgl. -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch)
Normalerweise hat der Mensch 23 Chromosomenpaare, das heißt 46 einzelne Chromosomen. Ein Paar besteht aus einem Chromosom des Vaters und einem Chromosom der Mutter. Beim so genannten -> Down Syndrom (S. 24 im Buch) existiert das 21. Chromosom dreimal statt zweimal. Diese Tatsache, dass das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist, erklärt den Begriff Trisomie 21 (gr.-lat. Tri = 3). Die Folgen der Trisomie 21 sind Symptome wie ein plattes Gesicht, schütteres Haar, schrägstehende Augen, sowie eine Lernbehinderung, die unterschiedlich ausgeprägt ist. Menschen mit Trisomie 21 haben vielfältige Fähigkeiten. Viele von ihnen sind überdurchschnittlich beweglich, sehr kontaktfreudig und sozial, musikalisch und zeichnen sich oft durch gute intuitive Menschenkenntnis aus.
bedeutet eigentlich "verwundet". Vor dem 1. Weltkrieg wurden Menschen, die im Krieg ohne eigene Schuld verletzt wurden, als "Versehrte" bezeichnet. Heute wirkt das Wort antiquiert, außerdem sind heute nach 60 Jahren Frieden in Österreich nur mehr sehr wenige Menschen tatsächlich (Kriegs-)Versehrte. Im Sprachgebrauch ist das Wort dennoch bisweilen in Verwendung, z.B. als Versehrten-WC oder Versehrten-Sport oder in der Unfallversicherung, wo es noch den Terminus "Versehrtenrente" gibt. Vgl. -> invalid (S. 27 im Buch)
Inhaltsverzeichnis
- Arbeitsassistenz
- Arbeitsbegleiter/in
- Arbeitsmarkt
- Arbeitsplatzassistenz
- Assistenzgenossenschaften
- Beschäftigungstherapie
- Empowerment
- Geschützte Beschäftigung
- Independent Living
- Integrative Betriebe
- Job-Coach Vgl.
- Mentoring
- Peer Counseling
- Persönliche Assistenz
- Selbstbestimmt Leben
- Supported Employment
- Teilgeschützte Beschäftigung
- Unterstützte Beschäftigung
Assistenz schafft Unabhängigkeit
Der zentrale Begriff dieses Kapitels lautet Selbstbestimmt Leben. Er stellt sowohl den thematischen Ausgangspunkt als auch den Endpunkt einer Entwicklung dar, die behinderten Menschen das Recht einräumt, ihr Leben eigenständig und nach eigenen Vorstellungen führen zu können.
Manche Menschen mit Behinderungen brauchen viel und laufend Unterstützung, sei es im Alltag oder bei der Erledigung beruflicher Aufgaben. Es besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied zwischen jenen Formen der Unterstützung, die von den Anforderungen der Anspruchnehmer/innen geleitet wird und gegenseitigen Respekt und Gleichwertigkeit voraussetzt, und jener Betreuung und Pflege, in der Nehmende und Gebende in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Der Unterschied lässt sich leicht nachvollziehen: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall und sind für eine längere Zeitspanne auf die Hilfe anderer Personen angewiesen - wollen Sie lieber nach Gutdünken ihres Pflegers betreut oder bei der Bewältigung Ihres gewohnten Alltags unterstützt werden?
Ein selbstbestimmtes Leben ist nicht ein Leben, das durch eine von Institutionen geregelte Betreuung und Pflege bestimmt wird. Im Gegenteil. Die Selbstbestimmung beginnt mit dem Recht auf persönliche Assistenz, die es erlaubt, selbst zu entscheiden und zu organisieren, wann, wo und wie Unterstützung im Alltag notwendig ist. Sie setzt sich fort mit verschiedenen Formen von Arbeits(platz)assistenz, die dazu beitragen können, dass sich behinderte Menschen im Berufsleben verwirklichen. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung bedeutet mehr Selbstbewusstsein für jene, die diesen Emanzipationsprozess geschafft haben. Es bedeutet auch, dass behinderte Menschen tatsächlich in alle Lebensbereiche eingebunden werden, vom Kindergarten bis zur Schule, von der Freizeit bis hin zur Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude für Alle.
Ein flexibles System von Hilfestellungen soll es ermöglichen, Idealen wie Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit für alle Mitglieder unserer Gesellschaft näher zu kommen. Dieses Recht auf Selbstbestimmung ist in Österreich - noch - nicht selbstverständlich.
Petra Wiener
Durch Arbeitsassistenz werden Menschen mit Behinderungen beraten und unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu sichern, der ihren persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Wünschen entspricht. Prinzipiell könnten alle Menschen, unabhängig von Art und Schwere ihrer Behinderung, mit entsprechender Unterstützung am allgemeinen -> Arbeitsmarkt (S. 37 im Buch) tätig sein. Im englischsprachigen Raum werden Arbeitsassistent/innen als Job-Placement-Worker bezeichnet. Das Angebot der Arbeitsassistent/innen richtet sich auch an die Arbeitgeberseite, etwa mit Informationen zu arbeitsrechtlichen Angelegenheiten oder barrierefreier Arbeitsplatzgestaltung. Umgesetzt wurde dieses individuelle Modell unterstützter Beschäftigung in Österreich erstmals 1992 in zwei Pilotprojekten für psychisch beeinträchtigte Menschen in Linz und in Wolkersdorf im Weinviertel. Die Erfolge verdeutlichen, dass sich dieses Service in der Praxis bewährt hat. Derzeit wird diese Dienstleistung, gefördert vom Bundessozialamt, nahezu flächendeckend im gesamten Bundesgebiet angeboten. Weitere Informationen dazu bietet die "Projektdatenbank" auf der Website des Bundessozialamtes: www.bmsg.basb.gv.at
Teilweise gleichbedeutend mit Arbeitsassistent/in wird der Begriff Arbeitsbegleiter/in (engl.: "Job Coach" oder "Job Trainer" oder "Job Coordinator") verwendet. Werden diese Bezeichnungen für zwei verschiedene Aufgabengebiete unterschieden, steht ArbeitsbegleiterIn für eine Person, die einen Menschen mit Behinderung in der ersten Phase nach Antreten der Stelle ins Unternehmen unterstützt. Die Aufgaben der Arbeitsbegleitung bestehen darin, die/den Arbeitsassistenznehmer/in in den Betrieb zu begleiten und mittels Training on the Job (Qualifikation am Arbeitsplatz) einzuarbeiten. Übernimmt diese Funktion eine andere Person als diejenige, die die Stelle vermittelt hat (wie in manchen Arbeitsassistenzprojekten), erfolgt eine Arbeitsteilung zwischen Arbeitsbegleiter/in und Arbeitsassistent/in. Werden beide Aufgabenfelder von ein und derselben Person betreut, sind die Begriffe gleichbedeutend (wobei Arbeitsassistenz der Oberbegriff ist).
Den Gegenpol zu Sondereinrichtungen und -> geschützter Beschäftigung (S. 39 im Buch), die einen von der freien Wirtschaft isolierten "zweiten Arbeitsmarkt" darstellen, bildet der "erste" oder "allgemeine Arbeitsmarkt". Er zeichnet sich dadurch aus, dass er durch freien Wettbewerb bestimmt wird und auf ihm vorwiegend nichtbehinderte Menschen tätig sind. Da ein sehr hoher Anteil an Menschen mit Behinderungen keine Arbeit hat, stellt die berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt ein, auch von der EU gefördertes Ziel der österreichischen Bundesregierung dar. Seit 2001 wurden die Förderinstrumente zur beruflichen Integration für Menschen mit Behinderungen durch die so genannte -> Behindertenmilliarde (S. 47 im Buch) wesentlich ausgeweitet (Beispiele: Übergang Schule - Beruf, Sensibilisierungsmaßnahmen)
ist eine Form der -> Persönlichen Assistenz (S. 41 im Buch) am Arbeitsplatz. Die Assistenznehmer/innen sind in diesem Fall Auftraggeber. Arbeitsplatzassistent/innen übernehmen Handreichungen und Tätigkeiten, die ihr/sein Auftraggeber/in aufgrund der Behinderung nicht oder nicht so effizient ohne Hilfe ausführen kann. Wie sich diese Aufgaben konkret gestalten, richtet sich nach den Wünschen und der Anleitung der Person, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz in Anspruch nimmt. Da es in Österreich auf diese Unterstützung noch keinen Rechtsanspruch gibt, gestaltet sich die Finanzierung oft äußerst schwierig und erfolgt in der Regel aus eigener Tasche.
unterstützen und begleiten Menschen mit Behinderungen bei der Organisation von persönlicher Assistenz, von der Personalsuche und -auswahl über Lohnverrechnung und arbeitnehmer/innen-rechtliche Angelegenheiten bis hin zu Kranken- und Urlaubsvertretungen. Assistenzgenossenschaften finden sich in den Bundesländern und in der Bundeshauptstadt, wo im Jahr 2002 diese Servicestelle von der Selbstbestimmt Leben Initative Wien gegründet wurde: www.wag.or.at
In diesem so genannten "geschützten Bereich" arbeiten Menschen mit Behinderungen ohne Sozialversicherung für Taschengeld an Stelle von Lohn. In Beschäftigungstherapie kommen Personen, die weniger als die Hälfte der Arbeitsleistung einer/s Nichtbehinderten erbringen können. Mit dieser -> Aussonderung (S. 117 im Buch) vom allgemeinen -> Arbeitsmarkt (S. 37 im Buch) und somit einem wichtigen Bereich des sozialen Lebens geht ein abgestimmtes Freizeitprogramm und eine fixe Tagesstruktur einher. Festgelegt werden diese Regelungen von den meist privaten Trägern der Einrichtungen, das sind vor allem kirchliche Hilfswerke, Wohlfahrts- oder Elternorganisationen.
steht einerseits für die Überwindung sozialer und gesetzlicher Ungleichheiten und Diskriminierungen, andererseits für "einen Prozess, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen. Leitperspektive ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens" (THEUNISSEN/PLAUTE, 1995,
S. 12 im Buch). Der Begriff Empowerment wurde im Zuge der amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen der 1970-er Jahre geprägt. Das sprachliche Äquivalent zu "Black Power" oder "Women Power" ist der provokante Ausdruck "Krüppelpower". Zu deutsch wörtlich "Ermächtigung" ist unter Empowerment allgemein die Emanzipation gesellschaftlich benachteiligter Gruppen zu verstehen. Dieses neue Bewusstsein für die eigenen Stärken ist Ursprung und Antriebsfeder sowohl der -> Independent Living-Bewegung (S. 39 im Buch) als auch der People First-Bewegung. Anliegen ist es, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund zu rücken und nicht ihre physische oder psychische Beeinträchtigung.
ist ein Beschäftigungsmodell, bei dem Menschen mit Behinderungen in so genannten "geschützten Werkstätten" arbeiten. Die Tätigkeit in betreuten Strukturen sollte sie für die Anforderungen des ersten -> Arbeitsmarktes (S. 37 im Buch) qualifizieren und auf diese vorbereiten. Vielfach gehen die "Klient/innen" solcher Einrichtungen dort jedoch Tätigkeiten nach, die auf dem ersten Arbeitsmarkt von sehr geringer oder gar keiner Bedeutung sind, wie z.B. Besenbinden, Körbeflechten u. Ä. Ein weiteres Manko dieses Beschäftigungsmodells besteht darin, dass die Betreiber/innen von Werkstätten in der Regel ökonomischen Prinzipien unterworfen sind, das heißt Geld erwirtschaften sollen. Der Konflikt, die dort Angestellten auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten zu müssen, dadurch aber gleichzeitig die produktivsten Mitarbeiter/innen an die freie Wirtschaft zu verlieren, ist vorprogrammiert. Das Modell der Geschützen Werkstätten ist in der Praxis stark vom Betreuungsgedanken und von Fremdbestimmung geprägt und daher eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Vgl. -> Integrative Betriebe (S. 40 im Buch)
geht auf eine amerikanische Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderungen Ende der 1960-er Jahre zurück. Die Vertreter dieser Bewegung lehnten sich gegen die Institutionalisierung und die reduzierende, vorwiegend klinische Bewertung ihrer Lebensumstände auf. Forderungen der Initiative sind Selbstbestimmung, konsumentenorientierte Unterstützungsangebote und Hilfen, das Recht auf aktive Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben sowie deren verwaltungsmäßige Umsetzung (Vgl.: ÖSTERWITZ in Integra Tagungsmagazin, 1994, S. 45-54 im Buch).
Anfang der 1970-er Jahre entstanden die ersten Zentren für Independent Living in Amerika, die als Beratungsstellen Serviceleistungen wie Rechtsberatung, Hilfe bei Fragen der Mobilität, der Assistenz, oder bei Behördenwegen etc. anboten und anbieten. Vgl. -> Selbstbestimmt Leben (S. 42 im Buch)
sollen behinderte Menschen mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den offenen Arbeitsmarkt beschäftigen. Soweit dies nicht möglich ist, stellen sie auch Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. Die Dienstnehmer/innen mit Behinderung arbeiten in einem IB zu einem kollektivvertraglich geregelten Lohn und sind, im Gegensatz zur - > geschützten Beschäftigung (S. 39 im Buch), sozialversichert. Zur Unterstützung und Beratung stehen den Arbeitnehmer/innen dieser Betriebe fachbegleitende Dienste (Ärzt/innen, Psycholog/innen, Sozialarbeiter/innen und berufskundliche Sachverständige) zur Verfügung. Über die Aufnahme in einen integrativen Betrieb entscheidet ein Team, in dem u.a. das Bundessozialamt vertreten ist. Integrative Betriebe gibt es vor allem in den Bereichen Holz- und Metallverarbeitung, Druckereien, Kunststoffverarbeitung und Montage. Sie erhalten zwar Subventionen, müssen aber den Großteil ihrer Aufwendungen selbst erwirtschaften. www.basb.bmsg.gv.at
ist eine Variante des -> Supported Employment (S. 42 im Buch). Anders als bei der -> Arbeitsassistenz (S. 36 im Buch) weisen hier nicht externe Arbeitsassistent/innen, sondern ein/e Kolleg/in im Betrieb einen Menschen mit Behinderung in den neuen Job ein. Dieser Mentor wird von einer Supported-Employment-Agentur in ihre/seine Aufgaben eingeführt und bei etwaigen Problemen unterstützt. Das Modell des Mentoring wird auch als "Natural Support" bezeichnet.
ist eine Beratungsmethode, die davon ausgeht, dass Menschen mit Behinderungen einander bei verschiedensten Fragestellungen besser unterstützen und beraten können als Nichtbehinderte. Denn Menschen mit eigenen Erfahrungen, etwa mit Diskriminierung durch Behörden oder bei der Jobsuche, fühlen sich leichter in Menschen in ähnlichen Lebensumständen ein. Grundprinzipien dieser mit der -> Independent Living-Bewegung (S. 39 im Buch) verbundenen Beratungsform sind aktives Zuhören, Beratung ohne Bevormundung und Übernahme von Eigenverantwortung für die eigenen Probleme. Auf politischer Ebene fordern Independent Living-Vertreter/innen, dass auch für Menschen mit Behinderungen möglichst große Wahlmöglichkeiten, z. B. bei der Ausbildung oder der Berufswahl, geschaffen werden. Eine ausführliche Erklärung des Begriffes findet sich auch auf der BIZEPS-Website: www.service4u.at/bizeps/index2.html.
ist eine auf die individuellen Bedürfnisse "maßgeschneiderte" Hilfe, die die Assistenznehmer/innen in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Körperpflege, Haushaltshilfe, Mobilitätshilfe sowie Kommunikationshilfe. In jedem Fall aber soll die Persönliche Assistenz von den Assistenznehmer/innen angeleitet, Zeit, Ort und Ablauf von ihnen bestimmt und die Assistenzleistenden von ihnen ausgesucht werden (Vgl.: www.bizeps.or.at ). Menschen mit Behinderungen sind durch dieses Angebot unabhängig von Vorgaben und Bevormundung durch Institutionen. Damit einher geht auch ein neues Rollenverständnis weg vom hilflosen Leistungsempfänger hin zum Auftraggeber, nach dessen Wünschen die Assistenz abläuft. In der Rolle als Auftraggeber müssen die Assistenznehmer/innen koordinieren, wo und wann sie persönliche Assistenz benötigen und wie diese zu finanzieren ist. Sie sollten auch über Personalkompetenz und Menschenkenntnis verfügen. Schließlich ist Persönliche Assistenz ohne Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen nicht machbar.
ist die deutsche Entsprechung von -> Independent Living (S. 39 im Buch). Diese Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderungen ging Ende der 1960-er Jahre von den USA aus. In Österreich gibt es Selbstbestimmt Leben-Initiativen in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Schwaz in Tirol. "Menschen mit Behinderungen arbeiten daran, ihre persönliche Kompetenz im Rahmen der Selbstbestimmung zu nützen. Die Menschen sehen sich als Expert/innen in eigener Sache und lernen sich selbst -> Persönliche Assistenz (S. 41 im Buch) zu organisieren und anzulernen. Sie arbeiten an der politischen Selbstvertretung und kämpfen für die Gleichstellung und Antidiskriminierung." (Vgl. BURTSCHER, 1999)
oder "Unterstützte Beschäftigung" lässt sich durch vier Merkmale charakterisieren: 1. Es ist bezahlte Arbeit, die 2. in einem integrativen Arbeitsumfeld verrichtet wird, d.h. dass die Mehrzahl der Kolleg/innen nichtbehindert sind. 3. ermöglicht Supported Employment Menschen mit Behinderungen, unabhängig von Grad und Schwere der Beeinträchtigung, durch entsprechende Unterstützung einer sinnvollen Erwerbstätigkeit nachzugehen.
4. handelt es sich um eine langfristige Form der Unterstützung, die - falls nötig - die gesamte Zeit einer Anstellung hindurch geleistet wird (Vgl. DOOSE, 1997). Bei Supported Employment stehen die Fähigkeiten und Talente eines jobsuchenden Menschen mit Behinderung im Vordergrund, nicht seine Defizite. Umgesetzt wird Supported Employment seit Ende der 1980er Jahre in Europa in Form von vier Modellen (Vgl. BADELT/ÖSTERLE in Badelt (Hg.) Wien, 1992, S. 79-150 im Buch):
-
Individuelles Betreuungsmodell: Ein Mensch mit Behinderung geht mit Unterstützung einer/s Assistent/in einem Beruf auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach.
-
Arbeitsenklave: Eine ständige Gruppe von Mitarbeitern mit Behinderung wird in einer eigenen Einheit eines Unternehmens von einem oder mehreren Assistent/innen betreut.
-
Die Mitglieder der Arbeitsenklave sollen später auf einem
-
individuellen Arbeitsplatz beschäftigt werden.
-
Mobile Arbeitsgruppe: Eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen wird an verschiedenen Orten für die Dauer eines Auftrages eingesetzt.
-
Integrative Betriebe (S. 40 im Buch)
Inhaltsverzeichnis
- Behindertenmilliarde
- berufliche Integration
- Berufsqualifizierung
- Bildung für Alle
- Clearing
- I-Kinder
- inklusive Erziehung
- Integer
- Integration in der Schule
- Integration in weiterführenden Schulen
- Integrationsklasse
- integrative Volkshochschulkurse
- Integrativer Kindergarten
- Interkulturelles Lernen
- Normalisierungsprinzip
- QSI
- Salamanca Erklärung
- Sonderschulen
- soziale Integration
- Spezial-Sonderschulen
- SPF
- TQL
- Uniability
Gemeinsam Leben und Lernen
Integration bedeutet die Eingliederung eines Teilstücks in ein Ganzes. In unserem konkreten Fall bedeutet es die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in unsere Gesellschaft. In dieser Auffassung wird Integration durchaus als wichtige Aufgabe der Gesellschaft anerkannt und weitgehend befürwortet. Sie ist jedoch irreführend, da ihr die Sichtweise innewohnt, dass etwas von außen in etwas Bestehendes aufgenommen wird. Behinderte Menschen werden in die Gesellschaft integriert. Es genügt jedoch nicht, einen Platz für behinderte Menschen in unserer Gesellschaft zu schaffen, sie zu betreuen, sie zu beschäftigen etc. Sie haben bereits einen Platz in unserer Gesellschaft, sind einer von vielen Bestandteilen davon und sind als solcher anzusehen und zu behandeln. In Fachkreisen wird dieser neuen Sichtweise durch die Verwendung eines neuen Begriffes Rechnung getragen. Der Begriff "Inklusion" entstammt dem angelsächsischen Sprachraum und setzt sich nach und nach auch im deutschsprachigen Raum durch. Er beschreibt ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Inklusion stellt ein Modell dar, in dem allen Menschen dieselbe Achtung, dieselbe Würde, dieselbe Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und dieselben Rechte zuerkannt werden. Die Einführung des neuen Begriffes leitet einen Umdenk-Prozess ein. Das Zusammenleben von behinderten und nicht-behinderten Menschen soll eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft sein.
Andrea Martiny
ist die geläufige Abkürzung für die Beschäftigungsoffensive für behinderte Menschen, die die österreichische Bundesregierung im Jahr 2001 startete. Mittel in der Höhe von 1 Milliarde Schilling (laut Rechnungshof de facto 59,59 Millionen € ) wurden dafür zur Verfügung gestellt. Ziel der Beschäftigungsoffensive ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit die Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus werden auch Maßnahmen zur Verbesserung des beruflichen Umfelds gefördert (z.B. Gebärdendolmetscher/innen, Job-Coaching, etc.) Zielgruppen der Beschäftigungsoffensive sind insbesondere:
-
behinderte Jugendliche (mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf, S. 57 im Buch) unmittelbar vor oder beim Übergang von der Schule ins Berufsleben
-
behinderte Menschen höheren Alters zur Aufrechterhaltung bestehender Arbeitsplätze, die durch zunehmende gesundheitliche Beeinträchtigung (z.B. chronische Erkrankungen) gefährdet sind, sowie
-
behinderte Menschen mit besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt (vor allem psychisch behinderte, geistig behinderte und sinnesbehinderte Personen). www.bmsg.gv.at/bmsg/relaunch/behinderung/content/behindertenmilliarde.htm
Der Übergang von der Schule ins Berufsleben gestaltet sich gerade für behinderte Menschen schwierig. Potenzielle Arbeitgeber/innen können die Fähigkeiten und Möglichkeiten behinderter Bewerber/innen oft nicht einschätzen. Manchmal sind nur kleine Hilfestellungen oder Änderungen notwendig, damit Arbeitnehmer/innen mit Behinderung ihren Job erledigen können. Wenn ein behinderter Arbeitnehmer technische Hilfsmittel für seinen Arbeitsplatz benötigt, so werden etwa -> Sprachausgabe (S. 110 im Buch) oder eine spezielle Tastatur vom Bundessozialamt gefördert. Blinde Menschen z.B. können dadurch mit technischen Hilfsmitteln in vielen Berufen tätig sein, die sich mit EDV und Internet beschäftigen oder wo Menschen mit dem Computer arbeiten. Da Menschen mit Behinderungen keine reinen Empfänger von Hilfsleistungen sein wollen, sondern ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten können und ein selbstbestimmtes Leben führen möchten, ist Integration in der Arbeitswelt ein wichtiges Moment im gesellschaftlichen Zusammenleben. Vgl. -> soziale Integration (S. 56 im Buch)
Unter diesem Begriff werden allgemein arbeitsmarktpolitische Projekte und Maßnahmen zusammengefasst, die der beruflichen Integration behinderter Menschen dienen. Das Kursangebot ist eindeutig am Arbeitsmarkt orientiert und vergleichsweise eingeschränkt. Es bietet die "klassischen" Schulungen, wie z. B. Massage-Lehrgänge für hochgradig Sehbehinderte und Blinde oder EDV- und Teleschulungen für Gehörlose sowie Ausbildungen für einfache Bürotätigkeit oder manuelle Tätigkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung an. Das Angebot orientiert sich im Wesentlichen an den Fähigkeiten behinderter Menschen, die ihnen zugetraut und am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Es orientiert sich jedoch nicht an den ganz persönlichen Interessen und Begabungen. Behinderte Menschen haben kaum die Möglichkeit der freien Berufswahl, sondern werden nach Art ihrer Behinderung in bestimmten Berufsfeldern schubladisiert. Die Lehrerin im Rollstuhl, der Balletttänzer mit -> Down-Syndrom (S. 24 im Buch), die sehbehinderte Hotelrezeptionistin etc. sind selten anzutreffen und - oder gerade deshalb - für viele unvorstellbar. Eine umfassende Auflistung und Kurzbeschreibung bestehender Projekte in Österreich findet sich unter: www.wegweiser.bmsg.gv.at
Unter diesem Motto lassen sich die Bemühungen hin zu einem integrativen Schulwesen zusammenfassen. Was im skandinavischen Raum und in Italien schon lange üblich ist, wurde in Österreich vereinzelt in "wilder Integration" ausprobiert. Elterninitiativen und engagierte Lehrer/innen fordern seit Mitte der 1980-er Jahre das Recht auf -> Integration in der Regelschule (S. 50 im Buch). Die gesetzlichen Grundlagen zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schüler/innen enden nach der 8. Schulstufe - in Polytechnischen Schulen sind allerdings integrative Schulversuche vorgesehen. Ein 10. oder 11. Schuljahr ist nur in der Sonderschule möglich. Nichtbehinderte Kinder können hingegen bis zu 15 - oder auch mehr - Jahre zur Schule gehen. Gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen Eltern mit der Unterstützung von Integration:Österreich für das Recht auf Aus- und Weiterbildung. Denn die Polytechnische Schule allein wird dem breiten Spektrum an (Aus-) Bildungsbedürfnissen behinderter Jugendlicher nicht gerecht. Um ihr Begabungspotential voll entfalten zu können, brauchen sie die gleiche Vielfalt an Bildungsangeboten und zumindest ebensoviel Zeit dafür wie ihre nicht behinderten Schulkolleg/innen auch. www.ioe.at Vgl. -> Integration in weiterführenden Schulen (S. 51 im Buch)
ist eine Dienstleistung für junge Menschen mit Behinderungen an der Nahtstelle von Schule und Beruf. Clearing soll unter Einbeziehung von Eltern bzw. Lehrer/innen die Jugendlichen über künftige Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten aufklären und Entscheidungsgrundlagen für ein realistisches weiteres Vorgehen in Richtung berufliche Integration schaffen. Das Angebot besteht österreichweit, wird in den einzelnen Bundesländern und Clearingstellen jedoch unterschiedlich umgesetzt. Häufig ist Clearing an eine -> Arbeitsassistenz (S. 36 im Buch) für Jugendliche gekoppelt. Die Clearing-Projekte werden vom Bundessozialamt aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive finanziert. -> Behindertenmilliarde (S. 47 im Buch)
ist eine vor allem unter Pädagog/innen sehr gebräuchliche, umgangssprachliche Bezeichnung für Schüler/innen mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) in integrativen Schulmodellen.
ist ein erzieherisch-pädagogischer Ansatz, der einen grundsätzlichen Wandel der selektionsorientierten Pädagogik beansprucht. Im Sinne einer "Pädagogik der Vielfalt" geht der Ansatz über die Diskussion der gemeinsamen (schulischen) Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder hinaus. Es ist eine Erziehung, die Unterschiedlichkeit willkommen heißt, unabhängig von Geschlechterrollen, ethnischer, religiöser, sprachlicher usw. Zugehörigkeit oder Behinderung. Sie setzt tiefgreifende pädagogische Reformen voraus, die gerade für die gemeinsame (schulische) Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder bedeutsam ist. Vgl. -> Integration in der Schule (S. 50 im Buch)
Das Projekt hat das Ziel, die Integration in der Lehrer/innenausbildung zu verankern und somit eine bisher vernachlässigte Lücke zu schließen. Gemeinsam mit 15 europäischen Partneruniversitäten wurde ein Curriculum für eine integrative Lehrer/innenausbildung entworfen. Die konkrete Umsetzung der festgelegten Prinzipien und Inhalte obliegt den Institutionen der Lehrer/innenbildung. In Österreich bietet u.a. die Pädagogische Akademie des Bundes Oberösterreich einen 3-semestrigen, berufsbegleitenden Akademielehrgang zur Integrationslehrer/in an. http://integer.pa-linz.ac.at
oder Schulische Integration bezeichnet den gemeinsamen Schulbesuch behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher und ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung -> sozialer Integration (S. 56 im Buch) und Gleichstellung. Die Nicht-Aussonderung bzw. Nicht-Abschiebung von Kindern in die -> Sonderschulen
(S. 55 im Buch) ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Der schulischen Integration kommt vor allem deshalb eine besondere Rolle zu, weil die Kinder das Zusammenleben von Kindheitstagen an als alltäglich und normal erleben. Damit wird ein Grundstein für das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung gelegt. Um vollständige Inklusion und Chancengleichheit zu schaffen, sollte sich schulische Integration durch alle Schulstufen und Schultypen, vom Pflichtschulbereich bis zu den weiterführenden Schulen ziehen und bereits im vorschulischen Bereich in -> integrativen Kindergärten (S. 53 im Buch) stattfinden. Diesem umfassenden Verständnis von Integration werden derzeit die Gesetzeslage und die öffentliche Meinung in Österreich nicht gerecht.
Chronologie zur Integration im österreichischen Schulwesen
|
1984 Errichtung der ersten -> Integrationsklasse (S. 52 im Buch) als Schulversuch |
|
1988 Schaffung der gesetzlichen Grundlage zur Durchführung integrativer Schulversuche, § 131a, 11. Novelle des Schulorganisationsgesetzes(SchOG) |
|
1993 gesetzliche Verankerung der Integration im Regelschulwesen für den Bereich der Volksschule, 15. Novelle des SchOG |
|
1996 gesetzliche Verankerung der Integration im Regelschulwesen für den Bereich der Sekundarstufe I (Haupt- & Mittelschule, AHS-Unterstufe), 17. Novelle des SchOG |
Gegen den Besuch einer AHS- oder BHS-Oberstufe für Menschen mit Behinderungen werden in der öffentlichen Debatte verschiedene Argumente angeführt, etwa: "Weiterführende Schulen sind nur Aufbewahrungsstätten" oder "Der Berufsorientierungslehrgang, eine Vorlehre, Anlehre oder spezielle Kurse sind geeigneter als eine integrative Bildung an allen Schultypen der Sekundarstufe II". Jugendlichen mit Körper- oder Sinnesbehinderung ist der Besuch einer weiterführenden Schule ihrer Wahl oft durch bauliche Barrieren oder aufgrund mangelnder Hilfsmittel, z.B. -> Gebärdensprachdolmetsch (S. 85 im Buch) nicht möglich. Alternative und innovative Modelle und Schulversuche sind bislang Einzelfälle.
Dieses Modell -> schulischer Integration (S. 50 im Buch) sieht den gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/innen unabhängig von Art und Grad der Behinderung vor. Integrationsklassen werden in Österreich vor allem im Volksschulbereich und zum Teil in der Sekundarstufe I (vor allem in der Hauptschule) geführt. Charakteristisch für Integrationsklassen sind 4 Merkmale:
-
eine verminderte Klassenschülerzahl
-
Unterricht durch zwei Pädagog/innen (davon ein/e Sonder- pädagoge/in) in allen Unterrichtsstunden, in denen Schüler/innen mit -> sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) anwesend sind
-
Unterricht nach verschiedenen Lehrplänen innerhalb der Klasse
-
Auflösung der Leistungsgruppen in der Hauptschule
Die Qualität des Unterrichts ist trotz dieser einheitlichen Rahmenbedingungen in allen Integrationsklassen unterschiedlich und stark von der persönlichen Einstellung, dem Engagement und der Ausbildung der jeweiligen Lehrpersonen abhängig.
Volkshochschulen leisten sowohl einen bedeutenden Beitrag zur persönlichen Freizeitgestaltung als auch zur Weiterbildung. Dieser Bereich ist Menschen mit Behinderungen aber nicht uneingeschränkt zugänglich. Zum einen sind es bauliche Barrieren, die den Besuch interessanter Kurse unmöglich machen. Zum anderen haben manche behinderte Menschen Hemmungen, nicht speziell integrative Kurse zu besuchen. Kursleiter/innen wie auch Teilnehmer/innen sind im Regelfall nicht darauf eingestellt, dass behinderte Menschen "normale" Kurse besuchen. Mangels ausreichender Sensibilisierung und Ausbildung sind oft Hemmungen vorhanden, die gerade durch das gemeinsame Interesse an einer Sache bzw. das gemeinsame Lernen überwunden werden könnten. VHS-Kurse, an denen behinderte Menschen problemlos teilnehmen können, sind demnach ziemlich rar. Angebote setzt in Wien beispielsweise die VHS Meidling, in der VHS 11 in Simmering können behinderte Menschen neben vielfältigen speziellen Kursen nach Rücksprache mit den Kursleiter/innen auch das allgemeine Kursangebot nutzen. (Nicht alle Kursräume sind aber auch rollstuhlgerecht.)
VHS 11: www.vhs11.at/kursangebot/kursthemen/integration.htm
VHS Meidling: www.meidling.vhs.at
Den Kindergärten kommt im Sinne der Integration bzw. einer -> inklusiven Erziehung (S. 50 im Buch) ein besonderer Stellenwert zu, da sie die erste Stufe im institutionalisierten Sozialisationsprozess der Kinder darstellen und es somit ermöglichen, einen vorurteilslosen Umgang miteinander von Anfang an zu lernen. Der erste integrative Kindergarten Österreichs wurde 1978 in Innsbruck gegründet. Die Anzahl stieg vor allem in den 1980-er Jahren österreichweit stark an, schwankt heute jedoch regional. Eine gesetzliche Verankerung auf Landesebene konnte bereits in 7 Bundesländern erzielt werden (außer in Wien und der Steiermark).
bezeichnet die integrative Beschulung von Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache. Der Begriff hat sich im österreichischen Schulwesen zum besseren Verständnis des Überbegriffes "Integration" durchgesetzt.
Behinderte Menschen leben oft in Heimen, gehen in eine -> Sonderschule (S. 55 im Buch) und werden häufig als Erwachsene wie Kinder behandelt. Das Normalisierungsprinzip geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, in einem "normalen" Umfeld mit Gewohnheiten wie Du und Ich zu leben. Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen müssen akzeptiert und respektiert werden. Es geht also nicht darum, behinderte Menschen zu normalisieren oder an die Gesellschaft anzupassen, sondern Lebensbedingungen zu schaffen, die ein Miteinander-Leben ermöglichen. Voraussetzung ist die Grundannahme der Gleichheit behinderter und nichtbehinderter Menschen und damit deren rechtliche Gleichstellung. Damit steht dieses Prinzip im Gegensatz zur -> Aussonderung (S. 117 im Buch) für Integration und Gleichstellung (Vgl. NIRJE, 1994).
ist die Abkürzung für "Quality Supported Skills for Integration" und bedeutet: "Qualitätsunterstützte Ausbildung für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im dritten Sektor". QSI ist eine österreichische Entwicklungspartnerschaft im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Ziel der Initiative ist die Entwicklung und Vernetzung integrationsrelevanter Ausbildungen. QSI strebt in Zusammenarbeit mit Betroffenen, Angehörigen, Beschäftigten im Integrationsbereich, Vertreter/innen integrativer (Aus-)Bildungseinrichtungen und der öffentlichen Hand (Fördergeber) die Schaffung einheitlich abgestimmter Ausbildungen für "Integrationsfachkräfte" an. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Sicherung bestimmter Qualitätsmerkmale und allgemein anerkannter Curricula. Das Projekt kommt somit dem Bedarf nach qualitativer, anerkannter Berufsausbildung für den Integrationsbereich nach. Die vermittelten Inhalte, Kompetenzen und Einstellungen der neu entstehenden Ausbildungen schaffen die Grundlage zukünftiger Integrationsarbeit. QSI ist gerade deshalb so bedeutend, weil damit ein Umdenken in der Begegnung und im Umgang mit behinderten Menschen bewirkt werden kann. www.qsi.at
Im Rahmen der UNESCO Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität" (Salamanca, 1994) wurde eine Erklärung sowie ein Aktionsrahmen mit Grundsätzen und Empfehlungen zur -> schulischen Integration (S. 50 im Buch) von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung erarbeitet. Beide wurden in der Schlusssitzung der Konferenz von Vertreter/innen aus Bildung, Politik, Verwaltung und NGO's mehrheitlich angenommen.
Allgemeine Sonderschulen (ASO) sind eigenständige Unterrichts-und Erziehungseinrichtungen für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die wegen unterschiedlicher, auch mehrfacher Behinderung dem Unterricht in den allgemeinen Schulen nicht folgen können. Die Hilfsschule als vom Normalschulwesen isolierte Bildungsinstitution existiert seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Folge des Reichsvolksschulgesetzes (1869) und der damit verbundenen Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus. Mit der damaligen Bezeichnung als "Idioten- und Schwachsinnigen-Schulen" waren diese Sondereinrichtungen von jeher mit einem diskriminierenden -> Stigma (S. 128 im Buch) behaftet, das trotz ideologischer Neuorientierung nach 1945 und der Umbenennung der Hilfsschule in "allgemeine Sonderschule" (1952) erhalten blieb. Heute wird mit dem Argument der besseren Fördermöglichkeit und der Gewährleistung eines geschützten Raumes Sonderschulen häufig der Vorzug vor integrativen Modellen gegeben. Die soziale Stigmatisierung, die mit dem Besuch der Sonderschule immer noch einhergeht, wird dabei ebenso wenig berücksichtigt wie die Tatsache, dass diese Art der -> Aussonderung (S. 117 im Buch) den Kindern und Jugendlichen auch zahlreiche Lernchancen vorenthält, weil bestimmte Fertigkeiten im Rahmen des Lehrplanes der allgemeinen Sonderschule nicht vorgesehen sind. Die Ausbildung in gesonderten Schulen bietet zudem unzureichende Möglichkeiten, sich in der "normalen" Welt zurechtzufinden und das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu "trainieren".
Dieser Begriff beschreibt die Teilnahme und die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft. Im Gegensatz dazu steht die soziale -> Aussonderung (S. 117 im Buch). Menschen, die behindert oder in anderen Bereichen benachteiligt sind, müssen oft um ihren Platz im gesellschaftlichen Leben kämpfen. Soziale Integration hat viele Aspekte. Sie beginnt mit dem sozialen Ansehen einer Gruppe, wird vom Zugang zu Bildungsangeboten, der Art zu leben und zu wohnen geprägt. Ein wichtiges Moment ist die Möglichkeit zu arbeiten und damit auch das wirtschaftliche Einkommen. Projekte zur sozialen Integration fördern die Integration in der Arbeitswelt und bieten alternative Wohnangebote wie betreutes oder begleitetes Wohnen an. Grundvoraussetzungen für soziale Integration bilden soziale Sicherheit und optimale Rahmenbedingungen. Dazu zählen -> barrierefreies Bauen (S. 98 im Buch) und behindertengerechte Arbeitsplätze, die mit Förderungen des Bundessozialamtes ausgestattet werden können.
Mit der Gründung des k.k. Taubstummeninstitutes (1779) und der Eröffnung eines Blindeninstitutes in Wien (1804) bildeten diese Einrichtungen die Wurzeln des österreichischen Sonderschulwesens. Die traditionelle Einrichtung von auf bestimmte Formen der Behinderung spezialisierten Sonderschulen wurde fortgeführt und ausgebaut (z.B Bundes-Blindenerziehungsinstitut, Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, Schulen für körperbehinderte, schwerstbehinderte oder autistische Kinder). Spezial-Sonderschulen werden maximal bis zur Vollendung der Schulpflicht geführt. Von Befürworter/innen der schulischen Integration wird das Konzept der Spezial-Sonderschulen kritisiert, da es die Integration behinderter Kinder in Schule und Gesellschaft erschwere.
ist das Fachkürzel für Sonderpädagogischen Förderbedarf. SPF besteht, wenn ein Kind aufgrund einer körperlichen, psychischen oder Lernbehinderung dem Unterricht der Regelschule nicht folgen kann und besagt, dass dem Kind ein größtmögliches Maß an sozialer und pädagogischer Betreuung und Förderung zuteil werden muss. Fördermaßnahmen können z.B. zusätzliches Lehrpersonal, die Anschaffung spezieller Lehrmittel, oder bauliche Veränderungen umfassen. Der "Antrag auf Feststellung des SPF" wird durch den zuständigen Bezirksschulrat anhand medizinischer, psychologischer und pädagogischer Gutachten entschieden.
ist die Abkürzung von Teilqualifizierungslehre. Bei diesem Modell sollen Jugendliche mit -> Sonderpädagogischem Förderbedarf (S. 57 im Buch) gemeinsam mit nichtbehinderten Lehrlingen in der Berufsschule unterrichtet werden. Mit Unterstützung zusätzlich ausgebildeter Lehrer/innen haben sie die Möglichkeit, Lernziele soweit zu erreichen, wie ihnen das in den einzelnen Bereichen möglich ist. Die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden im Zeugnis beschrieben und ermöglichen den Jugendlichen die Erreichung von Teilqualifikationen. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur höheren Qualifizierung behinderter Menschen geleistet werden, wodurch auch die Chancen späterer beruflicher Integration steigen.
ist eine Interessengemeinschaft von Behindertenbeauftragten, Betroffenen und anderen Personen, deren Ziel es ist, die Studienbedingungen an allen österreichischen Universitäten zu verbessern und die Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören u.a. Information und Beratung, Studienbegleitung, fachliche Beratung bezüglich baulicher Gestaltung und technischer Ausstattung sowie Öffentlichkeitsarbeit. http://info.tuwien.ac.at/uniability
Inhaltsverzeichnis
- Artikel 7, B-VG
- Artikel 13, Vertrag von Amsterdam
- Ausgleichtstaxe und Beschäftigungspflicht
- Begünstigte Behinderte
- Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
- Beschäftigungspflicht
- Bundesbehindertengesetz
- Diskriminierungsverbot
- EU-Gleichstellungsrichtlinie
- Gleichheitsgrundsatz
- Gleichstellungsbewegung in Österreich
- Gleichstellungsgesetz in Deutschland
- Gleichstellung in der Schweiz
- Gleichstellung in den USA
- Verwaltungsverfahrensgesetze
Vom Recht auf Chancengleichheit.
Sie werden in diesem unspektakulär klingenden Kapitel zur gesetzlichen (Un-)Gleichstellung nicht nur das Behinderteneinstellungsgesetz erläutert bekommen, sondern auch Begriffe wie "begünstigte Behinderte" oder "Ausgleichstaxe und Einstellungspflicht". Außerdem werden Sie einen kleinen Überblick erhalten, wie die rechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen außerhalb Österreichs aussieht.
Liebe Leser/innen, bevor Sie folgendes Kapitel lesen, möchte ich Ihnen einige Fragen mit auf den Weg geben:
Wie nennt man den Zustand, der in einem Land herrscht, in dem
-
ein vermutlich behindertes Kind - im Unterschied zu einem nichtbehinderten Kind, bei dem die Frist mit 12 Wochen begrenzt ist - bis zur Geburt straffrei abgetrieben werden darf?
-
die Sprache einer Minderheit noch immer nicht offiziell anerkannt wurde, obwohl sie an Schulen aktiv gelehrt wird und die Muttersprache von 10.000 Mitmenschen ist, nur weil es die Gebärdensprache der gehörlosen Menschen ist?
-
noch immer Gesetze und Verordnungen gelten, die bauliche Maßnahmen dulden, durch die 25.000 Menschen weder Zutritt zu Geschäften noch zu öffentlichen Gebäuden oder Arztpraxen (nur um einige Beispiele zu nennen) haben, nur weil sie im Rollstuhl sitzen und die Stufen nicht überwinden können?
-
die Arbeitslosigkeit unter behinderten Menschen um ein Vielfaches höher ist als bei Nichtbehinderten, wobei öffentliche Einrichtungen (Ministerien, Länder, Gemeinden) der gesetzlich vorgeschriebenen Einstellungspflicht noch immer zu wenig, aber in einem höheren Ausmaß nachkommen als private Unternehmen?
Nennen Sie diesen Zustand "unmöglich", "unannehmbar" oder "indiskutabel"? Ich nenne ihn schlicht "veränderbar".
Unzählige weitere Beispiele ließen sich in allen Bereichen des täglichen Lebens finden.
Obwohl ein Gleichstellungsgesetz nicht die Musterlösung für all diese Ungerechtigkeiten sein kann, wird man - bei genauerer Betrachtung - immer wieder auf die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes stoßen.
Jasna Puskaric
Der Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung enthält eine Nicht-Diskrimierungsbestimmung sowie eine Staatszielbestimmung für behinderte Menschen. Folgende Sätze wurden im Jahr 1997 angefügt: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten." (BGBl. I Nr.87/1997) Eine Staatszielbestimmung ist eine Art Verfassungsauftrag, die Ähnlichkeit mit Grundrechtsbestimmungen hat, sich aber dadurch unterscheidet, dass Staatszielbestimmungen keine subjektiven klagbaren Rechte gewährleisten. Folgende Frage drängt sich auf: Was geschieht, wenn der Gesetzgeber unterlässt, diese Staatszielbestimmung zu erfüllen? Nach der älteren Rechtssprechung ist die Untätigkeit des Gesetzgebers generell nicht sanktionierbar. Die neuere Judikatur hebt allerdings Regelungen auf, die einen Verfassungsauftrag, wie es z. B. der Artikel 7 ist, unvollkommen ausführen. www.service4u.at/info/VERFASS.html
Im Juni 1998 wurde der Vertrag von Amsterdam ratifiziert, welcher schließlich am 1. Mai 1999 in Kraft trat. Er enthält in Artikel 13 folgende Nichtdiskriminierungsbestimmung: "Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages kann der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen." Zum ersten Mal überträgt die Europäische Union Kompetenzen im Behindertenbereich, allerdings werden keine konkreten Auswirkungen erwartet, da dieser Artikel der Europäischen Gemeinschaft lediglich gestattet, Maßnahmen gegen Diskriminierungen zu ergreifen. Will die Gemeinschaft dies tatsächlich, muss jede Maßnahme erst einstimmig vom Europäischen Rat genehmigt werden. Dem einzelnen Bürger werden wiederum keine Rechte gegeben, auf die er sich vor den jeweiligen nationalen Gerichten berufen kann.
Arbeitgeber/innen, die 25 oder mehr Mitarbeiter/innen beschäftigen, müssen in Österreich pro 25 Arbeitnehmer/innen entweder eine Person einstellen, die den Status eines -> begünstigten Behinderten (S. 63 im Buch) trägt, oder aber Ausgleichstaxe zahlen. Diese beträgt 2003 EURO 196,22 pro Monat pro nicht besetzter Pflichtstelle und wird von den meisten Unternehmen ohne ausreichende Ahnung, warum dieses Geld zu entrichten ist, bezahlt. Tatsächlich fließen die Mittel in einen Ausgleichstaxfonds, aus dem Förderungen für behinderte Menschen und deren Arbeitgeber/innen gewährt werden.
Um nach dem -> Behinderteneinstellungsgesetz (S. 64 im Buch) den Status des begünstigten Behinderten zu erlangen, muss ein Feststellungsverfahren durch das Bundessozialamt durchgeführt werden. Dabei wird der Grad der Behinderung aufgrund ärztlicher Gutachten ermittelt. Der festgestellte Grad der Behinderung sagt jedoch nichts über die Einsetzbarkeit auf einem konkreten Arbeitsplatz aus. Das heißt, dass z. B. ein blinder Mensch, der einen Grad der Behinderung von bis zu 100 Prozent hat, mit entsprechender technischer Unterstützung seine volle Leistung am Arbeitsplatz erbringen kann. Die oft gemachte Gleichsetzung von "Grad der Behinderung" und "Minderung der Erwerbsfähigkeit" ist falsch. Rechtsfolgen der Begünstigung sind z.B. der erhöhte Kündigungsschutz sowie steuerliche Vergünstigungen sowohl für den/die behinderten Arbeitnehmer/in selbst als auch für den/die Arbeitgeber/in. Negativ kann sich aus der subjektiven Sicht der Betroffenen auswirken, dass sie aufgrund des Status als begünstigter Behinderter in der Berufswelt nicht als vollwertige Arbeitskraft anerkannt werden und deshalb mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Quelle: www.help.gv.at
Die Behinderten- bzw. Sozialhilfegesetze sind bis dato in Österreich Länderkompetenz. Eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer steht zur Debatte. Auf Bundesebene wurde das nach dem Krieg ursprünglich für Kriegsinvalide geschaffene Invalideneinstellungsgesetz (zunächst IEinstG 1946, IEinstG 1969, BGBl 22/ 1970) bis in die 1980-er Jahre schrittweise geändert, sodass es auch Unfallversehrte und Zivilinvalide miteinbezog. 1988 wurde es in Behinderteneinstellungsgesetz (BGBl 721/1988) umbenannt. Im Rahmen der vom Bund ausgeübten Kompetenzen wurde schließlich das -> Bundesbehindertengesetz (S. 64 im Buch) geschaffen. Heute regelt das BEinstG als Bundesgesetz die berufliche Integration behinderter Menschen. Darin sind Bestimmungen enthalten über
-
den Status der -> begünstigten Behinderten (S. 63 im Buch),
-
die Beschäftigungspflicht für Arbeitgeber/innen von Menschen mit Behinderungen, die gegebenenfalls zu leistenden -> Ausgleichstaxen (S. 63 im Buch) und
-
Schutzbestimmungen wie Kündigungsschutz von Behindertenvertrauenspersonen etc. (Vgl. STEINGRUBER, 2000)
Die gesetzlichen Bestimmungen werden grundsätzlich vom Bundessozialamt vollzogen. Davon unberührt bleibt die generelle Zuständigkeit der Behindertenhilfe beim jeweiligen Bundesland.
Das Bundesbehindertengesetz koordiniert die Tätigkeiten der einzelnen Rehabilitationsträger (Bundessozialämter, Arbeitsmarktservice, Sozialversicherungsträger). In die Teamberatungen gem. § 4 BBG ist auch die Behindertenhilfe des Landes eingebunden.
Es regelt weiters die Förderungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung. Quelle: www.help.gv.at
Der österreichische Gesetzgeber bekennt sich im -> Artikel 7 (S. 62 im Buch) der Bundesverfassung dazu, dass in allen Bereichen des täglichen Lebens niemand auf Grund seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Sollten zukünftig entsprechende Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof eingehen, wird zu deren Beurteilung nicht nur der -> Gleichheitsgrundsatz (S. 66 im Buch) herangezogen, sondern auch dieses Diskriminierungsverbot. Wenn diese Verfassungsbestimmungen allein auch noch nichts an den alltäglichen Problemen behinderter Menschen ändern, so stellen sie doch einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichbehandlung und gesellschaftliche Integration dar. Weiters wurde verfassungsgesetzlich verankert, dass alle Gebietskörperschaften (Bund, Land und Gemeinde) sich vermehrt um die Förderung und Unterstützung behinderter Menschen zu kümmern haben und auf deren Gleichbehandlung in allen Bereichen des täglichen Lebens hinwirken sollen. Diese Regelung ist allerdings nicht einklagbar.
Die Europäische Union fördert mit zahlreichen Richtlinien und Aktionen (z.B. EQUAL) die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (und anderen benachteiligten Gruppen). Im Jahr 2000 wurde die "EU-Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf" (Council Directive 2000/78/EC v. 27.11.00) beschlossen. Zweck der Richtlinie ist es, die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung am Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Für Menschen mit Behinderungen sollen gleiche Beschäftigungschancen, insbesondere bei der Einstellung und der Aufrechterhaltung des Arbeitsplatzes sowie bei der beruflichen Bildung und Weiterbildung, verwirklicht werden. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen die Gleichstellungsrichtlinie bis Dezember 2003 in nationales Recht umgesetzt haben.
Der Gleichheitsgrundsatz ist ein elementares Grundrecht. Das bedeutet, dass Verwaltung und Gesetzgebung verpflichtet sind, den Gleichheitsgrundsatz zu beachten und umzusetzen. Das Grundrecht der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist im -> Artikel 7 Absatz 1 B-VG (S. 62 im Buch) verankert. Daraus ergeben sich Leistungsansprüche gegenüber dem Staat. Ein anschauliches Beispiel für die hier enthaltene Problematik ist der Versuch, die -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch) in Österreich als offizielle Sprache anzuerkennen: Die vom Österreichischen Gehörlosenbund initiierte Petition "Anerkennung der Gebärdensprache" wurde am 20. März 1997 dem Präsidenten des Nationalrates übergeben. 10.000 Menschen haben dieses Anliegen unterschrieben. Leider führte die Initiative bisher nur zur Änderung zweier Verfahrensgesetze: Vor Gericht müssen nun bei Bedarf Gebärdensprachdolmetscher/innen finanziert werden.
Ein konkretes Datum, wie lang es die Gleichstellungsbewegung in Österreich schon gibt, lässt sich nicht nennen, nicht einmal ein bestimmtes Jahr. Tatsache ist aber, dass schon seit Jahrzehnten Organisationen und Gruppen nach Selbstbestimmung, Integration und Teilhabe an Bürgerrechten für behinderte Menschen streben. Dabei ist der Selbstvertretungsanspruch von Menschen mit Behinderungen und Eltern, die ein behindertes Kind haben, deutlich gestiegen. Man wollte weg von einer Fürsorge- und Aussonderungspolitik hin zu einer Politik VON behinderten Menschen. Dies musste früher oder später zu Mitteln der direkten Demokratie führen. Es wurden Petitionen und Bürgerinitiativen im Parlament eingebracht, sodass nach langem Kämpfen und Ringen am 9. Juli 1997 die Änderung der Österreichischen Bundesverfassung im Plenum des Nationalrats beschlossen wurde. Der neue -> Artikel 7 des BundesVerfassungsgesetzes (B-VG) (S. 62 im Buch) lautet seitdem: "Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten." Da diese Verfassungsänderung nur die Republik zur Gleichbehandlung verpflichtet, dem einzelnen behinderten Menschen aber noch keine individuellen, einklagbaren Rechte in die Hand gibt, besteht die Forderung nach einem Behindertengleichstellungsgesetz nach wie vor.
Antidiskriminierungsgesetz oder Gleichstellungsgesetz?
Die Frage, ob ein Antidiskriminierungsgesetz nicht die Notwendigkeit eines Gleichstellungsgesetzes aufheben würde, lässt sich bereits durch das Wort der Antidiskriminierung beantworten. Mag. Dieter Schindlauer, Jurist und Mitarbeiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, bringt es auf den Punkt: "Nicht diskriminiert zu sein heißt ja noch nicht, die Gleichstellung zu haben, heißt ja noch nicht, wirklich umfassende Gleichstellung bekommen zu haben, sondern es ist ein erster Sockel, auf dem man aufbauen kann." Ein Antidiskriminierungsgesetz, wie der Entwurf von Mag. Schindlauer, kann daher nur anfänglich helfen. In weiterer Folge wäre ein Gesetz, spezifisch auf die Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichtet, nötig. Der Gesetzesentwurf von Mag. Dieter Schindlauer findet sich online unter: www.livetogether.at/gleichstellungs_site/gleichstellung_pages/gleichstellung3-04.htm
In Deutschland ist seit dem 15. November 1994 im Grundgesetz (=deutsche Verfassung) eine Anti-Diskriminierungsbestimmung in Kraft. In Artikel 3 Absatz 3 heißt es: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Seit 1. Mai 2002 ist in Deutschland das Bundesgleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen in Kraft. Kernstück ist die Herstellung einer umfassend verstandenen -> Barrierefreiheit (S. 98 im Buch). Gemeint ist nicht nur die Beseitigung räumlicher Barrieren, sondern zum Beispiel auch die -> Accessibility (S. 97 im Buch) und Kommunikation blinder und sehbehinderter Menschen in den elektronischen Medien und ihre Teilnahme an Wahlen. Zur Erreichung dieses Ziels wurden verschiedene Bundesgesetze im Bereich Bahn-, Luft- und Nahverkehr sowie u.a. das Gaststätten- und Hochschulrahmengesetz geändert. Die Deutsche -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch) wird als eigenständige Sprache anerkannt. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) kann nach Ansicht der Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe aber nur der Anfang eines Prozesses sein, der auf Landes- und kommunaler Ebene und durch ein zivilrechtliches Gleichstellungsgesetz fortgesetzt werden muss. Für die Belange behinderter Menschen und für die Reformen der Behindertengesetzgebung und -politik wurde 1998 von der deutschen Bundesregierung ein Behindertenbeauftragter eingesetzt. Infos und BGG im Wortlaut: www.behindertenbeauftragter.de
Seit 18. April 1999 hat die Schweiz eine neue Bundesverfassung, welche im Artikel 8 ein Benachteiligungsverbot von behinderten Menschen beinhaltet. Weiters wurde am 14. Juni 1999 die Eidgenössische Volksinitiative "Gleiche Rechte für Behinderte" eingereicht, um die Chancen auf ein Gleichstellungsgesetz zu erhöhen. Seitdem arbeitet der Verein Volksinitiative, der aus rund 40 zusammengeschlossenen Behindertenorganisationen besteht, zusammen mit der Dachorganisationen-Konferenz der privaten Behindertenhilfe (DOK) daran, die Idee der Gleichstellung Behinderter voranzutreiben. Eine Gleichstellungsbeauftragte ist für die Umsetzung des Verfassungsauftrages verantwortlich.
Die Behindertenorganisationen der USA erreichten schon vor Jahrzehnten das, wovon Österreichs Menschen mit Behinderungen noch träumen:
Rehabilitation Act of 1973:
Das Gesetz besagt in seinem zentralen Paragraphen, dass niemand aufgrund seiner Behinderung von der gleichberechtigten Teilhabe an einer Aktivität, die von der Bundesregierung finanziell unterstützt wird, ausgeschlossen oder dabei benachteiligt werden darf. Diese Maßnahme hatte zur Folge, dass die Möglichkeiten für ein gleichberechtigtes Studium von behinderten Studierenden an Universitäten enorm verbessert wurden und zum Beispiel Materialien so aufbereitet werden müssen, dass sie für sehbehinderte und blinde Menschen zugänglich sind.
Education for all Handicapped Childrens Act of 1975:
Das Gesetz ermöglicht die Ausbildung für jedes behinderte Kind in einer integrativen Umgebung, die jeweils am Besten passt.
Air Carrier Access Act of 1986:
Mit diesem Gesetz wurde gesichert, dass Luftverkehrsgesellschaften behinderten Menschen nicht das Recht absprechen können, ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
The Americans with Disabilities Act - ADA of 1990:
Vertreter/innen der -> Independent Living-Bewegung (S. 39 im Buch) war bewusst, dass die Regelungen des bestehenden Rehabilitationsgesetzes völlig unzureichend sind, da es nur Bereiche berührte, die von der Bundesregierung finanziell unterstützt wurden. Nicht geahndet werden konnten die - nach wie vor weit verbreiteten - Diskriminierungen im privaten Bereich. Diese unbefriedigende Situation führte dazu, dass sich eine Vielzahl von Aktivist/innen ab Mitte der 1980-er Jahre für eine Ausweitung und Verbesserung der Anti-Diskriminierungsgesetzgebung einsetzten, was auch erfolgte. Das neue Gesetz umfasst die meisten gesellschaftlichen Aspekte, in denen behinderte Menschen diskriminiert werden und gliedert sich in vier Hauptbereiche:
-
der Einstellung und Beschäftigung
-
der Inanspruchnahme von öffentlichen und staatlichen Einrichtungen und Dienstleistungen
-
der Benützung des öffentlichen Personenverkehrs
-
der Inanspruchnahme von telekommunikativen Einrichtungen und Dienstleistungen
Wichtigste Anmerkung dabei ist, dass die Einklagbarkeit der Gesetzesbestimmungen an die bereits existierenden Bürgerrechtsbestimmungen angepasst wurden. Im Falle von Diskriminierungen, die von Privatpersonen angezeigt werden, können die Kläger/innen eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse bewirken. In Fragen der Beschäftigung kann beispielsweise die Rückerstattung des Verdienstausfalles geltend gemacht werden oder die Einstellung erwirkt werden. ADA Website des U.S. Department of Justice: www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
Im Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (BGBl. Nr. 50/1991, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 137/2001) heißt es: "Wer Personen allein aufgrund einer Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1090 € zu bestrafen."
Inhaltsverzeichnis
- Audiodeskription
- Basale Kommunikation
- Bliss
- Braille-System
- Braillezeichen
- Blindenkurzschrift
- Dialog im Dunkeln
- Easy to Read
- Elektronische Kommunikationsmittel
- Facilitated Communication (FC)
- Fingeralphabet
- Gebärdensprache
- Gebärdensprachdolmetscher/innen
- Gestützte Kommunikation Vgl.
- GUK
- Hörbuch
- Hörfilm
- Kunst
- LÖB
- Lormen
- Medien
- MUDRA
- Picture Exchange Communication System - PECS
- Symbol
- Unterstützte Kommunikation
- Untertitelungen
Verständigung macht Sinn
Kommunikation wird heute vielfach mit neuen Technologien, neuen Medien und anderen eher technischen Begriffen assoziiert.
Doch was bedeutet Kommunikation eigentlich? In diesem Kapitel möchten wir uns bewusst der Kommunikation als Weg der Verständigung und des Austausches widmen. Das geschieht oft nicht nur durch Sprache allein. Auch Sprache ist ja nur ein Hilfsmittel, um sich anderen Menschen verständlich zu machen, um sich Ausdruck verleihen und erfahrbar machen zu können. Doch wie schon Elias Canetti sagte: "Es gibt keine größere Illusion als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen." Oft sind es nonverbale Kommunikationsmittel, die uns mit anderen Menschen zum Beispiel durch Blickkontakt oder Körpersprache in Beziehung treten lassen.
Hiermit wird klar, dass wir - wollen wir uns wirklich verständlich machen - auf Mittel angewiesen sind, die unsere sprachliche Kommunikation unterstützen. Unserer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt und vor allem die Kunst vermag es, Grenzen zu überwinden und Inhalte erfahrbar zu machen, die uns sonst schwer zugänglich sind. Auch das Konzept der unterstützten Kommunikation arbeitet mit der Vielfalt aller möglichen Kommunikationsformen.
Jede mögliche Kommunikationsform stößt aber auch auf ihre Grenzen, wenn beispielsweise Gespräche durch das plötzliche Loshämmern eines Presslufthammers unterbrochen werden, oder durch einen Lichtausfall der Blickkontakt zu unserem Gegenüber verhindert wird. Und: Sie stößt vor allem auch an die Grenzen der Erfahrungswelten der unterschiedlichen Menschen. Auf Möglichkeiten, diese Grenzen der Kommunikation zu überwinden, möchte dieses Kapitel hinweisen. Wir möchten neugierig machen darauf, wie unterschiedlich und vielfältig Kommunikation stattfinden kann, wie spannend es ist, sich auf die Sprache und damit Erfahrungswelten des/der Anderen einzulassen. Natürlich können wir den technischen Aspekt in diesem Kapitel nicht völlig ignorieren, da ja vor allem auch die Medien bei der Vermittlung (also Kommunikation) unterschiedlichster Inhalte eine große Rolle spielen. Karin Martiny
ist die Bezeichnung des Verfahrens, aus einem Film einen Hörfilm zu machen. In knappen Worten werden zentrale Elemente der Handlung, sowie Gestik, Mimik und Dekors beschrieben. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Somit wird blinden und sehbehinderten Menschen ein direkter Zugang zur Bilderwelt des Films eröffnet. Getextet werden die Bildbeschreibungen von ausgebildeten Filmbeschreiber/innen gemeinsam mit einem/r blinden oder sehbehinderten Mitarbeiter/in, da es für Sehende meist nicht nachvollziehbar ist, welche Information für blinde oder sehbehinderte Menschen entnommen wird. Nach der Aufnahme der Audiodeskription im Tonstudio wird sie mit der Originaltonspur abgemischt und auf die zweite Spur des Sendebandes kopiert. Daher werden Hörfilme im Zweikanal-Ton ausgestrahlt. Für den Empfang sind ein Stereo-Fernseher, Stereo-Videorekorder oder bei Satellitenempfang ein Stereo-Satellitenreceiver notwendig, um auf Spur 2 die Mischung aus Filmton und Audiodeskription zu empfangen. Aufführungen von Hörfilmen im Kino sind nach wie vor eine Seltenheit. Erstmals wurden 1999 bei den Berliner Filmfestspielen Hörfilme präsentiert und somit einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Die Audiodeskription wird während der Vorführung life eingesprochen und mittels Kopfhörer von den blinden "Zuschauer/innen" empfangen. Mit der Digitalisierung der Vorführtechniken wird die Voraussetzung für die Aufführung vorproduzierter Audiodeskriptionen geschaffen. Die Deutsche Hörfilm GmbH informiert über die Ausbildung im Bereich Filmbeschreibung/Audiodeskription, Hörfilmversand, Hörprobe: www.hoerfilm.de
Auch der Bayrische Rundfunk bietet umfassende Informationen und einen Überblick mit aktuellen Hörfilm-Sendeterminen: www.br-online.de
Bei dieser von Winfried Mall entwickelten Methode der -> Unterstützten Kommunikation (S. 91 im Buch) erfolgt die Kontaktaufnahme über den Körper. Atem, Lautäußerungen, Berührungen, Bewegungen werden aufgegriffen, widergespiegelt oder variiert.
Die Bliss-Symbole wurden 1942-1965 von Charles K. Bliss entwickelt. Er wollte damit ein logisch aufgebautes grafisches System schaffen, das von Menschen unterschiedlicher Sprache verstanden werden kann. Als Inspiration für diese Entwicklung diente ihm die chinesische Bilderschrift. In den 1970-er Jahren wurde das Bliss-System am Ontario Crippled Children Centre in Toronto, Kanada, als ein Medium zur nonverbalen Kommunikation erprobt. Heute wird es in über 30 Ländern der Welt angewendet. Es besteht aus etwa 2.500 genormten Symbolen, die meist einen unmittelbaren Bezug zum realen Begriff, den sie darstellen, haben. (Beispielsweise symbolisiert eine Wellenlinie Wasser.) Zusatzzeichen für Verb-, Substantiv- oder Adjektivindikatoren ermöglichen logische Verknüpfungen innerhalb des Bliss-Systems.
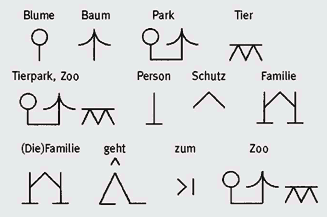
Bliss-Systems
Menschen, denen aufgrund ihrer Sehbehinderung das Lesen von "normalem" Schwarzdruck nicht möglich ist, verwenden das Braille-System. Das Braille-Alphabet wurde im frühen 19. Jahrhundert von dem Franzosen Louis Braille entwickelt. Louis Braille wurde 1809 in der Nähe von Paris geboren und erblindete im Alter von 3 Jahren aufgrund einer Infektion. Er besuchte das 1784 gegründete Pariser Blindeninstitut, wo es zwar bereits einige Bücher in erhabener Schrift gab, der größte Teil des Unterrichts wurde aber mündlich gehalten. Zu dieser Zeit entwickelte der französische Hauptmann Barbier gerade ein System zur schriftlichen Kommunikation (für militärische Zwecke) für die Nacht, das aus 11 abtastbaren Punkten in festgelegter Ordnung bestand. Davon inspiriert erfand Louis Braille im Alter von 16 Jahren sein 6-Punkt System, das er - trotz vorläufiger Ablehnung - stetig weiterentwickelte. Sein ganzes Leben lang kämpfte er für den Einsatz seiner Schrift, doch erst im Jahre 1850 wurde sie von der Pädagogischen Akademie Frankreichs anerkannt. Seit Braille's Zeit blieb das Alphabet im wesentlichen unverändert. Es wurde nur für einige Sprachen adaptiert.
wird auch "Zelle" genannt. Jedes Braillezeichen besteht aus bis zu 6 Punkten, die in 2 Spalten und 3 Reihen angeordnet sind. Ein Punkt kann auf jeder der 6 Positionen vorhanden sein oder in irgendeiner Kombination. So gibt es 63 Kombinationen plus dem Leerzeichen. Im Allgemeinen werden diese Kombinationen einfach durch ihre erhabenen Punkte bezeichnet. Dabei haben die Punkte auf der linken Seite die Nummern 1-2-3 von oben nach unten und auf der rechten Seite die Nummern 4-5-6. Weiters werden bestimmte Zeichen als Ankündigungszeichen verwendet, um den darauffolgenden Zeichen eine bestimmte Bedeutung zu geben. So wird z.B. der Punkt 6 dazu benutzt, um zu zeigen, dass das darauffolgende Zeichen ein Großbuchstabe ist. Zahlen werden dargestellt, indem man die ersten 10 Buchstaben des Alphabets nutzt.
Diesen Buchstaben wird ein Zahlenzeichen (Punkte 3-4-5-6) voranstellt.
Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband: www.oebsv.at
Unterlagen können in eigenen Druckereien gedruckt oder über diese bezogen werden: Blindendruckverlag am Bundes-Blindenerziehungsinstitut: www.bbi.at/deutsch/verlag.htm
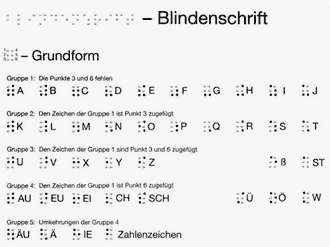
Blindenschrift
In "normaler" Schwarzschrift passen rund 3.500 Zeichen auf eine A4-Seite, in Brailleschrift sind es nur etwa 1.000 Zeichen. Ein Buch in Schwarzschrift umfasst daher in Braille-Version gleich mehrere Bände. Da es sehr zeit- und platzaufwändig wäre, jeden einzelnen Buchstaben als Braillezeichen wiederzugeben, wurden Kürzel für Vor- und Nachsilben, für bestimmte Lautgruppen und sogar für ganze Wörter oder Wortstämme eingeführt. Leider ist bei solchen Kürzeln die internationale Verständigung unmöglich, da in jeder Sprache unterschiedliche Worte und Silben existieren. Ein deutscher Blinder kann somit einen englischen Blindenkurzschrifttext nicht lesen, obwohl er Englisch sprechen kann. Bei der Blindenkurzschrift handelt es sich jedoch nicht um Stenographie. Dafür gibt es eine spezielle Form. Für die -> Braillezeile (S. 100 im Buch) am Computer, der 256 Zeichen unterscheiden muss, wurde eine weitere spezielle Form mit 8 statt 6 Punkten entwickelt. Auch für die Musiknoten, für mathematische Formeln oder für Schach gibt es jeweils ein spezielles Braille-System. www.behinderung.org/dbalphan.htm
nennt sich eine Erlebnisausstellung, bei der sehbehinderte und blinde Personen sehende Besucher durch einen vollkommen abgedunkelten Raum führen. Sie öffnen den Besucher/innen eine Welt, die nicht ärmer ist an Eindrücken, nur anders. Alltagssituationen wie ein Spaziergang durch einen Park oder einer vielbefahrenen Straße werden in absoluter Dunkelheit auf völlig neue Weise erlebbar. Beim Dialog im Dunkeln wird Vertrautes fremd und Selbstverständliches in Frage gestellt. www.dialog-im-dunkeln.de
In letzter Zeit entstanden Selbstvertretungsbewegungen von Erwachsenen, die als -> geistig behindert (S. 25 im Buch) bezeichnet werden, wie zum Beispiel die People First-Bewegung. Sie lehnen den bisher gebräuchlichen Begriff -> geistige Behinderung (S. 119 im Buch) als diskriminierend ab. Vielmehr bezeichnen sie sich selbst als -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch), um so auszudrücken, dass sie zwar mitunter eben Schwierigkeiten beim Lernen haben, aber doch lernen können und vor allem wollen. Dazu müssen aber Informationen so gestaltet sein, dass sie von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen verstanden und somit auch benutzt werden können. Easy to Read ist die Bezeichnung dafür, vor allem schriftliche Informationen so aufzubereiten und zu übersetzen, dass sie für alle Menschen leicht verständlich sind. Es gilt vorhandene oder neue Texte einfach - ohne Fremdwörter oder lange verschachtelte Sätze - zu schreiben bzw. zu übersetzen und sie gegebenenfalls auch mit Grafiken zu veranschaulichen. Auch im Internet müssen Informationen einfach zugänglich gemacht werden. Angesichts der fehlenden Benutzerfreundlichkeit (-> Usability S. 111 im Buch) vieler Websites können auch nichtbehinderte User/innen davon profitieren. Eine Anlaufstelle in Österreich für Easy to Read-Übersetzungen ist der Verein A'tempo in Graz (Tel.: +43/ (0)316/814716). Bücher in leichter Sprache können über die Seite von www.peoplefirst.de bezogen werden. Unter anderem auch das "Wörterbuch für leichte Sprache", das schwierige Wörter erklärt und zeigt, wie man Texte einfach schreiben kann.
sind Mittel der -> unterstützten Kommunikation (S. 91 im Buch). Sie ermöglichen es nichtsprechenden Menschen, sich auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mitzuteilen. Aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts werden diese Mittel immer häufiger verwendet. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte: So ist beispielsweise "Aladin" ein Symbolsystem, das als Software direkt am PC installiert werden kann. Die etwa 1.400 Bilder und Symbole sind thematisch sortiert und Farbe und Größe lassen sich einfach verändern und können auch mit einem Geräusch hinterlegt werden. Auch "Minspeak" wurde speziell für elektronische Kommunikationshilfen entwickelt, um sowohl das Abspeichern als auch den Einsatz von Wörtern und Sätzen zu erleichtern. Die "PCS - Picture Communication Symbols" wurden in den 1980-er Jahren von Roxie Johnson entwickelt, die mit ihrem Mann die Firma Mayer Johnson gründete, die bis heute dieses Symbolsystem in Form unterschiedlicher Software vertreibt. Als "Talker" wird ein tragbarer "Minicomputer" mit Sprachausgabe bezeichnet. Quellen und Infos: www.kometh.net, www.lifetool.at und www.integranet.at
Manche Menschen haben nicht nur mit der Lautsprache, sondern auch mit den Methoden der -> unterstützten Kommunikation (S. 91 im Buch) Schwierigkeiten. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise Freude nicht durch den entsprechenden Gesichtsausdruck artikuliert werden kann oder die Ausführung willensgesteuerter Handlungen so blockiert ist, dass es nicht gelingt, in einem bestimmten Augenblick eine bestimmte Bewegung (z.B. die Zeigebewegung auf ein Bild/Symbol/einen Buchstaben hin) alleine auszuführen. Dabei kann FC (= "Gestützte Kommunikation"; nicht gleichzusetzen mit dem Oberbegriff "Unterstützte Kommunikation") eine wertvolle Hilfe sein. Bei der gestützten Kommunikation (FC) stützt ein geübter Helfer den "FC-Schreiber" an Hand, Handgelenk, Ellenbogen oder später auch nur an der Schulter und ermöglicht es ihm dadurch, seine Bewegungen besser zu kontrollieren und im gewünschten Augenblick auf das Gewünschte (meist eine Buchstabentafel oder Computertastatur) zu deuten. Der Stützer oder die Stützerin darf dabei niemals führen, sondern nur dem Impuls des/der Schreibenden nachgeben. Ziel der Methode ist es, die Hilfe allmählich auszublenden, so dass der/die Schreibende sich schließlich eigenständig über ein Schreibgerät mitteilen kann. Quellen: www.isaac-online.de, www.kometh.net Infos unter: www.fc-netz.de
Einzelne Buchstaben werden mit speziellen Handformen dargestellt, diese Methode findet vor allem bei der Buchstabierung von Eigennamen und Ähnlichem Verwendung. Im Gegensatz zur -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch) ist das Fingeralphabet international.

Fingeralphabet
Aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände und Sprache haben gehörlose Menschen eine eigene Kultur entwickelt, es wird daher von einer "Gehörlosenkultur" gesprochen. Heute werden Gehörlosengemeinschaften eines Landes auch mit einer Minderheitengruppe verglichen, die im Laufe von Generationen ihre eigene Sprache und Kultur entwickelt hat. Gebärdensprachen bilden die Grundlage der Gehörlosenkultur und der Gehörlosengemeinschaft. Sie entstanden, da gehörlose Menschen, denen eine Lautsprache akustisch nicht zugänglich war, optische Kommunikationssysteme entwickelten. Gebärdensprachen sind eigenständige, vollwertige Sprachsysteme, die gehörlose Menschen in ihren verschiedenen nationalen und regionalen Gehörlosengemeinschaften untereinander ausgebildet haben. Sie sind nicht mit den nonverbalen Kommunikationsmitteln Hörender identisch (Körpersprache), sondern ausdifferenzierte Zeichensysteme, die über ein umfassendes Lexikon und eine komplexe Grammatik verfügen. Zwischen den verschiedenen nationalen Gebärdensprachen bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Form und Verwendung von Gebärden. Angesichts der nonverbalen Basis aller Gebärdensprachen finden sich andererseits gewisse grundsätzliche Ähnlichkeiten. Im Mittelpunkt der gebärdensprachlichen Verständigung stehen die Gebärden, aber auch Mimik, Körperausdruck und tonlos gesprochene Wörter sind von großer Bedeutung. Gebärden werden zu Folgen und Sätzen verknüpft, die eine ganz andere Reihenfolge und einen ganz anderen Aufbau haben als bedeutungsgleiche Sätze der Lautsprache. Satzarten (Aussagesätze, Fragen, Befehlssätze) werden mimisch markiert. Beziehungen zwischen Satzteilen (Subjekt, Objekt) werden durch die Ausführungsrichtung der Verbgebärde gekennzeichnet. Personen und Objekte werden im Gebärdenraum platziert und stehen für weitere Bezugnahmen zur Verfügung. Räumliche Verhältnisse werden durch eine analog räumliche Darstellung der Hände wiedergegeben. Anders als in Österreich ist in Deutschland die deutsche Gebärdensprache bereits als eigenständige Sprache anerkannt. Vgl. -> Gleichstellungsgesetz in Deutschland (S. 68 im Buch) Quellen und Infos: www-gewi.kfunigraz.ac.at/uedo/signhome/startgebaerd.html
www.deaf.uni-klu.ac.at/deaf/bildung_und_schule/pflichtschulen/ gl_behinderung.shtml
www.paritaet.org/bvkm/isaac/ www.gehoerlos.at
Österreichischer Gehörlosenbund: www.oeglb.at
Interessante Infos zur Verschriftung der Gebärdensprache bietet etwa die Website: www.gebaerdenschrift.de
Mit Hilfe eines Bewegungsbeschreibungssystems, das für die Amerikanische Gebärdesprache (ASL) "Sign Writing" genannt wird, lassen sich schriftliche Aufzeichnungen der Gebärdenäußerungen in erstaunlicher Präzision anfertigen. Der Terminus im deutschsprachigen Raum lautet GebärdenSchrift. Die Entwicklung einer Gebärden-Schrift soll es gehörlosen Menschen ermöglichen, in ihrer Sprache - der Gebärdensprache - Texte zu verfassen, Notizen zu machen, Gedichte oder Geschichten zu schreiben.
In verschiedenen Lebenssituationen hat es sich bewährt, für die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen Gebärdensprachdolmetscher/innen hinzuzuziehen, um eine flüssige Kommunikation bzw. gehörlosen Menschen die uneingeschränkte Teilhabe bei Vorträgen usw. zu ermöglichen. Die Themenkreise Gebärdensprache und Gehörlosenkultur sind auch ein zentraler Schwerpunkt der Lehre und Forschung des Forschungszentrums für Gebärdensprache und Hörgeschädigtenkommunikation an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Klagenfurt und des Instituts für theoretische und angewandte Translationswissenschaft an der Universität Graz, wo ab dem Wintersemester 2002/2003 ein Vollstudium für Gebärdendolmetschen angeboten wird. Über den Verband der Österreichischen Gebärdensprach-Dolmetscher/innen kann man eine Liste ausgebildeter Gebärdensprachdolmetscher/innen beziehen: (Tel/Fax: +43-1/802 52 82) Auch WITAF vermittelt Dolmetschdienste: www.witaf.at
Eine Verständigungsmöglichkeit für taubblinde Menschen ist das -> Lormen (S. 88 im Buch), das sind taktile Gebärden, wobei die/der "Hörer/in" die gebärdende Hand des/der "Sprechers/in" abfühlt.
Diese Methode der -> Unterstützten Kommunikation (S. 91 im Buch) wurde von Prof. Dr. Etta Wilken zur Unterstützung beim Spracherwerb hörender Kinder entwickelt und besonders in der Arbeit mit Menschen mit -> Down-Syndrom (S. 24 im Buch) eingesetzt. Anders als bei der -> Gebärdensprache (S. 82 im Buch) werden nur diejenigen Wörter gebärdet, die von Bedeutung sind. Quelle: www.kometh.net
Ob wissenschaftliche Werke, Lyrik oder Prosa - durch das Lesen von Literatur erschließen sich uns neue Welten, Bücher erweitern unseren Horizont. Eine Erscheinungsform des Buches, nämlich das Hörbuch, ermöglicht auch blinden und sehbehinderten Menschen den Zugang zu diesem Medium, wobei die Hörbücher auch bei sehenden Literaturfreund/innen zunehmend Anklang finden. Die meisten Buchhandlungen verfügen über eine eigene Hörbuchabteilung. Einen guten Überblick über Hörbücher und aktuelle Neuerscheinungen bietet unter anderem die Internetseite des Vereins Blickkontakt unter: www.service4u.at/blickkontakt/hoerbuch.html
kennt keine Grenzen, heißt es. Und wirklich: In ihrer Grenzenlosigkeit erlaubt die Kunst das Durchbrechen von Normen und die Verrückung von Sichtweisen. Die Grenzen zwischen Kunst und Behinderung sind fließend, weil beide Normen in Frage stellen. Oft ist es die Kunst, die durch einen anderen Zugang Dinge vermitteln kann, die uns auf einer rein rationalen, vernünftigen Ebene verschlossen bleiben. Andererseits dient sie auch oft Menschen als Transportkanal ihrer Ausdrucksmöglichkeit und ist daher ein wichtiges Kommunikationsmittel. Dennoch stößt die Kunst auch an Grenzen. Nicht jeder hat einen persönlichen Zugang zu ihren unterschiedlichen Spielarten. Und manchen Menschen bleibt der Zugang zu bestimmten Formen der Kunst von vorne herein verwehrt: Wenn Bilder nicht gesehen, Theaterstücke nicht gehört werden können, oder man vor manchen Kulturstätten ob mangelnder Zugänglichkeit wieder umkehren muss. Und auch die Künstler/innen stoßen an Grenzen. Sie zerbrechen oft - wie auch Menschen mit Behinderungen - an der Gesellschaft, weil sie mit deren Wertvorstellungen nicht zu Recht kommen. Der Maler Vincent Van Gogh und der Dichter Friedrich Hölderlin sind nur zwei bekannte Beispiele. Einst wie heute sind Künstler/innen, die als solche anerkannt werden wollen, mit Vorurteilen konfrontiert. Sie werden nicht selten als Sozialschmarotzer oder liebenswerte Spinner abgeurteilt. Gerade die Kunst behinderter Menschen wird nicht mit gebührendem Respekt anerkannt. Die Werke behinderter Künstler/innen sind zahlreicher in sozialen Einrichtungen anzutreffen als in Galerien, Theatern oder anderen Orten, in denen künstlerische Werke herkömmlicherweise ihre Heimat finden. Künstler/innen, die nicht trotz oder wegen ihrer Behinderung, sondern wegen ihrer Werke anerkannt sind, gibt es - doch lange noch nicht selbstverständlich. Ausgrenzung passiert auch durch Verharmlosung, durch ein Nichternstnehmen und die Scheu vor Auseinandersetzung, die aus Ängsten und Unwissenheit resultieren, welche nur durch das Ausschöpfen von Kommunikation in all ihren Möglichkeiten abgebaut werden können. Eine Anlaufstelle, die Informationen zum Thema Behinderung und Kunst bietet, sucht man in Österreich noch vergeblich.
nennt sich eine Bildersammlung, die in den 1980-er Jahren von Reinhold Löb zur Erleichterung bei der Erlernung von Sprache entwickelt wurde. Das LÖB-System umfasst 60 Bildkarten im DIN A6 Format, die in unterschiedliche Themenbereiche aufgeteilt sind. Auf den Karten befinden sich aber auch die in Schriftsprache ausgeschriebene Bedeutung, parallel dazu sollen konkrete Objekte, Sprache, Gesten und Gebärden verwendet werden. Quelle: www.kometh.net
Diese Fingersprache zur Kommunikation mit Menschen, die gleichzeitig gehörlos und blind sind, wurde von Hieronymus Lorm entwickelt. Hieronymus Lorm wurde 1821 in Nikolsburg / Mähren geboren. Mit 16 Jahren ertaubte er und musste sein Musikstudium aufgeben. Als Schriftsteller übersiedelte er nach Berlin und später nach Dresden. 1881 erblindete er. Um sich mit seinen Mitmenschen verständigen zu können, stellte er sein "Tastalphabet" zusammen. Lorm hat als Erster im deutschen Sprachraum mit seinem Hand-Zeichen-System jenen Menschen, die sowohl gehörlos als auch blind sind, den Weg zur Verständigung mit ihren Mitmenschen eröffnet. Dabei wird ein Tastalphabet verwendet, bei dem durch Betupfen und Bestreichen der Handinnenfläche die Buchstaben symbolisiert werden. Quelle: www.111er.de/lexikon/begriffe/lormen.htm
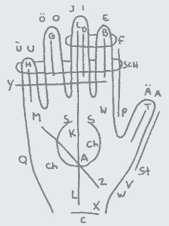
Buchstaben auf der Handinnenfläche
Tastalphabet für Taubblinde
A - Punkt auf die Daumenspitze
B - Kurzer Abstrich auf die Mitte des Zeigefingers
C - Punkt auf das Handgelenk
D - Kurzer Abstrich auf die Mitte des Mittelfingers
E - Punkt auf die Zeigefingerspitze
F - Zusammendrücken der Zeige- und Mittelfingerspitzen
G - Kurzer Abstrich auf die Mitte des Ringfingers
H - Kurzer Abstrich auf die Mitte des Kleinfingers
I - Punkt auf die Mittelfingerspitze
J - Zwei Punkte auf die Mittelfingerspitze
K - Punkt mit vier Fingerspitzen auf dem Handteller
L - Langer Abstrich von den Fingerspitzen zum Handgelenk
M - Punkt auf die Kleinfingerwurzel
N - Punkt auf die Zeigefingerwurzel
O - Punkt auf die Ringfingerspitze
P - Langer Aufstrich an der Außenseite des Zeigefingers
Q - Langer Aufstrich an der Außenseite der Hand
R - Leichtes Trommeln der Finger auf dem Handteller
S - Kreis auf dem Handteller
T - Kurzer Abstrichauf die Mitte des Daumens
U - Punkt auf die Kleinfingerspitze
V - Punkt auf den Daumenballen, etwas außen
W - Zwei Punkte auf den Daumenballen, dito
X - Querstrich über das Handgelenk
Y - Querstrich über die Mitte der Finger
Z - Schräger Strich vom Daumenballen zur Kleinfingerwurzel
Ä - Zwei Punkte auf die Daumenspitze
Ö - Zwei Punkte auf die Ringfingerspitze
Ü - Zwei Punkte auf die Kleinfingerspitze
ch - Schräges Kreuz auf den Handteller
SCH - Leichtes Umfassen der vier Finger
St - Langer Aufstrich am Daumen (Außenseite)
Wir leben heute in einer Informations- und Unterhaltungsgesellschaft, die durch unterschiedlichste Medien getragen wird. Die Zugänglichkeit zu diesen Informationen, die durch Medien vermittelt werden, sollte daher für alle Menschen gewährleistet sein. Dies gilt gleichermaßen für das Internet (in dem auch Zeitungen und Zeitschriften zugänglich gemacht werden können) als auch für das Fernsehen, Kino, Videos und Printmedien. (Vgl. -> Hörbuch, S. 86 im Buch, -> Accessibility, S. 97 im Buch) Das Fernsehen dominiert in Europa einen großen Teil unserer Freizeit und ist nach wie vor das Informations- und Unterhaltungsmedium par excellence. Es ist für die volle Teilnahme am sozialen, kulturellen und politischen Leben von großer Bedeutung. Die Möglichkeit der Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen durch -> Audiodeskription (S. 76 im Buch) als auch für gehörlose Menschen durch -> Untertitelung (S. 92 im Buch) ist aber leider noch keine Selbstverständlichkeit. Medien tragen aber auch dafür eine hohe Verantwortung, welche Bilder behinderter Menschen vermittelt werden. Dabei stellt sich die Frage, wie maßgeblich behinderte Menschen selbst an der Gestaltung medialer Inhalte und Bilder beteiligt sind. In Österreich gibt es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, allen voran Großbritannien, kaum behinderte Journalist/innen. Maßnahmen, die behinderte Menschen für den Journalismus qualifizieren und ihnen Zugang zu den Medienberufen eröffnen, sind daher gefragt. Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien, Deutschland: www.abm-medien.de/ Freak Radio/ORF Radio 1476: http://1476.orf.at/radiomacher/freak.html
ist das erste umfassende Lexikon der Österreichischen -> Gebärdensprache (ÖGS) (S. 82 im Buch) mit allen Dialekten und bietet die optimale Unterstützung zum Erlernen der Gebärdensprache. KinderMUDRA (KIMU) erleichtert Kindern ab dem Vorschulalter das Erlernen der Österreichischen Gebärdensprache. www.mudra.org
Diese Methode der -> Unterstützten Kommunikation (S. 91 im Buch) wurde in den 1980-er Jahren von Lori Frost ursprünglich zur Kommunikation mit autistischen Kindern entwickelt. Es geht hauptsächlich darum, Kommunikation in einem sozialen Kontext zu verstehen und anzuwenden. Der/die PECS-Anwender/in gibt eine von ihm/ihr ausgewählte Symbolkarte seinem/r Kommunikationspartner/in und erhält von diesem/r den gewünschten Gegenstand oder die "Dienstleistung". Dabei ist die Lautsprache zwar nicht vorgesehen, aber es soll dennoch dazu angeregt werden, die Symbole verbal in einfachen Sätzen umzuformen. Quelle: www.kometh.net
In den letzten Jahren ist das Computerprogramm "Symbol" entstanden: "Symbol" ist ein Kommunikationsprogramm für Menschen mit starken Körperbehinderungen, das -> Bliss Symbole(S. 77 im Buch) verwendet. -> Elektronische Kommunikationsmittel (S. 81 im Buch)
Viele Menschen können aufgrund einer angeborenen oder erworbenen Behinderung gar nicht oder nicht ausreichend sprechen oder können gesprochene Sprache nur schwer verstehen. Damit reduzieren sich auch die Möglichkeiten, Umwelt, Beziehungen und viele andere persönliche Lebensbereiche selbstbestimmt zu gestalten. Um mit der Umwelt in Beziehung treten zu können, ist Kommunikation unerlässlich. Das ist nicht nur durch Sprache alleine zu bewerkstelligen. Das Konzept der Unterstützten Kommunikation setzt unterschiedliche Kommunikationsformen ein, die gesprochene Sprache unterstützen, ergänzen oder ersetzen, um Verständigung und somit soziale Integration zu ermöglichen. Viele der Methoden fließen ganz automatisch auch in die alltägliche Kommunikation "normal sprechender" Menschen ein. Die unterstützte Kommunikation setzt sie bewusster und systematischer ein. Beispiele für Methoden der unterstützten Kommunikation sind die -> Basale Kommunikation (S. 76 im Buch), -> Facilitated Communication - FC (S. 82 im Buch), -> Picture Exchange Communication System - PECS (S. 90 im Buch) oder -> GUK (S. 85 im Buch), aber auch Symbolsysteme wie -> Bliss (S. 77 im Buch) oder -> LÖB (S. 87 im Buch). Nicht zuletzt sind es auch oft -> Elektronische Kommunikationsmittel (S. 81 im Buch), die zur Unterstützung herangezogen werden. Eine Fülle von Informationen zu diesem Thema findet sich bei ISAAC-Gesellschaft für unterstützte Kommunikation e.V. (Deutschsprachige Sektion der "International Society for Argumentative and Alternative Communication"): www.isaac-online.de
Weitere Infos online unter:
Wege zur Verständigung - eine Ausstellung mit Fotos und Texten zur Unterstützten Kommunikation: www.paritaet.org/bvkm/isaac/Seiten/bilderaus/bilderaus.html
geben einen gesprochenen Text, aber auch Geräusche wieder, sodass gehörlosen Menschen jener Teil, der nur akustisch erfassbar ist, zugänglich gemacht wird. Die meisten Sender bieten Untertitelung - wenn auch sehr spärlich - an. Eine Studie von Professor Dr. Siegmund Prillwitz im Auftrag der unabhängigen Landesanstalt für Rundfunkwesen in Kiel zum Fernsehangebot für gehörlose Menschen hat ergeben, dass die 17 Sender im deutschsprachigen Fernsehen nur 2% der Sendungen untertiteln (Vgl. PRILLWITZ, Hamburg, 2001) Der ORF kennzeichnet seit Juni 2001 Sendungen mittels einer Insert-Einblendung am Sendungsbeginn mit dem international üblichen Symbol der Untertitelung. ORF: Aktuelle Informationen für gehörlose Menschen ab Teletext Seite 751. Sendungen, die auf Teletextseite 777 untertitelt werden, werden im Internet auf http://programm.orf.at und im Rahmen der elektronischen Programminformation unter http://orfprog.apa.at/ORFProg/ gekennzeichnet. Alles über Untertitel und Gebärdensprache in TV, Video, DVD und RealVideo: www.deaf-tv.de
Die digitale Fernsehzeitschrift www.tvgenial.com bietet einen guten Überblick über Sender, die Untertitelung anbieten und Sendungen mit Untertitelungen sind abrufbar. Projekt OHR (Ohne Hören Reden): OHR bietet als erstes Bürgerfernsehen in Deutschland gehörlosen Menschen die Möglichkeit, selbst ihre Fernsehsendungen zu gestalten und zu senden. www.europahaus-gera.de
Inhaltsverzeichnis
- Accessibility
- akustische Ampeln
- akustische Anzeigen im Lift
- Barrierefreiheit
- behindertengerechtes Bauen
- Behindertenparkplatz
- Berollbarkeit
- Blindenführhund
- Bodenleitstreifen
- Braillezeile
- Cash Test
- Color Test
- Design für Alle
- Drehkreuz
- eAccessibility
- eEurope
- Euro-Schlüssel
- Fahrtendienst
- Gehhilfen
- Haltegriffe
- Handynet
- Induktive Höranlagen
- Kopfmaus
- Leitsystem
- Lift - Lifter
- optische Signale bei Alarmsystemen
- PKW
- Rampen
- Rollator
- Rollstuhl
- rollstuhlgerecht
- rollstuhlgerechte Duschen
- Rollstuhlradius
- Rutschbrett
- Screenreader
- Sitzkissen
- Spezialtastatur
- Sprachausgabe
- Stiegensteiggeräte
- Usability
- Vergrößerungsprogramme
- WAI
- Wohnungsadaptierung
Zugang zur realen und zur virtuellen Welt
Die grenzenlose Gesellschaft, in der Informationen schnell und global fließen, ist das Bild, mit dem wir uns dieser Tage gerne schmücken. Das World Wide Web steht als Symbol für schnelle weltumspannende Kommunikation. Dieses Bild ist brüchig. Denn Menschen, die nicht dem "Durchschnitts-User" neuer Technologien entsprechen, werden oft ausgegrenzt. Für behinderte Menschen eröffnet das Internet neue Möglichkeiten an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. So erlaubt es das Einkaufen im eShop auch blinden Menschen, etwa im Plattenladen zu stöbern oder in den Regalen der Supermärkte zu gustieren - so ferne die Webseiten der Anbieter barrierefrei zugänglich sind. Nichtsehende Menschen haben erstmals Zugang zu aktuellen Informationen in Tageszeitungen und digitalisierten Büchern. Kommunikationsprozesse für gehörlose Menschen und Menschen, die in ihrer Mobilität oder Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind, werden erheblich erleichtert.
Das Internet und die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind keine Allheilmittel und bergen auch Risken in sich. Doch wenn sie so gestaltet sind, dass eine möglichst große Gruppe an Menschen von ihrem Nutzen profitieren kann, eröffnen sich neue Chancen.
Die Beseitigung von Barrieren im Netz ist auch auf die reale Lebenswelt umzulegen. Wer ein Gebäude nicht betreten kann, muss draußen bleiben. Das gilt für Restaurants genau so wie für Banken, Büros und öffentliche Verkehrsmittel. Für eine funktionierende Gesellschaft ist es schließlich kein Ruhmesblatt, wenn der Zug halb leer abfährt, weil Passagiere nicht einsteigen können.
Michaela Braunreiter
Die Zugänglichkeit von Internetseiten wird als Accessibility oder barrierefreies Web bezeichnet. Webseiten sollen von allen User/innen gelesen und bedient werden können. Auf Hürden im Internet stoßen all jene Nutzer/innen, die vom so genannten Standard abweichen. Das sind Menschen, die im Sehen, Hören, in ihrer Bewegungsfreiheit, der Bedienung der Maus oder im intellektuellen Bereich beeinträchtigt sind. Betroffen sind also Menschen mit Behinderungen, aber auch Leute, die beispielsweise via WAP im Internet surfen oder einen Computer im Auto benützen. Schon bei der Gestaltung und Programmierung eines Web-Auftritts sollten diese User-Gruppen berücksichtigt werden. Für nichtsehende und sehbehinderte Menschen wird der Bildschirminhalt in Sprache oder Braille-Schrift wiedergegeben. Damit ist nur reine Text-Information erfassbar. So sind z.B. Beschreibungen von Bildern eine Möglichkeit, diese ersichtlich zu machen. Nur die Umsetzung von Normen, wie den -> WAI-Richt-linien (S. 112 im Buch), kann einen Zugang aller Nutzer/innen zum Internet gewährleisten. Vgl. -> Usability (S. 111 im Buch)
sind zusätzlich zu den Lichtsignalen mit hörbaren Signalen ausgestattet. Blinde und sehbehinderte Menschen richten sich beim Überqueren einer Straße nach der Fließrichtung des Verkehrs, was beim Straßenlärm nicht immer einfach und vor allem bei komplizierten Kreuzungen schwierig ist. In den unterschiedlichen Städten werden verschiedene Systeme verwendet. Meist gibt es ein Signal, das sehbehinderten oder blinden Menschen zum Auffinden der Ampel dient. Nach Knopfdruck wird die Grünphase mit einem anderen Signal (z.B. Ticken mit doppelter Geschwindigkeit) angezeigt. Es gibt auch Ampeln, die automatisch den "Grün-Ton" anzeigen.
Die Stimme eines Sprechers gibt darüber Auskunft, wo sich der Aufzug befindet. Damit können sehbehinderte Lift-Benützer/innen erfahren, ob sie im richtigen Stockwerk gelandet sind.
bedeutet Zugänglichkeit und Benützbarkeit von Gebäuden und Informationen für alle Menschen, egal ob sie im Rollstuhl sitzen, ob es sich um Mütter mit Kleinkindern oder Personen nicht deutscher Muttersprache handelt, ob es blinde, gehörlose, psychisch behinderte oder alte Menschen sind ...
wird heute auch als "barrierefreies Bauen", "Bauen für Alle", "menschengerechtes Bauen" oder -> Design für Alle (S. 101 im Buch) bezeichnet. Voraussetzungen, um Gebäude als rollstuhlgerecht bezeichnen zu können, sind
-
der stufenlose Eingang mit einer Rampe (Neigung maximal 6 bis 10 %) oder einem Lift (Kabinenmindestgröße 110 x 140 cm)
-
Türbreiten von mindestens 80 cm
-
Behinderten-WC
Behindertengerechtes Bauen wird oftmals in Verbindung mit Rollstuhlfahrer/innen gebracht, dies vor allem deshalb, da diese Personengruppe den größten Platzbedarf benötigt. So muss der Radius für einen Rollstuhl in Räumen bzw. zwischen fix montierten Möbelstücken 150 cm betragen. Diesbezügliche ÖNORMEN sind B 1600, B 1601 und B 1602. Doch auch blinde Bürger/innen haben aufgrund ihrer Behinderung spezielle Bedürfnisse an Planer. Sehbehinderte und blinde Personen benötigen im öffentlichen Raum ein Blindenleitsystem, um sich orientieren zu können. Dieses Blindenleitsystem gibt es z.B. in den Wiener U-Bahn-Stationen. Die Ö-Norm zum Thema Blindenleitsysteme ist V 2102. Um Räume und Veranstaltungen hörbehindertengerecht zu machen, ist es notwendig, -> induktive Höranlagen (S. 104 im Buch) zu montieren, wie z.B. im Schikanederkino und im Filmmuseum in Wien. Ein Verzeichnis und Informationen zu den ÖNORMEN für behindertengerechtes Bauen finden sich im HELP-Amtshelfer für Behinderung: www.help.gv.at/HELP-BEH.html
Die ÖNORM B 1600 fordert, dass vor allen öffentlichen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe des barrierefreien Eingangs ein Behindertenparkplatz eingerichtet wird. Vor Wohnhäusern und Arbeitsstätten werden nur auf Antrag von behinderten Autoinhaber/innen Behindertenparkplätze errichtet. Ein amtsärztliches Attest entscheidet, welche Strecke eine behinderte Person bewältigen kann und ob sich daraus das Privileg einen Behindertenparkplatz zu bekommen, ergibt. Behindertenparkplätze müssen mindestens 3,5 m breit sein, da Rollstuhlfahrer/innen die komplette Türbreite benötigen, um ihren Rollstuhl ein- und auszuladen. Schrägparkplätze sind als Behindertenparkplätze nicht geeignet, da es durch diese Anordnung nicht möglich ist, die Tür vollständig zu öffnen. Behinderte Autofahrer/innen dürfen Behindertenparkplätze und Kurzparkzonen nur mit dem § 29b-StVO Ausweis kostenlos und ohne zeitliches Limit benützen. Obwohl die Zahl behinderter Autofahrer/innen groß ist, sind nicht ständig alle Behindertenparkplätze ausgelastet. Dies verleitet oft nichtbehinderte Lenker/innen, diese Parkplätze zu benützen. Dieses "Kavaliersdelikt" ist nach § 89 StVO strafbar und kann auch mit einer Abschleppung enden, doch sieht die Polizei oftmals über dieses Vergehen hinweg. Ärgerlich für behinderte Autofahrer/innen ist ein "besetzter" Behindertenparkplatz nicht nur deshalb, weil er oder sie keinen Parkplatz hat. Es ist aufgrund von Stufen oftmals auch nicht möglich ins nächstgelegene Wachzimmer zu fahren, um eine Anzeige zu machen.
Dieser Ausdruck gibt darüber Auskunft, ob ein Gebäude oder ein öffentlicher Platz mit dem Rollstuhl zu befahren ist. Stufen, hohe Gehsteigkanten und fehlende Rampen versperren Rollstuhlfahrer/innen oft den Weg.
Er ist für blinde und schwer sehbehinderte Menschen ein Hilfsmittel zur besseren Mobilität. Blindenführhunde werden nach strengen Kriterien ausgewählt und ausgebildet. Sie reagieren auf die Kommandos des Hundebesitzers. Er kann den Hund z.B. auffordern, einen Zebrastreifen zu suchen oder zum Beginn einer Treppe zu gehen. Blindenführhunde sind im "Dienst" durch ein Führgeschirr gekennzeichnet.
Tastbare Streifen am Boden erleichtern blinden Menschen sich mit Hilfe des Blindenstockes zu orientieren und erhöhen die Sicherheit. In den Wiener U-Bahn-Stationen werden 7 bis 9 Bodenleitstreifen entlang der Bahnsteige angebracht. An wichtigen Punkten und vor Rolltreppen befinden sich schachbrettartige Markierungen. Bodenleitstreifen helfen auch, Eingänge schneller zu finden.
ist ein technisches Hilfsmittel für den Computer. Sie gibt den Bildschirminhalt mit Hilfe einer Software in Braille wieder. Sie besteht aus 40 oder 80 Zeichen. So kann ein nichtsehender Mensch den Bildschirm in Punktschrift Stück für Stück auslesen. Die Braillezeile wird über eine Schnittstelle an den PC angeschlossen. Sie ist ein flaches Gerät, das meist unter der Tastatur liegt. Auf einer Leiste erheben sich Stifte, die die Buchstaben darstellen. Mittels Cursor Routing kann der/die User/in die Schreibmarke mit einem Tastendruck an die gewünschte Stelle setzen. Die Navigation am Bildschirm erfolgt mit Funktionstasten oder Tastenkombinationen. Nichtsehende Menschen arbeiten meist in einer Kombination aus Braillezeile und -> Sprachausgabe (S. 110 im Buch). Für das Lesen von Tabellen oder das Arbeiten mit Datenbanken ist die Braillezeile unerlässlich. Vgl. -> Braille-System (S. 100 im Buch)
Die Größe von Banknoten ermöglicht es blinden Menschen, diese zu unterscheiden. Der Cash Test ist eine Plastikschablone in Scheckkartenformat, in die man Geldscheine und Münzen einlegen kann, um dann an beschrifteten Markierungen deren Wert abzulesen. Münzen können auch ohne Cash Test recht einfach durch Größe, Form und den Rand der Münze unterschieden werden. Für das Erkennen von Geldscheinen ist der Cash Test ein wichtiges Hilfsmittel.
ist ein sprechendes Farberkennungsgerät für blinde und farbenblinde Menschen. Mit seinem "künstlichen Auge" und dem eingebauten Lautsprecher kann der Color Test ungefähr 550 Farbnuancen erkennen und durch die digitalisierte Sprachausgabe mitteilen. Verwendet wird der Color Test z.B., um selbst überprüfen zu können, ob Kleidung zusammenpasst. So muss man sich nicht die Farbe jedes T-Shirts merken, was nützlich ist, wenn man die Wäsche in die Maschine steckt.
wird auch als "universelles Design" bezeichnet und ist ein Konzept, nach dem Produkte, Systeme und Dienstleistungen für eine möglichst große Benutzergruppe in einer möglichst breiten Umgebung benutzbar sein sollen. Besonderes Augenmerk wird auf die Nutzergruppen der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderungen gelegt. Aktuell findet Design für Alle besonders in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in der Innenraumgestaltung und im öffentlichen Raum Beachtung. Bei der Entwicklung neuer Produkte wird der Konsument miteinbezogen, um seine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Produkte oder Anwendungen, die speziell für bestimmte Nutzergruppen entwickelt wurden, finden fast immer auch beim "Durchschnitts-Konsumenten" Anklang. So kommen etwa Rampen bei Eingängen nicht nur Rollstuhlfahrer/innen zu Gute, sondern auch Eltern mit Kinderwagen. Ähnlich wird die Spracheingabe nicht nur von Menschen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit verwendet, sondern auch beim Autofahren.
Für Rollstuhlfahrer/innen ist es nicht möglich in Warenhäusern Drehkreuze zu durchfahren. Um auch diesem Personenkreis die Kaufhäuser zugänglich zu machen, sollten Push-Cats (automatisch aufschwingbare Flügel) montiert werden.
ist eine Expertenarbeitsgruppe im Rahmen des Aktionsplans eEurope. Erarbeitet werden Maßnahmen und Standards für den barrierefreien Zugang zu öffentlichen Webseiten und neuen Kommunikationstechnologien. Ziel ist es weiters, den Ist-Zustand der EU-Mitgliedsländer sowohl im technischen als auch im rechtlichen Bereich zu erheben, Kriterien für einen behindernden Zugang zu Informationen zu erstellen und Maßnahmen für die Umsetzung der -> WAI-Richtlinien (S. 112 im Buch) bei allen öffentlichen Webseiten als Mindeststandard zu entwickeln. Normen für den Zugang zu Information und die Anwendung technischer Produkte entsprechen dem Motto von -> Design für Alle (S. 101 im Buch).
heißt ein Aktionsplan der EU, der 1999 zur Unterstützung der Mitgliedsländer auf dem Weg ins digitale Zeitalter präsentiert wurde. Ziel ist es, Europa zur führenden Kraft im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie zu machen und alle Europäer/innen von den Vorteilen der Informationsgesellschaft profitieren zu lassen. Im Sinne der europäischen Menschenrechtskonvention hat jede/r Einzelne das individuelle Recht auf Ausbildung, Arbeit und Teilnahme am sozialen Leben und damit an der uneingeschränkten Nutzung von Informationstechnologien. Der Aktionsplan soll Voraussetzungen schaffen, dass auch behinderte Menschen die sozialen und ökonomischen Chancen neuer Technologien nutzen können. Ein Schritt in diese Richtung ist, dass alle öffentlichen Webseiten barrierefrei zugänglich werden. Zur Erarbeitung von rechtlichen und technischen Grundlagen wurde daher die Experten-Arbeitsgruppe -> eAccessibility (S.102 im Buch)
gegründet. Mit der Beschlussfassung von eEurope 2002 haben sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die Webinhalte der öffentlichen Verwaltung nach den -> WAI-Richtlinien (S. 112 im Buch) zu gestalten. Der Statusbericht über die Umsetzung der WAI-Leitlinien stellt fest, dass es ein fixer Bestandteil für den Webauftritt des Bundes geworden ist, die WAI-Konformität zumindest auf Level A zu erreichen. Derzeit gibt es in Österreich aber noch kaum Webseiten des Bundes, die mit W3C-Logo der Prioritätsstufe A ausgezeichnet sind. Das Bundessozialamt ist die erste Bundesbehörde in Österreich, die ihren Webauftritt auf Level AAA umgesetzt hat.
Mit dem Euro-Schlüssel werden im öffentlichen Bereich Behinderten-WC's und Treppenlifte ausgestattet. Damit können Rollstuhlfahrer/innen öffentliche Behinderteneinrichtungen in ganz Europa benützen, zum Beispiel die Rollstuhltoiletten auf den Autobahnen. Gegen eine Gebühr und den Nachweis der Behinderung kann der Euro-Schlüssel bei der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) bestellt werden. www.oear.or.at
ist ein Sammeltaxi, das Rollstuhlfahrer/innen, blinde und nachweislich gehbehinderte Personen um den Preis eines Fahrscheines benützen können. Der Fahrtendienst soll als Ausgleich für die nicht barrierefreien Verkehrsmittel dienen. Mit Kleinbussen, die durch Rampen auch von Rollstuhlfahrer/innen berollbar sind, kann der/die Nutzer/in unabhängig von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Freizeiteinrichtungen, Ausbildungs- und Arbeitsstätten gelangen. Service und Richtlinien sind je nach Bundesland verschieden, es gibt jedoch häufig Beschwerden von behinderten Nutzer/innen über mangelnde Flexibilität (der Fahrtendienst muss ein bis zwei Tage im voraus für eine fixe Uhrzeit bestellt werden) und schlechtes Service (zu spät kommende Busse, Unverlässlichkeit, unnötig lange Wegstrecken aufgrund des Sammeltaxisystems). Daher weichen viele Betroffene auf Alternativen aus, wie z.B. die Benützung eigener PKWs oder öffentlicher Verkehrsmittel mit Hilfe persönlicher Assistenz. Fahrtendienste gibt es vor allem nur in größeren Städten wie Wien, Linz, Graz, etc. Im ländlichen Raum steht meist kein Fahrtendienst zur Verfügung. Diese Versorgungslücke muss oft von der Familie gestopft werden.
Gehbehinderte Personen können ihre Füße eingeschränkt benützen. Manche Menschen brauchen für längere Strecken einen Rollstuhl, kurze Strecken und Stufen können sie aber oft mit Gehhilfen überwinden. Das Angebot an Gehhilfen ist groß, je nach den motorischen Fähigkeiten gibt es verschiedene -> Rollatoren (S. 107 im Buch). Dabei handelt sich um ein stabiles Metallgestell mit zwei bis vier Rädern, an dem man sich mit beiden Händen festhält und vor sich herschiebt. Für Personen mit gutem Gleichgewichtssinn genügen oft Krücken oder Stöcke.
Bei Badewanne und Dusche sowie im WC dienen Haltegriffe Rollstuhlfahrer/innen und gehbehinderten Personen zur leichteren Benützbarkeit.
ist ein Nachschlagewerk des Bundesministeriums für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz für behinderte Personen. Die Online-Version ist kostenlos zugänglich und enthält ca. 8.000 Datensätze über das derzeitige Produktangebot am heimischen Hilfsmittelmarkt. Weiters findet man Informationen über Behindertenorganisationen und über Alten- und Pflegeheime in Österreich. Über 1.600 Händleradressen und die Beschreibung der Arbeitsgebiete von österreichischen Behindertenorganisationen runden die Datenbank ab. www.bmsg.gv.at
In einer lärmerfüllten Umgebung, etwa bei Veranstaltungen, können sich auch gut hörende Menschen kaum verständigen oder einer Darbietung folgen. Für schwerhörige Personen (mit Hörgerät) ist es unter diesen Umständen besonders schwierig oder unmöglich, zu verstehen, was gesagt wird und sich mit den Hörenden zu verständigen. Abhilfe kann die moderne Hörtechnologie schaffen. So genannte induktive Höranlagen sind eine Voraussetzung für -> behindertengerechtes Bauen (S. 98 im Buch). Kernstück dieser technischen Einrichtung ist eine Drahtwindung, eine so genannte Induktionsschleife, die als Ringleitung im Fußboden, in den Wänden und in der Decke verlegt wird. Die Signale (z.B. Vortrag) werden mit einem geeigneten Mikrofon aufgenommen und einem speziellen Verstärker, dem Ringleitungsverstärker (auch Induktiv-Verstärker genannt), zugeführt. Die verstärkten Signale werden nun in die Ringleitung eingespielt. Innerhalb der Ringleitung bildet sich ein Magnetfeld im Rhythmus der Sprache, das vom Hörgerät aufgenommen wird. Die normalhörenden Personen können das Magnetfeld nicht wahrnehmen. Induktive Höranlagen in Theater, Kinos, Schalterhallen, Schulen etc. erleichtern Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Teilnahme am gesellschaftlichen, alltäglichen Leben wesentlich. Die hörbehindertengerechte Ausstattung von öffentlichen Gebäuden ist aber in Österreich die Ausnahme und nicht die Regel. Obwohl professionelle Induktionsanlagen heute einfach und preiswert zu installieren sind. Mit der technologischen Entwicklung hat die Übertragung einen hohen Qualitätsstandard erreicht, auch ungewöhnliche Orte (z.B. Auto) werden mittlerweile damit beschallt. Im Wohnbereich können ebenfalls induktive Höranlagen eingerichtet und mit TV- oder Radiosignalen verbunden werden. Quellen und Infos: www.schwerhoerigen-netz.at
Diese Computermaus wird nicht mit der Hand bedient, sondern über Bewegungen des Kopfes gesteuert. Ein Reflexionspunkt, den man an der Brille oder an der Stirn anbringt, steuert über eine Elektronik den Mausanzeiger. Über eine Bildschirmtastatur kann die/der Nutzer/in am PC arbeiten, ohne dass sie/er die Hände gebrauchen muss. Der Maus-Klick wird mit einem externen Taster oder durch Verweilen am ausgewählten Punkt ausgelöst.
Akustische, taktile und haptische, also auf den Tastsinn bezogene, Hinweise erleichtern blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung. Es gibt die verschiedensten Modelle von Leitsystemen im öffentlichen Raum, etwa -> akustische Ampeln (S. 97 im Buch) oder -> Bodenleitstreifen (S. 100 im Buch) entlang von U-Bahn-Bahnsteigen. In manchen Städten verwenden blinde Menschen auch Sender, die per Knopfdruck eine akustische Ampel aktivieren oder sogar Auskunft über Verkehrsmittel in der betreffenden Station geben. Leitsysteme werden auch in Gebäuden angebracht, um dort die Orientierung zu erleichtern. Dazu gehören Bodenleitstreifen, Handläufe, sprechende Aufzüge und Hinweisschilder in -> Braille (S. 78 im Buch). Für sehbehinderte Menschen sind gut sichtbare Schilder mit großer Schrift und die Kennzeichnung von Treppen mit Signalfarben wichtige Hilfestellungen.
Um Stufen überwinden zu können, gibt es für Personen im Rollstuhl bzw. stark gehbehinderte Menschen verschiedene Hilfsmittel. Aufzüge müssen eine Größe von 110 x 140 cm aufweisen, so genannte Treppenlifte haben eine Plattform für den Rollstuhl seitlich am Stiegengeländer entlang. Ist das Stiegenhaus nur über eine Wendeltreppe erschlossen, ist die Zugänglichkeit oft nur durch technische Hilfsmittel wie einen so genannten Deckenlifter möglich. Dabei hängen vier Gurte von einer an der Decke montierten Schiene, an denen man den Rollstuhl befestigt. Der Rollstuhl wird leicht angehoben und "schwebt" entlang der Schiene zum gewünschten Stockwerk.
Für gehörlose oder hörbehinderte Menschen stellen rein akustische Informationen ein großes Gefahrenpotential dar. Feueralarm oder Warnhinweise in öffentlichen Gebäuden oder in Stationen von Verkehrsmitteln werden häufig nur durch Sprecher oder laute Signale verlautbart. Für gehörlose Menschen ist es unerlässlich, diese Informationen auch auf Anzeigetafeln vorzufinden oder durch auffällige optische Signale alarmiert zu werden.
Die Mobilität mittels eigenem Auto ist für viele gehbehinderte Personen und Rollstuhlfahrer/innen besonders wichtig. Vor allem, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht flächendeckend behindertengerecht benützbar sind. Diese Einschränkung hat den Gesetzgeber bewogen, einige Förderungen zu gewähren. So erhalten berufstätige -> begünstigt behinderte Personen (S. 63 im Buch) Zuschüsse zum Ankauf eines Autos sowie die Autobahnvignette kostenlos, sofern für sie die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar ist. Stark gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer/innen dürfen mit dem Ausweis gemäß § 29b StVO die -> Behindertenparkplätze (S. 99 im Buch) sowie die Kurzparkzonen zeitlich unbeschränkt und gebührenfrei benützen.
ermöglichen Rollstuhlfahrer/innen anstelle von Stufen das barrierefreie Benützen von Gebäuden. Zu beachten ist, dass die Rampenneigung laut ÖNORM B 1600 nicht mehr als 6 bis 10 % beträgt. Außerdem sollte ein Handlauf für gehbehinderte und alte Personen rechts und links der Rampe angebracht sein.
ist eine -> Gehhilfe (S. 104 im Buch) mit schwenkbaren Vorderrädern, starren Hinterbeinen mit Gummikappen und ausziehbaren Haltegriffen. Das ist geeignet für Personen, die Gleichgewichtsstörungen (Spastiker, Prothesenträger) haben, oder eine starke Gehunsicherheit, die mit einem Stock oder Krücken nicht mehr ausgeglichen werden kann.
ist nicht gleich Rollstuhl. Standardrollstühle, Pflegerollstühle oder Geriatrierollstühle werden vom Arzt stark gehbehinderten und alten Leute verordnet. In Leichtgewicht- oder Aktivrollstühlen sitzen vorwiegend querschnittgelähmte Personen und Multiple Sklerose-(MS-)Patienten. Der Aktiv-Rollstuhl hat den Vorteil, dass er durch seinen Faltmechanismus leicht in einem PKW transportiert werden kann. Im Gegensatz dazu ist ein Elektrorollstuhl (E-Rollstuhl) durch seine Größe und Schwere nur in Kombis oder in Kleintransportern zu transportieren. Ein E-Rollstuhl wird Personen verordnet, die wenig oder keine Kraft in den Armen oder eine fortschreitende Muskelerkrankung haben. Auch die Kosten spielen bei der Anschaffung eines Rollstuhls eine wesentliche Rolle. Ein Aktivrollstuhl ist ab ca. € 1.500,- erhältlich, ein E-Rollstuhl hingegen nicht unter € 5.000,-. Der Preisunterschied erklärt sich beim E-Rollstuhl aus der elektronischen Steuerung und der Batterie, die ihn antreibt. Bei den Batterien ist wiederum zwischen Nass- oder Trockenbatterien zu unterscheiden, denn Elektrorollstühle dürfen nur auf Flugreisen mitgenommen werden, wenn sie mit einer Trockenbatterie ausgestattet sind. Jeder Aktivrollstuhl hat neben einer Sitzfläche und einer Rückenlehne auch Fußstützen, Seitenteile, Greifreifen und Bremsen. E-Rollstühle haben zusätzlich einen Sitzgurt, damit man während der Fahrt von bis zu 10 km/h nicht herausfällt, und Feststellbremsen. Eine Kopfstütze ist obligatorisch. Ob ein -> Sitzkissen (S. 109 im Buch) verwendet wird, hängt von der jeweiligen Behinderungsart ab. Sportrollstühle werden unterteilt in Rennrollstühle, Basketball-Rollstühle und Tennis-Rollstühle.
sind Gebäude, die ohne Stufen zugänglich sind, deren Durchgangsbreite aller Türen mindestens 80 cm beträgt und die eine Behindertentoilette haben.
haben einen bodenebenen Zugang und einen Neigungswinkel von höchstens 1 %, damit das Wasser abfließen kann. Duschtassen sind für Rollstuhlfahrer/innen nicht zu benützen!
Der Wendekreis oder Bewegungsradius für Rollstuhlfahrer/innen und gehbehinderte Personen beträgt 150 cm. Dieses Maß muss vor allem im Eingangsbereich, vor Liften und in Behinderten-WC's eingehalten werden.
ermöglicht Querschnittgelähmten das leichtere Überwechseln vom Rollstuhl ins Bett, vom Rollstuhl in die Badewanne, vom Rollstuhl ins Auto und umgekehrt.
Wenn nichtsehende Menschen am Computer arbeiten, benötigen sie eine -> Braillezeile (S. 100 im Buch) oder eine -> Sprachausgabe (S. 110 im Buch), um den Bildschirminhalt wahrnehmen zu können. Der Screenreader ist eine Software, die die Brücke zwischen Bildschirm und Endgerät herstellt. Er interpretiert das, was am Bildschirm passiert und gibt die Informationen weiter. Der Screenreader gibt den Text am Bildschirm nicht nur zeilenweise wieder. Er kann z.B. auch Menüs oder Linklisten per Tastenkombination vorlesen.
wie Roho-Kissen, Gelkissen, Jaykissen, Latex-Kissen helfen querschnittgelähmten Personen Druckstellen durch langes Sitzen zu vermeiden. Roho-Kissen haben separate Luftkammersysteme, die wahlweise gemeinsam oder getrennt aufgeblasen werden können um in der jeweiligen Sitzposition eine perfekte Druckverteilung zu erreichen. Jay-Sitzkissen haben eine optimal erarbeitete Formgebung. Die Sitzfläche besteht aus einem Mehrkammer-Leicht-Fluid, auf der Rückseite befindet sich eine robuste Hartschaumschale. Der Sitzbezug ist atmungsaktiv. Gelkissen passen sich optimal der Körperform an, haben aber den Nachteil, dass sie sehr schwer sind und das Gel nach einer gewissen Zeit hart wird. Latex-Kissen gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Höhen, sie sind atmungsaktiv und waschbar, zerbröseln aber nach ungefähr 2 bis 5 Jahren ständiger Benützung.
Tastaturen können in den verschiedensten Varianten hergestellt werden. Für körperlich behinderte Menschen ermöglichen sie die Bedienung des Computers. Es gibt z.B. Großfeldtastaturen mit großen, weit auseinandergezogenen Tasten, die für Menschen mit motorischen Störungen oder auch als Fußtastaturen zu verwenden sind. Andererseits gibt es auch Minitastaturen für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit und Tastaturen mit angepasstem Greiffeld, die eine Bedienung mit geringem Kraftaufwand ermöglichen. Wichtig für die individuellen Bedürfnisse ist es, dass die Berührungsempfindlichkeit der Tasten verstellbar ist. Auch die Bedienung der Maus kann durch Tasten ersetzt werden. Ein spezielles Modell dafür ist die Tastenmaus. Menschen, die keine Tastatur bedienen können, steuern den PC über eine Bildschirmtastatur. Die Tastatur wird am Bildschirm abgebildet und kann dann mit dem Mauszeiger bedient werden.
gibt den Bildschirminhalt in Sprache wieder. Sehbehinderte und blinde Menschen benützen die Sprachausgabe, um sich am Bildschirm zu orientieren, die eigene Texteingabe zu kontrollieren, im Internet zu surfen oder sich Texte in digitalisierter Form vorlesen zu lassen. Die Sprachausgabe wird heute meist als Software in Verbindung mit einer Soundkarte verwendet. Die Sprache selbst ist gewöhnungsbedürftig, doch wenn sich die/der User/in eingehört hat, gut zu gebrauchen. Hergestellt wird die Sprache entweder vollsynthetisch oder aus Fragmenten natürlicher Sprache. Beim Vorlesen können Sprecher, Sprachen, Satzmelodie und andere Einstellungen verändert werden.
wie Scalamobil, Treppen-Kuli oder Treppenraupe ermöglichen es Rollstuhlfahrer/innen, mit Hilfe einer nichtbehinderten Person Stufen und Treppen zu überwinden.
steht für die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und Software. Wenn Internetseiten nach den Richtlinien für barrierefreien Internetzugang programmiert und gestaltet sind, trägt dies zur Benutzerfreundlichkeit für alle User/innen bei. Ladezeiten werden verringert, Seiten sind nicht mit Pop up-Fenstern übersät und grafischen Spielereien überladen. Damit werden Webauftritte übersichtlich. -> Accessibility (S. 97 im Buch) bedeutet also auch größere Usability.
Diese spezielle Software vergrößert den Bildschirminhalt, damit sehbehinderte Menschen am Computer arbeiten können. Durch die Vergrößerung sind nur noch Bildschirmausschnitte sichtbar. So wird das Bild in Teilen wahrgenommen. Neben der Größe sind auch die Farben verstellbar. Zusätzlich kann bei manchen Programmen auch noch eine Sprachausgabe zugeschaltet werden. Die Programme verfügen über verschiedene Sonderfunktionen. Wenn ein sehbehinderter Mensch z.B. einen langen Text mit hoher Vergrößerung lesen möchte, dann kann er den Text nur in einer Zeile automatisch am Bildschirm vorbei fließen lassen und muss sich nicht ständig von einer Bildschirmseite zur anderen bewegen.
ist die Abkürzung für "Web Accessibility Initiative". Diese Initiatve ist Teil des W3C (World Wide Web Consortium), das sich seit 1994 mit der Weiterentwicklung des WWW beschäftigt. Die Bereiche Anwendung, Dienstleistung und soziale Veränderungen stehen im Zentrum. Die WAI kümmert sich um Richtlinien für die Zugänglichkeit von Webdesign. Diese Richtlinien werden in drei Prioritätsstufen unterteilt. WAI A muss befolgt werden, damit bestimmte Gruppen von Internetuser/innen nicht ausgeschlossen werden. Die Einhaltung von WAI AA schafft Hürden aus dem Weg und WAI AAA erleichtert den Zugang zu Webinhalten. www.w3.org
WAI - Richtlinien
Richtlinie 1. Stellen Sie äquivalente Alternativen für Audio- und visuellen Inhalt bereit.
Richtlinie 2. Verlassen Sie sich nicht auf Farbe allein.
Richtlinie 3. Verwenden Sie Markup und Stylesheets und tun Sie dies auf korrekte Weise.
Richtlinie 4. Verdeutlichen Sie die Verwendung natürlicher Sprache.
Richtlinie 5. Erstellen Sie Tabellen, die geschmeidig transformieren.
Richtlinie 6. Sorgen Sie dafür, dass Seiten, die neue Technologien verwenden, geschmeidig transformieren.
Richtlinie 7. Sorgen Sie für eine Kontrolle des Benutzers über zeitgesteuerte Änderungen des Inhalts.
Richtlinie 8. Sorgen Sie für direkte Zugänglichkeit eingebetteter Benutzerschnittstellen.
Richtlinie 9. Wählen Sie ein geräteunabhängiges Design.
Richtlinie 10. Verwenden Sie Interim-Lösungen.
Richtlinie 11. Verwenden Sie W3C-Technologien und Richtlinien.
Richtlinie 12. Stellen Sie Informationen zum Kontext und zur Orientierung bereit.
Richtlinie 13. Stellen Sie klare Navigationsmechanismen bereit.
Richtlinie 13. Sorgen Sie dafür, dass Dokumente klar und einfach gehalten wird.
Aufgrund von Unfall oder Krankheit ist oftmals eine Wohnungsadaptierung notwendig. Die Adaptierungen umfassen den stufenlosen Zugang von der Straße zur Wohnung, den Umbau von Badezimmer und WC sowie den stufenlosen Zugang zu Balkon oder Terrasse. Betroffene können bei Kostenträgern wie den Sozialversicherungsträgern und der Sozialabteilung des jeweiligen Bundeslandes finanzielle Unterstützungen beantragen. Die Umbaukosten sind oft höher als der Umzug in eine behindertengerechte Wohnung.
Inhaltsverzeichnis
Überlegungen zu Gesundheit und Krankheit
"Gesunder Geist in gesundem Körper." "Mens sana in corpore sano" Dieses oft ungenau zitierte Sprichwort bildet nicht selten die Grundlage von Überlegungen zu Gesundheit und Krankheit. In seiner 10. Satire lästert der römische Dichter Juvenal über die dummen Gebete und Wünsche der Menschen, aber die Bitte um körperliche und psychische Gesundheit lässt er gelten: "Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano." "Bitte darum, dass die Seel´ in gesundem Leibe gesund sei."
Behindert sein, in welcher Form auch immer, hat Auswirkungen. Behindert sein sensibilisiert und konfrontiert. Behindert sein ist zwischen beiden Polen "Gesundheit und Krankheit" möglich und behindert zu sein bedeutet nicht notwendigerweise krank zu sein. Moderne Ansätze sind ausgearbeitet und helfen Aussonderung und Stigmatisierung zu vermindern. Die Herausforderungen sind ökonomischer Natur, beispielsweise die Bereitstellung von strukturellen und finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand zur Integration von Menschen mit Behinderungen in Schule, Ausbildung, Beruf. Die Herausforderung liegt in der Formulierung eines klaren Willens, Menschen mit Behinderungen nicht mehr auszugrenzen, nicht mehr mit Sonderlösungen und Ausnahmeregelungen zu versorgen. So lange Menschen mit Behinderungen, die sich seit Jahren für mehr Rechte einsetzen und um mehr Lebensqualität bemühen, Bittsteller sind, solange sich Verantwortliche nicht auf Menschen mit Behinderungen zuzugehen trauen, um deren Lösungsansätze zu hören, solange immer noch bei Kindern, bei Senioren, bei Menschen mit psychischer Erkrankung und bei Menschen mit Behinderungen der Rechenstift in Griffweite liegt, werden Menschen mit Behinderungen Themen wie Gentechnologie, Bioethik, pränatale Diagnostik und Sterbehilfe als potenziell bedrohlich betrachten.
Hans Hirnsperger
ist facettenreich, subtil und geschieht zumeist in guter Absicht. Als aktiver Vorgang schon schwer wahrnehmbar kann Aussonderung, wenn in Strukturen verborgen und von Institutionen ausgeführt, zur Gänze verleugnet werden. Aussonderung findet im Begriff der Eingliederung ihr Gegenteil. Über Aussonderung spricht man nicht, über Integration und Inklusion schon. Der Menschen Wohl steht schließlich im Mittelpunkt. Es wird lieber darüber gesprochen, was sein könnte und nicht darüber, was passiert, nicht darüber "was der Fall ist". Sondereinrichtungen machen Menschen zu Sonderlingen. Menschen werden ausgesucht, eingewiesen, zugewiesen, abgewiesen. Viele müssen von zu Hause weg, in ein Heim, oft für immer. Alles nur zu ihrem eigenen Wohl, versteht sich. Das Ritual der Aussonderung, das Auswählen und Klassifizieren, das "Beste wollen", das Einweisen, das Abweisen bleiben unreflektiert. Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Welt ist eben ohne bestimmte Menschen einfach mehr in Ordnung. Oder nicht?
ist ein Kürzel. Es steht allgemein für "Ethik in Biologie und Medizin" und ist in dieser Bedeutung begrüßenswert. Es steht auch für die so genannte "Bioethik-Konvention" des Europarates, in Abkürzung für das "Europäische Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin". Diese "Bioethik-Konvention" stößt auf breiten Widerstand. Kritisiert wird etwa, dass kein ausreichender Schutz der Embryonen vorgesehen sei oder ein eindeutiges Verbot der Keimbahntherapie fehle. Vor allem der Artikel 17 der Bioethik-Konvention ruft Menschen auf den Plan, die für die Unantastbarkeit der Menschwürde eintreten. Der Artikel 17 regelt den Schutz von Personen, die nicht fähig sind, in Forschung einzuwilligen und sieht vor, dass in Ausnahmefällen Forschung auch dann zugemutet werden kann, wenn "deren erwartete Ergebnisse für die Gesundheit der betroffenen Person nicht von unmittelbarem Nutzen sind." Im Zusatzprotokoll heißt es: "Ein vollständiges Verbot solcher Forschung würde Fortschritte im Kampf um die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und bei der Bekämpfung von Krankheiten, von denen ausschließlich Kinder, Geistigbehinderte oder Personen mit Altersdemenz betroffen sind, unmöglich machen." (Quelle: http://conventions.coe.int). Betroffen sind also Menschen, die als schwach gelten und besonderen Schutzes bedürfen. Der Schutz der Menschen wird thematisiert, das ist wichtig. Bedeutet Bioethik aber das biologisch Machbare zu legitimieren, werden Menschen gegen Bioethik antreten. Ethischer Standard bleibt fragwürdig, wenn er zulässt, dass Menschen, die nicht selber entscheiden und einwilligen können, zu Forschungszwecken - wenn auch nur in Ausnahmefällen - herangezogen werden dürfen.
bedeutet biologische, psychologische, soziale und kulturelle Aspekte in der Diagnostik und Behandlung der Menschen mitzuberücksichtigen und ist eine ärztliche Notwendigkeit. Nur die Beachtung aller drei Bereiche, des Körperlichen, des Psychischen und die Beziehungen zur Umwelt, garantiert ein annähernd gutes Verstehen der komplexen Lebens-, Verhaltens- und Sichtweisen des Menschen. Biomedizin und Bioethik hingegen engen diese Disziplinen auf das Biologische, das Körperliche ein und schließen somit zwei weitere Determinanten aus, die jedem menschlichen Dasein innewohnen: Das Psychische und das Soziale. Die einzelnen Bereiche sind voneinander abhängig, sie stehen in einer engen Wechselwirkung. Die Beschränkung der Sichtweise auf nur einen der Bereiche, auf das Biologische, auf das Psychologische oder das Soziokulturelle alleine greift spätestens beim Aufeinandertreffen von Arzt und Patient zu kurz. Der Mensch wünscht ganz behandelt und ganz gesund zu werden. Eine "ganzheitliche Medizin" allerdings, wie sie in aller Munde ist, gibt es per se nicht. Nach wie vor gilt: Die Komplexität ist aufzuschlüsseln in: bio-psycho-sozio-kulturell.
kommt aus dem Griechischen. Die Vorsilbe eu bedeutet: Gut, wohl, recht, glücklich. Thanatos heißt Tod. Euthanasia, ein guter leichter Tod, war in der ursprünglichen Bedeutung auf den Sterbevorgang an sich bezogen. Euthanasie als beschönigender Ausdruck für Tötungsabsichten und Mord, verknüpft mit Gnade und Erlösung vom so genannten "lebensunwerten Leben", war die Diktion der Nationalsozialisten. Die größte Vernichtungsanstalt zur Durchführung des so genannten "Gnadentods" in Österreich war das Schloss Hartheim in Alkoven bei Linz. Hier wurden zwischen 1940 und 1944 über 30.000 Menschen ermordet. Es waren behinderte Menschen, Psychiatriepatient/innen, sozial benachteiligte Kinder und Waisen, die von der menschenverachtenden NS-Propaganda als "unnütze""Esser", als "erbkrank", als "Volksschädlinge" eingestuft wurden. Sie starben an Elektroschocks, an medizinischen Versuchen, durch Vergiften und Vergasen. In der Kinderklinik am Wiener Spiegelgrund standen Morde an körperlich und geistig behinderten Kindern auf der Tagesordnung. Verantwortlich dafür waren Euthanasie-Ärzte, von denen viele nach Kriegsende ihre Karriere einfach fortsetzen konnten. Wie spät diese Geschichte aufgearbeitet wurde, zeigt der Fall Heinrich Gross, nach dem Krieg prominenter Gerichtsgutachter. Dem ehemaligen Anstaltsarzt am Spiegelgrund wird vorgeworfen, an der Ermordung von Kindern beteiligt gewesen zu sein. Erst in den 1990-er Jahren wurde gegen Gross ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Der Begriff Euthanasie kann gleichbedeutend mit -> Sterbehilfe (S. 126 im Buch) verwendet werden, obwohl dies im deutschsprachigen Raum weniger gebräuchlich ist.
und "Geisteskrankheit" sind obsolete Begriffe, zu allgemein und zu Verschiedenes wird darunter verstanden; zu oft machen Vorurteil und Angst schnell ein Bild von Menschen, welche als unheilbar, als aggressiv, als hemmungslos, generell als schwierig erachtet werden. (-> Stigma S. 128 im Buch). Der Wirklichkeit entspricht diese Sichtweise nicht. Personen mit besonderen Bedürfnissen wird zuwenig zugetraut. Ein Mangel, ein Defekt wird über die Person hinaus stilisiert und erdrückt deren individuelle Fähigkeiten. Es gibt Abhilfe: Integration statt Aussonderung im Kindergarten, in der Schule, an der Universität, im Beruf. Die Bezeichnung geistig behinderte Menschen kann durch Begriffe wie -> Menschen mit Lernschwierigkeiten (S. 29 im Buch) ersetzt werden.
beschäftigt sich mit der genetischen Information der Lebewesen und versucht einzelne Gene zu bestimmen, zu isolieren, zu vermehren und neu zu kombinieren. Konkreter wird unter Gentechnologie die Vermehrung eines Genes in einem Organismus, das zuvor aus einem anderen Lebewesen gewonnen wurde, verstanden. Dies ist möglich, da der genetische Aufbau aller Lebewesen nach den selben Prinzipien funktioniert. Ein Stück menschliche Erbinformation, die z.B. die Bauanleitung für ein menschliches Hormon enthält, kann, wird es in ein Bakterium gebracht, auch dieses produzieren. Der Zugang zur genetischen Information aller Lebewesen und die Möglichkeit, deren Baupläne zu ändern, ermöglichen die Durchführung schwerwiegender Eingriffe. Vorsicht ist daher geboten. Die Anwendung der Gentechnologie am Menschen ist als so genannte Gentherapie bekannt. Wird genetisches Material in Körperzellen gebracht, geht es um die Behandlung einer Person. Bei Eingriffen in die Keimbahn wird neue genetische Information in Ei- oder Samenzellen gebracht, es kann also die Veränderung wieder vererbt werden. Der Transfer von genetischen Fragmenten in den Körper, um dort eine krankmachende Störung auszuschalten, wird erprobt. "Potente Stammzellen", genetisch verbessert, geben zu Spekulation und Hoffnung Anlass. Euphorie ist aber nicht angebracht. Komplexe Themen brauchen auf lange Sicht Befürworter/innen und Gegner/innen, brauchen Unsicherheit, Angst und Zweifel. Schon einmal wurde die Genetik als Wissenschaft euphorisch in den Himmel gehoben und ein gesunder Volkskörper phantasiert. Die Vorteile und die Nachteile einer gentechnologisch veränderten Lebenswelt müssen klargelegt werden. Gegenwärtiges genetisches Wissen ist begrenzt. Es braucht also noch viel Information über Anwendung und Auswirkung.
Nach dem Lateinischen "hospitium" (= "Gastfreundschaft") benannt, ist heute Hospiz eine Einrichtung für sterbenskranke Menschen, die stationär oder ambulant genützt werden kann. Der im Krankenhaus gebrauchte Satz "wir können nichts mehr machen" gilt nicht im Hospiz. Wie in der -> Palliativmedizin (S. 124 im Buch) steht im Mittelpunkt der Hospizarbeit der Mensch mit seinen physischen und psychischen Bedürfnissen im letzten Lebensabschnitt. Wichtiges Anliegen der Hospizbewegung ist es auch, dass Menschen die Möglichkeit haben, zu Hause, in der vetrauten Umgebung sterben zu können. www.hospiz.at
ist die Abkürzung für "International Classification of Functioning, Disability and Health". Dieses von der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegte Klassifikationssystem, dient dazu den Gesundheitszustand individueller Personen zu beurteilen (www3.who.int/icf/onlinebrowser/icf.cfm). War in der früheren WHO-Klassifikation von -> Beeinträchtigung, -> Behinderung und -> Handicap (Vgl. S. 23 im Buch) die Rede, vereint die ICF nun dieses rein medizinische Modell mit dem sozialen Modell von Behinderung, wie es meist von den Betroffenen vertreten wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung von Funktionen und Fähigkeiten des Einzelnen. Diese wertneutrale Sichtweise von Beeinträchtigung und Behinderung ermöglicht es eher, -> Stigmatisierung (S. 128 im Buch) und -> Aussonderung (S. 117 im Buch) hintanzuhalten. Wie Menschen mit ihrem Gesundheitszustand leben und zurecht kommen, und nicht die Beschreibung von Defekt und Defizit sind von Bedeutung. Die Beschreibung täglicher Aktivitäten, wie Lernen, Wissensanwendung, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung und das Leben zu Hause, sind dabei wichtige Bereiche. Zu erkennen, wie und in welchem Ausmaß eine Person an den verschiedenen sozialen Lebensbereichen teilnimmt, kann Isolation verhindern helfen. Wie Menschen ihr Leben und ihre persönliche Umgebung gestalten, wie sie soziale Unterstützung, Hilfsmittel sowie Dienste und Leistungen nutzen können, steht im Brennpunkt der ICF-Betrachtung.
"Ein Schicksal schlägt zu. Kein Ausweg, keine Aussicht. Diagnose Krebs! Ein langwieriger schwieriger Kampf beginnt. Geduldig und bis zum letzten Atemzug kämpft jemand, bleibt nicht Sieger. Jemand ist tapfer." Diese Sprachbilder sind häufig in den Medien zu finden, zu hören und zu lesen. Der "Kampf gegen den Krebs" kann allerdings immer öfter gewonnen werden, insbesondere wenn es gelingt, frühzeitig die richtige Diagnose zu stellen, sich der "Schreckensnachricht" zu stellen. Aufklärung und Motivation, die in erster Linie Ängste und Vorurteile abbauen, sind wichtig. Information über Krebsarten, Symptome und mögliche Vorsorgeuntersuchungen können tatsächlich Leben retten. Die Hälfte aller Krebskranken wird wieder gesund! Die Verwendung der Metapher des "Kampfes, der gewonnenen Schlachten, des Sieges und der Niederlage" führt zu vermehrter Angst, die letztlich zu Isolation führen kann. Das Thema Krebs gehört entängstigt.
gibt es in vielen Varianten und Abstufungen, bleibt aber oft zweischneidig. Mitleid entsteht aus Betroffenheit, die wiederum zu stark und zu schwach ausfallen kann. Schon sind wir beim feinen Taktgefühl. Echtes Mitleid wird empfunden und gegeben, wenn Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit mit von der Partie sind. Mitleid wird zur Farce und Geschmacklosigkeit, wenn Einer Mitleid empfindet und dies auch kundtut, sein Gegenüber sich aber gut fühlt, kein Mitleid braucht. Dieses Mitleid hilft nur denen, die es spenden. Diese Mitleidspender/innen brauchen leidende Menschen, brauchen ihre Opfer, um zu spüren und zu genießen, wie gut es ihnen geht. Das ist Mitleid mit mangelndem Mitgefühl, mit fehlendem Einfühlungsvermögen und dieses Mitleid ist für Menschen, die beispielsweise auf Grund eines -> Stigmas (S. 128 im Buch) dieses Mitleid öfter zu spüren kriegen, unangenehm und anstrengend. Mitleid ist auch wichtig, um Spenden und Geld zu sammeln für Menschen, die in Not geraten sind. Das Taktgefühl entscheidet über echtes und falsches Mitleid. Spendenaufrufe mit Floskeln wie -> Licht ins Dunkel (S. 27 im Buch) wirken taktlos, weil Menschen mit Behinderungen zu Opfern, zu Gezeichneten stilisiert werden und das auch so empfinden.
ist ein zentraler, aber relativer Begriff, der ganz allgemein Regel, Richtschnur oder Maßstab bedeutet und in verschiedensten Bezugssystemen Anwendung findet. Normen oder Regeln ermöglichen eine Bewertung, Einschätzung oder Beurteilung, Einstufung, Abstufung, Aufstufung. Normen werden konstruiert. Die statistische Norm bildet durch Vergleich verschiedener Merkmale Beziehungen. Durchschnittswerte werden gebildet, wenn ein Mittelwert als Bezugspunkt gilt. Die statistische Norm prägt unser Verständnis von Normalität, sie wäre im Prinzip neutral, also im eigentlichen Sinne keine Norm. Problematisch wird die Tatsache, wenn die statistische Norm zur Idealnorm und die Normabweichung mit Sanktionen belegt wird. Liegt der Bezugsrahmen im Subjekt, ist er geprägt von Vorerfahrung und Erwartung. Die Aussage "das ist nicht normal" gibt Auskunft über den Bezugsrahmen des Urteilenden, gibt Auskunft über Meinung, Wissen und Erfahrung. Die Begegnung mit Neu em und Unbekanntem, von der bisher gekannten Norm Abweichendem, macht Angst und kann eine Bedrohung der eigenen Identität darstellen. Abgrenzung und Ablehnung bieten Schutz. Abweichung von der Norm, von "allgemein gültigen Regeln", wird vorschnell als negativ betrachtet. Abweichendes Verhalten ist immer auch normbezogen und damit selbst "normal".
ist ein Spezialfach der Medizin und beinhaltet die Diagnostik, die Behandlung und die medizinische Betreuung von Menschen, deren Lebenserwartung begrenzt ist und nicht heilbare, fortgeschrittene Erkrankungen haben. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und so wird die Lebensqualität der Patient/innen und der Angehörigen verbessert. Die Kontrolle von Schmerzen, also Schmerzfreiheit, sowie die Betreuung bei psychischen, sozialen und spirituellen Problemen werden durch ein multiprofessionelles Team gewährleistet. -> Hospiz (S. 121 im Buch)
heißt ein ungeborenes Kind auf dessen Gesundheitszustand zu prüfen, zu untersuchen, darüber Auskunft zu geben. Pränatale Diagnostik heißt auch gezielt nach genetischen Erkrankungen zu suchen. Die Untersuchungsmethoden reichen von Ultraschall als Routineuntersuchung, über Tripple-Test bis zum Eingriff mittels Nadel bei Chorionzottenbiopsie und Amniozentese/Fruchtwasserpunktion. Beim Tripple-Test werden Hormone und Eiweiße im Blut der Mutter bestimmt. Bei der Chorionzottenbiopsie wird Gewebe des Mutterkuchens, bei der Fruchtwasserpunktion werden freischwimmende Zellen des Kindes gewonnen und genetisch untersucht. Alle Untersuchungen sind von der 12. bis zur 17. Schwangerschaftswoche durchführbar und dienen der Abschätzung oder definitiven Diagnostik von Erbsubstanzstörungen. Immer mehr Erkrankungen können pränatal diagnostiziert werden, selten kann ein Behandlungsangebot geboten werden. Wird eine genetische Erkrankung oder Behinderung beim werdenden Kind erkannt, bedeutet dies vor allem für die Mutter Anspannung, Angst, Trauer, Scham. Was machen wir? Alle Beteiligten sind mit eigenen Wertvorstellungen konfrontiert, Grundfragen werden gestellt, ethische Fragen drängen. Die Eltern entscheiden letztendlich, wie es weitergehen soll, brauchen aber Information und oft psychotherapeutische Unterstützung, um die schwierige Situation zu klären. Auch wenn die Entscheidung leicht fallen sollte, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, bleiben Belastung, Trauer- und Schamgefühl. Genetische Beratung, präklinische und pränatale Diagnostik müssen ganz klar auf eine Person, auf ein individuelles Problem, bezogen bleiben.
ist ein Spezialfach der Medizin und arbeitet mit denselben medizinischen Grundsätzen wie andere Fächer der Medizin auch. Psychiatrie befasst sich mit Erforschung, Diagnostik, Therapie und Prävention von Verhaltensstörungen. Die moderne Psychiatrie hat nichts mehr mit der Anstaltspsychiatrie, wie es sie noch vor 30 Jahren gab, zu tun. Große Anstalten außerhalb der Städte mit tausenden Betten stehen zwar noch, sind aber in sich sektorisiert und spezialisiert. Die sogenannte "Sozialpsychiatrie", die Umwelt und Umfeld der Patient/innen einbezieht, hat eine gemeindenahe Psychiatrie, wie sie derzeit etabliert und praktiziert wird, möglich gemacht. Menschen, die psychiatrische Hilfe brauchen, können möglichst nahe ihres Wohnortes die Hilfe in Anspruch nehmen, die sie brauchen. Nach wie vor ist die Psychiatrie mit Angst und Vorurteil behaftet. Die Scheu vor der Psychiatrie ist, so wie die Scheu vor dem Zahnarzt, verständlich, aber unbegründet. Eine Sonderstellung der Psychiatrie ist nicht gerechtfertigt.
liegt dann vor, wenn ein Mensch die in einer Gesellschaft üblichen sozialen Rollen nicht oder nur eingeschränkt ausüben kann. Heute wird anstelle von "psychischer Behinderung" immer mehr der Begriff der "psychosozialen Beeinträchtigung" verwendet. Menschen mit einer psychosozialen Beeinträchtigung werden auch als "innere Fremde" bezeichnet, weil ihr Denken, Fühlen und Handeln für Dritte oft nicht nachvollziehbar erscheint. Eine weniger defizitorientierte Betrachtungsweise spricht nicht mehr von psychosozialer Behinderung, sondern vom Grad der Möglichkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft und zur Ausübung der gesellschaftlich erwünschten sozialen Rollen. Dies soll auch zum Ausdruck bringen, dass Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen nicht behindert sind, sondern behindert werden. Im Grundsatz wird damit die Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitszustand einer Person und dem Lebenshintergrund verstanden. In einer personenorientierten Betrachtungsweise wird vom individuellen psychosozialen Unterstützungsbedarf in den Funktionsbereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Betreuung gesprochen.
Ist eine Wortbildung aus dem griechischen schizo (spalten) und phren (Geist; Sinn; Verstand) und wird in der Medizin etwas unscharf für mehrere psychische Erkrankungen verwendet, die mit Realitätsverlust, Trugwahrnehmungen, Wahnvorstellungen, Bewusstseinsstörungen, Störungen des Denkens und der Gefühlswelt verbunden sein können. Auch in der Medizin ist Vorsicht angebracht mit Diagnosen, da sie Momentaufnahmen darstellen und oft nur von geringem Nutzen für Außenstehende sind. Wissen sie, was es heißt, schizophren zu sein? Besser als Fremdwörter zu verteilen, ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Was ist Stimmenhören? Schizophren? Nein! Vorerst ist Stimmenhören, ein mögliches Symptom bei schizophrenen Erkrankungen. Wenn jemand Dinge sagt, die widersprüchlich sind oder Dinge tut, die unvereinbar erscheinen, sind manche immer noch verleitet, dies als schizophren oder als Schizophrenie oder gar als Persönlichkeitsspaltung zu beschreiben. Werden alltägliche Vorkommnisse in den Medien mit diesen Begriffen belegt, werden Menschen mit schizophrener Erkrankung stigmatisiert und abgewertet.
bedeutet allgemein Sterbebegleitung und steht im Speziellen für alle Handlungen, die bei Menschen mit unheilbaren Erkrankungen und unabwendbarem tödlichen Verlauf oder in hohem Alter zu einer Herbeiführung, Verkürzung oder Erleichterung des Sterbens führen. Unterlässt es der/die Helfer/in Maßnahmen zu setzen, die das Leben und damit das Sterben verlängern, spricht man von passiver Sterbehilfe. Passive Sterbehilfe bedeutet einvernehmlich mit dem Sterbenden dem Sterbeprozess seinen Lauf zu lassen, also keine lebensverlängernden Maßnahmen zu setzen, nur solche, die die Lebensqualität verbessern (-> Palliativmedizin, S. 124 im Buch). Greift der/die Helfende aktiv ein, um den Tod herbeizuführen, spricht man von aktiver Sterbehilfe. Indirekte aktive Sterbehilfe bedeutet, dass der/die Helfende mit einer palliativen Maßnahme die Lebensverkürzung nicht bezweckt aber gegebenenfalls billigend in Kauf nimmt. Die indirekte aktive Sterbehilfe ist gegeben, wenn beispielsweise bei bestehenden starken Schmerzen eine Schmerztherapie angezeigt ist, die das Leben verkürzen kann, ohne dass dies die primäre Absicht dieser Schmerztherapie ist. Aktive Sterbehilfe heißt dem/der Patienten/in zu helfen, sich zu töten (Beihilfe zum Suizid) oder selbst diese Tötung auf Verlangen vorzunehmen. Aktive Sterbehilfe steht in Österreich unter Strafe. Eine Diskussion über eine gesetzliche Regelung, wie sie bereits in den Niederlanden und Belgien exstiert, hat auch in Österreich begonnen. Einige Befürworter/innen der aktiven Sterbehilfe argumentieren mit der persönlichen Freiheit, die ein Recht auf Tötung auf Verlangen miteinbeziehen soll. Der freie Mensch wünsche sich ein Recht auf einen freigewählten Tod, will auch selbst Vorsorge treffen, die Kontrolle behalten beim eigenen Tod, notfalls aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Andere Befürworter/innen weisen daraufhin, wie unmenschlich, wie einsam, wie ängstlich, wie qualvoll gestorben wird und fordern -> Euthanasie (S. 119 im Buch), damit das nicht mehr Ertragbare beendet werden kann. Hier kommt die Angst vor dem Sterben zum Ausdruck, sie ist immer auch ein Stück Lebensangst. Zuerst sind also im Sinne der -> Hospizbewegung (S. 121 im Buch) Strukturen und Möglichkeiten für ein würdevolles Sterben zu schaffen und auszubauen. Vom Wunsch nach aktiver Sterbehilfe werden dann einige Menschen Abstand nehmen. Andere werden trotzdem eine gesetzliche Verankerung der aktiven Sterbehilfe nicht aus den Augen verlieren. Eine Diskussion darüber hilft allen.
ist griechisch und heißt Punkt, Fleck, Merkmal, Brandmal. Stigma ist ein Merkmal eines Menschen, das zu Reaktionen der Abwendung und Ausgrenzung führen kann. Stigmatisierung bedeutet, Menschen mit einem mehr oder weniger auffälligen Merkmal zusätzliche negative Vorurteile zuzuschreiben, die unbegründet sind, nicht der Realität entsprechen. Beispielsweise werden Menschen mit Erkrankungen, welche die Gesichtsmimik beeinträchtigen, seien es Menschen mit spastischen Lähmungen oder Menschen mit Parkinson-Erkrankung, für dumm, für depressiv, für taktlos und uninteressiert gehalten. Ein Stigma erleichtert die Zuschreibung von weiteren negativen Eigenschaften. Das Stigma kann zur zweiten, zur zusätzlichen Krankheit werden. Menschen, die hervorstechende Merkmale nicht verbergen können, weichen dieser zweiten Krankheit aus, ziehen sich zurück oder lernen, sich gegen die negativen Zuschreibungen zu wehren. Unwissen und Ahnungslosigkeit spielen beim Thema Stigmatisierung eine große Rolle. So hat beispielsweise der Weltverband für Psychiatrie ein Anti-Stigma-Programm gegen Stigma und Diskriminierung ins Leben gerufen, das Wissen, Einstellung und Verhalten der Menschen gegenüber -> schizophren Kranken (S. 126 im Buch) verändern will.
Kapitel 1
Bechtold, Johannes: Radl fahrn in Korsika, das wär ne tolle Sache! - Autonome. Lebensformen von und für Menschen mit Behinderung.Diplomarbeit, Innsbruck 1998
Eggli, Ursula: Freakgeschichten für Kinder und Erwachsene. RIURS-Eigenverlag, Bern 1983
Niedecken, Dietmut: Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. Ein Buch für Psychologen und Eltern. Piper, München 1989, 3. akt. Aufl., Luchterhand, Neuwied 1998. ISBN: 3-472-03606-0
Kapitel 2
Theunissen, Georg / Plaute, Wolfgang: Empowerment und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch. Lambertus Verlag, Freiburg in Breisgau 2002. ISBN: 3-7841-1336-2
Pfaffenbichler, Maria: Lebensqualität durch Arbeitsassistenz. Berufliche Integration behinderter Menschen - ein Erfolgsbericht.Studienverlag, Innsbruck-Wien 1999. ISBN: 3-70651281-5
Österwitz, Ingolf: Independent Living. Paradigmenwechsel in der Rehabilitation. In: Integra Tagungsmagazin der Fachmesse für Rehabilitation und Integration. Altenhof am Hausruck 1994, S. 45 - 54 im Buch.
Burtscher Reinhard: Behindertenpolitik und Emanzipation - Aktuelle Situation der Integration. 1999, online unter: http://www2.uibk.ac.at/bidok/bib/recht/burtscher-politik
Doose, Stefan: Unterstützte Beschäftigung - Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich. Hamburg 1997, online unter: http://www2.uibk.ac.at/bidok/bib/arbeit/doose-vergleich
Badelt, Christoph / Österle, August: Supported Employment - Erfahrungen mit einem österreichischenModell zur beruflichen und sozialen Integration behinderterMenschen. In: Badelt, C. (Hg.): Geschützte Arbeit. Böhlau Verlag, Wien 1992, S. 79 - 150 im Buch. ISBN: 3-20505-552-7
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen/Blumberger/Leutgeb: "Qualifizierungsinitiative in Integrativen Betrieben" - Evaluierungsabschlussbericht, Wien 2001, www.bmsg.gv.at/bestellservice
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen/Blumberger/Heilbrunner/Moser: "Arbeitsassistenz in Österreich" - Entwicklung und Perspektiven, Wien 2002, www.bmsg.gv.at/bestellservice
Kapitel 3
Nirje, Bengt: Das Normalisierungsprinzip - 25 Jahre danach. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 63, 1994 /1, S. 12-32 im Buch
Thimm, Walter: Das Normalisierungsprinzip. Eine Einführung. Kleine Schriftenreihe der Bundesvereinigung Lebenshilfe. 6. akt. Aufl., Marburg 1995 ISBN: 3-88617-102-7
Feyerer, Ewald: Behindern Behinderte? Integrativer Unterricht auf der Sekundarstufe I. Studien zur Bildungsforschung & Bildungspolitik, Bd. 21, Studien Verlag, Innsbruck-Wien, 1998 ISBN: 3-7065-1321-8
Ramberger, Monika: Der Funktionswandel der Sonderschule. Diplomarbeit Universität Wien 2001
Kapitel 4
Steingruber, Alfred: Der Behindertenbegriff im österreichischen Recht. Abdruck der approbierten Diplomarbeit an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz, Juni 2000
Kapitel 5
Biermann, Adrienne: Gestützte Kommunikation im Widerstreit. Edition Marhold im Spiess Verlag, Berlin 1999. ISBN: 3-89166-988-7
Prillwitz, Siegmund: Angebote für Gehörlose im Fernsehen und ihre Rezeption. Universität Hamburg 2001. ISBN: 3-934857-03-5. Bestellung: Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen (ULR) www.ulr.de
Kapitel 6
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen: "Leitlinien zur Gestaltung von barrierefreien Websites", Wien 2002, www.bmsg.gv.at/bestellservice
Kapitel 7
Brosch, Werner (Hg.): Sterben als Lebensabschnitt Ethische Fragen im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. edition pro mente, Linz 2000. ISBN: 3-901409-31-9
Goffman, Erving H.: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität.Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975. ISBN: 3-518-27740-5
Kneihs, Benjamin: Grundrechte und Sterbehilfe. Verlag Österreich, Wien 1998. ISBN: 3-7046-1233-2
Redlich, Fredrick C. / Freedman, Daniel X.: Theorie und Praxis der Psychiatrie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976. ISBN: 3-518-27748-0
Susan Sontag: Krankheit als Metapher. Fischer, Frankfurt am Main 1981. ISBN: 3-596-23823-4
Mag. Michaela Braunreiter
geboren 1973 in Kirchdorf a. d. Krems (OÖ) / Studium der Ethnologie und Politikwissenschaft an der Universität Wien / während des Studiums Betreuung von Schülergruppen beim Projekt Schülerradio des Bildungsministeriums / Absolventin und Mitarbeiterin des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
Buch der Begriffe: Projektmitarbeit
-
Kapitel 6: Einleitung und Begriffe zu den Themen: Accessibility, Usability, barrierefreies Web, elektronische Hilfsmittel und Leitsysteme für Menschen mit Sehbehinderung
-
in Kapitel 3: Bildung für alle, Normalisierungsprinzip, soziale Integration
Beate Firlinger
geboren 1961 in Linz (OÖ) / freiberufliche Journalistin und Mitarbeiterin des ORF-Hörfunks / Lektorin am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien / Teilhaberin der Multimedia-Firma CultureCodes / Redaktion und Projektmanagement für Multimedia- und Internet-Projekte / inhaltliche Leitung und Organisation des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
Buch der Begriffe: Projektleitung, Gesamtkonzept und Redaktion
Kornelia Götzinger
geboren 1962 in Wien / Behindertenbeauftragte an der Universität Wien / freiberufliche Trainerin, Mediatorin, PR-und Kommunikationsberaterin / mehrjährige Erfahrung bei Non-Profit-Radios (Schwerpunkte: Biographien, Recht, Sachbücher, Veranstaltungen) / Absolventin des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
-
Kapitel 1: Einleitung und Begriffe (gemeinsam mit Marlies Neumüller)
-
Kapitel 6: Begriffe zu den Themen: barrierefreies Bauen, Wohnen, Mobilität, Rollstühle, Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
-
in Kapitel 5: Dialog im Dunkeln
Dr. Hans Hirnsperger
geboren 1962 in Schwaz (Tirol) / Studium der Medizin / Facharzt für Psychiatrie und Neurologie / beschäftigt am Institut für Medizinische Psychologie der Universität Wien / Gründungsmitglied von Bizeps - Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung / Absolvent des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
-
Kapitel 7: Einleitung und Begriffe
-
in Kapitel 1: Pflegefall
Mag. Andrea Martiny
geboren 1973 in Mödling (NÖ) / Studium der Anglistik und Geografie & Wirtschaftskunde an der Universität Wien (Schwerpunkt Sprachwissenschaft, Diplomarbeit über Sprache und Identität) / während des Schulpraktikums Unterricht in einer Integrationsklasse / derzeit Ausbildung zur Integrationslehrerin an der Pädagogischen Akademie Linz.
-
Kapitel 3: Einleitung und Begriffe
Karin Martiny
geboren 1970 in Mödling (NÖ) / Studium der Völkerkunde und vergleichenden Literaturwissenschaften an der Universität Wien / nach Abbruch des Studiums vermehrte Tätigkeit im künstlerischen Bereich (Lehrgänge für Keramik und Fotografie an der künstlerischen VHS in Wien) / Mitarbeit in verschiedenen Vereinen und Projekten wie "Amnesty International", "SOS-Mitmensch", "Jung & Alt" / derzeit Mitarbeiterin von Integration: Österreich in den Projekten k21 und Bilddatenbank.
-
Kapitel 5: Einleitung und Begriffe
Marlies Neumüller
geboren 1980 in Freistadt (OÖ) / Besuch und Abschluss der Handelsakademie im Schulzentrum Ungargasse in Wien / derzeit Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien / Absolventin des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
-
Kapitel 1: Einleitung und Begriffe (gemeinsam mit Kornelia Götzinger)
-
Kapitel 6: Mitarbeit bei Begriffen zu den Themen: barrierefreies Bauen, Wohnen, Mobilität, Rollstühle, Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
Jasna Puskaric
geboren 1980 in Wien / Besuch und Abschluss der Handelsakademie im Schulzentrum Ungargasse in Wien / seit Oktober 2001 Studium der Rechtswissenschaften in Wien / Absolventin des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
-
Kapitel 4: Einleitung und Begriffe
Petra Wiener
geboren 1978 in Gmunden (OÖ) / Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Wien / im Rahmen der Diplomarbeit Mitarbeit am I:JL-Begleitforschungsprojekt und gleichzeitig Absolventin des Integrativen Journalismus-Lehrgangs.
-
Kapitel 2: Einleitung und Begriffe
Dank an pro mente austria und Herrn Mag. Christian Rachbauer, der den Begriff "Psychische Behinderung" (Kap. 7) beigesteuert hat.
Viele nichtbehinderte Menschen reagieren hilflos, mitleidig oder peinlich berührt, wenn sie mit einer für sie "schrecklichen" Behinderung konfrontiert werden.
Diese Unfähigkeit mit einer Situation umzugehen, manifestiert sich im Sprachgebrauch. So finden sich zahlreiche Redewendungen, die scheinbares Leid implizieren. Beispiele dafür sind: "an Behinderung leiden", "einen Schicksalsschlag erleiden", "sein Leben fristen müssen", "hilfsbedürftig sein" oder "an den Rollstuhl gefesselt sein" ...
Das "Buch der Begriffe" ist ein ungewöhnliches Wörterbuch zu Fragen von Behinderung und Integration. Das Nachschlagewerk listet nicht nur eine Reihe von Begriffen und Ausdrücken auf, die behinderte Menschen sprachlich diskriminieren. Es bietet auch Anleitungen für einen nicht - diskriminierenden, respektvollen Umgang mit Sprache und erläutert wichtige Fachbegriffe. Entstanden ist das "Buch der Begriffe" in einer Kooperation von Integration: Österreich und dem Integrativen Journalismus-Lehrgang. Gefördert wurde das Projekt vom Bundessozialamt, Landesstelle Salzburg, aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung.
integration österreich
Das Werk einschließlich all seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig.

Logo: Bundessozialamt

Logo: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

Logo: Integration:Österreich
© Copyright: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, Integration:Österreich
Herausgeber: Integration:Österreich / Beate Firlinger
Redaktion: Beate Firlinger
Konzept und Texte: Integrativer Journalismus-Lehrgang (siehe Autor/innen - Verzeichnis)
Illustrationen, Layout, Satz und Umschlaggestaltung: Barbara Schuster, 5m - mindwarp network, Wien
Druck und Bindung: Ing. Walter Adam Ges.m.b.H., Wien
Kontakt: Integration:Österreich, Tannhäuserplatz 2, 1150 Wien, Email: info@ioe.at. Wien 2003
Quelle:
Beate Firlinger: Buch der Begriffe. Sprache, Behinderung, Integration
Herausgegeben von: Integration: Österreich
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 15.05.2007
