Ein Zwischenbericht von Georg Feuser
Georg Feuser (1984/1987): Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Hrsg.: Diakonisches Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten. Bremen [die Originalarbeit]
Inhaltsverzeichnis
- Eine Vorbemerkung und Orientierung
- 1. Ein Blick zurück dient dem, wieder voran zu kommen ...
- 2. Die besondere entwicklungspsychologische und pädagogische Relevanz inklusiver Früher Bildung
- 3. Literaturhinweise
- 4. Redaktionelle Hinweise zum „Zwischenbericht: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim” von 1984 (19872)
- 5. Und heute?
- 1. Allgemeine Grundlagen eines Verständnisses von Integration und dessen pädagogischer Umsetzung im Zusammenhang der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
- 2. Die Entwicklung des Vorhabens gemeinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting
-
3. Grundlagen und Aspekte der pädagogischen Konzeption der gemeinsamen
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
- 3.1 Allgemeine Grundlagen menschlicher Entwicklung und deren neuropsychologische Struktur
- 3.2 Die lernpsychologische Struktur der Anpassungs- und Aneignungsprozesse im ersten und zweiten Signalsystem
- 3.3 Die entwicklungspsychologische Struktur menschlicher Anpassungs- und Aneignungsprozesse
- 3.4 Aspekte der pädagogischen Arbeit und deren Organisation im Alltag des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
- 4. Integration - eine weitreichende Aufgabe!
- 5. Aspekte der wissenschaftlichen Begleitung
- Schlussbemerkungen
- Anmerkungen
- Literaturhinweise zur Integration
Es mag noch einige Menschen geben, die sich an das nebenstehende Titelblatt und vielleicht sogar an das ganze Buch erinnern können und damit an die Entwicklung der damals so benannten „Vollintegration”[1] in den Kindertagesheimen der Brem. Ev. Kirche, getragen durch den Landesverband für Ev. Kindertagesstätten in Bremen.
Es wäre schön, man könnte es heute als anachronistisch erachten, diesen Bericht, der erstmals 1984 erschienen ist[2], nach 34 Jahren noch einmal aufleben zu lassen und ihn in der Digitalen Volltextbibliothek „bidok”[3] daran interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Dem ist leider nicht so.

Nach mehr als vier Jahrzehnten der Entwicklung der Integration im deutschsprachigen Raum, heute spricht man vor allem nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention[4] von „Inklusion”, ist es noch immer keine Selbstverständlichkeit, (a) dass Kinder mit Beeinträchtigungen in ihrem unmittelbaren Wohnbereich einen inklusiv arbeitenden Kindergarten besuchen können und (b) eben keinem Kind wegen Art und Schweregrad seiner Beeinträchtigungen der Zugang und die aktive Teilhabe an der Frühen Bildung[5] verwehrt wird.
Das ist im Grunde eine ernüchternde Bilanz. Sie paart sich damit, dass bis heute - selbst in der entsprechenden Fachliteratur - noch immer nicht wirklich erkannt wird, wie bedeutend gerade dieser Altersbereich für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen hinsichtlich seiner sozialen und individuellen Existenz, zusammengefasst in seiner „Subjektwerdung“, ist und welche Bedeutung dem für eine gelingende Inklusion im institutionalisierten Schulsystem zukommt. Eine inklusive „Frühe Bildung” vor dem Schuleintritt ist unverzichtbar, um vor allem auch den Eltern Zeit und Raum zu geben, die Qualität einer gemeinsamen Erziehung und Bildung ohne den immensen Druck, der schon von der Grundschule ausgeht, erfahren zu müssen. Viele der Problemstellungen schulischer Inklusion, die oft als nicht lösbar angesehen werden und letztlich zu einer selektierenden Inklusion führen - insgesamt gesehen zur Tendenz der Integration der Inklusion in die Segregation, die für die gesamte Entwicklung der Integration/Inklusion kennzeichnend ist, weshalb ich von Inklusionismus spreche (Feuser 2012), sind Artefakte, die aus einer nicht inklusiven Frühen Bildung resultieren. Ohne eine solche wird in dieser dafür hoch sensiblen Entwicklungsphase unter dem Einfluss der erfahrenen und erlebten Selektionen und Ausgrenzungen der andere Mensch bezogen auf die als abweichend oder gar schon befremdend wahrgenommenen Merkmale, die beobachtet werden können, zum anderen Anderen. In der Alterspanne 3-6 Jahre werden zentrale Grundlagen der Anerkennung des anderen Menschen als Mensch wie ich es bin, gelegt - eine sehr zentrale Grundlage einer Identitätsbildung, durch die der Andere nicht mehr der andere Andere ist, wie ich das über viele Jahre hinweg täglich erfahren durfte, sondern ein Mensch wie ich unter seinen Ausgangs- und Randbedingungen für Leben, Lernen und Entwicklung.[6] So war es, was auch im Bericht deutlich wird, z.B. den Kindern kein Problem, wenn sie im Kreis saßen und jedes Kind eine Handlung in der Mitte des Kreises ausführte, zehn Minuten zu warten, bis Katinka, ein tetraspastisches Mädchen mit seiner Assistenz seine Aufgabe in der Kreismitte erledigt und wieder in der Runde auf ihrem Stuhl Platz genommen hatte - und das war kein Erziehungsproblem disziplinarischer Art den anderen Kindern gegenüber.[7]
Unter diesen Gesichtspunkten legitimiert sich die Wiederzurverfügungstellung dieses Berichtes nicht nur seiner - bezogen auf die Integrationsentwicklung in der BRD - historischen Bedeutung wegen, sondern vor allem hinsichtlich der entwicklungspsychologischen und damit auch pädagogischen und Sozialraum bezogenen Bedeutung. Dies auch, um zu verdeutlichen, wie widersinnig es ist, noch immer die Ausbildung der Fachpersonen der Frühen Bildung getrennt von der der Lehrpersonen für den Bereich der Primarschule zu praktizieren, wie es längst überfällig ist, eine Lehrerbildung getrennt für Heil- und Sonderpädagogik und Regelpädagogik zugunsten einer einheitlichen Lehrerbildung zu überwinden. Es bedarf eines gemeinsamen humanwissenschaftlich basierten Bachleor-Studiums für alle späterhin in Feldern der Pädagogik tätigen Fachpersonen und eines darauf aufbauenden Masterstudiums mit spezifischen Vertiefungen und Spezialisierungen, die allerdings nicht in den Schulstufen und Schulformen oder in einzelnen Fächern zu sehen sind, wie es sie heute noch gibt, sondern differenziert hinsichtlich einer uneingeschränkten Teilhabe Aller in allen Lebens- und Lernbereichen von Gesellschaft und Kultur (Feuser 2013a).
Vor allem mit dem 2017 erschienenen, von Donja Amirpur und Andrea Platte herausgegebenen „Handbuch Inklusive Kindheit” verbinde ich die Erwartung, dass doch endlich die skizzierten Erkenntnisse über die Bedeutung der Frühen Bildung ins individuelle Bewusstsein von Fachpersonen und ins kollektive Bewusstsein der Eltern und der bildungspolitisch Verantwortung tragenden Menschen gelangen mögen. Diesbezüglich kann der Bericht über die Entwicklung der Vollintegration in Bremen zumindest verdeutlichen, was, Ende der 1970er Jahre beginnend und Anfang der 1980er Jahre umfassend praktiziert schon möglich war. Unter der heute euphemisierten und mystifizierten Formel der Inklusion, die mehr Heilsversprechen ist, als Kampfansage an gesellschaftliche Ausgrenzungs-, Marginalisierungs- und Prekarisierungsprozesse, bleiben diese Grundlagen und Erfahrungen selbst in Fachkreisen ignoriert und verdrängt oder können noch nicht wieder gedacht werden.
Um den Bericht diesbezüglich lesbarer zu machen, stelle ich ihm hier (1) eine kurze Orientierung auf die damaligen Entwicklungsprozesse der Integration voran und verweise (2) in der gebotenen Kürze vertiefend auf die besondere entwicklungspsychologische und pädagogische Relevanz einer inklusiven Frühen Bildung. Dem füge ich (3) einige wichtige Literaturhinweise an; allerdings nur bezogen auf diese Orientierung. Schließlich verbinde ich das (4) noch mit einigen redaktionellen Hinweisen auf den Text des Berichtes. Die Frage des weiteren Verlaufs der Entwicklungen würde eine eigene Arbeit erfordern. Unter (5) „Und heute?” gebe ich einen Hinweis auf eine im Netz zur Verfügung stehende Dokumentation, die diesbezüglich einige Fragen beantworten kann, aber keine fachwissenschaftliche Analyse leistet und auch nicht leisten will.[8] Darüber hinaus erlaube ich mir eine knappe kritische Betrachtung der mit der Frühen Bildung in Zusammenhang zu bringenden Fragen der Zeit.
[1] Es wurde damals oft auch - das abschätzend - von der „totalen Integration” gesprochen, da wir, was bis heute in der BRD und leider auch nach Inkrafttreten der UN-BRK noch einmalig sein dürfte, Kinder ohne Ansehen der Art oder des Schweregrades ihrer Behinderung in den Kindergarten ihres Wohnbezirkes aufgenommen haben und damit im Laufe der ersten sieben Jahre in Bremen eine flächendeckende, regionalisierte und dezentralisierte Integration aufbauten.
[2] Das Buch wurde 1987 in unveränderter Form noch einmal aufgelegt und dürfte, so meine Information, weit über zehntausend Mal verkauft worden sein. D.h., es wurde auch nach 1987 noch nachgedruckt und in vielen Aus-, Fort- und Weiterbildungszusammenhängen, bei Fachtagungen und Kongressen verwendet und bei entsprechenden Anlässen auch an interessierte Fachpersonen, Eltern und Organisationen verschenkt.
[3] Siehe: http://bidok.uibk.ac.at/
[4] Siehe: Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2014). Inklusion bewegt. Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Berlin: Druckerei des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Bonn Die UN-BRK ist in Deutschland am 26. März 2009, in Österreich am 26. Okt. 2008 und in der Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten.
[5] Mit dem Begriff der Frühen Bildung kennzeichne ich hier alle institutionalisierten Erziehungs- und Bildungsangebote im Altersbereich bis zur Einschulung; in besonderer Weise den Elementarbereich. Verwiesen sei auch auf den Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen von 2004; https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_04-Fruehe-Bildung- Kitas.pdf [10.08.2016]
[6] Anzumerken wäre noch, dass es stets selbstverständlich war, dass Kinder mit Migrationshintergrund, anderer Kultur, Sprache und Religion, ohne dass dies in besonderer Weise hätte thematisiert und veranlasst werden müssen, integriert waren. Heute dividiert man im Inklusionismus wieder Migrationsinklusion und Behinderteninklusion auseinander (wie ich hörte selbst in Denominationen von Professuren), wohl der Ideologie verpflichtet, Differenz konstruieren zu müssen, obwohl es Menschen nur in ihrer individuellen Einmaligkeit - und damit ein jeder von einem anderen different - gibt (und seien es eineiige Zwillinge).
[7] Stellvertretend für Bücher füllende Erfahrungen hier noch ein Beispiel, wie sehr die »Inklusion« im Kindergarten bzw. später im schulischen Alltag mit dem außerschulischen Leben in der Kommune verbunden war und eine nicht zu trennende und auch praktizierte Einheit wurden: So waren in Bremen selbst schwer beeinträchtigte Kinder z.B. oft mehrere Tage nacheinander in der Familie eines anderen Kindes aus dem Kindergarten zu Gast, obwohl man sich zuvor, oft im selben Wohnblock wohnend, nicht einmal persönlich kannte oder wusste, dass es in einer benachbarten Familie ein behindertes Kind gab. Das entlastete die Familien und gab zuvor nie mögliche Spielräume in der Alltagsgestaltung vor allem für die Mütter, ohne dass professionelle und institutionalisierte Dienste in Anspruch genommen werden mussten. So lud ein Junge mit einem zerebralen Anfallsleiden ein durch eine tetraspastische Parese schwer beeinträchtigtes Mädchen zu sich nach Hause ein, das in allen Verrichtungen des Alltags volle Hilfe benötigte. Die Mutter des Jungen war aufgelöst und meinte, dass sie dem nicht entsprechen könnte. Ihr das Mädchen einladender Sohn tröstete sie und meinte, ich weiß, wie das geht, ich sage Dir das alles und wir machen es zusammen. Die Einladung kam zustande und verlief für alle sehr befriedigend und erfreulich und war der Beginn einer langen familiären Freundschaft. Solches war bald selbstverständlich. Das schafft ganz andere Ausgangsbedingungen für eine Inklusion in der Schule.
[8] Es sei noch der Hinweis auf ein mit diesem Bericht verbundenes Kuriosum erlaubt: Den Bericht habe ich in 21 Tagen erstellt; im Grunde Tag und Nacht arbeitend. Dadurch bedingt hat es viele Tipp- und Schreibfehler gegeben und auch manche Satzkonstruktion ist unbemerkt etwas aus dem Ruder gelaufen. Zeit für eine Durchsicht der Druckvorlage gab es nicht. Der hinsichtlich meiner Sozialisation bedeutende russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewskij [siehe Feuser, G. (2017): Es ging immer um das Mögliche, das im Wirklichen nicht sichtbar ist! In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2017. Berlin: Lehmanns Media, S. 72- 109] hatte unter großer finanzieller Not und von Verhaftung bedroht, um dem Schuldgefängnis zu entkommen, seinen Roman „Der Spieler” in genau 21 Tagen geschrieben. Er ist 1867 mit annähernd vergleichbarem Umfang erschienen und wurde ein Welterfolg. Er konnte ihn seiner späteren Frau Anna Grigorjewna diktieren. Ich war froh, den Bericht in diesem Zeitraum erstellt zu haben, wohl wissend, dass seine Qualität weit unter den damit verbundenen Ansprüchen geblieben ist.
Seit Mitte der 1970er Jahre gibt es im deutschsprachigen Raum in Feldern der Pädagogik und des institutionalisierten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems (EBU) eine intensive Befassung mit Fragen des „gemeinsamen Lebens und Lernens“ behinderter und nicht behinderter Kinder. Ich greife auf diese Formulierung zurück, weil sie das damals mit dem Begriff der Integration gefasste Begehren von Eltern, dass ihre behinderten Kinder gleich deren nichtbehinderten Alterskameraden einen Kindergarten und die Schule ihres Wohnbezirks besuchen können, am besten auf den Punkt bringt. Sie wollten ihre als behindert klassifizierten Kinder den als nichtbehindert geltenden gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt wissen. Diese Anerkennung war das zentrale Anliegen vieler Eltern. Und dieses konnte seinen Ausdruck konsequenterweise nur in der Forderung eines gemeinsamen Lebens und Lernens unmittelbar am Wohnort der Familien finden, was folgerichtig den Ausgrenzungs- und Separierungspraxen der Kinder in Sonderinstitutionen entsprechend den kategorialen Zuordnungen der diagnostizierten Beeinträchtigungen widersprach. Den Eltern wurde ihr konsequentes Eintreten für ihre behinderten Kinder oft und vehement als Unfähigkeit ausgelegt, die Behinderung ihrer Töchter oder Söhne akzeptieren zu können, unangemessene Ziele hinsichtlich Lernen und Entwicklung ihrer Kinder zu verfolgen und ihren Kindern dadurch zu schaden, wovor man die Kinder schützen müsse.
Spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten vollzog sich ein erster, sehr rigider Verweis vor allem der offensichtlich physisch, in ihrer Entwicklung und psychisch beeinträchtigten Kinder in die entsprechenden Sonderkindergärten, zu denen sie oft quer durch Städte oder übers Land gefahren werden mussten. Dies schon früh am Morgen bevor andere Kinder in den Kindergarten ihres Wohnbezirks gebracht wurden oder sich auf den Schulweg machten. Nach Hause kamen sie meist erst dann wieder, wenn die anderen Kinder längst mit ihren Spiel- und Freizeitaktivitäten beschäftigt waren. Das bedeutete für behinderte Kinder einen Tagesablauf, der, würden Gymnasiasten davon betroffen worden sein, mit Sicherheit zu breiten Gegenmaßnahmen der Eltern geführt hätten. Für erst im sozial- und leistungsnormierten Schulsystem auffällig werdende Kinder vollzog sich deren Selektion, Ausgrenzung und inkludierende Separierung ins Sonderschulsystem dann schon im Prozess ihrer Schullaufbahn. Diese vordergründig wohl hinlänglich bekannten Prozesse verlangen dennoch eine Verdeutlichung unter drei Aspekten:
-
Die lern- und entwicklungspsychologisch gesehen am schwersten beeinträchtigten Kinder. Erfahren hinsichtlich des Lebensalters die früheste Herauslösung aus ihren regulären Lern- und Lebensumfeldern und aus der sozialen Gemeinschaft des Wohnumfeldes.
-
Sie werden oft schon vor dem Kindergartenalter in zentralen Institutionen, die in der Regel lange Anfahrtswege erforderlich machen, mit vergleichbar beeinträchtigten Kindern, die aus anderen Regionen kommen, zusammengeführt, so dass sie keine gemeinsamen Lebenserfahrungen teilen und schließlich werden sie
-
entsprechend der diagnostizierten Art der Behinderung und des Schweregrades gemäß einer kategorialen Heil- und Sonderpädagogik in Kindergärten bzw. Kindergruppen zusammengefasst.
Oft schon mit Eintritt in den Kindergarten, spätestens aber mit dem Übergang ins institutionalisierte EBU bewirken diese Verfahren für die Kinder (a) eine nahezu totale Entfremdung aus ihrem Lebensumfeld und, damit in Zusammenhang stehend, (b) einen Verlust sozial-interaktiver und kommunikativer Vertrautheit und Bindungssicherheit wie (c) einen Orientierungsverlust in Bezug auf die räumlich-zeitlichen Abläufe ihres Lebensumfelds, die sich zu potenzierten externen Bedingungen der Isolation verdichten und sich wiederum mit den beeinträchtigungsbedingten internen Bedingungen der Isolation integral akkumulieren (Feuser & Jantzen 2012; Jantzen & Meyer 2014). Das findet dann nahezu automatisch seine Fortsetzung in das Sonderschulsystem hinein. Dort werden vor allem an Schulen für Geistigbehinderte und Körperbehinderte, wie ich das in vielen Fällen zur Kenntnis nehmen musste, noch eigens Gruppen für schwerst-mehrfach, oder, wie man später klassifizierte, intensiv oder komplex Behinderte eingerichtet. An anderen Sonderschulen auch solche für Schüler mit so genannten „herausfordernden Verhaltensweisen” oder für „Verhaltensoriginelle”; Klassifikationen, die an Zynismus nicht mehr zu überbieten sind. Nach der Schulzeit fanden sich diese Menschen, denen mangels Erfüllung der Mindestvoraussetzungen auch der Zugang in den Anlernbereich der Werkstätten für Behinderte verwehrt blieb, in Tages- bzw. Beschäftigungsstätten und in zentralen Wohnheimen wieder.[9]
Die Forderung „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen“, mit der sich die deutschen Elterninitiativen bundesweit zusammenschlossen, hatte, wie aus den vorstehenden Hinweisen deutlich werden dürfte, weiter reichende Implikationen als sie der Mehrzahl der heute zur Inklusion vorliegenden Publikationen zu entnehmen sind. Die Eltern hatten erfahrungsbedingt ein feines Gespür für ein sie bevormundendes und paternalistisches Herrschaftsgebahren oder ihre Erniedrigung wegen Armut und sozialen Notlagen, mit denen sie zu kämpfen hatten. In Bremen waren entsprechende universitäre Veranstaltungen des Studiengangs Behindertenpädagogik selbstverständlich auch für Eltern offen und ebenso die mit Beginn der 1980er Jahre stattfindenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Personal der Kindergärten[10], so dass ein breites Bewusstsein der Bedeutung integrativer Kindergartenarbeit für die Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder geschaffen werden konnte. Dies verbunden mit der Einsicht in den das Lernen und die Entwicklung der Kinder behindernden bis (gerade in Bezug auf schwer beeinträchtigte Kinder) Lernen verunmöglichenden Charakter einer derart frühen Ausgrenzung aus dem regulären Lebensumfeld und der Inklusion in eine nach Behinderungsart und -schweregrad segregierten Frühen Bildung.
Aus dem Begehren der Anerkennung ihrer Kinder, mit der berechtigt auch die durch ein behindertes Kind in vielen Fällen erfolgte soziale Stigmatisierung bis Ächtung der Eltern selbst zurückgewiesen wurde, entwickelte sich folgerichtig die Forderung der nahtlosen Fortsetzung der Kindergartenintegration in einer integrativen Schullaufbahn. Diese auch getragen von hohem Sachverstand in verschiedensten humanwissenschaftlichen Dimensionen, den sich viele Eltern im Laufe der dreijährigen Kindergartenzeit angeeignet haben - auch heute als „bildungsferne“ Eltern bzw. Familien diskreditierte, ein Terminus, der leider auch in pädagogischen Diskursen Verwendung findet.[11] Integration wurde von uns von Anfang an als ein Gesellschaftsprojekt verstanden, in dem Bildung in den ersten zwei Lebensjahrzehnten der Menschen allgemein eine besondere Rolle einnimmt, wobei die Zeit des Übergangs der Kinder aus der Familie in eine professionell organisierte und geleitete Lerngemeinschaft mit anderen Kindern für die Persönlichkeitsentwicklung speziell zu gewichten und von besonderer Bedeutung ist. Es war für Eltern behinderter wie nichtbehinderter Kinder geradezu selbstverständlich, eine integrative Schule einzufordern.[12]
Nach vier Jahrzehnten der Integration/Inklusion müsste es heute zumindest in pädagogischen Fachkreisen eine Selbstverständlichkeit sein, in den frühen Exklusionen (vor allem der schwerst behinderten bzw. entwicklungsbeeinträchtigten Kinder), den zentralen Schlüssel der Inklusion darin zu sehen, die Exklusionen dort außer Kraft zu setzen, wo sie sozial, kulturell und institutionell am ersten wirksam werden - in der Frühen Bildung. Diese Erkenntnis war in Bezug auf die Integrationsentwicklung leitend, die in der BRD mit integrativen Kindergarteninitiativen ihren Anfang genommen hat. Überwiegend blieb die Integration in Kindergärten aber auf solche beschränkt, die sich einem reformpädagogischen Modell verpflichtet fühlten, wie dies vor allem in Bezug auf Montessori-Kindergärten der Fall war. Dies war u.a. der Annahme geschuldet, dass reformpädagogische Modelle per se in der Lage seien, Integration zu realisieren. Zwar konnte man durchaus beobachten, dass die MitarbeiterInnen reformpädagogischer Kindergartenmodelle und auch die Eltern, die ihre Kinder dort aufgenommen haben wollten, dem Integrationsanliegen offener gegenüber standen, als dies in Bezug auf Einrichtungen in kommunaler oder auch kirchlicher Trägerschaft der Fall war. Aber die Geschichte der Reformpädagogik, aus der Kindergartenund auch Schulmodelle hervorgegangen waren, hatten hinsichtlich verschiedenster Momente ihrer theoretischen Grundlegung und ihrer Konzeption nicht die Reich- und Tragweite, dem Anliegen der Integration umfänglich zu entsprechen. Auch sie verhielten sich den aufzunehmenden Kindern gegenüber hinsichtlich der Art und des Schweregrades vorliegender Behinderung sehr selektierend. Ein großes Problem war auch, dass auf die wenigen integrativ arbeitenden reformpädagogischen Kindergärten sehr viele Eltern zukamen, die ihre behinderten und nichtbehinderten Kinder dort aufgenommen sehen wollten, was zwangsläufig allein schon aus Kapazitätsgründen zur Selektion zwang. Auch mussten vor allem die behinderten Kinder jetzt zu erreichbaren integrativ arbeitenden Kindergärten gefahren werden, wie zuvor zu den zentralen, kategorial ausgerichteten Sonderkindergärten der Fall gewesen war. Dadurch blieben sie auch mittels Integration gemeinsamen Lebensfeldern entfremdet, was auch auf ein gemeinsames Lernen negative Rückwirkungen hatte. Hinzu kam, dass integrative Kindergärten aus Finanzierungsgründen durch sozial- und Kinder- und Jugendbehörden als „teilstationäre Einrichtungen“ behandelt wurden. Das führte dazu, dass in einer Regelgruppe mindestens fünf als behindert diagnostizierte Kinder platziert werden mussten, um die damit verknüpften Auflagen erfüllen und das sonderpädagogische und therapeutische Personal vorhalten zu können. Nur in Bremen wurden die Kindertagesheime vollständig zu integrativ arbeitenden weiter entwickelt und die Sonderkindergärten in reguläre integrative Kindergärten ihres lokalen Einzugsbereiches überführt - und das ohne einen einschränkenden Versuchscharakter als Regelfall. Ich verweise hier exemplarisch auf den Bericht von 1984/1987, auf Feuser & Wehrmann 1985, Seidler 1992 und auf die Projektgruppe Integration (1981) aber auch auf die „Spandauer Verhältnisse“ (1989) und ich erinnere an die frühe integrative Kindergartenarbeit in Berlin-Friedenau.
Die Fläming-Grundschule in Berlin begann mit dem Schuljahr 1975/76 als erste Grundschule integrativ zu arbeiten (vgl. Projektgruppe Integrationsversuch 1988). In der ersten Hälfte der 1980er Jahre etablierten sich dann in einigen Bundesländern die „Schulversuche Integration“ (Erzmann 2003). Diese Schulversuche waren, mit wenigen Ausnahmen, so z.B. in Bremen (vgl. Feuser & Meyer 1987), nicht mehr in unmittelbarer Fortsetzung integrativer Kindergartenarbeit entstanden. Oft brauchte es Jahre, bis nach der integrativen Kindergartenarbeit eine integrative Beschulung erkämpft werden konnte und möglich wurde.[13] Das lenkte die Aufmerksamkeit im Allgemeinen und auch das Forschungsinteresse sehr schnell auf die schulische Integration, was im Feld der Pädagogik so bis heute dominiert. Dies auch bedingt durch die unterschiedlichsten Interessenlagen und Einflusssphären von Fach- und Lehrerverbänden und vieler Organisationen der Behindertenfürsorge aber auch pädiatrischer und psychiatrischer Institutionen, die der Integration zu Beginn überwiegend ablehnend gegenüber standen. Die Sorge der Sozial- und Behindertenhilfe, durch die Integration an Einfluss zu verlieren und als Träger von Sondermaßnahmen und -institutionen sogar überflüssig zu werden, was kaum offen thematisiert wurde, war und ist mit enormen wirtschaftlichen Interessen verbunden.[14]
Soweit ich die mit den 1980er Jahren eingetretene Entwicklung beurteilen kann, gerieten nicht nur das hier kurz skizzierte Verständnis der Integration als Gesellschaftsprojekt und die mit Beginn der integrativen Frühen Bildung verknüpften Erfahrungen zunehmend in Vergessenheit, sondern auch die Bedeutung der frühen Etappen der Persönlichkeitsentwicklung, die nicht nur für das schulische Lernen relevant sind, sondern lebenslang entsprechend ihrer Ausbildung in der frühen Kindheit sehr stabil bleiben. Die heute zur Thematik der Inklusion geführten wissenschaftlichen und fachlichen Diskurse entbehren aus meiner Sicht entsprechend fundierter entwicklungs-, lern- und sozial-psychologischer Grundlagen und sind in der Ausbildung der PädagogInnen in studienstruktureller und curricular-inhaltlicher Hinsicht katastrophal unterbelichtet. In ein Bild gefasst würde ich sagen: Ohne eine solide inklusive Frühe Bildung ist die schulische Inklusion in mehrfacher Hinsicht der Wortbedeutung ein Luftschloss oder, wie man auch sagt, in den Sand gesetzt.
Neben den schon erwähnten Problemlagen, die daraus resultieren, sei noch einmal betont, dass vor allem die Eltern, die für die Dauer der Kindergartenzeit nicht die Möglichkeit hatten, die Erfahrung inklusiven Lernens und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder zu machen, unter dem schon in der eigenen Schulzeit internalisierten Leistungsdruck und gegenwärtigen Optimierungswahn einer Informations-, Wissens- und Kreativgesellschaft hoch individualistischer Ausprägung, der längst die frühe Kindheit erreicht hat (vgl. Seifert-Karb 2015), schulischer Inklusion, heterogenen Lerngemeinschaften und einem zieldifferenten Lernen unsicher bis hoch vorurteilsbelastet gegenüber stehen.
Allgemein gesehen hat die Frühe Bildung heute eine beachtliche methodische Vielfalt bezogen darauf erreicht, dass z.B. lebensweltbezogen, projektorientiert, jahrgangsübergreifend und bilingual gearbeitet wird. Das alles sind gute Voraussetzungen auch für eine inklusive Arbeit. Diese aber erfolgt auch in den Kindergärten, wenn überhaupt, weitgehend unter Ausschluss der Kinder, wie es so schön heißt, mit „erhöhtem Förderbedarf“ bzw. „Bedarf an heilpädagogischen Fördermaßnahmen“, die den Sonderkindergärten überantwortet bleiben. Der auf Kinder mit schweren Beeinträchtigungen reduzierte „Rest-Sonderkindergarten” findet dann schließlich seine Fortsetzung in den dem „harten Kern”[15] vorbehaltenen „Rest-Sonderschulen”. Und auch die UN-BRK findet Interpretationen dahingehend, dass dies durchaus mit deren Geist zu vereinbaren sei, wie sich das in der 80-90:100-Regel ausdrückt, wie sie im Gutachten von Poscher, Rux und Langer (2008) mit Bezug auf den § 24 der UN-BRK vertreten wird.[16]
[9] In Berlin hatte man dafür einmal die Bezeichnung „Tageslagerstätte” in die Diskussion gebracht, was seitens der bei der Spastikerhilfe Berlin tätigen Psychologen abgewendet werden konnte.
[10] Über Jahre gab es in der Stadtgemeinde Bremen, organisiert durch den Landesverband der BEK, die „Zusatzausbildung Integration (ZA-INT)”, deren Curriculum den Grundfragen menschlicher Entwicklung unter Einbezug der relevanten humanwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihrer naturphilosophischen Grundlagen in ihrer historisch-logischen Entwicklung und Ganzheit entsprach (Feuser 1984b, 2018).
[11] Die Frage die hier unumwunden zu stellen und zu beantworten ist, ist die, ob nicht die Bildung den Eltern fern ist, denn diese der Bildung, wenn man sie allein durch eine solche Einschätzung von vornherein sozial ächtet und nicht mit ihre Erfahrungen, Interessen und Lebenslagen berücksichtigenden Bildungsangeboten auf sie zu geht. Auch Erwachsene bedürfen individualisierter Bildungsangebote; nicht nur die Kinder. Der Begriff selbst verdient der Ächtung als Unwort des Jahres.
[12] Alle Eltern stellten damals in Bremen Antrag auf integrative Beschulung und kein behindertes Kind wurde, wie zur Sonderschulüberweisung üblich, getestet. Die Eltern der Kinder lehnten dies ab. Die zukünftigen Lehrpersonen konnten die Kinder im Kindergarten kennen lernen und deren persönliche Situation wurde sehr differenziert unter Einbezug der Biographie und sozialen Lage der Kinder besprochen.
[13] Die Schulversuche dienten seitens der damit befassen Bildungspolitik und Administration zwar vordergründig der Sicherung des Kindeswohls, der Gewinnung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse über die neue Form integrativer Beschulung und ermöglichten, das mag damals ihre wichtigste Funktion gewesen sein, auch Abweichungen von den üblicherweise geltenden Schulgesetzen und Regularien. Die Schulversuche erfüllten im Besonderen aber eine ordnungspolitische Funktion der Sicherung und des Erhalts des gegliederten Systems und seiner rechtlichen Bedingungen. Das beweist auch die Tatsache, dass kein Schulversuch nach dessen Abschluss als reguläre Beschulungsform ins allgemeine EBU übernommen wurde.
[14] Große Verbände und Organisationen wie z.B, der Verband Sonderpädagogik e.V. oder die Bundesvereinigung Lebenshilfe, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, um nur einige zu nennen, vertreten bis heute keine für mich hinreichende Positionen in Bezug auf die Realisierung der
[15] Mit dem Begriff des „harten Kerns” bezeichneten wir in der 1968er Bewegung die schwerst und mehrfach beeinträchtigten, intensiv oder komplex behinderten Menschen und jene, die man z.B. auf dem Hintergrund tiefgreifender Entwicklungsstörungen als solche mit „herausfordernden Verhaltensweisen” charakterisiert hatte. Sie waren damals die Ausgeschlossenen und in Sondersysteme Eingeschlossenen (also sehr wohl inkludiert) und sie gelten auch heute noch überwiegend als nicht integrierbar, was mit der Zuschreibung eines besonderen Förderbedarfs kaschiert wird. Es wird so getan, als könne ein solche nur in Sonderinstitutionen gewährt werden während auch das dort, schaut man genau hin, häufig nicht der Fall ist.
[16] Als Zielvorstellung, so die Autoren, liegt der UN-BRK „eine fast vollständige Inklusion von Schülern mit Behinderungen in die Regelschulen zugrunde” (S. 27). Ebenso ergibt sich „aus dem Inklusionsziel des Abkommens von 80 bis 90% [...] nicht die Verpflichtung, genau diese Inklusionsquote zu erreichen” (S. 28). Zudem schließt der Art. 24, Abs. 1, der UN-BRK, so folgern die Autoren weiter, „die Existenz von Förderschulen nicht aus”. „Er enthält keine Vorgaben dazu, wie die 10 bis 20% der Schüler mit Behinderungen unterrichtet werden, die auch von einer inklusiven Regelschule nicht aufgenommen werden” (ebd.).
Die Befassung mit entwicklungspsychologisch relevanten Momenten, die der Bedeutung einer inklusiven Frühen Bildung Nachdruck verleihen und veranlassen, sie als unverzichtbare Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder von hoher Dringlichkeit zu erkennen, tangiert die Grundlagen menschlicher Lebenstätigkeit im Allgemeinen, wie eine differenzierte lern-, entwicklungs- und sozialpsychologische Betrachtung der Persönlichkeitsentwicklung in der Spanne von der Säuglingszeit bis zum Schuleintrittsalter. Darauf bezogen kann hier nur kurz skizziert werden, dass Persönlichkeit sich nicht, wie im Verständnis der differenziellen psychologischen Forschung traditionell üblich, aus beobachtbaren Erscheinungen konstituiert, die sich jeweils voneinander isolieren und beeinflussen lassen, wie z.B. Affekte, Emotionen, Kognitionen, Begabung, Intelligenz, Bedürfnisse, Motive, Wille oder auch Extra- bzw. Intraversion, sondern dass diese als vermeintliche „Eigenschaften“ eines Kindes aufscheinenden Momente nur von der Gesamtpersönlichkeit ausgehend zu begreifen sind. Schon zu Beginn des Kindergartenalters drücken sie sich in der Einheit produktiv-gegenständlich-kooperativer und kreativer Tätigkeit aus, die sie hervorbringen. Die Erkenntnis, dass die menschliche Persönlichkeit nicht als Summe ihrer Eigenschaften verstanden werden kann, die als vorrangige Aufgabe einer „Vorschulpädagogik“ als einzelne Komponenten auszubilden und zu fördern sind, um - es sei einmal so deutlich gesagt - die Kinder schultauglich zu optimieren, dürfte im wahrsten Sinn des Wortes ein „revolutionäres“ Moment inklusiver Früher Bildung sein. Dabei ist auch zu sehen, dass viele Eltern selbst starker Motor des Ansinnens sind, die Frühe Bildung funktional auf eine „Vorschule“ zu reduzieren und schon viele Kinder dieses Alters Terminpläne für das isolierte Training einzelner für bedeutend gehaltenen Funktionen haben, die einem voll beschäftigten Erwachsenen in nichts nachstehen. Allein die erforderlichen Veränderungen des Bewusstseins der Fachpersonen dürfte sich als ein schwieriges Unterfangen erweisen und erfordern, wie schon angesprochen, eine grundlegende Veränderung der Ausbildung für den Elementarbereich.[17]
Boshowitwsch (2016) stellt fest: „Die Persönlichkeit ist tatsächlich ein höchst integratives System, eine nicht aufzulösende Ganzheit” (S. 86). Ihre Entwicklung kann im Sinne Vygotskij’s - hier sehr verkürzt dargestellt - als eine Abfolge von Neubildungen verstanden werden, die sich von Geburt an aus den ständigen Wechselwirkungen der affektiv erlebten primären Bedürfnisse nach Nahrung, Wärme, Bewegung u.a. (sie können auch als homöostatische Bedarfe verstanden werden) mit ihrer Einlösung und Befriedigung durch eine erwachsene Bezugsperson (in unserem Kulturkreis in der Regel die Mutter des Kindes) generieren, wodurch neue Bedürfnisse entstehen, die wir als soziale Bedürfnisse und Bedürfnisse nach neuen Eindrücken verstehen können. Es geht dabei also um wechselwirkende Tätigkeitsverhältnisse, um Kommunikationen, die in Kooperationen eingebunden sind und sie konstituieren, so auch eine geteilte Aufmerksamkeit bezüglich deren gegenständlicher Seite. „Das Erleben ist gleichsam ein Knoten, in dem die Einflüsse verschiedener äußerer und innerer Bedingungen miteinander verknüpft sind”, so Boshowitsch (1970, S. 116). Es bildet eine untrennbare Einheit von Subjekt und Umwelt und das jeweils erreichte Entwicklungsniveau bestimmt darüber, was das Kind erlebt und was es mit diesem Erleben auf dem Hintergrund seiner vorliegenden Erfahrungen bedeutungsmäßig verknüpft. In gleicher Weise untrennbar verbunden sind das emotionale Erleben, das als affektiver Zustand verstanden werden kann (und nicht mit einem durch äußere Umstände bedingten Affekt im Sinne eines Gefühlsausbruchs, der zu einem Kontrollverlust über das Handeln führen kann, weil er Bewusstsein und Wille beeinträchtigt, zu verwechseln ist) mit den für das Subjekt lebenswichtigen Bedürfnissen und Bestrebungen. In diesen Zusammenhängen differenzieren sich die Wahrnehmung, das Gedächtnis, ausgehend von einfachen Formen des Wiedererkennens, das Denken in Form sich immer differenzierterer Eindrücke und die Wahrnehmung der Gegenstände in Verbindung mit sich ausbildenden Emotionen über die Zeit hinaus, in der die Gegenstände unmittelbar einsehbar sind. Dies alles verbunden im Sinne der sich aus- und umbildenden Systemstruktur des Psychischen, das Bewusstsein eingeschlossen. Immer bezogen auf das, was für das Kind hinsichtlich der Befriedung seiner Bedürfnisse subjektiv Sinnhaft erfahren werden kann, einen nützlichen Endeffekt hat (Simonov 1975, 1982) und folglich mit Bedeutung belegt wird; stets auf der Basis einer zunehmend kreativer werdenden gegenständlichen Tätigkeit und motivgeleiteten Handlungsfähigkeit, das im Sinne der Ausbildung volitiver Verhaltensweisen schrittweise auch die Überwindung von Hindernissen bewerkstelligt.
Diese Prozesse ermöglichen dem Kind, bis in der Regel mit dem dritten Lebensjahr die Aufnahme in einen Kindergarten erfolgt, sich in Unterscheidung zu anderen Objekten (Menschen eingeschlossen) selbst als Subjekt und Akteur nach Außen wahrzunehmen, wie sich das im Kontext der Sprachentwicklung dann im Begriff des „Ich“ ausdrückt. Nichts - und zu keiner Zeit in der Entwicklung des Kindes - ist, was wir an seinem Verhalten beobachten können, Ausdruck mechanischer oder gar nur reflektorischer Akte. Aus der angemessenen Kooperation mit dem Kind, deren Basis eine reziproke Kommunikation ist und die berücksichtigt, dass das Kind (a) selbst handeln will und (b) in diesem Prozess der Bestätigung seines Ichs bedarf - das sind zentrale pädagogisches Momente - kann die „aktuelle Zone der Entwicklung“ des Kindes erfahren und die „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij 1987) sich auftun; dies auch in Aktionen der Kinder unterschiedlichster Entwicklungsniveaus untereinander.
Die in diesen Altersperioden entstehenden psychischen Funktionen werden zu lebenslang wirkenden stabilen Neubildungen; zu solchen, die sich aus der Verknüpfung mit elementaren psychischen Funktionen ergeben, auf diesen aufbauen aber auch zu solchen, die sich im Sinne höherer psychischer Funktionen aus dem angesprochenen Zusammenhang subjektiven Erlebens und subjektiver Bedürftigkeit nach Realisierung und Bestätigung seiner Selbst, seiner Motive und Intentionen in Relation zu diesen entsprechenden, inkompatiblen oder gar fehlenden Umweltbedingungen als in die psychische Struktur integrierte Erfahrungen konstituieren. Auch jene Driften einer Entwicklung und der aus ihr resultierenden Handlungsstrukturen, die, von außen betrachtet, als „pathologisch“ bewertet werden.
René Spitz (1884-1974) bringt das mit dem Bild „der Dialog entgleist“ (1976) zum Ausdruck und verdeutlicht, dass die resultierenden Stereotypien und selbstverletzenden Handlungen - aber auch aggressive und destruktive Verhaltensweisen - die wir als herausfordernde erleben, im aufgezeigten Sinne für das Subjekt sinn- und systemhafter Art sind. Diese Prozesse sind grundlegend menschlicher Natur, so dass es für die Funktionsweise menschlicher Persönlichkeitsentwicklung erst einmal keine Rolle spielt, welche individuellen Ausstattungen bzw. Beeinträchtigungen ein Kind von Geburt an in den Erziehungs- und Bildungsprozess einbringt. Von Bedeutung für die Frühe Erziehung und Bildung sind der Eintritt[18], die Art und der Schweregrad individueller Beeinträchtigungen, deren Stärke und Dauer im Verlauf der Lern- und Entwicklungsgeschichte im Hinblick auf eine angemessene pädagogische - und, wo erforderlich - therapeutische Gestaltung des Dialogs, der Kommunikationen und resultierenden Kooperationen seitens der erziehenden und unterrichtenden[19] Erwachsenen - damit auch der pädagogischen und organisatorischen Konzeption eines Kindergartens.
Geradezu als Essenz früher Erziehung und Bildung resümiert Boshowitsch 1970: „Also muss man die Art des Erlebens des Kindes verstehen, den Charakter seiner affektiven Beziehung zur Umwelt, um erfassen zu können, welchen Einfluss die Umwelteinwirkungen auf den Entwicklungsverlauf des Kindes haben” (S. 115). Dazu gibt es keine einfache Testdiagnostik, weder bezogen auf die Tendenz von Entwicklungsverläufen noch hinsichtlich des Verhältnisses von aktueller und nächster Zone der Entwicklung in den vielfältigen Dimensionen psychischer Neubildungen, die auch Denken, Sprache und Bewusstsein, eingeschlossen Funktionen, die wir grob als Intelligenz und Begabung bezeichnen, umfassen, die nicht biologisch kodiert vorhanden, sondern im Prozess von Erziehung und Bildung zu schaffen sind. Die heute mehr denn je hoch favorisierten kognitiven Prozesse, auf die sich der beschriebene Optimierungswahn fokussiert, sind im Spiegel der Selbstorganisation eines lebenden Systems rekursive Produkte der Interaktion des Systems mit seinen eigenen Zuständen und damit durch den Zustand des Gesamtsystems bestimmt, der seinerseits als autopoietisches Produkt des Austauschs des Systems mit seiner (personalen wie dinglichen) Umwelt zu verstehen ist und - es sei noch einmal darauf verwiesen - in den affektiven Qualitäten und Emotionen des Systems gründen. Es sind die Emotionen, die für das Erschließen kognitiver Dimensionen kodieren und wie weit diese nach Maßgabe des individuell Möglichen, das im Gegenwärtigen (noch) nicht zu erkennen ist, ausgebildet werden können (vgl. Friedlmeier & Holodynski 1999). Nur biographisch fundierte Recherchen der bisherigen Lern- und Entwicklungsverläufe (Jantzen 2005, Jantzen & Lanwer 2011) und ihrer sozio-ökonomischen und kulturellen Bedingungen und prozessbegleitende Beobachtungen und deren Analyse im Spiegel relevanter Entwicklungstheorien und Entwicklungspsychologien vermögen pädagogisch relevante Erklärungen für die Hintergründe des bei Kindern zu Beobachtenden geben, auf deren Basis das Verstehen ihrer Persönlichkeit und Handlungen als Grundlagen erzieherischer und bildender Kooperation mit den Kindern im Sinne der auf die nächste Zukunft gerichteten Erziehungs- und Bildungsintention sinnvoll möglich ist.
Den aufgezeigten Zusammenhängen implizit und von grundlegender Bedeutung für die kindliche Entwicklung sind die Qualitäten der zwischenmenschlichen Beziehungen und damit des „Dialogs” und der Bindungspotentiale (Feuser & Jantzen 2014). René Spitz verdeutlicht in seiner Arbeit „Vom Dialog” (1976) und zahlreichen anderen schon in die 1930er Jahre zurückreichenden Arbeiten zum „psychischen Hospitalismus” und den damit verbundenen filmischen Dokumentationen (Mantell 1991), die der Entwicklung der Bindungstheorie durch John Bowlby (1907-1990) vorausgegangen sind, in an Deutlichkeit kaum zu übertreffender Weise, was es für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes bedeutet, wenn die Beziehungen zum Kind unzureichend oder ungeeignet sind. Er führt aus: „Der Mensch, dem man als Säugling den Dialog vorenthält, wird zu einer leeren Hülle, geistig tot, ein Anwärter auf Anstaltsbetreuung. Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muss sozial sein. Leben in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen” (1976, S. 26). Mit dem Begriff „Dialog” verweist er auf die „Quelle und den Beginn artspezifischer Anpassung“. „Ohne den Dialog - jenen Dialog, durch welchen das Kind das Belebte vom Unbelebten unterscheiden lernt - kann wohl die Reifung, nicht aber die Entwicklung voranschreiten” (ebd., S. 26).
Zur Erklärung der Begriffe, wie Spitz sie verwendet, noch folgende Hinweise: Ausgehend von der Gesamtheit der phylogenetisch präformierten und ererbten „angeborenen Ausstattung” des Menschen bezeichnet Spitz mit Reifung „den Prozess der allmählichen Veränderungen und des Wachstums in den physischen und psychischen Sektoren des kindlichen Organismus”. (Psychische) Entwicklung „bezieht sich auf die Modifikation der angeborenen Ausstattung [...], die teils durch Umweltbedingungen, teils durch Be- oder Entlastung bestimmt werden, welche ihrerseits von in der Reifung und in der biologischen Entwicklung wirksamen Faktoren abhängen” (Spitz 1972, S. 10f). „Die Reifung des Angeborenen geht ohne Unterbrechung weiter, programmiert von der Epigenese. Entwicklung und sich entwickelndes Verhalten dagegen werden vom Erleben ausgelöst und durch die sich entfaltenden Gegenseitigkeitsbeziehungen mit der Umwelt in Gang gehalten und gefördert” (Spitz 1974, S. 106). Aber: „Denn wenn der Dialog in der Frühkindheit zusammenbricht, wird die Ich-Bildung gehemmt, die Ich-Funktionen entarten und verkümmern. Die Ich-Apparate verkrüppeln, und die Integrität des Ichs, des Hauptorgans der Anpassung, ist in Gefahr. Es werden dann kompensatorische Funktionen entwickelt, die wenig oder nichts mit den Gegebenheiten der Realität zu tun haben” (1976, S. 112).[20]
Damit verweist Spitz auf die biologischen, psychologischen und sozialen Momente, die in intersubjektiven Kontexten zusammenwirken und sich in die intrapsychischen Bereiche der sich entwickelnden Persönlichkeit transformieren. Vygotskij schreibt: „In der Entwicklung des Kindes tritt jede höhere psychische Funktion zweimal in Szene - einmal als kollektive, soziale Tätigkeit, das heißt als interpsychische Funktion, das zweite Mal als individuelle Tätigkeit, als innere Denkweise des Kindes, als intrapsychische Funktion” (1987, S. 302).
Das verweist wieder auf das Erfordernis der Kooperation i.S. „funktionsteiliger Abstimmung individueller Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel hin”, die nicht nur eine Bedingung menschlicher Entwicklung ist, sondern zwei Wesenseigenschaften des Menschen in ihrer elementarsten Weise ausdrückt: nämlich „den gesellschaftlichen Charakter des menschlichen Wesens“ und „die Arbeit als die wesentliche Lebenstätigkeit der Menschen“, worauf Clauß et. al. (1983, S. 339) verweisen. Arbeit im Sinne der Leont’evschen Theorie der „Dominierenden Tätigkeit” (Leont’ev 1973, S. 402) ist mit dem Erreichen des Niveaus der „Gegenständlichen Tätigkeit“ und der Möglichkeit zu gegenständlichen Handlungen entwicklungspsychologisch grundgelegt, auf der die Phase des für die Kindergartenzeit zentralen dominierenden Tätigkeit des Spiels aufbaut.
Die bedeutendsten Studien und die fundierteste Theoriebildung zum kindlichen Spiel verdanken wir Daniil Borisovič Él’konin (1904-1984). Das zentrale und sich darin entwicklungspsychologisch ausdrückende Moment ist, „dass sich in der Spielhandlung der Gedanke vom Gegenstand löst und die Handlung beim Gedanken ihren Anfang nimmt, nicht beim Gegenstand” (Él’konin 2010, S. 452f). Und er fährt fort: „Der Gedanke löst sich deshalb vom Gegenstand, weil ein Stückchen Holz die Rolle der Puppe zu spielen beginnt, ein Stock zum Pferd wird. Die Handlung nach Regeln beginnt vom Gedanken bestimmt zu werden und nicht vom Gegenstand. Das ist eine Wende in der Beziehung des Kindes zur realen konkreten nächstliegenden Situation” (ebd., S. 453). Er sieht das Spiel als eine Übergangsform, den Gedanken und damit die Bedeutung eines Wortes vom Gegenstand loslösen zu können; eine Wende von kaum zu ermessender Tragweite und eine für das Kind außerordentlich schwierige Aufgabe.
Dominierte zuvor in der Entwicklung der Gegenstand die Bedeutung, die unmittelbar mit ihm verbunden ist, kehrt sich dieses Verhältnis jetzt um und das Moment der Bedeutung wird führend - für und im Denken, für das Bewusstsein und die Handlungen und damit für die Verhaltensweisen des Kindes. Die in Kontexten subjektiver Sinnbildung generierte Bedeutung wird vom Gegenstand gelöst und führt, in das Schulalter hineinreichend, zur inneren Sprache, zum logischen Gedächtnis, zum abstrakten Denken, so Él’konin.
Er kennzeichnet zwei Paradoxa: Das erste Paradoxon des Spiels sieht er darin, „dass das Kind mit losgelösten Bedeutungen operiert, aber in einer realen Situation”, das zweite darin, „dass das Kind im Spiel auf der Linie des geringsten Widerstandes handelt, das heißt, es macht das, was es am liebsten möchte, weil Spiel mit Lustgewinn zusammenhängt. Gleichzeitig lernt es, auf der Linie des größten Widerstandes zu handeln. Indem es sich den Regeln unterordnet, verzichtet es auf etwas, das es gerne möchte, weil die Unterordnung unter die Regel und der Verzicht auf eine dem unmittelbaren Impuls folgende Handlung der Weg zu maximaler Lust ist” (ebd., S. 456f). Damit werden die Erfüllung der Regel zur Quelle der Lust, sie selbst zum stärksten Impuls und das Spiel zum führenden Moment in der Entwicklung des Kindes. „Das Spiel ist Quelle der Entwicklung und schafft die Zone der nächsten Entwicklung” (ebd., S. 462), schreibt Él’konin - durch die damit verbundenen Kommunikationen und Kooperationen bis hin zur arbeitsteiligen Übernahme von Funktionen und Rollen im Sinne zielgerichteter Tätigkeiten, über die das Kind eine zunehmende Bewusstheit erlangt. „Die Tatsache, dass dem Kind die eingebildete Situation bewusst wird, kann man unter dem Entwicklungsaspekt als Weg zur Entwicklung des abstrakten Denkens betrachten. Die hiermit verbundene Regel führt meines Erachtens zur Entwicklung jener Handlungen des Kindes, auf denen die Trennung zwischen Spiel und Arbeit basiert, wie sie im Schulalter eintritt. [...] Im Schulalter verschwindet das Spiel nicht, sondern gewinnt ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit” (ebd., S. 465).
Die Orientierung der Tätigkeit erfolgt wesentlich auf die Handlung selbst und im Gegensatz zur Arbeit wird im Spiel die Orientierung auf das Produkt zurückgestellt, d.h., das vorrangige Produkt des Spiels ist also die Beherrschung von Handlungen durch das Kind, Handlungen, die wesentlich durch die Erweiterung der Sozialbezüge - gerade auch durch den Übertritt von der Familie in die Lebensgemeinschaft der Kinder in den Institutionen der Frühen Bildung - in umfassender Weise eine zunehmend regelgeleitete und rollenspezifische kooperative gegenständliche Tätigkeit ermöglichen. In diesen Kontexten gewinnen auch Momente der Selbsteinschätzung, der Selbstwirksamkeit und -kompetenz - auch im Spiegel der Bewertung durch andere - zunehmend an Bedeutung und bringen auch sittliche Verhaltensmotive hervor, d.h., es kommt zur Ausbildung ethischer Instanzen, in denen die vom Kind erlebten realen Umweltsituationen widergespiegelt sind.
Im Laufe der auf dieser Stufe zur Ausbildung kommenden inneren Abbildstrukturen beginnt das Kind, im Spiel sich seines sozialen Ichs bewusst zu werden, d.h., es vermag sich nicht nur als Subjekt gegenständlicher Handlungen, sondern als Subjekt in einem differenzierten System sozialer menschlicher Beziehungen zu begreifen. Die konkreten Handlungen, die das Kind auf dieser Niveaustufe ausführt, können, wie schon vermerkt, vom Denken getrennt werden, was ermöglicht, im Sinne eines neuen Niveaus der Orientierungstätigkeit, Beziehungen vom persönlichen Ziel zu Gegenstand, Mittel, Produkt und zur Tätigkeit herzustellen und sich die Produkt- und Symbolbedeutungen gesellschaftlicher Tätigkeitsbedeutungen zu eigen zu machen. Individuelle Ich-Bedeutungen und persönliche Gegenstandsbedeutungen bauen sich auf und produktive Bedürfnisse werden neben den nach wie vor bestehenden sinnlich-vitalen Bedürfnissen zur Basis der Motivation der Tätigkeit. Es bilden sich Hierarchien an Motiven, auch bedingt durch die an anderen Kindern und Erwachsenen beobachteten und erschlossenen Handlungsweisen, was wiederum auf die Bedeutung adäquater Kooperationen verweist. Ohne die Möglichkeit dazu kann das gesamte Entwicklungsniveau erheblich beeinträchtigt werden; eben auch, was Leont’ev sehr eindrucksvoll und zutreffend mit dem Bild der „ersten Geburt der Persönlichkeit“ in dieser Entwicklungsperiode beschreibt, eine ich-reflexive persönliche Sinnbildung im Zusammenhang von subjektiver Motivation und objektiv Erkanntem (vgl. Jantzen 2007). Im Sinne der Arbeiten von Jean Piaget (1896-1980) wandelt sich in dieser Phase das „vorbegrifflich-anschauliche Denken“ zum „begrifflichen Denken“, das dann in der nächsten Stufe der „dominierenden Tätigkeit“ des (schulischen) Lernens zum „konkret-operativen Denken“ wird, das sich in Fortsetzung der Entwicklungslogik über das formal-logische bis hin zum kategorialen Denken entwickeln kann (Piaget 1969). Dann ist die Sprache schließlich weitgehend von den Objektbereichen losgelöst und selbst Objekt der Handlung, während sie zuvor noch in engem Zusammenhang mit der praktisch-gegenständlichen Tätigkeit eingebettet in die sozialen Kooperationen die semantische Aneignung der Welt ermöglichte.[21]
Unter entwicklungsneuropsychologischen Gesichtspunkten mit der Perspektive eines „inneren Beobachters“ (vgl. Leont’ev 1973) findet die Einheit der hier kurz skizzierten Momente in dem von Trevarthen und Aitken (2001) beschriebenen Modell „primärer und sekundärer Intersubjektivität“[22] ihre Erklärung. Aitken & Trevarthen (1997) schreiben: „The dependence of the child on cooperative understanding and cultural learning is part of human genetic inheretance. It is a persisting need in the childs brain and is motivated by a powerful appetite for human company and effectiveley regulated interaction. This need must have its origin in development and integration of extensive systems of brain structures, receptors, and boily effectors that are formed bevore birth” (S. 672). Die Autoren verorten diese Funktionen strukturell in „coherent mechanisms of motives” in „an Intrinsic Motive Formation (IMF) [...] ready at birth to engage with the expressed emotions of adult companions” (ebd., S. 655), eine Art Möglichkeit der Suche nach anderen Gattungsmitgliedern, eine Grundlage soziokulturellen Lernens. Ausdruck findet die IMF im System des ESM. „Their output in dynamic displays of emotion and changing moods involves a great Emotional Motor System (EMS) [...], reaching from the spinal cord to the relatively ancient ‘limbic’ regions of the cerebral cortex [...]” (Trevarthen et.al. 1998, S. 67). Damit und unter Aspekten der Funktion der Spiegelneuronen (vgl. Gallese 2001) sind von Seiten beider Partner im Sinne primärer Intersubjektivität eine reziproke Kommunikation und dieser übergeordnet Bindung und Dialog abgesichert. Da diese ihrerseits in Kontexten kultureller Umwelt mit ihren Sachverhalten und Objekten stattfinden, werden diese im Sinne kooperativer Intersubjektivität in gemeinsame Aktionen integriert. Die Beziehung vermittelt sich über den handelnden Umgang mit den Objekten und konstituieren, was Trevarthen als „sekundäre Intersubjektivität” fasst. Er schreibt mit Bezug auf Hubley: „Thus an infant becomes capable, before the development of symbolic, linguistic communications, of joint interest in objects an joint task performance, in the person-person-object fluency of Scondary Intersubjectivity” (Trevarthen 1997, S. 656). So führt das Kontinuum der Entwicklung zur weiteren Differenzierungen von Affekten und Emotionen im Erleben und über Sprachhandlungen schließlich zur Fähigkeit zu sprachlich-symbolischer Abstraktion. In meinen Arbeiten bringe ich diese entwicklungspsychologisch fundamental bedeutenden Zusammenhänge in die Aussage: Der Mensch erschließt sich die Dinge durch den Menschen und sich den Menschen über die Dinge - in gemeinsamer Kooperation.
Damit sind die unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten skizzierten Zusammenhänge in ihrer Bedeutung für eine Frühe Bildung und Erziehung wohl kaum noch zu übersehen oder gar zu negieren. Aufgabe ist, diese Erkenntnisse und damit die entwicklungsrelevanten Prozesse in eine adäquate Pädagogik zu übersetzen, bzw. die Pädagogik als ein System zu etablieren, das der Entwicklungsdynamik der ersten sechs Lebensjahre nicht nur entspricht, sondern sie induziert, entfaltet, ausformt, die Kinder über die damit einhergehenden Krisen begleitet und stets Möglichkeitsräume schafft, in denen die Subjektwerdung im Sinne der Ich-Bildung und Entwicklung zum sozialen Subjekt durch die Möglichkeit zu adäquaten gegenständlichen Tätigkeiten und Handlungen in Kooperation mit den Gattungsmitgliedern in reziprok-kommunikativen Referenzen, in die die Erwachsenen einbezogen sind, ermöglicht wird und bleibt.
Entsprechend sind diese Anforderungen an die Pädagogik sowohl spezieller als auch genereller Art. Sie sind insofern speziell, als sie jedes Subjekt bezogen auf seine spezifische Lebens-, Lern- und Entwicklungssituation reflektiert und insofern generell, als sie sich an den basalen Gesetzmässigkeiten und Bedingungsrahmen menschlicher Entwicklung schlechthin orientieren. Damit sind alle in Richtung von Maßnahmen der Homogenisierung weisenden Organisationsstrukturen in der Frühen Bildung, z.B. bezogen auf Alter, Entwicklungsniveau oder Behinderung, wie dadurch bedingte Selektions- und Segregationsprozesse dem Grunde nach obsolet. Obsolet ist auch die Kategorisierung von Beeinträchtigungen und Behinderungen, da sie in der Orientierung auf die spezifischen Lebenslagen und die speziellen Bedürfnisse sowie dominierenden Motive der Kinder aufgehoben sind und diese nicht in eine Kategorie hinein anonymisiert werden dürfen - in ein Bild gefasst, die Kinder behalten ihre Namen, die nicht durch kategoriale Gruppierungen zu ersetzen sind. Es gibt keine Bildung und Erziehung für eine geistige Behinderung oder andere heil- und sonderpädagogisch kreierte Kategorien. Es gibt sie aber sehr wohl für ein bestimmtes Kind, das einen Namen hat, eine Lern-, Kultur- und Sozialisationsgeschichte und ein dieser entsprechendes Entwicklungsniveau, dem in einer bestimmten Situation angemessen Rechnung zu tragen ist. Und das gilt auch für die einer solchen Pädagogik implizite Vorstellung von „Bildung“, die nicht erst ab dem Niveau der Ausbildung höherer psychischer Funktionen relevant wird, sondern über alle Entwicklungsstufen hinweg ein zentrales Grundbedürfnis des Menschen darstellt.
Insofern ist, wie das zu Beginn der Integrationsentwicklung immer noch gedacht wurde (und heute noch nicht aus den Köpfen ist), eine institutionsbezogene integrative/inklusive Pädagogik (z.B: Kindergarteninklusion versus Schulinklusion) genauso unzutreffend, wie eine vermeintlich inklusive (auf Unterrichtsfächer bezogene) Fachdidaktik. Die von mir entwickelte „Allgemeine Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik” (Feuser 1989, 1995, 2011, 2013b) fasst diesen Komplex. Sie leistet die konsequent subjektwissenschaftliche Ausformulierung und Bestimmung der von Wolfgang Klafki (1927-2016) grundgelegten „Allgemeinbildungskonzeption”; stellt sie, in einem Bild formuliert, insofern vom Kopf auf die Füße, als der Mensch das zur Erkenntnis von Welt fähige Wesen ist und von ihm in „gegenständlicher Tätigkeit“ die Erkenntnis der Welt ausgeht und nicht vom Stoff oder den Sachverhalten. Erkenntnisse und in Folge die Bildung von Wissen, das dann verstandenes Wissen ist (nicht nur im Gedächtnis verankerte Information), ist nicht dem Stoff geschuldet, sondern - es ei noch einmal betont - der „gegenständlichen Tätigkeit“ der Menschen in kollektiv-kooperativen Zusammenhängen. Schon Klafki fordert eine „Allgemeinbildung als Bildung für alle zur Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, als kritische Auseinandersetzung mit einem neu zu durchdenkenden Gefüge des Allgemeinen als des uns alle Angehenden und als Bildung aller uns heute erkennbaren humanen Fähigkeitsdimensionen des Menschen” (Klafki 1996, S. 40). Dies verbunden mit der Intention, Demokratisierungsprozesse entschieden voranzutreiben.
Eine solche Bildung konstituiert sich als Aufklärung und Erziehung, diese verstanden als die Ausbildung des Bedürfnisses des Menschen nach dem Menschen im Sinne von Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Das erfordert,
-
Bildung zu jedem Lebensalter sowohl vom Subjekt ausgehend, als auch einen auf dessen Potentiale und deren Entfaltung hin ausgerichteten, auf Anerkennung und Gleichheit basierter Prozess der Ermöglichung in einem zum Zweck dieser Ermöglichung weitgehend strukturell umgebauten EBU zu begreifen. Das würde erfordern, annähernd bestimmen zu können, welches erkenntnisrelevante Qualitätsniveaus bezogen auf ein spezifisches Ereignis ein Mensch hinsichtlich dessen Wahrnehmung, dessen interner Unterscheidung, Kategorisierung und Versprachlichung - mithin seines Denkens - und daraus resultierend, seiner handlungsmäßig aktiven Einflussnahme auf das Ereignis hat, was unmittelbar erfordert, auch Kenntnisse seiner aktuellen Bedürfnisse, seiner Motive, seines diesbezüglich gedächtnismäßig verankerten Erfahrungsschatzes wie sein aktuelles affektives Empfinden und emotionales Erleben und sein Wollen mit einzubeziehen. Ohne Kenntnis des Verhältnisses von „aktueller und nächster Zone der Entwicklung” im Sinne Vygotskij’s (1987)[23] und der diesbezüglich sozialisatorischen Kontexte dürfte es dem Zufall überlassen bleiben, ob ein Lernangebot als solches wahrgenommen werden kann, redundant ist oder jenseits einer erfahrungsmäßig damit zu verknüpfenden Dimension liegt und ob es Bedürfnissen und Motiven, sich damit zu befassen, entspricht, zu positiven Emotionen führt oder gar angstbesetzte Vermeidungsstrategien hervorruft.[24]
-
ein Verständnis von Bildung als Aufklärung, der die Mündigkeit inhärent ist. Ganz grundlegend gesehen spiegelt sich darin die Neugier und das Interesse, das Wesen hinter den Dingen zu ergründen, das seine Erscheinungen hervorbringt, sie zu erklären, im Sinne von Erfahrungsbildung zu erfassen und schließlich zu verstehen, was seine Quelle bereits in der assimilativ-perzeptiven und manipulierendenTätigkeit des Kleinkindes hat, die es zu akkommodativen Anpassungen seines Tuns an die gegenständliche Welt veranlasst. Im kooperativen Miteinander, durch Nachahmung verfeinert und durch die Übernahme von Rollen und Regeln ständig ausdifferenziert, entwickelt das soziale Subjekt, die von Klafki geforderte Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit in der Bedeutung, Kant (1784) folgend, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, aber in entsprechender Verantwortung den Anderen, der ich sein könnte, mit zu denken und entsprechend zu handeln. Ohne diese Einheit gerät Bildung zur Halbbildung, die Adorno (1998) wie folgt beschreibt: „Halbbildung ist die Verbreitung von Geistigem ohne lebendige Beziehung zu lebendigen Subjekten, nivelliert auf Anschauungen, die herrschenden Interessen sich anpassen” (S. 576). Das vornehmste Ziel pädagogischer Inklusionsbemühungen hätte dem zu gelten: Ungleichheit abzuschaffen, was voraussetzt und verlangt, Solidarität aufzubauen! Und dies bedarf der Erziehungs- und Bildungsarbeit von früher Kindheit an.
Entsprechend bedarf es auch in der Frühen Bildung eines inklusiven Unterrichts in Projekten, der mittels Lernen in und durch Kooperation an einem Gemeinsamen Gegenstand (Feuser 1984a, 2011, 2013b) Entwicklung induziert, damit die sozio- und psychodynamischen Grundlagen solidarischen Denkens und Handelns grundgelegt werden können, die die Kinder in die Schule und die Schülerinnen und Schüler später als Erwachsene in ihre Lebenswelten mit hinaustragen, in denen sie dann auch gesellschaftlich und politisch relevant werden können. Der Vielfalt der in Gemeinschaft miteinander Lernenden kann im Sinne einer entwicklungslogischen Didaktik durch eine entwicklungsniveaubezogene Individualisierung des Gemeinsamen Gegenstandes entsprochen werden, was ermöglicht, dass jedes Mitglied der Lerngemeinschaft sich auf dem Hintergrund seiner Vorerfahrungen und seiner Bedürfnisse und Motive kompetent in die Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand einbringen und sich dadurch auch als kompetent erleben kann. Diese „Allgemeine Pädagogik” leistet ein Doppeltes in einem, nämlich:
-
durch das Moment der Kooperationen, die eine Vielfalt an Kommunikationen erfordern, wird schon im Kindergarten ein auf ein gemeinsames Ziel oder Produkt hin orientiertes Miteinander-Handeln möglich, in dem die Heterogenität der vielen zur Wirkung kommenden Momente ein hohes synergetisches Potential erzeugen, das zu emergenten Lösungen führt, zu solchen Lernergebnissen also, die kein einzelnes Kind für sich hätte erreichen können oder mit ihm schon per se vorhanden gewesen wären. Das könnte auch als kognitive Dimension des Bildungsprozesses begriffen werden, der auf Erkenntnisgewinn abzielt, aus dem Wissen resultiert, das durch die Erkenntnis selbst bedeutend wird und auf diese Weise eine intrinsische Motivation aufbaut, sich lernend mit den Menschen und der Welt auseinander zu setzen.
-
Durch das Moment der die Kooperationen ermöglichenden Kommunikationen werden die Lernenden sozial füreinander bedeutsam, entstehen Empathie und die Integration des Anderen ins eigene soziale Ich. Diese Bedeutung eines jeden für jeden anderen in der Lerngemeinschaft misst sich nicht daran, ob er oder sie sich auf Beinen oder mit Hilfe eines Rollstuhles fortbewegt, ob sie sich in Lautsprache oder Gebärdensprache, mit Hilfe von Bliss-Symbolen, eines Delta-Talkers oder mimisch-gestisch verständigen, ob sie tasten oder schauen oder ob sie sieben oder dreizehn Jahre alt sind. Der Grad an personaler und/oder advokatorischer Assistenz, der für manche Kinder zu gewährleisten ist, bestimmt nicht den Grad der Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Kompetenz und schmälert auch in der Wahrnehmung der anderen im Kollektiv das in der gemeinsamen Kooperation zu gewinnende Prestige nicht. Die/der Andere ist dann eine/r wie ich, die oder der ich auch sein könnte, aber nie die oder der auszugrenzende andere Andere.
Machen wir nicht schon in der Frühen Bildung die durch räumliche Segregation und Immobilisierung verkörperte Politik der Ausschließung „zum Patentrezept für eine Gesellschaft, die nicht mehr dafür sorgen mag, dass alle ihre Angehörigen „am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, die aber sehr wohl wünscht, dass jene weiterhin daran teilnehmen, die es nicht an Eifer und vor allem nicht an Gehorsam fehlen lassen”, wie Bauman (2009, S. 150) schreibt, denn „Alles in allem bedingt das Ghetto die Unmöglichkeit von Gemeinschaft” (ebd.) - für alle!
Ein Lernen, wie ich es hier kurz skizziert habe, das in Projekten mit altersgemischten Lerngemeinschaften zu organisieren wäre, garantiert die Wahrung der Würde der Einzelnen. Es wird zum zentralen Moment emotional-sozialen Erlebens und generiert Empathie im Sinne des Erzieherischen im Bildungsprozess, was in Zusammenhang mit dem erkennenden Begreifen der Welt das mit Bildung nicht zu unterschreitende Moment der Aufklärung realisiert.
[17] Die gegenwärtigen Bemühungen um die Implementierung des Anliegens der Inklusion in die Lehrerbildung lassen die dafür erforderlichen Strukturreformen nicht erkennen. Die Frühe Bildung in der gesamten Spanne von der Geburt bis zum Schuleintritt und die Primarpädagogik (bezogen auf eine sechsjährige Grundschule) wären zu einer Studieneinheit zusammen zu führen, auch um die Zäsur zwischen Kindergarten und Schule, wie sie heute noch besteht, zu überwinden. Auszugehen wäre von einer pädagogischen Qualifikation für das Lernen und die Entwicklungsverläufe von Kindern von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit im Sinne der bisherigen Früherziehung (Geburt bis 3. Lj.), der Elementarerziehung (Kindergarten, 3. bis 6. Lj.) und der Primarpädagogik (Grundschule, 6. - 12. Lj.); dies als Spezialisierung im MA-Studium auf der Basis eines humanwissenschaftlich fundierten gemeinsamen BA in Pädagogik (vgl. Feuser 2013a).
[18] Diesbezüglich sind auch die intrauterinen (embryonalen und fetalen) Verläufe der kindlichen Entwicklung im mütterlichen Organismus unter dessen Bedingungen bis zur Geburt hoch relevant und vor allem in der Ausbildung für das professionelle Personal in der Frühen Bildung entsprechend zu gewichten. Ich verweise hier nur stellvertretend auf die nach wie vor hoch bedeutende Schrift von Hofer (1981).
[19] Mit Unterricht geht es, wie Vygotskij betont, darum, dass etwas Neues in den Entwicklungsverlauf der Kinder eingebracht wird. Er sieht Unterricht nicht als eine der Institution Schule zuzuordnende Kategorie und folgert: „Unterricht und Entwicklung treten also nicht erstmals im Schulalter auf, sondern sind praktisch vom ersten Lebenstag des Kindes an miteinander verbunden” (1987, S. 297). Siebert (2006) schreibt: „Geht man von dieser Theorie aus, wonach der Unterricht ideale Formen der Entwicklung vermittelt und damit eine Zone der nächsten Entwicklung schafft, dann wird deutlich, dass er keineswegs an ein bestimmtes Alter noch eine institutionelle Form gebunden ist” (S. 113). Es geht also auch im Kindergarten um Unterricht im Sinne eines Entwicklung induzierenden Lernens! Dies wiederum wäre ein weiterer Faktor, der in einer Neuorganisation der Ausbildung des pädagogischen Personals für die Frühe Bildung zu berücksichtigen ist.
[20] Um das hier nur kurz anzumerken: Die Dramatik der Entwicklung von Kindern, die wir dem Autismus-Spektrum zuordnen, besteht, verkürzt gesagt, darin, in der frühesten Kindheit den derart hoch relevanten (reziproken) „Dialog” aufgrund interner Bedingungen der Isolation nicht aufbauen zu können. Ferner wäre Spitz auf der Basis heute vorliegender Erkenntnisse insofern zu widersprechen, das die resultierenden autokompensatorischen Verhaltensweisen (bei Spitz: kompensatorische Funktionen) sehr wohl mit den Gegebenheiten der Realität zu tun haben - und selbstverständlich pädagogisch/therapeutisch zu beeinflussen sind.
[21] Als Quellen der u.a. für die Pädagogik der Frühen Bildung relevanten entwicklungstheoretischen und entwicklungspsychologischen humanwissenschaftlichen Grundlagen können vor allem das Werk von Lev Semjonovič Vygotskij (1896-1934), Aleksej Nikolajevič Leont’ev (1903-1979), Jean Piaget (1896-1980) und René Apard Spitz (1887-1974) als nahezu unverzichtbar für eine angemessene pädagogische und didaktische Konzeption und praktische Gestaltung des »Unterrichts« (verstanden i.S. von Vygotskij als Lernen, das Entwicklung induziert) im Kindergarten benannt werden. Als Einführung und übergreifende Befassung mit den hier erwähnten Zusammenhängen siehe Jantzen 2007.
[22] . Zur Einarbeitung in diese Zusammenhänge siehe Trevarthen (2012): Intersubjektivität und Kommunikation.
[23] . „Die Differenz zwischen dem Niveau, auf dem die Aufgaben unter Anleitung, unter Mithilfe der Erwachsenen gelöst werden [das können auch ältere Kinder sein; GF:], und dem Niveau, auf dem das Kind Aufgaben selbständig löst, macht die Zone der nächsten Entwicklung aus” (Vygotskij 1987, S. 300; siehe auch Jantzen 2008a,b).
[24] . In kritischer Analyse meiner Beobachtungen in Bildungsinstitutionen (die Ausbildung von Pädagogen an Hochschulen und Universitäten einbezogen) scheint die Zufälligkeit pädagogischen Handelns noch immer ein qualitativ hinreichendes Moment professioneller pädagogischer Tätigkeit zu sein, um eine genügend große Anzahl Menschen einer Nachfolgegeneration zu produzieren, deren »Humankapital« hinreicht, das Gesellschaftssystem, wie es besteht und funktioniert, zu reproduzieren und mögliche Driften in andere Regime zu blockieren. Das drückt sich auch darin aus, dass keine geringe Anzahl von Personen in der Ausbildung von PädagogInnen tätig sind, die selbst weder fachwissenschaftliche Expertisen noch praxisrelevante Erfahrungen in dem haben, was sie lehren. In Bezug auf die Inklusion ist das in besonderer Weise der Fall.
Adorno, T.W. (1998): Dialektik der Aufklärung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Aitken, K. & Trevarthen, C. (1997): Self/other organization in human psychological development. In: Development and Psychopathology. 9, S. 653-677
Amirpur, D. & Platte, A. (Hrsg.) (2017): Handbuch Inklusive Kindheiten. Opladen/Toronto: Verlag B. Budrich
Bauman, Z. (2009): Gemeinschaften. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag
Bauman, Z. (2017): Das Vertraute unvertraut machen. Ein Gespräch mit Peter Haffner. Hamburg: Hoffmann und Campe
Boshowitsch, L.I. (1970): Die Persönlichkeit und ihre Entwicklung im Schulalter. Berlin: Volk und Wissen, Volkseigener Verlag
Boshowitsch, L.I. (2016): Etappen der Persönlichkeitsentwicklung in der Ontogenese. In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2015, S. 83-120
Clauß, G. et al. (Hrsg.) (1983): Wörterbuch der Psychologie. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag
Él’konin, D.B. (2010): Psychologie des Spiels. Berlin: Lehmanns Media
Erzmann, T. (2003): Konstitutive Elemente einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik und eines veränderten Verständnisses von Behinderung. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag
Feuser, G. (1984a): Zwischenbericht - Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesheimen. Bremen: Diak. Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten in Bremen [zweite unveränderte Auflage 1987]
Feuser, G. (1984b): Curriculare und thematische Aspekte einer Qualifikation für die pädagogisch-therapeutische Tätigkeit in der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder (Integration) in Regelkindergärten/Kindertagesheimen. In: Behindertenpädagogik 23, 4, S. 349-366
Feuser, G. (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Behindertenpädagogik 28, 1, S. 4-48
Feuser, G. (1995): Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Feuser, G. (2011): Entwicklungslogische Didaktik. In: Kaiser, A. et.al. (Hrsg.): Didaktik und Unterricht. Band 4 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 86-100
Feuser, G. (2012): Der lange Marsch durch die Institutionen. Ein Inklusionismus war nicht das Ziel! In: Behindertenpädagogik 51, 1, S. 5-34
Feuser, G. (2013a): Grundlegende Dimensionen einer LehrerInnen-Bildung für die Realisierung einer inklusionskompetenten Allgemeinen Pädagogik. In: G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.): Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikation braucht die inklusive Schule? Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 11-66
Feuser, G. (2013b): Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand” - ein Entwicklung induzierendes Lernen. In: Feuser, G. & Kutscher, J. (Hrsg.): Entwicklung und Lernen. Band 7 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 282-293
Feuser, G. (2015a): Inklusion - eine Herausforderung der Pädagogik? In: Jahrbuch für Pädagogik 2015. Frankfurt/M.: Edition Peter Lang, S. 133-158
Feuser, G. (2015b): Inklusion - Eine Forderung nach Gleichheit, Solidarität und Bildungsgerechtigkeit. In: Behindertenpädagogik 54, 3, S. 257-269
Feuser, G. (2018): Wider die Integration der Inklusion in die Segregation. Zur Grundlegung einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik. Frankfurt/M.: Verlag Peter Lang
Feuser, G. & Jantzen, W. (2014): Bindung und Dialog. In: Feuser; G., Herz, B. & Jantzen, W. (Hrsg.): Emotion und Persönlichkeit. Band 10 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 64-90
Feuser, G. & Meyer, H. (1987): Integrativer Unterricht in der Grundschule. Ein Zwischenbericht. Solms-Oberbiel: Jarick Verlag
Feuser, G. &. Wehrmann, I. (1985): Informationen zur gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder (Integration) in Kindergarten, Kindertagesheim und Schule. Bremen: Selbstverlag Diakonisches Werk Bremen e. V.
Friedlmeier, W. & Holodynski, M. (Hrsg.) (1999): Emotionale Entwicklung. Heidelberg/Berlin: Spektrum Akademischer Verlag
Gallese, V. (2001): The roots of empathy: the shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. In: Psychopathology 36, S. 171-180
Hofer, M.A. (1981): The Roots of Human Behavior. An Introduction to the Psychobiology of Early Human Behavior. San Francisco: Freeman
Holodynski, M. (2006): Emotionen - Entwicklung und Regulation. Heidelberg: Springer Verlag
Jantzen, W. (2005): „Es kommt darauf an, sich zu verändern ...“ Zur Methodologie und Praxis rehistorisierender Diagnostik und Intervention. Gießen: Psychosozial-Verlag
Jantzen, W. (2007): Allgemeine Behindertenpädagogik. Berlin: Lehmanns Media
Jantzen, W. (2008a): Die „Zone der nächsten Entwicklung” - neu betrachtet. In: Jantzen, W.: Kulturhistorische Psychologie heute. Berlin: Lehmanns Media, S. 231-244
Jantzen, W. (2008b): Schwerste Beeinträchtigung und die „Zone der nächsten Entwicklung”. In: Jantzen, W.: Kulturhistorische Psychologie heute. Berlin: Lehmanns Media, S. 171-195
Jantzen, W. & Meyer, D. (2014): Isolation und Entwicklungspsychopathologie. In: Feuser, G., Herz, B. & Jantzen, W. (Hrsg.): Emotion und Persönlichkeit. Band 10 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 38-63
Jantzen, W. & Lanwer, W. (2011): Diagnostik als Rehistorisierung. Berlin: Lehmanns Media
Kant, E. (1784): Was ist Aufklärung? In: Berlinische Monatszeitschrift, Dezember-Heft, S. 481-494
Klafki, W. (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz Verlag
Leont’ev, A.N. (1973): Probleme der Entwicklung des Psychischen. Frankfurt/M.: Athenäum Fischer TB Verlag
Lingenauber, S. (Hrsg.) (2008): Handlexikon der Integrationspädagogik. Bd. 1, Kindertageseinrichtungen. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag
Mantell, P. (1991): René Spitz. Leben und Werk im Spiegel seiner Filme. Köln: ISAB-Verlag
Piaget. J. (1969): Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart: Fischer Verlag
Piaget, J. (1975): Nachahmung, Spiel und Traum. Stuttgart: Ernst Klett Verlag
Poscher, R., Rux, J. & Langer, T. (2008): Von der Integration zur Inklusion. Baden-Baden: Nomos Verlag
Projektgruppe Integration von Kindern mit besonderen Problemen (Hrsg.) (1981): Gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich. München: Deutsches Jugendinstitut
Projektgruppe Integrationsversuch (Hrsg.) (1988): Das Fläming Modell. Weinheim/Basel: Beltz Verlag
Seidler, D. (1992): Integration heißt: Ausschluss vermeiden! Umwandlung einer Sonderkindertagesstätte in eine Integrationseinrichtung. Münster/Hamburg: Lit Verlag
Seifert-Karb, I. (Hrsg.) (2015): Frühe Kindheit unter Optimierungsdruck. Gießen: Psychosozial-Verlag
Seitz, S. (2010): Erziehung und Bildung. In: Kaiser, A. et.al. (Hrsg.): Bildung und Erziehung. Band 3 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 43-58
Shore, A.N. (1994): Affect Regulation and the Origin of the Self. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Publisher
Siebert, B. (2006): Begriffliches Lernen und entwickelnder Unterricht. Berlin: Lehmanns Media
Simonov, P.V. (1975): Widerspiegelungstheorie und Psychophysiologie der Emotionen. Berlin/DDR: Verlag Volk und Gesundheit
Simonov, P.V. (1982): Höhere Nerventätigkeit des Menschen - Motivationelle und emotionale Aspekte. Berlin/DDR: Verlag Volk und Gesundheit
Spandauer Verhältnisse (1989): Integration durch gemeinsames Leben und Lernen. Berlin: Verlag Klaus Guhl
Spitz, René (1972a). Vom Säugling zum Kleinkind. Stuttgart: Klett Verlag
Spitz, René (1972b). Eine genetische Feldtheorie der Ichbildung. Frankfurt/M.: S. Fischer
Spitz, R.A: (1974): Brücken. In: Psyche 28, 7, S. 1003-1018
Spitz, R.A. (1976): Vom Dialog. Stuttgart: Klett Verlag
Trevarthen, C. (2012): Intersubjektivität und Kommunikation. In: Braun, O. & Lüdtke, U. (Hrsg.): Sprache und Kommunikation. Band 8 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 82-157
Trevarthen, C. & Aitken, K. (2001): Infant Intersubjectivity: Research, Theory, and Clinical Applications. In: J. Child Psychol. Psychiat. 42, 1, S. 3-48
Trevarthen, C., Aitken, K., Papoudi, D. & Robarts, J. (1998): Children with autism. London/Philadelphia
Vygotskij, L.S. (1985): Ausgewählte Schriften, Bd. 1. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag
Vygotskij, L.S. (1987): Ausgewählte Schriften, Bd. 2. Köln: Pahl-Rugenstein-Verlag
Ziemen, K. (Hrsg.) (2017): Lexikon Inklusion. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Das hier in digitalisierter Form zum Nachdruck kommende Buch wird in seiner originalen Textfassung beibehalten; auch die Skizzen, Grafiken, Tabellen und Fotos, die dieser Band enthält. Eingriffe in den Text werden nur vorgenommen,um Druckfehler zu berichtigen,
-
um Sätze, deren grammatikalische Struktur das Textverständnis verfälscht oder nicht dem Sinn gemäß zu erfassen erlaubt, zu berichtigen, ohne die inhaltliche Aussage zu verändern,
-
um fehlende Wörter bzw. Begriffe zu ergänzen, was dann mit den Initialen des Autors in eckigen Klammern deutlich gemacht wird [...; GF] oder,
-
um Anpassungen an die neue Rechtschreibung vorzunehmen, wo das angezeigt erscheint. Dies erfolgt nicht in Zitaten, die wie üblich durch „ ...” gekennzeichnet sind.
-
Hervorhebungen, die im Buch durch Unterstreichen erfolgt sind, werden, sofern es Überschriften betrifft, fett hervorgehoben. Hervorhebungen mit ‘...’ werden durch „...“ bzw. kursiv ersetzt; durch „...“, wenn es um Begriffe geht; kursiv, wenn mehr auf die Bedeutung eines Zusammenhanges verwiesen sein soll.
-
Hinsichtlich des Verständnisses einer selektions- und segregationsbasierten „allgemeinen Pädagogik” verwende ich den Begriff der „Regelpädagogik”, dies auch in Unterscheidung zur Heil- und Sonderpädagogik. Mit der Schreibweise „Allgemeine Pädagogik” bezeichne ich eine nicht selektierende und nicht segregierende Pädagogik die der Forderung der Integration/Inklusion gerecht wird, wie sie in den Kindertagesheimen umfassend praktiziert wurde. Sie verlangt eine „entwicklungslogische Didaktik”, ohne die sie zwangsläufig in traditioneller Weise wiederum selektierend und segregierend werden würde.
Hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit der Buchversion werden die Seitenumbrüche, wie sie im Buch erfolgten, im digitalen Text an der Stelle in der Seitenmitte zwischen Spiegelstrichen angezeigt, wo der Umbruch erfolgt ist. Die Seitenangabe bezieht sich auf den ihr nachfolgenden Text. Dies ermöglicht auch das Zitieren mit Bezug auf die Druckversion von 1984 (bzw. des unveränderten Nachdrucks 1987).
Die im Text in Klammern als Ziffern vermerkten Endnoten, z.B. (01), (02) usw. bleiben auch in der digitalen Version erhalten und finden sich im Anschluss an den Text. Ebenso die Literaturangaben der Buchversion.
Der Originaltext enthält keine Fußnoten. Die in der digitalen Wiedergabe eingefügten Fußnoten dienen ergänzenden, sachdienlichen Hinweisen, die dem Verfasser aus heutiger Sicht erforderlich erscheinen.
Die Grundpositionen und die Konzeption der „Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik” waren schon im Vorfeld der Praxis der Integration in den Bremischen Kindertagesheimen entfaltet und erforderten mit ihrer Umsetzung ab 1981 keine grundlegenden Veränderungen. Dies auch nicht für den „Schulversuch Integration“. Auch im akademischen Diskurs, wo es diesen in Ansätzen gegeben hat, konnte diese Konzeption bis heute in ihrer Substanz hinsichtlich der Realisierung einer inklusiven Pädagogik für Alle nicht in Frage gestellt werden.
Die Entwicklung der Integration/Inklusion in den Kindertagesheimen in Bremen bis heute nachzuzeichnen, würde eine eigene, umfangreiche Arbeit und kritische Analysen bedingen, was hier nicht geleistet werden kann. Ich möchte aber auf eine Dokumentation der Bremisch Evangelischen Kirche verweisen, die 30 Jahre Integration/Inklusion eben anlässlich der 30 Jahre ihrer Entwicklung und Praxis nachzeichnet und einen guten Überblick über die Folgeentwicklungen gibt. Die Dokumentation ist im Netz zu finden unter:
https://www.bek-intern.de/zeitstrahl/#article2
Bezogen auf die Absicht, diesen Bericht noch einmal aufzugreifen und ihn erneut zugänglich zu machen, gab es Erstaunen, Augenbrauen und Schultern wurden hochgezogen und in verschiedenster Weise signalisiert, dass solches doch heute nicht mehr interessiere und es weder angemessen wäre noch hilfreich, sich damit zu befassen. Dem stehen meine Erfahrungen entgegen und der in meiner Wahrnehmung geradezu erschreckende Stau hinsichtlich der Entwicklung der Inklusion im Bildungssystem von Anfang des Zugriffs der Exklusionspraxen auf die Sozialisationsgeschichte und Bildungslaufbahn der Kinder an - und das ist spätestens der Kindergarten.
Wenn man sich mit den heute als existentiell zu bezeichnenden Fragen der Menschheit befasst, vor allem mit den ökonomischen Verwerfungen und ökologischen Katastrophen, die keine anonyme Größe mehr sind und sich nicht in fernen Bereichen des Planeten auftun, sondern inzwischen längst in die Wahrnehmung, das Denken und Handeln eines jeden von uns eingedrungen sind und man die Augen und Ohren nicht vor den resultierenden Gesinnungen und sozialen und politischen Meinungen verschließt, wie sie nicht nur Facebook oder Twitter überschwemmen, sondern inzwischen in aller Öffentlichkeit sich nationalistisch, fremdenfeindlich, rassistisch und durchaus auch faschistisch artikulieren, müsste zumindest den pädagogisch tätigen Fachpersonen auf allen Ebenen des Erziehungs- und Bildungssystems deutlich werden, welche Ansprüche sich daraus für ihre eigene Arbeit in diesem System ableiten. Es dürfte keine Frage mehr sein, dass die strukturelle, organisatorische und curriculare Betonierung des institutionalisierten Bildungssystems, das wir heute praktizieren, wie ein Bollwerk wider jede Vernunft und als eine Verteidigungsanlage der Unvernunft fungiert, die mit keiner Lernsequenz und Unterrichtsstunde mehr weiter stabilisiert werden dürfte.
Die Fülle ökonomischer, ökologischer und soziologischer Studien, die in aller Deutlichkeit die inzwischen tief in die Identitätsbildung des einzelnen Menschen hineinreichenden gesellschaftlichen Verwerfungen auf dem Hintergrund eines völlig enthemmten, globalisierten Markt- und Finanzsystems herausarbeiten, das den Staat schon zu beachtlichen Teilen seiner Souveränität beraubt hat und mit Hunderten gut geschulter Lobbyisten die Parlamentarier zu Marionetten der Banken und Großkonzerne macht, müssten gerade von denen, die die nächste Generation professionell erziehen und bilden - und das sind vor allem die ErzieherInnen und LehrerInnen - endlich zur Kenntnis genommen werden. Auch (um nur dies noch zu benennen) der Fetisch der Algorithmen, mit deren Hilfe, wie spätestens der laufende Facebook-Skandal des Handels und Missbrauchs der Nutzerdaten von 87 Millionen Menschen gezeigt hat, mit denen Milliardengewinne gemacht werden. Die Forderungen nach der Einführung eines Unterrichtsfaches Informatik dürfte eher dadurch motiviert sein, den technischen Entwicklungen nachzuziehen und sie weiterentwickelndes wie weitgehend unkritisch bedienendes „Humankapital“ zu schaffen. In Feldern der Sozialhilfe, der Obdachlosigkeit oder des Kinderschutzes erfolgt auf diesen Wegen eine weitere Moralisierung der Armut, die leicht zum Zusammenhang führen kann: Arme Eltern = schlechte Eltern und die Strategien der Vorenthaltung von Sozialleistungen unterstützt, die über Jahrhunderte hinweg zivilgesellschaftlich erstritten worden sind und nun ohne Widerstand technologisch rechtlich „ent-setzt” und unterlaufen werden.[25] Der Diskurs in der Schweiz geht derzeit darum, gegen den vermuteten Missbrauch der Sozialsysteme Fahndungsmethoden einzusetzen, die selbst bezüglich der Terrorabwehr ungesetzlich wären und über diese hinausreichen. Den sozial Bedürftigen scheint geradezu ein Krieg angesagt, der gegen sie geführt werden soll.
Allein die Beibehaltung der Fragmentierung des Bildungssystems in zu unterrichtende Fächer, die dem, was Bildung genannt wird, längst völlig entfremdet sind, lässt die Vermutung zu, dass selbst die, die den Kindern die Welt erschließen und so weit als möglich auch erklären sollen, selbst schon vor deren Komplexität kapituliert haben Das aber, läge das entsprechende Bewusstsein vor, wäre immerhin ein Ansatz- und Ausgangspunkt, pädagogisch an die basalen Möglichkeiten von Kindern, sich Welt anzueignen, anzuknüpfen und von dort her in Projekten gemeinsam mit ihnen ihre Bildung und Erziehung aufzubauen. Auch diesbezüglich käme dem Kindergarten, wie in diesem Beitrag ausgeführt, eine Schlüsselfunktion zu, von der aus dann nahtlos in das schulische Lernen übergegangen werden kann, indem es dieses basale, auf das Gewinnen grundlegender Erkenntnisse ausgerichtete Lernen, das vor allem das „Lernen lernen“ einschließt, entsprechend den Entwicklungsverläufen der Kinder fortsetzt. Lernen und Persönlichkeitsentwicklung sind Prozesse, die nichts mit Schulformen und Schulstufen, nichts mit Fächern und Jahrgangsklassen und auf diese bezogene Curricula oder mit irgendwelchen Kompetenzrastern und Standards zu tun haben, sondern mit gelingenden, auf Erkenntnisse über die Welt orientierten kommunikationsbezogenen Kooperationen, in das die Erzieher und Lehrpersonen eingeschlossen sind und aus denen ein verstandenes Wissen resultiert (kein im doppelten Sinn des Wortes „verpasstes“), das wiederum Werkzeug der Erkenntnisgenerierung werden kann.
Diese längst von zentralen Humanwissenschaften belegten und vertretenen Erkenntnisse stossen auf eine zutiefst antidemokratische, hierarchische Struktur des institutionalisierten EBU, das Ausdruck einer ständisch orientierten Willkür gesellschaftlich herrschender Kreise ist, die sich als gesellschaftliche Elite verstehen und als „Leistungsträger” hofiert werden, woraus sie anscheinend meinen, die Be-Recht-igung ableiten zu können, der nicht-lineraren Prozess-Dynamik menschlicher Entwicklungsverläufe ein sie verengendes und einschnürendes Korsett anlegen zu dürfen, das Jahr für Jahr ungeahnte Entwicklungspotenzen einer ganzen Generation blockiert, derer wir mehr als dringend zur Lösung der anstehenden globalen Probleme und jener bedürfen, die sich vor unserer eigenen Haustür aufschaukeln. Ohne dieses System in Frage zu stellen, opfern Eltern in der Gier nach der Optimierung ihrer Kinder, mit der sie im Grunde eine Vorteilsnahme derart verknüpfen, dass ihre Kinder zukünftig durch ihrer brauchbare Verwertung und Vernutzung in der Produktion, Konsumtion und Reproduktion des etablierten Systems eine anerkannte und honorierte Position erhalten. Der im Rahmen der Schullaufbahn dafür zu bezahlende Preis psychischer Belastungen und Verkrüppelungen wird unbesehen in Kauf genommen und medikamentös und psychotherapeutisch kompensiert und das Versagen des Unterrichtssystems, das seine Inkompetenz in die Hausaufgaben verlegt, wird, so es die finanzielle Lage der Eltern erlaubt, durch teuren Nachhilfeunterricht auszugleichen versucht, der seinerseits zu einem prosperierenden Geschäft geworden ist.
Allein Verweise auf die Verwerfungen, in die das gesamte EBU verstrickt ist und von denen es in so hohen Graden abhängig gehalten wird, dass die, die es betreiben, einem kollektiven vorauseilenden Gehorsam folgend, oft schon vermeiden, daran zu denken, pädagogisch anders zu arbeiten, ziehen diskreditierende Kommentare nach sich, die gespickt mit tabuisierten und verteufelten Begriffen, dass dies eine sozialistische Utopie, gar eine kommunistisch sei oder einfach soziale Traumtänzerei. Perfektioniert wird die Abwehr einer kritischen Sicht auf die gängige Praxis und deren sie legitimierenden politischen und juridischen Absicherung in den einzelnen Bundesländern und durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) mit dem Ideologievorwurf. Die Legitimierungs- und Handlungspraxen der Wirtschafts- und Finanzeliten mit ihrem Einfluss auf Parlamente und Regierungen in Bund und Ländern der BRD wie eine weitgehend deregulierte marktkonforme kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird selbstverständlich nicht mit dem Begriff der Ideologie belegt. Dies obwohl gerade diese Mächte und die von ihnen ausgehenden normativen Setzungen, die, das kann man heute annehmen, die Erde zugrunde richten werden und eine brutale Ausbeutung der Bodenschätze und anderer Ressourcen ganzer Länder und der Menschen zugunsten ihrer Profitmaximierung betreiben, das mit dem Ideologiebegriff verbundene „falsche Bewusstsein“ haben dürften - und nicht nur das. Die Gier nach Gewinnmaximierung auf eine Weise, dass sich die, die sie betreiben, dadurch selbst ihre zukünftige irdische Existenzgrundlage vernichten und tiefe soziale Spaltungen ganzer Gesellschaften herbeiführen, die nicht nur als um Asyl, Arbeit und ein menschenwürdiges Leben bittende „Flüchtlinge” vor ihren Türen stehen werden, sondern in revolutionären Prozessen sie einfach vernichten könnten, muss schon als eine Perversität besonderer Güte bezeichnet werden. Die gebetsmühlenartigen Verweise auf die Wertegemeinschaft, die gerade die EU in besonderer Weise auszeichne, die aber nicht zu sehen ist, wohin man auch schaut, hat in der Politik inzwischen weit eher eine die Einbildung als höchster Grad anzutreffender Bildung mystifizierende Funktion, denn eine wertsetzende im Sinne von „nicht weiter so!“ Die Durchdringung der Gesellschaft mit dieser dominierenden, nicht als Ideologie erkannten Weltanschauung ist bereits so weit fortgeschritten, dass der einzelne Mensch sich nur noch in diesem System seiner vergewissern und sich verorten kann. Jede Kritik daran wird als extrem zerstörend erlebt, löst tiefe Ängste aus, die für diese Ideologie im Denken und Handeln gefügig machen und den Rest wischt man wie am Tablett weg und ertränkt ihn in den zahllosen Events, die permanent angeboten werden. Die wahrgenommene Wirklichkeit verfälscht die Realität und der Schein übertüncht das Sein.[26] Bauman (2017) fordert: „Das Vertraute unvertraut machen” - darum geht es.
Es bedarf einer zivilgesellschaftlichen Verantwortung und eines sich damit verbindenden zivilen Ungehorsams auch und gerade der Erzieher und Lehrpersonen, um durch ein berechtigt mit dem Begriff der Bildung zu bezeichnendes Lernen, wie in diesen Vorbemerkungen ausgeführt, den Kindern jenen Grad an erkennendem Bewusstsein und kontrolliertem Handeln zu vermitteln, das ihnen ermöglichen kann, der realen Ideologiefalle zu entkommen, als mündige Menschen, die zur Solidarität fähig sind und Gemeinsinn schaffen können. Das ist keine gymnasiale oder universitäre Aufgabe, sondern die des Kindergartens und dort der Frühen Bildung und deren Fortsetzung in der Schule bis in das tertiäre Bildungssystem hinein. Das aber ist nicht beliebiger pädagogischer Art, sondern erfordert, wie oben skizziert, ein in Projekten organisiertes Lernen an einem Gemeinsamen Gegenstand. Wenn dies im Kindergarten nicht grundgelegt wird, so meine Auffassung, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Schule noch geschaffen werden könnte, gegen Null. Aus zwei Gründen: Die für die Persönlichkeitsentwicklung dafür höchst relevanten Phasen der Ich-Bildung bleiben Attraktoren des dominierenden Systems ausgesetzt und verdichten sich zu einem nur noch sehr schwer zu verändernden Habitus und die Eltern haben keine Chance, ihre eigenen Erfahrungen des Lernens zu revidieren und Vertrauen in die Potentiale ihrer Kinder aufzubauen.
Die Verantwortung, die aus den aufgezeigten Zusammenhängen resultiert, ist nicht zu delegieren - weder an den Anstellungsträger oder den Dienstherrn noch an die Ausbildungspraxen oder die Institution, in der man arbeitet. Sie ist eine berufsethische. Die Proklamierung der „Bildungsnation” durch die Bundeskanzlerin Merkel hat keine Spur im Sinne der aufgezeigten Not-Wendigkeiten hinterlassen und blieb hohles Geschwätze. Ob die nun neu amtierende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Dr. Giffey, die die Bedeutung der Frühen Bildung gerade erst in einer Talkshow in eindeutiger Weise herausgestellt hat, ihre Macht und Kraft dafür einsetzt, wird sich zeigen. Als ehemalige Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln in Berlin darf man annehmen, dass sie weiß wovon sie spricht und nicht nur die üblichen politischen Sonntagsreden reproduziert. Dass sie eine Kindergartenpflicht ab dem 3. Lj. fordert, wie zu lesen ist, wäre ein entscheidender Schritt, aber nicht, um die Kinder für eine kinderfeindliche Schule und einen Unterricht abzurichten, der seinerseits dringendster Revision bedarf, sondern um das Lernen in einer Weise zu lernen, das die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder induziert und dies in der hier aufgezeigten Form inklusiver Früher Bildung, dann wäre das ein entscheidender Schritt in eine richtige Richtung.
Abschließen möchte ich diese Vorbemerkungen und Orientierung auf den Bericht von 1984 mit einem Zitat, das ich dem Bericht eines Zivildienstleistenden über seine Arbeit als persönliche Assistenz eines Mädchens entnehme, das aufgrund seiner Beeinträchtigung ständiger Assistenz bedurfte und die erste Integrationsgruppe des Kindertagesheims der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde zu Bremen-Huchting besuchte. Er vermag zu skizzieren, was über viele Jahre der Entwicklung der Integration in vielen Kindertagesheimen immer wieder zu beobachten war, so dass seine Beobachtungen geradezu als ein Resümee betrachtet werden können:
„Mich hat immer wieder fasziniert, wie die Kinder gemeinsam etwas geschaffen haben und ganz allein Wege fanden, wie jedes Kind seiner Fähigkeit entsprechend daran teilnehmen konnte. Gegenüber den anderen Kindergartengruppen, in denen noch nicht Integration betrieben wurde, fiel mir in unserer Gruppe auf, dass die Kinder sehr viel friedfertiger waren und auch eher bereit waren, einen Konflikt mit Worten zu lösen. Darüber hinaus beobachtete ich sehr ausgeprägtes soziales Verhalten in der Gruppe, es gab keine Außenseiter in der Gruppe und keinen Anführer. Es wunderte mich auch nicht, dass die vielen Hospitanten in der Hasen Gruppe oftmals die behinderten Kinder nicht von den nichtbehinderten unterscheiden konnten, denn da, wo Kinder nicht zu Behinderten erzogen werden, entwickeln sie eben auch nicht solche Verhaltensweisen, die ihnen später dann irrtümlicherweise als Behinderungen ausgelegt werden. Je länger ich hier arbeite, desto mehr verstehe ich auch, was folgender Satz bedeutet: Behinderte sind eigentlich Gehinderte. Behinderte behindern sich ja nicht selbst, sie werden von der Gesellschaft daran gehindert, so zu sein, wie sie sind.”
Jens Markus Wegener
Prof. Dr. Georg Feuser
Basel/Konstanz im April 2018[27]
Feuser, G. (1984/19872):
Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim.
[Die Originalarbeit]
- 5 –
Vorbemerkungen:
Die Erwartungen und Anliegen, die sich mit einem Zwischenbericht über die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in einem Kindertagesheim verbinden, sind vielschichtig und unterschiedlicher Art.
Ein vordergründiges Motiv aller an der Arbeit Beteiligten, über die es hier zu berichten gilt, ist, sich selbst in gewisser Weise durch diesen Bericht vor Augen zu führen, welchen Stand die gemeinsame Arbeit erreicht hat, in die auch unsere Entwicklung im Rahmen dieser Arbeit eingeschlossen ist. Zur Bestimmung dieses momentanen Standes des gemeinsamen Anliegens ist die Beschreibung der Entstehung und Entwicklung des Vorhabens, über das wir berichten, also sein Werdegang, unverzichtbar. Wie in Zukunft weiter zu arbeiten sein wird, welche Schwerpunkte zu vertiefen, neu zu setzen oder auch zu revidieren sein werden, kann jeweils nur von einer als historisch geworden zu begreifenden Gegenwart her bestimmt werden und nicht aus dem Anliegen eines momentanen Einfalles, einer opportunen Gelegenheit oder aus einer Laune heraus. Damit dient dieser Zwischenbericht primär dazu, diese dem gemeinsamen Vorhaben verantwortliche und den Kindern unseres Kindertagesheimes (KTH) wie deren Eltern verpflichtete Reflexion im Sinne einer momentanen Bestandsaufnahme vorzunehmen.
Der Herausgeber des Zwischenberichts und der übergeordnete Träger unseres Vorhabens integrativer Kindergartenarbeit, das Diakonische Werk Bremen e.V., Referat für Ev. Kindertagesstätten, möchte mit diesem Bericht im Rahmen seiner Trägerschaft einerseits eine Art Rechenschaftsbericht vorlegen, der im Hause selbst wie auch gegenüber den staatlichen Behörden die geleistete Arbeit dokumentiert, wie gleichzeitig damit die von uns in allen Phasen der Entwicklung des Vorhabens geleisteten Öffentlichkeits-, Fort- und Weiterbildungsarbeit einerseits ein Stück weiter voranbringen wie andererseits, durch den möglichen Rückgriff auf diesen Bericht, diese auch vereinfachen.
Für das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting und die Eltern ist dieser Bericht eine Art neue Seite in der Geschichte dieser Einrichtung und der Gemeindearbeit; auch eine Revision und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen der pädagogischen Arbeit dieses KTHs, was verdeutlicht, dass eine Institution, in der Pädagogik für Kinder realisiert werden soll und in die nicht Kinder für die Pädagogen/Pädagogik gehen, sich selbst als ein offenes und in ständiger Entwicklung befindliches System der Organisation von Spielen und Lernen verstehen muss, das nicht in vorzeitiger Tradierung erstarren kann.
Schließlich hat dieser Bericht auch die Funktion eines wesentlichen Bausteines im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens, die, sofern es unter den gegebenen Bedingungen oft über die Kräfte gehender Arbeitsbelastung möglich ist, später zu einem umfassenden Bericht über diese Arbeit, deren Entwicklung und Weiterentwicklung führen soll, der nicht nur Dokumentation, sondern Hilfe sein soll, Kolleginnen und Kollegen an anderen Orten den Beginn einer ähnlichen Arbeit etwas zu erleichtern wie zu verdeutlichen, dass die integrative Erziehung im Kindergarten nicht ein für sich stehendes Exotum sein kann und darf, sondern den Beginn einer Humanisierung der institutionalisierten Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder markiert, die notwendig in die Schule hinein fortzusetzen ist. Dabei kommt dem Kindergarten eine überaus große Bedeutung in doppelter Hinsicht zu:
-
er ist der erste Ort, an dem es zum institutionsbedingten Ausschluss behinderter, von Behinderung bedrohter, entwicklungsverzögerter bzw. verhaltensauffälliger Kinder
-
kommen kann, indem diese Kinder erst gar nicht aufgenommen oder im Laufe ihrer Kindergartenzeit, vor allem aber im Übergangsfeld zur Grundschule ausgesondert werden können. Damit ist er in gleicher Weise auch
- 6 -
-
der erste Ort, an dem der institutionelle Ausschluss verhindert und für Kinder, für die er bereits erfolgt ist, wieder aufgehoben werden kann und dies in einer der zentralsten Entwicklungsetappe des Menschen hinsichtlich der Aneignung seines gesellschaftlichen Erbes, des Erwerbes seiner sozialen Kompetenzen.
Diesen Gründen für die Vorlage eines solchen Berichtes stehen die Erwartungen der möglichen LeserInnen gegenüber, deren Motive, sich mit dem Bericht zu beschäftigen, wir zwar aus Anfragen, die uns erreichen, und aus Gesprächen erahnen können, die wir aber nicht konkret kennen. Dennoch hoffen wir, zumindest Anregungen vermitteln und fruchtbare Diskussionen in Gang setzen zu können, müssen aber auch deutlich zum Ausdruck bringen, dass es von unserem Selbstverständnis wie von der Sache her nicht darum gehen kann, von uns Rezepte zu erwarten, wie die integrative Erziehung in KTHs in Gang gesetzt und fortgeführt werden kann; solche Erwartungen müssen wir nicht nur enttäuschen, sondern wollen ihnen auch von vornherein keine Nahrung geben. Der Bericht wird deutlich machen, dass integrative Erziehung nicht etwas Rezeptives ist, sondern eine Angelegenheit, die nur durch die Kooperation aller Betroffenen miteinander auf dem Hintergrund der jeweils vorfindbaren Situation im gemeinsamen Handeln zu leisten ist.
Die Arbeit, die mit dem Bericht beschrieben wird, reicht in den September 1981 zurück. Ihn nach 2½ Jahren zu erstellen, kann nicht bedeuten, eine lückenlose Historie zu verfassen. Er ist zentriert auf inhaltliche Aspekte unserer Arbeit, die wir für das Verständnis wie die Realisierung integrativer Arbeit für unverzichtbar und basal halten. Auch haben sich in dieser Zeit Erfahrungen angesammelt, die wir, soweit es ein solcher Bericht überhaupt zulässt, in diesen einbringen, ohne auch diesbezüglich immer aufzeigen zu können, auf welchem Hintergrund sich diese grundlegenden Aspekte unserer Arbeit entfaltet haben. Dies darzulegen würde einen solchen Bericht überfrachten.
Zu beachten wäre auch, dass die hier in der notwendigen Gliederung, die eine solche Darstellung erfordert, auftretenden einzelnen Aspekte in der Praxis unserer Arbeit eng miteinander verwoben sind und sich wechselseitig bedingen, was bei der Lektüre des Berichtes entsprechend zu berücksichtigen wäre.
Nachfolgend sollen im 1. Punkt des Berichtes die allgemeinen Grundlagen eines Verständnisses von Integration und dessen pädagogischer Umsetzung im Zusammenhang der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder erfolgen. Verwiesen wird dazu in einem kurzen Abriss auf den Zusammenhang von Regelpädagogik und Sonderpädagogik und deren historische Entwicklung und Ist-Situation. Anschließend werden die Basiselemente gemeinsamer Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder, allgemeine Aspekte und Prinzipien der Integration und die pädagogischen Aspekte ihrer Realisierung skizziert.
In einem 2. Punkt wird die Entwicklung des Vorhabens integrativer Erziehung im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde beschrieben. Dabei wird auf die Rolle und Funktion des Diakonischen Werkes, der Gemeinde und schließlich auf das KTH selbst eingegangen. Berichte von Mitarbeitern und Eltern ergänzen die inhaltlich orientierte Darstellung des Beginns und Verlaufes der Arbeit im KTH.
Mit dem 3. Punkt des Berichtes sollen die Grundlagen und Aspekte der pädagogischen Konzeption der integrativen Erziehung dargelegt werden. Ausgehend von den allgemeinen Grundlagen menschlicher Entwicklung werden den die neuropsychologischen und lernpsychologischen Grundlagen menschlicher Lernprozesse aufgezeigt und im Zusammenhang mit einer kurzen Darstellung der entwicklungspsychologischen Grundlagen auf die didaktischen, methodischen und therapeutischen Aspekte unserer Arbeit eingegangen, die durch Ausschnitte aus einer projektorientierten Aktivität zu verdeutlichen versucht werden.
Der 4. Punkt des Berichtes geht kurz auf die Aufgaben im Umfeld von Integration ein und gibt Hinweise zur Frage der Fortbildung der Mitarbeiter und zur Fortführung des Vorhabens integrativer Erziehung in der Grundschule.
- 7 -
Der 5. Punkt geht noch kurz auf die speziellen Aufgaben im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung ein, besonders auf die Versuche, die Entwicklung des Vorhabens zu dokumentieren. Insgesamt aber kann die wissenschaftliche Begleitung aus dem Gesamt des Vorhabens nicht herausgenommen oder isoliert betrachtet werden.
Dass ein Zwischenbericht weder den Anspruch auf erschöpfende Behandlung aller aufgeworfenen Fragen noch den auf eine lückenlosen Berichterstattung leisten kann (und auch nicht anstrebt), setzen wir als ein Verständnis seitens der Leserinnen und Leser voraus, das sie diesem Bericht entgegenbringen. Dennoch hoffen wir, wie schon betont, Anregungen geben und unsere Arbeit etwas offen legen zu können, denn wir verstehen sie grundsätzlich als ein öffentliches Anliegen - nicht nur in dem Sinne, Rechenschaft zu geben, sondern auch Eltern und Kolleginnen und Kollegen, die sich der integrativen Erziehung öffnen möchten, Mut zu machen, d. h. neue Ansätze zu innovieren und den Gegnern der Idee der Integration Material vorzulegen, das viele der üblichen Gegenargumente zu entkräften und vielleicht die Diskussion ein Stückchen mehr zu versachlichen vermag.
Bremen, im März 1984
(Georg Feuser)

Integration = kooperatives Spielen und Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern am Gemeinsamen Gegenstand
- 8 -
[25] . Vgl. O’Neil, C. (2017): Angriff der Algorithmen. München: Hanser Verlag und Eubanks, V. (2018): Automating Inequality. New York: St. Martin’s Press
[26] Es wäre mehr als wünschenswert, man würde, was ich hier kurz angeschnitten und aufgezeigt habe, zu widerlegen versuchen. Die dafür erforderlichen Recherchen, zu denen ich ausdrücklich ermuntern möchte (vor allem auch Studierende), wären eine sehr sinnvoll eingesetzte Zeit der eigenen Bildung. Besonders glücklich wäre ich, sie könnten mich widerlegen, dann wäre einiges, von dem ich meine, dass es sein müsste, schon Realität.
[27] Last not least gilt mein Dank für die Hilfen in der Digitalisierung des Originaltextes Frau Birte Klages, Univ. Bremen, und Frau Monika Schmon, Univ. Zürich.
Inhaltsverzeichnis
Unter dem Stichwort Integration erfolgt heute eine sich in den letzten Jahren verstärkende Diskussion um die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindergarten und Schule, die nicht nur mehr regional, sondern bundesweit geführt wird. Anlass dafür, dass sich die Diskussion um diese Frage über einen kleineren Personenkreis, der durch wissenschaftliche oder praktische Tätigkeit damit befasst war, hinausführte und zu einem gesellschaftlichen Anliegen wurde, war in der 2. Hälfte der 1960er Jahre und zu Beginn der 1970er Jahre einerseits die Diskussion um die Konzeption und Einführung der Gesamtschule und andererseits die auf der 34. Sitzung am 12. und 13. Oktober 1973 in Bonn verabschiedete Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates „Zur pädagogischen Förderung Behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“.
So begrüßenswert die dadurch angestoßene Ausweitung der Diskussion um die Vermeidung des Ausschlusses Behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher aus regulären Lebens- und Lernzusammenhängen auch war, führten dennoch beide Ereignisse nicht zu spürbaren Veränderungen in der dem Erziehungs- und Bildungswesen eigenen und hoch verfeinerten Praxis der Auslese und Aussonderung der Kinder und Jugendlichen, die den immer enger werdenden Erwartungshaltungen, die an sie gestellt werden, bzw. den geforderten Leistungsnormen nicht mehr voll entsprechen konnten. Ursachen dafür sind schon in den konzeptionellen Grundlagen sowohl der Diskussion um die Gesamtschule als auch der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates zu sehen.
Indem mit der Gesamtschulidee versucht wurde, das bestehende dreigliedrige Schulsystem zusammenzuführen (additive Form der Gesamtschule) und zu überwinden (integrative Form der Gesamtschule), war man schon von einer falschen Voraussetzung ausgegangen; man hatte übersehen, dass in der BRD in Fortsetzung der Tradition von vor 1933 und vor 1945 unser Erziehungs- und Bildungssystem längst explizit ein Viergliedriges geworden war – man hatte die Sonderschulen einfach übersehen. Eine Gesamtschulidee ohne Einbezug des Sonderschulwesens und des Versuches dessen Überwindung hat selbst in ihrer ideellen Konzeption jene Elemente eines Erziehungs- und Bildungssystems mit übernommen, die in der Geschichte immer wieder zum Ausschluss bestimmter Gruppen aus diesem System und deren Verweis in eine erziehungs- und bildungsmäßige Ersatzversorgung bewirkt hat. In diesem Zusammenhang gerann die Idee der Chancengleichheit zu einem formalen Versatzstück, indem wiederum unberücksichtigt blieb, dass die Chance des einzelnen nur durch ein ihn tragendes und ihn akzeptierendes und integrierendes Kollektiv realisiert werden kann und nicht in Form eines Superangebotes an Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten, mit dem sich der einzelne, auf sich gestellt, wie in einem Selbstbedienungsladen versorgt. Ob derart eine Chance wahrgenommen wird oder eben nicht, bleibt wieder das isolierte Problem des Einzelnen, wobei nicht weiter hinterfragt wird, welches die Bedingungen sind, unter denen der eine sich dieses Angebot anzueignen vermag und der andere eben nicht.
Was die Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates betrifft, so war sie zwar eine umfassende Sammlung wissenschaftlich vertretbarer und belegbarer Forderungen hinsichtlich pädagogischer und institutionalisierter Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, die aber weitgehend von der gesellschaftlichen Realität des existierenden Erziehungs- und Bildungssystems abstrahierte und letztlich als moralische Forderung im Raum stehen blieb, von der nicht anzunehmen war, dass in Anbetracht der vorherrschenden gesellschaftlichen Interessen eine
- 9 -
Sensibilität vorliegen könnte, die diesen Anspruch aufzunehmen und in soziale und bildungsmäßige Praxis umzusetzen in der Lage gewesen wäre. Vielmehr führte das Erscheinen der Empfehlung in einer ersten Reaktion zu einem Stopp in Bezug auf den weiteren Ausbau und die Verbesserung des Versorgungs- und Erziehungs- und Bildungssystems für behinderte Menschen (was schon damals wesentlich aus finanziellen Einsparungsgründen und nicht aus Überzeugung für die ‚Integration‘ erfolgte), ohne dass auch nur entfernt danach gefragt worden wäre, was anstelle der Aussonderung in Sondereinrichtungen zu setzen und wie reguläre Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen zu verändern wären, um den Verbleib der betroffenen Menschen in ihrer regulären Lebens- und Lernumwelt so zu garantieren, dass Behinderte wie Nichtbehinderte zu neuen Qualitäten des Umganges miteinander kommen, ohne dass die eine Gruppe auf Kosten der anderen missbraucht worden wäre. Zudem erscheint die Annahme begründet, dass die Intensität, mit der die Bildungsratsempfehlung selbst den Gedanken der Integration vertritt (was voraussetzt, dass sich die an der Erstellung des Gutachtens Beteiligten damit umfassend identifizieren), sehr weit überschätzt worden ist. Zu dieser Einschätzung muss man kommen, wenn man die Arbeiten einzelner VertreterInnen in der Bildungskommission, die an dieser Empfehlung mitgearbeitet haben, auf diesen Aspekt hin durchsieht.
Mithin lagen weder durch die Entwicklung der Gesamtschule noch durch die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates konzeptionelle und inhaltliche Grundlagen vor, die die Praxis der Integration hätten einleiten können, abgesehen davon, dass beide genannten Ereignisse in Bezug auf diese Aufgabe selbst nicht hinreichend überzeugend waren. Dies wird deutlich, wenn man die Hinweise der Empfehlung im Punkt 4.5.3.4 „Allgemeiner Kindergarten und Kindergarten für Behinderte“ auf Seite 55 des Berichtes durchsieht. Dort werden drei Organisationsformen für die Förderung behinderter Kinder in der Kindergartenarbeit erwähnt:
-
„Spielgruppen für behinderte Kinder, die einer umfänglichen behinderungsspezifischen Förderung bedürfen (z. B. Sprachanbahnung),
-
Spielgruppen von behinderten und nichtbehinderten Kindern für eine stundenweise gemeinsame Förderung,
-
Spielgruppen nichtbehinderter Kinder, in die behinderte Kinder auf Dauer aufgenommen werden, wobei für diese Kinder eine behinderungsspezifische Förderung durch die Mitarbeiter des Kindergartens für Behinderte aufrechterhalten bleiben muss.“ 3(01)
Wie dieser Bericht zeigen wird, sind diese Hinweise der Empfehlung kaum mehr als ein allgemeines Statement, dass das Wesen der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindergarten und die entsprechenden pädagogischen, d. h. curricularen, didaktischen, methodischen, therapeutischen und medialen Aspekte in keiner Weise zu erfassen vermag.
In jüngerer Zeit dürfte der zentrale Anstoß für die beschriebene Ausweitung der Diskussion um die Integration in der BRD wesentlich die Bewegung der „Demokratischen Psychiatrie“ in Italien gewesen sein, die ab Mitte der 1970er Jahre durch vergleichbare Ansätze in der BRD z.B. durch die „Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie“ (DGSP) bzw. die „Kritische Psychologie“ und vergleichbar dazu die „Kritische Behindertenpädagogik“ aufgegriffen wurden. Vor allem wurde in diese Diskussion in der BRD auch die Entwicklungen in den skandinavischen Ländern, insbesondere die in Dänemark, mit einbezogen sowie auch Erfahrungen, die in Teilen der USA unter dem Stichwort des ‚Mainstreaming‘ gemacht werden konnte. Dass diese Anstöße derart breit greifen und wirksam werden konnten und zahlreiche Versuche in der Praxis nach sich zogen, liegt daran, dass die dahinter stehenden Überlegungen nicht symptomatisch auf Aufschluss Behinderter und psychisch Kranker orientiert sind, sondern dass es hier um die grundsätzliche Einlösung der für alle Menschen geltenden Grundrechte auf Gesundheit, Erziehung und Bildung geht und offen gelegt wird, dass diese Grundrechte Behinderten und psychisch Kranken durch ihren Ausschluss aus den regulären Lebens- und Lernzusammenhängen, quasi als strafende Antwort auf ihr Abweichen von erwarteten Vorstellungen und Normen, vorenthalten werden und dass diese Sanktionen
- 10 -
ihrerseits in keiner Weise „behinderungsspezifisch“ und „heilend“ sind, sondern in der Folge sogar Ergebnisse zeitigen, die man zuvor für das eigentliche Wesen des behinderten bzw. psychisch kranken Subjekts hielt. Allerdings vermögen diese Erkenntnisse nur sehr langsam einen breiteren Prozess der Bewusstseinsveränderung in der Öffentlichkeit auszulösen. So wird heute mehrheitlich noch immer die Position vertreten, dass die segregierte Förderung behinderter Kinder in besonderen Einrichtungen mit dem Ziel ihrer Rehabilitation der einzige und ein unverzichtbarer Weg sei, dem Erziehungs- und Bildungsbedürfnis behinderter Kinder gerecht werden und sie für eine spätere Teilhabe am und für die Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben qualifizieren zu können. Dabei bleibt eben weiterhin ausserhalb der Betrachtung, dass dieser Weg dem verfolgten Anliegen und Ziel selbst extrem zuwiderläuft.
In der allgemeinen Diskussion um die Integration Behinderter vernachlässigt man allzu oft die Bestimmung der Ausgangslage. Vordergründig erweckt die Forderung nach Integration den Eindruck, Behinderte stünden ausserhalb dieser Gesellschaft. Dem widerspricht, was heute sicher als allgemeingültiger Konsens in dieser Sache angesehen werden kann, dass menschliche Existenz außerhalb eines sozialen bzw. gesellschaftlichen Rahmens nicht denkbar ist. Vielmehr macht die bestehende Realität in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass bestimmte soziale Schichten oder Gruppen, insbesondere wenn sie mit einer „Arbeitskraft extrem minderer Güte“ (Jantzen) ausgestattet sind und/oder nach äußerlich in Erscheinung tretenden biologischen Merkmalen bzw. aufgrund auffälliger Abweichungen von einer Verhaltensnorm als behindert oder psychisch krank klassifiziert wurden und bestimmte Erwartungshaltungen nicht mehr einlösen, in besonders negativer und sie zerstörender Weise sozusagen die negativen Lasten dieser Gesellschaft zu tragen haben, indem man sie in „Institutionen der Gewalt“ (psychiatrische Abteilungen, Kliniken, Anstalten, Heime, Sondereinrichtungen anderer Art) ausgrenzt. Ein Teil der so Ausgegrenzten wird, was besonders zynisch ist, dann von jenen, die die Ausgrenzung bzw. darüber hinaus auch oft die Bedingungen zu verantworten haben, unter denen Behinderung und psychische Krankheit in Erscheinung treten kann, dadurch funktionalisiert, dass man sich ihnen mitleidvoll zuwendet oder Maßnahmen, wie z.B. Aktion Sorgenkind in Gang setzt, die den realen Mechanismus von Ausschluss aus den regulären Lebens- und Lernzusammenhängen und den Einschluss in Anstalten und Heime oder die Segregierung in Sonderkindergärten und Sonderschulen verschleiern. Diese Zusammenhänge schaffen als real existierende gesellschaftliche Verhältnisse einen Widerspruch, den wir als solchen in unserem Bewusstsein erst einmal zulassen und dem gegenüber wir uns offen stellen müssen. Dies verdeutlicht, dass Behinderte in besonders extremer Weise die negativen Lasten unserer Gesellschaft zu tragen haben, sie aber nicht außerhalb unserer gesellschaftlichen Realität stehen, sondern in einem ihrer zentralen Brennpunkte.
Übertragen findet sich diese Problematik auch im Bereich der Pädagogik. Wer den altersbezogenen Erwartungs- und Leistungsnormen im Rahmen seiner Erziehung und Bildung und hier den durch die Kindergärten und das Schulsystem vorgegebenen Anforderungen der Regelpädagogik nicht entspricht, wird in vorschulische und schulische Sondereinrichtungen segregiert und in diesen Einrichtungen entsprechend Art und Schweregrad der Behinderung unter Kinder und Jugendliche vergleichbarer Beeinträchtigungen mit einem pädagogischen Angebot konfrontiert, das auf der Ziel- und Inhaltesebene entsprechend der herabgesetzten Erwartungsnorm diesen Kindern und Jugendlichen gegenüber weitgehend reduziert ist (Sonderschulpädagogik). Eine an den in Erscheinung tretenden Merkmalen der Behinderung orientierte Methodik und entsprechende therapeutische Versatzstücke sowie die zusätzlich angebotenen Hilfen vermögen die durch den Ausschluss aus regulären Lebens- und Lernzusammenhängen und die reduzierten Ziel- und Inhaltsangebote geschaffenen Beeinträchtigungen bei weitem nicht zu kompensieren. Zudem besteht selbst heute noch für sehr schwer und umfassend behinderte Kinder (z.B. sog. Schwerstbehinderte) die Gefahr, sogar noch von der erziehungs- und bil-
- 11 -
dungsmäßigen Ersatzversorgung im Rahmen der Sonderpädagogik ausgeschlossen zu bleiben und der Verwahrung und Versorgung in Heimen und Anstalten überantwortet zu werden.
Entsprechend hatte sich in der Diskussion um integrative Bemühungen eingebürgert, von Regelpädagogik im Vergleich zu Sonderpädagogik zu sprechen, denn beide sind Formen einer allgemeinen Pädagogik und des allgemeinen Erziehungs- und Bildungssystems.
Die bis in die Antike hinein nachvollziehbaren Versuche der Behandlung der heute als behindert bzw. psychisch krank geltenden Menschen zeigen zu jeder historischen Epoche die Abhängigkeit dieser Versuche von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Grundauffassungen darüber, was Behinderung und psychische Krankheit sei, von der ökonomischen Lage einer Gesellschaft, den jeweils herausgebildeten Norm- und Wertvorstellungen und von den Erwartungen, die sich an der späteren gesellschaftlichen Verwertbarkeit des betroffenen Personenkreises in Relation zum Aufwand für die Wiederherstellung bzw. die Erhaltung seiner Gesundheit und der erforderlichen Erziehung und Bildung orientieren.
Die sich unter den entsprechenden gesellschaftlichen Bedingungen herausbildenden Fachwissenschaften, insbesondere Medizin, Psychologie und Pädagogik, orientierten sich an den vorherrschenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen, Haltungen und Einstellungen der herrschenden Gruppen einer Gesellschaft. In diesem Zusammenhang haben sie weitgehend die Funktion, den bereits gesellschaftlich vollzogenen Ausschluss behinderter und psychisch kranker Menschen nachträglich durch Diagnosen mit wissenschaftlichem Charakter zu legitimieren. Aufbauend auf diesen Diagnosen war ein wissenschaftliches Alibi für die ‚Aussonderung‘ und den ‚Ausschluss‘ der Betroffenen von der Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern und am sozialen Verkehr und für die Kinder und Jugendlichen von einer regulären Lern- und Lebensumwelt gefunden, was in der Regel ihren ‚Einschluss‘ in die ihrer Verwahrung dienenden Anstalten, in psychiatrische Kliniken und Landeskrankenhäuser und andere Sondereinrichtungen nach sich zog (3).
Der Mensch selbst rückte aus dem Zentrum des Interesses der Fachwissenschaften; Gegenstand der medizinischen Betrachtung wurde die „Defektivität“ und „Pathologie“, der psychologischen die „Devianz“ und der pädagogischen die „Behinderung“. Die sich auf diesem Hintergrund entwickelnden Denkkategorien des medizinischen Modells mit seiner Ausdifferenzierung in die Bereiche von Psychopathologie und Psychiatrie in Kombination mit sozialdarwinistischen Bestrebungen, biologistischen Betrachtungsweisen und anthropologischen und ontologisch-wertphilosophischen Tendenzen führten im Zusammenhang mit rassenideologischen Bestrebungen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen z. B. im deutschen Faschismus konsequent zur „Sterilisation“ der Betroffenen unter dem Deckmantel der „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und unter dem Stichwort der „Euthanasie“ zur Vernichtung der als lebensunwert deklarierten Existenz Behinderter und psychisch Kranker (4).
Mit der Entfaltung der Fachwissenschaften waren aber auch immer ansatzweise Bemühungen erkennbar, Behinderten und psychisch Kranken eine hinreichende Existenzsicherung durch die Einlösung der menschlichen Grundbedürfnisse nach Gesundheit, Erziehung und Bildung und eine humane Lebensführung in sozialer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Bemühungen koppelten sich fortschreitend mit Erkenntnissen, dass der Ausschluss aus regulären Lebens- und Lernzusammenhängen und der Ein- und Zusammenschluss der Betroffenen nach Maßgabe klassifizierter Krankheitseinheiten und Behinderungsformen, nach deren Art und Schweregrad, nicht nur die angestrebte Rehabilitation nicht ermöglichen, sondern für die Betroffenen extrem belastend und beeinträchtigend sind und, wie schon erwähnt, gerade die verhaltensmäßigen Erscheinungen als Ausdruck
- 12 -
der dadurch bedingten psychischen Verkrüppelung der Betroffenen hervorrufen, die man für ihre Behinderung bzw. psychische Krankheit hält (5).
Darüber hinaus werden durch diese Maßnahmen und die Art und Weise der Behandlung der Betroffenen die organischen und/oder sozialen Beeinträchtigungen, die sie schon erfahren haben, noch zusätzlich verstärkt und bei Kindern deren Entwicklung erheblich fehlgeleitet bzw. sogar verhindert. Diese Erkenntnisse, auf die man spätestens nach den Arbeiten von René Spitz über die Entstehung und den Verlauf des „psychischen Hospitalismus“ im Zusammenhang mit der frühkindlichen Entwicklung hätte aufmerksam werden müssen (6), sind historisch gesehen in ihrem Grundverständnis schon viel früher angelegt und finden ihren pädagogischen Ausdruck z.B. in der Arbeit mit Viktor dem sog. „Wilden von Aveyron“, dessen Fall 1799 (er wurde als Wildling im Alter von etwa 11 Jahren in den Ardennen eingefangen) bereits weltweites Interesse fand.
Obwohl heute z.B. im Rahmen der Stress- und Isolationsforschung oder auf dem Hintergrund der vorliegenden neuropsychologischen Erkenntnisse selbst empirische Belege für die negativen bis zerstörerischen Auswirkungen der Isolation des Menschen aus seinem natürlichen Lebensumfeld vorliegen, werden diese nicht nur verdrängt, sondern noch immer durch diffamierende Polemik bekämpft (7).
Auch der mit der Integration verbundene Anspruch auf eine Revision dieser jahrhundertealten Praxis der Aussonderung und des Ausschlusses Behinderter aus dem regulären Lebens- und Lernumfeld wird oft so interpretiert, dass gerade durch die Integration das geschehe, was man durch Segregation der Betroffenen vermeiden möchte, nämlich ihre Isolation (8). Der erreichte Stand der Bemühungen um integrative Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie die bereits vorliegenden praktischen Erfahrungen erlauben heute die Verdrängung der Forderung nach Integration nicht mehr. Allerdings wird versucht, sie zu unterlaufen, sie durch Vorenthaltung der erforderlichen materiellen Basis zu verhindern oder zu erschweren oder sie im Interesse drastischer Kostenersparnisse im Behindertenbereich zwar zu gestatten, jedoch unter Bedingungen, die dem Sachanliegen und dem Personenkreis kaum gerecht zu werden vermögen.
Unter den Aspekten der aufgezeigten Zusammenhänge im Rahmen der seit der Antike feststellbaren Besonderung Behinderter und psychisch Kranker haben sich sowohl die allgemeine Pädagogik wie die Heil- und Sonderpädagogik als weitgehend voneinander isolierte pädagogische Praxisfelder entwickelt. Die Denk- und Handlungsweisen der Heil- und Sonderpädagogik sind weitgehend dem defektorientierten medizinisch-psychiatrischen Modell verpflichtet; die allgemeine Pädagogik denkt fast ausschließlich in leistungsorientierten Werthaltungen und Vorstellungen, wie sie unsere heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse, besonders die Produktions- und Konsumptionsbedingungen aufzwingen.
Beide pädagogischen Bereiche sind mehr oder weniger ihrem eigentlichen Gegenstand, nämlich die menschliche Entwicklung eines jeden Subjekts auf ein umfassend entfaltetes Niveau voranzubringen, entfremdet, wie beide Bereiche ihre Theorien und Handlungsweisen unter Ausschluss der anderen Richtung entfaltet haben. So ist die Erziehung und Bildung Behinderter eine Sonderpädagogik wesentlich durch ihr Ausgeschlossensein von den Nichtbehinderten und die Regelpädagogik eine Sonderpädagogik durch den Ausschluss der Behinderten.
Diese historisch herausgebildeten Funktionen haben in beiden pädagogischen Bereichen dogmatische Elemente entstehen lassen, die nur durch die Schaffung einer neuen pädagogischen Qualität überwunden werden können (9).
Selbst eine grobe Analyse der historischen Entwicklung der sich um Behinderte und Nichtbehinderte bemühenden Pädagogik, der Regel- und Sonderpädagogik, zeigten, dass
- 13 -
-
keiner der beiden Bereiche allein
-
wie auch die additive Verquickung der beiden Bereiche (der Regel- und Sonderpädagogik)
das Anliegen der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder nicht zu leisten vermögen.
Viele Inhalte und Methoden der Regelpädagogik sind auf die zukünftige Verwertbarkeit des Menschen in Produktions- und Konsumtionszusammenhängen orientiert, während die Heil- und Sonderpädagogik in ihren Zielen, Inhalten und Methoden auf den Defekt, die Pathologie, die Devianz oder Behinderung fixiert ist, wobei beide von der Einheit und Gesamtheit des Menschen und seiner Entwicklung abstrahieren und in der Folge davon die Grundlagen und das etappenweise Voranschreiten der menschlichen Entwicklung weitgehend unberücksichtigt lassen.
In ihrer Verpflichtung auf die Normalität der Regelpädagogik und durch die Fixierung der Behindertenpädagogik auf den Defekt des Menschen haben beide ihr ureigenes pädagogisches Anliegen verloren. Dieses war selbst in den Anfängen der Heilpädagogik noch transparent, was deutlich wird, wenn Georgens und Deinhardt (1861) im 1. Band ihres Werkes mit dem Titel „Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten“, das in Leipzig erschien, Heilpädagogik als „den pädagogischen Kampf gegen bestimmte Gestaltungen der Not, des Leidens und der Entartung ..., damit aber als die Fortsetzung und Besonderung einer Tätigkeit... welche der Erziehung schlechthin zukommt“ beschreiben (10). Hier wird im Kontext des Kampfes gegen bestimmte Gestaltungen der Not, des Leidens und der Entartung, wie ihn die Bewegung der „Demokratischen Psychiatrie“ aufgegriffen hat, von der Besonderung einer Tätigkeit welche der Erziehung schlechthin zukommt, gesprochen und nicht von der Besonderung behinderter Kinder und Jugendlicher.
Integration hat den Kampf gegen die noch immer unbeschreibbare Not behinderter Kinder und Jugendlicher zu führen, indem sie deren Besonderung aufhebt und ihre Tätigkeit derart spezialisiert, dass Erziehung und Bildung behinderter Kinder zusammen mit Nichtbehinderten in den regulären Lebens- und Lernumfeldern wieder möglich wird. Dies bedarf der umfassenden Einsicht, dass
-
jedes Kind für die Realisierung seiner Entwicklung der Einbettung in ein tragfähiges Sozialgefüge unter Gewährung von Hilfen bedarf,
-
von Behinderung bedrohte bzw. bereits als behindert geltende Kinder besonderer Hilfen bedürfen, die im Sinne von Georgens und Deinhardt als „Besonderung einer Tätigkeit, welche der Erziehung schlechthin zukommt“, zu verstehen sind, also als Besonderung, als Spezialisierung unserer pädagogischen Tätigkeit und nicht der Besonderung der Gruppe der Behinderten in Sondereinrichtungen und in andere segregierende Maßnahmen und dass
-
was wir als Behinderung feststellen, Ausdruck ein und derselben Not, desselben Leides und derselben Entartung ist, um auch hier mit Georgens und Deinhardt zu sprechen, aber nicht dieser Menschen, sondern unserer Art ihnen zu helfen.
-
Gilt es zu erkennen, dass wir die Bedingungen, unter denen sich behinderte Menschen entwickeln müssen, noch allzu leicht zu ihrem Wesen machen, obwohl festzustellen ist:
-
Es ist unsere Art, sie zu isolieren und ihnen dann als Therapie alles das gewähren zu müssen, was jedem Menschen selbstverständlich zur Verfügung stehen müsste,
-
es ist unsere Art, sie isoliert zu behandeln, zu stimulieren, zu therapieren, ohne dass für die Kinder, was sie hierbei erfahren, einen Sinn und Bezug zur Befriedigung ihrer alltäglichen Bedürfnisse ergeben oder das Gefühl einer Kompetenz für das Leben in einer Gruppe von Altersgenossen verleihen könnte,
- 14 -
-
es ist unsere Art, sie aus heil- und sonderpädagogischen und anderen Gründen zu besondern, damit wir auch mit einer singulären Pädagogik etwas erreichen, anstatt dass wir unsere Pädagogik für die Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse dieser Kinder spezialisieren,
-
es ist unsere Art, ihnen Welt und Begegnung mit nichtbehinderten, altersgleichen Kameraden und eine adäquate didaktische und methodisch/therapeutische Konzeption unseres Handelns vorzuenthalten, weil wir nicht hinreichend ausgebildet sind, weil dies zu personalintensiv und zu teuer wäre, anstatt dass wir gewähren; letztlich auch uns selbst in einer ehrlichen Begegnung,
-
und es ist unsere Art, sie zu bemitleiden und dadurch zu behindern, dass wir ihnen alle Probleme aus dem Weg räumen, anstatt dass wir sie im regulären Alltag mit fachpädagogischer und therapeutischer Hilfe mit bewältigbaren Problemen konfrontieren.
Dies bedeutet, wie schon an anderer Stelle betont (11), dass wir einer Pädagogik, bedürfen, die
-
soweit individuenbezogen ist, dass sie jedem Menschen ein individuelles [muss heißen: individualisiertes; GF] Curriculum ermöglicht, und
-
die soweit gesellschaftlich ist, dass jedem curricularen Teilschritt die Sozialität des Kindes immanent ist,
-
die insofern historisch ist, dass sie die Biographie des Menschen und die Analyse seiner momentanen Handlungsfähigkeit zum Ausgangspunkt nimmt und sein Lernen mittels didaktisch relevanter Inhalte, adäquater Methoden und geeigneter Medien in der „nächsten Zone der Entwicklung“ realisiert, und die
-
in ihrer didaktischen Dimension exakte Strukturanalysen des zu vermittelnden Stoffes leistet,
-
in ihrer methodischen Dimension eindeutige, einfache und klare Interaktions- und Kommunikationsangebote macht, die weder unter- noch überstimulieren und nicht widersprüchlich, d. h., nicht durch isolierende Bedingungen gekennzeichnet sind und eine Handlungskompetenz ermöglichen und
-
in ihrer lernorganisatorischen Dimension die Integration der Betroffenen in ihrer natürlichen Lern- und Lebensumwelt erhält oder diese wiederherstellt.
Die über Jahrhunderte hinweg herausgebildete, unsere heutige Situation weitgehend definierende Art der Behandlung der Frage der Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder wie die Art und Weise der „Be-Handlung“ der als behindert bzw. psychisch krank geltenden Personen i.e.S. kann, wie die vorausgegangene Bestimmung von Regelpädagogik und Sonderpädagogik zeigt, weder seitens der Regel- noch seitens der Sonderpädagogik allein, noch durch die additive Verknüpfung beider pädagogischer Bereiche überwunden werden und keine integrative Erziehung realisieren , wie das bereits zum Ausdruck gebracht wurde. Daraus ergibt sich als allgemeine Forderung, dass Regel- und Sonderpädagogen und Therapeuten, die in integrativ arbeitenden Gruppen/Einrichtungen zusammenarbeiten, gemeinsam einer grundlegenden Qualifikation bedürfen, auf deren Hintergrund sie eine Pädagogik entwickeln und eine Handlungskompetenz herausbilden können, die es
-
in Orientierung am individuellen Erziehungs- und Bildungsbedarf der Kinder,
-
unter Verzicht auf Aussonderung und Ausschluss bzw. unter Wiederherstellung einer durch Aussonderung und Ausschluss bereits zerstörten gemeinsamen Lebensrealität,
- 15 -
-
die es in kooperativen und kommunikativen Handlungen ständig neu herzustellen und zu erhalten gilt,
zu leisten vermag, dass die Kinder
-
entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen in der Ontogenese,
-
unter Berücksichtigung subjektiver Hilfen,
-
durch angemessene methodische Vorgehensweisen,
-
in entsprechenden Zusammenhängen,
-
mit sinnvollen und der Lebensrealität der Kinder entsprechenden Gegenständen und Inhalten in eine handelnde Auseinandersetzung kommen, die
-
ausgehend von der momentanen Handlungskompetenz des einzelnen Kindes,
-
in Orientierung auf die nächste Zone seiner Entwicklung
-
eine jeder Entwicklungsetappe angemessene soziale Kompetenz und eine kognitive, emotive und erlebnismäßig stabile psychische Widerspiegelung und Bewältigung ihrer Umwelt ausbilden können (siehe hierzu Punkt 4.1 des Berichtes: Fortbildung).
Blicken wir zurück: Die Fixierung der Regelpädagogik auf die Normalität und die Fixierung der Sonderpädagogik auf Defekte, Ausfälle, Abweichungen und Behinderungen haben dazu geführt, behinderte Kinder (und in abgeschwächter Weise auch nichtbehinderte Kinder mit sog. Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten) in Fixierung auf ihre Defekte und Devianz zu betrachten, sie sozusagen zu atomisieren und entsprechend ihrer Ausfälle zu behandeln, sie also einer Erwartungsnorm durch korrektive und kompensatorische Erziehungs-, Bildungs- und Therapiemaßnahmen anzugleichen. Damit ging der Blick für die Ganzheit Mensch, für die Einheitlichkeit seiner Entwicklung auf allen Etappen auf der Basis einer uns allen gemeinsamen Stammesgeschichte weitgehend verloren.
Hilfen und Übungen für die Kinder wurden nicht auf ihre Weiterentwicklung fokussiert, sondern auf die Korrektur von Ausfällen spezifiziert und entsprechend überwiegend als reines Funktionstraining eingesetzt. Pädagogisch-therapeutische Bemühungen muten den Kindern oft Behandlungen zu, die für die Kinder nicht einsehbar und nicht nachvollziehbar und von ihren momentanen Bedürfnissen und Motivationen losgelöst sind und derart sinnleer meist nur passiv erduldet werden konnten bis hin, dass sie den Kindern aufgezwungen wurden.
Die geforderte (basale) allgemeine Pädagogik kann als solche überhaupt erst in integrativen Handlungszusammenhängen zwischen Regel- und Sonderpädagogen/Therapeuten und den Kindern zum Tragen kommen. Die humanbiologischen, neuropsychologischen, entwicklungs- und lernpsychologischen basalen Strukturen und Elemente dieser Pädagogik konnten in den letzten Jahren verstärkt im Rahmen unserer Forschungs-, Lehr- und Ausbildungstätigkeit in Kooperation mit jenen Kolleginnen und Kollegen entwickelt werden, mit denen in die integrative pädagogische Praxis (z. B. bei der Spastikerhilfe Bremen und in Bremen-Huchting) eingetreten werden konnte (diese Grundlagen waren auch Gegenstand der Fortbildung aller Beteiligten in der Vorlaufphase).
Die umschriebene, eine basale, allgemeine Pädagogik konstituierende und die Regelpädagogik und Sonderpädagogik überwindende pädagogische Qualität und Handlungskompetenz aller am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten (Pädagogen und Therapeuten) ist insofern eine kindzentrierte Pädagogik, als sie
-
auf den Grundlagen menschlicher Entwicklung fußt,
-
auf der Ebene der aktuellen Zone der Entwicklung und damit auf dem Niveau der momentanen Handlungskompetenz eines Kindes sich mit diesem handelnd in Beziehung setzt und
-
auf die nächste Zone der Entwicklung des Kindes orientiert ist.
- 16 -
Die sich aus einer solchen Pädagogik ergebende erzieherische Grundeinstellung und Haltung ermöglicht es den Pädagogen und Therapeuten, auch wenn sie bisher in einer traditionellen pädagogisch/therapeutischen Praxis standen, mit der Verpflichtung auf die Dogmen der Regel- und Sonderpädagogik zu brechen, d.h. der Verpflichtung an eine fiktive und nur als gesellschaftliches Normen- und Wertsystem verstellbaren Normalität, sowie der vermeintlichen Bildungsunfähigkeit und Therapieresistenz einiger (oft als unverstehbar bezeichneten) schwerstbehinderten oder besonders verhaltenssauffälligen Menschen eine endgültige Absage zu erteilen. Auf der Basis einer solchen Grundeinstellung vermögen sie mit jedem Kind in eine „pädagogische Begegnung“ einzutreten, d.h. auf dessen jeweils höchst entfaltetem Niveau mit ihm zu interagieren, zu kommunizieren und zu kooperieren, ohne dass sie selbst in vermeintlicher Regression auf die Niveaustufen der Kinder ihr jeweils höchst entfaltetes Niveau pädagogischer Arbeit verlassen müssen, was dann der Fall ist, wenn eine der Entwicklungslogik der Kinder entfremdete Grundeinstellung und Handlungsmotivation der Pädagogen und Therapeuten vorliegt.
Insofern ist für eine integrative Erziehungs- und Bildungsarbeit die Entfaltung des hier vorgetragenen Menschenbildes unverzichtbare Grundlage und notwendige Voraussetzung, um in integrative Erziehungsprozesse eintreten zu können.
Die beschriebene erzieherische Grundeinstellung und Grundhaltung lässt sich also nicht, wie dies in Anlehnung an Bleidick formuliert werden könnte, aus der Anthropologie des Behinderten und seiner Erziehung gewinnen, die „die Appelle, die Motive, die humanen Verpflichtungen aufzählt, die dem Erzieher abverlangt werden, wenn er den Behinderten recht erziehen will, wobei es seine Sache sei, für welches Menschenbild er sich entscheidet“ (12). Hier bleibt nur die Frage: War es nicht Appell, Motiv und humane Verpflichtung des Pädagogen in der NS-Zeit, seine Schüler für Maßnahmen der Sterilisation zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zu melden und Maßnahmen der Euthanasie nicht hinderlich zu sein? (13). Für die Entfaltung einer basalen allgemeinen Pädagogik ist das Menschenbild primär und grundsätzlich, denn aus ihm entstehen die Appelle, die Motive und Verpflichtungen, die dem Erzieher abverlangt werden!
Erst ein solches Menschenbild und die Orientierung auf eine basale allgemeine Pädagogik ermöglichen es, die Pädagogik zu differenzieren und sie den besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnissen der einzelnen Kinder anzupassen und nicht die Kinder auf der Basis der an der Normalität orientierten fiktiven Merkmalsklassen von Behinderung und deren Schweregrade auszusondern. Damit erteilt eine kindzentrierte, basale allgemeine Pädagogik auch entschiedene Absagen an ein antipädagogisches Konzept, an das Prinzip des Laissez-faire u.a. sich vermeintlich fortschrittlich gebärdende pädagogische Ideologien und Phrasologien, die davon reden, sich von den Bedürfnissen der Kinder lenken zu lassen, in Wirklichkeit aber diese zum Alibi für eine Erziehung nehmen, die weitgehend als praktizierte „Willkürpädagogik“ beschrieben werden muss, zumal diese PädagogInnen meist keinen entfalteten bzw. aus der Entwicklungslogik des Menschen heraus begründeten Bedürfnisbegriff haben und ihre Auffassungen meist mit einem extrem wissenschafts- und theoriefeindlichen Grundverständnis der Personen einhergeht, die sich PädagogInnen nennen.
Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass im Umfeld der Vorbereitung, Durchführung und Weiterentwicklung integrativer Maßnahmen in das schulische Feld hinein derartige pädagogische Positionen, die im Prinzip gar nicht als solche gewürdigt werden können, den angestrebten Entwicklungen weit hinderlicher im Wege stehen als tradierte Vorurteile gegen Behinderte, zumal ich auf dem Hintergrund breiter Erfahrungszusammenhänge in diesem Feld eine Tendenz sehe, dass es heute ‚in‘ ist, für Integration zu sein, dass aber schon erste Versuche ihrer Realisierung, besonders dann, wenn in den Vorbereitungsphasen die möglichen MitarbeiterInnen mit der Veränderung ihres Menschenbildes und den Ansprüchen einer basalen allgemeinen Pädagogik konfrontiert werden, z.T. massiver Widerstände entwickeln. Dann ist meist ein Punkt erreicht, der die Entwicklung und Ausdehnung integrativer Maßnahmen extrem gefährdet. Wenngleich dies ein Widerspruch ist, ist es aus historischen
- 17 -
Zusammenhängen heraus dennoch erklärbar (in diesem Bericht muss auf die Analyse dieser Widersprüche verzichtet werden), dass die VertreterInnen solcher Positionen sich meist selbst als sehr fortschrittlich verstehen und nicht selten gewerkschaftlich organisiert sind, zu den aus der integrativen Pädagogik sich ergebenden Konsequenzen hinsichtlich ihrer eigenen Veränderung aber ‚nein‘ sagen.
Die beschriebene kindgemäße basale allgemeine Pädagogik [diese Bestimmung von Pädagogik wird zu dieser Zeit in anderen Schriften bereits als „Allgemeine Pädagogik“ gefasst; GF] verweist auf zwei Ebenen, die in Anlehnung an Séguin (14) im Prozess gemeinsamer Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder Integration konstituieren. Diese sind
-
die Wiederherstellung der Einheit des Menschen in der Menschheit und
-
die Wiederherstellung der Einheit unserer zusammenhanglos gewordenen Mittel und Werkzeuge der Erziehung.
Mit der Wiederherstellung der Einheit des Menschen wird die Absage an die Fixierung der Sonderpädagogik auf die Defekte, die Devianz und die Behinderung des Kindes und damit dessen Atomisierung in pathologische Merkmale und Verhaltensauffälligkeiten und die Absage an die Regelpädagogik und ihre Fixierung auf die Normalität umschrieben und auf die Ganzheit und Einheit des Menschen in allen Etappen und auf allen Niveaus seiner Entwicklung verwiesen.
Mit der Wiederherstellung der Einheit des Menschen in der Menschheit wird die Absage an die Aussonderung aus regulären Lebens- und Lernzusammenhängen, an den Ausschluss von der Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern und vom sozialen Verkehr, an den Ausschluss von der umfassenden Aneignung des gesellschaftlichen Erbes und die Besonderung der Einlösung der Bedürfnisse nach Gesundheit, Erziehung und Bildung und an die Segregierung in Sondereinrichtungen und den Einschluss in Heime und Anstalten umschrieben und auf die grundsätzliche soziale Kompetenz und soziale Bedürftigkeit und Einbettung eines jeden Individuums in die menschliche Gemeinschaft verwiesen und
mit der Wiederherstellung der Einheit unserer zusammenhanglos gewordenen Mittel und Werkzeuge der Erziehung wird die Absage an die Regel- und Sonderpädagogik und an eine isolierte Therapie umschrieben und auf den Zusammenhang von curricularen, didaktischen, medialen, methodischen und therapeutischen Aspekte einer kindzentrierten basalen Allgemeinpädagogik verwiesen.
Auf der Grundlage der beschriebenen Pädagogik ist es ein zentrales Anliegen integrativer Erziehung, den Zusammenhang von individueller Entwicklung und sozialer Gemeinschaft mit Möglichkeiten von Erziehung und Bildung wieder herzustellen, so dass die Kinder
-
nicht als Objekte behandelt,
-
sondern mit ihnen als Subjekte im gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsprozess gehandelt wird und sie derart
-
eine persönliche Integrität ausbilden,
-
sich subjektiv als vermögend erfahren und
-
ihre Handlungen für den jeweilig anderen/die Gruppe als bedeutend erleben können.
Dies verweist darauf, dass Integration weder ein Ziel noch eine Methode, noch ein pädagogisches Faktum an sich ist und sein kann, sondern sich aus den hier aufgezeigten Zusammenhängen von Erziehung und Bildung auf der Basis eines kindzentrierten Menschenbildes bestimmt, das Regelpädagogen, Behindertenpädagogen und Therapeuten zu einem gemeinsamen Handeln mit den Kindern veranlasst. Erst dies ermöglicht eine individuelle und soziale Integrität der Betroffenen (der nichtbehinderten und behinderten Kinder, der Pädagogen und Therapeuten) als Basis der Überwindung von Segregation und Isolation, was mit dem Begriff der ‚Integration‘ beschrieben werden kann; Integration existiert entsprechend nur dann und nur dort, wo sie (im pädagogischen Feld) in pädagogischen Handlungszusam-
- 18 –
menhängen realisiert wird. Derart kann nun Integration beschrieben werden, wie sie unser Vorhaben in Bremen-Huchting in gleicher Weise voraussetzt wie bestätigt:
Integration zu realisieren heisst, dass
-
alle Kinder
-
an/mit einem Gemeinsamen Gegenstand
-
in Kooperation miteinander
-
auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau spielen und lernen.
Die vorgenannte Beschreibung und Bestimmung von Integration, wie sie in unsere Kindergartenarbeit als Voraussetzung einging und in der Praxis, wie noch aufzuzeigen sein wird, realisiert werden konnte, hat folgende allgemeine Bestimmung von Integration zur Grundlage:
Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit)
am Gemeinsamen Gegenstand/Produkt
in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen.
Die Herleitung und Begründung dieser Beschreibung von Integration, wie sie für unsere heutige Praxis als nicht mehr zu unterschreitende Grundlage und Voraussetzung angesehen und durch die Praxis selbst als realisierbar erfahren wird, erfolgte 1982 in einem grundlegenden Aufsatz dazu, auf den verwiesen wird (15); aus dem aber aus Gründen des Verständnisses der nachfolgenden Zusammenhänge und Praxis einige zentrale Aspekte thesenartig wiedergegeben werden sollen:
1. Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass die Entwicklung der menschlichen Tätigkeit ausgehend von der verhaltensmäßigen Darstellung angeborener Auslösemechanismen in der frühen Mutter-Kind-Interaktion unmittelbar nach der Geburt über das Stadium überwiegend durch Anpassung gekennzeichneter Ausbildung individueller Fertigkeiten, die wir phylogenetisch gesehen mit allen durch höhere Nervenprozesse organisierten Lebewesen im Säuglings- und frühen Kleinkindalter gemeinsam haben (16), bis hin zur Aneignung des historisch durch die Menschheit angesammelten Wissens durch sinnmotivierte und zielorientierte Handlungen, die den Menschen als Gattungswesen eindeutig vom Tier unterscheiden und die Ausbildung eines (Ich- und Selbst-)Bewusstseins, der Sprache und eines hierarchischen Denkens in Symbolen ermöglichen (die sowohl Produkte wie Werkzeug dieses Aneignungsprozesses sind), auch bei unterschiedlichsten individuellen Voraussetzungen und selbst schwerster Schädigungen (Hirn-)organischer Art ein eindeutig sozial bestimmter Prozess ist, der sowohl in seinen organischen (Aufbau differenzierter funktionaler Hirnorgane) wie psychisch-geistigen Komponenten (Kognition, Emotion, Erleben und die zu erwerbende Identität) nur im sozialen Kontext, also durch Interaktion, Kommunikation und Kooperation verstehbar, aufbaubar wie beeinflussbar ist (17).
Diese Prozesse realisieren sich durch Lernen, auf dessen allgemeine Aspekte im nächsten Unterpunkt des Berichtes eingegangen werden wird.
2. Wir verstehen Integration als einen historischen Prozess der Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen wie individuellen Bewusstseins, das zwangsläufig auf der historisch gewordenen Gegenwartsrealität aufbauen muss. Dies schliesst die Forderung ein, Integration hier und jetzt zu beginnen und zu leisten.
Ein Argument, das uns sowohl in der Vorbereitungsphase der Integration im Kindergarten, in der Vorbereitungsphase der Fortsetzung integrativer Förderung in der Grundschule und in der allgemeinen Diskussion häufig begegnet, ist, dass
- 19 -
sich doch zuerst die Gesellschaft wandeln müsse, um Kinder integrieren zu können, zumal das bestehende Erziehungs- und Bildungswesen selbst schon nichtbehinderte Kinder an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit im bestehenden System führe. Ergänzt wird dieses Argument durch Hinweise und Befürchtungen derart, dass behinderte Kinder in Regelsystemen ohne die vorausgesetzte Veränderung gesellschaftlichen Verständnisses und gesellschaftlicher Erziehungs- und Bildungspraxis erst recht an den Rand gedrängt werden könnten und sie ihr Ausgeschlossen-Sein und die Ausschlussprozesse täglich neu erfahren ließe, womit auch die Schaffung eines Schonraumes mit den Sondereinrichtungen oft begründet wird.
Vorstellungen dieser Art gehen davon aus, dass das gesellschaftliche Bewusstsein und bestimmte Ideologien an sich bestünden und ebenso an sich verändert werden könnten. Die Veränderungen, die wir in Zusammenhang mit unserer integrativen Erziehungspraxis im betroffenen Stadtteil wie durch die Öffentlichkeitsarbeit, die darüber hinaus viele Diskussionsprozesse ausgelöst hat, bewirken konnten, verdeutlichen, dass die jeweils das Bewusstsein bestimmenden Inhalte, die dann wieder zum handlungsleitenden Sinn und zum Motiv des Handelns werden, als Widerspiegelungsprozesse der konkreten individuellen wie gesellschaftlichen Praxis zu verstehen sind. Mithin wird sich das Bewusstsein des Einzelnen wie der Gesellschaft erst durch eine veränderte gesellschaftliche Praxis verändern. Dies zeigt sich uns darin, dass z. B. zuvor skeptische und die Integration ablehnende Mediziner oder Fachleute aus der Schulverwaltung nach Besuchen im Kindergarten und dem Erlebnis der dort praktizierten Pädagogik und des erfahrenen Erziehungsklimas ihre Vorbehalte zurückzunehmen begannen, oder darin, dass einzelne Eltern, die zu Beginn der Befassung mit der Möglichkeit integrativer Erziehung ihrer behinderten und nichtbehinderten Kinder skeptisch bis ablehnend waren, heute selbst in öffentlichen Diskussionen z.B. nicht nur zur Behinderung ihres Kindes stehen können, sondern zu dezidierten Verfechtern integrativer erzieherischer Maßnahmen geworden sind.
Dies geschah im Rahmen unseres Vorhabens nie durch ideologische Beeinflussung oder gar eine repressive Praxis den Beteiligten und Betroffenen gegenüber, sondern durch das offene Einräumen der Chance, neue Erfahrungen zu machen und an dem in Gang kommenden Prozess partizipieren zu können, was dann sowohl bei den Pädagogen, die noch Vorbehalte oder Ängste hatten, wie bei den Eltern zu Veränderungen ihrer Einstellungen und Haltungen führte, was, wie wir das oft bestätigt fanden, selbst im Rahmen der familiären Erziehung eine veränderte Erziehungspraxis nach sich zog.
Auch von den Institutionen her gesehen ist Integration hier und jetzt zu beginnen: Das heisst, auch Institutionen werden sich erst dann verändern und isolierende, stigmatisierende und wenig kindzentrierte, sondern mehr an den Bedürfnissen des Personals und des institutionellen Ablaufes orientierte Verfahrensweisen aufgeben, wenn durch das geschaffene Faktum des gemeinsamen Besuches der Einrichtung durch nichtbehinderte und behinderte Kinder sich in den Köpfen der Betroffenen der entsprechende Einstellungswandel vollziehen kann und damit die Institutionen wieder als ein Werkzeug, ein Instrument begriffen werden, eine kindzentrierte Pädagogik zu organisieren und abzusichern, wo zuvor selbst das Personal der Einrichtungen mehr oder weniger eine abhängige Funktion der institutionellen Gesetzmäßigkeiten gewesen war.
Diese Erfahrungen verweisen einerseits darauf, dass es, wie es die Spastikerhilfe in Bremen (18) bereits in sehr weit fortgeschrittener Weise zeigt, sich auch Sondereinrichtungen auf der Basis ihrer historischen Gewordenheit und als Gegebenheit institutioneller Art in bestimmten Stadtteilen für nichtbehinderte Kinder öffnen können, wie wir die Regelkindergärten für behinderte Kinder ihres Stadtteiles öffnen. Dass dabei selbstverständlich rückgehende Belegzahlen durch behinderte Kinder in den Sondereinrichtungen eine Rolle spielen, ist unbestritten; dennoch werden sich auch Sondereinrichtungen dann endgültig in Regeleinrichtungen umwandeln können, wenn eine genügende Anzahl von Regeleinrichtungen bereit und in der Lage ist, behinderte Kinder ihres Stadtteils aufzunehmen. Auf diese Weise reduziert sich das überregionale Aufkommen behinderter Kinder für
- 20 -
die zentralen Sondereinrichtungen.
Allerdings besteht eine massive Gefahr dann, wenn eine Sondereinrichtung sich nur um ihrer institutionellen Erhaltung willen für nichtbehinderte Kinder öffnet, weil dann der institutionelle Zwang, sich selbst zu erhalten, Maßstab für eine solche Maßnahme ist und damit die Chance einer breiten Veränderung bewusstseinsmäßiger Einstellungen und erzieherischer Haltungen minimiert wird. Daraus ergeben sich weitere grundlegende Aspekte.
3. Integration bedeutet die Regionalisierung und Dezentralisierung des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens, findet dabei aber ihr größtes Hemmnis in der Tendenz der Institutionen, sich selbst zu erhalten. Es wurde bereits unter Punkt 2. deutlich, dass auch institutionelle Veränderungen nicht von der ‚Institution an sich‘ zu erwarten sind, sondern dadurch, dass sich durch Bewusstseins- und Einstellungsveränderungen der letztlich eine Institution tragenden und sie ausmachenden MitarbeiterInnen diese sich der Institution wieder als Instrument zur Durchsetzung menschenwürdiger Erziehung und Bildung bedienen und sich aus ihrer funktionalen Abhängigkeit von institutionellen Zwängen emanzipieren.
Ferner wird deutlich, dass Integration, will sie nicht ein institutioneller Selbstzweck oder z.B. zum Renommee sich fortschrittlich wähnender PädagogInnen werden, sich in außerinstitutionellen Lebenszusammenhängen zu bewähren hat. Integration wird ihr ‚wahres Gesicht‘ erst dann zeigen, wenn im weitgehend selbst organisierten Zusammenleben, ohne institutionelle Zwänge, wie sie auch Erziehungs- und Bildungseinrichtungen immer mehr oder weniger ausüben, kommunikativ und kooperative Lebenszusammenhänge zwischen Behinderten und Nichtbehinderten bzw. deren Familien in der Lebensgemeinschaft der Nachbarschaft, in alltäglichen Situationen, in der Freizeit usw. entstehen, sich strukturieren, sich erhalten und auch in kritischen Situationen tragfähig bleiben. Integrative Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen in pädagogischen Institutionen können darauf, was Integration eigentlich ausmacht, im Grunde nur vorbereiten und Angebote machen, angstfrei Erfahrungen mit dem jeweils anderen sammeln zu können und durch die Vermittlung dieser Erfahrungen soziale Kompetenzen aufzubauen, die in der heute grundsätzlich segregierenden und nach Leistungsnormen orientierten Pädagogik in keiner Lernsituation mehr vorhanden sind, weshalb durch Segregation nie zur Integration, zur echten Rehabilitation gekommen werden kann.
Daraus hat sich für uns konsequent ergeben, ein deutliches Nein zu jeder Integrationsmacherei derart zu sagen, dass wir kein Modell oder keinen Versuch starten, der, wie vielerorts der Fall, ggf. sogar noch ein überregionales Einzugsgebiet für integrationswillige Kinder und Eltern, Behinderte und Nichtbehinderte schafft. Integration ist der Regelfall und nicht die Ausnahme! Wo durch institutionelle Charakteristika oder durch Versuchsvorhaben in Form von Modellen nicht das Wesen der Integration, sondern das institutionell und personell Machbare im Vordergrund steht, reduzieren sich bereits wieder jene Zusammenhänge, durch die im Rahmen der Erziehung der Kinder sich die eben beschriebene soziale Kompetenz aufbauen könnte, derart, dass kaum zu erwarten ist, dass sie auch in außerinstitutionellen Zusammenhängen ein Leben lang stabil bleiben wird.
Entsprechend muss Integration regionalisiert stattfinden; d. h., dass die behinderten und nichtbehinderten Kinder des Einzugsbereiches eines Kindergartens bzw. später einer Grundschule eben diese besuchen, so dass in den außerinstitutionellen Lebenszusammenhängen ohne großen Fahraufwand die durch institutionelle Integration zustande gekommenen Begegnungen und Beziehungen jederzeit auch außerhalb der Institution fortgesetzt werden können.
Diese Regionalisierung, die gleichzeitig einziges Ausschlusskriterium für den Besuch integrativ arbeitender Einrichtungen abgibt (nämlich keine Zulassung von Kindern außerhalb des regulären Einzugsgebietes einer Einrichtung) bedeutet auch die Dezentralisierung aller erforderlichen Hilfen und Maßnahmen, derer behinderte wie auch nichtbehinderte Kinder für ihre Erziehung und Bildung bedürfen. Das verlangt sowohl in personeller wie in materieller Hinsicht, die durch die Sondereinrichtungen geschaffene Zentrierung der Hilfsangebote dort zur Ver-
- 21 -
fügung zu stellen, wo die Kinder im täglichen Leben, also im Kindergarten und in der Schule, in ihrer häuslichen Umgebung, beim Einkaufen oder Spielen usw. dieser Hilfen bedürfen. Dies bedeutet, das Personal nicht mehr an Institutionen zu binden, sondern an die Sache, d. h. der Dienstort des behindertenpädagogischen und therapeutischen Fachpersonals sowie der Einsatzort entsprechender Materialien (z. B. Spastikerball, Rollstuhl, Spiele zur Sprachförderung) ist der Ort, an dem die Kinder integriert sind. Da nun insbesondere im therapeutischen Bereich unterschiedlicher Hilfsbedarf von Seiten der Kinder vorliegt, kann sein, dass z. B. eine therapeutische Fachperson in mehreren integrativ arbeitenden Gruppen bzw. Kindergärten arbeiten wird. Gleichzeitig sind punktuelle und funktionale Therapien, die, wie schon eingangs beschrieben, Kinder aus den pädagogischen Zusammenhängen in der Gruppe herausreißen, weil sie in isolierten Therapie- und Funktionsräumen betrieben werden, überwunden werden müssen, wird die Anstellung und der Einsatz z.B. des therapeutischen Personals in Form eines Pools zu organisieren sein, der z.B. dem überregionalen Träger mehrerer Einrichtungen zugeordnet ist. Was den Einsatz vor Ort betrifft, muss garantiert sein, dass ein/e Therapeut/in tageweise (kürzeste Frequenz!) in einer Einrichtungen ist. Die Sache verbietet, wie wir das in unserer Praxis gesehen und bestätigt bekommen haben, einen Therapeuten nur kurzfristig [für eine Therapieeinheit; GF] mit einem Kind zu konfrontieren. Es kommt dabei zu keiner Begegnung mit dem Kind, die tragfähig genug wäre, effektiv therapeutisch zu arbeiten, es würde erschweren, die Therapie in den pädagogischen Zusammenhang zu integrieren und auch einen Kompetenz-Transfer derart zu ermöglichen, dass die Handlungskompetenz des Therapeuten mehr und mehr in die Handlungskompetenz des Pädagogen eingeht. Deshalb wird ein/e Therapeut/in im Mindestfall immer einen Tag am Gesamtgeschehen der Gruppe eines Kindes teilnehmen und dort in gleicher Weise wie andere verantwortlich an der Planung, der Durchführung und Revision der Arbeit beteiligt sein müssen.
Die sich aus dem Erfordernis der Regionalisierung ergebende Dezentralisierung muss, auch was das Personal betrifft, konsequent durchgeführt werden, um qualitativ wertvolle Integration betreiben zu können. Sie verlangt, schließlich das gesamte Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen zu regionalisieren, was vor allem für das Bildungswesen in Bezug auf die Schulen in z.B. ländlichen Gegenden bedeutet, auch kleine Schulsysteme zu erhalten und sie nicht der Ideologie der äußeren Differenzierung zu opfern, was in den letzten Jahren immer größere Kindergärten und Schulsysteme mit immer grösserer Entfremdung der Kinder aus ihrem Wohngebiet nach sich zog. Das läuft integrativen Bemühungen in direkter Weise entgegen. Daraus folgert sich konsequent:
4. Integration bedeutet die Gewährung aller für Gesundheit, Erziehung und Bildung erforderlichen Hilfen und fachlichen Qualitäten in allen Lebensbereichen und zu allen Altersstufen Behinderter/psychisch Kranker, in denen sie diese benötigen.
Daraus ergibt sich, dass die Einführung und Stabilisierung integrativer Maßnahmen parallel zum segregierenden Erziehungs- und Bildungswesen und der zentralisierten Versorgung im Gesundheits- und Sozialbereich durch Großkliniken und Anstalten weder billiger sein noch ohne differenzierten Einsatz spezialisierten Fachpersonals erfolgen kann, wenngleich zu sehen ist, dass nach einer strukturellen Veränderung zugunsten von Regionalisierung und Dezentralisierung des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens Integration tatsächlich volkswirtschaftlich gesehen billiger zu leisten ist als der Preis, den die Gesellschaft heute bei dem vorherrschenden Bewusstseinsstand bereit ist, für den Ausschluss und die Zerstörung eines Teils ihrer Mitglieder zu bezahlen.
Was die inhaltliche Seite der integrativen Maßnahmen betrifft, so ergeben sich daraus zwei weitere grundlegende Aspekte:
5. Integration bedeutet nicht nur die Aufhebung der Segregation und Verteilung negativer sozial-gesellschaftlicher Lasten auf Behinderte, sondern auch die Aufhebung der psychischen Verkrüppelung Nichtbehinderter durch ihre Einschränkung auf die herrschende Normalitäts- und Leistungsorientiertheit, und
- 22 -
6 . Integration bedeutet weder die Anpassung Behinderter an die Normen der Nichtbehinderten noch die Reduzierung der Entwicklungsmöglichkeiten der Nichtbehinderten auf ein für alle erreichbares Niveau, sondern die Wiederherstellung ihrer zerstörten sozial-gesellschaftlichen und individuellen (Identität) Einheit.
Beide Punkte verdeutlichen, dass Integration, zu welchen Lebensaltersbereichen und in welchen Lebensabschnitten sie auch immer geschieht, kein einseitiger Prozess wechselseitiger Anpassungen Behinderter und Nichtbehinderter sein kann und darf. Geschehe dieses, würde in gleicher Weise das Moment der Integration zerstört, wie dieses nie aufgebaut werden kann, wenn nur in räumlicher Nähe wie bisher an unterschiedlichen Inhalten/Gegenständen/Themen in den Institutionen Kindergarten und Schule gelernt und gearbeitet würde.
In diesen Punkten drückt sich auch eine tiefe Sorge betroffener Eltern behinderter wie nichtbehinderter Kinder aus. Die Erfahrungen der betroffenen Eltern, [die sie; GF] in ihrer Kindheit und Jugend, die sie mit Erziehungs- und Bildungsinstitutionen gemacht haben, erschwert es außerordentlich, dem Gedanken folgen und die Vorstellung entwickeln zu können, dass nicht immer etwas, was für [den; GF] Einen von Vorteil ist, gleichzeitig zum Nachteil des Anderen sein muss, d.h., dass integrative pädagogische Prozesse und solche des Zusammenlebens nicht, was grundsätzlicher Lebensstil in unseren gesellschaftlichen Zusammenhängen geworden ist, unter Aspekten von Konkurrenz und Übervorteilung und, damit [verbunden; GF]von Benachteiligung organisiert werden. Die Diskussion darüber erfolgte besonders, nachdem unser Vorhaben in den vergangenen Monaten in die Vorbereitungsphase der Fortsetzung integrativer Erziehung und Bildung in der Grundschule einmündete. Die daraus resultierenden Fragen der Eltern, der Erzieher, aber auch der Lehrer zu beantworten, ist in der entsprechenden Fortbildungs-, Öffentlichkeits- und Elternarbeit ein schwieriges Moment unserer Arbeit. Es fehlt jeder Erfahrungshintergrund und jede Praxis der Betroffenen, die eine andere Erfahrung hätten bedingen können.
Auflösbar sind die hier in Erscheinung tretenden Widersprüche nur dadurch, dass wir auf zwei Momente, wie sie sich in der Praxis bei einer pädagogischen Orientierung unter den bereits beschriebenen Vorgaben auch einstellen, verweisen:
Zum einen ist es das Moment, dass durch die integrative pädagogische Praxis eine neue soziale Qualität entsteht, die mit Egoismen und den die Konkurrenzverhältnisse begleitenden Rivalisierungen nicht vereinbar ist. Die Erfahrung des jeweils Anderen als ein wertvolles Mitglied in den entsprechenden Spiel-, Lern- und Arbeitszusammenhängen bewirkt, dass der Wert eines Menschen und seiner Mitarbeit nicht daraus abzuleiten ist, dass er genauso gut oder in bestimmten Bereichen gar besser ist wie ich selbst, sondern dass das, was er tut für das gemeinsam zu erarbeitende Produkt, für das gemeinsame Ziel ein unverzichtbares Element darstellt, ohne das das gesamte Vorhaben nicht gelingen kann. Daraus erwächst für integrative Maßnahmen das bisher noch nicht erörterte, wenng1eich begrifflich dargestellte Moment, dass in pädagogischen Zusammenhängen, die integrativen Wert haben sollen, die Kinder in Kooperation miteinander an Gemeinsamen Gegenständen/Themen/Inhalten spielen bzw. lernen müssen. Nur so bleiben die einzelnen Personen nach Maßgabe ihrer je individuellen Kompetenz über den Gemeinsamen Gegenstand kooperativ miteinander verbunden, ergibt sich die Erfahrung der Bedeutung des Mittuns des einzelnen für das Ganze.
Zum anderen kommt das Moment der Entwicklungsgemäßheit hinzu. Die Differenzierung in der gemeinsamen Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand erfolgt nicht wie bisher durch Aussonderung und Ausschluss (äußere Differenzierung) und die Reduktion der Spiel-, Lern- und Arbeitsangebote auf ein jeweils vorfindbares Niveau (reduziertes Curriculum), sondern im Sinne einer inneren Differenzierung dadurch, dass der Gemeinsame Gegenstand/Thema/Inhalt unter dem Aspekt des „antizipierten Produkts“, das den Kindern bereits zu Eingang des Aufgreifens eines gemeinsamen Vorhabens im Sinne der Schaffung der „Orientierungsgrundlage“ zugänglich gemacht wird, derart in all seinen spezifischen und allgemeinen
- 23 -
(grundsätzlichen) Gesetzmäßigkeiten aufgegliedert wird,[28] das nun jedes Kind auf seinem jeweils momentan erreichten Entwicklungsniveau in eine adäquate handelnde Auseinandersetzung mit dem [Gemeinsamen; GF] Gegenstand eintreten kann. Das erfordert, pädagogisch gewendet, eine entsprechende historisch-logische Sachstrukturanalyse des [Gemeinsamen; GF] Gegenstandes und eine entsprechende Analyse der Tätigkeitsstruktur eines jeden Kindes, das am integrativen Gruppenprozess teilnimmt. So kann jedem Kind von einer gemeinsamen Sache her ein es ansprechendes und seine Bedürfnisse befriedigendes, mithin motivierendes und bekräftigendes Angebot in Bezug auf den Gemeinsamen Gegenstand (Thema/Inhalt) gemacht werden.
Derart kann jedes Kind, sei es auch schwerstbehindert, zum einen kompetent handeln und zum anderen einen wertvollen Beitrag zum gesamten Vorhaben[29] leisten. Dieses nehmen alle Kinder aneinander wahr. Somit leitet sich also die Bedeutung, die die Mitarbeit eines Kindes für die gesamte Gruppe hat, nicht aus dem „BesserSein“ des Einen gegenüber dem Anderen ab, sondern dadurch, dass der, der bereits komplexere und auf höherem Tätigkeitsniveau organisierte Handlungen am Gemeinsamen Gegenstand tätigen kann, auch jener Arbeitergebnisse bedarf, die z.B. von Kindern auf einem noch nicht so weit entfalteten Entwicklungsniveau mittels ihrer Tätigkeit im gemeinsamen Spiel- und Lernprozess erstellt werden. Erst beide Faktoren zusammen, nämlich die sich neu entwickelnde soziale Kompetenz und die aufgezeigte Form innerer Differenzierungen der Spiel- und Lernprozesse lassen das uns heute allgegenwärtige Konkurrenz-, Neid- und Übervorteilungssystem in kooperativen Spiel- und Lernprozessen erst gar nicht aufkommen. In unserer Praxis finden wir das täglich bestätigt.
Diese Orientierung an der Kooperation der Kinder miteinander auf der Basis ihres jeweils entfalteten Entwicklungsniveaus, verbunden mit dem Ziel, durch diese Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand das nächst höhere individuelle Entwicklungsniveau eines jeden Kindes zu erreichen, zeigt, dass es in integrativen Erziehungsprozessen keinen einseitigen Vorteil der Behinderten oder nichtbehinderten Kinder und Jugendlichen gibt. Jedes Kind profitiert von der Tragfähigkeit einer sich aufbauenden sozialen Gemeinschaft wie dadurch, dass seine momentane Handlungskompetenz voll ausgeschöpft und neue Handlungskompetenzen im Sinne fortschreitender Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit dabei erworben werden.
Es bedarf vieler grundlegender Fortbildungsmaßnahmen und Gespräche, bis der hier aufgezeigte Zusammenhang von Pädagogen, Therapeuten und Eltern umfassend nachvollzogen werden kann. Viel schneller vermögen Personen diese Sachverhalte nachzuvollziehen, die bereits durch Erfahrungen in einer integrativ arbeitenden Gruppe quasi ein „Lernmodell“ für sich hatten, was deutlich zeigt, dass Veränderungen der gesellschaftlichen Erfahrungen nur durch die Veränderung der jeweiligen gesellschaftlichen Praxis wirksam erfolgen kann.
Diese Zusammenhänge sind besonders schwierig in Diskussionen mit Lehrern zu vermitteln, zumal man in Schulen fast ausschließlich auf nur eine Komponente der Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit fixiert ist, nämlich auf die der Kognition, auf das herkömmliche Verständnis von „Intelligenz“ und „Leistung“.
Die beschriebenen Sachverhalte verdeutlichen, dass in der integrativen Erziehung und Bildung weder kognitive Prozesse zugunsten von sozialen gestoppt oder nivelliert werden, sondern höhere kognitive Leistungen nur auf der Basis einer integrierten Sozietät des einzelnen Subjekts in seiner Gemeinschaft erfolgen kann; mithin zu erwarten ist, dass im Rahmen integrierter Erziehungs- und Bildungsprozesse sowohl behinderte wie nichtbehinderte Kinder höhere kognitive Entwicklungsniveaus zu erreichen vermögen, ohne dass diese nun im Widerspruch oder gar in grosser Diskrepanz zum emotional-affektiven Bereich psychischen Erlebens oder gar auf Kosten der Entwicklung eben dieses Bereiches erfolgen würde. Entsprechend können Eltern sowohl behinderter wie nichtbehinderter Kinder, ohne zu meinen, dass sie für die Kinder anderer Eltern etwas opfern oder verlieren würden, integrativ erzieherischen Maßnahmen zustimmen und erfahren, dass dadurch, dass jedes Kind von integrativer Erziehung und Bildung profitiert, auch die Kon-
- 24 -
kurrenzsituation unter den Eltern, die Egoismen des neidischen Blickes auf die besseren Noten eines Kindes aus der Nachbarschaft an Bedeutung und Relevanz verlieren.
Integrative Erziehung und Bildung wirkt auch der Verkrüppelung der nichtbehinderten Kinder durch inadäquate Leistungsanforderungen und isolierte kognitive Förderung und Belastung entgegen und vermag sie zu vermeiden. Wenn wir heute statistisch mit ähnlich vielen Selbstmordversuchen von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter umzugehen haben, wie die Anzahl der jährlichen Verkehrstoten ausmacht, dann kann man dies von Seiten der Schule nicht nur mehr mit einer einseitigen Belastung [der Kinder durch die; GF) Eltern und von Seiten der Elternschaft nicht nur mehr mit einer einseitigen Belastung [der Kinder durch die; GF] Schule begründen. Hier haben sich Systeme, sei es der Verkehr oder das Erziehungs- und Bildungssystem, endlich den menschlichen Bedürfnissen zu beugen. Es kann doch nicht so getan werden, wie man das nach einigen Jahrhunderttausenden vielleicht aus historischer Sicht betrachten könnte, dass die für uns heute Lebenden modernen Formen gesellschaftlicher Ritualmorde weiterhin so zu praktizieren seien, als sei dies unveränderbar, unüberwindbar und damit, weil nicht mehr veränderbar, notwendigerweise auch richtig.
Aus den bisherigen Ausführungen zu den grundlegenden Aspekten und Prinzipien der Integration wird ein weiterer Punkt deutlich:
7. Integration ist nicht ein einmal erreichter Zustand, sondern ein gesellschaftlich-sozialer Prozess, der ständig neu vollzogen werden muss.
Integration kann und wird nie ein Zustand sein. Unsere Massengesellschaft lehrt uns überdeutlich, dass selbst in den kleinsten Einheiten unserer Gesellschaft, in der Familie oder in der Zweierbeziehung größte Einsamkeit im Nebeneinander dann bestehen kann, wenn durch Entfremdung im Rahmen z.B. völlig unterschiedlicher Arbeitsprozesse jedwedes gemeinsame Tätigwerden im Sinne von Kooperation, Interaktion und Kommunikation nicht mehr zugelassen wird bzw. es nur noch auf Bereiche gesellschaftlich weniger produktiver Tätigkeit, nämlich des Konsums, beschränkt bleibt.
Integration ist über alle Lebensaltersstufen hinweg und in allen Lebensphasen ein prozesshaftes Geschehen, das ständiger Innovation und Erneuerung bedarf.
Gewendet auf die Praxis unseres Vorhabens integrativer Kindergartenarbeit haben wir deutlich erfahren, dass alleine aus dem Zusammensein von behinderten und nichtbehinderten Kindern keine der genannten und für Integration unabdingbaren Qualitäten entstehen. Das räumliche Zusammensein ist insofern nur eine äußere, allerdings unverzichtbare und notwendige Voraussetzung für Integration. Eine Gruppe unseres Kindergartens ist nur wenige Schritte über den Hof in einem anderen Gebäudeteil der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde untergebracht; schon dies erschwert die integrativen Prozesse, wie sie hier beschrieben wurden, erheblich.
Zusammenfassend wäre festzustellen:
Das vorgetragene Verständnis von Integration, das unsere praktische Arbeit in allen Phasen leitete, verbietet von selbst,
-
behinderte Kinder je nach Art und Schweregrad einer vorliegenden Behinderung von integrativer Erziehung auszuschließen,
-
eine einseitige Anpassung behinderter an nichtbehinderte bzw. nichtbehinderter an behinderte Kinder zu betreiben, und
-
meint mehr als nur ein räumliches Beisammensein von behinderten und nichtbehinderten Kindern, das allerdings unerlässliche Voraussetzung für die Realisierung von Integration ist.
Das vorgetragene Verständnis von Integration schliesst ein
-
das Prinzip der Regionalisierung (-stadtteilbezogene, im unmittelbaren Lebensumfeld aller Kinder organisierte Erziehung),
- 25 -
-
das Prinzip der Dezentralisierung (-personelle wie materielle Hilfen, derer sowohl behinderte wie nichtbehinderte Kinder bedürfen, sind am Ort des Lernens und dort nicht isoliert in Therapieräumen usw., sondern eingebettet in das Gruppengeschehen zu gewähren; es verbietet, Integrationszentren zu schaffen).
Alle MitarbeiterInnen im integrativen pädagogischen Feld müssen
-
sich gemeinsam über den Entwicklungsstand eines Kindes und die Situation einer Gruppe klar werden (förderungsdiagnostischer Aspekt),[30]
-
auf dieser Basis die Spiel- und Lernangebote planen (curricularer Aspekt),
-
gemeinsam in der jeweils zu vertretenden Fachkompetenz den Gruppenalltag gestalten und die Erziehungsaufgaben wahrnehmen (didaktisch-methodischer Aspekt) und
-
in gemeinsamer Aussprache das Erziehungsgeschehen reflektieren und Schlüsse für die weitere Planung ziehen und entsprechend das weitere Vorgehen revidieren.
Das schliesst ein
-
das Prinzip des Kompetenz-Transfers (Die verschiedenen fachlichen Qualifikationen aller Mitarbeiter – Pädagogen und Therapeuten – müssen untereinander ausgetauscht und wechselseitig angeeignet, wie als solche weiterentwickelt werden.)[31]
Es ist bereits in den vorausgegangenen Ausführungen deutlich geworden: Integration ist in ihrer pädagogischen Dimension notwendig mit einer kindzentrierten, basalen allgemeinen Pädagogik verbunden. Insofern ist sie notwendig [unmittelbar; GF] auf die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen allgemein und auf das jeweilige Niveau derselben wie auf das nächsthöhere anzustrebende Niveau der Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes zentriert, d.h., eine entsprechende Pädagogik ist durch die allgemeinen wie speziellen Grundlagen der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung strukturiert. Gewinnt eine Pädagogik ihre Struktur aus den Grundlagen menschlicher Entwicklung, muss sie sich gegen Einflüsse verwahren, die aus einer pädagogischen Tradition oder zivilisatorischen Konvention entstammen, die sich von einer solchen Orientierung heute bereits entfremdet haben.
Dies erfordert auf dem Hintergrund der Entwicklung von Regel- und Sonderpädagogik eine intensive Befassung mit den allgemeinen und speziellen Aspekten menschlicher Persönlichkeitsentwicklung, die im Rahmen der dem Menschen möglichen Anpassungs-, Aneignungs- und Lernprozesse sich entfaltet, wie dies in Ansätzen die „kritische Psychologie und Behindertenpädagogik“ heute bereits geleistet hat.
In der Vorbereitung und der begleitenden Vertiefung der integrativen Arbeit sowie in Fort- und Weiterbildungsprozessen von Mitarbeitern und Eltern gehen wir davon aus, dass sich die menschliche Entwicklung auf der Basis phylogenetisch vorgebildeter, artspezifisch jedoch in der Ontogenese modifizierbarer (nervaler) Strukturen vollzieht, die für alle Menschen grundsätzlich gleich sind: auch für solche, die wir als behindert (auch schwerstbehindert) oder psychisch krank klassifizieren.
Organische Beeinträchtigungen, wie sie für bestimmte Kinder bereits mit der Geburt vorliegen oder im Sinne der frühkindlichen Hirnschädigung eintreten können, aber auch soziale Beeinträchtigungen, wie sie insbesondere durch deprivierende Lebensbedingungen verursacht werden (z.B. durch sensorische Deprivation im Rahmen einer auf Versorgung und Verwahrung orientierten Heimunterbringung),
- 26 -
verändern das Wesen bzw. die Natur menschlicher Anpassungs-, Aneignungs- und Lernprozesse nicht, sondern sie sind Bedingungen, die über die für den Menschen heute als invariant zu bezeichnenden Funktionen der „Adaptation“ (Anpassung) mittels seiner Tätigkeit an die Umwelt und durch die damit unmittelbar verbundene „Organisation“ dieser Adaptationsprozesse in seinem Innern (mittels zentralnervöser und psychischer Regulation), durch die er diese Prozesse steuert und seine „Erfahrungen“ ausbildet und speichert, damit sie spätere Tätigkeiten regulieren können, die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen modifizieren, wodurch diese von uns allgemein mit „Isolation“ beschriebenen Bedingungen selbstverständlich auch in der Folge die Anpassungs-, Aneignungs- und Lernprozesse, mithin die Tätigkeits- und Handlungsstruktur eines Individuums beeinträchtigen und verändern (18).
Behinderung wie psychische Krankheit sind folglich das Ergebnis einer Entwicklung auf der oben beschriebenen Grundlage, die durch dieser Entwicklung äußerst abträgliche Bedingungen, allgemein durch die Isolation der Betroffenen von der umfassenden Aneignung des gesellschaftlichen Erbes gekennzeichnet sind.
Was wir als verhaltensmäßige Erscheinungen an behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern, an psychisch Kranken, aber auch an erst einmal nur leicht entwicklungsverzögerten bzw. verhaltensgestörten Kindern, die noch nicht als behindert klassifiziert worden sind, beobachten, ist der Ausdruck einer Isolation (die durch organische und/oder soziale Faktoren bedingt sein kann) in der Tätigkeits- und Handlungsstruktur eines betroffenen Individuums dadurch, dass durch die bestehende Bedingung der Isolation die Aneignungs- und Vergegenständlichungsprozesse im innerorganismischen Bereich ebenso wie die Widerspiegelungsprozesse im Sinne der psychisch-geistigen Funktion selbst beeinträchtigt wurden.
Eine in Erscheinung tretende Behinderung oder eine die Aufmerksamkeit von Eltern bzw. Erziehern erregende Verhaltensauffälligkeit eines Kindes, somit jede graduelle Abstufung von leichten Störungen einer Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu schwersten (mehrfach) Behinderungen sind folglich das „entwicklungslogische“ Produkt einer menschlichen Entwicklung unter den bezeichneten Bedingungen.
Das bedeutet, dass wir den Zusammenhang zwischen menschlicher Entwicklung und deren Beeinträchtigung dadurch verstehen können, dass wir nach den Bedingungen fragen, die eine menschliche Entwicklung in Richtung auf Behinderung und psychische Krankheit modifizieren, was umgekehrt auf der Basis der Kenntnis der Grundlagen menschlicher Persönlichkeitsentwicklung auch weitgehend bestimmbar vorhersagen lässt, welche psychischen Erscheinungen, die wir als „pathologisch“‚ „deviant“ oder „behindert“ bezeichnen, in Erscheinung treten werden, wenn spezifische Bedingungen der Isolation zu einem bestimmten Stand[32] der Persönlichkeitsentwicklung, also zu einem bestimmten Entwicklungsniveau der innerorganisch ausgebildeten Abbildestruktur der äußeren Austauschprozesse eines Individuums mit seiner Umwelt eintreten. Dies ermöglicht dann präventiv diese Bedingungen zu vermeiden bzw., wenn sie für ein Kind bereits bestehen, sie so zu verändern, dass eine möglichst unbeeinträchtigte Persönlichkeitsentwicklung erfolgen kann.
In konsequenter Verfolgung dieser Grundlagen wird deutlich, dass auch in den Fällen, in denen die von der Aneignung isolierenden Bedingungen solche organischer Art sind, im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung eines betroffenen Kindes wesentlich nur die sozialen Komponenten seiner Erziehung und Bildung im Sinne der Reduzierung bzw. Vermeidung beeinträchtigender Faktoren und durch Angebote seiner Fähigkeiten adäquaten Austauschprozesse[33] den Umfang und die Qualität der möglichen Persönlichkeitsentwicklung entscheiden.[34] Eine organische Beeinträchtigung ist mithin eine variable Bedingung im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, auch dann, wenn eine eingetretene (hirnorganische) Schädigung als irreversibel zu bezeichnen ist. Allerdings gilt auch hier, dass im Sinne der integrativen Funktion der
- 27 -
zentral-nervösen Tätigkeit nur aus anatomischer Sicht von Irreversibilität gesprochen werden kann; das „funktionelle System“ als solches aber in der Lage ist, Ausfälle bzw. Defizite, die durch organische Beeinträchtigungen entstehen, zu kompensieren; dies aber wiederum nur, wenn dem betroffenen Individuum entsprechend seinen Wahrnehmungskapazitäten strukturierte Informationen von außen zukommt (sie also sozial hergestellt und gewährt werden).
In der integrativen Praxis wird jedem Beteiligten sehr schnell deutlich, dass es sich äußerst relativiert, von behinderten bzw. nichtbehinderten Kindern zu sprechen, denn alle Kinder haben entsprechend ihren subjektiven Gegebenheiten und ihrer bis zum Eintritt in den Kindergarten bereits erfolgten Persönlichkeitsentwicklung verschiedene Sozialisations-, Lern- und Entwicklungsbedingungen und bedürfen adäquater Erziehungs- und Bildungsangebote, damit ihre Persönlichkeitsentwicklung ungestört erfolgen kann. Dabei haben wir erfahren, dass es oft schwieriger ist, einem nichtbehinderten Kind adäquate Entwicklungsangebote zur Verfügung zu stellen als dies für ein behindertes Kind der Fall ist, dessen spezifischen Bedarf wir aufgrund der mehr auf der Hand liegenden Faktoren und deren leichteren Analysierbarkeit wegen gezielter entwickeln können.[35] So sind in Dienstbesprechungen und in den Planungsgesprächen für das Erziehungsangebot die Lernstruktur aller Kinder in gleicher Weise Gegenstand für die Analyse, Planung und Strukturierung entsprechender Angebote in der Gruppe.
Auf der Basis dieser Erfahrungen in der Praxis wird es schnell ein Leichtes, von der Illusion der Homogenität einer bestimmten Kindergruppe und der Ideologie Abschied zu nehmen, dass sich Lernprozesse leichter organisieren und strukturieren, das Lernen sich leichter gestalten ließe und das Lernen der Kinder leichter vonstatten ginge, wenn Gruppen homogen wären. Eine Pädagogik, die auf die Homogenität einer Gruppe und damit auf ein singuläres pädagogisches Angebot baut, lehrt immer nur für ganz wenige Kinder einer Gruppe, für die dieses Angebot das entwicklungsbezogen adäquate ist, und damit auf Kosten der Mehrheit, für die dieses lineare Angebot im Sinne ihrer Wahrnehmungskapazitäten als überfordernd, unterfordernd, widersprüchlich oder so gestaltet ist, dass es eine aktive Handlung der Kinder verunmöglicht, was, wie später noch kurz aufgezeigt werden wird, die Wahrnehmungs- und damit die Aneignungsprozesse zentral zerstört, mithin Behinderungen schafft.
Eine integrative pädagogische Praxis muss sich auf die fundamentale Basis menschlicher Entwicklung stellen, um begreifen zu können und um im pädagogischen Prozess zu realisieren, dass
-
Behinderung das entwicklungslogische Produkt menschlicher Entwicklung unter isolierenden Bedingungen organischer und/oder sozialer Art ist,
-
jedes Kind auf der jeweiligen Stufe seiner Entwicklung ein kompetent handelndes Subjekt ist, auch wenn es uns als entwicklungsverzögert, verhaltensauffällig bzw. behindert erscheint, und
-
dass diese Handlungen Ausdruck einer psychischen Regulation seiner Lebensprozesse sind, die sich unter den jeweils spezifischen Bedingungen seiner Biographie ausgebildet haben (19).
Die Berücksichtigung dieser zentralen Aspekte für das Menschenbild, das unmittelbar mit integrativen Vorhaben neu zu erarbeiten ist, ermöglicht dann die Organisation pädagogischer Prozesse, die nicht auf der Behinderung aufbauen und sie derart auch nicht konsolidieren, sondern die so geartet sind, dass die die Entwicklung beeinträchtigenden Bedingungen abgebaut und Handlungsfelder geschaffen werden können, in denen das Kind im Sinne der Basiselemente von Integration am Gemeinsamen Gegenstand in Kooperation mit anderen unter Einsatz entsprechender Hilfen lernen kann.
Diese pädagogischen Prozesse einer kindzentrierten, basalen allgemeinen und damit integrativen Pädagogik verstehen wir im Sinne von Erziehung und Bildung.
- 28 -
Das Begriffspaar Erziehung und Bildung, das im Zusammenhang dieses Berichtes schon wiederholt an zentralen Stellen gebraucht wurde, verlangt nun seinerseits nach einer genaueren Bestimmung.
Erziehung wird allgemein auf dem Hintergrund anthropologischer Vorstellungen, dass die Menschwerdung dem Kind aufgegeben, aber auch der Gemeinschaft die Menschwerdung ihrer Kinder als Aufgabe gegeben ist, als die Heranführung der Kinder an jene Fertigkeiten, Werthaltungen, Gefühlseinstellungen und Denkweisen in ihnen verstanden, die sie befähigen sollen, das kulturelle Erbe zu übernehmen und fortzusetzen, was aus der Sicht des Kindes als Verwirklichung seiner Selbst als individuelle Person gesehen wird, die fähig ist, ihr Leben in Selbständigkeit und sittlicher Verantwortung zu führen (20).
Bildung, die von Anfang an als auf die Mitmenschlichkeit, die Sozialität und auf die politische Existenz des Menschen bezogen gedacht werden muss, meint im Kern immer eine „innere“ Haltung und Geformtheit des Menschen, sie muss auf positive Weise dieses In-der-Welt-Sein des Menschen erfüllen und vollziehen, ist also auch eine Haltung, die uns hilft, Lebensspannungen zu bewältigen und der sittlichen Dimension der menschlichen Existenz bewusst zu sein; Bildung darf den Menschen nicht vorzeitig fixieren, sie muss auf einen „weltweiten Horizont“ hin orientiert sein, sie kann insgesamt nur noch als eine Haltung verstanden werden, die sich selbst als dynamisch, wandlungsfähig und offen versteht (21).
Dieses Verständnis von Erziehung und Bildung, auf das man in dieser differenzierten Form selbst nur bei wenigen Pädagogen im Fachgespräch trifft, verdeutlicht, dass es das zu erziehende und bildende Individuum kaum in seiner Dimension als aktiv tätiges Wesen erkennt, dessen Bedürfnis nach ständig höherer Strukturiertheit seiner inneren Prozesse darauf abzielt, nach aussen hin eine immer größere Realitätskontrolle zu erreichen und nach innen hin seine Selbstorganisation aktiv zu stabilisieren.
Da es in der Regel um Einstellungen, Haltungen, Wertungen und andere Eigenschaften geht, die in der Tradition gesellschaftlicher Vorstellungen einen hohen Rang und Bedeutungsgrad erhalten haben, werden sowohl Erziehung und Bildung weitgehend als Massnahmen verstanden, die von außen an den zu Erziehenden und zu Bildenden herangetragen werden müssen und die er dann sich selbst zu eigen zu machen hat, um als erzogen und gebildet gelten und damit eingereiht werden zu können in den Kreis jener, denen man die Teilhabe am gesellschaftlichen Erbe und Verkehr nicht mehr streitig macht. Mithin sind in ihrer Entwicklung bedrohte, durch organische und soziale Beeinträchtigungen behinderte Kinder immer schon in ihrer Erziehungs- und Bildungsfähigkeit als mangelnd „begabt“, als zu gering „intelligent“, ja, wie im historischen Abriss aufgezeigt, als erziehungs- und bildungsunfähig eingestuft und damit von der Teilhabe am gesellschaftlichen Erbe [und sozialen Verkehr; GF] ausgeschlossen worden.
Erziehung und Bildung wird weitgehend gesehen als etwas von aussen her Machbares und nicht als etwas erkannt, was zwar im Sinne der Teilhabe am gesellschaftlichen Erbe von aussen her zur Verfügung gestellt, vom betroffenen Individuum aber durch seine aktive Tätigkeit selbst angeeignet und in Form der Ausbildung der inneren Struktur zu seinem eigenen Besitz gemacht werden muss.
Ein basales pädagogisches Konzept, das auf die Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen gerichtet ist, erkennt in jedem Menschen grundsätzlich eine hinreichende Erziehungs- und Bildungsfähigkeit, d.h. auf der jeweiligen Stufe des momentan vorfindbaren Entwicklungsniveaus kann jedes Kind im Sinne seiner „dominierenden Tätigkeit“ sich Welt aneignen, d.h. eine größere Realitätskontrolle und eine konstantere und stabilere Struktur seiner Selbstorganisation erreichen. Voraussetzung dazu ist nur, dass seinem Tätigkeitsniveau entsprechend die Erziehungs- und Bildungsangebote organisiert werden, d.h., es müssen die Interaktions- und Kommunikationsangebote seiner Erziehung und die Gegenstände/Themen/Inhalte seiner Bildung seinen jeweiligen Wahrnehmungskapazitäten entsprechend aufbereitet sein.
- 29 -
In diesem Sinne hat die integrative Pädagogik nicht das zu erziehende und zu bildende Kind zum Gegenstand, sondern ihr Gegenstand ist die Struktur des Erziehungs- und Bildungsprozesses, als solcher jeweils bezogen auf die momentane Handlungskompetenz eines Kindes. Erziehung und Bildung ist, was das Kind selbst aktiv zu leisten hat und zu leisten vermag.
Auf diesem Hintergrund wird innerhalb integrativer basaler allgemeiner Pädagogik folgendes Verständnis von Erziehung und Bildung deutlich:
Erziehung ist Ausdruck der Strukturierung der Tätigkeit der Kinder mit dem Ziel grösserer Realitätskontrolle,
und
Bildung ist Ausdruck der Biographie (der Gesamtheit der Handlungskompetenzen, der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, der Bedürfnisse und der Motive) im Sinne der aktiven Selbstorganisation (22).
Je nach dem vorliegenden Entwicklungsniveau eines Kindes realisieren sich Erziehung und Bildung im Sinne der ‚Anpassung an‘ und ‚Aneignung von‘ Welt auf der Basis von Lernen.
Menschliches Lernen verstehen wir auf allen Stufen menschlicher Entwicklung
-
als Prozess der Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung von Information
-
auf der Basis phylogenetisch vorgebildeter, artspezifisch modifizierbarer nervöser Strukturen
-
mit der Funktion der Individual- und Arterhaltung,
-
was als Prozess antriebsgesteuerter, adaptativer Verhaltensänderungen nach aussen in Erscheinung tritt (23).
Lernen wird im Rahmen unserer integrativen Arbeit begrifflich in einem doppelten Sinne gebraucht: Es wird einerseits verstanden als „dominierende Tätigkeit“ der Kinder im Schulalter, wie dies im Kindergartenalter „Spielen“ und nach der schulischen Ausbildung ‚ „Arbeit“[36] ist, und andererseits als die oben bereits beschriebene, zu allen Lebensphasen bestehende Grundtätigkeit des Menschen, die nur durch den Tod endet. Lernen ist damit die Basis der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Entsprechend vollzieht sich Lernen im Sinne der Gesetzmäßigkeiten menschlicher Entwicklung als eine spezifisch menschliche Tätigkeit unter besonderen gesellschaftlichen Bedingungen.
Damit sind im Rahmen unserer Weiter- und Fortbildungsbemühungen die Vermittlung und Erkenntnis dieser Gesetzmäßigkeiten und ihrer Bedingungsfelder, deren didaktische Aufbereitung und Umsetzung in die Planung der Lernprozesse wie deren methodische Gestaltung unter Einbezug angemessener Medien zwingend Bestandteil auch der täglichen Vorbereitung des nächsten Kindergartentages durch die Pädagogen.
Lernen verstehen wir als das Mittel, sich in sozialen Bezügen als Individuum entfalten zu können, als einen Prozess der Transferierung des Gesellschaftlichen in das Individuelle, wie das Soziale und Gesellschaftliche nur durch kooperatives Handeln von Individuen an einem für alle relevanten Gegenstand/Produkt/Problem existent ist.
Diese Zusammenhänge machen darauf aufmerksam, dass es vordergründig nicht nur darum gehen kann, die konkrete Einmaligkeit jedes Individuums zu erklären (was im historischen Prozess schließlich dazu geführt hat, den behinderten Menschen auf seine Pathologie zu reduzieren und im Sinne seiner Defekte zu atomisieren), sondern zu verstehen, dass auf der Basis des Lernens im Sinne der Anpassungs-, Aneignungs- und psychischen Widerspiegelungsprozesse das Individuum „einmalig im wesentlich Gesellschaftlichen und gesellschaftlich im wesentlich Einmaligen seiner Persönlichkeit ist“ (24).
- 30 -
Erst durch das Verlassen einer polaren Sichtweise menschlicher Lernprozesse, die das lernende Individuum in eine Art Gegenpol zu einem sozial-gesellschaftlichen Umfeld stellt, lässt uns begreifen, dass die Einmaligkeit des Individuums jeweils nur aus seiner sozial-gesellschaftlichen Tätigkeit heraus zu verstehen sein kann, wie sozial-gesellschaftliche Tätigkeit nur durch das kooperativ handelnde Individuum zu entstehen vermag.
Lernen ist entsprechend mehr als seine heute meist praktizierte Reduktion auf die Ausbildung isolierter Fertigkeiten und die Anhäufung eines bestimmten Wissens. Lernen ist Erkenntnis bezogenes (Kognition: vom einfachen Wiedererkennen eines Signals bis hin zu einer die physikalische Realität überschreitenden Theoriebildung) Erleben seiner selbst, der Anderen und der Welt (Emotion: von der einfachen Befindlichkeit auf der Basis biologischen Bedarfs wie Hunger, Durst oder auch Angst bis hin zur Ausbildung differenzierter Gefühle, Bedürfnisse und Motivationen); mithin ist es die basale menschliche Tätigkeit auf sozialem wie individuellem Niveau; eine sich nur im Austausch mit der Umwelt realisierende Fähigkeit.
Lernen ist nicht etwas Abstraktes, etwas nicht Fassbares, sondern es ist die beschriebene menschliche Tätigkeit, die sich auf einer frühen Stufe im Tun mit Dingen und Personen vergegenständlicht, sich materialisiert (begreifen) und auf einer späteren Stufe, wenn entsprechende Begriffe aufgebaut sind, ihren Gegenstand in Themen, Inhalten, Theorien o.a. findet, mit denen denkend gehandelt werden kann, ohne dass nach aussen sichtbar ein motorischer Akt erfolgt.
Lernen erfolgt in seiner Basis durch den handelnden Umgang mit Dingen (die wiederum von der menschlichen Gesellschaft geschaffen und vom sozialen Umfeld dem Kind zur Erfahrungsbildung zur Verfügung gestellt werden), sei dieser Gegenstand ein Ball, ein Musikinstrument, eine mathematische Formel, ein Schriftsatz, ein Film, ein Hobby, der Austausch von Signalen oder Worten zwischen zwei Menschen. Wo eine Mutter ihren Säugling ernährt, ist es die gemeinsame Tätigkeit des Stillens, wo sie ihr Kind ausführt, das gemeinsame Erleben der sinnlichen Eindrücke und der Bewegung, wo sie es belehrt, lobt oder tadelt eine soziale Übereinkunft, die das Zusammenleben regelt. Im Seminar mit Studenten ist es das Thema, die Problematik, der Lehrstoff. Lernen vollzieht sich nur über Kooperation an einem Gemeinsamen Gegenstand und sei es, dass ich allein lesend in einem Zimmer sitze und mir einen Lesestoff (das Produkt eines Autors) aneigne, d.h. in diese Form mit ihm kommuniziere.
Aus diesem grundlegenden Verständnis von Lernen heraus ergibt sich, dass eine Einteilung von Kindern und Jugendlichen in Behinderte und Nichtbehinderte oder in Gymnasiasten, Hauptschüler, Studenten, Lernbehinderte, Grundschüler oder Geistigbehinderte weder als notwendig für das Lernen [angesehen; GF], noch aus diesem heraus begründet werden kann. Solche Einteilungen dienen letztlich nur der Wahrung eines Bildungsprivileges, in dem man, scheinbar nach Fähigkeiten gegliedert, dem einen dies, dem anderen jenes als Lerngegenstände anbietet bzw. vorenthält und sich so systematisch unterschiedlich ausgebildete und entsprechend unterschiedlich verwertbare Gruppen im gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess schafft. Auf diesem Hintergrund hat dann auch der schwer Geistigbehinderte in einer Anstalt seine Funktion, nämlich die, durch das ihm entgegengebrachte Mitleid ein Alibi zu schaffen und dadurch von gesellschaftlichen Praktiken abzulenken, die persönlichkeitszerstörend sind, den Menschen psychisch verkrüppeln bzw. gar menschenvernichtend sein können (25).
Menschliches Lernen und menschliche Persönlichkeistsentwicklung sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille; sie sind Prozesse höchst strukturierter Art. Pädagogisch-therapeutische Maßnahmen haben dieser Strukturierung Rechnung zu tragen. Sie können weder beliebig noch willkürlich angeboten werden, weil sie derart nur zufällig entwicklungsfördernde, genauso aber auch eine entwicklungshemmende Wirkung haben können. Missverstandene Praktiken des sog. „Situationsansatzes“ in der Kindergartenpädagogik lassen vehemente Widersprüche gegen die Planung und Strukturierung des Spiel- und Lernangebotes für die Kin-
- 31 -
der aufkommen und verraten sich so als ein die Willkürpädagogik einiger Pädagogen kaschierendes Alibi, als eine Arbeit, die es dem Zufall überlässt, ob sich das eine oder andere Kind unter diesen Bedingungen zu entwickeln vermag oder eben nicht oder in seiner Entwicklung gehemmt wird.
Situationsbezogenheit von Pädagogik steht im Zusammenhang mit der Motivation der Kinder, sich im Kontext erlebnismäßig sie beeindruckender Zusammenhänge besonders intensiv mit bestimmten Gegenständen, Fragen, Themen, Inhalten o.a. auseinanderzusetzen; diese Motivation des Kindes ersetzt aber nicht die Strukturierung komplexer Gegenstände und Inhalte der Tätigkeit der Kinder. Vermögen die Kinder auf dem Hintergrund ihrer bereits aufgebauten Organisations- und Steuerungsprozesse, also auf dem Hintergrund des erreichten Niveaus ihrer Realitätskontrolle es nicht, die Gegenstände/Themen zu strukturieren, bleibt auch ihr Umgang damit unstrukturiert und die anfängliche grosse Motivation geht nach wiederholten Erfahrungen dieser Art sehr schnell verloren; und äußerlich verliert sich die Kooperation der Kinder im chaotischen und aggressiven Tohuwabohu.
Persönlichkeitsentwicklung und Lernen als Prozesse höchst individueller Anpassungs-, Aneignungs- und Vergegenständlichungs- wie Abbildprozesse erfordern pädagogisch die Erarbeitung individueller [individualisierter; GF] Curricula, d.h. die Aufbereitung der gemeinsamen Lerngegenstände/Themen/Inhalte auf das für ein Kind jeweils zutreffende Entwicklungsniveau, also bezogen auf seine Wahrnehmungskapazität und Handlungskompetenz. Die Erstellung individueller [individualisierter; GF]Curricula bedeutet nicht, für jedes Kind den Gegenstand/das Thema anzubieten, das es gerade bewältigen kann; dies würde wieder, sind behinderte und nichtbehinderte Kinder in einer Gruppe zusammen, dazu führen, dass wir den Sonderkindergarten und den Regelkindergarten schließlich in einer Gruppe vereint haben. Integrative Pädagogik hat es für das Lernen der Kinder zu leisten, ein Lernangebot (Projekt/Vorhaben/Thema/Inhalt) in all seinen Dimensionen so aufzubereiten, dass ein jedes Kind entsprechend seiner momentanen Handlungskompetenz (mit Möglichkeiten seiner dominierenden Tätigkeit) am kooperativen Spiel- und Lernprozess kompetent beteiligt sein kann.
Lernen als Prozess der Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung von Informationen erfordert intensive Berücksichtigung aller in der Lern- und Lebensumwelt liegenden Faktoren (sie alle bieten mehr oder weniger lernrelevante Informationen; ein Mensch lernt immer; nicht nur dann, wenn wir es möchten oder glauben, dass er es tut), so z.B. im Sinne der Elternarbeit, der Teilhabe am Leben in Nachbarschaft und Gemeinde, gemeinsame Freizeiten und Erkundungen, die Vorbereitung integrativer schulischer Bildung, Ausweitung der Integration auf alle Lebensbereiche und die Entwicklung einer Lebensperspektive.
Die mit dem ersten Punkt dieses Berichtes vorgetragenen Zusammenhänge verdeutlichen, dass Integration (wie es der Begriff selbst suggerieren mag und man es sehr häufig in der Diskussion erfährt) nicht eine Angelegenheit ist, die man eben mal schnell „herstellt“ und dem bestehenden System additiv einverleibt.
Integration ist zutiefst verwoben mit den sich historisch herausgebildeten Formen der Regel- und Sonderpädagogik und bezieht sich im Sinne der Notwendigkeit, in der Praxis eine kindzentrierte, basale allgemeine Pädagogik zu leisten, auf die Grundlagen menschlicher Persönlichkeitsentwicklung und menschlichen Lernens.
Integration im Bereich der Pädagogik des Kindergartens (später der schulischen Pädagogik) ist nicht ein neuer Touch, ein neuer Glanz, dem man dem alten System verleiht; es bedeutet in der Konsequenz die Absage an das bestehende segregierende Erziehungs- und Bildungssystem und die darin entfalteten didaktischen, methodischen und therapeutischen Prozesse.
Was unter diesem Punkt beschrieben wurde, kennzeichnet jene grundlegenden Einstellungen zur Frage der Integration und deren pädagogisches Verständnis,
- 32 -
mit dem wir in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen und Personen unser Vorhaben begannen.
Wir waren uns klar und einig darin, kein neues Modell zu schaffen, denn dass die integrative Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder nicht nur sinnvoll, sondern im Sinne der Humanisierung des Erziehungs- und Bildungssystems wie im Hinblick auf die Möglichkeit, allen Kindern umfassende Angebote für eine optimale Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu schaffen, notwendig ist, konnte längst als erwiesen angesehen werden; schließlich lässt sich dies unter hinreichender Kenntnis menschliche Persönlichkeitsentwicklung auch ohne praktische Versuche logisch erschließen.
Unser gemeinsames Vorhaben sollte auch deshalb kein Modell sein, weil pädagogische Modelle im Erziehungs- und Bildungssystem der BRD meist unter Bedingungen organisiert werden, die von vornherein eine Fortführung nach Abschluss des Modellversuchs als Regelsituation ausschließen, und die Erfahrung lehrt, dass Modelle im pädagogischen Bereich noch nie landesweit und bundesweit zu einer Regelsituation geworden sind. Wir wollten mit unserem Vorhaben also auch von vornherein vermeiden, dass, wer auch immer daran beteiligt ist, dies als ein Alibi oder ein Vorzeigestück nach außen missbrauchen könnte.
Es ging uns dezidiert von Anfang an darum, die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern im Altersbereich vom 3. bis zum 6. Lebensjahr im Sinne der Kindergartenarbeit als reguläre Situation durchzuführen, um damit, was sich erwiesen hat, auch die Chance zu haben, das Angefangene in anderen Kindergärten und in die Schule hinein fortzusetzen.
Wenn gesagt wurde, dass die im ersten Punkt dieses Berichtes vorgestellten Aspekte der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im pädagogischen Bereich für uns in dieser Form von vornherein klar vor Augen stand, so heisst dies nicht, dass die Verfeinerung dieser Vorstellung nicht gerade auch durch die gemeinsame Arbeit am Vorhaben und die gemeinsam erfahrene Praxis erfolgt wäre; aber in der Grobstruktur standen uns diese Zusammenhänge sehr klar vor Augen. Dies war sicherlich auch ein Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit Fragen der Integration im pädagogischen Bereich im Zusammenhang gemeinsamer Forschungs- und Lehrtätigkeit von Hochschullehrern und Studierenden, die sich dann zur Stützung und Durchführung dieses Vorhabens wieder zusammenfanden.
Historisch gesehen haben wir seit Beginn der Diskussion um die Gesamtschule die Integration der behinderten Kinder in das Regelschulwesen und entsprechend auch für den Vorschulbereich gefordert.[37] Insofern ist das nun nachfolgend im nächsten Punkt von der institutionellen Seite her zu beschreibende Vorhaben nicht etwas Aufgesetztes oder schnell Gemachtes, sondern der nächste notwendige Schritt in einer langen Abfolge von Entwicklungen gewesen.
- 33 -
[28] Mit dieser Aussage ist auf die Gal’perin’sche Interiorisationstheorie und die etappenweise Ausbildung geistiger Funktionen verwiesen, die in der dreidimensionalen entwicklungslogischen Didaktik als zwischen der Tätigkeitsstruktur und Sachstruktur vermittelnde „Handlungsstrukturanalyse“ (im Sinne »gegenständlicher Tätigkeit«) die zweite Dimension der didaktischen Struktur darstellt (bezogen auf den Text der Vororientierung siehe Feuser 1995, 2011, 2013b)
Siehe u.a. Gal’perin, P.J. (1980): Zu Grundfragen der Psychologie. Köln: Pahl Rugenstein Verlag; Ferrari, D. & Kurpiers, S. (2001): P.J. Gal’perin. Auf der Suche nach dem Wesen des Psychischen. Butzbach-Griedel: Afra-Verlag; Janzten, W. (Hrsg.) (2004): Die Schule Gal’perins. Tätigkeitstheoretische Beiträge zum Begriffserwerb im Vor- und Grundschulalter. Berlin: Lehmanns Media
[29] In diesem Text wird der Begriff des „Vorhabens“ weitgehend Synonym mit „Projektunterricht“ verwendet. Dieser aber nicht, wie in der Schulpädagogik, als eine einmal auftretende Projektwoche verstanden, sondern als grundlegendes didaktisches Prinzip.
[30] Hier – wie in späteren Schriften vorgenommen – wäre von „Entwicklungsdiagnostik“ zu sprechen, die ich begrifflich von Förderdiagnostik unterscheide, da sie auf die unterschiedlichen Entwicklungsniveaus von Kindern in verschiedensten Tätigkeitszusammenhängen bezogen ist und nicht auf einen Sachverhalt, in dem ein Kind in seinem Lernprozess ab einem bestimmten Moment einen Bruch oder eine Verständnislücke erfahren hat, die es aufzufinden und zu schließen gilt.
[31] Das Prinzip des Kompetenztransfers ist ein sehr bedeutendes Prinzip inklusiv kompetenter Pädagogik auch insofern, dass alle Personen, in welcher Profession auch immer, die mit einem Kind handeln, dieses Handeln therapeutisch effizient realisieren können. Die Erfahrungen damit lassen jede isolierte Therapie als obsolet erscheinen und begründen auch das Prinzip der integrierten Therapie.
[32] Gemeint ist hier der Zeitpunkt des Eintritts isolierender Bedingungen im Entwicklungsverlauf.
[33] Hier sind vor allem auch die Beziehungs- und Bindungsprozesse gemeint und nicht nur die sachbezogenen Austauschprozesse
[34] Dieser Satz musste aus grammatikalischen Gründen zum besseren Verständnis weitgehend revidiert werden.
[35] Die beiden vorstehenden Sätze mussten grammatikalisch korrigiert werden.
[36] Mit diesen Begriffen wird auf das Konzept der „dominierenden Tätigkeit“ nach Leont’ev verwiesen.
[37] Damit ist auf die Entwicklung der schulformübergreifenden integrierten Gesamtschule als flächendeckender Versuch in Hessen der frühen 1970er Jahre verwiesen, die uns schon damals fordern ließ, dass Kinder und Jugendliche, die als lernbehindert, sprachbehindert und verhaltensgestört galten, nicht mehr in Sonderschulen, sondern in der integrierten Gesamtschule integrativ zu unterreichten seien. Siehe:
http://www.ggg-bund.de/index.php/gesamtschulentwicklung/282-entwicklung-der-integrierten-gesamtschulen-in-hessen (12.04.2016)
Inhaltsverzeichnis
Die Darstellung der Entwicklung unseres Vorhabens integrativer Erziehung im Kindergarten führt uns in die 2. Hälfte des Jahres 1981 zurück. Damit ist, wie zum Abschluss des ersten Punktes dieses Zwischenberichtes betont, jedoch nicht eine Art „Stunde Null“ gemeint, sondern ein Zeitraum, zu dem die an verschiedenen Orten, von verschiedenen Personen und auf dem Hintergrund unterschiedlicher Motive entwickelten Vorstellungen, die gegenwärtige segregierende Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder zu überwinden, durch das Zusammentreffen der diese Ideen tragenden Personen zu einer neuen Handlungsqualität akkumulierten, nämlich zu der, trotz zu erwartender erheblicher Widerstände und trotz der bestehenden Schwierigkeiten, eine neue pädagogische Handlungsqualität nicht nur zu wünschen, sondern zu realisieren.
Eine Basis dazu war ein sich wiederholt in unterschiedlichen Einrichtungen zum Meinungsaustausch über Möglichkeiten integrativer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder treffender Kreis, der sich aus Leitern und Mitarbeitern der staatlichen Kindergärten der Freien und Hansestadt Bremen, der Hans-Wendt-Stiftung, einer Einrichtung überwiegend für geistigbehinderte und verhaltensgestörte Kinder, Mitarbeitern des Diakonischen Werkes, der Spastikerhilfe Bremen und mir von Seiten des Studienganges Behindertenpädagogik der Universität Bremen zusammensetzte. In der Zielsetzung bestand Einigkeit, auf dem Hintergrund der von unserer Seite immer wieder in die Öffentlichkeit hineingetragenen Forderung nach Schaffung integrierter Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten in Kindergarten und Schule und den damit aufgezeigten konzeptionellen Vorstellungen diese praktische Realität werden zu lassen.
Parallel dazu fanden wiederholt Gespräche und Elternabende im Rahmen der Schule am Wandrahm (Schule für Geistigbehinderte, Sonderschule) wie auch mit dem Landesverband Bremen der Lebenshilfe für Geistigbehinderte e.V. statt. Anlass dieser z.T. kontroversen, im Kern aber immer konstruktiven Auseinandersetzungen und Gespräche, war ein von mir anlässlich des Jahres der Behinderten 1981 einer bremischen Zeitung gegenüber gegebenes Interview, das dezidiert die Überwindung der institutionellen Segregation Behinderter forderte (26). Dass dieses Interview zum Teil auf erheblichen und extremen Widerspruch bei Vertretern verschiedener Sondereinrichtungen und Organisationen für Behinderte führte, hängt wohl auch damit zusammen, dass es auf die noch nicht verheilte Wunde einer 1979 und 1980 geführten Diskussion traf, die sich um das Bemühen unseres Studienganges Behindertenpädagogik an der Universität Bremen rankte, dort eine neutrale und von Behörden unabhängige „Beratungsstelle für Behinderte“ einzurichten, die als freie Anlaufstelle für Betroffene und deren Eltern nicht nur diagnostizieren, sondern auch ein entsprechendes Förder- und Therapieangebot insbesondere an solche Betroffene machen sollte, die als „bildungsunfähig“ und „therapieresistent“ aufgegeben und weitgehend in die Versorgung und Verwahrung abgeschoben waren.
Gegen diese Bemühungen organisierten sich ohne Ausnahme alle Behindertenorganisationen des Landes Bremen, als deren Zusammenschluss die „Landesarbeitsgemeinschaft für Behinderte“ als entschiedener Gegner dieses Vorhabens auftrat. Personen, die damals aus unterschiedlichsten Motiven heraus, wobei wir aber annahmen, dass ein Hauptmotiv die Tendenz der bestehenden Institutionen war, sich selbst zu erhalten, fanden sich nun wieder durch das gegebene Interview zutiefst betroffen. Dass dieses so eingeschätzt werden musste, zeigte sich auch daran, dass Kontakte zu mir abgebrochen wurden und, wo dies nicht möglich war, selbst Kolleginnen und Kollegen, mit denen man in den verschiedensten Institutionen zuvor zusammenarbeitete, mich negierten und nicht mehr grüssten.
- 34 -
Ich möchte damit nicht ein persönliches Betroffensein verdeutlichen, sondern vielmehr, wie die Forderung nach Aufhebung des Ausschlusses, nach Integration Behinderter und psychisch Kranker in reguläre Lebens-, Lern- und Arbeitsverhältnisse, in das Bewusstsein und in tiefste innere Motive der in der Behindertenarbeit Stehenden treffen.
Erst im letzten Drittel des Jahres 1981 konnte, nachdem ich auch durch einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in den USA von Bremen abwesend war, die Diskussion um diese Frage wieder aufgenommen werden. Es zeigte sich dabei, wie schon betont, dass [zwar; GF] ein konstruktiver Umgang mit dieser „heiklen“ Frage möglich wurde, sich aber trotz der Forderungen eines Teils der Elternschaft einer Schule für Geistigbehinderte, auch nach Beginn integrativer Bemühungen, diese für ihre sich bereits in Sonderschuleinrichtungen befindlichen Kinder nicht realisieren ließen. Die Bedenken waren dabei vor allen Dingen der Art, dass diese Kinder wie die Nichtbehinderten, auf die sie treffen würden, [in Anbetracht dessen, dass sie; GF] schon eine lange Biographie der Entwicklung ihres Ich- und Selbstbewusstseins in Segregation voneinander durchlaufen haben, vor pädagogisch unüberwindbare Schwierigkeiten stellen würde. Man befürchtete, dass Integration derart wesentlich auf Kosten der behinderten Schüler und Schülerinnen gehen würde.
Unsere Forschungsergebnisse wie die erfahrene Praxis in anderen Ländern zeigten, dass auch bei einem fortgeschrittenen Lebensalter die Überwindung segregierter Maßnahmen zugunsten integrativer Erziehung, Bildung, Berufsausbildung und Arbeit möglich sind; dass diese sich aber didaktisch und methodisch etwas anders gestalten würden als die Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder, die man von Anfang an vor dem gegenseitigen Ausschluss bewahrt. Im Rahmen dieses Berichtes kann diese Linie der, wie wir es im Rahmen unserer Konzeption bezeichnen würden, „Wiederherstellung“ der bereits zerstörten sozialen und gesellschaftlichen Einheit von Behinderten und Nichtbehinderten, nicht weiter verfolgt werden.
Ergebnis der damaligen Gespräche und Bemühungen war, dass in Anbetracht der Verfestigung vorgefasster Meinungen gegen integrative Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder und in Anbetracht der doch weitgehend verfestigten Starrheit der Institutionen gegenwärtig eine reale Chance, Integration zu praktizieren, nur darin liegt, den Ausschluss der von Behinderung bedrohten bzw. bereits als behindert geltenden Kinder von vornherein zu verhindern. Dafür zeigte sich auch von Seiten der Elternschaft behinderter wie nichtbehinderter Kinder ein größeres Maß an Aufgeschlossenheit als bei Eltern von Kindern, die die Segregation in Sondereinrichtungen bereits erfahren haben.[38]
Der beschriebene Gesprächskreis überprüfte nun auf der Ebene der pädagogischen Arbeit in Kindergärten und Kindertagesheimen Möglichkeiten einer integrativen Erziehung der Kinder. Einige Kindertagesheime hatten sich in einer gewissen Weise nie gegen die Aufnahme von Kindern verschlossen, die in ihrem Entwicklungsniveau „hinter anderen Kindern zurück“ waren oder auch äußere Merkmale von Beeinträchtigungen zeigten. Man sprach also davon, dass man in Kindertagesheimen [schon; GF]behinderte Kinder habe. In einem beschränkten Masse traf dies auch zu, wobei deutlich zu sehen ist, dass es überwiegend Kinder waren, die, galten sie z.B. durch ein Down-Syndrom als behindert, relativ verhaltensunauffällig waren und derart keine Probleme hinsichtlich ihrer Eingliederung boten; sie liefen eben mit, meist ohne hinreichend spezifisch gefördert zu werden.[39] Andere Kinder, die ich in diesem Zusammenhang kennenlernte, konnten allenfalls als verhaltensauffällig oder entwicklungsverzögert, also von Behinderung bedroht, aber nicht als behindert beschrieben werden, obwohl man sie in den Einrichtungen so bezeichnete. Dennoch war hier ein Stück weit eine Offenheit zur Kenntnis zu nehmen, die eine Art „Vorschuss“ für die gemeinsam erarbeiteten Pläne integrativer Erziehung boten.
Bei den staatlichen Kindergärten war im Rahmen verschiedener Einrichtungen die Versorgung der behinderten Kinder in Sondergruppen auf dem Gelände bzw. auch in den Häusern der Regelkindergärten/Kindertagesheime erfolgt. So boten sich auch
- 35 -
hier, bedingt allein schon durch die räumliche Nähe, Kontaktnahmen und Kooperation zwischen Regel- und Sondergruppen an, die in den letzten Jahren verstärkt in Richtung eines Niveaus der pädagogischen Arbeit weiterentwickelt werden konnten, wie es mit dem ersten Kapitel dieses Berichtes beschrieben wurde, wenngleich deutlich zu sehen ist, dass man im Bereich der staatlichen Einrichtungen unter dem bestehenden Sparzwang vielleicht doch in erheblicher Weise in der Gefahr steht, zwar Integration zu machen, damit aber eher sparen zu wollen als eine adäquate Pädagogik zu entwickeln, so dass es auch schon vorkam, was für die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter spricht, „geforderte Integration“ abzulehnen, da sich die Mitarbeiter nicht hinreichend vorbereitet und qualifiziert für diese Arbeit fanden. Dies verdeutlicht, dass die im ersten Kapitel dieses Berichtes vorgetragenen konzeptionellen Grundlagen integrativer Arbeit von den Mitarbeitern in den KTHs weitgehend akzeptiert werden, dass aber unterschiedliche Grade der Realisierung dieser konzeptionellen Grundlagen in der Praxis bestehen. Auch diese Linie kann im Rahmen dieses Berichtes nicht weiter verfolgt werden.
Die Hans-Wendt-Stiftung ging unter den damals gegebenen Bedingungen den Weg der Dezentralisierung ihrer Einrichtung. Sie begab sich mit ihren Gruppen, die zentral am Stadtrand Horn/Lehe zur niedersächsischen Landesgrenze hin lagen, in verschiedene Stadtteile, um dem Prinzip der Regionalisierung der Behindertenarbeit und ihrer Dezentralisierung näher zu kommen. Auch dieses ist ein Strang notwendiger Entwicklung bereits bestehender Sondereinrichtungen, dem hier vorgestellten konzeptionellen Ziel näher zu kommen.
Bezeichnend ist allerdings, was im Hinblick auf die Realisierung der Fortsetzung der gemeinsamen integrativen Erziehung und Bildung in den Bereich der Schule hinein sicher nicht unbedeutend ist, dass man, nachdem das sogenannte Bremer Projekt, das mit der schulischen Förderung autistischer Kinder auf der Basis eines von Bund, Land und dem Regionalverband Bremen des Vereins „Hilfe für das autistische Kind e.V.“ (Sitz:[40] Hamburg) in das Schulwesen des Landes Bremen übergegangen war, die Gruppen/Klassen für autistische Kinder zwar nominell der Schule für Entwicklungsgestörte (Sonderschule für Verhaltensgestörte) zuordnete, die Gruppen dann aber in den durch die Maßnahmen der Dezentralisierung der Hans-Wendt-Stiftung leer stehenden Gebäude am Stadtrand Bremens unterbrachte. Nicht nur, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Autismusforschung und den herausgearbeiteten Möglichkeiten integrativer Erziehung und Bildung autistischer Kinder keinen wissenschaftlich begründbaren pädagogischen Sinn ergibt, autistische Kinder ausgerechnet in eine Schule für verhaltensgestörte Kinder zu integrieren, so ist es auch von der Entwicklungsproblematik als autistisch geltender Kinder her gesehen absolut widersinnig, sie in bereits von Behinderten verlassenen Gebäuden am Stadtrand in noch größere Isolation zu bringen, als sie dies zuvor durch eine zentrale Lage des Projekts in der Stadt bereits waren.
Dieselbe Schulverwaltung, die dieses veranlasst und vertreten hat und dies, wie erst jüngst in einem trägerübergreifenden Arbeitskreis aller mit Fragen der Integration behinderten Menschen Befasster als eine außerordentliche Leistung darstellte, die in der Bundesrepublik einmalig sei, ist nun damit befasst, integrative Erziehung und Bildung in Fortsetzung unseres Vorhabens in der Grundschule zu organisieren. Hier brechen die Widersprüche in extremer Weise auf. Einmalig ist für Bremen, was die Förderung autistischer Kinder betrifft, diese Lösung in der Bundesrepublik – im negativen Sinne. Sie hätte nach Übergang des Projekts in das Schulwesen des Landes Bremen im Sinne regionalisiert betriebener Integration erfolgen und geleistet werden können. Man hat aber Tatsachen geschaffen, ohne in die Vorbereitung dieser Maßnahmen auch die entsprechenden Fachleute aus dem universitären Bereich hinzuzuziehen. Auch dieser Strang wird hier nicht weiter zu verfolgen sein, aber auch er charakterisiert, in welchem Umfang und in welchem bildungspolitischen Klima unser Vorhaben entwickelt wurde.
So verblieben für die weiteren Überlegungen der Sonderkindergarten der Spastikerhilfe e.V. und das Diakonische Werk in Bremen, das für die pädagogische Ar-
- 36 -
beit in den ihm angeschlossenen evangelischen Kindertagesstätten verantwortlich ist.
Durch die schon länger bestehende intensive Zusammenarbeit einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens der Spastikerhilfe Bremen e.V. mit dem Studiengang Behindertenpädagogik der Universität Bremen sowohl vor Ort wie in Seminaren begannen nun Überlegungen, den Sonderkindergarten der Spastikerhilfe für nichtbehinderte Kinder in dem Stadtteil, in dem sich dieser Sonderkindergarten befindet, zu öffnen. Im Rahmen entsprechender Fortbildungsmaßnahmen und unter wissenschaftlicher Begleitung des Kollegen Prof. Dr. Jantzen entfaltete sich dort eine für die Kinder sehr wertvolle integrative Arbeit, die bereits in einem Zwischenbericht (27) dokumentiert ist. Die konzeptionellen Voraussetzungen sind denen, wie sie hier im 1. Kapitel des Berichtes geschildert wurden, im Grunde vergleichbar; Modifikationen des Vorgehens ergeben sich daraus, dass es sich bei dem Kindergarten der Spastikerhilfe um einen Sonderkindergarten handelt, in dem aus einem überregionalen Einzugsbereich sehr schwerbehinderte Kinder zusammentreffen, Kinder, die man oft auch in anderen Sondereinrichtungen nicht zu fördern können glaubte oder wollte. Dieser Umstand, dass also wenig nichtbehinderte Kinder auf sehr viele sehr schwer behinderte Kinder treffen, erfordert auch bei gleicher Grundkonzeption andere Vorgehensweisen, als dies, wie im Bericht nun nachfolgend weiter ausgeführt werden wird, der Fall ist, wenn sich ein Regelkindergarten für behinderte Kinder öffnet, die, wie schon betont, nur aus dem Einzugsbereich des Kindergartens selbst kommen und unterschiedliche Arten und Schweregrade von Behinderung aufweisen. Unter Verweis auf den Bericht über die Integrationsgruppen des Sonderkindergartens der Spastikerhilfe kann auch dieser Strang integrativer Bemühungen in Bremen hier nicht weitergeführt werden.
Im Rahmen des aufgezeigten, sehr differenzierten Austausches in Bremen zu Fragen der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder kam es zur intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Diakonischen Werk Bremen und mir im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Hochschullehrer an der Universität Bremen im Studiengang Behindertenpädagogik mit der Stellenbeschreibung „Didaktik und Integration bei Geistigbehinderten“. Es erfolgte ein intensiver Austausch über Zielvorstellungen und konzeptionelle Vorgaben darüber, wie in einem ersten Schritt mit einem noch zu findenden Kindergarten, der dem Landesverband der evangelischen Kindertagesstätten angehört, integrative Erziehung geleistet werden könnte. In mehreren Sitzungen konnte eine grundsätzliche Abstimmung darüber erreicht werden, mit welchen konzeptionellen Grundlagen dies geleistet werden könnte und welche nicht zu unterschreitenden Vorgaben für ein solches Vorhaben zu realisieren sind. Diese Übereinstimmung, wie sie dann später die Bremische Evangelische Kirche (BEK) mit ihrer Zustimmung zur Durchführung eines solchen Vorhabens übernahm, entspricht den Grundlagen, wie sie im 1. Kapitel dieses Berichtes sehr ausführlich dargestellt worden sind. Damit sah ich alle Grundbedingungen für eine sowohl behinderten wie nichtbehinderten Kindern gegenüber vertretbare pädagogische Konzeption integrativer Erziehung für gegeben, wie umgekehrt das Diakonische Werk und die BEK die wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens durch mich wünschte.
Auf dieser Basis konnte nun nach einem Kindertagesheim gefragt werden, das seinerseits im Entwicklungsprozess dieser Fragestellungen zu der Auffassung gekommen war, sich für behinderte Kinder zu öffnen und dieses im Hinblick auf die regionale Versorgung und die pädagogischen Konsequenzen auch zu realisieren. Eine Überlegung, von der wir uns in Anbetracht der sehr problematischen Diskussionslage um die Integration in Bremen leiten ließen, war die, nach Möglichkeit mit einem Kindergarten die integrative Arbeit zu beginnen, der in einem Stadtteil liegt, in dem keine Versorgung behinderter Kinder organisiert ist; d.h. in dem es keine Sondereinrichtungen für Kinder im Vorschulalter gibt. Damit wollten wir den immer wieder laut gewordenen Bemerkungen, man würde mit der Öffnung von Regeleinrichtungen für Behinderte den Sondereinrichtungen die Kinder abwerben wollen und noch dazu schlechter versorgen, keinen unnötigen Vorschub lei-
- 37 -
sten, so sehr sich solche Befürchtungen auch selbst in Misskredit bringen. Damit richtete sich unser Interesse auf die Bereiche Bremen-Mitte und Bremen-Huchting. Schließlich fanden wir in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde mit ihrem Kindertagesheim eine Einrichtung, die sich aufgrund ihrer Geschichte und entwickelten Vorstellungen als dritter Partner dem gemeinsamen Vorhaben anschloss, das nun beginnen konnte.
Die oben beschriebene intensive Auseinandersetzung um Fragen der Realisierung integrativer Bemühungen im Regelkindergarten mit dem Diakonischen Werk führte dann über mehrere Stufen zu einer ersten konzeptionellen Vorlage, die in ihrer Fassung vom 10. November 1981 als Basispapier für die Diskussion des Vorhabens sowohl mit der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde und der Mitarbeiterschaft des Kindertagesheimes dieser Gemeinde als auch für die Diskussion im Rahmen des Diakonischen Werkes, des Kindergarten-, Erziehungs- und Kirchenausschusses der BEK diente. Aufgrund dieser zentralen Bedeutung des Papiers soll dieses nachfolgend wiedergegeben werden.
2.1.1Der erste Konzeptionsentwurf zur Schaffung von Möglichkeiten, behinderte Kinder in Regelgruppen einer evangelischen Kindertagesstätte zu integrieren[41]
Es ist unser Ziel, auf solide Weise zu versuchen, dem einzelnen Behinderten zu helfen. Es soll sich dabei weder um ein Modell noch um einen Versuch handeln, sondern um die Schaffung der Möglichkeit, Behinderte in Regeleinrichtungen zu integrieren. Für diese Art der Integration gibt es im Bundesgebiet bisher noch keine Erfahrungen. Hierin liegt die besondere Chance.
Es soll versucht werden, mit den behinderten Kindern einen anderen Weg zu gehen als den bisher üblichen, und zwar die Kinder in ihrer gewohnten und natürlichen Umgebung einer normalen Kindergruppe zu integrieren, also nicht den bisher üblichen Weg der Integration in Form einer Sondergruppe in einer Regeleinrichtung. Erstrebenswert ist es, das Verhältnis des statistischen Bevölkerungsdurchschnitts von 1:10 nicht zu überschreiten, das heisst konkret, in einer Kindergruppe von 20 Kindern nicht mehr als zwei behinderte Kinder aufzunehmen. Behinderte werden dadurch zum Problem,[42] indem [dass; GF]wir sie in einer Sondereinrichtung zusammenfassen und von ihrer natürlichen Umgebung entfremden und isolieren.
Entscheidend für den Erfolg der Integrationsbemühungen ist, dass Integration als fortlaufender Prozess verstanden wird und sich im gesamten sozialen Kontext vollzieht: Familie, Kindergarten, Kirchengemeinde, Wohnbereich, Schule und Beruf. Dementsprechend müssen Kontakte mit der infragekommenden Schule für eine gemeinsame Einschulung der behinderten und nichtbehinderten Kinder rechtzeitig aufgenommen werden.
Wir weisen darauf hin, dass ein behindertes Kind in der Regelgruppe eines Kindergartens alles bekommen soll, was es an speziellen Förderungsangeboten braucht, z.B. notwendige Therapien, allerdings in der natürlichen Umgebung. Der Schweregrad des zur Integration anstehenden behinderten Kindes beeinflusst die Notwendigkeit für weitere unterstützende Maßnahmen wie besondere Therapien. Ein Schwerstbehinderter benötigt Sonderhilfen wie überall sonst auch. Wesentlich soll aber auch die Hilfe der Kinder untereinander sein.
Nach unserer Auffassung wird das grösste Problem der Integrationsbemühungen bei der Übersetzungsarbeit und Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter und Eltern liegen. Es ist notwendig, das behinderte Kind in den Lebensalltag einer Einrichtung zu integrieren. Nichtbehinderte Kinder lernen das Zusammensein mit behin-
- 38 -
derten Kindern auf natürliche Weise. Sie erfahren, dass ein anderes Kind, das anders erscheint, nicht anders sein muss.
Die Schaffung der Möglichkeit, behinderte Kinder in eine Regelgruppe eines evangelischen Kindergartens zu integrieren, beinhaltet für die Kirchengemeinde die besondere Chance und Aufgabe einer umfassenden Integration sowohl des Kindes als auch der Eltern in das Gemeindeleben.
Die Verwirklichung unserer Integrationsvorstellungen sollte sich wie folgt gestalten:
Ca. 1 Jahr Vorlaufsarbeit für die Einrichtung, das bedeutet Vorbereitung der Mitarbeiter, der Kinder und Eltern und nicht zuletzt auch der Gemeinde. Nach Möglichkeit sollte das aufzunehmende behinderte Kind in eine zum Teil bereits bestehende Gruppe integriert werden, um eine gezielte Vorbereitung der bestehenden Gruppe zu gewährleisten. Wegen der größeren Kontinuität in der Betreuung bietet nach unseren Vorstellungen die altersgemischte Gruppe die günstigsten Voraussetzungen für die Integration behinderter Kinder.
Nach der einjährigen Vorlaufsphase, in der Professor Feuser gemeinsam mit vier Studenten der Sonderpädagogik bzw. Doktoranden die Vorbereitung und Schulung der Eltern und Mitarbeiter leiten will, sollen die Integrationsbemühungen beginnen und auf drei Jahre angelegt sein. Die Studenten sollen während dieser Zeit aufgrund ihrer sonderpädagogischen Vorkenntnisse und Erfahrungen die Gruppenleiter in der praktischen Arbeit mit dem behinderten Kind unterstützen, sie sollen die Funktion eines Stützpädagogen[43] übernehmen.
Durch die Maßnahme einer integrativen Vorschulerziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern werden sowohl für die Behinderten wie Nichtbehinderten neue Bereiche für ihre Persönlichkeitsentwicklung erschlossen, von denen beide Gruppen unter den gegenwärtigen Bedingungen ausgeschlossen sind. Neue Erfahrungen ergeben sich für die Nichtbehinderten insbesondere durch den Aufbau von neuen Fähigkeiten im sozialen Bereich bis hin zu interaktiven und kommunikativen Elementen, so wie sich für die behinderten Kinder neue Möglichkeiten ergeben würden, am Verhalten der nichtbehinderten Kinder modellhaft bessere Anpassungsmöglichkeiten an die Lebens- und Lernbereiche im Kindergarten zu erreichen. Durch das gemeinsame Gruppenerlebnis wird für die Nichtbehinderten Behinderung zum Lerngegenstand, und zwar durch praktische Erfahrungen und nicht durch Vermittlung theoretischer Kenntnisse. Außerdem erhält das behinderte Kind die Möglichkeit des spontanen Lernens und des Akzeptiertwerdens in der natürlichen sozialen Umgebung. Dieses frühe Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten verringert die üblicherweise auftretenden Interessenskonflikte.
Nach unseren Vorstellungen muss Integration auch Schwerstbehinderte mit einbeziehen, da auch sie hochentwickelte Wesen sind und über viele Kommunikationsmöglichkeiten verfügen. Das bedeutet für den Erzieher in der Situation mit dem behinderten Kind zu überlegen, wie wird kommuniziert und wie können wir diese Art der Kommunikation so ausbauen, dass das behinderte Kind in die Gemeinschaft der nichtbehinderten Kinder eingebunden ist und wird. Die von den Erziehern gemachten Erfahrungen durch die Auseinandersetzung mit behinderten Kindern kommen jedem nichtbehinderten Kind zugute.
Unter den zuvor genannten Aspekten zielt Integration darauf ab, dass behinderte wie nichtbehinderte Kinder miteinander an gemeinsamen Gegenständen durch Erfahrung lernen und im gemeinsamen Umfeld leben können.
Die Koordination der Integrationsbemühungen und die kontinuierliche Begleitung sollen vom Landesverband erfolgen, um Voraussetzungen für spätere Übersetzungsmöglichkeiten auf andere Einrichtungen zu ermöglichen.
- 39 -
a) Organisation in der Kindertagesstätte und der Gemeinde
In der Vorlaufsphase werden die Mitarbeiter auf die Schaffung von Integrationsmöglichkeiten behinderter Kinder in Regeleinrichtungen gezielt vorbereitet. Dieses geschieht nach ersten Gesprächen mit der infragekommenden Einrichtung in einem gemeinsamen Vorbereitungsseminar aller Beteiligten, wie z. B. Mitarbeitern, Eltern und Vertreter der Kirchengemeinde, und anschließenden vierzehntägig stattfindenden Vorbereitungstreffen.
b) Wissenschaftliche Begleitung
Die wissenschaftliche Begleitung in Theorie und Praxis übernimmt Herr Feuser, Professor für Behindertenpädagogik an der Universität Bremen, gemeinsam mit vier praxiserfahrenen Studenten bzw. Doktoranden des Behindertenstudienganges.[44] Sie sollen während dieser Zeit aufgrund ihrer sonderpädagogischen Vorkenntnisse und Erfahrungen die Gruppenleiter in der praktischen Arbeit mit den behinderten Kindern unterstützen und somit die Funktion eines Stützpädagogen übernehmen.
Die wissenschaftliche Begleitung umfasst neben der aktiven Praxisbetreuung die theoretische Vorbereitung der Mitarbeiter, Gemeinde und Eltern sowie die Dokumentation der Integrationsbemühungen und die Auswertung der einzelnen Schritte. Sie beinhaltet ebenfalls die Schlussauswertung einschließlich der Frage der Übersetzbarkeit auf andere Regeleinrichtungen.
a) Personalkosten
Zusätzliche Personalkosten entstehen in der Anfangsphase durch die unterstützende Mitarbeit einer sozialpädagogischen Fachkraft (wahrgenommen durch die Studenten) in Höhe einer vollen Planstelle. Die dafür notwendigen Kosten müssten auf Honorarbasis über den Pflegesatz nach dem BSHG finanziert werden. Außerdem sollte an die Anstellung eines Zivildienstleistenden gruppenübergreifend gedacht werden. Die dafür entstehenden Kosten müssten zum Teil ebenso von der Bundessozialhilfe getragen werden. Ferner halten wir die Anstellung einer Berufspraktikantin (mit Schwerpunkt Sonderpädagogik) als Zweitkraft für die infragekommende Gruppe für notwendig, sie wird im Rahmen des üblichen Berufspraktikantenkontingents für die evangelischen Kindergärten finanziert.
b) Sachkosten
Zusätzliche Sachkosten in Form von besonderen Therapieangeboten müssten auf Krankenkassenbasis oder über den Pflegesatz nach dem BSHG abgerechnet werden.
Die geringeren Einnahmen an Elternbeiträgen, bedingt durch den Ausfall der von Behinderten besetzten Plätze, müssten ebenfalls im Pflegesatz Berücksichtigung finden.
Bremen, 10.11.1981“
Im Zusammenhang mit dieser ersten Diskussionsvorlage war auch der Zeitplan für die Vorbereitung und Durchführung des Vorhabens entstanden. Er lautete wie folgt:
November 1981: Abschließende Beratung der Konzeption in der Kindergartenkommission.
November 1981: Antrag an den Kirchenausschuss auf Genehmigung der Schaffung von Integrationsmöglichkeiten für behinderte Kinder in einer Regeleinrichtung der BEK.
November 1981: Entscheidung des Kirchenausschusses.
- 40 -
Dezember 1981: Antrag an den Senator für Soziales, Jugend und Sport auf Kostenübernahme.
Januar 1982: Prozess der Entscheidungsfindung der in Frage kommenden Gemeinde und der Mitarbeiter der Kindertagesstätte.
Beginn der Vorlaufphase mit Mitarbeitern, Gemeindeorganen, Eltern und Kindern unter begleitender Auswertung der einzelnen Schritte und der Frage der Übertragbarkeit auf andere Regeleinrichtung.
August 1982: Beginn der Hauptphase der Integrationsbemühungen unter begleitender Auswertung der einzelnen Schritte und der Frage der Übertragbarkeit auf andere Regeleinrichtungen.
Sommer 1985: Gesamtauswertung
Die nun auf allen Ebenen erforderlich werdenden Entscheidungen fielen nicht ganz so schnell, wie es im Sinne der Vorbereitungsphase wünschenswert gewesen wäre, aber sie kamen alle im Rahmen konstruktiver Gespräche der Beteiligten untereinander ohne Ausnahme in positiver Weise zustande, so dass mit Beginn des Kindergartenjahres 1982 das Vorhaben in der Praxis beginnen konnte.
Ist hier vom „Diakonischen Werk e.V., Bremen“ die Rede, so ist im engeren Sinne der „Landesverband für evangelische Kindertagesstätten“ gemeint, der ein Fachreferat im Rahmen des Diakonischen Werkes darstellt, das für die ihm angeschlossenen evangelischen Kindergärten und anderen Einrichtungen verantwortlich ist. Drei Mitarbeiterinnen teilen sich diese Arbeit. Zwei von ihnen sind im engeren Sinne wiederum Ansprechpartner in Fragen der integrativen Bemühungen, sei dies von Seiten der Kindergärten, den Gremien der BEK oder von Seiten der wissenschaftlichen Begleitung.
Wir waren schon zu Beginn der Diskussion um den ersten Entwurf für das Vorhaben übereingekommen, dass eine der Kolleginnen alle Maßnahmen (Besprechungen, Fortbildungen, Beratungen o.a.) begleitet und sie im wesentlichen mit der Dokumentation aller dieser Maßnahmen betraut wird (Frau König), während eine andere Kollegin durch ihre bereits bestehende spezifische Funktion als Referentin für Ev. Kindertagesstätten (Frau Wehrmann) die Verhandlungen von der formalen Seite her in Bezug auf die BEK und gegenüber den entsprechenden staatlichen Stellen, insbesondere mit dem Senator für Soziales, Jugend und Sport, führen würde. Derart war von Seiten des Diakonischen Werkes eine Arbeitsteilung gefunden, die im Sinne der erforderlichen Informationsaufnahme und Informationsweitergabe sowie der Dokumentation und der Planung aller weitergehenden Schritte, wie die Praxis bis heute erwies, vollauf Rechnung tragen konnte.
Wie aus der Sicht dieser beiden direkt mit der Entwicklung und den Fragen der integrativen Bemühungen betrauten Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werkes heute das gemeinsame Vorhaben eingeschätzt wird, wird aus ihrer nachfolgend zitierten Stellungnahme selbst am besten deutlich.
„Der Landesverband für Evangelische Kindertagesstätten ist als zuständiges Fachreferat des Diakonischen Werkes in Bremen verantwortlich für die pädagogische Arbeit in den ihm angeschlossenen evangelischen Kindergärten, Kindertagesheimen, Horten und Kinderspielkreisen. Ihm obliegt die fachliche Beratung der Mitarbeiter, Eltern und Träger sowie die Organisation von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die pädagogischen Mitarbeiter.
Evangelische Kindergartenarbeit orientiert sich im Sinne eines christlichen Menschenbildes an der Gesamtpersönlichkeit eines Kindes und versteht sich
- 41 -
von daher als familienergänzende und familienunterstützende Einrichtung.
Weitergehende und neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf eine gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder in anderen Ländern, wie beispielsweise Dänemark, Italien und den USA, waren für uns Anlass neben der allgemeinen Diskussion im Jahr der Behinderten, uns näher mit den Lebensbedingungen von Behinderten und von Behinderung bedrohter Menschen in unserem Land auseinanderzusetzen, mit dem Ergebnis, den Gedanken der Integration in unsere evangelische Kindergartenarbeit einzubeziehen.
Je mehr wir uns in die inhaltliche Diskussion begaben, umso mehr wurde uns die Notwendigkeit einer gemeinsamen Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern klar und die besondere Möglichkeit und Chance einer gemeinsamen Förderung und einer gemeinsamen Integrationsmöglichkeit von Eltern und Kindern in einem kirchlichen Kindergarten mit dem sozialen Umfeld einer Kirchengemeinde deutlich.
Auch in der Vergangenheit wurden immer wieder einzelne behinderte Kinder nicht vom Kindergartenbereich in evangelische Kindergärten ausgeschlossen, aber man begegnete ihnen häufig mit Unsicherheit und erkannte oft die Grenzen der eigenen Förderungsmöglichkeiten. Zum anderen sind Kirchengemeinden bisher relativ wenig mit Behinderten in Kontakt gekommen, da sie meistens in Sondereinrichtungen ausserhalb der Familien untergebracht waren, diese Tatsache führte häufig zur Isolierung von Eltern und Kindern.
Es folgten inhaltliche Diskussionen mit Wissenschaftlern, Mitarbeitern aus Integrationseinrichtungen sowie den pädagogischen Mitarbeitern in unseren evangelischen Kindertagesstätten, den Mitgliedern von Kirchenvorständen sowie den verantwortlichen Gremien der Bremisch Evangelischen Kirche bis hin zur Zustimmung aller Beteiligten wie Kindergarten, Elternbeirat, Kirchenvorstand, Kindergartenausschuss, Erziehungsausschuss der BEK und nicht zuletzt des Kirchenausschusses der BEK und des Senators für Soziales, Jugend und Sport und die Genehmigung der inhaltlichen Konzeption als Rahmen für die Integration behinderter Kinder im Regelkindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Die nachfolgend beschriebene Konzeption zur Schaffung von Möglichkeiten, behinderte Kinder in Regelgruppen einer evangelischen Kindertagesstätte zu integrieren, beschreibt die geplante Aufgabe und dient als inhaltliche Grundlage der integrativen Arbeit.
Fachliche Unterstützung erhielten wir bei allen Überlegungen und Diskussionen durch Prof. Dr. Georg Feuser vom Studiengang Behindertenpädagogik in Bremen, der später auch die fachliche Vorbereitung der pädagogischen Mitarbeiter übernahm wie auch die wissenschaftliche Begleitung unserer Integrationsbemühungen.
Die gute fachliche Vorbereitung der pädagogischen Mitarbeiter geschah unter Begleitung von Prof. Dr. Feuser und der zuständigen Fachberaterin im Landesverband in mehreren Fortbildungsseminaren an Wochenenden und in wöchentlichen Dienstbesprechungen.
Das Diakonische Werk bzw. der Landesverband für Evang. Kindertagesstätten steht wie zu Beginn der integrativen Überlegungen in ständigem Austausch mit Vertretern anderer Integrationseinrichtungen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene und arbeitet in sehr engem fachlichen Austausch mit den Frühen Hilfen, dem Kinderzentrum, dem Hauptgesundheitsamt, den Erziehungsberatungsstellen und der Familienhilfen zusammen. Der Landesverband sieht diese positive Zusammenarbeit als notwendige Voraussetzung einer qualifizierten Förderung der behinderten Kinder an.
Aufgrund der überaus positiven Erfahrungen mit der integrativen Arbeit im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde bemüht sich der Landesverband für Evang. Kindertagesstätten als Träger der integrativen Maßnahmen im
- 42 -
genannten Kindertagesheim um die Ausweitung der integrativen Arbeit innerhalb der evang. Kindertagesstätten, indem er nach und nach weitere evang. Kindertagesstätten für die gemeinsame Arbeit mit behinderten und nichtbehinderten Kindern vorbereitet und in die inhaltliche Diskussion und die Erfahrungen in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde einbezieht.
Da entscheidend für den Erfolg unserer begonnenen Integrationsbemühungen ist, dass Integration als fortlaufender Prozess verstanden wird und sich im gesamten sozialen Kontext vollzieht: wie Familie, Kindergarten, Kirchengemeinde, Wohnbereich und nicht zuletzt in Schule und Beruf, bemüht sich der Landesverband um die Fortsetzung der Integration im Hinblick auf die Regeleinschulung der behinderten Kinder. Er unterstützt in diesem Zusammenhang das Begehren der Eltern auf gemeinsame Regelbeschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern und führte aus diesem Grunde zahlreiche Gespräche mit Lehrern der zuständigen Grundschulen sowie Vertretern des Senators für Bildung, Gewerkschaftsvertretern und mit den Sozial- und Bildungspolitikern der einzelnen in der Bremer Bürgerschaft vertretenen Parteien. Der Landesverband steht außerdem bezüglich der Regeleinschulung im ständigen Austausch mit anderen Integrationseinrichtungen im Lande Bremen und ist um einheitliche Regelungen und Entscheidungen im Schulbereich bemüht.
Im Hinblick auf die Finanzierung unserer Integrationsvorhabens, behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde zu fördern, sind wir in Bremen einen anderen Weg gegangen als den bisher üblichen.
Es war unsere Absicht, die entstehenden Kosten für die Förderung und Betreuung sowohl der behinderten als auch der nichtbehinderten Kinder einheitlich und ohne Unterschiede auf die einzelnen Kostenträger zu verteilen. Dieses bedeutete, dass auch die für die behinderten Kinder zusätzlich entstehenden Kosten voll aus dem Regelzuschuss über Jugendhilfemittel finanziert werden sollten.
Der Kirchenausschuss der Bremisch Evangelischen Kirche (BEK) hat in seinem Antrag vom 28. Januar 1982 an den Senator für Soziales, Jugend und Sport um Zustimmung zur inhaltlichen Konzeption im Hinblick auf die Schaffung von Möglichkeiten, behinderte Kinder in Regelgruppen eines evangelischen Kindertagesheimes zu integrieren, gebeten und gleichzeitig die Einbeziehung der zusätzlichen Kosten für die sachgemäße Betreuung behinderter Kinder aus Regelzuschüssen für Kindergärten, d.h. aus Mitteln der Jugendhilfe, beantragt.
Diesem Wunsch der BEK und des Diakonischen Werkes mit besonderem Anliegen einer gemeinsamen, auch finanziellen Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern hat der Senator für Soziales, Jugend und Sport Rechnung getragen. Ebenso hat auch die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände, die über die Verteilung der staatlichen Zuschüsse für die Offenhaltung von Kindertagesstätten freier Träger entscheidet, dem Zuschussantrag der Bremischen Evangelischen Kirche zugestimmt. Diese sehr wesentliche, wenn auch nur finanzielle Entscheidung hat uns auf unserem Weg einer umfassenden Integration sehr bestärkt.
Der Senator für Soziales, Jugend und Sport bewilligte uns im Rahmen der allgemeinen Zuschüsse somit für das Jahr 1982 alle zusätzlichen durch die Aufnahme von 11 behinderten Kindern entstandenen Kosten wie z. B.
-
40 Honorarstunden für einen Stützpädagogen
-
22 Honorarstunden für Therapie
-
Anteilige Kosten für einen Zivildienstleistenden
-
Sachkosten für Spezialgeräte, Mobiliar, Materialien, Fahrt- und Fortbildungskosten und Fachbücher
-
Ausgleich für Mindereinnahmen an Ganztagselternbeiträge.
Die für die genannte Position bewilligten Mittel betragen insgesamt für die 11 aufgenommenen behinderten Kinder DM 65.000. Die relativ niedrigen zusätz-
- 43 -
lichen Betreuungskosten für 11 behinderte Kinder im Zeitraum vom 01.08.1982 bis 31.12.1982 konnten nur deshalb so niedrig gehalten werden, weil es sich um rein zusätzliche Ausgaben bzw. Kosten handelte und alle regulären Personal- und Sachkosten der Gesamteinrichtung im Rahmen der allgemeinen Zuschussregelung in Bremen mit 53% Eigenanteil der BEK aus Kirchensteuermitteln, mit 10% aus Elternbeiträgen und 37% staatlichen Zuschüssen getragen werden.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser Stelle die mit der Änderung des Kindergarten- und Hortgesetzes vom 19.03.1982 eingeführten Bestimmung in § 19, Abs.6: „Für Kinder, bei denen eine Behinderung amtsärztlich festgestellt ist, die eine Anwendung des § 39 des Bundessozialhilfegesetzes rechtfertigt und die aufgrund dieser Behinderung aufgenommen werden, sind Gebühren bzw. Entgelts nicht zu erheben. Die Kosten für Verpflegung sind in voller Höhe zu zahlen.“
Diese gesetzliche Regelung, die keine finanziellen Nachteile für Eltern mehr bedeuten, wenn ihre behinderten Kinder in einem Regelkindergarten betreut werden, war für uns ein ganz wesentlicher Schritt im Hinblick auf unser Integrationsziel und auf die Entscheidungsmöglichkeiten der Eltern von behinderten Kindern.
Um so mehr sind wir enttäuscht, dass nach so positiven Anfängen nicht nur einer gemeinsamen inhaltlichen Förderung der Senator für Soziales, Jugend und Sport uns aufgrund der angespannten Haushaltslage in Bremen seit Anfang 1983 mitteilen musste, dass weniger Haushaltsmittel für die Zuschüsse zur Offenhaltung von Kindergärten zur Verfügung stehen. Angesichts der Tatsache der geringer werdenden staatlichen Zuschüsse und des steigenden Eigenanteils der BEK mit derzeit schon 53% sind wir gezwungen, die zusätzlich für die behinderten Kinder entstehenden Kosten nun doch wie üblich aus Bundessozialhilfemitteln über Einzelanträge der Eltern zu finanzieren. Wir sehen dies als enormen Rückschritt auf dem eingeschlagenen Weg der Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten an und es bleibt das erklärte Ziel von Kirche und Diakonie, ein einheitliches Finanzierungsmodell für die Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder anzustreben. Die Übernahme der Kosten für die behinderten Kinder aus Bundessozialhilfemitteln sehen wir daher als Übergangslösung an und hoffen und kämpfen für eine baldige andere Lösung.
Nur durch Zustimmung zu den veränderten Finanzierungsbedingungen konnten wir die Arbeit der übrigen Regeleinrichtungen als auch der integrativen Bemühungen fortsetzen. Wir wollten und konnten aber auch nicht die Förderung behinderter Kinder in Regelkindergärten auf Kosten der nichtbehinderten Kinder betreiben, das hätte dem Integrationsziel mit Sicherheit entgegengewirkt.
gez.: I. König/I. Wehrmann“
Die letzten Hinweise bringen deutlich unser aller Sorge zum Ausdruck, dass durch Zwänge in der Finanzierung das Anliegen, das wir in Punkt 1. mit Integration beschrieben haben, auch in ideeller Hinsicht unterlaufen wird. Nach wie vor sehen wir überhaupt keinen Hinderungsgrund darin, die Vorhaben integrativer Förderung behinderter Kinder in Kindertagesheimen nicht durch Jugendhilfemittel zu finanzieren. Wer sich die Mühe macht, sich durch die Bestimmungen und die Kommentare der Jugendhilfegesetze 5 und 6 hindurchzulesen, wird unschwer feststellen, dass es letztlich keine hinreichenden Sachkriterien gibt, nach denen entschieden werden könnte, ob Maßnahmen spezieller Hilfen und Förderungen für von Behinderung bedrohte oder behinderte Kinder in Regeleinrichtungen nach Jugendhilfe oder nach BSHG zu bezahlen sind. Wird nur letztere Möglichkeit akzeptiert und praktiziert, bedeutet dies, dass selbst für Kinder, die nach dem Gesetz noch nicht als behindert gelten, und für die entsprechende Feststellungen durch die Gesundheits-, Jugend- und Sozialbehörden noch nicht getroffen wurden, damit man ihnen die Hilfen gewähren kann, die zur Abwendung einer drohenden Behinderung erforderlich werden, sie zuerst zu Behinderten
- 44 -
machen muss, damit das nach dem BSHG finanziert eine drohende Behinderung verhindert werden kann.[45]
Regelungen dieser Art zeigen hinreichend, dass es oft primär nicht um vernünftige und den Menschen dienliche Verfahrensweisen geht, sondern mehr um eine Akrobatik der Abwälzung der Finanzierung des erforderlichen Förderungsbedarf auf Andere, die zu zahlen haben. So entlastet sich die Kommune von Zahlungen, in dem sie das BSHG verpflichtet. Dass damit aber der Zwang eintritt, Kinder nach dem Gesetz behindert machen zu müssen, um integrative Maßnahmen durchführen zu können, würde die Perversion der Idee der Integration par excellence bedeuten.
Wir verschließen uns grundsätzlich diesen Zwängen. Dennoch bedeutet dies, in der Praxis mehr an speziellen Hilfen für Kinder gewähren und leisten zu müssen, als dies durch die Finanzierung abgedeckt werden kann. Hier ist der freie Träger aufgerufen, aus seinen Mitteln zu investieren, um Kinder davor zu bewahren, dem Stigma des Behindertseins – und sei es auch nur auf dem Papier, was in unserer Gesellschaft verheerend genug sein kann – ausgesetzt werden zu müssen.
Eine Finanzierung nach dem Jugendhilfegesetz ist auch insofern eindeutig gerechtfertigt, als integrative Bemühungen im Anschluss an Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung (in Bremen Frühe Hilfen genannt) eindeutig im Sinne der sekundären Prävention nach Bestimmungen der WHO zu gewichten sind d.h. sie haben präventiv-vorbeugenden Charakter, sie verhindern, dass ein Ausschluss für die Kinder zustande kommt, der ihnen das Stigma der Behinderung mit all den in Kapitel 1 des Berichtes beschriebenen Folgekonsequenzen aufzwingt. Integrative Bemühungen im Rahmen der Vorschulerziehung sind also, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Maßnahmen der Verhinderung eines sozialgesellschaftlichen Ausschlusses von Kindern, die über das übliche Maß hinausgehend spezieller Hilfen in ihrer weiteren Persönlichkeitsentwicklung bedürfen. Sie haben nicht den Charakter der Rehabilitation, wie sie das BSHG vorsieht, sondern der Habilitation.
So bitter es um den Fortbestand der Integration willen ist, die uns momentan aufgezwungene Finanzierungsregelung zu akzeptieren, so sehr müssen wir uns um eine Solidarisierung aller bemühen, dass integrative Maßnahmen im Bereich der Kindergärten und Kindertagesheime bundesweit nach dem Jugendhilfegesetz finanziert werden. Nur so wird auf Dauer zu verhindern sein, dass uns Finanzierungszwänge letztlich doch dazu veranlassen könnten, Behinderungen zu schaffen, anstatt Behinderung zu überwinden. Es sollte dem Bewusstsein verantwortlicher Gesundheits- Sozial- und Bildungspolitiker zugänglich sein, dass nicht geleistete Prävention im weiteren Lebensverlauf eines dann behindert werdenden Menschen mit Folgekosten verbunden ist, die ein Vielfaches dessen übersteigen, was eine wirksame Prävention gekostet hätte; unabhängig davon, dass es zutiefst unmenschlich ist, mit dem Verweis auf die Verantwortung der Familie, Kinder sich in Behinderungen hinein entwickeln zu lassen, wo diese durch wirksame Maßnahmen der Prävention erst gar nicht aufzutreten bräuchten oder weit milder verlaufen würden. Diese Art des Hände-in-den-Schoss-Legens der verantwortlichen Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker mit dem Fingerzeig darauf, dass man schon etwas unternehmen werde, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, denn dann ist das BSHG zuständig, dient nicht einmal den fiskalischen Egoismen der Verantwortlichen, denn auf Umwegen müssen sie schließlich die später dann weit höher anfallenden Kosten, auch wenn sie sich als Bundesmittel deklarieren, doch bezahlen.
Ein weiteres Problem ist mit dieser Finanzierungsfrage verbunden. Keines der bestehenden Gesetze, nach denen Mittel für die Prävention bzw. Rehabilitation für von Behinderung Bedrohte und Behinderte erwirkt werden können, konnte bei seiner Abfassung den Sachverhalt berücksichtigen, wirksame Hilfen für Behinderte im Rahmen und durch integrative Maßnahmen zu gewähren. Dazu sind diese Ansätze noch zu jung. Das verlangt, dass sich die mit der Integration eröffnenden Möglichkeiten in einer Revision der gesetzlichen Grundlagen, was die materielle und personelle Seite integrativer Bemühungen betrifft, niederschlagen müssen.
- 45 -
Wir haben, worüber noch berichtet wird, z.B. mit der Einführung des „Stützpädagogen“ (mitarbeitende/r Behindertenpädagog/e/in im Regelkindergarten) sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber auch hier stoßen wir dadurch, dass eine neue Sache mit einer veralteten Elle gemessen wird, auf grosse Schwierigkeiten. Da z.B. das BSHG keine höher qualifizierten Stellen pädagogischer Art für den Einsatz bei behinderten Menschen vorsieht, als „Stützpädagoge“ aber ein qualifizierter Behindertenpädagoge mit universitärem Abschluss (BAT II A) bei Integrationsmaßnahmen in Regeleinrichtungen nach unserer Auffassung unbedingt einzusetzen ist, entstehen auch hier Finanzierungsschwierigkeiten. So gerät man schnell auf das Geleise, wie dies in Bremen z.T. in den staatlichen Einrichtungen geschieht, eine zweite in einer Kindergartengruppe mitarbeitende sozialpädagogische Kraft als „Stützpädagoge“ zu deklarieren. Hier wird nicht nur die Funktion des Stützpädagogen, wie sie später noch beschrieben werden wird, unterlaufen, sondern auch um das eigene Gewissen und vielleicht auch die Öffentlichkeit und die Eltern der Betroffenen zu beruhigen, eine personell ohnehin erforderliche Maßnahme, mit dem Mäntelchen einer besonderen Maßnahme versehen. Hinzu kommt, dass die Erzieher- bzw. selbst die Sozialpädagogenausbildung in Sachen einer Qualifikation in Behindertenpädagogik bei weitem nicht ausreichend ist, um die Aufgaben eines „Stützpädagogen“ in einer Regeleinrichtung wahrzunehmen, die von Kindern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen ihrer Entwicklung besucht werden.
Wird die sich entwickelnde und ausdehnende Integration auf der Basis der bestehenden, unrevidierten gesetzlichen Regelungen finanziert, so erfährt sie von vornherein Beschränkungen, die im Rahmen integrativer Bemühungen die Schaffung unverzichtbarer Qualitäten im pädagogischen und therapeutischen Bereich verhindern und somit die Integration tatsächlich zu einem Alibi für den Sozialabbau werden lassen könnte.
Es ist also ohnehin notwendig, dass die Erfahrungen, die im Rahmen integrativer Maßnahmen in Regeleinrichtungen im pädagogisch-therapeutischen Feld gemacht werden, sich in entsprechenden Gesetzesinitiativen niederschlagen, die die bestehenden Gesetze hinsichtlich der materiellen und personellen Ausstattung dieser Bemühungen zu revidieren, zu ergänzen oder eben, was im Hinblick auf einige mit Integration unverzichtbare Forderungen zu leisten ist, (z.B. Einsatz des „Stützpädagogen“) neu zu formulieren hätten. Daraus entsteht die Konsequenz, sich einerseits gegen den Zwang bestimmter Finanzierungsmodi entschieden zur Wehr zu setzen und andererseits entsprechende Gesetzesinitiativen zu initiieren. Es ist den Behörden nach meiner Auffassung darin nicht Folge zu leisten, etwas sachlich, fachlich, organisatorisch, gesundheits-, sozial- und bildungspolitisch Neues nur von dem Bestehenden her zu beurteilen und zu finanzieren, das auf dem Hintergrund völlig anderer Vorstellungen zustande gekommen ist.
Dieser Appell kann im Rahmen dieses Berichtes nicht deutlich genug ausgebracht werden, denn nur im Bewusstsein um diese Zusammenhänge können alle, die sich um die Realisierung der Integration bemühen, vorsichtig genug sein und schnell genug bemerken, wann die Gefahr droht, dass ihnen ihr Anliegen durch die bestehenden Systemzwänge unter der Hand pervertiert und sie selbst zum Alibi von etwas gemacht werden, was sie mit ihrem Bemühen genau nicht wollen. Träte dieses ein, könnte das Wasser auf die Mühlen jener sein, die aus ideologischen Gründen die Integration verteufeln und ihr alle Macht entgegensetzen, die sie im etablierten System zu entfalten vermögen, was die Integration zerstören könnte, ehe sie eine Chance hatte, sich zu entwickeln.
Das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde wurde 1970 in einem Neubaugebiet, das überwiegend aus Sozialem Wohnungsbau besteht, in Huchting in Betrieb genommen. Huchting, ein Stadtteil von Bremen, der sich 1964/65 aus einer dörflichen Gemeinschaft heraus zu einer Satellitenstadt entwickelt hat,
- 46 -
zählt ungefähr 36.000 Einwohner. Der Stadtteil hat keine gewachsene Infrastruktur und keine gewachsenen kulturellen und kommunalen Einrichtungen. Diese wurden erst eingerichtet, als mit steigender Einwohnerzahl der zwingende Bedarf nach entsprechenden kulturellen, sozialen aber auch Erziehungs- und Bildungseinrichtungen unbedingt berücksichtigt werden musste.
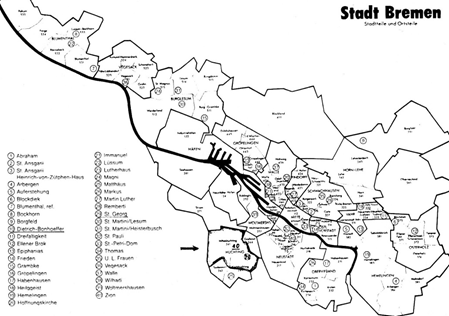
Das KTH hat eine Kapazität von 95 Plätzen. Es unterhält vier Ganztagsgruppen (altersgemischt) und eine Teilzeit-/Halbtagsgruppe, die überwiegend von 3-jährigen Kindern besucht wird.
Personal: Im KTH arbeiten je eine Erzieherin pro Gruppe mit 40 Stunden und eine Erzieherin mit 31 Stunden pro Woche.
Ferner sind beschäftigt:
3 Vorpraktikanten,
2 Berufspraktikanten (Erzieher) und
eine ABM-Kraft als Sozialpädagogin
Weitere Mitarbeiter sind:
1 Sprachheilpädagogin mit 4 Stunden pro Woche,
1 Bürokraft mit 6 Stunden pro Woche,
1 türkische Honorarkraft mit 10 Stunden pro Woche;
2 Reinigungskräfte mit 23 1/2 Stunden und
2 Frauen, die den Küchendienst besorgen, mit je 40 Stunden pro Woche
Die Leiterin mit 40-Wochenstunden ist von einer direkten Gruppenleitung freigestellt und arbeitet 6 Stunden pro Woche in der Sprachförderung der Kinder.
Durch die Aufnahme der behinderten Kinder erweiterte sich das Personal um
- 47 -
1 Stützpädagogen (40 Stunden)
2 Zivildienstleistende (je 40 Stunden)
2 Krankengymnastinnen (mit je 10 und 12 Stunden pro Woche).
Das KTH ist täglich von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Es ergibt sich daraus folgender zeitlicher Arbeitsrahmen:
Ganztagsgruppen: von 08:00 - 14:30 Uhr
Teilzeitgruppen: von 08:00 - 13:00 Uhr
Halbtagsgruppen: von 08:00 - 12:00 Uhr
Frühdienst: von 07:00 - 8:00 Uhr
Spätdienst: von 14:30 - 17:00 Uhr
Zur Zeit besuchen 88 Kinder das KTH; 10 Kinder, die schon die Schule besuchen, kommen täglich zum Mittagessen dazu.
Ausgehend von den 88 Kindern beträgt der Ausländeranteil 20%, als sozial benachteiligt können 30% der Kinder gelten, 18% der Eltern der Kinder sind Alleinerziehende.
Der prozentuale Anteil der nach dem Gesetz als behindert geltenden Kinder beträgt 15% der Gesamtpopulation.
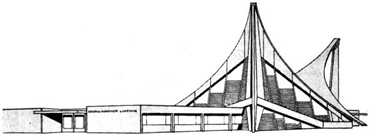
Zusammengefasst in einer 20-seitigen Broschüre mit Datum vom 24. Februar 1981 sind das Statut und das Konzept der Arbeit im Kindertagesheim dargelegt, das die Leitlinie für die Arbeit im KTH zu der Zeit kennzeichnete, zu der wir in Sachen integrativer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder erste Kontakte mit dem KTH knüpften.
In der Präambel wird festgestellt, dass „das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde der Bremischen Evangelischen Kirche eine soziale Einrichtung in Huchting für die Bevölkerung“ ist.
Gremien, die alle gleichberechtigt im Rahmen des Statuts an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, sind Gruppenelternabend, Gesamtelternabend, Elternrat, Kollegium und der Drittelparitätische Ausschuss, der mit Fragen des Haushaltsplanes des KTH, der Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern, für Klärung und Vermittlung in Konfliktfällen und für die Vorbereitung gemeinsamer Aktivitäten mit Elternrat, Kollegium und Gemeindevertretung bzw. Eltern, KTH und Gemeinde zuständig ist.
Was die inhaltliche Arbeit betrifft, nennt die Konzeption als Erziehungsziele im Kindergarten „Selbständigkeit und Selbstbewusstsein“, „Kritikfähigkeit“, die „Fähigkeit zu solidarischem und sozialen Handeln“ und die „Fähigkeit, sich mit Problemen, die durch Gesellschaft und Umwelt entstehen, konstruktiv auseinanderzusetzen“.
- 48 -
Selbständigkeit und Selbstbewusstsein der Kinder wird als Voraussetzung für jede konstruktive Handlungsweise, für Gespräch und Auseinandersetzung angesehen. In diesen Fähigkeiten wird die Voraussetzung gesehen, die anderen Ziele im Rahmen der Kindergartenarbeit mit den Kindern zu erreichen. Die Befähigung zur Kritikfähigkeit soll auf der Basis des Prinzips der Kritik und Selbstkritik als weitere Grundlage der Erziehungsarbeit in der Auseinandersetzung zwischen Eltern, Kindern und Erziehern aufgebaut werden. Die Fähigkeit zu solidarischem und sozialen Handeln soll dadurch erreicht werden, dass Erwachsene und Kinder lernen, dass die Differenzen, die sie haben, nicht an Personen und Äußerlichkeiten festzumachen sind, sondern jeweils an der richtigen oder falschen Meinung; egal, ob diese Meinung von einem Erwachsenen oder einem Kind vertreten wird, wobei die demokratische Abstimmung und die Anerkennung von demokratisch zustande gekommenen Mehrheiten eine Grundlage dieser Vorgehensweise sind. Dabei sollen die Kinder erfahren, dass im gemeinsamen Handeln und in der Unterstützung anderer häufig die einzige Möglichkeit liegt, Veränderungen herbeizuführen. Die Entwicklung der Fähigkeit sich mit Problemen, die durch Gesellschaft und Umwelt entstehen, konstruktiv auseinanderzusetzen, hat unter anderem zum Ziel, den Kindern die Situation und die Bedingungen, unter denen die Eltern arbeiten, begreiflich zu machen, so dass den Kindern Verständnis für ihre Eltern möglich ist, wie diese Rücksicht auf die Kinder nehmen sollten. Aus dem Begreifen der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Eltern soll den Kindern auch verdeutlicht werden, weshalb es im Elternhaus notwendigerweise andere Einschränkungen gibt als im Kindergarten. Durch Umweltprojekte soll den Kindern Hilfen gegeben werden, die durch die technische Umwelt an die Kinder gestellten Anforderungen besser bewältigen und Gefahren erkennen zu können und eine Ermutigung darin erfolgen, dass sie unverständliche Dinge nicht einfach hinnehmen, sondern sie anzupacken und zu untersuchen wagen. Ferner sollen die Kinder von klein an daran gewöhnt werden, Probleme zu sehen und auch zu lösen, damit sie diesen später nicht hilflos gegenüberstehen.
Erreicht werden sollten diese Ziele in verschiedenen Lernbereichen des Kindergartens. Mit den Lernbereichen wollten die Pädagogen im KTH „keinen vorverlegten Grundschulunterricht, kein isoliertes Training von Kenntnissen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen im Kindergarten“ vorwegnehmen. Die Lernbereiche sollen mit dem praktischen Leben und Erleben der Kinder verbunden sein und in der Bewältigung der konkreten Erfahrungen berücksichtigt werden. Als Lernbereiche wurden angesehen Gesundheit, Erscheinungen der Natur und Technik und Möglichkeiten, Erlebtes bei Tätigkeiten wie Kneten, Malen, Basteln und Werken im Spiel zu verarbeiten, die den Kindern zu garantieren sind. Die Kinder sollen Freude am praktischen Tätigsein, d.h. an der Arbeit finden, und dabei sollen sie ihre praktischen und geistigen Fähigkeiten entwickeln. Dadurch, dass im Kindergarten Tiere gehalten und gepflegt, Gemüse und Blumen angepflanzt werden, soll der Kindergartenalltag erlebnisreicher gemacht, sollen die Kinder mit der Arbeit der Erwachsenen bekannt werden. Da die Menschen bei jeder Arbeit in bestimmten Beziehungen zueinander stehen, was für die Kinder ebenso gilt,wie für die Erwachsenen, ist das hauptsächliche Verständigungsmittel zwischen den Menschen die Sprache. Wichtig dabei sind aber nicht nur die Sprache im Sinne von Wörtern und Sätzen, sondern auch der Tonfall, der Gesichtsausdruck und die Bewegung beim Sprechen. Die Entwicklung dieser Kommunikationsfähigkeit, die mit einem Sprachtraining allein nicht zu erfüllen ist, muss im direkten Zusammenhang mit den Erlebnissen und Eindrücken der Kinder gefördert werden (28).
Diese hier ausschnittweise referierten Aspekte der Konzeption des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde verdeutlicht, auf welche Anforderungen der pädagogischen Arbeit, die die Mitarbeiter des Kindertagesheimes an sich stellten, wir mit unserem Ansinnen, mit diesem Kindertagesheim, das damals in gleicher Weise mit einem weiteren Kindergarten in Huchting, dem der Sankt-Georgs-Gemeinde, in der Diskussion war, trafen.
Von den grundlegenden Voraussetzungen her gesehen war sowohl die Gemeinde wie das Kindertagesheim und die entsprechenden Gremien der Idee, kein Kind mehr vom Besuch des KTHs aus Gründen einer Behinderung ausschließen zu müssen, nicht
- 49 -
fern, zumal sich das KTH als eine soziale Einrichtung in Huchting für die Bevölkerung verstand.
Auf diesem Hintergrund waren einige Übereinstimmungen in dieser Frage von vornherein im Grundsätzlichen gegeben. Schwierigkeiten ergaben sich dann, als mit dem Einstieg in die Vorbereitung der integrativen Arbeit und vor allem, als diese begonnen war, die Frage nicht nur auf das gerichtet wurde, was mit der pädagogischen Arbeit im KTH angestrebt und realisiert werden soll, sondern wie, was angestrebt ist, realisiert werden kann und ob es realisiert wurde. Die Konflikte, die dabei aufbrachen, hatten einerseits ihre Wurzeln in der Entwicklungsgeschichte des KTHs und andererseits in einer Orientierung der Mitarbeiter, wie sie folgender Satz aus dem Punkt 4 der Konzeption, die sich mit den Lernbereichen im Kindergarten beschäftigt, beschreibt: „Wenn wir von Lernbereichen im Kindergarten sprechen, heisst das nicht, dass wir über einen ausgearbeiteten Plan mit konkreten Zielen, Inhalten und Methoden verfügen“ (S. 11).
Unter diesem Aspekt war, wie sich in der beginnenden gemeinsamen theoretischen Vorarbeit und im ersten Jahr der gemeinsamen Praxis herausstellte (wie dies auch im Rahmen der Dokumentation des Vorhabens im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung belegt werden konnte), eine gewisse Kluft zwischen den gesetzten Zielen und den Vorstellungen, wie diese im Erziehungsalltag erreicht werden könnten. Wie sich erwies, zeigten sich deutlich zwei Tendenzen in der Erziehungspraxis: Zum einen gingen diese in Richtung eines sich mehr als „laissez-faire“ verstehenden situativen Ansatzes und zum anderen mehr in die entgegengesetzte Richtung eines autoritären, ja auch strafenden Erziehungsstils. Dabei war festzustellen, dass sich letztere Tendenz fast zwangsläufig aus der ersteren ergab. Dadurch, dass die Kräfte der Kinder zur Selbstorganisation durch ein zu wenig strukturiertes Angebot überfordert waren, chaotisierte sich die Gruppe leicht. Die Kinder verfielen in wenig konstruktive bis apathische bzw. aggressive Verhaltensweisen, so dass die Pädagogen mit strengeren Maßnahmen versuchen mussten, den so herbeigeführten Zustand wieder in einer gewissen Weise zu normalisieren, wobei auch die Auffassungen darüber, was ein hinreichender Grad der Strukturierung einer Situation sei, sehr weit auseinander liefen. Dadurch mussten die Kinder die Erzieher zwangsläufig auch ambivalent bis widersprüchlich erfahren, was als eine weitere Komponente problematischer Erziehungssituationen angesehen werden muss.
Diese Hinweise skizzieren grob die Zusammenhänge, aus denen in der gemeinsamen Arbeit dann jene Konflikte entstanden, die eine Neuorientierung erschwerten und bei einigen Erzieherinnen zu dem Gefühl führten, im Rückblick auf die vergangenen Berufsjahre durch die pädagogische Neuorientierung nicht mehr arbeitsfähig zu sein, was es erschwerte zu sehen, dass es mit der integrativen Erziehung darum ging, neue Möglichkeiten und Formen der Kindergartenarbeit herauszubilden, und es mit dem neu erworbenen Wissen und den neu gewonnenen praktischen Fähigkeiten nicht darum ging, die Arbeit, wie sie früher war, abzuqualifizieren, sondern weiterführende Arbeits- und Verkehrsformen im Kindergarten (und dies noch in Anbetracht des sich durch Stützpädagoge, Therapeuten und Zivildienstleistenden erweiternden Personals) zu entwickeln.
So war, zurückschauend gewichtet, das Vorhaben in manchen Phasen seiner Entwicklung auch gefährdet, zumal sich die notwendig entstehenden Verunsicherungen bei einzelnen Erzieherinnen auch auf die Elternschaft übertrug. Notwendig ergaben sich solche Krisen für die einzelne Erzieherin dadurch, dass eine neue Identität und ein neues Selbstverständnis in der eigenen Arbeit nur dadurch herausgebildet werden konnte, dass das alte Selbstverständnis hinterfragt wurde, was subjektiv verunsicherte, da die neue Identität noch nicht voll gewonnen war.
Berücksichtigen wir die institutionellen Zusammenhänge, in deren Abhängigkeit sich einerseits das Selbstbild der Mitarbeiter als Pädagogen entwickelt hat, und setzen wir die eigene Biographie dazu in Beziehung, insbesondere die Erfahrungen, die daraus resultieren, selbst einmal erzogen worden zu sein und nun selbst erziehen zu müssen, und verknüpfen wir das andererseits mit dem An-
- 50 -
spruch, den eine „kindzentrierte basale allgemeine integrative Pädagogik“[46] an die ErzieherInnen stellt, so wird deutlich, dass die Einführung integrativer Arbeit in eine gewachsene Regelinstitution hinein nie ohne Konflikte wird verlaufen können. Unsere Erfahrungen und unsere gemeinsame Praxis hat aber auch gezeigt, dass diese Konflikte konstruktiv gelöst und das neue Selbstverständnis und die neue Identität gewonnen werden können, ohne dass dieses als Verlust erlebt wird, ja dass es als neue Chance und Möglichkeit nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erzieher und die Eltern erfahren werden kann.
Dies kann nachfolgend in dem Bericht der Leiterin des KTHs, Frau Christine Brüß, verdeutlicht werden, der die gesamte Zeitspanne des Vorhabens bis heute umfasst und mit dem sie nachfolgend selbst zu Wort kommen soll:
„Die pädagogische Arbeit unseres KTHs, das 1970 in Betrieb genommen wurde, war durch die Kinderladenbewegung in Berlin stark antiautoritär geprägt. Der damalige Gemeindepastor legte alles Gewicht der Gemeinde auf die Kindergartenarbeit. So setzte sich die Elternschaft vorwiegend aus sogenannten Bildungsbürgern zusammen. Aus allen Stadtteilen Bremens wurden die Kinder herangefahren. Von regionaler Versorgung konnte nicht gesprochen werden.
So wurden maximal 60 Kinder in 4 Gruppen betreut. Die Bevölkerung in Huchting lehnte die pädagogische Arbeit ab. Nach einigem Personal-, Kinder- und Materialverschleiß änderten wir unsere pädagogische Arbeit. Geblieben aus der Zeit sind unsere Tiere, die aktive Mitarbeit der Eltern und das morgens gemeinsam mit den Kindern eingenommene Frühstück.
Um diese Aktivitäten finanzieren zu können, gründeten wir einen Verein zur Förderung unserer pädagogischen Arbeit. In diesem Verein zahlen die Eltern freiwillige Spenden. Die Spenden sind zweckgebunden und dienen nur der Arbeit im Kindertagesheim. Eltern können, aber müssen nicht Mitglied dieses Vereins werden.
Anfang der siebziger Jahre wurde das erste Statutenkonzept schriftlich erarbeitet. 1979 wurde dieses überarbeitet und Bestandteil der Gemeindeordnung und eingebunden in die Gemeinde. Durch die integrative Arbeit und die veränderte Arbeitsweise durch neue Erkenntnisse steht eine neue Fassung des Konzeptes an.
Die Elternarbeit ist im Statut geregelt. Im KTH haben wir keinen Elternbeirat, sondern einen Elternrat. Die Eltern haben nicht nur beratende Funktion, sondern entscheiden in allen Belangen des KTHs mit.
Ein weiteres und entscheidendes Gremium innerhalb des KTHs gegenüber der Gemeindevertretung ist der Drittelparitätische Ausschuss. Dieser Ausschuss setzt sich aus 6 Gemeindevertretern, 6 Mitarbeitern und 6 Elternvertretern zusammen. Der Drittelparitätische Ausschuss entscheidet auf höchster Ebene alle Belange, wie Einstellungen, Haushalt, Konzeption des KTHs. Die Gemeindevertretung ist angehalten, dem Votum zu entsprechen. Sie ist das höchste Entscheidungsgremium der Gesamtgemeinde. Bisher konnten wir nur positive Erfahrungen auf diesen Ebenen und in diesen Gremien sammeln.
Weiterhin gibt es den Gruppenelternabend und den Gesamtelternabend sowie weitere Aktivitäten wie Klönabende bei den Eltern zu Hause, Bastel-, Sing- und Spielnachmittage, Ausflüge, Freizeiten und Spielplatzbau. Renovierungsarbeiten werden zum Teil in Elternarbeit erstellt. Dies ist auch ein Teil der aktiven Elternarbeit. Aktive Elternarbeit heißt auch weitestgehend Informationen an die Eltern weiterzugeben. Ein Elternrat kann nur dann Entscheidungen treffen, wenn er umfangreich informiert ist, aber dies bedeutet Mehrarbeit.
Die 8 Stunden, die uns im Monat für Elternarbeit – und dies nur auf dem Weg der Überstunden – zustehen, reichen bei weitem nicht aus, da auch noch die Hausbesuche – jedes Kind wird vor der Aufnahme zu Hause besucht – und Einzelgespräche je nach Bedarf hinzukommen. Doch scheint uns die Elternarbeit ebenso wichtig wie die pädagogische Arbeit am Kind.
- 51 -
Seit 1980 betreuen wir 95 Kinder in 5 Gruppen. Davon sind 4 Gruppen altersgemischt (ganztags) und eine Gruppe mit überwiegend 3-jährigen Kindern (Teilzeit). Diese Gruppe liegt nicht im eigentlichen KTH-Gebäude, sondern ist in der ehemaligen Küsterwohnung untergebracht. Durch die Ausgliederung ist sie immer etwas abseits, woraus sich Probleme ergeben.
Noch immer haben wir eine Warteliste und können bei den vorliegenden Anmeldungen nicht alle Kinder berücksichtigen. Unser Stadtteil ist, was Kindergartenplätze betrifft, unterversorgt.
Im Kindergartenjahr 1981/2 nahmen wir die ersten nach dem Gesetz behinderten Kinder auf. Zu diesem Zeitpunkt war dies durch den Gesetzgeber noch nicht rechtlich gesichert. Doch die Frühen Hilfen und auch die Eltern wollten ihre Kinder nicht in einer Sondereinrichtung unterbringen. Die anderen KTHs in Huchting nahmen diese Kinder auch nicht auf, da es zum Teil noch Windelkinder waren und 3-jährige Kinder in Regeleinrichtungen ohnehin nicht gerne gesehen sind.
Eine Versorgung behinderter Kinder im Raum Huchting gab und gibt es außer bei den Freien Trägern nicht. Kommen Kinder in eine Sondereinrichtung, müssen sie lange Busfahrten in Kauf nehmen. Im gleichen Zeitraum wurde auch an uns die Frage gestellt, ob wir integrative Arbeit im Kindertagesheim zum Bestandteil unserer Arbeit machen wollten. Die Mitarbeiter sagten alle spontan zu. So nahm die ganze Arbeit ihren Anfang. In den einzelnen Gremien wurde das Vorhaben dargestellt. Über den Elternrat kam es in die Gruppenelternabende, von den Gruppenelternabenden in den Drittelparitätischen Ausschuss und vom Drittelparitätischen Ausschuss in die Gemeindevertretung. In allen Gremien wurde positiv entschieden und das Vorhaben einstimmig angenommen. Es gab auch einige Bedenken, die durch die Bereitschaft aller aber immer aus dem Weg geräumt werden konnten. Der erste Gesamtelternabend mit dem Thema „Integration = behinderte und nichtbehinderte Kinder spielen und lernen gemeinsam im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde“ fand noch vor den Sommerferien statt.
Nach der spontanen Entscheidung der Mitarbeiter, Integration zu leisten, ergaben sich in der praktischen Arbeit durch veränderte Arbeitsweisen Konflikte und Spannungen. Alle Mitarbeiter nahmen ½ Jahr vor Aufnahme der Kinder an den angebotenen Fortbildungsveranstaltungen teil. Schon nach dem ersten Seminar wurde deutlich, dass unsere bisherige pädagogische Arbeit nicht ausreichte. Wir, die wir meinten, bisher recht gute Kindergartenarbeit geleistet zu haben, mussten schmerzlich begreifen, dass unsere pädagogische Ansprache an das Kind den Anforderungen, die mit dem Lernen der Kinder verbunden sind, nur unzureichend nachkam. Vieles wurde im guten Glauben praktiziert, ohne zu fragen warum. Unsere Ausbildung reichte nicht aus. Man hatte uns nur unzureichend für die pädagogische Arbeit mit den Kindern ausgebildet. Das, was wir lernten, lernten wir nicht nur für die behinderten Kinder, sondern lernten es grundsätzlich. Lerntheoretische und entwicklungspsychologische Grundlagen wurden uns zum ersten Mal vermittelt sie bilden den Grundstock für unsere heutige Arbeit.
So gab es viele Veränderungen im Haus. Diese Veränderungen waren nicht nur an das Haus gebunden, sondern sie betrafen uns ganz persönlich. Unsere Einstellung, Werte und Normen wurden stark in Frage gestellt, auch sie haben heute einen anderen Stellenwert. Die pädagogische Ansprache an das Kind hat sich verändert. Alles zusammen führte zu starken Spannungen unter den Mitarbeitern. Immer wenn eine neue Anforderung an uns gestellt wurde, brachen Konflikte aus. Nach der Sommerpause, als die Theorie durch die Praxis Bestand hatte, war jede Neuerung auch ein neuer Auslöser für Spannungen, und davon gab es viele. So kamen wir in der Arbeit nur langsam voran, da wir immer wieder in Grundlagendiskussionen einsteigen mussten. Jeder versuchte an dem alten festzuhalten, das Letzte, das Beste für sich zu retten. Erst durch die praktische Einbeziehung der Gruppenleiter durch die Hospitation in der ersten Integrationsgruppe und durch die praktische Arbeit und Anleitung
- 52 -
durch die Stützpädagogin in der eigenen Gruppe wurden die Veränderungen und die neue Arbeitsweise verstanden und positiv umgesetzt.
Nach der Sommerpause 1983 war die Umsetzung der behinderten Kinder in alle 4 Gruppen abgeschlossen. Die Gruppenleiterinnen wurden noch durch Stützpädagogen eingearbeitet. Die Lernbereitschaft und die Motivation sind unter den Mitarbeitern jetzt sehr gross. Der Arbeitsstil und die Vermittlung von Kenntnissen laufen problemloser. Die Arbeit hat sich gelohnt. Auch wenn kein behindertes Kind in der Einrichtung wäre, scheint uns die veränderte pädagogische Arbeitsweise notwendig. Hierzu sollten sich auch die Ausbildungsstätten Gedanken machen. Die sogenannten Außenseiter, die Störer gibt es bei uns nicht mehr. Kinder wurden aus Unfähigkeit des Erziehers, auf die Situation adäquat zu reagieren, aus dem Gruppenprozess ausgeschlossen. Wir haben erkannt, dass es unser Problem war, ein Problem der Erzieher, nicht der Kinder.
Nach all den Schwierigkeiten, die es uns gemacht hat, ist heute eine Atmosphäre der Ruhe, der Freude, der Gemeinsamkeit im Gruppenalltag zu spüren.
Für mich und für die Gruppenleiter bedeutet diese Arbeit Mehrarbeit. Viele Dinge müssen noch erarbeitet werden und brauchen länger Zeit. Vieles hat sich noch nicht eingespielt, bedarf vieler Gespräche. Immer neue Formen der Zusammenarbeit müssen gefunden werden. Der gute Ablauf am Ende des letzten Kindergartenjahres in den Gruppen, musste durch die neuen personellen Bedingungen – Praktikanten schieden aus – neu erarbeitet werden. Dies braucht Zeit. Unsere wöchentliche Mitarbeiterbesprechung von 2 Stunden reicht dazu bei weitem nicht aus.
Um die Praktikanten besser zu qualifizieren, haben wir 14-tägig eine Praktikantenbesprechung eingeführt. Zusätzlich findet im 14-tägigen Rhythmus die Gruppenleiterbesprechung statt. Regelmässig montags nehme ich an der Gemeindebesprechung teil, um über den Stand unserer Arbeit zu berichten.
Auch erste Kontakte zu den Schulen haben stattgefunden. Mit dem Diakonischen Werk arbeite ich eng zusammen. Alle Erfahrungen, Probleme und sonstiges werden ausgetauscht. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit der Universität und den Institutionen wie Hauptgesundheitsamt, Frühe Hilfen, Kinderzentrum, Ärzte usw. Diese Arbeit erfordert von allen viel Offenheit und Kooperationsbereitschaft.“
gez.: Chr. Brüß
Die skizzierten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten und die Entwicklung der Arbeit, wie sie dann mit dem Kindergartenjahr 1982/83 begann, gingen Hand in Hand mit einer engen Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die insbesondere durch Gemeindeelternvertreter und Herrn Pastor Kruse repräsentiert war.
Es ist deutlich geworden, dass das Vorhaben von Anfang an darauf hin ausgerichtet war, dass sich die im Kindertagesheim anzubahnende integrative Arbeit ausserhalb der Institution Kindergarten zu bewähren habe. Von daher war es selbstverständlich, dass jene Vertreter der Gemeinde, die in diesem Stadtteil bekannt waren, die Stadtteilinterna hinreichend kannten, viele Beziehungen zu anderen Einrichtungen der Kommune und zu dem regionalen öffentlichen Leben hatten, nicht nur in dem Sinne ein wichtiger Faktor für den Einstieg und die Weiterentwicklung der Arbeit waren, dass sie Informationen nach aussen tragen und Integration zum Gegenstand in der Kommune machen konnten, sondern vor allen Dingen auch insofern, dass ihre Meinungen und Auffassungen zu dieser Frage von Anfang an in die Planungsvorhaben und in jeder einzelnen Phase in die Entwicklung des Vorhabens mit einflossen.
Es war auch erklärtes Ziel des Pastors der Gemeinde wie der Gemeindegremien und der auch dort aktiven Elternschaft, von vornherein mit zu bedenken, dass Integration ein Anliegen der Region werden müsse, damit die gemeinsame Erziehung
- 53 -
der Kinder nach Möglichkeit nicht auf den Bereich des Kindergartens beschränkt bleiben würde. So gingen dann auch die ersten Kontakte und die Informationen, die in das regionale Umfeld drangen, wesentlich durch das Engagement und die intensive Mitarbeit des Pastors vonstatten. Von der Sache her von Anfang an überzeugt, dass ein Ausschluss von Kindern aus einer Einrichtung in der Gemeinde, weil sie behindert seien, nicht vertretbar sei, davon überzeugt, dass sie aber auch um eines Alibis willen nicht in der Gemeinde bleiben, sondern adäquat mit den für ihre Entwicklung erforderlichen Hilfen versorgt sein müssen, war er als Wissender wie in gleicher Weise als Lernender an der Einführung und Entwicklung des Vorhabens beteiligt.
Wie sich diese Prozesse aus der Sicht des Gemeindepastors, Herrn Kruse, darstellen, sei nachfolgend von ihm selbst beschrieben:
„Integration im Kindertagesheim einer Gemeinde? ja, selbstverständlich! Es erscheint ja auch auf den ersten Blick geradezu zwingend, dass sich eine evangelische Kirchengemeinde mit der integrierten Erziehung von Behinderten und Nichtbehinderten beschäftigt. Denn schließlich ist sie es doch, die sich durch die Jahrhunderte hindurch um die Schwachen kümmerte. Und die Nächstenliebe ohne Unterschiede ist ja schließlich auch eine Forderung des Neuen Testamentes. Auf den zweiten Blick jedoch ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, denn integrierte Erziehung erfordert sehr viel Fachwissen, Zielkennzeichnung und Umlernen. Wer aber in der Gefahr ist, seine Aufgaben auf dem Mitleid mit anderen aufzubauen, und das sind Gemeinden in ihrem guten Willen zwar manchmal, der sollte sich sehr wohl fragen, ob er diese integrierte Erziehung annehmen will. Denn ein Annehmen ist es in jeder Beziehung. Annehmen von neuen Theorien, die gar nicht im Raume der Kirche gedacht wurden, annehmen von anderen Erziehungsformen und -stilen, die nicht ohne weiteres in kirchlichen Einrichtungen zuhause sind, und es ist ein Annehmen von Menschen mit dem Wissen, sie nicht nur zu trösten, sondern pädagogisch weiterzubringen. Und da beginnt die Herausforderung. Denn die Kirchengemeinde, die sich auf die Herausforderungen der Pädagogik einlässt und sie sogar als Korrektiv der eigenen Handlungsweise anerkennt, ist sehr leicht in der Gefahr in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, nämlich die, christliches Gedankengut preiszugeben. Dass dem nicht so ist, wer will das dann noch wissen?
Aber zurück zur integrierten Erziehung im Gemeindekindertagesheim. Hier leitete uns nicht der Grundsatz für „arme behinderte Menschen“ in unserer Gesellschaft etwas zu tun, nein, wir waren der Meinung, behinderte Menschen leben in unserer Gemeinde, gehören zu uns, immer! Und wir beobachteten, dass die behinderten Kinder aus unserer Mitte weggeholt wurden, in entfernt liegende Einrichtungen gebracht wurden und somit völlig aus unserer Mitte herausgerissen wurden. Und mehr noch, wir waren der Meinung, der behinderte Mensch gehört zu unserer Gesellschaft und darf, aus welchen Gründen auch immer, nicht aus ihr ausgegliedert werden. Unsere Gesellschaft lebt nämlich mehr und mehr nach dem Lustprinzip, Trumpf ist nur was mir Spass macht, und da gerät der Behinderte unausweichlich an den Rand, denn er stört. Und da sich die Gesellschaft auf dieser Grundlage mehr und mehr nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, werden ganze Menschheitsgruppen aus ihr auch gedanklich ausgesondert, nicht nur Behinderte auch andere Randgruppen. Alles Unangenehme wird ausgeklammert, einer Fürsorge, die man sich zwar etwas kosten lässt, anvertraut, und deshalb wird nicht integriert, sondern verneint, denn Aussonderung ist im tiefsten Sinne Verneinung. Und deshalb, da das nicht sein darf, dass irgendjemand aus der grossen Gesellschaft der Geschöpfe Gottes verneint wird, hat eine Kirchengemeinde nicht nur die Möglichkeit, nein den Auftrag zu integrieren, in ihre Mitte zu holen. Es gibt keine Störfaktoren unter den Menschen, es gibt nur gleich geliebte Menschen. Und wenn das an einer Stelle nicht mehr geschieht, ist die Gemeinde in ihrem Wächteramt aufgerufen darauf hinzuweisen. Es ist nämlich so, dass bei einer Ausgliederung sich die ganze Gesellschaft entstellt, denn Behinderte und Nichtbehinderte zusammen sind ein Bild der Geschöpfe Gottes.
- 54 -
Als uns das klar geworden war, haben wir ohne zu zögern, unser Kindertagesheim dieser integrierten Erziehung geöffnet. Und wir sind froh darüber, denn wir erfahren ganz neue Aufgaben und ganz neue Ziele in unserer Arbeit. Wir dürfen unsere Öffentlichkeit dafür einsetzen, dass in unserem Stadtteil dieser Weg auch weiterführt, nämlich in die Schule hinein. Das Vertrauen das man uns entgegenbringt in dieser Öffentlichkeit kann Türen öffnen, Menschen bewegen, sich damit zu beschäftigen vielleicht sogar das Unmögliche der Zukunft zu denken, Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam in der Schule zu sehen. Und dabei geht es uns darum, Aussonderung zu verhindern, denn Behinderte darf man nicht einteilen; der körperlich behinderte Mensch ist dem geistig behinderten Menschen nicht voranzustellen.
Grundsätzlich gehen wir bei unserem Menschenbild in der Gemeinde davon aus, dass es nur eine Gemeinschaft der Schöpfung gibt in der es gilt, dass der Schwache in Liebe vom Stärkeren gefördert wird. Aber wir erleben, dass diese Stärkung nicht auf den Schwächeren beschränkt ist, es geht davon eine Wechselwirkung aus. Menschen die in dieser integrierten Gemeinschaft gross werden, erfahren eine gegenseitige Bereicherung, die nicht mit der Elle der Leistung gemessen werden sollte, sondern mit den Augen des Herzens und die sehen bekanntlich mehr als Können, die sehen den liebevollen Menschen.
So stehen wir in dieser Arbeit, ständig im Umlernen begriffen, fehlerhaft, aber leider auch ständig damit beschäftigt, unseren gewonnenen Standpunkt in unserer Gesellschaft zu verteidigen. Wir freuen uns aber auf die ersten Jahrgänge dieser Kinder, die nun in unsere Jugendgruppen kommen, die zur Konfirmation kommen, denn wir erwarten uns eine Bereicherung davon für unser Gemeindeleben. Wenigstens haben wir heute schon soviel gelernt, dass wir zur integrierten Erziehung nur sagen können: Das ist für eine lebendige Gemeinde doch selbstverständlich!“
gez.: W. T. Kruse
Es ist nicht möglich, im Rahmen eines solchen Berichtes die vielfältig Zusammenwirkenden Faktoren, die es ermöglichten, in der Vorbereitungsphase das gemeinsame Vorhaben bis zum Sommer 1982 soweit voranzutreiben, dass wir mit der integrativen Erziehungsarbeit beginnen konnten, hier im einzelnen darzustellen. Ebenso wenig kann es gelingen die Besprechungen, Gespräche, Diskussionen, Planungstreffen und die Fort- und Weiterbildungsvorhaben im einzelnen zu beschreiben, die mit der Vorbereitungsphase anliefen und bis heute einen recht grossen Umfang angenommen haben, da es zum einen darum geht, in weiteren Kindergärten die integrative Erziehungsarbeit vorzubereiten und zum anderen sie in die Schule hinein fortzusetzen.
Deshalb soll nachfolgend ein Abriss der Entwicklung gegeben werden:
Herbst 1981: Koordiniert durch das Diakonische Werk Bremen e.V. erfolgten erste Gespräche mit der Kirchengemeinde, dem Kindertagesheim, der Elternschaft, der Landeskirche; der Gesundheits- und Sozialbehörde, den Ein-
- 55 -
richtungen für Behinderte, dem Kinderzentrum und den ‚Frühen Hilfen‘ (Frühförderung).
Es wurde von Seiten aller Beteiligten das Einverständnis erzielt, den Weg integrativer Förderung der Kinder in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde zu beginnen, ohne dass dort ein Modellversuch eingerichtet wird, der später in der Gefahr stünde, wegen seiner besonderen Bedingungen nicht in die Regelsituation überführt werden zu können.
1. Halbjahr 1982:
Beginn einer intensiven Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Kindertagesheimes unter Beteiligung von Vertretern der Kirchengemeinde und der Eltern, die in ihren Grundzügen auf der entscheidenden Sitzung vom 7. Januar 1982 festgelegt wurde, mit der das Kindertagesheim und im Nachgang dazu die Gemeinde ihre Zustimmung zum Integrationsvorhaben erteilten.
Zentraler Gegenstand der Fort und Weiterbildung war die Befassung mit humanbiologischen und neuropsychologischen Grundlagen menschlicher Entwicklung und die daraus resultierenden entwicklungs- und lernpsychologischen Konsequenzen für das Kindesalter. Auf diesem Hintergrund wurde auch ein umfassendes, nicht am Defekt und der Devianz bzw. an der Behinderung orientiertes Verständnis darüber entwickelt, was Behinderung sei und wie ein behindertes Kind verstanden werden kann.[47]
Die Organisation und Durchführung der Fortbildungen ist mit der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens identisch und deren zentralste Aufgabe neben einer fortlaufenden Dokumentation der Entwicklung der pädagogischen Arbeit im Kindergarten, die erstmals auch im ersten Halbjahr 1982 erfolgte, um die pädagogische Arbeit im Kindergarten vor Aufnahme der ersten behinderten Kinder erfassen zu können. Ein weiteres Aufgabenfeld der wissenschaftlichen Begleitung war damit durch Anregung und Supervision der pädagogischen Praxis im Rahmen der Fort- und Weiterbildungsvorhaben wie später, nach Beginn des Vorhabens, in Koordination mit der Stützpädagogin im Zusammenhang mit der konkreten täglichen Kindergartenarbeit selbst.
Im Rahmen der Fortbildung erfolgte eine erste Einführung in die Problematik vom 22. bis 24.01.1982 und ein zweites zentrales Seminar, das den erreichten Stand zusammenfassen und die weiteren Fortbildungsvorhaben inhaltlich klären sollte, am 14. und 15. April 1982. Dazwischen fand ein Vorbereitungsseminar für eine Studienfahrt nach Dänemark vom 3. bis 5. Februar und die Studienfahrt selbst vom 28. März bis zum 2. April 1982 statt (29).
Laut Beschluss der Mitarbeiterbesprechungen vom 7. Januar 1982 erfolgte zusätzlich im 14-tägigem Rhythmus eine Dienstbesprechung für alle Mitarbeiter des Kindertagesheimes, die ebenfalls Fragen der Vorbereitung der integrativen Arbeit zum Gegenstand und damit zentral fort- und weiterbildenden Charakter hatte. Ferner konnten je nach Bedarf und inhaltlichen Erfordernissen zwischendurch 1 bis 1½-tägige Fortbildungsphasen eingeschoben werden, die in der Regel an Wochenenden stattfanden.
Da von Anfang an zwei Kindergärten um die Aufnahme behinderter Kinder bemüht waren, wurde zu Beginn des Jahres ebenfalls eine Übereinkunft getroffen, dass ein Vertreter des Kindergartens St. Georg an allen Fort- und Weiterbildungsterminen, an allen Dienstbesprechungen und Beratungsgesprächen teilnehmen konnte, da wir uns entscheiden mussten, erst einmal mit einem Kindertagesheim zu beginnen, da die damit anfallende Arbeit von uns nicht gleichzeitig in zwei Kindergärten bewältigbar erschien. So konnte die Vorbereitung der Mitarbeiter und insbesondere der Gruppenleiterin, die die ersten behinderten Kinder in St. Georg in ihre Gruppe aufnehmen sollte, parallel zu den Bemühungen in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Dieses Verfahren erwies sich als besonders fruchtbar, weil auch Probleme und Konflikte, die im Rahmen der ersten 1½ Jahre zu bewältigen waren, exemplarisch so zum Teil auch für die nachfolgende Kindertagesstätte in gewisser Weise vorgreifend und vorwegnehmend bewältigt werden konnten, so dass sich die Öffnung des zweiten
- 56 -
Kindergartens zum Kindergartenjahresbeginn 1983/84 weit einfacher gestalten konnte, als dies ein Jahr zuvor im ersten Kindergarten der Fall war.
Daraus erwächst nicht nur die Empfehlung, das Personal einer Einrichtung, die sich für die integrative Erziehung öffnen möchte, bereits ein Jahr zuvor an der integrativen Arbeit einer bereits laufenden Einrichtung zu beteiligen, sondern auch der Hinweis, dass eine Ausweitung integrativer Praxis in diesem Sinne (Schneeballsystem) vorangetrieben werden kann. Will man die hier formulierte und als Basis unserer Bemühungen akzeptierte Auffassung von Integration in der pädagogischen Praxis realisieren, bedarf ein Regelkindergarten, der sich öffnen möchte, aller Arbeitskraft, um dieses auch in Anbetracht dessen leisten zu können, dass die Mitarbeiter einer Regeleinrichtung, von einigen abgesehen, erst einmal grundlegend mit Fragen menschlicher Entwicklung und der Problematik von Behinderung und mit Lernen, ohne Ausschluss zu praktizieren, befasst werden müssen.
Parallel zu dem Planungs-, Fort- und Weiterbildungsvorhaben wurden erste Kontakte zu den im Einzugsbereich des Kindergartens wohnenden behinderten Kindern und deren Eltern aufgenommen. Durch Zusammenarbeit mit den Gesundheits-, Sozial- und Jugendbehörden wie mit der Einrichtung der Frühen Hilfen und dem Kinderzentrum, aber auch von den Eltern des Kindergartens direkt oder von den betroffenen Eltern selbst waren uns die Kinder bekannt geworden. Waren Kinder bereits in Sondereinrichtungen, so wurden sie über die Hausbesuche hinaus auch in der Einrichtung besucht, in der sie sich befanden, bzw. Kontakte mit den Stellen geknüpft, bei denen die Kinder in ärztlicher, psychologischer oder in therapeutischer Behandlung waren. Anliegen dieser ersten Kontaktnahmen war wesentlich, die Biographie der Kinder zu erfassen und in Gesprächen mit behandelnden Ärzten, dem Psychologen und Sonderpädagogen, die die Kinder bisher betreuten, einen vorläufigen Eindruck über den bisherigen Entwicklungsverlauf, die momentane Handlungskompetenz und den spezifischen Bedarf zu erhalten, der für die Kinder vorzusehen war.
Im Rahmen dieser Bemühungen zeigte sich dann auch, dass die größten Bedenken unserem Vorhaben gegenüber von medizinischer Seite artikuliert wurden, wobei mehr oder weniger behauptet wurde, dass wir nicht in der Lage seien, den spezifischen Therapiebedarf der Kinder im Rahmen der Arbeit in einer Regeleinrichtung abzudecken.
Hier galt es, nicht nur kritische, sondern pädagogischen Bemühungen gegenüber insgesamt sehr vorurteilsbehaftete Einstellungen hinsichtlich der Arbeit mit behinderten Kindern in Regeleinrichtungen soweit als möglich aufzuarbeiten, aber es auch trotz verbleibender Reste an Widerstand zu wagen, in die Arbeit einzusteigen. Wir hatten dann auch nach einer relativ kurzen Anlaufphase in der ersten Integrationsgruppe die ersten Möglichkeiten zur Hospitation für eben diesen Personenkreis vorbehalten, damit noch bestehende Fehleinschätzungen unserer Möglichkeiten aus eigener Anschauung heraus relativiert werden konnten.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Auseinandersetzungen mit der genannten Vielfalt von Einzelpersonen und Behörden, mit Gremien und Institutionen sehr konstruktiv verlief, weil wir uns von vornherein mit unserem Vorhaben äußerst sachlich orientiert haben und von Anfang an unsere Grundsätze wie die Vorgehensweise, wie diese in der täglichen Erziehungspraxis umgesetzt werden sollen, allen Beteiligten in Gesprächen und in der Diskussion offenlegten, wenngleich wir zum damaligen Zeitpunkt sehr zurückhaltend darin waren, weitgehende Informationen an die Presse zu geben als die, dass im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde mit Beginn des Kindergartenjahres 1982 behinderte Kinder, die im Einzugsbereich leben, aufgenommen werden konnten.
Zur Zurückhaltung in einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit bewog uns während der ersten 1½ Jahre die Befürchtung, was ich in meinem Arbeitsbereich immer wieder feststellen musste, dass sich Gegenkräfte gegen das Vorhaben schon organisieren könnten, solange es noch in der Vorbereitungsphase war. Wir hätten dann keine Chance gehabt, eine Praxis zu entwickeln und durch diese überzeugend nachweisen zu können, dass solche Maßnahmen den Kindern keinen Schaden zufügen
- 57 -
würden. Auch wollten wir unsere Arbeit, die wie schon erwähnt, aus sich heraus selbst konfliktträchtig genug war, ohne zu grossen äußeren Druck auf ein Niveau bringen, auf dem eine fachlich qualifizierte Position von allen Mitarbeitern eingenommen werden konnte und eine tragfähige Solidarität entwickelt war, die es leistete, den mit Sicherheit von aussen entstehenden Druck nicht nur abzufangen, sondern eine Gegenkraft zu entwickeln. Dies gelang gegen Ende des ersten Halbjahres 1983. Von diesem Zeitpunkt an waren wir dann auch entschieden in die Öffentlichkeitsarbeit eingetreten.
Gruppen- und Gesamtelternabende informierten alle Interessenten in Kindergarten und Kirchengemeinden über das Vorhaben. In Einzelgesprächen wurden spezifische Fragen geklärt. Die Kirchengemeinde spielte dabei eine wichtige Rolle. Über Pastor, Gemeindeschwester und -helfer erfolgte eine breite Befassung mit dem Vorhaben auch über den Kreis der betroffenen Elternschaft hinaus.
Das erforderliche Fachpersonal, insbesondere für Physiotherapie und die Bereiche Sensomotorik und Psychomotorik und der „Stützpädagoge“ (eine Sozialpädagogin mit behindertenpädagogischer Ausbildung schwerpunktmässig in Sprachbehinderten- und Geistigbehindertenpädagogik; Sonderschullehrerin) wurden für die Arbeit gewonnen. Die Stützpädagogin koordinierte dann wesentlich die inhaltliche Arbeit der ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres zusammen mit dem Personal der Einrichtung. Zusätzlich liefen die Bemühungen um die Anerkennung einer Zivildienststelle, die genehmigt und besetzt werden konnte.
Studentische MitarbeiterInnen führten die ersten Erhebungen zur Dokumentation der pädagogischen Arbeitsweise im Kindergarten durch; parallel dazu erfolgte die entsprechende filmische Dokumentation.
August 1982:
Damals hielten wir fest:
„Seit 9. August d.J. hat sich im Gemeindekindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting etwas entschieden verändert: Seit dieser Zeit spielen und lernen dort behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam mit und an denselben Gegenständen und Themen in ständiger Kooperation miteinander. Das nennen wir Integration. Damit soll versucht werden, in der Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder einen anderen Weg zu gehen als den bisher üblichen. Die Kinder sollten in ihrer gewohnten und natürlichen Umgebung ihres Stadtteils gemeinsam im Kindergarten gefördert werden, ohne dass die Behinderten täglich weite Wege in eine ihnen fremde Umgebung zurücklegen müssen, um dort in Sondereinrichtungen gefördert zu werden, die sie ihrer Umgebung entfremden, kaum Sozialkontakte mit Nichtbehinderten zulassen bzw. diese auf das Fachpersonal begrenzen.“
Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres standen elf nach dem Gesetz als behindert geltende Kinder für die Aufnahme und Eingliederung in das KTH an. Dies war eine unerwartet hohe Zahl von behinderten Kindern; wir hatten in der Vorbereitungsphase mit 4 bis 6 Kindern entsprechend dem Bevölkerungsanteil gerechnet und mussten dann kurz vor Kindergartenjahresende und zum Teil noch in den Sommerferien erfahren, dass es bis zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 11 Kinder werden würden.
Dies hatte zwei Gründe: Durch unsere sehr zurückhaltend betriebene Öffentlichkeitsarbeit sprach sich unser Vorhaben von Mund zu Mund im Stadtteil herum. Dies erforderte mehr Zeit als unter Einschaltung von Presseorganen und des lokalen Fernsehens. Zudem war es ein eiserner Grundsatz von uns, Eltern in keiner Weise zur Teilnahme ihrer Kinder an der integrativen Arbeit zu überreden. Wir gaben die Information, und wer uns daraufhin ansprach, wer spezielle Fragen hatte, wer mehr wissen wollte, dem erklärten wir unser Vorhaben in allen Details. Auf dieser Basis mussten die Eltern sich selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in eine Sondereinrichtung oder in das Kindertagesheim geben, ob sie es weiterhin in einer Sondereinrichtung belassen oder die Möglichkeit nutzen wollten, es nun in der unmittelbaren Wohngegend in den Kindergarten bringen zu können. Diese Entscheidungen nahmen mehr Zeit in Anspruch, sie waren uns aber sehr wichtig, denn nur mit einer Elternschaft, die aufgrund eines eigenständigen Be-
- 58 -
schlusses die integrative Erziehung wünscht und unterstützt, würde beim Auftauchen von Schwierigkeiten auch stark genug sein, die Hürden, die sich ergeben, zu nehmen. Dies zeigte sich z.B. einmal, als die methodische Umstellung der Arbeit im Kindergarten deutlich wurde und überwiegend die Eltern nichtbehinderter Kinder befürchteten, dass dies die nichtbehinderten Kinder unterfordern könnte, ein Problem, das ausgeräumt werden konnte, und ein anderes Mal, als das Kollegium der zuständigen Grundschule im Oktober 1983, nachdem von Seiten der Bildungspolitiker und der Schulbehörde für die Fortsetzung der integrativen Arbeit in die Grundschule hinein bereits grünes Licht bestand, die Aufnahme der behinderten Kinder ablehnte. Eltern behinderter wie nichtbehinderter Kinder solidarisierten sich in der Durchsetzung ihres Anliegens, so dass auch in diesem Punkt die Weiterentwicklung des Vorhabens vorangetrieben werden konnte.
Dennoch stellte uns die größere Anzahl von behinderten Kindern, die sich wohl aus der in Bremen-Huchting gegebenen Sozialstruktur der Bevölkerung erklärt, vor schwierige Fragen. Schon gegen Ende des ersten Halbjahres 1982 war uns im Rahmen der Vorbereitungsarbeit klar geworden, dass wir unser ursprüngliches Ziel, von vornherein gleich eine völlig normale Situation derart herzustellen, dass in allen Gruppen des Kindergartens behinderte Kinder sein würden, mit Beginn des neuen Kindergartenjahres nicht erreichen würden. Die Vorbereitungsphase, für die wir von vornherein ein ganzes Jahr gefordert hatten, war durch die erwähnten Umstände auf ein halbes Jahr zusammengeschmolzen. Es war nicht mehr möglich, in der verbleibenden Zeit alle Gruppenleiterinnen auf die neue Arbeit vorzubereiten. Auch hätte es für die Stützpädagogin bedeutet, von Anfang an vier Gruppen in der Planung und Durchführung des Erziehungsalltages zu beraten und zu unterstützen. Deshalb beschlossen wir, erst einmal mit einer integrativen Gruppe im KTH zu beginnen.
Eine Erzieherin, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, wollte die erste Integrationsgruppe übernehmen. Damit konnte auch den MitarbeiterInnen, die sich noch unsicher waren, zu diesem Zeitpunkt bereits integrative Gruppenarbeit zu leisten, Rechnung getragen werden, wie gleichzeitig mit dieser ersten Gruppe, obwohl sie durch den überproportional hohen Anteil behinderter Kinder nun doch eine Art Sondergruppe war, ein Modell geschaffen werden, durch das die weiteren Mitarbeiter des KTHs an die Praxis dieser Arbeit herangeführt, dort hospitierend und mitarbeitend eingeführt und so durch das direkte Tun besser befähigt werden konnten, im Laufe der Entwicklung des Vorhabens in ihrer Gruppe dann einen entsprechend geringeren Anteil behinderter Kinder zu integrieren. Unser Ziel war nun, bis zum Ende des ersten Kindergartenjahres in allen vier Ganztagsgruppen integrativ zu arbeiten. Durch die räumliche Abtrennung der fünften Gruppe und den extrem schlechten räumlichen Bedingungen, mit denen diese Gruppe zu recht kommen muss, haben wir das Ziel, auch die fünfte Gruppe in die integrative Arbeit einzubeziehen, bis heute aufschieben müssen. Damit begann die integrative Arbeit im August 1982 in der Gruppe „Hase“.
2. Halbjahr 1982:
(Erste Umsetzungsphase): In der ersten Integrationsgruppe arbeiteten die Gruppenleiterin, die Stützpädagogin, eine Berufspraktikantin und ein Zivildienstleistender auf der Basis des entwickelten pädagogischen Konzeptes zusammen. In den ersten Wochen spielten sich die Mitarbeiter untereinander als ein Team ein; die Kindergruppe konstituierte sich. Nach und nach stabilisierte sich auch der Tagesablauf für die Kinder und die Arbeit wurde immer „natürlicher“ und die speziellen Hilfen, derer die behinderten Kinder bedürfen, wurden unter dem Schwerpunkt, zuerst stabile soziale Beziehungen in der Gruppe aufzubauen, schrittweise in das pädagogische Gesamtkonzept integriert, so auch der krankengymnastische Bedarf zweier körperbehinderter Kinder.
Es gelang verhältnismäßig schnell, dass sich die vier MitarbeiterInnen derart gut in die Teamarbeit einfanden, dass sie sich auch dann weder gegenseitig behinderten noch für die Kinder überlastende Situationen eintraten, wenn an zwei Tagen in der Woche noch die Krankengymnastin im Team anwesend war. In regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen wurde die weitere pädagogische Planung grob
- 59 -
skizziert, wurde geklärt, wer welche speziellen Hilfen in welchen Situationen des Alltags einem Kind gewährt, wer für das gesamte Gruppengeschehen in einer bestimmten Phase verantwortlich ist und wer im Rahmen dessen Teilaufgaben und Hilfsfunktionen übernimmt.
War die Stützpädagogin anfänglich auch umfassender für das Gesamtgruppengeschehen innovativ, übernahm die Gruppenleiterin dann in den folgenden Wochen bis gegen Jahresende mehr und mehr die Gesamtverantwortung und Leitung der Gruppenarbeit, und die Stützpädagogin trat entsprechend in ihre eigentliche Funktion der Beratung, der Hilfestellung spezifischer Art und Supervision zurück. Dieser Prozess konnte bis zum Jahresende 1982 abgeschlossen werden.
1. Halbjahr 1983:
(Zweite Umsetzungsphase): War die Hasen-Gruppe anfänglich vor allzu viel Neugier und Hospitationswünschen der Mitarbeiter im Hause aber auch durch Eltern und Fachleute von aussen geschützt, da wir vereinbarten, den Selbstfindungsprozess der Gruppe und des Teams in einem gewissen Schonraum zu ermöglichen, führte dies, so notwendig die Hasen-Gruppe dies hatte, doch zu Schwierigkeiten in der Mitarbeiterschaft, da sich die Informationen, wie es denn nun in der Hasen-Gruppe liefe, nicht hinreichend vermitteln ließen. Dennoch muss auch nachträglich diese gemeinsam gefällte Entscheidung, der Gruppe in der ersten Phase der Einarbeitung möglichst viel Ruhe zu belassen, als richtig angesehen werden. Gegen Ende 1982 änderte sich dies und nun klagten umgekehrt die MitarbeiterInnen der ersten Integrationsgruppe über allzu viel Besuche und Hospitationen.
Wie schon angedeutet, musste nun aber einerseits die Einarbeitung der weiteren GruppenleiterInnen im Hause erfolgen und andererseits den Kritikern wie Förderern des Vorhabens möglichst schnell Einblick in das Geschehen eröffnet werden. So waren die letzten Wochen des Jahres 1982 und die ersten Wochen des Jahres 1983 durch besonders viele Hospitationen in der ersten Integrationsgruppe gekennzeichnet, die mit den nun intensiv einsetzenden Bemühungen um Fortsetzung des Vorhabens in die Grundschule hinein sich auch auf die Bildungspolitiker der Fraktionen und die Vertreter der senatorischen Behörden für Soziales, Jugend und Sport und für Wissenschaft, Bildung und Kunst ausweiteten. Verfolgt man den weiteren Prozess dieser Bemühungen, so verdeutlicht sich, dass der Erwerb von Kenntnissen und Einblicken dieses Personenkreises vor Ort besonders wichtig war, ehe die Fachdiskussion über die Fortführung des Vorhabens in die Grundschule hinein begann. Auf diese Weise konnte nämlich eine politische Willensbildung angebahnt werden, die auch eine gewisse Gegenkraft gegen die eher abwehrende und hemmende Tendenz einzelner Bürokraten in der Verwaltung bildete.
Für die Weiterentwicklung des Vorhabens im KTH selbst waren nun aber die Einarbeitung der weiteren Mitarbeiter und damit die Normalisierung der integrativen Bemühungen im KTH von besonderer Bedeutung. So konnten im ersten Halbjahr 1983 drei weitere Gruppenleiterinnen in der ersten Integrationsgruppe hospitieren, dort eingearbeitet werden und die Kontakte zu den behinderten Kindern knüpfen, die nach der Einarbeitungsphase dann mit ihnen in eine andere Gruppe wechselten. Diese Hospitations-, Einarbeitungs- und Umsetzungsphase der Kinder konnte so organisiert und durchgeführt werden, dass nach einer gewissen Zeit der Arbeit in der ersten Integrationsgruppe sowohl die Gruppenleiterinnen wie die Kinder, die für die Umsetzung vorgesehen waren, den Wunsch äußerten, in der eigenen Stammgruppe integrativ weiterzuarbeiten. Ebenso wurde aber auch der Wunsch einer Gruppenleiterin berücksichtigt, noch zu Anfang des 2. Halbjahres 1983 für einen längeren Zeitraum als dafür vorgesehen war, mit der Stützpädagogin zusammen die eigene Gruppe zu führen.
Mit den Beratungen über die Neuaufnahmen zum Kindergartenjahr 1983/84 stand fest, dass mit Beginn des neuen Kindergartenjahres unter verstärkter Berücksichtigung auch der „3-jährigen Gruppe“ alle Gruppen integrativ arbeiteten, wie wir dies bereits ein Jahr früher erreicht haben wollten.
Die Erfahrungen, die wir mit diesem exemplarischen Vorgehen innerhalb des KTHs sammeln konnten, haben uns darin bestärkt, bei der Ausweitung der Integra-
- 60 -
tion auf vergleichbar große andere Kindertagesheime ein ähnliches Verfahren zu empfehlen, da die Neukonstrukturierung von erzieherischen Einstellungen und Haltungen und die Entwicklung einer entsprechenden pädagogischen Handlungskompetenz bei den Mitarbeitern doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man geneigt ist, dafür von vornherein in Ansatz zu bringen.
Durch die Beteiligung einer Gruppenleiterin aus der Nachbargemeinde St. Georg an der Vorbereitungs- und den ersten beiden Umsetzungsphasen im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde konnte relativ problemlos mit Beginn des Kindergartenjahres 1983/84 die Ausweitung auf den nächsten Kindergarten erfolgen. Die Vorbereitung der Eltern in der Gemeinde erfolgte parallel zu der Arbeit im Kindergarten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, und wiederum ein Jahr später, mit Beginn des Kindergartenjahres 1984/85, werden auch dort alle drei Gruppen dieses KTHs integrativ arbeiten. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf eine schrittweise Ausweitung der integrativen Erziehung.
Im Zusammenhang dieses Berichtes erscheint es wichtig, die Erfahrungen, wie sie die Gruppenleiterin, die Berufspraktikantin und der Zivildienstleistende in der ersten Integrationsgruppe gewinnen konnten, einzubringen und die Betroffenen dazu selbst zu Wort kommen zu lassen.
Exkurs:
Die MitarbeiterInnen der ersten Integrationsgruppe berichten:
Die Gruppenleiterin der ersten Integrationsgruppe, Frau Karin Sparberg, die Berufspraktikantin Frau Birgit Meyer und der Zivildienstleistende Jens-Markus Wegener schreiben:
„Als Gruppenleiterin der ersten Integrationsgruppe möchte ich über meine bisherigen Erfahrungen, die sich ergebenen Schwierigkeiten und die Veränderung in unserer pädagogischen Arbeit berichten.
Als ich vor der Entscheidung stand, ob ich nun diese erste Integrationsgruppe übernehmen sollte, stellten sich mir zwangsläufig einige Fragen:
-
Bist Du dieser Arbeit gewachsen?
-
Wie arbeitest Du mit den behinderten Kindern?
-
Wie werde ich mit der Elternarbeit fertig werden?
-
Kann ich auf die Fragen der Eltern richtig eingehen?
Die Angst vor dieser neuen Aufgabe, die sich zwangsläufig ergab, wurde nur durch die Hoffnung gemindert, gerade jetzt in der ersten Phase viel Erfahrungen sammeln und viel Hilfe bekommen zu können.
Mich unterstützten in meiner Arbeit innerhalb der Gruppe eine Vorpraktikantin, ein Zivildienstleistender und eine Stützpädagogin.
Organisatorische Maßnahmen:
Vor Aufnahme der Kinder in die Gruppe gab es noch viele vorbereitende Maßnahmen zu treffen. So nahmen wir Kontakt zu den Institutionen auf, die die Kinder bisher betreuten, um Informationen über die Kinder zu erhalten und zu erfahren, wo wir mit unserer Arbeit ansetzen müssen.
Wir unternahmen Besuche bei den Eltern der behinderten Kinder, um möglichst viele Eindrücke von den jeweiligen Lebensbedingungen zu erhalten.
Mit diesen Eltern veranstalteten wir einen Elternnachmittag, der dazu diente, alle noch offenen Fragen gemeinsam zu klären. Vor Aufnahme der Gruppenarbeit fand ein Gruppenelternabend für sämtliche Eltern der Gruppe statt, um es allen zu ermöglichen, sich vorher kennenzulernen.
Auch im Gruppenraum mussten einige Veränderungen getroffen werden. Weiterhin galt es, die Frühstückssets mit den Umrissen des jeweils benötigten Geschirrs zu bekleben, um den Kindern später das Decken des Tisches zu er leichtern. Ein sehr wesentlicher Punkt, der sehr viel Zeit in Anspruch nahm, war die Planung des Tagesablaufes für die erste, aber auch für die folgenden Wochen.
- 61 -
Am 02.08.1982 kamen dann die ersten Kinder ins KTH. Die Aufnahme erfolgte gestaffelt im Abstand von einer Woche, um sich intensiver um die Kinder kümmern zu können. Diese Form der Aufnahme wird im KTH grundsätzlich durchgeführt.
Die Gruppe umfasste schließlich 16 Kinder, von denen 10 als behindert galten und eine besondere Förderung benötigten. Die Anfangsphase dieser Gruppe war hart und anstrengend:
-
Unser Gruppenteam musste sich erst aufeinander einspielen.
-
Mit Ausnahme der Stützpädagogin tat sich uns ein neues Arbeitsfeld auf, denn wir hatten noch nie mit behinderten Kindern gearbeitet. Zwei meiner Mitarbeiter hatten außerdem überhaupt keine pädagogische Ausbildung.
Eine Vielfalt von Informationen prasselte auf alle Mitarbeiter des KTHs ein. Oft gab es harte Auseinandersetzungen, bevor eine neue Sache (z.B. Frühstückssets) im KTH eingeführt wurde. Dabei ergab sich für mich oft die Frage, was von dem, das ich bisher gelernt habe, noch richtig oder falsch ist. Was ich bisher wusste und langjährig praktiziert hatte, gab mir bis dahin Sicherheit im Umgang mit den Kindern. Doch nun musste ich umlernen, da ich feststellte, dass mit den bisherigen Methoden nicht alle auftretenden Probleme angemessen gelöst werden können. Sehr wichtig erscheint mir hier, dass man als Gruppenleiter bereit ist, diese Änderungen mitzumachen.
Wie hat sich nun bei mir diese Neuorientierung vollzogen? Am Anfang war es so, dass ich erst einmal Neuerungen akzeptiert habe und hauptsächlich der Stützpädagogin die Gruppenleitung überließ, um so ihr Verhalten und das der Kinder intensiv beobachten zu können. In gemeinsamen Gesprächen reflektierten wir dieses anschließend. Der nächste Schritt bestand für mich darin, diese neuen Erfahrungen umzusetzen. Dieses ist wohl der schwierigste Schritt für mich gewesen. Denn zwischen einsehen und danach handeln können liegt noch ein weiter Weg.
In der neuen Situation fühlte ich mich oft als Fremdkörper und war enttäuscht, wenn es nicht so klappte, wie ich es mir vorstellte. Mit der Zeit habe ich jedoch die neue Arbeitsweise immer stärker übernommen. Ich fühlte mich immer wohler und wurde in meiner Arbeit immer sicherer. Dieses übertrug sich auch immer mehr auf meine Arbeit mit den Kindern.
Was hat sich nun in unserer Arbeit geändert? Änderungen haben sich vor allem im Tagesablauf, in der Planung und in der pädagogischen Arbeit ergeben.
Im Tagesablauf sind u.a. der Morgenkreis und der Abschlusskreis ein fester Bestandteil geworden. Diese beiden Kreise dienen vor allem der Kontaktförderung untereinander. Beim Essen haben die Kinder jetzt Sets auf dem Tisch liegen, auf denen die Umrisse des Geschirrs und des Besteckes aufgezeichnet sind, so dass die Kinder beim Tischdecken genau sehen, wohin was gehört. Sehr viel umfangreicher und intensiver ist die Planung und Vorbereitung geworden.
In der Praxis habe ich erfahren, wie wichtig eine Materialerfahrung für die Kinder ist, d.h., man muss in der Planung berücksichtigen, dass die Kinder das zu bearbeitende Material sinnlich erfahren müssen, bevor sie daraus fertige Produkte herstellen können.
Von großer Bedeutung ist für mich das Planen und Lenken von Kontaktanbahnung, d.h., wir organisieren täglich Spiele, in denen die Kinder spielerisch aufeinander zugehen lernen, miteinander agieren und so lernen, Beziehungen aufzubauen. Bisher war diese Kontaktaufnahme unter den Kindern eher zufällig und ungeplant.
In jeden Morgenkreis wird auch Bewegung, Sprache und Wahrnehmung mit eingeplant. Außerdem erarbeiten und planen wir Hilfen für die Kinder. Es wird noch abgesprochen, wer die Hilfe gibt und in welcher Weise sie erfolgt.
- 62 -

Nachfolgende Bilder zeigen: Interaktion und Kommunikation finden eine weitere Intensivierung im Morgenkreis. Beziehungen der einzelnen Kinder zueinander, zum Erzieher und zur Gesamtgruppe realisiert durch Sing-, Sprach- und Bewegungsangebote, die räumlich zeitliche Orientierung auf den Tagesablauf. Erste Erfahrungen mit Material, Gegenständen und Sachzusammenhängen der geplanten Tagesaktivität stehen hier im Mittelpunkt.
Im Bereich Sprache habe ich erfahren, dass es wichtig ist, seine Sprachgewohnheiten zu überprüfen und zu überlegen, was man sagen will und wie man es sagen will. Die Ansprache zu den Kindern hat sich geändert. Wir sprechen jetzt langsamer und deutlicher. Außerdem gehen wir in die Hocke, um uns auf der Austauschebene der Kinder zu befinden. Wichtig ist auch, dass uns alle Kinder verstehen und wir alle Kinder der Gruppe erreichen. Dazu kann es nötig sein, dass man das Gesagte durch Gesten noch untermalt. Wichtig ist auch, dass man Blickkontakt hält, wenn man miteinander spricht. Dies ist notwendig für die Sprachentwicklung und auch für das bessere Wahrnehmen der Personen und Verstehen des Gesagten.
Weiterhin erleichtern Signale unsere Arbeit. Sollen z.B. alle Kinder zu mir herkommen, so singe ich: „Alle Kinder kommen her zu mir.“ Diese Signale bedeuten für unsere Arbeit eine enorme Erleichterung, denn sie erleichtern den freundlichen Umgang mit Kindern und verhindern, dass wir die Kinder z.B. tadeln. Ist es einem Kind oder uns in der Gruppe zu laut, so schnippen wir mit den Fingern und singen dann mit allen zusammen: „Es ist zu laut, alle werden leiser.“ Dadurch kann sich die Gruppe selbst beeinflussen. Diese Signale haben wir aus der Rhythmik übernommen.
Schwierigkeiten und Probleme:
Ich glaube, es ist jedem klar, dass diese neue Arbeitsweise sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr hohe Anforderungen an uns Erzieher stellt. Ein simples Beispiel mag dieses verdeutlichen. Gerade in der Anfangphase war der Arbeitsanfall so hoch, dass die Situation in der Gruppe es nicht einmal zuließ, die Toilette aufzusuchen. Wir MitarbeiterInnen der Hasengruppe waren voll in die Gruppe eingebunden und fanden somit keine Zeit und Gelegenheit, uns mit den anderen Mitarbeitern zu unterhalten und über Probleme zu sprechen. Viele Blicke waren von allen Seiten auf uns gerichtet, und ich kann sagen,
- 63 -
dass viele davon nicht gerade wohlwollend waren. Zusätzlich trat noch das Gefühl ein, nicht mehr zu den übrigen Mitarbeitern zu gehören, denn innerhalb des Hauses kam es zu erheblichen Spannungen. In dieser Phase der Integration halfen mir sehr stark die Mitarbeiter der Hasengruppe, die mich voll unterstützten.
Eine Änderung in dieser Situation trat ein, nachdem die Mitarbeiter der anderen Gruppen bei uns hospitieren konnten und ihnen so die neue Arbeitsweise verdeutlicht werden konnte. Inzwischen löste sich dieses Problem von selbst, da nun alle Gruppen des KTHs in die Integration einbezogen wurden.
Als sehr störend empfand ich die vielen Hospitationen in unserer Gruppe. Bis Ende des Jahres 1982 waren diese noch nicht gestattet, da wir erst einmal als Gruppe zusammenwachsen wollten. Dann jedoch kamen Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen, Fachleute, die vorher für die Betreuung der behinderten Kinder zuständig waren, eine Lehrerin, die regelmässig alle 14 Tage einmal hospitierte, Mitarbeiter des Diakonischen Werkes, Eltern der sich in unserer Gruppe befindlichen Kinder und auch die Mitarbeiter unserer Einrichtung zur Hospitation. Außerdem fanden zeitweise Beobachtungen durch Studenten der Universität Bremen statt.
Mir ist schon klar, dass die Hospitationen wichtig sind und unsere Arbeit transparenter machen, aber sie stören doch sehr den alltäglichen Ablauf. Ich kann sagen, dass ich froh war, wenn ich mit meinen Mitarbeitern und den Kindern in der Gruppe wieder alleine war. Positiv daran war, dass mir im Laufe der Zeit die Hospitationen immer weniger ausmachten.
Arbeit mit Therapeuten:
Eine sehr grosse Hilfe und Erleichterung erbrachte die Zusammenarbeit mit den Krankengymnastinnen. Sie zeigten uns z.B., wie man Hilfestellungen geben muss bei einem Kind, das nicht alleine gehen kann, welche Hilfe den Kindern zuteil werden muss, die durch ihre Behinderung Probleme beim Einnehmen der Mahlzeit haben, wie den Kindern beim Waschen, Zähneputzen oder beim Gang zur Toilette Unterstützung gegeben werden kann.
In einem Fortbildungslehrgang haben wir Mitarbeiter erfahren, wie es ist, sowohl Hilfestellungen bei einem anderen auszuüben als auch Hilfe anzunehmen.
Obwohl die eine Therapeutin nur einen Tag und die andere einen Tag und 1½ Stunden pro Woche kommen, war doch deutlich festzustellen, dass die Kinder Fortschritte machten. Der weitestgehende Einbau der Therapie in den Tagesablauf führte zu einer positiven Beeinflussung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder.[48]
Gerade hier hat es sich gezeigt, wie wichtig die gemeinsame Planung mit den Therapeuten ist. Nur so kann man erkennen, welche Hilfe für das Kind angebracht wäre und wie sie zu erfolgen hätte. Leider sind dieser Möglichkeit durch die nur spärlich zu Verfügung stehenden Zeiten des gemeinsamen Planens Grenzen gesetzt.
Außerdem kam einmal in der Woche eine Rhythmiklehrerin zur Supervision. Dadurch habe ich sehr viele Anregungen und Hilfen bekommen, wie ich Rhythmik innerhalb des Tagesablaufes einbauen kann.
Zur Kindergruppe:
Da wir Mitarbeiter der Hasengruppe uns auch erst einmal aufeinander einspielen mussten, haben wir uns dazu entschlossen, die Kinder in der Anfangsphase stark zu lenken, was ihnen meiner Meinung nach Sicherheit und Orientierung gab. Mit der Zeit übergaben wir ihnen dann immer mehr Verantwortung wie z.B. das Verteilen der Aufgaben des Tischdienstes.
Von Anfang an gingen die Kinder auf natürliche Art und Weise aufeinander zu. Sie machten keine Unterschiede zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern. Und doch interessierten sie sich für die behinderten Kinder
- 64 -
und fragten z. B.: „Warum schreit Peso?“ „Wozu braucht A. einen Toilettenstuhl?“ Außerdem probierten sie die Hilfsmittel der behinderten Kinder aus. Die Kinder gingen zum größten Teil sehr liebevoll miteinander um. Konnte z.B. ein Kind ein Wort aussprechen, das es vorher nicht konnte, so freuten sich die anderen Kinder mit diesem Kind gemeinsam.

Auch die gegenseitige Hilfsbereitschaft war sehr gross. Dabei lernten die nichtbehinderten Kinder, die behinderten Kinder zu fragen, ob sie Hilfe benötigten und ob sie helfen dürfen. Die behinderten Kinder lernten, die Hilfen von den andern zu fordern und anzunehmen. Das gute soziale Verhalten führe ich hauptsächlich auf die neue pädagogische Arbeitsweise zurück (Kinder auf andere Kinder beziehen, Kinder auf andere Kinder orientieren). Beeindruckend war für mich die hohe Toleranzschwelle der Gruppe, die sich z.B. darin zeigte, dass man so lange wartete, bis auch das Kind, das nur sehr langsam gehen kann, seine Aufgabe beendet hatte, dass man wartete, bis sich das Kind, das vorher heftig geschrieen hatte, wieder beruhigte, oder dass man auf den Erzieher so lange wartete, bis dieser mit seiner Aufgabe fertig ist.
Für Außenstehende war es oft nicht leicht zu erkennen, wer zu den behinderten Kindern gehört. Das zeigt meiner Meinung nach, was es bedeutet, wenn Kinder nicht aus ihrer gewohnten natürlichen Umgebung herausgerissen werden.
In diesem Jahr habe ich sehr viel gelernt und viele neue Erfahrungen gesammelt. Ich habe festgestellt, dass ich auch vorhandene Erziehungsgrundsätze auf die veränderte Situation übertragen kann. Die bisherige Pädagogik wurde sehr verfeinert. Ich habe in diesem Jahr gelernt, sowohl auf die behinderten als auf die nichtbehinderten Kinder besser einzugehen.
In diesem Jahr habe ich erfahren, wie man eine Gruppe aufbauen kann. Es ist dabei von unschätzbarem Wert, die Kinder aufeinander zu beziehen. Dazu gehört aber auch, dass vom Erzieher die Bedingungen hergestellt werden müssen, damit sich kooperatives Verhalten unter den Kindern bildet.
Ich habe gelernt, wie man Unruhe und unübersichtliche Situationen vermeiden kann, wenn man eine Situation anders gestaltet oder organisiert wie z.B. die Zeit nach dem Essen: Bisher war es so, dass alle Kinder auf einmal in den Waschraum gingen, so dass es zwangsläufig zu Konflikten und Unruhen kam. Jetzt ist es so, dass die eine Hälfte der Kinder in den Waschraum geht, wäh-
- 65 -
rend die andere Hälfte den Tisch abdeckt. Durch diese Umstrukturierung war es möglich, z.B. diese Konflikte weitgehend zu vermeiden.
Für den Erzieher bedeutet diese neue Form der Pädagogik natürlich auch, dass er stärker gefordert ist. Aber diese höhere Beanspruchung bringt auch eine bessere Qualität unserer Arbeit und unserer Ausbildung mit sich. Das Handeln wird einem dadurch viel bewusster. Wichtig ist, dass wir ständig an uns arbeiten und uns fortbilden.
Dieses Jahr hat für mich aber auch einige wesentliche negative Aspekte gehabt, die durch die hohen Anforderungen und den enormen Arbeitsanfall verursacht worden sind.
Dazu gehört:
-
Freizeit nimmt stark ab.
-
Im Privatleben sind erhebliche Abstriche zu machen, man hat kaum noch die Möglichkeit, sich mit wichtigen privaten Angelegenheiten zu befassen.
-
Motivationsbereitschaft lässt nach durch den Kräfteverschleiß, so dass man teilweise nicht mehr in der Lage ist, den Kindern das zu geben, was sie brauchen.
-
Persönliche Spannungen wie Gereiztheit nehmen zu.
Ich glaube, dass man sich überlegen muss, ob dieses Ausmaß an Arbeit nicht zu einer Beeinträchtigung der Integration führt. Folgende Bedingungen müssten sich ändern:
-
Es muss mehr Vorbereitungszeit geben.
-
In jeder Gruppe sollten nach Möglichkeit zwei ausgebildete Erzieher arbeiten. Ist dies nicht möglich, so sollte die Zweitkraft mindestens eine Berufspraktikantin sein.
-
Es muss mehr Zeit für die Ausbildung der Praktikanten geschaffen werden.
Trotz aller Vorteile der Integration, die ich voll unterstütze, um das noch einmal klarzustellen, darf es nicht dazu kommen, dass wir Erzieher nach ein paar Jahren so verbraucht sind, dass wir nicht mehr die Kraft haben, den Ansprüchen dieser Arbeit gerecht zu werden.“
Gez.: Karin Sparberg
„Mein Interesse an der Arbeit mit behinderten Kindern entwickelte sich in dem Jahr, als ich mein Abitur machte. Ich las in unserer Regionalzeitung im Februar 1982 einen kleinen Artikel darüber, dass in dem Tagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde erstmals behinderte Kinder aufgenommen werden sollten. Diese Idee der Integration faszinierte mich sehr, und ich entschloss mich, in dieser Gruppe als Vorpraktikantin zu arbeiten.
Mir war die Integration sehr wichtig, da ich bisher nur von Sondereinrichtungen gehört hatte, was ich immer mit Aussonderung gleichsetzte.
Die Anfangsphase im KTH war nicht leicht. Neue Mitarbeiter, die Eltern der Kinder und die Kinder selbst erforderten eine grosse Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen. Da wir aber alle ein gemeinsames Interesse hatten, wurden wir von Tag zu Tag erfolgreicher, in jeder Beziehung.
Meine persönlichen Erfahrungen in diesem Jahr waren mehr als positiv. Bevor ich meine Arbeit antrat, dachte ich über Integration nach und hatte schließlich viele Fragen im Kopf, die sich nach kurzer Zeit schon von selbst beantworteten.
Ein Beispiel: Wie ist die Kind-Kind-Beziehung, wenn ein Kind behindert und das andere nicht behindert ist? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte bei meinen ganzen Fragen nicht mit den Kindern gerechnet. Ich stellte meine Fragen aus meiner Erfahrung in der „Erwachsenenwelt“, und sie wurden aus der „Kinderwelt“ beantwortet, wie ich es mir nicht hätte träumen lassen. Die Kinder spielten, lernten und lebten ohne Vorurteile miteinander: Wie Vorurteile Urteile blockieren!
- 66 -
Meine schönste Erfahrung war, dass unsere Kinder jeden Tag etwas Neues dazu lernten und es im gemeinsamen Zusammenleben aktiv anwendeten.
Für mich war es auch sehr wichtig, dass man Theorie wirksam und erfolgreich in die Praxis umsetzen konnte. Ein Grund: Dass wir das, was sich sonst in kalten und weißen, oftmals isolierten Therapiezimmern abspielt, in unserem Gruppenraum praktizierten, ohne Aussonderung und gemeinsam.

Was wir jeden Tag im Gruppenalltag praktizierten, z.B. Wahrnehmung, Motorik, Sprache, Begriffsbildung, Kontaktaufnahme etc., war lebendig und im Gruppenalltag integriert. Es war ein fröhliches und spielerisches Lernen und hatte eine grosse Wirkung auf die Entwicklung sowohl der behinderten als auch nichtbehinderten Kinder.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine These von Prof. Dr. Georg Feuser hinweisen, die das beschreibt, was wir in unserer Arbeit umgesetzt haben und was in den nächsten Jahren umgesetzt werden wird: These 6: „Integration bedeutet weder die Anpassung Behinderter an die Normen der Nichtbehinderten noch die Reduzierung der Entwicklungsmöglichkeiten der Nichtbehinderten auf ein für alle erreichbares Niveau, sondern die Wiederherstellung ihrer zerstörten sozial gesellschaftlichen und individuellen (Identität) Einheit.“
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die sehr gute, ja freundschaftliche Beziehung zu den Mitarbeitern der ‚Hasengruppe‘, den anderen Mitarbeitern des KTH und den Eltern der Kinder hinweisen und mich auf diesem Wege herzlich für alles bedanken.“
gez.: Birgit Meyer
„Ein für mich wesentlicher Grund, den Kriegsdienst zu verweigern, war die in meinen Augen sinnlose Gammelei bei der Bundeswehr, die ich darüber hinaus auch aus politischer Überzeugung ablehne. Aufgrund unserer Verfassung bin ich ja dazu gezwungen, entweder Soldat zu spielen oder aber einen der Allgemeinheit dienenden sozialen Dienst abzuleisten. Zum Zeitpunkt meiner Verweigerung wusste ich schon, dass ich am liebsten mit Behinderten gearbeitet hätte. Als ich schließlich meine Gewissensprüfung „bestanden“ hatte, war für mich klar, dass ich im KTH Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde tätig sein wollte, da ich durch meine Mutter von den Integrationsplänen des KTHs gehört hatte. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass dort auch eine Zivildienststelle einge-
- 67 -
richtet worden sei und ich mit einer glaubwürdigen Bewerbung bestimmt gute Chancen haben würde.
Meinen eigenen Interessen kam die Stelle insoweit entgegen, als dass ich dort mit Behinderten und eben Kindern arbeiten konnte. Aber ich erkannte auch die gesellschaftliche Einzigartigkeit dieses Projekts, echte und wahrhafte Integration von behinderten Kindern nicht mehr im Modellversuch, sondern im richtigen Alltagsbetrieb zu vollziehen. Mich faszinierte die Vorstellung daran teilzuhaben, wenn kleine Menschen ohne Vorurteile miteinander aufwachsen, ohne falsches Mitleid und Gefühlsduselei. Integration hieß für mich einfach zusammen lernen und sich gegenseitig zu helfen. Ich wusste auch, dass auf mich eine grosse Verantwortung zukommen würde, denn wie fast alle Mitmenschen musste ich erst einmal lernen, eigene Vorurteile gegenüber Behinderten abzubauen.
So begann ich meinen Dienst in der Hasen Gruppe, der ersten Integrationsgruppe im KTH. Karin, die Gruppenleiterin, und Birgit, eine Vorpraktikantin hatten genau wie ich vorher noch nie mit Behinderten gearbeitet. Nur Angela, unsere Stützpädagogin, brachte Erfahrung mit in der Arbeit mit Behinderten.
Es war schon erstaunlich, wie natürlich die Kinder miteinander umgingen und wie selbstbewusst, wo doch gerade wir Erwachsenen unsere Schwierigkeiten hatten, uns unbefangen den behinderten Kindern zu nähern. Aber je länger ich in der Gruppe arbeitete, desto weniger nahm ich äußerliche Merkmale wahr, die mit einer Behinderung eines Kindes zu tun hatten. Ich begann die Kinder nach Charakter und ihren persönlichen Eigenarten zu unterscheiden, nicht mehr danach, ob sie behindert waren oder nicht.
Als sich Erwachsene und Kinder schließlich kennengelernt hatten, bekam ich auch meine eigentliche Aufgabe zugewiesen. Ich wurde persönlicher Betreuer von K.B., einem 5-jährigen, durch ihre spastische Lähmung schwer behinderten Mädchen[49], das ständig im Rollstuhl saß und sehr wenig und schwer verständlich sprach. In unserem Morgenkreis, der der Orientierung aller Kinder aufeinander diente, leistete ich ihr Hilfestellung beim Klatschen, indem ich ihre Arme führte, half ihr beim Laufen etc. Alle Hilfestellungen, die ich gab, versuchte ich so zu leisten, als ob ich ihr Körper wäre. Soweit es möglich war, ließ ich sie lenken und war quasi nur ein Werkzeug. Es blieb nicht aus, dass sich so eine sehr intime Beziehung zwischen uns aufbaute. Ich spürte oft, was sie wollte und konnte handeln, wie sie es wollte.
Da ich als Laie und Anfänger in den Kindergarten gekommen war, musste ich den richtigen Umgang mit K.B. erst einmal lernen. Schließlich wusste ich nicht, welche Körperstellungen für sie gut oder schlecht waren. Durch einen andauernden Austausch mit unseren Therapeuten und Krankengymnastinnen lernte ich, auf natürliche Weise Hilfen zu gegen und vor allem selbst alltagstauglich zu werden im Umgang mit K. So konnte ich ihr entsprechende Hilfestellungen geben beim Essen, indem ich ihre Arme führte, sie aber die eigentlichen Impulse gab zum Brotschmieren oder zum Löffel in den Mund stecken. K. aß also von Anfang an gemeinsam mit den anderen zusammen aus eigener Kraft. Kein Kind wurde gefüttert, sondern jedes Kind aß selbst mit mehr oder weniger Hilfestellungen, sofern sie nötig waren. Zu Beginn des Kindergartenjahres hatte K. Mühe, auch mit viel Hilfestellung ihr Brot zu schmieren. Jetzt, nach über einem Jahr kann sie ihr selbstgeschmiertes Brötchen kleingeschnitten fast selbständig in den Mund schieben. Ab und zu verfehlt sie mal den Mund, aber beim zweiten, dritten Versuch ist der Happen dann im Mund.
Auf der Toilette und im Waschraum machte sie ebenfalls grosse Fortschritte. Mit Hilfestellung ist es ihr möglich, die Zähne zu putzen, während sie gelernt hat, sich vollkommen selbständig den Mund abzuwischen. Sie kann sich auch die Hände und den Mund abtrocknen, wenn das Handtuch hängt.
Auf der Toilette hatten sich von Anfang an Probleme ergeben. Sobald sie ihren Toilettenstuhl sah, fing sie an zu schreien und bestritt, auf Klo zu müssen, auch wenn es offensichtlich dringend war. Nicht verwunderlich, dass
- 68 -
sie sich anfangs oft in die Hose machte. Wir fanden heraus, dass sie durch ihr Schreien und ihre Verweigerung das Dableiben einer Bezugsperson provozieren wollte, ja, es gab Wochen, da akzeptierte sie nur meine Hilfestellung, der ich ja auch meistens mit ihr zu tun hatte. Durch eine mit der Stützpädagogin erarbeitete Verhaltenskette gelang es dann, dass K. aufhörte zu schreien und schließlich auch andere Bezugspersonen akzeptierte. Später übernahm Karin dann die Toilettensequenz, um die allzu enge Bindung zwischen K. und mir zu lösen. Das Hoch- und Herunterziehen von Hosen und Strümpfen übernahm K. fast selbständig, während ich oder eine andere Person K. festhielt.

K. bekam Gehschienen, und ich lernte durch die Krankengymnastinnen, entsprechende Hilfe zu geben. Jetzt war K. nicht mehr an den Rollstuhl gefesselt, sie konnte mittanzen, mitturnen mit den anderen und ein speziell für sie gebauter Wagen ermöglichte es ihr, andere Kinder, die darauf Platz nahmen, zu schieben. Allein die Genugtuung, selbst auch Kinder schieben zu können und nicht immer nur selbst geschoben zu werden, muss viel bei K. bewirkt haben.
Mich hat immer wieder fasziniert, wie die Kinder gemeinsam etwas geschaffen haben und ganz allein Wege fanden, wie jedes Kind seiner Fähigkeit entsprechend daran teilnehmen konnte. Gegenüber den anderen Kindergartengruppen, in denen noch nicht Integration betrieben wurde, fiel mir in unserer Gruppe auf, dass die Kinder sehr viel friedfertiger waren und auch eher bereit waren, einen Konflikt mit Worten zu lösen. Darüber hinaus beobachtete ich sehr ausgeprägtes soziales Verhalten in der Gruppe, es gab keine Außenseiter in der Gruppe und keinen Anführer. Es wunderte mich auch nicht, dass die vielen Hospitanten in der Hasen Gruppe oftmals die behinderten Kinder nicht von den nichtbehinderten unterscheiden konnten, denn da, wo Kinder nicht zu Behinderten erzogen werden, entwickeln sie eben auch nicht solche Verhaltensweisen, die ihnen später dann irrtümlicherweise als Behinderungen ausgelegt werden. Je länger ich hier arbeite, desto mehr verstehe ich auch, was folgender Satz bedeutet: Behinderte sind eigentlich Gehinderte. Behinderte behindern sich ja nicht selbst, sie werden von der Gesellschaft daran gehindert, so zu sein, wie sie sind.
- 69 -
Ich habe sehr viel in diesem Jahr gelernt, auch über mich. Ich habe gelernt, wie einfach es ist, wie viel natürlicher es ist, wenn Behinderte nicht isoliert werden und Nichtbehinderte nicht daran gehindert werden, mit Behinderten zusammenzuleben lernen. Für mich ist die Integration kein Modell oder ein Projekt, sie ist Realität. Ich wünsche jedem Soldaten, dass er 16 Monate sinnvollen Dienst in einem Kindergarten machen dürfte wie ich.“
gez.: Jens Markus Wegener
Im ersten Halbjahr 1983 erfolgte, wie schon berichtet, die Einarbeitung einer weiteren Gruppenleiterin in die integrative Arbeit in der ersten Integrationsgruppe, nach der sie dann mit zwei behinderten Kindern in ihre Stammgruppe zurückkehrte und dort die Arbeit fortsetzte. Während der Einarbeitungsphase bestanden täglich stundenweise Kontakte der Gruppenleiterin mit ihrer eigenen Gruppe, damit sich Kinder und Erzieherin nicht entfremdeten. Eine Vertretungskraft und eine Berufspraktikantin, die nachfolgend ihre Erfahrung aus dieser Sicht schildert, leiteten während dieser Zeit die Gruppenarbeit, die schon zu vor nach und nach im Sinne der pädagogischen Erfordernissen, wie sie gemeinsam erarbeitet wurden, auszurichten versucht wurde. Dem Bericht von Sabine Gawrisch entnehmen wir:
„Nach einem halben Jahr ging meine Gruppenleiterin zur Hospitation in die erste Integrationsgruppe, um sich dort mit dem neuen pädagogischen Konzept vertraut zu machen. Nach einer Einarbeitungszeit kam sie mit der Stützpädagogin und zwei behinderten Kindern aus dieser Gruppe wieder in unsere Gruppe zurück.
Nach einer Einarbeitungszeit in unserer Gruppe, die von der Stützpädagogin anleitend unterstützt wurde, zog sich diese mehr und mehr auf die Gewährung spezifischer Hilfestellungen und die Supervision unserer Arbeit zurück. Nachdem auch wir die integrative Arbeit selbständig im Rahmen der Unterstützung der Therapeuten leisten konnten, ging die Stützpädagogin zur Einarbeitung der nächsten Gruppenleiterin in die erste Integrationsgruppe zurück.
Durch Hospitationen in der ersten Integrationsgruppe, die sich daraus ergebenden Gespräche mit der Stützpädagogin, durch die Beobachtung der Arbeit dieser Gruppe auch während des Freispiels auf dem Spielplatz, durch Diskussionen auf den Mitarbeiterbesprechungen und durch die Fortbildungsseminare konnte ich die didaktisch methodischen Veränderungen, die sich daraus für unsere Arbeit ergaben, in unserer Gruppe umsetzen. Schwerpunktmäßig möchte ich das sprachliche Verhalten der Erzieher im Rahmen der integrativen Arbeit beschreiben. Für die Arbeit in einer integrativen Gruppe ist es eine zentrale Frage zu klären, wie im Gruppengeschehen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern kommuniziert wird und welche Art und Weise der Kommunikation aufzubauen ist, so dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, am Gruppengeschehen teilhaben zu können. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich die Erzieher ihres Sprachverhaltens bewusst werden. Dies wurde für uns dadurch erleichtert, dass wir bestimmte Sequenzen aus dem Gruppenalltag auf Video aufzeichneten, diese Sequenzen analysierten und uns darüber unterhielten. Dabei wurde klar, dass ein entsprechend strukturiertes sprachliches Verhalten, das schon in Anbetracht einer altersgemischten Gruppe von besonderer Bedeutung ist, wesentlich dafür ursächlich ist, dass auch die nichtbehinderten Kinder durch die integrative Erziehung gefördert werden. Uns fiel auf, dass wir die Kommunikation mit den Kindern häufig im Sinne des „Double bind“ bzw. der „Mystifizierung“ (30; G.F.) gestalteten. So weisen wir z.B. darauf hin, dass wir gleich auf den Spielplatz gehen wollen. Die ersten Kinder laufen schon zur Tür, und es entsteht eine grosse Unruhe, weil wir dann hinterherlaufen und sie zurückholen müssen, weil unsere Information an die Kinder noch nicht abgeschlossen war und wir nachsetzen mussten, aber erst räumen wir noch auf.[50] Daraus erfolgt für die Kinder hinsichtlich ihres Bedürfnisses, nach draussen zu gehen, eine negative Konsequenz, die man hätte vermeiden können, wenn wir unsere Instruktionen bewusster gesteuert hätten. We-
- 70 -
der sind es die schwächsten Glieder der Gruppe, also die jüngeren Kinder, die behinderten Kinder und vor allem auch die ausländischen Kinder, die aufgrund zum Teil bestehender Sprachbarrieren dadurch verunsichert werden.
Das Sprachverhalten des Erziehers muss auch mit seinen Handlungen verbunden werden. Fordere ich die Kinder auf, sich im Kreis niederzusetzen, gehe aber selbst durch den Raum, um etwas anderes zu erledigen, gebe ich durch mein eigenes Verhalten eine gegenläufige Information zur sprachlichen Aufforderung. Beide Informationen zusammen werden missverständlich die Kinder orientieren sich an meinem sprachlichen Verhalten oder imitieren, was ich tue; es entsteht Unruhe und Durcheinander, was uns dann wieder veranlasst, den Kindern gegenüber zu negativen Konsequenzen zu greifen. Widersprüchlichkeiten sind auch dann beobachtbar, wenn ich es mit Worten barsch auffordere, endlich zum Tisch zu kommen, dabei aber eine Geste mit dem Arm mache, die ich auch immer dann einsetze, wenn ich das Kind für etwas loben möchte.
Für ein behindertes Kind mit einer Wahrnehmungsstörung dürfte das alles ein derart missverständliches Verhalten sein, dass wir ihm mehr schaden als nützen würden, wenn es ständig einem solchen Erzieherverhalten ausgesetzt sein würde. Motiviert durch die Erfahrungen in der ersten Integrationsgruppe überprüften und modifizierten wir unser Erzieherverhalten noch vor Beginn der Integration in unserer Gruppe.
Von großer Bedeutung ist auch der rhythmisierende Aspekt im Erzieherverhalten. So werden z. B. Freispielsituationen, das Frühstück oder Mittagessen, die gezielte Beschäftigung o.a. durch rhythmisierende Ansprachen angekündigt oder beendet. Diese Form der Ansprache ermöglicht es allen Kindern, meine Instruktion zu verstehen, wodurch sie wieder gemeinsam handeln können. Durch Rhythmisierung und besondere Betonung bestimmter Worte erreichen wir auch bei jüngeren und behinderten Kindern mühelos Aufmerksamkeit. Auch achten wir darauf, nicht jeden Tag für eine bestimmte Situation eine völlig unterschiedliche Ansprache an die Kinder zu benutzen.
In der Arbeit mit behinderten Kindern, die eine Wahrnehmungsstörung haben, für die selbst die rhythmisierende Ansprache nicht ausreichend ist, setzen wir zusätzlich Instrumente ein (z.B. ein Orff Instrument), um die Instruktion zu verstärken und ein eindeutiges Signal zu geben. Ziel ist es, die Kinder der Gruppe dahingehend zu fördern, dass sie über und durch diese Hilfen zu einem Sprachverständnis kommen, das der „normalen Kommunikation“ Entspricht“.
Gez.: Sabine Gawrisch
Mit Beginn des Kindergartenjahres 1983/84 befanden sich in allen Gruppen des KTHs behinderte Kinder, und die erste Integrationsgruppe war dadurch auch zu einer regulären Integrationsgruppe geworden. Da die Einarbeitungszeit für zwei Gruppen vor den Sommerferien nicht mehr ausreichend war, wurde die Einarbeitung bis zu den Herbstferien 1983 fortgesetzt.
Da die Stützpädagogin des ersten Integrationsjahres für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ihr Studium unterbrochen hatte, erfolgte zu diesem Zeitpunkt auch der Wechsel des Stützpädagogen. Günstig war dabei, dass sich der neue Stützpädagoge schon mit Beginn des Kindergartenjahres im August einarbeiten konnte und die ausscheidende Stützpädagogin mit abnehmender Intensität noch bis zu den Herbstferien zur Verfügung stand.
Das Bemühen der weiteren Arbeit richtet sich nun darauf, den erreichten Stand der integrativen Arbeit im KTH zu sichern, das meint, die erreichte Qualität in der pädagogischen Arbeit nicht mehr zu unterschreiten, sondern sie im Gegenteil gemeinsam weiterzuentwickeln. Eine notwendige Voraussetzung dazu ist, Fortbildungsmaßnahmen zu intensivieren und die Arbeit im Kindergarten unter ruhigeren Bedingungen fortsetzen zu können, d.h. die Ansprüche auf Hospitationen,
- 71 -
Erfahrungsaustausch usw. auf ein Maß zu reduzieren, die eine weitere Verbesserung der Arbeit im KTH zulässt. Allerdings konnten wir gerade dieses dringende Erfordernis selbst bis heute noch nicht realisieren. Durch die intensive Diskussion um die Fortsetzung des Vorhabens in die Grundschule hinein, was nun den integrativ arbeitenden Nachbarkindergarten der St. Georg Gemeinde betrifft, und die Bemühungen, die integrative Arbeit auf weitere Kindergärten auszudehnen mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten, waren die Leiterin und der Stützpädagoge, die Gruppenleiterinnen und die Therapeuten immer wieder aufgefordert, den unterschiedlichen Gremien aus der gemachten Erfahrung zu berichten, die Arbeit darzustellen, auf Fragen einzugehen, Vorurteile zu überwinden und dies gegenüber interessierten Kolleginnen und Kollegen, gegenüber den Schulbehörden, den senatorischen Behörden, der Schule, gegenüber den Bildungspolitikern der verschiedenen Fraktionen und auch innerhalb der kirchlichen Ausschüsse und Gremien. Die Öffentlichkeitsarbeit überschritt damit bei weitem das von uns selbst angestrebte Maß, was zeitweise dazu führte, dass die bereits in hohem Masse eingetretene Arbeitsüberlastung nach der Konsolidierung unserer integrativen Arbeit eher noch grösser wurde, als dass sie hätte abgebaut werden können. Diesbezüglich müssen sich im weiteren Verlauf der Arbeit aber unbedingt positive Möglichkeiten der Bewältigung dieser Situation ergeben.
Wenn ich von den Fragen ausgehe, die immer wieder im Zusammenhang mit unserer integrativen pädagogischen Arbeit gestellt werden, erwartet der an diesem Bericht Interessierte spätestens jetzt Auskünfte darüber, welcher Art und von welchem Schweregrad die Behinderten der elf zu Beginn des Vorhabens 1982 aufgenommenen Kinder waren. Diese Auskunft werden wir nachfolgend sicherlich nicht in der gewünschten Weise geben können, weil die ausweisbaren medizinischen Diagnosen nur die „Pathologie“ und den „Defekt“ Kennzeichnen und psychologische Kategorien wie Entwicklungs- und Intelligenzquotient nur die „Devianz“ der Kinder gegenüber einer fiktiven Normalverteilung bezeichnen würden und die im pädagogischen Bereich üblichen Behinderungsbegriffe wieder ihren selektierenden Charakter über unseren behinderten Kindern ausbreiten würden, die wir durch unser Vorhaben vor eben dieser Aussonderung bewahren bzw. deren bereits erfolgte Aussonderung wir wieder rückgängig machen konnten.
Die konkrete Arbeit mit den Kindern und die Lernprozesse, die wir aus der Beobachtung der noch ungebrochenen sozialen Verhältnisse der behinderten und nichtbehinderten Kinder untereinander im Kindergarten machen konnten, lässt es uns heute außerordentlich schwer fallen, wozu wir durch die gesetzlichen Vorgaben leider immer wieder gezwungen sind, die Namen unserer Kinder aus dem KTH mit Diagnosen und Behinderungsbegriffen in Zusammenhang zu bringen. Wenn wir in Gesprächen oder Schriftsätzen von den „nach dem Gesetz behinderten Kindern“ sprechen, so versuchen wir damit zu dokumentieren, dass es den Behinderten nicht geben kann und die organischen und/oder sozialen Bedingungen, die die Entwicklung der Kinder derart beeinträchtigt haben, dass sie heute nach dem bestehenden Gesetz als behindert gelten, keine „Unpersonen“ sind, sondern dass dies eben die Lisa, der Egon, der Robert oder die Maria sind, d.h. Kinder wie andere, für die ich willkürlich Namen herausgegriffen habe.
Wir wollen damit aber auch dokumentieren, dass integrative Erziehung die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern meint und diese nicht eine Sondermaßnahme für Behinderte ist, wie dies aus dem 1.Kapitel dieses Berichtes hinreichend deutlich werden kann. Das heisst, dass alle spezifischen Maßnahmen für die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Kinder und ihrer Erziehung und Bildung (damit unser pädagogisches Konzept) so angelegt sind, dass sie im Sinne der beschriebenen kindzentrierten, basalen allgemeinen Pädagogik jedem Kind hinreichend Hilfe und Motivation in seinem weiteren (nur Subjekt bezogen denkbaren) Entwicklungsprozess sind. Dabei machen wir die Erfahrung, dass die Ansprüche, die die nach dem Gesetz nicht als behindert geltenden Kinder an
- 72 -
uns stellen, oft schwieriger zu lösen sind als die, die von einem als behindert geltenden Kind an uns ausgehen.
Es war für mich eine der erschütternsten Erfahrungen im Rahmen der Durchführung unseres Vorhabens, in dessen Rahmen ich sehr viele Einblicke und Eindrücke in die vorschulische Erziehungsarbeit gewinnen konnte, wie „kaputt“ Kinder schon im Alter von 3 bis 6 Jahren (und das nicht wenige) sein können, und in Kombination damit, wie wenig die vielerorts praktizierte Pädagogik eine solche ist, die den dadurch bedingten erzieherischen Ansprüchen der Kinder (bis in den Bereich des Therapeutischen hinein) gerecht werden könnte. So relativiert sich für uns das Problem und Phänomen „Behinderung“ außerordentlich. Wir erfahren es als eine überdimensioniert grosse, in allen Farben schillernde Seifenblase, die bewusstseinsmäßig in dem Moment zerplatzt, wo man sich vom Charakter der Aussonderung und Segregierung, der Diskriminierung und Stigmatisierung entsprechend klassifizierter Kinder entfernt und sich wieder der Gemeinschaft der altersgleichen[51] Kinder im Kindergartenbereich und in ihrem regulären Lebensumfeld zuwendet.
Wir sind uns sehr bald alle einstimmig darüber klar geworden, dass jede einzelne Maßnahme im organisatorischen, pädagogischen und therapeutischen Umfeld unseres Vorhabens auch dann in der gleichen Weise gerechtfertigt gewesen wäre, wenn nie ein behindertes Kind das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besucht hätte. Diese Einsicht ist für uns alle eine der zentralsten und bedeutendsten, die wir aus dem gesamten Vorhaben ableiten können, wenngleich eine, die wir in dieser Form zu machen zuvor nie geglaubt und erwartet hätten.
Allerdings ist auch nicht zu übersehen, dass die gegenwärtige Diskussion um die Integration bei der Inflationierung des Begriffes es dennoch sehr deutlich erforderlich macht, aufzuzeigen, dass im Rahmen unseres Vorhabens, wie das grundsätzlich bei der Erklärung unseres Verständnisses von Integration im 1. Kapitel dieses Berichtes ausgeführt wurde, kein Kind von diesem Vorhaben ausgeschlossen wird, ganz unabhängig davon, welcher Art und wie schwer die medizinisch, psychologisch, pädagogisch oder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu konstatierende Behinderung auch sei.
In strenger Unterscheidung zwischen Behinderung und Krankheit[52] können wir sagen, dass kein behindertes Kind von der integrativen Erziehung im Kindergarten ausgeschlossen wird. Würde nur eines wegen Art oder Schweregrad seiner Behinderung nicht aufgenommen, wäre die gesamte Integration aus unserer Sicht eine Lüge oder ein Alibi auf dem Hintergrund völlig anderer Motive. Wäre ein Kind allerdings so sehr erkrankt, dass der Besuch des Kindergartens seine Krankheit verschlimmern oder seine Genesung verhindern würde, so wäre es selbstverständlich nicht verantwortbar, für die Dauer einer solchen Erkrankung nicht anderen Maßnahmen den Vorrang einzuräumen, nur, dies hat mit dem Problem und der Frage der Behinderung eines Kindes nichts zu tun. Wer eine Sondereinrichtung und sei es eine Gruppe oder eine Einrichtung für schwerstmehrfachbehinderte Kinder besuchen kann, kann auch den integriert arbeitenden Kindergarten besuchen. Das bedeutet für uns konkret, dass auch ein sogenanntes „Liegekind“, stünde es in unserem Einzugsbereich für das KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde bzw. der St. Georg Gemeinde an, selbstverständlich eines unserer Kinder im Kindergarten wäre, wie dies ab Kindergartenjahresbeginn 1984/85 auch in Bezug auf ein Kind der Fall sein wird.
Um uns aber nicht dem Vorwurf auszusetzen, zu verschleiern, welche Kinder den Kindergarten besuchen, und dann, was wir schon erfahren mussten, zu hören, dass wir doch nur so genannte „Edelbehinderte“ aufnehmen, möchte ich darauf verweisen, dass die behinderten Kinder des KTHs, die mit dem nächsten Schuljahr im Rahmen des Schulversuches an einer Grundschule gefördert[53] werden können, bezogen auf das bremische sonderschulische Angebot z. B. die Schule für Lernbehinderte, die Schule für Körperbehinderte, die Schule für Geistigbehinderte, die Schule für Sprachbehinderte und die Schule für Entwicklungsgestörte (gegebenenfalls dort die Klassen für autistische Kinder) besuchen würden.
- 73 -
Nun spielen in der internen Diskussion um die Klärung förderdiagnostischer Fragen, wie z.B. das momentane Entwicklungs- und Handlungsniveau eines Kindes einzuschätzen ist bzw. welches für ein bestimmtes Kind die „nächste Zone seiner Entwicklung“ auf der Basis seiner momentan „dominierenden Tätigkeit“ ist, aber auch Begriffe eine Rolle, die im Rahmen medizinisch neurologischer Betrachtung einer Beeinträchtigung verwendet werden. Wir sehen darin eine Erleichterung des Austausches in entsprechenden Fachgesprächen und mit entsprechenden Fachleuten, mit denen wir zusammenarbeiten (z.B. das Kinderzentrum, behandelnde Ärzte, Psychologen, die früher mit den Kindern tätig waren) in dem Sinne, dass wir mit den entsprechenden Kategorien kennzeichnen, welcher Art die Bedingungen sind, die die Entwicklung eines Kindes derart beeinträchtigen, dass eine Behinderung konstatiert wurde; wir bezeichnen damit, was ein Kind „be“-hindert und nicht, wie es ist. In dieser Form der Verkürzung der Aussagen darüber, was besonders negative Bedingungen für die Entwicklung bei einigen unserer Kinder sind, können wir von frühkindlich sensorischer Deprivation, von Beeinträchtigungen der Wahrnehmungstätigkeit mit der Qualität und Intensität von Autismus, von beeinträchtiger sensorischer und motorischer Integration, von zerebellarer Ataxie, von Tetraplegie und Athetose, von Down Syndrom und schließlich auch von den heute in der Diskussion äußerst fragwürdigen Begriffen wie MCD (minimale cerebrale Dysfunktion) und hyperkinetischem Syndrom, aber auch von Anfallsleiden und fast allen Formen sprachlicher Beeinträchtigung sprechen (31).
Zur Verdeutlichung, wie auch im Schriftverkehr versucht wir, die Entwicklung der Kinder und ihren spezifischen Erziehungs- und Bildungsbedarf zu beschreiben, ohne sie gleichzeitig damit zu klassifizieren, zu katalogisieren und abzustempeln, können auszugsweise zwei Schreiben dienen, die wir im Rahmen des Aufnahmeverfahrens für den integrativen Schulversuch an den Senator für Bildung richteten. Aus beiden Berichten, die exemplarisch hier wiedergegeben werden sollen, selbstverständlich ohne die Benennung der personenbezogenen Daten, wird darüber hinaus deutlich, wie sich die Gruppenleiterinnen der Kinder in Zusammenarbeit mit dem StützpädagogInnen darum bemühen, eine angemessene Mitteilungsform zu finden, wie gleichzeitig daraus deutlich wird, wie die Kinder sich im Laufe des Vorhabens bis zum Dezember 1983, zu dem die Schreiben verfasst wurden, entwickelt haben. Bei intensiver Lektüre verdeutlichen die Schreiben mehr als lange Ausführungen darüber, wie wir versuchen, den Kindern in der Benennung ihrer Entwicklung gerecht zu werden.
„Entwicklungsbericht K.:
1. Allgemeine Personalangaben
K. wurde am --.--.1976 als zweites Kind der Eltern ... geboren. K. hat noch einen älteren Bruder, geb. --.--.1973.
K. wurde im August 1982 in das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde aufgenommen. Zuvor besuchte K. den Sonderkindergarten der Hans-Wendt-Stiftung (seit Herbst 1980).
2. Allgemeiner Überblick von der Aufnahme bis heute
K. wurde in das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde und dort in die erste Integrationsgruppe aufgenommen. Diese wurde zunächst von zehn nach dem BSHG als behindert bezeichneten Kindern und sechs sogenannten nichtbehinderten Kindern besucht. Sie wurden betreut von einer Erzieherin, einer Praktikantin, einem Zivildienstleistenden und der Stützpädagogin. Stundenweise kamen hinzu: zwei Krankengymnastinnen mit zusammen 16 Stunden und eine Pädagogin für die rhythmisch musikalische Erziehung mit 6 Stunden, um Hilfe und Förderung im Rahmen der Gruppensituation für einzelne Kinder zu geben und die Mitarbeiter anzuleiten.
Ende Februar 1983 wurde K. im Zuge der Ausgliederung der sogenannten behinderten Kinder in andere Gruppen des Kindertagesheimes in eine Gruppe mit 17 sogenannten nichtbehinderten Kindern und 3 sogenannten behinderten Kindern
- 74 -
aufgenommen.
Betreut wurde diese Gruppe von einer Erzieherin und einer Berufpraktikantin. Für die ersten drei Monate kam zusätzlich zur Einarbeitung täglich die Stützpädagogin hinzu. Danach kam die Stützpädagogin tageweise zur Beratung in die Gruppe.
Ab August 1983 wurde die Gruppenstärke auf 18 Kinder reduziert. Betreut wurde diese Gruppe von einer Erzieherin und zwei Vorpraktikanten. Tage-/Wochenweise kommt der Stützpädagoge in die Gruppe.
3. Situation des Kindes in der Gruppe
K.s Beziehungen zu den anderen Gruppenmitgliedern gestaltete sich zunächst hauptsächlich über die Vermittlung ihrer erwachsenen Bezugsperson, auf die K. stark fixiert war und mit deren Hilfe sie schrittweise in der gemeinsamen Tätigkeit zur Auseinandersetzung mit Gegenständen, Sachverhalten und anderen Personen gelangte. K. lernte mit Hilfe verhaltenstherapeutischer Methoden ihre Handlungen als sozial erwünscht bzw. unerwünscht zu unterscheiden. Zugleich lernten die anderen Gruppenmitglieder, K.s Verhaltensweisen einzuschätzen und verstärkt in Kontakt zu K. zu treten. In der Folge gelang es K. immer mehr, von sich aus auf die anderen Kinder der Gruppe zuzugehen, so dass sie zur Zeit überwiegend ohne Hilfe der erwachsenen Bezugsperson Kontakt zu anderen Gruppenmitgliedern aufnehmen kann und mit ihnen zu spielen und zu arbeiten in der Lage ist. Näheren und bevorzugten Kontakt hat K. zu fünf Gruppenmitgliedern.
In ihr bekannten Situationen benötigt K. über die allgemeine Gruppeninstruktion hinaus keine weitere Aufforderung. Veränderungen im Rahmen solcher Situationen sowie ihr vollkommen neuen Situationen kann K. mit Hilfe direkter Ansprache und unterstützenden nonverbalen Kommunikationsformen wie Signale, Gesten, Mimik, Gebärden, die durch die Erzieher bzw. zum Teil auch durch die Kinder gegeben werden, bewältigen. Hier werden dann auch wieder als Hilfe verhaltenstherapeutische Methoden eingesetzt.
K. benötigte anfangs Hilfen bei der Realisierung ihrer Spielwünsche. Sie ist jetzt in der Lage, selbständig einen Spielpartner zu wählen. Sie nimmt Angebote anderer Kinder an und äußert ihre Spielwünsche. Im Rollenspiel übernimmt sie weniger ihr zugewiesene Rollen, sondern spielt ihre eigene Rolle. In neuen oder veränderten Spielsituationen wiederholt sie zunächst die ihr bekannten Elemente und kann dann durch Hilfe (direkte Ansprache, Signale, Gesten, Mimik) der Bezugsperson auch die neuen Elemente aufgreifen und in ihrem Handlungskonzept umsetzen.
K.’s Vorlieben im Kindergartenalltag gelten dem Malen, Bauen, Schminken, Verkleiden, Handpuppenspiel und musikalisch rhythmischen Einheiten.
K.’s Sprachverständnis ist altersgemäß. Sie versteht lautsprachliche Aufforderungen. Sie nimmt lautsprachlichen Kontakt zu Erwachsenen und Kindern auf. Sie spricht in Mehrwortsätzen. K. setzt Sprache als Mittel der Kontaktaufnahme und handlungsbegleitend ein. Zur Klärung und Erörterung von Situationen, Gegenständen, Personen beginnt sie zur Zeit Sprache einzusetzen. Sie verwendet manchmal noch ‚private‘ Wörter, d.h. Silbenaneinanderreihungen.
K. kann auch eindeutige Zeichen, Gesten, Mimik, Gebärden verstehen und kann danach handeln. Sie benutzt diese auch selber und setzt sie kommunikativ ein.
K. kennt alle im Kindertagesheim vorhandenen Einrichtungsgegenstände, das Spielzeug, ihre Bekleidung, die Grundfarben, Gegensätze wie z. B. gross - klein, schwer - leicht, laut - leise, glatt - rauh, süss - sauer und kann diese auch sprachlich benennen. K. kann Objekte zu anderen Objekten, zu anderen Personen, zum Raum und zu Symbolen in Beziehung setzen (z.B. Stecker in Steckdose, Milchkanne leer - neue Milch aus der Küche holen, ihre Klei-
- 75 -
dung an den Kleiderhaken mit ihrem Symbol hängen, entsprechend Kleidung eines anderen Kindes an dessen Kleiderhaken hängen). K. kann einige Oberbegriffe bilden wie z.B. Kleidung, Spielzeug, Obst. Sie fragt nach und erzählt über Objekte, die in der konkreten Situation nicht vorhanden sein müssen.
Die zeitliche und inhaltliche Struktur einer Aufgabe kann K. bei entsprechender Aufbereitung durch den Erzieher erkennen und sich daran orientieren.
Objektmengen bis vier kann sie erkennen und benennen.
K. kann sich ohne Hilfe fortbewegen. K.s Hand- und Armbewegungen sind größtenteils den Eigenschaften und Formen des Gegenstandes und/oder der Aufgabenstellung, dem Vorhaben angepasst. Sie benutzt beide Hände.
In manchen Situationen zeigt und zeigte sie Bewegungsstereotypien wie Zähneknirschen, Augen bohren, Auf der Stelle laufen, Mit den Fingern wedeln, die durch den Erzieher durch eindeutige Zeichen, Gesten und verbale Ansprache im Sinne verhaltenstherapeutischer Maßnahmen beeinflussbar und abbaubar sind.
4. Abschließende, zusammenfassende Gesamteinschätzung
K. hat sich während der bisherigen Kindergartenzeit in den Integrationsgruppen gut entwickelt. Zu Beginn der Kindergartenzeit war sie ein Kind, das auf sich bezogen lebte, ‚passiv‘ am Kindergartengeschehen teilnahm und ausschließlich Kontakt zu Erwachsenen suchte. Durch entsprechend erarbeitete Hilfen für das Kind hat sie sich zu einem kooperativ aufgeschlossenen Kind entwickelt. Sie ist in der Lage, selbständig zu handeln und Kontakt (auch Körperkontakt) zu anderen Kindern aufzunehmen. Sie hat gelernt, Ängste und Bedürfnisse zu verbalisieren. Ihre genaue und sensible Beobachtungsgabe ermöglichen es ihr, Veränderungen und Bewegungen (Gefühlsregungen) abzuschätzen und darauf zu reagieren. Sie kann sich auch an Regeln halten. Anforderungen, die an sie gestellt werden, kann sie bei entsprechender Hilfe einlösen. Ebenso findet sie bei entsprechender Hilfe Zugang zu allen im Kindergartenalltag auftretenden Spiel- und Lernformen.
Um in veränderten Situationen und Anforderungen angemessen sich zu verhalten, benötigt K. spezielle Hilfen in Form von Zeichen, Gesten, Gebärden, eindeutiger Sprache, die im Sinne verhaltenstherapeutischer Maßnahmen eingesetzt werden und dadurch werden Bedingungen geschaffen, unter denen K. lernen kann.“
„Entwicklungsbericht K.
1. Allgemeine Personalangaben
K. wurde am --.--.1977 in Bremen als Kind der Eltern … geboren. K. hat keine Geschwister.
Das Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besucht K. seit dem 09.08.1982. Von März 1982 bis zur Aufnahme wurde sie in einem Kindergarten für Körperbehinderte (Heinrich von Zütphen Haus) betreut. Zuvor besuchte sie bereits einen Spielkreis und wurde von den Frühen Hilfen gefördert.
2. Allgemeiner Überblick von der Aufnahme bis heute
K. wurde im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in die erste Integrationsgruppe aufgenommen. Diese war zunächst mit 10 nach dem BSHG als behindert bezeichneten Kindern und 6 sogenannten nichtbehinderten Kindern besetzt. Sie wurden betreut von einer Erzieherin, einer Praktikantin, einem Zivildienstleistenden und einer Stützpädagogin. Stundenweise kamen zwei Krankengymnastinnen mit zusammen 16 Stunden und eine Pädagogin für die rhythmisch musikalische Erziehung mit 6 Stunden in die Gruppe, um Hilfen und Förderung für einzelne Kinder zu geben und die Mitarbeiter anzuleiten.
Im Zuge der Ausgliederung der sogenannten behinderten Kinder in andere Gruppen des Kindertagesheimes wurde diese Gruppe umstrukturiert. Dieser Prozess vollzog sich im Laufe eines halben Jahres. Danach war die Gruppe mit 15 so
- 76 –
genannten nichtbehinderten und insgesamt 3 sogenannten behinderten Kindern besetzt. Betreut wird diese jetzt entstandene Gruppe von der Erzieherin, einer Berufspraktikantin und einem Zivildienstleistenden. Tage- /wochenweise kommt der Stützpädagoge und einen Tag in der Woche die Krankengymnastin mit in die Gruppe.
3. Situation des Kindes in der Gruppe
K. hat innerhalb der Gruppe eine sehr positive Beziehung zu den anderen Kindern aufgebaut. Nach dem ersten Kennenlernen haben die Kinder K. gerne in ihr Spiel mit einbezogen, haben Hilfen, die für K. nötig sind, mit übernommen und haben gelernt, K.s Handicaps zu akzeptieren. Zu Erwachsenen nimmt K. von sich aus Kontakt auf durch Gestik, Mimik oder einzelne Worte, zu anderen Kindern mit Hilfe von Erwachsenen oder Kindern. Bevorzugten Kontakt hat K. zu vier Kindern in der Gruppe. Sie spielt längere Zeit mit anderen Kindern und ohne erwachsene Bezugsperson.
Bei Fragen an die Gruppe, deren Beantwortung mit einem Ein- bis Zweiwortsatz möglich ist, ist K. in der Lage, diese sprachlich zu beantworten. Mit Hilfe von Erwachsenen kann K. bei Fragen, die eine differenziertere Antwort verlangen, ihre Meinungen, Interessen und Wünsche deutlich machen. K. versteht die verbale Lautsprache und handelt mit funktionellen Hilfen folgerichtig. Im allgemeinen Gruppenprozess eingesetzte nonverbale Kommunikationsform (Zeichen, Gestik, Mimik, Gebärden) versteht K. Sie benutzt diese Form der Kommunikation im Austausch mit Kindern und Erwachsenen.
K. kennt alle im Kindertagesheim vorhandenen Einrichtungsgegenstände, das Spielzeug, ihre Bekleidung, die Grundfarben, Gegensätze wie z.B. laut – leise, süss – sauer, gross – klein, kalt – warm und kann diese auch sprachlich benennen. K. kann Gleichheiten und Unterschiede erkennen. Sie kann Objekte zu anderen Objekten, zu anderen Personen, zum Raum und zu Symbolen in Beziehung setzen (z.B. Geschirr auf den Tisch, Zahnbürste in den Zahnputzbecher, zum Tisch abwischen Eimer mit Wasser aus dem Waschraum holen, Handtuch an den Haken mit ihrem Symbol hängen, Servietten, die mit den Symbolen der Kinder gekennzeichnet sind, an die entsprechenden Kinder verteilen). K. kann Oberbegriffe bilden wie z.B. Geschirr, Besteck, Kleidung, Tiere, Brot, Spielzeug und bei entsprechender Hilfe des Erziehers diese benennen.
K. ist in der Lage, die zeitliche Struktur des Tagesablaufs zu erkennen und sich daran zu orientieren.
Ohne Hilfen kann sie sich im Raum durch Rollen und Robben auf dem Boden vorwärts bewegen, mit Hilfen durch Kriechen und Gehen. Beim Schieben eines Puppenwagens sind einige Schritte ohne Führungshilfen möglich. Sie trägt dabei Gehschienen. Sie kann auf dem Boden mit Abstützen nach vorne und auf der Rolle alleine sitzen. In der allgemeinen Gruppensituation sitzt sie in einem Spezialstuhl. Wenn K. sich an Gegenständen festhalten kann, steht sie kurze Zeit ohne fremde Hilfe. Ihre Hand- und Armbewegungen sind den Eigenschaften und Formen des Gegenstandes und/oder der Aufgabenstellung, dem Vorhaben teilweise angepasst. Grosse Gegenstände werden mit beiden Händen genommen, kleine Gegenstände mit einer Hand, sehr kleine Dinge werden auch mit der ganzen Hand und nicht mit dem Daumen Zeigefingergriff genommen. Für die Zielrichtung des Greifens sind häufig Führungshilfen notwendig. Ohne Hilfen holt sie bei den Greifbewegungen weit von den Seiten aus und trifft nach einigen zielabweichenden Bewegungen auf den Gegenstand. Sie kann ohne Hilfen mit dem Zeigefinger auf Dinge zeigen, mit der linken Hand Esswaren zum Mund führen. Bei Bewegungsabläufen, in denen Hilfen nötig sind, kann sie Teilbewegungen alleine übernehmen (z.B. beim Anziehen, Ausziehen, Türöffnen, Servietten verteilen).
K. kann feste und halbfeste Speisen essen. Sie hat Mühe, diese mit der Zunge im Mund zu bewegen. Beim Essen von halbfesten Speisen ist ein nach außen gerichteter Zungenstoß zu beobachten. Das Trinken gelingt ihr mit Hilfe mit einem Trinkschlauch. Ihre Probleme in der Mundmotorik haben Auswirkungen auf
- 77 –
die Artikulation beim Sprechen.
K. kann mit Hilfen handeln und interagieren. Probleme machen ihr der wechselnde Muskeltonus, ihre Kopf-Rumpf-Kontrolle, ihre Tendenz, die Beine zu überkreuzen und sich auf Zehenspitzen zu stellen und ihre zielabweichenden Bewegungen. Mit physiotherapeutischen Hilfen kann sie diese Probleme so überwinden, dass sie in der Situation angemessen handeln kann. Zum Verständnis solcher Situationen braucht sie keine besonderen Hilfen.
4. Abschließende, zusammenfassende Gesamteinschätzung
K. hat sich während der bisherigen Kindergartenzeit in den Integrationsgruppen gut entwickelt. Sie hat gelernt, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen deutlich zu machen und durchzusetzen. Sie kann Wünsche und Forderungen anderer Personen annehmen, sich dagegen wehren und sich abgrenzen. Nachdem sie anfänglich hauptsächlich zu einer erwachsenen Bezugsperson Kontakt aufgenommen hatte, nimmt sie die für sie notwendigen Hilfen jetzt von verschiedenen Bezugspersonen an. Sie spielt längere Zeit mit anderen Kindern ohne Unterstützung Erwachsener.
Ihr aktiver Wortschatz hat sich von einzelnen Wörtern zu einer Vielzahl von Wörtern erweitert. Sie kann Ein- bis Zweiwortsätze bilden. Ihre Sprechweise ist verständlicher geworden. Gemeinsam in der Gruppe langsam gesungene und gesprochene Texte singt oder spricht sie weitgehendst mit.
Ihre Bewegungsmöglichkeiten und –fertigkeiten haben sich sehr erweitert. Hilfen konnten teilweise zurückgenommen werden. Einige Handlungen kann sie ohne Hilfen ausführen. Sie hat ihre Bewegungsmöglichkeiten in Bezug zur Umwelt kennen und verbessern gelernt.“
* * *
War unsere Erwartung bezüglich der Behandlung des Vorhabens durch die Eltern eher dahingehend orientiert, dass es mehr den Eltern nichtbehinderter Kinder als den Eltern behinderter Kinder ein Problem sein könnte, die gemeinsame Erziehung anzustreben, so hat sich dieses in dieser pauschalen Erwartungshaltung nicht bestätigt. Einzelgespräche, die sich aus sehr ernst zu nehmende Fragen ergaben, zeigten, dass sowohl Eltern behinderter wie nichtbehinderter Kinder auf der Basis ihres Informationsstandes zu der einen oder anderen Frage in berechtigter Sorge waren. Diese Fragen konnten weitgehend geklärt und schließlich durch die praktische Arbeit für die Eltern selber greifbar veranschaulicht werden. Der von mir als mögliche Reaktion nicht ausgeschlossene Fall, dass es auch Eltern geben könnte, die ihr Kind aus dem Kindertagesheim herausnehmen, wenn behinderte Kinder dort aufgenommen werden, ist nicht eingetreten. Überblicke ich die an mich gerichteten Fragen, so waren die Bedenken einiger Eltern behinderter Kinder grösser als die der Eltern nichtbehinderter Kinder. Dies zeigt zum einen, wie sehr die Eltern behinderter Kinder in der Öffentlichkeit verunsichert werden und wie sehr sie sich an die ihnen einzig angetragenen Möglichkeiten klammern, dass ihrem Kind wirksam nur in Sondereinrichtungen geholfen werden könnte.
Eine vergleichbare Verunsicherung einiger Eltern behinderter Kinder trat erst wieder ein, als zu Beginn dieses Jahres bei einem gemeinsamen Gesamtelternabend von Eltern einer Grundschule und den Eltern des Kindertagesheimes von einem kleinen Kreis der dort anwesenden Elternschaft aus der Grundschule nahezu diffamierende Positionen den Eltern behinderter Kinder gegenüber geäußert wurden. Dieser Abend hat schmerzlich deutlich gemacht, dass nicht primär böser Wille oder böse Absicht Motiv segregierender Einstellungen ist, sondern die in der eigenen Entwicklung nie gemachte Erfahrung des Miteinanders. Auch in Bezug auf die Elternschaft der Grundschule werden letzte Zweifel erst dadurch beseitigt werden können, dass integrativ gearbeitet wird und man nicht durch die Haltung, dass zuerst alle restlos überzeugt und eines verändernden Bewusstseins gegenwärtig sein müssen, ehe man mit Integration beginnen kann, sie stets selbst blockiert.
- 78 -
Auch in Bezug auf die Kooperation mit den Eltern wird nie eine Art Status erreicht sein, auf dessen Grundlage diese Sache schon laufen wird. Eltern scheiden durch den Weggang ihrer Kinder aus, neue Eltern kommen hinzu; was wir aber beobachten können, ist, dass die Tatsache der integrativen pädagogischen Arbeit bereits als selbstverständlich für das KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde angesehen wird. Die Fragen richten sich auf die Weiterentwicklung und nicht auf „alte Zeiten“!
Die Leser des Zwischenberichtes wird vielleicht auch interessieren, wie die Kinder zu Beginn des Vorhabens in die erste Integrationsgruppe des KTHs eingewöhnt oder, nachdem sie bereits Erfahrungen in einer Sondereinrichtung gemacht hatten, sich auf das KTH umgestellt haben. Allein diese Fragen wären umfassender Beschreibungen und Darstellungen würdig. Im Rahmen dieses Berichtes, der auf die konzeptionellen Grundlagen verweisen soll, kann aber auch dieses nur durch exemplarische Hinweise erfolgen.
Am kürzesten ist die Frage nach den Kindern durch die Feststellung beantwortbar, dass die Schwierigkeiten und Probleme, die sich ergaben, auf der Seite der Erwachsenen, der Pädagogen, der Therapeuten und der Eltern oder auf der Seite organisatorischer Zusammenhänge zu suchen und zu finden waren. Die Arbeit mit den Kindern war, auch unter dem Aspekt des zeitweiligen Sonderstatus der ersten Integrationsgruppe und einer dadurch bedingten großen Anzahl behinderter Kinder in einer Gruppe, im Grunde immer erfreulich und gleichzeitig auch eine Quelle für die Kraft der MitarbeiterInnen, ihre Selbstveränderung und die Veränderung ihres pädagogischen Handelns trotz der daraus zwangläufig erst einmal resultierenden Verunsicherung zu bewältigen, wie dies die im Exkurs eingefügten Berichte der MitarbeiterInnen der ersten Integrationsgruppe hinreichend verdeutlichen.
Durch die Konzentration der Arbeit auf die erste Integrationsgruppe konnte dort von Anfang an ein pädagogisches Konzept realisiert werden, das den Kindern eine relativ leichte und schnelle Einstellung auf ihr neues Lebensumfeld und auf die neuen Beziehungen untereinander wie zu den MitarbeiterInnen des Hauses ermöglichte. Größere Schwierigkeiten der Eingewöhnung gab es z.B. mit einem sogenannten nichtbehinderten Jungen, der uns für eine gewisse Zeit vor grosse pädagogische Probleme stellte, zumal die an ihm beobachtbaren Schwierigkeiten, sich von zu Hause abzulösen und sich in diesem neuen Lebensumfeld von Gruppe und Kindergarten zu orientieren, in der erzieherischen Einstellung und Haltung seiner Eltern ihm gegenüber wurzelten. Erst die Bearbeitung dieser Problematik löste den Konflikt des Kindes, so dass diese Problematik weit mehr auf der Ebene der Beratung der Eltern bewältigt werden konnte und musste als durch spezielle pädagogische und therapeutische Angebote an das Kind, was wir in vielen Fällen erfahren haben.
Eine zweite sehr wichtige und bedeutende Erfahrung aus unserer Arbeit war in diesem Zusammenhang, dass, was wir an den sogenannten behinderten Kindern als „ihre Behinderung“ wahrnahmen, für die nichtbehinderten Kinder, die mit ihnen konfrontiert wurden, völlig unerheblich war. So interessierte in einer Anfangsphase z.B. der Stuhl mit Sitzschale und kleinen Rollen darunter, der von einem Mädchen benutzt werden musste (der Vater konstruierte diese Sitz- und Fortbewegungsmöglichkeit, so dass wir im Gruppenraum auf einen Rollstuhl verzichten konnten), oder dessen Beinschienen weit mehr als die doch sehr erhebliche Bewegungsbeeinträchtigung des Kindes selbst. Nachdem die Kinder die speziellen Hilfsmittel, derer dieses Mädchen bedarf, hinreichend kennengelernt und nachdem sie sich selbst den Umgang mit diesen Sitz- und Fortbewegungsmöglichkeiten erobert hatten, war und blieb dieses „Besondere“ für die Kinder etwas, das eben zu ihrer Altersgenossin genauso gehört, wie dass jemand z.B. einen roten Pullover oder ein anderes Kleidungsstück trägt.
Verhindert man nicht, was jede segregierende Erziehung tut, dass die nichtbehinderten Kinder mit dem behinderten Kind und seiner Lebensweise wie umgekehrt das behinderte Kind mit der Lebensweise der anderen auf ihre Weise Erfahrung sammeln können, wurde also dieser Rahmen der „Normalität“ in der wechselseitigen Beziehung der Kinder nicht durch ein verqueres Bewusstsein der Erwachsenen gestört, wurde das, was für uns als „Besonderes“ oder als „Behinderung“ an einem
- 79 -
Menschen erscheint, eben als in die Identität dieses Menschen integriert wahrgenommen, so dass die nichtbehinderten Kinder ihrerseits eine Identität ausbildeten, in die der für uns Behinderte und seine Hilfsmittel integriert sind.[54]
Erzieherische Einflussnahme war allerdings notwendig, um den nichtbehinderten Kindern zu vermitteln, dass sie die behinderten Kinder nicht mit Hilfestellungen und anderen fürsorglichen Maßnahmen überschütteten. Sie imitierten einfach die Funktion des Zivildienstleistenden, des Therapeuten oder des Stützpädagogen und übernahmen derart ganz selbstverständlich viele Aufgaben, die im Rahmen einer Sondereinrichtung Personal über Personal und Therapie über Therapie erforderlich machen würden. Aber die Kinder lernten sehr rasch, dass Hilfe nicht nur etwas ist, das man einem Anderen gegenüber gewährt, sondern dass Hilfe auch etwas ist, das ein Anderer ganz selbstverständlich von einem fordern kann, dass Hilfe etwas ist, über das man sich unterhalten und auseinandersetzen muss. Darauf aufmerksam geworden, gelang es recht bald, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass das Angebot der Hilfe nicht damit identisch ist, sie auch sofort durchzuführen, sondern das behinderte Kind erst zu fragen ist, ob die angebotene Hilfe auch mit seinen Bedürfnissen übereinstimmt, wie die behinderten Kinder ihrerseits lernten, nicht irgendeiner Hilfe zu harren, was sie zum Teil aus ihrer Behandlung in den Sondereinrichtungen heraus gewöhnt waren, sondern Hilfe zu fordern und in einer Art und Weise zu verlangen, wie es den Bedürfnissen des Behinderten entspricht und nicht, wie es für die Erwachsenen oder die Gruppe erst einmal einfacher wäre. Dies gelang, obwohl erhebliche Kommunikationsschwierigkeiten zu bewältigen waren, sei es dadurch, dass ein Kind durch seine Bewegungsbeeinträchtigung kaum oder nur sehr unverständlich sich artikulieren konnte oder ein anderes Kind noch nicht sprach. Die im Gruppenalltag von Pädagogen und Therapeuten verwendeten Kommunikationstechniken, die Gebärden und Signale für bestimmte Tätigkeiten einschlossen, wurden von den Kindern in ihre Kommunikation übernommen, so dass kein Kind von aktiver Kommunikation dem Verständnis einer an es gerichteten Ansprache ausgeschlossen blieb.
In Absage an ein Modell mussten wir entsprechend der [vorhandenen; GF] Raumgröße auch mit sehr grossen Kinderzahlen pro Gruppe zu recht kommen. 20 Kinder besuchen eine Gruppe, wovon 2 Plätze meist als Notplätze im Laufe des Kindergartenjahres belegt worden sind. Eine solche Gruppenstärke ist unter Berücksichtigung der sozialen Kompetenzen, die ein 3-jähriges Kind zu Beginn seiner Kindergartenzeit mitbringt, aber auch aus der Perspektive eines 6-jährigen zu gross, unabhängig davon, ob noch behinderte Kinder eine solche Gruppe besuchen.
Wir erzielten das Einverständnis, die Notplätze nicht mehr zu belegen, so dass wenigstens in einigen Gruppen die Obergrenze von 18 Kindern nicht mehr überschritten zu werden brauchte. Zu grosse Gruppenstärken im Kindergarten schränken von vornherein die Entwicklungsbedingungen [aller; GF] ein und verstärken bereits angebahnte negative Verhaltensweisen, die von individueller Durchsetzung bis hin zu massiver Aggressivität reichen. Auf der Basis einer sehr klaren Strukturierung des Kindergartenalltags und einer entsprechenden Strukturierung der pädagogischen Einheiten innerhalb dieses Alltages wie z.B. durch Morgenkreis, Frühstück, gezielte Aktivität, Freispiel und Mittagessen konnten dennoch sehr stabile soziale Strukturen aufgebaut werden. Die Enge des Raumes macht mehrmals täglich, je nach Erfordernissen der einzelnen Aktivitäten, das Umstellen von Stühlen und Tischen und anderen Einrichtungsgegenständen erforderlich. Während dieses geschieht, sind einige Kinder z.B. im Waschraum mit anderen Aufgaben beschäftigt, während wieder andere bei den Umräumungsarbeiten behilflich sind. Auch wenn es aus den Zwängen der Situation heraus oft notwendig wird, abzuwarten, bis eine neue Aktivität angefangen werden kann, gerät dies weder zum Chaos noch zu einer Art Leerlauf, der, wie früher beobachtbar, durch die Kinder mit apathischem Rückzug oder durch aggressive und destruktive Auseinandersetzungen gefüllt wurde. Sind dann alle z.B. wieder im Stuhlkreis versammelt, ermöglicht die Rückerinnerung an die bereits im Morgenkreis auf diese Aktivität hin erfolgte Orientierung schnell die Konzentration auf das nächste Teilvorhaben.
- 80 -
Im ersten Teil wurde verdeutlicht, dass Integration gemeinsame Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand bedeutet, d.h., dass kein Kind von einer anstehenden Tätigkeit ausgeschlossen wird. Will man nun z.B. bei einer rhythmischen Übung mit einem schwer bewegungsbeeinträchtigten Kind nicht für dieses handeln, sondern mit ihm, benötigt es, um von seinem Platz aufzustehen, bestimmte Bewegungen durchzuführen und wieder zu seinem Platz zurückzukehren, viel mehr Zeit als ein anderes Kind. Üblicherweise schreibt man Drei- bis Sechsjährigen nur eine sehr kurze Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne zu und denkt, dass sich die anderen Kinder in solchen Situationen langweilen, sich von der Aufgabe entfernen oder sich mit sonstigen Dingen beschäftigen, während die für alle geltende Übung unter therapeutischer Führung mit dem bewegungsbeeinträchtigten Kind stattfindet. Aber auch diese Erwartung, die wir Erwachsenen in die Kinder hineintragen, wird enttäuscht. Es ist für die Kinder selbstverständlich, dass, was sie selbst in 30 Sekunden erledigen, einen anderen 40 Sekunden und wieder einen anderen vielleicht 2½ Minuten kostet, ohne dass dies durch besonderen erzieherischen Aufwand hätte an die Kinder herangetragen werden müssen. Es gab keine Buhrufe, man hörte kein „oh wie ist der lahm“ oder andere Kommentare. Es wurde auch nicht in Wettkampfstimmung angefeuert: „Nun mach doch schneller!“ Im Gegenteil: Die Kinder verfolgen gespannt, wie das der oder die eine oder andere machen und freuen sich über das Gelingen. Von Beobachtern, die ähnliches in ihrer eigenen Tätigkeit noch nicht erfahren haben und nur kurz Einblick in unsere Arbeit nehmen, wird oft vermutet, dass die Kinder auf solche Verhaltensweisen „dressiert“ worden wären. Abgesehen davon, dass dieser Begriff recht missbräuchlich verwendet wird, zeigt dies, dass Verhaltensweisen bei Kindern, die sich im Rahmen unserer Arbeit selbstverständlich ergeben, in anderen pädagogischen Zusammenhängen und in anderen Organisationsformen der pädagogischen Arbeit wohl durch viel erzieherischen Druck, durch Drohungen und Sanktionen erzwungen werden müssen oder aber, man verzichtet auf den Aufbau solcher Verhaltensweisen ganz und hält ein chaotisches Durcheinander der Kinder, destruktive und aggressive Auseinandersetzungen und einen Geräuschpegel, der, misst man ihn, an die Schmerzgrenze reicht und krankmachenden Charakter entfaltet, für das „normale“ Verhalten 3- bis 6-jähriger Kinder. Dass hierbei die eigene pädagogische Unfähigkeit und falsche pädagogische Organisationsformen und Zielsetzungen gerade solche Fähigkeiten von Kindern zerstören, die man zwar als im Laufe des Lebens für richtig ansieht, bleibt undiskutiert. Schließlich hält man die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Konzentration für etwas, das der eine Mensch hat und der andere eben nicht, weil keine hinreichenden entwicklungspsychologischen Grundkenntnisse vorhanden sind, die vermitteln könnten, dass Aufmerksamkeit und Konzentration nichts anderes sind als die Fähigkeit zur selbständigen Strukturierung und Steuerung der eigenen Handlung, weshalb sie hohen emanzipatorischen Wert haben und pädagogisch gesehen ein hohes Maß an Fremdkontrolle von aussen verzichtbar machen.
Ich greife solche Beispiele auf, um exemplarisch zu verdeutlichen, dass Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Kindern meist nicht da aufgetreten sind, wo man sie aus der Sicht seiner bisherigen pädagogischen Praxis erwartet hätte. Dass viele der von uns praktizierten Arbeitsformen und der von den Kindern dargestellten Verhaltensweisen einer autoritären und restriktiven wie sanktionierenden Form der Pädagogik zugerechnet werden, geschieht meist durch Personen, die genau eine solche Pädagogik praktizieren (ohne sich dessen bewusst zu sein) und die im Glauben, dass das aggressiv destruktive und chaotische Verhaltensweisen der Kinder ein altersgemäßes sei und es nicht als Produkt ihrer (meist noch für fortschrittlich gehaltenen) Pädagogik erkennen.
Schließlich erkennen wir auch an den behinderten Kindern die Entwicklung von Verhaltensweisen, die man unter dem begrenzenden Blickwinkel auf verschiedene Behinderungsarten oder auf dem Hintergrund der als Sonderpädagoge/in in Sondereinrichtungen gewonnenen Erfahrung weitgehend für unmöglich hält. Wenige Wochen der Arbeit in einer integrativen Gruppe haben unsere Auffassung bestätigt, dass viele verhaltensmäßige Probleme, die einer Behinderung bzw. einer behinderten Person zugeschrieben werden, dadurch entstehen, dass Behinderte in Sondereinrichtungen zusammengefasst und ihrer natürlichen Lebens- und Lernumwelt und
- 81 -
den entsprechenden sozialen Bezügen entfremdet werden. In nach Behinderungsarten und zum Teil noch nach Schweregrade der Behinderung differenzierten Sondereinrichtungen hat das Kind immer nur ein Gegenüber, das in denselben Bereichen beeinträchtigt ist, wie es selbst. Der Körperbehinderte unter Körperbehinderten, der Geistigbehinderte unter Geistigbehinderten, der Autist unter Autisten, Blinde unter Blinden, Gehörlose unter Gehörlosen haben immer nur das, was wir als Behinderung bezeichnen, zum Lernmodell für sich selbst und sind in anderen Interaktionen zum einen nur auf Erwachsene und zum anderen nur auf die Fachkräfte verwiesen. Auf diesem Hintergrund und im Rahmen des sozialen Ausschlusses kann nur als Modell genommen und reproduziert werden, was den Betroffenen selbst in diese Situation gebracht hat - die Behinderung.
Im regulären Lebens und Lernumfeld hat jedes Kind im anderen vielfältige Lernmodelle, vielfältige Formen der Ansprache, vielfältige Möglichkeiten an Lösungsstrategien, mit einem Problem umzugehen, eine Situation zu bewältigen. Die für bestimmte Behinderungen als typisch gehaltenen Verhaltensweisen, die man in den speziellen Sondereinrichtungen für bestimmte Behinderung massenweise beobachten kann, treten bei unseren Kindern überhaupt nicht in Erscheinung. So hat der Beobachter oft das Gefühl, dass diese „Normalität“ im Verhalten der Kinder entweder eine Ausnahme sei, die sie noch nicht erlebt hätten, oder aber auf eine besonders leichte Art der Behinderung zurückzuführen sei. Oft muss man dann mit Hilfe von Videosequenzen aus dem Beginn unserer Arbeit oder mit Berichten aus der Zeit, zu der wir die Kinder erstmals in den Sondereinrichtungen kennenlernten, in denen sie zuvor waren, diese Annahmen in das rechte Licht rücken. Beobachte ich Kinder vergleichbarer Behinderungsarten und Schweregrade in Sondereinrichtungen oder ziehe ich meine Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen heran, wird mir in Bezug auf die Erfahrungen, die wir im Rahmen unseres Vorhabens machen können, nicht nur der Sinn der Aussage von Gal‘perin, dass „der Mensch nicht auf die individuelle Erfahrung beschränkt ist“, sondern dass er „sich die gesellschaftliche Erfahrung jener sozialen Gruppe aneignet, in der er erzogen wird und in der er lebt, und dass er diese nutzt“, überdeutlich, sondern auch darüber hinaus klar, weshalb Kinder unterschiedlichster Behinderungsarten, wenn ihre reguläre Lebensumwelt auch zu ihrer Lernumwelt wird, genauso die ihrer Umwelt entsprechen Verhaltensweisen aufbauen, wie dies dieselben behinderten Kinder tun würden, wären sie in einer Sondereinrichtung. Sie würden uns entsprechend den Erwartungen, die man an die Population einer solchen Einrichtung richtet, so erscheinen, dass es uns glauben macht, sie müssen unbedingt da sein, wo sie sind, nämlich in einer Sondereinrichtung. Es ist geradezu ein Zeichen der Lernfähigkeit, ja im engeren Sinne der Intelligenz behinderter Kinder, dass sie sich unter Behinderten in Sondereinrichtungen immer behinderter zu verhalten lernen, wie es für ihre Intelligenz spricht, dass sie in einer regulären Lebens- und Lernumwelt in adaptativer Weise ihr Verhaltensweisen „normalisieren“ d.h. sich situationsadäquat verhalten lernen.
Eine Sorge, mit der wir besonders von Seiten der Eltern, aber durchaus auch von Seiten der PädagogInnen und SonderpädagogInnen anderer Einrichtungen konfrontiert wurden, ist die, dass nun in umgekehrter Weise doch auch die nichtbehinderten Kinder die Verhaltensweisen der behinderten Kinder übernehmen könnten. Diese Erfahrung konnten wir vergleichsweise wie die, von denen eben berichtet wurde, nicht machen und schon auch aus theoretischen Gründen im Vorhinein nicht bestätigen.
Zum einen kann man davon ausgehen, dass in der Regel bei einem integrativen Vorhaben unter den von uns beschriebenen Bedingungen die behinderten Kinder in einem Verhältnis 1:10 zu den nichtbehinderten Kindern in einer Einrichtung sein werden. Ist eine Einrichtung durchintegriert, so sind in einer Gruppe von 18 bis 20 Kindern 2 bis maximal 3 behinderte Kinder. Die Behinderungen der Kinder variieren nun aber wiederum über alle Behinderungsarten und Schweregrade der Behinderung. Damit treten unter dem Aspekt des Prinzips der Regionalisierung der integrativen Arbeit behinderte Kinder nie in einer solchen Massierung auf,
- 82 -
wie wir das von unseren Erfahrungen bezüglich der Sondereinrichtungen her erwarten, so dass die adaptative Imitation der Verhaltensweisen eines behinderten Kindes in dem befürchteten Sinne überhaupt nicht auftreten wird. Ahmen dennoch nichtbehinderte Kinder ein behindertes Kind nach, so können wir dieses nur richtig im Zusammenhang damit interpretieren, dass wir uns bewusst machen, auf welchem individuellen Entwicklungsniveau die jeweiligen nichtbehinderten Kinder stehen. Für Kinder des Kindergartenalters sind Nachahmungen und darauf aufbauend das Spiel und Rollenspiel die „dominierende Tätigkeit“, durch die die nächste Stufe ihrer Entwicklung wesentlich vorbereitet wird. Entsprechend sind Nachahmung und Spiel für die Kinder Mittel und Werkzeuge, mit den aus der Umwelt zu gewinnenden Erfahrungen umzugehen und Probleme und Konflikte zu lösen. In diesem Zusammenhang hat die Nachahmung eines behinderten Kindes durch ein nichtbehindertes eine völlig andere Qualität als die, die wir damit verbinden, wenn wir befürchten, dass nun auch die Nichtbehinderten „verrückt“ spielen könnten. Selbst unter den Bedingungen der ersten Integrationsgruppe, in der die nichtbehinderten Kinder in der Minderzahl waren, ergab sich nur in Bezug auf ein Kind eine Problematik, die uns besondere Überlegungen in dieser Sache abverlangt hat.
Ein zuvor unauffälliges, gut in die Gruppe integrierte Kind begann plötzlich sich sehr passiv zu verhalten und erforderte alle Hilfestellungen, wie wir sie einem schwerer bewegungsbeeinträchtigten Kind zuteil werden lassen mussten. Als sich dieses nach einer gewissen Zeit nicht normalisierte, sondern sogar noch steigerte, beschäftigten wir uns damit im Rahmen unserer Dienstbesprechungen und wurden in der Folge darauf aufmerksam, dass dieses Kind eine in einem bestimmten Bereich äußerst leistungsorientierte Schwester hatte, die mit ihren Erfolgen den Anforderungen durch die Eltern gerade genügen konnte, und dass die Eltern diese Anforderungen auf die weitaus jüngere Schwester übertrugen und ihre Zuwendung zu den Kindern in Relation zur Erfüllung oder Nichterfüllung der Leistungsanforderung dosierten. Dieses Mädchen, das in der Gruppe die Erfahrung machte, dass behinderte Kinder, die vergleichbare Leistungsanforderungen, denen sie sich selbst immer ausgesetzt sah, nicht zu erbringen hatten und trotzdem ein hohes Maß an Zuwendung von allen in der Gruppe erhielten, wählte den Weg in die Rolle eines behinderten Kindes, was ihrem Entwicklungsniveau, ihre Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt dominierend über die Tätigkeit des Spiels zu regulieren, genau entsprach.
Nachdem uns dieser Sachverhalt klar geworden war und eine entsprechende Beratung der Eltern erfolgen konnte, verloren sich diese Verhaltensweisen des Kindes langsam wieder, ohne dass es für uns Anlass zu Dramatisierungen oder besonderer pädagogischer oder therapeutischer Maßnahmen geworden wäre, obwohl die Eltern bezüglich der durch ihr Kind erfahrenen Verhaltensweisen noch lange verunsichert blieben.
Auch aus diesem Beispiel wird deutlich, dass behinderte Kinder in einer Gruppe für nichtbehinderte im Grunde überhaupt kein Problem sind, sondern sich allenfalls bei inadäquaten erzieherischen Einstellungen und Haltungen und Leistungsanforderungen an ein Kind dieser Umstand zum Anlass werden kann, den Konflikt zu artikulieren, was für ein nichtbehindertes Kind dann den Vorteil hat, dass in seiner Entwicklungslinie dadurch keine „Brüche“ oder „Ich-Lücken“, „Regressionen“ und „Fixierungen“ entstehen, die die Entwicklung gefährden könnten, sondern von den Kindern Signale an uns gegeben werden, die uns auf ihre Situation aufmerksam machen. Das setzt allerdings voraus, dass wir diese Form der Interaktion und Kommunikation der Kinder richtig verstehen können, was von einer/m Pädagogin/en verlangt, eine adäquate Persönlichkeitstheorie als Werkzeug der Analyse solcher Phänomene zur Verfügung zu haben, was erst einmal in unserem integrativen Vorhaben durch die Fortbildung und durch die ständige Mitarbeit der/s Stützpädagogin/en im Haus erreicht werden konnte, und solange wesentlich durch ihn zu leisten ist, bis diese seine Qualifikation im Sinne des beschriebenen Kompetenztransfers sozusagen eine allgemeine Kompetenz aller MitarbeiterInnen geworden ist.
- 83 -
Während meiner Studienaufenthalte in Ländern, die bereits längere Erfahrungen in der integrativen pädagogischen Arbeit hatten, und bei den dort erfolgten Einblicken in unterschiedlichste Einrichtungen vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter, habe ich in der Regel recht frohe und aufgeschlossene und sich in unterschiedlichsten Situationen sehr souverän verhaltende behinderte Menschen gesehen; souverän und kompetent auch im Umgang mit Nichtbehinderten, wie ich dies trotz all meiner Bemühungen in den Sondereinrichtungen, in denen ich selbst gearbeitet habe, nur annähernd und da meist nur, wenn wir z.B. weit ab von der Institution in Schullandheimen waren, erreichen konnte. Im Rahmen unserer integrativen Kindergartenarbeit finde ich nun mehr und mehr diese lockeren, frohen und souverän sich verhaltenden Kinder wieder.
Die Kinder zeigen uns auch, dass die durch unsere Kindergartenarbeit angelegte Integration sich auch draußen bewährt und tragfähige soziale Realität ist. Es gehört heute zum täglichen Leben und Erleben der behinderten Kinder, die zuvor quer durch die Stadt in Sondereinrichtungen gefahren wurden oder mit Beginn des Kindergartenalters dorthin hätten gehen müssen und die zuvor weder von den Kindern ihrer engeren Nachbarschaft wussten noch mit ihnen Kontakt hatten, dass sie oft schon am Morgen im Kindergarten miteinander aushandeln, wer bei wem zu Hause schlafen darf. So machen die Eltern der behinderten Kinder Erfahrungen mit anderen nichtbehinderten Kindern und die Eltern der nichtbehinderten Kinder die Erfahrung, ein behindertes Kind in ihrer Familie zu haben. Dabei wird auch von Eltern der nichtbehinderten Kinder immer wieder eingestanden, dass es ihnen Schwierigkeiten bereitet, die Zeit zu planen, in der ein behindertes Kind in ihrer Familie sein würde, vor allem wie sie mit diesem umzugehen hätten. Oft haben sie das einfach ihren eigenen nichtbehinderten Kindern abgeschaut oder diese haben schlichtweg ihre Eltern darüber belehrt. Dadurch sind die Kinder wieder zu einem wesentlichen Erziehungsfaktor für ihre Eltern und für deren Einstellungen und Haltungen und deren Handlungskompetenz behinderten Menschen gegenüber geworben.
Es war von vornherein unsere Einstellung gewesen, dass unser Vorhaben in keiner Weise „gegen“ die Eltern, aber auch nicht „für“ die Eltern gemacht werden kann; sondern nur mit den Eltern.
Indem dieses als grundsätzliche Einstellung vorgestellt wird, muss aber unmittelbar auch gesagt werden, dass die ungeheueren Anstrengungen, die uns das Vorhaben abverlangt hat, und die Bedingungen, unter denen es realisiert werden musste, oft nicht sensibel genug sein ließen für die Bedürfnisse der Eltern und deren Fragen, die oft nicht direkt ausgesprochen wurden, so dass wir sie unter dem Druck der Arbeit und der primären Orientierung an unseren pädagogischen Aufgaben nicht hinreichend wahrnahmen und erst dann darauf aufmerksam wurden, wenn Eltern uns unvermittelt ansprachen oder ab und zu eine konfliktreichere Spannung auftrat. Gerade aber in diesen Fällen erwies sich, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern trotz eines aufgenommenen Konfliktes bereits tragfähig genug war, dass dieser ohne Schöntuerei und Schönfärberei auf den Tisch gebracht und offen ausdiskutiert werden konnte.
Soweit das aus unserer Sicht beurteilbar ist, haben die Eltern inzwischen die Integration zu ihrer eigenen Sache gemacht, was sich in der Forderung und im Einsatz der Elternschaft in Bezug auf die Fortsetzung des Vorhabens in die Grundschule hinein in der Öffentlichkeit wie in den entsprechenden Verhandlungen in Gremien deutlich zeigte. Der Antrag der Eltern der behinderten Kinder auf Einschulung in die Grundschule wurde vom Gesamtelternrat des Kindertagesheimes getragen. Schon im Statut und Konzept des Kindertagesheimes vom Februar 1981 heißt es: „Elternarbeit heißt für uns: Mitdenken, Mitbestimmen, aber auch Mitarbeiten.“ (33). Um diese Form der Elternarbeit zu realisieren, sind Elterngespräche, Hausbesuche, Gruppenelternabende, Gesamtelternabende, der Elternrat
- 84 -
und Elternmitarbeit vorgesehen, zu denen Veranstaltungen wie Seminare, Feste, Bastelabende und -nachmittage, Ausflüge, Freizeiten und die praktische Arbeit im KTH (z.B. zur Spielplatzverbesserung) hinzukommen. Die Eltern werden über alle Maßnahmen organisatorischer und pädagogischer Art nicht nur informiert, sondern auch an Entscheidungs- und Durchführungsprozessen beteiligt. Die Hospitation der Eltern und die Teilnahme am Gruppengeschehen sind selbstverständlich. Auf Gruppenelternabenden wird über die Arbeit in der Gruppe berichtet und über die weitere Planung informiert sowie Vorschläge der Eltern und deren Kritik aufgenommen und bearbeitet. Außerdem werden auf den Gruppenelternabenden, allgemeine Erziehungsfragen angesprochen und eventuelle Schwierigkeiten und deren Lösungen diskutiert. Bei Ausflügen, Freizeiten und Schwimmen ist die Mitarbeit der Eltern längst selbstverständlich geworden.
Das Integrationsvorhaben traf auf eine weitgehend aktive und an dieser Frage interessierte Elternschaft. Auf Gruppenelternabenden des KTHs und in Gemeindelternabenden wurde im kleineren Kreis die Frage der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im KTH diskutiert, in Einzelgesprächen und auf den sog. „Klön-Abenden“ vertieft und schließlich im Rahmen der Gesamtelternabende über den engeren Kreis der Elternschaft hinaus allen Interessierten zugänglich gemacht.
Aus der Sicht der Schwierigkeiten, die sich in den zentralen Sondereinrichtungen ergeben, Elternarbeit sinnvoll und wirksam zu betreiben, erscheint dieses im Rahmen der integrativen Arbeit als völlig problemlos. Allein durch die zentrale und weit vom Wohnort der Eltern entfernte Lage der Sondereinrichtungen wie auch dadurch, dass die Eltern der Kinder der Sondereinrichtungen ihrerseits wieder flächenmäßig sehr weit voneinander entfernt wohnen und arbeiten, verhindert von vornherein entsprechend soziale Kontakte, so dass die Elternarbeit auf den relativ dienstlichen und entfremdeten Rahmen der Sondereinrichtung begrenzt bleibt und sich weitgehend auf das Formal-juristische beschränkt; oft triff man sich nur ein- bis zweimal im Jahr, wählt die Elternvertreter und ansonsten kommt es kaum zu Aktivitäten, wird dafür nicht ein erheblicher Aufwand von Seiten der Eltern wie von Seiten der Mitarbeiter einer Einrichtung betrieben.
Anders ist dies im Rahmen des Vorhabens integrativer Erziehung. Morgens zu Beginn der Kindergartenarbeit wie am Nachmittag nach deren Ende kommen die Eltern oder Familienmitglieder, um die Kinder zu bringen und abzuholen. So ergibt sich auf ganz natürliche Weise zweimal am Tag die Möglichkeit, das eine oder andere Mitglied der Familie zu sprechen, von ihm zu hören, wie es zu Hause so geht, welche Freuden und Schwierigkeiten sich dort ergeben, wie umgekehrt die Mitarbeiter darüber berichten können, was tagsüber abgelaufen ist, welche Vorhaben anstehen oder welche gerade erst aufgetauchten Schwierigkeiten im Rahmen eines schnell zusammen gerufenen Elterntreffens beraten und geklärt werden müssen. Dadurch haben sich enge Beziehungen zwischen den Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder ergeben. Viele erfuhren erst durch das Treffen im Kindergarten davon, dass im selben Wohnblock mit ihnen auch ein behindertes Kind mit seiner Familie zu Hause ist. So werden wechselseitige Besuche der Kinder ausserhalb der Kindergartenzeit, an den Wochenenden und in der Freizeit selbstverständlich. Da wir von vornherein auch für die Eltern behinderter Kinder keine Fahrmöglichkeiten eingerichtet haben, weil dies der Normalisierung der Lebenssituation der Betroffenen völlig widersprechen würde, hat sich auch sehr schnell im Rahmen nachbarschaftlicher Hilfe ergeben, dass es im Grunde kein besonderes Problem ist, die Kinder zum Kindergarten zu bringen und wieder zu holen.
Traten dennoch grössere Probleme auf, wie dies z.B. bei einem Kind der Fall war, dem es auf dem Hintergrund der Gewöhnung an die täglich weite Busfahrt in eine genau am anderen Ende der Stadt gelegene Einrichtung und eine es erheblich in seinen Wahrnehmungskapazitäten beeinträchtigenden Störung seiner sensorischen Integration sehr schwer fiel, zu Fuß die ihm vertraute Wohnung zu verlassen und sich auf den Weg zum Kindergarten zu begeben. Hatte es schon zuvor große Schwierigkeiten am Morgen beim Aufstehen bis zum Abholen gegeben, so
- 85 -
setzten sich diese nun auf den Weg hinaus fort. Das Kind warf sich unterwegs schreiend auf den Boden, verweigerte das weitere Mitgehen und begann, sich zu entkleiden, warf die Schuhe weg und kam erst wieder zur Ruhe, wenn es im KTH (einer wiederum für es stabilen und vertrauten Umgebung) angekommen war. Das Kind konnte für sich die Bedeutung des Weges als eine Verbindung zwischen der vertrauten Wohnung und dem wiederum vertrauten Kindergarten nicht erschließen und sah sich so unterwegs einer für es subjektiv sinnlosen Situation ausgesetzt, die zusätzlich durch Reize und Einflüsse gekennzeichnet war, in denen sich das Kind nicht zu orientieren vermochte.

Regelkindergarten bedeutet Förderung von Kindern aus dem unmittelbaren Wohngebiet. Hier erhalten Kinder und Eltern die Möglichkeit durch gemeinsames Bringen und Abholen der Kinder aus dem Kindertagesheim Nachbarschaftskontakte aufzubauen.
In diesem Fall übernahm es die Stützpädagogin, morgens, vor Beginn des Kindergartenalltags, das Kind in der Familie zu besuchen, die Eltern hinsichtlich der Gestaltung des Aufstehens und des Fertigmachens für den Weg in den Kindergarten zu beraten und schließlich mit dem Kind den Weg zu bewältigen, indem ihm Einzelheiten des Weges erklärt und das Gehen mit einfachen Liedchen, die dem Kind aus dem Kinderalltag bekannt waren, begleitet wurde. Nach kurzer Zeit wurde die Mutter in diesen Lernprozess einbezogen, sie übernahm die kleinen Hilfestellungen, die mit dem Kind erarbeitet wurden, und die Stützpädagogin hielt sich nach und nach mehr im Hintergrund, bis der Weg von Mutter und Kind in gleicher Weise problemlos bewältigt werden konnte und das Kind angstfrei im Kindergarten eintraf.
An diesem kleinen Beispiel soll wiederum nur exemplarisch verdeutlicht werden, dass integrative Erziehungsarbeit weder an der Tür zum Gruppenraum noch an der Tür zum Kindergarten beginnt oder endet, sondern dort stattzufinden hat, wo die Kinder und ihre Eltern leben und wo sich die Probleme stellen. Nur unter Berücksichtigung dieses Umfeldes kann auch die integrative Erziehungsarbeit in der Gruppe sinnvoll sein und zu den Erfolgen führen, die mit den ausgebrachten Zielen partizipiert werden.
- 86 -
In Anbetracht der großen Kinderzahl, denn solche speziellen Hilfen waren und sind nie nur auf behinderte Kinder begrenzt geblieben, konnten wir aber auch solchen Anliegen oft nicht in dem gebotenen Umfang entsprechen. Die Schwierigkeiten, in die viele Familien zum Teil auch durch die zunehmende Arbeitslosigkeit, aber auch schon durch eine zuvor bestehende gravierende soziale Benachteiligung geraten sind, machten es immer wieder erforderlich, hinsichtlich entsprechender familientherapeutischer Beratung und Hilfen andere Organisationen in Anspruch zu nehmen, mit denen wir eng kooperieren.

Die Nöte und Schwierigkeiten, die uns aus der einen oder anderen Familie offenbart wurden, sind leider nicht Einzelfälle oder extreme Ausnahmen, sondern die Spitze eines Eisberges, dessen Größe man anhand seiner an der Oberfläche sichtbaren Masse nur ahnen kann. Wie sehr die finanziellen und sozialen Probleme der einzelnen Familie und der Grad der Zerstörung der Persönlichkeit des einen oder anderen Elternteils sich auf die Entwicklung der Kinder auswirkt, ohne dass die Eltern die Chance wirksamer finanzieller, sozialer und familientherapeutischer Beratung und Unterstützung haben, müssten den verantwortlichen Familien- und Sozialpolitikern buchstäblich die Haare zu Berge stehen lassen, würden sie davon nur einmal objektiv Kenntnis nehmen.
Es geht mit diesem Bericht nicht darum, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie man mit falscher und lüsterner Neugier und einer grossen Tendenz zur Verharmlosung sagt, sondern aus der Sicht der gewonnenen Erfahrung einen eindeutigen Appell auch an den Senator für Soziales, Jugend und Sport, Herrn Dr. Scherff, zu richten, der wie der Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst am ehesten dazu gezwungen werden könnte, den Ausverkauf der Sozial- und Bildungspolitik des Landes mit zu betreiben, was die Finanznöte des Landes Bremen nur scheinbar reduziert. Jeder Abstrich in der Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik bedeutet Flickwerk, das auf ein paar Jahre hochgerechnet größere Defizite schafft, als man mit diesem Flickwerk im Moment abtragen kann; abgesehen davon, dass die Lebenssituation der Menschen in ihren Familien und die Entwicklungschancen der Kinder noch unwürdiger werden und noch mehr gefährdet sind als zuvor. Würden allein die Finanzmittel, derer wir für eine legitime integrative Erziehungsarbeit bedürfen, reduziert, würde damit ein Maß an Prävention vor drohender Behinderung und Reduktion bereits eingetretener Behinderung wie auch die Beratung der Eltern der Kinder entfallen und dadurch Behinderungen entste-
- 87 -
hen, die in ein paar Jahren mit einem Vielfachen an finanziellem Aufwand nicht mehr bereinigt, sondern allenfalls im Sinne des Erhaltens eines Status quo konsolidiert werden können.
Integrative Arbeit reicht auch unter dem Aspekt der Zusammenarbeit mit den Eltern bis in den Kern der gesellschaftspolitischen Verhältnisse hinein. Auch hier können wir nicht für die Eltern sprechen, sondern nur mit ihnen und uns ihnen darin solidarisch gegenüber erweisen, dass wir ihre Anliegen, ihren Kindern angemessenere und qualitativ bessere Erziehungs- und Bildungsangebote zusichern, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und Kräfte unterstützen. Was die Eltern im Rahmen integrativer Erziehung bewegt, können sie nur selbst hinreichend zutreffend artikulieren. Die nachfolgenden Berichte von zwei Müttern sprechen diesbezüglich in gleicher Weise für sich selbst wie für unsere gemeinsame Sache. Sie schreiben:
„K. hat eine spastische Athetose und kam im Alter von 4 Jahren in einen Kindergarten für körperbehinderte Kinder.
Als wir erfuhren, dass hier im KTH nun auch behinderte Kinder aufgenommen werden, waren wir noch sehr skeptisch diesem Vorhaben gegenüber, weil wir nicht sicher waren, inwieweit sich Möglichkeiten für K., die ja doch speziellere Förderung als andere Kinder benötigt, verwirklichen sollten. Wir hatten anfangs auch das Gefühl, dass K. durch ihr ‚Handicap‘ im Regelkindergarten unter nichtbehinderten Kindern zu kurz kommen würde. Dazu kam noch die Angst, inwieweit die Eltern nichtbehinderter Kinder sich dem Vorhaben gegenüber verhalten würden. Nach langem Hin und Her und Für und Wider entschlossen wir uns vor einem Jahr dann doch zu dem Wechsel vom Sonderkindergarten in das KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde.

Gemeinsames Bringen und Abholen ermöglicht private Kontakte der Eltern und Kinder untereinander, bedeutet soziale Sicherheit durch das Gefühl der Annahme als eigenständige Persönlichkeit und nicht die Reduzierung auf den Defekt sowohl für Eltern als auch für das Kind.
- 88 -
Jetzt – nach einjähriger Praxis – sind all unsere Ängste und unsere Unsicherheit verschwunden. K. zeigt uns jeden Tag, wie viel Spass und Freude ihr das Spielen mit ihren Freunden aus der Nachbarschaft im Kindergarten bereitet, und es spiegelt sich aus ihrem Gesicht und aus den Gesichtern der „anderen“ Kinder wider, dass es für sie untereinander keinen Unterschied macht, ob nun einer nicht laufen, nicht sprechen oder sonst etwas kann, sondern dass sie sehr viel schneller und unkomplizierter als wir Erwachsenen den Gegebenheiten gegenüber stehen. Die „gesunden“ Kinder haben sich schnell damit abgefunden, dass eben manche Kinder anders sind als sie und trotzdem wiederum genauso empfinden wie sie selbst; mal sind sie traurig oder fröhlich und durchaus liebenswert wie alle anderen auch. Dass K. von den anderen Kindern profitiert, ist gar keine Frage aber auch die anderen Kinder freuen sich mit ihr, wenn ihr mal etwas gelungen ist, was ihr im allgemeinen vielleicht große Schwierigkeiten bereitet wie z. B. das Festhalten eines Gegenstandes oder das Aussprechen eines Wortes und und und ...
Endlich haben wir Eltern auch mal die Möglichkeit, uns untereinander kennenzulernen, was im Sonderkindergarten so gut wie unmöglich war, da die Kinder aus den unterschiedlichsten Stadtteilen kamen. Wir Mütter gehen gemeinsam mit den Kindern ins KTH und hierbei kommt man auch gerne mal ins „Schnacken“. Es wird über alles Mögliche geplaudert, und ich als Mutter von K. fühle mich überhaupt nicht mehr als etwas Besonderes. Man spricht nicht ständig von Behinderungen und ihrer Problematik, sondern von ganz alltäglichen Dingen.
Es finden ca. alle vier Wochen Elternabende statt, an denen wir über den Gruppenablauf informiert werden oder auch über spezielle Sachen reden können. Zudem kommen noch unsere sogenannten „Klönabende“, die auch ca. in 4- bis 6-wöchentlichen Abständen stattfinden. Dort haben wir die Möglichkeit – wenn wir wollen – uns privat ein bisschen näher zu kommen. Es wird da oft sehr lustig, und es haben sich auch schon kleine Freundschaften gebildet. Man trifft sich außerdem einfach beim Spazierengehen, beim Einkaufen oder auch mal zum Kaffeetrinken. Durch diesen Kontakt fühlen wir uns akzeptiert und verstanden, und die Eltern der nichtbehinderten Kinder haben ihre Unnahbarkeit oder ihre Hemmschwelle uns gegenüber stark bis ganz abgebaut. Ein Stückchen Normalität hat sich auch in unserem Alltag breitgemacht.
Um noch einmal auf K. zurückzukommen, so ist vielleicht noch erwähnenswert, dass sie sehr grosse Fortschritte in sich als Persönlichkeit gemacht hat. Sie weiss, dass sie Grenzen hat – aber sie lernt sich damit auseinanderzusetzen. Um das vielleicht noch mehr zu konkretisieren: Selbstbewusster, nicht mehr passiv verhalten, versuchen sich bemerkbar zu machen, wenn ihr was nicht gefällt, Eigenständigkeit auszudrücken – aber auch zu erfahren: die anderen sind auch noch da, also nicht immer im Mittelpunkt stehen, auch mal ‚einstecken‘ müssen.
Die anderen Kinder geben ihr das Gefühl, ernst genommen zu werden und in alles mit einbezogen werden zu können. Rücksicht und Verständnis. Oder Forderung: Du kannst das auch!
Im Moment findet auch noch etwas sehr Wichtiges bei ihr statt, nämlich die Lösung von mir als Mutter. Meistens bin ich ja stets in greifbarer Nähe, und nun kommt von K. die Reaktion, dass sie mir zu verstehen gibt: Mama nicht! Das heisst, die Kinder haben mit K. abgesprochen, dass sie nach dem Kindergarten noch zum Spielen mit nach Hause gehen soll. Dann geht sie ohne Trennungsangst von mir mit anderen Müttern und deren Kind nach Hause. Sie hat erfahren, Vertrauen zu haben. Das ist eben auch noch ein grosser Pluspunkt, dass sich die Kinder am Nachmittag auch noch treffen oder draussen spielen können.
Besondere Hilfen sind natürlich für ein körperbehindertes Kind schon erforderlich. Die Krankengymnastin vermittelt uns und den Mitarbeitern in der Gruppe, wie und wo wir K. Hilfen geben können, in welcher Haltung wir ihr
- 89 -
am besten beim Essen, Spielen usw. helfen können. Auch Übungen werden durchgeführt und wenn die anderen Kinder mitmachen wollen, so können sie es tun, denn K. wird nicht gesondert in einem Raum ‚behandelt‘. Alles findet in einem Gruppenraum statt. Ich habe beobachtet, dass nichtbehinderte Kinder ihr helfen bei gewissen Greifsituationen – ohne K. dazu zu bevormunden. Sie wird gefragt, und es wird eine Antwort erwartet. Diese Reaktionen sind spontan da, nicht etwa den nichtbehinderten Kindern ‚andressiert‘.
Zum Schluss möchten wir Eltern hier erwähnen, dass wir heute sehr froh sind, diesen Wechsel gewagt zu haben. Doch je näher die Frage der Einschulung rückt, desto mehr schleicht sich auch wieder ein wenig Angst ein. Denn wir möchten K. ersparen, dass sie nach all dem Normalen nun wieder etwas Besonderes wird, dann nämlich, wenn sie wieder in eine Sonderschule muss. Diese wäre für sie die Schule für Körperbehinderte in Bremen-Nord. Das würde bedeuten, dass sie wieder mit einem Sonderbus von zuhause abgeholt werden müsste und einen langen Weg dorthin gefahren und wieder zurückgebracht werden muss. Um ihr das zu ersparen, müssten wir als Familie unseren Wohnort und unsere gewohnte Umgebung wechseln, um in die Nähe der Schule zu ziehen.
Alles, was wir uns aufgebaut haben an familiären und freundschaftlichen Kontakten, würde zwangsläufig auseinander gerissen, und wir müssten wieder ganz neu anfangen, was für eine Familie mit einem behinderten Kind auch heute noch immer nicht sehr einfach ist. Damit wären wir dann wieder in die Nähe der gesellschaftlichen Randgruppen gerückt.
Die Behinderung ist zu akzeptieren und ist das kleinere Übel ... .“
gez.: N.N.

„D. ist jetzt vier Jahre alt und lebt seit 1½ Jahren bei seinem Vater und mir. Bis Oktober 1982 hat er alleine mit seiner Mutter gelebt. Dort hatte er so gut wie gar keine Kontakte zu anderen Kindern. Dementsprechend ängstlich und schüchtern waren seine ersten Kontakte mit Kindern seines Alters. Was selbstbewusstes Auftreten und eigenständiges Spielen betrifft, war er den Kindern weit unterlegen und „hielt“ sich zu gerne an die „Großen“.
Da wir beide berufstätig waren, kam D. gleich in den Kindergarten, und zwar in die Halbtaggruppe des KTH. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ging er ganz gerne hin, behielt aber doch seine typischen Verhaltensweisen bei. Auf
- 90 -
unser Betreiben konnte D. Ostern 1983 in die erste Integrationsgruppe im Kindergarten aufgenommen werden. Es hat sich in dem vergangenen Jahr viel getan, D. hat inzwischen ein Selbstbewusstsein erlangt, das dem anderer Kinder in nichts nachsteht. Dies drückt sich sowohl im Umgang mit Erwachsenen aus, wie auch gegenüber anderen Kindern. Er kann seine Wünsche durchsetzen, und sucht sich gezielt Spielpartner aus. Mit seinen Freunden und Freundinnen, kann er alleine spielen, lädt sie nach seinen Bedürfnissen ein und kann auch Konflikte mit ihnen bewältigen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass gezielt darauf geachtet wurde, dass sich D. nicht an die ‚Grossen‘ im Kindergarten hängt und sein Selbstbewusstsein durch Erfolgserlebnisse gestutzt wurde, was in der Halbtagsgruppe nicht geleistet wurde. Durch die integrative Arbeit bekommt D. Anregungen zur Entwicklung seiner Kreativität, sein Wissensstand erweitert sich ständig; z.B. erzählte er mir neulich, wie ich nun Kaminchenbraten zubereiten sollte.
D.s Verhalten gegenüber den „behinderten“ Kindern ist nicht anders als zu den anderen. Er hat sich nie besonders dazu geäußert. Er lädt die Kinder gerne ein und besucht sie, wodurch auch wir Kontakte zu den Eltern bekommen haben, die über bloße Randgespräche hinausgehen. Wenn er z.B. mit S., die ihm bewegungsmäßig und sprachlich unterlegen ist, oder mit J., die ihm in nichts nachsteht, spielt, ist das kein Unterschied. Er kann mit beiden zusammen bauen oder toben, aber auch streiten. Wo nötig, nimmt er Rücksicht und hilft, aber so etwas wie Mitleid ist nie angeklungen.
Auf diese Erfahrungen im Kindergarten führen wir auch zurück, dass er mit seiner kleinen Schwester (9 Monate) keine erkennbaren Schwierigkeiten hat. Er hat es von Anfang an als selbstverständlich aufgenommen, dass sie mehr Hilfe als er braucht und beteiligt sich auch daran an.“
gez.: N.N.
Im Rahmen dieses Berichtes wurde schon wiederholt auf einzelne Aspekte und Aufgaben des Stützpädagogen verwiesen. Ihm kommt im Rahmen unserer Konzeption der gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Regeleinrichtungen eine zentrale Funktion zu, die wir in gleicher Weise für ähnliche Vorhaben auch im Bereich der Regelschule für unverzichtbar und als einen zentralen Bestandteil einer legitimen Integration erachten.
Mit dem von uns gewählten Begriff des „Stützpädagogen“, mit dem sich in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit weder eine gesetzlich verankerte, noch im Rahmen eines Berufsbildes beschriebene Funktion verbindet, bezeichnen wir eine behindertenpädagogisch qualifizierte Fachkraft, deren Qualifikationsniveau
-
den medizinischen und neuropsychologischen Bereich,
-
den pädagogisch-diagnostischen Bereich (Förderdiagnostik)
-
den pädagogisch-didaktischen Bereich (Lernzielanalyse, Sachstruktur- und Handlungsstrukturanalyse) und
-
den pädagogisch-methodisch/therapeutischen Bereich (lernpsychologische und psychotherapeutische Aspekte)
umfassen muss, wozu eine universitäre Ausbildung unverzichtbar ist, die mit einem Staatsexamen bzw. einem Diplom in Behindertenpädagogik abschließt. Allerdings erscheint uns auch hier eine im traditionellen Verständnis erworbene heil- und sonderpädagogische Ausbildung nicht hinreichend, die von vornherein die Studierenden auf zwei Behinderungsarten festlegt und keine therapeutische Ausbildung beinhaltet.[55] Zusätzlich wäre es wünschenswert, wenn Berufserfahrungen im Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik bei der betroffenen Person vorlägen.
- 91 -
Diese Forderungen werden insbesondere jenen, die sich mit der entsprechenden Vergütung nach BAT II A zu befassen haben, überzogen erscheinen. Wir halten indessen auf dem Hintergrund unsrer Erfahrungen das hier kurz anskizzierte Qualifikationsniveau für unverzichtbar. Bei integrativen Maßnahmen in Regeleinrichtungen muss deutlich erkannt werden, dass sämtliche in Regeleinrichtungen arbeitenden Mitarbeitern, deren Qualifikationsniveau im besten Falle das des Sozialpädagogen erreicht (selbst wenn während des Studiums eine schwerpunktmäßige Befassung mit Heil- und Sonderpädagogik möglich gewesen sein sollte) für die zu leistenden Aufgaben nicht hinreichend qualifiziert sind, um den spezifischen Erziehungs- und Bildungsbedarf z.B. der die Einrichtung besuchenden behinderten Kinder zu garantieren, wie im Rahmen der Erzieher- und Sozialpädagogenausbildung auch keine hinreichende Diagnostik und Didaktik gelehrt wird, in denen eine Person, die in einer integrativen Einrichtung mitarbeitet, kompetent sein muss.[56] Von diesen Anforderungen her gesehen, sind im Grunde auch schon die Aufgaben, die dem „Stützpädagogen“ in der integriert arbeitenden Einrichtung zukommen, skizziert. Kurz aufgelistet geht es darum,
-
in kompetenter Weise mit Medizinern, Psychologen und Therapeuten, die mit einem behinderten Kind befasst sind oder die mit einem behinderten Kind zu befassen sind, Informationen auszutauschen, die Ergebnisse daraus in den Förderungsplan des Kindes einzubeziehen und die Eltern und anderen Mitarbeiter entsprechend zu beraten,
-
sowohl für die behinderten wie nichtbehinderten Kinder im Sinne einer Förderungsdiagnostik[57] herauszuarbeiten, welches Entwicklungsniveau die Kinder erreicht haben, wie ihre momentane Handlungskompetenz in der Auseinandersetzung mit der dinglichen und personellen Umwelt und das Niveau ihrer dominierenden Tätigkeit zu beschreiben ist,
-
festzustellen, welches für die Kinder die jeweils nächste Zone ihrer Entwicklung darstellt,
-
welche Erziehungs- und Lernziele für ein Kind zu formulieren sind und
-
durch welche Projekte, Vorhaben, Themen, Inhalte o.a. diese Ziele so zu erreichen sind, dass die Kinder im Rahmen gemeinsamer Vorhaben kooperativ zusammenwirken können und sich als kompetente Gruppenmitglieder unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Entwicklungsniveaus erfahren können;
-
die entsprechenden Methoden herauszuarbeiten und in Anwendung zu bringen, spezielle Hilfen zu entwickeln und, sofern dies erforderlich ist, den therapeutischen Bedarf zu erkennen und im Bereich sprachheilpädagogischer und psychotherapeutischer Aufgaben weitgehend auch selbst zu übernehmen und zu bewältigen.
Darüber hinaus
-
koordiniert der Stützpädagoge das sich aus den Pädagogen und Therapeuten und den weiteren Mitarbeitern (z.B. Zivildienstleistende u./o.) zusammensetzende Team,
-
er berät sowohl Mitarbeiter wie Eltern in Einzelfragen und
-
leitet durch seine konkrete Mitarbeit in der Gruppe und durch die Übernahme spezieller pädagogisch-therapeutischer Aufgaben einzelnen Kindern gegenüber alle Mitarbeitenden an.
Dem Stützpädagogen kommt auf diesem Hintergrund auch die Funktion ständiger Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterschaft vor Ort und in der täglichen Arbeit wie aber auch darüber hinaus in hausinternen Fortbildungsveranstaltungen zu.
In Kenntnis der Gruppenprozesse beteiligt er sich (bzw. leitet er an) an der Gestaltung des Gruppen-/Kindergartenalltages, an der Ausarbeitung allgemeiner und spezieller Hilfen, an der Klärung von Fragen der Diagnostik, der didaktischen Planung und Gestaltung der Gruppenarbeit sowie an der Kombination von
- 92 -
Einzelförderung und Gruppenförderung wie an der Integration der Therapie in den gesamtpädagogischen Prozess.
Im Sinne seiner Supervisionsaufgabe berät er die Mitarbeiter nicht nur und ist auch nicht nur auf die Vermittlung von Hilfen begrenzt, sondern hat eine Aufgabe darin, ihre Gefühle im Umgang mit den Kindern bewusst werden zu lassen, um Grundlagen zu schaffen, gegebenenfalls entsprechende Haltungen und erzieherische Einstellungen und Handlungsweisen neu zu überdenken und Hilfen in deren Veränderung zu gewähren, was erforderlich macht, dass der Stützpädagoge gleichzeitig auch eine Person integren Vertrauens ist.
Der Stützpädagoge ist entsprechend an der Elternarbeit beteiligt und leitet die Erstellung von Berichten über den Entwicklungsstand der Kinder für andere Institutionen, für Ärzte, die Eltern o.a. an, bzw. er hilft in der Erklärung vorliegender Berichte gegenüber den Mitarbeitern wie den Eltern.
Integrativ arbeitende Einrichtungen stehen derzeit im öffentlichen Blickfeld. Mit größerem Bekanntheitsgrad einer Einrichtung mehren sich die Anfragen nach Hospitationen. Obwohl diese nach Möglichkeit gewährt werden sollten, bedeutet eine Hospitation mehr, als dass man Gästen nur die beobachtende Teilnahme am Gruppengeschehen ermöglicht. Es darf nicht versäumt werden, die Besucher über die Konzeption der Einrichtung sowie über die Grundlagen und Hintergründe der in der Hospitation konkret beobachteten Situationen zu informieren, Dies bedeutet auch für den Stützpädagogen eine weitere Komponente seines Arbeitsfeldes, das gegebenenfalls in Koordination und Kooperation mit der Leitung eines Kindertagesheimes bis zur Vertretung derselben nach aussen reicht.
Selbstverständlich gehört die Teilnahme an Ausschusssitzungen des Trägers, die durch ihre Beschlüsse auch Rückwirkungen auf die pädagogischen Möglichkeiten des Arbeitens im Kindertagesheim haben, zu seinen Aufgaben. Im Rahmen trägerübergreifender Treffen, Veranstaltungen u.a. zur Integration fällt ihm oft die Aufgabe zu, über den aktuellen Stand der Entwicklung und die weiteren Vorhaben zu berichten, wie umgekehrt im Rahmen von Dienstbesprechungen u.a. wiederum den Mitarbeitern im Hause selbst alle erforderlichen Informationen zukommen zu lassen.
Es erscheint erforderlich, sowohl das Qualifikationsniveau wie das Aufgabenfeld des Stützpädagogen in dieser Weise zu umschreiben, weil derzeit schon in Anlehnung an unsere Terminologie verschiedene Stützpädagogen-Modelle praktiziert werden, die mit dem von uns Gemeinten nichts zu tun haben, sondern eher geeignet sind, ein Alibi für integrative Maßnahmen ohne hinreichende diagnostische, pädagogische, methodische und therapeutische Qualität abzugeben. So wird in manchen Einrichtungen Bremens einfach eine zusätzliche sozialpädagogische Kraft, die fest in einer Gruppe mitarbeitet, als Stützpädagoge bezeichnet, ohne dass sie, wie wir dies unverzichtbar für erforderlich halten, eine entsprechende Qualifikation mit einbringen kann oder die hier aufgezeigten Aufgabenfelder abdecken könnte.
Was die Finanzierung des Stützpädagogen betrifft, so dürfen sich Träger in keiner Weise von der Einstellung eines entsprechend qualifizierten Mitarbeiters abbringen lassen, auch wenn darauf verwiesen wird, dass weder Jugendhilfegesetz noch BSHG einen Mitarbeiter vom anskizzierten Qualifikationsniveau vorsehen. Es ist hier deutlich zu machen, dass die integrative Erziehung noch nicht reales Faktum gewesen war, als diese Gesetzeswerke entstanden sind, nach denen die Förderung von durch Behinderung bedrohter bzw. behinderter Kinder und Jugendlicher geleistet wird. Die schon an anderer Stelle erwähnten Gesetzesinitiativen müssen für die Integration in Regeleinrichtungen auch den Stützpädagogen in entsprechender Weise aufnehmen. Die von mir erfahrene Faktizität des Entwicklungsstandes der pädagogischen Praxis im Bereich der Kindergärten hat einen entsprechenden Mitarbeiter ohnehin mehr als notwendig.
Es muss hier auch deutlich die Frage gestellt werden, ob sich die Ausbildungsstätten für Erzieher weiterhin noch um die qualifizierte Behandlung der angesprochenen Aufgabenfelder, wie sie dem Stützpädagogen abverlangt werden müssen,
- 93 -
drücken und darauf beharren können, dass ein Schwerpunkt mit heil- und sonderpädagogischen Fragestellungen angeboten würde. Entsprechende Vorgaben für den Aufbau einer behindertenpädagogischen Qualifikation auf sozialpädagogischem Niveau liegen bereits vor (34). Erzieher und Sozialpädagogen müssen zukünftig dringlicher denn je propädeutisch auf Fragen der Integration und Behindertenpädagogik in ihrer ersten Ausbildung vorbereitet werden.
Entsprechend den anskizzierten Aufgabenbereichen des Stützpädagogen ist er im Kindertagesheim gruppenübergreifend tätig. Das bedeutet allerdings nicht, dass sein Arbeitsplatz irgendeine Form von Büro oder eine Art von Therapieraum wäre; er arbeitet in den Gruppen und im Team mit den MitarbeiterInnen und Kindern. Er ist dabei aber keiner Gruppe als sog. feste Kraft zugeordnet und kann auch nicht auf den Personalschlüssel der Einrichtung im engeren Sinne angerechnet werden. In Fällen, die das dringend erforderlich machen, muss er aus seinem mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeiteten Zeitplan, nach dem er regelmässig teils eine Woche, dann wiederum teils tageweise (aber nie kürzer) in die einzelnen Gruppen kommt, auch einmal aussteigen können, um in einer anderen Gruppe entsprechende Hilfestellungen geben zu können.
Im Laufe der Entwicklung eines integrativen Vorhabens verändern sich auch die Schwerpunkte der Arbeit des Stützpädagogen, wenngleich alle genannten Aufgabenbereiche sein Arbeitsfeld definieren. Unter dem Aspekt der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens ist der Stützpädagoge auch mit dem Aufgabenfeld dieser Funktion betraut und ein wichtiger Ansprechpartner für die Weiterentwicklung des gesamten Vorhabens. Schließlich kommt ihm, anfänglich selbst im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung in diese Arbeit eingeführt, auch die Aufgabe zu, im Rahmen der Ausweitung der integrativen Erziehung auf andere Kindertagesheime die dort tätig werdenden Stützpädagogen auf ihre Aufgaben vorzubereiten und einzuarbeiten.
Eine zentrale Frage ist auch die nach dem stundenmäßigen Umfang des Einsatzes der Stützpädagogen. Unsere Erfahrungen (auch im Zusammenhang mit der Ausweitung der Integration auf einen Nachbarkindergarten) haben gezeigt, dass ein unteres Minimum des Einsatzes eines Stützpädagogen 20 Stunden beträgt, auch wenn zu Beginn einer integrativen Maßnahme nur ein oder zwei leichter behinderte Kinder zur Aufnahme anstehen würden. Die Vielfalt der Aufgaben und insbesondere die Fort- und Ausbildung der Mitarbeiter und die Erstellung und Realisierung der pädagogischen Konzeption erfordern diesen zeitlichen Einsatz als ein Minimum. Darüber hinaus sollte der zeitliche Umfang des Einsatzes nicht an irgendeinem Richt- oder Normwert festgemacht werden, sondern tatsächlich nach Erfordernis unter Berücksichtigung der Anzahl behinderter Kinder einer Einrichtung und deren Arten und Schweregrade von Behinderungen erfolgen. So arbeitet derzeit (wie von Beginn des Vorhabens an) ein Stützpädagoge mit 40 Stunden im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde bei derzeit 12 behinderten Kindern. Obwohl zum kommenden Kindergartenjahr im Sommer 1984 die ersten behinderten Kinder die Einrichtung verlassen, um zur Schule zu gehen, und durch die neu aufzunehmenden Kinder sich die Anzahl der behinderten Kinder nur um eines erhöht, wird ab dem kommenden Kindergartenjahr im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde ein zweiter Stützpädagoge mit weiteren 40 Stunden eingesetzt werden müssen, da dies aus Sicht des erhöhten Erziehungsbedarfs der aufzunehmenden Kinder bei einer sehr schweren Behinderung erforderlich wird.
Auf diesem Hintergrund gehen unsere Überlegungen dahin, die Stützpädagogen trägerübergreifend in einem Pool zusammen zu fassen und nicht bei den einzelnen KTHs einzustellen. Dies wäre von Vorteil im Hinblick darauf, dass ein effektive Einsatz erfolgen kann, wie der Stützpädagoge durch eine nicht unmittelbar dienstrechtliche Zugehörigkeit zu einem Kindertagesheim dort die vertrauensvolle Position, wie sie im Rahmen seines Aufgabenbereichs beschrieben wurde, leichter wahrnehmen kann, als wenn er dort in direkter dienstlicher Abhängigkeit steht. Das Modell der Bildung eines Stützpädagogen-Pools (das wir auch im Hinblick auf die Therapeuten verfolgen) wäre auch für die Fortführung integrativer Vorhaben in den schulischen Bereich hinein aus unserer Sicht zu praktizieren.
- 94 -
In mancher Phase der Entwicklung des Vorhabens war die Stützpädagogin auch die Initiatorin weiterer Schritte, jene, die ermutigte, wenn ein Mitarbeiter selbst mutlos wurde, aber auch immer wieder Zielpunkt der Projektion der Angst, der Mitarbeiter, die besonders dann aufkeimten, wenn sie sich mit dem Blick zurückgewandt orientierten anstatt auf das anzustrebende Ziel.
In solchen Situationen muss sich der Stützpädagoge als konstruktiv-konfliktfähige Persönlichkeit erweisen, die es auch in schwierigen Situationen und bei Krisen leisten muss, in sachlicher Orientierung die aufgetretenen Konflikte und persönlichen Schwierigkeiten nicht als Angriff auf die eigene Person zu werten, sondern den Mitarbeitern eine neue Perspektive zu ermöglichen, die die Zusammenarbeit wiederum zu versachlichen vermag. Dies ist im Laufe unseres Vorhabens wiederholt gelungen und auch für den weiteren Verlauf nicht auszuschließen.
Um eine Sache wie die der Integration muss auf dem Hintergrund des historischen Gewordenseins unserer gegenwärtigen Situation und in Anbetracht der Eingriffe, die wir gegenwärtig in das Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem erfahren, wie auf dem Hintergrund der individuellen Biographie, die ein jeder im ein solches Vorhaben einbringt, grundsätzlich hart gekämpft werden. Dies gerade auch dann, wenn die Solidarisierung der in einem solchen Vorhaben Arbeitenden nicht dadurch erfolgt, das man sich in verbalen Bekräftigungen eines bestimmten Zieles versichert oder die organisatorischen und pädagogischen Mängel in der Arbeit unter den Teppich kehrt und wenn man sich zu einer klaren Vorstellung von Integration bekennt und nicht bereit ist, ein bestimmtes Niveau der Realisierung dieser Vorstellung zu unterschreiten. Man wird derzeit auch in Kauf nehmen müssen, manches in der Vorbereitungsphase schon weit vorangetriebene Integrationsvorhaben wieder aufzugeben, wenn sich ein solcher Konsens nicht herstellen lässt. Jede angefangene und gescheiterte Integrationsmaßnahme oder jede integrative Erziehung, die unter Nichterfüllung der beschriebenen Bedingungen auf dem Rücken der Kinder oder anderer ausgetragen wird, schadet der Weiterentwicklung des gesamten Anliegens mehr, als viele gelungene und positiv zu würdigende Vorhaben der Sache nutzen können. Deshalb muss auch ein Nein zur Integration, dass am Ende langer Bemühungen um diese Sache stehen kann, akzeptiert werden, ohne dass daraus abzuleiten wäre, dass man damit nach ersten Anfängen bereits wieder am Ende wäre. Beginnen wir erst einmal integrative Vorhaben unter quantitativen Aspekten zu würdigen, werden wir selbst dazu beitragen, ihnen zu schaden.
Mit dem Vorhaben der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, Bremen-Huchting, liegen uns heute Ergebnisse vor, die
-
ein solches Vorhaben auf der Basis der den Kindern eröffneten entwicklungs- und Lernmöglichkeiten sowohl im Interesse der behinderten wie auch nichtbehinderten Kinder rechtfertigen,
-
die am Ausgangspunkt des Vorhabens stehenden Hypothesen weitgehend verifizieren und
-
mit Nachdruck darauf verweisen, Bemühungen gemeinsamer Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern auch in anderen Kindergärten/Kindertagesheimen anzustreben.
Bezogen auf das unter Punkt 1 ausgebrachte Verständnis von Integration, unter Berücksichtigung des Prinzips der Regionalisierung, der Dezentralisierung und des Team-Teaching bleibt festzustellen, dass integrative Erziehung im Kindergarten die Entwicklung neuer pädagogischer Fähigkeiten verlangt, die sich nicht einfach aus dem additiven Zusammenfügen von regelpädagogischen und behindertenpädagogischen Erfahrungen ergibt.
- 95 -
Da eine umfassende Einschätzung des Vorhabens einem Abschlussbericht vorbehalten bleibt, seien hier nur einige Aspekte herausgegriffen, die aus der spezifischen Sicht unseres Vorhabens und für die Weiterentwicklung der integrativen Arbeit im Moment vorrangig von Bedeutung sind.
1. Folgende Hinweise, die nicht aus der Tatsache des Einbezuges behinderter Kinder in die Kindergartenarbeit zu begründen sind, ergeben sich aus der Entwicklungsdynamik von 3- bis 6-jährigen Kindern:
-
der psychische Entwicklungsstand von 3- bis 6-jährigen Kindern erlaubt Gruppenstärken von 20 Kindern je Gruppe nicht. Im Verlaufe der kindlichen Entwicklung gewinnt das Kind erst ab ungefähr dem 3. Lebensjahr durch behutsame Einführung in immer komplexere Situationen eine soziale Kompetenz, die die Orientierung auf mehrere Interaktions- und Kommunikationspartner erlaubt. Oft können, wie wir gesehen haben, 3-jährige Kinder, die bislang ausschließlich in der Kleinfamilie erzogen worden sind, in diesem Alter kaum mit mehreren Personen gleichzeitig kommunizieren. Im Laufe der Entwicklung bis zum 6. Lebensjahr wird diese Kompetenz der Kinder weiter entwickelt. In Anbetracht dessen, dass altersgemischte Gruppen zu empfehlen sind, kann eine nach Lebensalter/Entwicklungsalter gestaffelte Gruppengröße nicht vorgenommen werden. Deshalb sollte man bei altersgemischten Gruppen in einem ersten Schritt davon ausgehen, dass eine Gruppenstärke von 14 Kindern nicht überschritten wird. Auch eine personelle Mehrausstattung (z.B. drei Erzieher/Gruppe) kann den überfordernden Charakter einer zu großen Kindergruppe für das einzelne Kind allenfalls etwas reduzieren, die negativen Aspekte aber keinesfalls kompensieren.
-
Es empfiehlt sich, im Kindergarten mit altersgemischten Gruppen zu arbeiten. Altersgemischte Gruppen haben hinsichtlich des jeweils vorliegenden Entwicklungsniveaus der Kinder für diese den Vorteil
-
dass bei jüngeren Kindern durch ältere und weiterentwickelte Kinder lernintensive und hoch motivierenden vorbildhafte Wirkungen entstehen,
-
dass entwickelte soziale Kompetenzen älterer Kinder sich in Form von Hilfestellungen jüngeren Kindern gegenüber in der Gruppe realisieren können und
-
dass der erzieherische Anspruch von Seiten der Kinder an den Pädagogen vielschichtiger ist, so dass der Erzieher nicht zu leicht in einer auf ein bestimmtes Entwicklungsniveau bezogenen Routine erstarrt und derart Weiterentwicklungen von Kindern sogar beeinträchtigen könnte.
Der Pädagoge erhält derart
-
mehr und differenziertere Rückmeldungen von Seiten der Kindergruppe, die ihn motivieren,
-
er gerät weniger in die Gefahr, die Fähigkeit der Kinder zur selbständigen Problemlösung und durch viele Hilfen zu unterdrücken und
-
er erfährt in vielen Bereichen des Gruppenalltages durch ältere Kinder Entlastung, so dass die Zentrierung auf spezifische Probleme erfolgen kann.
Insgesamt entfaltet sich in altersgemischten Gruppen ein soziales Gefüge, das jüngere Gruppenmitglieder leichter und problemloser integriert und eine psychosoziale Dynamik, die mehr Entwicklungsanreize für die einzelnen Gruppenmitglieder bietet, als dies in altershomogenen Gruppen der Fall sein kann, wo zentrale Entwicklungsanreize für die Kinder wesentlich nur vom Pädagogen ausgehen können.
-
Die materielle Grundausstattung der Gruppen im Kindergarten ist oft nicht der notwendig zu praktizierenden Pädagogik adäquat. Sind die Erzieher häufig gezwungen zu improvisieren, werden reibungslose Gruppenabläufe, Spiel-
- 96 -
-
und Lernprozesse gehemmt, unterbrochen oder blockiert. Bestimmte Ausstattungsgegenstände müssen jedem Kind zur Verfügung stehen; andere müssen, zwar nicht in größerer Anzahl, sollten aber in einer entsprechenden Qualität ihrer Ausführung vorhanden sein (z.B. für jedes Kind eine gute Schere; aber nicht 20 Plastikautos, sondern zwei oder drei qualitativ wertvolle Modelle oder Holzautos).
2. Unter dem Aspekt der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ergeben sich folgende Hinweise:
-
Die in integrativen Kindergruppen zu garantierende pädagogische Qualität macht die Besetzung einer Gruppe mit zwei ausgebildeten PädagogInnen erforderlich. Diese können sein die hauptamtliche Gruppenleiterin und eine 3. Praktikantin im Berufspraktikum. Probleme ergeben sich daraus, dass angehende ErzieherInnen bereits im Rahmen des Vorbereitungsjahres in diesen Gruppen bedarfsbezogen zum Einsatz kommen, ohne dass sie hinreichende Voraussetzungen mit einbringen, um die zu realisierenden pädagogischen Ansätze hinreichend aufarbeiten und realisieren zu können. In einem nächsten Schritt sollte darauf geachtet werden, dass integrativ arbeitende Gruppen entsprechend mit einer hauptamtlichen Gruppenleiterin und zumindest mit einer Erzieherin im Berufspraktikum besetzt werden. Grundsätzlich ist jedoch zu fordern, dass zwei ausgebildete Kräfte pro Gruppe zur Verfügung stehen und anzulernende und auszubildende Praktikantinnen und Praktikanten nicht auf das Stellentableau angerechnet werden.
-
Es zeigt sich, dass die Zumessung eines Stützpädagogen nicht rein mathematisch auf der Basis eines bestimmten fixen Stundenkontingents für eine bestimmte Anzahl behinderter Kinder erfolgen kann. Wo ein behindertes Kind in einen Kindergarten eingegliedert wird und integrative Erziehung zu realisieren ist, muss zumindest ein Stützpädagoge (Behindertenpädagoge) mit 20 Stunden pro Woche zur Verfügung stehen. Je nach Art und Schweregrad einer Behinderung der dann weiterhin aufzunehmenden Kinder wären die Stützpädagogenstunden entsprechend dem Erziehungsbedarf des Kindes zu bemessen. Kommen nach Anlaufen einer integrativen Massnahme nur leicht entwicklungsverzögerte Kinder hinzu, könnte das Stützpädagogenkontingent von 20 Stunden pro Woche auch dann noch aufrecht erhalten bleiben, wie andererseits ein z.B. schwerst-(mehrfach)behindertes Kind allein einen Stützpädagogen (zumindest in der Anfangsphase) erforderlich machen könnte.
Die Bemessung der Stützpädagogenstunden sollte von einem Basiskontingent von 20 Stunden pro Woche je Kindergarten ausgehen (wenn nicht mit Beginn der integrativen Arbeit schon ein schwerbehindertes Kind zur Aufnahme ansteht) und dann nach Bedarf erweitert werden.
Der Einsatz des therapeutischen Personals (z.B. für Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie, Sprachheilpädagogik, sensomotorische und psychomotorische Übungshandlungen u.a.) muss grundsätzlich in das Gruppengeschehen integriert stattfinden. Integrative Arbeit widerspricht der üblichen Verfahrensweise, zur Durchführung spezieller therapeutischer Vorhaben die Kinder aus dem pädagogischen Gruppenprozess herauszunehmen und isoliert von anderen Kindern therapeutisch zu behandeln. Unsere Erfahrungen verweisen darauf, dass diese Forderung praktizierbar und von großem Vorteil nicht nur für das betroffene Kind, sondern auch für andere Kinder und besonders für das nicht-therapeutische Personal ist.
Ein wesentliches Anliegen integrativer Arbeit ist, die von einzelnen Mitarbeitern (sei es nun Regelpädagoge, Stützpädagoge oder Therapeut) eingebrachte Kompetenzen auf andere Mitarbeiter zu übertragen. Das richtige Handling eines körperbehinderten Kindes muss auch von Pädagogen in jeder Alltagssituation praktiziert werden können, damit dem Kind entsprechende Hilfen gewährt werden können. Dadurch wird vermieden, dass Therapieerfolge durch falsches Handling in der Gruppe (erfolgte die Therapie isoliert) wieder zerstört würden. Ferner ergibt sich ein Vorteil für das Kind daraus, dass
- 97 -
die therapeutischen Maßnahmen erst durch ihre Einbettung in alltägliche Verrichtungen für das Kind subjektiv sinnvoll werden, wodurch es höhergradig motiviert ist mitzuarbeiten, als dies je in einer isolierten therapeutischen Situation erreicht werden kann, in der die Therapie meist auf ein bloßes Funktionstraining reduziert bleibt.
Ferner wäre zu beachten, dass Therapeuten so eingesetzt werden, dass sie einen ganzen Tag in der Gruppe therapiebedürftiger Kinder mitarbeiten können, Nur so kann der entsprechende Kompetenz-Transfer stattfinden und therapeutische und pädagogische Aspekte der Arbeit sich miteinander verzahnen.
3. Hinsichtlich der Ausweitung integrativer Erziehung in Kindertagesheimen ergeben sich folgende Hinweise:
-
Je nach Art der Behinderung von Kindern, die einen integrativen Kindergarten besuchen, werden unterschiedliche Arten therapeutischer Hilfen erforderlich, wie diese auch in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlichem zeitlichen Umfang zu garantieren sind. Da bei Erhaltung des Prinzips der Regionalisierung der integrativen Arbeit behinderte Kinder in einem Kindergarten entsprechend der normalen Verteilung unterschiedlicher Behinderungen in der Bevölkerung auftreten, ist die Anbindung entsprechender Therapeuten an einen Regelkindergarten nicht zweckmäßig. Deshalb sollten Therapeuten zentral (in unserem Falle z.B. beim Diakonischen Werk) eingestellt und im Pool koordiniert werden. Auf dieser Basis könnte ein Therapeut je nach Erfordernissen zwei einander benachbarte Kindergärten mit entsprechenden Hilfen versorgen. Dies würde dann in jeder Einrichtung und je nach Bedarf die erforderliche therapeutische Qualität garantieren, ohne dass Überhangkapazität in der einen oder mangelnde Stundenkontingente in einer anderen Einrichtung zu beklagen wären.
Diese Überlegungen wären entsprechend auf den Einsatz von Stützpädagogen anzuwenden.
-
Bei einer Ausweitung der integrativen Arbeit auf weitere Kindergärten und Kindertagesheime würde es erforderlich, kindergartenübergreifend eine entsprechende qualifizierte Fachkraft (z.B.zum Beispiel im Rahmen des Diakonischen Werks) einzustellen. (Fachreferat: Integration). Aufgabe dieser speziell mit Fragen der Integration befassten Fachkraft wäre es,
-
die integrativen Maßnahmen vorzubereiten und zu koordinieren
-
den Einsatz der Stützpädagogen und des therapeutischen Personals zu planen und durchzuführen.
-
die Supervision der in Einrichtungen tätigen Stützpädagogen (und soweit als fachlich möglich, auch der Therapeuten) zu übernehmen,
-
Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung bzw. der Vorbereitung des Personals der Einrichtung auf integrative Erziehung zu planen und soweit als möglich auch durchzuführen und
-
Kontakte zu anderen Einrichtungen (Behörden, Schulen, Kliniken u.a.) zu unterhalten u.v.m.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten für alle Betroffenen Vorteile bringt:
-
Für die behinderten und nichtbehinderten Kinder umfassendere und qualitativ bessere Entwicklungsanreize als in den jeweils segregierenden Formen der Erziehung, für die Pädagogen den Anstoß ständiger Neuorientierung auf die Kinder und einer über ihre bisherigen Erfahrung hinausgehende Qualifikation zu einer „Pädagogik vom Kinde aus“ was ihre weitere Tätigkeit motiviert und persönlich als bereichernd erlebt werden kann, und
- 98 -
-
für die Eltern neue Möglichkeiten der Kooperation untereinander, umfassendere Möglichkeiten, erzieherische Beratung durch das Personal in Anspruch nehmen zu können und sich selbst nicht mehr in ihrer eigenen Wohngegend und Nachbarschaft als ausgeschlossen und ausgestoßen zu erfahren.
Wir erkennen aber auch, dass Integration eine stets neu zu erbringende pädagogische und soziale Qualität ist.


Der Abschlusskreis zum Ausklang des Tages bedeutet für den Tag Abschied nehmen von der Gruppe, somit sind Interaktion und Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil des Kreises. Die Ereignisse des Tages noch einmal bewusst werden lassen, sowie einen Einblick geben in das was morgen sein wird, kennzeichnen einen weiteren Schwerpunkt, die zeitliche, räumliche und inhaltliche Orientierung der Kinder.
- 99 -
[38] Ich verweise zu diesen Zusammenhängen auf die diesem Bericht vorangestellten Ausführungen. Meine Erfahrungen bestätigen bis heute die Notwendigkeit des Beginns der Inklusion mit Beginn drohender Segregation; vor allem mit Bezug auf die Offenheit, die seitens aller Beteiligten im Rahmen der Frühen Bildung noch anzutreffen ist.
[39] Diese Art der Integration bezeichnete ich schon im Vorfeld als „Beistellintegration“ und warnte intensiv vor solchen Maßnahmen aus dem Geist eines Gutmenschentums, das meist nur durch Mitleid motiviert war und nicht aus pädagogischen Überzeugungen heraus.
[40] Der Sitz des Bundesverbandes „Hilfe für das autistische Kind e.V.“ befand sich in Hamburg; nicht der des Regionalverbandes Bremen
[41] Dieses Papier (wie andere im Prozess der Entwicklung der integrativen Frühen Bildung in Bremen) verdeutlicht nicht nur die intensiven Auseinandersetzungen zur Sache, sondern auch das Ringen um einen Konsens für die Integrationsentwicklung unter allen Beteiligten auf einem im Sinne der Sache hohen Niveau und einer wirklich weitgehenden Integration im Stadtteil. Solche Papiere kamen meist nur unter großem Zeitdruck in kurzen Sitzungspausen oder in der Nacht für den nächsten Morgen zustande, was leider auch zu oft nicht hinreichend präzisen Formulierungen führte.
[42] Gemeint ist, dass nichtbehinderte Menschen ein Problem mit behinderten Menschen haben, weil sie durch deren Verwahrung in Sonderinstitutionen keine Möglichkeit hatten, sich konkret mit als behindert geltenden Menschen zu befassen. In diesem Sinne verliefen die Diskussionen, die mit der obigen Formulierung in diesem Papier zu einer falschen Orientierung führen.
[43] Dieser Begriff wurde in Bezug auf die Entwicklungen in Dänemark gewählt und meint den Einsatz von an der Universität Bremen ausgebildeten Behindertenpädagoginnen und –pädagogen (= SonderschullehrerInnen bzw. Diplom BehindertenpädagogInnen).
[44] Gemeint ist der Studiengang Behindertenpädagogik
[45] Dieser Satz wurde grammatikalisch korrigiert.
[46] Diese Bezeichnung wurde später und ist bis heute im Begriff „Allgemeine Pädagogik, und entwicklungslogische Didaktik“ aufgehoben.
[47] Bezogen auf die sowohl pädagogischen wie humanwissenschaftlichen Hintergründe der Fort- und Weitebildungsmaßnahmen im Vorfeld der integrativen Frühen Bildung, diese begleitend und sie für andere Kindertagesheime fortsetzend, verweise ich auf Feuser, G. (2018): Wider die Integration der Inklusion in die Segregation. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag. Diese Arbeit repräsentiert den Stand der Diskurse um die Frage der Integration hinsichtlich der von mir entwickelten Konzeption wie bezüglich der BRD.
[48] Das verdeutlicht auch aus der Sicht der Gruppenleiterin die Bedeutung des Prinzips der „integrierten Therapie“, die ich bis heute als für eine gelingende Integration/Inklusion unverzichtbar halte. Isolierte therapeutische Interventionen verbesondern ein therapiebedürftiges Kind, schließen die KameradInnen vom damit verbundenen Lern- und Entwicklungsprozessen aus und es kommt nicht zu den mit einer integrierten Therapie verbundenen präventiven Wirkungen für andere Kinder.
[49] Das Mädchen hatte eine spastische Tetraparese aller vier Extremitäten (Arme und Beine).
[50] Die Sprachregelung war damals, die Kinder zuerst durch eine gesungene Aufforderung: „Alle Kinder hören mal!“ gemeinsam anzusprechen und ihre Orientierung zu bekommen. Die Instruktion lautete dann: „Wir räumen auf. Dann gehen wir hinaus“. Allein durch die Beachtung solcher „Kleinigkeiten“ in der Kommunikation ermöglicht Kindern konstruktives und solidarisches Handeln.
[51] Diese Aussage ist nicht so zu verstehen, dass wir in den Kindertagesheimen jahrgangsbezogene Gruppen gehabt hätten; die Lerngemeinschaften waren altersgemischt. Gemeint ist hier die Altersepoche der Kindergartenkinder.
[52] Selbst heute ist diese Unterscheidung noch nicht durchgängig die Regel. Es ist mit Bezug auf als behindert diagnostizierte Kinder immer wieder die Rede von den „kranken“ Kindern.
[53] Auch wenn ich damals den Begriff des „Förderns“ verwendet habe, muss ich diesen, mich entschuldigend, zurück nehmen. Die Schule hat einen Bildungsauftrag, an dem keine Abstriche zu machen sind, wie immer sie diesem nachkommt oder wie weit sie schon von dessen Wahrnehmung im Sinne der Vermittlung von „Halbbildung“ im Sinne Adorno’s entfernt ist. Auch dieses gilt selbst für eine/n schwerst beeinträchtigte/n Schüler/in.
[54] Es könnte auch so gesagt werden: Während für Menschen mit segregierter Erfahrung der behinderte Mensch ein anderer Anderer ist, waren selbst schwer beeinträchtigte Kinder für die anderen Kinder einfach jemand wie ich selbst mit eben seinen spezifischen Merkmalen.
[55] Angesprochen wird hier auf das Studium der Behindertenpädagogik an der Universität Bremen (Lehramt und Diplom), im Rahmen dessen beim Lehramt Behindertenpädagogik ein Fach ist und schulstufenbezogen studiert wird, was die spätere Tätigkeit als Lehrperson nicht nur auf eine Sonderschule begrenzt, sondern entsprechend der gewählten Stufe und einer weiteren Stufe als Ergänzung auch in der Regelschule. Dies vor allem auch deshalb, weil neben Behindertenpädagogik ein weiteres Fach (z.B. Deutsch, Mathematik u.a.) für die gewählte Stufe studiert wird. Die in der BRD damals üblichen Studiengänge fixieren auf Sonderschulen und zwei dafür kategoriale Schwerpunkte.
[56] Zu der für Lehrpersonen für Inklusion im Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem erforderlichen Studien siehe: Feuser, G. (2013): Grundlegende Dimensionen einer LehrerInnen-Bildung für die Realisierung einer inklusionskompetenten Allgemeinen Pädagogik. In: G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.): Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikation braucht die inklusive Schule? Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 11-66
[57] Erforderlich ist eine von der Förderdiagnostik zu unterscheidende Entwicklungsdiagnostisch insofern, als es nicht nur um die Feststellung von Problemen in einem Lernprozess geht, die diesen z.B. blockiert hat, sondern um das Verhältnis von aktueller und nächster Zone der Entwicklung in den verschiedensten psychischen Bereichen.
Inhaltsverzeichnis
- 3.1 Allgemeine Grundlagen menschlicher Entwicklung und deren neuropsychologische Struktur
- 3.2 Die lernpsychologische Struktur der Anpassungs- und Aneignungsprozesse im ersten und zweiten Signalsystem
- 3.3 Die entwicklungspsychologische Struktur menschlicher Anpassungs- und Aneignungsprozesse
- 3.4 Aspekte der pädagogischen Arbeit und deren Organisation im Alltag des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Unter dem Aspekt der Beschreibung der allgemeinen Grundlagen eines Verständnisses von Integration und dessen pädagogischer Umsetzung im Zusammenhang der integrativen Erziehung wurde im 1. Kapitel des Berichtes verdeutlicht, dass es das Ziel integrativer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder ist,
-
allen Kindern in einer regulären Lebens- und Lernumwelt durch gemeinsames, kooperatives Spielen und Lernen mit und an Gemeinsamen Gegenständen, Inhalten und Themen
-
auf der Basis ihres jeweiligen Entwicklungsniveaus sich im gemeinsamen Handeln kompetent erfahren zu können und
-
durch die Vermeidung ihrer Segregation die Einheit ihrer Person und der sozialen Bezüge erhalten zu können.
-
Eine Pädagogik, die dies zu leisten vermag, wurde als eine kindzentrierte, basale allgemeine Pädagogik beschrieben, die es im Sinne der dargestellten Zielsetzung leisten muss,
-
die die Entwicklung der Kinder bedrohende oder bereits eingetretene Isolation (organischer und/oder sozialer Art) aufzuheben oder zu vermeiden und
-
je nach drohender oder eingetretener Behinderung bzw. entsprechend den jeweiligen Voraussetzungen, die ein Kind als Basis für seine individuellen Lern und Aneignungsprozesse hat (Biographie), individuelle Hilfen pädagogischer und therapeutischer Art zu entwickeln, die den jeweils spezifischen Erziehungs- und Bildungsbedarf eines Kindes befriedigen, ohne es dadurch hinsichtlich seiner sozialen Situation zu besondern oder seine regulären Lebensbezüge zu stören oder gar zu zerstören.
Ist es das allgemeine Anliegen der Pädagogik, eine autonom entscheidungsfähige Persönlichkeit herauszubilden, die sich im gesellschaftlichen Leben orientieren und in den unterschiedlichsten Situationen den jeweiligen Anforderungen entsprechen und kompetent handeln kann und selbst aktiv an der Gestaltung der eigenen und allgemeinen Lebensrealität beteiligt ist, verweist eine „kindzentrierte basale allgemeine Pädagogik“ darauf, dass auf dem jeweils bei einem Kind vorfindbaren Entwicklungsniveau (bei dessen momentaner Handlungskompetenz und unter Berücksichtigung des jeweils subjektiv herausgebildeten Abbildniveaus und der ihm jeweils zur Verfügung stehenden psychischen Regulationen) anzusetzen ist, und in Folge davon grundsätzlich jedes menschliche Wesen, das in der Lage ist, mit den jeweils zu gewährenden Hilfen seine Lebensprozesse aufrechtzuerhalten, auch lernfähig und erzieh- und bildbar ist.
Eine integrative basale allgemeine Pädagogik, die sich entsprechend auch im Bereich integrativer Kindergartenarbeit im Sinne einer dafür spezifischen pädagogischen Konzeption zu realisieren hat, setzt notwendig voraus, dass diese Konzeption in ihrer pädagogischen und therapeutischen Ausdifferenzierung
-
sich im Sinne ihrer Basalität an den allgemeinen Grundlagen menschlicher Entwicklung und menschlicher Aneignungs- und Lernprozesse orientiert,
-
sich im Sinne der Kindzentriertheit auf eine den allgemeinen Grundlagen menschlicher Entwicklung und Aneignungs- und Lernprozesse widerspruchsfrei entsprechende Persönlichkeitstheorie orientiert, deren das entsprechende Menschenbild implizit ist,
-
in der Lage ist, im Sinne einer Förderungsdiagnostik eine Analyse der ‚aktuellen Zone der Entwicklung‘ eines Kindes zu leisten und zutreffend die momentane Handlungskompetenz und die Stufe der dominierenden Tätigkeit des Kindes in unterschiedlichen Situationen und Handlungsfeldern zu erfassen (Tätigkeitsstrukturanalyse),
-
auf dieser Basis die nächste Zone der Entwicklung des Kindes zu bestimmen (Lernzielfindung),
- 100 -
-
die zu erreichenden Lernziele, bezogen auf die verschiedensten Lebens- und Lernsituationen in operationalisierter Weise zu beschreiben (Entwicklung eines individuellen [individualisierten; GF] Curriculums),
-
die möglichen Vorhaben/Projekte (Gegenstände, Inhalte, Themen) in ihren aneigenbaren Qualitäten und Dimensionen (sensomotorisch und psychomotorisch, kognitiv, emotiv und erlebnismäßig motivativ) zu bestimmen (Strukturanalyse) und
-
auf dieser Basis die Verfahrensweise (didaktisch, methodischer und therapeutischer Art) festzulegen, wie das jeweilige Kind in Kooperation mit anderen zu einer gemeinsamen Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand – Handlungsstrukturanalyse -) gelangen kann.
Im Zusammenhang von Tätigkeits-, Sach- und Handlungsstrukturanalyse[58] sind auch die pädagogischen Hilfen (in Form individueller, aber auch für die gesamte Gruppe relevant) zu planen, was bedeutet, den Kindern diejenigen Mittel zur Verfügung zu stellen, die ihnen auch in Anbetracht unterschiedlicher Tätigkeitsstrukturen, Abbildniveaus und Handlungskompetenzen ermöglichen, in die kooperative, gemeinsame Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand einzutreten und darin und dadurch zu lernen. Hierin ergänzen sich dann auch pädagogisches und therapeutisches Handeln je nach Maßgabe der individuellen Biographie eines Kindes, in der durch drohende oder eingetretene Behinderung und andere beeinträchtigende Einflüsse „Brüche“ oder „Lücken“ eingetreten sind und durch die es zu Fixierungen auf bestimmte Lösungsstrategien und Handlungsweisen gekommen ist, die dem Kind zwar subjektiv in einer bestimmten Situation eine individuelle Handlungsmöglichkeit erhalten, objektiv aber dennoch hemmend oder gar verhindernd darin sind, dass dieses Kind die Fixierung überwinden und ein nächst höheres Entwicklungsniveau in der Lösung vergleichbarer Situationen erreichen könnte.
Im Sinne pädagogisch-therapeutischen Handelns geht es auch darum, die von den Kindern aufzunehmenden und zu verarbeitenden Informationen in Form klar strukturierter Instruktionen aufzubereiten und Bewertungskriterien festzulegen, mittels derer es möglich ist, den Kindern aus der Sache heraus wie im Rahmen des sozialen Beziehungsfeldes bekräftigende Rückmeldungen für ihre Handlungen zu geben, während bei entsprechender Aufbereitung und Strukturierung des pädagogischen Handlungsfeldes ein falsches Lernen des Kindes und damit auch Fehler weitgehend vermieden werden können und negative oder gar strafende Korrekturen ausgeschlossen bleiben.
Ehe nachfolgend die pädagogisch therapeutische Organisation der Arbeit im Kindergarten auch anhand einzelner Beispiele dargestellt wird, sollen die entwicklungslogischen und lernrelevanten Grundlagen menschlicher Entwicklung und Aneignungsprozesse sowie die Grundlagen des Aufbaues eines entsprechenden inneren Abbildniveaus und entsprechender psychischer Regulationen kurz verdeutlicht werden.
Mit dem Satz von Piaget: „Indem sich das Denken den Dingen anpasst, strukturiert es sich selbst, und indem es sich selbst strukturiert, strukturiert es auch die Dinge“ (35), sind im Prinzip die Grundlagen menschlicher Entwicklung, menschlichen Lernens und der Ausbildung jener nur dem Menschen in dieser Form möglichen psychischen Qualitäten, wie auch der Weg, der zur Ausbildung dieser Qualitäten führt, skizziert.
In allgemeinster Form beschreibt er mit dem Blick auf das Verhältnis des Individuums zur Umwelt die Basis seiner Entwicklung als die invarianten Funktionen der Adaptation (= Anpassung) und der Organisation (= innere Abbildung und Strukturierung der nach aussen gerichteten Anpassungsprozesse). Das
- 101 -
Prinzip der Organisation, die durch das zentrale Nervensystem (ZNS) geleistet wird, kann entsprechend als der interne Aspekt der Anpassung an die Welt verstanden werden.
Betrachten wir diesen Adaptationsprozess genauer, ist festzustellen, dass jedes Individuum versucht, sich seine Umwelt „einzuverleiben“, sie zu assimilieren, d.h., sie an seine schon erworbenen und ausgebildeten Schemata der inneren Organisation anzupassen. Dieses Bemühen ist deutlich zu beobachten, wenn z.B. ein Säugling versucht, alle erreichbaren Objekte in den Mund zu stecken und an ihnen zu saugen.
Viele Dinge sind aber durch diese Schemata nicht zu assimilieren. Diese Erfahrung führt den Organismus dazu, die bereits entwickelten Schemata permanent zu verändern, d.h., sie den Dingen der Welt anzupassen. Diesem Aspekt der Adaptation entspricht nach Piaget die Akkommodation. Beide Prozesse, Assimilation und Akkommodation vollziehen sich immer gleichzeitig und können im Adaptationsprozess nicht auseinander genommen werden, wie das mit der nachfolgenden Skizze zur besseren Veranschaulichung gemacht wird.
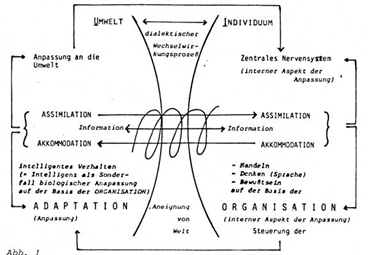
Abb. 1: Darstellung basaler Austauschprozesse lebendiger Organismen mit ihrer Umwelt, die nicht unterschritten werden können und Grundlagen der physischen und psychischen Existenz sind - nach Piaget
Mittels dieser Prozesse eignet sich der Mensch Welt an: Er bildet, beschrieben durch den Begriff der Organisation und realisiert über die Ausbildung entsprechender funktionaler Hirnorgane, in seinem Innern mit den Mitteln seines ZNS die ihn umgebende Umwelt in ihrer materiellen und personellen Erscheinung und deren Beziehungen untereinander im Sinne des Aufbaues der psychischen Funktionen ab. Die für den Menschen typische Entwicklung des ZNS reicht dabei vom Aufbau einfacher bedingt reflektorischer Systeme im Sinne des ersten Signalsystems (es ermöglicht ein reizverknüpfendes Denken und von Emotionen geleitete Tätigkeiten) bis hin zu psychischen Leistungen im Sinne des zweiten Signalsystems (dieses ermöglicht ein hierarchisch logisches, auf der Basis von Symbolen
- 102 -
aufgebautes Denken, die Sprache und durch den Sinn geleitete und zielgerichtete Handlungen und das Bewusstsein). Dabei meint ‚funktionale Hirnorgane‘, dass die im ZNS zur Verarbeitung kommenden Informationen eben exakt der Umwelt, d.h. dem beschriebenen Anpassungsprozess an diese entsprechen und nicht vermeintlich ‚vorprogrammierten‘ Inhalten.
Diese adaptativen Prozesse, die mit den Mitteln des zentralen Nervensystems verarbeitet und gesteuert werden und beim Menschen auf der Basis seiner phylogenetischen Entwicklung (= Stammesgeschichte) bereits so komplex geleistet werden, dass er diese Vorgänge im Sinne der psychischen Widerspiegelung erkennen, empfinden und erleben, d.h. sich darüber bewusst werden kann, können wir im Sinne des Funktionsniveaus des ersten Signalsystems als „Anpassungsprozess“ und im Sinne des Funktionsniveaus des zweiten Signalsystems als „Aneignungsprozess“ verstehen beide laufen für einen Menschen jeweils unter bestimmten Bedingungen der in spezifischer Weise für ihn existierenden Umwelt ab und haben ihre Basis in einem Prozess, den wir als Lernen bezeichnen können.
Lernen, das wir im Sinne eines allgemeinen Verständnisses bereits im 1. Kapitel dieses Berichtes beschrieben haben, können wir jetzt im Zusammenhang von assimilativen und akkommodativen Prozessen im Sinne eines nach aussen gerichteten Prozesses als Anpassung an die jeweils dinglichen und sozialen Umweltbedingungen und nach innen als einen Prozess der Strukturbildung im Sinne der Widerspiegelung von Umwelt verstehen. Die psychische Widerspiegelung erreicht im Laufe der Entwicklung immer höhere Niveaus der Abbildung und damit immer komplexere Möglichkeiten der Steuerung des wiederum nach aussen sichtbaren und rückwirkenden Verhaltens eines Menschen, das in seiner Umweltorientierung zielgerichtet ist und der Befriedigung von Bedürfnissen dient und den Motiven entspricht, die es hervorbringen und zu einer immer umfassenderen Realitätskontrolle im Sinne der eigenen Existenzerhaltung dient.
Das Lernen des Menschen ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass ihm die Aneignung von Realität im Sinne des Niveaus des zweiten Signalsystems, das ihn von allen anderen höheren Lebewesen unterscheidet, nur in sozialen Bezügen und durch die von Menschen geschaffenen Werkzeugen, Symbole und Sprache und deren Bedeutungen vollziehen kann, die ihm wiederum gesellschaftlich vermittelt werden müssen. Werkzeuge, Symbole, Sprache und die dem Menschen typischen psychischen Leistungen wie das hierarchisch logische Denken und das Ich- und Selbstbewusstsein sind in gleicher Weise das Produkt der Vermittlung und Vermitteltheit der Aneignung durch die Gesellschaft wie Werkzeug für den einzelnen Menschen in seinen Aneignungsprozessen.
Die Zusammenhänge der adaptativen Austauschprozesse mit der Umwelt und deren Organisation im Sinne der Tätigkeit des ZNS und des Aufbaues einer psychischen Widerspiegelung als interne organisatorische Produkte und Werkzeuge des Anpassungs- und Aneignungsprozesses können wir in vereinfachter Form wie in Abb. 2 (sieh es. 103) darstellen.
Die beschriebenen Anpassungs- und Aneignungsprozesse (mithin die Entwicklung des Menschen) können zu jeder Etappe der Entwicklung und auf allen Ebenen des Prozesses (auf der biologischen, der organischen und der psycho-[sozialen; GF] Ebene) durch spezifische Bedingungen beeinträchtigt werden. Dies von seinen organischen Voraussetzungen her wie von der sozial gesellschaftlichen Vermitteltheit wie Vermittlung seiner Adaptationsprozesse. Die eine Entwicklung beeinträchtigenden Bedingungen beschreiben wir allgemein mit dem Begriff der Isolation, in deren Folge der weitere Verlauf der Entwicklung (unter isolierenden Bedingungen) entwicklungslogisch zu einer Behinderung bzw. psychischen Krankheit führen kann.
- 103 -
Je nachdem
-
zu welchem Zeitpunkt,
-
von welcher Art und
-
mit welcher Intensität die Isolation eintritt,
-
von welcher Dauer sie ist und
-
wie die Persönlichkeitsentwicklung bis zum Eintritt der Bedingung der Isolation (Biographie) verlaufen ist,
kann eine bestimmte Form der dann von aussen beobachtbaren Behinderung bzw. psychischen Krankheit eines Menschen eintreten.
Die Verhaltensweisen, die uns auf einen Menschen als Behinderten und/oder psychisch Kranken aufmerksam werden lassen, sind also nicht sein ‚inneres Wesen‘, sondern äusserer Ausdruck der psychischen Widerspiegelung von Welt unter dem Aspekt der Aneignung von Welt und der Anpassung an die Welt unter der Bedingung von Isolation.
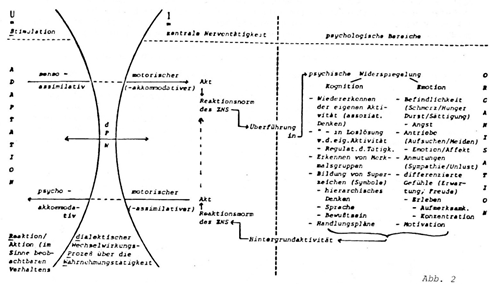
Abb. 2: Darstellung der Austauschprozesse von Individuum und Umwelt und der Überführung der neuronalen Prozesse in die psychologischen Bereiche sowie deren Rückwirkung auf den Gegenstand und die Art und Weise der Wahrnehmungstätigkeit
Behinderung ist mithin nicht ein „pathologisches“, sondern ein „entwicklungslogisches“
Ergebnis des Versuches des Menschen, sich an ihn isolierende Bedingungen bestmöglich anzupassen und seine individuelle Existenz mittels dieser Anpassung an und der Aneignung von isolierenden Bedingungen zu erhalten.
Die Brücke zwischen Individuum und Umwelt, so könnten wir bildlich sagen, bildet die Wahrnehmung. Nur mittels der Sinnesfunktionen können wir wahrnehmen, was entfernt von uns ist (z.B. Sehen, Hören, Riechen), an und in unserem Körper
104 -
(z.B. Tasten, Schmecken, Schmerz) und mit der Bewegung der Muskulatur (propriozeptive Stimulation) vorgeht und welche Lage unser Körper im Raum einnimmt (vestibuläre und kinästhetische Stimulation). Wahrnehmung führt also durch Informationsaufnahme (das ist ein sensomotorischer Akt dominant assimilativ) und deren Verarbeitung zur Ausbildung von Erfahrungen (= psychische Widerspiegelung), die als „Hintergrundaktivität“ auf sie selbst und das Verhalten (das sind die psychomotorischen Akte) zurückwirken und es hervorbringen.
Informationen aus der Umwelt werden mittels der Sinnesorgane (= Rezeptoren) aufgenommen, zum zentralen Nervensystem geleitet (afferente und efferente [re-afferente; GF] Bahnsysteme), dort gespeichert (Gedächtnis), zueinander in Beziehung gesetzt (assoziiert), voneinander unterschieden (diskriminiert) und in bereits gemachte Erfahrungen integriert. Die Wahrnehmungstätigkeit des Menschen können wir entsprechend als eine integrierte sensomotorische und psychomotorische [= efferente; GF] Aktivität des ZNS und der aus ihm resultierenden wie ihm übergeordneten psychischen Regulationen verstehen, wie es Abb. 3 vereinfacht darzustellen versucht.
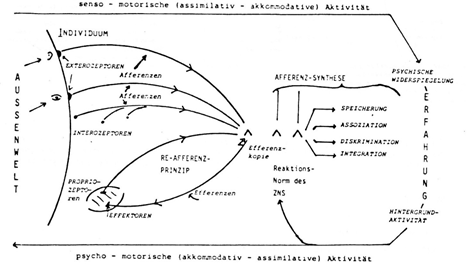
Abb. 3 Darstellung der Rezeptor-Effektor-Systeme bzw. des Afferenz-Efferenz-und Re-Afferenzprinzips und der Afferenzsynthese sowie der Wahrnehmungstätigkeit im Sinne eines Modelles einfachster Form polysynaptischer Organisation der Wahrnehmungstätigkeit und des Aufbaues bedingt-reflektorischer Systeme
Die Wahrnehmungstätigkeit des Menschen kann aber nur adäquat aufgebaut werden,
-
wenn zwischen sensorischer und motorischer Tätigkeit eine relevante Einheit besteht, d.h., wenn beide Aspekte nicht inkompatibel (= unvereinbar) miteinander sind oder im Extremfall gar unabhängig voneinander verlaufen und
-
wenn das Sinnessystem nicht überlastet (sensory overload),
-
unterbelastet (sensorische Deprivation) oder
-
widersprüchlicher Information ausgesetzt und
-
die Bewegungsfähigkeit des Individuums (= Handlungskriterium) nicht stark herabgesetzt oder unmöglich ist.
- 105 -
Fassen wir die dargestellten Zusammenhänge zusammen, wird deutlich, dass der Mensch im Austauschprozess mit der Umwelt über die Fähigkeit zur Wahrnehmung die objektive Realität (die Dinge, die Menschen und deren Beziehungen untereinander) über sein Sinnessystem durch die Orientierung auf die objektive Realität aufnimmt und davon mit den Mitteln seines Gehirns ein „re-produktives Abbild“ erstellt, d.h. die aufgenommene objektive Realität mit den Mitteln der Kodierung der Information durch das zentrale Nervensystem wieder erstellt und auf der Basis dieses Vorganges zur „psychischen Widerspiegelung“ (d.h. im Laufe seiner Entwicklung zu unterschiedlichen Abbildniveaus der objektiven Realität in seinem Innern) kommt. Mittels des daraus resultierenden Denkens und Bewusstseins ist er in der Lage, die Welt und sich selbst als Teil derselben zu erkennen und zu erleben und durch seine Tätigkeit und Handlungen auf diese zurückwirken und sich in bestimmter Weise zu ihr in Beziehung zu setzen, wie es Abb.4 zu veranschaulichen versucht.
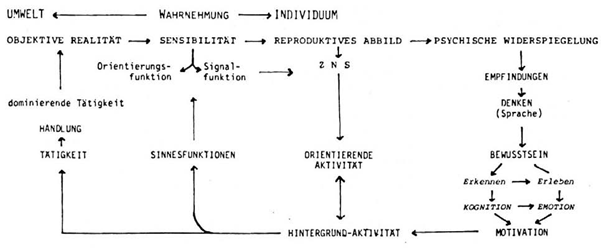
Abb. 4: Darstellung der verschiedenen Transformationsstufen der Abbildung der objektiven Realität im Sinne der psychischen Widerspiegelung
Die Struktur der individuellen Lerntätigkeit eines Kindes entspricht der Organisationsform und Tätigkeit seines zentralen Nervensystems je nach Entwicklungsniveau im Sinne des ersten bzw. zweiten Signalsystems. Letzteres ist die heute dem Menschen mögliche Organisation seiner Lernprozesse im Rahmen seiner Aneignungstätigkeit, die kontinuierlich aus der während der vorgeburtlichen Lebensphase und dem ersten nachgeburtlichen Lebensjahr dominierenden Organisationsform des ersten Signalsystems heraus entwickelt wird und in den Lebensaltersbereichen des zweiten und dritten Lebensjahres sich als dominierende Organisationsform stabilisiert, die dann im Kindergartenalter mit Beginn der öffentlichen Erziehung sich umfassend vergesellschaftet. Um im Rahmen der Erziehung der Kinder in dieser Altersspanne die entsprechenden curricularen, didaktischen und methodischen Fragen sowie die entsprechenden Aspekte der Lernorganisation berücksichtigen zu können und
-
die momentane Lerntätigkeit eines Kindes erfassen, ihre Struktur erkennen und das Lernangebot auf eben die von dieser Stufe aus in seiner Persönlichkeitsentwicklung nächst erreichbare ausrichten zu können und
die Tätigkeit und die Verhaltensweisen eines behinderten Kindes nicht wie bisher als „defektiv“ zu erfassen, sondern als eine Fähigkeit erkennen zu können, die vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet,
- 106 -
bedarf es eines lernpsychologischen Verständnisses dieser entwicklungsmäßigen Zusammenhänge.
Die Struktur des ersten Signalsystems können wir als eine neuropsychologische Organisation der Austauschprozesse eines Menschen mit seiner Umwelt beschreiben, die schon ab etwa der 12. Embryonalwoche erreicht wird, nachdem durch Erbkoordination und Zellenmigration Nervenzellen aufgebaut und funktionsfähig wurden und sich fortschreitend mit anderen Nervenzellen verschalteten. Sie bestimmt bis etwa zum 12./15. Lebensmonat nach der Geburt die Aneignungs- und Lerntätigkeit. Mit der Geburt ändert sich also die Organisationsstruktur des Lernens nicht, wohl aber werden durch den Eintritt des Menschen in sein soziales Umfeld die Lernbedingungen so vielfältig und gleichzeitig so komplex, dass der Umfang des Lernens des Menschen im ersten Lebensjahr zu keinem Zeitpunkt des späteren Lebens mehr erreicht wird.
Diese Organisationsstruktur drückt sich in Verhaltensweisen des Individuums aus, die einer von Außenreizen gesteuerten „Tätigkeit“ entsprechen, die im Laufe des Anpassungsprozesses an die Umwelt für das Individuum einen spezifischen Signalcharakter bekommen haben. Tritt also ein bestimmtes Signal in der (vorgeburtlichen oder nachgeburtlichen) Umwelt auf, kann dieses eine bestimmte Tätigkeit auslösen, d.h., ein bereits erworbenes „Schema“ wird abgerufen, aktiviert. So können z.B. in der vorgeburtlichen Lebensphase, je nach dem in welchem Umfeld sich die Mutter bewegt, Bewegungen ihres Kindes ausgelöst werden, sich verstärken oder aber in der nachgeburtlichen Lebensphase kann der Säugling das Erblicken des Gesichtes der Mutter im vis-à-vis Kontakt mit einem Lächeln beantworten.
Neuropsychologisch basiert diese Organisation auf der Ebene der Überführung unbedingter Reflexe in bedingt reflektorische Systeme und zu bedingt-bedingt-reflektorischen Verknüpfungen, die aber noch nicht derart vielfältig untereinander verschaltet sind, dass die jeweilige Gesamtsituation in ihrer Komplexität durch das Kind erfasst werden könnte. Mit seinen Verhaltensweisen beantwortet es einzelne Signale (Informationen)[59] aus der Umwelt, die durch die erfolgten Lernprozesse für das Kind bereits subjektiv bedeutend geworden sind. So hört das Kind z.B. während des für es sehr bedeutenden Vorganges des Stillens die Stimme der mit ihm sprechenden Mutter, was ihm ermöglicht, die intensiv erlebte Befriedigung des organischen Bedarfs (Hunger) mit der Stimme der Mutter in Verbindung zu bringen. Es entsteht so ein Bedürfnis nach der Stimme der Mutter, auch dann, wenn kein zu befriedigender organischer Bedarf (Hunger) beim Kind vorliegt.
Lernpsychologisch können wir diesen Sachverhalt wie folgt fassen: Ein Kind kann aus der Fälle der es umgebenden Stimulation (Gesamtsituation) einen Stimulus einen besonderen wiedererkennen (ihn diskriminieren = SD und Information bilden) und mit einer bestimmten sensomotorischen (z.B. Hören) und psychomotorischen (z.B. Lächeln) Tätigkeit verknüpfen (= assoziieren). Damit bekommt dieser bestimmte Stimulus (z.B. die Stimme der Mutter) den (Wert-) Gehalt eines „Anlasser Stimulus“ (= Auslöser von komplexen Aktivitäten). Andere gleichzeitig auftretende Stimuli (der Organismus nimmt etwa 10.000 pro Sekunde auf) können entweder noch nicht als besondere erkannt werden (d.h., sie halten das zentrale Nervensystem nur auf einem bestimmten Erregungsniveau, innervieren jedoch noch keine spezifische Tätigkeit (= Ausser Anlasser Stimuli) oder aber sie können im Sinne der Aufmerksamkeit (= selektiv gesteuerte Wahrnehmungstätigkeit) als unbedeutende Einwirkungen in ihrer Intensität reduziert oder aber, sind sie hinreichend bekannt, aber subjektiv in der Situation unbedeutend, „habituiert“ werden.
- 107 -
Es ergibt sich:
-
Nur solche Informationen aus der Umwelt, die in der konkreten Lebenssituation des Kindes für dieses eine subjektive Bedeutung gewonnen haben, ermöglichen ihm, gezielte und gesteuerte Aktivitäten aufzubauen und auf die Umwelt in entsprechender Weise zurückzuwirken;
-
dem Kind noch unbekannte Informationen aus der Umwelt werden dadurch bekannt und für es subjektiv bedeutend, dass sie in Kombination mit solchen Informationen auftreten, die für das Kind bereits einen besonderen Wert, eine subjektive Bedeutung erlangt haben;
-
Informationen in der Umwelt, die immer wieder in gleicher Weise auftreten und für das Kind subjektiv unbedeutend sind, werden habituiert, d.h., es erfolgt von Seiten des Kindes keine spezifische Reaktion auf diese Information[60] und
-
alle Informationen, die für das Kind neu sind (also Neuheitswert haben und die Neugier des Kindes befriedigen), erregen seine Aufmerksamkeit aber nur der Anteil an der Information, der für das Kind subjektiv bedeutend werden kann, vermag seine zentral nervösen und psychischen Regulationsprozesse weiter zu stabilisieren und deren Tätigkeit und seine Handlungen nach aussen zu steuern.
Auf dieser Basis erwirbt das Kind Abbildstrukturen, die ihm ermöglichen, eine Organisationsstruktur im Sinne des zweiten Signalsystems aufzubauen. Wir können dies am Beispiel eines als autistisch bezeichneten Kindes und seiner Handlungen mit einem Löffel verdeutlichen:
Ein Kind, obwohl es Hunger hat, dreht einen Silberlöffel vor seinen Augen, durch dessen Gravur das einfallende Licht, bedingt durch das Drehen, in kleinen Lichtblitzen reflektiert wird. Es setzt diese Tätigkeit auch dann noch fort, als eine mit dem Löffel aufzunehmende Speise vor dem Kind steht. Wird der Raum abgedunkelt, damit das Drehen des Löffels keine Lichtblitze mehr auslöst, beginnt das Kind dennoch nicht zu essen, sondern gerät in starke Erregung. Dies geschieht auch dann, wenn man dem Kind einen anderen Löffel gibt, der keine Gravur hat, die das Licht bricht, auch wenn es mit diesem in gleicher Weise schon zu essen gelernt hat und obwohl es nach wie vor Hunger hat.
Das Beispiel verdeutlicht, was wir mit einer fehlenden „Realitätskontrolle“ beschreiben könnten und was uns das Kind im Spiegel einer bestimmten Norm betrachtet als „autistisch“, als behindert, als zornig oder böse erscheinen lässt; Kategorien, die nichts von dem bezeichnen und auf nichts aufmerksam machen, was eine Förderung dieses Kindes zu leisten hätte. Was das Kind aber zu lernen hätte, wäre, die Objekte Löffel an für diese Dinge (Werkzeuge) typischen Merkmalen als solche erkennen, eine Assoziation der (des bestimmten) Löffel(s) mit der Tätigkeit Essen herstellen und sie als Auslöser der adäquaten Verhaltensweise Essen (z.B. in der Situation, in der die Plätze zum Essen am vorbereiteten Tisch eingenommen sind und wenn das Kind auch Hunger hat) generalisieren zu können, was einer entsprechenden Realitätskontrolle entsprechen würde. Derart würde das Kind entsprechend des vorliegenden Bedürfnisses nach Sättigung handeln und nicht durch das auf den Löffel fallende Licht gezwungen werden [das kann als unter Stimuluskontrolle stehend bezeichnet werden; GF], selbst vor dem gefüllten Teller Hunger leiden zu müssen.
Ein solcher Lernprozess würde neuropsychologisch darin bestehen, neue assoziative Verbindungen aufzubauen, die es dem Kind ermöglichen, dem Löffel „Werkzeugcharakter“ zuzuerkennen, vergleichbare Werkzeuge als solche zu erkennen (Messer, Gabel, Löffel) und sie im Sinne eines Oberbegriffes (Besteck) bezeichnen zu können und nicht die bestehende [Affektlage und; GF] Emotion (Wohlbehagen bei optischer Stimulation), sondern den Sinn (die Befriedigung des Hungers durch Essen) zum Motiv für die Handlung (Essen) machen zu können. Dann wird der Sinn erkenntnis- , interessen- und handlungsleitend dafür, das Ziel (die Befriedigung des Hungers) durch die Tätigkeit, mit dem Löffel Speisen zum Mund zu führen (eine Operation im Rahmen der Handlung Essen), zu erreichen.
- 108 -
Das Ergebnis eines solchen Lernprozesses verweist auf eine neuropsychologische Organisation des Austausches mit der Umwelt, die wir als zweites Signalsystem bezeichnen können. Auf dieser Ebene erhalten Außenreize Invarianz-, Symbol- und Werkzeugcharakter, und die einzelnen Handlungen werden der (gesamten) Tätigkeit untergeordnet, d.h. bis ins Erwachsenenalter hineingedacht, es kann Arbeit geleistet werden.
Die Qualität des so organisierten Austauschprozesses mit der Umwelt entspricht nicht mehr einer Anpassung mittels Tätigkeiten an einen bestimmten Anlasser-Stimulus, sondern der Aneignung von Welt, d.h. im genannten Beispiel des im Werkzeug „Löffel“
historisch angesammelten und vergegenständlichten menschlichen Erbes.
Für den Aufbau des Bewusstseins bedeutet dieser Prozess für das Kind die Ablösung eines komplexiv-assoziativen (an Reiz-, Aktivitätszusammenhänge gebundenes) Denken durch ein (auf der Ebene von Sinnzusammenhängen orientiertes, symbolhaft werkzeugliches/sprachliches) hierarchisches Denken, das in der menschlichen Entwicklung ab ungefähr dem ersten Lebensjahr fortschreitend die Realitätskontrolle übernimmt und damit den Aneignungsprozess, das Lernen, determiniert.
Es muss noch auf eine weitere neuropsychologische Gesetzmäßigkeit des Lernens verwiesen werden. Tätigkeiten (im ersten Signalsystem) wie auch Handlungen (im zweiten Signalsystem) werden nur aufrecht erhalten, wenn sie für das Individuum bezüglich seiner Bemühungen um die Adaptation an und für die Aneignung von Welt erfolgreich sind, d.h. allgemein im Lernprozess bekräftigt werden und seine Motivation befriedigen. Als Bekräftigung auf der Ebene des assoziativen Lernens kann im dargestellten Beispiel das an die optische Stimulation assoziierte Wohlbefinden wie die Wahrnehmung der eigenen Tätigkeit (proprizeptive, re-afferente Rückmeldung) gelten, was verdeutlicht, dass eine solche als Stereotypie klassifizierte Verhaltensweise für die Kinder selbst eine sehr bedeutende Funktion haben und sie mit diesen Handlungen die Stabilität ihres zentralnervösen und psychischen Systems aufrecht erhalten können.
In Fortsetzung des Beispiels auf der Ebene des zweiten Signalsystems kann die Bekräftigung in der durch das Essen mit dem Löffel ereichte Sättigung gesehen werden, d.h. in der Instrumentalisierung der Tätigkeit zu einem bestimmten Zweck durch das Individuum selbst. Dies führt zum Aufbau einer Motivation, die das sog. „Lernen um des Lernen willens“
erklärt; das meint die Darstellung einer Tätigkeit auch dann, wenn der Erfolg der gesamten Handlung erst in weiterer Zukunft erwartet werden kann (z.B. Einkaufen von Lebensmitteln, Zubereitung derselben zu einem Essen, Decken des Tisches, Auftragen der Speisen, und dann erst erfolgt durch das Essen als Tätigkeit wie im Zusammenhang mit der Sättigung die Bekräftigung des den gesamten Arbeitsprozess motivierenden Motivs). Daraus ergeben sich folgende allgemeine Lerngesetzmäßigkeiten, die hierarchisch aufeinander bezogen sind und unter dem Aspekt des Lernprozesses selbst, der dazu nötigen Voraussetzungen und Bedingungen und des Lernergebnisses charakterisiert werden sollen:
Basis der beiden habituativen Lernformen des Wahrnehmungslernens (WL) und des Assoziationslernens (AL) ist die beschriebene Fähigkeit der Habituation, die bereits auf der Ebene einer einzigen Nervenzelle als die anhaltende Abnahme einer neurophysiologisch bzw. verhaltensmäßig ausgeprägten Antwort als Folge wiederholter, sich als bedeutungslos erweisender Reizung verstanden werden kann (36). Dies besagt, dass ein Lernprozess immer identisch ist mit einem subjektiven Bedeutungserwerb, d.h. umgekehrt, dass ein Kind auch nicht lernt (gedächtnismäßig speichert), was für es (hinsichtlich der Befriedigung seiner Bedürfnisse und der Bekräftigung seiner Motive zu handeln) keine Bedeutung gewinnt und seine Realitätskontrolle einer Umwelt gegenüber, in der es lebt und lernt, nicht verbessert.
- 109 -
Aufbauend auf der Fähigkeit zur Habituation beschreiben wir nachfolgend die aufeinander aufbauenden drei Grundformen des Lernens im Sinne der Darstellung des Lernprozesses und der Bedingungen, unter denen dieses Lernen nur zustande kommen kann, sowie des Ergebnisses, das der Lernende damit erzielt.
-
Das Wahrnehmungslernen (WL)
Lernprozess:
Aus der Vielfalt der eine Gesamtsituation kennzeichnenden Stimuli (- diffuse Reizsituation)

kann ein ganz bestimmter Stimulus (SD) wiedererkannt werden (- Prozess der Wahrnehmung = PW),
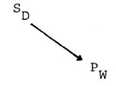
Bedingung:
Wenn (Hirn-) Wachheit des lernenden Organismus vorliegt und der Stimulus mit einer bestimmten Häufigkeit und Intensität (vom Umfeld gut abgehoben) im Lernprozess [anfangs; GF] stets gleichbleibend auftritt.
Ergebnis:
Es findet ein invarianter Wahrnehmungsprozess statt. Eine diskriminative Unterscheidung verschiedener, eine Gesamtsituation kennzeichnender Stimuli ermöglicht fortschreitend das Wiedererkennen der gesamten Situation als Basiselement einer kognitiven Leistung, die emotiv angenehm (Kriterium der Vertrautheit) erlebt wird.
-
Das Assoziationslernen (AL)
Lernprozess:
Ein Stimulus, der als ein bestimmter wahrgenommen werden kann (WL), aber für einen Organismus noch keine spezifische Bedeutung erlangt hat (S1), wird an einen schon wertbesetzten, also einen für den Organismus bedeutenden Stimulus (S2) assoziiert, der ganz bestimmte organismische Aktivitäten auszulösen vermag (Prke).
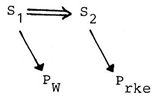
Bedingung:
Wenn er [S1 S2; GF] in einem räumlich zeitlichen Abstand unmittelbar vorausgeht (= Kontiguität).
Ergebnis:
Der zuvor wertneutrale Stimulus (S1) erlangt einen Wert- und Bedeutungsgehalt und kann nun seinerseits die entsprechende Aktivität (Tätigkeit) des Organismus hervorrufen.
Es kommt zu einer zeitweiligen Verbindung , die eine gezielte Orientierung auf die Umwelt gestattet und als psychisches Korrelat eine Motivation (M) aufbaut, die den Organismus dann auch ohne auslösende Außenreize tätig werden lässt (Mt), wenn der Erfolg der Hand-
- 110 -
lung erwartet (Mk) und die Befriedigung der Motivation (Me) abzusehen ist.
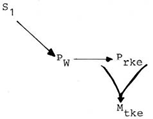
-
Das Instrumentelle Lernen (IL)
Lernprozess:
Zeigt ein Organismus in einer bestimmten Situation (Sit) bei Vorliegen einer bestimmten Motivation (Mtke) ein bestimmtes Verhalten (V) und erfolgt auf dieses Verhalten eine die Motivation, die es hervorgebracht hat, befriedigende Bekräftigung (B), wird dieses Verhalten bei Vorliegen einer gleichen oder einer ähnlichen Situation und Motivation in Zukunft häufiger dargestellt werden.
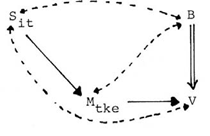
Bedingung:
Es muss eine definierte Beziehung zwischen Situation, Motivation und dargestelltem Verhalten einerseits und der Bekräftigung des Verhaltens andererseits bestehen (= Kontingenz) in dem Sinne, dass die Bekräftigung die Motivation, die das Verhalten hervorbringt, befriedigt.
Dazu muss die Bekräftigung dem Verhalten, das erzielt werden soll oder in Ansätzen dazu auftritt, unmittelbar (= Kontiguität) nachfolgen, also auf dieses bezogen werden können.
Ergebnis:
Auf diesem Weg kann eine zeitweilige Verbindung stabil und das Verhalten instrumentalisiert werden, d.h. auch zur Hervorrufung bestimmter Bedingungen in der Umwelt eingesetzt und damit von Seiten des lernenden Individuums aktiv verändernd auf sie zurückgewirkt werden.
Dies ermöglicht den Aufbau fester Verbindungen und konstanter Orientierungsreaktionen, die eine umfassende und immer mehr sich ausweitende wie differenzierende Realitätskontrolle erlauben, wie wir sie im Sinne des 2. Signalsystems beschrieben haben.
Derart kann das Lernen als orientierende Tätigkeit des Organismus in einer sich ständig verändernden, komplexen Umwelt selbst als eine erfolgsversprechende Tätigkeit erfahren werden, mittels derer die Auseinandersetzung mit der Umwelt immer besser gelöst werden kann.
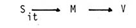
- 111 -
Fassen wir die aufgezeigten lerntheoretischen Grundlangen zusammen, erkennen wir, dass jede vorausgegangene Lernform in die nächst höhere integriert wird, also in dieser „aufgehoben“ ist, und dass die erforderlichen Lernbedingungen stets eingelöst sein müssen, damit Lernen einer bestimmten Art zustande kommen kann. Dies erfordert eine Art Interpunktion der Ereignisfolgen im Lernprozess, durch die z.B. eine von aussen kommende Information für die Kinder (wie für uns z.B. in der Schrift der Abstand zwischen den Wörtern und Punkt und Komma im Satz) erst verstehbar wird. Für den einfachen Lernprozess der Instruktion „steh auf!“ z.B. kann dies unter Berücksichtigung aller am Lernen beteiligten Aspekte wie folgt dargestellt werden; dabei ist die Einhaltung der Bedingungen, (Hirn-) Wachheit, Intensität, Konstanz und wiederholtes Auftreten (Häufigkeit) der Stimuli sowie Kontiguität und Kontingenz unverzichtbar für einen erfolgreichen Lernprozess (siehe hierzu Abb. 5)
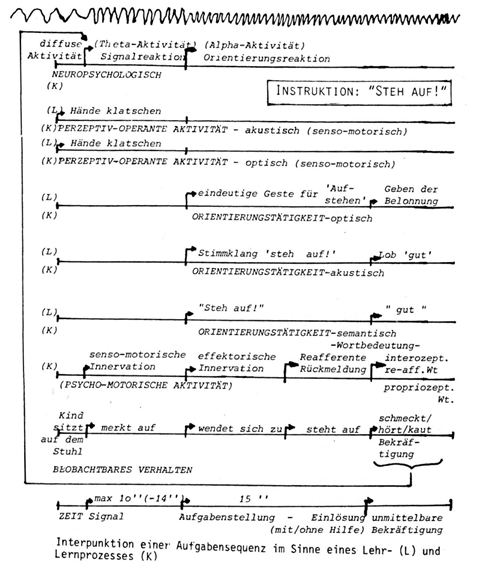
- 112 -
Zusammenfassend lassen sich die aufgezeigten Zusammenhänge neuropsychologischer und lernpsychologischer Prozesse im Aneignungsprozess der Kinder auch als einen Prozess der Bewertung der aus der Umwelt kommenden Information in Relation zu dem subjektiv vorherrschenden Bedürfnis nach Information verstehen, das also die gesamte Erfahrung, die bisher erworben werden konnte, umfasst.
Ob die Differenz zwischen den für die Aufrechterhaltung und die weitere Entfaltung der psychischen Funktionen notwendigen Information für das Subjekt im Vergleich zur angebotenen Information aus der Umwelt einen positiven oder negativen Wert ergibt, hängt es ab, ob es in einer bestimmten Situation zu einer angenehmen oder unangenehmen emotionalen Befindlichkeit kommt, die nicht nur auf die Handlungsmotivation, sondern auch auf die somatisch vegetativen Bereiche des Körpers rückwirkt und damit wiederum günstige oder ungünstige hormonelle Ausgangslagen für den Lernprozess schafft.
Beim Lernprozess selbst kommt es dann zu einer differenzierten Abfolge der Bewertung der aufgenommenen Information nach den Kriterien bekannt – neu, angenehm – aversiv (emotional), subjektiv bedeutend – subjektiv unbedeutend bzw. neutral und erfolgreich – nicht erfolgreich. Dies kann in nachfolgendem Schema als Regulationsprozess der Handlungsmotivation und des Verhaltens verdeutlicht werden (siehe Abb. 6 auf der nächsten Seite).
Wie die handlungsmotivative und verhaltensmäßige Konsequenz als Resultat eines Lernprozesses ausfällt, hängt also von den subjektiven Bewertungsvorgängen ab, die wir uns grob in nachfolgender Aufstellung, die einige Bewertungskombinationen aufführt, etwas veranschaulichen können:[61]
|
a / 2 |
= Habituationkeine spezifische Reaktion |
|---|---|
|
a / B |
= Vermeidungkeine Reaktion (passiv),Flucht,Selbststimulation,Aggression, SVV SVV ist die Abkürzung für SelbstVerletzende Verhaltensweisen, die (entwicklungspsychologisch gesehen) meist fälschlicherweise als Autoaggressionen beschrieben werden, (aktiv),Destruktion |
|
a / II |
= Extinktion Extinktion meint Löschung einer zuvor dargestellten Verhaltensweise |
|
b |
= Aufmerksamkeit - Orientierung - Habituation |
|
b / A / 1 |
= Aufmerksamkeit - Orientierung - Aktivität (Neugier/Exploration) Motivation - ansteigende Festigung eines Verhaltens |
|
b / A / 1 / I |
= hohe Motivation - große Erwartungshaltung - stabile Verhaltensweise |
|
b / B |
= Vermeidung (aktiv/passiv) |
|
b / 2 |
= Habituation |
|
b / II |
= Aufmerksamkeit - Orientierung - Extinktion |
|
b / B / II |
= aktive Vermeidung |
|
b / B / I |
= Aktivierung [Handeln; GF] nur zur Vermeidung |
a / bekannt, b / neu, A / angenehm B / unangenehm I / erfolgreich II / nicht erfolgreich 1 / subjektiv bedeutend, 2 / subjektiv unbedeutend (neutral)
Sind wir pädagogisch daran interessiert, dass es nicht dem Zufall überlassen bleibt, welche bedeutungsmäßigen Bewertungen ein Kind aufgrund unserer Spiel- und Lernangebote erfährt, müssten wir in Kenntnis der Biographie des Kindes (siehe Kapitel 3. des Berichtes) für das Kind
-
neue oder bekannte Informationen so aufbereiten, dass
-
es diese als angenehm erfahren (bedürfnisadäquate Information = positive Emotion),
- 113 -
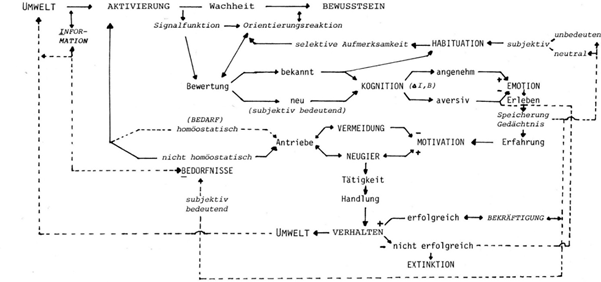
Abb. 6: Schema der lernpsychologischen Struktur der Bewertungsprozesse der Information beim Lernvorgang nach den Kriterien der Differenz zwischen bedürfnisbezogener notwendiger Information und des Informationsangebotes aus der Umwelt (∆ I, B) und den Kriterien bekannt : neu, subjektiv bedeutend : unbedeutend/neutral, angenehm : aversiv und erfolgreich : nicht erfolgreich in Bezug auf Handlungsmotivation und Verhaltensregulation
- 114 -
-
als subjektiv bedeutend erleben (ansetzend an der aktuellen Zone seiner Handlungskompetenz und auf die nächste Zone seiner Entwicklung verweisend) und
-
es als erfolgreich erfahren kann (motivationsbezogene, adäquate Information/ Tätigkeit).
Dadurch würden wir die Neugier und das Explorationsverhalten der Kinder stärken, ihnen positive Emotionen ermöglichen, sie motivational aktivieren und darin bestärken (grosse Motivation), aktive Realitätskontrolle auszuüben. Das Ergebnis wären stabile Verhaltenweisen bei den Kindern im Sinne kompetenten Handelns in vielfältigen Situationen.
Unter Bezug auf diese Zusammenhänge ließen sich die daraus resultierenden Forderungen an unsere Praxis wie folgt zusammenfassen:
|
a/b neue oder bekannte Situationen |
A Angenehm erfahren |
I erfolgreich |
1 Subjektiv bedeutend |
Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
|
NEUGIER EXPLORATION |
positive EMOTION |
AKTIVITÄT KONTROLLE |
hohe MOTIVATION |
=stabile Verhaltensweisen |
Die Berücksichtigung der lerntheoretischen Folgerungen aus den allgemeinen Grundlagen menschlicher Anpassungs-, Aneignungs- und damit Lernprozesse gestaltet im Rahmen unserer pädagogischen Konzeption wesentlich methodische und allgemein therapeutische Aspekte, mittels derer wir auch schwerstbehinderte Kinder auf den gemeinsamen Spiel- und Lernprozess orientieren können, mittels derer wir Kindern, die im Übergangsfeld vom ersten zum zweiten Signalsystem ihrer Entwicklung organisiert sind, den Übergang in das zweite Signalsystem erleichtern und wodurch wir (dann allerdings wesentlich durch das steuernde Element und Werkzeug der Sprache) die von den Kindern erworbene Organisationsstruktur des zweiten Signalsystems festigen und weiter aufbauen.
Die Umsetzung dieser Grundlagen methodisch therapeutischer Art bedeutet auch, dass wir Signale und sprachliche Zeichen kombiniert einsetzen, um Kindern im Spracherwerb noch auf der Ebene eines eindeutigen Signals eine Information eines bestimmten Bedeutungsgehaltes vermitteln und ihnen damit assoziiert bereits die entsprechende sprachlich semantische Struktur und Bedeutung des Wortes erschließen zu können. Aus den im Punkt 3.3 noch aufzuzeigenden entwicklungspsychologischen Zusammenhängen heraus wird erkennbar, dass bei integrativer Erziehung im KTH in einer Gruppe Kinder sind, die über alle Entwicklungsstufen, von der unmittelbar nachgeburtlichen Lebensphase bis hin zu der der Sechs- bzw. Siebenjährigkeit streuen, weshalb eine Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand nur zustande kommen kann, wenn der Gegenstand hinsichtlich aller Entwicklungsniveaus menschlicher Aneignungsstrukturen analysiert ist und er in Bezug auf jede Aneignungsstruktur eines Kindes mit einem entsprechenden Aufforderungscharakter versehen und hinsichtlich der bestehenden Bedürfnisse und Motive der Kinder, die in gleicher Weise differenziert und unterschiedlich sind, subjektiv bedeutend gemacht werden kann.
Eine häufig dazu geäußerte Befürchtung ist, dass die behinderten Kinder über- und die nichtbehinderten Kinder unterfordert werden könnten. Diese Argumentation entspringt aber wiederum nur einer sehr oberflächlichen, am äußeren Phänomen des pädagogischen Vorgehens orientierten Beobachtung und nicht der Realität der individuellen Aneignungsprozesse der Kinder.
Hat ein Kind eine bestimmte Systemhöhe der Organisation seiner (neuropsychologischen und psychischen) Austauschprozesse mit der Umwelt entwickelt, dann hat dieses System zum einen die Tendenz, sich immer höher zu entwickeln, und zum anderen immer auf dem höchsterreichbaren Niveau die Existenzsicherung zu garantieren, denn ein niedrigeres Niveau, so sinnvoll es im Rahmen der Entwicklung eines höheren Niveaus gewesen war, kann dieses nur jeweils schlechter und unter
- 115 -
Gefährdung der bereits möglichen höheren Stabilität erreichen. Deshalb wird jedes Kind aus einer die ganze Bandbreite der möglichen Entwicklungsniveaus der Kinder abdeckenden Information (von Seiten des Erziehers, der Therapeuten, eines Gegenstandes, einer Situation u.a.) diese für sich jeweils auf dem höchst erreichten Niveau abbilden und nicht unter seinen Möglichkeiten seine Austauschprozesse organisieren. Tritt dieser Umstand ein, so wäre bereits zu bedenken, dass für ein Kind in irgendeiner Form isolierende Bedingungen derart bestehen, dass es seine Austauschprozesse nicht auf dem höchst von ihm erreichten Niveau realisieren kann, sondern gezwungen ist, dies auf niedrigeren Niveaus zu leisten, was auf deren Desintegration aus den höheren Niveaus verweist. (Hieran erinnert uns z.B. das im 2. Kapitel beschriebene „nichtbehinderte“ Kind, das sehr stark eine Behinderung imitiert hat, weil es nur so sein Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz erreichen und durch die Verweigerung derselben gezwungen war, seine ihm höchstmögliche Systemhöhe zur Organisation seiner Lebensprozesse zu verlassen.) Pädagogisch macht uns dies auch darauf aufmerksam, dass der von Pädagogen häufig und leichtfertig ausgesprochenen Satz: „Der könnte schon, wenn er wollte“, einfach insofern unsinnig ist, als er nichts erklärt und ein Kind eindeutig stigmatisiert und belastet.
Auf der Basis der neuropsychologischen und lernpsychologischen Struktur der Anpassungs- und Aneignungsprozesse auf unterschiedlicher Systemhöhe erhalten wir also jene Grundbedingungen, die ein pädagogisches Konzept im Sinne methodisch therapeutischer Aspekte beinhalten muss, um Kindern unterschiedlichster Entwicklungsniveaus gemeinsame Lernprozesse zu ermöglichen, die ihre Entwicklung weiter vorantreiben.
Auf der Basis der neuropsychologischen Struktur der Anpassungs- und Aneignungsprozesse vermögen wir aber auch die psychologische Struktur der jeweiligen Entwicklungsniveaus der Kinder zu erfassen, die ihrerseits relevant ist für die Bestimmung der jeweils curricularen und didaktischen Komponenten der pädagogischen Konzeption, während beide Aspekte zusammen (die curricular-didaktische und die methodisch-therapeutische Komponente) die Organisationsformen der integrativen Erziehung (Projektarbeit am und im Lebensumfeld der Kinder auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen) bedingen.
Wir haben gesehen, dass menschliche Entwicklung, was die Seite der Anpassungs-, Aneignungs- und Lernprozesse betrifft, aufgrund unserer (phylogenetischen) Vorgeschichte in einer ganz bestimmten Weise strukturiert und organisiert ist und dass infolge dessen das methodische und therapeutische Vorgehen, die Art also, wie man Kinder anspricht, wie man ihnen Informationen mitteilt, wie man sie mit Gegenständen und Dingen in eine handelnde Beziehung zu versetzen vermag o.a. nicht willkürlicher Art sind, weshalb auch eine pädagogische Konzeption, wie schon eingangs dieses Berichtes kritisch betont wurde, nicht jedweder oft nur ideologisch geprägten pädagogischen Meinungsvielfalt überantwortet bleiben kann.
Es gibt sicherlich so viele Lernbedingungen wie es Menschen und Lebenssituationen (Lernsituationen) auf dieser Erde gibt; aber es kann nur so viele Arten des menschlichen Lernens geben, wie es die menschliche Art gibt; und die gibt es auf der Erde nur einmal und keine menschliche Rasse, keine Behinderung oder keine psychische Erkrankung stellt eine Ausnahme davon dar.
- 116 -
Aufbauend auf den dargestellten allgemeinen Grundlagen menschlicher Entwicklung und der daraus resultierenden Möglichkeit zur Anpassung und Aneignung von Welt und des Aufbaues einer Organisationsstruktur im Sinne des beschriebenen ersten und zweiten Signalsystems kommt es, sozusagen im Sinne des Weges der Übersetzung der „äußeren Welt an sich“
über die Wahrnehmungstätigkeit, die zentralnervöse Verarbeitung und die psychische Widerspiegelung dieser objektiven Realität im Rahmen der Ontogenese menschlicher Entwicklung zu einer immer differenzierten inneren Abbildung derselben, so dass diese äußere Welt an sich schließlich zu „einer Welt für mich“ wird; wesentlich dadurch, dass sich mir in der tätigen Auseinandersetzung mit der Welt deren individuelle (für mich als Individuum) wie gleichzeitig deren allgemeine gesellschaftliche Bedeutung erschließt.
In vereinfachter Form, wie dies bereits im vorausgegangenen Unterpunkt angedeutet wurde, können wir die menschliche Entwicklung in ihrem vorgeburtlichen und nachgeburtlichen Zeitraum verstehen
-
als der fortschreitende Erwerb von individuellen und gesellschaftlichen Bedeutungen der objektiven Realität (der Dinge, der Personen und der Verhältnisse der Dinge und der Personen untereinander), der sich
-
auf der Basis tätiger und handelnder Auseinandersetzung mit der Welt, mit den Dingen und den Personen und deren Bemühungen und Verhältnisse untereinander vollzieht und der
-
durch die jeweiligen individuellen und sozial gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sich dieser Prozess vollziehen muss, modifiziert wird.
Der Mensch ist grundsätzlich ein aktiv tätiges und handelndes Wesen, auch wenn wir in der Umgangssprache und in einem allgemeinen Verständnis zum Beispiel das Hantieren eines Säuglings mit einer Rassel vor seinen Augen oder das uns als stereotyp erscheinende leichte Schaukeln eines schwerbehinderten Menschen nicht als eine Tätigkeit bzw. eine Handlung erfassen, mittels deren er sich Welt aneignet und seine psychischen Prozesse strukturiert und ausbildet. Dabei transportieren die sinnlich wahrnehmbaren Momente z.B. nur die Beschaffenheit und Eigenschaft eines Gegenstandes (er ist weich, rot und gelb, leicht, warm), während sich dem Kind erst in der handelnden Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand (er ist rund und rollt - ein Ball), d.h. indem sich das Kind mit ihm handelnd in Beziehung setzt und andere Sozialpartner über diesen Gegenstand wiederum mit dem Kind handelnd in Beziehung treten, über die wahrnehmbaren Eigenschaften und Beschaffenheiten des Gegenstandes hinaus sich dessen Bedeutung für das Kind und die Allgemeinheit erschließt.
Dieser Bedeutungserwerb ist im Sinne der psychischen Verarbeitung keine „sinnliche Qualität“ mehr, sondern ein darüber hinaus reichendes „Wissen“ und „Erleben“ der Zusammenhänge, in denen ein Objekt mit bestimmten Eigenschaften zu mir und zu anderen steht. Im Prozess der inneren Abbildung der äußeren Welt, die sich für den Menschen von Anfang an auf der Basis intermodaler Wahrnehmungsqualitäten vollzieht (= die Verknüpfung mehrkanaliger sinnlicher Erkenntnisprozesse; z.B. den Ball sehen, wie er rollt, und hören, wie er hüpft), erwirb der Mensch entsprechend modale (durch die sinnliche Begreifbarkeit und Erkennbarkeit) und amodale (die Bedeutungen integrierende, die Struktur der Beziehungsverhältnisse erkennende) Abbilder von seiner Umwelt, die im Laufe ihrer Ausdifferenzierung über das gegenständlich und sinnlich Abbildbare weit hinausführen und im Sinne des Denkens und Bewusstseins Zusammenhänge erkennen lassen können, die unserer sinnlichen Erfahrung nie zugänglich sein werden oder wiederum nur zugänglich gemacht werden können, indem wir die gewonnene Erkenntnis wieder in sinnlich wahrnehmbare Qualitäten zurückübersetzen, d.h. „materialisieren“ (ein Beispiel dafür wäre, dass wir aufgrund physikalisch chemischer Erkenntnisprozesse um die sinnlich nicht wahrnehmbare Qualität radioaktiver Strahlungen wissen,
- 117 -
in Bezug auf die wir nun Instrumente bauen können, die uns diese nicht sichtbare und wahrnehmbare Strahlung durch den Ausschlag eines Zeigers oder das Ticken eines Instruments – z.B. Geigerzähler – wieder sinnlich wahrnehmbar machen können).
Ziehen wir daraus allgemeine Folgerungen, können wir sagen, dass die menschliche Entwicklungslogik in der Ontogenese und der Aufbau der höheren psychischen und geistigen Strukturen nur möglich sind
-
auf der Basis der menschlichen Tätigkeit, die
-
auf allen Entwicklungsniveaus zu einer unterschiedlichen differenziert handelnden Auseinandersetzung mit der „Welt“ führt und
-
dass sich daraus dem Menschen die Dinge an sich als Dinge für mich erschließen, d.h. er sich schließlich nicht nur die individuellen und gegenständlichen Bedeutungen erwirbt, sondern auch die gesellschaftlichen Bedeutungen der Dinge und Werkzeuge erfassen kann, auch wenn er sie selbst nicht hervorbringt oder nutzt.
Im Zusammenhang integrativer Pädagogik können wir uns also nicht damit begnügen, die nach aussen sichtbar in Erscheinung tretenden Tätigkeiten und Handlungen des Menschen zu betrachten, sondern müssen, wie bereits betont, uns die Qualifikation erwerben, zu erfassen, welche Qualitäten der inneren psychischen Widerspiegelung, der Abbildstruktur der äußeren gegenständlichen und personellen Welt sich ein Kind ausgebildet hat, um sein momentanes Entwicklungsniveau bestimmen zu können, d.h. eine Aussage über seine Tätigkeitsstruktur machen zu können, mittels derer das Kind zum Zeitpunkt, zu dem wir mit ihm arbeiten, seine Austauschprozesse mit der Welt reguliert und strukturiert. Erst wenn wir dieses Niveau erfasst haben eine Aufgabe der Förderungsdiagnostik[62] (37) , können wir für dieses Kind eine Aussage machen, auf welche nächst höhere Qualität der psychischen Widerspiegelung und Abbildstruktur seine Entwicklung zusteuert, um diese pädagogisch innovieren und Hilfen zur Verfügung stellen zu können, dass das Kind sich dieses Niveau sicher erarbeiten kann.
Dabei ist der Mensch nicht auf die jeweils bestehende Situation fixiert. Auf der Basis seiner Fähigkeit zur vorgreifenden Widerspiegelung (Anochin) kann er anhand z.B. der Analyse situativer Merkmale bereits vorwegnehmen, was sich daraus folgernd in Kürze ereignen wird, oder, auf einem hoch entfalteten Niveau, wird er z.B. als Architekt am Reissbrett ein Haus längst in seinem Kopf gebaut haben, ehe die erste Materialbeschaffung dazu stattgefunden hat. Auf dieser Basis kann auch das Kind beim Umgang mit Dingen und Personen bereits antizipieren, was aus dieser Handlung bzw. Beziehung als Produkt entstehen soll oder kann. Dadurch kann es sich bereits auf das Kommende oder Werdende hoch spezifisch einstellen und so in der dann auftretenden Situation schneller und kompetenter handeln, als wenn sie ihn völlig unerwartet überraschen würde, was wieder somatische und psychische Folgen (freudiger oder ängstigender Natur) nach sich ziehen würde.
Der Mensch ist mit ansteigendem Entwicklungsniveau immer umfassender nicht nur auf seine Umwelt orientiert, sondern er bedarf – pädagogisch gesehen – auch immer der „Orientierung“
auf das, was Gegenstand/Thema u.a. seiner Tätigkeit und Handlungen oder Anspruch an seine Person sein wird. Da die Gegenstände der handelnden Auseinandersetzung aber ihrerseits bereits wieder ein Produkt schon vorausgegangener handelnder Auseinandersetzung von Menschen mit Dingen sind, haben die Dinge wie die Handlung mit den Dingen für den konkret handelnden Menschen „Werkzeugcharakter“, so dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes hergestellter Dinge bedienen kann, um neue Dinge herzustellen. Je differenzierter die Lebensgemeinschaften und je komplexer die Produkte, umso notwendiger und umso differenzierter werden dabei im Rahmen der Herstellung dieser Werkzeuge und Produkte die Prozesse der Beziehungen der Menschen untereinander, so dass, vom Stand der heutigen Entfaltung der gesellschaftlichen Beziehungen her gesehen, die individuelle menschliche Entwicklung von Anfang an nur innerhalb kooperativer Beziehungen verstanden werden kann.
- 118 -
Gegenständliche und beziehungsmäßige Aspekte menschlicher Tätigkeit sind zu keinem Zeitpunkt der ontogenetischen menschlichen Entwicklung voneinander zu trennen und die entsprechende innerpsychische Abbildung und Widerspiegelung dieser Zusammenhänge im Sinne der daraus resultierenden Bedeutungen sind immer „vermittelnder“ und „vermittelter“Art. Pädagogik könnten wir derart schließlich als eine gesellschaftlich organisierte Hilfe verstehen, durch die eine Strukturierung der Austauschprozesse und der Wahrnehmungstätigkeit durch das Handeln mit den Kindern umfassend und so erfolgen kann, dass sich das Kind dabei nicht als versagend und inkompetent, sondern als kompetent und erfolgreich erfährt, was die Motivation zu weiteren aktiven Auseinandersetzungen mit allen in die verschiedensten Situationen auftauchenden Problemen bestärkt.
Im Rahmen des beschriebenen Bedeutungserwerbs erfährt das Kind ständig neue Handlungsmöglichkeiten, die , innerlich abgebildet und zum Bedürfnis geworden, ein wesentlicher Aspekt des Motivs abgeben, bestimmte Situationen wieder aufzusuchen, bestimmte Handlungen zu wiederholen, sie zu verändern und Situationen zu schaffen, in denen das Bedürfnis selbst kultiviert werden kann.
Bedürfnisse und Emotionen, die im Sinne des berechtigten Anliegens der Pädagogik, durch ihre Angebote die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen und ihnen positive, angenehme Emotionen zu vermitteln, gewichtige Begriffe sind, werden aber nicht selten in einer Weise gebraucht, hinter denen sich ein Verständnis verbirgt, das annimmt, dass Bedürfnisse und Emotionen quasi feststehende und vorhandene oder eben in verschiedener Weise vorhandene statische Elemente menschlicher Existenz wären. Es wird davon abstrahiert, dass Bedürfnisse ein psychisches Entwicklungsprodukt des tätigen Menschen sind, die z.B. beim Säugling, wie schon in vorausgegangenen Beispielen erwähnt, auf der Basis der Befriedigung des organischen Bedarfs dadurch aufgebaut werden, dass die erfahrene Befriedigung im Sinne intermodaler Wahrnehmung mit neuen Erfahrungen assoziiert wird, die sich dann als eigenständige Erfahrung festigen und als Bedürfnisse auch unabhängig vom Bedarf der Existenzsicherung (als psychische Erscheinungsweise menschlicher Tätigkeit) das Handeln und Erleben bestimmen. Eine Pädagogik, die es zum Maßstab macht, Bedürfnisse der Kinder aufzugreifen und zu befriedigen, wird eine aktiv handlungsorientierte Pädagogik sein müssen, die auch bewusst neu Bedürfnisse schafft und diese weiterentwickelt. Sie wird nicht, wie in Diskussionen immer wieder deutlich wird, z.B. in Bezug auf ein schwerbehindertes Kind durch mangelnde Kenntnis seiner individuellen Bedürfnisse rhetorisch fragen, ob es das Kind überhaupt möchte, dass wir mit ihm ein Spiel beginnen, gegen das es sich ja sichtbar erst einmal wehrt. In einer solchen „antipädagogischen“ Wendung wird der momentane Entwicklungsstatus eines Menschen dadurch fixiert, dass er in keine handelnde Auseinandersetzung hineingebracht wird (was immer ein assimilativ-akkommodativ dynamischer Prozess ist), als deren Resultat neue Bedürfnisse ausgebildet werden.
Entsprechen wir dem Bedarf[63] und den Bedürfnissen eines Kindes nicht, wird die Information, die wir ihm durch die Gestaltung seiner Lebenssituation bzw. unseres pädagogischen Ansatzes vermitteln, weit geringer sein als die Information, deren das Kind bedarf. Die negative Differenz von vorhandener und subjektiv notwendiger Information ist der (kognitiv) quantitative Aspekt des qualitativen Erlebens einer negativen Emotion, von Angst und schließlich Stress, der die Aktivitäten des Kindes blockiert und es veranlasst, seinen Bedarf an Information dadurch abzudecken, dass es sich z.B. selbst stimuliert (38).
Bedürfnis und Emotion sind also ihrerseits in den gesamten Prozess der psychischen Entwicklung vermittelte Kategorien menschlicher Erkenntnis- und Erlebnismöglichkeiten und somit auch für die Pädagogik keine isolierten Standards, die einen Wert von Maximen für pädagogisches Handeln in sich, losgelöst von der Betrachtung der Gesamtätigkeitsstruktur und entwickelten psychischen Abbildstruktur eines Menschen zu einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt hätten.
Die hier kurz anskizzierten allgemeinen basalen Elemente entwicklungspsychologischer Zusammenhänge, wie sie als Fundament einer pädagogischen Konzeption in-
- 119 -
tegrativer Arbeit im Kindergarten unverzichtbar sind, verweisen darauf, dass wir wesentlich den Standpunkt des „inneren Betrachters“[64] einnehmen müssen, um die Analyse der Tätigkeitsstruktur [und Handlungsstruktur; GF] eines Kindes so leisten zu können, dass wir in Zusammenhang mit der Gegenstands-/Sachstrukturanalyse die pädagogischen und therapeutischen Hilfen so organisieren können, dass ein Kind möglichst optimal und umfassend in handelnde Auseinandersetzungen im Rahmen kooperativer Spiel und Lernprozesse eintreten kann.
Unter dem Aspekt der Bedeutung, die menschlicher Tätigkeit und Handlung (als in gleicher Weise Instrument wie Produkt der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt) zukommt, eignet sich in besonderer Weise das Konzept der „dominierenden Tätigkeit“, wie es von Leon‘tev eingeführt und von Jantzen[65] weiterentwickelt wurde, zur Darstellung der menschlichen Entwicklungslogik in der Ontogenese, der etappenweisen Ausbildung der entsprechenden psychischen Organisation und der Abbildstruktur sowie des fortschreitenden Bedeutungserwerbs und damit der Verdeutlichung der Gesetzmässigkeiten wie des Ablaufes menschlicher Persönlichkeitsentwicklung.
Diese Konzeption verdeutlicht, dass der Mensch (phylogenetisch bedingt) in seiner Ontogenese zwar eine festgelegte Reihenfolge von Entwicklungsphasen in einer bestimmten biologischen Zeit durchlaufen muss, dass aber diesen Phasen eine hochgradige eigenständige Bedeutung für die menschliche Entwicklung zukommt, was im Zusammenhang phylogenetischer und ontogenetischer Elemente bedeutet, dass ein jeweils in der Ontogenese sich herausbildendes Tätigkeitsniveau nicht überdurchschnittlich lange fixiert oder negiert werden darf, ohne dass sich daraus dann Brüche und Lücken in der Entwicklung ergeben, die wir vom Standpunkt des „äußeren Beobachters“ aus als pathologische Phänomene im Sinne traditioneller Klassifikation der verhaltensmäßigen Erscheinungen des Menschen missdeuten würden.
Unter der dominierenden Tätigkeit wird „jene Tätigkeitsform verstanden, die vorrangig in einer Entwicklungsphase zur Bildung und Umgestaltung der psychischen Vorgänge“, also zu grundlegenden Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit und zu einer neuen Niveaustufe seiner Austauschprozesse führt (39).
Ausgehend von der mit dem Genom verankerten genetischen Struktur und der Zellverschmelzung durch den Zeugungsprozess kommt es auf der Basis von Zellmigration, d.h. der Morpho- und Physiogenese des Embryos zur Genexpression und der Herausbildung des Phänotyps des Menschen.
Diese erste Phase der dominierenden Tätigkeit im Sinne der Entwicklung des metabolisch-, strukturell-, funktionellen Phänotyps, die gegen Ende des 4. vorgeburtlichen Lebensmonats weitgehend abgeschlossen ist, kommt es bis zur Geburt in einer damit beginnenden zweiten Phase der dominierenden Tätigkeit zur Abbildung der körperlichen Funktionen im ZNS.
Schon mit der 13. Embryonalwoche sind die Bildung der wichtigsten Hirnzentren soweit fortgeschritten, dass sie sich voneinander differenziert und untereinander derart komplex verschaltet haben, dass auf der Basis unbedingter Reflexe die erste Ausbildung bedingter Tätigkeit durch die Entwicklung der Sensibilität in verschiedenen Wahrnehmungsbereichen stattfinden kann. Auch für die damit einsetzende „psychische Tätigkeit“ werden für das sich entwickelnde Kind im Mutterleib durch die Tätigkeit der Mutter in ihrer Umwelt wie durch die spezifischen Interaktionen des Embryos mit der Mutter die entsprechenden entwicklungsnotwendigen Austauschprozesse realisiert; d.h., das Kind lernt. Auf dieser Basis ist das Kind bereits von seiner Geburt an ein aktiv wahrnehmendes, lernendes und Informationen verbreitendes und strukturierendes Individuum.
- 120 -
-
Die perzeptive Tätigkeit
Mit der Geburt verfügt das Kind über ein bestimmtes Inventar bedingter und unbedingter Tätigkeit und über funktional vollentwickelte Sinnesorgane, wie jedes Kind entsprechend der vorgeburtlichen Lernprozesse bereits zum Zeitpunkt der Geburt einen unterschiedlichen Lernstatus aufweist. Auf der Basis der Spezifik „modaler“ Wahrnehmung durch funktionelle Differenzierung der primren und sekundären Felder der Grosshirnrinde (Projektionsfelder) ermöglicht die „intermodale“ Wahrnehmung eine Entwicklung zur ganzheitlichen Gegenstandswahrnehmung.
War zu Beginn dieser ersten von der Geburt bis ungefähr zum 6. Lebensmonat reichenden Phase nur die unzusammenhängende Wahrnehmung spezifischer Eigenschaften von Objekten auf bestimmten Wahrnehmungsebenen (optisch, akustisch, taktil, kinästhetisch u.a.), wenngleich sehr differenziert möglich, entfaltet sich gegen Ende dieser Phase die Fähigkeit zur „serialen“ Wahrnehmung durch die funktionelle Strukturierung des Frontallappens (der stirnseitige Lappen des Großhirns). Der Einbezug dieses „unspezifischen“ Bereiches des Gehirns (unspezifisch in Relation zu den spezifischen Feldern, auf denen die sinnlichen, perzeptiv-sensorischen Wahrnehmungen und die motorischen, bewegungsmäßigen Abläufe gespeichert sind) ermöglichen dem Kind auf der Basis der Interaktion mit seinen primären Bezugspersonen (in unserem Kulturkreis insbesondere mit der Mutter) durch eine Organisation seiner Tätigkeit in der Zeit die gegenwärtig widergespiegelten Informationen und alle anderen im Gehirn abgespeicherten abzurufen und zueinander in Beziehung zu setzen, was den Übergang zur nächsten Entwicklungsphase der dominierenden Tätigkeit ermöglicht.
Mit diesen Fähigkeiten wird zunehmend die kortikale Steuerung (durch die Großhirnrinde) der praktischen Tätigkeit möglich, wo zu Beginn und im Laufe der Phase der perzeptiven Tätigkeit die Bedürfnisleitung dieser Tätigkeit überwiegend unmittelbar emotional erfolgt ist. Die bedürfnisleitende Emotion entsteht auf der Basis des organischen Bedarfs, wie dies schon erwähnt wurde, in Kombination, d.h. assoziiert mit den sinnlichen Erfahrungen, so dass wir in Bezug auf das Bedürfnissystem des Menschen in dieser frühen Phase seiner Entwicklung von sinnlichen vitalen Bedürfnissen sprechen können, die sich im Neugier und Explorationsverhalten, im Bemühen um Realitätskontrolle und in seinem sozialen Bedarf ausdrücken.
Ein Mangel in der Befriedigung des sinnlich-vitalen Bedürfnissystems und des Sozialbedarfs des Kindes führen zur Bedrohung seiner Entwicklung und äussern sich in Angst, was wiederum heftige motorische, mimische und lautliche Gesamtreaktionen des Kindes hervorrufen. Die adäquate Befriedigung des sinnlich vitalen und sozialen Bedürfnissystems führt hingegen zu positiver emotionaler Aktivierung, Ausgeglichenheit und zur Steigerung des Neugierverhaltens und der eigenen aktiven Tätigkeit.
Im Sinne des Ansatzes von Piaget gelangt das Kind durch die Bestätigung der Reflexe, die nicht als unveränderliche Automatismen, sondern vielmehr als Funktionen zu verstehen sind, die zu einer graduellen Akkommodation an die äußere Wirklichkeit fähig sind, zur reproduktiven und generalisierenden Assimilation, indem das Kind versucht, durch die Wiederholung des Reflexschemas diesem immer mehr und vielfältigere Gegenstände einzuverleiben (an allen Gegenständen, die den Mund berühren, wird z.B. gesaugt). Im Sinne der rekognitiven (wiedererkennenden) Assimilation erwirbt das Kind die Fähigkeit, einen Gegenstand als an ein Schema assimilierbar wiederzuerkennen. Ehe also ein Kind ein Objekt erkennt, erkennt es im Zusammenhang mit diesem Objekt seine eigene Reaktion. Die kumulative Wiederholung der Reflexbetätigung, ein „Zyklus“, also die einfache Wiederholung einer Handlung bezeichnet Piaget als primäre Zirkulärreaktion.
Sind im ersten und zweiten Lebensmonat Sehen, Greifen und Saugen noch nicht koordiniert, so folgen schon im zweiten und dritten Lebensmonat die Augen der Bewegung der Hand und ab dem dritten bis vierten Lebensmonat kann man beobachten, dass das Sehen bereits die Bewegung der Hand beeinflusst, d.h., das Kind ver-
- 121 -
sucht, die Hand im Sehbereich zu halten und dadurch ihre Aktivität zu erhöhen. Ist dieses möglich, kann das Kind im vierten bis fünften Monat, sofern Hand und Gegenstand gleichzeitig im Sehfeld sind, nach einem Gegenstand greifen, was sich dann im fünften bis sechsten Lebensmonat zu einem echten, durch Sehen gesteuerten Greifen nach einem Gegenstand ausbildet.
Die dabei entwickelte Abbildstruktur eines Kindes ist also gekennzeichnet durch eine assoziativ-assimilative perzeptive Tätigkeit, die zu „intermodalen Abbildern“ führt und für das Kind einen bedeutungsmäßigen Zusammenhang zwischen innerorganischer Befindlichkeit und von aussen kommenden Eindrücken herstellt.
Ist die Phase der perzeptiven Tätigkeit dadurch gekennzeichnet, dass die auf der Basis der sinnlich vitalen Bedürfnisse/Bedarfs entstehenden Emotionen das Motiv der Tätigkeit sind, kann gegen Ende dieser Phase und dem Übergang zur nächsten Phase der dominierenden Tätigkeit sowohl auf diese Weise wie auch durch von aussen kommende Eindrücke (Reize, Stimulationen) die Tätigkeit des Kindes aktiviert werden, die sich nun auf den Gegenstand orientiert und sich fortschreitend im Umgang mit diesem selbst strukturiert.
-
Die manipulierende Tätigkeit
Diese ungefähr vom siebten bis zum zwölften/dreizehnten Lebensmonat dominierende Tätigkeit ermöglicht dem Kind bereits die erfolgreiche Ausgliederung von Objekten aus der Gesamtheit der aus der Umwelt kommenden Informationen in seiner Wahrnehmung, d.h., es kann die Verknüpfung der Widerspiegelung mehrerer Eigenschaften eines Objektes zu einem einheitlichen amodalen Abbild integrieren und im gewissen Grad bereits die Veränderung des Objekts in Raum und Zeit widerspiegeln. Dieses ermöglicht dem Kind auch Bezugspersonen an unterschiedlichen äußeren Merkmalen zu unterscheiden, was sich in dem Ansatz von Spitz im Sinne der 8-Monats-Angst äußert, der zweite Indikator für eine neu erreichte Stufe der psychischen Organisation, wie das 3-Monats-Lächeln als Indikator der ersten psychischen Organisation auf dem Wege der Objektentwicklung gesehen wird.
Die Möglichkeit zum durch Sehen geleiteten Hantieren mit Objekten erlaubt die differenzierte Entwicklung motorischer und bewegungsmäßiger Fertigkeiten mittels derer das Kind nun erste individuelle Gegenstandsbedeutungen erwirbt. Das bedeutet, dass es in der Entwicklung des Kindes nun durch diese manipulierende Tätigkeit auf der Basis der sinnlichen Erfahrungen zu ersten amodalen Bedeutungskonstitutionen kommt. Das Interesse und die Neugier des Kindes, sein Bedürfnis nach neuen Eindrücken, weiten sich über die Bezugsperson hinaus auf die Gegenstände aus, die dem Kind im sozialen Kontext durch seine Bezugspersonen zur Verfügung gestellt werden. Erinnern wir uns an das aufgezeigte Beispiel mit dem Löffel, so ist dieser für das Kind zu Beginn dieser Phase eben ein Gegenstand, den man im Licht bewegen kann, der glänzt, mit dem man auf etwas klopfen kann, den man fallen lassen kann, der aber auch von anderen ähnlichen Gegenständen deutlich zu unterscheiden ist. Dadurch, dass der Löffel nun bei der Befriedigung des sinnlich vitalen Bedarfs beim Essen als ein Werkzeug in Erscheinung tritt, kann er auf der nächsten Stufe der dominierenden Tätigkeit auch als Werkzeug und damit im Sinne seiner Produkt- und Symbolbedeutung erkannt werden.
In dieser Phase hat das Kind einen objektiven Bedarf an adäquaten, strukturierbaren und zu strukturierenden Informationen aus der Umwelt, der, wird er nicht erfüllt, durch z.B. sensorische Deprivation oder andere Negationen der Befriedigung dieser Bedürfnisse des Kindes zu Störungen der Entwicklung führen kann, wie das Spitz mit dem Hospitalismus- Syndrom beschrieben hat, wie die Vorenthaltung der Befriedigung der Bedürfnisse des Kindes auf der Stufe der perzeptiven Tätigkeit im Zusammenhang mit Entwicklungen zu sehen sind, die mit psychosomatischen Störungen, motorischen Stereotypien und Autismus beschrieben werden.
- 122 -
Piaget beschreibt diese Phase mit dem dritten Stadium und der sekundären Zirkulärreaktion, die auf die neu erworbene Fähigkeit, Schemata zu entwickeln, zurückgehen, mittels derer durch das Kind zufällig entdeckte Ereignisse reproduziert werden können. Piaget beobachtet das Bestreben des Kindes, jedes interessante Handlungsergebnis, das aufgrund einer Einwirkung auf die Außenwelt erzielt worden ist, neu hervorzurufen. Dabei ist das Ziel nicht von vornherein gegeben, sondern wird erst im Augenblick der Wiederholung der Handlung gesetzt. Dies zeigt in der Entwicklung des Kindes die Nahtstelle zwischen vorintelligenten Handlungen und wirklichen Operationen. In diesem Stadium liegen also das Ziel und das Ergebnis des Handelns des Kindes in der Außenwelt. Löste das Kind in der vorausgegangenen Phase durch seine Bewegungen z.B. das Schaukeln von aufgehängten Bällen aus, was es erfreut und sich immer noch mehr bewegen ließ, so dass auch das Schaukeln der Bälle sich verstärkte und andauerte, vermag das Kind in dieser Phase jetzt schon das Ergebnis seines Handelns zu antizipieren (vorwegzunehmen; wenn ich mich bewege, werden die Bälle schaukeln), so dass das eintretende Resultat der Handlung (das Schaukeln der Bälle durch Bewegung) kein Zufall mehr ist.
Diese Handlungen machen auch deutlich, dass der als Antrieb fungierende organische Bedarf fortschreitend den funktionellen Bedürfnissen untergeordnet wird. Somit löst das Bedürfnis den einzelnen Akt wie auch die fortlaufende Betätigung aus, was verdeutlicht, dass auch auf dieser Stufe das assimilative Moment, das das Lernen organisiert, noch im Vordergrund steht. Der akkommodative Anteil dieser Handlungen besteht darin, dass der Säugling, um sein Bedürfnis nach Wiederholung der Ereignisse zu befriedigen, nun eben jene Bewegungen erlernen muss, die für eine beständigere Produktion des Ereignisses notwendig sind. Das Kind hat dabei nicht vor, ein neues Verhalten zu „erfinden“, hat sich also zu Beginn noch kein Ziel gesetzt. Auf der Basis der Koordination dieser Möglichkeit entdeckt das Kind, dass man greifen kann, was man sieht, und anschauen, was man ergriffen hat. Piaget betont, dass „die Wirklichkeit das Kind ständig zu immer neuen Akkommodationen zwingt“.
Die Objekte werden für das Kind zum „Bedeutungsträger“ und das Kind kann nun schon insofern „Klassen“ bilden, als bestimmte Bewegungen z.B. bestimmten Gegenständen zugeordnet werden. Auf dieser Stufe leistet das Kind die visuelle Antizipation zukünftiger Positionen von Gegenständen, es vermag also den Ort zu bestimmen, wo ein bewegter Gegenstand zu liegen kommt; es beginnt einen verschwundenen Gegenstand zu suchen, was bedeutet, dass der Gegenstand eine Art subjektive Permanenz hat. Die Zirkulärreaktion kann unterbrochen, aufgeschoben und später wieder fortgesetzt werden und schließlich kann das Kind einen Gegenstand auch schon an wenigen Teilen, die man ihm zeigt, erkennen.
Im nächstfolgenden vierten Stadium nach Piaget (ungefähr im zehnten bis zwölften Lebensmonat) wendet das Kind zuvor erlernte Verhaltensmuster verallgemeinernd auf neue Probleme an, d.h., das Kind unterscheidet Mittel und Ziel, es beginnt Werkzeuge zu gebrauchen. Es leistet also eine Koordination verschiedener Schemata. Dient ein Schema als Mittel, ein anderes als Ziel, werden zwei früher erlernte Verhaltensmuster in neuer Weise kombiniert. Was die Handlung betrifft, hat das Kind also bereits zu Beginn das Ziel im Auge, d.h., es entdeckt es nicht wie zuvor durch Zufall.
Verwehrt ein Hindernis den Zugang zum Ziel, erfolgt durch das Ziel eine direkte Annäherung, und um das Hindernis zu überwinden, verwendet das Kind ein Schema (Mittel), das anders ist als jenes, das sich auf das Ziel (Zweck) richtet. Damit kommt das Kind zur Voraussicht von Ereignissen, die von der eigenen Handlung auch unabhängig sein können. Diese Fähigkeit zur Antizipation ermöglicht ihm nun z.B. auch Speisen, die es nicht mag, schon abzulehnen, ehe die Erfahrung des unangenehmen Geschmackes oder Geruches eintritt, dadurch, dass es eines Gefäßes ansichtig wird, in dem z.B. die unbeliebte Speise immer gereicht wird.
Bezogen auf die jetzt mögliche Abbildstruktur in der Phase der manipulierenden Tätigkeit erwirbt das Kind also individuelle Gegenstandsbedeutungen,
- 123 -
was die nächste Etappe der Entwicklung seiner dominierenden Tätigkeit ermöglicht.
-
Die gegenständliche Tätigkeit
Diese, das zweite und dritte Lebensjahr umfassende dominierende Tätigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind, wie eben den Ausführungen Piaget‘s folgend bereits angedeutet wurde, zwischen Ziel und Mittel seiner Tätigkeit zu unterscheiden vermag und beide aufeinander beziehen kann. Damit kann es seine Handlungen einem bestimmten Zweck zugunsten eines bestimmten Zieles zu- und unterordnen und Gegenstände als Werkzeuge verwenden, um ein bestimmtes zuvor schon vorgestelltes, antizipiertes Produkt zu erreichen.
Durch die sich immer mehr ausdifferenzierenden Möglichkeiten der Bewegung und durch den aufrechten Gang, der die Hände sozusagen freisetzt, ist die weitere Expansion seiner Tätigkeit im Rahmen der sozial vorgegebenen Freiheitsgrade möglich (je nachdem ob im Laufstall eingesperrt, in kleiner Wohnung begrenzte oder ob einem Kind ein eigenes Kinderzimmer, ein Haus und Garten und eine Person zur Verfügung stehen, die mit ihm darüber hinaus vielfältige Aktionsmöglichkeiten erschließt). Auf der Grundlage häufiger Wiederholungen der Tätigkeit bildet sich auf kortikaler Ebene ein umfassendes Gedächtnis von Werkzeugbedeutungen aus, das die Tätigkeit des Kindes anregen und bestimmten kann. In seinen Handlungen muss das Kind die unterschiedlichen Aspekte von Motiv, Mittel und Ziel der Tätigkeit entsprechend seinen Bedürfnissen in den jeweils erforderlichen Zusammenhang bringen, wie es diese Möglichkeit ihrerseits wesentlich nur aus der Tätigkeit entwickeln kann. Dabei wird der Erwachsene als aktiver Kommunikationspartner in neuer Sicht für das Kind bedeutend, da nun die angeeigneten Gegenstandsbedeutungen in und durch die Tätigkeit mit dem Erwachsenen objektiviert und zu instrumentellen Bedeutungen weiterentwickelt werden können und müssen. Erfolgreiche Tätigkeitserfahrungen und Werkzeugbedeutungen werden auf verschiedene Gegenstände verallgemeinert, so dass nun auch amodale Tätigkeits- und Werkzeugbedeutungen freigesetzt werden.
Im Spiegel der Arbeiten von Piaget kommt das Kind im fünften Stadium (12. bis 18. Monat) nun zur Bildung neuer Handlungsschemata. Hat das Kind im dritten Stadium durch fortwährendes Manipulieren der Dinge eine Reihe von Handlungsschemata aufgebaut (sekundäre Zirkulärreaktion) und im vierten Stadium diese sekundären Handlungsschemata koordiniert, erste Intelligenzhandlungen vollzogen, indem bekannte Mittel auf neue Umstände angewendet und Mittel und Ziel unterschieden wurden, kommt es nun zu den tertiären Zirkulärreaktionen, die darin besteht, dass der zufällig erzielte neue Effekt nicht nur reproduziert, sondern mit der Absicht modifiziert wird, sein Wesen zu erforschen, durch Ausprobieren neue Mittel zu entdecken.
Werden mit der sekundären Zirkulärreaktion bekannte Mittel auf neue Situationen angewendet, werden in der tertiären Zirkulärreaktion durch Ausprobieren neue Mittel gefunden. Das zeigt, dass nun die Akkommodation sich deutlich von der Assimilation differenziert und die Akkommodation die Assimilation leitet. Die instrumentelle Verwendung von Gegenständen wird möglich, d.h., das Kind benutzt einen Stock, um sich z.B. etwas heranzuholen. Der Aufbau der tertiären Zirkulärreaktion erfolgt dadurch, dass das Kind beim Versuch, neue Gegenstände an ein vertrautes Schema zu assimilieren, auf Widerstände stößt. An diesen Widerständen findet es nun aber Interesse und versucht, die Widerstände dadurch zu überwinden, dass es neue Handlungsmöglichkeiten ausprobiert und erfindet. Mittels der Akkommodation kann es der Widerstände Herr werden, d.h. sie wieder an seine Schemata assimilieren.
Beobachten wir ein Kind von aussen, erweckt seine Tätigkeit auf diesem Niveau den Eindruck eines Handelns nach Versuch und Irrtum, während es vom Standpunkt der inneren Handlungslogik her zielstrebig (also auf ein Ziel gerichtet) orientiert ist und verschiedene Mittel ausprobiert. Das Kind versucht, sein Verhalten in Antwort auf die Anforderungen aus der Umwelt zu modifizieren
- 124 -
(Akkommodation) und ist bemüht, diese nach Maßgabe seiner eigenen Schemata zu verstehen (Assimilation).
Im sechsten Stadium (18. - 24. Monat) erkennt Piaget die systematische Intelligenz, die das Verhalten des Kindes charakterisiert. Schieben sich zwischen Absicht und Ziel neue Hindernisse, muss das Kind adäquate Mittel finden, das Hindernis zu bewältigen, es muss etwas Neues erfunden werden. Dieses geschieht aber nicht mehr durch Ausprobieren, sondern durch eine schnelle Reorganisation schon bestehender Schemata, durch ein Handeln im Denken.
Das setzt voraus, dass das Kind sich mittels symbolischer Vorstellungen und Wörter auch auf abwesende Gegenstände beziehen, sich vom konkreten Hier und Jetzt befreien und die Welt des Möglichen erschließen kann. Wo die Lösung durch Denken möglich ist, braucht nicht mehr tatsächlich ausprobiert zu werden, das Denken ersetzt dieses. Die Handlungen wurden verinnerlicht.
Waren in der zweiten Hälfte der zweiten Stufe der dominierenden Tätigkeit sinnlich vitaler Bedarf und psychische Bedürfnisse das Motiv zur Tätigkeit, die sich auf Objekte (Dinge und Personen) bezog, und im handelnden Umgang mit diesen wiederum neu, die Tätigkeit motivierende Bedürfnisse entstanden, wird auf der Stufe der gegenständlichen Tätigkeit, die dritte Phase in der Entwicklung des Kindes, der mit dem antizipierten Ziel und Produkt der Tätigkeit verbundene Sinn zum Motiv der auf das Ziel gerichteten Handlungen, wobei als Mittel, das Ziel zu erreichen, Werkzeuge und Sprache eingesetzt werden, wodurch im Sinne der erreichten Abbildstruktur individuelle Werkzeug- und individuelle Tätigkeitsbedeutungen entstehen.
In den Arbeiten von Spitz ist diese Phase durch das in Erscheinung treten des dritten Organisators, der semantischen Nein-Geste gekennzeichnet (die Verwendung eines Symbols bzw. eines Begriffes für das Wahrgenommene) und des vierten Organisators, der in verbalen Berichten von Träumen gegen Ende des zweiten Lebensjahres gesehen wird und bereits den Ansatz zur Ich-Reflexivität in der psychischen Entwicklung dokumentiert. Damit können auch Erfahrungen, die zum Selbst- und Nicht-Selbst gehören, lokalisiert und im Sinne der basalen Ich-Funktionen eine Realitätsprüfung und -kontrolle umfassend ermöglicht werden.
Die bisher aufgezeigten drei Stufen der Entwicklung skizzieren die Entwicklungsverläufe der Kinder bis zu einem Alter, zu dem sie dann durch den Eintritt in den Kindergarten eine bedeutende Ausweitung ihrer sozialen Bezüge erfahren und die nächste Stufe ihrer dominierenden Tätigkeit erreicht wird. Die Abb. 7 (siehe nächste Seite) soll den bislang geschilderten hierarchischen Tätigkeitsaufbau kurz verdeutlichen.
Im Vergleich zur phylogenetischen Entwicklung hat das Kind nun die Stufe des Lernens durch Einsicht erreicht; allerdings sind die Gegenstände, die der Mensch als Werkzeug benutzt, im Vergleich zum Tier nicht Naturgegenstände, sondern hergestellte Werkzeuge, zweckgebundene Gegenstände, in denen das gesellschaftliche Erbe, die gesellschaftliche und historische Erfahrung vergegenständlicht ist. In der weiteren Entwicklung geht es nun darum, dem Kind in seiner Individualentwicklung diese gesellschaftlich angesammelte Erfahrung und die darin eingebundenen Bedeutungen zu erschließen, was nur dadurch möglich ist, dass die Tätigkeit des Kindes durch die betreuenden Erwachsenen (Pädagogen) entsprechend angeleitet wird, wobei es für das Lernen, wie schon aufgezeigt, von besonderer Bedeutung ist, dass es in emotional positiven Situationen für das Kind stattfindet und dass die adäquate Ausführung seiner Tätigkeit bekräftigt wird.
War die Denktätigkeit bisher wesentlich auf das sinnlich Erfahrbare und das bewegungsmäßig Ausgeführte zentriert, kommt es nun durch die weiter fortschreitende Sprachentwicklung zu einer Synthese zwischen der bisherigen Form der Denktätigkeit und der Sprache im Sinne des „sprachlichen Denkens“. Die Erkenntnistätigkeit des Kindes richtet sich ab dem dritten Lebensjahr nun auch auf die eigene Person, was mit dem Begriff des reflexiven Ich angedeutet wurde.
- 125 -

Abb. 7: Hierarchischer Tätigkeitsaufbau und die Entwicklung des Denkens
-
Die dominierende Tätigkeit des Spiels
Diese vom dritten bis sechsten Lebensjahr, also in der Zeit anzusetzende Phase, in der das Kind den Kindergarten besucht, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang von der Individualität zur Persönlichkeit geleistet wird.
In dieser recht langen Phase können sowohl noch die gegenständliche Tätigkeit (dritte Phase), aber auch schon Formen des schulischen Lernens (fünfte Phase des Schulalters) und der Arbeit (sechste Phase des Erwachsenenalters) sich entwickeln und in der Tätigkeitsstruktur darstellen.
Auf der Basis der erworbenen Fähigkeiten ist das Spiel des Vorschulkindes stets real und sozial. Die Orientierung der Tätigkeit erfolgt wesentlich auf
- 126 -
die Handlung selbst und im Gegensatz zur Arbeit wird die Orientierung auf das Produkt im Spiel zurückgestellt, d.h., das vorrangige Produkt des Spiels ist also die Beherrschung von Handlungen durch das Kind, Handlungen, die wesentlich durch die Erweiterung der Sozialbezüge auf den benannten Voraussetzungen die ‚kooperative Tätigkeit‘ ermöglichen.
Aus der langen Entwicklung der Spieltätigkeit aus einfachsten Nachahmungen der frühen Phasen heraus kommt es in dieser Phase immer mehr zur Übernahme und Ausgestaltung einer Rolle und damit zur Entwicklung und zum Verständnis von Regeln. Auch hier gilt die wechselseitige Dialektik des Austauschprozesses: Indem das Kind spielt, entwickelt das Spiel das Kind. Die wesentlich auf soziale Zusammenhänge bezogene individuelle Tätigkeit des Spiels wird aber auch durch andere Kinder und die Erzieher unterschiedlichen Wertungen unterzogen, die fortschreitend vom Kind verinnerlicht werden und im Kind zum Begriff für erfolgreiche oder erfolglose Tätigkeit für „gut“ und „schlecht“ werden und wesentlich seine „Selbsteinschätzung“ bestimmen. Im Rollenspiel geht es zunächst um die Reproduktion von Ideal-Situationen, in denen das Kind so handelt, wie sich z.B. die in der Rolle dargestellte Person idealerweise verhalten sollte, während später die Rollen und Regeln weiter in dem Masse ausgespielt werden, wie sich die Realitätskontrolle des Kindes ausweitet. Im Laufe des Prozesses von der Bewertung durch andere zur Selbsteinschätzung treten dann beim Kind auch sittliche Verhaltensmotive hervor, d.h., es kommt zur Ausbildung ethischer Instanzen, in denen die vom Kind erlebten realen Umweltsituationen widergespiegelt sind.
Im Laufe der auf dieser Stufe zur Ausbildung kommenden Abbildstruktur beginnt das Kind, im Spiel sich seines sozialen Ich bewusst zu werden, d.h., es vermag sich nicht nur als Subjekt gegenständlicher Handlungen, sondern als Subjekt in einem differenzierten System sozialer menschlicher Beziehungen zu begreifen. Die konkreten Handlungen, die das Kind auf dieser Niveaustufe ausführt, können vom Denken getrennt werden, was in der nun möglichen Theoretisierung der Handlungen ermöglicht, im Sinne eines neuen Niveaus der Orientierungstätigkeit Beziehungen vom persönlichen Ziel zu Gegenstand, Mittel, Produkt und Tätigkeit zu vollziehen und sich die Produkt- und Symbolbedeutungen gesellschaftlicher Tätigkeitsbedeutungen zu eigen zu machen.
Die Abbildstruktur ermöglicht also, die individuelle Ich-Bedeutung und die persönliche Gegenstandsbedeutung aufzubauen.
Dies bedeutet auch die Ausbildung neuer Bedürfnisformen im Sinne der „produktiven Bedürfnisse“, die neben den nach wie vor bestehenden sinnlich vitalen Bedürfnissen zur Basis der Motivation der Tätigkeit werden. Es bildet sich also eine Hierarchie der Motive wesentlich durch den Einbezug und die Verarbeitung der an anderen Kindern und Erwachsenen beobachteten und erschlossenen Handlungsweisen aus, was nur unter der Bedingung adäquater Kooperationen vonstatten gehen kann. Ohne die Möglichkeit dazu kann das gesamte Entwicklungsniveau erheblich beeinträchtigt werden, so dass sowohl die Sicherung der Antizipation des Produkts wie das Eingehen kooperativer Beziehungen gestört oder verunmöglicht wird, wie durch adäquate Sicherung dieses Niveaus, wie Jantzen betont, „eine Ich reflexive persönliche Sinngebung in der Einheit von subjektiver Motivation und objektiv Erkanntem im Erkenntnisprozess“ und damit nach Leont‘ev die „erste Geburt der Persönlichkeit“ möglich wird (40). Im Sinne der Arbeiten von Piaget wandelt sich in dieser Phase das vorbegrifflich anschauliche Denken zum begrifflichen Denken, das dann in der nächsten Stufe der dominierenden Tätigkeit des (schulischen) Lernens zum konkret operativen Denken wird, das sich in Fortsetzung der Entwicklungslogik über das formal logische bis hin zum kategorialen Denken entwickeln kann. Diese Prozesse kennzeichnen bereits die 5. und 6. Stufe der dominierenden Tätigkeit des „(schulischen) Lernens“ und der „Arbeit“, in denen fortschreitend persönliche Werkzeug- und Tätigkeitsbedeutungen und persönliche Ich-Bedeutungen erworben werden, bei deren Störung es zur Entwicklung von Neurosen, von Störungen schizophrener und depressiver Art kommen kann. In diesen Phasen eignen sich Kinder und Jugendli-
- 127 -
che die in der gesellschafts-historischen Praxis verallgemeinerten, vergegenständlichten und verwissenschaftlichen Kenntnisse von Wirkungszusammenhängen der gesamten natürlichen und sozialen Umwelt an (41).
Im Laufe der dominierenden Tätigkeit des Spiels, in der über das Lernen die Aneignung der gesellschaftlichen Bedeutungen im persönlichen Sinn sich vollzieht, spielen in einer ersten Phase Spielsituationen und gegenständliche Spiele eine Rolle als Weg und Mittel, um mit den Erwachsenen zu kommunizieren. In einer zweiten Phase gewinnt das Anhören einer Geschichte an Bedeutung und in einer dritten Phase interessieren besonders Gespräche über die eigene Person und andere Menschen. Beginnend mit dieser Entwicklungsphase (und fortgesetzt in den nachfolgenden Phasen der dominierenden Tätigkeit hinein) bildet das Kind begrifflich Abbilder der objektiven Realität (in Natur und Gesellschaft) einschließlich jene der eigenen Körperlichkeit und Existenz aus. Sie entstehen, wie Jantzen betont, dadurch, dass die sozialhistorisch vorgefundenen Bedeutungsstrukturen in den persönlichen Sinn übernommen werden. Diese Bedeutungen entwickeln sich in einem Prozess dialektischer Übergänge von außen nach innen und werden zunächst intersubjektiv als tätigkeits- und praxissteuernde Abbilder durch Kooperation in der „Zone der nächsten Entwicklung“ vermittelt, um dann intrasubjektiv als Begriffe steuernd verwendet werden zu können (42).
Diese Zusammenhänge bezeichnen jene Entwicklungsstufe, die wir in der Arbeit im Regelkindergarten in mehr oder weniger fließenden Übergängen und individuell ausgeprägten Varianten bei der Mehrzahl der Kinder vorfinden und in der pädagogischen Konzeption zu berücksichtigen haben. Bei Einbezug behinderter Kinder im Sinne der integrativen Arbeit haben aber alle vorausgegangenen Stufen, bei schwerstbehinderten Kindern selbst solche, die in die pränatale Phase zurück reichen, entwicklungslogische Bedeutung.
Eine Konzeption integrativer Pädagogik muss in ihren Ziel- und Inhaltsstrukturen jedes Niveau abzubilden vermögen und in Antizipation der entsprechenden Tätigkeitsstruktur der Kinder in dieser gemäße Angebote zu übertragen. Dabei ist jedoch ein in der Abfolge der vorausgegangenen Betrachtung noch nicht hinreichend erwähntes Faktum von besonderer Bedeutung sowohl hinsichtlich der Entwicklung der psychischen Funktionen wie der Vermittlung im pädagogischen Zusammenhang, nämlich die Sprache.
Exkurs:
Die Entfaltung menschlicher Tätigkeit und Sprache
Sprache selbst hat sich innerhalb der kollektiven Tätigkeit des Menschen und deren bewussten Verkehr untereinander entwickelt. Sie ist also Produkt kooperativer menschlicher Tätigkeit wie Werkzeug in der Kooperation zwischen Menschen. Im semantischen Gehalt der Sprache gewinnt das Wort die Bedeutung eines Mittels der bewussten Einwirkung auf und Mitteilung an andere. Entsprechend ist das Sprechen eine Tätigkeit, eine Verkehrsform des Ausdrucks und der Einwirkung, eine Form der verallgemeinerten Widerspiegelung der Wirklichkeit oder die Existenzform des Denkens (43). Hervorgegangen aus der Notwendigkeit menschlichen Verkehrs untereinander wurde die Sprache in der Phylogenese fortschreitend Mittel der Vergegenständlichung des sich in gleicher Weise entfaltenden menschlichen Bewusstseins, wie wir dies im Rahmen der ontogenetischen Betrachtung der frühen menschlichen Entwicklung in Form der Konzeption der dominierenden Tätigkeit verdeutlichen konnten
Aus Sprechlauten, die eng mit Gesten verbunden waren und deren Bedeutung nur im Rahmen der Situation (von der konkreten Handlung her; sympraktischer Charakter der Sprache) erschlossen werden konnte, entwickelte sich zu einem System von Codes, das Gegenstände und Handlungen sowie deren Beziehungen zu erfassen vermag. Dabei ist das Wort der Träger einer bestimmten Bedeutung und somit grundlegendes Element der Sprache, das die Dinge bezeichnet, das Merkmale, Handlungen und Beziehungen benennt. Auf dem Weg dieser Entwicklung gewinnt sie „kategoriale Bedeutung“, verliert sie ihren sympraktischen Charakter zugunsten der Herausbildung eines synsemantischen Systems, das ohne die sinnliche Präsenz
- 128 -
der bezeichneten Gegenstände oder der zu beschreibenden Situation, diese treffend und allgemein verständlich zu charakterisieren vermag. Mit Fortschreiten der Entwicklung des Denkens im Sinne der Fähigkeit, Verallgemeinerungen und Abstraktionen zu bilden, wird das Wort, in dem es Merkmale abstrahiert und Gegenstände verallgemeinert, zum Werkzeug des Denkens. Sprache und Denken werden identisch und schließlich zu einem einheitlichen Prozess zusammengefasst.
In der Ontogenese vermag das Kind schon im Alter von 5 bis 6 Monaten eine allmähliche Ausgliederung der verbalen Signale aus allen übrigen Komponenten der ihm zur Verfügung stehenden Information vorzunehmen. Die Reaktionen auf die sprachlichen Signale sind zu dieser Phase aber noch abhängig von der Stimme, dem Gesichtsausdruck, der Situation und der Gestik.
Im Alter von 7 bis 8 Monaten beginnt dann die Ausbildung eines Systems von generalisierenden Verbindungen, die hinter dem Wort stehen. Das Kind verbindet ein an es gerichtetes Wort nun nicht mehr nur mit der eigenen Bewegung; es ist also nicht nur mehr ein Signal, das eine bestimmte Reaktion auszulösen vermag, sondern das Wort verbindet sich jetzt mit einzelnen Merkmalen der vom Kind unmittelbar wahrgenommenen Gegenstände, bis es, ungefähr um die erste Hälfte des 3. Lebensjahres, jene präzise gegenständliche Bedeutung erhält (die nominative Funktion), die den allgemein gebräuchlichen Wörtern des Erwachsenen eigen ist (44).
Dies verweist deutlich darauf, dass Kinder beim Eintritt in den Kindergarten mehr oder weniger den Übergang von der noch sehr signalhaften und sympraktischen Funktion des Wortes zur semantischen vollziehen oder vollzogen haben und entsprechend in der Kommunikation im Rahmen integrativer pädagogischer Arbeit die gesamte Bandbreite sprachlicher Entwicklung im Sinne der aufgezeigten Wortbedeutung zu berücksichtigen ist, also Intonation und Rhythmisierung, Mimik und Gestik und die Eindeutigkeit der Bezeichnung und die Klarheit des sprachlichen Ausdrucks eine wesentliche Grundlage der anzuwendenden kommunikativen Verkehrsformen bedeuten, ganz abgesehen davon, dass die Wortbedeutungen und Begriffe nie ausserhalb des Erfahrungsfeldes und -horizontes des Kindes zu erreichen sind. Gekennzeichnet ist der Prozess des Sprechens im Zusammenhang mit dem Prozess der Fähigkeit zur Ausgliederung des verbalen Signals aus allen übrigen Komponenten, die auf ein Kind in einer Situation einwirken, woraus zur pädagogischen Unterstützung des Spracherwerbs wiederum die Notwendigkeit sich verdeutlicht, dem Kind Hilfen zu geben, den diskriminativen Lernprozess der Ausgliederung dieser Komponente zu erleichtern.
Im Übergang von der sympraktischen zur synsemantischen Entwicklung der Sprache nimmt der Wortschatz zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr erheblich zu. Fortschreitend kann das Kind entsprechend das Wort von der Handlung lösen und sich schließlich auch die Grammatik der Muttersprache aneignen.
Das Wort „bezeichnet“ aber nicht nur (Merkmale, Handlungen, Beziehungen), sondern es analysiert und verallgemeinert auch die Gegenstände. Entsprechend verändert sich in jeder Etappe der Entwicklung auch die Sinnstruktur des Wortes, d.h., es entwickeln sich die Wortbedeutungen (45). Indem sich die Wortbedeutung entwickelt, ändert sie aber auch das System psychischer Prozesse, durch das sie selbst realisiert wird. Insofern kann Sprache als eine spezifische Form der Ausdifferenzierung der psychischen Tätigkeit verstanden werden, wie die Sprache selbst die psychische Tätigkeit weiter differenziert. Ihre wesentliche Funktion besteht nach innen gewendet darin, alle höheren psychischen Funktionen zu steuern und zu strukturieren.[66]
Nach Vygotski kann die „äußere Sprache“ als die Verwandlung der Gedanken in Worte, als ein Prozess der „Materialisation“ verstanden werden, während die „innere Sprache“ der entgegengesetzt verlaufende Prozess der Verdampfung der Sprache in den Gedanken ist. Entsprechend sind äußere Sprache und innere Sprache zu unterscheiden. Mit der Entwicklung der inneren Sprache ist dann auch die Synthese der sich aus verschiedenen Wurzeln entwickelnden Sprache und des Denkens möglich.
- 129 -
Sprache als Verkehrs- und Verständigungsform nach außen und als Werkzeug des Denkens und Mittel der Strukturierung der psychischen Prozesse nach innen differenziert sich ab dem 3. Lebensjahr immer weiter aus. In dem Maße, wie es dem Kind im Laufe seiner Entwicklung im Rahmen der dritten Phase der dominierenden Tätigkeit gelingt, die eigenen Bewegungs- und Tätigkeitsmuster von dem sie vermittelnden Werkzeug zu trennen, also invariant zu setzen, erhält die Sprache über ihre erworbenen Begrifflichkeit hinaus den Charakter eines Symbols, und dem Kind wird es möglich, von sich selbst nicht mehr in der dritten, sondern in der ersten Person zu sprechen es vermag Ich zu sagen.
In der für die Kindergartenzeit der Kinder so bedeutenden Phasen des Übergangs von der gegenständlichen Tätigkeit zum Spiel wird ein Niveau in der kindlichen Entwicklung erreicht, auf dem die Sprache selbst zum Hauptgegenstand der Aneignung wird. Damit gewinnt auch in der pädagogischen Arbeit im Kindergarten die Sprache immer mehr die Funktion eines zentralen Aneignungsgegenstandes; sie transferiert Bedeutungen, regelt den sozialen Verkehr und strukturiert und reguliert die innerpsychischen Prozesse, wird Werkzeug des Denkens und durch ihre Symbolfunktion Basis eines persönlichkeitsspezifischen Bewusstseins. In einer diese Grundlagen berücksichtigenden pädagogischen Konzeption können Sprache und Sprechen aus dem Gesamtzusammenhang der Entwicklung und der Ausbildung der Tätigkeitsstruktur eines Kindes, aus der Entwicklung seiner sensorischen und motorischen Funktionen, aus der aktuellen Interaktion und der realen Kooperation nicht herausgenommen, d.h. auch nicht als isolierte Therapie aus dem Kontext der pädagogischen Arbeit in der Gruppe herausgelöst werden, wenn sprachheilpädagogische bzw. sprachtherapeutische Hilfe erforderlich werden.
Die aufgezeigten Zusammenhänge menschlicher Entwicklung unter besonderer Beachtung der „dominierenden Tätigkeit“ wie der jeweils damit korrespondierenden „Abbildstruktur“
in der psychischen Widerspiegelung der mittels der Tätigkeit erfahrenen, in den Gegenständen der Realität repräsentierten, objektiven Realität und die entwicklungslogischen Folgen beim Auftreten von isolierenden Bedingungen im Aneignungsprozess können in Anlehnung an Petrowsky und Jantzen wie folgt in einer Übersicht (Abb. 8) zusammengefasst werden (46) – (siehe nächste Seite oben).
Auf der Basis der kurz dargestellten Zusammenhänge der allgemeinen Grundlagen menschlicher Entwicklung, ihrer lernpsychologischen Aspekte und des in der Ontogenese entwicklungslogisch prozesshaften Verlaufs der Ausbildung der Abbild- und Tätigkeitsstruktur erfährt die unter Punkt 1 des Berichtes herausgearbeitete Beschreibung und Bestimmung von Integration ihre zentrale Begründung sowohl im pädagogischen wie im außerpädagogischen Feld. Es wird deutlich, weshalb Integration nur in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand unter Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsniveaus eines Menschen realisierbar ist. Im Einzelnen ergibt sich:
1. In tätiger Auseinandersetzung mit der „an sich“ bestehenden objektiven Realität wird diese angeeignet und nach Maßgabe des Grades der Aneignung für die Betroffenen zur Welt „für mich“.
2. Die objektive Realität präsentiert sich in naturhaften wie gesellschaftlich hergestellten Gegenständen, die in der Dimension der von ihnen ausgehenden Signale und Merkmale in Form ihrer sinnlich verifizierbaren Eigenschaften (modaler Aspekt), aber auch in der Dimension ihrer allgemeinen Struktur, der Beziehung der Merkmale untereinander, der Beziehung der Gegenstände zueinander und in der Dimension der Beziehungen der Gegenstände zu den Menschen und deren Beziehungen untereinander im Sinne raum-zeitlicher Dimension (amodaler Art) im Subjekt zur Abbildung kommen.
- 130 -
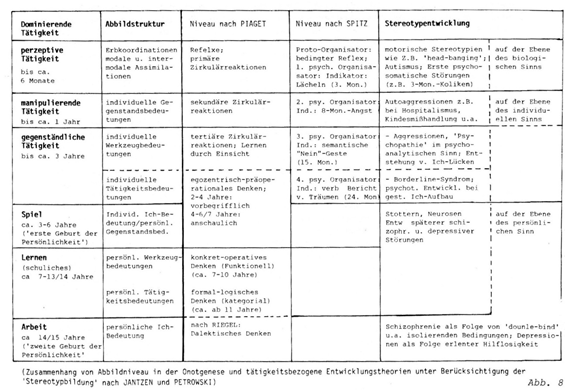
3. Im Sinne der Anpassungs- und Aneignungs- wie Vergegenständlichungsprozesse bestimmt der Gegenstand (assimilativ-akkommodativer Aspekt) die Tätigkeit, wie die Tätigkeit (akkommodativ-assimilativer Aspekt) den Gegenstand bestimmt.
4. Als naturhaft vorfindbarer bzw.beziehungsweise sozial gesellschaftlich hergestellter Gegenstand besitzt dieser eine historisch logische Sach- und Bedeutungsstruktur, die im handelnden Umgang vom Subjekt erschlossen wird.
Die mit verschiedenen Gegenständen erfahrenen Bedeutungen wie die an den Gegenständen differenzierte Tätigkeit erschließen den Zusammenhang von „Mittel“ und „Ziel“ einer Handlung, so dass die angeeignete Tätigkeitsstruktur im handelnden Umgang mit den Gegenständen deren Gebrauch als Werkzeug ermöglicht.
5. Reproduktive wie produktive Tätigkeit im handelnden Umgang mit dem Gegenstand führen zu einem zufälligen und später gezielt herstellbaren Produkt, wie die Gegenstände selbst ihrerseits Produkt menschlicher Tätigkeit sind.
Gegenständliche Tätigkeit ist immer unmittelbar (z.B. beim Stillen eines Kindes oder bei einem Ballspiel mit einem Partner) oder mittelbar (z.B. Lesen eines Buches eines nicht anwesenden Autors) kooperativ und bedarf deshalb notwendig der entsprechenden (interaktiven und kommunikativen) Verkehrsformen.
- 131 -
6. Gegenständliche Tätigkeit in höchst entfalteter Form wäre die sinnmotivierte und zielorientierte produktbezogene (arbeitsteilige) kooperative Arbeit, die Interaktions- und Kommunikationsformen einschließt.
Bezogen auf die jeweiligen Abbildniveaus wäre das zufällige/antizipierte Produkt auf der Ebene
-
der perzeptiven Tätigkeit z.B. das Hervorrufen einer Tastempfindung und eines Geräusches beim Bestreichen eines rauhen Gegenstandes und die intermodale Assoziation von Tastempfindung und akustischem Signal;
-
der manipulierenden Tätigkeit z.B. das Ziehen an einer Schnur, um das daran aufgehängte Glockenspiel zum Klingen zum bringen, wobei hierbei Schnur und Glockenspiel noch eine untrennbare Einheit für das Subjekt sind und ihr Gesamt sich zur individuellen Gegenstandsbedeutung verdichtet;
-
der gegenständlichen Tätigkeit z.B. das Ziehen an der Schnur, um das antizipierte Produkt der Bewegung und des Klanges des daran aufgehängten Glockenspiels bewusst hervorzurufen, wobei im Sinne einer individuellen Werkzeug- und Tätigkeitsbedeutung die Schnur als Mittel erkannt wird, das antizipierte Produkt zu schaffen, und die Bewegung des Ziehens als eine spezifische Tätigkeit erkannt wird, die auch in anderen Situationen und in Bezug auf andere Gegenstände zu vergleichbaren Ergebnissen führt
-
des Spiels durch die Kooperation mit anderen Kindern, den Eltern, Pädagogen z.B. die gesellschaftlich definierte Bedeutung des Werkzeuges Schnur, die auch zu Zwecken als brauchbar erkannt werden kann, die bisher individuell nicht notwendig oder notwendig waren oder genutzt wurden. Durch differenzierte Interaktions- und Kommunikationsformen vermag sich das Individuum (z.B. im Rollenspiel) selbst in Beziehung zu anderen, wie auch abgehoben von diesen zu definieren, was z.B. im Zusammenspiel mit dem Orff Instrumentarium mittels der Tätigkeit des Schlagens (Trommel, Triangel, Xylophon, Metallophon u.a.) ermöglicht, im Gruppenzusammenhang ein gemeinsames Stück zu gestalten, dessen Gesamt als das kooperative Produkt der koordinierten individuellen Tätigkeit erkannt wird.
7. Unter der Voraussetzung des zeitlich-räumlichen Beisammenseins behinderter und nichtbehinderter Kinder sind entsprechend unverzichtbare Bestimmungselemente von Integration
-
der Gemeinsame Gegenstand, der entsprechend seiner historisch logischen Sachstruktur je nach dem Niveau der dominierenden Tätigkeit der anwesenden Kinder von jedem erfahrbar, d.h. als der gemeinsame erkannt werden kann,
-
die Kooperation [67] im Sinne des produktorientierten handelnden Umgangs mit dem Gegenstand in raum-zeitlicher Einheit der miteinander Kooperierenden und
-
das antizipierte Produkt als Ergebnis des kooperativen Prozesses am gemeinsamen Gegenstand.
Kooperation allein ist also nicht Integration, sondern nur eine Kooperation, die, entsprechend den von allen Gruppenmitgliedern ausgebildeten raum-zeitlichen Vorstellungen her gesehen, die Distanz der Trennung der Kooperationspartner zu erfassen vermag.
Dies würde z.B. für einen integrativen Prozess in einer Gruppe, in der ein blindes Kind ist, bedeuten, dass ihm über die Brücke der Geräusche die Tätigkeit, die Bewegungen der anderen Kinder oder durch taktile Berührungen eine Brücke zum Gemeinsamen Gegenstand geschaffen werden muss; es würde in einer Gruppe mit einem schwerstbehinderten Kind bedeuten, dass entsprechend seiner intermodal perzeptiven Wahrnehmungsmöglichkeiten, auch wenn in Einzelarbeit (Geben voller Hilfestellungen) mit ihm kooperiert werden muss, die Erfassung des Gemeinsamen Gegenstandes (z.B. an dessen Geruch, an den Geräuschen, an den Bewegungen oder an der vibratorisch wahrgenommenen Rhythmisierung im Tätigkeitsprozess) ermöglicht wird, was bedeutet, dass je schwerer be-
- 132 -
hindert ein Kind ist und je nötiger es Einzelförderung/Therapie zur Ausbildung seiner Tätigkeitsformen und Abbildstrukturen hat, diese umso notwendiger in enger räumlicher Beziehung zu den Interaktions- und Kommunikationspartnern stattfinden muss; es kann in einer Gruppe mit Kindern, die sämtliche auf dem Niveau der gegenständlichen Tätigkeit bzw. des Spiels sind, auch ein Vorhaben gewählt werden, in dem z.B. ein gemeinsam mit einer bestimmten Technik zu erstellende Kollage zeitweise arbeitsteilig in zwei getrennt liegenden Räumen erarbeitet wird, weil sie, auf der Basis der Orientierungsgrundlage (z.B. im Morgenkreis gegeben), in der Lage sind zu antizipieren, welches auch für ihr zu fertigendes Teilstück notwendiges Ergänzungsstück die Kinder der anderen Gruppenhälfte im Nachbarraum gerade herstellen (dabei darf es aber nicht zu einer Arbeitsteilung zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern kommen!!).
Die gemeinsame kooperative Tätigkeit macht immer die Orientierung der Gruppe aufeinander wie der Mitglieder der Gruppe auf den Gegenstand und das antizipierte Produkt notwendig, wie menschliche Tätigkeit in ihrer allgemeinen Grundlage immer Orientierungstätigkeit (auf den Gegenstand, das Produkt, den Interaktions-, Kommunikations- und Kooperationspartner) ist.
Integration im pädagogischen Feld ist also notwendig die Tätigkeit am Gemeinsamen Gegenstand durch Kooperation
-
der Kinder untereinander (d.h., je nach momentaner Handlungskompetenz helfen die Kinder einander) und
-
zwischen Kindern und Erwachsenen sowohl in partnerschaftlicher Weise der Mitarbeit am Gemeinsamen Gegenstand wie im Sinne der pädagogisch-therapeutischen Intention, mit den Kindern neue Tätigkeitsstrukturen anzubahnen und ihnen Hilfen für die Ausbildung eines höheren psychischen Abbildniveaus (nach innen) und eines erweiterten Tätigkeitsniveaus (nach aussen) zu geben.
Aufgabe der Pädagogik im integrativen Prozess ist es also
-
die historisch logische Analyse der Sachstruktur der Gegenstände zu leisten, an und mit denen im kooperativen Handlungsprozess gespielt und gelernt werden soll,
-
die Analyse der momentanen Handlungskompetenz der Kinder entsprechend deren tätigkeitssteuernden Abbildniveaus im Sinne der Tätigkeitsstrukturanalyse,
-
den produktbezogenen Zusammenhang zwischen Elementen in der Sachstruktur und den Kompetenzen im Rahmen der Tätigkeitsstruktur oder Kinder herbeizuführen, wozu es gilt,
-
entsprechende Hilfen pädagogischer und therapeutischer Art zu entwickeln, bereitzustellen und zu gewähren,
-
entsprechend klare, eindeutige, widerspruchsfreie Instruktionen durch die sich die Hilfen vermitteln, sei es durch direkte physische Führung, durch Vor- und Nachmachen oder durch verbale Hinweise) zu geben
-
und die Handlungen der Kinder im Sinne der graduellen Annäherung an das antizipierte Produkt zu bekräftigen.
Die mit den sieben Punkten aufgezeigten Zusammenhänge von menschlicher Tätigkeit und Integration im pädagogischen Umfeld können in Abb. 9 (siehe nächste Seite) in vorläufiger Form zusammengefasst werden.
- 133 -
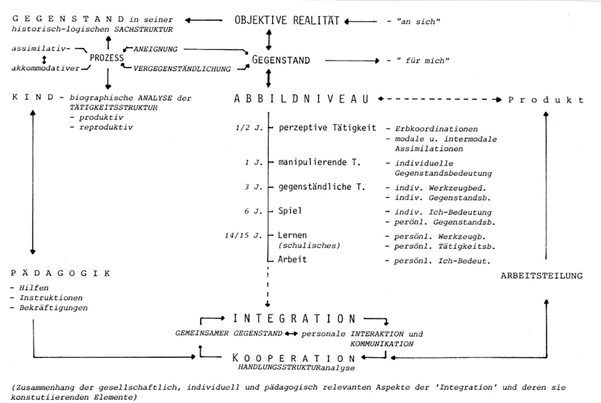
Abb. 9
- 134 -
Der Zusammenhang der erwähnten Prozesse der didaktischen Aufgabe der historisch logischen Sachstrukturanalyse und der förderungsdiagnostischen Analyse der Tätigkeitsstruktur eines Kindes wie die pädagogisch therapeutische Intention des Zusammenführens von Kind und Gegenstand im Sinne der Handlungsstrukturanalyse lässt sich wie folgt skizzieren:[68]
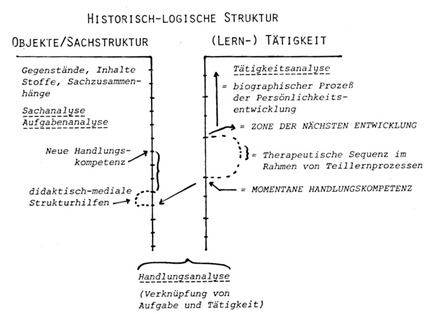
Abb. 10: Zusammenhang von Sach-, Tätigkeits- und Handlungsstrukturanalyse unter Berücksichtigung didaktisch medialer und pädagogisch therapeutischer Struktur- und Lernhilfen
Exkurs:
Zur Einheit von Pädagogik und Therapie in der integrativen Arbeit im Kindergarten
Das gesellschaftliche Faktum segregierter Erziehung und Bildung behinderter Kinder und jugendlicher in Sonderkindergärten und Sonderschulen und die damit verbundene Zentralisierung entsprechender pädagogischer und therapeutischer Hilfsangebote für die Betroffenen erweckt vordergründig den Eindruck, als würden die als behindert geltenden Kinder und Jugendlichen „behinderungsspezifisch“ nur im Rahmen der Entfremdung aus ihren regulären Sozialbezügen und Lebens- und Lernzusammenhängen adäquat gefördert werden können und als gäbe es für die Gewährung entsprechender spezifischer pädagogischer und therapeutischer Hilfen nur den organisatorischen Weg ihrer Gewährung in extrem sozial reduzierter Umgebung.
Die aufgezeigten Zusammenhänge menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens verdeutlichen jedoch, dass jedweder dem Menschen förderlicher Prozess ein kooperativer Austauschprozess ist, der sich in gegenständlicher Tätigkeit realisiert. Insofern sind Pädagogik wie Therapie in gleicher Weise sowohl für den Pädagogen wie für den Therapeuten kooperative Arbeitsprozesse und im Prinzip nicht voneinander unterschieden.
- 135 -
Pädagogik wie Therapie können im Interesse der Betroffenen nur das gemeinsame Anliegen haben, wiederum ausgehend von der jeweils bestehenden momentanen Handlungskompetenz, diese zu akzeptieren und eine Verbesserung der Realitätskontrolle anzustreben, d.h. auf Gewinn von Emanzipation und die Stabilisierung der Identität des Betroffenen auf dem ihm nächst erreichbaren Entwicklungsniveau hinzuarbeiten.
Institutionelle Vereinzelung und hergestellte soziale Deprivation als notwendige Voraussetzung für Therapie spricht für die damit verbundene gesellschaftliche Absicht, aber nicht für die Notwendigkeit, dem Bedürfnis nach Gesundheit, Erziehung und Bildung eines Menschen adäquat zu entsprechen.
Im Zusammenhang integrativer Arbeit mit behinderten und nichtbehinderten Kindern sind Pädagogik und Therapie weder von ihrer Zielsetzung her noch im Handlungsfeld voneinander unterschieden und unterscheidbar. Sowohl in ihrem Ziel wie in ihrer Orientierung an Individualität und Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder sind, sowohl allgemein pädagogische wie allgemein und speziell therapeutische Maßnahmen
-
nur über die gegenständlich-kooperative Tätigkeit zu realisieren, die
-
an der Lebensrealität des Kindes ansetzen muss und
-
in dieser zu realisieren ist.
Daraus entsteht das bereits im ersten Kapitel benannte Erfordernis der Kooperation aller Pädagogen und Therapeuten im Sinne des „Team-Teaching“[69] und die Notwendigkeit zum Kompetenz-Transfer, um die Aneignungsprozesse der Kinder unter Berücksichtigung ihrer höchst unterschiedlichen strukturierten Bedingungen und die Ausbildung der Formen der Aneignungstätigkeit adäquat fördern zu können.
Entwicklung unter isolierenden Bedingungen führt zu Fixierungen und Stereotypbildungen in der Tätigkeitsstruktur der betroffenen Individuen, die der Bewältigung der jeweiligen Lebensbezüge und der Aufrechterhaltung der jeweils ausgebildeten inneren Organisationsform dienen.[70]
Ist Pädagogik überwiegend darauf ausgerichtet, Kindern und Jugendlichen durch die Strukturierung ihrer Lernprozesse Hilfen in der Aneignung von Welt unter nicht-isolierenden Bedingungen zu gewähren, muss Therapie im Rahmen dieser pädagogischen Orientierung die Lern- und Aneignungsprozesse unter der Bedingung unterschiedlicher Grade und unterschiedlichen Umfangs von Isolation leisten, um Brüche in der Entwicklung nachholend zu bewältigen, Lücken zu füllen und die unter der Bedingung der Isolation aufgebauten Stereotypien (je nach Niveau der Abbildstruktur auf der Ebene des biologischen, des individuellen bzw. persönlichen Sinns) in solche Tätigkeitsstrukturen hinein zu überführen, die einen Austausch auf einem höheren Niveau ermöglichen und damit wiederum im ursprünglichen Sinne der pädagogischen Strukturierung der Aneignungsprozesse zugänglich sind.
Gewinnt die allgemeine Pädagogik, wie das auch in Abb. 10 verdeutlicht ist, ihre Ausgangsbasis (aktuelle Zone der Entwicklung) und ihr Ziel (nächste Zone der Entwicklung) in Orientierung an der Entfaltung der Individualität und Persönlichkeit des Kindes (Biografie) und überprüft im Sinne der Sachstrukturanalysen, welche Gegenstände/Themen/Inhalte geeignet sein können, in gegenstandbezogener Tätigkeit die ‚nächste Zone der Entwicklung‘ zu erreichen, so hat die Therapie in derselben Spanne der Orientierung an der Persönlichkeitsentwicklung ihren Ansatz wesentlich im Rahmen der Handlungsstrukturanalyse; als spezifische Hilfe trägt sie zum Aufbau einer adäquaten bzw. zur Verbesserung der gegenstandsbezogenen Tätigkeit bei, sei dies nun in Form einer individual-biografisch orientierten Psychotherapie, einer lernpsychologisch orientierten Beschäftigungstherapie, Sprachtherapie, eines Wahrnehmungstrainings, rhythmischer Bewegungserziehung oder anderer Angebote.[71]
- 136 -
Therapie bedeutet im Sinne des griechischen Ursprungs des Wortes „dienen“‚ „Dienst“ und Therapeut bezeichnet einen „Diener, Pfleger“. Im Sinne des bezeichneten entwicklungslogischen Ansatzes vermag sie dem Menschen zu dienen und vermag der Therapeut ein Diener der Menschen zu sein, die seiner bedürfen, aber auch einen Dienst im Rahmen des pädagogischen Anliegens mit den Kindern zu erbringen, seien diese behindert oder nicht, indem er Hilfen für eine umfassende und weitestmögliche Entfaltung ihrer Persönlichkeit bietez. Insofern können Pädagogik und Therapie weder als humane Wissenschaften noch in ihrer Zielsetzung und in ihrem Arbeitsfeld voneinander getrennt und unterschieden werden, noch die herrschende Auffassung, dass therapiebedürftig nur der sei, der als behindert und/oder als psychisch krank gelte, bestätigt werden. Deshalb wird sich Therapie in integrativen pädagogischen Zusammenhängen auch nicht auf die behinderten Kinder allein beschränken und nur diese in entsprechend kooperative Lernprozesse einbeziehen, sondern sie muss in ihrem Angebot grundsätzlich offen sein, in ihrer Methodik grundsätzlich menschlichen Aneignungs- und Lernprozessen verpflichtet und in der Wahl ihres Ausübungsortes grundsätzlich dort anzusiedeln sein, wo sich in regulären sozialen Lebens- und Lernzusammenhängen die Notwendigkeit spezifischer Strukturierung der Aneignungsprozesse und der Tätigkeitsstruktur ergibt.
Entsprechend wird in der täglichen Kindergartenarbeit durch die zusammenarbeitenden Pädagogen und Therapeuten Pädagogik und Therapie in einem einheitlichen Prozess organisiert, indem nun aber die spezifischen und differenzierten therapeutischen Anteile nicht verwässert werden oder untergehen, sondern in dem Sinne, dass die spezifischen Zielsetzungen verschiedener therapeutischer Handlungsmöglichkeiten sich
-
inhaltlich in Orientierung an der kindlichen Entwicklungslogik dem Gesamtziel unterordnen,
-
thematisch sich einem Projekt/Vorhaben und dessen Teilinhalten anschließen und
-
von der Durchführung her sich räumlich und sozial nicht aus dem kooperativen Gesamtprozess absetzen oder herauslösen.
Pädagogische wie therapeutische Prozesse laufen also ihrerseits integrativ ab; sie wahren, wie in Kapitel 1 des Berichtes dargestellt, die Einheit des Menschen in der Menschheit im Sinne des sozial-kooperativen Tätigkeitszusammenhanges am Gemeinsamen Gegenstand/Produkt, und orientiert an der Entwicklungslogik sind sie auf die Einheit des Menschen, also die Gesamtheit der Ganzheitlichkeit seiner Subjekthaftigkeit und Persönlichkeit ausgerichtet und nicht, wie im herkömmlichen Verständnis der Therapie, den Menschen atomisierend auf seine Defekte, Devianzen und Behinderungen fixiert.
Therapie gewinnt im integrativen Arbeitszusammenhang damit eine ungewohnt neue Qualität, nämlich die, gerade die als „pathologisch“ und „gestört“ erscheinende Tätigkeitsstruktur eines Menschen, gegen die immer antherapiert wurde, als eine von ihm unter den gegebenen Entwicklungsbedingungen herausgebildete optimale Aneignungsstrategie zu verstehen und unter Einbezug der ihr eigenen Struktureigenheiten neue Tätigkeitsstrukturen zu entfalten, die in der Folge dann z.B. stereotype Fixierungen auf eine Tätigkeitsstruktur weniger entfalteten Niveaus nicht mehr notwendig machen. Dies gilt sowohl für die therapeutisch orientierte Arbeit z.B. mit einem autistischen Kind wie für die krankengymnastische Arbeit bei z.B. einer vorliegender spastischer Lähmung.
Auf der Basis der entsprechenden therapeutischen Qualifikation wird in kooperativen Analyse- (Förderdiagnostik, Sachstrukturanalyse) und Planungsprozessen die jeweilige Störungsgenese auf der biologischen, der organischen und der psychologischen Ebene offenzulegen versucht, um den Ursachen der jeweiligen Störungsprozesse entsprechend mit dem Kind in gezielte therapeutische Kooperationsprozesse eintreten zu können, die sich nun schwerpunktmäßig auf alle Ebenen zerebraler Integration beziehen können, z.B. auf die vestibulärkinästhetische bis hin zur kortikalen Koordination sensomotorischer und motorischer Prozesse im Sinne des spezifischen Tätigkeitszusammenhanges z.B. der Kranken-
- 137 -
gymnastik. In gleicher Weise verläuft die Organisation der sensomotorischen und motorischen Prozesse eines Kindes für die Integration seiner Sprechtätigkeit im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld des Sprachtherapeuten, der sich nicht wie im herkömmlichen Verständnis auf nahezu ausschließlich lautsprachliche Artikulations- und Diskriminationsfähigkeiten oder vorwiegend auf Probleme im Zusammenhang der linguistischen Struktur von Sprache bezieht, sondern auch die sensorische Koordination in einem umfassenden Sinne eines Verständnisses von Sprechen als eine spezifische Form der Bewegungsfähigkeit berücksichtigt. Dies verdeutlicht auch den Zusammenhang der im traditionellen Verständnis weitgehend unabhängig voneinander praktizierten therapeutischen Intervention von Krankengymnastik und Sprachtherapie, die mit anderen Therapieformen ihrerseits gemeinsam haben,
-
direkt in gestörte funktionale Zusammenhänge einzugreifen und ausfallende Teilfunktionen zu überbrücken und
-
auf der Basis oder unter Kompensation ausfallender Teilfunktionen durch eine Neuorganisation eines entsprechenden funktionalen Regelsystems auf einem höheren Niveau (auf der Basis der intakten funktionellen Systemeinheiten) ein höheres Integrationsniveau derselben zu erreichen, damit die entstandene Entwicklungslücke und das sie überbrückende Stereotyp bzw. die entstandene „Fixierung“ überwunden werden kann, was in jedem Fall immer auch bedeutet, Bedingungen der Isolation bzw. Isolation selbst zu reduzieren.
Therapie im integrativen Zusammenhang bedeutet also grundsätzlich, in erster Linie die isolierenden Bedingungen zu erkennen und abzubauen und nicht unter Belassung derselben am betroffenen Kind eine individuelle Korrektur vornehmen zu wollen, was bedeuten würde, wieder im Kind selbst die Ursache seiner Behinderung zu sehen. Damit gewinnt die Therapie im pädagogischen Bezugsfeld im allgemeinen wie die therapeutische Intervention im Sinne der Kooperation zwischen Therapeut und Kind im Gesamtzusammenhang gegenstandsbezogener Tätigkeit ihre ursprüngliche Funktion und Bedeutung wieder, die im institutionell segregierten Rahmen notwendig eine Verarmung und intentionale Reduzierung auf eine individuenbezogene Defektkompensation erfuhr.

- 138 -
In der Kooperation zwischen Pädagogik und Therapie im Rahmen integrierter Arbeit hat die therapeutische Intervention im Zusammenhang der Störung und Fixierung der prozesshaften Dynamik menschlicher Entwicklungslogik eine unverzichtbare und nicht zu schmälernde Funktion und Position, die sich weder im pädagogischen Feld verliert noch von der Pädagogik dominiert wird, wie die Therapie ihrerseits nicht, wie in sonderpädagogischen Zusammenhängen meist üblich, die Pädagogik dominiert.
Dies verlangt von den PädagogInnen und TherapeutInnen im Rahmen integrativer Pädagogik eine entsprechende Veränderung des Bewusstseins, damit eine neue berufsspezifische Identität erworben werden kann, in deren Folge die in diesen Arbeitszusammenhängen notwendige Handlungskompetenz gleichberechtigter Kooperation einerseits und hochspezifischer Tätigkeit als Pädagoge/in und Therapeut/in andererseits erst ermöglichen wird.
Kooperation und Handlungsfeld beziehen selbstverständlich die ausserinstitutionelle Lebensumwelt, insbesondere die Familie und die Eltern des Kindes mit ein.
Im Teamgespräch findet schließlich vor Ort im Kindergarten, wie das im Rahmen unserer Arbeit verzeichnet werden kann, auch der Mediziner Informationen, die sowohl seine Diagnose wie seine Therapie zu verbessern und zu modifizieren vermögen und ihm über das Erleben des Kindes in seinem Alltag mehr für seine Tätigkeit bedeutende Aufschlüsse gibt, als wenn das Kind in seiner ärztlichen Praxis in einer ihm nahezu unbekannten Umgebung weitgehend handlungsunfähig bleiben muss und oft noch durch Angst gehemmt ist, so dass eine orthopädische Maßnahme z.B. in Bezug auf die Herstellung eines Stützapparates an in der ärztlichen Praxis verfälschten Bewegungsmustern und Körperhaltungen orientiert wird, anstatt an der Haltung und Bewegung des Kindes in seinen Alltagssituationen, in denen sich das Stützsystem als wirksam und fördernd bewähren soll. Dies gilt in gleicher Weise für die krankengymnastische Praxis, wie dies aus dem nachfolgenden Bericht der Krankengymnastin deutlich wird. Sie schreibt:
„Krankengymnastik mit Kindern mit Bewegungseinschränkungen und/oder -veränderungen hat die Aufgabe, – ganz grob gesagt – diese Kinder in ihrer Bewegungsentwicklung zu fördern. Dazu ist eine umfassende Kenntnis von Bewegungsentwicklung notwendig.
Biologisch, funktionell entwickelt sich Bewegung unter drei Gesichtspunkten:
-
Anpassung an die Schwerkraft
-
Bewegung mit der Schwerkraft
-
Bewegung gegen die Schwerkraft
Jedem, der dies liest, wird klar, dass wichtige Aspekte von Bewegung nicht genannt werden:
-
Zweck und Ziel der Bewegung,
-
die Motivation der Bewegung und
-
die individuellen und sozialen Bedingungen, unter denen Bewegung passiert.
Die Wahrnehmung eines Gegenstandes und der Wunsch, ihn zu ergreifen, lässt uns eine Kette von hierarchisch geordneten Bewegungen ausführen: Z.B. den Arm ausstrecken, die Hand öffnen, eventuell die Hand drehen, die Hand um den Gegenstand schliessen, Arm beugen, Hand zur anderen Hand führen, Hand öffnen – Gegenstand fällt in die andere geöffnete Hand.
Die verschiedenen Formen, mit Menschen zu kommunizieren, äussern sich auch in verschiedenen Bewegungen. Bewegung ist also in Handlung eingebettet. Sie bestimmen die Qualität und den Bewegungsablauf. Durch vielfältige Wahrnehmungskontrollen werden Personen - Bewegung - Gegenstand zu einander in Bezug gebracht.
Die vorherrschende Möglichkeit des Kindes, seine gegenständliche und soziale Umwelt zu erfahren, sind Handlungen. Das gilt für Kinder mit Bewegungsproblemen und für Kinder ohne Bewegungsprobleme gleichermaßen.
- 139 –
Aufgabe der Krankengymnastik kann also nicht sein, bestimmte, von der Norm abweichende Bewegungsformen „wegzutherapieren“ oder zu „heilen“, sondern neue Handlungskompetenzen zu eröffnen. Das bedeutet auch, eine größere Variationsbreite von Bewegungen zu erarbeiten. Milani und Roser schreiben im „Forum für Medizin und Gesundheitspolitik“ (1982, Heft 19): „… dass sich die physiotherapeutische Wirkung nicht auf die Fähigkeit der Heilung des Defekts aufbaut, sondern auf den Versuch, Normalität zu fördern. Der Defekt besteht im Fehlen von Alternativen oder im Fehlen einer funktionellen Organisation. Die Behandlung fußt deshalb nicht auf der Inhibition oder der Heilung des pathologischen Phänomens, sondern in seiner Überwindung durch den Aufbau eines weitläufigeren und besser organisierten Repertoires, das für eine größere Freiheit der operativen und funktionalen Entscheidungen gebracht werden kann. Dies geschieht aber, wie wir gesehen haben, nur durch das Hervorheben der Handlungen, die möglich sind.“
Wo entstehen nun die meisten Handlungen des Kindes? In seinem Alltag! Und nicht in einer Therapiesitzung! Zum Alltag des 3- bis 6-jährigen Kindes gehört in unserer Gesellschaft der Kindergarten.

Fundamental wichtige Qualifikationen eines Bewegungstherapeuten sind das Erspüren von therapeutischen Qualitäten in der alltäglichen Tätigkeit des Kindes und das Einsetzen von behutsamen Hilfen bei Hochachtung vor der Kreativität des Kindes. In dem Masse, wie sich Handlungskompetenz entwickelt (was Bewegungsfähigkeit beinhaltet), müssen die Hilfen zurückgenommen werden.
Um dies alles zu gewährleisten, muss die Krankengymnastin das Kind in seinem Alltag gründlich kennenlernen. Hier den Kindergartenalltag, die Gruppe und die Kinder mit ihren individuellen Problemen. Nur so ist sie in der Lage, die oben genannten Qualifikationen überhaupt einzusetzen.
Wichtig für das Gelingen einer Förderung im Alltag ist eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehern der Kindergartengruppe.
-
In die Planung der pädagogischen Vorhaben müssen therapeutische Gesichtspunkte miteinfliessen.
-
Hilfen in sich wiederholenden Alltagssituationen (Ausziehen, Anziehen, Essen, Toilette, Waschen) müssen an den Pädagogen weitergegeben werden.
Das Ganze wird auf ein breiteres Fundament gestellt durch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern geben wichtige Informationen aus dem restlichen Alltag mit ihrem Kind, und Therapeuten vermitteln die speziellen Hilfen an sie weiter.
In Einzelfällen kann es notwendig sein, zusätzlich zur Therapie im Alltag gezielte Einzelförderung anzubieten. Das bedeutet aber nicht: Arbeiten im
- 140 -
gesonderten Raum, sondern im Gruppenraum, auf dem Hof oder im Garten unter Verwendung von Alltagsmaterialien und offen für alle Kinder.“
Gez.: Hille Viebrock

Es wurde bereits an anderer Stelle des Berichtes erwähnt, dass wir im Rahmen der Arbeit im KTH die doch recht besorgniserregende Erfahrung machen mussten, dass die Kinder, weit über die als nach dem Gesetz behindert geltende hinaus, in ihrer Entwicklung durch die verschiedensten Faktoren, vorwiegend durch solche, die aus erheblicher sozialer Benachteiligung ihrer Familien resultieren, von Beeinträchtigungen ihrer Entwicklung bedroht bzw. bereits erheblich dadurch betroffen sind. Bei diesen Kindern treten vorwiegend Verhaltensweisen auf, die allgemein als Störungen von Aufmerksamkeit und Konzentration, als Übererregbarkeit, mangelnde Bereitschaft zum Mittun, Tendenz der Vereinzelung und des apathischen Rückzugs, als störende Umtriebigkeit, aber auch als Aggressivität und Destruktivität beurteilt werden.
Dies führt zu einem erweiterten Anspruch an die tägliche pädagogische Arbeit in dem Sinne, dass insbesondere durch die Strukturierung und Gestaltung der pädagogischen Beziehung zwischen Pädagoge und Kind derart therapeutische Elemente integriert werden, dass es dem Pädagogen möglich wird, für das Kind Partei ergreifen zu können, d.h. auch sein Verhalten nicht als „böswillig“ gegen den Erzieher als Person oder dessen Sache, die er mit großem Aufwand vorbereitet hat, gerichtet aufzufassen, sondern durch strukturierte Integrationsangebote das Interesse dieser Kinder auf die jeweiligen Aktivitäten zu lenken, ihr Neugier- und Explorationsverhalten wie ihre Motivation zu bekräftigen und durch die raum-zeitliche Gestaltung der gemeinsamen Arbeit mit den Kindern diesen überschaubare und durch sie kompetent kontrollierbare Zusammenhänge zu schaffen.
In der gegenstandsbezogenen Tätigkeit eignet sich der Mensch nicht nur den Gegenstand an, sondern auch die Art und Weise der Struktur des Tätigkeitsprozesses selbst. Auf der Basis der Fähigkeit des zentralen Nervensystems, sich selbst zu programmieren und durch Rückkopplungsprozesse sich selbst regulierende und induzierende Regelkreise aufzubauen, können sich im Sinne der erwähnten Stereotypentwicklung die auf der Verhaltensebene beschriebenen und erscheinenden kompensatorischen Mechanismen einschleifen und sehr schnell eine die weitere Entwicklung blockierende und hemmende Funktion und eine das Kind isolierende
- 141 -
Bedeutung gewinnen. Auf diese Weise kann nicht nur z.B. auf organischer Basis beruhendes Anfallsleiden im Hinblick auf die in Erscheinung tretenden Anfälle als ein fortgesetzt sich selbst induzierendes Phänomen betrachtet werden, sondern, was an den Kindern als Verhaltensstörung oder bereits wieder in psychiatrischer Wendung z.B. als hyperkinetisches Syndrom oder MCD (Minimale Cerebrale Dysfunktion) beschrieben wird,[72] als ein kortikal organisierter, sich selbst regulierender und induzierender Regelkreis kompensatorischer Funktionen verstanden werden, der seinerseits die Qualität einer entwicklungsbeeinträchtigenden Isolation hat.
Dies erfordert vom Pädagogen die Einarbeitung in diese Zusammenhänge und die bereits beschriebene Strukturierung seiner auf Bedürfnisse und Motivationen der Kinder bezogenen Intention im kooperativen pädagogischen Prozess derart, dass dieser in Bezug auf die beschriebenen Zusammenhänge präventiv, d.h. auch therapeutisch wirksam wird.[73]
In das Team der PädagogInnen und TherapeutInnen muss wesentlich der „Stützpädagoge“ eine entsprechende Qualifikation einbringen, so dass er in der Lage ist, im Prozess der Beratung und Supervision der PädagogInnen diesen die hier nur kurz skizzierten Zusammenhänge zu erschließen und in der Beratung zu Fragen des erzieherischen Verhaltens mit diesen die entsprechende Handlungskompetenz zu erarbeiten. Dazu muss er selbst im Rahmen seiner notwendig behindertenpädagogischen Ausbildung eine entsprechende auf Psycho- oder Verhaltenstherapie bezogene Qualifikation in seine Tätigkeit mit einbringen. Als Behindertenpädagoge, der in der Regel selbst entweder in behinderungsspezifischen fachlichen Schwerpunkten (z.B. Sprachbehindertenpädagogik und Geistigbehindertenpädagogik) ausgebildet oder im Sinne einer Schwerpunktbildung in Therapie im Rahmen eines Studiums als Diplom-Behindertenpädagoge[74] qualifiziert ist, ist er die Person im Kindergarten, die wesentlich auch die Koordination der dort tätigen TherapeutInnen und PädagogInnen zu organisieren hat, zumal der Stützpädagoge täglich im Hause anwesend ist, während fachspezifische Therapeuten wie z.B. die Krankengymnastin nicht in diesem Umfang in einer Regeleinrichtung präsent sein wird.
Hier ergeben sich auf der formalen Ebene Unterschiede z.B. zu Sonderkindertagesstätten, die wie z.B. die Spastikerhilfe in Bremen oder das Heinrich-von-Zütphen-Haus der Ansgarii-Gemeinde sich unter vorläufig noch notwendiger Beibehaltung ihrer überregionalen und damit zentralen Funktion der Versorgung z.B. körperbehinderter Kinder organisatorisch und hinsichtlich des therapeutischen Personals quantitativ anders darstellen, als dies in regional sich für behinderte Kinder öffnenden KTHs der Fall ist. Hinsichtlich der inhaltlichen Struktur von Pädagogik und Therapie sowie der Kooperation von PädagogInnen und TherapeutInnen muss die Qualität therapeutischer Intervention und therapeutischer Wirkung pädagogischer Arbeitsweisen auch bei einem unterschiedlichen quantitativen Verhältnis von Pädagogik und Therapie im integrativ arbeitenden Sonderkindergarten in Relation zum integrativ arbeitenden Regelkindergarten denselben Ansprüchen genügen, die aus der Sicht der Individual- und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes an sie zu stellen sind. Dabei werden therapeutische Maßnahmen im Sinne von Psychotherapie[75] und Verhaltenstherapie im Regelkindergarten gegenüber therapeutischen Anteilen im Sinne von Physiotherapie und Beschäftigungstherapie in der quantitativen Gewichtung notwendigerweise unterschiedlich in Erscheinung treten.
Auch aus dieser Sicht muss auf den Punkt 2.3.3 des Berichtes verwiesen werden und die Gewichtung eines entsprechend behindertenpädagogisch und therapeutisch qualifizierten Stützpädagogen im Einsatz im Regelkindergarten verstärkt erfolgen.
Im pädagogischen Alltag selbst, der nachfolgend kurz skizziert werden soll, treten für den Beobachter meist nur die therapeutischen Anteile der Tätigkeit der Krankengymnastin direkt in Erscheinung, während die der Sprachtherapie und die therapeutisch wirkenden Anteile der Pädagogen voll in die pädagogische Struktur der Arbeit integriert sind, was selbst vielen
- 142 -
Pädagogen im Rahmen ihrer Hospitationen im KTH entweder überhaupt nicht auffällt oder allenfalls so registriert wird, dass eine bestimmte Art und Weise, die Kinder anzusprechen oder sich mit ihnen in Beziehung zu setzen, doch recht „eigenartig“ oder „unsinnig“ sei, was oft noch damit begründet wird, dass dies den Bedürfnissen der Kinder nicht entspreche. Derweil nehmen gerade die Überlegungen zu diesen Problemzusammenhängen und die Vorbereitung und Planung von pädagogischen Situationen, die einen entsprechenden therapeutischen Wert für die Kinder gewinnen, einen sehr grossen Umfang hinsichtlich der diagnostischen Analyse, der Planung und der Beratung und Supervision der Mitarbeiter im Alltag des KTHs ein. Die Arbeit im KTH belehrt den jahrelang z.B. zuvor in der institutionalisierten sonderpädagogischen Praxis tätig Gewesenen in kürzester Zeit sehr eindringlich, dass die Realisierung eines an der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder orientierten pädagogischen Konzepts, was seine Planung, Durchführung und Revision betrifft, nicht minder aufwändig oder anstrengend ist als die sonderpädagogische Arbeit; im Gegenteil vermögen die nichtbehinderten Kinder ihre Bedürfnisse und Interessen eher noch selbst dem Erzieher gegenüber durchzusetzen, so dass die Negation der aus der jeweiligen dominierenden Tätigkeit der Kinder resultierenden Ansprüche weit weniger möglich ist als in einer Sondereinrichtung, wo z.B. die einzigen Personen, die sich selbständig bewegen können, die Pädagogen und Therapeuten sind, die anderen aber an ihre Stühle und Liegen gefesselt bei oft extrem reduzierten Kommunikationsmöglichkeiten für jeden Handschlag, der getan wird, noch „dankbar“ sein müssen.
Die Erfahrung der integrativen pädagogischen Praxis vermag vielleicht endgültig der heuchlerischen Glorifizierung segregierter sonderpädagogischer Arbeit ein Ende zu setzen. Um dies in aller Schärfe zu bezeichnen, erlaube ich mir hier zum Ausdruck zu bringen, dass nicht ein besonderes Maß an menschlicher Güte und Wärme, an Moral, Ethik oder Mitleid dazu gehört, in der Isolation von Sondereinrichtungen und Anstalten unter einer enormen Massierung von Menschen ähnlicher Art schwerer Beeinträchtigung ihrer Persönlichkeitsstruktur zu arbeiten, sondern ein ungeheures Maß an menschlichem Unverstand und menschlicher Unvernunft und Ignoranz den Bedürfnissen eben jenen gegenüber, die man unter dem Vorzeichen, besonderen Sachverstand walten zu lassen, in eben diesen Einrichtungen zusammenfasst. Wir haben heute, 40 Jahre nach Ende des deutschen Faschismus, sowohl die ökonomischen Voraussetzungen wie einen entsprechenden Stand in den Fachwissenschaften erreicht, der die Negation des dem Menschen im wahrsten Sinne wesenseigenen Bedürfnisses nach kooperativen Tätigkeitsbeziehungen und entsprechenden Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten und deren Unterbringung in segregierten Einrichtungen und Anstalten in dem Masse nicht mehr notwendig macht, wie eine entsprechende dezentralisierte und regionalisierte Versorgung in allen Lebensbereichen aufgebaut wird.
Auf der Basis einer offenen Kooperation zwischen Pädagogen und Therapeuten und den weiteren Mitarbeitern versuchen wir die Erziehung im KTH als Bestandteil der öffentlichen Erziehung zu gestalten, bewusst zu lenken und anzuregen und die Lebenswelt der Kinder als Quelle für ihre Lernerfahrung zu erschließen und zu nutzen. Die Kinder sollen mit Hilfe ihrer erwachsenen Bezugspersonen lernen, sich in ihrer Umwelt zu orientieren und diese Umwelt zu bewältigen, um in Situationen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens möglichst autonom und kompetent denken und Handeln zu können (47).
Bei der Entwicklung von Spiel und Lernangeboten und systematischer Förderung gehen wir von den realen Lebenssituationen der Kinder aus (48). Die Förderung in Alltagssituationen sehen wir als eine wesentliche Bedingung bei der erzieherischen Vermittlung zwischen Kindern und ihrer Lebenswelt an. Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies für die Vermittlung von Fertigkeiten und Qualifikationen eine Orientierung an den Erfahrungen und Bedürfnissen der Kinder. In der gemeinsamen Tätigkeit im Kindertagesheim treten die Kinder mit
- 143 -
anderen Kindern ihrer Altersgruppe und mit ihren erwachsenen Bezugspersonen in Beziehung und erwerben darin neue Handlungskompetenzen, sie bilden Vorstellungen über ihre Umwelt aus und entwickeln Pläne für individuelles und gemeinsames Handeln im Alltag, der sich in und durch die gegenständliche Tätigkeit der Kinder vermittelnde soziale Kontakt ist das wichtigste Element der täglichen Arbeit im KTH.
Erziehung verstehen wir dabei als die Strukturierung der Tätigkeit der Kinder unter Berücksichtigung
-
des Prinzips der Individualisierung und
-
der Gewährung besonderer Hilfen.
Individualisierung soll jedem Kind die Teilnahme am gemeinsamen Spiel- und Lernprozess mit dem Ziel ermöglichen, die Handlungskompetenz eines jeden Kindes zu erweitern. Das bedeutet, dass keineswegs immer alle Kinder das gleiche machen oder gar eine Anpassung aller an eine bestimmte vorgegebene Norm verfolgt würde, was für einzelne Kinder wesentlich eine Über- bzw. Unterforderung bedeuten würde. Das Prinzip der Individualisierung soll jedem Kind eine optimale Teilhabe am kooperativen Prozess ermöglichen und ihm den Gegenstand kooperativer Tätigkeit auf seinem Niveau weit möglichst zu erschließen.
Hilfen sind für uns ein pädagogisches Instrument (dies können z.B. auch Spiele oder Lieder u.a. sein), um für Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsniveaus und Tätigkeitsstrukturen adäquate Austauschprozesse mit der Umwelt zu ermöglichen. Dies schließt ein, für bestimmte Lernvorhaben, wenn erforderlich, auch eine Einzelförderung[76] durchzuführen oder mit einer kleinen Gruppe an spezifischen Aufgaben zu arbeiten. Hilfen verhindern
-
die Überforderung der Kinder durch Informationsüberflutung bei komplexen Aufgaben/in komplexen Situationen,
-
Unterforderung durch Informationsmangel und
-
eine widersprüchliche Orientierung der Kinder auf den Gegenstand bzw. in den sozialen Bezügen.
Hilfen sind so wenig wie möglich, aber soviel als notwendig zu geben und in dem Masse auszublenden, wie Kinder eine Spiel- und Lernsituation mehr und mehr selbständig ausführen können.
Die Strukturierung der Tätigkeit der Kinder erfolgt bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsniveaus unter drei Schwerpunkten:
-
Unter dem Aspekt der Tätigkeitsstrukturanalyse ist diagnostisch im Rahmen der Biografie der Kinder die aktuelle Zone ihrer Entwicklung und die Tätigkeitsstruktur zu erfassen, die die nächste Zone der Entwicklung zu erschließen vermag. Basis einer solchen förderungsbezogenen, prozesshaften Diagnostik sind kontinuierliche Beobachtungen der Kinder in unterschiedlichen Alltagssituationen und beim Spielen und Lernen und die Analyse und Interpretation der Beobachtungsergebnisse unter den Kriterien von
-
Fähigkeit, Fertigkeit und Kenntnissen,
-
Interaktion, Kommunikation und Kooperation,
-
Bedürfnisse, Interesse und Motivation und
-
der häuslichen und familiären Situation.
-
Unter dem Aspekt der Analyse der Sachstruktur erfolgt die Auswahl der Spiel- und Lerngegenstände nach Qualitäten, d.h. nach ihrem (Bildungs-) Gehalt bezogen auf die Zugangsmöglichkeiten der Kinder zum Gegenstand
-
mittels ihrer Wahrnehmungstätigkeit (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) im Sinne der perzeptiv-sensorischen Qualitäten,
- 144 -
-
mittels der handelnden Auseinandersetzungen in dem Sinne, dass die ansehbaren, die hörbaren, die tastbaren Merkmale usw. der Gegenstände vom Kind aktiv verändert werden können. Dies führt zu einer qualitativ höheren Informationsauswertung und ermöglicht dem Kind die Gruppierung situationsbedeutsamer Merkmale und eine Klassenbildung innerhalb der gegenständlichen und sozialen Umwelt.
Die aktive Veränderung des Gegenstandes durch das Kind stellt sich als zeitlich gegliederte Tätigkeitsfolge dar, die ein räumlich zeitlich geordnetes Zusammenwirken von Bewegungsvorgängen und die Herausbildung übergeordneter Handlungsprogramme bedingt (vestibulärer und kinästhetischer Aspekt), so z.B. das Erhalten des Gleichgewichts im handelnden Umgang mit einem Gegenstand, das Zusammenwirken der Finger einer Hand, der Hände miteinander unter optischer Kontrolle oder die Herausbildung gegenständlich gerichteter Handlungsweisen wie Greifen u.a. (psychomotorischer Aspekt). Dies schliesst auch die Analyse des Gehaltes von Spiel- und Lerngegenständen hinsichtlich ihrer Qualität, durch deutliche Merkmale im Sinne der von den Eigenschaften des Gegenstandes ausgehenden Zeichen und Signale eine eindeutige Informationsaufnahme und -verarbeitung zu ermöglichen, ein bis hin zu der Möglichkeit, an und im handelnden Umgang mit dem Gegenstand kategoriale Klassen zu bilden, Symbole und Begriffe aufzubauen (interaktiv kommunikativ/sprachliche Qualität).
-
Unter dem Aspekt der Handlungsstrukturanalyse soll die Verknüpfung der Tätigkeit der Kinder in der Zone ihrer nächsten Entwicklung im Rahmen der Spiel- und Lernangebote ermöglicht werden, was die Beschreibung der entsprechenden Zieldimensionen unter verschiedenen Schwerpunkten erforderlich macht, so z.B.
-
emotional erlebnismäßige, motivationale Ziele,
-
kognitive, interaktive und kommunikativ sprachliche Ziele und
-
psychomotorische, pragmatische Ziele.
-
Diese Zielvorstellungen sind jeweils „operationalisiert“ zu beschreiben, d.h. im Sinne konkreter Tätigkeiten und Verfahrensweisen der Kinder im handelnden Umgang mit den Spiel- und Lerngegenständen, was
-
auf die Eindeutigkeit des pädagogischen Vermittlungsprozesses zwischen den Kindern und ihrer Umwelt abzielt,
-
die Organisation der Beteiligung der Kinder an arbeitsteilig durchzuführenden gemeinsamen Vorhaben ermöglicht,
-
Transparenz der Zusammenhänge für die Kinder schafft und es ihnen erleichtert, im Rahmen der Orientierung auf ein Vorhaben/Gegenstand das intendierte Produkt zu antizipieren und
-
eine Selbstkontrolle über den Grad der Ausbildung einer z.B. zu erwerbenden Fertigkeit im gemeinsamen Tätigkeitsprozess von Anfang an zu ereichen, um möglichst unabhängig von Fremdkontrolle das eigene Handeln bewerten zu können.
Die Struktur des Tagesablaufs ermöglicht den Kindern im Sinne von zeitlichen (zeitliche Dauer und Abfolge einzelner Aktivitäten im Tagesablauf) und räumlichen Fixpunkten (Tätigkeiten im Gruppenraum, im Nebenraum, im Waschraum, im Rhythmikraum, im Matsch- und Duschraum, auf dem Hof, im Hallenbad u.a.) eine ihrer räumlich zeitlichen Strukturierungsfähigkeit eines Tages entsprechende Gliederung desselben und damit dessen Überschaubarkeit, was selbständiges Handeln in unterschiedlichen Zusammenhängen des Tagesablaufs ermöglicht und durch
- 145 -
die jeweilige Orientierung der Kinder auf diese Abläufe auch deren weitgehende emotionale Stabilität mit bedingt.
Grundsätzlich ist es Intention, in allen Phasen und Zusammenhängen des Tagesablaufs
-
Kontakte und kooperative Prozesse zwischen den Kindern und ihren Bezugspersonen abzubahnen und aufrechtzuerhalten,
-
alle Kinder am gemeinsamen Spielen und Lernen durch die Individualisierung von inhaltlichen Angeboten und Methoden im Kontext gemeinsamer Vorhaben zu beteiligen,
-
Hilfen pädagogischer und therapeutischer Art für einzelne Kinder zu realisieren und
-
die Kinder jeweils auf Beginn und Ende einer Einheit gemeinsamer Tätigkeiten und deren Inhalte zu orientieren und sie am Abschluss wie an der Vorbereitung eines weiteren Vorhabens zu beteiligen.

Im Einzelnen weist der Tagesablauf folgende zeitliche und Aktivitäten bezogene Gliederung auf:
|
Einheit/Zeit: |
Tagesablauf: |
|---|---|
|
Frühdienst: 07:00 - 08:00 |
Für Kinder berufstätiger Mütter und Väter |
|
Ankunft: 08:00 - 08:15 |
Eintreffen der Kinder im KTH, Garderobe aufhängen, erste Kontaktaufnahme, Begrüßung im Stuhlkreis im Gruppenraum;Austausch, Gespräche, Berichte von zu Hause und sonstige Erlebnisse; Intention: Stuhlkreis als räumlich-zeitliche Strukturierungshilfe; Initiierung erster Kontakte über Begrüßung und Spielangebote im Kreis; |
- 146 -
|
Morgenkreis: 08:15 - 08:45 |
Spiellied, jeweils wiederkehrend, zum Beginn des Tages im KTH; Kontakt- und Begrüßungsspiel; Orientierung der Kinder auf die an diesem Tag stattfindenden Aktivitäten und auf den Wochentag; Spiele im Zusammenhang mit den geplanten Aktivitäten; Gemeinsames Singen des Wochentagliedes; Intention: Initiierung von Kontakten, Anbahnung von kooperativen Prozesses über Spiele: Kreis-, Kontakt-, Sing-, Finger- und Bewegungsspiele mit wiederkehrenden Themen; Orientierung auf die im Rahmen des Tagesablaufs stattfindenden Aktivitäten, auf die gemeinsamen Lerngegenstände und Zielsetzungen unter Einbezug der Möglichkeit einer ersten Darbietung eines Gegenstandes und der freien und angeleiteten Erfahrung mit diesem. |
|
Frühstück: 08:45 - 09:30 |
Aufgabenverteilung hinsichtlich der Selbstbesorgung der Gruppe bei den Mahlzeiten (verschiedene Ämter); Gemeinsames Tischdecken; Des Essenwagens aus der Küche holen; Alle Kinder und Erwachsenen reichen sich die Hände, sprechen gemeinsam den Tischspruch und frühstücken; Dabei: Austausch über einzelne Aspekte der Selbstversorgung, Wünsche äussern, Speisen weiterreichen; Kinder helfen sich gegenseitig; Austausch, Berichte, Gespräche über Erlebtes und geplante Aktivitäten im KTH; Abräumen des Geschirrs und der Nahrungsmittel in Gruppen mit jeweils wechselnder Zuständigkeit; Intention: Kooperative Tätigkeit bei der Selbstbesorgung; Zuständigkeit der Kinder für einzelnen Aufgaben; Kommunikation über Symbole bei der Aufgabenverteilung; Erkennen, Benennen, Zuordnen, Unterscheiden von Personen, benötigten Gegenständen (z.B. andere Kinder, Pädagogen; Symbolkarten bei der Aufgabenverteilung, Geschirr, Nahrungsmittel); |
|
Waschraum/ Toiletten |
Toilettengang, Hände waschen, Zähne putzen; Anschließend Spiele im Gruppenraum für die Kinder, die mit der Tätigkeit im Waschraum bereits fertig sind; Intention: Aufbau einer allgemeinen Kompetenz in der selbständigen Körperhygiene (z.B. Waschen, Zähneputzen, An- und Auskleiden); |
|
Systematische Förderung: 09:30 - 10:45 |
Orientierung der Kinder auf den gemeinsamen Spiel- und Lerngegenstand; Spiele: Kreis-, Kontakt-, Sing-, Finger- und Bewegungsspiele, die auf das Thema des gemeinsamen Vorhabens einstimmen; Durchführung systematischer Förderung; siehe hierzu die Darstellung aus dem Vorhaben „Wir füttern und tränken die Hasen und misten die Ställe aus“; Intention: Orientierung der Kinder auf den Gegenstand der gemeinsamen Tätigkeit, produktbezogene Antizipation (Zielsetzung), auf die Aufgabenstellung, die Mittel und Bedingungen der gemeinsamen Tätigkeit; Wahrnehmungs- und bewegungsmäßige Erfahrung mit dem vorgegebenen Material in zeitlich/inhaltlich strukturierter Weise; |
- 147 -
|
Saftpause: 10:45 - 11:00 |
Getränk und/oder Früchte nach Wahl; Intention: Intention wie im Rahmen des Frühstücks |
|
Freie Aktivitäten 11:00 - 12:00 |
Spielplatz, Treffen mit Kindern anderer Gruppen; Spielplatz ausserhalb des KTHs, Besuche, Einkaufen, Verkehr u.a.; Spiel- und Materialangebote zur freien Auswahl, z.B. Bilderbücher, Kneten, Schneiden, Malen, Musik usw.; Intention: Weiterführung des Erlernten, Kompetenzerwerb in unterschiedlichen Situationen und Kooperation mit anderen Kindern; Selbstinitiativen der Kinder bei Kontaktaufnahmen und Kooperation mit anderen Kindern; |
|
Mittagessen 12:15 - 13:15 |
Siehe Frühstück |
|
Waschraum/ Toiletten |
Toilettengang, Hände waschen, Zähne putzen u.a. wie nach dem Frühstück |
|
Spontane, situationsbedingte Aktivitäten: 13:15 – 14:00 |
Spielangebote, Bereitstellung von Material durch Pädagogen; Spontane Kleingruppenbildung; Aktivitäten auf dem Spielplatz, Treffen mit Kindern anderer Gruppen; Intention: Förderung eigeninitiativer Aktivitäten der Kinder in Bezug auf die gegenständliche Tätigkeit und interaktive, kommunikative und kooperative Beziehungen der Kinder untereinander; |
|
Ausklang: 14:00 - 14:15 |
Schlusskreis Gemeinsamer Austausch über den Tagesablauf (z.B. Betrachten der hergestellten Produkte); Orientierung auf den nächsten Tag im KTH und die diesbezüglichen Vorhaben bzw. auf längerfristiges Geschehen im KTH im Rahmen von Projekten; Schlusslied bzw. -spiel, jeweils wiederkehrend am Ende des Aufenthaltes der Kinder im KTH; Verabschiedung; Intention: Gewährung raum-zeitlicher Strukturierungshilfen; Austausch über gemeinsame Tätigkeiten und Spiel- und Lerngegenstände; Erinnern und gedankliches Nachvollziehen der gemeinsamen Aktivitäten; Zeitlich-räumliches Einordnen der Spiel- und Lerngegenstände und der gemeinsamen Tätigkeiten; Lernkontrolle; Vorwegnahme künftiger Aktivitäten durch die Kinder; |
|
Abholen der Kinder: 14:15 - 14.30 |
Kurze Gespräche mit den Eltern durch Pädagogen und Therapeuten; Aufräumen; Vorbereitung der Spiel- und Lernangebote für den nächsten Tag; Intention: Beratende und informative Kontakte mit den Eltern wie der Eltern untereinander im KTH; |
|
Spätdienst 14:30 - 16:00/17:00 |
Für Kinder berufstätiger Mütter und Väter Mitarbeiterbesprechungen Teambesprechungen Externe Vorbereitungszeiten |
- 148 -

Nachfolgende Fotos zeigen: Interaktion und Kommunikation als tragende Elemente des Kindergartenalltages bedingen diese bewusste Orientierung jedes einzelnen Kindes in der Gruppe.
Der organisatorische Ablauf der Woche ist durch die unterschiedlichen Tagesvorhaben einzelner Gruppen wie z.B. die wöchentlichen Schwimmzeiten in einem Hallenbad des Stadtteils, Ausflüge, Besichtigungen und Besuche im Zusammenhang mit unterschiedlichen Projekten in einzelnen Gruppen, der Belegung des Rhythmikraumes, der Tage, an denen die Krankengymnastinnen anwesend sind, durch gemeinsame Vorhaben zusammen mit den Eltern u.a. in sich für jeder der Kindergruppen im KTH unterschiedlich strukturiert, so dass grundsätzlich immer in den zwei Dimensionen der Orientierung auf den jeweiligen Tag (und am Ende desselben auf den nächsten) wie auf den Gesamtzusammenhang der Aktivitäten der Kinder (bezogen auf die ganze Woche) sozusagen ein Raster bildet, das den Kindern je nach den bereits erworbenen Fähigkeiten räumlich-zeitlicher Orientierung diese in mehr oder weniger größeren oder kleineren Abschnitten im Tages- bzw. Wochenablauf ermöglicht. Auch Teilvorhaben innerhalb eines grossen und gegebenenfalls mehrere Wochen hinweg zu bearbeitende Vorhabens werden in ihrer kleinsten Teileinheit so aufbereitet, dass diese in sich wiederum zielmäßig und inhaltlich/thematisch selbst für ein schwerbehindertes Kind überschaubar und sinnvoll im Rahmen seines Mittuns erfahren und erlebt werden kann.
Die didaktische Analyse und Aufbereitung der Spiel- und Lerngegenstände mit denen die Kinder in kooperative handelnde Auseinandersetzung kommen sollen, muss sich notwendig im Rahmen einer basalen allgemeinen Pädagogik auf die Grundlagen menschlicher Tätigkeit beziehen. Entsprechend muss in diesem Zusammenhang die gegenständliche Tätigkeit der Kinder
-
zum einen unter dem Aspekt ihrer materiellen, realen Existenzform und
-
zum anderen unter dem Aspekt des Abbilds der gegenständlichen Tätigkeit im Sinne der psychischen Widerspiegelung
berücksichtigt werden.
- 149 -

Dabei ist klar zu sehen, dass nicht die Einwirkung eines Objektes auf das Subjekt die Veränderung der Eigenschaften des Subjektes bewirkt, sondern die eigenaktive, subjektgebundene Tätigkeit des Kindes, die unter bestimmten Bedingungen stattfindet, die ein bestimmtes Ziel hat und die sich bestimmter Mittel bedient (49). Entsprechend der Tatsache, dass sich der Aneignungs- (Lern-)prozess in der praktischen Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn umgebenden Realität vollzieht, ist mit dieser äußeren Tätigkeit auch unmittelbar der Erkenntnisprozess, die innere Tätigkeit verknüpft und entsprechend im didaktischen Zusammenhang der Aneignungsprozess als einer von aussen nach innen und wiederum als einer von innen nach aussen zu analysieren und zu planen, wie dies von Gal‘perin in Sinne seiner Interiorisationstheorie beschrieben wurde.
Da Werkzeuge die Tätigkeit vermitteln und die Tätigkeit selbst den Menschen mit anderen Menschen verbindet, muss der Vergegenständlichung seiner Tätigkeit in den Werkzeugen, wie sie auch im Kindergarten von der Sandschippe bis hin zum Klebematerial oder der Schere benutzt werden, planend Berücksichtigung finden. Ebenso ist die Sprache im kooperativen Verständigungs- und Kommunikationsprozess als ein Werkzeug zu betrachten, das entsprechend des Entwicklungsniveaus der Kinder von der Ebene der Wahrnehmung einfacher Signale und Gesten bis hin zum Aufbau neuer, die sprachliche Kompetenz der Kinder erweiternder Begriffe ebenfalls in die Planung einzubeziehen ist.
Ferner spielt das Verhältnis von Motiv, Tätigkeit und Ziel eine stets zu reflektierende Rolle, da menschliche Tätigkeit nur in Form von Handlungen realisiert werden kann und Handlungen ihrerseits sich als Prozess vollziehen, die einem Ziel untergeordnet sind. Insofern sind die intentionalen (Ziele) also auch die operationalen (Verfahren) Aspekte im Sinne der „Operation“, die sich auf die Bedingungen der Zielrealisation beziehen, entsprechend didaktisch zu berücksichtigen.
Im Übergang von aussen nach innen werden die ihrer Form nach äußeren Prozesse, welche sich an und mit den äußeren stofflichen Gegenständen vollziehen, in geistige, in Bewusstseinprozesse transformiert; sie werden verallgemeinert, sprachlich objektiviert, verkürzt und, was die Hauptsache ist, sie weisen über die Leistungsmöglichkeiten der äußeren Tätigkeiten hinaus.
- 150 -

Nachfolgende Fotos zeigen: Gemeinsam zubereitetes Frühstück und gemeinsames Mittagessen bieten nach entsprechender Aufbereitung und Strukturierung vielfältige Lernsituationen sowohl im sozialen als auch kognitiven Bereich: z.B. Aufgaben verteilen, annehmen, sachgerecht durchführen; sachgerechter Umgang mit Geschirr und Besteck; Symbole erkennen; Zuordnungsübungen; erste mathematische Grundkenntnisse; zeitliche Orientierung wie gestern, vorgestern, morgen, übermorgen; Sprachaufbau/Begriffsbildung; Gesundheitserziehung; Möglichkeit zum bewussten Essen; Zahnpflege, Körperpflege: vom selbständigen Waschen bis zum Toilettentraining)
Dadurch ist der Mensch in der Lage, mit den „Abbildern“ von Gegenständen zu operieren und dabei ist ein wichtiges Element das Wort, das die wesentlichen Eigenschaften der Dinge sowie die Verfahren, mit Informationen zu operieren, hervorhebt (siehe hierzu den Exkurs in Punkt 3.3.2). Dieser von aussen nach innen gerichtete Interiorisationsprozess vollzieht sich in aufeinander bezogenen Etappen, nämlich der
-
Orientierungsgrundlage,
-
materiellen/materialisierten Handlung,
-
lautsprachlichen Handlung,
-
äußeren Sprache für sich und
-
inneren Sprache (Denken).
Jede dieser Etappen ist modifiziert nach den Parametern
-
Entfaltung,
-
Verallgemeinerung,
-
Beherrschung und
-
Verkürzung.
Mit der Entfaltung der Handlung wird sie so in Teiloperationen zerlegt, dass die Kinder fähig sind, jede Operation und die Verbindung zwischen den einzelnen Operationen zu verfolgen, d.h. die Bestimmung der Teil-Operationen erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Fähigkeit eines Kindes.
Danach ist es notwendig, die Handlung genügend zu verallgemeinern; d.h., aus den vielfälti-gen Eigenschaften des Objektes der Handlung gerade die auszuson-
- 151-
dern, die von entscheidender Bedeutung für ihre Ausführung sind. „Entfaltung“ und „Verallgemeinerung“ ermöglichen dem Kind Einsicht in den objektiven Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Gegenstandes und der Handlung.
Sind im Sinne der „Beherrschung“ alle für die neue Handlung erforderlichen Teiloperationen in aller Ausführlichkeit ausgegliedert und angeeignet, sind die Voraussetzungen für die „Verkürzung“ geschaffen, d.h., die Teiloperationen können nun reduziert werden und die Handlung (eine äußere wie eine innere geistige) auf zentrale Aspekte verkürzt werden.

Die Orientierungsgrundlage als unverzichtbare Voraussetzung für jedweden Lern- und Aneignungsprozess gibt dem Lernenden eine vorläufige Vorstellung von der Handlung in dem Sinne, dass
-
das Objekt der Handlung und der ihm innewohnenden Eigenschaften und Strukturen,
-
das Ziel der Handlung sowie die Mittel zu seiner Realisierung und
-
der präzise Verlauf der Handlung dem Kind bekannt und angeeignet werden kann. Je nach Entwicklungsniveau kann die Orientierungsgrundlage dadurch erfolgen, dass dem Kind (z.B. unter therapeutischer Begleitung und Führung seiner Bewegungen) ein Muster der Handlung und ihres Produktes gegeben werden, nachdem das Kind versucht, sie selbst unter immer reduzierter Hilfe auszuführen.
Auf höherem Niveau können Hinweise darauf gegeben werden, wie die Handlung mit dem neuen Material richtig auszuführen ist, oder aber auf einem noch höheren Niveau dadurch, dass im Sinne einer planmäßigen Unterweisung alle Punkte für die richtige Ausführung einer Tätigkeit herausgearbeitet werden, durch die entsprechende Einsichten in den Handlungsvollzug sowie in die Bedingungen seiner inneren Struktur beim Kind geweckt werden, was im Rahmen des Aneignungsprozesses die Übertragung der Handlung auf andere Situationen erleichtert.
Die materialisierte Handlung dient dazu, komplexe Zusammenhänge, Begriffe und Systeme oder abstrakte Inhalte anhand einer Zeichnung eines Schemas, eines Modells oder gar im Sinne des originären Gegenstandes in die handelnde Verfügung des Kindes zu stellen.
Erst im nächsten Schritt der lautsprachlichen Handlung wird diese sozusagen ihrer gegenständlichen Stützen beraubt und in die Form der gesprochenen
- 152 -
Sprache übertragen. Erst jetzt kann der gegenständliche Inhalt Besitz des Bewusstseins werden. Waren Sprache (Signale. Gesten, Zeichen, Rhythmisierungen, Worte) auf den vorausgegangenen Etappen hauptsächlich als Hinweis auf die unmittelbar wahrgenommene Erscheinung zu verstehen, wird die lautsprachliche Handlung auf diesem Niveau nun zum selbständigen Träger des gesamten Lernprozesses. Der gegenständliche Inhalt wird auf dieser Etappe der Handlung zum Inhalt des Denkens, jedoch noch nicht zum eigentlichen Gedanken, zur sprachlich ausgelösten Vorstellung vom gegenständlichen Inhalt.
Die damit schon vollziehbare Abstraktion ermöglicht eine Vereinfachung der Handlung und eine höhere Standardisierung und damit eine schnellere Automatisierung des Prozesses. Auf der materiellen Basis der Wörter kann das Kind nun mit ihnen genauso arbeiten wie mit den materiellen Gegenständen.
Auf dem Niveau der äußeren Sprache modifiziert sich nun die Funktion der Sprache vom Kommunikationsmittel zum Mittel des Denkens. Dabei wird die lautsprachliche Handlung des dritten Niveaus in eine innere Form verwandelt, was bedeutet, dass der Handlungsablauf so reduziert werden kann, dass letztlich nur das Teil- bzw. das Endresultat lautsprachlich mitgeteilt wird. Diese Niveauform stellt die erste Form der eigentlichen geistigen Handlung dar.
Auf dem letzten Niveau des Interiorisationsprozesses wird nun die Sprachformel ihrerseits so sehr verkürzt, dass im individuellen Bewusstsein nur noch deren wesentliche Teile übrig bleiben, mit deren Hilfe die Wörter im Moment ihrer Reproduktion wiedererkannt werden können. Sprachliches Denken ist also von der gesprochenen Sprache unterschieden; um Gedachtes auszudrücken, bedarf es der Übersetzung des sprachlichen Denkens in die kommunikative, grammatikalische Form gesprochener Sprache (50).
Die hier nur verkürzt dargestellten didaktischen Elemente sind allgemeine Grundlagen der Planungsvorgänge der Projekte/Vorhaben/Themen/Inhalte in der integrativen Arbeit im KTH, die sich sowohl auf die alltäglichen Schwerpunktbereiche wie auf die speziellen Vorhaben und Themen beziehen.
Schwerpunktbereiche und Aktivitäten in der Arbeit im KTH, deren Inhalte entsprechend zu planen sind, sind
-
Spiel,
-
Musik und Rhythmik (Sensomotorik und Psychomotorik),
-
Konstruktion/Bauen,
-
Kreativ-Techniken,
-
Schwimmen,
-
Sport/Sonderturnen/Krankengymnastik,
-
Natur/Tiere/Garten,
-
Umwelt, Verkehr.
Als täglich wiederkehrende Themen treten in Erscheinung: Kontaktaufnahme, Wahrnehmungsertüchtigung, Motorik und Sprache,
-
wobei es bei der Wahrnehmung um adäquate Aufnahme der Information zur Ausbildung von Erfahrung geht,
-
bei der Kontaktaufnahme um die Schaffung von Möglichkeiten des Zusammenlebens, der Anbahnung, Herstellung und Wahrung kooperativer (interaktiver und kommunikativer) Prozesse in der gemeinsamen Tätigkeit der Kinder,
-
bei der Motorik um den Aufbau neuer Fertigkeiten bzw. Bewegungen (nicht funktional, sondern verstanden im Rahmen der ganzheitlichen Tätigkeit der Kinder) unter Anwendung bereits erworbener Fertigkeiten und
-
bei der Sprache und Begriffsbildung um den Aufbau individuell adäquater Kommunikationssysteme zur symbolischen Erschließung und Strukturierung der Umwelt wie gestische und mimische Zeichen, Gebärden, Lautsprache.
- 153 -
Die vorausgehend dargestellten Schwerpunktbereiche und die im pädagogischen Gesamtangebot des KTHs täglich wiederkehrenden Themen mit den Förderschwerpunkten sind
-
Wahrnehmungstätigkeit,
-
Sensomotorik,
-
Psychomotorik und Bewegungskoordination,
-
Interaktion und Kommunikation
Werden auf der Basis der erworbenen Kenntnisse über die Lebenszusammenhänge und
- 155 -[77]
Die Bedürfnis- wie Motivationsstruktur der Kinder im Rahmen von Projekten und Vorhaben realisiert, innerhalb derer wir wiederum folgende Tätigkeitsformen unterscheiden:
-
systematische Förderung (= räumlich und zeitlich wie inhaltlich strukturierter handelnder Umgang mit spezifischen Materialien),
-
freiere Aktivitäten (= geplante und spontan von den Kindern eingebrachte Spiele, Ausflüge, Besuche, Einkäufe und andere Aktivitäten innerhalb und ausserhalb des KTHs) und
-
spontane, situationsbedingte Aktivitäten (= spontane Aufteilung in Kleingruppen für bestimmte Aktivitäten der Kinder, enge Kontakte der Kinder mit ihren Bezugspersonen, von den Kindern selbst erfundene Aktivitäten oder Gestaltungen zu einem Thema u.a.).





Unter Projekten und Vorhaben verstehen wir an der Lebensrealität der Kinder anknüpfende Verfahrensweisen der Vermittlung von Spiel- und Lerninhalten im konkreten Tätigkeitsbezug, d.h., Projekte sind auf Handlungen der Kinder gerichtet, sie sind umweltbezogen, sie vollziehen sich inner- und ausserhalb des Kindergartens und an ihnen sind nicht nur die Pädagogen und Therapeuten beteiligt, sondern auch die Personen, die in den entsprechenden Situationsbereichen (z.B. bei Besuchen, Einkäufen, Besichtigungen u.a. oder durch Einbezug der Eltern) auf Kinder treffen‘ (51).
„Projekte sind geplante Abfolgen von Schritten, die dem unmittelbaren Erfahrungserwerb gelten und in denen versucht wird, wichtige Teile der Situation aufzuklären und mittelbar oder unmittelbar zu beeinflussen“. Als wiederkehrende Bestandteile von Projekten werden situationsbezogene Spiele, das Erzählen und Dramatisieren von Geschichten, das Anfertigen von Zeichnungen und Kollagen und Gespräche bezeichnet (52).
Vorhaben beinhalten die Gestaltung eines Werkes aus der Lebensrealität der Kinder in gemeinsamer Tätigkeit, zu dessen Verwirklichung verschiedene Lernbereiche einbezogen und Erfahrungen und Erlebnisse eingebracht werden (53).
Bei der Durchführung der unterschiedlichen Projekte und Vorhaben sowie der täglichen im Kindergartenalltag wiederkehrenden Schwerpunktbereiche erfolgt hinsichtlich der praktischen Durchführung eine Orientierung an der rhythmischen Arbeitsweise und an der Sensomotorik und Psychomotorik als methodische Prinzipien.
Rhythmik und Melodik verbunden mit den entsprechenden Interpunktionen bilden hinsichtlich der Gestaltung der Aktivformen von Instruktionen, Fragen, Hinweisen, beim Erzählen und bei Gesprächen zentrale Strukturierungshilfen bei der Verarbeitung sprachlicher Äußerungen durch die Kinder. Wie schon aus den speziellen Hinweisen zum Bereich der Sprache deutlich wurde, ist es im integrierten pädagogischen Zusammenhang erforderlich, vorsprachliche Ausdrucksmittel wie Mimik, Gestik und Gebärden als visuell anschauliche Kommunikationsmittel und Kommunikationshilfen in gleicher Weise einzusetzen, wie die verbal akustische Sprache.[78] Die Kombination visuell anschaulicher Kommunikationsmittel und -hilfen erfordert auch eine entsprechende Strukturierung der verbal akustischen Kommunikation, insbesondere durch verschiedene Elemente der Betonung der sprachlichen Äußerung durch
-
den melodischen Akzent (= Wechsel der Tonhöhe),
-
den dynamischen Akzent (= Wechsel der Intensität) und
-
den zeitlichen Akzent (= Wechsel der Zeitdauer)[79]
Die drei Akzentuierungen ermöglichen im sprachlichen Zusammenhang z. B. etwas Wichtiges mit stärkerer Intensität, gedehnter, mit aufsteigender und abfallen-
- 159 -[80]
der Tonhöhe und einer klaren Interpunktion zu sagen und bedingen eine Rhythmisierung und damit eine äussere zeitliche Strukturierung der Information, was den Kindern eine schnellere









Im Freispiel sollen die Kinder aus eigener Initiative und aus eigener Vorstellung allein oder in Kooperation mit anderen ihr Spiel gestalten. Dieses wird den Kindern ermöglicht durch eine entsprechende, d.h. von dem Entwicklungsniveau der Kinder ausgehende Gestaltung der Umwelt, die durch die Schaffung gewisser äußerer Rahmenbedingungen die ständige gezielte Erweiterung von Erfahrungen und Fertigkeiten beim Kind ermöglicht. Freispiel ist meist nicht gleichzusetzen mit einer absoluten, beziehungsfreien Freiheit. Die Freiheit im Spiel ist erst dann eine wirkliche Freiheit, wenn dieses Spiel bei den Kindern nicht zu Über- oder Unterforderung bzw. zu widersprüchlicher Erfahrung und in der Folge zum Chaos führt)
und sicherere Informationsaufnahme und Informationsspeicherung, eine präzisere Orientierung und eine leichtere Bedeutungserfassung der sprachlichen Inhalte ermöglicht.
Rhythmische Organisationsformen von Spiel- und Lernangeboten nach dem Prinzip des mehrkanaligen Lernens findet man insbesondere auch in Form der Stabreime, Reime, Fingerspiele u.a. wie auch in vereinfachter Form Kommunikationsmöglichkeiten, wie sie die Pantomime oder auch die Eurythmie in ausgeprägter Form nutzt, anregend sein können, eine methodische Strukturierung der Inhalte und Themen oder einzelner Aspekte eines Vorhabens vorzunehmen.
Durch den Einsatz spezifischer Signale, der sprachlich in Verbindung mit rhythmischer, instrumenteller Begleitung (z.B. durch Orff-Instrumente) oder durch andere Gegenstände (z.B. Material aus der Scheiblauer-Rhythmik) gegeben wird, können z.B. der Beginn und das Ende einer gemeinsamen Tätigkeit angekündigt wie auch im Rahmen des täglich wiederkehrenden Förderschwerpunktes der Wahrnehmungsertüchtigung wirksame Lernhilfen gegeben werden.
Sensomotorik und Psychomotorik als methodisches Prinzip beruht auf dem Grundgedanken des Handelnden Lernens durch Bewegung, d.h., dass die individuelle Bewegungsfähigkeit und die Koordination der Bewegungsabläufe die Entwicklung der Handlungskompetenz eines Menschen wesentlich beeinflussen, wenngleich das Prinzip der Bewegung nicht die umfassende Qualität von Handlung hat, wie dies im Kontext der didaktischen Fragestellungen dargestellt wurde (54).
Unter dem Aspekt der Sensomotorik richten wir uns schwerpunktmäßig auf die Entwicklung einzelner Sinnesgebiete, die Verknüpfung spezifischer Sinnesmodalitäten und die Herausbildung von psychischen Strukturen, die die Sinneswahrnehmungen zielgerichtet und bewusst steuern, was über die unmittelbare praktische Tätigkeit (und damit wiederum über die Bewegungskomponente) zu erreichen versucht wird. Auf dieser Basis wird unter dem Schwerpunkt der Psychomotorik im Rahmen kooperativer Prozesse in Spiel- und Lernsituationen, die den motorischen Aspekt besonders hervorheben, schließlich auch darauf abgezielt, den Kindern Möglichkeiten zur Entwicklung sprachlich kontrollierter Tätigkeiten zu bieten.
Im Rahmen dieser allgemeinen methodischen Prinzipien gewinnen nun eine Reihe von Strukturierungsfaktoren im Lernprozess generelle Bedeutung, die in Anlehnung an Vester (55), der die gedächtnismäßige Bewältigung der Information im Lernprozess durch Kurz- und Langzeitgedächtnis (KZG/LZG) und deren Hemmung bzw. Begünstigung in Abb. 11 (siehe unten) zusammenfasst, zu berücksichtigen sind.
-
Subjektiver Sinn: Die Kinder sollen zu jedem Zeitpunkt das, was im Kindergarten getan (gesehen, gehört u.a.) wird, subjektiv als sinnvoll erleben können.
-
Sinnvolles Curriculum: Die Reihenfolge und der Aufbau von Elementen eines Spiel- und Lerngegenstandes ist nach realen Lernzielen und den Kindern möglichen Verständnisfolgen zu gliedern.
-
Neugierde kompensiert Fremdeln: Die Konfrontation mit neuen, unbekannten Inhalten wirkt zunächst feindlich und kann sogar Frustration und Abwehr erzeugen. Eine Gestaltung der Annäherung an das Neue im Sinne der Betonung von Neugierde, Faszination und positiver Erwartungshaltung lassen diese innere Abwehr überwinden.
-
Neues alt verpacken: Neue Details und neue Informationen sind so darzubieten, dass sie an bekannte Inhalte assoziiert werden können oder aber dass neue und unbekannte Details in einer vertrauten Art den Kindern näher gebracht werden. (Informationstheoretisch gesehen reduziert die Möglichkeit, neue Informationen mit bekannten zu assoziieren, den quantitativen Aspekt der Information, so dass sie von der begrenzten Aufnahmekapazität der Kinder her gesehen (Kurzzeitgedächtnis) aufgenommen und verarbeitet und damit auch verstanden werden kann.
- 160 -
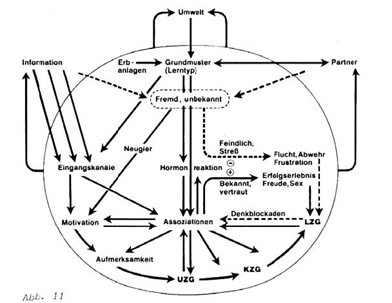
-
Skelett vor Detail: Zuerst wird ein allgemeiner Zusammenhang zur vertrauten, alltäglichen Erlebniswelt hergestellt. Dann können Details und Einzelinformationen in das schon vorhandene Gerüst eingeordnet werden. Das ermöglicht eine Verstärkung der Motivation, die Ausbildung von Assoziationsmöglichkeiten und eine sinnvolle Speicherung neuer Inhalte.
-
Interferenz vermeiden: Zusätzliche ähnliche Inhalte überlagern die Erstinformation und verhindern oder erschweren die Speicherung, das Behalten. Durch ein Zuviel an Inhalten kommt es zu einem Informationsüberangebot und dadurch zu sich gegenseitig bei der Speicherung störende Informationen.
-
Erklärung vor Begriff: Erst wenn Assoziationsmöglichkeiten geschaffen sind (siehe Skelett vor Detail), kann ein neuer Begriff, eine neue Sache, auf die das Kind jetzt schon neugierig ist, richtig verankert werden.
-
Zusätzliche Assoziationen: Durch veranschaulichende Begleitinformationen erhält eine neue Information gleichsam je nach vorliegender Erfahrung der Kinder ein Erkennungssignal, das wiederum das Abspeichern und das Abrufen der Information erleichtert.
-
Lern-Spaß: Spaß und Freude und Erfolgserlebnisse sorgen für eine positive Hormonlage im Körper und damit für ein von der biochemischen Ebene her gesehen reibungsloseren Funktionieren der Schaltstellen im Nervensystem und in den Nervenzellen. Mit positiven Erlebnissen verknüpfte Informationen werden besonders gut verarbeitet.
-
Viele Eingangskanäle: Die Darbietung von Inhalten über möglichst viele Eingangskanäle schafft nicht nur Assoziationsmöglichkeiten, größere Aufmerksamkeiten, Motivation, sondern bietet darüber hinaus den Kindern die Möglichkeit, die Information jeweils über die von ihnen besonders ausgebildeten Kanäle aufzunehmen.
-
Verknüpfung mit der Realität: Mit realen Begebenheiten und Erfahrungen verknüpfte Inhalte werden nicht nur leichter aufgenommen, sondern auch durch ihre hohe subjektive Bedeutsamkeit intensiver verarbeitet.
-
Wiederholung neuer Information: Die Aufnahme neuer Information bedarf wiederholter Darbietung in aufeinander folgenden kurzen Zeitabständen. Erst durch die Verknüpfung mit mehreren Assoziationen bilden sich entsprechende Vorstellungen aus, wird die neue Information in die vorhandene eingebettet.
- 161 -
-
Dichte Verknüpfung: Eine dichte Verknüpfung aller Elemente eines Spiel- und Lerngegenstandes erleichtern die Aufnahme und Verarbeitung, aber auch das Behalten und ein kreatives Kombinieren sämtlicher Faktoren, die im Lernprozess angeeignet werden. Das Prinzip der dichten Verknüpfung gilt aber auch für die vorgenannten methodisch zu berücksichtigenden Faktoren im Lernprozess.
Diese Prinzipien werden nun wiederum auf der methodischen Ebene aufbereitet, wie sie im Rahmen der Darstellung der lernpsychologischen Aspekte und lerntheoretischen Folgerungen (siehe 3.2.1 und 3.2.2) aus den Organisationsprinzipien des ZNS und der psychischen Widerspiegelung abgeleitet wurden.
Wir haben gesehen, dass es keine Tätigkeit der Kinder an sich gibt. Die Tätigkeiten sind gegenstandsbezogen und durch die situativen und individuellen Bedingungen, die zum Tätigkeitsaufbau wie zu ihrer Darstellung führt, modifiziert. Unter diesen Aspekten kommt dem Erziehungsstil der Pädagogen und innerhalb dessen insbesondere deren Urteilsformen eine besondere Qualität im pädagogischen Handeln zu. In diesem Zusammenhang bilden im Rahmen der Reflexion und Supervision der täglichen pädagogischen Praxis der in den einzelnen Gruppen zusammenarbeitenden Mitarbeiter folgende Prinzipien einen weiteren wichtigen methodischen Faktor:
-
Positives Sehen und Verstärken!
Ein aufmerksames, genaues und wohlwollendes Beobachten ermöglichen dem Erzieher das Wahrnehmen der Tätigkeit der Kinder und verhindern eine allzu leicht erfolgende Fixierung im erzieherischen Handeln auf das Intervenieren gegen das Unerwünschte, gegen das von der Vorstellung des Erziehers Abweichende und dessen Auffassung darüber, wie er meint, dass ein Kind in einer bestimmten Situation handeln solle oder müsse. Je klarer die Zielvorstellungen formuliert sind und je besser die Orientierungsgrundlage des Kindes geschaffen wurde, umso eher gelingt dem Erzieher eine Einordnung der Verhaltensweisen der Kinder in einer gestimmten Situation hinsichtlich ihrer Biographie wie der situativen Bedingungen, unter denen sie handeln.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und im Rahmen kooperativer Tätigkeiten gelingt der Aufbau positiver Interaktions- und Kommunikationsformen, innerhalb derer auch klare und eindeutige Rückmeldungen an das Kind gegeben werden können, ohne die Beziehung zu gefährden oder das Kind zu verletzen.
-
Strafen (gewollte oder ungewollte) vermeiden!
Strafe, das ist schlechthin heute in der Erziehungswissenschaft bekannt, sind das untauglichste, ja ein nicht zu verantwortendes Erziehungsmittel. Sie führen nur dazu, dass ein Kind lernt, in bestimmten Situationen (auch bei Vorliegen eines entsprechenden Motivs) eine bestimmte Handlung (die dann bestraft würde) nicht zu zeigen; d.h., es lernt derart nur eine Situation, in der gestraft werden wird, von einer zu unterscheiden, in der nicht gestraft werden wird; es lernt aber nicht, neue Handlungskompetenzen aufzubauen, die ihm in einer entsprechenden Lage Realitätskontrolle und eine adäquate Bewältigung der Situation erlauben würden. Dennoch werden, das zeigen Beobachtungen immer wieder, in den erzieherischen Handlungen von Pädagogen und anderen Mitarbeitern sehr häufig Verhaltensweisen praktiziert, die den Pädagogen und Mitarbeitern nicht als strafendes Verhalten bekannt oder bewusst sind, wohl aber derart auf die Kinder wirken. Das systematische Beobachten und die Selbstbeobachtung (dabei leisten uns auch Videoaufzeichnungen gute Dienste) ermöglichen das Herausfinden von Bedingungen und Situationen in der kooperativen Tätigkeit von Kindern und Erwachsenen, in denen Maßnahmen auftreten, die eine Qualität von Strafe haben, auch wenn sie im allgemeinen pädagogischen Verständnis nicht als solche verstanden und gewertet werden.[81]
Im Zusammenhang der wissenschaftlichen Begleitung (siehe Kapitel 5. des Berichtes) wurden entsprechende Analysen zum praktizierten Erziehungsstil und
- 162 -
zum jeweiligen Erzieherverhalten bereits schon vor Aufnahme der integrativen Arbeit als Ausgangspunkt für entsprechende Thematisierungen in den Fortbildungen gewählt, so dass unser Versuch, eine kindzentrierte basale allgemeine Pädagogik im Kindergarten zu entwickeln, von Anfang an auch eine entsprechende Parallele bis hinein in den Erziehungsstil fand. In einer Art Faustregel zusammengefasst gibt nachfolgendes Merkblatt die vier wichtigsten methodischen Maximen erzieherischen Verhaltens wieder, die nach den neurophysiologischen und lernpsychologischen Grundbedingungen, wie unter den Punkten 3.1 und 3.2 ausgeführt, orientiert sind:
BITTE BEACHTE !
1. ERREGE AUFMERKSAMKEIT !
-
LENKE SIE AUF DICH ODER DIE SACHE, UM DIE ES GEHT.
2. GIB EINFACHE, EINDEUTIGE UND KLARE ANWEISUNGEN UND BEGLEITE DIESE DURCH DEUTLICHE GESTEN UND ZEICHEN !
-
BENUTZE DABEI FÜR DEN SELBEN VORGANG ODER DIESELBE SACHE IMMER DIE GLEICHEN WORTE, GESTEN UND ZEICHEN.
3. GIB HILFEN !
-
SO WENIG ALS MÖGLICH
-
SO VIEL ALS NOTWENDIG
DURCH: PHYSISCHE HILFE, PHYSICHE ZEICHEN, VOR- UND NACHMACHEN, ZEICHEN, WORTE
-
UND BLENDE DIE HILFEN IN DEM MAßE AUS, WIE EINE PERSON DEN AUFTRAG MEHR UND MEHR SELBSTÄNDIG AUSFÜHREN KANN UND DAS ZIEL ERREICHT WIRD.
4. GIB RÜCKMELDUNG !
-
ÜBER DIE RICHTIGE ODER FALSCHE AUSFÜHRUNG EINER HANDLUNG
-
VERMEIDE NACH MÖGLICHKEIT JEDE FALSCHE AUSFÜHRUNG DURCH HILFEN UND EINE AUF DIE NÄCHSTE ZONE DER ENTWICKLUNG VERWEISENDE AUFGABESTELLUNG
-
BELOHNE JEDES RICHTIGE VERHALTEN ODER DEM ENDZIEL SICH ANNÄHERNDES VERHALTEN
NUR EIN VERHALTEN, DAS BEKRÄFTIGT WURDE UND DADURCH SUBJEKTIVE BEDEUTUNG ERLANGEN KONNTE; WIRD BEI VORLIEGEN EINER VERGLEICHBAREN SITUATION UND MOTIVATION WIEDER DARGESTELLT WERDEN .
CATCH HIM AT BEEING GOOD !
- 163 -
Nachfolgend soll anhand von Ausschnitten aus der Bearbeitung der Aktivität „Wir füttern und tränken die Hasen und misten die Ställe aus“, ein Teil eines Projektes, an dem alle Kinder des Kindertagesheimes beteiligt sind, verdeutlicht werden, wie mit einer Gruppe des KHTs unter dem Aspekt des Richtziels „Die Kinder sollen lernen, sich in ihrer Umwelt zu orientieren und diese Umwelt zu bewältigen, um in Situationen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens möglichst autonom und kompetent denken und handeln zu können“ diee Teilaktivität pädagogisch zu bewältigen versucht wird.
Durch das nachfolgende Grobziel „Die Kinder sollen mit Tieren angemessen umgehen“ und die darin eingebundenen gemeinsamen Aktivitäten „Die Kinder sollen den Vorgang des Fütterns, Tränkens, Ausmistens erfassen und erproben bzw. einzelne Teilhandlungen mit Hilfe der erwachsenen Bezugspersonen und anderer Kinder ausführen“, soll ein Teilaspekt des obigen Richtziels realisiert werden.
Die Kleingruppe setzt sich aus den Kindern B., D., K. und M. zusammen; D. gilt als ein behindertes Kind.
Das Thema der gemeinsamen Aktivität bezieht sich auf Erlebensaspekte der Kinder und Versorgungsaspekte der Tiere. Über dazugehörige Aktivitäten wie Kreis- und Bewegungsspiele (z.B. Häschen in der Grube), Fingerspiele (z.B. Ich bin ein kleines Häschen), ein Vorhaben zum Finden und Gestalten des Gruppennamens ‚Hase‘ (z.B. erstellen eines Wandbildes vom Hasen), Bauen und Rollenspiel (z.B. Wir bauen uns Hasenställe im Turnraum und füttern die Hasen), Formen (z.B. Hase aus Knetgummi), Bilderbücher (Hasen), Fingerpuppen (Hasen) und die Bewegungserziehung (z.B. Nachahmung der Bewegungsmuster der Hasen, die zuvor beobachtet wurden) und die nachträgliche Erörterung der gemeinsamen Aktivitäten Füttern, Tränken und Ausmisten, Besuche auf dem Bauernhof u.a. wird der Zusammenhang der gemeinsamen Aktivität im Rahmen einer projektorientierten Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen Lerngegenstand Tiere deutlich.
Das Teilvorhaben umfasst folgende Phasen:
-
Beschaffen von Materialien, Geräten und Informationen,
-
arbeitsseitiges Organisieren und Koordinieren der gemeinsamen Aktivität und
-
Verarbeiten und Erzielen eines Ergebnisses, hier: Füttern, Tränken und Ausmisten.
Verwendung der bereitgestellten Materialien, Gebrauch von Werkzeugen.
Der nachfolgenden Aktivität ging die Phase der Orientierung, Planung und Aufgabenverteilung voraus, z.B. Kontakte mit den Tieren, die auf dem Gelände des KTHs neben anderen Tieren gehalten werden. Die Kinder haben die Hasen beobachtet, Erwachsenen und anderen Kindern beim Füttern zugesehen, den Tieren selbst schon Futter gereicht, sie angefasst und gestreichelt.
Das gemeinsame Erleben der Tiere und ein pflegerisches Umgehen mit ihnen werden im Prozess der gemeinsamen Tätigkeit der Kinder und Erwachsenen langfristig zu realisieren sein. Es ist geplant, dass die Kinder in Kleingruppen (4 bis 6
- 164 -
Kinder) und im Wechsel mit anderen KHT-Gruppen in jeweils 5-wöchigem Turnus eine Woche lang dieselben Tiere mit ihren Erziehern (Pädagogen, Therapeuten, Mitarbeitern) verantwortlich zuständig sind.
Die Ausrichtung auf die Strukturierung der konkreten Tätigkeit der Kinder impliziert
-
die Ausweitung von Erfahrungen mit der Umwelt in Alltagssituationen im Sinne des Erwerbs neuer Qualifikationen und
-
die Vermittlung von Fertigkeiten unter Anwendung bereits angeeigneter Begriffe und Vorstellungen der Kinder mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Kinder zur Umweltbewältigung zu erweitern.


- 165 -



- 166 -



- 167 -
Intention: Es ist die Absicht, alle Kinder entsprechend ihrer Handlungskompetenz an der gemeinsamen Tätigkeit Füttern, Tränken und Ausmisten der Tiere zu beteiligen. Dabei sollen die Kinder jeweils ausgehend von der aktuellen Zone ihrer Entwicklung, von der her sie bereits selbst angeeignete Vorstellungen und Begriffe und Fertigkeiten einbringen können, Erfahrungen machen, die in der Zone ihrer nächsten Entwicklung liegen und mit Hilfe ihrer erwachsenen Bezugspersonen erreichbar ist.
Die nachfolgende Sach- und Verlaufsanalyse des Vorganges Füttern, Tränken und Ausmisten der Tiere verdeutlicht in 72 Schritten den Arbeitsprozess und zeigt durch die vorgestellten Grossbuchstaben B, D, K und M, welches der Kinder der Kleingruppe welche aktuellen Tätigkeiten (entsprechend ihrer Handlungskompetenz bezogen auf die nächste Zone ihrer Entwicklung) im Handlungsablauf wahrnehmen werden.
|
01 |
K |
Frischfutter (Gemüse- und andere Abfälle) am zentralen Sammelort im KHT in bereitstehenden Eimer füllen und zum Hasenstall tragen |
|
02 |
BDKM |
Zum Schuppen gehen usw. |
|
03 |
D |
Schuppentür öffnen |
|
04 |
D |
Eimer und Hasenschaufel aus dem Schuppen holen |
|
05 |
B |
Gießkanne aus dem Schuppen holen |
|
06 |
B |
Sandschaufel aus dem Schuppen holen |
|
07 |
M |
Mistgabel und Schiebkarre aus dem Schuppen holen |
|
08 |
B |
Kiste für den Hasen aus dem Schuppen holen |
|
09 |
D |
Trockenfutter mit Handschaufel aus der Futtertonne in Eimer füllen |
|
10 |
B |
Wasser in Gieskanne füllen |
|
11 |
BM |
Mistgabel und Sandschaufel auf die Schiebkarre legen |
|
12 |
D |
Schuppentür schliessen |
|
13 |
D |
Eimer mit Trockenfutter und Handschaufel zum Hasenstall tragen und dort abstellen |
|
14 |
B |
Mit Wasser gefüllte Gieskanne zum Hasenstall tragen und dort abstellen |
|
15 |
K |
Kiste für den Hasen zum Hasenstall tragen und dort abstellen |
|
16 |
M |
Schiebkarre mit Mistgabel und Sandschaufel zum Hasenstall fahren und dort abstellen |
|
17 |
D |
Stalltür öffnen |
|
18 |
BDKM |
Mit den Hasen Kontakt aufnehmen |
|
19 |
P |
Den Hasen herausnehmen und in die bereitgestellte Kiste setzen |
|
20 |
BDKM |
Mit dem Hasen Kontakt aufnehmen |
|
21 |
B |
Wassernapf aus dem Hasenstall herausnehmen |
|
22 |
B |
Wassernapf reinigen |
|
23 |
B |
Wasser aus der Gieskanne in den Wassernapf füllen |
|
24 |
B |
Wassernapf zur Seite stellen |
|
25 |
D |
Futternapf aus dem Hasenstall herausnehmen |
|
26 |
D |
Futternapf reinigen |
|
27 |
D |
Trockenfutter mit Handschaufel aus dem Futtereimer in den Futternapf füllen |
|
28 |
D |
Futternapf zu Seite stellen |
|
29 |
BDKM |
Nistmittel kennenlernen, Stroh und Mist unterscheiden |
|
30 |
BM |
Mist mit Mistgabel und Sandschaufel auf die Schiebkarre laden |
|
31 |
BM |
Sandschaufel auf die Schiebkarre legen |
|
32 |
B |
Schiebkarre mit Mist, Mistgabel und Sandschaufel zum Misthaufen fahren |
|
33 |
BM |
Mist mit Mistgabel und Sandschaufel auf dem Misthaufen abladen |
|
34 |
BM |
Mistgabel und Sandschaufel auf die Schiebkarre legen |
|
35 |
BDKM |
Zum zentralen Stallgebäude gehen |
|
36 |
D |
Tür öffnen |
- 168 -
|
37 |
BDKM |
Bevorratete Nist- und Futtermittel kennenlernen, Heu und Stroh unterscheiden |
|
38 |
DK |
Kisten für Heu und Stroh im Stallgebäude bereitstellen |
|
39 |
BDKM |
Heu und Stroh in Kisten füllen |
|
40 |
BDKM |
Kisten zum Hasenstall tragen und dort abstellen |
|
41 |
D |
Tür vom zentralen Stallgebäude schliessen |
|
42 |
DM |
Stroh in den Hasenstall einstreuen |
|
43 |
BK |
Heu in den Hasenstall legen |
|
44 |
BDKM |
Mit dem Hasen in der Kiste Kontakt aufnehmen |
|
45 |
P |
Hasen wieder in den Stall setzen |
|
46 |
BDKM |
Mit dem Hasen Kontakt aufnehmen |
|
47 |
B |
Wassernapf in den Hasenstall zurückstellen |
|
48 |
D |
Futternapf in den Hasenstall zurückstellen |
|
49 |
K |
Frischfutter in den Hasenstall legen |
|
50 |
BDM |
Dem Hasen Futter mit der Hand reichen |
|
51 |
BDKM |
Nachsehen, ob der Hase |
|
52 |
D |
-Futter |
|
53 |
K |
-Frischfutter |
|
54 |
B |
-Wasser |
|
55 |
BK |
-Heu |
|
56 |
DM |
-Stroh hat |
|
57 |
D |
-Tür schliessen |
|
58 |
BM |
Kisten für Heu und Stroh zum zentralen Stallgebäude zurücktragen |
|
59 |
BM |
Tür öffnen |
|
60 |
BM |
Kisten für Heu und Stroh an ihren Platz zurückstellen |
|
61 |
BM |
Tür schliessen |
|
62 |
M |
Schiebkarre mit Mistgabel und Sandschaufel vom Misthaufen zum Schuppen zurückfahren |
|
63 |
K |
Frischfuttereimer vom Hasenstall zur zentralen Sammelstelle im KTH zurücktragen |
|
64 |
D |
Futtereimer und Handschaufel vom Hasenstall zum Schuppen zurücktragen |
|
65 |
B |
Gießkanne vom Hasenstall zum Schuppen zurücktragen |
|
66 |
K |
Kiste für den Hasen vom Hasenstall zum Schuppen zurücktragen |
|
67 |
D |
Tür öffnen |
|
68 |
M |
Schiebkarre, Mistgabel und Sandschaufel an ihren Platz zurückstellen |
|
69 |
D |
Futtereimer und Handschaufel an ihren Platz zurückstellen |
|
70 |
B |
Gieskanne an ihren Platz zurückstellen |
|
71 |
K |
Kiste für den Hasen an ihren Platz zurückstellen |
|
72 |
D |
Tür schliessen |
Die aktuelle Handlungskompetenz der Kinder
Nachfolgend soll am Beispiel des Kindes D. sehr verkürzt seine aktuelle Handlungskompetenz beschrieben und zu dem Teilvorhaben „Füttern, Tränken und Ausmisten der Tiere“ in Beziehung gesetzt und im Spiegel des Teilvorhabens aufgezeigt werden, welches die Handlungen sind, die die nächste Zone seiner Entwicklung intendieren, und welche angestrebten Fertigkeiten und Qualifikationen das Kind D. im kooperativen Prozess mit anderen im Rahmen der gegenständlichen Tätigkeit dieses Teilvorhabens entwickeln soll. Diese Tätigkeiten wiederum werden hinsichtlich ihres gegenständlichen Aspektes wie der kommunikativen Zusammenhänge dargestellt (letztere dadurch, dass Worte, die im Zusammenhang mit Gebärden und Gesten im Kommunikationsprozess an D. gerichtet werden und die für die Handlungen besonders bedeutend sind; sie werden im Sinne rhythmischer Arbeitsweise besonders prononciert und im Text hervorgehoben werden).
Der Vorbereitung durch die Stützpädagogin wird entnommen:
„D., geb. --.--.1979: D gehört zum Personenkreis der nach dem BSHG als behindert bezeichneten Kinder. Bei D. wurde ein Down-Syndrom diagnostiziert. Er wurde bereist mit weniger als 3 Jahren in das KHT aufgenommen (in
- 169 -
Absprache mit den Frühen Hilfen), insbesondere wegen der Kommunikationsproblematik im Elternhaus. D.’s Mutter ist hörbehindert und kann seine sprachlichen Äußerungen nicht verstehen.
Aktuelle Handlungskompetenz: D. geht gerne in den Kindergarten. Er nimmt zu allen Kindern und Erwachsenen seiner Gruppe Kontakt auf, z.B. indem er morgens jeden einzelnen begrüßt. D. besucht den KHT täglich von 8:00 bis 14:30 Uhr. Entsprechend seinen Schlaf-Wach-Bedürfnissen, die er zum Teil selbst kundtut, schläft D. zwischenzeitlich am Vormittag oder Nachmittag im KTH.
Bei erwünschten Hilfestellungen wendet sich D. an die für ihn zuständige erwachsene Bezugsperson.
D.’s Vorlieben gelten bei den gemeinsamen Aktivitäten der Gruppe den Bewegungsspielen, rhythmisch-musikalischen Einheiten, dem Schwimmen und den Tieren des KTHs.
In seiner Gruppe führt D. mit Hilfe seiner Bezugsperson kleine Aufgaben/Ämter der Selbstbesorgung aus, z.B. das Verteilen kleiner Löffel auf dem Frühstücks- bzw. Mittagstisch. Er ordnet dabei Gegenstände deren Abbildern zu.
D. bezeichnet Gegenstände, Erscheinungen, Personen, drückt Gefühle, Stimmungen und eigene Wünsche über private Gebärden, expressive Mimik, Gestik, Gebrauch einzelner Wörter und Ausdruckslaute usw.
In angeleiteten Situationen spielt D. mit erwachsenen Bezugspersonen und anderen Kindern. Er verwendet Gegenstände als Spielgegenstände, z.B. einen Bauklotz als Auto, ahmt Spielvorschläge der anderen in Form von verbundenen Einzelhandlungen nach – bei gemeinsamem Spiel in der Puppenecke schüttet er ein, trinkt, ißt. Beim Bewegungsspiel macht D. auf Aufforderung selbst Spielvorschläge, die er sich zuvor mit Hilfe der Erwachsenen angeeignet hat, z.B. Bimmel-Bammel-Sequenz, klatschen, patschen.
In freien Aktivitäten spielt D. neben anderen Kindern, führt Einzelhandlungen aus, die Momente des realen Lebens widerspiegeln, und wiederholt diese vielfältig, z.B. eine Puppe schlafen legen.
D. erwirbt den Gebrauch von Werkzeugen, z.B. der Schaufel im Sandkasten. Er ißt mit dem Löffel und erwirbt den Gebrauch von Gabel und Messer. Bei Einheiten der Selbstbesorgung wie Toilettengang, Händewaschen, Zähneputzen benötigt D. Hilfen und führt einzelne Teilhandlungen selbständig aus. D. wird gewindelt.
Beim Sprechen, Essen und Trinken lernt D., seinen Zungenvorfall zu kontrollieren, z.B. durch Trinken mit einem dicken Strohhalm. Zeitweise trägt er auf Wunsch seines Elternhauses eine Gaumenspange zur Kontrolle des Zungenvorfalls.
Die aktuelle Handlungskompetenz von D. zum Vorhaben ‚Füttern, Tränken, Ausmisten der Tiere‘:
D.
-
kennt den Hasenstall als Unterbringungsort/-raum für Hasen,
-
kennt den Schuppen als Sammelort für Spielgeräte,
-
trägt Gegenstände beidhändig und einhändig, trägt Behälter, ohne seine Bewegungsaufführung der Konsistenz des Behälterinhaltes anzupassen,
-
kennt die Bedeutung von Gefässen zur Aufbewahrung von flüssigen und festen Inhalten,
-
führt mit Gegenständen und Spielgegenständen Operationen des Schüttens und Füllens aus: kippt, lässt herausströmen (wiederholt vielfältig),
-
gebraucht Sandschaufeln als Werkzeuge,
-
kennt Türen als Schließvorrichtungen; offene Türen z.B. im Gruppenraum bedingen für D. das Ritual „schließen“
-
schliesst Türen mit Griff selbständig.
- 170 -
Zum Thema ‚Tiere füttern, tränken und ausmisten‘ hat D. bereits Erfahrungen gesammelt. Er mag die Hasen des KHTs gern. Während des Spielplatzaufenthaltes verbringt er lange Zeit vor den ihm zugänglichen Ställen, holt sich selbst einen Kasten, steigt darauf, um besser sehen zu können, beobachtet die Hasen, reicht ihnen selbstgerupftes Gras als Futter (nachdem die Erwachsenen es ihm zuvor gezeigt haben) und hat auch einen Hasen angefasst. Dabei hat D. fest zugegriffen und den Hasen zu sich herangezogen. Seinen erwachsenen Bezugspersonen gegenüber deutet er auf die beiden Hasen und bezeichnet sie mit Ausdruckslauten.
Zone der nächsten Entwicklung von D. im geplanten Vorhaben (Grobziele):
D. soll
-
mit dem Hasen Kontakt aufnehmen (erlebnismäßig, emotional, motivational),
-
Wirkungen seiner Handlungen erkennen (kognitiv-interaktiv-kommunikativ),
-
Schließvorrichtungen, Naturmaterial, Behälter, Werkzeug entsprechend ihren Eigenschaften/Beschaffenheiten und Nutzungsformen im Handlungsablauf verwenden (psychomotorisch-pragmatisch),
-
sprachliche Äußerungen, mimische Zeichen, Gesten und Gebärden entsprechend dem Handlungsablauf verstehen und erwidern (kognitiv-interaktiv-kommunikativ).
Angestrebte Qualifikationen, Fertigkeiten:
D. soll
-
Schuppentür als Vorrichtung zum Freilegen/Verschließen einer Durchgangsöffnung kennen, um zum Eimer und zur Handschaufel zu gelangen. D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür auf, (Gebärde),
-
Schuppentür mit Griff öffnen,
-
Eimer und Handschaufel aus dem Schuppen holen. D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Hol Futter für den Hasen, (Gebärde),
-
Körniges Trockenfutter mit Handschaufel aus der Futtertonne in bereitgestellten Eimer füllen,
Wenn der Eimer voll ist, sollen ihm das Ende und das Ergebnis seiner Tätigkeit mit der Darbietung von D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), fertig (Gebärde) vermittelt werden.
D., der Eimer ist voll (mit den Händen mit Handführung über die Öffnung des randvoll gefüllten Eimers streichen)
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür zu (Gebärde)
-
die Schuppentür schliessen,
-
die vollen Futtereimer und die Handschaufel zum Hasenstall tragen,
-
die Stalltür (mit Haken und Öse als Schließvorrichtung) als Vorrichtung zum Freilegen/Verschließen einer Durchgangsöffnung kennen, um zum Hasen zu gelangen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür auf! (Gebärde)
-
Fass an, (mit Handführung den Haken anfassen)
-
Schieb hoch, (mit Handführung den Haken hochschieben)
-
Zieh die Tür auf, (Gebärde – mit Handführung die Tür aufziehen),
-
mit dem Hasen Kontakt aufnehmen,
-
mit Handführung mit der ausgestreckten Hand über den Hasen streichen und weich gesagt bekommen,
-
den Hasen mit seinen Eigenschaften und Merkmalen sinnlich wahrnehmen,
- 171 -
-
den Hasen ansehen, hoppeln sehen, rascheln hören, riechen.
D. (Hinweisgeste), Hase (Mundbild, Gebärde)
-
das Wort und die Gebärde nachahmen,
-
den Tränkvorgang miterleben,
-
B. beim Herausnehmen, säubern, Füllen und Beiseitestellen des Wassernapfes zusehen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), nimm den Futternapf heraus (Gebärde)
-
Den Futternapf aus dem Stall herausholen und abstellen
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), wir machen den Futternapf sauber (Gebärde)
-
den bei B. beobachteten Säuberungsvorgang nachahmen,
-
mit Handführung mit einer Hand, wechselnd oder beidhändig dem Futternapf anhaftende feuchte Nist- und Futtermittelreste abreiben, mit den Fingern abkratzen und herausnehmen,
-
mit der Handschaufel körniges Trockenfutter aus dem Futtereimer in den Futternapf füllen,
-
wenn der Napf voll ist, D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen) fertig (Gebärde)
D. der Napf ist voll (mit den Händen mit Handführung über die Öffnung des randvoll gefüllten Napfes streichen),
-
den Napf beiseite stellen,
-
Nistmittel des Hasen kennen,
-
Stroh und Mist ansehen und riechen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), einen Strohhalm gezeigt bekommen, Stroh (Mundbild u. Gebärde),
-
das Ausmisten miterleben,
-
B. und M. beim Mistladen, Schiebkarrentransport und Entladen auf dem Misthaufen zusehen.
D. wir holen neues Stroh (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen),
-
Strohhalm und Gebärde dargeboten bekommen,
-
Vorratsraum für Nist- und Futtermittel kennen,
-
Zum zentralen Stallgebäude gehen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür auf (Gebärde),
-
die Tür öffnen,
-
Nist- und Futtermittel des Hasen kennen,
-
Heu und Stroh sinnlich wahrnehmen,
-
Heu und Stroh ansehen, anfassen, rascheln, hören, riechen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Hol eine Kiste für das Stroh (Gebärde),
-
eine Kiste holen,
-
mit einem anderen Kind unter Anleitung das Strohholen ausführen,
- 172 -
-
mit M. abwechselnd mit den Händen Stroh in die Kiste füllen, bis sie voll ist.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), fertig (Gebärde),
-
mit M. die Kiste aus dem zentralen Stallgebäude heraustragen. Und halt (Gebärde),
D. mach die Tür zu (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen und Gebärde),
die Tür zumachen,
mit M. die Strohkiste zum Hasenstall tragen,
dem Hasen eine Einstreu bereiten.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Verteile Stroh im Stall (Gebärde),
-
M. beim losen Verteilen des Strohs im Hasenstall zusehen und nachahmen, bis die Strohkiste leer ist.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), fertig (Gebärde),
-
mit dem Hasen in der Kiste Kontakt aufnehmen,
-
mit der Handführung mit der ausgestreckten Hand über den Hasen streichen und allein weich gesagt bekommen,
-
den Hasen mit seinen Eigenschaften sinnlich wahrnehmen,
-
den Hasen ansehen, hoppeln sehen, rascheln hören, riechen, anfassen,
-
Trockenfutter als vom Menschen dem Tier gereichte Nahrung kennen,
-
den Futternapf in den Hasenstall zurückstellen,
-
mit den anderen Kindern zusammen dem Hasen Futter aus der Hand anreichen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Wir füttern den Hasen (Mundbild u. Gebärde),
-
das Trockenfutter zeigen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür zu (Gebärde),
-
die Tür zuschieben, Haken anfassen, mit Handführung anheben, über die Öse (Metallring) führen, in den Ring schieben, dabei hak(e) ein gesagt bekommen,
-
Futtereimer und Handschaufel zum Schuppen zurücktragen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür auf (Gebärde),
-
die Tür öffnen
-
Eimer und Handschaufel an ihren Platz zurückstellen.
D. (Hinweisgeste, Verfolgen mit den Augen), Mach die Tür zu (Gebärde),
-
die Tür schliessen.
Dieser Ausschnitt aus der Aktivität kann nur wenige Aspekte aus dem Bereich curricularer, didaktischer und methodischer Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit aufzeigen.
Im Rahmen der weiteren begleitenden Auswertung soll insbesondere der didaktische Bereich bearbeitet werden, so dass zu einem späteren Zeitpunkt speziell zu diesem Thema berichtet werden kann.
Projekte und Vorhaben mit Teilaktivitäten werden im Rahmen der Wochenplanung sowie der speziellen Planung konkreter Spiel- und Lerneinheiten vorgenom-
- 173 -
men und durch eine mit Beginn unserer Arbeit im KHT angelegten und schrittweise weiter auszubauenden Kartei ergänzt.
Im Wochenplan wird jeweils in Stichworten ein Überblick über Inhalte, Struktur und Organisation der Gruppenaktivität gegeben. Er dient zur Orientierung der Mitarbeiter im Gruppenteam, wie er auch in abgewandelter Form z.B. gemeinsam mit den Kindern schwerpunktmäßig ausgestaltet werden kann und auch die Eltern über die Aktivitäten der einzelnen Kindergruppen informiert.
Die Planung der konkreten Spiel- und Lerneinheiten erfolgt auf einem Blatt, das die laufende Nummer, den Inhalt, den Ablauf, die Mitarbeit und Hilfen und die Medien bezeichnet. Sie stellt auch eine Strukturierungs- und Organisationshilfe für die jeweils miteinander kooperierenden Pädagogen und Therapeuten dar.
Die Kartei soll im Sinne des Leitkartenprinzips in einer Zusammenschau Strukturierungs- und Organisationshilfen sowie der Auffindung einmal geleisteter
-
Sachanalysen nach Qualitäten und Gehalt bezogen auf den Zugang der Kinder zu den Spielen und Lerngegenständen,
-
Zielsetzungen, die jeweils individualisierbar sind, und
-
adäquate Methoden der Vermittlung zusammenfassen und allen Mitarbeitern im Kindergarten zugänglich machen.
Nachfolgend soll hier ein Vordruck des Wochenplanes (Originalgröße DIN A3; Abb. 12) des Plans für konkrete Spiel- und Lerneinheiten (Abb. 13) und der Kartei (Originalgrösse jeweils DIN A4; Abb. 14) zu Themen im Rahmen von Projekten und Vorhaben wiedergegeben werden, die sich in unserer didaktischen Planungsarbeit bislang bewährt haben.
|
Woche von:/bis |
MONTAG |
DIENSTAG |
MITTWOCH |
DONNERSTAG |
FREITAG |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ankunft 8.00 - 8.15 |
|||||
|
Morgenkreis 8.15 - 8.45 |
|||||
|
Frühstück 8.45 - 9.30 |
Frühstück |
Frühstück |
Frühstück |
Frühstück |
Frühstück |
|
systematische Forderung 9.30 - 10.45 |
|||||
|
Saftpause 10.45 - 11.00 |
Saftpause |
Saftpause |
Saftpause |
Saftpause |
Saftpause |
|
freie Aktivitäten 11.00 - 12.00 |
|||||
|
Mittagessen 12.15 - 13.15 |
Mittagessen |
Mittagessen |
Mittagessen |
Mittagessen |
Mittagessen |
|
spontane Aktivitäten 13.15 - 14.00 |
|||||
|
Ausklang 14.00 - 14.15 |
Abb.: 12
- 174 –
|
Laufende Nr. |
Zeit |
Inhalte/Ablauf |
Mitarbeiter/Hilfen |
Medien |
|---|---|---|---|---|
Abb. 13: Arbeitsplan, Originalgröße DIN A4
Was im Rahmen des 3. Kapitels dieses Berichtes über die Grundlagen, die entwicklungs- und lernpsychologischen, die didaktischen, methodischen und therapeutischen Aspekte unserer pädagogischen Konzeption ausgesagt werden konnte, ist durch die Bedingungen dieses Berichtes notwendig verkürzt; auf der anderen Seite aber vor allem im Hinblick auf die didaktische Bewältigung der sich täglich stellenden pädagogischen Aufgaben erst in einem Entwicklungsstadium, das uns zwar tragfähige Anfänge im Sinne unseres Verständnisses von Integration erlaubt hat, mit dem wir aber noch keineswegs alle pädagogisch-didaktischen Fragen hinsichtlich der gegenständlichen Tätigkeit der Kinder im integrativ-kooperativen Spiel- und Lernprozess zu unserer vollen Zufriedenheit lösen konnten. Auch zeigt sich, dass die Handlungskompetenzen der im Integrationsvorhaben mitarbeitenden Pädagogen auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen Ausbildungserfahrungen und ihrer beruflichen Praxis wesentlich medial und methodisch orientiert sind, so dass der zentrale Bereich der Bewältigung didaktischer Fragestellungen erst im Rahmen der Fortbildung der Mitarbeiter und der gemeinsamen Tätigkeit im KHT (wesentlich auch durch den Stützpädagogen zu vertreten) neu aufgegriffen und in Gang gebracht werden musste. Auch diese Fragen verlangen allen im Rahmen der Mitarbeit neue Orientierung und selbst neues Lernen ab.
- 175 -
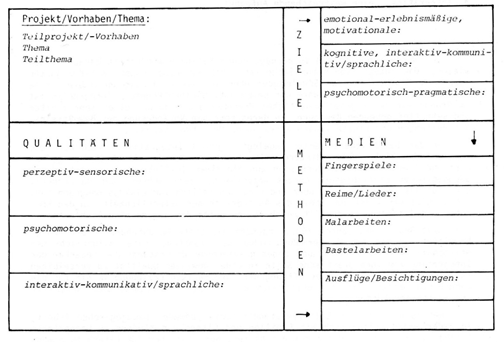
Abb. 14: Karteikarte – Originalgrösse DIN A4
- 176 -
[58] Die dreidimensionale Didaktik erfordert die Klärung und Reflexion in folgender Abfolge: (1) Tätigkeitsstrukturanalyse, (2) Handlungsstrukturanalyse und (3) Sachstrukturanalyse. Siehe Feuser, G. (2011): Entwicklungslogische Didaktik. In: Kaiser, A. et. al. (Hrsg.): Didaktik und Unterricht. Band 4 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 86-100
[59] Signale haben nicht an sich die Qualität von Informationen. Information entsteht im ZNS, was heißt, dass wir auch per Sprache keine Information übermitteln, sondern durch den Sprechakt Longitudinalwellen (Schallwellen), die das Ohr in Nervenimpulse übersetzt, die ins ZNS gelangen und dort in den für Sprache zuständigen Arealen als solche erkannt werden kann – dann erst entsteht Information, der bezogen auf die subjektive Sinnhaftigkeit und erfahrungsbedingt Bedeutung zugemessen wird.
[60] Dies aufgrund der subjektiven Bedeutungslosigkeit obwohl generell eine spezifische Re-Aktion darauf mögliche wäre. Wie sehr Habituationsprozesse in pädagogischen Situationen das Lernen negativ beeinflussen, wird nur wenig berücksichtigt und oft mangelnden Lernmöglichkeiten zugeschrieben. Dabei hat es dominant mit der Gestaltung von Lernanlässen zu tun.
[61] Wir konnten sowohl in Bezug auf die Arbeit in den Kindergärten wie in der Schule beobachten, dass so gehandelt wird, als gäbe es »Verstärker« an sich oder dass bestimmte Gegenstände an sich verstärkend wirken. Dem ist nicht so. Ein Verstärker ist nur, was die Motivation befriedigt, auf deren Hintergrund eine Handlung erfolgt ist.
[62] Wie schon an anderer Stelle angemerkt, ist das eine Aufgabe der Entwicklungsdiagnostik.
[63] Um es noch einmal zu verdeutlichen, unter „Bedarf“ verstehe ich die homöostatische Bedürftigkeit des Menschen nach Nahrung, Wärme etc.
[64] Gemeint ist nach Leon’tev die Sicht auf die Welt aus der Perspektive des Anderen, des Kindes – das hängt eng, wie oben beschrieben, mit der (1) Tätigkeitsstrukturanalyse und der (2) Handlungsstrukturanalyse der dreidimensionalen entwicklungslogischen Didaktik zusammen.
[65] Siehe: Jantzen, W. (2007): Allgemeine Behindertenpädagogik. Berlin: Lehmanns Media
[66] Für die mit der Sprachentwicklung verbundenen Fragestellungen verweise ich hier besonders auf: Braun, O. & Lüdtke, U. (Hrsg.) (2012): Sprache und Kommunikation. Band 8 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag
[67] Es sei darauf hingewiesen, dass Kooperationen immer Kommunikationen erforderlich machen, was an verschiedenen Stellen im Text bereits angeklungen ist. Es geht also um kommunikationsbasierte Kooperationen.
[68] Die nachfolgende Skizze (Abb. 10) kennzeichnet noch einen frühen Stand ihrer Entwicklung. Zur besseren Befassung mit ihrer Bedeutung für eine „entwicklungslogische Didaktik“ und deren dreidimensionalen Struktur verweise ich auf Feuser, G. (2011): Entwicklungslogische Didaktik. In: Kaiser, A. et al. (Hrsg.): Didaktik und Unterricht. Band 4 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik: Behinderung, Bildung, Partizipation. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, S. 86-100
[69] Den Begriff des „Team-Teaching“ verwende ich für die Zusammenarbeit aller Fachpersonen in einem inklusiven Setting (also der von Lehrpersonen, Therapeuten und Assistenzen). Mit „Co-Teaching“ bezeichne ich die multiprofessionelle Zusammenarbeit von PädagogInnen (z.B. Regelschul- und SonderschullehrerInnen).
[70] Es sei nur kurz angemerkt, dass diese autokompensatorischen Handlungen das System stabilisieren und vor dem Zusammenbruch bewahren, dies aber um den Preis, Kontakte zur oder Ansprüche der Außenwelt ablehnen zu müssen, weil diese wiederum diese Form neuro-psychischer Stabilisierung des eigenen Systems gefährden.
[71] Unabdingbare Voraussetzung dieses Prozesses in der konkreten Arbeit ist die tätigkeitstrukturanalytische Einschätzung des Entwicklungsniveaus im Verhältnis von aktueller zu nächster Zone der Entwicklung.
[72] Heute ist diesbezüglich von ADHS (ein Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom) die Rede. Dass selbst schon Kleinkinder und auch Kinder im Kindergarten auf Basis einer solchen Diagnose mit „Ritalin“ behandelt werden, muss in Anbetracht u.a. auch fehlender Langzeitstudien und der frühen Hirnentwicklung als äußerst problematisch angesehen werden.
[73] Gemeint ist hier nicht, dass Prävention = Therapie wäre, sondern, leider durch diesen Satz nicht hinreichend genau ausgedrückt, dass z.T. auch präventive Maßnahmen bereits einer therapeutische n Qualität bedürfen.
[74] Diese Hinweise beziehen sich auf das damals in Bremen mögliche Lehramtsstudium mit dem Fach Behindertenpädagogik bzw. auf das Diplomstudium Behindertenpädagogik. Diese Studienmöglichkeiten wurden geschliffen und sind heute nicht mehr verfügbar.
[75] Gemeint sind hier Angebote im direktiven und nondirektiven Verfahren, wie z.B. die psychoanalytische Kinderspieltherapie, wie sie von Hans Zulliger entwickelt wurde oder die nondirektive Kinderspiel- bzw. Kinderpsychotherapie, wie sie von Virgina Axline und Reinhard und Anne-Marie Tausch vorgeschlagen wurden.
[76] Es hat sich im Laufe der Zeit in Anbetracht der von den ErzieherInnen, StützpädagogInnen und AssistentInnen erworbenen Erfahrungen gezeigt, dass eine Einzelförderung, wie sie im engeren Sinne verstanden wird, praktisch nicht notwendig wurde und die Arbeit mit Kindern unter spezifischen Gesichtspunkten in der Gruppe und auch nicht außerhalb der inhaltlichen Kontexte zu realisieren war.
[77] Die beiden nächsten Fotos sind im Buch noch der Seite 153 zugeordnet. Die darauf folgenden drei Fotos der Seite 154. Deshalb tritt bei dieser Anordnung die Seite 154 nicht extra in Erscheinung.
[78] Aus diesen Erfahrungen heraus ist die Forderung entstanden, dass zukünftige PädagogInnen in ihrer Ausbildung mindestens zwei Semester Schauspiel- und Sprechunterricht haben müssten, um für die Entwicklungsniveaus der Kinder adäquate Ausdrucksmöglichkeiten zu haben und dadurch auch ganz zentral die Sprachentwicklung unterstützen zu können.
[79] Das kann u.a. als Interpunktion des Sprechaktes verstanden werden.
[80] Die nachfolgenden Fotos finden sich im Original auf den Buchseiten 156-158. Deshalb sind diese Seiten nicht extra ausgewiesen. Der Text wird auf Seite 159 fortgesetzt.
[81] Die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung angestellten Beobachtungen zweigten sehr hohe Raten (bis zu 80%) an Verhaltensweisen seitens der Fachpersonen gegenüber den Kindern, die als Strafe des Typs II, aber auch als negative Verstärkung zu bewerten waren; abgesehen davon, dass Double-Bind-Situationen und auch Mystifizierungen, wie sie seitens der Forscher der Paolo-Alto-Gruppe in Kalifornien, führend durch Gregory Bateson beschrieben wurden, sehr hohe Raten auswiesen. Das verweist auf eine sehr ungenügende Ausbildung der Fachpersonen, was wir durch die „Zusatzausbildung Integration“ ausgleichen konnten.
Inhaltsverzeichnis
Es wurde schon in den vorausgegangenen Kapiteln wiederholt darauf hingewiesen, dass Integration keine Sache ist, die auf eine Gruppe im Kindergarten oder eine Klasse in einer Schule oder eben auf ein Kindertagesheim bzw. eine Grundschule zu beschränken wäre und beschränkt bleiben könnte. Integration ist im Grunde ein sozialgesellschaftliches Phänomen als Ausdruck einer sehr breiten und sehr tief gehenden Bewegung, in deren Kern die Veränderung des Bewusstseins, der Haltungen und Einstellungen eines jeden Menschen stehen.
In der beschriebenen Weise angelegt, greift Integration, auch wenn sie aufgrund des historischen Hintergrundes nicht von der Gesellschaft her gefordert und gewollt ist, sondern sich aus einzelnen Initiativen in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen heraus entwickelt, sehr schnell auf das nähere, dann auf das weitere Umfeld über und wird schließlich zum Diskussionsgegenstand wie in gleicher Weise zum Stein des Anstoßes in der Öffentlichkeit, in den Kommunen und Behörden, in der Elternschaft wie unter den sogenannten Fachleuten.
Seit Beginn des Jahres 1983, nachdem die erste Anlaufphase in der Praxis bewältigt war und wir einigermaßen sicher sein konnten, eine solidarische Gemeinschaft zu bilden, die auch gegen gravierende Widerstände den Gedanken der Integration wie ihre praktische Seite in einer gewissen Qualität zu verteidigen in der Lage ist, nahm mit der Öffnung der integrativen Erziehung im KHT für die nähere und weitere Öffentlichkeit auch der Umfang der Aufgaben zu, denen wir uns zu stellen hatten.
Gehört es noch zur Selbstverständlichkeit jedweder pädagogischer Arbeit, in jeder Weise solidarisch mit Familien und Eltern von Kindern zu kooperieren (siehe 2.3.2), also Elternabende abzuhalten, Hospitationen für Eltern zu ermöglichen, Eltern zu Hause zu besuchen, sie bei Arztbesuchen mit den Kindern, in der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber kommunalen oder übergeordneten Ämtern und Behörden zu unterstützen, ihnen Zugang zu anderen Einrichtungen zu verschaffen und vieles mehr, ergaben sich darüber hinaus weitere Aufgabenfelder:
-
Die Verteilung und Verstärkung der Information im Stadtteil selbst, in dem das Kindertagesheim liegt, wie dort zu den benachbarten Schulen, zu Nachbargemeinden, zur Ortsverwaltung und anderen Einrichtungen,
-
Kontakte zu Parteien und Fraktionen und zu deren bildungspolitischen Vertretern,
-
Kontakte zu anderen Elterninitiativen und Arbeitskreisen von fachlich wie politisch engagierten Eltern, Pädagogen und Therapeuten,
-
Kontakte zu den senatorischen Behörden, insbesondere hinsichtlich der Fragen der weiteren Verankerung der integrativen Arbeit im Bereich bremischer Vorschuleinrichtungen (Senator für Soziales, Jugend und Sport) und hinsichtlich der weiteren Fortführung unserer Integrationsarbeit in den Bereich der Grundschule hinein (Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst).
-
Die Diskussion um die Integration fand in Bremen ein sehr breites Echo, sicher leider auch dadurch, dass entsprechende Bemühungen von Eltern und Pädagogen nicht hinreichend unterstützt oder, was das Verlangen der Fortsetzung in die Schule hinein betraf, in fachwissenschaftlich unhaltbarer Weise hinweg argumentiert wurde, da es, würde man ein diesbezüglich verfasstes Schreiben der Schulbehörde an die Elterninitiative in Bremen-Grohn vom 27.06.1983 entsprechend fachwissenschaftlich analysieren und begutachten, das Ergebnis mehr als beschämend für die ausstellende Behörde wäre.
Als Ergebnis aus dem Bemühen, unsererseits im Rahmen der Trägerschaft durch das Diakonische Werk unsere Ansätze und Erfahrungen breit zu streuen (wie aus den geschilderten Zusammenhängen heraus, kam es schließlich auch zu Treffen im Sinne eines „trägerübergreifenden Kreises“, an dem alle mit diesen Fragen im Bereich von Kindergärten und Schulen befassten Behörden, Politiker und El-
- 177 -
tern beteiligt sind, der sich in größeren Abständen zum Informationsaustausch und zur Diskussion der Frage zusammenfindet.
-
Schließlich waren auch immer die Fortbildungsanliegen der Mitarbeiter des KHT und deren weitere Qualifikation zu garantieren, die kirchlichen Gremien wie Kindergartenausschuss, Erziehungsausschuss und Kirchenausschuss waren mit Informationen zu versehen und in Form von Gesprächen und Diskussionen im Hinblick auf ihre Sachfragen zu befriedigen. Auch in gemeinsamen Treffen der Leiterinnen der evangelischen Kindertagesstätten in Bremen war über Integration zu informieren und zu diskutieren.
-
Mit viel Aufwand und Zeit war verbunden, interessierten Mitarbeitern aus anderen Kindertagesheimen, die sich mit dem Gedanken trugen oder tragen, ihr Kindertagesheim im Sinne der Integration zu öffnen, was mit Hospitationen im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, mit gemeinsamen Dienstbesprechungen, mit Tagesseminaren und dann oft noch mit recht kontroversen Diskussionen verbunden war, wenn im einen oder anderen Fall für die interessierten Kolleginnen und Kollegen deutlich wurde, dass Integration mehr ist, als eben dem allgemeinen Trend Rechnung zu tragen, sich für behinderte Kinder zu öffnen.
-
Breiten Raum nahm auch die Diskussion um die Frage der Fortführung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder, die das KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde besuchen, mit den zuständigen Grundschulen ein. Auch hier waren den Lehrern Hospitationsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Aussprache entsprechend zur Verfügung zu stellen.
-
Schließlich konstituierte sich auch schon von Ende 1981 an beim Senator für Soziales, Jugend und Sport ein Arbeitskreis, in dem alle betroffenen Träger in der Kindergartenarbeit wie Vertreter der verschiedenen Einrichtungen, die mit Fragen der Integration beschäftigt waren, zusammentrafen, wiederum auch unter Beteiligung der entsprechenden Vertreter aus dem Bereich der senatorischen Behörden für Gesundheit und Umweltschutz wie des Kinderzentrums in Bremen. Die Behandlung der verschiedenen Fachfragen spielte dort eine grosse Rolle; in letzter Zeit insbesondere die Frage nach der Gestaltung und Organisation einer breiten Fortbildungsmöglichkeit für Mitarbeiter in Regel- und Sonderkindergärten (Pädagogen, Sonderpädagogen und Therapeuten).
Es ist nicht möglich, hier die gesamte Arbeit im Umfeld von Integration auch nur annähernd zu beschreiben oder gar aufzuzeigen, welche zeitlichen und arbeitsmäßigen Belastungen im Rahmen der Integration damit verbunden sind. In keinem Fall, in dem es darum ging, andere Personen, Gremien oder Behörden/Parteien mit dieser Frage zu beschäftigen, blieb es dabei, sich das ganze nur einmal anzusehen, sondern jeweils – und das bedarf einer positiven Würdigung – waren alle außerordentlich an einem vertieften Verständnis der Zusammenhänge und Fachfragen interessiert, so dass es Sitzungsdaten gibt, die sehr viel Vorbereitung und sogar auch ganztägige Beschäftigungen mit diesen Fragen bedeuteten.
Um nur einen Überblick zu geben, sei darauf verwiesen, dass es z.B. im Rahmen der BEK zu vier Sitzungen mit dem Kindergartenausschuss, zu fünf Sitzungen mit den Leiterinnen der evangelischen Kindertagesstätten, zu zwei Sitzungen mit dem Erziehungsausschuss und zu zwei Sitzungen mit dem Kirchenausschuss kam. Mit Fraktionen und Verbänden (GEW und VDS) kam es zu sieben Sitzungen, mit Schulen zu fünf Sitzungen, mit dem Senator für Soziales, Jugend und Sport zu dreizehn Sitzungen, mit dem Senator für Bildung zu drei Sitzungen und mit dem trägerübergreifenden Kreis zu vier Sitzungen; dies sind quantitative Hinweise, die sicherlich wenig aussagekräftig sind, aber im Rahmen dieses Berichtes auch nicht weiter vertieft werden können, so bedeutend sie alle für die Weiterentwicklung der gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder auch waren und sind.
Auf zwei Bereiche soll allerdings noch kurz eingegangen werden, weil sie für die Weiter- und Fortführung integrativer pädagogischer Praxis aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung sind: dies sind die Fragen der Fortbildung und auch der Fortführung der Integration in der Grundschule.
- 178 -
Es wurde schon eingangs des Berichtes über die Entwicklung unseres Vorhabens im Punkt 2 dieses Berichtes betont, dass wir eine einjährige Vorbereitungsphase, die insbesondere auch der Fort und Weiterbildung der zukünftigen Mitarbeiter in der Integration dienen soll, für unverzichtbar halten. Obwohl wir, was die Arbeit im KHT der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde betrifft, wie dargestellt, schließlich nur noch ½ Jahr für diese Vorbereitung zur Verfügung hat ten und der Einstieg in die integrative Arbeit dennoch gelang, müssen wir aus heutiger Sicht rückblickend wie für zukünftige, weitere Vorhaben vorausschauend nach wie vor fordern, dass eine mindestens einjährige Vorbereitungsphase zur Verfügung stehen muss, es sei denn, was wir anstreben, dass grundsätzlich ein Fortbildungsangebot für alle die zukünftigen MitarbeiterInnen in der Integration realisiert wird, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Einrichtungen für behinderte Kinder zu öffnen und sich dadurch die Qualifikationen für eine basale allgemeine Pädagogik, wie sie die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder erforderlich macht, anzueignen.
Viele Kontakte, Gespräche, Tages- und Wochenendseminare (auf spezifisch für Mitarbeiter bestimmter Einrichtungen) haben gezeigt, dass eine grundsätzliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in diesen Fragen, d.h. in allen Grundelementen einer basalen allgemeinen Pädagogik, notwendig erfolgen muss; notwendig nicht nur, um die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder realisieren zu können, sondern ‚not‘-wendig (im wahrsten Sinne des Wortes, um Not zu wenden) auch für die Kinder, die sich bereits in den Einrichtungen der Regelkindergärten befinden.
Es mag sich überheblich und auch diskriminierend anhören, wenn hier im Rahmen dieses Berichtes gesagt wir, dass die vielerorts praktizierte Pädagogik zwar den Vorstellungen von einer adäquaten Kindergartenarbeit entspricht, damit aber nicht automatisch garantiert ist, dass sie auch den Erziehungsbedürfnissen der Kinder unter den heute gesellschaftlich für diese gegebenen Entwicklungsbedingungen gerecht wird. Unser Wissen über die Grundlagen menschlicher Entwicklung, über neuropsychologische und lernpsychologische Sachverhalte, über didaktische, methodische und therapeutische Fragen hat sich erweitert; mehr als dies von Ausbildungsstätten aufgegriffen und in ihre Ausbildung junger Pädagoginnen und Pädagogen eingehen kann. Fort- und Weiterbildung ist also ein grundsätzliches Anliegen, das wir in allen Bereichen als dringendes Erfordernis vorfinden. Es ist aber unverzichtbar und ein vordringliches Erfordernis, sie dort zu betreiben, wo von der pädagogischen Qualität der in Institutionen Erziehenden, seien es Sozialpädagogen oder Lehrer, die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen, für die wir Verantwortung tragen, mehr oder weniger davon abhängig sind.
Wir sind uns nach wie vor einig darüber, dass alles, was wir uns im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde erarbeitet und zu realisieren versucht haben, in jedem einzelnen Punkt und auch dann gerechtfertigt wäre, wenn nie ein behindertes Kind dieses Kindertagesheim besucht hätte.
Nachfolgend soll ein kurzer Überblick verdeutlichen, wie wir uns in der Vorbereitungsphase unserer Arbeit im KHT, zeitlich zerhackt und themenmäßig springend, an die Materie herantasten mussten. Folgende Fortbildungen fanden statt:
|
Datum und Ort |
Thema |
|---|---|
|
22.-24.01.82 Fischerhude |
Einführung in Formen gemeinsamen Lernens |
|
03.-05.02.82 Haus Hügel |
Vorbereitungsseminar für die Studienfahrt nach Dänemark |
|
28.03-02.04.82 |
Studienfahrt nach Dänemark |
|
14.-15.04.82 KTH Bonhoeffer |
Psychologische Grundlagen menschlichen Lernens |
- 179 -
|
Datum und Ort |
Thema |
|---|---|
|
25.-26.06.82 KTH Bonhoeffer |
Fortsetzung vom 14. und 15.04.82 und Planung der Gruppenarbeit |
|
10.09.82 KTH Bonhoeffer |
Thesen zur Integration und Planung zur Durchintegration im KTH |
|
11.-15.10.82 KTH Bonhoeffer |
Rhythmik (Ursula Becker und Hille Viebrock) |
|
04. 06.03.83 Haus Hügel |
Integration behinderter Kinder – Erfahrungen, Perspektiven |
|
16.-18.03.83 Haus Hügel |
Einführung in Formen gemeinsamen Lernens |
|
10.-12.10.83 KTH Bonhoeffer |
Einführung in den Umgang mit Orff-Instrumenten (Dumko) |
|
11.-12.11.83 KTH Bonhoeffer |
Einführung in die Grundlagen der Sprachheiltherapie 1 (Ulli Holste) |
|
27.-28.01.84 KTH Bonhoeffer |
Einführung in die Grundlagen der Sprachheiltherapie 2 (Ulli Holste) |
Was in dieser Art weder zeitlich noch in runden thematischen Überschriften aufzulisten ist, sind die Vielzahl der unterschiedlichen Mitarbeiterbesprechungen, die immer vorwiegend bis nahezu ausschließlich mit Fragen der Entwicklung der Kinder und der Ermöglichung adäquater pädagogischer und therapeutischer Hilfen befasst sind.
Eine Fortbildung muss, wie dies im Rahmen der Vorbereitung unserer integrativen Arbeit im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde nicht mehr möglich geworden war, insgesamt der inneren Logik des Gegenstandes der Fortbildung folgen; d.h. der Logik der Entwicklung menschlicher Persönlichkeit. Dies kann aber nur realisiert werden, wenn ein Fortbildungsangebot als in sich geschlossene Einheit realisiert werden kann. Eine entsprechende Vorlage ist inzwischen erarbeitet worden und liegt den entsprechenden Gremien zur Diskussion und Beschlussfassung vor.[82] Im Rahmen der Behandlung von Fortbildungsfragen im Arbeitskreis beim Senator für Soziales, Jugend und Sport wurde in den letzten Monaten auch ein vom Paritätischen Bildungswerk, Landesverband Niedersachsen, vorgelegte Fortbildungskonzeption diskutiert, in Bezug auf die es aber noch zu keinen weiteren Klärungen kam. Aus unserer Sicht muss jedoch dringend mit Beginn des 2. Halbjahres 1984 ein entsprechendes Fortbildungsangebot unterbreitet werden, damit eine weitere Ausweitung integrativer Arbeit in anderen Kindertagesheimen begonnen und fortgeführt werden kann.
Es ist nicht möglich, die Art und Weise, wie wir gemeinsam die Arbeit im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde vorbereitet und durchgeführt haben, auf andere Einrichtungen zu übertragen. Das überfordert die Arbeitskraft bei weitem und wäre auch diesbezüglich ein unökonomischer Weg. Deshalb sehen wir die Durchführung eines entsprechend systematischen Fortbildungsangebotes als grundsätzliche Vorbereitung interessierter Mitarbeiter an Kindertagesstätten als eine unverzichtbar und wiederum unmittelbar zu beginnende Voraussetzung an, damit, was von Anfang an unsere Intention war, Integration nicht in einem Kindergarten und auch nicht in einem Stadtteil auf nur wenige Kindertagesstätten des Diakonischen Werkes beschränkt bleibt.
Da der Bericht selbst alle Grundlagen aufzeigt, die auch in eine Fortbildungskonzeption hineinragen, sollen nachfolgend nur die organisatorischen und curricular inhaltlichen Aspekte einer solchen Fortbildung sowie das themenbezogene Curriculum vorgestellt werden.
- 180 -
Eine Fortbildung für die integrative pädagogische Praxis ist im Grunde auch ein Stück (Aus-) Bildung für die Teilnehmenden, zumindest in den Bereichen, die in deren Erstausbildung bzw. in den vorausgegangenen Fort- und Weiterbildungsvorhaben unberücksichtigt blieben, für die Realisierung einer integrativen Pädagogik aber unverzichtbar sind. Entsprechend wäre eine Fortbildung, die berufsbegleitend organisiert wird, in
-
zentralen Lehrgangswochen zu organisieren und durch
-
Beratung, Anleitung und Supervision in der Praxis der Teilnehmer zu ergänzen.
In den zentralen Lehrgangswochen werden die Grundlagen des Curriculums bearbeitet. Dass dies nicht in Form der Verteilung von Rezepten erfolgen kann, wird aus den Ausführungen dieses Berichtes hinreichend deutlich. Eine Einarbeitung und Vertiefung in die Grundlagen menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens sind unverzichtbar, damit die Teilnehmer eine Kompetenz aufbauen können, um in der Praxis die sich durch einzelne Kinder stellenden Erziehungsfragen zu adäquaten Lösungen führen zu können.
Die Teilnehmer sollen sich aus den Berufsgruppen zusammensetzen, die in der integrativen Arbeit im Team zusammenarbeiten werden (Pädagogen, Sonderpädagogen, Therapeuten).
Ferner sollen aus einer Einrichtung mindestens zwei Teilnehmer an einem Lehrgang beteiligt sein, damit in der täglichen Arbeit ein Ansprechpartner vorhanden ist und die Kooperation der Mitarbeiter möglich wird.
Im vergleichbaren Umfang findet die Supervision in der Praxis statt. Sie soll Möglichkeiten bieten,
-
gemeinsam anstehende Erziehungsfragen zu erfassen und zu analysieren,
-
eine entsprechende Strukturierung des Tagesablaufes und die Planung der Erziehungsarbeit in einzelnen Phasen des Tagesablaufes zu leisten,
-
dazu anzuregen, entsprechend den Inhalten adäquate Medien einzusetzen,
-
methodisch entsprechend den Erfordernissen (was Erziehungsstil, Instruktionen, Hilfen und Bewertungskriterien betrifft) zu verfahren,
-
die Bedürfnislage der Kinder und deren Motivationsstruktur ständig zu reflektieren und
-
in die Revision bzw. Weiterentwicklung der täglichen Arbeit adäquat einfliessen zu lassen.
Zentrale Lehrgangswochen wie die begleitende Arbeit in der Praxis haben das gemeinsame Anliegen
-
sich in gemeinsamen Lernprozessen die grundlegenden Erkenntnisse über Persönlichkeitsentwicklung und Lernen des Menschen unter besonderer Berücksichtigung der Altersbereiche 0.-6. Lebensjahr anzueignen,
-
die Erfahrungen, die die Teilnehmer aufgrund unterschiedlicher Ausgangsberufe einbringen, auszutauschen und zu erweitern und
-
eine pädagogische und therapeutische Handlungskompetenz auszubilden, auf deren Basis die vielfältigen und je individuell in Erscheinung tretenden Anforderungen in der Erziehungspraxis zu angemessenen Lösungen pädagogischer und therapeutischer Art geführt werden können.
Die Teilnahme an der Fortbildung wäre verbindlich zu regeln; auch erfordert der systematisch aufeinander bezogene Aufbau des Curriculums eine regelmäßige Teilnahme an den zentralen Lehrgangswochen.
Die Ausführungen dieses Berichtes verdeutlichen die zu erzielenden Qualifikationen der Teilnehmer, mithin die Ziele der Fortbildung, was die Befassung
- 181 -
mit folgenden Inhalten erfordert, die nachfolgend in Form eines curricularen Ablaufes themenbezogen aufgelistet werden:
-
Die Analyse der gegenwärtigen Situation der Erziehung und Bildung Behinderter und Nichtbehinderter auf dem Hintergrund einer geschichtlichen Gewordenheit unter dem Aspekt der zu entfaltenden Perspektiven und zukünftigen Veränderungen.
-
Historische, ökonomische und sozial gesellschaftliche Aspekte des Verständnisses von Pädagogik, Behindertenpädagogik und Therapie, von Behinderung und psychischer Krankheit, von Familie, institutionalisierter Erziehung, Bildung und Arbeit.
-
Funktion und Bedeutung der Wahrnehmung, Sensomotorik und Psychomotorik und deren Umsetzung in das Spiel, in musisch-rhythmische Übungen, Gymnastik, physiotherapeutische Verfahren u.a.
-
Humanbiologische, neuropsychologische und psychische Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen und der sie modifizierenden organischen und/oder sozialen Bedingungen, von Interaktion, Kommunikation und Sprache, von Kooperation und Arbeit.
-
Naturhistorische, phylogenetische und ontogenetische Aspekte menschlichen Lernens, Lernarten des Menschen und methodische Folgerungen für die Präsentation der Lerngegenstände, von Instruktionen, Hilfen, Bekräftigungen und gedächtnismäßiger Verankerung.
-
Lernorganisation und Lernumfeld, Struktur der Aneignungs- und Lernprozesse; Strukturanalyse der zu vermittelnden Gegenstände und Inhalte in Projekten, Tätigkeitsstrukturanalyse im Sinne der Ermittlung der momentanen Handlungskompetenz der Kinder und Handlungsstrukturanalyse im Sinne der erforderlichen aktiven Auseinandersetzung mit den gemeinsamen Gegenständen und Inhalten der Projekte in kooperativer Tätigkeit.
-
Planungsaspekte hinsichtlich der Lernvorhaben und Projekte, des Wochen- und Tagesablaufs, der einzelnen Phasen im Alltag (z.B. gezielte Aktivitäten, Freispiel, Essen, Erkundungen).
-
Organisation entwicklungsfördernder Lebensumwelt, Beteiligung der Eltern, deren Beratung und Weiterbildung, Kontakte zu Schulen und anderen Angeboten (Freizeitangebote, Spielkreise u.a.).
Es wird davon ausgegangen, dass mindestens elf zentrale Lehrgangswochen zur Bearbeitung des nachfolgend aufgelisteten themenbezogenen Curriculums, das in fünf Hauptpunkte und in einem Wochenraster gegliedert ist, zur Verfügung stehen. Innerhalb der fünf Hauptpunkte wurden die Themen einer systematischen Gliederung unterzogen, die der Sachlogik der einzelnen Themenzusammenhänge entspricht und sich durch den gesamten Fortbildungsplan hindurchzieht.
Bei der Durchsicht des themenbezogenen Curriculums ist zu berücksichtigen, dass
-
erst bei der Erstellung der jeweiligen Wochenarbeitspläne die Gewichtung hinsichtlich der zeitlichen Behandlung eines Unterpunktes deutlich wird, zumal manche Punkte im Sinne der Gliederung nur überschriftmäßigen Charakter haben und
-
die Themen der Punkte 5.3 bis 5.9 nach der dritten zentralen Lehrgangswoche im Kombination mit jeder nachfolgenden Lehrgangswoche als sogenannte Praxistage behandelt werden, so dass nach Erarbeitung einiger Grundlagen bereits eine entsprechende Organisation, Gestaltung und Planung der Praxis begonnen werden kann, die dann im Rahmen der Supervision in den parallel laufenden Praxisphasen weiter betreut wird.
- 182 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
QUALIFIKATION FÜR DIE PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE TÄTIGKEIT IN DER GEMEINSAMEN ERZIEHUNG BEHINDERTER UND NICHTBEHINDERTER KINDER (INTEGRATION) IN REGELKINDERGÄRTEN/KINDERTAGESHEIMEN Fortbildung für Sozialpäd., Erzieher, Sonderpäd. U. Therapeuten an Regel- u. Sonderkindergärten/Kindertagesheimen (Lg.: INT) Eröffnung und Einführung in den Lg.: INT
Einstieg in den Lg.: INT:
(Was meinen wir, ist Behinderung ? - was ein sog. Reguläre Entwicklung ?) (Berichte und Aussprachen über Vorerfahrungen dazu) 0 EINFÜHRUNG IN FRAGEN MENSCHLICHEN LERNENS 0.1 Aussprache über bekannte Vorstellungen von Lernen,Vererbung u. Begabung, Intelligenz u. Milieu 0.2 Grundlagen des menschlichen Lernens 0.3 Bedingungen des menschlichen Lernens 0.4 Funktion und Bedeutung menschlichen Lernens und seine Beeinträchtigungen 0.5 Organisation des menschlichen Lebens 1 LERNEN
1.1 Zur Naturgeschichte des Lernens 1.1.1 Beschreibung und Abgrenzung des Lernens von anderen Prozessen organismischer Veränderungen (genetische Aspekte, Instinkte) 1.1.1.1 Biokyberietische und psychologische Lernklassifikationen 1.1.1.2 Phänomenologische und physikalisch-reduktioistische Lernklassifikationen 1.1.1.3 Zoologische Lernklassifikationen 1.1.2 Grenzformen tierischen Lernverhaltens 1.1.2.1 Habitulation (und deren Abgrenzung von Ermüdung, Gewöhnung u. Extinktion) 1.1.2.2 Prägung 1.1.2.3 Lernen durch Einsicht 1.1.2.4 Lernen als individuelle Anpassungsleistung |
- 183 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
1.2 Lernarten des Menschen 1.2.1 Die habituative Lernform 1.2.1.1 Wahrnehmungslernen 1.2.1.2 Assoziationslernen 1.2.2 Instrumentelles Lernen 1.2.2.1 Grundprinzipien instrumentellen Lernens 1.2.2.1.1 Verstärkung, Strafe u. Nichtbeachtung (Extinkton) 1.2.2.1.2 Differenzierung, Generalisierung u. Transfer 1.2.2.2 Methodische Aspekte lerntheoretisch fundierter Arbeit 1.2.2.2.1 Instruktion und Aufforderung 1.2.2.2.2 Imitation und Regellernen 1.2.2.2.3 Einführung, Gewährung und Ausblenden von Hilfen 1.2.2.2.4 Fehlervermeidung und -Korrektur 1.2.3 Verhaltensanalyse 1.2.3.1 Grundlagen und Verfahren der Verhaltensbeobachtung 1.2.3.2 Interpunktion von Lernsequenzen 2 LERNEN
2.1 Grundgesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Natur
2.2 Prinzipien der individuellen Organisation menschlicher Lebens- und Lernprozessen 2.2.1 Das Wechselwirkungsverhältnis von Individuum und Umwelt
2.2.2 Die Ein- und Ausfuhr von Information und die Informationsverarbeitung (Gedächtnis und vorgreifende Wiederspiegelung) 2.2.3 Die Intelligenz als Sonderfall biologischer und Grundform menschlicher Anpassung 2.3 Die physikalisch-chemische Evolution 2.4 Die Entwicklung des Lebendigen und der biologischen Organisation 2.4.1 Der genetische Code - das 1. Informationssystem 2.4.2 Die Evolution der Arten und des Phänomen von Mutation und Selektion |
- 184 -[83]
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
3 Lernen
3.1 Die Wahrnehmungstätigkeit - „Brücke zur Welt“ und „Straße des Lernens“ 3.1.1 Die Entwicklung des Psychischen 3.1.1.2 Die Entwicklung der Empfindungen und der sinnlichen Widerspiegelung 3.1.1.3 Exkurs: Die elementar-sensorische Psyche Die perceptiv-sensorische Psyche Die perceptiv-operante Psyche Der Intellekt 3.1.2 Anpassung durch emotionsmotivierte und Signal-regulierte Tätigkeit Das 1. Signalsystem (2. Informationssystem) Exkurs: Neuropsychologische Aspekte der Funktion des ZNS[84] als Basis individueller Organisation des Lernens
Neuronen, Synapsen und die zentrale Aktivierung und Hemmung (Signal- und Orientierungsfunktion)
Neuropsychologische Aspekte der individuellen Organisation des Lernens
Exkurs: Kognition, Emotion, Erleben; Bedürfnis, Motivation; Tätigkeit, Handlung, Denken, Sprache, Bewusstsein 3.1.3.1 Die invarianten Funktionen der Adaptation und Organisation 3.1.4 Der Aufbau und die Funktion des zentralen Nervensystems 3.1.4.1 Funktion und Bedeutung der Großhirnrinde und des Großhirns
3.1.4.2 Funktion und Bedeutung von Zwischen-, Mittel-, Klein- und Rautenhirn
3.1.4.3 Die Funktion des Rückenmarkes (Eigen- und Leitungsfunktionen) |
- 185 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
3.2 Zusammenfassender Überblick 3.2.1 Die Systemhöhe neuropsycholgischer Organisation im Austausch mit der Umwelt 3.2.2 Die untere Grenze der Systemstabilität (Isolation, Zusammenbruch der Wt) 3.2.3 Spezielle Probleme 3.2.3.1 Aktivierung, Wachheit u. Bewußtheit (Schlaf/Traum) 3.2.3.2 Aufmerksamkeit und Habituation 3.2.3.3 Bedürfnisse, Emotion, Motivation 3.2.4 Aufbau eines Nervenpotentials (Generierung, Triggerung, Codierung) 3.2.5 Hemisphärendominanz 3.2.6 Lernpsychologische Betrachtung der neuropsychologischen Organisation der Verhaltensregulation im Überblick 4 LERNEN
4.1 Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung durch organische Faktoren 4.1.1 Genetisch-chromosomale Beeinträchtigungen (z.B. Down-Syndrom u. Stoffwechselerkrankungen) 4.1.2 Pränatale Beinträchtigungen (z.B. Rötelnembriopathie, Blutgruppenunverträglichkeit) 4.1.3 Perinatale Beeinträchtigungen (z.B. Asphyxie) 4.1.4 Postnatale Beeinträchtigungen (z.B. Hirn- u. Hirnhautentzündungen, Anfallsleiden) 4.1.5 Beeinträchtigung einzelner Areale der Großhirnrinde 4.1.5.1 Sensibilitätsstörungen 4.1.5.2 Störungen der optischen und akustischen Wahrnehmung 4.1.5.3 Sprach- Sprechstörungen 4.1.5.4 Lähmungen 4.1.5.5 Gedächtnis- und Persönlichkeitsstörungen 4.1.6 Zusammenfassender Überblick 4.2 Der Aufbau der Persönlichkeitsentwicklung und der geistigen Strukturen im 1. Und 2. Signalsystem 4.2.1 Die pränatale Entwicklung (Zellmigration, Erbkoordination und Aufbau des ES) 4.2.2 Die sechs Stadien der Entwicklung der ‚elementar-sensomotorischen Anpassungsverhalten‘ bis zu den geistigen Operationen‘ (und die Zirkulärreaktionen nach PIAGET |
- 186 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
4.2.3 Das Konzept der ‚dominierenden Tätigkeit‘ nach LEONTJEW 4.2.3.1 Das perceptive Lernen 4.2.3.2 Die manipulierende Tätigkeit 4.2.3.3 Die gegenständliche Tätigkeit 4.2.3.4 Das Spiel 4.2.3.5 Das schulische Lernen 4.2.3.6 Die Arbeit 4.2.4 Die etappenweise Ausbildung geitiger Funktionen durch Interiorisation nach GALPERIN 4.2.5 Entwicklungsniveau und psychisches Abbildungsniveau 4.2.6 Die Bedeutung und Funktion der Sprache 4.2.6.1 Grundlagen der Entwicklung der Sprache 4.2.6.2 Sprachanbahnung und Spracherwerb 4.2.7 Die Entwicklung der räumlich-zeitlichen Strukturen 4.2.7.1 Mengenbegriff und Invarianz 4.2.7.2 Anzahl, Zahl und Ziffer, Rechenoperationen 4.2.8 Die Entstehung der ‚ersten Objektbeziehungen und die Indikatoren der psychischen Organisation‘ nach SPITZ 4.3 Beeinträchtigung der Persänlichkeitsentwicklung durch soziale Faktoren 4.3.1 Psycho-toxische Störungen und der psychische Hospitalismus 4.3.2 Der frühkindliche Autismus 4.3.3 Die motorischen Stereotypien, Aggression und selbstverletzendes Verhalten 4.3.4 Die Objektbeziehungen, die Kommunikation und die ‚Rollen‘ 4.3.4.1 Elterliche Erwartungen und behindertes Kind 4.3.4.2 Die Situation von Eltern und Familien mit behinderten Kindern 4.3.4.3 Die Lage der Familie in der Gegenwart 4.3.4.3.1 Kindliche Rolle und elterliche Übertragung 4.3.4.3.2 Traumatische Rollen des Kindes und die Entstehung von Neurosen 4.3.5 Pragmatische Axiome der Kommunikation und die Metakommunikation 4.3.5.1 Gestörte Kommunikation, Ich-funktion und Selbstkonzept 4.3.5.2 Schwere psychische Beeinträchtigungen (Psychose und Depression) 4.3.6 Zum Begriff und der Funktion von ‚Behinderung‘ 4.3.6.1 Historische Entwicklung der Behindertenarbeit u.deren gegenwärtige Situation 4.3.6.2 Behinderung und soziale Schicht 4.3.6.3 Behinderung als Prozeß der Stigmatisierung, Diskreditierung u. Deklassierung |
- 187 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
4.3.6.4 Aussonderung, Ausschluß und Segregierung im Interesse der Behinderten? 4.3.6.4.1 Funktion der Segregierung, von Ausschluß und Einschluß in Anstalten u.a. Einrichtungen 4.3.6.4.2 Ängste, Vorurteile und Schwierigkeiten im Umgang mit behinderten Menschen 4.3.6.5 Feststellung von Behinderung 4.3.6.5.1 Behinderung in medizinischer, psychologischer, pädagogischer und gesetzlicher Sicht 4.3.6.5.2 Tests- und Entwicklungsskalen / Intelligenz- und Begabungsmessung 4.3.6.5.3 Informationen zu einer Diagnostik der Lernfähigkeit (Förderdiagnostik) 5 LERNEN
5.1 Früherkennung und Früherziehung 5.1.1 Die primäre Prävention (Prävention und Früherkennung) 5.1.2 Die sekundäre Prävention (Früherziehung von 0 - 3. Lj.) 5.2 Zusammenhang von Pädagogik und Therapie 5.2.1 Medizinische Therapie 5.2.1.1 Physiotherapie 5.2.2 Psychologische Therapie 5.2.2.1 Die Psychotherapie 5.2.2.2 Die Psychagogik 5.2.2.3 Die kinderpsychoanalytische Kinderpsychotherapie 5.2.2.4 Die Therapie im non-direktiven Verfahren 5.2.3 Die heil- und sonderpädagogischen Verfahren 5.3 Die Realisierung der integrativen Arbeit in Kindergärten/Kindertagesheimen 5.3.1 Begriffsbestimmung von Integration 5.3.2 Entwicklung integrativer Arbeit in den letzten 10 Jahren 5.3.2.1 Beispiel: Dänemark 5.3.2.2 Beispiel: Italien 5.3.2.3 Beispiel: Oregon und Wisconsin (USA) 5.3.2.4 Situation in der BRD 5.3.3 Basiselemente der ‚Integration‘ 5.3.3.1 Spielen/Lernen an gemeinsamen Gegenständen/Inhalten in Kooperation miteinander 5.3.3.2 Der Stützpädagoge (Aufgaben und Einsatz) |
- 188 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
5.3.3.3 Team-Teaching aller Pädagogen/Fachkräfte 5.3.3.3.1 Die Aufgaben und die Funktion des therapeutischen Fachpersonals 5.3.3.3.2 Zusammenhang von Pädagogik und Therapie 5.3.3.3.3 Organisation und Durchführung der Therapie 5.3.3.3.4 Ausbildung und Einsatz der Praktikanten(innen) 5.3.3.3.5 Der Zivildienstleistende im Team 5.3.3.3.6 Die Einbeziehung des Arztes 5.3.4 Grundprinzipien der Integration 5.3.4.1 Prinzip der Regionalisierung 5.3.4.2 Prinzip der Dezentralisierung 5.3.4.3 Prinzip der Beteiligung aller (behinderter) Kinder im Einzugsbereich der Einrichtung 5.3.4.4 Prinzip der Sinnerfülltheit und Lebensnähe im Lernprozeß 5.3.5 Curriculare und didaktische Aspekte 5.3.5.1 Lernziel Integration - Lernweg Integration 5.3.5.2 Ziele für die Kinder - Ziele für die Pädagogen 5.3.5.3 Arbeit in Projekten/Vorhaben 5.3.5.3.1 Projekte und ihre Untergliederung 5.3.5.3.1.1 Ziele: Richt-, Grob- und Feinziele 5.3.5.3.1.1.1 Das ‚individuelle Curriculum‘ 5.3.5.4 Bearbeitung eines Themas/Gegenstandes 5.3.5.4.1 Die Sachstrukturanalyse 5.3.5.4.1.1 Historische Aspekte des Themas/Inhaltes 5.3.5.4.1.2 Gegenwärtige Bedeutung des Themas/Inhaltes 5.3.5.4.1.3 Der kognitive Aspekt 5.3.5.4.1.4 Der emotiv-affektive Aspekt 5.3.5.4.1.5 Der psychomotorisch-pragmatische Aspekt 5.3.5.4.2 Die Tätigkeitsstrukturanalyse 5.3.5.4.2.1 Erfahrungshorizont der Kinder in Bezug auf das Thema/den Inhalt 5.3.5.4.2.2 Feststellung der momentanen Handlungskompetenz der Kinder 5.3.5.4.2.3 Stufe der dominierenden Tätigkeit der Kinder 5.3.5.4.2.4 Zone der nächsten Entwicklung |
- 189 -
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
5.3.5.4.2.5 Ziele für die einzelnen Kinder, die mit dem Thema/Inhalt erreicht werden sollen, unter den Aspekten
5.3.5.4.3 Die Handlungsstrukturanalyse 5.3.5.4.3.1 Die Orientierungsgrundlage 5.3.5.4.3.1.1 Die Niveaustufen der Orientierungsgrundlage 5.3.5.4.3.2 Die materialiseirte Handlung 5.3.5.4.3.3 Übertragung der Handlung in die gesprochene Sprache 5.3.5.4.3.4 Auufbau der äußeren Sprache an sich 5.3.5.4.3.5 Aspekte der inneren Sprache - Erweiterung des Denkens 5.3.6 Methodisch-therapeutische und medienspezifische Aspekte 5.3.6.1 Organisation der kooperativen Handlungen der Kinder 5.3.6.1.1 Sozialformen 5.3.6.2 Einführung, Motivierung, Darbietung 5.3.6.3 Erarbeitung, Verarbeiten und Problemlöse 5.3.6.4 Üben, Vertiefen, Festigen und Ausklang 5.3.6.5 Überprüfung der Lernziele 5.3.6.6 Herstellung und Beschaffung adäquater Medien 5.3.6.6.1 Reime, Spiele, Lieder (Schallplatten/Cassetten) 5.3.6.6.2 Gegenstände, Bilder, Vorlagen 5.3.6.6.3 Qualität und Einsatz von Bilderbüchern und Geschichten/Märchen 5.3.6.6.4 Qualität und Einsatz von Spielmaterialien/Gegenständen, Bildern und Vorlagen 5.3.6.7 Zusammenwirken verschiedener Fachkräfte 5.3.6.7.1 Therapeutische Aspekte des Vorhabens 5.3.6.7.2 Realisierung der therapeutischen Ansätze in der Tätigkeit des Kindes 5.3.6.7.3 Instruktionen, Hilfen, Bekräftigung 5.4 Didaktische Grundsätze und methodische Aspekte der Sinneschulung, Sensomotorik und Wahrnehmungstätigkeit 5.5 Didaktische Grundsätze und methodische Aspekte der Psychomotorik und Bewegungserziehung 5.5.1 Rhytmische Erziehung (Z.B. Schewiblauer-Rythmik) |
- 190 –
|
Ausbildungswoche von - bis |
CURRICULUM |
Referenten |
|---|---|---|
|
5.6 Didaktische Grundsätze und methodische Aspekte der Musikerziehung 5.6.1 Instrumente, deren Herstellung und Einsatz (z.B. Orff-Instrumentarium 5.6.2 Tanz und Bewegung 5.7 Wassergewöhnung und Schwimmen 5.8 Planung und Durchführung von Freizeitaufenthalten 5.9 Aufgaben der Verkehrserziehung und Wegebewältigung zusammen mit den Eltern 5.10 Zusammenarbeit mit Eltern und Gemeinde 5.11 Zusammenarbeit mit dem Träger (Gremienarbeit/Ausschüsse) 5.12 Aufgabenbereiche im Umfeld des Kindergartens/Kindertagesheimes 5.12.1 Zusammenarbeit mit Behörden und Ämtern (z.B. Jugendamt, Gesundheitsamt, Sozialamt u.a.) 5.12.2 Zusammenarbeit mit Clubs, Vereinen und Selbsthilfegruppen 5.13 Fragen der Finanzierung/Verwaltung 5.14 Rechtsfragen (z.B. JWG, BSHG, SchwBG u.a.) |
- 191 -
Wir gehen davon aus und haben dies in entsprechender Weise in allen Verhandlungen, Schriftstücken, Diskussionen und öffentlichen Erklärungen entsprechend deutlich ausgedrückt, dass die von uns entwickelte und im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde und der St. Georg Gemeinde praktizierte gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in ihren Grundlagen derart fundamental ist, dass diese im Prinzip auch Gültigkeit für die schulische Niveaustufe der Entwicklung menschlicher Tätigkeit haben; in der Schule ist eben den dann jeweils vorherrschenden Niveaus der Tätigkeit der Schüler und den Bedingungen Rechnung zu tragen , unter denen sie zu diesem Zeitpunkt sich realisieren kann. Insofern gelten alle hier in diesem Bericht zu Fragen der Integration (siehe Kapitel 1) und zu Fragen der pädagogischen Konzeption (siehe Kapitel 3) gemachten Ausführungen ohne Einschränkungen auch für die Fortführung der integrativen Arbeit in der Grundschule.
Das heisst nun insbesondere auch, dass alle (behinderten) Kinder ohne Ausnahme (nach Art und Schweregrad ihrer Behinderung) in die Grundschule aufzunehmen sind. Viele der in der BRD laufenden Schulversuche sind aber gerade dadurch charakterisiert, dass sie Kinder mit bestimmten Behinderungsarten oder Kinder mit Behinderungen bestimmter Schweregrade vom integrativen Schulversuch ausschließen und/oder aber einen derartigen Modellcharakter haben, dass die Kinder wiederum zentralisiert integrativ unterrichtet werden, d.h., sie kommen aus besonders integrationswilligen Elternhäusern über die gesamte Stadt verteilt in einer Schule zum Unterricht zusammen.
Der Ausschluss auch nur eines Kindes wegen der Art oder des Schweregrades seiner Behinderung würde für uns in der Substanz bedrohen, was Integration meint und wie wir nachgewiesen haben, dass sie praktizierbar ist. Deshalb haben wir bei den bereits im Spätjahr 1982 aufgenommenen ersten Kontakten mit dem Senator für Bildung und in allen nachfolgenden Initiativen und gemeinsamen Besprechungen die Grundlagen und Prinzipien unseres integrativen Vorhabens erläutert und darauf aufmerksam gemacht, dass diese für Integration unverzichtbare Grundelemente sind.
In der zweiten Jahreshälfte 1983 war die Diskussion soweit vorangeschritten, dass es zu ersten konkreten Skizzierungen in Sachen der Fortführung unserer integrativen Arbeit in der Grundschule des Stadtteils gekommen ist. Leider war im Oktober 1983 zu verzeichnen, dass eine der zuständigen Grundschulen per Abstimmungsergebnis in ihrer Konferenz sich mit nur zwei Stimmen Mehrheit gegen eine integrative Arbeit in der Grundschule aussprach. In weiteren Verhandlungen konnte jedoch eine Zusage des Senators für Bildung erreicht werden, aufgrund eben der mit der Arbeit im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde angebahnten gemeinsamen Erziehung und Bildung einen Schulversuch vorzunehmen.
Unser Anliegen war von Anfang an, einen Schulversuch nach Möglichkeit zu vermeiden, um die integrative Erziehung und Bildung unter regulären Bedingungen des Unterrichts unter Einbezug entsprechenden sonderpädagogischen und therapeutischen Personals erproben und als Regelfall durchführen zu können. Dem stimmte der Senator für Bildung nicht zu, u. a. auch aus Gründen, dass sich das Begehren nach Integration derart ausweiten könnte, dass die qualitativen Anforderungen an einen integrativen Unterricht in der Grundschule nicht garantiert werden könnten.
Der Bericht mag ausreichend verdeutlichen, dass Integration ein gesellschaftliches Anliegen, mithin eine bildungspolitisch zu entscheidende Frage ist. Deshalb haben wir in unseren Bemühungen von vornherein die entsprechenden politischen Gremien mit dieser Frage befasst, um eine entsprechende Willensbildung zu erreichen, da uns aus der Behandlung von Anliegen einer Elterninitiative in Bremen-Grohn hinreichend transparent wurde, dass die Frage der Integration primär auf der Ebene der Schulverwaltung anzugehen und aufgrund deren Organisationsstruktur und der dort vorfindbaren Einstellungen und Haltungen solchen
- 192 -
Bemühungen gegenüber zum Scheitern verurteilt sein musste. Wir sind der Meinung, dass eine entsprechende Willensbildung zumindest ansatzweise zustande gekommen ist und derart nun auch dieselbe Schulbehörde, d.h. im engeren Sinne dieselben Referate innerhalb der Schulbehörde und die Personen, die noch vor knapp mehr als einem Jahr einen Antrag auf einen Integrations-Schulversuch mit fachwissenschaftlich unhaltbaren Argumenten, wie schon betont, zurückgewiesen haben, nun den Schulversuch in Fortführung unserer Arbeit in Bremen-Huchting planen und organisieren müssen.
Dies stimmt uns, was die Behandlung des in gemeinsamen Sitzungen erreichten Konsenses in verschiedenen Punkten durch die Schulbürokratie zeigt, berechtigt bedenklich. So wird z. B. in der entsprechenden Vorlage vom Januar 1984 zur Frage der Organisation des Unterrichts davon gesprochen, dass für die „behinderten Schüler eine spezifische Auswahl von Lernzielen und -inhalten“ erfolgt. Ferner wird dort die Aussage gemacht, dass der Sonderschullehrer in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer auch Schüler mit Lernschwächen betreut und gegebenenfalls Team-Teaching erfolgt.
Allein diese wenigen Zeilen verdeutlichen, wie man sich von Seiten der Schulbehörde mit den vorgetragenen und für Integration unverzichtbaren Aspekte, z.B. des Verständnisses eines individuellen Curriculums nicht als einen besonderen Lehrplan für jedes, sondern als einen gemeinsamen Lehrplan, der so aufbereitet wird, dass alle Kinder sich kompetent in die Behandlung des gewählten Inhaltes einbringen können, schwer tun. Auch dürfte jedem, der in integrativen Zusammenhängen arbeitet, hinreichend klar sein, dass in einer integrativen Grundschulklasse Grundschullehrer und Sonderschullehrer nicht „gegebenenfalls“, sondern grundsätzlich im Sinne des Team-Teaching[85] zusammenarbeiten müssen und dass eine Zuordnung von Sonderschullehrern zu behinderten Schülern und des Grundschullehrers zu den nichtbehinderten von vornherein eine Qualität des Unterrichts, die mit dem Begriff der Integration bezeichnet werden kann, schon gar nicht aufkommen lässt.
Die Ausführungen dieses Berichtes sind zu all diesen Fragen deutlich genug. Verunsichert sind wir und vor allen Dingen die Eltern auch nach wie vor in der Frage, ob nicht doch entgegen aller getroffenen Absprachen irgendwann im Laufe der nächsten 4 Jahre ein Kind aufgrund der Schwere oder der Art seiner Behinderung vom Schulversuch ausgeschlossen werden könnte. Wir sind uns aber einig darin, dass wir alles uns zu Gebote stehende aufwenden werden, dieses zu vermeiden. Viele, die in Gesprächen in dieser Sache mit dem Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, Herrn Franke, sich austauschen konnten, haben den Eindruck gewonnen, dass ihm das Anliegen, das der Begriff Integration umschließt, klar geworden ist und er auch einen Schulversuch in und mit dieser Klarheit durchzuführen für notwendig und sinnvoll hält. Dass dies in gleicher Weise von der Behörde, der Herr Senator Franke vorsteht, gesagt werden könnte, lässt uns alle in gleicher Weise zutiefst zweifeln.
Ein bedeutendes Ereignis in dieser Frage insgesamt war sicher das am 05.12.1983 gemeinsam durch die Landesfachgruppe Sonderschule und Grundschule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und des Landesverbandes Bremen des Fachverbandes für Behindertenpädagogik, der Verband Deutscher Sonderschulen, durchgeführte Podiumsgespräch mit dem Thema: Die Grundschule – die Schule für alle Schüler!? An diesem Tag war am Vormittag die endgültige Entscheidung für einen Schulversuch in Bremen-Huchting, der die von uns begonnene Integration im Kindertagesheim nahtlos in die Grundschule hinein fortsetzen soll, gefallen. Im Rahmen dieser Podiumsdiskussion wurde sehr deutlich gemacht, dass, was mit Integration umschrieben wird, eindeutig bedeutet, dass dann die Grundschule eine Schule für alle ist. Im Rahmen der Realisierung eines solchen Vorhabens wird für die Schüler beginnen, was damals für uns 1981 in Bezug auf das Kindertagesheim begann. In wenigen Stichworten skizziert wird dies für eine Grundschule als Schule für alle Schüler bedeuten, endgültig darauf zu verzichten,
- 193 -
-
die Störungsfreiheit des Schulbetriebes als höchsten anzustrebenden Wert zu erachten, der einseitig durch das Mittel des Ausschlusses zu Lasten bestimmter Schüler zu erreichen versucht wird, und
-
nicht länger so zu tun, als könne man dem Erziehungs- und Bildungsbedarf beeinträchtigter bzw. behinderter Kinder nur in Sonderschulen gerecht werden.
Integration in der Grundschule bedeutet, nicht nur bereits im Vorfeld der Schule in Sondereinrichtungen ausgegliederte behinderte Kinder in die Grundschule aufzunehmen, sondern dort selbst den Ausschluss von Kindern zu verhindern, die Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zeigen und bisher überwiegend als „Lernbehinderte“ diagnostiziert und klassifiziert in die Sonderschulen ausgegliedert wurden.
Wir werden lernen müssen, auch Schule realistischer als bisher in und aus der Funktion heraus, die sie für die Gesellschaft hat, die sie trägt, zu verstehen und ihren im Sinne eines vertikal und hierarchisch gegliederten Systems auf allen Ebenen ausschließenden Charakter zu erkennen, der von der (Sonder-)Schule für Geistigbehinderte, die heute noch immer versucht, schwerstbehinderte Kinder in der familiären Obhut oder in der Anstaltsverwahrung zu belassen bzw. nach dort auszusondern, bis hin zur Universität reicht, die ihren Zugang durch den Numerus Clausus reguliert, um hinreichend für die Schaffung pädagogischer Qualitäten eintreten zu können, die den Mechanismus der Aussonderung zu überwinden vermögen. Die Grundschule und die Förder- bzw. Orientierungsstufe sind das Zentrum dieses hierarchisch-selegierenden Systems. Sie stehen in besonderer Weise in der Gefahr, zur Drehscheibe des schulischen Auf- bzw. Abstieges zu werden und damit nicht nur Bildungsmöglichkeiten, sondern auch Lebenswege von Kindern und Jugendlichen entscheidend und oft nicht mehr revidierbar zu beeinflussen.
Die Prinzipien der Integration, wie sie im Bericht beschrieben wurde, (Prinzip der Regionalisierung, Dezentralisierung, [des Kompetenztransfer; GF] und des Team-Teaching) haben, wie angedeutet, auch für die Arbeit in der Grundschule grundlegende Bedeutung. Ebenso die Entwicklung individuelle [individualisierter; GF] Curricula[86] für jedes Kind, was, wie der Bericht zeigt, eben nicht so verstanden werden kann, wie dies im Planungspapier des Schulversuches durch die Behörde wider einen weiterreichenden Diskussionsstand schriftlich festgehalten worden ist.
Integrative Arbeit in der Grundschule wird auch bedeuten, vom Frontalunterricht endgültig abzurücken und ein Verständnis zu entwickeln, das im Klassenzimmer ein Handlungsfeld für die Kinder sieht, das ausgehend von einem Morgenkreis und entsprechend zu treffenden Absprachen in verschiedenen Zonen verschiedene Lernangebote macht und das, wann immer es erforderlich ist, auf den Bereich ausserhalb der Schule erweitert wird. Die Arbeit in Form von Projekten und Vorhaben ist auch hier die adäquate Organisationsform der Themen und Inhalte des Unterrichts.
Integrative Arbeit in der Grundschule wird auf der organisatorischen Ebene die Revision der Leistungsbeurteilung der Schüler und der Sanktionierung einzelner Schüler durch das Sitzenbleiben unabdingbar notwendig machen. Für den Schulversuch ist vorgesehen, in den Jahrgangsstufen 1 und 2 die bestehende Regelung für die Zeugniserteilung in den Grundschulen anzuwenden. Danach erfolgt zum Ende der Schulhalbjahre die mündliche Information und zum Ende des 1. Schuljahres die schriftliche Information der Erziehungsberechtigten über die Lernentwicklung ihres Kindes. In der Jahrgangsstufe 2 wird zum Ende des Schuljahres ein Zeugnis erteilt, indem die Lernentwicklung des Schülers in einem ausführlichen Bericht dargestellt wird und in dem neben anderen Angaben die Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik im Notenwortlaut beurteilt werden soll. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird das Zeugnis zum Ende des Schulhalbjahres und des Schuljahres ebenfalls in der Form eines ausführlichen Berichtes erteilt werden, in dem die Lernentwicklung dargestellt wird und die Leistungen in den unterrichteten Fächern, bezogen auf die entsprechenden Lernziele, im Notenwortlaut beurteilt werden.
- 194 -
Dies verdeutlicht, wie schwer es der Schulverwaltung fällt, selbst in einem Schulversuch von der Beurteilung der Leistungen im Notenwortlaut abzurücken, als würde die Schule damit Zepter und Krone aus der Hand geben, die Symbole ihrer Allmacht, mit der sie nahezu unangefochten die Selektion nach oben und unten betrieben hat, obwohl heute hinreichend viele und abgesicherte Untersuchungen auf den Unwert der Noten verweisen.
Was ein Kind gelernt hat und auf welchem Entwicklungs- und Lernniveau es sich jeweils befindet, wird immer nur im Sinne eines intraindividuellen Vergleiches von Ausgangs- und Ist-Situation im Spiegel der nächsten Zone der Entwicklung eines Kindes objektiviert werden können und nicht im „Zerr“-Spiegel weitgehend willkürlicher oder am Klassendurchschnitt (des mathematischen Alibis wegen) orientierter Ziffernnoten. Dass eine Schule für alle Schüler schließlich das Instrument des Sitzenbleibens als strafende Antwort auf das in das Kind und dessen scheinbares Versagen hineinprojizierte Unvermögen der Schule endgültig zu überwinden hätte, bedarf zum Stand dieser Ausführungen keiner weitern Begründung.
Der Fortbildung der im integrativen Unterricht zusammenwirkenden Pädagogen und Therapeuten wird die gleiche Bedeutung zugemessen werden müssen, wie dies im Hinblick auf die Mitarbeiter im integrativen Kindergarten erfolgt ist. Wo aber in der Grundschule die bereits im Kindergarten angebahnte gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder fortgesetzt wird, steht diese Arbeit längst nicht mehr auf tönernen Füssen. Die Kinder haben in der bedeutenden Entwicklungsepoche vom 3.-6. Lebensjahr, die, wie wir herausgestellt haben, durch die Aneignung der gesellschaftlichen Bedeutung und deren Überführung in den persönlichen Sinn durch Prozesse kollektiven Spielens und Lernens gekennzeichnet ist, im Rahmen der sich weiterentwickelnden Sprache im Übergang vom assoziativ und affektiv-komplexen Denken zum operativen Denken im Aufbau ihres Ich- und Selbstbewusstseins Entwicklungsfortschritte erzielt, die für die nichtbehinderten Kinder die behinderten und für die behinderten die nichtbehinderten selbstverständlich einschließen; sie haben sich gegenseitig in der Einheit der Person als notwendiges Mitglied der Gruppe und nicht defizitär, abweichend oder als behindert, sondern als jemanden wie Du und Ich erfahren und sich verankert.
Die Schule ist grundsätzlich aufgefordert, sich auf diese Erfahrungen einzulassen, zu akzeptieren, dass es für diese Kinder selbstverständlich und „normal“ ist, was uns nichtbehinderten Erwachsenen und Pädagogen, die wir unser Ich- und Selbstbewusstsein ohne soziale Gemeinschaft mit Behinderten entwickeln mussten, bedrohlich und fremd erscheint. Wir dürfen unsere eigene psychische Verkrüppelung nicht zum Vorwand nehmen, gewachsene Gemeinschaften wieder zu zerstören, indem wir mit der Institution Schule den Ausschluss wieder herstellen und auch weiterhin praktizieren.
Eine umfassende Darstellung und Analyse unserer Bemühungen um die Fortsetzung der integrativen Erziehung in die Grundschule hinein würde viele Seiten der Integration und ihrer Realisierung erhellen. Im Rahmen dieses Zwischenberichtes und auf dem Hintergrund, dass wir die Bemühungen zu dieser Frage noch nicht als abgeschlossen ansehen können, sollen diese allgemeinen Hinweise genügen, das Problem zu skizzieren. Die von den Eltern zum Schuljahresbeginn 1984/85 zur Einschulung in die Grundschule angemeldeten behinderten Kinder werden alle aufgenommen werden.
Es bleibt zu hoffen, dass auch bei Fortführung des Schulversuches kein Ausschluss eines behinderten Kindes erfolgen wird. Mit nur einer Ausnahme haben auch alle Eltern der nichtbehinderten Kinder dem gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in den beiden Grundschulen, in die die Kinder des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde und der Gemeinde St. Georg eingeschult werden, zugestimmt. Bleibt zu hoffen, dass unsere Stellungnahme vom 25.01.1984 zu dem entsprechenden Aktenvermerk über den Schulversuch des Senators für Bildung in ihrer inhaltlichen Tragweite nicht nur zur Kenntnis genom-
- 195 -
men, sondern als Grundlage in die Konzeption des Schulversuches aufgenommen und eingearbeitet wird. Als unverzichtbare Grundlage einer integrativen Arbeit in der Grundschule wäre zu fordern:
-
Die Aufnahme aller im Einzugsbereich der Grundschule wohnenden behinderten Kinder,
-
kein Ausschluss der von Behinderung bedrohten, oder in ihrem Lernen und Verhalten während der Grundschulzeit auffällig werdenden Kinder,
-
kein Sitzenbleiben,
-
gleichberechtigtes Team- [Co-; GF]Teaching von Grund- und Sonderschullehrer,
-
Einbezug und Realisierung der erforderlichen therapeutischen Hilfen aller Art in den pädagogischen Prozess und Alltag,
-
Die Entwicklung individueller Curricula, die kooperative Lern- und Arbeitsprozesse im Schulalltag derart ermöglichen, dass jeder Schüler auf der Basis seiner Handlungskompetenz an kooperativen Lernprozessen am Gemeinsamen Gegenstand teilnehmen kann,
-
die Organisation des Unterrichts in lebensnahen und für die Schüler sinnerfüllten Projekten und
-
die Gewährung entsprechender Beratungs-, Supervisions- und Fortbildungsmöglichkeiten für die am integrierten Unterricht beteiligten Lehrer, Therapeuten und Eltern.
Die Realisierung dieser Grundlagen würde ein pädagogisches Umfeld und eine unterrichtliche Praxis garantieren, in der jeder Schüler im Rahmen der integrativen Erziehung weitreichende Möglichkeiten erhält, seine Persönlichkeit auszubilden. Dass nichtbehinderte Schüler die Behinderten und behinderte Schüler die Nichtbehinderten in eben dieser Ganzheit ihrer kognitiven, emotiven und sozialen Entwicklung sich wechselseitig behindern könnten, ist gerade in Bezug auf die Schule ein zwar häufig vorgetragenes, abwehrendes und abwertendes Argument, das aber jeder berechtigten Grundlage entbehrt, wenn Integration beginnend mit dem Kindergartenalter so realisiert wird, wie wir es im Kindertagesheim der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting versuchen. Im Rahmen des Ausbaues tragfähiger sozialer Beziehungen und einer Ich-Entwicklung der Kinder, die den jeweils anderen selbstverständlich einschließt, haben alle bessere Bedingungen, nicht nur sozial kompetenter, menschlichen Belangen gegenüber sensibler und in Alltagssituationen handlungsfähiger zu sein, sondern auch ihre kognitiven Fähigkeiten umfassender zu entwickeln, als dieses auf dieser Stufe unseres selegierenden Schulsystems einem Schüler möglich sein kann, denn die durch Auswahl ausgemergelten und auf bestimmte Leistungsanforderungen hin zugespitzten Schulformen und -stufen entbehren alle jener Lernanlässe, die unverzichtbare Grundlagen für eine Persönlichkeitsentwicklung bieten, wie sie im Rahmen integrativer Erziehung erreicht werden kann. Noch so ausgefeilte Curricula und noch so spezifische Fachdidaktiken, auch wenn es das erklärte Ziel aller Schulformen in ihren Präambeln ist, erreichen weder die individuelle Handlungskompetenz noch die menschliche Sensibilität, soziale Beziehungsfähigkeit und kognitive Strukturiertheit, wie dies bei einer entsprechenden pädagogischen Konzeption im Rahmen der Realisierung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in allen Stufen der Schule würde erreichet werden können.
- 196 -
[82] Es handelt sich hier um die Planung und das Curriculum der „Zusatzausbildung Integration“. Siehe Feuser 2018 [im Druck]; dort das Kapitel 2.2
[83] Die Buchseite 184 musste inhaltsgleich in der nachfolgenden Form rekonstruiert werden.
[84] ZNS steht für das „zentrale Nervensystem“ – Gehirn und Rückenmark
[85] Mit Team-Teaching bezeichne ich die Zusammenarbeit aller Lehr-und Fachkräfte und Assistenzen, also ein multiprofessionelles Team. Hier wäre der Begriff des Co-Teaching im Sinne der Zusammenarbeit von Sonder- und RegelschullehrerInnen die richtige Bezeichnung.
[86] Zum Verständnis: Seitens der Schulbehörde wurden je nach Behinderungskategorie der SchülerInnen individuelle Curricula vorgesehen. Wir plädierten von Anfang an für die Individualisierung des Curriculums der Grundschule, was dann doch noch realisiert werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
Die wissenschaftliche Begleitung – dies macht dieser Bericht hinreichend deutlich –, ist keine Angelegenheit, die das Vorhaben integrativer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde sozusagen aus einer abgehobenen und abgeklärten Distanz heraus betrachtet, sondern ein integrativer Bestandteil derselben. Es waren zwei Grundgedanken, die uns von Anfang an bewogen haben, dem Vorhaben nicht nur eine wissenschaftliche Begleitung bei- oder zuzuordnen, weil dies einen entsprechend guten Eindruck nach Außen machen würde, sondern um einerseits die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, deren Beratung und Supervision zu garantieren und andererseits die Erziehungsarbeit in bestimmten Punkten vor Aufnahme der integrativen Arbeit, nach Aufnahme der integrativen Arbeit und im Rahmen deren Ausweitung auf alle Gruppen des KTHs zu dokumentieren.
Zum ersten Anliegen der erziehungswissenschaftlichen (und damit der regelpädagogischen wie behindertenpädagogischen) Begleitung liegt dieser Zwischenbericht selbst vor; er ist ein Teil der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung zu erfüllenden Aufgaben.
Zum zweiten Anliegen der Dokumentation der Erziehungsarbeit im Sinne der Feststellung der Ausgangssituation, wie in Bezug darauf, zur Dokumentation der sich aus dem Anliegen integrativer Erziehung ergebenden Veränderungen im pädagogischen Bereich wurden zwei Wege eingeschlagen:
Es erfolgen in bestimmten Zeitabständen und in verschiedenen Gruppen Videodokumentationen in fünf für den Kindergartenalltag typischen Situationen (Frühstück, Freispiel, gezielte Aktivitäten, auf dem Hof, Mittagessen; inzwischen erweitert um den Morgenkreis), die nach einer entsprechenden Auswertung im Sinne einer Langzeitdokumentation die Veränderungen in der Erziehungsarbeit einerseits wie die Entwicklungen der Kinder andererseits festhalten sollen. Darüber hinaus dienen aufgezeichnete Videosequenzen dazu, diese mit den Mitarbeitern entweder in allgemeinen Dienstbesprechungen oder aber in Besprechungen mit den Mitarbeitern einer Gruppe zu analysieren und Anhang der Aufzeichnungen im Sinne der Supervision die Handlungskompetenz der Mitarbeiter im pädagogischen und therapeutischen Bereich weiter zu verfeinern.
Die zuletzt genannte Funktion der audio-visuellen Dokumentation hat inzwischen im KTH einen eigenständigen Stellenwert erhalten. Nachdem die Mitarbeiter diesem Medium zuerst etwa scheu gegenüberstanden, ist es heute aus der Arbeit im Kindergarten nicht mehr wegzudenken. Eine Videoanlage, die dem KTH inzwischen selbst zur Verfügung steht, wird von den Mitarbeitern und insbesondere auch im Rahmen der Aufgaben des Stützpädagogen selbstverständlich als Werkzeug pädagogischer Analyse, aber auch als eine Möglichkeit genutzt, die im Gruppengeschehen einmaligen und als solche nicht wiederkehrenden Situationen zwischen den Kindern bzw. zwischen den Mitarbeitern und den Kindern aufzuzeichnen, und - entlastet von der Aufgabe der Gruppenleitung und –arbeit - im Nachhinein sich diesen Ablauf noch einmal zu vergegenwärtigen. Entsprechend arbeiten die Mitarbeiter einer Gruppe unter sich, zusammen mit den Therapeuten oder gemeinsam mit dem Stützpädagogen mit diesem Medium völlig selbständig und haben dessen Wert für die Verfeinerung der eigenen Handlungskompetenz zu schätzen gelernt.
Aus der Video-Dokumentation heraus erarbeiten wir derzeit auch einen Videofilm, der einen Einblick in die integrative Arbeit im KTH geben soll. Mit diesem Film wird versucht, entsprechend den Möglichkeiten des Mediums die allgemeinen Grundlagen und Prinzipien unseres Verständnisses der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder sowie der entsprechenden pädagogischen und therapeutischen Konsequenzen aus dem Alltag heraus darzustellen, um so den immer mehr wachsenden Ansprüchen an uns bezüglich der Möglichkeit zur
- 197 -
Hospitation durch einen Film wenigstens einigermaßen gerecht werden zu können, da es dem KTH, d.h. den Kindern und Mitarbeitern gegenüber nicht mehr vertretbar ist, die Belastung durch Hospitationen noch weiter zu steigern. Ob dieser Videofilm später ausleihbar sein wird, kann derzeit noch nicht festgelegt werden.
Aus dem Gesamtrahmen der mit der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens in Zusammenhang stehenden Dokumentationen möchte ich deshalb nachfolgend nur auf den zweiten Weg, nämlich auf die Beobachtungs- und Protokollierungsverfahren eingehen, die wir entwickelt haben, um im Sinne von Langzeitbeobachtungen die Veränderungen im Erziehungsbereich einerseits und im Interaktionsbereich der Kinder untereinander andererseits aufzuzeigen.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurde auch eine Pilotstudie in Bremen über die „Einstellung zur gesellschaftlichen Integration behinderter Kinder und Erwachsener“
durchgeführt, auf die anschließend noch kurz verwiesen werden kann.
Rahmen dieses Berichtes muss darauf verzichtet werden, im Einzelnen darzulegen, welche Beobachtungsstrategien wir uns erarbeitet haben, um die nachfolgend zu erklärenden Zusammenhänge zu erfassen. Unsere Vorgehensweise wurde über Jahre hinweg in verschiedenen Arbeitszusammenhängen erarbeitet und in der Praxis erprobt, so dass wir auf ein Instrumentarium zurückgreifen konnten, das der aufgeworfenen Fragestellung doch recht weitgehend gerecht werden konnte. Hinsichtlich der allgemeinen Grundlagen und unserer auf der Verhaltensanalyse basierenden Beobachtungsverfahren verweise ich u.a. z.B. auf Adameit, Fassnacht, Mees und Schulte (55), die in der Lage sind, einen praxisrelevanten Überblick über die Möglichkeiten unsystematischer und systematischer Verhaltensbeobachtung und die Verhaltensanalyse zu geben.
Unter Berücksichtigung der entsprechend im Rahmen der Verhaltensbeobachtung auftretenden Beobachtungsfehler versuchen wir eine Faktenbeschreibung zu erreichen, die wir im Sinne bestimmter Notationsverfahren so gewinnen, dass wir über den Zeitfluss der Interaktions- und Erziehungsprozesse sowohl ein Zeitraster wie ein Kriterienraster legen, nach dem mindestens immer zwei Beobachter in denselben Situationen entsprechend den Kategorien ihre Aufzeichnungen vornehmen, so dass im Vergleich der Beobachtungen wiederum durch Berechnung des Übereinstimmungsquotienten der beiden Beobachter ein höheres Zuverlässigkeitskriterium erreicht wird. Ist die Übereinstimmung der beiden Beobachter geringer als 80 [Prozent; GF] werden die erhobenen Beobachtungen als zu wenig zuverlässig nicht gewertet.
-
Methoden der Verhaltensbeobachtung
Im Rahmen der sich uns für die Verhaltensbeobachtung stellenden Erfordernisse wählen wir folgende Methoden:
-
Die nicht-teilnehmende Beobachtung:
Der Beobachter ist in diesem Falle im Gruppenraum anwesend, ist aber nicht Interaktionspartner im Gruppengeschehen. Dadurch wird der Geschehensablauf durch den Beobachter selbst nicht direkt beeinflusst. Obwohl allgemein angenommen werden kann, dass die Anwesenheit des Beobachters im Gruppenraum als „milder aversiver Reiz“ erlebt wird, haben sich die Kinder sehr schnell an diese Situation gewöhnt, so dass die Beobachtungssituationen inzwischen dazugehören. Den Kindern wurde auch erklärt, welche Aufgabe die Studierenden, die die Beobachtungen durchführen, wahrnehmen.
-
Die Feldbeobachtung:
Feldbeobachtung meint, dass wir das Verhalten dort beobachten, wo es und wie es auch sonst, ohne dass eine Beobachtung durchgeführt wird, ablaufen würde;
- 198 -
also in der natürlichen Umgebung im Rahmen des KTH.
-
Die offene Beobachtung:
Die offene Beobachtung macht erforderlich, dass die zu Beobachtenden darüber informiert sind, dass sie beobachtet werden sollen; d.h. die Beobachter sind in der Situation mit anwesend und die Funktion der Aufzeichnungsgeräte (z.B. ein Tonbandgerät mit einem 10-Sekunden-Zeitimpuls) sind bekannt.
-
Verfahren bei der Verhaltensbeobachtung
Bezüglich der unterschiedlichen Verfahren der Verhaltensbeobachtung bedienen wir uns im Rahmen unseres Anliegens der „diskontinuierlichen Beobachtung“. Dieses Verfahren erfasst Verhaltensweisen stichprobenartig, d.h. es wird nicht über einen zusammenhängenden Zeitraum hinweg, sondern nur von Zeit zu Zeit beobachtet. Dazu wählen wir eine Beobachtungsdauer von 15 Minuten in fünf unterschiedlichen Situationen, die bereits benannt worden sind. Über diese 15 Minuten legen wir wiederum ein Zeitraster von 10-Sekunden-Intervallen, so dass wir im Sinne der „Zeit-Teil-Methode“ (= time sampling) verfahren; d, h., tritt eine zu notierende Kategorie in einem Intervall von 10 Sekunden mehrmals auf, wird sie dennoch nur einmal registriert (so als wäre die Kategorie durchgehend aufgetreten); tritt sie in einem Intervall nicht auf, erfolgt keine Notation,
-
Die Gewinnung der Kategorien
Die Kategorien, nach denen wir beobachten, wurden im Sinne einer unseren Beobachtungen vorgeschalteten „unsystematischen Verhaltensbeobachtung“ gewonnen. Die unsystematische Verhaltensbeobachtung dient einer ersten Orientierung und ermöglicht im Sinne der Anwendung der verschiedenen Kriterien und Vorgehensweisen dieses Verfahrens, in mehreren Schritten zu einer deskriptiven Erfassung der Situationen, in denen beobachtet wird, zu kommen und entsprechend den vorgenommenen Notationen besonders häufig beobachtete Phänomene in stichhaltigen Kategorien zusammenzufassen, so dass diese Kategorien dann als Kategorienraster für die „systematische Beobachtung“ dienen können.
In einem ersten Schritt bedienten wir uns einer „isomorphen Deskription“, in einem zweiten Schritt legten wir bereits ein grobes Zeitraster über die unsystematischen Beobachtungssequenzen unter Beibehaltung der isomorphen Deskription, und in einem dritten Schritt kamen wir zur Entwicklung der „Sequenzanalyse“, wie sie dann auch in den systematischen Beobachtungen durchgeführt und nachfolgend beschrieben werden wird.
Diese Verfahrensweise erlaubte eine Art Standardisierung unseres Beobachtungsinstrumentariums an und in der Praxis, die später wiederum mit diesem Instrumentarium beobachtungsmäßig erfasst werden soll.
Die entsprechend gewonnenen Kategoriensysteme erleichtern die Beobachtung und ein relativ einfache Zeichensystem ermöglicht im Sinne des über den zu beobachtenden Verhaltensfluss gelegten Zeitrasters in einem 10-Sekunden-Intervall das Auftreten einer Kategorie durch ein einfaches Abhaken zu notieren; bzw. das Nichtauftreten durch das Freilassen des entsprechenden Intervalles anzuzeigen.
Entsprechend der systematischen Verhaltensbeobachtung führen wir insbesondere die „Kontingenzanalyse“ durch.
Die sequentierte Situationsanalyse haben wir uns dadurch erarbeitet, dass wir im zweiten Schritt der unsystematischen Beobachtung die isomorphe Deskription (dritter Schritt) überführt haben, in dem Sinne, dass bestimmte interessante Parameter gebildet wurden, die wiederum auf die Bildung von Verhaltensklassen abzielen.
Entsprechend nahmen wir die Beschreibung nach folgenden drei lerntheoretisch relevanten Gesetzmässigkeiten (siehe 3.2.2 dieses Berichtes) vor:
-
die Situation
-
das Verhalten und
-
die Konsequenz.
- 199 -
Entsprechend den lernrelevanten Zusammenhängen, dass in einer bestimmten Situation die Darstellung eines bestimmten Verhaltens zu einer Konsequenz aus der Umwelt führt, können wir uns den Zusammenhang wie folgt verdeutlichen:
|
Situation |
Verhalten |
Konsequenz |
|---|---|---|
|
Die Kinder machen eine Bastelarbeit. |
Otto schlägt sich mit der Hand an den Kopf und wimmert leise. |
Die Kinder unterbrechen ihre Bastelarbeit; Edith streichelt Otto übers Haar. |
|
Die Sequentierung kann nun in folgender Weise erfolgen: A-B-C: |
||
|
Die Kinder arbeiten (A) |
Otto schlägt sich (B) |
Die Kinder unterbrechen ihre Arbeit, und Edith streichelt Otto (C) |
|
Entsprechend ist nun auch die Veränderung der Sequenz möglich. B-C-A: |
||
|
Otto schlägt sich und weint (B) |
Edith streichelt ihn (C) |
Otto springt auf schlägt sich schneller, schreit, wirft sich auf den Boden (A) |
|
oder C-A-B: |
||
|
Edith streichelt Otto, der sich geschlagen hatte (C) |
Otto springt auf, schlägt sich schneller, schreit, wirft sich auf den Boden (A) |
Die Erzieherin geht zu Otto, nimmt ihn auf, drückt ihn an sich, bis Otto sich beruhigt hat (B) |
Das Beispiel verdeutlicht, wie eine fortlaufende Sequenz in diesem Situations-, Verhaltens- und Konsequenzraster und im Sinne des Abflusses der Verhaltensweise von A nach B nach C erfasst werden kann.
Diese Verfahrensweise dient uns zur Erhebung sequentierter Situationsanalysen, in die wir im Unterschied zum vorgenannten Beispiel nicht nur Kind-Kind-, sondern wesentlich auch Erzieher-Kind-Interaktionen einbeziehen und analysieren.
Eine weitere Darstellung der Grundlagen unserer Beobachtungen erlaubt dieser Zwischenbericht nicht; sie können jedoch hinreichend sein, die nachfolgend kurz zu skizzierenden Beobachtungen entsprechend zur Kenntnis nehmen zu können.
Im Sinne der sequentierten Situationsanalyse geht es darum, eine Verhaltensanalyse in der Interaktion von Erziehern und Kindern in folgender Sequentierung der Kategorien, die zu beobachten sind, vorzunehmen.
Beobachtungskategorien und Sequenzen:
|
Kategorie: |
Situation: |
Verhalten: |
Konsequenz: |
|---|---|---|---|
|
(a) |
Initiativen des Erziehers zum Kind |
Verhalten der Kinder |
Konsequenz des Erziehers |
|
(b) |
Initiativen vom Kind zum Erzieher |
Erzieherverhalten |
Konsequenzen durch das Kind |
|
(c) |
Kinder agieren untereinander |
Erzieherverhalten |
Konsequenzen durch die Kinder |
- 200 -
Beobachtungsorte und -zeiten während des Kindergartenalltages:
-
Frühstück
-
Freispiel
-
gezielte Aktivitäten
-
auf dem Hof
-
Mittagessen
Jede der 5 Situationen soll für einen Auswertungsdurchgang 3-mal jeweils 15 Minuten erfasst werden.
Notation:
Die einzelnen Verhaltenssequenzen werden jeweils fortlaufend durchnummeriert sowie durch die zutreffende Kategorie gekennzeichnet (z.B. ein Kind spricht beim Freispiel einen Erzieher an: 2b).
Es wird von einem hierarchischen Aufbau der Kategorien ausgegangen, so dass A vor B und B vor C beobachtet wird – jeweils nach Abschluss einer Sequenz. Die Protokollierung erfolgt auf entsprechenden Vordrucken.
Mit der sequentierten Situationsanalyse haben wir eindeutig eine Priorität auf die Erfassung der Initiativen gesetzt, die von Seiten des Erziehers zum Kind gehen. An zweiter Stelle werden die Initiativen erfasst, die vom Kind aus auf den Erzieher gerichtet sind. Da entsprechend dieser Hierarchisierung das Agieren der Kinder untereinander und deren Beziehungsgeflecht wie auch die Qualität der Art und Weise ihrer Beziehungen so kaum hinreichend erfasst werden kann, wurde ein entsprechendes Beobachtungsinstrumentarium, dass die Kind-Kind-Interaktionen zu erfassen vermag zusätzlich entwickelt und eingesetzt.
In einem engen Zusammenhang mit den sequentierten Situationsanalysen sind die Kontingenzanalysen zu sehen, durch die erfasst werden soll, welche Kontingenzen ein Erzieher in der Interaktion mit den Kindern im Sinne der Hilfen, die er gewährt, und der Konsequenzen, die er auf Handlungsweisen der Kinder folgen lässt, erfasst werden. Die entsprechenden Kontingenzen haben wir in folgende Kategorien gefasst, die, wie schon vorausgehend betont, aus der unsystematischen Beobachtung der Erziehungspraxis heraus gewonnen worden sind. Diese sind:
-
(1) Lob, Zuwendung, Streicheln
-
(2) Tadeln, Schimpfen, Anschreien, Abwenden, aus dem Gruppenraum verweisen
-
(3) Neutrale Konsequenzen (- Nichtbeachtung einer Situation durch den Gruppenleiter
-
(4) Hilfestellungen geben, Auskünfte erteilen
Es wird, wie in der sequentierten Situationsanalyse im Sinne des time-sampling in jeder Situation 3-mal je 15 Minuten beobachtet und entsprechend den Kategorien notiert.
Auf der Basis dieser Beobachtungen interessieren uns folgende Fragen:
-
Wie verteilen sich die beobachteten Sequenzen unter Berücksichtigung des hierarchischen Aufbaues A vor B und B vor C?
-
Wie viele Initiativen zum Kind führen die Erzieher zu Ende bzw. nicht zu Ende?
-
Wie beenden die Erzieher ihre Initiativen zum Kind? (bekräftigend, tadelnd, neutral)
-
Welche Gründe führten zum Abbruch von Erzieher-Initiativen zum Kind? (Ein anderes Kind spricht den Erzieher an, Kind-Kind-Aktionen lenken die Aufmerksamkeit des Erziehers auf sich, der Erzieher führt andere Tätigkeiten aus, der Erzieher wendet sich anderen Erwachsenen zu.)
-
Wie beginnen die Erzieher-initiativen zum Kind? (Auffordernd, abwehrend/tadelnd, bekräftigend)
- 201 -
-
Wie reagieren die Erzieher auf die Initiativen vom Kind zum Erzieher? (bekräftigend, tadelnd, neutral)
-
Wie reagieren die Erzieher auf das Verhalten der Kinder untereinander? (bekräftigend, tadelnd, neutral)
-
Welche Kontingenzen wenden die Erzieher in der Interaktion mit Kindern an? (Lob, Zuwendung, Streicheln / Tadeln, Schimpfen u.a. / neutrale Konsequenzen – Nichtbeachtung / Hilfestellungen)
Die kombinierte Auswertung der beobachteten Kontingenzen in Relation zu den beobachteten Situationen, die für den Kindergartenalltag typisch sind, ermöglichen nun die unterschiedlichsten Schlussfolgerungen, insbesondere dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, die Situation in den integrativen Gruppen mit entsprechenden Situationen vor Beginn der integrativen Erziehung zu vergleichen; es gibt die Möglichkeit des einzelnen Vergleiches einer Gruppe und eines Mitarbeiterteams, sowie Unterschiede zwischen verschiedenen Situationen festzustellen wie auch Vergleiche zwischen den beobachteten Gruppen vorzunehmen.
Als die Beobachtungsergebnisse der Erhebungen vor Beginn der integrativen Arbeit und die Beobachtungsergebnisse, die in der ersten Integrationsgruppe durchgeführt wurden, vorlagen, waren auch diese Zusammenhänge Gegenstand gemeinsamer Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und dabei recht betroffener Diskussionen unter allen Beteiligten.
Ich hatte schon bei der Darstellung des Statuts des KTHs (siehe Punkt 2.2.1) darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen Anspruch an die Erziehungsqualität und dem Grad ihrer Einlösung unter den gegebenen Bedingungen eine Diskrepanz festzustellen war, die wesentlich dadurch zustande kam, dass den Mitarbeitern in Bezug auf die Realisierung ihrer Zielsetzung keine adäquaten didaktischen und methodischen Möglichkeiten zur Verfügung standen. Da im Rahmen der Aufnahme der integrativen Erziehung die Frage nicht nur auf das gemeinsame Ziel, sondern auch auf den Weg gerichtet wurde, wie dieses Ziel zu erreichen sei, und dass entsprechende Entwicklungen bei den Kindern sich nicht alleine aus der guten Absicht der Mitarbeiter heraus ergeben, konnten die erhobenen Beobachtungen bei der Diskussion um diese Frage doch recht nüchtern auf verschiedene Zusammenhänge aufmerksam machen, die wesentlich dazu beigetragen haben, sich der Frage der Didaktik und Methodik nicht nur engagierter, sondern auch offener und weniger emotional zu stellen. Darin haben die Mitarbeiter des KTHs auch sehr viel Mut bewiesen und sich nach und nach (auch heftige Reaktionen eingeschlossen) mit der entsprechenden Sachlichkeit an die Neuorganisation ihrer Arbeit gemacht. Sie haben damit in der Praxis erwiesen, was viele Kritiker unserer Arbeit (insbesondere solche, die aus anderen Kindertagesheimen kommen) uns zu belegen noch schuldig sind. Im Gegenteil, es wurde uns nicht einmal erlaubt, auf unseren Wunsch hin in Einrichtungen zu hospitieren, deren Mitarbeiter ihrerseits selbst über die Dauer einer Woche die Möglichkeit zur Hospitation im KTH der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde hatten und ihrerseits heftige Kritik an unserer Arbeit übten, die allerdings als wenig sachlich fundiert zurückgewiesen werden muss.
Auf dem Hintergrund der zu erwartenden unsachlichen Reaktionen und zum persönlichen Schutz der Mitarbeiter im KTH bleibt derzeit offen, ob in einem Abschlussbericht das entsprechende Beobachtungsmaterial publiziert werden wird. Als Beispiel mag hier zur Verdeutlichung ein Vergleich genügen.
Die Frage, wie viele Initiativen zum Kind durch die Erzieher zu Ende bzw. nicht zu Ende geführt werden, beantwortet nachfolgende Grafik, die mit der durchgezogenen Linie die Prozentwerte der zu Ende geführten und mit der gestrichelten Linie die Prozentwerte der nicht zu Ende geführten Initiativen zum Kind durch die Erzieher aufzeigt und zwar wurden die beiden in der Mitte liegenden Kurven in einer Gruppe vor Beginn der integrativen Erziehung und die ganz oben und die ganz unten liegenden Kurven in einer integrativ arbeitenden Gruppe erhoben.
- 202 -
Es wird deutlich dass die Initiativen überwiegend zu Ende geführt werden: in der nicht integrativen Gruppe mit 62% durchschnittlich und in der integrativ arbeitenden Gruppe mit durchschnittlich 95%. Die nicht zu Ende geführten Initiativen lagen in der nicht integrativ arbeitenden Gruppe durchschnittlich bei 38% und in der integrativ arbeitenden Gruppe bei durchschnittlich 5%.
Ein Beispiel dazu wäre, dass eine Erzieherin ein Kind im Rahmen des Mittagessens bittet, in der Küche ein Salatschälchen zu holen. Das Kind erledigt die Anforderung und bringt den besagten Teller aus der Küche in den Gruppenraum. Dieses wird aber von der Erzieherin nicht mehr registriert; sie ist mit anderen Dingen beschäftigt, und das Kind bekommt keine Rückmeldung darüber, ob nun seine Handlung richtig oder nicht richtig war oder eine Bedeutung für die Gruppe oder den Erzieher gehabt hat oder nicht. Treten solche erzieherischen Momente häufig auf, werden sie die Kinder demotivieren und schrittweise dazu führen, dass z.B. solche gestellten Aufforderungen nicht mehr eingelöst werden. Dieses wird dann wieder zur Kenntnis genommen werden, und das Kind erntet u.U. Tadel für ein Verhalten, das auf diesem Hintergrund als weitgehend als erzieherisch verursacht anzusehen ist. (Siehe Abb. 15 auf der nächsten Seite [siehe Seite 203)[87]
Dieses Beispiel mag genügen, um den praktischen Zusammenhang der zuvor beschriebenen Beobachtungen und deren Auswertungen zu erläutern.
Es wurde bereits darauf verwiesen, dass den Interaktionen der Kinder untereinander besondere Bedeutung zukommt, zumal sich in den Beziehungs- und Verhaltensweisen letztlich auch ausdrückt, ob die Integration auch insofern tatsächlich gelungen ist, dass die Kinder untereinander in vielfältigem Beziehungen und Handlungszusammenhängen stehen, auch dann, wenn diese nicht direkt angeleitet sind, sondern wesentlich durch die Bedürfnisse und Motive der Kinder bestimmt werden.
Von Beginn der integrativen Erziehung im KTH an wurden im Rahmen freier Beobachtungen, aber auch durch die Befragung der Kinder, Soziogramme erstellt, die einen Aufschluss darüber geben sollten, ob es in den Gruppen besonders dominante, besonders bevorzugte oder besonders gemiedene Kinder gibt oder gar solche, die im Rahmen der Gruppe als Außenseiter in Erscheinung treten.
Dazu wurden Spiele der Kinder beobachtet, wie z.B. ‚Mein rechter, rechter Platz ist leer …’ oder wer wen zum Tanzspiel auffordert oder wer sich mit wem beim Freispiel zusammentut. Diese ersten Erhebungen ergaben, dass derartige Probleme in den Gruppen des KTHs nicht bestanden und mehr oder weniger alle Kinder zu mindestens einem anderen Kind eine positive Beziehung hatten oder eine positive Beziehung auf sich vereinigen konnten. Dies galt in gleicher Weise auch für die vielen türkischen Kinder im KTH, so dass bezüglich der Gruppenstrukturen gute Voraussetzungen für das integrative Vorhaben bestanden.
Um nun in den integrativen Gruppen nicht nur feststellen zu können, dass und wie häufig die Kinder untereinander Beziehungen aufnehmen, sondern auch herauszufinden, welcher Art diese Beziehungen sind, wurde dafür ein Beobachtungssystem entworfen, das uns ermöglicht, insbesondere im Rahmen des Freispiels die Aktivitäten der Kinder und die Qualität ihres Umganges miteinander zu beobachten und festzuhalten. Wichtig für uns ist diesbezüglich vor allem, objektiver festzustellen, ob die sog. behinderten Kinder nicht nur über die Mitarbeiter, sondern durch die Gruppenzugehörigkeit und ein entsprechendes Beziehungsgeflecht zwischen den Alterskameraden integriert sind oder ob sie im Rahmen der Gruppe eine Untergruppe bilden oder gar mehr oder weniger, wenn keine angeleiteten Situationen bestehen, als Außenseiter in Erscheinung treten.
Beobachtet wird entsprechend:
-
wie viele Kontakte von einem Kind zu anderen Kindern ausgehen und
- 203 -
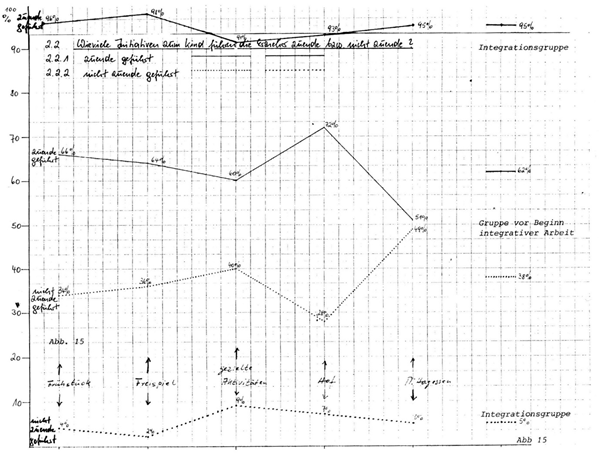
- 204 -
-
wie viele Kontakte von anderen Kindern auf ein Kind gerichtet sind,
Diese Kontaktnahmen werden dann wiederum in solche eingeteilt die partnerschaftlich sind, sich auf Hilfen beziehen, die neutraler Art oder aversiv sind.
Dabei ist die Erfassung der Hilfen als Mittel der Kontaktnahmen wiederum besonders interessant dadurch, dass einige der sog. behinderten Kinder auch für einfache alltägliche Verrichtungen entsprechender Hilfen bedürfen und, wie ich dies im Laufe des Berichtes schon angedeutet habe, die nichtbehinderten Kinder diese oft mit ihrem Hilfsangebot überschüttet oder es den sog. behinderten Kindern „verpasst“ haben.
Im Einzelnen sind die Kategorien wie folgt untergliedert:
-
partnerschaftliche Kontaktnahmen
-
im Sinne einer Unterhaltung (Pu)[88],
-
im Sinne eines Spiel (Ps),
-
im Sinne der Regelfindung auf verbale Weise (PRV) (-hierzu gehört z.B. auch, wenn eine kontroverse Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einem Spiel verbal ausgetragen wird und man zu einer Einigung findet),
-
Regelfindung physisch (Prs) (- hier würde eine entsprechende Auseinandersetzung z.B. durch einander schlagen gelöst).
-
Die Kategorie Hilfe gliedert sich in
-
Hilfe erbeten (Hb) (- ein Kind, das Hilfe braucht, erbittet sich Hilfe),
-
Hilfe erfragt (Hf) (- ein hilfsbedürftiges Kind wird gefragt, ob es Hilfe brauche),
-
Hilfe aufgefordert (Ha) (- der Erzieher fordert ein Kind auf, einem anderen Kind Hilfe zu geben und
-
Hilfe unaufgefordert (Hu) (- ein Kind hilft einem anderen, ohne dazu aufgefordert worden zu sein.)
-
Mit der Kategorie aversiv werden Auseinandersetzungen registriert, die auf der psychischen [physischen; GF] Ebene (As) z.B. durch Schlagen oder auf der verbalen Ebene (Av) z.B. durch Schimpfworte oder Anschreien ausgetragen werden.
-
Mit neutral werden Kontaktnahmen registriert, die durch den Angesprochenen durch keine der genannten Kategorien (partnerschaftlich, Hilfe, aversiv) eine Beantwortung finden.
Durchgeführt wird die Beobachtung, wie schon angedeutet, in möglichst freien Aktivitäten und dadurch, dass während dieses Zeitraums ein bestimmtes Kind im Mittelpunkt der Beobachtung steht und dessen Kontaktaufnahmen mit anderen Kindern wie die Kontakte, die auf dieses Kind gerichtet sind, registriert und entsprechend den genannten Kategorien ausgewertet werden.
Die ersten Beobachtungsdurchgänge dieser Art wurden erst vor kurzem abgeschlossen und werden zur Zeit ausgewertet. Mit diesem Instrumentarium vermögen wir also zu beschreiben, wer mit wem welcher Art Kontakte aufnimmt und wie die angebotenen oder aufgenommenen Kontakte durch den jeweiligen Partner beantwortet werden. In der Tendenz ist festzustellen, dass alle Kinder differenzierte Kontakte untereinander haben, es keine Aussonderung der behinderten Kinder gibt und diese auch keine besondere Rolle im gruppendynamischen Geschehen spielen. Selbst ein Kind, dem man in klassischer Weise der Interpretation der bei ihm vorliegenden Beeinträchtigung seiner Wahrnehmungstätigkeit eine differenzierte Kontaktfähigkeit abspricht,realisiert in 90 Minuten 33 Kontakte, von denen 14 von diesem Kind ausgehen und 19 auf dieses Kind gerichtet sind. Dabei spielen die Unterhaltung und das Spielen eine besondere Rolle; auch verbal und physisch aversive Auseinandersetzungen sind dabei, wie auch eine grössere Anzahl von Kontakten neutral beantwortet wird. Mit 6 von 18 Kindern steht dieses Kind
- 205 -
im Beobachtungszeitraum in Kontakten, d.h. in Bezug auf diese willkürlich aus den Erhebungsunterlagen herausgegriffene Beobachtungssequenz, dass diese Kind alle 3 Minuten einen Kontakt hat und dabei mit einem Drittel der Kinder der Gruppe in Beziehung kommt.[89] Die beigefügte Auswertung verweist auf die ausgeführten Zusammenhänge (siehe Abb. 16; auf Original-Seite 206 ausgeführt).
Dass und wie die Kinder integriert sind, lässt sich sicherlich mit Hilfe solcher Beobachtungsverfahren nicht endgültig erschließen; das ist damit auch nicht beabsichtigt. Die Qualität der Beziehung der Kinder untereinander ist nur aus dem Miteinander aller heraus erfassbar, erlebbar und zu verstehen. Dennoch erscheint es sinnvoll, zur weiteren Absicherung dieses Weges auch Anstrengungen zu unternehmen, in möglichst objektiver Weise, soweit dies mit den zur Verfügung stehenden und entworfenen Instrumentarien möglich ist, nicht nur die Didaktik und Methodik, sondern auch die Quantitäten und soweit als möglich auch die Qualitäten im Beziehungsgeflecht der Kinder untereinander darzulegen.[90]
Alles, was wir erfahren und beobachtungsmäßig auch absichern konnten, widerspricht der immer wieder und auch hier im Bericht schon zitierten Auffassung, dass ein behindertes Kind in der „Regelsituation „ seine Behinderung, sein Anderssein erst recht erfahren und damit ständig seinen Ausschluss und seine Besonderung erleben muss. Dies sind Argumentationen gegen eine integrative Erziehung, die in Worten recht gewaltig und vielleicht für viele Zweifler auch beeindruckend sind, die aber in der Erziehungspraxis überall dort, wo ich persönlich Einblick hatte und habe, nie auch nur ansatzweise in Erscheinung getreten sind.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Planung und Durchführung unseres Vorhabens in Bremen-Huchting stand von Anfang an auch die Frage im Raum, auf welche Einstellungen wir mit unserem Vorhaben treffen werden, zumal wir in dem Bemühen einig waren, Integration im Stadtteil, im unmittelbaren Umfeld der Kinder zu verankern.
Auf dem Hintergrund verschiedener Einstellungsuntersuchungen planten wir, eine eigene Untersuchung durchzuführen, die einerseits einen Vergleich mit früheren Einstellungsuntersuchungen ermöglicht und andererseits aber auch berücksichtigt, dass die Diskussion um die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen in den letzten Jahren mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen ist, wenngleich die Qualität, wie versucht wird, ein solches Bewusstsein zu schaffen, mehr als fragwürdig erscheint.
Die Hypothesen, die in die Untersuchung eingingen, lauteten:
-
Aufgrund der angenommenen Vorurteile sind die Befragten gegen eine Teilhabe behinderter Menschen an den Bereichen Familie/Privat(bereich), Bildung, Freizeit und Arbeit.
-
Die Teilhabechancen sind für geistigbehinderte Menschen schlechter als für körperbehinderte.
-
Die Einstellung der Befragten, die ein behindertes Kind persönlich kennen, sind positiver als die Einstellungen derjenigen, denen ein behindertes Kind nicht bekannt ist.
- 206 –
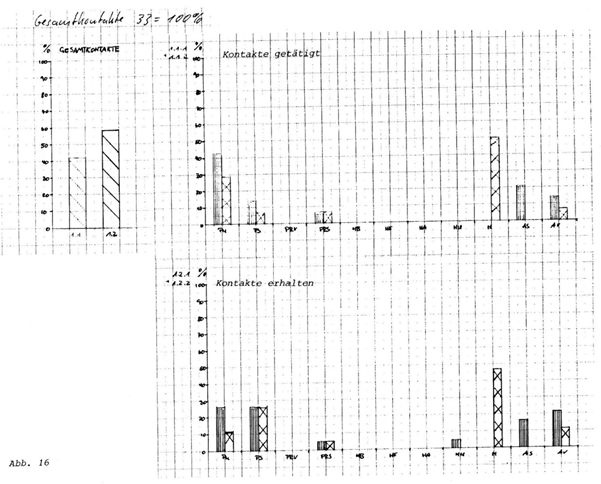
- 207 -
Diese Fragen wurden entsprechend in folgende Komponenten unterteilt:
-
Affektion (positive, negative, ambivalente Gefühle)
-
Kognition (Urteile, Wissen über Behinderte)
-
Konation (integrierende, isolierende Handlungsintentionen, delegierende Hilfe) und
-
Verhalten anderer (Einschätzung des Verhaltens anderer Menschen gegenüber Behinderten) sowie in die Kategorien Privat, Bildung, Freizeit und Arbeit.
Es wurde eine Voruntersuchung durchgeführt, die sich auf 115 Erhebungen (von 150 verteilten Exemplaren) stützte. Durch die Voruntersuchung konnte der Fragebogen für die Hauptuntersuchung revidiert werden; der Fragebogen wurde in zwei Versionen jeweils für geistig- und körperbehinderte Menschen erstellt.
Die Hauptuntersuchung erfolgte durch die Verteilung der Fragebogen im Frühjahr 1983. Die Verteilung wurde über Grundschulen, Vereine und Kindertagesstätten vorgenommen; von 860 Exemplaren erhielten wir 370 (= 43%) zurück.
Die Auswertung erfolgte entsprechend dem Einstellungsmodell (Kognition, Konation, Affektion und Verhalten anderer) unter den Aspekten integrierend-isolierend und bezogen auf die Partizipationschancen Behinderter in den Bereichen Privat, Bildung, Freizeit und Arbeit, was dann in der Folge die Überprüfung der benannten Hypothesen ermöglichte.
Die Differenziertheit der Untersuchung erlaubt es nicht, hier einzelne Ergebnisse zu interpretieren und diese Ergebnisse aus dem Gesamtzusammenhang herauszureißen. Dennoch der Verweis auf einige wenige Tendenzen:
-
Die Mehrheit der Befragten ist gewillt, finanziell im weitesten Sinne integrative Maßnahmen zu unterstützen.
-
Es zeigen sich relativ positive Einstellungen der Respondenten gegenüber Maßnahmen, die die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen vorantreiben.
-
Hauptsächlich jüngere Eltern stehen integrativer schulischer Erziehung verhältnismäßig positiv gegenüber.
-
85% würde es nicht stören, wenn ein geistig/körperlich behindertes Kind in ihrer Nachbarschaft wäre und die ihm täglich begegnen würden.
-
Der Grad der Bereitschaft der Respondenten, mit geistig/körperlich behinderten Menschen Kontakt zu haben, sinkt in dem Masse, je direkter, konkreter sich die Situation für die Beteiligten darstellt, also der Grad der Betroffenheit steigt.
-
85% der Respondenten lehnen mehr oder weniger Heime in ländlichen Gebieten für behinderte Menschen ab, wodurch extremen Formen der Isolierung eine klare Absage erteilt wird. Nur 35,4% sind bereit, integrationsfeindliche Behinderteneinrichtungen für eine scheinbar bessere Förderung geistig- und körperlich behinderter Menschen in Kauf zu nehmen.
-
Hinsichtlich des Urlaubs in unmittelbarer Nähe mit geistig- und körperlich behinderten Kindern zeigen sich 95% diesbezüglich tolerant.
-
41,5% der Respondenten würden einem gesunden Menschen eher einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen als einem behinderten.
-
Es bleibt zu vermuten, dass Mitleid die häufigste typische affektive Reaktion oder Norm gegenüber Behinderten darstellt.
-
Die Mehrzahl der Befragten steht einer Normalisierung des Zusammenlebens von Behinderten und Nichtbehinderten weder ausgesprochen positiv noch ablehnend gegenüber.
-
Die Befragten stehen der Integration im Arbeitsbereich mit großer Zurückhaltung gegenüber.
- 208 -
-
Die Kategorie Bildung wird im Vergleich mit den übrigen Kategorien (sie folgen in der Rangfolge Freizeit, Privat, Arbeit) im Hinblick auf integrative Bemühungen am besten beantwortet. Zwar wird eine mögliche schulische Integration für geistigbehinderte Kinder deutlich negativer eingeschätzt, doch liegt sie mit 79% der Befürwortung recht hoch. Ein nur auf räumliches Beisammensein behinderter und nichtbehinderter Kinder beschränktes Integrationskonzept ohne spezielle Hilfen für behinderte Kinder stößt auf Ablehnung.
-
Hinsichtlich der Tätigkeitsbereiche der Respondenten gaben die positivsten Bewertungen Studenten ab. An zweiter Stelle positiver Meinungen stehen Arbeiter, danach folgen Selbständige, Angestellte, Beamte und Hausfrauen (Sie nehmen im Verhältnis eine extrem negative Haltung zu Integrationsfragen ein.). Der integrative Bildungsbereich wird von Beamten mit der größten Skepsis beurteilt.
Zusammenfassend gesehen stehen vergleichsweise die Zeichen für eine Befürwortung sozialer Partizipation behinderter Menschen im Bildungsbereich noch am günstigsten. Die Mehrheit der Befragten steht integrativer vorschulischer sowie schulischer Erziehung rein theoretisch verhältnismäßig positiv gegenüber. Bei der beruflichen Partizipation wird hinsichtlich der Realisierung integrativer Maßnahmen mit den stärksten Widerständen zu rechnen sein. Insgesamt sind die Teilhabechancen für geistig behinderte Menschen schlechter als für körperbehinderte. Was die befragten Personen betrifft, sind sie weder eindeutig für, noch stehen sie der Partizipation Behinderter in allen Gesellschaftsbereichen völlig ablehnend gegenüber.
Insgesamt herrscht momentan keine eindeutige Einstellung zur gesellschaftlichen Integration behinderter Menschen vor. Deutlich wird, dass bisher kaum eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Problematik stattgefunden hat.
Die Überprüfung der Hypothesen ergab, dass
-
die erste Hypothese in ihrer absoluten Formulierung durch die Ergebnisse der Einstellungsuntersuchungen nicht bestätigt wurde. Die Mehrzahl der Befragten hat sich für gemeinsames vorschulisches und schulisches Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder ausgesprochen;
-
die zweite Hypothese wird bestätigt,
-
auch die dritte Hypothese wird durch die Ergebnisse der Untersuchung gestützt.
Diese wenigen Hinweise aus der Arbeit von Heusmann und Laue (56) mögen genügen, um einen Trend zu skizzieren, wie wir ihn hier in Bremen im Rahmen dieser Arbeit erfassen konnten.
Wenngleich, was mit „wissenschaftlicher Begleitung“ bezeichnet wird, in das Zentrum unseres Integrationsvorhabens hineinragt und nur aus ihm heraus sinnvoll zu verstehen ist, muss sie dennoch in gewisser Weise am Rande, also zusätzlich zu vielfältigen anderen Aufgaben geleistet werden. Dies wäre in der beschriebenen Weise nicht möglich, fänden sich nicht mehrere engagierte Studentinnen und Studenten zusammen, die sich weit über das hinaus, was im Rahmen eines Studiums in diesen Belangen obligatorisch ist, an der Sache, aber auch am Geschehen engagieren würden.[91] Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, ihnen für ihre Mitarbeit zu danken. Dies ist im Zusammenhang mit diesem Punkt nicht nur eine übliche rhetorische Floskel, sondern Ausdruck meiner Wertschätzung dafür, dass sie diese sehr aufwändige Arbeit ihrerseits zusätzlich zu vielen anderen Arbeiten leisten, und ich sage es hier, weil ich dies von ihnen weiss, wie sie von mir wissen, dass diese Arbeiten, so auch dieser Bericht, unter den schwierigsten Bedingungen geleistet werden müssen, sei dies hinsichtlich der Sache und der Widerstände, die sie erfährt, oder hinsichtlich der mehr als bescheidenen Arbeitsmöglichkeiten, die uns im Rahmen der Universität zur Verfügung stehen.
- 209 -
Solange ich im pädagogischen Bereich tätig bin, habe ich aber immer die Erfahrung machen müssen, dass die Veränderung, die im Interesse der Kinder und Jugendlichen und einer ihnen adäquaten Erziehung und Bildung notwendig sind, stets ohne die entsprechenden Voraussetzungen geleistet werden müssen. Würde man auf die Realisierung der notwendigen Voraussetzungen warten, gäbe es nie eine Veränderung. Erst durch die unter unzumutbaren Bedingungen erreichten Veränderungen werden wir nachweisen und erreichen können, dass auch die Bedingung für eine weiterführende und humanere Erziehungs- und Bildungsarbeit garantiert werden.
- 210 -
[87] Dass Sequenzen in der Integrationsgruppe sehr weitgehend zu Ende geführt werden (über 90%) und nur in geringem Maß nicht zu Ende geführt werden (um die 10%), während die Werte vor der Integration zwischen 50% und 65% zu Ende geführte in Relation zu 28% bis 54% nicht zu Ende geführten ausmachen, ist auch ein Hinweis auf die verändernde Wirkung der Verhaltensweisen der ErzieherInnen in kommunikationsbasierten Kooperationen mit den Kindern, die mit den Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu begründen sind.
[88] Die in Klammern angegebenen Buchstaben sind die entsprechenden Notationskürzel.
[89] Gemeint ist hier ein Kind aus dem Autismus-Spektrum mit einem „frühkindlichen Autismus“ (nach Kanner), was u.a. die Annahmen in Bezug auf diese Kinder hinsichtlich ihrer Unfähigkeit zu sozialen Kontakten erheblich in Zweifel zieht. Ich beziehe mich dazu auf solche Erfahrungen, die ich in vielen Arbeitszusammenhängen machen konnte.
[90] Das hier andeutungsweise beschriebene Verfahren der „Sequentierten Interaktionsanalysen“ (so die spätere Bezeichnung) wurde u.a. auch im Schulversuch Integration angewendet und darüber hinaus auch im Rahmen der Arbeit im Rahmen der Konzeption der SDKHT, zur Beratung etc. Dieses Instrument hat sich als ein sehr relevantes Verfahren erwiesen, das die hier noch mit Fragezeichen versehenen Annahmen voll einlösen konnte. Bezogen auf den sich aus der Integration in den KTH Bremens ergebenden Schulversuch siehe dazu: Feuser, G. & Meyer, H. (1987): Integrativer Unterricht in der Grundschule. Ein Zwischenbericht. Solms-Oberbiel: Jarick Verlag
[91] Seitens der Universität Bremen standen mir in keiner Weise wissenschaftliche MitarbeiterInnen oder so genannte studentische Hilfskräfte zur Verfügung; auch keine damals üblichen Schreibkräfte; Sekretäre/innen gab es ohnehin nicht.
„Es ist ganz richtig: Dadurch, dass man einen anderen ins Irrenhaus sperrt, beweist man noch nicht seinen eigenen Verstand.“
Diesen Satz schrieb Fjoder Michailowitsch Dostojewski 1837 in seiner Erzählung „Bobok“. Diese wenigen Worte vermögen deutlich auszudrücken, was mit dem 1. Kapitel dieses Zwischenberichtes zu sagen versucht wurde. Auf unser Anliegen bezogen und in den Zusammenhang des pädagogischen Anliegens gestellt, werden wir darauf aufmerksam, dass wir dadurch, dass wir von Behinderung bedrohte oder als behindert geltende Kinder und Jugendliche aus ihren regulären Lebenszusammenhängen herausreißen und in zentrale Therapiestätten und Sondereinrichtungen stecken, noch lange nicht erwiesen ist, dass diese Maßnahmen auch die richtigen sind. In einen Sonderkindergarten und in eine Sonderschule zu gehen, sagt nichts aus über die dort praktizierte Qualität der Erziehungs- und Bildungsarbeit; sie ist nicht dadurch besser oder richtiger, dass sie in einer Einrichtung stattfindet, der man die Vorsilbe „Sonder-“ gibt. Erziehung und Bildung für Kinder, insbesondere wenn ihre Persönlichkeitsentwicklung durch die verschiedensten Faktoren beeinträchtigt wird, muss und hat etwas besonderes zu sein; nämlich besonders in Anbetracht der besonderen Bedingungen, unter denen sich Kinder entwickeln müssen.
Das Besondere aber einer solchen Pädagogik liegt nicht in der „Besonderung“ der Kinder, sondern im Allgemeinen einer basalen Pädagogik, im Allgemeinen der Grundlagen der menschlichen Entwicklung und des menschlichen Lernens.
Dieses Allgemeine herauszuarbeiten, ist das spezielle an unserer Arbeit; es in der Besonderung zu suchen, ist ein Irrweg.
Ich habe die Vision, dass wir eines Tages in Fortführung und in breiterer Ausweitung der gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindergärten und Schulen, die keine Sondereinrichtung sind, werden erkennen müssen, dass der institutionelle Weg der Heil- und Sonderpädagogik ein Irrweg war, wenngleich er, historisch gesehen, als Umweg im Lauf der Geschichte in Kauf genommen werden musste und heute noch in Kauf genommen werden muss – so lange, bis eine qualifizierte basale allgemeine Pädagogik entwickelt und zum Allgemeingut aller Pädagogen und Therapeuten geworden ist.
Die Arbeit in integrativen Gruppen in Kindergarten und Schule hat wenig zu tun mit Groll gegen die noch immer mit vielen Annehmlichkeiten gepflasterte Sackgasse in die Sondereinrichtungen. Sie ist unter den bestehenden Verhältnissen eine demokratische Alternative zu dem gesetzlich verfügten Zwang der Besonderung all derer, die unsere Gesellschaft als behindert oder psychisch krank erkennt. Wenngleich diese Gesellschaft auch nur von einem ihrer Grundwerte selbst überzeugt ist, wird sie die integrativen Bemühungen im Bereich von Erziehung und Bildung nicht nur dulden, sondern in der gleichen Weise fördern müssen, wie sie die Aussonderung und Besonderung behinderter Kinder und Jugendlicher betrieben hat und noch immer betreibt. Dann kann und wird im weiteren Verlauf der Arbeit sich erweisen, welcher Weg in Zukunft zu gehen sein wird.
Dieses aber ist eine Verpflichtung an Fairness und an Korrektheit sowohl derer, die heute für die Alternative der gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder eintreten, wie derer, die gegen sie sind.
Das bedeutet, dass Integration hier und heute fortzusetzen und auszuweiten ist und dass mit allem Nachdruck die Bedingungen zu fordern und bis in gesetzliche Revisionen hinein zu realisieren sind, die eine Basis dafür ermöglichen, die nur in und durch Integration entfaltbare Qualität einer längst für alle Kinder überfällig gewordenen Pädagogik auch zu realisieren.
- 211 -
Zu diesen Bedingungen gehört nicht nur das fachwissenschaftliche Feld, das im Rahmen des Berichtes als Förderdiagnostik, als Entwicklungs- und Lernpsychologie, als Didaktik, Methodik und Therapie beschrieben wurde, sondern auch z.B. die längst notwendige und überfällige Verkürzung der Arbeitszeit der Pädagogen und Therapeuten, die zur Verfügungstellung genügender Planungs- und Vorbereitungszeiten, die Reduzierung der Gruppengrössen, d.h. eben die Beseitigung von Verhältnissen, die im Grunde als Missstände bezeichnet werden müssen, an die wir uns aber z.T. als gegeben gewöhnt haben und die in den Augen derer, die sie zu verantworten haben, als die angesehen werden, die auch so sein müssen, wie sie sind.
Die geforderte Qualität einer basalen allgemeinen Pädagogik zu entwickeln, ist auch unvereinbar mit dem immer weiter voranschreitenden Abbau der finanziellen, materiellen und personellen Grundbedingungen für die Ausbildung in der Pädagogik in allen Bereichen; auch in der Behindertenpädagogik. Integration, die Erübrigung von Sondereinrichtungen bedeutet nicht die Erübrigung einer Behindertenpädagogik; im Gegenteil, sie hat sich als Pädagogik zu qualifizieren und in diesem Sinne in Zukunft in diese hinein aufzulösen und bei allen Pädagogen eine entsprechende Qualifikation auszubilden.
Genauso wenig, wie die Kinder durch das Lernen, was unsere Ansicht ist, sondern an dem und durch das, was sie konkret für sich sinnvoll wahrnehmbar durch uns erfahren, genauso entsteht eine pädagogische Qualität nicht dadurch, dass wir die Pädagogik Sonderpädagogik nennen, sondern dass wir das pädagogisch leisten, was den Bedürfnissen und Bedingungen der Kinder für eine möglichst umfassende Entfaltung ihrer Persönlichkeit entspricht.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei Aussagen von Martin Buber verweisen, die mich in meiner eigenen pädagogischen Arbeit über Jahre hinweg begleitet haben: Die eine verdeutlicht eine Illusion, deren wir uns als Pädagogen immer wieder hingeben, wie dies auch in diesem Bericht an einigen Stellen aufgezeigt werden konnte; es ist die Illusion, dass die Kinder, mit denen wir arbeiten, das lernen würden, was wir wollen, dass sie lernen: sie lernen, was wir ihnen in unserem konkreten pädagogischen Handeln zu lernen ermöglichen. Buber drückt dies mit dem Satz aus:
„Pädagogisch fruchtbar ist nicht die pädagogische Absicht, sondern die pädagogische Begegnung.“ (57)
Integrative Erziehung ist Begegnung von Menschen, ist pädagogische Begegnung – in einer Weise, wie sie jede segregierende Maßnahme im pädagogischen Bereich im Sinne der äußeren Differenzierung schon an ihrer Wurzel zu zerstören beginnt.
Die zweite Aussage von Buber lautet:
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (58)
In dieser einfachen Aussage steckt jede pädagogische Maxime und die tiefste Begründung für Integration.
Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewährt. Setzt man den behinderten Menschen nur dem Du des Therapeuten, des Pädagogen und den Geistigbehinderten dem Geistigbehinderten, den Gehörlosen dem Gehörlosen gegenüber, erstarren und gerinnen die dynamischen Entwicklungsprozesse zu zähflüssigen Strömen, in denen Ich und Du ihre Konturen verlieren; sie drohen zu einer Schablone der Institution zu werden.
Ob ein Kind behindert ist oder nicht: Es hat das Recht und den Anspruch auf das Du in seiner regulären Lebens und Lernumwelt, und nicht noch soviel therapeutisches und sonderpädagogisches Personal kann für ein behindertes Kind je den Umgang mit seinem nichtbehinderten Altersgenossen auch nur ansatzweise ersetzen und seine Bedürfnisse und Motive so nachhaltig beeinflussen.
- 212 -
Mit der Möglichkeit, den Weg der integrativen Erziehung zu wählen, haben wir alle, nicht nur die behinderten oder nichtbehinderten Kinder, die Chance zu realisieren, was Vygotski (59) mit dem Satz zum Ausdruck bringt:
„In unseren Händen liegt es, so zu handeln, dass das gehörlose, das blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt.“
- 213 -
(01) Siehe Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung gedrohter Kinder und Jugendlicher“, verabschiedet auf der 34. Sitzung der Bildungskommission am 12./13. Oktober 1973. In: Beiheft 11 der Zeitschrift für Heilpädagogik, Februar 1974, S. 55
(02) Franco Basaglia schreibt in seiner Arbeit: „Was ist Psychiatrie?“ (siehe Basaglia, F. (Hrsg.): Was ist Psychiatrie? Frankfurt/M.. Edition Suhrkamp 19724): „Die psychiatrischen Diagnosen haben inzwischen einen kategorialen Wert erlangt insofern nämlich, als sie eine Etikettierung, eine Stigmatisierung des Kranken darstellen, über die hinaus es keine Möglichkeit der Aktion oder Annäherung gibt“ (S. 7)
Michel Foucault verweist in seiner Arbeit „Psychologie und Geisteskrankheit“, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag, 1972, darauf: „Der Mensch ist eine psychologisierbare Gattung erst geworden, seit sein Verhältnis zum Wahnsinn eine Psychologie ermöglicht hat, d.h., seit sein Verhältnis zum Wahnsinn äußerlich durch Ausschluss und Bestrafung und innerlich durch Einordnung in die Moral und durch Schuld definiert worden ist“ (S. 113)
(03) Siehe hierzu z.B. Jantzen, W.: Sozialgeschichte des Behindertenbetreungswesens, München: Deutsches Jugendinstitut 1982; Reichmann, E.: „Zur Geschichte der Hilfsschule (Lernbehindertenschule)“. In: Jantzen, W. (Hrsg.): Soziologie der Sonderschule, Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1981, S. 101-128; Trabant, H.: „Wem hilft die Sonderschule?“ Königstein/Taunus: Verlag Anton Hain, 1979
(04) Siehe hierzu z.B. die Dokumentation ‚Behinderte Menschen unterm Hakenkreuz‘ – „Von der Aussonderung zur Sonderbehandlung“, Lehren und Forderungen für heute, aus Anlass des 40. Jahrestages der Massen-Abtransporte aus den Alsterdorfer Anstalten in die Tötungsanstalten der „Euthanasie“, herausgegeben durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Hamburg, Hamburg 1983; Kogon, E. u.a.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas (eine Dokumentation). Stuttgart: S. Fischer Verlag 1983
(05) Dies wird besonders deutlich, wenn Agostino Pirella in seinem Aufsatz „Negation der traditionellen Anstalt“. In: Basaglia, F. (Hrsg.): „Die negierte Institution oder Die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen“. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 19782 schreibt: „Der Geisteskranke war sehr lange und ist noch heute ein Mensch, der brutal unterdrückt werden darf, ein Staatsbürger, der seiner Rechte beraubt ist, dem auf unbestimmte Zeit persönliche Freizeit, Besitz und zwischenmenschliche Beziehungen entzogen werden können, der sich verzweifelt die Frage stellt: Was habe ich eigentlich Schlimmes getan? – er hat eine Norm durchbrochen, ist einer der abweicht. Die Psychiatrie hat sich jahrelang fast überschlagen, um ihn in eine Festung aus Klischees und Kategorien einzuschließen, bis sie sich schließlich selbst zur Norm erhob“ (S. 204).
(06) Siehe Spitz, R.A.: Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. Stuttgart: Klett Verlag 19733
(07) Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Sonderschulen e.V. (Bruno Prändl) sprach im Rahmen der Eröffnung des Sonderpädagogischen Kongresses 1981 in Braunschweig in Bezug auf die Bemühungen um die Integration behinderter Menschen in Italien von der „italienischen Seuche“, was eine öffentliche Diskussion auslöste. Siehe hierzu z.B. auch die Zeitschrift Behindertenpädagogik, 20(1981), Hefte 2 und 3
- 214 -
(08) Siehe hierzu die Diskussion um den Beitrag von Norbert Baude „Zum Selbstverständnis der Sonderpädagogik: Wider die Abschaffung der Sonderschule“. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 32(1961)6, S. 449-451 und 33(1982)1, S. 50-64 und 33(1982)4, S. 259f
(09) Siehe hierzu Feuser; G.: „Der Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Pädagogik und Therapie – ein Widerspruch zur Aussonderung und Institutionalisierung? Oder: Was den einen bestraft, kann den anderen nicht heilen“! In: Bericht der 15. Fachtagung der Bundesfachgruppe der Heilpädagogen im BHS, Büdelsdorf 1983, S. 77-109
(10) Siehe Enzyklop. HdB der Sonderpädagogik und ihrer Grenzgebiete, Bd. 1, Berlin: Marhold Verlag 1969, Sp. 1259
(11) Siehe Feuser, G.: „Bedeutet die zunehmende Forderung nach Therapie eine Bankrotterklärung der Behindertenpädagogik? – oder die Steigerung ihrer Qualität?“ In: Holz, K.-L. (Hrsg.): Sonderpädagogik und Therapie. Rheinstetten-Neu: Schindele Verlag 1980, S. 58-69 und Feuser, G: Thesen zum Problemkreis schwerst geistigbehinderter Kinder und Jugendlicher. In: Feuser/Oskamp/Rumpler (Hrsg.): Förderung und schulische Erziehung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher. Stuttgart 1983, S. 19-28
(12) Siehe Bleidick, U.: „Pädagogik der Behinderten“. Berlin: Marhold Verlag 1972, S. 324ff
(13) Siehe in diesem Zusammenhang Berner, H.-P.: „Behindertenpädagogik und Faschismus – Aspekte der Fachgeschichte und der Verbandsgeschichte (VdHD, NSLB, VDH, VDS)“. Bremen: Schriftliche Hausarbeit für das Lehramt an öffentlichen Schulen (Behindertenpädagogik), unveröffentlicht 1984
(14) Siehe Séguin, S. E.: „Die Idiotie und ihre Behandlung nach der physiologischen Methode“. Wien: Verlag Karl Graeser 1972
(15) Siehe Feuser, G.: „Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am Gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. In: Behindertenpädagogik 21(1982)2, S. 86-105
(16) Anochin, P. K.: „Beiträge zur allgemeinen Theorie des funktionellen Systems“. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag 1978
Bierbaumer, N.: „Physiologische Psychologie“. Berlin/Heidelberg/New York: Springer Verlag 1975
Guttmann, G.: „Einführung in die Neuropsychologie“. Bern/Stuttgart/Wien: Hans Huber Verlag 19742
Klix, F.: „Information und Verhalten“. Bern/Stuttgart/Wien: Hans Huber Verlag 19763.
Luria, A. R.: „Die höheren kortikalen Funktionen und ihre Störung bei örtlicher Hirnschädigung“. Berlin/DDR: DVW 1970
Schurig, V.: „Naturgeschichte des Psychischen“, Bd. 1 u. 2. Frankfurt/New York: Campus Verlag 1975 – ders.: „Die Entstehung des Bewusstseins“. Frankfurt/New York: Campus Verlag 1976
Simonov, P. V.: „Höhere Nerventätigkeit des Menschen – Motivationelle und emotionale Aspekte“. Berlin/DDR: VEB Verlag Volk und Gesundheit 1982
Sinz, R.: „Lernen und Gedächtnis“. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag (UTB 358) 19762 – ders.: „Neurobiologie und Gedächtnis“. Stuttgart/New York: Gustav Fischer Verlag (UTB 852) 1978
Wazuro, E. G.: „Die Lehre Pavlow’s von der höheren Nerventätigkeit“. Berlin/DDR: VEB Volk und Wissen 1975
(17) El’konin, D. B.: „Zur Psychologie des Vorschulalters“. Berlin/DDR: VEB Volk und Wissen 1965 – ders.: „Psychologie des Spiels“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1980
Gal‘perin, P. J.: „Zu Grundfragen der Psychologie“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1980
- 214 -
Gibson, J. J.: „Die Sinne und der Prozess der Wahrnehmung“. Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Hans Huber 19822
Pörz, H./Wessel, K.-F.: „Philosophische Entwicklungstheorie“. Berlin/DDR: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1983
Holzkamp, K.: „Sinnliche Erkenntnis – historischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnehmung“. Frankfurt/M.: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag 1973
Jantzen, W.: „Grundriss einer allgemeinen Psychopathologie und Psychotherapie“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1979 – ders: „Menschliche Entwicklung, allgemeine Therapie und allgemeine Pädagogik“. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1980
Leon‘tev, A.N.: „Probleme der Entwicklung des Psychischen“. Frankfurt/M.: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag 1973 – ders.: „Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1982
Luria, A. R.: „Sprache und Bewusstsein“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1982
Piaget, J.: „Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde“. Stuttgart: Fischer Verlag 1972
Stadler, M. u.a.: „Psychologie der Wahrnehmung“. München: Juventa Verlag 1975
(18) In Bezug auf den Zusammenhang von Adaptation und Organisation als invariante Funktionen des Wechselwirkungsverhältnisses lebendiger Systeme mit ihrer Umwelt, siehe unter entwicklungspsychologischen Aspekten PIAGET, J.: Gesammelte Werke, Bde. 1-10; insbesondere hierzu: Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde, gesammelte Werke, Bd. 1, Studienausgabe, Stuttgart: Klett Verlag 1975
Zum Zusammenhang menschlicher Entwicklung unter den Bedingungen von Isolation, siehe den grundlegenden Aufsatz von Jantzen, W.: „Zur begrifflichen Fassung von Behinderung aus der Sicht des historischen und dialektischen Materialismus“. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 27(1976)7, S. 428-436
(19) Zu diesen Zusammenhängen ergibt eine grundlegende allgemeine Information die Arbeit von Jantzen, W.: „Grundriss einer allgemeinen Psychopathologie und Psychotherapie“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1979. Wie dann mit den nachfolgenden Arbeiten versucht wurde, auf der speziellen Ebene die Auswirkungen isolierender Bedingungen auf dem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung darzustellen; siehe Feuser, G.: „Grundlagen zur Pädagogik autistischer Kinder“. Weinheim: Beltz Verlag 1979; ders.: „Autistische Kinder“. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1980, ferner ders.: „Beiträge zur Geistigbehindertenpädagogik“. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1981
(20) Siehe z.B. Brezinka, W.: „Erziehung als Lebenshilfe“. 19612
(21) Siehe hierzu Klafki, W.: „Studien zur Bildungstheorie und Didaktik“. Weinheim: Beltz Verlag 19657
(22) Siehe hierzu Stegemann, W.: „Tätigkeitstheorie und Bildungsbegriff“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1983
(23) Siehe Sinz, R.: „Lernen und Gedächtnis“. Stuttgart: G. Fischer Verlag 1976
(24) Siehe hierzu die Arbeit von Sève, L.: „Marxismus und Theorie der Persönlichkeit“. Frankfurt/M.: Verlag Marxistische Blätter 19732, S. 237
(25) Siehe hierzu: Feuser, G.: „Arbeit am Behinderten – Arbeit mit Behinderten, Beispiel: Schwerbehinderte. In: Feuser, G.: Beiträge zur Geistigbehindertenpädagogik. Solm-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1981, 209-219; ders.: An der Schwelle zum Jahr der Behinderten“. In: Behindertenpädagogik (BHP) 19(1980)4, S. 364-367; ders: „Am Ende? … (des Jahres der Behinderten!)“. In: BHP 20(1981)4, S. 370-374
(26) Siehe: „Isolation in Heimen ist falsch und unmenschlich“, WK-Gespräch zum Jahr der Behinderten mit Prof. Feuser und Heiko Wegener: Tageszeitung Weser-Kurier vom Donnerstag, den 12. März 1981, Nr. 60, S. 3
- 216 -
(27) Kindertagesstätte der Spastikerhilfe Bremen e.V. (Hrsg.): „Integration – Erste Erfahrungen nach 6 Monaten gemeinsamen Spielens und gemeinsamen Lernens“. Zu Beziehen durch die Kindertagesstätte (Osterholzer Heerstr. 194, 2800 Bremen 44, Tel: 0421/442031 – 34; Schutzgebühr DM 5.-)
(28) Siehe hierzu: Statut und Konzept des Kindertagesheimes der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde vom 24. Februar 1981, S. 1-18
(29) Siehe hierzu: „Integration behinderter Menschen in Dänemark“. Bremen: Hrsg.: Diakonisches Werk Bremen e.V. (Rembertistr. 64, 2800 Bremen 1) 1982
(30) Siehe hierzu: Watzlawick, P. u.a.: „Menschliche Kommunikation“. Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Hans Huber 1974; Bateson, G. u.a.: „Schizophrenie und Familie“. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 1972
(31) Ich verweise in Bezug auf diese Begriffe insbesondere auf das von Feuser, G. und Jantzen, W. herausgegebene „Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie“, das im Pahl-Rugenstein Verlag Köln erscheint und dessen Bände I/1981-III/1983 bereits vorliegen (der Band IV/1984 erscheint in Kürze).[92]In einzelnen Beiträgen dieses Jahrbuchs wird versucht, im Sinne konstruktiv-kritischer Analyse der als psychopathologisch bezeichneten Zusammenhänge und Störungsbilder der menschlichen Entwicklung im Sinne einer der menschlichen Entwicklung entsprechenden Persönlichkeitstheorie neu zu begründen und zu fassen.
(32) Siehe hierzu Gal‘perin, P.J.: „Zu Grundfragen der Psychologie“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1980, S. 172
(33) Siehe Anmerkung 28, hier S. 17
(34) Siehe hierzu ein im Auftrag des Landes Hessen für die Fachhochschule in Zusammenarbeit mit Kollege Wolfgang Jantzen erstelltes Gutachten zur Einrichtung eines Studienganges (Fachbereichs) „Behindertenpädagogik und Rehabilitation“ an der Fachhochschule Fulda vom Februar 1980
(35) Siehe Piaget, J.: „Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde“. Stuttgart: Ernst Klett Verlag 1969, S. 18
(36) Siehe hierzu Sinz, R.: „Lernen und Gedächtnis“. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag (UTB 358) 1976, S. 86-94
(37) Siehe hierzu „Diagnostik im Interesse der Betroffenen“, Hrsg. durch die Fachschaftsinitiative Sonderpädagogik, Arbeitsgruppe Förderdiagnostik, (zu beziehen durch Ulrich Reuter, Haus Nr. 17½, 8701 Reichenberg-Lindflur), Würzburg 1982 mit Beiträgen von Jantzen, Kornmann, Probst, Rödler und Reuter und ferner Kornmann, R. und Schleh: „Förderdiagnostik“. Heidelberg: Schindele Verla
(38) Siehe zu Fragen von Motivation und Emotion Simoniv, P.V.: „Höhere Nerventätigkeit des Menschen“. Berlin/DDR: VEB Verlag Volk und Gesundheit 1982
(39) Zur Konzeption der Dominierenden Tätigkeit; siehe die Literaturangaben zu Leont’ev und Jantzen im Rahmen der hier gemachten Anmerkungen; insbesondere dazu Jantzen, W.: Menschliche Entwicklung, allgemeine Therapie und allgemeine Pädagogik. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1980, S. 15
(40) Siehe Jantzen, W.: „Diagnostik im Interesse der Betroffenen (Anmerkung 37) und Leont‘ev, A.N.: „Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1982
(41) Siehe hierzu u.a. Jantzen, W.: „Kulturelle Bedürfnisse“. In: Kürbiskern (1983)2, A. S. 121-135
(42) Siehe Jantzen, W.: „Abbildtheorie und Stereotypenentwicklung – ein methodologischer Beitrag zur Diagnose des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung bei schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen“. In: Feuser/Jantzen (Hrsg.): Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie III/1983. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1983, S. 111-158
- 217 -
(43) Siehe hierzu Rubinstein, S.L.: „Grundlagen der allgemeinen Psychologie“ und „Sein und Bewusstsein“, beide Berlin/DDR 1977
(44) Siehe hierzu Luria, A.R.: „Die Entwicklung der Sprache und die Entstehung psychischer Prozesse“. In: Hiebsch, H. (Hrsg.): Ergebnisse der sowjetischen Psychologie. Stuttgart: Klett Verlag 1969, s. 465-546; ders.: „Sprache und Bewusstsein“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1982
(45) Siehe Vygotski, L.S.: „Denken und Sprechen“. Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 1974
(46) Siehe hierzu Petrowski, A.W.: „Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie“. Berlin/DDR: Volk und Wissen 1977; Jantzen, W.: „Abbildtheorie und Stereotypenentwicklung: Einige Aspekte der Entwicklung eines erweiterten diagnostischen Zugangs zur Problematik der Lern- und Lebensprozesse schwerstbehinderter Menschen“. In: Feuser/Oskamp/Rumpler (Hrsg.): Förderung und schulische Erziehung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher. Tagungsbericht des gleichlautenden Symposiums 1982 in Würzburg. Stuttgart: (Verband Deutscher Sonderschulen, Rosenbergstrasse 49, 7000 Stuttgart 1) 1983, S. 217-229; Jantzen, W.: „Abbildtheorie und Stereotypenentwicklung – ein methodologischer Beitrag zur Diagnose des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung bei schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen“. In: FEUSER/JANTZEN (Hrsg.): Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie III/1983. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1983, S. 111-158
(47) Siehe hierzu Arbeitsgruppe Vorschulerziehung. Anregungen III: Didaktische Einheiten im Kindergarten. München 1976, S. 15
(48) Siehe hierzu Deutscher Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungskommission: Zur Einrichtung eines Modellprogramms für Curriculum-Entwicklung im Elementarbereich. Stuttgart 1973. In: Zimmer, J. (Hrsg.): Curriculumentwicklung im Vorschulbereich. Bd. 1, München 1973
(49) Allein unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge wird deutlich, dass eine einlinige Betrachtung der Aneignungstätigkeit im Sinne der Entwicklung/Stimulation eines Subjekts allein, bei weitem nicht ausreichend ist, damit der Aneignungsprozess stattfinden kann, was u.a. Konzeptionen wie die der Basalen Stimulation, wie sie wesentlich von Fröhlich für die Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern entwickelt wurde, nur eine Dimension der Arbeit mit diesen Kindern repräsentieren kann, nicht aber deren Aneignungs- und Lernprozesse als solche. Als Stimulation ohne bewusste Planung der gegenständlichen Tätigkeit des Kindes bleibt die basale Stimulation eine ‚Be’-Handlung des Kindes ohne die Chance, die intendierte Höherentwicklung von der perzeptiven zu manipulierenden und gegenständlichen Tätigkeit auch nur annähernd zu erreichen.
(50) Siehe hierzu den grundlegenden Aufsatz von Gal‘perin, P.J.: „Die Entwicklung der Untersuchungen über die Bildung geistiger Operationen“. In: Hiebsch, H. (Hrsg.): Ergebnisse der sowjetischen Psychologie. Stuttgart: Ernst Klett Verlag 1969, S. 367-405; ferner siehe auch das grundlegende Buch von Gal‘perin, P. J.: Zu Grundfragen der Psychologie. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1980
In diesem Zusammenhang sind auch interessant die Arbeiten von Keseling, E.: „Sprache als Abbild und Werkzeug“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1979; ders.: „Sprach-Lernen in der Schule – Die Funktion der Sprache für die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten“. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1974
(51) Siehe hierzu Arbeitsgruppe Vorschulerziehung: Anregungen I: Zur pädagogischen Arbeit im Kindergarten. München 1974, S. 119
(52) Siehe hierzu Bambach, H.U. und Gerstacker, R.: „Der Situationsansatz als didaktisches Prinzip: Die Entwicklung didaktischer Einheiten“. In: Zimmer, J. (Hrsg.): Curriculumentwicklung im Vorschulbereich, Bd. 1. München 1973,
- 218 -
S. 154-206, sowie Arbeitsgruppe Vorschulerziehung: Anregungen III: Didaktische Einheiten im Kindergarten. München 1976, S. 76-78
(53) Siehe Mühl, H.: „Handlungsbezogener Unterricht mit Geistigbehinderten“. Bonn-Bad Godesberg: Verlag Dür’sche Buchhandlung 1979
(54) Siehe hierzu besonders die Arbeit von Schulke-Vandre, J.: Grundlagen der psychomotorischen Erziehung. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag 1982
(55) Siehe hierzu Adameit, H.U.A.: „Grundkurs/Verhaltensmodifikation“. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1978
Fassnacht, G.: „Systematische Verhaltensbeobachtung“. München/Basel: Ernst Reinhard Verlag (UTB 889) 1979
Mess/SELG (Hrsg.): „Verhaltensbeobachtung und Verhaltensmodifikation“. Stuttgart: Ernst Klett Verlag 1977
Schulte, D. (Hrsg.): „Diagnostik in der Verhaltenstherapie“. München/Berlin/Wien: Urban & Schwarzenberg 19762
(56) Siehe Heusmann/Laue, B.: „Pilotstudie über Einstellungen zur gesellschaftlichen Integration behinderter Kinder und Erwachsener“. Bremen: Schriftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an öffentlichen Schulen, unveröffentlicht 1983. Diese Arbeit wird in ihren wichtigsten Grundzügen im Rahmen eines späteren Berichtes veröffentlicht werden.[93] (57) Buber, M.: „Reden über Erziehung“. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 1962, S. 69.
(58) Buber, M.: „Das dialogische Prinzip“. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 1965, S. 32.
(59) Vygotski, L.S.: „Zur Psychologie und Pädagogik der kindlichen Defektivität“. In: Die Sonderschule 20(1975), S. 72
- 219 -
BÄCHTOLD, A.: Behinderte Jugendliche: Soziale Isolierung oder Partizipation? Stuttgart: Haupt Verlag 1981
BEHINDERTENPÄDAGOGIK: Integration statt Aussonderung Behinderter? (Themenheft: Integration) 20(1981)2, 2-38 u. 41-58. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1981.
Integration behinderter Kinder in Italien – Ein Reisebericht (Themenheft: Integration) 22(1983)4, 306-369. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1983
BONDERER, E./BÄCHTOLD, A. (Hrsg.): Schweizer Beiträge zur Integration Behinderter. Luzern: Verlag der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik 1981
BROWN, L. u.a.: Eine Begründung für umfassende und langandauernde Interaktionen zwischen schwerstbehinderten Schülern, nichtbehinderten Schülern und anderen Bürgern. In: BEHINDERTENPÄDAGOGIK 21(1982)2, 106-116
BUCH, A./HEINECKE, B. u.a.: An den Rand gedrängt. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag (rororo A 4642) 1980
BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG (Hrsg.): Ein Kindergarten für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Bonn: BMBW-Werkstattberichte 1982
DEPPE-WOLFINGER, H. (Hrsg.): Behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft. Weinheim/Basel: Beltz Verlag 1983
DIAKONISCHES WERK BREMEN e.V. (Hrsg.): Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim – Ein Zwischenbericht von Georg Feuser. Bremen: Selbstverlag Diak. Werk Bremen e.V. 1984
DIAKONIE: Gemeinsam leben lernen – Kinder mit und ohne Behinderung in Kindertagesstätten (Themenheft: Integration) 9(1983)1, 1-76
DREYER, A. u.a.: Warum nicht so? Geistigbehinderte in Dänemark. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel Verlag 1982
EV. REFORMIERTE GEMEINDE FRANKFURT (Hrsg.): Lernziel Integration. Erfahrungen bei Einrichtung und Führung eines integrativen Kindergartens. Heft 1, Bonn: Rehabilitationsverlag 1982
FEUSER, G.: Integration statt Aussonderung Behinderter? In: Behindertenpädagogik 20(1981)1, 5-17
FEUSER, G.: Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. In: Behindertenpädagogik 21(1982)2, 86-15
FEUSER, G.: Der Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Pädagogik und Therapie – Ein Widerspruch zur Aussonderung und Institutionalisierung? – oder: Was den einen bestraft kann den anderen nicht heilen! In: Bericht der 15. Fachtagung der Heilpädagogen im BSH. Büdelsdorf: (Rudolf-Kinau-Str. 1, 2370 Büdelsdorf) 1983, 77-109
FEUSER, G.: Die Grundschule – Schule für alle Schüler!? In: Demokratische Erziehung 10(1984)3
GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT (Hrsg.): Gemeinsam leben lernen. Modelle, Perspektiven zur Integration Behinderter. Frankfurt/M. 1979
GROSCH, E.: Die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher im allgemeinen Schulwesen – Am Beispiel der norwegischen Schulentwicklung 1970-1980. In: Europäische Hochschulschriften Reihe 11, Pädagogik Bd. 131. Frankfurt/Bern 1982
GRUNDSCHULE: Behinderte Kinder in der Grundschule (Themenheft: Integration), 9(1983)10, Braunschweig: Westermann Verlag 1983
HELLBRÜGGE, T.: Pädagogik ohne Angst. Erfahrungen aus der Montessori Modellschule in München als Schulversuch der integrierten Erziehung gesunder mit mehrfach und verschiedenartig behinderten Kindern. In: Heilpädagogische Forschung 7(1977)1, 1-26
HÖSSL, A.: Integration behinderter Kinder in Schweden – Ergebnisse einer Studienreise. München: Deutsches Jugendinstitut 1982
JANTZEN, W.: Schafft die Sonderschule ab! In: Demokratische Erziehung 7(1982)2, 96-103
JANTZEN, W.: Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. Bern: Huber Verlag 1980
KASZTANTOWICZ, U. (Hrsg.): Wege aus der Isolation. Heidelberg: Schindele Verlag 1982
KINDERTAGESSTÄTTE DER SPASTIKERHILFE BREMEN e.V. (Hrsg.): Integration – Erfahrungen nach 6 Monaten gemeinsamen Spielens und gemeinsamen Lernens. Bremen: (Osterholzer Heerstr. 194, 2800 Bremen 44) 1983.
KRENZ, A.: Gemeinsam Leben und Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern im Regelkindergarten. In: Wehrfritz Wissenschaftlicher Dienst (WWD) Nr. 25, Rodach Juli 1983
MUTH, J./KNIEL, A./TOSCH, W.: Schulversuche zur Integration behinderter Kinder in den allgemeinen Unterricht. Deutscher Bildungsrat (Materialien) zur integrativen Förderung in der Regelschule. Weinheim: Beltz Verlag 1981
PREUSS-LAUSITZ, U.: Fördern ohne Sonderschule. Konzepte und Erfahrungen zur integrativen Förderung in der Regelschule. Weinheim: Beltz Verlag 1981
PREUSS-LAUSITZ, U.: Statt Sonderschulen: Schulen ohne Aussonderung. Über das Konzept einer gemeindenahen, integrierten Schule. In: päd. Extra (1982)5, 17-20
PROJEKTGRUPPE INTEGRATION VON KINDERN MIT BESONDEREN PROBLEMEN (Hrsg.): Gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich. Berichte und Materialien einer Fachtagung im Deutschen Jugendinstitut München vom 20.-22.05.81. München: Deutsches Jugendinstitut 1981
RUTTE, V.: Sonderpädagogik und Aussonderung. Das Prinzip des Mainstreaming in den USA. In: Erziehung und Unterricht 131(1981)10, 759-765
SANDER, A.: Aussondern ist falsch. In: Betrifft Erziehung 13(1980)3, 40-45
SAURBIER, H.: Rechtliche und finanzielle Grundlagen der Integration behinderter Kinder im Kindergarten. München: Deutsches Jugendinstitut 1982
SCHINDELE, R. (Hrsg.): Unterricht und Erziehung Behinderter in Regelschulen. Heidelberg: Schindele Verlag 1980(2)
SCHÖLER, L. (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung in Italien. Eine Exkursionsgruppe berichtet von ihren Erfahrungen. Berlin: Guhl Verlag 1983
Quelle
Georg Feuser (1984/1987): Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Hrsg.: Diakonisches Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten. Bremen [die Originalarbeit].
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 22.08.2018
