Am Beispiel der alltäglichen Mobilitätsproblematik von Rollstuhlfahrer/innen in Wien
DIPLOMARBEIT zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Studienrichtung Politikwissenschaft
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- EINFÜHRUNG
- THEORETISCHE RAHMUNG
-
1 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN - ZWISCHEN INKLUSION UND EXKLUSION
- 1.1 Definition(en) und Erklärungsmodelle von Behinderung
- 1.2 Daten zu (mobilitäts)behinderten Menschen in Österreich
- 1.3 Exkurs: Exklusion vs. Inklusion
- 1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)
- 1.5 Grundsätze und Richtlinien internationaler Behindertenpolitik zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
- 2 MOBILITÄT - EINE "ERMÄCHTIGENDE RESSOURCE"
- 3 FAZIT
- EMPIRISCHER TEIL
- 4 ANLAGE UND ERKENNTNISINTERESSE DER UNTERSUCHUNG
- 5 POLITISCHE UND RECHTLICHE INTERVENTIONEN ZUR VERBESSERUNG DER MOBILITÄTSSITUATION VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH
- 6 RAHMENBEDINGUNGEN BARRIEREFREIER MOBILITÄT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IN ÖSTERREICH
- 7 FALLSTUDIE: ALLTÄGLICHE MOBILITÄTSPROBLEMATIK VON ROLLSTUHLFAHRER/INNEN IN WIEN
- 8 FAZIT UND MASSNAHMENVORSCHLÄGE ZUR VERBESSERUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
- TABELLEN
- LEBENSLAUF
Ich danke meinen Eltern, die mir meine Ausbildung ermöglicht haben und allen, die mich bei dieser Arbeit begleitet und unterstützt haben, von ganzem Herzen!
"Ein Resultat ist nur der Ausgangspunkt für den nächsten Teil der Reise." (Chögyam Trungpa)
Es kann davon ausgegangen werden, dass ca. 10 bis 15 % der Bevölkerung in den Industriestaaten zur sehr heterogenen Gruppe behinderter Menschen zu rechnen sind. Nach Schätzungen leben in der Europäischen Union zwischen 37 und 50 Millionen, in Österreich zwischen 800.000 und 1 Million Menschen mit Behinderungen. (vgl. Bloemers 2004, Hofer 2006a, Riess/Flieger 2000, Williams 2006)
Physische, soziale und politische Ausschließung und Absonderung sind für Menschen mit Behinderungen alltagskonstituierende Erfahrungen. (vgl. Bernard 1995: 48f)
Weltweit, in den Ländern der Europäischen Union sowie in Österreich werden Menschen mit Behinderungen -trotz Fortschritte hinsichtlich Antidiskriminierung und Inklusion vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten (vgl. 1.5, 5) - nach wie vor direkt oder indirekt (strukturell) diskriminiert[1]. Sie sind von sozialer Exklusion bedroht bzw. betroffen. Das heißt: von Marginalisierung bis hin zum Ausschluss am Arbeitsmarkt, von Einschränkungen der sozialen Beziehungen bis hin zur Isolation und dem Ausschluss an Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich anerkannten Lebenschancen und -standards. Im Zugang zu und in der umfassenden Teilhabe an wesentlichen Bereichen wie Erwerbstätigkeit, Bildung, Freizeit oder der Zugänglichkeit der Umwelt sowie zu Dienstleistungen werden behinderte Menschen nach wie vor benachteiligt und behindert. (vgl. 1.3, 1.4) Beispielsweise liegen in Österreich die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen unter dem allgemeinen Durchschnitt, wodurch eine stärkere Armutsgefährdung behinderter Menschen besteht. (vgl. Hofer 2006a: 19)
Die Inklusionschancen in der modernen Gesellschaft werden durch die Verfügbarkeit und Mobilisierung von ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen bzw. Kapital nachhaltig bestimmt. Nicht alle Menschen verfügen jedoch über ein gleiches Maß an (Wahl-)Möglichkeiten oder an Voraussetzungen zur Inanspruchnahme und dem entsprechenden Zugang zu den Ressourcen und damit zur Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Teilhabechancen. (vgl. Wansing 2005, 2.1.2.2) Das Schaffen der Rahmenbedingungen um soziale Ausgrenzung behinderter Menschen zu verhindern sowie Inklusion und Teilhabe(rechte) zu sichern, ist die zentrale Herausforderung und Aufgabe des modernen Sozialstaates[2] bzw. der (Behinderten-)Politik als wesentlicher Gestalterin und entscheidungstragender Akteurin. Seit den 1980er Jahren gerät jedoch zunehmend das traditionelle sozialstaatliche Arrangement unter Beschuss. Wohlfahrtsstaatliche Sicherungssysteme geraten ins Wanken. Mit dem Rückzug des Sozialstaates korrespondieren Appelle an die individuelle Risikobereitschaft und Eigenverantwortung des/der Einzelnen. (vgl. dazu z.B. Bourdieu 1998, Butterwege 2001, Grode 2005, Kronauer 2002, Lemke 2000, Wansing 2005)
Behinderte Menschen sehen sich Geringschätzung und Abwertung ausgesetzt in einer Gesellschaft, die ganz im Zeichen neoliberalistischer Tendenzen steht. Eine Gesellschaft, die den Marktwert einer Person als einzigen Bewertungsmaßstab kennt, die den Nutzen eines Menschen ausschließlich nach einer in ihren Standards sich immer höher schraubenden Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben und entlang entsprechender Kosten-Nutzen-Dimensionen, Produktivitäts- und Effizienzkriterien bemisst. (vgl. Rommelspacher 1999: 31)
Menschen mit Behinderungen werden unter anderem durch Kulturimperialismus[3] unterdrückt (vgl. Young 1996) und haben mit Vorurteilen, Klischees und stereotypen Verhaltensmustern (z.B. Mitleid) zu kämpfen. Sie sind von gesellschaftlichen Abwehrmechanismen, wie etwa Paternalismus, der sie zu (Fürsorge-)Objekten degradiert und nicht als gleichwertige und gleichberechtigte Personen anerkennt (vgl. Rommelspacher 1999: 15) genauso betroffen, wie sie sich mit Ansätzen einer modernen Reproduktionsmedizin konfrontiert sehen, die die Auffassung von "Behinderten" als "vermeidbare Ausnahmeexistenzen" vorantreibt. (vgl. Rösner 2002: 352)
In den letzten beiden Jahrzehnten zeichnete sich tendenziell ein "Paradigmenwechsel" im internationalen behindertenpolitischen Diskurs ab, weg von (bevormundender) staatlicher Versorgung und Fürsorge hin zu Selbstbestimmung, Emanzipation und Empowerment[4] von Menschen mit Behinderungen. Aus ehemaligen "Fürsorge-Objekten" einer Sozial- und Behindertenpolitik wurden zusehends Subjekte (politischen Handelns), die ihre Bedürfnisse und Ansprüche selbst artikulierten sowie ihr Recht auf Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung lautstark einforderten. "Nichts für uns, ohne uns", ist ein Slogan der Behindertenbewegung, in dem sich jene Emanzipation, weg von Fremdbestimmung und Ausschließung, hin zu Selbstbestimmung und Partizipation und ein "neues" starkes Selbstbewusstsein behinderter Menschen ausdrücken. Betroffene schlossen sich zusehends in Behindertenorganisationen und Interessensvertretungen zusammen und forderten zum einen massiv ihre Anerkennung sowie ihre bürgerrechtliche und sozialrechtliche Gleichstellung ein, wie sie etwa in der Reklamierung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzen oder auch der Zugänglichmachung öffentlicher Bauten und Verkehrsmittel, der politischen Repräsentation behinderter Menschen oder der Abschaffung ausschließender und ausgrenzender Arbeitsmarkt- und Bildungsstrukturen zum Ausdruck kommt. Zum anderen stand die Forderung zur Schaffung von unterstützenden sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen, die ein möglichst selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen mittels Direktzahlungen und "persönlicher Assistenz"[5] ermöglichen sollen, im Mittelpunkt. (vgl. Riess/Flieger 2000)
Sich explizit als politisch verstehende und sich in die staatliche Behindertenpolitik "einmischende" nichtstaatliche (autonome) Behindertenbewegungen und Interessensvertretungen, z.B. die "Selbstbestimmt-Leben-Bewegungen", die vor allem von den USA im Gefolge der "Sozialen Bewegungen" in den 1970er Jahren ihren Ausgang fanden, prägten und veränderten zusehends die Inhalte und Diskurse staatlicher Sozial- und Behindertenpolitik in Europa. (vgl. dazu z.B. Bloemers 2004, Österwitz 1996) Gerade das Thema der Zugänglichkeit der räumlichen Umwelt und damit zusammenhängend der Aspekt "barrierefreier Mobilität" (vgl. 2.3.2.2) erhielt in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit und wurde zu einem zentralen Diskussions- und Reibepunkt im "politischen Feld"[6] (Bourdieu 2001) beim Kampf von Menschen mit Behinderungen gegen Diskriminierung und für Inklusion und Partizipation.
Die alltäglichen Lebensvollzüge des Menschen sind strukturiert durch körperliche Eingebundenheit in Raum und Zeit. Täglich werden Wege im gebauten öffentlichen Raum zurückgelegt, sei es zu Fuß, mit dem Auto oder einem öffentlichen Verkehrsmittel. Wie sehr Mobilität[7] unser Leben beeinflusst, welche weit reichenden Verflechtungen und Qualitäten mit dem Mobilsein verbunden sind, wird den meisten Menschen oft erst bewusst, wenn sie ihre Mobilität einbüßen, sich die Voraussetzungen für das Mobilsein ändern. Sei es, dass ein Verkehrsunfall dazu führt, dass für die Fortbewegung ein Rollstuhl beansprucht werden muss oder, dass ein Kinderwagen zu schieben ist, ein Gipsfuß die bisherigen Mobilitätsgewohnheiten verändert oder aufgrund des fortschreitenden Alters und seiner Begleitumstände die Stufen in die Straßenbahn nur mühsam zu bewältigen sind.
Es bestehen für bestimmte Personengruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen, Frauen, Kinder) allerdings unterschiedliche Voraussetzungen zur Mobilität, öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen, sich diesen physisch aber auch kognitiv aneignen zu können, da die gebaute Umwelt und ihre Einrichtungen nach spezifischen Normen, die auf bestimmten Normalitätsvorstellungen basieren, ausgerichtet und konstruiert sind und diese manche Menschen bevorzugen und manche Menschen behindern oder ausschließen. Diese quasi normierten umweltspezifischen Rahmenbedingungen nehmen (neben sozialen oder wirtschaftlichen Komponenten) nicht nur Einfluss auf die individuelle Mobilitätssituation und das alltägliche Mobilitätsverhalten der Menschen, sondern sie sind - wie vorliegende Arbeit unter anderem aufzeigt - ein nicht zu unterschätzender Faktor hinsichtlich der Förderung oder Verminderung sozialer Exklusion.
Mobilität ist nicht nur eine Ressource, um physische und damit verbunden auch soziale Räume zu erreichen und sich diese dadurch anzueignen, sondern Mobilität gehört quasi zu einem "guten Leben" an sich. Sie nimmt Einfluss auf die Lebensqualität. Sie stellt eine Qualität an sich dar im Sinne von, sich (frei) zwischen verschiedenen Orten bewegen zu können. Darüber hinaus ist Mobilität nicht nur Voraussetzung, sondern auch eine gesellschaftliche (An-)Forderung an den modernen Menschen, um in den funktional getrennten, unterschiedlichen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit etc.) partizipieren und reüssieren zu können. (vgl. Stöppler 1999: 19f)
Das Thema der Mobilität bzw. Mobilitätsbehinderung von Menschen mit Behinderungen ist nicht auf eine "individuelle" oder "Minderheiten-Problematik" reduzierbar, sondern ist von "kollektiver", gesellschaftspolitischer Relevanz. Die Schaffung der Rahmenbedingungen für eine "inklusive Mobilität" - darunter ist Mobilität zu verstehen, die nicht nur bestimmten, sondern idealer Weise allen Menschen zugänglich ist und die die Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Personen entsprechend berücksichtigt - wäre die Aufgabe des (Sozial-)Staates, rechtlicher wie politischer Interventionen, um einerseits die faktische strukturelle Diskriminierung durch Mobilitätsbehinderung abzubauen und andererseits um soziale Exklusion zu vermeiden sowie die Teilhaberechte aller BürgerInnen zu gewährleisten.
Die Probleme von mobilitätsbehinderten Menschen und mit der Thematik verbundene Begriffe, wie "Barrierefreiheit"[8], "Barrierefreies Planen und Bauen", "Design für Alle"[9] stehen in Österreich seit den 1990er Jahren mehr oder weniger im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, gesetzlicher und politischer Interventionen sowie des (behinderten-)politischen Diskurses. Trotz eines gestiegenen Problembewusstseins auch bei den relevanten AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen (z.B. Politik, Behörden, Verkehrsbetreiber, ArchitektInnen, PlanerInnen) im "Mobilitätsfeld", und trotz des schon seit langem vorhandenen Know-hows zu barrierefreiem Planen und Bauen, kommt es in Österreich nur schleppend zu Verbesserungen der Mobilitätsrealität von Menschen mit Behinderungen.
Mit 1. Jänner 2006 trat in Österreich ein Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, im Rahmen dessen bauliche Barrieren als Tatbestand von Diskriminierung anerkannt werden. Hinsichtlich der Beseitigung baulicher Barrieren und nicht behindertengerechter öffentlicher Verkehrsmittel und Verkehrsanlagen sind allerdings lange Übergangsfristen, teilweise bis zum Jahr 2015 vorgesehen. Im Zusammenhang mit begleitenden weiteren Gesetzes(ab)änderungen, die im Rahmen des so genannten "Behindertengleichstellungspakets" erfolgten, werden etwa auch ArbeitgeberInnen aufgefordert - im Rahmen der "Zumutbarkeit" - bauliche Barrieren zu beseitigen.
Problemstellung und inhaltlicher Überblick
Vorweg ist zu erwähnen, dass meine Recherchen kaum auf empirisch fundiertes Datenmaterial oder wissenschaftliche Literatur stießen, die die Bedeutungszusammenhänge von räumlicher Ausgrenzung und sozialer Exklusion von Menschen mit Behinderungen genauer beleuchten. Dem Mangel an wissenschaftlichem Grundlagenmaterial begegnete ich durch selbstständiges Erarbeiten der für relevant befundenen Zusammenhänge innerhalb einer ausführlichen theoretischen Rahmung.
Es scheint, dass die Lebenslage behinderter Menschen noch eine eher untergeordnete Rolle im sozialwissenschaftlichen Diskurs spielt; sei es in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Phänomen sozialer Exklusion oder der Ausgrenzung beim Zugang zur Umwelt. Ein Grund für diese ungenügende Berücksichtigung kann darin gesehen werden, dass Behinderung noch bis vor kurzem - gewissermaßen entpolitisiert - primär als individuelle Problematik, als (defizitärer) "persönlicher Umstand" betrachtet wurde. Mittlerweile hat die internationale Entwicklung der Rehabilitationswissenschaften eine Veränderung dahingehend bewirkt, dass es zunehmend zu einer Zurückdrängung der individuumsbezogenen Perspektive zugunsten einer kompetenzorientierten und umfeldbezogenen Sichtweise von Behinderung kam. Damit wird Behinderung als soziales und politisches Faktum verstanden und der Fokus der Problembearbeitung auf eine strukturelle, soziopolitische und rechtliche Dimension gelegt. (vgl. Wansing 2005: 78f)
Ebenso ist anzumerken, dass meine Recherchen zu empirischem Datenmaterial hinsichtlich der österreichweiten Mobilitätssituation bzw. -problematiken von Menschen mit Behinderungen mehr oder weniger erfolglos blieben.[10] Das mag daran liegen, dass sowohl Mobilität als auch Behinderung komplexe und differenzierte Querschnittsmaterien darstellen. Das heißt, dass z.B. gesetzliche Bestimmungen, die für die Rahmenbedingungen zur Mobilität relevant sind, unterschiedlichste Kompetenzebenen tangieren (Bundes-, Landes-, Gemeindeebene) und folglich unterschiedliche Bestimmungen in einzelnen Bundesländern wirksam sind, deren Vollziehung schließlich die alltäglichen Mobilitätsbedingungen der Menschen unterschiedlich beeinflussen. Eine weitere Rolle spielt vielleicht auch, dass die Gruppe mobilitätsbehinderter Menschen sehr heterogen ist (vgl. 2.3.1) und dies eine umfassendere österreichweite Untersuchung der Situation bzw. der tatsächlichen Mobilitätsbedingungen mobilitätsbehinderter Menschen erschwert.
Aufgrund zeitlich wie budgetär eingeschränkter Ressourcen zur Erstellung der Diplomarbeit, kann dieser den Arbeitsbegriffen inhärenten Komplexität ebenfalls nur bedingt Rechnung getragen werden. Einerseits wird versucht, die österreichweit bedeutsamen und für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen relevanten Inhalte und Maßnahmen staatlicher (Behinderten-)Politik nachzuzeichnen. Andererseits wird durch die Bezugnahme auf die spezifische Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen in Wien versucht, das strukturelle Problem der Diskriminierung behinderter Menschen durch Ausgrenzung in der Mobilität auch in seiner "mikropolitischen" Dimension aufzuzeigen. Das heißt, in der alltäglichen Auswirkung struktureller Diskriminierung und Exklusion auf eine ausgewählte Personengruppe mobilitätsbehinderter Menschen. Die Rückbindung an die "Makroebene" ergibt sich alleine aufgrund der Frage, wie jene ausgrenzenden Mobilitätsbedingungen zu beseitigen sind - und dabei richtet sich mein politikwissenschaftlicher Fokus primär auf das politische (Macht-)Feld, auf (behinderten)politische und rechtliche Interventionen im Mobilitätskontext.
Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße und in mehrfacher Hinsicht von sozialer Exklusion betroffen. (vgl. Wansing 2005) Ein Teilbereich, in dem sich soziale Exklusion manifestieren kann und dem hohe Aufmerksamkeit bezüglich der Gewährleistung und Schaffung voller gesellschaftlicher Inklusion behinderter Menschen zu schenken ist, ist jener der Mobilität.
Vor diesem Hintergrund ist die Zielsetzung der vorliegenden Diplomarbeit die empirische Untersuchung, Analyse und Bewertung der Mobilitätssituation behinderter Menschen in Österreich am Beispiel der Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen in Wien. Zum einen interessiert dabei der Status quo der Mobilitätsproblematik in Österreich (Wien), sowohl hinsichtlich der objektiven Rahmenbedingungen zur Mobilität (z.B. barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel) als insbesondere auch hinsichtlich der (behinderten)politischen und rechtlichen Interventionen. Weiters soll anhand der durchgeführten Fallstudie (Befragung von RollstuhlfahrerInnen in Wien) die alltägliche Praxis und Wirkung sozialer Exklusion und struktureller Diskriminierung durch Mobilitätsbehinderung aufgezeigt werden. Schließlich ist es mir ein Anliegen, Maßnahmenvorschläge zu präsentieren, die Schritte hin zu einer inklusiven Mobilität sein können.
Dahingehend schließen sich die forschungsleitenden Fragen an:
-
Welche Bedeutung und welchen Stellenwert hat Mobilität für die gesellschaftliche Partizipation von Menschen mit Behinderungen? Inwiefern spielt Mobilität im Zusammenhang mit sozialer Exklusion bzw. sozialer Inklusion von Menschen mit Behinderungen eine Rolle?
-
Welche Resonanz erfährt die Mobilitätsproblematik von Menschen mit Behinderungen in der internationalen und insbesondere der österreichischen Behindertenpolitik? Ist die Mobilitätsproblematik behinderter Menschen auf der behindertenpolitischen Agenda und wenn ja, welche Konzepte, Ansätze und Tendenzen können dabei ausgemacht werden?
-
Welche (behinderten)politischen und rechtlichen Interventionen erfolgten bislang in Österreich, die zu einer "inklusiven Mobilität" beitragen können?
-
Wie ist der Status quo barrierefreier Mobilität in Österreich (Wien)? Welche Rahmenbedingungen vor allem hinsichtlich der Teilhabe an der öffentlichen Verkehrsmobilität bestehen? Welche Tendenzen sind zu erkennen?
-
Wie zeigt sich die alltägliche Mobilitätsrealität von Menschen mit Behinderungen - beispielhaft diejenige von RollstuhlfahrerInnen in Wien? Mit welchen Barrieren haben sie in ihrer alltäglichen Mobilität zu kämpfen? Von welchen Schwierigkeiten ist ihr Mobilitätsverhalten gekennzeichnet?
-
Welche Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien können formuliert werden?
In der theoretischen Rahmung soll anhand der inhaltlichen Analyse von wissenschaftlicher Sekundärliteratur im Rahmen selektiver Theoriearbeit (vgl. dazu ausführlicher S. 18) ein Einblick in die Zusammenhänge zwischen Mobilität/Mobilitätsbehinderung und sozialer Inklusion/Exklusion von Menschen mit Behinderungen gegeben werden.
Zunächst ist es erforderlich, die wesentlichen Begriffe zu erläutern. So wird im 1. Kapitel zum einen dem "Phänomen Behinderung" nachgegangen. Aufgezeigt werden unterschiedliche Definitionen und Erklärungsmodelle zu Behinderung und welches Verständnis von Behinderung für die thematische Auseinandersetzung bedeutsam erscheint. (vgl. 1.1) Zum anderen werden in einem Exkurs die Begriffe soziale Exklusion und soziale Inklusion kurz erläutert (vgl. 1.3), um daran anknüpfend auf die besondere Gefährdung von Menschen mit Behinderungen durch soziale Exklusion einzugehen. In diesem Kontext werden - soweit dies die mangelhafte Datenlage zulässt - mit Bezugnahme auf die österreichische Situation spezifische Ausgrenzungsbereiche (ökonomische Ausgrenzung, Ausgrenzung im Bildungsbereich, Barrieren im Zugang zur Umwelt und Dienstleistungen) anvisiert. (vgl. 1.4) Grundsätze und Richtlinien in der internationalen Behindertenpolitik - wobei das Hauptaugenmerk sich auf die Europäische Union richtet -, zur Risikobearbeitung sozialer Exklusion unter besonderer Berücksichtigung des Ausgrenzungsfeldes Mobilität sollen aufgezeigt werden. (vgl. 1.5)
Im 2. Kapitel wird die Bedeutung, die dem Mobilitätsbereich als Feld der Ausgrenzung bzw. Inklusion zukommt herausgearbeitet. Dazu erschien es notwendig etwas weiter auszuholen. Mobilität ist nicht loszulösen von der gebauten Umwelt, dem gebauten Raum samt seiner Einrichtungen (z.B. Verkehrsmittel). Mobilität spielt sich im (öffentlichen) gebauten Raum ab. Im einleitenden Exkurs dieses Kapitels (vgl. 2.1) wird zunächst auf die enge Verknüpfung und Wechselwirkung von gebautem und sozialem Raum eingegangen und aufgezeigt, dass gebauter Raum nichts "Naturgegebenes" ist, sondern anhand ganz bestimmter Norm-Vorstellung konstruiert wird, die von den Entscheidungs- und Definitionsmächtigen (z.B. PolitikerInnen, ArchitektInnen oder PlanerInnen) durchgesetzt werden. Inwiefern Zugang und Nutzung gebauten Raumes als Kämpfe um Ressourcen anzusehen sind bzw. inwiefern sich darin Machtverhältnisse ausdrücken und widerspiegeln wird ebenso versucht zu skizzieren. An den Exkurs anknüpfend wird unter anderem auf die Funktionen und Dimensionen von Mobilität Bezug genommen und geklärt, weshalb Mobilität als "machtvolle Ressource" bzw. "ermächtigende Ressource" anzusehen ist. (vgl. 2.2) Welche Mobilitätsbarrieren wirksam werden können bzw. welche Anforderungen an eine "barrierefreie Mobilität" für Menschen mit Behinderungen bestehen und welche Rahmenbedingungen und AkteurInnen im politischen Feld Mobilität zu berücksichtigen sind, wird am Ende des Kapitels bearbeitet. (vgl. 2.3)
Nachdem im 3. Kapitel nochmals ausführlicher die wesentlichen Implikationen zwischen Mobilität/Mobilitätsbehinderung und sozialer Inklusion/Exklusion zusammengefasst werden, geht es im empirischen Teil der Arbeit um die Erhebung, Analyse und Bewertung der Mobilitätsbedingungen behinderter Menschen in Österreich am Fallbeispiel der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Behindertenpolitik, die als wesentliche Akteurin und Gestalterin der Rahmenbedingungen zur Mobilität anzusehen ist. Als Bewertungsmaßstab dient das gesellschaftspolitisch anzustrebende Ziel der Gewährleistung "inklusiver Mobilität" bzw. der Schaffung "inklusiver Mobilitätsbedingungen".
Aufbereitet und in die Analyse miteinbezogen wurden in diesem Zusammenhang zusätzlich zu Interviews mit RollstuhlfahrerInnen in Wien, Datenmaterial und Literatur zur Mobilitätssituation behinderter Menschen in Österreich, (partei)politische Programme, Dokumente, Internetinformationen und durchgeführte Interviews mit (partei-)politischen AkteurInnen und ausgewählten ExpertInnen aus dem Behindertenbereich. (vgl. 4, Anhang)
In Kapitel 5 beschäftige ich mich nach Ausführungen zu den wesentlichen AkteurInnen in der österreichischen Behindertenpolitik (vgl. 5.1) primär mit ausgewählten politischen und rechtlichen Interventionen in Österreich, die im Kontext der Mobilitätsthematik behinderter Personen stehen. Einerseits werden diesbezüglich wichtige Grundsätze, Konzepte und Programmatiken diskutiert. (vgl. 5.2) Andererseits interessieren gesetzliche Regelungen und Maßnahmen, die hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur Schaffung "inklusiver Mobilitätsbedingungen" zu berücksichtigen sind. (vgl. 5.3)
Daran anschließend werden im 6. Kapitel die objektiven Rahmenbedingungen, der Status quo der Mobilitätssituation behinderter Personen in Österreich und insbesondere in Wien anschaulich gemacht, u.zw. entlang wesentlicher Mobilitätsbereiche: barrierefreies Planen und Bauen, ÖPNV, Fahrtendienste und motorisierter Individualverkehr.
Einen Schwerpunkt der Diplomarbeit bildet die durchgeführte Fallstudie. (vgl. 7) Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Herstellung von Inklusion bzw. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht ausschließlich an Gesetzen oder politischen Deklarationen gemessen werden kann oder sollte, sondern an den Teilhabechancen, die sich ihnen im konkreten Lebensumfeld bieten oder eben versagt werden! (vgl. Golka 2004: 5)
Die Erhebungsarbeiten zur Fallstudie (Interviews mit RollstuhlfahrerInnen sowie mit ausgewählten AkteurInnen und ExpertInnen im Mobilitätsbereich) wurden von mir im Auftrag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Wien im Rahmen des vom Bundessozialamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland geförderten und aus den Mitteln der österreichischen Beschäftigungsoffensive (2001) finanzierten Projekts "RollstuhlfahrerInnen in Wien" (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002), zwischen Februar und August 2001 durchgeführt. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Erlaubnis zur Verwendung des Datenmaterials (ausgenommen sind die Gespräche mit den BehindertensprecherInnen der politischen Parteien, die nicht im Rahmen des Projekts, sondern ausschließlich im Rahmen der Diplomarbeit geführt wurden) für diese Diplomarbeit bedanken.
Vorgenommen wurde eine Befragung von RollstuhlfahrerInnen in Wien zu ihrer alltäglichen Mobilitätssituation und ihrem alltäglichen Mobilitätsverhalten. Im Kapitel "Methodik und Zielgruppenbeschreibung" (vgl. 7.1) wird ausführlich auf die Methodenwahl und die methodische Vorgangsweise bei der Erhebung sowie auf die Auswertung eingegangen. Die anhand eines problemzentrierten Leitfadens durchgeführten und qualitativ (inhaltsanalytisch) ausgewerteten Interviews verdeutlichen die mannigfaltig barrierebehaftete Mobilitätsrealität dieser Gruppe mobilitätsbehinderter Personen. Die Ergebnisse der Untersuchung (vgl. 7.3) werden entlang der spezifischen Barrierefelder: Fortbewegung "zu Fuß"/per Rollstuhl, Nutzung des motorisierten Individualverkehrs, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrtendienst, soziale Barrieren sowie Informationsbarrieren illustriert. Wobei der Zitation der Aussagen der Interviewten bewusst und ausreichend Platz eingeräumt wurde, um den Subjektstatus der Befragten zu "erhalten".
Ein Ertrag der Fallstudie ist, empirische Befunde zur alltäglichen Mobilitätsproblematik der ausgewählten Personengruppe der RollstuhlfahrerInnen in Wien und damit Einsicht in die Manifestationen struktureller Ausgrenzung auf der individuellen ("Mikro")-Ebene zu liefern sowie darauf basierend Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der Situation aufzeigen zu können.
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit in einem gerafften Fazit hervorgehoben sowie einige Maßnahmenvorschläge und Good-Practice-Beispiele insbesondere zur Verbesserung der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien aufgezeigt. (vgl. 8)
Last but not least ist es mir ein Anliegen mich ganz besonders bei allen InterviewpartnerInnen für ihr zeitliches Engagement, die hohe Kooperationsbereitschaft und ihre Offenheit zu bedanken!
[1] Diskriminierung geht grundsätzlich "mit ungleichmäßig verteilter Limitierung von Lebenschancen einher und hat u.a. zur Folge, dass Mitglieder der betroffenen Gruppe ¬im Vergleich mit den privilegierten - ihre Fähigkeiten nicht ausreichend zur Geltung bringen können" (Aleksandrowicz 1996: 330). Unter direkter Diskriminierung kann etwa Verspotten, Beschimpfen oder Gewalttätigkeiten verstanden werden. Eine strukturelle Diskriminierung liegt beispielsweise vor, wenn ein öffentliches Verkehrsmittel nicht benützt werden kann. Eine Diskriminierung kann nicht nur ein "Tun", sondern auch ein "Unterlassen" sein. (vgl. Heiden 1997)
[2] "Die sozialstaatliche Bearbeitung sozialer Risiken setzt ein, wenn die Normalität biografischer Lebensläufe, wie sie das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt verkörpern, nicht zutrifft und zielt darauf, Individuen in die Lage zu versetzen, ihre Lebensführung (wieder) an den Inklusionsbedingungen der Funktionssysteme auszurichten: durch überbrückende Versicherungsleistungen, Ausbildungsunterstützungen, Rehabilitationsmaßnahmen usw." (Wansing 2005: 105)
[3] Unter Kulturimperialismus zu leiden heißt, so Young (1996: 127), "(...) zu erfahren, wie durch die in einer Gesellschaft herrschenden Werte die besondere Perspektive der eigenen Gruppe unsichtbar gemacht und wie zugleich die eigene Gruppe stereotypisiert und als das Andere gekennzeichnet wird. (...) Kulturimperialismus bedeutet, dass die Erfahrungen und die Kultur der herrschenden Gruppe universalisiert und zur Norm gemacht werden".
[4] Empowerment steht sowohl für die Überwindung sozialer und gesetzlicher Ungleichheiten sowie Diskriminierung als auch für einen Prozess, in dem Betroffene ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, ihre Ressourcen erkennen und nutzen unter der Leitperspektive einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 38f)
[5] Persönliche Assistenz "ist eine auf die individuellen Bedürfnisse ‚maßgeschneiderte' Hilfe, die die Assistenznehmer/innen in die Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Körperpflege, Haushaltshilfe, Mobilitätshilfe sowie Kommunikationshilfe." (Firlinger/Integration:Österreich 2003: 41) Genaueres zur persönlichen Assistenz siehe unter 8.2.5.2
[6] Bourdieu (2001) versteht das "politische Feld" als Mikrokosmos, als "kleine, relativ autonome soziale Welt innerhalb der großen sozialen Welt" (41). Der Begriff erlaubt es, so Bourdieu, die Realität der Politik oder des politischen Spiels genau zu erfassen und mit anderen Realitäten (z.B. religiöses, künstlerisches Feld) zu vergleichen. Jedes Feld kann als ein Kampffeld zur Veränderung von Kräfteverhältnissen betrachtet werden, wobei die politischen Kämpfe gewissermaßen "Klassifizierungskämpfe" sind. Das heißt, Politik kann als ein Kampf um die Formulierung und Durchsetzung der "guten" Sicht- und Teilungsprinzipien (z.B. Teilung in Arme und Reiche, Behinderte und Nichtbehinderte), um Ideen und um Macht gesehen werden. Aber auch die Grenzen, die Definition des politischen Feldes an sich sind umkämpft - die Frage der Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit wird hierbei gestellt. Es kann sein, dass "Neulinge" die Prinzipien der Zugehörigkeit so verändern, dass Personen, die nicht dazugehört hatten, plötzlich dazugehören bzw. vice versa. Es kann dann von einem so genannten "Paradigmenwechsel" gesprochen werden. Damit zeigt sich eine Besonderheit des politischen Feldes: "es bleibt ständig auf seine Klientel bezogen, auf die Laien" (ebd.: 51). Bourdieu (2001) bemerkt innerhalb der letzten 20 Jahren eine wichtige Veränderung in der Politik u.zw., dass z.B. JournalistInnen oder MeinungsforscherInnen, die vormals ZuschauerInnen des politischen Feldes waren, zu AkteurInnen im eigentlichen Sinn wurden. Auch soziale Bewegungen können in diesem Zusammenhang genannt werden. Allerdings sieht der Soziologe eine Schwierigkeit für die neueren sozialen Bewegungen darin, dass sie vom politischen Feld auch als politisch anerkannt werden. Um Bedeutung zu gewinnen, könnten sie etwa versuchen mit Hilfe von z.B. JournalistInnen oder Gewerkschaften das Interesse der Leute zu wecken, die sich im politischen Feld befinden.
[7] Die ursprüngliche Bedeutung von Mobilität geht auf den lateinischen Begriff "mobilitas" (=Beweglichkeit) zurück (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1998: 12) und wird laut Duden (1990) sowohl als "Beweglichkeit von Individuen oder Gruppen innerhalb der Gesellschaft" als auch "die Häufigkeit des Wohnsitzwechsels einer Person" definiert. In vorliegender Arbeit ist prinzipiell von räumlicher Mobilität und im speziellen von Mobilität im öffentlich-städtischen (Verkehrs¬)Raum die Rede. Näheres zum Mobilitätsbegriff siehe unter 2.2, 2.3
[8] Unter "Barrierefreiheit" wird die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Gebäuden und Informationen für alle Menschen verstanden, egal ob RollstuhlfahrerInnen, Eltern mit Kinderwägen, blinde, alte oder gehörlose Menschen etc. (vgl. Firlinger/Integration: Österreich 2003).
[9] "Design für Alle" bzw. "universelles Design" ist ein Konzept nach dem Produkte, Systeme und Dienstleistungen für eine möglichst große BenutzerInnengruppe in einer möglichst breiten Umgebung benutzbar sein sollen. Besonders werden die Anliegen der NutzerInnengruppe der älteren und behinderten Menschen einbezogen. Die Anwendung "universellen Designs" beispielsweise durch barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum kommt fast immer auch allen NutzerInnengruppen - nicht nur Menschen mit Behinderungen - zu Gute. Beispielsweise erleichtert eine Rampe nicht nur einem/einer RollstuhlfahrerIn den Zugang zu einem Gebäude, sondern ebenso älteren Menschen oder Eltern mit Kinderwägen. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003)
[10] Eine österreichweite Einschätzung zur Zugänglichkeit (von den AutorInnen verstanden als barrierefreie Gestaltung und Ausstattung von Gebäuden sowie Benutzbarkeit von Verkehrsmitteln und Einrichtungen zu Telekommunikation für behinderte Personen) gibt grob die Studie von Riess/Flieger (2000). In der vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999 herausgegebenen Broschüre zur Lage behinderter Menschen im Mobilitätsbereich (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999) oder im Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2003a), wird ebenfalls nur spärlich auf empirische Daten gestützt, die Mobilitätssituation von Menschen mit Behinderungen in Österreich beschrieben. Ausführliche und zahlreichere Literatur gibt es dagegen zu planerischen und gestalterischen Lösungsansätzen zur Beseitigung der baulichen und konstruktionsbedingten Hindernisse und Benachteiligungen von behinderten Menschen. (vgl. dazu z.B. Weidert 2000, Magistrat Graz 1994, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 2003) Einige Studien und Arbeiten beschäftigten sich mit der Mobilitätssituation und ¬problematik behinderter Menschen in spezifischen, ausgewählten Kontexten, sei es hinsichtlich der vorgenommen Eingrenzung der Zielgruppe, des Bundeslandes/Ortes oder des Barrierefeldes. Nennenswert sind hierbei etwa die Studien von Theussl/Lückler/Steinbacher (1991) und von Haselsteiner/Reiter (2000), die sich auf die Mobilität für Menschen mit Behinderungen in Graz/Steiermark konzentrierten. Die Studie von Drexel et al. (1991) fokussiert als Untersuchungsgegenstand die Anforderungen von Menschen mit Behinderungen an öffentliche Freiflächen. Die beiden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit herausgegebenen Studien gehen konkret auf die Mobilitätsproblematik bestimmter Personengruppen (in Wien) ein u.zw. von RollstuhlfahrerInnen sowie sehbehinderten Menschen. (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002, Wölfl/Leuprecht 2004)
Vorbemerkung
Im Rahmen selektiver Theoriearbeit, die neben Begriffsklärungen primär die abstrakteren Zusammenhänge und für relevant befundenen Aspekte im politischen Feld von Mobilität und Behinderung als Bezugspunkt hatte, wurde auf Sekundärliteratur aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Quellen zurückgegriffen. Es dienten beispielsweise Texte, die der (feministischen) Sozialgeographie bzw. Stadtplanung sowie der Verkehrssoziologie zuzuordnen sind oder auf handlungs- und strukturationstheoretischen Raum- bzw. Machttheorien basieren, genauso als Quellen, wie sozialwissenschaftliche Studien zu sozialer Exklusion (und Behinderung) oder auch so genannte "Disability Studies" mit unterschiedlichen Fokussierungen (z.B. behindertenpolitisch, behindertenpädagogisch oder rechtlich orientiert). Ebenfalls recherchiert und in die Analyse miteinbezogen wurden z.B. politische Programmatiken, Dokumente, Proklamationen oder auch Informationen aus dem Internet. Anzumerken ist, dass das Heranziehen jener aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen stammenden Quellen nicht ganz "freiwillig" erfolgte, da im Zuge der Recherchen leider keine adäquate Literatur gefunden wurde, in der die Bedeutung räumlicher Mobilität im Kontext von Behinderung und (sozialer) Exklusion bereits bearbeitet wurde. Insofern sind die umfangreicheren Ausführungen der theoretischen Rahmung dieser Arbeit zu erklären. Es wird aber keinesfalls der Anspruch gestellt, diese "Lücke" schließen zu können. Es wurde lediglich der Versuch unternommen, einen etwas genaueren Blick auf Hintergründe und Verquickungen von Mobilität und Exklusion zu werfen. Ich wollte darauf nicht verzichten, weil die gesellschaftspolitische Bedeutung von Mobilität/Mobilitätsbehinderung transparent gemacht werden sollte sowie auch den Zusammenhängen zwischen Mobilitätsbehinderung und sozialer Exklusion behinderter Menschen ein angemessener Raum gewährt werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Definition(en) und Erklärungsmodelle von Behinderung
- 1.2 Daten zu (mobilitäts)behinderten Menschen in Österreich
- 1.3 Exkurs: Exklusion vs. Inklusion
- 1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)
- 1.5 Grundsätze und Richtlinien internationaler Behindertenpolitik zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
Bevor auf den Stellenwert und die Bedeutung die Mobilität im Kontext sozialer Exklusion bzw. Inklusion von Menschen mit Behinderungen hat, eingegangen werden kann, ist es notwendig, die Begriffe "soziale Exklusion" und "soziale Inklusion" kurz zu erläutern und sich anzusehen, welche Exklusionsrisiken insbesondere mit "Behinderung" verbunden sind.
Zunächst ist es aber unumgänglich, sich mit dem sehr vieldeutigen und assoziativen Begriff Behinderung zu befassen. Wobei an dieser Stelle natürlich keine Abhandlung über die vielfältigen historischen, philosophischen, medizinischen, rechtlichen etc. Auffassungen und Betrachtungsweisen zu bzw. über Behinderung erfolgen kann. Vielmehr werden aus einer Vielzahl an Erklärungsmodellen und Definitionen zu Behinderung nachstehend diejenigen Ansätze herausgegriffen, die für den thematischen Zusammenhang dieser Arbeit wichtig befunden wurden.
Es ist eine Annäherung an den Begriff Behinderung wichtig, weil einerseits Behinderung als behinderten-, sozial-, oder antidiskriminierungspolitische Kategorie fungiert und andererseits die herrschenden Sichtweisen oder Erklärungsmodelle von Behinderung Einfluss auf die "belief systems" (Grundüberzeugungen) und damit verquickt auf das Verhalten und Agieren relevanter AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen, sowohl im "Mobilitätsfeld" als auch im "politischen Feld" beeinflussen können. Weiters gilt es darzulegen, welche Sichtweisen oder Definitionen von Behinderung für die thematische Auseinandersetzung tauglich befunden werden, um die Beseitigung von Diskriminierung qua Mobilitätsbehinderung zu erreichen.
Behinderung, kann global konstatiert werden, ist ein komplexes Feld, das sich gegen eindimensionale Betrachtungsweisen sträubt. (vgl. Bernard 1995: 184) Behinderung kann als "gesellschaftliche Konstruktion" (Rommelspacher 1999) betrachtet werden.
"(...) denn nicht die faktische Beeinträchtigung ist das entscheidende Problem, sondern die Konstruktion einer Normalität (Hervorhebung, T.E.), die nur für bestimmte Menschen gilt und die die anderen als andere ausgrenzt. Wer und wie sehr jemand als anders begriffen wird, ist jedoch nicht zufällig, sondern spiegelt die Wertmaßstäbe dieser Gesellschaft wider." (ebd. 10)
Behinderung kann aber auch als eine verbreitete persönliche Erfahrung und als ein weltweites Phänomen mit weit reichenden wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Verzweigungen für die gesamte Gesellschaft gesehen werden. (vgl. Barnes 2002: 311)
Zu betonen ist, dass es keine allgemein - sei es national oder international - anerkannte oder gültige Bestimmung von Behinderung gibt. (vgl. Badelt/Österle 1993) Es ist in diesem Zusammenhang daher von ganz entscheidender Bedeutung wer die "Definitionsmacht" (Rommelspacher 1995) besitzt, Behinderung zu definieren.
Definitionen von Behinderung sind dahingehend als problematisch anzusehen, da bereits "durch das Definieren einer Gruppe die Möglichkeit geschaffen (wird; Anmerkung T.E.), diese auszugrenzen". (Drexel et al. 1991: 9)
"Behinderung ist ein Produkt von Definitionen und Praktiken, die versuchen, Personen auszuschließen, die als von den sozial gefestigten Normen der ‚körperlich Gesunden' abweichend angesehen werden können. Kurz gesagt wird das ‚Behinderung' benannt, was die ‚Behinderungsgesellschaft' entscheidet. ... Es ist nicht das innewohnende Wesen der Behinderung das zählt, sondern der Klassifizierungsprozess, der die Menschen aufgrund ihrer Position in Bezug zu den dominanten Strukturen und Werten der Gesellschaft kategorisiert." (Bury zitiert nach Johnstone 2004: 157)
Definitionen von Behinderung können nicht nur als Richtlinien für eine Maßnahmenpolitik im Bereich Behindertenpolitik dienen, sondern sie fließen auch explizit in die Gesetzgebung ein und bilden Zugangskriterien für z.B. sozialstaatliche Förderungen und Leistungen. Liegt bei Antidiskriminierungsvorschriften (Definitionen sind im Allgemeinen hier weiter gefasst) beispielsweise das Augenmerk eher auf dem Tatbestand der Diskriminierung als auf dem Gesundheitszustand der betreffenden Person, so sind die in der Sozialpolitik verwendeten Definitionen restriktiver, da sie dann zur Anwendung kommen, wenn es gilt begrenzte Mittel unter Menschen mit anerkannten Bedürfnissen zu verteilen. (vgl. Europäische Kommission 2002)
Die mangelnde Klarheit über den Begriff Behinderung kann allerdings auch ein Hemmnis sein, wenn es um die Bewertung der Behindertenpolitik und -programme geht. (ebd.: 3f) Darüber hinaus
"ist die Frage der Definitionen von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung kohärenter Strategien für den Umgang mit Behinderung und für das Verständnis der Wechselwirkungen der Entwicklungen in diesem spezifischen Bereich (der Bereich der Behindertenpolitik; Anmerkung T.E.) mit anderen verwandten Politikbereichen, wie Antidiskriminierungsmaßnahmen, Einkommensförderungsprogrammen und allgemeinen Arbeitsmarktkonzepten". (ebd.: 4)
Unterschiedliche Erklärungsmodelle von Behinderung sind Teil gegenwärtiger behinderten- wie sozialpolitischer Diskurse und Debatten in deren Rahmen Fragen darüber aufgeworfen werden, welche Ansichten in punkto Behinderung am ehesten dazu geeignet sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren. (ebd.: 61) Ebenso bilden jene Modelle und Sichtweisen von Behinderung die Grundlage für behinderten- und sozialpolitische Interventionen bzw. Interventionsstrategien zur Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen behinderter Personen. Mit anderen Worten, gesellschaftspolitisch dominierende Sichtweisen zu Behinderung fließen in medizinische, arbeits- oder sozialrechtliche Definitionen von Behinderung ein und verändern diese auch. Schauen wir uns folglich näher ausgewählte Erklärungs- bzw. Interventionsmodelle an.[11]
Das medizinische Erklärungsmodell lässt sich dadurch charakterisieren, dass es Behinderung "individualisiert". Behinderung wird als persönliches Problem oder persönliche Tragödie verstanden bzw. evoziert, als gesundheitliches Defizit, verursacht durch Unfall oder Krankheit. Behinderung wird als Abweichung von bestimmten gesundheitlichen Normvorstellungen von ÄrztInnen diagnostiziert und klassifiziert, wobei dieser Klassifikationsprozess als hierarchisch-dualistisch konnotiert zu verstehen ist: auf der einen "besseren" Seite, Gesundheit/Leistungsfähigkeit/Normalität etc. - auf der anderen "schlechteren" Seite, Krankheit/Behinderung/Abnormalität etc. Der so "konstruierte" behinderte Mensch ist ausschließlich PatientIn, der/dem geholfen werden muss sich so weit wie möglich zu rehabilitieren, sprich, durch richtige Behandlung wieder "ganz" zu werden. (Johnstone 2004: 165fff)
Auch beim Erklärungsmodell der Rehabilitation, das in seiner traditionellen Form auf einer Interpretation von Pflege für behinderte Menschen als "Wiederherstellung" basiert, dient eine "Normalität" als Richtschnur, die es für den Betroffenen gilt (wieder) zu erlangen. Wobei, erweitert zur medizinischen Intervention, die Teilnahme des Individuums am Entscheidungsprozeß zur Rückkehr in die bestehende Gesellschaft betont wird. Eine Angleichung an die "normale" Lebensweise der nichtbehinderten Mehrheit in der Gesellschaft, eine Integration in die Mainstream-Gesellschaft ist das Ziel, das durch entsprechende Pflege sowie Adaption der Umgebung gewährleistet werden soll. Rehabilitation als Intervention basiert, wie Johnstone (2004) schreibt, auf einer als problematisch anzusehenden Interpretation von Normalität und tendiert dazu, "die persönliche Tragödie der Auswirkung der Beeinträchtigung auf die Lebensweise und den markanten Unterschied zur funktionalen Lebensweise nichtbehinderter Menschen zu betonen" (169).
Im Gegensatz zum medizinischen und dem auf Rehabilitation bezogenen Erklärungsmodell betrachtet der soziale Ansatz
"Behinderung nicht als eine einer Person innewohnende Eigenschaft, sondern als Produkt des sozialen Kontextes und Umfelds dieser Person, einschließlich der physischen Strukturen dieses Umfelds (Gebäudekonstruktionen, Beförderungssysteme usw.) sowie der sozialen Konstrukte und Überzeugungen, die zur Diskriminierung behinderter Menschen führen." (Europäische Kommission 2002: 21)
Das soziale Modell versteht damit Behinderung in Relation zur gesellschaftlichen Umwelt, die durch ihre Strukturen behindernd wirken kann. Damit wird -und dies wird als große Stärke dieses Modells von Johnstone (2004) hervorgehoben -"die Last der Verantwortung vom Individuum mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung auf die Beschränkungen, die durch die Struktur der Umwelt und die Einstellungen von Institutionen und Organisationen auferlegt werden, verschoben" (170).
Als wesentliche Merkmale oder Grundsätze des sozialen Modells benennt Johnstone (2004: 170):
-
Anerkennung der Interaktion von Struktur- und Verhaltensvariablen, die Behinderung erzeugen,
-
Anerkennung der Meinung des behinderten Menschen,
-
Anerkennung der politischen Prozesse, die unterdrücken,
-
gibt behinderten Menschen oder deren Organisationen mehr Kontrolle.
Der Ansatz problematisiert im Vergleich zum medizinischen Modell nicht den behinderten Menschen, sondern impliziert politische Maßnahmen, die vorhandene Barrieren oder Situationen ermitteln und beseitigen und dadurch die volle gesellschaftliche Partizipation behinderter Menschen ermöglichen. Die Politik bzw. politischen EntscheidungsträgerInnen werden durch die Konsequenzen aus dem sozialen Ansatz auf die Möglichkeiten hingewiesen, dass es nicht unbedingt nötig ist, zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen zu unterscheiden um (Verbesserungs-)Maßnahmen zu setzen, sondern eher die Unterscheidung von behindernden oder "befähigenden Faktoren" bedeutsam sein kann. Ein Beispiel für letzteres ist etwa eine Rollstuhlrampe, die dazu befähigt eine physische Barriere zu überwinden, wobei deren Nutzung "frei von Rivalität" ist, das heißt, durch die Rampe wird niemand anderer beeinträchtigt. (Europäische Kommission 2002: 21f)
Eine quasi politisierte Erweiterung des sozialen Ansatzes stellt das "auf Rechten basierende Modell" von Behinderung dar. Richtet sich beim medizinischen und rehabilitativen Ansatz der Fokus primär auf das Individuum und beim sozialen Modell auf die Relationen zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt, wird beim rechtlichen Modell Behinderung gewissermaßen kollektiver verstanden. Damit ist gemeint, dass behinderte Menschen eine "Gruppe" oder es könnte auch gesagt werden, eine politische Kategorie - wie Frauen, schwule, lesbische, schwarze Menschen etc. - bilden, die sich selbst definiert und öffentlich artikuliert, über das was ihr gemein ist: die Erfahrung von Diskriminierung, Chancenungleichheit und Verweigerung von (Menschen-)Rechten. (vgl. Johnstone 2004: 172f)
Dieses Erklärungsmodell politisiert Behinderung als persönliche Erfahrung innerhalb struktureller gesellschaftspolitischer Gegebenheiten, die verändert werden können und im Hinblick auf die angestrebte Gleichstellung, Selbstbestimmung und volle gesellschaftliche Inklusion auch verändert werden müssten. (ebd.)
Das auf Rechten basierende Modell erkennt
-
die Existenz von struktureller Diskriminierung behinderter Menschen,
-
die gemeinsame Kraft der Menschen,
-
den Subjektstatus behinderter Menschen, die ihre Ansprüche formulieren,
-
die Gesetzgebung als Basis einer Durchsetzung von Rechten
-
und die Sanktionierung von Behindertendiskriminierung an. (ebd.: 173)
Beim auf Rechten basierenden Modell geht es also nicht um die Veränderung von Rahmenbedingungen unter der Berufung auf eine individuelle Gerechtigkeit oder Fairness (wie es beim Modell der sozialen Intervention eher der Fall ist), sondern es geht um die Veränderung der Gesellschaftsstruktur durch Anerkennung behinderter Menschen als Menschen, die wie alle anderen Anspruch auf die Wahrung und Durchsetzung ihrer vollen BürgerInnenrechte haben. Auf das Thema Mobilitätsbehinderung bzw. -barrieren bezogen hieße das, dass Maßnahmen zu deren Beseitigung und der Schaffung inklusiver Mobilitätsbedingungen als die Einlösung vorenthaltener sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gleichheits-und Grundrechte anzusehen wären.
Neuere Sichtweisen und Definitionen von Behinderung lassen - international betrachtet - eine Weiterentwicklung in der (staatlichen) Behindertenpolitik der letzten Jahre erkennen - weg von einer medizinischen, hin zu einer sozialen/umfeldbezogenen Betrachtungsweise von Behinderung, welche auch als Reaktion auf sich wandelnde Einstellungen der Gesellschaft gegenüber Behinderung gesehen werden kann. Bei neueren Politikmaßnahmen geht der allgemeine Trend, laut OECD Studie (2003), in die Richtung, dass Behinderung weniger als individuelles (medizinisch-defektologisches) Merkmal gesehen wird, sondern als "soziales Konstrukt", das heißt als "ein Attribut, das sich aus der Interaktion zwischen dem Einzelnen und dem sozialen und physischen Umfeld ergibt". (OECD 2003: 335) Bei neueren Politikmaßnahmen z.B. liegt daher der Akzent mehr auf "Befähigung" als auf "Behinderung". (ebd.)
Als Ausdruck für diesen Übergang von einer "statischen zu einer dynamischen Sichtweise von Behinderung" (ebd.) ist z.B. das 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgelegte ICF-Klassifikationssystem (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) anzusehen (vgl. Abb. 1).
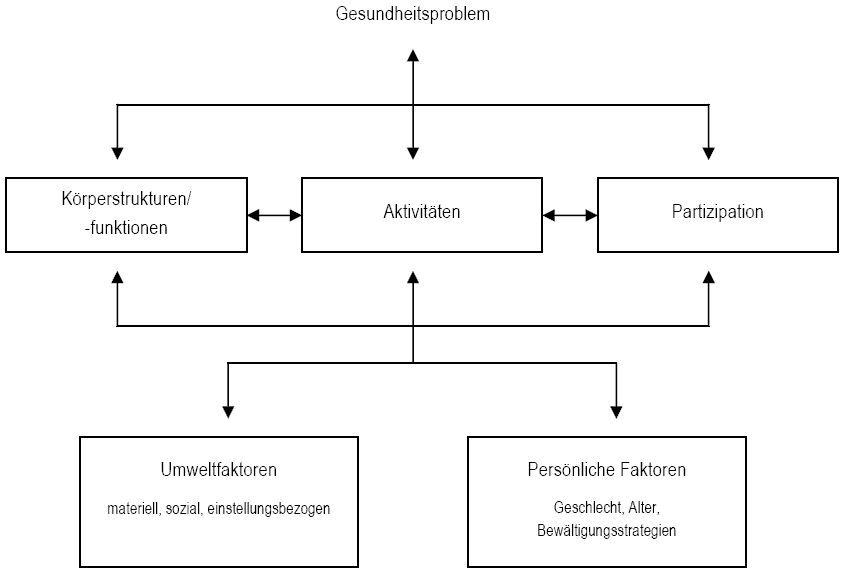
Abbildung 1: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO (Quelle: Wansing 2005: 80)
Behinderung wird hier als Oberbegriff verstanden, der die Beeinträchtigung auf den sich wechselseitig beeinflussenden Ebenen der Körperfunktionen/-strukturen, der Aktivitäten und der Teilhabe (Einbezogensein in die verschiedenen Lebensbereiche wie z.B. Mobilität, Arbeit, Bildung, Rechte) bezeichnet. Diese Bereiche stehen in Abhängigkeit zu den Umweltfaktoren (wie Technologien, soziale Beziehungen und Unterstützung) und den persönlichen Voraussetzungen (Alter, Geschlecht, Lebensstil usw.). Behinderung wird damit als ein Ergebnis negativer Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen betrachtet; sie entsteht dann, wenn quasi die Relationen zwischen einer Person und den Umweltfaktoren gestört sind. (vgl. Wansing 2005: 79)
Nicht die Beschreibung eines Defektes oder Defizits steht demnach bei der ICF-Klassifikation im Vordergrund, sondern wie Menschen mit ihrem Gesundheitszustand leben und zurecht kommen, z.B. in den Bereichen Bildung, Kommunikation, Versorgung oder auch Mobilität. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 121f)
Mit dem ICF-Modell wird einer "Individualisierung der Problemlage" (Wansing 2005: 80) entgegengewirkt und die Handlungsfähigkeiten (Aktivitäten) und Teilhabemöglichkeiten (Partizipation) von Menschen mit Behinderung werden in den Vordergrund gerückt. Das Modell soll (laut WHO) die Möglichkeit eines Paradigmenwechsel von der Defizit- zur Ressourcenorientierung in der Behindertenpolitik einleiten. (vgl. Rösner 2002: 289)
Diese Arbeit präferiert eine Sichtweise von Behinderung, die sich an der dynamischen, sozialen und rechtlichen Auffassung von Behinderung orientiert. Im Kontext der Mobilitätsthematik ist weniger die Frage einer spezifischen Definition von Behinderung bedeutsam, als es gilt, die Strukturen, Maßnahmen oder Verhaltensweisen unter die Lupe zu nehmen, die behindernd und ausgrenzend auf Menschen wirken (können), welche nicht einer bestimmten "Durchschnittsnorm" entsprechen.
Damit wird unter anderem auch der Leitformel der zivilgesellschaftlichen Behindertenbewegung des "selbstbestimmten Leben" (Independent-Living) gefolgt, die die behindernden Umweltfaktoren in den Mittelpunkt rückt. (vgl. Herriger 1989: 37)
Die Independent-Living-Bewegung[12] trug maßgeblich zu jenem Wandel im Verständnis von Behinderung - weg von medizinischen Auffassungen, hin zu einer "Politisierung" von Behinderung wie sie durch den sozialen und rechtlichen Ansatz erfolgt - bei. (vgl. Österwitz 1996)
Behinderung wird im Sinne des Independent-Living nicht als ausschließlich individuelles, sondern vorwiegend als soziales und politisches Problem angesehen und artikuliert. Es wird um BürgerInnenrechte, gegen Diskriminierung und für Gleichstellung behinderter Menschen in allen Bereichen des Lebens gekämpft. Der Schaffung von gesetzlichen Regelungen, konkret von Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgesetzen, wird dabei hohe Priorität eingeräumt, da dadurch bezüglich dem Abbau von Diskriminierung z.B. in den Bereichen Mobilität, Bildung, Arbeit oder bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen den Menschen mit Behinderungen Rechtsansprüche eingeräumt werden. Die sozialen, politischen, ökonomischen sowie umweltfaktorischen ("Hilfe"-)Strukturen der Gesellschaft werden als zentrale behindernde Bedingungen entlarvt, die behinderten Menschen in ihrer Emanzipation von Abhängigkeit, Fremdbestimmtheit und Isolation hin zu Autonomie, Selbstbestimmung und Partizipation oftmals im Wege stehen. Dementsprechend wird die Ansicht vertreten, dass positive Veränderungen primär über die Umgestaltung jener strukturellen Rahmenbedingungen zu erzielen sind. (vgl. Österwitz 1996) Das heißt, bezogen auf den Aspekt der Zugänglichkeit von Gebäuden oder der Mobilität, dass nicht der Mensch mit Behinderung das Problem ist, sondern die nicht adäquate gebaute räumliche Umwelt bzw. die Rahmenbedingungen der individuellen Mobilität. In einem gängigen Slogan der Behindertenbewegung "Man ist nicht behindert, man wird es" verdichtet sich jene Denkweise.
Mit der sozialen und rechtlichen Auffassung von Behinderung korrespondiert, dass soziale Inklusion (und Selbstbestimmung) von Menschen mit Behinderungen ganz wesentlich nur über den Abbau ausschließender, diskriminierender Strukturen bzw. der Förderung von partizipativen Strukturen anhand von sozial- bzw. behindertenpolitischen und rechtlichen Interventionen erreicht werden kann.
In diesem Kapitel werden einige Zahlen und Daten zu Menschen mit Behinderungen in Österreich präsentiert. Herauszustreichen ist, dass im Allgemeinen, speziell aber auch im Kontext der Mobilitätsthematik präzise Daten über behinderte Menschen kaum vorliegen bzw. schwer damit zu operieren ist, da ihre Gewinnung einerseits auf unterschiedlichen Erhebungsansätzen/-verfahren oder reinen Schätzungen beruhen und andererseits ein analoger Rückschluss von einer Klassifikation, wie etwa "bewegungsbeeinträchtigt", auf das Vorhandensein von Mobilitätsbehinderung nicht zulässig ist, da beispielsweise eine chronisch kranke Person nicht zwangsläufig Probleme in der alltäglichen Mobilität haben muss. Weiters ist anzumerken, dass unterschiedlichste Definitionen und Begriffe in Erhebungen bzw. bei der Datengenerierung Verwendung finden und somit den Versuch, einen genaueren Überblick über die Anzahl behinderter Menschen in Österreich zu geben, erschweren.
Darüber hinaus muss gesagt werden, dass angesprochene Definitionen und Begrifflichkeiten meines Erachtens nach, immer auch kritisch zu reflektieren sind, da deren Verwendung das Ausblenden der umweltbedingten Dimension von Behinderung leichter ermöglicht.
Es liegen also keine präzisen Daten über die Gesamtanzahl von Menschen mit Behinderung in Österreich vor. Dies hängt nicht nur damit zusammen, dass keine einheitliche Definition von Behinderung besteht, sondern auch unterschiedliche Einstufungspraktiken Personen klassifizieren und statistisch erfassen, beispielsweise als "invalid", "pflegebedürftig" oder "begünstigt Behinderte" (vgl. Tab. 1). Die "Gruppe" der Menschen mit Behinderungen ist demnach eine äußerst heterogene.
Tabelle 1: Ausgewählte Zahlen zu einzelnen Gruppen behinderter Menschen in Österreich. (eigene Zusammenstellung)
|
Beim AMS vorgemerkte arbeitslose Menschen mit Behinderung 2005 |
26.382[a] |
|
Beim AMS vorgemerkte arbeitslose "begünstigte Behinderte"[b] 2005 |
4.353[c] |
|
Begünstigte Behinderte nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 2005 |
91.086[d] |
|
PflegegeldbezieherInnen (Bund und Länder) 2004 |
376.967[e] |
|
Pensionsversicherung: Invaliditätspensionen 2001 |
381.228[f] |
|
InhaberInnen eines Behindertenpasses nach dem Bundesbehindertengesetz (BBG)[g] |
ca. 180.000[h] |
|
[a] Die 26.382 arbeitslosen Personen mit Behinderung setzen sich zusammen aus: 21.601 laut AMS als arbeitslose behinderte Personen erfasste sowie 4.784 "begünstigte Behinderte". AMS Österreich, Stand 3.7.2005. Telefonische Auskunft AMS Bundesgeschäftsstelle, 25.7.2005. [b] Der Status des "begünstigten Behinderten" nach dem Behinderteneinstellungsgesetz wird erlangt durch ein Feststellungsverfahren des Bundessozialamts. Dabei wird der Grad der Behinderung aufgrund ärztlicher Gutachten ermittelt. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 200363f) [c] Die 4.353 beim AMS als "begünstigt Behinderte" erfassten Personen setzen sich zusammen aus: 3.037 "begünstigt Behinderten" nach dem Behinderteneinstellungsgesetz und/oder Opferfürsorgegesetz, 1.316 Personen nach dem Landesbehindertengesetz und 428 Personen, die unter beide Kriterien fallen. AMS Österreich, Stand 3.7.2005. Auskunft AMS Bundesgeschäftsstelle, 25.7.2005. [d] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (2005: Online) [e] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz (2006c: Online) [f] Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz (2003a: 12) [g] Ein Behindertenpass nach dem BBG kann von einer Person mit einem Behinderungsgrad von mind. 50% angefordert werden und dient als Nachweis des Behinderungsgrades z.B. bei Behörden sowie zur Inanspruchnahme diverser Vergünstigungen. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 26) [h] Geschätzte Zahl laut Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz. Telefonische Auskunft, 22.7.2005. |
|
Der Anteil behinderter Menschen an der Gesamtbevölkerung wird in den OECD-Ländern auf 10 - 15 % geschätzt. Bezogen auf Österreich sprechen Schätzungen von ca. 1 Million Menschen mit Behinderungen. (vgl. Riess/Flieger 2000)
Ein Vergleich der letzten Mikrozensus-Erhebung aus dem Jahr 2002 mit jener aus dem Jahr 1995 (vgl. Tab. 2) macht eingangs angesprochene Schwierigkeiten hinsichtlich des Datenmaterials besonders deutlich: Wurden 1995 in Österreich über 2,1 Mio. Personen mit "mindestens einer körperlichen Beeinträchtigung" gezählt - also fast 30 % der Gesamtbevölkerung -, so wird 2002 von ca. 1,26 Mio. Menschen "mit lang andauernden gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen" (ÖSTAT 2003:279) ausgegangen. Die frappierenden Differenzen haben ihre Ursache, laut Auskunft des ÖSTAT, in den unterschiedlichen Fragestellungen der Erhebungen.[13]
Von den 475.900 Bewegungsbeeinträchtigten (1995) gaben 24.300 Personen an, dass ein Rollstuhl vorhanden ist und 6.000, dass sie einen benötigen würden. Schätzungen zufolge (Stand: 2001) beläuft sich die Zahl der RollstuhlfahrerInnen österreichweit auf geschätzte 30.000 Personen, davon ca. 10.000 in Wien. (vgl. EI 2, 2001; Engl/Schlögl/Sigl 2003
Tabelle 2: Ausgewählte Daten aus den Mikrozensus-Erhebungen 1995 und 2002 Sowohl in den Daten von 1995 als auch von 2002 sind keine Personen erfasst, die in Anstalten oder Gemeinschaftsunterkünften leben, da sich die Mikrozensus-Sonderprogramme nur an Personen in Privathaushalten richten. Die Zahlen sind also lediglich für die österreichische Bevölkerung in Privathaushalten repräsentativ. 1995 wurden allerdings noch zusätzlich die in Anstalten untergebrachten körperlich beeinträchtigten Personen ermittelt. Demnach lebten 116.600 Menschen mit Sehbeeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung, Bewegungsbeeinträchtigung oder chronischer Erkrankung in Anstalten. (eigene Zusammenstellung)
|
Körperliche beeinträchtigte Personen 1995 (Quelle: ÖSTAT 1997) |
Personen mit lang andauernden gesundheitlichen Problemen 2002 (Auswahl) (Quelle: ÖSTAT 2003) |
|
Bewegungsbeeinträchtigte[a] 475.900 |
Personen mit Problemen an Beinen und Füßen + Personen mit Problemen an Armen und Händen 332.600 |
|
Sehbeeinträchtigte 407.400 |
Probleme beim Sehen (trotz Brille oder Kontaktlinsen) 63.000 |
|
Hörbeeinträchtigte 456.000 |
Probleme beim Hören (trotz Hörgerät) 38.600 |
|
Insgesamt 2.128.800 |
Insgesamt 1.262.300 |
|
[a] Bewegungsbeeinträchtigungen an Daumen, Fingern, Händen, Armen, Füßen, Unterschenkeln, Beinen sowie halbseitige Lähmungen und Querschnittlähmungen. |
|
Einer Bewegungsbeeinträchtigung können verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Das ist für die betroffenen Personen insofern relevant, da (die Höhe von) bestimmte(n) Sozialleistungen bzw. finanziellen Förderungen davon abhängen. Tabelle 3 listet, basierend auf den Daten des Mikrozensus-Sonderprogramms 1995, die Ursachen der Bewegungsbeeinträchtigung ("Invalidität") auf.
Tabelle 3: Ursachen von Bewegungsbeeinträchtigung (Quelle: "Sicher Leben" 1997)
|
Bewegungsbeeinträchtigte (100%) |
Seit Geburt (%) |
Krankheit, im Laufe der Zeit (%) |
Arbeitsunfall, Berufsausübung (%) |
Verkehrsunfall (%) |
Heim-, Freizeit-, Sportunfall (%) |
|
475.900 |
4,9 |
42,8 |
21,2 |
6,2 |
11,9 |
Es wird anhand dieser Zahlen (vgl. Tab. 3) deutlich, dass der Großteil der Personen eine Beeinträchtigung durch Krankheit, aufgrund des Alterungsprozesse oder eines Unfalls erfährt. Da, wie die demographischen Veränderungen zeigen, die österreichische Bevölkerung immer älter wird, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der (körperlich) Beeinträchtigten und somit auch der mobilitätsbehinderten Personen zunehmen wird.
Über psychisch und geistig behinderte Menschen ist kaum Zahlenmaterial zugänglich. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 1 % der österreichischen Bevölkerung eine psychische Behinderung aufweist. Die Zahl geistig behinderter Personen wird auf ca. 0,6 % geschätzt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 11)
Menschen, die zeitweise oder ständig in ihrer Mobilität eingeschränkt sind - dazu zählen unter anderem Menschen im höheren Lebensalter, RollstuhlfahrerInnen, blinde und sehbehinderte Menschen oder Hörgeschädigte, stellen keine Minderheit dar - ca. ein Drittel der Bevölkerung kann als mobilitätseingeschränkt bzw. mobilitätsbehindert betrachtet werden. (vgl. Ackermann 1996)
Der Begriff der sozialen Exklusion lässt sich nicht eindeutig und präzise bestimmen. Ganz allgemein wird jedoch, laut Wansing (2005), soziale Exklusion interpretiert als "(...) Ausschluss von Personen oder Personengruppen von grundlegenden politischen, ökonomischen und sozialen Leistungen und Prozessen der Gesellschaft" (60).
Der Begriff bzw. das Konzept der sozialen Exklusion erhält in Europa bzw. in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft seit den 1980er und vor allem seit den 1990er Jahren, während derer sich tief greifende gesellschaftliche Umbrüche vollzogen, die sich mit Schlagwörtern wie "Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit", "neue Armut", "Rücknahme sozialer Rechte", "Zunahme eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neoliberalismus" oder "Zunahme der Einkommensungleichheit" bündeln lassen, verstärkt Resonanz in der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit und nimmt mittlerweile einen hohen Stellenwert in sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen Diskursen ein, um die Strukturen und Ursachen sozialer Ungleichheiten zu beschreiben. (vgl. Kronauer 2002, Wansing 2005)
Kronauer (2002: 16f) sieht den Verdienst des Exklusionsbegriffs darin, dass der Begriff, unter Berücksichtigung angesprochener gesellschaftlicher Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte, das Problem von Arbeitslosigkeit und Armut auf neue Weise aufgreift, indem er besonders auf die Aspekte gesellschaftliche Teilhabe und die Gefährdung der sozialen Grundlagen der Demokratie hinweist. Vor allem zwei Aussagen sind mit dem Begriff der sozialen Exklusion verknüpft: Erstens, dass anhaltende Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Armut eine neue Spaltung der Gesellschaft hervor bringt, und zweitens, dass sich diese Spaltung im Ausschluss von Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft niederschlägt. (ebd.: 11)
Seine politische Brisanz erhält der Begriff der sozialen Ausgrenzung nicht nur dadurch, dass er der Politik quasi eine bestimmte Richtung vorgibt, u.zw. die der "Eingliederung" von "Problemgruppen" (ebd.: 11), sondern auch dahingehend, dass in der Ausgrenzungsdiskussion die sozialen Grundlagen der Demokratie in den Mittelpunkt gerückt werden:
"Ausgrenzung ist nicht nur eine tief greifende Erfahrung, die einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen betrifft. Sie wirkt auch auf die ausgrenzende Gesellschaft und deren Institutionen zurück. (...) Wenn Individuen von wesentlichen Teilhabemöglichkeiten abgeschnitten werden, stellt dies zugleich den Geltungsbereich und die sozialen Grundlagen der Demokratie in Frage." (ebd.: 227)
Mit dem Exklusionsgedanken ist eine Ambivalenz verbunden, die sich an der Vorstellung einer in ein "Innen" und ein "Außen" gespaltenen Gesellschaft festmachen lässt. Diese Vorstellung macht das Exklusionskonzept offen für die verschiedensten und auch gegensätzlichsten Ausdeutungen. So kann der Gedanke der Ausgrenzung z.B. kritisch gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die ausgrenzend wirken, gewendet werden, oder aber auch die Ausgegrenzten als "Andersartige" ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, die in eine nicht weiter zur Disposition stehende Gesellschaft "wiedereingegliedert" werden müssen, und so ihre weitere Ausschließung forcieren. (ebd.: 11f).
Obwohl der Begriff vieldeutig ist und kontrovers diskutiert wird, können, wie Kronauer (2002) ausführt, drei Dimensionen als kennzeichnend für das Exklusionskonzept herausgegriffen werden:
-
Relationalität
-
Mehrdimensionalität
-
Prozesscharakter
Unter Relationalität ist zu verstehen, dass die Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut als "sozial und damit relational, als abgestufte soziale Verhältnisse von Teilhabe bzw. Ausschluss bestimmt" sind (ebd.: 17). Exklusion bedeutet in diesem Sinne den Ausschluss am Arbeitsmarkt und die Auflösung bzw. Einschränkung sozialer Beziehungen. Von Inklusion kann diesem Verständnis nach dann gesprochen werden, wenn eine Einbindung und Anerkennung in den Sozialbeziehungen (Erwerbsarbeit und im persönlichen Bereich) erfolgt. (ebd.: 43f)
Gesellschaftliche Zugehörigkeit und Partizipation umfasst mehrere Dimensionen: Ökonomie (materielle Teilhabe), Kultur (Orientierungen und Werte), Politik (sozialstaatliche und politische Institutionen, Rechte) und soziale Beziehungen. In dieser Bedeutung geht der Exklusionsbegriff davon aus,
"dass es in all den genannten Dimensionen gesellschaftlich geteilte Vorstellungen von angemessenen Lebenschancen gibt - solche des Konsums, der Interessenvertretung, des gesellschaftlichen Status, der materiellen Sicherheit, der Möglichkeit, sein Leben nach eigenen Zielvorstellungen zu gestalten. Ihnen nicht entsprechen zu können, bedeutet Ausschluss von wesentlichen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. (...) Ausschluss von Lebenschancen ist für die Betroffenen deshalb in aller Regel mit der Erfahrung verbunden, an gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen zu scheitern" (ebd.: 45).
Exklusion ist demnach als Verlust von Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich anerkannten Lebenschancen und -standards zu betrachten bzw. konstituiert sich Inklusion über entsprechende Partizipationsmöglichkeiten, die über Teilhaberechte hergestellt bzw. abgesichert werden. Vor allem den (wohlfahrts)staatlichen Institutionen kommt bei der Eröffnung von Chancen bzw. der Risikoabsicherung eine wichtige Rolle zu. (ebd.: 45, 151f)
Ausgrenzung ist weniger als ein Zustand zu betrachten, vielmehr als Prozess, der sich im Inneren der Gesellschaft abspielt. (ebd.: 47, 140) Mit dem Prozesscharakter von Ausgrenzung wird einerseits auf gesellschaftliche Instanzen, die AkteurInnen und Agenturen der Ausschließung (Strategien von Unternehmen, institutionelle Regelungen, soziales Verhalten) verwiesen, die Exklusion bewirken. Andererseits wird das Augenmerk auch auf die "biographische Kumulation" (ebd.: 18, 47), das Ineinandergreifen von individueller Erfahrung und Wirkung sozialer Ausgrenzung gelenkt. Wird Exklusion als Prozess betrachtet, kann dadurch dem Ausgrenzungsproblem differenzierter (Ursachen, Formen, Abstufungen), bis in den Kern der Gesellschaft nachgegangen werden, so Kronauer (ebd.). Wer einem hohen Exklusionsrisiko ausgesetzt ist, hängt von den drei "Integrationsinstanzen" Arbeitsmarkt, soziale Beziehungen und (Wohlfahrts-)-Staat ab. (ebd.: 155)
Kronauer (2003: 139) folgend, muss heute in den westlichen Ländern mit sozialstaatlicher Verfassung Ausgrenzung als Ausgrenzung in der Gesellschaft begriffen werden, als "eine besondere Form der Ungleichheit" in der Gesellschaft. Das heißt, dass die beiden zentralen Kriterien gesellschaftlicher Zugehörigkeit: Interdependenz (Aspekt der Einbindung in Erwerbsarbeit und soziale Nahbeziehungen) und Partizipation (Teilhabe am gesellschaftlich erreichten Lebensstandard und Lebenschancen, insbesondere vermittelt über Bürgerrechte) auf neue Weise auseinander treten können. So können z.B. Betroffene zwar im Besitz sozialer und politischer Bürgerrechte (z.B. Wahlrecht, Recht auf Minimalversorgung), aber gleichzeitig als "Überflüssige" aus dem Erwerbsleben ausgegrenzt sein. (ebd.: 24; 120). Ein "gehaltvoller" Exklusionsbegriff erlaubt es, wie Kronauer (2002: 146) konstatiert, diese Gleichzeitigkeit des "Drinnen und Draußen" zusammenzudenken und wirkt darüber hinaus einer "Individualisierung" des Eingliederungsproblems dahingehend entgegen, indem Ausgrenzung nicht als Problem der Ausgeschlossenen gesehen wird, die wiedereingliederungsfähig gemacht werden müssen, sondern "die Gesellschaft, die Ausgrenzung bewirkt, muss selbst verändert werden". (ebd.: 139)
Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich ein Verständnis von sozialer Inklusion, das die
-
Einbindung in Erwerbsarbeit,
-
Einbindung in soziale Netze,
-
materielle Teilhabe (angemessener Lebensstandard),
-
politisch-institutionelle Teilhabe (Zugang zu Rechten und Institutionen sowie deren Nutzung),
-
kulturelle Teilhabe (Möglichkeiten zur Realisierung individuell und gesellschaftlich anerkannter Ziele der Lebensführung) umfasst. (ebd.: 152f)
Für die Realisierung von Inklusionschancen ist es ganz entscheidend, über ökonomische[14], soziale[15] und kulturelle[16] Ressourcen zu verfügen bzw. diese mobilisieren zu können. (vgl. Wansing 2005: 69fff)
Der Begriff der Inklusion erhielt in den letzten Jahren zunehmend gesellschaftliche Resonanz, vor allem über den behindertenpädagogischen Diskurs, gerade auch in Unterscheidung zum traditionellen Begriff der Integration. Obwohl in jener Debatte primär der (Aus-)Bildungsbereich im Zentrum steht, so wird dennoch "(...) auf Prämissen wie Antidiskriminierung, Forderung nach Gleichbehandlung/Gleichstellung, nach uneingeschränkter Teilhabe und Heterogenität in allenFeldern (fokussiert, Anmerkung T.E.) (kursiv, T.E.)" (Ziemen 2003: Online). Ich halte es daher für wichtig, auf eine Bedeutungskomponente von Inklusion hinzuweisen, die eine gesellschaftspolitisch ganz wesentliche qualitative und richtungsweisende Orientierung impliziert:
"Integration: zielt die Eingliederung behinderter Menschen in die bestehende Gesellschaft an. Inklusion: wählt als Ausgangsbedingung die Veränderung bestehender Strukturen und Auffassungen, wobei die Unterschiedlichkeit der Menschen (Heterogenität als Normalität) als Voraussetzung betrachtet wird und damit jedem Menschen die Unterstützung zukommen soll, die er für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benötigt." (ebd.)
1.4 Exklusionsrisiko Behinderung (in Österreich)[17]
Menschen mit Behinderungen werden in der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Ausgrenzung als Gruppe definiert, die besonders von sozialer Exklusion bedroht ist. (vgl. Wansing 2005: 78)
Wansing (ebd.: 78, 82) weist darauf hin, dass Behinderung im Rahmen des sozialwissenschaftlichen Diskurses zur sozialen Exklusion bislang wenig beachtet wird und dass auf europäischer Ebene vergleichbare Informationen über die Situation bzw. die Teilhabe behinderter Menschen unzureichend sind. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die lange Zeit vorherrschende individualisierende Sichtweise von Behinderung, die die gesellschaftspolitischen Dimensionen weitgehend außer Acht ließ. Und andererseits erschweren die international unterschiedlichen Definitionen und Kriterien für die Bestimmung von Behinderung die Sammlung und den Vergleich von Daten.
Analog dem Befund von Wansing (ebd.: 83), der lückenhaften Datenlage zur Lebenssituation behinderter Menschen bzw. deren Gefährdung durch soziale Exklusion in Deutschland, ist Vergleichbares auch für Österreich zu konstatieren: Es sind nur spärlich Daten vorhanden. Dies hängt wohl mit der Heterogenität der Gruppe von Menschen mit Behinderungen zusammen - eine einheitliche Definition von Behinderung gibt es in Österreich nicht und so lassen sich nur schwer allgemeine, auf empirische Daten gestützte Aussagen zur Situation behinderter Menschen oder den Prozessen ihrer sozialen Ausgrenzung in verschiedenen Gesellschaftsbereichen treffen. Unter Berücksichtigung dieses Umstands seien dennoch drei zentrale Bereiche herausgegriffen:[18]
Behinderte Menschen sind besonderen Arbeitsmarktrisiken ausgesetzt. Es ist feststellbar, dass Menschen nach dem Eintritt einer Behinderung besonders gefährdet sind, dass sie arbeitslos werden. (vgl. Badelt/Österle 1993: 65)
Durchschnittlich ist in Österreich die Arbeitslosenrate unter behinderten Personen mindestens doppelt so hoch wie jene von Personen ohne Behinderung. (vgl. Riess/Flieger 2000) Von den Arbeitslosengeld- bzw. NotstandshilfebezieherInnen waren 2001 ca. 16 % Personen mit Behinderung. Der Anteil der NotstandshilfebezieherInnen ist bei den behinderten Personen signifikant höher (mehr als das Doppelte) als in der Gruppe der nichtbehinderten BezieherInnen. Die arbeitsmarktpolitische Situation behinderter Menschen in Österreich ist angespannt. Sie sind häufiger und länger von Arbeitslosigkeit betroffen als nichtbehinderte Menschen und die Höhe des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandhilfe ist geringer als bei denen, die nicht dieser Gruppe zugeordnet werden. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a:14)
Behindert zu sein, stellt ein erhöhtes Armutsrisiko dar. Insbesondere dann, wenn mit der Behinderung eine gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit einhergeht. (ebd.: 15) Behinderte Menschen weisen eine Armutsgefährdungsquote von 15 % auf. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2006b: 1) Die stärkere Betroffenheit von Armutsgefährdung hängt damit zusammen, dass die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen deutlich unter dem Durchschnitt liegen. (ebd.: 10) Gründe für das niedrigere Erwerbseinkommen von Menschen mit Behinderungen im Vergleich zu nichtbehinderten ArbeitnehmerInnen liegen darin, dass behinderte Menschen oft über geringere berufliche Qualifikationen verfügen und vermehrt in Niedriglohnbranchen tätig sind. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 16)
Seit dem Schuljahr 1993/94 ist integrativer Unterricht in der Volksschule und seit 1996 in der Sekundarstufe I (10 bis 14-Jährige) in Österreich gesetzlich verankert. Eltern haben seither de jure die Wahlmöglichkeit zwischen integrativer Betreuung in einer Regelschule oder der Betreuung in einer Sonderschule. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 88) De facto kann jedoch von keinem individuellen Durchsetzungsrecht der Eltern auf schulische Integration ihrer Kinder gesprochen werden, da beispielsweise das Recht das Kind in der nächstgelegenen Schule unterzubringen immer wieder von integrationsfeindlichen Schulverwaltungen unterlaufen wird. (vgl. Riess/Flieger 2000)
Festzuhalten ist, dass unter anderem aufgrund gesetzlicher Veränderungen im schulischen Bereich Österreich international betrachtet zwar zu den fortschrittlichsten Staaten zählt, die konkrete Umsetzung allerdings ist unter anderem aus folgenden Gründen als problematisch anzusehen: Mangelhafte Ausstattung der Regelschulen mit technischen Hilfsmitteln, die Stigmatisierung durch einen Sonderschulbesuch, mangelnde Ausbildung und Vorbereitung des Lehrpersonals auf die Arbeit mit behinderten SchülerInnen oder das Vorhandensein vielfältiger baulicher Barrieren, die den Zugang zur Regel- oder Hochschule erschweren. (ebd.)
Die im Rahmen einer Studie von Riess/Flieger (2000) interviewten ExpertInnen im Bereich der Behindertenpolitik bewerten die Ist-Situation bei der Berufsbildung negativ und sprechen eine Reihe von benachteiligenden Faktoren an: Wenig Möglichkeiten der Berufsorientierung in der 7. und 8. Schulstufe, Berufsberatung orientiert sich an der Behinderung und nicht an den konkreten Berufswünschen und Fähigkeiten, für Jugendliche mit geistiger Behinderung gibt es de facto keine Möglichkeit der beruflichen Bildung, Arbeitsassistenz während der Berufsfindung und -bildung ist zu gering ausgebaut, die Berufsschule wird bis auf wenige Ausnahmen nicht integrativ geführt, usw.
Zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass seit 2001, im Rahmen der von der österreichischen Bundesregierung gestarteten Beschäftigungsoffensive insbesondere für Jugendliche mit Behinderungen verstärkt Maßnahmen hinsichtlich deren beruflicher Orientierung und Integration gesetzt wurden, z.B. durch die Maßnahme "Clearing".[19] (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 102, 120)
Sowohl die schulischen als auch die beruflichen Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) werden von den in der Studie von Riess/Flieger (2000) befragten ExpertInnen als nicht befriedigend bewertet und als benachteiligend gegenüber nichtbehinderten Personen angesehen.
Die Zugänglichkeit der Umwelt und von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen als Faktor für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erlangte seit den 1990er Jahren sowohl international (vgl. 1.5) als auch national (vgl. 5) erhöhte Präsenz. Die Bereiche barrierefreie Gestaltung, Ausstattung und Nutzung von Gebäuden und (öffentlichen) Verkehrsmitteln sowie der barrierefreie Zugang zu Information und (Tele-)Kommunikation, die Benutzbarkeit von Produkten und Dienstleistungen des täglichen Lebens für Personen mit Behinderungen erhalten auch in Österreich zunehmend mediale wie politische Resonanz im Kontext von Diskriminierung bzw. Gleichstellung von behinderten Menschen. Als Beispiel dafür kann das jüngst (2006) in Kraft getretene österreichische Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGStG) dienen, das behinderte Menschen vor Diskriminierung beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen schützen soll. Barrieren dahingehend werden als Diskriminierungstatbestand anerkennt. Welche konkreten Auswirkungen das Gesetz etwa auf eine Verbesserung der alltäglichen Mobilitätssituation behinderter Menschen hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht einschätzen. (vgl. 5.3)
In vorliegender Arbeit steht der Aspekt der Mobilität im Zentrum des Interesses, das heißt, primär der Zugang und die Nutzung von (öffentlichen) Verkehrsmittel und des öffentlichen (Verkehrs-)Raums durch Menschen mit Behinderungen. Da in nachfolgenden Kapiteln (vgl. 5, 6) ausführlich auf die Mobilitätssituation bzw. Rahmenbedingungen barrierefreier Mobilität von Menschen mit Behinderungen in Österreich und speziell in Wien eingegangen wird, möchte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, an dieser Stelle lediglich einige Punkte kurz skizzieren.
"Fragen der Zugänglichkeit (...) spielen eine Schlüsselrolle für den Ausschluss und die Diskriminierung von Personen mit Behinderung im sozialen Alltag", heißt es in der Studie von Riess/Flieger (2000: Online), in der darauf verwiesen wird, dass in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern es erst spät Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung etwa von baulichen Barrieren gesetzt wurden. (ebd.) Die in der Untersuchung befragten ExpertInnen kommen hinsichtlich der Zugänglichkeit zur Umwelt und zu Dienstleistungen zu folgenden Ergebnissen:
-
Generell wird das erreichte Niveau der Zugänglichkeit[20] für behinderte Menschen in Österreich von fast 85 % der Befragten als eher schlecht beurteilt. Ebenso werden die Verbesserungen der Zugänglichkeit in den letzten Jahren als eher unbefriedigend (60 %) oder sogar ungenügend (21 %) erachtet.
-
Die Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude wird von 68 % der Befragten als eher schlecht, von fast 16 % als sehr schlecht eingeschätzt; die Zugänglichkeit von privaten Gebäuden sogar von 84 % als sehr schlecht.
-
Die Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln wird von 53 % als eher schlecht und von 47 % als sehr schlecht angesehen.
-
Die Benutzbarkeit von Einrichtungen zur Telekommunikation für hörbeeinträchtigte bzw. gehörlose Personen wird von ca. 63 % der Befragten als eher schlecht betrachtet. (ebd.)
Wie aus den dargestellten Ergebnissen ersichtlich wird, stellt Behinderung (auch in Österreich) ein erhebliches Risiko für soziale Ausgrenzung dar. Wie Wansing (2005) feststellt, "lassen sich gesellschaftliche Institutionen und Organisationen sowie soziale und ökologische Umweltfaktoren als ‚Agenten der Ausgrenzung' identifizieren" (98). Dass diese Faktoren erheblich an den Prozessen der sozialen Ausgrenzung beteiligt sind, geht unter anderem aus einer Befragung europäischer Behindertenorganisationen zu den Hauptursachen sozialer Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung hervor (vgl. Abb. 2).
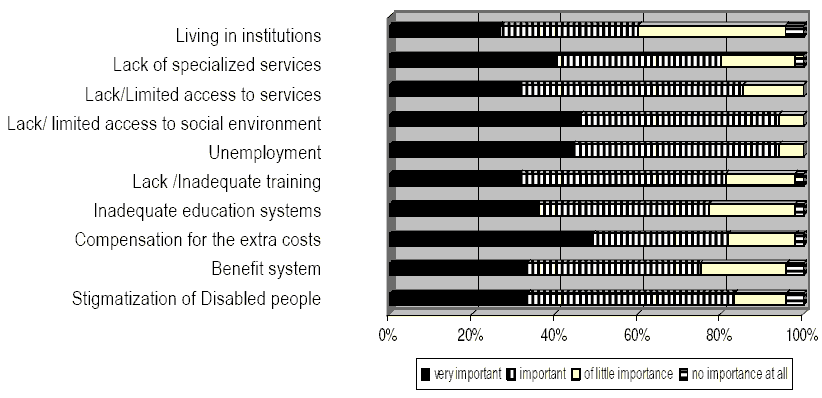
Abbildung 2: Hauptursachen für die soziale Exklusion von Menschen mit Behinderung aus Sicht von Behindertenorganisationen in den europäischen Mitgliedsstaaten (Quelle: CERMI et al. 2002: 63)
Besonders interessant ist, dass die Ergebnisse der Befragung - neben Arbeitslosigkeit und dem Mangel an finanzieller Unterstützung, um die Extrakosten im Zusammenhang mit einer Behinderung zu kompensieren - insbesondere auf die unzureichenden Zugänge zur Umwelt als Ursache für soziale Exklusion hinweisen!
Der Exklusions- und Inklusionsbegriff nimmt, wie erwähnt, seit den 1990er Jahren einen zunehmenden Stellenwert in sozialpolitischen Diskursen ein und wurde auch in den offiziellen Sprachgebrauch der Europäischen Union aufgenommen ("social exklusion"/"social inclusion"). Beispielsweise sind die Begriffe im Vertrag von Amsterdam in den Artikeln 136, 137 zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung zu finden. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich bei den Europäischen Ratssitzungen (Lissabon, März 2000; Nizza, Dezember 2000; Stockholm, Juni 2001) dazu verpflichtet, soziale Ausgrenzung und Armut zu bekämpfen. Konkret sollen einige Punkte in den Mitgliedsstaaten durch jeweils zweijährige nationale Aktionspläne ("NAPs") umgesetzt werden:
-
Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben,
-
Förderung des Zugangs aller zu Ressourcen, Rechten, Gütern und Dienstleistungen
-
Vorbeugung der Risiken der Ausgrenzung,
-
Handeln für die sozial Schwachen,
-
Mobilisierung relevanter AkteurInnen. (vgl. Wansing 2005: 57f)
Die im Vertrag von Amsterdam empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung sind auch bedeutsam für die nationale Behindertenpolitik der einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union. Im nationalen Aktionsplan ("NAP inclusion") für 2003-2005 bekennt sich Österreich "zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung als zentrales gesellschaftspolitisches Anliegen" (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2006b: 1). Die Ziele, die in Nizza formuliert wurden, sind "der strategische Rahmen für die politischen Akteure, allen faire Teilhabechancen zu ermöglichen" (ebd.). Weiters heißt es im NAPincl:
"Obwohl Österreich einen hohen Sozialstandard aufweist und die Teilhabechancen deutlich verbessert wurden, weisen die Befunde zur Armutsgefährdung auf die Notwendigkeit hin, weiterhin und verstärkt die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in den Mittelpunkt der politischen Bemühungen zu stellen" (ebd.).
Im NAPincl 2003-2005 werden unter anderem Menschen mit Behinderungen als besondere Risikogruppe hinsichtlich sozialer Ausgrenzung und Armut angeführt, deren Teilhabechancen es durch eine "behindertenfreundliche und verständnisvollere Lebenswelt" sowie durch spezifische Förderungen zu verbessern gilt. (ebd.: 42) Dahingehend sollen z.B. folgende Maßnahmen zum Tragen kommen:
"Die Beschäftigungs- und Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen sind zu verbessern. Die Ausarbeitung eines Behindertengleichstellungsgesetzes soll dazu beitragen, Diskriminierungen vorzubeugen bzw. sie zu eliminieren. Mit entsprechenden Förderprogrammen für Kinder und Jugendliche sind deren spätere Beschäftigungsfähigkeiten und - möglichkeiten zu stärken. Umfassende integrative Maßnahmen sowie Beratung, Betreuung und Assistenz sind für die Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft nötig. Präventive, rehabilitative und therapeutische Maßnahmen und Betreuungsmaßnahmen sind weiter zu entwickeln bzw. auszubauen, um Menschen mit psychosozialem Betreuungsbedarf und Suchtkranken eine weitestgehend selbstständige Lebensführung in gewohnter Umgebung zu ermöglichen" (ebd.: 2).
Auf den Bereich der Mobilität wird im österreichischen NAPincl allerdings nicht ausdrücklich Bezug genommen.
Interessierte im vorangegangen Kapitel die Gefährdung behinderter Menschen durch soziale Ausgrenzung am Beispiel ausgewählter, auf Österreich Bezug nehmende, Bereiche, so geht es im folgenden darum, Grundsätze und Richtlinien internationaler Behindertenpolitik aufzuzeigen, die im Kontext sozialer Inklusion von Menschen mit Behinderungen stehen, wobei besonders der Faktor des Zugangs zur Umwelt (Mobilität) berücksichtigt wird. Da Österreich Mitglied der Europäischen Union und Teil der internationalen Gemeinschaft ist und somit jene Grundsätze auch nationale Bedeutsamkeit besitzen, sollte auf diese Ausführungen nicht verzichtet werden. Neben einer bereits weiter oben angesprochenen programmatischen Ausrichtung österreichischer Behindertenpolitik im Kontext der Bekämpfung sozialer Exklusion (NAP), soll die österreichische "Risikobearbeitung" sozialer Exklusion primär anhand des Mobilitätsbereichs aufbereitet werden. (vgl. 5)
Obwohl Behindertenpolitik nach wie vor nationale Politik ist, ist es sinnvoll, sich entsprechende Grundsätze und Richtlinien anzusehen, da alle Vorschläge, Aktivitäten, Initiativen und Programme der Europäischen Union (EU) eine direkte oder indirekte Auswirkung auf das Leben behinderter BürgerInnen in der Union hat. Vorangestellt werden kann, dass Diskriminierung und soziale Exklusion behinderter Menschen ein in ganz Europa verbreitetes Phänomen ist, das Auswirkungen auf europäischer Ebene hat. (vgl. McKay 1995: 21)
Wie bereits weiter oben erwähnt, wird im Vertrag von Amsterdam (Artikel 137 EG-Vertrag) die Bekämpfung sozialer Exklusion zum Ziel erklärt. Die Mitgliedsstaaten wurden aufgefordert nationale Aktionspläne für die Förderung von Inklusion festzulegen. Darin sollen Maßnahmen (unter anderem für Menschen mit Behinderungen) entwickelt werden, die die Förderung im Beschäftigungs-, Bildungs- und Ausbildungsbereich sowie in der Gesundheits- und Wohnungspolitik stärker berücksichtigen. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 75)
"Die Europäische Kommission strebt im Behindertenbereich im Wesentlichen die Ziele
-
‚Kampf gegen Diskriminierung und soziale Ausgrenzung',
-
die ‚Förderung von Beschäftigung' sowie die
-
‚Förderung der Zugänglichkeit' an." (ebd.: 74)
Bereits in der 1989 verabschiedeten "Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer" (Art.26), die als Orientierungslinie für Sozialpolitik heranzuziehen ist, sind Maßnahmen zugunsten von behinderten Menschen vorgesehen. Es wird darin gefordert, dass Menschen mit Behinderung konkrete ergänzende Maßnahmen in Anspruch nehmen können, die ihre berufliche und soziale Eingliederung fördern. Als Maßnahmen die zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen führen, werden unter anderem die Bereiche Zugänglichkeit, Mobilität und Verkehrsmittel erwähnt. Die Charta stellt aber lediglich eine Empfehlung dar und ist nicht rechtsverbindlich. (vgl. Funk 1994: 74f)
Eines der ersten nennenswerten europaweiten Projekte zum Abbau von Barrieren war die "Erklärung von Barcelona" (1995), in der sich europäische Städte zusammengeschlossen und selbst verpflichtet haben, ihre Städte barrierefrei zu gestalten. Diese Aktion hatte eine "starke Impulswirkung". (Bloemers 2004: 233)
In dem anlässlich des Europäischen Behindertentages 1995 veröffentlichten Bericht "Unsichtbare Bürger", geschrieben von Menschenrechts- und BehindertenanwältInnen, wurde der Status behinderter Menschen in den EU-Verträgen aus rechtlicher Sicht untersucht. Die in dem Bericht von 1995 enthaltenen Fallbeispiele zeigen auf, dass Menschen mit Behinderung ihre mit der europäischen BürgerInnenschaft verbundenen Rechte verweigert werden: So wird z.B. das Recht auf freien Personenverkehr dadurch eingeschränkt, dass behinderte Personen auf Probleme stoßen, wenn es um den Zugang zu Verkehrsmitteln, Wohnungen, die Unterstützung für eine unabhängige Lebensführung geht. Die Bewegungsfreiheit in der EU wird dadurch eingeschränkt. Ebenso wird die Freiheit zur Beanspruchung von Diensten beschnitten, sei es, dass Dienstleistungsanbieter (Restaurants, Kino, Bars, etc.) behinderten Menschen den Zugang verweigern oder, dass Transportunternehmen bewegungseingeschränkten Personen die Mitfahrt entweder gar nicht oder nur unter gewissen Bedingungen gestatten und darüber hinaus sind viele Dienstleistungen und Geschäfte in unzugänglichen Gebäuden zu finden. Der Bericht weist darauf hin, dass in manchen Ländern behinderte Menschen keinen Zugang zu einem Auto und Schwierigkeiten bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Bei der Zugänglichkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln wird zu wenig unternommen, heißt es, wobei hier die europäische Dimension zu berücksichtigen wäre, da die Zugänglichkeit auch bei grenzüberschreitendem Verkehr koordiniert werden sollte, beispielsweise durch Richtlinien über den Bau von Linien- und Reisebussen. (vgl. McKay 1995: 25f)
Der Bericht wies unter anderem auch darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen in den Verträgen nicht erwähnt wurden. Dieser Umstand hat sich seit 1997 durch den Artikel 13 im Vertrag von Amsterdam (EG-Vertrag) (ist 1999 in Österreich in Kraft getreten) sowie die 2003 verabschiedeten EU-Antidiskriminierungsrichtlinien geändert. Die in Artikel 13 EG-Vertrag enthaltene Antidiskriminierungsbestimmung überträgt der EU zum ersten Mal Kompetenzen im Behindertenbereich und erkennt damit die Tatsache, dass es behinderte Menschen gibt, an. Direkte Auswirkungen hat die Bestimmung jedoch keine, da der Artikel der Europäischen Gemeinschaft lediglich gestattet, Maßnahmen gegen Diskriminierung zu ergreifen. Den einzelnen BürgerInnen werden keine Rechte gegeben, auf die sie sich berufen könnten. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 62f)
In der Charta der Grundfreiheiten der Europäischen Union (2000) wird in Artikel 21 bekräftigt, dass jede Diskriminierung wegen einer Behinderung verboten ist. Weiters wird in der Charta "das Recht von Menschen mit Behinderungen auf begünstigende Maßnahmen, welche geeignet sind, ihre Unabhängigkeit, ihre gesellschaftliche und berufliche Integration und Teilnahme am Leben der Gemeinschaft, zu gewährleisten" (Hofer 2006a: 18) anerkannt.
Die beiden EU-Antidiskriminierungsrichtlinien 43/2000 und 78/2000, die Diskriminierung unter anderem aufgrund einer Behinderung und in Bereichen, wie etwa beim Zugang zu Waren und Dienstleistungen verbieten, haben bereits eine mittelbarere Wirkung für die Mitgliedsstaaten, da sie in nationale Rechte eingehen. Die Richtlinie 78 soll insbesondere den Gleichbehandlungsgrundsatz aller Personen im Erwerbsleben gewährleisten. ArbeitgeberInnen werden demnach aufgefordert Vorkehrungen zu treffen um Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur Beschäftigung zu ermöglichen. Die Richtlinien sollten von den Mitgliedsstaaten der EU bis Ende 2003 auf nationaler Ebene umgesetzt werden. (vgl. Hofer 2006a: 18f) In Österreich erfolgte die Umsetzung der Richtlinien durch das so genannte "Behindertengleichstellungspaket", im Rahmen dessen 2006 unter anderem das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft trat sowie bestehende Gesetze novelliert wurden.
2001 wurde die Resolution des Europäischen Parlaments "Auf dem Weg zu einem Europa ohne Hindernisse für Menschen mit Behinderungen" fast einstimmig angenommen. Sie stellt eine politische Willenserklärung bezüglich der Barrierefreiheit für behinderte Menschen dar, gibt einen Überblick über die EU-Strategie in der Behindertenpolitik und enthält konkrete Zielvorgaben sowie geplante Maßnahmen. (vgl. Hofer 2006a: 19, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 77)
Die im Jahr 2002 vom "Europäischen Kongress über Behinderung" verabschiedete "Deklaration von Madrid" stellt eine bedeutsame politische Willenserklärung der Europäischen Behindertenorganisationen dar und
"(...) drückt die nachhaltige Forderung nach voller Chancengleichheit und Gleichberechtigung in der Gesellschaft aus. Die Deklaration wird inzwischen von zahlreichen Behindertenorganisationen als Grundlage für ihre politische Lobbytätigkeit zur Erreichung der von behinderten Menschen geforderten gesellschaftlichen Gleichberechtigung verwendet" (Hofer 2006a: 20).
Sie wurde auf der Grundlage von sechs theorie- und empiriegestützten Thesen verfasst (vgl. Bloemers 2004: 228f):
-
Behinderung ist ein Menschenrechtsthema
-
Behinderte Menschen wollen Chancengleichheit und nicht Wohltätigkeit
-
Barrieren in der Gesellschaft führen zu Diskriminierung und sozialem Ausschluss
-
Behinderte Menschen: Die unsichtbaren Bürger
-
Behinderte Menschen bilden eine verschiedenartige Gruppe
-
Nicht-Diskriminierung plus positive Handlung(en) = soziale Inklusion
Das Jahr 2003 wurde von der EU zum "Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen" erklärt. Im Rahmen dessen wurden finanzielle Mittel bereitgestellt, die Maßnahmen sowohl auf europäischer Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedsstaaten fördern sollten. Als Ziele wurden unter anderem verfolgt (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 77f):
-
Sensibilisierung für den Diskriminierungsschutz und die Gleichberechtigung behinderter Menschen;
-
Förderung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen;
-
Förderung beispielhafter Verfahren und Strategien (Best-Practice-Modelle);
-
Sensibilisierung für die vielfältigen Formen der Diskriminierung behinderter Menschen,
-
Positive Darstellung der Menschen mit Behinderungen; usw.
In Österreich wurden als Schwerpunkte beispielsweise die Sensibilisierung der Bevölkerung für ein verändertes Bild von Menschen mit Behinderungen, die Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung (so genannte "Behindertenmilliarde") und auch "Barrierefreiheit im umfassenden Sinn" festgelegt. (ebd.)
Dem Thema Mobilität und der Förderung der Zugänglichkeit für behinderte Menschen wurde seitens der EU-Politik weiters durch zwei Maßnahmen Aufmerksamkeit geschenkt:
-
1998 wurde die "Empfehlung des Rates betreffend eines Parkausweises für Behinderte" verabschiedet. Ein einheitlicher EU-weit gültiger Behinderten-Parkausweis soll in allen Mitgliedsstaaten anerkannt werden. Diese Maßnahme wurde in Österreich bereits umgesetzt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 76; Hofer 2006a: 18)
-
2001 wurde die "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über besondere Vorschriften für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz" angenommen. Diese Richtlinie legt fest, dass ab 2003 bestimmte Omnibusse, die vor allem für den Stadtverkehr von Bedeutung sind, nur noch dann eine Typengenehmigung erhalten, wenn sie für Personen mit eingeschränkter Mobilität, einschließlich RollstuhlfahrerInnen, zugänglich sind. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 77)
Hervorgehoben sei abschließend noch eine zentrale Dimension der EU-Behindertenpolitik: Seit 1996, mit der Entschließung des Rates zur Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen, kommt dem Prinzip oder Grundsatz des "Mainstreaming" besondere Bedeutung zu. Das bedeutet, dass die Anliegen behinderter Menschen in sämtlichen Politikbereichen zu beachten sind, also die Interessen von behinderten Personen bei allen politischen Maßnahmen auch zu berücksichtigen sind. (vgl. Hofer 2006a: 16; Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 74). Diesem Ansatz wird meines Erachtens in den nächsten Jahren noch verstärkt Aufmerksamkeit auch in der nationalen Behindertenpolitik geschenkt werden müssen, um dadurch volle gesellschaftliche Inklusion und Teilhabemöglichkeiten behinderter Menschen gerade auch im Bereich der Mobilität zu fördern.
Folglich sollten noch einige wichtige internationale Bestimmungen erwähnt werden.
Vereinte Nationen
Das Jahr 1981 wurde von der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) zum Internationen Jahr der Behinderten erklärt und damit die "Dekade der Behinderten" (1983-1992) eingeleitet. 1982 wurde durch das "Weltaktionsprogramm" das Recht der behinderten Menschen auf Chancengleichheit mit anderen BürgerInnen und auf gleiche Teilhabe an den Verbesserungen der Lebensbedingungen, bekräftigt. (vgl. Weidert 2000: 136)
Während der "Dekade der Behinderten" wurden in vielen Nationen Ist-Zustandserhebungen zur Lage der Menschen mit Behinderung erarbeitet und es kam zur vermehrten Bildung von Dachorganisationen. Die Forderungen bezogen sich einerseits auf die bürgerrechtliche Gleichstellung behinderter Personen durch die Zugänglichmachung öffentlicher Bauten und Verkehrsmittel, die Abschaffung ausschließender Strukturen am Arbeitsmarkt usw. und andererseits konzentrierten sie sich auf die Herstellung von Strukturen, die ein möglichst selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen mittels Direktzahlungen und persönlicher Assistenz gewährleisten sollten. Behinderte Menschen wurden zumindest tendenziell vom Objekt zum Subjekt staatlicher und internationaler Politik erhoben. (vgl. Riess/Flieger 2000)
Dass Behindertenfragen auch als Menschenrechtsfragen thematisiert gehören, wurde unter anderem bereits durch die UN-Resolution von 1975 aufgezeigt, in der es heißt: "Behinderte Menschen haben dieselben bürgerlichen politischen Rechte wie alle anderen Menschen" und "Behinderte Menschen haben Anspruch auf Maßnahmen, die ihnen dazu verhelfen, zu größtmöglicher Selbständigkeit zu gelangen". (BIZEPS 1999: Online)
Von Bedeutung ist insbesondere die 1993 verabschiedete Resolution "Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte". Dieses Dokument skizziert in 22 Standardregeln wie die Mitgliedsstaaten die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung sicherstellen sollen. Es findet sich darunter auch eine Standardregel, die explizit auf die Schaffung einer behindertengerechten Umwelt Bezug nimmt:
"Die Staaten sollen bei der Herstellung der Chancengleichheit in allen Gesellschaftsbereichen die allgemeine Bedeutung einer behindertengerechten Umwelt erkennen. Die Staaten sollen für Menschen mit Behinderungen, gleich welcher Art, a) Aktionsprogramme für eine behindertengerechte Gestaltung der Umwelt einführen und b) Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten zu gewährleisten." (UN Standardregel Nr.5 1993 zitiert nach ForseA 2006)
Hinsichtlich der behindertengerechten Gestaltung der baulichen Umwelt wird insbesondere empfohlen:
"Die Staaten sollen Maßnahmen zum Abbau bestehender Hindernisse ergreifen, die sich dem Zugang zur baulichen Umwelt in den Weg stellen. Sie sollen Normen und Richtlinien ausarbeiten und den Erlaß von Rechtsvorschriften erwägen, um die behindertengerechte Gestaltung verschiedener Bereiche - Wohnungen, Gebäude, öffentliche und sonstige Verkehrseinrichtungen, Straßen, Plätze usw. - zu gewährleisten.
Die Staaten sollen sicherstellen, daß Architekten, Bauingenieure und andere, die durch ihre planerische und bauliche Tätigkeit die Umwelt mitgestalten, Zugang zu entsprechenden Informationen über Behindertenpolitik und über Maßnahmen zur Schaffung einer behindertengerechten Umwelt erhalten.
Die Anforderungen an eine behindertengerechte Umwelt sollen in die planerischen und baulichen Maßnahmen von Beginn an einbezogen werden.
Behindertenorganisationen sollen bei der Ausarbeitung von Normen für eine behindertengerechte Umwelt beteiligt werden. Auch bei öffentlichen Bauvorhaben sollen sie vom Beginn der Planungsphase an einbezogen werden, um eine möglichst behindertengerechte Umwelt sicherzustellen." (UN Standardregel Nr.5 1993 zitiert nach ForseA 2006)
ExpertInnen weisen darauf hin, dass die Standardregeln bzw. Rahmenbestimmungen zwar kein bindendes Gesetz darstellen, aber "dennoch erwächst aus ihnen eine starke moralische und politische Verpflichtung der Staaten zum Handeln. Außerdem fordern sie die Staaten zur Zusammenarbeit bei der Schaffung der politischen Voraussetzungen für die Chancengleichheit behinderter Menschen auf" (Weidert 2000: 137).
Europäische Sozialcharta (ESC)
Der 1969 von Österreich ratifizierte multilaterale völkerrechtliche Vertrag, garantiert jedem behinderten Menschen das Recht auf berufliche Ausbildung und (Wieder)Eingliederung. Die Vertragspartner verpflichteten sich zu entsprechenden Maßnahmen. Aufgrund der Transformierung als einfaches Gesetz, ist jedoch eine unmittelbare Anwendbarkeit ausgeschlossen und es können keine Ansprüche Einzelner abgeleitet werden. (vgl. Funk 1994: 67)
Die revidierte Europäische Sozialcharta, die 1999 von Österreich unterzeichnet wurde, stellt eine modernisierte und um eine Reihe neuer Rechte erweiterte Form dar. Der revidierte Artikel 15 sieht das Recht der behinderten Menschen auf Eigenständigkeit und soziale Eingliederung sowie auf Teilhabe am Leben der Gemeinschaft vor. Der ratifizierende Staat verpflichtet sich darin, für behinderte Menschen die vollständige soziale Eingliederung und volle Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu fördern, insbesondere durch Maßnahmen, einschließlich technischer Hilfen, die darauf gerichtet sind, Kommunikations- und Mobilitätshindernisse zu überwinden und ihnen den Zugang zu Beförderungsmitteln, Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Aktivitäten zu ermöglichen. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 81f)
In einer weiteren Resolution (ResAP, 2002) verabschiedete der Europarat die Empfehlung, die Mitgliedsstaaten mögen Grundsätze allgemein handhabbarer Umweltgestaltung ("principles of universal design") in die Ausbildungsvorschriften aller mit baulicher Gestaltung befassten Berufe aufnehmen. (ebd.)
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
Im Dokument des Moskauer Treffens über die menschliche Dimension der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) von 1991 wird festgehalten:
"Die Teilnehmerstaaten beschließen unter anderem:
-
den Schutz der Menschenrechte für Behinderte zu gewährleisten
-
Maßnahmen zu treffen, um die Chancengleichheit und die volle Teilnahme solcher Personen am öffentlichen Leben zu gewährleisten
-
zu günstigen Zugangsmöglichkeiten für Behinderte zu öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, zu Wohnhäusern, Transportmitteln sowie kulturelle Veranstaltungen und Erholungsmöglichkeiten zu ermutigen." (BIZEPS 2004: Online)
Trotz der, wie wir gesehen haben, beträchtlichen Aktivitäten der Europäischen Union und internationaler Einrichtungen im Kontext der sozialen Inklusion, Anerkennung, Gleichstellung und Antidiskriminierung behinderter Menschen und den damit erwartbaren positiven Auswirkungen auf die nationalen Behindertenpolitiken der einzelnen Mitgliedsstaaten bzw. Unterzeichnerstaaten, zeigt sich die Situation in den Ländern allerdings noch verbesserungswürdig. In der internationalen Vergleichsstudie "Behindertenpolitik zwischen Beschäftigung und Versorgung", die von der OECD im Jahr 2003 veröffentlicht wurde und in die 20 OECD-Länder (darunter auch Österreich) eingebunden waren, wird z.B. darauf hingewiesen, dass von keinem der untersuchten Länder gesagt werden kann, "dass es eine besonders erfolgreiche Behindertenpolitik verfolgt". (OECD 2003: 26f)
[11] Zurückgegriffen wird dabei auf die Darstellung verschiedener Interventionstheorien in Bezug auf Behinderung von Johnstone (2004: 157fff).
[12] Die Independent-Living-Bewegung ist in den USA Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre aus den BürgerInnenrechtsbewegungen behinderter Menschen entstanden, welche sich inhaltlich und strategisch an der BürgerInnenrechtsbewegung der AfroamerikanerInnen und der Frauenbewegung anlehnten. Independent-Living hat sich mittlerweile als weltweite Bewegung etabliert und ist in regionalen und/oder nationalen Netzwerken organisiert. (vgl. Österwitz 1996) In Österreich formierten sich Ende der 1980er Jahre autonome Behindertengruppen (Selbstbestimmt-Leben-Initiativen), die sich an den Ideen und Prinzipien des "Independent-Living" orientieren. Es begann die Gründung von Selbstbestimmt-Leben-Zentren in den größeren Städten. (vgl. Riess 1999, Schönwiese 1999)
[13] ÖSTAT. Telefonische Auskunft, 22.7.2005.
[14] Unter ökonomische Ressourcen ist zu verstehen: "Einkommen und Vermögen sichern die Inklusion in das Wirtschaftssystem als Konsument, aber auch die Teilhabe an wirtschaftlichen Austauschprozessen wie Verkauf, Investition oder Spekulation" (...) "Über ökonomische Ressourcen regeln sich darüber hinaus der Wohnstandard, Möglichkeiten der Mobilität, die Teilhabe an kulturellen Angeboten sowie der Lebensstandard im Alter" (Wansing 2005: 71).
[15] Soziale Ressourcen umfassen "die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen" (Bourdieu zitiert nach Wansing 2005: 72).
[16] Kulturelle Ressourcen bzw. Kapital: Königseder fasst mit Bezugnahme auf das Bourdieu'sche Verständnis von kulturellem Kapital zusammen: "Das kulturelle Kapital existiert in drei Formen: - in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand, als dauerhafte Disposition des Organismus - in objektiviertem Zustand, also in Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen, in denen bestimmte Theorien und deren Kritiken, Problematiken usw. Spuren hinterlassen oder sich verwirklicht haben, und in - institutionalisiertem Zustand, was dem kulturellen Kapital, das sie garantieren soll, ganz einmalige Eigenschaften verleiht." (Königseder 1999: 27)
[17] Die Formulierung "Exklusionsrisiko Behinderung" wurde von Wansing (2005) übernommen.
[18] Die Gliederung in jene drei Bereiche erfolgt in Anlehnung an Wansing (2005), wobei die Autorin als vierten Bereich an dem sie Prozesse der sozialen Ausgrenzung behinderter Menschen beleuchtet, deren "Soziale Isolation und Diskriminierung" anführt. Es wird aus Platzgründen auf die nähere Ausführung dieses Aspekts verzichtet. Es sei aber angemerkt, dass, was Wansing (2005) für Deutschland feststellt, wohl auch für Österreich aussagekräftig ist, u.zw., dass "für viele Menschen mit Behinderung diskriminierende Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen fester Bestandteil ihrer Lebenssituation" ist (93).
[19] "Clearing" ist eine Maßnahme für behinderte SchülerInnen ab der 7. Schulstufe und für Jugendliche, welche die Schule bereits absolviert haben. Mit "Clearing" wird direkt an der Nahtstelle Schule/Beruf angesetzt. Clearingeinrichtungen legen gemeinsam mit den Betroffenen das individuell am besten geeignete Maßnahmenpaket zur beruflichen Integration fest. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 102; NAP inclusion 2003-2005: 59)
[20] Unter Zugänglichkeit wird in der Studie "die barrierefreie Gestaltung und Ausstattung von Gebäuden sowie die Benutzbarkeit von Verkehrsmitteln und Einrichtungen zur Telekommunikation für Personen mit Behinderung verstanden" (Riess/Flieger 2000: Online).
Inhaltsverzeichnis
Mobilität kann als "(...) Veränderung mobilitätsfähiger Einheiten zwischen zwei Elementen im geographischen Raum" (Kaiser zitiert nach Stöppler 1999: 19) definiert werden. Sie bezieht sich immer auf Individuen, im Unterschied zum Verkehr, der die "(...) Summe von individuellen räumlichen Fortbewegungen in einem definierten Gebiet und Zeitraum" (Limbourg/Flade/Schönharting 2000: 12) bezeichnet.
Grundsätzlich ist soziale von räumlicher Mobilität zu unterscheiden. Erstere bezeichnet den Wechsel zwischen einerseits höheren und tieferen sozialen Positionen (vertikale Mobilität) und andererseits gleichrangigen sozialen Positionen (horizontale Mobilität) aufgrund innerbetrieblicher oder außerbetrieblicher Karriere. Räumliche Mobilität hingegen ist mit Ortsveränderungen verbunden, wobei wiederum zwischen einem Wohnortswechsel (residentielle Mobilität) und einem alltäglichen Ortswechsel (zirkuläre Mobilität), um Aktivitäten wie Arbeiten, Versorgung, Freizeit etc. nachzugehen, zu unterscheiden ist. (vgl. Stöppler 1999: 19)
In dieser Arbeit wird Mobilität verstanden als zirkuläre, räumliche Mobilität, wobei bei der durchgeführten Fallstudie speziell die öffentlich-städtische Verkehrsmobilität, das alltägliche Mobilitätsverhalten[21]von RollstuhlfahrerInnen im öffentlich-städtischen Verkehrsraum im Mittelpunkt steht.
Mobilität steht im Konnex zu (öffentlichem) Raum. Sie ist nicht loszulösen von der gebauten Umwelt, dem gebauten Raum samt seiner Einrichtungen (z.B. Verkehrsmittel). Im einleitenden Exkurs dieses Kapitels wird diesen Verflechtungen genauer nachgegangen, da so gewonnene Erkenntnisse als fruchtbar zum Verständnis der Bedeutung von Mobilität als Faktor für soziale Exklusion bzw. Inklusion befunden wird. An den Exkurs anknüpfend wird detailliert auf die Funktionen und Dimensionen von Mobilität eingegangen, geklärt warum Mobilität als machtvolle, "ermächtigende" Ressource anzusehen ist, welche Mobilitätsbarrieren wirksam werden können bzw. welche Anforderungen an eine "barrierefreie Mobilität" für Menschen mit Behinderungen bestehen und schließlich, welche Rahmenbedingungen und AkteurInnen im (politischen) Feld Mobilität eine Rolle spielen.
2.1.1 Raum [22]
2.1.1.1 Gebauter und sozialer Raum
Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen physisch-gebautem und sozialem Raum. Der physische Raum ist nach Bourdieu (1991: 28) nur als Abstraktion denkbar, das heißt unter Absehung von allem, was darauf zurückzuführen ist, dass er ein bewohnter und angeeigneter Raum ist. Er stellt demnach eine soziale Konstruktion und Projektion des sozialen Raumes dar.
Der gebaute Raum, als spezielle Form des physischen Raums strukturiert quasi letzteren durch Grenzziehungen, wobei diese Grenzen der Mensch mittels Planung und Bebauung vornimmt. Daraus folgt, dass gebauter Raum bestimmte Vorstellungen und soziale Verhältnisse widerspiegelt. Er ist "(...) eine soziale Struktur in objektiviertem Zustand". (ebd.: 28)
Der abstrakte Begriff des "sozialen Raums" meint nicht einen "realen" Raum, sondern institutionalisierte soziale Beziehungen, die sich durch Inhalt (z.B. Politik, Wirtschaft, Sport etc.) und Form unterscheiden. Sozialer Raum kann, im Sinne Bourdieus', synonym mit Gesellschaft, die immer auch lokalisiert ist, umschrieben werden und besteht aus einem Ensemble von Subräumen oder Feldern (wirtschaftliches, politisches, künstlerisches etc.), in denen "Verteilungskämpfe" um ökonomisches, politisches, soziales etc. Kapital stattfinden. Kennzeichnend für den sozialen Raum ist weiters die Regelung des Zugangs und die Reichweite der Entscheidungen, die in diesem Raum gefällt werden können. (vgl. Bourdieu 1991; Königseder 1999: 10)
Sozialer und physisch-gebauter Raum stehen in enger Verknüpfung und Wechselwirkung zueinander. Die Gestaltung und Nutzung des gebauten Raumes wird geprägt von den Akteursentscheidungen, die in den (halböffentlichen) sozialen Räumen, das heißt z.B. von PolitikerInnen, ArchitektInnen, PlanerInnen, Verkehrsbetreibern, EigentümerInnen usw., ausverhandelt und getroffen werden. Einfluss auf die Gestaltung und Nutzung gebauten Raums kann auf vielfältige Weise genommen werden, sei es durch das Bauen oder Entfernen physischer Begrenzungen, durch die Belegung der Nutzung mit Ge- oder Verboten, Zugangs- Ausschlussmöglichkeiten oder etwa auch durch das Einsetzen öffentlicher Verkehrsmittel, die nicht für alle Menschen benutzbar sind. Neben politischen EntscheidungsträgerInnen verfügen insbesondere ArchitektInnen und PlanerInnen über ein hohes Maß an raumbezogener Durchsetzungs-und Definitionsmacht. Es darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass den Hintergrund ihrer professionellen Handlungen ihre spezifischen Erfahrungen und Anschauungen bilden, welche immer auch gesellschaftlich kontextualisiert und das heißt, geprägt sind von den herrschenden Norm- und Wertvorstellungen. (vgl. Königseder 1999)
Gebauter Raum ist jedoch nicht nur ein sozial konstituiertes und konstruiertes und eo ipso veränderbares (!) "Produkt", sondern beeinflusst, strukturiert und reguliert maßgeblich das alltäglich Verhalten und die Lebenssituation der Menschen. (ebd.: 12)
2.1.1.2 Privater und (halb-)öffentlicher Raum
Im Unterschied zu privaten Räumen, die mehr oder weniger auf die Wohnung oder das eigene Haus begrenzbar und mit dem sozialen Raum der Familie oder sozialen Beziehungen verbunden sind, verfügen (halb-)öffentliche Räume über eine große und vor allem, gesellschaftlich gesehen, machtvollere Reichweite. Als soziale Räume betrachtet (Organisationen, Parteien, Vereine usw.), werden hier die Entscheidungen beispielsweise bezüglich der physischen Bebauung und Ausgestaltung des (halb-)öffentlichen Raumes getroffen. (vgl. Königseder 1999)
Öffentlicher kann von halböffentlichem Raum dadurch unterschieden werden, dass bei ersterem bestimmte Raumausschnitte im "Besitz" der Allgemeinheit sind und allen Gesellschaftsmitgliedern - theoretisch zumindest - offen stehen: der Straßenraum ab der privaten Haustürschwelle, öffentliche Gebäude, Plätze, Parks, Spielplätze etc. (ebd.)
Der gebaute städtisch-öffentliche Raum besteht aus mobilen (z.B. öffentlichen Verkehrsmittel) und immobilen (z.B. Straßen, Gehsteige, Häuser) Artefakten, die für bestimmte Zwecke hergestellt und positioniert worden sind. Diese, von Menschen produzierten Gegenstände erhalten somit bereits bei ihrer Herstellung Bedeutung und Funktionen. (vgl. Scheller 1995: 79)
Öffentlicher Raum ist nicht nur ein wichtiger Begegnungs- und Kommunikationsort, sowie ein Ort um Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern er symbolisiert darüber hinaus städtische Freiheit schlechthin und die Nutzung stellt ein bürgerliches Freiheitsrecht dahingehend dar, dass er dafür gedacht ist, dass er niemandem und dennoch allen BürgerInnen gehört und zu dem alle Menschen von Gesetzes wegen Zutritt und Nutzungsanspruch haben sollten. In der (alltäglichen) Praxis steht er jedoch nicht allen BürgerInnen gleichermaßen offen, sondern bestimmte Gruppen sind von der Beteiligung am öffentlichen Leben (Politik, Freizeit, Arbeit, Kultur, Bildung etc.) und auch von physischer Präsenz im öffentlichen Raum ausgeschlossen, weil sie beispielsweise nicht über die benötigten Nutzungsmittel (Auto, öffentliche Verkehrsmittel, etc.) verfügen oder sie in Anspruch nehmen können. (vgl. Scheller 1995). Dazu zählen insbesondere Menschen mit Behinderungen.
Die physische Durchquerung öffentlichen Raums ermöglicht vielfach erst den Zugang zu den halböffentlichen Räumen. Halböffentliche Räume stehen zwar grundsätzlich in ihrer spezifischen Funktion auch allen BürgerInnen zur Verfügung, "gehören" ihnen aber nicht, wobei der Zutritt grundsätzlich ebenso für alle gegeben sein sollte: Geschäfte, Restaurants, Freizeitstätten, Bahnhöfe, Kirchen etc. Allerdings können bestimmte Voraussetzungen oder Bedingungen an den Zutritt geknüpft sein, wie z.B.: Konsumation, Arbeitsverhältnis, Eintrittskarte, etc. (ebd.)
Die Unterscheidung zwischen privatem, halböffentlichem und öffentlichem Raum ist in der Realität nicht eindeutig möglich; die Grenzen variieren und hängen mit den subjektiv-spezifischen Interpretationen und Definitionen der BenutzerInnen im Besonderen, sowie gesellschaftlicher Gruppierungen im Allgemeinen, zusammen.
Räume und Orte sind nichts Ein-für-alle-mal-Feststehendes, sondern sie sind unbestimmt, fließend und kontextabhängig, "(...) (d)enn das, was Räume und Orte definiert, sind soziale Praktiken und kulturelle Werte, die sich zudem meist räumlich überschneiden und überlappen und keine eindeutigen Grenzen aufweisen". (Terlinden 2002: 142f)
Es drücken sich nicht nur soziale Verhältnisse in den Strukturen der gebauten Umwelt aus, sondern auch Machtverhältnisse: "Raum ist für jede Form kommunalen Lebens fundamental, Raum ist für jede Form der Machtausübung fundamental" (Michel Foucault zitiert nach Soja 1991: 77).
Als zentrale Punkt im Konnex von Raum und Macht sind unter anderem herauszugreifen: das Handlungsvermögen der Personen, der Zugang zu Ressourcen, die Verknüpfung von Wissen, Wahrheit und Macht und die Reproduktion von Machtstrukturen durch den expliziten und impliziten Bezug darauf. (vgl. Scheller 1995: 98) In den weiteren Ausführungen werden diese Punkte berücksichtigt.
2.1.2.1 Definitions- und Gestaltungsmacht
Ein Kreuzungspunkt von Macht und Raum ist jener, wenn es darum geht Definitions- und Gestaltungsmacht über den öffentlich-städtischen Raum zu haben. Es ist von großer Wichtigkeit, wer Sinngehalt - und das heißt zu bestimmen, was als "wahr" oder "normal" gilt - verleihen und damit über Raum-Zutritt oder Raum-Ausschluss bestimmen kann. Dies betrifft allerdings nicht nur den gebauten Raum, sondern genauso die Einrichtungen und Transportmittel, die zur Durchquerung des öffentlichen Raumes dienen. Diese materiellen Artefakte sind nicht als "neutrale" und wertfreie Objekte anzusehen, sondern sie spiegeln gewissermaßen die Funktionen und Bedeutungen wider, die ihnen von den ProduzentInnen (bewusst oder unbewusst) mitgegeben wurden.
Die PlanerInnen und KonstrukteurInnen der gebauten und beweglichen Artefakte der öffentlich-städtischen Umwelt bestimmen (bewusst oder unbewusst) die Eigenschaften, über die Individuen verfügen müssen, um die Objekte für sich nutzbar zu machen. Sie haben demnach ein großes, machtvolles Potential, um damit auch soziale Bedeutungen zu tradieren und gewisse soziale Gruppen zu bevorzugen und andere auszugrenzen - die Aneignungsmöglichkeiten von gebautem und sozialem Raum für manche zu fördern oder für andere zu hemmen. (vgl. Scheller 1995: 98f; Königseder 1999: 64)
Der öffentlich-städtische Raum kann als zonierter Raum begriffen werden, das heißt, er weist permanent Zonen auf, die von mehr oder weniger starren Funktionen und über klar definierte Zielgruppen bestimmt sind. Es werden spezifische soziale Gruppen oder Bevölkerungssegmente mehr angesprochen als andere. So ist der städtische Raum der Gegenwart vor allem für Auto fahrende und voll Erwerbstätige konzipiert und gebaut. (vgl. Scheller 1995: 102f)
Der Raumplanung und -bebauung, aber auch der (Aus-)gestaltung von (öffentlichen) Transportmitteln, liegt die Orientierung entlang der Bedürfnisse eines fiktiven Normmenschen zugrunde, der jung, gesund, männlich und leistungsfähig ist. (vgl. Hohenester 1994: 83)
Es ist aber davon auszugehen, dass jene Formung von Raumstrukturen nicht bewusst erfolgt, um bestimmte Personengruppen auszuschließen, sondern es sich eher um "nicht-intendierte Handlungsfolgen" handelt. (vgl. Scheller 1995: 102f)
Es setzten sich "(...) in der Regel solche sozialen Praktiken und kulturellen Wertmuster symbolisch und materiell durch, die von machtvollen Gruppen getragen werden" (Terlinden 2002: 143). Politik, Stadtplanung, Architektur, Eigentümer sind als machtvolle Instanzen und Entscheidungsträger identifizierbar, wenn es darum geht, welche und inwiefern Nutzungsansprüche bei der Planung und Gestaltung von öffentlichen und halböffentlichen Räumen berücksichtigt werden. Nutzung und Aneignungsmöglichkeiten von Räumen werden durch diese Instanzen sozusagen vorstrukturiert. (vgl. Scheller 1995: 84)
Festzuhalten gilt, dass der öffentlich-städtische Raum samt Einrichtungen, Transportmittel etc. entlang von spezifischen Normen konstituiert wird, welche von ProduzentInnen, VerwalterInnen und EntscheidungsträgerInnen definiert, generiert und durchgesetzt werden. Der auf diese Art "genormte" Raum impliziert eine Normalität, die den BenutzerInnen quasi als ein "stummes Gebot" abverlangt wird, wollen sie sich in diesem Raum bewegen. Von entscheidender Bedeutung ist daher: Wer definiert die Normen und setzt sie durch? Wie sehen diese Normen aus? Welche "Normalität" liegt diesen Normen zugrunde?
2.1.2.2 Verfügungsmacht und Handlungsvermögen
Wie Scheller (1995) - den Machtkonzeptionen von Anthony Giddens und Pierre Bourdieu folgend - feststellt, ist zur Gestaltung, Bewahrung und Veränderung von (räumlichen) Strukturen der Zugang zu allokativen und autoritativen Ressourcen[23] notwendig, die an der Generierung von Macht beteiligt sind.
Das Handeln bzw. das Handlungsvermögen einer Person zu gestalten, zu produzieren und auch Bedeutung zu verleihen, ist abhängig von der Fähigkeit auf jene Ressourcen zurückgreifen zu können und, "(...) je sozial bedeutender die Ressourcen sind, zu denen sie Zugang hat, desto grösser sind das Ausmass an Gestaltungs- bzw. Veränderungsmöglichkeiten und der Wirkungskreis der Handlungsfolgen". (Scheller 1995: 99)
Die unterschiedliche Zugriffsmöglichkeit (Verfügungsmacht) von Personen "(...) ist mit den gesellschaftlichen Regeln zu erklären, in denen festgelegt ist, wer wie, wann und wo welche Ressourcen als Mittel ihres Handelns einsetzen kann und wer nicht". (ebd.: 57) Unter Regeln sind sowohl alltägliche Verfahrensregeln, die gebraucht und informell festgelegt werden als auch Gesetze, die diskursiv formuliert und formalisiert werden, zu verstehen. (ebd.: 56)
Macht ist, im Sinne Giddens, jedem Handeln inhärent und Handeln, das nicht losgelöst von Raum und Zeit betrachtet werden kann, ist rekursiv verknüpft mit Strukturen (Regeln, Ressourcen). Die unterschiedliche Verfügungsmöglichkeit über letztere führt zu Machtverhältnissen, die auch Herrschaft beinhalten. Macht wird dem strukturationstheoretischen Konzept nach also einerseits als Handlungsvermögen ("Macht zu") und andererseits als strukturelle Form von Herrschaft ("Macht über") verstanden, wobei jene Strukturen wiederum die Handlungsvoraussetzungen bilden. Charakteristisch für diesen "prozesshaften" Aspekt von Macht ist folglich die Veränderbarkeit von Strukturen durch Handeln bzw. Handlungsvermögen aller AkteurInnen, den Verfügungsmächtigeren aber auch den weniger Verfügungsmächtigen. Dem/der Einzelnen wird durch die "Macht zu"-Konzeption mehr an ermöglichendem und befähigendem Handlungspotential belassen und zugestanden, als dies durch eine Auffassung gegeben wäre, die Machtverhältnisse a priori als "Herrschafts-Knechtschaftsbeziehungen" ansieht. (ebd.: 56fff) Dennoch manifestiert sich Bedeutung und Funktion in den Raumstrukturen über die Verfügungsmächtigeren und die NutzerInnen müssen ihr Handeln in jene "materialisierten" Strukturen einpassen. Diese von den machtvolleren AkteurInnen - also jenen, die über den öffentlichen und halböffentlichen Raum verfügen, indem sie mehr Zugang und Verfügungsmacht über autoritative und allokative Ressourcen haben - geprägten Strukturen produzieren und konstruieren die "normalen", alltäglichen individuellen raum-zeitlichen Praktiken. Was sich als scheinbar individuelle Handlungs(un)möglichkeit sich als individuelle Erfahrungen im Alltag zeigt, ist zutiefst verwoben mit machtkonnotierten strukturellen gesellschaftlichen Bedingungen. (ebd.: 118)
Steht bei den Betrachtungen von Raum und Macht bei Giddens eher das Handlungsvermögen im Mittelpunkt, so ist dies bei Bourdieu der Herrschaftsaspekt. In einer hierarchisierten Gesellschaft gibt es, wie er schreibt, "(...) keinen Raum, der nicht hierarchisiert ist und nicht die Hierarchien und sozialen Distanzen zum Ausdruck bringt" (Bourdieu 1991: 26f). Das heißt, in den räumlichen Strukturen bilden sich die gesellschaftlichen Hierarchien ab bzw. spiegeln sich wider. Der Theoretiker folgert daraus, "(...) daß der von einem Akteur eingenommene Ort und sein Platz im angeeigneten physischen Raum hervorragende Indikatoren für seine Stellung im sozialen Raum abgeben" (ebd. 26).
Ähnlich wie bei Giddens, bei dem die Verfügungsmacht über Raum abhängig ist vom Zugang zu Ressourcen, hängt bei Bourdieu die Verfügung oder Aneignung von Raum vom ökonomischen (z.B. Besitz an Grund und Boden, Verfügung über Transportmittel), sozialen (Positionen, Status und Beziehungen, die Räume für die einen öffnen und andere ausschließen) und kulturellen Kapital (Wissen und Habitus, die zum Gebrauch des Raumes befähigen) ab. Je größer diese Kapitalien sind, umso ausgeprägter ist die Fähigkeit, den Raum zu dominieren. Mehr Kapitalbesitz ermächtigt gleichermaßen, sich unerwünschte Personen und Dinge vom Leib zu halten, oder sich diesen zu nähern. Im Umkehrschluss kulminiert daher mit Kapitallosigkeit die Erfahrung, "an einen Ort gekettet zu sein" (Bourdieu 1991: 30), sprich geringere räumliche Mobilität und eingeschränkte Freiheit bei der Ortswahl. (vgl. Scheller 1995: 101)
Die Herrschaft über den Raum bildet nach Bourdieu eine der privilegiertesten Formen von Herrschaftsausübung. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Raum stellen sich als soziale Auseinandersetzungen um Raumprofite (Verteilung der räumlichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten) dar, die sich nicht zuletzt anhand "politischer Kämpfe" (Bourdieu 1991) vollziehen. Es geht in diesen Kämpfen "um die Konstruktion von auf räumlicher Basis homogenen Gruppen, das heißt um eine soziale Segregation, die zugleich Ursache und Wirkung des exklusiven Gebrauchs eines Raumes und der für die Gruppe, die ihn besetzt hält, und deren Reproduktion notwendigen Einrichtungen darstellt. (vgl. Bourdieu 1991: 30)
Gebauter Raum kann nicht nur als Projektionsfläche, beispielsweise von sozialer Ungleichheit oder von Werten und Normen aufgefasst, er kann auch als Projektionsfläche für die Person, als "Symbole des Selbst" (Weichhart 1990) betrachtet werden. (ebd.: 41) Raum, Raumausschnitte oder Objekte des gebauten Raums wirken sich auch auf die Identitätsbildung und Selbstdefinition aus. Das Verhältnis Raum - Ich-Identität bildet eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung von Zugehörigkeitsgefühlen oder auch Loyalität, die eine Person für einen Raumausschnitt und seine MitbewohnerInnen empfindet. Als negativer Ausdruck dieses Verhältnisses wäre beispielsweise Zwang, Stigma oder Gefangensein zu nennen. (vgl. Weichhart 1990: 42)
Der poststrukturalistische Theoretiker Michel Foucault analysierte jene Verschränkungen von Raum und Macht, indem er z.B. die Entstehung und Funktionsweise von Räumen, wie Gefängnisse, Spitäler, Psychiatrien etc. untersuchte und beschrieb, wie sich Machtdispositive direkt an den Körper oder Empfindungen schalten und somit konstitutiv zur Identitäts-Konstruktion beitragen; u.zw. teilweise mittels einer kontrollierenden, disziplinierenden Raumorganisation. (vgl. dazu ausführlich bei Dreyfus/Rabinow 1994) Jene sehr spannenden Ansätze Foucaults, vor allem auch hinsichtlich der Wirkungsweisen der Disziplinierungs- und Normalisierungstechnologien im Sinne der Konstruktion, Produktion und Kontrolle "normaler" und "anormaler" (Körper-)Normen durch räumliche Aus- und Einschließungen, kann an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Erwähnung finden soll abschließend, dass Foucault die Kontrolle über Körper und Raum elementar für die Erhaltung politischer Macht ansah. Macht, Wissen, Körper und Raum können mittels Disziplinarmechanismen untrennbar miteinander verknüpft werden. Räumliche Faktoren sind für die Ausübung und Erhaltung von Macht entscheidend. (vgl. dazu ausführlicher bei: Scheller 1995: 50fff und Dreyfus/Rabinow 1994: 216fff)
Scheller (1995) weist (aus einem frauenspezifischen Blickpunkt) darauf hin, dass die symbolkräftige Wirkung von Raumstrukturen von den Personen, die sich im Raum bewegen implizit oder explizit berücksichtigt wird. Jene Kenntnis und Wahrnehmung prägt das individuelle Verhalten. Die Akteurin
"(...) geht zu den Orten, die sie zu irgendeinem Zweck nutzen will, wählt dazu aus den möglichen das geeignete Verkehrsmittel, macht Umwege oder Abkürzungen um dahin zu gelangen, wenn möglich verweilt sie in von ihr angeeigneten Regionen und meidet andere, wo sie sich nicht zugehörig fühlt, sie kontrolliert ihr Benehmen in vorderseitigen Regionen und entspannt sich in rückseitigen. (...) Sie muss möglichst über die Eigenschaften der sozialen Gruppen verfügen, für die die Artefakte eingerichtet und gedacht sind". (Scheller 1995: 105)
Rekurrierend auf Erkenntnisse soziologischer und psychologischer Identitätsforschung kann angenommen werden, "(...) daß das Individuum für die reflexive Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst auch Merkmale heranzieht, die sich aus seiner Position im physischen Raum ableiten lassen (Gebürtigkeit, Wohnstandort, (...) Mobilität etc.)". (Weichhart 1990: 19)
Wird von "raumbezogener Identität" gesprochen, ist darunter nicht nur die "Selbst-Identität" eines Individuums, sondern - auf der sozialen Ebene - auch das "Wir-Gefühl" einer Gruppe subsumierbar. "Raumbezogene Identität" verweist in letzterer Dimension auf die "(...) Identität einer Gruppe, die einen bestimmten Raumausschnitt als Bestandteil des Zusammengehörigkeitsgefühls wahrnimmt, der funktional als Mittel der Ausbildung von Gruppenkohärenz wirksam wird und damit ein Teilelement der ideologischen Repräsentation des ‚Wir-Konzepts' darstellen kann". (ebd.: 23)
Scheller (1995: 108, 113) spricht davon, dass die Bedeutung des gebauten Raumes bzw. seiner Funktionen und Sinngehalte auf die Konstitution von Identität nicht zu unterschätzen ist. Die Identität und Subjektwerdung eines Menschen wird durch räumliche Strukturen beeinflusst. Dies trägt dazu bei, dass es zur Internalisierung und Reproduktion der vorhandenen Gesellschaftsverhältnisse kommt. Die Auseinandersetzungen um Nutzungs- und Funktionsmöglichkeiten sind letztlich Konflikte um die sozialen Konstruktionen von persönlicher Identität.
Bourdieu (1991) verweist auf die Relationen zwischen Raum, Identität und Macht, wenn er feststellt, dass sich die Herrschaftsstrukturen bzw. Hierarchien, die in den gebauten Raum eingelagert sind, über die Bewegung darin auch im Körper niederschreiben, sich in "Präferenzsysteme" und "mentale Strukturen" umwandeln. Das heißt, der gebaute Raum richtet einerseits "stumme Gebote" an den Körper - welcher bewegt, verlagert, in Stellung gebracht und dadurch auch organisiert und sozial qualifiziert wird, z.B. als Einschluss oder Ausschluss oder als Nähe oder Ferne zu einem bedeutsamen Zentralort. Andererseits wird die Mentalität der Subjekte, ihre Vorstellungen und Bewertungen und damit auch ihr Verhalten, von der Wahrnehmung des Raums geprägt. (vgl. Bourdieu 1991: 27; Dörhöfer/Terlinden 1998: 24) "Stumm" bezeichnet Boudieu (1991: 27) die Gebote deshalb, da sie sich quasi unsichtbar an den Körper richten. Macht produziert und reproduziert sich demnach in den gebauten Räumen auf subtile Form u.zw. als Gewalt, die nicht unbedingt wahrgenommen werden muss, also symbolisch ist. "Der soziale Raum ist somit zugleich in die Objektivität der räumlichen Strukturen eingeschrieben und in die subjektiven Strukturen, die zum Teil aus der Inkorporation (Einverleibung, Anmerkung T.E.) dieser objektivierten Strukturen hervorgehen." (ebd.)
Die individuelle räumliche Mobilität realisiert sich über den Körper und dessen Bewegung in einem Zeit-Raum-Kontinuum, in dem Wege zurückgelegt werden, die einen identischen Ausgangs- und Zielpunkt haben, wobei meistens die Wohnung den Bezugspunkt im "Aktionsraum"[24] der Person darstellt. (vgl. Stöppler 1999: 20f)
Mobilität vollzieht sich im öffentlichen Raum[25] bzw. über die Durchquerung des gebauten öffentlichen Raums, sei es zu Fuß oder über die Nutzung eines (öffentlichen) Verkehrs- bzw. Transportmittels. Von der Aneignung öffentlichen Raums sollte per definitionem niemand ausgeschlossen sein, der Aufenthalt und die Bewegung darin für alle Menschen stellt quasi eine Mindestanforderung an ihn dar.
Mobilität dient als Mittel zur Überbrückung räumlicher Distanzen, zum Erreichen bestimmter Zielorte und stellt die Voraussetzung dar, um elementare Bedürfnisse befriedigen bzw. um gesellschaftlich partizipieren und tätig werden zu können - Arbeit, Bildung, Erholung und Versorgung bilden diesbezüglich die wesentlichen "Zielgebiete" des Mobilseins. (vgl. Stöppler 1999: 20ff)
Mobilität fungiert demnach als "Mediator" (Stöppler 1999). Sie verschafft Zugang zu den großteils örtlich und funktional getrennten Bereichen Arbeit, Wohnen, Freizeit, Bildung und Versorgung. Insofern kann Mobilität als gesellschaftlicher Imperativ bezeichnet werden: vom Individuum wird eingefordert und erwartet, dass es mobil ist. Ist dem nicht so, drohen Sanktionen, z.B. kann der Job kann nicht angenommen werden oder er geht "verloren", soziale Beziehungen lösen sich auf oder können erst gar nicht zustande kommen, politische Partizipation wird verunmöglicht oder erschwert indem beispielsweise das Wahllokal nicht barrierefrei zugänglich ist usw.
Mobilität ist gewissermaßen die zentrale "Drehscheibe", das Mittel, um sich öffentliche, halböffentliche und private Räume physisch - und damit auch geistig und sozial - aneignen zu können. Der Zugang zu (halb)öffentlichen Räumen ist allerdings nicht nur als Faktor für die Bedürfnisbefriedigung anzusehen, sondern - wie wir gesehen haben - erfolgt darüber der Zugang zu ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen bzw. Kapital mit dem gesellschaftspolitische Einfluss-, Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten ebenso einhergehen wie das Erlangen von Definitionsmacht (darüber, was als "normal" und gesellschaftlich "wertvoll" gilt oder nicht).
Limbourg/Flade/Schönharting (2000: 11f) weisen darauf hin, dass Mobilität nicht nur eine quantitative Dimension hat, die sich als Häufigkeit von Wegen oder als zurückgelegte Wegstrecke pro Person und Zeiteinheit messen lässt, jedoch in der Aussagekraft zur Mobilität einer Person nur eingeschränkt Rückschlüsse zulässt. Beispielsweise findet der Umstand, dass eine Person ein Ziel bewusst nicht aufsucht (oder aufsuchen kann), bei der Zählung von Wegen oder Kilometern keine Berücksichtigung. Mobilität hat vielmehr auch eine qualitative Dimension, die sich vor allem durch das Merkmal der individuellen Wahlfreiheit spezifizieren lässt. Die AutorInnen bemerken, dass
"(...) nicht die Person mobiler (ist; Anmerkung T.E.), die 50 statt 30 km oder sechs anstelle von drei Wegen pro Tag zurücklegt, sondern diejenige, die wählen kann, wann und wohin sie unterwegs ist, welche Route sie nimmt, ob sie zu Fuß geht, mit dem Rad fährt oder sich anderer Verkehrsmittel bedient und ob sie den Weg rasch oder eher gemütlich bummelnd zurücklegt". (ebd.: 12)
Mobilität heißt demnach, dass eine Person zwischen verschiedenen Alternativen bezüglich Zeitpunkten, Zielen, Wegen, Verkehrsmitteln und Geschwindigkeiten wählen kann und damit "zeitliche, räumliche und personale Unabhängigkeit" (Stöppler 1999: 22) erreicht. Für das Erfassen des Mobilitätsphänomens spielt neben der tatsächlichen genauso die potentiell mögliche Mobilität eine wichtige Rolle. Das Ausmaß der individuellen Wahlfreiheit, der Mobilitätsmöglichkeiten, ist entscheidend von den Umweltbedingungen beeinflusst und abhängig, beispielsweise von Informationen darüber, welche Verkehrsangebote bestehen. (vgl. Limbourg/Flade/Schönharting 2000: 12)
Mobilität ist nicht ausschließlich als Raumüberwindung zu verstehen, das Gelangen von "A" nach "B", sondern auch als Kommunikation, Austausch, Wahrnehmung der Umwelt und sich selbst, Lust am Bewegen, Selbsterfahrung. Sie beinhaltet an sich bereits einen befriedigenden Aspekt: Aktivität, Handeln, an der Ortsveränderung, am Erwerben motorischer Fähigkeiten. (vgl. Stöppler 1999: 22)
Königseder (1999: 21) versteht unter "Aneignung" die Erweiterung des individuellen Aktionsraums (welcher sowohl körperlich als auch in seiner sozialen Dimension zu verstehen ist) nicht nur durch Besitz von Raum, sondern gleichfalls (selbstverständliches) physisches, geistiges und soziales Bewegen zwischen privatem, öffentlichem und halböffentlichem Raum, das immer über den Körper realisiert wird.
Es kann folglich gesagt werden, dass über Mobilität physischer wie sozialer Raum auf allen "Raum-Kategorien" (privater, halböffentlicher, öffentlicher Raum) angeeignet wird. Gleichzeitig stellt Mobilität das (alltägliche) Mittel dar, über das der Zugang zu gebautem wie sozialem Raum erfolgt und wodurch jener angeeignet werden kann.
Mobilität ermöglicht den Zugang zu allokativen und autoritativen Ressourcen sowie sozialem, ökonomischem und kulturellem Kapital über die die Teilhabechancen von Individuen und sozialen Gruppen beeinflusst werden. Gleichzeitig wird Mobilität bestimmt, beeinflusst und reguliert von den Rahmenbedingungen, die in den halböffentlichen und öffentlichen Räumen "konstruiert", verhandelt und normativ festgelegt werden. Nicht nur mit dem Besitz von Kapital ist die Aneignung von Raum leichter möglich, worauf Königseder (1999: 25) verweist, sondern ebenso über die Verfügbarkeit eines Körpers (oder Eigenschaften), der den Anforderungen des gebauten Raumes am besten entspricht. Da diese Anforderungen, wie wir gesehen haben, über die Definitions-, Verfügungs- und Entscheidungsmächtigen determiniert werden, ist jener Körper oder sind jene Eigenschaften von Vorteil für die individuelle räumliche Mobilität, die mit den Normalitäts-Vorstellungen und -Kriterien der dominanten sozialen Gruppen soweit wie möglich korrelieren.
Es lässt sich daran anknüpfend die These formulieren, dass Abweichungen von diesen normativen und unter anderem über alltägliche Praktiken (wie beispielsweise eben Mobilität) produzierte und reproduzierte "Normalitätsfeldern" (Rösner 2002) als individuelle oder kollektive Stigmatisierung (z.B.: "behindert") in Erscheinung treten und sich etwa als Ausschluss oder strukturelle Diskriminierung bei der Aneignung physischen wie sozialen Raums manifestieren können.
Über die alltägliche Aneignung von Raum wird sowohl der individuelle Handlungs- und Gestaltungsspielraum erweitert als auch die Subjektposition der AkteurInnen gestärkt, da mit der Erweiterung von Handlungsfreiheit Gefühle von Selbstbestimmung, Autonomie, Kompetenz und Kontrolle verbunden sind. (vgl. Scheller 1995: 92) P.-H. Chombart de Lauwe beschreibt in diesem Zusammenhang trefflich die Aneignung des Raumes als das
"...Resultat der Möglichkeit, sich im Raum frei bewegen, sich entspannen, ihn besitzen zu können, etwas empfinden, bewundern, träumen, etwas kennenlernen, etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und konkreten Vorstellungen gemäßes tun und hervorbringen können. Die Aneignung des Raumes entspricht so einer Gesamtheit psychologischer Prozesse, die in der Subjekt-Objekt-Beziehung verortet sind (...) Sie vermittelt die Formen alltäglicher Praxis (die Verhaltensweisen, das Handeln) mit den kognitiven und affektiven Prozessen". (P.-H. Chombart de Lauwe zitiert nach Weichhart 1990: 38f)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Mobilität als bedeutsame Machtressource zu verstehen ist. Über die Verfügbarkeit oder Nicht-Verfügbarkeit von Mobilität wird Einfluss auf die Ausgestaltung gesellschaftlicher (Macht-)Verhältnisse genommen. Sie ist als gesellschaftspolitisch zentrale Dimension hinsichtlich der Partizipationschancen und Inklusion von Individuen und sozialen Gruppen identifizierbar. Mobilität kann als relevante Machtressource in den Verteilungskämpfen um ökonomische, kulturelle und soziale Ressourcen (Kapital) angesehen werden. Die Auseinandersetzungen um Raum, respektive auch um die Gestaltung der Mobilitätsbedingungen, werden also nicht zuletzt anhand politischer Kämpfe ausgetragen.
Mobilität ist dahingehend als "ermächtigende Ressource" zu verstehen, weil einerseits durch das Mobilsein Menschen (mit Behinderungen) sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst(er) werden und eigene Kräfte entdecken und entwickeln können. Andererseits ermächtigt die Verfügbarkeit von Mobilität dazu Zugang zu den ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen zu haben, mit denen die Chancen zur Realisierung sozialer Inklusion und Teilhabe verbunden sind.
In diesem Kapitel stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie ist der Begriff "Mobilitätsbehinderung" zu verstehen? Wer ist von Mobilitätsbehinderung betroffen? Gibt es spezielle Bedürfnisse oder Anforderungen mobilitätsbehinderter Menschen? Welche Mobilitätsbarrieren sind wirksam? Welche AkteurInnen sind im Kontext von Mobilität bzw. der Konstruktion der Mobilitätsbedingungen relevant?
In ihrer individuellen Mobilität eingeschränkte Menschen stellen keine Minderheit dar - ca. ein Drittel der Bevölkerung ist aus differierenden Gründen zeitweise oder ständig mobilitätseingeschränkt, Tendenz steigend, da der Anteil älterer Personen an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich wächst. So wird z.B. der Anteil der 60- bis 80-Jährigen bis zum Jahr 2011 um rund 13 % und bei den über 80-Jährigen um mehr als 50 % zunehmen! (vgl. Rainer 2006: 133, Ackermann 1996: 24)
Als mobilitätsbehindert oder mobilitätseingeschränkt im engeren Sinn werden Menschen bezeichnet, die als Merkmal eine dauerhafte oder vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung aufweisen. Zu ihnen werden gezählt:
-
bewegungsbehinderte Menschen (geh-, steh-, greif- und mehrfach-behinderte Personen),
-
wahrnehmungsbehinderte Menschen (blinde, sehbehinderte, gehörlose und hörbehinderte Personen),
-
sprachbehinderte Menschen,
-
geistig behinderte Personen und
-
Menschen mit psychischer Krankheit (unter anderem Klaustrophobe, Zwangsneurotiker). (vgl. Haselsteiner/Reiter 2000:9)
Im weiteren Sinn werden zu den mobilitätsbehinderten Personen aber auch ältere, übergewichtige, kleinwüchsige und großwüchsige Menschen, Kinder, werdende Mütter, Personen mit vorübergehenden Unfallfolgen oder postoperativen Beeinträchtigungen sowie Personen mit Kinderwagen oder mit schwerem Gepäck, etc. gerechnet. (ebd.)
Fast jeder Mensch ist somit im Laufe seines Lebens zu der heterogenen Gruppe der mobilitätsbehinderten Personen zu zählen und kann potentiell von Mobilitätseinschränkungen betroffen sein. (vgl. VCÖ 2002: 18)
Mobilitätseingeschränkte Personen stellen ca. 20 % der Fahrgäste eines Verkehrsunternehmens, wobei sich dieses Verhältnis durch die steigende Alterung der Bevölkerung in Zukunft weiter erhöhen wird. (vgl. VDV 1998: 2)
Die Rahmenbedingungen zur Mobilität sind grundlegend für das Mobilitätsverhalten bzw. die Raum-Aneignungsmöglichkeiten von Personen oder Personengruppen. Das Mobilitätsverhalten, das heißt, die Handlungen über die sich die Positionsveränderungen der Menschen vollziehen sowie die alltäglichen Wahlmöglichkeiten, welche Orte aufgesucht, welche Verkehrsmittel benutzt werden können oder auch das Verkehrsverhalten an sich (vgl. Kalwitzki 1994: 12), hängen neben subjektiven Faktoren (z.B. Wertevorstellungen, Wohlfühlen, Präferenzen, Gewohnheiten) insbesondere auch von den "objektiv-situativen Bedingungen" ab, wie z.B. der Verfügbarkeit über öffentliche und private Verkehrsmittel, der Verfügbarkeit über die Nutzung gebauten öffentlichen Raums, der Kompetenz zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel als Voraussetzung für diese Nutzung. (vgl. Stöppler 1999: 23) Ebenso nehmen Gesetze, Regelungen und Normen, die Verfügbarkeit über adäquate Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl) oder auch das Verhalten anderer VerkehrsteilnehmerInnen direkten oder indirekten Einfluss auf die Mobilitätsbedingungen bzw. das Mobilitätsverhalten. Die Ausformung jener Rahmenbedingungen laden einerseits zu bestimmten Arten der Fortbewegung ein oder sie können auch eine Barriere diesbezüglich darstellen. (vgl. Kalwitzki 1994: 13)
2.3.2.1 Mobilitätsbarrieren [26]
(Mobilitäts-)behinderte Menschen werden mit einer Vielzahl von Barrieren im öffentlichen Verkehrs-Raum und Schwierigkeiten in ihrem alltäglichen Mobilitätsverhalten, das heißt auf ihren Arbeits-, Freizeit- oder Versorgungswegen, konfrontiert. Die durchgeführte Fallstudie wird sich mit jenen Problematiken im Kontext der Zielgruppe der RollstuhlfahrerInnen genauer befassen. (vgl. 7)
Mobilitätsbarrieren können nicht nur bauliche oder konstruktionsbedingte Hindernisse sein, sondern ebenso spezifische "situative Rahmenbedingungen"[27] (Kalwitzki 1994) bei der Verkehrsmittelwahl, denn auch diese können einzeln oder in ihrer Gesamtheit so gestaltet sein, dass sie die (Art der) Fortbewegung, das Mobilitätsverhalten von behinderten Menschen, einschränken, hemmen oder aber positiv begünstigen. Anders ausgedrückt, barrierefreie Mobilität für behinderte Menschen umfasst mehr als beispielsweise die Beseitigung baulicher Hindernisse. (vgl. VCÖ 2002)
Werfen wir nun einen genaueren Blick auf unterschiedliche Problemfelder der Mobilität:
Bauliche bzw. konstruktionsbedingte Mobilitätsbarrieren sind gegeben hinsichtlich des Zugangs zu Gebäuden (Stufen, unbenutzbare Rampen, unbedienbare Türen etc.), des öffentlichen Straßenraums, der Verkehrs- sowie Freiraumflächen (Gehwegoberfläche, fehlende Bordsteinkantenabsenkungen, problematische Möblierung des Straßenraums, fehlende Orientierungshilfen, unzugängliche Haltestellen, Stationen oder Bahnhöfe, fehlende "Behindertenparkplätze" sowie öffentliche behindertengerechte WCs etc.) und bezogen auf die bauliche Gestaltung, Konstruktion und infrastrukturellen Gegebenheiten im Rahmen der öffentlichen Verkehrsmittelnutzung (Stufen, Niveauunterschiede, Bedienungselemente, Fahrscheinautomaten, WCs etc.).
Unter den situativen Rahmenbedingungen die Mobilität behindern oder negativ beeinflussen (können) seien herausgehoben[28]:
-
"Soziale Barrieren"
Im öffentlichen Raum über den sich Mobilität realisiert findet zwischen den AkteurInnen Kommunikation und Interaktion statt, welche auch Einfluss auf die Mobilität, das Mobilitätsverhalten nimmt. So kann Spott, Ächtung, Erniedrigung bis hin zu physischer Gewalt, egal ob tatsächlich erfahren oder antizipiert, zu Vermeidungsstrategien führen. (vgl. Königseder 1999: 24) Insbesondere Menschen mit "sichtbaren" Behinderungen (z.B. RollstuhlfahrerInnen) sind leicht der Stigmatisierung und Etikettierung durch andere VerkehrsteilnehmerInnen ausgesetzt.
"Menschen orientieren sich in vielen Verhaltensmustern nach dem sog. ‚Körperschema'. Das Aussehen stellt eine wichtige Norm für die Integration dar und unterscheidet sich bei Behinderten meist unveränderbar von den Erwartungshaltungen Nichtbehinderter. Die Verunsicherung, die Behinderte oft durch ihre bloße Anwesenheit auslösen, schlägt sich deutlich im Verhalten der anderen nieder. Es sind hier, bei Begegnungen in Parks, auf der Straße etc. unterschiedlichste Reaktionen zu beobachten, von denen das zwanghaft Ignorieren eine sehr häufige darstellt." (Drexel et al. 1991: 15)
-
Informations- und Orientierungsbarrieren
Informationen und Orientierung spielen sowohl bei der Bewegung im öffentlichen Straßenraum als auch bei der Nutzung des ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) eine grundlegende Rolle. "Sie stellen neben den körperlichen Bedingungen (Einstiegs- und Mitfahrmöglichkeit) eine gleich wichtige Zugangsvoraussetzung dar." (VDV 1998: 17) Unzugängliche, ungenügende, verwirrende, falsche oder fehlende Informationen wirken sich negativ auf die Mobilität aus. Es müssen dadurch beispielsweise zeitraubende und körperlich wie psychisch belastende Umwege in Kauf genommen werden. In einer barrierebehafteten Mobilitätsrealität für behinderte Menschen können Informationen nicht unwesentlich zu einer Milderung von Barrieren beitragen, etwa indem sie eine gezielte und detaillierte Planung von Wegen ermöglichen. Vice versa kann Informationsmangel oder qualitativ unzulängliche Information noch zusätzlich Barrieren aufbauen und die Mobilität erschweren.
-
Barrieren durch Gesetze und Vorschriften
Mobilitätsbarrieren können auch durch explizite Vorschriften geschaffen werden, z.B. wenn einem Rollstuhlfahrer/einer Rollstuhlfahrerin per Benutzungsbestimmungen das selbstständige Inanspruchnehmen eines öffentlichen Verkehrsmittels untersagt wird. (vgl. VCÖ 2002) Im "good-practice-guide" zur Mobilität behinderter Menschen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr (1998) wird hervorgehoben, dass es
"nicht nur technische Hindernisse (sind, Anmerkung T.E.), die einen behinderten Menschen in seiner Mobilität beeinträchtigen. Auch die fehlende bzw. mangelhafte Durchsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen, die für behinderte Menschen im Verkehrswesen geschaffen werden, bedeuten ein großes Handicap; beispielsweise das Nichteinschreiten der Behörde bei der unberechtigten Benutzung eines Behindertenparkplatzes". (4f)
2.3.2.2 Barrierefreie Mobilität
Die Heterogenität der Gruppe mobilitätseingeschränkter Personen spiegelt sich in den Anforderungen und spezifischen Bedürfnissen im Zusammenhang mit z.B. der Fahrzeugausstattung und Verkehrsanlagen wider. (vgl. Pauls 2001: 3f) So haben RollstuhlfahrerInnen andere Anforderungen an die (Um-)Gestaltung des öffentlich-städtischen Straßen- oder Freiraums, um sich darin barrierefrei und sicher fortbewegen können, als etwa blinde oder gehörlose Menschen. (vgl. dazu genauer Weidert 2000: 18ff, Teufelsbrucker 1998: 53 und Drexel et al. 1991: 21fff).
Jene unterschiedlichen Anforderungen (baulich-technischer Natur) sind bereits zum Großteil
wissenschaftlich aufbereitet und stehen einer Raum-, Verkehrs- und Bauplanung, die sich an den Grundsätzen barrierefreien Planens und Bauens orientieren möchte, zur Verfügung. So gibt es auch in Österreich Planungshandbücher zu diesem Thema, Beratungsstellen, die darüber informieren und sogar ausgearbeitete Normen (ÖNORMEN), die die praktische Anwendung barrierefreien Planens und Bauens garantieren würden. (vgl. Weidert 2000)
Längst ist es aus planerischen Gesichtspunkten möglich auf spezifische Benutzungsbedürfnisse und - ansprüche mobilitätsbehinderter Personen so einzugehen, dass für fast alle Menschen befriedigende Rahmenbedingungen zur Mobilität herbeigeführt werden könnten. Schlagwörter in diesem Zusammenhang sind "Design für Alle" oder "Barrierefreies Bauen".
"Design für Alle", oder auch "universelles Design" genannt,
"ist ein Konzept, nach dem Produkte, Systeme und Dienstleistungen für eine möglichst große Benutzergruppe in einer möglichst breiten Umgebung benutzbar sein sollen. Besonderes Augenmerk wird auf die Nutzergruppe der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderungen gelegt. Aktuell findet Design für Alle besonders in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in der Innenraumgestaltung und im öffentlichen Raum Beachtung. (...) Produkte oder Anwendungen, die speziell für bestimmte Nutzergruppen entwickelt wurden, finden fast immer auch beim ‚Durchschnitts-Konsumenten' Anklang". (Firlinger/Integration:Österreich 2003: 101)
"Barrierefreies Bauen", "menschengerechtes Bauen", "behindertengerechtes Bauen" oder "Design für Alle" - egal, wie es auch genannt wird, Ziel ist "Barrierefreiheit", das heißt, die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Gebäuden, des öffentlichen Raums und der (öffentlichen) Verkehrsmittel sowie von Informationen und Kommunikation für alle Menschen. (vgl. ebd.: 98)
Es soll herausgestrichen werden, dass es kein besonderes, anderes oder gar "abweichendes" - im Gegensatz zu einem "normalen" - Mobilitätsbedürfnis (mobilitäts)behinderter Menschen gibt. Was besteht, sind unterschiedliche Anforderungen an die gebaute Umwelt und ihre mobilen wie immobilen Artefakte um das Mobilitätsbedürfnis realisieren zu können.
Mobilitätsbehinderte bzw. -eingeschränkte Menschen haben prinzipiell keine anderen Bedürfnisse in ihrer Mobilität als nicht in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen, da sie ebenfalls selbstständig, und das heißt, so weit wie möglich ohne fremde Hilfe, am "normalen" öffentlichen Verkehrsgeschehen teilnehmen möchten. (vgl. Theussl/Lückler/Steinbacher 1991: 24)
Wenn Reinalter/Rubisch (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999: 13), die Autoren des Berichts zur Lage behinderter Menschen im Freizeit- und Mobilitätsbereich, konstatieren, dass zu den wichtigsten Handlungszielen mobilitätseingeschränkter Menschen in Verkehrssituationen
-
das selbstständige Bewältigen von Wegen,
-
das selbstständige Auffinden und Verstehen von Informationen,
-
das selbstständige Nutzen von Beförderungsmitteln (vor allem des ÖPNV),
-
das gefahrlose und angstfreie Aufhalten im öffentlichen Raum und
-
das Vorfinden von Verweilplätzen zum Ausruhen zählt,
dann sind diese Handlungsziele, möchte ich ergänzen, natürlich nicht nur speziell auf
mobilitätsbehinderte Menschen zutreffend, sondern generell auf alle Menschen.
Für eine barrierefreie Mobilität, also für die problemlose Durchquerung des öffentlichen Raums, um beispielsweise von der Wohnung zum Arbeitsplatz, vom Arbeitsplatz zum Supermarkt und von dort wieder zur Wohnung zu gelangen, ist eine geschlossene Informations- und Transportkette das Um und Auf. Letztere ergibt sich aus der durchgängigen und leichten Zugänglichkeit von Verkehrswegen und Verkehrsmitteln. "Für den Mobilitätsbehinderten gibt es nichts Schlimmeres, als daß er plötzlich vor einem unüberwindbaren Hindernis steht und sein Ziel ohne fremde Hilfe unerreichbar ist." (Weidert 2000: 23) Eine geschlossene Transportkette muss allerdings von einer geschlossenen Informationskette begleitet sein um eine barrierefreie Mobilität zu ermöglichen. Die Geschlossenheit einer Informationskette wird gewährleistet, indem z.B. die Beständigkeit von Zielangaben und Erläuterungen, die Bestätigung von Zwischenzielen und Zielen, die Verwendung identischer Piktogramme gewährleistet wird. (vgl. ebd.: 22f)
In vorliegender Diplomarbeit steht mit der Zielgruppe der RollstuhlfahrerInnen eine ausgewählte mobilitätsbehinderte Gruppe im Mittelpunkt des Interesses, deren Mobilitätssituation primär hinsichtlich der Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum bzw. der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Wien untersucht wurde. Wenn von "barrierefreier Mobilität" gesprochen wird, so ist damit immer auch das Kriterium der Rollstuhlzugänglichkeit bzw. "Berollbarkeit" gemeint.
Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen ist eine fast unübersehbare Reihe von AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen auf vielfältigen (Kompetenz-)Ebenen (Bund, Länder, Gemeinde, Private, BürgerInnen) involviert, mitbestimmend und verantwortlich: Verkehrspolitik und -planung, ArchitektInnen, Baubehörden und Bauausführende, Gesetzgebung, Polizei, Bildungseinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen, Private oder öffentliche Verkehrsmittelbetreiber, ArbeitgeberInnen, VeranstalterInnen, etc. - und letztlich auch die Handelnden selber. (vgl. Kalwitzki 1994: 12fff)
Nachstehende schematische Abbildung (vgl. Abb. 3) zeigt das (notwendige) Zusammenwirken und die Interdependenzen der relevanten AkteurInnen auf, die z.B. im Rahmen der Schaffung eines barrierefrei zugänglichen öffentlichen Raums involviert sind.
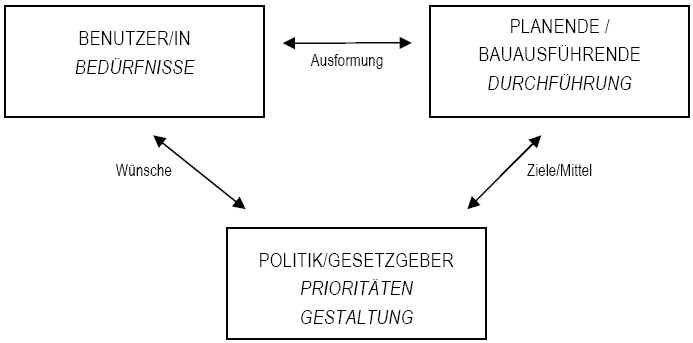
Abbildung 3: Zusammenarbeit zwischen BenutzerInnen, Politik/Gesetzgeber und Planenden/Bauausführenden. (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Magistrat Graz, Stadtbaudirektion 1994: 10)
Raumaneignungsmöglichkeiten und (alltägliches) Mobilitätsverhalten stehen in engem kausalen Zusammenhang mit den vorgefundenen objektiven Rahmenbedingungen, welche von den Verfügungs-, Gestaltungs- und Definitionsmächtigen vorgegeben, konstituiert und in den öffentlichen Raum "eingeschrieben" und von der mobilitätswilligen Person quasi eingefordert werden ("stumme Gebote"). (vgl. 2.1.2.1, 2.1.2.2)
Wenngleich die einzelnen NutzerInnen nicht unbedeutend hinsichtlich der Aushandlungsprozesse jener Bedingungen sind, ist evident, dass bestimmte NutzerInnen-Gruppen ihre Vorstellungen mehr durchsetzen können als andere. Die vorherrschenden Mobilitätsbedingungen sind nach fiktiven Durchschnittsnormen ausgerichtet, wie z.B.: Gehfähigkeit, Vollzeit-Erwerbstätigkeit, Ausrichtung des Verkehrsraums am Autoverkehr etc. und spiegeln die spezifischen Erfahrungs- und Vorstellungswelten der Verfügungsmächtigen wider: von nichtbehinderten, "voll" leistungsfähigen, berufstätigen, jungen, gesunden Männern.
[21] Unter Mobilitätsverhalten können jene menschlichen Handlungen verstanden werden, die die räumlichen Positionsveränderungen realisieren. (vgl. Kalwitzki 1994: 12)
[22] Nachstehende Kategorisierung von "Raum-Arten" dient rein heuristischen Zwecken. Eine klare Separierung der verschiedenen Räume ist in der Realität nicht gegeben. Darauf lassen sich auch die unterschiedlichen Definitionen in der Literatur zurückführen. Ich greife folglich die für meinen Interessenszusammenhang wesentlichen Aspekte auf und folge vor allem den unter geschlechtsspezifischem Blickpunkt stehenden sozialgeographisch und soziologisch orientierten Arbeiten Schellers (1995) und Königseders (1999), welche auf handlungs- und strukturationstheoretische Raum- bzw. Macht-Theorien rekurrieren (Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Michel Foucault).
[23] Unter allokativen Ressourcen versteht Giddens materielle Ressourcen wie der Besitz von Kapital, Immobilien, Produktionsmitteln oder Gütern, welche zu Handlungsmöglichkeiten und -bedingungen werden. Autoritative Ressourcen sind nicht-materielle Ressourcen, z.B. Entscheidungsrechte über räumliche und zeitliche Zutrittsbeschränkungen, Entscheidungskompetenz über Formen des sozialen Zusammenlebens und das Vermögen, die Aktivitäten von Menschen verfügbar zu machen. (vgl. Scheller 1995: 53fff, 93ff)
[24] Unter "Aktionsraum" wird die Summe der aufgesuchten Orte einer Person bezeichnet. Durch die Anzahl der Orte, die sie aufsuchen kann, wird das Umfeld eines Individuums strukturiert. (vgl. Stöppler 1999: 20)
[25] Wenn von "öffentlichem Raum" gesprochen wird, so wird damit in dieser Arbeit der öffentlich-städtische Raum gemeint. Die österreichische Straßenverkehrsordnung (StVO, gem. § 2) definiert den öffentlichen Raum als "die Straße mit ihren Fahrbahnen, ihren Rad-und Gehwegen sowie mit den Abgrenzungen dazwischen. Aber auch die ‚Möblierung' der Straße, in Form von Schildern, Geländern, Masten, Bänken und Blumenkisten, und die ‚Wände' der Straße mit herausragenden Gebäudeteilen, Türen, Pforten oder Einfahrten gehört dazu" (zitiert nach Magistrat Graz 1994: 11). Es ist nicht immer klar zwischen öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Raum zu trennen. Als bauliche Übergänge wären etwa die Haustürschwelle oder die Schwelle zu Geschäften, Restaurants etc. anzuführen. Zum öffentlichen Raum ist neben dem öffentlichen Straßen- bzw. Verkehrsraum auch städtischer Freiraum (z.B. Parkanlagen, Spielplätze) samt Einrichtungen (z.B. öffentliche WCs, Parkplätze, Telefonzellen) zu zählen.
[26] Die Quellen für nachstehende, selbst konzipierte Kategorisierungen von Mobilitätsbarrieren beruhen teils auf vorhandener Literatur, teils auf den Erkenntnissen aus der empirischen Fallstudie. Letzteres impliziert eine stärkere Orientierung an den Barrieren, die für körperlich eingeschränkte Personen, respektive RollstuhlfahrerInnen bestehen.
[27] Es wird mit diesem Begriff in groben Zügen auf Kalwitzki (1994) rekurriert. Kalwitzki (1994: 13f) führt z.B. "individuelle Ressourcen" (verfügbare Fahrzeuge, Geldmittel...), "vorhandene Infrastruktur" (Straßen, Bahnhöfe, Ziel-Orte...), "Gesetze, Regelungen", "Kosten/Preise", "Verhalten anderer" oder "Informationen" im Zusammenhang mit den "situativen Rahmenbedingungen der Verkehrsmittelwahl" an.
[28] Betreffend der Benutzung- bzw. Aneignungsproblematiken von Gebäuden erfolgt - ausgenommen den Gebäudezugang - keine explizite Auseinandersetzung, da vorliegende Arbeit den Fokus auf die individuelle Mobilität im öffentlichen Verkehrs-Raum legt.
Das Ziel der vorangegangenen Ausführungen war, die Bedeutung und den Stellenwert den Mobilität hinsichtlich sozialer Exklusion bzw. sozialer Inklusion von Menschen mit Behinderungen hat, darzulegen und Zusammenhänge zwischen Mobilität/Mobilitätsbehinderung und sozialer Inklusion/Exklusion ins Blickfeld zu rücken.
Dafür war es einerseits notwendig, ein Bild darüber zu zeichnen, was unter sozialer Exklusion bzw. sozialer Inklusion zu verstehen ist und inwiefern Menschen mit Behinderungen von sozialer Exklusion betroffen sind. Weiters interessierte, inwiefern Mobilität im Kontext sozialer Exklusion Berücksichtigung findet, besonders im Bezugsrahmen behindertenpolitischer (internationaler) Ansätze und Richtlinien. Andererseits war es notwendig, über eine allgemeine Begriffsbestimmung von Mobilität bzw. Mobilitätsbehinderung hinausgehend, sich genauer mit den Dimensionen und Implikationen des politischen Macht- und Exklusion-Feldes Mobilität zu befassen.
Als wesentlichste Ergebnisse können zusammengefasst werden:
Behinderung ist weniger als "individuelles Schicksal" oder "defizitär" aufzufassen, vielmehr als persönliche Erfahrung innerhalb struktureller (Umwelt-)Bedingungen, die behindernd (ein)wirken. Behinderung ist die Beeinträchtigung von Teilhabe an grundlegenden Lebensfeldern (Arbeit, Bildung, Freizeit, Versorgung, Gesundheit) sowie die Beeinträchtigung von Handlungsfähigkeiten (Aktivitäten) vorwiegend durch strukturelle Faktoren bzw. Rahmenbedingungen, die politischer Gestaltung und somit auch Veränderungsmöglichkeiten unterliegen. Behinderung wird vielfach erst über die behindernden Rahmenbedingungen konstruiert und durch das Auftreten von Schwierigkeiten in den alltäglichen Lebenszusammenhängen individuell erfahren, z.B. in der alltäglichen Mobilität.
Soziale Exklusion manifestiert sich als Ausschluss in der Gesellschaft durch ungleiche Bedingungen der Zugehörigkeit, sei es hinsichtlich der Einbindung in Erwerbsarbeit, soziale Beziehungen, der Teilhabe an Lebenschancen oder Chancen der individuellen Lebensführung.
Soziale Exklusion muss auch als Prozess, der bis ins "Alltägliche" hinein wirksam ist, und das heißt individuell erfahren werden kann, betrachtet werden. An diesem Prozess sind spezifische AkteurInnen, "Agenten" (Wansing 2005) bzw. "Agenturen" (Kronauer 2002) (z.B. politische und rechtliche Regelungen, Umweltfaktoren, soziales Verhalten, Unternehmensstrategien) beteiligt.
Zur Schaffung sozialer Inklusion kommt demnach der Einräumung (sozialer) Teilhabe- und Grundrechte, der Einbindung in Erwerbsarbeit und in soziale Beziehungen Bedeutung zu. Die Möglichkeiten zur Realisierung sozialer Inklusion sind aufs Engste mit der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen verknüpft.
Menschen mit Behinderungen sind besonders von sozialer Exklusion bedroht. Dabei spielt neben den Faktoren sozialer Ausgrenzung wie z.B. Arbeitslosigkeit, Mangel an finanzieller Unterstützung oder Stigmatisierung, auch der Zugang zur Umwelt eine Rolle.
Soziale Exklusion (von Menschen mit Behinderung) ist sowohl im internationalen als auch im nationalen Konnex Thema (sozial-)staatlicher Interventionen sozial- bzw. behindertenpolitischer Risikobearbeitung. Das Ausgrenzungsfeld "Zugänglichkeit zur Umwelt" (hier: Fokus auf Mobilität) erhält in Verbindung mit sozialer Exklusion auch Aufmerksamkeit seitens internationaler Grundsätze und Richtlinien der Behindertenpolitik. Herauszuheben ist dabei, dass in der europäischen sowie internationalen Behindertenpolitik wichtige Signale gesetzt wurden, die die Inklusion von Menschen mit Behinderungen (im Mobilitätsfeld) zum Ziel haben, z.B. EU-Antidiskriminierungsrichtlinien, Europäisches Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003, Grundsatz des "Mainstreaming", UN-Standardregeln, revidierte Europäische Sozialcharta. Die nationalstaatliche, verbindliche Umsetzung jener Richtlinien oder Vorgaben hält sich allerdings, mit Blick auf die tatsächlichen Verhältnissen in den einzelnen Ländern, in Grenzen. ExpertInnen sprechen - bezogen auf die OECD-Länder - davon, dass staatliche Behindertenpolitik nicht sehr erfolgreich betrieben wird.
Mobilität ist einerseits zu einem grundlegenden Bedürfnis des modernen Menschen geworden. Sie bildet den Zugang zur Befriedigung existentieller Bedürfnisse (Erwerbstätigkeit, Nahrung, soziale Kontakte etc.). Andererseits stellt Mobilität auch eine Anforderung, einen Imperativ an den modernen Menschen dar, um gesellschaftlich voll partizipieren und reüssieren zu können.
Mobilität ist eine machtvolle bzw. ermächtigende Ressource: Sie ermöglicht einerseits individuelles Handlungsvermögen und verschafft andererseits Zugang zu (und Macht über) Strukturen bzw. strategischen Ressourcen. Daraus folgt unter anderem, dass das "Mobilitätsfeld" und dessen Strukturen auch veränderbar sind. Jedoch nicht alleine die Verfügungsmächtigeren bestimmen, sondern ebenso sind die weniger verfügungsmächtigeren AkteurInnen im "politischen (Kampf-)Feld" Mobilität. Über Mobilität - im Sinne der Aneignung von physischem, sozialem oder symbolischem Raum - zu verfügen oder nicht zu verfügen kann als Ausdruck von Macht oder Ohnmacht einer Person oder von Personengruppen betrachtet werden.
Mobilität ist ein Machtfeld. Im gebauten Raum und demnach auch in der Mobilität drücken sich nicht nur soziale Verhältnisse, sondern gleichfalls Machtverhältnisse aus, die diesen (Raum/Mobilität) inhärent sind. Mobilität ist weiters als ein Normalitätsfeld zu bezeichnen. Das bedeutet, hier werden Vorstellungen von Normalität ("normal"/"behindert") konstruiert und reproduziert, verhandelt und durchgesetzt z.B. über Gesetze. Der gebaute öffentliche Raum und seine Einrichtungen sowie Transportmittel sind nichts "Naturgegebenes" oder "Unveränderliches", sondern werden durch AkteurInnen, die über entsprechende Definitions- und Gestaltungsmacht verfügen (Politik, Gesetzgeber, ProduzentInnen, Planung, Architektur, etc.), entlang spezifischer Normen und Werte konstruiert sowie durchgesetzt. Jene AkteurInnen können folglich als machtvolle Instanzen, als zentrale Agenturen räumlicher Ausgrenzung oder Teilhabe verstanden werden, da die Gestaltung, aber auch die Veränderung (!) der Rahmenbedingungen zur Realisierung von Mobilität durch sie nachhaltig bestimmt und beeinflusst werden. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird - neben den NutzerInnen öffentlichen Raums/Mobilität - der Fokus primär auf die "Akteurin Politik" (speziell das Politikfeld der Behindertenpolitik) und Gesetzgebung (im behindertenpolitischen Kontext) gerichtet, die als wesentliche Gestalterinnen der Rahmenbedingungen zur Mobilität zu identifizieren sind.
Menschen, die in ihrer Mobilität behindert werden sind keine Minderheit - ca. ein Drittel der Bevölkerung hat (im Laufe des Lebens) mit Mobilitätsbarrieren zu kämpfen; aufgrund der demographischen Tendenz zur "Überalterung" der Bevölkerung wird dieser Anteil noch zunehmen.
Die situativen und baulichen Rahmenbedingungen und Strukturen im Konnex von Mobilität prägen das individuelle (Mobilitäts-)Verhalten der Menschen (mit Behinderungen). Sie richten sich als "stumme Gebote" an den Körper, dem z.B. der Zugang zu einem Ort verwehrt oder ermöglicht wird. In diesem Sinn könnte durchaus davon gesprochen werden, dass Mobilitätsbehinderung bzw. eine Mobilitätsbarriere strukturelle Gewalt ist, die nicht unbedingt individuell wahrgenommen werden muss, also symbolisch sein kann. Mobilitätsbehinderung ist strukturelle Diskriminierung, die über spezifische situative Rahmenbedingungen (Gesetze, Regelungen, normative Praktiken, etc.) erzeugt wird und nicht kausal auf "individuelle Mängel" ("Behinderung") rückführbar ist. Mit Diskriminierung ist dabei nicht nur ein spezifisches "Tun" gemeint, sondern sie kann ebenso über ein Unterlassen und Ignorieren erfolgen. Beispielsweise in dem Gesetze, die eine Verbesserung der Mobilitätsbedingungen unter anderem für Menschen mit Behinderungen bedeuten würden, nicht geschaffen oder umgesetzt werden.
Reduzierte oder behinderte Mobilität kann soziale und kognitiveAuswirkungen auf die Betroffenen haben. Wenn die individuelle Aneignungsmöglichkeit öffentlichen Raums ungünstig ist, trägt dies zur Behinderung von Selbstständigkeit, Autonomie und Kompetenzen bei und kann bis hin zur sozialen Isolation sowie räumlicher, zeitlicher und personeller Abhängigkeit führen (vgl. Stöppler 1999: 25) und/oder zu einer Veränderung der "kognitiven Struktur"[29](Flade 2000) eines Menschen u.zw. dahingehend, dass diese zu einem "subjektiven Hindernis" wird. Damit ist gemeint, dass es z.B. einem Rollstuhlfahrer gar nicht in den Sinn kommt, ein bestimmtes Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen, weil es kein "Bestandteil der kognitiven Karte" ist. (ebd.: 15f)
Mobilitätsbehinderung für den/die Einzelne/n ergibt sich, zugespitzt formuliert, aus der individuellen Abweichung von den in die (baulichen und konstruktionsspezifischen) Umweltbedingungen eingelassenen "Normalitäts-Normen". Die Diskrepanz zwischen den über die Umweltbedingungen gestellten Normalitäts-Anforderungen und deren individueller Erfüllbarkeit wird in der alltäglichen Mobilitätsproblematik von Menschen (mit Behinderungen) sichtbar.
Mobilitätsbehinderung ist kein "individuelles" oder "subjektives" Problem einzelner (behinderter) Menschen, sondern ein strukturelles Problem, das im Kontext von Macht zu sehen ist. Es geht um die Verteilungs- und Verfügungsmacht über Ressourcen. Mobilitätsbarrieren implizieren geringere Chancen auf den Zugang zu (Macht-)Ressourcen in Form von sozialem, ökonomischem oder kulturellem Kapital. Dieser Zugang ist allerdings notwendig um öffentlichen und halböffentlichen Raum zu gestalten, diesbezüglich relevante Entscheidungen zu fällen, ihm Bedeutung zu verleihen - letztlich also, darauf Einfluss zu nehmen, wie und unter welchen Bedingungen sich Mobilität im öffentlichen Raum individuell und von spezifischen Gruppen realisieren lässt.
Mobilitätsbehinderung manifestiert sich in der alltäglichen Praxis des Ausschließens[30] von der Ressource Mobilität. Wird die alltägliche Mobilität eingeschränkt oder verhindert heißt dies unmittelbar: Beschneidung des individuellen Aktionsraumes, von Selbstbestimmung, von Wahlmöglichkeiten, Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten, Verminderung zeitlicher, räumlicher und personaler Unabhängigkeit.
[29] Für das Zurücklegen alltäglicher Wege benötigen Menschen ein internes Bild ihrer Umwelt ("cognitive map"), das ihnen ermöglicht, die Umwelt zu erkennen und zu verstehen. Bestandteile dieser kognitiven Karten sind Straßen, Plätze, Verkehrsmittel die benützt werden können etc. Kognitive Karten "sind die Grundlage bei der Entscheidung, ob man überhaupt weg will, wohin man will und welches Verkehrsmittel und welche Route zum Zielort gewählt wird". (Flade 2000: 15)
[30] Es kann sich allerdings gleichzeitig um eine Praktik des Einschließens handeln, die ausschließende Wirkung hat. Ein Beispiel dafür wäre der Transport von Menschen mit Behinderungen mit einem "Sonderfahrtendienst". Der/die Einzelne wird zwar zwischen Orten bewegt, scheint aber im öffentlichen Raum nicht auf; ist quasi "unsichtbar". Die transportierte Person ist also von der Aneignung öffentlichen Raums ausgeschlossen indem sie in einen "be-sonderen" Raum eingeschlossen ist.
Ausgangsbasis der empirischen Untersuchung ist die im theoretischen Rahmen erarbeitete Erkenntnis, dass Mobilität ein ganz wesentlicher Faktor bezüglich der Förderung und Schaffung sozialer Inklusion bzw. gesellschaftlicher Teilhabechancen von Menschen (mit Behinderungen) ist. Oder, mit anderen Worten, dass eingeschränkte Mobilität sowohl ein Teilbereich sozialer Exklusion an sich ist, als sie auch die Mobilisierung von und den Zugang zu ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen und das heißt, die Inklusionschancen, mindern kann.
Um dem gesellschaftspolitischen Ziel der sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden, ist ganz klar festzuhalten, dass die Schaffung "inklusiver Mobilitätsbedingungen" berücksichtigt werden muss. Als Kriterien einer "inklusiven Mobilität" bzw. "inklusiver Mobilitätsbedingungen" können beispielsweise formuliert werden:
-
Die situativen und baulich-konstruktionsbezogenen Rahmenbedingungen von Mobilität berücksichtigen die Anforderungen und Bedürfnisse aller Menschen.
-
Die alltägliche individuelle Mobilität von Menschen mit Behinderungen wird nicht eingeschränkt und behindert. Sie ist gekennzeichnet von: Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeiten, Selbstständigkeit, Gefahrlosigkeit, etc.
-
Die Mobilitätsthematik ist ein wesentlicher Bestandteil des behindertenpolitischen Diskurses sowie politischer und rechtlicher Interventionen zur sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Das Ziel der Enthinderung von Mobilitätsbarrieren wird als gesellschaftspolitische Aufgabe betrachtet, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit z.B. zwischen den AkteurInnen verschiedener Politikfelder erfordert um soziale Inklusion der BürgerInnen (mit Behinderungen) zu gewährleisten. Dass nicht der Mensch mit Behinderung das Problem ist, sondern die Umweltfaktoren, die barrierefreie Mobilität verhindern, und folglich jene umweltfaktorischen Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten wären, dient dabei als Prämisse.
-
Die Interessen der von (Mobilitäts-)Behinderung Betroffenen werden auch von ihnen selbst artikuliert und vertreten. Von (Mobilitäts-)Behinderung Betroffene bzw. deren Interessensvertretungen werden in die politischen Entscheidungsfindungsprozesse, in alle Planungs- und Gestaltungsprozesse die sie tangieren aktiv einbezogen.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel, die Untersuchung, Analyse und Bewertung der Mobilitätssituation bzw. Mobilitätsbedingungen von Menschen mit Behinderungen in Österreich mit speziellem Fokus auf eine ausgewählte Personengruppe mobilitätsbehinderter Menschen: RollstuhlfahrerInnen in Wien. Es interessiert einerseits, welche objektiven Rahmenbedingungen (politische und gesetzliche Interventionen, Nutzungsbedingungen) existieren und andererseits die konkreten Mobilitätserfahrungen von mobilitätsbehinderten Menschen (RollstuhlfahrerInnen). Die Bewertung soll dahingehend erfolgen, inwiefern die vorhandenen Bedingungen als förderlich oder hemmend hinsichtlich der Realisierung von "inklusiver Mobilität" bzw. "inklusiver Mobilitätsbedingungen" einzuschätzen sind. Besonderes Augenmerk wird auf die Bewertung der Mobilitätsrealität der RollstuhlfahrerInnen in Wien gelegt, die unter anderem dahingehend zu bewerten ist, inwiefern sie selbstständige bzw. selbstbestimmte Mobilität zulässt oder verhindert.
Fokussiert werden drei Bereiche:
-
Inwiefern steht Mobilität auf der Agenda der Behindertenpolitik in Österreich? Welche politischen und rechtlichen Interventionen mit Bezug auf den Mobilitätskontext können erkannt werden?
-
Welche situativen und baulichen/konstruktionsspezifischen Rahmenbedingungen (gesetzliche, vorhandene Infrastruktur, Verhalten anderer, Informationen,...) bestimmen die Mobilitätsmöglichkeiten von RollstuhlfahrerInnen in Wien?
-
Wie zeigt sich die konkrete Mobilitätssituation, die alltägliche Mobilitätsrealität von RollstuhlfahrerInnen in Wien?
Die Kernpunkte der methodisch qualitativen Herangehensweise zur Analyse empirischen Datenmaterials bilden sowohl eine Text- und Dokumentenauswahl problemspezifischer Fachliteratur, deren Aufbereitung, Analyse und Bewertung als auch eine narrativ/problemzentriert durchgeführte qualitative Befragung von RollstuhlfahrerInnen in Wien zu ihrer alltäglichen Mobilitätssituation sowie ihrem alltäglichen Mobilitätsverhalten und durchgeführte Interviews mit (politischen) AkteurInnen und ExpertInnen im mobilitätsrelevanten Kontext. Genaueres zur methodischen Vorgehensweise, dem Sample und der Auswertungstechnik bei der Befragung der RollstuhlfahrerInnen in Wien ist - aus dem Grund einer besseren Übersichtlichkeit - dem Kapitel 7.1 zu entnehmen.
Für die Erfassung und Beschreibung des Ist-Zustands sowie der objektiven Rahmenbedingungen zur Mobilitätssituation behinderter Menschen in Österreich, respektive Wien, wurden neben spärlich vorliegendem empirischen Material, (partei)politische Programme, Dokumente, Internet-Informationen, etc. sowie die im Jahr 2001 durchgeführten ExpertInnengespräche sowohl mit (partei)politischen und mobilitätsrelevanten AkteurInnen bzw. EntscheidungsträgerInnen als auch mit (teilweise selbst von Behinderung betroffenen) Mobilitäts-ExpertInnen in Wien herangezogen, analysiert und bewertet. Die Einschätzungen und Bewertungen der ExpertInnen flossen (vor allem die Gespräche mit den BehindertensprecherInnen der politischen Parteien in Wien) in die Arbeit mit ein.
Hohe Bedeutung für das Akteurshandeln in jedem politischen Feld und somit auch in dem Bereich der Behindertenpolitik haben die verankerten Grundüberzeugungen bei den AkteurInnen. Die Inhalte einer Politik und folglich auch die Handlungen, Absichten oder Ziele der AkteurInnen werden stark davon beeinflusst, welches Problemverständnis (vor)herrscht. Gerade bezogen auf Akteurshandeln in der Behindertenpolitik spielt es beispielsweise eine nicht zu unterschätzende Rolle, welche Ansichten z.B. über "Behinderung" oder die Mobilitätsproblematik von Menschen mit Behinderungen gängig oder dominierend sind. Dementsprechend wurde unter anderem ein Schwerpunkt auf die Konzepte und Willensbekundungen in der österreichischen Behindertenpolitik, die im Zusammenhang von Mobilität/Behinderung bestehen, gelegt. Verarbeitet wurde dabei neben (partei)politischen Konzepten oder Programmen ebenso die geführten Interviews mit den BehindertensprecherInnen der Wiener Parlamentsparteien und mit den ausgewählten VertreterInnen nichtstaatlicher Behindertenorganisationen.
Da die Datenerhebung bereits einige Zeit zurückliegt (Jahr 2001), konnte auf eine Aktualisierung nicht verzichtet werden. Diese erfolgte dahingehend, dass relevante Veränderungen, sowohl bei den Mobilitäts-Rahmenbedingungen in Wien (z.B.: Neuerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln hinsichtlich ihrer "Barrierefreiheit") als auch in der Behindertenpolitik (z.B.: Rechtsgrundlagen, Begrifflichkeiten) sowie (partei-)politischen Programmatiken im Kontext der Mobilitätsthematik nachträglich integriert und auf den neuesten Stand gebracht wurden. Ebenso fanden etwaige Änderungen der Rahmenbedingungen bei der Formulierung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung der Mobilitätssituation von RollstuhlfahrerInnen in Wien bzw. mobilitätsbehinderter Menschen Berücksichtigung. Obwohl der Eindruck besteht, dass sich seit 2001 substantielle Veränderungen im Kontext der Mobilitätsbedingungen für mobilitätsbehinderte Menschen (in Wien) nur sehr langsam vollziehen, ist dennoch zu berücksichtigen, dass sich die Befragungsergebnisse der interviewten RollstuhlfahrerInnen auf das Jahr 2001 beziehen. Es ist daher möglich, dass spezifische Problematiken, die im Jahr 2001 für RollstuhlfahrerInnen subjektiv bestanden und geäußert wurden, aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr (ganz) zutreffen. Diesem Umstand wird insofern Rechnung getragen, als bei der Zusammenfassung der Befragungsergebnisse der RollstuhlfahrerInnen und bei der Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen auf die seit 2001 veränderten objektiven Rahmenbedingungen (z.B. barrierefreie Zugänglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel) verwiesen wird. Auch in die Darstellung und Bewertung der Aussagen bestimmter (partei-)politischer AkteurInnen sowie Programmatiken wurden neuere Entwicklungen miteinbezogen.
Abschließend ist es mir wichtig zu ergänzen, dass der empirischen Erhebung ein qualitativer Forschungsansatz zugrunde liegt. Dieser ist unter anderem mit der Annahme verbunden, dass mit einem Interview nicht nur subjektive Empfindungen und Wahrnehmungen erhoben werden, sondern überindividuelle Strukturen, die unabhängig von der interviewten Person existieren und doch handlungsleitend für diese sind. Charakteristisch für diesen Ansatz ist, dass nicht Hypothesen getestet werden, sondern diese durch das Datenmaterial generiert werden, so dass die Bedeutungsstrukturen und Relevanzsysteme der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Mit diesem Forschungsansatz sind methodische Merkmale verbunden, welche die Forschung leiten: Offenheit und Kommunikativität im Forschungsprozess sowie flexible Forschungsorganisation. (vgl. Lamnek 1995)
Die epistemologische Basis dieser Arbeit kann als standpunkttheoretisch bezeichnet werden. Das heißt, die Subjektivität des Forschenden wird nicht als Problem betrachtet, "sondern als eine durch Selbstreflexion systematisch zugängliche Ressource für eine ‚starke Objektivität' (...)". (Scheller 1995: 143) Die Lebenszusammenhänge benachteiligter Menschen (hier: Menschen mit Behinderungen) sind der Ausgangspunkt für die kritische Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Verhältnissen (hier: alltäglicher Mobilitätsbehinderung) im Sinne einer wissenschaftlich-reflexiven Objektivität, die sich nicht davor scheut, Partei für die von Exklusion Betroffenen zu ergreifen.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel geht es darum, sich genauer mit den (behinderten)politischen und rechtlichen Interventionen, die im Kontext der Mobilitätsthematik von Menschen mit Behinderungen in Österreich eine Rolle spielen, zu befassen und zu versuchen, diese dahingehend zu bewerten, ob und inwiefern sie zur Schaffung inklusiver Mobilität (für Menschen mit Behinderungen) beitragen können. Dabei ist es natürlich erforderlich einen Blick darauf zu werfen, welchen Stellenwert der Mobilitätsthematik in der österreichischen Behindertenpolitik überhaupt eingeräumt wird, und welche Tendenzen bemerkbar sind. Zunächst wird ein Überblick über die Organisationsstruktur und wesentliche AkteurInnen der österreichischen Behindertenpolitik gegeben, wobei insbesondere den nichtstaatlichen behindertenpolitischen AkteurInnen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Daran anschließend werden die wichtigsten Merkmale, Grundsätze und Konzepte österreichischer Behindertenpolitik sowie die Ergebnisse der Befragung der BehindertensprecherInnen der Wiener Landesparteien zur Mobilitätsproblematik von Menschen mit Behinderungen (in Wien) dargestellt und analysiert. Bei letzterem interessieren vor allem die Einschätzung der Mobilitätsbedingungen für RollstuhlfahrerInnen in Wien sowie die parteipolitischen Konzepte im thematischen Zusammenhang. Die Erläuterung der primären gesetzlichen Regelungen und Maßnahmen der letzten Jahre in Bezug auf Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen, vor allem im mobilitätsrelevanten Kontext, bildet den Abschluss dieses Kapitels.
Die österreichische Rechtsordnung kennt keinen einheitlichen Kompetenztatbestand des Behindertenwesens (vgl. 5.2). Mit den damit einhergehenden Kompetenzaufteilungen steht auch die Vielfalt an AkteurInnen sowie EntscheidungsträgerInnen in Zusammenhang. Die Organisationsstruktur wichtiger Bereiche der Behindertenpolitik in Österreich sowie die spezifischen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen sind mannigfaltig und es kann folglich nicht ins Detail gegangen werden (vgl. dazu genauer Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 22).
Behindertenpolitik tangiert die unterschiedlichsten Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden), und die verschiedensten AkteurInnen (Sozialversicherungsträger, Ministerien, Arbeitsmarktservice, etc.) sind involviert. Einzelne Bereiche der "Behindertenhilfe" oder der Rehabilitation unterliegen dem Bund z.B. die Sozialversicherung oder der Großteil des Arbeitsrechts und Gesundheitswesens. In anderen Bereichen, wie etwa der Sozialhilfe, liegt die Grundsatzgesetzgebung zwar beim Bund, die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung allerdings bei den Ländern. Einige der HauptakteurInnen der beruflichen Integration sind das Arbeitsmarktservice, das Bundessozialamt und die Länder. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 21f; Europäische Kommission 2003: 103)
Der Bericht der Bundesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich spricht davon, dass sich diese Kompetenzaufteilung grundsätzlich bewährt hat, "weil sie es ermöglicht, sich mit Problemen behinderter Menschen dort auseinanderzusetzen, wo sie auftreten" (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 21).
Analog zur allgemeinen Kompetenzsplittung im Behindertenwesen sind im Mobilitätsfeld ebenso die vielfältigsten (politischen) AkteurInnen bzw. Ebenen involviert. (vgl. 2.4) So fallen etwa Bauordnungen, die die relevanten Regelungen für barrierefreies Planen und Bauen beinhalten, ebenso unter Länderkompetenz wie Regelungen beim öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr, während aber Bauvorhaben bei Eisenbahn, Schiff- und Luftfahrt unter Bundeskompetenz fallen. (vgl. 6) Ist z.B. das Finanzministerium als Akteur involviert, wenn es um Regelungen der finanziellen Zuschüsse für Menschen mit Behinderungen, die einen PKW nutzen geht, so hätte das für Bildungsfragen zuständige Ministerium die Kompetenz in den Lehrplänen zum Architekturstudium den Besuch einer Vorlesung über barrierefreies Planen und Bauen verpflichtend vorzuschreiben (bis dato ist die Teilnahme freiwillig). Oder, fallen z.B. Regelungen zum Fahrtendienst in die Kompetenz der einzelnen Länder (vgl. 6.3), so tangiert die Frage des barrierefreien Zugangs zu Gewerbebetrieben die Gewerbeordnung (Bundeskompetenz).
Erwähnenswert ist, dass im Rahmen der Einführung des Bundesbehindertengesetzes (1990) ein Bundesbehindertenbeirat eingerichtet wurde. Dieser hat allerdings ausschließlich eine für das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz beratende Funktion in allen grundsätzlichen Fragen der Behindertenpolitik. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 18) Er kann des weiteren Gutachten, Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben, die die Interessen von Menschen mit Behinderungen tangieren. Dem Beirat gehören unter anderem VertreterInnen der im Nationalrat vertretenen Parteien, VertreterInnen des Verbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, VertreterInnen von DienstgeberInnen- wie DienstnehmerInnenorganisationen, VertreterInnen von Behindertenorganisationen sowie seit 2006 auch der Behindertenanwalt an. (vgl. BGBl. I Nr. 82/2005)
Im Rahmen der Schaffung des "Behindertengleichstellungspaktes" (vgl. z.B. Tab. 5) und einer im Zuge dessen geschaffenen Novelle zum Bundesbehindertengesetz, wurde ein Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen (Behindertenanwalt) ins Leben gerufen. Dieser ist zuständig für die Beratung und Unterstützung von Personen, die sich im Sinne des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) oder des Behinderteneinstellungsgesetzes diskriminiert fühlen. Der Anwalt ist an keine Weisungen gebunden und agiert unabhängig. Er kann weiters Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung von behinderten Menschen durchführen und Berichte veröffentlichen. (vgl. ebd.)
Wir haben es in der österreichischen Behindertenpolitik mit einem sehr komplexen Feld von involvierten AkteurInnen, Instanzen usw. zu tun. Eine Einrichtung, mit der eine übergreifende Koordinierung erfolgen würde, wie dies z.B. durch eine Koordinationsstelle für die Belange behinderter Menschen denkbar wäre, gibt es nicht.
Zu den AkteurInnen in der Behindertenpolitik zählen neben den genannten Instanzen und den politischen Parteien auch (staatsnahe) Behindertenorganisationen sowie autonome Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen, auf die nun näher eingegangen wird.
Von Seiten der großen staatsnahen Verbände und Organisationen wird Behindertenpolitik hauptsächlich als Klientelpolitik betrieben. Die Kirche kümmert sich vorwiegend um den karitativen Bereich, die Wirtschaftskammern und Interessensvertretungen behandeln Behinderung eher als Kostenfaktor. ÖGB und Arbeiterkammer beschäftigen sich hauptsächlich mit der Situation von behinderten Menschen am Arbeitsmarkt. Paternalistische Denkmodelle gegenüber Behinderung sind vorherrschend und auch die Tatsache, dass sich in verantwortungsvollen Positionen keine behinderten Menschen befinden und wenn, dann solche, die ihre Behinderung nicht politisch thematisieren. (vgl. Riess 1999: 28)
Beispielhaft für eine staatsnahe Interessensvertretung behinderter Menschen, möchte ich an dieser Stelle die Anfang der 1970er Jahre gegründete Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation (ÖAR) herausgreifen, die über ca. 50 Mitgliedsorganisationen verfügt und rund 86 Behindertenverbände repräsentiert. Sie ist damit die größte österreichische Dachorganisation von Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderungen und fungiert als überwachendes und politisch einflussnehmendes Korrektiv parteipolitischer AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen. Die Dachorganisation ist in die Gesetzesentwicklung, das Monitoring einschlägiger Gesetze und Maßnahmen, die Erstellung von Normen und in diverse Charity-Unternehmen eingebunden. Darüber hinaus beschickt sie die wichtigsten behindertenspezifischen Einrichtungen auf europäischer und internationaler Ebene mit ihren ExpertInnen. Die ÖAR ist einer der wichtigsten Ansprechpartner für das in Fragen der Behindertenpolitik und der Pflegevorsorge zuständige Ministerium. Sie ist unter anderem im Bundesbehindertenbeirat und auch bei den einzelnen Sozialversicherungsträgern vertreten. (ebd.: 29f)
Politisch spielt die ÖAR eine Mediatisierungs- und Moderationsfunktion innerhalb der Behindertenpolitik. Viele Themen und Vorschläge, die von autonomen Gruppen ausgearbeitet und erhoben wurden, werden von ihr gebündelt und an die Politik herangetragen. Vergleichsweise zur Situation in anderen Staaten, die eine starke Zersplitterung innerhalb der Behindertenverbände aufweisen, stellt sich die ÖAR als politikfähige Organisation dar, "deren Effizienz allerdings unter personellen Engpässen, nicht immer gegebenem politischen Durchsetzungswillen und finanzieller Abhängigkeit von staatlichen Stellen leidet", so Riess (ebd.: 30).
Eine wesentliche Aufgabe des Dachverbandes liegt weiters in der Öffentlichkeitsarbeit. Zum einen werden behinderte Menschen über ihre Rechte und Möglichkeiten beraten. Zum anderen wird in Veranstaltungen über Probleme und Benachteiligungen behinderter Menschen informiert und die Wünsche und Forderungen der Behindertenverbände vorgestellt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 70)
Ende der 1980er Jahre wurden in Österreich die ersten autonomen Behindertengruppen, die sich dem "Independent-Living"-Konzept (vgl. 1.1.3) verbunden fühlen, gegründet. Grundlegend für die Arbeit aller Selbstbestimmt-Leben-Initiativen ist die Erkenntnis, dass behinderte Menschen ExpertInnen in eigener Sache sind und vom Objekt zum Subjekt der Politik und der Gesellschaft werden müssen. Es existieren in fast allen Landeshauptstädten einschlägige Gruppen, die die Ideen des "Independent Living" verfolgen. Unter anderem die räumliche Zersplitterung, die Unerfahrenheit und auch die dünne Personaldecke brachten es mit sich, dass kaum eine kohärente theoretische und praktische Politik entwickelt wurde, so dass politische Einflussmöglichkeiten nur in geringerem Ausmaß genützt werden konnten. (vgl. Riess 1999) Riess (1999) spricht davon, dass die autonome Behindertenbewegung "durch einen hohen Grad an Engagement und Spontanität aber auch durch eine sprunghafte Politikauffassung sowie wenig professionelles öffentliches Agieren gekennzeichnet" (32) ist.
Das Aufzeigen von (alltäglichen) Diskriminierungen und Benachteiligungen behinderter Menschen gerade auch im Mobilitätsbereich, die Beratung von Menschen mit Behinderung durch selbst von Behinderung Betroffenen, das Setzen von diversen Aktivitäten bzw. Aktionen und das hohe (politische) Engagement für Inklusion und Gleichstellung können als auffällige Merkmale der Politik der autonomen Behindertenbewegung herausgegriffen werden. Der Appell an den "good-will" der jeweils verantwortlichen (politischen) Entscheidungsträger, greift letzten Endes nicht, wenn es um konkrete Veränderungen hinsichtlich der Gleichstellung bzw. Nichtdiskriminierung behinderter Menschen geht, stellen ExpertInnen des Vereins BIZEPS fest und "(s)chlussendlich muss klar sein, dass Diskriminierung ein Rechtsbruch ist". (vgl. ORF 2003: CD2 Titel1)
Die älteste und auch theoretisch am besten fundierte "Selbstbestimmt-Leben-Initiative" ist "BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben in Wien". (vgl. Riess 1999: 32) Auf den Verein soll beispielhaft für eine Organisation der autonomen Behindertenbewegung, respektive für eine nichtstaatliche behindertenpolitisch aktive Organisation, kurz näher eingegangen werden.
BIZEPS betreibt seit 1994 in Wien eine Beratungsstelle für behinderte Menschen und deren Angehörige, die nach den Kriterien des Independent-Living organisiert ist und nach der Sozialtechnik des Peer-Counseling[31] arbeitet. BIZEPS ist Teil der Selbstbestimmt-Leben-Initiative-Österreich (SLIÖ) und leistet neben persönlicher Beratung auch Begleitung und Unterstützung bei der Durchsetzung individueller Rechte und selbstbestimmter Lebensmöglichkeiten behinderter Menschen. Es werden Informationen über Missstände und Diskriminierungen gesammelt, gebündelt, öffentlich gemacht und Widerstand organisiert. Weiters führt BIZEPS diverse Projekte durch, z.B. die Internet-Info-Datenbank "Service4u" für Menschen mit Behinderung[32] oder das Projekt "Behinderte Menschen im Krankenhaus und in anderen Gesundheitseinrichtungen" aus dem die Broschüre "krank, behindert, ungehindert...in Wien"[33] hervorging. Gleichfalls ist BIZEPS Mitbegründer und seither aktiv eingebunden in das 2002 gegründete "Forum Gleichstellung"[34], ein Zusammenschluss von ExpertInnen, die sich im Kampf um ein österreichisches Behindertengleichstellungsgesetz wesentlich beteiligten.
Ein interviewter Experte des Vereins skizziert die Aufgaben von BIZEPS: "Wir setzen uns ein für Selbstbestimmung und Gleichstellung. In dem Bereich Mobilität kümmern wir uns um Fahrtendienste, öffentlichen Personennahverkehr und bauliche Barrieren im Alltag." (EI 4, 2001) Beim Versuch z.B. die Mobilitätsbedingungen für behinderte Menschen in Wien nachhaltig zu verbessern wird, so der Experte, unter anderem mit den "Wiener Linien" zusammengearbeitet. BIZEPS versteht sich nicht ausschließlich als "Beratungseinrichtung", sondern auch als Akteur, der "intensiv Gesellschaftspolitik" betreibt. (EI 4, 2001)
Abschließend ist anzumerken, dass ein wichtiger Aspekt, wenn es um eine durchsetzungsfähige politische Einflussnahme nichtstaatlicher Interessensvertretungen auf die staatliche Behindertenpolitik geht, sicherlich das gemeinsame Auf- und Eintreten der verschiedenen Vereine und Interessensvertretungen ist. In diesem Punkt ist auch verstärkt in den letzten Jahren die Tendenz zu einer intensiveren Zusammenarbeit erkennbar:
"Die Zusammenarbeit der verschiedensten Organisationen, Gruppen und Initiativen wird immer besser. Mittlerweile ist allen Beteiligten klar geworden, daß wir nur etwas erreichen können, wenn wir uns nicht auseinanderdividieren lassen und möglichst alle Gruppen von Anfang an miteinbeziehen." (BIZEPS 1999: Online)
Ebenso ist bemerkbar, dass, wie Riess (1999) schreibt, die "politische Emanzipation behinderter Menschen und ihrer Verbände, der Kampf um die Erlangung bislang vorbehaltener Bürgerrechte (...) das Prinzip der Vertretung von politischen Interessen durch Betroffene" (27) in den letzten Jahren in Österreich in den Vordergrund gerückt ist. Dies ist vor dem Hintergrund, dass in Österreich "die Mediatisierung von Betroffeneninteressen durch nichtbetroffene Experten sehr ausgeprägt ist" und die Akzeptanz des Grundsatzes, dass "Betroffene an politischen, planerischen und wissenschaftlichen Arbeiten mitarbeiten sollen" unter den österreichischen Behörden eher "unterentwickelt" ist (ebd.), doch als eine sehr wichtige Entwicklung, die die Inklusion von Menschen mit Behinderungen vorantreibt, zu werten.
Die österreichische Behindertenpolitik der letzten 25 Jahre hat sich von einem Sonderzweig staatlicher Sozialpolitik zu einem eigenständigen politischen Bereich emanzipiert, der in der "political" und "public agenda" vermehrt Selbstständigkeit gewann. (ebd.: 99)
Behindertenpolitik ist in Österreich, rechtlich gesehen, eine so genannte Querschnittsmaterie, das heißt die Kompetenzregelungen sind vielfach aufgesplittet. Sowohl Bund als auch Länder können beispielsweise im Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze erlassen, denen auch unterschiedliche Definitionen von Behinderung zugrunde liegen können. Es besteht eine fast unüberschaubare Zahl von behindertenrelevanten Bezugnahmen in den diversen Landes- und Bundesgesetzen. Manche sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem "Kompetenz- und Regelungsdschungel" (Hofer 2006a). Wesentliche Bestimmungen finden sich beispielsweise im Sozialversicherungsrecht, Heeresversorgungsrecht, Schulrecht, Baurecht, Sozialgesetzgebung der Länder, etc. Ein Bundesbehindertengesetz, das Kompilationscharakter hat, existiert nicht. (vgl. Riess 1999, Weidert 2000, Funk 1994) Es ist aufgrund jener vielfachen Kompetenzaufsplitterung nicht verwunderlich, dass Mängel in der Koordination von verschiedenen Organisationen und rechtlich geregelten Maßnahmen reklamiert werden. So konstatiert etwa Riess (1999):
"Die Belange der Behindertenpolitik (...) in Österreich werden von den jeweiligen Ministerien im Rahmen des Gesetzesauftrags wahrgenommen. Es existiert keine übergeordnete Koordinierung der einzelnen Maßnahmen. Da sich bedeutende Belange der Sozial-, Bildungs- und Baupolitik in der Kompetenz der Bundesländer befinden, bestehen in den einzelnen Bereichen unterschiedliche Standards und Zugänge." (28)
Die Ursache dieser Zersplitterung liegt im föderalistischen Aufbau Österreichs und hat gegenüber einer Konzentration von Regelungen durchaus auch Vorteile, z.B., dass die Gefahr der Abhängigkeit von einem monopolen Leistungsträger weniger vorhanden ist. Als Nachteil ist die "Verwässerung" der Gesetzesmaterie anzuführen. Das einzige Gesetz, das diese Zersplitterung durchbrach, ist das Bundespflegegeldgesetz 1993. (vgl. Riess 1999: 13) Da keine Veränderung dieser Realität in Aussicht ist, wäre es umso wichtiger eine verbesserte Koordination zwischen Bund und Ländern zu erreichen. (vgl. Funk 1994: 68)
Badelt/Österle (1993: 133ff) führen den Umstand, dass Behindertenpolitik in Österreich oft eine Summe von Einzelmaßnahmen darstellt, auf ein "grundsatzpolitisches Vakuum" zurück, welches bewirkt, dass in der Behindertenpolitik eher juristische Details im Vordergrund stehen und weniger sozial-und gesellschaftspolitische Dimensionen, die die Frage der legislativen Umsetzung behindertenpolitischer Grundsätze wie Normalisierung und Selbstbestimmung in den Vordergrund rückt.
Ein weiteres Merkmal staatlicher Behindertenpolitik ist, dass die Unterstützung und Förderung von Menschen mit Behinderung an unterschiedliche Zugangskriterien gebunden ist. Nach Badelt/Österle (ebd.: 138ff) lassen sich drei Zugänge unterscheiden:
-
Orientierung an einer Definition von Behinderung (zielgruppenorientierte Politik)
-
Orientierung an den konkreten Problemen von Menschen (problemorientierte bzw. funktionale Politik) mit Behinderung
-
Orientierung nach der Ursache der Behinderung (Kausalitätsprinzip)
ad 1) Diese findet sich z.B. im Behinderteneinstellungsgesetz, welches das zentrale Instrument der österreichischen Rechtsordnung für die Unterstützung der beruflichen Eingliederung für behinderte Menschen darstellt. In diesem Zusammenhang ist die Anspruchsberechtigung mit einer Feststellung der Behinderung durch Einstufung nach medizinischen Kriterien verbunden.
ad 2) Beispiel Arbeitsmarktservice: Hierbei besteht eine flexiblere Zielgruppenbestimmung, wo individuelle Probleme berücksichtigt und konkrete Maßnahmen daran geknüpft werden können. Die Gefahr besteht hierbei allerdings darin, dass bei Ressourcenknappheit die Qualität der Beratung oder Hilfestellung abnehmen kann oder, dass bestimmte Personen als nicht zur Zielgruppe gehörig definiert werden und folglich diese nicht adäquat unterstützt werden.
ad 3) Beispiel Sozialversicherung: In Österreich ist die Art und das Ausmaß der Rehabilitationsleistungen davon abhängig, ob die betroffene Person als Erwerbstätige/r im Rahmen der Beschäftigung oder in der Freizeit, als Angehörige/r oder als PensionistIn eine Behinderung erlangte.
Das österreichische Sozialversicherungssystem differenziert deutlich nach Beitragsleistung bzw. Einbindung in den Erwerbsprozess. Dieser Umstand hat beispielsweise bedeutende Auswirkungen darauf, welche Rehabilitationsleistungen in Anspruch genommen werden können oder auch auf die Finanzierung der Hilfsmittel (z.B. eines Rollstuhls). Im Gegensatz zum Kausalitätsprinzip verlangt das Finalitätsprinzip, dass einer bestimmten Behinderung bestimmte Leistungen folgen, also Menschen mit gleichen Behinderungen in gleicher Weise unterstützt werden.
Aufgrund des sehr komplexen Förderungssystems, kommt der Information ein besonders hoher Stellenwert zu, sei es, wenn es um die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten behinderter Kinder, die Möglichkeiten finanzieller Förderung bei der Beschäftigung oder auch - hinsichtlich des Mobilitätsthemas von Bedeutung - um die Anschaffung der Hilfsmittel, die Inanspruchnahme von Vergünstigungen usw. geht. Die unterschiedlichen Zugänge zu Rehabilitationsleistungen und die parallele Zuständigkeit mehrerer Träger bewirkt, dass vielfach (auch bei potentiellen Informanten) ein beträchtliches Wissens- bzw. Informationsdefizit festzustellen ist, wie Badelt/Österle (ebd.: 140) anmerken. Die Autoren kommen zu dem Schluss:
"Es ist daher sicherzustellen, daß die potentiellen Informanten (und dieser Informantenkreis umfaßt auch Behörden oder Ärzte, die sich nicht primär behindertenpolitischen Aktivitäten widmen) nicht nur jenen Bereich kennen, für den sie verantwortlich sind, sondern in der Lage sind, Betroffene umfassend zu informieren oder wenigstens sinnvoll weiterzuverweisen." (ebd.)
Im Blickpunkt der in Europa gängigen zwei unterschiedlichen Modelle von Behindertenpolitik gehört Österreich zu jenen Ländern, in denen der Sozialstaat mit besonderen Leistungen und besonderen Förderungsprogrammen eine große Tradition hat. Dem zweiten Modell, das sich an Prinzipien der (rechtlichen) Gleichstellung orientiert, kam in Österreich historisch betrachtet weniger Aufmerksamkeit zu, wobei sich seit den 1990er Jahren ein "Paradigmenwechsel" oder doch zumindest ein Umdenken feststellen lässt: Die Menschenrechte und die Thematik Gleichberechtigung haben in den letzten Jahren in der Behindertenpolitik besondere Bedeutung erlangt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 43) Als Ausdruck dafür können vielleicht auch die verstärkt geführten Diskussionen zur Mobilitätsproblematik behinderter Menschen, zu "Barrierefreiheit" oder die Kontroversen im Rahmen der Schaffung des Behindertengleichstellungsgesetzes in Österreich gesehen werden.
5.2.2.1 Das "Behindertenkonzept" der Österreichischen Bundesregierung
Vor mittlerweile 15 Jahren, am Ende der von den Vereinten Nationen erklärten "Dekade der Behinderten" (1983-1992), wurde 1992 von der damaligen österreichischen Bundesregierung (SPÖ/ÖVP) das so genannte "Behindertenkonzept" beschlossen, welches in Zusammenarbeit mit der größten österreichischen Interessensvertretung behinderter Menschen, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), erarbeitet wurde und in dem sich die Bundesregierung "zum Prinzip der Integration behinderter Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft" (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993: 74) bekannte. Dieses Konzept stellt sicherlich die bedeutendste Willensbekundung der letzten Jahre dar "und wird als Richtschnur für kommende notwendige Maßnahmen im gesamten Behindertenbereich heranzuziehen sein" (Berdel/Pruner 1995: 2.1-1). So rekurriert etwa auch der 2003 von der Bundesregierung (ÖVP/FPÖ) vorgelegte "Bericht über die Lage der behinderten Menschen in Österreich" (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a) darauf. Er stellt "eine Evaluierung des Behindertenkonzepts der österreichischen Bundesregierung dar und soll alle fünf Jahre aktualisiert werden". (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 8)
Es soll folglich intensiver auf ausgewählte Inhalte dieses für die österreichische Behindertenpolitik bedeutenden und nachhaltig prägenden Konzepts eingegangen werden.
Im Behindertenkonzept heißt es:
"Behindertsein ist eine der vielfältigen Formen menschlichen Lebens: Sie ist als solche zu akzeptieren und darf nicht Anlaß sein, die betroffenen Menschen in irgendeiner Weise von der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auszusondern. Die österreichische Behindertenpolitik muß auf einer ganzheitlichen Sicht des Menschen beruhen, in der seine körperlichen, geistigen, psychischen und sozialen Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden." (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993: 10)
Behindertenpolitik wird somit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, die in die allgemeinen politischen Konzepte und Maßnahmen eingebunden werden muss.
Vor diesem Hintergrund wurden Grundsätze und Ziele formuliert, die folglich auszugsweise wiedergegeben werden, wobei insbesondere die für die gegenständliche Untersuchung wichtigen Aspekte (Mobilität) Betonung finden.
Behindertenpolitik sollte sich in Österreich unter anderen an bestimmten Grundsätzen orientieren (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993: 10ff):
-
Prävention: Vorsorgemaßnahmen sollen das Entstehen von Behinderung vermeiden
-
Integration: Behinderten Menschen muss die bestmögliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gesichert werden.
-
Normalisierung: Das Leben behinderter Menschen soll sich möglichst wenig von dem nichtbehinderter Menschen unterscheiden.
-
Selbstbestimmung: Behinderte Menschen sollen Entscheidungen, die sie berühren, im gleichen Maß wie nichtbehinderte Menschen selbst treffen oder zumindest an ihnen mitwirken.
-
Hilfe zur Selbsthilfe: Die Hilfen sind darauf auszurichten, die Fähigkeiten des behinderten Menschen und seines sozialen Umfeldes zu stärken und ihm größtmögliche Selbstständigkeit zu verschaffen.
-
Finalität: Die Hilfen für behinderte Menschen müssen unabhängig von der Ursache der Behinderung erbracht werden.
-
Rehabilitation: Vor der Bewilligung von Renten oder Pflegeleistungen sind alle Möglichkeiten der Rehabilitation auszuschöpfen.
-
Zugänglichkeit: Die angebotenen Hilfen müssen den betroffenen Menschen durch Information und Beratung zugänglich gemacht werden.
Aus den Grundsätzen ergeben sich Vorhaben und Zielsetzungen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993: 13fff):
-
In der Frage der Integration und der Rehabilitation, dem das Bekenntnis zum Finalitätsprinzip zugrunde liegt, werden als Ziele z.B. die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Rehabilitation oder die Abkehr vom Kosten-Nutzen-Prinzip in der Rehabilitation genannt. Im Bereich der Hilfsmittel sollten etwa die ÖNORMEN für gesetzlich verbindlich erklärt werden.
-
Behinderten Menschen soll die Möglichkeit einer qualifizierten, zeitgemäßen Berufsausbildung sowie einer eigenen Erwerbstätigkeit gegeben werden. Der Zugang zu allgemeinen Ausbildungsmöglichkeiten und die Eingliederung in den freien Arbeitsmarkt haben dabei Vorrang vor Sondereinrichtungen.
-
Basierend auf der Anerkennung des Problems, dass (körper)behinderten Menschen der Zugang zu den Orten von Veranstaltungen oder sonstiger Freizeitgestaltung durch bauliche Hindernisse vielfach nicht oder nur erschwert möglich ist, wird als Ziel die Gewährleistung der gleichen Möglichkeiten wie nichtbehinderte Menschen genannt. Dies muss die behindertengerechte Gestaltung aller Freizeiteinrichtungen und einen unbeschränkten Zugang umfassen.
-
Anerkannt wird, dass Österreich im internationalen Vergleich spät Maßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung baulicher Barrieren getroffen hat, und ein großer Nachholbedarf diesbezüglich besteht. Zielsetzung des behindertengerechten Bauens muss es sein, alle öffentlichen Gebäude und Anlagen - sowohl bei Neu-, Zu- und Umbauten als auch bei Althaussanierungen - für behinderte Menschen zugänglich zu machen. Bei öffentlichen Gebäuden und Anlagen müssen die Bedürfnisse von RollstuhlfahrerInnen, blinden und sehbehinderten Menschen berücksichtigt werden. Als wesentliche weitere Zielsetzungen werden das Zugänglichmachen öffentlicher Gebäude und Anlagen sowie Wohnhäusern genannt, was insbesondere die Übernahme der Empfehlungen der ÖNORM B 1600 in die Bauvorschriften, eine verstärkte Aus- und Fortbildung im behindertengerechten Bauen für ArchitektInnen und BauingenieurInnen, die flächendeckende Einrichtung von regionalen Beratungsstellen für behindertengerechtes Bauen und die Schaffung einer zentralen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen - als Beispiel wird die "Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen" angeführt - umfasst.
-
Anerkannt wird, dass praktisch alle behinderten Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen Mobilität mehr oder minder eingeschränkt sind. Spezielle Fahrtendienste sind für den behinderten Menschen mit größerem organisatorischen Aufwand und mit Abhängigkeiten verbunden und können die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ersetzen. Als Zielvorstellung sollten diese Fahrtendienste daher nur mehr für jene Personen eingesetzt werden, die sehr schwer behindert sind und barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel in keinem Fall benutzen können. Ein weiteres Ziel ist, die Mobilitätschancen behinderter Menschen weitestgehend denen der nichtbehinderten anzugleichen. Erforderlich ist daher eine behindertengerechte Gestaltung aller öffentlichen Verkehrsmittel und der dazugehörigen Anlagen sowie nötigenfalls der Einsatz von technischen Hilfsmitteln.
Zur Realisierung genannter Grundsätze und Ziele werden legislative und organisatorische Rahmenbedingungen empfohlen. Kernaussagen dazu lauten (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993: 69fff):
-
Behinderte Menschen werden noch immer in den verschiedensten Lebensbereichen diskriminiert. Um der Gleichberechtigung behinderter und nichtbehinderter Menschen näher zu kommen, bietet sich eine Kommission nach dem Vorbild der Gleichbehandlungskommission für Frauen an, die angerufen werden könnte, wenn eine Person wegen ihrer Behinderung benachteiligt wird.
-
Es ist nicht zielführend, alle öffentlichen Aufgaben durch öffentliche Stellen durchzuführen, da dies häufig eine teure, schwerfällige und ineffiziente Lösung darstellt. Andererseits darf sich der Staat nicht seiner Verantwortung entziehen und soziale Probleme den Marktkräften überlassen. Anzustreben ist daher ein System, in dem sich öffentliche und private Dienste möglichst sinnvoll ergänzen.
-
Rehabilitation und Integration müssen als umfassende, interdisziplinäre Aufgaben verstanden werden.
-
Wichtige, zu forcierende Forschungsbereiche sind barrierefreies Bauen, das Verhältnis zwischen "Selbsthilfe" und öffentlichen Versorgungsangeboten oder gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse, von denen behinderte Menschen in besonderem Maß betroffen sind.
-
Öffentlichkeitsarbeit stellt eine wichtige Voraussetzung für die Integration behinderter Menschen dar.
Das "Behindertenkonzept" von 1992 ist der wohl bedeutendste Markstein politischer Willensbekundung bzw. bildet die wichtigste behindertenpolitische Leitlinie der letzten 15 Jahre und hat die Behindertenpolitik seither geprägt und beeinflusst. Eine Reihe von nachfolgenden Maßnahmen und gesetzlichen Neuerungen orientierten sich an den Grundsätzen und Zielformulierungen des Konzepts. Beispielhaft können genannt werden:
-
Einführung des Pflegegeldes (Bundespflegegeldgesetz 1993): Orientierung am Grundsatz der Finalität
-
Wesentlich für die berufliche Integration und dem Grundsatz "Rehabilitation vor Pension" verpflichtet ist das 1996 eingeführte Strukturanpassungsgesetz.
-
Dem Grundsatz der Integration folgt auch die Einführung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Kinder in Volksschule (1993) und Sekundarstufe I (1996).
Es kann gesagt werden, dass das Konzept der barrierefreien Mobilität und Zugänglichkeit von Gebäuden, Anlagen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen mit Behinderungen breite Aufmerksamkeit schenkt. Analog den Grundsätzen von Integration und Normalisierung wird klar herausgestrichen, dass die Mobilitätschancen behinderter Menschen denen nichtbehinderter Menschen anzugleichen sind, wobei die Benutzbarkeit und Zugänglichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel und deren Anlagen im Vergleich zu (Sonder-)Fahrtendiensten besonderen Vorrang hat. Mit dem 1993 in Kraft getretenen Bundesvergabegesetz, demnach einen öffentlichen Auftrag nur erhält, wer die Mindestanfordernisse des barrierefreien Bauens beachtet oder dem im Jahr 2000 in Kraft getretenen öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrsgesetz wurden z.B. erste Schritte in Richtung Abbau bestehender Mobilitätsbarrieren gesetzt.
Schließlich können als wichtige Prinzipien oder Haltungen, die das Konzept bereits vor 15 Jahren formulierte und "transportierte" und die sich teilweise erst später im behindertenpolitischen Diskurs in Österreich breiter durchzusetzen begannen, folgende hervorgehoben werden:
-
Behinderung wird nicht als individuelles Problem oder Schicksal, sondern primär in ihrer sozialen Dimension verstanden. Das heißt, behinderte Menschen werden als Personen gesehen, die in fundamentalen sozialen Beziehungsfeldern (Erwerbstätigkeit, Schulbildung, Freizeitgestaltung, Mobilität etc.) beeinträchtigt werden.
-
Dem Gedanken bzw. dem Prinzip des vor allem durch die (Sozial-)Politik der Europäischen Union Mitte/Ende der 1990er Jahre verstärkt in den Blickpunkt gerückten "Mainstreaming" wird behindertenpolitische Bedeutung beigemessen. Behindertenpolitik wird als interdisziplinäre Aufgabe verstanden.
-
Mit dem Grundsatz "Hilfe zur Selbsthilfe" wird ein Gedanke formuliert, der dem Prinzip des "Empowerment" entspricht, welches vor allem durch die autonome Behindertenbewegung vertreten und forciert wurde /wird.
-
Durch die Tatsache, dass bei der Entwicklung und Erstellung des "Behindertenkonzepts" der größte österreichische Behindertenverband, die ÖAR, eingebunden war, wurde dem im Konzept formulierten Grundsatz der Beteiligung der Betroffenen an Entscheidungen, die für sie relevant sind, gefolgt. Meiner Einschätzung nach verdankt das Behindertenkonzept seine impulsgebende, richtungsweisende und nachhaltige Kraft gerade auch diesem Faktor: der Einbeziehung Betroffener bei der Erstellung des Konzepts.
5.2.2.2 Ansätze der Wiener Parlamentsparteien
Parallel zur Befragung der RollstuhlfahrerInnen zu ihrer Mobilitätssituation führte ich im Jahr 2001 auch Interviews mit den BehindertensprecherInnen der vier Wiener Parlamentsparteien. Die Interviews erfolgten entlang eines offen strukturierten Interviewleitfadens, wobei folgende Themenbereiche im Mittelpunkt standen:
-
Die "Wiener Gemeinderätliche Behindertenkommission" als Vernetzungsplattform
-
Eckpfeiler bzw. zentrale Ansätze der Behindertenpolitik der Wiener Landesparteien
-
Einschätzung der gegenwärtigen Mobilitätssituation bzw. -chancen von behinderten Menschen mit besonderer Berücksichtigung der Wiener Situation
-
Ansätze und Maßnahmen (der eigenen Partei), die zu einer Erhöhung der Mobilitätschancen behinderter Menschen führen, mit besonderem Blickpunkt auf RollstuhlfahrerInnen
-
Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Parteien und Behindertenorganisationen
Den Stellungnahmen der BehindertensprecherInnen ist unter anderem dahingehend Beachtung zu schenken, da sie den Stellenwert der Mobilitätsthematik, grundsätzliche Haltungen und das Problembewusstsein der politischen Parteien wiedergeben.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die zentralen Aussagen der PolitikerInnen tabellarisch und in Schlagwörtern zusammengefasst (vgl. Tab.4 im Anhang). Der punktuellen Auflistung ist keine Wertung oder Gewichtung implizit; sie erfolgte willkürlich.
Einig sind sich alle Parteien, dass die Einführung eines Behindertengleichstellungsgesetzes auf Bundesebene vordringlich ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Befragung, also 2001, das im Jahr 2006 schließlich in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz noch relativ weit entfernt von einer Realisierung schien.
Ebenso besteht Einigkeit darüber, dass es zwar auf der einen Seite in den letzten Jahren in Wien zu Verbesserungen hinsichtlich barrierefreien Bauens und barrierefrei benutzbarer öffentlicher Verkehrsmittel gekommen ist, auf der anderen Seite aber noch bei weitem kein Non-Plus-Ultra-Zustand bei den Mobilitätsbedingungen behinderter Menschen erreicht wurde und daher die baulichen Barrieren und die Benutzungsbarrieren von öffentlichen Verkehrsmitteln weiter beseitigt werden müssen. Hinsichtlich konkreter Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang gesetzt werden sollen, sind sich GRÜNE und SPÖ bei der Notwendigkeit zur Novellierung der Wiener Bauordnung einig.[35] Darüber hinaus sehen die BehindertensprecherInnen aller Parteien die Bewusstseinsarbeit als vordringlich an, damit es zu Verbesserungen in den Mobilitätsbedingungen kommt.
Gemeinsam ist den Parteien aber auch, dass keine/r der interviewten BehindertensprecherInnen selbst von Behinderung betroffen ist. Dem vor allem in den letzten Jahren stark in den Vordergrund getretenen Prinzip der Vertretung von politischen Interessen durch Betroffene selbst wird dadurch nicht entsprochen.
Alle GesprächspartnerInnen wiesen darauf hin, dass ein mehr oder weniger intensiver Austausch mit Behindertenorganisationen und -vereinen besteht und, dass dieser in Zukunft noch intensiviert werden soll.
Aufgrund der Interviews kann gesagt werden, dass ein offenbar parteiübergreifender Konsens in relevanten behindertenpolitischen Fragen unter den BehindertensprecherInnen besteht und Ansätze einer überparteilichen Zusammenarbeit in behindertenspezifischen Belangen existieren. Ein Beispiel dafür ist die "Wiener Gemeinderätliche Behindertenkommission", die allerdings keine Beschlüsse fassen, sondern lediglich der Stadtregierung gegenüber Empfehlungen aussprechen kann.
Wurden im vorangegangenen Kapitel wesentliche behindertenpolitische Konzepte analysiert sowie parteipolitische Ansätze auf Landesebene Wien vorgestellt und insbesondere unter dem Fokus mobilitätsbezogener Aspekte beleuchtet, geht es nun darum, welche konkreten Maßnahmen und vor allem gesetzliche Regelungen in Österreich im Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung bzw. für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, wiederum besonders im Mobilitätskontext, bedeutsam sind. Der rechtlichen Dimension wird, frei nach dem Durkheimschen Nachweis, dass Rechte erst existieren, wenn sie auch ausdrücklich eingeräumt werden (vgl. Yeatman 1996), erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Es sollen aber auch wesentliche Merkmale der österreichischen Behindertenpolitik im Kontext der Risikobearbeitung sozialer Exklusion und wiederum im Fokus auf Mobilität skizziert werden.
Da in Österreich die Behindertenpolitik und das Behindertenrecht zu den so genannten Querschnittsmaterien zu zählen ist (vgl. 5.2.1), sind dementsprechend in den diversen Bundes- und Landesgesetzen zahlreiche und verschiedene Definitionen von Behinderung zu finden. Es ist derzeit kein einheitlicher Behindertenbegriff gesetzlich verankert. (vgl. Hofer 2006a: 13; Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 9) Folglich werden ausgewählte Definitionen erläutert.
In das 1990 in Kraft getretene Bundesbehindertengesetz (BBG) wurde zwar kein bestimmter Behindertenbegriff aufgenommen, allerdings wurden zwei weit gefasste Definitionen erarbeitet, "die als Auftrag an die Behindertenpolitik des Bundes und der Länder verstanden werden sollten" (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 9). Diese lauten:
"Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." (ebd.)
"Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist, geregelte soziale Beziehungen zu pflegen, sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen." (ebd.)
Im 2006 in Kraft getretenen Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wurde eine Definition von Behinderung zwar dezidiert aufgenommen; Behinderung wird hier sehr allgemein definiert als
"(...) die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten". (BGBl. I Nr. 82/2005)
Der Gesetzgebung der letzen Jahre ist gemein, dass sie den Begriff Behinderung relativ unbestimmt lässt. Dahinter steckt der durchaus begrüßenswerte Gedanke, dass möglichst keine hilfsbedürftige Person ausgeschlossen werden soll. (vgl. Wahl 1996: 10)
Der Fokus der Legislative hat sich vom "Schutz-Gedanken" der Gesetze "mehr und mehr zum Prinzip des selbstbestimmten Lebens als dem Motor der normativen Auseinandersetzung mit behinderten Menschen verschoben". (ebd.: 170)
Die graduelle Feststellung von Behinderung wie sie durch das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), das die berufliche Integration behinderter Menschen in Österreich regelt, erfolgt, ist ein Beispiel für eine defizitäre, medizinische Definition von Behinderung mit der die Annahme verbunden ist, dass es einen feststehenden Prozentsatz der Minderung der Arbeitsfähigkeit gibt. Medizinische Diagnosen und Gutachten, denen eine bestimmte objektiv gesetzte Norm zugrunde liegt, bilden die Basis für die Klassifizierung als "begünstigter Behinderter". Über diesen Status ist dann der Zugang zu Förderungen geregelt. Es wird damit ein Zusammenhang zwischen Befähigung und Produktivität evoziert, der - wird der WHO-Definition gefolgt (vgl. 1.1.3) - die unterschiedlichen Ebenen von Behinderung vermischt und wovon eigentlich abzugehen wäre. Wobei ExpertInnen zugestehen, dass das in der Praxis schwer möglich ist. (vgl. OECD 2003: 227)
Im Bundespflegegeldgesetz (BPGG) von 1993 bzw. den entsprechenden Ländergesetzen wird die Inanspruchnahmemöglichkeit und Höhe des Pflegegeldes geregelt. Die wesentliche Entscheidungsgrundlage in diesem Zusammenhang bildet ein ärztliches Sachverständigengutachten.[36] Als Anspruchsvoraussetzung dient dabei jedoch nicht eine spezifische Definition von Behinderung, sondern der konkrete Betreuungs- und Hilfsbedarf der durch das medizinische Gutachtungsverfahren ermittelt und bewertet wird. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 152f)
Abschließend sei darauf verwiesen, dass in den verschiedenen (sozial)politischen Bereichen (Sozialversicherung, Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, Beschäftigungspolitik etc.) gleichzeitig unterschiedliche Ansätze bei der Definition von Behinderung vorhanden sind und in Österreich verfolgt werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass in Österreich ein ethisch-moralischer Konsens über die Förderung behinderter Menschen durch den Staat und die Gesellschaft besteht - an politische Proklamationen und Absichtserklärungen mangelt es diesbezüglich nicht. Gerade vor dem Hintergrund, dass offenbar Wertvorstellungen mit hoher sozialer Akzeptanz bestehen, kommt dem Recht als Mittel der Umsetzung besondere Bedeutung zu:
"Wo die ethischen Grundlagen und die politische Programmatik außer Streit stehen, ist die Chance für eine wirksame Verankerung und Fortentwicklung der jeweils maßgebenden Werte mit Hilfe des Rechts besonders groß. Das bedeutet, daß für die Bewältigung der Probleme behinderter Menschen das Recht eine entsprechend große Rolle spielt."(Funk 1994: 64)
Die wichtigsten bundesgesetzlichen Änderungen der letzten 15 Jahre werden in Tabelle 5 (siehe Anhang) aufgezeigt und erläutert.
Stehen in Kapitel 6 Gesetze, die für die Mobilität behinderter Menschen primär in Wien relevant sind (neben den natürlich auch für Wien geltenden Bundesgesetzen) im Mittelpunkt, möchte ich an dieser Stelle drei Bundesgesetze herausgreifen, die hinsichtlich der Mobilität von Menschen mit Behinderungen Bedeutung haben, aber auch darüber hinaus im Kontext der Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen als besonders wichtig gelten können:
-
Artikel 7 im B-VG (1997)
-
Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen und zur Gewerbeordnung (1997)
-
"Behindertengleichstellungspaket" (2006)
Der zeitliche Rahmen der Gesetze ist insofern zu beachten, da zum Erhebungszeitpunkt (2001) manche Gesetze noch nicht in Kraft waren. Dennoch sollen diese Neuerungen aufgegriffen und auch in die Analyse miteinbezogen werden.
Seit 1997 heißt es in der österreichischen Bundesverfassung, B-VG Art. 7 Abs.1:
"Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten." (BGBl. I Nr. 87/1997)
Dieses verfassungsrechtliche Benachteiligungsverbot ("Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden") für Menschen mit Behinderungen ist ein Grundrecht jedes Staatsbürgers und jeder Staatsbürgerin, das in einem behördlichen Verfahren durchgesetzt werden kann. Das Verbot bezieht sich aber nur auf Maßnahmen des Staates (Gesetze, Verordnungen etc.) und nicht auf Diskriminierungen durch Privatpersonen. (vgl. Krispl 2006b: 235) Die dem Gleichheitssatz hinzugefügte Staatszielbestimmung ("Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten") garantiert zwar keine subjektiven, individuell einklagbaren Rechte und auch ein Tätigwerden der Staatsorgane, z.B. auf Erlassung von gesetzlichen Bestimmungen zum barrierefreien Bauen, kann nicht aus der Staatszielbestimmung abgeleitet werden, so ist dennoch die Signalwirkung nicht zu unterschätzen. Der Staat wird zum Handeln aufgefordert. Es kam z.B. dadurch zur Durchforstung, Abänderung und Novellierung behindertendiskriminierender Bestimmungen und Gesetze und, es schienen nun erstmals (!) überhaupt behinderte Menschen in der Verfassung auf. (vgl. Krispl 2006b: 246; BIZEPS 1999)
Dass die Verfassungsbestimmung allein noch nichts an den alltäglichen Problemen behinderter Menschen ändert, obgleich es einen wesentlichen Schritt in Richtung Gleichstellung bedeutet, wird auch im "Bericht der Bundesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich" erwähnt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 44f)
Die "Wirkungsweise", Möglichkeiten und Grenzen der Verfassungsbestimmung soll anhand eines konkreten Beispiels kurz illustriert werden: Gibt das Kraftfahrgesetz von 1967 hinsichtlich der Zugänglichkeit für Omnibusse keine detaillierten Regelungen bekannt, präzisiert die Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 diese gesetzlichen Vorgaben: "Einstiegsstufen an Türöffnungen von Omnibussen müssen gleitsicher sein. Griffstangen müssen so angeordnet sein, dass sie bei Ein- und Aussteigen schon vor dem Betreten der Stufen sicher und bequem erreicht werden können" (KDV 1967 zitiert nach Krispl 2006b: 241). Krispl (2006b) erläutert dazu:
"Diese Bestimmungen schreiben zwar für die behördliche Zulassungsgenehmigung für Omnibusse nicht zwingend das Vorhandensein von Stufen bei Ein- und Ausstiegen vor, doch die Verordnung lässt deutlich erkennen, dass Einstiegsstufen (...) zu den Mindestausstattungen gehören, die einen Omnibus genehmigungsfähig machen." (241)
Diese Verordnung legt Mindeststandards fest, die sich offenbar an ganz bestimmten Normen orientieren u.zw. an Menschen, die Stufen bewältigen können. Durch diesen Standard werden allerdings Menschen mit Behinderungen von der Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittels ausgeschlossen. Gegen diese Benachteiligung durch die Verordnung könnten sich Betroffene nun mittels eines Individualantrags (Artikel 139 und 140 B-VG) beim Verfassungsgerichtshof beschweren bzw. sich zur Wehr setzen. Dies würde allerdings nur Sinn machen, wenn durch eine eventuell positive Entscheidung des Verfassungsgerichtshof tatsächlich eine Verbesserung der Situation zu erwarten wäre, was in diesem Fall - wie juristische ExpertInnen meinen - nicht ohne weiteres behauptet werden kann. (ebd.: 242)
Ebenfalls 1997 wurde vom Nationalrat eine Novelle zum Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG) und zur Gewerbeordnung (GewO) beschlossen, mit der die Diskriminierung behinderter Menschen zum ersten Mal[37] unter Strafe gestellt wird. Nach dem EGVG muss mit einer Geldbuße bis zu € 1.090,-gerechnet werden, wenn jemand "eine Person allein auf Grund einer Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind" (ebd.: 248). Die Verwaltungsstrafbestimmung räumt allerdings nur eine Möglichkeit zur Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens ein und bietet kein behördlich durchsetzbares Recht auf Bestrafung der diskriminierenden Person. (ebd.: 249)
Das Diskriminierungsverbot in der GewO ermöglicht zwar grundsätzlich der Bezirksverwaltungsbehörde bei Vorliegen einer Diskriminierung dem Gewerbeinhaber oder der Gewerbeinhaberin die Gewerbeberechtigung zu entziehen; in der Praxis besteht jedoch keine wirkliche zivilrechtliche Klagsgrundlage bzw. besteht wie beim EGVG lediglich die Möglichkeit der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens. (vgl. Krispl 2006b: 252)
Ende der 1990er Jahre wurden auch in Österreich die Forderungen von VertreterInnen der österreichischen Behindertenbewegung, verschiedenster Behindertenorganisationen, staatsnaher wie autonomer Interessensvertretungen und sich formierenden Bürgerrechtsinitiativen nach einem Antidiskriminierungs- oder Behindertengleichstellungsgesetz immer lauter. Damit wurde die Hoffnung verbunden, dass ein solches Gesetz ein Mittel wäre, um behinderten Menschen endlich die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte auf gesellschaftliche Teilhabe und Gleichstellung wirklich durchzusetzen und Defizite in den Bereichen Wohnen, Bauen und Öffentlicher Verkehr zu beheben. (vgl. Riess/Flieger 2000)
"Erst ein bundeseinheitliches ‚Antidiskriminierungsgesetz' würde materielles Recht schaffen, das den Zielen der Behindertenbewegung - Gleichberechtigung, Einklagbarkeit und Transparenz rechtlicher Bestimmungen - entspricht" (Riess 1999: 13) erläuterte ein Experte im Jahr 1999 und könnte folglich zu einem wesentlichen Schritt zur sozialen Inklusion und Gleichstellung von behinderten Menschen in Österreich führen.
Als internationales Vorbild für ein solches Behindertengleichstellungsgesetz diente vor allem das ADA (The Americans with Disabilities Act) von 1990 in den USA bei dessen Erstellung Betroffene entscheidend mitwirkten. Durch die Mitwirkung wurde der bürgerrechtlichen Gleichstellung behinderter Menschen Ausdruck verliehen und es wurde rechtlich möglich, gegen Diskriminierungen im privaten und öffentlichen Bereich vorzugehen. Im ADA werden beispielsweise Diskriminierungen bei der Einstellung und Beschäftigung sowie der Inanspruchnahme von öffentlichen und staatlichen Einrichtungen und Dienstleistungen sowie bei der Benutzung des öffentlichen Personenverkehrs verboten. Seit 1990 dürfen z.B. die öffentlichen Verkehrsbetriebe, aber auch die Busunternehmen im Überlandverkehr, nur noch Busse ankaufen, die für behinderte Menschen zugänglich sind. Im Gefolge des ADA kam es in immer mehr Ländern zur Implementierung von Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgesetzen, z.B. in Australien (1993), Großbritannien (1995), Schweden (1999), Deutschland (2002). (vgl. BIZEPS 1999) Und - mit 1. Jänner 2006 - auch in Österreich.
Am 6. Juli 2005 wurde durch den österreichischen Nationalrat ein "Behindertengleichstellungspaket" beschlossen, dessen Regelungen mit 1. 1. 2006 in Kraft getreten sind. Konkret wurde mit diesem Gesetzes-Bündel ein Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) geschaffen. Es kam des weiteren zu Änderungen des Behinderteneinstellungsgesetzes, des Bundesbehindertengesetzes, des Bundessozialamtsgesetzes, des Gleichbehandlungsgesetzes, des Bundesgesetzes über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft sowie des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes. (vgl. BGBl. I Nr. 82/2005) Dadurch wurde z.B. die österreichische Gebärdensprache verfassungsrechtlich anerkannt und ein Bundes-Behindertenanwalt (vgl. 5.1) eingerichtet.
Aus diesem "Paket" möchte ich das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGStG) näher betrachten u.zw. dahingehend, ob bzw. inwiefern mobilitätsrelevante Aspekte tangiert werden.
In Artikel 1, § 1 wird das Ziel des Gesetzes formuliert:
"(...) Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen." (ebd.)
In Artikel 1, § 4 wird unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund einer Behinderung ausdrücklich verboten, wobei eine unmittelbarer Diskriminierung dann vorliegt, "wenn eine Person auf Grund einer Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde" (§ 5). Eine mittelbare Diskriminierung ist,
"(...) wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich". (ebd.)
Ein Beispiel für eine mittelbare Diskriminierung wäre, wenn etwa die Beförderung durch die ÖBB mit dem Zug von Linz nach Graz behinderten Menschen wegen unüberwindlichen Barrieren (z. B. weil kein behindertengerechtes Zugabteil vorhanden ist) nicht offen steht. (vgl. Krispl 2006: 254)
In Art. 1, § 6 heißt es ergänzend, dass eine mittelbare Diskriminierung nicht vorliegt, "wenn die Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, insbesondere von Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar wäre". (BGBl. I Nr. 82/2005)
Das Gesetz weist auch eine Definition von Barrierefreiheit auf:
"Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind." (BGBl. I Nr. 82/2005, Art.1, § 5)
Im Rahmen der Herstellung barrierefreier Bedingungen weist das Gesetz zeitliche Übergangsregelungen aus: Baulichen Barrieren im Zusammenhang mit Bauwerken und Barrieren im Zusammenhang mit Verkehrsanlagen, Verkehrseinrichtungen und Schienenfahrzeugen sind bis 31. 12. 2015, Barrieren im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen sind bis 31. 12. 2008 zu beseitigen. (vgl. BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 1, § 19)
Eine Aufnahme detaillierter Bestimmungen zur Umsetzung von Barrierefreiheit, z.B. im baulichen Bereich durch die Bezugnahme auf die ÖNORMEN, erfolgte allerdings nicht.
Das "Behindertengleichstellungspaket" gilt im Wesentlichen nur für den Bundesbereich. Gerade Sachgebiete wie barrierefreies Bauen obliegen grundsätzlich der Kompetenz der Länder und sind damit vom Geltungsbereich des Gesetzes-Paktes nicht umfasst. Ebenso sind bei den Sanktionsnormen "kein ausdrücklicher und unmittelbar durchsetzbarer Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch vorgesehen" (Krispl 2006b: 259).
Die ersten Reaktionen auf das Gleichstellungsgesetz fielen - abgesehen von der allseitigen Begrüßung der Verankerung der Gebärdensprache in der Verfassung - je nach parteipolitischen oder sonstigen Interessenslagen sehr unterschiedlich aus: Sprachen (auch behinderte) VertreterInnen der Regierungsparteien im Jahr 2005 z.B. davon, dass mit der Beschlussfassung des Gesetzes ein "historischer Moment und ein wichtiger Schritt in Richtung einer "inklusiven Gesellschaft" verbunden ist, so wurde von der größten Behindertenvertretung Österreichs, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), das Gesetz lediglich als "tauglicher Kompromiss", als "Ausgangsbasis" mit "Änderungsbedarf in manchen Punkten" bezeichnet. Im Gegensatz dazu ging die Wirtschaft bei diesem "Kompromiss" bereits "bis an die Grenzen des Machbaren". VertreterInnen der Opposition oder (behinderte) ExpertInnen aus den Reihen der Selbstbetimmt-Leben-Bewegung fanden noch kritischere Worte. So wird etwa moniert, dass das Gesetz "zahnlos" sei oder "gravierende Schwachstellen" aufweise, wie z.B. fehlende "effektive Sanktions- und Rechtsdurchsetzungsinstrumentarien, keinen "Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch" im Falle von Diskriminierungen oder zu lange Übergangsbestimmungen bei der Beseitigung von baulichen Barrieren, keine genaue Definition des Begriffs Barrierefreiheit etc. (vgl. Parlamentskorrespondenz 2005: Online, Wirtschaftskammer Österreich 2005: Online)
Ob und wie rasch den mit einem Behindertengleichstellungsgesetz verknüpften Hoffnungen behinderter Menschen in Österreich nach einem Abbau von Diskriminierung, nach sozialer Inklusion und Selbstbestimmung, nach umfassender Gleichstellung nachgekommen werden kann, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Als erste Erfahrungen werden seitens des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz unter anderem genannt (vgl. Hofer 2006b):
-
Seit Einführung gab es bereits ca. 70 Schlichtungsverfahren (etwa je zur Hälfte arbeitsrechtliche und sonstige Diskriminierungstatbestände)
-
Eine hohe Akzeptanz in der Wirtschaft besteht
-
Die Erkenntnis, dass eine möglichst weitgehende Einbindung der Betroffenen unabdingbar ist.
-
Verstärkte Bemühungen in Richtung Barrierefreiheit in einem umfassenden Sinn
-
Notwendigkeit einer breiten Informationspolitik
In den letzten 15 Jahren kam es in Österreich zu einigen gesetzlichen wie politischen Maßnahmen betreffend der Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen (auch im Mobilitätskontext), was nicht zuletzt mit Initiativen auf supranationaler Ebene sowie der Antidiskriminierungspolitik der Europäischen Union und einer erstarkten und immer selbstbewusster politisch agierenden Behindertenbewegung in Verbindung gebracht werden kann. (vgl. OECD 2003: 259ff)
Die Situation in Österreich ist von einer relativ hohen sozialstaatlichen Absicherung gekennzeichnet. Dass es im Rahmen gesetzlicher Interventionen und diverser sozial-, bildungs- oder arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, etwa in den Bereichen Pflege und Betreuung, schulischer Integration behinderter Kinder und Jugendlicher oder im Bereich der beruflichen Eingliederung und Rehabilitation zu "Umorientierungen", wichtigen Fortschritten und teilweise auch wesentlichen Verbesserungen hinsichtlich der Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben und der gesellschaftlichen Inklusion behinderter Menschen kam, sollte nicht unter den Tisch fallen.
Sowohl Behindertenpolitik und Behindertenrecht in Österreich als auch der Bereich der Mobilität sind Querschnittsmaterien mit vielfachen Kompetenzaufsplitterungen. Behindertenpolitik wird konsensuell als interdisziplinäre Aufgabe verstanden (z.B. wird bereits im Behindertenkonzept 1992 der interdisziplinäre Gedanke betont), die sich am "Mainstreaming"-Prinzip orientieren sollte. Das heißt, dass Behinderung in allen politischen Konzepten und Maßnahmen mitberücksichtigt werden sollte. Es sind zahlreiche AkteurInnen aus unterschiedlichsten Politikfeldern (Antidiskriminierungs-, Verkehrs-, Sozial-, Gesundheits-, Bau-, Arbeitsmarktpolitik etc.) involviert. In diesem Kontext ist festzuhalten, dass Mängel in der Koordination zwischen den verschiedenen Organisationen und den rechtlich geregelten Maßnahmen auftreten.
An Proklamationen und Absichtserklärungen mangelt es der österreichischen Behindertenpolitik nicht. Werden die (partei)politischen Programmatiken und Willenserklärungen betrachtet, so wird etwa die Bedeutung der barrierefreien Mobilität für Menschen mit Behinderungen auf breiter Basis anerkannt und es werden auch Maßnahmenempfehlungen ausgesprochen. Schon 1992 wurden im Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung wichtige Grundsätze und Zielsetzungen für die österreichische Behindertenpolitik im Allgemeinen und konkret den Mobilitätsbereich tangierend formuliert. Gab auf der einen Seite das Konzept einen Impuls zu wesentlichen Verbesserungsmaßnahmen und gesetzlichen Änderungen (z.B. Bundespflegegeldgesetz, Grundsatz "Rehabilitation vor Rente"), blieb andererseits im Bereich der Mobilität auf der Umsetzungsebene vieles offen: Beispielsweise kam es seither weder zu einer rechtlichen Verankerung der ÖNORMEN bei Definitionen von Barrierefreiheit oder zu einer verpflichtenden Teilnahme an Seminaren zu barrierefreiem Bauen für angehende ArchitektInnen und BauingenieurInnen, noch konnte sich eine zentrale bundesweite Fachstelle für behindertengerechtes Bauen etablieren.
Obwohl immer noch paternalistische Strukturen in der Behindertenpolitik fortbestehen und sich in Österreich erst langsam das Selbstverständnis einer Vertretung der Interessen durch Betroffene durchzusetzen beginnt - so war z.B. von den 2001 interviewten BehindertensprecherInnen der Wiener Landesparteien keine/r selbst von einer Behinderung betroffen oder es sind derzeit auf Bundesebene von den vier BehindertensprecherInnen zwei mit Behinderungen[38] - ist eine Tendenz, weg von paternalistischen Denkmustern, hin zu Prinzipien der Anerkennung behinderter Menschen als Subjekte gesellschaftspolitischen Handelns erkennbar. Durch den massiven Druck der Behindertenbewegung wurde es in den letzten Jahren unumgänglich die Betroffenen selbst vermehrt in (politische) Entscheidungs- und Planungsprozesse einzubeziehen. Die Behindertenbewegung wurde zusehends zu einem von staatlicher Seite zumindest nicht mehr ignorierbaren Akteur im politischen Feld. Vielleicht liegt ein Grund dafür auch in der in den letzten Jahren intensivierten Zusammenarbeit der Interessensvertretungen behinderter Menschen. Auf jeden Fall geht mit diesen Veränderungen einher, dass behinderte Menschen vom Objekt der staatlichen Verwaltung zum Subjekt gesellschaftspolitischen Handelns avancieren. Als Beispiele dafür können genannt werden:
-
der Bundesbehindertenbeirat (geschaffen im Rahmen des BBG 1990) in dem unter anderen VertreterInnen von Behindertenorganisationen und -verbänden sitzen,
-
die Einbindung Betroffener in Arbeitsgruppen wie die zur "Rechtsbereinigung behindertendiskriminierender Rechtsvorschriften" auf Bundes-und Landesebene,
-
das vermehrte Einbeziehen der Meinung und Kompetenzen von InteressensvertreterInnen behinderter Menschen von Seiten der Verkehrsbetreiber (z.B. "Wiener Linien"),
-
die Einbindung in die Erarbeitung von Programmen und Gesetzesvorschlägen (z.B. Behindertenkonzept 1992, BGstG 2006).
Seit den 1990er Jahren ist zu bemerken, dass sich neben der in Österreich stärker ausgebildeten Tradition sozialstaatlicher Leistungen zunehmend die (rechtliche) Gleichstellung und Anerkennung von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund schiebt. Der Akzent der Legislative hat sich weg vom Schutz-Gedanken des Rechts mehr zum Prinzip des selbstbestimmten Lebens verschoben. Damit rücken Aspekte sozialer Inklusion, wie bürgerliche Gleichheits- und (soziale) Grundrecht oder die Menschenrechte, in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Neben dem Fokus auf die rechtliche Dimension, um Inklusion und Gleichstellung zu erreichen, gewannen in den letzten Jahren auch die Prinzipien von Selbstbestimmung und Empowerment sowie die öffentliche Thematisierung behindertenspezifischer Anliegen von Betroffenen mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang können auch die verstärkt geführten Diskurse und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen hinsichtlich barrierefreier Mobilität oder im Rahmen der Schaffung eines Behindertengleichstellungsgesetzes gesehen werden.
In dieser Tendenz spiegeln sich mit zeitlicher Verzögerung internationale Veränderungen wider. Einerseits gab die Behinderten- bzw. Antidiskriminierungspolitik der Europäischen Union merkbare Richtlinien zur sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen vor und beeinflusste so die nationalen Politiken. Andererseits wandelt sich global das Verständnis von Behinderung ("Paradigmenwechsel"); es kommt zusehends zu einer Politisierung. Das heißt, ein kompetenzorientiertes und umweltorientiertes Verständnis von Behinderungen verdrängt eine defizit- und individuumszentrierte Sichtweise. Beispielsweise rekurriert in Österreich die Behinderungsdefinition des BBG (1990) auf dem "sozialen Modell" von Behinderung. Der "lauter" gewordene Kampf um die Zugänglichkeit zur Umwelt, die Teilhabe an Mobilität (auch in Österreich) kann vielleicht als Abbild jener Verschiebung betrachtet werden.
Diskriminierungsschutz und Antidiskriminierungsbestimmungen sind insbesondere auch im Kontext der Schaffung inklusiver Mobilitätsbedingungen relevant. In Österreich sind als wesentliche Maßnahmen in dieser Hinsicht das verfassungsrechtliche Benachteiligungsverbot sowie die dem Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung hinzugefügte Staatszielbestimmung zu nennen (1997). Weiters sind das EGVG (1997), eine Novelle der GewO (1997), das ÖPNRV-G (2000) und das BGStG (2006) bedeutsame gesetzliche Richtlinien, die unter anderem das Mobilitätsfeld tangieren. Festzuhalten ist, dass es in Österreich zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene zu gesetzlichen Interventionen kam, die den Schutz vor Diskriminierung vorsehen und in die Richtung der Gewährleistung inklusiver Mobilitätsbedingungen gehen. Bei genauerem Hinsehen ist allerdings bemerkbar, dass es an der Durchsetzbarkeit (bestehender Regelungen) mangelt. Das heißt, dass mit genannten Bestimmungen keine behördlich durchsetzbaren materiellen Gleichstellungsrechte eingeräumt werden, die z.B. eine Beseitigung von Mobilitätsbarrieren ermöglichen würden. So können beispielsweise aus dem Benachteiligungsverbot bzw. der Staatszielbestimmung keine subjektiven, individuell einklagbaren Rechte oder ein Tätigwerden der Staatsorgane, z.B. auf Erlassung von gesetzlichen Bestimmungen zum barrierefreien Bauen, abgeleitet werden. Ebenso bietet das EGVG kein behördlich durchsetzbares Recht auf Bestrafung der diskriminierenden Person und mit der Novelle zur GewO ist detto keine zivilrechtliche Klagsgrundlage verknüpft. Das BGStG soll vor mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung schützen. Es weist allerdings keine detaillierten Bestimmungen zur Umsetzung von Barrierefreiheit auf, wie es etwa durch die Aufnahme der spezifischen ÖNORMEN als verbindliche Standards möglich gewesen wäre. Das "Behindertengleichstellungspaket" gilt im Wesentlichen nur für den Bundesbereich. Aber gerade Sachgebiete wie barrierefreies Bauen obliegen grundsätzlich der Kompetenz der Länder und sind damit vom Geltungsbereich des Gesetzes-Paketes nicht umfasst. Ebenso ist bei den Sanktionsnormen kein ausdrücklicher und unmittelbar durchsetzbarer Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch vorgesehen.
[31] Peer Counseling ist eine Beratungsmethode, der die Annahme zugrunde liegt, dass selbst von Behinderung betroffene andere behinderte Menschen besser beraten können, da sie selbst die ExpertInnen in eigener Sache sind und somit wissen wovon sie sprechen. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 41)
[32] Die Info-Datenbank ist zu finden unter (online) http://www.service4u.at [Stand: 10.12.2006]
[33] Abrufbar unter (online) http://www.bizeps.or.at/info/krank/ [Stand: 27.7.2004]
[34] Siehe (online) http://www.gleichstellung.at
[35] Hierzu kann mittlerweile auch vermerkt werden, dass es 2004 zu einer Novellierung der Bauordnung kam. Von InteressensvertreterInnen behinderter Menschen wird allerdings kritisiert, dass die Novellierung in einigen Bereichen zu wenig weit gegangen ist und lückenhaft blieb. (vgl. Krispl 2004: Online)
[36] Präzise formuliert, handelt es sich um die Einstufungsverordnung zum BPGG, die als Regelung für die Beurteilung des Pflegebedarfs und als Grundlage für die Entscheidung über das Pflegegeld dient (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 152ff).
[37] Noch vor der Aufnahme des Benachteilungsverbotes für Menschen mit Behinderungen in Artikel 7 Abs. 1 der Bundesverfassung (1997) wurde mit dem EGVG (BGBl. I Nr. 63/1997) eine Verwaltungsstrafbestimmung für Fälle einer Behindertendiskriminierung gesetzlich verankert. (vgl. Krispl 2006b: 248)
[38] Neben Theresia Haidlmayr (GRÜNE) ist Dr. Franz-Joseph Huainigg (ÖVP) auf einen Rollstuhl angewiesen.
Inhaltsverzeichnis
In diesem Kapitel stehen die situativen und baulichen Rahmenbedingungen barrierefreier Mobilität in Österreich im Zentrum des Interesses, wobei "Barrierefreiheit"[39] sich hier primär auf den Verkehrsbereich bezieht, das heißt, als Zugänglichkeit zum und Nutzung des gebauten (halb-)öffentlichen Raums sowie des öffentlichen Personenverkehr verstanden und berücksichtigt wird. Es stehen jene Regelungen, rechtliche Bestimmungen etc. im Mittelpunkt des Interesses, die für die barrierefreie alltägliche Mobilität im öffentlichen Verkehrsraum von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und besonders für RollstuhlfahrerInnen in Wien, relevant sind.
Da mobilitätsrelevante (gesetzliche) Regelungen oder Vorschriften wie beispielsweise Bauordnungen, Bestimmungen öffentlicher Verkehrsbetreiber, Bestimmungen für Fahrtendienste, Regelungen von Hilfsmittelzuschüssen, etc. teilweise stark länder-, ja, sogar städtespezifisch variieren, sowie aufgrund fehlendem empirischen Datenmaterial zu bundesweiten Mobilitätsbedingungen lassen sich nur partielle Aussagen hinsichtlich der mobilitätsspezifischen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen in Österreich treffen. Es wird folglich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Betreffend der gesetzlichen Grundlagen im Kontext barrierefreier Mobilität bzw. barrierefreien Planens und Bauens sind in erster Linie die Bauordnungen der Bundesländer von Bedeutung. In den einzelnen Bundesländern sind unterschiedliche baurechtliche Bestimmungen wirksam, in denen die bautechnischen Vorschriften für jede Gemeinde im jeweiligen Bundesland verbindlich festgelegt sind. (vgl. Weidert 2000: 139) Lediglich Bauvorhaben im Verkehrswesen bezüglich Eisenbahnen, Schifffahrt und Luftfahrt fallen in Bundeskompetenz. Eine Vereinheitlichung auf nationaler Ebene ist derzeit nicht gegeben. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 48) Ebenfalls in Bundeskompetenz fällt die GewO, die hinsichtlich der barrierefreien Gestaltung von Geschäftslokalen zum Tragen kommt. (vgl. 5.3.2)
Folglich sei die "Wiener Bauordnung" exemplarisch herausgegriffen. Die "Wiener Bauordnung" (2004)[40] weist mittlerweile umfangreiche und detaillierte Bestimmungen zum barrierefreien Planen und Bauen auf, die mobilitätsbehinderte Menschen und im speziellen auch RollstuhlfahrerInnen tangieren. Beispielsweise hinsichtlich der Gestaltung von Zugängen, Normierung von Türbreiten, Maßangaben für
Stufen oder zur Gestaltung des Straßenraums (z.B. Gehsteigabsenkungen[41]) etc. Die Bauordnung ist auf alle Neu-, Um- und Zubauten anzuwenden und umfasst alle Wohn-, wie öffentliche Gebäude und Arbeitsstätten. Durch die Anwendung dieser Regelungen würde erreicht, dass behinderte und ältere Menschen, Familien mit Kindern, aber z.B. auch Menschen bei denen durch Krankheit oder einen Unfall eine Behinderung erst eintreten wird, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und andererseits alle übrigen Bereiche wie Arbeitsstätten, Kultur-, Freizeit- und Schuleinrichtungen, Arztpraxen, öffentliche Freiraumflächen und öffentliche Verkehrseinrichtungen, barrierefrei gestaltet werden können. (vgl. Wollersberger 2004, Groiss 1996: 26f)
Vereinfachend gesagt, gelten als wichtigste Grundsätze barrierefreien Planens und Bauens:
-
stufenloser Zugang
-
mindestens 80 cm Türbreite
-
Bewegungsfreiheit im Gebäudeinneren, insbesondere Sanitärräumen. (vgl. Wollersberger 2004: 2)
Insbesondere für RollstuhlfahrerInnen relevante Bestimmungen der Wiener Bauordnung (BO) bzw. des ebenfalls 2004 novellierten Wiener Garagengesetzes (WGG) sind:
"§ 106a / Abs.2 BO: Jedes Gebäude muss mindestens einen Eingang haben, der von Rollstuhlfahrern barrierefrei gefahrlos und ohne fremde Hilfe benutzt werden kann. Höhenunterschiede zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und dem Eingangstor sind durch eine Rampe oder, wenn eine Rampe infolge der Geländeverhältnisse nicht ausgeführt werden kann, durch eine maschinelle Aufstiegshilfe für behinderte Menschen zu überbrücken." (Wollersberger 2004: 14)
"§ 90 / Abs.6 BO: (...) Spielplätze müssen barrierefrei zugänglich sein. Darüber hinaus ist auf eine ausreichende Anzahl von barrierefreien Spielgeräten Bedacht zu nehmen." (ebd.: 22)
"§ 12 / Abs.1 WGG: (...) Bei Anlagen zum Einstellen von mehr als 30 Kraftfahrzeugen ist für jeweils angefangene 50 Stellplätze ein Behindertenplatz herzustellen." (ebd.: 21)
Mit der Novellierung der Bauordnung und des Garagengesetztes im Jahr 2004 wurden eine Reihe von behindertendiskriminierenden Bestimmungen, die zum Erhebungszeitpunkt (2001) noch gültig waren, geändert oder entfernt. Die Novellierung erfolgte auch unter Einbeziehung von ExpertInnen, die selbst von Behinderung betroffen sind. Wobei von Seiten der BehindertenvertreterInnen sowohl der Prozess als auch die Novellierung in ihrer nunmehrigen Form teils kritisch kommentiert wurde:
"Das Ergebnis (die Novellierung der Bauordnung, Anmerkung T.E.) war ein zähes und mühevolles Ringen mit der Beamtenschaft, den diversen Gremien und den zuständigen Politikern. Punkt für Punkt und Zeile für Zeile mussten wir argumentieren und bei der Gegenseite Überzeugungsarbeit und Zustimmung zur Änderung erkämpfen - was uns leider in einigen Bereichen nicht gelungen ist." (Srb 2004: Online)
Beispielhaft für Aspekte, die trotz der Novellierung von Interessensvertretungen behinderter Menschen als weiterhin problematisch angesehen werden, seien genannt: Der Begriff "barrierefrei" wird nicht ausreichend definiert, die ÖNORM B 1600 wurde nicht für verbindlich anwendbar erklärt, es fehlt z.B. ein Verweis auf die ÖNORMEN für die Ausgestaltung der Behindertentoiletten. Auf die Rechte von sinnesbehinderten Menschen wurde mit der Bauordnungsnovelle am wenigsten eingegangen. Positiv von ExpertInnen bewertet wird vor allem, dass die Grundsätze barrierefreien Planens und Bauens nun auch vom Planverfasser bzw. von der Planverfasserin zu bestätigen sind, wobei allerdings weiterhin in Einzelfällen die Möglichkeit besteht aufgrund der "Interessensabwägung" Bestimmungen nicht einhalten zu müssen. (vgl. Srb 2004: Online; Krispl 2004: Online)
Folgender Aspekt im Zusammenhang der Novellierung der Wiener Bauordnung 2004 kann auch als prägnantes Beispiel für Schwierigkeiten bei der effektiven Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen für mobilitätsbehinderte Menschen dienen: Im Vorfeld der Gesetzesänderung wurden zwar ExpertInnen aus Behindertenorganisationen in Form einer Arbeitsgruppe der gemeinderätlichen Behindertenkommission bei der Entwurfsgestaltung des Gesetzes miteinbezogen. Schlussendlich wurde aber vom Wiener Landtag ein anderer Entwurf beschlossen, der - neben durchaus auch positiven Maßnahmen - "so gut wie keine Maßnahmen für sinnesbehinderte Menschen enthielt, ja diese sogar weitestgehend aus dem von den Regelungen zum barrierefreien Bauen betroffenen Personenkreis ausschloss, und dass auch die Maßnahmen für körperbehinderte Menschen teilweise stark zu wünschen übrig ließen". (Krispl 2004: Online) Es ist daher zu erwarten, "dass sich fundamentale Verbesserungen für Menschen mit Behinderung kaum ergeben werden". (ebd.)
Zur Durchsetzung und Vollziehung jener Bestimmungen ist anzumerken, dass hierbei teilweise unterschiedliche Behörden, die auch unabhängig voneinander entscheiden, zuständig sind. So kann es sein, dass in einem barrierefrei zugänglichen Einkaufszentrum Geschäftslokale zu finden sind, die nicht barrierefrei gestaltet wurden. (vgl. Srb 2004: Online) Dies ist deshalb möglich, da der Bau des Einkaufszentrums in die Zuständigkeit des Landes fällt, innerhalb des Zentrums, die baulichen Bestimmungen für die diversen Geschäftslokale allerdings über die Gewerbeordnung (Bundeskompetenz) geregelt sind. Ein weiteres Problem bilden Schlupflöcher. Es besteht etwa die Möglichkeit auf behindertengerechte Maßnahmen zu verzichten, wenn dem Durchführenden dies aus finanziellen Gründen nicht zumutbar ist. Ebenso kann der Denkmalschutz verhindernd wirksam werden. (vgl. Teufelsbrucker 1998: 50; Weidert 2000: 139f, SPÖ 2005: Online)
Neben den Vorschriften der Bauordnungen gibt es empfehlende Richtlinien. Die bundesweit einheitliche Norm für die behindertengerechte Gestaltung von öffentlich zugänglichen Bauten und Verkehrsanlagen ist die bereits erwähnte ÖNORM B 1600 "Barrierefreies Bauen - Planungsgrundsätze"[42]. Die darin enthaltenen Planungsgrundsätze umfassen jene baulichen Maßnahmen, die notwendig sind, um die unterschiedlichen physischen Möglichkeiten aller Menschen in der gebauten Umwelt besser berücksichtigen zu können. Das Anwenden dieser baulichen Maßnahmen würde mobilitätsbehinderten Menschen die Nutzung von Gebäuden und Anlagen erleichtern und darüber hinaus auch die sozialen und ökonomischen Folgekosten für die Gesellschaft mildern, da nachträgliche Umbauten mit höheren Mehrkosten verbunden sind. Sofern in der Planungsphase bereits auf "anpassbaren Wohnungsbau" Rücksicht genommen wird, fallen diese jedoch kaum an. Weitere relevante Normen sind die ÖNORM B1601 über spezielle Baulichkeiten für behinderte und alte Menschen, die ÖNORMEN V2100-V2103, die für sehbehinderte Personen gelten oder auch die ÖNORM A2615, Teil2, die Standards für Computerbraille setzt. (vgl. Rainer 2006: 131fff; Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 49; Riess 1999: 17f; Weidert 2000: 139f)
Es handelt sich bei den ÖNORMEN allerdings um keine sanktionierbaren oder einklagbaren Verbindlichkeiten, da sie lediglich Empfehlungscharakter haben, sofern sie nicht in Gesetze oder Verordnungen eigens aufgenommen und rechtsverbindlich erklärt werden. Zwar wurden von den Bundesländern einige Bestimmungen übernommen oder auch vom Wirtschaftsministerium die ÖNORM B1600 für in Bundesbesitz befindliche Bauwerke verbindlich erklärt, bei letzterem mit dem Zusatz "wenn kein außerordentlich hoher finanzieller Aufwand damit verbunden ist" (Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr 1998: 17) aufgenommen. Zur Übernahme von Bestimmungen seitens der Bundesländer ist hinzuzufügen, dass selbst dort, wo die gesetzlichen Regelungen an sich relativ weitgehend sind, wie in Wien oder in Salzburg, dennoch keinerlei individuelle Durchsetzungsrechte für Betroffene bestehen. Groiss (1996: 18) erläutert: "Durch die fehlende Sanktionierbarkeit und Einklagbarkeit der bereits beschlossenen gesetzlichen Regelungen entsteht darüber hinaus kein Druck auf die Bauwirtschaft, die bauliche Situation nachhaltig zugunsten behinderter Menschen zu ändern."
Für Wien geltende gesetzliche Regelungen, die für mobilitätsbehinderte Menschen (und speziell auch RollstuhlfahrerInnen) bedeutsam sind, seien noch erwähnt: Das "Wiener Veranstaltungsstättengesetz" (1999) gilt wie auch die Wiener Bauordnung nur für Neubauten bzw. für genehmigungspflichtige Umbauten und die "Verordnung über die Beschaffenheit der Gehsteige und ihrer baulichen Anlagen" (2004), in der unter anderem Vorschriften zur Breite, Bauart, Gestaltung von Bordsteinabsenkungen vorhanden sind, kommt ebenso nur beim Neu- und Umbau von Anlagen zum Tragen soweit im Bebauungsplan keine Vorschriften über die Beschaffenheit der Gehsteige enthalten sind. (vgl. Teufelsbrucker 1998: 51f)
Mit dem "Öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrsgesetz" (ÖPNRV-G) (2000) werden die Kompetenzen im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr geregelt. Grundsätzlich obliegt die "Bestellung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsdienste im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr" (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 196) den Ländern und Gemeinden. Die rechtlichen Vorgaben durch Bund und Land (je nach Kompetenzbereich) müssen jedoch beachtet werden, wobei sowohl seitens des Bundes (z.B. ÖBB oder Postbus) als auch seitens der Länder (z.B. "Wiener Linien") "kein unmittelbarer Durchgriff auf kaufmännische Entscheidungen der Unternehmensführungen" (ebd.) besteht. Dennoch hätten die einzelnen Länder aber die Möglichkeit durch entsprechende gesetzliche Beschlüsse, z.B. die Anschaffung barrierefrei zugänglicher öffentlicher Verkehrsmittel, verpflichtend für die Verkehrsunternehmen zu machen.
Zur Förderung von Bestellungen der Länder und Gemeinden im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr wurden im Jahr 2002 vom Bund Mittel in der Höhe von 14,535.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die maximale Förderhöhe beträgt 50 % der Bestellsumme und ist von der Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien abhängig. Die Anliegen behinderter Menschen finden sich in den im ÖPNRV-G festgeschriebenen Kriterien wieder: Berücksichtigung der Bedürfnisse von in ihrer Mobilität physisch beeinträchtigten Personen, benutzerfreundliche Konzipierung der Fahrzeuge und Fahrkartenausgabegeräte sowie gute Erreichbarkeit von Haltestellen und die Anbindung von wichtigen Fahrzielen an das öffentliche Regional- und Nahverkehrssystem. Ich möchte hierbei anmerken, dass die Kriterien allerdings keine konkreten Definitionen aufweisen, nach welchen Standards oder Normen
(z.B. ÖNORMEN) eine Berücksichtigung erfolgen soll. Als positive Beispiele für neu eingerichtete Verkehrsmittel, die mit Bundesmitteln finanziert wurden und in denen laut dem "Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen in Österreich" die Belange der behinderten Menschen voll umgesetzt wurden sind z.B.: Citybus Baden, Stadtbus Zwettl, Landbus Unterland (Vorarlberg), einige Buslinien in Graz. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 199f)
Im Bericht heißt es weiters:
"Eine vollständige Erschließung mit klassischen Linienverkehren in allen Regionen und mit umfassenden Betriebszeiten wird auch in Zukunft kaum von den öffentlichen Händen finanziert werden können. Dies gilt vor allem auch deshalb, da der Einsatz behindertengerechter Fahrzeuge und Infrastruktur bei Adaptierungen wesentlich höhere Kosten verursacht. Im ÖPNRV-G wird deshalb auch der Einsatz alternativer Betriebsformen wie Anrufsammeltaxi und Rufbusse gefördert." (ebd.: 200)
Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) kam es in den 1980er Jahren und Anfang der 1990er Jahre zu bemerkbaren Verbesserungen und einer verstärkten (theoretischen) Auseinandersetzung mit dem Thema barrierefrei zugängliche Bahn, Bus und deren Anlagen. (vgl. Berdel/Pruner 1995, Band 1) Verbesserungen wurden z.B. dahingehend vorgenommen, dass in den größeren Bahnhöfen stationäre Hebelifte eingesetzt werden, die in der Lage sind Rollstühle in die Waggons zu befördern. Oder, dass auf einigen Hauptstrecken Waggons im Einsatz sind, die behindertengerechte Sitzplätze bzw. rollstuhlgerechte Toiletten aufweisen. Oder z.B., dass stufenlos zugängliche ÖBB-Doppelstockwagen ("Wiesel") im Nahverkehr eingesetzt werden. (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999; Riess 1999) Im Zuge der "Bahnhofsoffensive" der ÖBB wurde/wird bei der Modernisierung frequenzstarker Bahnhöfe (z.B. Linz, Wels, Graz) auch der behindertengerechte Ausbau berücksichtigt: behindertengerechte Zugänge, Adaptierung von Bahnsteigen, Einbau von Liftanlagen etc. Weiters haben die ÖBB in Zusammenarbeit mit Organisationen sehbehinderter und blinder Menschen ein taktiles Leitsystem für Bahnsteige und Bahnsteigzugänge entwickelt und betreiben acht regionale sowie eine zentrale Behinderten-Servicestelle, die als Ansprechstellen fungieren. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 196f) Bei eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren wird zwar auf die behindertengerechte Ausgestaltung der Eisenbahnanlagen Bedacht genommen, "(g)rundsätzlich ist es jedoch die Entscheidung der Leitung des Unternehmens, für in der Mobilität beeinträchtigte Personen entsprechende Vorkehrungen zu treffen". (ebd.: 197)
ExpertInnen sprechen dennoch davon, dass eine volle Zugänglich- und Benutzbarkeit der Bahn bei weitem nicht besteht. Moniert wird, dass es an einem zeitgemäßen Gesamtkonzept fehlt, um die Benutzbarkeit der Bahn durch behinderte Menschen nachhaltig zu verbessern. Verbesserungskonzepte werden aus Kostengründen oftmals nicht realisiert. Im Zuge der Ausgliederungen der ÖBB aus dem Bundeshaushalt haben Maßnahmen für behinderte Menschen einen deutlichen Rückschlag erlitten. Die ÖBB argumentierte, dass sie den Einnahmeausfall durch die besondere Rücksichtnahme auf Personen mit Behinderung vom Gesetzgeber nicht vergütet bekommen. So wurde die Anzahl der eingesetzten rollstuhlgängigen Waggons in den letzten Jahren drastisch reduziert. Auch liegt die bauliche Situation auf vielen Bahnhöfen noch im Argen. (vgl. Riess/Flieger 2000; Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999; Riess 1999)
Am Flughafen Wien Schwechat werden gewisse Vorkehrungen für behinderte Fluggäste getroffen: Behindertenparkplätze, barrierefreie Toiletten, Leihrollstühle, Tragsessel, Informationsbroschüre etc. Die großen und die neuen Flugzeuge sind mit vielen Sondereinrichtungen ausgestattet, sodass RollstuhlfahrerInnen die Teilnahme am Flug möglich ist. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 198f)
Eine differenzierte österreichweite Bestandsaufnahme des öffentlichen Personenverkehrs hinsichtlich dessen Barrierefreiheit ist - wie einleitend festgestellt wurde - kaum möglich, da teilweise sehr unterschiedliche Richtlinien in den jeweiligen Ländern bzw. Städten bestehen, beginnend bei der Anschaffung von Verkehrsmitteln bis hin zu Fahrpreisermäßigungen für Menschen mit Behinderung. Allgemein kann gesagt werden, dass ein Stadt-Land Gefälle besteht, das heißt, dass in (manchen) Städten die Bedingungen besser sind als in ländlichen Gebieten - Verkehrsangebot als auch Mobilitätsbedarf sind unterschiedlich. (vgl. Theussl/Lückler/Steinbacher 1991) In den letzten Jahren wurden in einigen Städten "Experimente" mit Niederflurstraßenbahnen und Niederflurbussen getätigt, die eine mittelfristige Umrüstung in Richtung barrierefreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmitteln erahnen lassen. In Wien ist im Vergleich zu anderen Großstädten mittlerweile die Situation relativ positiv anzusehen oder zumindest können gute Fortschritte hinsichtlich der Teilnahme behinderter Menschen am ÖPNV bemerkt werden. (vgl. Riess 1999; Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999)
Eine interviewte Expertin konstatiert, dass "im Sinne einer Gleichstellung und Integration natürlich die Förderung des öffentlichen Verkehrs das wichtigste ist". (EI 3, 2001)
ExpertInnen bewerten die Lage in Österreich betreffend der Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln durch behinderte Personen als "eher schlecht" oder "sehr schlecht". (vgl. Flieger/Riess 2000: 17)
Ein interviewter Experte des Vereins BIZEPS schätzt den Status quo barrierefreien ÖPNVs in Österreich wie folgt ein:
"In Bezug ÖPNV und Barrierefreiheit ist Österreich ein Entwicklungsland. (...) Wir haben uns relativ intensiv im Ausland angesehen wie das jetzt in Dublin ist, wie das in Bremen ist, wie das in München ist, wie Helsinki damit umgeht; wir haben das bis Washington und New York durchgesehen. Also, da ist Wien ein Entwicklungsland. Man beginnt endlich an diesem Status zu arbeiten; versucht diesen Rückstand den man hat aufzuholen. Es ist allerdings eine mühselige Geschichte, dauert Jahre." (EI 4, 2001)
6.2.1 ÖPNV in Wien[43]
Obwohl ca. 20 % der Fahrgäste von Verkehrsbetrieben mobilitätsbehinderte Personen sind (vgl. VDV 1998: 2), orientierten sich die Entwicklung und der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes bzw. die Konstruktion der eingesetzten Verkehrsmittel in Wien lange Zeit überhaupt nicht an den Bedürfnissen dieser Personengruppen. Der Zugang und die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel werden neben einer nicht barrierefreien Konstruktion der Fahrzeuge, durch Stufen oder fehlende Orientierungshilfen erschwert oder verunmöglicht.
In den letzten Jahren kam es allerdings zu einigen Verbesserungen und es wurden Maßnahmen gesetzt, die unter anderem darauf schließen lassen, dass ein gewisses Bewusstsein und eine Sensibilisierung hinsichtlich der Anliegen von mobilitätsbehinderten Personen (z.B. RollstuhlfahrerInnen) vorhanden sind. Ein interviewter Vertreter der "Wiener Linien" stellt fest:
"Also von unserer Seite aus wird alles getan, um eben behinderten Menschen die voll auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, das Leben zu erleichtern. Für RollstuhlfahrerInnen im speziellen sind das Niederflurfahrzeuge, die natürlich nicht von heute auf morgen angeschafft werden können." (EI 5)
Und ein Experte der Interessensvertretung BIZEPS weist darauf hin:
"Die ‚Wiener Linien' haben in den letzten Jahren begonnen uns als KundInnengruppe zu entdecken. Nicht, weil sie sich sehr viel davon erwarten, aber sie akzeptieren endlich, dass wir Kundinnen und Kunden sind. Das war vor zehn Jahren überhaupt nicht so. Da hat's geheißen, na, dann fahrt's halt mit dem Fahrtendienst, wenn ihr nicht in den Bus rein kommt's. Und jetzt ist zumindest in den wesentlichen Köpfen der "Wiener Linien" klar: das sind auch unsere Kundinnen und Kunden." (EI 4, 2001)
Ein Experte der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation (ÖAR) ergänzt:
"Es ist aber auch eine ähnliche Situation mit öffentlichen Einrichtungen, also Behörden, Magistratsabteilungen. Da gab's vor zehn Jahren eher noch Widerstand und Gegnerschaft und mittlerweile ist das in unterschiedlichen Qualitäten wirklich konstruktiv. Es ist den Leuten mittlerweile zum Problem geworden." (EI 2, 2001)
Der Status quo (2001; Anmerkung T.E.) hinsichtlich der Bedingungen zur Nutzung des ÖPNV, speziell von RollstuhlfahrerInnen, wird von interviewten ExpertInnen wie folgt kommentiert:
"Ich sehe das System ÖPNV in Wien am Anfang einer Umbauphase. Man kann davon ausgehen, dass die Verkehrsmittel in Wien samt Infrastruktur - das heißt: wie bekomme ich meine Auskunft? Wie bekomme ich meinen Fahrschein? - am Anfang stehen. (...) Innerhalb von Österreich gibt's einige Städte, die Wien weit voraus sind mit dem Start der Umrüstung der Verkehrsmittel. Wien war eine der letzten Landeshauptstädte, die begonnen hat Niederflurbusse mit Einstiegshilfen zu beschaffen." (EI 4, 2001)
"Es ist aber im Vergleich mit anderen Hauptstädten (...) in Wien die Kombination von zumindest teilweise benutzbaren öffentlichen Verkehrsmitteln und der Möglichkeit des Fahrtendienstes, ist es so, dass Wien wahrscheinlich die Hauptstadt ist, wo man sich am besten bewegen kann." (EI 3, 2001)
I: "Wie schätzen Sie die Mobilitätsmöglichkeiten für RollstuhlfahrerInnen in Wien ein?"
Expertin: "Es ist besser geworden." (EI 6, 2001)
Erst seit Mai 2001 und auf Drängen von Behindertenorganisationen[44] ist es Menschen mit Behinderungen offiziell gestattet, auch ohne Begleitung einen Niederflurbus oder eine -straßenbahn und die U-Bahn zu benutzen. Der diskriminierende Passus in den Beförderungsrichtlinien der "Wiener Linien":
"Jeder Kinderwagen oder Rollstuhl muß von mindestens einer erwachsenen Person, die für Hilfestellung zum Ein- und Aussteigen der behinderten Person, für Ein- und Ausladen der Kinderwägen oder Rollstühle sowie für Sicherung insbesondere mittels der vorhandenen Befestigungseinrichtungen im Wageninneren zu sorgen hat, begleitet werden" (BIZEPS 2001: Online)
wurde gestrichen, mit einer Ausnahme: Auf der U-Bahn-Linie U6 gilt weiterhin diese Bestimmung (Stand: 2001).[45] Der interviewte Vertreter der "Wiener Linien" verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass dies auf eine behördlich angeordnete Sicherheitsmaßnahme zurückzuführen ist, da derzeit noch entsprechende "Rückhaltesysteme" in der U-Bahn fehlen. (vgl. EI 5, 2001)
Informationen sind äußerst wichtig, wenn es um die Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht, hinsichtlich der Orientierung im Verkehrsnetz und auch generell für die Nutzungsbedingungen. In diesem Kontext wäre es besonders für mobilitätsbehinderte Fahrgäste notwendig über die Bedingungen (eventuelle Problematiken) und Möglichkeiten der Verkehrsmittelnutzung Bescheid zu wissen. Jene Informationen speziell auch für mobilitätsbehinderte Menschen wären, laut BIZEPS-Experten, klarerweise immer auch von dem zuständigen Akteur, also im Falle des ÖPNV in Wien von Seiten der "Wiener Linien", bereitzustellen.
Die "Wiener Linien" haben diesbezüglich z.B. bei den ausgehängten U-Bahn-Plänen jene Stationen markiert, die über einen Lift verfügen. Wurden zum Befragungszeitpunkt, 2001, auf der Website der "Wiener Linien" die Gruppe der mobilitätsbehinderten Menschen noch nicht berücksichtigt, so hat sich das mittlerweile geändert, da auf der Homepage nachzulesen ist, in welchen U-Bahnstationen Aufzüge und Behinderten-WCs zu finden sind.[46]
Bus
Erst durch das Einsetzen so genannter Niederflurbusse in das öffentliche Busnetz von Wien, kam der Bus überhaupt erst für RollstuhlfahrerInnen grundsätzlich als Verkehrsmittel in Betracht, da der Einstieg in "Normalbusse" nur über Stufen und eine große Einstiegshöhe möglich war/ist. Ein barrierefreier Zugang zu den Niederflurbussen wurde jedoch erst durch die Installation von Klapprampen, die bei der Mitteltür platziert sind, gewährleistet. Dieses System wurde von den "Wiener Linien" in Verhandlungen gemeinsam mit Behindertenorganisationen erarbeitet, 1998 in den Probebetrieb genommen und ist mittlerweile in allen Niederflurbussen fixer Bestandteil. Mithilfe angesprochener Rampe bzw. auch der den Niederflurbussen inhärenten Einrichtung einer "Kneeling-Funktion"[47] ist der Bus prinzipiell für RollstuhlfahrerInnen benutzbar. Ein äußerst wichtiger Aspekt betreffend der Rampe ist, dass sie händisch von den BusfahrerInnen ausgeklappt werden muss. Es gibt in diesem Zusammenhang seit 1998 einen Dienstauftrag[48] für die FahrerInnen der "Wiener Linien", in dem es heißt: "Bei Fahrgästen in Rollstühlen ist immer das Kneeling zu betätigen und zusätzlich die Klapprampe auszuklappen." (BIZEPS 2006c: Online) Schulungen oder "Sensibilisierungsmaßnahmen" des Buspersonals hinsichtlich etwaiger "neuralgischer Punkte" was das (Fahr-)Verhalten oder die Interaktion mit den RollstuhlfahrerInnen betrifft, gab es zum Zeitpunkt der Befragungsdurchführung noch nicht. Dies hat sich mittlerweile insofern geändert, als bei den im Jahr 2003 vom "Kuratorium für Verkehrssicherheit" in Kooperation mit den "Wiener Linien" und der Behindertenorganisation "Wiener Assistenzgenossenschaft" entwickelten Schulungs- und Trainingsmaßnahmen "Fahrgäste im Rollstuhl" auch das Fahrpersonal der "Wiener Linien" auf Freiwilligenbasis einbezogen wird. (vgl. 8.2.4.2)
Bezüglich der Infrastruktur des öffentlichen Busnetzes zum Erhebungszeitpunkt (2001) ist zu sagen, dass auf manchen Kursen nur teilweise Niederflurwagen verkehrten, somit nur jeder zweite oder dritte Bus für RollstuhlfahrerInnen prinzipiell benutzbar waren. Insgesamt verkehrten in Wien 2001 ca. 505 Autobusse, davon ca. 300 in Niederflurbauweise wovon ca. 250 mit Klapprampen ausgestattet sind. (vgl. Wiener Linien 2000) Mittlerweile sind alle Niederflurbusse mit einer Klapprampe ausgestattet, und mit Jahresende 2006 sollen in Wien nur mehr Niederflurbusse verkehren. (vgl. Kobinet-Nachrichten 2006: Online)
Straßenbahn
Seit Dezember 1996 wird, neben den herkömmlichen mit hohen Stufen ausgestatten Straßenbahnen, die Niederflurstraßenbahn SGP ULF ("Ultra Low Floor") auf ausgewählten Strecken eingesetzt. Verkehrten 2002 erst auf sieben von insgesamt 32 Straßenbahnlinien ULFs (vgl. BIZEPS 2002: Online), so steigerte sich der Anteil bis ins Jahr 2006 auf 15 Linien auf denen insgesamt 150 ULF-Straßenbahnen (vgl. Krichmayr 2006), zumindest teilweise verkehren. Das heißt, auf mehr als der Hälfte der betriebenen Straßenbahnlinien sind keine Niederflur-Wagen im Einsatz. Jene Fahrzeuge allerdings ermöglichen - als einzige - durch ihre extrem geringe Einstiegshöhe (197 mm) sowie eine bei der FahrerInnentür befindliche, automatisch ausfahrbare Rampe die Benutzung dieses öffentlichen Verkehrsmittels durch RollstuhlfahrerInnen. Warum theoretisch? Dass faktisch auch die ULF-Straßenbahn nur bedingt von auf den Rollstuhl angewiesene Menschen in Anspruch genommen werden kann, hat hauptsächlich zweierlei Gründe: Erstens, kann der ULF erst dann seine niedrige Einstiegshöhe ausspielen, wenn dementsprechend auch die Haltestellenkaps vorhanden bzw. gestaltet sind - dem ist an vielen Haltestellen jedoch nicht so. Und zweitens, wird besagte Rampe zum Befragungszeitpunkt, 2001, in der Verkehrsrealität aufgrund technischer Probleme erst gar nicht verwendet, was z.B. für die meisten Menschen mit Behinderungen, die mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs sind, folglich eine Nutzung ausschließt. Zu diesen beiden Problempunkten ein Experte der "Wiener Linien":
"(...) das Niederflurfahrzeug kann erst dann seine Stärke ausspielen, wenn es dazu eine so genannte Bahnsteigkante gibt. (...) Und diese Bahnsteigkanten werden von uns beantragt und von sehr sehr vielen anderen abgelehnt, weil sie einen Parkplatz kosten. Weil sie nicht mehr das Gerade-Durchfahren (mit dem Auto, Anmerkung T.E.) erlauben" (EI 5, 2001).
"Es (die Rampe, Anmerkung T.E.) ist ein Produkt, das weltweit Probleme hat. Man kann es händisch hineindrehen, das geht schon, aber dann kann man sie nicht mehr hinaus fahren." (EI 5, 2001)
Problematisch und erschwerend für eine tatsächliche Nutzung der Straßenbahn durch RollstuhlfahrerInnen ist ebenso, dass die Bestückung der spezifischen Linien mit ULF-Fahrzeugen variiert. Verkehrt auf manchen Linien bereits zur Gänze dieser Typ, so kommt er auf anderen nur zeitlich unregelmäßig zum Einsatz. Es obliegt daher mehr oder weniger dem Zufall, wann eine benutzbare Straßenbahn in der Haltestelle eintrifft; lange Wartezeiten sind die Folge. Positiv an dieser Stelle ist zu vermerken, dass mit November 2006 die "Wiener Linien" in diesem Zusammenhang einen neuen Service anbieten. Vorerst bei der Linie 49 geht die Ausschilderung eines eigenen ULF-Fahrplans in Betrieb, der den Fahrgästen anzeigt, wann die nächste Niederflurstraßenbahn kommt. Die Wartezeiten sollten so nicht länger als 20 Minuten betragen. Stellt sich der Test als erfolgreich heraus, so erwägen die "Wiener Linien" die Übertragung des Konzepts auch auf die anderen Linien. (vgl. Krichmayr 2006; Ladstätter 2006)
U-Bahn
In Wien sind drei differierende "U-Bahn-Modelle" im Einsatz sind: Die so genannten "Silberpfeile" (U-Bahn-Doppeltriebwaagen) stellen 253 der insgesamt 383 Triebwagen. Zweitens, die nur auf der Linie U6 verkehrenden "6-achsige Zwei-Richtungswagen in Niederflurbauweise" (78 Stk.) und die von der Benutzung durch RollstuhlfahrerInnen vergleichbar sind mit den ULF-Straßenbahnwagen, das heißt ein Spalt zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn zu überbrücken ist. Drittens und marginal eingesetzt, da nur als Prototyp verkehrend, der so genannte "V-Wagen". Ab 2005 soll die Auslieferung der Serienfahrzeuge beginnen und bis Ende 2008 sollen 25 Züge zur Verfügung stehen. (vgl. BIZEPS 2006a: Online, Wiener Linien 2000)
Seit Mitte des Jahres 2001 verkehrt probeweise der Prototyp der neuen Generation U-Bahn-Züge, die so genannten "V-Wagen", die auf den Linien U1, U2 und U3 voraussichtlich die herkömmlichen und im Wiener U-Bahnsystem derzeit am häufigsten eingesetzten "Silberpfeile" auf lange Sicht ersetzen sollen und welche am vorderen und hinteren Ende der Garnitur pneumatisch ausfahrbare Rampen besitzen, wodurch der Spalt (zwischen 11 und 20cm) und der Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante (zwischen 4 und 9,5 cm) überbrückt wird. Dadurch ist ein barrierefreier bzw. berollbarer Einstieg garantiert. Ebenso wurden vorne und hinten "Mehrzweckabteile" vorgesehen, die weiträumig Platz und daher mehr Bewegungsradius für RollstuhlfahrerInnen, Eltern mit Kinderwägen etc. bieten. Und auch die Türen müssen nicht durch händischen Kraftaufwand geöffnet werden (wie bei den "Silberpfeilen"), sondern es sind Druckimpulsknöpfe vorhanden, wo ein Fingerdruck genügt - wie bei den ULF-Fahrzeugen. Diese neuen Züge würden für RollstuhlfahrerInnen (vor allem für "E"-RollstuhlfahrerInnen) sicherlich einen großen Fortschritt zur (leichteren) Inanspruchnahme des wohl beliebtesten öffentlichen Verkehrsmittel Wiens bedeuten. (vgl. BIZEPS 2006a: Online)
Die Inanspruchnahme der U-Bahn durch RollstuhlfahrerInnen steht und fällt mit dem barrierefreien Zugang zum U-Bahn-Bereich, also den Aufzügen. Mit dem Beginn des U-Bahn-Betriebs in Wien (1976) war nicht der Einbau von Aufzügen verbunden. Erst ab 1993, im Zuge eines nachträglichen Umrüstprogramms mit einem erforderlichen Investitionsvolumen von über 60 Mio. Euro, wurden mittlerweile mit einer Ausnahme alle U-Bahn-Stationen mit zumindest einem Lift versehen, wodurch ein barrierefreier Zugang nun fast überall gewährleistet wird.
Ein interviewter Experte kommentiert den Einbau von Aufzügen:
"Und eins muss man bei dieser Gelegenheit schon sagen, die Lifte bei den U-Bahnen sind nicht für uns (Menschen mit Behinderungen, Anmerkung T.E.) gebaut. Das wird ihnen auch jeder bestätigen. Die Lifte bei den U-Bahnen sind für ältere Menschen gebaut, weil hier wirklich das Potential besteht eine große KundInnengruppe in die U-Bahnen zu bekommen." (EI 4, 2001)
War zum Erhebungszeitpunkt (2001) für mobilitätsbehinderte Menschen noch keine Information abrufbar, ob ein Aufzug in Betrieb oder funktionsgestört ist, so hat sich dies mittlerweile geändert: Die "Wiener Linien" geben in ihrer Servicehotline darüber Auskunft, ob ein Aufzug in Betrieb ist oder nicht (vgl. BIZEPS 2006b: Online), wodurch den mobilitätsbehinderten Fahrgästen unliebsame "Überraschungen" erspart bleiben und sie ihre Mobilität zumindest besser planen können.
In den größeren Städten Österreichs (Wien, Linz, Graz, etc.) werden von diversen Unternehmen Fahrtendienste (Sammeltaxis) betrieben, die RollstuhlfahrerInnen, blinde und gehbehinderte Personen um den Preis eines Fahrscheins benutzen können. Im ländlichen Raum gibt es meist keine derartige Einrichtungen. Service und Richtlinien unterscheiden sich länderspezifisch. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 103f) Der Fahrtendienst soll als Ausgleich für die nicht barrierefreien öffentlichen Verkehrsmittel dienen: "Sie sind der Ersatz, wenn andere Verkehrsmittel nicht benutzbar oder verfügbar sind" (Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999: 57), heißt es bereits im "Behindertenkonzept" der österreichischen Bundesregierung von 1992.
Drei Arten von Fahrtendiensten sind in Wien vorhanden: Regel-, Freizeit- und Krankenkassenfahrtendienst. Wollen diese benutzt werden, so muss bei Regel- bzw. Freizeitfahrtendienst ein entsprechender Antrag bei der zuständigen Behörde (im Jahr 2001 war dies die MA12, Referat Fahrtendienst) oder beim Krankenkassenfahrtendienst ein Antrag an die Kasse gestellt und bewilligt werden.
Freizeit- und Regelfahrtendienst dienen allen behinderten Menschen, denen die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels auf Grund einer schweren Gehbehinderung nicht möglich ist. Der Freizeitfahrtendienst kann für maximal 60 Fahrten (Hin- und Rückfahrt zu/von einem Zielort sind zwei Fahrten) im Monat in Anspruch genommen werden. Eine so genannte Berechtigungskarte, die die nach den Kriterien des "Wiener Behindertengesetzes" (WBHG) oder vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen als schwer gehbehindert eingestufte Person beantragen kann, ermächtigt dazu. Die Nutzung des Fahrtendienstes ist in der Zeit von 6.00 bis 24.00 möglich bzw. müssen die Fahrten zwischen 7.00 und 18.00 bei der jeweiligen Firma bestellt und der Zielort sowie - bei Bedarf - die genaue Abholzeit bekannt gegeben werden. Freizeitfahrten sind kostenpflichtig. Derzeit wird für eine Fahrt 1,60 Euro verlangt; bis Oktober 2001 betrug der Preis 1,45 Euro. Der Regelfahrtendienst, der ausschließlich für Arbeitsfahrten (Montag bis Freitag, bei Bedarf auch an Samstagen bzw. an einzelnen Tagen) ist nicht kostenpflichtig.
Es gibt in Wien momentan ca. ein Dutzend Fahrtendienstfirmen, die Freizeit- und/oder Regelfahrten übernehmen, wobei zwischen den Firmen und der Stadt Wien ein Vertrag abgeschlossen wird, in dem die jeweiligen Rechte und Aufgaben festgelegt sind, z.B. in welchem Umfang die LenkerInnen den behinderten FahrgästInnen Hilfestellungen zu leisten haben oder, dass die Firmen das Fahrpersonal schulen müssen etc. (vgl. Ladstätter 2002, Fonds Soziales Wien 2006)
Immer wieder kommt es von den NutzerInnen der Fahrtendienste zu Beschwerden bezüglich des Service und mangelhafter Flexibilität. Ein Interviewpartner, der unter anderem in einer extra eingerichteten Arbeitsgruppe zur Verbesserung des Fahrtendienstes im Jahr 2001 mitwirkte, stellte fest: "(...) von einem qualitativ hochwertigen Fahrtendienst sind wir weit entfernt". (EI 4, 2001)
Vor dem Hintergrund eines nicht durchgängigen barrierefreien öffentlichen Verkehrsnetzes, ist die Mobilität mit dem PKW für gehbehinderte Personen und RollstuhlfahrerInnen besonders wichtig. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 107) Will ein(e) RollstuhlfahrerInnen mit dem PKW mobil sein, bedeutet das meistens eine finanzielle Mehrbelastung, da bestimmte Umbauten oder Adaptionen am Auto vorgenommen werden müssen, um dieses selbstlenkend verwenden zu können. Insbesondere für "E"-RollstuhlfahrerInnen[49] ist (selbstlenkendes) Autofahren mit einem höheren Kostenaufwand verbunden, da einerseits aufgrund der notwendigen Auto-Innenhöhe - es wird mit dem Rollstuhl in den Wagen hinein gefahren und nicht "übergewechselt", wie dies "M"-RollstuhlfahrerInnen[50] tun - nur spezielle, teurere Automodelle in Frage kommen und andererseits sind die notwendigen Adaptionen, damit das Auto selbst gesteuert werden kann, kostenintensiv.
Im Kontext eines Autokaufs bzw. notwendigen Autoumbaus gibt es für Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit diverser Begünstigungen in Form von Darlehen, finanziellen Zuschüssen, der Abgeltung der Normverbrauchsabgabe (NOVA), einer Befreiung von Kfz-Steuer und motorbezogener Versicherungssteuer sowie eine kostenlose Autobahnvignette. An den Erhalt dieser Begünstigungen werden eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft (z.B.: Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Zulassung des PKW auf den Menschen mit Behinderung, ein Ausweis nach § 29b der Straßenverkehrsordnung etc.) auf die hier jedoch nicht im Einzelnen eingegangen werden braucht. (vgl. dazu genauer Svoboda/Pallinger 2006: 114fff)
Laut ÖNORM B 1600 sollen vor allem bei öffentlichen Einrichtungen Behindertenparkplätze eingerichtet werden. Für die Nutzung von Behindertenparkplätzen ("Behindertenzonen") vor Wohnhäusern oder dem Arbeitsplatz sind bestimmte Voraussetzungen (amtsärztliches Attest, Behindertenausweis gemäß § 29b-StVO) nötig, damit diese beansprucht bzw. auf Antrag vom zuständigen Magistratsamt errichtet werden können. Für RollstuhlfahrerInnen, die selbst ihr Fahrzeug lenken, besteht die Möglichkeit der Einschränkung einer Behindertenzone auf ein polizeiliches Kennzeichen, wodurch der Parkplatz dann nur von diesem Auto besetzt werden darf. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 99; MA 46 2006: Online)
Waren zum Befragungszeitpunkt 2001 noch keine Informationen über die genauen Standorte von Behindertenzonen in Wien zugänglich, kann sich mittlerweile der/die Interessierte per Internet (vgl. MA46 2006: Online) darüber in Kenntnis setzen.
Für Taxis gilt prinzipiell Beförderungspflicht und es darf kein Gepäckszuschlag für das Transportieren von Rollstuhl oder Krücken verrechnet werden. (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999: 57) Gehbehinderten Personen, die eine mindestens 50%-ige Erwerbsminderung haben, und über kein eigenes Kraftfahrzeug verfügen, können sich Aufwendungen für Taxifahrten mit einem Betrag von bis zu € 153,-(Stand: 2003) rückerstatten lassen. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 226)
In Wien besteht die Möglichkeit, neben herkömmlichen Taxis so genannte "London-Taxis", die vom Taxiunternehmen "Chvatal" seit Jahresende 2000 in relativ begrenzter Anzahl eingesetzt werden, zu beanspruchen. Der Vorteil dieser großräumigen Taxis ist, dass sie über eine Rampe verfügen und der/die RollstuhlfahrerIn nicht aus dem Rollstuhl wechseln muss, sondern in diesem sitzen bleiben und das Taxi benutzen kann. Eine Taxifahrt mit den "London-Taxis" kostet nicht mehr als eine herkömmliche Fahrt und kann von jeder/jedem, egal ob im Rollstuhl oder nicht, genützt werden.
Im internationalen Vergleich wurden in Österreich verhältnismäßig spät Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung baulicher Barrieren sowie auf dem Gebiet der Zugänglich- und Benutzbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel für mobilitätsbehinderte Personen getroffen. Obwohl die Situation für mobilitätsbehinderte Menschen noch keineswegs befriedigend ist, ist doch in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein ernsthafteres Bemühen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen seitens der in die Entscheidungs- oder Implementierungsprozesse involvierten AkteurInnen (Politik, Behörden, Verkehrsbetriebe, etc.) erkennbar. Die Thematik trat stärker ins öffentliche Bewusstsein und es kam auch punktuell zu gewissen Verbesserungen, sowohl hinsichtlich barrierefrei zugänglicher und benutzbarer Verkehrsmittel als auch bezüglich der barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Zugänglichkeit von (öffentlichen) Gebäuden. Damit wird, zwar verspätet aber doch, der internationalen Entwicklung gefolgt, die klar in Richtung barrierefreies Planen und Bauen und barrierefreien öffentlichen Verkehrsmittel geht. Im selben Atemzug muss allerdings erwähnt werden, dass durchgeführte Verbesserungen oftmals nur punktuell und kaum koordiniert gesetzt wurden/werden.
Von weitgehend barrierefrei benutzbaren öffentlichen Verkehrsmitteln, einem barrierefreien öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum oder einer barrierefreien Zugänglichkeit von (öffentlichen) Gebäuden kann in Österreich jedenfalls - weder zum Erhebungszeitpunkt 2001 noch derzeit - nicht gesprochen werden (vgl. VCÖ 2002, Riess 1999):
-
ExpertInnen beurteilen das erreichte Niveau der Zugänglichkeit zu öffentlichen und privaten Gebäuden als schlecht. (vgl. Riess/Flieger 2000) Noch immer bleiben vielfach Ämter, Schulen, Arbeitsstätten, Öffentliche Dienststellen, Arztpraxen, Ambulatorien, Wahllokale, Geschäfte, usw. für Menschen mit Behinderung unzugänglich. Es gelten in Österreich noch immer Gesetze und Verordnungen, die Stufen am Eingang zu Geschäften und öffentlichen Gebäuden zulassen. (vgl. BIZEPS 1999)
-
"Anpassbarer Wohnungsbau" bzw. die Errichtung barrierefreier Neubauten setzt sich kaum durch, obwohl durch zahlreiche Studien im Rahmen der Wohnbauforschung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten belegt wurde, dass diese Bauweise kaum Mehrkosten verursacht (max. 2 bis 3 % der Baukosten), sofern in der Planungsphase bereits darauf Rücksicht genommen wird. (vgl. Riess/Flieger 2000) Andere Quellen sprechen sogar von nur ca. 1 % höherer Kosten im Vergleich zu konventionellen Neubauten. (vgl. Rainer 2006: 133)
-
In der Freiraumplanung (z.B. Grünflächen, Parks) wird sehr begrenzt auf deren barrierefreie Gestaltung bzw. auf die Bedürfnisse von behinderten Menschen eingegangen. (vgl. Drexel et al. 1991: 122)
-
Es werden zwar verbreitet Gehsteigabsenkungen durchgeführt oder teilweise blindengerechte Zusatzeinrichtungen installiert, jedoch kann nur in Ausnahmefällen von einem barrierefreien Straßenraum die Rede sein. (vgl. Weidert 2000: 136)
Im Hinblick auf die gegebenen Rahmenbedingungen des ÖPNV-Netzes in Wien hinsichtlich barrierefreier Zugänglichkeit und Benutzbarkeit lässt sich summieren, dass zwar vor allem seit Ende der 1990er Jahre gewisse Fortschritte gemacht wurden: Die schrittweise Einführung neuer Systeme, insbesondere bei Bus und Straßenbahn (Klapprampen, Niederflurbusse, -straßenbahnen), und infrastrukturelle Verbesserungen (z.B. Nachrüstung der U-Bahnstationen mit Aufzügen) ermöglicht es z.B. RollstuhlfahrerInnen, zumindest mehr als noch vor einigen Jahren, teilweise die öffentlichen Verkehrsmittel in ihre individuelle Mobilität einzubeziehen. Aber weder zum Zeitpunkt der Erhebung (2001) noch zum jetzigen Zeitpunkt kann von einer für RollstuhlfahrerInnen barrierefrei möglichen Inanspruchnahme des Wiener öffentlichen Verkehrssystems gesprochen werden - zu gering ist die Anzahl der barrierefrei zugänglich und benutzbaren Straßenbahnen und U-Bahnen. Ein Großteil der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien ist faktisch nicht barrierefrei zugänglich und benutzbar. Alleine das Wiener S-Bahn-System, das von der ÖBB betrieben wird, ist aufgrund der nicht barrierefrei zugänglichen Garnituren und der spärlich vorhandenen Lifte in den Stationen für RollstuhlfahrerInnen kaum benutzbar.
Die technische Machbarkeit und Umsetzung barrierefreien Planens und Bauens ist in Österreich schon seit vielen Jahren bekannt und fand bereits Eingang in diverse Vorschriften. Riess (1999) folgert daher zu Recht, "dass es aus diesem Grund nicht mehr darum geht, wie barrierefreies Bauen auszusehen hat, sondern wie es durchzusetzen ist". (17) Bis zum Jahr 2016 müssen jedenfalls, wie es das Behindertengleichstellungsgesetz vorsieht, sämtliche öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäude in Österreich behindertengerecht gestaltet sein. (vgl. Krichmayr 2006)
Erkennbar ist aber, dass gerade in den letzten Jahren doch einige wesentliche gesetzliche Neuerungen in Kraft traten, die hinsichtlich der Rahmenbedingungen einer barrierefreien Mobilität eine wichtige Rolle spielen können. Dabei ist vor allen Dingen das Behindertengleichstellungsgesetz (2006) und die Novellierung der Wiener Bauordnung (2004) zu nennen. Wie sich diese Neuerungen allerdings auf die alltägliche Mobilität, z.B. von RollstuhlfahrerInnen, konkret auswirken kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen. Zum Befragungszeitpunkt der RollstuhlfahrerInnen (2001) gab es diese Regelungen noch nicht.
Weiters ist festzustellen, dass in den diversen gesetzlichen Regelungen nicht definiert wird, was unter "barrierefrei" bzw. "Barrierefreiheit" explizit verstanden werden soll, also welche konkreten Normen bei der Herstellung von Barrierefreiheit beachtet werden müssen. Dieser Umstand ist als problematisch zu bewerten, da aufgrund der damit einhergehenden Auffassungs- oder Auslegungsspielräume die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen beeinträchtigt und "unterlaufen" werden können und die Mobilitätsbedingungen somit für manche Gruppen mobilitätsbehinderter Menschen unbefriedigend bleiben müssen.
Abschließend ist noch anzumerken, dass sowohl bundesweit als auch bezogen auf Wien im Konnex der Schaffung inklusiver Mobilitätsbedingungen für Menschen mit Behinderungen zahlreiche und unterschiedliche (entscheidungstragende) AkteurInnen, Instanzen und Kompetenzebenen tangiert werden bzw. involviert sind. Es gibt keine bundesweite übergreifende Koordinierungs- oder Fachstelle, deren Gründung z.B. schon im "Behindertenkonzept" von 1992 empfohlen wurde.
[39] "Barrierefreies Planen und Bauen" und "behindertengerechtes Planen und Bauen" wird im weiteren synonym verwendet. Grundsätzlich wird von ExpertInnen empfohlen statt von "behindertengerecht", das vorwiegend mit RollstuhlfahrerInnen assoziiert wird, besser von "Barrierefreiheit" zu sprechen, da damit besser zum Ausdruck kommt, dass die Zugänglichkeit von Gebäuden sowie die Benutzbarkeit von Verkehrsmitteln, Geschäften etc. für alle Menschen relevant ist. (vgl. Firlinger/Integration:Österreich 2003: 23)
[40] Bezug genommen wird auf die 2004 wesentlich novellierte Wiener Bauordnung (LGBl. 33/2004, "Behindertennovelle") und das Wiener Garagengesetz, die am 30. Juni 2004 vom Wiener Landtag beschlossen wurden. Zum Erhebungszeitpunkt der Befragung (2001) bestand diese bedeutende Novellierung noch nicht.
[41] Der Wiener Magistratsabteilung MA28 (Straßenverwaltung- und Straßenbau) können bauliche Barrieren, also z.B. fehlende Gehsteigabsenkungen gemeldet werden. (vgl. Labi 2006) Diese Möglichkeit gab es zum Befragungszeitpunkt 2001 noch nicht.
[42] Zum Befragungs- bzw. Erhebungszeitpunkt war noch die ÖNORM B1600, Ausgabe 1997, gängig. Seit 1. 9. 2003 ist eine Neufassung der ÖNORM B1600 in Kraft. Es erfolgten gestalterische und teilweise auch inhaltliche Änderungen der Planungsgrundsätze. (vgl. dazu genauer Rainer 2006: 134fff)
[43] Wenn im weiteren von Öffentlichem Personennahverkehr (Öffentliches Verkehrsnetz, öffentliches Bussystem usw.) die Rede ist, so wird dieser Ausdruck gewissermaßen synonym für das von den "Wiener Linien" betriebene öffentliche Verkehrsnetz verstanden, obwohl es daneben sehr wohl - aber in verhältnismäßig äußerst geringem Umfang und auf bestimmte Verkehrsmittel beschränkt - auch noch andere (private) Verkehrbetreiber in Wien gibt, z.B. "Dr. Richard" oder die "Wiener Lokalbahnen".
[44] Dazu ein interviewter Experte von BIZEPS: "Jetzt, am 1. Mai [2001; Anmerkung T.E.] sind die Beförderungsrichtlinien geändert worden für RollstuhlfahrerInnen. Das war ein neun Jahre langer Kampf, um das zu erreichen." (EI 4, 2001)
[45] "In den Niederflurfahrzeugen der Linie U6 benötigen Fahrgäste im Rollstuhl vorerst weiterhin eine Begleitperson. Hier müssten vor einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde noch bauliche Änderungen (Rückhaltevorrichtung) vorgenommen werden, für die bisher allerdings noch keine befriedigende technische Umsetzung gefunden werden konnte." (Wiener Linien: "Presse-Information" vom 21.3.2001)
[46] Homepage der Wiener Linien: (online) http://www.wienerlinien.at
[47] Kneeling-Funktion bedeutet, dass der Bus seitlich abgesenkt werden kann und sich somit die Einstiegshöhe verringert. Das Kneeling, also Absenken, wird vom Busfahrer bzw. von der Busfahrerin per Knopfdruck getätigt.
[48] Dienstauftrag Nr. 481 mit dem Titel: "Richtlinie für den Gebrauch der Kneeling-Einrichtung, sowie vorläufiger Festlegung der Betätigung der Klapprampe". (Quelle: (online) www.service4u.at/info/BUS.html [30.10.2002])
[49] Das "E" steht für "elektrisch" und bedeutet, die Person verfügt über einen Rollstuhl, der elektrisch angetrieben wird. Die Steuerung erfolgt meist mit einer Art Joy-Stick, der händisch zu bedienen ist; kann aber auch z.B. über den Mund betrieben werden.
[50] Das "M" steht für "mechanisch" und bedeutet, die Person verfügt über einen Rollstuhl, der mechanisch, also händisch, zu bewegen ist.
Inhaltsverzeichnis
Die Entscheidung zur Untersuchung der Mobilitätssituation bzw. des Mobilitätsverhaltens speziell von RollstuhlfahrerInnen in Wien ergab sich aus mehreren Gründen.[51] Einerseits dadurch, dass aus projektbudgetären Gesichtspunkten eine Eingrenzung der Zielgruppe erfolgen musste. Andererseits gab es bis zum Erhebungszeitpunkt (2001) noch keine Untersuchung in Österreich zur Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen. Es wurde dadurch empirisches Grundlagenmaterial geschaffen, das die Problematiken einer spezifischen Gruppe, die in ihrer Mobilität eingeschränkt wird, dokumentiert und nachweist, sowie konkrete Maßnahmen für diese Gruppe aufzeigt. Insbesondere durch die qualitative Erhebung konnte die Situation aus der Sicht der Betroffenen nachgezeichnet werden. Es werden die Barrieren sowie deren Auswirkungen auf die individuelle Mobilität, auf das individuelle Mobilitätsverhalten, sichtbar und nachvollziehbar - was es konkret bedeutet, im Alltag von Mobilitätseinschränkung betroffen zu sein. Und weiters sind RollstuhlfahrerInnen (zu berücksichtigen ist, dass diese keine homogene Gruppe bilden) eine Teilgruppe der mobilitätseingeschränkten Personen, die als "guter Maßstab" für Verbesserungen der Mobilitätsbedingungen dient. Die Anforderungen, die sie an eine barrierefreie Mobilität haben (Stichwort: "Berollbarkeit") können auch für viele andere mobilitätsbehinderte Menschen gelten, da z.B. Stufen oder Gehsteigkanten genauso für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwägen, vorübergehend körperlich beeinträchtigten Personen etc. ein Problem darstellen. Maßnahmen, die sich auf eine "Rollstuhlbenutzbarkeit" bzw. "Berollbarkeit" hin orientieren, kommen also einer großen Anzahl weiterer Mobilitätseingeschränkter zu Gute: älteren Menschen, Personen mit Kinderwägen, Menschen die Waren transportieren, temporär behinderte Menschen etc. (vgl. Resch 1996: 35).
Bei der Darstellung der Befragungsergebnisse wurde bewusst Wert darauf gelegt, die Personen anhand der Zitate "für sich selber sprechen" sprechen zu lassen, ihre "individuelle Sprache" beizubehalten. Damit soll ausgedrückt werden, dass die Befragten - sowohl während des Erhebungsprozesses als auch im Rahmen der Auswertung - nicht als reine "Objekte" wissenschaftlicher Untersuchung verstanden werden, sondern es sollte im "wissenschaftlichen Setting" ihr Subjektstatus erhalten bleiben. Die genaue Beschreibung der methodischen Vorgangsweise und Auswertung erfolgt weiter unten.
In diesem Kapitel geht es darum, die alltägliche Mobilitätssituation von Menschen in Wien zu beleuchten, die für Ihre Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Mit welchen Problemen und Hindernissen werden RollstuhlfahrerInnen auf ihren Wegen zur Arbeit (die meisten der Befragten sind berufstätig), zum Supermarkt, zur Freizeiteinrichtung, etc. konfrontiert? Was bedeuten diese Barrieren konkret für die Betroffenen, deren Mobilitätsverhalten, Handlungsweisen, Alltagsgestaltung usw.? Wie gehen sie mit Problemen um und welche Bedürfnisse bestehen hinsichtlich barrierefreier Mobilitätsbedingungen? Welche Wünsche und Forderungen werden geäußert, um so weit wie möglich selbstständig und selbstbestimmt mobil sein zu können? Welchen Stellenwert, welche Bedeutung und welche Qualität hat überhaupt Mobilität für die Befragten? Unter anderem diese Fragen sollen folglich entlang der sich durch die Analyse ergebenden Barrierefelder (Barrieren bei der Fortbewegung "zu Fuß",[52] bei der Nutzung des motorisierten Individualverkehrs, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, bei der Nutzung von Fahrtendiensten sowie Soziale Barrieren und Informationsbarrieren) beantwortet werden.
Das Erhebungsverfahren
In der empirischen Erhebungsphase erfolgte der Einstieg ins Feld mittels zweier narrativer Interviews im Sinne eines Pre-Tests. Der Interviewverlauf bzw. die Thematiken wurden weitgehend von den Befragten bestimmt. Diese wurden dazu animiert, ihr Wissen und ihre Wahrnehmungen zu benanntem Gegenstand zu vermitteln. Auf Basis der narrativen Interviews, die einen ersten Einblick in die Forschungsthematik ermöglichten, wurden konkretere Fragen(bereiche) zur Thematik zusammengestellt und problemzentrierte Interviews geführt. Das problemzentrierte Leitfadeninterview stellt insofern eine strukturierte Art des qualitativen Interviews dar, als längere Erzählsequenzen generiert werden können, in denen die Einstellungs-, Deutungs- und Handlungsmuster auffindbar sind. Im Allgemeinen wurde das Prinzip der Offenheit hinsichtlich unterwarteter Informationen aufrechterhalten und es konnte je nach Gesprächs- und Interviewsituation modifiziert werden. Methodologisch handelt es sich beim problemzentrierten Leitfaden-Interview um eine Kombination von qualitativer und quantitativer Vorgehensweise. (vgl. Lamnek 1995)
Die Befragung habe ich im Rahmen der Studie "RollstuhlfahrerInnen in Wien" für das Kuratorium für Verkehrssicherheit durchgeführt. Der Leitfaden wurde auf der Basis von wissenschaftlicher Literaturarbeit und unter Einbeziehung der Pre-Tests erstellt. Konkret wurden bei der Durchführung der problemzentrierten Interviews die folgenden Themenbereiche (entlang qualitativer Aspekte von Mobilität wie Bedürfnisse, Barrieren, Bedingungen und Chancen) angesprochen: Verwendung und Benutzung des Rollstuhls, tatsächliche Verkehrsmittelwahl und Mobilitätsverhalten auf Arbeit- und Freizeitwegen, konkrete Bedingungen und subjektive Erfahrungen mit den einzelnen Verkehrs- bzw. Fortbewegungsmitteln, Trainings- und Informationsaspekt im Kontext der Gestaltung der Arbeits- und Freizeitwege, Erfahrungen und Wahrnehmungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Wünsche und Forderungen im Zusammenhang von (selbstständiger) Mobilität.
Aufbereitung und Auswertung
Als Analysemethode diente die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Lamnek 1995: 207ffff), anhand derer eine inhaltliche Strukturierung der Handlungsweisen im Umgang mit der individuellen Mobilität vorgenommen wurde. Als primäre Zielsetzung für meine Aufgabenstellung erschien mir die inhaltliche Strukturierung als geeignet, da sie darauf abzielt, bestimmte Inhalte, Aspekte und Themen aus den Interviews herauszufiltern. Die individuellen Handlungsmuster werden dabei nicht in ihrer spezifischen Ganzheit nachvollzogen, sondern durch analytische Kategorien unter verschiedenen Gesichtspunkten strukturiert.
Die Auswertung wurde computerunterstützt unter Anwendung des Programms WinMAXpro 98 durchgeführt.
Die Transkription der gesprochenen Tonbandaufzeichnungen erfolgte in Annäherung an die Schriftsprache. Dies lässt die ausgewählte Analysemethode zu, welche die manifesten Kommunikationsinhalte interpretierend auswertet.
Die RollstuhlfahrerInnen wurden über das Adressenverzeichnis des Bundessozialamts für Wien, Niederösterreich und das Burgenland brieflich zur Mitarbeit eingeladen. Ein beigelegter Kupon war bei Interesse, unter Angabe unter anderem von Name, Wohnbezirk und Telefonnummer an das Kuratorium für Schutz und Sicherheit zu retournieren; selbstverständlich mit der Zusicherung der vertraulichen Datenbehandlung.
Die Auswahl der InterviewpartnerInnen erfolgte im Sinne eines "theoretical samplings"[53], d.h., es wurde versucht, möglichst unterschiedliche Typen von InterviewpartnerInnen zu finden, um wesentliche Strukturen und Handlungsmuster erfassen zu können. Unter anderem deckte die Auswahl folgende Strukturmerkmale ab: Alter, Geschlecht, jeweilige Wohn- und Arbeitsbezirk in Wien, Berufstätigkeit, Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung, Art des Rollstuhls (der primär für die außerhäusliche Mobilität eingesetzte), Auto vorhanden/nicht vorhanden. Diese Auswahl begründete sich in der Vorannahme, dass diese Kriterien zur Variation von Einstellungen beitragen. Eine gewisse Vorauswahl der Interviewpersonen wurde anhand der schriftlichen Rückmeldung und weiters telefonisch im Vorhinein getroffen. Ein entscheidendes Wahlkriterium stellte die Angabe dar, dass der/die RollstuhlfahrerIn - soweit dies eben die (körperlichen und umweltbezogenen) Umstände zulassen - zumindest teilweise auch selbstständig, also ohne Begleitung bzw. Hilfestellung im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs ist. Befragt wurden im Zeitraum von Februar bis August 2001 insgesamt 20 Frauen und Männer im erwerbsfähigen Alter (zwischen 25 bis 59 Jahren), die zum Zeitpunkt der Erhebung in Wien lebten und entweder "von Geburt an" bzw. von Kind auf oder aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit bei ihrer Fortbewegung primär auf den Rollstuhl angewiesen sind. Die Durchführung der Interviews fand -je nach Wunsch des Rollstuhlfahrers/der Rollstuhlfahrerin -entweder in der eigenen Wohnung oder an einem öffentlichen Ort wie z.B. Kaffeehaus, Gaststätte etc. statt, den ebenso der/die Interviewte bestimmen konnte. Die Dauer eines Interviews betrug zwischen 1,5 und 2,5 Stunden.
Vielfach erst vor dem Hintergrund von selbst erlebter Mobilitätseinschränkung wird sichtbar, welchen enormen Stellenwert Mobilität in unserer Gesellschaft einnimmt, welche Bereiche des täglichen Lebens mit Mobilität in Zusammenhang stehen oder davon tangiert werden, aber auch die Selbstverständlichkeit mit der Mobilität realisiert wird.
Dieses Kapitel bildet die Folie, auf der die Dimensionen reduzierter und eingeschränkter Mobilität(smöglichkeiten) von RollstuhlfahrerInnen in Wien besonders deutlich zutage treten sollen. Stellenwert, Bedeutung und die (subjektive) Qualität von Mobilität sowie Bedürfnisse und Anforderungen im Rahmen der alltäglichen Fortbewegung im öffentlichen (Verkehrs-) Raum der interviewten Personen sollen greifbar werden.
-
Mobilität ist ein (Grund-)Bedürfnis
Mobilität ist für die Interviewten mit dem Bedürfnis verbunden, sich im öffentlichen Raum, wie alle anderen Menschen auch, "normal" fort-bewegen zu können, das heißt ebenso wie nichtbehinderte Menschen z.B. öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, oder den öffentlichen Verkehrsraum ungehindert durchqueren und benutzen zu können.
Fr. L.: "(...), dass man einfach die Möglichkeit hat sie (die öffentlichen Verkehrsmittel, Anmerkung T.E.) zu benutzen und, dass man nicht vor Stiegen steht oder nicht vor Hindernissen steht."
Hr. A.: "Dort (in Australien, Anmerkung T.E.) funktioniert jedes öffentliche Verkehrsmittel (...) alles ist rollstuhlgerecht. Und jede Kneipe ist rollstuhlgerecht. Das heißt, ich brauch nicht mehr überlegen. Ich brauch nicht irgendwo anrufen - seid' ihr rollstuhlgerecht, oder nicht? - sondern dich ruft ein Freund an und sagt, gehen wir dort und dort hin. Und du sagst, ja oder nein; willst ihn sehen oder willst ihn nicht sehen. Das ist das einzige Kriterium."
Mobilität ist weiters mit dem Bedürfnis bzw. dem Wunsch verbunden, ein normales Leben führen zu können und das bedeutet uneingeschränkte Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, sei es auf privater, beruflicher, kultureller oder sozialer Ebene.
Hr. D.: "Mobilität ist sehr wichtig. Einerseits für meinen Beruf auch, dass ich den ausüben kann. (...) Man muss da auch flexibel sein. Oder um zur Arbeit zu kommen generell. Und auch im Freizeitbereich bin ich oft unterwegs und treff' Leute und da ist auch Mobilität sehr wichtig."
Fr. C.: "Tun und lassen, was alle anderen auch können."
Da jene "Ebenen" unter anderem sphärisch-räumlich separiert sind, bedeutet Mobilität für die RollstuhlfahrerInnen Zugänglichkeit zu diesen Räumen zu haben. Wobei der Zugang einerseits mit der Bedingung verknüpft ist, den öffentlichen Verkehrsraum benutzen und durchqueren zu können als auch Zugänglichkeit zu den (öffentlichen) Gebäuden zu haben. Anders formuliert: Die individuelle alltägliche Mobilität umfasst für die Interviewten mehr als "nur" die Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum, sondern ebenso die Zugänglichkeit der (öffentlichen) Gebäude[54] durch welche erst spezifische Bedürfnisse abgedeckt werden können: Berufstätigkeit, Versorgung, Erholung, Freunde treffen, Kommunikation etc. Durch die Interviews wird verdeutlicht, dass die RollstuhlfahrerInnen eine "ganzheitliche" Sicht von Mobilität haben[55], woran sich ablesen lässt, dass die Realisierung von Mobilität Einfluss auf und Bedeutung für sämtliche Lebensbereiche und deren Gestaltungsmöglichkeiten hat.
Mobilität ist allerdings nicht nur ein Bedürfnis, sondern ist in der räumlichen und gesellschaftlichen Realität weiters - wie sich durch die Interviews gezeigt hat - mit bestimmten Anforderungen verknüpft, deren Erfüllung oder Nicht-Erfüllung sehr bestimmend unter anderem für die Qualität der individuellen Mobilität und den Mobilitätsspielraum sein können. Zwei solcher Anforderungen, die sich von erhöhter Brisanz für die RollstuhlfahrerInnen zeigten, sind die Aspekte Information und Orientierung(svermögen).
-
Mobilität bedeutet: Informiert sein
Vor dem Hintergrund eines barrierebehafteten und den verschiedensten Hindernissen geprägten öffentlichen Verkehrs-Raums (vgl. 7.2.2) gewinnen Informationen gerade für die selbstständige Mobilität einen zusätzlich maßgebenden Stellenwert. Ein rasches Auffinden benötigter und verlässlicher Information trägt entsprechend dazu bei, bestehende Mobilitätsnachteile wenigstens abzuschwächen oder zu minimieren. Sie können auch animierend auf das (potentielle) Mobilitätsverhalten einwirken. Den RollstuhlfahrerInnen ermöglicht Information großteils rascher und besser auf die speziellen Anforderungen, die ihnen durch die barrierebehaftete Umwelt erwachsen, reagieren zu können. Leicht zugängliche, gezielte und gebündelte Information stellt insofern nicht nur ein Kriterium, sondern auch ein Bedürfnis dar, um mobil(er) im behindernden öffentlichen Verkehrsraum zu sein.
Informationen bzw. Informationsdefizite wurden primär über zwei Aspekte thematisiert:
a) Hinsichtlich der Benutzungsbedingungen bzw. -möglichkeiten, also Zugänglichkeit, von (öffentlichen) Verkehrsmitteln: Welche Verkehrsmittel können RollstuhlfahrerInnen überhaupt benutzen? Welche Erfordernisse werden an den/die RollstuhlfahrerInnen gestellt, um ein spezifisches Verkehrsmittel benutzen zu können? Welche infrastrukturellen Bedingungen sind vorhanden? etc.
b) Hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten zu (öffentlichen) Gebäuden: Sind Stufen vorhanden? Gibt es eine rollstuhlgerechte Toilette? etc.
Interviewer (Int.)[56]: "Welche Anliegen haben Sie, wie man die Mobilität für RollstuhlfahrerInnen in Wien verbessern könnte?
Fr. G.: "(...) Informationen - Wo komm' ich als Rollstuhlfahrer problemlos hin, wo nicht? (...)"
Hr. A.: "Also, das ist eines der größten Mankos in Wien, dass es so was (gebündelte Information, Anmerkung T.E.) nicht gibt. Ich kenn' das z.B. aus Amsterdam. Da gehst du zur nächsten Touristeninformation, kriegst einen Handicap-Katalog in die Hand, der beinhaltet alle Verkehrsmittel, öffentlichen, die möglich sind, alle Behindertenklos, alle Behindertenparkplätze. (...) Ist es einfach so, dass ich vorher irgendwie versuch eine Information zu kriegen."
Hr. I.: "(...) wo halt im öffentlichen Raum z.B. Behinderten-WCs sind und wo in öffentlichen Gebäuden ein Lift ist, ob da eine Rampe ist."
Fr. Q.: "(...) das wär auch gut so eine Information, wenn die Lifte nicht funktionieren. (...) Ich mein, dass du das vorher weißt. (...) Ob ein Lift funktioniert oder nicht, ist für einen Rollstuhlfahrer wesentlich."
-
Mobilität bedeutet: Orientierungsvermögen
Orientierungsprobleme bei der Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum sind ein hauptsächlich von den von "Geburt" bzw. von Kindheit an auf den Rollstuhl angewiesenen RollstuhlfahrerInnen thematisierter Bereich. Die Ursachen dafür liegen zu einem bedeutenden Anteil an einer von Segregation und Passivität geprägten "Mobilitätssozialisation". Beispielsweise wirkt sich der über Jahre hindurch erfolgte Transport per Sonderfahrtendienst nachteilig auf das Orientierungsvermögen aus. Eine Konsequenz mangelnder Orientierungsfähigkeit ist unter anderem die Verminderung von Erlebnismöglichkeiten und von (Selbst-)Erfahrungsmöglichkeiten über die Bewegung im öffentlich-städtischen Raum.
Fr. Sch.: "Ich hab extreme Orientierungsschwierigkeiten, wenn es darum geht zu wissen, wo fährt welche Bim hin? Wo fährt welche U-Bahn hin? (...) als Kind nicht gelernt hab. Also, das war nicht notwendig. Ich bin mit dem Schulbus gebracht worden. Ich bin mit dem Fahrtendienst gebracht worden oder mit meiner Mutter mit dem Auto (...)"
Int.: "Sie haben das so schön beschrieben, wie auf einmal die Welt "auftaucht", wie Sie mit dem E-Rollstuhl hinausgefahren sind. Da haben Sie gesagt, Sie sind vorher fast nur mit dem Fahrtendienst gefahren. Stichwort Orientierung, wie war das für Sie?"
Fr. O.: "Das war eben das Tollste, die Stadt selber kennenlernen. Und ich bin noch total am lernen. Ich hab eine ganz schlechte Orientierung, weil ich das nie lernen hab müssen."
-
Mobilität bedeutet: Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
Eine besonders wichtiger Aspekte ist die (bzw. das Verlangen nach) selbstständige(r) Bewältigung der alltäglichen Wege das heißt, sich auch ohne (fremde) Hilfe öffentlichen Verkehrsraum aneignen zu können. Angewiesen sein auf Hilfe bedeutet für die Befragten Passivität, Abhängigkeit und wird vorwiegend negativ assoziiert - man möchte ja schließlich nicht "zur Last fallen". Wobei ein ausschlaggebender Punkt hinsichtlich des subjektiven Erlebens auch jener ist, ob Hilfe gewissermaßen durch die äußeren Umstände "erzwungen" wird, obwohl die Person vielleicht durchaus von ihren physischen Fähigkeiten her in der Lage wäre selbstständig zu agieren, beispielsweise alleine in die Arbeit fahren könnte und nicht nur mit einer Begleitperson. Es wird grundsätzlich von den Interviewten danach getrachtet, soviel und soweit wie möglich selbstständig sein zu können und dadurch eine Qualität der Unabhängigkeit zu erlangen. Selbstständige, unbegleitete Mobilität ist ein zentraler Indikator für das subjektive Wohlbefinden und ist für die RollstuhlfahrerInnen ein angestrebtes Ziel. Die selbstständige Mobilität steht für Freiheit und beeinflusst positiv das Selbstwertgefühl.
Fr. G.: "(...) das ist ja auch schrecklich irgendwo. Man ist immer angewiesen. (...) Ich möchte nicht angewiesen sein. (...) möchte niemandem zur Last fallen. Ich möchte ziemlich alles alleine machen."
Hr. F.: "Versorgungswege zum Supermarkt möchte ich selbstständig machen. (...) ich möchte nicht immer bitten müssen."
Hr. B.: "(...) Mobilität bedeutet für mich ein enormes Stück Freiheit. Ich bin einfach ungebunden. Im weitesten Sinne gesehen auf niemanden anderen, außer mich selbst angewiesen. Hebt und steigert und fördert natürlich irrsinnig das Selbstbewusstsein."
Int.: "Was wäre Ihre Wunschvorstellung, wie Ihre Mobilität ausschauen sollte?"
Fr. Q.: "Dass ich locker überall einsteigen könnte. Dass ich mir so wie früher eine Wochenkarte kaufen könnte und die auch ausnutz'. Dass ich da quer durch Wien fahr' und das eigenständig."
Fr. H.: "Und ich wähl aber jetzt schon lieber das Mittel mit dem Rollstuhl bis zur U3-Station zu fahren, weil ich da halt wirklich selbstständig bin. Weil ich beim Einsteigen in den Bus wirklich immer Hilfe braucht, weil das nie hinhaut."
-
Mobilität bedeutet: Flexibilität und Spontanität
Flexibel und spontan auf bestimmte Erfordernisse im Alltag oder in bestimmten Situationen reagieren zu können, ist nicht nur ein qualitativer Aspekt im alltäglichen Leben, sondern wird etwa im beruflichen Bereich auch vorausgesetzt und erwartet. Ebenso ist Spontanität gerade im sozialen Bereich ein entscheidender Faktor von Lebensqualität. Nicht alles genau überlegen, planen, kalkulieren und im Voraus organisieren müssen (z.B. sich mit Freunden "auf an schnön Kaffee treffen können") ist ein Charakteristikum selbstbestimmter Mobilität. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die körperlichen Fähigkeiten dem persönlichen Empfinden nach Flexibilität und Spontanität eher abträglich sein kann, gewinnt die Möglichkeit spontan und flexibel im öffentlichen Verkehrsraum zu agieren an zusätzlichem Stellenwert für die Befragten. Flexibel und spontan zu sein setzt jedoch ein Maß an potentiellen und auch ausschöpfbaren Wahlmöglichkeiten, etwa hinsichtlich benutzbarer Verkehrsmittel oder Wege-Routen, voraus.
Hr. F.: "Man geht immer automatisch denselben Weg, weil man das genau schon immer abgezirkelt hat wie viel Energie und wie viel Zentimeter oder welchen Energieaufwand oder welchen Winkel ich brauche. Und sei es, wenn der Gehsteig hängt - Wenn ich das Kopfsteinpflaster vermeiden will (...)"
(...) "Spontanität ist da, aber die wird eigentlich immer zugunsten einer rigiden Planung zurückgesteckt."
Int.: "Also, diese Vorplanung im Kopf?"
Hr. F.: "Richtig. Ist auch so automatisiert. Das ist auch eine Selbstbeobachtung, die ich gemacht habe. Aufgrund dieser Mühseligkeit oder Einschränkung einfach die Spontanität abnimmt."
Fr. O.: "Wenn jemand sagt, machen wir das jetzt, dann bin ich einfach irritiert, weil ich bin gewohnt: machen wir's morgen? Also (...) ich bin schon so konditioniert, spontane Reaktionen sind von mir schwer zu kriegen vor allem wenn sie Ortswechsel bedeuten. (...) (Fr. O. bezieht sich im Folgenden konkret auf den Sonderfahrtendienst, Anmerkung T.E.) was eine Einschränkung ist, dass man nicht spontan kommen und gehen kann. Bei Festln muss ich mir wirklich überlegen, mag ich da wirklich hin (...) Weil, ich muss bleiben."
Int.: "(...) inwiefern haben Sie auch Spontanität?"
Hr. D.: Man muss sicher mehr planen. (...) wie komm ich rein? Wo kann man parken? Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel? Gibt's da einen Lift?"
-
Mobilität bedeutet: Entscheidungs- und Wahl-freiheit
Mobilität heißt für die RollstuhlfahrerInnen Entscheidungs- und Wahlfreiheit zu haben hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl, der Wege- bzw. Routenwahl, aber auch selber entscheiden zu können, ob und in welchem Ausmaß z.B. für einen bestimmten Weg Begleitung benötigt wird oder nicht.
Fr. C.: "Jeder Rollstuhlfahrer sollte die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob er heute mit dem Auto fährt oder lieber mit den Öffentlichen. Jeder andere hat's ja auch, warum soll ich sie nicht haben?"
Wo (Wahl des Zielortes) will ich hin? Wie (mit welchen Verkehrs- oder Fortbewegungsmitteln, alleine oder in Begleitung) und auf welchen Wegen (auf "dem schnellsten" oder auch auf selbstgewählten "Bummel-Wegen") will ich dorthin kommen? Unter anderen werden diese Fragen schon im Ansatz erstickt, da häufig nicht die Entscheidungs- und Wahlfreiheit diesbezüglich gegeben ist. Diese Freiheiten sind verquickt damit, selbstbestimmt und aktiv, SchöpferIn und EntscheidungsträgerIn seiner/ihrer (potentiellen) Erfahrungen zu sein. Aus Alternativen wählen zu können, bedeutet und gewährleistet ein Mehr an Bewegungs-, Verhaltens- und Handlungsspielraum.
Fr. J.: "(...) hab eine extrem gute U-Bahnanbindung gehabt mit Liften in der U-Bahn-Station. Also, das hab ich dann auch sehr genossen, wirklich das Auto stehen lassen zu können, nirgendwo Parkplatz suchen zu müssen und einfach mit der U-Bahn zu fahren."
Anschließend geht es einerseits darum, die Erfahrungen, die RollstuhlfahrerInnen während ihrer Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum in Wien machen, zu verdeutlichen. Es werden dadurch die unterschiedlichen und ebenso vielfältigen Barrieren und Problemfelder aufgezeigt werden, mit denen die Befragten in ihrer alltäglichen Mobilität, also bei ihren Arbeits-, Freizeit- oder Versorgungswegen primär konfrontiert sind. Und schließlich wird sichtbar, welche Auswirkungen die Barrieren auf die Mobilität/das Mobilitätsverhalten der Interviewten haben.
7.2.2.1 Barrieren bei der Fortbewegung "zu Fuß"
Der Rollstuhl stellt die Grundbedingung für stark gehbehinderte Menschen dar, um überhaupt mobil sein zu können. Er ist gewissermaßen die Basis um bestimmte Entfernungen und Wege (selbstständig) zurücklegen zu können ohne getragen oder gestützt werden zu müssen.
Fr. C.: "Der Rollstuhl sind meine Füße."
Steht einem der Rollstuhl - beispielsweise weil in Reparatur - nicht zur Verfügung und ist auch kein adäquater Ersatzrollstuhl vorhanden, bedeutet dies absolute Immobilität bzw. Abhängigkeit. Mit den Worten eines Interviewten ausgedrückt:
Hr. B.: "Dann bin ich wie eine Schildkröte am Rücken, sag' ich immer, weil dann bin ich aufgeschmissen. Weil, dann brauch' ich wen, der mich überall hinbringt, von A nach B."
Ebenso nimmt die Art (M- oder E-Rollstuhl) und Konstruktion des Rollstuhls einen wichtigen Stellenwert ein, sowohl Vor- oder Nachteile im "Handling" mancher Barrieren betreffend als auch hinsichtlich der Qualität bei der Fortbewegung "zu Fuß".[57]
Für die alltägliche Mobilität ist die Bewegungsmöglichkeit mit dem Rollstuhl im öffentlichen Verkehrsraum ein wesentlicher Aspekt. Alleine aufgrund der Tatsache, dass im Allgemeinen das nähere Wohnumfeld den Raum darstellt, wo die häufigsten Wege zurückgelegt werden, sei es zum Einkaufen, zur Freizeitgestaltung oder, wenn es sich einfach nur um einen Spaziergang handelt. Denn von Mobilitätsbehinderten werden ca. 45 % aller Ortsveränderungen zu Fuß bzw. im Rollstuhl wahrgenommen. (vgl. Weidert 2000: 23) Aber auch bezüglich der Bewältigung von so genannten "Wegeketten" spielt das Vermögen sich alleine per Rollstuhl fortzubewegen eine Rolle.[58]
Die interviewten Personen wurden befragt, mit welchen Hindernissen oder Schwierigkeiten sie auf ihren Wegen konfrontiert werden, wenn sie sich im öffentlichen Verkehrs- bzw. Straßenraum ausschließlich per Rollstuhl bewegen und was als problematisch oder störend wahrgenommen wird. Im Blickpunkt des Frageinteresses stand primär der Gesichtspunkt von Erfahrungen bei der Fortbewegung und nicht - außer es ergab sich im Gespräch von selbst - beim Aufenthalt (z.B. Rasten, Park, Spielplätze) im öffentlichen Straßenraum.
Basierend auf der Erhebung kristallisierten sich drei Problemfelder heraus, die bei der Zurücklegung von Wegen per Rollstuhl relevant sind:[59]
1. Bauliche Barrieren im öffentlichen Raum
Die nicht abgeschrägte Gehsteigkante ist - trotz einer von den Interviewten wahrgenommenen Verbesserung der Situation in den letzten Jahren - ein zentraler Barrierebereich bei der Fortbewegung "zu Fuß". RollstuhlfahrerInnen ist es nicht möglich, spontan an einer x-beliebigen Stelle die Straße bzw. Fahrbahn zu queren; umso erforderlicher wären zumindest abgeschrägte Randsteine am Gehsteigende respektive -anfang.
Für die meisten "E"-RollstuhlfahrerInnen bedeutet eine nicht abgeflachte Gehsteigkante[60] ein unüberwindbares Hindernis oder zumindest die Gefahr, beim Überwinden-Wollen nach vorne aus dem Rollstuhl zu kippen. So sind manche "M"-RollstuhlfahrerInnen zwar in der Lage, höhere Gehsteigkanten zu überwinden, jedoch ist dies mit dem Risiko verbunden, dass der/die Betroffene eventuell nach hinten kippt. Oder das Auf- bzw. Abfahren ist nur mit erhöhter körperlicher Anstrengung zu bewerkstelligen.
(Hr. S., E-Rollstuhlfahrer, bezugnehmend auf das Überwinden eines abgeflachten (max. 3cm) Gehsteigs, Anmerkung T.E.):
Hr. S.: "Wobei man da mit Schwung fahren muss und da gibt's einen ziemlichen Rucker. Und, ich weiß nicht, manche würde es wahrscheinlich hinauswerfen. Optimal ist es nicht."
(Fr. C., M-Rollstuhlfahrerin, bezugnehmend auf das Überwinden eines nicht abgeflachten Gehsteigs, Anmerkung T.E.):
Fr. C.: "Ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs gewesen und hab einen Randstein runter gekippt. Da hat's aber geregnet. Und da bin ich halt durchgerutscht mit den Reifen und bin wirklich geflogen; mit Minirock und schwarzen Strümpfen, die haben natürlich super ausgeschaut."
Eine nicht abgeflachte Gehsteigkante heißt für die Befragten einen Umweg fahren müssen. Sei es, weil erst gar nicht auf den Gehsteig aufgefahren werden kann oder zwar die Auffahrt möglich ist, jedoch die Abfahrt nicht mehr und somit wieder retour gefahren werden muss. Der Gehsteig entpuppt sich sozusagen als Sackgasse.
Hr. S.: "(...) ist auch der Fall, dass öfter eine Gehsteigkante zu hoch ist. Dann muss ich entweder die nächste Hauseinfahrt auf den Gehsteig rauf verwenden oder ein Stück auf der Straße fahren bis es wieder einen abgeschrägten gibt. Das ist natürlich in Gebieten wo ich nie bin, wo ich mich halt ausnahmsweise beweg dann schlecht, weil da weiß ich nicht, ist jetzt die nächste Hausecke abgeschrägt? Dann muss ich oft wieder zurückfahren bis ich eine Abschrägung oder eine Hausausfahrt erwisch und runter komm. Was dann ganz lästig sein kann, weil man immer nur hin und her fährt."
Int.: "Sie haben einen Umweg."
Hr. S.: "Ja, ich muss dann zurück, oder ich muss einmal eine Runde ums Haus fahren bis ich seh, wo ist die nächste Kante."
Einen Umweg fahren impliziert, dass die RollstuhlfahrerInnen, wollen sie ihren Weg fortsetzen, auf die Fahrbahn ausweichen müssen, um sich die nächste benutzbare Gehsteigauffahrt zu suchen. Die Gefährlichkeit dessen ist evident und wird von den Interviewten auch thematisiert. Gleichzeitig werden die verschiedensten Verhaltensstrategien zur Minimierung dieses Risikos angewandt.[61]
Ärger, Stress, sich Unwohl fühlen oder Angst sind Emotionen, die die Interviewten begleiten, wenn sie sich auf die Fahrbahn wagen müssen.
Hr. S.: "Ich fühl mich eigentlich nicht wohl. Manchmal erfordert es die Situation, dass ich auf der Straße fahr, wenn kein abgeschrägter Gehsteig ist, dann muss man sich eh auf die Straße wagen, aber sehr zu empfehlen ist das eigentlich nicht."
Hr. A.: "(...) ich muss dann hinunter auf die Straße und ich weiß, ich bin schwer sehbar, ja, ich bin kleiner, nicht unbedingt immer hell angezogen, d.h. gerade Dämmerung oder auf d'Nacht kann's blöd sein. Und meistens ist es ja dann auf d'Nacht wenn du "umadum" bist, dass die Ecken verparkt sind oder ein Gehsteig verparkt ist, und so was kann dann blöd sein. (...)
dann den Umweg über die Straße zu machen und dann wieder hinauf und so - ist letztendlich nicht ganz ungefährlich, aber das ist, ja, mir ist noch nie diesbezüglich was passiert jetzt oder irgendwas, nur es nervt doch gewaltig."
Neben den nicht abgeschrägten Randsteinen wurden bezüglich baulicher Barrieren im Straßenraum zu schmal konstruierte Gehsteige, Kopfsteinpflaster, Spurrinnen, Straßenunebenheiten, usw. als Schwierigkeiten benannt, die das Fortbewegen "zu Fuß" erschweren. Insbesondere Stufen stellen das Hauptproblem dar. Stufen erschweren oder verunmöglichen nicht nur die Fortbewegung, sondern sie sind ebenso eine Hürde beim Zugang zu Gebäuden. Die RollstuhlfahrerInnen berichten davon, dass ihnen durch Stufen und fehlende Rampen leider noch immer der Zugang zu vielen Geschäften, Lokalen, Amtsgebäuden, Wohnhäusern (sowohl "Alt-" als auch teilweise Neubauten!) oder auch zu infrastrukturelle Einrichtungen im öffentlichen Straßenraum (Geld- oder sonstigen Automaten, WC etc.) verwehrt bleibt oder dieser zumindest erschwert wird.
Hr. A.: "(...) in derselben Gasse wo ich arbeit' ist ein "Billa", den ich nicht benutzen kann. Der hat zwar eine Rampe, aber die Rampe ist unfahrbar. (...) schaffen aber nicht einmal Mütter mit dem Kinderwagen den Kinderwagen raufzuschieben (...)"
Hr. F.: "Klassisches Beispiel, eine Wahl. Das weiß ich, dass ich dort wo ich den Wahlsprengel hab, dass ich dort nicht hinein komm."
Fr. E.: "Nein. Auf der Praterstraße z.B. waren wir unlängst mit Kollegen zu Mittag auch unterwegs: Bankomat nicht erreichbar, da hat mir jemand das machen müssen. Dann war ein "Zielpunkt" mit zwei hohen Stufen, eine Bäckerei mit hohen Stufen, eine Trafik, also es war ein einziges Geschäft - das war der Spar - wo's rein gegangen wäre."
Fr. C.: "Also, 50 % der Geschäfte kann ich nicht frequentieren, weil überall Stufen hinein sind. Manchmal total enge Türen wo ich einfach nicht rein komm. Deshalb geh ich am liebsten in ein Einkaufszentrum. Das ist eigentlich der Grund. Nicht deswegen, weil ich so bequem bin, sondern da hab ich halt keine Stufen wo ich irgendjemanden brauch der mir rein hilft."
2. "Fixe" Einrichtungen oder vorübergehend platzierte Objekte im öffentlichen Raum
Häufig auftretende Hindernisse, die sich RollstuhlfahrerInnen "in den Weg stellen" bzw. die ihnen in den Weg gestellt werden und mit denen sie zu kämpfen haben sind fix angebrachte, infrastrukturelle Einrichtungen im Straßenraum wie:
-
Straßenbahnschienen
Hr. N.: "(...) Oder mit den Schienen, dass man mit den kleinen Rädern hängen bleibt."
-
Verkehrsschilder, Pfosten, Mistkübel etc.
Fr. Q.: "Warum wird genau z.B. bei den Abschrägungen ein Laternenmast hingestellt. (...) Du musst mit dem Rollstuhl (...) genau 90 Grad anfahren, sonst kippt er. Es ist genau der Mast wo der Papierkorb drauf hängt oder der Mast wo steht, ‚Halten und Parken verboten'. Den können sie doch woanders auch machen. Das wir doch wurscht sein. (...)"
Hr. R.: "Was überhaupt jetzt Mode ist in Wien, dass man bei den abgeschrägten Gehsteigen genau in der Mitte am Gehsteig Eisenpfosten hinstellt."
Oder "vorübergehend" platzierte Objekte wie z.B.:
-
(Wahl)plakatständer
Hr. R.: "Auch die Wahlplakate sind ein Horror für Rollstuhlfahrer. Die stellen sie genau dorthin wo die Abfahrten sind."
-
Baustellen, aufgerissenes Trottoire
Hr. S.: "(...) Baustellen (...), wenn die einfach zu spät angekündigt sind. Dass man am Gehsteig runter muss und dann steh ich vor der Baustelle. Man kann sich gar nicht mehr g'scheit umdrehen, weil der Gehsteig nicht breit ist und dann muss man aber zurück oder links ausweichen auf die Straße. Das ist aber meistens sehr "lustig", weil eine Stufe runter ist. Also wenn man solche Ausweichsachen macht. dann sollte man die auch abschrägen damit die nicht nur ein Fußgänger benutzen kann. Weil ich muss zurückfahren, ich kann nicht hinunterhüpfen. Also das sind schon lästige Hindernisse."
Ebenfalls wurden die städtischen Freiräume wie Spielplätze, Parks oder auch teilweise unbenutzbare "Elemente" des (halb-)öffentlichen Raums wie WCs, Geldautomaten, unbenutzbare Rampen, etc. als nicht rollstuhlfreundlich beklagt.
Int.: "(...) Kiesel. Ich glaub, das ist ja auch nicht gerade angenehm?"
Fr. J.: "Das ist nicht angenehm, oder auch so dieser Rindenmulch. Also, meine Schwester hat zwei Kinder, mit denen geh ich natürlich schon auch am Spielplatz, aber wenn die Anna schaukeln will, ich hab keine Chance, dass ich durch den Rindenmulch irgendwie zur Schaukel komm um sie anzuschupfen."
Fr. C.: "Bankomaten-Horror! Weil, die sind prinzipiell so weit oben, dass man gar nicht das Display sieht. Da gibt's ganz ganz wenige. Das ist wirklich schlimm."
Hr. I.: "Bei Rampen ist es meistens so, dass sie gut gemeint sind, aber manchmal für Behinderte nicht zu benutzen sind, weil sie zu kurz und zu steil sind, oder sie enden knapp vor einer Mauer wo auch kein Abstand ist zwischen Rampe und Mauer."
3. Barrieren basierend auf dem Verhalten anderer VerkehrsteilnehmerInnen
Zeitlich meist begrenzte, nichtsdestotrotz für die alltägliche Mobilität relevante Hindernisse sind auch jene, die durch andere VerkehrsteilnehmerInnen verursacht werden: Häufig genannt werden in diesem Kontext parkende Autos vor (abgeschrägten) Gehsteigkanten, Autos bzw. LKWs bei Ladetätigkeiten oder abgestellte Fahrräder, die den RollstuhlfahrerInnen den Weg versperren.
Hr. B.: "Wo ich mich auch sehr darüber ärgere ist, wenn Autos stehen, parkend, bei Abschrägungen. Also, ich fahr den Gehsteig der abgeschrägt ist und genau dort wo die Abschrägung ist (...) steht das Auto und der parkt dort. Da ärgere ich mich dann schon."
Im Kontext der Fortbewegung per Rollstuhl im öffentlichen Raum werden von den Interviewten signifikant häufig gefährliche Situationen oder Unfälle erwähnt. Die Unfälle reichen vom Hinausfallen aus dem Rollstuhl beim Überwinden einer zu hohen Gehsteigkante oder einer Straßenbahnschiene, über Zusammenstöße mit FußgängerInnen bis hin zur Kollision mit einem PKW beim Versuch, eine Kreuzung zu queren. Neben den diversen baulichen Barrieren, die einem Unfall oder einem gefährlichen Moment zu Grunde liegen, im wahrsten Sinn des Wortes vielfach die "Steine des Anstoßes" sind, kommen noch zusätzliche verkehrssicherheitsspezifische Faktoren zum Tragen. Zum Beispiel die geringe Höhe von RollstuhlfahrerInnen und dadurch ihre geringere Sichtbarkeit.
Fr. H.: "(...) und zwischen diesen Schienen ist Kopfsteinpflaster. (...)Ich bin hängen geblieben drinnen und auf einmal auf der Straße gelegen, weil ich da einfach mit einem kleinen Radel auf der Schiene irgendwie hängen geblieben bin."
Fr. O.: "Z.B. bin ich einmal, das war ein Zebrastreifen und da war ein Auto das ein bisserl weiter vor gefahren ist und ich fahr drüber und er fährt zurück und er hat mich erwischt. Der ist zu weit auf den Zebrastreifen gefahren und ich hab mir gedacht, na ja, kann man nichts machen. Und ich fang an drüber zu fahren und er denkt sich, denk ich mir, scheiße, ich bin am Zebrastreifen, fährt zurück, hat mich nicht gesehen, einfach von der Höhe - ganz langsam Gott sei Dank. Und seine Stoßstange ist in meinen Rädern hängen geblieben und nur weil mein Rollstuhl so schwer war, ist er nicht umgefallen."
Fr. Q.: "Ich bin auf dem Gehsteig gefahren, da auf der Erdbergerstraße heroben, und aus der Garage beim Supermarkt schießt ein Autofahrer heraus und das war's. Und mein E-Rolli war Geschichte."
Hr. B.: "(...)draußen beim Spitz wo sich Hütteldorfer Straße, Linzer Straße treffen, ja, bin ich hereingefahren mit dem E-Rollstuhl und (...) fahr am Gehsteig, und wollte nur die Straße queren und (...) schau ich zuerst links, rechts (...) seh', kommt nix, fahr; bin genau in der Mitte von der Straße, ziemlich genau, auf einmal kommt von links ein Autofahrer, einfach zu schnell dran. Und legt noch eine Vollbremsung hin und erwischt mich aber noch, dass ich komplett umgefallen bin mit dem Rollstuhl."
7.2.2.2 Barrieren bei der Nutzung motorisierter Individualverkehrsmittel
Auto
Die Befragung ergab, dass das Auto[62] zu dem am öftesten verwendeten Verkehrsmittel und wohl das beliebteste Verkehrsmittel ist. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der durch das Auto gewährleisteten (zeitlich und räumlichen) Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bei der Mobilität.[63] Das Auto bedeutet - im Gegensatz zur Fortbewegung mit manchen anderen Verkehrsmitteln - ein hohes Maß an Autonomie, sowohl betreffend der Benutzung an sich[64] als auch hinsichtlich der damit verbundenen Bewegungsfreiheit. Ziele können mit dem Auto zeitlich kalkulierbarer, direkter und spontaner angesteuert werden, ohne Gefahr zu laufen, dass bauliche oder andere Hindernisse den Weg versperren. Die PKW-Nutzung reduziert Risiken und Probleme, die die barrierebehaftete Verkehrsumwelt für RollstuhlfahrerInnen in sich birgt.
Int.: "Was ist da die Motivation, dass Sie den Führerschein machen wollen?"
Fr. I.: "Weil ich es mir selber einteilen kann, wann ich weg fahr. Und dann weiß ich dann ganz sicher, z.B. zu einem wichtigen Termin pünktlich kommen kann, was mir beim Fahrtendienst als Problem erscheint."
Hr. P.: "Es ist absolut Nummer Eins, weil die ‚Öffentlichen' sind nur bedingt allein benutzbar."
Fr. L.: "Für mich ist das Auto wirklich, dass ich auch sagen kann, wenn so ein schönes Wetter ist wie heute, dass ich einfach sag, ich fahr raus. Das hat für mich nichts damit zu tun, ob jetzt eine U-Bahnstation in der Nähe ist, oder nicht. (...) Das Auto bedeutet für mich Spontanität. (...) Es ist arg, dass ich so viel mit dem Auto mach, aber es ist um so vieles einfacher. (...) es ist halt ein direkteres Ansteuern der Ziele"
Fr. J.: "Ich bin mit dem Fahrtendienst hingebracht (zur Schule, Anmerkung T.E.) worden. Ich bin vom Fahrtendienst heimgebracht worden. Also, irgendwelche Spontanaktionen, von wegen: ‚nach der Schule gehen wir auf ein Bier', waren nicht drinnen. Das hat sich dann mit dem Auto endlich geändert. (...) es war endlich Unabhängigkeit. Es hat mir meine eigene Mobilität ermöglicht."
Als der Problemfaktor bei der Autonutzung ist das Thema Parkplatz zu nennen. Zwei Aspekte können konkretisiert werden: Zum einen wird von den Betroffenen generell ein Mangel an Behindertenparkplätzen[65] in Wien konstatiert und zum anderen wird eine "soziale Problem-Dimension" beim Thema "Behindertenzonen" evident: Ausnahmslos alle (Auto fahrenden) Interviewten berichten davon, dass es immer wieder passiert, dass die Behindertenzone von einem Unbefugten besetzt wird und es in diesem Zusammenhang manchmal zu Konflikten und Auseinandersetzungen kommt.[66] Gerade für einen in der körperlichen Bewegung eingeschränkten Menschen ist es besonders wichtig, dass die Distanz zwischen Wohnung/Arbeitsstätte und Parkplatz so gering wie möglich und so zugänglich wie möglich ist, da eine größere Entfernung eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Barrieren zu treffen sowie erhöhte körperliche Anstrengung, Zeit- und Nervenaufwand bedeutet. So wird z.B. ein paar Runden um den "Block" gefahren, in der Hoffnung, dass der Parkplatz dann wieder frei ist oder es wird, wenn sich das Problem nicht anders lösen lässt, der Schritt zum Abschleppen des Fahrzeugs und/oder einer Anzeige unternommen. Letzteres ist für die RollstuhlfahrerInnen jedoch mit Zeitaufwand verbunden und manchmal noch mit gewissen anderen "Risiken". (vgl. 7.2.2.5)
Fr. C.: "Weil nämlich wirklich viele Leute sich trauen ganz selbstverständlich als Geher auf einen Behindertenparkplatz stellen und gar nicht daran denken, dass wir wirklich darauf angewiesen sind. Weil, wenn ich ins Auto einsteig, dann muss ich meine Tür total aufmachen, sonst komm ich nicht hinein. Jetzt klemmt mich dann irgendeiner ein- Also, ich brauch den Behindertenparkplatz, weil der soll ja breiter sein als die anderen. Und das ist eigentlich das einzige (...) wo ich wirklich sag, also das ist ein Handicap."
Fr. H.: "Und es gibt in Wien viel zuwenig Behindertenparkplätze. Das heißt, man kreist da herum. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Ich hab in den letzten paar Jahren, ich hab mir's nie ausgerechnet wie viel Parkstrafen ich krieg, weil ich keinen regulären Parkplatz krieg. Obwohl ich im Parkverbot oder in Kurzparkzone darf ich parken solange ich will. Es sind aber trotzdem keine Parkplätze zu kriegen. Das heißt, ich pick irgendwo an einer Ecke oder steh im Halteverbot und krieg dann natürlich auch die Strafen."
Fr. Q.: "Letztens war der Parkplatz nicht frei. Da war um die Ecke einer frei in der Kurzparkzone. Wir haben das Auto voll gehabt mit Sachen. Da hab ich den mechanischen Rollstuhl geschnappt und Sackerl für Sackerl zwei Häuser weiter heimgebracht."
Fr. L.: "Also, einer hat sich einmal hineingestellt und da bin ich eine halbe Stunde herumgefahren, weil ich mir gedacht hab, der ist sicher im Lokal, im (Name des Lokals wird genannt, Anmerkung T.E.), und kommt vielleicht eh gleich raus. Und dann bin ich aber doch zur Polizei gefahren und hab gesagt, da steht wer in meinem Parkplatz."
Taxi
Das Taxi wird primär als "Alternative" zu anderen Verkehrsmitteln genützt, etwa weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht oder nur schwer benutzbar sind, weil es spontaner zu benutzen ist als der Fahrtendienst oder, weil das Auto in Reparatur ist. Alternative wurde deshalb unter Anführungszeichen gesetzt, da - aus Kostengründen - das Taxi nicht wirklich ein Verkehrsmittel ist, das für die alltägliche Wegplanung einsetzbar ist.
Hr. I.: "Ich nehm' ein Taxi, denk ich, wenn ich's relativ kurzfristig brauche, weil ich da eben gleich direkt anrufen kann. Und, ja, das ist eher so der zeitliche Aspekt. Ich weiß halt, dass es sehr teuer ist, aber ich nehm's dann, wenn ich z.B. ganz schnell irgendwo sein muss."
"E"-RollstuhlfahrerInnen benutzen im Vergleich zu "M"-RollstuhlfahrerInnen das Taxi fast gar nicht da es für sie mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist. Dies liegt an der größeren Sperrigkeit des E-Rollstuhls und daran, dass man ihn (normalerweise) nicht zusammenklappen kann. Deshalb werden von den "E"-RollstuhlfahrerInnen die so genannten "London-Taxis" besonders goutiert.
Fr. L.: "(...) weil mehr Raum ist und sie haben eine Rampe. Das ist sehr praktisch. (...)Ich mein, man fährt halt einfach mit dem Rolli hinein und fährt wieder mit dem Rolli raus. Die Rampe oder so, das ist, glaube ich, auch für den Taxifahrer nicht unpraktisch."
"M"-RollstuhlfahrerInnen erzählen davon, dass sie entweder ein ganz gewöhnliches Taxi benutzen, wenn der Rollstuhl zusammenklappbar ist, oder bei der Taxibestellung einen Kombi-PKW anfordern, um ihn unterzubringen. Bei der Taxi-Nutzung treten kaum Schwierigkeiten auf. Teilweise benötigte Hilfestellung wird von den LenkerInnen großteils unproblematisch geleistet.
Int.: "Und von der Benutzung?"
Hr. N.: "Nein, da gibt's nichts. Da hat noch ein jeder geholfen. Die Taxler sind eh super. Aber das ist ja sein Geld. Ich bin ein zahlender Kunde wie jeder andere."
7.2.2.3 Barrieren bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel [67]
Bus
Der Bus wird von den Befragten nicht besonders gerne in Anspruch genommen, obwohl dieses Verkehrsmittel theoretisch - die Rede ist von einem Bus in Niederflurbauweise mit Kneeling-Funktion und ausklappbarer Rampe -, für RollstuhlfahrerInnen benutzbar wäre. Die Benutzung wird jedoch oftmals als mühsam, unangenehm, stressig - als "Kampf" erlebt, worauf sich die Rollstuhl fahrenden KundInnen "seelisch vorbereiten" müssen.
Fr. O.: "Ich fahr nie spontan mit dem 13A. Ich muss mich immer seelisch vorbereiten: Heute benutz ich den 13 A. -Ich hab in einer WG gewohnt. Da war ich immer schon so angespannt und alle: "Was ist denn, fährst du wieder mit dem 13A?" (...) Aber wenn ich ihn benutz, dann bin ich stolz. Super, geschafft (...). Der (gemeint ist der/die BusfahrerIn, Anmerkung T.E.) ist natürlich angfressn, dass ich mit dem Rollstuhl komm und er muss die Rampe mit der Hand ausklappen.(...) Er lässt sie auch entsprechend laut runter fallen, weil man sozusagen gewagt hat das zu benutzen.(...) Wenn jemand im Rollstuhl kommt, das dauert lange, weil die Leute wissen oft nicht, das es eine Rampe gibt; die stehen auf der Rampe. Dann muss man sagen, bitte gehen Sie auf die Seite, weil die Rampe kann man ja nur aufklappen wenn niemand drauf steht. Es gibt irrsinnig viel Aufregung. Alle sind ganz aufgeregt wenn man kommt. Für mich ist das manchmal so anstrengend, dass ich mir denk, nein, ich fahr lieber mit dem Rollstuhl bevor ich den 13A benutz."
Die Ursachen der Benutzungsproblematik liegen primär bei zwei Faktoren:
Erstens handelt es sich dabei um infrastrukturelle Komponenten: (noch) nicht alle Buslinien sind durchgehend mit Niederflurfahrzeugen bestückt[68] oder die Haltestellen sind nicht so gestaltet, dass die Zugänglichkeit für den/die RollstuhlfahrerIn gegeben ist.
Fr. J.: "Es sind dann auch so Sachen wie, dass auf manchen Strecken halt noch alte Busse fahren und jeder dritte nur ein Niederflur ist. Das ist natürlich ein Problem, weil ich kann nicht wenn ich irgendwo hin muss zu einem Termin vier Busse fahren lassen und hoffen, dass der fünfte ein Niederflur ist."
Dadurch ergibt sich für RollstuhlfahrerInnen eine Unsicherheit bei der Busbenutzung, die nur durch individuellen Zeitaufwand minimierbar ist, u.zw. indem sich die Betroffenen bereits im Vorfeld der eigentlichen Benutzung informieren müssen, ob auf der jeweiligen Linie wenigstens teilweise Niederflurbusse verkehren und sie dies dann zeitlich einkalkulieren müssten, beispielsweise wenn es sich um einen beruflichen Termin handelt. Eine normale Nutzung bzw. Einbindung dieses Verkehrsmittels wird somit deutlich erschwert.
Zweitens - und diesem Punkt wird von den Interviewten ein besonderer Stellenwert zugemessen - treten Probleme auf, die im Zusammenhang mit dem (Fahr-)Verhalten der BusfahrerInnen stehen. Die (meisten) Niederflurbusse sind mit einer von den BusfahrerInnen händisch zu bedienenden Klapprampe ausgestattet. Die Rampe ist besonders für "E"-RollstuhlfahrerInnen unabdingbar, um in den Bus gelangen zu können. Aber auch für "M"-RollstuhlfahrerInnen, die selbstständig unterwegs sein wollen, sich jedoch z.B. mit dem Kippen schwerer tun, oder wenn sich durch ungenaues Anfahren der Haltestelle und/oder dem Nichteinsetzen des Kneelings der Abstand zwischen Gehsteigkante und Bus als ein unüberwindbares Hindernis entpuppt, ist die Rampe ein wichtiges Hilfsmittel, um in den Bus zu gelangen.[69]
Hr. I: "(...) hab ich das Problem, dass sie für mich eigentlich nicht verwendbar sind, weil sie viel zu weit weg meistens von den Randsteinen stehen bleiben."
Int.: "Die Busse?"
Herr I: "Genau, die Niederflurbusse. Das heißt, ich muss auf die Straße runter und dann ist von der Straße bis zur Kante vom Bus halt einfach so ein großer Spalt (...) Dann frag ich meistens um Hilfe auch, von Passanten, weil das am schnellsten geht."
Die Interviewten berichten davon, dass es ihnen immer wieder passiert, dass die BusfahrerInnen die Rampe nicht unaufgefordert ausklappen, wie es eigentlich laut Dienstauftrag vorgesehen ist.
Hr. S.: "Die Fahrer haben die Weisung auszusteigen. Aber die Weisung kann man vergessen. (...) wenn der Fahrer die Rampe ausklappen würd', könnte ich mit dem E-Rollstuhl ohne Probleme alleine Busfahren, ist aber nicht so, weil man muss immer zum Fahrer nach vorne gehen, womöglich auch hinein steigen und ihm sagen, ob er nicht die Liebenswürdigkeit hätte die Rampe- (...) es war immer so, dass man ihn ersuchen hat müssen und dann hat er halt irgendwie die Rampe herausgeklappt. Einmal hat er vorgeschlagen, ich kann Ihnen eh' beim Rauskippen helfen, das geht ja viel schneller und ist angenehmer. Wobei ich nicht finde, dass das angenehmer ist."
Herr "S" spricht hier eine konkrete Auswirkung der Benutzungsproblematik auf sein Mobilitätsverhalten an: Er will nur ungern alleine den Bus benutzen, obwohl es ja eigentlich für ihn möglich wäre.
Die negativen Erfahrungen, die in Verbindung mit dem Verhalten der BusfahrerInnen gemacht wurden, reichen vom "extra" Bitten-Müssen, dass die Rampe ausgeklappt wird, über das Zu-spüren-Bekommen, dass man als lästiger Fahrgast, als ProblemverursacherIn gesehen wird...
Hr. P.: "Der steigt aus, klappt die Rampe aus, mehr oder weniger enthusiastisch, da merkt man schon den Aggressionspegel wenn er sie hinunterfallen lässt und alle Leute erschrecken. Dann weiß man schon wie man dran ist."
...bis hin zu direkt diskriminierendem Verhalten. Angesprochen wurde diesbezüglich etwa das Verweigern des Mitfahrens, sei es durch offenkundiges Ignorieren der Person und Weiterfahren, oder durch gezielte Falschauskunft, dass z.B. die Rampe defekt sei.[70] Auch provokant empfundenes Ansprechen darauf, ob eine Begleitperson[71] vorhanden ist oder diskriminierende Wortmeldungen wurden als Beispiele genannt.
Hr. P.: "Einmal bin ich halt nur eine Station gefahren, was ja genauso mein Recht ist, weil alle anderen steigen auch oft nur für eine Station ein, und dann war er so nett und hat gesagt: ‚so machts' euch nicht beliebt (...)'."
Es kann zusammengefasst werden, dass die Busbenutzung für die RollstuhlfahrerInnen mit vielen Unsicherheiten, bedingt durch infrastrukturelle Mängel oder durch die Abhängigkeit vom "good-will" der BusfahrerInnen verbunden ist und sich folglich auf die Benutzungspraxis negativ auswirkt.
Int.: "Sie haben bisher den Bus eher aus ‚political correctness' benutzt?"
Fr. O: "Aber das ist gefährlich, wenn Sie das so schreiben, weil dann sagen die Verkehrsbetriebe, nein, wir brauchen das nicht. Also, mir ist es schon wichtig, dass es das gibt. Deswegen benutzt ich es ja, weil ich mir denk, benutz es, weil sonst stellen sie es wieder ein. Aber ich benutz es nicht freien Herzens. Ich denk mir nie, super, da fährt der 13A, da nehm ich den, sondern ich denk mir, um Himmels willen. Aber da hab ich halt Angst, dass am Ende raus kommt, na, sie brauchen es eh nicht. Ich denk mir, benutz es, damit die Leute sehen, du bist da. Weil jedes Mal wenn ich den benutzt, sagen die Leute, oh, da gibt's eine Rampe. Ich mach da irrsinnig viel Bewusstseinsarbeit. Es ist nicht so einfach. Und auch die Busfahrer müssen sich daran gewöhnen, sag ich mal, dass das einfach dazugehört."
Trotz angesprochener Schwierigkeiten bei der Busbenutzung wird grundsätzlich die Umstellung auf Niederflurbusse von den RollstuhlfahrerInnen sehr begrüßt und als ein Schritt in die richtige Richtung gewertet.
Hr. P.: "Prinzipiell ist natürlich die Entwicklung super und ich hoff', dass das weitergeht."
Int.: "Warum benutzen Sie den 13A noch, obwohl Sie 30 Prozent ‚Kampf' haben?"
Hr. P.: "Weil das meine Freiheit ist. Ich kann ihn benutzen, dann wann ich will, so wieder jeder andere auch. Fahrtendienst ist Abhängigkeit."
Straßenbahn
Wie bei den Bussen kommen auch bei den Straßenbahnen prinzipiell nur Niederflurstraßenbahnen (ULF) für eine Benutzung in Frage. Die herkömmlichen Straßenbahn-Garnituren sind zur Gänze unberollbar, da der Zugang nur über Stufen möglich ist. Noch ausgeprägter als bei den Bussen verhindert der sehr sporadische Einsatz des ULF[72] eine extensive Nutzung dieses Verkehrsmittels. Aber auch auf den Strecken, wo ULF-Wagen eingesetzt werden bedeutet das nicht, dass sie zur Fortbewegung auch tatsächlich genutzt werden können. Ein Grund dafür ist z.B., dass eine nicht adäquate Haltestelle (keine Haltestellenkaps, zu großer Spalt zwischen Bordstein und Straßenbahn, etc.) den Ein- bzw. Ausstieg unmöglich machen.
Hr. B.: "Einmal bin ich nach Oberlaa gefahren und da war ich halt zufällig mit dem Mechanischen (gemeint ist der Rollstuhl, Anmerkung T.E.) unterwegs und beim Einsteigen war das eben so eine Station, die von der Straße weg war, also wär das sowieso nicht verwendbar für einen Rollstuhlfahrer alleine. (...) Also da ist es sehr oft auch so, dass die Stationen offenbar nicht zweckentsprechend gebaut worden sind."
Fr. T.: "(...) was da das Problem ist, das was technisch nicht so gut ist zumindest: die Haltestellenkaps, da ist keine Auffahrt. Und das ist wirklich gefährlich, ja, da zischen irgendwie die Autos vorbei. Die Haltestellenkaps sollten wirklich so gemacht werden, dass man mit dem Rollstuhl rauf kann."
Prinzipiell äußern sich die Interviewten positiv über den "ULF", da die Fahrzeuge im Vergleich zu den "alten" Straßenbahnen sie zumindest nicht im Vorhinein von der Inanspruchnahme ausschließen. Die tatsächliche, alltägliche Einbeziehung der Straßenbahn in die individuelle Mobilität bzw. Verkehrsmittelwahl ist allerdings nicht nur aufgrund der wenigen Linien, auf denen der "ULF" verkehrt, gering.
Fr. H.: "(...) diese Niederflur ist so sporadisch wo eingesetzt. Also, erstens einmal hab ich gar keine Informationen wo die grad eingesetzt ist, außer wenn ich halt von Rollstuhlfahrern, Bekannten grad hör, dort und dort gibt's es jetzt auch schon. Und dann ist es ja, glaube ich, auch nicht jede Straßenbahn, sondern man muss ja dann wieder warten. Das heißt, das ist dann einfach wirklich nicht mehr zu kalkulieren. Das wird wirklich dann interessant, wenn sie halt kontinuierlich eingesetzt sind, dass man sie verwenden kann. Das heißt, Straßenbahn fällt zur Zeit einfach noch weg. Sobald sie da die "49er" bei mir ausstatten, werd ich sicher mit der Straßenbahn unterwegs sein."
Hr. A.: "Bei mir daheim fährt jetzt der "31er", nur, er fährt mir noch einfach zu unsicher. Wenn ich wirklich damit fahren will, interessiert's mich einfach nicht, grad im Winter, dass ich oft dann drei, vier fahren lassen muss bis jetzt der nächste Niederflur kommt."
Zusätzlich erschwert ein technisches Problem die Benutzung: Die elektrisch ausfahrbare Rampe im Vorderteil des ULF funktioniert nicht immer so, wie sie sollte. Frau "T." schildert ihre Erfahrungen damit:
Frau T.: "Wir stehen eben davor (vor der Straßenbahn, Anmerkung T.E.) und er tut nichts. Sagt wieder meine Assistentin zu ihm am Fenster, bitte, tun sie die Rampe raus. Da muss er nur auf einen Knopf drücken. "Die ist kaputt". Fange ich wieder an zu diskutieren. Er kommt nicht raus. Ich höre ihn nicht, er hört mich nicht. Und da hat die Assistentin immer gedolmetscht, hin und her. Okay, auf alle Fälle "die ist kaputt", "die geht nie", wenn er sie aufmacht dann geht sie nicht rein und dann steht er. Und ich wieder halt, "und warum melden sie es nicht?" (...) Er hat auf den Knopf gedrückt und ich bin mitgefahren. Sie ist
gegangen. Beim Aussteigen hat sie auch funktioniert. Dann haben wir gerade die Straßenbahnnummer aufgeschrieben und er hat Dienstwechsel gehabt und ist auch in unsere Richtung gegangen. Er hat uns angeredet und hat mir dann erzählt: "Wissen Sie was, das ist ja ‚alles für den Hugo', wir kriegen in den Schulungen gesagt, ‚na ja, die Rampe gibt es, aber die vergessen Sie. Ihr helfts' den Leuten lieber so.'"
Dieses Problem bestätigt ein interviewter Experte der Behindertenorganisation BIZEPS, der unter anderem auch Anlaufstelle für Mobilitätsthemen und -fragen behinderter Menschen ist.
"Im Moment ist z.B. ein Problem, dass Niederflurstraßenbahnen eingesetzt werden auf den bekannten Linien, allerdings die Fahrer mehr oder weniger bei der Schulung gesagt bekommen: ‚Verwendet die Rampen nicht.' Es kommt immer wieder zu Vorfällen, dass RollstuhlfahrerInnen vor einer Niederflurstraßenbahn stehen und der Fahrer die Rampe nicht ausfahren will vor Angst, dass sie defekt ist und die ganze Straßenbahn dann stehen bleibt." (EI 4, 2001)
U-Bahn
Die U-Bahn ist mit Sicherheit das beliebteste und auch das am häufigsten von den interviewten RollstuhlfahrerInnen genutzte öffentliche Verkehrsmittel, wobei hier angemerkt werden muss, dass dies weniger an der "Rollstuhlgerechtigkeit" der U-Bahn[73] liegt, als in den Vorteilen, die dieses Verkehrsmittel generell für die Mobilität bedeutet, wie z.B. Schnelligkeit, Bequemlichkeit, keinen Parkplatz suchen müssen usw. Im Vergleich zu Bus und Straßenbahn erfreut sich die U-Bahn unter den RollstuhlfahrerInnen[74] größerer Beliebtheit, da sich die Nutzungsbarrieren vergleichsweise in Grenzen halten.
Eine Benutzungsbarriere, die ein nicht unerhebliches Benutzungsrisiko beinhaltet, ist der U-Bahn-Spalt bzw. der Niveauunterschied zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante, der überwunden werden muss. Dazu muss der/die M-RollstuhlfahrerIn entweder in der Lage sein, den Rollstuhl zu kippen - dabei besteht die Gefahr rückwärts aus dem Rollstuhl zu fallen - oder der/die E-RollstuhlfahrerIn muss einen "Anlauf" nehmen, um den Spalt zu überwinden. Wobei durch die Wucht des Aufpralls sowohl Körper als auch Rollstuhl gehörig durchgerüttelt werden und die Möglichkeit besteht, dass beides auf Dauer Schaden nimmt. Dieses Risiko, das mit der Überwindung des U-Bahn-Spalts verbunden ist, möchte nicht von jedem bzw. jeder eingegangen werden. Um dieses Risiko zu minimieren wird doch häufig auf eine Begleitung beim U-Bahn fahren nicht verzichtet oder es wird Hilfe von PassantInnen in Anspruch genommen.
Int.: "(...) was sind Problematiken bei der U-Bahn-Benutzung für Sie?"
Fr. J.: "Die Spalte dazwischen. (...) dass es sich dann fast kaum ausgeht mit den vorderen Rädern draufzukommen um mit den hinteren nicht im Spalt hängen zu bleiben. Also, das ist dann immer auch so eine Geschichte (...)"
Fr. Q.: "Schauen Sie sich die U-Bahn an, die ist nicht eben. Sie hat einen Spalt und eine Breite. (...) der E-Rollstuhl hat nur relativ kleine Reifen, aber die haben sich durchgedreht. Die waren zu klein um mit Schwung hinüberzukommen. Darum hab ich eine Hilfe gebraucht."
Hr. N.: "Nein, U-Bahn fahr ich nie alleine."
Der Ein- und Ausstieg stellt nicht nur aufgrund des zu überwindenden Spalts und Niveauunterschieds einen Unsicherheitsfaktor bzw. eine Stressbelastung dar, denn es gilt rasch, unter Zeitdruck, auf einige kritische Punkte gleichzeitig zu achten: Es muss geschaut werden, dass beide Türen zum Einfahren offen sind, was bedeutet, entweder sich darauf zu konzentrieren und dort einzusteigen, wo andere Fahrgäste die Türen aufmachen oder selber die häufig schwer zu öffnenden Türen[75] auseinander zu ziehen versuchen, was aufgrund der durch die niedrigere Körperposition reduzierte Hebelwirkung der Hände noch mehr Kraft erfordert als für "Geher". Es muss genügend Schwung genommen werden, um in die U-Bahn hinein zu kommen, gleichzeitig muss aber auch darauf geachtet werden, dass keine anderen VerkehrsteilnehmerInnen angefahren werden. Das alles gilt es selbstverständlich für das Ein- und Aussteigen zu beachten.
Fr. H.: "Es ist eher ein bisserl problematisch wegen diesem Türen-Öffnen. Man muss eben beide Flügel aufmachen als erstes, um diese Kante zu überwinden. Und, ich bin oft alleine unterwegs, muss ich wieder Anlauf nehmen um das bewältigen zu können und dann wird's zeitlich oft schon ein bisserl knapp. Das heißt, wenn wenig Leute sind, ich schau natürlich, wo steigen die Leute auf, wo werden die Türen aufgemacht und nehm Anlauf und fahr da rein. Also, problematisch ist es, wenn irrsinnig viel Leute sind, weil da kann ich nicht mit vollem Karacho da hineinfahren und die Leute niederschieben. Oder, wenn gar keine Leute sind die die Türen nicht aufmachen."
Fr. J.: "Das ist irgendwie nicht so, dass ich mir denk, naja, da komm ich schon raus, sondern ich krieg dann schon wenn viele Leute auf der Plattform stehen die Panik, dass ich nicht mehr rechtzeitig hinaus komm. Wenn dann die Leute noch reingehen, sowieso noch."
Ein neuer U-Bahn-Typ, der so genannte "V-Wagen" (vgl. 6.2.1), der momentan als Prototyp eingesetzt wird, scheint für RollstuhlfahrerInnen einen großen Fortschritt zur (leichteren) Inanspruchnahme der U-Bahn und damit zur Erweiterung der selbstständigen Mobilität zu bedeuten und wird deshalb grundsätzlich auch begrüßt. Kritisch angemerkt wird von den RollstuhlfahrerInnen, die diesen neuen Typ bereits ausprobiert haben, dass die am Wagenanfang bzw. -ende befindlichen pneumatischen Rampen, die den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante schließen, nicht durchgehend, also an allen Türen, installiert wurde.
Hr. S.: "Ich bin auch gestern das erste Mal in der Früh damit gefahren."
Int.: "Wie war das?"
Hr. S.: "Ich steig bei der U-Bahn generell nicht ganz vorn und ganz hinten ein, weil da die größte Drängerei ist. Oft kommt man dann gar nicht mehr rein. (...) wenn es möglich ist, sollte man überall Rampen anbringen. Vorne und hinten würd es wahrscheinlich gehen wenn man reinkommt und es genügend Platz ist, dass man alleine fährt. Insofern wäre es ein riesen Fortschritt für die Mobilität, weil dann könnte ich jedenfalls alleine in die Arbeit fahren. Vorausgesetzt ist, dass durchgängig nur neue Garnituren sind. Das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern."
Eine weitere Barriere im Rahmen der U-Bahnbenutzung, die für Unsicherheit sorgt, sind die Aufzüge, ohne die die Erreichung des Bahnsteigs nicht möglich ist. Konkret beziehen sich die Probleme, die in diesem Kontext bestehen, einerseits darauf, dass es entweder gar keinen Aufzug gibt oder keinen anderen barrierefreien U-Bahn-Zugang. Andererseits wurden die auftretenden Schwierigkeiten thematisiert, wenn der Lift ausfällt.
Hr. B.: "Die U1 hat nicht überall Aufzüge. Also, da muss man teilweise ganz genau wissen bevor Fahrtantritt, ja, wenn ich weiß ok., ich fahre, ich muss z.B. umsteigen, U3, U1, ja, dann muss ich mich vorher vorbereiten und erkundigen wenn ich's nicht selber weiß, wenn ich die Strecke zum ersten Mal fahr, ja, muss ich vorher anrufen und fragen ob dort wirklich ein Aufzug ist."
Fr. H.: "Es ist so, wenn ich das vorher weiß, dass ich bei einer U-Bahn-Station aussteigen muss wo es keinen Aufzug gibt, wo ich sicher nicht rauf komm, dann organisier' ich mir das vorher. Entweder treff' ich dort jemanden der mir rauf hilft oder ich nehm' eine Begleitperson mit. Es ist wirklich nur bei Sachen, wo jetzt der Aufzug ausfällt (...) Dann steh ich wirklich dort und hab einfach Niemanden, bin praktisch wie jeder andere Straßenbenutzer unterwegs und auf einmal funktioniert das nicht. Und damit wird dann halt wirklich die Behinderung und die Abhängigkeit von solchen Dingen unmittelbar bewusst und macht mich wirklich dann sehr ärgerlich, weil ich halt wirklich von diesen Dingen abhängig bin um einfach leben zu können und mobil zu sein."
Waren zum Zeitpunkt der Befragung (2001) noch nicht in allen U-Bahnstationen Aufzüge vorhanden, so haben die "Wiener Linien" in den letzten Jahren eine Nachrüstung der U-Bahn-Stationen mit Aufzügen betrieben und mittlerweile ist zumindest ein Lift in jeder U-Bahn-Station vorhanden oder zumindest ein barrierefreier Zugang z.B. über Rampen.
Sind Aufzüge defekt, wäre es für den/die RollstuhlfahrerIn unbedingt nötig, bereits vor Fahrtantritt darüber informiert zu sein, da ansonsten "unliebsame Überraschungen" die Mobilität gefährden. An den Schilderungen von Herrn "D." werden die Konsequenzen für die RollstuhlfahrerInnen sichtbar, wenn sie vor die Tatsache eines unbenutzbaren Aufzugs gestellt werden:
Hr. D.: "Also, da hat es schon mehrfach Probleme gegeben. Z.B. da beim Schottentor der zweite Lift (...) Da bin ich eine Station weiter gefahren. Hab wieder auf die U-Bahn warten müssen. Bin eine Station weiter gefahren, Rathaus, da gibt's einen Lift. Ist natürlich dann weiter zum Herfahren. Einmal war der andere Lift kaputt der ganz rauf fährt. War auch sehr blöd, weil ich hab' es sehr eilig gehabt und hab' dann Leute gebeten, dass sie mich rauf tragen. Mit dem Elektrorollstuhl ist das sehr schwer. Da braucht man schon vier starke Männer und die sind dann auch fix und fertig. Aber die Leute sind sehr hilfsbereit. Und so hab ich schon öfter Probleme gehabt."
Weiters bedeuten nicht funktionsfähige Aufzüge für den rollstuhlfahrenden Fahrgast einen Umweg fahren zu müssen, was mit einem Mehr an körperlicher Anstrengung verbunden sein kann und/oder die Wahrscheinlichkeit beinhaltet, dass durch das Umfahren-Müssen des bekannten Weges und Ansteuern des Zieles auf einem unbekannten Weg andere Barrieren auf einen zukommen können, die dann zu bewältigen sind. Oder, der/die RollstuhlfahrerIn muss Hilfe in Anspruch nehmen, um z.B. über die Rolltreppe das angestrebte Ziel erreichen zu können.
Hr. F.: "Das ist eine mühseligere Geschichte. Also, wo man relativ schnell dann innerlich eingeht. Vor allem wenn so etwas ist, dann musst du den weiten Weg wieder zurück latschen. Dann musst du umdisponieren, innerlich und äußerlich. Da kriegt man schon ein fades Aug dann."
Hr. W.: "Station Keplerplatz. Und die hatte nur einen Lift. Und wenn der ausgefallen ist, dann bin ich eben auf Hilfe angewiesen, auf Unterstützung bei der Rolltreppe. Und hab dann versucht bei den "Wiener Linien" anzurufen, was aber eigentlich sehr schwierig war, weil man mich immer vertröstet hat und gesagt hat, ja, das wird schon repariert von den Mechanikern. Die können nur zu gewissen Zeiten arbeiten und deswegen dauert's so lange."
Int.: "Und wie Sie von der Arbeit nach Hause gefahren sind, war er dann schon repariert?"
Hr. W.: "Nein. Das hat ziemlich lange gedauert. Es hat eine Störphase gegeben die sich sicher über mehrere Wochen erstreckt hat."
Int.: "Was haben Sie dann konkret gemacht, wenn das über Wochen gegangen ist? Sich jedes Mal helfen lassen?"
Hr. W.: "Ja, genau."
Int.: "Von Passanten?"
Hr. W.: "Passanten."
7.2.2.4 Fahrtendienst
Es wird zwar die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Fahrtendienstes sowohl für Arbeits- als auch für Freizeitfahrten durchaus positiv betrachtet. Das heißt es werden etwa Vorteile dahingehend gesehen, dass der/die Einzelne vom Wohnort direkt zum Zielort gebracht wird und dadurch, verglichen etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Barrieren im Vorhinein ausgeschalten werden. Abgesehen davon wurde jedoch verstärkt auf Problematiken bzw. Nachteile im Kontext mit dem Fahrtendienst hingewiesen.[76] Die Probleme beziehen sich dabei in erster Linie auf die Nichteinhaltung von Bestellzeiten und mangelnde Verlässlichkeit, aber auch auf personalbezogene und bürokratische Aspekte. An dieser Stelle ist anzumerken, dass bestimmte negative/positive Erfahrungen vermutlich firmenspezifisch variieren; genauso wie die Interviewten von unterschiedlichen "Praktiken" bzw. Qualitätsstandards bei den Fahrtendienstfirmen berichten. Es weist beispielsweise eine RollstuhlfahrerIn darauf hin, dass sich ihre Zufriedenheit hinsichtlich der Verlässlichkeit bei ihren täglichen Arbeitsfahrten etc. stark verbessert hat, seit sie bei einer Firma die Möglichkeit gefunden hat, direkt mit dem Fahrer die Bestellungen abzuwickeln.
Fr. G.: "Natürlich kommt's halt auch leider oft vor, dass die Fahrtzeiten, also die Bestellzeiten nicht so eingehalten werden."
Int.: "Kommen Sie dann zu spät in die Arbeit?"
Fr. G.: "Ja, oder ich werde zu früh geholt." (...)
Int.: "Und wie gehen Sie damit um?"
Fr. G.: "Naja, ich hab an sich Gleitzeit und wenn ich halt ein Minus hab - das hab ich leider im Moment - dann muss ich halt versuchen irgendwann länger zu bleiben oder früher zu kommen." (...)
Fr. G.: "In der Früh, wenn ich merk es dauert schon lang, dann ruf ich halt an und dann erfahr' ich halt wann jemand kommt bzw. ob überhaupt- Es ist auch schon vorgekommen, dass einer nicht gekommen ist, allerdings selten. Und manchmal haben Sie mich angerufen, ich soll mir ein Taxi nehmen und die Rechnung einschicken. "
Int.: "Wie ist das für Sie?"
Fr. G.: "Unangenehm. Unangenehm."
Die Erfahrungen mit Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit oder auch die Schwierigkeiten, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Fahrtendienst überhaupt zu bekommen, führen dazu, dass auf die Inanspruchnahme entweder eher verzichtet oder nach anderen Lösungen, z.B. für die tägliche Fahrt zur Arbeit, gesucht wird.
Hr. S.: "Früher bin ich zur Uni mit einem Fahrtendienst gefahren und da hab ich halt so meine Erfahrungen gemacht und die misse ich eigentlich nicht."
Int.: "Sie greifen gar nicht mehr darauf zurück?"
Hr. S.: "Nein. Ich hätte ihn voriges Jahr ein paar mal gebraucht, da hab ich ihn auch dann verwendet. (...) da war es wirklich ein Problem einen Bus (gemeint ist ein Fahrzeug des Fahrtendienstes, Anmerkung T.E.) vor Neun zu kriegen, weil da fängt eben der Kurs an. Ich hab dann erst wirklich kurz vorher erfahren, kann ich jetzt in den Kurs fahren oder brauch ich jemanden der mit mir mit dem Taxi hinfährt. Ich hab das eh schon eine Woche vorher angemeldet, hab es aber trotzdem erst einen Tag vorher erfahren. Also das ist eigentlich nicht lustig. Und ich weiß nicht, ob ich das nächste mal nicht wirklich gleich mit dem Taxi organisier (...)"
Int.: "Sie haben schon einige Problematiken vom Fahrtendienst angesprochen. Gibt es sonst noch Aspekte?"
Hr. S.: "Die Unzuverlässigkeit. Also entweder kommen sie zu spät oder - was auch wieder unangenehm ist - sie kommen früher und sollten schon wieder wegfahren. Einerseits, ich bin in der Früh vielleicht noch nicht fertig oder andererseits, ich kann nicht unbedingt eine Besprechung oder ein Seminar sofort verlassen. Das geht einfach nicht. Und da kommen sie rein und sind dann da, was soll ich tun? Ich mein, das ist einfach lästig. Das ist ein Grund. Und dann, was auf der Uni oft war, die Sammelfahrten. Da wird man eingeladen zum Rücktransport oder so und fährt dann oft noch eine Stunde oder zwei in Wien umher bis das Auto voll ist, bis es dann wieder ausgeladen ist."
Herr "S." spricht hier einen Aspekt an, der ebenfalls immer wieder thematisiert wurde u.zw., dass bei diesen "Sammelfahrten" teilweise eine sehr lange Fahrzeit besteht. Es lässt sich vermuten, dass diese durch eine mangelhafte Logistik bzw. Organisation bei manchen Fahrtendienstfirmen zustande kommt, das heißt, es werden teils Umwege gefahren, die für die BenutzerInnen zeitraubende Auswirkungen haben.
In einigen Fällen wird auch von den Betroffenen eine wahrgenommene mangelhafte Schulung (betreffend Umgang und/oder Fahrverhalten) der FahrerInnen moniert bzw. wiesen einige darauf hin, dass sie sich eine bessere Schulung der FahrerInnen wünschen würden:
Hr. D.: "Die Fahrer, das ist ein bissel eine eigene Welt beim Fahrtendienst. Die Fahrer sind meist sehr bodenständig. Es kommt darauf an wen man erwischt."
Int.: "Was heißt das?" Hr. D.: "(...) Ja, wie mit einem umgegangen wird (...) Und dann sind sie oft schlecht eingeschult, sind überfordert mit der Behinderung die die Leute auch haben. Und jetzt kommt dann jemand, der zwar auch schwerer behindert ist, aber mit dem man reden kann. Und dann ist es mir passiert, dass sie quasi ihre Sorgen halt erzählen die sie haben, die Problematik. Sie beginnen dir ihr Herz auszuschütten."
Die RollstuhlfahrerInnen berichten neben den Erfahrungen mit dem Nicht-Einhalten von Bestellzeiten und den zeitlich limitierten Benutzungsmöglichkeiten[77] seitens der Fahrtendienstfirmen weiters von zu langen Vorbestellzeiten, die in Kauf genommen werden müssen. Dadurch wird der Fahrtendienst für die Interviewten zu einem Fortbewegungsmittel, das mit Abhängigkeit assoziiert wird und keine Spontanität erlaubt, sondern rigide Planung bedeutet.
Hr. E.: "Ein wesentliches Manko ist auch, dass nach 22 Uhr nichts ist. Wenn ich irgendeinen Abendtermin hab, kann ich in aller Regel ihn nur für einen Weg benutzen. Weil, deswegen, weil ich bewegungsbehindert bin, dass ich um 22 Uhr Gitterbettsperre hab, das ist nicht einzusehen."
Fr. O.: "Was halt schwer ist, dieses Vorplanen. Das haben wahrscheinlich auch alle gesagt, aber es ist halt so. Dass du schwer etwas spontan machen kannst. Du musst immer schon heute wissen was du morgen machst. (...) Also, dieses ewige Planen und dann auch wenn man abgeholt wird, dieses nicht bleiben können solange man will. Für das soziale Leben ist es einfach schwer, weil immer wenn es lustig wird, kommt der Fahrtendienst. Oder, wenn einem fad ist, kann man nicht weg."
7.2.2.5 Soziale Barrieren
Der öffentliche Raum ist nicht nur gebauter Verkehrsraum, sondern gleichzeitig auch sozialer Raum, in dem zwischenmenschliche Interaktionen und Kommunikation stattfinden. Im Kontext von Mobilitätsbarrieren bedeutet dies, dass dementsprechend nicht nur bauliche bzw. Benutzungsbarrieren, sondern auch Barrieren im Sinne von Problematiken hinsichtlich der Interaktionen, die im gebauten Raum stattfinden, zu beachten und im Rahmen dieser Arbeit aufzugreifen sind. Die Mobilitätsbarrieren können sich ebenso auf das (potentielle) Mobilitätsverhalten der RollstuhlfahrerInnen, das Wohlfühlen bei der Verkehrsmittelnutzung und im öffentlichen Raum bzw. damit korrelierend auf die (potentielle) Inanspruchnahme von Verkehrsmitteln oder/und -raum, auswirken.
Vor allem zwei Bereiche sozialer Barrieren kristallisierten sich anhand der Befragung heraus:
-
Problematiken, die sich im Umfeld der Verkehrsmittelnutzung mit dem Personal oder anderen Instanzen im Dienstleistungsbereich für die RollstuhlfahrerInnen ergeben.
-
Problematiken, die sich aufgrund des Verkehrs-Verhaltens nichtbehinderter VerkehrsteilnehmerInnen gegenüber den RollstuhlfahrerInnen ergeben.
Hauptsächlich bei der Busbenutzung (vgl. 7.2.2.3) oder der Inanspruchnahme des Fahrtendienstes (vgl. 7.2.2.4) kommt es zu Kontakten mit dem Personal, die von den RollstuhlfahrerInnen teilweise als unangenehm bis diskriminierend erlebt werden. RollstuhlfahrerInnen werden offenbar von manchen als KundInnen nicht ernst genommen, fühlen sich teilweise als Kunden zweiter Klasse behandelt, oftmals sogar ignoriert und diskriminiert. Von den Interviewten wurde immer wieder darauf verwiesen, dass ihrer Meinung nach Schulungen für das Personal notwendig wären, damit eine Sensibilisierung bzw. ein Problembewusstsein geschaffen würde und sich dadurch vielleicht auch das Verhalten ändern würde, sodass es dem/der RollstuhlfahrerIn möglich ist, wie jeder andere zahlende Kunde auch das Verkehrsmittel nutzen zu können ohne sich mit dem Personal "herumschlagen" zu müssen.
Fr. H.: "Das wichtige, glaube ich, ist, dass man die Leute aufklärt, dass z.B. die Busfahrer oder für die Straßenbahnfahrer eine interne Schulung gäbe; auch für die ÖBB-Bediensteten[78] (...) Dass die z.B. sich auch einmal in den Rollstuhl setzen oder mit den Bussen unterwegs sind und ausprobieren. Das würde, glaube ich, einiges zum Verständnis auch beitragen."
Zum einen haben es die Interviewten mit einem Verkehrsverhalten anderer VerkehrsteilnehmerInnen zu tun, das sich einschränkend oder sogar gefährdend auf die eigene Mobilität auswirken kann. Vor allem regelwidriges Parken nichtbehinderter bzw. -befugter Menschen auf Behindertenparkplätzen, das "Parken" am Gehsteig, rücksichtsloses oder unachtsames Verkehrsverhalten sind die genannten Problemfelder. Die diesbezüglichen Erfahrungen bzw. die daraus resultierenden Konsequenzen für die Mobilität/das Mobilitätsverhalten der Betroffenen dürften anhand der vorangehenden Kapitel ausreichend verdeutlicht worden sein.
Für die Befragten zeigt sich in jenen Verhaltensweisen eine Rücksichtslosigkeit, ein mangelndes Problembewusstsein sowie mangelnde Sensibilität dafür, was für Konsequenzen das spezifische (regelwidrige) Verkehrsverhalten für eine(n) RollstuhlfahrerIn haben kann.
Zum anderen haben wir es mit Verhaltensweisen gegenüber RollstuhlfahrerInnen zu tun, die häufig auf Klischeebildern, -vorstellungen und Vorurteilen basieren. Gerade weil RollstuhlfahrerInnen rein äußerlich (Rollstuhl) sofort als Menschen mit Behinderung klassifizierbar sind und sie weiters im Straßenbild von nicht allzu großer Präsenz sind, von dem her also bereits etwas "Außergewöhnliches" verkörpern, bieten sie offenbar eine leichte Angriffsfläche für die unterschiedlichsten Re-Aktionsweisen anderer VerkehrsteilnehmerInnen. Wobei von den Interviewten eine eklatante Verunsicherung seitens der "Nichtbehinderten" hinsichtlich einer adäquaten, "richtigen" Verhaltensweise geortet wird.
Int..: "Welchen Eindruck haben Sie wenn Sie sich im Öffentlichen Raum bewegen (...) wie Sie wahrgenommen werden. (...) Was herrscht da vor was Ihnen entgegengebracht wird?"
Fr. J.: "Befremdung. Also, so in der U-Bahn oder am Bahnsteig ist es schon befremdend. (...) die Leute sind es nicht gewohnt, dass man Rollstuhlfahrer auf der Straße sieht, schon gar nicht in der U-Bahn. Das heißt, es wird einmal angeschaut, oder so verhohlen, mhm, aha und, muss ich da jetzt helfen oder nicht (...) die Leute sind es nicht gewohnt Rollifahrer im Öffentlichen Raum zu sehen."
Fr. H.: "(...) also, das Eine ist so das Sensibler-zu-werden was jetzt so das Bewusstsein anbelangt und das Andere hat was mit Angst verlieren auch zu tun. Angst im Umgang mit Behinderten. Ich begegne sehr vielen Menschen die einfach unsicher sind und Angst haben, weil sie nicht wissen wie sie's anpacken sollen. Und das kann man eben wieder verändern indem man Informationen gibt, von öffentlicher Seite her, und damit das mehr ins Bewusstsein rufen kann. Damit sind die Leute nicht mehr so verunsichert, sondern wissen auch schon Einiges und das, was sie nicht wissen, trauen sie sich dann eher zu fragen. (...) Und es gehört ein selbstverständlicherer Umgang. Das ist z.B. auch etwas was ich merk, ich mein, die Behinderung ist offensichtlich, keine Frage. Ich hab eine Behinderung die man von der Weite sieht, weil der Rollstuhl einfach ganz augenscheinlich ist. Also auf der einen Seite werden verschiedene Dinge (...) ignoriert und auf der anderen Seite fällt mir aber sehr oft auf, dass aber nur der Rollstuhl gesehen wird, das heißt, gar nicht die Person die da drinnen sitzt, sondern nur die Behinderung und der Rollstuhl der dazu gehört."
Positiv wird die vielfache Hilfsbereitschaft anderer VerkehrsteilnehmerInnen betont. Oft wird aber hinzugefügt, dass erkennbare Unsicherheit darin besteht, wann Hilfe anzubieten ist und vor allem wie adäquate Hilfe geleistet werden kann. Es besteht offensichtlich ein großes Informations- und Erfahrungsdefizit seitens nichtbehinderter Menschen. Es kann sich dann auch vielleicht gut gemeinte Hilfe ins Gegenteil verkehren und für die RollstuhlfahrerInnen zu einer Gefahr werden oder der/die RollstuhlfahrerIn wird zur Inanspruchnahme der Hilfe in gewisser Weise sogar genötigt.
Fr. C.: "Prinzipiell, egal wer mir seine Hilfe anbietet, also, entweder ich sag, nein danke, es geht schon, und das wirklich sehr freundlich, oder wenn derjenige sich nicht abweisen lässt, dann lass ich ihn helfen. Wie gesagt, mit dem Gedanken, dass andere Rollstuhlfahrer darauf angewiesen sind und die Leute dann vielleicht zu einem anderen gar nicht mehr hingehen um zu helfen. Also, ich würde nie wirklich böse reagieren, so, jetzt lassen sie mich endlich in Ruh-"
Fr. J.: "Es wird jetzt schon öfter, dass die Leute fragen. Es gibt noch immer so Reflexdinge, dass wenn ich aufkipp oder so, ja, dass die Leute irrsinnig erschrecken und hingreifen, ja. Wo ich sag, nein, nein, danke, es geht schon. Und bevor sie irgendwo anziehen, ja, weil das ist, ja, eine sehr sensible G'schicht."
Die Bandbreite der eher unangenehm bis äußerst negativen Erfahrungen, die RollstuhlfahrerInnen im öffentlichen Raum mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen machen, sind mannigfaltig und reichen vom Weg-Schauen bis hin zu direkter verbaler Diskriminierung oder sogar körperlichen Übergriffen.
Die Interviewten berichteten unter anderem von:
-
der Wahrnehmung eines "stigmatisierenden Blicks", das heißt entweder ein "Angaffen" oder ein absichtliches "Weg-schauen":
Hr. N.: "Man wird angeschaut. Man wird einkategoriert: sitzt im Rollstuhl, ob er's geistig hat oder nicht?"
Hr. I.: "(...) hab ich öfter das Gefühl, dass die Leute mich nicht anschauen, möglichst wegschauen und möglichst schnell von mir wegkommen wollen. Auch wenn sie mir Hilfe anbieten, kommt das manchmal vor. Wenn sie mir Hilfe anbieten, (...) hab ich öfter so das Gefühl, dass sie möglichst bald quasi die nicht normale Gegebenheit wieder weg haben wollen. Mir kommt auch öfter vor, dass die Leute mich nicht anschauen trauen. Dass Leute so tun, wie wenn ich nicht da wär."
-
Verhaltensweisen, die die persönliche Grenze überschreiten, etwa durch unaufgefordertes Angesprochen-Werden und dass auf scheinbar selbstverständliche Weise in die Privatsphäre eingedrungen wird
Hr. F.: "(...) es geht dann meistens so: Tschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Und die eher über 70jährigen, gut, da kann ich jetzt auch schon damit umgehen. Wenn ich den Berg hinauf roll oder so, na, wieso haben Sie denn keinen Elektrorollstuhl? Sie müssen sich ja plagen. Also, das Mitleid oder so, das ist schon irgendwie da."
Fr. O.: "Das geht mir manchmal echt auf die Nerven. (...) so die Distanzlosigkeit zu behinderten Leuten. (...) Die reden dich irrsinnig viel an und der Rollstuhl ist sozusagen der Grund. (...) Mir ist das natürlich völlig unangenehm. Ich reagier unterschiedlich. Am liebsten wär mir natürlich, ich möchte Ihnen das nicht sagen, aber ich bin leider sehr gut erzogen. Ich antwort irrsinnig schnell drauf, bevor ich merk, ich muss da jetzt gar nicht antworten. Und vor allem, wenn ich dann mit Begleitung bin, dann, also mir passieren Sachen, dass jemand sagt, und? Ist das Ihr Freund? Und was machen Sie ? Und wieso sind Sie im Rollstuhl? Einfach so. Da denkst du dir, Vogel? (...) Ja, das ist das, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt wieder die Gefahr, weil dann hast du das Gefühl du bist irgendwie freigegeben.(...) Nur, wenn Sie mir Geld geben, dann werd ich grantig."
-
Beschimpfungen, direkt diskriminierenden (verbalen) Attacken:
Fr. Q.: "Jetzt muss ich da rüber fahren (über eine Straßenkreuzung, Anmerkung T.E.). Da stehen aber schon die anderen Autos. In dem Moment wo ich dann die Grünphase hab, haben die noch rot. Aber bis ich da drüben bin und mich wieder mit dem Waggerl so einjustiert hab - vor, zurück, vor, zurück - (...) haben die Grün, hupen wie wild, schimpfen, heißen mich eine blöde Sau oder sonst was. Schleich dich, oder beim Hitler hätten sie dich vergast, lauter so Sachen hörst du. Alles schon erlebt."
Oftmals wurden im Zusammenhang mit der "Parkplatz-Problematik" dementsprechende Erfahrungen gemacht - wenn nichtbehinderte bzw. - befugte AutofahrerInnen auf Behindertenparkplätzen parken und die RollstuhlfahrerInnen entweder direkt den/die ProblemverursacherIn damit konfrontieren oder das Auto abschleppen lassen. Die Re-Aktionen, von denen die Interviewten berichten sind vielfältig: vom "Goschen anhängen" bis hin zu (vermuteten) Racheakten.
Hr. K.: "(...) Und die Reaktion von den Leuten ist ganz verschieden. Manche sagen, es tut mir leid und ich fahr gleich weg und manche bleiben stur drin steh'n und liefern sich mit dir noch Schreiduelle."
F(Freundin von Hr. N., Anmerkung T.E.).: Aber so zieht man sich auch den Zorn zu. Das erleben wir fast täglich. Weil, da steig ich aus und sag, haben Sie einen Ausweis? Sind sie behindert? Haben Sie einen Rollstuhl? Nein? Ja, was machen Sie dann auf dem Parkplatz? Keine Ahnung. Dann fangt er an zu stänkern oder nicht."
Int.: "Haben sich da Leute die überhaupt keine Behinderung hatten auch hingestellt? (n den Behindertenparkplatz mit Nummernschild, Anmerkung T.E.)"
Hr. R.: "Ja. Die hab ich abschleppen lassen. Dafür hab ich dann vier Patschen gehabt. Patschen gestochen. Nur, ich kann es nicht beweisen, dass es er war den ich abschleppen hab lassen.(...) Ich hab eine Anzeige gegen unbekannt gemacht."
Hr. K.: "(...) ich bin mir auch sicher, dass alle Kratzer an meinem Auto (...) kommen nicht von mir. Weil, ich hab z.B. so einen (zeigt mit der Hand ca. einen Meter, Anmerkung T.E.) Kratzer über den Kofferraum. Also, da kann ich mir sehr wohl denken, dass da einmal jemand, der ja weiß wo ich park, weil er aus der Lücke abgeschleppt worden ist, einmal vorbeigegangen ist und einfach einmal sich revanchiert hat, sagen wir einmal so."
Die RollstuhlfahrerInnen werden durch das Fehlverhalten, die Ignoranz der FalschparkerInnen nicht nur dazu genötigt, nervenaufreibende Diskussionen führen zu müssen, sich Beschimpfungen anzuhören etc., sondern der "Kampf" um den Parkplatz lässt die RollstuhlfahrerInnen aufgrund erfahrener bzw. potentieller "sozialer Sanktionen" teilweise auch ihr Verhalten dementsprechend ausrichten. Beispielsweise wird das eigene Verhalten, die eigene Reaktion, sehr genau abgewogen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf ein bestimmtes gesellschaftliches "Behindertenbild".
Hr. E.: "(...) ich gehe hier regelmäßig her, arbeite da, seit Jahr und Tag. Und das führt auch dazu, dass ich da relativ bekannt bin in der Gegend, sag ich einmal. Wenn ich da irgendwie ständig die Polizei mobilisier und die Leute abschleppen lass, das kostet nicht unter 3000 Schilling alles in allem, bring ich natürlich alle gegen mich auf. (...) Ja, und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn ich mich da regelmäßig bewegen muss und mir jemand das Auto abschleppen lässt, hab ich auch einen heiligen Zorn, eh klar.
Int.: "Ja, aber Sie schränkt es ein."
Hr. E: "Ja, das muss ich dann sorgfältig abwägen wie ich mich da verhalte."
7.2.2.6 Informationsbarrieren
Informationen spielen im Kontext von Mobilität eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie sollten idealer Weise dazu dienen, die Mobilität und die Beweglichkeit im Öffentlichen Raum zu erleichtern oder auch zu erhöhen. Ebenso sollten Informationen aufklärenden Charakter haben, sei es hinsichtlich bestehender Mobilitätsmöglichkeiten (z.B. Alternativen bei der Verkehrsmittelwahl) oder hinsichtlich diverser Problematiken und eventueller Risiken im Rahmen der Mobilität. Organisation und Planung im Vorfeld der Mobilität sowie Orientierungsvermögen ist beeinflusst und abhängig von den zur Verfügung stehenden Informationen. Qualität und Verständlichkeit sowie einfache Zugänglichkeit und Zielgerichtetheit der Informationen kommt in diesem Zusammenhang ein hoher Stellenwert zu.
Die befragten RollstuhlfahrerInnen beklagen einerseits ein ausgeprägtes Informationsdefizit und andererseits artikulieren sie auch ein gesteigertes Informationsbedürfnis. Es wird primär gebündelte, leicht zugängliche Information allgemein zum Thema Behinderung sowie im speziellen die Thematik Behinderung und Mobilität betreffend vermisst. Parallel dazu wird aber auch ein "Informations-Dschungel" beklagt, in dem es äußerst schwierig ist, rasch und gezielt Informationen ausfindig zu machen. Diesbezüglich gewünscht und angeregt wurde unter anderem die Schaffung von so etwas wie einer "Informations-Koordinationsstelle", die Informationen bündelt, leicht zugänglich und abrufbar macht.
Int.: "Wenn es um Informationen zur Mobilität geht, auf was greifen Sie da zurück?"
Fr. Q.: "Ich telefoniere mich zu Tode."
Int.: "Was würden Sie sich wünschen?"
Fr. Q.: "Eine Zentralstelle, die sich wirklich auskennen, die wirklich echte Erfahrungen haben aus der Praxis. (...) Es gibt keine Stelle die irgendwie alles koordiniert und von überall ein bisserl weiß. Und wenn Sie dir nur sagen, dort müssen Sie hin, oder dort müssen Sie hin. Das gibt's nicht. -Tonbänder, Tonbänder, Tonbänder."
Fr. H.: "Was ganz fein wäre und ich nicht kenne ist, so eine zentrale Stelle, oder Beratungsstelle wo man wirklich diese Informationen bekommen kann, alles was mit Behinderung oder Zugänglichkeit oder so zu tun hat."
Um adäquate Informationen geben zu können, kommt es aber auch auf das nötige Bewusstsein bzw. Know-how in bestehenden Service- oder Informationsstellen an. Dieses vermissen die Interviewten manchmal:
Hr. B.: "(...) auf die Servicestelle bezogen - Wenn ich anrufe und frage, ob diese Station wo ich hin will einen Aufzug hat. Und dann ist es mir auch schon passiert, bitte, dann sagt mir die, ja, sie hat einen Aufzug - Fahr bis dorthin; weißt du wo der Aufzug war bzw. wie der Aufzug zu erreichen war? Hätte ich erst wieder müssen fünf Stiegen hinaufgehen. Warum kann mir die Dame oder der Herr dort nicht sagen, ja, es gibt einen Aufzug, aber sie müssen fünf Stiegen hinaufgehen. (...) Ja, und das ist für mich eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Weil, wenn der mir sagt, ja, es gibt einen Aufzug, aber sie müssen fünf Stiegen hinaufgehen und ich sage ihm schon vorher - weil das ist das allererste was ich mach wenn ich anruf - sage, ich bin E-Rollstuhlfahrer. Und das ist der Punkt. (...) Wir sind wirklich hingefahren (...) weil ich hab nicht einmal im Traum daran gedacht (...) ob da zum Aufzug Stiegen hin sind (...), aber ich frag mich auch, wenn ich davon ausgehe, dass ein Aufzug ist, dass ich den auch erreichen kann."
Kritik wurde laut, dass die für die spezifischen Informationen vermeintlich zuständigen Stellen spärlich bis gar nicht ein Info-Service für mobilitätsbehinderte Menschen und damit auch nicht für RollstuhlfahrerInnen anbieten oder die erhaltenen Informationen oftmals ungenügend sind. Ebenso wurde von manchen InterviewpartnerInnen betont, dass dieses Nicht-Aufscheinen von behindertenspezifischen Informationen dafür symptomatisch ist, dass es an Bewusstsein in diesem Bereich mangelt und ebenso, dass diese Personengruppen mit ihren Bedürfnissen gewissermaßen ausgeblendet und nicht ernst genommen werden.
Fr. T.: "Also ich wünsche mir gerade beim Verkehr schon den Service von denen, die es angeht also von den "Wiener Linien", weil wenn Freunde von mir von irgendwo herkommen, dass die einfach zum Service Schalter gehen können und sagen, gibt es ein Verzeichnis wo ich schauen kann, wo gibt es die Lifte? welche Linien sind mit Rollstuhl benutzbar? (...) das wünsche ich mir von den "Wiener Linien", weil die sind dafür zuständig."
Fr. Sch.: "Im öffentlichen Raum existieren behinderte Leute eigentlich kaum; weder mit irgendwelchen Informationsmaterialien noch mit Hinweisschildern zu Behinderteneingängen."
Die von den RollstuhlfahrerInnen angesprochenen Informationsdefizite bzw. -bedürfnisse können grob in drei Kategorien eingeteilt werden:
-
Informationen, die direkt im Kontext ihrer räumlichen Mobilität stehen. Das sind Informationen betreffend der Verkehrsmittel (öffentliche Verkehrsmittel, Individualverkehr, Fahrtendienste) oder Fortbewegungsweise ("zu Fuß", per Transportmittel, begleitet/unbegleitet). Fragen wie z.B.: Welche Verkehrsmittel sind für mich als RollstuhlfahrerIn benutzbar? Wie sind diese benutzbar? Wo können Schwierigkeiten auftauchen? Wie komme ich am besten, schnellsten, günstigsten, angenehmste etc. von A nach B? Wo kann ich mich informieren? etc. stehen diesbezüglich im Blickpunkt der Nachfrage.
-
Informationen im "weiteren" Kontext von Mobilität. Das sind Informationen, die entweder die Qualität der Fortbewegung stark beeinflussen können (z.B. die individuell adäquate Rollstuhlwahl) und/oder die Relevanz für den Zugang zu (halb-)öffentlichen Einrichtungen (WC, Geld- und Fahrscheinautomaten, usw.) oder Gebäuden besitzen.
-
Allgemeiner Informationsbedarf an behinderungsspezifischen Themen.
Bei der Befragung lag verständlicher Weise der Fokus auf erstem und zweitem Aspekt. Folglich wird beispielhaft auf einige genannte Defizite und deren Bedeutung für bzw. Auswirkung auf die Mobilität hingewiesen:
Informationsmangel und Informationsbedarf wurde vor allem hinsichtlich der Benutzungs(möglichkeiten) der Öffentlichen Verkehrsmittel artikuliert. (Wie) kann ich einen Bus überhaupt benutzen? Wie funktioniert die Benutzung der Rampe bei den Bussen? Welche Straßenbahn-Linien sind für RollstuhlfahrerInnen benutzbar und zu welchen Zeiten verkehren diese? Gibt es in allen U-Bahn-Stationen einen Lift? Kann ich als Rollstuhlfahrer überhaupt die U-Bahn benutzen und was muss ich dabei beachten? Was mache ich, wenn der Lift nicht funktioniert? etc. Fragen dieser Art sind für die Interviewten Thema in ihrer alltäglichen Mobilität. Für RollstuhlfahrerInnen ist es von größter Bedeutung, über bestimmte mobilitätsrelevante Informationen im Vorfeld der Mobilität zu verfügen, da sie nur so die Möglichkeit haben, sich zu orientieren, zu organisieren und auf etwaige Barrieren frühzeitig zu reagieren. Eine solche Barriere kann beispielsweise ein unbenutzbarer Aufzug sein.
Fr. Q.: "Oder das wär auch gut, so eine Information wenn die Lifte nicht funktionieren. (...) Ich mein, dass du das vorher weißt. (...) Ob ein Lift funktioniert oder nicht, ist für einen Rollstuhlfahrer wesentlich."
Zu einer Barriere kann mangelnde Information aber auch in dem Sinn werden, dass aufgrund von Uninformiertheit ein Verkehrsmittel subjektiv als unbenutzbar eingestuft und daher nicht benutzt wird, obwohl es eigentlich durchaus benutzbar wäre oder aufgrund der Unwissenheit die Benutzung mühsamer als nötig wird. Wie bereits weiter oben erwähnt, hat Information Einfluss auf die Inanspruchnahme und Benutzung(swahrscheinlichkeit) von Verkehrsmitteln, die Qualität der Mobilität, usw.
Int.: "Es gibt bei den Bussen eine Rampe die der Buschauffeur ausklappt."
F(reundin) v. Hr. N.: Das hab ich noch nie gesehen, dass das einer gemacht hätte."
Hr. N.: "Ich kenn das auch nicht. Nur absenken."
Int.: "Also das war noch nie?"
Hr. N.: "Ich hab gar nicht gewusst, dass das geht."
Häufig thematisiert wurde Informationsmangel in folgenden Zusammenhängen:
-
Behindertenparkplätze
Fr. L.: "Das Hauptproblem ist oft, dass man nicht weiß wo sie sind, die Behindertenparkplätze. Wir haben einmal bei der Polizei nachgefragt, ob es möglich ist, das irgendwie in einer Form auszudrucken, oder Bescheid zu geben wo welche sind. Und das war nicht möglich."
-
Status als VerkehrsteilnehmerIn
Int.: "Wann fahren Sie auf einem Radweg z.B. und wann nicht?"
Hr. I.: "Naja, ich bin mir nicht ganz sicher manchmal z.B. ob Polizisten mich akzeptieren als Fahrer."
-
Öffentliche Behinderten-WC
Hr. F.: "(...) wenn ich irgendwo wüsste wo es in Wien angenehme WCs gäbe, wo man mit dem Rollstuhl hineinkommt."
-
Zugang zu (öffentlichen) Gebäuden und Geschäften - einer der am häufigsten genannten Punkte.
Hr. I.: "(...) und wo auch vielleicht in öffentlichen Gebäuden, ob da ein Lift ist, ob da eine Rampe ist."
-
Rollstuhlwahl
Fr. Q.: "Heute würde ich mir einen anderen E-Rollstuhl anschaffen. Aber wo finde ich bitte die ganzen E-Wagerl-Hersteller auf einen Haufen und wo kann man was probieren?"
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Information bzw. Informationsmangel Auswirkungen hat auf:
-
die Steigerung/Reduktion selbstständiger Mobilität: Das heißt, die Weg-Planung und -Organisation kann mehr oder weniger gezielt erfolgen. Ungewissheiten (Wie ist die Zugänglichkeit des Zielortes? Wie komme ich sicher zum Ziel-Ort? Was ist, wenn der Lift nicht funktioniert etc.) können reduziert werden und dadurch auch die individuelle Mobilität erhöht werden. Es könnte teilweise sogar auf Assistenz oder Begleitung im Rahmen der alltäglichen Mobilität verzichtet werden.
-
die Qualität der Mobilität: Adäquate Informationen bewirken Erleichterungen (weniger Ärger, Stress, unliebsame Überraschungen, usw.) in der alltäglichen Mobilität. Bauliche und/oder Benutzungsbarrieren in der Verkehrsumwelt könnten im Vorfeld besser erkannt und dementsprechend darauf reagiert werden. RollstuhlfahrerInnen können sowohl bedingt durch die körperliche Einschränkung und das Angewiesensein auf den Rollstuhl als auch aufgrund der barrierebehafteten Umwelt teilweise nicht so flexibel in bestimmten Situationen reagieren. Informationen könnten dabei "ausgleichend" wirken.
-
die Verkehrsmittelwahl: Wenn ein/e RollstuhlfahrerIn nicht weiß, dass bzw. wie ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzt werden kann, dann wirkt sich dies auf die tatsächliche Inanspruchnahme negativ aus.
-
die Sicherheit bei der Mobilität: Kompetente Information würde beispielsweise die "richtige" und sichere Benutzung spezifischer Verkehrsmittel erhöhen und so ein Verunfallungsrisiko mindern.
Mobilität ist für die RollstuhlfahrerInnen ein Grund-Bedürfnis und eine Voraussetzung, um in allen Lebensbereichen (Arbeit, Freizeit, Versorgung, Wohnen, etc.) voll partizipieren zu können.
Die Befragten präferieren, selbstständig und selbstbestimmt mobil zu sein. Die Befragten möchten so weit wie möglich ohne (fremde) Hilfe ihre Wege zurücklegen können oder wenn Hilfe benötigt wird, möchten sie selber entscheiden bzw. wählen können, wer diese Hilfe leisten soll und in welcher Form die Hilfe benötigt wird. Generell werden von den RollstuhlfahrerInnen vor allem jene Verkehrsmittel bevorzugt, die eine selbstständige und unabhängige Mobilität ermöglichen. Mit (selbstbestimmter) Mobilität wird nicht nur ein hohes Maß an Unabhängigkeit verbunden, sondern Mobilität führt für die interviewten Personen gerade auch dazu. Es könnte gewissermaßen von einem "Emanzipationseffekt" gesprochen werden, den (gesteigerte) Mobilität für die Befragten mit sich bringt. Mobilsein-Können ist für die Interviewten auch ein wichtiger Aspekt für das Selbstbewusstsein bzw. prägt die Identität.
Den RespondentInnen ist es besonders wichtig, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, da sie dadurch gleichberechtigt wie alle anderen Menschen am öffentlichen Verkehrsleben teilhaben können und nicht abgesondert werden.
Mobilität heißt für die Befragten:
-
Nicht behindert zu werden, sich "normal" bewegen zu können:
Fr. H.: "Das erste Mal wie ich in Amerika war hab ich wirklich so erlebt als hätte ich keine Behinderung. Es war so ein unglaublich befreiendes Gefühl, das können Sie sich gar nicht vorstellen. (...) zur Alltagsbewältigung, zur Fortbewegung bin ich ja selbstständig wenn die Gegebenheiten entsprechend sind. Und in Amerika sorgt man dafür, dass das ist und damit spürt man die Behinderung was jetzt den Bewegungsradius anbelangt eigentlich überhaupt nicht mehr. Bei uns ist das so, dass immer wieder Kleinigkeiten auftauchen wo man sich denkt, das ist eigentlich nicht notwendig und damit wird wieder die Behinderung und die Abhängigkeit vor Augen geführt in Bereichen wo es wirklich nicht notwendig ist. (...)"
Int.: "Also, behindert werden?"
Fr. H.: "Auf alle Fälle. Ich fühle mich wirklich auch behindert gemacht. Keine Frage, weil ich kenn's anders."
-
Integration: nicht (räumlich) aus- bzw. eingeschlossen zu werden; sich wie die anderen Menschen auch öffentlichen Verkehrs-Raum aneignen zu können und damit auch Zugang zu öffentlichem Raum sowie damit verbunden auch zu sozialen Räumen zu haben; sich mit anderen Menschen auszutauschen, zu kommunizieren.
Hr. F.: "Integration ist für mich (...) Kommunikations-und Mobilitätsmöglichkeiten auf allen Ebenen. (...) Wahlmöglichkeit muss gegeben sein. Die Möglichkeiten zur Begegnung und Auseinandersetzung in allen Lebensbereichen."
-
Selbstbestimmung: über den eigenen Körper in seiner räumlich-zeitlichen Positionierung eigenständig und selbstbewusst verfügen zu können; soweit wie möglich, diesbezügliche Entscheidungs- und Wahlfreiheit zu besitzen.
Hr. B.: "Mobilität bedeutet für mich ein enormes Stück Freiheit. Ich bin einfach ungebunden. Im weitesten Sinne gesehen auf niemanden anderen, außer mich selbst, angewiesen. Hebt und steigert und fördert natürlich irrsinnig das Selbstbewusstsein. Und ich möchte die Mobilität, die ich jetzt habe, die ich mir erarbeitet habe sicher nicht mehr missen. Und, ja, Mobilität bedeutet kurzum für mich wirklich alles, das heißt, frei sein (...) wie ein Vogel der, wenn er Lust hat, wenn er irgendwo sitzt und Lust hat wegzufliegen, dann fliegt er einfach weg. Dann streckt er seine Flügel aus, schlägt mit den Flügeln, hebt ab und ist frei. Ja, und genauso vom Gefühl her ist es für mich auch."
RollstuhlfahrerInnen haben in ihrer alltäglichen Mobilität in Wien mit mannigfaltigen Barrieren zu kämpfen, sei es auf ihren Arbeits-, Freizeit- oder Versorgungswegen. Die Mobilitätsbedingungen in Wien werden von den Befragten als einschränkend und problembehaftet erfahren. Die Barrieren können gegliedert werden in: Strukturelle, soziale sowie informationsbezogene Barrieren.
Strukturelle Barrieren im öffentlichen Verkehrsraum und bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Zum Hindernis kann einerseits der gebaute Straßen- und Verkehrsraum an sich bzw. bauliche Elemente des Straßenraums (nicht oder zu wenig abgeschrägte Randsteine, Stufen, Kopfsteinpflaster etc.) und andererseits fix verankerte oder vorübergehend platzierte Objekte bzw. Einrichtungen im Straßenraum werden (Straßenbahnschienen, Wahlplakatständer, abgestellte/parkende Autos etc.). Stufen, die quasi die "Schwellen" zwischen den öffentlichen oder privaten Gebäuden und dem öffentlichen Straßenraum bilden, verwehren RollstuhlfahrerInnen oftmals den Zugang zu (öffentlichen) Gebäuden, Geschäften, Lokalen etc.
Das heißt, Barrieren bei der Mobilität "zu Fuß" im öffentlichen (Straßen-)Raum werden für die Befragten manifest durch die bauliche Konstruktion des Raumes und dessen Einrichtungen, als sie auch auf ein mangelndes Problembewusstsein von nichtbehinderten VerkehrsteilnehmerInnen zurückzuführen sind.
RollstuhlfahrerInnen müssen, sobald sie sich in den öffentlichen Raum begeben damit rechnen, dass sie auf Hindernisse stoßen, die ihnen das Weiterkommen entweder gänzlich verunmöglichen oder für deren Überwindung bestimmte Anforderungen an sie gestellt werden: Um (potentielle) Barrieren schon im vorhinein auszuschalten bzw. um die Gefahr des Liegen-Bleibens "wie eine Schildkröte am Rücken", wie das ein Rollstuhlfahrer sehr bildhaft formuliert hat, zu minimieren, entsteht ein überdurchschnittlicher Planungs-, und Organisationsaufwand (Informationen müssen eingeholt, mögliche Risiken kalkuliert und minimiert, Hilfe organisiert werden etc.). Das heißt, spontanes, aber auch selbstständiges Bewegen im öffentlichen Raum ist reduziert zu Lasten einer verstärkten zeitlich-räumlichen Planungsnotwendigkeit, insbesondere wenn es sich um nicht alltäglich zurückgelegte, unbekannte Wege handelt. Diese permanente Risikokalkulation ist erforderlich, da jede Barriere bzw. deren Überwindung einen körperlichen und psychischen Energieaufwand für den/die RollstuhlfahrerIn darstellt. Es kann festgehalten werden, dass die (selbstständige) Fortbewegung "zu Fuß"/per Rollstuhl im öffentlichen Raum der Bewältigung eines Hindernisparcours gleicht, in dem es für die Betroffenen darum geht, ihren Zielort auf dem Weg des geringsten Widerstandes zu finden und zu bewältigen. Anders gesagt, nicht der kürzeste Weg zum Zielort kann oftmals gewählt werden, sondern der Weg des geringsten Widerstandes - auch wenn er einen zeitlich-räumlichen Umweg bedeutet - beeinflusst die Wege-"Wahl" entscheidend.
Anforderungen wie beispielsweise ein erhöhter Planungs- und Organisationsaufwand werden ebenso an RollstuhlfahrerInnen gestellt, sobald sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen möchten. Denn öffentliche Verkehrsmittel können selbstständig, das heißt ohne auf Begleitung oder fremde Hilfe zurückgreifen zu müssen, teilweise gar nicht oder nur zu erschwerten Bedingungen genützt werden.
Die Problembereiche bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind vielfältig:
Da in Wien nicht alle eingesetzten Busse in Niederflurbauweise und mit einer Rampe ausgestattet sind[79], sind manche Buslinien für RollstuhlfahrerInnen gänzlich unbenutzbar oder, da auf bestimmten Linien nicht durchgehend die Niederflurbusse eingesetzt werden, nur mit Einschränkungen in Anspruch zu nehmen. Weiters sind teilweise die Haltestellenkaps noch so gestaltet, dass es trotz Absenken des Busses und das Ausklappen der Rampe nicht möglich ist, selbstständig in den Bus zu gelangen, da die Rampe einen zu steilen Winkel aufweist.
Das von den Befragten am häufigsten und eindringlichsten geschilderte Problem bei der Busbenutzung stellt jedoch die offenbar mangelhafte Dienstauffassung mancher BuschauffeurInnen dar. Diese wären laut Dienstauftrag verpflichtet, die im Bus befindliche Rampe auszuklappen, um so die Benutzung des Busses durch RollstuhlfahrerInnen zu ermöglichen. Dass das teilweise gar nicht, teilweise nur auf Bitten und/oder mit Unwillen oder sogar mit verbalen Verunglimpfungen einher geht, lautet der Grundtenor bei den RespondentInnen.
Als hinderlich für die Einbindung der Straßenbahn in die individuelle alltägliche Mobilität können genannt werden:
-
Die meisten Straßenbahngarnituren in Wien sind aufgrund ihrer Bauweise (Stufen) für RollstuhlfahrerInnen unbenutzbar
-
Die ULF-Straßenbahnen, die für RollstuhlfahrerInnen grundsätzlich zugänglich wären, verkehren bislang nur auf einigen Linien bzw. teilweise auch nur sporadisch.
-
Die Haltestellen sind teilweise so gestaltet, dass trotz Niederflurstraßenbahn der Zugang zum Verkehrsmittel verwehrt bleibt (z.B. zu großer Spalt und Niveauunterschied zwischen Straßenbahn und Bordsteinkante)
-
Die elektrisch ausfahrbare Rampe, die im Vorderteil der ULF-Straßenbahn angebracht ist und den Spalt zwischen Straßenbahn und Bordsteinkante bis zu einem gewissen Grad überbrücken hilft, wird von den ChauffeurInnen zum Zeitpunkt der Befragung aufgrund technischer Probleme mehr oder weniger nicht betätigt.
Die Einführung der Niederflurwaggons wird allerdings sehr begrüßt und es besteht bei den Befragten die Hoffnung, dass bei rascher Umrüstung aller Straßenbahnen und Beseitigung der oben genannten Problematiken dieses Verkehrsmittel auch verstärkt genützt werden kann.
Die größten Schwierigkeiten im Rahmen der U-Bahn-Nutzung stellen sich wie folgt dar:
-
Der Spalt und Niveauunterschied zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante ist für RollstuhlfahrerInnen eine Hürde, für deren Bewältigung entweder eine gewisse Technik ("Kippen") oder Hilfe nötig ist. Die Gefahr mit den Rädern im Spalt hängen zu bleiben oder überzukippen ist ständig präsent. Für "E"-RollstuhlfahrerInnen ist der Spalt ohne Hilfe kaum zu bewältigen.
-
Die Ein- bzw. Ausstiegssituation ist für die RollstuhlfahrerInnen ein kritischer, physisch und psychisch belastender Moment, gerade dann, wenn die U-Bahn selbstständig benutzt werden möchte.
-
Zum Erhebungszeitpunkt (2001) waren noch nicht alle U-Bahnstationen mit Aufzügen zugänglich. Dies hat sich zwar mittlerweile geändert, dennoch stellen die Aufzüge auch weiterhin einen Risikoaspekt für die Benutzung dar: Fällt ein Aufzug aus, kann es sein, dass die Fahrt entweder bereits vor dem Antritt ihr Ende findet oder sie quasi mittendrin abgestoppt wird und die RollstuhlfahrerInnen nur über langwierige Umwege zu ihrem Ziel gelangen. In diesem Zusammenhang wurde von den Befragten der Wunsch nach einem Informationssystem laut, dass einem den Ausfall eines Liftes mitteilt, um so zumindest im voraus planen zu können. Hier ist mittlerweile ebenfalls positiv zu vermelden, dass die "Wiener Linien" in einer Service-Hotline über ausgefallene Aufzüge informieren.
Die RespondentInnen betrachten die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Arbeits- oder Freizeitfahrtendienstes grundsätzlich als positiv, da sie von Tür-zu-Tür transportiert werden und dadurch die Barrieren bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel weg fallen.
Die Probleme bei der Benutzung des Fahrtendienstes konzentrieren sich primär auf die zu langen (Vor-)Bestellzeiten bzw. deren Nichteinhaltung. Der Fahrtendienst wird mit Abhängigkeit und mangelhafter Spontanität assoziiert und es wird versucht, ihn eher zu meiden oder sich von der Nutzung zu "emanzipieren" (gerade jene RollstuhlfahrerIn, die von Kindheit an damit unterwegs waren, geben dies an). Die Befragung zeigte, dass mit einer jahre- oder jahrzehntelangen Benutzung des Fahrtendienstes offenbar der Orientierungssinn in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies kann für die "normale" Fortbewegung im öffentlichen Raum Probleme für die RollstuhlfahrerInnen verursachen.
Soziale Barrieren werden im Kontext der individuellen Mobilität einerseits über die Interaktion mit dem Personal der öffentlichen Verkehrsbetriebe und Fahrtendienstfirmen und andererseits über die Interaktion mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen wirksam.
Die befragten Personen sehen sich teilweise nicht als gleichwertige KundInnen, sondern als solche "zweiter Klasse", die sich mit unprofessionellem, ignorierendem oder gar diskriminierendem Verhalten seitens des Personals auseinander setzen müssen.
Der Kontakt zu anderen VerkehrsteilnehmerInnen gestaltet sich unterschiedlich: von entgegengebrachter Hilfsbereitschaft bis hin zu verbalen Attacken und Diskriminierungen.
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass viele der Interviewten damit konfrontiert sind, dass ihnen oftmals mit vorgefassten, stereotypen "Behinderten-Bildern" (arm, hilfsbedürftig, asexuell, usw.) begegnet wird bzw., dass die Erwartung besteht, dass sich "der/die Behinderte" adäquat diesen imaginierten "Behinderten-Bildern" zu verhalten habe. Es sind neben direkten verbal diskriminierenden Bemerkungen vor allem scheinbare "Kleinigkeiten" wodurch sich die RollstuhlfahrerInnen abgewertet, nicht als gleich- und vollwertige Mitglieder der Gesellschaft gesehen und behandelt fühlen.
Aufgrund der barrierebehafteten Mobilitätsbedingungen sind RollstuhlfahrerInnen besonders auf (gezielte und korrekte) Informationen angewiesen, die ihnen die Fortbewegung im öffentlichen Raum bis zu einem gewissen Grad erleichtern würde, da sie dadurch zumindest vorausplanend agieren können.
Von den befragten Personen wird einerseits ein Informationsdefizit im Zusammenhang mit ihrer Mobilität beklagt bzw. ein Informationsbedürfnis artikuliert. Andererseits wird ein unübersichtlicher "Informationsdschungel" reklamiert, in dem es äußerst schwierig ist, sich rasch und gezielt die benötigten Informationen beschaffen zu können.
Informationsmangel besteht primär hinsichtlich
-
der Zugänglichkeit/Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden,
-
der individuell adäquaten Rollstuhlwahl für die Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum,
-
bei Bedarf, sich an verantwortliche Ansprechpersonen für Auskünfte oder auch Beschwerden richten zu können,
-
mobilitätsrelevanter Rahmenbedingungen wie z.B. "Behindertenparkplätze", öffentliche WC für behinderte Menschen
-
sonstige behinderungsspezifische Informationen.
Der Wunsch nach gebündelten Informationen (auch über den Mobilitätsaspekt hinausgehend) etwa durch die Schaffung einer zentralen Informationsstelle wurde von Befragten geäußert.
[51] Ich darf daran erinnern, dass die Erhebung des Datenmaterials im Auftrag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Wien im Rahmen des vom Bundessozialamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland geförderten und aus den Mitteln der österreichischen Beschäftigungsoffensive (2001) finanzierten Projekts "RollstuhlfahrerInnen in Wien", zwischen Februar und August 2001 durchgeführt wurde.
[52] Der Ausdruck Fortbewegung "zu Fuß" meint, die Fortbewegung mit dem Rollstuhl im öffentlichen Verkehrsraum ohne die Benutzung eines Verkehrsmittels. Da sich der/die RollstuhlfahrerIn aber bei seiner/ihrer individuellen Mobilität mehr oder weniger immer im bzw. mit dem Rollstuhl fortbewegt, wurde "zu Fuß" als Behelfsbegriff gewählt.
[53] Unter "theoretical sampling" bzw. "theoretischem sampling" ist zu verstehen, dass die Auswahl der Zielgruppe aufgrund theoretischer Erwägungen, die für die Untersuchung besonders wichtig erscheinen, erfolgt. Genaueres dazu siehe bei Lamnek 1995: 148fff.
[54] Auch die rollstuhlgerechte Benutzbarkeit bzw. Ausstattung der Gebäude wurde im Zuge der Interviews immer wieder thematisiert, beispielsweise ob eine rollstuhlgerechte Toilette vorhanden ist, oder nicht usw.
[55] Im Rahmen der Erhebung sowie bei der Analyse steht jedoch die Mobilität/das Mobilitätsverhalten im öffentlichen Verkehrsraum im Mittelpunkt des Forschungsinteresses.
[56] Im Weiteren wird für Interviewer die Abkürzung "Int." Verwendet.
[57] "Rollstuhl ist nicht gleich Rollstuhl. Standardrollstühle, Pflegerollstühle oder Geriatrierollstühle werden vom Arzt stark gehbehinderten und alten Leuten verordnet. In Leichtgewicht- oder Aktivrollstühlen [in der von mir verwendeten Terminologie "M-Rollstühle"; Anmerkung T.E.] sitzen vorwiegend querschnittgelähmte Personen und Multiple Sklerose-(MS-)Patienten. Der Aktiv-Rollstuhl hat den Vorteil, dass er durch seinen Faltmechanismus leicht in einem PKW transportiert werden kann. Im Gegensatz dazu ist ein Elektrorollstuhl (E-Rollstuhl) durch seine Größe und Schwere nur in Kombis oder in Kleintransportern zu transportieren. Ein E-Rollstuhl wird Personen verordnet, die wenig oder keine Kraft in den Armen oder eine fortschreitende Muskelerkrankung haben. Auch die Kosten spielen bei der Anschaffung eines Rollstuhls eine wesentliche Rolle. Ein Aktivrollstuhl ist ab ca. € 1.500,- erhältlich, ein E-Rollstuhl hingegen nicht unter € 5.000,-. Der Preisunterschied erklärt sich beim E-Rollstuhl aus der elektronischen Steuerung und der Batterie, die ihn antreibt. Bei den Batterien ist wiederum zwischen Nass- oder Trockenbatterien zu unterscheiden, denn Elektrorollstühle dürfen nur auf Flugreisen mitgenommen werden, wenn sie mit einer Trockenbatterie ausgestattet sind. Jeder Aktivrollstuhl hat neben einer Sitzfläche und einer Rückenlehne auch Fußstützen, Seitenteile, Greifreifen und Bremsen. E-Rollstühle haben zusätzlich einen Sitzgurt, damit man während der Fahrt von bis zu 10 km/h nicht heraus fällt, und Feststellbremsen. Eine Kopfstütze ist obligatorisch." (Firlinger/Integration:Österreich 2003: 108)
[58] Beispielsweise muss, um zum Arbeitsplatz zu gelangen, zuerst der Weg von der Wohnung zur U-Bahn, dann muss vielleicht in einen Bus umgestiegen und von der Zielhaltestelle erneut ein Fußweg zurückgelegt werden.
[59] Angemerkt werden möchte, dass sich die im Rahmen dieser Aufzählung gewählten Begrifflichkeiten und jeweiligen Zuordnungen nicht (streng) an die Definitionen der StVO halten, beispielsweise gehören Randsteine lt. § 31 StVO zu den "Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs".
[60] Eine abgeflachte Gehsteig- bzw. Bordsteinkante sollte laut ÖNORM nicht höher als 3cm sein. (vgl. Wollersberger 2004: 4) Ist sie höher, so kann sie von RollstuhlfahrerInnen nicht oder nur schwer bewältigt werden.
[61] Manche fahren, um besser gesehen zu werden, eher in der Mitte der Fahrbahn, manche gegen die Fahrtrichtung der Autos um das entgegenkommende Fahrzeug schneller und besser zu sehen; generell wird so genanntes "Parkplatzhopping" betrieben, das heißt, es wird nach Parklücken Ausschau gehalten, die bei nahendem Auto eventuell aufgesucht werden können und Sicherheit bieten.
[62] Mehr als zwei Drittel der Befragten besitzen einen Führerschein und die meisten von ihnen auch ein eigenes, adaptiertes Auto. Anzumerken ist, dass es hauptsächlich aus Kostengründen für E-RollstuhlfahrerInnen wesentlich schwieriger ist über ein Auto zu verfügen als für M-RollstuhlfahrerInnen, bei denen sich meist die notwendigen Adaptierungen weniger aufwändig und kostspielig gestalten.
[63] Abgesehen davon ist das Auto für manche selbstverständlich auch eine berufliche Notwendigkeit oder es ermöglicht die (selbstständige) Erledigung von größeren Einkäufen und Besorgungen.
[64] Fast alle interviewten AutobesitzerInnen sind so genannte "SelbstfahrerInnen". Das heißt, sie können das adaptierte Auto ohne fremde Hilfe benützen und steuern.
[65] Unterschieden werden kann zwischen so genannten "Behindertenzonen", die ausschließlich von einer bestimmten Privatperson (diese muss RollstuhlfahrerIn und SelbstlenkerIn sein), sei es am Wohn- oder auch am Arbeitsort, benützt werden darf (gekennzeichnet durch das polizeiliche Kfz-Kennzeichen der jeweiligen Person). Voraussetzung dafür ist unter anderem der Ausweis gemäß § 29b StVO und ein entsprechender Antrag ist bei der zuständigen Behörde zu stellen. Den Antrag kann entweder die Privatperson selbst, oder eine Firma, Behörde etc. für eine(n) Mitarbeiter(in) stellen. Zum anderen gibt es Behindertenzonen (sind am häufigsten), die generell für § 29b StVO-AusweisinhaberInnen benutzbar sind.
[66] Es werden diesbezüglich von den RollstuhlfahrerInnen stärkere Kontrollen der Behindertenzonen durch die Exekutive gefordert, aber auch mehr Information darüber, wo sich die Behindertenzonen in Wien befinden.
[67] Wenn folglich von den öffentlichen Verkehrsmitteln die Rede ist, wird implizit auf die "Wiener Linien" Bezug genommen, da sie die mit Abstand größten Verkehrsmittelbetreiber in Wien sind.
[68] Eine für die mobilitätsbehinderten Fahrgäste erfreuliche Entwicklung ist, dass bis Ende des Jahres 2006 nur mehr Niederflurbusse unterwegs sein sollen. (vgl. 6.2.1)
[69] M-RollstuhlfahrerInnen, die das "Kippen" beherrschen, die körperlich fit genug sind, können theoretisch den Niederflurbus auch ohne das Ausklappen der Rampe benützen. Bedingung dafür ist allerdings genaues Anfahren der Haltestelle und Absenken des Busses durch den Busfahrer/die Busfahrerin sowie eine gewisse Risikobereitschaft der RollstuhlfahrerInnen.
[70] Der Vorteil der mechanischen Klapprampe ist gerade der, dass sie kaum defekt sein kann!
[71] Eine Begleitperson ist laut telefonischer Auskunft der Wiener Linien (27. 2. 2002) bei der Benutzung von Niederflurbussen nicht mehr nötig.
[72] Die ULF-Straßenbahn-Garnituren verkehren nur auf einigen Straßenbahnlinien und teilweise auch nicht durchgehend.
[73] Wenn von "der" U-Bahn gesprochen wird, so ist die Rede von den so genannten "Silberpfeilen", welche den Hauptteil der Wiener U-Bahn-Garnituren stellen.
[74] Vor allem unter den M-RollstuhlfahrerInnen, die auch körperlich so fit sind, dass sie "Kippen" und somit den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante überwinden können. Für die meisten E-RollstuhlfahrerInnen ist es kaum möglich, selbstständig die U-Bahn zu benützen, weil bei ihnen noch erhöhtere Gefahr besteht mit den Rädern im Spalt hängen zu bleiben und/oder aus dem Rollstuhl geschleudert zu werden.
[75] Die Türen der "Silberpfeile" sind nur mechanisch zu öffnen. Bei den U-Bahn-Garnituren, die auf der U6 verkehren sowie den "V-Wagen" lassen sich die Türen elektronisch öffnen.
[76] An dieser Stelle sei klar und deutlich darauf hingewiesen, dass sich die Kritik der InterviewpartnerInnen auf die Benutzungsbedingungen und nicht auf den Fahrtendienst als Einrichtung an sich richten!
[77] Die Einsatzzeit des Fahrtendienstes ist lt. Vertag zwischen den diversen Firmen und der MA12 von 6 bis 24 Uhr bzw. sollten die Fahrtaufträge zwischen 7 bis 23 Uhr angenommen (am Wochenende eingeschränkt) werden.
[78] Laut der Behindertenansprechperson bei den ÖBB (Zentrale Behindertenansprechstelle Wien) gibt es interne Schulungen des Personals, speziell auf behinderte FahrgästInnen bezogen. (EI 7, 2001)
[79] Zum Befragungszeitpunkt 2001 war dies der Fall. Erfreulicher Weise hat sich die Situation mittlerweile dahin verändert, dass es fast flächendeckend Niederflurbusse gibt. Bis Ende des Jahres 2006 sollen, laut telefonischer Auskunft der "Wiener Linien", 19.10.2006, überhaupt nur mehr Niederflurbusse verkehren.
Inhaltsverzeichnis
Im Fazit werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse dieser Diplomarbeit zusammengefasst. Daran anschließend werden auf Basis der durch die empirische Untersuchung gewonnenen Ergebnisse, Maßnahmenvorschläge aufgezeigt, die zu einer Verbesserung der Mobilitätssituation von Menschen mit Behinderungen beitragen können. Der primäre Fokus ist dabei auf die Zielgruppe der RollstuhlfahrerInnen in Wien gerichtet. Die Darstellung erfolgt analog den Problem- bzw. Barrierefeldern: Gebauter (öffentlicher) Verkehrs-Raum, Transportsysteme, Information und Sozialer Aspekt. Ebenso werden aktuellere innovative Good-Practice-Beispiele vorgestellt.
Mobilität ist nicht nur ein Teilbereich sozialer Exklusion, sondern ist als machtvolle Ressource auch ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt hinsichtlich der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, hinsichtlich der Teilhabe an allen Bereichen, in denen sich soziale Exklusion manifestieren kann (z.B. Erwerbsarbeit, soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe). Mobilität ermächtigt einerseits zu individuellem Handlungsvermögen und bildet andererseits den Zugang zu den ökonomischen, sozialen und kulturellen Ressourcen bzw. Kapital.
Damit Menschen mit Behinderungen am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben voll teilhaben können, ist die Realisierung und die Gewährleistung von Mobilität ein zentraler Aspekt. Nur dadurch kann auch volle gesellschaftliche Inklusion sowie ein Recht auf Teilhabe umgesetzt werden. Es nützt z.B. der behinderten Person ein Arbeitsplatz nichts, wenn dieser nicht zugänglich ist.
Die Schaffung der Rahmenbedingungen zu "inklusiver Mobilität" (barrierefreie Mobilitätsbedingungen für alle Menschen, selbstbestimmte und gleiche Teilhabechancen beim Zugang zu bzw. der Nutzung der Ressource Mobilität) ist demnach eine gesellschaftspolitische Aufgabe, auf die aus menschen- und grundrechtlichen Gründen ein Anspruch geltend gemacht werden kann. Mobilität ist nicht nur auf eine Notwendigkeit reduzierbar, sondern sollte als Recht angesehen werden, das jeder Bürgerin und jedem Bürger zustehen sollte. (vgl. Pauls 2001)
Menschen mit Behinderungen sind (in Österreich) sowohl von sozialer Exklusion besonders bedroht und betroffen als auch von den ausschließenden, normativen Strukturen einer Mobilitätsrealität, die die Anforderungen und Bedürfnisse von (mobilitäts)behinderten Personen kaum zu berücksichtigten scheint. In den letzten 15 Jahren erhielt jedoch in der europäischen wie in der österreichischen Behindertenpolitik die Bekämpfung sozialer Exklusion von Menschen mit Behinderungen zunehmend Aufmerksamkeit. Gerade von Seiten der europäischen Behindertenpolitik gingen wichtige Impulse (Richtlinien, Maßnahmen, gesetzliche Vorschriften, Empfehlungen, Aktionsprogramme etc.) für die nationale Behindertenpolitik aus, die unter anderem auch dem Bereich der Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der Umwelt einen wichtigen Stellenwert zur Inklusion und vollen Teilhabe beimessen.
Das Thema der Zugänglichkeit der Umwelt im allgemeinen und der barrierefreien Mobilität im speziellen hat sich im behindertenpolitischen Diskurs in Österreich verankert, ist Teil behindertenpolitischer Programme und Richtlinien und ist zu einem Ziel politischer und rechtlicher Interventionen in den letzten Jahren avanciert. Die staatliche Behindertenpolitik erhielt dabei Schubkraft von einer Behindertenbewegung, die sich im Kampf um Inklusion und Gleichstellung zusehends besser vernetzt und durch selbstbewusstes Auftreten bzw. Agieren als ernstzunehmende Akteurin im politischen Feld zu etablieren begann.
Eine Tendenz, weg von paternalistischen Denkmustern in der Behindertenpolitik, hin zu Prinzipien der Anerkennung behinderter Menschen als Subjekte gesellschaftspolitischen Handelns ist erkennbar und manifestiert sich z.B. in einer vermehrten Einbeziehung der Betroffenen in (politische) Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene.
Behindertenpolitik und das Mobilitätsfeld sind in Österreich rechtliche wie politische Querschnittsmaterien. Wir haben es mit einer hohen Anzahl von involvierten, unterschiedlichen und entscheidungstragenden AkteurInnen in mehreren Politikfeldern (Verkehrspolitik bzw. -planung, Baupolitik bzw. -planung, ArchitektInnen, Sozial- und Gesundheitspolitik, Antidiskriminierungspolitik, BürgerInnen usw.) auf vielfältigen Kompetenzebenen (Bund, Länder, Gemeinden, Private etc.) zu tun. In diesem Kontext sind Mängel in der Koordination zwischen den verschiedenen Organisationen sowie bei der Vollziehung und Durchsetzung rechtlicher Regelungen zu konstatieren, die dazu führen, dass z.B. länderspezifisch variierende Standards für Barrierefreiheit und folglich unterschiedliche Rahmenbedingungen zur Mobilität bestehen.
Die Schaffung rechtlicher Verbindlichkeiten erhielt in Österreich tendenziell in den letzten 15 Jahren stärkere Aufmerksamkeit im Rahmen der Durchsetzung von Gleichstellung und Inklusion behinderter Menschen - auch im Mobilitätskontext. Zu nennen sind dabei z.B. das Benachteiligungsverbot sowie das Bekenntnis zur Gleichbehandlung in Artikel 7 der Bundesverfassung (1997), das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen und zur Gewerbeordnung (1997), das öffentliche Personennah- und Regionalverkehrsgesetz (2000) oder das 2006 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz. So begrüßenswert diese gesetzlichen Bestimmungen sind, da sie einerseits eine Signalwirkung darstellen und andererseits auch gewisse (rechtliche) Möglichkeiten bieten, Benachteiligungen und Diskriminierungen im Mobilitätsbereich zu verhindern. Dennoch ist festzuhalten, dass sie z.B. Schlupflöcher (Stichwörter: "finanzielle Unzumutbarkeit", "Interessensabwägung", "Denkmalschutz-Aspekt") aufweisen und damit "zahnlos" bleiben: Bestimmungen z.B. nur beim Neu- oder Umbau von Anlagen zum Tragen kommen, die gesetzlichen Maßnahmen nicht weit genug gehen und dadurch lediglich punktuelle Verbesserungen möglich sind, vielfach keine wirklichen zivilrechtlichen Einklagemöglichkeiten für Betroffene bestehen, existierende Vorschriften in der Ausführung nicht eingehalten, mangelhaft umgesetzt und zu wenig kontrolliert werden, keine österreichweit einheitlich geltenden Standards geschaffen werden.
Generelle Aussagen zu den mobilitätsspezifischen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen oder im speziellen bezogen auf RollstuhlfahrerInnen in Österreich lassen sich nur schwer treffen. Mobilitätsrelevante (gesetzliche) Regelungen oder Vorschriften wie beispielsweise Bauordnungen, Bestimmungen öffentlicher Verkehrsbetreiber, Bestimmungen für Fahrtendienste, Regelungen von Hilfsmittelzuschüssen, etc. variieren teilweise stark länder-, ja, sogar städtespezifisch.
Nach ausführlicher Recherche gibt es auch kein empirisches Datenmaterial, das die konkrete Mobilitätsbedingungen für Menschen mit Behinderungen österreichweit detailliert erfasst. Aufgrund regionaler Untersuchungen (z.B. Graz, Wien), Erfahrungsberichten Betroffener und der Einschätzungen von ExpertInnen lässt sich allerdings festhalten, dass von weitgehend barrierefrei benutzbaren öffentlichen Verkehrsmitteln, einem barrierefreien öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum oder einer barrierefreien Zugänglichkeit von (öffentlichen) Gebäuden in Österreich jedenfalls nicht gesprochen werden kann, weder zum Erhebungszeitpunkt 2001 noch derzeit.
Die Bewertung der objektiven Rahmenbedingungen zur Mobilität für Menschen mit Behinderungen bzw. konkret für RollstuhlfahrerInnen in Wien hinsichtlich "inklusiver Mobilität" muss zu dem Schluss kommen, dass trotz punktueller Verbesserungen von inklusiven Mobilitätsbedingungen nicht gesprochen werden kann. Es ist z.B. absolut unverständlich, wie es trotz gesetzlicher Vorschriften, einer gestiegenen öffentlichen Präsenz der Thematik und dem vorhandenen technischen Know-how sein kann, dass nicht barrierefrei konzipierte und zugängliche öffentliche Verkehrsmittel angeschafft werden. Zwei Beispiele seien in diesem Zusammenhang erwähnt: Von den "Wiener Lokalbahnen", die zum größten Teil im Besitz der Stadt Wien sind, wurden z.B. neue Niederflurstraßenbahnen ohne Einstiegshilfe angeschafft (vgl. EI 4, 2001), das heißt, dass das Verkehrsmittel nicht wirklich "berollbar" ist, also mit dem Rollstuhl ohne Hilfe nicht befahren werden kann. Ebenfalls nicht barrierefrei erfolgte die Neuanschaffung von Nahverkehrszügen ("Talent"-Triebwagen) der ÖBB im Jahr 2004, die z.B. in Wien auf manchen S-Bahn-Strecken eingesetzt werden. Die Fahrzeuge wiesen bei der Anschaffung keine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe (Hublift) auf, die Türöffner sind für sehbehinderte oder blinde Menschen schwer zu finden, das WC ist für Rollstuhlfahrer zu klein, etc. (David-Freihsl 2004: 9, Ladstätter 2004: Online)
Dennoch sind auch signifikante Tendenzen in Richtung Schaffung inklusiver Mobilitätsbedingungen zu beobachten. Dafür sprechen z.B.:
-
ein gestiegenes Problembewusstsein bei entscheidungsrelevanten und -tragenden AkteurInnen,
-
BehindertenvertreterInnen werden zunehmend in Entscheidungsfindungsprozesse bzw. Gestaltungsprozesse eingebunden,
-
Einführung gesetzlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilitätsbedingungen in den letzten Jahren, z.B. die Novellierung der Wiener Bauordnung und des Garagengesetzes im Jahr 2004 oder das Behindertengleichstellungsgesetz im Jahr 2006 (wobei aber Handlungsbedarf hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzung und Kontrolle bestünde),
-
zunehmender Einsatz zugänglicher und benutzbarer öffentlicher Verkehrsmittel für mobilitätsbehinderte Menschen und konkret auch für RollstuhlfahrerInnen in Wien sowie bemerkbare Verbesserungen bei Um- und Neubauten im öffentlichen Verkehrsraum (in Wien z.B.: Einführung neuer Systeme bei Bus und Straßenbahn und infrastrukturelle Verbesserungen oder vermehrte Durchführung von Gehsteigabsenkungen).
Als strukturelle Stärke des Wiener "Mobilitäts-Systems" kann vielleicht dessen "Mischung" betrachtet werden. Das heißt, im nationalen oder auch internationalen Städte-Vergleich wird in Wien nicht ein Entweder-oder-System, sprich entweder barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel oder Sonderfahrtendienste für behinderte Menschen vertreten, sondern es wird versucht, beide Verkehrssysteme zu kombinieren.
Die vorgefundenen Mobilitätsbedingungen in Wien werden von den befragten RollstuhlfahrerInnen (2001) als problembehaftet und vielfach als unbefriedigend erfahren und wahrgenommen, obwohl auch Verbesserungen z.B. im Rahmen des steigenden Einsatzes barrierefreier öffentlichen Verkehrsmittel anerkannt und begrüßt werden. Von "inklusiven Mobilitätsbedingungen", einer weitgehend selbstbestimmten und selbständigen Mobilität für diese Gruppe mobilitätsbehinderter Menschen kann nicht gesprochen werden.
RollstuhlfahrerInnen haben in Wien auf ihren alltäglichen Wegen, also bei der Erreichung des Arbeitsplatzes, einer Freizeitstätte, bei der gesundheitlichen und nutritiven Versorgung oder auch beispielsweise bei der Erledigung von Behördengängen mit einer Vielzahl von Barrieren zu kämpfen, die sie in ihrer individuellen alltäglichen Mobilität einschränken und behindern. Öffentlicher Verkehrs-Raum und öffentliche Verkehrsmittel können teilweise gar nicht ohne Hilfe oder nur unter erschwerten Bedingungen (z.B. körperlicher und psychischer Stress, Angst, Angewiesensein auf Hilfe, Umwege,...) benutzt und angeeignet werden. Barrieren sind aber nicht nur baulicher oder konstruktionsspezifischer Art. Zusätzlich werden Informations-Defizite und soziale Barrieren für die RollstuhlfahrerInnen zu Hindernissen, die die Qualität ihrer Mobilität und ihr Mobilitätsverhalten negativ beeinflusst.
Durch jene Barrieren im öffentlichen Verkehrsraum bzw. bei der Verkehrsmittelnutzung wird
-
das selbstständige Bewältigen von Wegen,
-
das selbstständige Auffinden und Verstehen von Informationen,
-
das selbstständige Nutzen von Beförderungsmitteln,
-
und das gefahrlose und angstfreie Aufhalten im öffentlichen Raum gehemmt, erschwert, behindert oder zur Gänze verhindert.
Die Befragung ergab weiters, dass für die RollstuhlfahrerInnen der Wunsch oder das Ziel eine "inklusive Mobilität" ist u.zw. in dem Sinn, dass eine "normale" Teilhabe am öffentlichen Verkehrsgeschehen präferiert wird und "(Ab-)Sonder(ungs)maßnahmen" kritisch gesehen bzw. abgelehnt werden. Es werden z.B. Fahrtendienste für behinderte Menschen zwar als durchaus notwendig betrachtet, grundsätzlich wird aber eine nicht absondernde, sondern partizipative Mobilitätssituation favorisiert. Dazu gehört insbesondere die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und des öffentlichen Straßen- bzw. Verkehrsraums.
Konklusion
Die derzeitigen Rahmenbedingungen der Mobilität erschweren Menschen mit Behinderungen nach wie vor die volle gesellschaftliche Teilhabe. Exklusion durch Mobilitätsbehinderung gehört zur alltäglichen Erfahrung von behinderten Menschen in Österreich wie am Beispiel der Mobilitätsproblematik von RollstuhlfahrerInnen in Wien zu sehen ist. Von inklusiven Mobilitätsbedingungen in Österreich bzw. Wien kann nicht gesprochen werden. Die Ressource Mobilität ist für (mobilitäts)behinderte Menschen nur eingeschränkt zugänglich und nutzbar.
Dass räumliche Mobilität, dass der Bereich der "behindernden Umwelt" als ganz wesentlicher Faktor hinsichtlich der Teilhabe und vollen Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen ist, ist eigentlich nichts "Neues". Schon vor 25 Jahren wurde erkannt,
"dass unsere bisherigen Maßstäbe zur Gestaltung der Umwelt (...) fiktiv sind und den realen Bedürfnissen eines hohen Prozentsatzes der Bevölkerung nicht gerecht werden. Es wird immer die Tatsache verkannt, dass es sich um bestimmte Umstände und Zustände in der baulichen und gegenständlichen Umwelt handelt, die behindern und die bestimmte Personen in behindernde Situationen bringen. (...) das Faktum Behinderung (ist, Anmerkung T.E.) weder allgemein noch in Bezug auf die bauliche und gegenständliche Umwelt in medizinischen und juristischen Kategorien zu messen, sondern ausschließlich nach dem Ausmaß der Selbstständigkeit, dem Zurechtkommen mit dieser Umwelt und den sozialen Folgen, die sich daraus für den Betroffenen ergeben. Behinderung stellt sich in diesem Zusammenhang als eine Störung der Relationen, als eine mangelhafte Abstimmung der Umwelt auf die realen Bedürfnisse der Betroffenen dar. Entscheidende Zielsetzung einer Integration muß daher auch eine Neuordnung der gestörten Relation zwischen baulicher und gegenständlicher Umwelt und den durch Barrieren ausgeschlossenen oder zusätzlich behinderten Personen sein. Dabei darf diese Neuordnung nicht als Vorwand zur weiteren Unterlassung genereller Maßnahmen dienen. Beseitigung und planvolle Vermeidung von Umweltbarrieren muß als Teil umfassender Rehabilitation und Integration verstanden und betrieben werden. Eine Loslösung von umfassenden Maßnahmen und eine Negierung der tatsächlichen Hintergründe sozialer Ausschließung führt (...) zur Schaffung einer Pseudonormalität (...) und bewirkt die totale Gettoisierung der Betroffenen. Die Forderung nach einer barrierefreien Umwelt erstreckt sich daher folgerichtig auf alle Lebensbereiche über die vier Wände hinaus und zielt auf eine Umwelt, die erreichbar, zugänglich und benutzbar für alle ist". (Berdel et al. 1981: 279)
Vielleicht ist der Kampf, den Menschen mit Behinderungen für die Teilhabe an Mobilität führen, deshalb so zäh und stellen sich Erfolge nur langsam ein, weil in diesem Kontext ein zentrales gesellschaftspolitisches Kampf- und Machtfeld tangiert wird. Denn Mobilität kann als ein politisches (Macht)-Feld angesehen werden, in dem sich der Kampf behinderter Menschen um Teilhaberechte, Gleichstellung und Selbstbestimmung - letztlich um volle gesellschaftliche Inklusion manifestiert.
Es geht in diesem Kampf um die Fragen des Zugangs zur und Nutzung der "machtvollen Ressource" Mobilität und dadurch - vermittelt über die Verfügbarkeit der Ressource - des Zugangs zu allen Gesellschaftsbereichen. Es geht letztlich um die Realisierung des Rechts auf Mobilität als wesentlichen Faktor für die Herstellung und Gewährleistung voller gesellschaftlicher Inklusion und Teilhabe.
Grundsätzlich sollte eine nationale Vereinheitlichung der unterschiedlichen Landes-Bauordnungen betreffend der Bestimmungen für barrierefreies Bauen angestrebt werden. In den Gesetzen ist eine klare Definition von "Barrierefreiheit" vorzunehmen, die die ÖNORMEN für barrierefreies Bauen und Planen integriert und für verbindlich erklärt und die auch die Vollziehung und Kontrolle der Bestimmungen gewährleistet. (vgl. Weidert 2000: 144; Theussl/Lückler/Steinbacher 1991)
Vorhandene gesetzliche Bestimmungen dürfen nicht zahnlos bleiben. Sie müssen vollzogen und kontrolliert werden, sanktionierbar und einklagbar sein. Das heißt, es sollten Schlupflöcher (z.B. "finanzielle Unzumutbarkeit") nicht möglich sein, die die Wirksamkeit gesetzlicher Regelungen aushöhlen. Nur durch entsprechende Sanktionierbarkeit gesetzlicher Regelungen kann es langfristig gesehen auch zu umfassenden strukturellen Änderungen kommen, die nicht vom "good-will" oder rein wirtschaftlichen Interessen z.B. von BauträgerInnen oder Unternehmen abhängig sind.
Aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen, die teilweise untereinander kollidieren (z.B. in punkto Denkmalschutz) (siehe dazu ausführlicher bei Berdel 1996: 18) und der Kompetenzaufsplitterungen zwischen Bund, Land und Gemeinde, kommt es oftmals zum Effekt, dass die Umsetzung von Maßnahmen gehemmt oder verhindert wird, da sie den divergierenden Vorschriften zum Opfer fällt. (vgl. Bernard 1995: 171f) Es wäre daher wichtig - auch im Sinne einer Verbesserung der Handhabbarkeit rechtlicher Regelungen - dass eine Intensivierung der Zusammenarbeit und Koordination der involvierten (Bau-)Behörden untereinander aber auch mit den vorhandenen regionalen Fachstellen für barrierefreies Bauen, den öffentlichen Verkehrsbetreibern und den Interessensvertretungen behinderter Menschen angestrebt wird. (ebd.: 165)
Eine wichtige Voraussetzung um Verbesserungen hinsichtlich der Benutzbarkeit von öffentlichen Flächen und Gebäuden herbeizuführen, ist die enge Kooperation zwischen technischen und sozialen Verwaltungskörpern sowohl auf Bundes- Landes- und Gemeindeebene. Das heißt, es sollte auf der Verwaltungsdirektionsebene das Bewusstsein hinsichtlich erforderlicher "behinderungsspezifischer" Maßnahmen gefördert und verbessert werden. (vgl. Magistrat Graz 1994: 25)
Die barrierefreie Zugänglichkeit aller öffentlichen Gebäude sowie die Zugänge zu Geschäften, Veranstaltungsstätten etc. sollte rechtlich verbindlich gemacht und besonders darauf geachtet werden, dass die entsprechenden baulich-technischen Standards eingehalten, korrekt ausgeführt und kontrolliert werden. Gerade eine "halbherzige" Durchführung von Maßnahmen ist für die Betroffenen häufig mit keiner wirklichen Verbesserung verbunden. Ebenso sind Baukorrekturen, die nachträglich erfolgen (müssen), mit einem vielfach höheren Mehrkostenaufwand verbunden, als bei entsprechender Berücksichtigung der spezifischen Standards vor Bau- oder Umbaubeginn.
Bei der Ausarbeitung von Normen, Richtlinien, Gesetzen, Vorschriften etc. im Kontext der Planung und Gestaltung des öffentlichen Straßen- und Verkehrsraums, sollten die Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens oberste Priorität genießen und nicht als "Sondermaßnahmen" für "Minderheiten" angesehen werden. Die grundlegenden Anforderungen und Bedürfnisse (mobilitäts)behinderter Personen sollten bei allen Entwürfen neuer oder umzugestaltender städtischer Straßen-, Verkehrs- und Freiräumen sowie bei Fahrzeugen, die im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden, Berücksichtigung finden. Das impliziert, dass Betroffene in die Ausarbeitungs- bzw. Planungs- und Mitbestimmungsprozesse immer einbezogen werden sollten. (vgl. Drexel et al. 1991)
Eine von vielen ExpertInnen geäußerte Empfehlung, um die Durchsetzung barrierefreien Planens und Bauens in Österreich voranzutreiben, ist die Etablierung einer zentralen Fachstelle für barrierefreies Planen und Bauen etwa nach Schweizer Vorbild. Bereits im 1992 beschlossenen Behindertenkonzept der Österreichischen Bundesregierung wird dies empfohlen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1993). Zwar existieren in Österreich regionale Beratungsstellen, es ist jedoch keine übergreifende Institution vorhanden, die als Anlaufstelle mit Bundesrichtlinien zum barrierefreien Bauen dienen könnte. Zu den Aufgaben einer solchen Fachstelle würde beispielsweise die konkrete Bauberatung, die Koordinierung der regionalen Einrichtungen, die Information der politischen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen oder die Einflussnahme auf die Lehrpläne der ArchitektInnen- und IngenieurInnensausbildung zählen. Die Gründung einer Fachstelle scheiterte bislang an mangelndem Interesse und fehlender Unterstützung von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. Seit 1995 ist immerhin ein "Netzwerk der österreichischen Beratungsstellen für Planen und Bauen" (ISD - Institut für Soziales Design) aktiv, in dem österreichische ExpertInnen und die regionalen Beratungsstellen ihre Erfahrungen austauschen, sich vernetzen und zusammenarbeiten. Damit sind zwar die Chancen auf verbesserte Durchsetzungsbedingungen barrierefreien Bauens gestiegen, die Notwendigkeit der Errichtung einer zentralen Fachstelle sollte dadurch allerdings nicht aufgehoben werden. (vgl. Riess 1999; Weidert 2000)
Barrierefreie Mobilität hängt allgemein vom Zusammenspiel einer Kette von Faktoren ab. Die kleinste Unterbrechung dieser Kette kann die Mobilität beeinträchtigen oder bereits im Ansatz verhindern. (vgl. VCÖ 2002) Grundbedingung für eine selbstständige und barrierefreie[80] Mobilität (von RollstuhlfahrerInnen) ist eine lückenlose barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung des öffentlichen Verkehrs- und Straßenraums. Die Zurücklegung von Wegen von einem Quell- zu einem Zielort muss problemlos und sicher erfolgen können. Eine geschlossene Transport- und Wegekette ist dafür notwendig. Daraus folgt, dass lediglich punktuell gesetzte Maßnahmen nicht ausreichen, da in diesem Fall die Mobilität ständig von der Gefahr plötzlich auftretender Barrieren, des "Nicht-Mehr-Weiterkönnens" bedroht ist. (vgl. Weidert 2000: 23)
Nachstehende Bereiche sind barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht zu gestalten damit eine großflächige und lückenlose Nutzung und Aneignung des öffentlichen Straßenraums von RollstuhlfahrerInnen erfolgen kann:
-
Gehsteige sind so zu gestalten, dass sie von RollstuhlfahrerInnen zu benutzen sind. (vgl. Weidert 2000: 41fff; Drexel et al. 1991: 22; Teufelsbrucker 1998: 56ff)
-
Stufen oder Treppen im Gehsteigbereich sollten entfernt und die Eingänge zu (öffentlichen) Gebäuden stufenlos gestaltet werden oder zumindest über eine Rampe berollbar sein. (vgl. Weidert 2000: 49, 65ff; Drexel et al. 1991: 23)
-
Fahrbahnüberquerungen sollten so gestaltet werden, dass Bordsteinkanten entsprechend abgesenkt sind. Schutzinseln sollten Sicherheit bei der Überquerung bieten und die Grünphasen der FußgängerInnen-Ampeln verlängert werden. (vgl. Weidert 2000: 54fff)
-
(Ausstattungs-)Elemente im Straßenraum (Baustellen, Verkehrsschilder, WC, Behindertenparkplätze etc.) dürfen nicht zu Hindernissen bei der Mobilität werden und sind entsprechend zu gestalten bzw. auszurichten. (vgl. Weidert 2000: 44ff, 86f, 114f; Teufelsbrucker 1998: 59f)
-
Die baulichen Anlagen, die im Zusammenhang mit der Nutzung des ÖPNV stehen (Haltestellenkaps, Busbuchen, Haltestelleninseln, Zugang zu Bahnhöfen etc.) müssen barrierefrei sein, um den reibungslosen Übergang zwischen den Verkehrsmitteln zu ermöglichen. (vgl. Weidert 2000: 89fff)
8.2.2.1 ÖPNV
Um für RollstuhlfahrerInnen eine flächendeckende Zugänglichkeit und Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Wien zu erreichen, muss noch eine Reihe von Maßnahmen auf baulich-technischer sowie organisatorischer Ebene erfolgen. Die Befragung zeigte, dass es an vielen Ecken und Enden mangelt. Folgende Verbesserungsmaßnahmen wären z.B. notwendig:
Bus
Niederflurbusse, die über eine ausklappbare Rampe verfügen, sollten flächendeckend und ausnahmslos zum Einsatz kommen. Wie erwähnt, sind die "Wiener Linien" auch auf dem besten Weg dazu, da bis Ende 2006 der flächendeckende Einsatz der Niederflurbusse gewährleistet sein soll.[81]
Parallel dazu sind die Haltestellenbereiche baulich so zu gestalten, dass sie ein gefahrloses und barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglichen. Die Verkehrsunternehmen haben dafür zu sorgen, dass die BuslenkerInnen den laut Dienstauftrag verpflichtenden Hilfestellungen beim Ein- und Aussteigen auch nachkommen. Anhand der Interviews zeigte sich, dass das Verhalten der BuslenkerInnen sowie die richtig durchgeführte Hilfeleistung beim Ein- und Aussteigen eine wesentliche Komponente ist, damit die Niederflurbusse mit händisch auszuklappender Rampe auch benutzt werden (können).
Straßenbahn
Auf dem gesamten Straßenbahnnetz sollten so bald als möglich ausnahmslos Niederflurstraßenbahnen (ULF) eingesetzt werden, die über eine funktionierende elektrisch ausfahrbare Rampe verfügen. Gleichzeitig ist ein barrierefreier Zugang zur Straßenbahn herzustellen. Das heißt, die Haltestellenkaps müssen entsprechend (um)gestaltet werden. Da nur einige Straßenbahnlinien durchgehend mit ULFs bestückt sind, also auf einigen Linien sowohl die "alten", für RollstuhlfahrerInnen gänzlich unbenutzbaren Garnituren als auch teilweise neue ULF-Garnituren zum Einsatz kommen, wäre als überbrückende Maßnahme ein Informationssystem anzuraten, das den rollstuhlfahrenden KundInnen zumindest anzeigt, ob/in welchen Abständen Niederflurgarnituren auf der jeweiligen Linien verkehren.
U-Bahn
Bei der U-Bahnnützung sind die Überwindung der Lücke und des Niveauunterschieds zwischen Waggon und Bahnsteigkante und das Tür-Öffnen die größten Probleme für die RollstuhlfahrerInnen. Da die so genannten "V-Wagen", die die neue Generation von U-Bahn-Zügen in Wien sein sollen und die derzeit verkehrenden "Silberpfeile" langfristig ersetzen sollen (vgl. 6.2.1), erst in einigen Jahren oder eher Jahrzehnten durchgehend zum Einsatz kommen werden, wäre eine Übergangslösung zu schaffen. So könnte etwa ein berollbarer Zugang durch eine händisch zu bedienende Klapprampe im vordersten Waggon, wie sie z.B. in Berlin bei U- und S-Bahnzügen eingesetzt wird (vgl. BIZEPS 2006a: Online), geschaffen werden. Für die U6 wäre eine baldige Umstellung auf Garnituren in Niederflurbauweise erforderlich bzw. ebenfalls für einen berollbaren Zugang im vordersten Wagen über eine Rampe zu sorgen, damit eine selbstständige Benutzung der U-Bahn möglich wäre. Weiters ist bei der U6 die bestehende diskriminierende Beförderungsbestimmung, die RollstuhlfahrerInnen die Benutzung der U-Bahn nur mit einer Begleitperson erlaubt (vgl. Interessensvertretung der behinderten Menschen nach § 46 des Wiener Behindertengesetzes 2002: 9), aufzuheben.
S-Bahn
Die von der ÖBB betriebenen S-Bahnen in Wien sind für RollstuhlfahrerInnen kaum zugänglich, da sie nur über Stufen erreichbar sind und auch S-Bahnstationen nicht durchgängig mit Aufzügen ausgestattet sind. Die Anschaffung barrierefrei zugänglicher S-Bahnen und die Schaffung einer barrierefreien Zugänglichkeit der Stationen sind daher dringend notwendig, um auch RollstuhlfahrerInnen die Nutzung zu ermöglichen. Im Zuge der Neuanschaffung von Nahverkehrszügen ("Talent") durch die ÖBB kam es zu Diskussionen, da der neue Fahrzeugtyp wiederum keinen barrierefreien (berollbaren) Einstieg für RollstuhlfahrerInnen ermöglicht. Aufgrund der Proteste von Seiten der Behindertenorganisationen und Interessensvertretungen sollen die Zugeinheiten nun mit Hebeliften nachgerüstet werden. (vgl. Kobinet-Nachrichten 2004: Online)
Infrastruktur/Bauliche (Neben)Anlagen
Maßnahmen, die sich ausschließlich auf die barrierefreie/behindertengerechte Gestaltung des Verkehrsmittels bzw. deren Einsatz im ÖPNV konzentrieren, bleiben mangelhaft, wenn nicht gleichzeitig die infrastrukturellen Gegebenheiten und Einrichtungen von den RollstuhlfahrerInnen nutzbar sind, die die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrsmittels vielfach erst ermöglichen oder die Benutzung erleichtern. Erst wenn die Haltestellen, Aufzüge, WC, Fahrkartenautomaten, Informationsschalter, Bedienungselemente, Bahnhofrestaurants usw. auch problemlos benutzt werden können, ist barrierefreie Mobilität möglich. Dementsprechend sollte bei der Planung und Konstruktion der städtischen Infrastruktur, dem Prinzip des "Design für Alle" gefolgt werden.
Die Kompetenzen im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr sind im ÖPNRV-G (2000) geregelt. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a:196) Die Gestaltung von Verkehrsanlagen oder die Anschaffung der Verkehrsmittel obliegt den Verkehrsunternehmen, die dabei allerdings die rechtlichen Vorgaben durch Bund und Land, je nach Kompetenzbereich, beachten müssen. (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1999: 51) Da es sogar vorkommt, dass bei Neukäufen nicht barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel angeschafft werden, wäre es erforderlich, dass eine gesetzliche Verankerung erfolgt, die im Rahmen der Neuanschaffung öffentlicher Verkehrsmittel verbindlich deren barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit vorschreibt. Ein Experte der Behindertenorganisation BIZEPS merkt dazu an:
"Der wichtigste Punkt wäre, dass es einen Beschluss gibt, dass ab jetzt nur mehr barrierefreie Verkehrsmittel gekauft werden. Den gibt es nicht. (in Wien, Anmerkung T.E.) (...) Wenn wir von Wien reden, dann würde ich sagen, es wäre doch interessant, dass der Wiener Landtag sagt, alle Verkehrsmittel die wir kaufen, sind ab jetzt barrierefrei. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Verfassung schreibt das seit 1997 vor. Sie tun es nur nicht." (EI 4, 2001)
Individualverkehr (Auto, Taxi)
Im Rahmen der Fortbewegung von RollstuhlfahrerInnen mit dem Auto ist vor allen Dingen notwendig, dass richtig platzierte, gestaltete und auch mit dem Rollstuhl zugängliche Behindertenparkplätze vorhanden sind sowie das Wissen darüber, ob, und wo es an bestimmten Örtlichkeiten (z.B. öffentlichen Gebäuden, Veranstaltungsstätten etc.) bzw. generell im öffentlichen Raum Behindertenparkplätze gibt. Gab es zum Befragungszeitpunkt 2001 noch kein Informationssystem über die Standorte der Behindertenzonen in Wien, so hat sich das mittlerweile geändert (siehe dazu 6.4).
Notwendig wäre einerseits, dass unbefugt parkende Autos auf Behindertenabstellplätzen rigoros abgeschleppt werden und andererseits Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen bei der Auto fahrenden Bevölkerung. Beispielsweise könnte im Rahmen der Führerscheinprüfung das Thema mobilitätsbehinderte VerkehrsteilnehmerInnen aufgegriffen werden. Aber auch mediale Kampagnen könnten auf diesem Gebiet eine Sensibilisierung fördern.
Herkömmliche Taxis können von den meisten RollstuhlfahrerInnen gar nicht (E-RollstuhlfaherInnen) oder nur unter erschwerten Bedingungen benutzt werden. Die öffentliche Hand könnte etwa über zinsenlose Darlehen oder Zuschüsse Taxiunternehmen motivieren, rollstuhlfreundliche Fahrzeuge - wie das Modell des "Londoner Taxis" der Firma "Chvatal" - einzusetzen oder Umbauten bei Fahrzeugen durchzuführen (z.B. schwenkbare Sitze), die das Einsteigen ins Fahrzeug erleichtern. (vgl. Theussl/Lückler/Steinbacher 1991)
Fahrtendienste
Wenn alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien für RollstuhlfahrerInnen barrierefrei zugänglich und benutzbar wären und auch wenn der gesamte öffentliche Verkehrs- und Straßenraum barrierefrei gestaltet wäre, so sollte dennoch nicht auf alternative Fahrmöglichkeiten verzichtet werden, da manche Menschen - auch unter barrierefreien Bedingungen - auf entsprechende Hilfestellungen, die Fahrtendienste bieten (Tür-zu-Tür-Service), nicht verzichten können. (vgl. Haselsteiner/Reiter 2000: 42) Grundsätzlich und langfristig gesehen muss allerdings der Ausbau eines barrierefreien öffentlichen Verkehrssystems Vorrang gegenüber Sonderfahrtendiensten haben, da durch Sondertransporte behinderte Menschen vom öffentlichen (Verkehrs-)Geschehen abgesondert werden und nicht aktiv partizipieren können.
Um die Probleme, die bei der Inanspruchnahme von Sonderfahrtendiensten in Wien für RollstuhlfahrerInnen vorhanden sind (vgl. 7.2.2.4) zu mindern, wären als Maßnahmen geeignet: Es sollten technische Standards bezüglich der eingesetzten Fahrzeuge erarbeitet und verbindlich vorgeschrieben werden. Damit die Vorbestellzeiten entsprechend eingehalten werden und die Pünktlichkeit verbessert wird, könnten logistische Maßnahmen wie beispielsweise die Schaffung einer gemeinsamen Leitzentrale für alle Fahrtendienstfirmen Verbesserungen bewirken. Um die Qualität der Sonderfahrtendienst-Nutzung zu erhöhen, sollte eine intensive Schulung des Fahrpersonals erfolgen, sowohl hinsichtlich fahrtechnischer Aspekte (Ortskenntnisse, Fahrverhalten) als auch bezogen auf das "soziale Verhalten" ("richtig" Hilfe leisten, Sensibilisierung im kommunikativen Bereich). Bei der Erstellung von Standards und bei der Abhaltung von Schulungen wäre im Vorfeld eine Art Qualitätskontrolle mittels Monitoring, das jedes Jahr durchgeführt wird, um Mängel rasch beheben zu können, sinnvoll. (vgl. Haselsteiner/Reiter 2000: 7)
Information und Orientierung stellt neben der physischen Zugänglichkeit eine gleich wichtige Zugangsvoraussetzung dar. (vgl. VDV 1998: 17)
Gerade vor dem Hintergrund mannigfaltiger Barrieren und Hindernisse, die einer Mobilität behinderter Menschen im wahrsten Sinn des Wortes im Weg stehen, spielen Informationen und Orientierung nicht nur im ÖPNV eine bedeutende Rolle. Ebenso trifft dies auf die Nutzungsmöglichkeit und -bedingungen öffentlichen Straßenraums, dessen Anlagen (WC, Parkplätze,...), öffentlicher (oder privater) Gebäude, bei der Hilfsmittelbeschaffung bis hin zu den Möglichkeiten finanzieller Leistungen zu.
Es muss bei den im Mobilitätsfeld involvierten AkteurInnen (Behörden, Verkehrsbetreiber, Unternehmen usw.) noch vermehrt das Bewusstsein für eine zielgruppengerechte Aufbereitung und Gestaltung von Information geschaffen werden. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 54)
8.2.3.1 Öffentlicher Straßen- und Verkehrsraum
Eine "geschlossene Transportkette" ist nicht nur von den baulichen Gegebenheiten abhängig, sondern muss gleichzeitig von einer "geschlossenen Informationskette" begleitet werden, um die reibungslose Fortbewegung zu garantieren.
Anhand der Befragung wurde deutlich, dass in einer barrierebehafteten Umwelt für die RollstuhlfahrerInnen Vorausplanung ein entscheidender Aspekt in ihrer individuellen Mobilität ist und in diesem Zusammenhang kommt der Information im Vorfeld- und/oder während der Bewegung im öffentlichen Verkehrs- und Straßenraum eine fundamentale Bedeutung zu. Gerade weil der öffentliche Verkehrs- und Straßenraum noch eine Vielzahl von Barrieren aufweist, können Informationen und/oder Orientierungshilfen entscheidend zu einer besseren Qualität der individuellen Mobilität beitragen: Informationen über Zugänglichkeit von (öffentlichen) Gebäuden, Informationen über Anlagen (barrierefreie WCs, Telefonzellen, Parkplätze usw.), Hinweisschilder, Warnungen vor Hindernissen, Wegbeschreibungen etc. sind unabdingbar, damit den RollstuhlfahrerInnen die Fortbewegung zumindest nicht noch mehr erschwert wird.
Bedürfnisgerechte und regelmäßig auf den neuesten Stand gebrachte (Online-)Stadtführer für RollstuhlfahrerInnen bzw. mobilitätsbehinderte Personen im allgemeinen könnten als wichtige Informationsbeschaffung für den betroffenen Personenkreis dienen. (vgl. Teufelsbrucker 1998: 62)
In diesem Kontext ist z.B. auf das von der EU geförderte Projekt "Barrier Info" hinzuweisen (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 50). Da bei angebotenen Informationen vereinheitlichte Kriterien hinsichtlich Zugänglichkeit und Benutzbarkeit eine ganz wesentliche Rolle spielen, um den betroffenen Menschen eine Erleichterung bei der Planung ihrer Mobilität zu bieten, ist diesem Projekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da damit ein Instrument geschaffen wurde, "das eine Vermessung von Zugänglichkeitskriterien nach objektiven Regeln gestattet". (VCÖ 2002: 32) Mobilitätsbehinderte Menschen respektive RollstuhlfahrerInnen können über die Datenbank "you-too" (Homepage: www.you-too.at) Informationen beziehen, ob ein gewünschtes Ziel erreicht werden kann und mit welchen Hindernissen gerechnet werden muss. Die Datenbank ist allerdings noch stark im Aufbau begriffen. Große Datenmengen müssen erst noch erhoben werden. In Wien wird derzeit z.B. die "Behindertengerechtigkeit" von Bundesgebäuden erhoben. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 50)
Projekte dieser Art sind dahingehend sinnvoll, da einerseits durch die Erhebung die (problematische) Ist-Situation sichtbar wird und andererseits den betroffenen Menschen durch die Bereitstellung von Informationen ein Planungsinstrument in ihrer alltäglichen Mobilität bereit steht. Langfristig gesehen sollte es sich dabei aber um "Überbrückungsmaßnahmen" handeln, da das Ziel die Beseitigung und der Abbau der jeweiligen Hindernisse sein muss und nicht Informationen darüber, was alles nicht benutzt werden kann.
8.2.3.2 Transportsysteme
Um das von den Befragten reklamierte Informationsdefizit, die Unübersichtlichkeit sowie die teilweise als mangelhaft gesehene Qualität von Informationen im ÖPNV-Bereich verbessern zu können, wären als Maßnahmen zu empfehlen:
-
Die öffentlichen Verkehrsbetreiber sollten barrierefrei zugängliche und übersichtlich gestaltete Informationen für RollstuhlfahrerInnen (bzw. mobilitätsbehinderte Menschen generell) anbieten. Es sollte neben z.B. Broschüren oder Internet immer auch eine Anlaufstelle vorhanden sein, die sowohl Informationen geben als auch als Beschwerde- oder Anregungsstelle fungieren kann. Das Personal sollte entsprechend (Informationen für mobilitätsbehinderte KundInnen) geschult werden. In diesem Zusammenhang ist die Einbeziehung des Know-hows von selbst von Behinderung betroffenen ExpertInnen das Um- und Auf.
-
Es sollten in den (öffentlichen) Verkehrsunternehmen "(Mobilitäts-)Behindertenbeauftragte" etabliert werden, die selbst von einer Behinderung betroffen sind und/oder die mit Interessensvertretungen behinderter Menschen zusammenarbeiten.
-
Orientierungshilfen (Piktogramme etc.) und BenutzerInnen-Informationen sollten effektiv und bestmöglich gewährleistet sein. Neue Technologien ("Telematik") sind in diesem Kontext verstärkter einzusetzen, beispielsweise Handy-Ticketing, Ein- und Ausstiegsrichtungsanzeigen in den Verkehrsmitteln, aktuelle Information über Ausfall von Aufzügen etc. "Verschiedenste telematische Dienste können bei der Planung von barrierefreien Routen, bei der Abschätzung von Risiken alternativer Wege und bei der Auskunft über die Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von Objekten eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen." (VCÖ 2002: 32) Gerade im ÖPNV besteht durch den Einsatz neuer Technologien ein "großes Rationalisierungspotential". (ebd.: 12)
"Politische Entscheidungsträger in Bund, Länder und Gemeinden, Entscheidungsträger aus dem Bereich der Forschung und Forschungsförderung, aber auch Fahrzeughersteller, Verkehrsunternehmen, Unternehmen aus den Bereichen Informatik, Telekommunikation, Messtechnik, Medizintechnik sowie Infrastruktur-Betreiber sind gefordert, jetzt die notwendigen Weichenstellungen zu treffen, damit das Potenzial der neuen Technologien mit seinen Marktchancen (...) zum Vorteil mobilitätseingeschränkter Personen voll ausgeschöpft wird." (ebd.: 12)
8.2.4.1 Öffentlicher Straßen- und Verkehrsraum sowie Transportsysteme
Neben der rechtlichen Verankerung barrierefreien Bauens und Planens ist ebenso Bewusstseins- und Aufklärungsarbeit bei allen relevanten AkteurInnen (Politische EntscheidungsträgerInnen, Öffentliche Verwaltungsbehörden, UnternehmerInnen, ArchitektInnen usw.) erforderlich.
Wie die Befragung der RollstuhlfahrerInnen ergab, stellen bei der Fortbewegung im öffentlichen Verkehrs- und Straßenraum nicht nur bauliche Barrieren oder mangelhafte bzw. unzugängliche Informationen ein Problem dar, sondern es kann sich auch die Interaktion und Kommunikation mit anderen, nichtbehinderten VerkehrsteilnehmerInnen hemmend (aber ebenso fördernd) auf das individuelle Mobilitätsverhalten auswirken. Es zeigte sich, dass primär das Verkehrsverhalten anderer (nichtbehinderter) VerkehrsteilnehmerInnen (z.B. Parken der Autos, Fahrräder auf Gehsteigen bzw. vor Gehsteigabsenkungen, das Parken von Unbefugten in den Behindertenzonen) sowie "klischeegleitetes" und/oder diskriminierendes Agieren nichtbehinderter Personen Problemfaktoren sind. Drexel et al. (1991) stellen dazu fest:
"Gerade die Kommunikation und Interaktion zwischen behinderten und nicht behinderten Personen ist Teil des herrschenden sozialen Klimas. (...) Der Umgang miteinander ist ungewohnt, da behinderte Menschen aufgrund der Benutzungsschwierigkeiten seltener in Freiräumen präsent sind. Beiderseitige Lernprozesse sind unbedingt notwendig, können aber nur dann in Gang gebracht werden, wenn es behinderten Menschen möglich ist, sich freier und selbstständiger im Freiraum fortzubewegen." (122f)
"Für die persönliche Hemmschwelle für behinderte Menschen, den Freiraum trotz Schwierigkeiten (...) zu nutzen, hat das soziale Gefüge im Freiraum große Bedeutung. Deshalb muß dieses auch bei deren Gestaltung beachtet werden. Spezielle Anreize für behinderte Menschen, Freiräume aufzusuchen, können diese Schwelle herabsetzen und so die Präsenz von behinderten Menschen im Freiraum erhöhen." (ebd.: 123)
In diesem Zusammenhang können folgende Maßnahmen zu einer verbesserten Mobilität beitragen:
-
(Freiwillige) Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen relevanter AkteurInnen im Verkehrsbereich: ExekutivbeamtInnen, MitarbeiterInnen der Verkehrsbetreiber (siehe 8.2.4.2), SchülerlotsInnen, ParkraumwächterInnen, TaxilenkerInnen, etc. (vgl. Haselsteiner/Reiter 2000: 44) Bei der Ausarbeitung entsprechender Arbeitsmaterialien und Unterlagen sowie bei der Durchführung von Schulungen sind mobilitätsbehinderte ExpertInnen bei zu ziehen.
-
Öffentlichkeits- bzw. Bewusstseinsarbeit zur Erhöhung des Wissens zum Thema Mobilitätsbehinderung sowie zur Anerkennung der spezifischen Anforderungen (mobilitäts)behinderter Menschen an eine barrierefreie Mobilität ist notwendig. (vgl. Drexel et al. 1991: 124) Öffentlichkeitsarbeit kann und sollte durch die verschiedensten Medien (Zeitungen, Fernsehen, Video, Internet, Broschüren usw.) erfolgen und in die diversen Institutionen Eingang finden wie z.B. ORF, Privatradios und -fernsehen, Medienherausgeber, Verkehrsunternehmen, Schulen und Universitäten, usw. Wichtig dabei ist sicherlich die adäquate Aufbereitung der Informationen wofür die Beiziehung von Betroffenen unumgänglich ist.
-
Verstärkte Öffentlichkeits- und Bewusstseinsarbeit sowie aktive Offerierung und Vermittlung von Know-how barrierefreien Planens und Bauens, "Design für Alle" bzw. so genannter "partizipativer Planungsansätze" an Planer, Bauberater, Bauingenieure, Bauausführende, etc. Es sollten auch Weiterbildungsmöglichkeiten und der Erfahrungsaustausch der AkteurInnen forciert werden. (vgl. Bernard 1995: 176)
-
Intensiver Bewusstseinstransfer in Unternehmen unter anderem hinsichtlich mobilitätsrelevanter Aspekte (Zugänglichkeit, Förderungen, Good-Practice-Modelle etc.) z.B. über die Initiierung und Durchführung von Wettbewerben oder die Auszeichnung barrierefreier Unternehmen. (vgl. Bernard 1995: 176) Als Beispiel kann auf das Kommunikations- und Kooperationsprojekt "Job-Allianz" verwiesen werden, das jährlich den "JobOskar" für das behindertenfreundlichste Unternehmen vergibt. Ein Vergabekriterium ist dabei die bauliche und organisatorische Adaptierung der Arbeitsplätze, das auch barrierefreie Zugänglichkeit umfasst. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 36f, www.joballianz.at)
-
Bewusstseinsarbeit hinsichtlich barrierefreiem Bauen bzw. "Design für Alle" in höhere berufsbildende Schulen und den einschlägigen Studienrichtungen forcieren. (vgl. Bernard 1995: 176) Es sollten die Grundsätze barrierefreien Planens und Bauens in der universitären Ausbildung als Pflichtfach verankert werden.
-
Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung politischer EntscheidungsträgerInnen durch forciertes Lobbying hinsichtlich der Anerkennung von Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung als höhere Priorität und nicht als "Sondermaßnahmen". (ebd.: 175) Bewusstseinsbildung der EntscheidungsträgerInnen, dass barrierefreies Bauen dann nicht zu einem finanziellen Problem wird, wenn es bereits bei der Planung berücksichtigt wird. Umbauten führen zu erhöhten Baubudgets und höheren Mehrkosten. (ebd.: 172)
-
Aufklärende und bewusstseinsbildende Maßnahmen sollten in den schulischen Verkehrserziehungsunterricht und auch in die Fahrausbildungen verstärkt Eingang finden. So könnte eine Sensibilisierung der Kinder- und Jugendlichen durch praxisnahen Projektunterricht, Anschauungsunterricht im öffentlichen Verkehrs- und Straßenraum, um die Problematiken/Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Menschen "direkter" zu erfahren. Derzeit wird kaum auf die Aspekte der Mobilität von mobilitätsbeeinträchtigten Personen Bezug genommen. (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002: 88f) Als konkrete bildungspolitische Maßnahmen können laut Sigl/Leuprecht/Götz (2002: 90) empfohlen werden: Verdoppelung der Unterrichtseinheiten in der schulischen Verkehrserziehung, damit eine Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgen kann, Berücksichtigung der Thematik in den Lehrer- und Schülerheften für die Verkehrserziehung im Primärbereich sowie entsprechende inhaltliche Adaptierung der Fahrausbildung für die Führerscheinklasse A und B im Sinne einer Schwerpunktverlagerung weg von ausschließlicher Fahrzeugkunde hin zu Bedürfnissen und Besonderheiten einzelner VerkehrsteilnehmerInnen-Gruppen.
8.2.4.2 Good-Practice: "Gemeinsam mobil"
Es ist notwendig, dass in den (öffentlichen) Verkehrsunternehmen ein Bewusstsein über die Anliegen der mobilitätsbehinderten KundInnen vorhanden ist und die Bedürfnisse dieser KundInnen-Gruppe ernst genommen werden. Eine entsprechende Vermarktung der gesetzten Maßnahmen kann "nebenbei" das Image eines Unternehmens sicherlich positiv beeinflussen. Das Pilotprojekt "Gemeinsam Mobil" (vgl. Engl/Schlögl/Sigl 2003) soll in diesem Kontext als Good-Practice-Modell näher vorgestellt werden:
2003 wurde, gefördert vom Bundessozialamt Wien (im Rahmen der Initiativen im Europäischen Jahr der Behinderung) und getragen vom Kuratorium für Verkehrssicherheit in Kooperation mit den "Wiener Linien" und der "Wiener Assistenzgenossenschaft", eine Schulungs- und Trainingsmaßnahme mit dem Titel "Fahrgäste im Rollstuhl" entwickelt und umgesetzt.
Als Grundlage dieses Pilotprojekts diente die vorher durchgeführte Studie über das Mobilitätsverhalten von RollstuhlfahrerInnen in Wien (siehe Sigl/Leuprecht/Götz 2002). Ziel des Schulungsprogramms war es, Personen im Rollstuhl zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu motivieren und ihnen eine verbesserte Dienstleistung der "Wiener Linien" anzubieten. Begleitend zu den Schulungsmaßnahmen wurde auf der Homepage der "Wiener Linien" mehr Information für mobilitätsbehinderte Menschen online gestellt. Weiters wurde ein Folder "Mobilität für alle" produziert, der die öffentlichen VerkehrsteilnehmerInnen auf die Thematik aufmerksam machen soll.
Die 2003 durchgeführten Schulungen hatten RollstuhlfahrerInnen und das Personal der "Wiener Linien"[82] als Zielgruppe. Der Aufbau und die Ziele orientierten sich an den Leitbildern/Leitideen: Motivation von Menschen im Rollstuhl im Sinne eines Empowerment, Sensibilisierung des Fahrpersonal durch Selbsterfahrung, Erfahrungsaustausch und Abbau von Kommunikationsbarrieren und Schulung durch Personen, die selbst auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Die Schulungen umfassten sowohl einen "theoretischen" als auch einen "praktischen" Teil. In ersterem wurde den RollstuhlfahrerInnen z.B. Verhaltens- und Sicherheitstipps oder rechtliche Grundlagen für die Beförderung im ÖPNV, dem Fahrpersonal z.B. Techniken zur richtigen Hilfestellung oder Sensibilisierung hinsichtlich der Sichtweisen und Problematiken der RollstuhlfahrerInnen näher gebracht. In den gemeinsamen Übungs- und Aktionstagen erfolgte dann eine Annäherung beider Zielgruppen, sowohl was den Austausch der jeweiligen Ansichten betraf als auch durch das gemeinsame praktische Üben. Die SchulungsteilnehmerInnen im Rollstuhl bekamen z.B. Techniken für die Benutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel (durch TrainerInnen, die selbst im Rollstuhl sitzen) vermittelt bzw. konnten sie sowohl im "geschützten Raum" einer Remise als auch in der normalen Verkehrsrealität das Ein- und Aussteigen in U-Bahn, Straßenbahn und Bus trainieren. Das Fahrpersonal lernte gemeinsam mit den RollstuhlfahrerInnen, gekonnt Hilfestellung zu leisten bzw. lernten sie die alltäglichen Benutzungs-Probleme der behinderten Menschen in der Praxis und durch Selbsterfahrung kennen. Für beide Zielgruppen ging es um die Vertiefung der Kommunikation und den Abbau von Hemmschwellen im Umgang miteinander. Sowohl das Personal der "Wiener Linien" als auch die RollstuhlfahrerInnen bewerteten die Schulungsmaßnahmen überaus positiv. (ebd.: 48ff)
Anhand der gesammelten Erfahrungen während der Schulungen wurden Richtlinien für eine effiziente Umsetzung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen erarbeitet, sowie das Feedback von allen AkteurInnen ermittelt und dokumentiert. (ebd.: 40ff)
Mit dieser Pilotschulung konnte ein erster Schritt zur attraktiveren Benutzung des ÖPNV für Fahrgäste im Rollstuhl gesetzt werden. Wobei es für die Zukunft gilt, so die AutorInnen des Berichts zum Pilotprojekt, "dass die gemeinsam ausgearbeitete Lösungsvorschläge umgesetzt werden. Die Schulungsangebote müssen weitergeführt bzw. in den Ausbildungsmodus des Fahrpersonals der ‚Wiener Linien' integriert werden" (ebd.: 61f).
Als Vorteile und positive Auswirkungen eines solchen Schulungsangebotes können benannt werden:
-
Schwellenängste hinsichtlich der Benutzung des Verkehrsmittels können abgebaut werden. Behinderte Fahrgäste können (im Sinne des Empowerment-Gedanken) bei Interesse im geschützten Raum unter Anleitung kompetenter TrainerInnen motiviert werden, sich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln und Benutzungstechniken vertraut zu machen. Dies kann zu einer verstärkten Einbindung öffentlicher Verkehrsmittel in die individuelle alltägliche Mobilität beitragen.
-
Verkehrsanbieter setzen ein Signal, dass die adressierte Personengruppe als KundInnen wahr- und ernst genommen werden. Die Schulungen tragen zu einem verbesserten Know-how des Personals bei und dies wiederum verbessert die Umgangsrealität mit mobilitätsbehinderten Fahrgästen.
-
Die gezielte Information von mobilitätsbehinderten Fahrgästen, wie sie motiviert durch das Pilotprojekt über die Homepage der "Wiener Linien" verstärkt erfolgt (Stand: 2003), trägt wesentlich auch zur Animation der Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel bei.
Schulungsmaßnahmen, wie die gerade vorgestellte, sollten jedoch nicht als Ersatz für den Abbau bestehender Barrieren bei der Verkehrsmittelnutzung durch barrierefreie Zugänglichkeit und Gestaltung der Verkehrsmittel gesehen werden, sondern als wichtige Ergänzung. Dass alle KundInnengruppen auf für sie relevante Informationen im Rahmen der Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen können, sollte zu einer Selbstverständlichkeit für ein Dienstleistungsunternehmen werden.
8.2.5.1 "Individuelle Ressource" Rollstuhl
Technische Hilfen (Rollstuhl, Blindenstock, Prothesen, Hörgeräte etc.) stellen eine notwendige Voraussetzung dar, um eine Schädigung z.B. des Bewegungsapparates auszugleichen.
Die richtige Rollstuhlwahl kann sich (mit)entscheidend auf die Qualität der individuellen Mobilität auswirken: Rollstuhltyp (elektrisch oder mechanisch betriebener Rollstuhl), Rollstuhlmodell, Bereifung etc. spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fortbewegung im öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum respektive für die Bewältigung auftretender Hindernisse. Ebenso kann sich die Handhabung des Rollstuhls (z.B. das "Kippen") (mit)entscheidend auf die Benutzungsmöglichkeiten z.B. öffentlicher Verkehrsmittel auswirken, die nicht berollbar sind. Andererseits kann auch trotz barrierefreier Umweltbedingungen aufgrund von Mangel an Know-how der Handhabung des Rollstuhls die individuelle Mobilität beeinträchtigt werden.
Wie die Interviews der RollstuhlfahrerInnen ergaben, spielen in diesem Zusammenhang die Anschaffung/Finanzierung des Hilfsmittels, Beratung und Information beim Rollstuhlkauf sowie Mobilitäts-Trainings für die BenutzerInnen eine wichtige Rolle:
Für RollstuhlfahrerInnen ist es sehr wichtig, beim Rollstuhlkauf gut beraten zu sein, nicht nur hinsichtlich der individuellen Passform, sondern auch bezüglich der spezifischen Fahreigenschaften des Rollstuhls, da es einen enormen Unterschied macht, ob ein Rollstuhl straßentauglich sein soll oder nur für die Wohnung benutzt wird. Mit einer falschen Rollstuhlwahl kann räumliche Mobilität noch bevor der erste Meter im öffentlichen Raum zurückgelegt wird bereits im Keim erstickt werden. Da in Österreich die Hilfsmittel vergleichsweise teuer sind, werden sie oftmals aus dem Ausland importiert, wodurch eine ausführliche und individuelle Beratung entfällt.
Wichtig wäre eine intensive KundInnenberatung in den Geschäften. Menschen die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sind im eigenen Interesse hierbei angehalten, Informationsaustausch zu suchen (z.B. Interessensvertretungen). Eine "Hilfsmittelberatungsstelle" könnte bei Bedarf, welcher zuvor zu evaluieren wäre, etabliert werden.
RollstuhlfahrerInnen in Österreich haben mit teilweise überhöhten Anschaffungskosten bei Hilfsmitteln zu rechnen, da der Hilfsmittelmarkt durch Oligopole[83] gekennzeichnet ist. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 221) Es sollte im Interesse der von den Hilfsmitteln abhängigen KundInnen zu einer Liberalisierung des Marktes kommen. Diese würden Tarifsenkungen bei den Produktgruppen nach sich ziehen. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Krankenversicherungsträger, die gesetzlich für die Leistungen für Hilfsmittel zuständig sind, die Zuschüsse in den letzten Jahren reduzierten wäre dies wünschenswert. (vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 220)
Die Finanzierung von Hilfsmitteln kann auch als medizinische Maßnahme der Rehabilitation möglich sein. Allerdings ist dabei die Ursache der Behinderung, also, ob ihr ein Arbeits- oder Freizeitunfall zugrunde liegt oder ob eine Schädigung von Geburt an besteht sowie ob die Person beim Eintritt der Schädigung erwerbstätig, mitversichert oder PensionistIn ist, entscheidend (Kausalitätsprinzip). (vgl. Badelt 1993: 139) Abgesehen davon, dass sich manche Personen daher Mobilität "gar nicht leisten" können (vgl. Theussl/Lückler/Steinbacher 1991: 46) steht mit der Knüpfung von Leistungen an das Kausalitätsprinzip beispielsweise auch die Möglichkeit ein Mobilitätstraining zur Handhabung des Rollstuhls (im öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum) in Anspruch nehmen zu können, in Verbindung. Da ein solches Mobilitätstraining quasi eine Startbasis für die räumliche Mobilität bildet, "denn es nützen die besten Hilfsmittel nicht viel, wenn der Behinderte nicht damit umgehen kann" (Theussl/Lückler/Steinbacher 1991: 46), sollte neben einer prinzipiellen Hinorientierung des Sozialversicherungssystems zum Finalitätsprinzip (Leistungen sollten von Menschen mit gleicher Behinderung auch gleich genützt werden können) das Angebot des Mobilitätstrainings, das von allen kostenfrei in Anspruch genommen werden kann, geschaffen werden. (vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002: 98) Wie ein solches Mobilitätstraining konkret gestaltet, finanziert und durchgeführt werden kann, wäre genauer auszuarbeiten. Anregungen dazu wären z.B.: Die Schaffung oder Förderung einer (bestehenden) Organisation, die durch betroffene ExpertInnen ("Mobilitätscoachs") ein spezifisches Training anbietet oder etwa über die Förderung der "Persönlichen Assistenz" im Rahmen der mit entsprechend geschulten AssistentInnen z.B. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trainiert werden könnte.
Betreffend der Maßnahmenvorschläge wie "Mobilitätstrainings" oder der Hilfsmittelanschaffung ist meines Erachtens zu beachten: Auch wenn der/die RollstuhlfahrerIn den Rollstuhl perfekt Handhaben kann und z.B. befähigt ist, die U-Bahn trotz Spalt zu benutzen, dann darf daraus keinesfalls abgeleitet werden, dass jede/r einzelne RollstuhlfahrerIn nur ein Training und/oder den "richtigen" Rollstuhl braucht, um selbstständig am öffentlichen Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können. Der Abbau der behindernden Barrieren im öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum muss das primäre gesellschaftspolitische Ziel zur Gewährleistung einer barrierefreien Mobilität für behinderte Menschen sein, denn ein Training, das z.B. befähigt ein nicht barrierefrei zugängliches Verkehrsmittel dennoch "irgendwie" benutzen zu können, bleibt immer auf eine begrenzte Zahl von RollstuhlfahrerInnen beschränkt. Außerdem würde eine Sichtweise transportiert, die als Problem nicht die barrierebehaftete Umwelt ansieht, sondern der/die einzelne "unbefähigte" bzw. untrainierte RollstuhlfahrerIn wäre "das Problem".
8.2.5.2 Good-Practice: "Persönliche Assistenz" am Beispiel der Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG)
Am Beispiel des Pilotprojekts WAG (Wiener Assistenzgenossenschaft) soll skizziert werden, welche Rolle persönliche Assistenz im Kontext des Mobilitätsaspekts spielen könnte. Zunächst ist es jedoch notwendig, kurz zu erläutern, was persönliche Assistenz meint.
Persönlicher Assistenz liegt die Ideologie oder Philosophie des "Selbstbestimmt Leben" zugrunde. Selbstbestimmt leben bedeutet, weitgehend die Kontrolle über das eigene Leben zu haben, über Wahlmöglichkeiten zwischen akzeptablen Alternativen bei der Bewältigung des Alltags zu verfügen, wie dies für nichtbehinderte Menschen selbstverständlich ist. Jede/r soll selber darüber entscheiden können, z.B. in welche Schule er/sie gehen möchte oder ob er/sie lieber mit dem öffentlichen Bus oder mit dem Auto in die Arbeit fährt - also, einfach ein "normales" Leben führen zu können. Das Modell der persönlichen Assistenz wurde in Europa in den letzten 20 Jahren von behinderten Menschen innerhalb der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung weiterentwickelt. Ihm liegt das Paradigma zugrunde, dass behinderte Menschen selbst die ExpertInnen in eigener Sache sind, das heißt, dass er/sie am besten weiß, welche Bedürfnisse, wie am besten befriedigt werden können oder welche Hilfe nötig ist, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Persönliche Assistenz ist einerseits eine Organisationsform von Hilfen für behinderte Menschen, die Fremdbestimmung reduziert und Selbstbestimmung ermöglicht und gleichzeitig ist sie ein Instrument, das Chancengleichheit forciert und Diskriminierung abbaut. Es erfolgt dadurch gewissermaßen eine Umverteilung der Macht von Institutionen (über behinderte Personen) hin zu den Betroffenen selbst. Persönliche Assistenz bezieht sich auf alle Lebensbereiche: Arbeitsplatz, "basic-needs" (Körperpflege etc.), Haushaltsführung, Freizeit, Mobilität usw. Damit von Persönlicher Assistenz gesprochen werden kann, muss eine Reihe von Kompetenzen in den Händen der AssistenznehmerInnen liegen. Sie bestimmen darüber, wie die Assistenz zu verrichten ist (Anleitungskompetenz), an welchem Ort sie erbracht werden soll (Raumkompetenz), wann sie geleistet werden soll (Organisationskompetenz), wer die Assistenz leistet (Personalkompetenz) und wie die Geldmittel verwendet werden (Finanzkompetenz). (vgl. Brozek/Schachinger 2003)
WAG - Wiener Assistenzgenossenschaft
Als Pilotprojekt wurde 2003 die WAG (vgl. Brozek/Schachinger 2003, (online) www.wag.or.at) in der Form eines gemeinnützigen Dienstleistungsunternehmens gegründet. Als Alternative zu den üblichen Betreuungsangeboten setzt sie sich zum Ziel, dass Menschen mit Behinderung, die im Alltag Hilfe brauchen, ihr Leben mit Persönlicher Assistenz selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten können, also die Subjekte und nicht Objekte von Hilfeleistungen sind. Die WAG übernimmt für ihre KundInnen Tätigkeiten wie z.B. Gehaltsverrechnung oder Abrechnung der Leistungen mit den Fördergebern, bietet Beratung etwa hinsichtlich der Einschulung der Persönlichen AssistentInnen, Organisation des AssistentInnenteams an oder unterstützt z.B. bei der Assistenzplanerstellung, der Erlangung der erforderlichen Managementqualitäten etc. Eine Assistenzstunde kostet derzeit 20 Euro, wobei ca. ein Viertel davon über das Pflegegeld abgedeckt werden kann, der Rest muss aus eigener Tasche finanziert werden.
Persönliche Assistenz unterscheidet sich von Betreuung im Sinne des Pflegegeldgesetztes primär dahingehend, dass Behinderung bei ersterem im Kontext eines sozialen Modells, bei letzterem im Kontext eines medizinischen Models, welches von einem Defizit des behinderten Menschen ausgeht, gesehen wird.
Ist etwa in Großbritannien (seit Anfang der 1990er Jahre), Schweden oder Deutschland die Finanzierung der Persönlichen Assistenz gesetzlich bereits verankert und bildet somit eine Wahlmöglichkeit bei Hilfs- und Betreuungsbedarf behinderter Menschen, so besteht in Österreich dahingehend noch kein Rechtsanspruch. In Österreich ist bei den politisch Verantwortlichen noch die Meinung vorherrschend, dass persönliche Assistenz eine "Luxusleistung" darstellt (ORF 2003).
Persönliche Assistenz kann, wie gesagt, in allen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt werden: Hilfe- und Unterstützung am Arbeits- oder Ausbildungsplatz, bei den "basic-needs", bei der Haushaltsführung, der Freizeitgestaltung oder bei der Erhaltung der Gesundheit. Sie richtet sich aber immer nach den spezifischen Bedürfnissen der KundInnen, hängt von deren Lebenssituation, dem Lebensstil oder auch von den vorhandenen Barrieren beim Mobilsein im öffentlichen Raum ab.
Werden im Konzept der WAG vor allem die arbeitsmarktpolitischen Aspekte von Persönlicher Assistenz herausgestrichen (Persönliche Assistenz fördert die Jobchancen von Menschen mit Behinderung bzw. sichert deren Arbeitsplätze und gibt ihnen die Möglichkeit zu GehaltsempfängerInnen und nicht zu SozialhilfeempfängerInnen zu werden), so möchte ich nun das Thema Mobilität tangierende Aspekte ansprechen.
Persönliche Assistenz - Mobilität
Vor dem Hintergrund, dass die selbstständige räumliche Mobilität behinderter Menschen aufgrund der vielfältigsten Barrieren eingeschränkt oder verunmöglicht wird, möchte ich einigen Fragen nachgehen: Welche Auswirkungen kann/könnte das Modell der Persönlichen Assistenz auf die Mobilität bzw. Mobilitätsmöglichkeiten behinderter Menschen haben? Welche Vorteile können benannt werden, wenn für die alltägliche Mobilität, also bei der Zurücklegung von Arbeits-, Freizeit- und Versorgungswegen, persönliche Assistenz in Anspruch genommen werden kann?
-
Eine zentrale Konsequenz der Inanspruchnahme von Assistenz bei der alltäglichen räumlichen Mobilität ist, dass der (mobilitäts)behinderte Mensch im öffentlichen Raum überhaupt sichtbar wird. Er bleibt nicht "verborgen", wie beispielsweise durch den Transport per Fahrtendienst, sondern tritt im Zuge der Benutzung Öffentlicher Verkehrsmittel wie alle anderen BenutzerInnen auch in das Spiel von Kommunikation und Interaktion im öffentlichen Raum ein.
-
Die AssistenznehmerInnen verfügen über mehr Entscheidungsfähigkeit und Wahlfreiheit. Er/Sie kann selbst entscheiden, ob z.B. lieber mit einem Fahrtendienst oder mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln der tägliche Arbeitsweg zurückgelegt werden soll.
-
Die AssistenznehmerInnen verfügen über mehr Flexibilität, Spontanität und Selbstbestimmung. Sie können selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt oder wie häufig sie Wege zurücklegen möchten. Hier kann persönliche Assistenz sicherlich flexibler agieren als etwa Fahrtendienste mit ihrem eingeschränkten Inanspruchnahme-Zeiten bzw. -system. Ebenso kann eigenständig darüber entschieden werden, von wem der/die Einzelne Hilfe in Anspruch nimmt und wie diese Hilfe auszusehen hat. Es ist nachvollziehbar, dass eine vom Assistenznehmer bzw. von der Assistenznehmerin selbst eingeschulte Person persönliche Assistenz gezielter und mit mehr Know-how etwa Hilfe beim Einstieg in die U-Bahn leisten kann, als eine fremde Person. Zusätzlich ist vermutlich das Sicherheitsgefühl bei der Benutzung des Verkehrsmittels durch die Unterstützung einer bekannten Vertrauensperson mehr gegeben, als dies durch fremde Personen (PassantInnen) der Fall wäre. Ebenso macht es einen Unterschied, ob eine fremde Person um Hilfe gebeten werden muss oder, ob die Hilfe eines/einer bezahlten AssistentIn in Anspruch genommen wird. Weiters kann durch persönliche Assistenz flexibler auf plötzlich auftauchende Hindernisse (nicht funktionierende Lifte, Stufen, etc.) reagiert werden.
Persönliche Assistenz könnte entscheidend die Mobilitätsmöglichkeiten in einer barrierebehafteten Umwelt erhöhen und die Qualität der Mobilität verbessern. Mobilität kann durch persönliche Assistenz sicherlich auch gefördert werden, z.B. fassen vielleicht dadurch einige erst den Mut überhaupt ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen und sehen, dass dies durchaus auch eine Option bei der Verkehrsmittelwahl für sie sein kann. Persönliche Assistenz könnte hierbei vielleicht auch unterstützend im Sinne eines Anstoßgebens zur Erweiterung der Mobilitätsmöglichkeiten bieten oder eine Multiplikator-Rolle einnehmen, wenn es etwa um Informationsvermittlung geht. Denkbar wäre z.B. Information und Schulung der AssistentInnen hinsichtlich der praktischen Möglichkeiten öffentlicher Verkehrsmittelnutzung, um dies bei Bedarf die KundInnen weiterzugeben.
Persönliche Assistenz könnte auch eine Empowerment-Funktion zur selbstständigen Bewältigung von Alltagswegen übernehmen. Auf Wunsch der Kundin/des Kundin könnte z.B. so lange die richtige Technik für die Benutzung der ULF-Straßenbahn geübt werden, bis er/sie sich sicher genug fühlt, ohne Begleitung das Verkehrsmittel zu nutzen.
Festzuhalten ist, dass mit diesen Ausführungen nicht der Schluss nahe gelegt werden soll, dass durch das Einsetzen Persönlicher Assistenz für RollstuhlfahrerInnen zur Fortbewegung im öffentlichen Verkehrsraum auf die Beseitigung baulicher oder verkehrsmittelnutzungsbezogener Hindernisse verzichtet werden kann, etwa nach dem Motto: AssistentIn hilft - Stufe bleibt. Dem möchte ich entgegenhalten, dass das primäre Ziel die Beseitigung der umweltfaktorischen Barrieren sein muss.
[80] Im Kontext der Verbesserung der Mobilitätsbedingungen von RollstuhlfahrerInnen ist mit "barrierefrei" oder "Barrierefreiheit" immer "Berollbarkeit" bzw. "Rollstuhlgerechtigkeit" gemeint.
[81] Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Diplomarbeit konnte nicht mehr eruiert werden, ob tatsächlich nur mehr Niederflurbusse zum Einsatz kommen.
[82] Die Teilnahme seitens des Personals der Wiener Linien erfolgte freiwillig.
[83] Oligopol = "Form des Monopols, bei der der Markt von einigen wenigen Großunternehmen beherrscht wird" (Duden 1990).
ACKERMANN Kurt (1996): Mobilitätserfordernisse ausgewählter Personengruppen. In: INTERNATIONALES VERKEHRSWESEN (1996). 48. Jg. Heft 1-2, Jänner/Februar. Hamburg. S.22-26
ALEKSANDROWICZ Dariusz (1996): Zwischen Ausgrenzung und Universalanspruch. In: JOERDEN Jan C. (1996) (Hg.) S. 329-353.
ARNADE Sigrid, HEIDEN H.-Günter, VOM HOFE Jutta, MITTLER Karl-Josef, ZIRDEN Heide (Red.) (1997): Die Gesellschaft der Behinderer. Das Buch zur Aktion Grundgesetz. Reinbek bei Hamburg.
BADELT Christoph, ÖSTERLE August (1993): Zur Lebenssituation behinderter Menschen in Österreich. Wien.
BARNES Colin (2002): Introduction: Disability, policy and politics. In: POLICY & POLITICS (2002). Vol. 30. Nr. 3. London. S. 311-318.
BERDEL Dieter (1996): Das Netzwerk der Beratungsstellen für barrierefreies Bauen. In: BREIT T., KREMSER W. (1996) (Hg.) S. 15-19.
BERDEL Dieter, BERNARD Jeff, HOVORKA Hans, PRUNER Peter: Behindernde Umwelt - Zustände, Umstände, Widerstände. Analysen und Stellungnahmen aus der Sicht des Sozialen Design. In: NEIDER Michael, RETT Andreas (1981) (Hg.) S. 273-295.
BERDEL Dieter, PRUNER Peter (1995): Behinderte Menschen in Bahn und Bus. Wien.
BERNARD Jeff (1995): Behinderung: Kultur, Umraum, Gesellschaft / Jeff Bernard. ÖGS/ISSS. Wien.
BERNARD Jeff, HOVORKA Hans (1992): Behinderung: ein gesellschaftliches Phänomen. Befunde, Strukturen, Probleme. Wien.
BERNDT Andreas, BREINER Gerlinde, KRICHMAYR Martina, ROITHNER Thomas (2001) (Hg.): Der totale Markt. Gefahr für Sozialstaat und Demokratie. Wien.
BGBl. I Nr. 82/2005: Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG sowie Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes, des Bundesbehindertengesetzes, des Bundessozialamtsgesetzes, des Gleichbehandlungsgesetzes, des Bundesgesetzes über die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft sowie des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes. (online) www.ris.bka.gv.at [Stand: 31.1.2006].
BGBl. I Nr. 87/1997: Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes (online) http://ris1.bka.gv.at/bgbl-pdf/RequestDoc.aspx?path=bgblpdf/1997/1997a087.pdf&docid=1997a087.pdf [Stand: 10.11.2006].
BIZEPS (Hg.) (1999): Broschüre "Gleichstellung jetzt!". Wien. (online) http://www.bizeps.or.at/info/gleichst.html [Stand: 1.12.2006].
BIZEPS (Hg.) (2001): (online) www.bizeps.or.at/info/jetzt/fall06.html [Stand: 28.6.2001].
BIZEPS (Hg.) (2002): Bim. (online) www.service4u.at/info/BIM.html [Stand: 14.8.2002].
BIZEPS (Hg.) (2004): OSZE. (online) www.bizeps.or.at/info/gleich/4252.html [Stand: 2.8.2004].
BIZEPS (Hg.) (2006a): U-Bahn. (online) www.service4u.at/links.php?nr=111 [Stand: 7.11.2006].
BIZEPS (Hg.) (2006b): Aufzüge. (online) www.service4u.at/links.php?nr=26 und www.service4u.at/links.php?nr=111 [Stand: 16. 11. 2006].
BIZEPS (Hg.) (2006c): Bus. (online) http://www.service4u.at/links.php?nr=27 [Stand: 16. 11. 2006].
BLOEMERS Wolf (2004): Europäische Visionen in Bezug auf behinderte Menschen. In: BLOEMERS Wolf, WISCH Fritz-Helmut (2004) (Hg.) S. 227-237.
BLOEMERS Wolf, WISCH Fritz-Helmut (2004) (Hg.): European Social Inclusion/Sozialgemeinschaft Europa. Vol. 10. Behinderte Menschen aus Europäischen Blickwinkeln. Frankfurt am Main.
BOURDIEU (1998) (Hg.) Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion. Konstanz.
BOURDIEU Pierre (1991): Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum. In: WENTZ (1991) (Hg.) S. 25-34.
BOURDIEU Pierre (1998): Der Neoliberalismus. Eine Utopie grenzenloser Ausbeutung wird Realität. In: BOURDIEU (1998) (Hg.) S. 109-118.
BOURDIEU Pierre (1998): Der Neoliberalismus. Eine Utopie grenzenloser Ausbeutung wird Realität. In: Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion. Konstanz. S. 109-118.
BOURDIEU Pierre (2001): Das politische Feld: Zur Kritik der politischen Vernunft. Konstanz.
BRAND Ulrich (2004): Soziale Politik immer neu erkämpfen. Alternativen gibt es - sie werden nur nicht gehört. In: HEBEL Stephan, KESSLER Wolfgang (2004) (Hg.) S. 205-212.
BREIT T., KREMSER W. (1996) (Hg.): ICCHP 96 Österreichtag Proceedings. Publikation der Vorträge der Veranstaltung am 16.Juli 1996 an der Johannes Kepler Universität Linz. Wien.
BROZEK Dorothea, SCHACHINGER Roswitha (2003): WAG -Wiener Assistenzgenossenschaft. Konzept. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (1993) (Hg.): Das Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES (1999) (Hg.): Bericht zur Lage behinderter Menschen Nr. 3 - Freizeit/Mobilität. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2006c) (Hg.): Broschürenreihe "Einblick". Orientierungshilfe zum Thema Behinderung. Heft8 - Gleichstellung. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2006a) (Hg.): Pflegegeldbezieher/innen. (online) http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/8/1/3/CH0356/CMS1078922496642/pflege04.pdf [Stand: 10.11.2006].
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2006b) (Hg.): "NAP inclusion". (online) http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/0/7/5/CH0335/CMS1083929522616/nap_ii-de2.doc [Stand: 14.10.2006].
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2005) (Hg.): Menschen mit Behinderung und Arbeitsmarkt. (online) http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/8/1/3/CH0356/CMS1078922496642/menschen_m_behin derung04.pdf [Stand: 22.7.2005].
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2003b) (Hg.): Bundesweites arbeitsmarktpolitisches Behindertenprogramm (BABE). Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT, GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ (2003a) (Hg.): Bericht der Bundesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE (2003) (Hg.): Straßenraum für Alle. Wien.
BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND VERKEHR (1998) (Hg.): good-practice-guide. Mobilität trotz Handicap. Zugang behinderter Menschen zu Verkehr und Mobilität im nationalen und internationalen Vergleich. Wien.
BUTTERWEGE Christoph (2001): Das neoliberale Konzept zum "Umbau" des Sozialstaates im Zeichen der Globalisierung. In: BERNDT et al. (2002) (Hg.) S. 30-63.
COMITE ESPANOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVALIDOS, EUROPEAN BLIND UNION, FINNISH DISABILITY FOURM, INCLUSION EUROPE et al. (2002) (Hg.): Disability and social exclusion in the European Union. Time for change, tools for change. Final study report. (online) http://www.edf-feph.org/en/policy/socexc-pub.htm [Stand: 14.10.2006].
DAVID-FREIHSL Roman (2004): Weichen für neue Schnellbahn gestellt. In: DER STANDARD. Tageszeitung. Ausgabe vom 22. 12. 2004. S.9.
DETTMERING Katja (1999): Behinderung und Anerkennung. Gleichheit fordern, auf Differenz bestehen. In: ROMMELSPACHER Birgit (1999) (Hg.) S.179-205.
DÖRHÖFER Kerstin, TERLINDEN Ulla (1998): Geschlechterverhältnisse und Raumstrukturen. Basel u.a.
DREXEL Anita, FEURSTEIN Bernadette, LICKA Lilli, PROKSCH Thomas (1991): Behindertengerechte städtische Freiräume. Wien.
DREYFUS Hubert L., RABINOW Paul (1994): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Weinheim.
DUDEN (1990). Fremdwörterbuch. Mannheim.
ENGL Michael, SCHLÖGL Waltraud, SIGL Ulrike (2003): Gemeinsam mobil. Dokumentation der Pilotschulung "Barrierefreier Zugang für Fahrgäste im Rollstuhl" mit RollstuhlfahrerInnen und dem Fahrpersonal der Wiener Linien. (Hg.): Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien.
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2002) (Hg.): Definitionen des Begriffs "Behinderung" in Europa: Eine vergleichende Analyse. Eine Studie der Universität Brunel im Auftrag der Europäischen Kommission (Generaldirektion Beschäftigung und Soziales Referat E/4). (online) http://europa.eu.int/comm/employment_social/index/complete_report_de.pdf [Stand: 14.1.2005].
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2003) (Hg.): MISSOC-Info 1/2003: Soziale Sicherung für Menschen mit Behinderung. Manuskript. o.O. (online) http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/2003/info/info_0103_de.pdf [Stand: 14.1.2005].
FETKA-EINSIEDLER Gerhard, FÖRSTER Gerfried (1994) (Hg.): Diskriminiert? Zur Situation der Behinderten in unserer Gesellschaft. Graz.
FIRLINGER Beate/INTEGRATION:ÖSTERREICH (2003) (Hg.): Buch der Begriffe. Wien 2003.
FLADE Antje (1994) (Hg.): Mobilitätsverhalten: Bedingungen und Veränderungsmöglichkeiten aus Umweltpsychologischer Sicht. Weinheim.
FLADE Antje (2000): Theorien und Modelle zur Verkehrsmittelwahl. In: VERKEHRSZEICHEN (2000). 16. Jg. Heft 3. Mühlheim an der Ruhr. S. 14-17.
FONDS SOZIALES WIEN (2006) (Hg.): Freizeitfahrtendienste. (online) http://pflege.fsw.at/tagesbetreuung/fahrtendienste.html [Stand: 16. 11. 2006].
ForseA - Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V. (2006) (Hg.): Standard Rules der Vereinten Nationen. (online) http://www.forsea.de/aktuelles/un_standard_rules.shtml [Stand: 8.12.2006].
FUCHS Peter (2004): Der Schatten der Ausgrenzung. Was ist mit dem Sozialstaat los? In: HEBEL Stephan, KESSLER Wolfgang (2004) (Hg.) S. 23-28.
FUNK, Bernd Christian (1994): Menschenrechte - behinderte Menschen - Österreichische Bundesverfassung. In: FETKA-EINSIEDLER Gerhard, FÖRSTER Gerfried (1994) (Hg.) S. 63-79.
GOLKA Thomas (2004): Agenda 22. Umsetzung der UN-Standardregeln auf lokaler und regionaler Ebene. Behindertenpolitische Planungsrichtlinien für kommunale und regionale Behörden. Überarbeitete Version. (Hg.): Fürst Donnersmark-Stiftung et al. (online) http://www.fdst.de [Stand: 10.12.2006].
GRODE Walter (2005): Das neue Lob der Freiheit - Vom Leben auf eigene Rechnung. Essay. (online) http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/sok/25252.html [Stand: 18.7.2005].
GROISS Peter (1996): Wien - Umsetzung des barrierefreien Bauens. In: BREIT T., KREMSER W. (1996) (Hg.) S. 25-28.
HASELSTEINER Barbara, REITER Karl (2000): Mobilität für Menschen mit Behinderung. Graz.
HEBEL Stephan, KESSLER Wolfgang (2004) (Hg.): Zukunft sozial: Wegweiser zu mehr Gerechtigkeit. Frankfurt am Main.
HEIDEN Hans-Günter (1996) (Hg.): "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Grundrecht und Alltag - eine Bestandsaufnahme. Reinbek bei Hamburg.
HEIDEN Hans-Günter (1997): Behindert ist man nicht - behindert wird man. In: ARNADE et al. (1997) (Red.) S. 13-19.
HOFER Hansjörg (2006a) (Hg.): Alltag mit Behinderung - Ein Wegweiser für alle Lebenslagen. Wien/Graz.
HOFER Hansjörg (2006b): Behindertengleichstellungsrecht in Österreich. Referat im Rahmen der Konferenz "Barrierefreie Karriere - Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung", 12.-13. Juni 2006 in Brünn. Konferenzunterlagen.
HOHENESTER Gerlinde (1994): Behinderung durch bauliche Barrieren. In: FETKA-EINSIEDLER Gerhard, FÖRSTER Gerfried (1994) (Hg.) S. 79-87.
HOVORKA Hans (1999) (Hg.): Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen in allen Lebensbereichen und Lebensphasen. Klagenfurt.
HUAINIGG Franz-Joseph (1999): O du mein behinderndes Österreich! Zur Situation behinderter Menschen. Klagenfurt.
HUMPHREYS Anne, MÜLLER Kurt (1996): Norm und Normabweichung. In: ZWIERLEIN Eduard (1996) (Hg.) S. 57-67.
INTERESSENSVERTRETUNG DER BEHINDERTEN MENSCHEN NACH § 46 DES WIENER BEHINDERTENGESETZES (2002): Behindertengleichstellung in Wien. Ist-Stand und Notwendigkeiten. Bericht 2002. Wien. (online) http://www.gleichstellung.at/wien/wien2002.doc [Stand: 10.12.2006].
JOERDEN Jan C. (1996) (Hg.): Diskriminierung - Antidiskriminierung. Berlin u.a.
JOHNSTONE David (2004): Interventionstheorien und sozialer Wandel in Bezug auf Behinderung. In: BLOEMERS Wolf, WISCH Fritz-Helmut (2004) (Hg.) S. 157-177.
KALWITZKI Klaus-Peter (1994): Mobilitätsverhalten: Bedingungen und Veränderung - Beiträge aus psychologischer Sicht. In: VERKEHRSZEICHEN. 10. Jg. Heft 4. Mühlheim an der Ruhr. S. 12-18.
KANTER Olivia Tamara (1997): Mobilitätsprobleme behinderter Menschen im Werktagsverkehr von Wien. Diplomarbeit. Wien.
KOBINET-NACHRICHTEN (2004): Barrierefreier Zugang für "Talent" bleibt Thema. In: BIZEPS (Hg.) (online) http://www.gleichstellung.at/news.php?nr=5254 [Stand: 10.12.2006]
KOBINET-NACHRICHTEN (2006): Wiener Linien bald komplett mit Niederflurbussen. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.bizeps.or.at/news.php?nr=7193&suchhigh=niederflurbusse [Stand: 16. 11. 2006].
KÖNIGSEDER Renate Maria (1999): Geschlechtsspezifische Raumaneignungsmöglichkeiten und deren Reproduktion durch gebauten Raum. Diplomarbeit. Linz.
KRICHMAYR Karin (2006): "'Ulf' wird pünktlich und verlässlich". In: DER STANDARD. Tageszeitung. Ausgabe vom 8.11.2006.
KRISPL Michael (2004): Wiener Landtag beschließt einstimmig Bauordnungsnovelle zum barrierefreien Bauen. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.gleichstellung.at/news.php?nr=5209 [Stand: 16. 11. 2006].
KRISPL Michael (2006b): Diskriminierungsschutz. In: HOFER Hansjörg (2006b) (Hg.) S. 233-270.
KRONAUER Martin (2002): Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus. Frankfurt am Main/New York.
LABI Robert (2006): Barrierefreie Stadt Wien. In: MAGISTRAT DER STADT WIEN (2006) (Hg.) (online) http://www.wien.gv.at/menschen/barrierefreiestadt/ [Stand: 10. 11. 2006].
LADSTÄTTER Martin (2002): Freizeitfahrtendienst: 38 % mehr Selbstbehalt? In: BIZEPS (Hg.) (online) www.bizeps.or.at/news.php?nr=3111&suchhigh=fahrtendienst [Stand: 16. 11. 2006].
LADSTÄTTER Martin (2004): SPÖ beschließt: behindertenfeindliche Fahrzeuge werden mitfinanziert. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.gleichstellung.at/news.php?nr=4942 [Stand: 12. 2. 2004].
LADSTÄTTER Martin (2006): "Neuer Service der Wiener Linien: Eigener ULF-Fahrplan. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.bizeps.or.at/news.php?nr=7274 [Stand: 3. 11. 2006].
LAMNEK Siegfried (1995): Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. Weinheim.
LÄPPLE Dieter (1991): Gesellschaftszentriertes Raumkonzept. Zur Überwindung von physikalisch-mathematischen Raumauffassungen in der Gesellschaftsanalyse. In: WENTZ Martin (1991) (Hg.) S. 35-46.
LEMKE Thomas (2000): Die Regierung der Risiken. Von der Eugenik zur genetischen Gouvernementalität. In: LEMKE/KRASMANN/BRÖCKLING (2000) (Hg.) S. 227-265.
LEMKE Thomas, KRASMANN Susanne, BRÖCKLING Ulrich (2000) (Hg.): Gouvermentalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main.
LIMBOURG Maria, FLADE Antje, SCHÖNHARTING Jörg (2000): Mobilität im Kindes-und Jugendalter. Opladen.
LÖW Martina (2002) (Hg.): Differenzierungen des Städtischen. Opladen.
MA 46 (2006): Allgemeine Behindertenparkplätze in Wien. In: MAGISTRAT DER STADT WIEN (2006) (Hg.) (online) http://www.wien.gv.at/verkehr/organisation/service/behindertenparkplaetze/index.htm [Stand: 10.11.2006]
MAGISTRAT GRAZ, Stadtbaudirektion (1994): Straßen für Alle. Ideen zur Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes für Fußgänger. Graz.
MATTNER, Dieter (2000): Behinderte Menschen in der Gesellschaft. Stuttgart.
McKAY Colin (1995): Diskriminierung innerhalb der Union. In: Der Status von behinderten Menschen in Europäischen Verträgen. Unsichtbare Bürger. Brüssel. S.21-39.
NAGL-DOCEKAL Herta, PAUER-STUDER Herlinde (1996): Politische Theorie. Differenz und Lebensqualität. Frankfurt am Main.
NAGL-DOCEKAL Herta, PAUER-STUDER, Herlinde (1996) (Hg.): Politische Theorie. Differenz und Lebensqualität. Frankfurt am Main.
NEIDER Michael, RETT Andreas (1981): Behindertenpolitik. Politik für Behinderte. Wien.
OECD (2003): Behindertenpolitik zwischen Beschäftigung und Versorgung. Ein internationaler Vergleich. Deutsche Edition: MARIN Bernd (2003) (Hg.): Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Band 12. Europäisches Zentrum Wien. Wien.
OECHSNER Andreas, HEIDEN Hans-Günter (1996): "Sie sind systemfremd!" Über die systematische Verletzung des Menschenrechts auf Mobilität. In: HEIDEN Hans-Günter (1996) (Hg.) S. 55-67.
ORF (2003) (Hg.): Ohne Barrieren. Neue Wege für Menschen mit Behinderung. Beiträge aus dem Ö1 Schwerpunkt anlässlich des "Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung". CD 1+2. Wien.
ÖSTAT (1997) (Hg.): Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Hauptergebnisse des Mikrozensus-Sonderprogrammes Juni 1995. In: STATISTISCHE NACHRICHTEN Nr. 5/1997. Wien. S. 372-382.
ÖSTAT (2003) (Hg.): Körperlich Beeinträchtigte und Erwerbstätigkeit. Mikrozensus Juni 2002. In: STATISTISCHE NACHRICHTEN Nr. 4/2003. Wien. S. 278-288.
ÖSTERWITZ Ingolf (1996): Das Konzept Selbstbestimmt Leben - eine neue Perspektive in der Rehabilitation. In: ZWIERLEIN Eduard (1996) (Hg.) S. 197-204.
PARLAMENTSKORRESPONDEZN (2005): Verfassungsausschuss beschließt Behindertengleichstellungsgesetz. In: BIZEPS (Hg.) (online) http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=6109 [Stand: 18.7.2005].
PAULS Kerstin (2001) (Hg.): Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region Stuttgart. Arbeitsbericht. Nr. 190. Stuttgart.
RAINER Johanna (2006): Bauen. In: HOFER Hansjörg (2006) (Hg.) S. 131-156.
RESCH Manfred F. (1996): Menschengerechtes Bauen. In: BREIT T., KREMSER W. (1996) (Hg.) S. 32-37.
RIESS Erwin (1999): Volle gesellschaftliche Teilhabe: Vom Konzept zur schwierigen Umsetzung. In: HOVORKA Hans (1999) (Hg.) S. 13-37.
RIESS Erwin, FLIEGER Petra (2000): Wege zur Beseitigung von Diskriminierungen behinderter Menschen. Wien. (online) http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger_riess-diskriminierung.html [Stand: 12.12.2006].
ROMMELSPACHER Birgit (1995): Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht. Berlin.
ROMMELSPACHER Birgit (1999) (Hg.): Behindertenfeindlichkeit. Ausgrenzungen und Vereinnahmungen. Göttingen.
ROMMELSPACHER Birgit: Behindernde und Behinderte - Politische, kulturelle und psychologische Aspekte der Behindertenfeindlichkeit. In: ROMMELSPACHER (1999) (Hg.) S. 7-37.
SCHELLER Andrea (1995): Frau. Macht. Raum. Geschlechtsspezifische Regionalisierungen der Alltagswelt als Ausdruck von Machtstrukturen. Zürich.
SCHÖNWIESE Volker (1999): Die "Alternative Behindertenbewegung". In: HUAINIGG Franz-Joseph (1999) (Hg.) S. 46-55.
SCHULTZE-MELLING Jan (1997): Mit dem Rollstuhl mobil. Augsburg.
SICHER LEBEN (1997): Unfallinvalidität in Österreich. (Hg.): Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien.
SIGL Ulrike, LEUPRECHT Eva, GÖTZ Rudolf (2002): RollstuhlfahrerInnen in Wien. (Hg.): Kuratorium für Schutz und Sicherheit . Wien.
SIMONE Magda (1999): Einstellungen gegenüber körperbehinderten Menschen und die Wirkung der Durchführung der Befragung durch körperbehinderte und nichtkörperbehinderte Interviewer. Diplomarbeit. Wien.
SOJA Edward W. (1991): Geschichte:Geographie:Modernität. In: WENTZ Martin (1991) (Hg.) S. 73-90.
SPÖ (2005): SPÖ-Stubenvoll: Behindertenpolitik Wiens ist vorbildlich. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.bizeps.or.at/news.php?nr=7025&suchhigh=bauordnung%2Bwien [Stand: 16. 11. 2006].
SRB Manfred (2004): Bauordnungsnovelle: Sieg mit Wermutstropfen. In: BIZEPS (Hg.) (online) www.bizeps.or.at/news.php?nr=5290&style=2 [Stand: 16.11.2006].
STADLER-RICHTER Helga (2003): Ich habe ein Handicap. Anregungen für Behindertenpolitik im öffentlichen und privaten Bereich. Wien.
STERNEDER Werner (1999): Konzept für eine BehindertenInformationsQuelle www.biq.at zur Realisation im Internet. Diplomarbeit. Salzburg.
STÖPPLER Reinhilde (1999): Verkehrserziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Bad Heilbrunn/Obb.
SVOBODA Michael, PALLINGER Manfred (2006): Steuern und Gebühren. In: HOFER Hansjörg (2006) (Hg.) S. 101-122.
TERLINDEN Ulla: Räumliche Definitionsmacht und weibliche Überschreitungen. Öffentlichkeit, Privatheit und Geschlechterdifferenzierung im städtischen Raum. In: LÖW Martina (2002) (Hg.) S. 141-157.
TEUFELSBRUCKER Doris (1998): Aufbau eines kartographischen Informationssystems für Rollstuhlfahrer in der Wiener City - unter Berücksichtigung von touristischen Zielen und Mobilitätsbarrieren. Diplomarbeit. Wien.
THEUSSL Christian, LÜCKLER Franz, STEINBACHER Angelika (1991): Mobilität von Behinderten. (Hg.): Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Graz.
VCÖ - Verkehrsclub Österreich (2002) (Hg.): Neue Technologien für sichere und barrierefreie Mobilität. Wien.
VDV - Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (1998) (Hg.): Kundenorientierter und behindertenfreundlicher ÖPNV. VDV Mitteilungen. Teil 1: Betrieb nach BOKraft. Köln.
WEICHHART Peter (1990): Raumbezogene Identität. Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer Kognition und Identifikation. Stuttgart.
WEIDERT Jean-Luc (2000): Behindertengerechter öffentlicher Straßenraum unter besonderer Berücksichtigung Geh- und Sehbehinderter. Wien.
WENTZ Martin (Hg.) (1991): Stadt-Räume. Frankfurt am Main.
WIENER LINIEN (2000): "Alles über uns". Betriebsangaben. Wien.
WILLIAMS Anthony (2006): Internationale Trends in der Behindertenpolitik. Referat im Rahmen der Konferenz "Barrierefreie Karriere - Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung", 12.-13. Juni 2006 in Brünn. Konferenzunterlagen.
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH (2005): Mitterlehner: Behindertegleichstellungsgesetz ist ein "gerade noch akzeptabler Kompromiss". In: BIZEPS (Hg.) (online) http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=6137&suchhigh=Wirtschaftskammer [Stand: 18.7.2005].
WISOTZKI Karl Heinz (2000): Integration Behinderter. Modelle und Perspektiven. Stuttgart u.a.
WÖLFL Judith, LEUPRECHT Eva (2004): Unterwegs im Dunkeln. Forschungsbericht über die Mobilitätsbedingungen von blinden und sehbehinderten Personen in Wien unter besonderer Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs. (Hg.): Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien.
WOLLERSBERGER Johannes (2004): Tipps für barrierefreies Planen und Bauen. Unter Zugrundelegung der Bestimmungen der Bauordnung für Wien (BO). (Hg.): Magistrat der Stadt Wien. MA37. Wien.
YEATMAN Anna (1996): Jenseits des Naturrechts. Die Bedingungen für einen universalen Staatsbürgerstatus. In: NAGL-DOCEKAL Herta, PAUER-STUDER Herlinde (1996) (Hg.) S. 315-350.
YOUNG Iris Marion (1996): Fünf Formen der Unterdrückung. In: NAGL-DOCEKAL/PAUER-STUDER (1996) (Hg.) S.99-140.
ZIEMEN Kerstin (2003): Anerkennung - Selbstbestimmung - Gleichstellung. Auf dem Weg zu Integration/Inklusion. Aufsatz. (online) http://bidok.uibk.ac.at/library/ziemen-kategorien.html [Stand: 17.9.2007,Link aktualisiert durch bidok].
ZWIERLEIN Eduard (1996) (Hg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung. Neuwied u.a.
EXPERT/INNENINTERVIEWS (im Text abgekürzt mit: EI)
Interviews mit ExpertInnen aus dem Behindertenbereich und mit AkteurInnen im Kontext der Mobilität behinderter Menschen (in Wien):
EI 1: Theresia Haidlmayr. Parlamentarische Behindertensprecherin der GRÜNEN. Rollstuhlfahrerin.
Interview am 19.12.2000.
EI 2: Eduard Riha. Vertreter des ÖAR (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation). Rollstuhlfahrer. Interview wurde gemeinsam mit Ulrike Sigl vom Kuratorium für Schutz und Sicherheit (Projektleiterin der Studie "RollstuhlfahrerInnen in Wien", vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002) am 15.5.2001 durchgeführt.
EI 3: Bernadette Feuerstein. Expertin im Behindertenbereich (z.B. Mitarbeiterin bei der "Arbeitsgruppe Mobilität" in Wien, Obfrau des Vereins "Selbstbestimmt Leben" in Wien). Rollstuhlfahrerin. Interview am 17.5.2001.
EI 4: Martin Ladstätter. Vertreter von BIZEPS -Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Wien. Rollstuhlfahrer. Interview am 23.5.2001.
EI 5: Günther Ertl. Vertreter der "Wiener Linien". Interview wurde gemeinsam mit Ulrike Sigl vom Kuratorium für Schutz und Sicherheit (Projektleiterin der Studie "RollstuhlfahrerInnen in Wien", vgl. Sigl/Leuprecht/Götz 2002) am 12.6.2001 durchgeführt.
EI 6: Kornelia Götzinger. Behindertenbeauftragte der Universität Wien. Rollstuhlfahrerin. Interview am 25.6.2001.
EI 7: Sabine Scherzer. Zentrale Behindertenansprechstelle der ÖBB. Interview am 1.8.2001.
Interviews mit den BehindertensprecherInnen der Wiener Landesparteien: [84]
FPÖ: Heinz-Christian Strache und Johann Römer. Interview am 5.6.2001.
GRÜNE: Maria Vassilakou. Interview am 13.6.2001.
ÖVP: Franz Karl. Interview am 20.6.2001.
SPÖ: Erika Stubenvoll. Interview am 25.6.2001.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
|
ADA |
The Americans with Disabilities Act |
|
AMS |
Arbeitsmarktservice |
|
BBG |
Bundesbehindertengesetz |
|
BEinstG |
Behinderteneinstellungsgesetz |
|
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
|
BGstG |
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz |
|
BMVIT |
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie |
|
BPGG |
Bundespflegegeldgesetz |
|
BVG |
Bundesverfassungsgesetz |
|
EG |
Europäische Gemeinschaften |
|
EGVG |
Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen |
|
EI |
ExpertInneninterview |
|
ESC |
Europäische Sozialcharta |
|
EU |
Europäische Union |
|
FPÖ |
Freiheitliche Partei Österreich |
|
GewO |
Gewerbeordnung |
|
ICF |
International Classification of Functioning, Disability and Health |
|
Kfz |
Kraftfahrzeug |
|
KSZE |
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
|
LGBl. |
Landesgesetzblatt |
|
LKW |
Lastkraftwagen |
|
MA |
Magistratsabteilung |
|
NAP |
Nationaler Aktionsplan |
|
NOVA |
Normverbrauchsabgabe |
|
ÖAR |
Österreichische Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation |
|
ÖBB |
Österreichische Bundesbahnen |
|
OECD |
Organisation for Economic Cooperation and Development |
|
ÖGB |
Österreichischer Gewerkschaftsbund |
|
ÖPNRVG |
Öffentliches Personennahund Regionalverkehrsgesetz |
|
ÖPNV |
Öffentlicher Personennahverkehr |
|
ORF |
Österreichischer Rundfunk |
|
ÖSTAT |
Österreichisches Statistisches Zentralamt |
|
OSZE |
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
|
ÖVP |
Österreichische Volkspartei |
|
PKW |
Personenkraftwagen |
|
SLIÖ |
Selbstbestimmt-Leben-Initiative-Österreich |
|
SPÖ |
Sozialdemokratische Partei Österreich |
|
StVO |
Straßenverkehrsordnung |
|
ULF |
Ultra Low Floor |
|
UN |
United Nations |
|
VCÖ |
Verkehrsclub Österreich |
|
VDV |
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen |
|
WAG |
Wiener Assistenzgenossenschaft |
|
WBHG |
Wiener Behindertengesetz |
|
WGG |
Wiener Garagengesetzes |
|
WHO |
World Health Organisation |
Tabelle 4: Statements der BehindertensprecherInnen der Wiener Landesparteien zur Mobilität behinderter Menschen in Wien (2001)
|
Themenbereich / Name der Behindertensprecher bzw. des Behindertensprechers |
Statements der BehindertensprecherInnen der Wiener Landesparteien zur Mobilität behinderter Menschen in Wien (2001) |
|
THEMENBEREICH: "Wiener Gemeinderätliche Behindertenkommission" |
|
|
THEMENBEREICH: Wichtige Eckpfeiler/Ansätze der "Behindertenpolitik" der Partei Erika Stubenvoll Behindertensprecherin SPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Wichtige Eckpfeiler/Ansätze der "Behindertenpolitik" der Partei Franz Karl Behindertensprecher ÖVP |
|
|
THEMENBEREICH: Wichtige Eckpfeiler/Ansätze der "Behindertenpolitik" der Partei Heinz-Christian Strache Behindertensprecher FPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Wichtige Eckpfeiler/Ansätze der "Behindertenpolitik" der Partei Maria Vassilakou Behindertensprecherin GRÜNE |
|
|
THEMENBEREICH: Einschätzung der Ist-Situation der Mobilität bzw. Mobilitätschancen von behinderten Menschen (in Wien) Erika Stubenvoll Behindertensprecherin SPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Einschätzung der Ist-Situation der Mobilität bzw. Mobilitätschancen von behinderten Menschen (in Wien) Franz Karl Behindertensprecher ÖVP |
|
|
THEMENBEREICH: Einschätzung der Ist-Situation der Mobilität bzw. Mobilitätschancen von behinderten Menschen (in Wien) Heinz-Christian Strache Behindertensprecher FPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Einschätzung der Ist-Situation der Mobilität bzw. Mobilitätschancen von behinderten Menschen (in Wien) Maria Vassilakou Behindertensprecherin GRÜNE |
|
|
THEMENBEREICH: Favorisierte Ansätze/Maßnahmen (der Partei) zur Erhöhung der Mobilität behinderter Menschen, insb. von RollstuhlfahrerInnen Erika Stubenvoll Behindertensprecherin SPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Favorisierte Ansätze/Maßnahmen (der Partei) zur Erhöhung der Mobilität behinderter Menschen, insb. von RollstuhlfahrerInnen Franz Karl Behindertensprecher ÖVP |
|
|
THEMENBEREICH: Favorisierte Ansätze/Maßnahmen (der Partei) zur Erhöhung der Mobilität behinderter Menschen, insb. von RollstuhlfahrerInnen Heinz-Christian Strache Behindertensprecher FPÖ |
|
|
THEMENBEREICH: Favorisierte Ansätze/Maßnahmen (der Partei) zur Erhöhung der Mobilität behinderter Menschen, insb. von RollstuhlfahrerInnen Maria Vassilakou Behindertensprecherin GRÜNE |
|
|
THEMENBEREICH: Kontakt/Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen bzw. - vereinen |
|
Tabelle 5: Wichtige gesetzliche Regelungen der letzten Jahre im Behindertenbereich in Österreich. Eigene Zusammenstellung (Quellen: Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 26, 229ff; Firlinger/Integration:Österreich 2003: 64f; Krispl 2006b: 253fff)
|
Jahr |
Gesetzliche Regelung |
Inhalt |
|
1990 |
Bundesbehindertengesetz |
Das Bundesbehindertengesetz (BGG) koordiniert die Tätigkeiten der Rehabilitationsträger (Bundessozialämter, Arbeitsmarktservice, Sozialversicherungsträger. Ebenso regelt es Förderungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung (Firlinger/Integration:Österreich 2003: 64f). Durch das BGG wurde ein einheitlicher Behindertenpass auf Bundesebene eingeführt, für dessen Erhalt der Grad der Behinderung mit mindestens 50 % festgestellt werden muss (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 26). |
|
1993 |
Bundespflegegeldgesetzt |
Einführung eines bedarfsorientierten Pflegegeldes, auf das unabhängig von Einkommen, Vermögen und Ursache der Pflegebedürftigkeit ein Rechtsanspruch besteht (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz 2003a: 229) |
|
1993 |
Novellen zum Schulorganisations-, Schulpflicht- und Schulunterrichtsgesetz |
Einführung des integrativen Unterrichts in der Volksschule; 1996 auch für die Sekundarstufe I |
|
1993 |
Bundesvergabegesetz |
Öffentliche Aufträge erhält nur, wer die Mindestanfordernisse barrierefreien Bauens beachtet. Das Gesetz gilt für Auftragsvergaben durch den Bund, die Sozialversicherungen, bundesnahe Unternehmungen, Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Stiftungen, Fonds und Anstalten. |
|
1996 |
Strukturanpassungsgesetz (Art. 36), Novelle des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes |
Einführung des Grundsatzes "Rehabilitation vor Pension". |
|
1997 |
Novelle zum Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen und zur Gewerbeordnung |
Werden Menschen mit Behinderungen benachteiligt oder daran gehindert Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen ist eine Verwaltungsstrafe vorgesehen. Unter Umständen kann sogar eine Gewerbeberechtigung entzogen werden. |
|
1997 |
Ergänzung des Art.7 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz |
Verfassungszusatz über ein Diskriminierungsverbot sowie das Bekenntnis zur Gleichbehandlung behinderter Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens. |
|
1998 |
Novellen zum Volksbegehrengesetz, zur Nationalrats-Wahlordnung und zur Europawahlordnung |
Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten sind vorgesehen: barrierefrei zugängliche Eintragungslokale sowie Leitsysteme und Stimmzettelschablonen für blinde und sehbehinderte Stimmberechtigte. |
|
1998 |
Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz |
Gesetzliche Verankerung der Arbeitsassistenz. |
|
1999 |
Sammelnovelle zur Beseitigung behindertendiskriminierender Bestimmungen in einigen Bundesgesetzen |
Schaffung von Erleichterungen zur Teilnahme behinderter Menschen an Verfahren und zur Wahrnehmung ihrer Parteienrechte. |
|
2000 |
Öffentliches Personennah- und Regionalverkehrsgesetz |
Vergabe von Budgetgeldern bzw. Aufträgen nur bei Berücksichtigung der Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Menschen. |
|
2006 |
"Behindertengleichstellungspaket" |
1.1.2006 traten die Regelungen des so genannten "Behindertengleichstellungspakets" in Kraft, dessen Kernstücke sind: Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, Novellierung des Behinderteneinstellungsgesetzes, Novellierung des Bundesbehindertengesetzes Mit diesem Gesetzespaket soll das Bekenntnis der Republik Österreich (Art. 7 Abs. 1 B-VG) zur Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens konkretisiert und rechtlich umgesetzt werden. Mit den Gesetzen wurde unter anderem die österreichische Gebärdensprache verfassungsrechtlich anerkannt sowie eine eigene Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderung (Bundes-Behindertenanwalt) eingerichtet. |
|
NAME |
Thomas Eglseer |
|
KONTAKT |
eglseerthomas@gmx.at |
|
GEBURTSDATUM |
9. Dezember 1972 |
|
GEBURTSORT |
Kremsmünster, Oberösterreich |
|
FAMILIENSTAND |
Ledig |
|
STAATSBÜRGERSCHAFT |
Österreich |
|
STUDIUM |
|
|
1993-2007 |
Politikwissenschaft/kombinierte Fächer (Soziologie, Philosophie) an der Universität Wien |
|
1992-1993 |
Politikwissenschaft/Kunstgeschichte an der Universität Wien |
|
SCHULBILDUNG |
|
|
1992 |
Matura |
|
1987-1992 |
Handelsakademie in Wels, Oberösterreich |
|
BERUFSTÄTIGKEIT (studienbegleitend) |
|
|
seit 2003 |
L&R Sozialforschung: Wissenschaftlicher Assistent |
|
2001-2002 |
Ordentlicher Zivildienst am Kuratorium für Schutz und Sicherheit, Institut für Verkehrserziehung |
|
2001 |
Kuratorium für Schutz und Sicherheit, Institut für Verkehrserziehung: Projektmitarbeit |
|
1999-2001 |
IFES, Institut für empirische Sozialforschung Wien: Leitung des Telefon-Labors |
|
1999-2000 |
L&R Sozialforschung: Projektmitarbeit, Interviewtätigkeit IFES, Institut für empirische Sozialforschung Wien: telefonische Meinungsforschung |
|
1997-1999 |
OMNITEL, Agentur für Telemarketing und Direktwerbung: Telesalesagent |
|
1995-1997 |
Euro-Languages, Sprachakademie: Büroarbeit, Datenpflege Optiker WYK: Datenpflege, Büroarbeit |
|
FREMDSPRACHEN |
Englisch, Französisch (Matura) |
|
SONSTIGES |
Gedichtbände "dreißig" (2007) und "alles rot" (1996) erstellt in eigener Regie und Produktion. Lesungen/Performance in Wien (1999) und Puchberg b. Wels (1998). |
Thomas Eglseer: Exklusion behinderter Menschen durch Mobilitätsbarrieren in Österreich. Am Beispiel der alltäglichen Mobilitätsproblematik von Rollstuhlfahrer/innen in Wien
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Studienrichtung Politikwissenschaft.
bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 12.05.2010
