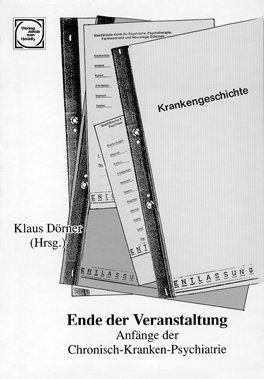Anfänge der Chronisch-Kranken-Psychiatrie
Entnommen aus: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 3/99
Inhaltsverzeichnis
AutorIn/Hrsg.: Klaus Dörner (Hrsg.)
Titel: Ende der Veranstaltung. Anfänge der Chronisch-Kranken-Psychiatrie
Infos: Verlag Jakob van Hoddis, Gütersloh 1998, 400 Seiten, DM 38,-.
Themenbereich: Psychiatrie
Inhaltsverzeichnis
Raus aus der Anstalt
Chronisch psychisch behinderte Menschen - wie "Normale" unter "Normalen" leben lassen
Es gilt auf ein über weite Strecken tief bewegendes, von warmer Humanität und pfiffiger Nüchternheit getragenes Buch hinzuweisen: "Ende der Veranstaltung / Anfänge der Chronisch-Kranken-Psychiatrie". Will heißen: Nicht nur der "heilbare" Akutkranke verdient unsere ganze Aufmerksamkeit, sondern auch der bisher gern übersehene Langzeitpatient. Er muß wieder Fuß fassen können in einer "normalen" Umwelt. Von der praktischen Umsetzung dieser Idee handelt der angesprochene Band.
Als Herausgeber und engagierter Autor zahlreicher Beiträge firmiert der Psychiater Klaus Dörner, 1981 bis 1996 ärztlicher Leiter des Landeskrankenhauses Gütersloh, das man ganz im Sinne der neuen Zielsetzung in "Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie" umbenannte. "Ende der Veranstaltung" schildert die Herkulesarbeit, 800 Betten auf weniger als die Hälfte dauerhaft zu reduzieren. Dies gelang, indem der ganze Bereich der Langzeitpatienten ersatzlos im Laufe der fünfzehn Jahre aufgelöst wurde - ja, die Verantwortlichen unternahmen noch viel mehr: Um nicht in Versuchung zu geraten, eines Tages die alter Häuser doch wieder zu belegen, wurden sie entweder abgerissen oder an eine Nachbarklinik abgegeben.
Der Begriff "Langzeitpatient" wirkt vergleichsweise harmlos, klingt in ihm doch noch weniger bedrohlich die vage Möglichkeit einer eventuellen Entlassung an. Nicht selten indes bedeutet "Langzeit" nicht anderes als "lebenslänglich". Exemplarisch führt dies die Fachärztin Lisa Hödemann in ihrem Beitrag "Frauenschicksal: Langzeitpatientin" vor. - Elisabeth H. wird mit siebzehn Jahren in die Psychiatrie wegen aufsässigen Verhaltens eingewiesen. Aus dieser Zeit befindet sich in ihrer Akte ein durch und durch hilfloser Brief an die Pflegeeltern, in dem sie irritiert die "lieben Eltern" fragt, ob sie diese noch Vater und Mutter nennen darf. Oder ob sie von ihnen vergessen worden sei. Es käme ihr komisch vor, von ihnen so lange nichts mehr gehört zu haben. Darum ihr dringender Appell: "Bitte besucht mich oder holt mich hier heraus." Der Brief bleibt nach allem, was man weiß, unbeantwortet. Sie fügt sich ergeben in das Unvermeidliche. In einer Aktennotiz heißt es: "H. arbeitet ruhig und fleißig." Als Stationshilfe macht sie sich offenbar unentbehrlich. Dann eine Periode des Aufbegehrens - ein vergeblicher Versuch, dem Schicksal noch eine andere Richtung zu geben. Sie paßt sich wieder an, kann sich erneut rühmen, als "fleißige Arbeiterin" zu gelten. Mit 85 stirbt sie in ihrem Anstaltsbett und wird auf dem Krankenhausfriedhof begraben.
Erst auf dem Hintergrund solch einer Biographie läßt sich die Bedeutung voll ermessen, die der Auflösung von Langzeitstationen in der Psychiatrie (und anderswo) zukommt. Ganz abgesehen von dem Kompetenzverzicht in der bisher dominierenden Rolle eines allein zuständigen ärztlichen und pflegerischen Personals, das sich immerhin teilweise mit diesen Maßnahmen selbst für überflüssig erklärt, werden jahrhundertealte Denkschablonen radikal in Frage gestellt. Umso erstaunlicher mußte es anfangs erscheinen, daß sich die Betroffenen alles andere als begeistert über das Angebot einer Entlassung zeigten. Sie wollten in der gewohnten Umgebung bleiben.
Dabei läßt sich diese Haltung eigentlich recht gut nachvollziehen. In der Situation eines Anstaltsinsassen stützt man sich nach jahrelanger Hospitalisierung lieber auf das, was man hat - nicht jedoch, auf das Ungewisse eines beängstigenden "Ende der Ver-Anstaltung". Warum sich freiwillig in panisch gefürchtete Zustände der Unsicherheit begeben?! Also galt es, die zu Entlassenden sanft durch Überraschungsmanöver in die Richtung ihres "Glück's zu stupsen. Es stellte sich nämlich heraus, weder ein Trainingsprogramm zur Bewältigung des Alltagsleben "draußen" noch sonstige Vorbereitungsmaßnahmen richteten etwas aus. Im entscheidenden Augenblick traten psychosomatische Störungen auf - und das gesamte Unternehmen mußte abgeblasen werden. Deshalb versuchte man das Problem von der anderen Seite anzugehen. Erst wenn eine geeignete Wohnung zur Verfügung stand, in der der zu Entlassende selbständig oder mit ambulanter Betreuung leben konnte, lud man den potentiellen Mieter zu einer unverbindlichen Besichtigung ein. Damit war meistens die erste Bresche geschlagen. Auch die betreffenden Nachbarn wurden erst einmal nicht weiter auf den neuen Hausbewohner vorbereitet. Erst im nachhinein sorgte man für einen intensiven Kontakt. Wenn sich dann allerdings herausstellte, daß sich auch auf Dauer keine Aussicht auf ein gutes Einvernehmen ergeben könnte, wurde dieses Vorhaben aufgegeben und ein neues in Angriff genommen. Auf diese Weise fanden ein hoher Prozentstatz der ehemaligen mehr als 400 Langzeitpatienten eine zufriedenstellende Bleibe. Da sich die Überweisung der restlichen Männer und Frauen in bestehende Einrichtungen für Behinderte nicht bewährte, wurden sogenannte Kleinst-Heime ins Leben gerufen, in denen je ein Unterstützungsbedürftigter mit seinem Betreuer wohnten.
Aber nicht nur der individuellen Unterkunft galt die Sorge. Man gründete auch viele verschiedene Firmen, um möglichst jedem Entlassenen einen Arbeitsplatz anbieten zu können, der seiner Neigung entsprach. Zwar sollte niemand zur Berufstätigkeit gezwungen werden, doch die Betroffenen sollten auf den Geschmack kommen, wenigstens einen von ihnen selbst bestimmten Zeitraum mit einer festen Tätigkeit auszufüllen.
Dem liegt die Maxime zugrunde: "Jeder Mensch will notwendig sein". Es ließe sich jedoch auch ebensogut sagen: Jeder Mensch hat erst einmal das Recht ohne jede Vorleistung, so angenommen zu werden, wie er sich selbst im Dasein vorfindet.
Fredi Saal
Quelle:
Rezensiert von Fredi Saal
Entnommen aus: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 3/99
bidok-Rezensionshinweise
Stand: 01.03.2006