Peer-Interview als Möglichkeit der Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung - anhand eines Beispiels aus dem Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Kultur- und Gesllschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, Fachbereich Soziologie und Politikwissenschaft, Gutachter: Ao.Univ.-Prof.DDr. Nikolaus Dimmel
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
-
1. Definition des Begriffes "Behinderung"
- 1.1 Definition von "Behinderung" in der österreichischen Behindertenpolitik
- 1.2 Arten von Behinderung
- 1.3 Definition von "Behinderung" im Recht der Europäischen Union
- 1.4 Bedeutung und Konsequenzen des Behinderungsbegriffs
- 1.5 "Behinderung" aus soziologischer Sicht
- 1.6 "Behinderung" aus Sicht der Vereinten Nationen (UNO)
- 1.7 Definition "Geistige Behinderung"
-
2. Lebensqualität/ Quality of Life
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Vom ersehnten Bedürfnis zu erreichter Lebensqualität: Theorie der Bedürfnisse als notwendige theoretische Voraussetzung
- 2.3 Theorie der Bedürfnisse
- 2.4 Soziologischer Theoriekontext des Begriffs "Lebensqualität"
- 2.5 Bedeutende Definitionen von "Lebensqualität"
- 2.6 Beiträge aktueller Lebensqualitätforschung - Definitionen "Quality of Life"/Praktische Anwendung im Bereich Wohnen
- 2.7 Lebensqualität und Wohnen
- 2.8 Studien zur Lebensqualität im Wohnbereich
- 3. Implikationen der Lebensqualität-Forschung in Politik und Gesellschaft
- 4. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
-
5. Peer-Interview
- 5.1 Warum Beteiligung von Menschen mit Behinderung in der Forschung?
- 5.2 Arten der Beteiligung von Menschen mit Behinderung
- 5.3 Kurzüberblick zu aktuellen Forschungsansätzen mit NutzerInnenbeteiligung
- 5.4 Definition "Peer-Interview"
- 5.5 Methodologische Einordnung des Peer-Interviews
- 5.6 Beispiele für Erhebungen mit Menschen mit Behinderung als Peer- InterviewerInnen:
- 5.7 Vor- und Nachteile der Peer-Methodik mit Menschen mit Behinderung
- 5.8 Besonderheiten bei Menschen mit Behinderung als InterviewerInnen
- 5.9 Ausblick: Verbreitung der Methode - Vernetzung von Forschungsaktivitäten
- 6. Dokumentation der InterviewerInnenschulung und Erhebung
-
7. Auswertung der inhaltlichen Ergebnisse
- 7.1 Soziodemografisches
- 7.2 Auswahlmöglichkeiten und Gestaltung der Wohnung
- 7.3 Selbstversorgung und Alltagshandeln
- 7.4 Freizeitgestaltung und Erwachsenenbildung
- 7.5 Zusammenleben mit den MitbewohnerInnen
- 7.6 Beziehungsgestaltung mit den BetreuerInnen
- 7.7 Privatheit und Individualisierung
- 7.8 Umgang mit Krisen
- 7.9 Soziale Netzwerke und private Beziehungen
- 7.10 Sexualität und Partnerschaft
- 7.11 Rechte und Schutz
- 7.12 Gesundheit
- 7.13 Vertretung
- 7.14 Zufriedenheit mit dem Betreuungspersonal
- 7.15 Angebotsplanung und Evaluierung
- 7.16 Unterschiede nach Wohnform und Wohndauer
- 7.17 Interpretation der Ergebnisse
- 8. Auswertung der InterviewerInnen-Rückmeldungen
- 9. Zusammenfassung
- 10. Bibliografie
- Eidesstattliche Erklärung
- Anhang
Abb. 1: Wechselwirkung der Komponenten im ICF-Modell
Abb. 2: Lebensqualität-Dimensionen nach verschiedenen Autoren im anglo-amerikanischen Raum
Abb. 3: Inhalte der acht Lebensqualität-Dimensionen
Abb. 4: Indikatoren zur Operationalisierung der Lebensqualitätsdimensionen
Abb. 5: Das Lebensqualität-Modell von Felce/Perry
Abb. 6: Das Lebensqualitätsmodell von Seifert: Dimensionen und Indikatoren
Abb. 7: LQ-Dimensionen und Indikatoren nach gesellschaftlichen Ebenen
Abb. 8:Forschungsansätze mit NutzerInnenbeteiligung und verwendete Methode
Abb. 9: Forschungsansätze nach beteiligten Forschungsakteuren
Abb. 10: Aufbau des Fragebogens
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei
Mag. Monika Daoudi-Rosenhammer für die wertvolle Zusammenarbeit und motivierende Unterstützung,
Dr. Karin Astegger, die mein Interesse an dem Thema erst geweckt und mir wichtige fachliche Anregungen gegeben hat,
allen Peer-InterviewerInnen, die als erste mit vollem Einsatz einen inklusiveren Zugang zur Erhebung von Lebensqualität ermöglichen,
jenen KlientInnen der Lebenshilfe Salzburg, die sich für die Befragung zur Verfügung stellten,
meinem Freund, der mich in dieser arbeitsintensiven Phase stets vorbehaltlos unterstützt, motiviert und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat,
meiner Familie für ihre große interessierte Wertschätzung und Unterstützung während des gesamten Studiums.
Die zentrale Fragestellung, mit der sich die vorliegende Arbeit auseinandersetzt, ist die Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Bereich des Wohnens. Im Mittelpunkt steht dabei die Erhebungsmethode Peer-Interview, bei der Menschen mit Behinderung andere beeinträchtigte Menschen über ihre Zufriedenheit mit der in Anspruch genommenen Dienstleistung im Wohnbereich befragen.
Kontext und Relevanz
Österreich ratifizierte im Herbst 2008 die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung und nahm diese somit in die nationale Rechtsordnung auf. Diese fordert Inklusion als umfassende Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung ein. Nun sind Maßnahmen und Mittel zu ergreifen, um beispielsweise für Menschen mit Behinderung "unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft" zu erreichen, sodass z.B.
"[...] Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben" (Artikel 19 a)
Umso dringlicher erscheint die Notwendigkeit, die Einlösung solcher Rechte für die Lebenswirklichkeit überprüfen zu können. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei soziale Dienstleistungen ein, weil sie einen entscheidenden Beitrag für die Verbesserung der Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung, also für die Erhöhung ihrer Lebensqualität in einem umfassenden Verständnis, leisten.
Forschungsstand
Um Lebensqualität besser erfassen zu können, werden Menschen mit Behinderung immer häufiger nicht nur passiv als Befragte im Forschungsprozess beteiligt, sondern als Interviewende eingesetzt: In Peer-Interviews befragen sie andere Menschen mit Behinderung selbst, z.B. zu ihrer Zufriedenheit mit Wohn- oder Arbeitsangeboten im Rahmen von Evaluationen von sozialen Dienstleistungen. Es wird in der aktuellen Forschungsliteratur angenommen, dass Menschen mit Behinderung gleich gute oder sogar validere Befragungsergebnisse als nichtbehinderte Interviewende liefern können, wenn sie ihre Peers in Interviews befragen.
Eine Pionierrolle nimmt diesbezüglich das "Ask Me!"-Interview-Projekt im USBundesstaat Maryland ein, das seit 1998 aus öffentlichen Mitteln finanziert regelmäßig Panelumfragen anhand von Peer-Interviews durchführt. In Österreich befasst sich seit dem Jahr 2001 das Institut "Atempo" (Graz) damit. Das Unternehmen entwickelte "Nueva", ein Erhebungsinstrument für Peer-Interviews, und bietet Interviewerschulungen als Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung an. Die Erprobung und Verbreitung des Forschungsansatzes ist in Europa erst in Ansätzen gegeben.
Diese Arbeit ist befasst mit einer Dimension von Lebensqualität, nämlich der Wohnqualität, die exemplarisch anhand einer empirischen Erhebung mit Peer-Interviews, durchgeführt von Menschen mit Behinderung, für eine Organisationseinheit der Lebenshilfe Salzburg erfasst werden soll. Die Erhebung widmet sich sowohl der inhaltlichen Ebene als auch der Erprobung dieser relativ jungen Methodik.
Die Methodik, der sich die Arbeit bedient, ist folgende:
-
Inhaltsanalyse der Fachliteratur
-
Ausbildung einiger KlientInnen der Lebenshilfe Salzburg zu Peer-InterviewerInnen
-
Vollerhebung eines Wohnverbundes der Lebenshilfe durch Peer-InterviewerInnen mit standardisiertem Instrument
-
Feedback-Befragung des Peer-Interview-Teams anhand eines kurzen standardisierten Fragebogens
Im Folgenden werden die zentralen Forschungsfragen aufgelistet:
-
Wie ist der Begriff "Behinderung" fassbar?
-
Mit welcher Definition/ welchen Definitionen kann das Konstrukt "Lebensqualität" erfasst werden? Welche Dimensionen beinhaltet das Konzept?
-
Was bedeutet Lebensqualität im Wohnbereich für Menschen mit Behinderung?
-
Was heißt Wohnqualität für Menschen mit Behinderung praktisch? / Welche Bedürfnisse/Interessen artikulieren sie im Rahmen der Befragung?
-
Welche Bedingungen erfordert die Peer-Interview-Methodik in der Praxis von Seiten der Interviewenden selbst/ seitens der UnterstützerInnen?
-
Welche Implikationen hat Peer-Interview in unserer Fallstudie?
-
Hypothese 1: KlientInnen profitieren von neuen Fertigkeiten (Selbstwertgefühl)
-
Hypothese 2: KlientInnen werden sich neuer Bedürfnisse bewusst. Diese werden erst sichtbar, weil sie mit Peers diskutiert werden.
-
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Erhebungen?
Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Begriffsdefinition von "Behinderung" aus Sicht unterschiedlicher soziologischer Theorien, der österreichischen Behindertenpolitik und der Weltgesundheitsorganisation, wobei auch auf den Wandel des Behinderungsbegriffs eingegangen wird.
Der zweite Abschnitt widmet sich der näheren Bestimmung des theoretischen Konstrukts "Lebensqualität". Da damit eng verknüpft, wird auch der Begriff "Bedürfnis" erörtert und zu diesem Zweck eine Auswahl bedeutender Bedürfnistheorien vorgestellt. Es werden die Theoriegeschichte des Begriffs "Lebensqualität" und aktuelle Forschungsansätze zusammengefasst und schließlich Aspekte der Lebensqualitätsforschung in Bezug auf Wohnen behandelt.
Das dritte Kapitel ist befasst mit praxisbezogenen Aspekten der Lebensqualitätsforschung. Es werden ihre Implikationen in Politik und Gesellschaft im Sinne eines Orientierungsrahmens für inklusives Handeln dargestellt und schwerpunktmäßig ihre Auswirkungen auf die Qualitätsdiskussion im Bereich sozialer Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung aufgezeigt.
Der vierte Abschnitt behandelt die 1998 ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention und ihre zentralen Bestimmungen mit Berücksichtigung jener für Wohnen und individuelle Lebensführung relevanten Rechte.
Das fünfte Kapitel hat die Erhebungsmethode Peer-Interview als Beispiel eines Forschungsansatzes unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung zum Inhalt. An dieser Stelle werden ihre methodologischen Vor- und Nachteile diskutiert und wird auf ihre Verbreitung in der inklusiven Forschunglandschaft eingegangen.
Der sechste Abschnitt beinhaltet das empirische Beispiel aus dem Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg. Neben einer Dokumentation des Forschungsprozesses werden die Ergebnisse inhaltlich ausgewertet und unter methodischen Gesichtspunkten betrachtet. Die Erhebungsergebnisse werden in den Kontext der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur gestellt und in einer Zusammenschau der Ergebnisse zusammenfassend präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Definition von "Behinderung" in der österreichischen Behindertenpolitik
- 1.2 Arten von Behinderung
- 1.3 Definition von "Behinderung" im Recht der Europäischen Union
- 1.4 Bedeutung und Konsequenzen des Behinderungsbegriffs
- 1.5 "Behinderung" aus soziologischer Sicht
- 1.6 "Behinderung" aus Sicht der Vereinten Nationen (UNO)
- 1.7 Definition "Geistige Behinderung"
Das österreichische Sozialministerium hat das von der Europäischen Union ausgerufene Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 zum Anlass genommen, um erstmals mit Einbeziehung aller Bundesministerien einen ausführlichen Behindertenbericht herauszugeben, der über sämtliche Lebensbereiche von Menschen mit Behinderung informieren soll. Darin wird darauf hingewiesen, dass bereits 1988 ein einheitlicher und umfassender Behinderungsbegriff ausgearbeitet worden ist, der der sozialen Tragweite von Behinderung Rechnung tragen und als Arbeitsgrundlage für die Ziele der österreichischen Behindertenpolitik dienen soll und folgendermaßen lautet (vgl. BMSG 2003: 8):
"Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." (BMSG 2003: 9)
"Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist,
-
geregelte soziale Beziehungen zu pflegen,
-
sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und
-
angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen." (ebd.)
Da jedoch die mit Behinderung befassten Gesetze eine Querschnittsmaterie darstellen, wonach eine ganze Reihe von Bundes- und Landesgesetzen für Menschen mit Behinderung relevant sind, haben die obigen zwei Definitionen bis heute nicht Eingang in das Gesetz gefunden. Denn jeder bedeutende Rechtsbereich legte sich entsprechend der Materie (z.B. Arbeit, Pflege, Sozialversicherung, Familie) verschiedene Definitionen zurecht. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005) etwa stützt sich auf folgende allgemeine Arbeitsdefinition, die eine wichtige Basis für dessen politische Zielsetzungen und den Bezug von Leistungen bildet (vgl. BMASK 2009: 4):
"§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. " (ebd.)
Anhaltspunkte für eine Ausdifferenzierung des Begriffs im Sinne der Abgrenzung verschiedener Behinderungsarten bieten die Kategorien der jährlichen EU-SILC Statistik (EU-Statistics on Income and Living Conditions ). Das nationale, durchführende Institut Statistik Austria fragt zur Erhebung der Zahl der Menschen mit Behinderung in Österreich nach folgenden Formen von Beeinträchtigung:
-
"Probleme beim Sehen (trotz Brille, Kontaktlinse oder anderer Sehhilfe);
-
Probleme beim Hören (trotz Hörgerät oder Cochlearimplantat);
-
Probleme beim Sprechen;
-
Probleme mit Beweglichkeit/Mobilität;
-
Geistige Probleme oder Lernprobleme;
-
Nervliche oder psychische Probleme;
-
Probleme durch andere Beeinträchtigungen;
-
Mehrfache Beeinträchtigungen. " (BMASK 2009: 10)
Die Europäische Union hat sich bisher auf keine allgemeine Definition des Behinderungsbegriffs festgelegt: Die Rahmenrichtlinie zur "Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf" (Richtlinie 2000/78/EG, ABl. Nr. L 303/16) enthält ein Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderung - ohne jedoch den Begriff im Gesetzestext zu erläutern. Dieser Lücke nahm sich, wie in vielen Fällen im Bereich der EU-Sozialpolitik, der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seiner Judikatur vom 11. Juli 2006 in der Rechtssache Chacón Navas an, wobei sich dessen Definitionsversuch natürlich auf den Geltungsbereich der besagten Richtlinie beschränkte. (vgl. Europäische Kommission 2010: 5) Demnach sollte der Diskriminierungsschutz im Bereich Beschäftigung für jene Personen gelten, deren "Behinderung" eine "Einschränkung" darstellt, "die insbesondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen sei und die ein Hindernis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bilde". (ebd.)
Der EuGH betonte an dieser Stelle auch die entscheidende Abgrenzung von "Behinderung" und "Krankheit" - ohne eine Klärung der Begriffe vorzunehmen. (vgl. Europäische Kommission 2010: 16) In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Richtlinie nicht intendiere "dass Arbeitnehmer aufgrund des Verbotes der Diskriminierung wegen einer Behinderung in den Schutzbereich der Richtlinie fallen, sobald sich irgendeine Krankheit manifestiert". (ebd.) Die Judikatur lässt aber die theoretische Grenzziehung zwischen Behinderung und Krankheit, zum Beispiel über das Definitionskriterium ihrer Dauer, offen. (vgl. ebd.)
Im zitierten Bericht wird stark kritisiert, dass ein individualtheoretischer Behinderungsbegriff der von einem medizinisch-diagnostischen Modell ausgeht, einem gesellschaftstheoretischen vorgezogen wird. Im Gegensatz dazu wäre den Autorinnen zufolge ein soziologischer Zugang, der auch die gesellschaftlichen Erschwernisse für Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Blick nimmt, in viel größerem Maße im Stande, das rechtliche Potential für einen wirksamen Diskriminierungsschutz und für die Stärkung der europäischen Menschenrechte auszuschöpfen. (vgl. Europäische Kommission 2010: 16f)
Die oben genannten Beispiele aus dem österreichischen und EU-Recht weisen auf die theoretische und praktische Bedeutung und Reichweite des Behinderungsbegriffs hin. Das überaus komplexe Phänomen "Behinderung" ist interdisziplinär und so von unterschiedlichsten wissenschaftlichen Zugängen, wie der Medizin, Psychologie, Pädagogik und Soziologie bestimmt. (vgl. Fornefeld 2009: 60)
Der Begriff war und ist entlang gesellschaftlicher Veränderungen, wie z.B. Industrialisierungsprozessen und den Entwicklungsprozessen von behindertenpädagogischen Institutionen, einem starken Wandel unterworfen und in der Behindertenpädagogik umstrittener Gegenstand andauernder Auseinandersetzungen. (vgl. Moser/Sasse 2008: 33, 37-41) Ulrich Bleidick, Vertreter der kritisch-rationalistischen Denktraditionin der Pädagogik, stellt das große Maß an Relativität und Relationalität, dem der Behinderungsbegriff unterworfen ist, heraus: "Was als Behinderung gilt, das ist eine pragmatische Entscheidung [...] mit dem Zweck, benachteiligten Menschen Hilfe zukommen zu lassen." (Bleidick 1999: 19) "Behinderung ist demnach keine feststehende Eingenschaft eines Individuums, sondern eine Kategorie sozialer Geltung für einzelne Sektionen des Lebens und auf Zeit." (ebd.) Sie ist zweitens äußerst relational, weil abhängig von sozialem Handeln und somit von der Art und Weise "wie das soziale Umfeld auf Defekte, Mängel Schädigung und Behinderung reagiert und wie der Betroffene selbst mit seinem Behindertsein fertig wird" (Bleidick 1977: 12)
In diesem Sinne haben die Begrifflichkeiten nicht nur in theoretischer Hinsicht Bedeutung für die wissenschaftliche Disziplin, sondern weitreichende praktische Konsequenzen als notwendige Grundlage für die Tätigkeit von PraktikerInnen, Organisationen der Behindertenhilfe sowie der gesellschaftliche Umgang mit behinderten Menschen im Allgemeinen. (vgl. Moser/Sasse 2008: 16-19)
Die Pädagogik stützt sich auf von der Soziologie entwickelten Theoriestränge und unterscheidet unter anderen zwischen individualtheoretischen, systemtheoretischen, interaktionistischen und gesellschaftstheoretischen Ansätzen sowie Theorien der Konstruktion/Dekonstruktion. (vgl. Fornefeld 2009: 62f) Im Anschluss soll das Phänomen "Behinderung" aus soziologischer Perspektive beleuchtet und eine Auswahl entsprechender Theorien vorgestellt werden.
Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, sämtliche wichtigen soziologischen
Theorien zu behandeln, sollen die konkurrierenden Theorieansätze des Interaktionismus
und des kritischen Materialismus dargelegt werden, um der Bandbreite an
Definitionsvorschlägen Rechnung zu tragen.
An erster Stelle soll die Definition von Günther Cloerkes vorgestellt werden, die kompakt aber zugleich umfassend ausfällt. Diese ist dem interaktionistischen Ansatz zuzuordnen, der den Fokus auf das mikrosoziologische Umfeld legt.
Wesentliche Bestandteile der Definition von Cloerkes sind die Folgenden:
-
Da die Soziologie - im Gegensatz zur Medizin etwa - die Objektivität und eindeutige Messbarkeit von Schädigung bzw. Behinderung in Zweifel zieht, ist Behinderung aus soziologischer Sicht in erster Linie eine Abweichung von der gesellschaftlichen Norm. Behinderung stellt daher eine "unerwünschte Abweichung von sozialen Erwartungen" dar. (Cloerkes 2007: 7) Voraussetzung ist nach Cloerkes auch die Eigenschaft des Merkmals, eine spontane Reaktion bzw. Aufmerksamkeit zu provozieren. Dieses besitzt also "Stimulusqualität" und repräsentiert gleichzeitig "Andersartigkeit". (vgl. ebd.) Bereits Goffman konstatierte im Rahmen seiner theoretischen Auseinandersetzung mit Stigma und Identität, dass Behinderung das soziale Etikett, "in unerwünschter Weise anders" zu sein, anhaftet. (Goffman 1967: 11).
-
Der Autor zieht daraus den Schluss, dass Behinderung das "Ergebnis eines sozialen Bewertungsprozesses bzw. Abwertungsprozesses" ist und dass Behinderung durch die gesellschaftliche Reaktion sogar eine Verstärkung erfahren kann. (Cloerkes 2007: 8)
-
Ausschlaggebend für den Begriff "Behinderung" sind laut Cloerkes also die negative soziale Reaktion[1] auf das Merkmal bzw. seine negative Zuschreibung (Stigma) sowie die Benachteiligung, die Behinderung als soziale Konsequenz nach sich zieht. (vgl. Cloerkes 2007: 7f)
Cloerkes erarbeitete aus diesen Annahmen folgende Definition:
"Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. 'Dauerhaftigkeit' unterscheidet Behinderung von Krankheit. 'Sichtbarkeit' ist im weitesten Sinne das 'Wissen' anderer Menschen um die Abweichung. Ein Mensch ist behindert, wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die Reaktion auf ihn negativ ist." (Cloerkes 2007: 8)
Der Autor weist relativierend darauf hin, dass die negative Bewertung jedoch nicht zwangsläufig eine negative Reaktion auf die konkrete behinderte Person hervorrufen muss. Das Merkmal "Dauerhaftigkeit" ist bedeutsam, unterscheidet es doch Behinderung von Krankheit - im Umkehrschluss sind viele chronische Krankheitszustände ihrem Wesen nach eine Behinderung. (vgl. ebd.)
Nach Cloerkes dürfen außerdem der Charakter der Verhandelbarkeit und die hohe Relativität von Behinderung in ihren sozialen Auswirkungen nicht außer Acht gelassen werden: "Behinderung ist nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar. Nicht der Defekt, die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum." (Cloerkes 2007: 9)
Die gesellschaftstheoretische Herangehensweise an den Behinderungsbegriff hat im Gegensatz zum Interaktionismus einen makro-soziologischen Fokus. Im Folgenden sollen Wolfgang Jantzens Arbeiten stellvertretend für diesen Ansatz exemplarisch herangezogen werden.
Jantzen wählt für seinen teils interaktionistisch geprägten gesellschaftstheoretischen Behinderungsbegriff einen interdisziplinären Zugang zu diesem komplexen Phänomen mit dem Ausgangspunkt des behinderten Menschen gedacht als "Einheit aus Biologischem, Psychischem und Sozialem" nach Georg Feuser. (Feuser 1995: 89 zit. n. Moser/Sasse 2008: 73)
Behinderung ist für Jantzen nicht als objektives Merkmal gegeben. Vielmehr macht die gesellschaftliche Verhandlung diese zur sozialen Tatsache und etabliert Menschen mit Behinderung als soziale Kategorie:
"Behinderung kann nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu jeweiligen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, daß ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augenblick an." (Jantzen 1992: 18)
Als Vertreter einer materialistisch-dialektischen Sichtweise will er das Phänomen Behinderung historisch erklären und nimmt die gesellschaftlichen Bedingungen als von den Klassen- und Produktionsverhältnissen der Gesamtgesellschaft bestimmt an. Die beeinträchtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und ihre soziale Lage sind somit durch sozial und ökonomisch bestimmte "mangelnde Vermittlungsprozesse zwischen Individuum und Gesellschaft" charakterisiert. (Jantzen 1990: 370 zit. n. Moser/Sasse 2008: 67) So erleben behinderte Menschen laut Jantzen - unter Zuhilfenahme von Bourdieu - als "Resultat von Austauschbeziehungen" (Jantzen 2002: 322 zit. n. Moser/Sasse 2008: 67) "höchst unterschiedliche Verluste an sozialem Kapital [...], kulturellem Kapital [...], an sozialrechtlichem Kapital." (Jantzen 2000: 71 zit. n. Moser/Sasse 2008: 68)
Jantzen führt sieben solcher wesentlichen gesellschaftlichen Wechselbezüge an, die die soziale Kategorie Behinderung in besonderem Maße prägen:
-
Menschen mit Behinderung sind lediglich im Besitz von "Arbeitskraft minderer Güte" für die Verwertbarkeit in der kapitalistischen Produktion. (Jantzen 1992: 30)
-
Ein Mensch mit Behinderung ist eingeschränkt durch seine "reduzierte Geschäftsfähigkeit" und "nicht in der Lage, seine Arbeitskraft selbstständig und in üblicher Weise zu Markte zu tragen, wobei die Grade seiner Geschäftsfähigkeit" in formaler Hinsicht rechtlich und in praktischer Hinsicht vom Ausmaß der zur Verfügung gestellten Unterstützung bestimmt sind. (Jantzen 1992: 40f)
-
"Aus Sicht der Konsumsphäre, also des Verbrauchs von Gütern zu Zwecken der Reproduktion der Arbeitskraft, fallen Behinderte aus der Norm der sozialen Konsumfähigkeit." Diese reduziert sich aufgrund negativer sozialer Reaktionen auf die Betroffenen bis hin zum "sozialen Ausschluss" davon. (Jantzen 1992: 41)
-
Menschen mit Behinderung sind von vornherein benachteiligt durch eine objektiv "reduzierte Ausbeutungsbereitschaft", weil für integrative Arbeitsplätze höhere Investitionskosten in Infrastrukutr und Qualifizierung notwendig sind und sich dadurch der Profit verringert. (ebd.)
-
Die "Ästhetik des Hässlichen" als Merkmal der sozialen Kategorie Behinderung weicht beträchtlich ab vom Gebrauchswertversprechen der Waren in der Konsumsphäre mit zugeschriebenen Attributen wie "Jugend", "Schönheit", "Gesundheit" und "Leistungsfähigkeit". (Jantzen 1992: 41f)
-
Das Etikett "Anormalität und Minderwertigkeit" haftet Behinderung an, "weil sie die Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch die herrschende Klasse stört" und wird in Verbindung gebracht mit "menschenverachtende[n] Ideologien" wie Chauvinismus, Rassismus, Sexismus. (Jantzen 1992: 42)
-
"Als gesellschaftliche Form des Umgangs mit den Betroffenen entwickelt sich der "gesellschaftliche Ausschluss, der nicht nur Behinderte trifft, aber diese in besonderer Form und Schwere." (ebd.) Behinderte werden als Ergebnis (teilweise) von Produktionsprozessen und Konsumtion ausgeschlossen und in separierte Insitutionen wie Sondersschulen verwiesen. (vgl. ebd.)
Wie etwa die Auseinandersetzungen um Definitionsprozesse der WHO zeigen, setzt sich auch im von medizinischer Logik dominierten Gesundheitsbereich in zunehmendem Maße eine gesamtheitliche Sicht auf Behinderung - zumindest auf der sprachlichen Ebene - durch. Angesichts der internationalen Bedeutsamkeit für den behindertenpolitischen Auftrag ihrer Mitgliedstaaten sollen im folgenden Abschnitt wesentliche von den Vereinten Nationen bzw. der Unterorganisation Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten Modelle zum Behinderungsbegriff vorgestellt werden.
Eine solche grundlegende Definitionsbemühung stellt die ICIDH ("International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps"), die Internationale Klassifikation von Behinderung der WHO, von 1980 dar und intendiert, Behinderung international einheitlich zu definieren. (vgl. Fornefeld 2009: 68)
Sie wurde auch deshalb eingeführt, um die einseitig konzipierte "Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" ICD zu vervollständigen. Die ICD findet zwar breite, internationale Verwendung im Gesundheitssektor ( z.B. im rechtlichen Auftrag durch die österreichischen Krankenkassen) erfasst jedoch lediglich Defizite und legt das Individuum in seiner defektorientierten Perspektive auf die Behinderung fest, während sie deren soziale Konsequenzen aber ausspart. (vgl. Fornefeld 2009: 67ff)
Die ICIDH betrachtet Behinderung auf drei Ebenen und differenziert die Aspekte "impairment" (die organische Schädigung), "disability" (die Behinderung) und "handicap" (die Benachteiligung). Diese analytische Trennung ist wesentlich für das Verständnis des Behinderungsbegriffs: Eine Behinderung sei dann gegeben, wenn eine körperliche Schädigung eine Leistungsminderung nach sich zieht, die die soziale Teilhabe an der Gesellschaft erschwert. (vgl. Moser/Sasse 2008: 56, 79f)
1993 lassen die UN-Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte unter dem Abschnitt "Grundbegriffe der Behindertenpolitik" mit der verstärkten Bezugnahme auf die "soziale Beeinträchtigung" ("handicap") auf die allmähliche Ablöse des individualtheoretischen und medizinisch geprägten Behinderungsbegriffs schließen. (vgl. Vereinte Nationen 1993: 221)
Mehrmals überarbeitet, wie 1997 mit der Einführung neuer Dimensionen, sodass nun "impairment", "activity" und "participation" als Zentralbegriffe geführt wurden (vgl. Moser/Sasse 2008: 56), und dem Zwischenschritt der ICIDH-2, die stärker fähigkeitsorientiert ist, resultierten die Weiterentwicklungen der Klassifikation schließlich 2001 in der umfassenderen "International Classification of Impairments, Activities and Participation", ICF, übersetzt als "Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit". (vgl. Fornefeld 2009: 68)
Funktion und Ziel der ICF ist es, im Allgemeinen Gesundheitszustände und gesundheitliche Probleme in ihrem Gesamtkontext zu analysieren und auf standardisierte Weise möglichst vollständig zu fassen. Sie kann ebenfalls in Ergänzung mit der ICD verwendet werden. (vgl. DIMDI 2005: 9) Die Klassifikation beinhaltet zudem die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung und findet eine breite Anwendung in den "Gebieten des Versicherungswesens, der sozialen Sicherheit, Arbeit, Erziehung/Bildung, Wirtschaft, Sozialpolitik und der Fortentwicklung der Gesetzgebung sowie der Umweltveränderung". (DIMDI 2005: 11)
Die Klassifikation versteht Behinderung als "Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]." (DIMDI 2005: 9) Das Konzept der gesellschaftlichen Teilhabe ist somit nun ein zentraler Bestandteil des Modells. Da die ICF stärker die gesellschaftliche Einbettung von Behinderung berücksichtigt und die große soziale Bedeutung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung anerkennt, ist sie etwas "soziologischer" als die vorangegangenen Klassifikationen angelegt. (vgl. Fornefeld 2009: 68f)
Denn die ICF führt Behinderung auch aus als
"ein komplexes Geflecht von Bedingungen, von denen viele vom gesellschaftlichen Umfeld geschaffen werden. Daher erfordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation [Teilhabe] der Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens erforderlich ist. Das zentrale Thema ist daher ein einstellungsbezogenes oder weltanschauliches, welches soziale Veränderungen erfordert." (DIMDI 2005: 25)
Die ICF verbindet also den medizinisch-diagnostischen Ansatz, ohne Behinderung als Merkmal einer Person aufzufassen, und die soziologischen Sicht in ihrem Modell. Die ICF greift auf ein bio-psycho-soziales Konzept von Behinderung zurück und bietet somit einen umfassenden Begriff von Behinderung. Die Abkehr des neuen Modells von der Defektorientiertung bringt zudem einen Perspektivwechsel auf die Fähigkeiten und das Förderungspotential von Menschen mit Behinderung mit sich. Sie versucht, durch Integration sämtlicher den Lebenshintergrund beschreibenden Kontextfaktoren, differenziert in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren, die gesamte Lebensrealität der Betroffenen abzubilden. (vgl. Fornefeld 2009: 69f) Daher nimmt das ICF-Modell in den Blick, wie sich das Gesundheitsproblem einer Person auf seine Körperfunktionen bzw. Körperstrukturen (im Sinne "anatomischer Teile des Körpers", DIMDI 2005: 17) auswirkt und welche Konsequenzen dies für seine Aktivität und Partizipation hat. Das ICF nimmt "eine dynamische Wechselwirkung zwischen diesen Größen" an (DIMDI 2005: 23), wie anhand der folgenden Abbildung dargestellt:

Abb. 1: Wechselwirkung der Komponenten im ICF-Modell (DIMDI 2005: 23)
Markus Schäfers stellt diesbezüglich heraus, dass die ICF letztlich auf die Beschreibung spezifischer sozialer Situationen abzielt sowie auf die Qualität der Interaktion zwischen Individuen und ihrem sozialen Umfeld in bestimmten Lebensbereichen (z.B. wie es die ICF ausdrückt: in den Bereichen "Lernen und Wissensanwendung", "Kommunikation", "Mobilität", "Selbstversorgung") und nicht auf Personen. (vgl. Schäfers 2009: 25f) Rainer Kreuzer merkt dazu an, dass es im Sinne der ICF konsequenter sei, nicht mehr von "Menschen mit Behinderung", sondern von "sozialen Feldern mit Behinderung" zu sprechen. (vgl. Kreuzer 2010: 74) Denn es gehe laut Kreuzer "nicht mehr um die Kategorisierung von Menschen, sondern von Situationen, Feldern und Strukturen." (ebd.)
Der Anspruch eines ganzheitlichen Konzepts von Behinderung mit dem Potential die Betroffenen ihrem Bedarf nach zu fördern, hinkt in seiner Umsetzung leider erheblich. Ein großer Kritikpunkt ist dahingehend, dass die ICF ohnehin rein klassisch medizinisch in Anwendung gebracht werden kann, also wiederum defektorientiert Menschen mit Behinderung in Kategorien verweist, die stigmatisierend wirken. Außerdem scheint die Klassifikation nicht eindeutig zu einem Qualitätsfortschritt bei Diagnosen beizutragen, weil diese in der Praxis viel zu wenig benutzerfreundlich ist. So sind etwa die Kodierungen der Diagnosen schwer nachvollziehbar, sodass sich einzelne Staaten und sogar innerstaatliche Einrichtungen gezwungen sehen, wieder eigene Handbücher mit Diagnoserichtlinien zu erstellen. Aufgrund dieser Mängel kann keine internationale Vergleichbarkeit erzielt werden. (vgl. Grill 2007)
Die ICF wurde in Österreich übrigens rechtlich nicht implementiert. Es gibt zwar Datenbanksysteme für den Gesundheitsbereich, die auf Basis der ICF arbeiten, es existieren aber weder entsprechende Richtlinien noch besteht eine bundesweit einheitliche Anwendung der ICF. (vgl. ebd.)
Der Begriff "Geistige Behinderung" fand seine erste offizielle Verwendung aus Anlass der Gründung der Selbsthilfeorganisation "Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind" in Marburg 1958. (vgl. Speck 2007: 136) Dieser sollte abwertende Begriffe wie "Blödsinn", "Idiotie", "Schwachsinn" ablösen und hat sich inzwischen auch weitgehend durchgesetzt. (vgl. Fornefeld 2009: 58) "Geistige Behinderung" wird zwar in der Behindertenpädagogik ebenfalls als Problembegriff wahrgenommen, es ließ sich bisher aber auch kein geeigneterer finden, wie die Disziplin übereinstimmend feststellt. (vgl. Speck 2007: 136) Speck stellt diesbezüglich heraus, dass dieser Problematik durch einen angemessenen "kommunikative[n] Umgang" mit dem Begriff begegnet werden kann. (Speck 2007: 137)
Die aktuelle Klassifikation der Krankheiten ICD-10 führt im "Krankheitskapitel 5: Psychische und Verhaltensstörungen" geistige Behinderung unter den Oberbegriffen "Intelligenzstörung" bzw. "Intelligenzminderung" auf. Dort wird "Geistige Behinderung" definiert als "ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. " (BMSG 2001: 235)
Festgestellt wird eine Intelligenzstörung bzw. -minderung durch Intelligenztests, wobei betont wird, dass es sich dabei um die Feststellung eines gegenwärtigen Zustands handelt, der sich durch Rehabilitation verändern kann. Zudem können zusätzlich zu einer geistigen Behinderung "begleitende Zustandsbilder, wie Autismus, andere Entwicklungsstörungen, Epilepsie, Störungen des Sozialverhaltens oder schwere körperliche Behinderung" auftreten. (ebd.)
Die Behindertenpädagogik definiert den Begriff "Geistige Behinderung" in mehrdimensionaler Weise wie folgt: "Er soll Menschen kennzeichnen, die auf Grund komplexer Dysfunktionen der hirnneuralen Systeme erhebliche Schwierigkeiten haben, ihr Leben selbstständig zu führen, und die deshalb lebenslanger besonderer Hilfe, Förderung und Begleitung bedürfen". (Speck 2007: 136) Bei geistiger Behinderung handelt es sich häufig um eine Mehrfachbehinderung, weil in vielen Fällen gleichzeitig mehrere Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen. (Speck 2007: 137) Allgemein (nach ICD-10) wird ausgehend vom Grad der Intelligenzminderung zwischen leichter, mittelgradiger, schwerer und schwerster geistiger Behinderung unterschieden. (vgl. Neuhäuser et al. 1999: 27)
Neuhäuser weist auf die Vielschichtigkeit des Begriffes hin: "Die geistige Behinderung eines Menschen wird als ein komplexer Zustand aufgefaßt, der sich unter dem vielfältigen Einfluß sozialer Faktoren aus medizinisch beschreibbaren Störungen entwickelt hat." (Neuhäuser et al. 1999: 10) Die hohe Individualität von geistiger Behinderung ist darauf zurückzuführen, dass diese in großem Maße von der Sozialisation, insbesondere von der pädagogischen Förderung und dem Grad von sozialer Inklusion abhängt. Geistige Behinderung tritt daher häufiger in sozial benachteiligten Familien auf als in Familien mit höherem Bildungsniveau. (vgl. Speck 2007: 137)
Der Begriff "Geistige Behinderung" leitet sich ab vom damals im anglo-amerikanischen Raum verwendeten "mental retardation". Wurde seit den späten 1950er Jahren der Begriff "mental retardation" verwendet, so löste diesen der Terminus "intellectual disability" allmählich ab. Diese werden zwar immer noch nebeneinander verwendet, "intellectual disability" ist aber heute gebräuchlicher. (vgl. AAID 2010: 17)
Die "American Association on Intellectual and Developmental Disabilities" AAIDD schlägt folgende Definition vor: "Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before the age of 18." (AAID 2010: 3)
Angesichts der großen Verschiedenartigkeit von geistiger Behinderung plädieren die AutorInnen zur umfassenden Erfassung die Integration mehrerer Einflussfaktoren wie intellektuelle Fähigkeiten, Sozialverhalten, Gesundheit, Teilhabe, Kontext und Hilfebedarf. (vgl. AAID 2010: 15) Dieser mulitdimensionale Zugang ist auf den Zweck der Förderung der Betroffenen orientiert. In dieser Logik entwickelte sich die Klassifikation von "intellectual disability" der AAID zu einem ganzen, anwendungsorientierten Framework, das nicht nur als Beurteilungsschema dienen kann, sondern auf die Planung von Unterstützungssystemen bis hin zur Evaluation von Programmen ausgerichtet ist. (vgl. AAID 2010: 22)
[1] Unter sozialer Reaktion versteht Cloerkes unter anderem die "Gesamtheit der Einstellungen und
Verhaltensweisen auf der informellen Ebene zwischenmenschlicher Interaktionen". (Cloerkes 2007: 8)
Inhaltsverzeichnis
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Vom ersehnten Bedürfnis zu erreichter Lebensqualität: Theorie der Bedürfnisse als notwendige theoretische Voraussetzung
- 2.3 Theorie der Bedürfnisse
- 2.4 Soziologischer Theoriekontext des Begriffs "Lebensqualität"
- 2.5 Bedeutende Definitionen von "Lebensqualität"
- 2.6 Beiträge aktueller Lebensqualitätforschung - Definitionen "Quality of Life"/Praktische Anwendung im Bereich Wohnen
- 2.7 Lebensqualität und Wohnen
- 2.8 Studien zur Lebensqualität im Wohnbereich
Im nächsten Abschnitt folgt eine theoretische Betrachtung des Begriffs Lebensqualität, um zunächst dessen Inhalte vorzustellen.
Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Fundierung des Konzepts Lebensqualität. Es soll in diesem Rahmen versucht werden, den Begriff theoretisch zu erfassen und sich einer Definition anzunähern. Die dabei präsentierten Feststellungen gelten jedoch (auch im Kontext des Normalisierungsgedankens) nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für die gesamte Population. Es soll behinderten Menschen dennoch nicht abgesprochen werden, dass sie spezielle Bedürfnisse ("special needs") aufweisen.
Der Begriff Lebensqualität nimmt mittlerweile einen festen Platz sowohl als Schlagwort im alltäglichen sowie politischen Diskurs als auch als Forschungsbegriff in der Sozialwissenschaft ein. Zur Illustration: Im Zuge einer Literaturstudie englischsprachiger Literatur fanden die Autoren Schalock und Verdugo 20.900 Artikel und Buchkapitel (im Erscheinungszeitraum 1985-1999) mit quality of life im Titel. (Schalock et al. 2002: 352) Schon lange vor der Etablierung des wissenschaftlichen Terminus wurde der Themenkreis Lebensqualität unter Begriffen wie "Wohlbefinden", "Glück", "Zufriedenheit", "Lebensstandard" oder "Wohlfahrt" diskutiert. (vgl. Bellebaum 1994: 8) Die Soziologen Glatzer und Zapf (siehe Abschnitt 2.5.2) betrachten beispielsweise im Rahmen ihrer Sozialindikatorenforschung "subjektives Wohlbefinden", "Glück" und "Zufriedenheit" als subjektive Komponenten des Konzepts Lebensqualität. (vgl. Dworschak 2004: 33) Eine klare Abgrenzung von verwandten Begriffen ist indes kaum zu treffen. Ebenso wenig kann das Konstrukt Lebensqualität auf eine abschließende Definition festgelegt werden, weil es der Forschungslogik entsprechend darauf angewiesen ist, ein offenes Konzept zu repräsentieren. (vgl. Bellebaum 1994: 8)
Manche Autoren (z.B. Luckasson und Wolfensberger) plädieren sogar überhaupt für die Streichung des Begriffs aus dem wissenschaftlichen Vokabular, weil das sozialwissenschaftliche Wissen um Lebensqualität unweigerlich moralische und ethische Konsequenzen nach sich zieht. (vgl. Vreeke et al. 1997: 290) So schwingt ihrer Meinung nach der "implizierte und unreflektierte Wertaspekt" bei Lebensqualität in ihrer Bedeutung stets mit, was etwa bei der aktuellen Debatte um die Bedingungen von Sterbehilfe offensichtlich wird. (Bellebaum 1994: 10) Im Anschluss an Peter Singers "Praktische Ethik" (1994), die in der Geistigbehindertenpädagogik ethische Diskurse zum Lebensrecht bzw. Lebenswert von Menschen mit schweren Behinderungen hervorgerufen hat, weist Wolfensberger daraufhin, dass Lebensqualität leicht problematische Bedeutungszuweisungen erhält wie "Qualität eines Lebens" oder "Wert eines Lebens bzw. einer Person". Seiner Meinung nach handelt es sich deshalb bei Lebensqualität um einen äußerst problembehafteten Begriff und fordert vehement dessen Aufgabe. (Seifert 1997: 79 zit. n. Dworschak 2004: 39) Jedenfalls muss bei seiner Verwendung eine Begriffsklärung differenziert vorgenommen und expliziert werden, was darunter verstanden wird - um nicht zuletzt eine Vergleichbarkeit in der wissenschaftlichen Praxis zu gewährleisten. (vgl. Dworschak et al. 2001: 369)
Lebensqualität ist untrennbar mit der Frage nach der Rolle menschlicher Bedürfnisse verbunden. So haben beispielsweise auch die allgemein gehaltenen Grundbedürfnisse nach Maslow für Albert A. Campbell et al. (1976) als weiter konkretisierbare Grundlage der Operationalisierung von Quality of Life gedient. (vgl. Beck 1998: 365) Iris Becks Definition macht deutlich, dass Lebensqualität vor allem das Ergebnis von Bedürfnisbefriedigung ist:
"Lebensqualität kann zunächst als Prozeß der Bedürfnisrealisierung in unterschiedlichen Lebensbereichen und Lebensphasen und dessen subjektive Wahrnehmung und Bewertung bezeichnet werden. Die Voraussetzung zur Realisierung von Bedürfnissen ist die Teilhabe an Interaktions- und Kommunikationsprozessen, an Austauschprozessen mit der sozialen und materiellen Umwelt. Positiv erlebte Austauschbeziehungen ermöglichen Entwicklungsprozesse, in denen ein physisches und psychisches Gleichgewicht erreicht werden kann." (Beck 1998: 356f)
Dieser sachliche Zusammenhang zwischen menschlichen Bedürfnissen, ihrer Befriedigung und dem Konzept Lebensqualität legt eine Betrachtung theoretischer Erkenntnisse des Wesens von Bedürfnissen nahe. Deshalb werden im Folgenden entsprechende Antworten der soziologischen Theorie und Erklärungsmodelle, die Analysen anstellen, welche Funktionen und Bedeutung Bedürfnisse in der menschlichen Existenz zukommen, in den Blick genommen. Zu diesem Zweck sollen in diesem Abschnitt bedeutende Theorien der Bedürfnisse diskutiert werden.
Nach Fuchs-Heinritz et al. ist die Begriffsbedeutung von "Bedürfnis" (englisch: "need") "jeder Mangelzustand, den ein Individuum zu überwinden sucht; jeder Zustand des Organismus, der ein bestimmtes Verhalten in Richtung auf seine Beseitigung auslöst." (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 77f) Es herrscht in der Literatur eine unklare Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie "Trieb" und "Motiv", diese werden oft synonym gebraucht. (vgl. ebd.) Die Soziologie nimmt eine Unterscheidung hinsichtlich ihres Zustandekommens in die zwei grundlegenden Bedürfniskategorien "primäre" und "sekundäre Bedürfnisse" vor: "Als physiologische oder primäre B[edürfniss]e werden jene physiologischen Mangelzustände oder Ungleichgewichte bezeichnet, die bestimmte ererbte Mechanismen zu ihrer Behebung aktivieren (z.B. Hunger, Durst). [...] Sekundäre B[edürfniss]e sind demgegenüber jene, die erst durch einen Lernprozeß, insbesondere durch Interaktion mit der sozialen Umwelt (Sozialisation) erworben werden." (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 82) Die behavioristische Motivationspsychologie betont die sekundäre Bedürnisart ihrem Verständnis nach als "erlerntes Bedürfnis als Initiator weiteren Lernens" (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 446)
Hillmann nennt folgende weitere Unterscheidungskriterien: "Je nach Dringlichkeit des B[edürfnisses] für die Selbsterhaltung des Organismus differenziert man Existenz- B[edürfnisse] von Kultur-B[edürfnissen] und Luxus-B[edürfnissen]. Hinsichtlich der Quelle der Bedürfnisbefriedigung grenzt Hillmann "(auf sachl[iche] Existenzmittel bezogene) materielle von (auf andere Personen bezogenen) sozialen B[edürfnis]sen" ab. Hillmann 1994: 75)
Der Soziologe Hondrich betont die soziale Bedingtheit von Bedürfnissen: "Nach K.O. Hondrich ist von B[edürfnisorientierung] statt von Bedürfnissen zu sprechen, um zu verdeutlichen, daß sich alle personalen Bedürfnisse in Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt formen. Die Dynamik der B[edürfnisorientierung] erwächst aus der Spannung wischen personalem und sozialem System." Fuchs-Heinritz et al. 2007: 78)
Bedürfnisse sind in diesem Sinne nicht nur in Bezug auf das Individuum relevant, sondern können sich auch auf gesellschaftliche Gruppen beziehen: [...] Wenn nicht einzelne, sondern Gruppen oder Kollektive Träger von B[edürfnis]sen sind, spricht man auch von Kollektivbedürfnissen." (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 82);
Der Maslowschen Bedürfnistheorie soll im Folgenden angesichts der breiten, anhaltenden Rezeption entsprechend Platz eingeräumt werden. Theoriegeschichtlich betrachtet ist das wissenschaftliche Werk von Abrahm H. Maslow vielfältig beeinflusst und weist eine interdisziplinäre und ganzheitliche, humanistisch geprägte Sicht auf: So greift er den Funktionalismus und Pragmatismus nach James und Dewey sowie Ideen der Gestaltpsychologie bzw. Theorien der Psychologen Freud, Fromm, Horney, Reich, Jung und Adler auf. (vgl. Möller 1983: 589)
Maslow etabliert in seinem Modell eine Bedürfnishierarchie und identifiziert fünf Bedürfnisstufen[2]. Die erste und unterste Stufe umfasst die "physiologischen Bedürfnisse" wie das Bedürfnis nach Nahrung, Sexualität und Schlaf. "Dieser physiologische Bedürfnistyp ist für die menschliche Antriebsstruktur nach Maslow 'ungewöhnlich' und 'untypisch'." (Maslow 1977: 77f zit. n. Möller 1983: 578, kursiv im Orig.) Denn er unterscheidet sich klar von anderen Bedürfnistypen, grenzt sich zeitlich ein und ermangelt Erklärungskraft für menschliche Motivationen. (vgl. Möller 1983: 578)
Die zweite Stufe bezieht sich auf Sicherheitsbedürfnisse. Inhaltlich drücken sich diese aus im "Verlangen nach Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Struktur, Ordnung, Gesetz" sowie durch "die Vorliebe für irgendeine Art ungestörter Routine, einen glatten Ablaufrhythmus". Für Maslow bildet "eine gesicherte, ordentliche, vorausschaubare, gesetzesmäßige, organisierte Welt" die Voraussetzung für eine "Sinnsuche in Familie, Religion und Wissenschaft." (Maslow 1977: 80-82)
Als dritte Stufe identifiziert Maslow "Bedürfnisse nach Liebe und Zuneigung" (Maslow 1977: 84), die sich im Bedürfnis nach "vertrauten Arbeitskollegen", "Kontakt und Intimität, Zugehörigkeit", nach "wirklichem Zusammensein" und "Brüderlichkeit" zeigen. (Maslow 1977: 84-86)
Den vierten Rang in der Bedürfnishierarchie nimmt die "Selbstachtung und Achtung seitens anderer" ein. Diese Bedürfniskategorie konstituiert sich aus zwei entgegengesetzten Dimensionen: Das "Bedürfnis nach Stärke, Leistung, Bewältigung und Kompetenz, Vertrauen angesichts der übrigen Welt und Unabhängigkeit und Freiheit" (Maslow 1977: 87) nährt das "reale Selbst"- angelehnt an den Begriff von Horney. (vgl. Möller 1983: 578f) Die zweite Dimension beinhaltet Bedürfnisse nach "Prestige", "Status, Berühmtheit
und Ruhm, nach Dominanz und Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bedeutung, Würde oder Wertschätzung." Demzufolge konstituiert Handeln, das der zweiten Dimension zuordenbar ist, das "idealisierte Pseudo-Selbst". (Maslow 1977: 87) Gleichwohl welcher der beiden Bedürfnisarten sie angehören, schafft die Befriedigung dieser Bedürfnisse ein "Gefühl, nützlich und notwendig für die Welt zu sein" (ebd.)
Als fünfte und höchste Stufe der Bedürfnishierarchie nennt der Psychologe das "Verlangen nach Selbsterfüllung" bzw. "Selbstverwirklichung". Hier liegt Maslows Annahme einer Tendenz des Menschen zu Grunde, das "zu aktualisieren, was man an Möglichkeiten besitzt": "Was ein Mensch sein kann, muß [sic!] er sein." (Maslow 1977: 88f) Konkret bedeutet dies ein Bedürfnis nach "Wachstum", ein "Streben nach Gesundheit, nach Identität und Autonomie, das Verlangen nach Vortrefflichkeit." (Maslow 1977: 11) Der Verwirklichung der eigenen Identität misst Maslow dabei eine besondere Bedeutung zu und beschreibt es als zielgerichteten Prozess, nämlich "aktuell das zu machen, was man bereits ist, wenn auch nur in potentieller Form. Die Suche nach Identität bedeutet dasselbe wie auch 'werden, was man wahrhaftig ist'. Und so auch 'voll-funktionierend' oder 'vollmenschlich werden' oder 'authentisch man selbst'." (Maslow 1977: 152) Selbstverwirklichung im Sinne einer "positive[n] Wachstumstendenz als Triebkraft" ist der "inneren Natur" des Menschen zugehörig. (Maslow 1977: 118ff) Maslow zufolge gibt es "vernünftige theoretische und empirische Gründe für das Vorhandensein einer Vorwärtstendenz im menschlichen Wesen". (vgl. Maslow 1973: 158) Er erkennt darin einen umfassenden Erklärungsfaktor der Entwicklung von Persönlichkeit und menschlichen Werten. (vgl. Maslow 1973: 158-161, 169-172)
Maslow versteht diese "Wachstumsmotivation" oder "Metamotivation" als den "Überlebenswert" Darwins ergänzenden menschlichen Antrieb. Er grenzt diese klar von "Mangel- oder Defizitmotivation" ab, die sich lediglich auf die unter der Selbstaktualisierungsstufe befindlichen Kategorien beziehen. (vgl. Möller 1983: 579)
Die Maslowsche Bedürfnishierarchie ist gekennzeichnet von einer "Hierarchie der relativen Vormächtigkeit" (Maslow 1977: 78). So muss die jeweils untergeordnete Bedürfnisstufe mindestens in relativen Ausmaß befriedigt sein, damit jene Bedürfnisart, die den nächst höheren Stellenwert einnimmt, relevant wird. Je weiter nach oben man in der "Bedürfnispyramide" gelangt, desto weniger dringend ist die Bedürfnisbefriedigung für das physische Überleben bzw. desto leichter kann die Bedienung höher angesiedelter Bedürfnisse aufgeschoben werden. (vgl. Möller 1983: 1980) Dieses Konzept macht deutlich, dass die Maslowsche Bedürfnistheorie einer strikten, statischen Logik und implizit behaupteten Zielgerichtetheit unterliegt. Eigentlich fasst Maslow auch den Begriff Selbstverwirklichung hinsichtlich der menschlichen Existenz und Sinndeutung teleologisch auf. Im Bewusstsein dessen formuliert der Psychologe die fünfte Bedürfnisstufe später in "Wachstumsbedürnisse" um. (vgl. Möller 1983: 579, Goble 1979: 70f)
Laut Möller erlebte Maslows Beürfniskonzeption eine beinahe unumstrittene Rezeption in den 60er und 70er Jahren, insbesondere in der Betriebspsychlogie im Kontext der "Humanisierung der Arbeitswelt". (vgl. Möller 1983: 577) In der Psychologie etablierte er seinen Ansatz der "humanistischen Psychologie" als "dritte Kraft" zwischen Behaviorismus und Freudianismus (laut Selbstbezeichnung). Maslow wollte eine psychologische Theorie der menschlichen Werte zur Verfügung stellen, auf die die Philosophie aufbauen könnte. Diese "dritte Kraft" sollte durch ihre Ideen und Methoden einen Beitrag für einen Paradigmenwechsel leisten, der eine Verbesserung der Lebenssituation der Individuen in der Gesellschaft vollzieht. (vgl. Goble 1979: 26-29) Es fand eine interdisziplinäre Integration der Maslowschen Bedürfnistheorie u.a. in der Soziologie, Pädagogik und Politikwissenschaft statt, die jedoch häufig von einer oberflächlichen, willkürlichen Betrachtungsweise sowie von Umdeutungen und Instrumentalisierung gekennzeichnet war. (vgl. Möller 1983: 577)
So weit verbreitet das Konzept ist, so umstritten ist es auch. Der Soziologe Möller kritisiert Maslows "Verbindung von ahistorischer Spekulation und Sozialisation-negierendem Biologismus" und damit einhergehend ein unwissenschaftliches Maß an Widersprüchlichkeit, Vagheit und Subjektivität, die in dessen Theorie zum Tragen kommen. (Möller 1983: 587) Dies kommt zum Beispiel bei Maslows Annahme zum Ausdruck, der Mensch strebe von Natur aus nach Selbstverwirklichung, welcher das "höchste Gut" und somit den Idealzustand des Menschen darstelle. (vgl. Spielthenner 1996: 138, 141) Die Natur des Menschen begreift Maslow also im moralischen Sinne an sich als gut und der Mensch soll nach der möglichst vollständigen Verwirklichung seiner potentiellen Fähigkeiten und Bedürfnisse trachten. (vgl. Spielthenner 1996: 43, 45f) Das Wesen des Menschen, das Maslow realisiert sehen will, geht aber auf ein positives Menschenbild zurück, das nicht empirisch, sondern nur philosophisch begründbar ist. (vgl. Spielthenner 1996: 169f)
Hinsichtlich der Prägung menschlicher Bedürfnisse nimmt Maslow definitv eine "instinktoide Natur der Grundbedürfnisse" (Maslow 1977: 12) und sogar eine "biologische Determination, die 'bis zu einem gewissen Grad' 'konstitutionell oder erblich ist' " an. (Maslow 1977: 142 zit. n. Möller 1983: 581; vgl. Maslow 1973: 164f) Maslow behauptet eine solche genetische Veranlagung auch für die "Wachstumsbedürnisse", was ihn zur These einer "höheren Animalität" verleitet. (Spielthenner 1996: 122 zit. n. Maslow 1967: 115)
Andererseits gesteht er zu, dass Arten der Bedürfnisbefriedigung kulturabhängig sowie die Möglichkeit der Bedürfnisrealisierung von Umweltfaktoren bedingt sind. (vgl. ebd.) Anstatt dieses Paradox aufzulösen, unterlässt Maslow eine Entscheidung zwischen Natur und Kultur als vorherrschenden Bestimmungsfaktor, indem er ihre Gegensätzlichkeit schlicht negiert und als versöhnt darstellt[3]. (vgl. Möller 1983: 581, 590)
Außerdem weist Möller darauf hin, dass die von Maslow aufgestellte Bedürfnishierarchie nicht stichhaltig zu begründen ist (vgl. Möller 1983: 587) und dass Maslow eine Definition seines Bedürfnisbegriffes unterlassen hat. (vgl. Möller 1983: 588) Vielmehr besitzen für Maslow Bedürfnisse auf pauschale Weise universale Gültigkeit, sie sind "ahistorisch, klassenübergreifend, transkulturell." (Möller 1983: 587)
Der Soziologe Hillmann wirft Maslows Bedürfnistheorie ebenso vor, dass das Modell "ein verfestigtes naturalist[isches] Wertsystem zum Ausdruck bringt" (Hillman 1994: 76) und eine unzulässige Reduktion zu Lasten einer Berücksichtigung historischer und soziologischer Verhältnisse bzw. individueller Abweichungen vornimmt. Der isolierende Fokus auf das Individuum, der keinen analytischen Zusammenhang zur Gesellschaft herzustellen vermag, führt laut Möller dazu, dass Maslows Theoriekonzept "kollektive Bedürfnisse" nicht beinhaltet und Motivationen unabhängig von Handeln gedacht sind. Daher verfügt Maslow weder über Überlegungen zu situativen, handlungsdeterminierenden Einflüssen noch über eine anschlussfähige Handlungstheorie. (vgl. Möller 1983: 586f) Möller kommt in seiner Maslow-Kritik zum Schluss, dass die Leistung des Maslowschen Bedürfniskonzepts darin
besteht, einen Perspektivwechsel und eine Abkehr vom behavioristischen Konzept des handlungssteuerenden Reizes sowie von der Vorstellung, Bedürfnisbefriedigung habe die Funktion der Widerherstellung eines organismischen Gleichgewichts (Homöostatie), einzufordern. An diese Stelle tritt die Annahme einer Dynamik der Bedürfnisse, wonach der Mensch neue Bedürfnisse auf aktive Weise selbst schafft, das im Kontext der menschlichen Tendenz nach Selbstverwirklichung stark zum Ausdruck gebracht wird. (vgl. Möller 1983: 582)
Bronislaw Malinowski, Schüler der Anthropologen Wilhelm Wundt und James Frazer, ist neben Radcliffe-Brown ein Hauptvertreter der britischen Kulturanthropologie. Er führte eine Vielzahl ethonologischer Untersuchungen durch und verstand sich vorrangig als empirisch-arbeitender Ethnologe. Ebenso viel aber leistete er hinsichtlich der Systematisierung von Forschungsergebnissen und soziologischer Theoriebildung. (vgl. Bernsdorf et al. 1980: 264)
So führte er etwa den elementaren Funktionsbegriff in der Ethnologie und Soziologie ein. Malinowski, ausgehend von einem "universalen Funktionalismus", kann als "Funktionalist im strikten Sinne" gelten. (Osterdiekhoff 2001: 438, vgl. Bernsdorf et al. 1980: 265) Seine funktionalistische Theoriekonzeption entwickelte er im Rahmen seiner Theorie der Bedürfnisse: denn ihm zufolge fungiert Kultur stets als Mittel der Bedürfnisbefriedigung: "Funktion bedeutet daher immer die Befriedigung eines Bedürfnisses, vom einfachsten Akt des Essens zur sakramentalen Handlung." (Malinowski 1944: 159 zit. n. Bernsdorf et al. 1980: 264) So liegt bei Malinowski der "Analyse von Kulturen stets eine Analyse von Institutionen in ihrem Bezug auf menschliche Bedürfnisse" zu Grunde. (Bernsdorf et al. 1980: 264)
Dabei trifft er die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Grundbedürfnissen ("basic needs") und abgeleiteten Bedürfnissen ("derived needs"), die eine soziale Organisation des Handelns in Form von Institutionen erfordern. (vgl. Hillmann 1994: 508) Diese Grundbedürfnissse und die dazugehörigen kulturellen Institutionen sind laut Malinowski folgende: Metabolismus (Kommissariat)[4], Reproduktion (Sippe), physischer Komfort (Unterkunft), Sicherheit (Schutz), Bewegung (Tätigkeiten), Wachstum (Erziehung) und Gesundheit (Hygiene). (vgl. Malinowski 1969: 91) Als dritte Bedürfniskategorie nennt er die symbolischen bzw. integrativen Bedürfnisse, die sich in integrativen Werten (z.B. Solidarität), Glauben, Tradition und Überlieferung oder Kommunikation durch Symbolsysteme manifestieren. (vgl. Malinowski 1969: 132-136)
Malinowski fasst Kultur in erster Linie auf als einen "instrumentellen Apparat" zur Bedürfnisbefriedigung und gesellschaftlichen Problemlösung: "Kultur ist damit ein mit der Bedürfnisbefriedigung verflochtenes System von Gegenständen, Tätigkeiten und Haltungen (attitudes), in dem jedes Teil als Mittel zu einem Zweck fungiert. Die Kultur bildet zugleich eine Ganzheit, in der die einzelnen Elemente in einem interdependenten Zusammenhang stehen." (Hillmann 1994: 508)
seiner Theorie der Institutionen eine Antwort auf diese Imperative zu finden. (Bernsdorf et al. 1980: 264) Ein Rückbezug auf diese Grundbedürfnisse ist zwar letztlich Erklärungsprinzip für kulturelle Erscheinungen, viele Institutionen lassen sich nur auf abgeleitete Bedürfnisse zurückführen. (vgl. Bernsdorf et al. 1980: 265) Dies gilt für die vier von Malinowski genannten Imperative, die Imperative der Wirtschaft, der sozialen Kontrolle, der Erziehung und der politischen Organisation. (vgl. Malinowski 1969: 91)
Kultur ist nach Malinowskis Verständnis mit menschlichen Bedürfnissen somit stets funktional verknüpft, teilweise auch nur mit den abgeleiteten Bedürfnissen. Seine theoretische Vorgangsweise besteht also darin, eine Theorie der menschlichen Bedürfnisse, und darauf aufbauend einen Katalog funktionaler Imperative zu entwickeln, um schließlich mithilfe
Da Malinowski durch sein empirisches und theoretisches Schaffen den gesamten strukturell-funktionalen Theorie-Ansatz (insbesondere das Werk von Robert K. Merton und Talcott Parsons) nachhaltig beeinflusst hat, gilt er als ein Wegbereiter der modernen Theorie des Funktionalismus. (vgl. Hillmann 1994: 508)
Der folgende Abschnitt stützt sich auf die Soziologin und Philosophin Ágnes Heller, die im Rahmen von "Theorie der Bedürfnisse bei Marx" den Gehalt der Bedürfnistheorie im Werk von Karl Marx herausarbeitet.
Laut Ágnes Heller nehmen Überlegungen zu menschlichen Bedürfnissen im Werk von Karl Marx einen großen Stellenwert ein. So ließ Marx den Begriff "Bedürfnis" in die Definition wichtiger Analysekategorien, wie Gebrauchswert und Mehrwert, einfließen, definierte den Begriff selbst jedoch nicht. (vgl. Heller 1976: 23f) Dies bringt Heller zur Annahme, dass "der Bedürfnis-Begriff die geheime Hauptrolle in Marxens ökonomischen Kategorien spielt". (Heller 1976: 27)
Bedürfnisse versteht Marx in erster Linie nicht in ökonomischer Hinsicht, sondern historisch geprägt und gesellschaftlich veränderbar. Er greift sie auf als humanistischen Wesensbegriff, denn für ihn sind sie vor allem "geschichts-philosophische Kategorien bzw. anthropologische Wertkategorien" (Heller 1976: 27; kursiv im Orig.)
Analytischer Ausgangspunkt bei Marx ist die kapitalistische Gesellschaft (vgl. Heller 1976: 29): die historische Produktion des Mehrwerts reproduziert das Privateigentum sowie die Arbeitsteilung und damit eine bestimmte Verteilung der Bedürfnisse als Bedürfnissystem: "Die innerhalb der Arbeitsteilung eingenommene Position bestimmt die Bedürfnisstruktur oder zumindest deren Grenzen" (Heller 1976: 25; kursiv im Orig.) In seiner Analyse legt Marx das Hauptaugenmerk auf die Analyse der "Entfremdung der Bedürfnisse" (Heller 1976: 48), wonach die kapitalistische Produktion der Kapitalverwertung, und nicht der Bedürfnisbefriedigung dient. Dies zieht die Konsequenz nach sich, dass "das Bedürfnis nur auf dem Markt, in Form von zahlungskräftiger Nachfrage in Erscheinung tritt" (Heller 1976: 26) Außerdem, so Marx, bringt der Kapitalismus einerseits neue Bedürfnisse hervor und ist andererseits wirksam in der Manipulierung der menschlichen Bedürfnisse. (vgl. Heller 1976: 48)
Heller identifiziert bei Marx auch verschiedene Bedürfnistypen, die sich immer auf gewisse Gegenstände (Objektivationen) beziehen. Marx trifft in seinem Werk die allgemeine Unterscheidung zwischen "materiellen" und "geistigen Gütern" und nennt weiters "politische Bedürfnisse", "Bedürfnisse des Gemeinschaftslebens" sowie das "Arbeits- oder Betätigungsbedürfnis". (Heller 1976: 29)
Im Sinne einer "geschichtsphilosophisch-anthropologische[n] Klassifizierung" grenzt Marx grundsätzlich "natürliche Bedürfnisse" (oder "physische" bzw. "notwendige Bedürfnisse") von "gesellschaftlich produzierten Bedürfnissen" (auch "gesellschaftliche Bedürfnisse") ab. (Heller 1976: 29; kursiv im Orig.) Im "Kapital" setzt sich Marx hauptsächlich mit den Kategorien der "natürlichen Bedürfnisse" und "notwendigen Bedürfnisse" auseinander. (vgl. Heller 1976: 32)
Unter "natürlichen Bedürfnissen" versteht Marx solche Bedürfnisse, die sich auf die Selbsterhaltung, also auf die Erhaltung der Lebensbedingungen beziehen. Während es dabei um die Erhaltung des Menschen als "Naturwesen" geht, macht die Art der Bedürfnisbefriedigung diese wiederum zu gesellschaftlichen Bedürfnissen. Aufgrund dieser Annahme verliert die separate Kategorie an analytischer Eigenständigkeit, laut Heller jedoch nicht ihre Berechtigung[5]. (vgl. Heller 1976: 29)
Die notwendigen Bedürfnisse sind jene, die "auf der gegebenen Ebene der Arbeitsteilung" als "normal" angesehen werden - im Sinne eines durchschnittlichen, objektiv messbaren Lebensstandards. (Heller 1976: 34) Diese Bedürfnisart ist somit als "Durchschnitt" einer bestimmten Klasse in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit definiert. Dies gründet in Marx' Überlegung, dass die Bedürfnisstruktur nur in Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen interpretiert werden kann. (vgl. Heller 1976: 32) Die notwendigen Bedürfnisse sind daher auch stark kulturell und moralisch geprägt, der Gebrauch der Bedürfnisgegenstände steht dabei im Mittelpunkt[6] . (vgl. Heller 1976: 34) Auch inhaltlich nicht materielle Bedürfnisse, wie Bildung oder Gewerkschaftszugehörigkeit, zählt Marx zu dieser Bedürfnisart - weil diese letztlich auch von materiellen Mitteln abhängig sind. (vgl. Heller 1976: 35)
Die Produktivitätsentwicklung der Industrieproduktion bedeutet laut Marx ein Ende der Arbeit als bloße Existenzsicherung. (vgl. Heller 1976: 33) Damit verbunden, führt die "Zurückweichung der Naturschranken" zur Reduktion der "natürlichen Bedürfnisse" auf rein "physische Bedürfnisse". (Heller 1976: 33) Die äußere Natur ist in diesem Kontext nur in Interaktion zwischen Mensch und Umwelt begreifbar und damit gesellschaftlich vermittelt. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen natürlichen und notwendigen Bedürfnissen bedeutet dies die Verwischung der Bedürfniskategorien, denn die Industrieproduktion "liquidiert das Problem (den Gegensatz [zwischen natürlichen und notwendigen Bedürfnissen; Anm. d. Verf.]) selbst - nach Möglichkeit ein für allemal." (Heller 1976: 33; kursiv im Orig.)
Marx nennt in Abgrenzung zu den notwendigen (bzw. "wahren") Bedürfnissen die "Luxus- Bedürfnisse". Marx trifft die Zuordnung uneindeutig nach den Kriterien Inhalt bzw. Qualität des Gegenstands einerseits und zahlungskräftiger Nachfrage im Sinne einer ökonomischen Erreichbarkeit von Gegenständen zur Bedürfnisbefriedigung, beispielsweise für eine gesellschaftliche Mehrheit oder Minderheit, andererseits. (vgl. Heller 1976: 37)
Der Begriff der "gesellschaftlichen Bedürfnisse" verwendet Marx auf uneinheitliche Weise mit mehreren Bedeutungszuschreibungen. Häufig ist die Bedeutungsübereinstimmung mit den notwendigen Bedürfnissen, wobei trotz des gesellschaftlichen Charakters immer Bedürfnisse von Individuen gemeint sind. In diesem Sinne geht es um "objektive" Bedürfnisse von Individuen auf Basis eines durch Sozialisation vermittelten Bedürfnissystems. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse als Durchschnitt von Bedürfnissen bezogen auf materielle Güter sind Ausdruck zahlungskräftiger Nachfrage. (vgl. Heller 1976: 80)
Andererseits bezeichnet Marx auch Bedürfnisse als gesellschaftlich, die nicht marktbezogen sind. (vgl. Heller 1976: 79) Diese Bedeutungsvariante taucht bei Marx häufig im Zusammenhang mit geistigen Gütern, wie Kunst, und der Kritik an ihrer Verdinglichung auf: So stellt für ihn die "allerkennzeichnendste Erscheinungsform der Entfremdung die Quantifizierung des Nichtquantifizierbaren" dar. (Heller 1976: 81)
In einem anderen Verständnis sind gesellschaftliche Bedürfnisse solche, die gesellschaftlich produziert sind und nur mit gesellschaftlichen Institutionen befriedigt werden können. Exemplarisch hierfür ist das Lernbedürfnis. (vgl. Heller 1976: 81) Desweiteren nennt Marx die Gesundheitsversorgung, Arten der kulturellen Bedürfnisse und Gemeinschaftsbedürfnisse. (vgl. Heller 1976: 82)
Die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals stehen laut Marx im Gegensatz zu den Entwicklungsbedürfnissen der ArbeiterInnen. (vgl. Heller 1976: 41) Dies führt ihm zufolge zur Entfremdung der ArbeiterInnen von Arbeit und Produktion. Entfremdung als philosophischer Leitbegriff der Kapitalismuskritik bei Marx, zielt also ab auf die Entfremdung des Menschen im kapitalistischen Arbeitsprozess und als Konsequenz der "Entmenschlichung" im Sinne der Entfremdung des Menschen von sich Selbst (als Mensch).
Marx setzt als positiven Begriff die philosophische Konzeption des "an Bedürfnissen reichen" Menschen den gesellschaftlichen Verhältnissen entgegen. (vgl. Heller 1976: 40) Die damit identifizierten Bedürfnisse sind in erster Linie individuelle "freie Bedürfnisse". Dazu zählen vor allem geistige und moralische Bedürfnisse, die auf die Gemeinschaft bezogen und immaterieller Natur sind. (vgl. Heller 1976: 36) Das Verlangen danach bezeichnet Marx mit dem "Bedürfnis dieses Reichtums". (vgl. Heller 1976: 40) Marx zufolge stellt die materielle Wertkategorie "Reichtum" die voraussetzende Basis für die "freie Entfaltung sämtlicher menschlicher Fähigkeiten und Sinne" dar. (ebd.)
In einem fortgeschrittenen Stadium der Entfremdung nimmt Marx an, dass sogenannte "radikale Bedürfnisse" in der Gesellschaft auftreten, die auf die Verwirklichung dieser Utopie hinwirken: "Die höchstgradigste Entfremdung muß das Bedürfnis auf Transzendierung der Entfremdung, den Reichtum, die Realisierung des 'Gattungswesens' hervorbringen." (Heller 1976: 52) Die radikalen Bedürfnisse setzen laut Marx dann jene Kräfe frei, die eine "Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch" ermöglichen, welche gleichbedeutend ist mit der Entwicklung des Individuums in der zukünftigen Gesellschaft. (vgl. Heller 1976: 96) Das emanzipatorische Potential schreibt Marx dabei der Arbeiterklasse zu, die als Träger der radikalen Bedürfnisse die zu erkämpfende Überwindung des Kapitalismus und den Übergang in die Zukunftsgesellschaft garantieren sollen, indem diese ein "kollektiven Subjekt" mit "kollektivem Sollen" konstituiert. Marx geht davon aus, dass der Kapitalismus die radikalen Bedürfnisse "notwendigerweise" selbst erzeugt, wobei er selbst einen Determinismus zurückgewiesen hat. (Heller 1976: 98)
Das angestrebte Ziel der klassenlosen Gesellschaft im Sozialismus macht die freie Entfaltung menschlicher Bedürfnisse schließlich erst möglich: "Wo die Herrschaft der Dinge über den Menschen aufhört, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht als Beziehung der Dinge erscheinen, dort regiert jedes Bedürfnis, das 'Entwicklungsbedürfnis des Individuums', das Bedürfnis der Selbstverwirklichung der Persönlichkeit." (Heller 1976: 82, kursiv im Orig.)
Bei der Theorie der Bedürfnisse bei Marx handelt es sich nicht um eine in sich geschlossene Theorie, obwohl ihre Annahmen stets konsistent sind. So weisen einige Begriffe eine unsystematische Bedeutungsvielfalt auf, weil sie in Marx' Werk häufig die Funktion impliziter vorausgesetzter Annahmen für weitergehende Überlegungen einnehmen. Die Bedürfniskonzeption nach Marx erscheint jedenfalls sinnvoll, weil sie eher allgemein gehalten ist und keinen "Katalog" von bestimmten Grundbedürfnissen behauptet. Daraus und aufgrund ihrer Konfliktorientierung sowie aus der starken Berücksichtigung von historischer und kultureller Bedingtheit resultiert ihre relative Offenheit für verschiedene Inhalte.
Nach dieser Diskussion einiger Überlegungen zur Beschaffenheit menschlicher Bedürfnisse, ihrer Bedeutung für den Menschen und zu den Möglichkeiten ihrer Befriedigung soll mit diesem Vorverständnis eine nähere Betrachtung des Konzepts "Lebensqualität"stattfinden. Zunächst folgen an dieser Stelle einige allgemeine Definitionen der Begrifflichkeit aus Sicht der Soziologie:
Hillmanns soziologischem Wörterbuch zufolge ist der Terminus "Lebensqualität" ein "in den USA aus der komplexen Krise der mod[ernen] Industrieges[ellschaft] heraus entstandener Begriff zur umfassenden Bezeichnung der gesamten Lebensbedingungen in einer Ges[ellschaft]." (Hillmann 1994: 476) Nach Fuchs-Heinritz et al. ist Lebensqualität eine "zusammenfassende Bezeichnung für den durch sog. soziale Indikatoren (social indicators) angezeigten Entwicklungsstand der allgemeinen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft". (Fuchs-Heinritz et al. 2007: 388f; kursiv im Orig.) Dieser sollte undifferenzierte und ökonomisch-fokussierte Deskriptionen wie "Bruttosozialprodukt" oder "Lebensstandard", die als überholt empfunden wurden, durch eine mehrdimensionale Erfassung der Lebensbedingungen in einer Gesellschaft ablösen. So bezieht das neue Konzept qualitative Bestimmungsfaktoren wie Gesundheitswesen, Bildung und Erziehung, Arbeit und Beschäftigung, Freizeit, Umwelt (Natur), soziale Beziehungen, Sicherheit und Recht, politische Beteiligung mit ein. (vgl. Hillmann 1994: 476)
In der deutschsprachigen Soziologie haben Wolfgang Glatzer und Wolfgang Zapf seit Anfang der 1970er Jahre - und bis heute nachwirkend - diese Begrifflichkeit in theoretischkonzeptioneller und empirischer Hinsicht mit ihren Arbeiten im Rahmen der Sozialstrukturforschung und Sozialberichterstattung geprägt. Glatzer und Zapf erhoben gesellschaftliche Lebenslagen und Verteilungsprobleme mithilfe von objektiven sozialen Standards, den Sozialindikatoren. Das Erkenntnisinteresse lag dabei im Bereich der Wohlfahrtsentwicklung und des sozialen Wandels in der BRD und DDR begründet. Die Bedeutung der Sozialindikatorenforschung wurde durch die Interessen der BRD Reformpolitik der 60er und 70er Jahre unterstrichen, die die wissenschaftlichen Ergebnisse im Sinne der Evaluierung politischer Outcomes und sozialer Bedarfsmessung für sich sozialpolitisch nutzbar machte. (vgl. Beck 1998: 361)
Im "Begriff Lebensqualität drücken sich Zielvorstellungen einer Gesellschaft aus, die historisch gesehen ein hohes Wohlstandsniveau erreicht hat und an die 'Grenzen des Wachstums' angekommen ist" (Glatzer 1990 zit. n. Bellebaum 1994: 8), so Wolfgang Glatzer. Deshalb hat für Glatzer und Zapf das Konstrukt Lebensqualität dazu beigetragen, am unhinterfragten Ziel des Wirtschaftswachstums und damit einhergehender Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung Kritik zu üben. (vgl. Dworschak 2004: 34) Im Bereich der internationalen Sozialindikatorenforschung sind auch die Bemühungen der transnationalen Organisation OECD (Organization for Economic Cooperation and Delevopment), Wohlfahrtsentwicklung messbar zu machen, erwähnenswert. Diese entwickelte eine Liste von Sozialindikatoren zur Operationalisierung der Lebensqualität, die erstmals 1982 veröffentlicht wurde. Dabei sollten 33 Indikatoren das Ausmaß der Bedürfniserfüllung in acht gesellschaftlichen Zielbereichen objektiv bestimmen. Die von der OECD identifizierten Zielbereiche sind folgende:
-
"Gesundheit
-
Persönlichkeitsentwicklung, intellektuelle und kulturelle Entfaltung durch Lernen
-
Arbeit und Qualität des Arbeitslebens
-
Zeitbudget und Freizeit
-
Verfügung über Güter und Dienstleistungen
-
Physische Umwelt
-
Persönliche Freiheit und Recht
-
Qualität des Lebens in der Gemeinde" (vgl. OECD 1982: 7)
Die Lebensqualität ist nach dieser Auffassung vom Grad der Befriedigung von Bedürfnissen in diesen Zielbereichen determiniert. Die OECD ging und geht - etwa im Gegensatz von Glatzer und Zapf - davon aus, dass Lebensqualität mithilfe der Erhebung externer Bestimmungsfaktoren der Lebensverhältnisse in einer Gesellschaft hinreichend erfasst werden kann[7] (vgl. Beck 1998: 362)
Bei diesem Anspruch von Objektivität ist hinsichtlich seiner beiden Bedeutungsebenen Kritik angebracht: Erstens ist die Möglichkeit der Erhebung Lebensqualität oder - zufriedenheit, die allein auf einer extern beobachtende Weise basiert, in Zweifel zu ziehen, zum Zweiten ist die Forderung nach Objektivität im wertneutralen Sinne zu hinterfragen. Iris Beck stellt diesbezüglich heraus, dass im Allgemeinen weder im wissenschaftlichen noch im politischen Bereich beim Entstehungs- und Verwertungskontext von Sozialdatensammlungen Objektivität erreicht werden kann, weil der Operationalisierung von sozialen Indikatoren ohnehin stets Bewertungsprozesse, z.B. in Form von Theorien über Bedürfnisse oder Menschenbilder, vorausgehen: "Auch eine rein wissenschaftliche Begründung kann angesichts der normativen Definition sozialer Problemlagen nicht 'objektiv' im wertneutralen Sinn erfolgen." (Beck 1998: 363)
Tatsächlich herrschte eine heftige Kontroverse über die Bedeutung subjektiver vs. objektiver Einflussfaktoren zwischen den sogenannten "Objektivisten" und "Subjektivisten" als Vertreter zweier entgegengesetzter Paradigmen in der Lebensqualitätsforschung. Mittlerweile ist die Paradigmen-Debatte zwischen objektivistischem und subjektivistischem Lager beigelegt. Somit ist heute in der Lebensqualitätforschung weitgehend anerkannt, dass Lebensqualität ein mehrdimensionales Konstrukt und die subjektive Forschungsperspektive unverzichtbar in der Analyse ist. (vgl. Bundschuh et al. 2002: 70) Denn objektiv gleiche Lebensbedingungen können stets unterschiedlich wahrgenommen und einer unterschiedlichen Bewertung unterzogen werden. (vgl. Beck 1998: 367f, Seifert 1998: 158) "People live in an objectively defined environment, but they perceive a subjectively defined environment", stellte Albert A. Campbell als Pionier dieser Disziplin bereits 1976 fest. (Campbell et al. 1976: 13 zit. n. Beck 1998: 364)
Wolfgang Glatzer und Wolfgang Zapf prägten in dieser Hinsicht die Begriffe "Unzufriedenheitsdilemma" und "Zufriedenheitsparadox", die eine Diskrepanz zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektiver Wahrnehmung beschreiben. So können Menschen trotz "guter" Lebenslage unzufrieden sein bzw. im Umkehrschluss sich mit einem objektiv schlechten Lebensstandard durchaus zufrieden geben. Dies ist auch durch den Einfluss von Normen und Werten, die stets subjektive Prioritäten einnehmen, zu erklären. (vgl. Glatzer/Zapf 1984: 23)
Außerdem sind rein objektive und begrenzte Auflistungen von Lebensqualität-Kriterien stets äußerst komplexitätsreduziert, da sie unter anderem nicht berücksichtigen, dass manche Menschen mit Behinderung gewisse Werte aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht realisieren können - diese aber trotzdem ein von Lebensqualität gekennzeichnetes Leben erfahren können. (vgl. Vreeke et al. 1997: 294f)
Bereits lange vor der Sozialstrukturforschung um Glatzer und Zapf forderte W. I. Thomas (1863 - 1947) ebenfalls mit Nachdruck, sowohl objektive als auch subjektive Erklärungsfaktoren in die soziologische Analyse zu integrieren. Sein einflussreiches Thomas-Theorem - "If men define situations as real, they are real in there consequences" - besagt, dass die subjektive Situationsdefinition, die Akteuren in ihrem Handeln zu grundeliegt, von entscheidender Bedeutung für Handlungsvorbereitung, -ausführung und -folgen ist. (Osterdiekhoff 2001: 657f) In seinem bis heute nachwirkenden Hauptwerk "The Polish Peasant in Europe and America" führt er diesen Forschungsansatz wie folgt näher aus: "The situation is the set of values and attitudes with which the individual or the group has to deal in a process of activity and with regard to which this activity is planned and its results appreciated. Every concrete activity is the solution of a situation." (Thomas 1918: 68 zit. n. Osterdiekhoff 2001: 658) W. I. Thomas folgert daraus, dass es für sozialwissenschaftliche Methodik unabdingbar ist, subjektive Wirkungsfaktoren zu erheben. (vgl. Osterdiekhoff 2001: 658)
Für die empirische Erfassung von Lebensqualität impliziert dies die unumstrittene Annahme eines zweidimensionalen Konstrukts, das objektive und subjektive Bestimmungsfaktoren miteinander verknüpft, wie Iris Beck in ihrem Forschungskonzept darlegt:
"'Lebensqualität' ist komplex, und die einzelnen Dimensionen und Kriterien für Lebensqualität können nur durch eine Verbindung von objektiven und subjektiven Indikatoren, von theoretisch begründeten Kriterien und Standards und den subjektiven Bedürfnisorientierungen und Anspruchsniveaus, gefüllt werden." (Beck 1998: 375)
Für Monika Seifert lässt sich dieser theoretische Zugang hinsichtlich der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung folgendermaßen konkretisieren: Während sich die objektive Beurteilung der Lebensverhältnisse "an den Rechten von Menschen mit Behinderung sowie den Leitideen und Standards der Behindertenhilfe" orientiert, misst sich die jeweilige subjektive Einschätzung an der Zufriedenheit in Lebenssituationen. (Seifert 2007: 206) Daraus folgt für die Erhebung des Ressourcen- und Unterstützungsbedarfs von Menschen mit Behinderung: "Nur das Individuum selbst kann beurteilen, was es für ein "gutes Leben" braucht und wie es seine Lebenssituation einschätzt." (ebd.)
"The quality of life must be in the eye of the beholder" (Campbell 1972 zit. n. Schalock 2002: 29): Die US-amerikanische Quality of Life-Forschung ist beeinflusst von der Sozialpsychologie und "Mental Health - Forschung" und vertritt seit den Anfängen ihrer Forschungstradition eine personenzentrierte Sicht auf Lebensqualität.
Expemplarisch dafür sind die US-amerikanischen Autoren Taylor und Bogdan, die in ihrer Definition dem subjektiven Bedeutungsanteil am Konzept Lebensqualität einen überaus hohen Stellenwert einräumen:
"Quality of life is a matter of subjective experience. The concept has no meaning apart from what a person feels and experiences. It is a question of how people feel about their lives and situations and not what others attribute to them. [...] Quality of life refers to one's satisfaction with one's lot in life, an inner sense of contentment or fulfillment with one's experience in the world. As a subjective experience of feeling, quality of life may or may not be something people think about." (Taylor/Bogdan 1996: 16)
Taylor und Bogdan verstehen Lebensqualität in erster Linie als 'senzitizing concept', das nicht von vornherein determiniert ist, sondern Offenheit für die Wahrnehmung und Sicht der Betroffenen bereithält. (vgl. Seifert et al. 2001: 89) Neben Blumers symbolischen Interaktionismus beziehen sich die Autoren auf "Verstehen" nach Max Weber auf einer persönlichen Ebene, William James' Unterscheidung zwischen "knowledge of people" und "knowledge about people". (Taylor/Bogdan 1996: 18; kurisv im Orig.)
Campbell, Converse und Rogers haben 1971 die Lebensbedingungen in den USA anhand einer Stichprobe von 2.146 Befragten erhoben. (vgl. Glatzer/Zapf 1984: 29) Obwohl die Autoren Lebensqualität mithilfe von Sozialindikatoren operationalisierten, war ihnen stets bewusst, dass sich die individuelle Selbstwahrnehmung als subjektiver Bedeutungsanteil der objektiven Messung entzog. So sind Indikatoren zwar in der Lage, sozialen Wandel zu erfassen, jedoch sagen diese nichts über dessen Auswirkungen für die Gesellschaftmitglieder und ihrer Wahrnehmung und Bewertung desselben aus. (vgl. Beck 1998: 365)
Campbell et al. definieren "Zufriedenheit" in "The Quality of American Life" (1976) "als die kognitive Bewertung des erreichten im Vergleich zum erwünschten (oder notwendigen) Zustand der Bedürfnisbefriedigung in einem Lebensbereich" (ebd.). In diesem Sinne ist Zufriedenheit - einerseits als Ergebnis von Bedürfnisbefriedigung, andererseits als Bewertungsprozess - nicht nur von objektiven Faktoren abhängig, sondern auch "von individuellen Erwartungen, Ansprüchen, Einstellungen und Erfahrungen, die wiederum auf Lebensbedingungen und damit auf deren Veränderung einwirken können." (ebd.) Die Bewertung vollzieht sich Campbell et al. zufolge vor dem Hintergrund der individuellen Wahrnehmung und eines "Vergleichsmaßstabs" ('standard of comparison'). (ebd.) Auf diesen Vergleichsmaßstab wirken Faktoren wie "Erwartungen, Ansprüche, Werte, Einstellungen" etc. ein und ist durch sozioökonomische (Beruf, Status), demographische (Alter, Geschlecht) und psychische (Zukunftserwartung, Selbstbild) Variablen geprägt. (ebd.) "Diskrepanzen zwischen Anspruchsniveau und Befriedigungszustand" motivieren Individuen schließlich, ihre Lebensbedigungen aktiv zu verändern, wenn sie diese als gestaltbar wahrnehmen. (Beck 1998: 365f)
Die US-Forscher Andrews und Withey waren mit ihren Arbeiten ebenfalls wegweisend für die internationale Quality of Life-Forschung. Sie trugen 1976 in einer großangelegten, methodisch-fokussierten Studie der Bandbreite an Operationalisierungsmöglichkeiten von Zufriedenheit Rechnung. Dabei haben sie über fünfzig verschiedene Messinstrumente und Antwortskalen hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit, subjektives Wohlbefinden von Individuen zu messen, getestet. (vgl. Glatzer/Zapf 1984: 29, 177)
Campell et al. (1976) sowie Andrews und Withey (1976) wurden in Deutschland stark rezipiert und haben auch den Forschungsansatz von Glatzer und Zapf maßbeglich beeinflusst. (vgl. Beck 1998: 364, Glatzer/Zapf 1984: 29f) Dieser wird im folgenden Abschnitt näher vorgestellt werden.
Bereits für Glatzer und Zapfs Konzept von Lebensqualität ist das "subjektive Wohlbefinden in Form eines individuellen Bewertungsprozesses" zentral, jedoch methodisch viel schwieriger zu fassen als die objektive Inhaltsdimension. (Dworschak 2004: 36) Dieser subjektive Bedeutungsanteil fand Eingang in ihre Arbeitsdefinition, wie folgt:
"Unter Lebensbedingungen verstehen wir für unsere Zwecke zunächst einmal gute Lebensbedingungen, die mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden zusammengehen. In einer allgemeinen Definition ist die Lebensqualität von Individuen und Gruppen bestimmt durch die Konstellation (Niveau, Streuung, Korrelation) der einzelnen Lebensbedigungen und der Komponenten des subjektiven Wohlbefindens. Unter Lebensbedingungen verstehen wir die beobachtbaren, "tangiblen" Lebensverhältnisse: Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Familienbeziehungen und soziale Kontakte, Gesundheit, soziale und politische Beteiligung. Unter subjektivem Wohlbefinden verstehen wir die von den Betroffenen selbst abgegebenen Einschätzungen über spezifische Lebensbedingungen und das Leben im allgemeinen." (Glatzer et al. 1984: 23)
Das Zusammenwirken der drei Aspekte - positive bzw. negative Dimension und Zukunftserwartungen - charakterisieren laut Glatzer das subjektive Wohlbefinden näher:
-
Die positive Dimension konkretisiert sich in Lebenssituationen, denen subjektiv "Glück" und "Zufriedenheit" zugeschrieben wird. Zufriedenheit ist laut Glatzer tendenziell kognitiv bestimmt und dadurch geprägt, dass sie dem Vergleich mit bedeutenden sozialen Normen und Bezugsgruppen ausgesetzt ist. Glück ist hingegen eine mehr affektive Dimension, die sich aus positiven und negativen Erfahrungsinhalten realisiert. (vgl. Dworschak 2004: 36f) Die Autoren nehmen an, dass Glück als emotional charakterisierte Erscheinung im Gegensatz zu Zufriedenheit zeitnäher ist, also eine vergleichsweise geringere Stabilität im Zeitverlauf aufweist. (vgl. Glatzer/Zapf 1984: 189) Glatzer und Zapf erkennen in ihren Untersuchungen stabile Muster von Korrelationen zwischen den Konzepten "Glück" und "Zufriedenheit". (vgl. Glatzer et al. 1984: 191)
-
Die negative Dimension von subjektiven Wohlbefinden bezieht sich den Autoren zufolge auf "Besorgnis- und Anomiesymptome". Besorgnis wird durch "negativ mentale Erfahrungen" verursacht und konstituiert sich sowohl aus kognitiven als auch aus affektiven Elementen. Diese wird konkret durch Begriffe wie "niedergeschlagen", "erschöpft" oder "unglücklich" beschrieben. (vgl. Glatzer et al. 1984: 179f) Als Anomie bezeichnet man einen "Zustand sozialer Desintegration" mit "verminderten Sozialkontakten" (vgl. Cloerkes 1997: 137 zit. n. Dworschak 2004: 37) und beinhaltet Glatzer zufolge Symptome wie "Machtlosigkeit", "Einsamkeit", "Orientierungslosigkeit" oder "Entfremdung von der Arbeit" (vgl. Glatzer et al. 1984: 181).
-
Zukunftserwartungen schließlich beeinflussen die Zufriedenheitsbewertung von Personen im Zeitverlauf, und können in negativer oder postiver Weise intersubjektiv voneinander abweichen. (vgl. Dworschak 2004: 37)
Nachfolgend soll eine Auswahl aktueller Forschungskonzepte der internationalen Lebensqualitätforschung dargestellt werden.
Das Konstrukt Lebensqualität etablierte sich als Forschungsbegriff in den 1980er Jahren und war in der Lage, die aktuellen Paradigmen wie Selbstbestimmung, die Konzentration auf Stärken und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung, die Notwendigkeit personenbezogener Unterstützung und Gleichberechtigung aufzunehmen. Der neue Leitbegriff drückt diese Ideen aus und transportiert als übergeordnetes Ziel eine Verbesserung der Lebenszufriedenheit von behinderten Menschen. Damit ist der Lebensqualität-Begriff konsistent mit der Förderung von Individualisierung und dem personenzentierten Fokus in der Behindertenarbeit. (vgl. Schalock 2000: 117) Das Konzept Lebensqualität ist anschlussfähig an den Normalisierungsgedanken und die Bewegung der Deinstitutionalisierung, durch die das Feld der Geistigbehindertenpädagogik in dieser Zeit einen Umbruch erlebte. (vgl. Dworschak et al. 2001: 368) Schalock zufolge waren aber diese Paradigmen zu sehr prozessorientiert statt interessiert an "Outcomes", und aufgrund dessen nicht im Stande, konkret formulierte Ziele und adäquate Problemlöungsstrategien zu bieten. "Quality of Life" im Verständnis als universeller Grundsatz ("universal principle") mit dem Ziel der Verbesserung der individuellen Lebensqualität ("to enhance one's quality of life") konnte hingegen nicht nur die neuen Paradigmen auffangen, sondern auch konkretisieren. (vgl. Schalock 2000: 117)
Lebensqualität trug zur Sensibilisierung bei, weil es geeignet ist, allgemeinverständliche und verbindende Begrifflichkeit einzuführen und ein gemeinsames Ziel zu stecken ("common language" und "common goal"). (vgl. Schalock 2000: 118) Zudem passte das Lebensqualität-Konzept zur wachsenden Bedeutung von Evaluation und zum steigenden Bedarf nach Rechenschaft über die Wirksamkeit von Hilfen und rehabilitativer Programme. Lebensqualität drückte in diesem Kontext sowohl den "messbaren" Grad der Zielerreichung als auch die angestrebte "Zielperspektive" aus. (vgl. Dworschak et al. 2001: 368)
Im Laufe der 1980er Jahre eignete sich die Lebensqualitätsforschung ein noch nicht genau bestimmtes Konzept an, so existierten an die 100 unterschiedliche Definitionen von "Lebensqualität". Die 1990er Jahre waren also vom unzureichendem Verständnis von Lebensqualität geprägt, das einen Prozess der weiteren Konzeptualisierung und Versuch der Klärung methodologischer Fragestellungen in Gang setzte. (vgl. Schalock 2000: 119) Allmählich gingen 11 Grundprinzipien konsensual für die Konzeptualisierung und die Anwendung des "Quality of Life"-Konzepts als Essenz aus der Diskussion in der Disziplin hervor:
-
Lebensqualität setzt sich aus denselben Faktoren und Beziehungen zusammen, die für nichtbehinderte Menschen bedeutsam sind.
-
Lebensqualität ist dann erreicht, wenn die Grundbedürfnisse einer Person befriedigt sind und diese die gleichen Chancen hat, ihre Lebensziele in der Gemeinschaft, im Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnumfeld zu erreichen.
-
Die bestimmenden Faktoren variieren gemäß unterschiedlichen Lebensphasen einer Person.
-
Lebensqualität muss vor dem kulturellen und ethnischen Hintergrund eines Individuums betrachtet werden.
-
Lebensqualität ist in Werten grundgelegt, die den NutzerInnen- und Familienaspekt betonen.
-
Lebensqualität ist abhängig von der Zielgerichtetheit von Public Policy ("congruence of public policy and behavior"). (Schalock 2000: 126)
-
Das Konstrukt Lebensqualität ist von großer Validität gekennzeichnet, die verschiedene Perspektiven einschließen kann (z.B. NutzerInnen und deren Angehörige, Professionisten, Träger).
-
Untersuchungen über Lebensqualität erfordern voraussetzend eine intensive Kenntnis über die Betroffenen und deren Sichtweisen.
-
Die Messung von Lebensqualität macht mehrere methodologische Zugänge und Methodenpluralismus notwendig.
-
Das Konzept Lebensqualität umfasst subjektive und objektive Komponenten. Die subjektive Sichtweise des Individuums ist jedoch in der Wahrnmehmung von Lebensqualität vorherrschend.
-
Die Variablen sollen in der Maßnahmen-Evaluation konsistent angewandt werden. (vgl. Schalock 2000: 126/ Schalock 2002: 19f)
In der internationalen LQ-Forschung sind mittlerweile folgende acht Kerndimensionen, die Schalock im Rahmen einer vergleichenden Analyse der Quality of Life-Literatur identifiziert hat, als zentral anerkannt. (vgl. Seifert 2007: 206) Sie stützen sich auf die Forschung von Cummins (1996, 1997), Felce (1997), Felce und Perry (1996, 1997), Hughes und Hwang (1996) und sind zu einem großen Maß generalisierbar. (vgl. Schalock 2000: 119)
Abb. 2: Lebensqualität-Dimensionen nach verschiedenen Autoren im anglo-amerikanischen Raum (vgl. Schalock 2000: 119)
|
Exemplary Quality of Life Domains |
|
|
Investigator |
Core Domains |
|
Flanigan (1982) |
|
|
World Health Organization (1997) |
|
|
Cummins (1996) |
|
|
Felce (1997) |
|
|
Schalock (1996, 2000) |
|
Die acht Kerndimensionen von Lebensqualität hat die internationaleLebensqualitätforschung als folgende bezeichnet:
-
Körperliches Wohlbefinden ("Physical well-being")
-
Emotionales Wohlbefinden ("Emotional well-being")
-
Soziale Beziehungen ("Interpersonal Relationships")
-
Soziale Inklusion ("Social inclusion")
-
Persönliche Entwicklung ("Personal development")
-
Materielle Teilhabe ("Material well-being")
-
Selbstbestimmung ("Self-determination")
-
Persönlichkeitsrechte und Bürgerrechte ("Rights") (vgl. Schalock 1996: 126f)
Abb. 3: Inhalte der acht Lebensqualität-Dimensionen (vgl. Schalock 1996: 126f)
|
Core Quality of Life Dimensions and Indicators |
|
|
Dimension |
Exemplary Indicators |
|
1. Emotional Well-Being |
|
|
2. Interpersonal Relations |
|
|
3. Material Well-Being |
|
|
4. Personal Development |
|
|
5. Physical Well-Being |
|
|
6. Self-Determination |
|
|
7. Social Inclusion |
|
|
8. Rights |
|
In der obigen Tabelle sind Beispielindikatoren für die jeweilige Dimension aufgelistet.
Die Dimensionen werden mithilfe von Indikatoren näher inhaltlich bestimmt. Sie bieten auch die Möglichkeit, diese individuell, je nach Priorität, mit Inhalten zusammenzusetzen. Die Indikatoren können entweder hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmungen (als subjektives Maß) oder in Bezug auf eine funktionale Bewertung (als objektives Maß) abgefragt werden. (vgl. Schalock 2000: 121) Es ergibt sich natürlich aus den Inhalten, dass gewisse Dimensionen sich eher für die subjektive ( z.B. emotionales Wohlbefinden, soziale Beziehungen) und andere (z.B. materielle Teilhabe, Rechte) sich besser für die objektive Forschungsperspektive eignen. Dem wirkt das multivariate Forschungsdesign entgegen, bei dem verschiedenste Messperspektiven zum Einsatz kommen. (vgl. Schalock 2000: 122)
Schalock und Verdugo fanden in quantitativen Analysen der Lebensqualität-Literatur (879 Artikel und Buchkapitel, erschienen zwischen 1985 und 1999) heraus, dass hinsichtlich der Dimensionen eine Rangfolge besteht, die der obigen Aufzählung entspricht. (vgl. Schalock et al. 2002: 182) Analysiert man die Korrelationen mit bestimmten Themenschwerpunkten wie beispielsweise Bildung und Sondererziehung, Gesundheit im psychischen und Verhaltensbereich oder Altern, so weist diese Rangfolge Abweichungen auf, die aber leicht erkennbare Ähnlichkeiten aufweisen. So würden sich die Dimensionen, in Bezug auf Geistige Behinderung betrachtet, folgendermaßen reihen: An erster Stelle steht soziale Inklusion, gefolgt von den Dimensionen körperliches Wohlbefinden, soziale Beziehungen, materielle Teilhabe, emotionales Wohlbefinden, Selbstbestimmung und schließlich Rechte. (vgl. Schalock et al. 2002: 182f)
Schalock und Verdugo identifizierten in ihrer Literaturanalyse folgende Hauptindikatoren als häufigst verwendete Inhalte der Lebensqualität-Kerndimensionen (jedoch hier ohne Reihung):
Abb. 4: Indikatoren zur Operationalisierung der Lebensqualitätsdimensionen (Schalock et al. 2002: 184-187)
|
Physical well-being |
Emotional well-being |
Interpersonal Relationships |
Social inclusion |
|
Health: Physical functioning Disease symptoms Physical Discomfort/Pain Fitness Energy/vitality Nutritional status Medication Sensory skills |
Contentment: Satisfaction Moods Mental and/or physical functioning Pleasure, enjoyment |
Interactions: Social networks Social contacts Social life |
Community integration and participation: Access Presence Involvement Acceptance |
|
Activities of daily living: Eating Transfer Mobility Toileting Dressing |
Self-concept: Identity Self-worth Self-Esteem Body image |
Relationships: Family Friends Peers |
Community Roles: Contributor Lifestyle Interdependence |
|
Health Care: Availability Effectiveness Satisfaction |
Freedom from stress: Safe environment Stable and predictable environment Coping mechanisms/ stress management |
Supports: Emotional Physical Financial Feedback |
Social supports: Support network Services |
|
Leisure: Recreation Hobbies Opportunities Creativity |
|||
|
Personal development |
Material well-being |
Self-determination |
Rights |
|
Education: Activities Achievements Status Satisfaction |
Financial Status: Income Financial security Benefits |
Autonomy/ personal control: Independence Self-direction Self-sufficiency |
Human: Respect Dignity Equality |
|
Personal Competence: Cognitive Social Practical |
Employment: Occupational status Employment status (full time, part time) Work environment Advancement opportunities |
Goals and personal values: Hopes/ desires/ ambitions Expectations Beliefs Interests |
Legal: Citizenship Access Due process |
|
Performance: Success/ achievement Productivity Improvement/ personal development Creativity/ personal expression |
Housing: Type of residence Ownership Comfort |
Choices: Opportunities Options Preferences Priorities |
Die oben genannten Indikatoren beziehen sich allesamt auf die personenzentrierte Analyse auf Mikro-Ebene. (vgl. Schalock et al. 2002: 188) Schalock und Verdugo stellen heraus, dass im Zuge der Untersuchung außer "supports", das "social inclusion" und "interpersonal relationships zugeordnet" ist, kein Indikator in mehr als einer Dimension auftaucht. (vgl. Schalock et al. 2002: 184)
Die britischen Forscher David Felce und Jonathan Perry stützen sich bei ihrem Modell von Lebensqualität auf Annahmen von Sharon A. Borthwick-Duffy (1992). Es setzt sich zunächst zusammen aus der objektiven Einschätzung der Lebensbedingungen und ihrer subjektiven Einschätzung, der subjektiven Zufriedenheit. Der Komplex "Persönliche Werte und Ziele" zielt auf die Berücksichtigung subjektiver Prioritäten ab, also inwiefern welche relative Bedeutung einem gewissen Lebensbereich individuell zukommt. (vgl. Felce et al. 1996: 64) Fünf Dimensionen, die die subjektive Lebensqualität oder Zufriedenheit ('wellbeing') näher beschreiben, stehen miteinander in Wechselwirkungen. Monika Seifert, eine bedeutende Vertreterin der deutschen Lebensqualitätforschung, die sich in ihrer Forschungsarbeit in erster Linie auf herausfordernde Fragestellungen über die Bedürfnisse von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung im Wohnbereich konzentriert, hat diese fünf Dimensionen, teilweise in spezifischen Bezug auf Wohnqualität, konkretisiert (vgl. Seifert 1998: 158):
-
Physisches Wohlbefinden steht in Verbindung mit dem Gesundheitszustand, mit Körperpflege, Ernährung, Ausgewogenheit von Entspannung und Bewegung, persönlicher Sicherheit bzw. Schutz vor Verletzungen sowie nicht zuletzt mit einer individuelle Form des Pflegeprozesses eingebettet in einem angemessenen Tagesablauf[8] (vgl. Seifert 2003: 6, 2004: 5)
-
Soziales Wohlbefinden[9]beinhaltet u.a. die Anzahl und Qualität der sozialen
Beziehungen zu BegleiterInnen, Freunden, MitbewohnerInnen, Angehörigen, KollegInnen, Nachbarn, die soziale Integration in der Bezugsgruppe, in der Einrichtung und in der Öffentlichkeit. Zentral ist auch die Akzeptanz und Wertschätzung des Umfelds für Menschen mit Behinderung. (vgl. Seifert 2003: 6) Wichtige Faktoren für das soziale Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung sind "Kommunikation, Interaktion und Dialog". (Seifert 2004: 6)
-
Materielles Wohlbefinden[10]meint die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung durch materielle Güter. In Bezug auf den Wohnbereich ist dies die Einrichtung und Ausstattung der Wohnung, wichtiger persönlicher Besitz, die Infrastruktur in der Wohnumgebung sowie nicht zuletzt Transportmittel als Voraussetzung der Partizipation am öffentlichen Leben. (vgl. Seifert 2003: 6)
-
Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden[11]umfasst Aktivitäten, die sich auf "Wohnen, Arbeit, Freizeit Bildung und Therapie" beziehen und Fähigkeiten fördern zur eigenständigen Lebensführung und zur Kontrolle über das eigene Leben. Im Mittelpunkt stehen also Einflussfaktoren wie Eigenantrieb, Mitwirkung an Entscheidungen, Autonomie und Selbstbestimmung. (vgl. Seifert 2004: 6)
-
Emotionales Wohlbefinden[12]drückt sich vor allem aus durch Gefühle von "Zugehörigkeit, Sicherheit, Geborgenheit" sowie intakter psychischer Gesundheit. Weitere zentrale Faktoren sind Selbstachtung und Respekt seitens anderer sowie Sexualität. (Seifert 2004: 6)
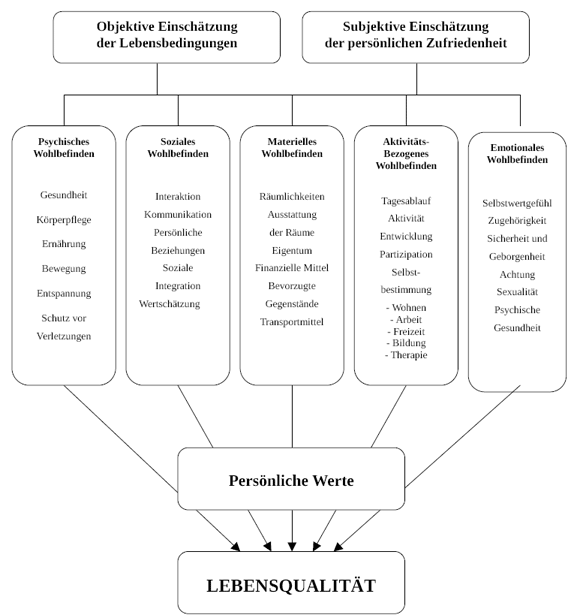
Abb. 5: Das Lebensqualität-Modell von Felce/Perry (1997) (nach Seifert 2004: 5)
Seiferts Perspektive von Lebensqualität hat als theoretischen Ansatzpunkt die Interaktion des Einzelnen mit seiner Umwelt, angelehnt an den sogenannten ökologischen Ansatz nach Bonfenbrenner. Die Entwicklung des Menschen mit Behinderung vollzieht sich demzufolge stets im Rahmen von Austausch(beziehungen) mit der Umwelt. (vgl. Seifert 2001 et al.: 86): "Lebensqualität ist abhängig vom Grad der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse durch die ökologischen Gegebenheiten." (Seifert 1998: 158) So ist die Bedürfnisbefriedigung als Voraussetzung von Lebensqualität vor allem angewiesen auf "Wechselwirkungen zwischen einem Individuum und den personellen und materiellen Bedingungen seiner näheren und weiteren Umgebung." (Seifert 1998: 221 zit. n. Dworschak 2004: 44) Daher ist bei Seifert die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung auf direkte Weise abhängig von der Qualität der materiellen und personellen Unterstützung, die ihnen zur Verfügung stehen. (vgl. Dworschak 2004: 44) Seifert bringt das ökologische Modell zur Konkretisierung, indem sie für Menschen mit hohem Hilfebedarf in Wohneinrichtungen Einflussfaktoren der "Systeme Wohngruppe, Institution, Gemeinde und Gesellschaft" untersucht. (Seifert et al. 2001: 87)
Seifert entwickelte ihre Konzeption in Anlehnung an die Lebensqualität-Komponenten nach Felce und Perry. Als objektive Komponente verwendet sie objektiv beobachtbare "Standards der Behindertenhilfe, die sich an den Leitideen Normalisierung, soziale Integration, Partizipation, Selbstbestimmung und Empowerment orientieren" (Seifert et al. 2001: 111). Erweitert um die Dimension "Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen" identifiziert Seifert in ihrem Modell folgende sechs Dimensionen, die für die Lebensqualität von Menschen in Wohneinrichtungen zentral sind:
Abb. 6: Das Lebensqualitätsmodell von Seifert: Dimensionen und Indikatoren (vgl. Seifert 1998: 159)
|
Lebensqualität individuelle Bedürfnisse / ökologische Bedingungen |
|
Dimension 1: Interaktion im Wohnbereich Indikatoren
|
|
Dimension 2: Materielle Struktur des Wohnbereichs und des Umfelds Indikatoren
|
|
Dimension 3: Soziales Netzwerk Indikatoren
|
|
Dimension 4: Teilnahme am Allgemeinen Leben Indikatoren
|
|
Dimension 5: Akzeptanz durch die Bevölkerung Indikatoren
|
|
Dimension 6: Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter Indikatoren
|
Seifert hebt die Dimension Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen als entscheidenden, übergeordneten Bestimmungsfaktor für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in stationären Wohnformen hervor (vgl. Seifert et al. 2001: 111f): "Von der Arbeitssituation der Mitarbeiter hängt es letztlich ab, ob Lebensqualität für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in einer Einrichtung realisiert werden kann." (Seifert 1998: 162) Das schließt laut Seifert nicht nur die Arbeitsbedingungen, fachliche Qualifikation, Betreuungsschlüssel, sondern auch die Erarbeitung und konsequente Anwendung pädagogischer Konzepte mit ein. (vgl. Seifert et al. 2001: 111)
Nun soll eine kleine Auswahl bedeutender empirischer Studien aus dem deutschen Sprachraum, die Lebensqualität im Wohnbereich mittels unterschiedlicher Herangehensweisen erfassen wollen, vorgestellt werden.
Petra Gromann und Ulrich Niehoff-Dittmann setzten eine Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen in Nordhessen und Niedersachsen um (1999)[13], indem sie eine dem Wohnbereich entsprechende Version des Quality of Life- Fragebogens von Schalock et al. (1989) ins Deutsche übersetzten. (vgl. Dworschak 2004: 44) Die Studie ergab großteils hohe Zufriedenheitswerte, während Unzufriedenheit herrschte hinsichtlich "Wohnen im Doppelzimmer, geringer Kontakt zur Nachbarschaft, Wunsch nach einem Haustier, Mangel an Freunden außerhalb der Wohngruppe, Mangel an individuellen Freizeitaktivitäten, morgendliche Weckzeiten, Streit mit Mitbewohnern." (ebd.)
Monika Seifert hat mehrere Studien zur Lebensqualität im Wohnbereich mit Schwerpunkt auf schwere geistige Behinderung durchgeführt. Bei einer Untersuchung in Berlin in den Jahren 1991/92 erhob sie die Wohnsituation von 185 Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen. (vgl. Seifert 2002: 40f) Die Autorin setzte dabei die qualitative Methode des problemzentrierten Interviews mit einem teilstrukturierten Interviewleitfaden im Rahmen einer stellvertretenden Befragung ein und führte zusätzlich Experteninterviews, qualitative Beobachtungen und quantitative Untersuchungen durch (vgl. Seifert 2002: 26f, 30, 33-35).In einer anderen Studie (1999) führte Seifert Einzelfallstudien mit 22 Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung durch. Damit waren 21 verschiedene Wohngruppen abgedeckt, wobei 18 der TeilnehmerInnen in Wohneinrichtungen der Kölner Behindertenhilfe wohnen und vier in Pflegeheimen untergebracht sind. (vgl. Seifert 2003: 8f) Ergänzend wurden mit einem Fragebogen Strukturdaten erhoben, eine Dokumentenanalyse und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Ebenfalls untersuchte Seifert die Lebensqualität hinsichtlich der Wohnsituation der KlientInnen anhand von problemzentrierten Interviews sowie informellen Gesprächen mit MitarbeiterInnen in Stellvertretung der BewohnerInnen. (vgl. Seifert et al. 2001: 119-127)
Wolfgang Dworschak hat eine Erhebung von Wohnqualität mittels quantitativer Befragung von 143 Erwachsenen mit geistiger Behinderung und 41 MitarbeiterInnen sowie qualitativer Netzwerkanalyse unternommen, die den Charakter einer explorativen Pilotstudie bzw. Methodenstudie hatte.
Theoretischer Ausgangspunkt der Untersuchung ist der Kontext des "Supported-Living"[14] Gedankens im Zusammenhang der Gestaltung von Wohnformen und Deinstitutionalisierung, wonach Menschen mit geistiger Behinderung Hilfe durch die Erhaltung und Erweiterung ihres intakten sozialen Netzwerks professionelle und andere Formen der sozialen Unterstützung erhalten. Die Idee des "sozialen Netzwerks" stammt von John Barnes und Elizabeth Bott und hat die Erfassung von sozialen Beziehungen zwischen Personen und/oder Gruppen zum Ziel[15]. (vgl. Dworschak 2004: 62) "Soziale Unterstützung" ist ein daran anschließendes Konzept, das sich auf die Funktionen von sozialen Beziehungen konzentriert. (vgl. Dworschak 2004: 63) Schiller z.B. definiert diese als "Grad der sozialen Bedürfnisbefriedigung eines Individuums durch signifikant andere Mitglieder seines sozialen Netzwerks". (Schiller 1987: 103 zit. n. Dworschak 2004: 64) Einer gebräuchlichen Auffassung zufolge (Walker et al.) ist soziale Unterstützung durch die Dimensionen "affektive Unterstützung, instrumentelle Unterstützung, kognitive Unterstützung, Aufrechterhaltung sozialer Identität sowie Vermittlung sozialer Kontakte" gekennzeichnet. (Keupp 1994: 701 zit. n. Dworschak 2004: 64) Da es kaum Daten über Netzwerke von behinderten Menschen im stationären Wohnbereich gab, fertigte Dworschak anhand der durchgeführten Netzwerkanalyse Netzwerkkarten (Straus 1994, 2002, Bullinger/ Nowak 1998) zur Visualisierung an. Damit versuchte er, einen konkreten praktischen Nutzen zur Förderung der inidividuellen Netzwerke zu verbinden. (vgl. Dworschak 2004: 74)
[2] Maslow identifizierte (1943/1977) mit dem "Erklärungs- und Wissensbedürfnis" sowie den "ästhetischen Bedürfnissen" noch eine sechste und siebte Bedürfnisstufe, die sich jedoch als schwer in das Schema der Bedürfnishierarchie einordenbar erwiesen. (vgl. Möller 1983: 589)
[3] vgl. Maslows "Synergiethese"; "Instinktoide Bedürfnisse und Vernunft [sind] wahrscheinlich synergisch und nicht antagonistisch" (Maslow 1977: 138).
[4] Unter "Kommissariat" ("commissariat") versteht Malinowski die Gesamtheit an Normen, Kulturtechniken und Werkzeugen, die zum Zweck der Produktion und Verteilung von Nahrung in einem Gemeinwesen zum Einsatz kommt. (vgl. Malinowski 1969: 96-98)
[5] Heller interpretiert als Bedeutungserweiterung der Marxschen natürlichen Bedürfnisse diese als "existenzielle Grenze der Bedürfnisbefriedigung" (Heller 1976: 34) im Sinne einer Grenze der Reproduzierbarkeit des Menschen, die je nach Entwicklungsstand einer Gesellschaft unterschiedlich zu ziehen ist. (vgl. ebd.)
[6] Dem liegt die zentrale Marxsche Kategorie Gebrauchswerts zu Grunde: "Der Gebrauchswert drückt die Naturbezeichnung zwischen Dingen und Menschen aus, in fact das Dasein der Dinge für den Menschen. Der Tauschwert . . . ist das gesellschaftliche Dasein der Dinge." (MEW 26.3: 291 zit. n. Heller 1976: 36)
[7] Die OECD hält zwar immer noch an der objektiven Messbarkeit von Lebensqualität fest, es gibt jedoch Anstrengungen, zumindest die sozialen und ökologischen Folgen als externe Kosten des Wirtschaftswachstums ernsthaft in Berechnungen der Wirtschaftsleistung von Staaten einzubeziehen. So ist die OECD an der 2007 gestarteten Initiative "Beyond GDP" in Kooperation mit Kommission und Parlament der EU, WWF und dem Club of Rome beteiligt. (vgl. Weber 2008) Dies ist ein Ausdruck der Relativität angeblich objektiver, aussagekräftiger Messbarkeit.
[8] Originial-Terminologie bei Felce/Perry ist folgende (Seifert 2001: 95): "Physical well-being: Health, fitness, mobility, personal safety"
[9] "Social well-being: personal relationsship (Family/household, relatives, friends/social Life), community involvement, (Activities/Events, Acceptance/Support)"
[10] "Material well-being: Finance/Income, housing quality (privacy, possessions, meals/food, neighbourhood), security, tenure, transport"
[11] "Productive well-being: Competence, Independence, Choice/Control, Productivity/Contribution (Job, Homelife/Housework, Leisure/Hobbies, Education)"
[12] "Emotional well-being: Positive effect, status/respect, mental health/stress, sexuality, fulfilment, faith/belief, self-esteem"
[13] Vgl. Gromann, Petra/ Niehoff-Dittmann, Ulrich 1999: Selbstbestimmung und Qualitätssicherung: Erfahrungen mit der Bewertung von Einrichtungen durch ihre Bewohner, in: Geistige Behinderung. 38, 2. S. 156-164
[14] Smull (1994) zufolge bedeutet "Supported Living" ein prozesshaftes Konzept, wonach die Menschen mit Behinderung Wahlmöglichkeiten haben, selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie leben und wie ihre Lebensgestaltung aussehen soll. Die Hilfen sollen sich stets an den Vorstellungen der KlientInnen orientieren und so angelegt sein, dass sie flexibel auf Veränderungen reagieren können. (vgl. Karan et al. 1997: 83)
[15] "Der professionelle Helfer wird primär als Netzwerker verstanden, der gemeinsam mit einem Unterstützerkreis, der vorwiegend aus Personen des informellen Netzwerkes besteht, die Planung und Bereitstellung von Unterstützung für die Menschen mit geistiger Behinderung übernimmt." (Lindmeier 2001: 46 zit. n. Dworschak 2004: 181) Die Aktivierung von informellen Ressourcen gemäß "Supported Living" und dem "sozialen Netzwerk"-Konstrukt birgt natürlich auch die Gefahr des Rückzugs staatlicher Verantwortung vor dem Hintergrund sinkender Finanzmittel für den Sozialbereich.
Inhaltsverzeichnis
Schalock nahm den Stellenwert des Konzepts Lebensqualität vor dessen fachlicher Durchsetzung vorweg: "Quality of life has recently become an important issue in human services and may replace deinstitutionalization, normalization, and community adjustment as the issue of the 1990s." (Schalock 1989: 25 zit. n. Beck 1998: 348) Tatsächlich entfaltet das Quality of Life-Konzept seine Wirksamkeit in verschiedener Hinsicht: Neben der wissenschaftlichen Bedeutung als soziales Konstrukt hat es als Bewertungsmaßstab Auswirkungen auf die Planung sozialer Maßnahmenprogramme und die Effektivität ihrer Umsetzung in den Bereichen Bildung und Erziehung, Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung und Förderung psychischer Gesundheit. (vgl. Schalock 2000: 116f) Der Praxisbezug ergibt sich also aus seiner Eigenschaft als Beurteilungskriterium und Orientierung für Policies, deren Umsetzung die Voraussetzungen für Qualitätsfortschritte in den unmittelbaren Lebensrealitäten sowie auf der personalen Ebene von Menschen mit Behinderung schaffen sollen. (vgl. Schalock et al. 2002: 28)
Der forschungsleitende Begriff Quality of Life ist also ein soziales Konstrukt, dessen Komponenten sowohl auf der persönlichen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene wirken - damit korrespondieren die subjektiven und objektiven Dimensionen des Modells. Der Autor versteht Quality of Life als übergeordnetes Prinzip gesellschaftlichen Fortschritts: "an overarching principle that is applicable to the betterment of society as a whole". (Schalock 1996: 123)
Schalock und Verdugo legen in einer Zusammenschau ihrer Forschungsergebnisse einig wesentliche Anwendungsprinzipien des Quality of Life-Konzepts folgendermaßen dar:
-
es soll Zufriedenheit und Wohlbefinden des Einzelnen erhöhen;
-
seine Anwendung soll den kulturellen und ethnischen Hintergrund der jeweiligen Person berücksichtigen;
-
ein Wirkungszusammenhang ist herzustellen, sodass mittels Kooperation von Individuen, Trägern, Gemeinwesen/Gemeinde und staatlicher Ebene gesellschaftliche Veränderungen durchgesetzt werden können;
-
Erweiterung der Kontrolle über das eigene Leben und der individuellen Möglichkeiten in Bezug auf Aktivitäten und Umfeld von Menschen mit Behinderung;
-
Funktion des Zusammentragens wissenschaftlicher Belege, insbesondere jene, die zur Identifikation von Bestimmungsfaktoren der Lebensqualität und der eingesetzten Planungsressourcen beitragen, um möglichst positive Effekte herbeizuführen; (vgl. Schalock et al. 2002: 349)
In konkreter Hinsicht können Schalocks Kerndimensionen und Indikatoren auf sämtlichen soziologischen Ebenen angewandt werden - bleiben aber selbst unverändert, wie im Folgenden ausgeführt ist (vgl. Schalock et al. 2002: 25):
-
Mikro-Ebene:
Die der Mikroebene zugerechneten sozialen Systeme wie Familie, Wohnhaus, Peer Group, Schule und Arbeitsplatz wirken direkt auf die Person als Subjekt ein.
→ Dies ist operationalisiert durch Selbsteinschätzung und subjektive Zufriedenheit
der jeweiligen Person. (vgl. Schalock et al. 2002: 27)
-
Meso-Ebene:
Auf der Meso-Ebene wird die Lebensqualität mitbestimmt durch Angehörige der Nachbarschaft, die Gemeinde, soziale Dienstleister sowie andere Organisationen, die das Mikrosystem direkt beeinflussen.
→ Ein Indikator hierfür ist der Grad der funktionalen Anpassung, beispielsweise in Form von Interaktion als ein objektiver Aspekt von Lebensqualität. (vgl. Schalock et al. 2002: 27f)
-
Makro-Ebene:
Kultur, Sozialpolitik, Wirtschaftssystem, gesellschaftlich geprägte Werte, Kommunikation, Konzepte stellen auf der gesellschaftlichen Makro-Ebene jene wichtigen strukturierenden Rahmenbedingungen her, die Inklusion und somit Lebensqualität von Menschen mit Behinderung fördern bzw. hemmen. (vgl. ebd.)
→ Sozialindikatoren versuchen Lebensbedingungen wie Lebensstandard, Soziale Sicherheit und Bildung zu messen sowie externe Faktoren und Umweltbedingungen zu beschreiben. (vgl. Schalock et al. 2002: 28)

Viele Akteure der Quality of Life-Forschung haben sich eine Praxis-Perspektive zu eigen gemacht. Diese Betrachtungsweise baut auf den Ideen Selbstbestimmung, Empowerment und Inklusion auf und fordert von Dienstleistungsanbietern ihr Angebot auf eine Steigerung der Lebensqualität hin auszurichten: "The current paradigm shift in mental retardation and closely related disabilities with its emphasis on self-determination, inclusion, equity, empowerment, community-based supports and quality outcome has forced service providers to focus on enhanced quality of life for persons with disabilities". (Schalock 1996: 123) In diesem funktionalen Zusammenhang ist das Konstrukt Lebensqualität auf mehreren Ebenen sozialer Dienstleistungserbringung und für unterschiedliche Zielgruppen relevant:
-
für Betroffene, die ein qualitätsvolles Leben anstreben
-
für Dienstleister, die qualitativ hochwertige Angebote bereitstellen möchten
-
für EvaluatorInnen, die überprüfbaren Qualitätsfortschritt fordern - die entsprechenden Akteure sind z.B. politische Auftraggeber, Kostenträger gemeinnütziger Dienste, NutzerInnen (vgl. Schalock 2000: 117)
Soziale Dienstleistungen sind in diesem Sinne ein Schlüssel für die Verbesserung der Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderung und sollen also eine Steigerung ihrer Lebensqualität auf eine von den Betroffenen selbstbestimmte Weise in einem umfassenden Verständnis erwirken. Aufgrund des hohen Abhängigkeitsgrades behinderter Menschen von anderen und der noch nicht in angemessenen Ausmaß entwickelten Selbstvertretungsmöglichkeiten ist die Bereitstellung von entsprechender Assistenz entscheidende Grundlage für ihre Selbstbestimmung. (vgl. Beck 1998: 348) Qualitätsvolle Unterstützung setzt eine Normalisierung der Hilfen Menschen mit Behinderung voraus und entsprechende Konzepte, die sich abwenden "vom Denken, Planen, Handeln, das an Institutionen ausgerichtet ist [...] hin zu einem Denken, Planen, Handeln, das funktionsbezogen an den alltagsspezifischen Lebensvollzügen ansetzt" (Thimm 1991: 8 zit. n. Beck 1998: 356) Neben der Forcierung von Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung nennt Iris Beck folgende bedeutende Entwicklungen, die auf "implizte oder explizite" Weise die Zielperspektive Lebensqualität von Menschen mit Behinderung verfolgen und auf Normalisierung aufbauen (vgl. Beck 1998: 356):
-
"eine mehrdimensionale, an den sozialen Folgen ansetzende Betrachtung von Behinderung,
-
ein entwicklungsorientiertes Bild vom behinderten Menschen,
-
damit einhergehend die wachsende Bedeutung interaktionistischer bzw. systemischer Sichtweisen, z.B. [...] Soziale Netzwerke/ Soziale Unterstützung als Forschungs- und Interventionsperspektive,
-
die zunehmende Thematisierung von Zielen, Normen, Werten in der sozialen Arbeit, [...]
-
Orientierung an den Bedürfnissen der Adressatinnen und Adressaten von Dienstleistungsangeboten,
-
der Wandel in der Organisation der Angebote von stationären und institutionsbezogenen zu gemeindenahen, bedarfsbezogenen ambulanten und komplementären Angeboten." (Beck 1998: 356)
In diesem Kontext gibt das Konzept Lebensqualität seit den 1980er Jahren ausgehend vom anglo-amerikanischen Raum Anstoß für Reformen und etablierte sich als "Orientierungsrahmen für die Planung und Evaluation der Hilfen". (Seifert 2007: 205) Wie man sich einer Erfassung der Qualität sozialer Dienstleistungen annähern kann, behandelt nun der folgende Abschnitt.
Bernhard Badura und Peter Gross konstatierten bereits 1976 die Vielfältigkeit der Begriffsauffassungen hinsichtlich sozialer Dienstleistungen und stellten die sozialpolitische Relevanz als bedeutendes Definitionskriterium sozialer Dienstleistungen heraus. Noch immer bietet die Soziologie keine verbindliche Definition dazu an. (vgl. Heinze 2011: 169) Grunow schlägt beispielsweise eine breitangelegte Definition sozialer Dienstleistungen vor:
"Soziale Dienstleistungen beschreiben eine basale gesellschaftliche Form von Hilfeleistung 'von Mensch zu Mensch', die sich auf akute Notlagen und Konflikte sowie auf die Maßstäbe und Mittel für eine zufrieden stellende Lebensführung beziehen. Der Modus der Hilfeleistung ist dadurch gekennzeichnet, dass die immateriellen Probleme im Mittelpunkt stehen und die besonderen Lebensumstände des einzelnen Menschen bei der Gestaltung von Inhalt und Form der Unterstützungsleistungen einbezogen werden." (Grunow 2011: 233)
Bei allen gegebenen Konzeptionsunterschieden ist laut Heinze ihre "Haushalts- bzw. Personenorientierung" in der Literatur jedoch allgemein anerkannt. (Heinze 2011: 169) Dem Autor zufolge sind folgende Bereiche der Kategorie soziale Dienstleistungen zuzuordnen:
• "Gesundheitsdienstleistungen,
• (Körper-)Pflegedienstleistungen,
• Erziehung und Bildung,
• Beratung und Betreuung,
• Freizeitdienstleistungen (Kultur und Sport) und
• Sicherheitsdienstleistungen (Hausnotrufsysteme)"
(ebd.)
Soziale Dienstleistungen weisen eine Reihe besonderer Merkmale auf, die sie von anderen Dienstleistungen abgrenzen lassen. Einen wesentlichen Unterschied beschreibt das "Unoactu- Prinzip", wonach der "Akt der Produktion mit dem Akt der Konsumtion zusammenfällt." (Hartmann 2011: 76) Aufgrund dieses Zusammenhangs kann diese nicht gelagert werden, ist situativ geprägt und entzieht sich somit der Standardisierung und Rationalisierung. (vgl. Grunow 2011: 233) Der ausgeprägte Interaktionscharakter der sozialen Dienstleistung bringt mit sich, dass diese von den NutzerInnen mitproduziert wird und man deshalb auf deren kooperative Mitwirkung angewiesen ist. Dies ist mit dem aus der Medizinsoziologie stammenden Begriff "compliance" ausgedrückt. (vgl. Hartmann 2011: 86) So betont Adalbert Evers, dass die Qualität sozialer Dienstleistungen in entscheidendem Maß von diesem Interaktionsprozess abhängt, der die Abgrenzung zwischen Produzenten und Konsumenten ("pro-sumers", "co-producers") der sozialen Dienstleistung verwischen lässt. (vgl. Evers 1997: 14) Doch Soziale Arbeit ist gerade damit konfrontiert, dass sich KlientInnen häufig nicht bereitwillig helfen lassen - dies ist nicht zuletzt auf die beinhaltete Machtasymmetrie zugunsten der ProfessionistInnen zurückzuführen. (vgl. Hartmann 2011: 86) Generell muss man in Abgrenzung zu anderen kommerziellen Dienstleistungen herausstellen, dass "[...] sich Qualität [sozialer Dienstleistungen; Anm. d. Verf.] im Zusammenspiel unterschiedlicher Interessen und somit in engem Zusammenhang mit der Aktivierbarkeit von Machtpotentialen konstituiert". (Karpf 2004: 21)
Die Wirkungen sozialer Dienstleistungen zielen auf die Lebensqualität der KlientInnen ab, werden aber meist erst mit einiger zeitlicher Verzögerung für die Betroffenen erkennbar. Deshalb werden diese auch als "Erfahrungs"- bzw. "Vertrauensgüter" bezeichnet. (vgl. Grunow 2011: 233f)
Rolf G. Heinze fasst die Merkmale, die soziale Dienstleistungen im Wesentlichen
kennzeichnen, folgendermaßen zusammen:
-
"Personenbezug und begrenzte Rationalisierbarkeit,
-
Uno-actu-Prinzip,
-
Ko-Produktion,
-
eingeschränkte Kundensouveränität,
-
Informationsasymmetrien zwischen Adressaten und Anbietern sozialer Dienste,
-
Unbestimmtheit der Nachfrage und
-
Soziale Dienste als Erfahrungs- und Vertrauensgüter" (Heinze 2011: 170)
Wichtig festzuhalten ist, dass soziale, personenbezogene Dienstleistungen als Aufgabe im öffentlichen Interesse im Gefüge wohlfahrtsstaatlicher nationaler und supranationaler Gesetze und herrschender sozialer Normen (z.B. Geschlechter- und Familienmodell, Normalarbeitszeit-Modell) sowie im Spannungsfeld divergierender staatlicher und Organisationsinteressen erbracht werden. (vgl. Kessl 2011: 390f) Trotzdem ist es in der Literatur hingegen umstritten, ob der Charakter der sozialen Dienste als ein öffentliches Gut (vergleichbar mit dem Recht auf Bildung) nun ebenfalls eine spezifische Eigenschaft ist. (vgl. Grunow 2011: 234)
Um die Qualität sozialer Dienste angemessen erfassen zu können, stellten die Autoren des Messinstruments LEWO II für Angebotsqualität im Wohnbereich folgende Überlegungen zu zentralen Besonderheiten sozialer Dienstleistungen an:
-
Soziale Dienstleistungen richten sich an mehrere Zielgruppen, wie NutzerInnen,
-
Angehörige, Auftrag- und Kostenträger, die verschiedene Ansprüche an sie
-
herantragen.
-
Die Ziele der Dienstleistungserbringung sind keine fixen Größen, sondern unterliegen häufig eigens getroffenen Vereinbarungen.
-
Da es sich zu einem großen Teil um affektive Arbeit handelt, sind die Ergebnisse der Arbeitsleistung maßgeblich von der Güte sozialer Beziehungen bestimmt und von "immateriellem" Wert.
-
Die Arbeitsprozesse sind von Komplexität geprägt und ihre Standardisierung nur eingeschränkt möglich und sinnvoll. Im Gegenteil wäre den Autoren zufolge im Falle von personenbezogenen Dienstleistungen ein Qualitätsverlust zu erwarten.
-
Struktur- und Prozessqualität sind keine Garanten für eine anvisierte Ergebnisqualität
-
"die Arbeit zielt weniger auf messbare Ergebnisse als auf komplexe Wirkungen, die sich allenfalls ausschnitthaft beschreiben lassen;" (Schwarte et al. 2001: 42)
-
Die Effektivität der Arbeit entzieht sich einer Planung im Vorhinein und kann häufig erst nachträglich beurteilt werden. (vgl. Schwarte et al. 2001: 42)
Schwarte et al. ziehen aus diesen Gründen den Schluss, dass eine nachvollziehbare Darlegung nicht nur von "outputs" im Sinne von "Zielerreichungsgraden" sondern auch von "outcomes" im Sinne multifaktoriell zustande gekommener Ergebnisse, notwendig ist, will man der Komplexität von Wirkungen von Unterstützung und Hilfen ernsthaft Rechnung tragen. (vgl. Schwarte et al. 2001: 43)
Der Pädagoge Otto Speck fasst den Begriff Qualität in Bezug auf den Sozialbereich folgendermaßen:
"'Qualität' lässt sich als die wertmäßige Beschaffenheit eines Gegenstandes oder einer Leistung im Sinne des beabsichtigten oder erwarteten Zwecks verstehen. Sie lässt sich nur bedingt messen; sie wird vielmehr - vor allem in Bezug auf Leistungen und auf soziale Qualitäten - eingeschätzt, also bewertet, wobei subjektive Normen und Maßstäbe eine wesentliche Rolle spielen." (Speck 1999: 127f; kursiv im Orig.)
Qualität ist also ein äußerst komplexes und zugleich relatives Konzept, für das es bei personenbezogenen Dienstleistungen keine absolute Erfüllung, sondern lediglich eine Annäherung geben kann. Qualität sozialer Dienstleistungen ist somit ein Konstrukt, das seinen Gehalt aus ethischen Normen und fachlichen Standards der sozialen Arbeit bezieht. (vgl. Karpf 2004: 20) Hinzu kommt, dass es natürlich ein im zeitlichen Verlauf nicht feststehendes, sondern ein in dynamischer Veränderung entlang gesellschaftlichem Wandel befindliches Konzept darstellt. (vgl. Karpf 2004: 20f)
Otto Speck schlägt das auf den Werten der individuellen Menschenwürde und Inklusion basierende Konzept "Sozialer Qualität" vor: "Soziale Qualität geht aus den Wechselwirkungen der Individuen oder sozialen Gruppen hervor, die darauf abzielen, das Zusammenleben und zugleich die eigene Lebensqualität zu verbessern." (Speck 1999: 129)
Soziale Qualität zielt zunächst auf eine menschliche Qualität (als Menschlichkeit) in den Dienstleistungsprozessen für das Individuum, jedoch schließt sie auch die Wirkungszusammenhänge zwischen diesem und dem Lebensumfeld mit ein. (Speck 1999: 130)
Die Differenzierung von Qualität in die drei Dimensionen "Strukturqualität", "Prozessqualität" und "Ergebnisqualität" ist in der Literatur ein gebräuchlicher Konsens.(vgl. Kannonier-Finster et al. 2005: 116)
Strukturqualität umfasst dabei
"sozial- und gesundheitspolitische, organisatorische und personelle Ressourcen, deren Verfügbarkeit den Rahmen dafür absteckt, in welcher Weise fachliche und sachliche Kompetenz überhaupt aktiviert werden kann." (Kannonier-Finster et al. 2005: 116)
Tobias Karpf zufolge konstituiert sich Strukturqualität im Wesentlichen aus Kriterien
-
"der Mitarbeiterstruktur und -qualifikation inklusive Maßnahmen der Personalentwicklung, Fortbildung und Supervision,
-
der Gebäude, der Ausstattung, des Standorts und des direkten örtlichen Umfeldes,
-
der Struktur und Problemlage der Zielgruppen, [...]
-
des Leistungsspektrums in Form von Gesamtkonzeption, Leistungsbeschreibungen, Angebotsstruktur und Methodendifferenzierung,
-
der Wirtschaftlichkeit, Finanzausstattung und Kosten,
-
der Aufbau- und Ablauforganisation, d.h. Der Konfiguration, internen und externen Vernetzung und Formalisierung, und
-
der Qualitätsentwicklung und -kontrolle als solche, z.B. in Form von Dokumentation." (Karpf 2004: 21)
Eine abschließend sinnvolle Einordnung von Kriterien zu den drei Qualitätsdimensionen ist kaum machbar, so würden laut Karpf andere AutorInnen (Jordan 2000: 265, Knab/Macsenaere 1998: 38) beispielsweise die beiden letzten Merkmale eher der Prozessqualität zuordnen. (vgl. Karpf 2004: 21f) Gute Strukturmerkmale sind unverzichtbare Ausgangsbedingungen für soziale Dienste, jedoch nicht mehr, denn Strukturqualität stellt "eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für Prozessqualität" dar. (Macsenaere 2002: 100f zit. n. Karpf 2004: 22) Diese wiederum ist aufgrund einer teilweise gegebenen Nichtbeeinflussbarkeit externer Faktoren nicht hinreichend für die Ergebnisqualität. (vgl. Karpf 2004: 23)
Prozessqualität umfasst in einem engeren Verständnis "[...] sämtliche Handlungen zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger [...]". (Karpf 2004: 22). Im weiteren Sinne schließt diese auch Handlungen zwischen MitarbeiterInnen und internen und externen Organisationseinheiten mit ein. (vgl. ebd.) Die Qualität der Interaktion mit den NutzerInnen drückt sich aus "[...] in Form von Kooperation, Kommunikation und Partizipation, der Konzeptumsetzung und Fachlichkeit, der Rahmenbedingungen [...], des Ablaufs der Leistungen sowie deren Transparenz". (Karpf 2004: 22) Für Kannonier-Finster und Ziegler, die ihre Definition aus dem Bereich der psychosozialen Versorgung ableiten, meint Prozessqualität ähnlich lautend in erster Linie "[...] die grundlegenden Leitbilder, die konkreten Leitlinien und Standards, die in der Begegnung und Interaktion [...]" von SozialarbeiterInnen und NutzerInnen angewendet werden. (Kannonier-Finster et al. 2005: 116f)
Prozessqualität kann durch zielgerichtete und konsequente Dokumentation und durch Verfahren, die von den MitarbeiterInnen gemeinsam erarbeitet sind (z.B. Abläufe in der Betreuung), optimiert werden. Es geht aber laut Kannonier-Finster und Ziegler nicht vorrangig um Erkenntnisse über Prozessqualität, die sich zur Verallgemeinerung oder zum Vergleich eignen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2005: 129) Dies würde zu sehr von der sozialen Wirklichkeit und dem Bedeutungsgehalt, den ProfessionistInnen und NutzerInnen Prozessen zuschreiben, abstrahieren. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2005: 124) Zentral ist vielmehr die selbstkritische Reflexion der MitarbeiterInnen auf das eigene professionelle Handeln, mit dem Ziel die Qualität des Angebots für die NutzerInnen zu verbessern (vgl. Kannonier-Finster et al. 2005: 129)
Tobias Karpf definiert Ergebnisqualität schließlich wie folgt: "Ergebnisqualität umfasst sämtliche Resultate, Erfolge und Wirkungen sowie Mißerfolge und Nebenwirkungen interner Abläufe und Aktivitäten." (Karpf 2004: 24) Damit ist auch die "Problem- und Situationsgerechtigkeit des Angebots" (ebd.) gemeint, denn in erster Linie geht es um die Zufriedenheit der NutzerInnen und deren Umfeld mit dem Angebot. Ergebnisqualität ist also der Wirkungszusammenhang von Struktur- und Prozessqualität und beschreibt "[...] in welchem Verhältnis Struktur- und Prozessfaktoren als zentrale Momente von psychosozialen Interventionen deren Ergebnis beeinflussen." (Kannonier-Finster et al. 2005: 117) Otto Speck weist zudem daraufhin, dass es kaum eine Messbarkeit der Ergebnisqualität geben kann - in eingeschränktem Maße kann dies für einzelne Bedingungen, die zur Leistung beitragen, zutreffen. Der Autor argumentiert weiters, dass selbst eine vergleichbare Leistung für verschiedene KlientInnen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf verschiedene Weise bewertet wird. (vgl. Speck 1999: 128)
Aufgrund ihrer spezifischen Erbringungskontexte geraten soziale Arbeit und soziale Dienste unter Legitimations- und Rationalisierungsdruck. Dies bringt mit sich, dass Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung häufig Hand in Hand mit Kostenkontrolle und Vermarktlichung gehen - werden doch zudem die Instrumente und Prinzipien teilweise direkt aus dem privatwirtschaftlichen Sektor übernommen. Diese wirtschaftliche Dynamik ist Hans Braun zufolge durchaus "politisch gewollt" und im folgenden gesellschaftlichen Kontext zu betrachten (vgl. Braun 1999: 140):
Soziale Dienstleistungen sind durch ihr markantes Wachstum bzw. aufgrund einer Ökonomisierung (durch Privatisierung, Durchsetzung von quasi marktwirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnissen im Sozialsektor) von zwei sozialen Phänomenen gekennzeichnet, die miteinander verknüpft sind und von der Soziologie unterschiedlich erklärt werden. Zunächst vollzieht sich ihr Wachstum vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, wie demografischem Wandel und dem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit, die von sozialen Dienstleistungen äußerst sensibel aufgenommen werden und personenbezogene Dienstleistungen zu einem Beschäftigungsmotor machen. Dies ist begleitet von einem wirtschaftlichen Strukturwandel des Sozialsektors, der einer Expansion der Dienstleistungen und Transformation in Richtung Profitorientierung folgt. (vgl. Hartmann 2011: 78) Anja Hartmann konstatiert diesbezüglich kritisch in einer Zukunftsperspektive hinsichtlich der Intensivierung von Marktmechanismen im Sozialbereich:
"Ökonomisierung allein wird kein adäquates Mittel sein, um Prekarisierung und Exklusion zu begegnen, die als bedrohliche Krisenerscheinungen der modernen Gesellschaft eingestuft werden müssen - im Gegenteil droht damit auch eine Verschärfung bestehender Verhältnisse." (Hartmann 2011: 90) Wohlfahrtsstaatliche Theorien stellen die Zunahme sozialer Dienste in diesem Sinne in den Kontext einer Ausdehnung sozialstaatlicher Maßnahmen und sehen ihre Ökonomisierung an der Idee des Aktivierenden Sozialstaats orientiert. (vgl. Hartmann 2011: 80) Ansätze der Individualisierungstheorie und der reflexiven Modernisierung begründen das Wachstum sozialer Dienstleistungen in der Vermehrung der Risiken der modernen Gesellschaft. (vgl. Hartmann 2011: 81) Für sie liegt der wesentliche Ausdruck ihrer Ökonomisierung "in der Förderung des Individuums als Unternehmerpersönlichkeit". (Hartmann 2011: 89) SoziologInnen aus der Tradition der Kritischen Theorie zufolge stellt die fortschreitende Ökonomisierung sozialer Dienste - funktional betrachtet - "Steuerungs- und Disziplinierungsinstrument" dar, das als Kontrollelement der systemischen Ebene auf die individuelle Lebenswelt zugreift. Dies vollzieht sich nicht nur durch einen "Durchgriff" auf die Individuen von "außen", sondern in zunehmenden Maße durch Prozesse der Selbststeuerung , -disziplinierung und Selbstoptimierung. (vgl. Hartmann 2011: 85f)
Dies stellt die zweite Seite des Positivbegriffs "Empowerment" dar: In der Logik des aktivierenden Sozialstaats sollen soziale Dienste die Forderung und (Re-)Aktivierung sowie soziale Integration des Einzelnen, z.B. zur (Re-)integration in den Arbeitsmarkt oder mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe, bewirken. (vgl. Kessl et al. 2011: 397)
Kessl und Otto halten fest, dass mittlerweile der Diskurs um Soziale Arbeit und sozialen Diensten den Fokus auf die Zielgruppe gelegt hat:
So "[...] erscheint es inzwischen selbstverständlich im Kontext einer organisations- und institutionstheoretischen Betrachtung Sozialer Arbeit von sozialen Dienstleistungsorganisationen und aus einer kunden-, adressaten- oder nutzertheoretischen Perspektive von Sozialer Arbeit als personenbezogener sozialer Dienstleistung zu sprechen [...]" (Kessl et al. 2011: 389)
Die Autoren wenden ein, dass die "prinzipielle Konsumentenorientierung als zentralem Modernisierungs- und Innovationsversprechen" nicht allein durch die Beteiligung der AdressatInnen an der Dienstleistungserbringung haltbar ist. (Kessl et al. 2011: 399) Ihrer Auffassung nach ist zum Einen eine Konzeptualisierung der "Akteursfigur" und deren Positionierung im Dienstleistungsprozess notwendig sowie muss zum Zweiten stets das prinzipiell asymmetrische Verhältnis zwischen PädagogInnen und KlientInnen reflektiert werden. (Kessl et al. 2011: 394, 398f)
Hingegen werden die AdressatInnen personenbezogener Dienste in der Literatur tatsächlich teilweise unreflektiert mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet, wie "KonsumentInnen", "KundInnen" oder "NutzerInnen". Manche AutorInnen, wie Jörn Rabeneck verbinden mit der Bezeichnung des Kunden/ der Kundin, "dem 'Klienten' durch die Einführung des Begriffes 'Kunde' eine höhere Wertschätzung" zu verleihen. Dieser soll auch ausdrücken, dass die KundInnen das Recht haben, aus verschiedenen Produkten auswählen zu können. (Rabeneck zit. n. Kessl et al. 2011: 396)
In der Literatur wird der Kundenbegriff in der sozialen Arbeit häufig problematisiert. So kritisieren Beckmann und Richter wiederum, dass die Vorstellung von zweckrational und nutzenmaximierend handelnden KundInnen zwar nahtlos an die ökonomisch abgeleiteten Qualitätskriterien anknüpfen kann, für die Zielgruppe sozialer Dienste jedoch ungeeignet ist. (vgl. Beckmann et al. 2005: 132) Diesbezüglich wendet Otto Speck im Zuge seiner Ökonomisierungskritik ein, dass an den "helfenden Akt" keine ökonomische Maßstäbe eines konventionellen Tauschakts angelegt werden können, weil dieser einer gänzlich anderen, eigenen sozialen Logik folge. So kommen dem Autor zufolge nicht Überlegungen der Gegenseitigkeit oder des Eigennutzes zum Tragen, sondern Helfen ist eine sozialanthropologische Kategorie und beruht auf moralischen Motivationen und zeichnet sich durch eine asymmetrische Konstellation aus Helfendem und Hilfesuchendem aus. (vgl. Speck 1999: 124f)
Hans Braun stellt in diesem Kontext heraus, dass die Entscheidungssituation für einen gewissen sozialen Dienst (oder eine Kombination) gerade meist in einer Ausnahmesituationen, z.B. einer Lebenskrise oder bestimmten Notlage, erfolgt und eine eingeschränkte KundInnensouveränität erzwingt: "Die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen erfolgt gewöhnlich unter 'existentiell verdichteten' Bedingungen. (Braun 1999: 139) Hinzu kommt, dass realistischerweise die Betroffenen das Angebot nicht überblicken und gar nicht wissen können, welche soziale Dienstleistung(en) die passende(n) ist oder sind. (vgl. ebd.)
Kannonier-Finster und Ziegler stellen in ihrer Kritik der KundInnen-Begrifflichkeit die Rolle der NutzerInnen als individuelle Ko-ProduzentInnen von sozialen Dienstleistungen in den Mittelpunkt, wenn sie darauf hinweisen,
"[...] dass die KlientInnen nicht nur als amorphe 'Kundschaft' betrachtet werden, sondern als Agierende mit Geschichte und Erfahrung in Erscheinung treten, die die ablaufenden Prozesse ebenso produzieren wie die SozialarbeiterInnen." (Kannonier-Finster et al. 2005: 124)
Oelerich und Schaarschuch gehen noch weiter, in dem sie den AdressatInnen sozialer Dienste auf der Ebene der Erbringung, also der Interaktion und im Hinblick auf ihre aktiven Aneignungsleistungen der Hilfestellungen und Lernangebote, die Rolle der eigentlichen ProduzentInnen zuschreiben: "In systematischer Perspektive kommt somit dem Aneignungshandeln der Nutzerinnen und Nutzer im Dienstleistungsprozess der Primat zu." (Oelerich et al. 2005: 11)
Im Folgenden Abschnitt soll nun näher auf "Empowerment" und "Selbstbestimmung" als zentrale Begriffe aus der NutzerInnenperspektive eingegangen werden.
Die Formel Selbstbestimmung geht auf die Normalisierungsbewegung der 1970er Jahre zurück, als diese von Nirje in den Diskurs eingebracht wurde. Der Begriff wird häufig synonym mit Empowerment gebraucht, und meint das Recht von Menschen mit Behinderung, eigene Entscheidungen zu treffen und Kontrolle über ihr Leben zu erlangen. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 4)
Monika Seifert beobachtet einen Einstellungswandel, der sich im Laufe der letzten 15 Jahre vollzog und im Zuge dessen eine Haltung, die sich an "Fürsorge" orientiert, heute negativ konnotiert ist mit Bedeutungszuschreibungen wie "Bevormundung", "fürsorglicher Belagerung" (Keupp) und "Fremdbestimmung". Stattdessen greifen die handlungsleitenden Ideen "Empowerment" und "Selbstbestimmung" Raum in Diskurs und Praxis. Der Mensch mit Behinderung ist somit "nicht mehr Objekt von Fürsorge, sondern Akteur im Kontext seiner Lebensplanung und Alltagsgestaltung, der selbst weiß, was er will und was ihm gut tut". KlientInnen sind "nicht mehr Empfänger von Hilfen, sondern Nutzer von Dienstleistungen - mit Anspruch auf fachlichen Standards entsprechende Qualität der Angebote." (Seifert 2009: 122; kursiv im Orig.) Fürsorge kann im Fall von asymmetrischen Beziehungen (in der Betreuer-Klient-Beziehung) zu Überbehütung, Überversorgung, bis hin zum Absprechen von Entscheidungsfähigkeit und Entlassen aus der Verantwortung über die eigene Lebensgestaltung führen. (vgl. Seifert 2009: 123) "Solche überbehütende Fürsorge verfolgt möglicherweise hehre Motive, deaktiviert aber die noch vorfindlichen Eingenressourcen des Hilfeempfängers, des Patienten, des Menschen mit Behinderungen oder auch seiner Familienangehörigen."(Lob-Hüdepohl 2007: 170 zit. n. Seifert 2009: 123) Dem Autor zufolge steht eine solche Herangehensweise der menschenrechtlichen Forderung nach Autonomie entgegen. (vgl. ebd.)
Stancliffe, Abery und Smith (2000) liefern folgende Definition von Selbstbestimmung, die auf die Bedeutung einer "Eigenregie" insbesondere über subjektiv wichtige Lebensbereiche abzielt: "self-determination involves a person having the degree of control over his life that he desires in those areas that he values and over which he wishes to exercise control". (Stancliffe et al. 2000 zit. n. Schalock 2002: 356; kursiv im Orig.)
Wehmeyer und Schwartz entwickelten eine sozialpsychologische Definition von Selbstbestimmung, die sie auch in einer Studie, an der 400 Menschen mit Behinderung teilgenommen haben, empirisch validieren konnten (Wehmeyer 1996). Dabei bezieht sich Selbstbestimmung auf einen Handlungskomplex, der auf die Zurückdrängung von Fremdbestimmung gekennzeichnet ist und wie folgt beschrieben wird: "acting as the primary causal agent in one's life and making choices and decisions regarding one's quality of life free from undue external influence or interference". (Wehmeyer 1996: 22 zit. n. Ders. et al. 1998: 4; kursiv im Orig.)
Wehmeyer et al. zufolge können Handlungen dann als selbstbestimmt gelten, wenn sie vier maßgebliche Bedingungen erfüllen:
-
Das Individuum handelt autonom, also gemäß seiner eigenen Vorlieben und Interessen, auf unabhängige Weise und frei von Fremdbestimmung.
-
Verhalten und Handeln findet selbstreguliert ("self-regulated") statt, d.h. die Person trifft Entscheidungen, wie sie ihre Fähigkeiten und ihr Handlungsrepertoire gemäß der zugrundeliegenden Situationsbewertung einsetzt.
-
Die Reaktionen der Person sind von einer "psychologisch-empowerten" Haltung getragen ("psychologically empowered manner"), d.h. sie handelt im Bewusstsein, durch eigenes Handeln ihre Situation und Geschehnisse in ihrer Umwelt beeinflussen zu können.
-
Die betroffene Person handelt auf selbstreflektierte Weise, indem sie sich ihrer Stärken und Grenzen bewusst ist. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 4f)
Wehmeyer identifizierte im Rahmen seiner Forschung folgende elf entscheidende Eigenschaften und Fähigkeiten, deren Aneignung selbstbestimmtes Handeln ermöglicht: Diese sind (a) Selektionsfähigkeit, (b) Entscheidungsfähigkeit, (c) Fähigkeit zur Problemlösung, (d) Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel anzustreben und zu erreichen, (e) Selbstorganisation, (f) Eintreten für sich Selbst, (g) Führungsqualität, (h) Selbstkontrolle, (i) positives Bewusstsein und Erwartung über Effektivität und Ergebnisse des eigenen Handeln, (j) Selbstbewusstsein, und (k) Wissen über das Selbst. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 5) Diese Fähigkeiten bilden sich jeweils entweder aus spezifischen Entwicklungsprozessen oder durch Lernprozesse heraus. Auf diesen Voraussetzungen beruhend kann Selbstbestimmung ('self-determination') und Selbstvertretung ('selfadvocacy') von Menschen mit Behinderung durch Bildungsmaßnahmen erlernt werden. (vgl. ebd.)
Schalock und Wehmeyer kommen zum Schluss, dass mehr Selbstbestimmung einen direkten positven Einfluss auf die Lebensqualität hat, insofern als ein kausaler Zusammenhang zwischen beiden Konstrukten besteht. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 6, Schalock et al. 2002: 306) Das Verhältnis zwischen Selbstbestimmung und Lebensqualität ist zwar noch nicht systematisch erforscht worden, der theoretische Bezugsrahmen ist aber derselbe: Beide Konzepte bedingen einander in der Weise, dass sie sich wechselseitig als Definitionsgrundlage dienen. So verändern etwa selbstbestimmte Handlungsergebnisse die vorgefundenen Lebensbedingungen positiv und schaffen mehr Lebensqualität. Im Umkehrschluss beeinflusst Selbstbestimmung die Quality of Life-Kerndimensionen oder jene wird davon beeinflusst. (vgl. Schalock et al. 2002: 306f)
Wehmeyer bestätigte diesen Zusammenhang in einer Untersuchung mit 50 Menschen mit geistiger Behinderung[16] und führte die erhöhte Lebensqualität auf das größere Ausmaß von Kontrolle über das eigene Leben zurück. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 5f, 11)
Eine Veränderung der Dienstleistungsangebote in Richtung NutzerInnenorientierung und mehr Selbstbestimmung ist im Stande, die Lebensqualität zu steigern. Die Forschung belegt, dass Art und Größe der Wohneinrichtung den Grad an Selbstbestimmung beeinflusst. So erleben Menschen mit Behinderung in einem mehr eingeschränkten Wohnumfeld weniger Selbstbestimmung und haben weniger Entscheidungsmöglichkeiten. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 5) Schalock und Keith (1993) sowie Stancliffe und Wehmeyer (1995) fanden heraus, dass KlientInnen in stärker integrierten Wohnformen mehr Selbstbestimmung und einen positiveren Grad an Lebensqualität erzielten als Menschen mit Behinderung in Wohngruppen und Wohnheimen. Dies ist den Autoren zufolge darauf zurückzuführen, dass Personen im Gruppenumfeld weniger Möglichkeiten haben, eigene Entscheidungen zu treffen und daher weniger selbstbestimmt agieren können. (vgl. Wehmeyer et al. 1998: 9) Im Fall von Personen, die eine "supported living"-Wohnumfeld gewählt haben, können Karan und Bothwell diesen positiven Einfluss auf die Lebensqualität in der Tendenz ebenfalls bestätigen. (vgl. Karan et al. 1997: 92) Christine Rauscher erhielt in einer repräsentativen Studie (2003) deutliche empirische Befunde dafür, dass Menschen mit Behinderung nicht-institutionelle Wohnformen bevorzugen. (vgl. Rauscher 2005: 148)
Sozialpädagoge Eckhard Rohrmann stellt aber heraus, dass die etwa 20 Jahre umfassenden Erfahrungen (in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland) mit teilbetreuten Wohnformen und ambulanten Diensten zeigen, dass diese nicht automatisch inklusivere Modelle sind. Denn Aussonderung ist nicht von Sondereinrichtungen, sondern von den jeweiligen Lebenszusammenhängen, im Arbeits- oder Wohnbereich etwa, selbst verursacht: "Die Aufhebung des institutionellen Einschlusses ist zwar eine grundlegende Voraussetzung für die Aufhebung des sozialen Ausschlusses. Sie darf damit jedoch nicht gleichgesetzt werden." (Rohrmann 2005: 206)
Die Formel "fitting supports around people rather than fitting people to services" (Karan et al. 1997: 87) beschreibt einen Wandel hinsichtlich der Gestaltung von Unterstützung und Hilfen, deren zentraler Ausgangspunkt die betroffene Person darstellt. Diese neue Herangehensweise ist jedoch keineswegs unwidersprochen oder erwünscht, sondern trägt gesellschaftliches und politisches Konfliktpotential in sich. Im Kontext des nutzerorientierten "Supported Living"-Konzepts[17] zeigen Karan und Bothwell folgende drei wesentliche Konfliktlinien auf, die als Forderungen nach mehr Lebensqualität durch Selbstbestimmung und Individualisierung einige Problemfelder aufmachen können:
a) Die Funktionslogik von Bürokratien Der neue Anspruch personenzentrierter Dienstleistungen kollidiert mit der Funktionsweise und Logik, nach der Bürokratien arbeiten: Für die Arbeit von Bürokratien oder bürokratisch geprägten Organisationen spielen häufig interne Verhältnisse wie Effizienz, innere Machtstrukturen, routinisierte Abläufe, starre Regelwerke und äußere Sparzwänge eine größere Rolle als das Wohl und der Bedarf der Betroffenen. Bürokratischen Organisationen fällt es deshalb schwer, neue Wege zu beschreiten.
Orv C. Karan ist im Zuge einer Exploration von Gründen für die ausbleibende Förderung des "Supported Living"-Konzepts mit einer Reihe von Fokusgruppen auf einige Hemmschuhe der Entwicklung gestoßen.
-
So reagierten die OrganisationsleiterInnen von Trägern mit konventionellen Wohnangeboten mit großem Widerwillen auf eine Umstellung ihrer Angebote. Ihre Argumente beziehen sich auf geringe finanzielle Anreize bzw. finanzielle Hürden, einen Anstieg administrativer Kosten, Angst vor Dezentralisierung ihrer Programme, Bedenken hinsichtlich Qualitätssicherung und Sorgen über zusätzliche Kosten. (vgl. Karan et al. 1997: 86)
-
MitarbeiterInnen von Dienstleistungsanbietern äußerten Angst vor Veränderung oder Verlust der Beschäftigung, Bedenken über den Mangel an festen Strukturen, Skepsis über die Entscheidungsfähigkeit von Menschen mit schwerer Behinderung, Sorge über Isolation und Mangel an Unterstützung sowie eine fehlende Bereitschaft, Entscheidungen von den KlientInnen treffen zu lassen und sich auf die Assistenz-Rolle zu beschränken. Die negative Reaktion der MitarbeiterInnen bezieht sich also auf die Angst, sich selbst überflüssig zu machen. (vgl. ebd.)
-
Die Familien und Angehörigen von KlientInnen in stationären Wohneinrichtungen wiederum plagten Bedenken, eine sichere Umgebung zu verlassen sowie lebenslange Dienste oder einen sicheren Wohnplatz zu verlieren. Sie drückten die Sorge aus, ihre Angehörigen würden Beihilfen verlieren bzw. Unsicherheiten über die Wahl, die die Betroffenen selbst treffen würden. (vgl. ebd.)
b) Der soziokulturelle Hintergrund der NutzerInnen Es ist den Autoren zufolge notwendig, eine multikulturelle Perspektive und ein gegenseitiges Verständnis zwischen sozialen Trägern auf der einen und den NutzerInnen auf der anderen Seite im Rahmen sozialer Dienstleistungen herzustellen. Als Charakteristik des Menschen mit Behinderung schließt dies Überlegungen zu Faktoren wie Geschlecht, Lebensphase, Kultur, Ethnie, soziale Klasse, institutionelle Laufbahn, Lebensstil ein. So sollte Klarheit herrschen über Werthaltungen des Dienstleistungsanbieters, des Nutzers und der Familie des Nutzers, die häufig über die unmittelbare Familie hinausgeht. (vgl. Karan et al. 1997: 86)
c) Mögliche Kontroversität des KlientInnen-Wunsches - "With empowerment comes the privilege of making decisions and making mistakes." (Karan et al. 1997: 87) Was die betroffene Person sich wünscht, kann in Widerspruch zur Meinung der Angehörigen oder Dienstleistungserbringer stehen. Dies birgt Schwierigkeiten und Unsicherheiten im Umgang mit divergierenden Meinungen über das Wohl des Menschen mit Behinderung. Die Autoren weisen auf die Bedeutung hin, KlientInnen stets ernst zu nehmen: "We will maintain respectful contact with all parties but honor the choice of the person we assist." (O'Brien 1993: 20 zit. n. Karan et al. 1997: 87) Jedoch werden damit auch ethische Fragestellungen (noch mehr als zuvor) relevant, die sich an einer Einschätzung des notwendigen Maßes von Risiko und Schutzbedürftigkeit orientieren müssen. (vgl. Karan et al. 1997: 87)
In diesem Abschnitt sollen Ansätze für gesellschaftliche und politische Maßnahmen, die wirksam auf eine Verbesserung der Lebensqualität zielen, diskutiert werden. Die folgenden Ausführungen stützen sich großteils auf die fundierten Arbeiten von Robert L. Schalock und Miguel A. Verdugo.
Die Autoren weisen darauf hin, dass die Anwendung des Lebensqualitätkonstrukts auf gesamtgesellschaftlicher Ebene einem komplexen Wirkungszusammenhang unterliegt: "The societal-level application of the QOL concept is multifaceted [...and; Anm. d. Verf.] a complex interaction among people, programs, and public policy propagated at the societal level." (Schalock et al. 2002: 345) Sie schlagen folgende drei miteinander in Beziehung stehende Strategien für die effektive Implementierung von lebensqualitätssteigernden Programmen vor:
a) Politische Maßnahmen mit Lebensqualität-Bezug
Für die Verbesserung der sozialen Verhältnisse sind politische und rechtliche Rahmenbedingungen, die auf Lebensqualität Bezug nehmen, von Bedeutung. So verabschiedeten Staaten, häufig als Mitglieder der Vereinten Nationen, über 40 internationale Verträge oder Menschenrechtskonventionen, die sich mit den Belangen von Menschen mit Behinderung und anderen speziellen Bedürfnissen befassen. Beispiele hierfür sind die UN-Erklärung über die Rechte von geistig behinderten Menschen (1971), die UN-Erklärung über die Rechte von behinderten Personen (1975), der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1976), die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte (1993) sowie aktuell die UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2008). (vgl. Schalock et al. 2002: 337)
b) Implementation von Techniken und Hilfsmittel für eine Steigerung der Lebensqualität
Um Menschen mit Behinderung und anderen Bevölkerungsgruppen bessere und inklusivere Lebensbedingungen zu ermöglichen, ist es auf der gesellschaftlichen Ebene geboten, barrierefreie und nicht-behindernde Techniken und Hilfsmittel einzuführen. Es steht außer Zweifel, dass solche Neuerungen allen Gesellschaftsmitgliedern zu Gute kommen würden. Als zugrundeliegende Annahmen sind zu nennen (vgl. Schalock et al. 2002: 340):
-
Eine bessere Passung zwischen den Umweltbedingungen und den Fähigkeiten und Bedürfnissen eines Individuums (z.B. durch Abbau von Barrieren) hat eine verbesserte Lebensqualität zum Ergebnis.
-
Die Feststellung des Passungsverhältnisses von Behinderung und Umwelt ist machbar.
-
Je größer die Diskrepanz zwischen Behinderung und behindernden Umweltbedingungen, desto mehr Unterstützung brauchen die Betroffenen. (vgl. ebd.)
Folgende Hilfsmittel sind Beispiele für Einrichtungen, die eine Umgebung benutzerfreundlicher und barrierefreier machen: Gebäude und Gehwege, die für Rollstühle zugänglich sind; Braille-Hinweise in öffentlichen Gebäuden; Möglichkeiten für Beteiligung in der Gemeinde; Modifizierung von alltäglichen Apparaturen wie Wasserhähnen, Stiegen und Türgriffen; Sicherheitseinrichtungen wie Geländern und rutschfeste Oberflächen; Farbleitsysteme oder Piktogramme zur besseren Orientierung im öffentlichen Raum; spezielle Arbeitsmittel wie behinderungsgerechte PCs uvm. (vgl. ebd.)
c) Gesellschaftliche Mitwirkung am Wandel in Richtung Lebensqualitätsteigerung
Um Menschen mit Behinderung bessere Lebensverhältnisse zu ermöglichen, ist die Mitwirkung der Gesellschaft an inklusiver Praxis eine notwendige Bedingung und letztlich maßgeblich für eine Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe.
Schalock versuchte, Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu analysieren. So führten Schalock und Kelly im Jahr 1999 eine transnationale Studie durch, bei der 172 Menschen aus der Profession der (Geistig- )Behindertenarbeit in Kanada, England, Japan, in den Niederlanden, Polen, China und den Vereinigten Staaten, befragt wurden. Im Ergebnis kristallisierten sich neun Kontextfaktoren heraus, die gemeinde-integrierte Programme positiv oder negativ beeinflussen und interkulturell gleich sind. (vgl. Schalock et al. 2002: 341)
Dazu zählen (a) Public Policies, die auf Integration, Normalisierung, Deinstitutionalisierung und positive Diskriminierung ausgelegt sind; (b) konsistente und koordinierte Finanzierung von politischen Maßnahmen; (c) Koalitionen wie Unternehmen, Gewerkschaften und Verbände, PolitikerInnen, Familien, SelbstvertreterInnen und Professionisten; (d) Technologie, z.B. anpassungsfähige Geräte als Hilfsmittel; (e) professionelle Begleitung und Unterstützung durch rehabilitatives und medizinisches Personal, LehrerInnen, PsychologInnen und SozialarbeiterInnen; (f) Rehabilitation und Erwachsenenbildung; (g) Forschung und Entwicklung, Modellprogramme, Evaluation, Zusammenarbeit mit Hochschulen; (h) politische Organisationen wie Gewerkschaften sowie charismatische Führungspersonen, Sozialprogramme; (i) Einstellungen zu Menschen mit Behinderung: Normalisierung, Potential, Personenzentriertheit, Fähigkeitsorientierung, soziale Etikettierungen, Status. (vgl. Schalock et al. 2002: 341f) Diese Faktoren zeigen laut Schalock und Verdugo den Handlungsbedarf auf, wo Politik und Gemeinwesen gesellschaftlich ansetzen muss.
Das Konstrukt Lebensqualität könnte man mit politischen Entscheidungsprozessen als Leitprinzip verknüpfen, schlägt David Goode vor: " [...] quality of life policy means the use of the concept of quality of life as a guide, a common denominator, or core principle with respect to decision-making in services and supports for persons who require special supports." (Goode 1997: 212) Die Funktion einer derartig definierten Politik ist die Verringerung der Diskrepanzen zwischen der individuellen Wahrnehmung der Lebensbedingungen und den zu erfüllenden Bedürfnissen. Forschung, die solcher Politik dienlich wäre, würde den Erkenntnisgewinn ihrer wissenschaftlichen Arbeit zur Minimierung eben jener Diskrepanzen einsetzen. (vgl. ebd.)
Für Robert L. Schalock birgt das Konzept Lebensqualität ebenfalls das Potential eines umfassendenden theoretischen Rahmens für Politik im Allgemeinen in sich und trägt an das politische System folgende Schlussfolgerungen bzw. Forderungen heran:
-
Lebensqualität als Richtwert für das Wohl der gesamten Bevölkerung verwenden;
-
Public Policy-Maßnahmen mit dem Konzept "Quality of Life" abgleichen;
-
im Bewusstsein behalten, dass "Quality of Life" für alle Menschen relevant ist, nicht nur im Besonderen für Menschen mit Behinderung ;
-
Kooperationen zwischen SelbstvertreterInnen, politischen EntscheidungsträgerInnen, sozialen Dienstleistern und ForscherInnen sicherstellen, um Definition und Erfassung von Lebensqualität weiterzuentwickeln;
-
Internationale Netzwerke mit Bezug auf "Quality of Life" entwickeln und einen internationale Perspektive auf Lebensqualität beibehalten;
-
Evaluationen über Outcomes von politischen Maßnahmen mit Zielsetzungen, die relevant für die Lebensqualität sind; (vgl. Schalock 1997: 248)
Turnbull und Brunk weisen ergänzend darauf hin, dass Behindertenpolitik stets auf bestimmten Werten, im Sinne einer "value-driven policy", basiert. Den Autoren zufolge beziehen Bewegungen wie Deinstitutionalisierung und Gemeinde-Orientierung ihre Ideen aus einem Wertekomplex, der auf Gleichbehandlung, gleiche Rechte und Möglichkeiten abzielt. (vgl. Turnbull et al. 1997: 204f) Laut David Goode gibt es mehrere Rechtfertigungsgründe dafür, Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen stets in den Zusammenhang mit Lebensqualität der Gesamtgesellschaft zu stellen: so lässt sich dies aus rein moralischer und normativer Hinsicht argumentieren, oder aus einer Perspektive der Forschungserkenntnisse, die einen starken Zusammenhang nahelegen sowie aufgrund einer politischen bzw. ethischen Entscheidung, eine Gesellschaft dementsprechend zu gestalten, sodass niemand von einem angemessen Lebensqualität-Niveau ausgeschlossen ist. (vgl. Goode 1997: 213)
David Goode, der sich in seiner Forschungsarbeit für internationale Aspekte des Lebensqualität-Konzepts in Wissenschaft und Politik interessiert, konstatiert, dass historisch internationale Bestrebungen die treibenden Kräfte und maßgeblichen Impulse für die nationale Formulierung von Behindertenpolitik waren. (vgl. Goode 1997: 213f) Mit zunehmender internationaler Vernetzung im Forschungs- und politischen Bereich,insbesondere im Rahmen der Europäischen Union, trifft dies heute mehr denn je zu. Eine internationale Initiative, deren Bedeutung für eine fortschrittliche Politik kaum unterschätztwerden kann, ist die 2006 beschlossene "UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung". Die Konvention soll im folgenden Abschnitt vorgestellt und diskutiertwerden.
[16] Die Studienteilnehmer wurden hinsichtlich ähnlicher Wohnsituationen ausgewählt, um Wohnen als Einflussfaktor auszuschließen.
[17] Georg Theunissen bezeichnet "unterstützes Wohnen" als Konsequenz des Inklusionsprinzips als "ein flexibles, auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot, welches behinderten Menschen ein 'normales' Wohnen in der Gemeinde ernöglichen soll. Damit wird dem Recht und Wunsch auf Nicht- Aussonderung und Antidiskriminierung behinderter Menschen entsprochen." (Theunissen 2005: 219)
Inhaltsverzeichnis
Am 13. Dezember 2006 hat die UN-Generalversammlung das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBehindertenrechtskonvention) und eines Fakultativprotokolls beschlossen. (vgl. BMASK 2010: 1) Das Fakultativprotokoll räumt die Möglichkeit von Gruppen- und Individualbeschwerden im Rahmen eines internationalen Beschwerdeverfahrens ein, vorausgesetzt, es sind alle innerstaatlichen Rechtsmittel ausgeschöpft[18]. (vgl. Aichele 2008: 7) Zum jetzigen Zeitpunkt[19] haben 147 Staaten die Behindertenrechtskonvention gezeichnet, davon haben sie 98 Staaten ratifiziert. Die Ratifikation des Fakultativprotokoll wurde bisher von 60 Staaten vorgenommen. (vgl. http://www.un.org/disabilities)
Die Europäische Union ratifizierte die Konvention im Dezember 2010, das mit der aktuellen Richtlinie "Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010 bis 2020 - Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa" bereits Niederschlag in ihrer Gesetzgebung gefunden hat. Diese Richtlinie hat Maßnahmen für Barrierefreiheit zum Schwerpunkt und wird von einem zweijährigen EU-Aktionsplan flankiert, um die Umsetzung mittels konkreter Ziele voranzutreiben. (vgl. BMASK 2010b) Diese legistischen Neuerungen knüpfen an die bestehenden Antidiskriminierungsbestimmungen der Europäischen Union an.
Österreich ratifizierte die Konvention im Sommer 2008, sodass sie im Oktober des gleichen Jahres in Kraft treten konnte und nationales Recht wurde (BGBl. III Nr. 155/2008). Für den Staat als Adressat zieht das die völkerrechtliche Verpflichtung von Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene nach sich, die Gesetze in Übereinstimmung mit der UN-Konvention zu bringen. (vgl. BMASK 2010: 1) Zur Überwachung ihrer Implementierung nahm ein "unabhängiger" Monitoringausschuss, an den Beschwerden gerichtet werden können, seine Arbeit auf. (vgl.
Unabhg. Monitoringausschuss 2010) Die völlige Unabhängigkeit des Monitoringausschuss ist in Zweifel zu ziehen, da dieser an das Sozialministerium angegliedert ist[20]. Im Sinne der Forderung des Vertragstexts nach politischer Partizipation von Menschen mit Behinderung[21] (insbesondere, jedoch nicht nur in eigenen Belangen) sollen auch in diesem Kontrollgremium Betroffene als Akteure hinzugezogen werden. (vgl. BMASK 2008: 3) Im Oktober 2010 erstattete Österreich mit dem ersten Staatenbericht Bericht über den Stand der Implementierung der Konvention. (vgl. ebd.)
Wie bei der Frauen- und Kinderrechtskonvention handelt es sich bei der UN-Behindertenrechtskonvention um eine Gruppenkonvention, ohne jedoch "Sonderrechte" für Menschen mit Behinderung einräumen zu wollen, sondern gerade die allgemeinen Menschenrechte in Bezug auf Menschen mit Behinderung zu bekräftigen und zu verwirklichen, worin eine Stärke des Vertragstextes liegt. (vgl. Graumann 2008, Bielefeldt 2009: 14) Denn, wie in der Präambel (Abs. b u. c) deutlich ausgeführt, ist der ideengeschichtliche Ausgangspunkt der Menschenrechtsgedanke mit dem Postulat der Menschenwürde, von diesem alle anderen sozialen, kulturellen Teilhaberechte des Vertragstextes abgeleitet sind. (vgl. Aichele 2008: 4, Bielefeldt 2009: 5) Die Universalität der Menschenrechte, verknüpft mit dem Diskriminierungsverbot (im direkten und indirekten Verständnis) schafft die Basis für einen wirksamen Schutz von Menschen mit Behinderung. (vgl. Bielefeldt 2009: 4)
Mit dieser Voraussetzung macht die UN-Konvention "volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft"[22] (BMASK 2008: 6) von Menschen mit Behinderung im Sinne von Inklusion[23] und Würde und Autonomie des Menschen[24]
mit Behinderung zu ihren Leitprinzipien und zugleich zu ihrer Zielbestimmung. (vgl. Graumann 2008) Heiner Bielefeldt zufolge ist die verschränkte Sicht beider Prinzipien notwendig, den Sinn der Konvention richtig aufzufassen: "Erst in der wechselseitigen Verwiesenheit wird klar, dass Autonomie, gerade nicht die Selbstmächtigkeit des ganz auf sich gestellten Einzelnen [...] meint, sondern auf selbstbestimmtes Leben in sozialen Bezügen zielt". (Bielefeldt 2009: 11; kursiv im Orig.)
Laut Valentin Aichele findet man in der Konvention die Subjektorientierung und Anerkennung individueller Rechte als Ausgangspunkte für Rechte und Schutz, die auf die Lebensbedingungen, besonderen sozialen Situation und Gefährdungen von Menschen mit Behinderung abzielen: "Sie konkretisiert vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Lebenslagen behinderter Menschen die universalen Menschenrechte und präzisiert die mit diesen universalen Rechten korrespondierenden staatlichen Verpflichtungen." (Aichele 2008: 4) Ein weiteres wichtiges Element besteht in der Einmahnung einer positiven, wertschätzenden Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderung. (vgl. ebd.)
Die Konvention wendet sich insofern klar von einer Defizitorientierung (analog zur ICFKlassifikation der WHO) ab, als sie bewusst auf eine abgeschlossene Definition verzichtet und anerkennt, "dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht", wie aus der Präambel (Abs. e) hervorgeht. (BMASK 2008: 2) Die Denkrichtung der Konvention geht also von ihrer Zielbestimmung, Inklusion aus, - als ein Verhältnis zur Verwirklichung einer vollen gesellschaftlichen Teilhabe. (vgl. Aichele 2008: 5) Behinderung wird nicht als ein zugeschriebenes Defizit eines Individuums aufgefasst, sondern als gesellschaftliches Defizit in Form von Ausgrenzung von Partizipation und Diskriminierung. (vgl. Bielefeldt 2009: 8) Auf diese Weise werden soziale Problemlagen direkt aufgegriffen. Entscheidend in diesem Kontext und vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts ist Bielefeldt zufolge auch, dass die Haltung einer wertschätzenden "Akzeptanz von Behinderung als Bestandteil menschlicher Normalität" in der UN-Behindertenrechtskonvention deutlich herausgestrichen wird. (Bielefeldt 2009: 7)
Die UN-Behindertenrechtskonvention enthält Aichele zufolge einerseits "eine Reihe objektiver Pflichten, die teilweise die Form von Ziel- oder Förderverpflichtungen haben". (Aichele 2008: 6; kurisv im Orig.) Die Vertragsstaaten müssen somit z.B. Verpflichtungen zur allgemeinen Bewusstseinsbildung (Artikel 8), zur Zugänglichkeit (Barrierefreiheit in Art. 9), sowie zu Habilitation und Rehabilitation (Artikel 26) nachkommen. (vgl. BMASK 2008: 11-13, 27)
Zum anderen schreibt sie individuelle Rechte fest, wie z.B. das Recht auf Leben (Artikel 10), Schutz der Rechts- und Handlungsfähigkeit (Artikel 12), das Recht auf Freiheit und Sicherheit (Artikel 14), Freiheit vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel 16), das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit (Artikel 17), das Recht auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gesellschaft (Artikel 19), das Recht auf persönliche Mobilität (Artikel 20), das Recht auf Zugang zu Informationen (Artikel 21), das Recht auf Bildung (Artikel 24) und auf Gesundheit (Artikel 25), das Recht auf verändern, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen - gerade auch von Menschen mit Behinderungen - von vornherein besser gerecht werden." (Aichele 2008: 12) 24 Artikel 3a) Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27), Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29). (vgl. BMASK 2008: 14-31) "Alle diese Rechte haben grundsätzlich das Potential, die Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten des Staates auf verschiedenen Ebenen zu entfalten." (Aichele 2008: 7) Das heißt, die Vertragsstaaten sind in der Pflicht, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um diese Rechte zu verwirklichen. (vgl. ebd.) Einerseits schließt dies Maßnahmen auf der Ebene der Bewusstseinsbildung, andererseits strukturelle Veränderungen auf der materiellen Ebene (z.B. Infrastruktur) bzw. der Ebene sozialer Institutionen ein (z.B. Umgestaltung eines inklusiven Bildungssystems, das eine wirkliche Wahlmöglichkeit zwischen Sonderschule und Integrationsklassen bietet).
Besonderes Empowerment-Potential steckt in den Bestimmungen zur rechtlichen Handlungsfähigkeit und Barrierefreiheit, die im Folgenden näher erläutert werden: Für Theresia Degener ist Artikel 12 zur rechtlichen Handlungsfähigkeit richtungsweisend, weil man damit "auf das Prinzip der unterstützenden Entscheidungsfindung statt der weitverbreiteten substituierenden gesetzlichen Vertretung setzt". (Degener 2009: 3) Die transnationale Nichtregierungsorganisation "Inclusion Europe", die die EU-Kommission und das EU-Parlament in behindertenpolitischen Fragen berät, fordert eine vollständige Rechtsfähigkeit von Menschen mit Behinderung und die Unterstützung, die sie für eine rechtliche Gleichstellung benötigen. Die gesetzlichen Regelungen und die Praxis sollen gemäß der Konvention überprüft und angepasst werden, weil es in der Realität diesbezüglich noch große Diskrepanzen gebe. Denn dies betreffe zahlreiche Alltags- und Lebensentscheidungen wie z.B. die Bewerbung für eine Arbeitsstelle, die Wahl des Wohnortes und der MitbewohnerInnen oder die Entscheidung zu heiraten. (vgl. Inclusion Europe 2008: 279)
Wesentliches "Innovationspotential" kommt laut Aichele der Forderung, "angemessene Vorkehrungen"[25] zu treffen, zu. (Aichele 2008: 6). Diese definiert die Konvention als "notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden," sodass Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung sichergestellt sind. (BMASK 2008: 6) Degener bezeichnet die Tatsache, dass die Vorenthaltung solcher Vorkehrungen bei Verhältnismäßigkeit als strukturelle Diskriminierung zu werten ist, als "eine der größten Errungenschaften der Konvention ." (Degener 2009: 3) In der Praxis hat diese Vertragsbestimmung weitreichende Auswirkungen, so kann es sich dabei z.B. um barrierefreie Adaptionen von Arbeitsplätzen, Arbeitsmittel wie PCs und Homepages, Vorlesungen für gehörlose Studierende, oder bauliche Veränderungen handeln. Insgesamt ist zu betonen, dass nicht vorrangig gesetzliche Anpassungen, sondern die faktische Umsetzung des Vertragstextes maßgeblich sind.
Sigrid Graumann sieht den Fortschritt der UN-Konvention durch die "bemerkenswerte Verknüpfung von Freiheitsrechten als Abwehrrechte gegen staatliche und andere Eingriffe in die persönliche Freiheit mit sozialen Rechten als Anspruchsrechte auf soziale Dienste und Leistungen". (Graumann 2008) Die Forderungen nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind demnach konzipiert als Freiheitsrechte, denen zur Umsetzung Leistungsansprüche an die Seite gestellt werden. So soll garantiert werden, dass Menschen mit Behinderung die notwendige Assistenz und Unterstützung erhalten, die sie für ihre volle gesellschaftliche Partizipation brauchen. (vgl. Graumann 2008) In gleichem Maße sollen alle Barrieren beseitigt werden, die "den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umgebung, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation" (Art. 9) einschränken. (BMASK 2008: 12)
In spezifischen Zusammenhang mit Wohnen und verwandten Lebensbereichen sind folgende Artikel des Vertragstextes hervorzuheben:
Die Forderung nach "unabhängiger Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft" (Artikel 19) reflektiert den hohen Grad an Fremdbestimmung und bevormundenden Umgang, den Menschen mit Behinderung im Zuge von pädagogischen und therapeutischen, aber auch behördlichen Maßnahmen erlebten und erleben. Die "Erfahrung von Bevormundung und Entmündigung" erwachsen ihnen auch aus der fehlenden Wahlfreiheit von Wohn- und Arbeitsort, und Bildungsmöglichkeiten. (Graumann 2008a) Zudem sind Menschen mit Behinderung als Erwachsene meist nicht im Stande, sich ohne Unterstützung eine eigenständige Lebensführung zu schaffen und sich vom Familienumfeld zu emanzipieren.
So müssen laut Artikel 19 a) Maßnahmen ergriffen werden, sodass z.B. "[...] Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben". (BMASK 2008: 19) Dies stellt Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung im Bereich des Wohnens, aber auch andere Rehabilitations-, oder Bildungseinrichtungen (z.B. das Sonderschulsystem) klar in Frage, weil diese sozialen Ausschluss fördern, wie Graumann ausführt, wenn Menschen mit Behinderung
"in Anstalten und Heimen völlig von der restlichen Gesellschaft isoliert waren oder heute noch in 'Sonderorten' für behinderte Menschen leben, lernen und arbeiten und indem sie durch die unterschiedlichsten Barrieren von Gemeinschaften, Orten, Informationsmöglichkeiten und Kommunikationsräumen ausgeschlossen sind." (Graumann 2008a)
Die UN-Konvention gibt ebenfalls deutlich ambulanten Leistungen vor stationären
Wohnformen den Vorzug. (vgl. ebd.)
Die in Artikel 22 enthaltene "Achtung der Privatsphäre" präzisiert Abwehrrechte vor Übergriffen im Privat- und Wohnbereich, während Artikel 23, "Achtung der Wohnung und der Familie", das Recht auf eine eigene Familie behandelt. So soll beispielsweise statt der zwangsweisen Trennung des Kindes von seiner Familie (aufgrund seiner Behinderung oder der seiner Eltern) entsprechende Unterstützung gewährt werden, damit Eltern ihren Erziehungsaufgaben nachkommen können. (vgl. Graumann 2008a)
Die bedeutende Forderung "Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz" (Artikel 28) begegnet dem (oft dauerhaften Zustand verfestigter) Armut, unter der Menschen mit hohen Hilfebedarf oft (lebenslang) leiden. Der Staat muss daher geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschen mit Behinderung ein angemessenes Einkommen durch Arbeit und durch Sozialleistungen zu ermöglichen, wobei jedoch einem durch Arbeit erwirtschafteten Einkommen Priorität eingeräumt wird. Demnach soll der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt, die Beschäftigung im öffentlichen Dienst sowie der öffentliche Wohnbau Menschen mit Behinderung offen stehen. (vgl. Graumann 2008a) Der Anspruch auf "angemessenen Lebensstandard" reduziert den Einsatz finanzieller Mittel nicht auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse, sondern diese sollen für die effektive Partizipation an der Gesellschaft verwendet werden. Angesichts sinkender Mittel sind auch Trägerorganisationen, die soziale Dienstleistungen im Auftrag des Staates erbringen, gefordert: "Wenn die Mittel, die dafür gesellschaftlich zur Verfügung gestellt werden, nicht ausreichen, sind die Verbände in ihrem sozialpolitischen Engagement gefragt." (vgl. Graumann 2008a)
So groß der Fortschritt auch sein mag, den die UN-Behindertenrechtskonvention verkörpert, ihre Reichweite entfaltet sich erst in der Umsetzung, an der politischen und gesellschaftlichen Kräfte engagiert arbeiten und die kritisch beobachtet werden muss. Die hohe politische Brisanz zeigt das Ergebnis der deutschsprachigen Übersetzung der Konvention, auf die sich Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz geeinigt haben, und die als rechtsverbindlich gilt. Kommentatorin Sigrid Arnade, von der Behindertenorganisation "Netzwerk Artikel 3 e.V." zufolge sind bereits zentrale Leitbegriffe kontrovers und in der deutschen Version daher abgeschwächt wiedergegeben worden: So wurde "inclusion" mit "Integration" und "accessibility" mit "Zugänglichkeit" (statt mit Barrierefreiheit, die über Rollstuhl-Zugänglichkeit hinausgeht) übersetzt. Die Wendung "living independently" betitelte man mit "unabhängiger Lebensführung", statt mit "selbstbestimmten Leben". So erscheint der Begriff "Selbstbestimmung" gar nicht, obwohl die Konvention von diesem Gedanken getragen ist (Arnade 2008: zit. n. Frühauf 2008) und der Begriff in vielen Bestimmungen zentral ist (z.B. Art. 12: Gleichberechtigte Anerkennung als rechts- und handlungsfähige Person; Art. 19: Unabhängiges Leben und Teilhabe an der Gemeinschaft; Art. 22: Schutz der Privatsphäre; Art. 23 : Achtung vor Wohnung und Familie; und Art. 26: Habilitation und Rehabilitation) (vgl. Degener 2009: 7)
Die UN-Konvention bringt aus Sicht des Berliner Instituts für Menschenrechte[26], "große Chancen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu stärken und damit auch langfristig zur Humanisierung der Gesellschaft im Ganzen beizutragen", mit sich (Aichele 2008: 3):
"Indem sie Menschen mit Behinderungen davon befreit, sich selbst als 'defizitär' sehen zu müssen, befreit sie zugleich die Gesellschaft von einer falsch verstandenen Gesundheitsfixierung, durch die all diejenigen an den Rand gedrängt werden, die den durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen von Fitness, Jugendlichkeit und permanenter Leistungsfähigkeit nicht Genüge tun." (Bielefeldt 2009: 16)
Die UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrer Zielbestimmung der effektiven Teilhabe an der Gesellschaft (Inklusion) stellt weitreichende Anforderungen an Politik und Gesellschaft. Die Inhalte des Gesetzes müssen nun von Politik und unter aktiver Beteiligung der Gesellschaft mit Leben erfüllt werden, um eine echte rechtliche Wirksamkeit zu entfalten, wie bereits Nirje festgestellt hat: "Laws and legislative work cannot provide total answers to problem solving and proper actions with regards to the realization of human rights. These can only come into existence in the full cultural and human context. Such problems are not only practical, but also ethical." (Nirje 1985: 65 zit. n. Schalock et al. 2002: 346) Dazu gehört auch die Verbreitung, Erläuterung der UNKonvention und damit verbundene Bewusstseinsbildung bei den Betroffenen selbst[27].
Sigrid Graumann fordert die heute teils utopisch erscheinenden Forderungen für Menschen mit Behinderung zur selbstverständlichen Normalität zu machen, sodass Ansprüche, die aus der UN-Konvention erwachsen, "nicht mehr Kennzeichen einer besonders fortschrittliche Behindertenarbeit sondern der Normalität sein sollen" (Graumann 2008a)
[18] 18 Wird einer Beschwerde stattgegeben und ein Konventionsverstoß festgestellt, so sind keine bindenden rechtlichen Schritte vorgesehen, sondern es wird lediglich eine Empfehlung an den Vertragsstaat ausgesprochen (Art.6 Abs. 3 des Fakultativprotokolls). (vgl. Aichele 2008: 7f)
[19] Februar 2011
[20] "Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz führt die laufenden Geschäfte des Monitoringausschusses als sein Büro und ist auch mit beratender Stimme vertreten." (bmask 2010a)
[21] In der Präambel (Absatz o) lautet dieser Grundsatz folgendermaßen: "Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit haben, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, vor allem dann, wenn diese sie unmittelbar betreffen. " (bmask 2008: 3) Barrierefreiheit im politischen Bereich setzt auch die Übersetzung von Gesetzestexten (insbesondere die Menschen mit Behinderung direkt betreffen) und von Wahlprogrammen in Leichte Sprache soweit wie möglich voraus. Dies ist auch durch den gängigen Slogan "Nichts über uns ohne uns" ausgedrückt.
[22] "Grundsätze" der Konvention, Artikel 3c) und
[23] Inklusion geht über "Integration" hinaus als diese intendiert, "innerhalb bestehender Strukturen Raum zu schaffen auch für Behinderte, sondern gesellschaftliche Strukturen so zu gestalten und zu verändern, dass sie in der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen - gerade auch von Menschen mit Behinderungen - von vornherein besser gerechet werden." (Aichele 2008: 12)
[24] Artikel a)
[25] Der Begriff wird in Artikel 2 Unterabsatz 4 eingeführt. (BMASK 2008: 6)
[26] Das Institut für Menschenrechte fungiert für die Bundesrepublik Deutschland auch als Monitoring- Stelle bzgl. der UN-Behindertenrechtskonvention.
[27] Es gibt schon eine aus dem deutschprachigen Konventionstext abgeleitete Leichter Lesen-Version für Menschen mit Behinderung.
Inhaltsverzeichnis
- 5.1 Warum Beteiligung von Menschen mit Behinderung in der Forschung?
- 5.2 Arten der Beteiligung von Menschen mit Behinderung
- 5.3 Kurzüberblick zu aktuellen Forschungsansätzen mit NutzerInnenbeteiligung
- 5.4 Definition "Peer-Interview"
- 5.5 Methodologische Einordnung des Peer-Interviews
- 5.6 Beispiele für Erhebungen mit Menschen mit Behinderung als Peer- InterviewerInnen:
- 5.7 Vor- und Nachteile der Peer-Methodik mit Menschen mit Behinderung
- 5.8 Besonderheiten bei Menschen mit Behinderung als InterviewerInnen
- 5.9 Ausblick: Verbreitung der Methode - Vernetzung von Forschungsaktivitäten
Vor dem Hintergrund, dass die UN-Behindertenrechtskonvention als Teil der nationalen Rechtsordnung die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen einfordert, drängt sich verstärkt die Fragestellung nach inklusiver Forschung auf. Denn die Erfordernis, dass Chancen und Ergebnisse von Teilhabe auch überprüft werden können, bedingt vielen AutorInnen zufolge, dass Forschung mit Bezug auf Behinderung nicht über Menschen mit Behinderung, sondern in Zusammenarbeit mit ihnen durchgeführt wird. (vgl. Buchner et al. 2011: 1) So kann argumentiert werden, dass erstens ein Recht auf Inklusion im Bereich sie betreffender Forschung besteht, zweitens dass die Perspektive von Menschen mit Behinderung schon allein aus forschungsrelevanten Gründen einen zentralen Stellenwert einnehmen soll.
Buchner, Koenig und Schuppener weisen darauf hin, dass die Entwicklung solcher partizipativer/ emanzipatorischer Forschung nicht zufällig mit dem sich allmählich durchsetzenden Verständnis des sozialen Modells von Behinderung verknüpft ist, wonach das Hauptaugenmerk auf gesellschaftlichen Faktoren, die als Barrieren behindernd wirken, liegt. Die AutorInnen stellen auch fest, dass Behindertenbewegungen, z.B. Selbstvertreter- Initiativen, einen großen Anteil an der verstärkten Teilnahme von Menschen mit Behinderung in der Forschung haben, weil sie dies immer stärker als ihr Recht ansehen und daher einfordern.
Aspekte einer sachorientierten Herangehensweise, z.B. methodische Gründe, legen eine Beteiligung von Menschen mit Behinderung in Forschungsvorhaben ebenso nahe. So kann beispielsweise das Erleben von Teilhabeerfahrungen als subjektive Einschätzung von Lebensbedingungen aus einer externen Sicht gar nicht seriös erhoben werden. Zumindest in theoretischer Hinsicht ist unumstritten, dass die Betroffenenperspektive eine unverzichtbare Sicht darstellt, wenn Menschen mit Behinderung als "ExpertInnen in eigener Sache" Auskunft über sich und ihre Lebensqualität geben.
Gerade im Kontext eines verstärkten Fokus auf Personenzentriertheit - also etwa die möglichst genaue Anpassung von sozialen Dienstleistungen an die konkreten Bedürfnisse der NutzerInnen - kommt die zentrale Rolle von Menschen mit Behinderung zum Tragen, wenn Dienstleistungen z.B. im Rahmen einer Evaluation überprüft werden sollen.
"Ansonsten würde der soziale Sektor fordern, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Gesellschaft inkludiert werden müssen, ohne diese Inklusion in den dafür relevanten Prozessen selbst zu leben und ihnen die dafür notwendige Unterstützung zu bieten" resümiert diesbezüglich die die Selbstvertretungsorganisation "Inclusion Europe". (Inclusion Europe 2010: 24)
Dies trifft umso mehr zu als in der Logik der UN-Konvention nicht Input- sondern Outcome, also das Ergebnis im Sinne der Auswirkungen der Dienstleistungen auf den Lebenskontext von Menschen mit Behinderung maßgeblich ist. (vgl. Inclusion Europe 2010: 25f) So fordert die "EU-Richtlinie für Soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" (SSGI) ebenfalls das Einbeziehen von Menschen mit Behinderung in die Definition und Evaluation von Qualität sozialer Dienstleistungen. Eine Inklusion im Qualitätsmanagement könnte auch eine Überwindung der Dominanz der Interessen von Dienstleistungsanbietern, Kostenträgern und Politik bewirken. (vgl. Inclusion Europe 2010: 25)
Außerdem können moralisch-ethische Gründe für die Vermeidung von exkludierender Forschungspraxis angeführt werden. Zunächst bezogen auf eine mikrosoziologische Ebene gibt es sozialpädagogische Überlegungen, die Effekte auf die Lebenswirklichkeit von Individuen mit Behinderung haben können.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Theorie der "Social Role Valorisation": Wolf Wolfensberger (1983) postuliert mit seinem keineswegs neuem Konzept eine Aufwertung der sozialen Rolle von gesellschaftlichen Gruppen, denen ein negatives Etikett anhaftet. Der Autor formuliert seine These in Bezug auf die Gruppe der behinderten Menschen, die aufgrund eines als negativ deviant eingestuften Verhaltens und Auftretens, häufig von negativen Images bis hin zu Stigmatisierung betroffen sind. (vgl. Pracher et al. 2008: 91) In diesem Kontext weist der Autor auf die Dynamik der sozialen Abwertung hin, von der Menschen mit Behinderung betroffen sein können: Die negative gesellschaftliche Bewertung schränkt die Wahrnehmung ihrer Kompetenzen ein und hindert sie von vornherein daran, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Durch das Zusammenwirken zweier Prozesse ist es Menschen mit Behinderung jedoch möglich, zunächst auf der personalen Ebene eine höhere soziale Anerkennung zu erhalten: Zu diesem Zweck sollen Menschen mit Behinderung erstens soziale Rollen und Funktionen mit höherem gesellschaftlichen Ansehen einnehmen, und zweitens eine Kompetenzerweiterung erreichen, indem sie neue Fähigkeiten erwerben. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 24) Folgt man der Annahme, dass Prozesse der sozialen Abwertung und Aufwertung sich auf kollektive Weise vollziehen, so ist es denkbar, dass bei ausreichenden Ergebnissen sozialer Aufwertung in einer sozialen Gruppe oder Minderheit diese auf die ganze Gruppe ausstrahlt. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 25)
So ist die Erlangung höherer sozialer Anerkennung mithilfe der Rolle der InterviewerInnen bzw. NutzerInnen/KonsumentInnen, die in der Artikulation ihrer Bedürfnisse ernst genommen werden, sicherlich möglich. (vgl. ebd.) Konkret kann man solche Empowerment-Prozesse ebenfalls anstoßen, indem Menschen mit Behinderung als kompetente BeraterInnen für andere beeinträchtigte Menschen ("Peer-Counseling") oder beratend im politischen und Verwaltungsbereich fungieren. Sie sind laut Pracher und Bernhart auch im Stande, als "Übersetzer" zwischen "behinderten" und "nichtbehinderten" Lebenswelten zu vermitteln sowie zu erkennen und zu verdeutlichen, welche Probleme von der Behinderung und welche von der Gesellschaft "produziert" sind. (vgl. Pracher et al. 2008: 96)
Im folgenden Abschnitt soll auf die Beteiligungsformen von Menschen mit Behinderung im Bereich der Forschung eingegangen werden, die in der Literatur diskutiert werden.
In der Literatur scheint es keine einheitlichen Definitionen zu den Forschungsformen unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderung zu geben. Dies mag u.a. darauf zurückzuführen sein, dass Buchner et al. zufolge partizipative Forschung im deutschen Sprachraum immer noch eine Neuerung darstellt und dass existierende Forschungsprojekte, meist eher kleiner angelegt, recht heterogener Art und häufig nicht dokumentiert sind. (vgl. Buchner et al. 2011: 8)
Mit Blick auf verschiedene partizipatorische Forschungsprojekte in Großbritannien seit den 1990er Jahren, wo inklusive Forschung sich bereits mehr durchgesetzt hat, nennen Buchner et al. folgende Rollen, die Menschen mit Behinderung eingenommen haben:
-
"Ko-Forscher(innen) (vgl. March et al. 1997)
-
Mitglieder von Beratungsgremien (Advisory Boards) bzw. Referenzgruppen (vgl. Minkes et al. 1995)
-
Interviewer(innen) (vgl. Gramlich et al. 2002)
-
(Mit-)Herausgeber(innen) von Forschungspublikationen (vgl. Atkinson et al. 2000)" (Buchner et al. 2011: 6)
In der Literatur sind vor allem die Forschungsansätze
-
emanzipatorische Forschung/ emancipatory research,
-
partizipative Forschung/ participatory (action) research,
-
Evaluationsforschung nach partizipativen Kriterien/ inclsuive evaluation
verbreitet, die von Walmsley und Johnson (2003) unter dem Überbegriff inklusive Forschung geführt werden. (vgl. Krach 2011: 12)
Gemeinsam ist den verschiedenen Forschungsansätzen das Unterscheidungskriterium der Kontrolle über den Forschungsprozess. Häufig werden vor allem folgende Differenzierungen der Beteiligungsform von Menschen mit Behinderung in empirischen Untersuchungen angegeben:
-
Direkte/indirekte Beteiligung von NutzerInnen
Die Beteiligungsform direkte Partizipation ist mit einer aktiven Mitwirkung der NutzerInnen verbunden, z.B. wenn NutzerInnen empirische Erhebungen selbst planen und/oder durchführen. Unter indirekter Beteiligung versteht man die passive Einbindung von NutzerInnen, indem diese beispielsweise "Gegenstand" einer teilnehmenden Beobachtung sind oder in einem Interview befragt werden. (vgl. Promberger et al. 2008: 55)
-
Partizipative vs. emanzipatorische Forschung
Zarb (1992) trifft eine Unterscheidung zwischen partizipativer und emanzipatorischer Forschung. Bei der partizipativen Variante sind demnach Menschen mit Behinderung, z.B. als Befragte, involviert, während emanzipatorische Forschung ihre aktive Mitwirkung an der Durchführung des Forschungsvorhabens vorsieht. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 109)
Beide der oben dargestellten analytischen Unterscheidungen der NutzerInnenbeteiligung korrespondieren mit der Dichotomie passive Rolle "Forschungsobjekt" - aktive Rolle "Forschungssubjekt", wie sie Kannonier-Finster und Ziegler vorschlagen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 109)
Anhand des Unterscheidungskriteriums der Geschlossenheit des Forschungsprozesses kann man bei der NutzerInnenbeteiligung somit die Einbindung in den gesamten Forschungsprozess, von der Methodenentwicklung (Konzeption der Erhebungsinstrumente) über Erhebungsphase bis hin zur Auswertung und Präsentation der Ergebnisse, von einer auf die eigentliche Erhebungsphase beschränkte Beteiligungsform, abgrenzen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 109)
Die stark vom Empowerment-Gedanken geprägten Disability Studies beispielsweise vertreten einen emanzipatorischen Forschungsanspruch, wonach Menschen mit Behinderung in allen Phasen des Forschungsprozesses eingebunden sein sollten. (vgl. Buchner et al. 2011: 5) Diesem Verständnis nach ist - wie Walmsley und Johnson (2003) ausführen - ein Forschungsvorhaben erst dann inklusiv, wenn Menschen mit Behinderung als aktive ForscherInnen mit eigenen Forschungsfragen agieren und über die Kontrolle des Forschungsprozesses sowie über die Forschungsergebnisse verfügen. (vgl. Krach 2011: 12) Hinzu kommt die Forderung danach, dass ForscherInnen den Forschungssubjekten, z.B. Behindertenorganisationen, zur Rechenschaft verpflichtet sind - oder diese sogar als Auftraggeber auftreten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Die Behindertenorganisationen fordern, dass diese auch in Leichter Sprache zugänglich und nutzbar gemacht werden. (vgl. Buchner et al. 2011: 6) So schlägt Zarb (1992) vor, dass Forschung schließlich einer Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung dienen soll. (vgl. Buchner et al. 2011: 5) Anhand eines kurzen Überblicks über Forschungsansätze, die mehr oder weniger inklusiv gestaltet sind, soll nun auf vergleichende Weise gezeigt werden, wie Menschen mit Behinderung in der Forschungspraxis einbezogen werden können. Bei den vorgestellten Forschungsmodellen stehen Menschen mit Behinderung vorwiegend in ihrer Rolle als NutzerInnen von verschiedenen sozialen Dienstleistungen im Mittelpunkt.
In einer vergleichenden Analyse über die Verbreitung von Forschungsansätzen mit NutzerInnenbeteiligung in verschiedenen europäischen Ländern[28], die Geert Freyhof für die Selbstvertretungsorganisation "Inclusion Europe" durchgeführt hat, bestätigt die obige Differenzierung für die Forschungspraxis: So spielen Menschen mit Behinderung einerseits die aktiven Rollen von geschulten InterviewerInnen und Mitgliedern in anderen Funktionen in Evaluatoren-Teams, andererseits haben sie die passive Rolle des Befragten inne bzw. sind nur indirekt in der Forschung involviert. (vgl. Freyhof 2010: 25)
Freyhof kommt zum Schluss, dass sich die Befragung von NutzerInnen mit Behinderungen mittlerweile als Standard etabliert hat. In der Mehrheit der von ihm untersuchten Ansätze ist Menschen mit Behinderung zumindest auch eine Begleitrolle in der Forschung zugedacht, beispielsweise in Form von Mitarbeit in einem Forschungsteam unter Anleitung von WissenschaftlerInnen und ProfessionistInnen. Die Verantwortung über den ganzen Forschungsprozess hatten sie nur im Falle des österreichischen Evaluationsmodell "NUEVA". (vgl. Freyhof 2010: 26) Darüber hinaus werden Evaluationsergebnisse den befragten NutzerInnen mit Behinderung häufig nicht anhand leicht verständlicher Darstellungen zugänglich gemacht. (vgl. Freyhof 2010: 29)
Generell fand der Autor auf Basis seiner Vergleichsstudie den Nachweis für den Trend einer immer stärkeren NutzerInnenbeteiligung in der Evaluationsforschung. (vgl. Freyhof 2010: 29) Übereinstimmend konstatiert Kiernan (1999) ebenfalls den Bedeutungsgewinnder Methodik aktiver NutzerInnenbeteiligung, sodass Menschen mit Behinderung verstärkt die Rolle von "co-workern" bei Forschungsunternehmen einnehmen. (vgl. Kannonier- Finster et al. 2008: 110)
Kurt Promberger und Walter Lorenz geben mit ihrem Vergleich von dreizehn Forschungsansätzen einen detaillierteren Einblick in die internationale Forschungspraxis mit Blick auf die Beteiligung von behinderten Menschen. Von den untersuchten Forschungsansätzen[29] setzen lediglich "Ask Me!", "People First" und "NUEVA" Peer- InterviewerInnen - also Menschen mit Behinderung, die andere beeinträchtigte Menschen befragen - ein. (vgl. Promberger et al. 2008: 56) Die folgende Tabelle soll veranschaulichen, welche Methoden die verschiedenen Evaluationsmodelle verwenden und welche Personengruppen sie bei Befragungen und Gesprächen im Rahmen der Evaluation einbeziehen.
Abb. 8: Forschungsansätze mit NutzerInnenbeteiligung und verwendete Methoden (Darstellung nach Promberger et al. 2008: 54)
|
Ansätze |
Befragung/ Gespräche |
Teilnehmende Beobachtung |
Dokumentenanalyse |
||
|
Nutzer- Innen |
Mitarbeiter- Innen |
Angehörige, FürsprecherInnen |
|||
|
AQUA-FUD |
* |
* |
* |
||
|
AQUA-NetOH |
* |
* |
|||
|
AQUA-UWO |
* |
* |
* |
* |
|
|
LEWO |
* |
* |
* |
* |
* |
|
PASSING |
* |
* |
* |
* |
* |
|
GBM/POB |
* |
* |
* |
* |
|
|
QUOFHI |
* |
* |
* |
||
|
SIVUS |
* |
* |
|||
|
Ask Me! |
* |
(*) |
(*) |
||
|
People First |
* |
||||
|
Schöner Wohnen |
* |
(*) |
(*) |
||
|
NUEVA |
* |
* |
(*) |
(*) |
Die folgende Tabelle soll nun detaillierter darstellen, wer bei den jeweiligen Formen der Evaluation von wem evaluiert wird (ohne Berücksichtigung der Methoden). Man kann die Forschungsansätze zunächst hinsichtlich der Art und Zusammensetzung der Forschungsakteure unterscheiden: In einigen Fällen gibt es Evaluatorenteams (PASSING, AQUA-UWO, LEWO), die anderen Ansätze evaluieren über einzelne Interviewende. (vgl. Promberger et al. 2008: 47f)
Abb. 9: Forschungsansätze nach beteiligten Forschungsakteuren (Darstellung nach Promberger et al. 2008:48-51)
|
Forschungsansatz |
EvaluatorInnen |
Evaluierte |
|
AQUA-FUD |
Externer Berater, Leitungskräfte, MitarbeiterInnen, NutzerInnen, Angehörige |
MitarbeiterInnen, NutzerInnen |
|
AQUA-NetOH |
MitarbeiterInnen |
NutzerInnen |
|
AQUA-UWO |
Trägervertreter, Externer Berater, Leitungskräfte, MitarbeiterInnen, NutzerInnen, Angehörige |
NutzerInnen, MitarbeiterInnen |
|
LEWO |
Moderator (Externer Berater), MitarbeiterInnen, NutzerInnen, Angehörige/FürsprecherInnen |
NutzerInnen, MitarbeiterInnen, Angehörige |
|
PASSING |
MitarbeiterInnen, NutzerInnen, Angehörige, Fachleute aus Verbänden, andere Interessierte |
NutzerInnen, MitarbeiterInnen |
|
GBM/POB |
MitarbeiterInnen, ModeratorIn |
NutzerInnen, MitarbeiterInnen |
|
QUOFHI |
Fremdevaluation: Externe ExpertInnen/ Selbstevaluation: Leitungskräfte, MitarbeiterInnen, NutzerInnen |
NutzerInnen, MitarbeiterInnen, Angehörige, Institutionen |
|
SIVUS |
SchülerInnen nahe gelegener Ausbildungsstätten |
NutzerInnen |
|
Ask Me! |
NutzerInnen |
NutzerInnen (oder stv. FürsprecherInnen und MitarbeiterInnen) |
|
People First |
NutzerInnen |
NutzerInnen |
|
Schöner Wohnen |
NutzerInnen, institutionsunabhängige Personen wie PraktikantInnen, Zivildienstleistende, Studierende, externe MitarbeiterInnen |
NutzerInnen (oder stv. Angehörige, FürsprecherInnen, MitarbeiterInnen) |
|
NUEVA |
NutzerInnen |
NutzerInnen, Einrichtungsleitung |
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die hier vorgestellten Forschungsmodelle neben rein methodischen Unterschieden teils sehr unterschiedliche Zugänge und Zielsetzungen aufweisen. Diese reichen von der Erhebung der Zufriedenheit mit Dienstleistungen (Schöner Wohnen, NUEVA, LEWO, Ask Me!), Optimierung von Betreuungsabläufen und -konzepten (GBM/POB), Qualitätssicherung spezifischer Unterstützungsangebote und Hilfen in verschiedenen Kontexten (AQUA-FUD, QUOFHI, AQUA-UWO). (vgl. Promberger et al. 2008: 18)
Der nächste Abschnitt stellt die für die vorliegende Arbeit zentrale Methode "Peer-
Interview" vor.
Der zentrale Begriff "Peer"[30] bestimmt die Methode Peer-Interview näher. Er bezeichnet
"eine Person, die 'gleich' bzw. 'gleichgestellt' ist mit einer anderen Person, wobei dieser gleiche Status oder Rang sich auf verschiedenste Merkmale beziehen kann, z.B. auf den rechtlichen Stand, den sozialen Status, das Alter, aber auch auf Können und Fähigkeiten." (Gutknecht-Gmeiner 2008: 37f)
Im Forschungskontext zielt das Moment der Gleichstellung stets auf "die im Fokus stehende Bezugsgruppe" ab. (Fröhlich et al. 2009: 26)
Für diese Arbeit ist die Variante des Peer-Interviews relevant, bei der Menschen mit Behinderung Informationen über andere beeinträchtigte Menschen in ähnlichen Lebenszusammenhängen (z.B. Wohn- und Therapie-Einrichtungen, integrative Arbeitsangebote) sammeln.
Gutknecht-Gmeiner setzt eine ähnliche Methode, Peer-Review, für Evaluationen im Schulkontext ein, deren Forschungsgrundsätze für Peer-Interviews ebenso Gültigkeit besitzen. Beim Peer-Review evaluieren gleichgestellte Fachkräfte die Leistung ihrer KollegInnen, während beim Peer-Interview mit Menschen mit Behinderung diese als Peers der DienstleistungsnutzerInnen auftreten, jedoch nicht als Peers der Dienstleistungsanbieter. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 27) Demzufolge sind die zugrundeliegenden Forschungsprinzipien übertragbar, wenngleich die Methoden hinsichtlich ihrer konkreten Umsetzung Unterschiede aufweisen.
Gutknecht-Gmeiner findet folgende Charakteristika für Peers:
-
Ein Peer ist gleichgestellt mit der Befragungsperson bzw. der Person der betreffenden Evaluierung;
-
ist Mitglied einer ähnlichen Einrichtung;
-
ein Peer ist jedoch extern, stammt also aus einer anderen Einrichtung; und
-
verfügt über spezifisches Wissen und Verständnis, sodass er/sie das "Insiderwissen" über die zu evaluierende Einrichtung/ Dienstleistung einbringt und gleichzeitig eine gewisse Distanz behält - im Sinne eines "externen Insiders". (vgl. Gutknecht-Gmeiner 2008: 51f)
Menschen mit Behinderung, die als Peer-InterviewerInnen auftreten, teilen also ähnliche Erfahrungen über Lebenswelten, die nichtbehinderten Menschen unzugänglich sind.Aufgrund des gleichen Erfahrungshorizonts und gleicher geteilter Erfahrungen, die soziale Nähe bedeuten, ist es Peer-InterviewerInnen daher möglich, in der Interaktion mit ihrem gleichrangigen Gegenüber eine von Anfang an vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre in der Interviewsituation herzustellen. (vgl. Kannonier-Finster 2008: 113)
Neben der Bedeutung "Peer-Interview" fand der Begriff Eingang im Bereich der Selbsthilfe, sodass er Unterstützungs-, Beratungs- und Bildungstechniken bezeichnet, die Menschen mit Behinderung für ihre Peers anbieten wie "Peer Support", "Peer Counseling", "Peer Assistent", "Peer Educator", "Peer Consultant" und "Peer Helper". Das am weitesten verbreitete "Peer Counseling" stellt eine Form der Beratung dar, bei dem Menschen mit Behinderung einander bei der Bereitstellung von Informationen bis hin zu jahrelang andauernden Hilfestellungen unterstützen. Auch dabei geht man davon aus, dass bei Interaktionen zwischen Menschen mit Behinderung als Gleichrangige und Gleichgesinnte und mit ähnlichem Erfahrungshintergrund eine höhere Glaubwürdigkeit besteht und somit seitens der Hilfesuchenden eine größere Offenheit und geringere Hemmschwelle, über eigene Probleme zu sprechen. (vgl. Kannonier-Finster 2008: 116) Diese Herangehensweise in der Sozialarbeit setzt damit voraus, "[...] dass Peers einen direkteren und einfacheren Zugang zu KlientInnen als professionelle BeraterInnen haben und auch Hilfs- und Beratungsangebote von Peers besser akzeptiert werden." (Gutknecht- Gmeiner 2008: 57)
In diesem Abschnitt soll die Methode einerseits in methodologischer Hinsicht näher erläutert werden und andererseits der Anspruch und das Potential der Veränderung der sozialen Wirklichkeit dargestellt werden. Denn eine lediglich methodische Betrachtungsweise des Peer-Interviews würde aufgrund des emanzipatorischen Potentials der Methode laut Kannonier-Finster und Ziegler zu kurz greifen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 109) Deshalb soll an dieser Stelle kurz auf die Zugehörigkeit zur Aktionsforschungsmethodik hingewiesen werden.
"Aktionsforschung", die auch als "Handlungsforschung", und heute zunehmend - mit Bezugnahme der Relativierung ihrer Einzelstellung - als "Praxisforschung" bezeichnet wird, ist im angloamerikanischen Sprachraum als "action research" oder "participatory action research" bekannt. (vgl. Bortz et al. 2009: 341) Der Literatur zufolge wurde der Begriff "Aktionsforschung" von Kurt Lewin (1953) entwickelt, der in den 1940er Jahren Untersuchungen zu gesellschaftlichen Minderheiten in situ durchführte und damit den Anspruch verband, Lösungen für ihre Diskriminierung zu finden. (vgl. ebd.) Josef Gunz zufolge war jedoch Jacob Levi Moreno (1892-1974) eigentlicher Begründer der Aktionsforschung, von dem Lewin (1890-1947) erst beeinflusst worden ist. (vgl. Gunz 1998: 95f)
Nach verstärkter Rezeption des Forschungsansatzes in den 1970er Jahren, begünstigt durch die Studierendenbewegung und das reformorientierte politische Klima, wurde dieser danach beinahe ausnahmslos im Bereich der Pädagogik eingesetzt, mit dem Schwerpunkt der Bildungsforschung. (vgl. Bortz et al. 2009: 341) Gunz berichtet von einem stark abnehmenden Interesse an Aktionsforschung ab den 1980er Jahren, gibt aber an, dass in den 1980er und 1990er Jahren die Forschungsmethode an mehreren österreichischen Universitäten gelehrt wurde. Laut einer Umfrage in Österreich im Jahr 1995 beschäftigte sich die überwiegende Mehrheit der genannten Projekte mit Forschung im Schulsektor, einzelne befassten sich mit Entwicklungszusammenarbeit, Gesundheit und Umwelt. (vgl. Gunz 1998: 106f)
John Elliott, der die "action research" im Bereich der Schulentwicklung vorangetrieben hat, definiert Aktionsforschung als "die systematische Untersuchung beruflicher Situationen in der Absicht, diese zu verbessern". (Elliott 1991: 96 zit. n. Welte 1998: 166) Der Forschungsansatz will also die soziale Wirklichkeit, die er erkundet, verändern: "Aktionsforschung hat zum Ziel, mittels begleitender Forschung das soziale Handeln gemeinsam zu analysieren und zu reflektieren, um aufgetauchte soziale Probleme bewältigen zu können." (Gunz 1998: 97)
Dabei setzen AktionsforscherInnen auf gleichberechtigte ForschungspartnerInnen, einen hohen Grad an Beteiligung der Forschungssubjekte, auf Abstimmung und konsensuales Vorgehen und einen hohen Praxisbezug. Der Forschungsprozess ist charakterisiert als "Lern- und Veränderungsprozess". (Bortz et al. 2009: 342)
Kennzeichen der Aktionsforschung ist ebenfalls "eine sich ständig wiederholende Prozeßhaftigkeit, ein Verbund zwischen Forschung und Aktion, wobei die Aktion der Forschung nachgereiht ist: Handeln, Reflexion über dieses Handeln, daraus abgeleitete Handlungsstrategien." (Gunz 1998: 99) Das bedeutet, mithilfe dieser Methode, nach Moser "einen distanzierten Blick auf die Praxis zu gewinnen und damit das Handeln klären", was im Alltagshandeln selbst nicht möglich wäre. (Moser 1997: 7) Aktionsforschung verbindet laut Gunz mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit einen emanzipatorischen Anspruch im Verständnis der Kritischen Theorie, sie intendiert eine "Anstiftung zum Umdenken, zur Revision, zur Veränderung". (Gunz 1998: 102) Die Methodik zielt letztlich auf mehr Mitbestimmung ab. (vgl. Gunz 1998: 109) Vermutlich aber teilen nicht alle Forschungsakteure, die mit der Methodik arbeiten, diese Prämissen.
Gunz relativiert gleichzeitig das tatsächliche gesellschaftsverändernde Potential der
Methode, das wiederum in der Verfasstheit der Gesellschaft selbst begründet ist, und warnt
vor "überhöhten Erwartungen", die "nicht einlösbar" sind, sowie vor Widerständen, mit denen der Forschungsansatz häufig konfrontiert ist. (Gunz 1998: 107f)
Aktionsforschung besitzt aufgrund ihrer Arbeitsweise eine gewisse Nähe zum interpretativen Paradigma und zur qualitativen Sozialforschung, was sich aufgrund des Methodenpluralismus, insbesondere der jüngeren Aktionsforschung, verstärkt. (vgl. Gunz 1998: 105f, Welte 1998: 174) Dies schließt aber die Anwendung quantitativer Methoden keineswegs aus, die qualitative Methodologie scheint aber laut Moser in der praxisnahen Forschung oft geeigneter. (vgl. Moser 1995: 98f) Er weist auch darauf hin, dass nicht bestimmte Methoden die Handlungsforschung auszeichnen, sondern ihre kombinierte Anwendung im Forschungsprozess und der Grad an Reflektiertheit ihres Einsatzes zu einem jeweiligen definierten Zweck (z.B. durch ein Experiment eine bestimmte soziale Situation herzustellen). (vgl. Moser 1995: 98f) Für Welte steht bei Aktionsforschung ebenso nicht die Methodenwahl, sondern vielmehr deren "Einbindung in eine übergreifendere Forschungsstrategie" im Vordergrund. (Welte 1998: 174)
Häufige kritische Einwände gegen die Methodik lauten dahingehend, dass das angebliche Qualitätsmerkmal der Distanz im Forschungsprozess aufgrund der Involvierung von Betroffenen nicht erfüllt ist und dass es zu einer Überforderung der PraktikerInnen durch methodische Fragen kommen würde. Des weiteren wird der Methode mangelnde Validität der Ergebnisse und geringe Generalisierung von Forschungsergebnissen vorgeworfen. (vgl. Welte 1998: 175ff, Bortz et al. 2009: 342f)
Die Peer-Methodik teilt die genannten Prinzipien der Aktionsforschung, betont im Unterschied dazu aber noch mehr den partizipativen Charakter des Forschungsprozesses und hebt den Peer-Status und Expertenstatus der Beteiligten besonders hervor. (vgl. Moser 1997: 14) Whitney-Thomas verbindet mit "participatory action research" unter möglichst gleichberechtigter Mitwirkung von Menschen mit Behinderung eine andauernde gegenseitige Lernstrategie als einer "continuous mutual learning strategy" (Whyte 1991 zit. n. Whitney-Thomas 1997: 194; kursiv im Orig.) und eines "mutually educative enterprise". (Lather 1986 zit. n. ebd.; kursiv im Orig.) Mit Bezug auf McTaggert stellt Whitney-Thomas die potentielle Aneignung des Forschungsprozesses und den daraus erwachsenen Erkenntnissen heraus, wenn Beteiligung folgende praktische Bedeutung annimmt:
"sharing in the way research ist conceptualized, practiced, and brought to bear on the lifeworld. It means ownership - responsible agency in the production of knowledge and the improvement on practice" (McTaggert 1991: 171 zit. n. Whitney-Thomas 1997: 193)
Sie ist ebenfalls einem emanzipatorischen Anspruch sowie dem Aufdecken von Bedürfnissen und nicht eingelösten Forderungen verpflichtet. So soll der Handlungsdruck für Veränderungen gestärkt werden, umso mehr als dies von den Betroffenen selbst geleistet und artikuliert wird.
Bei der Peer-Methodik ist auch eine klare Zuordnung hinsichtlich der Methoden weder möglich noch sinnvoll - dies wird je nach Ziel der jeweiligen Erhebung entschieden. Dies drückt sich beispielsweise im Ansatz von Kannonier-Finster und Ziegler bezüglich des Peer-Interviews aus, wonach sie die von ihnen untersuchten Interview-Settings (siehe nächster Abschnitt) als standardisierte Befragungen in unstandardisierten Befragungssituationen einstuft. (Kannonier-Finster et al. 2008: 112)
Bonham, Volkman und Sorensen, die Projektkoordination von Ask Me!, einer Panelumfrage umgesetzt mit Peer-InterviewerInnen, die im Folgenden vorgestellt wird, geben z.B. für ihre Arbeitsweise an, folgenden Forschungsgrundsätzen partizipativer Aktionsforschung, in Anlehnung an Jean Whitney-Thomas (1996), verpflichtet zu sein:
-
Menschen mit geistiger Behinderung identifizieren Aspekte, die für ihre Lebensqualität maßgeblich sind und die in die Befragung einfließen, selbst;
-
Menschen mit geistiger Behinderung werden direkt über ihr Leben befragt;
-
Menschen mit geistiger Behinderung fungieren als InterviewerInnen und befragen ihre Peers
-
die auf diese Weise gesammelten Daten haben eine Empowerment-Funktion für Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Bonham et al. 2009: 1)
Im Folgenden sollen drei Umfrageprojekte, die auf Peer-InterviewerInnen setzen, vorgestellt werden. Die Forschungsansätze "Ask Me!" und "NUEVA" sind detaillierter dargestellt, weil sie weiter fortgeschritten, daher über umfassendere Erfahrungen verfügen sowie auch besser dokumentiert sind.
"People First", eine Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit geistiger Behinderung, führte 1994 in London, in den Stadtteilen Haringey und Sutton, eine Evaluation anhand von Befragungen mit Peer-InterviewerInnen durch. Gegenstand der Studie waren zum Einen der Wechsel von KlientInnen von stationären Langzeit-Einrichtungen zu Gemeinschaftswohnen (z.B. betreutes Wohnen, Wohngemeinschaft), zum Anderen Unterstützungsdienste, die Hilfe bei der Suche der geeigneten Wohnform bereitstellen. Das zweiköpfige Interviewteam, bestehend aus Alice Etherington und Brian Stocker, beide Mitglieder der Selbstvertretungsbewegung "People First", führte nach der Absolvierung einer Interviewerschulung, die Einzelbefragungen anhand eines Fragebogens mit Bildern durch. Die InterviewerInnen wurden von Andrea Wittaker, die dem "King's Fund Centre" bzw. dem "Charities Evaluation Services" zugehörig ist, beratend unterstützt. (vgl. Promberger et al. 2008: 37) Es gibt keine Hinweise auf eine Weiterführung der Peer- Interview-Aktivitäten und die Gründe, die dafür verantwortlich sind.
1996 wurde im US-Bundesstaat Maryland das "Ask Me!"-Umfrageprojekt durch ein breites Konsortium aus den maßgeblichen Stellen "Developmental Disabilities Administration" (DDA) , "Maryland Developmental Disabilities Council", "Maryland Disability Law Center", "Maryland Association of Community Service for Persons with Developmental Disabilites", The Arc of Maryland sowie der Selbstvertretungsinitiative "People On the Go" ins Leben gerufen. Der Anlass resultierte aus einem vom "Maryland Disability Law Center" angestoßenen Gerichtsurteil zu sozialen Dienstleistungen, bei dem sich die Parteien in einem Vergleich auf die Durchführung einer Erhebung der Lebens- und Dienstleistungsqualität einigten. (vgl. Bonham 2008: 2) 1998 gestartet, werden nach drei Jahren Pilotbetrieb seit dem Jahr 2002 repräsentative Erhebungen (mit zweistufigen Zufallsstichproben) im Vier-Jahres-Zyklen durchgeführt, wobei jährlich etwa 1000 Personen befragt werden. Die bundesstaatliche "DDA" in Maryland tritt dabei als Auftraggeber und Financier der Umfragen auf. (vgl. Bonham 2008: 1, Schalock et al. 2003: 232)
Menschen mit geistiger Behinderung durchlaufen eine Ausbildung als InterviewerInnen, um andere behinderte Menschen zu ihrer Zufriedenheit mit der von der "DDA" erbrachten Dienstleistungsqualität sowie zu ihrer Lebensqualität und deren Einflussfaktoren zu befragen. Zweck der Erhebungen ist einerseits eine Bewertung der Lebensqualität aus NutzerInnensicht ("consumer-based quality of life assessment"), und andererseits die Beurteilung der Produktqualität von sozialen Dienstleistungen, die am Ende bei den NutzerInnen ankommt ("consumer outcome"). (vgl. Promberger et al. 2008: 26) Menschen mit Behinderung sind bei der Konzeption des Instruments, der Durchführung der Interviews und der Dateneingabe intensiv beteiligt. (vgl. Bonham et al. 2009: 1)
In Vorbereitung auf die Interviews werden den Einrichtungen die von der Zufallsstichprobe ausgewählten Personen schriftlich mitgeteilt. Das Personal gibt es an die jeweiligen Betroffenen weiter und trifft die notwendigen Vorbereitungen. Die Durchführung der Befragung obliegt vollständig den Peer-InterviewerInnen. Das Interviewer-Team bestehend aus zwei InterviewerInnen mit geistiger Behinderung (in den Rollen des Befragers und des Protokollierers) befragen dabei eine/n DienstleistungsnutzerIn der DDA. Am Anfang jeder Befragung stehen sechs Testfragen[31], die den Peer-InterviewerInnen helfen sollen, die Entscheidungsfähigkeit und das Verständnis des jeweiligen Interviewten ("informed consent") einschätzen zu können und gegebenenfalls auf eine Stellvertreterbefragung auszuweichen. Nach diesem einleitenden Frageblock entscheiden die Peer-
InterviewerInnen eigenständig, ob der jeweilige Gesprächspartner selbst einwilligen und ausgehend davon interviewt werden kann. (vgl. Bonham 2008: 6)
Ist eine persönliche Befragung der jeweiligen Person nicht möglich, steht den InterviewerInnen ein Bevollmächtigten-Team aus zwei FürsprecherInnen (z.B. Angehörigen) und/oder MitarbeiterInnen mit Bezug auf die befragten KlientInnen aus der jeweiligen Einrichtung für ein stellvertretendes Interview zur Verfügung. Auf die Proxieswird in einer festgelegten Rangfolge zurückgegriffen, bei der die Tagesbetreuung an erster Stelle steht, gefolgt von Angehörigen und FreundInnen, sowie drittens die Wohnbetreuung. (vgl. Bonham 2008: 7)
"Ask Me!" sieht auch einen nicht in die Interviewsituation eingebundenen "Supervisor" vor, der bereitsteht, wenn die Befragten von gewalttätigen Übergriffen, Misshandlung oder Missbrauch berichten, was hin und wieder vorkommt. In diesem Fall macht der "Supervisor" mit Einverständnis des Betroffenen eine Anzeige. Generell gibt es einen sehr ernsthaften und umsichtigen Umgang mit den Erfordernissen von Vertraulichkeit bei "Ask Me!". (vgl. ebd.)
Eine Befragung dauert durchschnittlich 20-30 Minuten. Das Interviewer-Team setzt als Hilfsmittel Karten, die mit Smileys die Antwortmöglichkeiten visualisieren ("flash cards"), ein. (vgl. Promberger et al. 2008: 26, Bonham 2008: 5)
Der verwendete Fragebogen wurde seit dem Pilotprojekt völlig neu konzipiert und integriert neben dem "Quality of Life Questionnaire" von Robert L. Schalock und Ken Keith Fragen der NutzerInnen. Von der "Signs of Quality"-Broschüre von "People On the Go", die "DDA"-Dienstleistungsqualität überprüft, wurden Dreiviertel der Fragen der SelbstvertreterInnen in den Fragebogen übernommen. (vgl. Bonham et al. 2004: 350) Der Fragebogen umfasst insgesamt 56 Fragen und setzt sich aus jeweils sechs Fragen zu acht Kernthemen, die die Lebensqualität-Dimensionen nach Schalock repräsentieren, einem zusätzlichen Frageblock zur Mobilität und drei Fragen zur Validitätskontrolle zusammen. (vgl. Bonham 2008: 5)
Aktuell haben die Peer-InterviewerInnen in Maryland zwischen 2006 und 2009 Daten in Interviews mit ungefähr 5000 Menschen mit geistiger Behinderung, die Dienstleistungen der Behörde nutzen, gesammelt. Die AuftragnehmerInnen befragten 77% der Stichprobe direkt, darunter waren 19% der Interviewpartner mit einer schweren Behinderung. Daten über NutzerInnen, die nicht von InterviewerInnen befragt worden konnten, erhob man über Stellvertreterbefragungen ("Proxies"). (vgl. Bonham et al. 2009: i)
Die Umfrageergebnisse sollen Anhaltspunkte für konkrete Maßnahmen bieten, Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich der Behindertenpolitik unterstützen sowie die Formulierung von Zielbestimmungen fördern. (vgl. Schalock et al. 2003: 232) Indem auf eine nutzerbezogene Weise die Weiterentwicklung der Dienstleistungen vorangetrieben wird, erhält die Politik die Möglichkeit, die Lebensqualität der Betroffenen ihren Anliegen entsprechend zu erhöhen - und nicht zuletzt die Selbstbestimmung der involvierten InterviewerInnen und NutzerInnen zu steigern. (vgl. Promberger et al. 2008: 26f)
Jedes Jahr werden für die "Ask Me!"-Erhebung 35 bis 40 Peer-InterviewerInnen als Teilzeit-Beschäftigte angestellt. Sie erhalten pro Interview 11 US-Dollar, auch wenn dieses nicht zustande kommt. Die ProjektmitarbeiterInnen, die Telefoninterviews und die Dateneingabe durchführen, werden auf Stundenbasis bezahlt. Die Peer-InterviewerInnenwerden auch für das absolvierte Training entlohnt. (vgl. Bonham 2008: 9)
Laut Bonham und seinen Mitarbeiterinnen sind die Erhebungsergebnisse auf der politischen Ebene des Bundesstaats, sowie für die Dienstleistungsanbieter und in persönlicher Hinsicht für die NutzerInnen relevant, weil sie, an den Bedürfnissen der NutzerInnen orientiert, sich zur Bewertung und Planung von Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung besonders eignen. (vgl. Bonham et al. 2009: 1)
"NUEVA" ("Nutzerinnen und Nutzer evaluieren") ist ein Erhebungsdesign zur Evaluation von sozialen Dienstleistungen im Bereich Wohnen und Arbeit, das zwischen 2001 und 2004 in Kooperation mit 24 Menschen mit Behinderung entwickelt worden ist. Die UrheberInnen sind Walburga Fröhlich und Klaus Candussi, die Verein und GmbH "atempo" als Anbieter von "NUEVA" mit Sitz in Graz gegründet haben. Als Pilotprojekt und im Folgenden flächendeckend wurde es in den Bundesländern Wien und Steiermark für Evaluationen verwendet. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 13) Zentrales Ziel von NUEVA ist die Beurteilung u.a. der Ergebnisqualität von Dienstleistungsangeboten aus Sicht der NutzerInnen: "Konkrete Aussagen von NutzerInnen zu Soll- und Ist-Werten fördern dabei die Diskussion um Qualitätsstandards der Leistungen", sei die Intention des Instruments laut Fröhlich. (ebd.)
Die "NUEVA"-Methode versteht sich als "nutzergesteuerte Evaluation", die Peer- InterviewerInnen wirken daher auch in der Dateneingabe sowie der Analyse und Interpretation der Ergebnisse mit. Im Zusammenhang zur Partizipation ist ebenfalls zu betonen, dass Menschen mit Behinderung am Fragebogen-Design wesentlich beteiligt waren. Denn das Instrument wurde von Menschen mit Behinderung inhaltlich gestaltet, indem sie Qualität aus ihrer Sicht definiert haben. Wissenschaftler haben dies dann methodisch umgesetzt. Ein Entwicklungsteam aus 24 Menschen mit Behinderung bestimmte die übergeordneten Kategorien des Fragebogens. Dieser umfasst die sechs Lebensbereiche Alltagsaktivitäten, Allgemeine Regeln und Rahmenbedingungen, soziale Kontakte, Sexualität und Partnerschaft, Therapie und Gesundheit, Freizeit und Weiterbildung. Diese inhaltlichen Bereiche werden hinsichtlich der fünf Dimensionen Selbstbestimmung, Sicherheit, Privatsphäre, Förderung, Betreuung, Zufriedenheitsdimension überprüft. (vgl. Promberger et al. 2008: 45) Dabei weicht die Anzahl der Fragen zu den verschiedenen Lebensbereichen ziemlich stark voneinander ab. (vgl. Pracher et al. 2008: 88) Die ursprünglich 1.200 Fragen wurden im Zuge von zwei Testläufen vom Entwicklungsteam auf derzeit 123 Fragen reduziert. (vgl. Pracher et al. 2008: 84)
Die nueva-EvaluatorInnen durchlaufen eine zweijährige intensive Ausbildung zum Interviewer/ zur Interviewerin, zu der auch Praktika gehören. Die Peer-InterviewerInnen werden also erst ins Feld geschickt, nachdem sie auch den Beweis für ihre fachliche Eignung erbracht haben. (vgl. Promberger et al. 2008: 44)
Der Vorbereitung der eigentlichen Befragungen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt: Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit der Einrichtungsleitung wird ein Kennenlernbesuch angesetzt, um Informationen über Ziel und Ablauf der Erhebung an die NutzerInnen und BetreuerInnen zu vermitteln. Bei diesem ersten persönlichen Aufeinandertreffen können die zu befragenden NutzerInnen ihre Peer-InterviewerInnen nach Sympathiegründen selbst auswählen. (vgl. Pracher et al. 2008: 86)
Beim Interview selbst ist nur das zweiköpfige Interview-Team mit dem zu befragenden Nutzer in der Befragungssituation anwesend. Die Dauer des Interviews kann aufgrund des umfassenden Fragebogens bis zu eineinhalb Stunden betragen. Die oft lange Interviewzeit wird, wenn es notwendig erscheint, mit Pausen bewältigt. (vgl. ebd.)
Neben den Interviews als Kernstück der Erhebung werden zusätzliche Analysemethoden verwendet: So erhebt "NUEVA" ein Datenblatt zu Strukturdaten des Wohnangebots, das von der Einrichtungsleitung ausgefüllt wird. Weiters wird die Barrierefreiheit des jeweiligen Angebots anhand von Checklisten erhoben, um die Eignung der Angebote etwa für Rollstuhl-NutzerInnen, Gehörlose und Sehbehinderte zu überprüfen. Die Checklisten sind von den EvaluatorInnen zusammen mit Interessenverbänden entwickelt. Im Falle der Rollstuhltauglichkeit erfolgt die Überprüfung, indem ein/e EvluatorIn im Rollstuhl durch die Einrichtung fährt und anhand eines Kriterienkatalogs die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer feststellt.
Es gibt auch einen Fragebogen für die teilnehmende Beobachtung, der zum Einsatz kommt, wenn ein Interview abgebrochen wird oder nicht durchgeführt werden kann. (vgl. Pracher et al. 2008: 86)
Nach der Auswertung werden die Ergebnisse stets in der untersuchten Einrichtung in zweifacher Ausführung, angepasst an BewohnerInnen und ProfessionistInnen, präsentiert. (vgl. Promberger et al. 2008: 44)
Anhand der Ergebnisse erstellt "NUEVA" einen Eintrag in ihrem Katalog über Dienstleistungen, wenn dies vom Auftraggeber gewünscht wird. Es besteht auch die Möglichkeit der Veröffentlichung im "NUEVA"-Wohnangebot-Katalog mit Qualitätsprofil in leicht verständlicher Sprache. "NUEVA" bietet mittels Bedarfserhebung und Angebotsvergleich auch eine Unterstützung für Menschen mit Behinderung beim Finden von passenden Angeboten im Arbeits- und Wohnbereich an. (vgl. Promberger et al. 2008: 44)
"NUEVA" stellt als Vorteil ihrer Methodik die authentische Rückmeldung zu den in Anspruch genommenen Dienstleistungen heraus, die einen Nutzen für mehrere Akteure und Organisationen hat:
-
Die KundInnen erhalten "vergleichbare und verständliche Informationen";
-
Anbieter und Träger können das fundierte "Feedback der KundInnen als Grundlagen für Qualitäts- und Angebotsentwicklung" nutzen;
-
die Landesverwaltung kann sich anhand der "Qualitäts- und Bedürfnisprofile als Grundlagen für die Qualitätskontrolle und Sozialplanung" sowie durch "umfassendes Zahlenmaterial über die Entwicklung von Leistungen" einen guten Überblick über die soziale "Dienstleistungslandschaft" verschaffen. (nueva 2008 zit. n. Pracher et al. 2008: 85)
Als Perspektive in Bezug auf den Wohnbereich sind Behindertenanwaltschaften, Wohnvertrag und Nutzerkontrolle als Kontrollinstrumente und Ansatzpunkte für Partizipation maßgeblich. Denn so kann man entgegenwirken, dass Angebote unter Ausschluss der Betroffenen über ihre Interessen hinweg geplant werden - was immer noch eine übliche Vorgangsweise darstellt. "NUEVA" hat nach eigenen Angaben, die Absicht, Empowermentprozesse in Gang zu setzen und zu unterstützen. (vgl. Promberger et al. 2008: 44) Ein wegweisendes Beispiels ist die Peer-Wohnberatung des Behindertenanwalts des Landes Steiermark, die für die Informationssuchenden kostenlos angeboten wird. (vgl. Behindertenanwaltschaft Steiermark 2009: 14) Die Abgleichung der Interessen zwischen NutzerInnen und Dienstleistungsanbietern kann dabei einen wichtigen Beitrag leisten (vgl. Pracher et al. 2008: 95):
"Um im Sinne der Betroffenenperspektive Dienstleistungen zu definieren und zu kontrollieren, sollten Wohnungsanbieter und die Nutzer gemeinsam die Inhalte und Qualitäten definieren, vertraglich absichern und regelmäßig auf die Stimmigkeit bzw. Qualität überprüfen." (Pracher et al. 2008: 95)
Für die ausgebildeten Peer-InterviewerInnen ist Empowerment im Sinne positiver Auswirkungen auf ihre Persönlichkeitsentwicklung, und Lebenswirklichkeit möglich. Schließlich verfügen sie über ein eigenständiges Berufsbild "InterviewerIn" und sind entlohnt nach dem BAGS-Gehaltsschema für Fachkräfte. (vgl. Pracher et al. 2008: 95)
Beide Forschungsansätze teilen die gleichen ideologischen Wurzeln von Normalisierung und Inklusion und sind äußerst inklusiv gestaltet, so wurden in beiden Fällen die Instrumente zusammen mit Menschen mit Behinderung entwickelt. In der Fragebogenkonstruktion unterscheiden sie sich jedoch deutlich im Umfang, wobei der Marylander Fragebogen etwa nur halb so lang ist wie der von "NUEVA".
Beide Modelle setzen auf Peer-Interviewende, die sich in beiden Fällen einer intensiven Ausbildung unterziehen. Wenn der Fall eintritt, dass eine direkte Befragung der jeweiligen Person sich als nicht durchführbar herausstellt, sieht "Ask Me!" ein stellvertretendes Interview mit einem Bevollmächtigtenteam aus Angehörigen und FürsprecherInnen vor, während bei "NUEVA" ein standardisierter Fragebogen zur teilnehmenden Beobachtung der zu befragenden NutzerInnen zum Einsatz kommt. "Ask Me!" sieht auch keine zusätzlichen Methoden vor, während "NUEVA" standardmäßig die Strukturdaten eines Angebots erhebt, indem die Einrichtungsleitung befragt wird, und eventuell Checklisten zur Barrierefreiheit ausfertigt.
"Ask Me!", der etwas ältere Forschungsansatz, nahm 1998 den Probebetrieb auf ("NUEVA" 2004) und konnte sich im beheimatenden US-Bundesstaat Maryland nachhaltig etablieren - was in diesem Ausmaß für "NUEVA" nicht zutrifft, obwohl es auch hier Ansätze in der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gibt. Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass beide Evaluationsprogramme ihre Peer-InterviewerInnen auf einem "normalen", also an der Berufsgruppe orientierten, Lohnniveau für ihre Tätigkeit bezahlen.
Der folgende Abschnitt will die Vor- und Nachteile der Peer-Methodik mit Menschen mit Behinderung herausarbeiten. Zuerst wird auf die besonderen Bedingungen, die mit der Befragung dieser Zielgruppe verbunden ist, eingegangen, um anschließend wichtige methodische Aspekte beim Peer-Interview zu behandeln. Das Kapitel stützt sich stark auf die methodologischen Überprüfungen von "NUEVA", weil sie klare Anhaltspunkte und zeitnahe Einsichten bieten. Die Schlüsse, die aus den Annahmen gezogen werden können, sind zwar in erster Linie von exemplarischem Charakter, zum Teil jedoch durchaus verallgemeinerbar. Inwieweit sie sich mit den Erkenntnissen der Forschungsliteratur decken oder in Widerspruch zu dieser stehen, kann aber nicht abschließend beantwortet werden.
Die Befragung ist - teilweise in Kombination mit anderen Methoden - die gängige Erhebungsmethode bei Studien mit NutzerInnenbeteiligung. So setzen neun von dreizehn Evaluationsmodelle, die Promberger und Lorenz untersucht haben, eine Befragung anhand eines schriftlichen Fragebogens ein, drei Forschungsansätze bedienen sich teilstrukturierten Leitfaden-Interviews. (vgl. Promberger et al. 2008: 54f) Dabei wird beim Interview von Menschen mit Behinderung die mündliche Befragung der schriftlichen vorgezogen, weil Erfahrungen gezeigt haben, dass das Selbstausfüllen eines Fragebogens für Menschen mit Behinderung eine zu komplexe Aufgabe darstellt und daher Einbußen bei der Validität entstehen. So bedienen sich alle sieben untersuchten Forschungsansätze unter Verwendung eines NutzerInnenfragebogens der mündlichen Befragung. (vgl. Promberger et al. 2008: 57) Im Gegensatz dazu kann eine mündliche Befragungsart Auslassungen von Antworten oder andere Fehlerquellen, die aus nicht hinreichendem Verständnis resultieren, reduzieren. Natürlich muss man dafür aufgrund der Anwesenheit von Interviewenden einen wahrscheinlichen Einfluss sozialer Erwünschtheit in Kauf nehmen. (vgl. Dworschak 2004: 27) Deshalb wird an dieser Stelle hauptsächlich auf methodische Aspekte der Technik mündliche Befragung eingegangen.
Bereits in den 1970er Jahren sind Menschen mit Behinderung befragt worden, sodass im Laufe der Zeit bis heute viele Erfahrungen mit solchen Befragungen gesammelt werden konnten. Es fehlt laut Kannonier-Finster et al. jedoch an systematischer Dokumentation und Publikation, sodass die Ergebnisse kaum zugänglich sind. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 110) Den AutorInnen zufolge wird allerdings entgegen bestehender Erfahrungswerte die grundsätzliche Frage, ob Menschen mit Behinderung als InterviewpartnerInnen geeignet sind, in der Literatur immer noch durchaus kontrovers diskutiert. AutorInnen, die der Befragtenrolle von Menschen mit Behinderung skeptisch gegenüber stehen, führen in erster Linie unzulängliche kommunikative Kompetenzen, die das Verstehen und Beantworten von Fragen beeinträchtigen würden, ins Feld. (vgl. ebd.)
Andererseits gibt es in der Disziplin eine Vielzahl von Auffassungen und Erfahrungen, wonach sich Befragungsergebnisse von behinderten Befragungspersonen in wissenschaftlichen Gütekriterien der Validität und Reliabilität nicht von der Antwortzuverlässigkeit nichtbehinderter Befragter unterscheiden. Eine Mittlerposition nehmen jene Stimmen ein, die auf die allgemein vorhandene und zu bewältigende methodische Problematik bei allen Befragungen hinweisen, egal ob es sich um behinderte oder nichtbehinderte InterviewpartnerInnen handelt. (vgl. ebd.: 111) Antener und Landolt stellen diesbezüglich heraus: "Schwierigkeiten in der Befragung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind nicht anderer Art als diejenige anderer Befragungen - auch wenn sie deutlicher ausgeprägt sind." (Antener et al. 2005: 39ff zit. n. Kannonier- Finster et al. 2008: 111)
Kannonier-Finster und Ziegler schlagen den konstruktiveren Ansatz vor, die Frage nach der "Befragbarkeit" von Menschen mit Behinderung fallen zu lassen, um sich der Fragestellung zuzuwenden, welche Besonderheiten bei der Befragung dieser Zielgruppe bestehen können. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 111) Die wichtigsten methodischen Spezifitäten sollen im Folgenden zusammengefasst werden.
Aus Erfahrungen mit der Befragung von Menschen, die auf chronische Weise psychisch krank sind, entnehmen Kannonier-Finster und Ziegler einige auf die Kommunikation zwischen Interviewenden und Befragten bezogene methodische Aspekte, die auch bei Menschen mit Behinderung als Befragte Berücksichtigung finden sollen. (vgl. Kannonier- Finster et al. 2008: 111) Diese sind folgende:
-
Ein Fallstrick standardisierter Befragungen ist die damit verbundene Erwartung, mit ungeeigneten Fragen, "die mit dem praktischen Lebenskontext der Befragten in keinem Zusammenhang stehen", zutreffende Antworten finden zu wollen. (ebd.) Denn Menschen mit Behinderung in institutionellen Lebensformen, die zum Teil gesellschaftliche "Sonderorte" darstellen, sind in ihrem Lebensumfeld relativ eingeschränkt. Die methodisch zu lösende Herausforderung besteht in diesem Fall darin, "in der Befragungssituation eine Verknüpfung zwischen je spezifischer Lebenswelt und dem Sinn der Fragestellung herzustellen." (Kannonier-Finster et al. 2008: 111f) Diese Verbindung muss vom Interviewer erklärend in der Interviewsituation geschaffen werden.
-
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Menschen mit Behinderung mit der "verkürzten Kommunikation", die mit der künstlichen Befragungssituation und einem standardisierten Fragebogen einhergeht, nicht zurechtkommen, weil diese zu sehr von gewohnten Kommunikationsformen abweichen. Die AutorInnen gehen davon aus, dass die Befragten nicht eindeutige Antworten geben werden, sondern vielmehr "narrative Berichte" darüber erzählen. (vgl. ebd.: 112) Der Part des Interviewenden besteht dann darin, "aus diesen Berichten die 'gemeinte' Antwort zu isolieren und in die Kategorien des Fragebogens zu übersetzen." (ebd.)
-
Den AutorInnen zufolge resultiert daraus, dass aufgrund des erwartungsgemäß ausholenden und narrativ-geprägten Antwortverhaltens der Befragten für die Interviewenden die Interpretation und Reduktion der Antworten entsprechend der vorliegenden Antwortkategorien des Fragebogens notwendig wird. Deshalb nimmt "die Situation der Datenerhebung einen fließenden Übergang zur Situation einer Dateninterpretation" vorweg. (ebd.)
Die AutorInnen ziehen aus den oben genannten Annahmen die Schlussfolgerung, dass standardisierte Befragung von Menschen mit Behinderung am besten in einer nichtstandardisierten Befragungssituation erfolgen kann und deshalb die Interviewsituation wie eine gewohnte alltägliche Gesprächssituation gestaltet werden soll (vgl. ebd.):
Denn laut Kannonier-Finster und Ziegler sind
"[...] standardisierte Befragungen bei Menschen mit Behinderung möglich [...], allerdings nur in einem Kontext, der die Situation der Befragung selbst nicht standardisiert. Die Situation wird - ähnlich wie das bei qualitativen Befragungen praktiziert wird - in ein Gespräch eingebunden sein, das den Regeln der alltäglichen Kommunikation nahesteht." (ebd.)
Bei Interviews mit Menschen mit Behinderung ist laut Kannonier-Finster et al. von einem "deutlich höheren Maß an sozial erwünschten Antworten sowie verstärkter Tendenz zur Zustimmung" auszugehen. (ebd.) Dies gründet in den sozialen Abhängigkeits- und Machtbeziehungen, in denen sich Menschen mit Behinderung in Betreuungskontexten befinden, sowie in der Tatsache, dass Menschen mit Behinderung in Institutionen häufig zu Regelkonformität und anpassenden Verhaltensweisen sozialisiert werden. So ist die (anfängliche) Scheu vor Widerspruch zum Betreuungspersonal und der Möglichkeit daraus resultierender Konfrontationen etc. in vielen Fällen groß. (vgl. ebd.)
Nach Finlay und Lyons (2002) ist die Zustimmungstendenz bei sozialer Erwünschtheit ("acquiescence"/ "yes-saying") ebenso auf mehrere Faktoren zurückzuführen, beispielsweise das Bedürfnis, es anderen Recht machen zu wollen, sozialisierter Gehorsam, komplexe grammatikalische Strukturen, Anforderung durch Fragen, die mit Reflexionsanstrengungen verbunden sind. (vgl. Bonham et al. 2004: 339)
Erfahrungen aus der SIVUS-NutzerInnenbefragung bestätigen den Faktor "Soziale Erwünschtheit" stark und weisen auf die Notwendigkeit hin, dies bei Auswertung und Interpretation der Ergebnisse entsprechend zu berücksichtigen:
"Die fehlende Übung zur Äußerung von Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit über Lebensqualität im Heim und langjährige Hospitalisierung der Nutzerinnen [sic!] können dazu geführt haben, dass die Teilnehmerinnen [sic!] Fragen in der Form beantworteten, wie sie meinten, dass die Mitarbeiterinnen [sic!] es gerne hätten." (Janßen et al. 2003: 5 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 130)
Die AutorInnen geben an, dass die Art des Einflusses sozialer Erwünschtheit nicht genau analysiert und eingegrenzt werden konnte. Vermutete Deutungsmöglichkeiten waren bei einem geringeren Interviewereffekt sowohl "eine größere Diskussionsfreudigkeit und damit Selbstständigkeit" als auch "Ausdruck einer größeren Unzufriedenheit". (ebd.) Wolfgang Dworschak weist mit Bezug auf die Ergebnisse der von ihm durchgeführten BewohnerInnenbefragung relativierend darauf hin, dass "bei Menschen mit geistiger
Behinderung nicht von einer generellen Zufriedenheits- bzw. Zustimmungstendenz auszugehen ist." (Dworschak 2004: 154) In der besagten Erhebung haben die InterviewerInnen ihre Einschätzung zur sozialen Erwünschtheit des Antwortverhaltens der befragten Heim-BewohnerInnen abgegeben. Demnach haben ihrer Wahrnehmung zufolge 54% der Befragten in geringem Maße und 38% in durchschnittlicher Weise sozial erwünscht geantwortet, während 8% "in hohem Maß" sozial erwünschte Antwort abgaben. Dworschak führt in diesem Zusammenhang als Beleg den Anteil negativer Werte zu "individuellen Entscheidungsmöglichkeiten" und "im Bereich Partizipation" an. Der Autor geht davon aus, dass Menschen mit Behinderung durchaus in der Lage sind, den diesbezüglichen potentiellen Gehalt sozialer Erwünschtheit der Fragen zu erkennen. Dies illustriert er an der Frage nach belastenden Personen im Wohnalltag. So gaben 40% der Befragten keine Person als belastend an, in 88% der Fälle wurden keine MitarbeiterInnen genannt (dies trifft nur in 8% der Fälle zu). (vgl. ebd.)
Matikka und Vesala (1997) zufolge ist soziale Erwünschtheit vor allem von situativen Bedingungen und Faktoren der konkreten Interaktion der Befragungssituation verursacht und weniger von den individuellen Charakteristika der Befragungspersonen abhängig. (vgl. Bonham et al. 2004: 339) Dies stützt die Annahme eines starken Einflusses, der von der Fremdheit der Interviewsituation für die befragten Menschen mit Behinderung auszugehen scheint. Dieser Effekt mildert sich jedoch erfahrungsgemäß ab, wenn sie häufiger mit Befragungssituationen konfrontiert sind, sodass die Antworten mehr Authentizität erhalten. (vgl. Dworschak 2004: 30)
Angesichts der Verschiedenheit der empirischen Befunde muss der vielschichtig wirkende Aspekt sozialer Erwünschtheit bei der Durchführung und Auswertung solcher Erhebungen jedenfalls angemessen einkalkuliert werden.
Hinsichtlich der Frageinhalte ist es nicht von unwesentlicher Bedeutung, wie sie ausgewählt und der Fragebogen danach aufgebaut wird. Promberger und Lorenz stellten in ihrem Vergleich von Erhebungsinstrumenten fest, dass bei der Mehrheit der Instrumente Menschen mit Behinderung in der inhaltlichen Gestaltung beteiligt waren, auch wenn die genaue Art ihrer Mitwirkung offen bleibt: Im Rahmen der sieben untersuchten Forschungsansätze, die einen NutzerInnenfragebogen in Verbindung mit mündlicher Befragung einsetzen[32], wurden "die inhaltlichen Bezugspunkte der Fragebögen überwiegend entweder in Workshops oder z.B. in Zusammenarbeit mit Nutzern erarbeitet". (Promberger et al. 2008: 58) "Bei einigen Ansätzen wurden die inhaltlichen Bezugspunkte u.a. aus der einschlägigen Fachliteratur abgeleitet." (ebd.)
Hervorzuheben ist die Feststellung von Christian Janßen, der mit dem SIVUS-Ansatz befasst ist, dass "die von der Projektgruppe zusammengestellten Bereiche in etwa den Fragebereichen entsprachen, wie sie in der veröffentlichten Literatur nachzulesen sind." (Janßen 2003: 4 zit. n. Promberger et al. 2008: 58) So zeigte sich in einem Vergleich der selbst erarbeiteten Inhalte von SIVUS mit anderen vorliegenden Fragebögen und den Angaben in der Fachliteratur eine große Übereinstimmung im abgefragten Inhalt.
Hinsichtlich der Frageformulierung sind bei der Befragung von Menschen mit Behinderung Abgrenzungsprobleme bekannt: So sind Unterschiede in der Abfrage von Zufriedenheit und Wichtigkeit für Menschen mit Behinderung erfahrungsgemäß häufig nicht nachvollziehbar. (vgl. Promberger et al. 2008: 60) Vier von sieben von Promberger et al. untersuchten Fragebögen[33], die sich an Menschen mit Behinderung richten, verwenden Fragen sowohl zur Zufriedenheit als auch zu Wichtigkeit. Andere Erhebungsdesigns, z.B. AQUA-FUD, Ask Me! und NUEVA, verzichten jedoch zugunsten besserer Verständlichkeit sogar auf Fragen nach der Wichtigkeit und beschränken sich auf die Erhebung von Zufriedenheit. (vgl. ebd.)
Finlay and Lyons (2002) empfehlen als Lösungswege, generell die Frageformulierung zu vereinfachen sowie soll versucht werden, nachzuvollziehen, welche Formulierungen und Beurteilungen für die Befragten schwierig sein können. Menschen mit Behinderung sollten vermehrt in die Fragebogen-Entwicklung einbezogen werden, um diesen ihrem Verständnis gemäß zu gestalten. (vgl. Bonham et al. 2004: 339)
Befragungen von Menschen mit Behinderung sind überwiegend quantitativ umgesetzt. (vgl. Dworschak 2004: 27) Dworschak zufolge ist gegen den Einsatz qualitativer Befragungen in Hinblick auf deren Qualität jedoch nichts einzuwenden, denn
"Erfahrungen mit narrativen oder problemzentrierten Interviews deuten darauf hin, dass Menschen mit geistiger Behinderung durchaus im Rahmen qualitativer Interviews ihr Erleben der Alltagswirklichkeit verbalisieren können." (ebd.)
Die Ausrichtung einer Befragung nach quantitativen oder qualitativen Kriterien, entscheidet über den Einsatz offener oder geschlossener Frageformen.
Unter den sieben von Promberger untersuchten Forschungsansätzen verwenden "NUEVA" und "Ask Me!" ausnahmslos geschlossene Fragen. "Schöner Wohnen" bedient sich eigentlich auch vornehmlich geschlossener Fragen, nur wenn nach Bedürfnissen und Wünschen gefragt wird, verwendet das Instrument die offene Frageform. "AQUA-NetOH" setzt hingegen ausschließlich offene Fragen ein. In vier der untersuchten Fragebögen sind die Fragen auf beide Arten formuliert, während jedoch die Mehrzahl der Fragen geschlossen gestellt sind. (vgl. Promberger et al. 2008: 64)
Vier der sechs untersuchten Fragebögen[34] verfügen über eine Kombination einer verbalen und grafischen Skala. "AQUA-FUD" verwendet eine rein verbale Skala, während "Ask Me!" ausschließlich auf eine grafische Skala setzt, die die Antwortmöglichkeiten mit drei Smileys (positiv, neutral, negativ) darstellt. (vgl. Promberger et al. 2008: 65)
"AQUA- FUD", "AQUA-UWO" und "QUOFHI" weisen eine gerade Zahl von Antwortkategorien auf, während "Ask Me!", "NUEVA" und "Schöner Wohnen" eine ungerade Zahl von Antwortmöglichkeiten bereithalten. Diese Forschungsansätze und "QUOFHI" verfügen auch über eine zusätzliche "weiß nicht"-Antwortkategorie. (vgl. Promberger et al. 2008: 65)
Bei ungeraden Skalen stellt sich immer die Frage der Interpretation des mittleren Werts. So bleibt offen, ob dieser tatsächlich eine Antwort gemäß der mittleren Antwortkategorie meint oder als "weiß nicht" auszuwerten ist. Außerdem kann eine ungerade Skala zu einem Antwortverhalten entsprechend der "Tendenz der Mitte" einladen. Die gerade Antwortskala bietet zwar diese Ausflucht nicht, aber auch keine mittlere Antwortmöglichkeit. Wegen der Unsicherheit in der nachträglichen Interpretation und der zentralen Tendenz kann durch eine "weiß nicht"-Antwortkategorie Abhilfe geschaffen werden. (vgl. Promberger et al. 2008: 66) Die unterstützende Wirkung dieser Antwortkategorie betonen Finlay and Lyons (2002) ebenfalls. (vgl. Bonham et al. 2004: 339)
Bei den untersuchten Instrumenten reichte die Bandbreite bei der Anzahl der Fragen von 27 bis 123 Fragen. (vgl. Promberger et al. 2008: 59) "NUEVA" ist mit 123 Fragen der mit Abstand umfassendste Fragebogen, den Promberger et al. in ihrer Studie verglichen haben. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 126)
In der Forschungsliteratur gibt es bezüglich des Umfangs des Fragebogens die fast einheitliche Empfehlung von ca. 25 Fragen. (vgl. Dworschak 2004: 31) Petra Gromann merkt im Zusammenhang mit dem Erhebungsinstrument "Schöner Wohnen" folgendes an:
"Eine zu lange und aufwändige Erhebung überfordert die Bewohner und diejenigen, die sie durchführen und auswerten. Außerdem lässt sie sich nur in großen Abständen wiederholen. Mehr als 15 bis 25 Fragen sollte eine Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung nicht umfassen." (Gromann et al. 2002: 160)
Hinsichtlich der Dauer der Befragung ist die Maßgabe der Literatur zwischen 15 und 40 Minuten Befragungszeit. Dies bezieht sich auf die sowohl für Peer-Interviewer als auch Befragte zumutbare Zeit der Konzentration, ohne dass für beide Seiten Überforderung eintritt. Robert L. Schalock (1989) beschränkt die Befragungsdauer auf höchstens 45 Minuten, während Gromann und Niehoff maximal 30 Minuten für vertretbar halten. Beck (2000) gibt als Richtwert 40 Minuten für 40 Fragen an und Janßen (2000) 15 bis 20 Minuten für 26 Fragen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 126)
Kannonier-Finster und Ziegler ziehen unter Berücksichtigung der entsprechenden methodischen Faktoren ein positive Fazit hinsichtlich der Befragung von Menschen mit Behinderung: "Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei Beachtung der Besonderheiten der befragten Personengruppe wertvolle Ergebnisse zu erwarten sind." (Kannonier-Finster et al. 2008: 112)
Aufgrund der Komplexität der Interviewsituation, des Umfangs sowie der Vielschichtigkeit der erforderlichen Interviewereigenschaften halten es Kannonier-Finster und Ziegler nicht für seriös, eindeutige Angaben zu Effekten zu machen, die mit Menschen mit Behinderung als InterviewerInnen einhergehen. Dazu kommt der komplexitätssteigernde Faktor, dass beim Peer-Interview die Befragten ebenfalls beeinträchtigt sind. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 117) Vor diesem Hintergrund sollen an dieser Stelle methodologischen Vor- und Nachteile des Peer-Interviews diskutiert werden.
Intention der Peer-Interview-Methodik ist es, die Faktoren Fremdheit der sozialen Situation "Interview" und die vom Instrument vorgegebene Asymmetrie der Gesprächssituation abzuschwächen, indem die Interviewer Mitglieder der Peer-Group sind[35]. Aufgrund des vielfachen Erlebens von sozialen Abwertungen und Stigmatisierung besteht in der auf Peer-Interviews bezogene Forschungsliteratur die Annahme, dass die soziale Nähe zwischen Interviewendem und Befragten von vornherein einen positiven Einflussfaktor auf die Gesprächsatmosphäre darstellt und vertrauensschaffend wirkt. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 113, 116) Erfahrungen mit der Methodik deuten stark darauf hin, dass Peer- InterviewerInnen daher einen leichteren Zugang zu ihren GesprächspartnerInnen finden können. Das ist laut Kannonier-Finster und Ziegler darauf zurückzuführen, dass, "der Zugang zu der Lebenswelt und der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung für InterviewerInnen, denen diese Lebensform fremd ist, sich nur begrenzt erschließen kann." (Kannonier-Finster et al. 2008: 116) Das bringt mit sich, dass die Kontaktaufnahme vereinfacht ist und "kommunikative Hemmschwellen abgebaut werden." (ebd.)
Aufgrund der Fremdheit, die eine Befragungssituation für die interviewten Menschen mit Behinderung bedeutet, wird in der Literatur angegeben, das Interview am besten in der gewohnten Umgebung der Befragten durchzuführen. Bei einigen Evaluationsmodellen gibt es für die Befragten auch die Möglichkeit, die Interviewenden (nach Sympathie) selbst auszusuchen. Die Interviewsituation wird durch das Beisein von Dritten mit hoher Wahrscheinlichkeit verzerrt, es soll daher allein mit dem Befragten stattfinden, lautet der Tenor der Forschungserfahrungen. Bei vehementem Wunsch danach, ist es der Forschungsliteratur zufolge vertretbar, MitbewohnerInnen oder FreundInnen einzubeziehen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 113) Keinesfalls ist die Anwesenheit von Betreuungspersonal oder Angehörigen zu tolerieren: Erfahrungswerte zeigen nämlich, dass diese "im Laufe der Interviews massiv die Gesprächsführung übernehmen und somit das Interview 'über' und nicht 'mit' dem Menschen mit Behinderung erfolgt." (Kannonier- Finster et al. 2008: 113)
Die einschlägige Literatur hält nur wenige empirisch fundierte Aussagen darüber bereit, welche Effekte auf das Antwortverhalten, seien sie intendiert oder nicht intendiert, von Menschen mit Behinderung als Interviewende ausgehen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 114) Es wird jedoch in der Literatur immer wieder auf folgende zwei Methoden- Studien Bezug genommen, die sich mit der Stärke des Interviewereffekts befassen.
Bonham et al. führten als Pilotstudie eine Erhebung der NutzerInnenzufriedenheit mit sozialen Dienstleistungen und Lebensqualität von 2.500 Menschen mit Behinderung über vier Jahre hinweg durch. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 114) Während der Entwicklungsphase des Instruments setzte man bezahlte Peer-InterviewerInnen, Freiwillige als InterviewerInnen und MitarbeiterInnen eines Komitees für Qualitätssicherung als Interviewende ein, indem man sie nach Zufallsauswahl den Befragten zuordnete. Das Ergebnis zeigte, dass die Mitglieder des Komitees in einem der fünf Bereiche des Fragebogens mehr positive Antworten abfragten als die anderen InterviewerInnen- Gruppen. (vgl. Bonham et al. 2004: 350) Dieser InterviewerInnen-Effekt kann Bonham et al. zufolge durch ausgebildete Peer-InterviewerInnen eingegrenzt werden: "We believe a key factor in reducing acquiescence is the use of professionally trained peers to conduct the interviews." (ebd.)
In einer anderen Methoden-Studie, die jedoch nicht speziell zur Ermittlung des Antwortverhaltens konzipiert war, stellten Bonham et al. fest, dass die 923 befragten Menschen mit Behinderung im Durchschnitt 60% der 56 Fragen positiv beantworteten (bei den befragten Proxies betrug der Anteil 58%). Die AutorInnen stellten keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Grad der Behinderung der Befragten und einer positiven Beantwortung der Fragen fest. (vgl. Bonham et al. 2004: 344)
Erfahrungen von "Ask Me!" zeigen, dass auch Personen, deren Behinderung von der jeweiligen Einrichtung als mittelschwer bis schwer beschrieben wurde, zur Hälfte befragt werden konnten - darunter sind auch Personen, die nach Aussage von Betreuungspersonal oder Angehörigen als nicht befragbar gelten. (vgl. Bonham et al. 2004: 350) Anhand der im Zuge von "Ask Me!" gesammelten Daten kamen Bonham et al. hinsichtlich der Qualität der Antworten zu dem Ergebnis, dass direkt befragte Menschen mit Behinderung (a) eine größere Anzahl von Fragen beantworten, (b) zuverlässigere Werte liefern und (c) im Vergleich zu befragten StellverterInnen eine beinahe gleich hohe interne Validität aufweisen. Hervorzuheben ist auch der Befund, dass direkt Befragte über ein niedrigeres physisches Wohlbefinden berichten und höhere Selbstbestimmungswerte erzielen als in StellvertreterInnenbefragungen. (vgl. Bonham 2008 a: 1)
Ebenfalls 2004 analysierten Felce und Perry Unterschiede im Antwortverhalten anhand der Befragung von 21 Menschen mit Behinderung durch Peer-InterviewerInnen und eine Kontrollgruppe aus nichtbehinderten Interviewenden. Die Autoren setzten drei verschiedene Fragebögen ein und ließen auch Re-Tests mit gleichen Interviewenden oder anderen durchführen. Es ließen sich keine systematischen Antwortverzerrungen in eine bestimmte Richtung feststellen, sie variierten je nach verwendetem Instrument und Befragungspersonal. Daraus schließen Felce und Perry, dass die Verzerrungen im Antwortverhalten nicht von den Peer-InterviewerInnen verursacht sind, sondern in Verbindung mit Merkmalen der Befragten, z.B. bestimmte Fähigkeiten, stehen. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 114)
Aufgrund des Fehlens einer "linearen Tendenz der Antwortverzerrung" stützen die Resultate von Felce und Perry die These von Kannonier-Finster und Ziegler, wonach "prinzipiell davon ausgegangen werden kann, dass Intervieweffekte durch den Einsatz erfahrener, geschulter Interviewer mit 'positiven' Intervieweigenschaften reduzierbar sind." (Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Da eine Interviewsituation stets "eine künstliche und komplexe Situation" darstellt, spielen soziale Kompetenzen der Interviewenden eine große Rolle für den Verlauf und Erfolg einer Befragung. (Kannonier-Finster et al. 2008: 114) Diese Anforderungen, die ihre InterviewerInnen-Rolle an Menschen mit Behinderung stellen kann, sollen auf exemplarische Weise an "NUEVA" aufgezeigt und illustriert werden, weil diese sich bisher zweifach wissenschaftlich überprüfen ließ und die Ergebnisse publizierte. Zum Einen analysierten und hinterfragten Kannonier-Finster und Ziegler die "NUEVA"-Methodik und ihre praktische Umsetzung unter sozialwissenschaftlichen und soziologischen Gesichtspunkten (Kannonier-Finster et al. 2008). Zum Anderen untersuchte Rainer Loidl- Keil die Peer-Interviews[36], indem er 15 Interviewsituationen in Beobachtungen verfolgte und als Kontrollgruppe 13 Interviews von AbsolventInnen der FH Joanneum für Sozialarbeit durchführen ließ. Die Beobachtung wurde dabei offen und nichtteilnehmend durchgeführt, indem ein Beobachter in der Befragungssituation anwesend war, was natürlich einen Unterschied zur gewöhnlichen Interviewsituation darstellt. Das qualitativ angelegte experimentelle Verfahren wurde von Kurzinterviews mit den Interviewenden und Befragten begleitet. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 12) Die wichtigsten Erkenntnisse der beiden Methoden-Studien seien hier zusammengefasst.
Der folgende Abschnitt ist mit der Einschränkung zu betrachten, dass seine Grundlage (Fröhlich et al. 2009), die Forschungsergebnisse des Originalberichts, nicht systematisch, sondern eher selektiv wiederzugeben scheint (die Originalzitate der Forschungsgruppe sind teilweise zerpflückt). Trotz dieses Vorbehalts liefern Fröhlich und Konrad wertvolle Einsichten.
Für eine erfolgreiche Durchführung von Peer-Interviews ist die Auswahl der konkreten Personen für die Befragungen und Art und Umfang der Ausbildung, die sie genießen, maßgeblich. (vgl. Kannonier-Finster et al. 2008: 117) Wichtige Auswahlkriterien sind den AutorInnen zufolge "die Art und Intensität der kognitiven Beeinträchtigung, die Motivation und die Wohnerfahrung". (ebd.) So berichtet "NUEVA" von einer hohen Selektion, sodass bei ungefähr der Hälfte der Interviewer-AnwärterInnen im Laufe der Ausbildung und der ersten Praxiserfahrungen Überforderung eintritt. Diese Personen finden bei "atempo" eine andere, nicht weiter erläuterte, Verwendung. (vgl. ebd.)
Walburga Fröhlich und Martin Konrad von "atempo" betonen, dass die Faktoren "Ausbildung, Übung und laufendes Training" (Fröhlich et al. 2009: 41) zentral für eine ausreichende Vorbereitung der Interviewenden ist. Dies spiegelt sich auch in den
Ergebnissen der Begleitforschung: "Aus den Beobachtungen schließen wir, dass die Nueva-EvaluatorInnen ausbildungsgemäß und antrainiert handeln [...]." (Hirschmann et al. 2009: 32 zit.n. Fröhlich et al. 2009: 41; kursiv im Orig.) Dies wurde bei der Erprobung eines neuen Instruments zur Erhebung des Werkstättenbereichs, das weniger geübt wurde als der gewohnte Fragebogen zum Wohnbereich, deutlich: "Resultierende Unsicherheiten bei den Nueva-Evaluator/innen in den Frageformulierungen und Frageexplikationen weisen auf dieses Moment der 'Geübtheit' und 'Ungeübtheit' hin." (ebd.)
Die Schulung soll daher umfassend sein und beinhaltet u.a. Informationen und Übungen zu "Gestaltung des Interview-Settings, Techniken der Interviewführung, Verhalten während dem Interview, Umgang mit unerwarteten Störfaktoren" (Fröhlich et al. 2009: 41). Nach Absolvierung der Berufsausbildung schließen Weiterbildungsmaßnahmen an. Fröhlich et al. nehmen an, dass durch die Bereitstellung von standardisierten Lösungen Interviews für Menschen mit Behinderung leichter bewältigbar werden: "Aufgrund der möglicherweise anders ausgeprägten Merkfähigkeit bei Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Detailfragen sind gerade der Punkt der Standardisierung von Abläufen [...] von besonderer Bedeutung." (Fröhlich et al. 2009: 41f)
Dieser Abschnitt beruht auf der Methoden-Studie der FH Joanneum und gibt Einblicke darüber, wie die Peer-InterviewerInnen von "NUEVA" Befragungen meistern und Eigenschaften und Kompetenzen, die InterviewerInnen gemeinhin haben sollen, in der Interviewsituation aktualisierten und genutzt haben. Es beleuchtet also die Möglichkeit und Art der Umsetzung von Befragungen durch Menschen mit Behinderung im praktischen Kontext.
-
"Der Interviewer muss das Verhalten anderer aufmerksam beobachten und verstehen können." (Bortz et al. 2003: 246f zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Laut Hirschmann und Loidl-Keil sind die Peer-InterviewerInnen in der Lage, die Körpersprache ihrer GesprächspartnerInnen wahrzunehmen, richtig zu deuten und adäquat darauf zu reagieren, indem sie z.B. bei Anzeichen der Ermüdung und Unkonzentriertheit Pausen anbieten. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 43): "Auf unruhige Körperbewegungen, lange Nachdenkpausen und/ oder häufiges Missverstehen der Fragen reagieren die Nueva- EvaluatorInnen sichtbar verständnisvoll [...]." (Hirschmann et al. 2009: 38 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 43f; kursiv im Orig.) Der FH-Forschungsgruppe zufolge motivieren sie die Interviewten durch aktives Zuhören und widmen ihnen Signale der Aufmerksamkeit und Bestätigung (z.B. "mhm", "ja", "ok"). Die AutorInnen der Methoden-Studie gewannen den Eindruck, dass die Peer-InterviewerInnen erkennen, ob ein Interview zielführend verläuft, und im Bedarfsfall angelernte Lösungsstrategien einsetzen, z.B. das Interview abbrechen und stattdessen eine Beobachtung einsetzen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 44)
-
Ein/e Interviewer/in soll "[...] auch bei unangemessenen Reaktionen des Interviewpartners oder organisatorischen Problemen [...]" verantwortungsvoll handeln können. (Bortz et al. 2003: 247 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Fröhlich und Konrad geben an, dass die Peer-InterviewerInnen mit unangemessenen Reaktionen zurechtkommen müssen, denn "auf den ersten Blick nicht nachvollziehbare Wut- oder Tränenausbrüche, körperliche Gewaltausübung und Ähnliches wurden von den Nueva-EvaluatorInnen im Laufe ihrer Berufszeit erlebt." (Fröhlich et al. 2009: 44) Solch massive Reaktionen sind jedoch eher seltene Ausnahmen im Interviewalltag. Diese wurden auch nicht vom FH-Forschungsteam beobachtet. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 44)
Organisatorische Probleme kommen allerdings schon häufiger vor. So brach einer Beobachtung zufolge ein Befragter das Interview nach 15 Minuten ab, weil er einen Termin hatte. Die Peer-InterviewerInnen setzen die Befragung deshalb am darauffolgenden Tag fort. In einer anderen Situation, die von Stress, verursacht durch einen für die EvaluatorInnen unüblichen Zeitdruck, geprägt war, zeigte sich die Lösung weniger eindeutig, als es darum ging, die Hälfte der NutzerInnen eines Angebots zwecks Repräsentativität von der Teilnahme an der Befragung zu überzeugen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 45) Es wurden einerseits "verschiedene Lösungsansätze" beobachtet und andererseits, dass sich die Peer-InterviewerInnen "in dieser Stresssituation aber schwer tun, zu entscheiden, ob sie eine Ablehnung akzeptieren oder versuchen sollen, die Personen zum Mitmachen zu motivieren." (Fröhlich et al. 2009: 45)
-
InterviewerInnen sollen die Fähigkeit besitzen, "[...] mit den verschiedenartigsten Personen eine gelöste Gesprächsatmosphäre herstellen und aufrechterhalten zu können." (Bortz et al. 2003: 247 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Fröhlich schließt vom nur vereinzelten Auftreten schwieriger Situationen auf die "deutliche Sensibilität für die Schaffung eines positiven Interviewsettings" seitens der InterviewerInnen. (Fröhlich et al. 2009: 46) Hirschmann und Loidl-Keil geben mit Hinblick auf soziale Nähe bzw. Distanz zwischen den Peer-Interviewenden und ihren Interviewpartnern an, dass sie "auf Grund ihrer externen Position in den Interviews und ihrer geringen sozialen Distanz zu den Klient/innen Vertrauen genießen." (Hirschmann et al. 2009: 38 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 46; kursiv im Orig.) Der Beobachtergruppe fiel auf, dass die Nueva-EvaluatorInnen einen "kühleren" Interviewstil an den Tag legten als die Kontrollgruppe der FH-AbsolventInnen, die mehr als die Peer-InterviewerInnen von sich erzählten und versuchten (oder sogar versuchen mussten), durch kommunikative Vorleistungen, eine vertraute Gesprächsbasis herbeizuführen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 46)
So nutzen laut Hirschmann et al. die Nueva-InterviewerInnen im Gegensatz zur FHKontrollgruppe nicht die "...Möglichkeit des offenen Gesprächs, des Smalltalks, [...] allgemeine, vertiefende oder zusätzliche Informationen von den Klient/innen und ihrer Lebenswelt zu erhalten und schließlich die passende Antwort zu erschließen" (Hirschmann et al. 2009: 36 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 46; kursiv im Orig.) Dem Forschungsteam erschien es, dass die Peer-Interviewenden in erster Linie "zum Ziel haben, eine von den Befragten geäußerte, klar zuordenbare Antwort zu erhalten." (Fröhlich et al. 2009: 46) So versuchten sie nicht, über den Inhalt des Interviews hinausgehende Informationen einzuholen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 46)
-
InterviewerInnen müssen "[...] über das Befragungsthema ausreichend informiert sein [...]" (Bortz et al. 2003: 247 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Diese Informiertheit ergibt sich aus dem Erfahrungshintergrund und Peer-Verhältnis der InterviewerInnen, sodass sie ihre eigenen Erfahrungen zu den Dienstleistungen, also Wohnangeboten und Werkstätten, einbringen. Jedoch merken Hirschmann et al. diesbezüglich an, dass obgleich sie "diese [Erfahrungen; d. Verf.] auch gelegentlich in die Befragung einfließen lassen, [... ] die Nueva-Evaluator/innen ihr Potential hier nur gering" nutzen. (Hirschmann et al. 2009: 36 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 47; kursiv im Orig.) Die Autoren bringen dies damit in Verbindung, dass beim "NUEVA"- Evaluationsmodell, z.B. durch die Vermeidung voneinander abweichender Frageerläuterungen, "eine standardisierte und gut eingeübte Vorgangsweise" angestrebt wird. (ebd.) Das führt jedoch den Autoren zufolge dazu, dass die InterviewerInnen "den Spielraum zum offenen Dialog selten nutzen, bzw. gar nicht aufkommen lassen."(ebd.)
-
InterviewerInnen sollen möglichst versuchen, "[...] die Antworten des Befragten durch eigene Urteile und Bewertungen nicht zu beeinflussen." (Bortz et al. 2003: 247 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Hinsichtlich der Antwortverzerrung durch das Auftreten und Verhalten der Peer- InterviewerInnen konstatiert das FH-Forschungsteam folgendes:
Die Interviews "...entziehen sich [...] einer 'strengen Kontrolle', viel mehr sind sie subjektiv geprägt und vom Vorgehen der Interviewenden beeinflusst. [...] Häufiger als erwartet, wird das Interview zu einem 'Antwortsuchen', in das Suggestivfragen eingehen und in dem den Interviewten Antworten 'in den Mund gelegt' werden." (Hirschmann et al. 2009: 37 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 47; kursiv im Orig.)
Fröhlich stellt heraus, dass es besonders bei der Erläuterung von Fragen zu Beeinflussungen durch die Interviewenden kommen kann. Dies trifft verstärkt zu, wenn Erklärungsbeispiele spontan erfunden werden. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 47) Die Forschungsgruppe weist in diesem Kontext darauf hin, dass die Fähigkeit zum assoziativen Verständnis bei Menschen mit Behinderung nicht in gleichem Maß ausgeprägt ist wie bei Menschen ohne Lernschwierigkeiten. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 48) Die Beobachtungen ergeben auch, dass die Peer-InterviewerInnen "kaum versuchen, Antworten assoziativ aus verschiedenen vorher geäußerten Aussagen oder Beobachtungen abzuleiten bzw. zu ergänzen." (Fröhlich et al. 2009: 48)
Assoziation wirkt sich auch in der Interpretation der Antworten aus, wenn es darum geht, die Antworten gemäß der vorliegenden Antwortmöglichkeiten "richtig" einzuordnen: Die Erscheinung, "[...] dass Interviewte wiederholt nicht in vorgegebenen Antwortkategorien antworten [erfordert; d. Verf.] [...] ein hohes Maß an assoziativem Verständnis [...], um reale Situationen und verfügbare Instrumentenkategorien abzugleichen." (Hirschmann et al. 2009: 35 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 54; kursiv im Orig.)
Die "NUEVA"-InterviewerInnen unterlassen daher auch Korrekturen sowie das Hinterfragen der Antworten ihrer GesprächspartnerInnen und arbeiten wenig mit spontanen Erläuterungen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 48) Diese Vorgangsweise trägt laut Fröhlich et al. "zu verstärkter Standardisierung, [...] aber auch zu einem engeren Repertoire für die Antwortgewinnung" bei. (Fröhlich et al. 2009: 48)
-
"Der Interviewer muss selbstkritisch sein, um Gefährdungen der Interviewresultate durch die Art seines Auftretens [...] erkennen und ggf. vermeiden zu können." (Bortz et al. 2003: 247 zit. n. Kannonier-Finster et al. 2008: 117)
Was die Fähigkeit zur Selbstkritik betrifft, wurde in Gesprächen mit den Peer- InterviewerInnen für das Forschungsteam deutlich, "dass sie ein schwieriges Interview meist mit den verbalen und kognitiven Fähigkeiten der Klient/innen in Verbindung bringen." (Hirschmann et al. 2009: 38 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 48; kursiv im Orig.) Denn Fröhlich und Konrad zufolge ist dies eine nachvollziehbare und "normale" Verhaltensreaktion verglichen mit Reaktionen nichtbehinderter Menschen, die ebenfalls häufig bei problematischen Situationen den Interaktionspartner als Schuldigen heranziehen. Die FH-Forschungsgruppe weist jedoch auch kritisch darauf hin, dass die InterviewerInnen ihre Vorgangsweise selten reflektiert hinterfragen. (vgl. Fröhlich et al. 2009: 48) Wenn dies doch der Fall ist, "[...] finden sie durchaus zweckdienliche Hinweise für eine Verbesserung ihrer Gesprächsführung [...]." (ebd.)
In gewissem Maße sind die oben zusammengefassten Ergebnisse sicherlich verallgemeinerbar und zeigen grundsätzlich die Möglichkeit der Reproduzierbarkeit von standardisierten Daten durch Menschen mit Behinderung als Interviewende. Im Lichte der Erkenntnisse soll nun ein Resümé zum Peer-Interview versucht werden.
Das FH-Forschungsteam bewertet abschließend das Wissen, über das Peer InterviewerInnen zu Kommunikationsformen ihrer GesprächspartnerInnen verfügen als Vorteil für die Befragung. Gleichzeitig zieht es jedoch in Zweifel, dass die Peer-Methodik Befragungen mit anderen Interviewenden generell überlegen ist, weil eine vergleichbare soziale Nähe ihrer Auffassung nach auch ohne Peer-Inteviewenden zustande kommen könnte (vgl. Fröhlich et al. 2009: 51):
"Für das Konzept und Einsatz der eigenen Betroffenheit in Analogie zu den Interviewten spricht das Argument, dass ein gemeinsames Vorverständnis im Hinblick auf verbale und nonverbale Formen des Ausdrucks potentiell vorliegt. [...] Dass eine solche soziale Nähe und Symmetrie [wie mit Peer-InterviewerInnen, Fröhlich et al.] in Interviews mit anderen Interviewenden nicht herstellbar wäre, kann aus dem Argument jedoch keinesfalls geschlossen werden." (Hirschmann et al. 2009: 38 zit. n. Fröhlich et al. 2009: 51; kursiv im Orig.)
Fröhlich und Konrad halten dem entgegen, dass der mit den Peer-InterviewerInnen verbundene Expertenstatus entscheidend sei, denn dieser "bietet eine Möglichkeit, dem Gegenüber zu zeigen, dass Erfahrung im Feld vorhanden ist. Er bietet Vertrautheit auf einer eher professionell-distanzierenden Ebene [...] von Experte zu Experte." (Fröhlich et al. 2009: 52)
Die aufgeworfene Frage, ob ein Peer-Interview-Setting "automatisch" bessere Interviewresultate bringen würde, ist eine wichtige - auch wenn sie durch die vorliegende Literatur nicht abschließend beantwortbar ist. Schließlich gibt es viele Unsicherheits- und Risikofaktoren bei Befragungen von Menschen mit Behinderung, die ebenfalls von Menschen mit Behinderung durchgeführt werden. Da mit der Peer-Interview-Methode bewusst die ausschließliche Anwesenheit von Menschen mit Behinderung als Interviewende und Befragte in der Befragungssituation angestrebt ist, gibt es keine "Kontrolle" über die Interviewsituation.
Die daraus zu ziehende Konsequenz ist, dass verstärkt auf die Durchführungsobjektivität geachtet werden muss. Die Hinweise dafür, dass Menschen mit Behinderung im Rahmen von Peer-Interviews ebenso in der Lage sind, Befragungen durchzuführen, sind ausreichend. Kannonier-Finster und Ziegler ziehen die Bilanz, dass die Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei Erhebungen "grundsätzlich denkbar", aber stark abhängig von den konkreten ausführenden Personen ist. (Kannonier-Finster et al. 2008: 136):
"Inwiefern dieses Potential in der Lage ist, auch die erforderliche Validität der Daten, die unter Beteiligung der Menschen mit Behinderung erhoben werden, herzustellen, hängt in hohem Ausmaß von den verfügbaren Kompetenzen bei der Auswahl und bei der Ausbildung der Evaluatoren ab." (Kannonier-Finster et al. 2008: 118)
Peer-Interviews müssen also jedenfalls unter den entsprechenden Bedingungen erfolgen, die vor allem durch eine fundierte InterviewerInnen-Ausbildung und Training erarbeitet werden kann. In der Literatur wird daher durchwegs der InterviewerInnen-Ausbildung eine große Bedeutung beigemessen.
Kannonier-Finster et al. ziehen den Schluss, dass grundsätzlich die Befragung von Menschen mit Behinderung ebenso gut umsetzbar ist wie mit anderen Personengruppen, den Besonderheiten der Interviewsituation ist jedoch Rechnung zu tragen. (vgl. Kannonier- Finster et al. 2008: 112) Die AutorInnen stellen abschließend zu ihrer kritischen Betrachtung der "NUEVA"-Methode fest: "Grundsätzlich sind Befragungen von Menschen mit Behinderung den Befragungen von anderen Zielgruppen gleichzusetzen, wenn die verwendeten Methoden an die Zielgruppe angepasst sind." (Kannonier-Finster et al. 2008: 136)
Eine andere, über methodische Aspekte hinausweisende, ist die Ebene der Förderung der ausführenden Peer-InterviewerInnen aus sozialpädagogischen Motiven:
-
So kann die Befragung von Menschen mit Behinderung den Selbstwert steigern und die Würde des Menschen mit Behinderung unterstützen. (vgl. Kannonier- Finster et al. 2008: 113) Außerdem beinhaltet es für beide Seiten Erfahrungen und Lernchancen für Empowerment-Kompetenzen. "Die Befragungssituation selbst kann zu einem Akt der Förderung von persönlicher Autonomie werden." (ebd.)
-
Die Personengruppe ist in ihrer Lebensrealität selten angehalten, Zufriedenheit und/ oder Kritik zu äußern. Umso mehr hat "der Vorgang 'ich werde gefragt' [...] eine positive Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung und das Erleben von Einfluss und Gestaltung." (ebd.)
-
in Interview ist zugleich eine Schulung der Wahrnehmung, weil sie Menschen mit Behinderung auffordert, "die soziale Umwelt differenziert zu erleben, sie zu bewerten", was wiederum die Voraussetzung für die Artikulation von Bedürfnissen darstellt. (ebd.)
Zusammenfassend orten Kannonier-Finster und Ziegler "positive Nebeneffekte" im Fall der "NUEVA"-Methode wie z.B. "Beschäftigungsmöglichkeiten für NutzerInnen, theoretisch pädagogische Überlegungen, Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen [...], die neben den offiziellen Zielsetzungen einen beachtenswerten Stellenwert einnehmen." (Kannonier-Finster et al. 2008: 136)
Punktuell gibt es international Kooperationen im Bereich der Peer-Forschung mit Menschen mit Behinderung. Hervorzuheben ist die Vorbild-Funktion des "Ask Me!"- Forschungsdesigns, das international Maßstäbe setzt. Das "Ask Me!"- Instrument steht zwar unter Urheberrechtsschutz, dessen Weitergabe durch Bonham Research erfolgt aber recht freigiebig. So ist lediglich das Manual zum Erhebungsinstrument kostenpflichtig und unter der Auflage zu verwenden, dass die Peer-InterviewerInnen eine zweitägige Schulung von Bonham Research absolvieren, um das Instrument auch richtig einzusetzen. Abgesehen von der Kommunikation über wissenschaftliche Publikationen sind keine formalisierten Vernetzungsaktivitäten bekannt, es gibt aber vereinzelte Beispiele von informeller Verbreitung und Zusammenarbeit im Bereich von "Ask Me!":
So gibt es mittlerweile eine Adaptierung des Instruments von "Ask Me!" für die Niederlande namens "Zeg het ons!". Denn die niederländischen ForscherInnen hatten freundlicherweise eine noch nicht ganz ausgearbeitete Version des Ask Me!-Instruments von Robert L- Schalock erhalten, sodass es noch nicht dem Copyright unterlag. Diese setzen nun den Fragebogen für ihre Erhebungen unter der Bedingung ein, dieses nicht kommerziell zu nutzen oder weiterzugeben. Die niederländische Version wird umgesetzt vom "The Netherlands Organisation for Health Research and Development" (ZonMw) und dem "Netherlands Institute for Care and Welfare" (NIZW). Auch dieses Projekt trainiert Menschen mit geistiger Behinderung als InterviewerInnen, sodass sie ihre Peers im Wohnbereich befragen können. (vgl. Promberger et al. 2008: 17) Eine weitere Anwendung von Bonhams und Schalocks Expertisen findet in Edmonton, Alberta in Kanada statt. Die zuständige Regierungsbehörde besitzt ein großes politisches Interesse daran und engagierte deshalb Schalock und Bonham als Berater für ihr Erhebungsvorhaben. Das Instrument basiert auf den acht QOL-Dimensionen nach Schalock und wurde für Edmonton unter Einbindung der SelbstvertreterInnen adaptiert, ein lokales Foschungsinstitut wurde mit der wissenschaftlichen Ausarbeitung beauftragt. Dazu liegen keine Publikationen vor, weil kein wissenschaftliches Interesse seitens der Behörde in Edmonton besteht.
Vor dem Hintergrund der Qualitätsdiskussion zum Sozialbereich in Gremien der Europäischen Union gibt es im EU-Raum formalisierte Aktivitäten der Vernetzung. Zwar ist eine vollständige EU-weite Harmonisierung der Qualitätsstandards für soziale Dienstleistungen aufgrund der unterschiedlichen nationalen Ausgestaltung der sozialen Systeme nicht angestrebt, es sollen jedoch allgemeine Beurteilungskriterien für Dienstleistungsqualität erstellt werden. (vgl. Inclusion Europe 2010: 25)
Diesen Zweck verbindet die Europäische Union mit dem Programm der EU-Kommission "PROGRESS", das mit acht Projekten "bewährte Methoden zur Definition, Verbesserung und Messung der Qualität sozialer Dienstleistungen in den Mitgliedsländern verbreiten" will. (nueva 2009: 4) "PROGRESS" fördert u.a. das Vernetzungsprojekt "UNIQ" ("Users Network to Improve Quality"), das sich erst in jüngster Zeit als Netzwerk von Partnerorganisationen in verschiedenen europäischen Ländern entwickelt hat. (vgl. Fröhlich 2009: 13)
"Atempo/NUEVA" repräsentiert die österreichische Teilnehmerorganisation und koordiniert die Aktivitäten mit den Partnern in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in Norwegen, Spanien, Irland, Slowenien, Litauen, Makedonien und Italien, das gemeinsame Dach stellen "Inclusion Europe" und der europäische Zusammenschluss sozialer Dienstleistungsanbieter "EASPD" ("European Association of Service Providers for Persons With Disabilities") dar. (vgl. Inclusion Europe 2010: 31f)
Aufgrund des vergleichsweise hohen Entwicklungsstands und der Innovation, die "NUEVA" kennzeichnen, orientiert sich "UNIQ" daran und prüft die Möglichkeit der Übertragung auf andere Länder. Im Rahmen der "UNIQ"-Struktur können die Mitgliedstaaten die "NUEVA"-Methodik in ihren sozialen Kontexten adaptieren, einsetzen und weiterentwickeln. (vgl. Inclusion Europe 2010: 25) Dies wird z.B. in Test- Evaluationen in Deutschland, Tschechien und Norwegen, die 2009 angelaufen sind, verwirklicht, wobei EvaluatorInnen aus dem "NUEVA"-Team zusammen mit lokalen Trägerorganisationen das Instrument für die heimischen Verhältnisse anpassen und mit ausgewählten Peer-InterviewerInnen erproben. Aus den Erfahrungen können auch nicht beteiligte "UNIQ"-Mitgliedstaaten Schlüsse für eine Umsetzungsmöglichkeit in ihrem Land ziehen. (vgl. nueva 2009: 4)
Es besteht noch ein umfangreicher Entwicklungsspielraum, denn neben "Atempo/NUEVA" setzen lediglich die Partnerorganisationen in Spanien (FEAPS) und Deutschland (AquaUWO, "Arbeitshilfe zur Qualitätsentwicklung in Diensten für Unterstütztes Wohnen von Menschen mit geistiger Behinderung") auf Menschen mit Behinderung als EvaluatorInnen - und dies auch nur in begrenztem Ausmaß. (vgl. Freyhof 2010: 10, 26) In Anbetracht der zeitlichen Begrenztheit von EU-Projekten ist jedoch der mögliche Entwicklungsfortschritt im Rahmen von "PROGRESS" eingeschränkt.
Das Fazit der "Inclusion Europe"-Vergleichsstudie schlägt in die gleiche Kerbe: So sei direkte NutzerInnenbeteiligung im Sinne von emanzipatorischer Forschung noch immer die Ausnahme in der EU-Forschungslandschaft. Freyhof hält in der vergleichenden Betrachtung fest, dass unter den untersuchten Evaluationsmodellen "NUEVA" das einzige sei, das Menschen mit Behinderung konsequent eine zentrale Rolle im Forschungsprozess einräumt, indem sie ihre Auffassungen von Qualität als Basis ihrer Methodik einsetzt. (vgl. Freyhof 2010: 26)
Kannonier-Finster und Ziegler konstatieren übereinstimmend, "dass Sozialforschung zum Phänomen der Behinderung überwiegend dadurch gekennzeichnet ist, dass sie 'über' Menschen mit Behinderung und nicht 'mit' Menschen mit Behinderung erfolgt." (Kannonier-Finster et al. 2008: 110) Ebenfalls verbesserungswürdig ist die Literaturlage im Bereich Peer-Interview, um die Verbreitung des bereits vorhandenen Wissens zu steigern. Denn Literatur und Dokumentationen über praktische Erfahrungen mit der Methode nur schwer zugänglich, weil es kaum systematische Publikationen dazu gibt. Buchner et al. verweisen auf die gesellschaftliche Verwirklichung der UN-Konvention als geeignetes und breites Feld, dass der Beforschung mittels Peer-Methodik offen stehen würde. (vgl. Buchner et al. 2011: 8) Trotz ihrer noch geringen Verbreitung hoffen die AutorInnen darauf, dass partizipative Forschung in der näheren Zukunft einen dermaßen großen Stellenwert bekommt, "dass eine Einbeziehung nach den Kriterien Inklusiver Forschung selbstverständlich wird und daher der Begriff 'Inklusive Forschung' an Bedeutung verliert, denn, wie Walmsley (2004, 69) schreibt: 'Nur die Exkludierten brauchen Inklusive Forschung.' (Buchner et al. 2011: 9)
[28] Gegenstand der Untersuchung waren Forschungsprojekte ("user-led quality evaluation systems") in den UNIQ-Teilnehmerländern Österreich, Deutschland, Tschechische Republik, Norwegen, Spanien, Irland, Slowenien, Litauen, Makedonien und Italien. (vgl. Freyhof 2010: 28) Siehe Abschnitt "Vernetzung der Forschungsaktivitäten", S. 136
[29] Der dreizehnte Ansatz, "LOCO", den Promberger und Lorenz analysierten, wurde bewusst aufgrund dessen weggelassen, dass dieser eine Befragung von MitarbeiterInnen durch MitarbeiterInnen und keine NutzerInnenbeteiligung vorsieht.
[30] Im englischen Sprachgebrauch wird "peer" auch zur Bezeichnung des englischen Adels bzw. der Mitglieder des britischen Oberhauses und ihrer Gleichstellung im eigenen, elitären Kreis verwendet. Diese Bedeutung korrespondiert mit der Erscheinung kleiner elitärer Fachzirkel, wie sie bei Peer-Reviews im Wissenschaftsbetrieb in manchen Disziplinen durchaus vorkommen. (vgl. Gutknecht-Gmeiner 2008: 38)
[31] Die Testfragen lauten folgendermaßen: "(1) Do you understand you will be answering questions? (yes/no); (2) Do you understand you can skip questions if you do not want to answer them? (yes/no); (3) Do you understand you can stop the interview at any time? (yes/no); (4) Let me ask you a question from the interview. Would you say you are a happy person? (yes/sometimes/no); (5) Would you like to answer more questions? (yes/no); (6) Do you understand that you will be answering questions about your life? (yes/no)" (Bonham 2008: 6)
[32] Darunter AQUA-FUD, AQUANetOH, AQUA-UWO, Ask Me!, QUOFHI, Schöner Wohnen und NUEVA.
[33] Dieselben.
[34] "AQUA-NetOH" beinhaltet ausschließlich offene Fragen und fließt deshalb nicht in diese Analyse ein.
[35] Kannonier-Finster et al. zufolge erfährt das Prinzip der sozialen Nähe bzw. "einer möglichst geringen sozialen Distanz zwischen InterviewerInnen und InterviewpartnerInnen" (Kannonier-Finster et al. 2008: 115) in der jüngeren qualitativ-orientierten Literatur verstärkte Aufmerksamkeit. So bediente sich auch Pierre Bourdieu bei seiner Studie "Das Elend der Welt" (1997) Peers als InterviewerInnen nach dem Kriterium "gesellschaftlicher Nähe". Idealerweise setzte der Autor es so um, sodass z.B. eine Physikerin eine Physikerin, ein junger Lehrer einen anderen jungen Lehrer oder ein Arbeitsloser einen Arbeitslosen, also nach Beruf und sozialer Herkunft Gleichrangige, befragten. Man nimmt an, dass die Validität der Daten eine höhere ist, wenn seitens der Interviewenden ein Vorverständnis, Kenntnis der Lebenswelten und Kommunikationsformen in Bezug zur jeweiligen sozialen Gruppe besteht. (vgl. ebd.)
[36] Die Quelle war nicht erhältlich: Hirschmann, Heimo/ Loidl-Keil, Rainer 2009: Forschungsbericht zur Nueva Begleitforschung. Unveröffentlichter Forschungsbericht. FH Joanneum. Graz.
Inhaltsverzeichnis
Den Probeinterviews ging eine Interviewerausbildung voraus, in der die TeilnehmerInnen, die Angebote der Lebenshilfe im Bereich Wohnen und/ oder Arbeit nutzen, sich auf ihre künftige Tätigkeit als InterviewerInnen vorbereiteten.
Mag. Monika Daoudi-Rosenhammer informierte Anfang Oktober im Namen der Lebenshilfe Salzburg mittels einer Ausschreibung die Lebenshilfe-Einrichtungen in der Stadt und der näheren Umgebung über die Ausbildung zum Interviewer/ zur Interviewerin und präsentierte es dabei als ein Weiterbildungsangebot. Aufgrund der erstmaligen Durchführung der Ausbildung und fehlender Erfahrungswerte wurden relativ hohe Anforderungen an die BewerberInnen gestellt: So waren Grundvoraussetzungen die Lese und Schreibfähigkeit und ein angemessenes Sozialverhalten. Bis Ende der Anmeldefrist erhielten wir 19 Anmeldungen. Die betreffenden Personen bekamen eine Anmeldebestätigung und eine Einladung zum ersten Treffen am 8. November 2010 zugeschickt. Aufgrund der begrenzten Zahl der Anmeldungen war es möglich, alle BewerberInnen aufzunehmen (zwei Personen traten dabei die Schulung nicht an).
Das erste Vorbereitungs- und Kennenlerntreffen fand im Plenum im großen Seminarraum in der Landesgeschäftsstelle der Lebenshilfe (Nonntaler Hauptstraße 55, 5020 Salzburg) statt. Nach einer Einführung zur Ausbildung und deren Ziele sowie nach einer Vorstellrunde bekamen die TeilnehmerInnen als Medium zum Kennenlernen einen kleinen Fragebogen zum gegenseitigen Befragen in Zweiergruppen. Die fünf Fragen behandelten die Themen Befragungen von Menschen mit Behinderung, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Arbeitszufriedenheit und Erwartungen zum bevorstehenden Training.
Der zweite Termin bestand in der Exkursion einer kleineren Gruppe von drei SchlungsteilnehmerInnen und vier TrainerInnen nach Graz zu "Atempo", um sich ein Bild zur Arbeitsweise vom Evaluationsmodell "NUEVA" zu machen. Dort wurde den herzlich empfangenen BesucherInnen die "NUEVA"-Methode in einer Präsentation gezeigt, drei Peer-InterviewerInnen von "atempo" erzählten von sich und ihren Erfahrungen mit ihrem Beruf als InterviewerInnen und standen für weitere Fragen zur Verfügung.
An den darauffolgenden Terminen wurde das Training in zwei gleich großen Gruppen parallel weitergeführt, sodass jeweils acht Personen an der Schulung zum Wohnbereich bzw. zum Bereich Arbeit teilnahmen. Insgesamt waren zehn Termine im gleichmäßigen Wochenabstand vorgesehen, dabei wurde auch darauf geachtet, dass diese immer auf den gleichen Tag fallen. Die Termine beinhalteten jeweils drei Einheiten à eine Stunde und ein anschließendes gemeinsames Mittagessen im Speisesaal der Landesgeschäftsstelle. Fr. Claudia Häusler und Hr. Mag. Michael Hanel gestalteten die Schulung zum Arbeitsbereich, während Fr. Mag. Daoudi-Rosenhammer und ich die TeilnehmerInnen auf das Instrument zur Zufriedenheitsbefragung im Wohnbereich schulten.
Damit der Ablauf der Veranstaltung gesichert war, war ausschlaggebend, Bedingungen, die die Organisation betreffen, klar mit den KlientInnen zu vereinbaren. So waren die angehenden InterviewerInnen selbst für ihren Transport zuständig. Ein Teilnehmer erlernte zu diesem Zweck sogar den Weg zwischen Salzburg und Seekirchen, wo er wohnte und arbeitete, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen. Die KlientInnen waren auch dafür verantwortlich, die Schulungstermine eigenständig einzuhalten, in den jeweiligen Einrichtungen weiterzugeben und pünktlich zur Schulung zu erscheinen. Beim ersten Gruppentermin war die Pünktlichkeit beim Großteil der Interviewer-AnwärterInnen noch zu bemängeln, weil sich ihre Verspätung bis zu einer halben Stunde nach der eigentlichen Beginnzeit ausdehnte. Doch bereits beim darauffolgenden Termin besserte sich ihr Zeitmanagement sodass keine weitere Aufforderung mehr nötig war.
Zwei Termine (Anfang Dezember und Ende Jänner) sind aufgrund anderer Veranstaltungen, die einige der InterviewerInnen besuchten, ausgefallen und mussten nachgeholt werden. Deshalb dehnte sich die Ausbildung bis Mitte Februar aus. Es ereigneten sich aufgrund dessen vereinzelte Zwischenfälle, denn diese waren insbesondere der Fall, wenn Veränderungen im Zeitplan (z.B. das Verschieben auf andere Wochentage) notwendig wurde. Beispielsweise ist unserer Gruppe zum dritten Termin ein Interviewer abhanden gekommen, weil er sich im Termin geirrt hatte. Daraufhin wurde er in die andere Gruppe, zu deren Termin er erschienen ist, übernommen. Somit verblieben sieben (fünf Teilnehmer und zwei Teilnehmerinnen) in der Schulungsgruppe, die sich mit dem Instrument "Wohnen" beschäftigte. Eine andere Verwechslung trat bei einer Terminverschiebung auf, wobei ein Teilnehmer an einem falschen Tag erschien. Im Großen und Ganzen betrachtet, funktionierte das Organisatorische jedoch zufriedenstellend, sodass die Rahmenbedingungen für ein kontinuierliches Arbeiten gegeben waren. Im Allgemeinen schärfte die Durchführung der Ausbildung auch unser Bewusstsein um die zentrale Bedeutung in den verschiedensten Kontexten, den KlientInnen Zeit zu geben.
Dem Veranstalter-Team war es wichtig, den angehenden InterviewerInnen, Wertschätzung entgegenzubringen und ihrer Ausbildung den notwendigen offiziellen Charakter zu geben. Dies sollte mit einer persönlich überreichten Bestätigung über die Teilnahme an der Ausbildung zum Ausdruck gebracht werden. Beim Anlass der Zertifikatsverleihung hielt Hr. Guido Güntert, Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH, eine Rede zum Kontext und Zweck der Schulung, in der er die AbsolventInnen zu weiterem Engagement in ihrer InterviewerInnen-Tätigkeit aufrief. Hr. Güntert bekräftigte dies, indem er die Ergebnisse solcher Befragungen als besonders wertvoll und aussagekräftig für die Argumentation gegenüber den Kostenträgern (in diesem Fall dem Land Salzburg) herausstellte. Der Geschäftsführer überreichte den KlientInnen ihre Zertifikate, danach wurde mit Sekt angestoßen. Die frischgebackenen Interview-AnwärterInnen waren sichtlich angetan von der Feierlichkeit.
Der verwendete Fragebogen (siehe Anhang) wurde 2005 von einem Lebenshilfe-internen bundesweiten Arbeitskreis, dessen Mitglieder K. Astegger, H. Hamann, B. Klisch, E. Sperandio und S. Unterweger alle im Qualitätsmanagement tätig sind, entwickelt. Nach einer Analyse der bestehenden Erhebungsinstrumente wurde der Schluss gezogen, ein eigenes Instrument zu entwickeln, um den inhaltlichen Anforderungen, der praktischen Durchführbarkeit und Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung als Zielgruppe zu entsprechen. Es kristallisierte sich heraus, dass die Mindeststandards der Walisischen Regierung (Welsh Assembly Government 2002), LEWO-II (Schwarte/ Oberste-Ufer 2001) sowie AQUA-UWO den Erwartungen am ehesten entsprachen. Man entschied sich schließlich für das Evaluationsmodell LEWO-II als Orientierung, sodass anhand einer Kriterienliste auf systematische Weise die geeignetsten Items herausgefiltert werden können. Am Ende eines fundierten Bewertungs- und Diskussionsprozesses stand der Interviewleitfaden "Zufriedenheit der Klienten beim Wohnen". (vgl. Astegger et al. 2005)
Dieser setzt sich aus folgenden sieben Inhaltsdimensionen zusammen, die von 48 Fragen erfasst werden:
Abb. 10: Aufbau des Fragebogens (vgl. Astegger et al. 2005)
|
Inhaltsdimension |
Unterkategorien |
|
1.Wahlmöglichkeiten und individuelle Gestaltung der Wohnung |
|
|
2. Alltagsstrukturen |
2.1 Selbstversorgung und Alltagshandeln 2.2 Freizeitaktivitäten und Erwachsenenbildung 2.3 Zeitstrukturen 2.4 Religion |
|
3. Zusammenleben |
3.1 Zusammenleben mit MitbewohnerInnen 3.2 Beziehungsgestaltung mit BetreuerInnen 3.3 Privatheit und Individualisierung 3.4 Umgang mit Krisen |
|
4. Soziale Netzwerke und private Beziehungen |
4.1 Bedeutsame Beziehungen 4.2 Sexualität und Partnerschaft |
|
5. Rechte und Schutz |
5.1 Rechte 5.2 Gesundheit 5.3 Vertretung |
|
6. BetreuerInnen |
|
|
7. Angebotsplanung und Evaluierung |
Jede Frage bietet die Möglichkeit, eine Anmerkung hinzuzufügen. Das Instrument liegt in einer sprachlichen Form sowie in einer Leichter-Lesen-Version auf, wobei das Verständnis mit einfacheren Frageformulierungen und Bildern unterstützt wird. Der Frageinhalt ist dabei unverändert. In der Erhebung kam der Fragebogen in einer Leichter-Lesen-Version zur Anwendung. Die ursprüngliche zweistufige Antwortskala (ja/ nein) wurde jedoch überarbeitet auf eine dreistufige (ja/ neutral/ nein) und ergänzt durch eine vierte Antwortmöglichkeit (weiß nicht/ trifft nicht zu), um der zentralen Tendenz entgegenzuwirken. Im Sinne der Prinzipien "Leichter Sprache" wurden die Antwortmöglichkeiten mit Smilies sowie das "weiß nicht"/ "trifft nicht zu" mit einem Fragezeichen veranschaulicht.
Dieser Fragebogen erfuhr bisher eine mehrfache Nutzung: Eine Befragung von Menschen mit Behinderung führte Heidi-Sophie Fuchsberger (n=68) im Oktober 2005 bis Februar 2006 durch. Etwa im gleichen Zeitraum erfolgte damit eine Gesamterhebung der Organisation, die mit einer Erhebung der Mitarbeiterperspektive (zwischen Oktober 2005 und März 2006) von Thomas Thöny verglichen wurde. (vgl. Thöny 2008)
Aufgrund der Tatsache, dass wir einen bereits bestehenden, von ExpertInnen konzipierten Fragebogen, verwendeten, kann unsere Peer-Interview-Erhebung nicht als emanzipatorisches Forschungsunternehmen gewertet werden. Die inklusive Beteiligung ist in diesem Fall auf die Erhebungsphase beschränkt, welche jedoch ausgehend von den Erkenntnissen der Probeinterviews in Zukunft ausbaufähig ist. Es ist auch angedacht, die Präsentation der Ergebnisse in den Einrichtungen von den Peer-InterviewerInnen mitgestalten zu lassen.
Abgesehen von der intensiven InterviewerInnenschulung, die wohl die wirksamste Qualitätssicherungsmaßnahme darstellt, stellte ich Überlegungen an, die Interviewsituation für mich nachvollziehbar zu machen. Eine direkte Kontrolle, z.B. durch Beobachtung der Befragungssituation, schloss ich aus, weil es der Intention und den Prinzipien der Peer- Methodik widersprochen und Unglaubwürdigkeit erzeugt hätte.
Eine Maßnahme zur Qualitätssicherung der Interviews war ein Feedbackbogen, ein kurzer Fragebogen mit fünf Fragen und jeweils drei Antwortmöglichkeiten, mithilfe dessen sie uns eine Rückmeldung geben konnten, wie sie den Befragten, das Interview und die Befragungssituation erfahren haben. Der Feedbackbogen konnte jedenfalls direkt nach dem Interview, nach Wunsch gemeinsam mit uns oder alleine ausgefüllt werden. Natürlich wäre das Erleben beider Seiten interessant gewesen, für die Befragten schloss ich dies aber aus, weil sie nach einem Interview ohnehin schon eine lange Befragungszeit hinter sich haben.
Eine zweite geplante Maßnahme war, mit Zustimmung der Befragten, die Interviews aufzunehmen, um das Zustandekommen der Ergebnisse nachvollziehen zu können. Erwartungsgemäß groß war aber die ablehnende Haltung der Befragten.
Im Vorfeld der Befragung wurde das Vorhaben der Probeinterviews in Wohneinrichtungen der Lebenshilfe Salzburg mit Bereichsleiterin Fr. Mag. Sabine Biber abgeklärt. Unsere Überlegungen, darüber, welche Einrichtungen erhoben werden sollten führten uns zur Idee, die Erhebung im Wohnverbund bestehend aus der Betreuten Wohngemeinschaft (im Folgenden als "BW" abgekürzt) Stabauergasse und dem Wohnhaus Meierhofweg durchzuführen. Nach einem Gespräch mit der zuständigen Leiterin Fr. Mag. Ingrid Klein erteilte sie uns nach Beratungen mit den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen ihre Zustimmung. Fr. Mag. Klein leistete wichtige Vorarbeit, indem sie insbesondere den KlientInnen die Befragung näher brachte und sie dazu motivieren suchte. Sie wies uns auch darauf hin, einen Interviewer, aufgrund seiner Befangenheit zum BW, in dem er einst wohnte, und den dort lebenden Personen, nicht einzusetzen.
Der Zusammenstellung der zweiköpfigen Interviewteams wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt und Überlegungen damit verbunden. Das Ergebnis der Schulung stellte sich folgendermaßen dar: Neben dem einen oben genannten Interviewer wurde eine Kollegin nicht eingesetzt, weil sie drei Schulungstermine aufgrund eines Kuraufenthalts verpasst hatte. Beiden wurden in Aussicht gestellt, bei einer Nachschulung und bei den nächsten Erhebungen mitzumachen. Ein Schulungsteilnehmer verzichtete auf seine Mitwirkung bei den Probeinterviews, weil er noch mehr Übung und Zeit zur Auffassung des Gelernten brauchte. So blieben vier Peer-InterviewerInnen übrig, die in Zweier-Teams die Befragungen durchführen wollten. Bei der Zusammensetzung der Teams wurde in erster Linie darauf geachtet, Stärken und Schwächen der angehenden InterviewerInnen gut zu kombinieren, sodass ggf. Schwächen (z.B. Leseschwäche) ausgeglichen werden konnten. Anhaltspunkte dafür, welche Personen gut zusammenarbeiten, erhielten wir schon vorab bei den Übungen im Training.
Die Literatur sowie unsere Erfahrungswerte legen nahe, dass die Rahmenbedingungen, der Kontext und die Erhebungssituation selbst, nicht nur, aber gerade unter Beteiligung von Menschen mit Behinderung, maßgeblich sind. Aufgrund dieser Tatsache sollen im Folgenden die Bedingungen der Erhebung geschildert werden.
Die Vorbereitung der Befragungssituation gestaltete sich dahingehend, dass die Befragten in Besprechungen auf die Interviews von der Einrichtungsleiterin vorbereitet wurden. Diese stellte den potentiellen Befragten Ziele und Inhalt des Vorhabens vor. Unter Berücksichtigung der freiwilligen Teilnahme sondierte Fr. Mag Klein das Interesse unter den BewohnerInnen und gab dies an uns weiter.
Die Rahmenbedingungen der Erhebungssituation waren von logistischen Erfordernissen beeinflusst. Neben der etwas aufwändigen Organisation des Transports zu den Wohnstandorten, bestand die Problematik, dass die Peer-InterviewerInnen ihre anstrengende Interviewertätigkeit nicht an einem arbeitsfreien Tag, sondern anschließend an einen Arbeitstag ausführten. Die InterviewerInnen klagten dementsprechend über Ermüdung.
Der soziale Kontext der Befragungen unterschied sich in den zwei Einrichtungen erwartungsgemäß, in denen die Erhebung stattfand. Ein Faktor war, dass wir aufgrund eines Ausfalls bei der ersten Erhebung, der betreuten Wohngemeinschaft, nur drei Interviewer zur Verfügung hatten und bei der zweiten vier InterviewerInnen. Dies war bedeutsam, weil beim zweiten Interviewtermin zwei Paare parallel interviewen konnten, indem einander unterstützend, eine/r die Fragen stellte und die/ der andere sie am Fragebogen vermerkte.
Ein anderer Aspekt war die Form der Kontaktaufnahme mit den Befragten. So fand der erste persönliche Kontakt beim Interviewtermin selbst statt. Aus diesem Grund waren Fr. Mag. Daoudi-Rosenhammer und ich bei den Befragungsterminen anwesend, um im Ablauf unsere Unterstützung anbieten zu können. Im BW erfolgte die persönliche Vorstellung sowie eine nochmalige Information zur Befragung und deren Ziel und Einbettung im Plenum, bei dem drei Interviewpartner anwesend waren. Beim zweiten Interviewtermin unterschied sich die Vorgangsweise etwas, weil die InterviewpartnerInnen zu unterschiedlichen Zeiten von der Arbeit im Wohnhaus eintrafen, sodass mit Hinblick auf die verfügbare Zeit und mit Rücksicht auf den Lebensalltag der BewohnerInnen ein flexibleres Vorgehen notwendig wurde. Vorbereitend bekam im Wohnhaus jede/r Befragte für sich eine Erklärung von unserer Seite.
Die Auswahlkriterien der Befragten orientierte sich zunächst an der Freiwilligkeit als oberste Priorität. So wollte im BW und Wohnhaus jeweils ein/e BewohnerIn nicht befragt werden. Wir behielten uns auch vor, zwei non-verbale Klienten nicht zu interviewen, weil es zwar Hilfsmittel gibt, aber dieser Aspekt zu wenig Berücksichtigung in der Schulung gefunden hat. Dies hätte die Peer-InterviewerInnen wahrscheinlich überfordert und demotiviert. Zwei Ausfälle von Befragten ergaben sich aus den Krankenhausaufenthalten von zwei BewohnerInnen.
Insgesamt wurden somit sieben KlientInnen - drei von insgesamt fünf Personen im BW bzw. vier von insgesamt acht BewohnerInnen im Wohnhaus - in ihren Wohneinrichtungen interviewt. Die Befragten konnten den Ort, der ihnen am angenehmsten für die Befragung erschien, auswählen. Wer welche Befragungspersonen interviewte, wurde ebenfalls in Absprache mit den Interviewten vereinbart.
Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist, dass die InterviewerInnen zwar externen Einrichtungen zugehörig sind, aufgrund der Kleinräumigkeit der Lebenshilfe in Salzburg Stadt es aber teilweise Bekanntschaften - aber auch Konflikte - durch Besuche, gemeinsame Aktivitäten, Veranstaltungen gibt. Diesbezüglich wurde darauf geachtet, dass Personen mit engeren Kontakten nicht zusammen in der Interviewsituation waren, weil die vergangenen oder aktuellen Begegnungen die Befragungssituation überlagert hätten und beide Seiten zu sehr befangen wären.
Hinsichtlich der eingesetzten Instrumente zur Qualitätssicherung der Interviews stelle ich fest, dass die Feedbackbögen zuverlässig ausgefüllt wurden. Die Tonband-Aufnahmen konnte jedoch nur einmal eingesetzt werden. Denn im BW haben alle Befragten aus einer selbstbewussten Haltung heraus, abgelehnt, im Wohnhaus wollte auch nur ein Interviewter sein Gespräch aufnehmen und dieser war seines Zeichens selbst Interviewer (in der anderen Schulungsgruppe). Deshalb konnte diese Maßnahme ihrer Funktion nicht gerecht werden, weil gerade problematischere und eventuell kritischere Befragungspersonen, die die InterviewerInnen möglicherweise auf die Probe und vor Herausforderungen stellten, der Aufnahme nicht zustimmten.
Inhaltsverzeichnis
- 7.1 Soziodemografisches
- 7.2 Auswahlmöglichkeiten und Gestaltung der Wohnung
- 7.3 Selbstversorgung und Alltagshandeln
- 7.4 Freizeitgestaltung und Erwachsenenbildung
- 7.5 Zusammenleben mit den MitbewohnerInnen
- 7.6 Beziehungsgestaltung mit den BetreuerInnen
- 7.7 Privatheit und Individualisierung
- 7.8 Umgang mit Krisen
- 7.9 Soziale Netzwerke und private Beziehungen
- 7.10 Sexualität und Partnerschaft
- 7.11 Rechte und Schutz
- 7.12 Gesundheit
- 7.13 Vertretung
- 7.14 Zufriedenheit mit dem Betreuungspersonal
- 7.15 Angebotsplanung und Evaluierung
- 7.16 Unterschiede nach Wohnform und Wohndauer
- 7.17 Interpretation der Ergebnisse
Insgesamt haben die vier Peer-InterviewerInnen jeweils zu zweit insgesamt sieben KlientInnen befragt. Drei der Befragten leben im Betreuten Wohnen (von fünf BewohnerInnen insgesamt) und vier im Wohnhaus (von acht BewohnerInnen insgesamt). Sechs Befragte sind männlich, eine weiblich.
Alter und Wohndauer
Das Alter der Befragten liegt zwischen 29 und 50 Jahren (dies bezieht sich auf vier Personen, bei zwei hatte man keine Antwort erhalten). Im Mittel sind die befragten BewohnerInnen 40,20 Jahre alt, wobei gut die Hälfte der Personen zwischen 29 und 37 Jahren alt ist.
Die befragten BewohnerInnen leben zwischen vier und 25 Jahre lang, d.h. durchschnittlich 11,33 Jahre in der Wohneinrichtung. Fünf der sechs Personen, die die Frage nach der Wohndauer beantwortet haben, leben zwischen vier und zwölf Jahre lang in der jeweiligen Einrichtung. Nur eine Befragte lebt mit 25 Jahren mehr als doppelt so lange im Wohnhaus.
Sechs der sieben Befragten (86%) geben an, das aktuelle Wohnangebot aus verschiedenen Angeboten ausgesucht zu haben, während dies eine Person (14%) verneinte. Im Zuge dessen konnten sich drei der befragten BewohnerInnen (60%) gut informieren, während zwei andere (40%) sich nur mäßig oder nicht informiert fühlten[37].
Sechs der befragten KlientInnen (86%) geben an, das Angebot weiter nutzen zu wollen, eine Person (14%) teilte mit, vielleicht weiter in der Einrichtung wohnen zu wollen.
Ebenso sechs der Befragten (86%) können ihrer Aussage zufolge ihr Zimmer nach ihren Vorstellungen gestalten, für eine Person trifft dies mehr oder weniger zu. (14%)
Bei der Frage nach der sicheren Verwahrung ihres persönlichen Besitzes geben drei der befragten BewohnerInnen (43%) an, dass ihre Wertsachen sicher sind, zwei Personen (29%) halten es für mäßig gut verwahrt, weitere zwei verneinen die Sicherheit ihrer persönlichen Dinge.
Sechs der Befragten (86%) geben an, dass ihnen das Wohnumfeld (Haus und Garten) sowie die Einrichtung und Ausstattung gefällt, eine Person kann diese Fragen jeweils nicht beantworten (14%).
Fazit: Fünf von sieben Fragen zu Strukturmerkmalen des Wohnangebots sind überwiegend positiv beantwortet worden, die positiven Äußerungen von über 80% lassen eindeutig auf Zufriedenheit schließen. Das Informationsangebot als Basis der Auswahl von Wohnangeboten jedoch ließ deutlich zu wünschen übrig. Äußerst verbesserungswürdig erscheint die Verwahrung von persönlichen Dingen und Wertsachen (z.B. durch versperrbare Zimmer, Kästen o.ä.), dies bemängeln gut die Hälfte der befragten NutzerInnen.
Selbstversorgung
Sechs der befragten BewohnerInnen (86%) beantworten die Frage auf Mitwirkung bei Haushaltsaktivitäten positiv, darunter begrüßen fünf Befragte (71%) dies, während ein/e BewohnerIn diese Aufgabe nicht gerne erfüllt. Eine Person (14%) verrichtet laut eigener Aussage keine Tätigkeiten im Haushhalt. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Einkauf, das von sechs der befragten KlientInnen (86%) regelmäßig erledigt wird. Wobei dies wiederum von fünf der befragten BewohnerInnen (71%) als angenehme Tätigkeit empfinden, während eine Person dies ablehnt.
Alltagshandeln
Sechs der Befragten (86%) verwalten ihr Geld selbst, eine Person (14%) kann nicht selbstständig darüber verfügen.
Transport
Fünf der befragten Personen (71%) können selbstbestimmt die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wenn sie möchten, während jeweils eine Person (14%) diese nur manchmal oder nie in Anspruch nehmen kann.
Fazit: Die Form der Selbstversorgung und Mitwirkung an alltäglichen Tätigkeiten werden durchgehend zufriedenstellend bewertet, die Zufriedenheit mit dem Alltagshandeln bestätigen 80% positive Antworten. Weniger deutlich ausgeprägt ist die Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmittel, die nur 70% der Befragten regelmäßig und selbstbestimmt nutzen können.
Fünf der befragten KlientInnen (71%) können selbstbestimmt ihre Freizeit in der Wohneinrichtung so gestalten, wie sie möchten, während eine Person (14%) dies verneint. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten. Sechs der Befragten (86%) geben an, ihre freie Zeit, die sie in der Wohneinrichtung verbringen, nach ihren Bedürfnissen frei einteilen zu können, für eine Person (14%) ist dies mehr oder weniger gegeben.
Fünf der befragten BewohnerInnen (71%) geben an, nach ihrem Glauben leben zu können, für eine Person (14%) ist dies mehr oder weniger möglich. Für eine weitere Person (14%) trifft die Frage nicht zu.
Drei der befragten BewohnerInnen (43%) unternehmen regelmäßig Freizeitaktivitäten außerhalb der Wohneinrichtung, für zwei Personen (29%) trifft dies nur manchmal, für eine weitere Person (14%) gar nicht zu[38]. Fünf der befragten KlientInnen (71%) geben an, bei diesen Gelegenheiten neue Leute kennenzulernen, zwei der befragten BewohnerInnen (29%) knüpfen dabei keine neuen Kontakte.
Für den Bereich der Erwachsenenbildung geben zwei der befragten BewohnerInnen (29%) darüber Auskunft, dass sie häufig an Kursen oder Seminaren für Menschen mit
Behinderung teilnehmen. Zwei weitere Befragte (29%) nutzen solche Angebote eher selten, zwei Personen (29%) gar nicht. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fazit: Ein Anteil von 70-80% positiven Antworten bezüglich Selbstbestimmung von Freizeitgestaltung, individueller Zeiteinteilung in der Wohneinrichtung und Möglichkeit des Praktizierens des eigenen Glaubens lassen auf Zufriedenheit in diesen Bereichen schließen. Niedrige Teilhabe-Ergebnisse erzielen Aktivitäten außerhalb der Wohneinrichtungen: Zwei Drittel der befragten BewohnerInnen unternehmen kaum Aktivitäten außerhalb ihres Wohnbereichs in der Öffentlichkeit, wiederum etwa gut die Hälfte der Befragten nimmt gar nicht bis selten Weiterbildungsangebote in Anspruch.
Sechs der Befragten (86%) geben an, sich gut mit ihren MitbewohnerInnen zu verstehen, eine Person (14%) gibt an, mit diesen mehr oder weniger gut zurechtzukommen. Bei der Frage nach dem Wunsch nach anderen MitbewohnerInnen stellt sich ein anderes Bild dar: So wünschen sich drei der befragten BewohnerInnen (43%) andere WohnungskollegInnen, für drei weitere Befragte (43%) gibt es keinen Änderungsbedarf[39]. Es wurden jedoch keine Angaben dazu gemacht, mit welchen Personen die Befragten lieber zusammenleben würden. Die Hälfte der befragten KlientInnen (43%) möchte nicht alleine wohnen, eine Person (14%) kann sich dies vielleicht vorstellen, während eine weitere Person (14%) dies ausdrücklich wünscht.
Knapp die Hälfte der Befragten (50%) wünscht sich im Falle von Konflikten Unterstützung, eine Person (14%) verneint dies. Zwei Personen (29%) können die Frage nicht beantworten[40]. Alle drei befragten BewohnerInnen (43%), die einer solchen Hilfe bedürfen, geben an, diese auch zu erhalten.
Fazit: Im Bereich der Zufriedenheit im Zusammenleben mit den MitbewohnerInnen erhält man ein uneinheitliches Bild: Während zwar die überwiegende Mehrheit der Befragten angibt, gut miteinander auszukommen, würde doch knapp die Hälfte der Befragten
bevorzugen, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Der Widerspruch kann an dieser Stelle nicht erklärt werden. Eine Hypothese ist, dass KlientInnen sich üblicherweise nicht aussuchen können, mit wem sie zusammenwohnen. Die Antworten sind sicherlich kein Ausdruck der Zufriedenheit, sie können vielmehr auf eine Haltung des "Sich- Arrangierens" mit den Gegebenheiten hindeuten, eine Strategie, die praktiziert wird, solange Konflikte nicht zu dominant werden. Im Konfliktfall bekommen alle befragten KlientInnen jene Hilfe, die sie sich erwarten.
Alle sieben Befragten (100%) geben einhellig an, sich mit ihren Betreuungspersonen zu verstehen. Ebenso einheitlich positiv beantworten sie jeweils die zwei weiteren Fragen zum Betreuungspersonal. So geben alle sieben Befragten an, dass die BetreuerInnen auf ihre persönlichen Wünsche eingehen sowie, dass sie vertrauensvolle, persönliche Gespräche mit ihnen führen können.
Fazit: Die drei Fragen zur Zufriedenheit mit dem Betreuungspersonal sind auffallend einheitlich, und zwar alle zu 100% positiv beantwortet.
Zwei der befragten BewohnerInnen (29%) bekommen ihrer Aussage nach die nötige Unterstützung, wenn sie Aktivitäten ohne die Gruppe unternehmen möchten. Drei der Befragten (43%) sehen diese Möglichkeit manchmal als gegeben an, eine Person (14%) als nicht gegeben. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Vier der Befragten (57%) geben an, sich alleine zurückziehen zu können, wenn sie dies möchten, während drei der befragten BewohnerInnen (43%) dies verneinen.
Laut sechs der befragten KlientInnen (86%) ist es für sie möglich, ungestört Besuch zu empfangen. Eine Person (14%) sieht dies als mehr oder weniger möglich an. Fazit: Die Wohneinrichtungen bieten den befragten BewohnerInnen zufolge nicht genügend Möglichkeiten, Einzelaktivitäten ohne die Gruppe durchzuführen, dies ist nur für ein Drittel einwandfrei möglich. Die Zufriedenheit mit einer Rückzugsmöglichkeit innerhalb der Einrichtung ist mit knapp 60% eben so im niedrigen Bereich angesiedelt. Dagegen ist die Möglichkeit von ungestörten Besuchen überwiegend gegeben.
Vier der Befragten (57%) geben an, im Falle von Krisen oder kritischen Lebensereignissen Hilfe zu bekommen, während für eine Person (14%) dies nicht zutrifft. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten[41]
Sechs der befragten KlientInnen (86%) haben ihrer Aussage nach viele FreundInnen, eine Person (14%) gibt an, keine FreundInnen zu haben. Drei der Befragten (43%) geben an, auch außerhalb der Lebenshilfe auf viele FreundInnen zurückgreifen zu können, eine Person (14%) meint, wenige FreundInnen außerhalb des Bereichs der Lebenshilfe zu haben. Zwei der befragten BewohnerInnen (29%) verneinen dies. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Vier der Befragten (57%) pflegen nach eigener Aussage regelmäßigen Kontakt mit den NachbarInnen oder anderen Personen aus der näheren Umgebung. Zwei der befragten BewohnerInnen (29%) haben wenig Kontakt zu NachbarInnen, eine Person (14%) verneint dies ganz.
Sechs der befragten KlientInnen (86%) geben an, einen guten Kontakt zu ihren Verwandten zu haben, während dies für eine Person (14%) mehr oder weniger zu trifft. Vier der Befragten (57%) wünschen sich mehr Unterstützung bei der Pflege von bestehenden Kontakten oder beim Kennenlernen von anderen Menschen. Für jeweils eine Person (14%) trifft dies mehr oder weniger bzw. nicht zu. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fazit: Die befragten NutzerInnen zeigen sich im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Sozialleben, dies trifft insbesondere auf FreundInnen und Verwandte zu. Weniger ausgeprägte soziale Beziehungen scheint es zu nichtbehinderten Menschen zu geben. Dies scheint sich im überwiegend vorhandenen Wunsch bei mehr als der Hälfte der Befragten wiederzuspiegeln, mehr Unterstützung bei der Kontaktpflege bzw. Kennenlernen anderer Personen zu erhalten.
Drei der Befragten (43%) haben die Möglichkeit, sich bei Fragen rund um Sexualität an die BetreuerInnen zu wenden. Zwei der befragten BewohnerInnen (29%) sehen diese Möglichkeit mehr oder weniger gegeben, weitere zwei Befragte (29%) verneinen dies.
Für vier der Befragten (57%) besteht die Möglichkeit mit einem/einer Partner/in in der Wohneinrichtung zusammenzuleben, für zwei Personen (29%) dagegen nicht[42]
Es besteht die Vermutung, dass die ambivalente Beantwortung der Frage nach Informationen zu Sexualität auf ein zu wenig vorhandenes Gesprächsangebot zurückzuführen ist, als auf die teilweise geringe Bereitschaft - die Gründe hierfür können nicht ermittelt werden - solche Themen mit BetreuerInnen zu diskutieren.
Fünf der Befragten (71%) geben an, ihre Rechte zu kennen und bei deren Ausübung Unterstützung zu erhalten. Zwei Personen (29%) haben keine Kenntnis und Hilfe in Bezug auf ihre Rechte. Vier der befragten KlientInnen (57%) werden nach eigener Aussage vom Betreuungspersonal mit Respekt behandelt, für zwei der befragten BewohnerInnen (29%) trifft dies mehr oder weniger zu. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fünf der Befragten (71%) berichten, von den BetreuerInnen zurechtgewiesen zu werden, wenn sie etwas "falsch" machen. Davon fühlen sich vier der Befragten (57%) ungerecht behandelt, eine Person (14%) nicht. Eine Person (14%) verneint, zurechtgewiesen zu werden. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fazit: Mit Blick auf die Beantwortung der Fragen nach respektvollem Umgang sowie die häufige Erscheinung des Zurechtgewiesen-Werdens wird aus Sicht der befragten BewohnerInnen ein Bedarf an mehr respektvollem Umgang und Wertschätzung dringend nahegelegt. Welche Ereignisse und Erfahrungen und damit verknüpften Handlungsweisen und Situationsdeutungen im Hintergrund der Antworten stehen, kann natürlich nicht ermittelt werden - und somit bleibt das Ergebnis abstrahiert.
Sechs der befragten KlientInnen (86%) geben an, sich gesund zu fühlen. Eine weitere Person (14%) kann die Frage nicht beantworten. Fünf der Befragten (71%) bekommen laut eigener Aussage nach Bedarf Unterstützung in Gesundheitsfragen, eine Person (14%) bekommt diese Hilfe nicht. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Vier der befragten BewohnerInnen (57%) haben ihrer Angabe nach VertreterInnen, die sich für ihre Interessen einsetzen, zwei der befragten KlientInnen (29%) verneinen dies. Vier der Befragten (57%) sind mit der bestehenden Vertretungssituation zufrieden, während eine Person (14%) nicht damit zufrieden ist. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fazit: Da es im Wohnbereich keine Selbstvertreter-Gremien gibt, nehmen die Befragten mit ihren Antworten Bezug auf die Interessensvertretung im Bereich der Arbeit, womit diese durchweg zufrieden sind. Ob den befragten BewohnerInnen die Vertretung im Arbeitsbereich genügt oder sie doch eine Selbstvertretung im Wohnbereich von sich aus wünschen, geht nicht eindeutig aus den Ergebnissen hervor.
Sechs der befragten BewohnerInnen (86%) geben an, mit ihren BetreuerInnen zufrieden zu sein. Eine Person (14%) ist mäßig mit dem Personal zufriedengestellt.
Vier der Befragten (57%) können ihrer Aussage nach mitbestimmen, welche neuen MitarbeiterInnen aufgenommen werden, während dies für zwei der befragten KlientInnen (29%) nicht zutrifft. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Vier der befragten KlientInnen (57%) berichten von häufigem Betreuerwechsel. Darunter ist dies drei Befragten (43%) unangenehm, eine Person (14%) empfindet dies nicht als unangenehm. Für zwei der befragten KlientInnen (29%) besteht keine häufige Fluktuation von Betreuungspersonal. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Sechs der befragten BewohnerInnen (86%) geben an, auf einen Wechsel von BetreuerInnen, vorbereitet zu werden, während dies eine Person (14%) verneint.
Mit drei der Befragten (43%) ist für knapp die Hälfte der Befragten möglich, die eigene Bezugsbetreuung selbst zu wählen. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Die einheitliche Zustimmung zum Betreuungspersonal ist im Falle der mit dem Fragenblock "Beziehungsgestaltung mit BetreuerInnen" vergleichbaren Frage auch hier gegeben. Die Mehrheit der befragten BewohnerInnen berichten von hoher Mitarbeiterfluktuation, worauf sie aber zumindest überwiegend vorbereitet werden, und davon verursachter Unzufriedenheit. Die Mitbestimmung zur Auswahl neuer BetreuerInnen ist aus Sicht der BewohnerInnen ziemlich niedrig.
Drei der Befragten (43%) geben an, Gelegenheiten in unterschiedlichen Kontexten wahrnehmen zu können, um über ihre Zufriedenheit mit dem Wohnangebot Auskunft zu geben. Die andere Hälfte der befragten BewohnerInnen (43%) verneint dies. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Wiederum drei der Befragten (43%) geben an, dass ihre Wünsche in Bezug auf die Wohneinrichtung im Großen und Ganzen umgesetzt werden. Eine Person (14%) sieht ihre Wünsche im Wohnbereich mehr oder weniger erfüllt. Zwei der befragten KlientInnen (29%) verneinen dies. Eine Person (14%) kann die Frage nicht beantworten.
Fünf der Befragten (71%) bekommen Hilfe in ihrer persönlichen Zukunftsplanung, während zwei der befragten BewohnerInnen (29%) diese nicht erhalten.
Fazit: Bezüglich offiziellen und informellen Gelegenheiten des nach eigenen Interessen und Wünschen "Gefragt-Werdens" und der Möglichkeit persönlicher Zukunftsplanung fallen die Antworten ambivalent aus. Zusammenfassend ist aber die nur in der Hälfte der Fälle vorhandene systematischen Einbeziehung der Betroffenenperspektive jedenfalls noch entwicklungsbedürftig.
Nimmt man die Ergebnisse hinsichtlich der zwei Wohnformen in den Blick, erweisen sich diese als überwiegend homogen. Nur bei einzelnen Fragen treten deutliche Unterschiede auf. Beim Themenbereich Rechte und Schutz beispielsweise sind die befragten BewohnerInnen im Bereuten Wohnen zufriedener in Bezug auf den respektvollen Umgang, den sie von den BetreuerInnen erfahren, als im Wohnhaus. Während sich im Wohnhaus eine Person respektvoll behandelt fühlt und zwei Personen mehr oder weniger[43] trifft die respektvolle Zuwendung im Betreuten Wohnen für alle drei befragten BewohnerInnen zu. Dabei geben die befragten BewohnerInnen beider Wohneinrichtungen gleichermaßen an, zurechtgewiesen zu werden. Die befragten KlientInnen im Betreuten Wohnen fühlen sich im Falle solcher Zurechtweisungen eher ungerecht behandelt (zwei bestätigende Nennungen, eine lautet auf "mehr oder weniger") als ihre Peers im Wohnhaus (eine bestätigende Nennung).
Es konnten auch keine systematischen Tendenzen zur generellen Wohnzufriedenheit - z.B. eines Effekts höherer Zustimmung mit steigender Wohndauer - gefunden werden, wenn man die Variablen (a) des Wunsches weiter in der jeweiligen Einrichtung zu wohnen, (b) des Wunsches nach anderen MitbewohnerInnen, (c) des Bedürfnisses alleine zu wohnen in Zusammenhang mit der Wohndauer betrachtet.
Nun stellt sich bei Zufriedenheitserhebungen die Frage, ab welchem Wert das Ergebnis als Ausdruck der Zufriedenheit eingeschätzt werden kann. Vor dem Hintergrund der Annahme einer positiven Antworttendenz bei Menschen mit Behinderung kommen die Ergebnisse durch mehrere Einflussfaktoren zustande. Dworschak nennt einen "Deckeneffekt" verursacht von sozialer Erwünschtheit sowie fehlenden Vergleichsmöglichkeiten von Wohnangeboten und Lebensformen außerhalb von stationären Wohneinrichtungen und Leben in der Familie. (vgl. Dworschak 2004: 156) Die Literatur reflektiert den höheren Zustimmungsgrad von Menschen mit Behinderung in Befragungen. Wird bei herkömmlichen Befragungen von VerbraucherInnen häufig ein Grenzwert von 70% für die Zufriedenheit angenommen, so sieht Lebensqualitätforscher Cummins (1995) als Mittelwert für solche Erhebungen einen etwas höheren "gold standard" von 75 von insgesamt 100 Punkten vor. Gromann und Niehoff empfehlen ebenfalls diesen Richtwert:
"Bei der Erfahrung, dass sowieso eher zustimmend geantwortet wird, muss bereits eine Zustimmung von 2/3 oder ¾ aller Befragten einer Gruppe als ein Problem angesehen werden. Insgesamt schlagen wir vor, pragmatisch alle Fragen, bei denen sich mehr als ein Viertel der Bewohner kritisch äußern, als Problemrückmeldung zu werten." (Gromann et al. 2000: 12 zit. n. Dworschak 2004: 157)
Die AutorInnen Beck und Ollech schlagen dagegen vor, erst 80-prozentige Zustimmung als Zufriedenheit zu werten. (vgl. Dworschak 2004: 157) In der vorliegenden Auswertung wird der letzteren Empfehlung gefolgt und von einer kritischen Grenze von 80% ausgegangen. Aufgrund der geringen Fallzahl ist ein solcher Grenzwert ohnehin nicht zwingend notwendig, aber jedenfalls ein praktischer und der Transparenz dienender Richtwert.
Inhaltsverzeichnis
Der Rückmeldungsbogen (siehe Anhang) sollte anhand von fünf einfachen Fragen Erkenntnisse zum Befragtenverhalten und zu Aspekten der Interviewsituation bringen, um mehr Einblick in die Umsetzung der Befragungen zu erhalten. Zusätzlich wurde die Dauer als ein Indikator für den Verlauf des Interviews auf dem Bogen vermerkt. Zu jeder Interviewsituation gibt es demnach zwei Bewertungen, weil beide Interviewende einen Bogen ausgefüllt haben.
Die erste Frage mit drei Unterfragen bezieht sich auf das Verhalten der Befragten während des Interviews. Die Interviewenden sollen dies ihrer Wahrnehmung nach beantworten. Zwei dieser Fragen wurden sehr einheitlich beantwortet. Als Einschätzung der Eigenschaften der InterviewpartnerInnen geben die vier Peer-InterviewerInnen in 13 Fällen (93%) an, die Befragten waren "interessiert" sowie, dass diese in allen 14 Fällen (100%) "konzentriert bei der Sache" waren. Die Beantwortung der Frage nach der Geduldigkeit der InterviewpartnerInnen fiel ein wenig differenzierter aus: So nahmen die Interviewenden diese in elf Fällen (79%) als "geduldig", in einem Fall (7%) als "mäßig geduldig" und in zwei Fällen (14%) als "geduldig" wahr.
Die Rückmeldung zum wahrgenommenen Frageverständnis der InterviewpartnerInnen zeigt ebenso heterogene Ergebnisse: Die Peer-InterviewerInnen geben an, dass die Befragten in neun Fällen (64%) im Großen und Ganzen alle Fragen verstanden haben. In zwei Fällen (14%) haben diese die meisten Fragen und in drei Fällen (21%) nur wenige Fragen verstanden.
Zwei Fragen zielen darauf ab, ob die Peer-InterviewerInnen eine gute Gesprächsatmosphäre herstellen konnten. Beide Fragen wurden ebenfalls äußerst gleichförmig beantwortet. So berichten die Interviewenden in 13 Fällen (93%), dass sie "die Stimmung während des Interviews" als "angenehm" und in einem Fall (7%) als "ok" empfunden haben. Auf die Frage, ob sie sich in ihrer Rolle "als InterviewerInnen wohl gefühlt" haben, antworten alle (100%) zustimmend mit "ja".
Die Antworten auf die Frage nach weiterem Unterstützungs- und Übungsbedarf für ihre Interviewtätigkeit fielen ambivalent aus. In acht Fällen (57%) geben die Peer- InterviewerInnen an, dass sie noch weiteres Training benötigen, in fünf Fällen (36%) erachten sie dies als nicht notwendig[44]. Über die Art des Unterstützungsbedarfs gibt nur ein Interviewer Auskunft, der sich mehr Abgleich mit den Interviewer-KollegInnen wünscht, um die Antworten in die angemessenen Kategorien einzuordnen.
Die Dauer der Interviews betrug zwischen 30 und 60 Minuten. Durchschnittlich nahm ein Interview 38 Minuten in Anspruch. Damit hielt sich die Interviewdauer in der überwiegenden Mehrheit der Fälle in akzeptablen Grenzen, weil fünf Interviews die Länge von 35 Minuten nicht überschritten. Die zwei weiteren Interviews dauerten jeweils 50 und 60 Minuten.
Betrachtet man die Aussagen der Peer-InterviewerInnen im Zusammenhang mit der Interviewdauer, so fällt auf, dass sie auch bei den längeren und schwierigeren Befragungen positiv zur Gesprächsatmosphäre und zu ihrer Interviewer-Rolle äußern. Bei den zwei vergleichsweise langen Interviews wird zwar dreimal angegeben, dass die InterviewpartnerInnen nur "wenige Fragen" verstanden haben. Doch bis auf eine Nennung, die die Stimmung während eines langen Interviews als "ok" bezeichnete, waren trotzdem alle Angaben positiv.
Schwierigkeiten im Frageverständnis müssen bei Befragungen mit Peer-InterviewerInnen jedenfalls berücksichtigt werden. Betrachtet man die Häufigkeit fehlender Antworten und Fragen, die mit "weiß nicht/ trifft nicht zu" beantwortet sind, so bekommt man den Eindruck von einer hohen Verständlichkeit des Instruments. Die Ergebnisse lassen im Allgemeinen auf eine solide Antwortqualität schließen. Insgesamt beträgt die Anzahl fehlender Antworten nur sechs absolut. Diese treten in hinsichtlich sozialer Erwünschtheit "unverfänglichen" und aus meiner Sicht leicht verständlichen Fragekontexten auf. Die schwierig formulierte Frage nach dem persönlichen Besitz[45] und der Themenbereich Rechte und Schutz, von denen anzunehmen ist, dass sie Verständnisschwierigkeiten bereithalten, weisen überraschenderweise keine fehlenden Antworten auf.
Ob dies tatsächlich einem guten Verständnis entspricht, ist mit diesen Ergebnissen nicht gesichert, es können schließlich verdeckte Missverständnisse zwischen Interviewenden und Befragten vorliegen, die jetzt nicht mehr nachvollziehbar sind. Außerdem besteht eine gewisse Relativität, die von der gewählten Einordnung der Antworten in die Kategorien durch die Peer-InterviewerInnen ausgeht.
Für ein gutes Verständnis des Fragebogens spricht wiederum der Umgang mit den vier Filterfragen. Diese sind nach der Antwortmöglichkeit "ja" zu stellen und in der vorliegenden Befragung gemäß Intervieweranleitung immer richtig angewendet worden. Auffallend ist ebenfalls, dass es kaum Anmerkungen zu den Fragen gibt bzw. nicht viel notiert worden ist.
Es gibt in der Erhebung insgesamt 21 Nennungen mit "weiß nicht/ trifft nicht zu", die sich auf einen Anteil von 6,25% der Antworten belaufen. In der Gesamtsicht verteilen sich die Häufigkeit der mit "weiß nicht/ trifft nicht zu" beantworteten Fragen ziemlich gleichmäßig auf alle sieben Fragebereiche, die Frageblöcke vier bis sieben leicht in der Überzahl. Es
kann davon ausgegangen werden, dass darunter die Bereiche Rechte und Angebotsplanung die abstraktesten abgefragten Themen sind und deshalb schwerer verständlich sind. Jedoch kann diese Tendenz vielleicht auch auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass sie sich im hinteren Fragebogenteil befinden und mit fortgeschrittenem Interviewverlauf Geduld und Aufmerksamkeit der Befragten schon etwas nachgelassen haben.
Die Gesamtanzahl der positiv beantworteten Fragen beträgt 232 (von insgesamt abgefragten 371 Fragen, Folgefragen miteingerechnet), was eine Quote von 62,5% ergibt. Es liegen also zwei Drittel positive Rückmeldungen vor, wobei in diesem Fall wohl nicht von einer ausgeprägten Tendenz zur Zustimmung ausgegangen werden kann. Im Sinne des Grenzwerts ist eine Zufriedenheit mit der Lebenssituation hiermit nicht ganz erreicht.
Die hier ausgewerteten Probeinterviews sind natürlich nicht repräsentativ und schließlich als eine Momentaufnahme zu einem gewissem Zeitpunkt zu verstehen - der situative Charakter muss also in der Rezeption der Ergebnisse mitbedacht werden. Die Validität der Ergebnisse kann anhand der vorliegenden Stichprobe ohnehin nicht erfasst werden. ZumEinen dienen die inhaltlichen Ergebnisse der Erhebung einrichtungsspezifisch als Anregungen für eine (Lebens-)Qualitätssteigerung im Wohnumfeld der betroffenen BewohnerInnen. Zum Anderen sollen Auswertung und Interpretation beider Erhebungen mehr Erkenntnisse für die Umsetzung der Peer-Methodik bringen, indem gerade die dabei aufgeworfenen Fragen und aufgetretenen Schwierigkeiten anhand des jeweiligen Einzelfalls in den Blick genommen werden. In diesem Kontext ist eine Generalisierung gar nicht von großem Nutzen und Interesse.
Während sich fünf der sieben Interviews scheinbar gänzlich problemlos gestalteten, weil die befragten Personen über ein gutes Frageverständnis verfügten und bereitwillig kooperierten, traf dies in zwei Fällen nicht zu. Diese Interviewsituationen werden im Folgenden skizziert, nachdem die Rahmenbedingungen der Befragungssituation umrissen worden sind.
Ich folge damit den Ausführungen von Waltraud Kannonier-Finster, für die der Nutzen von Fallstudien - in Abgrenzung von der Logik statistischer Verallgemeinerbarkeit - darin liegt, "Aussagen darüber zu machen, in welcher Weise die konkret gefundenen Zusammenhänge für andere, analoge Fälle von Bedeutung sind." (Kannonier-Finster 1998: 38) In diesem Sinne soll das Fallbeispiel als konkreter, zeitnaher Einzelfall betrachtet und mittels quantitativer Analyse sowie einem verstehenden Zugang untersucht werden, mit der Intention, dass
"[...] der untersuchte Gegenstand nicht auf einige wenige Variablen reduziert wird; die Komplexität des Gegenstandes, seine Individualität und Identität sollen erhalten bleiben und in die Analyse einbezogen werden." (Kannonier-Finster 1998: 45) Die Rahmenbedingungen für die Gesprächssituationen bei den beiden längeren und schwierigeren Interviews, die sich zu diesem analytischen Zweck am besten eignen, stellten sich uns aus der Beobachterperspektive sowie gemäß den Berichten der Peer- InterviewerInnen folgendermaßen dar:
Fall a):
Dieses Interviewsetting war zunächst abweichend von den anderen aufgrund der Tatsache, dass drei der Peer-InterviewerInnen anwesend waren, was sich den Aussagen der Beteiligten zufolge jedoch nicht negativ auswirkte. Dass ein Interviewer die Situation verfolgte, war im Nachhinein für unseren Einblick von Vorteil. Aufgrund der langen Wohndauer der befragten Person - diese lebte schon seit der Gründung des Wohnhauses darin - nahm laut Aussagen der Interviewenden diese das Interview als Gelegenheit wahr, ihre "Lebensgeschichte" anzubringen. Deshalb war der Antwortstil stark narrativ geprägt, sodass die Peer-InterviewerInnen statt kurzen Antworten längere, ausgeschmückte Berichte erhielten. Die InterviewerInnen waren darauf angewiesen, für jede ausschweifende Antwort sich mit dem Gegenüber auf eine Kategorie zu einigen. Andererseits erhielten die Interviewenden durch Nachfragen mehr Klarheit durch die Erzählungen. Auffallend ist, dass die InterviewerInnen auch in diesem auskunftsreichen Interview nicht mehr Anmerkungen notierten als in anderen.
Fall b):
In dieser Befragungssituation war der Interviewpartner generell offen und interessiert, wollte aber vorher genau alle Fragen wissen, bevor er sie beantwortete. Dies stellte die Peer-InterviewerInnen offensichtlich vor eine zu große Herausforderung, denn sie waren mit dieser unerwarteten Situation überfordert und recht unschlüssig, wie sie vorgehen sollten. Im Ergebnis gaben sie dem Drängen des Befragten nach, sodass das Interview erst nach einiger Zeit begonnen wurde, nachdem dieser sich eingehend über den Inhalt des Fragebogens informiert hatte.
Geht man an die Probeinterviews auf interpretative Weise heran, indem man die Situation "ein Mensch mit Behinderung befragt einen anderen Menschen mit Behinderung" als "soziologisches Experiment" betrachtet, so kann man zu interessanten Einsichten gelangen.
-
In den oben beschriebenen zwei Fällen durchbrachen jedenfalls die Befragten die Erwartungshaltung der Peer-InterviewerInnen, die diese in Bezug auf die Interviews einnahmen:
-
In beiden Fällen waren die beiden Befragten skeptisch bis kritisch, hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Ablauf der Befragung und wollten sich nicht an die strikte Struktur Fragebogen halten. Daher haben sich die InterviewpartnerInnen nicht an die Normen, die für die Kommunikationssituation "Interview" gelten, gehalten.
-
Im Fall b) versuchte der Befragte sogar die Bedingungen für die Befragung diktieren, indem er die Fragen vollständig zu sehen verlangte.
-
Das Verhaltensrepertoire der Befragten hat die InterviewerInnen sichtlich aus dem Konzept gebracht und sie waren zu zurückhaltend, die von ihnen wahrgenommene Normabweichung zu "sanktionieren" und den GeprächspartnerInnen klare Grenzen innerhalb der Situation "Interview" zu setzen. Es fehlte ihnen an Regiekompetenz, um die Regeln und Struktur der Befragungssituation wieder herzustellen. Die Befragten zeigten sich in dieser Hinsicht improvisationsfreudiger als die InterviewerInnen.
Festzuhalten ist zum Fallbeispiel folgendes:
-
Die Peer-InterviewerInnen haben trotz aller Unannehmlichkeiten die zwei Interviews zu Ende geführt.
-
Ein wesentlicher Punkt besteht darin, dass Verständnisprobleme aufgetreten sind. So geben die Peer-InterviewerInnen für beide Interviews an, dass das Frageverständnis im Vergleich zu den anderen Befragungen geringer war.
-
Den Interviewenden ist nach eigenen Angaben die Erklärung der Fragen schwergefallen.
-
Die Peer-InterviewerInnen haben kaum Selbstkritik an sich geübt. Zu einem
-
kleinen Teil sehen sie den Bedarf nach mehr Übung, dieser ist aber in meisten Fällen nicht genau ausgeführt. Obwohl es die ersten Probeinterviews sind, nehmen sie kaum Verbesserungsmöglichkeiten wahr, stattdessen wird stets der/die InterviewpartnerIn als "Fehlerquelle" angegeben.
-
Ein weiterer Widerspruch ist, dass alle vier Interviewer sich laut eigenen Aussagen immer wohl gefühlt haben, also auch, wenn sich die Interviews schwierig gestalteten. Auch wenn man die kleine Fallzahl berücksichtigt, überrascht die Rückmeldung in ihrer Einheitlichkeit wegen offenkundiger Schwierigkeiten in der Interviewführung.
Die sich aus den zwei genannten Befragungen ergebenden Widersprüche können an dieser Stelle anhand der Ergebnisse des Feedbackbogens und unseren eigenen Beobachtungen bzw. Berichten der InterviewerInnen nicht restlos aufgeklärt werden. Die Überlegungen dazu gehen von zwei grundlegenden Vorannahmen aus:
-
In Bezug auf die Interpretation der Antworten durch die Interviewenden ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass die Antworten, je weniger diese von den InterviewerInnen interpretiert, desto authentischer sind.
-
Stärke und Richtung des Einflusses von InterviewerInnen und Befragten auf das Interviewgeschehen bleibt vorerst im Dunkeln. Das heißt, es kann nicht festgestellt werden, welche Einflussfaktoren durch Charakteristika der InterviewerInnen bzw. der Befragten oder situativen Faktoren auf die Ergebnisse in welcher Weise einwirken.
Es werden folgende Hypothesen zur Erklärung der offenen Punkte vorgeschlagen:
-
Die Interviewer-AnfängerInnen haben in der Schulung nicht hinreichend geübt, eine Befragung auch unter schwierigen Bedingungen zu strukturieren. Auf die fehlende Übung und Routine ist sicherlich auch zurückzuführen, dass sie die Fähigkeit, Frageinhalte zu erklären bzw. die Fragen auf andere Weise neu zu stellen, noch zu wenig ausgebildet haben.
-
Ein anderer Erklärungsansatz bezieht sich auf die Vorbereitung der Befragung. So hatten wir keinen zusätzlichen Vorstellungstermin, sodass die InterviewerInnen größere Vorleistungen für eine angemessene Gesprächsatmosphäre erbringen mussten. Daher mussten sie möglicherweise noch mehr auf die Ziele der Befragung eingehen und mehr für die Verstrauensbildung tun.
-
Die positiven Angaben der angehenden Peer-InterviewerInnen zu ihren teilweise nicht einfachen Interviewer-Erfahrungen sind eventuell in der Wertigkeit und Freude an der neuen Rolle begründet. Zudem haben sich ihnen mit dem Probelauf erst ein kleiner Erfahrungsraum und noch geringe Vergleichsmöglichkeiten erschlossen, sodass der Enthusiasmus und der "Reiz des Neuen" am Anfang überwiegt - noch ist keine Routine oder ein "Gewöhnungseffekt" eingetreten. Jedenfalls decken sich ihre Aussagen mit dem Engagement trotz der Anstrengungen und dem Aufwand, die mit ihrer Tätigkeit ja auch verbunden sind.
Anhand dieser Stichprobe kann die Validität ohnehin nicht überprüft werden, denn es wird erst in Zukunft im Rahmen größerer Erhebungen möglich sein, mehr Anhaltspunkte und Klarheit über entsprechende verzerrende Effekte zu gewinnen. Gewisse in den Ergebnissen aufgetretene Widersprüche muss man vorerst so stehen lassen. Die Hypothesen dazu können an dieser Stelle nicht überprüft werden. In erster Linie geht es darum, einen Lern und Entwicklungsprozess anzustoßen, um die Qualität der Peer-Interviews immer weiter zu verbessern. Mit der Qualität der Interviews ist die Intensität der InterviewerInnen- Ausbildung eng verknüpft. Die Schulung, die unseren Probeinterviews vorausging, erwies sich zwar als eine gute Basis, ist aber mit zehn Terminen ziemlich knapp bemessen. Nun muss es darum gehen, in weiteren Trainings noch mehr Augenmerk auf bestimmte Kernkomeptenzen, über die Peer-InterviewerInnen verfügen sollen, zu legen. Darunter sind bestimmte standardisierte Lösungsstrategien für problematisches Befragtenverhalten, Erklärungsmuster für schwierige Fragen, Techniken der Gesprächs- und Interviewführung sowie die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstkritik subsumiert.
Für die Organisation Lebenshilfe Salzburg besteht ein nächster Schritt darin, noch weitere NutzerInnen zu Peer-InterviewerInnen auszubilden bzw. die ersten Interviewer- AnwärterInnen für eine optionale Umschulung auf das jeweils andere Instrument (Wohnen/Arbeit) zu begeistern. Mit dem Ausbau und der Professionalisierung bekommt auch eine angemessene Bezahlung der KlientInnen für ihre Interviewtätigkeit einen höheren Stellenwert. Vorerst müssen sich die Peer-Interviewer-PionierInnen mit einer Prämie für ihre Probeinterviews zufrieden geben.
Der Behinderungsbegriff ist abschließend kaum zu definieren, weil er ein überaus komplexes, sich in Veränderung befindliches Phänomen beschreiben will, das letztlich nur interdisziplinär fassbar ist. Mit der Überwindung einer defektorientierten Sichtweise auf Behinderung wird sie nicht mehr als Eigenschaft einer Person aufgefasst, im heutigen Verständnis stehen vielmehr vorwiegend die sozialen Konsequenzen einer Schädigung für die Teilhabe der Menschen mit Behinderung im Kontext der gesellschaftlichen Bedingungen im Mittelpunkt. Behinderung kann also nur relational zum sozialen Handelns des betroffenen Individuums selbst und seines Umfelds gedacht werden, wie die interaktionistische Theorie argumentiert. Der zentrale Aspekt der Interaktion zwischen Menschen mit Behinderung und ihrer Umwelt wird auch im sozialen Modell der Behinderung, von der WHO in ihrer ICF-Klassifikation und von der UNBehindertenrechtskonvention, aufgegriffen.
Lebensqualität ist ebenfalls ein komplexer Begriff, der zunächst als Realisierung von individuell wichtigen Bedürfnissen verstanden wird. Die vollständige Bedeutung des mehrdimensionalen Konstrukts erschließt sich nur, wenn sowohl objektive Indikatoren im Sinne externer Bewertungen als auch subjektive Wahrnehmungen bzw. Bedürfnisorientierungen erklärend einfließen. Die Forschungsliteratur weist hinsichtlich der übergeordneten inhaltlichen Dimensionen, die Lebensqualität umfasst, große Übereinstimmung auf. Lebensqualität ist u.a. mittlerweile ein zentraler forschungsleitender Begriff für Studien geworden, die Wissen über die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung im Wohnen und damit in Verbindung stehenden Bereichen in Erfahrung bringen.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden dazu genützt, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu erhöhen. Entlang der allmählichen Durchsetzung der Prinzipien Normalisierung, Selbstbestimmung und Empowerment, Partizipation und Personenzentriertheit in professionellen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, die für Menschen mit Behinderung relevant sind, wird der Lebensqualitätsbegriff wirksam als Ausgangspunkt für Verbesserungen ihrer Lebenswirklichkeit. Schließlich fördern die Schlussfolgerungen aus der Lebensqualitätforschung aufgrund ihrer Breite den politischen Konsens und gehen ein in Unterstützung und Hilfen für Menschen mit Behinderung, die die Steigerung deren Lebensqualität zum Ziel haben. Anwendung können die Prinzipien von Lebensqualität neben der Relevanz für die individuelle Ebene auf multiperspektivische Weise finden: Diese reicht von Anhaltspunkten für die Qualität nutzerInnenbezogener sozialer Dienstleistungen bis hin zu einem politischen Orientierungsrahmen in der Sozialplanung.
Die UN-Behindertenrechtskonvention intendiert als ihre zentrale Zielbestimmung, die effektive Teilhabe an der Gesellschaft (Inklusion) von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten und birgt ein großes fortschrittliches Potential für die Stärkung ihrer Rechte. Einen hohen Stellenwert nehmen dabei die Forderungen nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, die als Freiheitsrechte angelegt sind, ein. Diese sind von Leistungsansprüchen begleitet, um deren Verwirklichung mittels der notwendigen Assistenz und Unterstützung zu ermöglichen. Hinsichtlich der Bereiche Wohnen und Arbeit postuliert die Konvention das Recht, den Wohn- und Arbeitsort frei wählen zu können, um Menschen mit Behinderung eine "normale" Lebensführung außerhalb von sozial exkludierenden Sondereinrichtungen zu ermöglichen. Weitreichend erscheint auch die Bestimmung zu "angemessenen Vorkehrungen" zur Barrierefreiheit für die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung und für den Schutz vor struktureller Diskriminierung. Jedenfalls stehen Politik und Gesellschaft vor hohen Anforderungen, sodass die rechtlichen Bestimmungen umgesetzt werden können.
Der Inklusions-Anspruch der Konvention findet in der inklusiven Forschung Berücksichtigung, die unterschiedliche Arten der Beteiligung von Menschen mit Behinderung in Forschungsprozessen vorsieht. Die für diese Arbeit relevante Methode des Peer-Interviews setzt diese als InterviewerInnen ein, um andere Menschen mit Behinderung zu befragen. Erfahrungen mit der Methodik lassen darauf schließen, dass Peer-InterviewerInnen ebenso valide Ergebnisse erzielen können wie nichtbehinderte InterviewerInnen. Es besteht die Annahme, dass sie Interviewsituationen sogar besser gestalten können, weil sie aufgrund der sozialen Nähe ein größeres Vertrauen der Befragten genießen sowie aufgrund des ähnlichen Erfahrungshintergrunds über ein ausgeprägtes Vorverständnis hinsichtlich der Kommunikationsformen und der Lebenswelten verfügen. Voraussetzungen für qualitätsvolle Befragungsergebnisse sind jedenfalls, vor allem mit Blick auf die erforderlichen Kompetenzen, eine gut getroffene Auswahl des Interviewpersonals, eine intensive InterviewerInnen-Vorbereitung und ausreichend Training und Praxis. Das Instrument muss so gestaltet sein, dass die Besonderheiten bei der Befragung der Zielgruppe, z.B. bezüglich der Dauer des Interviews, Frageformulierung, Konzeption der Antwortmöglichkeiten, ausreichend berücksichtigt werden. Es ist, bezogen auf die Masse der Forschung zum Themenkomplex Behinderung, festzuhalten, dass es zwar mittlerweile Standard ist, Menschen mit Behinderung direkt zu befragen, Erhebungen aber immer noch vorwiegend über sie - anstatt gemeinsam mit Menschen mit Behinderung durchgeführt werden. Die erbrachten empirischen Daten aus Befragungen von und mit Menschen mit Behinderung in einem Peer-Verhältnis erweisen sich in der Beurteilung als durchaus qualitätsvolle, wenn auch verbesserungswürdige Interviewresultate. Dies, sowie die Rückmeldung der InterviewerInnen, bestätigt die Annahme, dass auch Menschen mit Behinderung die Rolle von InterviewerInnen kompetent ausfüllen können. Das Vorhandensein von sozialer Nähe zwischen Peer-Interviewenden und der Zielgruppe ist in diesem Rahmen nicht unmittelbar feststellbar, jedenfalls ist es den InterviewerInnen überwiegend gelungen, eine angenehme, kollegiale Gesprächsatmosphäre herzustellen. Als entscheidend stellte sich der ähnliche und breite Erfahrungshintergrund und das Vorverständnis, das sie als Peers für die Lebenswelten und das erfragte Themenfeld mitbringen, heraus und auf das in Ausbildung und Praxis leicht aufgebaut werden konnte.
In unserem begrenzten Erfahrungsraum haben sich zudem die Informationsgestaltung im Vorfeld für alle involvierten Akteure (Befragte, Betreuungspersonal, EinrichtungsleiterInnen) und die Hinführung auf die Interviewsituation als zentrale Aspekte für die erfolgreiche Durchführung erwiesen. Die in der Literatur vertretene Auffassung der Bedeutung der InterviewerInnen-Ausbildung ist ebenfalls anhand der Ergebnisse der Probeinterviews zum Ausdruck gebracht worden, denn in unserem Fall konnten wir aufgrund der zeitlichen Begrenztheit der Schulung nicht an alle wesentlichen Kompetenzen ausreichend heranführen. Es hat sich gezeigt, dass für das Gelingen von Peer-Interviews eine hinreichende Schulung zentral ist, wenn sie auf diese Weise Peer-InterviewerInnen positive InterviewerInnen-Eigenschaften vermittelt, entsprechende soziale und kommunikative Fähigkeiten auszubilden versucht, sowie wenn sie viel Gelegenheit für Praxis und Erfahrung geben kann. Mit der richtigen personellen Auswahl gut ausgebildeter Peer-InterviewerInnen und passenden Interviewteams lassen sich verzerrende Effekte reduzieren. Fest steht, dass nicht nur wir Erkenntnisse erlangt haben, sondern dass auch jene Menschen mit Behinderung, die in unserem Fall ein Stück weit Pionierarbeit geleistet haben, sichtlich einen persönlichen Gewinn an Erfahrungen, neuen Fertigkeiten und Selbstwert mitgenommen haben. Wenn diese und noch mehr NutzerInnen sich dafür begeistern können, ist es realistisch, diese Erhebungsmethode zum Standard zu machen und künftig im Organisationsmaßstab Lebensqualität in Zusammenarbeit mit den NutzerInnen zu erheben. Für einige Menschen mit Behinderung könnte sich auf diese Weise so eine spannende Zukunftsperspektive mit dem Berufsbild "InterviewerIn" eröffnen.
Aichele, Valentin 2008: Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativprotokoll - Ein Beitrag zur Ratifikationsdebatte. Policy Paper No. 9. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin : http://www.institut-fuermenschenrechte. de/uploads/tx_commerce/policy_paper_9_die_un_behindertenrechtskonve ntion_und_ihr_fakultativprotokoll.pdf; abgerufen am 11.2.2011
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities AAIDD 2010: Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Support. The AAIDD Ad Hoc Committee on Terminology and Classification. 11th Edition: www.aamr.org/media/PDFs/CoreSlide.pdf; abgerufen am 20.11.2010
Astegger, K./ Hamann, H./ Klisch, B./Sperandio E./ Unterweger, S. 2005: Interviewleitfaden "Zufriedenheit der Klienten beim Wohnen". Unveröffentlichte Dokumentation. Lebenshilfe Salzburg. Salzburg.
Basehart, Sarah/ Bonham, Gordon Scott/ Schalock, Robert L./ Marchand, Cristine Boswell/ Kirchner, Nancy/ Rumenap, Joan M. 2004: Consumer-Based Quality of Life Assessment: The Maryland Ask Me! Project, in: Mental Retardation, Vol. 42/ No. 5. S. 338-355: http://www.bonhamresearch.com/PDF/2004JBasehart%20Consumer%20Based.pdf; abgerufen am 14.3.2011.
Beck, Iris 1998: Das Konzept der Lebensqualität: eine Perspektive für Theorie und Praxis der Hilfen für Menschen mit einer geistigen Behinderung, in: Jakobs, Hajo/ König, Andreas/ Theunissen, Georg (Hg.): Lebensräume - Lebensperspektiven: Ausgewählte Beiträge zur Situation Erwachsener mit geistiger Behinderung. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Afra-Verlag. Butzbach-Griedel. S. 348-387.
Beckmann, Christoph/ Richter, Martina 2005: "Qualität" sozialer Dienste aus der Perspektive ihrer Nutzerinnen und Nutzer: Theoretische und methodologische Annäherungen, in: Oelerich, Gertrud/ Schaarschuch, Andreas (Hg.): Soziale Dienstleistungen aus Nutzersicht: Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit. Ernst Reinhard Verlag. München/ Basel.S. 132-149.
Behindertenanwaltschaft des Landes Steiermark 2009: Tätigkeitsbericht 2007/2008. Graz: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/10695950_20054849/3c87bb5d/beric ht%202007-2008.pdf; abgerufen am 14.3.2011.
Bellebaum, Alfred 1994: Lebensqualität: Ein Konzept für Praxis und Forschung, in: Ders./ Barheier, Klaus (Hg.): Lebensqualität: Ein Konzept für Praxis und Forschung. Westdeutscher Verlag. Opladen. S. 7-13.
Bernsdorf, Wilhelm/ Knospe, Horst (Hg.) 1980: Eintrag "Malinowski", in: Dies.: Internationales Soziologenlexikon: Beiträge über bis Ende 1969 verstorbene Soziologen. Band 1. Zweite, neubearbeitete Auflage. Enke. Stuttgart. S. 264f.
Bielefeldt, Heiner 2009: Zum Innovationspotential der UN-Behindertenrechtskonvention.
Essay No. 5. Dritte, aktualisierte Auflage. Deutsches Institut für Menschenrechte. Berlin: http://www.institut-fuermenschenrechte. de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Essay/essay_zum_innovationspot enzial_der_un_behindertenrechtskonvention_auflage3.pdf; abgerufen am 11.2.2011
Bleidick, Ulrich/ Hagemeister, Ursula (Hg.) 1977: Einführung in die Behindertenpädagogik: Allgemeine Theorie und Bibliographie. Band 1. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart/ Berlin/ Köln/ Mainz.
Bleidick, Ulrich 1999: Behinderung als pädagogische Aufgabe: Behinderungsbegriff und behindertenpädagogische Theorie. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart/ Berlin/ Köln.
Bonham: Gordon Scott 2008: Measuring Quality of Life - "The Maryland Ask Me! Experience." Paper prepared for the QOL Measures International Conference, Vienna, September 15, 2008: http://www.bonhamresearch.com/PDF/2008AbstractViennaMeasuring%20Quality%20of% 20Life.pdf; abgerufen am 14.3.2011.
Bonham: Gordon Scott 2008 a : Who Should Speak for Individuals with Intellectual Disabilities? Evaluating Quality of Life at Community Providers.: http://www.bonhamresearch.com/PDF/2008TWho%20Should%20Speak%20AEA.pdf; abgerufen am 13.3.2011.
Bonham, Gordon Scott/ Volkman, Judy/ Sorensen, Sarah 2009: Ask Me! Fundyears 2006- 2009: The Quality of Life of Marylanders With Developmental Disabilities Receiving DDA-Funded Support: dhmh.maryland.gov/dda_md/ReportableInc/Ask09Report.pdf; abgerufen am 13.3.2011.
Bortz, Jürgen, Döring, Nicola 2009: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Vierte, überarbeitete Auflage. Springer Verlag. Heidelberg.
Braun, Hans 1999: Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung in sozialen Diensten, in: Peterander, Franz/ Speck, Otto (Hg.) 1999: Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen. Ernst Reinhard Verlag. München/ Basel. S. 134-145.
Buchner, Tobias/ Koenig, Oliver/ Schuppener, Saskia 2011: Gemeinsames Forschen mit Menschen mit intellektueller Behinderung: Geschichte, Status quo und Möglichkeiten im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention, in: Teilhabe, 50/1. S. 1-10.
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2008: UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: UN-Konvention, deutsche Fassung: http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/8/7/3/CH1027/CMS1283153806742/konv_tx t_dt_bgbl.pdf; abgerufen am 12.2.2011
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2009: Bericht der Bundesregierung zur Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich 2008. Wien: http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/3/0/6/CH0009/CMS1288266050658/behinder tenbericht_09-03-17.pdf; abgerufen am 10.11.2010
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2010: UNBehindertenrechtskonvention: Erster Staatenbericht. Wien: http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/1/8/6/CH0009/CMS1294740597447/1__staat enbericht_crpd_deutsche_endfassung.pdf; abgerufen am 21.10.2010
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2010a: UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Informationsübersicht: http://www.bmask.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH1027; abgerufen am 12.2.2011
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 2010b: Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: http://www.bmask.gv.at/cms/site/dokument.html?channel=CH0129&doc=CMS121818844 9066; abgerufen am 14.2.2011
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) 2001: ICD-10 BMSG 200: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision. Wien: http://www.bmg.gv.at/cms/site/attachments/8/6/4/CH0720/CMS1128332460003/icd- 10_bmsg_2001_-_systematisches_verzeichnis.pdf; abgerufen am 20.11.2010
Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) 2003: Bericht der Bundesregierung über die Lage der behinderten Menschen in Österreich: http://www.startlabor. org/filedir/Behindertenbericht.pdf; abgerufen am 10.11.2010
Bundschuh, Konrad/ Dworschak, Wolfgang 2002: Lebenszufriedenheit von Erwachsenen mit geistiger Behinderung in stationären Wohnformen, in: Geistige Behinderung, 1. S. 70- 72.
Cloerkes, Günther 2007: Soziologie der Behinderten: Eine Einführung. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. "Edition S". Universitätsverlag Winter. Heidelberg.
Degener, Theresia 2009: Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Bezug auf die nationale Implementierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bund und Ländern?. Fachartikel aus behindertenrecht 2/2009: http://www.netzwerk-artikel- 3.de/attachments/095_brk-degener-br30jan09s.pdf; abgerufen am 14.2.2011
Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). WHOKooperationszentrum für das System internationaler Klassifikationen. (Hg.) 2005: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung- 2005-10-01.pdf; abgerufen am 12.11.2010
Dworschak, Wolfgang/ Wagner, Michael/ Bundschuh, Konrad 2001: Das Konstrukt 'Lebensqualität' in der Geistigbehindertenpädagogik: Zur Analyse eines 'neuen' Leitbegriffs und Möglichkeiten der systematischen Erfassung bzw. Evaluation, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 9. S. 368-375.
Dworschak, Wolfgang 2004: Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung: Theoretische Analyse, empirische Erfassung und grundlegende Aspekte qualitativer Netzwerkanalyse. Dissertation. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn. S. 32-54.
Europäische Kommission 2010: Behinderung und europäisches Recht zur Nichtdiskriminierung: Eine Analyse des Rechts zur Nichtdiskriminierung und darüber hinaus. Bericht der EU-Kommission. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Luxemburg: http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4393&langId=de; abgerufen am 11.11.2010
Evers, Adalbert 1997: Quality Development - Part of a Changing Culture of Care in Personal Social Services, in: Ders./Haverinen, Riitta/ Leichsenring, Kai/ Wistow, Gerald (Hg.): Developing Quality in Personal Social Services: Concepts, Cases and Comments. Public Policy and Social Welfare Series, Volume 22. Ashgate. Aldershot. S. 9-24.
Felce, David/ Jonathan Perry 1996: Assessment of Quality of Life, in: Schalock, Robert L. (Hg.): Quality of Life, Volume I: Conceptualization and Measurement. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 63-72.
Freyhof, Geert 2010: Users Network to Improve Quality: Analysis of Existing User- Evaluation Systems at National Level: http://www.nuevanetwork. eu/cms/index.app/Index/download/?id=139; abgerufen am 14.3.2011.
Fröhlich, Walburga/ Konrad, Martin 2009: Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung als InterviewerInnen und Interviewer: Ergebnisse eines Forschungsprojekts mit nueva. Atempo. Graz.
Frühauf, Theo 2008: Editorial: Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, in: Geistige Behinderung, 47 (3). S. 201-203.
Fuchs-Heinritz, Werner/ Lautmann, Rüdiger/ Rammstedt, Otthein/ Wienold, Hans (Hg.) 1994: Eintrag "Bedürfnis", in: Lexikon zur Soziologie. Dritte, völlig neubearbeitete und erweiterete Auflage. VS Verlag. Wiesbaden. S. 82.
Fuchs-Heinritz, Werner/ Lautmann, Rüdiger/ Rammstedt, Otthein/ Wienold, Hans (Hg.) 2007: Eintrag "Bedürfnis"; "Bedürfnisorientierung"; "primäre Motive"; "sekundäre Motive", in: Lexikon zur Soziologie. Vierte, grundlegend überarbeitete Auflage. VS Verlag. Wiesbaden. S. 77f, S. 446.
Glatzer, Wolfgang/ Zapf, Wolfgang 1984: Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland: Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden. Campus. Frankfurt a. M.
Goble, Frank 1979: Die dritte Kraft: A.H. Maslows Beitrag zu einer Psychologie der Gesundheit. Walter-Verlag. Olten. S. 22-37.
Goffman, Erving 1967: Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Suhrkamp. Frankfurt a.M.
Goode, David 1997: Quality of Life as International Disability Policy: Implications for International Research, in: Quality of Life, Volume II: Application to Persons With Disabilities. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 211-222.
Graumann, Sigrid 2008: Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Institut Mensch, Ethik Wissenschaft. IMEW konkret Nr. 11: http://www.imew.de/index.php?id=405; abgerufen am 11.2.2011
Graumann, Sigrid 2008a: Die UN-Konvention zum Schutz der Rechte behinderter Menschen: Neue Anforderungen für Behindertenpolitik und Behindertenarbeit: http://www.dvfr.de/de/internationales/meldungen/single-news/artikel/die-un-konventionzum- schutz-der-rechte-behinderter-menschen-neue-anforderungen-fuer-behindertenpol/; abgerufen am 14.2.2011
Grill, Christian 2007: Soziogene Behinderung: Die Diagnose "Geistige Behinderung" bei Erwachsenen und die diesbezüglichen Sichtweisen unterschiedlicher Systeme. Diplomarbeit, FH Soziale Dienstleistungen für Menschen mit Betreuungsbedarf Linz. http://bidok.uibk.ac.at/library/grill-soziogene-dipl.html; abgerufen am 20.11.2010
Gromann, Petra 2002: Funktion und Möglichkeiten des Befragens von Nutzerinnen und Nutzern, in: Greving, Heinrich (Hg.): Hilfeplanung und Controlling in der Heilpädagogik. Lambertus- Verlag. Freiburg. S. 155-170.
Grunow, Dieter 2011: Soziale Dienste als "Öffentliches Gut", in: Evers, Adalbert/ Heinze, Rolf G./ Olk, Thomas (Hg.): Handbuch Soziale Dienste. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. S. 229-244.
Gunz, Josef 1998: Aktionsforschung als aktivierende Sozialforschung, in: Kannonier- Finster, Waltraud/ Ziegler, Meinrad (Hg.): Exemplarische Erkenntnis: Zehn Beiträge zur interpretativen Erforschung sozialer Wirklichkeit. Studienverlag. Innsbruck/Wien. S. 93-112.
Hartmann, Anja 2011: Soziale Dienste: Merkmale, Aufgaben und Entwicklungstrends aus der Perspektive soziologischer Theorien, in: Evers, Adalbert/ Heinze, Rolf G./ Olk, Thomas (Hg.): Handbuch Soziale Dienste. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. S. 76-93.
Heinze, Rolf G. 2011: Soziale Dienste und Beschäftigung, in: Evers, Adalbert/ Heinze, Rolf G./ Olk, Thomas (Hg.): Handbuch Soziale Dienste. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. S. 168-186.
Heller, Ágnes 1976: Theorie der Bedürfnisse bei Marx. VSA Verlag. Hamburg.
Gutknecht-Gmeiner, Maria 2008: Externe Evaluierung durch Peer-Review: Qualitätssicherung und -entwicklung in der beruflichen Erstausbildung. Dissertation. VSVerlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. S. 37-57.
Hillmann, Karl-Heinz (Hg.) 1994: Eintrag "Bedürfnis"; "Bedürfnishierarchie", in: Ders.: Wörterbuch der Soziologie. Vierte überarbeitete und ergänzte Auflage. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S. 75f.
Hillmann, Karl-Heinz (Hg.) 1994: Eintrag "Lebensqualität", in: Ders.: Wörterbuch der Soziologie. Vierte überarbeitete und ergänzte Auflage. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S.476.
Fornefeld, Barbara 2009: Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. Ernst Reinhardt Verlag. München/Basel.
Hillmann, Karl-Heinz (Hg.) 1994: Eintrag "Malinowski", in: Ders.: Wörterbuch der Soziologie. Vierte überarbeitete und ergänzte Auflage. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart. S.508.
Inclusion Europe 2008: Inclusion Europe fordert ein System der unterstützten Entscheidungs-findung, in: Geistige Behinderung, 47 (3). S. 279.
Inclusion Europe 2010: Users Network to Improve Quality. Konferenzbericht.
Jantzen, Wolfgang 1992: Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1: Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Zweite, korrigierte Auflage. Edition sozial. Beltz Verlag. Weinheim/Basel. S. 15-31.
Kannonier-Finster, Waltraud 1998: Methodologische Aspekte soziologischer Fallstudien, in: Dies./ Ziegler, Meinrad (Hg.): Exemplarische Erkenntnis: Zehn Beiträge zur interpretativen Erforschung sozialer Wirklichkeit. Studienverlag. Innsbruck/Wien. S. 35-64.
Kannonier-Finster, Waltraud/ Ziegler, Meinrad 2005: Prozess- und Ergebnisqualität: Qualitative Evaluationsdesigns im Feld der psychossozialen Arbeit, in: Schöch, Heidrun (Hg.): Was ist Qualität? Die Entzauberung eines Mythos. Reihe "Wandel und Kontinuität in Organisationen", Band 6. Wissenschaftlicher Verlag Berlin. Berlin. S. 113-148
Kannonier-Finster, Waltraud/ Ziegler, Meinrad 2008: NUEVA aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, in: Bernhart, Josef/ Obwexer, Wolfgang/ Promberger, Kurt (Hg.): Schlüssel zum selbstbestimmten Wohnen: Nutzerorientierte Ansätze zur Evaluation sozialer Dienstleistungen. Public Management, Band 4. Studienverlag. Innsbruck. S. 109-141.
Karan, Orv C./ Bothwell, James D. 1997: Supported Living: Beyound Conventional Thinking and Practice, in: Schalock, Robert L. (Hg.): Quality of Life, Volume II: Application to Persons With Disabilities. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 79-94.
Karpf, Tobias 2004: Kundenorientierte Qualitätsentwicklung in der Heimerziehung. Reihe Qualität und Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit, Band 6. ibidem Verlag. Stuttgart.
Kessl, Fabian/ Otto, Hans-Uwe 2011: Soziale Arbeit und soziale Dienste, in: Evers, Adalbert/ Heinze, Rolf G./ Olk, Thomas (Hg.): Handbuch Soziale Dienste. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. S. 389-403.
Kommission der Europäischen Union 2010: Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 (COM (2010) 636 final): http://www.parlament.gv.at/cgibin/ eukp.pdf?P_EU=XXIV.pdf/EU/04/04/040442.pdf; abgerufen am 14.2.2011
Krach, Stefanie 2011: Partizipative Evaluation als Beitrag zur Praxisentwicklung, in: Teilhabe, 50/1. S. 11-16.
Malinowski, Bronislaw 1969: A Scientific Theory of Culture And Other Essays. Oxford University Press. London/ Oxford/ New York. S. 91-136.
Maslow, Abraham H. 1973: Psychologie des Seins: Ein Entwurf. Kindler Verlag. München. S. 158-178.
Maslow, Abraham H. 1977: Motivation und Persönlichkeit. Walter-Verlag. Olten/Freiburg.
Möller, Kurt 1983: Sozialwissenschaftliche Implikationen des humanistischpsychologischen Bedürfnis-Begriffs bei Abraham H. Maslow, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Jahrgang 35. S. 577-593.
Moser, Heinz 1995: Grundlagen der Praxisforschung. Lambertus-Verlag. Freiburg.
Moser, Heinz 1997: Instrumentenkoffer für den Praxisforscher. Lambertus-Verlag. Freiburg.
Moser, Vera/ Sasse, Ada 2008: Theorien der Behindertenpädagogik. Ernst Reinhardt Verlag. München/Basel.
Neuhäuser, Gerhard/ Steinhausen, Hans-Christoph (Hg.) 1999: Geistige Behinderung: Grundlagen, Klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart/Berlin/Köln. S. 9-28.
Nueva 2009: UNIQ - Netzwerk für mehr Qualität, in: Nueva News. 10, Juni 2009.
Oelerich, Gertrud/ Schaarschuch, Andreas 2005: Theoretische Grundlagen und Perspektiven sozialpädagogischer Nutzerforschung, in: Dies. (Hg.): Soziale Dienstleistungen aus Nutzersicht: Zum Gebrauchswert Sozialer Arbeit. Ernst Reinhard Verlag. München/ Basel. S. 9-25.
Oesterdiekhoff, Georg W. (Hg.) 2001: Lexikon der soziologischen Werke. Westdeutscher Verlag. Wiesbaden. S. 438-456, S. 657f.
Pracher, Christian/ Bernhart, Josef 2008: Das Evaluationsverfahren NUEVA, in: Bernhart, Josef/ Obwexer, Wolfgang/ Promberger, Kurt (Hg.): Schlüssel zum selbstbestimmten Wohnen: Nutzerorientierte Ansätze zur Evaluation sozialer Dienstleistungen. Public Management, Band 4. Studienverlag. Innsbruck. S. 83-108.
Promberger, Kurt/ Lorenz, Walter 2008: Ansätze zur Evaluation von Wohnangeboten im internationalen Vergleich, in: Bernhart, Josef/ Obwexer, Wolfgang/ Promberger, Kurt (Hg.): Schlüssel zum selbstbestimmten Wohnen: Nutzerorientierte Ansätze zur Evaluation sozialer Dienstleistungen. Public Management, Band 4. Studienverlag. Innsbruck. S. 15-82.
Rauscher, Christine 2005: "Ein eigenes Leben in der Gemeinde führen" - Wohn- und Lebenswünsche von Menschen mit Behinderung, in: Wacker, Elisabeth/ Bosse, Ingo/ Dittrich, Torsten/ Niehoff, Ulrich/ Schäfers, Markus/ Wansing, Gudrun/ Zalfen, Birgit (Hg.): Teilhabe - wir wollen mehr als nur dabei sein. Lebenshilfe-Verlag. Marburg. S. 145-157.
Rohrmann, Eckhard 2005: Wohnen im Stadtteil erfordert mehr als eine Wohnung, in: Wacker, Elisabeth/ Bosse, Ingo/ Dittrich, Torsten/ Niehoff, Ulrich/ Schäfers, Markus/ Wansing, Gudrun/ Zalfen, Birgit (Hg.): Teilhabe - wir wollen mehr als nur dabei sein. Lebenshilfe-Verlag. Marburg. S. 199-210.
Schalock, Robert L. (Hg.) 1996: Reconsidering the Conzeptualization and Measurement of Quality of Life, in: Ders.: Quality of Life, Volume I: Conceptualization and Measurement. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 123-139.
Schalock, Robert L. 1997: Can The Concept of Quality of Life Make A Difference?, in: Ders. (Hg.): Quality of Life, Volume II: Application to Persons With Disabilities. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 245-267.
Schalock, Robert L. 2000: Three Decades of Quality of Life, in: Focus on Autism & Other Developmental Disablities. Summer 2000. Vol. 15 (2). pp. 116-134.
Schalock, Robert L./ Verdugo, Miguel A. 2002: Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners. American Association on Mental Retardation. Washington.
Schwarte, Norbert/ Oberste-Ufer, Ralf 2001: LEWO II: Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung: Ein Instrument für fachliches Qualitätsmanagement. Verlag der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (Hg.). Marburg. S. 39-47.
Seifert, Monika 1998: Wohnen - so normal wie möglich, in: Jakobs, Hajo/ König, Andreas/ Theunissen, Georg (Hg.): Lebensräume - Lebensperspektiven: Ausgewählte Beiträge zur Situation Erwachsener mit geistiger Behinderung. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Afra-Verlag. Butzbach-Griedel. S. 150-183.
Seifert, Monika/ Fornefeld, Barbara/ Koenig, Pamela 2001: Zielperspektive Lebensqualität: Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim. Bethel Beiträge 57. Bethel-Verlag. Bielefeld.
Seifert, Monika 2002: Wohnalltag von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung: Eine Studie zur Lebensqualität. Berliner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik von Menschen mit geistiger Behinderung, Band 4. 2. unveränderte Auflage. Diakonie-Verlag. Reutlingen.
Seifert, Monika 2003: Mehr Lebensqualität: Zielperspektiven für Menschen mit schwerer (geistiger) Behinderung in Wohneinrichtungen. Lebenshilfe-Verlag. Marburg. 42 S.
Seifert, Monika 2004: Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf?!, in: Fachdienst der Lebenshilfe, 1. Lebenshilfe-Verlag. Marburg. S. 1-14.
Seifert, Monika 2007: Eintrag "Lebensqualität", in: Theunissen, Georg/ Kulig, Wolfram/ Schirbort, Kerstin (Hg.): Handlexikon geistige Behinderung: Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und
Sozialpolitik. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart. S. 205f.
Speck, Otto 1999: Die Ökonomisierung sozialer Qualität: Zur Qualitätsdiskussion in Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit. Ernst Reinhard Verlag. München/ Basel. S. 116-130.
Speck, Otto 2007: Eintrag "Geistige Behinderung", in: Theunissen, Georg/ Kulig, Wolfram/ Schirbort, Kerstin (Hg.): Handlexikon geistige Behinderung: Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart. S. 136f.
Spielthenner, Georg 1996: Psychologische Beiträge zur Ethik: Humanistische Ethiken, Band 1. Peter Lang Verlag. Frankfurt a. M. S. 111-194.
Taylor, Steve J./Bogdan, Robert 1996: Quality of Life and the Individual's Perspective, in: Schalock, Robert L. (Hg.): Quality of Life, Volume I: Conceptualization and Measurement. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 11-22.
Thöny, Thomas 2008: Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg. Diplomarbeit. Universität Salzburg.
Turnbull, H. R./ Brunk, Gary L. 1997: Quality of Life and Public Policy, in: Quality of Life, Volume II: Application to Persons With Disabilities. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 201-210.
Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2010: http://www.monitoringausschuss.at; abgerufen am 21.10.2010
United Nations, Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Ratifications and Signatories of the Convention and its Optional Protocol: http://www.un.org/disabilities/; abgerufen am 11.2.2011
Vreeke, G. J./ Janssen C. G. C./ Resnick, S./ Stolk J. 1997: The Quality of Life of people with mental retardation: in search of an adequate approach, in: International Journal of Rehabilitation Research, 20. S. 289-301.
Vereinte Nationen 1993: 48/96. Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte: Text der Resolution [48/96] der Generalversammlung der vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993: http://www.unric.org/html/german/resolutions/A_RES_48_96.pdf; abgerufen am 12.11.2010
Weber, Beate 2008: Ein gutes Leben für heutige und zukünftige Generationen. Neue Herausforderungen für Gesellschaft und Politik. Konferenzvortrag, in: Haderlapp, Thomas/ Popp, Reinhold: Dokumentation der Konferenz. Werkstattbericht 10. Fachhochschule Salzburg, Zentrum für Zukunftsstudien. Puch.
Wehmeyer, Michael/ Schwartz, Michelle 1998: The Relationship between Self- Determination and Quality of Life for Adults with Mental Retardation, in: Educatiuon and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, Vol. 33 (1), March. S. 3-12.
Welte, Heike 1998: Aktionsforschung - ein Konzept zur Reflexion und Erforschung der eigenen Unterrichtspraxis, in: Kannonier-Finster, Waltraud/ Ziegler, Meinrad (Hg.): Exemplarische Erkenntnis: Zehn Beiträge zur interpretativen Erforschung sozialer Wirklichkeit. Studienverlag. Innsbruck/Wien. S. 163-182.
Whitney-Thomas 1997: Participatory Action Research as an Approach to Enhancing Quality of Life for Individuals with Disabilities, in: Schalock, Robert L. (Hg.): Quality of Life, Volume II: Application to Persons With Disabilities. American Association on Mental Retardation. Washington. pp. 181-198.
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken wurden als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.
Unterschrift
Ort und Datum:
............................................................ Name ..............................................
Anmerkung der bidok Redaktion: Der Anhang befindet sich als PDF in: http://bidok.uibk.ac.at/download/breinlinger-anhang.pdf
Quelle:
Stefanie Breinlinger: Forschen nicht ‚über' sondern ‚mit' Menschen mit Behinderung Peer-Interview als Möglichkeit der Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung - anhand eines Beispiels aus dem Wohnbereich der Lebenshilfe Salzburg
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Kultur- und Gesllschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, Fachbereich Soziologie und Politikwissenschaft, Gutachter: Ao.Univ.-Prof.DDr. Nikolaus Dimmel
bidok- Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 22.12.2011
